Kuratorisch handeln zwischen Theorie und Praxis

Widersprüche. Kuratorisch handeln zwischen Theorie und Praxis
Herausgegeben von Martina Griesser-Stermscheg, Christine Haupt-Stummer, Renate Höllwart, Beatrice Jaschke, Monika Sommer, Nora Sternfeld und Luisa Ziaja
Schriftenreihe curating. ausstellungstheorie & praxis, Band 6
WIE KANN DIE KRITIK AM MUSEUM IM MUSEUM FOLGEN HABEN?
DIE HERAUSGEBERINNEN IM GESPRÄCH
Martina
Griesser-Stermscheg, Christine Haupt-Stummer, Renate Höllwart, Beatrice Jaschke, Monika Sommer, Nora Sternfeld, Luisa ZiajaDiese Frage, die die Museumstheorie und -praxis am Ende des 20. Jahrhunderts beschäftigte, hat sich heute verändert. Denn seit Beginn des 21. Jahrhunderts verbreiten sich kritische Theorien in der Praxis von institutionellen Texten und Kontexten wie Lauffeuer. So sind Themen, für die jahrelang gekämpft wurde, wie Feminismus, Antirassismus, Umweltpolitiken, Institutionskritiken, Inklusionsdebatten, dekoloniale und queere Theorien, heute in aller Munde, während sich strukturell nur wenig zum Besseren verändert. Dadurch wird ein hart erarbeitetes kritisches Vokabular nicht selten zum Label entleert. Vor dem Hintergrund der nüchternen Erkenntnis, dass die Kritik an Institutionen bei ihrer Implementierung in Institutionen nicht immer positive Folgen hat, wollen wir in diesem Band dennoch wieder und weiter über die Verhältnisse von Theorie und Praxis nachdenken.
Beatrice In unseren täglichen kuratorischen und vermittlerischen Praxen stoßen wir oft an Grenzen, an
gläserne Decken, die es uns verunmöglichen, unsere Selbstverständnisse und Überzeugungen tatsächlich leben zu können. Umbrüche im Sinne eines kritisch-reflexiven Handelns sind im institutionellen Kontext meist nur auf Projektbasis möglich. Ein Etablieren als institutionelle Praxis scheitert an unterschiedlichen Punkten. Oft sind es die strukturellen „Verkrustungen“, die Veränderungen bremsen und in ihrer Logik Widersprüche produzieren. Denkt man konzeptiv gegen den Kanon, braucht es große Überzeugungskraft, das auch so umzusetzen. Die Wirkmacht dieses projektbezogenen Aufbrechens bleibt überschaubar.
Nora Diese Problematik stellt sich mir noch viel grundlegender dar: Wir haben uns im kritischen Museumsund Ausstellungsfeld seit vielen Jahren in Widersprüche verwickelt. Glauben wir den Anrufungen, dann stehen wir mitten in einem Paradigmenwechsel. Wir hören vielerorts von einem „Museum der Zukunft“1, und es scheint, als würde dies heißen: „Alles wird besser“, oder vielleicht: „Alles muss besser werden.“ Aber wenn wir uns der Realität der Institutionen, ihren Arbeitsverhältnissen, ihren Plänen im Krisenmodus und ihren Perspektiven widmen, stellen wir fest: Wenig ist besser. Vieles ist unsicherer geworden, vieles ist schwieriger. Also heißt „Alles wird besser“ einfach: „Alles muss gut klingen“? Heißt es vielleicht sogar, dass institutionelle Diskurse alle Beteiligten zunehmend performativ daran gewöhnen, dass kritische Rhetorik mit unkritischem Handeln einhergeht, dass alles anders formuliert werden muss, damit die Strukturen so bleiben können, wie sie sind, bzw. damit sie sogar unsicherer, privater und weniger öffentlich werden konnten und können? Und wie wollen wir über unsere Arbeit nachdenken,
1 Wir haben in diesem Zusammenhang gemeinsam mit Joachim Baur auch ein Buch herausgegeben: schnittpunkt, Joachim Baur (Hg.), Das Museum der Zukunft. 43 neue Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums, Bielefeld 2020.
sie zwischen Theorie und Praxis weiter reflektieren, ohne ständig dieselben unausgesprochenen Widersprüche zu reproduzieren?
Martina Das alles sind Fragen, die uns seit Jahren begleiten und die wir nun mit der vorliegenden Publikation adressieren wollen. Wir haben also Kolleg:innen eingeladen, mit uns über Widersprüche nachzudenken.
Nora Die Beiträge, die wir erhielten, haben uns insofern erstaunt, als sie vom alltäglichen reflektierten Umgang mit der Tatsache, dass wir zum widersprüchlichen Handeln gezwungen sind, zeugen – und davon, dass wir uns das Denken dabei nicht nehmen lassen.
Martina Im Vergleich zu anderen Büchern, die wir in unserer Schriftenreihe bisher veröffentlicht haben, ist dieser Sammelband vielleicht weniger proklamatorisch und verfolgt einen Ansatz, den ich als weder naiv noch ohnmächtig bezeichnen würde. Manche Beiträge haben den Charakter eines inneren Monologs, mit vielen Gedanken, die vielleicht bisher noch nicht als spektakulär genug erschienen, um schon einmal laut ausgesprochen worden zu sein. Schließlich haben wir offensichtlich gelernt, mit Widersprüchen zu leben, vieles mit uns selbst auszumachen, ohne aber zu resignieren, und trotzdem am nächsten Tag weiterzumachen. Manche Texte spiegeln das Unbehagen wider, das ihr angesprochen habt und das uns im professionellen Museums-, Ausstellungs- und Vermittlungsalltag manchmal begleitet. Denn alle kennen den theoretischen kritischen Ansatz, der nach einem „Idealzustand“ zu rufen scheint und sich in der Praxis nicht einholen lässt. Doch dann geht es – z. B. in den Beiträgen
PARA-MUSEUM UND DIE GESPENSTER DER INFRASTRUKTUR
1 Nora Sternfeld„The Art Workers’ Coalition (AWC) was born out of an action at MoMA on January 3, 1969, when the artist Takis removed his sculpture (which was owned by the Museum) from an exhibition on the grounds that an artist had the right to control the exhibition and treatment of his work even if he no longer owned it. This was the catalyst that led a group of artists, architects, filmmakers, critics, and museum and gallery personnel to coalesce into the Art Workers’ Coalition. The AWC sought to address the rights of artists and political and social justice matters. They imposed a set of thirteen demands on the Museum, including free admission, a section of the Museum devoted to showing work by black artists, and the Museum’s convening of a public hearing on the topic of ,The Museum’s Relationship to Artists and Society‘. Throughout the course of the year, the AWC staged demonstrations, organized an open hearing, and attended meetings with MoMA staff to further their cause.“
1 Dieser Text ist für eine Publikation der Dänischen Nationalgalerie und in deren Auftrag entstanden. Er wurde in Dänemark vom Deutschen ins Englische übersetzt und befindet sich dort im Erscheinen (2022). Der zweite Teil des Titels ist aus einem gemeinsamen Denkprozess mit dem Kollektiv freethought (http:// freethought-collective.net/ (Stand: 28.8.2022) entstanden und verdankt sich den Perspektiven meiner Kolleg:innen Irit Rogoff und Louis Moreno. Mittlerweile wurden die „Gespenster der Infrastruktur“ zum Titel eines mehrjährigen
Dies ist ein Raumtext in einer Vitrine der neuen Sammlungsausstellung des MoMA in New York. Wie jede Vitrine schafft auch diese Bedeutung. Der stylishe Glaskasten mit Archivmaterialien stellt Nähe bei gleichzeitiger Unnahbarkeit her, eine Aura. Die Vitrine schützt, was sie zeigt, aber sie macht uns auch auf den Wert des Präsentierten aufmerksam. Der Raumtext liegt perfekt platziert zwischen den Archivalien. Er kontextualisiert die Dokumente, Fotografien und Broschüren, die Einblick in ein konkretes Beispiel für einen historischen Kampf um eine Veränderung der Institution geben. Die Materialien stammen weitgehend aus den Archiven des MoMA und finden sich hier, im vierten Stock des Museums, in jenem Bereich, der Werke der Sammlung aus den 1940er- bis 1970erJahren zeigt, offensichtlich institutionalisiert wieder.
Was machen politische Forderungen in der Vitrine eines Museums moderner Kunst – noch dazu Forderungen an das Museum selbst? Dieser konkreten Frage wie auch weiterführenden allgemeineren Fragen möchte ich in diesem Text nachgehen: Was bedeutet das Verhältnis von Institutionen zu Kämpfen gegen Institutionen aus Sicht der Institutionen? Verstehen wir die Aufgabe eines Museums als kritische Treue zum Material, wie wäre dann die Institution den Materialien treu? Geht es dabei wirklich darum, das Stück Papier zu schützen, auf das 13 Forderungen getippt sind (klar wurde es vervielfältigt, also gibt es eigentlich gar kein Original, und ja, eines davon hat eine rote Markierung bei den Forderungen 2 und 3). Oder geht es möglicherweise doch eher darum, worum es darin geht? Müsste die Institutionalisierung, die dem Material treu sein will, nicht den Forderungen treu sein, sie also umsetzen? Und wie kann etwas von dem Konflikt bewahrt und reaktivierbar gemacht werden und nicht bloß entschärft und stillgestellt?
kuratorischen Forschungsprojekts, das wir im Rahmen von freethought am BAK (Basis für aktuelle Kunst) in Utrecht verfolgen.
Im Oktober 2019 eröffnete das MoMA die Neuaufstellung seiner Sammlung, die für Aufsehen sorgte, denn die bis dahin für den westlichen Blick auf die Kunstgeschichte des 20. Jahrhundert archetypische und stark vom sogenannten Kalten Krieg geprägte historische Anordnung hatte eine Neuperspektivierung erfahren.3 Immerhin scheint dabei an einigen Stellen eine Kanonisierung aufgebrochen, die sehr lange als universell gesetzt hatte, was doch eine ziemlich partikulare, westliche, männliche, weiße Perspektive war. Genauer gesagt folgt die neue Sammlungspräsentation einer durchbrochenen chronologischen Erzählung: In thematischen Clustern finden sich zentrale historische Werke der Sammlung mit rezenteren
2 Diese Frage stellen wir uns im Rahmen von schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis in Wien seit 2001; https://www.schnitt. org (Stand: 15.6.2020). schnittpunkt sind: Martina Griesser-Stermscheg, Christine Haupt-Stummer, Renate Höllwart, Beatrice Jaschke, Monika Sommer und Luisa Ziaja. Nachdem ich sie 2009 so am Ende eines Textes formuliert hatte, steht sie heute oft am Anfang unserer konzeptuellen und vermittelnden Texte und Veranstaltungen. Nora Sternfeld, „Erinnerung als Entledigung“, in: schnittpunkt, Belinda Kazeem, Charlotte Martinz-Turek, Nora Sternfeld (Hg.), Das Unbehagen im Museum, Wien 2009, S. 61–75, hier S. 73.
3 „How do you convert the archetypical institution of 20th-century art into one fit for the 21st?“, fragt die New York Times kurz nach der Eröffnung und beantwortet die Frage an etwas späterer Stelle mit „Go East, Go South“; „The New MoMA Is Here. Get Ready for Change“, https:// www.nytimes.com/2019/ 10/03/arts/design/MoMArenovation.html (Stand: 15.6.2020).
1. Wie kann die Kritik am Museum im Museum Folgen haben?2
4 Angekauft wurde die Arbeit übrigens erst 2016, sie hat die Objektnummer 212.2016.a-b; https://www. MoMA.org/collection/works/ 199915 (Stand: 15.6.2020).
5 Vgl. Thomas J. Lax, „How Do Black Lives Matter in MoMA’s Collection“, in: Natalie Bayer, Belinda Kazeem-Kamiński, Nora Sternfeld (Hg.), Curating as Anti-Racist Practice, Helsinki 2018, S. 229–237.
6 Faith Ringgold auf: Makers, http://www.makers. com/faith-ringgold (nicht mehr online, zu finden in der Wayback Machine: https://web.archive.org, http://www.makers.com/ faith-ringgold, Snapshot von 6.7.2017, Stand: 28.8.2022).
Arbeiten konfrontiert, weiße Kunstgeschichten hinterfragt, westliche Perspektiven durch südliche erweitert, ein männlicher Kanon feministisch durchkreuzt. Picassos Demoiselles d’Avignon (1907) wird etwa eine Arbeit von Faith Ringgold aus dem Jahr 1967 gegenübergestellt. Das monumentale Gemälde trägt den traurigen, sprechenden und leider immer noch allzu aktuellen Titel American People Series #20: Die4 und erinnert an die antirassistischen Unruhen, die damals im ganzen Land ausbrachen – und an ihre gewaltvolle Niederschlagung. Wir sehen Menschen in Businesskleidung, Schwarze und Weiße in einem Tumult, ein Blutbad, alle sind verletzt.5 In der Formensprache ihrer Arbeit bezog sich die Künstlerin auf die damalige Aufstellung des MoMA, in der in den 1960er-Jahren die Demoiselles d’Avignon zusammen mit Guernica präsentiert wurden. An Picasso interessierten Faith Ringgold seine politische Positionierung, die Bezugnahme auf seine Zeit und die Auseinandersetzung mit Gewalt in der Malerei. In Referenz darauf fragte sich die Künstlerin: „How could I, as an African American woman artist, document what was happening around me?“, und arbeitete an einer Formensprache, die die rassistische Gewalt in den USA zum Ausdruck brachte. Ihre Position hatte Faith Ringgold in den 1960er- und 1970er-Jahren sowohl in der Malerei als auch in konkretem Aktivismus zum Ausdruck gebracht. 1970 z. B., als das Whitney Museum in New York eine Ausstellung mit dem Titel 30 Americans zeigte und keine einzige Schwarze Position dabei war, protestierte sie gemeinsam mit anderen KünstlerInnen und Institutionen, etwa dem Studio Museum Harlem, gegen die weiße Museumspolitik: „We demonstrated in front of the Whitney and later the Museum of Modern Art, so that African-American artists could show their work in these museums. These were public institutions with a commitment to serve the people. However, one could not find art by African Americans in any of these museums.“6
KRITISCHE WISSENSPRODUKTION IN MUSEUMSDATENBANKEN. WIDERSPRÜCHE AM
Martina Griesser-Stermscheg1 Anke te Heesen, „Geschlossene und transparente Ordnungen. Sammlungsmöbel und ihre Wahrnehmung in der Aufklärungszeit“, in: Gabriele Dürbeck et al. (Hg.), Wahrnehmung der Natur. Natur der Wahrnehmung. Studien zur Geschichte visueller Kultur um 1800, Dresden 2001, S. 19–34; Anke te Heesen, „Vom Einräumen der Erkenntnis“, in: dies. / Anette Michels (Hg.), auf/zu. Der Schrank in den Wissenschaften (Ausst.Kat., Eberhard-Karls-Universität Tübingen), Berlin 2007, S. 90–97.
2 Martina GriesserStermscheg, Tabu Depot. Das Museumsdepot in Geschichte und Gegenwart, Wien/Köln/Weimar 2013, S. 34–52.
Verortung: der erste, der zweite und der dritte Ort Aufräumen. Einräumen. Ordnung machen. Für die einen klingt das fürchterlich langweilig, für die anderen hingegen nach einer recht befriedigenden Tätigkeit, die stets mit der Hoffnung einhergeht, dass alles nachher „besser“, vielleicht übersichtlicher, kontrollierbarer ist als vorher. Sammelnde Menschen und Institutionen beschäftigen sich seit jeher mit räumlichen Ordnungssystemen. Maßgebliche Erkenntnisse zur sinnstiftenden Wirkung von Ordnungsbehältnissen in vormusealen Sammlungen, insbesondere von Objekt- und Archivschränken samt ihren Referenzverzeichnissen, verdanken wir Anke te Heesen.1 Doch je öffentlicher die Museen in den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution wurden (und ich weiß, dass ich mich dabei immer noch auf einen Begriff der Öffentlichkeit beziehe, der nur wenige Privilegierte als Öffentlichkeit adressiert und der in koloniale Bedingungen verstrickt ist), desto mehr veränderten sich auch die Ordnungsmöbel und -räume. So kam es im Laufe des 19. Jahrhunderts zur noch heute gültigen Differenzierung in Depot- und Zeigebehältnisse, seien es Möbel oder ganze Räume.2 Beide unterliegen gänzlich unterschiedlichen Ansprüchen an Ordnung und Verzeichnis. Im Depot geht es um Logistik, Platzeffizienz, Langzeiterhaltung und schnelles Wiederauffinden. Beim Zeigen geht es um Repräsentation, Veröffentlichung, Vermittlung und Wissensproduktion. In jedem Fall wurden durch das Zeigen auch große Teile von Sammlungen wieder verborgen und die einstmalig erkämpften öffentlichen Wissenszugänge abermals eingeschränkt.
Daniela Döring teilt in einem Aufsatz, in dem sie auf die Erkenntnisse von Anke te Heesen aufbaut, die Behältnisse von Sammlungen in drei Orte: Der erste Ort ist der Ausstellungsraum, der zweite das Sammlungsdepot und der dritte
das Inventarbuch. Letzteres verzeichnet analog zur materiellen Sammlung ihre Kontextualisierung und Verortung. Durch die systematische Verzeichnung und Speicherung entsteht ein weiteres „mediales, archivalisches Objekt“, wie Döring es definiert; alles, was hier verzeichnet wird, hat Auswirkungen auf jenes Wissen, das über das Objekt verfügbar sein wird und künftig vermittelt werden kann.3 Döring schließt ihre Momentaufnahme von 2010 mit der Anmerkung, dass durch die Einführung von digitalen Museumsdatenbanken die (historischen) Aufzeichnungssysteme wiederum in eine neue Ordnung gebracht werden. Ihr Schluss ist mein Ausgangspunkt, und so möchte ich zwölf Jahre nach dem Erscheinen von Dörings Aufsatz einen kritischen Blick auf ebendiese neue Ordnung richten. Dabei gehe ich von einer postdigitalen Museumspraxis aus, in der analoge und digitale Umgebungen komplementär wirken und keine Gegensätze (mehr) bilden. Wie Inventarbücher, Zettelkataloge oder Karteikästen sind Datenbanken demnach nur ein weiteres Werkzeug in der langen Geschichte der musealen Wissensverwaltung. Meinen persönlichen Zugang finde ich über die Beobachtung von Widersprüchen, die mir in der täglichen Arbeit als Mitarbeiterin eines öffentlichen Museums, des Technischen Museums Wien (kurz TMW), mit dem Werkzeug Datenbank begegnen und die mir mitunter auch Unbehagen bereiten. Als Leiterin des Forschungsinstituts, dem die inhaltlich-strategische Steuerung der TMW-Datenbank abteilungsübergreifend zugeordnet ist (ich erwähne das auch, weil die strukturelle Verankerung der Datenbank in den Organigrammen der Museen sehr unterschiedlich geregelt ist, dies aber Auswirkungen auf deren inhaltliche Entwicklung hat), moderiere ich eine umkämpfte Schnittstelle. An dieser tummeln sich IT-Experten, Software-Dienstleister, Kustod_innen, Kurator_innen, Archivar_innen, Bibliothekar_innen, projektbezogene Forscher_innen,
3 Daniela Döring, „Das verrückte Inventar. Über ver/schränkte Wissensräume im Museum“, in: Trajekte. Zeitschrift des Zentrums für Literaturund Kulturforschung Berlin, Heft 20, 2010, S. 7–11, hier S. 9.
4 Siehe dazu Lukas Wieselberg, „Moderne Wissenschaften: Alles im Kasten. Interview mit Anke te Heesen über die Möblierung der Wissenschaft und die Bedeutung des Schrankes bei der Schaffung von Wissen“, Ö1-Sendebeitrag vom 18.3.2009; Staffan Müller-Wille, „Carl von Linnés Herbarschrank. Zur epistemischen Funktion eines Sammlungsmöbels“, in: Anke te Heesen / E. C. Spary (Hg.), Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, Göttingen 2001, S. 22–38; Johannes Schmidt, „Der Zettelkasten Niklas Luhmanns“, LuhmannArchiv, Universität Bielefeld, https://niklas-luhmannarchiv.de/nachlass/zettel kasten (Stand: 9.7.2022). Durch das Multiple-StoragePrinzip und die an Hyperlinks erinnernde Verweisungstechnik simulierte Luhmann in analoger Speichertechnik ab den 1950er-Jahren ein digitales Datenbanksystem.
Restaurator_innen, Registrarinnen, Depotarbeiter_innen, Fotograf_innen, Buchhalter_innen und die Web-Redaktion des Marketing-Teams. Am öffentlich sichtbaren Frontend stehen die Online-Datenbank-User_innen am PC/Smartphone sowie die TMW-App-User_innen beim Museumsbesuch.
Der vierte Ort: die Museumsdatenbank Museumsdatenbanken zählen heute wohl zu den mächtigsten Instrumenten der kollektiven Gedächtnis- und Wissensverwaltung. In ihnen dokumentieren, kontextualisieren und disziplinieren Museen ihre Sammlungsbestände. Die dingliche Begrenztheit von materiellen Sammlungen und die damit einhergehende Bedingtheit musealer Ordnungssysteme kennen digitale Museumsdatenbanken nicht. Damit eröffnen sich neue Handlungsräume, vor allem für die Vernetzung und Sichtbarmachung neuer Zusammenhänge, die möglicherweise bisher unentdeckt geblieben sind. Museumshistorisch betrachtet ging damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Denn was Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) mit seinem Exzerpierschrank, Carl von Linné (1707–1778) mit seinem Herbarschrank oder viel später Niklas Luhmann (1927–1998) mit seinem Zettelkasten noch im Analogen propagierten – nämlich neue Sinnzusammenhänge durch feste Ordnungssysteme, die zugleich Flexibilität ermöglichen, zu schaffen4 – ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts fester Bestandteil der Museumspraxis geworden.
Unbedingte Born Digitals Datenbanken bergen aber auch ein gewisses Risiko. Museumsdinge erinnern uns nämlich in ihrer materiellen, manchmal auch sperrigen Beschaffenheit seit Jahrhunderten als
„Vor dem Hintergrund sozialer Ungerechtigkeiten und ökologischer Krisen sind Dringlichkeiten die treibende Kraft für Ideen, die es uns erlauben, mit einer anderen Logik zu operieren und die engen Grenzen zwischen Disziplinen und Institutionen zu untergraben oder zu überwinden.“
„Vor dem Hintergrund sozialer Ungerechtigkeiten und ökologischer Krisen sind Dringlichkeiten die treibende Kraft für Ideen, die es uns erlauben, mit einer anderen Logik zu operieren und die engen Grenzen zwischen Disziplinen und Institutionen zu untergraben oder zu überwinden.“
Mit diesen Worten, diesem Aufruf von Studierenden des /ecm für ihr kollaboratives Projekt,1 machten mich Nora Sternfeld und Beatrice Jaschke auf die von ihnen konzipierte Diskussionsreihe aufmerksam, um mich im Februar 2021 für einen Beitrag einzuladen. Ich schlug daraufhin vor, über das Kuratieren als einen verstörenden Raum nachzudenken, als eine Praxis, die produktives kritisches Unbehagen zu erzeugen vermag und fundamental kollaborativ und transformativ sein kann.
Von Anfang an war meine Arbeit als Kuratorin stark von der Möglichkeit geprägt, Grenzen von Disziplinen zu überschreiten und mich mit der heuristischen wie disruptiven Kraft der Kunst als Form der Wissensproduktion auseinanderzusetzen. Darüber hinaus ging es mir darum, „Gleichheitsfragen in den Raum zu stellen“ (wie der Titel des /ecm-Projekts lautete), also die tiefgehenden Asymmetrien dieser Welt und die Geometrien von Machtstrukturen zu analysieren.
1 „SIND
WIR
SCHON DA? Gleichheitsfragen in den Raum stellen“, /ecm-Projekt 2020–2022, www.ecm.ac.at/ecmprojekt2020-2022/ (Stand: 4.5.2022).
Nach vielen Jahren der kuratorischen Arbeit habe ich mich in letzter Zeit vorrangig mit Selbstreflexion und Analyse beschäftigt sowie die Realität akzeptiert, dass kuratorische Projekte für mich keineswegs geradlinige Pfade bedeuten, sondern Umwege, Sackgassen und Abweichungen umfassen. In diesem Sinne möchte ich hier einige Widersprüche ansprechen, die mit meinen Ansprüchen an meine kuratorische Arbeit einhergehen, und mich ihnen stellen.
Ich glaube fest daran, dass, wie James Baldwin sagte, „der Zweck der Kunst darin besteht, die Fragen freizulegen, die von
den Antworten verdeckt wurden“, an die Möglichkeit, Perspektiven komplexer zu machen und zu den bereits gegebenen Antworten Fragen zu finden. Aus diesem Grund sind kuratorische Untersuchungen oftmals wie Holzwege, jene Pfade im Wald, die sich zumeist abseits der von den meisten begangenen Hauptwege befinden und die, oft unterbrochen, in viele verschiedene Richtungen verlaufen und Umwege nehmen. Dies sind Strategien des Ausprobierens, sogar der Irritation, und Taktiken kleinerer Akte der Sabotage – des Durchkreuzens und Verqueerens. Sie können bedeuten, dass man vom Weg abkommt, ihn ganz verliert oder einfach zögernd innehält. Und sie untersuchen die Zonen, in denen binäre Entgegensetzungen zu verblassen beginnen, und die Räume, in denen neue Bedeutungen und Werte noch nicht entstanden sind.
Als Nora und Beatrice auf mich zukamen, sagten sie mir, dass sie insbesondere genauer verstehen wollten, was ich meine, wenn ich – in meiner Kurzbiografie – schreibe, dass ich mich für das Kuratieren „als Form der Beunruhigung mit einem Fokus auf die performativen und relationalen Aspekte“ interessiere.
Dies möchte ich hier nun zu erklären versuchen, indem ich einige meiner neueren Projekte vorstelle und zeige, wie viel meiner Arbeit mit der Beunruhigung insbesondere auch meiner eigenen Position zu tun hat. Einer Position, die natürlich oftmals schwierig ist, da ich eine weiße europäische Kunsthistorikerin bin, die im Kontext eines Kunstraums wie SAVVY Contemporary bzw. überhaupt im Kontext eines engagierten und antidiskriminatorischen Kuratierens arbeitet.
Aus diesem Grund habe ich diesem Text seinen merkwürdigen Titel gegeben: „Zwiebeln schneiden, oder: Das Kuratieren kritischen Unbehagens und die Arbeit der Reparatur“.
Für das Abstract zu dem Vortrag, den ich im März 2021 in Wien bei /ecm hielt, habe ich diesen im Bild bleibend erläutert:
„Beinahe jedes gute Rezept beginnt mit dem Schneiden von Zwiebeln. Den Raum aufräumen, die Zutaten vorbereiten, einen Zeitplan erstellen. Doch erst wenn die Tränen zu rollen und die Augen zu brennen beginnen, fängt die eigentliche Arbeit an. Wenn ein intensiver Geruch plötzlich die Nasenlöcher trifft und ein Gefühl leichten Unbehagens oder Widerwillens hervorruft, kann die Kreativität einsetzen und die Arbeit beginnen. Vielleicht weil ich zu oft die Gelegenheit versäumt habe, mich in die edelste Alchemie des Kochens zu vertiefen, habe ich angefangen, Zwiebeln zu schneiden, als ich mit dem Kuratieren begann.
„Beinahe jedes gute Rezept beginnt mit dem Schneiden von Zwiebeln. Den Raum aufräumen, die Zutaten vorbereiten, einen Zeitplan erstellen. Doch erst wenn die Tränen zu rollen und die Augen zu brennen beginnen, fängt die eigentliche Arbeit an. Wenn ein intensiver Geruch plötzlich die Nasenlöcher trifft und ein Gefühl leichten Unbehagens oder Widerwillens hervorruft, kann die Kreativität einsetzen und die Arbeit beginnen. Vielleicht weil ich zu oft die Gelegenheit versäumt habe, mich in die edelste Alchemie des Kochens zu vertiefen, habe ich angefangen, Zwiebeln zu schneiden, als ich mit dem Kuratieren begann.
Im folgenden Vortrag möchte ich über die Arbeit des Kuratierens und dessen Politik des Affekts nachdenken. Kuratieren bedeutet für mich nicht nur, Fragen in den Raum zu stellen, vorherrschende Narrative zu beunruhigen und die politische Imagination zu gebrauchen, sondern – als weiße europäische Kunsthistorikerin – auch, zu verlernen und sich selbst in eine Position des kritischen Unbehagens zu begeben. Sich zu öffnen für Praktiken des genauen Zuhörens, das Unerwartete willkommen zu heißen, sich aus seiner Komfortzone herauszubegeben, um sich durch neue Kontaktzonen zu bewegen. Die folgende Präsentation wird sich mit dem Verständnis kuratorischer Praktiken als Formen der Beunruhigung beschäftigen, deren mäeutische und rebellische Kräfte in ihren relationalen und performativen Aspekten liegen.“
Im folgenden Vortrag möchte ich über die Arbeit des Kuratierens und dessen Politik des Affekts nachdenken. Kuratieren bedeutet für mich nicht nur, Fragen in den Raum zu stellen, vorherrschende Narrative zu beunruhigen und die politische Imagination zu gebrauchen, sondern – als weiße europäische Kunsthistorikerin – auch, zu verlernen und sich selbst in eine Position des kritischen Unbehagens zu begeben. Sich zu öffnen für Praktiken des genauen Zuhörens, das Unerwartete willkommen zu heißen, sich aus seiner Komfortzone herauszubegeben, um sich durch neue Kontaktzonen zu bewegen. Die folgende Präsentation wird sich mit dem Verständnis kuratorischer Praktiken als Formen der Beunruhigung beschäftigen, deren mäeutische und rebellische Kräfte in ihren relationalen und performativen Aspekten liegen.“
Um ehrlich zu sein, wurde ich zu diesem dramatischen, theatralischen, aber auch sehr häuslichen Bild der Handlung des Zwiebelschneidens und der Verunsicherung durch die dadurch hervorgerufenen Tränen durch eine künstlerische Arbeit inspiriert. Man könnte nun an Marina Abramović und ihren Film The Onion aus dem Jahr 1996 denken,2 tatsächlich aber war es die Arbeit einer Künstlerin, deren Recherche und
SAFE AND SOUND
Aldo Giannotti


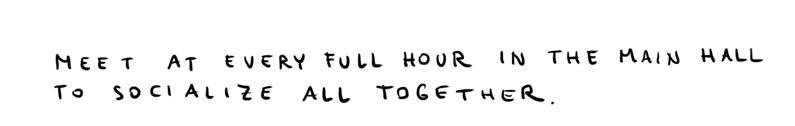


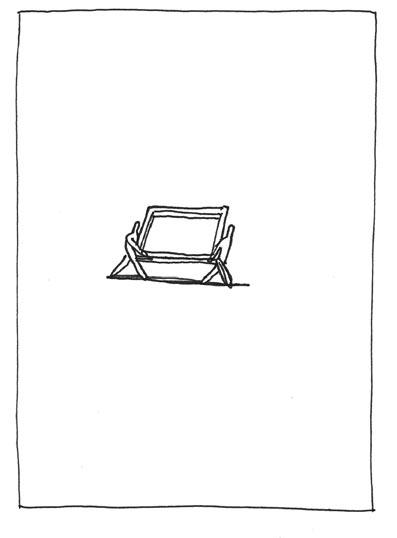




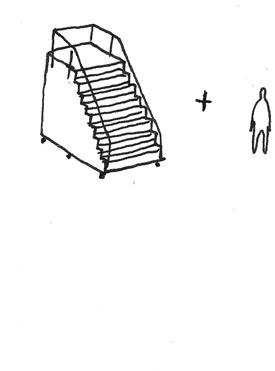

1 Z. B. „Arbeit. Sorge. Museum – Konzepte von Care-Arbeit in Ausstellungen“, Workshop der Museumsakademie Joanneum in Kooperation mit DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund, 23./25.5.2022; Anne Meerpohl, „#KOLLEKTIVITÄT #CARE“, in: FKW. Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur, Nr. 70, Februar 2022, S. 66–68; „(what it means to both) Care & Create“, Projektwoche an der Kunsthochschule Halle, 4.–8.10.2021; Radical Care, Projekt von Nora Mayr und Stephanie Winter mit einem szenischen Labor in Motherboard, Wien, 5.11.–5.12.2021; Caring Structures, Ausstellung im Kunstverein Hildesheim, 31.10.2020–9.1.2021; Care, inhaltlicher Fokus von Sascia Bailer als künstlerische Leiterin von M.1 Hohenlockstedt, 2019/20; I know I care, performative, kollaborative und partizipative Installation in der Waschhalle Wienerberg im Rahmen der Wienwoche 2019.
2 Dienstart B6: Museumsaufsichtsdienst EUR 9,90 / Std.; Kollektivvertrag Wachorgane – Bewachungsgewerbe, Arbeiter*innen, gültig ab 1.1.2022, abgeschlossen zwischen der Wirtschaftskammer
Im kulturellen Feld ist die Forderung nach Sichtbarkeit, Bewusstmachung und Aufwertung der Care-Arbeit auf der Ebene der Repräsentation sehr präsent. Vielerorts werden Workshops, Festivals, Forschungsprojekte oder Wechselausstellungen in diesem Sinne programmiert.1 In den Institutionen des kulturellen Feldes selbst sind diese Rufe allerdings strukturell noch nicht angekommen. Immer noch bleibt beispielsweise die Arbeit der Museumsaufsicht geradezu unsichtbar und ist als notwendige Maßnahme für den Schutz der Objekte und das Durchsetzen der Sicherheitsbestimmungen der Institution nur still geduldet. Die Bezahlung rangiert um den (wenn nicht unter dem) Mindestlohn bzw. die in den Tarifverträgen ausgehandelten Mindestsätze.2 Diese mehrfache Geringschätzung lässt die diensthabenden Mitarbeiter*innen in den Ausstellungsräumen leicht zu schattenhaften Wesen werden, die nur dann ins allgemeine Bewusstsein treten, wenn es gilt, Besucher*innen zu maßregeln und Respekt gegenüber den ausgestellten Werken und der Hausordnung einzufordern. Was passiert, wenn diese Widersprüche selbst sichtbar werden und die Museumsaufsicht zu einem Ausgangspunkt einer Ausstellungskonzeption wird? Was, wenn das Handeln in Widersprüchen zur kollaborativen Intervention wird? Was, wenn Aufseher*innen in einer künstlerischen Kooperation ihre Rolle neu, selbstbestimmt denken? Und was, wenn der Schutz wie die Sicherheit der Besucher*innen, die oberste Prämissen der Mitarbeiter*innen sind, selbst Teil gemeinsamer und lustvoller Prozesse werden?
Der Künstler Aldo Giannotti beschäftigte sich mit diesen Fragen, als er von Kurator Lorenzo Balbi eingeladen wurde, Anfang 2020 eine Einzelausstellung im MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna zu zeigen. Die Ausstellung mit dem Titel Safe and Sound war vom 5. Mai bis 5. September 2021 dort zu sehen. Die kuratorische Assistenz hatte Sabrina Samorì inne.
1 https://kunsthoch schulekassel.de/willkom men/veranstaltungen/ events/how-wow-wow.html (Stand: 23.7.2022).
2 Wo ich nicht auf spezifische Archive und die in ihnen enthaltenen Archivalien verweise (documenta archiv, Bundesarchiv), verwende ich in diesem Artikel einen weiten Archivbegriff nach Michel Foucault, der sämtliche verfügbare Formen von Erinnerung umfasst (Erzählungen, Artefakte, Bibliotheken u. v. a. m.). Vgl. Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 1973 [Paris 1969].
„How? Wow! Wow …“ hieß das offene Forschungskolloquium an der Kunsthochschule Kassel, zu dem mich documenta-Professorin Nora Sternfeld im Juli 2019 einlud.1 Ich präsentierte erste Ergebnisse einer Forschung, die ich im Rahmen meiner Doktorarbeit zur Internationalisierung der documenta unternommen hatte. Es ging darum, was die Organisator*innen während der NS-Zeit gemacht hatten: Allein in der ersten documenta waren knapp die Hälfte der Organisator*innen ehemalige NSDAP-Mitglieder. Das steht im Widerspruch zu oft wiederholten Selbsterzählungen der Institution, dabei waren die entsprechenden Quellen aus dem Bundesarchiv bereits seit Mitte der 1990er-Jahre öffentlich zugänglich.
In diesem Beitrag umreiße ich Dimensionen des immensen Forschungsbedarfs, der sich aus dem initialen Befund und ergänzenden Recherchen ergibt – und frage, wie es sein kann, dass nach wie vor eine offene Plattform fehlt, die erlauben würde, oft unverbundene Initiativen einzelner Künstler*innen und Forschender kontinuierlich und öffentlich zusammenzubringen. Ich argumentiere, dass die Defizite in Koordination, Vermittlung und Outreach a) mit einer Wissenschaftskommunikation zu tun haben, die sich allzu oft auf journalistisches Storytelling verengt, und b) mit einem Mangel an Ambiguitätstoleranz einhergehen, der durch die Struktur der deutschen Erinnerungskultur mitverursacht ist. Statt in die Erforschung der Grauzonen und Lücken zu investieren, die das Archiv unseres Wissens um die documenta durch das kommunikative Beschweigen von NS-Kontinuitäten in der BRD hat,2 kanalisieren die großen institutionellen Akteur*innen das immense Interesse an diesem Thema bisher vor allem in die Skandalisierung der Vita des documenta-Mitbegründers Werner Haftmann. So wird Täterschaft mystifiziert und der Blick auf die bis heute bestehenden strukturellen Kontinuitäten des NS-Erbes in unserer Gesellschaft verstellt.

