





AUFERSTANDEN AUS RUINEN
Kriegsnarben im Hamburger Stadtbild
OLIVIER MESSIAEN
Der radikal sanftmütige Komponist


INTERNATIONALES MUSIKFEST HAMBURG
Vladimir Jurowski

Elisabeth Leonskaja
Arditti Quartet
Jordi Savall
















AUFERSTANDEN AUS RUINEN
Kriegsnarben im Hamburger Stadtbild
Der radikal sanftmütige Komponist


Vladimir Jurowski

Elisabeth Leonskaja
Arditti Quartet
Jordi Savall









Liebe Leserin, lieber Leser,
seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2014 folgt das Internationale Musikfest Hamburg stets einem übergeordneten Thema. Wenige Monate, nachdem wir im Herbst 2021 mit den Planungen für das Musikfest 2024 begannen, gewann das dafür gewählte Motto »Krieg und Frieden« auf bedrückende Weise unerwartete Aktualität. Kriege werden seit Jahrtausenden leider immer irgendwo auf dem Globus geführt. Dass wir den Krieg in Europa überwunden glaubten, erwies sich als Illusion. Das Programm, zu dem uns das Motto »Krieg und Frieden« angeregt hat, tut weiterhin das, was es von Anfang an sollte: Es reflektiert die Allgegenwart dieses scheinbar ewigen Menschheitsthemas im Hinblick auf die Musik, über viele Jahrhunderte hinweg. In einem glänzenden Essay zeichnet Volker Hagedorn die schöpferischen Spuren nach, die all die Verwüstungen des beispiellos kriegerischen 20. Jahrhunderts im Schaffen maßgeblicher Komponisten hinterlassen haben (Seite 4).
Gleich im Anschluss geht es um die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges und auch hier wieder um das Echo darauf in der Musik der Zeit (Seite 12). Die in den beiden Texten angesprochenen Werke bewegen uns auch heute tief. Die meisten davon werden beim Musikfest zu hören sein.
Mit Sofia Gubaidulina und Olivier Messiaen werden in diesem Heft zwei der größten Komponisten der letzten hundert Jahre liebevoll porträtiert. Das Werk beider ist
nicht zu trennen von den leidvollen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, doch weist ihre – von tiefem Glauben geprägte – Musik auf ganz unterschiedliche Weise himmelweit über alle irdischen Verwerfungen hinaus. Gubaidulina, die meistgespielte Komponistin unserer Zeit, ist mit einigen ihrer wichtigsten Werke beim Musikfest vertreten. Bei Messiaen steht, neben anderen Kompositionen, das von ihm 1940 in deutscher Kriegsgefangenschaft komponierte »Quatuor pour la fin du temps« der szenischen Aufführung seiner einzigen Oper, »Saint François d’Assise«, gegenüber, die mit ihrer gleichsam kosmischen Friedensbotschaft den musikdramatischen Höhepunkt des Festivals markiert. Als ich die Pianistin Elisabeth Leonskaja vor vielen Jahren zum ersten Mal auf der Bühne erlebte, war sie gerade aus der Sowjetunion nach Wien geflohen und ich noch ein Teenager. Die Noblesse und Autorität ihres Spiels, gepaart mit ihrer großen Bescheidenheit, schlagen mich bis heute in ihren Bann. In der Begegnung mit dem Autor Walter Weidringer, die zu einem sehr lesenswerten Porträt über sie geführt hat (Seite 52), spricht sie ein großes Wort gelassen aus: »Musik ist eine heilige Kunst.«
Ich wünsche Ihnen eine friedliche und Ihren geistigen Appetit befriedigende Lektüre!
Ihr
Christoph LiebenSeutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle4
ESSAY
»DER MENSCH IST EIN ABGRUND«
Wie die Musik des 20. Jahrhunderts auf Kriege reagiert hat VON VOLKER HAGEDORN
12
GESCHICHTE
ALS DIE WELT ENTZAUBERT WURDE
Das 17. Jahrhundert war wie kaum ein anderes vom Krieg geprägt. VON PETER REICHELT
20
MUSIKLEXIKON
STICHWORT »KRIEG UND FRIEDEN«
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
VON CLEMENS MATUSCHEK
22
SOFIA GUBAIDULINA
FREIHEIT IN DEN AUGEN
Die Komponistin und ihre überwältigende Musik VON SIMON CHLOSTA
26
OLIVIER MESSIAEN
AVANTGARDE UND EWIGKEIT
Ein Zeitgenosse außerhalb der Zeit VON ALBRECHT SELGE
36
FOTOSTRECKE
DER ZWEITE BLICK
VON KARSTEN KRONAS
50
GLOSSE
VÖLLIG ZUFRIEDENSTELLEND
Über einen zunehmend interessanten Seelenzustand
VON TILL RAETHER
32

ARDITTI QUARTET
MIT EINEM LÄCHELN BIS GRINSEN
Das Ensemble wird 50. Warum? VON BERNHARD GÜNTHER
52

ELISABETH LEONSKAJA
DIE LEBENSFREUNDLICHKEIT
DER GRANDE DAME
Tiefsinn, Transzendenz und traumwandlerische Intuition VON WALTER WEIDRINGER
56
ENGAGEMENT
ICH BIN EIN FAN VON CLAUDIA SCHILLER
58
ADG7
VON JUNGEN SCHAMANEN UND IHREN AHNEN
Die Band holt koreanische Traditionen in die Gegenwart. VON JULIKA VON WERDER
62

JAZZ
DER KLANG, DER DICH ANLÄCHELT
Irreversible Entanglements sind die wohl politischste Band im zeitgenössischen Jazz. VON JAN PAERSCH
66
UMGEHÖRT FRIEDENSBOTSCHAFT
Eine Frage, sieben Antworten VON IVANA RAJIC
68
WELTMUSIK
DER TIEFE BRUNNEN DER GESCHICHTE
Streifzüge durch Armeniens uralte Musik im 21. Jahrhundert VON STEFAN FRANZEN
72
MITARBEITER DIE WAHREN SÄULEN
Sie kümmern sich um das Personal und die Finanzen der Elbphilharmonie. VON FRÄNZ KREMER
82
FÖRDERER UND SPONSOREN

44
STADTESSAY
AUFERSTANDEN AUS RUINEN Kriegsnarben prägen das Hamburger Stadtbild bis heute – oft anders, als man es vermuten würde.
VON TILL BRIEGLEB

16
INTERVIEW
»ES KANN KEINE RECHTFERTIGUNG FÜR EINE SOLCHE
BARBAREI GEBEN«
Der Dirigent Vladimir Jurowski über seine Heimat Russland und den Ukrainekrieg
VON BJØRN WOLL

76
REPORTAGE
AM ENDE DES SCHWEIGENS
Seit Maria Bostelmann weiß, welche NaziVerbrechen ihr Urgroßvater verübt hat, erzählt sie seine Geschichte oft und laut.
VON STEPHAN BARTELS

Seit dem frühen 20. Jahrhundert reagiert die Musik auf einen Krieg nach dem anderen. Vorahnend, unmittelbar oder verzögert, mit und ohne Botschaft, klagend oder anklagend. Eine Spurensuche von Alban Berg bis Steve Reich.
VON VOLKER HAGEDORN
Vielleicht gelingt mir doch einmal etwas Heiteres«, schrieb Alban Berg im Juni 1913 zu einer geplanten Folge von Orchesterstücken. Aber was der 29Jährige am 23. August 1914 zuerst vollendete, »Marsch« genannt, letztes der drei Orchesterstücke Opus 6, mündet in den brutalsten Schluss, der je komponiert wurde. Nach 174 Takten in einer gerade noch durchhörbaren Dichte polyphoner Ereignisse schlägt sich die Musik mit einem Hammerschlag des ganzen Orchesters gleichsam selbst tot. Zu dieser Zeit sind innerhalb von drei Wochen, seit der Krieg begann, schon Hunderttausende umgekommen.
Der Komponist hat, zurückgezogen in ein Alpenidyll südwestlich von Graz, kaum etwas davon mitbekommen und diesen letzten Satz seiner Orchesterstücke ohnehin schon seit dem Frühjahr 1914 konzipiert – keineswegs als »Kriegsstück«. Gerade deshalb kann man in seiner Partitur die Spannungen dieser Jahre, ihre Hypertrophie, ihr destruktives Potenzial, ihr kollektives Unbewusstes fast mitlesen wie in einer Computertomographie – nur dass es hier ein »tongebendes Verfahren« ist, kein bildgebendes. Beklemmend ist auch die leise, beharrliche Mechanik, das Weckerticken vor dem finalen Ausbruch. Alban Berg konnte nicht wissen, dass ihn diese Partitur vom Frieden
in den Krieg begleiten würde. Wer mit dem Blick auf Krieg und Frieden die Musikgeschichte seit dem frühen 20. Jahrhundert erkundet, findet hellseherisch anmutende Innenansichten wie seine, aber auch unmittelbare Reaktionen, politisch motivierte Statements und versteckte Botschaften. Manches Werk reagiert mit »Verspätung« auf nicht zu bewältigende Traumata, manches entsteht »in Echtzeit« parallel zum Kriegsgrauen, mitunter als bewusster Gegenentwurf dazu.
Aber ist nicht jede kreative Arbeit ein Gegenentwurf zum Krieg? »Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg«, schreibt Sigmund Freud 1933 an Albert Einstein in einem öffentlichen Briefwechsel zum Thema Krieg. Für den überzeugten Pazifisten Freud gehört die Dominanz des Liebens gegenüber dem Hassen zu den Errungenschaften der Kultur. Was für den Psychoanalytiker Freud nicht heißt, dass »die Aggressionsneigung mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen« in der Kultur keinen Platz hätte – sie gerät aber unter die Kontrolle des Intellekts. Das können wir in vielen großen Werken unseres Themas erleben. Jedes von ihnen verhält sich zur militärischen Destruktivität aus kultureller Erfahrung heraus, und selbst eine für den Verteidigungskampf komponierte Sinfonie wie die »Leningrader« von Dmitri Schostakowitsch erweist sich bei näherem Hören als hochsensibel.
WER IST FREUND, WER FEIND?
Auf »Freund« und »Feind« ist Kunst nicht zu reduzieren. Das zeigt vor allem Maurice Ravel, der sich nach Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig als Lastwagenfahrer bei Verdun einsetzen lässt. Parallel arbeitet er an der Klaviersuite »Le Tombeau de Couperin«, die er nicht nur dem Barockmeister, sondern auch sieben im Krieg getöteten Freunden widmet. Und doch antwortet er der »Liga zur Verteidigung der französischen Musik«, die 1916 ein Aufführungsverbot zeitgenössischer Musik aus Deutschland und Österreich anstrebt: »Es bedeutet mir wenig, dass Herr Schönberg, zum Beispiel, österreichischer Nationalität ist. Er ist darum nicht weniger ein Musiker von hohem Verdienst, dessen Erkundungen (…) einen glücklichen Einfluss auf gewisse Komponisten auf alliierter Seite und bis hin zu uns gehabt haben.« ›
Aus schwelgerischen Streichermotiven werden Fetzen, Heultöne. Ravels »La valse« vernichtet sich am Ende selbst.
Er weiß freilich nicht, was Arnold Schönberg schon am 28. August 1914 an Alma Mahler über »alle ausländische Musik« schrieb: »Aber jetzt kommt die Abrechnung! Jetzt werfen wir diese mediokren Kitschisten wieder in die Sklaverei und sie sollen den deutschen Geist verehren und den deutschen Gott anbeten lernen.« Übrigens arbeitet Ravel in einem seiner bis heute meistgespielten Stücke tatsächlich mit »Kitsch«, mit Wienerischem gar noch – indem er einen Wiener Walzer in jene Katastrophe führt, die von Anfang an in den unheimlichen Farben, Akzentverschiebungen, Binnendramen von »La valse« lauert, wie eine danse macabre. Das Orchesterwerk fasst gleichsam die Jahre von 1906 – damals entstand das früheste Material – bis 1920 in zwölf Minuten zusammen. Aus schwelgerischen Streichermotiven werden Fetzen, Heultöne; Rhythmus und Harmonik des Walzers werden zur immer dünneren Folie über den Spannungen, der Walzer vernichtet sich am Ende selbst.
Das lässt an die virtuos komponierte Orgie der Zerstörung denken, die Richard Strauss als »Gewitter und Sturm« in seiner »Alpensinfonie« realisiert, einem so beliebten wie zugleich unterschätzten Werk, das nicht nur in seiner Entstehungsgeschichte weit über eine alpine Tondichtung hinausgeht. In Skizzen schon 1900 beginnend, wird ein vielschichtiges Panorama daraus, das – wie Bergs Orchesterstücke – erst im Krieg vollendet wird. Einem Krieg, den Strauss zuerst als »herrlich« begrüßt und schon im Februar 1915 – da ist die Orchestrierung abgeschlossen – ernüchtert als »Morden« bezeichnet. Im »Gewitter« wird eine ganze Welt zermahlen und geschreddert. Strauss wirft – mit Ausnahme des Sonnenmotivs – alle Bestandteile seiner Alpensinfonie in den Häcksler. Nicht erst von hier aus kann man das ganze Werk auch als Zeitkino hören, als »Abschiedsfeier von einem scheinbar intakten Weltbild«, wie der Komponist Helmut Lachenmann meint, der diese Musik »apokalyptisch« findet.
GESPENSTISCHE VERZERRUNG
Die »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts reicht auch in der Musik weit in die Zukunft. Alban Berg erlebt militärische Verrohung zuerst als Reserveoffizier, dann als Kanzlist im Kriegsministerium – Erfahrungen, die in seine 1925 vollendete Oper »Wozzeck« einfließen. »Es steckt ja auch ein Stück von mir in seiner Figur«, schreibt Berg schon 1918 über den Soldaten Wozzeck. In extremer Verdichtung zeigt sein Werk das Zerbrechen des Ich und gibt Wozzecks Satz »Der Mensch ist ein Abgrund« –von Georg Büchner 1836 geschrieben – eine immense
Aktualität. Bergs neue Oper wurde nach der Uraufführung 1925 an so vielen Häusern gespielt, dass der Komponist von den Tantiemen ein Sportcabriolet kaufte und mit Zuversicht den 1930ern entgegenfuhr.
Schon zu deren Beginn zeichnet sich in Deutschland der Aufstieg der Nationalsozialisten ab, deren Diktatur dann den wohl größten Talenttransfer der Weltgeschichte auslöst – um es positiv zu formulieren neben der Tatsache, dass noch nie so viele Talente in so kurzer Zeit ihr Leben verloren. Dass mindestens 1500 europäische Musiker in die USA flohen, darunter bedeutendste Komponisten und Interpreten, gehört auch zum Thema »Krieg und Frieden«.
Wie gespenstisch, wenn Richard Strauss 26 Jahre nach der Uraufführung seiner »Alpensinfonie« dieses Werk im Juni 1941 in München dirigiert, mit nun 77 Jahren, während im Osten drei Heeresgruppen für den Überfall auf die Sowjetunion vorbereitet werden. Im »Gewitter« kommt die Aufnahmetechnik an ihre Grenzen, und das auskomponierte Chaos klingt – für unsere Ohren – so verzerrt, dass es sich realen Frontgemetzeln anzuverwandeln scheint. Eine zufällige und unheimliche Vorwegnahme der Effekte, mit denen Jimi Hendrix 1969 in Woodstock die amerikanische Nationalhymne auf der EGitarre in einen Fliegerangriff verwandelte, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren.
Nach dem Angriff am 22. Juni 1941 entstehen in der Sowjetunion unzählige Lieder und Märsche heroischen Charakters, vor allem aber nehmen zwei Werke ihren Anfang, die den Krieg überdauern. Sergej Prokofjew, 50 Jahre alt, konzipiert seine Oper »Krieg und Frieden« nach Tolstois Roman über den gescheiterten Feldzug Napoleons gegen Russland. Daran wird der Komponist bis zu seinem Tod 1953 arbeiten – eine finale Fassung gibt es nicht.
Das prominentere Werk ist die »Leningrader Sinfonie«, mit deren Komposition der 34jährige Dmitri Schostakowitsch schon vor der Blockade seiner Heimatstadt beginnt, des vormaligen (und jetzigen) Sankt Petersburg. Die Belagerung durch die Wehrmacht beginnt am 8. September 1941 mit dem Vorsatz, die Bürger der Stadt verhungern zu lassen. Bis Juni 1942 sind bereits 400.000 Leningrader an Unterernährung gestorben. Umso wichtiger wird, als symbolischer Widerstand, diese Siebte Sinfonie, die der beizeiten evakuierte Komponist schreibt. Seitdem auch nur Gerüchte darüber die Runde machten, reißen sich die Dirigenten um das Stück. Ein Mikrofilm der Partitur wird nach New York gebracht, wo Arturo Toscanini die amerikanische Erstaufführung realisiert.
Die Propagandatauglichkeit – Schostakowitsch erhält den Stalinpreis 1. Klasse – steht zugleich der späteren westlichen Rezeption im Weg, die hier mehr Botschaft als Originalität wahrnimmt und den »wahren« Schostakowitsch erst wieder in seiner Achten Sinfonie erkennen möchte. Indessen ist der immerwährende Rhythmus des ersten



















Satzes, an Ravels Bolero angelehnt, eine Abstraktion der Logik des Krieges, von schmerzhaften Intervallen überlagert. Es gibt keine Hymnen, keine Helden. Der zweite Satz zeigt ein zerbrechliches Glück, wie etwas Buntes, das ein Kind mit Kreide an eine Wand gemalt hat. Im Adagio zerfällt förmlich das komponierende Subjekt –und selbst im virtuosen Sturmgetöse des Finales finden sich marschuntaugliche SiebenviertelTakte.
Die Siebte hat also durchaus einen Platz an der Seite ihrer dunkleren Schwester, der Achten, verdient, einer Musik der verbrannten und beweinten Erde und der zerreißenden Maschinerien, der Schreie. Eine so persönliche wie komplexe Musik, in der auch die Angst und Not unter dem Regime des Massenmörders Stalin gehört werden können – und die nach ihrer Moskauer Uraufführung 1943 in der Sowjetunion überaus kühl aufgenommen wurde.
BOTSCHAFTEN AUS DEM JAHR 1943
Im selben Jahr 1943 wird im von den Deutschen besetzten Paris ein Werk uraufgeführt, dessen Komponist damit ein beträchtliches Risiko eingeht, auch wenn es »nur« eine Violinsonate ist, die die junge Ginette Neveu in der Salle Gaveau spielt, mit dem 44jährigen Francis Poulenc am Klavier. Zwei Tage zuvor hat er in der Zeitung »Comoedia« ausdrücklich auf den Widmungsträger hingewiesen: Federico García Lorca. Diesen berühmtesten spanischsprachigen Autor der Dreißigerjahre haben Francos Faschisten am 19. August 1936 brutal ermordet, seiner Liberalität wie seiner Homosexualität wegen. Es ist ziemlich unerschrocken, in Paris ein Werk zu seinem Gedenken aufzuführen, mit einem Zitat aus seiner Lyrik, wenn sich die Propagandastaffel der Nazis gerade mal 800 Meter weiter weg befindet. Dass zudem amerikanischer Jazz zitiert wird, nämlich der Standard »Tea for two«, ist auch eine Botschaft. Eine von vielen in diesem persönlichsten Werk Poulencs, das viel über jene Jahre erzählt, nicht weniger als Olivier Messiaens »Quatuor pour la fin du temps« (s. S.26), das Poulenc hoch schätzte. 1943 schrieb er auch eine Musik, die vorerst unaufführbar war. »Figure humaine« für Chor zu Gedichten von Paul Éluard endet mit »Liberté« – jenen Strophen, die als Flugblatt zu Tausenden von britischen Flugzeugen über dem besetzten Frankreich abgeworfen worden waren.
1943 ist außerdem das Jahr, in dem sich im Warschauer Ghetto jüdischer Widerstand gegen die deutschen Besatzer erhob, mit der Folge, dass mehr als 56.000 Menschen ermordet oder in Konzentrationslager deportiert wurden. Ihnen widmet Arnold Schönberg – selbst schon 1933 aus Deutschland über Frankreich in die USA emigriert – sein Werk »A Survivor from Warsaw« für Sprecher, Männerchor und Orchester, geschrieben im August 1947 als eine der frühesten künstlerischen Reaktionen auf den Holocaust. Nur sieben Minuten dauert es, einfach und schwer zu verstehen zugleich. Einfach, da der Sprecher, der »Überlebende«, auf Englisch erzählt, was geschieht, während die Kommandos des berlinernden Feldwebels
auf Deutsch gebrüllt werden, bis zu dem Moment, als die zusammengetriebenen Männer das »Schma Jisrael« zu singen beginnen, eines der wichtigsten Gebete des Judentums. Indessen reflektiert das Orchester das Geschehen in einer zwölftönigen Reihenstruktur, deren komplexe Bezüge sich nicht ohne Weiteres im Zeitmaß der Worte verfolgen lassen.
TATSÄCHLICH EIN ÜBERLEBENDER
In zugänglicherer Musiksprache arbeitet 1962 ein Komponist, der – anders als Schönbergs fiktiver Erzähler – tatsächlich ein Überlebender ist und aus Auschwitz in seine Wahlheimat Paris zurückkehrte. Dort berichtet Simon Laks zwar früh über seine Zeit im KZ, doch als Komponist setzt er sich erst als 60Jähriger direkt mit dem Holocaust auseinander. »Der Sarg war der Ofen des Krematoriums«, so beginnt das Gedicht »Begräbnis« von Mieczysław Jastrun, der uns auf »ein Grab aus Luft« blicken lässt, ganz wie Paul Celan in seiner »Todesfuge«. Laks, gebürtiger Pole, dessen Mutter, Schwester, Neffe die Shoah nicht überlebt haben, der einen Bruder in Warschau verlor, lässt das Klavier so etwas wie einen Legendenton anschlagen, wandernde dunkle Akkorde.
Dem unsagbaren Grauen setzt er die Kontinuität seines Musikdenkens gegenüber. Den Akkorden, den traurigen Bögen der Stimme können wir gut folgen, eine letzte tonale Gravitation ist von fern spürbar, wichtiger sind aber die Sensibilität, die Vorsicht und menschliche Wärme, mit der Laks den Worten folgt. Als großer Liedkomponist wird er erst wiederentdeckt, seit die serielle Avantgarde der Nachkriegszeit ihre jahrzehntelange Definitionshoheit verloren hat.
Die galt in Großbritannien allerdings wenig, und dort wurde 1962 ein Werk uraufgeführt, das noch Dur und Moll kennt und bis heute zum Bedeutendsten zählt, was je zum Thema »Krieg und Frieden« komponiert wurde: das »War Requiem« des 49jährigen Benjamin Britten, entstanden zur Einweihung der neuerbauten Kathedrale von Coventry – jener Stadt, über der die deutsche Luftwaffe am 14. November 1940 500 Tonnen Sprengbomben, 50 Luftminen und 36.000 Brandbomben abgeworfen hatte. »Operation Mondscheinsonate« nannten das die musikalischen Befehlshaber. Britten hatte als Pazifist den Kriegsdienst verweigert und blieb sich darin auch im »War Requiem« treu. »Was für Totenglocken gebühren denen, die wie Vieh sterben?«, sang der englische Tenor Peter Pears bei der Uraufführung. Und der deutsche Bariton Dietrich FischerDieskau sang: »Ich bin der Feind, den du
Schostakowitschs Achte ist eine Musik der verbrannten und beweinten Erde, der zerreißenden Maschinerien, der Schreie.
erschlugst, mein Freund.« Das sind Worte des Dichters Wilfred Owen, der im Ersten Weltkrieg mit 25 Jahren das Leben verlor und diesen Krieg verachtet hatte.
Britten vertonte sie eigens für diese beiden Sänger, den Engländer und den Deutschen, während der liturgische Text dem Chor, dazu einem Kinderchor und einer Sopranistin zugeteilt wurde. Der Erfolg war bahnbrechend, die Anwesenheit von Queen Elizabeth II. unterstrich auch den politischen Rang dieses Versöhnungswerkes. Auf die nukleare Aufrüstung der Supermächte in West und Ost hatte das natürlich keinen Einfluss. Natürlich? Wie »machtlos« die Kunst ist, auch sein muss, darüber lässt sich endlos nachdenken.
DER TAKT DER KEULENTRÄGER
Welche Mittel aber die Musik hat, uns unsägliches Leiden so nahezubringen, dass wir auch die unsägliche Anmaßung, Borniertheit, Dummheit und Machtgier erkennen können, die dahinter stehen, zeigt einer der großen Komponisten unserer Zeit, Steve Reich, 1937 geboren. Fast ein Klassiker ist inzwischen sein Streichquartett »Different Trains« aus dem Jahr 1988, in dem er von Band zugespielte Zeugenaussagen zu den Transporten in die Konzentrationslager zum Gegenstand und Ausgangspunkt einer eindringlichen dokumentarischen Musik macht. Sie fokussiert das Geschehen auf eine Weise, die nichts verkleinert, aber die Hörer nicht mit dem Rücken an die Wand drückt.
Reichs Technik, Sprachmelodien aus Audiodokumenten in instrumentale Patterns zu verwandeln, wird in der VideoOper »Three Tales« von 2002 aufs Visuelle ausgeweitet. Drei Fanale »technischen Fortschritts« nehmen sich Steve Reich und die Videokünstlerin Beryl Korot vor. Am erschütterndsten ist »Bikini« zu den Nuklearwaffen
Tests, die die USA bis 1958 auf den Marshallinseln durchführten, mit unabsehbaren Folgen für die dort lebenden Menschen, die hoher Strahlung ausgesetzt wurden.
Wenn da ein USOffizier den »Eingeborenen« erklärt, welch wichtiger Schritt für die Menschheit das sei, und der Rhythmus seiner Worte ins Ensemble wandert; wenn die eisige Laborsprache »test designed to measure effect on metal flesh air water« weiß auf schwarz flimmert und gleichzeitig von einem Vokalquintett gesungen wird; wenn das digital erstellte Video fast verspielt mit dem Countdown operiert, der den LiveMusikern den Takt vorgibt –dann begreift man in dieser perfekt getimten, mitunter bitter ironischen Collage nicht nur die Tragweite der monströsen Aktion. Man spürt auch die Enge in den Köpfen der Verantwortlichen. Sie haben steinzeitlichen Keulenträgern nichts voraus.
Wir sind weiterhin von solchen Keulenträgern umgeben. Aber mit ihren Arsenalen wächst der Fundus von Musik, in der wir erleben, dass die Dinge ganz anders sein könnten und werden können. Dazu muss sie nicht einmal vom Leiden erzählen, das Beschwiegene zum Klang bringen, den Krieg ins Visier nehmen. Im Oktober jenes Jahres 1915, in dem die Deutschen erstmals Giftgas eingesetzt
haben – 150 Tonnen Chlor auf sieben Kilometern Frontlänge – schreibt der 53jährige Claude Debussy einem Freund: »Es wäre mutlos, an nichts zu denken als an die verübten Schrecken, ohne den Versuch, darauf zu reagieren durch das Wiederherstellen – soweit es meine Mittel erlauben – jener Schönheit, gegen die diese ›Leute‹ wüten …« Er hat in diesem Jahr ein Trio für Flöte, Viola und Harfe komponiert, wie eine glückliche Insel, schwebend und leuchtend. Nur ein schöner Traum? Mag sein. Aber man spielt es seit es einem Jahrhundert.
M MEHR ZUM THEMA FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
A SURVIVOR FROM WARSAW
Fr, 3.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal NDR elbphilharmonie Orchester, Rundfunkchor Berlin alan gilbert (Leitung) Dominique horwitz (sprecher) susanna Phillips (sopran) gerhild Romberger (alt) Maximilian schmitt (tenor) John Lundgren (Bass) arnold schönberg: a survivor from Warsaw
Ludwig van Beethoven: sinfonie Nr. 9
SCHOSTAKOWITSCH ACHTE
Sa, 4.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal Rundfunk-sinfonieorchester Berlin
christian tetzlaff (Violine)
Vladimir Jurowski (Leitung)
Dmitri schostakowitsch: sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65
Bohuslav Martinů: Mahnmal für Lidice
Josef suk: Meditation über den altböhmischen st.-Wenzelschoral op. 35a; Fantasie für Violine und Orchester op. 24
DIFFERENT TRAINS
Di, 14.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal kronos Quartet
steve Reich: Different trains sowie Werke von gubaidulina, Riley, sun Ra, Vrebalov u. a.
FIGURE HUMAINE
So, 26.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal chorwerk Ruhr Jean-guihen Queyras (cello) sebastian Breuing (celesta) elbtonal Percussion
Florian helgath (Leitung)
Francis Poulenc: Figure humaine sofia gubaidulina: sonnengesang
LA VALSE
Sa, 1.6.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal sächsische staatskapelle
Dresden
Lang Lang (klavier) christian thielemann (Leitung)
Maurice Ravel: La valse; Ma mère l’oye (Ballettfassung); konzert für klavier und Orchester claude Debussy: ibéria
WAR REQUIEM
So, 16.6.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal sWR symphonieorchester
London symphony chorus sWR Vokalensemble stuttgart knabenchor hannover irina Lungu (sopran) allan clayton (tenor) Matthias goerne (Bariton) teodor currentzis (Leitung)
Benjamin Briten: War Requiem
Die Bilder:
Käthe Kollwitz: »Schlachtfeld« (1907) Ernst Barlach: »Massengrab« (1915)
Otto Dix: »Die Trümmer von Langemarck« (1924) Pablo Picasso: »Studie ›Weinender Kopf‹ – Skizze zu ›Guernica‹« (1937)


Das 17. Jahrhundert war wie kaum ein anderes vom Krieg geprägt. Aber auch von barocker Pracht und enormem Fortschritt in Kunst und Wissenschaft.
VON PETER REICHELTVergleicht man das subtile architektonische Programm des Grazer Schlosses Eggenberg aus dem 17. Jahrhundert mit dem Raumwidmungsplan des Tagungshotels Hilton in Köln, wird einem schlagartig der intellektuelle Tribut bewusst, den moderne Annehmlichkeiten fordern (können). Stellt Eggenberg den atemberaubenden Versuch einer totalen Spiegelung des Universums in einem repräsentativen Herrschaftsbau dar, so erschöpft sich der Kölner Mietluxus in Klischees, vermengt mit neuen astronomischen Mythen (Stichwort: »Apollo«). Der Ballsaal »Jupiter« im Parterre des Hilton Cologne hat mit dem prunkvollen »Planetensaal« auf der Beletage von Schloss Eggenberg nichts gemein, außer dass er naturgemäß der größte Saal im Haus ist und gerne von mehr oder weniger illustren Partygästen frequentiert wird. Ansonsten ist er schmucklos, »lichtdurchflutet« und (fast) barrierefrei. Magische, in einem komplexen Bildungskosmos aufgehobene Naturphilosophie dort ist ernüchternder Zweckmäßigkeit da gewichen.
Egidius Sadeler: »Kaiser Ferdinand II. triumphiert über seine Feinde« (1629)
Johannes Kepler stand zwar den Horoskopen, die er zur Aufbesserung seines Lebensunterhalts erstellte, im Detail mit einer gesunden Skepsis gegenüber. Ganz von der Hand weisen wollte der geniale Astronom einen Einfluss gewisser Himmelsphänomene auf den Menschen dann aber doch wieder nicht. Obwohl Protagonist der naturwissenschaftlichen »Entzauberung« der Welt, leuchtete Kepler mit der Fackel der Vernunft einen noch stark metaphysisch gedachten Raum aus; und das in einer der finstersten Epochen der Neuzeit, der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der sich den Menschen 1618 im Menetekel eines herbstlichen Kometen ankündigte.
Das 17. Jahrhundert ist als ein äußerst widersprüchliches Zeitalter der Kriege, Seuchen und Wetterkapriolen, eskalierender Glaubenskonflikte, Hexenverfolgungen und xenophober Ausschreitungen, aber auch barocker Prachtentfaltung, absolutistischen Größenwahns und eines enormen wissenschaftlichen Fortschritts in die Geschichte eingegangen. An seinem Beginn steht die Verbrennung des Ketzers Giordano Bruno auf dem Campo de’ Fiori in Rom. An seinem Ende wird der Große Türkenkrieg, der 1683 mit der Zweiten Wiener Türkenbelagerung begann, im Frieden von Karlowitz beigelegt.

Don Quijote und Wallenstein, Simplicius Simplicissimus und Johannes Kepler erscheinen so wie Perihel und Aphel eines entfesselten Totentanzes um eine blutrote Sonne, zu dem Jacques Callots gespenstischer Trommler – in seinem Gesicht steht blankes Entsetzen – vor dem Ballspiel auf der Piazza Santa Croce in Florenz den Takt schlägt. Die berühmte Radierung aus den 1617 veröffentlichten »Capricci di varie figure« macht böse Miene zum guten Spiel und wirkt wie eine Antizipation der kommenden Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges und seiner zahlreichen Nebenschauplätze.
Die Flammen des Krieges sind prinzipiell den höheren Formen menschlichen Strebens unzuträglich. Und dies gilt in den Annalen der oft brutalen Vergangenheit des Menschen für keinen Krieg mehr als für den Dreißigjährigen, der zwischen 1618 und 1648 in den meisten deutschen Ländern (und darüber hinaus) wütete. Die Verwüstungen und die Epidemien, die er nach sich zog, kosteten Europa letztendlich geschätzte 15 bis 30 Prozent der Bevölkerung; eine Stadt wie Augsburg verlor rund zwei Drittel ihrer Bewohner. Der Verlust für die Künste im Allgemeinen und für die Musik im Besonderen war enorm. Eine OnlineSuche im »Grove Dictionary of Music and Musicians« nach dem Schlagwort »Thirty Years War« zeitigt nicht weniger als 132 Treffer: in der Mehrzahl Namen von meist längst vergessenen Komponisten, deren Leben auf irgendeine Weise durch diesen Krieg beeinträchtigt wurde.
Der weitaus wichtigste Name ist der von Heinrich Schütz (1585–1672), dem größten unter Bachs Vorgängern in Deutschland; aber es finden sich auch Männer wie
Blankes Entsetzen im Gesicht: Jacques Callots gespenstischer »Trommler« (1617)
Andreas Hammerschmidt (1611–1675), Heinrich Albert (1604–1651), ein Cousin und Schüler von Schütz, der ein Jahr lang von schwedischen Truppen gefangen war, und Samuel Scheidt (1587–1654), ein Freund von Schütz, der erleben musste, wie jene Kapelle, die er mit viel Liebesmüh in Halle aufgebaut hatte – einer Stadt, die am Ende des Krieges ebenfalls einen großen Teil ihrer Bevölkerung verloren hatte –, in alle Winde zerstreut wurde.
Allerorts fehlten Auftraggeber und Mäzene. Fürsten feuerten ihre Musiker, und die Militärkapellen konnten die Einbußen natürlich nicht auffangen. Sie wirkten auch nicht sonderlich inspirierend, obwohl die Pauken und Trompeten um Pfeifen, Zinken und Schalmeien ergänzt wurden. Dagegen blühte das geistliche Lied. Die Bittgesänge um Frieden sind Legion, die gesungenen Trostgedichte sollten zur wahren Gottesfurcht ermuntern.
Heinrich Schütz’ Werke legen beredtes Zeugnis für die kriegsbedingte Ausdünnung der Ressourcen ab, über die er am Dresdner Hof verfügen konnte. Obgleich es ihm gelungen war, bis zum Jahre 1632 – dem Jahr, in dem Sachsen in den Krieg eintrat – 13 Sänger und eine etwa gleich hohe Anzahl an Instrumentalisten in der Kapelle zu halten, verringerten sich die Zahlen danach rasch. Diese Restriktionen waren für die bescheidenen Besetzungen verantwortlich, die etwa seine »Kleinen Geistlichen Konzerte« oder die »Symphoniae Sacrae« vorschreiben.
Wie aber lassen sich Schlachtengetümmel und Klagegesänge ganz ohne eine menschliche Stimme, allein mit dem Klang von Musikinstrumenten darstellen? Tatsächlich etablierte sich die Instrumentalmusik erst nach und nach zu einer eigenständigen, von der Vokal
musik unabhängigen musikalischen Ausdrucksform. Stand das 16. Jahrhundert noch so sehr unter dem Stern des reinen Vokalensembles a cappella, dass man es das »Zeitalter der Vokalpolyphonie« nennt, so nimmt die reine Instrumentalmusik im 17. Jahrhundert einen unablässigen Aufschwung – und dies interessanterweise in einer ziemlich eindeutigen Parallelbewegung zu wissenschaftlichen Erkenntniszuwächsen etwa in der Astronomie. Es entstehen dezidiert für Instrumente komponierte Stücke, die auf deren Klanglichkeit und technische Möglichkeiten eingehen, und die sich oft explizit als in stile moderno verfasst zu erkennen geben: Sinfonia, Canzone und Sonata. Häufig spiegeln sie als Vorläufer des späteren Konzerts Prinzipien, die einer Schlacht sehr nahekommen. Im Vordergrund steht das Konzertieren, das Wettstreiten einzelner Instrumente oder Gruppen, die gleichsam gegeneinander antreten, sich attackieren, ins Wort fallen, voranpreschen und nachfolgen, um schließlich im Gleichklang miteinander übereinzustimmen.
Die Auseinandersetzung kann schließlich bis hin zur Schlacht, zur Battaglia führen, wobei sich hier der Schwerpunkt von der Klangrede deutlich in Richtung Klangmalerei verschiebt. Die Instrumente ahmen nicht nur Säbelrasseln, Pferdegetrampel und das wüste Durcheinander des Schlachtfeldes nach, sondern auch die Pauken und Trompeten, die bei Schlachten zugegen waren und dort ihre Funktion als Signalgeber oder Ansporn zum Kampf zu erfüllen hatten.
Zu den Charakteristiken der Battaglia – vorbildlich zu studieren etwa an Claudio Monteverdis berühmtem »Combattimento di Tancredi e Clorinda« – gehören daher schnelle und stark akzentuierte Tonrepetitionen, Naturtonreihen in Nachahmung der Fanfaren der Bläsermusik, aber auch insgesamt ein aufgebrachter Duktus und zahlreiche Wechsel in Lautstärke, Metrum und Tempo.
In jedem Kampf gibt es schließlich einen Verlierer, und so mancher Anführer fand in historischen Schlachten ein jähes und tragisches Ende. Gerade im 17. Jahrhundert trifft man auf zahlreiche Klagegesänge, die dem Verlust von Kaisern, Prinzen oder Feldherren gewidmet sind. Neben den bekannten Lamenti aus italienischen Opern, etwa Monteverdis »Lamento d’Arianna«, tauchen auch in der deutschen Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts programmatische Stücke auf, in denen es Instrumenten anvertraut wird, ausdrucksstarke Klagen zum Klingen zu bringen.
Im 3. Kapitel des 3. Buches seines 1668/69 erschienenen Schelmenromans »Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch« beschwört Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621–1676), der selbst im Dreißigjährigen Krieg zwischen die Fronten geriet, ein »irdisches Zwangsparadies«, einen »totalitaristischen Traum vom Ewigen Frieden« (Georg Schmidt) herauf, bei dessen Lektüre einem heute kalte Schauer über den Rücken jagen.
Die Instrumente ahmen Säbelrasseln nach, Pferdegetrappel und das wüste Durcheinander des Schlachtfeldes.
Ein deutscher Leviathan solle, so heißt es in dieser sogenannten »JupiterSzene« des Romans, die göttlichen Friedenspläne mit einem Schwert durchsetzen, das »ein seltene Kraft an sich haben wird, Vulcanus wirds aus den Materialien verfertigen, daraus er mir meine Donnerkeil macht, und dessen Tugenden dahin richten, daß mein Held, wenn er solches entblößet und nur einen Streich damit in die Luft tut, einer ganzen Armada […] auf einmal die Köpf herunterhauen kann, also daß die armen Teufel ohne Köpf daliegen müssen, ehe sie einmal wissen wie ihnen geschehe! […] Alsdann (sagt’ Jupiter ferner) werde ich oftmals den ganzen Chorum Deorum nehmen und herunter zu den Teutschen steigen, mich unter ihren Weinstöcken und Feigenbäumen zu ergötzen, da werde ich den Helikon mitten in ihre Grenzen setzen und die Musen von neuem darauf pflanzen, ich werde Teutschland höher segnen mit allem Überfluß als das glückselige Arabiam, Mesopotamiam und die Gegend um Damasco; die griechische Sprach werde ich alsdann verschwören und nur Teutsch reden und mit einem Wort mich so gut teutsch erzeigen, daß ich ihnen auch endlich, wie vor diesem den Römern, die Beherrschung über die ganze Welt zukommen lassen werde.« – Gott bewahre!
Fr, 10.5.2024 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal
Le concert des Nations, hespèrion XXi, La capella Reial de catalunya Nedyalko Nedyalkov (kaval) yurdal tokcan (Oud) hakan güngör (kanun)
Dimitri Psonis (santur) Jordi savall (gambe und Leitung) »krieg und Frieden« vom Dreißigjährigen krieg bis zum Frieden von utrecht (1618–1713). Werke aus Orient und Okzident von heinrich schütz, samuel scheidt, Jean-Baptiste Lully, g F. händel, arvo Pärt u. a.
HATHOR CONSORT
Fr, 17.5.2024 | 20 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal hathor consort
Dorothee Mields (sopran) Romina Lischka (gambe und Leitung)
Musik gegen »die Widerwertigkeit deß kriegs«. komponisten im Dreißigjährigen krieg: heinrich schütz, samuel scheidt, andreas hammerschmidt, heinrich albert
VOCES SUAVES
Fr, 24.5.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Voces suaves capricornus consort Basel claudio Monteverdi: Madrigali guerrieri et amorosi

Der Dirigent Vladimir Jurowski über seine Heimat Russland und den Ukrainekrieg, über künstlerische Verantwortung und Schostakowitschs Philosophie in Tönen.
VON BJØRN WOLL
Als Putin am 24. Februar 2022 die russischen Truppen in der Ukraine einmarschieren ließ, zählte Vladimir Jurowski zu den ersten Künstlern, die sich öffentlich gegen diesen Angriffskrieg positionierten. Zwei Tage danach begann der gebürtige Moskauer seine Konzerte mit dem RundfunkSinfonieorchester Berlin, wo er seit 2017 Chefdirigent ist, mit der ukrainischen Nationalhymne. Und auch an seiner anderen Wirkungsstätte, der Bayerischen Staatsoper, der er seit 2021 als Generalmusikdirektor vorsteht, setzte er programmatische Zeichen, etwa mit Prokofjews Oper »Krieg und Frieden«, die auf Tolstois pazifistischem Roman basiert.
In seinem Heimatland Russland wurde der 52Jährige wegen seiner deutlichen Worte gegen Putins Regime längst zur Persona non grata erklärt, legte seine Arbeit als Künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Sinfonieorchesters Russlands nieder. Für sein Konzert mit dem RSB im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg hat er zum Motto »Krieg und Frieden« ein ganz persönliches Programm zusammengestellt.
Wie ist das Programm zu Ihrem Konzert in der Elbphilharmonie entstanden?
Vladimir Jurowski: Am Anfang stand Josef Suks »Fantasie«, das war eine gemeinsame Idee mit dem Geiger Christian Tetzlaff, mit dem ich seit vielen Jahren befreundet bin und mit dem ich bereits viele Werke des gängigen Geigenrepertoires aufgeführt habe. Dann kam zusätzlich die Einladung zum Musikfest – und damit auch das Thema »Krieg und Frieden«. Mir fiel dann gleich ein, dass Suk zu Beginn des Ersten Weltkriegs Variationen über einen altböhmischen Choral geschrieben hat: ein Zeichen gegen die deutschösterreichische Kriegsallianz. Danach habe ich das sozusagen tschechische Thema weitergedacht – und da kam mir Bohuslav Martinu˚ in den Sinn, der für mich einer der wichtigsten Vertreter der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts ist. Im amerikanischen Exil hat er sein »Mahnmal für Lidice« geschrieben, ein Aufschrei und Schreckensstück als Antwort auf die barbarische Zerstörung des tschechischen Dorfs Lidice durch ein SSKommando 1942. Damit fehlte nur noch ein Werk für die zweite Konzerthälfte.
Warum fiel Ihre Wahl dabei auf die 8. Sinfonie von Schostakowitsch?
Das war für mich gar keine Frage: Es musste Schostakowitsch sein und unbedingt die 8. Sinfonie. Denn die ist für mich eine Art absoluter, weil zeitloser Mythos über den Krieg per se. Es geht nicht um irgendeinen konkreten Krieg, um keine konkreten Kriegsaktionen, irgendwelche Schlachten oder sonstige politischmilitärische Ereignisse. Es geht einfach um die Menschen und den Krieg als eine philosophische Gegenüberstellung. In gewisser Hinsicht ist diese Sinfonie ein philosophischer Aufsatz in Tönen, ich kenne kein vergleichbares Stück: Die Achte steht über den Dingen. Sie ist losgelöst von jeglichem aktuellen politischen, ideologischen oder sozialen Kontext, und sie ist tatsächlich in jeglicher Zeit – leider – nach wie vor gültig.
Ihr Vater Michail war mit Schostakowitsch befreundet und hat als Dirigent mit ihm zusammengearbeitet. Hat das Ihre Sicht auf Schostakowitsch geprägt? Auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass es Zeiten in meinem Leben gab, in denen ich mich von Schostakowitschs Musik aus eben diesen Gründen eher entfernt habe. Ich wollte mich irgendwie loslösen vom Einfluss meines Vaters, von seiner Überpräsenz in meinem Leben. Und damit ging einher, dass ich einen radikal kritischen Blick auf
Schostakowitsch gewann, der in unserem Haus seit meiner Kindheit eine Ikone war. Ich bin meinem Vater aber auch dankbar für die vielen Gespräche, in denen er mir mit der Partitur in der Hand bestimmte Stellen etwa der 8. Sinfonie erklärt hat. Ich habe sie erst verstanden, nachdem ich mit ihm darüber sprach. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass man sich irgendwann von einem solchen, auch wahnsinnig starken und positiven Einfluss lösen will und dann seine eigene Beziehung mit der entsprechenden Musik aufbaut. Das ist auch genau das, was mein Vater seinerseits sagte: Man darf die großen Werke der Vergangenheit nicht wie Ikonen anbeten, man muss ihre Sprache sprechen lernen und dann einen Dialog auf Augenhöhe mit ihnen führen.
Schostakowitsch ist wenige Jahre nach Ihrer Geburt gestorben, Sie haben also vermutlich keine eigenen Erinnerungen an ihn. Hat Ihr Vater Ihnen denn erzählt, was für ein Typ, was für ein Mensch Schostakowitsch war?
Nicht nur mein Vater, sondern auch meine Mutter und meine Großmutter, die den Schostakowitsch ja noch viel früher als mein Vater gekannt hat. Die haben mir sehr viel von ihm berichtet. Ich kannte aber auch viele andere Menschen aus seinem Umfeld. Seine Witwe Irina zum Beispiel, die mehrmals bei Konzerten von mir war, in denen ich seine Werke dirigiert habe. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich diesen Menschen selbst gekannt habe. Ich habe außerdem so ein »mystisches« Erlebnis mit der 15. Sinfonie, denn ich war unsichtbarerweise bei der Uraufführung tatsächlich dabei. Meine Mutter saß damals im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums neben Schostakowitsch und war bereits schwanger mit mir. Später als Kind und Jugendlicher hörte ich diese Musik dann oft zu Hause auf Platten, die mein Vater spielte.
1990 haben Sie mit Ihrer Familie Russland verlassen und sind nach Deutschland gezogen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit in der Sowjetunion als junger Mensch?
Die Zeit ist mir immer noch sehr präsent. Ich habe die ersten 18 Jahre meines Lebens dort verbracht, also die prägenden Jahre. Ich bin sehr behütet aufgewachsen und hatte eine glückliche Kindheit. Dank der Bemühungen meiner Eltern habe ich von der ganzen gesellschaftlichen Misere gar nichts mitbekommen. Als ich dann in die Schule kam, war das für mich die erste Begegnung mit der realen Welt da draußen, das war ein Schock. Später habe ich am Konservatorium in Moskau Musiktheorie studiert, als angehender Musikwissenschaftler. Damals hatte man dort wirklich die bestmögliche Ausbildung, die überhaupt irgendwo zu finden war.
Stimmt es, dass Sie zunächst gar nicht nach Deutschland wollten?
Ich wollte tatsächlich nicht. Ich war glücklich mit meiner Ausbildung, wollte dort weiter studieren. ›
»Solange es möglich war, die Zivilgesellschaft in Russland aufrechtzuerhalten, eine alternative Gesellschaft mit alternativen Werten, musste man dafür kämpfen.«
Außerdem hatte ich das Gefühl, dass ich mich endlich selbst und auch echte Freunde fürs Leben gefunden hatte. Gleichzeitig wurden die gesellschaftlichen Widrigkeiten und Probleme immer größer, es war die Zeit der Perestroika. Die brachte viel Positives, aber auch viel Unsicherheit. Außerdem hätte mich niemand von der Wehrpflicht erlöst, die kam automatisch mit dem 18. Lebensjahr. Vor allem meine Eltern hatten Angst, dass mir beim Militärdienst etwas zustößt. Denn die Sitten dort waren damals mehr als rau. Und für jemanden, der aus diesen IntelligenzlerKreisen kam, war der Militärdienst umso schwerer. Zudem lief man Gefahr, in einen der damaligen militärischen Konflikte geschickt zu werden, nach Afghanistan oder in eine der abtrünnigen Republiken, wo in den späten Achtzigerjahren immer mehr Aufstände begannen. Das war durchaus möglich, so wie man heute die jungen Rekruten in die Ukraine als Kanonenfutter schickt.
Als Russland in der Ukraine einmarschierte, haben Sie sich als einer der ersten russischen Künstler gegen den Angriffskrieg positioniert. Warum war Ihnen das so wichtig?
Wahrscheinlich wegen meiner zehnjährigen aktiven Tätigkeit in Moskau, wo ich als Künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen Sinfonieorchesters, einem der wahrscheinlich wichtigsten Sinfonieorchester Russlands, eine relativ hohe Position hatte. Ich fühlte mich zwar nicht mitschuldig, aber irgendwie mitverantwortlich für das Ganze. Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel nach der Annexion der Krim, meine Tätigkeit dort einzustellen. Das habe ich besonders nach dem Abschuss des malaysischen Flugzeugs im Juli 2014 auch wirklich erwogen. Ich war damals schockiert und kurz davor, einen Brief zu schreiben und abzudanken. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das Orchester braucht mich. Und auch die Menschen, die in unsere Konzerte kamen, brauchten uns. Das heißt, solange es möglich war, die Zivilgesellschaft dort aufrechtzuerhalten, eine alternative Gesellschaft mit alternativen Werten, musste man dafür kämpfen.
Wie haben Sie das gemacht?
Ich hatte damals tatsächlich eine Carte blanche, mir konnte keiner in die Programme reinreden – und das habe ich zu hundert Prozent zur Weitervermittlung der liberalen
und demokratischen Werte verwendet. Aber es begann sich langsam fester und fester zu schrauben, was die Programmgestaltung angeht. Ganz am Ende, da merkte man dann: Die Ideologie gewinnt wieder die Oberhand. Und dennoch gehörte ich zu denjenigen, die bis zum Schluss, die noch einen Tag vor Kriegsbeginn gesagt haben: Ihr werdet sehen, es wird nichts passieren, das ist nur Säbelrasseln. Ich war tatsächlich überzeugt davon.
Die Situation war sicher auch für Sie persönlich schwierig, denn Teile Ihrer Familie kommen aus der Ukraine.
Es war ein Schock! Gut die Hälfte meiner Familie stammt aus der Ukraine. Sie gehörten zwar nicht der ukrainischen Nationalität an, aber meine Mutter hat in Kiew studiert und sprach Ukrainisch, genauso wie meine Oma, die 2014 gestorben ist. In meiner Kindheit fuhren wir jedes Jahr nach Kiew, um unsere Verwandten zu besuchen, das war ein Teil meiner Heimat. Dieser Krieg, diese ganze Situation erschien mir so absurd. Wenn wir uns die Umstände im Donbas ansehen, müssen wir aber anerkennen, dass die ukrainischen Regierungen der letzten 30 Jahre auch nicht immer gerecht gehandelt haben, da gab es durchaus eine Diskriminierung der russischen Bevölkerung. Aber das ist kein Grund, einen solchen Krieg anzufangen.
Ihr klares Statement gegen den Krieg blieb für Sie allerdings nicht ohne Folgen, bereuen Sie es?
Es kann keine Rechtfertigung für eine solche Barbarei geben, insofern bereue ich meine emotionale Reaktion von damals überhaupt nicht. Allerdings bedaure ich, dass ich infolge dessen keine Möglichkeit mehr habe, nach Russland zu gehen, um meine Freunde zu sehen und dort Musik zu machen. Obwohl ich unter den aktuellen Umständen dort gar keine Musik machen würde. Selbst wenn 90 Prozent der Menschen, die zu uns ins Konzert kommen, Gleichgesinnte wären, könnten immer noch zehn Prozent HurraPatrioten darunter sein. Und mit diesen Menschen will ich im Moment wirklich nichts zu tun haben. Das ist für mich purer Faschismus, was dort betrieben wird. Es erinnert mich fatal an die Dreißigerjahre in Deutschland, wie Andersdenkende heute in Russland verfolgt und diskriminiert werden. Ich würde sagen, die Innenpolitik Putins gegenüber seinen eigenen Mitbürgern ist für mich im Moment ein noch stärkerer Grund, nicht dahin gehen zu wollen, als der Krieg gegen die Ukraine.
Gerade zu Kriegsbeginn war der Druck auf russische Künstler hoch, sich deutlich gegen den Krieg auszusprechen. Wie erleben Sie das heute?
Der Druck war tatsächlich da. Es sind dabei auch Ungerechtigkeiten passiert, dass etwa Konzerte von Künstlern ohne einen triftigen Grund abgesagt wurden. Auch der Umgang mit dem russischen Repertoire war nicht immer richtig. Sei es in der Musik, im Theater oder der Literatur, wo tatsächlich der Versuch unternommen wurde, einen

Jurowski bei Proben mit dem RSB: »Ich denke, dass richtige Kunst die Fähigkeit besitzt, Ereignisse von früher zu transzendieren.«



ganzen Teil der Weltkultur, nämlich die russische Kultur, erst einmal stumm zu schalten. Das ist ja genau das, was Putin will, es rechtfertig seine Handlungen. Gott sei Dank ist das in Deutschland und auch im anderen westlichen Ausland inzwischen anders. Nur Skandinavien ist ein bisschen problematischer, und ganz schwierig sind die an Russland angrenzenden osteuropäischen Länder wie Polen und auch die baltischen Staaten. Aber insgesamt hat sich die Lage doch entspannt, und wir sehen zum Beispiel hier in München an der Bayerischen Staatsoper, dass die Einladung von Künstlern aus Russland, wenn sie nicht eindeutig und nachweisbar mit Putins Regierung in Verbindung stehen, gar kein Problem ist. Nur dass die Menschen nicht direkt reisen können, sie müssen daher über die Türkei oder über die Arabischen Emirate kommen.
Was kann Musik, was kann Kunst, was können Sie als Künstler ganz konkret in Zeiten wie diesen überhaupt tun?
Vor einigen Monaten haben wir in Berlin mit dem Rundfunkorchester Beethovens »Missa solemnis« gespielt. Das schien damals eine direkte Antwort auf die Ereignisse in Israel zu sein, wenn im »Dona nobis pacem«, der Bitte um inneren und äußeren Frieden, plötzlich die apokalyptischen Kriegstrompeten ihre Fanfare schmettern. Das ist
erschreckend, weil Beethoven vor 200 Jahren etwas erschuf, was heute immer noch eine wahnsinnige Aktualität besitzt. Ich denke, dass richtige Kunst, die hohe Kunst, tatsächlich die Fähigkeit besitzt, Ereignisse von früher zu transzendieren, sie emotional und philosophisch zu verarbeiten –und gleichzeitig auch die Fähigkeit, alle Ereignisse der Zukunft, vor allem die tragischen, voraussagen zu können. Wenn wir nach irgendeiner Tragödie auf der Welt etwa Bachs »hMollMesse« hören, haben wir das Gefühl, die Musik sei speziell für dieses Ereignis komponiert. Das ist für mich die Kraft dieser transzendierenden Emotion, die in allen großen Kunstwerken zu finden ist.
VLADIMIR JUROWSKI
Sa, 4.5.2024 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal Rundfunk-sinfonieorchester Berlin Vladimir Jurowski (Leitung), christian tetzlaff (Violine) Bohuslav Martinu˚: Mahnmal für Lidice Josef suk: Meditation über den altböhmischen st.-Wenzelschoral op. 35a; Fantasie für Violine und Orchester op. 24 Dmitri schostakowitsch: sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
Diesmal …
VON CLEMENS MATUSCHEK
ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

LUDWIG VAN BEETHOVEN: WELLINGTONS SIEG
Damals, als es noch keine BlockbusterKriegsfilme gab, musste es eben die Musik richten. »Battaglia« genannte Stücke machten den Schrecken und die vermeintliche Glorie des Kampfes für jedermann erlebbar – vom sicheren Plüschsessel im Konzertsaal aus. Populär wurden diese konzertanten Hörspiele Mitte des 17. Jahrhunderts als Reaktion auf den Dreißigjährigen Krieg. Den zweifelhaften Höhepunkt des Trends stellt Beethovens musikalische Imitation der Schlacht bei der nordspanischen Stadt Vitoria in den Napoleonischen Kriegen 1813 dar. Darin lässt er britische und französische Märsche und militärische Trompetensignale antreten, bevor mit einem Großaufgebot an Trommelfeuer und Kanonenschlägen im Orchester die eigentliche Schlacht entbrennt. Am Ende erklingt die siegreiche britische Hymne. Ausgerechnet dieses groteske Werk wurde zu Beethovens Lebzeiten sein größter Hit.

BENJAMIN BRITTEN: WAR REQUIEM
1940 legte die deutsche Luftwaffe die englische Industriestadt Coventry in Schutt und Asche. Die massive Bombardierung unter dem zynischen Decknamen »Operation Mondscheinsonate« zerstörte auch die berühmte Kathedrale. Direkt neben ihren Ruinen wurde später ein modernes Gotteshaus errichtet, genau wie bei der Berliner Gedächtniskirche. Zu ihrer Einweihung 1962 steuerte Englands wichtigster Komponist Benjamin Britten – der schon wenige Wochen nach Kriegsende mit Yehudi Menuhin für Überlebende im KZ BergenBelsen gespielt hatte – das höchst ergreifende »War Requiem« bei, das sowohl die Opfer beweint als auch Frieden und Versöhnung verkündet. Sichtbarstes Zeichen dafür war die Wahl der Solisten: die russische Sopranistin Galina Wischnewskaja, der englische Tenor Peter Pears (Brittens Lebenspartner) und der deutsche Bariton Dietrich FischerDieskau.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: JOSHUA
Musikwerke, die sich mit Krieg und Frieden beschäftigen, gibt es viele. Nur selten aber wird die Musik selbst zur Waffe. In Francis Ford Coppolas VietnamDrama »Apocalypse Now« nutzen die Amerikaner Wagners »Walkürenritt« während eines HubschrauberAngriffs zur psychologischen Kriegsführung. Noch viel konkreter wird es im Alten Testament, wenn die Posaunen bzw. SchofarHörner der jüdischen Armee die Mauern des belagerten Jericho einstürzen lassen. Das zu vertonen ist natürlich ein echter Leckerbissen, den sich ein gewiefter Komponist wie Händel nicht entgehen ließ – zumal er damit die Macht der Musik beweisen konnte. Ohnehin hatte er sich, als seine Operntruppe pleiteging, auf das geistliche Oratorium verlegt, das ein besseres KostenNutzenVerhältnis bot. Die JerichoSzene in »Joshua« gestaltete er mit einem pompösen BlechbläserMarsch (den er allerdings bei einem Kollegen abschrieb) und panisch zitternden Chorsängern.

CHARLES IVES: THREE PLACES IN NEW ENGLAND
Ives gilt als ein Maverick der Musikgeschichte und, obwohl zu Lebzeiten praktisch unbekannt, als erster wahrhaft amerikanischer Komponist. In seinen Werken überlagerte er oft mehrere Ebenen von Texturen und musikalischen Zitaten: Kirchen und Volkslieder, Spirituals, Kunstmusik und Militärmärsche, die er bei seinem Vater aufgeschnappt hatte, einem Bandleader der US Army. Diese auf tonale und stilistische Kollisionen keine Rücksicht nehmende CollageTechnik kommt auch bei den »Three Places in New England« von 1914 zur Anwendung. Die ersten beiden Sätze sind von Denkmälern inspiriert: für eines der ersten ausschließlich aus Schwarzen bestehenden SezessionskriegsRegimenter und für Israel Putnam, einen General im Unabhängigkeitskrieg. Im dritten Satz blickt Ives selbst friedlichnachdenklich auf die Geschichte und den strömenden Housatonic River.
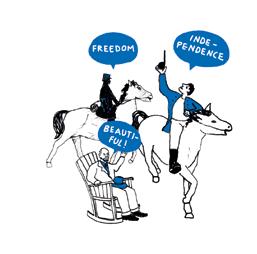
KRZYSZTOF PENDERECKI: THRENOS
Geboren 1933, wusste der polnische Komponist Krzysztof Penderecki nur zu gut, welch fragiles Gut der Frieden ist: »Ein Onkel von mir wurde als hoher Offizier in Katyn getötet, ein anderer war im Widerstand und wurde in Warschau erschossen.« Den Opfern des AtombombenAbwurfs auf Hiroshima widmete er 1961 sein Werk »Threnos« – was im Altgriechischen Weh oder Totenklage bedeutet – für 52 Streicher. Wobei dieser Terminus viel zu kurz greift: Gemäß der grafisch notierten Partitur streichen die Musiker nicht nur, sondern sägen, drücken, quetschen, zupfen, reißen, spielen auch auf Korpus, Steg und Saitenhalter. Die Musik schwankt zwischen HorrorKreischen, wuchtigen ClusterBallungen und grenzenloser Leere. Den tonangebenden Serialisten der NeueMusikSzene mit ihren kleinteiligen Konstruktionen blieb der Mund offen stehen angesichts solch hemmungsloser Intensität, dem Publikum erst recht.
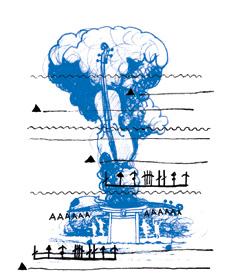
MAURICIO KAGEL: ZEHN MÄRSCHE, UM DEN SIEG ZU VERFEHLEN
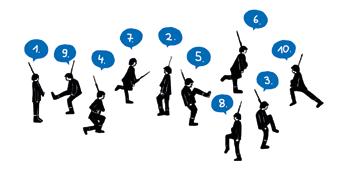
»Wenn ich von der Kriegskunst so viel verstünde wie von der Tonkunst, würde ich Napoleon besiegen«, meinte Beethoven angeblich einmal. Bei Mauricio Kagel ist es umgekehrt: Wenn alle Armeen nach seiner Musik marschierten, gäbe es keinen Krieg mehr auf der Welt. Die Soldaten würden aus dem Takt geraten, stolpern, sich gegenseitig über den Haufen laufen, auf einem Bein hüpfen, mittendrin stehenbleiben und sich kaputtlachen. Und dann Arm in Arm nach Hause gehen. Kagels MarschParodie von 1979 ist typisch für den argentinischdeutschen, lange in Köln wirkenden Komponisten, dem Schalk der Neuen Musik. Er schrieb ein Solo für Dirigent, ein Stück für 111 Radfahrer und das dadaistische Werk »Staatstheater«, das 1971 an der Hamburgischen Staatsoper für einen Skandal sorgte. Wie seinem GeistesBruder Till Eulenspiegel ging es ihm dabei aber stets um tiefere Weisheiten: »Nur Leute, die Humor haben, sind unerbittlich ernst.«
JOHN LENNON: GIVE PEACE A CHANCE
In den Flitterwochen kann man ruhig mal ein bisschen länger im Bett bleiben. Dachten sich wohl auch John Lennon und seine frisch angetraute Frau, die AvantgardeKünstlerin Yoko Ono – und verbrachten im März 1969 die gesamte Zeit im Bett ihrer Suite im HiltonHotel Amsterdam. »Kommt und redet mit uns über den Frieden«, lautete ihre Einladung an die Presse, die das gern annahm, wohl weil das Paar kurz zuvor auf dem Cover der ersten gemeinsamen LP nackt posiert hatte. Doch Lennon und Ono ging es tatsächlich um den Weltfrieden, für den sie sich auf dem Höhepunkt der Beatlemania, der HippieBewegung und des VietnamKrieges mit ihrer Popularität einsetzen wollten. Zwei Monate später wiederholten sie ihre »Bedin« getaufte Aktion in Montreal, wobei auch der FlowerPowerSong »Give Peace a Chance« entstand und aufgenommen wurde –die erste SoloSingle eines Beatle überhaupt. Schlussendlich sollte der Song also weniger das Ende des Krieges einläuten als vielmehr das Ende der Band.

M DIE PLAYLIST ZUM LEXIKON FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/PLAYLIST

»Nur wenn es gelingt, aus dem Alltag herauszutreten, kommt es zum Imaginären«: Sofia Gubaidulina in ihrem Haus in Appen (2020)

Sofia Gubaidulina und ihre im besten Sinn überwältigende Musik
VON SIMON CHLOSTADas vielleicht schönste Zitat über Sofia Gubaidulina stammt vom Dirigenten Simon Rattle: Sie sei wie ein »fliegender Einsiedler«, denn sie befinde sich immer »auf einer Umlaufbahn und besucht nur gelegentlich terra firma. Ab und zu kommt sie zu uns auf die Erde und bringt uns Licht und geht dann wieder auf ihre Umlaufbahn.« Wer der mittlerweile 92jährigen Komponistin einmal begegnen durfte, bekommt eine Ahnung davon, was Rattle gemeint haben könnte: Gubaidulina scheint in ihrer eigenen Welt zu leben; es umgibt sie eine tiefe Aura, wie sie nur ganz große Künstlerinnen und Künstler besitzen, zugleich wirkt sie unnahbar, fast scheu. Eigentlich kaum zu glauben, dass aus den Gedanken dieser zierlichen Person derartige Klänge entstehen. Ihre Werke sind oft düster und gewaltig, verlangen einen riesigen Orchesterapparat – Überwältigungsmusik im besten Sinne.
Geboren wurde Sofia Gubaidulina 1931 in Tschistopol in der autonomen russischen Republik Tatarstan. Sie studierte in Kasan und am Moskauer Konservatorium und ist seit 1963 als freischaffende Komponistin tätig. In der Sowjetunion fanden ihre Werke jedoch kaum Beachtung und wurden zeitweise mit einem Aufführungsverbot belegt – sie entsprachen nicht den Vorgaben des Sozialistischen Realismus, der jede Form von Abstraktion ablehnte. Ihren Lebensunterhalt verdiente Gubaidulina in dieser Zeit unter anderem mit Filmmusik.
Es war Dmitri Schostakowitsch, der sie ermutigte, auf ihrem »Irrweg« weiterzugehen. Politischer Aktivismus stand für sie dabei allerdings nicht im Vordergrund. »Es war vielmehr eine ideologische Angelegenheit. Es ging um die Frage der Freiheit«, erzählte sie bei einem Gespräch vor vier Jahren bei ihr zu Hause. »Ohne die hätte ich als Komponistin nicht weiterleben, ohne eine freie Seele nicht schreiben können. Da gab es nur ein Entwederoder. Aber eine freie Tätigkeit war in diesem Regime nicht möglich. Ich war nicht gefährlich, das Problem war nicht meine Musik, die war eigentlich egal. Aber der Wunsch nach Freiheit lag in meinen Augen.«
Längst muss Gubaidulina nicht mehr um Anerkennung kämpfen. Ihre Musik wird von Dirigenten wie Christian Thielemann und eben Simon Rattle geschätzt und von Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und dem Gewandhausorchester Leipzig aufgeführt. Das OnlineMagazin »Bachtrack« hat sie gerade erst zur meistgespielten Komponistin der Welt gekürt. Doch auch unabhängig vom Geschlecht zählt sie zu den am höchsten geehrten klassischen Musikschaffenden, ausgezeichnet mit Preisen wie dem schwedischen Polar Music Prize, dem japanischen Praemium Imperiale und in Deutschland mit dem Bundesverdienstkreuz. Ihre Trophäen muss manin ihrem Wohnzimmer jedoch regelrecht suchen. Spricht man sie darauf an, beginnen ihre Augen trotzdem
zu strahlen. Stolz zeigt sie ihren Besuchern den Goldenen Löwen der MusikBiennale Venedig und die Goldmedaille der Royal Philharmonic Society London. Bereits seit 1992 lebt die Komponistin in einem von Bäumen umringten Haus in Appen, einer kleinen Gemeinde nordwestlich von Hamburg. Ihr Nachbar war der 2012 verstorbene russische Komponist Viktor Suslin, mit dem sie in den Siebzigerjahren eine Improvisationsgruppe gründete. Seine Witwe, die Klavierpädagogin Julia Suslin, lebt noch heute dort. Gubaidulina selbst war dreimal verheiratet; ihre Tochter, an die ein Bild im Wohnzimmer erinnert, verstarb bereits vor einigen Jahren. Appen hat sich Gubaidulina vor allem wegen der Nähe zu ihrem Verlag Sikorski ausgesucht – und weil ihr dieser entlegene Ort die nötige Freiheit und Ruhe für ihre Arbeit gibt. »Ich brauche Stille und Einsamkeit«, so die Komponistin, die die »Befreiung vom alltäglichen Leben« als die wichtigste Voraussetzung bezeichnet. »Nur wenn es gelingt, aus dem Alltag herauszutreten, kommt es zum Imaginären.« Ihre Kompositionen entstehen dabei ausschließlich am Schreibtisch. An ihren Flügel, den ihr einst Mstislaw Rostropowitsch schenkte, setzt sie sich nur noch, »wenn es die Zeit erlaubt«. Ansonsten äußert sich Gubaidulina, die auch Deutsch spricht, nur ungern über ihre Musik. Erst recht nicht während des Kompositionsprozesses, in dem sie sich nach eigener Aussage vollständig für das Werk aufopfert – nur keine Ablenkung!
Gesagt und geschrieben wurde über ihre Musik trotzdem viel. Sie sei »verkopft, aber ohne, dass dieser Kopf je im Vordergrund steht«, sagte etwa AnneSophie Mutter, die Widmungsträgerin ihres Zweiten Violinkonzerts »In tempus praesens« aus dem Jahr 2007 – und spielte damit einerseits auf die mathematischen Konzepte an, die Gubaidulina ihren Kompositionen zugrunde legt, andererseits auf die enorme emotionale Wirkung, die diese Musik trotz ihres Intellekts stets ausstrahlt. Ihre Klänge berauschen und entfalten eine suggestive Kraft, sind aber niemals plakativ. Und obwohl die Schöpferin meist auf traditionelle Kompositionsformen und methoden zurückgreift, klingt ihre Musik auf bemerkenswerte Weise neu. Fast immer kreisen Gubaidulinas Werke um ihr zentrales Lebensthema, ihren Glauben. »Ich kann mir keine Kunst vorstellen, die sich nicht zum Himmel, zum Vollkommenen, zum Absoluten wendet«, hat sie einmal ihr musikalisches Credo beschrieben. 1970 ließ sie sich russischorthodox taufen. Ihre Verbundenheit mit dem göttlichen Kosmos prägt ihr gesamtes Schaffen und offenbart sich in zahlreichen religiös inspirierten Werktiteln. So bereits bei ihrem Ersten Violinkonzert »Offertorium«, das die damals 50Jährige 1981 für Gidon Kremer schrieb und das für sie den internationalen Durchbruch bedeutete. In Hamburg ist nun ihr erst 2022 ›

uraufgeführtes Orchesterwerk »Der Zorn Gottes« zu hören, in dem Gubaidulina mit geradezu apokalyptischen Klängen eine musikalische Erzählung des Jüngsten Gerichts entwirft.
Wenn nicht unmittelbar religiös, dann sind ihre Kompositionen meist von Dichtung inspiriert. Ihr Drittes Violinkonzert etwa trägt den Titel »Dialog: Ich und Du« (2018) und bezieht sich auf das gleichnamige Buch Martin Bubers aus dem Jahr 1923, in dem der jüdische Philosoph und Theologe die Beziehungen von Menschen beschrieb. Oft sind Gubaidulinas Quellen aber noch viel älter. In der außergewöhnlichen Besetzung für Chor, Cello und Schlagzeug vertonte sie 1997 mit dem die Schöpfung preisenden »Sonnengesang« des Heiligen Franz von Assisi aus dem 13. Jahrhundert das älteste bekannte Zeugnis der italienischen Literatur.
Auch bei ihrem Vierten Streichquartett handelt es sich um eine – wenn auch sehr abstrakte – »musikalische Reaktion auf die schöpferische Welt« eines Literaten, nämlich T. S. Eliot. Dessen Gedanken über »die Geburt des ›echten Echten‹ aus dem ›unwirklich Künstlichen‹« übersetzt Gubaidulina in verschiedene, zum Teil vom Quartett vorab auf Tonband aufzuzeichnende Klangschichten, die zudem um FarblichtProjektionen ergänzt werden. Das Kronos Quartet hat diese innovative Synthese aus Klang und Licht 1993 in der New Yorker Carnegie Hall uraufgeführt (und kommt damit nun zur Feier seines 50. Jubiläums auch in die Elbphilharmonie).
Leidenschaft für außereuropäische
Instrumente: Sofia Gubaidulina mit einer Sitar aus ihrer Sammlung (1993)
Gubaidulinas besondere Vorliebe für düstere, tiefe Klangfarben wiederum zeigt sich etwa bei ihrem Konzert für Fagott und tiefe Streicher (1975), ebenso bei dem einsätzigen Werk »Am Rande des Abgrunds« (2003) für sieben Celli und zwei mit Wasser gefüllte Aquaphone, deren Klang an Walgesänge erinnert. Zugleich steht dieses Stück exemplarisch für Gubaidulinas Interesse an einem Instrumentarium, das über die traditionelle Orchesterbesetzung hinausgeht; die Komponistin selbst besitzt eine ganze Sammlung außereuropäischer Instrumente und greift auf diese auch regelmäßig in ihren Arbeiten zurück.
Trotz all der Anerkennung und des persönlichen Erfolgs blickt Gubaidulina eher pessimistisch auf die Gegenwart. »Warum ist der Hass in der Welt so gewachsen, obwohl das Leben doch eigentlich durch den technologischen Fortschritt immer leichter für den Menschen wird?«
Auch aus diesem Grund hat sie vor einigen Jahren das Oratorium »Über Liebe und Hass« geschrieben, das 2016 in Tallinn zur Uraufführung kam und als ihr Opus summum gilt. »Ich habe sehr alte Texte aus der Bibel gewählt, um etwas Allgemeingültiges zu schaffen und zu zeigen, dass die Gegensätze Liebe und Hass schon immer existiert haben. Allerdings scheint mir diese Diskrepanz heute unüberwindbarer als in der Vergangenheit.« Liebe dorthin tragen, wo Hass regiert – so hat sie einmal ihr künstlerisches Anliegen beschrieben. Und wenn sie das schon nicht politisch verstanden wissen möchte, so ist es doch zutiefst menschlich.
M MEHR ZU SOFIA GUBAIDULINA FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
SCHWERPUNKT SOFIA GUBAIDULINA
Mi, 8.5.2024 |20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal hr-sinfonieorchester
Maxime Pascal (Leitung) Baiba skride (Violine) sofia gubaidulina: Dialog: ich und Du / 3. Violinkonzert; Der Zorn gottes sowie Werke von strawinsky und Messiaen
Di, 14.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal kronos Quartet sofia gubaidulina: streichquartett Nr. 4 sowie Werke von Reich, Riley, sun Ra, Vrebalov u. a.
So, 26.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal chorwerk Ruhr Jean-guihen Queyras (cello) sebastian Breuing (celesta) elbtonal Percussion Florian helgath (Leitung) sofia gubaidulina: sonnengesang sowie Musik von Poulenc
Do, 30.5.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal David spranger (Fagott) Mitglieder des NDR elbphilharmonie Orchesters Marin alsop (Leitung) sofia gubaidulina: am Rande des abgrunds; Mirage – Die tanzende sonne (Fata Morgana); konzert für Fagott und tiefe streicher




















VON ALBRECHT SELGE
ILLUSTRATIONEN KATRIN FUNCKE
Eine der friedvollsten Kompositionen der Musikgeschichte ist ein Kind des Krieges. Die Uraufführung von Olivier Messiaens »Quatuor pour la fin du temps« gehört zu den großen Legenden der Musik des 20. Jahrhunderts. Wobei der Legendenstatus bereits signalisiert, dass man das eine oder andere Detail mit Vorsicht genießen sollte. Oder allegorisch.
Das »Quartett für das Ende der Zeit« wurde am 15. Januar 1941 in einer Baracke im Kriegsgefangenenlager Stalag VIII A in der Nähe des schlesischen Görlitz zum ersten Mal gespielt. Wenn Messiaen sich später erinnerte, dass bei dieser Aufführung 5000 Zuhörer dabei gewesen seien, dann darf man sich daran erinnern, was wir in der Schule über die Symbolik biblischer Zahlenangaben gelernt haben. Konkreter: über die »Speisung der 5000«, von der alle Evangelien berichten. Da geht es weder um eine göttliche Wunderkantine noch um eine statistisch exakte Fütterungsbilanz, sondern um das höhere, wahre Sattwerden vieler, potenziell aller Menschen. Im gleichen höheren Sinn dürfte auch Messiaens Verklärung der Rezeption des Publikums, bunt gemischt vom Hilfsarbeiter bis zum Geistlichen, zu verstehen sein: »Nie wieder hat man mir mit solcher Aufmerksamkeit und solchem Verständnis zugehört wie damals.«
Das alles trotz sehr reellem Hunger, der auch in die Entstehung des Werks selbst hineinwirkte, wie Messiaen beschrieb: »Während meiner Gefangenschaft löste der Nahrungsmangel bei mir farbige Träume aus: Ich sah den Regenbogen des Engels und ein seltsames Kreisen von Farben.« Auch dürfte es auf der physischen Ebene bitterkalt gewesen sein in der elenden Baracke des Kriegsgefangenenlagers, das uns nur im Vergleich mit den Konzentrations und Vernichtungslagern der Nazis als ein irgendwie begünstigter Ort erscheinen kann. Mancher Hörer dürfte auch, rein musikalisch, eher ratlos gewesen sein angesichts der fremdartigen Klänge, mit denen er da konfrontiert wurde. Aber auf einer anderen Ebene wurden gewiss viele satt – nicht aus fünf Broten und zwei Fischen, sondern aus vier ziemlich lädierten Instrumenten,
die eine wundersame Tonvermehrung in den leidenden Herzen bewirkten. (Und ich glaube, dieses Sattwerden aus der Fremdheit ist ein Ideal, von dem wir im heutigen, dankenswert gutgewärmten Konzertleben immer mal wieder träumen sollten und dem wir uns in den besten Momenten des Hörens annähern dürfen.)
Die seltsame Besetzung des »Quatuor pour la fin du temps« war aus Zufällen geboren: Der Klarinettist Henri Akoka war einer von tausenden gefangenen französischen Soldaten, mit denen der zur Landesverteidigung eingezogene 31jährige Messiaen ein halbes Jahr zuvor westlich von Nancy auf den Abtransport in deutsche Gefangenenlager wartete. Dort, auf freiem Feld, hatte Akoka den Mitgefangenen bereits eine solistische Komposition vorgespielt, die Messiaen für ihn geschrieben hatte. Wie anders als im deutschen Winter wird, trotz aller bedrückenden Umstände, in diesem französischen Sommer noch jenes Stück, »Abîme des oiseaux« (»Abgrund der Vögel«), geklungen haben. Es bildet das faszinierende Zentrum des achtsätzigen »Quatuor«, welches Messiaen später im Stalag VIII A um den Abgrund herum schuf, auch unter Verwendung einiger älterer Kompositionen aus dem Gedächtnis heraus. Ein kunstsinniger deutscher Offizier richtete ihm dafür einen Komponierplatz inklusive Papier und Stiften ein. Und weil neben dem Klarinettisten Akoka auch ein Geiger und ein Cellist gefangen waren und Messiaen selbst vorzüglich Klavier spielte, ergab sich die Besetzung des Quartetts wie von selbst – aus der Not der Umstände.
VON ALLEN PAROLEN ENTFERNT
Als eine legendärsymbolische Behauptung muss man es auch lesen, wenn der New Yorker Musikkritiker Alex Ross in seinem immer wieder lesenswerten Buch über die Musik des 20. Jahrhunderts, »The Rest is Noise« (2007), schreibt, dass »in jener kalten Winternacht des Jahres 1941 die Ära der Avantgarde begonnen hatte«. Das ist, in gut amerikanischem story-telling, zumindest überpointiert. Was Avantgarde erwartenden Ersthörern des »Quatuor«

irritierend in die Ohren fallen dürfte, sind die pendelnden Süßheiten des fünften und des finalen achten Satzes, Lobpreisungen der Ewigkeit und der Unsterblichkeit Jesu, die betörend schmeicheln und hart am Kitsch segeln. Was für uns völlig undogmatische Hörer anno 2024 natürlich gar kein Einwand sein soll! Das ist wunderschön; aber Pierre Boulez oder Luigi Nono hätten spätestens beim verklärenden EDurSchluss die progressive Krätze gekriegt.
So wie sie auch Messiaens größtes Erfolgsstück überhaupt, die in den Nachkriegsjahren entstandene »TurangalîlaSinfonie« mit ihrem ekstatischen Überschwang, entschieden nicht liebten. Ganz im Gegensatz zum allgemeinen Konzertpublikum, das sich von diesem gewaltigen melomanen Liebesrausch, in dem die Sterne vor Freude bluten, bis heute begeistert berauschen lässt. Den fünften Satz, »Joie du Sang des Étoiles«, nannte Simon Rattle in seiner Fernsehserie über die Musik des 20. Jahrhunderts, als er gefragt wurde, ob es nicht irgendein Stück aus dieser Zeit gebe, das Hörende, ohne zuvor irgendetwas darüber wissen zu müssen, schlicht und einfach mitreiße. Ein klein bisschen kann es wirken, als sei Olivier Messiaen in die Nachkriegsavantgarde gekommen wie der Pontius ins Credo. In kaum einem Buch über den Serialismus dürfte der Hinweis fehlen, dass Messiaens Klavierstück »Mode des valeurs et d’intensités« immense Bedeutung für die Idee hatte, die Konstruktion von Musik (pseudo)wissenschaftlich durchzudeterminieren. Während Schönbergs ZwölftonMethode lediglich die möglichen Abfolgen einer Reihe ebenjener zwölf Töne bestimm
te, übertrug Messiaens Stück solch konsequente Striktheit auf weitere »Parameter« der Musik wie Tondauern oder (darauf konnte wohl nur ein Franzose kommen) Tonfarben. Dass Messiaen bei den Darmstädter Ferienkursen 1952, quasi im Jerusalem des musikalischen Fortschritts, seine »Mode des valeurs et d’intensités« vorspielte, wurde etwa für Karlheinz Stockhausen zu einem OffenbarungsErlebnis: »Klangmaterial in all seinen Eigenschaften voll durchkonstruiert!« Statt Tondichtung eine Art Tonbauingenieurswesen, das manchem arg unmusikalisch erschien (und erscheint). Stockhausen wie Boulez wurden einige Jahre lang zu verbissenen Großinquisitoren der neuen Methode.
VIELLEICHT PROPHETISCH
Messiaen aber, der gar keine neue »wissenschaftliche« Musikreligion stiften wollte, sondern vielleicht nur mal was ausprobiert hatte, bemerkte dazu später: »Ich habe mich sehr an der völlig übertriebenen Bedeutung gestört, die man einem kleinen Werk, das nicht mehr als drei Seiten umfasst (…), unter dem Vorwand beigemessen hat, dass es den Beginn der seriellen Aufspaltung im Bereich der Anschlagsarten, der Dauern und der Farbintensitäten, kurz aller musikalischen Parameter bezeichne. Diese Musik ist vielleicht prophetisch gewesen, historisch bedeutsam, aber in musikalischer Hinsicht ist sie nichts und wieder nichts.«
Auch was das Temperament angeht, unterschied sich der 1908 geborene Messiaen merklich von den etwa
bodenständig, dabei gläubig den Himmel ersehnend.
20 Jahre jüngeren Einpeitschern des Fortschritts. Über seinen Konservatoriumsschüler Boulez bemerkte er später: »Er war wie ein bei lebendigem Leib gehäuteter Löwe, er war schrecklich.« Umgekehrt beschieden Boulez und Iannis Xenakis ihrem Lehrer später übereinstimmend »Großzügigkeit«. Und ausgerechnet Stockhausen, der nach Ligetis Aussage immer »Jünger« um sich scharen wollte, schrieb schon 1958: »Messiaen versuchte nicht, mich zu überzeugen. Darum war er ein guter Lehrer.«
Es lag wohl eher an seinen Schülern, die er inspirierte, aber nicht lenkte, wenn Messiaen seinerzeit manchem als Oberteufel der Umstürzler galt. Francis Poulenc schrieb in einem Brief an Darius Milhaud von einer »fanatischen Sekte«, die er »Messiaenisten« nannte. Dabei empfahl Messiaen seinen radikalen Schülern schon 1945 »ein wenig himmlische Sanftmut«. Im Grunde galt für ihn noch immer, was er knapp zehn Jahre zuvor gemeinsam mit drei anderen jungen Komponisten formuliert hatte: Es gehe darum, »mit neuen Mitteln eine neue und kühne Ausdruckswelt zu erschließen und Werke zu verbreiten, die jugendlich, frei und von revolutionären Parolen ebenso weit entfernt sind wie von akademischen«. In der geradezu fanatischen Hochzeit des Serialismus verlegte er sich darauf, systematisch bis manisch Vogelstimmen aufzuzeichnen und zu katalogisieren.
VÖGEL, BIENEN, FREUDE
In späteren Jahren zog Messiaen nochmal ein Fazit seines Verhältnisses zur radikalen Avantgarde der 1950er: »Ich hatte menschliche Pläne – schließlich bin ich ein Mensch. Ich bin auch den Moden meiner Zeit gefolgt; so habe ich zu einem bestimmten Zeitpunkt seriell komponiert, ich habe auch modal komponiert, aber all das ist ein Irrtum. Real ist allein die Resonanz und ihre Entsprechung in der Farbe.«
Resonanz und Farbe: Letzteres war für Messiaen keine Metapher, sondern ebenso faktisch wie das physikalische Tönen selbst. Als Synästhet waren ihm Farben vom Klang untrennbar; das EDur etwa, in dem das »Quatuor« endet, ist zweifellos rot.
Doch auch wenn »Farbe« wörtlich gemeint war, hatte Messiaen ein Faible für blumigpoetische Beschreibungen seiner Musik, die vor dem Hintergrund eines einschüchternd analytischobjektiven Zeitgeists besonders auffallen: »unbekannter Duft« oder »Vogel ohne Schlaf«
nannte er eigene Werke. Das klingt eher nach Ästhetizismus als nach Rationalismus. Ähnlich regenbogenhaft wirkt die Vielzahl der Anregungen, die sich in Messiaens Musik vereinen. Geradezu humoristisch wirkt der Versuch des HarenbergOpernführers, die prägenden Einflüsse aufzuzählen: »Daneben beschäftigte er sich privat mit den Rhythmen der Griechen und Inder, der Sterne und des menschlichen Körpers, mit exotischer Musik und dem Gesang der Vögel.«
Dass diese eklektische Musik dennoch nicht in ihre Einzelteile zerfällt, ist auch der Einheit zu verdanken, die Messiaens Persönlichkeit stiftete: jederzeit menschlich bodenständig, dabei gläubig den Himmel ersehnend. Für ihn war Gott in allem anwesend, zugleich stand er als frommer Katholik immer mit einem Fuß außerhalb von Raum und Zeit. Wenn im »Quatuor« wechselnde Rhythmik jede Takteinheit auflöst, folgt Messiaen nicht nur Impulsen aus Strawinskys »Sacre du printemps«, altgriechischer Metrik und den Skalen indischer Ragas, sondern bewirkt vor allem etwas im Hörer: eine Ahnung vom Ende der Zeit.
Der feste Glaube spannt auch Messiaens Werk vom Anfang bis zum Ende unter eine Klammer: Es beginnt mit frühen Orchesterstücken der 1930erJahre wie »Les Offrandes oubliées« oder der auf Orgelmeditationen basierenden »L’Ascension«, die der »FAZ«Musikkritiker Jan Brachmann einmal mit so hübschen Begriffen wie »Muschebubu« oder »kuschelwolkig« beschrieb. Messiaen selbst verglich die Besprenkelung dahinströmender DurDreiklänge durch überrieselnde Dissonanzen bezeichnenderweise mit Bienen, die in Blüten herumstacheln … Und es endet in den 1980ern mit dem durchaus gefürchteten letzten Großwerk, der Oper »Saint François d’Assise«. Als Denkmal sowohl unbedingter Frömmigkeit als auch komplexer Vogelgesänge ist sie ein absolut stringenter, alles umfassender Höhepunkt in Messiaens Schaffen.
Nur ein dramatischer Bühnenreißer ist der »François« gewiss nicht, eher ein meditatives christliches Mysterienspiel, dessen Handlung und Dialogen gut zu folgen ist. Dabei sollte man entwarnen: Es ist auch nicht länger als Wagner. Und es steht mit seiner religiösen Thematik in der Musikdramatik des 20. Jahrhunderts keineswegs allein da (man denke an Debussys »Martyre de Saint Sébastian«, Honeggers »Jeanne d’Arc au bûcher« oder Schönbergs »Moses und Aron«). Dass es so selten aufgeführt wird, liegt auch daran, dass die Partitur gleich drei Ondes Martenot fordert, jene von Messiaen geliebte Vorform des Synthesizers, ein transzendent jaulendes Instrument, das weltweit circa fünfzehn Musiker spielen können. So jedenfalls die Schätzung eines Informierten, als das Werk 2002 in Regie von Daniel Libeskind an der Deutschen Oper Berlin zu erleben war. Etwas derart Kompliziertes habe er nie zuvor gemacht, sagte damals der vielgepriesene Dirigent Marc Albrecht über die komplexe Partitur. Die Regisseurin Antje Kaiser aber bezeichnete das vierstündige Werk als ein einziges »Crescendo zur Freude«.
Dass Messiaen von 1908 bis 1991 »ein ziemlich uninteressantes Leben« führte, wie Alex Ross behauptet, mag man zumindest für die unerhörte Begebenheit ums »Quatuor« im Lager nicht gelten lassen. Amüsant ist es gleichwohl, wenn Ross berichtet: »Als der Dirigent Kent Nagano, der in dessen letzten Jahren eng mit Messiaen zusammenarbeitete, einmal gedrängt wurde, eine weniger schmeichelhafte oder enthüllende Anekdote über seinen Mentor zum Besten zu geben, konnte er bloß die Geschichte bieten, wie Messiaen und [seine Frau Yvonne] Loriod einmal zum Kaffee eine ganze Birnentarte aufgegessen hatten.«
Als eine Radikalität ganz anderer Art, noch krasser als Birnentarte, mag man den Umstand betrachten, dass Messiaen sechzig Jahre seines Lebens ordentlicher Organist der Pariser Église de la SainteTrinité war, wo er regelmäßig sonntags spielte und auch großartige Improvisationen aufführte (die er, wie Peter Hill und Nigel Simeone in ihrer angemessen öden Referenzbiografie über Messiaens Leben ausführen, gründlich vorbereitete). So wie über Vögel oder Sterne kann man über Messiaens Kunst nicht sprechen, ohne seine Orgelmusik zu erwähnen. Der Pariser Erzbischof, Kardinal JeanMarie Lustiger, würdigte Messiaens religiöse, aber nicht liturgische Orgelkompositionen als »ein neues Genre, da seine Werke für Orgel wie ein Ort sind, der plötzlich innerhalb des katholischen Kultus von der Musik allein eingenommen worden ist, die jedoch nicht an die Stelle des Kultus tritt, son

dern ihm eine neue Dimension hinzufügt«. In diesem Sinn verglich Kardinal Lustiger ihre Bedeutung mit der von Johann Sebastian Bachs Kantaten im Protestantismus.
Gleich Bachs Kantaten sind auch Messiaens Orgelwerke im Konzert aufführbar, etwa sein gewichtiges spätes »Livre du Saint Sacrement«. Und so wie Bach selbstverständlich auch von Katholiken, Muslimen, Buddhisten oder Atheisten mit Gewinn gehört werden kann, dürfen natürlich auch NichtOrganisten dieses achtzehnteilige Opus ultimum hören – selbst wenn die Uraufführung 1986 in Detroit vor einer Zuhörerschaft von 2000 professionellen Organisten der American Guild of Organists stattfand.
Wie sah nun Olivier Messiaen selbst sein Leben? Es liegt keine Verzweiflung darin, eher friedfertige und ein wenig lächelnde Resignation, wenn er als alter Mann sagte, sein Dasein als Musiker seien im Grunde vier Tragödien gewesen: Als Gläubigen, als Ornithologen, als Farbenhörer und auch als »Rhythmiker«, aber eben außerhalb aller gleichmäßigen Zeitwerte, könne ihn leider kein Hörer verstehen. Ist das so? Die bleibende Präsenz von Messiaens Musik im Konzertleben spricht dafür, dass es auch unter uns hoffnungslosen Ignoranten so manchen gibt, der sich von der Musik gern aus dem Takt und damit dem Jenseits der Zeit näher bringen lassen will, der Farben und Vögeln und Glaube auf die Spur kommen will.
M KENT NAGANO ÜBER »SAINT FRANÇOIS D’ASSISE« FINDEN SIE UNTER WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
L’ASCENSION
Mi, 8.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal hr-sinfonieorchester Maxime Pascal (Leitung)
Olivier Messiaen: L’ascension / Quatre méditations symphoniques sowie Werke von strawinsky und gubaidulina
QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS
So, 19.5.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal sitkovetsky Piano trio
Pablo Barragán (klarinette)
Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps sowie Werke von Debussy und Ravel
LIVRE DU SAINT SACREMENT
Sa, 25.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Paul Jacobs (Orgel)
Olivier Messiaen: Livre du saint sacrement
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
So, 2.6. / Do, 6.6. /
So, 9.6.2024 | 17 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal Philharmonisches staatsorchester hamburg kent Nagano (Leitung)
anna Prohaska (L’ange) Johannes Martin kränzle (saint François) u. v. a. thomas Jürgens, Julia Mottl und georges Delnon (szenische einrichtung)
Olivier Messiaen: saint François d’assise / Oper in drei akten und acht Bildern. in französischer sprache mit deutschen Übertiteln
So, 16.6.2024| 19 Uhr und Mo, 17.6.2024 | 20 Uhr Laeiszhalle Großer Saal symphoniker hamburg sylvain cambreling (Leitung)
David kadouch (klavier)
Nathalie Forget (Ondes Martenot)
Olivier Messiaen: turangalîlasinfonie für klavier, Ondes Martenot und Orchester


Nutzen Sie die Vorteile eines Abonnements und lassen Sie sich die nächsten Ausgaben direkt nach Hause liefern. Oder verschenken Sie das Magazin-Abo.
3 Ausgaben zum Preis von € 15 (ausland € 22,50) Preis inklusive Mwst. und Versand
Unter-28-Jahre-Abo: 3 ausgaben zum Preis von € 10 (bitte altersnachweis beifügen)
Jetzt Fan der elbphilharmonie Facebook-community werden: www.fb.com / elbphilharmonie.hamburg
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular zu:
ELBPHILHARMONIE MagaZiN
Leserservice, Pressup gmbh Postfach 70 13 11, 22013 hamburg
Oder nutzen Sie eine der folgenden Alternativen: tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299 e-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de internet: www.elbphilharmonie.de
Für wen ist das Abonnement? Für mich selbst ein geschenk
Das Abo soll starten mit der aktuellen ausgabe der nächsten ausgabe
Rechnungsanschrift:
Name Vorname
Zusatz
straße / Nr.
e-Mail (erforderlich, wenn Rechnung per e-Mail)
Mit der Zusendung meiner Rechnung per e-Mail bin ich einverstanden.
hamburgMusik ggmbh darf mich per e-Mail über aktuelle Veranstaltungen informieren.
Ggf. abweichende Lieferadresse (z. B. bei Geschenk-Abo):
Zusatz
Jederzeit kündigen nach Mindestfrist: ein geschenk-abonnement endet automatisch nach 3 ausgaben, ansonsten verlängert sich das abonnement um weitere 3 ausgaben, kann aber nach dem Bezug der ersten 3 ausgaben jederzeit ohne einhaltung einer kündigungsfrist zum ende der verlängerten Laufzeit gekündigt werden.
Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 tagen ohne angabe von gründen in textform (z. B. Brief, Fax oder e-Mail) oder telefonisch widerrufen werden. Die Frist beginnt ab erhalt des ersten hefts. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels) an: elbphilharmonie Magazin Leserservice, Pressup gmbh, Postfach 70 13 11, 22013 hamburg tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299, e-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de
Elbphilharmonie Magazin ist eine Publikation der HamburgMusik gGmbH Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg, Deutschland Geschäftsführer: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Zahlungsweise:
Bequem per Bankeinzug gegen Rechnung
kontoinhaber
Bic (bitte unbedingt bei Zahlungen aus dem ausland angeben) geldinstitut
SEPA-Lastschriftmandat: ich ermächtige die hamburgMusik ggmbh bzw. deren beauftragte abo-Verwaltung, die Pressup gmbh, gläubiger-identifikationsnummer De32ZZZ00000516888, Zahlungen von meinem konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von der hamburgMusik ggmbh bzw. deren beauftragter abo-Verwaltung, die Pressup gmbh, auf mein konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die einzugsermächtigung erlischt automatisch mit ablauf des abonnements.




Das Arditti Quartet wird 50. Warum?
VON BERNHARD GÜNTHER


Die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens liegt in den USA bei 15 Jahren, in Deutschland sogar nur bei zwölf Jahren. Dass Streichquartette in der Profiliga so etwas wie Unternehmen sind, sei hier nur kurz dahingestellt, und auf die Idee, ausgerechnet das Arditti Quartet als durchschnittlich zu bezeichnen, käme ohnehin niemand. Aber der Umstand, dass es 2024 sein 50jähriges Bestehen feiert, ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Der Begriff Bestehen führt übrigens auf die richtige Spur: Was dieses Streichquartett an jedem Konzertabend seit 1974 lässig über die Bühne bringt, wäre für die meisten Profis im Musikbereich eine unpackbar schwere Prüfung.
Aber zurück zum Jubiläum. »Sie sollten wissen, dass ich 50 Jahre lang überlebt habe«, sagt – mit selbst am Telefon unübersehbarem Lächeln bis Grinsen – der Gründer und seither Primgeiger Irvine Arditti auf die Frage, was die Leserinnen und Leser aus diesem kleinen PorträtText zum runden Anlass denn unbedingt mitnehmen sollten. Und sofort kommen wir der Frage näher, warum sich das Arditti Quartet seit einem halben Jahrhundert frisch anfühlt: Der supertrockene Humor, die britische Coolness und die unverblümte Art, Dinge ganz direkt anzusprechen – all das gehört mit Sicherheit zu den Erfolgsfaktoren. Wie auch das entspannte Selbstbewusstsein von Menschen, die schon alles gesehen haben. Apropos direkt – mit Irvine Arditti zu Fuß in der Stadt unterwegs, lässt sich beobachten, wie ein erfolgreicher Primgeiger eine vielbefahrene Kreuzung überquert: Er muss sich nicht groß nach allen Seiten umschauen oder auf irgendetwas warten, schon gar nicht darauf, dass die Ampel grün wird. Gefahren sind ja nicht dazu da, dass man sich vor ihnen fürchtet.
Niemals aufhören, wenn etwas schiefgeht – auch diese Haltung ist offenbar gut für ein langes Leben. Das interne Motto aus den ersten Tagen des Quartetts ging zurück auf eine Panne fünf Jahre zuvor: Der 16jährige Irvine Arditti sollte in den ersten Tagen seines Studiums in London ein Bläserquintett von Karlheinz Stockhausen dirigieren. Dem war er bereits auf seiner ersten Auslandsreise bei den Darmstädter Ferienkursen begegnet, woraufhin er an der Royal Academy of Music von Anfang an als »Mr New Music« galt. Er verwackelte den ersten Einsatz am Dirigierpult, und die StockhausenAufführung startete in komplettem Chaos. Auch wenn der Rest des Stücks glattging, fragte sich der jugendliche Dirigent lange, ob er nicht doch hätte abbrechen und neu beginnen sollen. Statt Panik oder Pokerface wählte er den Blick nach vorn, vermutlich damals schon mit seinem typischen Lächeln bis Grinsen.
Apropos – wo in anderen Quartetten »vier vernünftige Leute sich unterhalten«, wie Goethe das nannte, flirten die Ardittis mit der Aufmerksamkeit des Publikums. Vom
Die Ardittis flirten mit der Aufmerksamkeit des Publikums, zelebrieren intensive Kommunikation mit dem Saal.
vielsagenden Augenaufschlag über den expressiven Mundwinkel bis zur launigen Ansage wird hier intensive Kommunikation mit dem Saal zelebriert. Kann also gut sein, dass die vier mittlerweile, mit einigen Jahrzehnten Bühnenerfahrung, nun doch abbrechen und die Gelegenheit zu einem Witz nutzen würden, falls einmal etwas schiefgehen sollte. Aber geht je etwas schief?
Seit seiner Gründung 1974 spielt das Arditti Quartet nahezu ausschließlich Musik der Gegenwart, brachte 700 Uraufführungen auf die Bühne (was statistisch mehr als einem neuen Werk pro Monat entspricht) – und hat dabei die Schwierigkeitsskala im Lauf der Jahrzehnte so weit nach oben erweitert wie kaum ein zweites Ensemble. Nichts ist unmöglich (»wenn man genug übt«, sagt Irvine Arditti), keine neue Entwicklung ihres Arbeitsbereichs bringt sie aus der Ruhe: Mit seinem völlig unerschrockenen, begeisternden Spiel von Musik des Schwierigkeitsgrades »unfassbar« wurde dieses Streichquartett weltweit zur Referenz seines Fachs. Irvine Arditti und seine kongenialen Kammermusikpartner Ashot Sarkissjan, Ralf Ehlers und Lucas Fels (die mit 18 Jahren am längsten bestehende Besetzung des Ensembles) machen noch die vermeintlich unspielbarsten Stücke souverän zum packenden Hörerlebnis. »Das Arditti Quartet fühlt sich an wie ein Auto von Bugatti oder eine Uhr von Rolex«, sagt die irische Komponistin Jennifer Walshe: »Du hast diese unglaublich gewandten, präzisen und begabten Menschen. Und um die LuxusmarkenMetapher noch fortzusetzen: Als Komponistin mit ihnen zu arbeiten, ist wie als AvantgardeDesigner für Louis Vuitton eine Handtasche zu entwerfen. Man hat Zugang zur Fabrik und kann auf alle Ressourcen zugreifen.«
DINOSAURIER IM MESOZOIKUM
1974 war aus heutiger Sicht so etwas wie das Mesozoikum, das Erdmittelalter der Neuen Musik. Innerhalb der stürmischen musikgeschichtlichen Entwicklungen seither hat sich das Arditti Quartet als Fels in der Brandung erwiesen. Man beachte die Brandung – denn am Anfang der ArdittiGeschichte galt die Gattung Streichquartett vielen im AvantgardeBereich schlicht als Fossil: Wer Wert darauf legte, nicht wie ein Dinosaurier zu wirken, komponierte, spielte oder hörte lieber etwas anderes.
›
Nach einigen Vorläufern begann allmählich eine Welle größerer Gründungen von Festivals und Ensembles zeitgenössischer Musik; Pierre Boulez rief 1976 in Paris das Ensemble intercontemporain ins Leben, 1978 folgte das Huddersfield Contemporary Music Festival, 1980 das Ensemble Modern Frankfurt, 1981 die Helsinki Biennale, 1985 das Klangforum Wien, 1988 Wien Modern und die Münchener Biennale … Künstlerisch, institutionell und gesellschaftlich geriet einiges in Bewegung in einem Kunstbereich, der als Orchideenfach gegolten hatte. Mittendrin und an dieser Dynamik nicht unbeteiligt war dank der Ardittis auch das paläozoische Genre Streichquartett, das plötzlich an den großen Häusern und Festivals für ungeahnte WowEffekte sorgte.
Was 1974 anlässlich einer Ehrung für Krzysztof Penderecki an der Royal Academy zunächst sehr spontan und dann als Teilzeitbeschäftigung neben dem London Symphony Orchestra begonnen hatte, wurde sechs Jahre später zum VollzeitJob: »Wir hatten da bereits alle Quartette von Henze und Ligeti gespielt, wurden 1980 Brian Ferneyhough vorgestellt und retteten sein Zweites Quartett, das eine ordentliche Uraufführung brauchte«, erinnerte sich Arditti im Gespräch mit dem »Guardian«. »Dann kam eine Einladung aus Paris, wo es ein Problem mit Elliott Carters Drittem Quartett gab. Es ist das schwerste seiner Stücke, wir lernten es in fünf Wochen, und Carter war zufrieden. So ging es weiter: Komponisten riefen andere Komponisten an und sagten ihnen, wir seien spannend und gut, und wir bekamen immer mehr Einladungen, bis wir schließlich Vollzeit arbeiten mussten.«
SPORTSGEIST UND FURCHTLOSIGKEIT
Wer im Mesozoikum ein Unternehmen gründet, darf vor furchterregenden Dinosauriern keine Scheu haben. Zwischen den großen, schwierigen Brocken und den Ardittis gibt es eine gewissermaßen magische wechselseitige Anziehung. Das unterstreicht auch das kürzlich erschienene erste Buch von Irvine Arditti (»Collaborations«, Schott, 2023), das auf 520 Seiten Geschichten aus der Zusammenarbeit mit 23 ausgewählten Komponisten und einer Komponistin erzählt. Den Fokus legt er komplett auf die großen Meister des 20. Jahrhunderts, die im Dialog mit dem Ausnahmequartett die schwierigsten Werke des neuen Repertoires komponierten – von Iannis Xenakis und György Ligeti bis hin zu Harrison Birtwistle und Karlheinz Stockhausen. Letzterer schickte nach jahrzehntelangen Absagen den Ardittis in den Neunzigern endlich ein Quartett, dessen Aufführung – Überraschung! – vier fliegende Hubschrauber, Fernsehübertragung, Multimedia und LiveModeration benötigt.
Dieser Sportsgeist im Umgang mit Berühmtheiten und Schwierigkeiten der Spitzenklasse macht freilich nur einen Teil der Breiten und Langzeitwirkung des Arditti Quartet aus. Die Komponisten mit den meisten Werken im Repertoire des Ensembles (auch Trios, Bearbeitungen etc. eingerechnet) sind Wolfgang Rihm (27), Arnold Schönberg (14), James Dillon, Brian
Ferneyhough (je 13), Georg Friedrich Haas (12), Elliott Carter, Hilda Paredes (je 10), James Clarke, Luis de Pablo, Anton Webern (je 9), Pascal Dusapin, György Kurtág, Akira Nishimura, Peter Ruzicka und Giacinto Scelsi (je 8). Nicht weniger wichtig ist aber der nachhaltige Einsatz für vielfältigen Nachwuchs, der sich in der Zahl von über 1.000 Streichquartetten im Repertoire ebenso zeigt wie im langjährigen Unterricht bei den Darmstädter Ferienkursen, bei Meisterkursen und Workshops auf der ganzen Welt. Gerade hier ist der lange Atem der Ardittis bemerkenswert: Die wenigen Quartettensembles, die vier Jahrzehnte und mehr überleben (der aktuelle Weltrekord liegt bei 216 Jahren im Gewandhaus zu Leipzig), stehen fast durchwegs für das traditionelle Repertoire. 50 Jahre lang nicht nur am Puls der Zeit, sondern Motor der Innovation zu bleiben, ist schlicht sensationell. Quartette, die sich mit einer solchen Ausdauer als Sparringspartner der Komponisten ihrer Zeit verstanden, gab es seit Beethoven nicht viele: Hellmesberger (1849 –1901), Rosé (1882–1945), LaSalle (1946 –1988), Kronos (seit 1973) und eben, am sportlichsten von allen, Arditti.
TYPISCH ARDITTI
Interessant, wie die Art der Zusammenarbeit (eher Boss oder eher Basisdemokratie) und des Klangs (eher kantig oder rund, knallhart analytisch oder leicht weichgezeichnet, extra brut oder Restsüße) auch auf dem engen Feld der professionellen zeitgenössischen Streichquartettensembles extrem spannende Differenzierungen ermöglicht. Auch beim Arditti Quartet geht es nicht nur um eine möglichst unendlich breite Klangpalette. »Wir versuchen, den Klang nach dem aufzubauen, was aus dem Notentext als notwendig spürbar wird, aber ich traue mich zu sagen, dass unser Klang relativ unverwechselbar ist. Es mag nicht wie beim Philadelphia Orchestra unter Ormandy sein, aber es gibt doch einen Klang, den wir anstreben und den wir durch alle Stücke, die wir spielen, durchkommen lassen möchten«, sagte der langjährige zweite Geiger David Alberman 1992 in einem Interview.
Wie fühlt sich dieser Klang an? Sehr direkt, ohne Umwege und überflüssige Verzierungen, aber mit spürbarem Spaß an Virtuosität und Komplexität; Vibrato niemals im Automatikmodus und nur wenn vorgeschrieben, kein Zucker bitte; klar und differenziert bis in die allerhöchsten Register (»Er ist auf Sauerstoff«, sagte Alberman über Irvine Arditti). Neutral vielleicht? Unmöglich: Auf Streichinstrumenten gibt es keinen neutralen Klang, nur eine jahrhundertelange Weiterentwicklung dessen, was in der jeweiligen Gegenwart als schön, gut, passend, richtig oder möglich gilt. Seit einem halben Jahrhundert trägt das Arditti Quartet in einzigartiger Weise zu dieser Weiterentwicklung bei – typischerweise mit einem Lächeln bis Grinsen.
BERNHARD GÜNTHER, geboren 1970, ist seit 2016 künstlerischer Leiter des Festivals Wien Modern.
Ashot Sarkissjan (Geige, seit 2005), Ralf Ehlers (Bratsche, seit 2003), Lucas Fels (Cello, seit 2006) und Irvine Arditti (Geige, seit 1974)




ARDITTI QUARTET MARATHON
Sa, 11.5.2024 | 17 Uhr Elbphilharmonie Kleiner Saal streichquartette von Jonathan harvey (Nr. 1), Rebecca saunders (Fletch), elliott carter (Nr. 5), iannis Xenakis (tetras), Olga Neuwirth (in the Realms of the unreal), Brian Ferneyhough (Nr. 3), sarah Nemtsov (Neues Werk) und helmut Lachenmann (grido). in der Pause spricht tom R. schulz mit dem arditti Quartet.



Unser Fotograf hat Papierabzüge von Bildern der Elbphilharmonie mit Chemikalien und Feuer bearbeitet – und führt uns damit drastisch vor Augen, wie fragil unsere Welt ist.
CHEMIGRAMME KARSTEN KRONAS





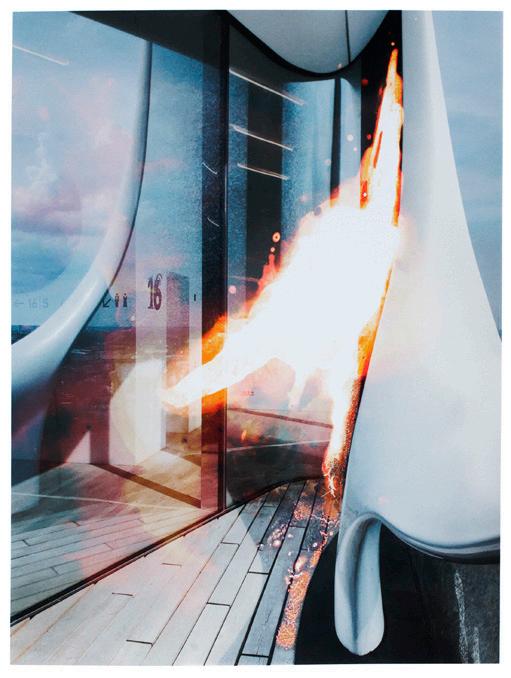

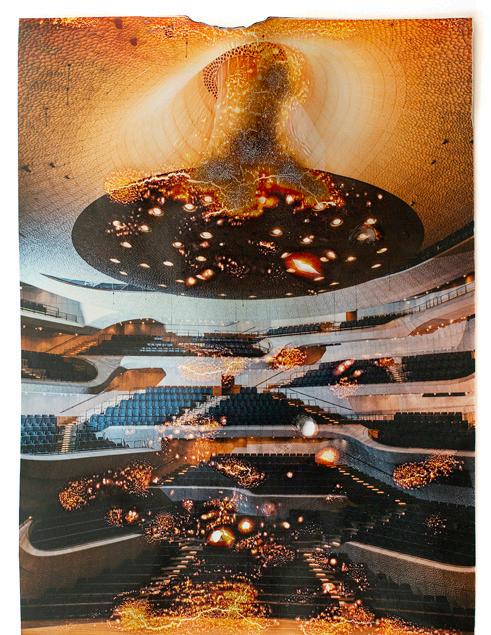



Kriegsnarben prägen das Hamburger Stadtbild bis heute – oft anders, als man es vermuten würde.
VON TILL BRIEGLEB


Im Krieg beschädigt, aber nicht zerstört: der alte Kaispeicher A zu Beginn der Sechzigerjahre. Heute steht hier die Elbphilharmonie.
Als Deutschland 1945 endlich den Krieg verloren hatte, lag das Land unter 400 Millionen
Kubikmetern Schutt begraben; elf Prozent davon befanden sich allein in Hamburg. Speziell die »Operation Gomorrha« im Sommer 1943 mit ihrem infernalischen Feuersturm machte aus Hamburg die Metropole im europäischen Kriegsgebiet, die durch eine einzige Angriffswelle am schwersten zerstört wurde.
Am Ende des Krieges und nach 213 Luftangriffen fehlten ganze Viertel und fast 50.000 Menschen. Die enge Bebauung der Alt und Neustadt mit historischen Bürgerhäusern zeigte sich teils ausradiert. Von der Hälfte aller Wohnungen blieben nur Trümmer. Lediglich ein Fünftel der Häuser überstand die Bombennächte unbeschadet, meist in den Stadtrandgebieten.
Fast 80 Jahre später macht die wachsende Stadt an der Elbe wieder einen so intakten Eindruck, dass Kriegsnarben für das ungeübte Auge fast nur noch an der MahnmalRuine der St. NikolaiKirche in der Innenstadt auszumachen sind. Die Schadenskarte des 21. Jahrhunderts wird eher von massiven Abrissen der Nachkriegsarchitektur geprägt. Teils denkmalgeschützte Hoch, Kauf und Bürohäuser des Wiederaufbaus verschwinden gerade reihenweise aus dem Stadtbild – man könnte sagen, durch Bombentreffer des Renditedenkens. Für den urbanen Heilungsprozess Hamburgs nach 1945 hat der Wandel mit der Abrissbirne allerdings auch Gutes: Die Kompaktheit kehrt zurück.
Diese Erneuerung der dichten Stadt reagiert mit großer Verzögerung auf die Verletzungen in den Vierzigern, die sich – und das ist heute kaum noch im öffentlichen Bewusstsein – über den Systemwechsel 1945 hinaus programmatisch fortsetzten. Spürt man heute die Kriegsnarben in Hamburg auf, stößt man fast immer zunächst auf Nachkriegsnarben. Und auf die gleichen Verursacher. Die autogerechte zugige Stadtidee des Wiederaufbaus, die häufig als die zweite Zerstörung der Stadt bezeichnet wurde, ist in Hamburg nämlich gar nicht primär die Erfindung einer Moderne, um einen Schlussstrich unter die dunkle Vergangenheit zu ziehen. Die postkriegerische Zergliederung des Stadtbilds in Punkt und Zeilenbauten, die sich ab den Fünfzigern auf breiter Front gegen die Idee von Stadtreparatur durchsetzte, stammte tatsächlich aus dem Werkzeugkasten der NSPlaner und folgte ihrer zerstörerischen Logik.
BOMBEN UND VISIONEN
Dicht bebaute Innenstadtviertel waren den Nazis ein Gräuel. Sie galten ihnen seit der sogenannten »Kampfzeit« vor 1933 als Brutstätte des Kommunismus, weswegen sie diese nach dem Krieg sowieso wegsanieren wollten.

Der Hopfenmarkt mit St. Nikolai, dem Nikolaifleet und der Reimersbrücke (ca. 1938)
Die bereits im Hamburger Generalbebauungsplan von 1941 formulierte Vision eines »zellenmäßigen Aufbaus« der Stadt fand ihre radikale Fortsetzung in den städtebaulichen Entwürfen für ein Hamburg nach dem »Endsieg«. Die Architekten von Albert Speers Wiederaufbaustab äußerten deshalb ihre zynische Freude über die Tabula rasa, die ihnen »BombenHarris’« AlliiertenFlotte in der Kernstadt besorgt hatte. Sie hielten es für »naturnotwendig«, die Zukunft der »Führerstadt« als »bandartige, die Großstadt auflockernde« Struktur neu zu ordnen.
Die nach 1945 umstandslos weiterbeschäftigten Planer des Dritten Reichs mussten als Ausweis ihrer neuen Gesinnung nur Spitz durch Flachdächer ersetzen und ein paar Mosaike vor ihre Kriegsentwürfe hängen. So entstanden die Neubauviertel wie in Altona, Barmbek oder HammHorn auf dem Trümmerfeld historischer Stadtteile, deklariert als Musterbauten einer »sachlichen« Moderne. Die stadthistorische Forschung aber hat längst nachgezeichnet, wie sich hier sowohl ideologisch als auch personell eine Kontinuität des antiurbanen Städtebaus über zwei konträre Systeme hinweg zeigt.
Radikal verändert wurde dabei die Topografie der Stadt. Die »starke Verringerung der Besiedlungsdichte und die Gliederung des Stadtorganismus durch Grünzüge«, wie das Leitmotiv der Kriegs wie der Nachkriegsplanung lautete, veränderte die einst kompakte Blockrandstruktur ›

der Altstadt wie der Gründerzeitquartiere massiv. Speziell für neue Verkehrswege und Hochbauten wurde bereitwillig weiter geopfert, was die Spreng und Phosphorbomben verfehlt hatten. Leider führte das nur an wenigen Stellen zu moderner Baukultur im Sinne großstädtischer Identität, etwa bei den Grindelhochhäusern oder dem UnileverHaus am Valentinskamp. Der größte Teil Hamburgs sah nach Krieg und Nachkriegssanierung kaum mehr aus wie eine Metropole, sondern wie eine Siedlung.
RACHE AN DER VERGANGENHEIT
Vor allem eine sehr lange Narbe hält die Erinnerung an die anpassungsfähige Zukunftsvision des Dritten Reichs wach: die 2,5 Kilometer lange InnenstadtTangente vom Millerntor zum Deichtor, die heute nach Willy Brandt und Ludwig Erhard benannt ist. Die von Albert Speers Stab entwickelte »OstWestDurchbruchstraße« machte diesem Namen ab 1956 alle Ehre. Für die Realisierung mussten einige der letzten erhaltenen Altbauten in der kriegsgezeichneten Innenstadt abgerissen und Fleete am Gründungsort der Stadt rund um die KatharinenKirche zugeschüttet werden.
Erst ab den Neunziger Jahren, als das Leitbild sich in Hamburg zurück zum Erbe der historischen »Europäischen Stadt« wendete, wurde diese sechsspurige Stadtautobahn als eine »für die baulichräumliche Umwelt blinde Verkehrswegeplanung« erkannt, wie der damalige Oberbaudirektor Egbert Kossak es formulierte. Ändern lässt sich an diesem Schnitt durch die Stadt leider nichts
Bauarbeiten für die Ost-West-Straße zwischen Rödingsmarkt und Hopfenmarkt (1955) – und die heutige Bebauung rund um das Mahnmal St. Nikolai

mehr. Dafür fallen jetzt seine Wundränder. Die dort komponierte Parade solitärer Nachkriegshochhäuser, gedacht als Autokino einer fließenden Stadt, wurde sukzessive wieder ausgelöscht, durch Abriss oder Verbauung. Man rächt sich in Hamburg immer wieder an der Vergangenheit, so gut man kann.
Trotz dieser über viele Generationen vererbten DNA als Abrissstadt hat es nach dem Krieg auch erfolgreiche Beispiele der Reparatur gegeben. Die zerstörten Hauptkirchen wurden mit Ausnahme von St. Nikolai wieder aufgebaut, der Totalverlust St. Katharinen sogar in Form einer recht originalgetreuen Reproduktion. Und die Speicherstadt hinter der Elbphilharmonie, für deren Bau 1882 mit dem Kehrwieder eines der schönsten und ältesten Stadtviertel Hamburgs flachgelegt wurde, bekam sehr sensible BacksteinImplantate im modernen Stil, die weiter dem harmonischen Gesamteindruck des Ensembles dienten.
Auch an verschiedenen schwer beschädigten Kulturbauten war man um eine komplementäre stilistische Lösung bemüht, die der Geschichte würdig begegnete. Wie unterschiedlich das ausgehen konnte, zeigt ein Vergleich von Staatsoper und Thalia Theater, die sich mit ihren klassizistischen Tempelfassaden bis in die Fünfzigerjahre
Für neue Straßen und Hochbauten wurde bereitwillig geopfert, was die Bomben verfehlt hatten.
noch sehr ähnlich waren. Hamburgs berühmtester Nachkriegsarchitekt, Werner Kallmorgen, baute in beide Ruinen einen neuen Zuschauerraum. Doch während beim ausgebrannten Thalia die gerettete Substanz des Gebäudes erhalten blieb, entschied sich die Stadt an der Dammtorstraße für einen Neubau mit einer hochtransparenten Pausenbühne zur Straße. Schon damals übrigens unter lauten Protesten für einen Erhalt des Geretteten.
VERLUSTSCHMERZ UND ERINNERUNG
Wer heute das Standardwerk »Kriegsschicksale Deutscher Architektur« durchsieht, dem vermitteln die 70 Seiten über Hamburg einen intensiven Eindruck von dem Verlustschmerz, der Hanseatinnen und Hanseaten in dieser Phase gequält haben muss. Identitätsprägende Architekturen von Schulen, Kirchen, Museen, Bürgerhäusern sind hier als »Totalverlust« gelistet. Und VorhernachherVergleiche fördern den Eindruck, dass vor dem 20. Jahrhundert selbst schlechte Bauten noch schön waren, wogegen später selbst gute das nicht immer von sich behaupten konnten.
Aus diesem Gefühl heraus erklärt sich auch Hamburgs berühmte »Atlbausammelstelle« an der Peterstraße. 1965 bot Bürgermeister Herbert Weichmann das

noch immer fast völlig zerstörte Areal in der Neustadt zwischen Michel und den Wallanlagen dem Mäzen Alfred C. Toepfer zur Wiederbebauung an. Der GetreideUnternehmer sah in dem Acker, aus dem noch ein paar spärliche Reste der historischen GängeviertelBebauung traurig hervorragten, eine einmalige Gelegenheit, die Erinnerung an die gute alte Zeit der Hamburger Kaufmannsregierung aufblühen zu lassen.
Er beauftragte den Baumeister Fritz Pahlke, verlorene Bürgerhäuser aus dem zerbombten Katharinenquartier möglichst detailliert zu rekonstruieren und als ArchitekturAltersheim neu zu bauen. Barocke Sandsteinportale und imposante Schmuckgiebel als Kopien aus dem 17. und 18. Jahrhundert entstanden dann bis in die Achtzigerjahre in dieser einstigen Schmuddelecke der historischen Stadt, wo vormals nur Soldaten, Prostituierte und arme Juden wohnten. Jüdischen Originalzeugnissen wurde dagegen eher selten die Ehre zuteil, so prominent wiederbelebt zu werden.
Zwar wird seit einigen Jahren über die Frage diskutiert, ob die im Dritten Reich zerstörte Bornplatzsynagoge an ihrem historischen Standort im Univiertel rekonstruiert oder neu entworfen wiederaufgebaut wird. Bis jetzt erinnert nur ein Bodenmosaik beim AbatonKino an den Verlust. Die Reste des alten israelitischen Tempels in der ›

Von dem 1844 errichteten Tempel in der Poolstraße haben sich nur das Vorderhaus und die Apsis erhalten.
Poolstraße, gleich um die Ecke der Altbausammelstelle, verfallen dagegen seit Kriegsende in einem verschlossenen Hinterhof. Selbst in der Mäzenaten und StifterHochburg Hamburg fand die kriegszerstörte Ruine nie genug Aufmerksamkeit und Unterstützung, um die erhaltene Apsis und das Vorderhaus der 1844 erbauten Synagoge einer zeitgemäßen Nutzung zuzuführen. Und vom Senat kam hier auch nie echte Hilfe.
Da mag es dann fast ein wenig sonderlich wirken, dass ausgerechnet für die langlebigsten Zeugnisse des Totalen Kriegs in der Stadt zuletzt spektakuläre Transformationen erfunden wurden: die weit sichtbaren Hochbunker in Wilhelmsburg und auf dem Heiligengeistfeld. Ab 2006 sorgte zunächst die Internationale Bauausstellung IBA auf der Elbinsel dafür, dass der ungenutzte 42 Meter hohe Flakturm VI aufgesägt und zum Energiebunker mit Blockheizkraftwerk, Warmwasserspeicher, Solarthermieanlage und Photovoltaik umgenutzt wurde. Und seit 2019 kann jeder DomBesucher mitverfolgen, wie auf dem MedienBunker in St. Pauli ein Berg wächst.
Als begehbarer Stadtgarten in luftiger Höhe, der unter seinem wuchernden Pflanzenkleid ein Hotel mit einer Halle verbergen wird, die tags Sport und nachts Konzertveranstaltungen offensteht, ist der »Grüne Bunker« genau das, was heute als ökologisches, kulturelles und touristisches Vorzeigeprojekt gilt. Eine aufsehenerregende Architekturidee mit einer um den Bunker spiralförmig laufenden begrünten Rampe umschmeichelt den Betonblock, den zwischen 1942 und 1944 hunderte Zwangsarbeiter errichten mussten. Hinter den meterdicken Wänden lebt Kultur
Die Reste der Apsis in der Poolstraße –bis vor Kurzem eine Autowerkstatt




Hamburg könnte heute wie eine Mischung aus Wien, Lübeck und Amsterdam aussehen.
allerdings schon seit 1946. Nach einer ersten Wohnnutzung des unzerstörbaren Riesenwürfels durch Kriegsobdachlose begann hier mit dem NWDR das deutsche TVZeitalter mit Fußball, Fernsehkoch, Goethe und Tagesschau.
Diese wenigen Beispiele von den vielen Verlusten durch Bombenschneisen, Folgebrände und Abrissbagger bekommen ihre historisch wahre Dimension jedoch erst beim Betrachten der Schadenskarten und Luftaufnahmen vom Kriegsende. Die zeigen dem nostalgischen Blick, was alles vernichtet wurde. Allerdings auch, was hätte gerettet werden können. Zum Beispiel am Ort der heutigen Elbphilharmonie. Dort stand noch bis 1963 der berühmte Kaispeicher A mit seinem Zeitball, der früher exakt um 12 Uhr Greenwich Mean Time herabfiel, so dass jeder im Hafen seine Uhr präzise einstellen konnte. Das von Bomben zwar beschädigte, aber nicht zerstörte Hafenwahrzeichen wurde 18 Jahre nach der Kapitulation gesprengt und durch den abstrakten Block von Werner Kallmorgen ersetzt, dessen Reste heute den Sockel des Konzerthauses bilden.
Und so hat man sich an vielen Stellen der Kernstadt bis heute der Mühe entledigt, das Erbe der Geschichte zu bewahren. Wie die 1500 Jahre alte Stadt ohne den destruktiven Willen der Deutschen im 20. Jahrhundert hätte aussehen können, das ist aus historischen Aufnahmen gut zu ermitteln: eine Mischung aus Wien, Lübeck und Amsterdam, mit langen Straßenzügen an idyllischen Fleeten, filigranen Kontorhäusern und mehrgeschossigen Fachwerkbauten, gut gefassten Stadtplätzen und imposanten Gründerzeitquartieren außerhalb des Wallrings. Also statt der sonntags ausgestorbenen Innenstadt vermutlich die populärste TouristenDestination Europas ohne Schloss.
Trotzdem kann es einem passieren, dass eine patriotische Zugchefin die sehr verspätete Ankunft in Hamburg als »in der schönsten Stadt der Welt« ankündigt. Es muss also doch einen Genius loci geben, der dafür sorgt, dass trotz eines beinahe kompletten Gebäudeaustauschs in achtzig Jahren die Liebe zu Hamburg immer wieder neu geboren wird. Und dass in einer vielleicht gesunden Geschichtsvergessenheit die Reaktion auf das Wort »Kriegsnarben« von jüngeren Zeitgenossen eigentlich immer lautet: »Welche Kriegsnarben?« Dazu lässt sich dann bei allem Phantomschmerz über die historischen und baukulturellen Verluste der Stadt nur leise seufzen: Tu felix Hammonia!






























Früher war unser Kolumnist unermüdlich auf Glückssuche, heute genügt ihm ein anderer Seelenzustand.
VON TILL RAETHER ILLUSTRATION NADINE REDLICH

Vor gut zwanzig Jahren arbeitete ich bei der Zeitschrift »Brigitte«, die heute noch am Hamburger Baumwall gemacht wird, schräg gegenüber der Elbphilharmonie. Nur, dass es damals die Elbphilharmonie noch nicht gab. Was es aber damals gab, am Zeitschriftenmarkt, in der Popkultur und vielleicht insgesamt bei Menschen, die wie ich gut zwanzig Jahre jünger waren als heute, das war die Leidenschaft für Glückssuche. Die positive Psychologie war gerade auf ihrem Siegeszug ins öffentliche Bewusstsein, darum waren Bücher und Medien voll von der Behauptung, dass das Glück für uns alle in greifbarer Nähe lag, wenn wir nur unsere innere Einstellung änderten. Zum Beispiel, und das war ganz wichtig, sollten wir uns nicht zu schnell zufriedengeben. Mit unserer Beziehung, unserem Job, unserem Aussehen.
Das Wort zufrieden bekam damals einen negativen Spin, den es bis dahin nur in Arbeitszeugnissen gehabt hatte. »Zufriedenstellend« oder sogar »im Großen und Ganzen zufriedenstellend« bedeutete und bedeutet nämlich nicht, dass man seine Sache völlig okay gemacht und auch niemand etwas anderes erwartet hat und alle, hurra!, zufrieden waren. Im Gegenteil, es bedeutete vier minus bis fünf, in Schulnoten. Zufrieden, das war also: gerade noch ausreichend oder schon mangelhaft.
In der »Brigitte« nun schrieb eine Kollegin einen flammenden Appell gegen die Zufriedenheit. Zufrieden sein würde bedeuten, sich mit dem Zweit oder Drittbesten abzufinden. Die Zufriedenheit decke Probleme, Mängel und Unzulänglichkeiten zu und sei spießig. Zufriedenheit sei wie die ausrollbare Plane über den Kofferraum hinten im Kombi.
Mir prägte sich dieses Bild so sehr ein, dass erstens meine Frau und ich anfingen, dieses unansehnliche Plastikrollo hinten im Auto »die Zufriedenheit« zu nennen, nach dem Motto: Wenn wir die Stehlampe mitnehmen, müssen wir die Zufriedenheit rausnehmen; auf dem Weg nach Italien hatten wir das Auto so voll, dass ich die Zufriedenheit nicht mehr drüber bekommen habe. Zweitens
war für mich damit das Schicksal des Gefühls Zufriedenheit vorerst besiegelt: Zufriedenheit war etwas Ausgeleiertes, Unglamouröses. Nach Glück und Erfüllung musste man streben, Zufriedenheit war der Trostpreis, eine TeilnahmeTrophäe.
Seitdem ist viel passiert. Die Welt ist gar nicht unbedingt schlechter geworden, im Gegenteil, in vielerlei Hinsicht ist sie sogar besser als vor zwanzig Jahren. Aber ich bin älter, und vielleicht ist auch die Welt älter, und vielleicht hat sich mein und unser Anspruch daran, was im Leben möglich und erstrebenswert ist, geändert. Ebenso wie mein Bewusstsein dafür, wie zerbrechlich alles ist, und dass wir eben doch nicht alles selbst in der Hand haben. Vor allem nicht das Glück.
Jedenfalls habe ich im vorigen Dezember zum ersten Mal seit der Pandemie wieder eine etwas größere Anzahl an Weihnachts und Neujahrskarten geschrieben, und dabei dachte ich immer wieder darüber nach, was ich den Leuten, die mir wichtig sind, eigentlich wirklich wünsche. Gesundheit, klar. Aber Glück? Es klingt so überdimensional, ein bisschen kitschig, naiv auch, mehr nach einem überhöht angepriesenen ShoppingErlebnis oder einem teuer hochverpackten Kräutertee. Am Ende schrieb ich auf die Karten: Gesundheit und Zufriedenheit.
Und hey, das Wort sah richtig schön aus, wie es dort so stand. Ja, ich wünsche mir Zufriedenheit. Es bedeutet für mich, dass die Stimmen in mir, die immer mehr wollen, endlich leise sind. Dass die Leere in mir kein dunkles Loch ist, das gefüllt werden muss, sondern eine Freifläche, über die ein mildes Lüftchen weht. Dass ich endlich meine Ruhe habe, vor meinen Sorgen, meinen Feinden und mir selbst. Wenn ich das schon vor zwanzig Jahren gewusst hätte, wäre ich heute vielleicht sogar noch zufriedener.
TILL RAETHER lebt und arbeitet als freier Journalist und Autor in Hamburg.
Tiefsinn, Transzendenz und traumwandlerische Intuition sind die Domänen der Pianistin Elisabeth Leonskaja.
VON WALTER WEIDRINGER
Selbstverständlich hat sie immer wieder auch mit Tschaikowskys bMollKlavierkonzert reüssiert, diesem besonderen Glanzstück pianistischer Virtuosität russischer Provenienz. Und Ehrensache für eine Künstlerin ihrer Herkunft ist es wohl auch, ihr Publikum mit den beiden anderen TschaikowskyKlavierkonzerten und seiner Konzertfantasie zu begeistern, mit Stücken also, die im Westen vergleichsweise unpopulär geblieben sind. Dazu kommen in ihrem großen Repertoire auch Schostakowitsch, Prokofjew, Chopin, Mendelssohn, so vieles mehr.
Dennoch fallen einem bei Elisabeth Leonskaja immer zuerst jene Auftritte ein, bei denen sie Musik über die »letzten Dinge« zum Klingen gebracht hat. Mit den letzten drei Klaviersonaten Beethovens etwa, dem »kürzesten Programm der Welt«, wie sie es schmunzelnd nennt, zumal sie es vorzugsweise ohne Pause spielt. Der eigenwillige zweisätzige Bau des finalen Opus 111 mit seinem monumentalen, zuletzt ruhig verklingenden Variationensatz scheint in unerhörter, tief beeindruckender Weise ganz auf Entrücktheit, Tiefsinn, Abschied und Transzendenz zu zielen – eine Domäne der Leonskaja.
Oder auch mit seinem Pendant, dem »längsten Programm der Welt«, gebildet aus den letzten drei SchubertSonaten. Da führen gerade Leonskajas bedachtsamliebendes Eingehen auf Schuberts epochale KlavierEpik und damit auch der Respekt vor seinen leider oft ignorierten Wiederholungszeichen ganz ins Zentrum dieses großen
Romans in drei Bänden. Denn Leonskaja besitzt nicht nur die Ruhe und den langen Atem für eine solche Unternehmung, sondern ihr gelingt auch das Paradoxon, Schuberts Labilität in gleichsam genau tariertem Gleichgewicht darzustellen. Soll heißen, dass etwa scheinbar heitere Tänze und triste Rastlosigkeit nahtlos ineinanderfließen, dass der Überraschungswert der harmonischen Ausweichungen weder überspielt noch eigens herausgestellt wird, wodurch sich das Ganze in Einzelheiten verlöre. Im Gegenteil, es ist gerade der erzählerische Fluss, der an Leonskajas Interpretationen fesselt – und in den die Details sich sorgsam einordnen. Es wirkt, als beschreite sie einfach traumwandlerisch intuitiv den Königsweg zu Schuberts Seelenleben.
Über technische Brillanz, über bloße Fingerfertigkeit denkt da niemand mehr nach. Eher fällt einem ein, dass Leonskaja 2016 von der Republik Georgien, ihrer einstigen, unvermindert geliebten engeren Heimat, mit dem Titel »Priesterin der Kunst« ausgezeichnet wurde. »Dafür kann ich aber nichts«, lacht sie in ihrem feinen Wiener Deutsch mit den russischen Obertönen – um dann, ganz typisch für sie, nach der spontanen Emotion die Worte dennoch auf die Goldwaage zu legen: »Ein Priester ist etwas anderes als ein König, aber selbst ein König ist eine Art von Diener. Königin möchte ich keine sein, das ist ein furchtbares Schicksal. Aber Priesterin … Es geht immer um Verantwortung. Für Musik und für Menschen.« Dass ihre Berufung untrennbar mit Dienen zu tun hat, mit der Interpretation























»Es
geht immer um Verantwortung. Für Musik und für Menschen«, sagt Elisabeth Leonskaja. »Musik ist eine heilige Kunst.«


von Texten und dem Dienst am Werk, daran besteht für Elisabeth Leonskaja kein Zweifel: »Musik ist eine heilige Kunst.«
Dieses Heilige zelebriert die Grande Dame nicht nur alleine am Klavier, sondern eben auch mit Orchester –und nicht zuletzt als leidenschaftliche Kammermusikerin. Auch da rührt sie immer wieder an Unaussprechliches. Etwa als sie 2015 mit den hinterbliebenen drei Mitgliedern des Artemis Quartetts in einer Konzerttournee des verstorbenen Bratschisten Friedemann Weigle gedachte. »Für sie war nicht nur der Verlust eines Freundes zu verarbeiten, sondern sie mussten auch wieder auf die Bühne gehen, ohne ihn. Tausend Emotionen …« Man hätte sich keine einfühlsamere und zugleich stärkeren Halt verleihende Partnerin als Elisabeth Leonskaja vorstellen können für einen solchen körperlichen, seelischen und musikalischen Kraftakt – der dann freilich überwiegend zart tönte, Trauer und Wehmut zum Klingen brachte, aber auch jene Dankbarkeit, die den Blick in die Zukunft erlaubt. Ganz im Sinne Thomas Manns, der einmal von »zweierlei Lebensfreundlichkeiten« schrieb: Es gebe »eine, die vom Tode nichts weiß; die ist recht einfältig und robust, und eine andere, die von ihm weiß, und nur diese, meine ich, hat vollen geistigen Wert. Sie ist die Lebensfreundlichkeit der Künstler, Dichter und Schriftsteller.«
Die Künstlerin Elisabeth Leonskaja hat diese Art der Lebensfreundlichkeit verinnerlicht – seit ihren musikalischen Anfängen in Tiflis, wo sie 1945 geboren wurde. Die Eltern waren aus Odessa vor Pogromen geflohen. Für die Mutter vor allem, die Gesang und Klavier studiert und dann alles verloren hatte, war es ein Herzenswunsch, ihre Tochter musizieren zu hören. »Papa hat immer gesagt: Lass das Kind länger glücklich leben! Doch Zwang habe ich keinen verspürt.« Die Aufnahmeprüfung an einer der mehr als 300 (!) Musikschulen von Tiflis hat die sie
benjährige Lisa also bestanden, ohne zuvor schon Klavier gespielt zu haben. Das sei übrigens nichts Besonderes, winkt Leonskaja ab: »Jedes Kind in Russland fängt mit sieben Jahren an, und jedes Kind ist für die Eltern ein Wunderkind.« Aber nicht jedes Kind debütiert mit elf als Solistin in Beethovens 1. Klavierkonzert.
Schließlich studierte Leonskaja am Moskauer Konservatorium. Dort erkannte auch Swjatoslaw Richter ihr eminentes Talent und begann, sie zu fördern: der Beginn einer musikalischen Zusammenarbeit und zugleich beglückenden, sich immer weiter vertiefenden Freundschaft. Eine hinreißende Ahnung dieser künstlerischen Beziehung vermittelt die 1993 entstandene gemeinsame Aufnahme der Bearbeitung von MozartKlaviersonaten durch Edvard Grieg – oder besser gesagt: Griegs frei hinzukomponierte Begleitung durch ein zweites Klavier bei der »Sonata facile« KV 545 sowie der cMollFantasie KV 475 und der Sonate KV 533/494. »Richter hat immer gesagt, bei Mozart sei das Timing besonders herausfordernd, er verzeihe viel weniger als zum Beispiel Beethoven«, erzählt Leonskaja. Im Moment, so verrät sie, gingen ihre Gedanken in die Richtung, dass der emotionale Gehalt der Ausführung bei Mozart ebenso hochtourig laufen müsse wie die extreme Schnelligkeit seines Komponierens. Und da schieße man eben mal über das Ziel hinaus oder erreiche es nicht: »Das macht es so schwer.«
Als ihr 1978 in letzter Sekunde die Ausreise aus der UdSSR erlaubt wurde und sie direkt vom Flughafen zur Probe ins Wiener Konzerthaus eilte, stand Beethovens 5. Klavierkonzert mit den Wiener Symphonikern unter Erich Leinsdorf auf dem Programm, ein Stück, das mit imperialprunkvollen Gesten einsetzt. »Bei irgendeiner Stelle sagte Leinsdorf: ›Machen Sie den Gürtel auf!‹«, erzählt Leonskaja lachend. Aber kein Wunder, dass sie in dieser Situation erst schrittweise zu ihrer gewohnten, aus
höchster Konzentration gespeisten Lockerheit hatte finden können. Erst kurz zuvor hatte sie nämlich eine Visumseinladung aus Israel bekommen, was von den Sowjetbehörden sofort registriert und mit einer Ausreisesperre quittiert worden war. »Die Frau von Swjatoslaw Richter hat dann für mich gebürgt, und ich glaube, dass ich deshalb doch noch den nötigen Pass bekommen habe – genau am Morgen dieser Probe. Und so ging es sofort ab zum Flugzeug Richtung Wien.«
Wien sollte es sein und Wien sollte es für sie bleiben als neuer Stützpunkt und Lebensmitte der passionierten Fußgängerin. Hier ist sie im Musikverein ebenso heimisch wie im Konzerthaus, und unser Treffen findet auf ihren Wunsch hin auch im Konzerthaus statt, denn »da findet man immer eine ruhige Ecke«. Der Portier hat Post für sie, und an der Sitzbank im Foyer, auf die sie gleich zustrebt, kommen immer wieder Mitarbeitende des Hauses vorbei, lächeln, nicken zum Gruß. Aus dem Großen Saal dringt eine Probe von Brahms’ Violinkonzert, man fühlt sich zu Hause.
»Jeden Morgen beim Aufwachen bin ich froh, in Wien zu sein. Diese Stadt ist phänomenal, man liebt Musik, man liebt Theater. Ich verdanke ihr für mein Werden, mein geistiges Wachstum unglaublich viel.« Dennoch hat sich Leonskaja auch eine gewisse kritische Distanz bewahrt –und zitiert schmunzelnd den Schauspieler Gert Voss, der einmal gesagt hat, man könne hier schnell zu einem Stück Sachertorte werden, wenn man nicht aufpasse: »Man denkt viel nach hier. Man wird verschlafen. Man muss mit sich selbst kämpfen. Und was mir fehlt, ist noch

mehr seelischer Austausch zwischen Menschen – jenseits oberflächlicher Nettigkeit. Ich habe mich gefreut und bestätigt gefühlt, davon auch bei Stefan Zweig und Arthur Schnabel zu lesen, die das ähnlich empfunden haben.«
Zuletzt habe sie vor allem die Beschäftigung mit der Musik Arnold Schönbergs weitergebracht, verrät Leonskaja: »Das ist so extrem polyphonisch und absolut genial. Manchmal will man beinahe aufgeben, weil es so schwer ist, alles zu verstehen und die Linie zu finden. Erst wenn man alles durchhören kann, die verschiedenen Intensitäten sämtlicher Stimmen erfasst, wird alles klar.« Mit Leidenschaft hat sie sich auch in den Briefwechsel zwischen Schönberg und Alma MahlerWerfel versenkt. »Die Mentalität von Schönbergs Zeit finde ich zum Greifen nah. Alma Mahler war eine großartige Persönlichkeit, die aus ihrer beinah allmächtigen Position heraus vielen geholfen hat. Aber ganz besonders hat mich ein Satz von Schönberg fasziniert, er schreibt ihr einmal sinngemäß: ›Glauben Sie mir, gnädige Frau, dass ich nicht überheblich bin, sondern mich wie ein Blinder jeden weiteren Schritt vortaste.‹«
Schönberg, der angebliche Konstrukteur, der dennoch im Dunkeln tappe und intuitiv vorgehe: So etwas rührt Elisabeth Leonskaja. Weil sie sich selbst als das Gegenteil eines strategisch überlegenden Kopfmenschen ansieht. Viel eher empfindet sie sich als auf einer Wanderung unterwegs. Wenn sich in der Ferne etwas möglicherweise Anziehendes zeige, dann halte sie darauf zu, bis sich die Erwartungen entweder bestätigen oder eben nicht. Vom BrahmsVerehrer Schönberg ist es auch nur ein Katzensprung zurück zu Brahms’ frühen, einzigen drei Klaviersonaten – noch so ein geliebtes »Monoprogramm« der Leonskaja. »Brahms war fast noch ein Teenager, als er sie schrieb, und steckte voller Energie, wie ein junges Rennpferd. Alles ist sofort wundersam aus ihm geströmt, aber trotzdem gibt es eine enorme Entwicklung. Am Ende lässt sich schon der große Symphoniker erkennen.« Was neue Werke in ihrem Repertoire anbelangt, schwanke sie im Moment zwischen Debussy und spanischer Musik. »Es wäre falsch formuliert, würde ich sagen: ›Ich denke darüber nach.‹ Eher ist es ein Nachfühlen, ein intuitiver Vorgang. Und wenn mir vorkommt, dass es passt, dann überprüfe ich das in der Praxis. Das Leben beginnt auf der Bühne.«
ELISABETH LEONSKAJA
Di, 7.5.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Johannes Brahms: klaviersonaten Nr. 1, 2 und 3
Fr, 30.8.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal Orchestre Français des Jeunes, kristiina Poska (Leitung) Piotr tschaikowsky: klavierkonzert Nr. 2 g-Dur
Robert schumann: sinfonie Nr. 3 es-Dur

Der Verleger Sven Murmann weiß genau, warum er sich für die Elbphilharmonie engagiert.
Musik hat in unserer Familie schon immer eine besondere Rolle gespielt. Meine Mutter sang im Chor und spielte Klavier, meine Schwestern musizierten, und auch ich habe mich am Cello versucht. Statt zu üben, bin ich dann aber doch oft lieber auf den Fußball oder Tennisplatz gegangen. Dennoch besuchte ich schon als Jugendlicher gerne klassische Konzerte. Ich bin in Kiel aufgewachsen und habe dort Mitte der Achtzigerjahre die Gründung des SchleswigHolstein Musik Festivals hautnah miterlebt. So schmierte ich Brote für die Künstlerinnen und Künstler und spürte den unglaublichen Enthusiasmus, als auf einmal WeltklasseStars in Scheunen auf dem Land auftraten. Das hat mich geprägt, meine Familie hat sich dann auch sehr als Förderer für das Festival eingesetzt.
Seit 2007 gehöre ich dem Aufsichtsrat der Elbphilharmonie und Laeiszhalle an. Die damalige Kultursenatorin Karin von Welck sprach mich an, den Ausschlag für ihr Interesse gab mein Amt als Stiftungsratsvorsitzender des SchleswigHolstein Musik Festivals, das ich von 2005 bis 2021 innehatte. Es war schon damals geplant, dass auch das Festival in der Elbphilharmonie Konzerte veranstaltet. Die herausragende neue Musikspielstätte sollte nicht nur als Tor zur Welt fungieren, sondern auch das Umland einbeziehen.
Natürlich hatte ich schon vorher von dem Projekt Elbphilharmonie gehört, es war damals in aller Munde und auch in der Musikszene nicht ganz unumstritten. Einige Konzertveranstalter hatten Sorge, dass die zusätzlichen 2.100 Plätze Publikum von der Laeiszhalle und den Konzerthäusern im Umland abziehen könnten. Ich habe immer gehofft, dass das nicht passiert und dieses beeindruckende Bauwerk stattdessen einen Schub in der gesamten Region bewirkt. Tatsächlich ist es so gekommen: Ich freue mich, dass heute in ganz Norddeutschland das Interesse an klassischer Musik gewachsen ist. Die Nachfrage ist deutlich angestiegen, das ist ein großartiger Erfolg der Elbphilharmonie!
Die Voraussetzung, dass die Stadt Hamburg sich derart für den Bau der Elbphilharmonie engagiert, war das Versprechen, ein Konzerthaus für alle zu schaffen. Angestrebt war ein Ort, an dem Menschen aus allen sozialen Milieus zusammenkommen und wo jeder etwas findet, was ihn inspiriert und begeistert. Ein Haus wie die Elbphilharmonie bietet die einmalige Chance, Hemmschwellen abzubauen, schon allein aufgrund ihrer Attrakti
vität und der Popularität des Ortes. Von Beginn an wurde das Augenmerk auf die Musikvermittlung gelegt, der musikpädagogische Bereich erscheint mir sehr gut gelungen. Aufgrund der riesigen Nachfrage, u. a. auch von Schulen und Kindergärten, wurde die Anzahl der Mitarbeitenden in diesem Bereich mittlerweile aufgestockt. Die Elbphilharmonie ermuntert die Menschen, sich frei und vorurteilslos der Musik zu nähern, sie repräsentiert eine Art musikalischen Kosmopolitismus. Die Konzertprogramme und Festivals mit ihrem oft multikulturellen Bezug, wie etwa das KurdistanFestival, tragen dazu bei und überraschen immer wieder aufs Neue. Aus meiner Sicht rechtfertigt die Elbphilharmonie die städtischen Zuschüsse, die sie erhält. Ihre Strahlkraft auf die Region ist groß, und Hamburg hat enorm von ihr profitiert. Ganz zu schweigen von den Touristen, die ihretwegen in die Hansestadt kommen. Die Rechnung, ein Tor zur Welt zu sein, ist großartig aufgegangen, und die Menschen der Stadt und der Region wurden mitgenommen.
Durch meine Tätigkeit im Aufsichtsrat des Konzerthauses habe ich Einblick hinter die Kulissen und kenne Interna und Zahlen. Dadurch verändert sich schon ein wenig der Blick auf das Haus, nicht jedoch das Konzerterlebnis an sich. Ich gehe nach wie vor gern und oft in Konzerte, und falls ich es einmal zeitlich nicht einrichten kann, finde ich in meiner Familie dankbare Abnehmer für die Karten. Die Elbphilharmonie beruht in ihrer gesamten Konzeption auf strengen ästhetischen Gesetzen. Bei Bauwerken dieser Art tritt das Phänomen auf, dass allein schon ihre ästhetische Perfektion hohen Respekt abfordert – selbst dann, wenn man vielleicht nicht in jedem Detail den gleichen Geschmack teilt. Der Große Saal ist ein ästhetisches Erlebnis und hat eine starke Wirkung. Ich spüre das insbesondere während der leisen Konzertpassagen, wenn über 2.000 Menschen gebannt schweigend einem Künstler lauschen. Ohne dass wir es bewusst merken, verführt uns auch der Raum, dem Künstler intensiv zuzuhören. Dieses gemeinschaftliche Erleben stellt sich bereits auf dem langen Weg in den Saal ein. Das eröffnet uns den Raum zu einem spirituellen Ereignis, das es in ähnlicher Art vielleicht nur noch in Kirchen oder anderen Sakralbauten gibt.
AUFGEZEICHNET VON CLAUDIA SCHILLER FOTO CHARLOTTE SCHREIBER



Die Band ADG7 übersetzt uralte koreanische Traditionen gut gelaunt in die Gegenwart.
Die Band ADG7 im »Tiny Desk Concert«, einem beliebten YouTubeFormat aus Washington, D. C.: Nicht weniger als neun junge Menschen mit ausgefallenen Instrumenten und bunten Bühnenoutfits quetschen sich um den winzigen Schreibtisch des Radiomoderators Bob Boilen – ein seltener Anblick, der das enge Studio logistisch an seine Grenzen bringt. In der VideoBeschreibung liest man, die in Seoul ansässige Gruppe würde traditionelle SchamanenMusik mit koreanischen Volksliedern kombinieren.
Der einzigartige FeelGoodSound der neunköpfigen Band ist nicht leicht zu beschreiben: Für die KPopFans der aktuellen TeenagerGeneration bietet sie zu viel Folk und ist vielleicht zu langsam – für historisch interessierte Zuhörer ist das wohl viel zu viel Party. Positiv formuliert: ADG7 verbinden das Beste aus zwei Welten. Es sind poppige Beats mit Background, uralte Traditionen gut gelaunt in die Gegenwart übersetzt. »Wir sind nicht einfach die KPopBand, die deine kleine Tochter hört«, betont die Gruppe, die sich selbst eher im FolkPop verortet. »Unser Ziel ist, die koreanische Kultur und vor allem den Schamanismus so weiterzudenken, dass wir einen Sound und LiveShows entwickeln, die ein Publikum von heute wegblasen.« Heißt: tanzbarer Pop, HinguckerInstrumente mit außergewöhnlichen Klängen, einfache koreanische Texte und verführerisch transzendente SchamanismusMusik. »Korean Psychedelic«, so fassen sie es zusammen.
Und der Bandname? Ist nicht Programm, wie die Musiker im schriftlichen Interview betonen. Der nationale Feiertag sei nur der persönliche Anlass, die Gründung der Band nicht politisch motiviert gewesen. Das Spiel mit der Ziffer 7 und dem ausgesprochenen »Gwang Chil« ist ein kleiner Gag, die Kombination von Großbuchstaben und Ziffern unter den derzeit so erfolgreichen KPopGruppen nicht unüblich. »Diese Band ist nicht aus einer ernsthaften oder formellen Stimmung geboren«, beteuern die Musiker. Das größte Kompliment, das man ihnen nach einer Show machen kann? Klare Antwort: »You guys are crazy.«
CVON JULIKA VON WERDER ›
Auch der außergewöhnliche Name wird prompt erklärt: ADG7 ist die Abkürzung für »Ak Dan Gwang Chil«. »Ak Dan« heißt dabei einfach »Musikband«; »Gwang Chil«, oder verkürzt »G7«, steht für den 70. »Gwangbokjeol« –den Nationalen Tag der Befreiung Koreas von der Kolonialmacht Japan, den man am 15. August sowohl in Südals auch in Nordkorea feiert und zu dessen Anlass sich die Band 2015 gründete. Man könnte von dieser Gruppe also durchaus traditionelle koreanische Musik erwarten, inhaltlich eher politisch ausgerichtet.
Aber dann das: Als »Best Band in the wooorld« stellt die Frontsängerin Hong Ok die Band mit einem großen Strahlen in die Kamera vor; ihre zwei Kolleginnen stimmen überschwänglich ein, ehe sie sich bald ganz dem überraschend schnellen Beat der BegleitCombo hingeben. ADG7, das wird schnell klar, liefern keine andächtige Darbietung alter Musiktraditionen, sondern Partymusik, wie man sie noch nie gehört zu haben meint.
razy hin oder her – ausgebildet sind alle Bandmitglieder in traditioneller koreanischer Musik, auch wenn sie privat schon immer vieles von den Beatles bis zu Coldplay gehört haben. Kennengelernt haben sie sich in dem auf traditionelle Musik spezialisierten ProfiEnsemble Jeong Ga Ak Hoe, und ihren fetzigen ADG7Sound erzeugen sie ausschließlich auf den Instrumenten ihrer jahrhundertealten Kultur. Dazu gehören in der aktuellen Besetzung Hyun Soo Kims Bambusflöte, das traditionsreiche zentralasiatische Rohrblasinstrument Piri sowie zwei verschiedene WölbbrettZithern.
Ganz besonders ins Auge sticht Hyang Hee Lees Mundorgel, mit deren 17 unterschiedlich langen Pfeifen die Musikerin einen unverkennbar durchdringenden

Zu den ausgelassenen, beinah überdrehten Shows der Band tragen auch die extravaganten Kostüme bei.
Ton erzeugt. »Weil all diese Instrumente lange vor den modernen großen Konzerthäusern und vor allem lange vor unserem heutigen SoundEquipment entstanden sind, war es nicht so einfach, ihren einzigartigen Klang richtig aufzunehmen oder zu verstärken«, erzählt der Bandleader Hyun Soo Kim.
So wie die Band urtümliche Klänge in einen modernen Sound fasst, so verleiht auch ihr Look der Tradition einen neuen Anstrich. Zu den ausgelassenen, beinah überdrehten Bühnenshows von ADG7 tragen nicht zuletzt die stilvollen Outfits der drei Sängerinnen bei – oft mit leuchtendbunten Stoffen, manchmal mit hippen Sonnenbrillen, meistens mit extravaganten Hüten. »Die farbenfrohen Kostüme sind denen von Schamanen nachempfunden, die immer sehr prächtige Kleidung und auffälligen Schmuck tragen«, erklärt eine der Sängerinnen. Passend gekleidet, verbinden sie die rituellen Bewegungen der Schamanen mit modernen KPopTanzschritten und einem Hauch von Glamour – selbstverständlich alles selbst choreografiert.
Dass die Band den uralten SchamanenKult neu belebt, ist in Korea überhaupt keine Ausnahme, im Gegenteil: SchamanenRituale erleben in dem HightechLand seit geraumer Zeit ein veritables Comeback. Vielfältige, teils auch kommerzialisierte Angebote locken als Gegenprogramm zum modernen Alltagsstress. Viele Menschen suchen Zuflucht und Rat in Wahrsagungen oder der Vertreibung böser Geister. Die Schamanen gelten als Vermittler zwischen Diesseits und Jenseits, als Medium zwischen Himmel und Erde. »Sie trösten und lindern den Schmerz eines Menschen durch bestimmte Rituale«, erklärt der Flötist Hyun Soo Kim. »Und so feiert auch




























unsere Musik das Zusammenleben. Wir singen und tanzen zusammen und erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind. Wir werden eins durch Musik. Das ist unsere Mission.«
Die traditionellen SchamanenRituale – sogenannte »gut« – variieren stark nach Region und Anlass. Die Musiker von ADG7 verwenden in ihrer Musik vor allem Riten, die ursprünglich aus dem heutigen Nordkorea stammen. »Im Vergleich zu anderen Regionen ist diese nordkoreanische SchamanenMusik bekannt für ihren schlichten repetitiven Aufbau und ihre kraftvollen PercussionSounds«, erklärt die Sängerin Chorong Bang. Ob in der Hinwendung zur nordkoreanischen Kultur auch die Sehnsucht nach Wiedervereinigung anklingt?
»Das ist der Wunsch aller Koreaner«, ist sie überzeugt. »Traditionelle Gesänge sind der Beweis dafür, dass Süd und Nordkorea eine gemeinsame Sprache, dieselben Instrumente und Lieder verwendet haben – und dass wir eins sind. Unsere Musik heute besingt die Verbindung zwischen allen Wesen, unabhängig von Nationalitäten.« Ganz unpolitisch ist das dann vielleicht doch nicht. In jedem Fall ist es nicht ohne gesellschaftliche Relevanz, wenn sich eine südkoreanische Band mit nordkoreanischer Musik in die weite Welt aufmacht.
ADG7
Do, 23.5.2024 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal koreanisch-schamanistischer Folk-Pop

Freuen Sie sich auf einzigartige Konzert-Pakete der Saison 2024/2025 in der Elbphilharmonie! Das erwartet Sie:
Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück im Louis C. Jacob Transfer zum CARLS an der Elbphilharmonie Dinner im CARLS an der Elbphilharmonie inklusive Aperitif, begleitende Weine und Wasser Karte der PK 1 für ein ausgewähltes Konzert in der Elbphilharmonie Rückfahrt zum Hotel mit der MS Jacob bei Käse und Wein

Der Vorverkauf für die neue Saison beginnt Ende Mai 2024. Melden Sie sich jetzt für den Newsletter an, um keine Termine zu verpassen.
hotel-jacob.de




Irreversible Entanglements sind die wohl politischste Band im zeitgenössischen Jazz.
VON JAN PAERSCH



Am besten fängt man mit ihrem längsten Song an. Er ist nur als »Single« erschienen, ein seltsamer Ausdruck für ein mehr als zwanzigminütiges Stück. Der Beginn: nur Schlagzeug und ein nervös trabender Kontrabass, minutenlang. Langsam schrauben sich ein Saxofon und eine Trompete gemeinsam in die Höhe, es wird laut, unangenehm.
Erst nach sieben Minuten gesellt sich eine sonore weibliche Stimme dazu: »Nobody wants to be who they are.« Ein »Wunderland voller Illusionen« erwähnt die Performerin, in energischem Sprechgesang beklagt sie verschlüsselt die Abgründe von SocialMediaPlattformen.
Die Bläser intonieren ein rasantmonotones Thema, fast wie eine Alarmsirene, doch der Klang ist seltsam weich, sie spielen es wie in Trance, werden lauter. Elf Minuten sind vorbei, dann beginnt ein SaxofonSolo, höllenschnell, schmerzhaft, verbindet sich erst nach drei gehetzten Minuten wieder mit der Trompete.
Irgendwann kommt dann der Song zu einem Stillstand. Die Sängerin fragt: »How far do we have to go / To get away from the hell / That’s always waiting.« Der Song endet so, wie er begonnen hat, mit gezupftem Kontrabass.
Ekstase des späten John Coltrane, der Spiritualität von Alice Coltrane oder Pharoah Sanders und den akustischelektrischen Texturen von Zeitgenossen wie Shabaka Hutchings«.
Die Band, die solch großen Vergleichen standhält, heißt Irreversible Entanglements. Vier Männer und eine Frau, die sich nach einem physikalischen Terminus benannt haben, der »unumkehrbaren Quantenverschränkung«: ein Phänomen, bei dem mehrere verschränkte Teilchen nicht mehr einzeln beschrieben werden können, sondern nur noch als Gesamtsystem.
Camae Ayewa, der Kopf der Band, hatte die Namensidee bereits, als das Quintett noch nicht die in beinahe telepathischer Einigkeit agierende Gruppe war, die später von der Kritik als »lebensbejahend und überwältigend« gefeiert werden sollte. Ayewa ist Sängerin, Dichterin und SpokenWordKünstlerin. »Ich versuche Dinge zu machen, die sich organisch anfühlen«, sagt sie. »Dinge, bei denen die Energie schon vorhanden ist. Ich erinnere michnoch daran, wie sehr ich Musik machen wollte, aber niemanden kannte. Um eine Band zu gründen, brauchst du Freunde!«
DDiese Musik ist unbarmherzig, sie fordert, prangert Missstände an, tut weh – aber sie berührt auch.
er Gründungsmoment ihrer Band hatte mit Kameradschaft zu tun, aber vor allem mit politischer Haltung. Ayewa, der Saxofonist Keir Neuringer und der Bassist Luke Stewart lernten sich in der HardcoreExperimentalSzene Philadelphias kennen und organisierten basisdemokratische Aktionen. Im April 2015 reisten die drei gemeinsam nach New York City, um an der musikalischen Demonstration »Musicians Against Police Brutality« teilzunehmen. Direkt nach ihrem Auftritt spielte dort ein Duo, bestehend aus Trompete und Schlagzeug – und diese beiden Musiker, Aquiles Navarro und Tcheser Holmes, lieferten mit ihren afrokaribischen Wurzeln und ihrem erstaunlichen Mix aus Jazz, Elektronischer Musik und LatinEinflüssen die ideale Ergänzung für den harschen NoiseSound der drei aus Philadelphia. Irreversible Entanglements waren geboren.
»Homeless/Global« ist eine 23 Minuten und 38 Sekunden lange Studioaufnahme, länger als eine Folge »Friends«, länger als so manches komplette PunkAlbum. Ein aufwühlendes politisches Gedicht, gesetzt zu einer Musik, die zumeist mit einem Begriff bezeichnet wird, mit dem viele nur Lärm assoziieren: Free Jazz. Dem Sog und der Wucht, aber auch der Schönheit von »Homeless/Global« wird diese Kategorisierung nicht gerecht. In den Sechzigerjahren hätte man so etwas wohl »Fire Music« genannt, angelehnt an ein frühes Album des Saxofonisten Archie Shepp. Eine politische, unbarmherzige Musik, die fordert, Missstände anprangert, die weh tut, aber auch berührt. Eine Musik, die nicht aus dem Nichts kommt. Ein Kritiker erwähnt die Band in einem Atemzug mit den »ritualistischen Rhythmen des altehrwürdigen Art Ensemble of Chicago, der hymnischen ›
»Wir spielen keine Songs«, sagt der Bassist Luke Stewart, »wir sind eine improvisierende Band. Alles, was du hörst, kommt aus dem Moment. Camae bringt vorgefertigte Gedichte mit, und wir diskutieren darüber. Meistens fangen wir einfach an und sagen: ›See you at the end.‹«
Seit 2017 haben Irreversible Entanglements vier Alben veröffentlicht, das jüngste für Impulse. Dieses Label hatte 1964 »A Love Supreme« veröffentlicht, das bald als Jahrhundertwerk gepriesene Album eines Saxofonisten namens John Coltrane. Wo Coltrane in den Sechzigern vor allem nach Erleuchtung strebte, Spiritualität in Klang
zu gießen suchte, ihm das Politische aber vorwiegend von anderen zugeschrieben wurde, da waren Irreversible Entanglements von Beginn an explizit aktivistisch unterwegs. Ihre jüngsten Albumtitel sind energische Imperative: »Open the Gates« und zuletzt »Protect Your Light«. Die Band beschreibt dieses im Herbst 2023 erschienene Album als »melancholische Erkundung der postkolonialen Trümmer, die uns umgeben«.
Wenn Kritiker die Musik des Quintetts beschreiben, greifen sie oft zu martialischem Vokabular. Von den »aggressiven Bläsersätzen«, vom »donnernden Bass« und von der Wut in Ayewas Vortrag ist die Rede – sie selbst wurde schon als »Poet Laureate der Apokalypse« bezeichnet. Die Künstlerin selbst sagt jedoch: »Ich bin nie wütend. Das ist Liebe. Ich mache Musik über das, was mir wichtig ist und was ich teilen möchte. Und das sind die Geschichten von Frauen.«
Camae Ayewa stammt aus der Kleinstadt Aberdeen, Maryland, 80 Kilometer südwestlich von Philadelphia. »To get away from the hell / That’s always waiting« – die allgegenwärtige Hölle, die sie im Song »Homeless/Global« beschreibt, das könnten die Sozialwohnungen ihrer Kindheit sein. Es könnten aber auch die immer noch alltäglichen Vorfälle von Rassismus und Misogynie sein, denen sie ausgesetzt ist. »Es ist nicht nur eine Geschichte, und es ist nicht nur meine Geschichte«, sagt Ayewa. »Es sind eine Milliarde Geschichten.«
Viele davon hat sie solo unter dem Namen Moor Mother vertont, mit Stücken, die sie als »Black ghost songs« bezeichnet. Sie arbeitet im Duo mit ihrem Kunstprojekt »Black Quantum Futurism« und mit den Geistesverwandten vom Art Ensemble of Chicago und der Londoner Band Sons of Kemet rund um den Saxofonisten Shabaka Hutchings.
Die Karriere ihrer wichtigsten Band Irreversible Entanglements ist eng mit dem wachsenden Renommee des Labels International Anthem aus Chicago verknüpft, ein weit offenes, politisches Label, das Jazz als Haltung, nicht als die Hinwendung zu einem bestimmten Sound versteht.
Dessen Chef, Scott McNiece, erinnert sich an sein erstes Moor MotherKonzert: »Es war inspirierend, eine schwarze Künstlerin zu sehen, die bereit war, einem zu 99 Prozent weißen Publikum so direkt ins Gewissen zu reden. Sie hat dessen Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit auf eine Art und Weise angegriffen, die auch für mich unangenehm war: ›Was guckst du so? Was tust du gegen das Chaos da draußen?‹ Ein unvergesslicher Auftritt. Dann traf ich sie nach der Show, und sie war so



friedlich und liebevoll, bewegte sich fast in Zeitlupe. Es war ein starker Kontrast zu der Unmittelbarkeit, die sie auf der Bühne zeigte. Sie tickt nach ihrer eigenen Zeit, und die bewegt sich in jedem Moment so schnell, wie sie es will.«
In ihrem aktuellen Programm »Protect Your Light« nun haben sich Ayewa und Co. für ein langsameres Ticken entschieden. Zwar gibt es auch hier lange, fanfarenhafte Intros, klagende, NewOrleanssatte Bläser, brasilianische SambaGrooves. Doch die schroffen Soli, die zuvor wie die musikalische Entsprechung der »Black Lives Matter«Empörung anmuteten, sind mittlerweile gezähmter. Und Ayewa stellt nun auch persönliche Geschichten aus. Auf »Root – Branch« verneigt sie sich vor der verstorbenen Trompeterin und Labelkollegin Jaimie Branch; der Song »Free Love« wiederum enthält die erotisch aufgeladene Forderung »I want more love«.
Doch bei aller Liebe: Irreversible Entanglements bleiben engagiert. »Homeless/Global« wird nicht der letzte Song sein, in dem die Band Themen wie Migration, Vertreibung und Gewalt verhandelt. Camae Ayewa fragt darin: »When was the last time you took a picture of a sound smiling at you?« Ein Klang, der den Zuhörer anlächelt – welch poetisches, vielsagendes Bild. Und ein zärtliches Angebot ans Publikum von der wohl politischsten Band im Jazz.
IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS
Mi, 29.5.2024 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Moor Mother (spoken Word), aquiles Navarro (trompete), keir Neuringer (saxofon), Luke stewart (Bass), tcheser holmes (schlagzeug) »Protect your Light«
Unser Gestaltungsauftrag
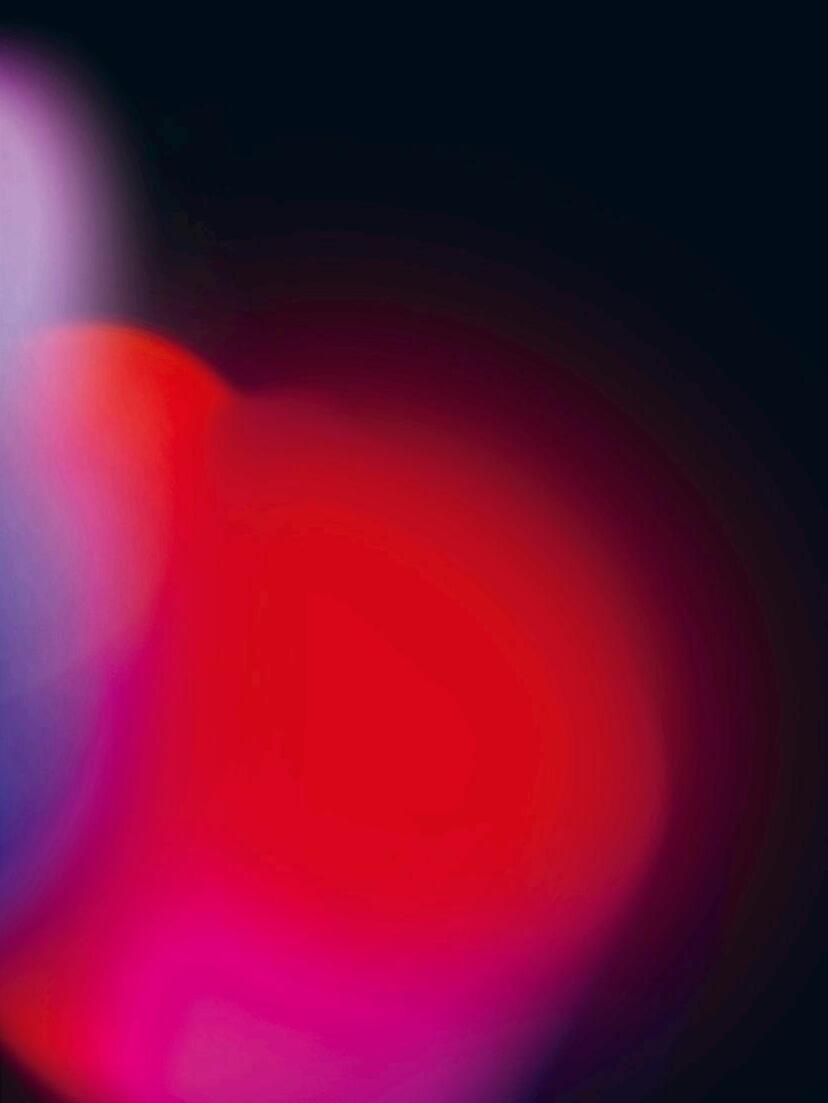
Unsere Welt erneuert sich. Wir gestalten ein neues Wirtschaftsystem aktiv mit –für unsere Zukunft als Gesellschaft und für unsere Zukunft als Unternehmen.
Eine
Frage, sieben Antworten:
»Wie hat sich der Krieg in Ihrer Heimat auf Ihre Kunst ausgewirkt?«
VON IVANA RAJIC
DAKH DAUGHTERS
Schrille Erscheinung, ernste Botschaft: Seit ihrem Auftritt bei den proeuropäischen Demonstrationen auf dem Kiewer Maidan 2013 sind die Dakh Daughters nicht nur in der Ukraine Kult. Nachdem Russland fast zehn Jahre später ihr Heimatland überfallen hat, flohen die Künstlerinnen nach Frankreich und fanden, dass »die Ukraine in der Welt durch die Brille der russischen Propaganda dargestellt wird«. Mit ihrem lauten und gewagten Mix aus ukrainischer Folklore, Punk, Kabarett, ProgRock und Klassik möchten sie deshalb »die Wahrheit über die Geschichte der russischen Aggression gegen die Ukraine und die Kriegsverbrechen der russischen Soldaten auf ukrainischem Gebiet vermitteln«. In ihrem mitreißenden »Freak Cabaret« spielt die Frauenband Dokumentarvideos aus der Ukraine ab, erzählt Geschichten von den Schicksalen ihrer Landsleute und tauscht sich nach den Konzerten mit dem Publikum aus. Für die Dakh Daughters wird ihre Kunst so zu einer »Waffe«.



Mehr als fünf Jahrzehnte lang tobte in Kolumbien ein brutaler Bürgerkrieg. Fast 220.000 Menschen kamen ums Leben, Millionen wurden vertrieben. »In den 1990erJahren war es mit den Drogenbanden und all den anderen bewaffneten Gruppen in Kolumbien sehr gefährlich und bedrückend«, erinnert sich der aus Bogotá stammende, in New York lebende Harfenist Edmar Castañeda. »Die Musik war eine Möglichkeit, diesem Wahnsinn in meinem Heimatland zu entkommen.« Sie führte ihn auf eine virtuose Reise durch die Jazzwelt des Big Apple, angetrieben von improvisatorischer Freiheit und mitreißenden lateinamerikanischen Rhythmen. Mit dem körperlichen Einsatz eines FlamencoTänzers spielt er dabei das Instrument seiner Wahl, die traditionelle Arpa Llanera. Für den gläubigen Katholiken ist sie »ein Geschenk Gottes« und hilft ihm, den durch blutige Konflikte verursachten Schmerz loszulassen und Lebensfreude zu verbreiten. Denn eins ist ihm klar: »Musik ist mächtig, wenn man sie einzusetzen weiß.«
IBRAHIM MAALOUF
»Was wir als Erwachsene tun, ist das Ergebnis unserer Kindheit«, davon ist der 1980 im Libanon geborene Jazztrompeter Ibrahim Maalouf überzeugt. »Als mich meine Mutter zur Welt brachte, wurde das Krankenhaus gerade bombardiert«, erzählt er. »Das prägt einen für immer.« Eigentlich wollte Maalouf als Kind Architekt werden, um die Trümmer seiner Heimatstadt Beirut, aus der er mit seinen Eltern nach Paris fliehen musste, wieder aufzubauen. Stattdessen versuchte der junge Exilant, sein musikalisches Erbe zu bewahren, und übte sich im Spagat der Kulturen: Er spielte Bachs »Brandenburgische Konzerte« ebenso wie traditionelle arabische Musik – auf einer mikrotonalen Trompete, die sein Vater Nassim in den Sechzigern entwickelt hatte. Sie half ihm, »beide Identitäten« in sich zu verbinden, wodurch er erst zu einer »menschlichen Brücke« werden konnte: »Ich glaube, dass alles miteinander verbunden ist, und an die Kraft der Musik, den Menschen zu helfen, einander zu verstehen, und so Frieden zu schaffen.«

ILLIA OVCHARENKO
Im selben Jahr, in dem Illia Ovcharenko mit dem ersten Platz beim HonensKlavierwettbewerb in Calgary den Grundstein für seine internationale Karriere legte, begann Russlands Angriffskrieg gegen sein Heimatland. »Anfangs hatte ich schlaflose Nächte und machte mir Sorgen um meine Familie, die noch im Norden der Ukraine lebt, und natürlich um mein geliebtes Land«, offenbart der 2001 in Tschernihiw geborene Pianist. Zwei Jahre später hat er vor allem einen Grund, auf den großen Bühnen der Welt aufzutreten: Er möchte seine Kultur repräsentieren. Er setzt die reiche und vielseitige Musik ukrainischer Komponisten wie Levko Revutsky und Valentin Silvestrov auf seine Programme, um sie einem breiten Publikum bekannt zu machen. »Die Musik ist meine Art, meine Stimme zu erheben und den Menschen in meinem Land zu zeigen, dass ich sie unterstütze –egal, wo sie sind, in der Ukraine oder vorübergehend außerhalb.«
»Das schreckliche Massaker in Israel am 7. Oktober letzten Jahres, der derzeitige Krieg, den mein kleines Land gegen die bösen Mächte führt, die versuchen, es zu zerstören, und die schockierenden Gefühle vieler Menschen, die nicht mit den Opfern, sondern mit den Verbrechern sympathisieren, geben mir mehr denn je das Gefühl, dass ich mit meiner Kunst mein leidgeprüftes jüdisches Volk repräsentiere«, sagt der Pianist Jewgenij Kissin, der als Angehöriger der jüdischen Minderheit in der Sowjetunion aufgewachsen ist und heute auch die britische und die israelische Staatsangehörigkeit besitzt. »Ich möchte jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, eine klare Botschaft vermitteln: Mein Volk steht für das Licht, während diejenigen, die versuchen, uns zu vernichten, für die Dunkelheit, den Obskurantismus und das Böse stehen, das sie über die gesamte westliche Zivilisation verbreiten wollen.«
WAED BOUHASSOUN
2010 verließ die syrische OudVirtuosin, Sängerin und Wissenschaftlerin Waed Bouhassoun ihre Heimat, um in Frankreich Musikethnologie zu studieren. Nur ein Jahr später hinderte sie der Ausbruch eines brutalen Bürgerkriegs daran, in die Stadt zurückzukehren, in der sie die vergangenen zehn Jahre verbracht hatte: Damaskus – »meine zweite Mutter, an die ich jede Sekunde denke«, wie die 45Jährige bekennt. In Paris lernte sie den Gambisten Jordi Savall und sein Ensemble Hesperion XXI kennen und fand damit eine »zweite Familie in Europa« sowie einen Ort, an dem sie ihre »Trauer musikalisch zum Ausdruck bringen und verarbeiten konnte«. Gemeinsam widmeten sie sich der reichen Tradition ihres Heimatlandes und hielten diese »Hommage an Syrien« auf einem Album fest. Denn seit Kriegsbeginn hat sich Bouhassoun zum Ziel gesetzt, mit ihrer Musik kulturelle Grenzen zu überwinden und »den Menschen in Europa zu zeigen, dass mein Land viel Schönes zu bieten hat.«

BAKR KHLEIFI
1991 in Jerusalem geboren, kennt der OudSpieler und Kontrabassist Bakr Khleifi nichts anderes als Krieg und Konflikt im Nahen Osten. Bereits mit zwölf Jahren trat er dem von Daniel Barenboim und Edward Said gegründeten West Eastern Divan Orchestra bei – ein Friedensprojekt, das zu gleichen Teilen aus israelischen und arabischen Musikern besteht. »Der Krieg treibt mich in der Regel weiter in die Musik«, erklärt der 32jährige Palästinenser, »denn sie ist eine Form des Menschseins.« Nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres wusste er: »Das Eintauchen in die Klänge ist das Beste, was ich tun kann, um mit der düsteren Realität fertig zu werden. Musik versetzt mich in einen anderen Seinszustand, der sehr therapeutisch ist und mir Energie geben kann – sie ist ein Akt der Hoffnung. Auch wenn sie das Problem äußerlich nicht löst, kann sie innerlich Trost spenden, was für mich genauso wichtig ist.«

Die Kuppel der Kathedrale von Etschmiadsin, dem religiösen Zentrum Armeniens


Armeniens Geschichte der letzten hundert Jahre ist wechselvoll und bitter: Seit dem Genozid von 1915 über die lange Ära der UdSSR bis hin zur Auseinandersetzung mit Aserbaidschan und jüngst der Flucht der Bevölkerung aus Bergkarabach ist das Land immer wieder der Willkür anderer Staaten ausgesetzt gewesen. Dem steht der einstige Stolz einer historischen Großmacht gegenüber, deren Territorium sich in der Antike vom Mittelmeer bis zum Kaspischen Meer erstreckte. Bis heute kündet davon eine jahrtausendealte Klangkultur, und aus diesem tiefen Brunnen schöpfen armenische Musikprojekte noch immer. Sowohl in den sakralen als auch in den weltlichen Aspekten zählen die tönenden Schätze der Kaukasusrepublik zu den faszinierendsten der Welt.
Welche Kultur kann schon von sich behaupten, sie wüsste, wie ihre Musik vor 1500 Jahren geklungen hat?
Die Beschäftigung damit ist wie eine Zeitreise: Noch vor Rom erhob Armenien bereits im Jahre 301 das Christentum zur Staatsreligion, und es verfügt über eine ungebrochene Kirchenmusiktradition vom Liturgiebegründer Mesrop Maschtoz (etwa 360–440) bis zu den Vertretern des 20. Jahrhunderts, allen voran der Mönch Komitas Vardapet (1869–1935). Er ist der Vater der modernen armenischen Musik, hat die Mehrstimmigkeit in die Kirchen
musik eingeführt, sammelte aber auch Volkslieder, die in Armenien mit der sakralen Musik gemeinsame Wurzeln haben. Sie reichen bis in vorchristliche Zeiten hinab, als noch der Sonnengott Vahagn verehrt wurde.
»Unsere sakralen Klänge sind Musik, die nicht von menschlicher Hand gemacht wurde«, schwärmt der in den USA lebende JazzPianist Tigran Hamasyan. Er ist nicht der Einzige seines Fachs, der dem Bann dieser Klänge erlegen ist. Auch Keith Jarrett, die Bratschistin Kim Kashkashian und das Hilliard Ensemble befassten sich schon mit armenischer Tonkunst. Hamasyan hat in seinem Projekt »Luys i Liso« mit einem Kammerchor die liturgische Musik Armeniens durch fünfzehn Jahrhunderte hindurch ausgekundschaftet. Diese Innenschau setzt sich auch in seinem Solospiel fort. Inspiration erhält er durch Reisen in seine alte Heimat: »Ich schaue aus dem Fenster und sehe den biblischen Berg Ararat mit ewigem Schnee auf dem Gipfel. Strommasten und Leitungsdrähte im Vordergrund zerschneiden das Bild, Satellitenschüsseln verschmelzen mit alten und modernen Häusern. Die altertümliche, gottgegebene Natur und unsere modernen menschlichen Errungenschaften treten in Dialog.«
TRADITION UND TRANSKRIPTION
Spiritualität ist in Armenien nicht nur kirchengebunden. Jeder dort kennt den Namen Georges Gurdjieff. Der Esoteriker griechischarmenischer Herkunft eröffnete 1922 sein »Institut zur Harmonischen Entwicklung des Menschen« in Fontainebleau bei Paris. Zuvor hatte er auf Reisen durch Armenien, aber auch durch Persien, Tibet, Indien, Griechenland und arabische Länder Musik und Tänze »gesammelt«, ohne sie zu notieren: Er bewahrte sie in seinem akustischen Gedächtnis. Seinem Schüler und Assistenten, dem russischen Pianisten Thomas de Hartmann, sang er später die memorierten Melodien vor – und der transkribierte sie. Bis vor kurzem erklangen sie nur in dieser Form in den Konzertsälen.
Das Gurdjieff Ensemble, Tigran Hamasyan: inspiriert von 1.500 Jahren Musikgeschichte ›


Und hier kommt Levon Eskenian, der Leiter des armenischen Gurdjieff Ensembles, ins Spiel. »Als ich das erste Mal die Klavierstücke von Gurdjieff und de Hartmann hörte, fühlte ich mich, als sei ich nach Hause gekommen! Solche Musik habe ich während meiner Kindheit gehört«, erinnert er sich. Mit akribischer Recherche und großem Einfühlungsvermögen führte er die Transkriptionen in eine Besetzung mit traditionellen Instrumenten zurück – so, wie sie Gurdjieff ursprünglich gehört haben könnte. Das Ergebnis ist bezwingend: Mit den Lang und Kurzhalslauten Saz, Tar und Oud, mit den Schalmeien Duduk (Armeniens Nationalinstrument) und Zurna, der Stachelgeige Kamantsche, der Schlüsselzither Kanun, verschiedenen Flöten und einer Vielzahl von Schlagwerk gespielt, klingt diese Musik tatsächlich wie aus einer anderen Zeit: erhaben, archaisch und wehmütig. Und Eskenian bestätigt diesen Charakter: »Es gibt etwas sehr Melancholisches unter den Armeniern, einen typischen Zustand des Nachsinnens.«
Die weltliche, bis heute mündlich überlieferte Musik der armenischen Barden, der Aschuk, befindet sich in Gurdjieffs Melodienfundus Seite an Seite mit der sakralen Sphäre. Die Scharakans, melismatische Gesänge aus der Liturgie, und die Taghs, Oden, die sowohl religiöse als auch weltliche Gesänge sein können, kommen aus einer uralten Überlieferungsschicht und wurden dann christianisiert. Eskenian ist es wichtig zu betonen, dass das Gurdjieff Ensemble keine Folkmusik spielt. Die Rückübertragungen von Gurdjieffs Sammlung auf das alte Instrumentarium werden von Musikern ausgeführt, die zwar aus der traditionellen Sphäre kommen, allesamt aber einen Hochschulabschluss in der Tasche haben. Das Quellwasser der alten Musik ist gleichsam zu einem akademischen Destillat geworden, das freilich nie steril tönt.
MELANCHOLIE UND SCHÖNHEIT
Irgendwo zwischen diesen Polen der weltlichen und sakralen Tradition, der Klassik und des Jazz steht der armenischamerikanische Komponist, Dirigent und Pianist John Hodian mit seinem Naghash Ensemble. Die Beschäftigung mit armenischen Klängen sieht er als Lebensaufgabe. »Für mich hat die armenische Kultur – bedingt durch die tragische Geschichte – immer eine etwas unheimliche Melancholie, die zugleich wunderschön ist«, sagt er. Hodian ist an der USOstküste aufgewachsen; eine intensive Bindung zum Land seiner Vorfahren hat er erst später aufgebaut. »In Amerika sagt man schon, wenn etwas 200 Jahre alt ist: ›Mein Gott, was für ein Erbe!‹ In Armenien aber sind Traditionen, die bis in vorchristliche Zeit zurückreichen, im Bewusstsein der Leute verankert.« Genau aus dieser Dualität bezieht seine Musik ihre Spannung. In Deutschland wurde Hodian zunächst durch das Epiphany Project bekannt: Mit der Sängerin Bet Williams bettete er armenische Wurzeln in eine jazzigfolkige Umgebung ein, die auch unverkennbare Elemente des American Folk in sich trug. Danach nahm er ein Großprojekt in Angriff, in dem er seine eigene Musik mit Texten des dich
»Für
mich hat die armenische Kultur immer eine etwas unheimliche Melancholie, die zugleich wunderschön ist.«
JOHN HODIAN
tenden Priesters Mkrtitsch Naghash (1394–1470) verbindet. Den Ausgangsimpuls erhielt er während eines Besuchs in der Heimat seiner Vorfahren: In einem Tempel bei Eriwan hörte er, wie ein Vokalquintett geistliche Musik des Mittelalters sang. Als er sich später in Naghashs Texte versenkte, verknüpften sich in seinem Kopf die Worte mit Musik aus jener Epoche – und er begann Arrangements zu entwerfen, die sich schließlich zu den »Songs of Exile« entwickelten.
Hodian gibt augenzwinkernd zu, er habe für die Vertonung der NaghashGedichte bei der alten Vokalmusik »gestohlen«. Wer nur leihe, so formulierte es schon Igor Strawinsky, bleibe schwach und oberflächlich; wer dagegen stehle, könne mit der Musik verschmelzen und Neues schaffen. 2010 stellte Hodian ein Ensemble zusammen, um die Musik aus seiner Vorstellung zum Tönen zu bringen. Lange, suitenartige Stücke sind das Resultat, geprägt von einer beglückenden Kombination aus einem weiblichen Vokaltrio und einer dreiköpfigen Instrumentalsektion. Harutyun Chkolyan spielt verschiedene Varianten der Duduk sowie die Flöte Shvi mit seelenvoller Hingabe; Aram Nikogosyan und Tigran Hoyhannisyan lassen virtuos Oud und DholTrommel erklingen. Hodian selbst füllt die musikalische Textur am Klavier mit donnernden Akkorden, repetitiven und fließenden Figuren. Er ist mit seiner grauen Mähne und dem Bart auch physisch eine Schöpfergestalt, gibt wuchtige Einsätze, dirigiert die Dynamik, indem er die Stücke geradezu zu »atmen« scheint, aus dem Moment heraus noch einmal kreiert.
Und dann ist da die sagenhafte Vokalabteilung: Die Sopranistin Hasmik Baghdasaryan besitzt leuchtende, kraftvolle Höhen; die unauffälligere Tatevik Movsesyan klettert souverän zwischen den Registern. Eine Ausnahmeerscheinung in jeder Hinsicht ist Arpine TerPetrosyan: Selten hört man einen Alt, der in solch geradezu maskuline Tiefen absteigen kann, dabei immer voll statt mühevoll klingt. Gemeinsam weben die drei eine Polyfonie wie aus einem Guss, ihre acappellaPassagen sind von betörend dichtem Melos. Klösterlicharchaischer Klang mischt sich mit den Reibungen der Hochrenaissance und poppigliedhafter Einfachheit. Hodian hat die Gedichte fast als Gespräch vertont, die Bestandteile der Verse teilen sich spielerisch zwischen den Stimmen auf. Und einen besonders schönen Effekt hat es, wenn der bauchige Klang der Duduk unmerklich mit dem AltRegister verschmilzt.







Ein sagenhaftes Vokaltrio, drei virtuose Instrumentalisten und John Hodian am Klavier: das Naghash Ensemble

Zentral für die Poesie des Priesters Mkrtitsch Naghash und für die »Songs of Exile« ist die Figur des Gharib –eines Wanderers, der in der Fremde leben muss. Diese Figur ist auch autobiografisch: In Diyarbakır zog sich Naghash den Zorn der muslimischen Autoritäten zu, indem er sein christliches Kloster so prächtig renovierte, dass es alle Moscheen überstrahlte. Er wurde ganz buchstäblich in die Wüste geschickt und starb dort. Sein Vermächtnis sind fünfzehn lange Gedichte, die von einer unauflöslichen Spannung leben: hier die Dummheit und Gier der Menschen, dort das euphorische Erwarten der göttlichen Sphäre – und dazwischen Ratschläge für ein besseres irdisches Dasein, um die Seele für das Leben nach dem Tod zu rüsten.
Man muss für den Hörgenuss die armenischen Texte zwar nicht verstehen, doch die Übersetzung kann innere Bilder unterstützen: etwa, um ein melancholisches DudukIntro besser zu deuten, wenn es um Versäumnisse im irdischen Leben geht. Oder um die einsame Wanderung
des Exilanten in einem Sopransolo über dem OudTremolo nachzuvollziehen, und an anderer Stelle die Unruhe, die der Teufel stiftet, in den gehämmerten Begleitfiguren zu erkennen. Am Ende bleibt der Eindruck einer beinahe höfischedlen Musik, die nicht distanziert, sondern immer leuchtend und warm wirkt. Und die den geistigen Horizont der uralten armenischen Musik mit einem zeitgenössischem Puls verbindet.
NAGHASH ENSEMBLE
Di, 14.5.2024 | 19:30 Uhr Elbphilharmonie Kleiner Saal the Naghash ensemble armenia »songs of exile – Lieder aus der Verbannung«


Diese Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um das Personal und die Finanzen in der Elbphilharmonie. Ihre Arbeit ist die Basis für alles andere.
VON FRÄNZ KREMER FOTOS GESCHE JÄGER

Die Elbphilharmonie mag eines der außergewöhnlichsten Gebäude Hamburgs sein, einmalig, mit keinem anderen zu vergleichen. Doch ihr Fundament ist das gleiche wie bei vielen anderen Gebäuden in der Hafencity: Sie ruht auf massiven Pfählen, fest verankert im Boden, grundsolide, durch nichts zu erschüttern. So ähnlich ist das auch innerhalb des Unternehmens Elbphilharmonie: Hier gibt es die Abteilungen, die künstlerisch Einzigartiges planen und betreuen, Projekte, die nach außen hin strahlen, die es so nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Und dann gibt es die eine Abteilung, die den ganzen Laden zusammenhält und für ein sicheres Fundament sorgt. Willkommen im Personal und Rechnungswesen!
CAROLA BLUCK UND SANDRA BOUCHEKIR
»Ja, im Kern machen wir hier klassische Buchhaltung«, sagt Carola Bluck. Sie lehnt an der Tür ihres Büros, hinter ihr ein übergroßer Computermonitor und ein überraschend kleines, graues Aktenschränkchen. »Aber Buchhaltung ist gar nicht mal so unspannend in einem Haus wie diesem«, lacht sie. »Auf jeden Fall ist es etwas Besonderes, dass wir wirklich mit jeder anderen Abteilung in der Elbphilharmonie in ständigem Austausch sind und bei uns viele große Stränge zusammenlaufen.«
Bluck hat in ihrem Leben schon in unterschiedlichsten Branchen gearbeitet, hat Bilanzbuchhaltung in Großunternehmen gemacht, war in der Modeindustrie: »Bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das Rechnungswesen eben überall gleich«, sagt sie. »Als Buchhalterin

kann man auch in einer Erbsendosenfabrik arbeiten. Oder in einem Kieswerk.« Aber gefühlt mache es eben doch einen Unterschied. »In meiner Studienzeit habe ich die Buchhaltung für den Mojo Club auf der Reeperbahn gemacht. Als ich dann 2019 das Stellenangebot in der Elbphilharmonie gesehen habe, war ich sofort begeistert. Weil sich für mich mit der Rückkehr in die Kultur ein Kreis schloss.«
Direkt gegenüber von Blucks Büro sitzt ihre Kollegin Sandra Bouchekir und nickt zustimmend: »Für mich kommt auch nichts anderes in Frage als die Kulturbranche.« Ganze 38 Jahre hat Bouchekir am Deutschen Schauspielhaus gearbeitet, hat dort auch das Rechnungswesen geleitet, bevor sie im Sommer 2023 zur Elbphilharmonie wechselte. »Kultur ist meiner Meinung nach einfach so wichtig, ja auch systemrelevant. Selbst in diesem Bereich zu arbeiten, speziell jetzt hier in der Elbphilharmonie, das ist ein echtes Privileg.«
Besonders gereizt hat Bouchekir, in der Elbphilharmonie nochmal Teil eines größeren Teams zu sein. Sie ist hier als Teamleiterin Ansprechpartnerin für ihre Kolleg innen in der Buchhaltung. »Aber auch für den Rest des Unternehmens verstehen wir uns in gewisser ›

Seit der Eröffnung wuchs das Team der Elbphilharmonie von 134 auf aktuell 247 Personen. Da muss auch die Personalabteilung wachsen, logisch.

Weise als Dienstleistungsabteilung, an die man sich mit fachlichen Fragen wenden kann. Denn vieles ist im Detail eben doch kompliziert, es gibt immer wieder Ausnahmen von den Ausnahmen.«
Die Komplexität beginnt schon bei der Firmenstruktur. Denn eigentlich arbeitet die Buchhaltung für drei Unternehmen: die HamburgMusik gGmbH, die Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft mbH, kurz ELBG, sowie die Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. »Die HamburgMusik ist der hausinterne Veranstalter, der eigene Konzerte und Veranstaltungen plant und durchführt«, erklärt Bouchekir. »Die ELBG hingegen betreibt die Gebäude und vermietet die Säle samt verschiedensten Services an Fremdveranstalter, aber eben auch an die HamburgMusik selbst. Alles, was an Veranstaltungen stattfindet, läuft einmal durch die ELBG.« Es gibt also jede Menge hausinterne Rechnungen und Zahlungen.
Die Bau KG schließlich ist für das »Facility Management« der Elbphilharmonie zuständig, kümmert sich um die Instandhaltung des Gebäudes und verpachtet Teilbereiche an die Betreiber des Hotels, des Parkhauses und des Restaurants. »Bei allem, was wir machen, ist daher als Erstes immer entscheidend, in welcher Firma wir uns gerade befinden«, so Bouchekir.
Was nach außen hin nicht zwangsläufig sichtbar ist, muss in der Buchhaltung streng getrennt werden: »Die einen Kolleginnen bei uns im Team kümmern sich um die HamburgMusik, die anderen um die ELBG und die Bau KG«, so Bluck. »Da gibt es viele Unterschiede: Die HamburgMusik hat als gemeinnützige Gesellschaft zum Beispiel andere Steuersätze, und man hat es hier in der Buchhaltung mit teils kleinteilig geregelten Künstlerverträgen und honoraren zu tun. In der ELBG wiederum gibt es mehr Vermietungsrechnungen, auf denen dann die unterschiedlichen Posten enthalten sind, von der Technik über den Kartenvertrieb bis zur Blumendeko. Alles ist vielleicht etwas stärker standardisiert, dafür ist das Volumen größer.«
Insgesamt sei es schon ziemlich einmalig, was unter dem Dach der Elbphilharmonie zusammenläuft, auch buchhalterisch: »Die Elbphilharmonie ist eben nicht nur ein Konzertsaal, sondern auch eine Sehenswürdigkeit, es gibt die Plaza, Hausführungen, einen Shop mit klassischem Warengeschäft, eine Gastronomie, wir sind Vorverkaufsstelle, machen Vermietungen, Konzerte, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Andere Unternehmen sind oft nur in einem dieser Geschäftsfelder aktiv, wir

machen alles gleichzeitig«, sagt Bluck. Neben dem Tagesgeschäft kümmert sie sich als stellvertretende Abteilungsleiterin auch um Bilanzen. Und sie fertigt Berichte für die unterschiedlichsten Stellen an: vom Nachhaltigkeitsbericht bis zum Bericht für die Kulturbehörde oder für das Statistische Landesamt.
Als Bouchekir im Sommer 2023 anfing, habe sie durchaus einige Wochen gebraucht, um sich in die vielen Themen einzuarbeiten, gesteht sie. »Das Konstrukt ist komplex, und entsprechend sind es auch die Programme, die wir nutzen, um effizient zwischen den Abteilungen zusammenzuarbeiten.« Eines sei im Gegensatz zu den vielen Systemen, Regelungen und Zahlen aber von Beginn an leicht gewesen: »Das Miteinander im Team fand ich wirklich einmalig, als ich hier ankam. Alle sind nett, begeistert, hilfsbereit. Schon ein sehr gutes Team.«
STEFAN GELDER
Würde Stefan Gelder diese Einschätzung am anderen Ende des Flurs hören, sie wäre sicher Musik in seinen Ohren. Schließlich hat er als Mitarbeiter der Personalabteilung eine ganze Reihe dieser angesprochenen Kolleginnen und Kollegen schon bei ihren jeweiligen Vorstellungsgesprächen kennengelernt – und sich mit dafür ausgesprochen, dass sie eingestellt werden sollen. Mitgezählt hat er die Vorstellungsgespräche, die er in der Elbphilharmonie geführt hat, nicht. »Aber über hundert waren es sicherlich«, meint er. Die Neueinstellungen seien auf jeden Fall das Spannendste an seinem Job: »Es beginnt mit der Ausschreibung, die wir zusammen mit den Fachabteilungen aufsetzen und an verschiedenen Stellen veröffentlichen. Dann sichten wir die Bewerbungen. Am Ende ist immer jemand aus der Personalabteilung beim Gespräch dabei, entweder eine meiner Kolleginnen oder ich.« So erlebt Gelder die verschiedenen Stadien mit: »Vom Namen aus dem Bewerbungsschreiben zur echten Person ist es schon ein spannender Schritt. Aber wenn man dann die Person ein Jahr später im Unternehmen trifft, sie ihre Probezeit bestanden hat und man merkt, dass man genau den
oder die Richtige eingestellt hat – das ist das schönste Gefühl.«
Das Team der Elbphilharmonie und Laeiszhalle hat seit seinem Bestehen eine außergewöhnliche Wachstumskurve hingelegt. Ähnelte man während der Bauphase lange Jahre einem kleinen StartupUnternehmen mit sehr übersichtlichem Team, so waren zur Eröffnung im Januar 2017 schon 134 Personen an Bord. Anderthalb Jahre später, im Juni 2018, als Gelder anfing, umfasste das Team 182 Personen, Tendenz steigend. »So kam ich zu meinem Job, denn wenn das Team wächst, muss auch die Personalabteilung größer werden, um alles zu bearbeiten, logisch.« Heute arbeiten an den beiden Standorten Elbphilharmonie und Laeiszhalle 247 Personen.
Irgendwie sei die Stimmung aber doch familiär geblieben. »Als ich 2018 anfing, war ich sofort begeistert, dass alle sich geduzt haben. Das kannte ich aus meinen vorherigen Unternehmen anders – und es macht einfach einen großen Unterschied«, sagt Gelder. Nicht zuletzt sei es natürlich die Begeisterung für Musik, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander verbindet. »Das ist das Schöne, und das sagen wir auch immer in den Gesprächen: dass hier nicht nur eine Musikrichtung angeboten wird. Sondern dass für viele musikalische Geschmäcker etwas dabei ist.«
Gelder etwa hat sich beim großen Neujahrskonzert mit Jacques Offenbachs Operette »Orpheus in der Unterwelt« bestens amüsiert. Besonders reizvoll findet er es aber auch, regelmäßig die Spielstätten zu wechseln. »Die Laeiszhalle ist ein so charmantes Gebäude, sowohl von außen als auch von innen. Und sie gehört ja auch zu unseren Spielstätten. Ich finde es wichtig, das immer wieder zu betonen. So wie wir in unserem Team ganz unterschiedliche Charaktere haben, so haben wir auch nach außen mit diesen zwei Gebäuden verschiedene Facetten. Und das ist so wertvoll.«
M MEHR AUS DEM TEAM DER ELBPHILHARMONIE FINDEN SIE UNTER WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK






In Maria Bostelmanns Familie wurde nie schlecht über ihren Urgroßvater gesprochen. Bis herauskam, welche Verbrechen er im Namen der Nazis verübt hat. Jetzt erzählt sie seine Geschichte, die zu ihrer gehört, oft und laut.
VON STEPHAN BARTELS
FOTOS BETTINA THEUERKAUF
Da also ist es passiert. An diesen beiden Heizungsrohren, die unter der Decke durch den Keller laufen, hat man sie aufgehängt, die zwanzig Kinder vom Bullenhuser Damm. Die Wand strahlt heute weiß im leeren Kellerraum, der Tod hat ein nüchternes Gewand in Rothenburgsort. Doch sein Nachhall nicht. Maria Bostelmann war schon oft hier, es trifft sie jedes Mal mit Wucht. Sie kennt die Namen der Kinder auswendig, die genau hier vor beinah achtzig Jahren ermordet wurden. Marek James. Lelka Birnbaum. Ruchla Zylberberg. Sergio de Simone. Sechs Jahre alt am 20. April 1945, zwölf, acht, sieben. Es berührt sie immer, wenn sie über die Kinder redet. Wenn sie durch den Keller geht, in dem sie gestorben sind, mit Morphium betäubt, an Seilen über einem Heizungsrohr aufgeknüpft, zu Tode gebracht durch SSMänner, die sich mit vollem Gewicht an die kleinen Körper hängten, bis kein Leben mehr in ihnen war. Es ist ein schwerer Ort. Und einer, der mit Maria Bostelmann verknüpft ist. Denn einer dieser SSMänner, einer dieser Mörder, war Wilhelm Dreimann. Ihr Urgroßvater. Ihre Oma hatte von ihm erzählt, daheim in Hiddesen, einem Stadtteil von Detmold. Was für ein toller Papa das gewesen sei, so liebevoll, wie eine Prinzessin habe er sie behandelt. »Dass er im Krieg geblieben sei, das hat sie mir oft erzählt«, sagt Bostelmann, »aber einmal war auch ein anderer Satz
dabei: ›Die Engländer haben ihn an die Wand gestellt.‹ Das hat mich irritiert.« Nachfragen gab es nicht, denn Hannelore Holzgrewe, Marias Oma, hatte noch einen anderen Satz im Repertoire: schweig stille. »Den kenne ich, den kennt auch mein Vater sehr gut«, sagt Bostelmann, »es wurde sehr viel still geschwiegen in der Familie.«
Ihr Vater hat das Schweigen durchbrochen. Gegen Ende der Nullerjahre saß das Ehepaar Peter und Brigitte Holzgrewe zusammen auf dem Sofa. Marias Mutter ist fasziniert von Ahnenforschung, das Internet ist eine Fundgrube für sie, und an diesem Abend sagte sie zu ihrem Mann: »Guck doch auch mal. Nach deinen Großeltern zum Beispiel.« Er gab den Namen seines Opas in die Suchmaschine ein, Wilhelm Dreimann. Sofort ploppten Sachen auf, von denen er nichts wusste. SSMann. Rapportführer im Konzentrationslager Neuengamme. Beteiligt an der Ermordung von zwanzig Kindern am Bullenhuser Damm in Hamburg, Tage vor dem Ende des Krieges. Ein Schläger, ein Sadist, ein Menschenquäler. Verurteilt und hingerichtet durch den Strang, als der Krieg, in dem er angeblich geblieben war, schon fast eineinhalb Jahre vorbei war.
Peter Holzgrewe war schockiert. Zwei Jahre lang trugen er und seine Frau alles zusammen, was sie finden konnten. Setzten sich mit der Gedenkstätte für das KZ Neuengamme
in Verbindung. Lasen »Der SSArzt und die Kinder vom Bullenhuser Damm« des »Stern«Journalisten Günther Schwarberg, der den Fall 1979 recherchiert hatte. Dann weihten sie ihre Tochter ein. Das war 2011. Sie war damals Anfang 20. »Es hat mich umgehauen«, sagt sie, »ich dachte immer, wir seien eine ganz normale Familie aus OstwestfalenLippe.« Sie stutzt kurz, immer noch im Keller am Bullenhuser Damm. »Aber vielleicht sind wir das ja auch.« Denn schweigen über die Nazizeit, das war die Werkseinstellung in deutschen Familien nach 1945. Peter Holzgrewe, Marias Vater, hat auch seine Mutter mit der Geschichte konfrontiert. Sie sagte zu den Vorwürfen nicht viel, nicht zu denen gegen Dreimann, nicht zu denen an sie wegen ihrer lebenslangen Unfähigkeit, darüber zu sprechen. Auch Maria hat mit ihr darüber reden wollen. »Ein Satz, den sie damals gesagt hat, ist mir krass im Gedächtnis geblieben«, sagt sie. »Der ging so: ›Maria, weißt du, vielleicht war er ein Mörder – aber er war auch mein Vater.‹« Das, sagt Maria Bostelmann, »war das erste und einzige Eingeständnis der Schuld ihres Vaters, abgemildert durch ein ›vielleicht‹«.
WER
Das Gebäude am Bullenhuser Damm war eine Schule, bevor die Stadt Hamburg es der SS als Außenlager des KZ Neuengamme zur Verfügung stellte. Nach dem Krieg wurde es Seewetterwarte, dann wieder Schule –bis 1989, als dem Industriestadtteil Rothenburgsort die schulpflichtigen Kinder ausgingen. 1999 wurde das Haus zur Gedenkstätte erklärt, 2011 die Ausstellung im Keller erweitert. Die Geschichte jedes Kindes wird erzählt, jede in einer Art Koffer. »Die Bilder haben die Familien ausgesucht«, sagt Bostelmann, »ich finde das schön – die Angehörigen durften selbst zeigen, wer diese Kinder waren.« Aber es gibt auch andere Informationstafeln hier. Über das KZ Neuengamme, über die medizinischen Versuche an den Kindern. Und über die Täter.
»Da ist er«, sagt Maria Bostelmann und schaut hinab auf das Bild eines Mannes in einer Uniform der WaffenSS, »Dreimann«. Sie hat verschiedene Namen ausprobiert. Uropa, das kommt ihr nicht über die Lippen. Willi auch nicht, zu nah, zu menschlich. Wilhelm geht gerade noch so an, aber »Dreimann« in all seiner Distanziertheit ist ihr am liebsten. Als sie 2011 von ihm erfahren hatte, war er ein Monster für sie, nichts Menschliches haftete für sie an ihm. Sie wollte verstehen, wie einer so werden kann, »darin liegt der Schlüssel für alles«, sagt Maria Bostelmann. Aber es war zu Anfang eine Suche wie mit einem ausgestreckten, abwehrbereiten Arm: Komm mir bloß nicht zu nah. Als sie wieder einmal hier im Keller der Geschichte nachspürte, hörte sie, wie eine polnische Verwandte eines der Kinder zu jemandem sagte: Der hatte eine Tochter im selben Alter. »Da wusste ich: Die redet von meiner Oma«, sagt Bostelmann. »Ich musste erstmal raus.«
Seine Lebensdaten stehen da. 1904 bis 1946. Geboren in Osdorf, damals bei, heute in Hamburg. Er war Holzbildhauer in Detmold, bewarb sich 1939 bei der Landespolizei. Wurde 1940 nach Neuengamme geschickt, als KZAufseher, gegen seinen Willen, so steht es da. War erst Aufseher, dann Barackenführer, im letzten Jahr Rapportführer, man könnte sagen: die Nummer zwei nach dem Lagerkommandanten. Das sagt noch nicht viel darüber, was für ein Mensch er war. Seine Taten tun es. Sein Verhalten gegenüber den Häftlingen im KZ. 1946 wurde ihm im Curiohaus der Prozess gemacht, vor einem britischen Militärgericht. Ein Häftling aus Neuengamme wurde zu Dreimann befragt. Hans Schwarz berichtete von dessen Gewalttätigkeit: Eine »ausgesprochen pathologische Erscheinung« sei er gewesen, »er machte sich eine Hauptfreude daraus, Häftlinge bei irgendwelchen Verfehlungen zu überraschen«. Dann nahm er sie mit in seine Blockführerstube. Schlug sie mit einem Stock oder einer Hundepeitsche so, »dass durch ihr
Schreien ein großer Teil des Lagers davon Kenntnis erhielt«. Keine Hinrichtung, bei der der Rapportführer nicht aktiv mitwirkte. Kein Tag, an dem er nicht schlug. »Daran stieß sich auch keiner mehr«, sagte Schwarz vor Gericht, »Dreimann war eben ein Faktum, an das man sich gewöhnt hatte.«
Das ist einer der Sätze, die Maria Bostelmann nicht aus dem Kopf gehen. Ein Faktum. Die Blockführerstube, »die war da«, sagt sie und zeigt auf einen Glaskasten am Eingang der Gedenkstätte in Neuengamme, knapp 25 Kilometer südöstlich vom Bullenhuser Damm. Hier war die Hauptwirkungsstätte von Wilhelm Dreimann, gleich neben dem Eingang, keine zehn Meter entfernt von der Krankenbaracke, in der auch die Kinder untergebracht waren. Der Glaskasten ist leer bis auf eine Infotafel, die Baracken sind nur noch als kniehohe Umrisse zu erkennen, angefüllt mit Schutt und Steinen. Auch hier war Bostelmann schon oft, zur Recherche, zum Verstehen, für Podiumsdiskussionen. »Allein wenn man die Dimensionen sieht, diese schiere Größe … Das ist so krank«, sagt sie.
ÜBERRASCHUNG IM ARCHIV
Die Verwaltungsbauten stehen noch, lange, dunkelrote Backsteinquader. Oben im ersten Stock ist das Archiv, da gibt es dicke Aktenordner zu Wilhelm Dreimann. Sie hat sie gewälzt bei ihren Besuchen hier. Hat Kopien gezogen von den Vernehmungen bei seinem Prozess im Frühjahr 1946. Hat die Lücken geschlossen über die Kinder. Die sind im November 1944 vom Lagerarzt angefordert worden. Dr. Kurt Heissmeyer hatte im KZ Neuengamme Menschenversuche mit TBCErregern durchgeführt, allerdings zu wenige mit Kindern, fand er. Er forderte welche aus Auschwitz an, Josef Mengele persönlich wählte sie aus und schickte sie in einem Sonderwaggon mit der Bahn nach Hamburg. Als im April 1945 auch dem letzten Nazi dämmerte, dass der Krieg verloren war, ging man mit deutscher
Gründlichkeit an die Spurenbeseitigung. Das Lager wurde geräumt, die Häftlinge auf die Todesmärsche Richtung Ostsee geschickt. Kein Insasse der KZ sollte den Engländern in die Hände fallen, auch nicht die zwanzig Kinder aus Auschwitz. Sie wurden am Abend des 20. April von Wilhelm Dreimann auf einen Lastwagen verfrachtet und nach Hamburg gebracht. Der Rest ist Geschichte. Und die kam bei den CuriohausProzessen ans Licht. Der juristische Berater des britischen Militärgerichts sagte damals: »Von allen dunklen und grausamen Geschehnissen in der Geschichte der Konzentrationslager war der Tod der Kinder in diesem Keller eines der grausamsten.«
Als Dreimann am 19. Mai 1945 in Rendsburg verhaftet wurde, hielt er das alles für einen Irrtum. Wie konnte man ihm vorwerfen, seinen Job gemacht zu haben? Er rechnete mit Freispruch. Sagte vor Gericht, er habe die Kinder nicht aufgehängt, »weil es meine innere Überzeugung war, es nicht zu tun. Eine solche Tat habe ich nie getan und ich finde es gemein, mich in dieser Weise zu beschuldigen.« Johann Frahm, ein ihm unterstellter Soldat, sagte bei seinem Prozess aus: Mindestens die ersten beiden Kinder habe Dreimann persönlich getötet.
Im Archiv ist auch Familiengeschichte dokumentiert. Marias Vater ist hier auf einen Onkel gestoßen, von dem niemand wusste. Oder besser: Von dem niemand erzählt hatte. Anfang des Jahrtausends hat ein gewisser Peter Tulius die Gedenkstätte angeschrieben. Er habe erfahren, dass er der Sohn von Wilhelm Dreimann sei. Seine Mutter Karla sei Büroangestellte im KZ Neuengamme gewesen, sie und Dreimann hätten sich verliebt, er selbst sei im Oktober 1945 geboren worden. Und nun sei er auf der Suche nach seiner Halbschwester – er habe Leukämie, seine Enkelin auch, und er versuche verzweifelt, Kontakt zu leiblichen Verwandten herzustellen in der Hoffnung auf einen passenden Knochenmarksspender. Die Gedenkstätte
leitete das Gesuch an die eigentliche Adressatin weiter. Hannelore Holzgrewe hat auf ihre Art darauf reagiert. Sie habe keinen Vater, somit auch keinen Halbbruder, das alles sei für sie lange vorbei und abgehakt, sie wünsche »nie wieder von Ihnen darauf angesprochen zu werden«, das »nie« doppelt unterstrichen. »P.S.: Ihren Brief vom 21.08.2003 werde ich selbstverständlich vernichten.«
Peter Holzgrewe hat die Sache anders gesehen. Als er von seinem Onkel erfuhr, hat er Kontakt zu ihm aufgenommen. Peter Tulius hatte seinen Blutkrebs überlebt, auch ohne die Hilfe seiner Schwester. Seine Enkelin nicht. Er kam trotzdem nach Detmold zu einem Familientreffen, ein freundlicher, zugewandter, vorwurfsfreier Mann. Auch Marias Oma mochte ihn. »Und der sieht ihr total ähnlich«, sagt Bostelmann. »Es ist schon irre.«
DAS MONSTER WIRD ZUM MENSCHEN
Maria ist Lehrerin, sie ist 2015 nach Hamburg gekommen, um an der Klosterschule zu arbeiten, eine Lehranstalt mit einem Theaterschwerpunkt. Sie zog nach Kirchwerder, nur ein paar Kilometer entfernt vom KZ Neuengamme. Und begegnete den Kindern vom Bullenhuser Damm wieder: Es gab an der Schule eine AG, die sich mit ihnen beschäftigte. Sie betrat den Raum – und blickte direkt in das auf eine Wand projizierte Gesicht von Wilhelm Dreimann. Drehte sich um, ging hinaus, verdrängte den Vorfall. Aber einige Zeit später bekam sie über den Schulverteiler eine Mail. Am 20. April würde vor der schuleigenen Gedenkstätte der ermordeten Kinder gedacht, wer mag, möge doch eine gelbe Rose mitbringen. Maria war wie vor den Kopf geschlagen. Sie war schon oft an der Gedenktafel am Schuleingang vorbeigegangen, »aber wie oft guckt man sich Gedenktafeln
an? Gar nicht«, sagt sie. Das holte sie nun nach. Sie schrieb ihrem Schulleiter: Ich glaube, wir müssen mal reden. Und stand dann vor diesem Ruben Herzberg. Er hörte ihr zu. Und dann erzählte ihr dieser Mann von Mitte sechzig seine Geschichte, die Geschichte eines Kindes von geflüchteten Juden. Danach nahm er seine erschütterte Nachwuchslehrkraft in den Arm. Und sagte: Wenn ihr Urgroßvater wüsste, dass sie jetzt an einer Schule mit hohem Migrationsanteil arbeite und gerade ihren jüdischen Schulleiter umarme –er würde sich im Grab umdrehen. »Und ich dachte nur: ja, geil«, sagt sie, »was für ein unglaublicher Zufall.« Jetzt blättert sie wieder in den Akten Dreimanns. Da steht, dass er seinen unehelichen Sohn annehmen wollte. Dass er dessen Mutter Karla wirklich geliebt hat, genau wie seine Frau Lisbeth und seine Tochter daheim in Detmold. Dass er das Lisbeth genau so gesagt hat. Dass diese Lisbeth Kontakt mit Karla hatte. Da ist ihr Brief an seine Affäre vom November 1946: »Es ist doch gar nicht der Wille meines geliebten und nun für immer schlafenden Gatten, dass wir Frauen wieder auseinander gingen.« Um ein Bildchen vom Jungen bat sie die andere, »auch Ihr Kind hängt mir an.« Es folgte nichts daraus. Der Kontakt brach ab. Peter Tulius lernte seine große Schwester erst siebzig Jahre später kennen.
Da sind Gnadengesuche abgeheftet. Von seiner Frau, vom Pastor seines Heimatortes, seinen Eltern, seinen Geschwistern, von alten Freunden. Dreimann, schrieben sie, habe sich nie politisch betätigt. Treusorgender Ehemann. Sein Kind sein Alles. Beliebt, immer hilfsbereit. Zur SS gezwungen. Judenverfolgung nie verstanden, ja als guter Christ abgelehnt. Taten nur auf Befehl und unter Einfluss des unseligen Krieges denk
»Hier stehst du schweigend, doch wenn du dich wendest, schweige nicht.«
bar, eigentlich aber gar nicht. Alles ein Irrtum. Todesstrafe zu hart. Aber Gnade gab es nicht. Wilhelm Dreimann wurde am 8. Oktober 1946 in Hameln gehängt und neben der Haftanstalt verscharrt.
Maria findet jedes Mal etwas Neues in den Akten. Heute die Mitteilung, dass Lisbeth Dreimann keine Kriegswitwenrente erhalten würde. »Gut so«, sagt Maria, »denn das rührt ja auch an die Frage: Wie bin ich eigentlich groß geworden, was hat unseren Wohlstand in der Familie ausgemacht?« Und dann sieht sie einen Brief Dreimanns an Karla aus dem Frühjahr 1944: sie in einem Müttergenesungsheim in Thüringen nach einer Fehlgeburt, er der zärtliche, tröstende Mann, der fest an ihrer Seite steht. »Krass«, sagt Bostelmann. »Der hatte ja vor Peter schon ein Kind mit ihr gezeugt. Hab ich noch nicht gewusst.«
Jede Information könne ihr helfen, den SSMann zusammenzubringen mit dem netten Typen von nebenan. »Je mehr ich erfahre, je menschlicher er wird, desto besser ist es für mich«, sagt Bostelmann. »Dass auch so einer ganz normale Gefühle hatte – das zeigt doch nur, dass so etwas in ganz vielen von uns stecken kann.« Sie fährt mit den Fingern über die offene Seite im Aktendeckel. »Aber das ändert nichts daran, dass er für mich ein sadistisches Arschloch ist.«
Vorhin, in Rothenburgsort, stand sie nach dem Besuch im Keller draußen in der nassen Kälte. Hinter Schulhof und Spielplatz liegt der Rosengarten, der für die toten Kinder 1986 angelegt wurde. Auf der Großmannstraße nebenan rauschen Laster an der Mauer vorbei, »das war schon damals so. Es ist ein zufälliger Ort, eine zufällige Schule, ein zufälliger Keller an einer zufälligen Straße«, sagt Maria Bostelmann. »Das ist wirklich der Inbegriff der Banalität des Bösen.«
Der Frühling braucht noch ein bisschen. Kahle Rosensträucher in brauner Erde, aber bald wird es blühen. »Das ist belebt hier, da sind immer Menschen, das ist so gut«, sagt
sie. An der Wand Gedenktafeln: alle von Verwandten, alle persönlich. »Hij was niet lang mijn vader«, schreibt Thea Deutekom auf einer Tafel. Ach ja, es sind nicht nur Kinder ermordet worden in dieser Nacht am Bullenhuser Damm. Auch die vier Betreuer der Kinder, alle selbst KZInsassen. Wie der Niederländer Dirk Deutekom, der nicht lange Theas Vater war. Und 23 sowjetische Gefangene. In der Mitte der Wand eine große Tafel: »Hier stehst du schweigend, doch wenn du dich wendest, schweige nicht«.
»Hier stehen auch Rosen von uns«, sagt Maria Bostelmann. 2014 war sie zum ersten Mal hier, mit ihren Eltern, bei der jährlichen Gedenkveranstaltung am 20. April. Sie standen zwischen den Schwestern, Brüdern, Cousinen, Neffen und Nichten der ermordeten Kinder. Und schwiegen stille. Sie trauten sich nicht, sich zu erkennen zu geben. Mittlerweile geht das, es macht Bostelmann nichts mehr aus, zu sagen, dass ihr Verwandter einer der Täter war. Ein wichtiger Baustein des Judentums ist: Vergeben, aber nicht vergessen. Sie vergisst nicht.
Das Wissen um Wilhelm Dreimann hat die Familie verändert.
»Mein Vater hatte immer Fragen«, sagt Maria Bostelmann, »es hat ihn bestätigt in dem Verdacht, dass er in einer Lüge aufgewachsen ist. Und es hat ihn von seiner Mutter entfernt. Nah dran an ihr war er allerdings noch nie«. Auch ihre Sicht auf ihren Vater hat sich, na ja: zumindest geschärft. »Ich bin so stolz auf meinen klugen, sich von all dem emanzipierenden Vater«, sagt sie. Er hat seinen Frieden gemacht mit der Geschichte. Und sie? »Ich war auf unendlich vielen Podiumsdiskussionen in Neuengamme, ich habe Wissen über Konzentrationslager und die Nazis angehäuft«, sagt sie. »Und ich kann für mich sagen: Ich habe wirklich, wirklich verstanden, was diese Zeit bedeutet hat. Wie sie passieren konnte. Und dass sie nie wieder passieren darf.« Dreimann hat es geschafft, dass Maria Bostelmann heute vor Leuten wie ihm warnen kann. »Das«, sagt sie, »ist mein Frieden.«



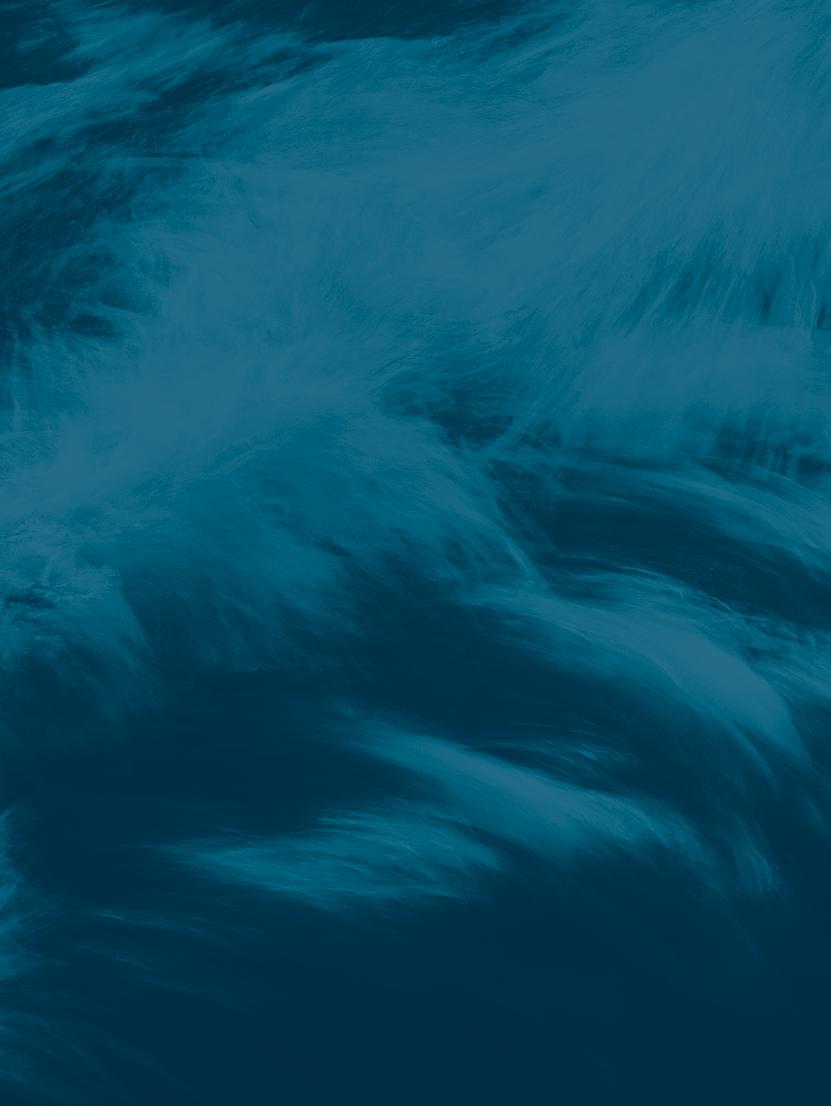
Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die Elbphilharmonie als Konzerthaus von Weltrang begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe im internationalen Konzertbetrieb setzen.
D e R sti F tu N g e LBP hi L ha RMON ie

MÄZENE
ZUWENDUNGEN AB 1.000.000 EURO
Prof. Dr. Dr. h. c. helmut und Prof. Dr. h. c. hannelore greve
Prof. Dr. Michael Otto und christl Otto hermann Reemtsma stiftung
christine und klaus-Michael kühne körber-stiftung
Peter Möhrle stiftung
Familie Dr. karin Fischer
Reederei claus-Peter Offen (gmbh & co.) kg stiftung Maritim hermann & Milena ebel hans-Otto und engelke schümann stiftung christiane und klaus e Oldendorff
Prof. Dr. ernst und Nataly Langner
PLATIN
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO
ian und Barbara karan-stiftung
gebr. heinemann se & co. kg
Bernhard schulte gmbh & co. kg
Deutsche Bank ag
M. M. Warburg & cO
hamburg commercial Bank ag
Lilli Driese
J. J. ganzer stiftung
claus und annegret Budelmann
Berenberg – Privatbankiers seit 1590
Mara und holger cassens stiftung christa und albert Büll christine und heinz Lehmann
Frank und sigrid Blochmann else schnabel edel Music + Books
Dr. Markus Warncke
Berit und Rainer Baumgarten christoph Lohfert stiftung eggert Voscherau
hellmut und kim-eva Wempe günter und Lieselotte Powalla
Martha Pulvermacher stiftung
heide + günther Voigt gabriele und Peter schwartzkopff
Dr. anneliese und Dr. hendrik von Zitzewitz
Prof. Dr. hans Jörn Braun † susanne und karl gernandt
Philipp J. Müller
ann-Mari und georg von Rantzau
Dr. gaby schönhärl-Voss und claus-Jürgen Voss
Lennertz & co.
Familie schacht
GOLD
ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO
Rainer abicht elbreederei
christa und Peter Potenberg-christoffersen
he R istO ag
christian Böhm und sigrid Neutzer amy und stefan Zuschke
SILBER
ZUWENDUNGEN AB 10.000 EURO
Ärzte am Markt: Dr. Jörg arnswald, Dr. hans-carsten Braun
Baden-Württembergische Bank hans Brökel stiftung für Wissenschaft und kultur
Jürgen und amrey Burmester
Rolf Dammers Ohg
Deutsche gigaNetz gmbh
eDekaBaNk ag
FR osta ag katja holert und thomas Nowak knott & Partner VD i
Jürgen k önnecke hannelore krome
Dr. claus und hannelore Löwe stiftung Meier-Bruck steinway & sons
BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO
ilse und Dr. gerd eichhorn hennig engels
Dr. t hecke und c Müller
Marga und erich helfrich
isabella hund-kastner und ulrich kastner
Familie klasen
Mercedes-Benz hamburg carmen Radszuweit
colleen B. Rosenblat
D es FR eu ND esk R eises e LBP hi L ha RMON ie + L aeis Z ha LL e e V.
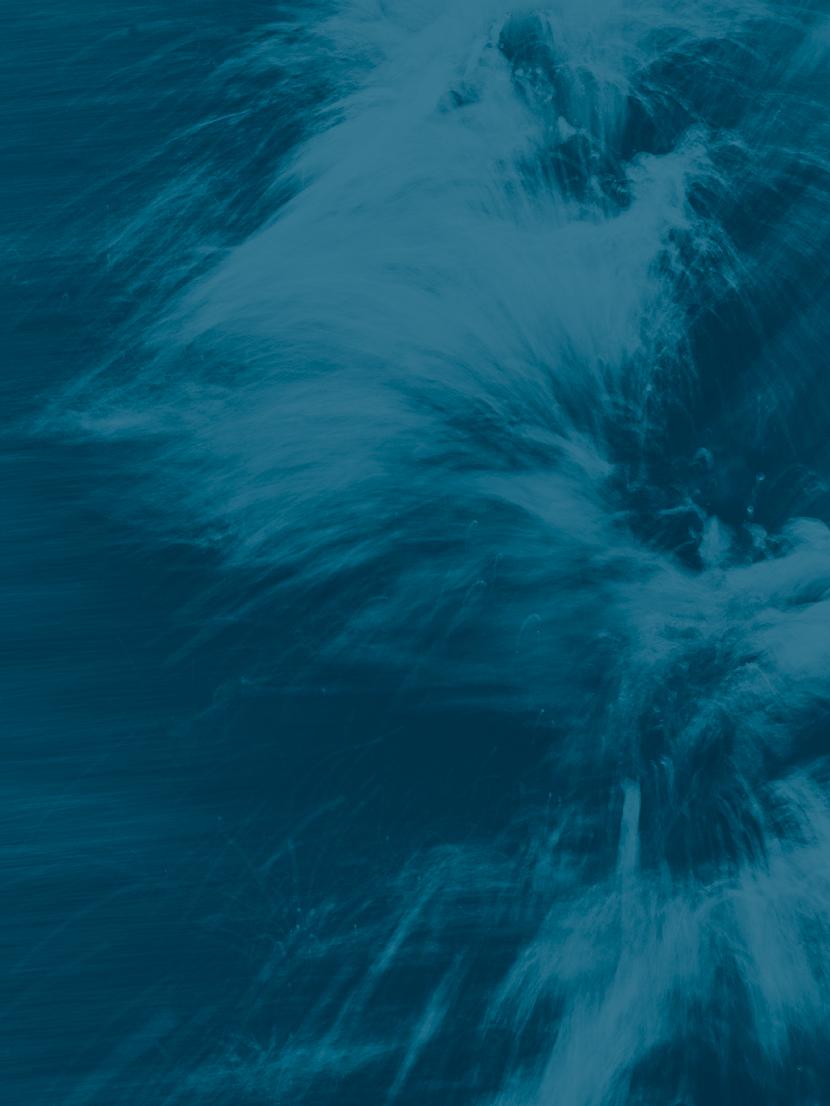
Jürgen abraham | Rolf abraham | andreas ackermann |
anja ahlers | Margret alwart | karl-Johann andreae | undine Baum | Rainer und Berit Baumgarten | gert hinnerk
Behlmer | Michael Behrendt | Robert von Bennigsen |
Joachim von Berenberg-consbruch | Prof. Dr. Wolfgang Berlit | tobias graf von Bernstorff | Peter Bettinghaus | Marlis und Franz-hartwig Betz | Wolfgang Biedermann | alexander Birken | Dr. Frank Billand | Dr. gottfried von Bismarck | Dr. Monika Blankenburg | ulrich Böcker |
Birgit Bode | andreas Borcherding | tara Bosenick |
Vicente Vento Bosch | Verena Brandt | Beatrix Breede | heiner Brinkhege | Nikolaus Broschek | Marie Brömmel | tobias Brinkhorst | claus-g Budelmann | engelbert
Büning | amrey und Jürgen Burmester | Dr. christian cassebaum | Dr. Markus conrad | Dr. katja conradi |
Dierk und Dagmar cordes | Familie Dammann | carsten Deecke | Jan F. Demuth | ulrike und karl Denkner |
Dr. Peter Dickstein | heribert Diehl | Detlef Dinsel | kurt Dohle | Benjamin Drehkopf | thomas Drehkopf | Oliver Drews | klaus Driessen | christian Dyckerhoff | hermann ebel | stephanie egerland | hennig engels | claus epe | Norbert essing | heike und John Feldmann | alexandra und Dr. christian Flach | Dr. Peter Figge | Jörg Finck | gabriele von Foerster | Dr. christoph Frankenheim | Dr. christian Friesecke | sigrid Fuchs | Manhard gerber | Dr. Peter glasmacher | Prof. Phillipp W. goltermann | inge groh | annegret und Dr. Joachim guntau | amelie guth | Michael haentjes | Petra hammelmann | andreas hanitsch | Jochen heins |
Dr. christine hellmann | Dr. Dieter helmke | Jan-hinnerk helms | kirsten henniges | Rainer herold | gabriele und henrik hertz | günter hess | Prof. Dr. Dr. stefan hillejan | Bärbel hinck | Joachim hipp | Dr. klaus-stefan hohenstatt | christian hoppenhöft | Prof. Dr. Dr. klaus J. hopt | Dr. stefanie howaldt | Maria illies | Dr. ulrich t Jäppelt |
Dr. Johann christian Jacobs | heike Jahr | Martin Freiherr von Jenisch | Roland Jung | Matthias kallis | ian kiru karan | tom kemcke | klaus kesting | Prof. Dr. stefan
kirmße | Renate kleenworth | Jochen knees | annemarie köhlmoss | Matthias kolbusa | Prof. Dr. irmtraud koop | Petrus koeleman | Bert e könig | sebastian krüper | arndt kwiatkowski | christiane Lafeld | Dr. klaus Landry | günther Lang | Dirk Lattemann | Per h Lauke | hannelore Lay | Dr. claus Liesner | Lions club hamburg | elbphilharmonie | Dr. claus Löwe | Prof. Dr. helgo Magnussen | sibylle Doris Markert | Franz-Josef Marxen | thomas J. c und angelika Matzen stiftung | helmut Meier | gunter Mengers | axel Meyersiek | erhard Mohnen | Dr. thomas Möller | christian Möller | karin Moojer-Deistler | ursula Morawski | katrin Morawski-Zoepffel | Jan Murmann | Dr. sven Murmann | Dr. ulrike Murmann | Julika und David M. Neumann | Michael R. Neumann | Franz Nienborg | Dr. ekkehard Nümann | thilo Oelert | Dr. andreas M. Odefey | Dr. Michael Ollmann | Dr. eva-Maria und Dr. Norbert Papst | Dirk Petersen | Dr. sabine Pfeifer | sabine gräfin von Pfeil | aenne und hartmut Pleitz | Bärbel Pokrandt | hans-Detlef Pries | karl-heinz Ramke | horst Rahe | ursula Rittstieg | sibylle von Rauchhaupt | Prof. Dr. hermann Rauhe | eberhard Runge | Prof. Michael Rutz | Bernd sager | Jens schafaff | Birgit schäfer | Mattias schmelzer | Vera schommartz | katja schmid von Linstow | Dr. hans ulrich und gabriele schmidt | Nikolaus h schües | Nikolaus W. schües | gabriele schumpelick | ulrich schütte | Dr. susanne staar | henrik stein | Prof. Dr. Volker steinkraus | Wolf O. storck | Dr. Patrick tegeder | Jörg tesch | ewald tewes | ute tietz | Dr. Jörg thierfelder | Dr. tjark thies | Dr. Jens thomsen | tourismusverband hamburg e. V. | Prof. Dr. eckardt trowitzsch | John g turner und Jerry g Fischer | Resi tröber-Nowc | hans ufer | Dr. sven-holger undritz | Markus Waitschies | Dr. Markus Warncke | thomas Weinmann | Peter Wesselhoeft | Dr. gerhard Wetzel | erika Wiebecke-Dihlmann | Dr. andreas Wiele | ulrich Winkel | Dr. andreas Witzig | Dr. thomas Wülfing | christa Wünsche | stefan Zuschke
sowie weitere kurator:innen, die nicht genannt werden möchten.
VORSTAND: alexander Birken (Vorsitzender), Roger hönig (schatzmeister), henrik hertz, Bert e könig, Magnus graf Lambsdorff, katja schmid von Linstow und Dr. ulrike Murmann
EHRENMITGLIEDER: christian Dyckerhoff, Dr. karin Fischer †, Manhard gerber, Prof. Dr. Dr. h. c. helmut greve †, Prof. Dr. h. c. hannelore greve †, Nikolaus h schües, Nikolaus
W. schües, Dr. Jochen stachow †, Prof. Dr. Michael Otto und Jutta a Palmer †
D e R u N te RN eh M e R k R eis D e R e LBP hi L ha RMON ie
a B acus a sset Management g mb h
a ddleshaw g oddard LLP
ah N & si MRO ck Bühnen- und Musikverlag g mb h
a LLcu R a Versicherungs- a ktiengesellschaft
a llen Overy LLP
a-tour a rchitekturführungen
Bankhaus DONN e R & R eusche L
Barkassen-Meyer
BB s Werbeagentur
BDV Behrens g mb h
Bornhold Die e inrichter
Braun h amburg
British a merican tobacco g ermany
c a . & W. von der Meden
c L aystON
c ompany c ompanions
Dienstleistungsgesellschaft der Norddeutschen Wirtschaft
Drawing Room
e N e RPa Rc
e ngel & Völkers h amburg Projektvermarktung
e ngel & Völkers h olding g mb h
e sche s chümann c ommichau
e ventteam g mb h
Flughafen h amburg
Fortune h otels
FR a N k - g ruppe
Freshfields Bruckhaus Deringer
g arbe
g ermerott i nnenausbau g mb h & c o. kg
g erresheim serviert g mb h
g rundstücksgesellschaft Bergstrasse
h amburg team
h anse Lounge, t he Private Business c lub
h BB h anseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mb h
h einrich Wegener & s ohn Bunkergesellschaft
h ermann h ollmann g mb h & c o.
hh L a
h otel Wedina h amburg
ik i nvestment Partners
i NP h olding ag
i ris von a rnim
J a R a h OLD i N g g mb h
i N te RN ati ON a L es M usik F est ha MB u R g
Jürgen a braham
c orinna a renhold-Lefebvre und Nadja Duken
i ngeborg Prinzessin zu s chleswig- h olstein und Nikolaus Broschek a nnegret und c laus- g Budelmann c hrista und a lbert Büll
g udrun und g eorg Joachim c laussen
Birgit g erlach u lrieke Jürs
e rnst Peter komrowski
Dr. u do kopka und Jeremy Zhijun Zeng h elga und Michael k rämer c hristine und h einz Lehmann
Joop!
k ahl h olding kesseböhmer h olding kg
k LB h andels g mb h
k linische Forschung Beteiligungsgesellschaft mb h
konzertdirektion Dr. Rudolf g oette g mb h
Larimar
Lauenstein & Lau i mmobilien
Lehmann i mmobilien
Lennertz & c o. g mb h
loved g mb h
Lupp + Partner
Madison h otel
Malereibetrieb Otto g erber g mb h
Miniatur Wunderland
nordwest Factoring und s ervice g mb h
Notare am g änsemarkt
Oppenhoff
Otto Dörner g mb h & c o. kg
PL ath c orporation g mb h
print-o-tec g mb h
Rosenthal c hausseestraße g bR
ROX a LL g roup
s chlüter & Maack g mb h
s ervice-Bund g mb h & c o. kg
s eydlitz g mb h
sh P Primaflex g mb h
s teinway & s ons
s tolle s anitätshaus g mb h
s trahlenzentrum h amburg MVZ
s trebeg Verwaltungsgesellschaft mb h
taylor Wessing
t he Fontenay h otel
trainingsManufaktur Dreiklang
u B s e urope se h amburg
u nger h amburg
Vladi Private i slands
Weischer.Media
Worlée c hemie
Wünsche h andelsgesellschaft
s owie weitere u nternehmen, die nicht genannt werden möchten.

Marion Meyenburg
k & s Müller
c hristiane und Dr. Lutz Peters
Änne und h artmut Pleitz
Bettina und Otto s chacht e ngelke s chümann
Martha Pulvermacher s tiftung
Margaret und Jochen s pethmann
Birgit s teenholdt- s chütt und h ertigk Diefenbach
a nja und Dr. Fred Wendt
s owie weitere Förderer, die nicht genannt werden möchten.
Die PaRtNeR DeR eLBPhiLhaRMONie
PRINCIPAL SPONSORS



PRODUCT SPONSORS

FÖRDERSTIFTUNGEN
Die nächste Ausgabe des Elbphilharmonie Magazins erscheint im August 2024.

Herausgeber hamburgMusik ggmbh geschäftsführer: christoph Lieben-seutter (generalintendant), Jochen Margedant Platz der Deutschen einheit 4, 20457 hamburg magazin@elbphilharmonie.de www.elbphilharmonie.de
Chefredakteur carsten Fastner
Redaktion katharina allmüller, Melanie kämpermann, clemens Matuschek, tom R. schulz; gilda Fernández-Wiencken (Bild)
Formgebung g ROOthuis gesellschaft der ideen und Passionen mbh für kommunikation und Medien, Marketing und gestaltung; groothuis.de gestaltung Lina Jeppener (Leitung), Janina Lentföhr, Lars hammer; Bildredaktion angela Wahl; herstellung sophie gabel; Projektleitung alexander von Oheimb; cvD Rainer groothuis
Beiträge in dieser Ausgabe von stephan Bartels, till Briegleb, simon chlosta, stefan Franzen, katrin Funcke, Bernhard günther, Volker hagedorn, Lars hammer, Fränz kremer, karsten kronas, clemens Matuschek, Melina Mörsdorf, Jan Paersch, till Raether, ivana Rajic, Nadine Redlich, Peter Reichelt, claudia schiller, charlotte schreiber, albrecht selge, Walter Weidringer, Julika von Werder, Bjørn Woll
Lithografie alexander Langenhagen, edelweiß publish, hamburg
Druck hartung Druck + Medien gmbh
Dieses Magazin wurde klimaneutral auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.
Korrektorat Ferdinand Leopold
Anzeigenleitung
antje sievert, anzeigen Marketingberatung sponsoring tel: 040 450 698 03, office@kultur-anzeigen.com
Vertrieb Pressup gmbh, hamburg
Leserservice / Abonnement elbphilharmonie Magazin Leserservice Pressup gmbh
Postfach 70 13 11, 22013 hamburg leserservice@elbphilharmonie.de tel: 040 386 666 343, Fax: 040 386 666 299
Das elbphilharmonie Magazin erscheint dreimal jährlich.
Bild- und Rechtenachweise cover: karsten kronas, verwendetes Foto von Jewgeni Roppel; s 1 Michael Zapf; s 2 links: Manu theobald, mitte: Julia Wesely, rechts: Piper Ferguson, s 3 oben: Julian Baumann, mitte: gRaNgeR - historical Picture archive / alamy stock Foto, unten: Bettina theuerkauf; s 4-7 akg-images, s 8 Otto Dix «Die trümmer von Langemar[c]k» 1924 © Vg Bild-kunst / Bonn 2024 / Foto: akg-images, s 11 Pablo Picasso / study for Weeping head (ii). sketch for «guernica» 1937 © Vg Bild-kunst / Bonn 2024 / Foto: akg-images / album / Oronoz; s 12 picture alliance / öNB-Bildarchiv / picturedesk / egidius sadeler, s 14 picture alliance / heritage images / Jacques callot; s 16 Julian Baumann, s 19 Peter Meisel; s 20-21 Lars hammer; s 22
Melina Mörsdorf / laif, s 24 picture-alliance / akgimages / Marion kalter; s.26-30 katrin Funcke; s.32 Jenny arditti, s 35 Manu theobald; s 36-43 karsten kronas, verwendete Fotos von Oliver Viana (s 36), Jewgeni Roppel (s 37 oben, s 38, s 40 unten, s 41, s 43), Niklas grapatin (s 37 unten); charlotte schreiber (s 39, s 40 oben) und andrea grützner (s 42); s 44 Walter Lüden / archiv Deutsches schifffahrtsmuseum, s 45 bildarchiv-hamburg.com, s 46 links: ullstein bild, rechts: picture alliance / ZB / euroluftbild.de / Martin elsen, s 47 links: courtesy of the Leo Baeck institute, rechts: Fotografie Dorfmüller klier, s 48 Fotografie Dorfmüller klier; s 50 Nadine Redlich; s 53 Marco Borggreve, s 54 picture-alliance / dpa / uPi s 55 Julia Wesely; s 56 charlotte schreiber; s 58 curtis Perry, s 59 Denz Nicolas, s 60 oben: Lee Jong sam, unten: World Music Festival @taiwan 2023; s 62 Bob sweeny, s 64 ebru yildiz; s 66 oben: adrien h tillmann, mitte: Oleksandr kosmach, unten: yann Orhan, s 67 oben: ewan Nicholson, mitte: hervé Pouyfourcat, mitte rechts: george khleifi, unten links: picture alliance / dpa / Michael Reichel; s 68 Picture alliance / Robert harding / g&M therin-Weise, s 69 unten links: andranik sahakyan, unten rechts: Vahan stepanyan, s 71 David galstyan; s 72-75 gesche Jäger; s 76-81 Bettina theuerkauf; s 82-87 Philip thurston / istockphoto; s 88 Jewgeni Roppel
Redaktionsschluss 26. März 2024 Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Printed in germany. alle Rechte vorbehalten.
träger der hamburgMusik ggmbh:






















Erkennbar. Unverkennbar. Der neue vollelektrische Macan.
In der Musik werden Meisterwerke durch Meisterwerke inspiriert. Genau wie die großen Komponisten hat auch Porsche eines seiner herausragenden Werke neu interpretiert.
Mehr unter www.porsche.de/Macan