KIDJO
HANNIGAN



juliusbaer.com
 PRINCIPA L SPONSOR
PRINCIPA L SPONSOR
Liebe Leserin, lieber Leser, »Moderne Zeiten« sind spätestens seit Charlie Chaplins gleichnamigem Film (1936) mit Vorsicht zu genießen. Aber gibt es für wache Genossinnen und Genossen ihrer jeweiligen (Lebens-)Zeit ernsthaft eine Alternative zur Moderne? Die Tradition, gewiss; die Neigung, am Bewährten, Liebgewonnenen festzuhalten, während die Zeit weitergeht und ihre eigenen, immer neuen Anforderungen an die Menschen stellt, ist ebenso stark wie legitim. Doch an der Moderne führt kein Weg vorbei, so unbequem die je eigenen Zeiten auch sein mögen.
Als kulturgeschichtlicher Epochenbegriff ist »die Moderne« längst selbst zum Museumsstück geworden. Als Synonym für eine bewusst und mitgestaltend erlebte Gegenwart bleibt der Begriff unvermindert aktuell. Wohl deshalb liefern nahezu alle Beiträge dieses unter dem Motto »modern« stehenden Hefts völlig zwanglos Referenzen zum Thema. Der Essay zu Beginn (S. 4) reflektiert die lange Begriffsgeschichte primär in musikhistorischem Zusammenhang. Wie modern, ja revolutionär man in den Sechzigerjahren sein musste, um Bachs Musik auf historischen Instrumenten aufzuführen – heute eine Selbstverständlichkeit –, zeigt das Portrait des britischen Originalklang-Pioniers Sir John Eliot Gardiner (S. 47).
Wahrhaft modern scheint mir auch die Haltung der Sängerin und Dirigentin Barbara Hannigan zu sein, die im Interview erklärt, zumindest in Sachen Musik gänzlich ohne Komfortzone zu leben (S. 41).
Und, auch das ist charakteristisch fürs Elbphilharmonie Magazin, wir schauen über die Musik hinaus: Diesmal auf die Architektur Hamburgs, wo wir erkennen, wie nahe Schönheit und Graus der Moderne etwa beim Blick auf die in den Sechzigerjahren entstandene Büroturmstadt City Nord beieinanderliegen (S. 72). Das ist kein Wunder, liegt doch die Schönheit (auch) im Auge des Betrachters.
Für alle, die Musik lieben, gilt: Die Schönheit liegt immer auch im Ohr der Hörerinnen und Hörer. Ich bin gespannt, zu welchem Urteil Sie im Februar beim Festival »Elbphilharmonie Visions« kommen, das einen weltweit wohl einzigartigen Überblick über die Modernität einiger der eindrucksvollsten Orchesterwerke des 21. Jahrhunderts bietet (S. 9).
Bleiben Sie neugierig. Bleiben Sie modern. Und lesen Sie dieses Heft mit Vergnügen.
Ihr
Christoph Lieben-Seutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle

4
ESSAY
WAS IST EIGENTLICH MODERN?
Ein Streifzug durch die Jahrhunderte
VON VOLKER HAGEDORN
10
ELBPHILHARMONIE VISIONS MORGENLUFT FÜR DIE MODERNE
Ein neues Festival für die Musik unserer Zeit
VON TOM R. SCHULZ
16
MUSIKLEXIKON STICHWORT »MODERN«
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
VON CLEMENS MATUSCHEK
Der Pianist zieht sein Publikum unmittelbar in Bann.
VON JULIKA VON WERDER
34
FOTOSTRECKE LICHTMALEREI
VON ANDREA GRÜTZNER
48
18
Der Komponist und seine emotional spontan verständliche Musik

Der große Dirigent wird achtzig.
VON SIMON CHLOSTA
52
MANDOLINE AGIL NACH ALLEN SEITEN Fokus auf ein abwechslungsreiches Instrument
VON RENSKE STEEN
56
UMGEHÖRT ZEIT-GEMÄẞ
58
GERALD CLAYTON
EIN SCHRITT ZURÜCK, DER BLICK NACH VORN
Der Jazz-Pianist verbindet die Generationen und Stile.

VON JAN PAERSCH
62
LEILA SCHAYEGH
ES GEHT UM JEDEN TON
Die Barockgeigerin taucht tief in die Vergangenheit ein.
VON JULIANE WEIGEL-KRÄMER
66
MITARBEITER
DIE BEGEISTERER
Täglich begrüßt die EducationAbteilung Schulklassen im Haus. VON FRÄNZ KREMER
70
ENGAGEMENT WIR SIND FANS VON CLAUDIA SCHILLER
80
SPONSOR FORM VOLLENDET
Eine Frage, sieben Antworten
VON LAURA ETSPÜLER
28
VON WALTER WEIDRINGER GLOSSE
HALTLOS IM HIER UND JETZT Warum hat das Wort »modern« so an Kraft verloren?
VON TILL RAETHER
Die Leidenschaft für Ästhetik verbindet Porsche mit der Elbphilharmonie.
VON ANDREA BIERLE
82 IMPRESSUM
FÖRDERER UND SPONSOREN
88

Mit ihrem viertägigen Reflektor zeigt die Sängerin, warum sie zu Recht als die neue »Mama Africa« gilt.
VON
STEFAN FRANZEN
Die Sängerin und Dirigentin über ihr Streben nach Leichtigkeit und die Wahrhaftigkeit ihrer drei Katzen
VON BJØRN WOLL

An drei spektakulären Hamburger Häusern lässt sich ablesen, was einmal modern war.
VON STEPHAN BARTELS VON VOLKER HAGEDORN
VON VOLKER HAGEDORN
Eine Bar etwas außerhalb von Los Angeles, Mitte der Sechziger, sehr cool, alle tragen Sonnenbrillen am frühen Abend, die meisten sind schon angezecht. Da bricht aus einer Art Jukebox ein wildes Pfeifen und Keuchen los. Sofort sind alle still. »Was ist los?«, flüstert eine, die zum ersten Mal hier ist. »Das ist von Stockhausen«, erklärt der Barkeeper. »Die Leute, die früh hier sind, stehen mehr auf den Radio-Köln-Sound …« Es könnte »Mikrophonie I« sein, im Juni 1965 vom WDR ausgestrahlt, was Thomas Pynchon in seinem 1966er Romanerstling »Die Versteigerung von Nr. 49« in der (fiktiven) Elektronikbar Scope erklingen lässt: Ein Tamtam wird mit diversen Gegenständen in Schwingung versetzt, zugleich mit Mikros wie mit Stethoskopen abgehorcht, deren Signale mit Filtern und Reglern transformiert werden. Screetch …
Noch immer sind das Klänge, mit denen man Hörer aus der Fassung bringen kann – moderne Klänge, dürfte man sagen, wäre der Begriff in der Musik nicht schon ab etwa 1965 »obsolet geworden«, wie das Lexikon »Musik in Geschichte und Gegenwart« erklärt. Tatsächlich wäre jeder heute lebende Komponist ziemlich befremdet, würde man ein neues Stück »moderne Musik« nennen. Aber rundherum ist das Wort längst nicht aus der Mode, und hilfreich bleibt es auch, wenn man nach Umbruchsmomenten in der Musik sucht, in denen etwas ganz Neues Folgen hatte, ohne dass immer gleich von »Fortschritt« gesprochen wurde. »Obsolet«, veraltet ist an »modern« allerdings die Ideologisierung des »Progressiven« in der Musik, die in den 1960ern ihren Gipfel erreichte.
Da hatten sich Lager gebildet, Arroganz war im Spiel und Kampf um Wirkungsmacht. Das Schöne an Pynchons Romanszene ist auch, dass sie davon gar nichts weiß. Diese kalifornischen Hipsters, die auf Stockhausen abfahren, haben garantiert nicht Adorno gelesen. Sie mögen diese Musik, weil sie krass und technisch auf der Spitze der Zeit ist, auf der sie sich selbst gefallen. Sie hören den »Köln-Sound« unbekümmert um den Diskurs dahinter, sie eignen ihn sich zur Distinktion ihrer Partykultur an. Sie sind uns nahe, weil wir in einer Diversität von Musik leben, in der die Lagergräben nur noch Schatten sind.
Aber was ist »modern«? Das Wort ist mindestens 1.500 Jahre alt, wie sich dank moderner Recherchemittel in Sekunden herausfinden lässt. In seiner 32. Epistel stellt im 5. Jahrhundert Papst Gelasius in Rom den »Regeln der Väter« die »Ermahnungen aus jüngster Zeit« zur Seite, »admonitiones modernas«, abgeleitet vom Adverb »modo« für »gerade erst«. 700 Jahre später prägt Bernhard von Chartres, ein Gelehrter an der Domschule von Chartres, wo der Bau der schönen Kathedrale erst noch bevorsteht, den Satz: »Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzend, um mehr und weiter als sie sehen zu können« – wobei er mit den Zwergen die »moderni« meint, die zeitgenössischen Gelehrten gegenüber denen der Antike, in deren spätester Sprache Latein er das mitteilt. Ein Schüler schreibt dies 1159 nieder.
Die Bewunderung der Kultur der Antike führt um 1600 zur Erfindung der Oper in Italien (ursprünglich ein Versuch, das antike Theater zu rekonstruieren) und am Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich zu einem Kunststreit, in dem ausdrücklich »die Modernen« eine Partei bilden. Anlässlich der Genesung des Sonnenkönigs hat es 1687 Charles Perrault in einem Gedicht gewagt, die »Riesen« kleiner zu machen: Die »Anciens«, die Menschen der Antike, seien »Menschen wie wir«. Man müsse nicht vor ihnen in die Knie gehen, das Zeitalter Louis’ XIV . lasse sich ohne Weiteres dem des Augustus an die Seite stellen. Darüber regen sich Kollegen auf, die, wie der Fabeldichter Jean de la Fontaine, mit antiken Vorlagen arbeiten und auch fürchten, es könne auf eine katholische Literatur hinauslaufen – immerhin ist die Antike »heidnisch«.
Da sich hier Fragen der Autonomie der Kunst mit politischen verbinden, findet die »Querelle des Anciens et des Modernes« auch in England und Deutschland Beachtung. Im Alltag gebildeter Deutscher landet aber nicht nur darum ein französisches Adjektiv: »moderne« steht 1736 als Neuzugang in Nehrings »Historisch-Politisch-Juristischem Lexicon«, das auch den lateinischen Paten vermerkt: »neu, neulich, nach der jetzigen Mode, Façon, Dracht, Manier, Art, Weise, Gewohnheit …« Vom lediglich »Modischen« ist das nicht weit entfernt, und hundert Jahre später nimmt ein Musikwissenschaftler eine Abgrenzung vor. ›
Ein Streifzug durch Umbruchsmomente, Epochen, Ideologien, Wörterbücher und Partituren, bei dem ein vielschichtiger Begriff und eine vielschichtige Kunst einander beleuchten.
Der bereits geläufige Ausdruck »moderne Musik«, findet Gustav Schilling 1837 im »Universal-Lexicon der Tonkunst«, müsse sich »an gewisse Principien knüpfen«, auch chronologisch: Modern könne nicht »die Musik seit Christus« meinen. Die »Epoche des Contrapuncts« zählt Schilling nun zum »Antiken«; »modern« sei erst die Kunst danach und auch nur bei »höherer Bedeutung«. Da ist er sich einig mit Robert Schumann, der 1840 vom »Ideal einer modernen Sinfonie« spricht, die nach Beethoven eine »neue Norm« brauche.
Für Richard Wagner ist »moderne Kunst« dann schon 1849 etwas Fragwürdiges. Ihr »moralischer Zweck« sei der Gelderwerb. Hinter den Zeilen aus »Die Kunst und die Revolution« steckt Wagners zutiefst antisemitische Positionierung gegenüber seinem großen Förderer Giacomo Meyerbeer, die 1850 in »Das Judenthum in der Musik« offenkundig wird: »Wir müssen die Periode des Judenthums in der modernen Musik geschichtlich als die der vollendeten Unproductivität, der verkommenden Stabilität bezeichnen«, schreibt Wagner da, ehe er Mendelssohn eine »ausdrucksunfähige moderne Sprache« attestiert und dem überaus erfolgreichen Meyerbeer die »modern pikante Aussprache« von »Trivialitäten« zur Last legt. Stilkritik ist hier verklebt mit den antisemitischen Superioritätsfantasien eines emporstrebenden Künstlers. Wagners Bewunderer Baudelaire hatte von »Modernität« einen anderen Begriff. Für ihn war sie »das Flüchtige, das Transitorische, das Ungewisse, die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unveränderliche ist«, wie er 1863 schrieb – nicht über Musik, sondern über zeitgenössische Kunst. In seinem großen Essay zum »Tannhäuser« verwendet Baudelaire den Begriff nicht. Ganz sachlich setzt Hector Berlioz ihn in seiner »Großen Abhandlung moderner Instrumentation und Orchestrierung« ein, 1843 erschienen und bis heute ein Grundlagenwerk, so klar geschrieben, dass einem die Klangmöglichkeiten, die er auf rund 400 Seiten in allen Facetten beschreibt, tatsächlich »modern« vorkommen. Das fand schon Richard Strauss, der 1905 eine erweiterte Fassung erscheinen ließ.
Für Berlioz fängt die Orchestermoderne mit Mozart an – also etwa mit der Zeit der Französischen Revolution, in der Jürgen Habermas den »philosophischen Diskurs der Moderne« beginnen sieht – und reicht bis zu Berlioz selbst: bis zu dem, was wir avantgardistische Spieltechniken nennen würden (auf seine Zeit bezogen), etwa das col legno der Violinen in der »Symphonie fantastique«, die zum Hexensabbat mit dem Holz ihrer Bögen auf die Saiten schlagen. Diese Sinfonie ist eine jener Kompositionen, die, egal aus welcher Epoche, nie ihre Treibkraft von Durchbruch, Aufbruch, neuer Freiheit verlieren. Im Finale der »Fantastique« könnte man auch an eine rappelvolle Straßenkreuzung von heute denken, neben der ein Avantgardist am Tablet sein Klangmaterial durchcheckt.
Das Werk trägt immer noch die Aktualität seines Entstehens in sich, von einem hellwachen Zeitgenossen komponiert im Vorfeld der Julirevolution 1830 und gleich danach uraufgeführt. Andere radikale Aufbrüche sind durchaus systemkonform: Monteverdis »Orfeo« war zunächst ein Privatvergnügen in Mantuas Herzogspalast, wo am Tag vor der konzertanten Uraufführung im Februar 1607 ein Hofbeamter notierte: »Alle Darsteller werden musikalisch sprechen« – nie da gewesen im Theater! Wie sie das aber tun, mit welchen Linien, zu welchen Harmonien der glückliche Orfeo abstürzt, als er vom Tod der Geliebten erfährt, wie nach einem Jahrhundert mehrstimmiger Madrigale ein einzelner Verzweifelter seine Stimme erhebt – das hat bis heute mehr Unmittelbarkeit als viele Arien, die dieser Erfindung der Oper folgten. Fast schon ein Gemeinplatz ist die Alterungsresistenz des »Sacre du Printemps«. Auch wenn, wie in aller Kunst, zu erkennen ist, welche Anreger eine Rolle spielten, bleiben Strawinskys Neukonstruieren von Rhythmus und Klang und sein souveränes Beiseitelassen der so lange fast naturgesetzhaft verbindlichen Diatonik bis heute herausfordernd und aufregend.
»Absolut modern« könnte man Werke wie diese drei mit einer häufig zitierten Zeile von Arthur Rimbaud nennen, 1873 geschrieben: »Il faut être absolument moderne«, »Man muss absolut modern sein«, heißt es in »Eine Zeit in der Hölle«. Aber das hat zwei Haken. Zum einen ist Modernität, egal wie man sie definiert, kein Synonym für Qualität: Wo würde für Bach das Adjektiv »modern« naheliegen? Zum andern hat Rimbaud den Satz gerade nicht in dem Sinn gemeint, in dem er so oft zitiert wird. Mit »modern«, das hat der Übersetzer Tim Trzaskalik gezeigt, meint Rimbaud das Gegenteil von Aufbruchsgeist. An anderer Stelle nämlich findet der Dichter »die Feierlichkeiten (…) der modernen Dichtung belanglos«. Oder: »Nichts ist eitel; heran an die Wissenschaft, und voran!, so schreit’s der moderne Prediger, also Allewelt.« Die Moderne ist für den 19-jährigen Arthur Rimbaud nervtötender Mainstream, von dem er sich zynisch distanziert.
Damit ist er nah bei einem Deutschen, der fast zeitgleich, 1874, der »Moderne« seiner Zeit nichts abgewinnen kann. »Der moderne Mensch«, schreibt dieser Philosoph, leide »an einer geschwächten Persönlichkeit«, weil er zu viel Geschichtsbewusstsein habe: »Der historische Sinn, wenn er ungebändigt waltet und alle seine Consequenzen zieht, entwurzelt die Zukunft, weil er (…) den bestehenden Dingen ihre Atmosphäre nimmt, in der sie allein leben können.« Unschwer ist als Autor Friedrich Nietzsche zu erraten, der in »Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben« letztlich den enorm gewachsenen Einfluss der Wissenschaften verantwortlich macht für eine innere Leere. Einen Ausweg sieht er in einer Kunst, die »das moderne Bewusstsein dezentrieren und für archaische Erfahrungen öffnen« wird, so Habermas im »Philosophischen Diskurs der Moderne«. Für den ›


jungen Nietzsche ist noch Wagner die große Hoffnung, für den reifen Nietzsche nicht mehr. Aber hätte er den »Sacre« geliebt?
Claude Debussy nannte dieses Werk in respektvoller Ironie »barbarische Musik mit allem Komfort der Moderne«, also auf der Höhe der musikalischen Mittel der Zeit. Der Begriff »modern« meint auch da noch nicht »Avantgarde«. Er schwankt in den Jahren bis 1918 zwischen »zeitgenössisch«, »aktuell« und »traditionsfern«. Der Kritiker Oscar Bie lobt das Libretto der »Salome« von Richard Strauss 1905 als »Muster eines modernen Operntextes«, weil keine Verse mehr gesungen werden wie auch schon 1902 in Debussys »Pelléas et Mélisande« – beides Opern, die heute für den Aufbruch ins 20. Jahrhundert stehen. Man liest aber auch vom »Schrecken und Grausen, das in den modernen Partituren webt«, und zwar bezogen auf die durchaus noch spätromantische Musiksprache, mit der die Komponistin Ethel Smyth 1906 in ihrer Oper »The Wreckers« arbeitet. Wer noch weiter ging, war »ultramodern«.
Wie »modern« noch 1917 verstanden werden kann, zeigt ein Satz in Hermann Hesses Roman »Demian«: »Der Musiker spielte (auf einer Orgel, Anm.) etwas Modernes, es konnte von Reger sein.« Unwillkürlich stutzen wir. Zwar war Max Reger, 1916 gestorben, noch ein Zeitgenosse Hesses, aber einer, der dezidiert Traditionen fortschrieb, mit J. S. Bach als zentraler Gestalt. In den uns geläufigen Begriff einer musikalischen Moderne ab 1900 scheint er nicht zu passen. Ganz gleich, wo man deren Ende vermutet – es besteht Einigkeit darüber, dass in den Jahren 1900 bis mindestens 1914 ein Aufbruch, eine Innovationslust zu erleben sind wie nie zuvor und vielleicht auch nicht danach, was die Kongruenz von Diversität und Substanz betrifft. Debussy, Ravel, Strawinsky, Skrjabin, Szymanowski, Schönberg, Berg, Webern, Mahler, Strauss, Schreker, Bartók, Janácˇek, Ives – es ist unfassbar, welche Vielfalt neuer Musiksprachen sich in jenen Jahren ballte.
Warum aber werden Komponisten wie Reger, Fauré, Elgar, Smyth, Sibelius, Nielsen in diesem Kontext kaum je genannt? Nicht »modern« genug? Die Vielfalt wird in der Rückschau gern reduziert, was im deutschen Sprachraum besonders drastisch geschah. Als maßgeblich wurde dort im öffentlichen Diskurs seit Theodor W. Adornos einflussreicher »Philosophie der neuen Musik« (1949) nur die »Zweite Wiener Schule« anerkannt, also Schönberg und seine Schüler und der Abschied von der Tonalität. Strauss’ »Rosenkavalier« galt nach »Salome« und »Elektra« bereits als Rückfall, die Franzosen liefen als »Impressionisten« gleichsam außer Konkurrenz, Elgar und Sibelius schrumpften zu Lokalgrößen, selbst der »Sacre« galt Adorno nur als »Virtuosenstück der Regression«: »Die ästhetischen Nerven zittern danach, in die Steinzeit zu regredieren.«
Allein Schönbergs »Schule«, schrieb Adorno, werde »den gegenwärtigen objektiven Möglichkeiten des musi-
kalischen Materials gerecht«. Die maßlose Arroganz dieser Position ist auch eine Reaktion auf das Verbot »entarteter« Musik im »Dritten Reich«, das dem organisierten Massenmord an Juden vorausging (vor dem sich etwa Schönberg und Adorno in die USA retten konnten).
Dieser Hintergrund verlieh der Ideologisierung einer durch Progressivität definierten Moderne nach 1945 eine enorme Wirkung, unabhängig vom Desinteresse eines größeren Publikums. Sie traf auch Werke jener überlebenden oder ermordeten jüdischen Komponisten, die nicht den Weg zum Serialismus gegangen waren: Goldschmidt, Laks, Schreker, Krása, Ullmann … Und sie wurde übernommen von einem Kreis enorm begabter Komponisten, dessen brillantes Haupt, Pierre Boulez, sich als Kreuzritter mit einer Mission verstand – der Musikbetrieb begrüßte die Avantgarde ja nicht gleich mit offenen Armen. »Jeder Musiker, der die Notwendigkeit der zwölftönigen Sprache nicht erkennt, ist unnötig«, erklärte Boulez 1952. »Sein ganzes Werk platziert sich damit jenseits der Notwendigkeiten seiner Epoche.« Dabei ging ihm Schönberg gar nicht weit genug; die Aufhebung der Hierarchie der Töne müsse auf sämtliche Parameter angewandt und subjektiven Emotionen entzogen werden, fand Boulez. Den Popmusikern, deren Publikum exponentiell wuchs, konnte das egal sein, aber nicht den Komponisten, nicht einmal den amerikanischen. »Als ich studierte«, sagte der 1936 geborene Steve Reich im Gespräch mit dem Autor, »gab es zwei Möglichkeiten, Musik zu schreiben. So wie Boulez und Stockhausen oder so wie Cage. Für alles andere wurde man ausgelacht, ins Gesicht oder hinter dem Rücken. Es war wie eine Wand.« Reich durchbrach diese Wand mit seiner Minimal Music, unter Verwendung von Metren und tonalen Zentren, in denen die ganze Energie seiner Heimatstadt New York vibriert – absolut modern, könnte man sagen. Das war übrigens etwa zu der Zeit, in der Pynchons Barbesucher Stockhausen ganz anders hörten, als das geschichtsphilosophisch vorgesehen war. Aus Spaß. Unendlich viel ist seitdem passiert. Die Vielfalt der jetzigen Musiksprachen, alle eingeschlossen, von ethnischen über Jazz und Rock bis zu jeglicher Formation, die sich aufs Podium und ins Netz stellt, ist vielleicht so groß wie die vom Gregorianischen Gesang bis zu Stockhausens »Mikrophonie I« und ein Wort wie »modern« vielleicht doch etwas zu klein dafür. Seine Definition im aktuellen Online-Duden geht über die von 1736 kaum hinaus; der musikgeschichtliche Horizont reicht dort aber immerhin bis zum 19. Jahrhundert. Als Beispiel für den Einsatz des Wortes liest man: »modern (im modernen Stil) komponieren«.
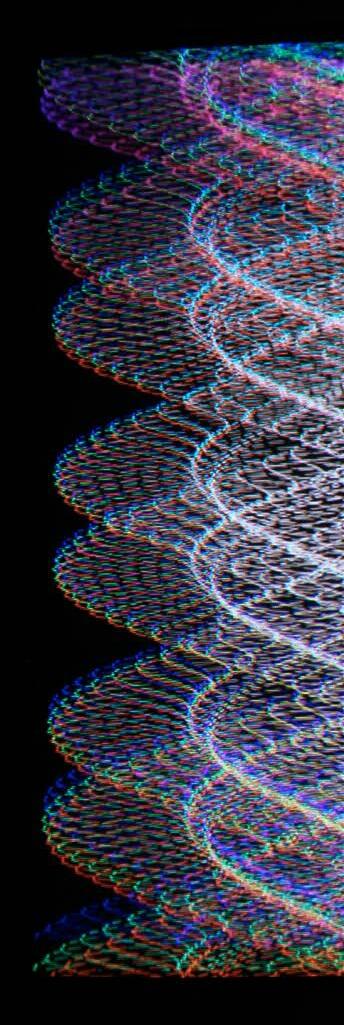
Die Elbphilharmonie setzt ihre Popularität hemmungslos für die Musik unserer Zeit ein –nun auch mit dem Festival »Elbphilharmonie Visions«.
 VON TOM R. SCHULZ
VON TOM R. SCHULZ
An einem regnerischen Freitagvormittag um elf Uhr, 13 Stunden vor Anbruch des 21. Jahrhunderts, unternahm das 20. Jahrhundert einen allerletzten Anlauf, sich mit der seit seinem Anbeginn komponierten Musik in Hamburg vielleicht doch noch beliebt zu machen. Einzelne in jener Zeitspanne entstandene Werke hatten durchaus die Gnade des lokalen Publikums gefunden. Vieles aber war ihm unbekannt geblieben, da es nie jemand aufzuführen gewagt hatte. Anderes wurde skeptisch beäugt. Was von dem, was die Komponisten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgedacht hatten, überhaupt auf den Spielplan kam, wurde in der Regel einmal öffentlich gespielt und anschließend von Konzertprogrammen weiträumig ferngehalten. Zu spröde. Unbequem. Nervig. Nicht zumutbar. Für die Interpreten wie fürs Publikum.
Wie sah dieses letzte Aufbäumen der Musik des 20. Jahrhunderts aus? Der Hamburgische Generalmusikdirektor Ingo Metzmacher, damals recht frisch bestallt, hatte zum traditionellen, bis dahin stets aufs Ehrwürdige abonnierten Silvesterkonzert mit seinem Philharmonischen Staatsorchester in der Musikhalle erstmals ausschließlich Stücke aufs Programm gesetzt, die in diesem nun rapide zu Ende gehenden Jahrhundert geschrieben worden waren, 15 an der Zahl, von Komponisten wie Kagel und Ravel, Ives und Strawinsky, Weill und Plate. Nichts allzu Krasses, schließlich war Silvester. Aber auch einiges, das die Ohren herausforderte.
Die Aktion unter dem Titel »Who Is Afraid of 20th Century Music?«, durchaus auch angelegt als kleine Wadlbeißerei gegen die Walzerseligkeit des Wiener Neujahrskonzerts, war ein toller Überraschungserfolg. Sie wurde in den folgenden Jahren zur stets ausverkauften Institution und blieb im Gedächtnis der Stadt haften als einer der besonders geglückten Schachzüge in Metzmachers beharrlich verfolgter Mission, mit leichter Hand am Abbau der Vorbehalte gegenüber moderner Musik mitzuwirken. Es lag über Hamburg damals noch jener noble Muff, der auch Modeschaffende zur Verzweiflung trieb. So, wie man in dieser Stadt jede Farbe tragen konnte, Hauptsache, sie war blau, konnte man hier auch jede Musik aufführen, Hauptsache, es war Brahms.
Wer damals dabei war oder in einem der vier späteren »Who Is Afraid of 20th Century Music?«-Konzerte saß, witterte hanseatische Morgenluft für die Moderne. Aber wohl niemand hätte sich auch nur träumen lassen, dass 22 Jahre nach der Premiere derselbe Ingo Metzmacher in demselben Hamburg vor atemlos lauschendem und am Ende schwer begeistertem Publikum einen ganzen Abend lang Musik von Mark Andre dirigieren würde, einem der skrupulösesten Komponisten der Gegenwart, der jeden Ton nur gleichsam widerstrebend gegen die kosmisch-göttliche Stille in die Welt bringt.

Seit jenem legendären Silvesterkonzert ist ein knappes Vierteljahrhundert vergangen. Und es ist ungeheuer viel passiert mit der modernen Musik in Hamburg und mit der Bereitschaft, ihr hier Raum zu geben und zuzuhören. Ingo Metzmacher war natürlich nicht der erste und einzige Katalysator dieser Entwicklung. Sie hatte schon früher begonnen, bei der Reihe »das neue werk«, mit der der NDR seit Beginn der Fünfzigerjahre zeitgenössischen Klängen ein prominentes Forum gab, meist im überschaubaren Rahmen der eigenen Studios.
Vor allem die erste Intendanz von Rolf Liebermann an der Hamburgischen Staatsoper (1959–1973) brachte eine Menge Uraufführungen, von denen viele allerdings Eintagsfliegen im Repertoire blieben. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts setzten die »Klangwerktage« auf Kampnagel Akzente, später dort das salopp »Greatest Hits« genannte Herbstfestival mit Neuer Musik. Ein echtes Aufblühen der musikalischen Moderne in Hamburg aber, die nun immer wieder Tausende zu zeitgenössischen Werken in den Konzertsaal zieht, lässt sich erst seit Bestehen der Elbphilharmonie konstatieren. Seit deren Eröffnung 2017 setzt sie ihre enorme Popularität konsequent und hemmungslos auch und gerade zur Popularisierung der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts ein.
Dieses Haus begegnet der Modernität der Musik mit der Modernität seiner Architektur. Auf Augenhöhe.
Wer das Musikleben der Stadt vor der elbphilharmonischen Zeitrechnung verfolgt hatte, konnte sich nur die Augen reiben. Zu György Ligetis »Études« mit PierreLaurent Aimard am Klavier hätten sich früher allenfalls zwei-, dreihundert Hartgesottene in der Laeiszhalle oder im Rolf-Liebermann-Studio eingefunden; im Großen Saal der Elbphilharmonie musste man zusätzlich zu den 2.100 fest verschraubten Plätzen noch 94 Stühle aufs Podium stellen, um dem Ansturm des Publikums nachzukommen. Selbst sperrigste Raritäten für Riesenorchester vom Kaliber der Friedrich Cerha’schen »Spiegel« oder Themenabende mit Musik von Iannis Xenakis, Olga Neuwirth oder Unsuk Chin fanden hier vor vollen Rängen statt. Anschließende Ovationen waren die Regel, auch wenn es anstrengend gewesen war. Und immer wieder waren es augenscheinlich auch Menschen aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, die mit solcher Musik kleine Erweckungserlebnisse hatten, so konzentriert wie sie zuhörten und hinterher ihre Begeisterung kundtaten.
Es ist verführerisch, den plötzlichen Reichtum an Neuer Musik als endliche Verwirklichung jener »Veränderung der Hörgewohnheiten« zu deuten, von der es immer hieß, habe sie nur erst stattgefunden, dann werde die Musik des 20. Jahrhunderts ganz bestimmt eine offene, vorurteilsfreie Aufnahme bei den Massen finden. Aber das ist Wunschdenken. Das Was ist vom Wo nicht zu trennen. Ohne Elbphilharmonie wäre in Hamburg wahrscheinlich alles beim Alten geblieben. Versänke das stolze Gebäude am Hafen durch irgendeinen bösen Zauber plötzlich im Schlick der Elbe, es risse die frisch entfachte Begeisterung für die Klangkunst der Gegenwart fürs erste wohl unweigerlich mit sich.
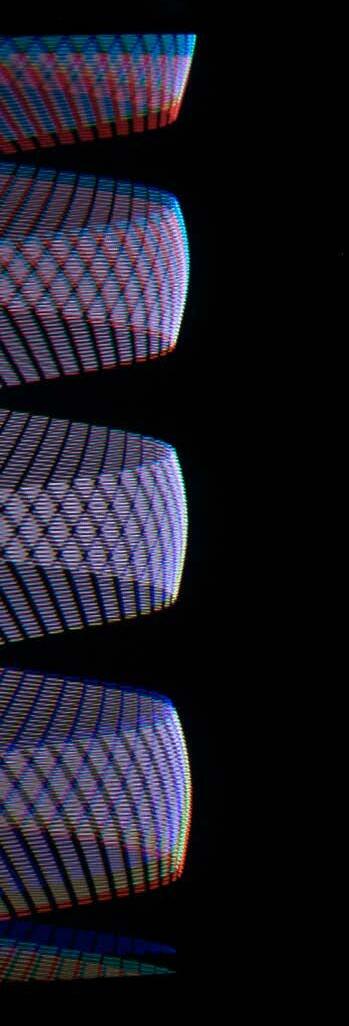
Dabei ist die neue Offenheit für die Neue Musik weniger ein Kollateralnutzen der Tatsache, dass die Elbphilharmonie ein touristischer Pflichttermin ist, für den man anfangs partout keine Karten zu bekommen glaubte, und wenn doch, dann halt für das, was am wenigsten schnell vergriffen war – eben Neue Musik. Nein, dass das zeitgenössische Repertoire hier so beständig reüssiert, liegt vor allem daran: Dieses Haus begegnet der Modernität der Musik mit der Modernität seiner Architektur. Auf Augenhöhe.
Bildende Kunst der Gegenwart wird schon lange bevorzugt in Häusern und Räumen ausgestellt, die frei sind vom Plüsch und Zierrat vergangener Jahrhunderte. Ein jüngeres, diverses Publikum fühlt sich in einer solchen Umgebung eher angesprochen und geht dann da auch hin. Es hat lange gedauert, bis bei den politisch Zuständigen das Bewusstsein dafür dämmerte, bei der Musik könne es ähnlich sein. Die Trägheit mag darin begründet liegen, dass die Hörgewohnheiten eben so anders noch gar nicht geworden sind und die Stadtväter und -mütter nach wie vor an den klassisch-romantischen Kanon denken, falls sie überhaupt an Konzerthäuser denken. ›
Aber vielleicht hat die Elbphilharmonie ja doch auch den ästhetischen Kompass in Hamburg neu justiert. Ob das inzwischen geschehen ist, gewissermaßen als Nebenprodukt der ausgiebigen Weltklangforschung der letzten Jahre, wird sich nun beim erstmals ausgerichteten Festival »Elbphilharmonie Visions« zeigen. Es bietet neun Konzertabende lang en suite nichts anderes als Musik des 21. Jahrhunderts, ganz überwiegend für großes Orchester. Die nötige Seherkraft für diese elbphilharmonischen Visionen brachte Alan Gilbert auf, der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Die Musik unserer Zeit stand bei ihm schon immer hoch im Kurs, auch zu seiner Zeit als Chef des New York Philharmonic, zum Leidwesen des lokalen Establishments und zur Freude der experimentierlustigen Hörerschaft.
Die erste Ausgabe der Elbphilharmonie Visions rückt vornehmlich Werke in den Fokus, die dem gefürchteten postwendenden Abseits nach der Uraufführung entrinnen und sich im Repertoire schon festkrallen konnten. Der Bogen reicht von den Granden der Moderne wie Helmut Lachenmann und Sofia Gubaidulina, John Adams und Kaija Saariaho über Komponisten der mittleren Generation wie Dieter Ammann, Rebecca Saunders und Brett Dean bis zu den Jungen wie Anna Þorvaldsdóttir und Lisa Streich, deren Werk »Flügel« den Claussen-Simon-Kompositionspreis gewann und das hier nun seine nachgereichte Uraufführung erlebt.
Auf der Bühne agieren internationale Fachanwälte der Neuen Musik: das Ensemble intercontemporain aus Paris, das Lucerne Festival Academy Orchestra und das Frankfurter Ensemble Modern, das gastgebende NDR Elbphilharmonie Orchester, das WDR Sinfonieorchester, die NDR Radiophilharmonie und das Hamburger Ensemble Resonanz. Die Konzerte dürften lauter kleine Happenings werden – ohne Pause, ohne Konventionen, intensiv und konzentriert, neun Energie-Booster aus Klang mit aufregender Musik, der Gegenwart mal abgelauscht, mal abgerungen.
Obwohl es so eindeutig ums Hören geht: Der Festivaltitel kommt vom Augensinn. Wer sich etwas Neues vorstellt, und sei es ein Klang, erlebt es in seiner Fantasie wohl zwangsläufig als Vision. Für das Zukunftsgestaltungsvermögen hellhöriger Ohrenmenschen bietet die Sprache jedenfalls kein Äquivalent. Gertrude Stein wusste aus diesem linguistischen Dilemma immerhin einen poetischen Ausweg. Er lautet: »Think of your ears as eyes«.

Do, 2.2., bis So, 12.2.2023 elbphilharmonie Großer saal eine biennale mit musik für das 21. Jahrhundert infos unter: www.elbphilharmonie.de









Ein Blick in die Musikgeschichte oder ins Familien-Fotoalbum lehrt: »modern« ist ein sehr relatives Wort. Was früher angesagt war, ist längst überholt; was heute State of the Art ist, wird morgen Oldschool sein. Beobachten lässt sich das schon in der Kirchenmusik des Mittelalters: Wurde der alte Gregorianische Choral noch einstimmig gesungen, fügten vorwitzige Sänger nach und nach weitere Linien hinzu, die sich aber rhythmisch und harmonisch stets parallel zur Melodie bewegten. Für echte Polyphonie, also mehrere eigenständige Stimmen, fehlte sowohl der Segen des Papstes als auch eine zweckdienliche Notenschrift. Das änderte sich erst mit der Erfindung der sogenannten Mensuralnotation, die eine selbstbewusst »Ars nova« (neue Kunst) bezeichnete Blütezeit auslöste. An ihrer Spitze stand der Franzose Guillaume de Machaut, der 1360 mit seiner »Messe de Nostre Dame« die erste vollständige Messvertonung vorlegte. »Modern« klingt sie in unseren heutigen Ohren allerdings kaum.
CARL PHILIPP EMANUEL BACH: HAMBURGER SINFONIEN
Geometrisch angelegte Parks, ondulierte Perücken, eine auf starren Hierarchien und Ritualen basierende Gesellschaftsordnung: das Zeitalter des Barock war nichts für moderne Freigeister. Umso entschiedener rebellierte die junge Generation seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Beispielhaft zu besichtigen im Hause der Musikerfamilie Bach: Von Vater Johann Sebastians mathematisch konstruierten Fugen allein zur Ehre Gottes wollten seine Söhne nichts wissen. Filius Carl Philipp Emanuel – der sich als Cembalo-Begleiter des flötenden Königs Friedrichs des Großen lange genug gelangweilt hatte – haute besonders heftig auf den Putz. Seine »Hamburger Sinfonien«, entstanden zur selben Sturm-und-Drang-Zeit wie Goethes »Werther« (1774), fegen radikal subjektiv und mit spätpubertär wechselhaften emotionalen Extremen durch den Konzertsaal, dass es einem noch heute schwindlig wird.
»Die auftretenden Leute sind alle pervers«, konstatierte Richard Strauss mit Blick auf seine Oper »Salome«, die 1905 in Dresden herauskam. In der Tat: Die laszive Titelheldin treibt einen verklemmten Verehrer in den Selbstmord, strippt auf Bitten ihres notgeilen Stiefvaters und lässt sich zum Dank den abgeschlagenen Kopf eines unentwegt wirre Visionen verkündenden Propheten servieren, mit dem sie Nekrophilie betreibt, wofür sie am Ende selbst exekutiert wird. Begleitet wird das Spektakel von einer Musik, die schwankt zwischen schwülstig schwelgendem Wohlklang und totaler Kakofonie. Strauss schuf damit das Pendant zur modernen Psychoanalyse, mit der Sigmund Freud kurz zuvor die Wiener Gesell- und weltweite Ärzteschaft irritiert hatte. Traumata, Träume und Triebe; Ich, Über-Ich und Es waren machtvoll auf der ganz großen Musiktheaterbühne angekommen.

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
Jahrhundertelang sahen sich Gitarristen mit einem Problem konfrontiert: Ihr Instrument war einfach zu leise, um sich in größeren Ensembles durchzusetzen. Die Lösung wurde ihnen 1932 in Form der ersten E-Gitarre in den Schoß gelegt, die die Schwingungen der Saiten in elektrische Signale umwandelte und an einen Lautsprecher schickte. Vier Jahre später kam mit der Gibson ES -150 das erste kommerziell erfolgreiche Serienmodell heraus (der Name bezog sich auf den Preis von 150 Dollar). Einer der early adopters war Charlie Christian, der sich aus ärmlichen Verhältnissen als Straßenmusiker-Kid zum Gitarristen in der Band der Swing-Ikone Benny Goodman hocharbeitete. Statt nur noch Akkorde zu schrubben, nutzte er die E-Gitarre so melodiös wie ein Saxofon und etablierte sie nachhaltig im Jazz. Von dort schwappte sie in den Blues, wanderte zum Rock und avancierte zum wichtigsten (und lautesten!) Instrument der modernen Popmusik.


Nichts muss, alles kann: Während Kritiker die Postmoderne als saft- und kraftloses Abrutschen in die Beliebigkeit schmähen, preisen Anhänger die (oft ironische) Brechung jedweder ästhetischer Dogmen zugunsten totaler individueller Ausdrucksfreiheit. Sich nicht festlegen zu lassen, ist geradezu ein Markenzeichen von Brian Eno. Als Mitgründer der Glam-Rock-Band Roxy Music trat er im Glitzerfummel auf, später produzierte er Bands wie die Talking Heads, U2 und Coldplay und schuf KlangInstallationen wie »The Ship« in der Elbphilharmonie. Vor allem aber hob er zuvor als Gebrauchsmusik geschmähte Genres auf ein neues Level. So komponierte er HandyKlingeltöne und den Windows-95-Start-Sound und erfand mit der Ambient Music ein ganz eigenes Genre: Nachdem er 1978 beim Umsteigen einige Stunden auf dem Flughafen Köln-Bonn festsaß und vom Gedudel der Lautsprecher genervt war, konzipierte er kurzerhand einen raffiniert aus Loops gewebten Klangteppich, der »Platz zum Denken schafft«.


Wer dieses Klavierstück hört, wird sofort stutzig. Die quecksilbrig perlenden, in enger Chromatik verknoteten Töne scheinen weder einem regelmäßigen Taktmaß noch einer Grundtonart zu folgen. Atonale Musik aus dem 20. Jahrhundert? Fehlanzeige! Franz Liszt brachte die »Bagatelle ohne Tonalität« bereits 1885 zu Papier; das prominent verwendete Tritonus-Intervall (»diabolus in musica«) spielt dabei auf den Untertitel »Mephisto-Walzer« an. Liszts äußerst erfolgreiche Karriere als reisender Klaviervirtuose und Salonlöwe lag zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre zurück. Um Konventionen und Erwartungen des Publikums brauchte er sich nun nicht länger zu scheren, stattdessen experimentierte er mit kühnen Formen und Klängen und antizipierte dabei etliche Errungenschaften der modernen Musik, um die der Zwölftonmusik-Erfinder Arnold Schönberg und seine Schüler noch lange ringen sollten.
»Modern« ist ja nicht nur ein Adjektiv, sondern, auf der ersten Silbe betont, auch ein Verb, meist assoziiert mit der »Tätigkeit« eines Verblichenen im Grab – sofern er denn darin bleibt. Denn glaubt man den Schauermärchen, die aus praktisch allen Kulturen der Welt bekannt sind, stehen immer wieder Tote auf und geistern als Zombies, Wiedergänger, Gespenster oder Vampire in der Gegend herum. Auch Michael Jacksons 1982er Song »Thriller« spielt mit diesen Klischees: »It’s close to midnight / Something evil’s lurkin’ in the dark.« Berühmt wurde er nicht nur wegen des funkigen Beats und Jackos charismatischer Stimme, sondern wegen des dazugehörigen Musikvideos, in dem sich der Sänger selbst erst in einen Werwolf und dann in einen Zombie verwandelt, um mit einer Gruppe halbverwester Horrorgestalten einen mitternächtlichen Tanz hinzufetzen. Von Fans organisierte Zombie-Walks beweisen bis heute: Jackos Musik ist einfach nicht totzukriegen.
 V on WALTER WEIDRINGER
V on WALTER WEIDRINGER
Ich bin ja kein Komponist«, sagt Thomas Larcher, »ich bin eigentlich Bildhauer.« Ein paar Obertöne an Ironie schwingen bei seinen Worten mit – aber was genau meint der Mann? Versteht er seine Musik gleichsam dreidimensional? Diese Metapher würde man sofort unterschreiben, so plastisch und zum Greifen, Begreifen nah tönen seine Werke immer wieder. Oder frönt er im Geheimen wirklich einer anderen Kunst? Ja und nein: »Ich schreibe alles mit der Hand. Das heißt, ich radiere Unmengen an Noten wieder aus. Und aus den Radiergummibröseln forme ich kleine Kugeln. Vielleicht hundert pro Tag, ganze Töpfe voll. Und das sind meine Skulpturen, an denen ich arbeite.«
Die Anekdote führt gleich tief hinein ins Denken einer Künstlerpersönlichkeit, die sich die eigene Stimme durch viele Zweifel und Widerstände erarbeiten musste. Dass Larcher vieles von dem, was er zu Papier gebracht hatte, lieber wieder ausradieren sollte, das wurde ihm von einigen Verfechtern der musikalischen Avantgarde schon bald geraten: tonale Harmonien und Melodien vor allem, die in seinen Werken eine erinnerte Vergangenheit repräsentieren, eine wundersame, neu entdeckte Zukunft verheißen oder schlicht die Schönheit des Augenblicks einfassen mögen.
Mit einem herbeizitierten »Als ob«, mit ironischer Distanz und polystilistischen Collagen hat das bei ihm jedoch nichts zu tun: Larcher nutzt die widerstreitenden Elemente, um seiner Musik ein enormes dramatisches Gefälle einzuschreiben. Kontraste zwischen Tonalität, Atonalität und geräuschhaften Ereignissen, zwischen virtuosen Zuspitzungen und großen Gesten in seinen Werken können emotionale Sturmböen entfesseln oder einen Hauch von Zärtlichkeit und Trauer hinwehen. Der spontan ver ständliche Ausdruck ist sein Movens – ein Ausdruck, den er dennoch mit aller intellektueller Konsequenz und künstlerischer Redlichkeit erzielt. Seitdem er sich das alles traut, also die erstarrten Gebote des »Neuen« in den Wind schlägt, setzt er den Radiergummi nur noch seinem eigenen Empfinden folgend ein. Ein Perfektionist bleibt er dabei dennoch.
Thomas Larcher hat die tonalen Gravitationskräfte nicht völlig vergessen – oder besser: er tut nicht so, als müsste und könnte man sie vergessen; vielmehr versteht er es, sie in frischem Kontext mit Bedacht zu nutzen. Da spielt auch seine Skepsis gegenüber musikalischer Individualität hinein: »Als ob irgendjemand behaupten könnte, völlig eigenständig zu komponieren! Dabei ist doch das ganze Leben ein Nachahmen: Menschen wollen so sein wie X oder Y, machen sich Dinge zu eigen. Rein autarke, autochthone Kunst gibt es nicht.« Das hat er, der 1963 in Innsbruck geboren wurde und zunächst als einer der versiertesten und vielseitigsten Pianisten seiner Generation Karriere gemacht hat, rasch durchschaut. »Durch die vielen Werke, die ich als Pianist in Auftrag gegeben habe, merkte ich aber auch, wie sich in der Kunst jeder von den anderen abgrenzen, ja bewusst distanzieren will – man muss sich ja schützen, um etwas zu finden, was das Eigene sein könnte.«
Den »Mythos des Eigenen« will Larcher dabei hinterfragen – und es gelingt ihm auf eine Weise, die man getrost individuell nennen darf. Gerade auch deshalb, weil seine Musik nicht nur emotional ersonnen ist, sondern eben auch die Fähigkeit besitzt, diese Emotionen einem breiten
Der Komponist Thomas Larcher und seine emotional spontan verständliche, klug ersonnene Musik.
Publikum unmittelbar verständlich und nachvollziehbar zu machen. Feinfühlig reagiert er zudem auf »die große Debatte zur ›kulturellen Aneignung‹, die aus den USA und England auf uns zurollt und in Europa noch gar nicht in der eigentlichen Intensität angelangt ist«. Seine musikhistorische Erkenntnis: »Ohne den viel geschmähten ›Exotismus‹, ohne die Pariser Weltausstellung 1889 mit ihrer Präsentation javanischer Gamelan-Musik gäbe es keinen Debussy, der das vielleicht zunächst einmal nur nachgeahmt, dann aber zu etwas ganz anderem, Fantastischem gemacht hat. Und ohne Debussy wäre auch die Jazzharmonik spätestens seit der Swing-Ära völlig anders verlaufen.«
Das Komponieren sei bei ihm quasi immer schon da gewesen, sagt Larcher, der als Jugendlicher eine fröhliche Gleichzeitigkeit der Stile erkunden konnte. Später in Wien hat er (neben dem Fach Klavier, u. a. bei Elisabeth Leonskaja) auch ganz förmlich Komposition studiert – und stieß plötzlich auf Diktate, Zwänge, Gebote und Verbote in den engeren Kreisen des »Neuen«: Molldreiklänge? Um Himmels willen!
Sich abwendend habe er ohnehin so viel Zeit mit dem Klavier verbracht, dass die eigene Musik ins Hintertreffen geraten sei. Mit den Stücken, die er trotzdem geschrieben hat, fühlte er sich dann aber nirgendwo so recht zugehörig. Sein Espressivo-Gestus – klinge der nicht vorgestrig?, musste er sich fragen lassen. Auch die Rolle des Komponisten als eloquenter Anwalt seiner selbst würde Larcher, so seine schmerzliche Erkenntnis, nicht ausfüllen können. Aus den Selbstzweifeln half immerhin der Gedanke: »Wenigstens spiele ich viel Neue Musik und lerne sie dadurch besser verstehen.« Eben dafür gründete Larcher 1993 das Festival Klangspuren in Schwaz (Tirol) – weil er es leid war, bei etablierten Veranstaltern mit seinen zeitgenössischen Programmen abzublitzen. Der Erfolg gab ihm auch dabei recht.
Schließlich wurden an den pianistischen Solisten und Kammermusiker immer mehr Anregungen und Ermutigungen zum Komponieren, ja sogar Aufträge herangetragen: Manfred Eicher, Kim Kashkashian, Dennis Russell Davies, das Artis-Quartett, Lars Vogt, Heinrich Schiff, Till Fellner waren die Prominentesten der ersten Zeit. »Damals hab ich oft ungläubig gedacht: Was haben denn die, warum wollen die was von mir?«, erzählt Larcher. »Offensichtlich haben sie irgendetwas in meiner Musik gehört, von dem sie dachten, das könne man auf dem Podium beleben, leben, vermitteln. So fand ich Seelenverwandte.«
Das Verhältnis zu ihnen sieht Larcher ähnlich wie das zwischen dem Architekten und dem Bauherrn eines Hauses, ja überhaupt als Handwerksgemeinschaft: »Hinter mir stehen Schafzüchter, die für Darmsaiten sorgen, Förster und Geigenbauer; danach Musiker, Bühnenbildner, Regisseure, Toningenieure, Radioleute. Ich bin nur ein Glied von vielen.« Die Autorinnen und Autoren der Texte nicht zu vergessen: »Sobald Musik und Wort
in Verbindung treten, ist das wie in einem Magnetfeld: Da richten sich dann die Zeichen der Musik für mich entlang einer klaren Bedeutungsrichtung aus.« Larcher stellt sich in eine alte Tradition: jene des komponierenden Musikers oder musizierenden Komponisten. Früher war diese Doppelrolle der Normalfall, doch heutzutage ist beides meist voneinander entkoppelt, und eben darin sieht er einen Grund für viele Probleme der Neuen Musik: wenn sie sich etwa hermetisch mit reinen Materialfragen beschäftigt, der Forderung nach etwas noch nie Dagewesenem nachjagt und sich dabei gleichgültig gegen ein breiteres Publikum zeigt. Dadurch büße sie an Bedeutung ein. »Es hat immer verschiedenste Strömungen parallel gegeben, Schönberg und Gershwin waren Zeitgenossen, sogar Freunde; Ginastera und Schostakowitsch, Villa-Lobos und Ravel, Stockhausen, die Beatles und Pink Floyd. Dass die Musik nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Spielarten bis hin zu Pop, Rock’n’Roll, Country & Folk oder Bob Dylan auch politisch höchst brisant und sogar relevant war, kann man sich heute kaum mehr vorstellen.«
Als Komponist fühlt sich Larcher zwar privilegiert, dafür habe er aber ein finanziell weitaus sichereres Leben als Pianist und Intendant aufgeben müssen, weil es ihm nicht die nötige Zeit und Ruhe gelassen habe. Das Komponieren versteht er im weitesten Sinne als gesellschaftspolitische Arbeit, bei der ihm das Weiterführen von Traditionen wichtig ist. »Es geht mir darum, die Qualität des Zuhörens in eine andere Zeit zu bringen, zu erhalten oder vielleicht gar zu retten.« Die im Serialismus mit seinen durchorganisierten Einzelereignissen ohnehin schon »zerpixelte Musik noch weiter zu zerpixeln«, das sieht Thomas Larcher nicht als seine Aufgabe an. Stattdessen will er Dinge zusammenführen, daran arbeiten, die Musik der Gegenwart auch jenen Menschen verständlich und nachvollziehbar zu erhalten, die sich nicht ständig damit beschäftigen und auch keine spezielle Ausbildung haben. Und das bezieht sich durchaus auf alle Beteiligten: »Ich schreibe für klassisch trainierte Musiker, die ich abholen will, um ihr Musizieren zu erweitern, sie zu fordern, weiterzubringen, anzuregen. Und ich schreibe für ein ›klassisches‹ Publikum – für Menschen, die klassische Musik mit den Ohren lesen können und sich auf dieser Grundlage 25 Minuten lang auf etwas Unbekanntes einlassen. Die gibt’s hoffentlich immer noch, und die wollen hoffentlich immer noch etwas Neues hören.«
m MEHR ZU THOMAS LARCHER FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK»Es geht mir darum, die Qualität des Zuhörens in eine andere Zeit zu bringen, zu erhalten oder vielleicht gar zu retten.«
Thomas Larcher stellt sich in eine alte Tradition: jene des komponierenden Musikers oder musizierenden Komponisten.
MÜNCHENER KAMMERORCHESTER, PIERRE BLEUSE
Mo, 12.12.2022 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal lawrence power (Viola), alisa Weilerstein (Cello), katrien baerts (sopran), aaron pilsan (klavier)
Thomas larcher: still; The living mountain für sopran und ensemble; ouroboros für Cello und kammerorchester

NDR RADIOPHILHARMONIE, PIERRE BLEUSE
So, 5.2.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal boglárka pecze (klarinette)
Thomas larcher: Time / Three movements for orchestra kaija saariaho: D’om le vrai sens
BOULANGER TRIO
Mi, 8.2.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal ilker arcayürek (Tenor)
Thomas larcher: a padmore Cycle
SIMPLY QUARTET
So, 19.2.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Thomas larcher: streichquartett nr. 4 »lucid Dreams« sowie Werke von haydn und Dvorˇák

MARIA IOUDENITCH / SEBASTIAN FRITSCH / AARON PILSAN
Mi, 19.4.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal maria ioudenitch (Violine), sebastian Fritsch (Cello), aaron pilsan (klavier)
Thomas larcher: »kraken« für klaviertrio sowie Werke von mendelssohn bartholdy und brahms
QUATUOR DIOTIMA
Do, 15.6.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal mark simpson (klarinette)
Thomas larcher: streichquartett nr. 5 (ua) sowie Werke von mochizuki, mantovani und adès
PORTRAIT THOMAS LARCHER
Lange bevor es die heutige Diskussion um Diversität und Inklusion in der Musik gab, hat Angélique Kidjo diese Werte schon gelebt. »Musik ist integrativ, sie gibt dir immer den Raum, das zu sein, was du sein willst«, sagt die Sängerin, die zweifellos zu den wahrhaft kosmopolitischen Stimmen nicht nur Afrikas, sondern des ganzen Planeten zählt. Und sie ist sich sicher: »Wenn politische Systeme auf den Grundsätzen der Musik aufbauen würden, dann hätten wir eine bessere Welt.«
Geboren 1960 in der Hafenstadt Ouidah im westafrikanischen Benin, sog Kidjo seit frühester Kindheit kulturelle Einflüsse aus den unterschiedlichsten Stilen und Epochen auf. Ihre Mutter war Choreografin und Theaterdirektorin, ihr Vater ein Mélomane, ein Musikverrückter, der Schallplatten aus aller Welt sammelte und seiner Tochter das Banjo-Spiel beibrachte. Mit sechs stand sie schon auf der Bühne, hatte mit elf ihre erste Band, orientierte sich an den heimischen Traditionen ebenso wie an Soul und Funk. Mit Anfang zwanzig dann hielt sie nichts mehr in Benin – als Freigeist eckte sie mit der damaligen kommunistischen Führung des Landes an.
Paris hieß das neue Ziel. Dort bildete sich die junge Frau mit Schauspiel- und Gesangsunterricht weiter und schrieb sich in Jura ein – durchaus bezeichnend für ihre Überzeugungen, die Menschenrechte sind ihr bis heute ein großes Anliegen. In der frühen Weltmusikszene begegnete man Kidjo in den Reihen der Fusionband Pili Pili des Keyboarders Jasper van’t Hof, in der sie ihre resolute, charismatische Stimme erstmals international ertönen ließ. Und ab den frühen Neunzigern konnte sie niemand mehr überhören und übersehen, der sich für afrikanische Musik interessiert: ihre frechen Auftritte im Zebrakostüm, ihre aus der Tradition inspirierten TanzPerformances, Songs wie »Agolo« von ihrem Debütalbum »Ayé« (1994), mit dem Kidjo den damaligen Afro-Pop in den Sprachen Fon und Yoruba funky machte.
Von dieser amazonenhaften, forschen Newcomerin hat sich Angélique Kidjo in den vergangenen 25 Jahren längst zu einer Grande Dame gewandelt, die auf ihren Alben und Konzerten stilistische Querverbindungen zwi-
schen Afrika, Kuba und Brasilien knüpft, die vor Präsidenten und Religionsführern singt und sich mit Elan für das panafrikanische Zusammenwirken von Künstlerinnen einsetzt. Ob Benin, Paris oder New York dabei als ihre Basis fungiert, spielt eigentlich keine Rolle mehr –Kidjo ist eine wahre Weltbürgerin. Da nimmt es auch nicht Wunder, dass sie den Ehrentitel ihrer legendären südafrikanischen Kollegin Miriam Makeba (1932–2008) als »Mama Africa« geerbt hat.
Nun gestaltet Angélique Kidjo einen viertägigen Reflektor in der Elbphilharmonie – und nutzt diese Carte blanche, um ein stark weiblich geprägtes Programm zu präsentieren. Mal steht sie selbst auf der Bühne, vor allem aber lässt sie Kolleginnen (und auch ein paar Kollegen) verschiedener Generationen als Gäste zu Wort und Ton kommen. Zwei ganz neue Projekte aus ihrer eigenen Kreativschmiede bilden den Kern des Programms, und es überrascht nicht, dass sich eines davon einer der stärksten Frauengestalten der Menschheitsgeschichte widmet.
»Heutzutage sprechen wir immer über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Vor drei Jahrtausenden war sie bereits verwirklicht – in der Weisheit der Königin von Saba«, sagt Angélique Kidjo im Interview. Das biblische Treffen der vermutlich aus dem Jemen oder aus Äthiopien stammenden Herrscherin von Saba mit dem israelitischen König Salomo in Jerusalem sieht Kidjo als Sinnbild für den Austausch vernünftiger Menschen. In den Rätseln, die die Königin ihrem Gegenüber stellte, wird für Kidjo der Kern der Menschlichkeit, ja der Menschheit deutlich: »Übst du einfach Macht aus, oder sprichst du mit anderen, lässt dich inspirieren, um deine Macht auf ein höheres Niveau zu bringen? Darum geht es bei diesem Treffen.«
Den Anstoß, in die Rolle der »Queen of Sheba« zu schlüpfen, gab ihr der franko-libanesische Trompeter Ibrahim Maalouf, ein großer Verehrer der Sängerin. »Wir fragten uns, was wir zusammen anstellen könnten«,
Angélique Kidjo gestaltet einen viertägigen Reflektor in der Elbphilharmonie – und zeigt damit, warum sie zu Recht als die neue »Mama Africa« gilt.
»Es ist immer noch nicht einfach für eine Frau, sich im Musikgeschäft durchzusetzen, besonders wenn sie aus Afrika kommt.«


erinnert sich Kidjo. »Die Beziehung zwischen dem Nahen Osten und Afrika sollte jedenfalls eine Rolle spielen –und da stieß ich sofort auf die Legende der Königin von Saba. Ich wählte sieben der vielen Rätsel aus, die sie Salomo stellte, und schrieb darüber Texte auf Yoruba. Ibrahim komponierte die Musik, wobei seine Trompete natürlich die Stimme von Salomo verkörpert.« In der musikalischen Ausformung dieses Tête-à-tête aus dem zehnten vorchristlichen Jahrhundert tritt Kidjos kraftgeladene Stimme also in einen atemberaubenden Dialog mit den VierteltonSchleifen und Improvisationen der Trompete. Maalouf (der beim Reflektor noch einen zweiten Abend mit dem Gitarristen François Delporte gestaltet) hat hier alle seine Tugenden gebündelt: rockige Wucht, jazzige Verspieltheit, sinfonische Räumlichkeit und Emotionalität.
Zeitlos sind die Themen der Rätsel: »Alles dreht sich um den Gebrauch unserer Zunge, darum, ob wir die Wahrheit oder eine Lüge erzählen – denn die Macht der Worte kann töten oder auch heilen.« Es geht um einen wundersamen Vogel, um eine geheimnisvolle Flüssigkeit und einen eigentümlich beschaffenen Stoff. All diese Rätsel verweben Kidjo und Maalouf mit den flammenden Reden der Königin vor dem fremden Thron, mit ihrer Leidenschaft, ihrem Schmerz und dem Stolz ihrer Weiblichkeit. Ein machtvolles Treffen auf Augen- und Ohrenhöhe, das die Gleichberechtigung als ein uraltes Thema der Menschheit verankert, für die Verständigung zwischen den Religionen wirbt – und auch fürs Auge ein Erlebnis wird, wenn Kidjo in fantasievollen Gewändern auf der Bühne agiert.
In ihrem zweiten neuen Projekt wagt sich Kidjo erstmals an ein Duo mit einem klassischen Pianisten – auf durchaus überraschende Weise: In »Les Mots d’Amour« rücken sie und Alexandre Tharaud das klassische französische Chanson in den Fokus. »Am Rande eines Konzerts gestand er mir einmal, dass er eine große Liebe für diese Musik hegt«, erzählt Kidjo. »Das hat mich sehr erstaunt, aber ich fand, dass wir darauf aufbauen sollten.« Und so tauschten die beiden einen riesigen Berg von Texten aus, die für ein gemeinsames Konzertprogramm in Betracht kommen könnten. Die Wahl fiel auf Chansons von Édith Piaf, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Pierre Perret, Josephine Baker und Barbara, doch die genaue Zusammenstellung ist ständig im Fluss, wird wohl gar eine Bach-Vertonung auf Yoruba umfassen.
Natürlich geht es in »Les Mots d’Amour« stets darum, was der Titel verspricht, doch es ist Kidjo wichtig zu betonen, dass es sich hier nicht einfach nur um hübsche Liebeslieder handelt. Auch die dunklere Seite dieses Gefühls komme zum Tragen: »Verletzlichkeit ist eine Stärke«, betont sie. »Wenn du immer nur Schmerzen vermeiden willst, wirst du nicht leben. Ohne Schmerzen gibt es kein Leben und keine Liebe, ohne Rückschläge gibt es keinen Erfolg. Aber die Botschaft ist: Das Leben geht weiter!«
Neben diesen beiden eigenen Projekten hat Angélique Kidjo für ihren Reflektor auch zahlreiche Gastkonzerte programmiert – und dazu fast ausschließlich Frauen eingeladen. Sie begründet das mit der Schieflage im Musikgeschäft: »Es ist noch immer nicht einfach für eine Frau, sich durchzusetzen, besonders wenn sie aus Afrika kommt. Die Präsenz, die wir in der westlichen Welt haben, ist minimal. Also nutze ich jede Gelegenheit, junge Afrikanerinnen nach vorne zu bringen. Es gibt keine Plattform, auf der wir existieren können, wenn wir sie nicht für uns selbst schaffen.«
Die große Vorreiterin für die Belange der afrikanischen Frau war zweifellos Miriam Makeba. Angélique Kidjo, die viel Zeit mit Makeba verbrachte und von ihr lernte, nennt die südafrikanische Sängerin immer wieder als Vorbild für ihre Arbeit – und hat dies mit der etwa zwanzig Jahre jüngeren Laura Kabasomi Kakoma, kurz Somi, gemein. Die Sängerin aus New York mit ruandischugandischen Wurzeln hat sich auf Konzeptalben spezialisiert, deren musikalische Erzählungen von der Verwandtschaft zwischen den Kulturen Afrikas und der African Americans berichten.
In ihrem neuen Programm »Zenzile« setzt Somi diesen Dialog zwischen den Kontinenten fort und erweist zugleich ihrem Vorbild Miriam Makeba die Reverenz. »Ich tat mein Bestes, um Miriams Stimme und deren Färbungen zu verstehen«, sagt die Sängerin. »Also habe ich mich in die Geschichte und Kultur Südafrikas vor Ort versenkt. Ich wollte nicht wie sie klingen; ich wollte, dass ein Gespräch zwischen ihrer und meiner Stimme zustande kommt. Dabei stellte ich mir die Frage: Wie würden sich ihre Songs heute anhören, mit dem Sound des 21. Jahrhunderts?«
Ausgewählt hat Somi schließlich siebzehn MakebaSongs, zu denen sie eine tiefe, intuitive Beziehung hat. Deren »Reimagination« fällt dann ganz unterschiedlich aus: Der Song »Milele« etwa bekam ein zeitgenössisches Afropop-Feeling, während »Malaika« und »Ring Bell« zu Jazzballaden mit ausgefuchsten Harmonien mutiert sind. Und Makebas Erkennungshit »Pata Pata« hat Somi mit dunklen Färbungen aller Tanzlied-Klischees entkleidet. »Besonders die Verwandlungen der Songs ins Jazzige sind für mich auch eine Metapher für die Freiheit, um die Makeba immer kämpfte.«
Zu den jungen westafrikanischen Künstlerinnen, die bislang von Europa aus gewirkt haben, zählte bis vor Kurzem die Ivorerin Dobet Gnahoré. Jetzt aber ist sie aus Paris in die Elfenbeinküste zurückgekehrt und hat dort das Repertoire für ihr neues Programm »Couleurs« entwickelt. »Ich bekam sehr viel Inspiration durch die Wurzeln, die mich umgeben, durch die verschiedenen Sprachen. ›Couleur‹ steht für die sicht- und hörbaren Farben, auch die Farben der Emotionen.« Gnahoré singt neben Franzö sisch und Englisch auch in der Sprache ihres Volkes, ›
der Bété, sowie in Dida, Djoula, Adjoukrou und Koulango – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der riesigen Palette der 72 Idiome in der Côte d’Ivoire. Musikalisch dagegen geht es quer durch den Kontinent, von südafrikanischen Einflüssen bis hin zum saharischen Wüstenblues-Groove. Denn die 41-Jährige, die ihre Ausbildung in Musik, Tanz und Schauspiel im berühmten ivorischen Künstlerdorf Ki-Yi Mbock erhielt, pflegte schon immer eine panafrikanische Philosophie. Textlich ist Gnahorés wichtigster Themenkomplex die Weiblichkeit in all ihren Ausprägungen: Sie feiert die Zukunft der klugen Frauen und die Mutterschaft, ermutigt Mädchen zur Selbstermächtigung: »Ich durchlebe eine intensive Phase des Wachstums«, bekennt sie. »Ich bin dabei, mich zu emanzipieren, meine Sexualität neu zu entdecken, mich zu behaupten.«
Oum El Ghaït Benessahraoui, die sich als Sängerin schlicht Oum nennt, ist eine der mutigsten Stimmen Marokkos, wenn es darum geht, für die Anliegen der modernen arabischen Frau einzutreten. Dabei vereint sie auch die verschiedenen kulturellen Facetten ihres Heimatlandes: »Die Musik des Marrakesch ist durch meine Ohren in meinen Körper hineingeflossen, ohne dass ich eine Wahl gehabt hätte«, erinnert sie sich an ihre Jugendjahre. Die Musik der Berber, arabo-andalusische Klänge und der nordafrikanische Châabi-Pop finden sich in ihren Liedern Seite an Seite mit westlichen Einflüssen aus Soul und Elektronik; arabische Knickhalslauten erklingen neben E-Gitarre und Trompete. Oum singt auf Derija, der lokalen Variante des Arabischen, hat sich aber ebenso die Kultur der Sahrauis zu eigen gemacht, der westsaharischen Nomaden, denen ihr Vater entstammt. »Es gibt bei den Sahraui ein herausragendes Gespür für Improvisation und Poesie«, sagt Oum. »Und den Frauen wird ein unglaublicher Respekt entgegengebracht.« Oum möchte damit ein Vorbildcharakter für ihre Geschlechtsgenossinnen in der Heimat sein: »Für die, die sprechen, und die, die schweigen; für die,
die sich verschleiern, und die, die es nicht tun. All diese Facetten gleichzeitig zu repräsentieren und sie als Reichtum anzunehmen, all das zu verkörpern und sich dabei wohl in seiner Haut zu fühlen – so begreife ich die marokkanische Kultur.«
Wer an die Musik der Kapverdischen Inseln denkt, dem dürfte gleich der Name Cesaria Evora durch den Kopf gehen. Doch seit dem Tod der barfüßigen Diva 2011 hat sich die Musik des Archipels verjüngt und kosmopolitische Züge angenommen – und Lura ist dabei eine der führenden Figuren. Die Sängerin entdeckt afrikanische Rhythmen wie Batuque, Ferrinho oder Funaná wieder und kombiniert sie mit Einflüssen aus dem Soul. Melodien und Texte großer Autoren wie etwa des Poeten und Kultur ministers Mario Lúcio über Geschichten aus dem Inselalltag sind ebenso Bestandteil ihres Repertoires wie politische Themen etwa zur Emigration; all das bereichert sie in ihren Eigenkompositionen gern mit augenzwinkernden Anekdoten.
Mit einer hierzulande noch weitgehend unbekannten Sängerin schließlich komplettiert Angélique Kidjo ihre Auswahl starker afrikanischer Frauen – wobei Shungudzo tatsächlich sogar auf die abenteuerlichste Weltbürgerinnen-Biografie verweisen kann: Sie wurde auf Hawaii geboren, ist aber Simbabwerin, hat Vorfahren auf mehreren Kontinenten. Shungudzo steht für einen Global Pop, der zeit- und grenzenlos ist. In ihrem Sounddesign stecken Indie-Folk, Retro-Soul und Avant-Pop, ihre Gedichte und ihre Videoclips strotzen vor Fantasie, die sich keinen Modediktaten unterwirft. Shungudzo glaubt an die heilende Kraft des Tanzens und an die politische Veränderung durch Musik und Text. »Sie hat eine ungeheure Vision, Dinge zu gestalten, lenkt Songs in eine ganz andere Richtung«, sagt Kidjo über ihre junge Seelenverwandte, die auch auf ihrem letzten Album »Mother Nature« gastierte.

Als Bewahrer der Geschichte und Erzähler von Geschichten, als lobpreisender Dichter, aber auch als kritische Stimme, als das Herz der westafrikanischen Gesellschaft: So lässt sich der Griot definieren. Ablayé Cissoko aus dem Senegal verkörpert diese ein Jahrtausend alte Rolle in ihrer modernen Form. Immer noch ist die Kora, die bis zu 21-saitige Stegharfe, sein Werkzeug. Doch in tiefer Verinnerlichung seiner Tradition bricht er auf zu neuen Ufern, hat ebenso mit Musikern der persischen Klassik zusammengearbeitet wie mit dem US -deutschen Trompeter Volker Goetze. Angélique Kidjo hat ihn für einen Soloabend zu ihrem Reflektor eingeladen – und begründet ihre Wahl so knapp wie einleuchtend: »Ich wollte einfach einen großartigen Musiker präsentieren. Wie mein Vater schon gesagt hat: Talent kennt kein Geschlecht!«
Von links oben: Somi, Dobet Gnahoré, Oum,

IBRAHIM MAALOUF

Fr, 10.3.2023 | 18 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
SOMI

Fr, 10.3.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
ANGÉLIQUE KIDJO & ALEXANDRE THARAUD

Sa, 11.3.2023 | 18 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
ABLAYE CISSOKO

So, 12.3.2023 | 19 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
AFRICAN WOMEN ALL-STARS


So, 12.3.2023 | 21 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
m EINEN STREAM MIT ANGÉLIQUE KIDJO FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/KIDJO_STREAM

Früher war es ein Zeichen von Anerkennung, etwas als modern zu bezeichnen. Warum hat das Wort heute so an Kraft und Reiz verloren? Oder gibt es eine Alternative?
VON TILL RAETHER ILLUSTRATION NADINE REDLICH
Mittlerweile bin ich so alt, dass ich mich noch an die Zeit erinnern kann, als das Wort »modern« einen positiven Klang hatte. Das sagt eigentlich alles über das Wort. In den Siebzigerjahren, als ich Kind war, wurden damit Stereoanlangen, Fahrzeuge oder Getränke beworben, die als innovativ und zeitgemäß gelten wollten, und ähnlich wurde es auch von den Erwachsenen im Alltag verwendet. Die etwas unübersichtliche Lebensgemeinschaft der jüngeren Nachbarn wurde leicht ehrfürchtig, leicht ironisch als modern bezeichnet, und wenn bei C&A ein zwar herabgesetztes, aber unbequem geschnittenes, kühn verziertes Kleidungsstück mir nicht gefiel, wurde es mir als modern angepriesen. Modern, begriff ich, war etwas, das aus der Zukunft in die Gegenwart lappte, und wir hielten die Zukunft doch für eher gut oder zumindest für unvermeidlich.
Das änderte sich in den Achtzigerjahren. Dinge, die besonders gut in die Zeit passten, nannten wir jetzt cool, geil, schräg oder, wenn wir schon »Tempo« lasen, zeitgeistig. Das Wort »modern« fand nur noch Verwendung, wenn der Mann im Radiogeschäft versuchte, dem reichen Onkel einen CD -Spieler zu verkaufen, obwohl es bisher nur »Brothers in Arms« von den Dire Straits auf CD gab.
Die Wochenzeitung »Die Zeit« führte ein Ressort ein, das »Modernes Leben« hieß, aber schnell »Moderndes Leben« genannt wurde, denn niemand hatte mehr das Gefühl, modern zu leben. Was sollte das bedeuten? Einer Mode, einem Modus folgend? In den Achtzigern und Neunzigern wollte doch jeder individuell sein, oder, realistischer gesagt: sich auf seine eigene Weise durchwurschteln, statt sich an ein vorherrschendes ästhetisches Prinzip zu halten. Meine Teenager-Kinder verstehen mich heute kaum noch, wenn ich sage, veganer Döner sei modern. Ich versuche, es ihnen zu erklären, also, dass ich ein Wort möchte für eine Sache, die genau in die Zeit passt, aber der Zeit sogar ein klein bisschen voraus ist. Und mir schwant, dass wir womöglich den gemeinsamen Zugriff darauf verloren haben, was »die Zeit« ist, dass wir gar keine geteilte Vorstellung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft haben.
Einerseits leben wir in einer Science-Fiction-Welt voller Gadgets, die sich die Science-Fiction in den Fünfzigern ausgedacht hat, die aber heute in Zukunftsfilmen immer noch vorkommen, als hätte die kollektive Imagination aufgehört: Bildschirmtelefone, Anschluss an allwissende Netzwerke, globale Überwachungssysteme, künstliche Intelligenz, die Vorbereitung von Mars-Reisen. All das ist Fantasie von gestern, Realität von heute und Fantasie von morgen zugleich. Was ist dann, nach dem Wortverständnis meiner Kindheit, noch modern? Ist es modern, Asteroiden aus ihrer Laufbahn zu schießen und schwarze Löcher zu fotografieren? Oder sind solche gegenwärtigen, realen Unglaublichkeiten eher von gestern, und modern ist vielmehr der Wunsch, wie ein Bauer im Mittelalter zu leben, also in einem winzigen Haus auf dem Land zu wohnen, nachhaltig Gemüse anzubauen und morgens Haferbrei zu essen?
Das Gegenwärtige vermischt sich nicht nur mit dem weit Zukünftigen, sondern auch mit der tiefen, archaischen Vergangenheit. Du kannst auf deinem Telefon mit der millionenfachen Rechnerleistung der Apollo11-Prozessoren Online-Seminare zu zehntausende Jahre alten Menschheitspraktiken wie Perma-Kultur und Handfermentation buchen. Und wenn du damit fertig bist, meditierst du oder machst Yoga, um für einen streng begrenzten Zeitraum ganz im Augenblick zu sein, in der reinen, gedankenlosen Gegenwart.
Das Wort »modern« für ein Krawattenmuster, eine Lebensform oder Honigmelone mit Parmaschinken zu verwenden, ergibt nur dann einen Sinn, wenn alle einen gemeinsamen Halt in der Zeit haben. Ich glaube, den haben wir verloren. Eigentlich müsste man jetzt, wenn etwas sehr gut in die Zeit passt, voller Anerkennung sagen: Wow, das ist wirklich völlig durcheinander.

Eine Solistengarderobe in der Elbphilharmonie. Der Raum ist schlicht und elegant eingerichtet, bodentiefe Fenster geben den Blick auf die Hamburger Innenstadt frei. Direkt vor den Fenstern sitzt ein junger Mann an einem Flügel und spielt Brahms. Wie unbewusst bewegt er seine Hände über die Tasten, behutsam schlägt er einige leise Akkorde an, lässt seinen Blick ruhig über die Skyline draußen schweifen, lauscht der Musik. Eben erst hat er ein Video-Interview gegeben, nun soll er sich für ein bisschen Schnittmaterial noch an den Flügel setzen, vielleicht ein paar Tonleitern spielen oder einfach nur über die Tasten streichen. Aber warum nur Tonleitern? Wenn dieser Mann am Instrument sitzt, dann spielt er. Und wenn er spielt, dann meint er es ernst. Für ein paar Momente scheint die Welt in der Garderobe stillzustehen. Das Kamerateam ist längst regungslos und hört einfach nur diesem jungen Mann zu, der da so uneitel und unmittelbar alle in Bann zieht.
Alexandre Kantorow ist kein Unbekannter in der Musikwelt. Sein Name hat längst die Runde gemacht, die internationale Kritik lobt ihn als einen der bedeutendsten Pianisten der jungen Generation. Man liest, er sei der »wiedergeborene Liszt«, technisch virtuos, wandelbar, ein idealer Interpret für die Musik dieses romantischen Komponisten. Aber natürlich spielt er nicht nur Liszt: Ein anderer Kritiker etwa fand, Kantorow sei »geboren für Saint-Saëns«; auch seine einfühlsamen Brahms-Aufnahmen werden hochgelobt, und mit Rachmaninow sorgt er ebenfalls für Begeisterung.

So stürmisch und laut ihm der Beifall im Konzert entgegenbrandet, so ruhig und zurückhaltend ist Kantorow abseits der Bühne. »Ich bin eher der introvertierte Typ«, sagt er selbst. Wohl nicht zufällig fühlt er sich im romantischen Repertoire besonders wohl. In der Musik findet er einen Weg, sich auszudrücken: »Das sind ganz besondere Momente, wenn man sich dadurch wirklich mit den anderen Menschen im Raum verbunden fühlt.« Und so ist er bei seinen Auftritten tatsächlich alles andere als verschlossen, im Gegenteil: »Sobald ich mich an den Flügel setze, werde ich ein bisschen ein anderer, denn da muss ich mich ganz öffnen.«
Geboren wurde Kantorow 1997 im französischen Clermont-Ferrand. Beide Eltern sind Musiker, die Mutter Geigerin, der Vater, Jean-Jacques, ist zunächst als Geiger und später auch als Dirigent berühmt geworden. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Sohn Alexandre als Kind mehr in Konzerthäusern als auf Spielplätzen unterwegs gewesen wäre: »Wir waren selten im Konzert«, erzählt er, »und das Klavier war für mich viele Jahre lang eigentlich nur etwas, das ich halt gerne nach der Schule gemacht habe.« Die Eltern ließen ihm den Raum, ließen ihm jede Freiheit, seine eigenen Interessen zu entwickeln. »Sie
So uneitel wie unmittelbar zieht der Pianist Alexandre Kantorow sein Publikum in Bann.VON JULIKA VON WERDER
wussten wahrscheinlich, dass es nicht einfach ist, als Kind von zwei Musikern aufzuwachsen. Sie waren sehr vorsichtig und haben sich zurückgehalten«, erinnert er sich. »Erst als ich irgendwann von mir aus gesagt habe, dass ich mir eine Karriere als Pianist vorstellen könnte, wurden sie aktiver und haben angefangen, mir Tipps zu geben.«
an der Seite von Teodor Currentzis und musicAeterna sein Debüt im Großen Saal gab – mit ausschließlich langsamen Sätzen unterschiedlicher Klavierkonzerte von Bach bis Schostakowitsch. Nun folgt auch sein SoloDebüt im Kleinen Saal mit Werken von Schubert und Brahms.
Auch als Kammermusiker ist Kantorow viel unterwegs. Gemeinsam mit zwei guten Freunden hat er im vergangenen Sommer sogar sein eigenes Festival für diese intime Form der Musik gegründet. Im südfranzösischen Nîmes brachten die drei an verschiedenen Orten drei Tage lang Kammerwerke auf die Bühne, die teilweise weit abseits des gängigen Repertoires liegen. »Es war ein Marathon«, erzählt er, »aber die Stimmung war super, und das Publikum hat viele der unbekannten Stücke sehr gut angenommen.« Was ihn antreibt: »Eine Welt, in der Musik lebendig bleibt, ist immer eine bessere Welt.«
Immer wieder steht Alexandre Kantorow auch mit seinem Vater Jean-Jacques auf der Bühne – mal im Duo mit Geige und Klavier, mal nebeneinander als Dirigent und Solist. »Wir haben uns vorgenommen, während unserer gemeinsamen aktiven Jahre in der Musikwelt so viel wie möglich gemeinsam zu machen.« Und das mit Erfolg: Neben einem Duo-Album mit französischen Violinsonaten entstanden hochgelobte Einspielungen von Liszts Klavierkonzerten. Im Frühling 2022 gaben die beiden ihre vorerst letzten gemeinsamen Konzerte – und legten nach mit Aufnahmen von Saint-Saëns’ Werken für Klavier und Orchester. »Ich bin wahrscheinlich ganz unbewusst mit den künstlerischen Vorstellungen und Instinkten meines Vaters großgeworden«, sagt der Sohn und ist glücklich darüber, wie viel sie zu zweit umgesetzt haben: »Wir verstehen uns beim Proben oft ohne Worte. Es ist immer etwas sehr Besonderes, mit ihm zu musizieren.«

Zu diesem Zeitpunkt war Kantorow 14 Jahre alt. Auf die Frage, was für seine Entscheidung damals ausschlaggebend war, erzählt er von einem Konzert mit seinem Schulorchester. Während der Proben fühlte er sich zum ersten Mal von vielen Gleichgesinnten umgeben. Auf dem Programm stand ein Werk von Franz Liszt, die Ungarische Fantasie für Klavier und Orchester. Gerne denkt der Pianist heute daran zurück: »Es hat so viel Spaß gemacht! Ich erinnere mich genau an dieses besondere Gefühl, das erste Mal auf so eine Bühne zu gehen und alles um mich herum zu vergessen. Ich wusste plötzlich ganz sicher, dass es das ist, was ich machen will.«
Schon bald folgten größere öffentliche Auftritte und erste Aufnahmen. Und als Kantorow 2019 mit gerade einmal 22 Jahren den prestigeträchtigen TschaikowskyWettbewerb in Moskau gewann, übersprang er damit gewissermaßen den Ruf als Nachwuchs-Star und reihte sich direkt in die erste Liga internationaler Solisten ein. Engagements führten ihn schnell zu renommierten Klangkörpern, darunter das Budapest Festival Orchestra, das Boston Symphony und die Staatskapelle Berlin. Und auch in der Elbphilharmonie eroberte er die Hamburger Herzen schon in den ersten Minuten, als er im April 2022
Wenn er nicht gerade auf Tournee ist, lebt Kantorow in einer Wohnung in der Pariser Innenstadt. Auch wenn er in den Vororten großgeworden ist – »in Orten, wo es mehr Hühner als Menschen gibt«, wie er es selbst beschreibt –, ist das urbane Paris seine Heimat, die er vermisst, sobald er für eine längere Zeit unterwegs sein muss. Sein Lieblingsort? Der Parc des Buttes-Chaumont im 19. Arrondissement. Wann immer er zwischen Konzerten zu Hause ist, umgibt er sich am liebsten mit Freunden und Familie. »Sie kennen mich am besten und sind ein gutes Regulativ«, sagt er schmunzelnd: »Ich muss mich mit Menschen umgeben, denn sonst werde ich noch introvertierter.«
Mo, 20.3.2023 | 19:30 Uhr Elbphilharmonie Kleiner Saal F as T lane – Junge spitzenmusiker:innen auf der Überholspur Johannes brahms: sonate nr. 1 CDur Franz schubert: Fantasie CDur »WandererFantasie«; ausgewählte lieder in klavierbearbeitungen von Franz liszt
»Eine Welt, in der Musik lebendig bleibt, ist immer eine bessere Welt.«m DAS ERWÄHNTE INTERVIEW MIT ALEXANDRE KANTOROW FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/KANTOROW_INTERVIEW

Im Geist der künstlerischen Freiheiten, die sich die Fotografie beim Aufbruch in die Moderne einst erobert hat, zeigt unsere Fotografin die Architektur der Elbphilharmonie: Räume werden zu abstrakten geometrischen Kompositionen, zu leuchtenden Tableaus, die ihre Motive nicht einfach reproduzieren, sondern daraus eigene, neue Bilder produzieren. Es ist ein zweidimensionales Verwirrspiel mit Licht und Schatten, Form und Farbe, Linien und Perspektiven.
 FOTOS ANDREA GRÜTZNER
FOTOS ANDREA GRÜTZNER



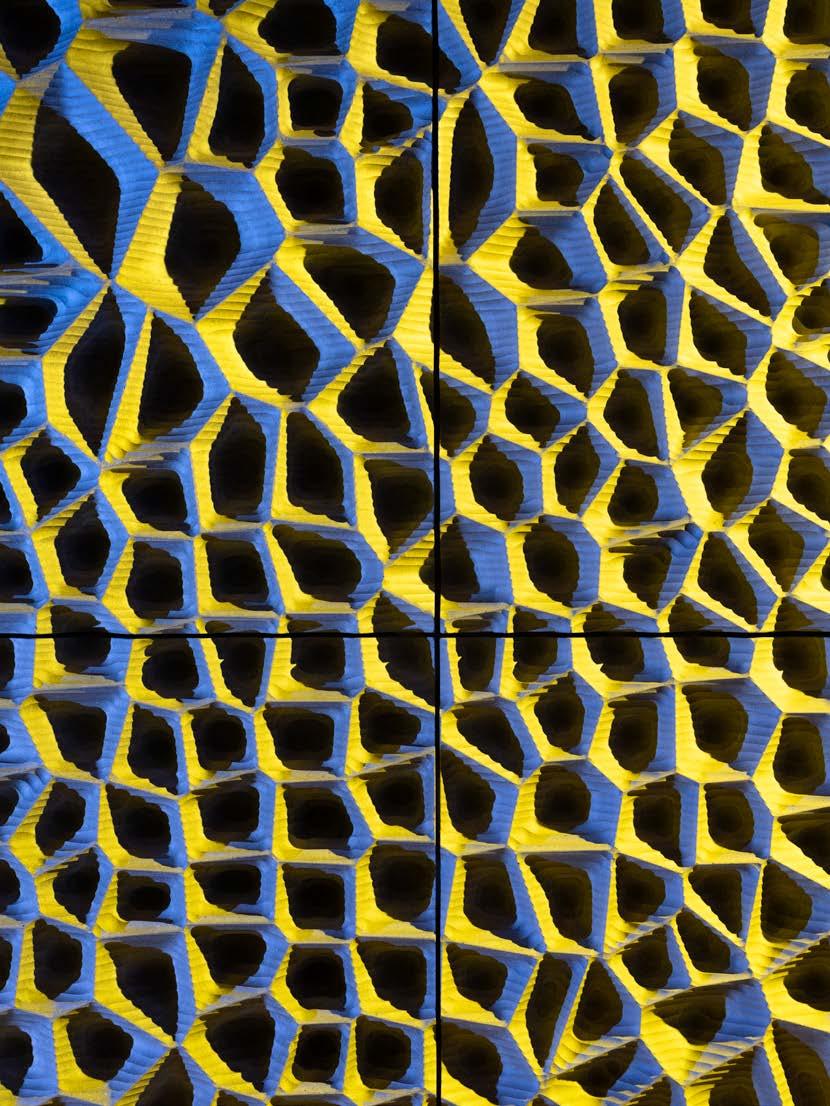




Den vergangenen Sommer hat Barbara Hannigan für einen Besuch in ihrer alten Heimat Nova Scotia genutzt, einer Halbinsel im Osten Kanadas, wo sie aufgewachsen ist. Nach zwei Wochen mit der Familie hat sie dort auch einen zweiwöchigen Workshop gegeben. Denn die Nachwuchsförderung ist ihr ein elementares Anliegen, davon zeugen auch zwei von ihr ins Leben gerufene Förderprogramme: »Equilibrium«, das junge Künstlerinnen und Künstler beim Übergang von der Ausbildung zur professionellen Karriere unterstützt, und »Momentum«, in dem sich renommierte Kollegen als Mentoren für den Nachwuchs engagieren.
Dass jeder Künstler seinen ganz eigenen, individuellen Weg finden kann, dafür ist Barbara Hannigan indes selbst das beste Beispiel, denn die vielseitig begabte Musikerin passt in keine Schublade. Statt sich an den etablier ten Mechanismen des Musikmarkts zu orientieren, verwirklicht sie unbeirrt ihre eigenen Ideen und folgt dabei ihrer inneren Stimme. »Meine drei Katzen sind da eine große Inspiration für mich«, erzählt sie lachend im Interview, »sie sind sich selbst und ihren Bedürfnissen gegenüber immer wahrhaftig.«
Außergewöhnlich ist Hannigans Laufbahn, die mittlerweile in der Bretagne lebt, in vielerlei Hinsicht. Da ist zum einen die ausgeprägte Leidenschaft für Neue Musik, die sie zu einer geradezu exemplarischen Inter pretin zeitgenössischer Werke macht, egal wie schwierig diese auch sein mögen. Mit 17 Jahren sang die Sopranistin ihre erste Uraufführung, bis heute bringt sie es auf die unglaubliche Anzahl von fast 100 Werken, die sie (mit) aus der Taufe gehoben hat, darunter George Benjamins Opern-Welterfolg »Written on Skin« (2012), Brett Deans »Hamlet«-Vertonung (2017) und »Die Schneekönigin« von Hans Abrahamsen (2018), der schon den berückend schönen Orchesterliederzyklus »Let me tell you« (2013) für die nicht weniger berückende Stimme der Sopranistin geschrieben hat.
Außergewöhnlich ist zudem die Verbindung von Singen und Dirigieren, die bei Barbara Hannigan zu einer fast schon neuen Kunstform miteinander verschmelzen, sich gegenseitig durchdringen und befruchten. Ihre Auftritte lassen sich daher am besten als Performance bezeich-
nen, als eine Art Gesamtkunstwerk. Was sich auch in der Vorliebe der Künstlerin für ausgeklügelte Konzertprogramme spiegelt, die in oft ungewöhnlichen Kombinationen neue Hörerfahrungen ermöglichen – vor allem wenn sie mit der Hannigan eigenen Perfektion und Intensität dargeboten werden.
Das Publikum der Elbphilharmonie erlebt Sie bei einer Portraitreihe in den nächsten Monaten als Sängerin, Dirigentin und Performerin – als was sehen Sie sich selbst?
Barbara Hannigan: Wenn ich mir selbst ein Label verpasse, würde mich das nur limitieren. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Und wenn ich etwas tue, versuche ich, dabei so präsent wie möglich zu sein. Egal ob ich gerade die »Lulu« singe, Mahlers Vierte dirigiere oder bei einem interdisziplinären Projekt mitmache. Im vergangenen März habe ich in der Elbphilharmonie zum Beispiel ein Konzert mit Werken von John Zorn gesungen, das hatte für mich dieses Gefühl des Außergewöhnlichen, weil ich mich selbst nicht als Jazz-Sängerin bezeichnen würde. Darum geht es auch gar nicht; es geht darum, Musik zu machen.
Den ersten Auftritt in Ihrem ElbphilharmoniePortrait haben Sie als Waldvogel in Richard Wagners »Siegfried«. Nicht unbedingt der Komponistenname, der einem als erstes bei Ihnen einfällt … Weil meine Stimme keine Wagner-Stimme ist, deshalb. Der Waldvogel ist so ziemlich die einzige Partie, die ich von ihm singen kann. Als Simon Rattle mich 2006 das erste Mal fragte, ob ich das mit ihm machen will, sagte ich mir: Das ist eine schöne Gelegenheit, für kurze Zeit in dieses Milieu einzutauchen. Das ist genau die richtige Dosis für mich, denn die Wagner-Kreaturen sind wirklich spezielle Wesen. Aber es war auch ein großer Spaß, und ich habe viel gelernt. Seitdem gehört der Waldvogel zu meinem Repertoire.
Können Sie sich vorstellen, mehr Wagner zu machen, vielleicht nicht als Sängerin, aber als Dirigentin? Sag niemals nie! Aber das ist keine Musik, mit der ich mich bisher intensiv auseinandergesetzt habe. Das »Siegfried-Idyll« oder das Vorspiel zu »Parsifal«, etwas in dieser Richtung könnte ich mir vorstellen zu dirigieren. Eine ganze Wagner-Oper würde ich für mich jedoch weniger in Betracht ziehen.
In Besprechungen Ihrer Aufnahmen und Auftritte tauchen oft Worte wie »grenzüberschreitend« oder – in einem guten Wortsinne – »irritierend« auf. Wollen Sie das: überraschen und unsere Hörgewohnheiten auf die Probe stellen?
Das steht nicht an erster Stelle. Zunächst einmal erlaube ich mir, frei zu sein. Viele meiner Performances haben einen starken Bewegungsaspekt, etwa als ich in »Passion« mit der Tanzkompagnie von Sasha Waltz gearbeitet
Barbara Hannigan über ihre Doppelrolle als Sängerin und Dirigentin, ihr Streben nach Leichtigkeit und die Wahrhaftigkeit ihrer drei Katzen.
oder als Lulu auf Spitzenschuhen getanzt habe. Natürlich bin ich keine ausgebildete Tänzerin, aber ich hatte ein tiefes Verlangen, es zu tun. Der Wille und die Vorstellungskraft sind unglaubliche Kraftquellen. So war es auch mit dem Dirigieren, auch hier waren Verlangen und Leidenschaft die Auslöser, es auszuprobieren. Ich habe nie gesagt: Das ist mein Stimmfach, deshalb sind das meine Rollen. Im Verlauf meiner Karriere gab es immer schon diese sozusagen grenzübergreifenden Projekte, geboren aus einem inneren Antrieb. Ich muss frei sein, körperlich und vokal – aber auch frei in der Wahl meiner Musik.
Vermeiden Sie damit bewusst eine lähmende Alltagsroutine?
Das ist ein Ergebnis, aber nicht mein Antrieb. »Passion« zum Beispiel habe ich nicht gemacht, weil ich unbedingt tanzen wollte, sondern weil ich mit Sasha Waltz arbeiten wollte. Es hat also stark mit der Künstlerpersönlichkeit zu tun, es geht mir nicht darum, einfach andere Dinge auszuprobieren. So ist es auch bei »Electric Fields« mit den Labèque-Schwestern und Werken von Hildegard von Bingen. Deren Musik ist auf eine gewisse Art minimalistisch, so etwas singe ich gar nicht oft. Ich brauche also ein Projekt wie dieses, bei dem ich einen inneren Drang und ein Verlangen spüre, das gibt mir die nötige Energie.
Was erwartet das Publikum beim Multimedia-Projekt »Electric Fields«?
Es ist multi auf ganz unterschiedliche Weise: Wir haben diese alte Musik von Hildegard von Bingen aus dem 12. Jahrhundert, dazu gibt es Werke von Francesca Caccini, einer italienischen Opernkomponistin des Frühbarock, aber auch Live-Elektronik. Zu den historischen Komponistinnen treten dann die beiden zeitgenössischen Komponisten David Chalmin und Bryce Dessner – es gibt also Verschränkungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und trotzdem wird der ganze Abend von einem großen Atem zusammengehalten, es gibt auch keine Pause oder Applaus zwischen den Stücken. Dazu kommt eine Art Mapping, eine Installation im Raum der Videokünstlerin Netia Jones. Das Projekt ist also auf eine gewisse Art sehr modern, geht aber auch mehr als zehn Jahrhunderte in die Vergangenheit zurück.

Eben haben Sie das Wort »modern« erwähnt: Welche Bedeutung hat es für Sie als Künstlerin? Schwierige Frage. Modern meint für mich: auf das Neue verweisen. Insofern können wir Schönberg eigentlich nicht mehr als moderne Musik bezeichnen. Am Anfang gehört er eher in die Spätromantik, die Zwölftonmusik bezeichnen wir dann als modern, weil sie für unsere Ohren offensichtlich nicht mehr romantisch klingt – aber das ist

mittlerweile 100 Jahre her. Hier sind wir wieder bei der Problematik mit den Labels, denn sobald wir ein Etikett auf etwas kleben, packen wir es in eine Schublade. Ich bin hingegen ein Mensch, der Fragen statt Antworten bevorzugt. Ich mag das Geheimnisvolle, das Rätselhafte an der Musik. Natürlich versuche ich, Werke, die ich aufführe, zu verstehen, gleichzeitig geben sie aber niemals alles von sich preis, es bleibt ein letztes Geheimnis.
Andere Wege zu gehen, heißt aber auch: regelmäßig raus aus der Komfortzone. Ist das nicht anstrengend? Ich habe gar keine Komfortzone, weil ich alles als Herausforderung betrachte. Komfortzone bedeutet für mich, dass Dinge mir leicht fallen, dass ich mich dafür nicht anstrengen muss. Das aber liegt nicht in meiner Natur, ich bin ein Arbeitstier: Ich liebe es, zu üben und zu studieren. Außerdem versuche ich immer, das nächste Level zu erreichen, selbst wenn es ein Stück ist, das ich schon x-mal gesungen habe. Man könnte also sagen, Risiken einzugehen, ist meine Komfortzone, sozusagen meine Werkseinstellung.
Das ist schon ein bisschen verrückt, oder? Keine Ahnung, ob das verrückt ist. Für mich ist es total normal. Als ich in der Highschool war, hatte unsere Schule ein Motto: »Strebe nach Exzellenz«. Das habe ich mir wohl zu Herzen genommen. Zu versuchen, die beste Ausgabe unser Selbst zu sein, ist doch ein schöner Gedanke.
Bei Ihnen klingen selbst die schwierigsten Stücke immer so einfach. Kennt Ihre Stimme keine Grenzen? Ich versuche, es leicht klingen zu lassen, weil ich möchte, dass das Publikum seine Aufmerksamkeit ganz der Musik schenken kann – und nicht meinen Anstrengungen, die Herausforderungen der Musik zu meistern. Wenn ich als Künstlerin, vor allem in Neuer Musik, mit meiner Inter-
pretation die Botschaft vermittle, dass es kompliziert und komplex ist, überträgt sich das zwangsläufig auf das Publikum. Daher ist es mir wichtig, als Interpretin so tief wie möglich in die Musik einzutauchen und mich dort möglichst wohl zu fühlen, um eben nicht nur die Komplexität, sondern auch die Emotionen der Musik hörbar zu machen.
Mit den Göteborger Sinfonikern werden Sie in Hamburg auch in der Doppelrolle als Sängerin und Dirigentin auf der Bühne stehen. Sind Sie da singende Dirigentin oder dirigierende Sängerin?

Das ist auch wieder so eine Frage nach Labels, singende Dirigentin klingt doch fürchterlich, oder? Wenn ich singe, bin ich Sängerin; wenn ich dirigiere, Dirigentin. Beides zusammen mache ich übrigens gar nicht so oft.
Warum sind Sie überhaupt Dirigentin geworden, waren Sie als Sängerin nicht ausgelastet?
Mein Debüt als Sängerin habe ich sehr früh gegeben, mein Debüt als Dirigentin kam erst viel später, mit 38 oder 39, so um den Dreh. Es ging mir allerdings nicht darum, meinen Beruf zu wechseln, ich wollte einfach etwas erkunden, mich ausprobieren. Nach meinem Dirigierdebüt habe ich dann beschlossen, diesen Pfad weiterzugehen, ebenso wie den als Sängerin. Außerdem habe ich gemerkt, dass es sinnvoll sein kann, in Programmen beides zu kombinieren, weil ich so viel über das Dirigieren gelernt habe. Mir wurde klar, dass ich eine bessere Dirigentin war, wenn ich gleichzeitig gesungen habe. Warum? Weil der Atem eine bessere Verbindung her stellt. Als ich das herausgefunden hatte, fühlte ich mich als Dirigentin erst richtig wohl. Wenn ich nicht gut atme, wenn ich kein tiefes Gravitationszentrum habe, dann funktioniert mein Dirigieren nicht.
»Ich versuche, es leicht klingen zu lassen, damit das Publikum seine Aufmerksamkeit ganz der Musik schenken kann – nicht meinen Anstrengungen, die Herausforderungen der Musik zu meistern.«
›
Hat umgekehrt auch die Sängerin von der Dirigentin gelernt?
Am Anfang war mir gar nicht klar, wie sehr. Vor allem habe ich ein besseres Verständnis für das ganze Bild bekommen, für jedes einzelne Teil, nicht nur für meinen Part. Außerdem wuchs mein Respekt für bestimmte Dirigentinnen und Dirigenten, mit denen ich als Sängerin arbeite – zu verstehen, wie sie sich einer Partitur annähern und wie nahe sie ihr dabei kommen. Es hat meine Sichtweisen auf ganz vielfältige Weise verändert: Es hat meine eigenen Maßstäbe erhöht und ich hoffe auch mein Mitgefühl mit meinen Kollegen.
Wie klappt die Kommunikation mit dem Orchester, wenn Sie gleichzeitig singen, oft ja mit dem Rücken zum Ensemble?
Das Publikum sieht nur die Aufführung, die aber ist das Ergebnis eines intensiven Probenprozesses. In dem Moment, in dem wir die Bühne betreten, ist das, was ich als Dirigentin mache, vielmehr eine Erinnerung an die Übereinkünfte, die wir in der Probe geschlossen haben. Die Arbeit während der Probe ist eine ganz andere als bei der Aufführung, in der es dann nur noch um eine Serie von »kleinen« Signalen geht.
Bei Ihren Auftritten fällt auf, dass Sie sich viel bewegen, fast tanzen. Es sieht so aus, als ob Sie Musik mit dem ganzen Körper machen. Richtig, wobei da jeder seine eigene Art hat. Manche Kolleginnen haben eine eher feste Säule, meine hingegen ist flexibel. Vor allem wenn ich singe, fühlt sich das einfach besser für mich an. Ich bewege mich nicht wegen des Show-Effekts, sondern weil es ein inneres Bedürfnis ist.
Ihre Interpretationen haben oft eine fast physisch wahrnehmbare Intensität, sogar auf CD. Wie erreichen Sie die?
Ich versuche das durch eine möglichst tiefe Verbindung mit der Musik. Diese besondere Verbindung habe ich zum ersten Mal vor gut zehn Jahren gespürt – das Gefühl, dass die Tür zur Musik immer offen steht und ich nicht jedes Mal nach dem Schlüssel suchen muss. Manche er reichen dieses Stadium früher, andere später. Bei mir fand dieser Prozess statt, als ich um die 40 war. Das war eine sehr intensive Phase in meiner Laufbahn mit der Partie der Lulu, mit »Written on Skin« und dem Beginn meiner Karriere als Dirigentin. Ich habe mit fünf Jahren angefangen Musik zu machen, es waren also 35 Jahre des Investierens, bis ich wirklich das Gefühl hatte, zum Kern vorgedrungen zu sein.
Sie haben einmal gesagt, dass Sie von sechs Uhr morgens bis Mitternacht arbeiten. Für eine Sängerin ist das eher ungewöhnlich, die meisten schlafen länger, auch weil es der Stimme gut tut. Das Interview muss schon eine Weile her sein, auf jeden Fall vor der Corona-Pandemie. Aktuell bin ich nicht mehr in diesem Modus, da hat mir die Entschleunigung durch Covid schon auch gut getan. Wenn ich unter Druck bin, arbeite ich natürlich immer noch so lange es nötig ist. Ansonsten versuche ich, etwas länger zu schlafen.
WAGNER: SIEGFRIED
Mi, 8.2.2023 | 18 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal symphonieorchester des br, sir simon rattle, simon o neill, peter hoare, michael Volle, Georg nigl, barbara hannigan u. a. richard Wagner: siegfried (konzertante aufführung)
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Mi, 8.3.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal aphrodite patoulidou (sopran), Veronika eberle (Violine), barbara hannigan (Dirigentin), J. s bach / luciano berio: Contrapunctus xix aus »Die kunst der Fuge« (bearbeitung für orchester) alban berg: konzert für Violine und orchester »Dem andenken eines engels« Joseph haydn: sinfonie nr. 44 »Trauersinfonie« Claude Vivier: lonely Child für sopran und kammerorchester
ELECTRIC FIELDS
Fr, 14.4.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal barbara hannigan (sopran), katia und marielle labèque (klavier), David Chalmin (liveelektronik), netia Jones (inszenierung, liveVideo) ein multimedialer konzertabend mit musik von hildegard von bingen, barbara strozzi, Francesca Caccini, bryce Dessner und David Chalmin
Di, 2.5.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal barbara hannigan (sopran und leitung) igor strawinsky: pulcinella Jacques offenbach: Gaîté parisienne kurt Weill: youkali lost in the stars aus dem musical »lost in the stars«
PORTRAIT BARBARA HANNIGANAlles Gute zum Geburtstag, liebe Melitta Bentz! Dein Erfindungsreichtum, deine Entschlossenheit und deine Weitsicht bringen uns Kaffeetrinkern köstlich schmeckenden Kaffee.







Als John Eliot Gardiner vor bald achtzig Jahren, am 20. April 1943, in der Grafschaft Dorset im Südwesten Englands zur Welt kam, hing in dem Haus, in dem er aufwuchs, ein Bild von Johann Sebastian Bach. Nicht irgendeine Replik eines Gemäldes, sondern das berühmte Bach-Porträt von Elias Gottlob Haußmann, von dem es (was nicht allzu bekannt ist) zwei Versionen gibt, eine von 1746 und eine zwei Jahre jüngere. Beide zeigen den alten Meister mit gepuderter Perücke und einem Notenblatt in der Hand und unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch ihren Erhaltungszustand. Das etwas besser erhaltene zweite Porträt war im Familienbesitz eines jüdischen Musiklehrers aus Breslau, der zu Beginn des Krieges nach England geflohen war und das Bach-Bild der befreundeten Familie Gardiner zur Aufbewahrung anvertraut hatte.



So kam es, dass der kleine John Eliot seine Kindheit »unter den strengen Augen des Kantors« verb(r)achte. »Jeden Tag, bis ich zehn Jahre alt war, habe ich das Porträt angeschaut. Ich fand es ein bisschen pädagogisch, ein bisschen fremd, gleichzeitig habe ich als Knabe die Musik von Bach auswendig gelernt. Und es dauerte eine Weile, bis ich Bachs Blick und die Freude in seiner Musik in Einklang bringen konnte. Aber mittlerweile habe ich für mich eine Lösung gefunden.«
»Eine Lösung«, das klingt nach typisch britischem Understatement. Denn das Werk und das Wesen Bachs zu ergründen, ist seitdem so etwas wie Gardiners Lebensaufgabe. Heute gilt der Dirigent vielen als der bedeutendste Bach-Interpret überhaupt, zumindest in Bezug auf dessen Vokalwerk. Kaum einer, der tiefer und umfassender in die Musik des Barockkomponisten eingetaucht wäre. Doch nicht nur das: Gardiner gründete mehrere Ensembles und hatte als Pionier der historischen Aufführungspraxis enormen Einfluss auf die Musikwelt. Mittlerweile ist der längst in den Ritterstand erhobene Sir John einer der letzten Vertreter jener großen Generation von Pult-Stars, die diese spezielle, mitunter ehrfurchterregende Aura umgibt, wie sie eben nur ältere, männliche Dirigenten ausstrahlen – auch wenn er selbst einmal zu Protokoll gab: »Die Zeit für despotische Dirigenten ist zum Glück lange vorbei.«
Gardiners Kindheit war nicht nur von den strengen Augen Bachs bestimmt; auch das akademisch-intellektuelle Umfeld der Familie prägte ihn. Der Großvater war einer der bedeutendsten Ägyptologen seiner Zeit, der Vater ein Pionier der Bio-Landwirtschaft, der sich nebenbei für die Wiederbelebung von englischen Volkstänzen ›
Sir John Eliot Gardiner wird achtzig und zeigt in Hamburg, was er bis dato über Bach und Brahms herausgefunden hat.Der doppelte Bach: Elias Gottlob Haußmanns Portrait existiert in zwei Versionen – rechts die, mit der John Eliot Gardiner aufwuchs.
einsetzte. Noch heute betreibt Gardiner selbst einen Bio-Bauernhof mit 100 Rindern und 900 Schafen. Auch die Musik spielte eine große Rolle in seinem Elternhaus: »Ich hatte das Glück, in einer Familie von ambitionierten Hobbymusikern aufzuwachsen, für die Musik einfach zum täglichen Leben gehörte. Es war ganz selbstverständlich, dass man sang und Instrumente spielte.« So konnte er bereits als kleiner Junge die Sopranpartien von Bachs Motetten auswendig singen, was neben seinem deutschen Kindermädchen der Grund für sein nahezu perfektes Deutsch ist. Außerdem lernte er Klavier und Geige und wechselte später auf die Bratsche.
Zunächst begann Gardiner jedoch ein Geschichtsstudium am King’s College in Cambridge. Seine Leidenschaft für die Musik ließ allerdings nicht nach, und so nahm er im dritten Studienjahr eine Auszeit und sein erstes ehrgeiziges Großprojekt in Angriff: eine Aufführung von Claudio Monteverdis »Marienvesper«, die er seit seiner Kindheit kannte. Schon damals von genauen Klangvorstellungen geleitet, begab er sich auf die Suche nach Musikern und Sängern, mit denen er diese Vorstellungen umsetzen konnte. Es war die Geburtsstunde des Monteverdi Choir, in dem Gardiner zu diesem Zeitpunkt eher einen »Anti-Chor« sah – »als Gegenentwurf zum gesitteten, verschmelzenden Wohlklang, der zu meiner Zeit für den Chor des King’s College charakteristisch war«.
Die Aufführung im März 1964 war ein Achtungserfolg. Vor allem aber bestärkte sie Gardiner darin, sich fortan ganz auf das Dirigieren zu konzentrieren. Er setzte seine musikalischen Studien in London fort und zog anschließend nach Paris, um bei Nadia Boulanger zu studieren – jener bedeutendsten Musikpädagogin des 20. Jahrhunderts, bei der unter anderem auch Astor Piazzolla und Philip Glass ihr Handwerk lernten. Boulanger war zu diesem Zeitpunkt schon über 80 und fast blind, »aber die
Ohren waren fantastisch präzise«, erinnert sich Gardiner, der an die zwei Jahre in ihrer Klasse durchaus zwiespältig zurückdenkt: »Sie war sehr, sehr streng, sie hat mir wirklich wehgetan. Aber es war nötig, und ich bin heute sehr dankbar.«
Zurück in England, gründete er 1968 das Monteverdi Orchestra (aus dem zehn Jahre später die English Baroque Soloists hervorgingen), das zunächst, wie damals üblich, auf modernen Instrumenten spielte. Für Gardiner, der weiterhin nach seinem barocken Klangideal suchte, wurde dies zunehmend zum Problem: »Ich war an einen Punkt gelangt, an dem ich in meinem Bemühen, jene Klangwelt zu kreieren, die ich suchte, nicht mehr weiterkommen konnte. Uns blieb nur eines: ein Neuanfang mit originalen oder nachgebauten Barockinstrumenten.«

Gardiner war zwar nicht der erste, der Musik mit Instrumenten aus ihrer jeweiligen Entstehungszeit aufführte (vor ihm taten dies bereits Nikolaus Harnoncourt in Österreich und der Niederländer Gustav Leonhardt), doch war er damit seinerzeit noch immer eine große Ausnahme. Und er war derjenige, der die historische Aufführungspraxis auf die Werke der Klassik und Romantik ausweitete, um sie von der »Karajan-Soße« zu befreien, wie er es einmal in einem Interview beschrieb.
Zu diesem Zweck rief Gardiner anlässlich des 200. Jahrestags der Französischen Revolution 1989 noch ein weiteres Orchester ins Leben: das Orchestre Révolutionnaire et Romantique, das ebenso wie seine anderen Ensembles zunächst misstrauisch beäugt wurde. »Die Leute haben eine Vorstellung, wie ein Orchester zu klingen hat – und da kamen wir: wirklich als Pioniere, die versuchten herauszufinden, wie Beethoven, Berlioz oder Schumann im Kontext ihrer Zeit geklungen haben könnten. Das war eine ganz neue und radikale – tatsächlich revolutionäre – Herangehensweise an die Musik des 19. Jahrhunderts.«
Mit seinen verschiedenen Ensembles konnte Gardiner im Laufe der Zeit zahlreiche vielbeachtete Großprojekte umsetzen – meist zu besonderen Anlässen. So brachte er 2017 zum 450. Geburtstag Monteverdis dessen drei überlieferte Opern als Zyklus in mehreren Städten auf die Bühne. 2019, zu Hector Berlioz’ 150. Todestag, spielte er sich allerorts durch das Kernrepertoire des französischen Romantikers. Seine wichtigste musikalische Unternehmung jedoch fand im Jahr 2000 statt: Zu Bachs 250. Todestag führte Gardiner innerhalb eines Jahres sämtliche Bach-Kantaten auf, rund 200 an der Zahl. Diese »Bach Cantata Pilgrimage« führte ihn und seine Ensembles durch ganz Europa und die USA . Und sie brachte ihm die Person Bach ein Stückchen näher: »Endlich hatte ich einen möglichen Hinweis auf die Lösung des Rätsels gefunden, wie diese vor Energie und Einfallsreichtum sprühende Musik unter der Perücke jenes teilnahmslos wirkenden Kantors entstehen konnte, dessen Porträt seit meiner Kindheit mein Bild von ihm als Mensch geprägt hat.«
Bei klassischen Sinfonieorchestern hingegen eckte Gardiner mit seinem Ehrgeiz und seinen ambitionierten Vorstellungen auch immer wieder einmal an. Seine Posten als Chefdirigent unter anderem in Vancouver und an der Oper in Lyon waren zwar nicht ohne Erfolg, blieben aber eher kurze Episoden seiner Karriere.
Fast vergessen ist heute, dass er Anfang der Neunziger für drei Spielzeiten auch das NDR Sinfonieorchester (das heutige NDR Elbphilharmonie Orchester) leitete. Eine Zeit, auf die man in Hamburg mit gemischten Gefühlen zurückschaut. So erinnert sich der Erste Konzertmeister Stefan Wagner: »Damals war es – anders als heute – ein Novum, dass ein Dirigent aus der Szene der historischen Aufführungspraxis die Leitung eines großen traditionellen Rundfunksinfonieorchesters übernimmt. Leider war diese Verbindung dann auch nicht so dauerhaft, wie man es sich erhofft hatte, es gab zwischen Dirigent und Orchester allmählich immer größere Spannungen.« Auch auf der Orchester-Webseite liest man von einem »arbeitswütigen Perfektionisten, der unter Zeitund Erfolgsdruck unduldsam werden konnte«, aber ebenso von einem »freundlichen, humorvollen Menschen«. Den Vertrag beendete Gardiner schließlich ein Jahr früher als geplant. Dennoch sieht er die Zeit im Rückblick als Gewinn: »Das Orchester und ich haben hart und, wie ich glaube, wirklich erfolgreich gearbeitet, und unsere Konzert- und Schallplattenaufnahmen beweisen es.«
Wenn Gardiner nun rund um seinen 80. Geburtstag für insgesamt drei Konzerte nach Hamburg zurückkehrt, ist er sowohl mit seinen eigenen Ensembles als auch als Gastdirigent eines großen Sinfonieorchesters zu erleben:

Mit dem Concertgebouworkest führt er die vier Sinfonien von Johannes Brahms auf, der ihm nicht nur am Herzen liegt, »weil er eine so ausdrucksvolle und leidenschaftliche Musik geschrieben hat«, sondern auch, weil er »ein
Forscher war, der sehr viel selbst transkribiert und dirigiert hat. Einer der ersten Historiker unter den Komponisten«.
Das passt zu Gardiner, dem wohl größten Historiker unter den Dirigenten. Und damit noch einmal zurück zu Johann Sebastian Bach. 2013 veröffentlichte Gardiner sein sehr persönliches Buch »Bach. Musik für die Himmelburg« – auch so ein Großprojekt, in dem der »lebenslange Bach-Student«, wie er sich selbst darin bezeichnet, auf rund 700 Seiten den Versuch unternimmt, »den Menschen über sein Werk kennenzulernen«. Es ist ein weiterer Baustein auf dem Weg, die Person Bach mit seiner Musik in Einklang zu bringen. Vom Cover des Buches blicken die strengen Augen des Kantors.
H-MOLL-MESSE
Do, 13.4.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal english baroque soloists, monteverdi Choir Johann sebastian bach: messe hmoll bWV 232
BRAHMS 1 & 3
So, 7.5.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal Concertgebouworkest
Johannes brahms: sinfonie nr. 1 cmoll sinfonie nr. 3 FDur
BRAHMS 2 & 4 Mo, 8.5.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal Concertgebouworkest
Johannes brahms: sinfonie nr. 2 DDur sinfonie nr. 4 emoll
2023 wird das Jahr der Mandoline. Und das heißt, es wird abwechslungsreich.
V on RENSKE STEEN

Sie ist das, was wahre Auskenner im Sport voller Achtung eine vielseitige Mittelfeldspielerin nennen würden: Sie schießt selten die spektakulären Tore, drängt sich kaum je als Solistin in den Vordergrund und rettet ihre Mannschaft nicht unbedingt mit brutalen Blutgrätschen vor Gegentreffern; dafür aber ist sie, nach allen Seiten agil, beinah universell einsetzbar und bildet so eine sichere, verlässliche Basis, ohne die im Sport wie in der Musik letztlich gar nichts geht. Mit dieser nicht zu unterschätzenden Qualität hat es die Mandoline auf eine lange, bewegte Geschichte gebracht –und auf eine lebendige Vielfalt in der Gegenwart (die wahre Auskenner natürlich keineswegs überrascht).
2023 wird das Jahr der Mandoline. So hat es der Landesmusikrat Schleswig-Holstein entschieden, der seit 15 Jahren das Instrument des Jahres kürt. Inzwischen haben sich alle weiteren Landesmusikräte angeschlossen und feiern das Instrument nun zwölf Monate lang inklusive Schirmherren, Konzerten, Workshops und allem Drum und Dran. Auch in der Elbphilharmonie wird die Mandoline in Szene gesetzt. Und wie es sich für eine vielseitige Mittelfeldspielerin gehört, bieten die einzelnen Konzerte eine erstaunlich breite Palette an Stilen, Epochen und Genres, von Barock und Bluegrass bis hin zum Zupforchester.
Die Mandoline gehört zur Gruppe der Lauten und damit zu einer der ältesten Instrumentenfamilien, die wir kennen. Seit nachweislich über 5000 Jahren (und vermutlich schon viel länger) existieren Lauten, traditionell bestehend aus einem meist runden oder mandelförmigen Korpus und einem angesetzten Hals mit Bünden, der abgeknickt oder gerade gebaut sein kann. Lange Zeit wurde sie mit einem Plektron gezupft; seit etwa tausend Jahren hat sich allerdings auch eine andere Technik etabliert, in der sie mit den Fingerkuppen gespielt wird. Seit dem frühen 17. Jahrhundert zählt auch die Mandoline zu dieser über die ganze Welt verteilten Familie der Lauteninstrumente. Entwickelt wurde die kleine Cousine in Italien, wo sie einen wahren Trend auslöste, der schnell in Richtung Paris und später auch nach Wien wanderte. Wer seinerzeit jung und reich war, spielte Mandoline. Die Komponisten schrieben eigens Werke für das modisch-musikalische Must-have, aber natürlich ließ sich auch jeder Gassenhauer und jeder OpernSchlager ganz hervorragend auf dem handlichen und nicht allzu komplizierten Instrument interpretieren. Dass die Mandoline vor allem als ein Instrument für Laien und Liebhaber gesehen wird, ist also eine schon sehr früh offenbarte Eigenschaft – die sich seit der vorletzten Jahrhundertwende bis in die Breitentauglichkeit ›

ausweitete. Damals, in den Anfängen der WandervogelBewegung in und um Berlin, entdeckte man die Mandoline als transporttaugliches Wanderlied-Begleitinstrument; wenig später, in den Zwanzigern und Dreißigern, gründeten vor allem Frauen sogenannte Zupfclubs, in denen gemeinsam Mandoline (und die verwandten Instrumente wie Mandola oder Cister) gespielt wurde. Auch nach dem Krieg blieben Mandolinenorchester für Amateure in Ost wie West sehr beliebt – und natürlich auch in Nord, wie das Norddeutsche Zupforchester mit seinem Auftritt in der Elbphilharmonie zeigen will.
Trotz dieser vielen Zupforchester, in denen Menschen miteinander klampfen, die im Zweifel gar nicht Noten lesen können müssen, gibt es bis heute weltweit nur eine einzige Hochschul-Professur für Mandoline, und zwar an der Hochschule für Musik und Theater in Köln. Caterina Lichtenberg ist diese einzige Professorin, und bei ihr dreht sich fast alles um die europäische Mandoline, die sie auch bei ihrem Konzert in der Elbphilharmonie spielen wird. Dieses Instrument, dessen rund gewölbter Rücken ohne Zargen auf die flache Decke trifft, wird nach seiner Herkunft auch Neapolitanische Mandoline genannt.
Als Gegenstück dazu – und man kann die Grenze wirklich entlang von E- und U-Musik ziehen – gibt es die Flachmandoline: Ende des 19. Jahrhunderts saß in den USA in fast jedem Saloon jemand, der oder die Mandoline spielte. Der berühmte Gitarren-Bauer Orville Gibson erkannte das (für ihn vor allem finanzielle) Potenzial und entwickelte einen Bautyp, der eine flache Decke und einen flachen Boden durch einen Zargen miteinander verbindet, ähnlich wie bei Gitarre und Violine. Dieser Typus war günstiger herzustellen, entsprach im Klang noch mehr den damaligen Gewohnheiten und drängte nach und nach die klassische Mandoline an den Rand.
Mike Marshall, der zusammen mit Caterina Lichtenberg in der Elbphilharmonie auftreten wird, spielt auf genau so einer Flachmandoline. Gemeinsam zupfen sich die beiden durch die Jahrhunderte, von den canzone der ragazzi nobili im Florenz des 17. Jahrhunderts bis hin zu jener Musik, die heute wohl die meisten Menschen mit der Mandoline verbinden: dem Bluegrass.
Was klingt wie die Feierabendmusik für Tabak kauende Cowboys nach Dienstschluss in der Bar, ist tatsächlich Ende der 1930er-Jahre in den Bergen rund um Tennessee und Kentucky entstanden, mit Wurzeln in der irischen Folklore ebenso wie in afroamerikanischer Tanzmusik und dem Gospel. Und die Mandoline spielt eine zentrale Rolle in jeder guten Bluegrass-Band. Sie übernimmt entweder die Melodiestimme oder ist zusammen mit dem Kontrabass für den charakteristisch treibenden Rhythmus zuständig.
Weit weniger bekannt ist hierzulande, dass ungefähr zur selben Zeit, da der Bluegrass entstand, 7000 Kilometer weiter südöstlich ein gewisser Jacob Pick Bittencourt das Bandolim für sich entdeckte. So heißt die Mandoline auf Portugiesisch. Eigentlich verdiente Bittencourt sein Geld als Verkäufer, Versicherungsmakler undPolizeisekretär, seine Liebe aber galt der Mandoline, für die er zahllose Kompositionen schrieb. Ihm ist es zu verdanken, dass dieses Instrument eine so wichtige Rolle in der brasilianischen Musik spielt.
Heute ist Hamilton de Holanda einer der berühmtesten Mandolinen-Spieler der Música Popular Brasileira. Zusammen mit dem südafrikanischen Pianisten Nduduzo Makhathini spürt er in der Elbphilharmonie den afrikanischen Wurzeln im brasilianischen Choro nach, die denen im Bluegrass gar nicht unähnlich sind. Dabei verwendet

oder
das ist die Frage, wenn es um den Unterschied zwischen europäischer und amerikanischer Mandoline geht.
er eine ungewöhnliche Bauform des Instruments: Während Mandolinen klassischerweise mit vier Saitenpaaren, sogenannten Saitenchoren, bespannt sind, ist sein Bandolim fünfchörig, was es ihm ermöglicht, Melodie und Bassstimme auf einem Instrument zu spielen. Die Stimmung ist aber auch bei de Holandas erweitertem Instrument ganz mandolinenüblich, nämlichim Quintabstand, also wie bei der Geige. Der historische Grund für die Doppelchörigkeit der Mandoline liegt übrigens ganz einfach in der Steigerung der Lautstärke. Ursprünglich zupfte man die Saitenpaare mit einem Federkiel oder mit den Fingern. Beides schien nicht sonderlich tauglich gewesen zu sein, und so kam im 18. Jahrhundert der Gebrauch des Plektrons auf, kleiner Plättchen aus Schildpatt, später aus Horn und mittlerweile meist aus Kunststoff. Dennoch: Wie bei allen gezupften Instrumenten, verhallt so ein Mandolinenton schnell. Lange ausgehaltene Töne kann man auf diesem Instrument eigentlich gar nicht realisieren. Seit dem 18. Jahrhundert ist für die Mandoline das Tremolo, also das rasch wiederholte Anschlagen der Saite auf demselben Ton nachgewiesen. Und längst ist es so etwas wie das Markenzeichen des Instruments.
Und das führt uns zu einem der derzeit größten Virtuosen der Mandoline, zu Avi Avital. Der 1978 in Israel geborene Musiker vermochte auch das traditionelle Konzertpublikum davon zu überzeugen, die Mandoline als klassisches Instrument ernst zu nehmen. Er spielt das bestehende barocke und klassische Repertoire, arrangiert aber auch Geigensonaten um und bringt zudem viel Folklore mit in seine Programme.
Der Mann birst vor Musikalität. Nur eines hat er nie so richtig gelernt: wie man ein Plektrum »richtig« hält.
Sein erster Mandolinen-Lehrer in seiner Heimatstadt Be’er Sheva war nämlich ein Geiger und hatte sich als solcher eine ganz individuelle Spieltechnik angeeignet, die er dem jungen Avi vermittelte. Erst viel später, als Student in Padua, lernte Avital durch seinen ersten echten Mandolinen-Lehrer die »korrekte« Handhabung. Heute findet sich in seinen Hosentaschen stets eine ganze Auswahl verschiedener Plektren, die er dann beim Spielen mal so, mal so einsetzt. Alles ist möglich, alles darf, auch da ist die Mandoline einfach vielseitig.
AVI AVITAL


Mi, 15.2.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal between Worlds ensemble, rustavi Choir »black sea«: musik von komitas, sulkhan Tsintsadze, rimskikorsakow sowie georgische Volkslieder
HAMILTON DE HOLANDA
Di, 25.4.2023 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal nduduzo makhathini (klavier) »routes of Discovery«
So, 28.5.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal alexander puliaev (Fortepiano) »mandolin magic«: eine musikalische liebesgeschichte durch stile und epochen
ZUPFORCHESTER
So, 29.1.2023 | 11 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Faszination mandoline: orchestermusik von barock bis modern
»Es ist ganz einfach: Wer es schafft, einen Draht zum Publikum zu finden, ist für mich modern«, sagt Cristina Gómez Godoy. Für die Oboistin aus Andalusien wurde ein Traum wahr, als sie mit 21 Jahren in die Staatskapelle Berlin berufen wurde. Seit zehn Jahren spielt sie dort Erste Oboe, unterrichtet parallel an der Uni, gibt Meisterklassen und gastiert als Solistin bei anderen Orchestern. Ob sie auch ein Privatleben hat? Gómez Godoy schmunzelt. »Es ist sicherlich schwieriger geworden mit der Work-Life-Balance.« Druck empfindet sie auch durch die sozialen Medien. »Wie leicht stellt sich das Gefühl ein, man müsse pausenlos arbeiten und posten, um erfolgreich zu sein. Sicher haben diese Plattformen enorm dazu beigetragen, Musik zugänglicher zu machen. Was man online aber nicht kaufen kann, ist Reife. Dafür muss man die Welt sehen, neugierig sein, mit Menschen – auch anderer Generationen – sprechen, reisen, manchmal auch leiden. Und das braucht Zeit.«
Caspar Vinzens ist noch keine 30, spielt aber schon fast sein halbes Leben lang im Aris Quartett. Vier Jugendliche waren sie damals; ein Lehrer an der Musikhochschule steckte sie kurzerhand zusammen. Das Experiment entpuppte sich als Glücksfall: Anna KatharinA, CaspaR, NoémI und LukaS – kurz »Aris« – wuchsen zusammen, wurden im Quartett erwachsen. Modern sein beginnt für Vinzens vielleicht auch deshalb bei der Ensemblekultur: »Wir sind eine demokratische Gruppe; wichtige Entscheidungen werden nur einstimmig getroffen.« Modern sein bedeutet heute aber auch, sich auf Instagram und Youtube zu präsentieren. »Junge Menschen zu erreichen, das ist ein ganz großes Thema. Allerdings erregt in den sozialen Medien oft nicht die beste Qualität am meisten Aufmerksamkeit, sondern die effektivste Selbstdarstellung. Inhalte verflachen und Algorithmen bestimmen, was sich verkaufen lässt.« Das Repertoire seines Quartetts bleibt davon unberührt. »Ich lasse mich lieber als ›unmodern‹ bezeichnen, als auf Meilensteine der Musikgeschichte zu verzichten.«

»Musik beginnt nicht pünktlich um 8 Uhr morgens und hört nicht nach Feierabend auf«, sagt Anna Katharina Wildermuth, die Primaria des Aris Quartetts, übers moderne Künstlerdasein. »Wir sind nie fertig mit Proben und Üben, es gibt fast immer noch etwas, was zu verbessern wäre. Wichtig ist, dass wir unserem Alltag eine Struktur geben. Wann habe ich Zeit für mich? Wann darf ich das Instrument einmal ohne schlechtes Gewissen weglegen?« Zeitgemäß zu sein bedeutet für Wildermuth zweierlei. Erstens: Es braucht Empathie. »In der Kammermusik sind wir darauf gepolt, sozial zu denken, die Einzelinteressen in den Hintergrund zu stellen. Nur so kommen wir vorwärts.« Zweitens: »Offen sein für neue Formate und Ideen«, auf die Bedürfnisse einer rasend sich verändernden Gesellschaft reagieren. »Wir leben in immer komplexeren Zeiten. Wir Musikerinnen können die aktuellen Probleme nicht mehr aus unserem Berufsleben ausblenden.«


Was macht einen modernen Musiker aus? Die jungen »Rising Stars« geben Auskunft.

»Gillam verbreitet Freude«, so lautet die einfachste und zugleich treffendste Kritik, die über die Saxofonistin Jess Gillam geschrieben worden ist. Die Britin ist die neue Botschafterin des Saxofons. Sie performt Bach und Bowie, Schostakowitsch und Radiohead und moderiert auf BBC Radio 3 ihre eigene Wochenshow mit klassischer Musik. All das tut sie nicht nur mit unbestreitbarer Virtuosität, sondern auch mit einer so ansteckenden Begeisterung, dass sich die Schar ihrer (auch jungen) Fans in den letzten Jahren vervielfacht hat: 30.000 Follower auf Instagram, eine Viertelmillion monatliche Aufrufe auf Spotify. Gillam will das Saxofon in all seiner Vielfalt zeigen und dabei alle mitnehmen. Modern ist das zweifellos. Ihr aber geht es um etwas anderes: »Unsere wichtigste Aufgabe ist in meinen Augen, mitfühlend und empathisch zu sein. Für mein Publikum versuche ich, eine magische Welt zu erschaffen – eine andere Wirklichkeit.«



Für den britischen Bariton James Newby ist das mächtigste Instrument eines Musikers sein eigener Gefühlshaushalt. »Ich erinnere mich an ein Erlebnis während meines Studiums. Ich war in einem Proberaum und wollte ein Lied üben, aber fühlte mich irgendwie mies. Beim Blick auf den Liedtext begriff ich auf einmal, dass dort exakt beschrieben stand, was ich in dem Moment empfunden habe. Das hat mich umgehauen.« Diesen Effekt will Newby an sein Publikum weitergeben. »Ich versuche, beim Singen meine eigenen Geschichten zu erzählen –wenn ich das tue, bin ich als Künstler zwangsläufig modern. Alles andere als zeitgemäß finde ich dagegen einige Vorgänge in der Opernwelt, etwa wenn sich Weiße das Gesicht schwarz anpinseln. Es muss mehr getan werden gegen Diskriminierung –ob nun rassistischer oder sexistischer Art.«
»Wenn ich daran denke, wie wenige Zuhörer die klassische Musik erreicht – verglichen mit Genres wie Pop und Rock –, stellen sich mir viele Fragen.« Die ukrainische Geigerin Diana Tishchenko wird nachdenklich beim Thema Zukunftsmusik. »Ich habe schon oft Dinge gehört wie ›Ich verstehe ja nichts von klassischer Musik‹ oder ›Ich bin nach der Arbeit zu müde für ein Konzert‹. Wir müssen solche Hemmungen abbauen.« Tishchenko träumt von neuen Formaten: weg von der steifen Sitzposition, weg vom verkrampften Image. »Ich mag es zum Beispiel, im Dunkeln zu spielen. Wir hören ganz anders, wenn die Augen nicht so aktiv sind. Ich stelle mir ein Konzert bei Kerzenlicht vor, unterm Sternenhimmel.« So ähnlich hat sie das kürzlich schon in die Tat umgesetzt – am Strand von Royan im Südwesten Frankreichs und auf der unbewohnten griechischen Insel Delos.«
Höher, schneller, lauter: Vanessa Porter erfüllt kein einziges dieser SchlagzeugerKlischees. Die Perkussionistin nutzt ihr Instrumentarium wie einen Farbkasten. Mit Gongs, Metallofonen und Trommeln erzählt sie Geschichten, erzeugt Stimmungen wie im Film. Seit Corona wählt sie ihre Programme mit noch mehr Bedacht. »Wir stecken mitten in einer großen Veränderung der Musikbranche. Viele Künstlerinnen und Künstler haben aufgegeben oder umgeschult. Geld für Kunst wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht mehr so abrufbar sein wie bisher.« Das kreidet Porter weder der Politik noch dem Publikum an. »Wir Künstler haben zum Teil den Anschluss an die Gesellschaft verloren. Wir halten an einem Konzertformat fest, mit dem viele Leute nichts mehr verbinden.« Was aber braucht eine Künstlerin heute? »Wir müssen wieder Nähe zum Publikum gewinnen«, meint Porter. »Ein Konzert sollte ein Wohlfühlort sein, wie ein guter Film oder ein gutes Buch.«
RISING STARS
Mo, 23.1., bis Sa, 28.1.2023
Elbphilharmonie Kleiner Saal sechs nachwuchsstars, nominiert von den großen konzerthäusern europas, treten innerhalb einer Woche in der elbphilharmonie auf.
Der Pianist Gerald Clayton verbindet die Generationen und Stile zwischen groovendem Nu-Jazz und klassisch inspirierter Kammermusik.
VON JAN PAERSCHWer an Kalifornien und Musik denkt, hat die Beach Boys im Kopf, vielleicht noch The Mamas & The Papas, die Red Hot Chili Peppers oder die Westcoast-Rapper um Snoop Dogg. Aber Jazzmusiker? Da dürften selbst Kenner ins Grübeln kommen. Dabei wuchs das Kontrabass-Genie Charles Mingus in Los Angeles auf, und auch die Saxofonisten Eric Dolphy sowie der 50 Jahre später zu Ruhm gekommene Kamasi Washington stammen von dort. Und dann ist da noch die Familie Clayton. Die Brüder John und Jeff wurden in den Fünfzigern in Venice Beach geboren, in Baseballwurfweite vom Strand entfernt. Jeff wurde ein gefragter Saxofonist, John ein geschätzter Kontrabassist, der sich bald auch als Arrangeur für Popstars einen Namen machte. Sein Sohn sollte später die gleiche Berufung verspüren. Sein Name: Gerald Clayton. Der Pianist hat als Interviewtermin 7 Uhr morgens Pacific Daylight Time vorgeschlagen. Die frühe Uhrzeit hat nichts mit einem übervollen Terminkalender zu tun: »Ich wollte einfach gleich morgens surfen gehen und für das Interview keine Pause einlegen müssen.« Clayton, der 1984 während eines Auslandsaufenthaltes seines Vaters im niederländischen Utrecht geboren wurde, lebt seit ein paar Jahren wieder am Pazifik. Sein Haus liegt in El Segundo, unweit des Ozeans, südlich des riesigen Flughafens
von Los Angeles. In der Mega-City machte er einen Klavier-Bachelor, ehe er 2007 nach New York City zog. Die unumstrittene Welt-Hauptstadt des Jazz ist für junge Musiker ein Sehnsuchtsziel – wenn auch eines mit knallharten Regeln: Wohl nirgendwo sonst treten selbst gestandene Profis für 50 Dollar Gage auf. Clayton behauptete sich. An der Manhattan School of Music war er Schüler von Kenny Barron, der Respekt der Szene wuchs. Doch der Erfolg kam erst, als er, wie schon sein Vater, über den Jazz hinaus dachte. Sein lyrisches Spiel erregte die Aufmerksamkeit erfolgreicher Crossover-Künstler, und so trat Gerald Clayton bald mit Diana Krall und Michael Bublé auf.
Wichtiger war ihm jedoch die enge Zusammenarbeit mit einem 2018 früh verstorbenen Trompeter, der es wie kein zweiter verstand, virtuosen Hard Bop mit Funk, R&B und Hip-Hop zu verbinden: Roy Hargrove. »Roy hat nie einen Song vergessen, den er einmal gelernt hat, selbst 20 Jahre später nicht«, erinnert sich Clayton. »Er hatte riesige Ohren! Und er erwartete von allen, die mit ihm spielten, mit seinem Tempo mitzuhalten. I’m gonna play it once – open up your ears! So war Roy, und dieses Level an Musikalität durfte ich drei Jahre lang erleben. Roy hat dieses Prinzip gelebt: Stell dir immer vor, es wäre die letzte Show, die du spielst.«

Seine Offenheit für verschiedene Genres verschaffte Gerald Clayton auch die Bekanntschaft einer weiteren Jazz-Größe: Seit 2013 ist er fester Sideman beim Saxofonisten Charles Lloyd; im vergangenen Jahr ist er mit dieser Ikone der Woodstock-Generation auch schon in der Elbphilharmonie aufgetreten. »Bei manchen Musikern geht es beim Spielen nicht darum, sich mit Soli abzuwechseln«, kommentiert Clayton die Zusammenarbeit mit seinem 84-jährigen Mentor. »Es ist vielmehr ein gemeinsamer Tanz. Nach jeder Show mit ihm gehe ich von der Bühne und frage mich: Was zum Teufel war das gerade? Ich fühle mich wie in Trance, ich habe keine Ahnung, was passiert ist.«

Nun ist Charles Lloyd auch einer der Gäste auf Claytons aktuellem Album »Bells on Sand«. Die Glocke im Titel sieht der Kalifornier als Metapher für das Leben, den Sand als Sinnbild für eine Umwelt, in der alles in unaufhörlicher Bewegung ist: »Alles was uns umgibt, auch unsere Songs und Geschichten, unterliegt stetiger Veränderung. Wer nach neuen Verbindungen sucht, sollte einen Schritt zurücktreten. Die Dinge aus dieser weiteren Perspektive betrachten. Die Lehren aus der Vergangenheit berücksichtigen, um die Gegenwart so zu leben, dass sie der Zukunft dient.«
Für die Zukunft stehen dabei junge Musiker wie die portugiesische Sängerin Maro und der Schlagzeuger Justin Brown. Gegenwart und Vergangenheit wiederum werden auf dem Album von Vater John repräsentiert, der auf drei Songs sein charakteristisches Bogenspiel auf dem Kontrabass einbringt. »Mein Vater und ich spielen zusammen, seit ich ein kleines Kind bin. Ich musste ihn aus musikalischen und aus persönlichen Gründen einladen. Dass er auf dem Album dabei ist, ist eigentlich keine große Sache – und irgendwie dann doch.«
»Bells on Sand« ist ein überraschend zurückhaltendes Statement – das selbstbewusst minimalistische Programm eines Musikers, der schon lange niemandem mehr etwas beweisen muss. Mit »Life Forum« zeigte
Clayton 2013 seine Nähe zum Pop, für den Hard Bop stand die darauf folgende Quintett-Platte »Tributary Tales«. Der Gerald Clayton des Jahres 2022 traut sich auch an die klassischen Werke des katalanischen Komponisten Frederic Mompou (1893–1987) heran, dazu kommen meditative Duo-Songs, Solo-Einspielungen und groovender Nu-Jazz im Trio. »Wenn ich Songs schreibe, habe ich nicht das Gefühl, den Prozess kontrollieren zu können«, sagt der Pianist. »Mein Spiel ist nicht geplant, es ist eher so: Das ist die Musik, lass mich ihr dienen, so gut ich es kann.«
Am Schluss von »Bells on Sand« steht eine weitere Geste in Richtung Vergangenheit: »There Is Music Where You’re Going, My Friends« ist eine Komposition seines 2020 verstorbenen Onkels Jeff. Im Internet findet sich das Video eines Auftritts aus dem Jahr 1996, den der Saxofonist allen verstorbenen Jazzern widmete. Jeff Clayton beteuert da, er glaube an einen Jazzhimmel, in dem auch ein Jazzclub mit bis in alle Ewigkeit währenden Jamsessions existiere. Der Neffe interpretiert nun diese Ballade mit viel Gospel-Emphase ganz allein am Flügel – ein schlichtes Statement, ganz ohne Schnörkel oder Virtuosengehabe.
Ob solo oder in der Trio-Besetzung, mit der er im März in Hamburg auftreten wird: Das freie Improvisieren liegt dem Pianisten. Beim Versuch, diese für den Jazz so essenzielle Kunst zu erklären, bedient sich Gerald Clayton einer Metapher, die mit seiner neuen alten Heimat Kalifornien untrennbar verbunden ist: »Klavier spielen ist wie Surfen: Du legst los und hoffst, ein paar Wellen zu erwischen.«
GERALD CLAYTON TRIO
Di, 14.3.2023 | 20 Uhr Laeiszhalle Kleiner Saal »bells on sand«
Gemeinsamer Tanz: im Duo mit Charles Lloyd beim Monterey Jazz Festival (2014) m MEHR ZUM THEMA JAZZ FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/ALLTHATJAZZBERCEUSEN Die Gattung steht historisch eher am Rande, dabei haben die stilisierten Wiegenlieder musikalisch einiges zu bieten.
Dietrich Fischer-Dieskau, der Bariton gilt als einer der wegweisenden Sänger des 20. Jahrhunderts.

Im Konzertleben und auf dem Tonträgermarkt besitzt Mozarts Jupiter-Sinfoniee bis heute eine Ausnahmestellung
Mit der Schauspielmusik zu Goethes Egmont entdecken August Zirner und Dirigent John Fiore ein gern übersehenes Werk von Beethoven wieder.
Musikalisch bilden Anne-Sophie Mutter und Pablo Ferrández schon seit Längerem ein musikalisches Doppel.

Eine Würdigung zum 80. Geburtstag des Dirigenten, Pianisten und politischen Aktivisten Daniel Barenboim.

Die Sopranistin Katharina Ruckgaber erzählt mit Liedern die Geschichte eines Mordes und seiner Hintergründe. www.fonoforum.de

Wenn Leila Schayegh musiziert, wirkt das wie ein intensives persönliches Zwiegespräch mit ihrer Geige. Immer wieder gleitet ihr Blick über das Instrument, ihre Mimik scheint zu antizipieren, welche Klangnuance sie als nächstes hören will. Und die wortlose Kommunikation funktioniert bestens: Hauchfeines Wispern, zartes Vibrato, kraftvolle melodische Linien – Schayegh entlockt ihrer Geige einen nicht enden wollenden Strom reich modulierter und in allen Facetten schillernder Klänge.

Dabei ist das, was bei der Schweizerin so spielerisch und leicht wirkt, in Wahrheit haarscharfe musikalische Präzisionsarbeit. Oft sind es winzige Details, die den entscheidenden Unterschied ausmachen: der Druck des Bogens auf die Saiten, das Strichtempo, minimale Veränderungen in der Position des Instruments. Denn Schayegh spielt keine »normale« moderne Geige, sondern eine mit Darmsaiten bespannte Barockgeige. Und diese verlangt nicht nur eine deutlich andere Spieltechnik als ihre moderne Nachfolgerin, mit Auswirkungen auf Körper-, Armund Bogenhaltung; im Grunde hängt an dieser Instrumentenwahl sogar eine ganze musikalische Lebensphilosophie: die historische Aufführungspraxis.
Deren Kernfrage, wie die Musik früherer Epochen zu ihrer Entstehungszeit geklungen habe, betrifft letztlich alle Bereiche des Musizierens, vom Instrumentenbau über Stimmungssysteme und Spielweisen bis hin zu Notation, Aufführungsorten, ja sogar der Aufstellung der Musiker im Raum. Irgendwann gegen Ende ihres klassischen Geigenstudiums wurde auch Leila Schayegh von der Faszination an dieser Frage gepackt. Sie besuchte einen Meisterkurs bei dem Barockviolinisten John Holloway, der unentwegt nachfragte, nachhakte, nachbohrte – und so den Grundstein für ihr musikalisches Denken legte: »Ich verstand erstmals, dass es in der Musik nicht nur darum gehen kann, was mir gefällt, sondern dass man den ganzen historischen und musikgeschichtlichen Kontext kennen muss, um auf Antworten zu stoßen, die ein plausibles Ganzes ergeben.«
Ein noch schärferer Wind wehte bei Sigiswald Kuijken, einem der Pioniere der historischen Aufführungspraxis: Er nahm Schayeghs Spiel bei einem öffentlichen Kurs mit kritischen Fragen von vorne bis hinten auseinander. »Jahre später habe ich erfahren, dass das Publikum furchtbar Mitleid mit mir hatte«, erinnert sich die Künstlerin – empfand die Situation damals selbst allerdings ganz anders: »Ich war von dieser Denkweise eingenommen, fasziniert und wie entzündet.«
Die Begegnungen mit Holloway und Kuijken wurden zu den prägenden Momenten im künstlerischen Werdegang Schayeghs. So studierte sie nach ihrem ersten Abschluss an der modernen Geige auch gleich noch Barockgeige bei der Violinistin und Dirigentin Chiara Banchini an der renommierten Schola Cantorum Basiliensis – und lernte dort zweierlei. Zum einen das diffizile Spiel auf der Barockgeige: »Es braucht ziemlich viel Fingerspitzengefühl, um eine Darmsaite mit der richtigen Mischung aus Gewicht und Bogengeschwindigkeit zum Schwingen zu bringen.« Dafür sind die musikalischen Gestaltungsmöglichkeiten dann aber auch immens: »Da die Darmsaiten sehr viel schneller als Stahlsaiten auf Druck- und Gewichtsänderungen reagieren, kann man die musikalischen
›
Leila Schayegh taucht tief in die Vergangenheit ein – mit einem sehr modernen Gedanken.
VON JULIANE WEIGEL-KRÄMER
Details viel genauer ausarbeiten. Das ist stilistisch auch durchaus erwünscht: Jeder Ton soll gestaltet und verschönert werden, es geht viel eher um kleinräumige Ausformung als um die großen Linien. Jede Harmonie hat in der melodischen Abfolge ihre Aufgabe, ihren hierarchischen Platz und ihre Farbe.«
Der zweite wesentliche Aspekt bei der historischen Aufführungspraxis: Man muss nicht nur spieltechnisch, sondern auch umfassend und allgemein in eine ganz andere, ferne Welt eintauchen: Wie lebten die Menschen früher? Zu welchen Anlässen wurde musiziert? Was bedeuten bestimmte Harmonien und melodische Figuren? Denn gerade in der Musik des Barock verbirgt sich hinter den vordergründig leicht zugänglichen und harmonischen Klängen oft ein beziehungsreiches Netz von Zitaten, Assoziationen und musikalischer Rhetorik. Dieses lässt sich nicht ohne weiteres aus den aufgeschriebenen Noten herauslesen, vielmehr erfordert es solides Hintergrundwissen, um die zahlreichen Bedeutungsschichten entschlüsseln zu können. Schayegh liebt es, diese ferne Welt zu erforschen – zumal dort noch eine schier unübersehbare Anzahl musikalischer Schätze ihrer Wiederentdeckung harrt.
Einer der bereits wiederentdeckten Schätze ist die Musik des Franzosen Jean-Marie Leclair (1697–1764), dem Leila Schayegh im Laufe der letzten Jahre neben Konzerten auch eine Reihe von CD -Einspielungen widmete. Allein die Biografie des in Lyon geborenen Korbflechtersohns könnte einen ganzen Roman füllen: In einer kometenhaften Karriere brachte er es bis zum Hofmusiker Ludwigs XV ., am Ende lebte er in einem Pariser Brennpunktviertel, wo er schließlich in seinem eigenen Hausflur erstochen wurde. Sein Schaffen jedoch errang über seinen Tod hinaus internationales Renommee.
Schayegh schätzt an Leclairs Werken insbesondere deren Vielschichtigkeit: »Einerseits ist da eine große Lust am Virtuosen, die man aber nicht so offen zeigen will –reine Virtuosität hat schließlich etwas Plakatives, ja fast Ordinäres. Gleichzeitig aber gibt es da ein tiefes Empfinden, das sich jedoch erst erschließt, wenn man wirklich
bereit ist, sich darauf einzulassen.« In ihrem aktuellen Konzertprogramm kombiniert sie Werke von Leclair und Arcangelo Corelli (1653–1713). Im Gegensatz zu seinem eine Generation jüngeren französischen Kollegen war der Italiener bis ans Ende seines Lebens hoch geehrt und gut situiert. Eines allerdings verbindet die beiden Barockkomponisten: »Beide haben sie den Stil ihres jeweiligen Landes maßgeblich beeinflusst und die Violintechnik ihrer Zeit auf ein neues Niveau gebracht«, sagt Schayegh.
Bleibt die Frage, ob sie es heute überhaupt noch als zeitgemäß empfindet, sich mit jahrhundertealten Werken und Spieltechniken auseinanderzusetzen. Schayegh antwortet mit einem klaren Ja: »In ihren Anfängen mag die sogenannte historische Aufführungspraxis wohl sehr rückwärtsgewandt gewirkt haben, sie hat aber seither längst bewiesen, dass sie in der klassischen Musik zum eigentlichen Zweig des Weiterdenkens geworden ist und maßgeblich dazu beiträgt, unser geschmackliches Empfinden zu verändern und zu erweitern.«
Genau dieses Verändern und Erweitern reizt Schayegh tagtäglich aufs Neue – nicht nur als Interpretin, sondern auch als Lehrerin. Seit 2010 gibt sie ihr Wissen als Professorin für Barockgeige an die nächste Generation weiter. Und legt dabei vor allem Wert auf einen zentralen, sehr modernen Gedanken: »Forscht und grabt, so viel ihr wollt – aber vergesst darüber nicht die Musik und ihr eigentliches Ziel: die Menschen von heute zu berühren.«
LEILA SCHAYEGH
Di, 21.3.2023 | 20 Uhr Laeiszhalle Großer Saal la Cetra barockorchester basel, leila schayegh (Violine und leitung) »Der französische Corelli«: Jeanmarie leclairs Violinkonzerte im Dialog mit italienischen Vorbildern
 La Cetra Barockorchester Basel
m MEHR ZUM THEMA ALTE MUSIK FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
La Cetra Barockorchester Basel
m MEHR ZUM THEMA ALTE MUSIK FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

Für wen ist das Abonnement? Für mich selbst
Nutzen Sie die Vorteile eines Abonnements und lassen Sie sich die nächsten Ausgaben direkt nach Hause liefern. Oder verschenken Sie das Magazin-Abo.
3 Ausgaben zum preis von € 15 ( ausland € 22,50) preis inklusive mwst. und Versand Unter-28-Jahre-Abo: 3 ausgaben zum preis von € 10 (bitte altersnachweis beifügen)
Jetzt Fan der elbphilharmonie FacebookCommunity werden: www.fb.com / elbphilharmonie.hamburg
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular zu:
ELBPHILHARMONIE ma G a Z in leserservice, pressup Gmbh postfach 70 13 11, 22013 hamburg
Oder nutzen Sie eine der folgenden Alternativen: Tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299 email: leserservice@elbphilharmonie.de internet: www.elbphilharmonie.de
Rechnungsanschrift:
Zusatz Zusatz
mit der Zusendung meiner rechnung per email bin ich einverstanden. hamburgmusik gGmbh darf mich per email über aktuelle Veranstaltungen informieren.
Ggf. abweichende Lieferadresse (z. B. bei Geschenk-Abo):
Das Abo soll starten mit der aktuellen ausgabe der nächsten ausgabe name Vorname straße / nr. plZ ort land email (erforderlich, wenn rechnung per email) name Vorname straße / nr. plZ ort land
Jederzeit kündigen nach Mindestfrist: ein Geschenkabonnement endet automatisch nach 3 ausgaben, ansonsten verlängert sich das abonnement um weitere 3 ausgaben, kann aber nach dem bezug der ersten 3 ausgaben jederzeit ohne einhaltung einer kündigungsfrist zum ende der verlängerten laufzeit gekündigt werden.
Widerrufsrecht: Die bestellung kann innerhalb von 14 Tagen ohne angabe von Gründen in Textform (z. b brief, Fax oder email) oder telefonisch widerrufen werden. Die Frist beginnt ab erhalt des ersten hefts. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs (Datum des poststempels) an: elbphilharmonie magazin leserservice, pressup Gmbh postfach 70 13 11, 22013 hamburg Tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299, email: leserservice@elbphilharmonie.de Elbphilharmonie Magazin ist eine Publikation der HamburgMusik gGmbH Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg, Deutschland Geschäftsführer: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Zahlungsweise: bequem per bankeinzug Gegen rechnung
kontoinhaber biC (bitte unbedingt bei Zahlungen aus dem ausland angeben) Geldinstitut
iban
SEPA-Lastschriftmandat: ich ermächtige die hamburgmusik gGmbh bzw. deren beauftragte aboVerwaltung, die pressup Gmbh, Gläubigeridentifikationsnummer De32ZZZ00000516888, Zahlungen von meinem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von der hamburgmusik gGmbh bzw. deren beauftragter aboVerwaltung, die pressup Gmbh, auf mein konto gezogenen lastschriften einzulösen. Die mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem kreditinstitut vereinbarten bedingungen.
Die einzugsermächtigung erlischt automatisch mit ablauf des abonnements.
Datum
Täglich begrüßt die Education-Abteilung Schulklassen in der Elbphilharmonie. Hefte und Stifte brauchen sie hier nicht. Wichtiger sind die Emotionen.
 VON FRÄNZ KREMER
VON FRÄNZ KREMER
In Hamburg gibt es 414 allgemeinbildende Schulen. Und als die Elbphilharmonie 2017 eröffnete, da startete sie mit einer Mission: Jede einzelne dieser Schulen, von Rissen bis nach Altengamme, von Duvenstedt über Eppendorf bis nach Neugraben-Fischbek, wollte man mit dem neu geschaffenen EducationProgramm ansprechen. Und natürlich in das neue Konzerthaus einladen. Ob das gelungen ist? Vor kurzem zählten die Verantwortlichen der Elbphilharmonie nach, und siehe da: Es waren bisher Klassen aus 410 verschiedenen Hamburger Schulen zu Gast. Eine Quote von 99 Prozent.
Die Zahlen überraschen nicht, wenn man weiß, mit welcher Power in der Elbphilharmonie Programm für junges Publikum gemacht wird. Die Education-Abteilung ist seit Beginn ein Eckpfeiler des Hauses, arbeitet mit einem großen Team daran, Menschen mit Musik in Verbindung zu bringen, nicht nur Kinder. Es gibt ein riesiges Workshop-Angebot, Funkelkonzerte für jede Altersstufe, fünf eigene Mitmach-Ensembles, Kooperationen mit Stadtteilzentren, Ferienprogramme, Community-Projekte. Die Angebote für Schulklassen sind nur ein Teil der Education-Arbeit, wenn auch ein wesentlicher: Einen Wochentag ohne Schulklasse im Haus, so etwas gibt es hier nicht. Morgen für Morgen wandern Kinder mit aufgeregten Stimmen über die Brücke Richtung Elbphilharmonie, um einen der vielen hundert Workshops oder eines der Dutzenden von Schulkonzerten zu besuchen, die pro Saison angeboten werden.
Eine dieser Schulklassen sitzt gerade im Kaistudio 6 in einem Halbkreis und hört Tobias Hertlein dabei zu, wie er seltsame Geräusche von sich gibt. Hertlein demonstriert die Technik des Tuba-Spielens. Und die geht so: Erst zur Vorbereitung die Lippen flattern lassen, Stichwort schnaubendes Pferd. Dann die Luft mit Druck durch die zusammengepressten Lippen pusten, bis es wie ein Rennmotorrad klingt. Und jetzt das Ganze mit Mundstück. Conrad, neun Jahre alt, hat aufmerksam zugehört. Er nimmt auf einem Hocker vor der großen Tuba Platz. Das golden glänzende Instrument ist auf einem Metallständer montiert und ziemlich genau so hoch wie er selbst. Testweise drückt er ein paar Knöpfe. Dann spannt er die Lippen, setzt an. Wow, ist das laut! Er dreht sich zu den anderen, breites Grinsen im Gesicht.
Mit seiner Klasse darf sich Conrad heute beim Workshop »Klassiko Orchesterinstrumente« anderthalb Stunden lang einmal quer durchs Orchesterinstrumentarium spielen: von Geige und Kontrabass bis zu Trompete und Querflöte. »Nicht jedes Instrument liegt jedem Kind«, sagt Tobias Hertlein, »aber deswegen haben wir ja eine große Auswahl und tauschen ständig durch. Am Ende hat dann eigentlich jeder ein Erfolgserlebnis.«
Hertlein macht die Mundübungen vor, erklärt, woher die Sandwichtrompete ihren Namen hat, desinfiziert, dirigiert den Rhythmus, zeigt die Spieltechniken geduldig auch noch ein drittes und viertes Mal. »Speziell die Blas- ›

instrumente sind ja wirklich knifflig zu spielen«, ermutigt er die Schüler, bei denen es nicht sofort klappt. Alles entspannt, es kann ja nicht jeder gleich mit dem ersten Versuch die Wände zum Erzittern bringen so wie Conrad.
Auch Hertlein musste sich manche Techniken erst beibringen. Er ist studierter Schlagzeuger, neben seiner Arbeit in der Elbphilharmonie spielt er regelmäßig bei großen Musicals und Orchestern in Hamburg mit. Im Studium lernte er nebenbei Klavier, spielt außerdem Kontrabass und Gitarre. Doch Posaune, Klarinette? »Das musste ich üben, ja klar. Und jetzt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder neu«, sagt er. Die vierte Klasse ist auf jeden Fall von seinem Spiel begeistert. Als Hertlein ein paar Töne auf dem Fagott spielt, ruft ein Schüler: »Cool, wie ein Schlangenbeschwörer!«
Der heutige Kurs mit Orchesterinstrumenten ist nur einer von insgesamt elf verschiedenen, die Hertlein und seine Kolleginnen aus der Instrumentenwelt anbieten. Die Workshops sind in die drei Bereiche »Klassiko«, »Kosmos« und »Kreativ« aufgeteilt; es gibt Kurse, bei denen man zusammen komponiert, auf »Klangsafari« durchs Haus geht, die Orgel im Großen Saal kennenlernt, indonesisches Gamelan spielt oder sogar modulare Synthesizer zusammenbaut. »Einiges davon ist über die Jahre aus dem Team entstanden. Das finde ich besonders toll«, sagt Hertlein, der selbst verschiedene Workshops leitet.
Dass es kein schöneres Musikerlebnis geben kann, als selbst ein Instrument zu spielen, das weiß kaum jemand besser als Bettina Fellinger. 19 Jahre lang leitete sie in der Laeiszhalle das »Klingende Museum«, den Vorgänger der heutigen Elbphilharmonie Instrumentenwelt. Es entstand 1989 auf Initiative von Gerd Albrecht, dem damaligen Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper. Seine Idee des Klingenden Museums mit Instrumenten zum Anfassen und Ausprobieren wurde anfangs von vielen kritisch beäugt, das Geld war immer knapp. Doch Albrecht trieb das Projekt beharrlich voran – und als die Instrumentensammlung 1997 in die Räume der Laeiszhalle überführt wurde, fragte er Fellinger, die er aus vorherigen Projekten kannte, ob sie das am neuen Ort umsetzen wolle.

»Ich sagte ihm: ›Ich organisiere Ihnen das gern, aber ich stelle mich nicht vor eine Klasse. Da haben andere bessere pädagogische Fähigkeiten‹«, sagt Fellinger schmunzelnd. Sie begann, ein Team von Musikstudenten zusammenzustellen. »Die Grundidee der Workshops war von Anfang an die gleiche«, sagt sie. »Diese Begeisterung, die beim Selbermachen entsteht! Die hat mich damals angetrieben, und sie treibt mich noch heute an.« Die Kurse wurden eine große Erfolgsgeschichte, auch dank Förderern wie der Hubertus Wald Stiftung, die an die Idee glaubten: Jahr für Jahr kamen mehr Besucher in die engen Workshop-Räume im Keller der Laeiszhalle, schon damals viele Schulklassen. 2014 starb Gerd Albrecht. »Ich glaube, wenn er heute sehen könnte, wie sich das entwickelt hat, wäre er sehr glücklich«, sagt Fellinger.
Als das Konzept 2017 in die Elbphilharmonie überführt wurde, trat sie in die zweite Reihe zurück. Seitdem ist sie in der Education-Abteilung für Beratung und Information zuständig. In dieser Funktion ist sie nicht nur Ansprechpartnerin für die Lehrkräfte, sondern für alle, die in der Elbphilharmonie mitmachen wollen –ob bei einem Workshop, einem Community-Projekt, einem der fünf hauseigenen Ensembles oder beim großen Chor-Wochenende. »Es gibt so viele tolle Projekte, ich habe hier den Sammelpott an Informationen«, sagt Fellinger.
Jährlich kommen mehr Schülerinnen und Schüler in die Elbphilharmonie, als in Hamburg Kinder geboren werden.

Wenn es nach Charlotte Beinhauer geht, dann soll der gute Kontakt, den unter anderem Fellinger zu den Schulen pflegt, in Zukunft noch intensiviert werden. Gerade wurde, im Rahmen des Programms »Tusch«, eine dreijährige Partnerschaft mit einer Förderschule gestartet. »Wir würden uns wünschen, das noch mehr zu machen: gemeinsam mit Schulen über längere Zeit Dinge entwickeln«, sagt sie. Gerne denkt Beinhauer an die Musikund Theaterprojekte in ihrer eigenen Schulzeit zurück. »Außer an das Projekt, wo ich nicht mitmachen durfte, weil meine Blockflöte nicht erwünscht war«, lacht sie. »Das war ein prägendes Erlebnis. Aber es hatte sein Gutes: Es hat mich erstens angestachelt, in Windeseile zusätzlich Oboe zu lernen. Und zweitens erinnert es mich bis heute daran, was das Wichtigste bei diesen Projekten ist: nämlich die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, sich auszudrücken. Egal, auf welchem Instrument.«
Seit fünf Jahren gehört Beinhauer zum EducationTeam der Elbphilharmonie. Sie hat hier schon verschiedene Projekte betreut, von Babykonzerten bis zu Konzerten für Demenzkranke und ihre Angehörigen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Konzeption neuer Konzerte, besonders Schulkonzerte. »Wenn wir neue, eigene Produktionen planen, machen wir das anfangs immer im Team. Wir schauen, zu welchem Thema und mit welcher Besetzung wir arbeiten wollen, und stellen ein künstlerisches Team zusammen: Regie, Bühnenbild, Licht, Künstler aus anderen Sparten wie Zirkus oder Tanz«, erklärt Beinhauer.
Gerade laufen die Proben für »treznoK – Rückwärts ins Konzert«, eine szenische Produktion mit der Tänzerin, Choreografin und Regisseurin Antje Pfundtner und dem Ensemble Resonanz, bei der es darum geht, die geheimnisvollen Rituale eines Konzerts einmal auf links zu drehen (daher der umgedrehte Titel). »Solche neuen
Stücke begleite ich von der ersten Idee bis zur praktischen Durchführung und der Abrechnung danach.« Acht Vorstellungen sind im Juni für die Klassen 1 bis 4 im Kleinen Saal geplant.
Zu den Konzerten begrüßt Beinhauer die Schulklassen auf der Bühne oder im Foyer und stimmt sie auf das Programm ein. »Auch Unterrichtsmaterial gibt es zu vielen Konzerten. Die Lehrer können das nutzen, aber sie müssen nicht – das ist uns wichtig«, sagt Beinhauer. »Es soll da keine Schwellen geben. Wichtig ist das künstlerische Erlebnis.« Hintergrundwissen, Infos zur Musik, alles schön und gut. »Aber Kinder und Jugendliche erreicht man am besten über Emotionen«, so Beinhauer. »Und das ist unser erstes Ziel: Wir wollen begeistern.«
In einer der aktuellen Produktionen geht es darum, die geheimnisvollen Rituale eines Konzerts einmal auf links zu drehen.m MEHR ZU DEN ANGEBOTEN FÜR SCHULKLASSEN FINDEN SIE

Dr. Udo Kopka: Ich bin schon sehr früh mit der Elbphilharmonie in Berührung gekommen, mein Büro befindet sich direkt gegenüber im 6. Stock des Hanseatic Trade Centers. Von diesem Logenplatz aus konnte ich in all den Jahren die Baufortschritte verfolgen. Fasziniert habe ich beobachtet, wie zunächst der alte Kaispeicher A entkernt wurde und dann nach und nach das Parkhaus, die Wohnungen, das Hotel und natürlich das Konzerthaus errichtet wurden. Während das neue Gebäude immer mehr Gestalt annahm, regte sich in mir der heftige Wunsch, selbst einmal in der Elbphilharmonie zu wohnen. Ich hatte dann auch tatsächlich die Kaufoption auf ein Apartment im 18. Stock, verlor sie aber leider wieder, da ich auf Reisen war, als der Brief mit der Fristmitteilung eintraf und ich nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Also musste ich einen anderen Weg finden, oft in die Elbphilharmonie zu kommen!
Jeremy Zhijun Zeng: Wir haben einige Jahre in Shanghai und Peking gelebt und sind vor zwei Jahren zurück nach Hamburg gezogen. Vor zehn Jahren war ich hier das erste Mal für einen Besuch und danach immer wieder mal. Udo lebte damals in Hamburg, ich in verschiedenen Städten in den USA und China. Vor drei Jahren haben wir dann beschlossen, zusammenzuziehen. Die Attraktivität der Elbphilharmonie hat für meine Entscheidung, endgültig nach Hamburg zu kommen, durchaus eine Rolle gespielt. Ich bin ein großer Musikliebhaber und habe viele berühmte Konzerthäuser kennen gelernt. Die Elbphilharmonie ist aus meiner Sicht etwas ganz besonderes, die Verbindung aus außergewöhnlicher Architektur und einem unvergleichlich spannenden Konzertprogramm begeistern mich immer wieder aufs Neue. Auch das Innendesign und die Möblierung gefallen mir sehr gut, sie sind außergewöhnlich und lenken dennoch nicht von der Hauptsache – der Musik – ab. Die Stühle sind äußerst komfortabel, im Gegensatz zu vielen anderen Konzerthäusern bieten sie ausreichend Platz.
Dr. Udo Kopka: Auch während meiner Zeit in China bin ich regelmäßig in mein Hamburger Büro gekommen. Vor vier Jahren haben wir dann gemeinsam mit unseren Eltern zum ersten Mal ein Konzert in der Elbphilharmonie besucht. Sir Simon Rattle dirigierte das London Symphony Orchestra, noch heute erinnere ich mich an das Programm mit Werken von Bartók und Bruckner. Von
unseren Plätzen aus konnten wir Rattle von vorne betrachten und ausgiebig sein Mienenspiel studieren. Es war sehr eindrucksvoll, wie er auch mithilfe seiner Mimik das Orchester leitete.
Jeremy Zhijun Zeng: Wir haben unser allererstes Konzert sehr genossen und uns gesagt, dass wir dieses Erlebnis sehr viel öfter wiederholen könnten, wenn wir in Hamburg leben würden. So ist es dann ja auch gekommen!
Dr. Udo Kopka: Unsere Beziehung zur Elbphilharmonie haben wir dann sehr schnell intensiviert: Claus-G. Budelmann, einer der maßgeblichen Unterstützer des Internationalen Musikfests Hamburg und Gründer des Förderkreises, sprach uns an, ob wir uns nicht auch für das Musikfest engagieren möchten. Wir haben mit Freuden zugesagt. Einen vergleichbaren Förderkreis habe ich noch in keiner anderen Stadt kennen gelernt, er erscheint mir einzigartig. Interessierte Menschen aus ganz Europa und sogar Dubai kommen dort zusammen, es ist sehr inspirierend. Normalerweise hat man in seinem beruflichen Umfeld immer mit den gleichen Menschen zu tun, hier dagegen treffen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen aufeinander. Uns vereint das Interesse an der Elbphilharmonie und an guter Musik, daraus entstehen immer wieder spannende, bereichernde Gespräche und Kontakte, die uns der Arbeitsalltag so nicht bieten kann.
Jeremy Zhijun Zeng: Wir wurden wirklich sehr freundlich aufgenommen und haben neue Freunde gewonnen. Als Neu-Hamburger habe ich eine Menge über die Geschichte und Kultur der Stadt gelernt.
Dr. Udo Kopka: Wir besuchen die Elbphilharmonie oft und gern mit ausländischen Freunden. Wir haben festgestellt, dass sie uns noch ein wenig lieber besuchen, wenn wir sie zu einem Konzert einladen – das gilt sogar für meine Eltern!
Jeremy Zhijun Zeng: Wir müssen aufpassen, dass wir die Konzertkarten gerecht unter unseren Freunden verteilen, deshalb kaufen wir auch meistens gleich vier davon. Es findet sich eigentlich immer jemand, der sehr gern mitkommt.
Jeremy Zhijun Zeng sind nicht zuletzt wegen der Elbphilharmonie nach Hamburg gezogen.


Was einmal modern war, lässt sich auch an Gebäuden aus vergangenen Epochen ablesen. Hamburg hat da drei ziemlich spektakuläre Beispiele zu bieten.
VON STEPHAN BARTELS FOTOS JAKOB BÖRNER DIE SPIELWIESESuperschön. Elegant. Fabelhaft. Es sind große Worte, die Jörg Stiehler in den Mund nimmt, ausgesprochen voller Ehrfurcht und Respekt und Faszination. Sie gelten einem Klotz aus Beton und Glas, der in der Herbstsonne braun schimmert. Nee, Moment, Klotz stimmt gar nicht –es sind zwei aneinandergebaute 90-Grad-Winkel, ein Bein für jede Himmelsrichtung, 13 Stockwerke über Grund, 68 Meter lichte Höhe. Bürohaus Ü 35 heißt das Ding, ein zarter Hinweis auf die Postadresse am Überseering. Heute hat sich die Polizei hier ausgebreitet und die Uni Hamburg, solange der Philosophen-Turm auf dem Campus renoviert wird. Aber für Kenner wie Stiehler ist und bleibt es das Shell-Haus.
oft vor Gebäuden und hat sich gefragt: Wer hat das gemacht? Und warum? Was ist da jetzt drin? Also hat er Ende 2019 begonnen, Standorte zu verlinken und Infos zu sammeln. Die ersten 11.000 Einträge gingen schnell – Stiehler durfte die Infos über sämtliche Hamburger Denkmäler hochladen. Im Moment steht er bei etwa 12.500 Gebäuden weltweit, die man auf seiner Karte anklicken kann. »Das soll mal das Gedächtnis der Architektur werden«, sagt er.
Unten: Grindelhochhäuser
Stiehler hat eine Website gestaltet, »Map of Architecture«, weil er will,dass man sich mit Architektur auseinandersetzt. Denn mit der wird man ständig konfrontiert. Er stand
Das Shell-Haus ist darauf verewigt, klar. Heute ist auch das ein Denkmal. 1968 aber war es noch die Zukunft: Da hat die Deutsche Shell ein Stück Land im Norden Winterhudes gekauft, für eine neue Konzernzentrale, gut 2.000 Leute sollten dort in Öl machen. 1975 ist das Gebäude fertig geworden. Meinhard von Gerkan und sein Kompagnon Volkwin Marg haben das Ding auf die grüne Wiese gestellt, eine von dutzenden Baustellen damals in der Gegend. ›
 Oben links: Chilehaus
Oben rechts: City Nord
Oben links: Chilehaus
Oben rechts: City Nord
Ein Jahrzehnt zuvor hatten die beiden, noch keine 30, das spektakuläre Terminal des Flughafens Tegel in Berlin gebaut, seitdem waren sie eine große Nummer in der Architektur. Denn auch darum ging es in der City Nord: Diese neue Bürostadt war von Anfang an dafür gedacht, dass Firmen sich architektonisch austoben. »Die sollten hier Statements bauen, echte Aushängeschilder für ihre Konzerne«, sagt Jörg Stiehler. Und dafür hat man sich die besten Architekten der Zeit gegönnt, angefangen mit Arne Jacobsen, der das damalige HEW -Haus entworfen hat. »Eine echte Ikone«, sagt Stiehler, »Hamburg kann sich glücklich schätzen, dass so etwas zeitlos Schönes hier steht.«

Der tiefere Grund für das alles hier war ein Mangel. In den Fünfzigern boomte auf wundersame Weise die Wirtschaft, Firmen brauchten Büroflächen für ihre anschwellenden Angestelltenzahlen. Eine Idee war, die Büros in der Innenstadt zu bauen, »da wäre dann so etwas wie in Frankfurt herausgekommen«, sagt Stiehler:
»Mainhattan an der Alster.« Man hatte auch schon damit angefangen, Ende der Fünfziger wuchs das Unilever-Hochhaus 92 Meter hoch aus der Neustadt, und man stellte fest: Nee, kann man mit Hamburg nicht machen. Der Oberbaudirektor Werner Hebebrand wiederum war 1956 in New York gewesen. Gab es dort nicht ganze Bürostädte im Grünen? Und war nördlich des Hamburger Stadtparks nicht dieses städtische Gebiet, halb so groß wie die Innenstadt, belegt bloß durch Kleingärten und Behelfsheime? Im August 1959 legte Hebebrand seinen Aufbauplan vor. Im Dezember 1960 machte die Bürgerschaft diesen Plan zum Gesetz. Ab Januar 1961 wurde die City Nord gebaut. Stiehler dreht sich um. Da sind das rot-blaue Edeka-Haus, der rote Vorbau der Ergo-Versicherung, da hat früher mal die Hamburg-Mannheimer residiert. »Mag ich total gern«, sagt Jörg Stiehler und vollführt eine weitere 180-Grad-Drehung. »Da hinten stand die Post-Pyramide, auch ein
 City Nord
Arne Jacobsens »HEW-Haus«
City Nord
Arne Jacobsens »HEW-Haus«
sehr spektakuläres Gebäude, und ein Stück weiter liegt das ehemalige IBM -Haus mit seinen abgerundeten Kanten.« In den frühen Siebzigern, als all diese Gebäude fertig wurden, war die City Nord optisch reine Science Fiction. Das war nicht mal der Standard der Bauzeit, die Firmen haben sich damals überboten: Wer kann es noch abgefahrener, wer noch futuristischer? Stiehler findet das großartig. »Und nicht nur wegen der Gebäude«, sagt er. 2000 ist er nach Hamburg gezogen, am Anfang hat er auch mal in Winterhude gewohnt. »Der Stadtpark war mir immer zu voll«, sagt er, »da habe ich dann die Grünflächen zwischen den Bürohäusern als wunderbare Orte der Ruhe entdeckt.« Und so war es ja auch gedacht, die City Nord sollte die Bürostadt im Grünen werden. Und stressfrei für Fußgänger. Die werden auf Wegen durchs Grüne durch die City Nord geleitet – und auf aufgebockten Bahnen über dem Straßenniveau.
Die große weite Welt gibt es hier auch, zumindest auf den Straßenschildern. Überseering, NewYork-Ring, Mexikoring. Und Manila, Singapur, Halifax, Dakar: alle manifestiert in Fußwegen. Auf dem Singapurweg läuft Stiehler jetzt Richtung Osten, durch einen dieser
Grünstreifen, auf dem seltsam hochgebockte Körbe mit orangefarbenem Rand stehen – die »Löcher« für Disc Golf, eine Trendsportart mit Frisbees. Auf dem Weg erzählt er seine Geschichte: Stiehler, 49, ist Grafikdesigner. Er ist in Dresden aufgewachsen, 1989 über Ungarn in den Westen geflohen, zwei Wochen vor dem Mauerfall. Tischlerlehre in der Lüneburger Heide, 1993 zurück nach Dresden, weil er es spannend fand, wie sich die Stadt nach der Wende veränderte. »Ich habe gemerkt: Das ist eine Zeit und eine Welt, die nicht mehr wiederkommt.« Wie sich diese Welt, auch in der Architektur, veränderte, das hat ihn fasziniert. Und dann ist da der Mexikoring. Ein Paradies für Anhänger des Brutalismus, hier sind die Cafés, Restaurants, Geschäfte der Geschäftsstadt Nord, zu erreichen über unendliche Waschbetonwege. Der Wind pfeift durch Betonschluchten. Er könne verstehen, dass Menschen das hier abweisend finden, sagt Stiehler. »Aber für mich ist das wunderbar. Es macht die Landschaft vielfältiger.« Vielfältiger? Ja, sagt er und erklärt, was er meint: So was wie hier, das gibt
es nicht überall. Es verblüfft, es spaltet, es ist diskutabel. »Architektur muss man nicht schön finden«, sagt er, »aber man muss über sie reden, im Kontext ihrer Zeit.«

Als Marion Swoboda 2003 nach Hamburg kam, hatte sie ziemlich schnell ein Date. Zum Kino war sie verabredet, genauer: im legendären Grindel-Lichtspielhaus. Sie war ein bisschen früh dran, sie wartete vor dem Eingang. Betrachtete die Häuser auf der anderen Straßenseite und dachte: Oh. Mein. Gott. Was bitte ist das denn? Mächtige Quader aus Glas und gelbem Klinker, 14 Stockwerke zählte sie bei einigen der Häuser, die lang waren wie ein Fußballfeld, mindestens. »Ich dachte nur: wie fürchterlich«, sagt Swoboda. Sie hatte noch keine feste Bleibe, sie war ja bloß für ein Praktikum nach Hamburg gekommen. »Aber da«, sagt sie, »wollte ich nie im Leben wohnen. So viel war klar.«

Da, das sind die Grindelhochhäuser: zwölf Hausscheiben, zwischen acht und 15 Stockwerken hoch, 2.122 Wohnungen mit Platz für um und bei fünfeinhalbtausend Men-

schen, und umstritten, seit mit dem Bau dieser ersten deutschen Hochhaussiedlung begonnen wurde. Das Datum dafür ist bekannt, am 12. Juli 1946 erfolgte der erste Spatenstich. Auf einem Gebiet in Harvestehude, auf dem zuvor Villen und Stadthäuser standen, es sah dort so aus wie ein paar Meter weiter östlich immer noch. Aber im Sommer 1943 hatte die Operation Gomorrha hier eine Bombenschneise der Verwüstung hinterlassen. Und dann waren nach dem Krieg die Briten in der Stadt, die Hamburg als Hauptstadt der von ihnen besetzten Zone auserkoren hatten. Um die 3000 Offiziere, Unteroffiziere und Zivilangestellte mussten irgendwie untergebracht werden. Aber Hamburger dafür aus ihren Wohnungen werfen? Den programmierten Aufstand wollte die Militärführung vermeiden. Stattdessen gab sie neue Wohnungen in Auftrag. Die Wahl fiel auf die Kriegswüste nahe der Alster. Und auf eine Gruppe von deutschen Architekten um Bernhard Hemkes und Fritz Trautwein, die nach dem »Dritten Reich« als unbelastet galten.
Und diese Architekten gingen eben in die Höhe. Denn Licht sollte es in allen Wohnungen geben und viel Grün dazwischen. Als die Briten kurz nach der Fundamentlegung aus dem Projekt ausstiegen, hat die Stadt übernommen. Noch heute werden zehn der zwölf Häuser von der SAGA verwaltet, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. 1956 waren alle zwölf Bauten fertig, so etwas gab es sonst nirgends in Deutschland. Viele fanden die Scheiben grauenvoll. Andere feierten sie als Ausdruck einer modernen Architektur, geprägt von Le Corbusier, inspiriert vom Bauhaus. Und die Bewohner hatten ohnehin relativ schnell mehr als nur ihren Frieden gemacht mit den futuristischen Quadern: Die Wohnungen waren großzügig und hell, verfügten über Zentralheizung, warmes Wasser und Kühlschränke, von Annehmlichkeiten wie Fahrstühlen und Müllschluckern ganz zu schweigen. Unten in den Häusern residierten Geschäfte und Cafés und die Wäscherei »Frauenlob«. Wer bitte hatte im Deutschland der Nachkriegszeit so etwas zu bieten?

 Grindelhochhäuser
Chilehaus
Grindelhochhäuser
Chilehaus
Marion Swoboda stammt aus Namibia, ihr Vater ist Sudetendeutscher. Sie hat in Südafrika studiert, ist durch halb Europa getingelt, vor knapp 20 Jahren in Hamburg angekommen –und wusste schnell, dass sie bleiben wollte. Sie hatte erst gar keine Wohnung und dann eine kleine im Portugiesenviertel, und als sie 2008 als Versuchsköchin und Food-Stylistin bei der »Brigitte« anfing, stolperte sie im Intranet ihres Arbeitgebers über eine Wohnungsanzeige – im zehnten Stock in einem der Grindelhochhäuser. Sie erinnerte sich an den Abscheu, mit dem sie Jahre zuvor auf die Dinger geschaut hatte. »Dass ich die Wohnung besichtigen wollte, hatte ausschließlich mit Voyeurismus zu tun«, sagt sie. Aber als sie die 51 Quadratmeter, zwei Zimmer, Küche, Bad dann sah, musste sie beinahe die Augen zusammenkneifen, so hell war es da oben. »Ich wohnte damals sehr dunkel im Erdgeschoss«, sagt sie, »mir war sofort klar: Das hier wird meine Wohnung.« Wie sie dann tatsächlich auf der Warteliste der SAGA ganz nach oben kam … »Muss irgendwie Glück gewesen sein«, sagt sie.
Sie ist nicht mehr allein hier. 2013 hat sie Carsten Schröder kennen gelernt, drei Jahre später ist ihr Freund in die Wohnung nebenan eingezogen. Da befinden sich jetzt das
Schlafzimmer und der Wohnraum, in ihrer alten Wohnung arbeiten die beiden oder bringen Gäste unter. Ihre Balkone gehen nach Westen, vom Schlafzimmer aus blicken sie durch tiefe Fenster über den Innocentiapark bis zum Stadtpark, ein Meer aus Grün. »Ich kann nicht verstehen, dass nicht jeder hier wohnen will«, sagt Swoboda.
Und ausziehen will sie schon gar nicht mehr. Die Wohnung ist bezahlbar, das gibt ihr Sicherheit, jetzt, wo sie 49 und plötzlich selbstständige Food-Stylistin ist. Und außerdem: die Nachbarschaft! So toll! »Ich hatte immer Schiss davor, mal in einem Ghetto zu landen«, sagt sie, »und damit meine ich Viertel wie Ottensen oder Eppendorf, wo gefühlt nur eine Sorte Mensch wohnt, wo es nur eine Art zu denken gibt. Dann ersticke ich.« Carsten Schröder sagt, dass es allein in diesem Haus buchstäblich alles an Menschen gibt, »das ist hier unser Melrose Place«. Jung, alt, arm, reich, IT -Spezialisten, Menschen, die was mit Medien machen, auch der Architekturfreak Jörg Stiehler – alle haben Platz in den Grindelhochhäusern. »Und das macht einen wirklich extrem tolerant«, sagt Marion Swoboda.
Alles super also in diesem ehemaligen Leuchtturm der Moderne. Nur das Kino gegenüber gibt es nicht mehr. Echt schade.
Im Allgemeinen gilt Hamburg ja als schöne Stadt, aber da ist diese eine Sache, die durchaus spaltet. Denn dass große Teile der Stadt aus rotem Backstein bestehen, massiv und dunkel, das mag nicht jeder. »Ich schon«, sagt Bernd Paulowitz, »ich habe in Edinburgh studiert – das Dunkle liegt mir.« Besser ist das: Paulowitz, Österreicher von Geburt, ist Hamburgs Welterbekoordinator. Und als solcher kümmert er sich eben auch um Hamburgs rotes Erbe. Speicherstadt, das Kontorhausviertel, alles sein Beritt, alles toll, findet er. Aber ein Gebäude mag er dann doch noch ein bisschen lieber als die anderen: das Chilehaus.
Und das feiert gerade ein stilles Jubiläum. »Vor genau 100 Jahren war Baubeginn«, sagt Paulowitz. Der Unternehmer Henry B. Sloman hatte das Kontorhaus in Auftrag gegeben, der Architekt Fritz Höger hat bauen lassen. Damals war es üblich, Kontorhäuser nach den Auftraggebern zu benennen. Aber das Sloman-Haus gab es schon, knapp eineinhalb Kilometer den Zollkanal runter am Baumwall. Doch Sloman hatte knapp 30 Jahre in Chile gelebt, der Import von Chile-Salpeter hatte den DeutschBriten zum reichsten Hamburger überhaupt gemacht – also wurde der Neubau zum Chilehaus. Und zur Sofort-Ikone des Backsteinexpressionismus, als er 1924 fertig war. Das Chilehaus mit seinem Schiffsbug im Osten, mit dem Lichthof in der Fischertwiete, mit der geschwungenen Südseite – das musste man gesehen haben, wenn man Hamburg besuchte. Kein Hamburg-Artikel kam ohne das Chilehaus aus, kein Postkartenmotiv wurde so oft verschickt.
Paulowitz, Jahrgang 1971, ist bei der Behörde für Kultur und Medien angestellt. War aber ein langer Weg mit vielen Schleifen dorthin. Er kommt aus Salzburg, hat in Wien auf der diplomatischen Akademie studiert und ist dann zur UNESCO gewechselt, »zur Vorbereitung auf das Außenministerium«. Bei der UNESCO aber ist er dann in die Sache mit dem Welterbe reingerutscht. Ist nach Paris gegangen, ins Welterbezentrum. Lebt mit einer Französin zusammen. Hat die UNESCO 2003 verlassen, eine eigene Firma gegründet, die sich mit der Vorbereitung zum Welterbe und dem Management von Kultur- und Naturerbe beschäftigt. Er hatte schon einige Projekte in Hamburg betreut, als die Speicherstadt, das Kontorhausviertel und damit auch das Chilehaus 2015 in die UNESCO -Welterbeliste eingetragen wurden. Und das musste irgendwie fachgerecht gemanagt werden, »von einer Art praktischem Denkmalpfleger«, sagt Paulowitz. Also stellte man ihn 2016 ein, mit der wohlklingenden Berufsbezeichnung Welterbekoordinator. »Das ist spannend, diese Art Job gibt’s ›

nicht so oft. Es gibt zwar 1154 Welterbestätten, aber die meisten werden vonFachbehörden mitverwaltet.«
Hamburgs Erbe, es lebt. Ist ja kein Museum, das Chilehaus erfüllt immer noch seinen ursprünglichen Zweck als Bürogebäude. Und das soll auch so bleiben, sagt Paulowitz. »Wenn man das Chilehaus zu einem Wohnhaus umbauen wollte, würde man den Charakter verändern«, sagt er, »da würden wir sagen: Nee, sorry, geht nicht.«

Die oberen beiden Stockwerke werden gerade saniert, »gut für uns, deshalb können wir heute rauf aufs Dach«. Und oben zeigt er dann, warum das Chilehaus überhaupt nötig war. Denn einen Steinwurf Richtung Süden beginnt die Speicherstadt, und die musste verwaltet werden. Deshalb hat man die alten Gängeviertel hier abgerissen und Platz geschaffen für Büroflächen. »So richtig modern war das Monofunktionale«, sagt Paulowitz. »Die modularen Büro-
flächen, die Paternoster, die verbaute Technik, das Konzept der offenen Vermietung, das war alles neu und auf der Höhe der Zeit.« Dass das Chilehaus außerdem so schön ist und ein Schmuckstück der expressionistischen Baukunst, »das ist für mich nur das i-Tüpfelchen«.
Es gibt Geschichten über den Bau. Zum Beispiel zu den Steinen, die verwendet wurden. Soll angeblich B-Ware sein, die Sloman den Architekten-Brüdern Gerson billig abgekauft hat, die das ehemalige Ballinhaus nebenan gebaut hatten, das heute Meßberghof heißt – und fest damit rechneten, auch den Auftrag für das Chilehaus zu bekommen. »Was soll ich mit dem Dreck?«, hat der tatsächliche Baumeister Fritz Höger angeblich gefragt. Und dann aus der Not eine Tugend gemacht, in dem er jeden siebten Stein versetzt gemauert hat. Denn auch dieses Detail macht dieses Gebäude so einzigartig. »Aber da weiß man jetzt auch nicht:
Ist das wahr oder Legende?«, sagt Paulowitz. »Am Ende ist es vor allem eine gute Geschichte.«
Von hier oben hat man einen schönen Blick über Paulowitz’ Reich. Der Montanhof, der Sprinkenhof, der Meßberg nebenan, der Österreicher redet sich in eine Euphorie hinein, so schön, so gelungen findet er das, als Historiker, als Denkmalpfleger, als Mensch. Aber er hat auch Visionen für die Gegend. Der Parkplatz auf dem Burchardplatz zum Beispiel, der kommt weg, das wird anders. »Den Vorplatz auf der Südseite stellen wir uns auch anders vor«, sagt Paulowitz und spricht von der »Achse zwischen Speicherstadt und Steinstraße«, von Umgestaltung und Einbettung in das Welterbe und ach! es gibt noch so viel zu tun hier in diesem Paradies für Backsteinliebhaber. Gut, dass Bernd Paulowitz einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat.
Vom Dach des Chilehauses


Was einmal zum Mythos wird, beginnt selten mit einem Paukenschlag. In der Regel geht es eher lautlos zu, manchmal begleitet von Misstönen. Bis zum Beispiel die Elbphilharmonie als »architektonische Ikone« gefeiert wurde, floss viel Wasser den namensgebenden Fluss hinunter. Inzwischen ist das Konzerthaus eine weltweit renommierte Marke, die zu ihren sechs »Principal Sponsors« auch Porsche zählt. Auch dessen weltberühmter Sportwagen, der Ur-911er, damals noch unter der Bezeichnung 901, war zunächst kein All-Star. Das Auto wurde im September 1963 auf der IAA präsentiert, hinter einem locker gespannten Seil und Blumenkübeln. Ein Vorserienfahrzeug in vanillegelb, auffällig in seiner Nüchternheit. Gerade im Vergleich zur Konkurrenz, die entweder sehr verschnörkelt oder extra-elegant daherkam. Wohl niemand hätte damals geglaubt, dass solch ein Exemplar eines Tages Teil der Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art sein würde, in bester Gesellschaft mit Werken von Andy Warhol, Marcel Duchamp und Henry Moore. Zumal erst einmal Ärger ins Haus stand: Wegen der Bezeichnung mit einer Null in der Mitte erhob der französische Autobauer Peugeot Einspruch, sodass diese Ziffer kurzerhand in eine Eins umgetauscht wurde. Ab Herbst 1964 rollte fortan der 911er in Stuttgart-Zuffenhausen vom Band, inzwischen sind es weit über eine Million. Hinter dem legendären Entwurf – fließende Linien, markanter Kotflügel und der Motor im Heck – steckte Ferdinand Alexander Porsche mit seinem Team. Gemein-
sam haben sie den Archetyp des Sportwagens »made in Germany« geschaffen, der schon bald eine Karriere als Klassiker machte und dessen Grundrezept auch heute noch funktioniert. Credo des ältesten Sohns vom Begründer der Marke, Ferry Porsche: »Ein formal stimmiges Produkt braucht keine Verzierung.« Das gestalterische Talent brachte »Butzi«, so der Spitzname des früheren Waldorfschülers, ins Konstruktionsbüro des familienbetriebenen Autobauers – 1958 gab es noch keine Designabteilung. Ganz anders heute, wo der »Elfer«, aber auch alle anderen Porsche-Modelle auf einem eigenen, rund hundert Hektar großen, hochmodernen Areal kreativ »betreut« werden.

Entwicklungszentrum Weissach (EZW ) nennt sich die Denk- und Traumfabrik der Luxusmarke. In diesem kleinen, von viel Natur umgebenen 7.500-Seelen-Ort zwischen Stuttgart und Pforzheim arbeiten inzwischen fas so viele Mitarbeiter wie Einwohner. Hier trifft sich die Elite der Fahrzeugentwickler: Konzeption und Design, Interieur und Exterieur, Bau von Modellen und Prototypen, Prüfung von Aerodynamik und Elektronik, Abstimmung von Motoren, Lenkungen und Fahrwerken, Sicherheitstechnik, Crashtests, Soundlabor und Farboptimierung.
Ungefähr vier Jahre dauert der Prozess von der Skizze bis zur Straße. Es sind viele Schritte notwendig, täglich neue Fragen, neue Aufgaben. Konzentration auf Details. Variationen dessen, was gestern war. »Bei der Arbeit an der nächsten Generation 911 sind uns zwei
Am Anfang war es nur eine Skizze. 60 Jahre später kümmert sich ein hochspezialisiertes Design-Team um den »Neunelfer« von Porsche. Nicht zuletzt die Leidenschaft für Ästhetik verbindet den Sportwagenhersteller mit seinem neuen Partner Elbphilharmonie.
Aspekte wichtig«, sagt der Design-Chef Michael Mauer. »Der neue 911 muss als 911 zu erkennen sein – und als der neue 911. Das ist eine Gratwanderung. Wie weit gehe ich? Nicht zu weit, aber weit genug.«
Hier das richtige Maß zu finden, ist die Aufgabe der Designabteilung »Style Porsche«. Die befindet sich seit 1972 am Standort Weissach und seit 2014 in einem aus zwei Ebenen bestehenden Neubau, ganz in Weiß, offen und durch riesige Fenster hell gehalten. Auf der oberen Etage des Designstudios sind die Arbeitsplätze für den Entwurf von Exterieur und Interieur untergebracht. Hier entstehen mit Stift und Papier sowie an Bildschirmen in 2D und 3D die ersten Entwürfe der neuen Fahrzeuge. Von oben haben die Kreativen auch den tiefer liegenden Modell-Prozess im Blick und damit ständig beides vor Augen: die Modellentstehung am Computer und ebenso am physischen Modell. Rund hundert Mitarbeiter agieren hier unter einem Dach, doch es geht erstaunlich leise zu. Mit Leidenschaft und Sorgfalt widmet sich jeder seiner Aufgabe. Während die einen Ziernähte am Ledersitz anbringen oder mit der Stickung der Kopfstützen beschäftigt sind, schauen sich andere über Virtual-RealityBrillen erste Visualisierungen zukünftiger Designs an. Nur das Motorengeräusch der Fräse ist deutlich zu hören –mit ihr werden Modelle aus Clay, einem braunen, tonartigen Werkstoff, in Originalgröße geformt. Ein komplizierter Vorgang, der Präzision und Geschick erfordert –Handwerk und Technik gehen beim Design-Entwicklungsprozess Hand in Hand. Beim Prozess, in dem Designentwürfe als lebensgroße Tonmodelle entstehen, wird besonders deutlich: Ein Fahrzeug ist auch eine Skulptur. Im Fall des 911er erst recht.
Die unverwechselbare Silhouette – etwas, das Porsche mit der Elbphilharmonie verbindet. Wie die charakteristische Form des Sportwagens mit den zwei runden Scheinwerfern und der typischen Fließheckform des 911, so ist das vom Büro Herzog & de Meuron entworfene Konzerthaus mit seiner markant geschwungenen, an Wellen erinnernden Glasfassade sofort erkennbar. Durch das Weglassen von Unnötigem zeigt sich die DNA , in der Architektur genauso wie beim Auto.
»Aufgeräumtheit«, nennt Peter Varga, Director Exterior Design bei Porsche, die puristische Erscheinung der 911-Baureihe. »Ikonisches Design wird nicht durch Special Effects erreicht«, so der 44-Jährige. »Das kann man nicht planen. Wir haben eine Marke, die sich als Identität so stark entwickelt hat – wir brauchen keinen radikalen Schnitt.« Und doch besteht die größte Herausforderung darin, den Klassiker von 1963, der laut Varga erst durch die Verbindung von stimmiger Form mit Leistung und Alltagstauglichkeit zu einer Ikone wurde, dem Zeitgeist dezent anzupassen.



Die Kunst besteht darin, den Urtyp so zu verwandeln, dass er mit neuen Proportionen überrascht und sich tetig wachsenden technischen Bedürfnissen und Gegebenheiten anpasst. Es geht um die Verbindung von Tradition und Innovation, von Eleganz und Emotion, von Design und Technik.
Im Laufe der Jahre ist der Porsche 911 größer und kraftvoller geworden, mit immer neuartigeren Technologien. Aber egal, wie die Optik in Zeiten von Digitalisierung und Elektromobilität überarbeitet wird – der »Elfer« wird auch in Zukunft immer noch ein bisschen so aussehen wie vor 60 Jahren. Zeitlos schön.
»Der neue 911 muss als 911 zu erkennen sein –und als der neue 911.«
Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die Elbphilharmonie als Konzerthaus von Weltrang begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe im internationalen Konzertbetrieb setzen.

ZUWENDUNGEN AB 1.000.000 EURO
prof. Dr. Dr. h. c. helmut und prof. Dr. h. c. hannelore Greve prof. Dr. michael otto und Christl otto hermann reemtsma stiftung Christine und klausmichael kühne körberstiftung peter möhrle stiftung Familie Dr. karin Fischer reederei Clauspeter offen (Gmbh & Co.) k G stiftung maritim hermann & milena ebel hansotto und engelke schümann stiftung Christiane und klaus e oldendorff prof. Dr. ernst und nataly langner
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO ian und barbara karanstiftung Gebr. heinemann se & Co. k G bernhard schulte Gmbh & Co. k G Deutsche bank aG m m Warburg & Co hamburg Commercial bank a G lilli Driese J. J. Ganzer stiftung Claus und annegret budelmann berenberg – privatbankiers seit 1590 mara und holger Cassens stiftung Christa und albert büll Christine und heinz lehmann Frank und sigrid blochmann else schnabel edel music + books Dr. markus Warncke berit und rainer baumgarten Christoph lohfert stiftung eggert Voscherau hellmut und kimeva Wempe Günter und lieselotte powalla martha pulvermacher stiftung heide + Günther Voigt Gabriele und peter schwartzkopff Dr. anneliese und Dr. hendrik von Zitzewitz prof. Dr. hans Jörn braun † susanne und karl Gernandt philipp J. müller annmari und Georg von rantzau

GOLD
ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO
rainer abicht elbreederei Christa und peter potenbergChristoffersen heris To a G Christian böhm und sigrid neutzer amy und stefan Zuschke
SILBER
ZUWENDUNGEN AB 10.000 EURO
Ärzte am markt: Dr. Jörg arnswald, Dr. hansCarsten braun marlis u. Franzhartwig betz stiftung hans brökel stiftung für Wissenschaft und kultur Jürgen und amrey burmester rolf Dammers ohG
Deutsche Giganetz Gmbh F r os Ta a G annakatrin und Felix Goedhart adolph haueisen Gmbh katja holert und Thomas nowak isabella hundkastner und ulrich kastner knott & partner VD i Dr. Claus und hannelore löwe stiftung meierbruck riedel Communications Gmbh & Co. k G Dr. Gaby schönhärlVoss und ClausJürgen Voss
BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO Dirk ahlers Dr. ute bavendamm / prof. Dr. henning hartebavendamm ilse und Dr. Gerd eichhorn hennig engels kiki Fehlauer & Dr. Fabian Fehlauer, strahlenzentrum hamburg Dr. T. hecke und C. müller marga und erich helfrich Daniela kämmnitz korinna klasenbouvatier mercedesbenz hamburg hartmut † und hannelore krome Georgplatestiftung hella und Günter porth Carmen radszuweit Colleen b rosenblat rölke pharma Gmbh hannelore und albrecht von ebenWorlée stiftung
Jürgen
bröker | marie brömmel | Tobias brinkhorst | ClausG. budelmann | peter bühler | engelbert büning | amrey und Jürgen burmester | stefanie busold | Dr. Christian Cassebaum | Dr. markus Conrad | Dr. katja Conradi | Dierk und Dagmar Cordes | Familie Dammann | Carsten Deecke | Jan F. Demuth | karl Denkner | Dr. peter Dickstein | heribert Diehl | Detlef Dinsel | kurt Dohle | benjamin Drehkopf | Thomas Drehkopf | oliver Drews | klaus Driessen | herbert Dürkop | Christian Dyckerhoff | hermann ebel | stephanie egerland | hennig engels | Claus epe | norbert essing | heike und John Feldmann | alexandra und Dr. Christian Flach | Dr. peter Figge | Jörg Finck | Gabriele von Foerster | Dr. Christoph Frankenheim | Dr. Christian Friesecke | manhard Gerber | birgit Gerlach | Dr. peter Glasmacher | prof. phillipp W. Goltermann | inge Groh | annegret und Dr. Joachim Guntau | amelie Guth | michael haentjes | petra hammelmann | Jochen heins | Dr. Christine heins | Dr. michael heller | Dr. Dieter helmke | Janhinnerk helms | kirsten henniges | rainer herold | Gabriele und henrik hertz | Günter hess | prof. Dr. Dr. stefan hillejan | bärbel hinck | Joachim hipp | Dr. klausstefan hohenstatt | Christian hoppenhöft | prof. Dr. Dr. klaus J. hopt | Dr. stefanie howaldt | rolf hunck | maria illies | Dr. ulrich T. Jäppelt | Dr. Johann Christian Jacobs | heike Jahr | martin Freiherr von Jenisch | roland Jung | matthias kallis | Dr. klaus kamlah | ian kiru karan | Tom kemcke | klaus kesting | prof. Dr. stefan kirmße | kaiJacob klasen | renate kleenworth | Gerd F. klein | Jochen knees |

annemarie köhlmoss | matthias kolbusa | prof. Dr. irmtraud koop | petrus koeleman | bert e könig | sebastian krüper | arndt kwiatkowski | Christiane lafeld | marcie ann Gräfin lambsdorff | Dr. klaus landry | Günther lang | Dirk lattemann | per h lauke | hannelore lay | Dr. Claus liesner | lions Club hamburg elbphilharmonie | Dr. Claus löwe | prof. Dr. helgo magnussen | Dr. Dieter markert | sybille Doris markert | FranzJosef marxen | Thomas J. C. und angelika matzen stiftung | helmut meier | Gunter mengers | axel meyersiek | erhard mohnen | Dr. Thomas möller | Christian möller | karin moojerDeistler | ursula morawski | katrin morawskiZoepffel | Jan murmann | Dr. sven murmann | Dr. ulrike murmann | Julika und David m neumann | michael r neumann | Franz nienborg | Frank nörenberg | Dr. ekkehard nümann | Dr. peter oberthür | Thilo oelert | Dr. andreas m odefey | Dr. michael ollmann | Dr. evamaria und Dr. norbert papst | Dirk petersen | Dr. sabine pfeifer | sabine Gräfin von pfeil | aenne und hartmut pleitz | bärbel pokrandt | hansDetlef pries | karlheinz ramke | horst rahe | ulrich rietschel | ursula rittstieg | Thimo von rauchhaupt | prof. Dr. hermann rauhe | prof. Dr.ing. Dr. ing. e h. heinrich rothert | prof. michael rutz | bernd sager | siegfried von saucken | birgit schäfer | Dieter scheck | mattias schmelzer | Vera schommartz | katja schmid von linstow | Dr. hans ulrich und Gabriele schmidt | nikolaus h schües | nikolaus W. schües | kathrin schulte | irene schultehillen | Gabriele schumpelick | ulrich schütte | Dr. rer. nat. mojtaba shamsrizi | Dr. susanne staar | henrik stein | prof. Dr. Volker steinkraus | Wolf o storck | Greta und Walter W. stork | Dr. patrick Tegeder | ewald Tewes | ute Tietz | Dr. Jörg Thierfelder | Dr. Tjark Thies | Dr. Jens Thomsen | Tourismusverband hamburg e. V. | John G. Turner und Jerry G. Fischer | resi Tröbernowc | hans ufer | Dr. svenholger undritz | markus Waitschies | Dr. markus Warncke | ulrike Webering | Thomas Weinmann | Dr. Gerhard Wetzel | erika Wiebecke Dihlmann | Dr. andreas Wiele | Dr. martin Willich | ulrich Winkel | Dr. andreas Witzig | Dr. Thomas Wülfing | Christa Wünsche | stefan Zuschke
sowie weitere kuratoren, die nicht genannt werden möchten.
VORSTAND:
EHRENMITGLIEDER:
D es F reun D eskreises elbphilharmonie + laeis Z halle e V. Christian Dyckerhoff (Vorsitzender), roger hönig (schatzmeister), henrik hertz, bert e könig, magnus Graf lambsdorff, katja schmid von linstow, Dr. ulrike murmann und irene schultehillen Dr. karin Fischer †, manhard Gerber, prof. Dr. Dr. h. c. helmut Greve †, prof. Dr. h. c. hannelore Greve, nikolaus h schües, nikolaus W. schües, Dr. Jochen stachow †, prof. Dr. michael otto und Jutta a palmer † abraham | rolf abraham | andreas ackermann | anja ahlers | margret alwart | karlJohann andreae | Dr. michael bamberg | undine baum | rainer und berit baumgarten | Gert hinnerk behlmer | michael behrendt | robert von bennigsen | Joachim von berenbergConsbruch | Tobias Graf von bernstorff | peter bettinghaus | marlis und Franzhartwig betz | ole von beust | Wolfgang biedermann | alexander birken | Dr. Frank billand | Dr. Gottfried von bismarck | Dr. monika blankenburg | ulrich böcker | birgit bode | andreas borcherding | Tim bosenick | Vicente Vento bosch | Jochen brachmann | Gerhard brackert | maren brandes | Verena brandt | beatrix breede | heiner brinkhege | nikolaus broschek | Carolinaba C us a sset m anagement Gmb h a ddleshaw Goddard llp ahn & simro C k b ühnen und m usikverlag Gmb h allC ura Versicherungs a ktiengesellschaft a llen o very llp a nja h enning i nterior & Design a tour a rchitekturführungen b ankhaus D onner & reus C hel b arkassen m eyer bbs Werbeagentur b DV b ehrens Gmb h bmk h amburg cosy architecture bnp paribas real e state b ornhold Die e inrichter b raun h amburg b ritish a merican Tobacco Germany C. a . & W. von der m eden Capgemini i nvent Carl robert e ckelmann Clayston Company Companions D n W Dr. a schpurwis Gmbh & Co. kG Drawing room enerparC aG e ngel & Völkers a G e ngel & Völkers h amburg p rojektvermarktung e sche s chümann Commichau e ventteam Gmb h Flughafen h amburg Fortune h otels F rank Gruppe Freshfields b ruckhaus Deringer Garbe Gerresheim serviert Gmb h Groth & Co. Gmb h & Co. kG Grundstücksgesellschaft b ergstrasse h amburg Team h anse l ounge, The p rivate b usiness Club hbb h anseatische b etreuungs und b eteiligungsgesellschaft mb h h einrich Wegener & s ohn b unkergesellschaft h ermann h ollmann Gmb h & Co. hhla h otel Wedina h amburg ik i nvestment partners inp h olding

in T ernaT ionales musik F es T hambur G
Jürgen a braham
Corinna a renhold l efebvre und n adja Duken i ngeborg p rinzessin zu s chleswig h olstein und n ikolaus b roschek a nnegret und Claus G. b udelmann Christa und a lbert b üll b irgit Gerlach u lrieke Jürs e rnst peter komrowski Dr. u do kopka und Jeremy Zhijun Zeng h elga und m ichael k rämer s abine und Dr. k laus l andry m arion m eyenburg
i ris von a rnim Jäderberg & Cie. J ara hol D in G Gmb h Joop! kesseböhmer h olding kG klb h andels Gmb h konzertdirektion Dr. rudolf Goette Gmb h l auenstein & l au i mmobilien Gmb h l arimar portugal l ehmann i mmobilien l ennertz & Co. Gmb h loved
l upp + partner m adison h otel m alereibetrieb otto Gerber Gmb h m iniatur Wunderland nordwest Factoring und s ervice Gmb h n otariat am Gänsemarkt n otariat an den a lsterakaden o ppenhoff otto Dörner Gmb h & Co. kG plaT h Corporation Gmb h print o tec Gmb h robert C. s pies Gewerbe & i nvestment rosenthal Chausseestraße Gb r roxall Group s chlüter & m aack Gmb h shp p rimaflex Gmb h s teinway & s ons s tenzel’s Werbebüro s tolle s anitätshaus Gmb h s trahlenzentrum h amburg m VZ s trebeg Verwaltungsgesellschaft mb h Taylor Wessing The Fontenay h otel Trainingsmanufaktur Dreiklang ubs e urope se h amburg u nger h amburg Vladi p rivate i slands Weischer. m edia Wirtschaftsrat recht Worlée Chemie Wünsche Group s owie weitere u nternehmen, die nicht genannt werden möchten.
k & s m üller Zai und e dgar e n ordmann Christiane und Dr. l utz peters Änne und h artmut p leitz e ngelke s chümann m artha p ulvermacher s tiftung m argaret und Jochen s pethmann b irgit s teenholdt s chütt und h ertigk Diefenbach Farhad Vladi a nja und Dr. Fred Wendt
s owie weitere Förderer, die nicht genannt werden möchten.





Herausgeber hamburgmusik gGmbh
Geschäftsführer: Christoph liebenseutter (Generalintendant), Jochen margedant platz der Deutschen einheit 4, 20457 hamburg magazin@elbphilharmonie.de www.elbphilharmonie.de
Redaktion katharina allmüller, melanie kämpermann, Clemens matuschek, Tom r schulz; Gilda FernándezWiencken (bild)
Formgebung G rooT huis . Gesellschaft der ideen und passionen mbh für kommunikation und medien, marketing und Gestaltung; groothuis.de Gestaltung lars hammer (leitung), miriam kunisch, susan schulz; bildredaktion angela Wahl; herstellung Carolin beck; projektleitung alexander von oheimb; CvD rainer Groothuis
Beiträge in dieser Ausgabe von stephan bartels, andrea bierle, Jakob börner, simon Chlosta, laura etspüler, stefan Franzen, andrea Gruetzner, Volker hagedorn, lars hammer, Gesche Jäger, Fränz kremer, Clemens matuschek, Jan paersch, Till raether, nadine redlich, Claudia schiller, Charlotte schreiber, Tom r schulz, renske steen, Julika von Werder, Walter Weidringer, Juliane Weigelkrämer, bjørn Woll
Lithografie alexander langenhagen, edelweiß publish, hamburg
Korrektorat Ferdinand leopold Druck gutenberg beuys, Feindruckerei Gmbh langenhagen Dieses magazin wurde klimaneutral auf papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.
Anzeigenleitung antje sievert, anzeigen marketingberatung sponsoring Tel: 040 450 698 03, antje.sievert@kulturanzeigen.com
Vertrieb pressup Gmbh, hamburg
Leserservice / Abonnement elbphilharmonie magazin leserservice pressup Gmbh postfach 70 13 11, 22013 hamburg leserservice@elbphilharmonie.de Tel: 040 386 666 343, Fax: 040 386 666 299
Das elbphilharmonie magazin erscheint dreimal jährlich.
Bild- und Rechtenachweise
Cover: andrea Grützner; s 1 michael Zapf; s 2 oben: sasha Gusov, unten: picture alliance / dpa | sebastian Willnow, s 3 oben: Jakob börner, mitte: sophie Wolter, unten: radio France / Christophe abramowitz; s 4–7 akgimages / mportfolio / electa; s 8 akgimages / Wha / World history archive; s 10–14 Friedrich Gobesso; s 16–17 lars hammer; s 18 eduardus lee,
s 21 richard haughton (2); s 22 patrick Fouque, s 24 oben: Daniel Dittus, unten: sophie Wolter, s 26 sophie Wolter, s 27 v. l. n. r.: Chris schwagga, Jean Goun, lamia lahbabi, pr mattia Ghisolfi, laure bernard / parlophone records ltd, yann orhan, pr; s 28–29: nadine redlich; s 30 sasha Gusov, s 31 Daniel Dittus, s 32 sasha Gusov; s 34–41 andrea Grützner; s 42 marco borggreve, s 44 marco borggreve (2), s 45 Claudia höhne, s 46 Cyrus allyar; s 48–49 picture alliance / Fred Toulet / leemage (4), akgimages, sammlung bacharchiv leipzig, s 50 picture alliance / united archives | united archives / kpa, s 51 Claudia höhne; Jim batty / alamy stock Foto, s 53 imagebroker / alamy stock Foto, s 54: Claudia kempf, s 55: links: Christoph köstlin/ DGG, rechts: rodrigo simas; s 56 oben: sophie Wolter, mitte: monika rittershaus, unten: sophie Wolter, s 57 oben: robin Clewley (1), sophie Wolter (3); s 59 ogata, s 60 mcphoto / lovell / alamy stock Foto; s 62–63 marco borggreve (2), s 64: martin Chiang; s 66 Claudia höhne; s 67–69 Gesche Jäger; s 70 Charlotte schreiber; s 72–78 Jakob börner; s.80–81 porsche (4); s 82 nejron, s 83 bogdan Vision, s 84t irabell; s 85: paul Gregor
Redaktionsschluss 23. november 2022
Änderungen vorbehalten. nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. printed in Germany. alle rechte vorbehalten.
Träger der hamburgmusik gGmbh:

Die nächste Ausgabe des Elbphilharmonie Magazins erscheint Mitte April 2023.Chefredakteur Carsten Fastner
Manche Träume hat man nur eine Nacht lang. Andere begleiten einen das ganze Leben. Denn sie bestehen aus etwas Besonderem. Aus Sehnsucht, Mut und Ambition. Wer jemals einen solchen Traum hatte, ruht nicht. Sondern folgt ihm rund um die Uhr. Und gibt Tag und Nacht alles. So wie wir alles geben. Lassen wir diese Träume gemeinsam Wirklichkeit werden.
Große Träume haben eine große Bühne verdient. Ganz besonders, wenn die Bühne selbst aus einem Traum geboren ist. Entdecken Sie weitere inspirierende Träume: porsche.de/dreams











Als echtes Familienmitglied und treuer Begleiter ist Ihr Hund bei der HanseMerkur in den besten Händen. Auf unseren Rundum-Gesundheitsschutz inklusive OP-Versicherung können Sie sich genauso verlassen wie auf unsere Haftpflichtversicherung –und das weltweit und bei jeder Hunderasse. Denn Hand in Hand ist HanseMerkur.


