JMB J O U RN A L





Die Videoinstallation „Sans histoire“ der französischen Künstlerin Maya Schweizer wurde mit dem von den FREUNDEN DES JMB geförderten DAGESH-Kunstpreis ausgezeichnet. Die Installation greift die Frage nach gesellschaftlicher und individueller Verantwortung für unsere Zukunft auf und wird vom 5. Mai bis 27. August 2023 im Jüdischen Museum Berlin zu sehen sein.




Fördern auch Sie junge Kunst und starke Stimmen für eine gemeinschaftliche Zukunft – als Mitglied der FREUNDE DES JMB.
Die Freunde des Jüdischen Museums Berlin +49 (0)30 259 93 436 freunde@jmberlin.de

Direktorin des Jüdischen Museums Berlin Director of the Jewish Museum Berlin

DE Menschen teilen sich Wohnräume, Straßen, Plätze, besuchen den Laden im Erdgeschoss, das Café an der Ecke, das Museum in der Nähe. Wir machen gemeinsame Erfahrungen –die Erfahrung von Nachbarschaft.
In dieser Ausgabe des JMB Journals schauen wir uns um: Wir befragen und erforschen unsere Umgebung und blicken zurück zu gelungenen, konfliktreichen, alteingesessenen und unverhofften Nachbarschaften.

Geleitet hat uns dabei eine Frage: Was macht gute Nachbarschaft aus?
Erste Antworten geben unsere Nachbar*innen rund um den Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz in Wort und Bild. Einen Einblick in den Alltag jüdisch-christlicher Nachbarschaft im Mittelalter bietet uns die Historikerin Rachel Furst und stellt dabei fest, dass sich die Herausforderungen des Zusammenlebens damals wie heute verblüffend ähneln. Der Judaist Richard Elliott Friedman argumentiert anhand der Tora, dass mit dem Gebot „Liebe deinen Nächsten“ nicht nur einzelne Gruppen, sondern buchstäblich alle Menschen gemeint sind. Dass Nachbarschaft auch Freundschaft bedeuten kann, in diesem Fall mit keinem geringeren als Albert Einstein, erzählt Archivleiter Aubrey Pomerance anhand von Fotos, Briefen und einem Gedicht. Lea Simon, wissenschaftliche Volontärin am JMB, begleiten wir auf ihrer Recherche durch das Berlin des frühen 20. Jahrhunderts und stellen fest, dass Namensschilder keineswegs nur zu Türklingeln führen. Mit Candy Hartmann, Benita Braun-Feldweg und Bülent Durmuş, die aus unterschiedlicher Perspektive jeweils Expert*innen der Gegend rund um unser Museum sind, sprachen wir über Kieze, lebendige Nachbarschaften und die Notwendigkeit von offenen Räumen. Die Autorin und Anwohnerin Marica Bodrožić erzählt vom Leben am Frometund-Moses-Mendelssohn-Platz, nicht zuletzt auch vom Bau der Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin. Dass ANOHA hier inzwischen eine feste Größe ist und bisweilen auch am Mehringplatz ankert, davon berichtet Ane Kleine-Engel. Im Interview befragen wir unseren neuen Verwaltungsdirektor Lars Bahners zu Digitalisierung, offenen Zugängen und Innovationen für die Museen der Zukunft.
In diesem JMB Journal treten wir hinaus, hinein in einen vielstimmigen Kiez, den wir seit über zwanzig Jahren mitgestalten, und öffnen für Sie die diversen Perspektiven unserer Nachbar*innen. Begleiten Sie uns – gerne auch vor Ort!
EN People inhabit the same living spaces, streets, and squares. They go to the shop on the ground floor of their buildings, the café on the corner, the museum nearby. In this way they share experiences of their neighborhood.
In this issue of the JMB Journal, we take a look at the world around us: we investigate and explore the environment in which we live and recall the successful, conflict-ridden, longestablished, and unexpected neighborly relations in history. What makes a good neighbor?
Initial answers can be found in a photo and text series about our neighbors at Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz in Berlin. Everyday life in the Jewish-Christian neighborhoods of the Middle Ages is the focus of an article by the historian Rachel Furst, who notes that the challenges of coexistence were strikingly similar both then and now. Based on the Torah, Jewish Studies scholar Richard Elliott Friedman argues that the commandment to “love thy neighbor” applies not only to specific groups, but quite literally to people in general. Drawing on photographs, letters, and a poem, Aubrey Pomerance, Head of Archives at the JMB, writes that neighborly relations can lead to friendship, even in the case of a man as famous as Albert Einstein. We accompany our research trainee Lea Simon as she explores early twentieth-century Berlin and discovers that name plates are associated with other things besides doorbells. In an interview with Candy Hartmann, Benita Braun-Feldweg, and Bülent Durmuş—each an expert on the museum’s surroundings in their own right—we discuss neighborhoods, lively urban environments, and the need for open spaces. Author and local resident Marica Bodrožić tells about life at Frometund-Moses-Mendelssohn-Platz, focusing particularly on the construction of ANOHA, the children’s world of the JMB. Ane Kleine-Engel explains that ANOHA is now a permanent fixture in the area and sometimes drops anchor at Mehringplatz. In an additional interview, we ask our new Managing Director Lars Bahners about digitization, open access, and innovations for the museums of the future.
In this issue of the JMB Journal, we step out into the diverse quarter we have helped to shape for over twenty years, and we share the different perspectives of our neighbors. Feel welcome to accompany us—here on these pages and on site at the museum.
Ihre / Yours,

Seit Anfang des Jahres
arbeitet Elisabeth Weber als Provenienzforscherin am Jüdischen Museum Berlin. Ihre Aufgabe ist es, die Sammlung des Museums, aber auch alle Neuerwerbungen auf ihre Herkunft hin zu überprüfen. Notwendig ist dies, um im Nationalsozialismus geraubte Objekte zu identifizieren und sie ihren Vorbesitzer*innen zurückzugeben oder eine andere gerechte Lösung zu finden. Bereits in der Vergangenheit hat es dazu zwei Projekte am Haus gegeben: Im April 2015 begann die Provenienzforschung im JMB mit der Untersuchung eines Teils der Gemälde- und Skulpturensammlung. In einem weiteren Projekt wurden jüdische Zeremonialgegenstände über prüft. Diese Forschung soll nun auf die gesamte Samm lung ausgeweitet werden.
Elisabeth Weber has been a provenance researcher at the Jewish Museum Berlin since the beginning of 2023. Her task is to investigate the ori gins of the museum’s existing collections and all new acqui sitions. The work is necessary in order to identify objects that were looted during the Nazi regime and return them to their previous owners or else find another legitimate solution. There have already been two projects of this kind at the museum: in April 2015, provenance research at the JMB began scrutinizing parts of the painting and sculpture collection, and another project examined the Jewish ceremonial objects. This type of research is now to be extended to the museum’s collection as a whole.



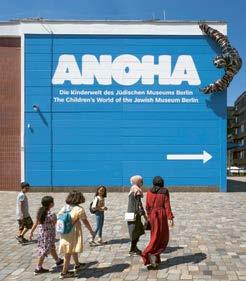


Mit wem teilt das JMB den Kiez? Anwohnerinnen, Ladenbesitzer, Projektraumbetreiberinnen, Künstlerinnen, Pädagogen und Gastronomen gestalten das Leben rund um das Museum entscheidend mit. Man findet Denk- und Projekträume, Orte des Verweilens, Arbeitsplätze, Lebens- und Lernraum. Wir haben angeklopft und wurden eingelassen.
Who shares the JMB’s neighborhood in Kreuzberg, Berlin? Residents, shopkeepers, project operators, artists, educators and restaurateurs all leave their unmistakable mark on life around the museum. You’ll find thinking and project spaces, places to linger awhile, workplaces— space to live and learn. We knocked on some doors and were invited in.
Stephan Pramme
Seite 7: Axel Gotthardt, Galilei Grundschule
Als Rektor freue ich mich täglich über das Kollegium, die internationale Ausrichtung der Schule und ihren Standort! In einer guten Nachbarschaft hilft man einander, es entstehen Kooperationen und Freund-
schaften. Als Schule arbeiten wir zum Beispiel eng mit dem Quartiersmanagement am Mehringplatz zusammen und werden durch dieses enorm unterstützt.
Axel Gotthardt, Galilei Elementary School
As the school principal, I delight every day in the teaching staff, the school’s
international orientation, and the location! In a good neighborhood, people help each other out. Cooperation and friendships arise. For example, our school works closely with the neighborhood management team based at Mehringplatz, who gives us enormous support.
Hans Nübel, Bio-Bäckerei Beumer&Lutum
Für mich bedeutet gute Nachbarschaft, dass ein kontinuierlicher Austausch von Ideen und Visionen statt findet. Das hat sich in den letzten vier Jahren hier gut entwickelt. Den Kiez kenne ich schon lange, ich habe meine ersten Gastroerfahrungen im Café Stresemann gesammelt. Es hat sich seither viel verändert – wohl fühle ich mich aber immer noch sehr!
Hans Nübel, Organic bakery Beumer&Lutum

For me, neighborliness means there is a constant exchange of ideas and visions. That has taken root very well around

here in the last four years. I’ve known this area for a long time—working at Café Stresemann was my first experience in the hospitality sector. A lot has changed since then, but I still feel very much at home!
Jinok Kim, Galerie für Keramik und Restaurant
NaNum
NaNum bedeutet Teilen. Das finde ich elementar für eine funktionierende Nachbarschaft. Dabei kann Materielles, aber auch Immaterielles wie Vertrauen und Glück miteinander geteilt werden. Während der Corona-Pandemie haben wir samstags die
Tür aufgemacht, einen Flügel in den Eingang geschoben und Musik gespielt. Die Leute standen am Platz und haben es sehr genossen.
Jinok Kim, gallery for ceramics and restaurant

NaNum
NaNum means “sharing.” I think that is fundamental to a well-functioning neighborhood. What we share could be either material things or immaterial ones like trust and happiness. During the pandemic, we opened the door on Saturdays, pushed a grand piano into the entrance, and played music. People stood on the square and really enjoyed it.
Esther Uleer, Freundin des JMB

Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, hier zu leben. Hier spüre ich Berlin. Den Blick aus meinem Wohnzimmer auf das Museum mag ich besonders. Es hat eine tolle Anziehungskraft. Für eine gute Nachbarschaft braucht es beides: Vertrautheit und Für-Sich-Sein. Die Gegend rund um den Fromet-undMoses-Mendelssohn-Platz ist mein Lebensmittelpunkt geworden. Nur ein entspannter Ort, an dem man abends mal gemütlich was trinken kann, der fehlt noch!
Esther Uleer, Friend of the JMB
I made a conscious decision to live here. Here, I can sense Berlin. I especially enjoy the view from my living room onto the museum, which has such a great power of attraction! A good neighborhood needs to both feel friendly and let you be on your own. For a long time now, my life has revolved about the area around Fromet-undMoses- Mendelssohn-Platz. The only thing still missing is somewhere to have a relaxed drink in the evening now and again!
Maha Rayan, Nachbarin
Ich lebe hier seit fast 33 Jahren und bin durchgängig sehr zufrieden. Es ist eine ruhige und sichere Umgebung – das schätze ich sehr. Mit meiner Nichte gehe ich gerne auf einen der Spielplätze, die nach und nach gebaut wurden und die alle sehr schön sind. Mit Freunden gehe ich
eher ins Café des Schicksals, dort gibt es himmlische Kuchen! Jetzt wünsche ich mir nur, dass die Miete nicht erhöht wird!

Maha Rayan, neighborhood resident I’ve been living here for almost thirty-three years and I like it very much in all respects. It’s a quiet and safe
environment—I appreciate that a lot. I like taking my niece to one of the excellent playgrounds that have been built over the years. With my friends, I prefer to go to Café des Schicksals, their cakes are heavenly! The only thing left to wish for is that my rent doesn’t go up!

Ilker Gün, Café des Schicksals Nachbarschaft? Also, in einer guten Nachbarschaft nehmen Nachbarn Pakete an und helfen auch mal aus, wenn beim Kochen zum Beispiel Salz fehlt. Mehr wäre mir aber auch wieder zu viel! Die Läden hier rund um das Museum sind gut vernetzt und wir helfen uns gerne aus, wenn es Probleme gibt.

Ilker Gün, Café des Schicksals Neighborhood? Well, in a good neighborhood, neighbors accept your parcels and they’ll help you out if you’ve run out of salt, for example. More than that would be a bit too much for me. The shops here around the museum have a good network, and we offer each other help if a problem arises.

Parameswaran
Kulasegaram, Indian Grocery Store
Meinen Laden habe ich 2005 als Kiosk für Touristen eröffnet. Erst fünf Jahre später haben wir ihn um indische Lebensmittel und einen Online-Handel erweitert. Mein Laden ist einer der ältesten in der Straße und ich kenne alle, die später dazu kamen, gut. Es ist eine tolle Nachbarschaft!
Parameswaran
Kulasegaram, Indian Grocery Store
I opened my store in 2005 as a kiosk for tourists. It was only five years later that we expanded it to sell Indian groceries and offer online shopping. So my shop is among the longest-standing in the street and I know everybody who moved in later. It’s a great neighborhood!


Valerie Schlee (links), Kreativstudio Zuckerwattenkrawatten Nachbarschaft, ein gutes Zusammenleben im Kiez, ist Arbeit. Man muss sich bemühen, und wenn das Engagement dann da ist und von vielen Leuten gleichzeitig kommt, dann kann was ganz Wunderbares geschehen. Das Schöne hier ist, dass noch so Vieles im Prozess ist!
Lisa Diedrich (Mitte), Stadtforscherin, feldfünf Ich würde gerne die internationale Dimension von Nachbarschaft betonen. Ich habe schon mit vielen Studierenden, die aus Schweden, Argentinien, Ägypten oder Island zum Forschen ins feldfünf kamen, Nachbarschaftsmodelle entwickelt.
Ihre Ideen von Stadt und Nachbarschaft bringen die Welt in den Kiez, und andersherum nehmen sie den Kiez mit in die Welt.
Karen Donndorf (rechts), donndorf design, feldfünf Schon in der Planungsphase der feldfünf-Projekträume haben wir versucht, mit experimentellen Projekten die Nachbarschaft einzubinden; die „Kreuzberg-Trilogie“ an der Kurt-Schumacher-Schule steht beispielhaft dafür. Heute sind besonders Visionen für ein Zusammenspiel mit dem Platz gefragt, der sich idealerweise bis zum JMB ausdehnen und mit Formaten bespielt werden sollte, die ihn zu einem lebendigen Ort der Begegnung machen.

Valerie Schlee (left), Creative Studio Zuckerwattenkrawatten Neighborliness, a good way of living together in the neighborhood, is hard work. You have to make an effort, and if the commitment is there, coming from many people at the same time, then something really wonderful can happen. The great thing around here is that so much is still in progress!
Lisa Diedrich (center), urban researcher, feldfünf I’d like to emphasize the international dimension of neighborhood. I have developed models of neighborhood with many students who came from Sweden, Argentina, Egypt, Iceland, and other places to research at feldfünf. Their ideas of city and of neighborhood bring the world into our corner of town and, in turn, they take our neighborhood out into the world.
Karen Donndorf (right), donndorf design, feldfünf Right at the start, when we were planning the feldfünf project spaces, we tried to involve the neighborhood through experimental projects; a good example is the “Kreuzberg Trilogy” of projects at the local Kurt Schumacher School. Today, we are specially looking for ideas regarding interaction with the square—which, ideally, should extend right up to the JMB and host formats that make it a vibrant meeting place.
Eine Vorstellung vom jüdischen Leben im vormodernen Mitteleuropa, die sich hartnäckig hält, ist die vom überfüllten, kontrollierten und abgeschotteten Ghetto. Ein Irrtum – denn die mittelalterlichen deutschen Viertel glichen in vieler Hinsicht eher heutigen Stadtstrukturen als den Ghettos der nachfolgenden Jahrhunderte.
Text Rachel FurstIn popular imagination, the crowded, controlled, and sealed ghetto is one of the enduring images of Jewish life in medieval times. A misunderstanding—medieval German neighborhoods were, in some ways, a closer analog to our contemporary urban landscapes than the ghettos of later centuries.
Ansicht der Stadt Köln, Schedelsche Weltchronik, Nürnberg, ca. 1493
Zu der Zeit, als dieser Holzschnitt entstand, gab es in Köln keine Jüdische Gemeinde mehr: Juden wurden 1424 offiziell aus der Stadt verbannt. Dennoch gibt es Belege für eine jüdische Präsenz in der Stadt bereits seit dem 4. Jahrhundert und für eine bedeutende mittelalterliche Jüdische Gemeinde zumindest vom 11. bis zum frühen 15. Jahrhundert. Das mittelalterliche jüdische Viertel in Köln war zentral gelegen, grenzte an das städtische Rathaus und umfasste sowohl private christliche als auch jüdische Wohnhäuser.
At the time this woodcut was created, there was no longer a Jewish community in Cologne: Jews were officially banned from the city in 1424. Nevertheless, there is evidence of Jewish presence in the city as early as the 4th century and of a significant medieval Jewish community from at least the 11th century through the early 15th. The medieval Jewish neighborhood in Cologne was centrally located, bordered the municipal town hall, and encompassed private Christian, as well as Jewish, residences.

DE Hohe Mauern, mächtige Tore, prekäre Lebensbedingungen und vor allem die Isolation von der christlichen Mehrheit prägten – so die weitverbreitete Annahme – den Alltag der nördlich der Alpen lebenden Jüdinnen und Juden, der „Ashkenazim“. Mitverantwortlich für diese irreführende Auf fassung sind literarische Werke wie Heinrich Heines historischer Roman „Der Rabbi von Bacharach“ und die bildlichen Darstellungen der heruntergekommenen Judengasse in Frankfurt im 19. Jahrhundert. Auch Historiker*innen haben zu diesem Missverständnis beigetragen, indem sie Begriffe wie „Ghetto“, „jüdisches Viertel“ und „jüdisches Wohngebiet“ undifferenziert verwendeten, um jüdische Lebensverhältnisse im Mittelalter zu beschreiben.
Tatsächlich gab es Ghettos als solche erst in der Frühen Neuzeit. In den allermeisten Städten des mittelalterlichen Römisch-deutschen Reiches mussten Jüdinnen und Juden nicht in abgegrenzten, ummauerten Arealen leben. Die sogenannten „Judenviertel“ waren lange Zeit gemischte Stadtviertel, in denen jüdische und christliche Familien Seite an Seite und manchmal sogar in denselben Gebäuden wohnten. Mit den Worten des Historikers Benjamin Ravid lässt sich feststellen: „Alle Ghettos waren jüdische Viertel, aber nicht alle jüdischen Viertel waren Ghettos.“ 1
Vor dem Schwarzen Tod, der verheerenden Pestwelle in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wohnte die Mehrzahl deutscher Jüdinnen und Juden in städtischen Zentren relativ nahe beieinander, oftmals in einigen wenigen miteinander verbundenen Straßen. In manchen Fällen gab es in diesen Straßen Tore, die abgeschlossen werden konnten, allerdings von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst veranlasst. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist Köln, wo sich das Rathaus im jüdischen Viertel befand und die Ratsherren die jüdische Gemeinde bitten mussten, die Tore bis zum Ende ihrer Sitzungen offen zu lassen, damit sie in andere Stadtteile zurückkehren konnten.
Dass Jüdinnen und Juden so nah beieinander lebten, bot ihnen einige Vorteile. Es ermöglichte vor allem eine uneingeschränkte Teilnahme am Gemeindeleben, da sich Gemeindeeinrichtungen wie die Synagoge, die Mikwe, das Tanzhaus oder Spielhaus und das Gästehaus in unmittelbarer Nähe befanden. In einigen Städten konnten die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner einen Eruw errichten, einen Zaun, innerhalb dessen sie am Schabbat im Einklang mit
EN High walls, imposing gates, squalid living conditions, and, above all, isolation from the Christian majority are commonly assumed to have defined the daily existence of Jews residing in the regions north of the Alps known as “Ashkenaz.” Literary works, such as Heinrich Heine’s historical novel The Rabbi of Bacharach, are partially responsible for this perception. So too are visual images of places like Frankfurt’s derelict Judengasse in the nineteenth century. And historians themselves have contributed to the confusion, by using the terms “ghetto,” “Jewish quarter,” and “Jewish neighborhood” indiscriminately to describe Jewish living arrangements in medieval times.
In point of fact, however, ghettos as such did not exist until the early modern period. In the vast majority of towns in the medieval German Empire, Jews were not forced to live in segregated, walled-off areas. For much of the Middle Ages, the so-called “Jewish quarters” of German municipalities were mixed neighborhoods in which Jews and Christians lived side by side and sometimes in the same physical structures. In the words of historian Benjamin Ravid, “All ghettos were Jewish quarters, but not all Jewish quarters were ghettos.” 1
Prior to the Black Death of the mid-fourteenth century, the vast majority of German Jews resided in urban centers, where they did tend to live in relatively close proximity to one another, often in a few interconnected streets. In some cases, these streets had gates that could be locked and unlocked; but such openings were controlled by the residents themselves. An outstanding example is Cologne, where the town hall was located within the Jewish quarter, and the local councilmen had to request that the Jewish community leave the gates unlocked until their meetings had adjourned, so that they would be able to exit the premises and return to other parts of the city.
This type of living arrangement had several advantages for the Jews. First and foremost, it enabled them to participate fully in communal life, as communal institutions, such as the synagogue, the mikveh, the community hall (Tanzhaus or Spielhaus), and the hostel for guests were located there. In some cities, it enabled the Jewish residents to set up an eruv, within whose boundaries they were allowed to transport items on Shabbat in accordance with the strictures of Jewish law. Clustered living also offered protection from occasional acts of violence directed at the Jewish community. But in
den jüdischen Gesetzen Dinge transportieren durften. Ein gemeinsames Wohngebiet bot auch Schutz vor gelegentlichen Gewalttaten gegen die jüdische Gemeinschaft. Doch vor Mitte des 14. Jahrhunderts waren diese jüdischen Wohngegenden in den meisten Fällen nicht ausschließlich jüdisch. Und selbst in späteren Zeiten, als tatsächlich meist nur noch Jüdinnen und Juden dort lebten, führte die Tatsache, dass die Wohngegenden häufig sehr zentral gelegen waren, an andere grenzten und nicht von den Behörden verschlossen und abgeschirmt wurden, dazu, dass jüdische und christliche Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt weiterhin regelmäßigen Kontakt hatten. 2
Die räumliche Nähe von jüdischen und christlichen Wohnstätten in mittelalterlichen Städten hatte erhebliche Auswirkungen auf die sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Gruppen. Das Zusammenleben auf engstem Raum bedeutete, dass sie sich nicht nur auf der Straße und auf Marktplätzen begegneten, sondern auch in privateren Räumen, beispielsweise in gemeinsamen Höfen und sogar in ihren Häusern. Beide wurden sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen mit den Lebensereignissen und den religiösen Bräuchen der jeweils anderen konfrontiert. Die gemeinsame Nutzung des städtischen Raums hieß außerdem, dass sie, wie in jeder Nachbarschaft, manchmal in Alltagsstreitigkeiten über verstopfte Abflüsse, eine verstellte Beleuchtung oder Küchengerüche gerieten. Bei dem Versuch, solche nachbarschaftlichen Konflikte zu lösen, kamen Juden und Christen auch mit dem jeweils anderen Rechtssystem in Kontakt. Diese alltäglichen Begegnungen, so aktuell sie erscheinen mögen, machten einen weit größeren Teil der mittelalterlichen jüdisch-christlichen Beziehungen aus, als die vereinzelten gewalttätigen Vorfälle und Aggressionen, die die historischen Darstellungen meist beherrschen.
Historiker*innen können die demografische Zusammensetzung mittelalterlicher Wohngebiete anhand zahlreicher Quellen rekonstruieren und die Beziehungen, die sich aus solchen Wohnverhältnissen ergaben, nachzeichnen. Ein Großteil der entsprechenden Informationen stammt aus Archivalien wie Grundbüchern, Häuserlisten und den Aufzeichnungen verschiedener städtischer Gerichtshöfe. Ein einschlägiges Beispiel ist ein Dokument, das Mitte des 14. Jahrhunderts vom Rat der Stadt Basel veröffentlicht wurde und derzeit im Basler Staatsarchiv aufbewahrt wird. 3 Dieses
Gebetbuch nach aschkenasischem Ritus, Mainz, ca. 1430
virtually all cases prior to the mid-fourteenth century, Jewish neighborhoods were not exclusively Jewish. And even during later periods, when most of these neighborhoods did house only Jews, the fact that they were often very centrally located, bordered on other residential areas, and were not locked and sealed by outside authorities continued to bring Jewish and Christian residents of the city into regular, daily contact. 2
The physical proximity between Jewish and Christian residences in medieval towns carried significant implications for social and cultural relations between these communities. Living in close quarters meant that Jews and Christians encountered one another not only in the streets and the marketplaces, but also in more intimate spaces, like shared courtyards and even the inner recesses of their homes. It meant that Jews and Christians were exposed to each other’s lifecycle events as well as to each other’s religious practices, to mundane moments as well as to extraordinary ones. Moreover, sharing urban space meant that, like neighbors anywhere, they sometimes got caught up in everyday conflicts over blocked drainage, obstructed light, and smelly cooking. In attempting to resolve these neighborhood disputes, which could be adjudicated according to both Jewish and German law, Jews and Christians also came into contact with each other’s distinct legal systems. These quotidian interactions, as contemporary as they might seem, constituted a far larger percentage of medieval Jewish-Christian relations than the occasional incidents of violence and aggression that tend to dominate historiographic accounts of religious contact.
Historians are able to reconstruct the demographic makeup of medieval neighborhoods and to make sense of the relationships that such living arrangements generated by drawing upon a variety of sources. Archival materials, including real estate registers, house lists, and the records of various municipal courts, provide much of the relevant information. One pertinent example is a document issued in the mid-fourteenth century by the city council of Basel that is currently preserved in the city’s state archive. 3 This deed, whose ostensible purpose was to affirm a ruling of the municipal judges, records a property dispute between a Christian resident of the town named Johann Tribok and his Jewish neighbor Judelin of Hanau that involved, among other things, Tribok’s kitchen window. The precise trigger for the neighborly altercation is not specified; regardless, the local
Diese Illumination aus einer Pessach-Haggada zeigt israelitische Sklaven beim Bau der pharaonischen Garnisonsstädte Pithom und Ramses. Der Baustil ist jedoch eher mittelalterlich-deutsch als altägyptisch. Das Stadtbild umfasst eine dicht bebaute Unterstadt sowie eine Oberstadt mit einer Festung, die an die rheinischen Städte erinnert, die zu dieser Zeit auch von jüdischen Gemeinden bewohnt wurden.
Prayerbook according to the Ashkenazi rite, Mainz, around 1430 This illumination from a Passover Haggadah depicts Israelite slaves building Pharaoh’s garrison cities Pithom and Rameses. The building style, however, is more medieval German than ancient Egyptian. The cityscape includes a densely-built lower city, as well as an upper city with a fortress, reminiscent of the Rhenish towns inhabited by Jewish communities throughout the era.
3 Staatsarchiv Basel-Stadt, Regest Kürschnerz. Urk. 7, 26. Juni 1344.

Schriftstück, das vermutlich eine Entscheidung der städtischen Richter bestätigen sollte, dokumentiert einen Streit zwischen dem Christen Johann Tribok und seinem jüdischen Nachbarn Judelin von Hanau, in dem es unter anderem um das Küchenfenster von Tribok ging. Der genaue Auslöser für den Nachbarschaftsstreit wird nicht erwähnt; auf jeden Fall verpflichtete das Gericht Tribok, die beanstandete Maueröffnung zu schließen und darauf zu achten, dabei seinem jüdischen Nachbarn nicht das Licht und die Luft zu nehmen. 4 Wie die meisten mittelalterlichen Urkunden identifiziert das Dokument Judelin ausdrücklich als Juden und weist umgekehrt darauf hin, dass Tribok Christ war. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass der Konflikt durch religiöse Spannungen ausgelöst worden wäre oder dass Judelins religiöse Identität den Ausgang des Gerichtsverfahrens beeinflusst hätte, das schließlich zu seinen Gunsten ausging.
Auch rabbinische Responsen – eine Form wissenschaftlicher Korrespondenzen zwischen jüdischen Rechtsgelehrten – bieten Einblicke in solche Auseinandersetzungen. Viele dieser Texte wurden von anerkannten jüdischen Rechtsgelehrten als Antwort auf Anfragen lokaler jüdischer Richter verfasst, die sich von komplizierten Gerichtsfällen überfordert sahen. In einem dieser Fälle wandten sich die Richter einer ungenannten deutschen Stadt wegen eines Juden namens Simeon, der kurz zuvor ein Haus von einem örtlichen Christen gekauft hatte, an Rabbi Meir ben Baruch von Rothenburg (gest. 1293).5 Simeon verklagte seinen neuen jüdischen Nachbarn Reuben, weil dieser eine Reihe von Fenstern zu ihrem gemeinsamen Hof hin öffnen wollte. Reuben brachte zu seiner Verteidigung vor, er habe ein Recht auf die beanstandeten Durchbrüche, da er sie nicht neu gebaut, sondern nur mit Brettern verschlossen habe, solange sein Nachbar Christ war. Er habe damals nicht gewollt, dass der Nichtjude in sein Haus blicken konnte. Bei seinem Glaubensgenossen hingegen habe er keine derartigen Bedenken. Überraschenderweise teilte der neue Nachbar Simeon seine Meinung nicht und bestand darauf, dass die Fenster – ungeachtet der religiösen Überzeugung von Reuben – wiederum seine Privatsphäre verletzten. Und auch Rabbi Meir folgte Reubens Argumentation nicht und stellte sich auf die Seite von dessen Kontrahenten. Das mittelalterliche Zusammenleben war allerdings keinesfalls selbstverständlich. Im Gegensatz zu älteren historischen Untersuchungen, die Jüdinnen und Juden eher als
court ordered Tribok to close up the offensive opening and to take care, in so doing, not to block his Jewish neighbor’s light and air. 4 The document in question, like most medieval records, explicitly identifies Judelin as a Jew and indicates, by contrast, that Tribok was Christian. It does not, however, imply that religious friction caused the conflict nor that Judelin’s religious identity affected the outcome of the court case, which was, in fact, decided in his favor.
Rabbinic responsa—a form of scholarly correspondence between Jewish legal authorities—offer additional insight into such interactions. Many of these texts were written by recognized authorities in Jewish law in response to queries submitted by local Jewish judges who found themselves stymied by complicated court cases. In one such instance, judges from an unnamed German town consulted with Rabbi Meir ben Barukh of Rothenburg (died 1293) concerning a Jew called Simeon, who had recently purchased a home from a local Christian. 5 Simeon sued his new, Jewish neighbor Reuben when the latter attempted to open a series of windows into their shared courtyard. In his own defense, Reuben claimed that he had pre-existing rights to the offending openings, as he was not constructing them anew: he had simply boarded them up so long as his neighbor was Christian, because he did not wish the non-Jew to gaze into his house. He had no such qualms, he asserted, concerning his co-religionist. Strikingly, however, Reuben’s sentiment was not shared by his new neighbor, who insisted that the windows violated his privacy, regardless of Reuben’s religious persuasion; nor was it lent credence by Rabbi Meir, who rejected Reuben’s elitist arguments and sided with his opponent. Medieval coexistence was, to be sure, far from a given. In contrast to older historical studies, which tended to depict Jews as strangers or outcasts in their own cities, recent scholarship has emphasized that medieval Jews were an integral part of the urban fabric and often felt a strong sense of identification with the urban communities in which they lived. Yet Jewish residence in these towns (much like the residence of the other groups that lived there) was dependent on privileges granted by local and regional authorities, and during times of tension, such privileges could be challenged or revoked. And while violence directed at Jews was not a daily occurrence, Jews were at times the target of physical hostilities as well as virulent polemics. This reality imbued
Fremde oder Außenseiter*innen in ihren eigenen Städten beschrieben, hat die neuere Forschung zwar hervorgehoben, dass Juden im Mittelalter ein integraler Bestandteil des städtischen Gefüges waren und sich häufig stark mit den sozialen Gefügen, in denen sie lebten, identifizierten. Jedoch war der Aufenthalt von Juden und ihrer Familien in diesen Städten an Privilegien gebunden, die von den lokalen und regionalen Behörden gewährt wurden und in Zeiten von Spannungen angefochten oder widerrufen werden konnten. Und auch wenn Gewalt gegen Jüdinnen und Juden nicht alltäglich war, so waren sie doch zuweilen das Ziel physischer Angriffe und scharfer Polemik. Aus diesen Gründen lebten sie im Mittelalter in ständiger Unsicherheit, und viele von ihnen fühlten sich in den deutschen Städten nicht zu Hause.
Tatsächlich gehörten dann in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die jüdisch-christlich gemischten Wohngebiete, die ein oder zwei Jahrhunderte zuvor noch typisch für deutsche Städte gewesen waren, weitgehend der Vergangenheit an. In mehreren Vertreibungswellen seit dem späten 14. bis zum 15. Jahrhundert wurden Jüdinnen und Juden aus den meisten Städten, in die sie jahrhundertelang integriert gewesen waren, verdrängt. Im Jahr 1462 verfügte die Frankfurter Stadtver waltung, dass alle jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner in ein abgeschottetes Areal am Stadtrand umzusiedeln hätten, und errichtete damit das erste Ghetto auf deutschem Gebiet.
In den darauffolgenden Jahrhunderten blieben die Jüdinnen und Juden zwar in den deutschen Ländern, und manche von ihnen gingen in den Städten, aus denen sie vertrieben worden waren, weiterhin ihren Geschäften und anderen Aktivitäten nach. Die meisten lebten in der Frühen Neuzeit jedoch in vergleichsweise abgelegenen ländlichen Gegenden, und die wenigen deutschen Städte, die Juden weiterhin Wohnrecht gewährten, folgten nach und nach dem Beispiel von Frankfurt.
Das ändert jedoch nichts an der Realität früherer Zeiten. Auch wenn die religiös und ethnisch gemischten Wohngebiete des mittelalterlichen Römisch-deutschen Reiches keineswegs ideal waren, glichen sie doch in mancher Hinsicht eher den heutigen Stadtstrukturen als ihren frühneuzeitlichen Pendants.
medieval Jewish life with a precariousness that made it difficult for many Jews to feel entirely at home in the German cities and towns they inhabited.
Indeed, by the second half of the fifteenth century, the mixed neighborhoods that were typical of German towns a century or two earlier had become largely a relic of the past. Waves of expulsions from the late fourteenth through fifteenth centuries removed Jews from most of the urban environments in which they had been embedded for centuries. And in 1462, the city authorities of Frankfurt ordered all Jewish residents to relocate to a closed-off area at the outskirts of the city, effectively establishing the first ghetto in the German Empire. Jews remained in German lands throughout the subsequent centuries, and some even continued to do business and pursue other endeavors in the very towns from which they had been expelled. But most of these early modern Jews lived in relatively secluded rural areas, and the few German cities that continued to grant Jews residency soon followed Frankfurt’s lead.
This coda does not change the earlier reality. Though far from utopian, the religiously and ethnically mixed neighborhoods of the medieval German Empire were, in some ways, a closer analog to our contemporary urban landscapes than their early modern counterparts.
Rachel Furst ist Spinoza-Forschungsstipendiatin für Jüdische Geschichte an der Universität Haifa, Israel. Sie hat in Jüdischer Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem promoviert und war als Research Fellow und Lehrbeauftragte an der LMU München tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen im Hochmittelalter, Geschichte des Jüdischen Rechts, Frauengeschichte und Gender Studies.
Rachel Furst is the Spinoza Research Fellow in Jewish History at the University of Haifa, Israel. She received a Ph.D in Jewish History from the Hebrew University of Jerusalem and has served as a Research Fellow and Adjunct Lecturer at LMU Munich. Her research interests include the history of Jewish-Christian relations in the Middle Ages and the history of Jewish law as well as women's history, and gender studies.
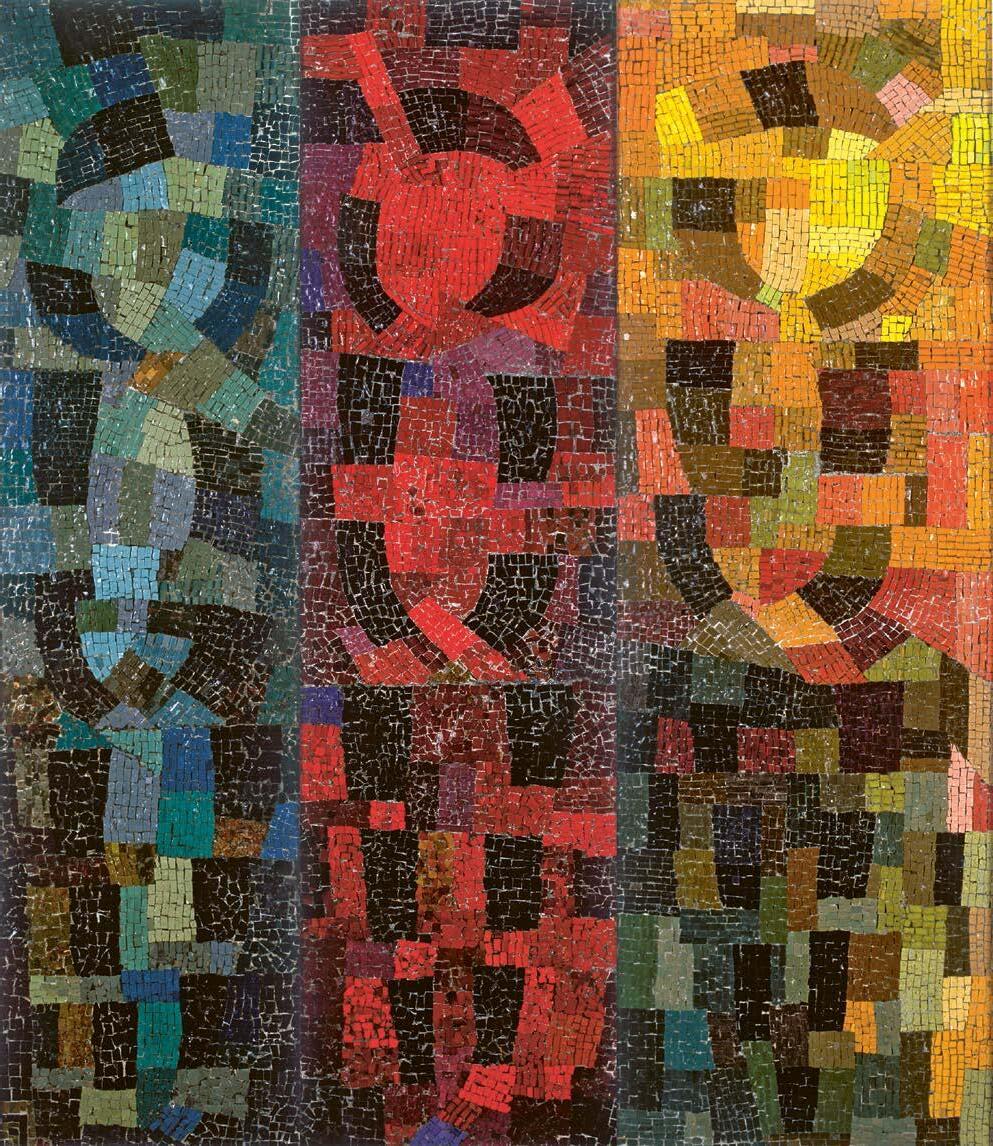 Otto Freundlich, Hommage aux peuples de couleur, 1938 175 x 156,5 cm, Mosaik, Donation Freundlich – Musées de Pontoise
Otto Freundlich, Hommage aux peuples de couleur, 1938 175 x 156,5 cm, Mosaik, Donation Freundlich – Musées de Pontoise
DE „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Ein beeindruckender Satz. Faszinierend. Inspirierend. Mit tausend möglichen Interpretationen und zehntausend offenen Fragen. Eine Forderung, die umso bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, dass sie aus dem nahöstlichen alten Juda stammt, mitten aus der Welt der Kriege, der Sklaverei, der Trennung von Klassen und Ethnien und der Diskriminierungen aller Art. Eine Deutung dieses Satzes, die seit Jahren kursiert, stellt diese große Idee allerdings auf den Kopf: Dieser Interpretation zufolge solle man nur seine israelitischen Mitmenschen wie sich selbst lieben. Was ist an dieser Auslegung dran?
In meinem Buch „The Exodus“ zeige ich, dass der Auszug aus Ägypten historisch gegeben war und insbesondere die Leviten betraf.1 Einer meiner zentralen Gedanken ist, dass die Leviten die Notwendigkeit eines anständigen Umgangs mit Fremden in der Tora deshalb besonders betonten, weil sie selbst als Fremde in Ägypten gelebt hatten:
In den levitischen Quellen E, P und D heißt es immer wieder, man dürfe einen Fremden nicht schlecht behandeln. Warum? „Weil wir in Ägypten Fremde gewesen sind.“ Die Stelle, an der das Wort „Tora“ zum ersten Mal in der Tora erscheint, lautet: „Für Einheimische und für Fremde, die bei euch leben, gilt die gleiche Weisung [Tora].“ (Ex 12:49). In den drei levitischen Quellen kommt das Gebot, Fremde gerecht zu behandeln, 52 Mal vor! Und in der nicht-levitischen Quelle J? Kein einziges Mal. William Propps Exodus-Kommentar liefert hinsichtlich der Etymologie des Wortes „Levi“ überzeugende Argumente dafür, dass dessen wahrscheinlichste Bedeutung eine „zugehörige Person“ im Sinne eines ortsansässigen Fremden ist.
Auch in anderen Gesetzbüchern des antiken Nahen Osten gibt es Hinweise auf die Sorge um schutzbedürftige Personen wie Witwen und Waisen, doch die Ausdehnung dieser Sorge auf Fremde, wie sie in der Tora zum Ausdruck kommt, ist einzigartig.
Wer gehört zu deinen Nächsten?
Das bringt uns zum Kedoschim und Levitikus 19. Dessen wohl berühmtester Satz (Lev 19:18b) lautet:
EN “Love your neighbor as yourself.” Impressive. Fascinating. Inspiring. Capable of a thousand interpretations and raising 10,000 questions. A remarkable proposition coming out of ancient Judah, which was embedded in the Near Eastern world of wars, slavery, class and ethnic divisions and discriminations of all kinds. One interpretation of this verse that has been making the rounds for years turns this grand idea on its head: The claim is that the verse means to love only one’s fellow Israelites as oneself. What is there to this claim?
In my book, The Exodus I argue that the exodus from Egypt was historical and that it particularly involved the Levites.1 I include the central idea that the Levites’ experience of having lived as aliens in Egypt led them to emphasize the importance of treating aliens fairly in the Torah:
Over and over, the Levite sources E, P, and D command that one must not mistreat an alien. Why? “Because we were aliens in Egypt.” The first occurrence of the word “torah” in the Torah is: “There shall be one torah for the citizen and for the alien who resides among you” (Exod. 12:49). In the three Levite sources, the command to treat aliens fairly comes up 52 times! And how many times in the non-Levite source, J? None. William Propp’s commentary on Exodus makes a strong case on the etymology of the very word “Levi” that its most probable meaning is an “attached person” in the sense of resident alien.
Other law codes from the ancient Near East also show concern for vulnerable persons — widows, orphans — but extending this concern to foreigners is unique to the Torah.
Which brings us to Kedoshim and Leviticus 19. Probably its most famous line is (Lev. 19:18b):
You shall love your neighbor as yourself.
As said above, some claim that this command is not gracious and inclusive at all. It is rigidly ex-clusive, meaning to love only one’s fellow Jews.
Bibel lautet: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
It’s one of the most famous lines in the Bible: “Love your neighbor as yourself.”
(Leviticus 19:18)
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Wie bereits erwähnt, behaupten manche, dieses Gebot sei keineswegs großzügig und uneingeschränkt anzuwenden. Es sei vielmehr streng exklusiv und besage, man solle nur seine jüdischen Mitmenschen lieben. Das ist eine merkwürdige Annahme. Denn der Text fordert die Juden/Israeliten an anderer Stelle auf, Fremde wie sich selbst zu lieben (Lev 19:34):
Der Fremde, der sich bei euch
aufhält, soll euch wie ein Einheimi-
scher gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen.
Was hätte also die Aufforderung, ausschließlich Juden zu lieben, für einen Sinn, noch dazu im selben Kapitel? Es stellt sich die Frage: Wer ist unser Nächster?
Der Ausdruck re’a in der Bibel
Der hebräische Ausdruck für den „Nächsten“ ist hier re’a. Re’a kommt in der Tora zum ersten Mal in der Geschichte vom Turmbau zu Babel (Babylon) vor, der biblischen Geschichte über den Ursprung der verschiedenen Völker und Sprachen. Das Wort schließt jeden Menschen auf der Erde ein (Gen. 11:3):
Sie sagten zueinander [jeder zu seinem re’a] ...
Der Ausdruck bezieht sich auf jeden Menschen, ohne verschiedene Gruppen zu unterscheiden. Man könnte einwenden, das Wort bezeichne nur die Mitglieder der eigenen Gruppe, denn an diesem Punkt der Geschichte waren tatsächlich alle Menschen noch Teil einer einzigen Gruppe. Schauen wir uns also die nächste Stelle an, an der das Wort vorkommt.
In der Geschichte von Juda und Tamar aus der Genesis hat Juda einen re’a namens Hira aus Adullam (יִמָלָֻּדֲעָה
; Gen. 38:12, 20). Hira ist ein Kanaaniter! Er kommt aus der (damals) kanaanitischen Stadt Adullam. Er kann nicht zu Judas Stamm gehören, denn zu diesem Zeitpunkt besteht der Stamm der Israeliten nur aus Jakob, seinen Kindern und etwaigen Enkelkindern.
In der Geschichte des Exodus, des Auszugs aus Ägypten, taucht das Wort an der Stelle, wo Moses die Israeliten auffordert, vor dem Auszug ihre ägyptischen Nachbarinnen und Nachbarn um Silber- und Goldgegenstände zu bitten, sowohl im Maskulinum als auch im Femininum auf (Ex 11:2):
ִיְו […] jeder Mann und jede Frau soll הָּתוּעְר תֵאֵמ sich von dem Nachbarn [re’a] Geräte aus Silber und Gold erbitten!
Es bezieht sich dort eindeutig auf Nichtisraeliten. In der Geschichte über seine ersten Jahre in Ägypten hingegen sagt Moses, als er einen Streit zwischen zwei „Hebräern“ schlichten will, zu dem Schuldigen (Ex 2:13):
Now that is very strange. When the text already directs Jews/Israelites to love aliens as oneself (Lev. 19:34),
רָגַָּה רֵגָּ ַה םֶכָל הֶיְהִי םֶ כִָָּמ חָרְזֶאְ
The stranger who resides with you
shall be to you as one of your
citizens; you shall love him as yourself, for you were strangers in the land of Egypt.
what would be the point of saying to love only Jews— and in the very same chapter! So who is our neighbor?
The Hebrew term here for “neighbor” is re‘a. The first occurrence of re‘a in the Torah is in the story of the tower of Babel (Babylon), the Bible’s story of the origin of different nations and languages. It involves every person on earth (Gen. 11:3):
and they said each to his re‘a
The term refers to every human, without any distinctions by group. Now, one might say, though, that the word might still refer only to members of one’s own group because, at this point in this story, all humans are in fact still a single group. So let us go to the next occurrence of the word.
In the story of Judah and Tamar in Genesis, Judah has a re‘a named Hirah the Adullamite (
וּהֵעֵר; Gen. 38:12, 20).
Hirah is a Canaanite! He comes from the (then) Canaanite city of Adullam. He cannot be a member of Judah’s clan because, at this point in the story, that clan, the Israelites, consists only of Jacob and his children and any grandchildren.
In the Exodus story the word appears in both the masculine and feminine in the account of how Moses instructs the Israelites to ask their Egyptian neighbors for silver and gold items before their exodus from Egypt (Exod. 11:2).
each man will ask of his neighbor
and each woman of her neighbor…
The word there refers precisely to non-Israelites. On the other hand, in the story of Moses’ early life in Egypt, when he intervenes between two “Hebrews” who are fighting, he says to the one at fault (Exod. 2:13),
?
So in that episode it refers to an Israelite. In short, the word re‘a is used to refer to an Israelite, a Canaanite, an Egyptian, or to everyone on earth.
And still people say that “Love your re‘a as yourself” means just your fellow Israelite. When the Ten Commandments include one that says: “You shall not bear false witness against your re‘a ” (
; Exod.
Deut. 5:17), do they think that this meant that it was okay to lie in a trial if the defendant was a foreigner—even though elsewhere
In dieser Begebenheit bezieht es sich also auf einen Israeliten. Kurz gesagt, mit dem Wort re’a kann ein Israelit, ein Kanaaniter, ein Ägypter oder jeder andere Mensch auf der Welt gemeint sein. Und trotzdem gibt es nach wie vor Leute, die behaupten, „Du sollst deinen re’a lieben wie dich selbst“ beziehe sich nur auf andere Israeliten. Sind sie dann auch der Ansicht, dass das Gebot „Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten [re’a] aussagen“ (רֶקָשׁ
הֶנֲעַת-אֹל; Ex 20:16; Dtn 5:20) bedeute, es sei in Ordnung, in einem Prozess zu lügen, wenn der Angeklagte ein Fremder ist – obwohl das Gesetz Israel an anderer Stelle gebietet: „Du sollst das Recht von Fremden […] nicht beugen“ (Dtn 24:17)?
Denken sie, das Gebot, man solle die Frau seines Nächsten nicht begehren (ךֶָעֵר תֶשֵׁא דֹמְחַת-אֹל ; Ex 20:17; Dtn 5:21), bedeute, dass es in Ordnung sei, die Frau eines Hetiters zu begehren – obwohl die Bibel an anderer Stelle König David dafür verurteilt, genau das zu tun?! David begehrt Batseba, die Frau des Hetiters Urija, woraufhin ihm der Prophet Natan Gottes Tadel für sein Verhalten überbringt. 2
Woher stammt also die Idee, dass man nur die eigene Gruppe lieben solle? Einige leiten sie aus dem Text-Zusammenhang ab. Wenn wir den Satz zusammen mit dem vorhergehenden lesen, heißt es:
An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen.
Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Da es in dem ersten Satz um „die Kinder deines Volkes“ geht und die beiden Sätze zu einem einzigen Vers zusammengefasst wurden, als man die Verse in der Bibel nummerierte, glaubt manch einer, es gehe in dem Satz „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ auch nur um „die Kinder deines Volkes“. Aber warum sollte das so sein? Es gibt überhaupt keinen Anlass, davon auszugehen. Lesen Sie Levitikus 19 noch einmal aufmerksam durch. Dieser Text, der fast in der Mitte der Tora steht, ist eine bemerkenswerte Zusammenstellung aus Geboten aller Art. Er wechselt zwischen ethischen und rituellen Geboten in Bezug auf Opfer, Irrlehren, Ungerechtigkeit, die gleichzeitige Aussaat von verschiedenen Pflanzenarten, das Tragen von Kleidung aus verschiedenerlei Stoffen (Schatnes), Totenbeschwörung, Klatsch, Raub, gegossene Götterbilder, Unterstützung für die Armen. Alles ist enthalten! Die Gebote in Levitikus 19 sind völlig unzusammenhängend durcheinandergewürfelt. Kein Satz kann nach dem beurteilt werden, was vor oder nach ihm steht.
Doch es gibt Kontext und Kontext. Betrachtet man alle Stellen, an denen das Wort re’a vorkommt, würde man
the law forbids Israel to “bend the judgment of an alien” (Deut. 24:17, 18)?
When another of the Ten Commandments says not to covet your re‘a’s wife (ךעֵר תֶֶשֵׁא ֹדמְחַת-ֹאל ; Exod. 20:17; Deut. 5:20), do they think that this would mean that it was okay to covet a Hittite’s wife—even though elsewhere the Bible condemns King David for doing just that!? David desires Bathsheba, who is the wife of Uriah the Hittite, and the prophet Nathan brings God’s condemnation for David’s behavior. 2
So from where did this idea come that one is supposed to love only one’s own group? Some get it from context. When we read it with the preceding line, it says:
You shall not take revenge, and you shall not keep on at the children of your people.
And you shall love your neighbor as yourself.
Since the line before it is about “the children of your people,” and the two lines were put together into a single verse when verse numbers were added to the Bible, some have assumed that the “love your neighbor as yourself” line must also be just about “the children of your people.” Why? No reason at all. Read Leviticus 19, carefully. Coming near the very center of the Torah, it is a remarkable mixture of laws of all kinds. It goes back and forth between ethical laws and ritual laws: sacrifice, heresy, injustice, mixing seeds, wearing mixed fabrics (shaatnez), consulting the dead, gossip, robbing, molten idols, caring for the poor. It has everything! The laws in Leviticus 19 come interspersed. No line can be judged by what comes before it or after it.
Indeed, there is context and there is context. In the full context of the occurrences of the word re‘a, we would never take the verse about loving your neighbor to mean: now this is just if your neighbor has the same religion as you. And in the full context of 52 references to treating aliens the same as ourselves, we would never take loving one’s neighbors to exclude aliens. People who have been reading the verse as meaning just-your-own-kind, were both misjudging the immediate context of the passage and completely missing its total context in the Bible. Apparently, they read only one verse, Leviticus 19:18.
So unfortunately Richard Dawkins in a bestselling book, The God Delusion , wrote: “‘Love thy neighbour’ didn’t mean what we now think it means. It meant only ‘Love another Jew.’ The point is devastatingly made by the American physician and evolutionary anthropologist John Hartung.”3 It was not devastating. Hartung, a professor of anesthesiology, emphasized the importance of context, but he then used only the one verse, seemingly unaware that the joining of its two statements was done by those who created numbered verses centuries after the Bible was written. And, reading
den Vers über die Nächstenliebe keinesfalls so verstehen, dass er nur dann gilt, wenn der Nächste dieselbe Religion hat wie man selbst. Und im Zusammenhang aller 52 Aussagen über die Gleichbehandlung von Fremden würde man kaum davon ausgehen, dass Nächstenliebe Fremde ausschließe. Diejenigen, die den Vers so lesen, dass er nur die eigenen Leute meint, schätzen den unmittelbaren Zusammenhang des Textabschnitts falsch ein und vernachlässigen zudem den Gesamtzusammenhang in der Bibel. Anscheinend haben sie nur einen einzigen Vers gelesen: Levitikus 19:18.
So schrieb Richard Dawkins in seinem Bestseller „Der Gotteswahn“ bedauerlicherweise: „‚Liebe deinen Nächsten‘ bedeutete nicht das, was wir heute darunter verstehen. Es hieß nur ‚Liebe einen anderen Juden‘. Diesen springenden Punkt macht der amerikanische Arzt und Evolutionsanthropologe John Hartung […] auf verheerende Weise deutlich.“3
Das Urteil Hartungs war keineswegs verheerend. Hartung, ein Anästhesieprofessor, betonte die Bedeutung des Zusammenhangs, doch benutzte er nur Levitikus 19:18 und bezog sich ausschließlich auf diese Stelle, obwohl er wusste, dass die Verbindung der beiden Sätze erst Jahrhunderte nach der Entstehung der Bibel hergestellt wurde, als man die Verse nummerierte. Und da er die Bibel nur in der Übersetzung las, erkannte er die Bedeutung des Wortes re’a nicht.
Du sollst alle Menschen lieben wie dich selbst Wir sollten diesen Fehler in der Lehre nicht weitergeben, denn im alten Israel geschah etwas Außergewöhnliches. Die Verfasser der Tora, die von jenen abstammten, die den Auszug aus Ägypten erlebt hatten, überlieferten uns ein bedeutendes Gebot: Behandle den Fremden gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Weisheit wird uns in einem Text mitgeteilt, der vor über zwei Jahrtausenden verfasst wurde. Und wenn unsere Analyse korrekt ist, geht sie auf ein Ereignis zurück, das über drei Jahrtausende zurückliegt. Wir brauchen nicht mehr darüber zu diskutieren, ob Nächstenliebe wirklich das bedeutet, was wir dachten. Sie bedeutet genau das. Vielleicht können wir unsere Zeit nun mehr denn je dazu nutzen, sie zu leben.
Verschiedene Versionen dieser Darstellung erschienen in Biblical Archaeology Review (September–Oktober 2014), S. 48–52, und auf TheTorah.com. Teile aus den beiden Texten werden hier mit freundlicher Genehmigung nachgedruckt und bieten einen Einstieg in Richard Elliott Friedmans umfassendere Abhandlung zu dem Thema in seinem 2017 bei HarperOne erschienenen Buch The Exodus
the Bible only in translation, he mistook the meaning of the word re‘a
So let’s teach not to repeat this mistake again. Something extraordinary happened in ancient Israel. The writers of the Torah who came from the stock of those who had experienced the exodus bequeathed to us something tremendous: Treat the alien the same. Love your neighbor as yourself. This piece of wisdom has reached us from a text written over two millennia ago. And, if we are right in our analysis, it derived from an event over three millennia ago. We no longer need to argue over whether love of neighbor really means what we thought. It does. Perhaps now we can use our time trying more than ever to live it.
Different versions of this treatment appeared in Biblical Archaeology Review (September–October, 2014), pp. 48–52, and in TheTorah.com. Portions of both are reprinted with permission and are preludes to the larger treatment in the book by Richard Elliott Friedman, The Exodus, published by HarperOne, 2017.
Richard Elliott Friedman ist emeritierter Ann und Jay Davis Professor für Jüdische Studien an der University of Georgia und emeritierter Katzin Professor für Jüdische Zivilisation an der University of California, San Diego.
Richard Elliott Friedman is the Ann and Jay Davis Professor of Jewish Studies Emeritus at University of Georgia and the Katzin Professor of Jewish Civilization Emeritus at University of California, San Diego.
Der
bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. The stranger who resides with you shall be to you as one of your citizens.
(Leviticus 19:34)3 Richard Dawkins, Der Gotteswahn, übers. v. Sebastian Vogel, Berlin, 2008, S. 351 f.
Am 15. Juni startet das Jüdische Museum
Berlin in den Kultursommer! Wir laden zu einem vielfältigen Programm aus Comedy, Jazz, Film und Sommerfest ein und freuen uns, Sie in unserem Museum und dem weitläufigen Museumsgarten begrüßen zu dürfen.
On 15 June, the Jewish Museum Berlin’s “Cultural Summer” begins! We invite you to a varied program of events—comedy, jazz, movies, and the Summer Party—and would be delighted to welcome you to our museum and its extensive grounds.
Comedy-Abend mit YidLife Crisis
An evening of comedy with YidLife Crisis
Yidd-ish, kosher-ish, blasphem-ish : Eli Batalion und Jamie Elman alias Chaimie und Leizer von YidLife Crisis blicken mit einer guten Portion Humor auf jüdisches Leben. Erstmals in Berlin, präsentieren die Boychiks aus Montreal einen Abend aus Comedy, Film und Musik, in dem sie auch die deutsche Hauptstadt mit viel Chuzpe unter die Lupe und aufs Korn nehmen.

In Kooperation mit dem Jüdischen Filmfestival Berlin Brandenburg (JFBB) und der Botschaft von Kanada
Yidd-ish, kosher-ish, blasphem-ish : Eli Batalion and Jamie Elman, alias Chaimie and Leizer of YidLife Crisis, reflect on Jewish life with a healthy dose of humor. For the first time ever in Berlin, the boychiks from Montreal present an evening of comedy, film, and music, which includes sizing up the German capital with their special brand of chutzpah.
In cooperation with the Jewish Film Festival Berlin Brandenburg (JFBB) and the Embassy of Canada to Germany
Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 7 Euro Admission: €12, reduced €7 Jiddisch und Englisch In Yiddish and English 15. Juni 2023, 19 Uhr 15 June 2023, 7 pm
AND THE REPRESENTATION OF JEWISH EXPERIENCE IN THE CINEMA OF THE GDR
Lust auf einen Filmmarathon der besonderen Art? Im Rahmen des Jüdischen Filmfestival Berlin Brandenburg (JFBB) zeigt das JMB alle vier Teile des Fernsehfilms „Die Bilder des Zeugen Schattmann“ von 1971/72 in Folge und stellt das Buch von Lisa Schoß „Von verschiedenen Standpunkten. Die Darstellung jüdischer Erfahrung im Film der DDR“ vor. Diese Veranstaltung bietet einen Ausblick auf die Ausstellung „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR“, die im September 2023 eröffnet.
Do you like the idea of a very special movie marathon? As part of the Jewish Film Festival Berlin Brandenburg (JFBB), the JMB is showing all four parts of the 1971/72 TV miniseries Die Bilder des Zeugen Schattmann (The Pictures of Witness Schattmann) in one session. We also present Lisa Schoß’s book Von verschiedenen Standpunkten (From Different Standpoints), about representations of Jewish experience in East German film. This event offers a taster of the exhibition Another Country : Jewish in the GDR , which will open at the JMB in September 2023.
Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro Admission: €8, reduced €5 18. Juni 2023, 14–21:45 Uhr 18 June 2023, 2–9.45 pm
Seit vielen Jahren bietet unsere open-air Konzertreihe im Museumsgarten die ganze Vielfalt des Jazz: von Klassisch bis Avantgarde.
For many years now, our open-air concert series in the Museum Garden has presented the whole spectrum of jazz, from classical to avant-garde.
Alle Konzerte: Eintritt frei, Voranmeldung auf der Website All concerts: free admission, online registration requested

jmberlin.de/kultursommer
jmberlin.de/en/summerfestival

Das Tel Aviv Wind Quintet, 2009 gegründet, ist inzwischen eines der führenden Kammermusikensembles in Israel. Sie spielen ein buntes Programm – von Bach bis Gershwin und Klezmer Musik.
Mit freundlicher Unterstützung der Israelischen Botschaft.
The Tel Aviv Wind Quintet, founded in 2009, has become one of Israel’s leading chamber ensembles. The quintet will present their program, from Bach to Gershwin and klezmer music.

Supported by the Israeli Embassy.
25. Juni 2023, 11 Uhr 25 June 2023, 11 am
Der Bassist und Komponist Shay Hazan ist eine feste Größe in der pulsierenden Jazzszene von Tel Aviv. Seine Musik verbindet Einflüsse aus der marokkanischen Gnawa-Musik, Hip-Hop und Free Jazz. Das Quintett wird durch das Duo Tal Avraham (Trompete) und Eyal Netzer (Saxophon) sowie durch Milton Michaeli (Klavier) und Haim Peskoff (Schlagzeug) vervollständigt.
Bassist and composer Shay Hazan is a mainstay of Tel Aviv’s vibrant jazz scene. His music brings together influences from Moroccan Gnawa music, hip-hop and free jazz. The quintet is completed by the horn duo of Tal Avraham (trumpet) and Eyal Netzer (saxophone) along with Milton Michaeli (piano) and Haim Peskoff (percussion).
23. Juli 2023, 11 Uhr 23 July 2023, 11 am
Für den Bassisten Tal Gamlieli ist Israel der perfekte Ort für Jazz. Klassische europäische Musikformen verbinden sich mit östlichen, nordafrikanischen und afrikanischen Stilen.
For the bassist Tal Gamlieli, Israel is the perfect place for jazz. There, classical European musical forms unite with eastern, North African, and African styles.
6. August 2023, 11 Uhr 6 August 2023, 11 am
Tayfun Guttstadts jüngstes Projekt ist die Zusammenarbeit mit Wassim Mukdad und Yael Gat. Westliche wie orientalische Klassik, sefardische und makedonische Lieder und Jazz finden in verschiedenen Mischungen und Instrumentationen mitreißend Gestalt.
Tayfun Guttstadt’s most recent project is a collaboration with Wassim Mukdad and Yael Gat. Western and oriental classical music, Sephardic and Macedonian songs, and jazz take captivating shape in different blends and instrumentations.
20. August 2023, 11 Uhr 20 August 2023, 11 am
Kinderprogramme, Expressführungen, Mitmachaktionen und eine besondere Livemusik: Auf dem diesjährigen Sommerfest sorgen die Matzoh Boys für ausgelassene Stimmung und eine gut gefüllte Tanzfläche.
Children’s entertainment, whistle-stop tours of the museum, hands-on activities, and some very special live music: At this year’s Summer Party the Matzoh Boys guarantee an exuberant atmosphere and a crowded dance floor.
9. Juli 2023, 14–19 Uhr 9 July 2023, 2–7 pm

Rund sechs Kilometer südlich von Potsdam erbaute Albert Einstein im Jahr 1929 einen Sommersitz, in Caputh gelegen und in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses der Berliner Familie Stern. Die Entdeckung einer Freundschaft.
Six kilometers south of Potsdam, in 1929, Albert Einstein built a summer residence, situated in Caputh and in the immediate vicinity of the house of the Stern family from Berlin. The discovery of a friendship.
DE „Ich bin früher oft mit Einstein segeln gegangen“, erzählte mir die 93-jährige Irene Salinger (geb. Stern) bei einem Besuch 2004 in Kalifornien. Eine Mitteilung, die ich als eine der unerwartetsten – trotz unzähliger Gespräche mit deutschjüdischen Überlebenden und Emigranten in den letzten 22 Jahren – sicher nie vergessen werde. „Hier sehen Sie uns“, sagte die zierliche, elegante Irene und zeigte mir ein Foto von sich als strahlende 20-Jährige neben dem berühmtesten Mann der Welt an Bord seines Segelschiffs „Tümmler“. Und so erfuhr ich die wunderbare Geschichte einer nachbarschaftlichen Freundschaft im malerischen Caputh, südlich von Potsdam.
Irene Salinger war die älteste Tochter des Regierungsbaumeisters Adolf Stern und seiner Frau Elsbeth geb. Salomon. In der ersten Hälfte der 1920er-Jahre hatten sich
EN “I often went sailing with Einstein,” the 93-year-old Irene Salinger (née Stern) told me when I visited her in California in 2004. It was a comment I’ll never forget, being one of the most unexpected I ever heard in the countless conver sations I have had with German-Jewish survivors and emigrants over the last twenty-two years. “Here we are,” said the elegant Irene, as she showed me a photo of herself as a radiant 20-year-old next to the most famous man in the world onboard his sailboat “Tümmler” (“Dolphin”). And thus I learned about the wonderful story of a neighborly friendship in picturesque Caputh, south of Potsdam.
Irene Salinger was the oldest daughter of the government master-builder Adolf Stern and his wife Elsbeth née Salomon. Elsa and Albert Einstein and the Sterns met
→
Elsa und Albert Einstein und die Eheleute Stern in Berlin kennengelernt und angefreundet. Im Jahr 1926 bauten die Sterns ein Sommerhaus auf ihrem einige Jahre zuvor erworbenen Grundstück, an einem sanften Hügel oberhalb des Templiner Sees am Rand des brandenburgischen Ortes Caputh. Sie hofften, dass sich allmählich Verwandte oder vielleicht auch besonders interessante Nachbarn neben ihnen ansiedeln würden. Sie mussten nicht allzu lange warten.
Zum 50. Geburtstag des Nobelpreisträgers Einstein, im Jahr 1929, beabsichtigte der Magistrat der Stadt Berlin ihrem bekanntesten Einwohner einen Sommersitz zu schenken. Das Vorhaben geriet allerdings zum öffentlichen Skandal, da die Stadt sich unfähig zeigte, einen geeigneten Standort zu finden. Die Diskussion zog sich, mitunter begleitet von antisemitischen Äußerungen, in die Länge. Die verfahrene Lage führte Adolf Stern dazu, der Stadt Bauland auf seinem eigenen Grundstück anzubieten. Vergebens. Als seine Geduld am Ende war, erwarb Einstein das Gelände und baute selbst. Kurz vor Baubeginn trugen sich der Architekt Konrad Wachsmann, Albert sowie Elsa Einstein in das Gästebuch ihrer künftigen Nachbarn ein, Albert mit einer witzigen Zeichnung eines Strichmännchens, das durch ein Teleskop auf ein Segelboot schaut. Fünf Monate später war das Haus bezugsfertig, und zum Einzug schenkten die Sterns den Einsteins ein eigenes Gästebuch mit der Inschrift: „Dem großen Nachbar in Verehrung gewidmet vom Hause Stern. Caputh, September 1929.“
Drei unbeschwerte Sommer verbrachten die Einsteins neben den Sterns. 1931 kam eine neue Nachbarin dazu, die jüdische Pädagogin Gertrud Feiertag, die oberhalb der Sterns eine Gründerzeitvilla erwarb und darin ein Landschulheim einrichtete.
Die enge Freundschaft zwischen Einsteins und Sterns ist in vielen Fotografien sowie in einigen erhaltenen Briefen und Texten festgehalten, beispielsweise in einem Gedicht, das der leidenschaftliche Briefmarkensammler Adolf Stern einem Brieföffner beilegte, den er der philatelistisch gänzlich unbewanderten Nachbarin schenkte, in „begieriger Hoffnung auf wohltätige Folgen“ – unzer-
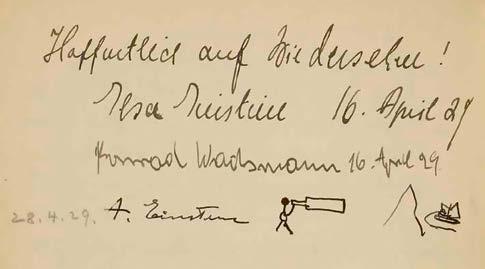
each other in Berlin in the first half of the 1920s and became friends. In 1926, the Sterns built a summerhouse on the property they had purchased a few years earlier on a gentle hillside above Templiner See, a lake on the edge of Caputh, a town in Brandenburg. They hoped that relatives or maybe even particularly interesting neighbors would move in next door. They didn’t have to wait very long.
On Albert Einstein’s fiftieth birthday in 1929, the magistrate of the city of Berlin wanted to present the Nobel laureate, its best-known resident, with a summer residence. The plan turned into a public scandal, however, since the city proved to be incapable of finding an appropriate location. The discussion dragged on, accompanied by antisemitic statements. The quandary led Adolf Stern to offer the city some building land on his own property. To no avail. When his patience started wearing thin, Einstein bought the plot and built a house himself. Shortly before the construction began, the architect Konrad Wachsmann and Albert and Elsa Einstein entered their names in the guestbook of the Einsteins’ future neighbor. Albert added a funny drawing of a stick figure gazing at a sailboat through a telescope. Five months later, the house was finished and as a housewarming gift the Sterns gave the Einsteins their own guestbook, with the inscription: “To our great neighbor—dedicated with admiration—the Sterns—Caputh, September 1929.”
The Einsteins enjoyed three carefree summers next to the Sterns. In 1931, a new neighbor joined them, the Jewish educator Gertrud Feiertag, who had purchased a late-nineteenth-century villa above the Sterns and set up a country boarding school there.
The close friendship between the Einsteins and the Sterns is evidenced in many photographs as well as in letters and texts, such as the poem that Adolf Stern, a passionate stamp collector, gave together with a letter opener to Elsa Einstein, who was totally inexperienced in all things philatelic, “in ardent hope for charitable results”—undamaged postage stamps from Einstein’s global correspondence. The poem, written in 1932, was signed “Adolf (regrettably) Stern.”
rissene Briefmarken der weltweiten Einstein’schen Korrespondenz. Unterzeichnet ist das 1932 entstandene Gedicht mit „Adolf (leider) Stern“.
Um die gleiche Zeit schrieb Albert Einstein weise Worte an seine Segelbegleiterin, Sterns Tochter Irene, die nunmehr eine angehende Modemacherin war:
„Jugend, weisst du, dass du nicht die erste Jugend bist, die nach einem Leben voll Schönheit und Freiheit lechzte? Jugend, weisst Du, dass all deine Vorfahren so waren wie du und der Sorge und dem Hass verfielen? Weisst du auch, dass deine heissen Wünsche nur dann in Erfüllung gehen können, wenn es dir gelingt, Liebe und Verständnis für Mensch, Tier, Pflanze und Sterne zu erringen, wenn jede Freude deine Freude und jeder Schmerz dein Schmerz sein wird? Oeffne deine Augen, dein Herz und deine Hände und meide das Gift, das deine Ahnen aus der Geschichte gierig gesogen haben. Dann wird die Erde dein Vaterland sein und all dein Schaffen und Wirken wird Segen spenden.“ 1
Die Einsteins verließen Caputh im Dezember 1932 in Richtung USA, wo Albert am California Institute of Technology eine Gastprofessur innehatte. Nach Deutschland sollten sie nie wieder zurückkehren. Am 20. März 1933 wurde das Haus in Caputh aufgrund der absurden Behauptung, dort seien Waffen gelagert, durchsucht und zum Teil beschädigt. Einsteins geliebtes Segelboot wurde im Juli konfisziert. Das Haus und dazugehörige Grundstück konnte jedoch ab Mai 1933 von Gertrud Feiertag gemietet werden, um dem starken Anstieg der Schülerzahl Rechnung zu tragen.
Around the same time, Albert Einstein wrote these wise words to his sailing companion, Stern’s daughter Irene, who had since become an aspiring fashion designer:
“O Youth: Do you know that yours is not the first generation to yearn for a life full of beauty and freedom? Do you know that all your ancestors felt as you do—and fell victim to trouble and hatred? Do you know, also, that your fervent wishes can only find fulfillment if you succeed in attaining love and understanding of men, and animals, and plants, and stars, so that every joy becomes your joy and every pain your pain? Open your eyes, your heart, your hands, and avoid the poison your forebears so greedily sucked in from History. Then will all the earth be your fatherland, and all your work and effort spread forth blessings.” 1
The Einsteins left Caputh in December 1932 bound for the United States, where Albert had a guest professorship at the California Institute of Technology. They were never to return to Germany. On 20 March 1933, their house in Caputh was searched and partially damaged on the basis of the absurd claim that weapons were being stored there. Einstein’s beloved sailboat was confiscated in July. Nevertheless, Gertrud Feiertag was able to rent the house and accompanying property as of May 1933 to accommodate the great increase in the number of pupils.
For the Stern family, as well, the political situation brought substantial changes. Both Adolf Stern and his sonin-law Harry Salinger were dismissed from their positions in public service. The first member of the family to leave Germany was the 21-year-old daughter Ingeborg, who traveled to rela-
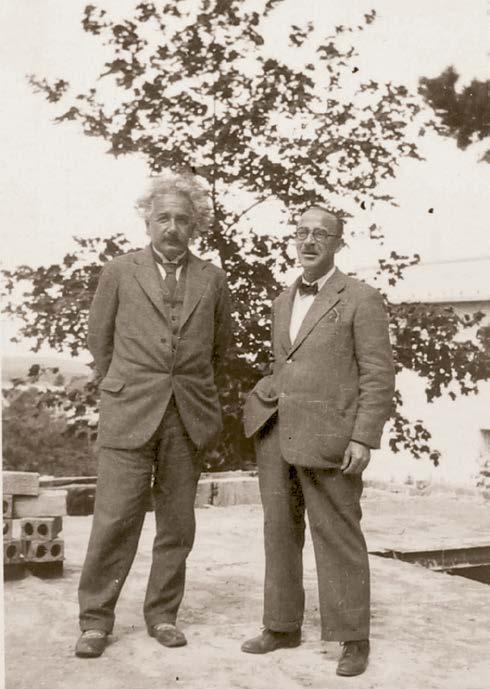
Auch für die Familie Stern brachte die politische Lage gravierende Änderungen. Sowohl Adolf Stern als auch sein Schwiegersohn Harry Salinger verloren ihre Ämter im öffentlichen Dienst. Als erstes Mitglied der Familie verließ Sterns 21-jährige Tochter Ingeborg Deutschland und reiste im Juni 1934 zu Verwandten der Mutter nach Kalifornien. In einem Brief aus Princeton vom März 1935 bringt Albert Einstein seine Freude zum Ausdruck, „dass Sie im fernen Westen nun doch einigermaßen festen Fuß gefasst haben.“ Und fügt hinzu: „So ein richtiges Caputher Sternchen findet schon seinen Weg durch die Finsternis.“ 2 Nach Kalifornien wanderten 1936 auch Irene und Harry Salinger aus; Elsbeth Stern folgte im Juni 1938. Adolf Stern blieb in Berlin zurück, wo er versuchte, soviel wie möglich vom Familienbesitz und -vermögen zu retten.
Im Juli 1935 wurde der Sommersitz von Albert Einstein beschlagnahmt und an das Land Preußen übereignet. 1938 ahnte Einstein, dass noch Schlimmeres bevorstand und setzte sich für eine Auswanderung Gertrud Feiertags ein. Sie aber blieb und musste am Morgen des 10. Novembers erleben, wie das Landschulheim demoliert und seine Bewohner*innen vertrieben wurden. Auch das Haus der Familie Stern wurde überfallen. Etwa drei Monate später konnte das Anwesen verkauft werden, worum sich Adolf Stern bereits ab Mitte 1938 bemüht hatte, natürlich weit unter Wert.
Im fernen Kalifornien verfasste im März 1939 die Familie Stern/Salinger, sicherlich mit den jüngsten gewalt-
tives of her mother in California in June 1934. In a letter Albert Einstein wrote from Princeton in March 1935, he expressed his delight that she “finally settled down in the distant West.” And he added, “A real Caputh starlet will surely find its way through the darkness.” 2
In 1936, Irene and Harry Salinger also emigrated to California. Elsbeth Stern followed in June 1938. Adolf Stern remained in Berlin, where he tried to rescue as much of the family property and assets as possible.
Albert Einstein’s summer residence was confiscated in July 1935 and transferred to the property of the State of Prussia. In 1938, sensing that things would get worse, he tried to help Gertrud Feiertag emigrate. But she stayed and on the morning of 10 November had to experience firsthand how her boarding school was ransacked and the pupils and teachers driven out. The house of the Stern family was also
Die Sommerhäuser der Familien Einstein und Stern in Caputh, ca. 1930–1966
The Einstein’s and Stern’s residences in Caputh, ca. 1930–1966

2 https://www.shapell.org/manuscript/einstein-jewish-refugees-from-germanyhitler-1935/#transcripts
Herbert Sonnenfeld, Broschüre des Jüdischen Landschulheims Caputh, ca. 1933
Herbert Sonnenfeld, Brochure of the Jewish country boarding school, Caputh, around 1933
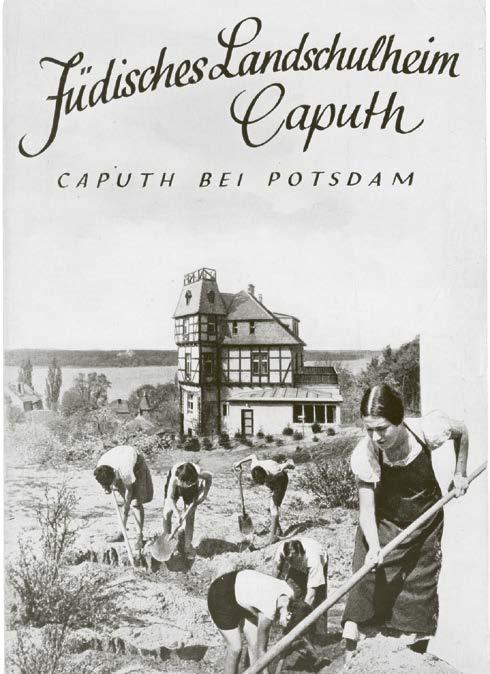
samen Ereignissen vor Augen, einen kurzen und bewegenden Brief an ihren ehemaligen Nachbarn:
„,Erinnerungen sind das einzige Land, aus dem wir nicht vertrieben werden können.‘ Wir sind froh und dankbar, dass wir so schöne Zeiten erleben durften, in welchen unser Zusammenleben mit Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, und Ihrer lieben Familie in dem herrlichen Caputh einen Höhepunkt bildet. In diesen dankbaren Rückerinnerungen senden die ‚Caputher Sterne‘ Ihnen noch nachträglich ihre herzlichsten Glückwünsche. Bis auf meinen Mann, der leider immer noch in Deutschland [ist], sind wir alle schon hier gelandet, wir hoffen aber, dass er nun auch baldigst nachkommen kann. Lockt Sie das herrliche Californien nicht auch wieder zu einem Besuch, worüber wir uns unendlich freuen würden. Mit den herzlichsten Grüssen an Sie und Frau Margot [Einsteins Stieftochter]
Ihre Elsbeth Stern, Reni Salinger, Harry Salinger, Inga SternFodor, Franz Fodor“ 3
Adolf Stern gelang es kurz vor Kriegsbeginn im August 1939 Deutschland zu verlassen, er kam im Oktober in Kalifornien an. 1944 nannte er in seinem Antrag auf amerikanische Staatsbürgerschaft seinen weltberühmten Nachbarn als Zeugen. Zu einem persönlichen Wiedersehen kam es aber scheinbar nie. Adolf Stern starb 78-jährig im August 1951, Albert Einstein vier Jahre später im Alter von 76 Jahren. Gertrud Feiertag schaffte es, trotz der Bemühungen Albert Einsteins, nicht zu emigrieren. Sie wurde im Mai 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet.
Schon seit vielen Jahren ist der ehemalige Sommersitz Albert Einsteins Ziel von Besucher*innen aus der ganzen Welt. Das 1997 eingerichtete Jugendhilfezentrum im Haus des früheren Landschulheims trägt seit 2008 den Namen Gertrud Feiertags, die 2020 postum zur Ehrenbürgerin Capuths ernannt wurde – wie schon Albert Einstein im Jahre 1949. Lediglich zur Familie Stern gibt es in Caputh keinerlei Hinweise. Ihr schönes, bald 100 Jahre altes Haus ist jedoch erhalten und bewohnt. Doch niemand wird vor Ort von den Beziehungen aller zueinander erfahren können.
Umso glücklicher die Fügung, dass diese Nachbarschaft sich in den Sammlungen des Jüdischen Museums Berlin abbildet. Unser herzlichster Dank gilt Irene, Thomas und Lynda Salinger für die Stiftung ihrer bedeutenden Familiensammlung.
raided. About three months later, after trying since mid-1938, Adolf Stern finally managed to sell the residence, needless to say far below its value.
Far away in California in March 1939, the Stern/ Salinger family wrote a short and moving letter to their former neighbor, certainly with the recent violent events in mind:
“‘Memories are the only land from which we cannot be expelled.’ We’re happy and grateful that we could enjoy such wonderful times, during which living together with you, dear Professor, and your dear family in lovely Caputh was a highlight. In these thankful reminiscences, the ‘Caputh stars’ are sending their belated but most heartfelt greetings. Except for my husband, who is unfortunately still in Germany, we have all landed here, but we hope that he will join us as soon as possible. Should the magnificent California entice you to visit again, we would be infinitely happy. With the most heartfelt greetings to you and Miss Margot [Einstein’s stepdaughter], Yours truly, Elsbeth Stern, Reni Salinger, Harry Salinger, Inga Stern-Fodor, Franz Fodor” 3
Adolf Stern was able to leave Germany in August 1939, shortly before the war started, and he arrived in California in October. In his application for American citizenship from 1944 he named his world famous neighbor as a witness and referred to him as a close friend. He and Einstein however apparently never met again in person. Stern died in August 1951 at the age of 78; and Einstein, age 76, died four years later. Gertrud Feiertag did not manage to emigrate despite Albert Einstein’s efforts. She was deported to Auschwitz in May 1943 and murdered there. For many years already, Albert Einstein’s former summer residence has been visited by tourists from all over the world. The youth welfare center created in 1997 in the building of the former country boarding school was named after Gertrud Feiertag in 2008. She was posthumously made an honorary citizen of Caputh in 2020, as was Albert Einstein in 1949. Only the Stern family is not remembered officially anywhere in Caputh. Their beautiful home, however, almost 100 years old, has survived and is inhabited. But on site in Caputh, no one can learn of the interrelationships among all the former neighbors. All the more fortunate is the stroke of fate that these neighborly relations are portrayed in the collections of the Jewish Museum Berlin. Our sincere gratitude goes to Irene, Thomas, and Lynda Salinger for donating their significant family collection to the Jewish Museum Berlin.
Aubrey Pomerance leitet seit 2001 das Archiv des Jüdischen Museums Berlin und die dortige Dependance des Archivs des Leo Baeck Instituts New York und der Dependance der Wiener Holocaust Library.
Since 2001, Aubrey Pomerance has been Director of Archives at the Jewish Museum Berlin and the local branch of the archives of the Leo Baeck Institute New York and the branch of the Wiener Holocaust Library.
8.9.2023 –14.1.2024

Die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße, Aufnahme von Mathias Brauner, Berlin, 1987
The Neue Synagoge (New Synagogue) in Oranienburger Strasse, photography by Mathias Brauner, Berlin, 1987
Zwischen antifaschistischer Gesellschaft, sozialistischer Utopie und gelebtem Judentum: Mit der kulturgeschichtlichen Ausstellung „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR“ nimmt das Jüdische Museum Berlin jüdische Erfahrungen in der DDR in den Blick und präsentiert damit einen oft unsichtbaren Teil deutsch-jüdischer Nachkriegsgeschichte. In Interviews, Alltagsobjekten, Kunst, Literatur und Film erzählt die Ausstellung vom jüdischen Leben in Ostdeutschland und wirft dabei Fragen nach Selbstverständnissen und Zugehörigkeiten auf. Sie gibt Einblicke in verschiedene Themengebiete, u.a. die Remigration aus dem Exil, Ostberlin, jüdische Kindheit und Jugend in der DDR, Gemeindeleben, Generationenkonflikte und Staatsfragen.
Die Ausstellung wird von einem vielfältigen Programm aus Filmabenden, einer Konferenz, Werkstattgesprächen und einem Konzert begleitet.
Eine reich bebilderte Publikation zur Ausstellung mit 15 Essays verschiedener Autor*innen erscheint im Ch. Links Verlag, Berlin.
Navigating ideas about anti-fascist society, socialist utopias, and practiced Judaism, the exhibition Another Country: Jewish in the GDR at the Jewish Museum Berlin will explore Jewish experiences in the German Democratic Republic and shed light on an often overlooked aspect of postwar German-Jewish history. Featuring interviews, everyday objects, artwork, literature, and films, the exhibition will tell the story of Jewish life in East Germany, raising questions about self-understanding and belonging. It will provide insight into a range of topics, including Jews returning from exile, the city of East Berlin, growing up Jewish in the GDR, Jewish community life, generational conflicts, and the communist state.
The exhibition will be accompanied by a diverse program of events, including film evenings, workshop discussions, a conference, and a concert.
Ch. Links Verlag, Berlin, will publish a richly illustrated exhibition catalogue with fifteen essays by various authors.
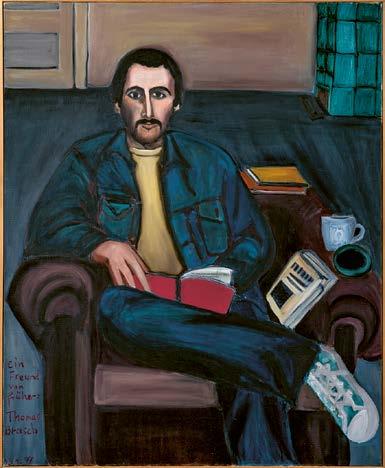
Automatenfoto von Dora Benjamin, Frankreich, ca. 1945
Photo booth image of Dora Benjamin, France, around 1945

A Talk with Benita Braun-Feldweg, Candy Hartmann and Bülent Durmuş
Benita Braun-Feldweg leitet mit Matthias Muffert bfstudio-architekten in Berlin, welches das Metropolenhaus am Jüdischen Museum Berlin realisiert hat. Als Architektin, Projektentwicklerin, Bauherrin und Kulturmanagerin in vielschichtigen Rollen hat sie Konzept und Finanzierung des Projekts verantwortet. Sie interessiert sich für Architektur und Stadt als mehrdimensionales Geflecht von öffentlichem und privatem Raum. Nachbarschaften zu initiieren bedeutet eine gemeinschaftliche Strategie des „Sich-Kümmerns“.
Candy Hartmann ist Geografin und Stadtentwicklerin und seit 2006 Quartiersmanagerin des Mehringplatzes in Berlin Kreuzberg. Mit dem Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier“ (ehemals: Soziale Stadt) unterstützt der Bund die Länder seit 1999 bei der Stabilisierung strukturschwacher Stadt- und Ortsteile durch den Einsatz von Quartiersmanagements. Das QM am Mehringplatz fördert die Vernetzung der Institutionen, lokalen Akteure und Anwohner*innen und trägt zu einer lebendigen und nachhaltigen Nachbarschaft bei.
Bülent Durmuş ist seit März 2008 Organisationsdirektor des JMB. Seit 2000 begleitet der studierte Architekt federführend die Entwicklung des Gebäudeensembles, darunter die baulichen und betrieblichen Maßnahmen rund um die beiden Dauerausstellungen des Museums (2001 und 2020) sowie den Kauf und Umbau der ehemaligen Blumengroßmarkthalle, die heute die W. Michael Blumenthal Akademie, die Bibliothek, das Archiv, Büroeinheiten und die Kinderwelt ANOHA beherbergt. Von 2017 bis 2019 war er Mitglied des Sanierungsbeirates Südliche Friedrichstadt und vertrat dort die Interessensgruppe Kultur.
Benita Braun-Feldweg co-directs, with Matthias Muffert, the Berlin firm bfstudio-architekten, which designed and oversaw the construction of the Metropolenhaus am Jüdischen Museum Berlin. She was responsible for the conceptual development and financing of the project and fulfilled complex roles as architect, project developer, building contractor, and cultural manager. She is interested in architecture and urban life, which she sees as a multidimensional interplay of public and private space. For her, creating neighborhoods involves a collaborative management strategy.
Candy Hartmann is a geographer and urban developer who began working as the neighborhood manager for Mehringplatz in Kreuzberg, Berlin, in 2006. Since 1999, as part of the urban development program “Social Cohesion – Living Together in the Neighborhood” (formerly Socially Integrative City), the German federal government has used the concept of neighborhood management to support the German Länder, or states, in stabilizing structurally weak urban and community districts. The neighborhood management team at Mehringplatz forges ties between institutions, local stakeholders, and residents and contributes to creating a lively, sustainable neighborhood.
Bülent Durmuş is a trained architect who was appointed organizational director of the JMB in March 2008. Since 2000, he has overseen the development of the JMB architectural ensemble, a field of work that has encompassed the structural and operational measures linked to the museum’s two permanent exhibitions (2001 and 2020), as well as the purchase and conversion of the former flower market hall, which now houses the W. Michael Blumenthal Academy, the JMB library, archives, office units, and the ANOHA Children’s World. From 2017 to 2019, he was a member of the advisory board for Südliche Friedrichstadt, representing stakeholders in the cultural sphere.
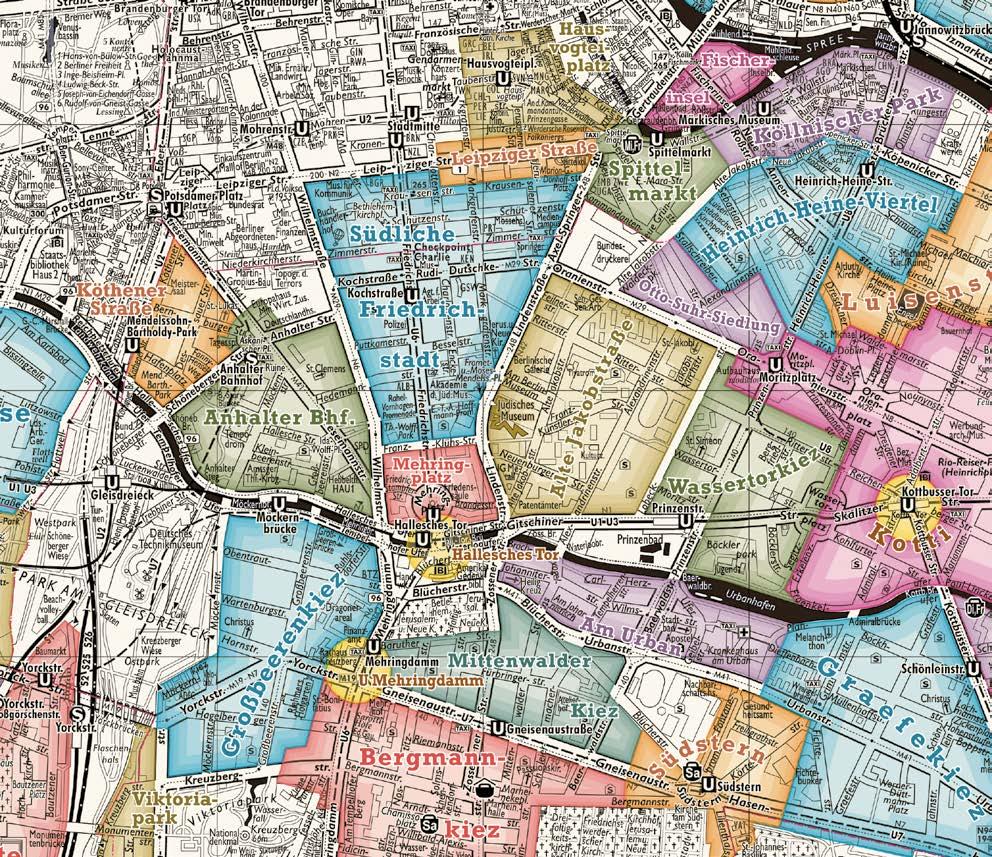
Libeskinds Zick-Zack-Bau, daneben das Barockpalais, gegenüber die ehemalige Blumengroßmarkthalle aus den 1960er-Jahren. Das ungewöhnliche Gebäudeensemble des JMB beflügelte in den letzten Jahren moderne Wohn- und Arbeitskonzepte rund um den Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz. Aber auch ältere Wohnanlagen und Hochhäuser, der Mehringplatz und das taz-Gebäude sind in unmittelbarer Nähe. Städtebauliche und soziale Projekte geben Impulse für ein lebendiges Miteinander in einer höchst diversen Nachbarschaft. Ein Gespräch über die Notwendigkeit von Begegnungen, die Überwindung von Barrieren und Visionen urbanen Zusammenlebens.
Libeskind’s zigzag building is located next to the baroque mansion and across the street from the former flower market hall built in the 1960s. In recent years, the unusual ensemble of JMB buildings has inspired modern residential and work concepts in and around Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz. Older housing complexes and high rises, the taz building, and Mehringplatz are situated in the direct vicinity. Urban development and social projects provide impetus for lively interactions in a highly diverse neighborhood. A conversation about the necessity of encounters, the overcoming of barriers, and visions of urban coexistence.
JMB: Sie alle haben beruflich mit Nachbarschaft zu tun. Wer oder was gehört hier, rund um den Fromet-und- MosesMendelssohn-Platz, eigentlich dazu?
Benita Braun-Feldweg: Mir stellt sich die Frage, ob Nachbarschaft und Kiez sich unterscheiden. Ich habe deshalb vorab zu unserem Gespräch einen Blick in den Berliner Kiezplan geworfen, um genau zu verstehen, von wo bis wo denn eigentlich unser Kiez verläuft. Ich war überrascht, dass er zwar Teil des Quartiers Südliche Friedrichstadt, aber ein eigener Kiez ist.
Bülent Durmuş: Aber das Quartiersmanagement ist doch auch hier zuständig, oder?
Candy Hartmann: Nein, streng genommen nicht! Unser Wirkungsbereich ist auf einzelne Straßenzüge genau definiert, in denen wir unsere Fördermittel einsetzen können. Wenn wir also von unserer Nachbarschaft sprechen, sprechen wir von allen Menschen, die genau in diesem Kiez leben. Aber natürlich gucken wir über
den Tellerrand! Wir haben ja schon mit dem JMB zusammengearbeitet, und auch mit feldfünf sind wir sehr eng vernetzt.
JMB: In einer Großstadt wie Berlin gibt es viele Formen des Zusammenlebens. Was bedeutet für Sie Nachbarschaft?
Benita Braun-Feldweg: Nachbarschaft hat in jedem Fall eine räumliche Dimension. Man lebt Tür an Tür, man trifft sich auf der Straße, vielleicht kommt man ins Gespräch. Durch das Zufällige und Spontane bekommt Nachbarschaft eine persönliche, eine soziale Note. Dadurch kommt es zu wiederkehrenden Begegnungen und im besten Falle entstehen dadurch gemeinsame nachbarschaftliche Projekte.
JMB: Nachbarschaft braucht also auch etwas Aktives.
Benita Braun-Feldweg: Ja, Nachbarschaft braucht Impulse!
Bülent Durmuş: Ich habe ja natürlich einen „dienstlichen Blick“ auf diese Nachbar-
JMB: You all deal with neighborhoods in your work. Who and what belongs to the neighborhood around Fromet-und-MosesMendelssohn-Platz?
Benita Braun-Feldweg: I’d first like to ask whether there’s a difference between the two German words for neighborhood, Nachbarschaft and Kiez. Before the interview, I took a look at the Berlin Kiez map to get a better idea of where the borders of our neighborhood lie. I was surprised to learn that although everything around the Fromet-und-Mo-
Candy Hartmann: Strictly speaking, no! The neighborhood we work in is precisely defined according to individual streets. That’s where we can use our funding. So when we talk about “our” neighborhood, we’re talking about all the people who live in this specific area. But we also take a broader view! We’ve worked with the JMB in the past, and we have very close ties with the feldfünf platform.
JMB: There are many ways people can live together in a major city like Berlin. What does “neighborhood” mean to you?
ses-Mendelssohn-Platz is technically part of the Südliche Friedrichstadt quarter, it’s a Kiez in its own right.
Bülent Durmuş: But the neighborhood management team is also responsible for it, isn't it?
Benita Braun-Feldweg: At any rate, a neighborhood has a spatial dimension. People live next to one another, they meet on the street, and they sometimes strike up conversations. Coincidence and spontaneity give neighborhoods a
Coincidence and spontaneity give neighborhoods a personal, social touch.DE EN
personal, social touch. This leads to recurring encounters and, ideally, to joint neighborhood projects.
JMB: So a neighborhood requires activity.
Benita Braun-Feldweg: Yes, a neighborhood needs impetus!
rity requirements, access to the museum continues to be a barrier for many people. We notice this especially when we invite people to our summer parties.
schaft. Als wir 2008 die ehemalige Blumengroßmarkthalle auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Museumskomplexes als Erweiterung im Blick hatten, habe ich das erste Mal wirklich über die Straße geguckt. Da war Beton, Asphalt, diese Parkpaletten, Metall und Stahlträger. Wir haben uns gefragt: Was passiert eigentlich, wenn wir rübergehen? Ich war sehr froh, als das Bauprojekt rund um den Platz losging und auf einmal eine Nachbarschaft entstand. Damit entwickelte sich auch für das JMB eine ganz neue, starke Identifikation. Gleichzeitig stellt der Zugang zum Museum mit seinen Sicherheitsauflagen für viele Leute noch immer eine Barriere dar – das merken wir zum Beispiel, wenn wir zu Sommerfesten einladen.

Benita Braun-Feldweg: Institutionell hat das JMB tatsächlich die Rolle eines Katalysators für die städtebauliche Entwicklung dieser Nachbarschaft übernommen. Allein die stadträumlichen Studien, aus denen sich Vorgaben für das Planungsrecht entwickelten, lenkten die Sicht auf eine kooperative Stadtentwicklung … dazu braucht es Akteure, die Verantwortung übernehmen.
JMB: Haben Sie, Frau Hartmann, diese Veränderungen auch wahrgenommen? Seit wann ist das Quartiersmanagement am Mehringplatz angesiedelt?
Candy Hartmann: Das Quartiersmanagement am Mehringplatz gibt es seit 2005, und es ist tatsächlich so, wie auch Herr Durmuş gerade sagte: Man guckt eigentlich kaum über die Straße. Wenn wir mit den Menschen oder mit Akteuren im Kiez reden, sind diese sehr auf „ihren“ Mehringplatz bezogen. Da ist schon allein die FranzKlühs-Straße eine Barriere, auch wegen der Hochhausbebauung. Und das Museum zu betreten, ja, das ist für viele hier durchaus eine Herausforderung. Da spielen die Sicherheitsauflagen, aber auch ein ganz anderer Punkt eine Rolle: nämlich, dass in diesem Kiez auch bildungsferne Familien wohnen, die man überhaupt erst motivieren darf und soll, solche Angebote wahrzunehmen. Deshalb wurden diese Straßen vom Senat auch als Quartiersmanagement-Gebiet ausgewählt.
Bülent Durmuş: Hinter dieser Hochhauswand steckt ja auch eine städtebauliche
Planung: Die Friedrichstraße sollte mal ein Autobahnzu-
Bülent Durmuş: Of course I have an “official view” of this neighborhood. In 2008, when we were considering purchasing the former wholesale flower market hall on the other side of the
Benita Braun-Feldweg: As an institution, the JMB has really served as a catalyst for developing this urban neighborhood. The urban planning studies that formed the basis of the planning law guidelines shifted the focus to cooperative urban development … For that you need responsible stakeholders.
street and converting it into a museum extension, I took a look at the area across the street for the very first time. I saw a whole lot of concrete, asphalt, parking lots, and metal and steel beams. We all wondered what would actually happen if we moved across the street. I was happy when the construction project began on and around the square and a new neighborhood emerged. The project created a completely new, strong point of identification for the JMB. At the same time, due to secu-
JMB: Ms. Hartmann, did you also notice these changes? When did you open the neighborhood management office at Mehringplatz?
Candy Hartmann: We opened the office at Mehringplatz in 2005 and it’s true what Mr. Durmuş just said: you hardly ever look across the street. When we talk to people or stakeholders in the neighborhood, they’re very much focused on “their” Mehringplatz. Franz-Klühs-Strasse forms
sehr froh, als das
um den Platz losging und auf einmal eine Nachbarschaft entstand.
bringer werden. Die architektonische Antwort darauf war, die Rückwand der Gebäude in die Richtung zu bauen –und mit diesem nie realisierten Vorhaben von damals müssen wir heute leben.
Benita Braun-Feldweg: Diese Gegend ist eine für Berlin typische zentrale Randlage (ehemaliges Zonenrandgebiet bis 1989)! Die Herausforderung be-
geht uns darum, Angebote und Projekte zu initiieren und Freiräume anzubieten, um gemeinsam etwas zu gestalten. Dazu braucht es offene Formate, Menschen unterschiedlicher Kulturen und das Verknüpfen mit vorhandenen Netzwerken, sei es mit dem Quartiersmanagement, sei es mit der Bauhütte, aber auch viele Initiativen und persönliches Engagement aus der Nachbarschaft.
a barrier, partly because of the high-rise buildings. In addition, entering the museum is a challenge for many people in the area. Security requirements are one reason, but another is the many educationally disadvantaged families in the neighborhood, who need to be encouraged to use these opportunities. That’s why the Berlin government selected certain streets for a neighborhood management area.
steht darin, Barrieren zu überwinden – und zwar auf allen Ebenen. Wir befinden uns in einem Gebiet mit parallelen Gesellschaften. Aber es gibt auch eine starke nachbarschaftliche Durchmischung mit all ihren Problemen, Fragestellungen und kulturellen Spannungen. Das birgt zugleich große Chancen – das Zusammenbringen unterschiedlicher Menschen benötigt jedoch einen echten Aktivierungsprozess.
JMB: Was für Ansätze gibt es, diese diverse Nachbarschaft zu erreichen und aktiv zu involvieren?
Benita Braun-Feldweg: Das Metropolenhaus haben wir genau zu diesem Thema konzipiert: ein aktives Erdgeschoss, in dem 40 Prozent nichtkommerzielle Projekträume sind, kuratiert von der Kulturplattform feldfünf. Es
Die Öffnung zum Frometund-Moses-MendelssohnPlatz ist der Nukleus unserer Planung – die Überlagerung von privatem und öffentlichem Raum. Ein solcher Platz mitten in Berlin bietet so viele Optionen! In vielen europäischen Städten können die Menschen sich oftmals ohne kommerziellen Druck im Stadtraum hinsetzen, lesen, reden… Eine solche Nutzung des Platzes ist eine Vision. Mit dem Modell einer vernetzten Planung, die das Quartier als Nachbarschaft in den Fokus stellt, haben wir erstmalig für Berlin den Deutschen Städtebau-Preis 2020 gewonnen. Es war ein gemeinsamer Erfolg von vielen Akteurinnen und Akteuren und wir würden sehr gern mehr daraus entwickeln! Leider konnte bisher das Konzept wegen Sicherheitsbedenken nur eingeschränkt
Bülent Durmuş: The wall formed by the high-rise buildings actually resulted from urban planning in the past: Friedrichstrasse was meant to be a feeder road to the autobahn. The architectural solution back then was to construct the buildings with their rear walls facing the street, and today we have to live with the results of a plan that was in fact never implemented.
Benita Braun-Feldweg: The area is a typical “central peripheral” zone in Berlin, one that bordered on the Soviet occupation zone until 1989. The challenge is to overcome barriers on all levels. We’re located in a neighborhood where parallel societies exists, but where the different population groups mix with all the problems, challenges, and intercultural tensions this entails. This creates a lot of opportunities, but you need a true activation process if you want to bring different people together.
JMB: How can you reach and actively engage residents of such a diverse neighborhood?
Benita Braun-Feldweg: We designed the Metropolenhaus with this very question in mind. It has an active ground floor in which 40 percent of the space is reserved for non-commercial projects, managed by the feldfünf cultural platform. Our goal is to initiate programs and projects and to provide space for people to create something together. This requires open formats, people of different cultures, and ties to existing networks, whether to the neighborhood management team or the Bauhütte project. It also requires a large number of initiatives and the personal engagement of neighborhood residents. The shops opening onto Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz are the nucleus of our planning – here, private and public space overlaps. A square like this in the center of Berlin offers so many options! In many European cities, people can sit, read, and talk in urban space without commercial pressure … using the square like this is a vision. With our integrated planning model that shifts the focus to the quarter as a neighborhood, we succeeded in winning the German Urban Design Award 2020 on behalf of the city of Berlin for the very first time. It was the joint achievement of many stakeholders and we would very much like to make more of it. Unfortunately, the concept could only be partially implemented for security reasons. If a chair alone is considered a security problem, the whole neighborhood concept, which the Berlin government originally called for, collapses. We’re confident that such obsta-

umgesetzt werden. Wenn ein Stuhl bereits als Sicherheitsproblem angesehen wird, bricht das Nachbarschaftskonzept ein – ursprünglich vom Senat gefordert. Wir sind zuversichtlich, dass es gelingen wird, derartige Blockaden zu lösen. Mit Verständnis für gemeinsames nachbarschaftliches Handeln wird der Platz als Ressource eines sozialkulturellen Raumes für alle zugänglich werden.
Candy Hartmann: Ein Platz, auf dem man ohne irgendeinen Anlass einfach verweilen kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gespräche können auch angeregt werden, weil man einfach gerade nichts zu tun hat. Am Mehringplatz haben wir übrigens eine ganz ähnliche Situation wie hier vor dem Museum; kaum einer nutzt ihn, um dort Zeit zu verbringen, obwohl er neu gestaltet und grün ist. Das liegt auch an der Situation des Gewerbes rund um den Platz. Man setzt sich nicht hin und entspannt, wenn man dann auf leerstehende Geschäfte guckt.
JMB: Plätze – und Nachbarschaften – leben also auch vom Zufall, vom Verweilen. Es braucht also die klassischen Parkbänke?
Benita Braun-Feldweg: Die Steinbänke hier auf dem Platz sind durchaus beliebt! Hier entwickeln sich im direkten Gespräch „en passant“ Ideen, Vorhaben und Projekte – und auf einmal entsteht ganz viel! Das Metropolenhaus wäre nicht möglich gewesen ohne dieses Trottoir. Auch für das Anliegen von feldfünf ist es essenziell.
JMB: Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, um in einer Nachbarschaft Raum für zufällige Begegnungen zu schaffen?
Bülent Durmuş: Im Rahmen der Planungen für unsere Kinderwelt ANOHA haben wir überlegt, ob wir auf dem Platz ein Wasserspiel für Kinder anlegen, ebenerdig. Es gab auch mal die Diskussion, aus dem ganzen Areal einen Spielplatz zu machen, mit von Kindern begehbaren Spuren.
Benita Braun-Feldweg: Ja, Childifying, das ist etwas sehr Schönes! Leider ist es nicht selbstverständlich, dass sich Nachbarschaft über Kinder und Jugendliche aufbaut. Hier gibt es auch viele konfrontative Begegnungen. Aber es gibt spannende Projekte zu dem Thema, die viel Potenzial haben. Wir konnten an der Kurt-Schumacher-Schule Workshops mit fünften und sechsten Klassen durchführen und Projekte gestalten wie „Kreuzberg klingt“, „Kreuzberg leuchtet“ und „Kreuzberg hockt“. Da entstanden greifbare und kreative Objekte, auf die die Kinder stolz waren. Viele der Kinder wohnen ja zum Teil am Mehringplatz in oft überbelegten Wohnungen, und gerade die Mädchen haben in den Familien oft nicht die Möglichkeit, sich auszuprobieren – da kann man mit kleinen Dingen sehr viel bewirken!
JMB: Während der Corona-Pandemie hat man gemerkt, wie wertvoll eine gute Nachbarschaft ist. Aber ist Nachbarschaft heute noch so spielentscheidend wie sie vielleicht früher mal war?
cles can be overcome. With an understanding of joint neighborly action, we can make the square accessible to everyone as a resource and sociocultural space.
Candy Hartmann: A place where you can hang out for no reason at all—that’s a very important need. People can strike up conversations because they have nothing else to do at the moment. By the way, the situation at Mehringplatz is very similar to the situation in front of the museum. Not many people come by just to hang out, even though it’s been redesigned and is very green. That has to do with the stores around the square. No one sits down to relax if all they can look at is empty storefronts.
JMB: How else can you ensure there are chance encounters in a neighborhood?
Bülent Durmuş: As part of the planning for the ANOHA Children’s World, we considered creating a water game for children on the square. We also discussed turning the whole area into a playground with paths for children.
Benita Braun-Feldweg: Yes, childifying, that’s great! Unfortunately, you can’t take for granted that children and teenagers will contribute to the development of neighborhoods—there are also many confrontational encounters here. But there are several exciting projects devoted to this problem, all
JMB: So squares and neighborhoods thrive on chance encounters, on people hanging out. Are traditional park benches what we need?
Benita Braun-Feldweg: The stone benches here on the square are quite popular! That’s where people have face-to-face conversations, come up with new ideas, plans and projects almost in passing, and things develop. The Metropolenhaus wouldn’t have been possible without the square, and it’s also important for the aims of the feldfünf platform.
with great potential. We’ve organized workshops for fifth and sixth graders at the Kurt Schumacher School and have carried out projects like “The Sounds of Kreuzberg,” “The Lights of Kreuzberg,” and “The Chairs of Kreuzberg.” The children made creative objects they were proud of. Many live in overcrowded apartments at Mehringplatz, and the girls in particular often have little opportunity in their families to discover their talents. You can make a big difference with small things!
JMB: During the Corona pandemic, people realized how valuable a good
You can make a big difference with small things!
Candy Hartmann: Das bringt mich auf etwas, was man nicht vergessen darf: Nämlich, dass man sich gerade in der hiesigen Hochhaussiedlung auch sehr schön verstecken kann, wenn man gerade gar keine Lust auf Nachbarschaft hat. Für einige ist diese Anonymität sicher sehr schade, aber für einen Großteil der Bewohner ist es genau das, was sie gerne möchten, nämlich NICHT angesprochen zu werden. Auch das ist eine Hürde, die genommen werden muss, will man Leute erreichen.
JMB: Wie lassen sich diese Hürden nehmen?
Candy Hartmann: Da muss man gucken, wen spricht man an und mit wem funktioniert was. Als Quartiersmanagement haben wir den Vorteil, dass unser Büro in der Friedrichstraße 1 im Erdgeschoss ist. Da gibt es gar keine Hemmschwelle, oft klopfen die Leute ans Fenster, einfach, um hallo zu sagen, und um dieses Gefühl zu haben, Mensch, da ist jemand und es ist nett, einen Plausch zu halten.
Benita Braun-Feldweg: Ich glaube, der Unterschied zwischen den Hochhäusern und unseren Neubauten ist gar nicht so groß. Es gibt zwar Nachbarn, die sich treffen und austauschen. Aber die Nachbarschaft für
gemeinsame Projekte zu aktivieren, ist nochmal eine ganz andere Aufgabe. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass jemand, der sich mit irgendetwas identifiziert, aktiv werden können muss. Es geht um Angebote, die dazu anregen, mitzumachen, etwas selbst zu gestalten, nichts Kommerzielles! Das Kreativstudio „Zuckerwattenkrawatten“ ist bei feldfünf schon von Anfang an mit dabei und macht Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen Lust und Freude am Gestalten. Wir würden uns über weitere solcher Partnerschaften freuen, um ein breites kulturelles Angebot für die Nachbarschaft ausbauen zu können, z.B. eine wöchentlich kuratierte Bar als sozialen Treffpunkt oder die Organisation eines KiezKinos… Nachbarschaft lebt von zugänglichen Aktionen, Nachbarschaft muss niedrigschwellig sein.
JMB: Auf welche Projekte blicken Sie außerdem gern zurück?
Candy Hartmann: Eines meiner liebsten Projekte ist das nachbarschaftliche Fastenbrechen, das wir jedes Jahr einmal während des Ramadans machen: Da kommen bis zu 500 Leute mit ganz unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen zusammen,
neighborhood was. But is a neighborhood still as game-changing today as it was in the past?
Candy Hartmann: That reminds me of something very important: if you don’t want to become part of the neighborhood, you can remain anonymous in the high-rise complex there. This anonymity is a shame for some people, but it’s exactly what others want—not being bothered. That’s another obstacle you have to overcome if you want to reach people.
JMB: And how can you overcome obstacles like that?
Candy Hartmann: You have to find out who you can talk to and what things work with different people. Our advantage as the neighborhood management team is that we have a ground-floor office at Friedrichstrasse 1. People often knock on the window just to say hello and have the feeling that, how nice, someone’s there that I can chat with.
Benita Braun-Feldweg: I don’t think there’s such a big difference between the high-rises and our new buildings. Some neighborhood residents want to meet and talk, but mobilizing the neighborhood for joint projects is an entirely different challenge. I always notice that people who identify with something want to become active and develop their ideas. What’s important are activities that encourage people to participate and create something themselves, something that isn’t commercial! The Zucker wattenkrawatten
studio has been part of the feldfünf platform from the start and whets people’s appetite for creative projects, targeting children, teenagers, and even adults. We would be happy to have more partnerships like this so that we could launch a broad cultural program for the neighborhood, including, for example, a weekly curated bar as a meeting place or a neighborhood cinema. Neighborhoods thrive on accessible activities—there shouldn’t be any barriers.
JMB: What are some of your other favorite projects?
Candy Hartmann: One of my favorite projects in the neighborhood is the celebration to mark the end of fasting, which we hold once a year during Ramadan. Around 500 people from very different religious and cultural backgrounds get together, and everyone enjoys the food, atmosphere, and music. Especially after the Corona pandemic, you could tell everyone was hungry for collective experience. Another great project is the program of courses we ran in 2008. We had language courses, a yoga class, a cabaret—all told, seven or eight different courses. That brought people together! The cabaret group still exists today. Often it’s a question of making the right things possible in the right setting; all you need is impetus, a spark!
Bülent Durmuş: For us, the initial spark was the purchase of the wholesale flower market hall—and now so much has happened all around it. It gave us a real feeling of achievement to
Es geht um Angebote, die dazu anregen, mitzumachen, etwas selbst zu gestalten, nichts Kommerzielles!
und alle genießen das gemeinsame Essen, die Atmosphäre, die Musik. Gerade nach der Corona-Pause hat man gemerkt, dass alle danach gezehrt haben, wieder was gemeinsam erleben zu können. Ein anderes tolles Projekt ist das Kurspaket, das wir 2008 durchgeführt haben: Es gab Sprachkurse, einen Yoga-Kurs, ein Kabarett, insgesamt sieben oder acht verschiedene Angebote. Das hat die Leute zusammengebracht! Die Kabarettgruppe zum Beispiel gibt es heute immer noch. Oft geht es vor allem darum, die richtigen Sachen im richtigen Rahmen zu ermöglichen, es braucht nur einen Impuls, eine Zündung!
Bülent Durmuş: Für uns war die Initialzündung, die Blumengroßmarkthalle zu kaufen – und was dann damit und darum herum gemacht wurde! Diese städtebauliche Entwicklung mit angestoßen zu haben, das ist für uns ein echtes Erfolgserlebnis.
Benita Braun-Feldweg: Für uns ist es das große Ganze: Dass es uns allen gelungen ist, unter der großen Überschrift „Machen und Zulassen" mit so vielen Akteuren unsere Projekte zu realisieren, das empfinde ich als unglaubliches Glück! Emotional wichtige Erfolgserlebnisse gab es immer wieder bei den Kooperationen mit der Kurt-Schumacher-Schule – wenn die Kinder stolz ihre eigenen Werke präsentieren, dann ist das sehr berührend.
JMB: Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielten: Was würden Sie hier in der Nachbarschaft gerne angehen?
Benita Braun-Feldweg: Ich weiß gar nicht, ob ich so glücklich wäre, wenn alles möglich wäre. Da könnte ich mich ja gar nicht reiben! Im Gegenüber von Einschränkungen eröffnen sich kreative Räume. Aber ein lohnender Gedanke könnte sein, Erdgeschoss-Einheiten über einen gemeinnützig orientierten Partner zu bündeln. Wenn Läden, Projekträume, Begegnungsorte im Erdgeschoss ohne Marktdruck an die unterschiedlichsten Träger vermietet werden könnten, mit der Auflage, in den Freiraum hineinzuspielen, dann entsteht urbanes Leben und Stadt. Das wäre ein nachhaltiges Investment in Nachbarschaft!
Candy Hartmann: Ich wünsche mir eine größere Lebendigkeit am Mehringplatz, insbesondere in Kombination mit dem Gewerbe. Dass man Anbieter findet, die eben nicht nur Magnet für Touristen sind, sondern gleichzeitig auch für die Bewohner und alle, die hier arbeiten. Es ist so viel Potenzial hier! Aber ich habe ja gelernt, Geduld zu haben. In einer perfekten Welt würde ich mir wünschen, dass die Dinge manchmal ein bisschen schneller vorangehen, das täte allen gut!
Bülent Durmuş: Was würden wir uns für das JMB wünschen? Barrieren runter, Zäune weg? In einer perfekten Welt müssten jüdische Institutionen nicht polizeilich gegen Gewalt gesichert werden. Ich würde am liebsten hier entlanglaufen und sehen, dass auf dem Platz oder bei uns im Garten vor einem nachbarschaftlichen Publikum der tolle Film „Victoria“ gezeigt wird – denn der spielt genau hier. Das wäre wirklich schön!
know we helped initiate this urban development.
Benita Braun-Feldweg: What’s important for us is the big picture. We’ve organized projects under the heading of “Live and Let Live” with numerous stakeholders, and we were incredibly lucky that they were successful. The successful collaborations with the Kurt Schumacher School mean a great deal to me. When the children proudly present their own works, it’s very touching.
be a sustainable investment in the neighborhood.
Candy Hartmann: I’d like to see more life at Mehringplatz, particularly in combination with the commercial sector. That would mean finding partners who attract not only tourists, but also residents and everyone who works here. There’s so much potential here! But I’ve learned to be patient. In a perfect world, things would move a little faster – that would benefit everyone.
JMB: If you didn’t have to worry about money, time, or safety regulations, what would you tackle here in the neighborhood?
Benita Braun-Feldweg: I don’t know if I’d be so happy in a situation where everything was possible. I need a little friction. Restrictions make you creative. But a worthwhile idea would be to combine ground-floor units with the help of a nonprofit partner. If the stores, project spaces, and meeting places could be rented out to different sponsors without market pressure and on the condition that they make use of the open space, it would create urban life and a city experience. That would
Bülent Durmuş: What we’d like to tackle? We’d like to see barriers removed and fences torn down. In a perfect world, Jewish institutions wouldn’t need to be protected against violence by the police. I’d love to walk through the area and see the wonderful movie Victoria being screened to a neighborhood audience on the square or our premises. That would be really nice! The film takes place here in this area.
Das Interview führten / The interview was conducted by Marie
Naumann & Katharina WulffiusOften it’s a question of making the right things possible in the right setting; all you need is impetus, a spark!
Es gibt Zeiten, in denen sich das Leben grundlegend verändert. Im wahrsten Sinne des Wortes legt sich dann ein neuer Grund. 2018 geschah das für mich sogar bei einer echten Grundsteinlegung – für das Haus in der Lindenstraße, in dem ich nun seit fast fünf Jahren mit meiner Familie lebe. Wir standen aufgeregt und fröhlich im Bauch der Erde an einer Stelle, die später unser Keller werden würde. Wir standen dort mit vielen Menschen, mit denen wir über einen langen Zeitraum hinweg dieses Haus geplant hatten und bauen würden. Alles in meinem Blick war durch die Grundsteinlegung verändert worden. Als wir in die Lindenstraße zogen, waren die Bäume auf dem Platz noch klein. Das unterirdische Leben der Wurzeln sprach und sah in mir mit, und auch wenn die buchstäbliche Stadtmitte in einem der heißesten Sommer des Jahrhunderts vor Hitze zu vibrieren, ja sich aufzulösen schien, wussten doch meine Füße noch genau, dass unter dem Asphalt die Erde ist, dass sie uns mit den Menschen dieses Viertels, mit den Tieren, mit den alten und neuen Gebäuden verbindet und eine Beziehung herstellt mit allen, die hier leben und arbeiten. Bei unserem Umzug wussten wir nicht, dass wir uns bald darauf und anders als je zuvor in der Corona-Pandemie aufeinander beziehen würden. Doch spürten wir schon bald die Dringlichkeit der Verknüpfungen, die sich an diesem Platz und in diesem Haus in etwas bündelten, das ich nur als Dorfkind gekannt hatte – in einer stetigen Empfindung des Aufgehobenseins in einem Umfeld von Menschen, die einander kennen und grüßen. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Jüdischen Museum baut zudem an einem eigenen, parallelen Sinnzusammenhang in mir und arbeitet einem inneren Raum der Verantwortung zu. Sie spricht direkt zu mir, wenn ich auf dem Platz stehe und am Eingang der Blumenthal-Akademie die Worte lese, die sich Tag um Tag tief in mich einschreiben, die mich ansprechen, die mich meinen, die mich noch tiefer in die Bedeutung des hiesigen und historischen Zusammenseins lotsen: „Höre die Wahrheit, wer sie auch spricht.“
Mitten im urbanen Raum klopft dieser Satz die Tiefenschichten meines Lebens ab, und ich sehe, während mein Kind hier das Laufen gelernt hat, nun ungestüm Fahrrad fährt oder mit Freundinnen in Windeseile den Platz überquert, dass Dankbarkeit in mir aufsteigt. Es ist Dankbarkeit, mit anderen Menschen im Frieden diesen Raum beleben zu dürfen. In den ersten Wochen und Monaten der Pandemie fehlten mir die alltäglichen Bewegungen auf dem Platz sehr. Das Jüdische Museum hatte wie alle anderen Museen geschlossen, die Mitarbeitenden aus den Büros in der Blumenthal-Akademie waren zu Hause. Damals las ich jeden Abend auf unserem Balkon Rilkes Gedicht „Der Panther“ und lud alle in unserem Haus ein, es laut mitzulesen. Ich sah auf die E.T.A.-HoffmannPromenade und freundete mich über drei Monate hinweg mit einer alten Stieleiche an, die langsam dem Frühling entgegengrünte und in mir an einem Raum der Hoffnung baute – dass alles gut werden würde, dass es uns als Einzelnen und in Gemeinschaft gelingen würde, unseren Raum der Verknüpfungen auszubauen. Je länger die Pandemie anhielt, desto größer wurde mein Bedürfnis, etwas über die von ihr gesetzte Begrenzung zu schreiben. Es entstand ein Buch aus den abendlichen Gedicht-Rezitationen. Darin habe ich damals festgehalten: „Das Jüdische Museum in Berlin baut seit zwei, drei Jahren für ein Kinder- und Jugendmuseum eine riesige Arche. Die Koinzidenz, mit Blick auf die leeren Büroräume des Museums in der alten Blumengroßmarkthalle, auf die ich jeden Tag schaue, ist in meiner Innenwelt ein großes Ereignis. Überhaupt ergreift mich das in den Jahren der Einsamkeit eingeübte Erstaunen über die präzisen Verstrebungen von Innenwelt und Außen-
There are times when life changes fundamentally, and a new foundation is laid in the truest sense of the word. This happened to me in 2018, when the cornerstone was laid for the building in Lindenstrasse where I have now lived with my family for almost five years. We stood there happy and excited in the belly of the earth at the place that would later become our basement. We stood there with the many people with whom we had long planned and would now construct the building. My entire perspective has changed because of the laying of the cornerstone. When we moved to Lindenstrasse, the trees on the square were still small. The subterranean life of their roots watched and spoke through me, and even when in one of the hottest summers of the century the very center of the city seemed to vibrate and even dissolve because of the heat, my feet still knew that under the asphalt I would find the earth that connected us to the people in the neighborhood, to the animals, to the old and new buildings, the earth that established a relationship with everyone who lived and worked there. When we moved in, we did not know that just afterwards, during the Corona pandemic, we would enter into a different relationship with one another. But we quickly felt the urgency of the ties that in this place and through this building formed something I had only known as a child growing up in a village, that constant sense of being accepted into a surrounding of people who know and greet one another. In addition, the direct neighborhood to the Jewish Museum produces its own parallel context of meaning within me and assists in creating an inner space of responsibility. This neighborhood speaks directly to me when I stand in the square and read the words over the entrance to the Blumenthal Academy, which engrave themselves in my consciousness day after day, which speak to me, which resonate with me, which immerse me ever more deeply in the meaning of current and historical coexistence: “Hear the truth, whoever speaks it.”

In the center of urban space, this sentence plumbs the depths of my life and I sense gratitude rising up in me—in that square where my child learned to walk, where she now rides her bike rambunctiously or dashes across with friends. It is gratitude that together with my neighbors I have been able to animate this space peacefully. In the first few weeks and months of the pandemic, I sorely missed the everyday movement in the square. The Jewish Museum, like all other museums, was closed, and the staff of the Blumenthal Academy remained at home. I read Rilke’s poem “The Panther” every evening on our balcony and invited everyone in our building to read it aloud with me. I looked out onto E.T.A.-Hoffmann-Promenade and, over a period of three months, made friends with an old English oak that was donning its best green suit for spring and opening a space of hope within me, hope that all would turn out well, that we as individuals and a community would succeed in expanding our space of interconnectedness. The longer the pandemic lasted, the greater my need to write something about the boundaries it had set. A book emerged from the poetry recitations in the evening. I wrote at the time:
“For two to three years now, the Jewish Museum in Berlin has been building a huge ark for a museum for children and young people. Every day I look at the museum’s empty offices in the old wholesale flower market hall, and the coincidence of past and present is a major event in my inner world. The astonishment I regularly felt during the years of solitude takes hold of me even more powerfully, a sense of surprise at the precise interconnection of inner and outer worlds. The Jewish Museum’s ark looks a little like the visionary designs of the American architect Richard Buckminster Fuller. I can imagine one of his geodesic domes above it, a kind of spiritual biosphere in which the heritage that needs to be saved receives a place in the open air. We breathe in this air that is life to us, that is space and time and a great gift.”
welt mit immer größerer Vehemenz. Die Arche des Jüdischen Museums gleicht ein bisschen den visionären Entwürfen des amerikanischen Architekten Richard Buckminster Fuller. Fast kann ich über ihr eine seiner geodätischen Kuppeln sehen, eine Art spirituelle Biosphäre, in der das zu rettende Erbe in meiner Vorstellungskraft seinen Platz in der Luft erhält. Wir atmen diese Luft ein, die uns Leben ist und Raum und Zeit und Geschenk.“
Die Dankbarkeit hier zu sein, an diesem Platz und in diesem Viertel zu leben – sie ist ein Leitmotiv in meiner Wahrnehmung. Als nach der Pandemie endlich das Café und die Bäckerei Beumer&Lutum normal geöffnet hat und wir da wieder sitzen und uns an den Menschen freuen können, die hier arbeiten, die durchgehalten haben, empfinde ich tiefe Freude. Nachbarschaft, was ist das genau, wenn nichts mehr selbstverständlich ist? Es sind die kleinen Augenblicke, in denen das gemeinsame Sein aufscheint, wenn etwa ein lächelnder Mensch grüßt, der Himmel blau wird und wir die Sonne genießen, die im Winter wieder zur Sehnsucht wird. Zu den Beglückungen dieser Nachbarschaft gehört für mich das ANOHA, die Kinderwelt des Jüdischen Museums mit seiner Arche, die hier in einer Zeit für Kinder gebaut wurde, in der viele Tiere aussterben, das Klima sich verändert, in der auf uns alle Aufgaben warten, Aufgaben, die die Erde uns abverlangt, weil wir es sind, die mit unseren Taten, mit unseren Blicken und unseren Verbindungen etwas ändern können.
In der biblischen Arche Noah überstehen Menschen und Tiere zusammen eine Krise. Eine neue Zeit beginnt mit ihrer Rettung. Wie würde unsere heutige Arche Noah aussehen? Wie können wir eine geistige Ökologie der Nähe erbauen, die uns in der Verantwortung hält, damit noch Hoffnung möglich ist? Die Blicke und die Beziehungen, die sich auf diesem Platz zwischen den einzelnen Menschen ereignen, spiegeln auch die Jahre, in denen wir in Zeiten großer weltweiter Krisen alle zusammen älter werden. Bäume wachsen. Kinder werden geboren. Menschen werden krank und wieder gesund. Wahrheit entsteht, wird sichtbar und ich lerne sie zu hören, ganz gleich, wer sie spricht. Und je länger ich hier lebe, desto klarer wird mir, die Stadt wird sich mit den Menschen verändern, die ihre Fragen und ihre Zugewandtheit mitbringen, auch wenn vieles im Guten Errungene gerade wieder von politischen Kräften rückgängig gemacht wird, die keinen Bezug zur Zukunft haben. Trotz aller Herausforderungen oder in Gedanken an den Krieg in der Ukraine möchte ich in diesen schreckverdichteten Zeiten an die Humanisierung des Lebens auf allen Ebenen glauben.
Dieses Wort ist mir bei Imre Kertész begegnet, der es einmal in seinem Tagebuch erwähnt, das ich hin und wieder auf dem Platz in der Sonne lese. Mit seinen Gedanken ist er für mich Teil dieser Nachbarschaft, ein geistiger Bewohner der Welt und des Platzes, den ich täglich überquere. „Höre die Wahrheit, wer sie auch spricht“, lese ich in seinem Sinne noch einmal neu. In einer Zeit der genau durchdachten, präzise inszenierten Lügen und perfiden Kriege, ist dieser Satz essenziell verbunden mit der Verantwortung für die Gegenwart, einer Verantwortung, die das Historische kennt und die eine Zukunft vor Augen hat, deren Humanisierung wir auf allen Ebenen brauchen. Dafür steht für mich auch in der Mitte dieser Stadt das Jüdische Museum Berlin.
The gratitude of being here, of living in this place, in this neighborhood, is a leitmotif of my perceptual world. After the pandemic, when the Beumer&Lutum café and bakery finally opened normally again and we were once again able to sit there and take pleasure in the people who worked there and had persevered through the crisis, I felt a deep sense of joy. “Neighborhood”—what exactly does that mean when we can no longer take anything for granted? Our neighborhood consists of the many small moments when our life together brightens, when someone greets us with a smile, when the sky turns blue and we enjoy the sun, which in winter becomes an object of longing. For me, one of the joys of this neighborhood is ANOHA, the Children’s World of the Jewish Museum, and its ark, which has been built for children at a time when many animals are becoming extinct, the climate is changing, and tasks are awaiting us that the earth demands of us, because it is we who can change things through our actions, our glances, and our connections.
In the biblical tale of Noah’s Ark, animals and humans survive a crisis together. With their rescue, a new era begins. What would Noah’s Ark look like today? How can we create an intellectual ecology of intimacy that holds us accountable and makes hope possible? The glances and relationships between individuals in this square also reflect the years in which we have been growing older together during great global crises. Trees have grown. Children have been born. People have fallen ill and become healthy again. The truth has emerged and become visible. I have learned to hear it, no matter who speaks it. And the longer I live here, the clearer it becomes to me that the city will change along with the people who ask questions and show their dedication, even if many of the good things that have been achieved are at this moment being undone by political forces that have no connection to the future. Despite all the challenges and despite the war in Ukraine, I would like to believe in the humanization of life at all levels in these horror-stricken times.
I encountered that word in the diary of Imre Kertész, which I sometimes read in the sun on the square. He and his thoughts became part of this neighborhood for me. He became a spiritual occupant of the world and the square that I walk across every day. Through his eyes I read these words anew: “Hear the truth, whoever speaks it.” In a time of carefully thought-out and orchestrated lies, in a time of perfidious wars, this statement is linked in a fundamental way to a sense of responsibility for the present that knows history and conceives of a future whose humanization we need at all levels. For me, the Jewish Museum Berlin stands for these principles in the center of the city.
Marica Bodrožić wurde 1973 im Hinterland von Split in Dalmatien geboren. 1983 siedelte sie nach Hessen über. Sie schreibt Gedichte, Romane, Erzählungen und Essays, die in über 16 Sprachen übersetzt wurden. Dafür wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Walter-Hasenclever-Preis und dem Manès-Sperber-Literaturpreis für ihr Gesamtwerk. Marica Bodrožić lebt mit ihrer Familie als freie Schriftstellerin in Berlin und in einem kleinen Dorf in Mecklenburg. 2021 erschien ihr Buch „Pantherzeit“ im Otto Müller Verlag, Salzburg, sowie ihr jüngstes Buch „Die Arbeit der Vögel. Seelenstenogramme“ im Luchterhand Verlag, München.
Marica Bodrožić was born near Split in the region of Dalmatia, Croatia, in 1973. She moved to Hesse, Germany, in 1983. Her poems, novels, stories, and essays have been translated into more than sixteen languages. She has received numerous awards for her work, most recently the Walter Hasenclever Prize and the Manès Sperber Prize for Literature. She lives with her family and works as a freelance writer in Berlin and a small village in Mecklenburg. In 2021, she published her book Pantherzeit (Salzburg: Otto Müller Verlag) as well as her most recent book, Die Arbeit der Vögel. Seelenstenogramme , which was published by Luchterhand Verlag, Munich.

In einem Kiez wie Berlin-Kreuzberg, wo vielfältige Kulturen in enger Nachbarschaft zusammenleben, ist die Kinderwelt ANOHA ein Ort für Begegnungen und Austausch. Schon die Lage des Kindermuseums ist ziemlich besonders: Am nördlichsten Ende von Kreuzberg, einst am Rande Westberlins, liegt es inmitten eines vielstimmigen Kiezes, der geprägt ist von alter und neuer Zuwanderung: eine kulturell wie religiös diverse Nachbarschaft, mit arabischen, türkischen, west- und osteuropäischen Eindrücken, in der sich alteingesessene Familien und Neuberliner*innen aus Israel, Syrien, der Ukraine und vielen anderen Ländern begegnen.
In a Berlin neighborhood like Kreuzberg, where people of very diverse cultures live close together, ANOHA serves as a place of encounter and dialogue. Its location alone is special: at the former border of West Berlin, in the northernmost corner of Kreuzberg, it is situated at the center of a polyphonic neighborhood marked by old and new immigration. It is an area that is culturally and religiously diverse, with Arab, Turkish, and Western and Eastern European influences, in which long-established families mix with new Berliners from Israel, Syria, Ukraine, and many other countries.
DE ANOHA lädt Kinder zwischen drei und zehn Jahren und ihre Familien zu einem immersiven Besuch der Geschichte der Arche Noah ein. Die Besuchszahlen zeigen, dass ANOHA über die Stadt hinaus sehr beliebt ist; und auch die Nachbarschaft kommt zahlreich, um in der großen Holzarche zu spielen, zu lernen und sich auszutauschen.
Mit seiner Geschichte von Noach, Noah oder Nuh, die sich Judentum, Christentum und Islam in der überlieferten Version teilen, und die selbst weit in humanistische und weltliche Kreise gut bekannt ist, spricht ANOHA alle Nachbar*innen an. Die kulturell und religiös geprägten Unterschiede in der Interpretation der Erzählung ermöglichen Freiräume in der Bedeutungszuschreibung der Geschichte. Das erlaubt eine Vielfalt an Auslegungen, Bezügen und Identifikationen für ganz unterschiedliche Besucher*innen.
Das Kindermuseum eröffnet allen die Gelegenheit, sich mit genau dieser Vielfalt selbstbestimmt auseinanderzusetzen. Denn es geht nicht darum, aus einer vorgeprägten
EN ANOHA invites three- to ten-year-olds and their families to immerse themselves in the story of Noah’s Ark. As visitor numbers show, the children’s museum is very popular outside the city, and it also attracts many neighborhood residents, who come to play, learn, and exchange ideas in the large wooden ark.
The story of “Noach,” “Noah,” or “Nuh” is shared by Judaism, Christianity, and Islam and is well known in humanist and secular circles as well. This makes ANOHA appealing for everyone in the neighborhood. The different interpretations of the story are shaped by cultural and religious factors and result in numerous points of reference and identification for the museum’s very different visitors.
The children’s museum allows everyone to determine how they want to engage with the diverse aspects of the tale. The goal is not to retell the story of Noah’s Ark from a predefined perspective or dictate to visitors in what order they should view exhibits. There is no rigid narrative. The open
Perspektive heraus die Geschichte der Arche Noah nachzuerzählen, es gibt auch keine vorgegebene Reihenfolge des Besuchs, kein starres Narrativ. Vielmehr erlaubt es das freie Vermittlungskonzept, selbst aktiv in der Geschichte zu handeln und damit eigene Erinnerungen an das Geschehene zu schaffen. Die Ausstellung zeigt die einzelnen Elemente, aus denen sich diese Geschichte zusammensetzt – nicht mehr und nicht weniger: eine sieben Meter hohe Arche, einen Sintflutsimulator und 150 upcycling-Tierfiguren, die allen Spielarten der Geschichte Raum geben. Wenn die Kinder eigene Schiffe bauen, Tiere zur Arche bringen oder über die Giraffenrutsche an Bord sausen, kommen bekannte und unbekannte Erzählelemente zusammen. Wo die einen in der Flut ein großes Unglück und große Zerstörung sehen, erleben andere sie als umfassendes Reinemachen auf der Erde für einen Neubeginn mit der Möglichkeit auf eine bessere Zukunft. All das sind interessante Perspektiven auf die Geschichte – keine ist „besser“ oder „richtiger“ als die anderen. Sie stehen vielfältig nebeneinander und spiegeln so nicht selten die unterschiedlichen Realitäten einer Nachbarschaft: Verschiedene Bedürfnisse treffen aufeinander, Nähe und Distanz werden ausprobiert, Zugänge zu Ressourcen und Territorien müssen immer wieder neu verhandelt werden. Spielerisch gilt es im ANOHA zu erkunden, wie auf der Arche so unterschiedliche Tiere auf engem Raum zusammenleben
Das digitale Spieleangebot „Lauscher auf!“ auf der Grundlage einer Geschichte des jiddischsprachigen Autors Isaak Baschewis Singer macht in sehr anschaulicher Weise deutlich, dass auch ein selbstgeschaffenes privilegiertes Selbstbild nicht weiterführt. Wo der Elefant sich aufgrund seiner einzigartigen Größe zunächst überlegen fühlt, melden sich nach und nach weitere Tiere zu Wort, selbst das Stinktier wähnt sich durch seinen einzigartigen Duft als bevorzugt zu behandeln. Letztlich wird klar, dass sie alle ohne Vorleistungen einen Platz auf der Arche gefunden haben.

The Listen Up! audio game, based on a story by the Yiddish author Isaac Bashevis Singer, illustrates that even a sense of one’s own privileged position is no guarantee of success. The elephant in the game initially feels that it is better than all the other animals on board because of its size, but these other animals eventually speak up, and even the skunk imagines it should be given preferential treatment due to its unique smell. Ultimately, the children learn that everyone has a place on the ark without having to earn it.
educational concept allows visitors to actively participate in the story and create their own memories. The exhibition presents the individual narrative elements, including a sevenmeter-high ark, a flood simulator, and 150 upcycled animal figures suitable for all variations of the tale. When children build their own ships, take the animals onto the ark, or enter it themselves on the giraffe slide, they combine familiar and unfamiliar elements. While some interpretations view the flood as a great calamity and destructive event, others argue that by purging the earth, it paved the way for new beginnings and a better future. All of these perspectives are interesting—none is better or more correct than the next. They exist side by side in various combinations and often reflect the different realities of neighborhoods in general, in which various needs are met, proximity and distance are explored, and access to resources and territories is subject to constant renegotiation. At ANOHA, children playfully explore how different animals can coexist in the cramped quarters on the ark. They quickly realize that they cannot solve problems by simply throwing certain animals overboard. They must find solutions within the story or come up with them themselves. When, for instance, one child asks whether the predators on board the ark might pose a threat to the other animals, another one might say, “Noah definitely stowed enough food on the ark for all the animals.” Or perhaps: “Maybe the carnivores are fasting!”

The ark is a model that has its origins in a story. While it is unlikely that pandas, polar bears, and orangutans would ever meet in real life, in the children’s museum they make their way onto the ark just a few yards from one another. In the ANOHA school, the frilled lizard of southern New Guinea sits next to the pelican, which is native to all the continents, and the naked mole rat, which lives in underground burrows in Africa. In addition to diurnal animals like chickens and flamingos, visitors encounter several nocturnal animals in a dark cave, including a fox, a hamster, and an owl. “Is that because nocturnal animals are afraid of something in the light?” asks
anoha.de/hoerstueck-lauscher-auf anoha.de/en/audio-play-listen-up
Ungewöhnliche Nachbarschaften: Wohl nur im ANOHA sitzen Nashorn, Pinguin und Kuh einträchtig nebeneinander auf der Toilette.
Unusual neighbors: a rhinoceros, a penguin, and a cow sitting peacefully side by side in bathroom stalls. ANOHA is probably the only place where this is possible.
können. Die Kinder erkennen schnell, dass es keine Lösung sein kann, bestimmte Tiere einfach über Bord zu werfen. Sie suchen nach Lösungen in der Geschichte oder denken sich selbst eine aus. Zum Beispiel wenn die Frage aufkommt, ob die Raubtiere auf dem Boot den anderen Tieren gefährlich werden können. „Vielleicht hat Noah für alle Tiere vor der Abreise genug Nahrung an Bord verstaut“, ist der Vorschlag eines der Kinder. „Vielleicht gilt eine Fastenzeit für die Passagiere, die sich vor allem von Fleisch ernähren!“, der eines anderen.
Die Arche ist ein Modell, entstanden aus einer Geschichte. Während Panda, Eisbär und Orang-Utan sich im „echten Leben“ kaum begegnen, suchen sie im ANOHA nur wenige Schritte voneinander entfernt ihren Weg auf das Boot. Dort sitzt die im Süden Neuguineas beheimatete Kragenechse in der ANOHA-Schule neben dem weltenbummlerischen Pelikan und den in unterirdischen Bauten Afrikas lebenden Nacktmullen. Neben den tagaktiven Lebewesen wie den Hühnern und dem Flamingo finden dämmerungsaktive Tiere wie Fuchs, Hamster und Eule ihren Platz in einer dunklen Höhle. „Ist das so, damit die Tiere der Nacht sich nicht im Hellen fürchten?“ fragt eine junge Besucherin. Eine kluge Frage. Wovor fürchtet sich der Hamster im Sonnenschein? Solche Überlegungen sind Anlass, einen Blick auf unterschiedliche Lebensweisen zu werfen. Und immer wieder hilft es, weitere Fragen zu stellen: Geht das Miteinander so unterschiedlicher Bedürfnisse auch draußen vor der Tür? Wie lässt sich das erreichen? Die gesamte Ausstellungsszenografie von ANOHA beruht auf der Fantasie und ganz vielen Fragen. Viele neue Erfahrungen und Ideen, die hier aufkommen, sind mobil und können nach dem Besuch in den Kiez mitgenommen werden.
Und was, wenn direkt das ganze Boot voller Geschichten, beladen mit diversen Bewohner*innen, Bedürfnissen und Fragen, in See sticht? Dann ankert es auch mal als ANOHA on.tour am zweiten, wichtigen Platz im Kiez rund um das Museum: dem Mehringplatz. An so einem Tag können dann die Bewohner*innen Teil der Geschichte werden, selber Boote bauen und diese wiederum in See stechen lassen.
So trägt ANOHA neue Ideen, Geschichten und Visionen hinaus in den Kiez und zu einer Vernetzung der Plätze und Menschen bei. Und die können dann gemeinsam großen Fragen nachgehen: Wenn die Flut kommt, weil der Mensch sich schlecht verhalten hat, dann fragen wir vielleicht, was das eigentlich ist: „gut“ oder „schlecht“. Und wer bestimmt das denn? Was ist gerecht? Und wie können wir alle mitnehmen und darauf achten, dass wir niemanden zurücklassen? Das gilt für das Zusammenleben auf der Arche genauso wie in unserer Nachbarschaft!
one young visitor—a good question. What is a hamster afraid of in the sunshine? Observations like these make it possible to consider different modes of life. And it is always helpful to ask a few additional questions. Can animals with such different needs coexist outside the museum? How is this possible? The ANOHA exhibition scenography is based on imagination and a lot of questions. The many new experiences and ideas are “mobile” and can be taken out into the neighborhood after a visit.
And what if the entire ark laden with all its stories, questions, and diverse animals and their needs puts out to sea? Then, in the form of ANOHA on.tour, the vessel might drop anchor at the second most important place in the museum’s neighborhood: Mehringplatz. On days like this, the residents of the square become part of the story, build their own boats, and set sail to foreign shores.
In this way, ANOHA brings new ideas, stories, and visions to the neighborhood. It helps connect places and people, who can then explore important questions together. One is the idea that the flood was unleashed because human beings are bad. If that is the case, what exactly do “good” and “bad” mean? And who is making that call? What is just? Finally, how can we ensure that there is a place for everyone on the ark and no one gets left behind? This applies to life together on the ark as well as to life in our neighborhood!
Ane Kleine-Engel ist seit November 2019 Leiterin der Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin. Sie promovierte in Jiddistik, lehrte weltweit an verschiedenen Hochschulen und kuratierte ab 2015 Ausstellungen für Gedenk- und Begegnungsstätten.
Ane Kleine-Engel has been Director of the Children's World at the Jewish Museum Berlin since November 2019. She earned her doctorate in Yiddish studies, taught at various universities worldwide, and curated exhibitions for memorial and encounter sites since 2015.
ANOHA on.tour mit mobiler Arche bei einer SchiffbastelAktion am Mehringplatz
ANOHA on.tour with a mobile ark during a shipbuilding session at Mehringplatz

In ANOHA, the Children’s World of the Jewish Museum Berlin, children can explore the story of Noah’s Ark with all their senses. Imaginatively designed animals large and small have found a place in the huge wooden ark. But how do they all get along?
In the four-day vacation program, children learn different storytelling techniques and gain insight into the art of creative writing. Afterward, they all try writing their own text about the story of Noah’s Ark and designing a book to go with it. On the last day of the program, the young authors present their books and stories to parents and friends.
Es war einmal … Geschichten schreiben auf der Arche Noah: 4-tägiges Ferienprogramm für Kinder von 9 bis 12 Jahren

Once upon a time … writing stories about Noah’s Ark: Four-day vacation program for children aged 9 to 12
Im ANOHA, der Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin, können Kinder die Geschichte der Arche Noah mit allen Sinnen erleben. Auf der riesigen Holzarche haben große und kleine phantasievoll gestaltete Tiere ihren Platz gefunden. Doch wie kommen alle gut miteinander aus?
Im 4-tägigen Ferienprogramm lernen die Kinder verschiedene Techniken des Geschichtenerzählens kennen und erhalten einen Einblick in die Kunst des kreativen Schreibens. Im Anschluss kann sich jedes Kind an einem eigenen Text über die Geschichte der Arche Noah versuchen und dazu ein Buch selbst gestalten. Am letzten Tag präsentieren die Nachwuchsautor*innen dann ihre Bücher und Geschichten vor Eltern und Freund*innen.
Der Ferienworkshop bietet ein vielfältiges Programm mit Spiel & Spaß sowie jeden Tag ein frisch zubereitetes vegetarisches Mittagessen. Kosten: 120 Euro inkl. Lunch.
Jeweils täglich von 9 bis 15:30 Uhr: 25. bis 28. Juli 2023
8. bis 11. August 2023
15. bis 18. August 2023
22. bis 25. August 2023
The vacation workshop offers a diverse program of fun, games, and a freshly prepared vegetarian lunch every day. Price: 120 euros incl. lunch. (Program in German only)
Daily from 9 am to 3:30 pm:
25 to 28 July 2023
8 to 11 August 2023
15 to 18 August 2023
22 to 25 August 2023
Öffentliche Führung für Erwachsene
PHILOSOPHY
Public tour for adults
Tauchen Sie ein in die Geschichte der Arche
Noah und gehen an Bord einer riesigen Arche aus Holz, die das renommierte US-amerikanische Büro Olson Kundig, Architecture and Design, entworfen hat.
Sonntags, jeweils 14:45 Uhr, 60 Minuten
6 Euro, ermäßigt 3 Euro
Dive into the story of Noah’s Ark and go aboard a huge wooden ark designed by the renowned American firm Olson Kundig Architecture and Design.
Sundays at 2:45 pm, 60 minutes
€6, reduced €3
Buchung Registration
Tickets: www.anoha.de
T +49 (0)30 259 93 305
visit@anoha.de

Ergebnisse eines partizipativen Werkstattprojekts im Jüdischen Museum Berlin
Outcomes of a participative workshop project at the Jewish Museum Berlin

Ein schöner Rückzugsraum: Hat er eine goldene Wandfarbe oder ist alles grün? Ist er bunt und wild? Oder doch lieber ruhiger mit einer weichen Stofftapete an den Wänden, die man streicheln kann? Die Schüler*innen der Biesalski-Schule, die seit April 2021 alle zwei Wochen zum Mitmachen und Entwerfen ins JMB kommen, zeigen ihre Gestaltungsentwürfe für einen Rückzugsraum, der am JMB entstehen soll.
19. bis 30. Juni 2023
W. Michael Blumenthal Akademie
Eröffnung am 14. Juni 2023 um 15 Uhr
Imagine a beautiful room to retreat to: Are its walls painted gold, or is it all in green? Is it bold and multicolored? Or perhaps something calmer, with strokably soft, fabric wallpaper? Students at the Biesalski School, who have been coming to the JMB every two weeks since April 2021 to participate and share design ideas, present their draft designs for a quiet space that will be created at the JMB.
19 to 30 June 2023
W. Michael Blumenthal Academy
Opening: 14 June 2023 at 3 pm
Das Jüdische Museum Berlin lädt Geflüchtete aus der Ukraine ein, die Highlights der Dauerausstellung kennenzulernen. Die Führungen geben anhand ausgewählter Objekte, Medienstationen, Videoinstallationen und Kunstwerke einen Überblick über die Ausstellung und bieten an, der wechselvollen Geschichte zu folgen und mehr darüber zu erfahren, was Jüdisch-Sein heute bedeutet.

Die Führungen sind kostenfrei und finden in ukrainischer oder russischer Sprache statt.
Ab Juli 2023 jeden 2. Sonntag des Monats um 14 Uhr Tickets kostenfrei online oder vor Ort
The Jewish Museum Berlin invites refugees from Ukraine to get to know the highlights of the core exhibition. Through selected objects, media stations, video installations, and artworks, the guided tours offer a survey of the exhibition. They encourage visitors to follow the ups and downs of history and learn more about what it means to be Jewish today.
The tours are free of charge and are held in Ukrainian or Russian.
Starting July 2023, every second Sunday of the month at 2 pm Tickets can be booked, free of charge, online or at the museum entrance.


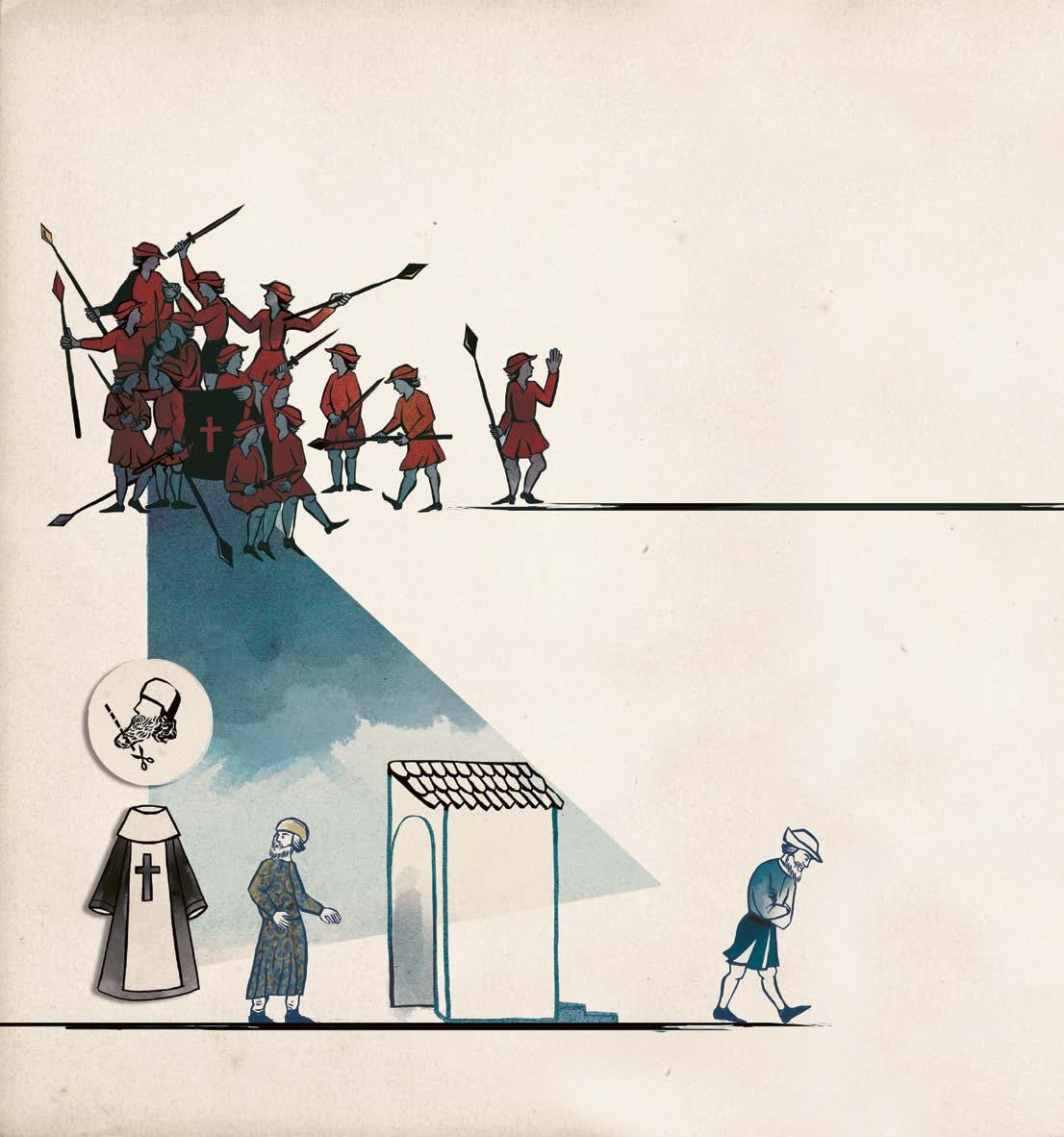
 Miriam Goldmann
Miriam Goldmann
In den Städten des Mittelalters lebten jüdische und christliche Familien in enger Nachbarschaft, und ihr Alltag war miteinander verwoben: Synagoge und Dom, zum Beispiel in Worms, wurden von den gleichen Bauleuten errichtet, und das Leben

spielte sich auf engstem Raum innerhalb der Stadtmauer ab. Das alltägliche Zusammenleben stellte Jüdinnen und Juden auch vor Herausforderungen, und sie gaben sich präzise Regeln, die dem Schutz der eigenen Tradi-
tionen dienten. Eine außergewöhnliche Quelle dafür ist das um 1200 aufgezeichnete „Sefer Chasidim“, das „Buch der Frommen“. Es ist eine Art Leitfaden der kleinen rigorosen Bewegung der Frommen Aschkenas’, die insbesondere in Regensburg, Speyer,
Worms und Mainz bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts blühte. Das „Sefer Chasidim“ enthält Anweisungen zum alltäglichen Leben und regelt so praxisnah wie detailliert, wie sich Jüdinnen und Juden gegenüber Christ*innen zu verhalten haben: Wann, zum
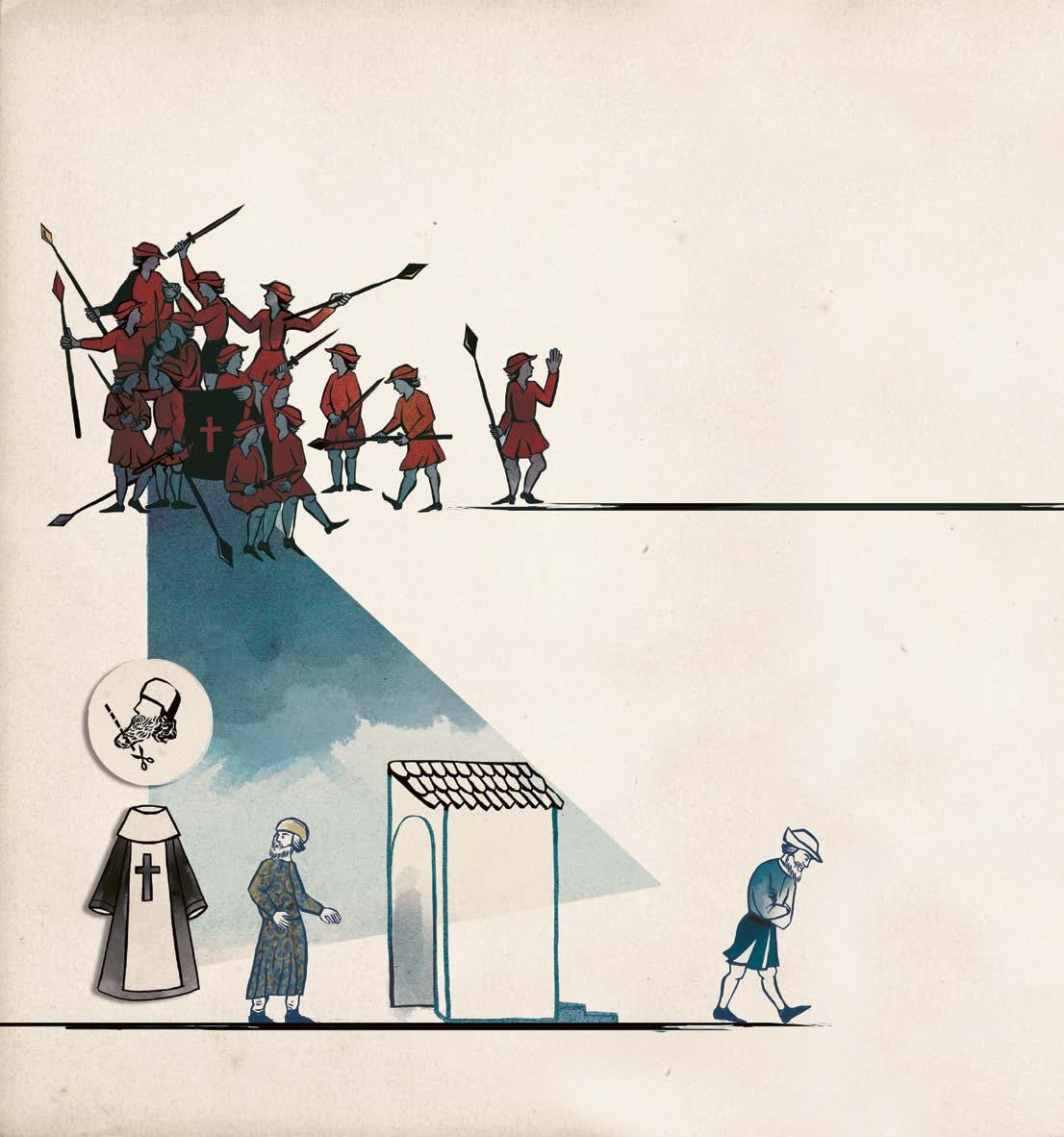
In the Middle Ages, Jewish and Christian communities coexisted in close proximity to each other and their everyday lives were interconnected: Synagogues and cathedrals, such as those in Worms, were built by the same construction workers, and both groups

lived in very tight quarters within the city walls. This proximity also posed challenges and Jews laid down precise rules to protect their own traditions. An unusual source for this is the Sefer Hassidim, the Book of the Pious, a kind of
handbook written around 1200 by the movement of the “Pious,” a group which was active during that time in Regensburg, Speyer, Worms and Mainz. The Sefer Hassidim contains instructions for everyday life and offers practical and detailed
guidelines for Jews in their dealings with Christians. For example, when may Jews ask Christians for help? Or how should Jews conduct themselves when they are near a church, without giving the impression it is a holy place for Jews?
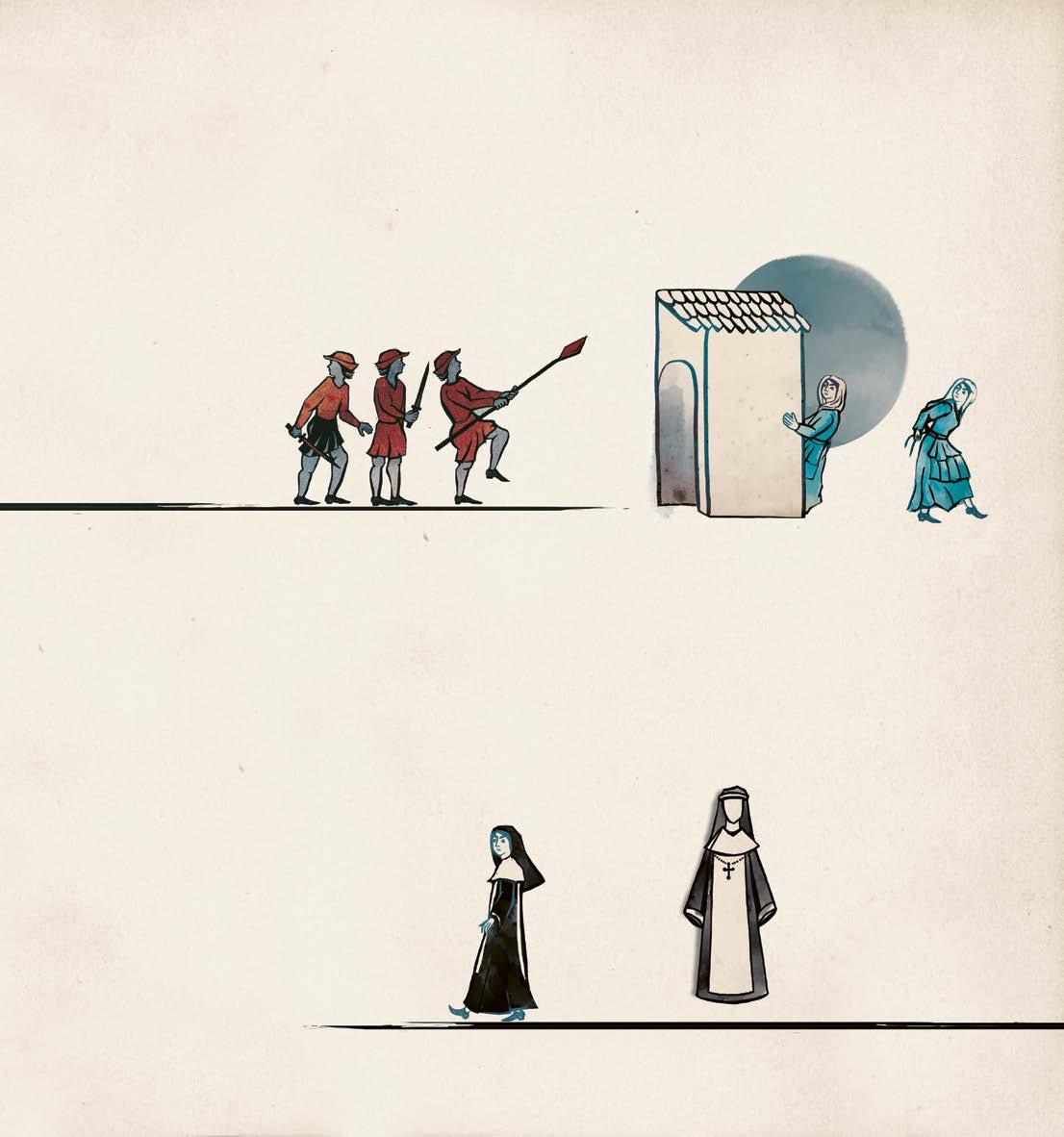
Beispiel, darf man Christ*innen um Hilfe bitten? Wie verhält man sich, wenn man sich einer Kirche nähert, ohne den Eindruck zu erwecken, sie sei für Jüdinnen und Juden ein heiliger Ort? Heute geben diese Regeln nicht nur Hinweise auf
jüdische Traditionen des Mittelalters, sondern bieten auch einen Einblick in die enge Nachbarschaft, in der sich christliche und jüdische Familien im Alltag begegneten.

Einen neu illustrierten Einblick in die Regeln des Zusammenlebens bietet in der Dauerausstellung eine Medienanwendung zum virtuellen Blättern: „Was tun, wenn …?“ Wüssten Sie es?
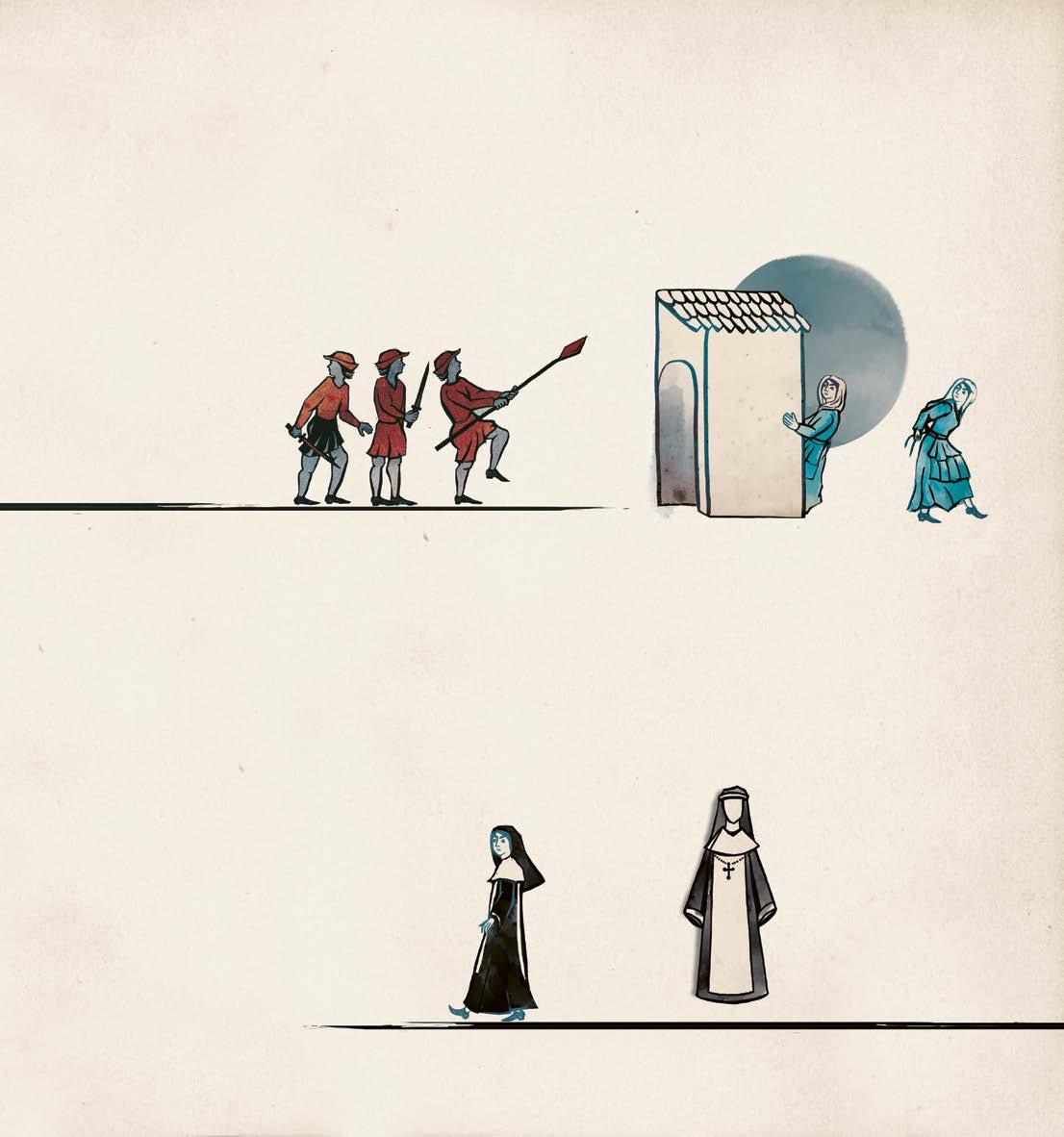
Today these rules not only shed light on Jewish traditions in the Middle Ages, they also offer insight into geographic proximity and neighborly coexistence in which Christian and Jewish families spent their daily lives.


In the core exhibition you can take a look at the rules in a media application and find out “What Should I Do If … ?” Would you know?
Miriam Goldmann ist seit 1999 Ausstellungskuratorin am Jüdischen Museum Berlin. Sie studierte Judaistik in Freiburg, an der Hebrew University Jerusalem und an der Freien Universität Berlin.
Miriam Goldmann has been an exhibition curator at the Jewish Museum Berlin since 1999. She studied Jewish Studies in Freiburg, at the Hebrew University Jerusalem and at the Free University Berlin.
Am 4. Mai 2023 erhielt Maya Schweizer den diesjährigen DAGESH -Kunstpreis für die Videoinstallation „Sans histoire“. Der Preis wird bereits zum dritten Mal gemeinsam vom Jüdischen Museum Berlin und Dagesh – Jüdische Kunst im Kontext verliehen.
Die französische Künstlerin setzt in ihrer Videoinstallation der diesjährigen Fragestellung des Kunstpreises „Was jetzt? Von Dystopien zu Utopien” ein offenes „Sans histoire“ – ein „ohne Geschichte“ – aus kunstvoll zusammengesetzten Bildern, Texten und Tönen entgegen. Die gleichnamige Ausstellung im JMB zeigt die preisgekrönte Videoinstallation sowie drei weitere filmische Werke aus den Jahren 2012 bis 2020. Schweizer verwebt in ihnen Fragmente der Erinnerung und Spuren des Vergessens. Die Werke der 1976 geborenen Künstlerin wurden bereits in zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. Maya Schweizer lebt und arbeitet in Berlin.
Der DAGESH-Kunstpreis wird alljährlich in Kooperation mit dem Programm Dagesh – Jüdische Kunst im Kontext verliehen und durch eine Förderung der FREUNDE DES JMB ermöglicht.
On 4 May 2023, Maya Schweizer will be presented with this year’s DAGESH Art Award for her video installation Sans histoire. This is the third year of the prize, which is awarded jointly by the Jewish Museum Berlin and “Dagesh— Jewish Art in Context.”

In her video piece, the French artist responds to the award’s question, “What Now? From Dystopias to Utopias,” with an open sans histoire —without history and without story— that is artfully assembled from images, texts, and sounds. The exhibition of the same title at the JMB shows the prizewinning artwork along with three other video installations from the period between 2012 and 2020. In them, Schweizer weaves together fragments of memory and strands of forgetting. Maya Schweizer, born in 1976, has shown her work internationally in numerous solo and group exhibitions. She lives and works in Berlin.
The DAGESH Art Award is conferred annually in cooperation with the program “Dagesh—Jewish Art in Context” and made possible through the support of the FRIENDS OF THE JMB.
5 May to 27 August 2023
Jewish Museum Berlin, Eric F. Ross Gallery free admission
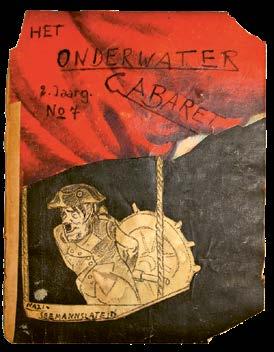
Im Februar 2024 zeigt das Jüdische Museum Berlin in der Ausstellung „Het Onderwater Cabaret“ („Das Unterwasserkabarett“) ein bemerkenswertes und einzigartiges Werk, das der deutsch-jüdische Flüchtling Curt Bloch in seinen Verstecken in den Städten Enschede und Borne schuf: Zwischen August 1943 und April 1945 produzierte er jede Woche eine 16- bis 24-seitige Ausgabe einer Zeitschrift, jeweils mit einem kunstvollen Umschlag aus Collagen und Fotomontagen geschmückt. In seinen niederländischen und deutschen Texten behandelt Bloch den Verlauf des Krieges, die Verbrechen der Nazis und ihrer faschistischen Kollaborateure, seine Situation im Versteck und das Schicksal seiner Familie, den nahenden Untergang und die Niederlage der Achsenmächte. Mit beißender Ironie und sardonischem Witz zieht Bloch über Hitler, Goebbels und Göring bis hin zu Mussolini und Seyß-Inquart (Reichskommissar der Niederlande) her, sowie über ihre Handlanger, und stellt die Ungeheuerlichkeit ihrer Gräueltaten dar. Viele Hefte enthalten zeitgenössische Zeitungsausschnitte und vereinzelte Texte sind als Lieder konzipiert.
Das nächste JMB Journal erscheint im Februar 2024 als Sonderausgabe zur Ausstellung.
9. Februar 2024 bis 26. Mai 2024
In February 2024, the Jewish Museum Berlin will present a remarkable and unique body of work by the German-Jewish refugee Curt Bloch, Het Onderwater Cabaret (The Underwater Cabaret), that he created in his hiding places in the cities of Enschede and Borne. Between August 1943 and April 1945, Bloch produced a weekly 16- to 24-page magazine with an artistic cover featuring collages and photomontages. In his Dutch and German verses he discussed the course of the war, the crimes committed by the Nazis and their fascist collaborators, his life in hiding, the fate of his family, and the approaching downfall and defeat of the Axis powers. With biting irony and sardonic wit, he attacked leading fascists and their henchman, including Hitler, Goebbels, Goering, Mussolini, and Arthur Seyß-Inquart, Reich Commissar for the Netherlands. He also exposed the enormity of their atrocities. Many issues contain newspaper clippings from the period, and a small number of texts are conceived as songs.
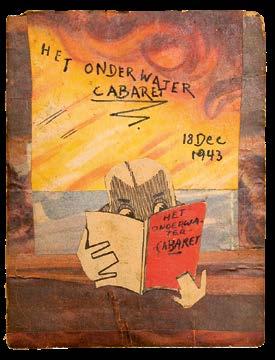
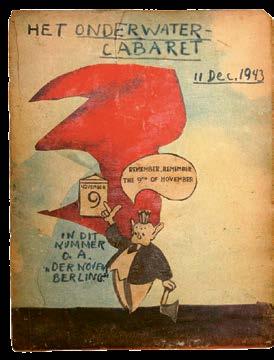
The next issue of the JMB Journal , to be published in February 2024, will be devoted to the exhibition.
9 February to 26 May 2024

Wie kommt ein Eimer mit Porzellanschildern tief unter die Erde, zwischen die Wurzeln eines Baumes im Norden von Berlin?
Warum werden die Schilder dem Jüdischen Museum Berlin übergeben? Wie viele Fachleute benötigt man, um dieses Rätsel aufzulösen?
Eine ungewöhnliche Spurensuche. How did a pail with small porcelain signs end up being buried deep between tree roots in the north of Berlin? Why were the signs consigned to the Jewish Museum? How many experts does it take to solve this puzzle?
An unusual search for traces.
DE Im Jahr 2020 stieß der Inhaber einer Gartenbaufirma im Außenbereich einer Berliner Kita auf die Reste eines Blecheimers mit 145 Namensschildern aus Porzellan. Er nahm sie zunächst zur Verwahrung an sich. Seiner Ehefrau fiel auf, dass sich auf zweien dieser Schilder der Nachname Brasch befand, einmal Joseph und einmal Leo Brasch. Es waren Namen, die sie aus dem Kino kannte, aus einem Film über die jüdische Familie Brasch. Könnten Leo und Joseph Mitglieder dieser Familie sein?
Das Ehepaar wandte sich an das Jüdische Museum Berlin und bot den Fund dem Archiv an. Auf den zunächst vorgelegten Fotos war Folgendes zu erkennen: Abgerundete weiße Schilder mit Löchern links und rechts, die also ursprünglich angeschraubt waren. Namen von Personen, aber auch von Firmen und Banken, waren in unterschiedlichen Schrifttypen darauf erkennbar. Die Gestaltung der Schilder legte nahe, dass sie um 1900 hergestellt worden waren. Der Sammlungsbereich des JMB beschloss, herauszufinden, wozu die Namensschilder dienten und woher sie stammten, bevor sie aufgenommen werden könnten.
Die naheliegendste Vermutung, dass es sich um Türschilder aus der Nachbarschaft der Fundstelle handeln könnte, ließ sich anhand Berliner Adressbücher am schnellsten prüfen: Stichprobenhaft suchten wir in jenen aus den Jahren 1900, 1913, 1923 und zogen auch das Jüdische Adressbuch von 1930 zu Rate, da nicht nur der Name Brasch, sondern auch weitere Namen auf eine potentiell jüdische Familie hindeuteten. Die Recherche ergab, dass in keinem Jahr alle Namen gleichzeitig zu finden waren; zudem waren die Adressen jener Firmen und Personen, die verzeichnet waren, in keinem Fall identisch.
Die Adressbücher brachten uns jedoch auf eine neue Fährte: Alle aufgefundenen Personen standen als „Kaufmann“ oder „Bankier“ im Adressbuch. Das ließ vermuten, dass alle eine ähnliche Tätigkeit ausübten und sie einem möglicherweise wohlhabenden Milieu angehörten. Wurden die Schilder vielleicht in einem Verein genutzt, etwa zur Personalisierung eines Spinds oder Postfachs? Einige der Namen fanden sich
EN In the yard outside a Berlin daycare center, in 2020, the owner of a landscaping business came upon the remnants of a metal pail filled with 145 porcelain nameplates. He initially held on to his find for safekeeping. His wife noticed that two of the signs had the last name “Brasch,” one of them Joseph, the other Leo. She was familiar with the name from the movie about the Jewish Brasch family. Might Leo and Joseph be part of that same family?
The couple contacted the Jewish Museum Berlin and offered to donate the find to the museum archives. On the photographs they initially presented, the following could be made out: The white signs with rounded edges have holes on the left and right, indicating that they had been screwed on to something. Written on them in various styles are the names of persons as well as companies and banks. The design of the nameplates suggested that they were presumably created around 1900. Before its collections department accepted the find, the Jewish Museum Berlin decided to research the origin of the nameplates and what purpose they served. They seemed most likely to be signs for doors from somewhere near where they were found, which could easily be verified by perusing old Berlin address books. We did some random checks in the address books from the years 1900, 1913, and 1923, and also looked at the 1930 Jewish address book, since not only the name “Brasch” but also some others indicated a potentially Jewish name. The search revealed that none of the address books listed all the names. And the addresses of the businesses and people listed were by no means identical.
However, the address books gave us a new idea: All of the names that were in fact found in the address books were listed as “businessman” or “banker.” This suggested that all of them carried out a similar activity and all might be wealthy. Could the signs have been used by a club or organization to personalize lockers or mailboxes? Some of the names were found on a membership list of the Jewish organization Gesellschaft der Freunde (Society of Friends) in Berlin,1 but that didn’t help in explaining the rest of the names.

auf einer Mitgliederliste des Vereins Die Gesellschaft der Freunde wieder.1 Das half bei der Zuordnung der übrigen Namen aber nicht weiter.
Waren es vielleicht Namensschilder von Sitzplätzen in einer Synagoge? Auch diese Hypothese konnte schnell verworfen werden, denn wieso hätte etwa der Protestant Albert Schappach, dessen Privatbank ebenfalls eines der Schilder ziert, einen beschilderten Sitz in der Synagoge haben sollen? Also doch ein Verein? Die Suche nach passenden Gruppen wurde abgebrochen, weil eine Eingrenzung unter den Hunderten Vereinen Berlins nicht möglich war. Wo also hätte man solche Schilder sonst noch anschrauben können? Vielleicht im Theater oder in der Oper als Zeichen sogenannter Stuhlpatenschaften, wie es sie heute noch gibt?
Ein Gespräch mit der Theaterwissenschaftlerin Ruth Freydank, die viele Jahre im Märkischen Museum, dem Stadtmuseum Berlins, tätig war, ergab, dass zwei kulturelle Einrichtungen mit großer bürgerschaftlicher Finanzierung in Frage kämen: Erstens der Vorgängerbau der Deutschen Oper und zweitens das Schillertheater. Das Archiv des Schillertheaters ist jedoch verbrannt, und der Bau an sich wurde von Frau Freydank selbst bereits in seiner Tiefe erforscht – ein Hinweis auf Porzellanschilder tauchte dort in keinem Zusammenhang auf. Der Vorgängerbau der Deutschen Oper wiederum wurde im Jahr 1913 realisiert. Allerdings war etwa der Bankier Alwin Abrahamsohn, dessen Name sich auf einem der Schilder befindet, bereits 1902 verstorben; als Zeichen einer Stuhlpatenschaft in diesem Bau konnten die Schilder also nicht gedient haben. Im nächsten Schritt wurden die Schilder selbst noch einmal genau unter die Lupe genommen. Ganz bewusst hatten die Finder Erde und Sand auf den Schildern belassen, um den Zustand beim Fund zu bewahren. Das vorsichtige Säubern einzelner Schilder legte in einigen Fällen eine rückseitige Pressmarke der Porzellan-Manufaktur LHA Schmidt-Berlin Moabit frei. Glücklicherweise ist die Sammlung der Moabiter Porzellane des Märkischen Museums online zugänglich, darunter auch Stücke aus Schmidt-Porzellan.
Or might they have marked seats in a synagogue? This hypothesis could also quickly be discarded, since Albert Schappach, a Protestant whose private bank was also mentioned on one of the signs, would certainly not have had a labelled seat in a synagogue. So were they from an organization after all? The search for fitting groups was discontinued because it was impossible to narrow down the possibilities from among the hundreds of organizations in Berlin. So where else could such porcelain labels have been screwed into place? Maybe in a theater or the opera, as a sign of someone having sponsored a seat, as is still done today?
In a conversation with the theater scholar Ruth Freydank, who worked for many years in the Märkisches Museum, Berlin’s city museum, we learned of two possible cultural institutions with substantial civic financing: First, the building that preceded the opera house of the Deutsche Oper, and second, Schiller Theater.
The Schiller Theater archives, however, had been burned, and the building itself had already been researched in depth by Ms Freydank, who had discovered no reference at all to the porcelain nameplates. The building that preceded the Deutsche Oper had been built in 1913, but the banker Alwin Abrahamsohn, whose name appears on one of the signs, had already died in 1902, so the signs could not have served to indicate the name of a seat sponsor in that building.

The next step involved examining the signs themselves closely. The finders had deliberately left dirt and sand on them in order to preserve their condition at the time they were found. As they were carefully cleansed, a factory mark of the LHA Schmidt porcelain manufactory in Berlin-Moabit was uncovered on the back of some of the nameplates. Luckily, the collection of the Moabit porcelain in the Märkisches Museum can be searched online, also including pieces of Schmidt porcelain. There the donor is listed, Frank Buschenhagen, a descendant of the company founder. When we sent a message using an online contact form for his print shop asking if he was the porcelain donor, he responded promptly, confirming that yes, he was the donor, and he also sent us his “porce-

Ebenfalls genannt ist ihr Stifter, ein Nachfahre der Firmengründer, der den Namen Buschenhagen trägt. Er antwortete auf die Anfrage im Kontaktformular seiner Druckerei, ob er der Porzellan-Stifter sei, prompt, ja, das sei er, und schickte noch seine „Porzellanadresse“, über die er in diesem Falle besser zu kontaktieren sei. Herr Buschenhagen und seine Frau waren begeistert von der Fragestellung nach dem Zweck der Schilder und schlossen sich der Recherche an. Der Porzellanexperte kannte die vorliegenden Schilder selbst nicht, konnte jedoch erkennen, dass es sich um eine Sonderanfertigung handelte, so wie z.B. die Schilder im Botanischen Garten zur Bezeichnung unterschiedlicher Pflanzen.
Den entscheidenden Hinweis lieferte indes seine Frau: Legt die Kombination aus Firmen, Bankiers und Kaufleuten nicht nahe, dass die Schilder aus der Berliner Börse stammen? Tatsächlich konnte der in den verschiedenen Adressbüchern angegebene Beruf Kaufmann mit Hilfe des Handels-Registers spezifiziert werden; es zeigte sich, dass alle Namensträger Berufen nachgingen, die an der Börse aktiv waren, darunter Getreidehändler, 2 wie etwa die Brüder Joseph und Leo Brasch, oder Börsenmakler. Zur Berliner Börse ist bereits geforscht worden, unter anderem von Christof Biggeleben, der sich intensiv mit der Korporation der Kaufmannschaft, also der Leitung der Börse beschäftigt hat. 3
Während eines Telefonats vermutete er, dass die Schilder die Orte markierten, an denen die Firmen bzw. Händler standen; damit lag er fast richtig. Die endgültige Lösung schließlich kannte Katrin Richter, die zum Thema „Die Medien der Börse“4 promoviert wurde, und uns Bilder der Börse zeigen konnte: Auf mehreren Zeichnungen, Gemälden und Fotos sind eindeutig weiße Schilder an den Sitzbänken zu erkennen. Außerdem kannte sie die Beschreibung des Publizisten und Reiseschriftstellers Georg Schweizer, der 1891
lain contact,” which he said was a better contact address in this regard. Buschenhagen and his wife were delighted to be asked about the purpose of the nameplates and they joined in the search to discover their origin. The porcelain expert was not familiar with these signs, but he could recognize that it was a custom-made product, like, for example, the signs in the Botanical Garden to identify the various plants.
It was his wife who finally solved the puzzle: Might the combination of companies, bankers, and businessmen not suggest that the signs came from the Berlin stock exchange? It was then possible to specify more precisely the occupation “businessman” in the various address books by referring to the commercial register. It turned out that all those listed pursued occupations that were active on the stock exchange, including grain merchants2—such as the brothers Joseph and Leo Brasch—and stockbrokers. The Berlin stock exchange has already been researched, by Christof Biggeleben for one, who has dealt extensively with the corporation of the merchants, that is, the stock exchange management. 3 When speaking with him on the telephone, Biggeleben presumed that the signs marked the locations where the companies or merchants stood. That was close to the mark. The ultimate solution was offered by Katrin Richter, who wrote her doctoral thesis on The Media of the Stock Exchange 4 and could show us pictures of the exchange: White signs on the benches can clearly be seen on numerous drawings, paintings, and photographs. She was also familiar with the description written by the journalist and travel writer Georg Schweizer in 1891:
“Those alcoves between the columns along the walls of the hall … are leased at handsome prices to the major companies, and that is where their representatives take a seat every midday. In fact, there are no spaces on the two-seater benches with a shared armrest or on the benches at the base of the columns that cannot be reserved for a particular party for a tidy sum. The small, white porcelain signs on both sides of the backrest display the names of the lessees.” 5
But how did the pail with the porcelain nameplates end up under the tree in the yard of the Berlin daycare center? According to the owner of the landscaping company who found the pail, the root growth of the tree would indicate the time the pail was buried about seventy or
The Berlin stock exchange with the 1892/93 extended Friedrichsbrücke, 1901

2 Grain merchants made sense because there had been a room for food retailers, the so-called commodity exchange.
2 Getreidehändler war deshalb passend, weil es einen Saal für den Lebensmittelhandel, die sogenannte, Produktenbörse gab.
3 Christof Biggeleben, Das Bollwerk des Bürgertums. Die Berliner Kaufmannschaft 1870–1920, München 2006.
4 Katrin Richter, Die Medien der Börse. Eine Wissensgeschichte der Berliner Börse von 1860 bis 1933, Berlin 2020.
3 Christof Biggeleben, Das “Bollwerk des Bürgertums.” Die Berliner Kaufmannschaft 1870–1920 (Munich 2006).
4 Katrin Richter, Die Medien der Börse. Eine Wissensgeschichte der Berliner Börse von 1860 bis 1933, Berlin: Lukas Verlag, 2020
5 Georg Schweitzer, “Berliner Börse,” in Berliner Pflaster. Illustrierte Schilderungen aus dem Berliner Leben, ed. M. Reymond and L. Manzel (Berlin 1891), 324–25.
berichtete: „Jene Nischen zwischen den Säulen entlang den Wänden des Saals […] sind zu ganz ansehnlichen Preisen an die großen Firmen vermiethet, und dort lassen sich deren Vertreter allmittags nieder. Ueberhaupt gibt es keinen Platz auf den zweisitzigen Bänken mit der gemeinschaftlichen Mittellehne oder auf den Subsellien [= Sitzbänke] am Fuße der Säulen, welcher nicht für ein hübsches Sümmchen einem bestimmten Hause reserviert wäre. Die kleinen, weißen Porzellanschilder auf beiden Seiten der Rückenlehne tragen die Namen der Miether.“ 5
Doch wie geriet der Eimer mit den Porzellanschildern unter den Baum im Garten der Berliner Kita? Laut dem Inhaber der Gartenbaufirma und Finder weist das Wurzelwachstum des Baums auf einen Vergrabungszeitpunkt vor 70 bis 80 Jahren hin –also zwischen 1940 und 1950. Vielleicht sind die Schilder von jemandem vergraben worden, der sie für bedeutsam hielt. Vielleicht war es eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Berliner Börse, der sie vor den Bombenangriffen retten wollte?
Wie dem auch sei: Heute gelten die Schilder als „herrenlose Funde“, und ihre Eigentümerin ist das Land Berlin, das sie dem Jüdischen Museum Berlin als Dauerleihgaben überlassen hat. Auch wenn es insgesamt wohl über tausend solcher Namensschilder in der Börse gegeben hat, können wir von Glück sagen, dass zumindest ein Teil dieser materiellen Überreste der Berliner Börse die Zeiten überdauert hat und nun der historischen Forschung zur Verfügung steht.
eighty years ago, that is, between 1940 and 1950. Perhaps the signs were buried by someone who considered them significant. Perhaps an employee of the Berlin stock exchange who wanted to save them from getting damaged in air raids? Be that as it may, today the signs are considered “abandoned property,” and their owner is the State of Berlin, which has given them to the Jewish Museum Berlin as a permanent loan.
Even though there were a total of more than one thousand such nameplates in the stock exchange, it was certainly a stroke of luck that at least a portion of these material remnants of the Berlin stock exchange survived and is now available for historical research.
Lea Simon ist seit Mai 2022 wissenschaftliche Volontärin im Jüdischen Museum Berlin. Sie studierte Musikwissenschaft und Romanistik in Heidelberg, Tours und Weimar und verteidigte ihre Dissertation zum Thema „Klassische Komponisten in Kibbuzim der 1930er- bis 1980er-Jahre“ an der Universität der Künste Berlin.
Lea Simon has been a research trainee at the Jewish Museum Berlin since May 2022. Having studied Musicology and Romance Studies in Heidelberg, Tours, and Weimar, she recently completed her PhD thesis on “Classical Composers in Kibbutzim from the 1930s to the 1980s” at the Berlin University of the Arts.
Ein Holzstich zeigt das Treiben in der Börse – wer genau hinsieht, entdeckt an den Sitzlehnen angeschraubte Porzellanschilder. Nach einer Zeichnung von Werner Zehme, 1896 A wood engraving shows the hustle and bustle in the stock exchange, as well as name plates on the benches. Based on a drawing by Werner Zehme, 1896

Was bedeutet Nachbarschaft im Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland? Nachbarschaft drückte sich zum Beispiel als kollektiver Zusammenschluss einzelner Jüdinnen und Juden auf lokaler Ebene aus, wie der im 19. Jahrhundert gegründete Gesangsverein „Liederkranz“ verdeutlicht. Dass das Konzept von Nachbarschaft mit traditionellen jüdischen Werten verknüpft ist, zeigte das Leben der jüdischen Sozialarbeiterin und Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim, die in allem für was sie stand, das jüdische Prinzip der Zedaka, der Wohltätigkeit, verkörperte. In den Jahren des NS-Regimes war Nachbarschaft oftmals mit Zwang und Verfolgung verknüpft. Im Wohnhaus in der Käthe-Niederkirchnerstraße 35 lebte die Familie Lewy/Gossels viele Jahre, bis die Nazis sie enteigneten und hier viele jüdische Familien zwangseinquartierten. Drei Beispiele, deren Geschichten sie auf Jewish Places nachlesen können.
What does neighborhood mean for Jews living in Germany? One way it manifested itself was through local Jewish groups like the Liederkranz choral society, which was founded in the nineteenth century. The link between the concept of neighborhood and traditional Jewish values is shown by the life of the Jewish social worker and women’s rights activist Bertha Pappenheim, who embodied the Jewish principle of zedakah, or charity, in everything she did. Under the Nazi regime, neighborhood was often associated with coercion and persecution. The Lewy and Gossels familiy lived in the building at Käthe-Niederkirchnerstrasse 35 for years until the Nazis expropriated the property and forced many Jewish families to live there. These are just three of the examples you can read about on Jewish Places .


Bertha Pappenheim, geboren 1859 in Wien, wuchs in einer jüdisch-orthodoxen Familie auf. Früh prangerte sie die Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen an. Nachdem sie als Patientin „Anna O“ in die Geschichte der Psychoanalyse einging, zog sie mit ihrer Mutter nach Frankfurt am Main. Motiviert von Ideen jüdischer Wohltätigkeit handelte sie fortan in Solidarität mit den Schwächsten: Sie half z.B. Waisenkindern und vor Pogromen aus dem russischen Zarenreich geflohenen Jüdinnen und Juden. 1904 gründete sie als unverheiratete Frau den Jüdischen Frauenbund.
Bertha Pappenheim was born in Vienna in 1859 and grew up in an Orthodox Jewish family. At an early age, she began criticizing the unequal treatment of girls and boys. After earning her place in psychoanalytical history as the patient “Anna O,” she moved to Frankfurt am Main with her mother. Motivated by the idea of Jewish charity, Pappenheim showed solidarity with society’s weakest, providing help to Jewish orphans and to Jews who had fled the pogroms in the Russian Empire. In 1904, she founded the Jewish Women’s League as an unmarried woman.
jewish-places.de




Das Gefühl von Gemeinschaft drückte sich im „Liederkranz“ in besonderem Maße aus. Angefangen als Synagogenchor entwickelte sich Mitte des 19. Jahrhunderts ein Männergesangsverein heraus, in dem sowohl religiöse als auch weltliche Lieder gesungen wurden. Die Mitgliederzahl wuchs stetig, es kamen Solisten aus ganz Europa, sodass der Liederkranz im kulturellen Leben der Stadt Mannheim zu einer festen Größe wurde. Nach der Machtübernahme der Nazis kamen dem Verein, bis zu seiner Zerschlagung im November 1938, neue Aufgaben zu. Er stärkte die jüdische Identität seiner Mitglieder und war einer der wenigen Orte, an denen Juden und Jüdinnen noch Kunst genießen konnten.

There was a particularly strong sense of community in the Liederkranz choral society, which was founded as a synagogue choir and in the mid-nineteenth century became a men’s singing club that performed religious and secular songs. Membership increased steadily, and with soloists from all over Europe, the choral society became an important fixture in Mannheim’s cultural life. After the Nazis took power, it devoted itself to new tasks until it was disbanded in November 1938. It reinforced the Jewish identity of its members and was one of the few places where Jews could still enjoy the arts.

12.05.2019
In der heutigen Käthe-Niederkirchner-Str. 35 in Berlin befindet sich das ehemalige Wohnhaus der Familie Lewy/Gossels. Mitglieder der Familie lebten hier von 1915 bis 1942. Vater Isidor Lewy verstarb 1936. Seine Frau und seine beiden Töchter wurden von den Nazis umgebracht. Vor ihrer Deportation gelang es Tochter Charlotte ihre beiden Söhne Peter und Werner ins Ausland zu bringen. Heute leben beide Söhne in den USA. Simon Lütgemeyer, Bewohner der Käthe-Niederkirchner-Str. 35, recherchierte die Geschichte des Hauses und seiner ehemaligen Bewohner*innen. In Gedenken an die Familie Lewy/Gossels und die jüdischen Familien, die in diesem Haus zwangseinquartiert waren, richtete er eine stille Klingelanlage mit den Namen der 83 jüdischen Nachbar*innen ein.
The building formerly owned and occupied by the Lewy and Gossels family is located at what is now Käthe-Niederkirchner-Str. 35 in Berlin. Family members lived there from 1915 to 1942. Isidor Lewy died in 1936 and his wife and two daughters were murdered by the Nazis. Before being deported, their daughter Charlotte succeeded in getting her two sons, Peter and Werner, out of Germany; today they live in the United States. Simon Lütgemeyer, a resident of Käthe-Niederkirchner-Str. 35, researched the history of both the building and its former residents. In memory of the Lewy and Gossels family and the Jewish families who were forcibly relocated to the building, he set up a silent door buzzer system with the names of 83 Jewish neighbors.

Lars Bahners ist Verwaltungsdirektor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin. Der studierte Jurist arbeitete zuvor über zwanzig Jahre in leitenden Funktionen u.a. in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der Berliner Kulturverwaltung und der Stiftung Deutsches Hygiene Museum in Dresden. Lars Bahners is Managing Director of the Jewish Museum Berlin Foundation. As a lawyer, he previously worked for more than twenty years in management positions at the Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Berlin’s cultural administration and the Stiftung Deutsches Hygiene Museum in Dresden.

Lieber Herr Bahners, Sie sind seit dem 1. Dezember 2022 Verwaltungsdirektor am Jüdischen Museum Berlin. Worauf haben Sie sich vor Beginn Ihrer Tätigkeit am meisten gefreut?
Es war und ist für mich ein großes Privileg, in einem der renommiertesten Jüdischen Museen Europas zu arbeiten. Ich habe mich vor allem auf die Zusammenarbeit mit den vielen neuen Kolleginnen und Kollegen gefreut, von denen einige ja das Haus von Beginn an mitaufgebaut haben. Nach den ersten Monaten im JMB hat sich auch herausgestellt: die Vorfreude war begründet!
Gibt es etwas, das Sie nicht erwartet haben?
Wie schön der Blick aus meinem Bürofenster ist! Wenn man von außen auf den Libeskind-Bau guckt, sieht er eher verschlossen aus. Von meinem Büro im obersten Stockwerk aus habe ich aber einen tollen Blick in die Gegend – damit hatte ich nicht gerechnet.
Sie waren an verschiedenen Museen für die Verwaltung verantwortlich. Wie sieht die Arbeit hinter den Ausstellungen und Programmen aus?
Kultureinrichtungen und Museen speziell sind komplexe soziale Systeme, die vielfältige Aufgaben mit manchmal auch sich widersprechenden Zielsetzungen haben. Sie sind zugleich Sammlungs- und Forschungseinrichtung, Bildungsinstitution, Touristenattraktion, häufig Baudenkmal, Diskursraum sowie
sozialer Ort für Freizeit und Entspannung. Eine Balance zwischen diesen Funktionen und unterschiedlichen Zielen zu bewahren und bei auseinandergehenden Interessen zu vermitteln, das ist auch die Arbeit der Verwaltung.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Eine dauerhafte Herausforderung ist der Umgang mit knappen oder sogar zurückgehenden Ressourcen bei steigender Anforderung an die Leistungsfähigkeit der Museen. Ressourcenmanagement und -schonung stehen also immer mehr im Fokus der Verwaltung. Ein Beispiel: Zur Bewahrung und zum Erhalt von Sammlungsgütern bedarf es der Sicherstellung konkreter konservatorischer Rahmenbedingungen. Diese sind häufig andere als Besucherinnen und Besucher für einen angenehmen und erlebnisreichen Museumsbesuch erwarten. Und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und Energieschonung sind wieder andere Parameter zu berücksichtigen. Die Aufgabe der Verwaltung ist hier, die Ressourcen, die das Haus hat, so zu nutzen, dass alle Funktionen des Museums trotz ihrer Komplexität erfolgreich erfüllt werden.
Zu Ihrem Antritt haben Sie betont, sich dafür einsetzen zu wollen, dass das JMB sich weiterhin durch eine exzellente Verwaltung auszeichnet. Was macht eine solche aus?
Museen sind wachsenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen ausgesetzt. Um
Mr. Bahners, you’ve served as Managing Director of the Jewish Museum Berlin since December 1, 2022. What were you looking forward to the most about your new position?
It’s been a great privilege to work for one of the most renowned Jewish museums in Europe. I was especially looking forward to the work with my many new colleagues, some of whom
complex social systems that perform a variety of tasks with sometimes contradictory goals. At the same time, they’re research and collecting institutions, educational facilities, tourist attractions, architectural monuments, and spaces for discourse, leisure activities, and relaxation. Museum management involves maintaining the proper balance between all these functions and goals and mediating between diverging interests.
have been with the JMB from the start. After my first few months on the job, it turned out that all my expectations were justified!
Is there anything you didn’t anticipate?
The beautiful view from my office window. The Libeskind building looks very closed from the outside, but from my office on the top floor, I have a wonderful view of the surrounding area, which I didn’t expect.
You’ve been responsible for managing several different museums. What’s it like to work behind the scenes of the exhibitions and programs?
Cultural institutions and museums in particular are
Can you give us an example?
One ongoing challenge is how to deal with limited or declining resources at a time when the demands on museum capabilities are growing. That’s why management is increasingly focusing on directing and conserving resources. Yes, let me give you an example: in order to preserve and store objects, we have to ensure proper conservation conditions, which are often quite different from the conditions museum goers expect for a pleasant, entertaining visit. We also need to consider factors relating to sustainability and energy conservation. Here managers must use architectural resources to ensure that all of the museum’s functions
Any kind of innovation requires people who constantly question themselves and their own actions.
ihnen gerecht zu werden, braucht es Innovationen, programmatisch und organisatorisch! Diese gilt es meiner Meinung nach innerhalb des Museums in einer gemeinschaftlichen Verantwortung zu entwickeln. Traditionell unterstützt die Verwaltung die anderen Organisationseinheiten durch die Bereitstellung effektiver und rechtssicherer Strukturen, wie es so schön heißt. Die einzelnen Fachbereiche sind dabei zunächst als rein dienende Funktionen gedacht. Ich glaube aber, dass Verwaltung mehr kann. Sie sollte im Prozess nicht am Ende stehen, sondern schon in die Problemlösung oder Entwicklung von Innovationen mit eingebunden werden; nicht zuletzt, um auf diese Art und Weise besser in die Komplexität und Kontingenz der Organisation verwoben zu sein.
Was braucht es, um innovativ zu sein?
Aus meiner Sicht ist die Voraussetzung für Innovationen jeglicher Art, dass man sich und das eigene Handeln immer wieder hinterfragt. Erst dann kann man eine gemeinschaftliche Haltung für die Aufgaben und Ziele herstellen und dabei neue Formen von Zusammenarbeit und Entscheidungsfin-
dung entwickeln. Mir macht es Freude, nicht nur einen ausbalancierten Finanzplan aufzustellen, sondern über die Art und Weise, über das „Wie“ der Umsetzung und Steuerung nachzudenken. Dabei können die Organisation und die Mitarbeitenden gemeinsam und in geteilter Verantwortung die eben beschriebene Balance herstellen. Dazu die benötigten Strukturen mit auszubauen und die Mitarbeitenden in dieser Hinsicht zu befähigen, inspiriert mich sehr.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung von Arbeit und Methoden an sich?
Vor drei Jahren, als auf einmal der erste Lockdown kam, haben wir uns gefragt, wie wir jetzt überhaupt miteinander in Kontakt bleiben können. Heute liegen analoge, digitale und hybride Termine in meinem Kalender ganz selbstverständlich nebeneinander. Die Arbeits-, Kommunikations- und Kooperationsmethoden haben sich geändert. Wir sind gezwungen worden, relativ schnell digitale Lösungen zu finden. Darüber hinaus haben sich auch unsere sozialen Beziehungen und gesellschaftlichen Strukturen verändert. Um diesen Veränderungen konstruktiv zu begegnen, neue Struk-
are successfully fulfilled despite their complexity.
When you began your work, you emphasized your commitment to continued managerial excellence at the JMB. How would you define that?
Museums face growing social, economic, and political challenges. To meet them, they require program and organizational innovations. In my opinion, these innovations need to be developed collaboratively within the museum. Management traditionally supports organizational units by providing effective, legally compliant structures. The specialized departments are usually thought of as performing purely supportive functions, but I believe management can achieve more than this. It shouldn’t be consulted only at the end of the process. It should be involved in problem-solving and innovating all along in order to be better integrated into the complexity and contingencies of the organization.
who constantly question themselves and their own actions. Only then can you establish a collaborative perspective on tasks and goals and develop new forms of cooperation and decision-making. I enjoy not only drawing up balanced financial plans, but also thinking about how to implement and monitor them. The organization and staff should work together with shared responsibilities to achieve the balance I mentioned earlier. Helping build the necessary structures and empower staff is a great source of inspiration for me.
What role does the digitization of work and work methods play?
Three years ago, when we faced our first lockdown, we wondered how we would be able to stay in touch. Today, I have real-life, virtual, and hybrid meetings listed side by side in my calendar. The methods by which we work, communicate, and collaborate have changed. We’ve been forced to find digital solutions relatively
What does it take to be innovative?
I think that any kind of innovation requires people
quickly. Our social relationships and structures have also changed. In order to confront these changes constructively, establish
wieder hinterfragt.
Three years ago, when we faced our first lockdown, we wondered how we would be able to stay in touch.
turen langfristig zu etablieren und eine umfassende digitale Transformation zu gestalten, sind finanzielle und personelle Ressourcen, eine erweiterte IT-Infrastruktur und Kenntnisse neuer Rechtsgebiete nötig. Für die Verwaltung bedeutet das auch ein Einarbeiten in neue Fachgebiete, was ich mit Neugier und Freude gestalte.
Welche Apps nutzen Sie gerne?
Mir gefallen vor allem Community-basierte Apps. Ein Vorteil der Digitalisierung ist ja auch, dass verschiedenste Daten zusammenfließen, sich sozusagen partizipativ aus dem Nutzerverhalten speisen, und dadurch kontinuierlich optimieren. Ich mag besonders eine App, in der User Wander- und Radtouren einsehen, Ausflüge planen und hochladen können.
Haben Sie bereits einen Lieblingsspaziergang oder eine Fahrradroute in der Umgebung?
Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut wieder regelmäßiger in Kreuzberg zu sein. Ich bin 1998 nach Berlin gekommen und hatte meine erste Wohnung in der Nähe des Viktoriaparks. Kreuzberg und Berlin habe ich damals vor allem auf dem Fahrrad entdeckt. Kurze Zeit später wurde der Libeskind-Bau eröffnet, und mittlerweile ist rund um den Fromet-und-MosesMendelssohn-Platz eine architektonische Lebendigkeit entstanden, die mir sehr gefällt und die ich auch heute noch gerne mit dem Fahrrad erkunde.
Welche Museen ziehen Sie besonders an?
Das Schöne an der Berliner Museumslandschaft ist ja die Vielfalt. Neben den größeren Museen, die Weltrang haben und eine beständige Touristenattraktion sind, habe ich nicht zuletzt aus meiner Tätigkeit in der Berliner Kulturverwaltung heraus vermehrt die kleineren Museen schätzen gelernt. Viele Häuser leisten bei sehr begrenzten Ressourcen eine absolut professionelle, hochwertige Arbeit. Persönlich ziehen mich immer wieder Kulturorte an, die Kunst, Natur und Architektur zusammenbringen. Ich denke da zum Beispiel an das Georg Kolbe Museum oder an das Brücke- Museum.
Was wünschen Sie sich für das Museum der Zukunft?
Ich wünsche mir vor allem, dass Museen gesellschaftlich relevante Orte bleiben! Mein Museum der Zukunft hat weniger Zugangsbarrieren, eine breitere Öffnung hinein in die Bevölkerung und arbeitet mit neuen Formen der Vermittlung und Kommunikation. Außerdem ist es in meiner Vorstellung personell divers aufgestellt, agiert sowohl analog als auch digital, und übernimmt gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
new structures over the long term, and design a comprehensive digital transformation, we need financial and human resources, expanded IT infrastructure, and knowledge of new branches of law. For management teams, this means becoming familiar with new areas of expertise, which I enjoy and approach with great curiosity.
What are your favorite apps?
I particularly like community-based apps. One advantage of the digital transformation is that a wide variety of data comes together, fed by participatory user behavior and constantly optimized. There’s one app I particularly enjoy that allows you to view hiking and biking routes and plan and upload excursions.
Do you have a favorite walk or bike ride in this part of the city?
I was actually very happy to be spending more time in Kreuzberg. I moved to Berlin in 1998 and had my first apartment near the Viktoriapark. Back then, I got to know Kreuzberg and Berlin mainly by bike. The Libeskind building opened a short time later. Today there’s a vibrant new architecture around Fromet-undMoses- Mendelssohn-Platz, which I really like. And I still enjoy exploring the area by bike!
Which museums do you find especially appealing?
The nice thing about Berlin’s museums is their great diversity. In addition to the larger museums, which are world-class institutions and popular tourist attractions, I’ve really come to appreciate the smaller ones, particularly through my work at Berlin’s Department of Cultural Affairs. Many museums do high-quality, professional work despite very limited resources. Personally, I’m always attracted to cultural sites that combine art, nature, and architecture—for example, the Georg Kolbe Museum or the Brücke Museum.
What are your hopes for the museum of the future?
Most of all, I want museums to remain relevant to society! In my opinion, the museum of the future will be more accessible, reach a broader public, and work with new forms of education and communication. I also envision a museum that is diverse in terms of staff, operates virtually and physically, and takes responsibility for all of society.
Das Interview führte / The interview was conducted by Toni Wagner
I want museums to remain relevant to society!
Impressum / Credits
© 2023, Stiftung Jüdisches Museum Berlin
Herausgeberin / Publisher:
Stiftung Jüdisches Museum Berlin
Direktion / Director: Hetty Berg
Redaktion / Editors: Marie Naumann, Katharina Wulffius, Toni Wagner (wiss. Volontariat / Research Trainee)
E-Mail: publikationen@jmberlin.de
Übersetzungen ins Englische / English
Translations: Adam Blauhut (S./pp. 3, 38, 40–55, 65, 72–78), Allison Brown (S./pp. 32–37, 66–71), Kate Sturge (S./pp. 4, 6–15, 30/31, 64), Avraham Yaakouv Finkel, „Sefer Chasidim. The Book Of The Pious,” Northvale, New Jersey: © Jason Aronson Inc., 1997 (S./pp. 58–63)
Übersetzungen ins Deutsche / German
Translations: Sylvia Zirden (S. /pp. 16–29)
Layout: Eggers + Diaper, Aachen
Druck /Printed by: Druckhaus Sportflieger, Berlin
ISSN: 2195-7002
Gefördert durch / Sponsored by
Stiftung Jüdisches Museum Berlin
Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25993 300 www.jmberlin.de info@jmberlin.de


Falls Rechte (auch) bei anderen liegen sollten, werden die Inhaber*innen gebeten, sich zu melden. / Should rights (also) lie with others, please inform the publisher.
Wir danken allen Autor*innen und Mitwirkenden! / With many thanks to all authors and staff!
Titel / Cover:
Blick auf die Bebauung zwischen Lindenstraße und Mehringplatz / View of the development between Lindenstrasse and Mehringplatz
Motiv: ullstein bild – imageBROKER/ Schoening Berlin
Gestaltung: Birgit Eggers, Eggers + Diaper, Aachen
Bildnachweis / Copyright
S./p. 4: Rückseite des Porträts Arnold Schönberg von Max Oppenheimer/Back of the portrait Arnold Schönberg by Max Oppenheimer, 1909, JMB, photo: Jens Ziehe
S./pp. 3, 74/75: JMB, photos: Yves Sucksdorff
S./pp. 5 oben/top, 7–15: JMB, photos: Stephan Pramme
S./p. 18: Schedelsche Weltchronik: CC BY-NC-SA 4.0
S./p. 21: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Cod. hebr. 37, fol.27v, https://katalogplus.sub.uni-hamburg. de/vufind/Record/846939428, CC BY 4.0
S./p. 25: Pontoise, Musée Tavet-Delacour
S./p. 30: © YidLife Crisis
S./p. 31 links oben/top left: photo: Dafna Gazit; rechts/right: photo: Alice End
S./pp. 5 2. von oben/second from top, 32: JMB, Schenkung der Familie Salinger / gift of the Salinger familiy
S./p. 34: Mit freundlicher Genehmigung von / with friendly permission of Lynda Salinger & Bonhams Auctioneers
S./p. 35: JMB, Schenkung der Familie Salinger / gift of the Salinger family
S./p. 36 links unten/bottom left: JMB, Schenkung von Irene Salinger / gift of Irene Salinger; rechts/right: JMB, photo: Roman März; Schenkung von David Friedman / gift of David Friedman
S./p. 38: JMB, photo: Mathias Brauner, Berlin, 1987

S./p. 39 links unten/bottom left: JMB, photo: Roman März; Schenkung Peter Schaul /
gift of Peter Schaul; rechts/right: JMB, photo: Roman März
S./p. 41: Kartenausschnitt Berliner Kiezplan, Edition Gauglitz
S./p. 43: JMB, photo: Roman März
S./p. 44: ullstein bild – imageBROKER/ Schoening Berlin

S./pp. 5 2. von unten/second from bottom, 49: © Peter von Felbert
S./pp. 5 unten/bottom, 52, 56: JMB, photos: Jule Roehr
S./p. 54: JMB, photo: Nadja Rentzsch
S./pp. 55, 57 oben recht/top right: JMB, photos: Svea Pietschmann
S./p. 57 unten/bottom: JMB
S./pp. 58–63: Illustrationen/illustrations: buchstabenschubser (Ellen Stein, Yeni Harkányi, Jan Gabbert), Jüdisches Museum Berlin, 2020
S./p. 64: Maya Schweizer, Sans histoire, 2023, Video still; © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
S./p. 65: © Loan of Charities Aid Foundation America, thanks to the generous support of the family of Curt Bloch
S. 66: privat
S./pp. 68/69: JMB, photos: Roman März
S./p. 70: Landesarchiv Berlin, F Rep. 290
Nr. II3343 / photo: Waldemar Titzenthaler
S./p. 71: bpk
S./p. 72: © Jüdisches Museum Frankfurt, Rechte vorbehalten/rights reserved
S./p. 73 unten/bottom: MARCHIVUM, Bildsammlung, Bild-Signatur: KF037458, Foto: o.A., Rechte vorbehalten/rights reserved
S./p. 73 oben rechts/top right: photo: Nancy Gossels, CC BY-SA 4.0


