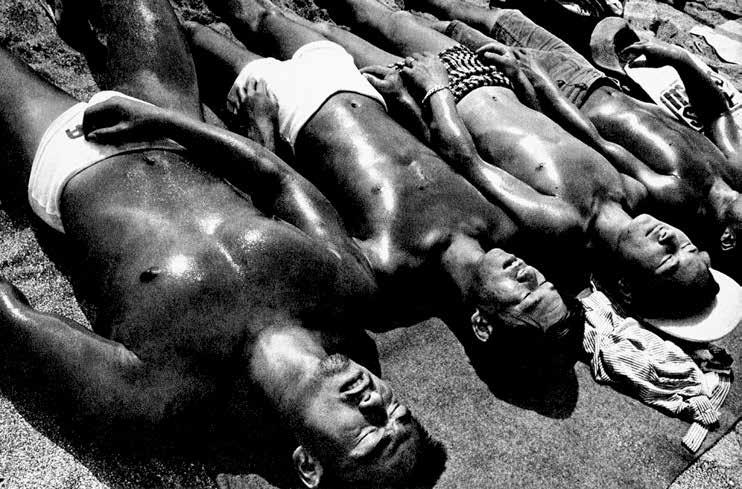2 minute read
Auswüchse des Begehrens
from MJ23_3
Die biomorphen Skulpturen und Installationen von EVA FÀBREGAS führen ein Eigenleben
Die Ausstellung im Hamburger Bahnhof befasst sich mit Fragen der Intimität, des Begehrens und der Zugänglichkeit. Die Installation aus den charakteristischen weichen, biomorphen Skulpturen geht eine enge Verflechtung mit der industriellen Architektur ein. Sie wächst aus den Seitengängen an den skelettartigen Stahlträgern hoch, umschlingt die Bögen und haucht der Halle eigenes Leben ein. Die nach dem Metall greifenden Tentakel vibrieren zudem zart, und es ist nicht ganz klar, ob sie Auswüchse eines gemeinsamen Körpers sind oder ein sich aggressiv ausbreitendes Eigenleben führen. Sie spielen auf biologische Prozesse und Rhythmen an, die mit Verdauung, Inkubation und Metamorphose, aber auch mit geschwürartigem Wachstum verbunden sind. Die hellen, vibrierenden Divertikel an den Säulen scheinen diesen Metabolismus aufzunehmen, einen eigenen hinzuzufügen und zu atmen. Aber sie durchschneiden den Ausstellungsraum auch und erzeugen den Eindruck einer barocken, in die Tiefe gestaffelten Bühne.
In den Skulpturen Fàbregas’ wird Luft zu einem greifbaren Material, indem sie Volumen und Formen schafft, die die Wahrnehmung von uns selbst und von Raum verändern. Die Materialien und Bewegungen bleiben dabei jedoch künstlich wie prothetische Hilfsmittel, die das Leben erleichtern oder gar ermöglichen. Diese Körpererweiterungen fordern Vorstellungen von anderen möglichen Körpern, von unerwarteten Formen des Begehrens und der Affekte heraus.
Ab Anfang Juli ist in der historischen Haupthalle des Hamburger Bahnhofs die bislang größte Einzelausstellung der Künstlerin Eva Fàbregas zu sehen. Ihre monumentale, ortsspezifische Installation erweitert die Grenzen des Skulpturalen und lädt das Publikum zu einem sinnlichen Raumerlebnis ein: Organisch anmutende Objekte verwandeln die von mächtigen industriellen Stahlträgern geprägte Bahnhofsarchitektur in einen scheinbar gewachsenen Raum. Die Installation erweckt die Vorstellung, ein großer, lebender Organismus zu sein, der einer eigenen libidinösen Logik folgt – eine kreatürliche »Maschine des Begehrens« (Gille Deleuze) mit womöglich unkontrollierbarem Wachstum.
Eva Fàbregas, geboren 1988, studierte bildende Kunst in ihrem Geburtsort Barcelona sowie in London, wo sie auch lebt. Mit ihren objektbasierten Werken, großformatigen Installationen, Zeichnungen und Soundarbeiten thematisiert sie Mechanismen des Verlangens und die Erotik von Dingen. Ihr Interesse an Affekten und die Analyse von Gefühlen setzt sie in Kunstwerken um, die sich mit Wellness und Entspannungskultur, Psychodramen und therapeutischen Methoden in den sozialen Medien sowie mit der sich dazu entwickelnden Marketingindustrie auseinandersetzen.

Fàbregas’ Objekte und Installationen, die aus dehnbaren, oft aufblasbaren Materialien bestehen, erinnern an organische Kreaturen, Knollen, Schläuche und Membranen. Durch die Verbindung von weichen, hautähnlichen Materialien, hellen Farben und biomorphen Formen, von raumbezogenen Installationen und Akustik erzeugt Eva Fàbregas synästhetische Effekte. Ihre Skulpturen rühren an, lösen den Wunsch nach Berührung aus und befremden doch gleichzeitig; die Wirkung der Objekte ist ambivalent – nährend oder parasitär, friedlich oder bedrohlich, unschuldig oder pervers. Der Moment der Überraschung und Unsicherheit, der sich beim Aufeinandertreffen von scheinbar Bekanntem und zunächst Unerklärlichem oder gar Bedrohlichem einstellt, interessiert die Künstlerin: Mit ihrer Kunst hinterfragt sie das Denken in gewohnten Gegensätzen wie natürlich – künstlich, belebt – unbelebt oder menschlichnicht menschlich. Die Werke vermitteln, wie Morphologie und taktile Beschaffenheit von Materialien die Gestaltung von Emotionen, Wirkungen und Wünschen beeinflussen.
Textur, Form, Farbe, Maßstab, die in stetem Wandel begriffenen, scheinbar lebendigen Skulpturen und die so erzeugte Sinnlichkeit der Installation im Hamburger Bahnhof verführen das Publikum zu einem Denken durch Berührung und sensorische Interaktion. Die Skulpturen fordern dazu auf, ihre Nähe zu suchen, unseren Atem mit dem ihren zu synchronisieren, ihre Haut als Verlängerung unserer eigenen zu empfinden, in einem Akt des Miteinanders, der ebenso schön wie seltsam ist. Sie laden dazu ein, eine somatische Beziehung zur Kunst herzustellen, Gemeinschaften zu bilden und die Vorstellungskraft zu nutzen, um das andere zuzulassen.