


















































Die vergangenen vier Jahre waren von der immer größer werdenden Hilflosigkeit meines pflegebedürftigen Vaters geprägt. Auf der einen Seite war es eine große Herausforderung für uns, immer die richtigen Stellen und Ansprechpartner zu finden. Andererseits waren es die vielen positiven Begegnungen mit Pflegekräften, die dazu geführt haben, mich intensiv mit dieser Berufsgruppe auseinanderzusetzen. Von mobilen Pflegerinnen über jene in den Spitälern bis hin zu den Pflegekräften in der Kurzzeitpflege und schließlich im Altenheim – sie alle waren nicht nur für meinen Papa, sondern auch für uns Angehörige da. Sie hatten immer ein offenes Ohr, haben uns kompetent, humorvoll und auch mitfühlend begleitet. Bis zu Papas Sterben im Spital waren sie an unserer Seite. Und ich gebe Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer recht, wenn er sagt, dass Pflegerinnen und Pfleger in der Öffentlichkeit dasselbe Ansehen wie Ärzten oder App-Programmierern zusteht.
Chefredakteurin
OBERÖSTERREICHERIN

der Öffentlichkeit und in den Medien oft schlecht gemacht. Wenn ich nicht in der Pflege arbeiten würde, würde ich mich bei manchen Beiträgen fragen, wer diesen Beruf freiwillig macht.“ Und genau dieses Bild vom Pflegeberuf wollten wir mit unserem Themenschwerpunkt in der OBERÖSTERREICHERIN und mit dieser Sonderausgabe widerlegen. Ich denke, das ist uns gelungen.
Meine eigenen Erfahrungen waren mitunter auch ausschlaggebend, uns in der OBERÖSTERREICHERIN vier Monate lang mit dem Thema Pflege zu beschäftigen – und zwar im positiven Sinn. Neben vielen Berichten über den Beruf und den damit einhergehenden Karrieremöglichkeiten haben wir mittels Nominierung und Onlinevoting aufgerufen, die Pflegerin und den Pfleger des Jahres zu suchen, und wir sind noch immer von der großen Teilnahme berührt.
Ein Satz ist mir bei all den vielen Interviews, Reportagen und Begegnungen besonders hängen geblieben. Philipp Verhofnik, unser Pfleger des Jahres, hat im Coverinterview gesagt: „Leider wird unser Beruf in
Danke an alle, die uns dabei unterstützt haben, an alle Pflegerinnen und Pfleger, die uns ihr Vertrauen geschenkt und offen mit uns geredet haben, an Familie Winzer, die den zwölf Erstplatzierten in ihrem tollen Wellnesshotel in St. Georgen im Attergau eine Auszeit ermöglicht, an unser sensationelles Team und an Stefan Kastner vom Eventlokal „DasSee“ in Feldkirchen an der Donau, wo wir am 13. Juni mit Pflegekräften, Lehrenden und allen Beteiligten ein cooles Fest für die Pflege gefeiert haben. Mit DJ, Drinks und allem, was dazugehört. Nach dem Motto: Das Leben sollte nicht nur gelebt, sondern vor allem gefeiert werden!
8 COVERSTORY
Im Talk mit Marlene Rohrauer und Philipp Verhofnik, „Pflegerin und Pfleger des Jahres“
16 TOP 10 DER PFLEGE
Wir präsentieren auf vier Seiten die Top Ten des Onlinevotings zur Wahl „Die Pflegerin und der Pfleger des Jahres“
20 GROSSES HERZ
Ordensschwester Immaculata ist mit 84 Jahren noch immer für ihre Dialyse-Patienten im Einsatz
26 GEMEINSAM STARK
Gesundheitslandesrätin LH.Stv. Christine Haberlander und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer über die Zukunft der Pflege in Oberösterreich
40 TRAUMJOB IM OP
Emely Osterkorn über ihre Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin
71 NETZWERK DEMENZ
Wo Betro ene und Angehörige in Oberösterreich Informationen und Unterstützung finden
82 LESENSWERT
Buchtipps zum Thema Pflege und Betreuung
Sonderbeilage im Magazin „OBERÖSTERREICHERIN”
Die Informationen zur Offenlegung gemäß § 25 MedienG können unter der URL http://www.dieoberoesterreicherin.at /de/impressum/651.html abgerufen werden.
HERAUSGEBER: Josef Rumer
MEDIENINHABER UND HERSTELLER: Neu-Media GmbH Bahnhofplatz 2, 4600 Wels
E-Mail: o ce@neu-media.at Tel.: 07242/9396 8100
Fax: 07242/9396 8110


GESCHÄFTSFÜHRUNG: Josef Rumer, Mag. Andreas Eisendle
PROKURISTIN: Astrid Gruber
ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG: Kerstin Artmayr
BÜROORGANISATION: Slavica Haminger
LEHRLING: Anna Eder
REDAKTIONSLEITUNG: Mag. Ulli Wright, E-Mail: redaktion@neu-media.at
REDAKTION: Nicole Madlmayr, Laura Zapletal BA, Mag. Petra Kinzl
LEKTORAT: Mag. Christa Schneider
ANZEIGENLEITUNG: Josef Rumer, E-Mail: anzeigen@neu-media.at



COVER : Philipp Verhofnik & Marlene Rohrauer
FOTO : Alexandra Parraghy/aundas


ANZEIGEN: Mag. Dietlinde Wegerer, Basim Nabi, Lisa Becker, Ing. Mag. Richard Haidinger, Victoria Felice
GRAFIK: Karin Rosenberger, Ana Mrvelj, Thom Trauner, E-Mail: grafik@neu-media.at
FOTOS: Thom Trauner, Shutterstock, beigestellt, Alexandra Parraghy/aundas
VERLAGS- UND HERSTELLUNGSORT: Bahnhofplatz 2, 4600 Wels
DRUCK: Druckerei Berger, A-3580 Horn
VERTRIEB: PGV Austria Trunk GmbH, 5412 Puch/Salzburg www.neu-media.at

Unsere exklusiven Villas sind Chalet, Boutique Lodge und Private Spa in einem und nur fünf Gehminuten vom Hotel Winzer entfernt. Sie sind luxuriös ausgestattet und bieten auf zwei Etagen und ca. 100 m² Wohnfläche alles, was die Zeit zu zweit besonders macht: Sauna, Outdoor Whirlpool, frei stehende Badewanne, offener Kamin, moderne Küche, Outdoor Grill und ein kuscheliges Rundbett.



Echtholzböden, die hochwertige Möblierung und die bestens befüllte Weinbar (unsere Interpretation einer luxuriösen Minibar) machen den Wohnraum zum Wohntraum. Hier bleibt der Alltag bestimmt draußen und drinnen lässt es sich fürstlich entspannen.

Attersee - Mondsee - Irrsee - Fuschlsee - Hallstättersee - Traunsee - Wolfgangsee



Großzügiges Bad




www.facebook.com/oberoesterreicherin





1 ganzes Jahr OBERÖSTERREICHERIN um nur € 29,50 lesen + 1 STRANDTUCH von LeSto mit unserem Logo









10 x die Oberösterreicherin um € 29,50 (Inland), (Ausland: € 42,-) plus ein Strandtuch von LeSto mit unserem Logo gratis dazu! (Das Strandtuch gibt es nur solange der Vorrat reicht)


IHR HABT DER PFLEGE EURE STIMME GEGEBEN. Marlene Rohrauer (28) und Philipp Verhofnik (37) freuen sich riesig über ihr gutes Ergebnis beim Voting und wie sie betonen, stellvertretend für alle Pflegekräfte des Landes, aufs Cover unserer „Sonderausgabe Pflege“ zu kommen.
Unter dem Titel „Gebt der Pflege eure Stimme!“ haben wir in den vergangenen Monaten „Die Pflegerin und der Pfleger des Jahres 2024“ gesucht und dank der zahlreichen Nominierungen auch gefunden.
REDAKTION: Ulli Wright | FOTOS: Alexandra Parraghy/aundas
In den vergangenen Monaten haben wir „Die Pflegerin und der Pfleger des Jahres 2024“ gesucht und waren von den vielen Zusendungen überwältigt. Rund 500 Menschen haben ihre Pflegerin, ihren Pfleger des Herzens nominiert. 22 davon schafften es mit ihren berührenden Geschichten ins Onlinevoting, wobei fast 19.000 Stimmen entschieden haben, wer es aufs Cover unserer „Sonderausgabe Pflege“ schafft.
Pflegekräfte am Cover Bei den weiblichen Pflegekräften erhielt Marlene Rohrauer die meisten Stimmen. Die diplomierte Krankenschwester hat durch Reanimation das Leben eines Babys gerettet und wurde von dessen Eltern nominiert. Die 28-Jährige arbeitet
im Team der Kinder- und Jugendchirurgie des Kepler Universitätsklinikum, Med Campus IV und wohnt in Gallneukirchen.
Bei den männlichen Pflegekräften bekam Philipp Verhofnik (37) die meisten Stimmen. Der Fachsozialbetreuer im Bereich Altenarbeit ist seit 15 Jahren im Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim bei Wels tätig und leitet dort eine eigene Station. Er ist Vater einer kleinen Tochter und ein absoluter Familienmensch. Beim Covershooting in Linz betonten beide, dass sie sich riesig freuen – „stellvertretend für alle Pflegekräfte des Landes“ – aufs Cover unserer „Sonderausgabe Pflege“ zu kommen.
„Ich liebe meinen Job auf der Kinderchirurgie“, schwärmt Marlene Rohrauer bei unserem Covershooting über ihren Beruf als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendlichenpflege am Kepler Universitätsklinikum. Ihrem beherzten Eingreifen ist es zu verdanken, dass die kleine Mara nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand noch am Leben ist.
Marlene, was hat Sie dazu bewogen, eine Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendlichenpflege zu machen?
Das Medizinische hat mich seit jeher fasziniert und auch Kinder haben mich immer schon interessiert. Lange Zeit hatte ich sogar vor, Lehrerin zu werden. Mit 18 Jahren war ich dann in den Sommerferien zwei Monate lang in Frankreich als Au-pair-Mädchen tätig und während dieser Zeit ist der Gedanke gereift, Kinderkrankenschwester zu werden.
Wann haben Sie mit der Ausbildung begonnen?
Direkt nach der Matura im Jahr 2015 habe ich mich bei der damaligen Landes-Frauenund Kinderklinik (Anm. d. Red.: heutiges Kepler Universitätsklinikum) für das Kinderdiplom beworben und bin auf Anhieb aufgenommen worden. Damals war es gar nicht so einfach, einen Platz zu bekommen, da von 250 Bewerbern nur 25 aufgenommen wurden. Noch im Zuge der dreieinhalbjährigen Ausbildung habe ich zusätzlich das Studium Pflegewissenschaften absolviert und direkt im Anschluss daran, auf der Kinder- und Jugendchirurgie am Med Campus IV im Kepler Uniklinikum zu arbeiten begonnen.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job in der Kinderchirurgie?

STRAHLEND.
Marlene Rohrauer beim Covershooting in Linz. Das Shirt, das sie auf der Station der Kinder- und Jugendchirurgie trägt, wurde übrigens von einer Kollegin gefertigt.
Besonders gefällt mir, dass er so abwechslungsreich ist. Auf unserer Station werden Patientinnen und Patienten im Alter von 0 bis 18 Jahren betreut. Das beginnt zum Beispiel bei ganz kleinen Babys mit Fehlstellungen, die operativ behandelt werden, und geht bis hin zu den 18-jährigen Burschen und Mädchen. Die kleinen und jungen Patientinnen und Patienten werden bei uns auf der Station unfallchirurgisch, neurochirurgisch oder im Bereich der Viszeralchirurgie behandelt.
Was fällt in Ihr Aufgabengebiet?
Die prä- und postoperative Versorgung der Kinder und Jugendlichen, das heißt, wir bereiten sie auf die Operationen vor und versorgen sie danach mit Schmerzmitteln, Antibiotika und so weiter. Die Kinder dürfen bis zum 12. Lebensjahr von den Eltern begleitet werden und so gilt es, quasi zwei Personen zu betreuen, was es auch sehr interessant macht.
Sie wurden von den Eltern jenes Babys nominiert, dessen Leben Sie gerettet haben. Kommt das oft vor?
Nein, grundsätzlich nicht, aber im vorigen Sommer hatten wir fünf Herzalarme in vier Wochen. Im August, als ich Mara nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand reanimiert habe, hatte ich mit einer Kollegin Nachtdienst, die schon rund 30 Jahre lang auf der Station arbeitet, aber noch nie einen Herzalarm hatte. Daran sieht man, dass das selten bis kaum vorkommt.

In ihrer Freizeit macht Marlene fünfmal die Woche Yoga und ist gerne mit Freundinnen und Freunden unterwegs.
Wie ist es Ihnen bei diesem Notfall ergangen?
Während der Reanimation war ich nur im Tun. Man macht einfach und kommt gar nicht viel zum Nachdenken. Erst als die Anspannung abgefallen ist, habe ich realisiert, was da gerade passiert ist. Das war schon ziemlich heftig und ich konnte nach dem Nachtdienst kein Auge zu tun. Vieles ist mir durch den Kopf gegangen und ich war einfach nur glücklich, dass alles gut ausgegangen ist.
Empathisch sein und sich abgrenzen können – wie schaffen Sie hier den Spagat?
Freundschaft entstanden. Maras Mama Annika ist so alt wie ich und wir waren von Anfang an auf derselben Wellenlänge. So ein Ereignis, wie die Lebensrettung, verbindet dann natürlich noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise.
Könnten Sie sich vorstellen, auch auf einer anderen Station im Spital zu arbeiten?
Während der Reanimation war ich nur im Tun. Erst als die Anspannung abgefallen ist, habe ich realisiert, was passiert ist.
Also ganz abgrenzen kann ich mich nicht immer, weil mich gewisse Dinge einfach beschäftigen. Man baut zu den Kindern und auch zu den Eltern eine Bindung auf, vor allem, wenn sie für längere Zeit auf der Station sind. Hier muss man aufpassen, dass es nicht zu intensiv wird. Grundsätzlich schaffe ich es aber recht gut, daheim abzuschalten. Wobei mich die Reanimation der kleinen Mara schon länger beschäftigt hat.
Mit den Eltern von Mara sind Sie noch immer in Kontakt ... Ja, zwischen der Mama und mir ist eine
Nein, ich kann mir nichts anderes vorstellen, auch nicht in einem Büro oder als Lehrerin tätig zu sein. Ich liebe meinen Job auf der Kinderchirurgie. Man bekommt so viel zurück von den Kindern und auch von den Eltern, die unsere Arbeit schätzen, weil sie merken, dass wir unseren Beruf mit Leidenschaft machen und das Beste geben. Klar sind nicht alle Tage lustig und es gibt immer wieder Ausnahmesituationen. Aber wenn ich von meinen Patientinnen und Patienten eine Zeichnung oder Basteleien sowie persönliche Dankeskarten bekomme, dann geht mir das Herz auf, das ist sehr wertschätzend.
Welche Fähigkeiten braucht man in Ihrem Job?
Man sollte empathisch, teamfähig, be-
lastbar und multitaskingfähig sein. Ganz wichtig ist auch, dass man Prioritäten setzen kann. Wenn viel los ist, muss man wissen, wo man beginnt und was im Moment das Wichtigste ist. Es ein extrem cooler Job, der oft unterschätzt wird. Man muss viel können und auch fachlich viel wissen.
Was machen Sie in der Freizeit, wobei können Sie vom Job runterkommen?
Ich mache fünfmal die Woche Yoga, zudem gehe ich ins Ballett und mache „Barre“, das ist eine Mischung aus Pilates und den Grundübungen von Ballett. Außerdem zeichne ich unheimlich gerne. Kreativ zu sein, ist generell ein guter Ausgleich für mich, und ich bin auch gerne mit Freundinnen und Freunden unterwegs.
Wo sehen Sie sich beruflich in der Zukunft?
Genau da, wo ich bin. Es ist mein Traumjob und für mich mehr Beru-
fung als Beruf. Wenn Menschen überlegen, in diesen Beruf zu gehen, dann rate ich ihnen, einfach einmal zum Schnuppern zu kommen. Ich habe in der Kinderchirurgie geschnuppert, bevor ich mich für die Ausbildung angemeldet habe. Jetzt arbeite ich da, wo alles begonnen hat.

Es ist ein extrem cooler Job, der oft unterschätzt wird.
Man muss viel können und auch fachlich viel wissen.
Mit folgenden Zeilen wurde Marlene Rohrauer von den Eltern der kleinen Mara nominiert, deren Leben sie gerettet hat (Foto): „Marlene hat nicht nur unserem Baby das Leben gerettet (Reanimation bei Herz-Kreislauf-Stillstand), sie ist auch die liebevollste, lustigste und herzlichste Pflegekraft, die es gibt! Nicht nur für ihre kleinen Patientinnen und Patienten hat sie ein großes Herz, sie kümmert sich auch liebevoll um Eltern und Angehörige. Egal wie stressig der Pflegealltag ist, sie hat immer ein Lächeln und/oder Späßchen übrig.“

Beim Covershooting in Linz bewiesen Marlene und Philipp absolute Modelqualitäten.
Durch den Zivildienst in einem Altenheim kam Philipp Verhofnik (37) zur Pflege. Mittlerweile ist der Fachsozialbetreuer/Altenarbeit seit 15 Jahren im Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim bei Wels tätig, wo er seit einem Jahr auch eine Wohngruppenleitung überhat.
Philipp, Sie arbeiten seit 15 Jahren im Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim bei Wels als Fachsozialbetreuer/Altenarbeit. Was hat Sie dazu bewogen, in diesen Beruf zu gehen?
Eigentlich bin ich gelernter Stahlbautechniker. Dann kam der Zivildienst und meine Mama, die ebenfalls im Pflegebereich tätig war, hat mich dazu motiviert, diesen in einem Altenheim zu machen. Und so habe ich als Zivildiener im Altenheim in Ried im Traunkreis zu arbeiten begonnen. Um die Zeit bis zum Beginn der Ausbildung zu überbrücken, habe ich den Zivildienst verlängert.
Mittlerweile haben Sie im Bezirksaltenund Pflegeheim Thalheim eine Wohngruppenleitung über. Wie darf man sich Ihre Tätigkeit als Wohngruppenleiter vorstellen? Mein Team besteht aus 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir betreuen aktuell 26 Bewohnerinnen und Bewohner. Neben den pflegerischen Aufgaben bin ich vor allem für das Organisatorische zuständig. Das beginnt beim Einteilen der Dienstpläne und reicht bis hin zu den Mitarbeitergesprächen. Für die medizinischen Belange, wie Medikamente und Injektionen verabreichen, Blut abnehmen, Infusionen oder Katheter setzen, sind unsere Diplomierten Fachkräfte verantwortlich.

Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit dem Team wichtig?
LIEBT SEINEN BERUF. Durch den Zivildienst in einem Altenheim ist Philipp Verhofnik zum Pflegeberuf gekommen und übt diesen seit mehr als 15 Jahren mit großer Leidenschaft aus.
Mir ist es wichtig, dass jede Kollegin und jeder Kollege auf der Station im Großen und Ganzen zufrieden ist. Daher bemühe ich mich zum Beispiel bei der Einteilung der Dienstpläne, dass es für alle gut passt.
Was gefällt Ihnen an der Arbeit mit älteren Menschen, die ja meistens ihren letzten Lebensabschnitt bei Ihnen im Heim verbringen?
Ich sehe es als Ehre, dass ich alte Menschen bis an ihr Lebensende begleiten darf. Für den letzten Weg nehmen wir uns wirklich extrem viel Zeit, auch bei der Begleitung der Angehörigen. In dieser Phase ist es uns ganz wichtig, für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu 100 Prozent da zu sein.
Sie sind oftmals mit Sterbenden konfrontiert. Wie stehen Sie selbst zum Tod?
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Bei uns im Heim ist der Tod für die meisten Menschen eine Erlösung. Ich weiß nicht, wie viele Bewohnerinnen und Bewohner ich schon auf ihrem letzten Weg begleitet habe, aber ich habe noch kein ängstliches oder panisches Gesicht gesehen. Ganz im Gegenteil, die meisten Menschen schauen recht zufrieden und glücklich aus, nachdem sie „eingeschlafen“ sind.
Empathisch sein und sich abgrenzen können – wie gelingt Ihnen der Spagat?
Natürlich gibt es traurige Situationen, und wenn Bewohnerinnen oder Bewohner lange Zeit bei uns waren, dann fehlen sie uns. Das ist normal, denke ich. Aber für uns geht der Alltag weiter und wir müssen wieder für die anderen Menschen da sein.

Was braucht es, um einen Beruf in der Pflege zu machen?
Man sollte gut zuhören können, braucht Einfühlungsvermögen und natürlich auch Humor. Es ist wichtig, sich nicht alles zu sehr zu Herzen zu nehmen und auch Spaß zu haben. Wir haben bei uns im Heim Mitarbeiterinnen, die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern basteln oder spazierengehen. Wir bieten jeden Tag Programm, das kommt sehr gut an. Zudem muss man zeitlich flexibel sein, weil Pflege kein Nine-to-five-Job ist und es Wochenenddienste gibt. Das bringt aber auch viele Vorteile, weil man Hobbys wie Skifahren, Badengehen, Einkaufen und so weiter an den freien Tagen auch unter der Woche machen kann und nicht dann, wenn alle unterwegs sind.
Mit Ihrer Zeit als Zivildiener sind Sie schon gut 17 Jahre in der Pflege tätig. Was hat sich seit Ihren Anfängen geändert?
Philipp Verhofnik mit seiner Freundin Elena Wiesmüller, einer Pflegeassistentin, sowie Töchterchen Frida, die im Oktober zwei Jahre alt wird.
Ich sehe es als Ehre, dass ich alte Menschen bis an ihr Lebensende begleiten darf.
Das Klientel hat sich geändert. Heute gibt es viel mehr Bewohnerinnen und Bewohner mit psychischen und demenziellen Erkrankungen. Das bedarf auch einer ganz anderen Art der Pflege. Wenn man zwei oder drei Menschen mit Demenz oder einer psychischen Erkrankung auf einer Station zu betreuen hat, ist es für uns, aber auch für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner herausfordernd.
Wie ist es Ihnen im Heim während der Coronakrise ergangen, wo man ja sehr viel über den Pflegeberuf gelesen und gehört hat?
Diese Zeit war schlimm – vor allem, weil die Bewohnerinnen und Bewohner keinen Besuch von ihren Angehörigen empfangen durften. Zu Beginn hat uns die Ungewissheit sehr stark beschäftigt, und natürlich mussten wir mit voller Schutzkleidung arbeiten, was sehr anstrengend war.
Sie sind Vater einer kleinen Tochter. Wie können Sie Ihren Job mit der Familie vereinbaren?
Meine Tochter wird im Oktober zwei Jahre alt und auch meine Freundin ist in der Pflege tätig. Wir haben uns während der Ausbildung im Krankenhaus kennengelernt und sind bereits seit 15 Jahren in einer Beziehung. Den Job kann ich sehr gut mit der Familie vereinbaren, da wir die Dienste im Vorfeld planen können. Meine Freundin wird nach der Karenz wieder im Krankenhaus arbeiten, wo sie sehr flexibel ein Arbeitszeitmodell wählen kann. Das ist schon optimal.
Haben Sie den Schritt, in die Pflege zu gehen, je bereut?
Nein, überhaupt nicht. Leider finde ich, dass der Beruf in der Öffentlichkeit und in den Medien oft schlecht gemacht
wird. Wenn ich nicht in der Pflege arbeiten würde, würde ich mich bei manchen Beiträgen fragen, wer diesen Beruf freiwillig macht. Natürlich gibt es auch negative Seiten, aber wo gibt es die nicht? Für mich ist mein Beruf wunderschön, man bekommt so viel zurück. Es kommt schon mal vor, dass mich Angehörige auf der Straße anreden oder umarmen, weil ich bei der Begleitung ihrer Lieben bis zum Schluss dabei war. Da spüre ich eine große Dankbarkeit.
Warum würden Sie jemandem empfehlen, in die Pflege zu gehen?
Ich sehe bei vielen Bekannten und Freunden, die in der Privatwirtschaft arbeiten, dass sie zum Beispiel nach ihrem Urlaub einen großen Stapel an Arbeit aufarbeiten müssen. Das fällt bei uns weg, da wir quasi jeden Tag wieder bei null anfangen. Außerdem ist man wegen der Dienstplangestaltung flexibel und der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Durch den Zusammenhalt im Team muss man Herausforderungen nicht alleine bewältigen, sondern bekommt Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen.
Wenn Sie sich etwas wünschen könnten für Ihren Beruf, was wäre das?
Ich glaube, dass die Politik in manchen Bereichen umdenken und alte Glau-
benssätze aufbrechen muss. Die Belastungsgrenze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Gesundheitszustand unserer Bewohnerinnen und Bewohner brauchen neue Antworten. In unserem komplexen Alltag ist es allerhöchste Zeit, berufsgruppenübergreifend neue Wege zu gehen. Gemeinsames Tun statt Worte bedeutet Ergebnisse.
Wie viele männliche Pfleger arbeiten im Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim?
Wir sind insgesamt sechs Männer.
Wie gehen die älteren Bewohnerinnen und Bewohner mit Ihren Tattoos um?
Sehr gut, so hat man direkt ein Gesprächsthema (lacht), außerdem schauen sie ohnehin mehr auf den Charakter.
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Bevor meine Tochter zur Welt kam, ging ich sehr viel laufen und habe sporttechnisch einiges ausprobiert. Jetzt ist es mir wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir sind viel unterwegs und reisen gerne. Wir waren mit Frida schon auf Ibiza, sie ist sehr brav und natürlich überall dabei.

Mit folgenden Zeilen wurde Philipp Verhofnik von einer Kollegin nominiert: „Unser Wohngruppenleiter Philipp ist sich für nichts zu schade und packt überall an, egal ob im Haushalt oder in der Pflege. Dieser Mann ist immer gut gelaunt für uns und unsere Bewohnerinnen und Bewohner da. Er ist humorvoll, sehr empathisch und liebt seinen Job von Herzen. Vor eineinhalb Jahren wurde Philipp Vater und wir gönnen ihm von Herzen ein schönes Wochenende mit seiner Freundin im Hotel Winzer.“

BEHIND THE SCENES. Philipp Verhofnik, Fotografin Alexandra Parraghy, Chefredakteurin Ulli Wright und Marlene Rohrauer genossen das Covershooting und hatten viel Spaß.
Sie haben nominiert, gevotet und entschieden: Wir dürfen Ihnen auf den nächsten drei Seiten die
Top Ten unseres Onlinevotings zur Wahl „Die Pflegerin und der Pfleger des Jahres 2024“ vorstellen. Sie konnten sich gegen ihre Mitbewerber durchsetzen und dürfen sich über eine wohlverdiente Auszeit im Wellnesshotel Winzer in St. Georgen im Attergau freuen.
REDAKTION : Laura Zapletal | FOTOS: beigestellt
Nachdem die strahlenden Gewinner unseres Onlinevotings, Marlene Rohrauer und Philipp Verhofnik, vorgestellt wurden, dürfen sich auf den folgenden Seiten zehn weitere Pflegekräfte über ein fulminantes Voting-Ergebnis freuen. Sie schafften es mit ihren Stimmen in die Top Ten und werden mit einer wohlverdienten Auszeit im Wellnesshotel Winzer in St. Georgen im Attergau verwöhnt. Doch wer sind die zehn Finalistinnen und Finalisten? In welchen Bereichen arbeiten sie und was treibt sie an? Auf den nächsten Seiten verraten wir es Ihnen. In diesem Sinne „Bühne frei“ für die Top Ten der Pflege (alphabetisch gereiht).

Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger im KUK Med Campus III. in Linz
Gemeinsam mit seiner Frau Isabella, die ebenfalls DGKS ist und ihn nominiert hat, arbeitet Manuel Aschauer im KUK Med Campus III in Linz. Außergewöhnliches Engagement, große Geduld und Mitgefühl den Patienten gegenüber machen ihn zu einer wertvollen Stütze im Pflegebereich. Privat geht er hingegen in seiner Rolle als liebevoller Familienvater von Lukas und Luisa auf. Seine ausgeprägte Fürsorglichkeit erstreckt sich damit nicht nur auf die Arbeit, sondern prägt sein gesamtes Leben.

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Palliativstation Krankenhaus Barmherzige Schwestern, Ried im Innkreis
Schon in ihrer Ausbildung merkte Eva Brandhuber, dass es ihr die Palliativmedizin angetan an, und diese ließ sie nicht mehr los. Begonnen auf der Palliativstation im Klinikum Wels, wo sie im Aufbau mitwirkte, wechselte die zweifache Mutter nach ihrer Heirat und Übersiedlung ins Innviertel vor zehn Jahren ins BHS Ried. Schwerstkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg zu begleiten, sieht Eva Brandhuber als ihre persönliche Aufgabe. Obwohl sie nebenbei als Thermomix-Teamleiterin arbeitet, würde sie ihren Beruf im Krankenhaus nie an den Nagel hängen.

Arbeitet im Ordensklinikum
Elisabethinen in Linz auf der Dialyse-Station
Im Onlinevoting verpasste Sr. Immaculata nur knapp den ersten Platz. Kein Wunder, ist sie mit 84 Jahren immer noch so aktiv und leidenschaftlich dabei wie zu Beginn. Seit 1959 als Ordensschwester der Elisabethinen sozial tätig, baute Sr. Immaculata ab 1961 gemeinsam mit dem pflegerischen und ärztlichen Team die Dialyse-Station im damaligen allgemeinen öffentlichen Krankenhaus der Elisabethinen mit auf. Ob Besuche während der Dialyse, auf der Station oder sogar nach einer Operation auf der Intensivabteilung: Sr. Immaculata begleitet ihre Patienten im gesamten Krankheitsverlauf mit.

Fachsozialbetreuer/Altenarbeit im Sozialhilfeverband Rohrbach –Bezirksalten- und Pflegeheim Lembach im Mühlkreis
Rainer Kiesl ist das beste Beispiel dafür, wie toll die Arbeit als Fachsozialarbeiter sein kann. Als einer von drei Personen in der Tagesbetreuung und fixes Teammitglied im Wohnbereich bringt er mit seiner humorvollen Art die Bewohner stets zum Lachen. Zeitgleich schafft er es, mit seinem einfühlsamen Gespür auch eine optimale palliative Begleitung zu ermöglichen und hat immer ein offenes Ort für jegliche Anliegen. Auch bei sämtlichen Heimausflügen oder sonstigen Aktivitäten ist Rainer Kiesl ehrenamtlich immer am Start. Ein Pfleger mit Leib und Seele!

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum WelsGrieskirchen/Standort Wels
Wer Andrea Kirchberger kennt, der weiß, dass sie ein unerlässliches Mitglied im Pflegeteam des Klinikum Wels-Grieskirchen ist. Nicht nur schafft sie es, Humor und Empathie mit absolutem Fachwissen zu vereinen, sie denkt auch immer zwei Schritte voraus und behält dabei stets den Patienten und seinen Lebensweg im Blick. Grundbedürfnisse bzw. -ansprüche nimmt sie genauso ernst wie die persönlichen Anliegen ihrer Patienten. Ihre Tätigkeit führt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin stets mit einem Lächeln und einer Freundlichkeit aus und ist damit ein inspirierendes Vorbild.

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Stationsleiterin auf der Geburtenstation im Phyrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr
Nach 19 Jahren als Lehrerin in der Pflegeausbildung wechselte Marion Kühberger auf die Geburtenstation am Phyrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr und fand darin ein weiteres Mal ihre Berufung. Engagiert und sicher hat sie ihr Team durch die Coronapandemie geführt und trotz Einschränkungen ihr Möglichstes getan, positive Geburtserlebnisse zu schaffen. Als Projektleiterin hat sie wesentlich dazu beigetragen, dass die Abteilung als „Baby Friendly Hospital“ rezertifiziert wurde. Hohes fachliches Wissen aufgrund zahlreicher Aus- und Weiterbildungen sowie ihre sympathische und zugleich kompetente Art sind eine tagtägliche Bereicherung für Patienten und Station.

Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Anästhesie im Klinikum Wels-Grieskirchen/ Standort Wels
Als langjähriger Gesundheits- und Krankenpfleger betreut Gernot Lettner Patienten während und nach der Operation – und das mit höchstem Einfühlungsvermögen und Professionalität. Neben seiner Tätigkeit in der Anästhesie ist er Reanimationsbeauftragter und schult jährlich Hunderte Mitarbeiter im Basic Life Support. Seine eigens für Kinder ins Leben gerufenen Erste-Hilfe-Kurse sind im Handumdrehen ausgebucht, und auch für die Laienreanimation setzt er sich immer wieder öffentlich mit wirkungsvollen Maßnahmen ein. Erst kürzlich hat er bei einem Weltrekordversuch teilgenommen.

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Station Neonatologie/Nimcu im Klinikum Wels-Grieskirchen/Standort Wels
Monika Mayr wurde stellvertretend für das gesamte Team der Station Neonatologie/ Nimcu nominiert. Als langjährige Mitarbeiterin zeichnet sich die leidenschaftliche Krankenpflegerin in ihrem professionellen und empathischen Umgang mit den Eltern und den kleinen Früh- und Neugeborenen aus. Neben ihrer Rolle als Betriebsrätin ist sie als Pflegequalitätsbeauftragte eine große treibende Kraft in der Pflegeweiterentwicklung auf der Station. Für ihre stets positive und humorvolle Lebenseinstellung sowie ihre Expertise in intensivpflegerischen Aufgaben wird sie vom Team hochgeschätzt.

Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und Stationsstellvertretung auf der N0Z3 (Akutpsychiatrie) im Kepler Universitätsklinikum Neuromed Campus Linz
Seit Beginn seiner Karriere als DGKP lebt Hannes Nichterl für seine Arbeit und seine Abteilung, welche er liebevoll als „Herzstück“ bezeichnet. Für seine Mitarbeiter hat er immer ein offenes Ohr und als Patient ist man bei ihm gut aufgehoben. Er vereint Theorie und Praxis perfekt, was sich nicht zuletzt im „basalen und mittleren Pflegemangement“, welches er gerade absolviert, zeigt. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine Flexibilität und Spontanität in Bezug auf die Diensteinteilung sowie seine hohe Teamkompetenz aus, die durch eine große Portion Humor, Verlässlichkeit und Gewissenhaftigkeit geprägt ist.

Als DGKP ergänzt Denise das multiprofessionelle hepatologische Team als ANP (advanced nursing practice) im Ordensklinikum Linz – Barmherzige Schwestern, Abteilung Interne IV, Gastroenterologie und Hepatologie.
Engagiert, überzeugend und zielstrebig sind nur einige von vielen Attributen, die Denise Schäfer zuzuschreiben sind. Mit großem Engagement und unermüdlichem Einsatz setzt sie sich täglich für ihre Patienten und deren Bedürfnisse ein. Sie überwacht Therapien, bewahrt den Überblick über lebertransplantierte und zur Transplantation gelistete Patienten, schult und informiert diese und bestärkt sie in ihren Ressourcen. Dabei steht der Mensch mit seinem Umfeld immer im Fokus. Abseits ihrer klinischen Tätigkeit liegen Denise Schäfer die Aus- und Weiterbildung sowie die Weiterentwicklung des Berufsfeldes Pflege sehr am Herzen.
Ordensschwester Immaculata ist 84 Jahre alt und arbeitet noch immer im Ordensklinikum der Elisabethinen Linz auf der Dialyse-Station, die sie mitaufgebaut und insgesamt 40 Jahre lange geleitet hat.
REDAKTION : Nicole Madlmayr | FOTOS: Ordensklinikum
„Pension? Das ist nichts für mich“, sagt Ordensschwester Immaculata lachend. Mit ihren 84 Jahren arbeitet sie noch immer im Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz. Regelmäßig im Einsatz ist sie auf der DialyseStation, die sie selbst liebevoll als ihr „Kind“ bezeichnet. Denn die gebürtige Mühlviertlerin hat diese Station Anfang der 60er-Jahre mitaufgebaut und insgesamt 40 Jahre lang geleitet. Heute ist sie mit mehr als 200 Patienten die größte Dialyse-Station in Oberösterreich. Viele Menschen kennen und lieben die umtriebige Ordensschwester mit dem ausgesprochen sonnigen Gemüt. Nicht umsonst hat sie es auch bei unserer Wahl zur „Pflegekraft des Jahres“ ganz weit nach vorne geschafft.
Sie arbeiten immer noch auf der Dialyse-Station. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ich habe die Dialyse 40 Jahre lang geleitet. Als ich die Leitung 2011 zurückgelegt habe, wollte ich weiterhin auf der Station bleiben. Weil ich weiß, dass die Menschen dort nicht nur die medizinische Betreuung brauchen, sondern besonders auch menschliche Zuwendung. Jemanden zum Zuhören und zum Reden. Jemanden, der sie versteht oder ihnen einfach nur die Hand hält und für sie da ist. Die meisten unserer Patienten lerne ich sehr gut kennen, weil sie mehrmals die Woche und über Jahre zur Dialyse kommen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt viel mehr Zeit für sie habe, weil meine medizinischen Aufgaben weggefallen sind. Früher habe ich die Seelsorge immer ein bisschen nebenbei gemacht.
Sie hätten nach so vielen Jahren auch sagen können: Danke, das war es jetzt für mich. Ab sofort bin ich im Ruhestand …
(lacht) Nein, das wäre nichts für mich gewesen. Man muss immer ein bisschen gefordert sein, um geistig rege zu bleiben. Wenn man nichts mehr tut, verrostet man da oben (tippt gegen ihre Stirn). Die Liebe zu den Patienten, die Freude, helfen zu können und durch menschliche Zuwendung eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen – ich habe das immer als eine sehr wichtige Aufgabe empfunden. Es wäre schade gewesen, das nicht mehr zu machen, und darum war für mich klar, dass ich auch weiterhin auf der Dialyse bleiben werde.
Sie haben so viele Menschen kennengelernt und begleitet. Gibt es eine Patientin oder einen Patienten, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich kann mich noch gut an einen Patienten erinnern, der schon als Schüler akut für zwei Monate zur Dialyse musste, bis sich seine Nierenfunktion wieder erholt hat. Nach kurzer Zeit musste er jedoch in das chronische Programm, bis er Anfang der 80er-Jahre eine neue Niere bekommen hat. Leider hat seine Spenderniere 1999 dann versagt und er musste erneut zu uns zur Nierenersatztherapie. Nach drei Jahren wurde er wieder transplantiert, seine neue Niere funktioniert bis heute gut. Als Dank dafür hat er in seinem Heimatort im Mühlviertel eine Kapelle errichtet. Er ist übrigens ein sehr lebensfroher Mensch und mittlerweile Vater von drei Kindern. Vor Kurzem erst hat er mir wieder Grüße geschickt, dass es ihm gut geht. Das hat mich sehr gefreut!

Was Anfang der 60er-Jahre in den Kellerräumen der Elisabethinen begonnen hat, ist heute die größte Dialyse-Station in Oberösterreich. Immer mit dabei: Schwester Immaculata und ihr sonniges Gemüt.

Vermutlich haben Sie aber auch andere Schicksale gesehen, die nicht so gut ausgegangen sind …
Das stimmt! Unsere Arbeit hat nicht immer nur Positives gebracht und wir haben auch schwere Schicksale erlebt. Bis in die 60er-Jahre mussten junge Menschen an Nierenversagen sterben, weil es – abgesehen von Wien – in ganz Österreich keine Dialyse-Station gegeben hat. Mit den heutigen Mitteln hätte man ihnen rasch und langfristig helfen können. Die Entscheidung der Krankenhausleitung, damals die neue und somit noch nicht sehr erprobte Fachrichtung Nephrologie (Anm. d. Red.: Nierenheilkunde) zuzulassen, war auch mit einem finanziellen Risiko verbunden. Heute wissen wir aber, dass es sich mehr als gelohnt hat.
Die Patienten auf der Dialyse-Station brauchen nicht nur die medizinische Betreuung, sondern besonders auch menschliche Zuwendung.
Jemanden, der für sie da ist und sie versteht.
Können Sie sich noch an Ihre Anfänge bei der Dialyse erinnern?
Natürlich (lacht). Unser Primar Professor Bruno Watschinger hat in den USA gemeinsam mit dem Erfinder der rotierenden Trommelniere ein Verfahren entwickelt, das weniger kostenintensiv und somit auch in Österreich umsetzbar gewesen ist. Er hat gewusst, dass wir uns die anderen teuren Geräte nicht hätten leisten können. Die erste Dialyse mit der von ihnen entwickelten Spulenniere hat dann 1961 in den Kellerräumen unseres Krankenhauses stattgefunden. Damals wurde eine junge Frau mit akutem Nierenversagen erfolgreich behandelt. Das war sehr beeindruckend. Wobei ich sagen muss, dass es trotzdem keine leichte Entscheidung für mich war, als ich 1971 als erste Diplom-Krankenschwester für die Dialyse bestellt wurde. Schweren Herzens habe ich meine damalige Arbeit auf der Lungen-Station aufgegeben und mich für diese völlig neue, unbekannte Arbeit bereit erklärt, das muss ich schon sagen. Heute schaue ich aber sehr dankbar
zurück! Es war gut und richtig, dass ich mich damals dafür entschieden habe, auf der Dialyse-Station zu arbeiten.
Sie haben 2017 sogar ein Buch über die Entstehungsgeschichte der DialyseBehandlungen bei den Elisabethinen geschrieben …
Ja, nachdem ich die einzige noch aktive Zeitgenossin aus der Dialyse-Pionierzeit bin, bin ich immer wieder darauf angesprochen worden, niederzuschreiben, wie alles begonnen hat. Es ist wirklich eine besondere Geschichte, die man einfach festhalten musste. Der vorhin angesprochene Schüler wäre gestorben, wenn es bei uns nicht schon die Möglichkeit zur Dialyse gegeben hätte. Damals waren wir die Ersten. Und wir sind in Oberösterreich auch immer noch die Einzigen, die Nieren transplantieren. Seit 50 Jahren machen wir das hier am Ordensklinikum. Sie sind jetzt 84 Jahre alt. Was gibt Ihnen Kraft und Energie, dass Sie Ihre Arbeit im Krankenhaus täglich machen können?
Meine Kraftquelle ist die Kapelle. Dafür stehe ich bewusst ein bisschen früher auf, also gegen halb fünf Uhr, und schließe auch alle Menschen in mein Gebet ein, mit denen ich an diesem Tag in Kontakt komme. Wir haben mit mehr als 200 Patienten die größte Dialyse-Station in Oberösterreich, da bin ich abends manchmal schon ziemlich müde. Dann schaue ich, dass ich zeitig ins Bett komme. Ich lese noch ein bisschen und spätestens um 22 Uhr drehe ich das Licht ab. Am nächsten Tag bin ich dann wieder fit!


Die Caritas Oberösterreich hat viele Jobs für Menschen mit Herz und Kompetenz zu bieten: unter anderem in Seniorenwohnhäusern, in den Mobilen Familien- und Pflegediensten, im Mobilen Hospiz Palliative Care, im Betreubaren Wohnen und in der Servicestelle für pflegende Angehörige. Zudem bildet die Caritas OÖ angehende Sozialbetreuerinnen und -betreuer aus.

Bilal Usman (39), Walding, Seniorenwohnhaus Karl Borromäus. 2015 floh er aus Pakistan nach Österreich und absolvierte die Caritas-Schule in Linz.
Es ist schön, dass ich die Unabhängigkeit der Menschen pflegen kann. Mir gefällt, dass die Menschen mit unserer Unterstützung auch im Alter zu Hause sein können. Selbst nach fast 20 Jahren in der Pflege ist es nach wie vor erfüllend zu hören, dass es schön ist, dass es uns gibt. Außerdem lässt sich der Job ideal mit der Familie vereinbaren.
Daniela Schwamberger (36), Oberwang, Mobile Pflegedienste. Sie unterstützt gerne Menschen in ihrem Zuhause.

Die Gewissheit, etwas Gutes zu tun, bereitet mir Freude. Ich möchte meinen Beruf so ausüben und so pflegen, wie ich im Alter auch einmal selbst gepflegt werden möchte. Und mit der passenden Weiterbildung habe ich Aufstiegsmöglichkeiten.
Die Schreibtischarbeit wurde zu einseitig. Als ich mich ehrenamtlich sozial engagieren wollte, bin ich auf die Sozialbetreuungsberufe gestoßen und habe mich gefragt: Warum nicht etwas komplett Neues beginnen? Mit dem Fachkräftestipendium war auch die Finanzierung meines Lebensunterhalts gesichert.
Melanie Ofner (44), Vöcklamarkt, in Ausbildung. Sie besucht die Caritas-Schule in Ebensee.
Tel.: 0732/76 10-24 01 betreuung@caritas-ooe.at caritas-pflege.at/ooe ausbildung-sozialberufe.at jobs.caritas-ooe.at
REDAKTION: Ulli Wright
FOTO: Klaus Vyhnalek (www.vyhnalek.com) für Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher (www.horx.com),
Die Menschen werden immer älter, Großfamilien immer seltener und schon jetzt fehlen aufgrund von Personalmangel Plätze in Alten- und Pflegeheimen. „Um qualitative Pflege auch künftig noch gewährleisten zu können, braucht es einen grundlegenden Systemwechsel“, sagt Zukunftsforscher Matthias Horx im Interview und verweist auf ein innovatives Pflegekonzept aus den Niederlanden.
Schon jetzt beziehen 468.000 Menschen in Österreich Pflegegeld und sind auf Betreuung und Hilfe angewiesen. Einer Prognose von Statista zufolge könnte die Zahl der betreuten Personen in der professionellen Pflege in Österreich im Jahr 2050 auf mehr als 650.000 anwachsen. Zahlen, die einen nachdenklich stimmen. Für uns Grund genug, beim renommierten Zukunftsforscher Matthias Horx nachzufragen, der sich mit seinem neuen Unternehmen „The Future:Project“ mit Transformationen, statt mit Trends beschäftigt. Denn die Umbrüche und Krisen unserer Zeit machen auch in der Zukunftsforschung einen neuen Ansatz des Denkens notwendig. „Wir brauchen eine Disziplin, die aus der Ganzheit der Zukunft heraus denkt, die Krisen als Teil von Transformationsprozessen begreift, anstatt in Zukunftsangst zu erstarren. Wir brauchen eine neue ‚Zukunfts-Bewusstheit‘“, sagt Matthias Horx und gibt uns einen Ausblick auf die Zukunft der Pflege.
Herr Horx, Mangel an Pflegepersonal bei einer immer älter werdenden Gesellschaft stellt uns alle vor große Herausforderungen. Wie bzw. kann man das Pflegeproblem überhaupt künftig noch lösen?
Die Pflege ist ein komplexes Problem, das in der Systemsprache als „Wicked Problem” (Anm.: verhext)

Mit seiner neuen Firma „The Future:Project“ geht Matthias Horx neue Wege in der Zukunftsforschung.
bezeichnet wird. Es ist eine Herausforderung, die sich nicht einfach lösen lässt, da sie von verschiedenen Trends und Faktoren beeinflusst wird. Zum einen gibt es demografische Veränderungen, da ein wachsender Anteil älterer Menschen zu einer erhöhten Nachfrage nach Pflege führt. Durch den medizinischen Fortschritt leben Menschen länger, aber nicht immer in guter Gesundheit. Eine Rolle spielt auch der Wertewandel. Immer noch werden rund 60 Prozent der Menschen von Angehörigen gepflegt, traditionell übernehmen vor allem Frauen die häusliche Pflege. Allerdings führen gesellschaftliche Veränderungen dazu, dass weniger Menschen bereit bzw. in der Lage sind, sich aufopfernd um andere zu kümmern. Problematisch ist auch, dass die Pflegekosten stetig ansteigen. Mehr Geld oder Altenheime allein werden das Problem nicht lösen.
Was braucht es dann?
Pflegeorganisationen sind Bürokraten, deren Mitarbeiter auf Bildschirme starren und Zahlenkolonnen erstellen. Doch allzu oft fehlt es an einer grundlegenden Verbindung zwischen ihrer Tätigkeit und der empathischen Liebe zur Notwendigkeit. Aber genau diese Verbindung bildet die Grundlage für eine effektive und individuelle Pflege, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen der Organisation von Pflegeleistungen und dem Verständnis für die menschlichen Bedürfnisse ist entscheidend, um eine bedeutungsvolle und unterstützende Pflegeumgebung zu schaffen.
Wie kann das gelingen?
Es bedarf eines grundlegenden Systemwechsels und neuer Ansätze. Wir brauchen zukunftsorientierte Lösungen und müssen innovative Lebensformen entwickeln, die den Bedürfnissen der Pflege gerecht werden. Das erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen. Insgesamt müssen wir die Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen und gemeinsam nachhaltige Lösungen finden. Nur so können wir den Herausforderungen gerecht werden und die Pflege für alle Beteiligten verbessern. Wir müssen zu integrativeren und kommunaleren Strukturen zurückkehren.
Haben Sie dazu ein Beispiel aus der Praxis?
Ein Best-Practice-Beispiel für innovative Pflege ist meiner Ansicht nach die niederländische Organisation „Buurtzorg“, die der Pfleger Jos de Blok im Jahr 2007 gegründet hat. „Buurtzorg“ (dt.: Nachbarschaftshilfe) setzt auf häusliche Pflege anstelle von Alten- und Pflegeheimen und organisiert sich in selbstverwalteten, autonomen Teams, die in bestimmten Stadtteilen arbeiten. Es gibt Lotsen, die genau wissen, welche Probleme wo auftreten und wer tageweise Vollbetreuung benötigt oder eventuell einen Ausflug machen will. Denn Pflege ist normalerweise nur Passivität. Man kann Menschen auch zu Tode pflegen, indem man nichts mehr von ihnen verlangt. Ziel der Pflege von „Buurtzorg“ ist, die Mobilität und Eigenständigkeit der Menschen weitgehend zu bewahren oder sogar zurückzugewinnen. Man hat auch kein Problem, Nachwuchs zu finden, weil die Arbeit selbstverwaltet ist und Freude macht. Es geht darum, das Alte, das Bewährte zu modernisieren. Bei „Buurtzorg“ in den Niederlanden kümmern sich aktuell täglich mehr als 1.000 Teams und rund 15.000 professionelle Pflege- und Betreuungskräfte um die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten.
Es geht in der Pflege darum, das Alte, das Bewährte zu modernisieren!
An Pflegerobotern wird schon länger geforscht und sie sind zum Teil auch schon im Einsatz. Werden sie die Zukunft sein?
Pflegeroboter sind Unsinn. Das sind hybride Ideen, die oft dem Rationalisierungswahn von Unternehmen entspringen und im Prinzip unmenschlich sind. Ganz wichtig ist im Pflegebereich, das Positive, das Sinnvolle, das Erleichternde vom Stupiden zu trennen. Pflegeroboter können zwar schwere Lasten tragen und Tabletten verteilen, aber sie können nicht die menschliche Zuwendung ersetzen. Wenn wir Pflegeroboter in Altenheime einbringen, riskieren wir psychische Verwahrlosung, da menschliche Zuneigung unersetzlich ist.

Gesundheitslandesrätin
LHStv. Mag. Christine Haberlander und Soziallandesrat Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer eint die Verantwortung für die Schwächsten in der Gesellschaft.
Dass ihre ressortübergreifende Zusammenarbeit sehr gut funktioniert, beweisen Gesundheitslandesrätin LHStv.in Christine Haberlander und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer mit ihrer gemeinsamen Ausbildungsoffensive in der Pflege, die nach nur einem Jahr bereits Früchte trägt. Von einer Trendwende kann allerdings noch nicht die Rede sein. Welche weiteren Ziele sie verfolgen, haben sie uns im Interview erzählt.
TEXT: Ulli Wright | FOTOS: Thom Trauner
Seit 2017 ist Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Christine Haberlander Landesrätin für Gesundheit. Seit 2021 ist Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer Landesrat für Soziales. In beiden Bereichen geht es um Menschen, um kranke und alte Menschen, um Menschen, die Hilfe brauchen und um Menschen, die bereit sind, für diese Menschen da zu sein. Kein leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass sich allein in Oberösterreich die Zahl der Pflegebedürftigen angesichts der demografischen Entwicklung bis 2040 um 45 Prozent erhöhen wird, während sich die Babyboomer-Generation in die Pension verabschiedet. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und dabei auch junge Menschen zu begeistern, ist derzeit die größte Herausforderung im Gesundheits- und Pflegebereich“, sind sich die beiden ÖVP-Politiker einig.
Das Sozialressort und das Gesundheitsressort verfolgen in einigen Bereichen gemeinsame Interessen. In welchen Projekten arbeiten Sie ressortübergreifend zusammen?
Haberlander: Ich bin sehr froh, dass die Zusammenarbeit mit Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer und dem Sozialressort so gut funktioniert. Das ist ganz wesentlich, weil es im Gesundheits- und Pflegebereich viele Themen gibt, die man gesamtheitlich betrachten muss. Wir arbeiten im Bereich der Pflegeausbildung zusammen, wo wir in den Krankenhäusern auch Menschen für die Alten- und Pflegeheime und für die mobilen Dienste ausbilden. Ein weiteres gemeinsames Projekt ist im Bereich der Digitalisierung, wo wir die Alten- und Pflegeheime an die elektronische Gesundheitsakte ELGA anbinden. Und auch beim großen Thema Demenz arbeiten wir ressortübergreifend zusammen.
Hattmannsdorfer: Uns beide eint die Verantwortung für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Als starkes Bundesland haben wir eine doppelte Verantwortung für Menschen, die krank sind, die alt sind und sich auf ein starkes Sozial- und Gesundheitssystem verlassen können müssen. Dieser Verant-
wortung werden wir in Oberösterreich gerecht. Das Wichtigste ist, ausreichend Menschen für die Gesundheits- und Sozialberufe zu finden, wo wir einen gemeinsamen Schwerpunkt gesetzt haben. Das beginnt bei einem attraktiven Pflegestipendium und reicht bis hin zu topmodernen Ausbildungen.
Im Bereich Demenz haben Sie sich im März gemeinsam mit einer Delegation den schottischen Weg angeschaut. Was haben Sie sich für Oberösterreich mitgenommen?
Hattmannsdorfer: Niemand redet gerne über das Altwerden, niemand will alt werden, aber ich sehe es als politische Verantwortung, das Thema ganz offen anzusprechen. Demenz ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Was wir von den Schotten lernen können, ist, dass diese Krankheit dort ganz offen thematisiert wird. Christine Haberlander und ich haben uns das Ziel gesetzt, Oberösterreich zum demenzfreundlichsten Bundesland zu machen und die Menschen zu sensibilisieren, so früh wie möglich unsere Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Wir haben elf Demenz-Servicestellen in Oberösterreich, wo man sich testen lassen kann und Unterstützung findet. Vor allem auch für pflegende Angehörige ist es ganz wichtig, ihnen Unterstützung anzubieten.
Haberlander: Die Schotten sind weder medizinisch noch pflegerisch und auch finanziell nicht bessergestellt als wir, aber sie haben einen positiven Zugang zu Demenz. Es ist kein Tabuthema. Das hat uns begeistert und dort möchten wir hin. Ein Beispiel beschreibt das Ziel ganz gut: Wenn ein Demenzkranker in Schottland vom Altenheim ins Krankenhaus muss, hat er einen Fragenbogen bei sich, der

ihn nicht nur medizinisch, sondern auch von der Persönlichkeit her beschreibt. Das baut Ängste ab und erleichtert dem Gesundheitspersonal ihren Arbeitsalltag.
Unter dem Titel „Viele Ausbildungswege führen in Oberösterreich zur Pflege“ haben Sie beide vor gut einem Jahr neue Angebote in der Pflegeausbildung präsentiert. Können Sie schon eine erste Bilanz ziehen?
Hattmannsdorfer: Das Wichtigste ist, dass ausreichend Menschen im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten. Diesbezüglich ist uns in den vergangenen zwei Jahren vieles gelungen. Zum einen geht es darum, das Image des Pflegeberufes zu erhöhen. Pflegerinnen und Pfleger sollen dasselbe Ansehen wie App-Programmierer oder Ärzte genießen. Deswegen haben wir in dieser Zeit die Gehälter erhöht und von der Pflegelehre bis hin zu eigenen Modellen für Umsteigerinnen unkomplizierte Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf geschaffen. Darüber hinaus haben wir die Ausbildungen digitalisiert und modernisiert. Ein zentraler Schritt war, dass wir ein eigenes Pflegestipendium in der Höhe von monatlich 600 Euro netto, ohne Zuverdienstgrenze, eingeführt haben. Wir sehen in Menschen, die ihre zweite Karriere in der Pflege starten wollen, eine große Zielgruppe. Sie sollen sich die Ausbildung auch leisten können. Dass erstmals wieder mehr Leute in Ausbildung sind, beweist, dass wir am richtigen Weg sind. Haberlander: Wir haben im Pflegebereich eine Vielfalt an Ausbildungen, wo für jede oder jeden das Passende dabei ist. Wir bieten Ausbildungen für Umsteigerinnen und Umsteiger und auch für Menschen, die erfreulicherweise direkt aus der Pflichtschule kommen. Diese werden sehr gut angenommen, auch von vielen Burschen. Außerdem bieten wir ganz bewusst dezentrale Ausbildungsorte an unseren Krankenhäusern. Die Fachhochschule für Gesundheitsberufe ist nicht nur in Linz, sondern an fünf
Ein zentraler Schritt war, dass wir ein Pflegestipendium in der Höhe von monatlich 600 Euro netto, ohne Zuverdienstgrenze, eingeführt haben.
Soziallandesrat Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer
Standorten in Oberösterreich vertreten. Pflege ist ein unglaublich breites Feld und je nachdem, wo Interesse vorhanden ist, kann man im Altenheim, im Hospizbereich, im Krankenhaus auf der Intensivstation oder auf der Neonatologie arbeiten und sich auch laufend weiterbilden. Diese Vielfalt findet man in den wenigsten Berufsfeldern. Seit 2022 verzeichnen wir zum Beispiel am Ordensklinikum in Linz eine Bewerbersteigerung von zehn Prozent, was zeigt, dass diese Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten sowie auch das Pflegestipendium greifen.
Die Lehrausbildung zur Pflegeassistenz dauert drei Jahre, die Lehrausbildung zur Pflegefachassistenz vier Jahre, wie schnell bekommt man die Leute zu den Patienten?
Haberlander: Bei jeder Ausbildung muss auch ein Praktikum absolviert werden. Das ist wichtig, weil man sehr schnell merkt, ob einem der Beruf auch in der Praxis gefällt. Die Pflegelehre in Oberösterreich ist als duales System organisiert, in dem Theorie und Praxis vermittelt werden: 80 Prozent der Ausbildungszeit findet im Lehrbetrieb, 20 Prozent in der Berufsschule statt. Mit der Pflegelehre haben wir neben der Ausbildung zu Pflegestartern, der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HPLS) und dem Lehrgang „Junge Pflege“ – einen weiteren Zugang zu einer Pflegeausbildung vor dem 17. Lebensjahr geschaffen.
Hattmannsdorfer: Im Bereich der Langzeitpflege kann man seit dem Vorjahr erstmals auch ganz ohne Ausbildung als Stützkraft zu arbeiten beginnen und nebenbei eine Ausbildung zur Heimhilfe machen. Diese dauert 420 Stunden: 200 Stunden sind Praxis, 220 Stunden sind Theorie, und man verdient 2.600 Euro brutto, plus Zulagen und Nachtschichten. Das ist vor allem für Ein- und Umsteiger in den Pflegebereich eine attraktive Möglichkeit. Diese Ausbildung „on the job“ haben wir vor einem Jahr gestartet, mittlerweile nutzen sie fast 200 Menschen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir 400 Personen mehr für die Langzeitpflege begeistern konnten.
Frau Mag. Haberlander, vor Kurzem wurde bekannt, dass in Oberösterreich rund 31 Millionen Euro in den Ausbau der Hospiz- und Palliativ-Versorgung investiert werden. Was darf man künftig erwarten?
Haberlander: Es geht darum, allen Menschen bis zum Schluss ein lebenswertes Dasein zu ermöglichen. Daher ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, und Gott sei Dank haben wir alle Krankenhausträger sowie das Rote Kreuz im Boot. Wir wollen in
Oberösterreich stationäre Hospizeinrichtungen flächendeckend an unterschiedlichen Standorten anbieten und planen auch ein Palliativangebot für Kinder am Uniklinikum in Linz, weil es genauso Kinder und deren Eltern betrifft, wo wir auch eine intensive Angehörigenbegleitung machen.
Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren auch im Gesundheitswesen einen großen Wandel ausgelöst. Was wird in Sachen Digitalisierung in Krankenhäusern bereits angewandt, um das Pflegepersonal zu entlasten? Was macht Ihrer Ansicht nach Sinn?
Haberlander: Unser Leitmotiv ist, dass die Technik den Menschen dienen muss und nicht umgekehrt. Erstens wollen wir beste Qualität für die Patientinnen und Patienten, zweitens eine Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir setzen Technik und Digitalisierung so ein, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch die Auszubildenden zum Beispiel mit einem Simulationstraining üben können. Hier möchten wir uns noch breiter aufstellen. Außerdem geht es darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch digitale Fieberkurven, digitale Spracherkennung bei der Dokumentation oder Mitarbeiter-Apps, wo man zum Beispiel den Dienstplan einsehen kann, zu entlasten. Ganz wichtig ist aber auch die Entlastung der Patientinnen und Patienten. Viele sind digitalaffin und wollen Termine online buchen, ihre Daten einsehen und verständigt werden.
Was macht in Sachen Digitalisierung in Alten- und Pflegeheimen Sinn?
Hattmannsdorfer: Oberösterreich ist bekannt als Land des Fortschritts, der Innovation und des sozialen Zusammenhalts. Unsere Aufgabe ist es, diese beiden Welten noch besser zu verbinden. Darin sehe ich eine riesengroße Chance. Einerseits bei der Entlastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch digitale Assistenzsysteme, aber vor allem auch durch Unterstützung von älteren Menschen mit Smart-Home-Living-Anwendungen zu Hause. Wichtig ist hier, den Menschen die Scheu vor diesen Anwendungen zu nehmen. Technik bedeutet nicht, dass ein Roboter die Pfle-

Unser Leitmotiv ist, dass die Technik den Menschen dienen muss und nicht umgekehrt.
Gesundheitslandesrätin
LHStv. Mag. Christine Haberlander
ge übernimmt, sondern dass wir pflegende Angehörige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei physischen Herausforderungen, aber auch im Bereich der Administration und Verwaltung entlasten können.
Als einziges Bundesland hat OÖ einen Pflegetechnologiefonds aufgelegt, der heuer mit zwei Millionen Euro ausgestattet ist. Reicht dieser Betrag aus?
Hattmannsdorfer: Hier muss man zwischen dem medizinischen Bereich im Krankenhaus, wo es ohne Hightech nicht geht, und dem Pflegebereich unterscheiden. In der Pflege geht es darum, wie digitale Assistenzsysteme und innovative Projekte den Pflegealltag erleichtern und Menschen im Älterwerden unterstützen können. Einerseits, um länger in den eigenen vier Wänden leben zu können, andererseits, um die Pflegekräfte zu entlasten. Wir haben mit der Johannes-Kepler-Universität, dem FH-Campus Hagenberg sowie den weiteren Fachhochschulstandorten eine super Forschungs-Infrastruktur. Wir haben viele Start-ups, die in diesem Bereich tätig sind und auch in Richtung Langzeitpflege ganz viel bewerkstelligen. Der Betrag von zwei Millionen Euro ist vorerst der erste Call, das wird sicher nicht der letzte sein.
Herr Dr. Hattmannsdorfer, erstmals seit sieben Jahren ist die Zahl der leerstehenden Betten aufgrund von Personalmangel in den Alten- und Pflegeheimen rückläufig. Ist das der „Fachkräftestrategie Pflege“ zuzuschreiben?
Wir haben vor einem Jahr mit der konsequenten Umsetzung der „Fachkräftestrategie Pflege“ begonnen und dabei parteiübergreifend mit dem Städtebund, dem Gemeindebund und der Arbeiterkammer viele Projekte entwickelt. Mit Erfolg, denn schon nach einem Jahr verzeichnen wir erstmals ein Plus von 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch ein Plus von fast 200 Personen, die eine Ausbildung im Bereich der Sozialbetreuungsberufe machen. Und wir können erstmals auch einen Rückgang bei den leerstehenden Betten verzeichnen. Daran sieht man, dass die „Fachkräftestrategie Pflege“ in die richtige Richtung geht. Von einer Trendumkehr würde ich aber noch lange nicht sprechen.

Welche Schritte darf man heuer noch erwarten? Was hat Priorität?
Hattmannsdorfer: Schwerpunkt in diesem Jahr wird die Ausrollung der Maßnahmen auf den mobilen Bereich sein. Unser Ziel lautet: mobil vor stationär. Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können.
Gibt es aktuell genug mobile Pflegerinnen und Pfleger?
Hattmannsdorfer: Derzeit sind wir gut aufgestellt, es wird aber in Einzelfällen immer Wartezeiten geben, weil man nicht an jedem Straßenzug jede Leistung rund um die Uhr parat halten kann. In Summe können wir den Bedarf in den Altenheimen und mobilen Diensten decken, aber vorausschauende Politik bedeutet, dass wir uns schon jetzt mit dem demografischen Wandel auseinandersetzen müssen. Laut Prognosen wird es bis zum Jahr 2040 um 40 Prozent mehr pflegebedürftige Menschen geben, daher müssen wir jetzt handeln und Maßnahmen einleiten.
An die 100 philippinische Pflegekräfte unterstützen Oberösterreich bereits in Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen sowie auch in Spitälern. 100 weitere sollen für heuer noch angeworben werden. Welche Erfahrungen machen Sie mit diesen Pflegekräften?
Hattmannsdorfer: Das Projekt mit philippinischen Pflegekräften haben wir in der Langzeitpflege gestartet und ich
kann nur sagen, das sind topausgebildete Diplomkräfte, von denen die ersten sogar schon „mühlviertlerisch“ reden. Alleine im vergangenen Jahr haben 230 Personen in Oberösterreich ihre Ausbildung anerkennen lassen, darunter sind auch Menschen aus Ex-Jugoslawien und anderen Drittstaaten. Ihnen ein gutes Angebot zu machen, ist das Gebot der Stunde. Da sind uns andere Länder wie Holland, USA oder Australien voraus. Hier braucht es einen Paradigmenwechsel. Man muss Menschen gezielt nach Österreich holen und darf nicht Zuwanderung am Roulettetisch betreiben, wo irgendwelche Leute zu uns kommen, die wir für unseren Wohlstand nicht brauchen können.
Warum ist man ausgerechnet darauf gekommen, Pflegekräfte von den Philippinen zu holen?
Hattmannsdorfer: Die Menschen verfügen über eine hochqualitative Diplomausbildung, aber vor allem haben sich die Philippinen auf die Vermittlung von Fachkräften ins Ausland konzentriert. Jedes Jahr werden circa 19.000 Diplom-Pflegekräfte vermittelt. Aktuell hauptsächlich nach Australien, in die USA und in den arabischen Raum. Wir müssen schauen, dass auch wir ein Stück vom Kuchen abbekommen.
Haberlander: Diesen Weg gehen wir auch in den Krankenhäusern und beschäftigen Pflegekräfte von den Philippinen und künftig auch aus Indien. Ich möchte festhalten, dass wir diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Die philippinischen Pflegekräfte in Oberösterreich sind topausgebildet. Manche reden sogar schon mühlviertlerisch!
Soziallandesrat Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer
gegenüber auch eine moralische Verantwortung haben. Wir müssen ihnen ein Zuhause bieten und sie auch aufnehmen. Daher stellen wir ihnen Kolleginnen und Kollegen zur Seite, die sich darum kümmern, dass sie sich in Österreich zu Hause fühlen. Das bedeutet vor allem auch eine emotionale und moralische Unterstützung.
Hattmannsdorfer: Wir handeln dabei auch ganz klar nach einem Ethikkodex und werben nur Pflegekräfte von Ländern an, die von der WHO freigegeben werden, wie die Philippinen oder Indien, wo es Teil des wirtschaftlichen Systems ist. 25 Prozent des BIPs machen die Philippinen mit Personalbereitstellung. Wir beschäftigen nur Menschen aus jenen Ländern, die Pflegekräfte für den internationalen Markt ausbilden.
Wenn man die Pflegesituation in der Zukunft betrachtet, wie schaut es diesbezüglich mit Prävention aus?
Haberlander: Ich sehe es als unseren Auftrag, dass man in Österreich gesund leben und alt werden kann. Vor allem ist es wichtig, die Anzahl der gesunden Lebensjahre zu erhöhen. Diesbezüglich gibt es zahlreiche Präventionsprogramme, die von der gesunden G emeinde bis hin zu intelligenten Vorsorge-Untersuchungsprogrammen reichen. Da sind auch die Sozialversicherungen gefordert, den Versicherten klügere Angebote und Anreize anzubieten.

Viktoria Tischler, Fachgruppenobfrau Personenberatung und Personenbetreuung und Berufsgruppensprecherin der OÖ Personenbetreuung in der WKOÖ, initiiert jährlich den Guide rund um die 24h-Personenbetreuung.
Umfassende Aufklärung über die 24h-Personenbetreuung ist ein vorrangiges Ziel von Viktoria Tischler, Berufsgruppensprecherin der OÖ Personenbetreuung: „Oft tritt ein Betreuungsfall ganz plötzlich ein, etwa nach einem Schlaganfall. Betroffene und deren Angehörige brauchen dann in dieser schwierigen Zeit bestmögliche Unterstützung und Information, um die beste Entscheidung für die weitere Zukunft fällen zu können. Der Guide ist bei der WKOÖ kostenlos unter pb@wkooe. at oder unter 05 90909-4145 erhältlich, erklärt übersichtlich dieses Betreuungsmodell der Zukunft und listet alle aktiven Vermittlungsagenturen in OÖ auf. Die Kontaktaufnahme muss so einfach und unkompliziert wie möglich sein, wenn ein Betreuungsfall entsteht“, weiß Viktoria Tischler aus ihrer langjährigen Erfahrung. Umfragen besagen, dass 85 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ihren Lebensabend in ihren eigenen vier Wänden verbringen möchten. Die 24h-Personenbetreuung kommt

Der Guide klärt umfassend über die 24h-Personenbetreuung im eigenen Zuhause auf.
KommR Mag. Dr. Viktoria Tischler
diesem Wunsch optimal entgegen, denn durch die Betreuung im eigenen Zuhause genießen alte Menschen ein Höchstmaß an Wohlbefinden und Lebensqualität.
Pflege und Betreuung betrifft alle. Die Brisanz des Pflege- und Betreuungsthemas ergibt sich aus aktuellen Daten: Lag die Zahl der österreichweiten Pensionsbezieherinnen und -bezieher im Jahr 2000 noch bei 2.451.695, stieg sie bis 2022 auf 2.928.518 an. Das ergibt eine Steigerung um rund 19 Prozent. Auch die Zahlen der Pflegegeldbezieherinnen und -bezieher steigen von Jahr zu Jahr. Waren es im Jahr 2018 noch 459.333 Personen, bezogen Ende 2023 bereits 476.228 Menschen Pflegegeld. „Wir dürfen die demografische Entwicklung nicht außer Acht lassen: In Zukunft werden uns alle die Themen Pflege und Betreuung betreffen. „Durch den Guide halten die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher einen Wissensvorsprung für eine Ausnahmesituation in Händen“, ist die Fachgruppenobfrau überzeugt.
Für die Berufsgruppe bietet dieses Aufklärungstool einen enormen Reichweitengewinn. Da sich in der Regel die Menschen erst im Bedarfsfall über Betreuungsmöglichkeiten informieren, dient der Guide auch langfristig als Informationsgrundlage. Die nachhaltige Wirkung des Guides steht für die Fachgruppenobfrau außer Frage: „Der Guide rund um die 24-Stunden-Betreuung ist ein wichtiges Medium. Durch das praktische A5-Format findet er in jedem Wohnzimmer Platz.“
Bestellen Sie den Guide unter pb@wkooe.at oder 05 090909 4145


KommR Mag. Dr. Viktoria TISCHLER Fachgruppenobfrau Personenberatung und Personenbetreuung Berufsgruppensprecherin der OÖ Personenbetreuung www.daheimbetreut.at

Laut aktuellen Prognosen werden in Österreich bis zum Jahr 2050 rund 200.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Wie das OÖ Hilfswerk dieser Herausforderung entgegensieht, hat uns Aufsichtsratsvorsitzender und Obmann, Landtags-Präsident Max Hiegelsberger, erzählt.
Nach einem schweren Unfall im März war Max Hiegelsberger selbst auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. „Es geht mir wieder gut“, zeigt er sich dankbar und erzählt, dass er auch heuer wieder im Rahmen von „Hilfswerk on Tour 2024“ in den Bezirken unterwegs ist. Als erfahrener Politiker weiß er, wie wichtig der direkte Kontakt zu den Menschen in den Regionen ist. „In persönlichen Gesprächen erfahren wir, wo der Schuh drückt und können so unsere Leistungen besser an die Bedürfnisse der Menschen anpassen“, erzählt Max Hiegelsberger im Interview.
TEXT: Ulli Wright | FOTO: Cityfoto/Roland Pelzl
Herr Hiegelsberger, welche Bilanz können Sie nach diesen drei Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender und Obmann des OÖ Hilfswerk ziehen?
Ich habe das Amt in einer Zeit übernommen, die uns alle sehr gefordert hat. Pandemie, Krieg und Teuerung haben unser aller Leben verändert. Für viele Menschen taten sich Abgründe auf, die wir als Hilfswerk gemeinsam mit ihnen bewältigt haben. Ich bin stolz, dass wir diese Zeit gut meistern und trotz der vielen Widrigkeiten so viel Positives bewirken konnten. Die Bilanz ist daher mehr als erfolgreich - dank unserer vielen aufopfernden und herzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Was hat Sie zu dieser Aufgabe motiviert?
Zusammenhalt und Für-Einander-Dasein hat mich mein Leben lang begleitet. Ich bin am Land aufgewachsen, wo Gemeinschaft und Helfen immer im Mittelpunkt des Dorflebens steht, und ich weiß, wie wichtig das für die Lebensqualität ist. Daher war es für mich überhaupt keine Frage, dass ich diese Funktion übernehme. Hier kann ich mich jeden Tag für Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe in der Gesellschaft einsetzen.
Inwieweit kommt Ihnen Ihre langjährige Erfahrung als Politiker zugute?
Natürlich schadet es nicht, das Parkett der Politik gut zu kennen und zu wissen, welche Hebel man betätigen kann, um für die Menschen die optimale Hilfe zu gewährleisten. Das OÖ Hilfswerk ist auch immer wieder in G espräche und Verhandlungen eingebunden, die sich mit der Situation in der Gesellschaft und mit Fragen der Betreuung, Pflege, Alten- und Jugendarbeit beschäftigen. Hier ist es hilfreich, ein gewisses Maß an politischen und diplomatischen Fähigkeiten mitzubringen.
werden vom Hilfswerk derzeit am dringendsten Mitarbeiterinnen ind Mitarbeiter gesucht?
Wir freuen uns über alle, die sich entscheiden, anderen Menschen helfen zu wollen. Ob diplomierte Pflegekräfte, Altenbetreuer/innen, Pflegeassistent/innen oder Heimhilfen – im OÖ Hilfswerk heißen wir alle helfenden Hände willkommen. Besonders die Mobile Pflege und Heimhilfe sind ein Schwerpunkt des OÖ Hilfswerk.
Was sind im Bereich der Pflege aktuell die größten Herausforderungen?
Die Menschen, die sich für diesen Beruf entschieden haben und ihr Engagement und ihre Empathie einbringen, verdienen es, gerecht entlohnt zu werden und faire Arbeitsbedingungen vorzufinden. Das OÖ Hilfswerk ist in diesem Bereich einer der beliebtesten und angesehensten Arbeitgeber. Das wirkt sich auch auf unser Service und unsere Leistungen aus. Die Herausforderung der Zukunft wird sein, die steigende Nachfrage nach unseren Angeboten weiterhin gut abzudecken und dieses Angebot an die sich ändernden Umstände qualitativ und quantitativ anzupassen.
Das OÖ Hilfswerk ist seit mehr als 25 Jahren ein bedeutender Dienstleister in der OÖ Soziallandschaft.
1.397 hauptberufliche und 300 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in der Kinderbetreuung, Jugendförderung und mobilen Pflegediensten professionelle und hochqualitative Hilfestellungen für Menschen in schwierigen Situationen.
Mobile Pflege, 24-StundenBetreuung, Essen auf Rädern, Tageszentren, Kurzzeit- und Urlaubspflege – das Hilfswerk ist Österreichs Nummer eins in der Pflege zu Hause. Laut aktuellen Prognosen werden in Österreich bis zum Jahr 2050 rund 200.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Wie sehen Sie diesen Prognosen entgegen?
Wir werden gerüstet sein. Auch wenn derzeit Pflege- und Betreuungskräfte Mangelberufe darstellen, sehen wir, dass sich immer mehr junge Menschen für einen Beruf in diesem Bereich interessieren und entscheiden. Das liegt auch daran, dass wir in Oberösterreich Ausbildungswege anbieten, die für die Jungen attraktiv und erfüllend sind. Schon diesen September starten wieder Lehrgänge an mehreren Fach- und Fachhochschulen z.B. mit der Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuung (FSB) mit Schwerpunkt Altenarbeit (inkl. Pflegeassistent/in). Viele der Lehrgänge sind für alle Personen. Und sie werden mit einem Pflegestipendium finanziell unterstützt. Der Zulauf zu den Ausbildungen lässt mich positiv in die Zukunft blicken.
Was muss gemacht werden, um mehr Menschen in Pflegeberufe zu bekommen und in welchem Bereich der Pflege
Sie sind auch heuer wieder im Rahmen von „Hilfswerk on Tour 2024“ in den Bezirken unterwegs. Wie wichtig ist der persönliche Kontakt zu den Menschen und mit welchen Anliegen kommen sie zu Ihnen?
Bei unseren Besuchen in den Bezirken merken wir, dass die vergangenen Jahre viele Probleme aufgeworfen haben und die Leute mehr Unterstützung suchen. Die Betreuung von älteren und kranken Menschen zu Hause ist ebenso ein Thema, wie die Betreuung von Kindern in Krabbelstuben, Kindergärten und Nachmittagsbetreuungen. Aus diesen persönlichen Gesprächen erfahren wir, wo der Schuh drückt und können so unsere Leistungen besser an die Bedürfnisse der Menschen anpassen.
Was war in Ihrer Zeit als Obmann des OÖ Hilfswerk das berührendste Erlebnis?
Da gibt es sehr viele. Aber am meisten berührt mich, wenn ich bei meinen Besuchen in den Betreuungseinrichtungen sehe, mit welcher Hingabe und guter Laune unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich den Menschen zuwenden und wie viel Freude und Dankbarkeit dabei zurückkommt.
Im März hatte Sie einen schweren Unfall und waren im Spital selber auf Hilfe angewiesen. Wie geht es Ihnen und was war in dieser Zeit das Wichtigste für Sie?
Heute geht es mir wieder gut, danke. In der Zeit im Spital konnte ich mich voll und ganz auf die beste Betreuung verlassen. Zu sehen, dass im Ernstfall alles klappt und man gut aufgehoben und umsorgt ist, ist viel wert. Dieses Gefühl soll jeder Mensch in Oberösterreich haben, nicht zuletzt auch dank der Arbeit unserer Hilfswerkerinnen und Hilfswerker.

REDAKTION : Nicole Madlmayr FOTOS : OÖ. Gesundheitsholding
Sabrina Herbst (im Bild mit Töchterchen Chayenne) wollte schon immer in der Pflege arbeiten, doch die Ausbildung in Vollzeit war für die fünffache Mama nicht möglich. Durch das Teilzeit-Modell kann sie sich ihren Traum nun doch noch erfüllen.
Sabrina Herbst ist Mama von fünf Kindern und absolviert seit März 2022 die Ausbildung zur Pflegefachassistenz an der Schule für G esundheits- und Krankenpflege am Salzkammergut Klinikum Gmunden. In einem Teilzeitmodell mit insgesamt 30 Wochenstunden, damit auch die Betreuung ihrer Kinder sichergestellt ist. „Und das Schöne ist, dass ich am Nachmittag sogar noch Zeit für sie habe“, erzählt die 35-Jährige in unserem Interview.
Sie absolvieren Ihre Ausbildung in Teilzeit. Wie kann man sich das vorstellen?
Eigentlich wollte Sabrina Herbst (35) schon immer in einem Krankenhaus arbeiten. Doch die Ausbildung zur diplomierten Pflegekraft in Vollzeit konnte sie als Mutter von fünf Kindern nicht absolvieren. Jetzt kann sie sich ihren Traum doch noch erfüllen ...
Sabrina Herbst: Meine Ausbildung umfasst 30 Wochenstunden. Wir haben an fünf Tagen die Woche von 8 bis 13 Uhr Unterricht, zwei Mal davon im Distance Learning von zu Hause aus. Das ist besonders praktisch, weil sich alles super im Vorfeld organisieren lässt und ich am Nachmittag auch noch Zeit für meine Kinder habe. Nur während des Praktikums können diese Zeiten etwas abweichen, aber auch das lässt sich managen, weil man vonseiten der Gesundheitsholding viel Unterstützung bekommt.
Sie sind Mama von fünf Kindern, die noch sehr klein waren, als Sie die Ausbildung gestartet haben …
Als ich mit der Ausbildung begonnen habe, war meine Jüngste erst elf Monate alt. In dieser Zeit hat mir meine Schwiegermama sehr geholfen, bis ich den Platz in der Krabbelstube für sie hatte. Meine anderen Kinder waren im Kindergarten und in der Volksschule. Und nachdem der Unterricht ja um 13 Uhr zu Ende ist, lässt sich das gut managen. Organisation ist alles! Außerdem spielt sich alles ein und bei manchen Dingen muss man ein bisschen kürzertreten, damit es sich besser ausgeht. Ich bügle jetzt zum Beispiel weniger, damit ich mehr Zeit für meine Kinder habe (lacht).
Sie schließen Ihre Ausbildung kommenden September ab. Wissen Sie schon, in welchem Bereich Sie dann arbeiten möchten?
Momentan interessiert mich die Unfallambulanz sehr, darum würde ich gern in diesem Bereich arbeiten. Da weiß man nie, welche Verletzungen hereinkommen. Jeder Tag ist eine andere Herausforderung und das würde mir sehr taugen. Außerdem kann man bei dieser Arbeit auch seine Kompetenzen gut ausschöpfen.
Was ist für Sie das Besondere an einem Beruf in der Pflege?
Das Besondere ist für mich, dass wir Menschen helfen können. Vor meinen Karenzzeiten habe ich als Zahnarztassistentin gearbeitet, wobei mein Traumjob immer schon in der Pflege war. Allerdings hat es die Ausbildung zur diplomierten Pflegekraft damals nur in Vollzeit gegeben und als Alleinerziehende war das damals leider unmöglich für mich. Somit habe ich mich von diesem Traum verabschieden müssen und freue mich jetzt umso mehr, dass ich ihn mir doch noch erfüllen kann.
Ich habe die Entscheidung, diese Ausbildung zu absolvieren, noch an keinem einzigen Tag bereut.
Sabrina Herbst
Wie leicht oder schwer ist Ihnen die Entscheidung in Hinblick auf Kinderbetreuung usw. gefallen, die Ausbildung an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege zu starten?
Sehr leicht, da habe ich wirklich nicht mehr lange überlegen müssen (lacht). Zu wissen, dass die Ausbildung in Teilzeit möglich ist und es auch die Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor Ort gibt, hat mir die Entscheidung zusätzlich erleichtert. Ich habe sie auch noch an keinem Tag bereut. Eine Herausforderung war eigentlich nur die Betreuung meiner Jüngsten, weil es um sechs Monate gegangen ist, bis ich den Platz in der Krabbelstube für sie hatte.
Wie gefällt Ihnen die Ausbildung? Gibt es etwas, was Ihnen besonders taugt?
Es gibt eigentlich nichts, was mir nicht taugt. Ich gehe sehr gern in die Schule – und das habe ich bisher noch nie sagen können (lacht). Man lernt so viel dazu und stößt auch mal an seine eigenen Grenzen, aber in Summe ist es ein einzigartiger Lernprozess. Man profitiert persönlich sehr und wächst daran.
Was können Sie anderen Frauen und Müttern sagen, die auch überlegen, eine Ausbildung im Gesundheitswesen zu machen?
Ich möchte allen Frauen und besonders jenen, die auch Kinder haben, Mut machen, es sich zuzutrauen. Natürlich ist es am Anfang eine Herausforderung, aber man bekommt so viel Unterstützung und wächst mit diesen Aufgaben. Die anfängliche Unsicherheit verfliegt mit der Zeit. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden!
MAG. MARTINA BRUCKNER, Leiterin der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.

Seit 2021 bietet die OÖ. Gesundheitsholding Ausbildungen in Teilzeit an. Wie kann man sich das vorstellen?
Die Teilzeitausbildung gibt es in unterschiedlichem Ausmaß – mit 25 oder 30 Wochenstunden zum Beispiel, geblockt, jeden Tag nur bis Mittag oder an einzelnen Tagen. Die Modelle sind je nach Standort unterschiedlich, aber man kann jede Ausbildung so absolvieren, dass sie mit den individuellen Lebensumständen gut vereinbar ist. Auch eine Höherqualifizierung ist bei uns flexibel möglich, wenn jemand zum Beispiel nach zwei Jahren im Job eine Aufschulung zur Pflegefachassistenz machen möchte. Bei einer Vollzeitausbildung mit 40 Wochenstunden dauert das ein Jahr. Geht sich Vollzeit nicht aus, weil etwa Kinder zu betreuen sind, dann ist es auch in der Teilzeitvariante möglich, die in etwa eineinhalb Jahre dauert.
Warum war es so wichtig, flexiblere Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen?
Früher hat es ausschließlich Vollzeitausbildungen gegeben, was für viele Berufsumsteiger und Menschen mit Betreuungspflichten ein Problem war. Um hier ein flexibles Angebot schaffen zu können, haben wir die Teilzeitausbildung entwickelt. Eine Umfrage aus dem Jahr 2022 unter den Auszubildenden hat uns gezeigt, dass 37,9 Prozent Betreuungspflichten haben – und ihnen somit die Möglichkeit der Teilzeitausbildung besonders wichtig war. 96,6 Prozent der Befragten haben zudem angegeben, dass die Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung einen enorm wichtigen Stellenwert für sie hat. Der überwiegende Teil unserer Auszubildenden ist weiblich. Darum ist es wichtig, besonders für Frauen ein Angebot zu schaffen, damit sie ihren Wunschberuf erlernen können. Aus diesem Grund gibt es bei allen unseren Standorten auch die Möglichkeit der Kinderbetreuung, deren Öffnungszeiten zum überwiegenden Teil an die Dienstzeiten unserer Mitarbeiter angepasst sind. Wenn man weiß, dass die Kinder gut versorgt sind, kann man die Ausbildung ruhigen Gewissens absolvieren.
Was hat sich seit dem Start der Teilzeitausbildung geändert?
Wie sind die Rückmeldungen?
Die Pflege war schon immer ein frauendominierter Beruf und ist es nach wie vor. Was sich verändert hat, ist die Zielgruppe. Früher lag der Schwerpunkt bei jüngeren Frauen ab dem 17. Lebensjahr. Jetzt sind auch Frauen in der Ausbildung, die Betreuungspflichten oder einen anderen Erstberuf haben. Die Rückmeldungen sind extrem positiv! Die Umfrage hat uns gezeigt, dass die Auszubildenden diese Flexibilität sehr schätzen und der überwiegende Teil die Ausbildung jederzeit wieder so absolvieren würde. Natürlich ist die Ausbildung herausfordernd, aber wir haben mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, um sie individuell an die Bedarfe unserer Auszubildenden und deren Lebensumstände anzupassen und jeden dort zu unterstützen, wo er es braucht.
Infos zu den Teilzeitausbildungen: www.ooeg.at/pflegeausbildung

(v. l.:) Stefanie Grill und Julia Wellek mögen die Abwechslung an ihrem Beruf als Pflegefachassistentinnen auf der Station der I. Chirurgie.
Julia Wellek (20) und Stefanie Grill (28):
Für die beiden Pflegefachassistentinnen am Klinikum Wels-Grieskirchen ist Pflege nicht nur ein Beruf. Wie bei fast allen Jobs in der Gesundheitsversorgung steckt eine Berufung dahinter. Nicht umsonst lautet der Claim des Klinikums „Berufung Leben“. Auf der Station der Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie setzen die jungen Pflegekräfte gezielt ihre Talente ein, um den herausfordernden Arbeitsalltag zu meistern.
„Der tägliche Umgang mit Menschen macht uns Spaß“, verraten die Pflegefachassistentinnen Julia Wellek und Stefanie Grill. „Und uns gefällt, dass wir in unserem Beruf eine hohe Verantwortung übernehmen dürfen.“ Ihre Station betreut Patienten der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, welche gemeinsam mit der gleichnamigen Abteilung des Kepler Universitätsklinikums das größte Referenzzentrum für Herzchirurgie in Österreich bildet. Dort nehmen Julia Wellek und Stefanie Grill eine zentrale Rolle in der Patientenversorgung ein – zum Beispiel rund um eine OP.

Abwechslungsreich. „Auf unserer Station wird es nie langweilig“, erzählen die beiden. „Einerseits gibt es die geplanten Aufnahmen, da finden im Vorfeld der Operation das Anamnesegespräch, aber auch Untersuchungen und Vorbereitungen statt. Außerplanmäßig kommt es auch immer wieder zu Notaufnahmen. Nach einem chirurgischen Eingriff sind zum Beispiel die Wunddokumentation sowie Verbandskontrolle und -wechsel wichtig.“ Die Arbeit in der Pflege ist abwechslungsreich, jeder Tag gestaltet sich anders. Das macht die Arbeit als Pflegefachassistenz interessant. „Viele aus meiner Familie arbeiten im Gesundheitsbereich. Auch wenn es oft herausfordernd ist, bereue ich es nicht, diesen Beruf gewählt zu haben“, sagt Julia Wellek.
Wege in die Pflege. Stefanie Grill lebt in Roßleithen, ihre Hobbys sind Snowboarden, ihr Hund und das Rote Kreuz. Nach Berufserfahrungen in der Gastronomie wechselte sie während der Pandemie in die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz am Ausbildungszentrum Wels. Diese schloss sie im September 2023 ab, wie auch ihre Kollegin Julia Wellek, die in St. Marienkirchen an der Polsenz zu Hause ist. Die Freizeit widmet Julia dem Tauchen, Reiten, Reisen und ihrem Hund. Bereits an der Fach-
Am Klinikum werden Stellen für ein Ferialpraktikum angeboten. Das ist eine gute Gelegenheit, den Krankenhausalltag hautnah zu erleben.
Julia Wellek, Pflegefachassistentin (PFA)
schule Bergheim hat sie sich auf den Schwerpunkt „Gesundheit und soziale Berufe“ fokussiert.
„Die folgenden zwei Jahre am Ausbildungszentrum waren schnell vorbei, die Lerninhalte geballt und intensiv – vor allem die Theorieblocks mit Anatomie, Physiologie und Medikamentenmanagement.“ Derzeit arbeiten die beiden Pflegefachassistentinnen in einem Teilzeitmodell mit 30 Wochenstunden. „Wir belegen nämlich zusätzlich ergänzende FH-Kurse zu Pflegewissenschaften und für den Englischnachweis Niveau B2, um ab September 2024 ins dritte Semester des Bachelorstudiums Gesundheits- und Krankenpflege einzusteigen.“
Unsere Tipps für die Jungen Allen, die sich für einen Pflegeberuf interessieren, rät Stefanie: „Einfach einmal hineinschnuppern – ist es wirklich das Richtige für mich? Man braucht ein Gespür für den Menschen, Empathie und Interesse für den menschlichen Körper.“ Julia ergänzt: „Am Klinikum werden Stellen für ein Ferialpraktikum angeboten, das ist eine gute Gelegenheit, den Krankenhausalltag hautnah zu erleben.“
Für den Pflegeberuf braucht man ein Gespür für den Menschen, Empathie und Interesse für den menschlichen Körper.
Stefanie Grill, Pflegefachassistentin

(PFA)
PFLEGEJOBS AM KLINIKUM WELS-GRIESKIRCHEN.
Hier finden Pflegekräfte vielseitige Arbeitsbereiche karriere.klinikum-wegr.at/jobs


„Ich pflege aus Liebe zum Menschen“
Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Michaela Grammer als Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit im Gemeindealtenheim Grünburg. Im Interview lässt sie uns an ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben.
REDAKTION : Ulli Wright FOTO : www.sinnstifter.at
Im Jahr 2002 hat Michaela Grammer im Gemeindealtenheim Grünburg als Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit (FSBA) ihren Dienst begonnen. Im Interview verrät sie, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat, was das Schöne daran ist, und was sie sich wünschen würde, wenn sie, wie im Märchen, drei Wünsche frei hätte.
F rau Grammer, warum haben Sie sich für den Pflegeberuf entschieden?
Aus Liebe zum Menschen und auch deshalb, weil ich gerne Menschen umsorge. Der Beruf ist für mich eine Berufung.
Wie sind Sie zu Ihrem Beruf in der Altenarbeit gekommen?
Eine Freundin von mir hat ein Schnupperpraktikum in einem Altenheim absolviert und dadurch mein Interesse geweckt. Daraufhin habe ich mich dazu entschieden, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Anschließend habe ich die zweijährige SOB/Schule für Sozialbetreuungsberufe Steyr absolviert und in meinem Beruf zu arbeiten begonnen.
Sie üben Ihren Beruf bereits seit mehr als 20 Jahren aus. Was macht Ihnen daran Spaß und Freude?
Die Arbeit mit und an Menschen sowie auch die Zusammenarbeit im Team machen mir sehr viel Freude. Es sind vor allem die Beziehungen und Gespräche mit den Menschen, die ich an meinem Beruf sehr schätze. Außerdem kann ich körperlich aktiv sein und mich persönlich wie auch fachlich durch Weiterbildungen und Fortbildungen laufend weiterentwickeln.
Was gefällt Ihnen an der Tätigkeit mit den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern?
Die Beziehung zu den Heimbewohnerinnen und -bewohnern sowie das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen, sind eine große Bereicherung für mich. Vor allem auch deshalb, weil die Menschen über viel Lebenserfahrung verfügen. Ein gegenseitiger ehrlicher Umgang ist mir sehr wichtig und ich finde es erfüllend, unsere Bewohnerinnen und Bewohner auf ihrem letzten Stück des Weges begleiten zu dürfen.
Welche Fähigkeiten und Talente sollten Pflegekräfte generell mitbringen?
Neben Geduld, Mitgefühl, Empathie und Einfühlungsvermögen sind vor allem auch Teamgeist sowie körperliche und psychische Belastbarkeit wichtige Eigenschaften, die man für einen Beruf in der Pflege mitbringen soll.
Was brauchen die Bewohner Bewohnerinnen in einem Altenheim?
Sie brauchen nicht nur die Pflege des Körpers. Für das allgemeine Wohlbefinden braucht es mehr, vor allem eine familiäre und soziale Bindung. Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse und auf die muss man eingehen. Daher sind aktives Zuhören und Reflektieren gefragt. Oft sind auch Themen wie biografisches Aufarbeiten und professionelle Unterstützung von Psychotherapeuten notwendig.
Wenn Sie, wie im Märchen, drei Wünsche frei hätten, welche wären das?
Erstens täte ich mir wünschen, dass sich jeder Mensch Gedanken und Überlegungen macht, wie sie oder er gerne alt werden möchte und was es dazu braucht.
Die Heimbewohnerinnen und -bewohner brauchen nicht nur die Pflege des Körpers. Für das allgemeine Wohlbefinden braucht es mehr, vor allem eine familiäre und soziale Bindung.
Michaela Grammer
Zweitens würde ich mir eine Gehaltsanpassung wünschen, also eine Anpassung, was die Wertschätzung zu dieser Tätigkeit mit Verantwortung widerspiegelt. Und drittens stünden mehr professionelle Helferinnen und Helfer, Ärztinnen und Ärzte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit Schwerpunkt Geriatrie auf meiner Wunschliste.
Informationen zu Berufsfeldern und Ausbildungen im Bereich Sozial- und Gesundheitsberufen sowie eine Jobbörse finden Sie auf der Homepage www.sinnstifter.at
Emely Osterkorn kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen, als in einem Operationssaal zu arbeiten. Aus diesem Grund absolviert sie gerade die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin, die es seit dem Vorjahr am Kepler Universitätsklinikum in Linz gibt. REDAKTION: Nicole Madlmayr | FOTOS: Dominik Derflinger
Ein offener Brustkorb und sehen, wie das Herz darin schlägt und sich die Lungenflügel heben und senken – für Emely Osterkorn war das ein ganz besonderer Moment während ihres ersten Praktikums im OP. „Das sehen zu dürfen, war ein überwältigendes Gefühl“, schwärmt die 21-Jährige. Sie absolviert gerade die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und medizinische Assistenzberufe des Kepler Universitätsklinikums in Linz, einem von neun Schulstandorten der OÖ. Gesundheitsholding. Wir haben sie zwischen Unterricht und OP am Neuromed-Campus zum Interview getroffen.
Sie machen die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin. Warum haben Sie sich für die Arbeit im OP entschieden?
Emely Osterkorn: Ich war schon immer sehr begeistert von der Medizin und habe sogar über ein Medizinstudium nachgedacht. Allerdings war mir die Studienzeit zu lange. Bis man den Facharzttitel hat, vergehen Jahre. Aus diesem Grund habe ich mich dagegen entschieden, allerdings hat mich die Medizin nie losgelassen. Und als ich von der neuen Ausbildungsmöglichkeit zur Operationstechnischen Assistenz gehört habe, war für mich klar, dass ich das machen möchte.

Seit April 2023 absolviert Emely Osterkorn die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin, die insgesamt drei Jahre dauert.
Sie haben davor in der Pädagogik gearbeitet und im April 2023 mit der OTA-Ausbildung begonnen. Wie gefällt es Ihnen bisher? War es die richtige Entscheidung? Definitiv! Die Ausbildung gefällt mir richtig gut. Schon beim ersten Praktikum im OP habe ich gemerkt, dass es mein Traumjob ist. Besondere Highlights waren für mich bisher die vier Praktika, die ich absolvieren durfte – vor allem jene im OP!
Und in welcher Richtung sehen Sie sich künftig?
Das finde ich im Moment noch schwierig zu sagen, weil ich sehr schnell sehr begeisterungsfähig bin (lacht). Mir hat es zum Beispiel auf der Herzchirurgie extrem gut gefallen, aber die Ortho-Trauma-Chirurgie hat mir auch sehr getaugt. Das Schöne ist, dass wir durch die unterschiedlichen Praktika einen guten Einblick in die verschiedenen chirurgischen Bereiche bekommen. Das wird mir dabei helfen, nach Ende der Ausbildung zu entscheiden, wo es beruflich hingehen soll.
Was ist für Sie das Besondere an dieser Arbeit?
Mich fasziniert vor allem, einen menschlichen Körper auf diese Art und Weise sehen zu dürfen. Zu sehen, wie das Innere aufgebaut ist und wie alles funktioniert, finde ich sehr spannend. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Praktikumstag in der Herz-ThoraxChirurgie erinnern. Es war eine HerzOP – und für mich ein überwältigendes Gefühl, zu sehen, wie dieses Herz schlägt und sich die beiden Lungenflügel heben und senken. In diesem Moment war ich einfach sprachlos. Was sind Ihre Aufgaben im Operationssaal?
Wir achten auch darauf, dass alles, was während der Operation im Körper drinnen war, wieder herauskommt.
Emely Osterkorn
Vor der Operation kümmern wir uns um die Vorbereitung der Instrumente. Außerdem nehmen wir den Patienten in Empfang und überprüfen sämtliche Daten. Während der Operation übernehmen wir die Dokumentation und instrumentieren, sprich, wir reichen der Chirurgin oder dem Chirurgen das Operationsbesteck an. Gibt es etwas, das bei diesem Job Ihrer Meinung nach besonders wichtig ist?
Für mich ist Empathie sehr wichtig. Wir haben die Möglichkeit, den Patienten etwaige Ängste zu nehmen, weil wir vor der Narkose noch mit ihnen sprechen und sie dabei auch beruhigen können. Es ist wichtig, sich dabei in den Patienten hineinzuversetzen. Wie möchte ich behandelt werden, wenn ich am Operationstisch liegen würde?
Eine sehr wesentliche Rolle spielen auch Teamarbeit und Kommunikation. Wir sind ein multiprofessionelles Team, wo sehr viele Aufgaben und Berufe aufeinandertreffen und man gut zusammenarbeiten muss.
Welche Voraussetzungen braucht man, um diesen Job machen zu können?
Neben den formalen Aufnahmekriterien ist das Wichtigste, dass man es „sehen“ kann und einem während ei-

Emely Osterkorn liebt die Arbeit im OP. „Aber manchmal braucht man wirklich einen starken Magen“, sagt sie.
ner Operation nicht übel wird. Manchmal braucht man einen wirklich starken Magen (lacht). Neben Empathie, Teamarbeit und Kommunikation, die ich eben schon erwähnt habe, finde ich auch ein starkes Interesse am Job als wesentlich. Wir lernen während der Ausbildung sehr viel über Anatomie, allerdings schadet auch ein Grundmaß an technischem Verständnis nicht, weil wir sehr viele Geräte und Instrumente anwenden müssen. Außerdem muss man in einem OP auch multitaskingfähig sein. Man muss immer den Überblick behalten, was zum Beispiel die Sterilität angeht und was die verschiedenen Leute im OP machen. Die Chirurgen sind meistens sehr auf ihre eigene Arbeit fokussiert, die Verantwortung für die Abläufe im OP liegt deshalb ein Stück weit bei uns. Wir achten auch darauf, dass alles, was im Körper drinnen war, wieder herauskommt. Kleinere Instrumente, wie Klemmen für Gefäße, werden abgezählt. Sehr wichtig sind auch Tupfer, die im Körper waren. Sie verfärben sich durch das Blut rot. Da muss man wirklich sehr genau schauen, dass nichts im Körper vergessen wird.
Bei jeder Operation können Komplikationen auftreten. Wie empfinden Sie die Verantwortung bei Ihrer Arbeit?
Die Verantwortung ist tatsächlich groß. Aber auch wenn einmal Komplikationen auftreten, weiß ich, dass wir alles geben, um einem Patienten helfen zu können. Am Ende des Tages gehe ich mit dem guten Gefühl heim, einen Beruf und eine Aufgabe zu haben, die sinnstiftend sind und mich erfüllen.
Für Caroline Scheuer war es wichtig, vor der Masterausbildung ausreichend Erfahrungen am Krankenbett zu sammeln. Durch das Klinikum wurde sie während des Studiums durch eine Bildungsteilzeit unterstützt.

Caroline Scheuer (26) ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Station der Abteilung für Innere Medizin V am Klinikum-Standort Grieskirchen. In ihren Aufgabenbereich fällt die selbstständige und eigenverantwortliche Pflege der Patientinnen und Patienten. Aus Erfahrung kennt sie die vielfältigen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in ihrer Branche. Davon profitiert sie beruflich wie privat.
Nach dem dreijährigen Bachelorstudiengang „Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege“ und einigen Jahren in der Praxis hat sich Caroline Scheuer für die Masterausbildung „Management for Health Professionals“ mit dem Schwerpunkt Krankenhausmanagement entschieden. „Das Klinikum hat mich durch die Möglichkeit einer Bildungsteilzeit unterstützt“, sagt die gebürtige Riederin. „Seit dem Masterabschluss im September 2023 arbeite ich 20 Stunden auf der Station mit Patienten und 20 Stunden in der Krankenhausverwaltung im Rahmen von IT- und Digitalisierungsprojekten. Donnerstags und freitags habe ich fixe Bürozeiten von 6:30 bis 15 Uhr und nehme anlassbezogen an Meetings teil. Danach richtet sich die zuständige Stationsleitung bei der Dienstplanung.“
„Es gibt viele Gründe, die für eine Pflegeausbildung sprechen“, so Caroline Scheuer. „Pflege ist nicht nur ein Job, sondern ein schöner Beruf und wichtiger Beitrag für die Gesellschaft. Es kommt so viel zurück vonseiten der Patienten und der Angehörigen – die Dankbarkeit, die zum Beispiel durch ein Lächeln Ausdruck findet. Es gibt vielfältige Einsatzgebiete und verschiedenste Wege der Weiterbildung – im Krankenhaus auf der Station, Ambulanz, Notfallversorgung, Anästhesie oder in Intensivbereichen, im Heim, in der Hauskrankenpflege, im Management, in der Lehre … wir werden überall gebraucht.“

Es ist mir ein Anliegen, das Image der Pflege zu heben. Der Beruf ist wunderschön.
Caroline Scheuer, MSc, DGKP, Klinikum Wels-Grieskirchen
Erfahrung am Krankenbett. Für Scheuer war es wichtig, vor dem Masterstudium ausreichend Erfahrungen am Krankenbett zu sammeln. „Meine heutige Sicht auf die Arbeit mit den Patienten ist eine andere als vor dem Masterstudium. So gehe ich zum Beispiel bewusster mit Ressourcen um, kann abschätzen, inwieweit neue Konzepte praktikabel sind und gebe meinen Erfahrungsschatz und mein Wissen weiter. Im Kreis der Kolleginnen bin ich immer noch super integriert und werde auch gefordert, so profitieren wir alle vom Wissensaustausch.“
Pflege ist mehr. Für Caroline Scheuer ist Pflege ein wunderschöner Beruf mit vielen Dimensionen: „Einerseits ist es toll, den Menschen durch unsere Tätigkeit helfen zu können. Andererseits verfügen wir auch über viel medizinisches Wissen, das auch nach dem Dienst nicht endet – bei Notfällen im privaten Umfeld wissen wir, wie man richtig reagiert.“ Auch über die Zukunft der Pflege macht sie sich Gedanken: „Wichtig wären neue Rahmenbedingungen, auch in finanzieller Hinsicht, um mehr Menschen in die Ausbildung zu holen. Denn Pflege ist mehr als zum Beispiel Körperpflege. Die Qualifikation von Pflegekräften ist überaus hoch und spezialisiert. Dieses Bewusstsein ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen.“
PFLEGEJOBS AM KLINIKUM WELS-GRIESKIRCHEN.
Pflege ist keine Einbahnstraße: Durch das Masterstudium tun sich viele Dimensionen in der Pflege auf, zum Beispiel Management, Lehre, Wissenschaft oder IT.
Hier finden Pflegekräfte vielseitige Arbeitsbereiche karriere.klinikum-wegr.at/jobs


Marites Steiner ist es ein großes Anliegen, die Selbstständigkeit der Bewohner und Bewohnerinnen zu fördern.
Marites Steiner (53) aus Kirchdorf an der Krems arbeitet als Fachsozialbetreuerin Altenarbeit im Bezirksaltenund Pflegeheim Kirchdorf. Zusätzlich ist sie Trainerin für Kinaesthetics Stufe 2 und Mentorin zur Begleitung von Praktikanten und Mitarbeitern.
Marites Steiner kam als Quereinsteigerin in den Pflegeberuf. Mittlerweile ist die 53-Jährige seit 14 Jahren als Fachsozialbetreuerin Altenarbeit im Bezirksalten- und Pflegeheim Kirchdorf an der Krems tätig. Warum sie diesen Beruf ergriffen hat und was ihr daran Spaß macht, hat uns die 53-Jährige im Interview erzählt.
Frau Steiner, wie sind Sie zu Ihrem Beruf in der Altenarbeit gekommen?
Marites Steiner: Ich habe auf einem Flyer gelesen, dass man ohne Ausbildung nach Österreich kommen kann. Damals wurden 500 Leute gesucht, die eine Pflegeausbildung machen möchten. Obwohl ich wenig Deutschkenntnisse hatte, bin ich mit dem Zug zur Veranstaltung nach Linz gefahren. Getreu meinem Motto: „Man kann nicht wissen, ob man dafür geeignet ist, wenn man es nicht probiert!“ Mittlerweile bin ich 14 Jahre in diesem Beruf im Altenund Pflegeheim in Kirchdorf tätig. Warum haben Sie diesen Beruf ergriffen?
Weil der Pflegeberuf erfüllend ist. Ich verdiene nicht nur Geld, sondern bekomme auch viel Lob und Dankbarkeit von den alten Menschen, die ich betreue. Ich bin stolz auf mich, wenn unsere Bewohnerinnen und Bewohner zufrieden sind, lachen, ihre Emotionen ausdrücken können und mir ihr Vertrauen schenken. In meiner Arbeit wird mir auch immer wieder bewusst, dass alte Menschen von jungen Menschen lernen können und auch umgekehrt. Ich erfahre viel vom Leben unserer Bewohnerinnen und Bewohner und auch von den Überlebensstrategien, die sie in schwierigen Zeiten entwickelt haben. Jeder einzelne Mensch in unserem Heim ist interessant. Ich lerne nicht nur ihren Namen kennen, sondern kann auch in ihre Seele blicken. Durch meine Arbeit hat sich die Sichtweise auf mein Privatleben verändert und ich blicke vor allem auf die positiven Dinge.
Was macht Ihnen an Ihrem Beruf Freude?
Durch das Beobachten der Verhaltensweisen und Emotionen von alten Menschen kann ich wie eine professionelle Forscherin arbeiten, mich persönlich weiterentwickeln und helfen, dass es ihnen emotional besser geht.
Was gefällt Ihnen an der Tätigkeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern?
Mir persönlich gefallen alle Tätigkeiten. Ich begleite unsere Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem alltäglichen Leben und unterstütze sie, wo sie mich brauchen. Ich pflege sie nach den Ritualen, die sie gewohnt sind, und trage dazu bei, ihre Gesundheit zu erhalten.

Durch meine Arbeit hat sich die Sichtweise auf mein Privatleben verändert!
Welche Fähigkeiten und Talente sollten Pflegekräfte generell mitbringen?
Humor, Ehrlichkeit, Verständnis, Akzeptanz, Respekt und Offenheit sind ganz wichtige Eigenschaften. Pflegekräfte sollen aber auch geduldig und flexibel sein sowie gut zuhören können. Neben professionellem Wissen und permanenter Weiterbildungsbereitschaft ist es ganz wichtig, Sicherheit vermitteln zu können, da bei alten Menschen durch ihre veränderte Lebenssituation die Ängste und Sorgen groß sind.
Warum empfehlen Sie Ihren Beruf weiter?
Weil man das erworbene Wissen und die Kenntnisse überall einsetzen kann. Auch privat, im Freundeskreis, in der Familie usw.
Möchten Sie rund um Ihre Tätigkeit in der Altenarbeit noch etwas loswerden?
Meine Tätigkeiten als Pflegerin in der Altenarbeit sind nicht nur die „Warm, satt, sauber“-Pflege, genauso wichtig ist die Seelenpflege der Menschen, die bei uns wohnen. Wichtig ist in meinem
Beruf auch, dass man vielschichtig denken kann, da es um die Auseinandersetzung mit den Gedanken und Gefühlen der alten Menschen geht. Ich fördere die Selbstständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner, damit sie wieder selbstständiger essen und trinken oder ihre Körperpflege mit weniger Unterstützung durchführen können. Indem ich ihre Meinung und Entscheidungen ernst nehme, fördere ich auch ihre Lebensqualität, Verraten Sie uns noch, was Sie gerne in Ihrer Freizeit machen? Tanzen, kochen und basteln. Informationen zu Berufsfeldern und Ausbildungen im Bereich Sozial- und Gesundheitsberufe sowie eine Jobbörse finden Sie auf der Homepage www.sinnstifter.at

Die letzte Lebensphase von Menschen pflegerisch fachlich und menschlich zu begleiten, ist die Aufgabe der Pflegekräfte im Hospiz.
Nadine Guntner, Leiterin vom St. Barbara Hospiz in Ried im Innkreis, und Cornelia Baumann, Leiterin des St. Barbara Hospiz Linz, geben uns einen Einlick in ihren Beruf.
REDAKTION : Ulli Wright | FOTO: privat
Sie sind sympathisch und kompetent, und wenn man mit ihnen über ihren Job spricht, merkt man, dass sie diesen mit viel Herzblut und Engagement ausüben. Die Rede ist von Nadine Guntner (34), Leiterin des St. Barbara Hospiz Ried, und Cornelia Baumann (38), Leiterin des St. Barbara Hospiz Linz. Beide betreuen mit ihren jeweils rund 20-köpfigen Teams Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Mit welchen Herausforderungen ihr Job verbunden ist, und dass der Alltag im Hospiz durchaus lustig und bunt ist, haben sie uns im Interview erzählt.
Wie geht es Ihnen aktuell?
C. Baumann: Mir geht es gut, wir betreuen momentan zehn Menschen und expandieren, weil wir zu unserem stationären Hospiz auch ein Tageshospiz bekommen. Das ist vorerst einmalig in Oberösterreich und wir sind die Vorreiter.
N. Guntner: Auch mir geht es gut. Wir haben in Ried sechs Plätze für Bewohnerinnen und Bewohner und auch bei uns wird es in den nächsten Jahren ein Tageshospiz geben.
Was sind derzeit für Sie jeweils die größten Herausforderungen?
N. Guntner: Wir haben in der letzten Zeit sehr viele junge Bewohner und Bewohnerinnen versorgt, was für das Team eine große Herausforderung ist. Wenn man die ganze psychosoziale Komponente mit Kindern und jungen Eltern mitbetreut, kann einen das selber triggern und es ist oft schwierig, sich abzugrenzen, wenn die Situationen dem eigenen Leben recht ähnlich sind.
Wie gehen Sie damit um?
N. Guntner: Grundsätzlich kommen wir einmal im Monat zur Besprechung oder Supervision zusammen, wo ein sehr guter Austausch stattfindet und auch Tränen fließen können. Treten akut Probleme auf, besprechen wir das im Alltag, und als Leiterinnen sind wir für unsere Mitarbeiter 24/7 erreichbar. Wenn eine Situation sehr belastend ist, dann können uns die Pflegekräfte auch am Wochenende, am Feiertag oder am Abend kontaktieren.
Was ist bei Ihnen die Herausforderung, Frau Baumann?
C. Baumann: Auch uns fällt auf, dass die Hospizbewohner und -bewohnerinnen immer jünger werden und wie Nadine Guntner schon angesprochen hat, ist die Betreuung der Angehörigen sehr intensiv. Da gibt es Eltern, die im Berufsleben stehen, es gibt Geschwister oder Lebenspartner und auch sie können sich unserer professionellen Begleitung sicher sein.
Sie betreuen und begleiten Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Was sind die Anforderungen an eine Pflegekraft im Hospiz?
N. Guntner: Man sollte eine gewisse Berufserfahrung haben und mit beiden Beinen fest im Leben stehen, weil einen gewisse Schicksale aus der Bahn werfen können. Da wir auch Ressourcen für komplementäre Anwendungen wie Wickelauflagen oder Aromatherapie haben, sollte man dafür offen sein. In Kombination mit der Medizin tun diese Behandlungen den Menschen gut und können von symptombelastenden Situationen ablenken. Man braucht in unserem Job eine gesunde Distanz und einen pragmatischen Blick. Zu viele Emotionen sind nicht gut, da diese Personen erfahrungsgemäß eher zum Ausbrennen neigen. Gilt das für Sie auch, Frau Baumann?
C. Baumann: Ja, unsere Pflegekräfte sollen so selbstreflektiert sein, dass sie offen ansprechen, wenn ihnen eine Situation zu nahe geht. Nur dann kann man sie auch gut begleiten oder eine Einzel-Supervision organisieren. Wir lassen niemanden alleine, egal wie lange sie oder er schon in diesem Bereich arbeitet. Braucht man eine spezielle Ausbildung, um im Hospiz arbeiten zu können?
tend die Weiterbildung zur Praxisanleiterin zu machen. Das ist wichtig, weil wir auch Praktikantinnen und Praktikanten beschäftigen. Sie sind eventuell die Mitarbeiter von morgen und sollen gut an unser spezielles Handlungsfeld herangeführt und in unser interprofessionelles Team integriert wer den. Eine weitere Mitarbeiterin startet ihre berufsbegleitende Weiterbildung „Komplementäre Pflege – Therapeutic Touch“. Diese Berührungen lindern Angst und Schmerz, verbessern die Wundheilung, erzeugen Tiefentspannung und steigern das Wohlbefinden. Den Alltag in einem stationären Hospiz stellt man sich sehr traurig und tragisch vor. Wie ist das in Realität?


Pflege ist, wenn man lernt, mit Augen und Händen zu sagen und zu verstehen, was mit Ohren nicht gehört oder mit Worten nicht gesagt werden kann.
Angelehnt an das Zitat von Gerda Jagnow leitet Nadine Guntner das St. Barbara Hospiz Ried im Innkreis.
N. Guntner: Zur allgemeinen Pflegeausbildung sollte man den interprofessionellen Basislehrgang für Palliative Care absolvieren, zusätzlich kann man auf der Universität eine Ausbildung machen. Wir besuchen auch regelmäßig einschlägige Fort- und Weiterbildungen, wie z.B. Palliativ-Tage. Da gibt es ein breites Angebot und wir sind sehr gut vernetzt.
C. Baumann: Eine Mitarbeiterin hat sich dazu entschlossen, berufsbeglei-
Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl.
Unter diesem Motto leitet Cornelia Baumann das St. Barbara Hospiz am Standort Linz.
N. Guntner: Ganz im Gegenteil, bei uns steht das Leben im Vordergrund. Die Menschen wissen, warum sie zu uns kommen, da muss man nicht ständig die Krankheit oder den bevorstehenden Tod thematisieren. Zum Beispiel haben wir vor Ostern traditionell Palmbuschen gebunden und Eier gefärbt. Auch der Fasching wird bei uns gefeiert. Die gesamten Feste im Jahreskreis sind uns ein Anliegen. Es darf bunt sein und es darf gelacht werden.
C. Baumann: Wenn ein Einzug ins Hospiz bevorsteht, laden wir vorab schon An- und Zugehörige ein, sich umzusehen. Bei uns ist es hell, freundlich, man hört Musik aus den Zimmern oder unseren Therapiebegleithund „Dobby“ und die Pflegekräfte versprühen positiven Esprit. Die Menschen verbringen hier auch, so gut es geht, viel Zeit in den Gemeinschaftsräumen und bei schönem Wetter auf unserer Dachterrasse.
N. Guntner: In der Karwoche hatte ich Urlaub, als ich wieder zur Arbeit kam, warteten schon alle auf meinen Hund „Toffee“. Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich auch, wenn ab und zu meine zwei Söhne oder Kinder von unseren Pflegekräften mitkommen. Diese Abwechslung dient ebenso dem Symptommanagement.
ST. BARBARA HOSPIZ GmbH
Standort Linz
Harrachtraße 15. 4020 Linz
Tel.: 0732/7676 5770
Standort Ried
Schlossberg 1 4910 Ried/Innkreis
Tel.: 07752/602 1160
www.barbarahospiz.at

... es mich glücklich macht, mit meiner Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität meiner Bewohnerinnen und Bewohner zu leisten“, erzählt Lisa Jungwirth aus Linz im Interview und gibt einen Einblick in die Vielfalt ihres Berufes als Diplomierte Gesundheitsund Krankenpflegerin.
Die 24-jährige Lisa Jungwirth aus Linz ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitet im Seniorenzentrum Franckviertel, wo sie auch die Funktion der Wohnbereichsleiterin inne hat. In ihrer Freizeit geht sie gern ins Theater, schaut Filme, und sie kocht und bäckt sehr gerne.
Frau Jungwirth, wie sind Sie zu Ihrem Beruf in der Altenarbeit gekommen und wie lange üben Sie ihn schon aus?
Lisa Jungwirth: Seit meinem 15. Lebensjahr habe ich jedes Jahr meine Sommerferien als Ferialpraktikantin in unterschiedlichen Seniorenzentren verbracht. Seither hat mich die Freude im Umgang mit Seniorinnen und Senioren nicht mehr losgelassen und mich schließlich dazu bewogen, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu machen. Die Herausforderungen im Langzeitpflegebereich sind vielfältig und es gibt täglich etwas Neues zu lernen. Neben der medizinischen und pflegerischen Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner erleben und gestalten Pflegende bei uns deren Alltag wesentlich mit und es entstehen mit der Zeit oft vertrauensvolle Beziehungen. Im Herbst 2020 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, seitdem bin als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig. Haben Sie davor in einem anderen Berufsfeld gearbeitet und was hat Sie dazu bewogen zu wechseln?
Vor meiner Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenpflegerin habe ich eine AHS-Matura abgelegt. Mein ursprünglicher Plan war, direkt nach der Berufsausbildung noch ein Studium im Verwaltungsbereich zu absolvieren. Neben meinem im Oktober 2020 begonnenen Studium habe ich dann eine Arbeit im Bereich der Persönlichen Assistenz angefangen. Während der Coronapandemie habe ich mich dann dazu entschieden, mein Studium zu beenden und habe daraufhin im März 2021 als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Seniorenzentrum Franckviertel begonnen.
Was mögen Sie an Ihrem Beruf?
Mich begeistert vor allem, wie vielfältig und abwechslungsreich meine Arbeit ist und wie viel ich von Kolleginnen und Kollegen sowie auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern fachlich, aber auch persönlich dazulernen kann. Besonders jetzt, in meiner Funktion als Wohnbereichsleitung, kümmere ich mich um die unterschiedlichsten Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bin immer über alles, was im Wohnbereich und darüber hinaus im ganzen Haus passiert, informiert.
Was gefällt Ihnen an der Tätigkeit mit den Heimbewohnerinnen und -bewohnern?
Es gefällt mir, gemeinsam mit ihnen ihren Alltag mitgestalten zu dürfen und den letzten Lebensabschnitt dadurch wesentlich zu begleiten. Viele dieser Menschen haben außergewöhnliche Lebensgeschichten und bringen liebenswerte, teilweise auch herausfordernde Persönlichkeiten mit, denen es mit Wertschätzung und Humor zu begegnen gilt.
Welche Fähigkeiten und Talente sollten Pflegekräfte generell mitbringen?
Geduld, Empathie, Verlässlichkeit und eine grundsätzlich wohlwollende und wertschätzende Art den Menschen gegenüber sind meiner Meinung nach im Pflegebereich unerlässliche Fähigkeiten. Inzwischen erfordert die Gesundheits- und Krankenpflege auch die Bereitschaft, sich gerne mit fachlichen Themen auseinanderzusetzen, was ein grundsätzliches Interesse an medizinischem, pflegerischem aber auch psychosozialem Wissen voraussetzt.
Warum empfehlen Sie Ihren Beruf weiter?
Neben einer absolut sinnvollen Tätigkeit stellt der Pflegeberuf auch einen sicheren Arbeitsplatz dar. In jedem Bereich der Pflege werden Pflegende auch immer mit den neuen Erkenntnissen aus Medizin und Pflegeforschung konfrontiert und es besteht jederzeit die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich weiterzubilden. Mittlerweile gibt es verschiedenste Arbeitszeitmodelle in den unterschiedlichen Pflegebereichen und für jeden Geschmack den passenden Weg, Berufs- und Privatleben miteinander zu verbinden. Insbesondere als Gesundheits- und Krankenpflegerin/-pfleger sind die Möglichkeiten der Einsatzbereiche zahlreich und es besteht auch jederzeit die Möglichkeit, sich trotz gleichbleibendem Grundberuf zu verändern.
Wir erleben und gestalten den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner wesentlich mit und es entstehen mit der Zeit vertrauensvolle Beziehungen.
Lisa Jungwirth











Einst zählte Brigitte Haberl zu den ersten Orthopädie-Technikerinnen Österreichs. Heute
ist die Werkstättenleiterin bei Bandagist Heindl neben vielen weiteren Kolleginnen in bester weiblicher Gesellschaft. Wo modernstes Gesundheitshandwerk entsteht und Frauenpower gelebt wird.
Hier wird an Gipsmodellen gefeilt, da Kunststoff für die Herstellung einer Orthese erhitzt, und im Nebenraum wird ein Kunde in die Handhabung einer Prothese eingeführt: Als wir von Geschäftsführerin Alexandra Heindl und Werkstättenleiterin Brigitte Haberl durch das orthopädie-technische Zentrum neben dem UKH, in der Linzer Garnisonstraße 3, der größten Fachwerkstätte von Bandagist Heindl, geführt werden, herrscht reges Treiben. Das Arbeitsklima ist herzlich und zugleich höchst professionell –und noch etwas fällt uns auf: Viele der Bereiche sind weiblich dominiert. Laut Alexandra Heindl ist das in den insgesamt neun österreichweiten Fachwerkstätten schon längst nicht mehr die Ausnahme, sondern mittlerweile die Regel.
„Das freut uns natürlich sehr“, so die Vollblutunternehmerin. Was alles bei Bandagist Heindl gefertigt wird und warum das Familienunternehmen zur ersten Adresse im Bereich der Orthopädietechnik zählt, haben wir im Interview erfahren.
Der Name Heindl steht nicht nur für Markenprodukte namhafter Hersteller, sondern auch für modernste Fachwerkstätten auf höchstem Niveau. Was wird in den Produktionen alles gefertigt?
Brigitte Haberl: Unsere Fertigungen unterteilen sich in die Bereiche Orthetik und Prothetik, wo unter anderem mikroprozessorgesteuerte Gelenke zum Einsatz kommen. Während der Begriff „Prothetik“ alle Körperersatzteile umfasst, fällt unter den Begriff „Orthetik“ alles, was der Stütze und Korrektur von Körperteilen dient. Die Orthetik gliedert sich noch einmal in die Rumpforthetik, in die Kinderorthopädie, die Neuroorthopädie und die klinische Orthopädie. Unter Letztere fallen Hilfsmittel, die wir halbfertig beziehen und vor Ort individuell anpassen. Damit können wir eine schnellstmögliche Versorgung garantieren.
Die orthopädischen Behelfe und Hilfsmittel von Bandagist Heindl genießen einen sehr guten Ruf. Woran liegt das?
Alexandra Heindl: Wir setzen seit jeher auf die bestmögliche Ausbildung

unserer Mitarbeiter. Angefangen bei medizinischen und technischen Fortbildungen bis hin zu modernster Ausstattung unserer Fachwerkstätten. Es ist uns wichtig, dass es unseren Technikern an nichts fehlt, was sie für eine hochwertige Versorgung im Arbeitsalltag benötigen.
Brigitte Haberl: Wir arbeiten mit den neuesten Materialien und Technologien. Gleichzeitig steht bei uns die Individualität unserer Kunden im Mittelpunkt, weshalb sich unsere Mitarbeiter bereits im Laufe ihrer Ausbildung auf Teilbereiche der Orthopädietechnik spezialisieren. Wir zählen in der Orthopädietechnik seit Jahrzehnten zu den größten Lehrlingsausbildner Österreichs.
Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Lehrlinge aus?
Heindl: Neben einem grundsätzlich medizinischen Interesse und der Bereitschaft, die nötigen medizinischen Begrifflichkeiten zu verinnerlichen, achten wir in erster Linie auf die handwerklichen Fähigkeiten unserer Bewerber. Mit großer Freude beobachten wir, dass die Branche weiblicher wird. Aktuell beschäftigten wir sogar mehr Frauen als Männer.
Wie halten Sie sich über die neuesten Entwicklungen und Technologien in der orthopädischen Industrie auf dem Laufenden?
Heindl: Wir besuchen jährlich sehr viele Messen und Kongresse im In- und Ausland und sind in engem Austausch mit Fachärzten, Therapeuten und der orthopädietechnischen Industrie. Gleichzeitig stehen wir auch in Kontakt mit universitären Bereichen, wo wir unter anderem
Hochtechnologische 3D-Lösungen kommen beim traditionsreichen Familienunternehmen genauso zum Einsatz wie akkurate Handwerkskunst, wie hier beim Modellieren des Gipsmodells für ein Korsett.

auch an Forschungsprojekten beteiligt sind.
Können Sie uns einen Einblick in die Entstehung der orthopädischen Hilfsmittel geben? Wie ist hier der Ablauf?
Haberl: Im ersten Schritt erhält der Patient eine Verordnung vom Arzt. Danach kommt es zum Erstgespräch. Dieses erfolgt oft bereits im Krankenhaus. In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten wird festgelegt, was möglich ist und was nicht. Im nächsten Schritt wird mittels Gipses oder 3D-Scan ein Abdruck von der betroffenen Extremität bzw. Körperstelle genommen. Die weitere Versorgung und Fertigung
MADE IN AUSTRIA.
Brigitte Haberl und eine Mitarbeiterin beim Einstellen einer Prothese für einen Kunden. Die Prothesenversorgung und -fertigung zählt neben der Orthetik zum Haupttätigkeitsfeld der Fachwerkstätte in der Linzer Garnisonstraße.
erfolgt dann in unseren orthopädischen Fachwerkstätten. Während bei einem 3D-Scan das Modell virtuell am Computer bearbeitet wird, wird der Gipsabdruck mit Gips ausgegossen und anschließend modelliert. Das „Modellieren“ ist einer der wichtigsten Arbeitsschritte. Durch das fachgerechte Modellieren des Gipsmodells oder des 3-Scans wird sichergestellt, dass in weiterer Folge die Passform perfekt auf den Patienten abgestimmt ist und keine störenden Druckstellen bestehen. Auf die Gips- oder Schaumstoff-
modelle werden dann Kunststoffe oder Faserverbundstoffe, wie Carbonfasern, gemeinsam mit Gießharzen tiefgezogen. Die daraus entstandenen Schienen, Prothesenschäfte und Korsette werden bei einer Anprobe am Körper des Trägers auf ihre Passgenauigkeit überprüft, bevor sie fertiggestellt werden.
Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob bei einer Prothese oder Orthese 3D-Lösungen zum Einsatz kommen?
Haberl: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Der 3D-Scan hat zweifelsohne Vorteile, sowohl für den Kunden als auch den Techniker. Das mitunter unangenehm empfundene Auftragen von Gipsbinden am Körper entfällt und die daraus entstehenden Schaumstoffmodelle sind für die Weiterbearbeitung weniger schwer. In manchen Fällen ist es aber immer noch nötig, die Modellabnahme mit Gipsbinden durchzuführen. Babys und Kleinkinder etwa bewegen sich in der Regel sehr viel. Das erschwert einen genauen 3D -Scan. Hier setzt man meist auf die Gipslösung. Die gewählte Abdruck- bzw. Fertigungsmethode ist also immer von der Indikation des jeweiligen Patienten und der Art des benötigten Produktes abhängig.
Heindl: Auch der 3D-Druck hat Einzug in die orthopädietechnische Fertigung gehalten, ist aber noch kritisch zu hinterfragen. Zwar können mittels 3D-Drucks luftdurchlässigere Orthesen gebaut werden, gerade bei Babys und Kindern im Wachstum sind diese aber oft kontraproduktiv, da die Materialien nur
Mit großer Freude beobachten wir, dass die Branche weiblicher wird. Aktuell beschäftigten wir sogar mehr Frauen als Männer.
Alexandra Heindl

Alexandra Heindl ist oft und gerne im orthopädie-technischen Zentrum. Zu ihren Mitarbeitern hat die Geschäftsführerin ein freundschaftliches und sehr wertschätzendes Verhältnis.
Wir arbeiten mit den neuesten Materialien und Technologien. Gleichzeitig verlieren wir dabei nie die Individualität der Orthopädietechnik aus den Augen.
Brigitte Haberl

bedingt verformbar sind. Auch die größenmäßige Beschränkung stellt hier vielmals noch einen limitierenden Faktor dar.
Mit wie viel Wartezeit müssen die Patienten in etwa rechnen, bis sie die orthopädischen Behelfe und Hilfsmittel erhalten? Gibt es in bestimmten Fällen eine Zwischenlösung?
Haberl: Meist hängt das davon ab, wie schnell es zu den Terminen zur Anprobe kommt. Bei Bedarf, nach Operationen, kann das orthopädische Hilfsmittel innerhalb weniger Tage fertiggestellt werden. G erade in der Kinderorthopädie muss es aufgrund des fortschreitenden Wachstumsprozesses ohnehin oft sehr schnell gehen. Im Bereich der Prothetik wird bei Erstversorgungen eine Behelfsprothese zur Feststellung der individuellen Mobilität gefertigt. Nach längstens sechs Monaten wird evaluiert, mit welcher Prothese weiter versorgt wird.
Werden die maßgefertigten Produkte der Fachwerkstätten von der Krankenkasse unterstützt?
Heindl: Ja, alle Hilfsmittel, die aufgrund einer ärztlichen Verordnung bei uns gefertigt werden, werden zum Großteil von der Krankenkasse übernommen.
Brigitte Haberl ist seit zehn Jahren die Werkstättenleiterin im orthopädie-technischen Zentrum UKH, und das mit Leib und Seele.

Alle Einreichungen bei den Kostenträgern erfolgen durch uns.
Sie bieten in Ihren Fachwerkstätten auch einen eigenen Reparaturservice an. Was fällt hier alles darunter?
Heindl: Grundsätzlich bieten wir in allen unseren Fertigungsbereichen auch notwendige Reparaturarbeiten und Instandsetzungen an. Auch bei allfälligen Garantiefragen stehen wir unseren Kundinnen und Kunden gerne zur Verfügung. In unseren Reha-Werkstätten sowie in unseren orthopädie-technischen Werkstätten versuchen wir immer, bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.
Als einer von wenigen Unternehmen haben Sie Ihre Produktion in Österreich belassen. Was waren die Beweggründe dafür?
Heindl: In unseren Fachwerkstätten wird im Sinne des Patienten noch maßgefertigtes Gesundheitshandwerk betrieben. Jedes Hilfsmittel wird von unseren Mitarbeitern mit viel Liebe zum Detail und modernstem Fachwissen von Hand gefertigt bzw. individuell an die Anatomie des Patienten angepasst. Um diese Versorgungssicherheit bestmöglich zu garantieren, ist es wichtig, nah am Kunden zu sein und unsere Techniker nah am Ort der Fertigung zu haben. Aus diesem Grund kommt für uns eine Fertigung außerhalb der Landesgrenzen nicht infrage.
Wo sehen Sie im Bereich der Orthopädietechnik künftig den größten Bedarf?
Haberl: Mit der steigenden Lebenserwartung so-
wie der erhöhten Anzahl an chronischen Krankheiten wie Parkinson und Multiple Sklerose bekommt das Thema Remobilisierung immer mehr Relevanz. In der Neuroorthopädie bieten wir mit Elektrostimulation über Sensoren, wie etwa beim Mollii Suit und der Bioness Fußheberorthese, bereits zahlreiche Lösungen für die Koordinierung und Harmonisierung der Bewegungsabläufe.
Heindl: Mein größter Traum ist es, Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, mithilfe der Neuroorthopädie eines Tages zu mehr Mobilität zu verhelfen.
Bei Bandagist Heindl arbeiten Sie stets am Puls der Zeit. Ist bei Ihnen die künstliche Intelligenz ein Thema?
Heindl: Natürlich beobachten wir die aktuellen Entwicklungen und wie künstliche Intelligenz konkret in unserer Branche Einzug halten könnte. Wenngleich für mich feststeht, dass unsere Techniker immer maßgeblich für das Gelingen einer orthopädietechnischen Versorgung verantwortlich sein werden. KI fühlt nicht, und gerade das Feingefühl unserer Mitarbeiter ist es, was uns erfolgreich macht.
www.heindl-bandagist.at

HILFSMITTEL IM LIEBLINGSLOOK. Die Orthesen werden nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden gefertigt.

Echt vielfältig, echt menschlich, echt zukunftssicher – das sind Berufe in der Pflege. Mit einer gemeinsamen Kampagne unter dem Motto „Pflege ist echt“ machen die beiden Krankenhäuser Barmherzige Schwestern Ried und St. Josef Braunau nun erneut und verstärkt darauf aufmerksam.
Unter dem Dach des Ordensklinikum Innviertel bieten die beiden Krankenhäuser ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege einen abwechslungsreichen, sinnstiftenden Beruf mit vielen Möglichkeiten: Das ist die Kernbotschaft der Kampagne, die bereits seit dem Vorjahr auf Plakatwänden und in den sozialen Medien läuft. Nun kommen Pflegekräfte aus den beiden Spitälern auch im Radio zu Wort: In Interview-Spots erzählen sie ab Anfang Juni (und weiterhin auch online), was ihnen an ihrem Beruf besonders gefällt.
Seit ihrer Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin (DGKP) am Vinzentinum Ried, der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, ist Theresa auf der Inneren Medizin I tätig. Im Berufsalltag arbeitet sie mit onkologischen Patient*innen und schätzt den stationsübergreifenden Austausch mit ihren Kolleg*innen. Das familiäre Arbeitsklima, der Zusammenhalt und die gemeinsamen Feste und Feiern motivieren sie, im Innviertler Schwerpunktspital zu arbeiten.


Im Radio-Spot erzählt Michael, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger (DGKP), von der Vielfalt des Pflegeberufs. Dem Pflegeprofi gefällt an seiner Tätigkeit in der Orthopädie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried vor allem der persönliche Kontakt zu Patient*innen und Kolleg*innen, die ihm mit herzlichem „Innviertler Charme“ begegnen. Auch die Ermöglichung individueller Wünsche, wie Väterkarenz oder Sabbatical, schätzt der sportliche Familienvater am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried.

Sandra arbeitet als OP-Pflegekraft im Krankenhaus St. Josef in Braunau. Nach ihrer Ausbildung zur DGKP war für sie klar, dass die Arbeit mit Menschen ihre Leidenschaft ist. „Bereits seit dem ersten Tag verspürte man bei uns im Krankenhaus die besondere Wertschätzung und das gute Arbeitsklima, denn der respektvolle Umgang aller Berufsgruppen miteinander wird hier großgeschrieben“, berichtet Sandra. „Im OP hat man ständig mit Menschen zu tun, die ihr ganzes Vertrauen in unsere Hände legen, und wir geben dabei gemeinsam als Team unser Bestes, um diesem Vertrauen gerecht zu werden.“
Weitere Informationen zur Kampagne unter www.pflegeistecht.at


Hohe Wertschätzung. Mit ihren persönlichen Geschichten stehen die Mitarbeiter*innen stellvertretend für alle Pflegekräfte der beiden Innviertler Krankenhäuser, die ihre Stärken und Ressourcen unter dem Dach des Ordensklinikum Innviertel bündeln. Sie zeigen die Wertschätzung der Pflege in den beiden großen, aber dennoch familiären Krankenhäusern.
Ziel der Kampagne ist es, den Stellenwert der Pflegeberufe insgesamt weiter zu stärken. Natürlich geht es auch darum, neue Mitarbeiter*innen für Jobs in der Pflege zu gewinnen, sowohl erfahrene Pflegekräfte als auch Neu-, Quer- und Wiedereinsteiger*innen.
„Mit der Fortsetzung der Kampagne wollen wir überzeugend darstellen, dass Gesundheitsberufe in den Krankenhäusern Ried und Braunau attraktiv sind und was sie besonders auszeichnet“, erklären Pflegedirektorin Angela Huber MSc MBA, vom Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried, und Pflegedirektorin Sandra Kaufmann MSc, aus Braunau.
Die Kampagne läuft ab Anfang Juni auf dem Radiosender kronehit sowie auf den SocialMedia-Kanälen Facebook, Instagram und Youtube.


Die junge Innviertlerin Jana Bayer hat das Berufsfindungspraktikum an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Schärding absolviert. Schon am ersten Tag war für sie klar, dass es die absolut richtige Entscheidung gewesen ist.
REDAKTION: Nicole Madlmayr
FOTOS: OÖG
Für Jana Bayer war früh klar, dass sie einmal im Gesundheits- oder Sozialbereich arbeiten möchte. Weil sie nicht genau wusste, in welche Richtung es gehen soll, hat sie das Berufsfindungspraktikum an der Schule für Gesundheitsund Krankenpflege in Schärding absolviert. Dort hat sich die 26-Jährige so wohl gefühlt, dass sie nach ihrer Ausbildung und nach mehreren Jahren Tätigkeit am Klinikum Schärding vor zwei Jahren an die Schule zurückgekehrt ist – und zwar auf der anderen Seite des Lehrerpults. Jetzt unterrichtet sie und gibt ihr Fachwissen und ihre Begeisterung für die Pflege an die Auszubildenden weiter.
Das Berufsfindungspraktikum bietet umfassende Einblicke in die Tätigkeitsfelder sowie in theoretische Inhalte. Dann lässt sich viel klarer sagen, ob der Pflegeberuf wirklich das Richtige ist, und wenn nicht, ist das eine ebenso wichtige Erkenntnis.
Jana Bayer
Sie wollten nach der Matura ins Gesundheitswesen. Was hat Sie daran am meisten interessiert und auch fasziniert?
Jana Bayer: Ich hatte schon lange den Wunsch, nach meinem Schulabschluss im Gesundheits- oder Sozialbereich tätig zu werden. Ich bin ein offener und kommunikativer Mensch und genieße den Kontakt zu anderen. Außerdem haben mich seit meiner Schulzeit Themen wie Anatomie interessiert und ich war sehr motiviert, mir pflegerisches und auch medizinisches Fachwissen anzueignen. Die Gesundheits- und Krankenpflege war für mich genau die richtige Kombination zwischen meinem hohen fachlichen Interesse und dem Wunsch nach einer für mich sinnstiftenden Arbeit im direkten Kontakt mit Menschen.
Sie haben das Berufsfindungspraktikum in Schärding absolviert. Wann haben Sie gewusst, dass das für Sie die richtige Entscheidung gewesen ist?
Das war schon am ersten Tag des Berufsfindungspraktikums (lacht). Zum einen, weil ich mich durch die wohlwollende Grundhaltung des Schulteams an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Schärding von Anfang an sehr wohlgefühlt habe. Auf der anderen Seite war ich froh über diese Chance, in den Pflegeberuf hineinschnuppern zu können. Ich konnte dann auch vollkommen unkompliziert das Berufsfindungspraktikum vorzeitig beenden, um direkt in den Diplom-Lehrgang zu starten. Für

Jana Bayer liebt ihren Job als Pflegepädagogin, weil jeder Tag, jede Klasse und jedes Unterrichtsthema anders sind.
mich war es das ideale Angebot, um die Zeit bis zum Start meiner Ausbildung perfekt zur Vorbereitung und zum Kennenlernen des Pflegeberufs und des Klinikums Schärding zu nutzen. Ich wurde mit jedem Theorie-Input und jedem ereignisreichen Tag während der Praktika aufs Neue in meinem Berufswunsch bestätigt.
Was können Sie jungen Menschen sagen, die sich vielleicht auch noch nicht ganz sicher sind, ob der Pflegebereich das Richtige für sie ist?
Ich würde das Berufsfindungspraktikum wirklich jedem empfehlen, der ein grundsätzliches Interesse an einem pflegerischen Beruf hat und noch unschlüssig ist. Die Berufswahl bzw. Wahl zu einer Ausbildung ist eine sehr wichtige Entscheidung und sollte wohl überlegt sein. Das Berufsfindungspraktikum bietet über einen Zeitraum von neun Monaten umfassende Einblicke in die Tätigkeitsfelder sowie in theoretische Inhalte. Dann lässt sich auch viel klarer sagen, ob der Pflegeberuf wirklich das Richtige ist, und wenn nicht, ist das eine ebenso wichtige Erkenntnis.
Was sind für Sie grundsätzlich die Vorteile dieses Berufsfindungspraktikums?
Die entscheidenden Vorteile für mich sind definitiv, dass man sich durch das Berufsfindungspraktikum unverbindlich im Gesundheitswesen orientieren kann und vielfältige Einblicke in die berufliche Tätigkeit erhält. Das neunmonatige Praktikum eignet sich ideal,
um die Zeit bis zum Ausbildungs- oder Studiumsbeginn sinnvoll zu nutzen. Sollte man dann schon früher eine Ausbildung starten, wie es bei mir der Fall war, oder eben feststellen, dass ein Beruf im Gesundheitswesen doch nicht den Erwartungen entspricht, lässt sich das Berufsfindungspraktikum flexibel und unkompliziert beenden.
Mittlerweile sind Sie ja wieder an die Pflegeschule zurückgekehrt – allerdings auf der anderen Seite. Jetzt geben Sie Ihr Wissen an die Auszubildenden weiter. Wie gefällt Ihnen dieser Job?
Die Arbeit als Pflegepädagogin macht sehr viel Spaß und ist abwechslungsreich, da jede Klasse, jedes Unterrichtsthema und jeder Tag einfach anders sind. Und das Beste daran ist, dass ich mein erworbenes Wissen, aber vor allem auch die Haltungen und Werte, die in der pflegerischen Arbeit und auch ganz allgemein im Zusammenleben so wichtig sind, weitergeben kann. Es ist sehr schön mitzuerleben, wie sich die Auszubildenden und die Berufsfindungspraktikantinnen und -praktikanten in der Zeit bei uns weiterentwickeln. Ich freue mich sehr, einen Teil dazu beitragen zu können, dass die Auszubildenden gut vorbereitet und mit Begeisterung den Pflegeberuf ausüben.
Mehr Infos zum Berufsfindungspraktikum gibt es unter www.ooeg.at/ pflegeausbildung



Die FH Gesundheitsberufe OÖ
bietet für diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger eine Reihe von interessanten Hochschullehrgängen zur Spezialisierung bzw. Weiterbildung an.
Praxisnah und wissenschaftlich fundiert: Die Hochschullehrgänge an der FH Gesundheitsberufe OÖ bieten das Beste aus beiden Welten. Die Absolventinnen und Absolventen verlassen die Hochschule als gesuchte Spezialistinnen und Spezialisten im jeweiligen Fachbereich wie Kinderund Jugendlichenpflege, Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege, Anästhesiepflege, Intensivpflege, Pflege bei Nierenersatztherapie, Pflege im Operationsbereich oder Pflegemanagement. Wir haben mit Martha Böhm, Leiterin der Hochschullehrgänge, und Karin Ertl,


diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Absolventin der FH Gesundheitsberufe OÖ in den Hochschullehrgängen Intensivpflege und Pflegemanagement, gesprochen.
Frau Böhm, warum ist eine Weiterqualifizierung in der Pflege wichtig?
Martha Böhm: Das Gesundheitssystem ist von einer hohen Dynamik geprägt. Schnelle Fortschritte in der Medizin, neue Technologien und die Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung führen zu einer immer stärkeren Spezialisierung und Subspezialisierung. Viele dieser Fachgebiete benötigen für ihre Leistungserbringung entsprechend spezialisierte Pflegekräfte mit einem erweiterten und vertieften Wissen und Können. Eine Zusatzqualifikation, wie
wir sie mit den Hochschullehrgängen anbieten, unterfüttert die bisherige Praxiserfahrung mit dem notwendigen theoretischen Hintergrund und erhöht das Verständnis für die komplexen und herausfordernden Aufgaben. In Verbindung mit mehreren Berufspraktika werden Handlungskompetenzen gefördert und erweitert. Die Studierenden lernen auch, ihr berufliches Handeln wissenschaftsbasiert auszurichten und pflegewissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis nutzbar zu machen. Ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten sind gesuchte Fachkräfte am Arbeitsmarkt.
Frau Ertl, Sie haben mit Intensivpflege und Pflegemanagement gleich zwei Lehrgänge absolviert. Was war Ihr persönlicher Beweggrund?
Karin Ertl: Neben persönlichem
Interesse ist die Spezialisierung Intensivpflege ein gesetzlich verpflichtender Lehrgang zur Ausübung der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege im Intensivbereich. Den Hochschullehrgang Pflegemanagement habe ich aufgrund der mir gegebenen Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung zur stellvertretenden Pflegeleitung absolviert. Durch die völlig neuen Erfahrungen und Herausforderungen, die ich in dieser Position zu bewältigen habe, war es mir wichtig, hier ein fundiertes Grundwissen zu erhalten.
Wie lange dauern die Lehrgänge und was erwartet die Studierenden in der Ausbildung?
Böhm: Die Lehrgänge, die auch berufsbegleitend angeboten werden, dauern zwei bis drei Semester und sind in theoretische und praktische Module gegliedert. Die theoretische Ausbildung

erfolgt zum Großteil an der FH Gesundheitsberufe OÖ, aber auch via Onlinelehre und im Selbststudium. Die Praktika können individuell von den Studierenden selbst gewählt und zwischen den theoretischen Blöcken geplant werden. Eine Absolvierung ist sowohl im Inland als auch im Ausland möglich. Neben Präsentationen und Seminararbeiten wird das Wissen in Prüfungen während des Jahres abgefragt. Der Lehrgang wird mit einer mündlichen Abschlussprüfung und der Präsentation der schriftlichen Abschlussarbeit abgeschlossen. Wer kann sich anmelden und gibt es ein Bewerbungsverfahren?
Böhm: Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege, die im jeweiligen Bereich tätig sind oder derartige Tätigkeiten anstreben. Für den Lehrgang Pflegemanagement bedarf es zusätzlich einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung. Die Bewerbung erfolgt online, bevor man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird.
Welchen Benefit bringen die Hochschullehrgänge?

Ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten sind gesuchte Fachkräfte am Arbeitsmarkt.
Martha Böhm, BScN MSc
Ertl: Nach dem Abschluss der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung erfolgt die praktische und theoretische Einarbeitung in erster Linie direkt in den jeweiligen Spezialbereichen durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen. In den Hochschullehrgängen wird dann dieses komplexe Wissen durch Lehrund Forschungspersonal der FH Gesundheitsberufe OÖ, insbesondere aber auch durch Praktikerinnen und Praktiker unterschiedlichster Bereiche vertieft und erweitert. Wissenschaftliches Arbeiten sowie die Auseinandersetzung mit Studien ist ebenfalls Teil der Theorieblöcke. Im Rahmen der Ausbildung werden Praktika in anderen Abteilungen und Krankenhäusern absolviert. Dadurch werden neue oder differente Herangehensweisen kennengelernt, Sichtweisen verändert und Inputs für die Arbeit im eigenen beruflichen Setting dazugewonnen. Für mich persönlich hat – neben der Erweiterung meines Know-hows –vor allem der Erfahrungsaustausch mit Studienkolleginnen und -kollegen einen der größten Benefits dargestellt. Gleichzeitig war es eine kleine „Auszeit“ von der anspruchsvollen und fordernden Arbeit im Gesundheitsbereich.
Für mich persönlich hat – neben der Erweiterung meines Know-hows – vor allem der Erfahrungsaustausch mit Studienkolleginnen und -kollegen einen der größten Benefits dargestellt .
Karin Ertl
MEHR INFOS:
Die Hochschullehrgänge der FH Gesundheitsberufe OÖ werden in Linz angeboten. Pflegemanagement ist zusätzlich zum Standort Linz auch in Ried im Innkreis möglich.
Infos und Anmeldung unter www. fh-gesundheitsberufe.at/studienangebot/hochschullehrgaenge/

DGKP Peter, Ordensklinikum Linz. Er ist Quereinsteiger in den Pflegeberuf. Nach absolvierter Lehre zum Frisör und Perückenmacher sprang der Funke zum Pflegeberuf beim Zivildienst über.
An meinem Beruf mag ich, dass man immer die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden, dass man in einem Team arbeitet bzw. multiprofessionell arbeiten kann. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf und man bekommt auch viel zurück – speziell im onkologischen Bereich.
Mit über 40 Abteilungen, 18 medizinischen Zentren und 32 Ambulanzen legt das Ordensklinikum Linz seinen Fokus auf Hightechmedizin sowie auf Werte wie Menschlichkeit und ein respektvolles Miteinander. Das Ordensspital bietet die Möglichkeit, von der Säuglingspflege bis zur Altersmedizin einen sinnstiftenden Beitrag an der Bevölkerung zu leisten.
Als onkologisches Leitspital in Oberösterreich ist das Ordensklinikum Linz mit zertifizierten Tumorzentren nicht nur führender Versorger, sondern auch starker Kooperationspartner im Gesundheitswesen. Um diese qualitativ hochwertige Arbeit in den spitzenmedizinischen Zentren des Ordensklinikum Linz gewährleisten zu können, braucht es topausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeberufen.
ÜBER DAS ORDENSKLINIKUM LINZ
Das Krankenhaus im Herzen der Landeshauptstadt zählt mit mehr als 3.900 Mitarbeitenden zu einem wichtigen Arbeitgeber im oberösterreichischen Zentralraum. Zu diesem schlossen sich die Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern und Elisabethinen 2017 zusammen. Jährlich werden
200.000 ambulante Patient*innen versorgt, 60.000 stationäre Aufnahmen verzeichnet und mehr als 22.000 Operationen im 1.100 Betten zählenden Spital durchgeführt. Als eines der am modernsten ausgestatteten Krankenhäuser Österreichs bietet das Ordensklinikum Linz seinen Mitarbeiter*innen neben seinem Fokus auf Hightechmedizin ein Umfeld, in dem Werte wie Menschlichkeit und ein respektvolles Miteinander den Alltag bestimmen.
Ausgezeichneter Arbeitgeber Auch 2024 wurde das Ordensklinikum Linz wieder vom Statistikunternehmen Statista und dem Karrierenetzwerk kununu mit dem TOP-Arbeitgebersiegel zu einem der besten Arbeitgeber im österreichischen Gesundheitswesen gekürt. Für das umfassende Angebot an betrieblicher Gesundheitsförderung wurde es 2024 außerdem mit dem BGF-Gütesiegel ausgezeichnet.






Berufe in der Pflege im #teamordensklinikum. Die Pflege im Ordensklinikum Linz sichert einen professionellen Partner in der Behandlung und Betreuung der Patient*innen. An zwei Standorten im Herzen von Linz bietet das Krankenhaus vielfältige Möglichkeiten in der Aus- und Weiterbildung und in den verschiedenen Berufen der Pflege. Gesundheits- und Krankenpflege am Ordensklinikum Linz bedeutet, Patient*innen ganzheitlich wahrzunehmen, den Menschen wertschätzend – im Sinne christlicher Wertehaltung – zu begegnen und sie in den Mittelpunkt zu stellen.
Gehobener Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz: Am Ordensklinikum Linz sind die Pflegekräfte maßgebliche Partner*innen im multiprofessionellen Behandlungs- und Betreuungsprozess unserer Patient*innen. Entlang der medizinischen Schwerpunkte des Ordensklinikum Linz besteht die Kernkompetenz der Pflege in der Erhebung des Pflegebedarfs, der Beurteilung der Pflegeabhängigkeit sowie der Planung, Organisation, Durchführung, Kontrolle und Evaluation aller sich daraus ergebenden Maßnahmen. Die Berufe OTA (Operationstechnische Assistenz) und OP Assistenz ergänzen diese Kompetenzen im Bereich OP, Endoskopie und NFA. Ab Herbst 2024 gibt es die Möglichkeit, sich am Vinzentinum, der Schule für Gesunden- und Krankenpflege am Ordensklinikum Linz, zu operationstechnischen Assistenz ausbilden zu lassen.
Bachelor Gesundheits- und Krankenpflege / Gehobener Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege. Die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in findet als Bachelorstudium an den Fachhochschulen für Gesundheitsberufe statt. Hier lernen die Studierenden die notwendigen theoretischen, praktischen und wissenschaftlichen Fertigkeiten, um den wachsenden Ansprüchen des modernen Gesundheitswesens gerecht zu werden. Die Ausbildung wird von der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich auch am Ordensklinikum Linz, am Standort Elisabethinen abgehalten. Die obligatorischen Praktika können direkt im Ordensklinikum Linz absolviert werden.
Studium ohne Matura: Der Ausbildungsweg zum gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege ist auch ohne Matura möglich: Nach der zweijährigen Ausbildung zur Pflegefachassistenz kann man direkt ins dritte Semester des Studiums einsteigen. Lediglich einige Lehrveranstaltungen sowie Englischkenntnisse auf Niveaustufe B2 müssen für den Einstieg nachgeholt werden.

Ich schätze an meinem Beruf die Abwechslung, die enge Zusammenarbeit im Team und die Eigenverantwortung, die man trägt. Man arbeitet mit verschiedenen Operateurinnen und Operateuren zusammen und auch die Operationen variieren täglich. Dies erfordert ein hohes Maß an fachlichem Know-how und der Kunst, sich diesen wechselnden Anforderungen rasch anpassen zu können.
OP-Instrumentarin DGKP Tanja, Zentral-OP Ordensklinikum Linz. Aufgrund ihrer Faszination für den menschlichen Körper stand schon bald fest, dass sich ihr Beruf in diese Richtung entwickeln wird. In der Krankenpflegeschule durfte Tanja dann ein Praktikum im OP absolvieren und da wusste sie, dass dies der Beruf sein wird, den sie ausüben möchte.
Besuche uns auch auf Social Media:

Pflegefachassistent*in (PFA). Die Pflegefachassistenz unterstützt Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege. Die Aufgaben umfassen Tätigkeiten in verschiedenen Pflege- und Behandlungssituationen bei Menschen aller Altersstufen in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen sowie auf allen Versorgungsstufen. Am Vinzentinum, der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, besteht die Möglichkeit, die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz zu absolvieren. Voraussetzung ist die erfolgreiche Absolvierung der zehnten Schulstufe, Deutschkenntnisse auf Niveaustufe B2 sowie ein Aufnahmetest inkl. Gespräch.
Operationstechnische Assistenz (OTA). Die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz am Vinzentinum, der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Ordensklinikum Linz, umfasst die eigenverantwortliche Betreuung und Versorgung der Patienten*innen im OP, in der Notfallaufnahme sowie der Endoskopie. Die Ausbildung ist staatlich geregelt und endet mit einer kommissionellen Abschlussprüfung. Die Kernaufgaben beinhalten das Instrumentieren bei einer Operation sowie die Vorbereitung der Instrumente, Apparate und Materialien. Sie koordinieren Arbeitsabläufe und bereiten diese vor, dokumentieren die Operation und übernehmen die prä- und postoperative Übergabe der Patient*innen und deren Daten.
Voraussetzungen für den Start der Ausbildung sind die erfolgreiche Absolvierung der zehnten Schulstufe, Deutschkenntnisse auf Niveaustufe B2 sowie ein Aufnahmetest inkl. Gespräch. Weitere Infos gibt es auf unserer Website: www.ordensklinikum.at
Du im #teamordensklinikum Unser Anliegen ist, die medizinische, pflegerische und therapeutische Qualität im Ordensklinikum Linz für unsere Patient*innen noch weiter auszubauen. Hierfür suchen wir Mitarbeiter*innen mit hoher fachlicher Qualifikation, sozialer Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein.
Werde auch Du Teil des #teamordensklinikum
Weitere Details zur Ausbildung: www.ordensklinikum.at/ ausbildungsangebot


Topqualifizierte Wahltherapeutinnen und -therapeuten bieten in den Praxisräumen von FRIMSports ein breites Therapie- und Wohlfühlangebot an. Durch Prävention können wir unseren Körper in Einklang halten, in Akutphasen oder nach Operationen helfen die Therapeutinnen und Therapeuten dabei, schnell wieder fit und vital zu werden.
FRIMSports ermöglicht mit dem ersten ambulanten Gangroboter Österreichs den Zugang zur innovativen, endeffektor-basierten Gangtherapie –erstmals außerhalb eines Kliniksettings. Die roboterunterstützte Gangtherapie ist eine effektive Methode in der neurologischen Rehabilitation. Neurologische Krankheitsbilder wie Schlaganfälle, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Rückenmarksverletzungen, Zerebralparesen und Schädel-Hirn-Traumen können dadurch sehr früh leistungsbezogen therapiert werden. Der Therapeut wird durch die Anwendung des Gangroboters entlastet und der Patient wird effektiver und zielgerichteter bei seinem Ziel des selbstständigen Gehens unterstützt.
Durch die Vielzahl an Wiederholungen der einzelnen Bewegungsabläufe können signifikante Verbesserungen im Bereich der Gangfähigkeit und dem Gangbild erzielt werden.
Physiotherapie. Durch die vielfältigen Möglichkeiten in der Physiotherapie ist eine Betreuung bei unterschiedlichsten Anliegen möglich: nach Unfällen oder Sportverletzungen, nach Operationen, bei Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen, bei Gangunsicherheit,
bei Schwindel, bei Haltungsschwächen und Fehlstellungen, bei orthopädischen Beschwerdebildern, bei neurologischen Beschwerdebildern und zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht und Koordination. Physiotherapie kommt nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch in der Prävention zum Einsatz.
Ergotherapie. In der Ergotherapie liegt der Fokus meistens am Training der Geschicklichkeit/Feinmotorik der Hände. Jedoch fließen auch andere Aspekte wie z.B. Schwäche im Oberkörper, Schmerzen, neurale Ausstrahlungen vom Nervensystem und vieles mehr in die Therapie mit ein.
Auch der Alltag des Patienten im beruflichen und häuslichen Bereich spielt eine große Rolle, vor allem bei der Zielsetzung. Somit werden in der Ergotherapie die Übungen alltagsnahe gestaltet.
Heilmassage. Professionelle Massagen haben eine positive Wirkung auf uns Menschen. Die mechanische Reizung von Haut, Muskeln und Bindegewebe kann Schmerzen lindern, das Immunsystem stärken, depressive Verstimmungen und Ängste verringern und führt zu besserem Schlaf. Durch eine Massage wird die
Durchblutung der Haut und der Muskulatur angeregt. Blutdruck und Puls sinken, der Zellstoffwechsel wird angeregt. Eine Massage wirkt unmittelbar entspannend. Durch das Massieren können zudem Verhärtungen und Verklebungen der Muskeln gelöst werden, wodurch eine Schmerzlinderung eintritt. Im Zuge einer Massage schüttet der Körper Endorphine aus. Durch die sogenannten Glückshormone wird die schmerzlindernde Wirkung einer Massage noch weiter gefördert und zusätzlich Stress abgebaut. Genau dieser Querschnitt durch alle Therapieansätze zeichnet FRIMSports aus. Jeder Mensch sollte aus unserer Erfahrung immer als Ganzes gesehen werden. Es reicht meistens nicht aus, nur ein betroffenes Bein oder eine betroffene Hand zu behandeln. Oft ist es hilfreich, darüber hinaus zu blicken, um nachhaltige Veränderungen herbeiführen zu können.
Therapiezentrum FRIMSports
Dornacher Straße 11a, 4040 Linz Tel.: 0660/554 65 16 office@frimsports.at www.frimsports.at

Sicherer Arbeitsplatz, sozialer Aspekt, vielfältige Aufgaben, berufliche Aufstiegschancen, Eigenverantwortung, Flexibilität und Teamwork –vieles spricht für einen Pflegeberuf. Zwei Gründe mehr: die regionalen Ausbildungsmöglichkeiten am Campus Gesundheit mitten in Wels und eine Jobgarantie am Klinikum Wels-Grieskirchen.
„Ich rate jedem einen Job in der Pflege, dem Menschlichkeit und Nächstenliebe wichtig sind“, sagt Alexandra Aigner. Sie ist Pflegefachassistentin auf der Augen-Derma-Station am Klinikum Wels-Grieskirchen. Das ist jene Berufsgruppe, die nahe am Patienten arbeitet und zukünftig in Krankenhäusern die breite Basis bilden wird.
MENSCHLICHKEIT
DAS MACHT DEN PFLEGEBERUF AUS
Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem krisenfesten, sicheren Arbeitsumfeld mit vielen Karrieremöglichkeiten – der Pflegeberuf ist für junge Menschen und Quereinsteiger eine tolle Chance.
PFLEGEFACHASSISTENZ (PFA):
Mittendrin statt nur dabei, das sind angehende Pflegefachassistenten im Rahmen ihrer Ausbildung. Der zweijährige PFA-Lehrgang erfolgt neben den theoretischen Einheiten direkt an den Fachabteilungen des Klinikum Wels-Grieskirchen, in Alten- und Pflegeheimen und anderen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Voraussetzungen für die Aufnahme sind das Mindestalter von 17 Jahren und der positive Abschluss der zehnten Schulstufe. Wer weiterlernen möchte, kann mit dem PFA-Abschluss in das dritte Semester des FH-Studiengangs Gesundheits- und Krankenpflege am Campus des Klinikum Wels-Grieskirchen einsteigen. Voraussetzung ist das Englischzertifikat B2. Der nächste Lehrgang zur Pflegefachassistenz in Vollzeit startet im Oktober 2024.
Seite an Seite mit den Chirurgen, technisch anspruchsvoll und spannend: Neben den Pflegeausbildungen steht am Campus Gesundheit auch die Operationstechnische Assistenz (OTA) am Lehrplan. Die OTA ist vorwiegend im OP-Bereich im Einsatz, aber auch in Ambulanzen mit Wundversorgung, in der Endoskopie sowie in der Aufbereitung für Medizinprodukte – überall dort, wo die Kombination aus technischer Geschicklichkeit und medizinischem Know-how gefragt ist. Je nach Vorkenntnissen dauert die Ausbildung drei bzw. das Upgrade zwei Jahre. Wer bereits die Ausbildung zum Operationsassistenten absolviert hat, kann unmittelbar in das OTA-Upgrade-Modul des zweiten Ausbildungsjahres einsteigen. Voraussetzungen sind eine Berechtigung zur Ausübung der OP-Assistenz gemäß MABG (Medizinische Assistenzberufe-Gesetz) sowie der Wunsch nach Weiterqualifikation. Die nächsten OTA-Lehrgänge starten im September 2024.

HIER HABEN PFLEGEBERUFE ZUKUNFT:
Mit 2025 zieht der Campus Gesundheit in den Neubau am Flotzingerplatz neben dem Eltern-Kind-Zentrum am Klinikum Wels-Grieskirchen ein.

Ich rate jedem einen Job in der Pflege, dem Menschlichkeit und Nächstenliebe wichtig sind.
Alexandra Aigner ist Pflegefachassistentin an der Augen-Derma-Station am Klinikum Wels-Grieskirchen.
Detailinfos und Anmeldemöglichkeit: Weiterführende Informationen zu den Ausbildungen am Campus Gesundheit am Klinikum Wels-Grieskirchen und die Möglichkeit zur Anmeldung: www.klinikum-wegr.at → Ausbildung und Karriere → Ausbildung und Anmeldung sowie auf www.wirsindpflege.at.
Der richtige Weg zur Pflegeausbildung beginnt hier: #wirsindpflege


Für die Pflegefachassistenz bietet die FH Gesundheitsberufe OÖ eine niederschwellige Möglichkeit, in den Bachelor für Gesundheitsund Krankenpflege einzusteigen: das Upgrade Pflegefachassistenz (PFA)!
REDAKTION : Linnéa Harringer FOTOS : FH Gesundheitsberufe OÖ, WOLFstudios – Wolfgang W. Luif
Die Ausbildung zur Pflegefachassistenz kann man auf jeder Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Oberösterreich machen. Sie dauert zwei Jahre und entlässt Top-Pflegerinnen und -Pfleger. Für diejenigen, die sich noch zum Bachelor of Science in der Gesundheits- und Krankenpflege weiterentwickeln möchten, bietet die FH Gesundheitsberufe OÖ ab April ein Upgrade an. Wir haben mit Matthias Reisinger, Mitglied des Lehr- und Forschungspersonals des Campus Gesundheit am Klinikum Wels-Grieskirchen, und Mag.a Heide Maria Jackel MBA, Studiengangsleitung Gesundheits- und Krankenpflege (beide FH Gesundheitsberufe OÖ), über das Upgrade Pflegefachassistenz gesprochen.

Matthias Reisinger BScN, MSc ANP FH Gesundheitsberufe OÖ
Mitglied Lehr- und Forschungspersonal
Campus Gesundheit am Klinikum
Wels-Grieskirchen
Welche Tätigkeitsbereiche umfasst die Pflegefachassistenz?
Die Pflegefachassistenz (PFA) hat den Aufgabenbereich der Grundpflege, wie die der Pflegeassistenz, und zusätzlich die erweiterten Tätigkeiten laut Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Die PFA ist das große Rückgrat der Pflege. Wir brauchen sie im Alltag dringend, da sie eine hervorragende Arbeit leistet. Trotzdem möchten wir die Möglichkeit geben, um niederschwellig ohne Matura in das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege einzusteigen und damit die fachlichen Kompetenzen zu erweitern und weitere berufliche Karrierechancen zu nutzen.
Wie sieht das Upgrade aus?
Mit dem Upgrade Pflegefachassistenz erhalten Personen, die ihr Diplom in der PFA abgeschlossen haben, die Berechtigung, direkt in das dritte Semester des Bachelors Gesundheits- und Krankenpflege einzusteigen. Voraussetzung ist, dass man das Upgrademodul an der FH (dauert drei Monate) absolviert hat und Englisch Level B2 nachweisen kann. Alle Infos zum Upgrade inklusive Lehrveranstaltungstermine gibt es auf der FH Website.
Man braucht also keine Matura oder Studienberechtigungsprüfung?
Genau, die PFA kann sich ohne Matura an der FH Gesundheitsberufe OÖ für das Upgrade Pflegefachassistenz bewerben. Wir möchten damit eine möglichst breite Personengruppe erreichen, um den Pflegerinnen und Pflegern zu ermöglichen, niederschwellig in die akademische Welt einzusteigen. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, ihre fachliche Kompetenz zu erweitern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken, ihre beruflichen Perspektiven zu verbessern und durch Evidence-Based-Nursing die Pflegepraxis auf wissenschaftlicher Grundlage neu zu gestalten.
Gibt es ein Aufnahmeverfahren?
Das Bewerbungsverfahren beinhaltet ein Aufnahmegespräch und eine praktische Testung.
Wo kann man sich bewerben?
Für das Upgrade Pflegefachassistenz gibt es zwei Anmeldemöglichkeiten. Wenn man im Herbst fix ins Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege einsteigen möchte, kann man sich online dafür bewerben. Es gibt auch die Möglichkeit, sich vorerst nur für das PFA-Upgrade anzumelden. Dafür einfach an pfaupgrade@fhgooe.ac.at eine E-Mail schreiben. Das eignet sich beispielsweise auch für eine Bildungskarenz, weil es in Kombination mit dem Englischkurs genau die Voraussetzungen dafür erfüllt.
Kommen Sie aus der Pflege?
Ja, ich habe das Diplom zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht und nebenbei den Bachelor in Pflegewissenschaften. Danach habe ich den Master in Advanced Nursing Practice absolviert. Aktuell mache ich gerade mein Doktorat. Ich bin an der FH für das wissenschaftliche Arbeiten im Bachelorstudium und das PFA-Upgrade zuständig. Auch für die Lehrveranstaltungen „Pflege im chronischen Setting“ und für „Skills-Training“ (Training von praktischen Fähigkeiten).
Warum sind Sie gerne im Bereich der Pflege?
Weil es ein extrem großes Berufsfeld mit interessanten Möglichkeiten ist. Man ist mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt und bekommt Einblick in zahlreiche medizinische Bereiche. Es ist eine fachliche Weiterentwicklung in unterschiedlichen Gebieten möglich – vom OP über Dialysen bis hin zur Psychiatrie oder Kinderpflege. Mit dem Bachelor hat man auch die Möglichkeit, in die Wissenschaft oder ins Management zu gehen und europaweit berufliche Chancen zu ergreifen.

Mag.a Heide
Maria Jackel MBA
FH Gesundheitsberufe OÖ Studiengangsleitung Gesundheits- und Krankenpflege
Was ist für Sie persönlich das Beste am Pflegeberuf?
Nachdem ich schon sehr lange in diesem Beruf tätig bin – ich habe 1988 diplomiert –kann ich nach wie vor sagen: Es ist ein sehr vielfältiger Beruf! Seit der Novellierung 2016 haben wir einen generalistischen Ansatz, sowohl im Studium als auch in der Praxis. Das heißt, unsere Absolventinnen und Absolventen können von der neonatologischen Intensivstation bis hin zur Palliativstation überall tätig werden. Diese Vielfalt ist eine riesige Chance, sich dort zu positionieren, wo es in der jeweiligen Lebenslage für den einen oder die andere eben passt.
Was würden Sie Quereinsteigerinnen und -einsteigern raten?
Es gibt in Oberösterreich sehr gute Fördermöglichkeiten für Personen, die das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege als zweiten Bildungsweg wählen. Beispielsweise das Selbsterhalterstipendium, wenn man mindestens vier Jahre gearbeitet hat, oder verschiedene Stiftungsmodelle. Diese Förderungsmodelle unterstützen die Studierenden über die ganze Dauer des Bachelors im Lebensunterhalt. Das ist großartig!
Mit dem Upgrade Pflegefachassistenz können Personen aus der PFA das Pflege-Studium in verkürzter Dauer absolvieren und damit die vielfältigen Job- und Karrieremöglichkeiten dieses tollen Berufs ausschöpfen.
Matthias Reisinger
Infos und Anmeldung unter www.fh-gesundheitsberufe.at

Mehr als 130.000 Menschen leiden in Österreich an einer demenziellen Erkrankung. Einer davon ist der ehemalige Fußballnationaltrainer Didi Constantini, dem diese Krankheit im Alter von 64 Jahren diagnostiziert wurde. Seine Tochter Johanna hat seither zwei Bücher veröffentlicht, wo sie Einblicke in das
Leben ihres Vaters und Strategien zum Umgang mit Demenzkranken gibt.
REDAKTION: Ulli Wright | FOTOS: Mel Burger, privat
Johanna Constantini ist im Wald joggen, als sie am 4. Juni 2019 einen Anruf mit der Nachricht bekommt, dass ihr Vater in einen Verkehrsunfall verwickelt ist. Im Spital erfährt sie, dass er es war, der den Geisterunfall auf der Brennerautobahn verursacht hat. Einige Wochen später dann die Diagnose: Didi Constantini, ehemals gefeierter Star und Liebling der Sportwelt, ist an Demenz erkrankt. Die Gerüchteküche brodelt und die Familie entschließt sich, mit seiner Krankheit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Heute, fünf Jahre später, ist Didi Constantini (69) rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Tochter Johanna, die in Innsbruck als selbstständige klinische Psychologin arbeitet, hat während dieser fünf Jahre im Seifert Verlag zwei Bücher herausgebracht.
Im ersten Buch „Abseits“ (erschienen 2020) gewährt sie Einblicke in persönliche Strategien und in die Karriere ihres Vaters. lm zweiten Buch „Abseits 2“ (erschienen 2023) gibt sie Einblicke in den Umgang mit Demenzkranken und legt den Fokus verstärkt auf Hilfe und Unterstützungsmöglichkeiten für An-
gehörige. Zudem hat die 31-Jährige Didi Constantini zum zweifachen Großvater gemacht. Während unseres Telefoninterviews war Johanna Constantini übrigens im Wohn- und Pflegeheim bei ihrem Vater.
Frau Constantini, wie geht es Ihrem Vater?
Johanna Constantini: Ich bin gerade bei ihm, es geht ihm gut, er ist zufrieden und wirkt im Moment ganz ausgeglichen. Leider kann er sich verbal nicht mehr ausführlich mitteilen, aber er ist hier sehr gut aufgehoben.
Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass Ihr Vater an Demenz erkrankt sein könnte?
Nach seinem Karriererücktritt vor 14 Jahren hat sich Papa immer mehr zurückgezogen und wir haben Stimmungsschwankungen bemerkt. Die Vergesslichkeit ist dann sukzessive gekommen sowie auch Orientierungsschwierigkeiten und Wortfindungsstörungen. Aber zu Beginn war vor allem die depressive Stimmung dominant.
Am 4. Juni 2019 hat er auf der Brennerautobahn einen Geisterunfall verursacht. Einige Wochen später dann die Diagnose Demenz. Wann haben Sie in der Familie entschieden, seine Erkrankung öffentlich zu machen?
Da sich Papa schon vor dem Unfall immer mehr zurückgezogen hat, wurde bereits im Vorfeld sehr viel geredet. Es gab sogar Gerüchte über eine Alkoholsucht. Diese sind allerdings nie direkt an uns herangetragen worden, sondern wir haben sie über Dritte erfahren. Dann hatte er den Unfall, der medial sehr präsent war und wo es auch rechtlich notwendige Untersuchungen gab. Daher haben wir beschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ihr Vater ist in einem Pflegeheim untergebracht, wie schwierig war dieser Schritt für die Familie?
Natürlich ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen, aber Papa zu Hause zu pflegen, war nicht mehr lebbar, weder für uns, noch für ihn. Es war ein Auf und Ab. Einmal war mehr Akzeptanz da, einmal weniger. Aber wir haben ihn in dieser Phase sehr intensiv begleitet und geschaut, dass er tagsüber entweder bei meiner Mama oder bei mir zu Hause sein konnte. Dieser sanfte Übergang hat uns allen geholfen, mit der neuen Situation klarzukommen.
Inwieweit ist Ihnen im Umgang mit der Krankheit Ihr Beruf als klinische Psychologin zugutegekommen? Vor allem im Vorfeld bei den Depressionen?
Durch meinen Beruf bin ich gut vernetzt und weiß, wo man sich hinwenden kann, um Unterstützung oder Hilfe zu bekommen. Dass ich methodisch in irgendeiner Form mit ihm interagiere, wollte Papa nicht. Er war auch nicht der Typ, der diese Art von Hilfe in Anspruch nehmen wollte, was bei einem familiären Naheverhältnis auch nicht einfach ist.
Ein Foto von
aus früheren Tagen. Aufgrund seiner Demenzerkrankung wird der ehemalige ÖFB-Trainer im Pflegeheim betreut. Die Familie hält fest zusammen.

Wie jede andere Krankheit ist auch Demenz sehr traurig, aber wenn man damit konfrontiert wird, funktioniert man.
Johanna Constantini
Sie haben Ihre Erfahrungen niedergeschrieben. Wann fiel die Entscheidung, ein Buch darüber zu veröffentlichen?
Anfangs wollte ich mir einfach alles von der Seele schreiben. Lange Zeit war ich mir nicht sicher, ob ich daraus ein Buch verlegen lassen soll. Demenzratgeber gibt es ja bereits zur Genüge. Wichtig war mir, mit meiner Offenheit anderen Betroffenen und Angehörigen zu helfen, aber dennoch die Privatsphä-

Nicht zuletzt aufgrund der Erkrankung ihres Vaters, sondern auch als klinische Psychologin und Autorin setzt sich Johanna Constantini für mehr Einsicht, Toleranz und Empathie für Demenzkranke ein.
re von uns als Familie und allem voran von Papa zu bewahren. Dank Verlegerin Maria Seifert ist mir dieser Balanceakt gelungen. Die Entscheidung für das zweite Buch ist mir wesentlich leichter gefallen, da ich auf das erste Buch viele Rückmeldungen von Menschen in ähnlichen Situationen bekam, die mir mitteilten, dass es ihnen hilft, wenn man offen über Demenz und den Umgang mit dieser Krankheit spricht. Was raten Sie Menschen, die in ähnlichen Situationen sind? Es ist sicher sehr traurig, wenn man den Vater an die Demenz verliert?
Wie jede andere Krankheit ist auch Demenz teilweise sehr tragisch und traurig, aber wenn man damit konfrontiert ist, funktioniert man. Viele Dinge, die wir uns nie vorstellen hätten können, sind heute für uns zur Normalität geworden. Man wächst in diese Situation hinein und man wächst auch daran. Ganz wichtig ist, dass man sich als Familie nicht zurückzieht oder versteckt, denn dann sind die Intensivität und die Pflegeherausforderungen sehr groß und auch psychisch schwer zu verkraften. Je mehr Menschen sich nach außen wenden und um Hilfe bitten, desto mehr Hilfe wird es auch geben müssen. Ausreichend Unterstützungsmöglichkeiten gibt es leider noch nicht. Mein Papa war mit 64 Jahren noch relativ jung. Anfangs war er in der
Tagespflege, wo die meisten Menschen über 80 Jahre alt waren. Zum Glück hat er es halbwegs gut angenommen. Sie sind selbstständig tätig und haben zwei kleine Kinder im Alter von dreieinhalb Jahren und zehn Monaten. Es ist sicher nicht einfach, sich mental abzugrenzen ...
Das gelingt mir einmal besser und einmal schlechter. Auch bei uns hat nicht immer alles super funktioniert und wir hatten Phasen in der Familie, die sehr anspruchsvoll und belastend waren. Aber dann gibt es Phasen, in denen es leichter und besser geht. Wir halten fest zusammen und haben früh geschaut, dass wir Entlastungsangebote in Anspruch nehmen. Ohne Pflegeheim könnten wir es uns, ehrlich gesagt, nicht mehr vorstellen, weil Papa 24 Stunden auf Unterstützung angewiesen ist. Das ist für uns eine große Entlastung, die Pflegerinnen und Pfleger sind extrem lieb, und wir wissen, dass er gut aufgehoben ist.
Sie appellieren für mehr „Demenzfreundlichkeit“ in der Gesellschaft. Können Sie das näher erklären?
Ja, das kann ich am Beispiel meines Papas gerne erklären. Egal ob beim Treffen mit seiner Stammtischrunde oder im Fußballstadion, er wurde immer als Didi angenommen. Es stand nicht an erster Stelle, dass er an Demenz leidet, sondern vielmehr, wie es
ihm geht, und dass er – so gut wie nur möglich – am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Oft werden Menschen ausgegrenzt oder ins Abseits gestellt, wenn sich ihre Persönlichkeit aufgrund von Demenz verändert. Daher ist es wichtig, dass wir alle wieder mehr aufeinander achten. Viele Dinge werden heute so verkompliziert, dass selbst Menschen ohne Demenzerkrankung Schwierigkeiten haben, ihnen zu folgen. Es genügt bereits, dass viele Leute mit bestimmten Technologien nicht mehr Schritt halten können.
Kennt Ihr Vater Ihre Kinder, also seine Enkelkinder noch?
Ich glaube nicht, dass er sie genau zuordnen kann. Das geht vielleicht in wenigen Momenten und ist von seiner jeweiligen Tagesverfassung abhängig, aber er weiß emotional, dass wir seine Familie sind. Das bleibt womöglich auch so, weil es bisher immer so war.
Wie unterscheidet sich Ihr erstes Buch vom zweiten?
Im ersten Buch ging es mir vor allem darum, Papas berufliche Laufbahn niederzuschreiben. Im zweiten Buch wird der Fokus intensiver auf die Begleitung von Personen gelegt, die an Demenz erkrankt sind. Zudem stelle ich die Verlernerfahrungen meines Papas den Lernerfahrungen meiner Tochter gegenüber.


Wir verlosen je zwei Bücher „Abseits – aus der Sicht einer Tochter“ und je zwei Bücher „Abseits 2 – Von Lern- und Verle(h)rnfahrungen“, beide im Seifert Verlag erschienen. Das Gewinnspiel finden Sie auf www.dieoberösterreicherin.at. Teilnahmeschluss ist der 6. März 2024.
Wenn Sie bei sich selbst oder anderen Veränderungen der Gedächtnisleistungen bemerken, die auf Demenz schließen lassen, helfen die elf Demenzservicestellen. in Oberösterreich unbürokratisch weiter.
Mit 2020 startete die Arbeit des „Demenz-Netzwerks OÖ“. In diesem arbeiten die Trägerorganisationen MAS Alzheimerhilfe, Stadt Wels und Volkshilfe sowie die Auftraggebervertreter von Land OÖ und der ÖGK gemeinsam an der erfolgreichen Umsetzung und an der Weiterentwicklung des Modells. Durch die optimale Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägerorganisationen werden gleiche Qualitätsstandards in der Begleitung und Förderung von Menschen mit Demenz gestaltet. Weiters wird durch die regelmäßige Vernetzung ein Forum geschaffen, indem wertvolle Erfahrungen aller Trägerorganisationen zur Innovation des Versorgungsmodells beitragen.
Beratung und Information. Einfach telefonischen Kontakt in einer Demenzservicestelle in Ihrer Nähe vereinbaren. In einem persönlichen Termin beantworten Experten und Expertinnen Ihre Fragen in einem verständnisvollen Umfeld.
Angebot der Servicestellen: Kostenlose Beratung von Demenz-Betroffenen und ihren Angehörigen sowie auch ein Training zum Erhalt von bestehenden und Erlernen neuer Fähigkeiten (hier ist bei manchen Beratungsstellen ein Selbstbehalt zu zahlen).
Weitere Angebote der Demenzservicestellen. Auf Wunsch erfolgt eine eingehende psychologische Testung, die Auf-
schluss über die Situation des Betroffenen, aber auch über die Belastungen des pflegenden Umfeldes gibt. Mögliche nächste Schritte, wie ein Facharztbesuch, werden gemeinsam zwischen allen Beteiligten vereinbart. Zudem gibt es regelmäßige Förderung und Ressourcentraining für Menschen mit Demenz und jede Demenzservicestelle bietet Schulungen der Angehörigen an.
Infos und Kontakte zu den elf Demenzservicestellen www.gesundheitskasse.at www.demenzstrategie.at www.pflegeinfo-ooe.at

WEIL ES UM MENSCHEN GEHT
Das OÖ Hilfswerk bietet Hilfe, Unterstützung und Beratung
Unsere Angebote im Bereich Pflege und Betreuung
• Haus- und Heimservice
• mobile Betreuung und Hilfe
• Hauskrankenpflege
• mobile Therapien
• 24-Stunden-Betreuung
• betreutes Wohnen
• Tagesbetreuung
• Gedächtnistraining
• Seniorenanimation
• Notruftelefon
MehrzuPflege undBetreuung

Eine Operation, ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung können nach dem
Aufenthalt im Spital einen Bedarf an persönlicher Unterstützung im täglichen
Leben zur Folge haben. Wo und wie man kurzfristig Hilfe findet, darüber beraten die Expertinnen vom Entlassungsmanagement Patienten und deren Angehörige.
REDAKTION: Ulli Wright | FOTO: Klinikum Wels-Grieskirchen/Nik Fleischmann
Vorwiegend betrifft es ältere Menschen, die nach einer Operation auf Unterstützung angewiesen sind. Aber auch jüngere Menschen, die nach einem Sport- oder Verkehrsunfall in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind und alleine wohnen, benötigen für einen absehbaren Zeitraum fremde Hilfe. Wer unterstützt mich bei der Körperpflege? Wer wechselt meinen Verband? Wo stelle ich einen Antrag auf Pflegegeld? Mit diesen und weiteren Fragen sind Patienten wie Angehörige plötzlich konfrontiert. Am Klinikum Wels-Grieskirchen gibt es seitens der Pflege eine eigene Einrichtung „Entlassungsmanagement“ an beiden Standorten, Wels und Grieskirchen. Die Expertinnen sind Diplo-
mierte Pflegekräfte und ausgebildete „Case- und Care-Managerinnen“. Das Team vom Entlassungsmanagement unterstützt Patienten, die sich stationär im Klinikum befinden, und deren Angehörige in allen Belangen rund um Pflege und Betreuung. Wir haben bei Sonja Schlichtner vom Entlassungsmanagement am Klinikum Wels-Grieskirchen nachgefragt.
Frau Schlichtner, wenn für einen Angehörigen nach einem Krankenhausaufenthalt die Pflege daheim nicht mehr gewährleistet ist, inwieweit kann das Entlassungsmanagement helfen?
Sonja Schlichtner: Gemeinsam mit den Patienten und deren Angehörigen arbeiten wir einen Plan aus und orien-
tieren uns dabei an den Ressourcen im Umfeld des Patienten und an seinen Wünschen. Die Angehörigen erhalten alle Kontakte und die nötigen Informationen, um die Organisation der Unterstützung gut durchführen zu können. Wann sollten sich Angehörige an das Entlassungsmanagement wenden? Im Idealfall informiert man sich bereits bevor ein Bedarf auftritt, somit entsteht keine „Notsituation“, man weiß bereits welche Angebote es gibt, für welchen Bedarf man Unterstützung anfordern kann. Es ist dann auch möglich, den Wohnraum so gut wie möglich barrierefrei zu gestalten, ohne Zeitdruck bzw. sich Gedanken zu machen, ob eventuell ein Wechsel z.B. in eine betreubare Wohnform sinnvoll wäre.

Ansonsten ist ein Leitsatz im Case und Care Management „Die Entlassung beginnt mit der Aufnahme“. Die Entlassung aus der Akutversorgung wird erfolgen, sobald die medizinische Betreuung abgeschlossen ist.
Ist das Entlassungsmanagement im Klinikum auch am Wochenende erreichbar?
Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Falls Angehörige nur am Wochenende ins Klinikum kommen können, hinterlegen wir Unterlagen und unsere Visitenkarte, die Angehörigen können uns dann am Montag telefonisch kontaktieren. Wir ersuchen immer um telefonische Terminvereinbarung, falls ein persönliches Beratungsgespräch gewünscht ist, bzw. beraten auch sehr gerne telefonisch. Dies ist für die oftmals berufstätigen Angehörigen meist einfacher und wir übermitteln Unterlagen auch gerne per Email. Bei Fragen können die Angehörigen uns erneut kontaktieren und wir suchen gemeinsam nach Lösungen.
Inwieweit kann das Entlassungsmanagement helfen, wenn nach dem Krankenhausaufenthalt kein Platz in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung gefunden wird?
Im Idealfall informiert man sich bereits bevor ein Bedarf auftritt, somit entsteht keine Notsituation.
DGKP Sonja Schlichtner, Case & Caremanagerin, Entlassungsmanagement Klinikum Wels-Grieskirchen
Wir empfehlen betreffend einer Kurzzeitpflege, nicht nur im Wohnbezirk anzufragen. Oftmals ist in umliegenden Bezirken eine Verfügbarkeit gegeben. Wir wissen, dass dies nicht immer die ideale Lösung ist, weil man den Angehörigen „in der Nähe haben“ möchte. Da es sich jedoch um eine vorübergehende Betreuung handelt, sollte man sich in diesem Fall eher an den Verfügbarkeiten orientieren als an der Nähe zum Wohnort.
Gibt es dahingehend auch noch andere Lösungen?
Eine weitere Option ist eine „Kurzzeitpflege in den eigenen vier Wänden“ durch eine 24h-Betreuungsagentur. Man kann auch diese Betreuung für einige Wochen in Anspruch nehmen und im Anschluss z.B. eine Unterstützung durch die Hauskrankenpflege organisieren.
Für welche Aufgaben ist das Entlassungsmanagement zuständig?
Das Entlassungsmanagement ist eine Beratungsstelle. Wir beraten beispielsweise über Hilfsmittel wie Pflegebett, Rollator usw., stellen auch Verordnungsscheine aus, geben Kontakte zu den Bandagisten bekannt. In Einzelfällen werden auch Rollatoren ins Klinikum geliefert, im Normalfall obliegt die
Organisation der Hilfsmittel jedoch den Angehörigen.
Organisieren Sie auch Hilfen wie Mobile Dienste oder Kurzzeitpflege? Generell organisieren wir keine Unterstützungsmöglichkeiten. Diese sind kostenpflichtig und die Entscheidung, ob man sich dies finanziell leisten kann und möchte, obliegt den Patienten bzw. den Angehörigen. Auch die Mobilen Dienste möchten mit Patient und Angehörigen direkt Kontakt haben, um sich ein Bild von der Situation zu Hause machen zu können. Bei Kurzzeitpflege oder Heimaufnahme werden von den Behörden immer persönliche Unterlagen benötigt, die wir nicht bereitstellen können, somit sind auch hier die Angehörigen gefragt, dies zu übernehmen. Wir informieren über Zuständigkeiten und Ablauf bei der Organisation, ebenso verhält es sich z.B. bei der Organisation einer 24h-Betreuung.
Was geschieht, wenn jemand keine Angehörigen hat?
Sollten Patienten ohne Angehörige oder Bezugspersonen wie Freunde oder Nachbarn Mobile Dienste benötigen, telefonieren wir natürlich gerne gemeinsam mit den Patienten.
Wenn Sie Betreuung und Unterstützung suchen, bieten die Sozialberatungsstellen in Oberösterreich kostenlose, neutrale und vertrauliche Informationen und Beratung. Wir haben bei Barbara Trilsam nachgefragt, wie sie Menschen als erfahrene Beraterin in der Sozialberatungsstelle Thalheim & Gunskirchen weiterhelfen kann.
REDAKTION : Ulli Wright | FOTO: privat
Mit Menschen in Notsituationen sind die Beraterinnen und Berater der Sozialberatungsstellen immer wieder konfrontiert. „Durch einen starken Zusammenhalt mit allen Partnern des sozialen Netzwerkes gelingt es meist, passende Lösungen zu finden“, erklärt Barbara Trilsam. Die 45-Jährige startete ihre berufliche Laufbahn beim Sozialhilfeverband Wels-Land in der Pflege und Betreuung im Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim bei Wels. 2017 wechselte sie als Beraterin für Soziales in die Sozialberatungsstelle Thalheim & Gunskirchen. Insgesamt gibt es im Bezirk WelsLand vier Sozialberatungsstellen (SBS) und einen Sprechtag im Monat in Bad Wimsbach-Neydharting.
Frau Trilsam, wie darf man sich Ihre Tätigkeit in der Sozialberatungsstelle Thalheim & Gunskirchen vorstellen? Geht es da ausschließlich um Beratung?
Barbara Trilsam: Wir geben einen Überblick über regionale und überregionale Hilfseinrichtungen. Von Themen wie Pflege und Betreuung, finanzielle Angelegenheiten, Heimanträge bis hin zu Familienberatung, Familienhilfe und vieles mehr informieren und unterstützen wir Menschen bei Antragstellungen und erarbeiten gemeinsam mit unseren Klientinnen und Klienten persönliche Lösungsansätze. Auf Wunsch vermitteln wir sie auch an die zuständigen Stellen und Institutionen weiter. Auf kürzestem Weg wird das passende soziale Angebot gefunden.
Barbara Trilsam, Beraterin für Soziales in der Sozialberatungsstelle Thalheim & Gunskirchen
Wie kommt man zur Sozialberatung?
Einerseits verweisen die Gemeinden im Bezirk Wels-Land, die Hausärzte, das Klinikum und viele andere Organisationen Beratungssuchende an die Sozialberatungsstellen Wels-Land. Andererseits findet man in G emeindezeitungen, auf der Gemeinde-Homepage und der SHV Wels-Land-Homepage www.shvwl.at unseren Kontakt und die Öffnungszeiten. Da gute Beratung Zeit braucht und wir gemeinsam mit unseren Klientinnen und Klienten nach individuellen Lösungen suchen, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung für die persönliche Beratung. Aber natürlich beraten wir auch telefonisch und versenden wichtige Informationen per E-Mail.

Mit welchen Fragen und Anliegen wenden sich ältere Menschen an Sie? Was sind die größten Probleme?
Die häufigsten Fragen unserer älteren Klientinnen und Klienten sowie auch sehr oft von deren Angehörigen handeln davon, welche Angebote für Pflege und Betreuung es gibt. Das Thema Pflege und Betreuung ist oftmals für die Familien Neuland. Leider sind es auch finanzielle Themen und Vereinsamung, die unsere älteren Klientinnen und Klienten belasten. Daher ist es wichtig, dass die Bevölkerung weiß, dass es Sozialberatungs-
stellen gibt und wir die erste Anlaufstelle sind, wenn Fragen im Bereich Pflege und Betreuung und/oder finanzielle Probleme auftauchen.
Kurzzeitpflege wird oft als Überbrückungsmöglichkeit nach einem Krankenhausaufenthalt oder als Übergangslösung genützt, bis eine Pflege und Betreuung organisiert werden kann. Wie schnell bekommt man in Oberösterreich einen Platz für eine Kurzzeitpflege?
Zeitangaben kann ich hier leider keine machen, da die Kurzzeitpflegeplätze nicht von den Mitarbeiterinnen der Sozialberatungsstellen vergeben werden. Aber wir beraten gerne, wie man einen Kurzzeitpflegeplatz bekommt.
Kurzzeitpflege ist teuer. Was passiert, wenn sich diese jemand nicht leisten kann?
Die Kurzzeitpflege ist selbst zu bezahlen, aber es gibt finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten vom Land OÖ und vom Sozialministerium. Hierzu beraten wir Sozialberatungsstellen oder das jeweilige Heim, in dem die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden soll. Wichtig zu wissen ist auch, dass ein Kurzzeitpflegeplatz nur für eine gewisse Zeit möglich ist und nicht automatisch zu einem fixen Heimplatz werden kann.
Wie findet man das passende Altenheim? Wann sollte man mit der Planung beginnen?
Man kann nie früh genug mit dem Einholen von Informationen über eine Heimaufnahme beginnen. Vor allem um herauszufinden, wer die Ansprechpartner sind und welche Voraussetzungen für eine Heimaufnahme nötig sind. Den Heimantrag und alle wichtigen Informationen zu einer Heimaufnahme im Bezirk Wels-Land bekommt man bei uns in der Sozialberatungsstelle. Für die Heimplatzvergabe in allen Heimen des Bezirkes Wels-Land sind unsere Koordinatorinnen für Pflege und Betreuung (KPB) zuständig.
Kann man sich auch an Sie wenden, wenn man Mobile Dienste braucht?
Im Bezirk Wels-Land bieten Caritas, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe „Mobile Betreuungen und Pflege“, in Sprengel eingeteilt, an. Wir arbeiten mit den Organisationen sehr eng und gut zusammen und engagieren uns, Lösungen für bedürftige Menschen zu finden. Ist es zum Beispiel dem Mobilen Dienst einmal nicht möglich, den gesamten gewünschten Bedarf der Klientinnen und Klienten abzudecken, können zusätzlich überbrückende freiberufliche Pflegekräfte organisiert werden, bis der Mobile Dienst wieder ausreichend Kapazitäten hat.
Inwieweit können Sie Menschen helfen, denen das Pflegegeld verweigert wird?
In unserer Beratungsstelle informieren und unterstützen wir bei Antragstellung des Pflegegeldes. Wird eine Pflegegeld-Einstufung nicht genehmigt oder zu gering eingestuft hat jeder das Recht, innerhalb der Einspruchsfrist, Einspruch vor Gericht einzubringen. Aufgrund unserer guten Erfahrungen können wir die Klientinnen und Klienten an Organisationen und Vereine vermitteln, die sich hierzu spezialisiert haben und dabei unterstützen.
Was ist Ihnen in der Sozialberatung wichtig?
Das Wichtigste ist, die Themen meiner Klientinnen und Klienten ernst zu nehmen, einfühlsam zu sein und mir Zeit zu nehmen, um über ihre Anliegen offen zu sprechen. Dieser empathische Umgang schafft Raum für alle Emotionen – es darf geweint und auch gelacht werden. Mein Ziel ist es, den Menschen ein bestärktes Gefühl mitzugeben.
Wie gehen Sie mit schwierigen oder herausfordernden Schicksalen Ihrer Klientinnen und Klienten um? Können Sie sich da gut abgrenzen?
Um sich gut abzugrenzen zu können, braucht es vor allem ein starkes Team, wo man sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen und über die Themen, die einem sehr nahe gehen, reden kann. Natürlich immer anonymisiert. Dafür möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und auch bei allen anderen, mit denen ich im engen Austausch bin, herzlich bedanken. Nur so ist unser Aufgabenbereich zu meistern. Die Schicksalsschläge meiner Klientinnen und Klienten öffnen mir die Augen und machen mir bewusst, dass ich mich privat in einer sehr glücklichen Lage befinde. Die Abgrenzung gelingt mir mit Unterstützung von meiner Familie und Freunden sehr gut. DANKE dafür!
Infos in der SBS Thalheim & Gunskirchen:
Mobil: 0664/19 81 105, sbs-thalheim.post@shvwl.at

24-Stunden-Betreuung für Senioren/innen und Kranke
Wer wir sind . . .
■ Spezialisten für die 24-Stunden-Betreuung von alten und kranken Menschen durch ausgebildete Betreuer/innen
■ Regionaler Schwerpunkt auf den Bezirk Vöcklabruck und Raum Gmunden
■ Langjährige Erfahrung in der Pflege von Senioren
Was wir bieten . . .
■ Rund-um-Betreuung in den eigenen vier Wänden
■ Unentgeltliche Abwicklung aller Behörden- und Amtswege (inkl. Förderansuchen)
■ Rücksichtnahme auf individuelle Anforderungen des Betreuungsbedürftigen
■ Fortlaufende Qualitätskontrolle
Für ein persönliches, kostenloses Beratungsgespräch stehen wir jederzeit zur Verfügung
Kontakt: Ulrike und Oskar Hepp, Mag. Sabine Schermaier
Telefon: 0660 / 1486 700 office@salus24.at | www.salus24.at Wir
Adresse: Pucheggerstraße 11, 4844 Regau
Erste Anlaufstellen für die Pflege sind beim Sozialministerium oder im eigenen Bundesland bei der Pflegehotline, beim Roten Kreuz, beim Hausarzt oder im Spital.




Wenn ein Pflegefall innerhalb einer Familie auftritt, geschieht das meist unerwartet. Schneller Rat ist gefragt. Wo man sich informieren kann und Unterstützung findet, erfahren Sie hier.
FOTO:Shutterstock
Die Pflege eines Angehörigen bringt viele Veränderungen, Herausforderungen und Fragen mit sich. Gerade zu Beginn ist es schwer, einen Überblick über die Unterstützungsangebote zu bekommen. So muss der Pflegebedarf abgeklärt und die Form der Pflege entsprechend organisiert werden. Es ist zu entscheiden, welche Form der Versorgung für die jeweilige Situation am besten geeignet ist. Um das alles nicht allein bewältigen zu müssen, gibt es mehrere Stellen, wo man sich Unterstützung holen kann. Folgende Anlaufstellen helfen, wenn plötzlich oder nach gesundheitlicher Verschlechterung eine Person zu pflegen ist:
BEIM SOZIALMINISTERIUM:
Das Bürger:innenservice gibt Auskunft zu allgemeinen Fragen zur Pflege: Tel.: 0800/201611, E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at (Mo. bis Fr. 8 bis 16 Uhr).
Beim Broschürenservice des Sozialministeriums können Broschüren wie „Mobile Soziale Dienste in Österreich“ oder „Alten- und Pflegeheime in Österreich“ angefordert werden, oder durchsuchen Sie das Verzeichnis online und laden das Material als PDF herunter. Das Infomaterial reicht von der Unterstützung für pflegende Angehörige über Pflegegeld, Umzug ins Senior:innenheim bis zur 24-Stunden-Pflege und Hospizbetreuung.
Kontakt: https://broschuerenservice.sozialministerium.at/
IM EIGENEN BUNDESLAND:
Für die Bereitstellung der sozialen Dienste (mobile Dienste, teilstationäre Dienste und stationäre Dienste) sind die Bundesländer zuständig, weshalb man sich hier in erster Linie an das Gemeindeamt, die Bezirkshauptmannschaft oder in größeren Städten an das Magistrat wendet. Genauso ist es aber möglich, die Organisation des Vertrauens direkt zu kontaktieren, da es oft mehrere Angebote in einer Region gibt.
Übersicht zu den Pflegehotlines der Bundesländer: www.arbeiterkammer. at/pflegehotlines
BEIM ROTEN KREUZ:
Das Rote Kreuz kann bei der Organisation der Pflege zu Hause unterstützen und über Angebote in der Nähe informieren, beispielsweise im Rahmen eines (kostenlosen) Beratungsgesprächs in einer Bezirksstelle.
BEIM HAUSARZT:
Wer sich um den gesundheitlichen Zustand des Angehörigen sorgt oder wenn

DEIN JOB BEIM ROTEN KREUZ: VIELFÄLTIGER ALS DU DENKST.
ein konkreter Pflegefall eingetreten ist, kann man sich von Hausärztin/Hausarzt beraten lassen. Im besten Fall ist diese/r mit der jeweiligen Situation bereits vertraut und kann an zuständige Stellen verweisen, um die nächsten Schritte in Gang zu setzen (bspw. die Beantragung des Pflegegeldes).
IM SPITAL:
Falls man selbst oder ein Angehöriger/ eine Angehörige wegen eines Unfalles oder einer Erkrankung im Spital ist, sollte man sich noch im Spital nach einer persönlichen Beratungsmöglichkeit erkundigen (zum Beispiel durch das Entlassungsmanagement).
Tipp: Interessensgemeinschaft pflegender Angehörige. Ist das häusliche Pflegearrangement erst einmal auf die Beine gestellt, darf auf die pflegenden Angehörigen nicht vergessen werden. Pflegebedürftige wie auch pflegende Angehörige haben Rechte und Ansprüche! Die Interessensgemeinschaft pflegender Angehörige fungiert als Beratungs- und
Anlaufstelle und setzt sich österreichweit für die Anliegen der Angehörigen, die Familienmitglieder oder Freunde daheim oder in stationären Einrichtungen betreuen und begleiten, ein.
Kontakt: www.ig-pflege.at, Tel.: 01/589 00 328, E-Mail: o ce@ig-pflege.at
Mobile Pflege. Das Rote Kreuz ist gerne Ansprechpartner, falls Sie noch nicht genau wissen, wie Sie die Pflege daheim am besten gestalten können. Zum Rot-Kreuz-Angebot im Rahmen der mobilen Pflege und Betreuung gehören Heimhilfe, Mobile Hauskrankenpflege, 24-Stunden-Betreuung zu Hause, Besuchs- und Begleitdienstdienst, Rufhilfe/Notruftelefon, Bewegungskurse, Essenszustellung bis hin zum betreuten Reisen.
Weitere Informationen auch auf https:// www.roteskreuz.at/pflegebetreuungdaheim
WWW.ROTESKREUZ.AT/OOE/JOBS









MENSCHLICHKEIT LEBT, WÜNSCHT SICH MEHR ZEIT FÜR DAS ZWISCHENMENSCHLICHE. Erlebe schöne, erfüllende Momente bei größtmöglicher Selbstorganisation und Eigenverantwortung.


REDAKTION: Ulli Wright | FOTO: Shutterstock

Die meisten pflegenden Angehörigen stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an, dabei ist es wichtig, gut auf sich selbst zu schauen und kleine Auszeiten in den Alltag einzubauen.
Die Pflege von Angehörigen kostet viel Kraft und wird zu 80 Prozent von Frauen übernommen. „Leider werden Entlastungs- und Beratungsangebote häufig erst dann in Anspruch genommen, wenn die pflegenden Angehörigen an ihre Belastungsgrenzen stoßen“, weiß Sonja Zauner, Leiterin der Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige.
Im Alter von 67 Jahren erleidet Johann M. einen schweren Schlaganfall. Nach zwei Wochen auf der Stroke-Unit im Krankenhaus und einer Reha wird er nach Hause entlassen. Sein Sprachzentrum ist gestört und auch motorisch ist er beeinträchtigt. „Obwohl mein Mann großes Glück gehabt hat, ist nichts mehr wie vor dem Schlaganfall“, schildert seine Frau Hannelore. Vor allem vom Gemüt her hat sich der ehemals humorvolle und an allem interessierte Mann verändert, wodurch auch soziale Kontakte immer weniger wurden.
Pflegefall nach Schlaganfall. Dennoch ging das Paar viel im Wald spazieren und auch regelmäßige Besuche im Stammcafé waren möglich. Im Alter von 78 Jahren verschlechterte sich der Zustand von Johann M. sukzessive, er konnte nur mehr mit Rollator gehen und auch die Körperpflege war sehr beschwerlich. Hannelore traute sich kaum noch aus dem Haus, zu groß war die Angst, dass ihr Mann hinfallen könnte. Auch bei der 75-Jährigen ließen die Kräfte nach und nach einem Sturz war sie selbst auf eine Gehhilfe angewiesen. Die Körperpflege ihres Mannes schaffte sie nur mehr mit Hilfe von Mobilen Pflegekräften und die ständige Sorge um ihren Mann machte sie körperlich wie auch psychisch fertig.
Regelmäßige Auszeiten. So wie Hannelore geht es vielen Menschen, weiß Sonja Zauner, die Leiterin der Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige in Oberösterreich. „Die meisten pflegenden Angehörigen stellen ihr eigenes Wohlergehen

rigen zu regelmäßigen Auszeiten, damit auch die eigenen Bedürfnisse und die eigene Gesundheit wieder mehr in den Fokus rücken und dadurch neue Perspektiven gefunden werden können.
© Caritas
Man kann nur gut für jemanden sorgen, wenn es einem selber gut geht.
Sonja Zauner, Leiterin der Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige
hinten an. Dabei ist es wirklich wichtig, dass sie auch auf die eigene Gesundheit achten und kleine Auszeiten in ihren Alltag einbauen. Denn man kann nur gut für jemanden sorgen, wenn es einem selber gut geht“, so Zauner. Aus ihrem Berufsalltag weiß sie, dass gerade für Frauen – 80 Prozent der pflegenden Angehörigen sind Frauen – oft das Wohlergehen anderer Familienmitglieder deutlich mehr im Fokus steht, als die eigenen Bedürfnisse. Dazu kommt das schlechte Gewissen, weil viele Pflegende hohe Anforderungen an sich selbst stellen, die nicht (immer) erfüllbar sind. Das Gefühl, die gesamte Last der Verantwortung zu tragen, kann unerträglich werden. Daher rät sie pflegenden Angehö-
Hilfe und Beratung suchen. „Häufig kommen Menschen zu uns in die Beratung, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn alles zu viel wird und sie an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Wir stehen an ihrer Seite und finden gemeinsam Lösungen, damit es ihnen – und somit dem gesamten Familiensystem – wieder besser geht“, erzählt Zauner. Sie empfiehlt pflegenden Angehörigen, sich möglichst frühzeitig, gerne auch bereits vor Eintritt einer Pflegesituation, an die Servicestelle zu wenden. „Denn es hilft, gut vorbereitet und informiert zu sein. Häufig hören wir: „Wenn ich gewusst hätte, wie hilfreich diese Beratung ist, dann hätte ich mich schon viel früher gemeldet und vieles wäre leichter gewesen“, schildert Zauner.
Online- und Videoberatung. Neben dem persönlichen Beratungsgespräch, bietet die Caritas Oberösterreich auch Online- und Videoberatung an. „Persönliche und telefonische Beratungen werden immer noch am häufigsten genutzt. Allerdings schätzen jene, die eine Videoberatung nutzen, dass sie Zeit einsparen, weil sie nicht zu einer Beratung fahren müssen – und trotzdem ein Gegenüber sehen. Bei der Onlineberatung schätzen sie vor allem die Zeitunabhängigkeit. Sehr gut angenommen werden auch unsere Online-Veranstaltungen“, so die Leiterin der Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige in Oberösterreich.
CARITAS-SERVICESTELLE PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
• Beratung
• Treffpunkte
• Bildungsforum
• Erholungstage
Tel.: 0676/87 76 87 91
www.pflegende-angehoerige.or.at

„Bandagist, Reha- und Pflegebedarf“ Lieferung innerhalb 24h in ganz Oberösterreich 4600 Wels, Dr.-Salzmann-Straße 6 Tel.: 07242/46 322
E-Mail: office@schaper.at www.schaper.at
4490 St. Florian, Tagerbachstraße 2 Tel.: 07224/20 777
E-Mail: zentrale@akin.cc www.alkin.cc
Fach- & Beratungsstelle, Selbst-Hilfe-Gruppe
Angehörigen-Treffen, Peer Club
Kontakt: Christa Hausjell, 07242/9396-1260
Mobil: 0676/9679483
4600 Wels, Bahnhofplatz 4
E-Mail: office.ooe@netzwerk-gehirn.at www.netzwerk-gehirn.at


Andreas Keck Fachgeschäft für Nahrungsergänzungen, Natur- und Reformwaren
A–4020 Linz, Volksfeststraße 14 Tel.: 0732/77 11 46
E-Mail: office@gesuender-leben.at www.gesuender-leben.at
Tel.: 01/489 49 36
E-Mail: office@die-pflegeagentur.at www.die-pflegeagentur.at
Das Unternehmen Innolift Treppenlifte aus Böheimkirchen beeindruckt mit einem in Österreich einzigartigen Konzept.
In den letzten eineinhalb Jahren hat sich das Unternehmen Innolift Treppenlifte aus Böheimkirchen von einem Branchenneuling zu einem ernstzunehmenden Spezialisten für Stuhltreppenlifte entwickelt. „Unser Konzept, so wichtige Alltagshilfen wie Treppenlifte in extrem kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen – wir sprechen hier von nur fünf bis zehn Werktagen, anstatt marktüblich mehreren Wochen –, hat die Branche komplett umgekrempelt“, erklärt Patric Wileczil, der Gründer und Inhaber von Innolift.
Umgesetzt wird dies durch ein innovatives und patentiertes Schienensystem, das es erlaubt, die Schienen des Treppenliftes viel schneller zu konstruieren, und anschließend werden die maßgefertigten Schienen direkt bei Innolift im Haus ge-
baut. „Dieses patentierte System erlaubt es, die Planung und Herstellung drastisch zu verkürzen und die Produktionskosten sinken ebenfalls, wodurch wir unsere Treppenlifte nicht nur extrem schnell, sondern auch zu äußerst attraktiven Preisen anbieten können. Das ist einzigartig in Österreich. Auch beim Design wird mit diesem Lift ein neuer Weg eingeschlagen. Weg vom klassischen Treppenlift und hin zum Möbelstück. Eine Alltagshilfe darf ruhig auch ein schönes Design haben“, erklärt Herr Wileczil weiter.
Im Fokus liegen nicht nur kurze Lieferzeiten. Auch die Qualität steht im Vordergrund. Dazu trägt bei, dass sich sämtliche Zulieferfirmen in Europa (Niederlande, Großbritannien, Deutschland …) befinden – das sichert die Qualität und die Trans-

Wir sorgen für stufenlose Begeisterung!
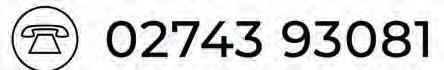

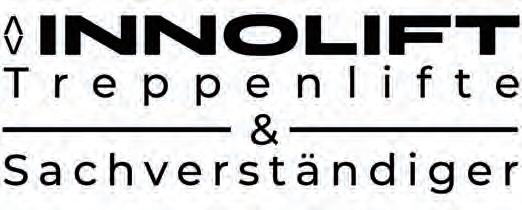
Der Fachbetrieb & Sachverständige aus Niederösterreich
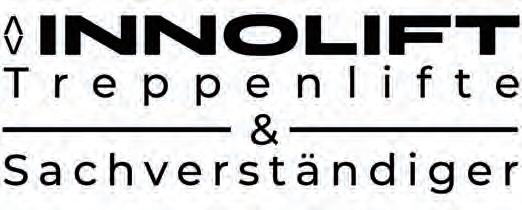
Schauraum mit der Möglichkeit zu Testfahrten
Österreichs schnellste Lieferzeiten!
PATRIC WILECZIL: Gründer und Inhaber von Innolift

portwege werden kurz gehalten, was in weiterer Folge auch die Umwelt schont. Das Ziel ist für Patric Wileczil klar: „Eine dringende Alltagshilfe muss schnell zur Hand sein, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.“
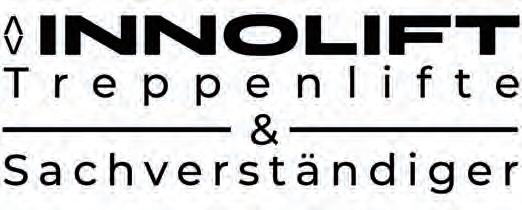
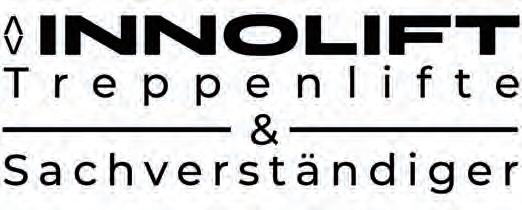
Persönliche und professionelle Beratung vor Ort
Individuelle und maßgefertigte Treppenlifte
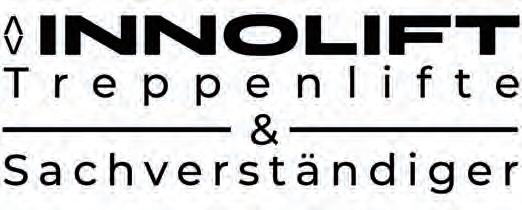
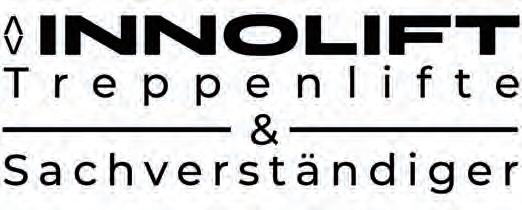


Herausgegeben von Dr. Peter Resetarits, bietet „Der Pflege-Ratgeber“ ausführliche Information über das Betreuungs- und Pflegeangebot in Österreich, beantwortet Fragen zu Vorsorgevollmacht und Erwachsenenvertretung sowie zu Patienten- und Sterbeverfügung. Darüber hinaus enthält das Buch Wissenswertes zu Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige sowie einen Serviceteil mit wichtigen Adressen. Die dritte Auflage stellt das Modellprojekt „Community Nursing“ vor, das gemeindenahe Gesundheitsförderung ermöglicht. Autorinnen: Juristin Mag. Ulrike Docekal, MSc, Juristin Mag. Ilse Zapletal, MA, Journalistin & Autorin Bärbel Danneberg.
„Der Pflegeratgeber“, RESETARITS (HRSG.), 3. Auflage 2023, 360 Seiten, ISBN 978-3-7093-0698-7, € 29,90, auch als E-Book erhältlich
Fünf Jahre lang hat die Journalistin Katrin Seyfert ihren Mann und Vater ihrer drei Kinder durch die Erkrankung Alzheimer begleitet. Sie hat den Familienalltag organisiert, die Finanzen, den Pflegedienst. Schließlich die Beerdigung. Schonungslos offen und brutal ehrlich erzählt sie davon, wie es ist, wenn der Partner allmählich seine Sprache und damit seine Identität verliert. Wie sie mit der Rolle hadert, die ihr erst als pflegende Ehefrau, dann als Witwe zugeschrieben wird. Sie berichtet ungeschönt und mit großer erzählerischer Kraft davon, was es bedeutet, wenn der eigene Mann mit Anfang 50 eine immer größer werdende Lücke im gemeinsamen Leben hinterlässt. In ihrem Buch „LÜCKENLEBEN“ schreibt Karin Seyfert gegen die Tabus, die Konventionen und die damit einhergehende Selbstverleugnung an.

„Lückenleben“ – Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich. Ein SPIEGEL-Buch von Katrin Seyfert, gebunden, 256 Seiten, ISBN-13: 978-3-421-07026-5, € 23,50


In seinem Roman „Zwischen Mauern“ (Haymon, 2023) schreibt der Linzer Palliativmediziner und Autor David Fuchs über die Komplexität der Fürsorge – bis dahin, wo Aufgabe zur Selbstaufgabe wird –und bringt Farbe in die schwarz-weiße Routine eines Pflegeheims. Zum Inhalt: Die junge Bankangestellte Meta ist auf der Suche nach Sinn. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit verschlägt es sie in ein Pflegeheim, wo sie als Sitzwache ihre Nächte neben dem Patienten Herrn T. verbringen soll. Herr T. schreit, sobald es dunkel wird. Er schreit, wenn er allein ist. Meta ist bereit, sich Herrn T. zuzuwenden. Jede Nacht Wache zu halten, auch wenn sie nicht weiß, was hinter den Schreien steckt. Muss man einem Menschen die Hand halten, wenn sich alles dem Ende zuneigt – einem Menschen, der es nicht verdient, stellt sich ihr die Frage.
„Zwischen Mauern“ von David Fuchs, Roman, Haymon Verlag, ISBN 978-3-7099-8203-7, 224 Seiten, gebunden € 19,90, auch als E-Book erhältlich

Weil das E viel ausmacht. Der Volvo EX40 und der Volvo EC40. Volllktrisch.
Weil das E viel ausmacht. Der Volvo EX40 und der Volvo EC40. Volllktrisch.
Mehr Infos bei uns im Autohaus.
Mehr Infos bei uns im Autohaus.
Volvo EX40. Stromverbrauch: 16,6 – 19,4 kWh /100 km, CO₂-Emission: 0 g/ km, Reichweite: 435 – 575 km. Volvo EC40. Stromverbrauch: 16,3 – 18,7 kWh/100 km, CO₂-Emission: 0 g/km, Reichweite: 445 – 582 km. Jeweils kombiniert, nach WLTP-Prüfverfahren. Verbrauchswerte basieren auf MY24.5. Symbolfoto. Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.
Volvo EX40. Stromverbrauch: 16,6 – 19,4 kWh /100 km, CO₂-Emission: 0 g/ km, Reichweite: 435 – 575 km. Volvo EC40. Stromverbrauch: 16,3 – 18,7 kWh/100 km, CO₂-Emission: 0 g/km, Reichweite: 445 – 582 km. Jeweils kombiniert, nach WLTP-Prüfverfahren. Verbrauchswerte basieren auf MY24.5. Symbolfoto. Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten.
–
Stand: Februar 2024.
Stand: Februar 2024.
km. Volvo EC40. Stromverbrauch: 16,3 – 18,7 kWh/100 km, CO₂-Emission: 0 g/km, Reichweite: 445 – 582 km. Jeweils kombiniert, nach WLTP-Prüfverfahren. Verbrauchswerte basieren auf MY24.5. Symbolfoto. Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten. Stand: Februar 2024.
gunskirchen@scheinecker.com voecklabruck@scheinecker.com volvocars.at/scheinecker
BIS ZU
7.200 €
JÄHRLICH
OHNE ZUVERDIENSTGRENZE
Unser Beitrag. Für Oberösterreichs Pflegeausbildung.
Der Bedarf an Pfleger/innen und Sozialbetreuer/innen in unserem Land steigt. Wir vom Land Oberösterreich wollen die Pflege und Betreuung langfristig sichern. Deshalb gibt es jetzt für Berufseinsteiger und Umsteiger für die Pflegeausbildung das Oö. Pflegestipendium in der Höhe von 600 € monatlich ohne Zuverdienstgrenze.
soziallandesrat.at/pflegestipendium
HIER informieren und Ausbildung in der Pflege und Betreuung starten.