
Jonas Borsch
Jan B. Meister
Vormoderne Herrscherkörper im globalen Vergleich



Jonas Borsch
Jan B. Meister

Herausgegeben von Nadine Amsler, Leander Diener, Mirjam Janett, Jan B. Meister und Anja Rathmann-Lutz
Band 1
Jan B. Meister (Hg.)
Schwabe Verlag
DieDruckvorstufedieserPublikationwurdevomSchweizerischenNationalfondszurFörderungderwissenschaftlichenForschungunterstützt.
OpenAccess:Wonichtandersfestgehalten,istdiese Publikationlizenziertunterder Creative-CommonsLizenzNamensnennung,keinekommerzielleNutzung,keine Bearbeitung4.0 International (CCBY-NC-ND4.0)
JedekommerzielleVerwertungdurch anderebedarfdervorherigenEinwilligungdes Verlages.
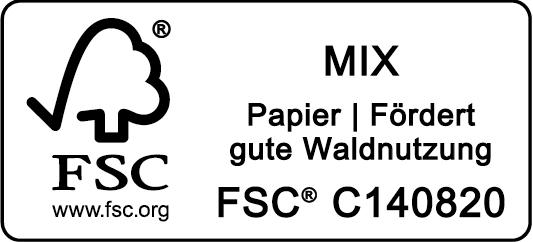
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 bei den Autor:innen; Zusammenstellung © 2025 Jonas Borsch, Jan B. Meister veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz
Abbildung Umschlag: Abbildungen Umschlag: Kompositporträt von Franz I. mit Attributen verschiedener Götter, nach 1532, © Bibliothèque Nationale de France; «Dame von Ins», © Anita Dettwiler, bunterhund Illustration, Zürich.
Korrektorat: Constanze Lehmann, Berlin
Cover & Layout: icona basel gmbh, Basel
Satz: 3w+p, Rimpar
Druck: Prime Rate Kft., Budapest
Printed in the EU
Herstellerinformation: Schwabe Verlagsgruppe AG, Grellingerstrasse 21, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7965-5228-1
ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-5229-8
DOI 10.24894/ 978-3-7965-5229-8
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabe.ch www.schwabe.ch
Jonas Borsch und Jan B. Meister, Bern: Vormoderne Herrscherkörper im globalen Vergleich
Barbara Stollberg-Rilinger, Berlin: Körper von Bedeutung. Über die Zuschreibung physischer Herrschaftskompetenz im 18. Jahrhundert
Daniel F. Schley, Zürich: Kollektive Herrscherkörper am japanischenHof des 11. und 13. Jahrhunderts
Jan B. Meister, Bern: VomKörper des Princeps zum Körper des Kaisers. Die Transformation römischer Herrscherkörper zwischen Hoher Kaiserzeit und Spätantike
Jonas Borsch, Bern: Kaiser-, Königs- und Kalifenkörper in der langen Spätantike. Zwischen sakraler Aufladung und physischer Unzulänglichkeit
Anna Kollatz, Heidelberg: Kann ein pādšāh schwächeln? Die finale Krankheit des Mogulherrschers ǦahāngīrimSpiegel der politischen Positionierung seiner Frau Nūr Ǧahān.
Anja Rathmann-Lutz, Tübingen/Basel: Kämpfen, Zeugen und was noch?
129
Zu den Funktionen des Herrscherkörpers im mittelalterlichen Europa 161
Cornelia Logemann, Graz/München: Wo beginnt der Körper und endet das Kostüm?Feste am französischen Hof des 16. Jahrhunderts ... . 185
Kerstin Nowack, Bonn: Rein. Vielfach. Ewig. Der lebende und der tote Körper der Herrschenden bei den Inka ....
211
Christian Büschges, Bern: Die abwesende Präsenz. Der Vizekönig als alter ego des Monarchen in der Spanischen Monarchie (1621–1635). . 237
Nadine Amsler, Basel: Der Körper künftigerHerrscher. Die Sorge um den jüngsten Nachwuchs am bayrischen Hof (1661–1670). .... ...
263
Brigitte Röder, Basel: Mächtige Männer – schöne Frauen.
Die Inszenierung der eisenzeitlichen Elite in archäologischen Publikationen und Ausstellungen
Dieser Band ist aus dem vom SchweizerischenNationalfondsgeförderten Eccellenza-Projekt «Herrscherkörperinden Monarchien der Spätantike und des frühen Mittelalters»ander Universität Bern hervorgegangen. Ziel war es, die Ergebnisse dieses auf den Raum des sich transformierenden und auflösenden römischen Imperiums fokussierten Projekts in einen globalen Kontext zu stellen und eine epochenübergreifende Perspektive zu eröffnen. Wir danken den Beiträgerinnen und Beiträgern dieses Bandes, dass sie sich auf diesen fruchtbaren Dialog über die Epochen- und Disziplingrenzenhinweg eingelassen haben, der an einer gemeinsamen TagunginBern im Mai 2023 begann und dessen reicheErträge nun hier versammelt sind.
Viele Personen haben zum Gelingen dieses Bandes beigetragen. Unser Dank gilt vor allem Anna Funk, die als studentische Mitarbeiterin im Berner Eccellenza-Projekt tätig war. Ihr akribisches Lektorat und ihre kritische Lektüre waren uns eine unschätzbare Hilfe. Ferner danken wir Fabrice Flückigerund Makbule Rüschendorf vom Schwabe Verlag für die kompetenteBetreuung des Manuskripts. Ebenso danken wir dem/der Verfasser:in des anonymen Gutachtens, das uns nochmals wertvolle Hinweisezur Verbesserung und Präzisierung der Argumentation gegeben hat. Dem Schweizerischen Nationalfonds danken wir für eine grosszügigeFörderung, die es möglich gemacht hat, dass dieser Band als «open access»-Publikation einer breiteren Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden kann. Nicht zuletzt möchten wir Stefan Rebenich und der Berner Abteilungfür Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike sowie den Kolleginnenund Kollegen am Historischen Institut der Universität Bern danken, die uns in den vergangenenfünf Jahren eine ebenso kollegiale wie intellektuell inspirierende Arbeitsumgebung geboten haben.
Eine ganz besondere Ehre und Freude ist es, dass dieses Buch als erster Band der neuen Reihe «Körpergeschichten »beim Schwabe Verlag erscheinen kann. Der epochenübergreifende Ansatz dieser Reihe steht programmatisch für das, was wir mit dem epochen-und kulturvergleichenden Blick auf Herrscherkörper erreichen wollen, und wir hoffen,dass dies der Auftakt für viele weitere spannende «Körpergeschichten »sein wird.
Jonas Borsch und Jan B. Meister
Bern im Dezember 2024
Jonas
Borsch und Jan B. Meister, Bern
1. Herrscherkörper und historische Vergleiche:
Probleme und Chancen
DieTagung, ausder dervorliegende Band hervorgegangen ist, fand zu einem denkwürdigen Zeitpunktstatt:Während dieTeilnehmenden in Bern über das Verhältnis vonHerrschaftund Körper diskutierten,wurde in London CharlesIII. zumKönig vonEngland gekrönt. Alszeremonielles Relikt derbritischenMonarchie führte dieseKrönung demvor denBildschirmen versammelten Milliardenpublikum die – teilsals verstörend wahrgenommene – Alteritätvormoderner Herrschaft vorAugen:Dennandersals modernepolitischeSysteme, diemeist durch festeInstitutionen,Schriftlichkeit undeinefunktionaldifferenzierteVerwaltung geprägt sind, sind vormoderne Herrschaften sehr viel stärker auf die direkte Interaktion unter Anwesenden angewiesen, auf rang- und herrschaftsstabilisierende Präsenzrituale und nicht zuletzt auf den Körper des Herrschers als die fleischgewordene Repräsentation der Monarchie, der auch bei der Krönung von Charles III. im Zentrum stand.
Dass vormodernen Herrscherkörpern eine besondere Bedeutung zukommt, ist schon lange gesehen worden. Das berühmte Buch von Ernst H. Kantorowicz über The King’ sTwo Bodies ist zumindest dem Titel nach akademisches Allgemeinwissen.1 Kantorowicz ist bekanntlich von der juristischen Fiktion der Tudor-Zeit ausgegangen, wonach der König zwei Körper habe, einen «body natural»und einen «body politic». Letzterer steht dabei symbolisch für das ewige und unsterbliche Amt, währendersterer sich auf die sterbliche Hülle des jeweiligen Monarchen bezieht. Der natürliche Herrscherkörper bildet für Kantorowicz allerdings eher einen Aufhänger als den Kerngegenstand. So wird von ihm auch nicht weiter reflektiert, dass englische Juristen sich just zu der Zeit besonders intensiv mit den zwei Körpern des Königs beschäftigten, als mit Elisabeth I. der
1 Kantorowicz 1957. Zum Erfolg und der bleibenden Aktualität des Buches (indem es mehr um die Entwicklung des frühneuzeitlichen Staates und seiner Semantik als um den eigentlichen Körper geht)inder Mediävistik s. Jussen 2009. Eine andere Frage ist freilich, wie weit sich die spezifisch an und für das mittelalterliche Europa gemachten Beobachtungen auf andere Zeiten und Kulturen übertragen lassen (bzw. ob eine Reduktion auf die bloße Trennung von natürlichem Körper und Amtskörper letztlich nicht auf eine völlige Banalität hinauszulaufen droht), s. dazu kritisch Mercier 2022.
«body natural»weiblich war.2 Im Zentrum seinerBetrachtungen stehtvielmehr die juristische Fiktion einer Korporation, die sich zwar aus dem Körper des Monarchen entwickelt, dann aber das Potenzial entfaltet, zu einer abstrakten, vom konkreten Körper losgelösten Staatlichkeit zu werden. Kantorowicz hebt dabei die Besonderheit des christlichen Mittelalters hervor,indem er scharfsinnig aufzeigt, wie in dieser Zeit die theologischen Debatten um die Naturen Christi auf die juristischen Debatten um die zwei Körper des Königs übertragen wurden. In einem Epilog räumt Kantorowicz zwar ein, dass es in der Antike schon ähnliche Tendenzen gab, erklärt aber auch, dass die volle Entwicklung der Doktrin das Christentum und die christliche Theologie zwingend voraussetze. Eine Perspektive über das christliche Europa hinaus wird zeitlich und geographisch also dezidiert nicht gesucht.
Ganz anders präsentiert sich ein zweiter «Klassiker», der Herrscherkörper prominent thematisiert:James Frazers monumentales Werk The Golden Bough, das erstmals 1890 in zwei Bänden erschien und in der zwischen 1906 und 1915 erschienenendritten Auflage bis auf 12 Bände anwuchs.3 Anders als Kantorowicz spielt Frazer heute kaum noch eineRolle, sein Werk interessiert hier vor allem deshalb,weil sich daran die methodischen Schwierigkeiten eines globalen Vergleichs besonders prägnant veranschaulichen lassen. Frazers Ausgangspunkt ist der in antiken Quellen fassbare Rex Nemorensis, ein römischer Priesterkönig, der ein ländliches Diana-Heiligtum hütete. Traditionell wurde dieses Amt nur von entlaufenen Sklaven bekleidet, denn Priesterkönig konnte man nur werden, indem man den amtierenden «König»tötete. Frazer entwarf daraus ein idealtypisches Bild eines magisch-primitiven Sakralkönigtums. Der rituelle Königsmord wie beim Priesterkönig von Nemi kann dabei ein wesentliches Element sein, um jene Kontinuität zu garantieren, die für den Fortbestand der Natur und fruchtbare Ernten als essenziell angesehen wird:Die magischeKraft des alten Königs geht auf seinen Mörder über und lebt in diesem weiter. Frazer sah in diesem magisch-personalisierten Naturglauben eine primitive Vorstufe zu der zivilisatorisch weiter entwickelten Phase der Religionund sammeltereichhaltiges ethnologisches Material, das er mit europäischen Mythen und Volkserzählungenvermengte, um daraus die Essenz eines magischen Königtums zu gewinnen.Der in seiner magischen Kraft unsterbliche Herrscherkörperbildet bei Frazer also den Startpunkt eines universalen Entwicklungsmodelles menschlicher Zivilisation. Frazers materialreiches Werk übt zwar noch immer eine Faszination aus, doch trotz gelegentlicher «Wiederentdeckungen»4 ist die kolonialistisch geprägte Idee, durch eine vergleichende Betrachtung einen kulturübergreifenden primitiv-vorzivilisatorischen Volksglauben rekonstruieren zu können,zutiefstproblematisch.
2 Vgl. Schulte 2002.
3 Frazer 1913–1914.
4 Vgl. etwa Heusch 1997 sowie diverse Beiträge in Quigley 2005.
Was Frazer und Kantorowicz – trotz aller gravierenden Differenzen – jedoch eint, ist der Ansatz, vormoderne Herrscherkörper mit einem gewaltigen symbolischenÜberschuss zu versehen:Sei es als Nukleus, aus dem sich der moderne Staat entwickelt, sei es als quasi magischer Talisman, der das Gleichgewicht der Natur garantiert. Überdies zeigen beide Werke exemplarisch die Schwierigkeiten eines historischen Vergleichs:Während Kantorowicz die Unvergleichbarkeit des christlichen Mittelalters hervorhebt, entwirft Frazer mithilfe seines global angelegten Vergleichs ein universelles Stufenmodell der Entwicklung menschlicher Gesellschaften, das kulturelle Spezifika weitgehend ausblendet und somit letztlich teleologisch ist.
Diese Überbetonung von kulturübergreifender Einheitlichkeit (bzw. «la monotonie»und «l’étonnante pauvertédes ressources intellectuelles», die «primitiven»Kulturen dabei unterstellt werde)bildet auch die zentrale Kritik, die Marc Bloch in seinem bekannten Aufsatz Pour une histoire comparée des sociétés européennes von 1928 gegenüber Vergleichsstudien vom Typ Frazers äußert.5 Er lobt demgegenüber die Vorzüge eines Vergleichs, der parallel existierende, sich gegenseitig beeinflussende Gesellschaften untersucht und der den Historiker so in die Lage versetze, Gemeinsamkeiten und Spezifika präziser zu erkennen. Obwohl unter Miteinbeziehung globaler Perspektiven entworfen, richtet sich diese Methode bei Bloch in Theorie wie Praxis jedoch ausschließlich auf die Erforschung Europas.
Diese Schwerpunktsetzung hat sich heute geändert. Globale Vergleiche haben in den letzten Jahrzehnten eine beachtliche Konjunktur erlebt, und dies aus guten Gründen:Die Erfahrungen der Globalisierung sowie die kritische Reflexion moderner (post‐)kolonialer Strukturen ließen seit etwa den 1990er Jahren Forderungenaufkommen, den Vergleich stärker über nationalstaatliche Kategorien hinauszudenken und eurozentrische Vorannahmen zu hinterfragen.6 Solche Debatten, obwohl von der Gegenwart ausgehend, betreffen mindestensimplizit auch das Verhältnis von Moderne und Vormoderne:Sobaut etwa Dipesh Chakrabartys Forderung, Europa zu «provinzialisieren», auf der Beobachtung auf, dass viele nicht-«europäische»Gesellschaften im Gegenwartsdiskurs als vormoderne, «unentwickelte»Gesellschaften gedacht würden.7 Eine ähnliche Kritik liegt Shmuel N. Eisenstadts Konzept der «multiple modernities»zugrunde, das
5 Bloch 1928, insb. 17–19 zur Kritik an globalen Vergleichen, für die explizit Frazers Golden Bough als exemplum dient (Zitate:19).
6 Zur Kritik an einer nationalstaatlich orientierten vergleichenden Geschichte s. etwa Espagne 1994;zur Verflechtungsgeschichte bzw. «histoire croisée»Werner/Zimmermann 2002. Zur älteren Forschungsgeschichte und den Ansätzen der vor allem in der deutschsprachigen Sozialgeschichte fest verankerten «historischen Komparatistik»s.Haupt/Kocka 1996;Kaelble 1999.
7 Chakrabarty 2000.
die Konzeptualisierung «der Moderne»entlang westlich orientierter Entwicklungsmodelleinfrage stellt.8
Der Beitrag der Vormoderne-Forschung zu einer stärker global orientierten Forschung ist mithin zentral:Einer Dekonstruktion teleologischer Modernisierungsnarrative fehlt es in entscheidender Weise an Schärfe, wenn man in sie nicht die Untersuchung jenes Gegenstandesmiteinbezieht, der «der Moderne» so häufig dichotomisch gegenübergestellt wird.9 Gerade auch mit Blick auf das Phänomen der Globalisierung selbst ist der Blick auf die entfernte Vergangenheit dabei geeignet, die Vorannahmen solcher Narrative auf die Probe zu stellen.10 Schließlich lassen sich auch zivilisatorische Fortschrittsmodelle àlaFrazer am besten dadurch hinterfragen, dass man ihnen einen Vergleichgegenüberstellt, der sowohl die vorhandenen Verflechtungen benennt als auch Unterschiede zwischen den Untersuchungsgegenständen deutlich aufzeigt.
Es nimmt vor diesem Hintergrund nicht Wunder,dass in den letzten Jahren global vergleichende Ansätze auch in der Vormoderne-Forschung erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Insbesondere zur vergleichenden Imperiumsforschung sind in den vergangenenJahren zahlreiche Publikationen erschienen.11 Der Blick richtet sich dabei aber v. a. auf gesellschaftlicheMakrostrukturen, imperiale Infrastruktur bzw. auf den «Early State». Die kulturelle und transzendentale Dimension von Herrschaft hat demgegenüber weniger Aufmerksamkeit erfahren. Eine Ausnahme bildet der 2015 erschienene Band von Wolfram Drewset al., der «monarchische Herrschaftsformen der Vormoderne»imRahmen einer auch transkulturelle Verflechtungen berücksichtigenden, epochen-und raumübergreifenden Analyse untersucht.12 Die Konzentration auf «monarchische Herrschaftsformen»anstattetwa auf Imperien und Reiche begründet sich hier gerade auch in der Wahl eines tertium comparationis, das Vergleichbarkeit ermöglicht, aber die Betrachtung außereuropäischer Kulturen nicht in eine «Defi-
8 Eisenstadt 2000.
9 Dazu Flüchter 2015, 20, Anm. 91:«Ähnlich wie Europahistoriker lange meinten, ohne Kenntnisse außereuropäischer Gesellschaften die europäischen Spezifika feststellen zu können, meint auch die Moderne vielfach, ihre Außergewöhnlichkeit ohne vertiefte Kenntnis der Vorgeschichte postulieren zu können.»
10 Vgl. ebd., 17–20.
11 Vgl. u. a. Scheidel 2009;Burbank/Cooper 2010;Rollinger/Gehlen/Fick 2014;Ando/Richardson 2017. Nebst der Geschichte sind Imperien auch Thema in der historisch informierten Politikwissenschaft so etwa bei Münkler 2005. Eine prominente Bündelung dieser Ansätze verspricht die Oxford World History of Empire (Bang/Bayly/Scheidel 2021), vgl. dazu freilich ebenso kritisch wie forschungsgeschichtlich und konzeptionell informativ Osterhammel 2022.
12 Drews et al. 2015. Eine vergleichend angelegte Verflechtungsgeschichte des römisch-byzantinischen Kaisertums, der islamischen Monarchie und des lateinischen Kaisertums im Westen bietet Höfert 2015.
zitgeschichte»münden lässt.13 Der Band zeigt dabei exemplarisch die Herausforderungen,die gerade die Auswahl der Kategorien – auch mit Blick auf vermeintlich typisch vormoderne Phänomene wie die «Sakralität» – für einen solchen Vergleich immer wieder bedeutet.14
Der «Herrscherkörper»bildet als ein solcher Vergleichsgegenstand nachgerade einen Idealfall, ist seine Existenz doch kultur- bzw. systemübergreifend lediglich an die Existenz von Herrschaft gebunden, während gerade die Variation seiner physischen und symbolischenVerkörperungen eine für seine Untersuchung zentrale Prämisse bildet. Dennoch sind Herrscherkörper bisher kaum systematisch verglichen worden. Ein globalgeschichtlicher Blick auf vormoderne Herrscherkörper aus einer nicht-eurozentrischen Perspektive, aberauch ohne die Suche nach einer kulturübergreifenden magischen Urreligion stellt daher ein Desiderat dar, und diesem Desiderat will der vorliegende Band begegnen.
Ausgangspunkt für die Konzeption des vorliegenden Bandesist die systemtheoretisch inspirierte Prämisse, dass in der Vormoderne die Kommunikation unter Anwesenden eine ungleich höhere Bedeutung besitzt als in der Moderne. Denn während in der Moderne Kommunikation vermehrt über Schrift und andere Medien erfolgt und sich an ausdifferenzierten Funktionssystemenmit einer je eigenen Logik orientiert,spielen in der Vormoderne rangmanifestierende Präsenzrituale eine ungleich größere Rolle und inszenieren und perpetuieren die für das Funktionieren dieser Gesellschaften zentrale Ehrhierarchie.15 Der Münsteraner Sonderforschungsbereich zu «symbolischer Kommunikation»hat dies eingehend untersuchtund zeigen können, wie heuristisch gewinnbringendeine solche Perspektive auf vormoderne Präsenzrituale sein kann.16 Darauf soll im Folgenden aufgebaut werden, denn die zentrale Bedeutung von Herrscherkörpern ergibt sich aus dieser Prämisse fast von selbst:Herrschaft muss verkörpert werden. Der Körper des Herrschers (bzw. der Herrscherin)ist dabei das zentrale Symbol, das Herrschaft sicht- und darstellbar und damit bis zu einem gewissen Grad überhaupt erst wirklich macht. Das hat auch zur Folge, dass Herrscherkör-
13 Flüchter 2015, 25. Zur Bedeutung der richtigen Auswahl des tertium comparationis siehe auch Welskopp 2010, 17.
14 Flüchter 2015, 29, sowie ausführlich Drews/Höfert/Gengnagel 2015, 175–182. Zur Kritik am Begriff «Sakralkönigtum»s.auch die abschliessenden Überlegungen von Kerstin Nowacks Beitrag in diesem Band (S.231).
15 Vgl. u. a. Luhmann 1997, insb. Bd. 2, 634–776, zu vormodernen Gesellschaftstypen im Unterschied zur modernen, funktional differenzierten Gesellschaft.
16 Vgl. dazu u. a. die programmatischen Beiträge:Althoff/Siep 2000;Stollberg-Rilinger 2004;Stollberg-Rilinger/Neu/Brauner 2013.
per in verschiedensten Medien thematisiert und repräsentiert werden, die Quellenlage also im Vergleich zu anderen körperhistorischen Gegenständen der Vormoderne vergleichsweise gut ist.
GleichzeitigbietensichHerrscherkörper füreinen kultur-und epochenübergreifenden Vergleichbesondersan, da sieals Teil der conditio humana grundsätzlich eine vergleichbare Größedarstellen. Denn Körper sind mitihrer Materialität, Widerständigkeit undVulnerabilitätnicht beliebig wandelbar17 undkonfrontieren unterschiedliche Kulturen mitähnlichen Problemen. Alswir im Frühjahr2024 dieseEinleitungverfassten, machte dieKrebsdiagnosedes kürzlich gekröntenKönigs CharlesIII.weltweitSchlagzeilenund führte damitdie Hinfälligkeitdes eben erst mitroyalem Pomp eingekleideten monarchischenKörpers drastischvor Augen. DieseVergänglichkeit undVerletzlichkeit desindividuellen Körpersführt kulturübergreifendzuvergleichbarenProblemen,die es zu lösenund aufzufangen gilt.Frazers Idee vomKönigsmordals kontinuitätsstiftendem Ritual,bei demder Mörder zumneuen Königwird, trifft sich hier mitKantorowiczsAusführungen zumunsterblichen «bodypolitic»des Königs:Symbolische Kontinuitätüberden individuellenTod hinaus istinbeidenFällendas Ziel,die Lösungen aber unterscheiden sich diametral. Ähnlichesgiltfür Ausnahmesituationen, dieinverschiedenenKulturenauftauchen, wo wieimEngland unterElisabeth I. derHerrscher eine Herrscherinist undStrategienentwickeltwerdenmüssen, wieeineoftmals als maskulin konnotierteHerrschaftsrollevon einemweiblichenKörperausgefüllt werden kann.Kurzum: Just weil Körper in vielen essenziellen BereichenZügeeineranthropologischen Gegebenheitaufweisen,lässt sich an ihnenbesonders gut aufzeigen, wieunterschiedlicheKulturenzuunterschiedlichenZeitenauf analoge Probleme unterschiedlichreagierten.
Herrscherkörperbietendaher einenidealen Ausgangspunktfür einenmethodischkontrollierten Vergleichunterschiedlicher Herrschaftssysteme,deren unterschiedliches Funktionierensichinunterschiedlichen Problemlösungenmanifestiert. DerKörperals tertiumcomparationis bildet dabeizwareinen pragmatischen Ausgangspunkt, doch damitverbunden istauchdie Gefahr,einer zu schematischen, letztlichahistorischenEssenzialisierung vom«Körper»als anthropologischerKonstante.Dennobschon sich alle etwasunter «Körpern»vorstellenkönnenund dieseVorstellungen auch eine gewisseSchnittmengehaben,sinddie jeweiligen Ausprägungen doch sehr verschieden. Es geht also auch darum, die conditio humana selbst in einer zweitenReflexionsschlaufezum Analysegegenstandzumachenund im Sinneeiner historischen Ontologienicht nurnachReaktionen undStrategienzufragen, mitdenen aufkörperbezogeneProblemereagiert
17 Ein Plädoyer dafür, die Materialität als heuristisches Instrumentarium der Körpergeschichte ernst zu nehmen, bietet Bynum 1996.
wurde, sondernauchdanach, wasinder jeweiligen Zeit undKulturüberhaupt als «Körper»,«Natur» undmenschliches«Sein»angesehen wurde.18
Um den angestrebten Vergleich heuristisch handhabbar zu machen, haben wir vier «Ebenen» identifiziert, die für eine Analyse von Herrscherkörpern relevant sein können und die der vergleichenden Perspektive in den einzelnen Beiträgen – mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – zugrunde liegen. Dabei handelt es sich um:
1. Eine symbolisch-metaphorische Ebene:Herrscherkörpersymbolisieren immer mehr als nur die Person des Herrschers,weisen also metaphorisch über diesen hinaus. So kann es zu einer Identifikation des Herrschers mit der von ihm beherrschtenEntität kommen. Der Herrscher wäre dann die Verkörperungdessen, was er beherrscht, wobei diese symbolische Dimension wichtiger sein kann als die eigentliche Herrschaft im Weber’schen Sinne. Er kann aber auch als Bindeglied oder Mittler zwischen der beherrschten Entität und einem göttlichen Prinzip gesehen werden. In diesem Zusammenhang wird es auch wichtig sein, die genaue Konzeptionder Besonderheit des Herrscherkörpers zu klären und problematische «Kofferbegriffe»wie «Sakralität»19 im jeweiligen Kontextgenauer zu bestimmen und mit konkreten Inhalten zu füllen.
2. Eine kommunikative Ebene:Herrscherkörper (wie auch ihre bildlichen Repräsentationen)sind das zentrale Medium für die in der Vormoderne so bedeutsame Kommunikation unter Anwesenden. Rituale und zeremonielle Formen tragen wesentlich zur symbolischen Konstituierung von Herrschaft bei und in diese Kommunikationmuss der Herrscherkörper eingebunden sein. Die Sichtbarkeit des Herrschers ist dabei keineswegs die einzig denkbareForm, ebenso können ein bewusstes Abschotten und eine personale Vertretung oder abereinemedial-dingliche Vervielfältigung des Herrscherkörpers Akte der symbolischen Kommunikation sein. Es geht bei dieser kommunikativen Ebene um die Inszenierung und performative Umsetzungder obenals «symbolisch»bezeichnetenBedeutung des Herrscherkörpers.
3. Eine physiologisch-biologische Ebene:Wie alle menschlichen Körper sind auch Herrscherkörper durch Materialität, Vulnerabilität und Hinfälligkeit geprägt und diese biologischen Restriktionen bringen Herausforderungen mit sich, die es zu bewältigengilt. Ein kranker oder versehrter Herrscher kann ein Problem darstellen, genauso wie der Tod des Herrschers kommunikativ und symbolisch aufgefangen werden muss, um die
18 Zum «ontological turn»imKontext der historischen Anthropologie s. programmatisch Arni 2018.
19 Dazu S. 13, Anm. 14.
Kontinuität der Herrschaft über die individuelle Person hinaus zu garantieren. Hier sind sehr unterschiedliche Formen denkbar:Eine Herrschaft kann an den Körper gebunden bleiben und im Tod (der so gesehen kein vollständiger Tod ist)weiterbestehenoder aber sie kann als abstrakter «body politic»auf einen neuen «body natural»übergehen. In diesem Zusammenhang ist die dynastische Reproduktion und Fertilität und damit auch die Frage nach männlichen und weiblichen Herrscherkörpern und ihren jeweiligenRollen in der monarchischen Ordnung zentral, wobei keineswegs ausgemacht ist, dass das biologische Geschlecht das Geschlecht eines Herrscherkörpers als symbolische und kommunikative Größe zwangsläufig prädestiniert.
4. Eine Ebene der Rezeption: Der Blick auf Herrscherkörper vergangener Zeiten ist zwangsläufig eine Außensicht, die als methodisches Problem adressiert werden muss. Es geht darum zu fragen, inwiefern (bzw. in welchem Ausmaß)anachronistische oder eurozentrisch-koloniale Kategorien unseren Blick prägen und den Zugriff auf vergangene Praktiken und Ontologien erschweren bzw. welche wissenschaftsgeschichtlichen Konventionen und Kategorien hier wirksam sind. Es geht aber auch darum, nach der Rezeption von Herrscherkörpern in den jeweiligenQuellen zu fragen – konkret, indem etwa analysiertwird, wie Deutungsmacht über Herrscherkörper reklamiert wird und ob es allenfalls alternative Sichtweisen gab, die sich rekonstruieren lassen. Sich diese Problematik bewusst zu machen, bildet eine Grundvoraussetzung, um die entsprechendenFragen überhaupt erst stellenzukönnen.
In derPraxissinddiese Ebenen engverwobenund bedingen sich gegenseitig. Die symbolisch-rituelle Einbettung desHerrscherkörperskanndabei jedoch sehr unterschiedlicheAusprägungenerfahren: DurchrituelleAbsonderung des Herrscherkörpers (etwadurch Reinheitsgebote) kann Distanzerzeugt werden, durchdie Betonung desgenuinMenschlichen Nähe,und durchVerstümmelung desHerrscherkörpers,seine Tötung oder denVerweis aufphysische Unzulänglichkeiten kann Herrschaft delegitimiertwerden – undzwartendenziell besonders dann,wennHerrscherkörper ansonstenals sakral überhöht inszeniert werden.
3. Herrscherkörper im globalen Vergleich –die Erträge dieses Bandes
Das Ziel der hier versammelten Beiträge ist es, durch eine Analyse der vier skizzierten Ebenen strukturelle Ähnlichkeiten im Umgang mit vormodernen Herrscherkörpern aufzuzeigen, um dann aber vor diesem Hintergrund das jeweils Spezifische und historisch Besondere umso deutlicher sehen zu können.
Dies betrifft sowohldie Praxis (d.h.die konkrete Inszenierung in Ritualen und Zeremonien)als auch die dahinterstehenden Konzepte von Körperlichkeit, Sakralität oder Vulnerabilität, die es dann jeweils genauer zu umreißen und in ihrer historischen Besonderheit zu beschreiben gilt. Der Vergleichist dabei, ganz im Sinne Blochs, das Mittel, um diese Besonderheit, die aus der jeweiligenKultur selbst heraus so oft gar nicht ersichtlich ist, überhaupt erst zu erkennen und entsprechende Fragen zu stellen.
Was sind die Erträge dieses Ansatzes?Den Auftakt macht Barbara Stollberg-Rilinger mit einem Beitrag, der unter dem Titel Körper von Bedeutung –über die Zuschreibung physischer Herrschaftskompetenz im 18. Jahrhundert konzeptionelle Leitlinien skizziert, die auch für die nachfolgendenBeiträge maßgebend sind. Ausgehend von der Bedeutung, die Körper für moderne Politikerinnen und Politiker haben, versucht Stollberg-Rilingerdie spezifische Besonderheit vormoderner Herrscherkörper herauszuarbeiten und formuliert dazu fünf Thesen, welche die oben skizzierten Untersuchungsebenen aufgreifen und konkretisieren. Erstens, so Stollberg-Rilinger, sei der Körper des Herrschers bzw. der Herrscherin in der Vormoderne sowohl Indiz als auch Metapher für die Eignung zur Herrschaft:Herrschaft über den eigenenKörper ist ein Indiz zur Befähigung für die Herrschaft über andere, während gleichzeitig die Körperlichkeit des Herrschers (oder der Herrscherin)als Metapher für das politischeGemeinwesen über sich selbst hinausweist. Zweitenshänge politischeGewalt aufs Engste mit physischer Gewalt zusammen. Das Darstellenphysischer Stärke sei daher eine zentrale Herrscherqualität. Das Besondere an der europäischen Frühen Neuzeit sei dabei, dass die instrumentelle Dimension an Bedeutung verlor(der Herrscher musste nicht mehr aktiv in die Schlacht ziehen), die symbolische Dimension (Gewaltmetaphorik und militärische Repräsentation)aber fortbestand und Herrscherkörper mit entsprechendenAnforderungen konfrontierte. Eng verflochten sind die symbolische und die instrumentelle Funktion des Körpers auch bei der dritten These, nämlich dass Fruchtbarkeit und Zeugungskraft in den dynastisch verfassten Monarchien der Frühen Neuzeit (aber auch vielenanderen vormodernen Herrschaften)von existenzieller Bedeutung seien. Der fruchtbare Herrscherkörper sichere dabei nicht nur den Fortbestand der Dynastie, sondern stehe pars pro toto auch für die Fruchtbarkeit des Landes. Viertens, so StollbergRilinger weiter, kenne die gottgewollte hierarchische Ordnung der Vormoderne keine funktionale Ausdifferenzierung von Teilsystemenmit eigenen Rollen, weshalb der Mächtigste «zugleich der Beste, der Schönste, der Stärkste,der Reichste»sein müsse oder zumindest so zu erscheinen habe – mit entsprechendenAnforderungen an die körperlicheErscheinung, Präsenz und Inszenierung des Herrschers bzw. der Herrscherin. Schließlich, so Stollberg-Rilingers fünfte These, sei vormoderne Majestät etwas Sichtbares. Sie müsseindirekter Interaktion oder medial inszeniert werden, und gleichzeitig müsse die Vulnerabilität, die diesen Körpern (imSinne der von uns als physiologisch-biologisch bezeichneten Ebe-
ne)anhaftet, kontrolliert und die Illusion eines majestätischen Körpers aufrechterhalten werden.
Diesem letztenPunkt widmet Stollberg-Rilinger dann denempirischen Teil ihresBeitrags, in demsie zwei frühneuzeitliche Fallstudien betrachtet,bei denen dieHerrschenden«Defekte» aufwiesen: im Falleder habsburgischen Kaiserin MariaTheresiaihr weibliches Geschlecht undimFalle despreußischenKönigsFriedrich WilhelmI.seine durchErbkrankheitenerheblich beeinträchtigtekörperliche Konstitution undseinUngenügen gegenüberden eigenenMännlichkeitsidealen
In beiden Fällen lässt sich zeigen,wie diesekörperbezogenen «Defizite» dieHerrschaft gefährdetenund unterschiedliche medialeStrategienverlangten,umder so zentralenForderung nach physischer Herrschaftskompetenz dennochgerecht zu werden.Damit zeigtder Beitragexemplarisch, wiephysiologisch-biologische Defizite einesHerrscherkörpers symbolisch undkommunikativeingehegt werden können(undmüssen).Zudem zeigtdie heroisierendeDarstellung des«Soldatenkönigs»Friedrich WilhelmI.inder preußischenGeschichtsschreibung des 19.Jahrhunderts, wiedieserinseinereigenen Zeit alsproblematisch angesehene Körper in derRezeption eine weitreichendeTransformationerfahrenkonnte.
Mit Daniel Schleys Beitrag verlagert sich der Schauplatz vom frühneuzeitlichen Europa in das japanische Mittelalter. In seinem Beitrag Kollektive Herrscherkörper am japanischen Hof des 11. und 13. Jahrhunderts untersucht Schley die Inszenierung und Symbolisierung des Körpers des Tennō.Die Signifikanz dieses Herrscherkörpers im Zeremoniell ist jener des frühneuzeitlichen Europas, die Stollberg-Rilinger in ihren fünf Thesen skizzierte, durchaus vergleichbar, doch die konkrete Ausprägung weist frappante Unterschiede auf. So geht die physische Präsenz der Kaiser in der Repräsentation ab dem 9. Jahrhundert markant zurück, dafür steigt seine symbolische Bedeutung. Dies liegt einerseits daran, dass die rituelle Abschirmung des Herrschers dem Schutz vor Befleckung diente, die reduzierte physische Präsenz also direkt mit der Bedeutungssteigerung der Reinheit des kaiserlichen Körpers einherging. Anderseits erhielt der Tennō,wie Schley in Anschluss an die Forschung betont, nebst den von Kantorowicz für das europäische Königtum untersuchten zwei Körpern einen dritten Körper:Die Insignien und die den abwesenden Kaiser vertretenden Personen aus der Familie Fujiwara bildeten im Zeremoniell einen symbolischen «Jadekörper», der den abwesenden Kaiser präsent werden ließ – man kann daher, wie der Titel des Beitrages unterstreicht, von einem kollektiven Körper sprechen, der durch weitere Personen, aberauch durch Gegenstände symbolisiert werden konnte. Anhand von Jiens Vision, einem Text aus dem frühen13. Jahrhundert, zeigt Schley, wie diese Symbolisierung des kaiserlichen «Jadekörpers»als Kombination aus Insignien und SippenverbandimKontext des esoterischen Buddhismus gedacht und beschrieben werden konnte. Majestät, so kann man die Ergebnisse zusammenfassen, musste auch im mittelalterlichen Japan sichtbar gemacht werden, doch das höfischeZeremoniell und buddhistische Rituale liefer-
ten Mittel, um eine Präsenz in Absenz und ohne Bild- und Text-Medien, wie sie europäische Herrschende der Frühen Neuzeit nutzten, sondern durch eine umfassende Symbolisierungdes kaiserlichen Körpers zu gewährleisten.
DienachfolgendenBeiträgewidmensichder römischenMonarchie undden dort zu beobachtendenTransformationen hinzuden diversen nachantiken Reichsbildungendes frühen Mittelalters.InseinemBeitrag VomKörperdes Princeps zumKörperdes Kaisers untersucht JanB.Meister dieTransformationvon Herrscherkörpern zwischen derHohen Kaiserzeit undder Spätantike.Dabei argumentiert er,dasssichim3.und 4. Jahrhunderteine«somatische Wende» beobachten lasse, dieden römischenHerrscherkörper grundlegendänderte undprägend werden solltefür spätereHerrschaften, diesichauf Romals imperiales Vorbildbezogen.Dennursprünglichwar Romstark vonden Traditioneneiner aristokratisch verfassten Adelsrepublikgeprägt gewesen, unddie fürdie Verkörperung vonHerrschaftsowichtigeKommunikationunter Anwesenden hattediesem UmstandRechnunggetragen, indemder alsPrinceps, alsder «Erste», bezeichnete Kaiser nichtsosehrals Monarch, sondernals primus interpares erschien.Mit der angesprochenen Wendeänderte sich dies grundlegend: Erstens, so Meister, wurdenexklusive Insignienwichtiger,was zu einerNeuvermessung desVerhältnisses vonindividuellemKörperund Kleidung führte. Zweitens wurdeder Umgang mit Krankheitund Vulnerabilität neukonzipiert: Betonten aristokratischeQuellen der HohenKaiserzeitden Umgang derKaisermit Krankheitenund Gebrechen, ging dieser Fokusauf Selbstsorge, derdem Kaiser einenseinenMitaristokraten vergleichbarenKörperzuschrieb,inden folgendenJahrhunderten deutlich zurück –wasmit derdistanzierteren Inszenierung derMonarchie aber auch demWandel derReichselite zusammenhängen dürfte.Als Drittes, so Meister, lassen sich neue Körperpraktikenidentifizieren, dieeinecharismatischeSakralisierungdes Kaisers begünstigen, enge Bezüge zu densichwandelnden Vorstellungenvon Körperlichkeit undAskeseaufweisen undfür religiöseInszenierungenimRahmender nun christlich gewordenen Monarchieausgesprochen anschluss-und zukunftsfähig waren. Die«somatische Wende» zwischen derHohen Kaiserzeit undder Spätantike markiert dahereinen entscheidenden Wandel derrömischen Monarchie, die voneiner sehr untypischenMonarchie,die sich in eine nicht-monarchische Tradition einfügen musste,zueinem Prototyp fürspätere Herrschaftenwurden, diesich aufdas Erbe Roms beriefen.
Jonas Borsch knüpft chronologisch unmittelbar an diesen Themenkomplex an und erweitert gleichzeitig die Perspektive über den europäischenRahmen hinaus. Sein Beitrag widmet sich dem Umgang mit Herrscherkörpern in (Ost‐) Rom während der langen Spätantike, fragt dabei aber auch nach Verflechtungen mit anderen Monarchien des spätantiken Mittelmeerraumes und Vorderasiens. Dabei diagnostiziert Borsch eine Bewegung zwischen zwei Polen:Einerseits beobachtet er eine zunehmende symbolisch-sakrale Aufladung des Herrscherkörpers, die sich etwa in einer in Rhetorik, Bildquellenund Praxis greifbaren Kon-
junktur astralerund solarer Assoziationen und im Verständnis des Herrschers als «Abbild Gottes»widerspiegelt. Andererseits, so argumentiert er, schuf gerade diese symbolische ÜberhöhungMöglichkeiten für Kritik. Wenn die römischen Kaiser prachtvoll und entrückt auftraten, eröffnete das Raum zur feindseligen Kontrastierungmit traditionellen Idealen männlicher Tugendhaftigkeit wie körperlicher Aktivität, Selbstbeherrschung und Luxusverzicht. Insbesondere die sogenannten«Kindkaiser»des ausgehenden4.und 5. Jahrhunderts wurdenvor diesem Hintergrund in der späterenHistoriographie als passive,unmännliche «Palastkaiser»zuSündenböcken für allerlei vermeintliche und tatsächliche Fehlentwicklungen. Zudemtraten gerade infolge der zunehmend enger werdenden Assoziation des Herrscherkörpers mit dem Kaisertum als Institution die Schwächen des biologischen Körpers umso deutlicher hervor. Als Mensch konnteder Kaiser nicht nur erkranken, sondern sein Körper war auch verletzbar.Die zunehmendeBetonungder Identität von Reichs- und Herrscherkörper führte daher im Umkehrschluss zu einer Zunahme von physischen Angriffen auf die römischen Herrscher. Es ging dabei keineswegsnur um Subversion: In gleich mehreren spätantiken Monarchien entstand im Laufe der Spätantike die Praxis der öffentlichen Verstümmelung von abgesetzten Herrschern. Sie nahm die Form eines Rechtsaktes an, welcher den ehemaligen Herrscher, wie Borsch zeigt, zu einem Verbrecher stilisierte, ihn der körperlichen Integrität enthob und seinen Körper dauerhaft als verletzlich markierte.
Die Vulnerabilität des Herrscherkörpers steht auch im Zentrum des Beitrages von Anna Kollatz,der sich mit körperlichen Aspekten der Mogulherrschaft im Nordindien des 17. Jahrhunderts auseinandersetzt. Kollatz betrachtet dabei zunächst Zuschreibungenangute (imAllgemeinen männlich gedachte) Herrschaft, wobei sie zwischen «transpersonalen»und «personalen»Eigenschaften unterscheidet. Erstere wurden jedem Herrscher zugeschrieben. Dabei nahm,in Anknüpfung an vorderasiatische Traditionen, die symbolische Aufladung eines lichtumfluteten und von gottgegebenem Glück begleiteten Herrschers eine wichtige Rolle ein. Noch direkter körperbezogen sind viele der personalen Eigenschaften, etwa die Fähigkeit des Herrschers, zu kämpfen, zu jagen oder einen wilden Elefanten zu bändigen. Daneben bildetedie körperliche Präsenz bei Audienzen, Prozessionen oder anderen öffentlichen Auftritten einen wichtigen Bestandteil der Herrschaftspraxis. Entsprechend problembehaftet waren auch für die Moguln das Erkranken oder der Tod eines Herrschers – beides versuchte man nach außen zumindest vorübergehend zu überspielen. Anhand eines spezifischen Fallbeispiels erörtert Kollatz nicht nur entsprechende Strategien, sondern zeigt zudem exemplarisch auf, welche Herausforderungen sich daraus für das Umfeld des Herrschers ergaben. Dazu betrachtet sie das Ende der Regierungszeit Ǧahāngīrs (reg. 1605–1627), das durch das ‹Schwächeln› des Herrschers, d. h. eine sukzessiveVerschlechterung seines Gesundheitszustandes, geprägt war. Von besonderemInteresse ist hier die Rolle von Ǧahāngīrs Ehefrau Nūr Ǧahān, die