teachware

Ausgabe für Lehrperson


Ausgabe für Lehrperson

Lehrmittelreihe «Brennpunkt Wirtschaft und Gesellschaft»
Brennpunkt Rechnungswesen – Kaufleute EFZ
1 «Grundlagen des Rechnungswesens – mit Swiss21»
Ausgabe für Lehrperson

PowerPoint-Folien
Den Foliensatz zu diesem Modul können Sie herunterladen und nach Ihren eigenen Bedürfnissen gestalten.

Online üben und prüfen mit isTest Wir haben sämtliche Übungen auf der Prüfungsplattform isTest aufgeschaltet und stellen diese im STR-LehrpersonenNetzwerk zur Verfügung. Interessiert?

Weitere Informationen finden sich im QR-Code/Link. buchen.ch
Auf buchen.ch finden Sie weitere Theorie-Handouts, Präsentationen und Selbsttests zu den Inhalten dieses Lernmoduls

Bookyto.com
Auf bookyto.com finden Sie einen Buchungstrainer mit zusätzlichen Übungen zu den Inhalten dieses Lernmoduls.

1. Auflage 2025
© copyright STR Teachware GmbH, St. Gallen, www.strteachware.ch
Umschlag und Aktualisierungen: schmizz communicate 360° GmbH, Schaffhausen Druck: Copy + Print AG, Schaffhausen
Wer eine Unternehmung gründet, stellt schnell fest: Ich muss meine Finanzen im Griff haben. Ich muss jederzeit wissen, ob ich genügend Geld habe, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Auch die Löhne der Mitarbeitenden müssen Ende Monat überwiesen werden. Wenn ich ein Darlehen oder einen Kredit aufgenommen habe, müssen die Zinsen und die Rückzahlungsbeträge bezahlt werden, wenn sie fällig sind. Gleichzeitig muss ich kontrollieren, ob meine Kunden die offenen Rechnungen fristgemäss bezahlt haben.
Einführung
1 Giulias Glacé-Mobil – von der Geschäftsidee zum Geschäftsmodell ................ 2
2 Budget und Finanzplanung – wichtige Elemente eines Businessplans .............. 7
Kontensystematik mit Bilanz und Erfolgsrechnung
3 Rechnungswesen – eine Begriffsübersicht 12
4 Bilanz und Erfolgsrechnung – Zwei Abschlussrechnungen in jeder Buchhaltung 14
5 Konto – Grundbaustein für die doppelte Buchhaltung .................................. 18
6 Vier Kontenarten – Aktiv, Passiv, Aufwand und Ertrag .................................. 20
7 Kontenrahmen und Kontenplan – Die Gliederung der vier Kontenarten 21 Geschäftsfälle verbuchen
8
Wie viel soll, muss oder darf
Mit dem System der doppelten Buchhaltung werden alle finanziell bedeutsamen Vorgänge systematisch erfasst und man hat den Überblick über finanzielle Lage der Unternehmung.
Zudem kann man jederzeit feststellen, wie erfolgreich eine Unternehmung wirtschaftet und aus welchen Gründen ein Gewinn oder ein Verlust erzielt worden ist.
1 Giulias Glacé-Mobil – von der Geschäftsidee zum Geschäftsmodell
2 Budget und Finanzplanung
n Gesucht: Ein Ferienjob für Giulia
Giulia ist 17 Jahre alt und besucht die Kantonsschule in Schaffhausen. Ihr Freund Marco (18) hat nach der Sekundarschule eine KVLehre begonnen.
Auch wenn Giulia – in der Regel – gerne zur Schule geht, denkt sie manchmal an die rund CHF 1'000.–, die Marco mittlerweile monatlich verdient. Aber sie sagt sich: «Dafür habe ich viel mehr
Ferien, das ist ja auch etwas – und in den fünf Wochen Sommerferien kann ich jobben gehen.»
In den Frühlingsferien sucht Giulia im Internet Tipps, wie man erfolgreich einen Ferienjob findet.

1.1 Beantworten Sie die folgenden beiden Fragen mit einer Internetrecherche.
a) Welche Ferienjobs werden in Ihrer Umgebung angeboten?
b) Wie viel kann man mit einem Ferienjob verdienen (Stundenlohn)?
a) Individuelle Antworten
Z.B. In vielen Regionen ein eher kleines Angebot.
Viele Angebote für Online-Umfragen
b) Durchschnittlicher Stundenlohn:
17 Jahre: ca. 16 – 18 CHF pro Stunde
Zum Vergleich bei 174 Arbeitsstunden pro Monat:
Lehrlingslohn CHF 1'000 = CHF 6 / bei CHF 6'000 = CHF 34/Std
Nach einigen Stunden Herumsurfen auf verschiedensten Websites und vier erfolglosen Anfragen ist Giulia recht frustriert. In Schaffhausen finden sich aktuell keine passenden Jobangebote und auf vier spontane Anfragen bei Unternehmungen in der Region erhält sie nur Absagen.
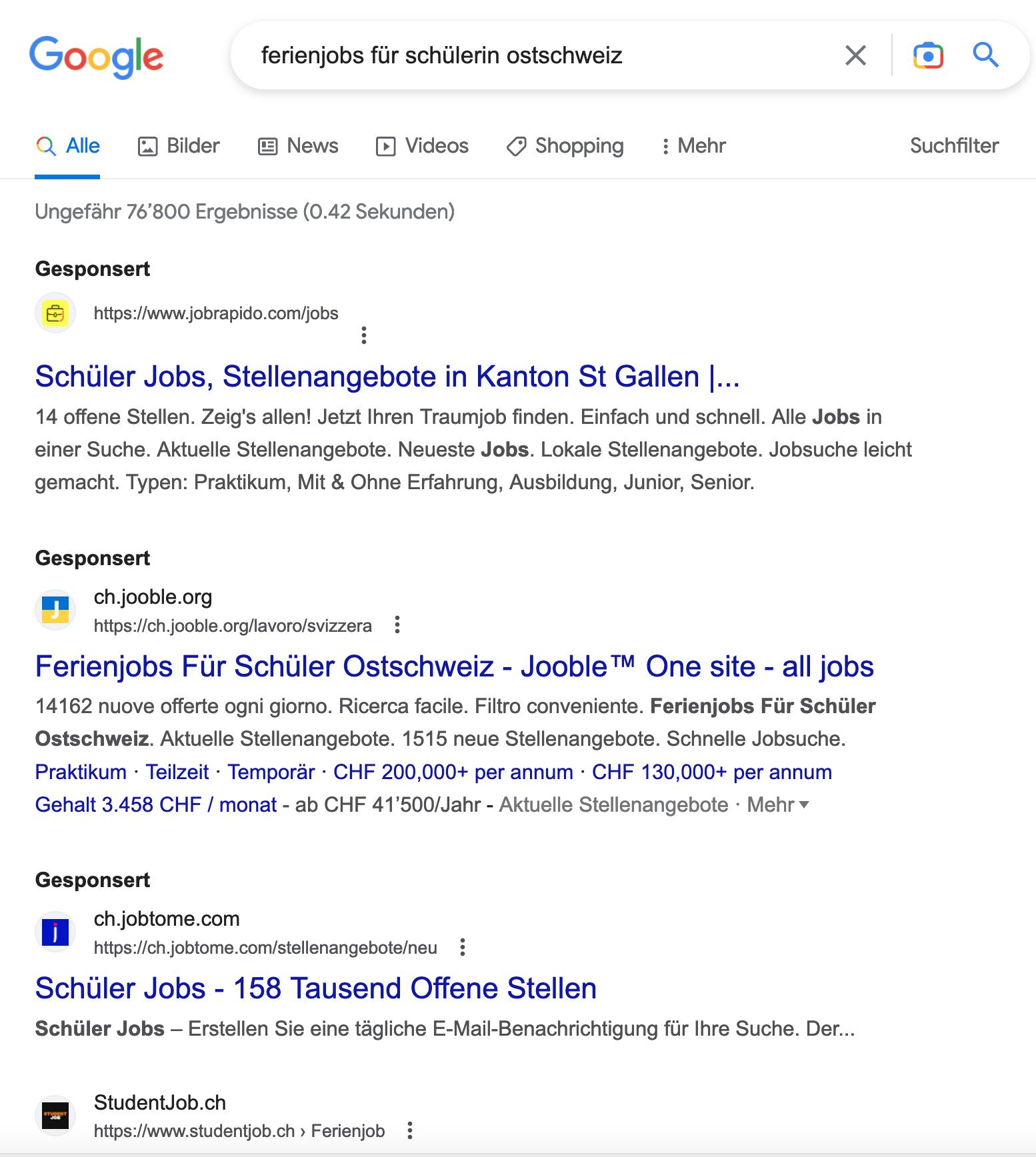
Abb. 2 Giulias Google-Anfrage zu Ferienjobs
Vertiefen und vernetzen Sie Ihre Kompetenzen mit der Aufgabe 1

Abb. 3 Lindli, Schaffhausen
Als Giulia mit Marco an einem sonnigen Sonntagnachmittag am Lindli, dem Rheinuferweg von Schaffhausen, den vorbeiziehenden Wolken nachsieht, entwickelt sich das folgende Gespräch zwischen den beiden:
Marco: Schau mal, die neueste Ausgabe des Context, das Magazin des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes. Was die da über die KV-Lehre schreiben: «fachlich stark, sozial kompetent und digital fit» – und vollbepackt mit Handlungskompetenzen: Du kannst ... «Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen, Interagieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld, Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen, Gestalten von Kunden- oder Lieferantenbeziehungen und Einsetzen von Technologien der digitalen Arbeitswelt».
Giulia: Ja, super. Und ich? Ich suche seit Wochen erfolglos einen Ferienjob.
Marco: Nun, Ferienjobs zu finden ist wirklich schwierig. Viele Unternehmen haben einfach keine Zeit, dich für einige Wochen für eine Aufgabe einzuarbeiten ...
Giulia: Ja, du bist mir ja eine schöne Hilfe
Marco: Du müsstest halt selbst eine Geschäftsidee entwickeln. Aber lass uns doch ein Glacé bei El Bertin holen.
Giulia: Okay, machen wir. Aber: Warum kommt hier am Lindli eigentlich niemand mit einem Velo vorbei und bringt uns Glacé? Das wäre doch was, oder?
Marco: Genau, das wär’s: Giulias Glacé-Mobil!
1.2 Was halten Sie von Giulias Geschäftsidee? Begründen Sie Ihre Einschätzung.
Individuelle Antworten
Denkbare Antworten: Zu riskant, unsicher
Nachfragen zur Diskussion: Was ist die Alternative für Giulia?
1.3 Welche Fragen würden Sie an der Stelle von Giulia noch abklären?
Individuelle Antworten
Weitere Entscheidungsgrundlagen für unternehmerischen
Entscheid:
Wie viele Glacé können verkauft werden?
Braucht es Werbung?
Wie teuer ist ein Glacé-Mobil?
Gibt es Konkurrenz?
Welche Verkaufspreise?
n Geschäftsmodell «Giulias Glacé-Mobil»
Giulia hat vor einigen Wochen im Wirtschaftsunterricht das «Business Model Canvas» behandelt. In diesem Geschäftsmodell werden die neun wichtigsten Bausteine für den Unternehmenserfolg auf einer Seite dargestellt, wie auf eine Leinwand gemalt (engl. canvas = Leinwand).
Mit dieser Canvas-Darstellung wird eine Geschäftsidee einfach und übersichtlich mit den folgenden vier Fragen beschrieben:
• Was für einen Nutzen bringt das Unternehmen für seine Kunden?
• Für wen genau werden die Produkte und Dienstleistungen angeboten?
• Wie werden die Produkte und Dienstleistungen hergestellt?
• Wie viel kann mit dem Geschäftsmodell verdient werden?
1.4 Schauen Sie sich das Video «Business Model Canvas Explained» an Im Video werden die neun Schlüsselfaktoren des Geschäftsmodell-«Canvas» vorgestellt.
a) Suchen Sie für die englischen Ausdrücke sinngemässe deutsche Formulierungen und notieren Sie diese neun Schlüsselfaktoren in die nummerierten weissen Felder.
b) Die Schlüsselfaktoren lassen sich zu den vier Fragen: WAS? - FÜR WEN? - WIE? und WIE VIEL? gruppieren Ordnen Sie diese vier Fragen den umrahmten Kästchen zu
c) Notieren Sie anschliessend in den neun Blöcken für jeden Schlüsselfaktor ein mögliches Beispiel für Giulias Glacé-Mobil.




1.5 Wie schätzen Sie die Erfolgschancen des Geschäftsmodells «Giulias Glacé-Mobil» ein? Begründen Sie Ihre Einschätzung.
Individuelle Antworten Es fehlen noch genaue Zahlen à sorgfältig Einnahmen und Ausgaben planen à Budget erstellen
Partner Aktivitäten
Gelateria El Bertin, Schaffhausen (Glacé-Bezug)
Fahrrad-Touren mit Glacé-Mobil

Persönliche Portionierung vor Ort


Wiesel Events (Glacé-Mobil)
Kundennutzen Kundenkontakt Zielgruppe Mittel Vertriebskanäle
Zahlungskräftige Touristen und Einheimische

Glacé-Mobil mit E-Betrieb


Die besten Glacés am Rheinuferweg und in der Altstadt ...
... direkt vom Glacé-Mobil



Direktverkauf ab Glacé-Mobil
Kostenstruktur Einnahmen

Variable Kosten: - Glacé-Einkauf - Lohnkosten

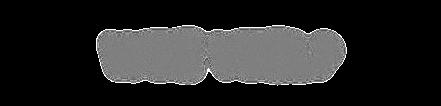
- Bareinnahmen - TWINT?
n Geschäftsidee
Eine Geschäftsidee ist ein erster Gedanke, wie man erfolgreich wirtschaften kann. Eine Geschäftsidee kann vieles sein, z.B. ein völlig neues Produkt bzw. eine völlig neue Dienstleistung, aber auch eine neue Lösung für ein bestehendes Problem oder die Verbesserung eines bereits bestehenden Produkts.
Schlüsselpartnerschaften, d.h.
unser Netzwerk von Lieferanten und Partnern
n Mit welchen Partnern können wir unsere Aktivtäten optimieren oder erweitern?
n Mit welchen Partnern können wir unser Risiko minimieren?
Schlüsselaktivitäten, d.h. Was genau müssen wir tun?
n Produktionsverfahren?
n Entwicklung von Problemlösungen?
n Entwicklung von Plattformen?
Kundennutzen, d.h.
n Geschäftsmodell
Ein Dokument, in dem aufgezeigt wird, nach welchen Grundprinzipien jemand mit einem Projekt oder einem Unternehmen Geld verdienen will, bezeichnen wir als Geschäftsmodell. Es gibt unterschiedliche «Vorlagen», um ein Geschäftsmodell zu erklären. Im Business Model Canvas (engl. Canvas = Leinwand) wird das Grundprinzip eines Unternehmens auf einer Seite mit den neun wichtigsten Faktoren (Schlüsselfaktoren) dargestellt, die für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind
Welches Paket von Produkten und/oder Dienstleistungen bieten wir an?
n Etwas ganz Neues?
n Ein bestehendes Produkt/eine bestehende Serviceleistung besser, schneller, günstiger?
n Massgeschneiderte Angebote, welche die Kunden selbst mitbestimmen?
n Spezielles Design, Marke, Status?

Schlüsselressourcen, d.h.
Was benötigen wir alles?
n Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge?
n Räumlichkeiten, Gebäude?
n Mitarbeitende?
Kostenstruktur (Aufwandseite der Erfolgsrechnung), d.h.
Wichtigste Kosten, die anfallen
n Wie viele fixe Kosten fallen an?
n Wie viele variable Kosten entstehen?
n Schwerpunkt auf Minimierung der Kosten?
n Schwerpunkt auf dem Erzielen von Wertschöpfung?
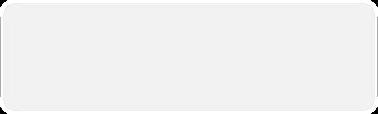
Kundenbeziehungen, d.h.
Wollen wir unsere Beziehungen zu den Kunden persönlich oder automatisiert gestalten?
n Persönliche Betreuung?
n Selbstbedienung?
n Automatisierte DL?
n Bilden unsere Kunden ein Netzwerk, eine Community?
n Sollen die Kunden das zukünftige Angebot mitbestimmen?
Zielgruppe, d.h.
Welche Kundensegmente wollen wir ansprechen?
n Grosse Gruppen von Kunden?
n Nischen abdecken?
n Spezielle Segmente mit besonderen Wünschen und Problemen?
n Mehrere Kundensegmente mit unterschiedlichen Ansprüchen und Problemen?
Vertriebskanäle, d.h.
Wie erreichen wir unsere Kunden?
n Eigene Verkaufsabteilung?
n Online-Shop?
n Eigene Filialen?
n Über den Grosshandel?
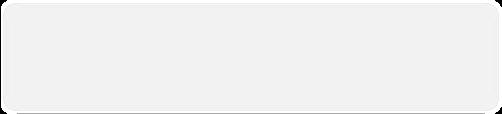
Einnahmequellen (Ertragsseite der Erfolgsrechnung)
Art der Kundenzahlungen; einmalige oder wiederkehrende Einnahmen?
n Verkauf von Produkten?
n Nutzungs-, Mitgliedsgebühren?
n Verleih, Vermietung, Leasing?
n Gebühren für Werbung?

Marco findet Giulias Geschäftsidee des Glacé-Mobils eigentlich auch noch cool. Er fragt sich aber ernsthaft, ob dieses Geschäftsmodell finanzierbar und rentabel ist. Marco schickt Giulia deshalb einen Artikel «Businessplan – Grundlage für erfolgreiche Unternehmungen» und schreibt dazu: Hey, Giulia, es gibt einiges zu planen: Mit wie viel Umsatz1 rechnest du? Benötigst du zusätzliches Personal? Welche Dinge musst du dir zu Beginn einmalig anschaffen, wie viel Kapital benötigst du für diese Anfangsinvestitionen? Und welche laufenden Kosten entstehen dir beim Betrieb deines Glacé-Mobils?
n Businessplan
Ein Businessplan gibt in knapper Form Auskunft über die Machbarkeit und die Leistungsziele der Unternehmung, enthält eine Chancen- und Gefahrenanalyse in Bezug auf Produkte und Märkte und umreisst die finanzielle Dimension des Unterfangens. Zudem liefert der Businessplan auch Informationen über den persönlichen Hintergrund der entscheidenden Personen. Für die Erstellung eines Businessplans gibt es viele verschiedene Anlässe.
n Gründung einer Unternehmung
Die Gründung einer Unternehmung ist ein Vorhaben, welches mit vielen Risiken verbunden ist. Dabei lohnt es sich, Vision und Strategie genau zu beschreiben, die Marktdaten sorgfältig zu analysieren, die Organisation der Unternehmung sowie die notwendigen Finanzen detailliert zu planen, um sämtliche Risiken realistisch beurteilen zu können. In einem Businessplan werden solche Informationen für Investoren, Kreditgeber oder allfällige Geschäftspartner systematisch zusammengestellt.
n Kapitalsuche für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit
Viele Unternehmungen erschliessen im Laufe der Zeit neue Geschäftsfelder, indem sie neue Produkte lancieren oder andere Firmen übernehmen. Diese Ausweitung der Geschäftstätigkeit erfordert in der Regel grosse Investitionen, die häufig mit Fremdkapital finanziert werden müssen. Für erfolgreiche Verhandlungen mit möglichen Kapitalgebern müssen alle relevanten Informationen systematisch und verständlich dargestellt werden – auch dazu dient ein Businessplan.
Mit einem Businessplan werden hauptsächlich zwei Ziele verfolgt:
• Erstens soll der Businessplan unternehmensintern die Machbarkeit eines Vorhabens aufzeigen. Wer einen Businessplan aufstellt, ist bereits bei der Planung von Vorhaben gezwungen, das ganze Projekt systematisch durchzudenken und die notwendigen Annahmen zu treffen.
• Zweitens dient der Businessplan auch als Dokument für Verhandlungen mit möglichen externen Kreditgebern (Investoren) und Geschäftspartnern. Diese wollen zur Beurteilung ihrer Entscheide die Chancen und Risiken umfassend dokumentiert haben.
n Elemente eines Businessplans
Ein Businessplan umfasst typischerweise zwei Bereiche: einen Konzeptteil und einen Finanzteil. Der Konzeptteil beinhaltet die Vision und die Strategie, eine Analyse des Marktes und das Marketingkonzept sowie die Organisation und das Management der Unternehmung. Der Finanzteil widmet sich dagegen der Darstellung der finanziellen Aufwände und Erträge des Vorhabens.
Konzeptteil
(1) Vision und Strategie
- Geschäftsidee
- Kundennutzen
(1) Markt
- Konkurrenzanalyse
- Zielgruppe, Kundensegmente
- Marketing-Mix (4P)
(2) Organisation und Management
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Führungs-, Geschäfts- und Supportprozesse
- Porträt der Geschäftsleitung
Abb. 8 Elemente eines Businessplans
Finanzteil
(4) Finanz planung
- Investitionsplanung
- Personalplanung
- Betriebsplanung
- Absatzplanung
- Plan- Erfolgsrechnung (Budget)
- Plan- Bilanz
- Liquiditätsplanung
1 Umsatz = Wert der verkauften Produkte und Dienstleistungen (Menge x Verkaufspreis)
n Finanzplanung
Unternehmerische Entscheide kosten Geld und sollen in der Zukunft Erträge für die Unternehmung bringen. Das für Investitionen benötigte Kapital sowie die mit der Geschäftstätigkeit zusammenhängenden Finanzströme gilt es sorgfältig zu planen.
Finanzplanung ist das Resultat einer umfassenden Unternehmungsplanung. Sie zeigt auf der Grundlage weiterer Planungsrechnungen (z.B. der Absatz- und Investitionsplanung) auf, ob eine Geschäftsidee bzw. ein Geschäftsmodell finanzierbar und rentabel ist.
Sie gibt Auskunft darüber, wie viel Gewinn das Unternehmen voraussichtlich über die Zeit erzielen wird (Plan-Erfolgsrechnung bzw. Budget), wie sich die Vermögens- und Finanzierungssituation entwickelt (Plan-Bilanz) und ob die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens jederzeit gewährleistet ist (Liquiditätsplan).
Investitionsplanung
Notwendige Anschaffungen?
Personalplanung
Mitarbeitende, Löhne?
Betriebsplanung
Arbeitstage, Arbeitszeiten?
Absatzplanung
Mengen, Sortiment?
Budgetierung
Einnahmen, Ausgaben?
Plan-Erfolgsrechnung
... gibt Auskunft über den voraussichtlichen Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)
Abb. 9 Finanzplanung
Finanzplanung
Plan-Bilanz
... gibt Auskunft über die Vermögens- und Finanzierungssituation
Liquiditätsplan
... gibt Auskunft über die jederzeitige Zahlungsfähigkeit
Plan-Erfolgsrechnung (Budget)
Mit der Plan-Erfolgsrechnung (oft auch als Budget bezeichnet) als Kernstück der Finanzplanung schätzt die Unternehmensführung auf Grundlage verschiedener Annahmen den zukünftigen Erfolg (Gewinn bzw. Verlust) innerhalb eines definierten Zeitraums (z.B. ein Jahr). Die Plan-Erfolgsrechnung besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: erstens der Schätzung des für den Betrachtungszeitraum erwarteten Umsatzes (Absatzmengen mal Verkaufspreise) und zweitens der Berechnung der mutmasslichen Aufwände für die Realisierung des prognostizierten Umsatzes (z.B. Einkaufs-, Produktionsaufwand, Löhne, Verwaltungsaufwand, Abschreibungen aus Investitionstätigkeiten).
Im Gegensatz zur Plan-Erfolgsrechnung ist die Plan-Bilanz eine zeitpunktbezogene Darstellung (Erfassung der Bestandesgrössen, vergleichbar mit einer Moment- bzw. Fotoaufnahme).
Die Plan-Bilanz im Sinne einer Eröffnungsbilanz steht am Ende der Gründungsphase und zeigt die substanzielle Struktur des Unternehmens als Ergebnis der Gründungsaktivitäten. In der Plan-Bilanz wird, bezogen auf einen bestimmten Stichtag, das Vermögen den Schulden bei Fremd- und Eigenkapitalgebern gegenübergestellt. Die Plan-Bilanz zeigt damit auf, auf welche Art das Unternehmen finanziert ist (Passivseite) und wie diese finanziellen Mittel investiert sind (Aktivseite).
Eine weitere wichtige Teilrechnung im Rahmen der Finanzplanung ist der Liquiditätsplan. Für die Planung und Überwachung der flüssigen Mittel werden alle Zahlungsein- und -ausgänge in einem definierten Zeitraum erfasst.
Damit wird primär die jederzeitige Zahlungsbereitschaft sichergestellt. Zeigt nämlich der Finanzplan eine zu starke Verminderung der liquiden Mittel, so muss der zusätzliche Finanzbedarf definiert und daraus entsprechende Massnahmen, wie z.B. Verhandlungen mit der Bank, abgeleitet werden.
n Ein Budget für «Giulias Glacé-Mobil»
Im Internet hat Giulia ihr Traum-«Glacé-Mobil» entdeckt: Das Eisfahrrad von Wiesel Events!

Abb. 10 Website www.das-eisfahrrad.com
2.1 Giulia fordert gleich eine Offerte an. Schon am nächsten Tag trifft die Offerte ein.
Öffnen Sie mit dem nebenstehenden QR-Code/Link die Offerte der Firma Wiesel Events und bestimmen Sie den Kapitalbedarf für die Finanzierung von Giulias Traum-Glacé-Mobil, wenn Giulia die teuerste bzw. die günstigste Variante wählt.
Teuerste Variante (Eisfahrrad): CHF 17'460.–
Günstigste Variante (Eiskarre): CHF 7'050.–

2.2 Jetzt geht’s ans Budgetieren:
In der untenstehenden Excel-Tabelle hat Giulia die geplanten Einnahmen- und Ausgabenpositionen vorbereitet, in den gelb markierten Feldern hat sie ihre Annahmen betreffend Arbeits-, Absatz- und Sortimentsplanung eingegeben und die Einnahmen und Ausgaben mit verschiedenen Preisansätzen budgetiert. Welche Annahmen würden Sie treffen?
Laden Sie mit dem nebenstehenden QR-Code/Link die Excel-Tabelle Giulias Budgetvorlage herunter und geben Sie Ihre Entscheidungen ein.
Mit welchem Erfolgrechnen Sie für Giulias Geschäftsmodell?


Abb. 11 Giulias Budget als Excel-Tabelle
Individuelle Antworten, je nach getroffenen Annahmen
n Giulias Budget
Giulia hat für sich das folgende Budget erstellt:
(1) Investitionsplanung
Glacé-Mobil 4’000.00 CHF
(2) Personalplanung
Giulia 4Wochen,28Tage
(3) Betriebsplanung
(4) Absatzplanung: Absatzmengen
Anzahl
Abb. 12 Giulias Budget (Teil 1)
Sortiment
1 Kugel - im Cornet
2 Kugeln - im Cornet
3 Kugeln -
4
(5) Budgetierung Einnahmen
1
2 Kugeln -
3
4
Ausgaben
Einkauf Glacé
Kugel inkl. Cornets und Becher
Gebühren Standplatz Lindli 250 CHF 27’008 CHF
Erfolg (Einnahmen – Ausgaben)
Abb. 13 Giulias Budget (Teil 2)
2.3 Wie beurteilen Sie dieses Budget? Begründen Sie Ihre Antwort.
Individuelle Antworten
- Annahmen zum Wetter realistisch?
- Annahmen zum Absatz realistisch ?
- Annahmen zu den Verkaufspreisen realistisch?
- Annahmen zum Lohn realistisch?

Aufgrund ihrer Finanzplanung ist Giulia wild entschlossen, ihr Glacé-Mobil-Projekt zu realisieren. Am nächsten Wochenende hat die Oma von Giulia Geburtstag und die ganze Familie feiert zusammen. Giulia will vor dem Dessert ihre Oma und die ganze Familie von der Geschäftsidee ihres Glacé-Mobils überzeugen.
n Omas Bedingung für die Finanzierung des Glacé-Mobils
Giulias Oma hat früher eine eigene Treuhandunternehmung geführt und ist vom unternehmerischen Engagement ihrer Enkelin begeistert. Giulia staunt nicht schlecht, als sie am nächsten Tag die folgende WhatsApp-Nachricht von ihrer Oma erhält:
«Liebe Giulia, für dein Ferienprojekt ‹Glacé-Mobil› fehlt dir ja noch etwas Kapital – nicht wahr? Ich möchte mich an deinem Projekt mit einem Darlehen beteiligen (Laufzeit 3 Jahre, Zinssatz 0,1%, fällig jeweils am 30. September). Und weil du immer den Überblick über deine Finanzen haben solltest, führst du für dein Glacé-Mobil eine doppelte Buchhaltung und erstellst per 31.12. jeweils eine Jahresrechnung mit Bilanz und Erfolgsrechnung. Und dann schauen wir gemeinsam, wie dein Projekt weitergehen soll. Einverstanden?
Falls ja, gib mir deine IBAN-Nummer an. Mit kühlen Glacé-Grüssen, deine Oma»
Abb. 14 Erste Kapitalgeberin: Giulias Oma
Giulia kann es kaum glauben ... und schreibt sofort zurück:
«Wow!!! Natürlich einverstanden!

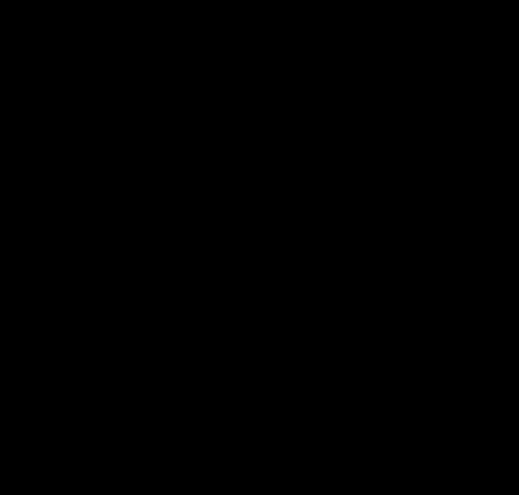
3.1 Wer ist an finanziellen Informationen einer Unternehmung überhaupt interessiert?
a) Tragen Sie die verschiedenen Anspruchsgruppen in die ovalen Kreise ein.
b) Weshalb sind finanzielle Informationen einer Unternehmung für die jeweiligen Anspruchsgruppen bedeutsam? Tragen Sie die Interessen der jeweiligen Anspruchsgruppen stichwortartig in die rot umrandeten Kästchen ein.

Vergleichszahlen?
(Benchmark)
Meine IBAN-Nummer sende ich dir, sobald ich das Bankkonto eröffnet habe.



»

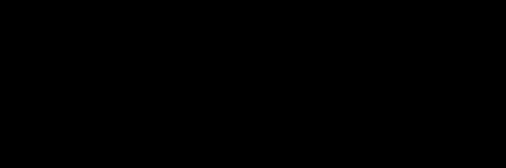
Konkurrenz

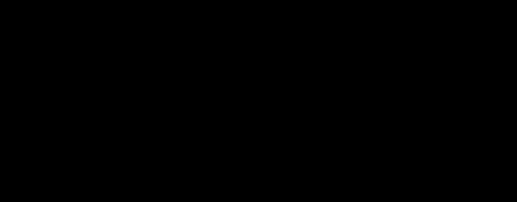
Kapitalgeber
Lieferanten

Liefersicherheit?

Staat
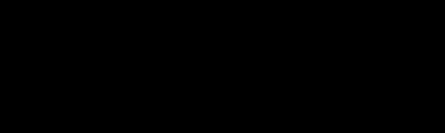


Angebot in Zukunft? Gewinn?
Kunden


Mitarbeitende
Institutionen
NGO
Zahlen für Steuern Lohnerhöhungen?

Soziales Engagement
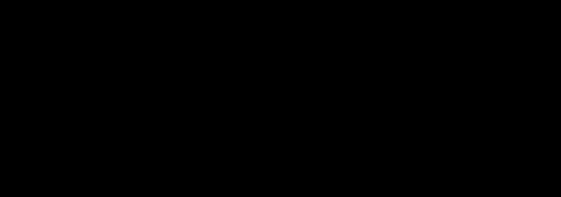



Abb. 15 Unternehmungsmodell – Anspruchsgruppen und ihre Interessen für finanzielle Informationen Vertiefen und vernetzen Sie Ihre Kompetenzen mit der Aufgabe 2
3.2
Giulia hat keine Ahnung, was eine «Doppelte Buchhaltung» ist. Sie recherchiert in der Schulbibliothek zu den Begriffen «Doppelte Buchhaltung», «Bilanz» und «Erfolgsrechnung». In einer Publikation findet Giulia die folgende Übersicht.
Recherchieren auch Sie zu den Begriffen «Doppelte Buchhaltung», «Bilanz» und «Erfolgsrechnung» und ergänzen Sie in der untenstehenden Abbildung die grau schattierten Kästchen mit den zutreffenden Fachausdrücken.
Rechnungswesen
Begriff systematische Erfassung, Überwachung und Aufbereitung aller finanziell relevanten Vorgänge eines Unternehmens
Ziele / Aufgaben
Dieser Bereich richtet sich mit seinen detaillierten Analysen zu Kosten und Erträgen der einzelnen Produkte oder Dienstleistungen intern an die Geschäftsleitung; die Ergebnisse sind für die Öffentlichkeit nicht einsehbar
1. Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen
2. Informationen für die Anspruchsgruppen des Unternehmens
Dieser Bereich liefert nicht nur intern Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsleitung, sondern er dient durch die Veröffentlichung des Geschäftsberichts (inkl. Jahresrechnung) ebenso der Information externer, interessierter Kreise (Stakeholder).
Bereiche Betriebsbuchhaltung (Bebu) Finanzbuchhaltung (Fibu) Ergänzende Bereiche
zeigt Kosten und Erlöse für einzelne Produkte und Dienstleistungen
Vorgänge
Buchführung
... erfasst die finanziell relevanten Geschäftsfälle
erfasst Geschäftsvorgänge und zeigt Vermögen, Schulden und Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)
... Geldflussrechnung
... Bilanz- und Erfolgsanalyse
... Budget
Rechnungslegung
... Geschäftsbericht (bei grösseren Unternehmungen einsehbar)
Gesetzliche Vorschriften
... Art. 957 – 964 Obligationenrecht (OR) beinhalten die Vorschriften zur Kaufmännischen Buchführung und zur Rechnungslegung.
Abb. 16 Begriffsübersicht zum Rechnungswesen
Jahresrechnung Anhang Bilanz Erfolgsrechnung
Alles verstanden? Kontrollieren Sie Ihr Wissen mit den Übungen 3.1 – 3.5
Viele Begriffe in der Begriffsübersicht zum Rechnungswesen erscheinen Giulia doch sehr abstrakt. Zusammen mit ihren Eltern schaut sie sich die Begriffe Vermögen, Schulden und Erfolg (Gewinn/Verlust) am Beispiel der finanziellen Situation ihrer Familie an.
n Die finanzielle Lage von Giulias Familie
Der Vater von Giulia (48 Jahre), arbeitet seit über 10 Jahren als Lastwagenfahrer bei einer Speditionsfirma, Giulias Mutter (45 Jahre) ist vor 5 Jahren wieder als Sachbearbeiterin mit einem Teilpensum von 50 % in einer Beratungsfirma eingestiegen. Tiziano (15 Jahre), der jüngere Bruder von Giulia, absolviert eine Kaufmännische Berufslehre mit Berufsmaturität im 1. Lehrjahr. Giulias Vater verdient als Lastwagenfahrer CHF 5'500.‒ pro Monat. Vor einigen Jahren konnte sich die Familie dank einer Erbschaft ein kleines Haus leisten, geerbt hat sie auch eine Ferienwohnung in Grindelwald. Das Haus wurde zu 80 %, die Ferienwohnung zu 75 % mit Bankkrediten (Hypotheken) finanziert.
4.1 Beantworten Sie die folgenden Fragen zur finanziellen Situation von Giulias Familie
a) Welche Beträge würden Sie für die noch offenen Positionen einsetzen? Tragen Sie in die grau schattierten Felder Ihre Schätzungen ein (auf CHF 1'000.– gerundet)
b) Welche weiteren Aktiven, Passiven, Aufwände oder Erträge fehlen aus Ihrer Sicht in dieser Übersicht? Notieren Sie diese Positionen mit dem von Ihnen geschätzten Betrag auf die freien Schreiblinien.
c) Recherchieren Sie im Internet jene Begriffe, die Sie nicht verstehen.
d) Ermitteln Sie mit der nebenstehenden Tabelle das Nettovermögen von Giulias Familie
e) Wie beurteilen Sie die finanzielle Lage von Giulias Familie?
Individuelle Antworten
Die Kellers sind zwar fast Millionäre, aber:
- Grossteil des Eigenkapitals ist für die Pensionskasse reserviert.
- Ertragsüberschuss ist nicht sehr gross, wenn man Ferien macht.
Schulden Offene Rechnungen
Vermögen
Aktiven
Abb. 17 Schema zur Berechnung des Nettovermögens bzw. des Eigenkapitals
Vermögen (Aktiven)
Bilanz Familie Keller per 31.12.2024
Schulden (Passiven)
Flüssige Mittel 10’000 Offene Rechnungen 20’000
Bargeld 1’500 Steuerrechnung 12’500
Postkontoguthaben 2’000 Zahnarztrechnung 5’000
Bankkontoguthaben 6’500 Kreditkartenrechnung 2’500
Wertschriften 35’000 Weitere Verbindlichkeiten 580’000
Aktien 25’000 Hypothek Haus 400’000
Fondsanteile 10’000 Hypothek Ferien-Wg 180’000
Sparguthaben 500’000
Sparkontoguthaben 50’000
Altersguthaben Pensionskasse 450’000
Mobiliar 200’000
Möbel, Kleider, Bilder, Geschirr
Geräte (Küche, Fernseher, PC)
Ausrüstung Hobby
Fahrzeuge 15’000
Toyota 13’000
Roller, Velo 2’000
Immobilien 740’000
Haus 500'000
Ferienwohnung 240'000
Vermögensüberschuss (= Eigenkapital)
Abb. 18 Bilanz und Erfolgsrechnung der Familie Keller
Wertverzehr (Aufwände)
Wohnen
Miete inkl. Nebenkosten / Hypothekarzinsen, Strom, Wasser, Telefon / Internet, Radio/TV (Serafe)
Erfolgsrechnung Familie Keller für das Jahr 2024
Wertzuwachs
Lohn Vater 71’500
Lohn Mutter 30’000
Kinder-/Ausbildungszulagen 6’000
Versicherungen 13’340 Übrige Einnahmen 2’500
Krankenkasse / Unfall 11’340 Wertschriftenerträge, Mieteinnahmen Ferienwohnung
Mobiliar / Haftpflicht 500
Lebens-/Gebäudeversicherung 1’500
Steuern 12’000
Gemeinde-/Kantonssteuern 10’000
Bundessteuer 2’000
Mobilität 3’360
Öffentlicher Verkehr
Roller, Velo
Auto 12’000
Steuern, Versicherungen (Haftpflicht/Kasko-Versicherung), Abstellplatz/Garage, Vignette, Service, Reparaturen, Benzin, Abschreibung (Wertverlust/Amortisation)
Verschiedenes 4’670
Zeitungen/Zeitschriften, Mitgliedschaften, Verbände, PC (Unterhalt/Amortisation), Schulgeld, Aus- und Weiterbildung, Sport (Ausrüstung, Lager)
Haushalt 6’000
Nahrungsmittel, Getränke, Nebenkosten, Geschenke/Einladungen/Geburtstage
Persönliche Auslagen 9’840
Kleider/Schuhe, Taschengeld (Freizeit, Ausgang), Handy, Auswärtige Verpflegung
Ertragsüberschuss (= Gewinn)
... für Anschaffungen, Ferien, Unvorhergesehenes 8’406
n Bilanz
Die Bilanz einer Unternehmung unterscheidet zwischen Vermögen (Aktiven) und Schulden (Passiven). Den Überschuss des Vermögens über die Schulden bezeichnet man als Nettovermögen bzw. als Eigenkapital.
Ziel einer Unternehmung ist es, Güter und Dienstleistungen zu produzieren und erfolgreich zu verkaufen. Durch die Herstellung und den Verkauf dieser Güter und Dienstleistungen entstehen Aufwendungen und Erträge. Diese stellt man in der Erfolgsrechnung einander gegenüber, um daraus den Erfolg (Gewinn oder Verlust) zu ermitteln.
Die Aktiven (das Vermögen) geben Auskunft darüber, wie die Unternehmung das verfügbare Kapital angelegt (investiert) hat. Beispiele dafür sind Bargeld, Guthaben auf dem Bank- oder Postkonto sowie Fahrzeuge, Maschinen oder Immobilien.
Gegliedert werden die Aktiven in Umlaufvermögen und Anlagevermögen:
• Zum Umlaufvermögen gehören die flüssigen Mittel (Kasse, Post- und Bankguthaben) und solche Vermögensteile (Kundenguthaben, Vorräte), die kurzfristig (d.h. innerhalb eines Jahres) in flüssige Mittel umgewandelt werden können.
• Das Anlagevermögen umfasst die Vermögensteile, die dem Unternehmen für lange Zeit (meist über mehrere Jahre) zur Nutzung bereitstehen (Büroeinrichtungen, Geschäftsliegenschaft, Maschinen etc.).
Die Passiven (die Schulden) zeigen auf, wie das Unternehmen finanziert ist, d.h. wer dem Unternehmen Kapital zur Verfügung gestellt hat. Das sind zum einen aussenstehende Geldgeber wie Banken oder weitere Kreditgeber und zum andern die Eigentümerinnen oder Eigentümer mit ihrem Eigenbetrag am Unternehmen.
Bei den Passiven wird zwischen Fremdkapital und Eigenkapital unterschieden.
• Fremdkapital (Schulden) wird nach der Fälligkeit geordnet, d.h. zuerst Schulden, die innerhalb eines Jahres bezahlt werden müssen (kurzfristiges Fremdkapital), und anschliessend Schulden, die erst nach mehr als einem Jahr bezahlt werden müssen (langfristiges Fremdkapital)
• Das Eigenkapital (Reinvermögen) zeigt den Kapitalbeitrag der Eigentümerinnen oder Eigentümer. Bei Aktiengesellschaften ist dies das Aktienkapital, bei einer GmbH das Stammkapital sowie bei beiden die Reserven und ein allfälliger Gewinnvortrag.
In der Bilanz werden die Aktiven und die Passiven an einem Stichtag einander gegenübergestellt und in ein «Gleichgewicht» gebracht, d.h. die Summe aller Aktiven muss gleich gross sein wie die Summe aller Passiven.
Aufwand ist alles, was (voraussichtlich) innerhalb eines Jahres verbraucht oder weiterverarbeitet oder weiterverkauft oder weniger wert wird
Beispiele für einen Coiffeur-Salon
• «verbrauchen»: Lohnzahlungen für Arbeitsstunden der Mitarbeitenden (Personalaufwand)
• «weiterverarbeiten»: Einkauf von Farben und Tönungsmitteln (Materialaufwand)
• «weiterverkaufen»: Einkauf von Shampoos und Haarfestiger zum Verkauf (Warenaufwand)
• «weniger wert wird»: Abnutzung Coiffeurstuhl durch Gebrauch und Alterung (Abschreibungsaufwand)
Ertrag entsteht aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen oder durch Einnahmen aus weiteren Leistungen
Beispiele für einen Coiffeur-Salon
• «Verkauf von Gütern und Dienstleistungen»
o Umsatz an Haarschnitten (Dienstleistungsertrag)
o Verkauf von Shampoos und Haarfestigern (Warenertrag)
• «Einnahmen aus weiteren Leistungen»
o an Dritte vermietete Lagerräume (Mietertrag)
Die Zahlen einer Erfolgsrechnung beziehen sich immer auf einen bestimmten Zeitraum. Gesetzliches Erfordernis ist eine Jahresrechnung, d.h. die Auflistung sämtlicher Aufwendungen und Erträge über ein Geschäftsjahr. Es lohnt sich allerdings in vielen Fällen, eine Erfolgsrechnung für das halbe Jahr, für das Quartal und eventuell sogar für jeden Monat zu erstellen. Damit kann man rasch abschätzen, ob ein Unternehmen im Budget liegt oder ob Korrekturen nötig sind.
Für die Betriebsabläufe in einem Unternehmen werden Arbeitskräfte, Vermögenswerte (Produktionsmittel usw.) und gewisse Leistungen von externen Anbietern benötigt. Das verursacht unter anderem Lohnzahlungen, Materialverbrauch, Abnützung von Anlagen und Mietzinskosten. Diesen Wertverzehr bezeichnet man in der Buchhaltung als Aufwand. Durch den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen entsteht auf der anderen Seite aber auch ein Wertzuwachs, den man als Ertrag bezeichnet.
Anlagevermögen oder Aufwand? In der Praxis werden kleinereAnschaffungen(biszuCHF1'000.–)als Aufwand behandelt, auch wenn sie länger als ein Jahr genutzt werden können, wie z.B. Computerprogramm für CHF 350.– oder Büromaterialvorrat (Drucksachen, Couverts)
4.2 Marco will Giulia eine Excel-Tabelle erstellen, mit welcher sie die Bilanz einfach und korrekt gegliedert erstellen kann. Seine Idee: Man gibt die Vermögenspositionen (Aktiven) und die Schuldpositionen (Passiven) in einer Spalte ein und ... schwupp steht die Bilanz, korrekt gegliedert und beschriftet.
Er erstellt eine Bilanz mit verschiedenen Aktiv- und Positionen. Marco hat die Geldbeträge in Kurzform bzw. Kurzbezeichnung eingegeben, um Platz zu sparen. Beim ersten Versuch (siehe rechts) hat es offensichtlich noch nicht richtig funktioniert.
Markieren Sie die Fehler und erstellen Sie unten die korrekt gegliederte und richtig beschriftete Bilanz.
Bilanz vom 01.01. – 31.12.2024 (Beträge in Kurzform)
(Laufzeit 4 Monate)
Verbindlichkeiten
Bilanz vom 31.12.2024 (Beträge in Kurzform) Aktiven
Giulia weiss jetzt, was sie im Rechnungswesen zu tun hat: mit einer sauberen Buchführung eine aussagekräftige Bilanz und Erfolgsrechnung erstellen. Eigentlich ganz einfach, oder?
n «Geschäftsfälle» verändern die Bilanz und die Erfolgsrechnung
Ja schon, denkt sich Giulia, aber im Zusammenhang mit ihrem Glacé-Mobil werden ja ganz viele Dinge zu berücksichtigen sein, z.B. der Kauf des Glacé-Mobils, die Überweisung des Darlehens der Grossmutter, der Einkauf der Glacé bei El Bertin, die (hoffentlich) vielen Einnahmen aus dem Glacé-Verkauf und dann natürlich der Lohn, den sich Giulia auszahlen will. Wie werden all diese Vorgänge, die sogenannten «Geschäftsfälle», am besten aufgezeichnet?
n «Konto» – die zentrale Datenstruktur in der Buchführung
In der Wikipedia findet Giulia die folgende Erklärung zum Begriff «Konto»:
«Prinzipiell ist ein Konto eine Tabelle mit beliebig vielen Zeilen und zwei (als Soll und Haben bezeichneten) Spalten, die Geldbeträge aufnehmen. Zu diesen zwei Spalten kommen in praktischen Anwendungen fast immer zusätzliche Hilfsspalten, die Informationen wie das Buchungsdatum, eine fortlaufende Nummer der Buchungszeile, erläuternden Text etc. aufnehmen.
Das Konto selbst wird durch eine (meist numerische, seltener alphanumerische) Kontonummer identifiziert und trägt fast immer zusätzlich eine prägnante Bezeichnung. Vielfach ist eine Information wie die Art des Kontos in seiner Nummer codiert, was ein als Kontenplan oder auch als Kontenrahmenplan bezeichnetes Schema zur Nummernvergabe erfordert.»
Abb. 19 T-Kontenblatt für den Schulgebrauch
5 Giulia überlegt sich, wie ein solches Konto für ihre Unternehmung aussehen würde und ...
... skizziert das Konto Bank(Kontokorrent-Guthaben) in Form eines T-Kreuzes
... beschriftet die beiden Seiten mit S ( für Soll) und H(für Haben)
... beschriftet die beiden Seiten mit +(fürZunahmen)und – (Abnahmen)
... trägt die Beträge der Geschäftsfälle1)bis 6) auf der richtigen Seite ein
... ermittelt die Differenz zwischen der Soll- und Habenseite (= Saldo)
... trägt den Schlussbestand (Saldo) ein.
Gehen Sie vor wie Giulia, und führen Sie das nebenstehende Konto.
Nr. Vorgang = Geschäftsfall
1) Giulia eröffnet für ihr Glacé-Mobil ein separates Bankkonto
Giulia zahlt von ihrem persönlichen Sparkonto CHF 600.– auf ihr neues Bankkonto ein.
2) Die Eltern gewähren Giulia für das Unternehmen «Glacé-Mobil» ein Darlehen
600
Die Eltern überweisen Giulia den Betrag von CHF 7'000.– auf ihr neues Bankkonto. 7’000
3) Giulia bestellt bei der Unternehmung ein GlacéMobil, Liefertermin Mitte Juni.
Giulia überweist den Betrag von CHF 4'000.–von ihrem Bankkonto.
4) Giulia vereinbart mit www.elbertin.ch einen laufenden Glacébezug für den Monat Juli.
4’000
Giulia überweist eine erste Teilzahlung von CHF 3'200 – im Voraus an die Gelateria El Bertin. 3’200
5) Das Geschäft läuft recht gut: Ende Juli hat Giulia die bezogenen Glacés restlos verkauft.
Giulia zahlt den ganzen Verkaufserlös von insgesamt CHF 6'400 – auf das Bankkonto ein
6) Aufgrund des guten Geschäftsganges kann ein Teil des Darlehens zurückbezahlt werden.
Giulia überweist ihren Eltern mit einer Banküberweisung CHF 3'500 –
6’400
(Zwischentotal Sollseite) und (Zwischentotal Habenseite) (14’000) (10'700)
Saldo = Differenz Zwischentotal Sollseite und Habenseite. Eintrag auf der kleineren Seite.
Mithilfe der Bilanz werden die Vermögens- und Schuldverhältnisse für einen bestimmten Stichtag (meistens 31.12.) übersichtlich dargestellt. Dabei wird für jede einzelne Vermögensposition ein Aktivkonto und für jede einzelne Schuldposition ein Passivkonto ausgewiesen.
6.1 Ergänzen Sie die Bilanzkonten mit S (Soll) und H (Haben) sowie + (plus) und – (minus)
Aktivkonten funktionieren plus / minus + / –
• Saldovortrag = Anfangsbestand (AB) im Soll (links)
• Zunahmen im Soll (links) / Abnahmen im Haben (rechts)
• Saldo (S) = Differenz zwischen
Soll- und Habenseite, steht rechts (Haben-Seite), zeigt den Schlussbestand (SB) des Aktivkontos S Aktivkonto H +
Anfangsbestand AB
Abnahmen –
Saldo = Schlussbestand
Aktivkonten

Gelb wie das Gold (Gold ist Vermögen)
(Farblegende nach www.buchen.ch)
Passivkonten funktionieren minus / plus
• Saldovortrag = Anfangsbestand im Haben (rechts)
• Abnahmen im Soll (links) / Zunahmen im Haben (rechts)
• Saldo (S) = Differenz zwischen Soll- und Habenseite, steht links (Soll-Seite), zeigt den Schlussbestand (SB) des Passivkontos
Passivkonto H
Abnahmen
Saldo = Schlussbestand
Anfangsbestand
Zunahmen
Passivkonten
Mithilfe der Erfolgsrechnung werden die Ursachen für den Gewinn bzw. den Verlust für einen bestimmten Zeitraum (meist 1 Jahr) dargestellt. Dabei wird für jede Aufwandposition ein Aufwandskonto und für jede Ertragsposition ein Ertragskonto geführt.
6.2 Ergänzen Sie die Erfolgskonten mit S (Soll) und H (Haben) sowie + (plus) und – (minus)
Aufwandskonten funktionieren plus / minus
• Kein Anfangsbestand (Rechnung beginnt bei «null»)
• Zunahmen im Soll (links) / Abnahmen im Haben (rechts)
• Saldo (S) = Differenz zwischen Soll- und Habenseite, steht im Haben (rechts), zeigt den Aufwand des Geschäftsjahres
Aufwandskonto
Zunahmen
Abnahmen
Aufwandskonten
Ertragskonten funktionieren minus / plus
• Kein Anfangsbestand (Rechnung beginnt bei «null»)
• Abnahmen im Soll (links) / Zunahmen im Haben (rechts)
• Saldo (S) = Differenz zwischen Soll- und Habenseite, steht im Soll (links), zeigt den Ertrag des Geschäftsjahres
Ertragskonto
Zunahmen
Saldo (S) Ertragskonten


Blau wie die Wellen (je grösser desto gefährlicher)

Rot wie das Feuer (sollte man im Griff haben)

Grün wie die Pflanzen (wollen wachsen)
7 Kontenrahmen und Kontenplan – Gliederung der vier Kontenarten
n Ein Kontenrahmen als «Menükarte» für die Buchhaltung
In jeder Unternehmung sind viele verschiedene Informationen gefragt: «Wie hoch ist unser Guthaben auf der Bank?», «Welche Rechnungsbeträge müssen unsere Kunden uns noch bezahlen?», «Welchen Wert haben unsere Produktionsmaschinen noch?», um nur einige zu nennen. Für jede gewünschte Information werden die massgebenden Geschäftsfälle, z.B. «Überweisung vom Bankkonto», «Zahlung eines Kunden» oder der «Wertverlust einer Maschine durch Gebrauch und Alterung», in der Form eines sogenannten Kontos laufend erfasst. Der aktuelle Kontostand zeigt dann die gewünschte Information.
S Kasse H S Verb L+L H S Warenaufwand H S Warenertrag H
Die Konten (mit 4-stelligen Kontennummern) werden in neun verschiedene Kontenklassen (Ziffer 1-9) eingeteilt, wobei diese wiederum in Hauptgruppen (10 – 89) und in Gruppen (100 – 899) zusammengefasst werden können.
7.1 Mit Hilfe der Kontenklassen lassen sich einfach Zwischenresultate berechnen, wie z.B. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust, Bruttogewinn und Betriebsgewinn. Tragen Sie diese drei Zwischenresultate in der folgenden Tabelle ein.
Nr. Kontenklasse
1 Aktiven
2 Passiven
3 Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen
4 – Aufwand für Material, Handelswaren und Dienstleistungen
=
S Bank H S Hypotheken H S Lohnaufwand H
10'000.– 4'000.–(S) 6'000.–
S Fahrzeuge H S Eigenkapital H S Raumaufwand H
4'000.– 10'000.–(S) 4'000.– (S) 10'000.-
n Kontenrahmen
Welche Konten soll man für seine Buchhaltung nun wählen? Je nach Branche bestehen dazu verschiedene Vorschläge, mit dem Fachausdruck Kontenrahmen genannt. Ein Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis von möglichen Konten für gleichartige Unternehmungen.
Jedes Konto besitzt dabei eine 4 - stellige Kontonummer , welche einerseits eine übersichtliche Gliederung und andererseits eine einfache elektronische Zuordnung in Buchhaltungsprogrammen ermöglicht.
Kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) sind Firmen mit weniger als 250 Beschäftigten. Die KMU bilden mehr als 99% der Unternehmen und stellen zwei Drittel der Arbeitsplätze. Für diese rund 600'000 Unternehmen besteht ein einheitlicher Schweizer Kontenrahmen KMU. Wenn die Unternehmen ihre Konten aus dieser Vorlage entnehmen, ist ein Vergleich der finanziellen Kennzahlen zwischen den Unternehmen einfacher möglich
Bruttogewinn
5 – Personalaufwand
6 – Übriger Betriebsaufwand, Abschreibungen und Finanzergebnis
Betriebsgewinn
7 + / – Betriebliche Nebenerfolge
8 + / – Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg, Steuern
=
Jahresgewinn bzw. Jahresverlust
9 Abschluss- und Hilfskonten
n Kontenplan
Je mehr Konten eine Unternehmung verwendet, desto mehr Informationen sind in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung ersichtlich. Jede Unternehmung kann die Konten individuell anpassen, z.B. die Kontennamen ändern. Die Struktur des Kontenrahmens ist beizubehalten, damit Vergleiche zwischen Unternehmungen einfach möglich sind.
7.2 In der folgenden Darstellung finden Sie die Kontenbezeichnungen, wie Sie im KMUKontenrahmen vorgeschlagen werden, mit Beispielen von Geschäftsfällen.
Häufig werden die Kontenbezeichnungen abgekürzt. Verwenden Sie konsequent die gleichen Abkürzungen.
n Kontenbezeichnungen, Abkürzungen und Beispiele
Kontenklasse 1 Aktiven Abkürzung
1000 Kasse Ka
1010 PostFinance (Kontokorrent-Guthaben) Po
1020 Bank (Kontokorrent-Guthaben) Ba
1060* Wertschriften UV (mit Börsenkurs) Ws UV
1100* Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) Ford L+L (Deb)
1200* Warenbestand (Vorräte Handelswaren) Wa-Best
1210* Rohmaterialbestand (Vorräte Rohmaterial) Roh-Mat-Best
1400* Wertschriften AV Ws AV
1500* Maschinen und Apparate Masch
1510* Mobiliar und Einrichtungen Mob
1520* Büromaschinen (inkl. Informatik) Büro-Masch
1530* Fahrzeuge Fz
1540* Werkzeuge und Geräte Werkz
1600* Immobilien (Geschäftsliegenschaften) Immob
Kontenklasse 2 Passiven
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) Verb L+L (Kred)
2100 Bank (Kontokorrent-Schuld) Ba
2101 PostFinance (Kontokorrent-Schuld) Po
2140 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Kfr Verb
2450 Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Lfr Darl-Verb
2451 Hypothekarschulden Hypo
2800 Eigenkapital EK
2891 Jahresgewinn / Jahresverlust
J-Gew / J-Verl
Erläuterung / Beispiele
Bargeld (Münzen, Noten) in der Geschäftskasse
Wir haben ein Guthaben auf dem Bankkonto bzw. Postkonto. Die Bank bzw. Post schuldet uns Geld. Die Bank führt für uns eine laufende Rechnung (Kontokorrent). Wir haben mehr Einzahlungen als Kreditbezüge.
Geld, welches kurzfristig in Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fonds) angelegt ist. Diese Wertschriften werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres wieder verkauft werden
Kundenrechnungen. Wir verkaufen selbst hergestellte Güter, Waren oder Dienstleistungen an Kunden auf Rechnung (auf Kredit) Zahlungsfrist 10, 20 oder 30 Tage. Kunden schulden uns Geld
Am Bilanzstichtag muss ein Verzeichnis (Inventar) unserer Vermögenspositionen erstellt werden. Warenbestand zeigt den Wert unserer Vorräte an Handelswaren, z.B. Wert der Kleider einer Boutique
Inventarwert der Rohstoffe, die wir zur Herstellung unserer Produkte benötigen, z.B. Wert des Holzlagers einer Schreinerei, Wert der Farben in einem Malergeschäft
Geld, welches langfristig in Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fonds) angelegt ist.
Diese Wertschriften werden nicht innerhalb eines Jahres verkauft.
Maschinelle Einrichtungen für die Produktion, z.B. Fräsmaschinen, Werkzeugroboter, Verpackungsmaschinen einer Schokoladenfabrik, vollautomatisches Hochregallager eines Online-Handelsunternehmens
Einrichtung der Verkaufsräume, Tische und Stühle in einem Restaurant, Garderoben, Regale, Ständer, Lampen in einer Boutique, Werkstatteinrichtungen einer Schreinerei
IT-Anlagen Hardware, z.B. Computer, Notebooks, Tablets, Smartphones für die Mitarbeitenden, Drucker, und Software (Computer-Programme). Kassensysteme, Bezahlterminals für Kartenzahlungen
Fahrzeugpark, z.B.
Geschäftsautos, Lieferwagen, Lastwagen
Bohrmaschinen, Messgeräte, Schaufeln
Fabrikationsgebäude, Lagerhallen, Bürogebäude, Showrooms, Parkplätze für Mitarbeitende, unbebaute Grundstücke
Erläuterung / Beispiele
Lieferantenrechnungen. Wir kaufen Güter, Waren oder Dienstleistungen von unseren Lieferanten auf Rechnung (auf Kredit) ein, Zahlungsfrist 10, 20 oder 30 Tage. Wir schulden unseren Lieferanten Geld.
Die Bank bzw. Post gewährt uns einen Kredit. Wir schulden der Bank bzw. der Post Geld. Die Bank bzw. Post führt für uns eine laufende Rechnung (Kontokorrent). Wir haben mehr Kreditbezüge als Einzahlungen auf diesem Bankkonto.
Schulden gegenüber Privatpersonen oder Unternehmungen, die wir innerhalb eines Jahres zurückzahlen müssen.
Kredite, die uns langfristig, d.h. länger als ein Jahr zur Verfügung stehen. Die Laufzeit und die Rückzahlung (evtl. ratenweise Rückzahlung) sind zu Beginn der Laufzeit festgelegt worden.
Für den Kauf einer Immobilie müssen wir mind. 20% des Kaufpreises selbst bezahlen. Für den Restbetrag können wir einen Kredit erhalten, wenn die Immobilie als Sicherheit (Grundpfand) hinterlegt wird
Langfristige Einlage der Geschäftsinhaberinnen
Die Unternehmung hat gegenüber den Eigentümern eine langfristige Schuld.
Der Jahresgewinn steht den Eigentümerinnen zu; die Unternehmung schuldet ihnen den Jahresgewinn Umgekehrt muss ein Verlust auch durch die Eigentümer gedeckt werden.
Kontenklasse 3
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen
3000 Produktionsertrag
Prod-Ertrag
3200 Warenertrag (Handelswarenertrag) Wa-Ertrag
3400 Dienstleistungsertrag
3410 Transportertrag
DL-Ertrag
Trsp-Ertrag
3420 Honorarertrag Hon-Ertrag
Kontenklasse 4 Aufwand für Material, Handelswaren und Dienstleistungen
4000 Materialaufwand (Produktion) Mat-Aufw
4200 Warenaufwand (Handelswarenaufwand) Wa-Aufw
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen Aufw bez DL
4500 Energieaufwand zur Leistungserstellung (Produktion) Energ-Aufw Prod
Erläuterung / Beispiele
Einnahmen aus dem Verkauf der von uns produzierten Gütern, z.B. verkaufte Maschinen, Pharmaprodukte, Schreiner-, Schlosser-, Gartenarbeiten.
Einnahmen aus dem Verkauf von Handelswaren, z.B. Kleider einer Boutique, Bücher einer Buchhandlung, Lebensmittel eines Grossverteilers
Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen (Güter, die nicht angefasst und nicht gelagert werden können), z.B. bei Coiffeur-Geschäften, Hotels.
Einnahmen aus dem Verkauf von Transportleistungen, z.B. von Speditions-, Schifffahrts-, Reisecar-, Taxiunternehmungen.
Einnahmen aus dem Verkauf von Beratungen und Behandlungen, z.B. von Anwaltskanzleien, Treuhandunternehmungen, Personaltrainerinnen, Ärzten, Physiotherapeutinnen.
Erläuterung / Beispiele
Einkauf von Gütern, die ein Produktionsbetrieb zur Herstellung seiner Produkte benötigt, z.B. Rohstoffe bei Pharmaunternehmen, Stahlbänder bei Messerproduzenten.
Einkauf von Gütern, die wir lagern, sortieren, verpacken und mit Beratung möglichst rasch, spätestens innerhalb eines Jahres, unverarbeitet weiterverkaufen.
Einkauf von Leistungen anderer Unternehmungen (Drittleistungen), z.B. eine Speditionsfirma lässt aus Kapazitätsgründen einzelne Fahrten ins Ausland durch eine andere Unternehmung ausführen.
Einkauf von Energie (Heizöl, Diesel, Benzin, Holzpellets, Strom, Wärme, Wasser, Wasserstoff) von Unternehmungen, die sehr viel Energie für die Erstellung ihrer Leistungen benötigen, z.B. Taxiunternehmen.
Kontenklasse 5 Personalaufwand Erläuterung / Beispiele
5000 Lohnaufwand Lohn-Aufw Ausgaben für geleistete Arbeitsstunden unserer Mitarbeitenden.
5800 Übriger Personalaufwand Übr Pers-Aufw Stelleninserate, Weiterbildung, Fitnessraum, Personalanlässe, Geschenke, Ausgaben für Sozialplan Kontenklasse 6 Übriger Betriebsaufwand, Abschreibungen und Finanzergebnis Erläuterung / Beispiele
6000 Raumaufwand (Mietaufwand) Raum-Aufw
6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz URE
6200 Fahrzeugaufwand Fz-Aufw
6300 Versicherungsaufwand, inkl. Gebühren, Bewilligungen Vers-Aufw
6400 Energieaufwand, inkl. Entsorgungsaufwand Energ-Aufw
6500 Verwaltungsaufwand Vw-Aufw
6570 Informatikaufwand Inf-Aufw
6600 Werbeaufwand Werbe-Aufw
6700 Sonstiger Betriebsaufwand Sonst BA
6800 Abschreibungen Abschr
6900 Finanzaufwand, inkl. Zins- und Wertschriftenaufwand Fi-Aufw
6950 (–) Finanzertrag, inkl. Zins- und Wertschriftenertrag Fi-Ertrag
Ausgaben für gemietete Räumlichkeiten und Unterhaltsleistungen, wie z.B. Miete, Reinigung, Unterhalt an Vermieter: innen, Reinigungsunternehmen, Liegenschaftsverwaltungen für Facility Management.
Ausgaben für den Unterhalt (z.B. Serviceleistungen), die Reparatur (z.B. Instandstellungsarbeiten) und Ersatz (z.B. Kauf einer neuen Maschine, welche für die alte defekte Maschine eingesetzt wird)
Ausgaben im Zusammenhang mit Geschäftsfahrzeugen, wie z.B. Treibstoff, Service, Reparaturen, Motorfahrzeugversicherungen, Leasingraten.
Ausgaben für Betriebshaftpflichtversicherung, Sachversicherungen für Gebäude und alles, was im Gebäude ist, Betriebsunterbrechungsversicherung, Maschinen und EDV-Versicherung,
Ausgaben für Strom, Gas, und Heizung, Wasser für die Unternehmung allgemein (Energie für direkte Leistungserstellung Konto 4500), Abfall- und Entsorgungsgebühren
Ausgaben für Büromaterial (z.B. Papier, Schreibmaterial, Flipcharts, Druckerpatronen), Kommunikation (Telefon, Radio- und Fernsehabgabe), Portokosten (z.B. Briefmarken, Buchführung, Beratung, Spenden.
Ausgaben für Unterhalt und Reparaturen für Informatikmittel, Lizenzen und Wartung, Beratung und Entwicklung, Schulung, Internetgebühren.
Ausgaben für Inseratekampagnen, Sponsoring, Werbedrucksachen, Flyer, Schaufenster, Dekoration, Mustergeschenke, Kundengeschenke, Reisepesen, Kundenessen.
Ausgaben, für die kein eigenes Konto vorgesehen ist, z.B. Forschung & Entwicklung, Betreibungskosten, Betriebssicherheit, Bewachung von Betriebsanlagen.
Wertverminderungen des Anlagevermögens durch Alterung und Gebrauch, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Informatikanlagen können nach 5 Jahren auf einen Wert von 0 CHF abgeschrieben werden.
Ausgaben für Darlehenszinsen, Bankzinsen, Bankspesen, Verzugszinsen für Bankspesen bzw. Gebühren für PostFinance-Dienstleistungen.
Einnahmen aus Zinsen auf gewährten Darlehen, Bankzinsguthaben. Das Konto Finanzertrag steht in der Kontenklasse 6, damit sich der Finanzerfolg (Finanzertrag minus Finanzaufwand) einfach ermitteln lässt.
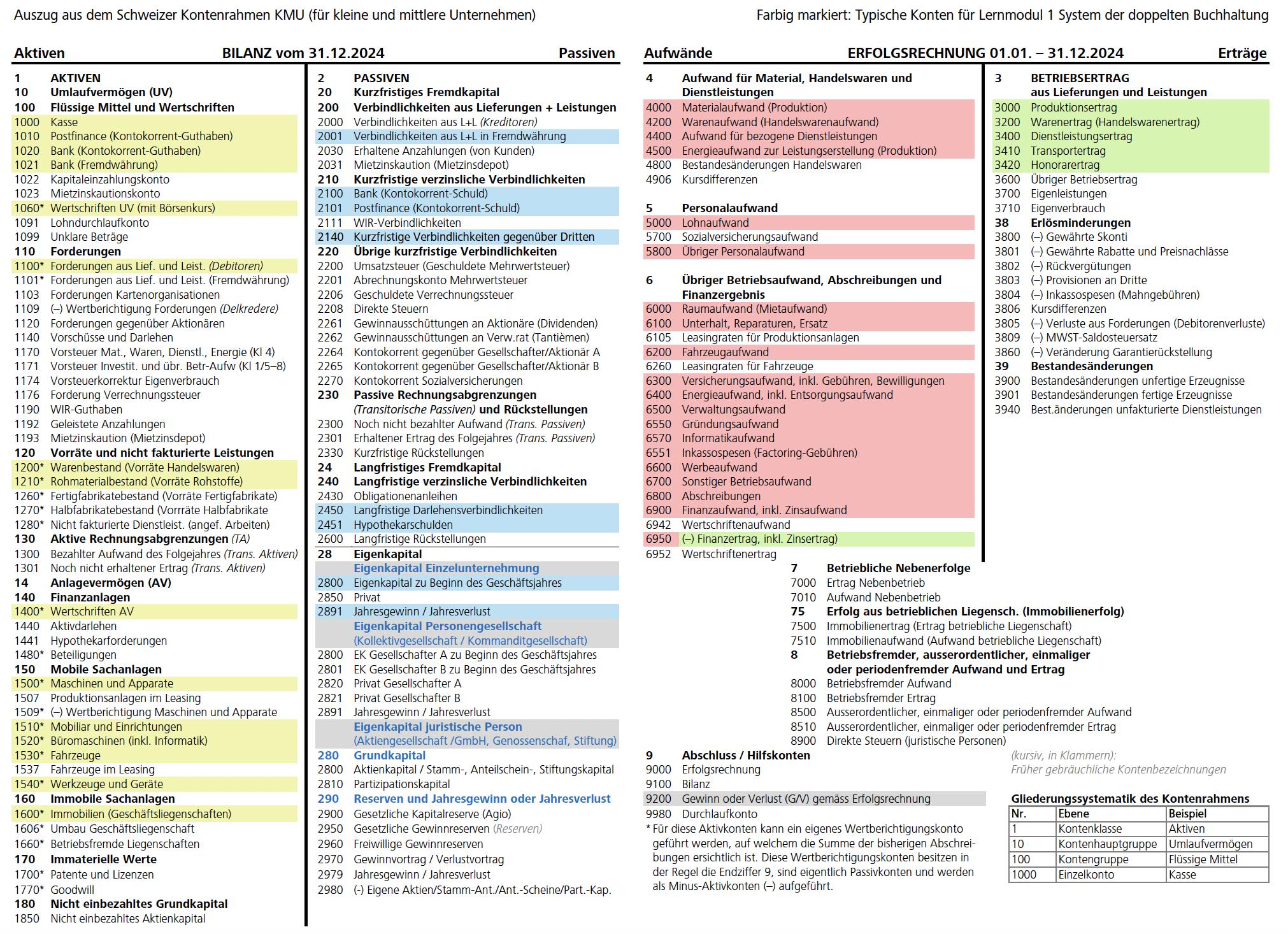
Ein Buchungssatz ist eine standardisierte Anweisung zum Eintrag der Beträge in den Konten der Buchhaltung. Der Buchungssatz bestimmt, welcher Betrag in welchen Konten auf welchen Seiten eingetragen (gebucht) wird. Das Konto, das durch den Geschäftsfall auf der Soll-Seite (links) betroffen wird, ist das «Sollkonto»; das Konto, welches auf der Haben-Seite (rechts) betroffen wird, ist das «Habenkonto».
n Vom Geschäftsfall zum Buchungssatz in drei Schritten
1. Schritt «Welche zwei Konten sind durch einen Geschäftsfall betroffen?»
Fragen Haben wir durch diesen Geschäftsfall mehr oder weniger Vermögen?
Welches Aktivkonto?
Der Buchungssatz nennt immer zuerst das Sollkonto und dann das Habenkonto und wird wie folgt ausgesprochen: «Sollkonto an Habenkonto».
Wird ein Buchungssatz aufgeschrieben, so wird anstelle des «an» ein Schrägstrich (slash) «/» verwendet: «Sollkonto / Habenkonto».
Haben wir durch diesen Geschäftsfall mehr oder weniger Schulden?
Wird durch diesen Geschäftsfall etwas verbraucht?
weiterverarbeitet bzw. zum Weiterverkauf eingekauft? weniger wert?
Welches Passivkonto?
Welches Aufwandskonto?
Erhalten wir durch diesen Geschäftsfall Einnahmen aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen oder aus weiteren Leistungen, wie z.B. an Dritte vermietete Lagerräume
Welches Ertragskonto?
2. Schritt «Auf welcher Seite (links oder rechts bzw. Soll-Seite oder Haben-Seite) wird die Veränderung (Zu- oder Abnahme) in den Konten eingetragen?»
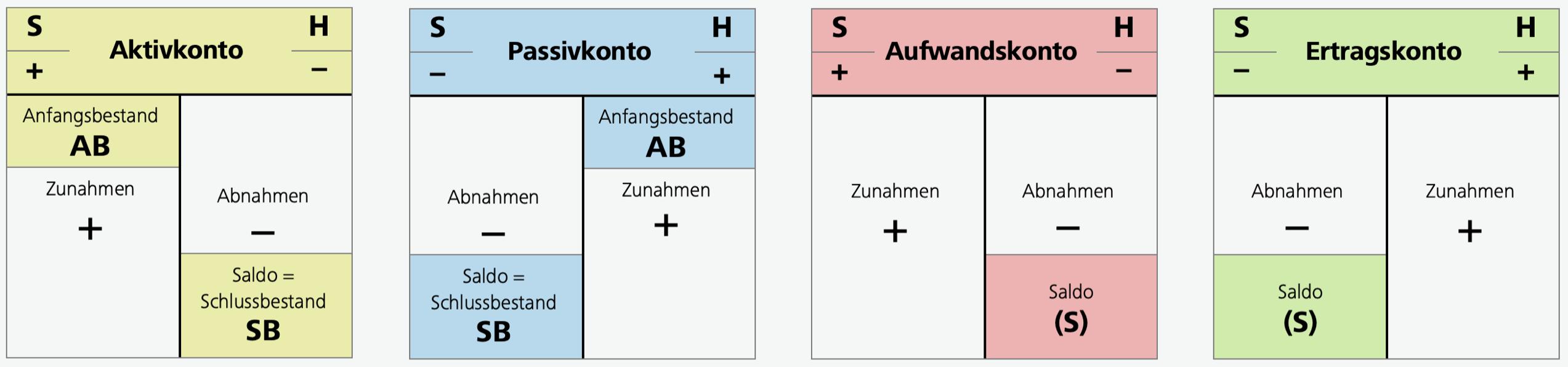
3. Schritt
8.1 Einstiegsbeispiel für die Erstellung von Buchungssätzen:
Marco, ein erfahrener Grafikdesigner und Marketingexperte, hat beschlossen, sich selbstständig zu machen und ein kleines Werbebüro zu gründen. Erstellen Sie die Buchungssätze zu den ersten Geschäftsfällen. Gehen Sie dabei in den folgenden 3 Schritten vor.
1. Schritt: Welche zwei Konten?
Kreuzen Sie an, ob durch den Geschäftsfall Aktiv-, Passiv-, Aufwands- oder Ertragskonten betroffen sind.
2. Schritt: Zu- oder Abnahme im Soll oder im Haben?
Bestimmen Sie, ob durch den Geschäftsfall die betroffenen Konten zunehmen oder abnehmen. Auf welcher Seite (links oder rechts bzw. Soll oder Haben) wird die Veränderung (Zu- oder Abnahme) in den betroffenen Konten eingetragen?
3. Schritt: Buchungssatz = Soll / Haben (Soll an Haben)
Formulieren Sie schliesslich den Buchungssatz, indem Sie zuerst das Konto nennen, in welchem der Betrag auf der Sollseite eingetragen wird. Und dann das Konto, in welchem der Betrag auf der Habenseite eingetragen wird.
Nr. Geschäftsfall
1) Marco überweist von seinem Sparkonto CHF 20'000.– als Kapitaleinlage auf das Bankkonto seiner Unternehmung.
2) Marco kauft die Büroeinrichtung und bezahlt CHF 6'750.– direkt über das Bankkonto.
3) Marco kauft Büromaterial für CHF 230.– auf Rechnung.
4) Marco stellt den Kunden für CHF 8'000.– seine Beratungsdienstleistungen in Rechnung.
5) Ein Kunde zahlt die fällige Rechnung von CHF 3'600.– auf das Bankkonto ein.
6) Marco überweist seiner Mitarbeiterin den Lohn von CHF 5'000.–über das Bankkonto.
n Erfolgswirksam oder erfolgsunwirksam?
Durch den Geschäftsfall bzw. durch den Buchungssatz werden immer zwei Konten verändert. Wenn in einem Buchungssatz zwei Bilanzkonten vorkommen, so hat dies keine Auswirkungen auf den Erfolg (Gewinn bzw. Verlust). Bei solchen erfolgsunwirksamen Geschäftsfällen können vier Fälle unterschieden werden (siehe nebenstehende Tabelle).
Wenn in einem Buchungssatz ein Bilanzkonto und ein Erfolgskonto betroffen sind, dann verändert sich der Erfolg (Gewinn oder Verlust). In diesem Fall sprechen wir von erfolgswirksamen Geschäftsfällen.
n Liquiditätswirksam oder liquiditätsunwirksam?
Jede Unternehmung muss ihre Zahlungsverpflichtungen termingerecht bezahlen können. Dazu benötigt die Unternehmung Geldmittel, die für eine sofortige Zahlung bereitstehen. Bargeldbestände, Post- oder Bankguthaben nennt man auch flüssige oder liquide Mittel.
Wenn in einem Buchungssatz ein Konto der Gruppe 100 Flüssige Mittel (Kasse, Post oder Bank) betroffen ist, dann verändert sich dadurch unsere Zahlungsbereitschaft (Liquidität); ein solcher Geschäftsfall ist liquiditätswirksam
Auswirkung auf Liquidität
Nr. Buchungssatz
Konto 1 Konto 2 Fachbegriff
Aktivkonto + Passivkonto + Finanzierung
Auswirkung auf Bilanzsumme (+ / –)
Bilanzsumme wird grösser (+) (Kapitalbeschaffung)
Passivkonto – Aktivkonto –Definanzierung
Bilanzsumme wird kleiner (–) (Kapitalrückzahlung)
Aktivkonto + Aktivkonto –Aktivtausch
Bilanzsumme bleibt gleich (=) (Vermögensverschiebung)
Passivkonto – Passivkonto + Passivtausch (Schuldverschiebung)
8.2 Ergänzen Sie die obenstehende Tabelle.
8.3 Ergänzen Sie die untenstehende Tabelle.
Auswirkung auf Erfolg
Auswirkung auf Bilanzsumme
Liquiditätswirksam Liquiditätsunwirksam Erfolgswirksam Erfolgsunwirksam bleibt gleich wird grösser wird kleiner Finanzierung Definanzierung Aktivtausch Passivtausch
1) Mobiliar / Verb L+L X X X
Möglicher Geschäftsfall: Wir kaufen die Büroeinrichtung gegen Rechnung (auf Kredit).
2) Lfr Darl-Verb / EK X X X
Möglicher Geschäftsfall: Unsere Darlehensgeberin beteiligt sich an unserer Unternehmung und wandelt ihr langfristiges Darlehen in Eigenkapital um.
3) Bank / Ford L+L X X X
Möglicher Geschäftsfall: Kunden zahlen ihre Rechnungen auf unser Bankkonto ein.
4) Verb L+L / Bank X X X
Möglicher Geschäftsfall: Wir begleichen Lieferantenrechnungen mit einer Banküberweisung.
5) Ford L+L / Wa-Ertrag X X X
Möglicher Geschäftsfall: Wir verkaufen Waren gegen Rechnung (auf Kredit). Alles verstanden? Kontrollieren Sie Ihr Wissen mit den Übungen 8.1 – 8.11
n Buchhaltungssoftware mit Buchungsmaske
In der Praxis wird die Buchhaltung mit einer Buchhaltungssoftware geführt. Dabei werden die Buchungen in einem speziellen Erfassungsformular, einer sogenannten Buchungsmaske erfasst.
Die Buchungsmaske enthält verschiedene Eingabefelder, in welche die für jeden Geschäftsfall erforderlichen Angaben eingetragen werden. Die Felder der Buchungsmaske sind bei den meisten Programmen ähnlich.
n Buchungsjournal
Die Einträge in der Buchungsmaske werden in der Buchhaltungssoftware in einem Buchungsjournal festgehalten.
Nr. Text Soll Haben Betrag
1 Meier, Kapitaleinlage 1020 Bank 2800 Eigenkapital 20’000.–
2 Kempf, Lieferwagen 1530 Fahrzeuge 1020 Bank 15'000 –
3 KB, Bankspesen Q03 6950 Fi-Aufwand 1020 Bank 12.–
4 It3, Mietzins Sept 2023 6000 Raum-Aufw 1020 Bank 2'500.–
5
Das Buchungsjournal im Buchhaltungsprogramm Swiss21/AbaNinja enthält Felder für Buchungsnummer, Valuta (Datum, ab welchem eine Zahlung zinswirksam ist), Soll-Konto, Haben-Konto, Betrag, Mehrwertsteuersatz, Buchungstext, Referenz, Beleg als Anhang.

Abb. 20 Journaldarstellung im Buchhaltungsprogramm Swiss21/21.AbaNinja
n Hauptbuch und Nebenbücher
Die Buchhaltungssoftware überträgt die Einträge im Buchungsjournal automatisch in die betreffenden Konten auf die Soll- bzw. die Habenseite. Das Verzeichnis aller Konten nennt man Hauptbuch

Abb. 21 Konten des Hauptbuches (bookyto.com)
Einzelne Konten enthalten viele Informationen, die man noch detaillierter analysieren möchte, wie z.B. das Konto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) mit allen noch nicht bezahlten Rechnungen unserer Kunden, das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) mit allen noch nicht bezahlten Lieferantenrechnungen oder das Konto Lohnaufwand mit allen Lohnzahlungen unserer Mitarbeitenden. Diese Konten werden häufig in sogenannten Nebenbüchern (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung) detaillierter geführt, um aussagekräftigere Informationen zu erhalten und die Veränderung des betreffenden Hauptkontos besser zu verstehen. Die Ergebnisse der Nebenbücher werden jeweils automatisch in die entsprechenden Hauptkonten übertragen.
n Journal und Hauptbuch mit Lernsoftware «bookyto» führen
In der Aufgabe Giulias Glacé-Mobil können Sie für die Geschäftsfälle die Konten in einem Dropdown-Menu auswählen. Die Buchungen werden fortlaufend in den Hauptkonten eintragen. Die aktuellen Salden der einzelnen Konten können Sie in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung ablesen. Gleichzeitig wird nach erfolgter Buchung der Erfolg (Gewinn bzw. Verlust) doppelt ausgewiesen: einmal in der Bilanz (Differenz zwischen Aktiven und Passiven) und einmal in der Erfolgsrechnung (Differenz zwischen Erträgen und Aufwänden)
9.1 Gehen Sie mit dem nebenstehenden QR-Code/Link zur Aufgabe Giulias Glacé-Mobil, verbuchen Sie die 7 Geschäftsfälle und beantworten Sie die folgenden Fragen.
a) Wie hoch ist der Erfolg nach 2 Geschäftsfällen? 0.–
b) Wie hoch ist der Erfolg nach 4 Geschäftsfällen? – 7'200.–
c) Wie hoch ist der Erfolg nach 6 Geschäftsfällen? + 4'800.–


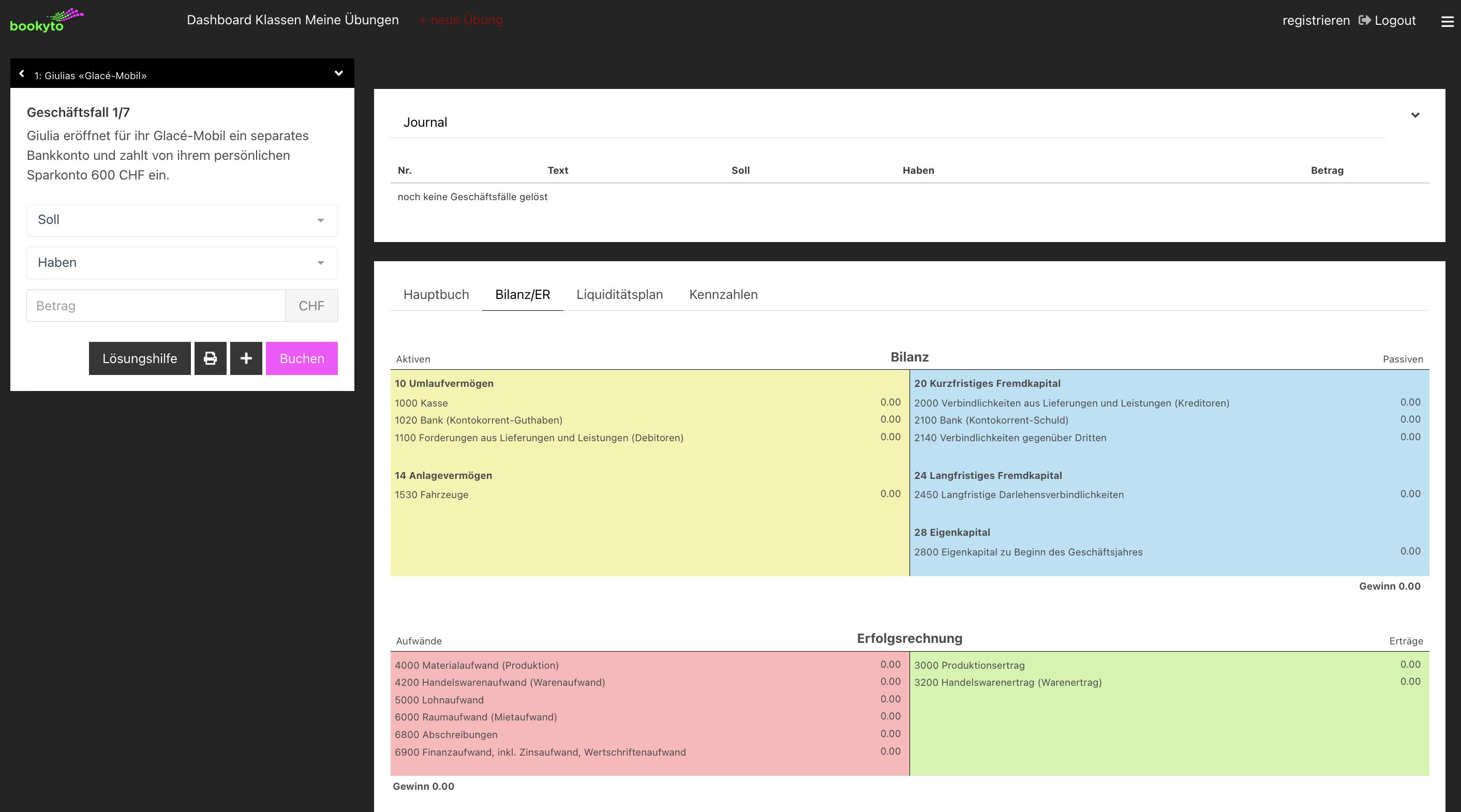
Abb. 22 Buchhaltungsprogramm bookyto.com (Buchungsmaske, Journal, Bilanz und Erfolgsrechnung) Alles verstanden? Kontrollieren
10.1 Im System der doppelten Buchhaltung wird jeder Geschäftsfäll in zwei Konten eingetragen. Aus diesem Grund wird der Erfolg (Gewinn oder Verlust) doppelt ausgewiesen, einmal in der Erfolgsrechnung und einmal in der Bilanz.
Die Eröffnungsbilanz zeigt die Aktiven (Vermögen) und die Passiven (Schulden) der Unternehmung zu Beginn des Geschäftsjahres.
Ergänzen Sie in der folgenden Übersicht die grau schraffierten Felder mit den zutreffenden Begriffen bzw. Symbolen.
Aktiven Eröffnungsbilanz 01.01.2024 Passiven Vermögen
Fremdkapital Eigenkapital (= Nettovermögen)
Die Vermögenspositionen werden in den Aktivkonten im Soll und die Schuldpositionen werden in den Passivkonten im Haben als Anfangsbestände eingetragen. Bei den Aufwand- und Ertragskonten beginnen die Aufzeichnungen anfangs Jahr jeweils wieder bei null und Erfolgskonten haben deshalb keine Anfangsbestände.
2. Journalbuchungen
Aufgrund der Belege werden die finanziell relevanten Geschäftsfälle im Journal erfasst.
Die Journalbuchungen werden in den entsprechenden Konten nachgetragen.
3. Schlussbilanz 1
(doppelter Erfolgsausweis)
Am Ende des Geschäftsjahres werden die Salden der Erfolgskonten in die Erfolgsrechnung übertragen.
Die Salden der Bilanzkonten werden in die Bilanz übertragen und ergeben die Schlussbilanz 1.
Der Gewinn ist sowohl in der Schlussbilanz 1 als auch in der Erfolgsrechnung ersichtlich. Dies bezeichnen wir als den doppelten Erfolgsausweis.
Aktiven Schlussbilanz 1 vom 31.12.2024 Passiven
Aufwände Erfolgsrechnung 2024 Erträge
Fremdkapital
Vermögen
Eigenkapital
(zu Beginn Geschäftsjahr)
Jahresgewinn (JG)
Aufwände Erträge
Jahresgewinn (JG)
4. Schlussbilanz 2
(Eigenkapital nach Erfolgsverwendung)
Die durch den Gewinn entstandene Zunahme des Vermögens gehört den Eigentümerinnen der Unternehmung.
Je nachdem, wie der Gewinn verteilt worden ist, verändern sich einzelne Bilanzkonten.
Die Schlussbilanz 2 zeigt das Vermögen und die Schuldpositionen nach der Erfolgsverwendung. Die Zahlen der Schlussbilanz 2 bilden anschliessend wieder die Grundlage für die Eröffnungsbilanz des nächsten Geschäftsjahres.
Aktiven Schlussbilanz 2 vom 31.12.2024 Passiven
Fremdkapital
Vermögen
Eigenkapital
(nach Gewinnverwendung)
Hinweis zur Farblegende
Die Passiven (= Schulden der Unternehmung) werden blau formatiert, wobei zwischen Fremd- und Eigenkapital unterschieden wird: Das Fremdkapital (= Schulden der Unternehmung gegenüber Dritten) wird dunkelblau formatiert, das Eigenkapital (= Schulden der Unternehmung gegenüber den Eigentümern) wird hellblau formatiert.
Der Erfolg (= Gewinn bzw. Verlust) gehört den Eigentümern und wird deshalb zum Eigenkapital gezählt. Aus diesem Grund wird der Erfolg (= Gewinn bzw. Verlust) in der Erfolgsrechnung hellblau formatiert.
n Zwei Optionen zur Gewinnverwendung
10.2 Die Eigentümer entscheiden, wie der Gewinn verwendet werden soll. Der Jahresgewinn von 30 (Betrag in Kurzform) kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten verwendet werden.
In Buchhaltungsprogrammen wird die Schlussbilanz 1 automatisch per Mausklick erstellt. Bei einem Gewinn sind die Erträge grösser als die Aufwände. Die Erfolgsrechnung weist einen Habenüberschuss auf. Im Konto Erfolgsrechnung steht dieser Saldo auf der Sollseite.
Die Erfolgsrechnung wird mit folgender Buchung abgeschlossen*) (Beträge in Kurzform):
Soll Haben Betrag
9200 ER 2979 J-Gew 30
*) Abschluss der Erfolgsrechnung über das Konto 9200 Aktiven Schlussbilanz
Option 1: Gewinn in der Unternehmung behalten
Die Eigentümer wollen mit dem Gewinn eine neue Investition tätigen und verzichten auf eine Gewinnauszahlung.
Ergänzen Sie in der folgenden Übersicht die grau schraffierten Felder mit den zutreffenden Kontenbezeichnungen und Beträgen.
Option 2: Gewinn ausbezahlen («ausschütten»)
Die Eigentümerinnen zahlen sich den Gewinn aus.
n Zwei Optionen zur Verlustdeckung
10.3 Die Eigentümerinnen der Unternehmung haften bei einem allfälligen Verlust (im Beispiel 50, Betrag in Kurzform). Sie müssen für die entstandenen Schulden einstehen. Dies kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten erfolgen.
In Buchhaltungsprogrammen wird die Schlussbilanz 1 automatisch per Mausklick erstellt.
Bei einem Verlust sind die Aufwände grösser als die Erträge, die Erfolgsrechnung weist einen Sollüberschuss auf. Im Konto Erfolgsrechnung steht dieser Saldo auf der Habenseite.
Die Erfolgsrechnung wird mit folgender Buchung abgeschlossen*) (Beträge in Kurzform):
Soll Haben Betrag
2979 J-Verl 9200 ER 50
*) Abschluss der Erfolgsrechnung über das Konto 9200.
Option 1: Verlust durch zusätzliche Vermögenseinlage decken
Die Eigentümerinnen zahlen zum Ausgleich des Verlustes 50 auf das Bankkonto der Unternehmung ein.
Ergänzen Sie in der folgenden Übersicht die grau schraffierten Felder mit den zutreffenden Kontenbezeichnungen und Beträgen.
Option 2: Verlust mit Eigenkapital verrechnen («Kapitalschnitt»)
Die Eigentümerinnen tragen den Verlust, indem sie auf 50 ihrer Eigenkapitaleinlage verzichten.
n Ein Geschäftsjahr im Überblick: Malergeschäft Jana Tanner
Jana Tanner führt ihr eigenes Malergeschäft.
In der Buchhaltung benutzt Jana den folgenden Kontenplan. Die Eröffnungsbilanz zeigt die folgenden Anfangsbestände.
Aktiven Passiven Aufwände Erträge Aktiven Eröffnungsbilanz 01.01.2024 Passiven
Bank Verb L+L
Materialaufwand Prod-Ertrag Bank 37 Verb L+L 5
Ford L+L Darlehen Personalaufwand Ford L+L 8 Darlehen 50
Werkzeuge Eigenkapital Raumaufwand Werkzeuge 35 Eigenkapital 70
Fahrzeuge Verwaltungsaufwand Fahrzeuge 45 Abschreibungen 125 125
1. Eröffnen Sie die Konten des Hauptbuches
2. Bilden Sie die Buchungssätze für die folgenden Geschäftsfälle (summiert) und führen Sie die Hauptbuchkonten
2) Banküberweisung,
Bankgutschrift,
Rückzahlung
9) Abschreibung Werkzeuge, Geräte 3 Fahrzeuge Jahresgewinn Abschreibungen Abschr / Masch AB) 45 10) 8 13)
10) Abschreibungen
3. Schlussbilanz 1 (vor Erfolgsverwendung) erstellen Aktiven Schlussbilanz 1 (31.12.2024) Passiven Aufwände Erfolgsrechnung 2024 Erträge
Doppelter Erfolgsausweis (in Bilanz und Erfolgsrechnung): Bank 33 Verb L+L 3 Materialaufwand 40 DL-Ertrag 150
1) Bilanzkonten abschliessen (Saldi in Schlussbilanz 1 übertragen) Ford L+L 28 Darlehen 35 Personalaufwand 80
2) Erfolgskonten abschliessen (Saldi in Erfolgsrechnung übertragen) Werkzeuge 32 Eigenkapital 85 Raumaufwand 10
Fahrzeuge 37 Jahresgewinn 7 Verw-Aufwand 2
Erfolg ins Konto Jahresgewinn 130 130 Abschreibungen 11
(= Erfolgsrechnung abschliessen, Schlussbilanz 1 erstellt) Jahresgewinn 7
4. Verbuchung des Erfolgs / Jahresgewinn / EK 7
Schlussbilanz 2 (nach Erfolgsverwendung) erstellen Aktiven Schlussbilanz 2 (31.12.2024) Passiven Bank 33 Verb L+L 3 Ford L+L 28 Darlehen 35
Werkzeuge, Geräte 32 Eigenkapital 92
Fahrzeuge 37
11 Wie viel soll, muss oder darf man abschreiben?
Giulia ist mit ihrem Ferienjob sehr zufrieden. Bilanz und Erfolgsrechnung zeigen aufgrund der Journalbuchungen das folgende Bild:

Abb. 23 Journaldarstellung in bookyto.com
11.1 Wie beurteilen Sie das finanzielle Ergebnis von Giulias Geschäftsmodell?
Individuelle Antworten
Auf den ersten Blick grandios!
Aus dem «Ferienjob» resultiert ein Gewinn von CHF 4'800.–
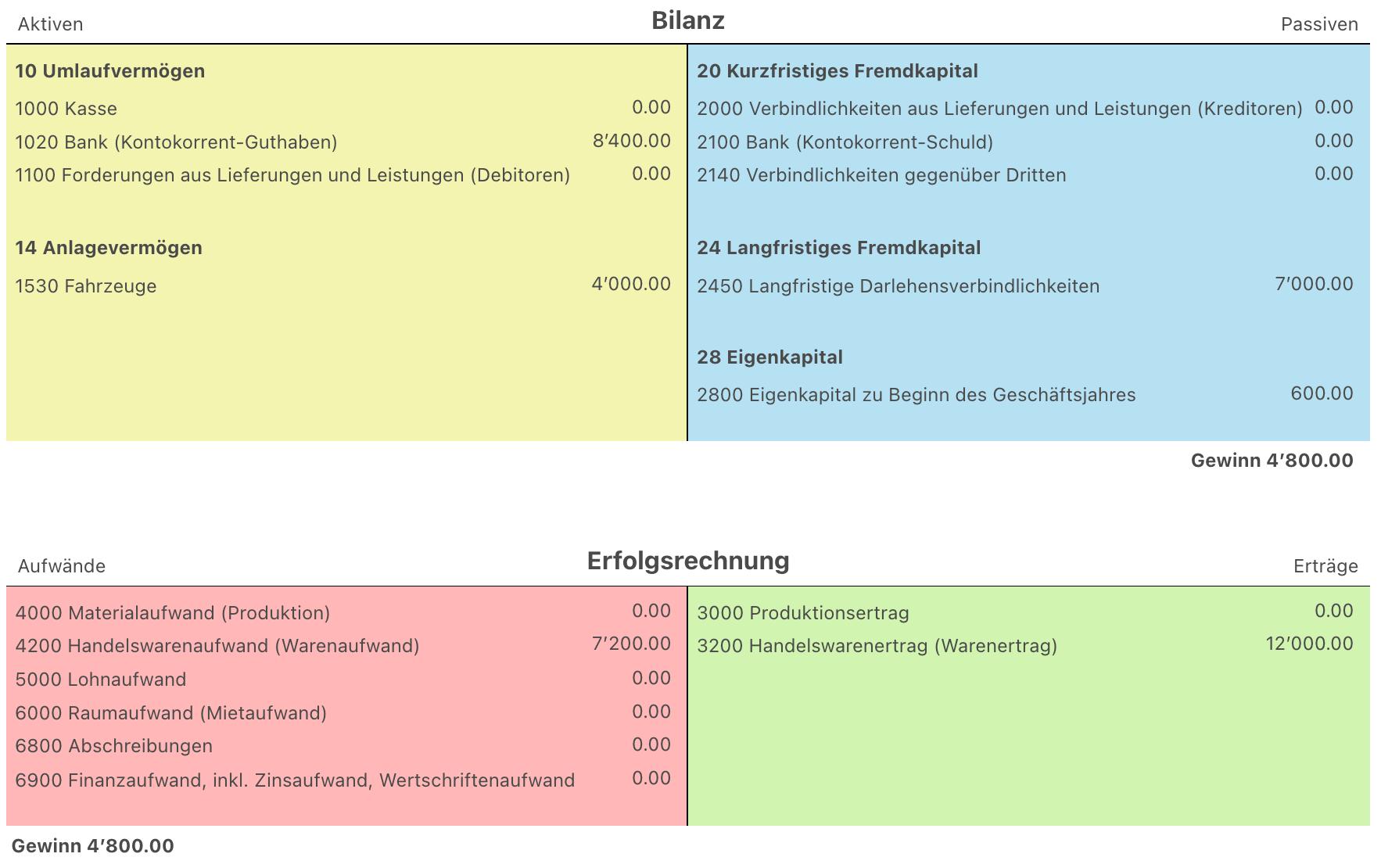
Abb. 24 Bilanz und Erfolgsrechnung in bookyto.com
11.2 Analysieren Sie die Vermögenswerte in der Bilanz. Was fällt Ihnen im Anlagevermögen auf?
Individuelle Antworten
Das Fahrzeug (= Giulias Glacé-Mobil) ist zum Anschaffungswert in der Bilanz eingesetzt.
Ist dieses Glacé-Mobil nach 5-wöchigem Gebrauch immer noch gleich viel wert wie beim Ankauf?
11.3 Marco meint, dass das Glacé-Mobil nach 5-wöchigem Gebrauch sicher nicht mehr CHF 4'000.– wert sei.
Welche Ursachen sind grundsätzlich dafür verantwortlich, dass Positionen des Anlagevermögens im Laufe eines Geschäftsjahres an Wert verlieren?

1) Abnutzung durch Gebrauch, Verschleiss, z.B. Fahrzeuge
2) Technischer Fortschritt, Alterung, z.B. Computer
11.4 Ende August stellt Giulia ihr Glacé-Mobil online zum Verkauf. Das höchste Angebot beläuft sich auf CHF 2’800. Giulia entscheidet sich, das Glacé-Mobil zu behalten.
Wie würden Sie die Wertverminderung buchen? Begründen Sie Ihre Empfehlung.
In der Buchhaltung werden Wertverminderungen des Anlagevermögens als Aufwand im Konto6800Abschreibungenverbucht.
Datum Soll Haben Betrag
30.08. 6800 Abschreibungen 1510 Fahrzeuge ?
Mögliche Begründungen:
z.B. Abschreibung von CHF 1'200.–, d.h. Restwert CHF 2'800.–, weil dies ein konkretes Kaufangebot ist (Liquidationswert)
Andere Werte, weil längere Nutzungsdauer (Fortführungswert)
11.5 Giulia möchte ihr Glacé-Mobil noch 3 Jahre benutzen und anschliessend als Occasion verkaufen. Sie schätzt den Restwert des Glacé-Mobils am Ende dieser drei Jahre vorsichtig auf CHF 400.–. Bestimmen Sie den jährlich gleichbleibenden Abschreibungsbetrag für das Glacé-Mobil.
Jährlicher
Abschreibungsbetrag (Giulias Glacé-Mobil) = CHF 4'000 – CHF 400 = CHF 3’600 = CHF 900 4 Jahre
11.6 Leiten Sie daraus eine allgemein gültige Formel für jährlich gleichbleibende Abschreibungsbeiträge ab.
Jährlicher
Abschreibungsbetrag (Allg. Formel) = Anschaffungskosten – Restwert = CHF ... Nutzungsdauer
11.7 Welchen Betrag soll, muss oder kann Giulia abschreiben? Gibt es allenfalls gesetzliche Vorschriften? In welchen Gesetzen würden Sie suchen? Begründen Sie Ihre Antwort.
Individuelle Antworten (Ermessenspielraum)
In welchen Gesetzen gibt es Vorschriften zu den Abschreibungen?
a) Obligationenrecht (OR): Nutzungs- und altersmässige Wertverlust muss durch Abschreibungen berücksichtigt werden (Art. 960a Abs. 3 OR), Vorsichtsprinzip (... höchstens bewerten)
b) Steuerrecht: Mindestbewertungsvorschriften (... max. abschreiben)
Abschreibungen sollen verbucht werden, weil nur so ...
1) Anlagevermögen in Bilanz richtig ausgewiesen wird
2) Abschreibungen in Verkaufspreise mit einkalkuliert werden
n Anschaffungswert
Weil Maschinen, Mobiliar, IT-Anlagen, Fahrzeuge, Werkzeuge oder Immobilien länger als ein Jahr genutzt werden können, wird der Kauf dieser Vermögenspositionen nicht als Aufwand, sondern in einem Aktivkonto des Anlagevermögens verbucht. Bei der Verbuchung einer solchen Anschaffung werden alle Kosten berücksichtigt. Der sogenannte Anschaffungswert umfass neben dem Kaufpreis auch allfällige Fracht-, Zoll-, Versicherungs- und Montagekosten.
n Buchwert
Alle Positionen des Anlagevermögens verlieren im Laufe der Zeit an Wert. Ursachen sind einerseits Abnützung durch den Gebrauch und andererseits der technische Fortschritt. Weil es immer wieder neuere, bessere Produkte gibt, verlieren die älteren Produkte an Wert. Wenn in der Bilanz die Vermögenspositionen mit dem aktuellen Wert ausgewiesen werden sollen, muss beim Anschaffungswert im Laufe der Zeit diese Wertverminderung berücksichtigt werden. Solche Wertverminderungen auf dem Anlagevermögen werden auf dem Aufwandkonto 6800 Abschreibungen verbucht. In der Bilanz wird dann der aktuelle Restwert ausgewiesen. Diesen Restwert gemäss Buchhaltung nennt man Buchwert.
n Zweck der Abschreibungen
Abschreibungen führen zu einem grösseren Aufwand und damit zu einem kleineren Gewinn. Damit steht weniger Geld für eine Gewinnausschüttung zur Verfügung, wodurch mehr liquide Mittel in der Unternehmung bleiben.
Wenn Abschreibungen in die Verkaufspreise einkalkuliert werden, führt dies über höhere Verkaufspreise zu mehr Einnahmen (sofern die Kunden nicht zu günstigeren Konkurrenzprodukten wechseln). Am Ende der Nutzungsdauer können mit den zusätzlichen Einnahmen (mehr liquide Mittel) neue Anlagen gekauft werden.
n Steuerrechtliche Vorschriften zu den Abschreibungen
Abschreibungen sind erfolgswirksam und führen zu einem kleineren Gewinn. Unternehmungen könnten durch übermässige Abschreibungen kleiner Gewinne ausweisen und damit Steuern sparen. Aus diesem Grund gibt es im Steuerrecht Vorschriften über die Höhe der steuerlich zulässigen Abschreibungen.
Die zulässigen Abschreibungen werden dabei in Prozenten des Buchwertes angegeben, bei Abschreibungen auf Anschaffungswert sind die Prozentsätze um die Hälfte zu reduzieren.
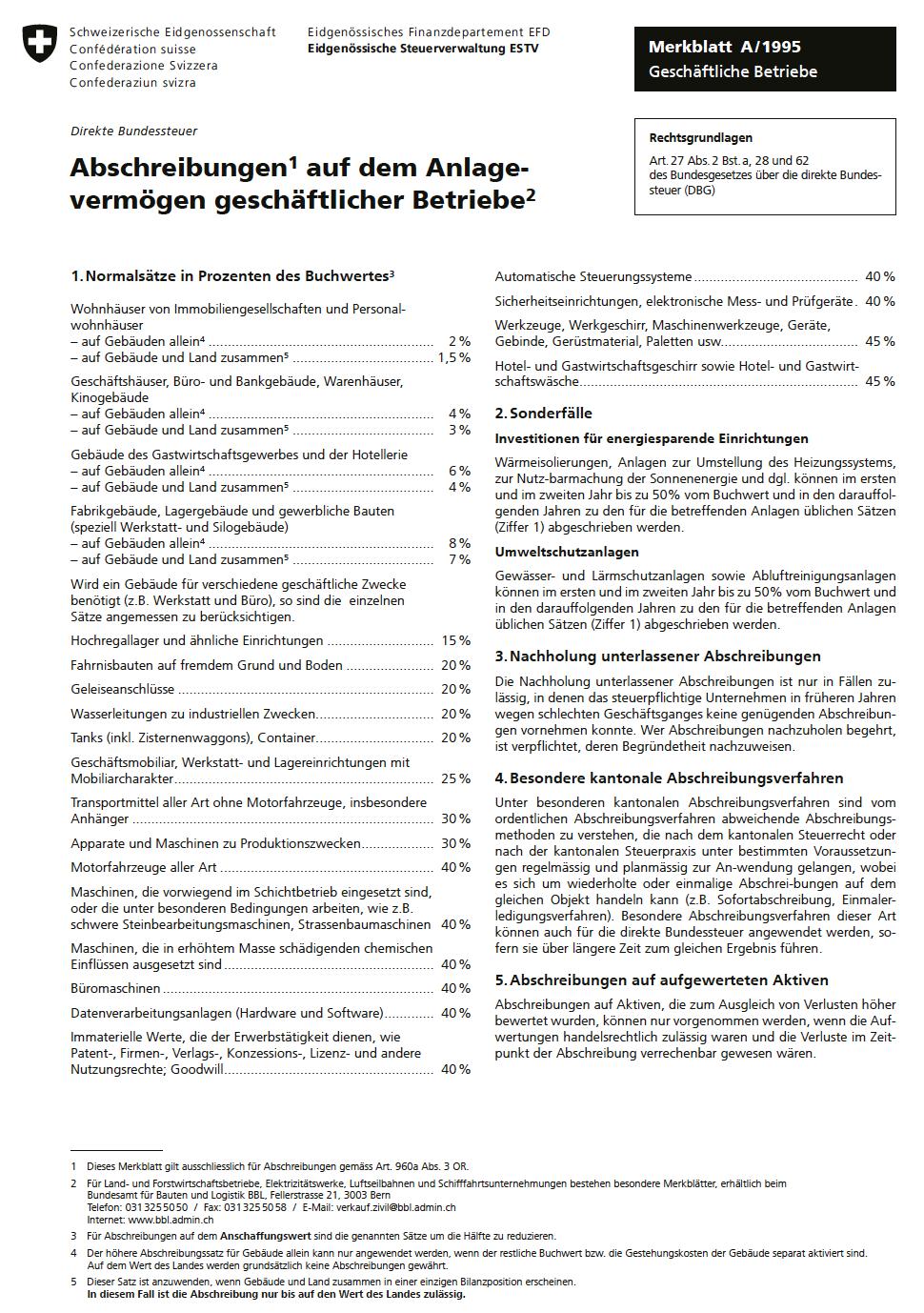
Abb. 25 Merkblatt der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu den erlaubten Abschreibungen
11.8 Füllen Sie die Tabellen aus und zeichnen Sie die Buchwerte in die Grafiken ein.
n Beispiel 1: Abschreibungen vom Anschaffungswert (= linear)
Anlageobjekt: Lieferwagen
Anschaffungswert: CHF 100'000.–
Nutzungsdauer: 5 Jahre
Zulässiger Abschreibungssatz: 20% vom Anschaffungswert
Jahr Buchwert 01.01. Abschreibungsbetrag Buchwert 31.12.
2023 100'000.– 20% von CHF 100'000.- = 20'000.– 80'000.–
2024 80'000.– 20% von CHF 100'000.- = 20'000.– 60'000.–2025 60'000.– 20% von CHF 100'000.- = 20'000.– 40'000.–2026 40'000.– 20% von CHF 100'000.- = 20'000.– 20'000.–2027 20'000.– 20% von CHF 100'000.- = 20'000.– 0.–

Abschreibungsbetrag: (linear immer gleich, degressiv zuerst höher)
Restwert: linear kein Restwert, degressiv nie ganz auf Null
n Beispiel 2: Abschreibungen vom Buchwert (= degressiv)
Anlageobjekt: Lieferwagen
Anschaffungswert: CHF 100'000.–
Nutzungsdauer: 5 Jahre
Zulässiger Abschreibungssatz: 40% vom Buchwert
Buchwert 31.12. (CHF)
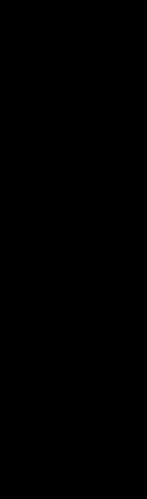
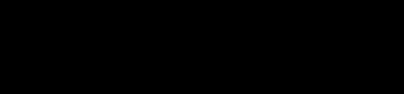

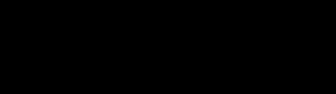
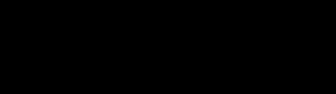
Welches Abschreibungsverfahren würden Sie empfehlen?
Linear, wenn Wertverminderung gleichmässig stattfindet
Degressiv: wenn Wertentwertung zu Beginn höher ist als später
12 Bilanzen und Erfolgsrechnungen dienen als Entscheidungsgrundlage für betriebswirtschaftlichen Entscheide. Eine erste Analyse einer Bilanz und einer Erfolgsrechnung kann anhand der folgenden drei Kriterien erfolgen: Liquidität, Rendite und Sicherheit
Lesen Sie die drei Texte und notieren Sie die Formeln für die vier Kennzahlen.
n Liquidität: die Frage nach der Zahlungsbereitschaft
Eine Unternehmung muss ihre fälligen Rechnungen fristgerecht bezahlen können. Bei längeren Zahlungsrückständen droht sonst eine Betreibung, die unter Umständen in kurzer Zeit zur Auflösung der Unternehmung führen kann. Die massgebende Grösse für die Liquiditätskontrolle ist das kurzfristige Fremdkapital; darunter verstehen wir Schulden (Verbindlichkeiten) der Unternehmung, die innerhalb eines Jahres zurückbezahlt werden müssen. Die Hauptposition beim kurzfristigen Fremdkapital sind die offenen Lieferantenrechnungen (= Kreditoren). Es ist nun aber nicht notwendig, dass für alle offenen Lieferantenrechnungen genau der entsprechende Betrag an flüssigen (liquiden) Mitteln (Bargeld in der Kasse sowie Post- und Bankguthaben) zur Verfügung steht. Weil in der Regel laufend Zahlungen von Kunden (= Debitoren) eingehen, können zur Beurteilung der Zahlungsbereitschaft auch die Kundenguthaben miteinbezogen werden.
Liquiditätsgrad 2 = (Flüssige Mittel + Ford L+L) x 100
Kurzfristiges Fremdkapital
Für den Liquiditätsgrad 2 setzen wir die flüssigen Mittel plus die Kundenguthaben ins Verhältnis zum kurzfristigen Fremdkapital. Der Liquiditätsgrad 2 sollte mindestens 100 % betragen. Zweifel an der Liquidität können für eine Unternehmung schwerwiegende Konsequenzen haben. Mögliche Kapitalgeber und Geschäftspartner begegnen einer solchen Unternehmung mit einer gewissen Skepsis. Sie nehmen Geschäftskontakte unter Umständen nur noch sehr zurückhaltend wahr, bestehen allenfalls auf sofortiger Bezahlung oder verlangen zusätzliche Sicherheiten.
Zu beachten ist, dass die Liquiditätsreserve auch nicht übermässig gross sein sollte, weil überschüssige Mittel sehr wenig bis keinen Zins abwerfen. Anzustreben ist deshalb ein Liquiditätsgrad im Bereich von 100 bis 120 %; liegt der Wert über dieser Normgrösse, so hat eine Unternehmung (wenn nicht besondere Verhältnisse vorliegen) brachliegende liquide Mittel.
Je schneller die Kunden ihre Rechnungen bezahlen, desto geringer ist der Gesamtbestand an flüssigen Mitteln, die eine Unternehmung halten muss. Deshalb gewähren viele Unternehmungen einen Abzug (Skonto) bei rascher Bezahlung. Wenn Skontoabzüge gewährt werden, sollten diese beim Kauf immer ausgenützt werden.
n Rendite: die Frage nach dem Gewinn
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist unbestritten, dass Unternehmungen Gewinne erzielen müssen. Nicht nur das Fremdkapital ist zu verzinsen, auch die Eigentümer oder Teilhaber (Aktionäre) erwarten eine Rendite für das zur Verfügung gestellte Kapital. Die Rendite für das Eigenkapital sollte einige Prozentpunkte über jener für sichere Anlagen liegen, wie z.B. Hypotheken oder Staatsanleihen. Wenn diese Entschädigung ausbleibt, werden die Kapitalgeber ihr Geld anderswo anlegen wollen, und zukünftige Finanzierungen dürften für die Unternehmung schwieriger werden.
Gewinne sind aber auch notwendig, damit eine Unternehmung weitere Vorhaben wie technische Anpassungen, Verbesserungen der Produktionsprozesse und Entwicklung neuer Produkte aus eigener Kraft finanzieren kann. Dies ist insbesondere bei risikoreichen Vorhaben nötig, weil Fremdkapitalgeber für solche Projekte den Unternehmungen nicht ohne Weiteres Kredite gewähren. Wir sprechen bei solchen Projekten auch davon, dass der Gewinn eine Risikoprämie, d.h. eine Entschädigung für die Risikobereitschaft der Kapitalgeber, darstellt.
Gewinne bringen jedoch nicht nur Vorteile. Die Ausschüttung der Gewinne an die Eigentümer (z.B. in Form von Dividenden) bedeutet aus Sicht der Unternehmung einen Mittelabfluss. Dies wird dann problematisch, wenn daraus Liquiditätsprobleme entstehen.
Damit Gewinne besser beurteilt werden können, werden sie in Relation zum Eigenkapital gesetzt. Dies führt uns zum Begriff der Eigenkapitalrendite. Diese Verhältniszahl (englisch ROE = Return On Equity) sagt aus, wie viel Prozent Reingewinn mit dem investierten Eigenkapital erwirtschaftet wird.
Eigenkapitalrendite = Reingewinn x 100 Eigenkapital
Zwar sind Unternehmungen ohne Gewinne langfristig nicht überlebensfähig. Ebenso unbestritten ist aber auch, dass eine Unternehmung in ihrer Unternehmungsstrategie die Erzielung eines grösstmöglichen Gewinns nicht als einziges Ziel postulieren soll. Das Gewinnziel muss eingebettet sein in einem Gesamtsystem unternehmerischer Ziele, welche auch leistungswirtschaftliche und soziale Aspekte umfasst. Als Normgrösse für die Eigenkapitalrendite gilt ein «Mindestwert» von etwa 8 %; je nach unternehmerischem Risiko sollte der Wert im Bereich von 8 bis 12 % liegen.
n Cashflow = Jahresgewinn und Abschreibungen
Weil bei den Abschreibungen ein gewisser Ermessensspielraum besteht, kann der Jahresgewinn durch die Abschreibungen höher oder tiefer ausgewiesen werden. Aus diesem Grund werden für die Beurteilung der finanziellen Lage einer Unternehmung die Abschreibungen zum Jahresgewinn dazugezählt. Diese zusätzliche Kennzahl (Jahresgewinn plus Abschreibungen) nennt man Cashflow.
n Sicherheit: die Frage nach der finanziellen Unabhängigkeit
Unter dem Aspekt der Sicherheit sollte sich eine Unternehmung mit möglichst viel Eigenkapital finanzieren. Eine Unternehmung, die viel Fremdkapital aufgenommen hat, wird von ihren Fremdkapitalgebern abhängig. Einerseits müssen laufend Fremdkapitalzinsen bezahlt, andererseits Kredite am Ende ihrer Laufzeit zurückbezahlt werden. Im Gegensatz dazu kann bei den Eigenkapitalgebern bei schlechtem Geschäftsgang auf eine Auszahlung eines Gewinnanteils (Dividende bei einer Aktiengesellschaft) verzichtet werden. Das Eigenkapital steht im Übrigen der Unternehmung bis zur allfälligen Auflösung zur Verfügung; es muss höchstens bei Schliessung der Geschäftstätigkeit zurückbezahlt werden. Schliesslich sind Unternehmungen mit einem hohen Fremdkapitalanteil weniger kreditfähig, weil das Eigenkapital den Kreditgebern als Sicherheit dient. Allfällige Verluste werden immer zuerst durch das Eigenkapital gedeckt. Eine Unternehmung, die sich nur mit Eigenkapital finanzieren würde, hätte jedoch rein rechnerisch eine tiefere Eigenkapitalrendite zu erwarten.
Die wichtigsten Kennzahlen zur Überprüfung der finanziellen Unabhängigkeit sind:
Eigenfinanzierungsgrad = Eigenkapital x 100 Gesamtkapital
Der Richtwert für den Eigenfinanzierungsgrad ist weitgehend branchenabhängig; oft gelten 30 bis 50 % als minimale Richtgrösse.
Die Zielsetzungen der genügenden Liquidität und der finanziellen Unabhängigkeit stehen auch bei der goldenen Bilanzregel im Mittelpunkt. Diese besagt, dass langfristig gebundenes Vermögen mit langfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert werden soll.
n Goldene Bilanzregel
Aktiven Bilanz Passiven
Langfristiges
Fremdkapital
Langfristig gebundenes Vermögen Anlagevermögen Eigenkapital
Langfristig zur Verfügung stehendes Kapital
Langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital (Hypotheken, Obligationenanleihen) ist aus Sicht der Finanzierungsdauer mit Eigenkapital vergleichbar. Zur Überprüfung der goldenen Bilanzregel kann deshalb neben dem Eigenkapital auch das langfristige Fremdkapital berücksichtigt werden.
Anlagedeckungsgrad 2 = (Eigenkapital + lfr. Fremdkapital) x 100 Anlagevermögen
In einer Unternehmung müssen sämtliche Vorgänge mit finanziellen Auswirkungen (die sogenannten Geschäftsfälle) dokumentiert werden. Erst wenn alle verbuchten Geschäftsfälle dokumentiert bzw. belegt sind, kann man eine Jahresrechnung mit Bilanz und Erfolgsrechnung auf ihre Richtigkeit hin überprüfen; dies ist sowohl für interne Anspruchsgruppen (wie z.B. Fremd- und Eigenkapitalgeber) als auch für externe Anspruchsgruppen (wie z.B. das Steueramt) zwingend notwendig. Aus diesem Grund sind Belege für jede Buchhaltung unerlässlich und es gilt das Prinzip: «Keine Buchung ohne Beleg».
n Verschiedene Arten von Belegen
Ein Beleg ist grundsätzlich alles, was geeignet ist, einen Geschäftsfall zu beweisen. Belege lassen sich in zwei Arten gliedern: Externe Belege erhalten wir von unseren Anspruchsgruppen, interne Belege erstellen wir in der Unternehmung selbst.
Interne Belege Externe Belege
§ Rechnungen an Kunden Kundenrechnungen, Ausgangsrechnungen
§ Kassabuch
§ Lohnabrechnungen
§ Lagerkartei (Bezüge und Rückgaben)
§ Aufstellung unverkäufliche Waren (Ladenhüter)
§ Aufstellungen über Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen (Formular Steueramt)
§ Fahrtenbuch (Datum, Zielort, Kilometerzahl von Privatfahrten mit dem Geschäftsfahrzeug)
§ Selbst ausgestellte Quittungen
§ «Eigenbelege» über Einlagen und Bezüge (Kasse, Bank, Post, Waren)
§ «Notbelege» für verlorene externe Belege
§ Rechnungen von Lieferanten Eingangsrechnungen Lieferantenrechnungen
§ Kontoauszüge (Bank, Post)
§ MWST-Abrechnungen
§ Mitteilungen des Steueramtes
§ Erhaltene Quittungen
§ Unterzeichnete Verträge
n Quittungen
Auf Muster-Vorlage.ch können Quittungsvorlagen für die Schweiz im Word-Format direkt und kostenlos heruntergeladen werden.

Abb. 26 Website Muster-Vorlage.ch
Insbesondere für Barkäufe empfiehlt es sich (für beide Seiten), eine Quittung auszustellen. Damit belegen beide Seiten (Käufer und Verkäufer), den geforderten Betrag übergeben, bzw. erhalten zu haben. Der Käufer hat somit eine Empfangsbestätigung in der Hand und der Verkäufer erhält mit der Quittung eine Unterlage für die Buchhaltung. Auch wenn Sie nicht aus Beweisgründen eine Quittung ausstellen möchten: Der Verkäufer hat dem Käufer auf Verlangen immer eine Quittung auszustellen.
Für mehrwertsteuerpflichtige Unternehmungen müssen Quittungen besondere Formvorschriften einhalten: Der MWST-Satz, der MWST-Betrag und die MWST-Nummer müssen auf dem Beleg ausgewiesen werden. Zudem muss bei einem Kauf von über CHF 400.– auf der Quittung ersichtlich sein, wer genau der Käufer ist. Auch der Kaufgegenstand oder die erbrachte Dienstleistung muss klar ausgewiesen sein. Ferner muss Ort, Datum und Unterschrift auch auf die Quittung. Übrigens: Trinkgelder müssen separat ausgewiesen werden, weil diese nicht als Vorsteuer in der Mehrwertsteuerabrechnung abgezogen werden dürfen.
n Kontierungsstempel – so verbucht man Belege
Bei der Verbuchung von Belegen gelten einige verbindliche Grundregeln:
1. Belege zeitgerecht und geordnet in die Buchhaltung übernehmen
Idealerweise wöchentlich, spätestens am Monatsende sollten alle Geschäftsfälle und die entsprechenden Belege in die Buchhaltung übernommen werden.
2. Belege fortlaufend nummerieren
Drittpersonen sollen jeden Beleg eindeutig dem dazugehörigen Geschäftsvorfall zuordnen können. Dafür eignet sich ein Buchungsstempel bzw. ein Kontierungsstempel.
Mit dem Kontierungsstempel und der entsprechenden Vorkontierung versieht man den Beleg sofort mit den wichtigsten Informationen zum Geschäftsfall. Das erleichtert es erheblich, die Belege am Ende des Monats korrekt zu einzubuchen. Im Handel sind viele verschiedene Arten von Kontierungsstempeln erhältlich Abb. 27 Website stempel-versand.ch

Die Kontierungsstempel können nicht bei allen Belegen am gleichen Ort platziert werden. Einige Firmen notieren deshalb die Beleg-Nummer separat in Farbe (z.B. rot) oben rechts. Dies erleichtert die Übersicht.
3. Belege im Buchhaltungsprogramm einscannen und verbuchen
Nach der Buchung wird der Beleg mit „Gebucht“ bezeichnet; so wird vermieden, dass Belege doppelt gebucht werden.
4. Belege 10 Jahre aufbewahren
Die Belege müssen 10 Jahre im Original aufbewahrt werden. Quittungen auf Thermodruckern verblassen mit der Zeit und sollten deshalb kopiert werden.

13 Kontieren Sie den nebenstehenden Beleg. Alles verstanden? Kontrollieren Sie Ihr Wissen mit den Übungen 13.1 – 13.2 1. 4000 2000 04.03.2023, Rü
Wie versprochen muss Giulia noch die Jahresrechnung für ihre Oma erstellen. Im Internet findet Giulia das kostenlose Angebot von www.swiss21.org. Giulia entscheidet sich, ihre sechs Journalbuchungen auf bookyto mit dieser professionellen Buchhaltungssoftware darzustellen. Oma wird staunen!
Wir begleiten Giulia auf diesem Weg und sehen, wie die Buchhaltung mit Swiss21 in der Praxis funktioniert.
14.1 Jetzt sind Sie dran: Erstellen Sie Ihren persönlichen, kostenlosen Starter-Account bei Swiss21. Rufen Sie die Website www.swiss21.org auf.

Klicken Sie ‹KOSTENLOS STARTEN› und dann auf ‹Kostenlos registrieren›
In der Eingabemaske Registrierung sind folgende Eingaben zu machen:
Vorname, Name, Mailadresse und Passwort (Fantasiebezeichnungen sind auch möglich, z.B. Petra Muster, Musterweg 2, Musterdorf) Einzig auf den Posteingang Ihrer angegebenen Mailadresse müssen Sie zugreifen können.
Der englische Begriff «Dashboard» bedeutet wörtlich übersetzt Armaturenbrett. In der Informatik handelt es sich bei Dashboards um eine Anordnung verschiedener grafischer Elemente, mit deren Hilfe Daten übersichtlich dargestellt (visualisiert) und verschiedene Computerprogramme (Apps) verwaltet werden können.
Nachdem Sie ihre Mail-Adresse verifiziert haben (Mail im Posteingang Ihrer Mailadresse bestätigen,) können Sie folgende Eingaben zu Ihrem persönlichen, kostenlosen Starter-Abonnement bei Swiss21 vornehmen:
• Unternehmensname, Adresse, Telefonnummer (geben Sie bei Unternehmensname ihren Vor- und Nachnamen ein, bei E-Mail des Unternehmens Ihre Mail-Adresse ein. )
• Unternehmensart (wählen Sie hier Handel)
• Unternehmensform (wählen Sie hier Einzelunternehmen)

Swiss21-Apps sind Software-Applikationen, mit denen verschiedene Anwendungen, wie ein Buchhaltungsprogramm, ein Fakturierungsprogramm, eine Lohnbuchhaltung oder E-Commerce-Lösungen sowie eine Kontaktverwaltung, integriert bearbeitet werden können.
Die App «21.ABANINJA» ist ein Buchhaltungsprogramm. Wenn man die App 21.ABANINJA das erste Mal aktiviert, sind noch einige wenige Angaben einzugeben.

Abb. 29 Registrierungsschritte im Buchhaltungsprogramm 21. AbaNinja
14.2 Aktivieren Sie in Ihrem Account die Applikation 21.AbaNinja.
1. Sie müssen keine zusätzlichen Eingaben vornehmen und können zweimal auf ‹Weiter› klicken.
2. Zum Abschluss müssen Sie für AbaNinja und DeepCloud1 die AGB und die Datenschutzerklärungen bestätigen, dann erscheint das nebenstehende Dashboard von AbaNinja.
14.3 Dashboard 21.AbaNinja anpassen

Unter der Schaltfläche ‹Bearbeiten› können Sie mit den Symbolen die angezeigten Kacheln verschieben oder ausblenden.
Passen Sie die Voreinstellung des Dashboards 21.AbaNinja wie in der nebenstehenden Abbildung an. Blenden Sie dazu, bis auf die Kachel Erste Schritte, alle übrigen Kacheln aus.
n Dashboard 21.AbaNinja
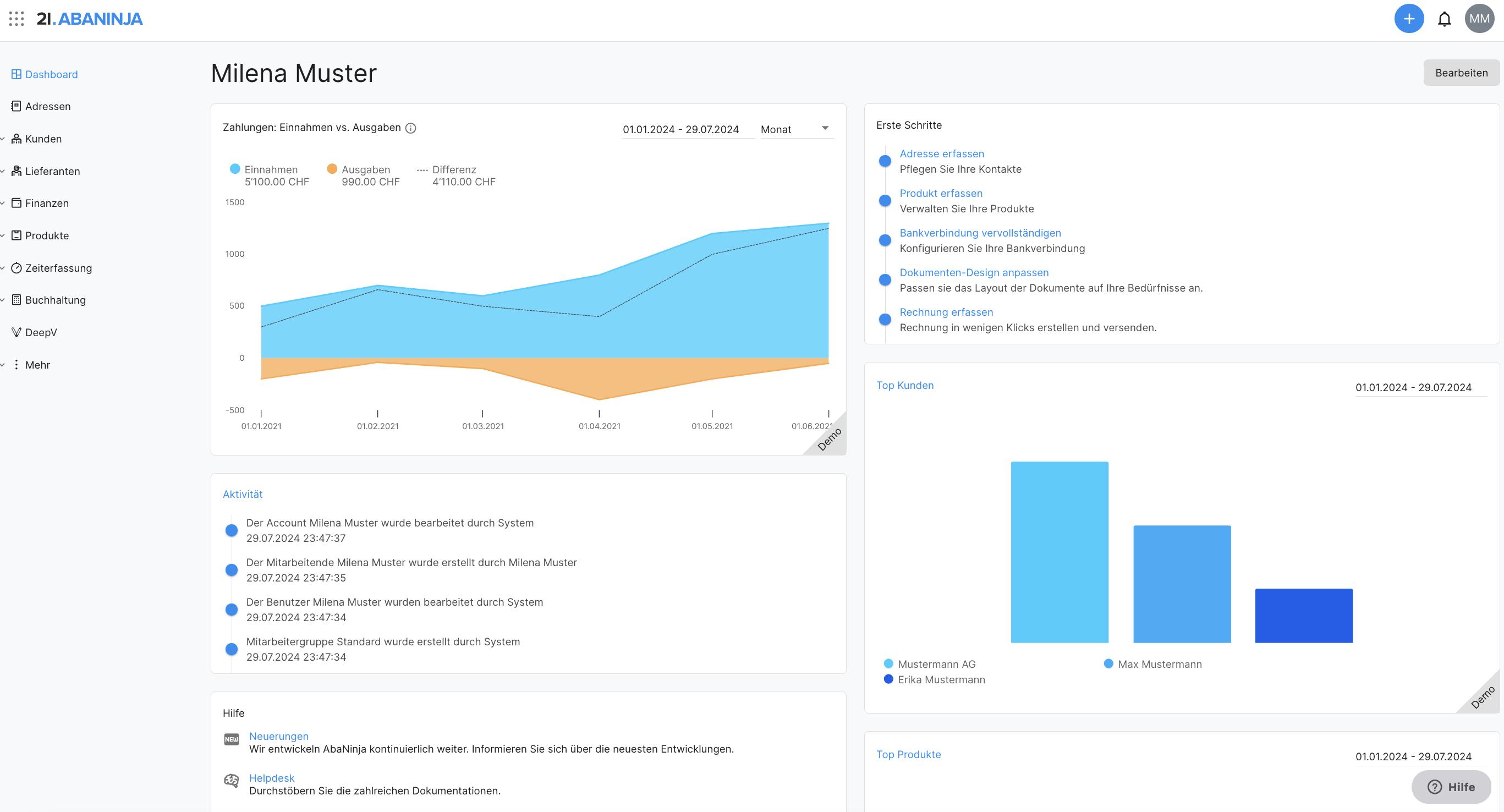
Abb. 30 Voreinstellung Dashboard 21.AbaNinja
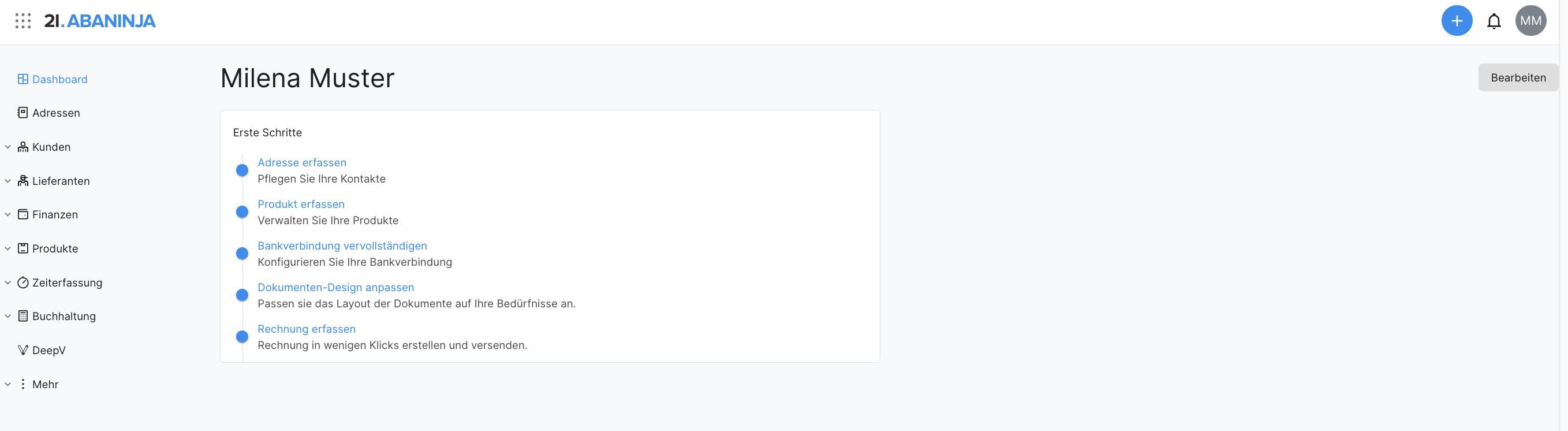
Abb. 31 Angepasstes Dashboard 21.AbaNinja
1 DeepCloud = Unternehmen, welches Services für die Speicherung, Aufbewahrung, Verarbeitung, Übermittlung und Visualisierung von Daten und Informationen bezweckt.
n So bucht man manuell in Swiss21 – Variante 1: Journal
Im Menu Buchhaltung > Journal können Journalbuchungen manuell eingegeben werden.
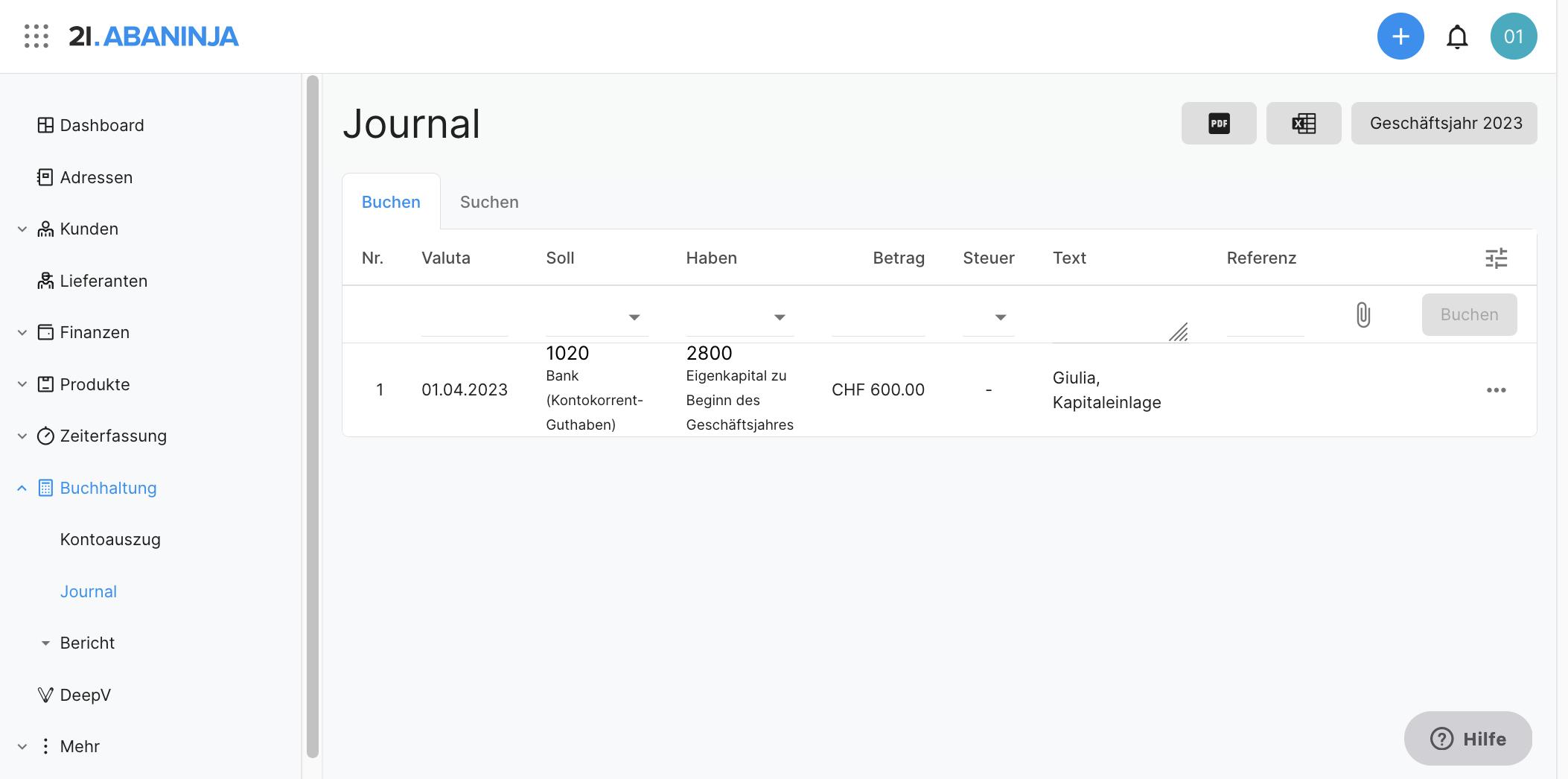
Abb. 32 Journal-Buchungsmaske in AbaNinja
Nr. Die Buchungen werden automatisch nummeriert.
Valuta Das Valutadatum ist ein Begriff, der im Bank- und Finanzwesen verwendet wird, um das Datum zu bezeichnen, an dem eine finanzielle Transaktion tatsächlich abgewickelt wird.
Das Valutadatum unterscheidet sich vom Buchungsdatum oder dem Erfassungsdatum einer Transaktion. Das Buchungsdatum ist das Datum, an dem eine Transaktion in den Büchern erfasst oder dokumentiert wird.
Soll Auswahl des Kontos, in welchem der Betrag im Konto links eingetragen wird.
Haben Auswahl des Kontos, in welchem der Betrag im Konto rechts eingetragen wird.
Betrag Geldbetrag
Steuer Massgebender Mehrwertsteuersatz. Falls nicht mehrwertsteuerpflichtig, «–» eingeben.
Text Kurztext
Referenz Bezeichnung, um einen Beleg einfach zu identifizieren, z.B. Rechnungsnummer, zuständige Mitarbeiter, Kundennummer.
Datei Mit dem Symbol der Büroklammer können Belege manuell angehängt werden.
n So bucht man manuell in Swiss21 – Variante 2: Kontoauszug
Im Menu Buchhaltung > Kontoauszug können Buchungssätze ebenfalls manuell eingegeben werden.
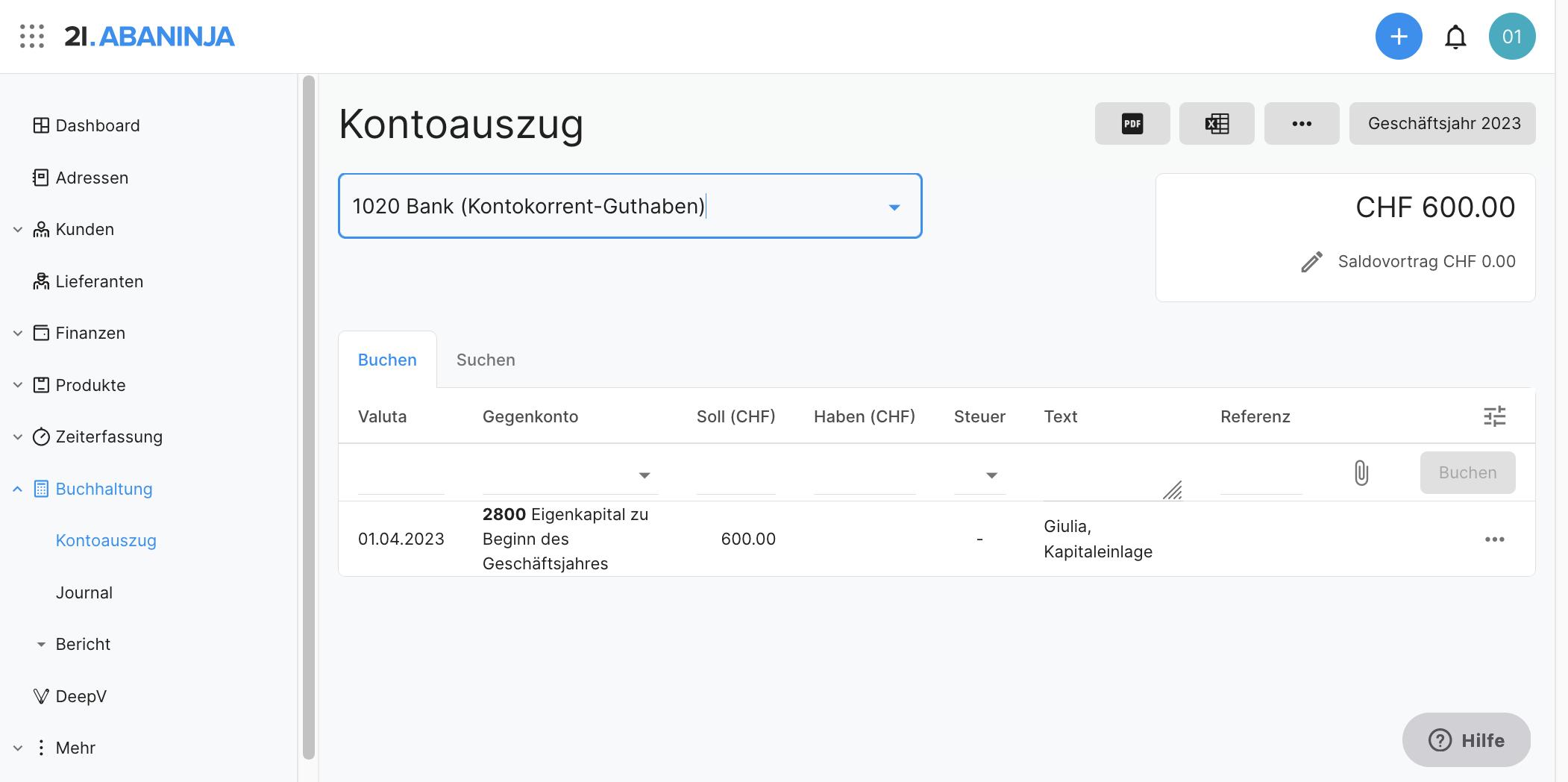
Abb. 33 Kontoauszug-Buchungsmaske in AbaNinja
Die Felder Valuta, Steuer, Text und Referenz werden gleich wie bei der Journalbuchung eingetragen.
Im Vergleich zu den Journalbuchungen wird der Buchungssatz bei dieser Variante jedoch direkt in das ausgewählte Konto eingetragen; je nach Geschäftsfall trägt man den Betrag auf der Soll-Seite oder der Haben-Seite des ausgewählten Kontos ein.
Anschliessend kann man das Gegenkonto auswählen. Der entsprechende Betrag wird dann im Gegenkonto automatisch auf der Gegenseite (Soll-Seite bzw. Haben-Seite) eingetragen.
Mit der Schaltfläche ‹Buchen› wird der gesamte Buchungssatz ins Journal übertragen.
n Lieferantenbelege digital verarbeiten
In 21.AbaNinja können Lieferantenrechnungen (Kreditoren) importiert, bearbeitet und zur Zahlung freigegeben werden. Daten wie Adresse, Rechnungsnummer oder Preise werden automatisch aus dem PDF ausgelesen und in die Eingabemaske übernommen. Für die weitere Verarbeitung der Belege müssen einzelne Punkte manuell bearbeitet werden.
14.4 Sehen Sie sich dazu den ersten Teil (00:00 – 01:23) des Erklärvideos «21.AbaNinja: Lieferanten > Lieferantenbeleg importieren und bearbeiten» an. Sie können die Musik ausschalten und unter den Einstellungen (Symbol Zahnrad) die Geschwindigkeit auf 0.75x oder 0.5x einstellen, in der normalen Geschwindigkeit geht es sehr schnell

in AbaNinja

Notieren Sie in der Tabelle rechts konkrete Eingaben, die bei den Schritten (1) bis (5) vorgenommen werden müssen.
14.5 Weshalb müssen Belege «freigegeben» werden?
Damit ist ein arbeitsteiliger Prozess mit Freigabe durch Vorgesetzte möglich. Sachbearbeiter können Belege vorbereiten und kontieren, für die Weiterverarbeitung ist die Freigabe der Vorgesetzten erforderlich.
Ablauf
Beleg importieren
Beleg bearbeiten
Beschreibung / Input / Output
Menu Lieferanten: oben rechts ‹Lieferantenbeleg importieren›
Beleg erhält den Status «Offen»
(1) Adresse speichern
Kontaktinformationen
(2) Details festlegen
Rechnungsdatum
Fälligkeitsdatum, Lieferdatum
Referenz, Buchungstext
(3) Positionen
Konto auswählen
Betrag kontrollieren
(4) Freigabe
Beleg selbst freigeben
Freigabe anfordern
(5) Zahlungsinformationen
Bankverbindung auswählen
Speichern à Beleg Status «Bestätigt»
n So kann die Bilanz in 21.AbaNinja aussehen
Unter dem Menu Buchhaltung > Bericht > Bilanz erscheint die Bilanz.
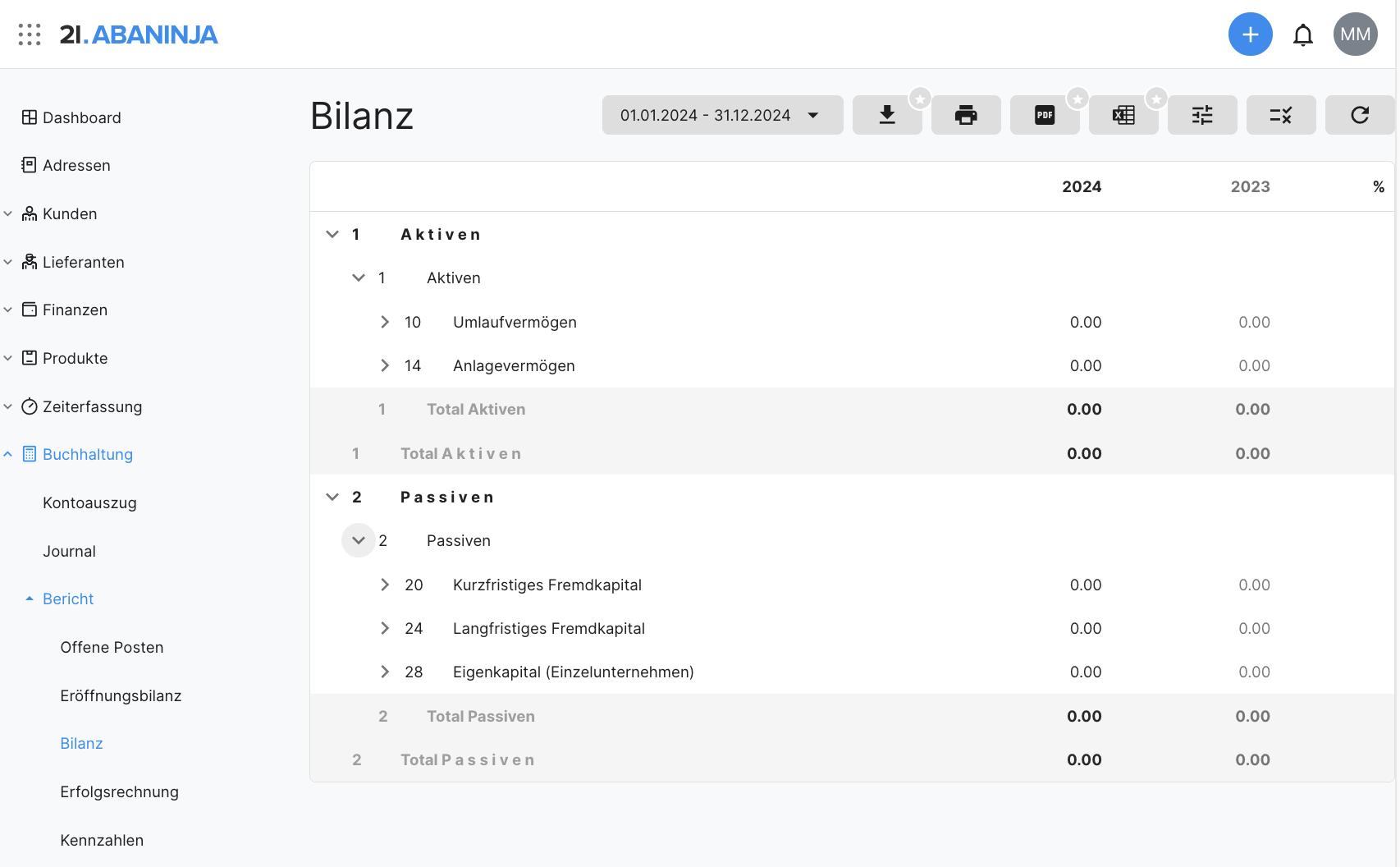
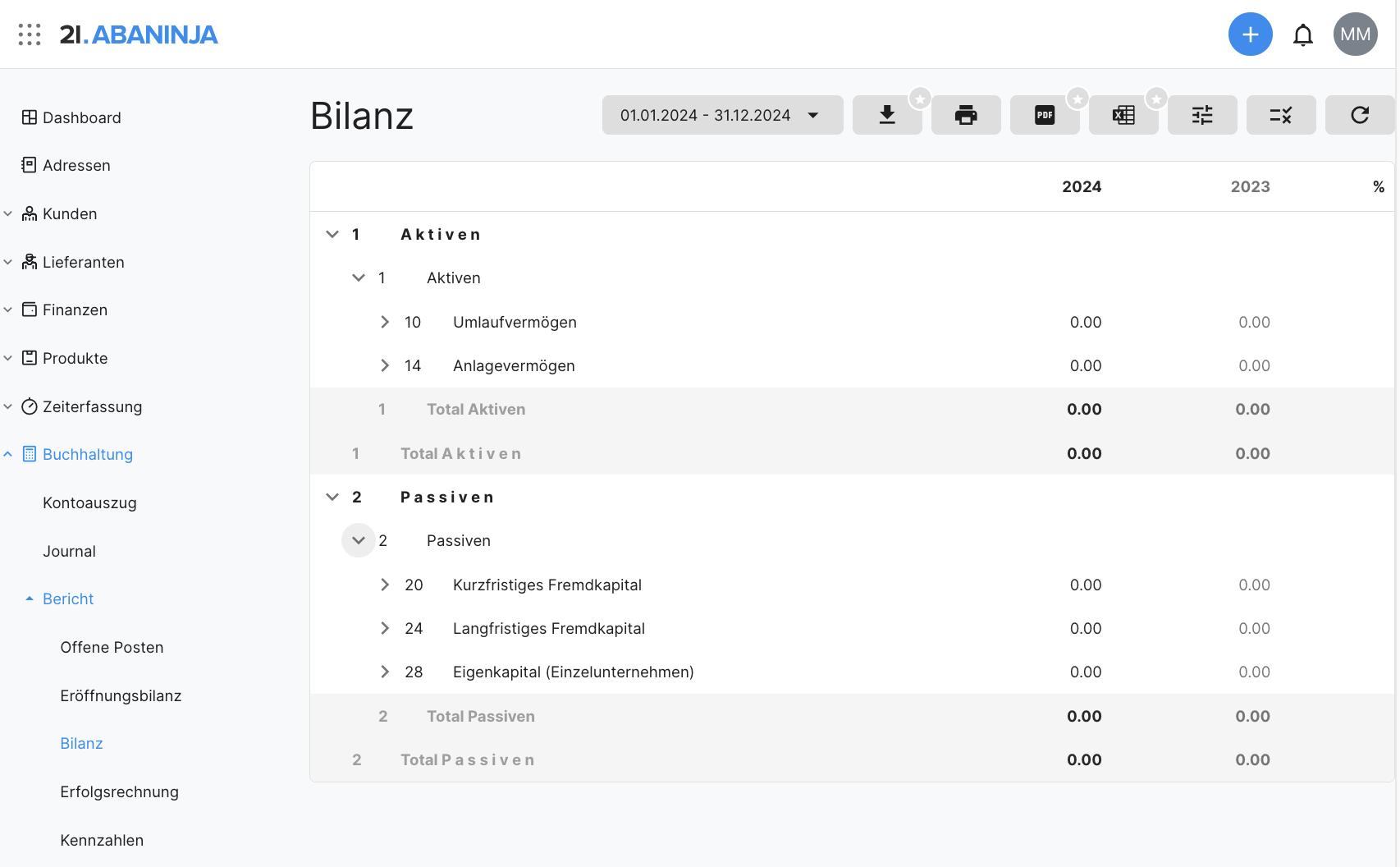
Abb. 35 Darstellung Bilanz in AbaNinja
14.6 Loggen Sie sich in Ihren Swiss21-Account ein und sehen Sie sich die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten für die Bilanz an.
Notieren Sie die wichtigsten Einstellungsoptionen in die Tabelle rechts.
Bilanz formatieren

a) Spalten einblenden:
Vorjahr, %, Fremdwährung
Zeilen Einstellungen:
Kategorien, Konten mit Saldo 0
Konten mit Bewegungen
Referenz, Buchungstext
Alles öffnen, Nummer
Eingerückte Darstellung
Guidelines

b) Ebene 1 = Aktiven/Passiven
2 = Kontenklassen
3 = Kontenhauptgruppen
4 = Kontengruppen
5 = Kontengruppen (gruppiert)
Einzelkonten
n So kann die Erfolgsrechnung in 21.AbaNinja aussehen
Unter dem Menu Buchhaltung > Bericht > Erfolgsrechnung erscheint die Erfolgsrechnung.
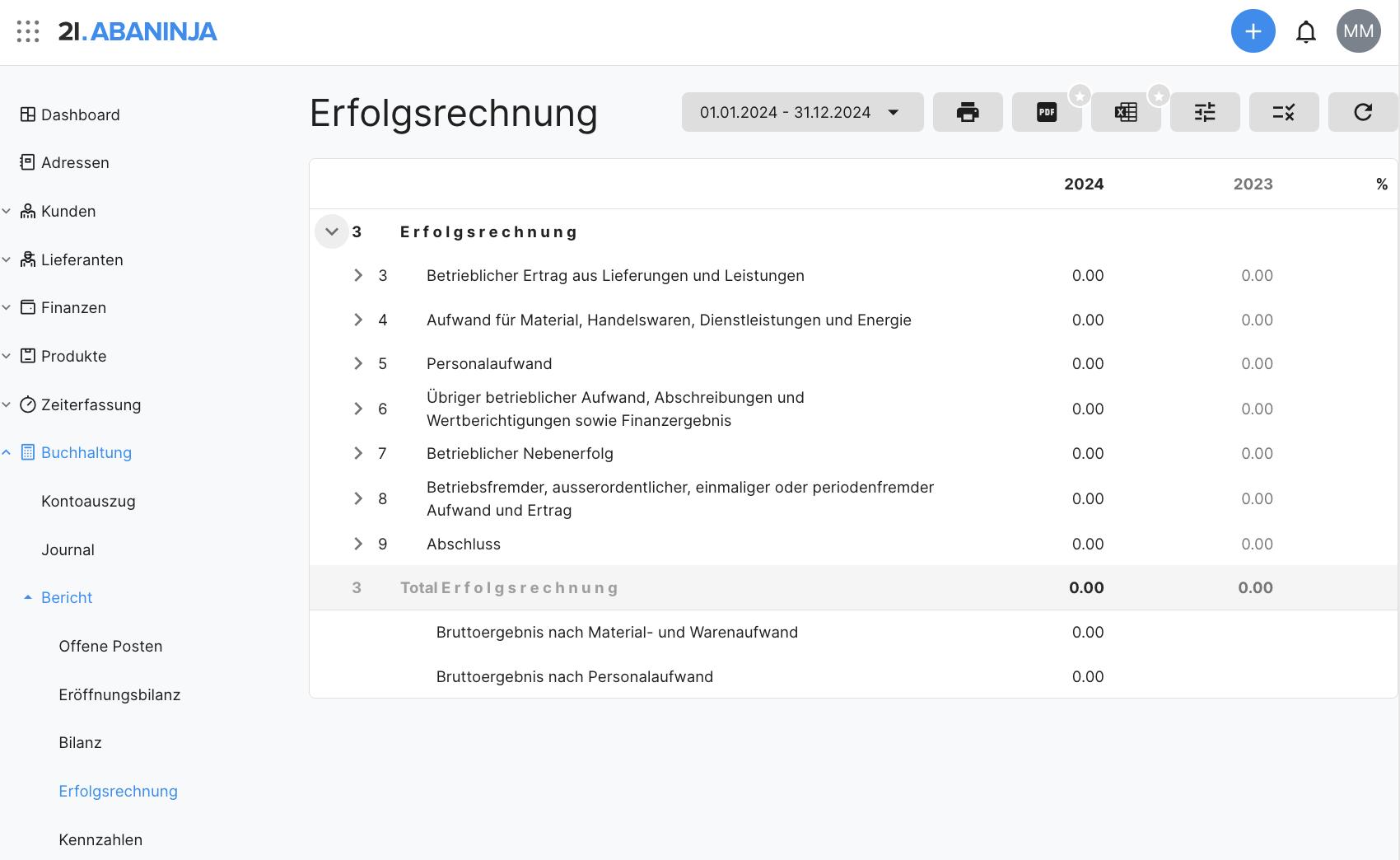
Abb. 36 Darstellung Erfolgsrechnung in AbaNinja
14.7 Loggen Sie sich in Ihren Swiss21-Account ein und sehen Sie sich die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten für die Erfolgsrechnung an. Beantworten Sie anschliessend die folgenden Fragen in der nebenstehenden Tabelle.
a) Blenden Sie unter den Darstellungsoptionen alle Spalten und alle Zeilen ein (alle Regler nach rechts).
Wählen Sie dann unter ‹Ebenen anzeigen/verstecken› folgende Einstellung: Ebene 1 anzeigen, Ebene 2 anzeigen und Konten anzeigen.
Scrollen Sie von oben nach unten durch diese Darstellung. Zählen Sie dabei die angezeigten Einzelkonten. Wie viele Konten werden angezeigt?
b) Für welche Zeiträume kann die Erfolgsrechnung angezeigt werden?
a)
Erfolgsrechnung formatieren

Anzahl Konten (KMU-Kontenrahmen):
a) 81 Konten
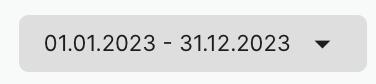
b) Voreingestellt, zur Auswahl:
b) 1. / 2. Halbjahr
1. / 2. / 3. / 4. Quartal
Zeitraum: auch frei wählbar
Alles verstanden? Kontrollieren Sie Ihr Wissen mit den Übungen 14.1 – 14.2
n Darstellung des Erfolgs in Bilanz und Erfolgsrechnung in 21.AbaNinja
In der Bilanz wird ein Gewinn als Unverbuchter Reingewinn (mit negativem Vorzeichen) unter den Passiven ausgewiesen.

Abb. 37 Darstellung Gewinn in Bilanz in AbaNinja
14.8 Wie lassen sich die unterschiedlichen Vorzeichen bei der Darstellung des Gewinns in Bilanz (–) und Erfolgsrechnung (+) erklären?
Eine Bilanz ist immer ausgeglichen. Aktiven (positive Vorzeichen) minus Passiven (negative Vorzeichen) muss deshalb gleich null sein.
Bei einem Gewinn sind die Aktiven (+) grösser als die Passiven (–), deshalb erscheint ein Reingewinn mit einem negativen Vorzeichen (–) unter den Passiven.
In der Erfolgsrechnung wird ein Gewinn unter dem Titel
Total Erfolgsrechnung (mit positivem Vorzeichen) ausgewiesen

38 Darstellung Gewinn in Erfolgsrechnung in AbaNinja
In der Erfolgsrechnung wird der Erfolg wie folgt ermittelt: Erträge (positive Vorzeichen) minus Aufwände (negative Vorzeichen).
Bei einem Gewinn sind die Erträge (+) grösser als die Aufwände (–), deshalb wird ein Gewinn in der Erfolgsrechnung mit einem positiven Vorzeichen aufgeführt.
Ein Verlust wird in der Bilanz wird als Unverbuchter Reinverlust (mit positivem Vorzeichen) unter den Aktiven ausgewiesen.
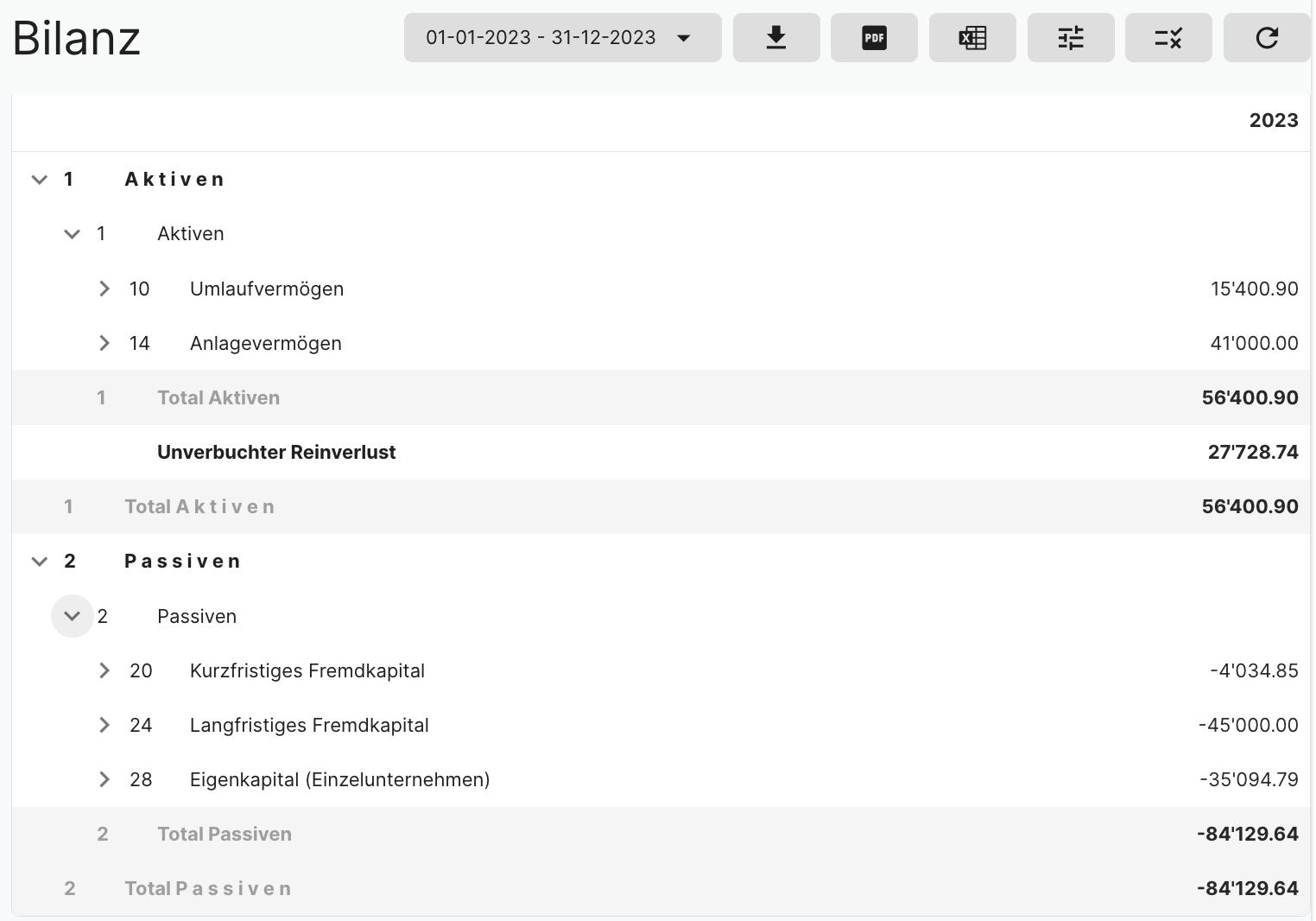
14.9 Wie lassen sich die unterschiedlichen Vorzeichen bei der Darstellung eines Verlusts in der Bilanz (+) und Erfolgsrechnung (–) erklären?
Eine Bilanz ist immer ausgeglichen. Aktiven (positive Vorzeichen) minus Passiven (negative Vorzeichen) muss deshalb gleich null sein. Bei einem Verlust sind die Aktiven (+) kleiner als die Passiven (–), deshalb erscheint ein Reinverlust mit einem positiven Vorzeichen (+) unter den Aktiven.
In der Erfolgsrechnung wird ein Verlust unter dem Titel Total Erfolgsrechnung (mit negativem Vorzeichen) ausgewiesen
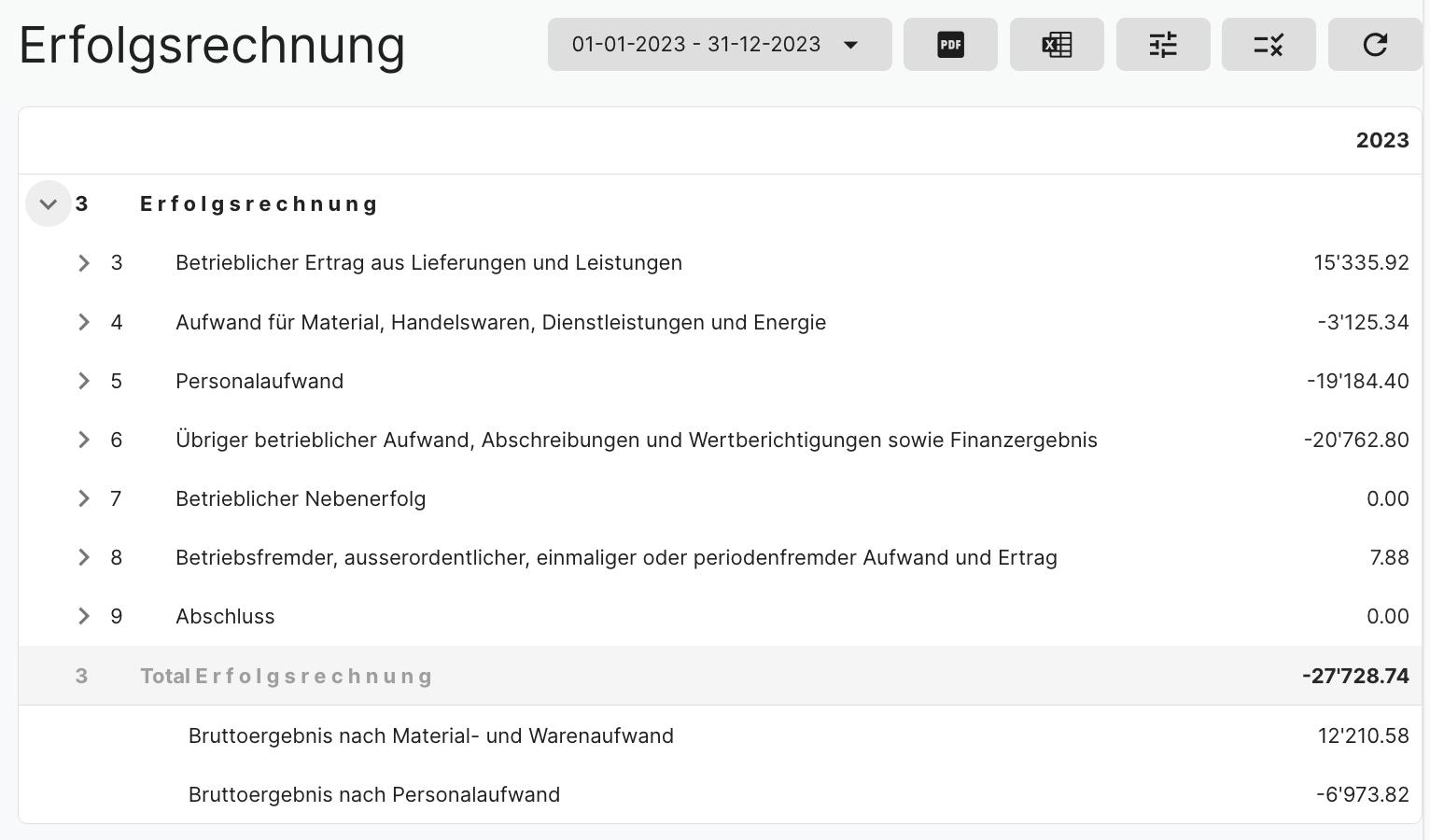
In der Erfolgsrechnung wird der Erfolg wie folgt ermittelt: Erträge (positive Vorzeichen) minus Aufwände (negative Vorzeichen). Bei einem Verlust sind die Erträge (+) kleiner als die Aufwände (–), deshalb wird ein Verlust in der Erfolgsrechnung mit einem negativen Vorzeichen aufgeführt.
Das haben Sie gelernt: Sie können ...
1 Geschäftsideen entwickeln und anhand von Kriterien (Zielgruppe, Wettbewerbsumfeld, finanzielle Machbarkeit) beurteilen
Geschäftsmodelle mithilfe des Business Models Canvas überzeugend präsentieren
2 Die Elemente eines Businessplans (Vision und Strategie, Markt, Organisationsstruktur, Finanzplanung) für ein Geschäftsmodell skizzieren und konkrete Anwendungsmöglichkeiten erklären.
Mit Annahmen für Investitions-, Personal-, Betriebs- und Umsatzpläne ein Budget erstellen und die finanzielle Machbarkeit eines Geschäftsmodells beurteilen
3 Die Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens (Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen, Information der Anspruchsgruppen) begründen.
Die verschiedenen Bereiche des Rechnungswesens (Betriebsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung) und die unterschiedlichen Vorgänge (Buchführung, Rechnungslegung) erläutern.
4 Den Aufbau, die Gliederung der Konten sowie die Aussagekraft von Bilanzen und Erfolgsrechnungen erläutern
5 Das «Konto» mit Soll- und Habenseite als zentrale Datenstruktur für die Erfassung von Geschäftsfällen erklären und korrekt «saldieren» (abschliessen)
6 Die Buchungsregeln (Anfangsbestand, Zunahmen, Abnahmen, Schlussbestand und Saldo) für die vier Kontenarten (Aktiven, Passiven, Aufwände, Erträge) erläutern
Die Beträge von Geschäftsfällen korrekt in ein Konto eintragen und die Auswirkungen auf den Saldo interpretieren.
7 Die Systematik und den Zweck des Kontenrahmens (mit 4-stelligen Kontennummern) erläutern und Zwischenresultate (Bruttogewinn, Betriebsgewinn, Jahresgewinn) durch die Zusammenfassung von einzelnen Kontenklassen ermitteln.
8 Für Geschäftsfälle die Buchungssätze anhand des KMU-Kontenrahmens bzw. eines vorgegebenen Kontenplans erstellen.
9 Die Journalbuchungen (mit Valutadatum, Soll-Konto, Haben-Konto, Betrag, Mehrwertsteuersatz, Buchungstext, Referenz) korrekt erfassen und die Übertragung der Journalbuchung ins «Hauptbuch» (Verzeichnis aller Konten) vornehmen
Den Zweck von «Nebenbüchern» (für Debitoren, Kreditoren und Löhne) erläutern
10 Das System der doppelten Buchhaltung mit dem Zusammenspiel von Eröffnungsbilanz, Journalbuchungen, Schlussbilanz 1 und Schlussbilanz 2 skizzieren.
Die Auswirkungen der zwei Optionen zur Gewinnverwendung (Gewinn in der Unternehmung behalten / Gewinn auszahlen) erläutern und in Beispielen begründete Empfehlungen abgeben.
Die Auswirkungen der zwei Optionen zur Verlustdeckung (Verlust durch zusätzliche Kapitaleinlage decken / Verlust mit Eigenkapital verrechnen) erläutern und in Beispielen begründete Empfehlungen abgeben.
11 Die Auswirkungen von Abschreibungen auf die Erfolgsrechnung, die Liquidität und die Investitionsplanung erläutern
In Beispielen begründete Empfehlungen zu den Abschreibungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften abgeben.
12 Die finanzielle Lage einer Unternehmung mithilfe von Kennzahlen (Liquiditätsgrad 2, Eigenkapitalrendite, Eigenfinanzierungsgrad und Anlagedeckungsgrad 2) beurteilen
13 Die Belege für Geschäftsfälle korrekt kontieren und bei Bedarf Belege selbst erstellen (keine Buchung ohne Beleg).
14 Geschäftsfälle in Swiss21 mit dem Buchhaltungsprogramm 21.AbaNinja manuell verbuchen, Belege importieren und für die Zahlung vorbereiten sowie eine Bilanz und eine Erfolgsrechnung erstellen.
Übung 1.1
Was ist eine Geschäftsidee?
a) Versuchen Sie, anhand dieser Grafik den Begriff «Geschäftsidee» in 1 bis 2 vollständigen Sätzen zu beschreiben, ohne dabei die Wörter «Geschäft» und «Idee» zu verwenden.

Mögliche Beschreibung: Eine Geschäftsidee ist ein erster Gedanke (Bild Leuchtbirne), wie man erfolgreich wirtschaften (Money) kann.
Eine Geschäftsidee ist etwas, womit man Geld verdienen kann, z.B. ein völlig neues Produkt bzw. eine völlig neue Dienstleistung, eine neue Lösung für ein bereits bestehendes Produkt oder auch die Verbesserung eines bestehenden Produkts bzw. einer Dienstleistung.
b) Was ist der Unterschied zwischen einer Geschäftsidee und einem Geschäftsmodell? Beschreiben Sie den grundlegenden Unterschied in 2 bis 3 vollständigen Sätzen. Eine Geschäftsidee ist ein erster Gedanke, wie man erfolgreich wirtschaften kann. Dies kann vieles sein, z.B. ein völlig neues Produkt, eine neue Lösung für ein bestehendes Problem, die Verbesserung bereits bestehender Probleme. Ein Geschäftsmodell ist eine Darstellung der wichtigsten Bausteine (Schlüsselfaktoren) für den Unternehmenserfolg.
Kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen an, welche Lückentexte zutreffen.
1. Ein Dokument, in dem aufgezeigt wird, nach welchen Grundprinzipien jemand mit einem Projekt oder einem Unternehmen Geld verdienen will, bezeichnen wir als ... .
2. Im Canvas Business Model wird das Grundprinzip eines Unternehmens auf einer Seite mit den wichtigsten ... Faktoren (Schlüsselfaktoren) dargestellt, die für den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind.
3. Das Geschäftsmodell beschreibt, wie das Unternehmen Werte schafft, liefert und erfasst, um langfristigen Erfolg zu erzielen. Es beinhaltet die , die die Struktur und den Betrieb des Unternehmens bestimmen
4. Der durchschnittliche Stundenlohn, den man als Schülerin mit 17 Jahren in einem Ferienjob verdienen kann, liegt etwa bei
A) ... Geschäftsidee
X B) ... Geschäftsmodell
C) ... Geschäftskonzept
D) Unternehmungsmodell
A) ... 5
B) ... 7
X C) ... 9
D) ...11
A) ... Schlüsselfaktoren
X B) zentrale Idee
C) ... Massnahmen
D) ... finanziellen Mittel
A) ... CHF 12.–
B) ... CHF 17.–
X C) ... CHF 20.–
D) ... CHF 25.–
5. Der durchschnittliche Stundenlohn, den man als Lehrling im 2. Lehrjahr verdient, liegt etwa bei
X A) ... CHF 6.–
B) ... CHF 12.–
C) ... CHF 20.–
D) ... CHF 34.–
Lückentext zu Business Model Canvas
Das Business Model Canvas ist ein Werkzeug, das Unternehmungen dabei unterstützt, ihr Geschäftsmodell zu analysieren und zu entwickeln. Es besteht aus neun Schlüsselelementen, die zusammen ein umfassendes Bild des Geschäftsmodells zeichnen.
3 Channels
9 Cost Structure
4 Customer Relationships
2 Customer Segments
7 Key Activities
8 Key Partnerships
6 Key Resources
5 Revenue Streams
1 Value Proposition

Ordnen Sie die Nummern im folgenden Lückentext den zutreffenden Begriffen in der obenstehenden Tabelle zu.
________ (1), definiert die Kundennutzen der Unternehmung für ihre Kunden. Hier werden die einzigartigen Merkmale und Vorteile der Produkte oder Dienstleistungen beschrieben.
________ (2), identifiziert die verschiedenen Kundensegmente, die die Unternehmung ansprechen möchte. Dies beinhaltet die Segmentierung des Marktes nach bestimmten Kriterien wie demografischen Merkmalen, Verhaltensweisen oder Bedürfnissen.
________ (3), beschreibt die Kanäle, über die die Unternehmung ihre Produkte oder Dienstleistungen an ihre Kunden liefert. Dies umfasst Vertriebskanäle, Marketingaktivitäten und Kommunikationswege.
________ (4), beschreibt die Beziehungen der Unternehmung zu ihren Kunden. Hier werden verschiedene Arten von Kundenbeziehungen festgelegt, wie persönlicher Kundenservice, Self-Service oder Community-Interaktion.
________ (5), bezieht sich auf die Einnahmequellen der Unternehmung. Es beschreibt, wie die Unternehmung Geld durch den Verkauf ihrer Produkte oder Dienstleistungen generiert und welche Preismodelle dabei angewendet werden.
________ (6), beschreibt die wichtigsten Ressourcen, die die Unternehmung benötigt, um ihr Geschäftsmodell umzusetzen. Dies können physische Ressourcen wie Produktionsanlagen oder immaterielle Ressourcen wie Patente oder Marken sein.
________ (7), beschreibt die wichtigsten Aktivitäten, die die Unternehmung ausführt, um ihren Kundennutzen zu schaffen. Dies umfasst Kernprozesse wie Produktion, Marketing oder Forschung und Entwicklung.
________ (8), beschreibt die wichtigsten Partnerschaften, die die Unternehmung eingeht, um ihr Geschäftsmodell umzusetzen. Dies können Lieferanten, Kooperationspartner oder strategische Allianzen sein.
________ (9), beschreibt die Kostenstruktur der Unternehmung. Hier werden die wichtigsten Kostenarten festgelegt, wie beispielsweise Personal-, Beschaffungs- oder Marketingkosten.
Indem Unternehmungen das Business Model Canvas ausfüllen, erhalten sie eine ganzheitliche Perspektive auf ihr Geschäftsmodell und können mögliche Verbesserungen und Optimierungen identifizieren.
(angepasster Lückentext aus ChatGPT)



Die Geschäftsleitung von «flavourized»: Tim, Marco, Billal, Zarin, Anders, Romeo (Klasse 3n, Kantonsschule Schaffhausen 2017, v.l.n.r.)
Unsere Geschäftsidee:
«… Wir wissen alle, dass man jeden Tag 6 bis 8 Gläser Wasser trinken sollte, um hydriert zu bleiben. Logisch, doch warum tut dies die Mehrheit nicht? Grund ist, dass viele es nicht ausstehen können, Wasser zu trinken, und über den fehlenden Geschmack klagen
Die Lösung: eine hochwertige und intelligente Flasche, gemacht für alle, die in der sich schnell wandelnden heutigen Welt mit möglichst wenig Aufwand stets mit Geschmack überrascht werden möchten.»
Auch diese Geschäftsidee lässt sich in einem Business Model Canvas darstellen.
Beschriften Sie die fehlenden Felder im Business Model Canvas von «flavourized» mit den zutreffenden Titeln und erläutern Sie die einzelnen Felder mit je einer möglichen Erklärung.
Titel/Begriff
Kundennutzen
Kundenbeziehung
Verkaufskanäle
Zielgruppe
Schlüsselaktivitäten
Mögliche Erläuterung für «flavourized»
Hochwertige und intelligente Flasche, bei der mit Beigabe von Früchten normales Wasser einfach aromatisieren kann.
Persönliche Beratung bzw. Erklärung an den Verkaufsorten
Online-Shop, Pausenplatz, Shopping-Center
Schülerinnen und Schüler, Mitglieder Fitnesscenter
Einkauf der Flaschen, Werbung, Versand mit Rechnungen
Schlüsselressourcen Mitarbeitende, Computer
Schlüsselpartnerschaften Fitness-Center
Kostenstruktur
Einnahmequellen
Wenig fixe Kosten, möglichst nur variable Kosten
Kundenzahlungen für verkaufte Flaschen
Sophie und Lukas planen einen Fahrradverleih-Service und erstellen einen Businessplan. Sie orientieren sich dabei an der folgenden Darstellung.
Businessplan
Konzeptteil
(1) Vision und Strategie
- Geschäftsidee
- Kundennutzen
(2) Markt
- Konkurrenzanalyse
- Zielgruppe, Kundensegmente
- Marketing-Mix (4P)
(3) Organisation und Management
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Führungs-, Geschäfts- und Supportprozesse
- Porträt der Geschäftsleitung
(4) Finan zplanung
- Investitionsplanung
- Personalplanung
- Betriebsplanung
- Absatzplanung
Sophie und Lukas haben sich die Stichworte und Fragen rund um die Finanzplanung wie folgt skizziert und einzelne Annahmen bereits getroffen.
Ergänzen Sie in dieser Darstellung der Finanzplanung die grau schattierten Felder mit den zutreffenden Begriffen.
Investitionsplanung
Wir kaufen 20 Fahrräder für je CHF 1’000.–, 2 Fahrradständer für CHF 800.– sowie Werkzeuge für CHF 500.–
- Plan - Erfolgsrechnung (Budget)
- Plan - Bilanz
- Liquiditätsplanung
Ordnen Sie die folgenden Formulierungen den Elementen mit den Nummern (1) bis (4) zu:
A) Sophie und Lukas haben eine klare langfristige Vorstellung, den Fahrradverleih-Service in der gesamten Stadt auszubauen und zur ersten Wahl für Fahrradvermietungen zu werden. (1)
B) Sophie und Lukas haben eine Prognose mit den erwarteten Einnahmen aus Fahrradvermietungen, den Kosten für Fahrradwartung und -reparaturen, den Mietkosten für den Standort und den Marketingausgaben erstellt (4)
C) Sophie und Lukas haben eine umfassende Analyse in ihrer Region erstellt, um die Nachfrage nach Fahrradverleih-Services, Mitbewerber und potenzielle Kundenbedürfnisse zu verstehen. (2)
D) Sophie und Lukas planen, sich auf Online-Werbung und Social-Media-Marketing zu konzentrieren, um ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen und den Bekanntheitsgrad ihres Fahrradverleih-Services zu steigern. (2)
E) Sophie und Lukas haben ein Team von Mitarbeitern eingestellt und eine klare Hierarchie und Aufgabenverteilung innerhalb ihres Unternehmens festgelegt (3)
Personalplanung
Wir stellen zwei Mitarbeitende zu einem monatlichen Gehalt von jeweils CHF 1'500.– an.
Finanzplanung
Liquiditätsplan
Haben wir genügend Geld, um die Rechnungen zu bezahlen?
Plan-Bilanz
Wie finanzieren wir den Grundstock unserer Fahrräder?
Betriebsplanung Budgetierung? Plan-ER
Wir planen mit sechs Arbeitstagen pro Woche mit jeweils acht Arbeitsstunden pro Tag.
Absatzplanung
Mit einem Sortiment von 5 Fahrradtypen planen wir eine wöchentliche Auslastung von 80% der verfügbaren Fahrräder
Wie viele Einnahmen und Ausgaben erwarten wir?
Wie hoch wird unser Gewinn bzw. Verlust?
Während Sophie mit Excel ein Budget entwirft, überlegt sich Lukas, dazu eine Anfrage bei ChatGPT zu machen.

Lukas gibt am Computer die folgende Anfrage ein: «Erstelle zwei unterschiedliche Budgets mit konkreten Zahlen zu unserem geplanten Fahrradverleih-Service mit Annahmen für Investitions-, Personal-, Betriebs- und Absatzplänen. Wie hoch wird der budgetierte Gewinn oder Verlust?» Nach 5 Sekunden kommt die folgende Antwort:
2 Budgets:
Budget 1: Annahmen:
• Investitionsplan: Es werden 10 Fahrräder für den Fahrradverleih-Service benötigt. Der Kaufpreis beträgt jeweils 200 Euro pro Fahrrad.
• Personalplanung: Es wird ein Mitarbeiter eingestellt, der einen Monatslohn von 1.500 Euro erhält.
• Betriebsplanung: Die monatlichen Betriebskosten, einschliesslich Miete, Versicherung, Wartung und Reparaturen, belaufen sich auf 800 Euro.
• Absatzplanung: Es wird erwartet, dass pro Monat durchschnittlich 100 Fahrräder vermietet werden. Der Mietpreis pro Fahrrad beträgt 10 Euro.
Budget 1 - Monatliche Ausgaben:
• Investitionskosten: 10 Fahrräder * 200 Euro = 2.000 Euro
• Personalkosten: 1.500 Euro
• Betriebskosten: 800 Euro Gesamtausgaben: 2.000 Euro + 1.500 Euro + 800 Euro = 4.300 Euro
Budget 1 - Monatliche Einnahmen:
• Umsatzerlöse: 100 Fahrräder * 10 Euro = 1.000 Euro
Budget 1 - Monatlicher Gewinn:
• Gewinn = Einnahmen - Ausgaben
• Gewinn = 1.000 Euro - 4.300 Euro = -3.300 Euro
Budget 2: Annahmen:
• Investitionsplan: Es werden 20 Fahrräder für den Fahrradverleih-Service benötigt. Der Kaufpreis beträgt jeweils 250 Euro pro Fahrrad.
• Personalplanung: Es werden zwei Mitarbeiter eingestellt. Der erste Mitarbeiter erhält einen Monatslohn von 1.500 Euro, der zweite Mitarbeiter erhält einen Monatslohn von 1.200 Euro.
• Betriebsplanung: Die monatlichen Betriebskosten, einschliesslich Miete, Versicherung, Wartung und Reparaturen, belaufen sich auf 1.200 Euro.
• Absatzplanung: Es wird erwartet, dass pro Monat durchschnittlich 150 Fahrräder vermietet werden. Der Mietpreis pro Fahrrad beträgt 12 Euro.
Budget 2 - Monatliche Ausgaben:
• Investitionskosten: 20 Fahrräder * 250 Euro = 5.000 Euro
• Personalkosten: 1.500 Euro + 1.200 Euro = 2.700 Euro
• Betriebskosten: 1.200 Euro Gesamtausgaben: 5.000 Euro + 2.700 Euro + 1.200 Euro = 8.900 Euro
Budget 2 - Monatliche Einnahmen:
a) Umsatzerlöse: 150 Fahrräder * 12 Euro = 1.800 Euro
Budget 2 - Monatlicher Gewinn:
• Gewinn = Einnahmen - Ausgaben
• Gewinn = 1.800 Euro - 8.900 Euro = -7.100 Euro
Bitte beachten Sie, dass diese Budgets vereinfachte Beispiele sind und nicht alle finanziellen Aspekte und Variablen berücksichtigen, die bei einer tatsächlichen Geschäftsplanung auftreten können.
Analysieren Sie die beiden Budgets. Sind die Budgets gut, brauchbar oder unbrauchbar? Begründen Sie Ihre Antwort.
Unbrauchbar, weil
1) Annahmen zu allgemein, vereinfachte Beispiele
2) Investitionskosten für Fahrräder fallen nicht jeden Monat an.
(ChatGPT weist selbst darauf hin, dass Antworten kritisch hinterfragt werden müssen.)
Übung 3.1 Wer ist an finanziellen Informationen interessiert?
a) Lesen Sie den folgenden Text und notieren Sie im nebenstehenden Unternehmungsmodell die angesprochenen Anspruchsgruppen
Finanzielle Informationen dienen als Grundlage für fundierte Entscheidungen und ermöglichen den verschiedenen Anspruchsgruppen, ihre Interessen und Ziele im Zusammenhang mit ABC Manufacturing zu verfolgen. Die transparente Bereitstellung finanzieller Informationen trägt zur Vertrauensbildung bei und fördert eine nachhaltige Geschäftsbeziehung zwischen der Unternehmung und ihren Anspruchsgruppen
Solche Informationen sind auch für verschiedene Anspruchsgruppen von Bedeutung, da sie ihre Entscheidungen und Interessen massgeblich beeinflussen.
Die ___ (1) ___ von ABC Manufacturing sind an den finanziellen Ergebnissen der Unternehmung interessiert, da sie ihr investiertes Kapital vermehren möchten. Sie benötigen Informationen über den Gewinn, die Rendite und die Dividendenpolitik, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen und den Erfolg ihrer Investitionen zu bewerten.
Für ___ (2) ___ ist die finanzielle Situation von ABC Manufacturing von grosser Bedeutung, da sie die Kreditwürdigkeit des Unternehmens bewerten und Kreditentscheidungen treffen müssen. Sie benötigen Informationen über die Liquidität, Verschuldung und das Vermögen der Unternehmung, um das Kreditrisiko angemessen einschätzen zu können.
Die ___ (3) ___ von ABC Manufacturing möchten die finanzielle Stabilität der Unternehmung kennen, um das Risiko von Zahlungsausfällen zu minimieren. Sie benötigen Informationen über die Zahlungsfähigkeit und die finanzielle Verlässlichkeit der Unternehmung, um ihre Geschäftsbeziehungen und Lieferungen entsprechend zu planen.
Die ___ (4) ___ von ABC Manufacturing sind an den finanziellen Informationen der Unternehmung interessiert, um sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse langfristig erfüllt werden können. Sie möchten wissen, ob die Unternehmung finanziell stabil und in der Lage ist, die vereinbarten Produkte oder Dienstleistungen fristgerecht zu liefern bzw. bereitzustellen
Die ___ (5) ___ von ABC Manufacturing sind an finanziellen Informationen interessiert, um die Stabilität ihres Arbeitsplatzes und gesicherte Lohnzahlungen zu beurteilen sowie mögliche Gehaltserhöhungen abzuschätzen. Sie möchten wissen, wie die Unternehmung finanziell abschneidet und welche Auswirkungen dies auf ihre berufliche Zukunft haben kann.
Der ___ (6) ___ benötigt finanzielle Informationen von ABC Manufacturing für steuerliche Zwecke und zur Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften. Er benötigt Informationen über die Gewinne, die Steuerzahlungen und die Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen, um die Compliance der Unternehmung sicherzustellen.
Konkurrenz (3) Lieferanten
Kapitalgeber
Kunden (1) / (2)

Institutionen
NGO (5) Mitarbeitende
b) Welche Anspruchsgruppen einer Unternehmung wurden im Text nicht erwähnt? An welchen finanziellen Informationen könnten diese Anspruchsgruppen interessiert sein?
(7) Institutionen, NGOs
Investitionen in den Umweltschutz?
Unterstützung von gesellschaftlichen Anliegen
Transparenz und Glaubwürdigkeit
(8) Konkurrenz
Kostenstruktur? Investitionen in neue Produkte?
Vergleich mit eigener Positionierung (Benchmark)
Übung 3.2 Aussagen zum Rechnungswesen – alles richtig?
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (R) oder falsch (F)? Setzen Sie den zutreffenden Buchstaben in das Kästchen und korrigieren Sie die Fehler stichwortartig auf den leeren Linien
1) Die systematische Erfassung, Überwachung und Aufbereitung aller finanziell relevanten Vorgänge einer Unternehmung legt die Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen.
2) Die Informationen, die durch die unregelmässige Erfassung, Überwachung und Aufbereitung finanzieller Vorgänge gewonnen werden, dienen den Anspruchsgruppen der Unternehmung.
Fehler: un regelmässige Erfassung
3) Die Jahresrechnung einer Unternehmung zeigt die Erfolgsrechnung, idealerweise mit den Abweichungen zu den Werten des Vorjahres.
... umfasst neben der Erfolgsrechnung auch die Bilanz
4) Der Anhang ist ein wichtiger Bestandteil der Jahresrechnung und enthält zusätzliche Informationen, die für das Verständnis der finanziellen Lage und Leistung des Unternehmens relevant sind. Fehlerhafte Angaben im Anhang können zu Missverständnissen und falschen Interpretationen der Jahresrechnung führen
5) Die Geldflussrechnung ist ein wichtiger Bestandteil der finanziellen Aufbereitung von Geschäftsvorgängen. Sie zeigt, wie Geld in das Unternehmen fliesst und wie es verwendet wird.
6) Die Bilanz- und Erfolgsanalyse ist ein Instrument, das zur Überwachung der Kundenzufriedenheit dient.
bezieht sich auf finanzielle Situation der Unternehmung
7) Die systematische Erfassung, Überwachung und Aufbereitung aller finanziell irrelevanten Vorgänge eines Unternehmens legt die Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen.
Tippfehler: relevante Informationen (nicht irrelevant)
8) Das Budget ist ein Dokument, das die vergangenen finanziellen Ergebnisse eines Unternehmens zusammenfasst.
... dient der Planung, nicht «vergangene Ergebnisse»
9) Die systematische Erfassung finanzieller Vorgänge erfolgt unter anderem durch die Erstellung von Bilanzen und Erfolgsrechnungen. Diese Berichte zeigen das Vermögen, die Schulden und den Erfolg (Gewinn bzw. Verlust) der Unternehmung.
Im folgenden Text finden Sie verschiedene Gründe, weshalb der Staat gesetzliche Vorschriften zum Rechnungswesen erlässt.
a) Lesen Sie den Text durch und markieren Sie die für Sie wichtigsten vier Stichworte.
Deshalb braucht es gesetzliche Vorschriften im Rechnungswesen
Der Staat erlässt gesetzliche Vorschriften zum Rechnungswesen aus verschiedenen Gründen. Ein zentraler Aspekt ist die Gewährleistung von Transparenz und Vertrauen in die Finanzberichterstattung von Unternehmen. Durch klare Regeln und Standards im Rechnungswesen wird sichergestellt, dass Unternehmungen ihre finanziellen Informationen auf eine einheitliche und vergleichbare Weise darstellen. Dadurch können Investoren, Gläubiger und andere Interessengruppen fundierte Entscheidungen treffen.
Darüber hinaus dienen gesetzliche Vorschriften der Verhinderung von Missbrauch, Betrug und Manipulation. Indem bestimmte Rechnungslegungsstandards und Prüfungsvorschriften festgelegt werden, wird versucht, unethisches Verhalten zu reduzieren und die Integrität der finanziellen Berichterstattung zu wahren.
Die Integrität von Finanzinformationen bezieht sich auf deren Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit. Finanzinformationen gelten als integer, wenn sie korrekt und wahrheitsgemäss sind, ohne bewusste Fehlinformationen, Fehler oder Auslassungen. Die Integrität umfasst auch die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards, gesetzlichen Vorschriften und ethischen Grundsätzen. Dies ist besonders wichtig, um das Vertrauen der Investoren und die Stabilität des Finanzsystems zu erhalten.
Eine hohe Integrität von Finanzinformationen ist von entscheidender Bedeutung, da sie das Vertrauen der Investoren, Gläubiger und anderer Interessengruppen in die Unternehmungen und den Finanzmarkt im Allgemeinen stärkt. Zuverlässige und verlässliche Finanzinformationen ermöglichen es den Interessengruppen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken besser einzuschätzen.
Die Integrität von Finanzinformationen wird durch verschiedene Massnahmen gewährleistet, wie beispielsweise die ordnungsgemässe Buchführung und Dokumentation von Geschäftsvorgängen, die Anwendung von Rechnungslegungsstandards und -prinzipien, die Durchführung unabhängiger Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und die Einhaltung von ethischen Grundsätzen.
Wenn die Integrität von Finanzinformationen gefährdet ist, sei es durch Manipulation, betrügerische Aktivitäten oder unsachgemässe Berichterstattung, kann dies zu Verzerrungen, Irreführung und Verlust des Vertrauens führen. Daher ist es von grosser Bedeutung, dass Unternehmen, Rechnungslegungsgremien und Aufsichtsbehörden Massnahmen ergreifen, um die Integrität von Finanzinformationen zu wahren und sicherzustellen, dass sie korrekt, zuverlässig und vollständig sind.
Gesetzliche Vorschriften im Rechnungswesen können auch zur Förderung der Vergleichbarkeit und Konsistenz von Finanzinformationen dienen, sowohl innerhalb eines Landes als auch international. Dies erleichtert den internationalen Handel, Investitionen und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmungen verschiedener Länder.
Ohne gesetzliche Vorschriften wäre das Rechnungswesen anfälliger für Manipulationen und Missbrauch. Es könnte zu einer erhöhten Unsicherheit und Ineffizienz bei der Informationsbeschaffung für externe Interessengruppen führen. Zudem würde die Vergleichbarkeit von Finanzinformationen erheblich eingeschränkt, was die Investitionsentscheidungen erschweren würde.
b) Formulieren Sie aus Ihren markierten vier Stichworten einen einzigen Satz als Zusammenfassung dieses Textes.
Individuelle Antworten, z.B.:
Insgesamt sind gesetzliche Vorschriften im Rechnungswesen notwendig, um die Integrität, Transparenz und Vergleichbarkeit von Finanzinformationen sicherzustellen und das Vertrauen der Investoren und der Öffentlichkeit in die Unternehmungen zu stärken.
Übung 3.4
Art. 957ff.3 OR
Im Obligationenrecht (OR) finden sich in den Artikeln 957 – 964 verschiedene Vorschriften zur Kaufmännischen Buchführung und zur Rechnungslegung.


1. Ist Giulia mit Ihrem Glacé-Mobil gesetzlich verpflichtet, die finanziell relevanten Geschäftsfälle zu erfassen? Was meinen Sie?
Schlagen Sie mit dem obenstehenden QR-Code/Link den Art. 957 OR in der Systematischen Rechtssammlung des Bundes nach.
Wer ist gesetzlich zur Buchführung (Erfassung der finanziell relevanten Geschäftsfälle) verpflichtet?
Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit Umsatzerlös von mind. CHF 500'000.–
Juristische Personen, z.B.
Vereine, AG, GmbH, Genossenschaften, Stiftungen
2. Damit Sie einen Eindruck der gesetzlichen Vorschriften erhalten, können Sie sich mit dem nebenstehenden Link bzw. QR-Code durch die Artikel 957 – 964 durchscrollen.
Die Gliederungsstruktur des Obligationenrechts ist folgendermassen aufgebaut: Abteilungen > Abschnitte > Artikel. Viele Abschnitte enthalten weitere Untergliederungen mit sogenannten Buchstabenklauseln A., B., C. usw.
Notieren Sie jeweils den ersten Gesetzesartikel in der folgenden Übersicht zu den entsprechenden Titelformulierungen
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
A. Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung Art. 957 OR
B. Buchführung Art. 957a OR
C. Rechnungslegung Art. 958 OR
D. Veröffentlichung und Einsichtnahme Art. 958e OR
E. Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher Art. 958f OR
Zweiter Abschnitt: Jahresrechnung und Zwischenabschluss
A. Bilanz Art. 959 OR
B. Erfolgsrechnung; Mindestgliederung Art. 959b OR
C. Anhang Art. 959c OR
D. Bewertung Art. 960 OR
E. Zwischenabschluss Art. 960f OR
3 Jede Rechtsvorschrift ist nummeriert. Diese Nummer bezeichnet man als Artikel; teilweise sind sie auch noch mit Buchstaben ergänzt, weil im Laufe der Zeit auch zusätzliche Artikel in ein Gesetz eingefügt werden. Umfangreiche Gesetze weisen über 1‘000 Artikel auf. Die Abkürzung f. bedeutet «und folgender»; die Abkürzung ff. bezeichnet mehrere weitere Artikel («fortfolgende»).
Brennpunkt Rechnungswesen Kaufleute
Grundlagen des Rechnungswesens (Ausgabe für Lehrperson)
a) Ergänzen Sie die zutreffenden Überschriften in den beiden Kästchen.
Finanzbuchhaltung (Fibu) Betriebsbuchhaltung (Bebu) erfasst Geschäftsvorgänge und zeigt Vermögen, Schulden und Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)
zeigt Kosten und Erträge für einzelne Produkte und Dienstleistungen
In jeder Bilanz findet man die folgenden beiden Positionen:
Aktiven Bilanz 31.12.2023 (Beträge in Kurzform) Passiven
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) 30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) 20
a) Ergänzen Sie das Unternehmungsmodell mit den Begriffen Kunden und Lieferanten.
b) Notieren Sie die Abkürzungen Ford L+L und Verb L+L bei den entsprechenden Pfeilen.
Jahresrechnung mit Bilanz und Erfolgsrechnung
Anhang zur Jahresrechnung
b) Aus welchem Grund findet man viele gesetzliche Vorschriften zur Finanzbuchhaltung, jedoch keine gesetzlichen Vorschriften für die Betriebsbuchhaltung? Formulieren Sie Ihre Antwort in vollständigen Sätzen.
Die Betriebsbuchhaltung ist eher für das Management und die interne Steuerung des Unternehmens relevant und hat keinen direkten externen Berichterstattungszweck. Da sich die Anforderungen und Schwerpunkte von Unternehmung zu Unternehmung unterscheiden können, überlässt es der Gesetzgeber den Unternehmungen, wie sie diese Informationen ermitteln wollen, und stellt zur Betriebsbuchhaltung deshalb keine gesetzlichen Vorschriften auf.

Lieferanten (Kreditoren)


Kunden (Debitoren)
c) Was sind Kreditoren? Was sind Debitoren? Notieren Sie die zutreffenden Begriffe.
Debitoren ... sind Personen oder Unternehmen (Kunden), denen wir Waren oder Dienstleistungen auf Rechnung verkauft haben, ihre Zahlung ist noch offen, sie sind unsere Schuldner, wir können den Rechnungsbetrag von ihnen einfordern, für uns ein Vermögen, steht unter den Aktiven.
Kreditoren ... sind Personen oder Unternehmen (Lieferanten), von denen wir Waren oder Dienstleistungen auf Rechnung gekauft haben, unsere Zahlung ist noch offen, sie haben uns Kredit gegeben, sind unsere Gläubiger (sie haben eine Forderung gegenüber uns), für uns eine Schuld, steht unter den Passiven.
Ordnen Sie die folgenden Positionen richtig zu:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Verb L+L, Kreditoren) X
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Ford L+L, Debitoren) X
Hypothek, in 6 Monaten zurückzahlbar X
Hypothek, in 18 Monaten zurückzahlbar X
Hypothek, in 5 Jahren zurückzahlbar X
Neuer Drucker (Multifunktionsgerät) X
Tonerpatronen X
Kundengeschenke, Zweijahresbedarf, Regenschirme für CHF 800.–X Kundengeschenke, Zweijahresbedarf, Schreibmappen mit exklusivem Kugelschreiber, für CHF 2'500.–X
Mietzinszahlung für den von uns vermieteten Lagerraum X
Jahresgewinn 2022 X
Jahresverlust 2021 (Corona-Krise) X
Übung
Welche der untenstehenden Aussagen sind bezogen auf die folgende Darstellung richtig (R), welche sind falsch (F)?
Aktiven Bilanz 31.12.2023 Passiven Aufwand Erfolgsrechnung 2023 Erträge
Umlaufvermögen
Kurzfristiges Fremdkapital Warenaufwand Warenertrag
Langfristiges Fremdkapital Lohnaufwand
Anlagevermögen Eigenkapital Übriger Aufwand
(inkl. Gewinn) Gewinn
1. Der Gewinn gehört den Eigentümern und zählt damit zum Eigenkapital R
2. Aktiven (Vermögen) = Passiven (Schulden) R
3. Warenaufwand + Lohnaufwand + übriger Aufwand – Warenertrag = Gewinn F
4. Aktiven – Fremdkapital = Eigenkapital (inkl. Gewinn) R
5. Passiven – Eigenkapital (inkl. Gewinn) = Fremdkapital R
6. Erträge – Aufwände = Gewinn R
7. Aktiven – Fremdkapital = Gewinn F
8. Aktiven = Fremdkapital + Eigenkapital (inkl. Gewinn) R
9. Umlaufvermögen = Anlagevermögen F
10. Erträge – Aufwände = Gewinn R
11. Das Total der Aktiven ist immer gleich gross wie das Total der Passiven R
12. Bilanz umfasst immer ein ganzes Jahr F
Übung 5.1 Kontoführung Geschäftskasse
Marco arbeitet in der Buchhaltungsabteilung seines Lehrbetriebs und ist für Verwaltung der Geschäftskasse zuständig. Die Geschäftskasse dient als kleine Bargeldreserve, um kleinere Ausgaben und Transaktionen in der Unternehmung abzuwickeln.
Tragen Sie die folgenden Geschäftsfälle im Kassakonto ein und saldieren Sie das Konto per 31.08.2023.
Datum Vorgang = Geschäftsfall
01.08.2023 Anfangsbestand (CHF 150.70)
03.08.2023 Kauf Briefmarken am Postschalter (CHF 50.–)
04.08.2023 Gipfeli, Müller Beck (CHF 12.50)
16.08.2023 Kaffeekapseln, Rahm, Zucker (CHF 65.75)
21.08.2023 Einlage, Bancomatbezug (CHF 300.–)
22.08.2023 Trinkgeld für Pizzakurier (CHF 5.–)
25.08.2023 Bargeldbezug Peter Müller (CHF 100.–)
29.08.2023 Rückzahlung Peter Müller (CHF 100.–)
(Zwischentotal Sollseite) und (Zwischentotal Habenseite)
Saldo
Übung 5.2 Geschäftskasse – wo steckt der Fehler?
Am 30.09.2023 schliesst Marco das Kassakonto wieder ab.
Bei der Kontrolle des Kassenbestandes (Kassensturz) stellt Marco fest, dass irgendetwas nicht stimmt: Der Kassensturz stimmt überhaupt nicht mit dem Saldo überein.
Was ist falsch gelaufen?
Patisserie Geburtstag, Müller Beck
07.09.2023 Verkauf gebrauchter Drucker
a) Welche Fehler haben Sie gefunden?
01.09.2023 Saldo falsch übertragen (CHF 317.45)
04.09.2023 Patisserie = Ausgabe (im Haben)
26.09.2023 Reinigungsmittel, Raumspray = Ausgabe (im Haben)
b) Wie hoch müsste der richtige Saldo sein? CHF 43.75
Übung 6.1 Skizze zu den Buchungsregeln
Giulia hat eine Skizze zu den Buchungsregeln erstellt. Stimmt alles?
a) Korrigieren Sie allfällige Fehler direkt in den Konten.



b) Welche Buchungsregeln hat Giulia nicht beachtet?
Soll = links / Haben = rechts (gilt für alle Kontenarten)
Aufwand und Ertragskonten haben keine Anfangsbestände
Ertragskonto: Saldo steht im Soll
Übung 6.2 Welche Buchungsregeln gelten für welche Kontenarten?
Ordnen Sie die folgenden Buchungsregeln den zutreffenden Kontenarten zu.
Buchungsregeln Aktiven Passiven Aufwand Ertrag
1. Abnahmen im Soll (links), Zunahmen im Haben (rechts) X X
2. Anfangsbestand (AB) steht im Haben (rechts) X
3. Anfangsbestand (AB) steht im Soll (links) X
4. Blau wie die Wellen (je grösser desto gefährlicher) X
5. Gelb wie das Gold (Gold ist Vermögen) X
6. Grün wie die Pflanzen (wollen wachsen) X
7. Kein Anfangsbestand (Rechnung beginnt bei null) X X
8. Rot wie das Feuer (sollte man im Griff haben) X
9. Saldo (S) steht im Haben (rechts) X
10. Saldo (S) steht im Soll (links) X
11. Saldo (S) zeigt Schlussbestand (SB), steht im Haben (rechts) X
12. Saldo (S) zeigt Schlussbestand (SB), steht im Soll (links) X
13. Zunahmen im Soll (links), Abnahmen im Haben (rechts) X X
Übung 6.3 Geschäftsfälle in Konten eintragen – Auswirkung auf Saldo?
a) In welchen Konten werden die folgenden Geschäftsfälle eingetragen?
b) Wird der Saldo des Kontos dadurch grösser (+), kleiner (–) oder bleibt er unverändert (0)? Nr Geschäftsfall
1 Anfangsbestand Offene Lieferantenrechnungen
2 Anfangsbestand Offene Kundenrechnungen
3 Eingang Lieferantenrechnung von Moretti AG
4 Versand Kundenrechnung an Stillhart GmbH
5 Bankgutschrift von H. Zwicker, Miete Lagerraum
6 Bankbelastung für Lohnzahlungen September
7 Lieferung Moretti hatte Mängel, wir erhalten Rabatt von 10%
8 Versand Kundenrechnung an Fex AG
9 Bankbelastung für Zahlung Lieferantenrechnung Moretti AG
10 Bankgutschrift für Zahlung Kundenrechnung von Fex AG
11 Versand Mahnung an Stillhart GmbH (Rechnung nicht bezahlt)
12 Rückerstattung an Fex AG, zu viel bezahlt bei Kundenrechnung
13 Teilzahlung von Stillhart GmbH, finanzielle Probleme
14 Mitteilung Betreibungsamt: Stillhart AG ist zahlungsunfähig, unsere Forderung ist verloren
15 Schlussbestand / Saldo
16 Wiedereröffnung / Anfangsbestand
Ordnen Sie die folgenden Aussagen den zutreffenden Begriffen zu.
Kontenrahmen Kontenplan Aussage falsch oder unpassend
Ermitteln Sie für die vier folgenden Einzelkonten mithilfe des Kontenrahmens die Nummern und Bezeichnungen der verschiedenen Ebenen.
a) Nr. Ebene Bezeichnung
1 ist nach den individuellen Bedürfnissen einer Unternehmung aufgebaut.
2 ... wird nur in grossen Unternehmen mit komplexen Buchführungssystemen verwendet. X
3 ermöglicht der Unternehmung die bessere Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen der gleichen Branche. X
4 ist ein einheitliches Verzeichnis sämtlicher Buchführungskonten für eine Branche. X
5 kann individuell an die Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden.
6 wird oft branchenspezifisch entwickelt, um den speziellen Anforderungen einer Branche gerecht zu werden.
7 erfasst alle buchhalterisch relevanten Konten für eine bestimmte Unternehmung.
8 legen die Gruppierung und Systematik der Konten fest, um die Vergleichbarkeit der Jahresrechnungen zu erleichtern.
9 kann im Laufe der Zeit geändert werden, indem Konten hinzugefügt, angepasst oder entfernt werden.
10 kann individuell von einer Unternehmung entwickelt werden, ohne Rücksicht auf allgemeine Standards oder Richtlinien.
11 ...ist nur für interne Verwendung gedacht, wird nicht für Aussenstehende veröffentlicht.
1 Kontenklasse Aktiven
10 Hauptgruppe Umlaufvermögen
100 Kontengruppe Flüssige Mittel und Wertschriften
1020 Einzelkonto Bank
b) Nr.
Ebene Bezeichnung
1 Kontenklasse Aktiven
14 Hauptgruppe Anlagevermögen
150 Kontengruppe Mobile Sachanlagen
1530 Einzelkonto Fahrzeuge
c) Nr.
Ebene Bezeichnung
2 Kontenklasse Passiven
20 Hauptgruppe Kurzfristiges Fremdkapital
210 Kontengruppe Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
2140 Einzelkonto Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
d) Nr.
Ebene Bezeichnung
2 Kontenklasse Passiven
28 Hauptgruppe Eigenkapital
290 Kontengruppe Reserven und Jahresgewinn / Jahresverlust
2979 Einzelkonto Jahresgewinn / Jahresverlust
Übung 7.3 In welche Konten gehören die Geschäftsfälle?
Damit die Vergleiche aussagekräftig sind, müssen Geschäftsfälle in die gleichen Konten verbucht werden.
a) Verwenden Sie konsequent die gleichen Abkürzungen. Notieren Sie Ihre Abkürzungen in die grau schattierten Felder
Kontenklasse 4 Aufwand für Material, Handelswaren und Dienstleistungen
4000 Materialaufwand (Produktion) Mat-Aufw
4200 Warenaufwand (Handelswarenaufwand) Wa-Aufw
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen Aufw bez DL
4500 Energieaufwand zur Leistungserstellung (Produktion) Energ-Aufw Prod
Erläuterung / Beispiele
Einkauf von Gütern, die ein Produktionsbetrieb zur Herstellung seiner Produkte benötigt, z.B. Rohstoffe bei Pharmaunternehmen, Stahlbänder bei Messerproduzenten.
Einkauf von Gütern, die wir lagern, sortieren, verpacken und mit Beratung möglichst rasch, spätestens innerhalb eines Jahres, unverarbeitet weiterverkaufen.
Einkauf von Leistungen anderer Unternehmungen (Drittleistungen), z.B. eine Speditionsfirma lässt aus Kapazitätsgründen einzelne Fahrten ins Ausland durch eine andere Unternehmung ausführen.
Einkauf von Energie (Heizöl, Diesel, Benzin, Holzpellets, Strom, Wärme, Wasser, Wasserstoff) von Unternehmungen, die sehr viel Energie für die Erstellung ihrer Leistungen benötigen, z.B. Taxiunternehmen. Kontenklasse 5 Personalaufwand Erläuterung / Beispiele
5000 Lohnaufwand Lohn-Aufw Ausgaben für geleistete Arbeitsstunden unserer Mitarbeitenden.
5800 Übriger Personalaufwand Übr Pers-Aufw
Stelleninserate, Weiterbildung, Fitnessraum, Personalanlässe, Geschenke, Ausgaben für Sozialplan
Kontenklasse 6 Übriger Betriebsaufwand, Abschreibungen und Finanzergebnis Erläuterung / Beispiele
6000 Raumaufwand (Mietaufwand)
Raum-Aufw
6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz URE
6200 Fahrzeugaufwand Fz-Aufw
6300 Versicherungsaufwand, inkl. Gebühren, Bewilligungen Vers-Aufw
6400 Energieaufwand, inkl. Entsorgungsaufwand Energ-Aufw
6500 Verwaltungsaufwand Vw-Aufw
6570 Informatikaufwand Inf-Aufw
6600 Werbeaufwand Werbe-Aufw
6700 Sonstiger Betriebsaufwand Sonst BA
6800 Abschreibungen Abschr
6900 Finanzaufwand, inkl. Zins- und Wertschriftenaufwand Fi-Aufw
6950 (–) Finanzertrag, inkl. Zins- und Wertschriftenertrag Fi-Ertrag
Ausgaben für gemietete Räumlichkeiten und Unterhaltsleistungen, wie z.B. Miete, Reinigung, Unterhalt an Vermieterinnen, Reinigungsunternehmen, Liegenschaftsverwaltungen für Facility Management.
Ausgaben für den Unterhalt (z.B. Serviceleistungen), die Reparatur (z.B. Instandstellungsarbeiten) und Ersatz (z.B. Kauf einer neuen Maschine, welche für die alte defekte Maschine eingesetzt wird)
Ausgaben im Zusammenhang mit Geschäftsfahrzeugen, wie z.B. Treibstoff, Service, Reparaturen, Motorfahrzeugversicherungen, Leasingraten
Ausgaben für Betriebshaftpflichtversicherung, Sachversicherungen für Gebäude und alles, was im Gebäude ist, Betriebsunterbrechungsversicherung, Maschinen und EDV-Versicherung
Ausgaben für Strom, Gas, Heizung und Wasser für die Unternehmung allgemein (Energie für direkte Leistungserstellung Konto 4500), Abfall- und Entsorgungsgebühren.
Ausgaben für Büromaterial (z.B. Papier, Schreibmaterial, Flipcharts, Druckerpatronen), Kommunikation (Telefon, Radio- und Fernsehabgabe), Portokosten (z.B. Briefmarken für Postversand), Buchführung (Buchhaltungsprogramm), Beratung, Spenden.
Ausgaben für Unterhalt und Reparaturen für Informatikmittel, Lizenzen und Wartung, Beratung und Entwicklung, Schulung, Internetgebühren.
Ausgaben für Inseratekampagnen, Sponsoring, Werbedrucksachen, Flyer, Schaufenster, Dekoration, Mustergeschenke, Kundengeschenke, Reisepesen, Kundenessen.
Ausgaben, für die kein eigenes Konto vorgesehen ist, z.B. Forschung & Entwicklung, Betreibungskosten, Betriebssicherheit, Bewachung von Betriebsanlagen.
Wertverminderungen des Anlagevermögens durch Alterung und Gebrauch, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Informatikanlagen können nach 5 Jahren auf einen Wert von 0 CHF abgeschrieben werden.
Ausgaben für Darlehenszinsen, Bankzinsen, Bankspesen, Verzugszinsen für Bankspesen bzw. Gebühren für PostFinance-Dienstleistungen.
Einnahmen aus Zinsen auf gewährten Darlehen, Bankzinsguthaben. Das Konto Finanzertrag steht in der Kontenklasse 6, damit sich der Finanzerfolg (Finanzertrag minus Finanzaufwand) einfach ermitteln lässt.
b) Nennen Sie für die folgenden Geschäftsfälle die Konto-Nr. und das entsprechende Aufwandkonto. Geschäftsfall
1 Telefonrechnung 6500 Vw-Aufw
2 Zinsbelastung der Bank für ein Darlehen 6900 Fi-Aufw
3 Mietzins für Verkaufsgeschäft in der Innenstadt 6000 Raum-Aufw
4 Rechnung Clean Service für die Reinigung unseres Verkaufsgeschäftes 6000 Raum-Aufw
5 Kauf von Briefmarken (Porto = Kosten für Postsendungen) 6500 Vw-Aufw
6 Inserat für die Einführung unserer neuen Produktelinie 6600 Werbe-Aufw
7 Matchballsponsoring beim FC Schaffhausen 6600 Werbe-Aufw
8 Lohnzahlung für Ferienaushilfen 5000 Lohn-Aufw
9 Tonerpatronen für Laserdrucker 6500 Vw-Aufw
10 Unsere Lieferwagen sind wieder ein Jahr älter geworden. Wir berücksichtigen 20% des Kaufpreises als Wertverminderung. 6800 Abschr
12 Rechnung Stadtwerke für Strom und Wasser 6400 Energ-Aufw
13 Jahresrechnung Internet 6570 Inf-Aufw
14 Jahresabonnement Schaffhauser Nachrichten 6500 Vw-Aufw
15 Monatsrechnung für Strom, Benzin und Diesel für unsere Lieferwagen 6200 Energ-Aufw Prod
16 Einkauf von Bilderrahmen für unsere Verkaufsstelle in der Innenstadt. 4200 Wa-Aufw
17 Einkauf von Farben für unser Spritzwerk 4000 Prod-Aufw
18 Jahresprämien für Motorfahrzeugversicherung 6200 Fz-Aufw
19 Reparatur unserer Waschmaschine 6100 URE
20 Jahresprämie für die betriebliche Haftpflichtversicherung 6300 Vers-Aufw
21 Ein Auftrag wurde infolge eines Personalengpasses durch Mitarbeitende eines Temporärbüros ausgeführt. Wir überweisen den vereinbarten Pauschalbetrag an das Temporärbüro. 4400 Aufw bez DL
Übung 7.4 Kontenklassen
Mithilfe der Kontenklassen lassen sich einfach Zwischenresultate berechnen. Beschriften Sie dazu die weissen Felder.
Kontenklasse 3 – Kontenklasse 4
Betriebsertrag
Aufwand für Material, aus Lieferungen
Handelswaren und und Leistungen
Dienstleistungen
Bruttogewinn
– Kontenklasse 5
Personalaufwand
– Kontenklasse 6
Übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen
Finanzergebnis +/–
Betriebsgewinn +/–
Kontenklasse 7
Betriebliche Nebenerfolge
Kontenklasse 8
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg, Steuern
Jahresgewinn/-verlust
Lesen Sie den folgenden Text und beschriften Sie anschliessend die grau schattierten Kästchen in der untenstehenden Grafik.
Jede Unternehmung benötigt Geld, um wirtschaften zu können. Die Beschaffung finanzieller Mittel bezeichnen wir als Finanzierung; die so zugeflossenen Mittel als Kapital. Durch jede Finanzierung steigt unsere Bilanzsumme.
Das erste Ergebnis der Finanzierungsvorgänge zeigt sich auf der Passivseite der Bilanz: Die verschiedenen Passivkonten zeigen, woher das Kapital stammt, z.B. von Banken oder von den Eigentümern selbst.
In einem zweiten Schritt wird das bereitgestellte Kapital in betrieblich notwendiges Vermögen investiert. Dies kann der Kauf von Sachgütern (z.B. IT-Infrastruktur, Maschinen, Gebäude) oder immateriellen Gütern (z.B. Lizenzen) sein. Die Aktivkonten zeigen somit, wie die Mittel verwendet worden sind.
Wenn wir eine Maschine verkaufen und uns der Käufer den Verkaufspreis auf unser Bankkonto überweist, bleibt die Bilanzsumme gleich, die Maschinen wurden in ein Bankguthaben getauscht.
Wenn wir schliesslich Vermögenswerte wieder an die Fremdkapitalgeber oder die Eigentümer zurückzahlen, findet eine Definanzierung statt.
Vermögen Kapital
Aktiven Bilanz 31.12.2023 Passiven
Mittel – verwendung Mittel – herkunft
Umlaufvermögen

Investierung


Kurzfristiges
Fremdkapital
Langfristiges
Fremdkapital


Finanzierung
Übung 8.2 Begriffe verstanden?
Kreuzen Sie die zutreffenden Antwortmöglichkeiten an.
1. Welche Art von Konten zeigt, woher das Kapital stammt (Mittelherkunft)?
a) Aktivkonten
b) X Passivkonten
c) Aufwandkonten
d) Ertragskonten
2. Was bezeichnet man als Definanzierung?
a) Beschaffung finanzieller Mittel
b) Verwendung der finanziellen Mittel
c) X Rückzahlung von Vermögenswerten an Fremdkapitalgeber / Eigentümer.
d) Verkauf von Sachgütern
3. Welche Aktivität fällt unter den Begriff Finanzierung?
a) Kauf von neuen Maschinen
b) X Aufnahme eines Bankkredites
c) Verkauf von finanziellen Dienstleistungen
d) Verwaltung der finanziellen Mittel
4. Was ist das Hauptziel einer Desinvestition?
a) Erhöhung der Bilanzsumme
b) X Reduzierung von Vermögenswerten
c) Sicherstellung einer langfristigen Finanzierung
d) Erhöhung des Anlagevermögens
5. Was ist ein Beispiel eines Aktivtauschs?
Anlagevermögen
Total Aktiven = Bilanzsumme
Eigenkapital
Total Passiven = Bilanzsumme

Aktivtausch Desinvestierung Passivtausch Definanzierung
a) X Verkauf einer Maschine
b) X Zahlung einer Kundenrechnung (Ford L+L)
c) Zahlung einer Lieferantenrechnung (Verb L+L)
d) Kauf einer Maschine auf Rechnung
Übung 8.3 Achtung fertig, los: 1 – 2 – 3 ... Buchungssätze für Taxi24

Kontenplan Taxi24
1000 Kasse 2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4500 Benzinaufwand 3410 Transportertrag 1020 Bank 5000 Lohnaufwand 3600 Übriger Ertrag
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2450 Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 6000 Raumaufwand 6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
1510 Mobiliar und Einrichtungen 2800 Eigenkapital 6500 Verwaltungsaufwand
1520 Büromaschinen (inkl. Informatik) 6570 Informatikaufwand 6600 Werbeaufwand
1530 Fahrzeuge 6900 Finanzaufwand
Taxi24 ist ein Taxiunternehmen mit drei Mitarbeitern, das in einer kleinen Stadt tätig ist.
Formulieren Sie für die folgenden Geschäftsfälle von Taxi24 die Buchungssätze.
Gehen Sie dabei nach den folgenden 3 Schritten vor und verwenden Sie den obenstehenden Kontenplan.
1. Schritt: Welche zwei Konten?
Bestimmen Sie, welche zwei Konten durch den Geschäftsfall betroffen sind, und tragen Sie die Kurzbezeichnungen der Konten oberhalb des Kontenkreuzes ein
2. Schritt: Auf welcher Seite wird die Veränderung eingetragen – Zu- oder Abnahme im Soll oder im Haben?
Bestimmen Sie anschliessend für jedes Konto einzeln, ob das Konto zunimmt oder abnimmt. Tragen Sie dazu in den vier Kontoarten (+) und (–) ein.
3. Schritt: Ableitung Buchungssatz: Soll / Haben (Soll an Haben)
Formulieren Sie schliesslich den Buchungssatz, indem Sie zuerst das Konto nennen, in welchem der Betrag auf der Sollseite eingetragen wird.
Geschäftsfall
1 Versand der Monatsrechnungen an Stammkunden.
2 Bareinnahmen werden jeden Abend in den Nachttresor der Bank eingeworfen. Verbuchung der Bankgutschrift.
3 Lohnzahlungen an die Mitarbeiter über das Bankkonto.
4 Aufnahme Bankkredit für den Kauf eines neuen Taxis. Kreditbetrag wird auf dem Bankkonto gutgeschrieben.
5 Rechnung der Garage für den Kauf des neuen Taxis.
6 Monatsrechnung Benzin
7 Zahlung der Rechnung (Nr. 5) für den Kauf des neuen Taxis
8 Bankgutschrift für Zahlungseingang Rechnungen (Nr. 1) unserer Stammkunden
9 Rechnung swizzonic für Internet-Abo
10 Büromaterial (Couverts, Schreibmaterial), Barzahlung in Papeterie
11 Rechnung Inseratekampagne für Sommeraktion von schmizz communicate
12 Rechnung für Werbebanner auf Taxi an Firma Hübscher, Holzbau
13 Erhöhung Kapitaleinlage durch Banküberweisung vom privaten Sparkonto
14 Bankbelastung Darlehenszins
Übung 8.4 Achtung fertig, los: 1 – 2 – 3 ... Buchungssätze für Spielwarengeschäft toy-toy

Kontenplan Spielwaren
1000 Kasse 2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4200 Warenertrag 3200 Warenertrag 1020 Bank 5000 Lohnaufwand 3600 Übriger Ertrag
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2450 Langfristige Darlehensverbindlichkeiten
6000 Raumaufwand 6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 1510 Mobiliar und Einrichtungen 2800 Eigenkapital 6200 Fahrzeugaufwand
1520 Büromaschinen (inkl. Informatik)
6500 Verwaltungsaufwand 6570 Informatikaufwand 1530 Fahrzeuge 6600 Werbeaufwand 6800 Abschreibungen 6900 Finanzaufwand
toy-toy ist ein kleines Spielwarengeschäft, welches sich auf originelle Geschenkartikel spezialisiert hat.
Formulieren Sie für die folgenden Geschäftsfälle von toy-toy die Buchungssätze.
Gehen Sie dabei nach den folgenden 3 Schritten vor und verwenden Sie den obenstehenden Kontenplan.
1. Schritt: Welche zwei Konten?
Bestimmen Sie, welche zwei Konten durch den Geschäftsfall betroffen sind, und tragen Sie die Kurzbezeichnungen der Konten oberhalb des Kontenkreuzes ein.
2. Schritt: Auf welcher Seite wird die Veränderung eingetragen – Zu- oder Abnahme im Soll oder im Haben?
Bestimmen Sie anschliessend für jedes Konto einzeln, ob das Konto zunimmt oder abnimmt. Tragen Sie dazu in den vier Kontoarten (+) und (–) ein.
3. Schritt: Ableitung Buchungssatz: Soll / Haben (Soll an Haben)
Formulieren Sie schliesslich den Buchungssatz, indem Sie zuerst das Konto nennen, in welchem der Betrag auf der Sollseite eingetragen wird.
Nr. Geschäftsfall
1 Wareneinkauf gegen Rechnung (Lieferant gibt uns Kredit, Lieferant ist unser «Kreditor»).
2 Rücksendung von defekten Waren.
3 Kauf Weihnachtsbeleuchtung für CHF 750.–, geschätzte Nutzungsdauer 4 Jahre.
4 Lieferung Weihnachtsgeschenke an Firma Huggler (Kunde ist uns Geld schuldig, Kunde ist unser Debitor).
5 Wir gewähren Firma Huggler nachträglich 10% Rabatt.
6 Weihnachtsmarkt Tageseinnahmen Barverkäufe.
7 Bankbelastung: Zahlungsausgang für Lieferantenrechnung.
8 Kunde bringt defektes Spielzeug in Laden zurück. Wir geben Kaufpreis in bar zurück.
9 Bankgutschrift: Zahlungseingang für Kundenrechnung.
10 Lieferant schickt uns eine Zahlungserinnerung.
11 Autounfall mit Lieferwagen. Rechnung Garage für Reparatur.
12 Lieferwagen hat durch Unfall an Wert verloren. Wir berücksichtigen Wertverlust durch Abschreibungen.
13 Darlehensgeber beteiligt sich an toy-toy. Verwendet sein bisheriges Darlehen an uns als Kapitaleinlage.
Wird die Bilanzsumme durch die untenstehenden Geschäftsfälle grösser, kleiner oder bleibt sie gleich hoch?
Notieren Sie für die folgenden Geschäftsfälle die Buchungssätze und bestimmen Sie anschliessend die Auswirkungen auf Erfolg und Liquidität, indem Sie die zutreffende Antwortmöglichkeit auswählen.
Nr. Geschäftsfall
1 Eine Kunde bezahlt seine offene Rechnung durch eine Banküberweisung. Die Rechnung haben wir bereits verbucht.
Buchungssatz: Ba / Ford L+L
2 Wir bezahlen eine offene Rechnung an unseren Lieferanten durch eine Banküberweisung. Die Rechnung wurde bereits verbucht
Bilanzsumme ... ... wird grösser ... wird kleiner ... bleibt gleich
Buchungssatz: Verb L+L / Ba X
3 Wir bezahlen die Monatslöhne unserer Mitarbeitenden
Buchungssatz: Lohn-Aufw / Bank
4 Wir kaufen einen neuen Lieferwagen und bezahlen den Kaufpreis bei der Abholung mit einer Banküberweisung.
Buchungssatz: Fahrzeuge / Bank
5 Wir liefern Waren gegen Rechnung an einen Kunden
Buchungssatz: Ford L+L / Wa-Ertrag
6 Wir kaufen Waren gegen Rechnung von unserem Lieferanten ein
Buchungssatz: Wa-Aufw / Verb L+L
Auswirkungen auf ... ... Liquidität ... Erfolg
Liquiditätswirksam
Liquiditätsunwirksam Erfolgswirksam Erfolgsunwirksam
Nr.
Geschäftsfall
1 Der Zins für das Bankdarlehen wird unserem Bankkonto belastet. X X
Fi-Aufw / Ba
2 Wir schreiben 40% der Informatikanlagen ab. X X Abschr / Büromasch, Inf
3 Unsere Kunden bezahlen offene Rechnungen. X X
Ba / Ford L+L
4 Lieferant beteiligt sich bei uns als Eigentümer. Als Kapitaleinlage bringt er seine offenen Lieferantenrechnungen ein.
Verb L+L / EK
5 Wir bezahlen die (bereits verbuchten) Rechnungen mit Banküberweisung. X X
Verb L+L / Ba
Übung 8.7 Buchhaltungs-Memory 1 – Welche Kontenskizzen passen zu den Geschäftsfällen?
Es geht auch analog: Ergänzen Sie die Memory-Karten mit den zutreffenden Kontenskizzen.
Sie können dann die Seite (doppelseitig) kopieren, die Karten ausschneiden, sortiert aufdecken und sich die Bildpaare einprägen (memorisieren).
Anschliessend Karten umdrehen und mischen, allein oder zu zweit eine Runde Buchhaltungs-Memory spielen.
Gutschrift, Rücksendung von Kunden
Gutschrift, Rücksendung an Lieferanten

w Rückseite Buchhaltungs-Memory 1
Übung 8.8 Buchhaltungs-Memory 2 – Welche Geschäftsfälle passen zu den Kontenskizzen?
Es geht auch analog: Ergänzen Sie die Memory-Karten mit den zutreffenden Kontenbezeichnungen und Geschäftsfällen.
Sie können dann die Seite (doppelseitig) kopieren, die Karten ausschneiden, sortiert aufdecken und sich die Bildpaare einprägen (memorisieren).
Anschliessend Karten umdrehen und mischen, allein oder zu zweit eine Runde Buchhaltungs-Memory spielen. 5000 1020

Bankbelastung, Zahlungsausgang Lohnabrechnung
2000

Rechnung, Unterhaltsreinigung
2000

Rechnung, Benzinbezüge
2000

Rechnung, Strom & Wasser
2000

Gutschrift, Anpassung Prämienrechnung

Büromaterial, Bareinkauf

w Rückseite Buchhaltungs-Memory 2
Das Geschäftsmodell der Treuhandunternehmung
Trauffer Treuhand basiert auf professioneller Buchhaltung, umfassender Finanz- und Steuerberatung sowie persönlicher Betreuung unserer Kunden. «Durch die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen streben wir danach, langfristige Partnerschaften mit kleinen und mittelständischen Unternehmen aufzubauen und ihnen dabei zu helfen, ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten.»
Canvas-Schlüssselfaktoren

1. Kundensegmente: Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen
2. Kundennutzen: Umfassende Buchhaltungs- und Finanzdienstleistungen, Führung der Buchhaltung, Finanzberatung und Steuerberatung
3. Vertriebskanäle: Informative und benutzerfreundliche Website, Direktvertrieb, Empfehlungen von bestehenden Kunden und Partnern
4. Kundenbeziehungen: Persönliche Beratung und Betreuung, regelmässiger Kontakt und individuelle Beratungsgespräche
5. Einnahmequellen: Gebühren für Buchhaltungsdienstleistungen, Beratungsgebühren, Honorare für Steuerberatung
6. Schlüsselressourcen: Fachwissen und Expertise in Buchhaltung und Finanzberatung, Kompetenz und Erfahrung der Mitarbeitenden
7. Schlüsselaktivitäten: Buchhaltungsführung, Finanzberatung, Steuerberatung
8. Schlüsselpartnerschaften: Kooperationen mit anderen Treuhandunternehmen, Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Anwälten
9. Kostenstruktur: Personalkosten, Bürokosten, Fortbildungskosten, IT-Infrastruktur.
Verbuchen Sie die folgenden Geschäftsfälle.
Geschäftsfall Soll / Haben (ohne Beträge)
1 TechServe; Rechnung neue Computer und Drucker (CHF 8'000.–) Büro-Masch / Verb L+L
2 Einkauf Papeterie; Toner, Couvert, Schreibmaterial, bar bezahlt (CHF 370.–) Vw-Aufw / Ka
3 Versand Rechnung an Kunde P. Vogelmann für Prozessmandat (CHF 20'000.–) Ford L+L / Hon-Ertr
Kontenplan Trauffer Treuhand
1000 Ka 2000 Verb L+L 4400 Aufw bez DL 3420 Hon-Ertr 1020 Ba 2451 Hyp 5000 Lohn-Aufw 3600 Übr Ertr
1100 Ford L+L 2800 EK 5800 Übr Pers-Aufw
1400 Ws 6000 Raum-Aufw 1510 Mob 6100 URE 1520 Büro-Masch 6200 Fz-Aufw 1530 Fz 6300 Vers-Aufw 1600 Immob 6400 Energ-Aufw 6500 Vw-Aufw 6600 Werbe-Aufw 6700 Sonst. Betr-Aufw 6800 Abschr 6900 Fi-Aufw 6950 Fi-Ertr
Geschäftsfall Soll / Haben
4 Kantonalbank; Hypothekarkredit für Kauf neues Bürogebäude (CHF 2'400'000.–) Immob / Hyp
5 Bankgutschrift, Verkauf von Wertschriften (CHF 800'000.–) Ba / Ws
6 Bankbelastung, Überweisung Rest-Kaufpreis neues Bürogebäude (CHF 1'600'000.-) Immob / Ba
7 Bankbelastung; Zahlungsauftrag Löhne Oktober (CHF 85'000.–) Lohn-Aufw / Ba
8 InnoTax (Partner-Kanzlei), Rechnung für Übernahme eines Mandats (CHF 50'000.–) Aufw bez DL / Verb L+L
9 Kantonalbank, Rückzahlung (Amortisation) Hypothek (CHF 200'000.–) Hyp / Ba
10 Kantonalbank, Hypothekarzins 30.06. –30.09. (CHF 24'000.–) Fi-Aufw / Ba
11 Versand Rechnungen an Kunden; diverse Beratungsmandate (80'000.–) Ford L+L / Hon-Ertr
12 Centerboard, Rechnung für neue Website (CHF 12'000.-) Vw-Aufw / Verb L+L
Das Geschäftsmodell der Fahrschule Neurauter basiert auf qualitativ hochwertiger Fahrausbildung, individueller Betreuung der Fahrschüler und gezielter Prüfungsvorbereitung.
Durch die Bereitstellung eines umfassenden Angebots und durch exzellenten Kundenservice streben wir danach, die führende Fahrschule in Zürich zu sein und unsere Kunden erfolgreich auf ihre Fahreignungsprüfungen vorzubereiten.

1. Kundensegmente: Fahrschüler in Zürich und Umgebung, Jugendliche, junge Erwachsene, Fahrer, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten.
2. Kundennutzen: Umfassende theoretische Ausbildung, individuelle Fahrstunden, Prüfungsvorbereitung, Zusatzangebote (Nothelferkurse, Verkehrskundeunterricht, Weiterbildung).
3. Vertriebskanäle: Website, Social Media, lokale Werbung, Empfehlungen.
4. Kundenbeziehungen: Kundenservice, individuelle Betreuung, positive Erfahrungen, Empfehlungen.
5. Einnahmequellen: Fahrausbildungspakete, Zusatzkurse, Weiterbildung für erfahrene Fahrer.
6. Schlüsselressourcen: Erfahrene Fahrlehrer, moderne Fahrzeuge, Unterrichtsmaterialien, Schulungsräume.
7. Schlüsselaktivitäten: Theoretische Ausbildung, praktische Fahrstunden, Prüfungsvorbereitung, Durchführung von Zusatzkursen.
8. Schlüsselpartnerschaften: Kooperationen mit anderen Fahrschulen, Versicherungsunternehmen, Verkehrsbehörden.
9. Kostenstruktur: Personalkosten, Fahrzeugkosten, Mietkosten für Schulungsräume, Marketingausgaben.
Kontenplan Fahrschule Neurauter
1000 Ka 2000 Verb L+L 4500 Treibstoff-Aufw 3400 Ertr VKU
1020 Ba 2450 Darl 5000 Lohn-Aufw 3410 Ertr Fahrschule
1100 Ford L+L 2800 EK 5800 Übr Pers-Aufw 3420 Ertr Zusatz-Ang
1510 Mob 6000 Raum-Aufw
1520 Büro-Masch
1530 Fz
6100 URE
6200 Fz-Aufw
6300 Vers-Aufw
6400 Energ-Aufw
6500 Vw-Aufw
6600 Werbe-Aufw
6700 Sonst. Betr-Aufw
6800 Abschr
6900 Fi-Aufw
6950 Fi-Ertr
Zusatzfrage: Welches ist die beste Fahrschule in Ihrer Region?


Recherchieren Sie die Angebote auf fahrlehrervergleich.ch. Stellen Sie in einer kurzen Präsentation Ihre drei besten Fahrschulen vor. Aufgrund welcher Kriterien schafften es Ihre Fahrschulen in die Top 3?
Verbuchen Sie die folgenden Geschäftsfälle.
Geschäftsfall Soll / Haben (ohne Beträge)
1 Avia, Rechnung für Treibstoffbezüge Oktober (CHF 4'500.–) Fz-Aufw / Verb L+L
2 Bang&Olufsen, Rechnung neues Lautsprechersystem im Theoriesaal (CHF 3'500.–) Mob / Verb L+L
3 Zubatech, Rechnung Modellautos und -figuren für Verkehrskundeunterricht (CHF 450.–) Vw-Aufw / Verb L+L
4 Versand Rechnung an M. Amsler, 10er-Abo Fahrstunden (CHF 1'050 –) Ford L+L / Ertr Fahrschule
5 Versand Rechnungen für Lektionen VKU Verkehrskundeunterricht (CHF 1'470 –) Ford L+L / Ertr VKU
6 Bankbelastung, Überweisung Mietzins für Schulungsraum (CHF 1'500.–) Raum-Auf / Ba
7 Bankgutschrift, Erhöhung Eigenkapital Neurauter (CHF 50'000.–) Ba / EK
8 Werbeagentur, Rechnung für Imagekampagne Wasserstoff-Taxi (CHF 5'000.–) Werbe-Aufw / Verb L+L
9 Bankbelastung, Zahlungsauftrag Mietzins für Theoriesaal (CHF 3'100.–) Raum-Aufw / Ba
10 Bankbelastung, Überweisung für Kauf Toyota Mirai II (CHF 70'000.–) Fz / Ba
11 Bankbelastung, Zahlungsauftrag für Lieferantenrechnungen, Nr. 1-3 (CHF 8'450.–) Fz / Ba
12 Versand Mahnungen, überfällige noch nicht bezahlte Rechnungen (CHF 2'450.–) Keine Buchung
13 Bankbelastung, Zahlungsauftrag für Löhne der Mitarbeiter (CHF 24'000.–) Lohn-Aufw / Ba
14 TCS, Rechnung für Weiterbildung «Schleuderkurs für Fortgeschrittene» (CHF 2'500.–) Übr Pers-Aufw / Verb L+L
Platz für Notizen:
Nicole ist eine erfahrene Malerin mit jahrelanger Berufserfahrung in einem renommierten Malerbetrieb. Sie hat beschlossen, sich selbstständig zu machen und ihr eigenes Malergeschäft zu gründen. Nicole verfügt über umfangreiches Fachwissen und handwerkliches Geschick, das sie nun nutzen möchte, um ihren eigenen Kundenstamm aufzubauen und ihre Leidenschaft für Farben und Malerarbeiten in die Tat umzusetzen.

Nachdem Nicole ihr Geschäftskonzept ausgearbeitet und einen Businessplan erstellt hat, beginnt sie mit den ersten Schritten, um ihr Malergeschäft aufzubauen. Sie registriert das Unternehmen, sucht nach einem geeigneten Standort für ihr Büro und Lager und richtet dort ihre Arbeitsmaterialien ein. Nicole entscheidet sich für einen Standort in der Nähe einer Wohngegend mit vielen Privatkunden und Unternehmen, die möglicherweise Malerarbeiten benötigen.
Um ihr Geschäft bekannt zu machen, erstellt Nicole professionelle Marketingmaterialien wie Visitenkarten, Flyer und eine Webseite. Sie nutzt ihre Kontakte aus der Branche und informiert Freunde, Familie und Bekannte über ihre Selbstständigkeit. Zusätzlich nutzt sie lokale Werbung in Zeitungen und Online-Plattformen, um potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen.
Nicole bietet ihren Kunden eine breite Palette von Maler- und Renovierungsdienstleistungen an. Sie besichtigt die Räumlichkeiten persönlich, um ein genaues Angebot zu erstellen und die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu verstehen. Dabei berät sie ihre Kunden hinsichtlich Farbauswahl, Materialien und gibt ihnen Empfehlungen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Parallel dazu eröffnet Nicole einen kleinen Einzelhandelsbereich in ihrem Büro, in dem sie Farben, Lacke, Pinsel und andere Malerbedarfsartikel verkauft. Sie baut Beziehungen zu verschiedenen Farbherstellern auf, um qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu können.
Nicole legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit und strebt eine hohe Qualität ihrer Arbeit an. Sie sorgt dafür, dass ihre Mitarbeiter ebenfalls gut ausgebildet und kompetent sind. Ihr Malergeschäft wächst langsam, da sie sich einen Ruf für zuverlässige und professionelle Arbeit aufbaut. Zufriedene Kunden empfehlen sie weiter und ihr Kundenstamm wächst stetig.
Mit der Zeit erweitert Nicole ihr Geschäft, indem sie neue Dienstleistungen wie Dekorationsmalerei oder Fassadenbeschichtungen anbietet. Sie arbeitet eng mit anderen Unternehmungen wie Raumausstattern und Bodenlegern zusammen, um ihren Kunden eine umfassende Lösung für ihre Renovierungsprojekte zu bieten.
Durch ihre Leidenschaft für Farben und ihre fachliche Kompetenz gelingt es Nicole, ihr Malergeschäft erfolgreich aufzubauen. Sie ist stolz darauf, ihr eigenes Unternehmen zu führen und ihren Kunden hochwertige Malerarbeiten anzubieten.
Die Buchhaltung führt Nicole mit dem folgenden Kontenplan.
Kontenplan ColorCraft Malerwerkstatt
1000 Ka 2000 Verb L+L 4000 Mat-Aufw 3000 Prod-Ertr 1020 Ba 2450 Darl 4200 Wa-Aufw 3200 Wa-Ertr
1100 Ford L+L 2451 Hyp 5000 Lohn-Aufw
1200 Wa-Best 2800 EK 5800 Übr Pers-Aufw
1210 Rohmat-Best 6000 Raum-Aufw 1510 Mob 6100 URE
1520 Büro-Masch 6200 Fz-Aufw
1530 Fz 6300 Vers-Aufw
1540 Werkz 6400 Energ-Aufw 1600 Immob 6500 Vw-Aufw
6600 Werbe-Aufw
6700 Sonst. Betr-Aufw 6800 Abschr
6900 Fi-Aufw 6950 Fi-Ertr
a) Vergleichen Sie diesen Kontenplan mit demjenigen der Fahrschule Neurauter. Welche Konten sind hier neu?
Aktivkonten: neu Vorräte
Aufwandkonten: Mat-Auf und Wa-Aufw
Ertragskonten: Prod-Ertr und Wa-Ertr
b) Verbuchen Sie die folgenden Geschäftsfälle.
Geschäftsfall Soll / Haben (ohne Beträge)
1 Gaba AG, Rechnung für gelieferte Kunstfarben für den Online-Shop (CHF 1'500.–) Wa-Aufw / Verb L+L
2 Gaba AG nimmt fehlerhafte Farben zurück und stellt uns eine Gutschrift aus (CHF 150.–) Verb L+L / Wa-Aufw
3 GF, Versand einer Offerte für Fassadenanstrich (CHF 8'000.–) Keine Buchung
4 It3, Unterzeichnung Mietvertrag Ladengeschäft ab 01.01.24, Mietzins CHF 3'000.– Keine Buchung
5 Jumbo Baumarkt, Regale für Ladengeschäft, Zahlung mit Debit-Karte (CHF 870.–) Mob / Ba
6 Bosshard-Farben, Monatsrechnung November, Farben für Baustellen (CHF 4'000) Mat-Aufw / Verb L+L
7 Ladengeschäft, Kunde hat defekte Waren erhalten. Kaufpreis in bar zurück (CHF 75.–) Wa-Ertr / Ka
8 Versand Rechnungen an Kunden, fertig erstellte Aufträge (CHF 37'500.–) Ford L+L / Prod-Ertr
9 Pascale beteiligt sich mit Lieferwagen als Partnerin im Geschäft (CHF 40'000.–) Fz / EK
10 Signer Catering, Rechnung für Jubiläumsanlass 10 Jahre ColorCraft (CHF1’300.–) Sonst BA / Verb L+L
11 Signer Catering, nachträglicher Rabatt auf Rechnung Nr. 10 von 10% v. 1'300.– Verb L+L / Sonst BA
12 Bankgutschrift, Zahlungseingang von offenen Rechnungen (CHF 28'800.–) Ba / Ford L+L
13 Wertverminderung auf Lieferwagen (CHF 16'000.–) Abschr / Fz
14 Korrektur, irrtümlich verschickte und verbuchte Rechnung an Kunden (CHF. 895.–) Prod-Ertr / Ford L+L
Platz für Notizen:
Weitere Übungsmöglichkeiten finden Sie auf www.buchen.ch und www.bookyto.com
Übung
In Buchungsmasken zu Journalbuchungen findet sich häufig die Spalte «Valuta».
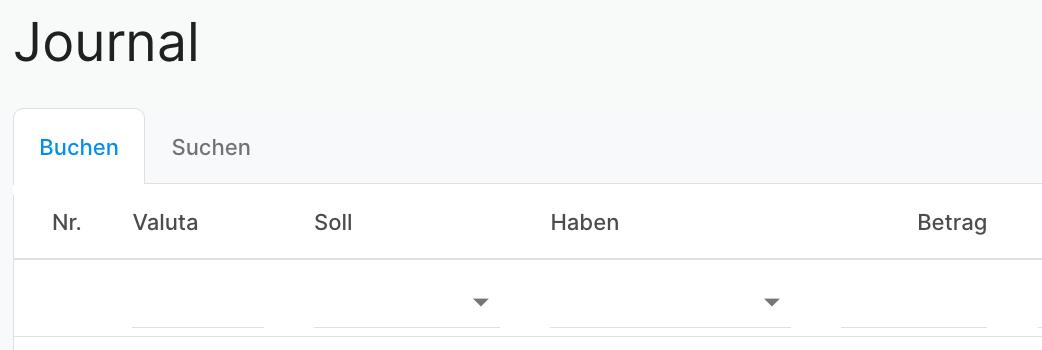
1. Das Valutadatum ist das Datum, an dem
a) eine Transaktion im Journal erfasst wird.
b) eine Rechnung ausgestellt wird.
c) X eine Transaktion wirksam wird oder als abgeschlossen betrachtet wird.
d) eine Transaktion bezahlt werden muss.
2. Das Valutadatum einer Überweisung ist der Tag, an dem...
e) das Geld von einem Konto abgebucht wird.
f) die Überweisung im Online-Banking-System getätigt wird.
g) X das Geld auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben wird.
h) der Zahlungsauftrag erteilt wird.
3. Ein Kunde überweist am 25. November 2023 Geld auf Ihr Bankkonto. Sie erhalten die Gutschrift jedoch erst am 27. November 2023.
Welches Datum entspricht dem Valutadatum in diesem Fall?
a) 25. November 2023
b) 26. November 2023
c) X 27. November 2023
d) Es ist nicht möglich, das Valutadatum zu bestimmen.
Die Journalbuchungen werden ins sogenannte Hauptbuch übertragen.

Welche Antwort beschreibt den Unterschied zwischen dem Hauptbuch und einem Nebenbuch in der Buchhaltung am besten?
a) X Das Hauptbuch enthält alle Buchungen zu einzelnen Geschäftsvorfällen, während ein Nebenbuch spezifische Informationen zu einem bestimmten Konto enthält.
b) Das Hauptbuch enthält nur Soll- und Haben-Buchungen, während ein Nebenbuch detaillierte Informationen zu einem Hauptkonto enthält.
c) Das Hauptbuch wird für externe Finanzberichte verwendet, während ein Nebenbuch intern für die Verfolgung von Buchungen verwendet wird.
d) Das Hauptbuch wird elektronisch geführt, während ein Nebenbuch in physischer Form vorliegt.
a) Beschriften Sie die Abbildungsfragmente analog wie die bereits eingetragene Legende bei Nummer 9.
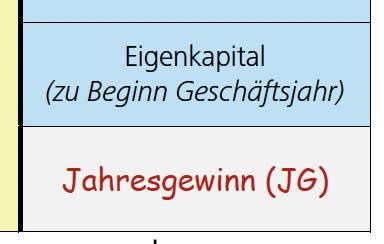


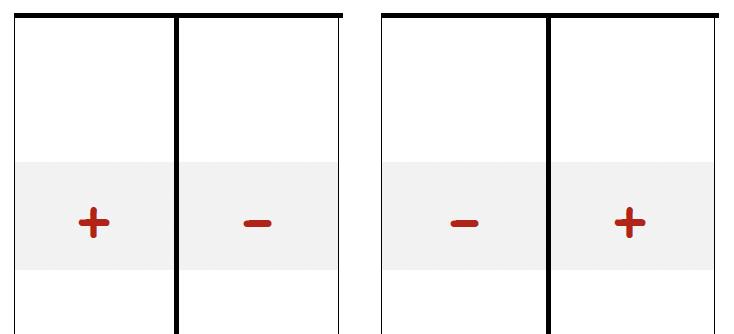
JG Schlussbilanz 1 Eröffnungsbilanz Abschluss Ertragskonto Regeln für Journalbuchungen der A- und E-Konten
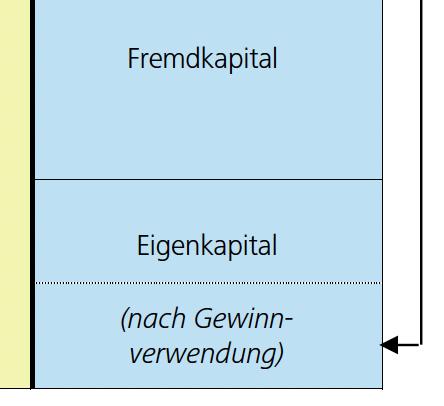



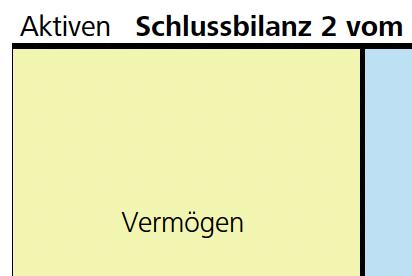
Schlussbilanz 2 Abschluss Aktivkonto JG Erfolgsrechnung Eröffnung Passivkonto Schlussbilanz 2
b) Tragen Sie die Nummern der Abbildungsfragmente in korrekter zeitlicher Abfolge auf dem unten dargestellten Zeitstrahl ein.
Eröffnung des Geschäftsjahres ... im Verlaufe des Geschäftsjahres; laufende Geschäftstätigkeit Abschluss des Geschäftsjahres 2 und 8 4 6 und 3, 1 und 7, 5 und 9
In den Übungen 2 war bereits von Sophies Fahrradverleih die Rede. Beim Jahresabschluss nach dem ersten Geschäftsjahr stellen Sophie und Lukas nicht ganz unterwartet fest, dass ihr Geschäft nicht «rentiert» hat. Zwar macht den beiden die Arbeit in ihrem Geschäft viel Freude. Die Löhne der beiden Angestellten konnten jeweils problemlos bezahlt werden, allerdings haben sich die beiden – bei erheblichen Arbeitszeiten – selbst nur ein minimales Gehalt ausbezahlt. Die Auslastung der Mieträder ist auf einem erfreulichen Stand, und die beiden möchten deshalb das Geschäft nochmals für mindestens eine Saison weiterführen.
a) Vorerst stellt sich für Sophie die Frage, wie die Buchhaltung abgeschlossen wird. Die Erfolgsrechnung weist einen Verlust von CHF 5'600.– aus. Gemäss doppeltem Erfolgsnachweis ist die Bilanz um den gleichen Betrag nicht ausgeglichen. Welche Bilanzseite ist bei einem Verlust in der Bilanz 1 grösser? Kreuzen Sie an.
Aktiven X Passiven
b) Wie lautet die Abschlussbuchung für die Erfolgsrechnung?
Soll Haben
Betrag
2979 J-Verl 9200 ER 5'600.–
c) Sophie findet, der Verlust müsse durch eine nochmalige Einlage in das Geschäft aufgefangen werden. Dies umso mehr, als die Stadt die Anfrage eines grossen schweizweit tätigen Anbieters für ein Bike-Sharing kürzlich abgelehnt hat. Sie meint, sie könnten doch aus ihren privaten Konten die CHF 5'600.– auf das Postkonto einzahlen, damit wäre der Verlust «abgehakt».
Wie heisst die Buchung für die Verlustdeckung gemäss Sophies Vorstellung?
Soll Haben
Betrag
1010 Post 2979 J-Verl 5'600.–
d) Lukas ist eher skeptisch: «Nun hat es ein Jahr lang nicht rentiert ... wir können ja mal dranbleiben, d.h. den Laden nicht gleich dicht machen, aber jetzt nochmals Geld einschiessen will ich nicht» meint er.
Wie heisst die Buchung für die Verlustdeckung gemäss Lukas’ Vorschlag?
Soll Haben
Betrag
2800 EK 2979 J-Verl 5'600.–
e) Wovon dürfte es abhängig sein, ob sich Sophie und Lukas für die Variante c) oder d) entscheiden? Nennen Sie mindestens zwei Argumente.
Individuelle Antworten, z.B.:
Haben die beiden privat genügend Kapital, um eine Einlage zu tätigen?
Wie stehen die Erfolgsaussichten des Fahrradverleihs?
Variante: Gewinn
Sophies Fahrradverleih-Service hat sich im ersten Jahr erfreulich gut entwickelt. Beim Jahresabschluss wird ein Gewinn von CHF 18'325.– ausgewiesen.
f) Auf welcher Seite der Erfolgsrechnung steht dieser Gewinn? Kreuzen Sie an.
X Aufwand Ertrag
g) Wie lautet in diesem Fall die Abschlussbuchung für die Erfolgsrechnung?
Soll Haben Betrag
9200 ER 2979 J-Gew 18'325.–
h) Sophie und Lukas sind der Meinung, den erwirtschafteten Gewinn im Geschäft zu belassen. Wie heisst die korrekte Buchung für diese Art der Gewinnverwendung?
Soll Haben Betrag
2979 J-Gew 2800 Eigenkapital 18’325.–
i) Wie heisst die zweite grundsätzliche Art (oder Möglichkeit), wie ein Gewinn verwendet werden kann?
Auszahlung oder Ausschüttung des Gewinns
j) Und wie lautet die entsprechende Buchung in diesem Fall?
Soll Haben Betrag
2979 J-Gew 1020 Bank (1010 Post) 18’325.–
k) Welche Voraussetzung in der Vermögensstruktur der Unternehmung muss gegeben sein, damit die zweite Variante der Gewinnverwendung überhaupt möglich ist?
Es müssen genügend Barmittel vorhanden sein; eine
Gewinnauszahlung vermindert die Liquidität der Unternehmung.
In Netzwerken (oder Feedbackdiagrammen) werden die Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen durch Pfeile und Symbole (Minus- oder Pluszeichen) dargestellt. Je nachdem, wie sich in Beziehungen die Veränderungen der einzelnen Elemente zueinander verhalten, sprechen wir von gleichgerichteten (+) Beziehungen oder von entgegengerichteten (–) Beziehungen.
a) Formulieren Sie die dargestellten Beziehungen im nebenstehenden Netzwerk und ergänzen Sie die Netzwerkdarstellung mit den entsprechenden Vorzeichen.
b) Erläutern Sie die Beziehung Nr. 8 an einem Beispiel.
Aufwand
Gewinn
für Investitionen Ertrag
Ansprüche auf Gewinnauszahlung
Ausbezahlte Gewinne
Wenn eine Unternehmung Nr Beziehung Ursache Beziehung Wirkung Vorzeichen in Forschung und Entwick- 1 Je mehr Abschreibungen desto mehr Aufwand + lung investiert, können 2 Je mehr Aufwand desto weniger Gewinn –Produkt- bzw. Prozess- 3 Je weniger Gewinn desto weniger Ansprüche auf Gewinnauszahlung + Innovationen erzielt werden. 4 Je weniger Ansprüche auf Gewinnauszahlung desto weniger Ausbezahlte Gewinne + Langfristig kann eine Unter- 5 Je weniger Ausbezahlte Gewinne desto mehr Liquidität –nehmung nur erfolgreich 6 Je mehr Liquidität desto mehr Mittel für Investitionen + wirtschaftlich tätig sein, 7 Je mehr Mittel für Investitionen desto mehr Investitionen + wenn sie innovativ bleibt. 8 Je mehr Investitionen desto mehr Ertrag + 9 Je mehr Ertrag desto mehr Gewinn +
Übung 11.2 Fahrradverleih – wie hoch sollen die Abschreibungen sein?
Sophie und Lukas überlegen sich, wie viel Abschreibungen sie auf ihrem Fahrradpark vornehmen sollen. Lukas hat dazu die gesetzlichen Vorschriften zusammengestellt.
n Gesetzliche Bewertungsvorschriften im Obligationenrecht (OR)
Art. 960 OR:
1 Aktiven und Verbindlichkeiten werden in der Regel einzeln bewertet, sofern sie wesentlich sind und aufgrund ihrer Gleichartigkeit für die Bewertung nicht üblicherweise als Gruppe zusammengefasst werden.
2 Die Bewertung muss vorsichtig erfolgen, darf aber die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nicht verhindern.
3 Bestehen konkrete Anzeichen für eine Überbewertung von Aktiven oder für zu geringe Rückstellungen, so sind die Werte zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Art. 960a Abs. 3 OR:
1 Bei ihrer Ersterfassung müssen die Aktiven höchstens zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden.
2 In der Folgebewertung dürfen Aktiven nicht höher bewertet werden als zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Vorbehalten bleiben Bestimmungen für einzelne Arten von Aktiven.
3 Der nutzungs- und altersbedingte Wertverlust muss durch Abschreibungen, anderweitige Wertverluste müssen durch Wertberichtigungen berücksichtigt werden. Abschreibungen und Wertberichtigungen müssen nach den allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen vorgenommen werden. Sie sind direkt oder indirekt bei den betreffenden Aktiven zulasten der Erfolgsrechnung abzusetzen und dürfen nicht unter den Passiven ausgewiesen werden.
Die Mindestbewertungsvorschriften im Steuerrecht werden durch maximale Abschreibungssätze (%) der Aktiven definiert.
a) Sehen Sie die maximalen Abschreibungssätze mit dem QR-Code/Link auf dem KMU-Portal des SECO nach und ergänzen Sie die nebenstehende Tabelle.

n Gesetzliche Bewertungsvorschriften im Steuerrecht
(Gebäude und Land)
(nur Gebäude)
Energiesparende Investitionen (in den ersten beiden Jahren)
w KMU-Portal des SECO
Diese Zahlen sind Richtgrössen (kantonale Abweichungen sind möglich) für degressive Abschreibungssätze. Das heisst: Die Abschreibungssätze beziehen sich immer auf den Restwert. Bei linearer Abschreibung auf den Anschaffungswert sind diese Sätze zu halbieren. Wurden in den Vorjahren wegen schlechten Geschäftsgangs nicht die höchstzulässigen Abschreibungssätze genutzt, so kann man dies in den darauffolgenden Jahren nachholen
b) Weshalb bestehen unterschiedliche Abschreibungssätze?
Man geht von einer unterschiedlichen Nutzungsdauer aus,
z.B. Motorfahrzeuge 5 Jahre (20%), Mobiliar 8 Jahre (12,5%).
Sophie und Lukas sind nicht sicher, ob sie ihren Farradpark degressiv oder linear abschreiben sollen. Zudem besteht beim Abschreibungsbetrag auch ein gewisser Ermessensspielraum:
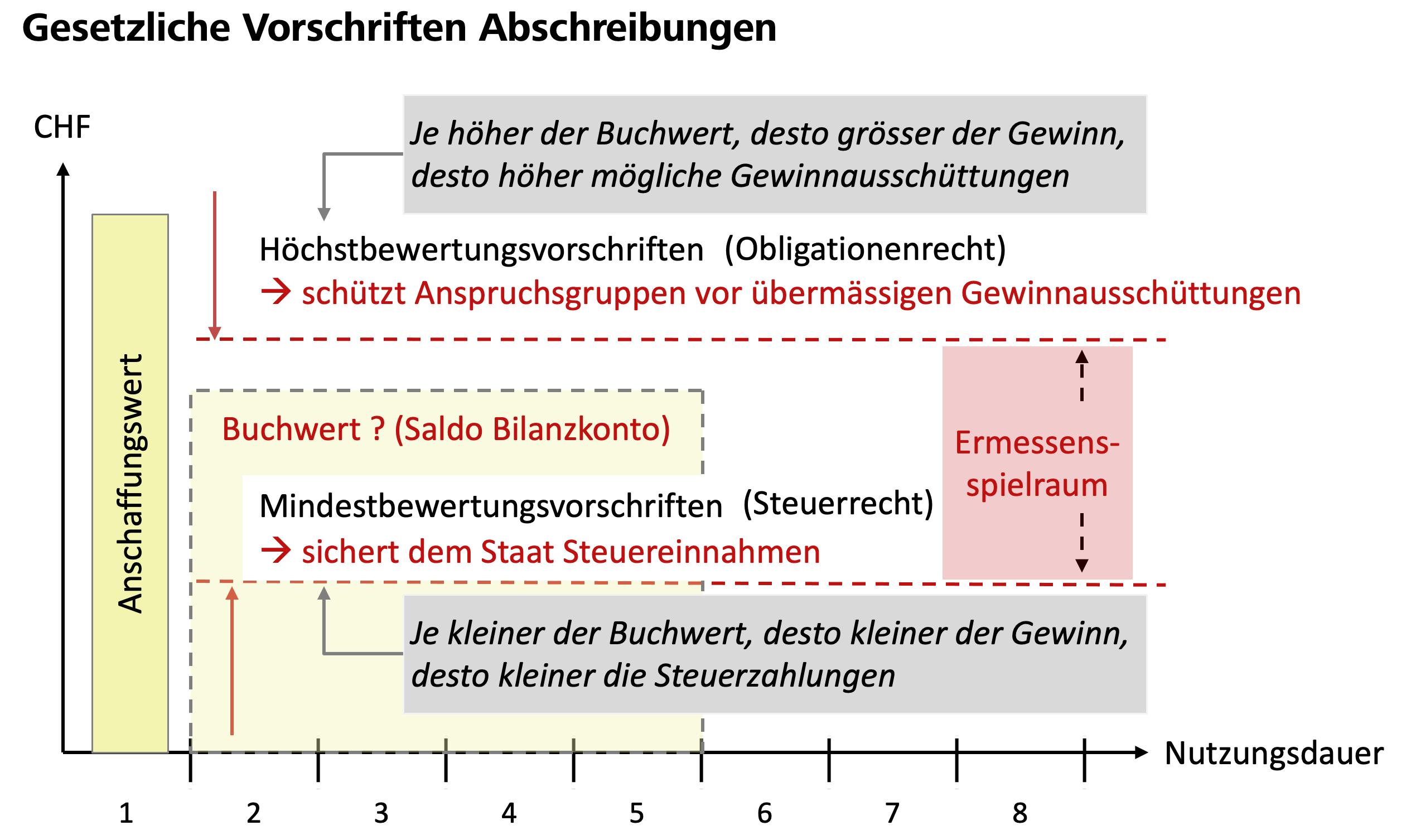
Wie würden Sie den Ermessenspielraum nutzen und den Fahrradpark von CHF 40'000.– abschreiben, wenn man annimmt, dass der Fahrradpark nach 5 Jahren noch einen Restwert (Liquidationswert) von CHF 5'000.– hat?
c) Erstellen Sie dazu zuerst einen 5-Jahres-Plan Abschreibungsbeträgen für das lineare und das degressive Abschreibungsverfahren. Sie können dazu mit dem QR-Code/Link die vorbereitete Excel-Tabelle von Sophie nutzen. Setzen Sie die Formeln ein und berechnen Sie für die fünf Jahre die steuerlich maximal zulässigen Abschreibungsbeträge und die Buchwerte per 31.12.

Was ist beim degressiven Abschreibungsverfahren im 5. Jahr zu berücksichtigen?
Im 5. Jahr beträgt der Buchwert am 01.01. CHF 5’184.–.
Bis zum geschätzten Liquidationswert von CHF 5'000.– müssen
im 5. Jahr nur noch CHF 184.– abgeschrieben werden.


w Excel-Tabellenblatt für Planung Abschreibungstabelle Fahrradpark
d) Welches Abschreibungsverfahren würden Sie Sophie und Lukas empfehlen? Welche Abschreibungsbeträge würden Sie für die fünf Jahre einplanen?
Begründen Sie Ihre Empfehlung.
Individuelle Antworten
Beispiel einer Empfehlung: Degressives Abschreibungsverfahren, Abschreibungsbeträge: CHF 16'000.–, 9'600.–, 5'760.–, 3’456.–. Begründung: Max. Umsetzung der vorsichtigen Bewertung, weil bei Fahrrädern Wertverminderung in den ersten Jahren am grössten. Falls keine grossen Verluste ausgewiesen werden sollten (zB wegen Kreditgesuchen), könnten Abschreibungsbeträge verringert werden (Link zu Vergleichslösung Excel-Tabelle)
Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
1. Warum sind Gewinne für Unternehmen wichtig?
a) Um die Kosten für Fremdkapital zu decken.
b) X Um technische Anpassungen und Entwicklung neuer Produkte zu finanzieren.
c) Um die Risikobereitschaft der Kapitalgeber zu belohnen.
d) Um Liquiditätsprobleme zu vermeiden.
2. Was ist die Eigenkapitalrendite?
a) X Der Gewinn, der auf das Eigenkapital entfällt.
b) Der Prozentsatz des Gewinns im Verhältnis zum Gesamtkapital.
c) Die Ausschüttung der Gewinne an die Eigentümer.
d) Der Cashflow abzüglich der Abschreibungen.
3. Was ist der Cashflow?
a) Der Gewinn nach Steuern.
b) Die Summe der Abschreibungen im Jahresabschluss.
c) X Der Gewinn plus die Abschreibungen.
d) Die Auszahlungen an die Eigentümer einer Unternehmung
4. Welcher Bereich wird als angemessene Eigenkapitalrendite genannt?
1. X 4 bis 6%
2. 8 bis 12%
3. 14 bis 16%
4. 16 bis 20%
Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
a) Warum sollten überschüssige liquide Mittel vermieden werden??
a) X Sie sind schwer zu verwalten.
b) Sie werfen wenig bis keinen Zins ab.
c) Sie erhöhen das Risiko von Zahlungsschwierigkeiten.
d) Sie müssen sofort in Investitionen umgewandelt werden.
b) Was bezeichnet der Liquiditätsgrad 2?
a) Das Verhältnis von Kundenguthaben zu langfristigem Fremdkapital
b) X Das Verhältnis von flüssigen Mitteln zu kurzfristigem Fremdkapital
c) Das Verhältnis von Kundenguthaben zu kurzfristigem Fremdkapital
d) Das Verhältnis von flüssigen Mitteln zu langfristigem Fremdkapital
c) Welche Konsequenzen können Zweifel an der Liquidität einer Unternehmung haben?
a) Erhöhte Kreditvergabe von Banken
b) Erhöhte Investitionsbereitschaft der Kapitalgeber
c) X Skepsis von potenziellen Kapitalgebern und Geschäftspartnern
d) Erhöhte Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen
d) Was besagt die goldene Bilanzregel?
a) Aktiva sollten die Passiva übersteigen.
b) X Langfristiges Vermögen sollte mit langfristigem Kapital finanziert werden.
c) Kurzfristiges Vermögen sollte mit kurzfristigem Kapital finanziert werden.
d) Eigenkapital sollte das Fremdkapital übersteigen.
Übung 12.3 Boutique Milano – Wie beurteilen Sie die finanzielle Lage?
Marco arbeitet in einem Treuhandbüro und hat die finanzielle Lage der Boutique Milano zu beurteilen. Bilanz und Erfolgsrechnung der Boutique Milano zeigen das folgende Bild:

Der Branchenverband gibt für vergleichbare Boutiquen folgende Empfehlungen ab: Der Personalaufwand sollte 16 % des Umsatzes nicht übersteigen; als Cashflow sollten mindestens 9 % des Umsatzes erreicht werden. In der Boutique arbeiten neben dem Geschäftsführer noch drei weitere Angestellte (Teilzeit).
Die Formel für die Rendite kennt Marco auswendig, die übrigen Formeln trägt er aus seinen Unterlagen zusammen:
Liquiditätsgrad 2 = (Flüssige Mittel + Ford L+L) x 100
Kurzfristiges Fremdkapital
Eigenfinanzierungsgrad = Eigenkapital x 100
Gesamtkapital
Anlagedeckungsgrad 2 = (Eigenkapital + lfr. Fremdkapital) x 100
Anlagevermögen
a) Wie lautet die Formel für die Rendite?
Eigenkapitalrendite = Reingewinn x 100 Eigenkapital
b) Kontrollieren Sie, ob Marco bei der Berechnung der Kennzahlen Fehler unterlaufen sind und tragen Sie die Korrektur in die Tabelle ein
Resultate von Marcos Berechnungen:
1. Eigenkapitalrendite 11,00 % richtig
2. Personalaufwand in % des Umsatzes 19,92 % 19,30 %
3. Cashflow in % des Umsatzes 4,33 % richtig
4. Liquiditätsgrad 2 150,00 % 171,67 %
5. Eigenfinanzierungsgrad 34,97 % richtig
6. Anlagedeckungsgrad 2
c) Welche Kennzahlen zeigen kein optimales Bild von der finanziellen Situation der Boutique? Begründen Sie Ihre Antwort.
Der Liquiditätsgrad 2 ist zu hoch (Normwert mind. 100 %); überschüssige liquide Mittel sollten ertragsbringend angelegt werden.
Der Cashflow in % des Umsatzes ist zu tief.
Personalaufwand liegt 3%-Punkte über dem Richtwert der Branche.
d) Welche Massnahmen halten Sie für angezeigt?
Anlage der überschüssigen liquiden Mittel
Gewinn steigern (günstiger einkaufen, teurer verkaufen)
Kosten einsparen), damit verbessert sich der Cashflow.
Übung 13.1 Vom Umgang mit Belegen
Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
1. Was besagt das Prinzip "Keine Buchung ohne Beleg"?
a) Jede Buchung muss von einem Buchhalter genehmigt werden.
b) Alle Buchungen müssen in der Bilanz und Erfolgsrechnung überprüft werden.
c) X Jeder Geschäftsfall mit finanziellen Auswirkungen muss dokumentiert werden.
d) Belege müssen vor der Buchung von externen Anspruchsgruppen genehmigt werden.
2. Welche Art von Belegen gibt es?
a) X Interne und externe Belege
b) Primäre und sekundäre Belege
c) Finanzielle und nichtfinanzielle Belege
d) Originale und Kopien von Belegen
3. Wie lange müssen Belege aufbewahrt werden?
a) 5 Jahre
b) X 10 Jahre
c) 2 Jahre
d) 1 Jahr
4. Was ist der Zweck der fortlaufenden Nummerierung von Belegen?
1. Zur Verbesserung der Buchführungsgenauigkeit
2. Um Belege einfacher zu verwalten
3. X Zur Identifikation und Zuordnung von Geschäftsvorfällen
4. Um die Belegart zu kennzeichnen
Der Gasthof Kreuz ist ein traditioneller Gasthof, der sowohl ein erstklassiges Restaurant als auch komfortable Hotelzimmer bietet. Seit vielen Jahren ist der Gasthof Kreuz eine beliebte Anlaufstelle für Einheimische und Touristen, die köstliche Gerichte in gemütlicher Atmosphäre geniessen möchten oder eine angenehme Übernachtungsmöglichkeit suchen.

Eine besonders geschätzte Option, die der Gasthof Kreuz anbietet, sind Geschenkgutscheine. Diese Gutscheine werden oft gekauft und verschenkt, um Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen ein besonderes kulinarisches Erlebnis oder einen entspannten Aufenthalt im Hotel zu ermöglichen.
In der Buchhaltung werden sämtliche Belege wöchentlich kontiert. Auf den folgenden Seiten finden Sie zu Übungszwecken 10 Belege aus dem Jahr 2023 (als der MWST-Steuersatz noch bei 7,7% lag). Kontieren Sie diese Belege mithilfe des Kontenplans (nächste Seite) des Gasthofs Kreuz.
Kontenplan Gasthof Kreuz
Aktiven Passiven Aufwände Erträge
1000 Kasse 2000 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen 4000 Materialaufwand Küche/Keller 3200 Warenertrag
1020 Post 2010 Verbindlichkeiten aus Gutscheinen 4004 Gästeunterhalt/Zeitungen 3000 Einnahmen Restaurant
1100 Forderungen aus Lief. und Leistungen 2100 Bank (Kontokorrent-Schuld) 4400 Reinigung/Wäsche 3010 Einnahmen Hotel
1200 Warenvorräte 2200 Ums.St. / Schuld MWSt 5000 Lohnaufwand (Personal) 3020 Hauslieferungen/Catering 1500 Betriebsmobiliar 2450 Darlehen Privat 5680 Direktion/Unt.leitung 3600 Übrige Einnahmen
1510 Einrichtungen 2800 Eigenkapital 5700 Sozialabgaben (Direktion)
1512 Geschirr 5830 Pauschalspesen
1530 Fahrzeuge 6000 Raumaufwand (Geschäftslokalität)
1600 Geschäftsliegenschaft 6200 Fahrzeugaufwand
6300 Sachversicherungen
6400 Energie (Heizöl, Strom, Gas)
6430 Wasser/Entsorgung
6500 Verwaltungsaufwand
6600 Werbeaufwand
6700 Sonst. Betriebsaufwand
6800 Abschreibungen
6900 Finanzaufwand (KK-Zinsen)
6901 Darlehenszinsen
7510 Hypothekarzinsaufwand 7500 Immobilienerfolg (Gasthof) 7511 Liegenschaftsunterhalt 7501 Immobilienerfolg (Privatwohnung)
Sie können den Kontenplan auch mit folgendem QR-Code/Link aufrufen.



7. März 2023
Lemco AG
Modelstrasse 122 8570 Weinfelden
Rechnung RE-945
Ihre Bestellung vom 5. März 2023
13. März 2023
Gasthof Kreuz
Bahnhofstrasse 8
8570 Weinfelden T 071 123 45 67
info@kreuz-weinfelden.ch
Frau Karin Berger
Chlaffentalstrasse 20 8212 Neuhausen
Gasthof Kreuz
Bahnhofstrasse 8
8570 Weinfelden T 071 123 45 67 info@kreuz-weinfelden.ch
Quittung
Essensgutscheine 5x CHF 200.00 1000.00
Gutscheine Nr. 2023–418, 419, 420, 421, 422 Total 1000.00
Zahlbar innert 30 Tagen rein netto.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Ihr Kreuz-Team
Beleg-Nr. Soll-Konto Haben-Konto
gebucht am, Visum:
Bemerkungen:
EZ, Übernachtung mit Frühstück 115.00 Kurtaxe 3.00
Total 118.00
Bezahlt mit Postcard 8973-XXXX-XXXX-321.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Ihr Kreuz-Team
Beleg-Nr. Soll-Konto Haben-Konto
Bemerkungen: 3 1100 2010
10.03.2023, Rü Gutscheine als Verbindlichkeiten gebucht 4 1010 3010
gebucht am, Visum:
17.03.2023, Rü Zahlung Postcard direkt auf Post gebucht
Bankverbindung: Neue Weinfelder Bank IBAN CH99 1234 5678 1234 5678 0 Postkonto: 85-82333-9 MWST-Nr. CHE-123.758.123 MWST
Bankverbindung: Neue Weinfelder Bank IBAN CH99 1234 5678 1234 5678 0
Postkonto: 85-82333-9
MWST-Nr. CHE-123.758.123 MWST
Gasthof Kreuz, Weinfelden Konto 85-82333-9
IBAN CH67 0078 4985 8582 3339 1

PostFinance AG
Region Ost
Fürstenlandstrasse 122 9020 St. Gallen Telefon 0848 888 900 business@postfnance.ch www.postfnance.ch
Gasthof Kreuz Bahnhofstrasse 8 8570 Weinfelden
St. Gallen, 18. März 2023
23. März 2023
Katrin und Hansjörg Koller Zürcherstrasse 12 8500 Frauenfeld Quittung
Sehr geehrte Kundin Sehr geehrter Kunde
Folgender Betrag wurde Ihrem Konto 85-82333-9 gutgeschrieben:
Text Mitteilung Währung Betrag
Anne und Joachim Hug Rechnung 867
Luegisland 34 8577 Ritzis-Buhwil
Konsumation 23.03.2023 140.00
Einlösung Gutschein 2020-89 -100.00
Total 40.00
Bezahlt mit: Barzahlung
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Ihr Kreuz-Team
Gasthof Kreuz Bahnhofstrasse 8 8570 Weinfelden T 071 123 45 67 info@kreuz-weinfelden.ch
Freundliche Grüsse Postfnance AG
gebucht am, Visum: Bemerkungen:
Soll-Konto Haben-Konto
Beleg-Nr. Soll-Konto Haben-Konto gebucht am, Visum: Bemerkungen: 5 1010 1100 24.03.2023, Rü Zahlung Beleg 1 6 1000 3000 24.03.2023, Rü Einlösung Gutschein: 2010 / 3000
Bankverbindung: Neue Weinfelder Bank IBAN CH99 1234 5678 1234 5678 0
Postkonto: 85-82333-9 MWST-Nr. CHE-123.758.123 MWST
neue WEINFELDER BANK AG
Paradeplätzli 1 8570 Weinfelden Telefon +41 71 626 00 00 info@nwbank.ch www.nwbank.ch
BIC WBTGCH22
CHE-110.889.023 MWST
Für Sie zuständig:
Fritz Feuz +41 71 626 00 24 fritz.feuz@nwbank.ch
Weinfelden, 21. März 2023 Referenznummer 21-1783
Gasthof Kreuz, Weinfelden
Kontokorrentkonto CHF IBAN CH00 0078 4991 1138 7899 2
Gasthof Kreuz Bahnhofstrasse 8 8570 Weinfelden
Belastung
Sehr geehrte Kundin Sehr geehrter Kunde
Vereinbarungsgemäss haben wir Ihr Konto zur Bezahlung der nachfolgenden Fälligkeiten wie folgt belastet:
Text Währung Betrag
Zu Gunsten von Cédric Bürgi, 8570 Weinfelden
Zu Ihren Lasten
Wir danken für Ihren Auftrag. Freundliche Grüsse Neue Weinfelder Bank AG
Beleg-Nr. Soll-Konto Haben-Konto gebucht am, Visum:
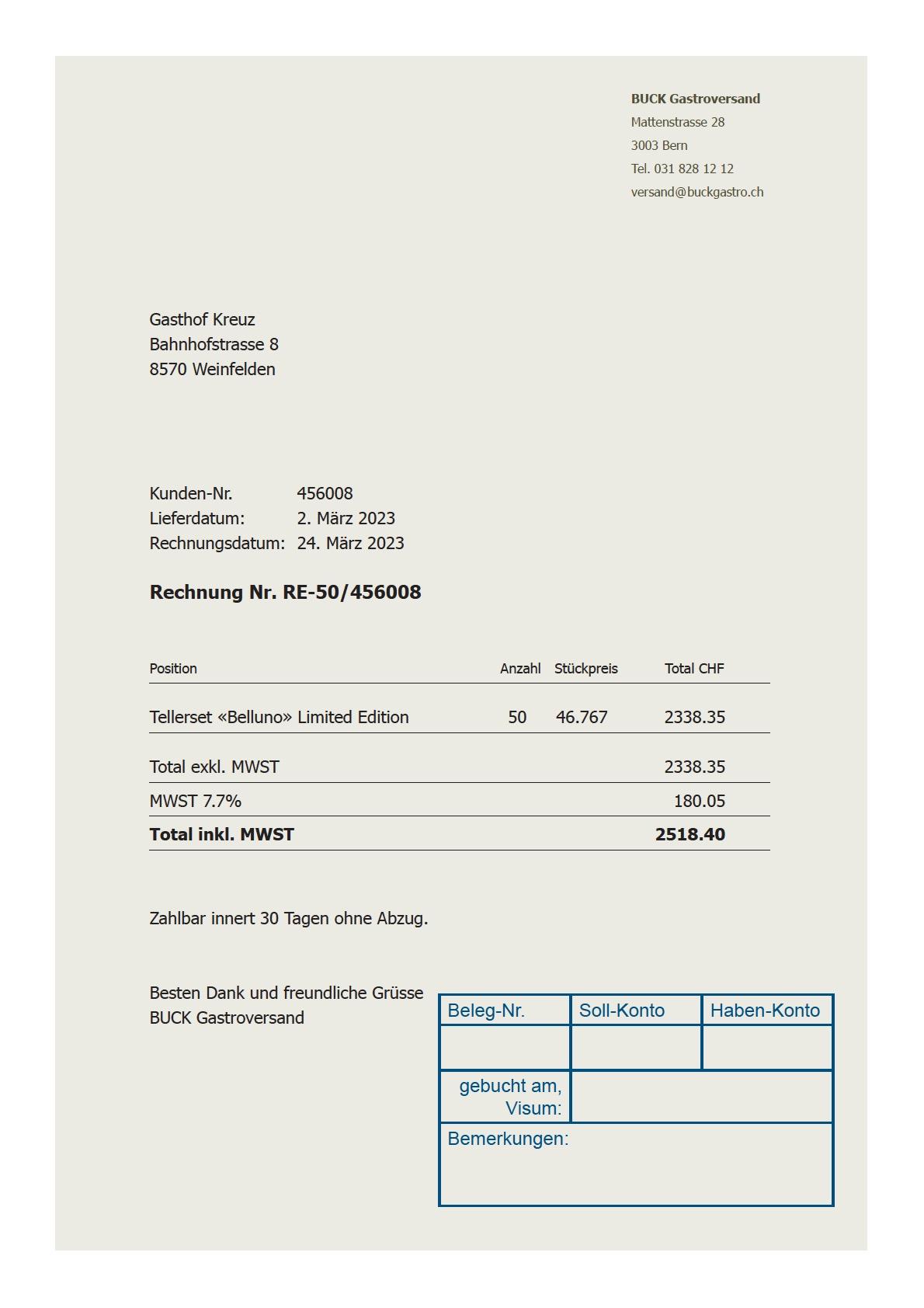

9 1020 1000 31.03.2023, Rü 10 4000 2000 12.05.2023, Rü
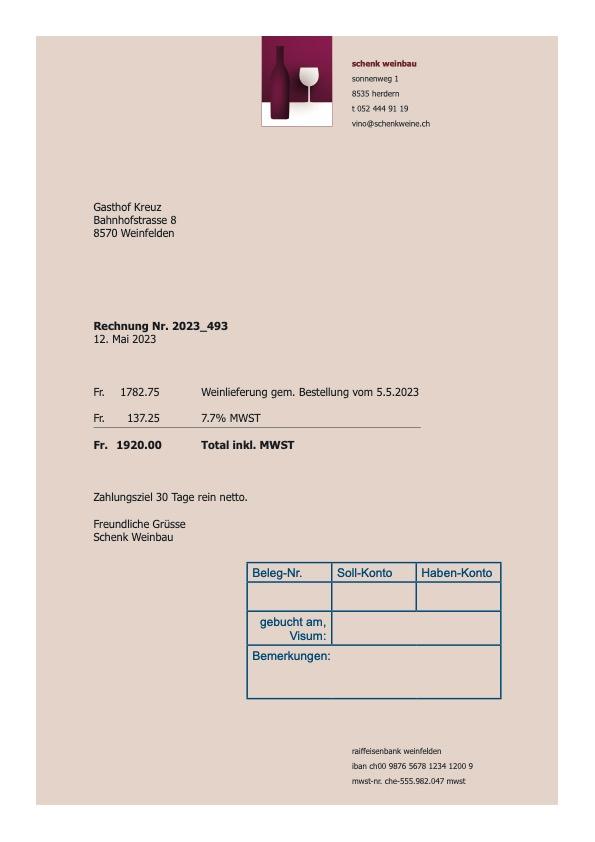
Giulia hat sich bei Swiss21 registriert und einen Account eingerichtet.

Sie hat die Konten, die sie verwendet, aus dem Kontenrahmen ausgewählt und als Favoriten (Kontenplan) abgespeichert.
Kontenplan Giulias Glacé-Mobil
1000 Ka 2000 Verb L+L 4200 Wa-Aufw 3200 Wa-Ertr 1020 Ba (KK-Guthaben) 2100 Ba (KK-Schuld) 5000 Lohn-Aufw
1100 Ford L+L 2150 Verb geg Dritten 6000 Raum-Aufw 1530 Fz 2450 Lfr Darl-Verb 6800 Abschr 2800 EK 6900 Fi-Aufw
Den ersten Geschäftsfall hat Giulia in AbaNinja bereits verbucht.

a) Öffnen Sie den nebenstehenden QR-Code/Link und wählen Sie den Link «Übung 14.1 – Lektion starten». Nach Ihrer Anmeldung in Ihrem persönlichen Swiss21-Account wird der Swiss21-Account von Giulias Glacé-Mobil als Lektion in Ihrem persönlichen Swiss21-Account erstellt.

Im Menu Buchhaltung > Journal können Sie dann dort fortfahren, wo Giulia aufgehört hat.
b) Verbuchen Sie die Geschäftsfälle 2 und 3 in AbaNinja mit der Variante 1 – Journal.
Wiesel, Rechnung
c) Verbuchen Sie die Geschäftsfälle 4 bis 6 in AbaNinja mit der Variante 2 – Kontoauszug.
d) Schauen Sie sich über das Menü > Buchhaltung > Bericht die Bilanz und die Erfolgsrechnung an. Wie hoch ist der Erfolg nach der Verbuchung der sechs Geschäftsfälle?
Gewinn von CHF 4‘800.–
Übung 14.2 Schreinerei Koller – digitale Verarbeitung von Lieferantenbelegen mit Swiss21
Die Schreinerei Koller führt ihre Buchhaltung mit Swiss21.
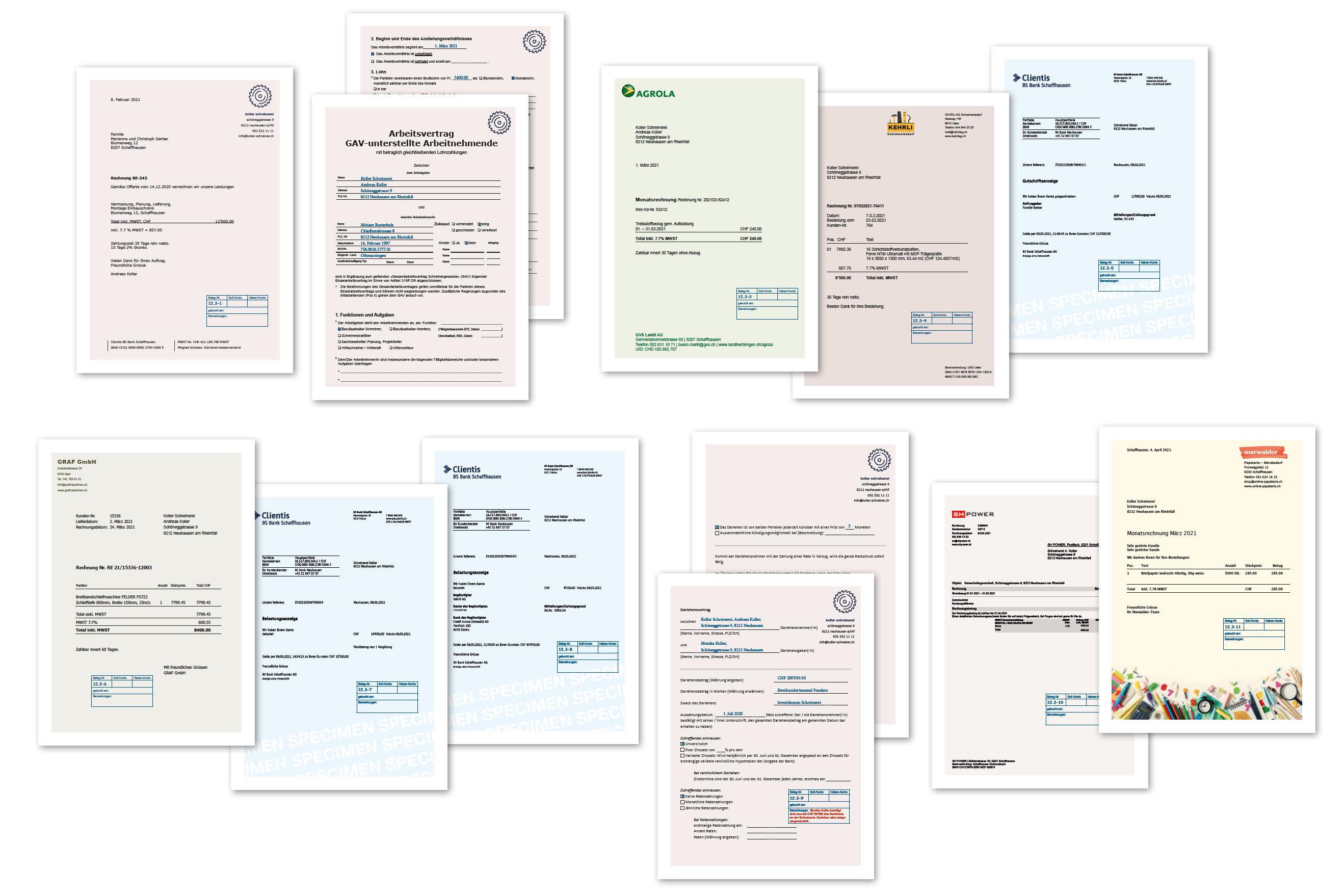
w Belegsammlung der Schreinerei Koller
a) Öffnen Sie den nebenstehenden QR-Code/Link und wählen Sie den Link «Übung 14.2 – Belegsammlung herunterladen». Wählen Sie den Ordner mit den Belegen des aktuellen Jahres und speichern Sie die Belege auf Ihrem Computer.

b) Wählen Sie anschliessend den Link «Übung 14.2 – Lektion starten».
Nach Ihrer Anmeldung in Ihrem persönlichen Swiss21-Account wird der Swiss21-Account der Schreinerei Koller als ‹Lektion› in Ihrem persönlichen Swiss21-Account erstellt.
Vergewissern Sie sich vor der Bearbeitung der Teilaufgabe c), dass Sie die digitale Verarbeitung von Lieferantenbelegen gemäss Theorie (Seite 45) verstanden haben.
c) Die vorliegende Belegsammlung enthält unterschiedliche Belege. Sehen Sie diese aufmerksam durch; verbuchen Sie lediglich die Lieferantenbelege, indem Sie diese gemäss Ablaufschema auf Seite 45 bearbeiten. Notieren Sie stichwortartig zu jedem Beleg, was zu tun ist?
1) SH Power: IBAN aus Beleg kopiert, in Bankverbindung kopiert
2) Marwalder: kein Bankkonto auf der Rechnung, offen gelassen
3) Arbeitsvertrag: Kein Lieferantenbeleg
4) Darlehensvertrag: Kein Lieferantenbeleg
5) Clientis, Zahlung Rechnung Kehrli: Kein Lieferantenbeleg
6) Clientis, Belastungsanzeige CHF 18'630.-: Kein Lieferantenbeleg
7) Kehrli, Rechnung: Adresse korrigiert (fehlendes Leerzeichen)
Konto 4000 Mat-Aufw, IBAN Nr falsch à offen gelassen
8) Graf, Rechnung: Kontovorschlag falsch, 1500 Masch, Apparate
9) Agrola, Rechnung: Adresse nicht gefunden, Konto 1520 Fz-Aufw
10) Gerber, Kundenrechnung: Kein Lieferantenbeleg
11) Clientis, Gutschriftsanzeige Gerber: Kein Lieferantenbeleg
d) Schauen Sie sich über das Menü > Buchhaltung > Bericht die Bilanz und die Erfolgsrechnung an. Wie hoch ist der Erfolg nach der Verbuchung der Lieferantenbelege? Was fällt Ihnen bei der Darstellung des Erfolgs im Vergleich der beiden Abschlussrechnungen auf?
Erfolg = Verlust CHF 10'575.–
Erfolgsrechnung: Total Erfolgsrechnung, mit negativem Vorzeichen
Bilanz: Unverbuchter Reinverlust mit positivem Vorzeichen
Erklärung siehe Theorie, S. 48-49.
Im Theorieteil sind rot markierte Elemente zu ausgewählten Wissensstrukturen eingestreut. Diese rot markierten Elemente à können im Lehrvortrag, im Lehrgespräch aber auch in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden.
Alternativ können die Lösungen für die Lernenden auch aufgeschaltet werden, dann liest sich der ganze Abschnitt wie ein Theorietext.
Wenn die Übungen online gelöst werden, kann man den Lernenden die Lösungen freischalten, sodass die Besprechung nicht zwingend mit der Lehrperson stattfinden muss.
Frage: «Wie lange benötigt man für die Vermittlung dieses Lernmoduls?»
Unsere Antwort: Die benötigte Unterrichtszeit hängt von vielen Faktoren ab. Z.B., ob man den Unterricht stärker lehrerzentriert oder schülerzentriert ausrichtet oder wie ausführlich man auf Fragen der Klasse eingeht. Einzelne Übungen kann man auch als Hausaufgaben bearbeiten lassen.
Auf den folgenden Seiten haben wir einzelne Stichworte zu einem möglichen Ablauf notiert, jeweils mit einer geschätzten Bandbreite Unterrichtszeit. Diese ist auch davon abhängig, wie weit die Aufgaben zur Vertiefung und Vernetzung im Unterricht eingebaut werden.
Einführung
Kontensystematik mit Bilanz und Erfolgsrechnung
Geschäftsfälle verbuchen
Unternehmerische Entscheide
Belege digital verarbeiten
Thema / Inhalt
Einführung
Der Ferienjob für Giulia bildet den roten Faden für dieses Lernmodul. Das Rechnungswesen liefert Grundlagen für unternehmerische Entscheide. Aus diesem Grund führen wir zuerst ein einfaches Geschäftsmodell mit Budgetierung ein.
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf
1 Giulias Glacé-Mobil –von der Geschäftsidee zum Geschäftsmodell ............................. 2
Im Theorieteil sind immer wieder Fragen zu ausgewählten Wissensstrukturen eingestreut. Die rot markierten Elemente àkönnen in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden. Alternativ können auch die Lösungen aufgeschaltet werden, dann liest sich der ganze Abschnitt wie ein Theorietext.
n Gesucht: Ein Ferienjob für Giulia
1.1 à Gibt es in unserer Region konkrete Angebote von Ferienjobs?
n Die Geschäftsidee am Lindli
1.2 à Geschäftsidee von Giulia beurteilen
1.3 à Zusätzliche Abklärungen?
n Geschäftsmodell «Giulias Glacé-Mobil»
In einem Geschäftsmodell wird die Geschäftsidee weiter ausformuliert.
1.4 à Das Business Model Canvas mit Video einführen; Video mit Link aus PDF oder via QR-Code über Smartphone aufrufen, mit Kopfhörer im eigenen Tempo betrachten
1.5 à Stichworte Canvas für Giulias Glacé-Mobil
Übungen – zur Kontrolle
1.1 Was ist eine Geschäftsidee?
1.2 Geschäftsidee und Geschäftsmodell
1.3 Lückentext zu Business Model Canvas
1.4 Das Geschäftsmodell von flavourized
Lektionen
Thema / Inhalt
2 Budget und Finanzplanung –wichtige Elemente eines Businessplans ...................................... 8
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
n Businessplan
Elemente eines Businessplans im Lehrvortrag erläutern
n Finanzplanung
2.1 à Kapitalbedarf für Glacé-Mobil aus Offerte Firma Wiesel ermitteln
2.2 à Mit Excel-Vorlage selbst budgetieren
n Ein Budget für »Giulias Glacé-Mobil»
2.3 à Budget von Giulia beurteilen
Übungen – zur Kontrolle
2.1 Fahrradverleih – Businessplan
2.2 Fahrradverleih – Finanzplanung
2.3 Fahrradverleih – Zwei Budgets von ChatGPT
Thema / Inhalt
Kontensystematik mit Bilanz und Erfolgsrechnung
Nachdem Giulias Oma die Finanzierung des Glacé-Mobils ermöglicht, beginnt in diesem Block das eigentliche Rechnungswesen. In den Kapiteln 3 – 7 werden Bilanz, Erfolgsrechnung, die vier Kontenarten sowie Kontenrahmen und Kontenplan eingeführt.
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
3 Rechnungswesen – eine Begriffsübersicht ............................... 12 n Omas Bedingung für die Finanzierung des Glacé-Mobils Investorinnen benötigen Informationen über den Geschäftsgang der Unternehmung. Giulias Oma finanziert das Glacé-Mobil, erwartet dafür aber eine Jahresrechnung mit Bilanz und Erfolgsrechnung.
An dieser Stelle kann die Aufgabe 2 bearbeitet werden. Diese Aufgabe kann aber auch später, z.B. im Kapitel 8 (beim Einüben der Buchungssätze) von denjenigen Lernenden bearbeitet werden, welche die Buchungssätze schneller beherrschen.
3.1 à Wer ist an den finanziellen Informationen einer Unternehmung interessiert? Verbindung zum Unternehmungsmodell
3.2 à Internetrecherche zu den Begriffen «Doppelte Buchhaltung», «Bilanz» und «Erfolgsrechnung», Übersicht auf Seite 13 ergänzen (oder Lehrvortrag)
Zu diesem Kapitel passt die Frage, ob man eine Buchhaltung auch einfacher führen kann bzw. darf. Die Vor- und Nachteile der Milchbüechli-Rechnung können mit der Aufgabe 3 bearbeitet werden.
Übungen – zur Kontrolle
3.1 Wer ist an finanziellen Informationen interessiert?
3.2 Aussagen zum Rechnungswesen – alles richtig?
3.3 Gesetzliche Vorschriften zum Rechnungswesen
3.4 Art. 957ff. OR
3.5 Fibu und Bebu
Thema / Inhalt
4 Bilanz und Erfolgsrechnung –
Zwei Abschlussrechnungen in jeder Buchhaltung 14
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
n Die finanzielle Lage von Giulias Familie
Bilanz und Erfolgsrechnung am Beispiel von Giulias Familie einführen (Begriff Erfolgsrechnung ist nicht ganz korrekt, hier ist es eine Einnahmen- und Ausgaben-Rechnung
4.1 à Vorstellung der finanziellen Lage einer Familie, Begriff Nettovermögen einführen. Begriffe können auch im Glossar/Lernkarten nachgeschlagen werden
n Bilanz
n Erfolgsrechnung
Lehrvortrag Bilanz und Erfolgsrechnung
4.2 à Fehlerhafte Bilanz korrigieren
Übungen – zur Kontrolle
4.1 Fachausdrücke Ford L+L (Deb) und Verb L+L (Kred)
4.2 Gliederung von Bilanz und Erfolgsrechnung
4.3 Aussagen zu Bilanz und Erfolgsrechnungen
5 Konto – Grundbaustein für die doppelte Buchhaltung ............. 18 n Geschäftsfälle verändern die Bilanz und die Erfolgsrechnung
Für jede Position der Bilanz und der Erfolgsrechnung wird ein «Konto» als laufende Rechnung geführt
n Konto – die zentrale Datenstruktur in der Buchführung
5 à Aufbau eines Kontos am Beispiel Bankkonto von Giulia einführen (z.B. am Visualizer)
Übungen – zur Kontrolle
5.1 Kontoführung Geschäftskasse
5.2 Geschäftskasse – wo steckt der Fehler?
6 Vier Kontenarten – Aktiv, Passiv, Aufwand und Ertrag ............ 20 Die vier Kontoarten im Lehrvortrag erläutern (z.B. am Visualizer)
6.1 à Bilanzkonten mit S (Soll) und H (Haben), + (plus) und – (minus) ergänzen
6.2 à Erfolgskonten mit S (Soll) und H (Haben), + (plus) und – (minus) ergänzen
Übungen – zur Kontrolle
6.1 Skizze zu den Buchungsregeln
6.2 Welche Buchungsregeln gelten für welche Kontenarten?
6.3 Geschäftsfälle in Konten eintragen – Auswirkung auf Saldo?
Thema / Inhalt
7 Kontenrahmung und Kontenplan –
Gliederung der 4 Kontenarten 21
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
n Ein Kontenrahmen als «Menükarte» für die Buchhaltung
7.1 à Systematik der Kontenklassen mit Eintrag der Zwischenresultate (Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Jahresgewinn) begründen. Wir verwenden konsequent Jahresgewinn statt Reingewinn, um nicht einen zusätzlichen Begriff einzuführen.
n Kontenbezeichnungen, Abkürzungen und Beispiele
7 2 à Definition der Abkürzungen (Lehrvortrag mit Hinweis auf Beispiele) Wir verwenden konsequent Ford L+L (Deb) und Verb L+L (Kred) statt FLL und VLL. Vor allem die leistungsschwächeren Lernenden können sich bei der vollen Aussprache die Bedeutung dieser Kontenbezeichnungen schneller merken.
In jedem Lernmodul verwenden wir den gleichen, umfassenden Auszug aus dem Kontenrahmen KMU, wobei die im jeweiligen Lernmodul typischen Konten farbig markiert sind. Auf der Seite 24 kann im Lehrvortrag nochmals auf den Unterschied Kontenrahmen und Kontenplan hingewiesen werden.
Übungen – zur Kontrolle
7.1 Kontenrahmen oder Kontenplan?
7.2 Gliederungssystematik des Kontenrahmens
7.3 In welche Konten gehören die Geschäftsfälle?
7.4 Kontenklassen
Thema / Inhalt
Geschäftsfälle verbuchen
In den Kapiteln 8, 9 und 10 wird die Verbuchung von Geschäftsfällen schrittweise eingeübt. Wir verwenden dabei die gleiche Farblegende wie die Bildungswebsite buchen.ch. Zusammen mit der Firma Künzler Sutter haben wir auf der Website bookyto.ch unser Einführungsbeispiel Giulias Glacé-Mobil (Seite 28) entwickelt. Die Wissensstrukturen der Lehrmittelreihe Brennpunkt Rechnungswesen sind damit auf die vielen Anwendungen auf buchen.ch und bookyto.ch abgestimmt. Die Lernenden finden dort viele zusätzliche individuelle Übungsmöglichkeiten.
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
Geschäftsfälle verbuchen, vielgestaltig und im eigenen Tempo intensiv üben. Wer den Buchungssatz sicher beherrscht, kann Aufgaben zur Vertiefung und Vernetzung bearbeiten.
8 Vom Geschäftsfall zum Buchungssatz....................................... 25 n Vom Geschäftsfall zum Buchungssatz in drei Schritten
Seite 25 im Lehrvortrag erläutern
8.1 à Geschäftsfall 1) im Lehrgespräch, übrige in Partnerarbeit lösen
n Erfolgswirksam oder erfolgsunwirksam?
Im Lehrvortrag erläutern
8.2 à Finanzierung, Definanzierung, Aktiv- und Passivtausch im Lehrvortrag erläutern und deren Auswirkungen auf Bilanzsumme im Lehrgespräch erarbeiten.
n Liquiditätswirksam oder liquiditätsunwirksam?
Im Lehrvortrag erläutern
8.3 à Buchungssatz 1) im Lehrgespräch erarbeiten, übrige in Einzel- oder Partnerarbeit. Schülerlösung am Visualizer im Lehrgespräch erläutern
Übungen – zur Kontrolle
8.1 Begriffe rund um die Bilanz
8.2 Begriffe verstanden?
8.3 Achtung fertig, los: 1 – 2 – 3 ... Buchungssätze für Taxi24
8.4 Achtung fertig, los: 1 – 2 – 3 ... Buchungssätze für Spielwarengeschäft toy-toy
8.5 Auswirkungen auf die Bilanzsumme
8.6 Erfolgswirksam und/oder liquiditätswirksam?
8.7 Buchungssatz-Memory 1 – Welche Kontenskizzen passen zu den Geschäftsfällen?
8.8 Buchungssatz-Memory 2 – Welche Geschäftsfälle passen zu den Kontenskizzen?
8.9 Trauffer Treuhand
8.10 Fahrschule Neurauter
8.11 Nicoles Color Craft Malerwerkstatt
Thema / Inhalt
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
9 Journal und Hauptbuch ............................................................. 28 n Buchhaltungssoftware mit Buchungsmaske Im Lehrvortrag Hinweis auf Buchhaltungsprogramm
n Buchungsjournal
Im Lehrvortrag Hinweis auf Journalbuchungen
n Hauptbuch und Nebenbücher
Im Lehrvortrag Begriff Hauptbuch erklären
n Journal und Hauptbuch mit Lernsoftware «bookyto» führen
9.1 à Am Beispiel bookyto die Elemente eines Buchhaltungsprogrammes erklären: – Buchungsmaske (mit Kontenplan als Dropdown-Auswahl)
– Journal – Hauptbuch Für die Lösung der Aufgaben a) bis c) müssen die Lernenden die Gesamtübersicht im Hauptbuch nachsehen
Übungen – zur Kontrolle
9.1 Valuta
9.2 Hauptbuch
Thema / Inhalt
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
10 Auf einen Blick – Das System der doppelten Buchhaltung ........ 30 n Eröffnungsbilanz (Saldovorträge)
n Journalbuchungen
n Schlussbilanz 1 (doppelter Erfolgsausweis)
n Schlussbilanz 2 (Eigenkapital nach Erfolgsverwendung)
10.1 à System der doppelten Buchhaltung auf einer A3-Seite (Seite 30 und 31) erläutern (Lernplakat im Schulzimmer aufhängen)
n Zwei Optionen zur Gewinnverwendung
10.2 à Option 1: Gewinn in der Unternehmung behalten
Option 2: Gewinn ausbezahlen
n Zwei Optionen zur Verlustdeckung
10.3 à Option 1: Verlust durch zusätzliche Vermögenseinlage decken
Option 2: Verlust mit dem Eigenkapital verrechnen (Kapitalschnitt)
n Ein Geschäftsjahr im Überblick: Malergeschäft Jana Tanner
10.4 à Von der Eröffnungsbilanz bis zur Schlussbilanz 2
Übungen – zur Kontrolle
10.1 Das System der doppelten Buchhaltung
10.2 Gewinnverwendung – Verlustdeckung
Thema / Inhalt
Unternehmerische Entscheide
Mit der Einführung zu Abschreibungen und vier einfachen Kennzahlen können unternehmerische Entscheide anhand von einfachen Bilanzen und Erfolgsrechnungen thematisiert werden.
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
11 Wie viel soll, muss oder darf man abschreiben? ....................... 34 n Jahresrechnung Giulias Glacé-Mobil
11.1 à Finanzielles Ergebnis von Giulias Geschäftsmodell beurteilen
11.2 à Vermögenswerte analysieren (Wertverminderung im Anlagevermögen)
11.3 à Ursachen von Wertverminderungen
11.4 à Verbuchungen von Wertverminderungen
11.5 à Formel für Berechnung der jährlichen Abschreibungsbeträge
11.6 à Allgemeine Formel
11.7 à Welchen Betrag soll Giulia abschreiben? Gesetzliche Vorschriften?
11.8 à Abschreibungstabelle in Excel erstellen, Begriff Buchwert einführen n Zusammenhang Abschreibungen – Liquidität – Ersatzanschaffungen Im Lehrvortrag erläutern
Übungen – zur Kontrolle
11.1 Netzwerkdarstellung Abschreibungen
11.2 Fahrradverleih – wie hoch sollen die Abschreibungen sein?
Thema / Inhalt
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
12 Fragen zu Liquidität, Rendite und Sicherheit ........................... 38 Anhand der Kennzahlen zu Liquidität, Rendite und Sicherheit lassen sich einfache Bilanzen und Erfolgsrechnungen beurteilen
n Liquidität: die Frage nach der Zahlungsbereitschaft
Formel: Liquiditätsgrad 2
n Rendite: die Frage nach dem Gewinn
Formel: Eigenkapitalrendite
n Sicherheit: die Frage nach der finanziellen Unabhängigkeit
Formel: Eigenfinanzierungsgrad
Goldene Bilanzregel
Formel: Anlagedeckungsgrad 2
12 à Formel in die Kästchen einfüllen
Übungen – zur Kontrolle
12.1 Rendite und Cashflow
12.2 Liquidität und Sicherheit
12.3 Boutique Milano – Wie beurteilen Sie die finanzielle Lage?
Thema / Inhalt
Belege digital verarbeiten
In der Praxis muss jede Buchung mit einem Dokument belegt werden. Wer Belege digital verarbeitet, spart Kosten und kann auf mehr Information zugreifen.
Heute können Belege in Buchhaltungsprogrammen einfach eingelesen und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz automatisch verbucht werden
13 Keine Buchung ohne Beleg ......................................................
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
40 n Verschiedene Arten von Belegen und Quittungen
Quittungen als Belege
Eigenbeleg für Abschreibungen
n Kontierungsstempel – so verbucht man Belege
13 à Beleg kontieren
Übungen – zur Kontrolle
13.1 Vom Umgang mit Belegen
13.2 Belege kontieren – Gasthof Kreuz
Thema / Inhalt
Überlegungen zu einem möglichen Ablauf Lektionen
14 So geht Buchhaltung in der Praxis – mit Swiss21 .................... 38 5 n Dashboard swiss21.org
14.1 à Registration für persönlichen Swiss21-Account mit eigener-Mail-Adresse n Dashboard 21.AbaNinja
14.2 à 21.AbaNinja aktivieren
14.3 à Dashboard 21.AbaNinja anpassen
n So bucht man manuell in Swiss21
Die beiden Varianten Journal und Kontoauszug im Lehrvortrag erklären
n Lieferantenbelege digital verarbeiten
14.4 à Erklärvideo 21.AbaNinja ansehen und Flussdiagramm ergänzen
14.5 à Freigabeprozesse von Belegen erläutern
n So kann die Bilanz in 21.AbaNinja aussehen
14.6 à Einstellungsoptionen der Bilanzdarstellung notieren
n So kann die Erfolgsrechnung in 21.AbaNinja aussehen
14.7 à Darstellungsoptionen der Erfolgsrechnung notieren
n Darstellung des Erfolgs in Bilanz und Erfolgsrechnung in 21.AbaNinja
14.8 à Negatives Vorzeichen bei Gewinn in der Bilanz
14.9 à Positives Vorzeichen bei einem Verlust in der Bilanz
Übungen – zur Kontrolle
14.1 Giulias Glacé-Mobil – mit Swiss21
14.2 Schreinerei Koller – digitale Verarbeitung von Lieferantenbelegen mit Swiss21
Umschlag: Adobe Stock / tiero Umschlag Innenseite: Adobe Stock / MR

Auszug aus dem Schweizer Kontenrahmen KMU (für kleine und mittlere Unternehmen)
Aktiven BILANZ vom 31.12.2025
Passiven Aufwände
Farbig markiert: Typische Konten für RW für EFZ 1 – Grundlagen des Rechnungswesens
ERFOLGSRECHNUNG 01.01. – 31.12.2025 Erträge
1 AKTIVEN 2 PASSIVEN 4 Aufwand für Material, Handelswaren und 3 BETRIEBSERTRAG 10 Umlaufvermögen (UV) 20 Kurzfristiges Fremdkapital Dienstleistungen aus Lieferungen und Leistungen 100 Flüssige Mittel und Wertschriften 200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen 4000 Materialaufwand (Produktion) 3000 Produktionsertrag 1000 Kasse 2000 Verbindlichkeiten aus L+L (Kreditoren) 4200 Warenaufwand (Handelswarenaufwand) 3200 Warenertrag (Handelswarenertrag) 1010 Postfinance (Kontokorrent-Guthaben) 2001 Verbindlichkeiten aus L+L in Fremdwährung 4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen 3400 Dienstleistungsertrag 1020 Bank (Kontokorrent-Guthaben) 2030 Erhaltene Anzahlungen (von Kunden) 4500 Energieaufwand zur Leistungserstellung (Produktion) 3410 Transportertrag 1021 Bank (Fremdwährung) 2031 Mietzinskaution (Mietzinsdepot) 4800 Bestandesänderungen Handelswaren 3420 Honorarertrag 1022 Kapitaleinzahlungskonto 210 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 4906 Kursdifferenzen
3600 Übriger Betriebsertrag 1023 Mietzinskautionskonto 2100 Bank (Kontokorrent-Schuld) 3700 Eigenleistungen 1060* Wertschriften UV (mit Börsenkurs) 2101 Postfinance (Kontokorrent-Schuld) 5 Personalaufwand 3710 Eigenverbrauch 1091 Lohndurchlaufkonto 2111 WIR-Verbindlichkeiten 5000 Lohnaufwand
38 Erlösminderungen 1099 Unklare Beträge 2140 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 5700 Sozialversicherungsaufwand
3800 (–) Gewährte Skonti 110 Forderungen 220 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 5800 Übriger Personalaufwand
3801 (–) Gewährte Rabatte und Preisnachlässe 1100* Forderungen aus Lief. und Leist. (Debitoren) 2200 Umsatzsteuer (Geschuldete Mehrwertsteuer)
3802 (–) Rückvergütungen 1101* Forderungen aus Lief. und Leist. (Fremdwährung) 2201 Abrechnungskonto Mehrwertsteuer 6 Übriger Betriebsaufwand, Abschreibungen und 3803 (–) Provisionen an Dritte 1103 Forderungen Kartenorganisationen 2206 Geschuldete Verrechnungssteuer Finanzergebnis
3804 (–) Inkassospesen (Mahngebühren) 1109 (–) Wertberichtigung Forderungen (Delkredere) 2208 Direkte Steuern 6000 Raumaufwand (Mietaufwand)
3806 Kursdifferenzen 1120 Forderungen gegenüber Aktionären 2261 Gewinnausschüttungen an Aktionäre (Dividenden) 6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
3805 (–) Verluste aus Forderungen (Debitorenverluste) 1140 Vorschüsse und Darlehen 2262 Gewinnausschüttungen an Verw.rat (Tantièmen) 6105 Leasingraten für Produktionsanlagen
3809 (–) MWST-Saldosteuersatz 1170 Vorsteuer Mat., Waren, Dienstl., Energie (Kl 4) 2264 Kontokorrent gegenüber Gesellschafter/Aktionär A 6200 Fahrzeugaufwand 3860 (–) Veränderung Garantierückstellung 1171 Vorsteuer Investit. und übr. Betr-Aufw (Kl 1/5–8) 2265 Kontokorrent gegenüber Gesellschafter/Aktionär B 6260 Leasingraten für Fahrzeuge 39 Bestandesänderungen 1174 Vorsteuerkorrektur Eigenverbrauch 2270 Kontokorrent Sozialversicherungen 6300 Versicherungsaufwand, inkl. Gebühren, Bewilligungen 3900 Bestandesänderungen unfertige Erzeugnisse 1176 Forderung Verrechnungssteuer 230 Passive Rechnungsabgrenzungen 6400 Energieaufwand, inkl. Entsorgungsaufwand 3901 Bestandesänderungen fertige Erzeugnisse 1190 WIR-Guthaben (Transitorische Passiven) und Rückstellungen 6500 Verwaltungsaufwand 3940 Best.änderungen unfakturierte Dienstleistungen 1192 Geleistete Anzahlungen 2300 Noch nicht bezahlter Aufwand (Trans. Passiven) 6550 Gründungsaufwand 1193 Mietzinskaution (Mietzinsdepot) 2301 Erhaltener Ertrag des Folgejahres (Trans. Passiven) 6570 Informatikaufwand 120 Vorräte und nicht fakturierte Leistungen 2330 Kurzfristige Rückstellungen 6551 Inkassospesen (Factoring-Gebühren) 1200* Warenbestand (Vorräte Handelswaren) 24 Langfristiges Fremdkapital 6600 Werbeaufwand 1210* Rohmaterialbestand (Vorräte Rohstoffe) 240 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 6700 Sonstiger Betriebsaufwand 1260* Fertigfabrikatebestand (Vorräte Fertigfabrikate) 2430 Obligationenanleihen 6800 Abschreibungen 1270* Halbfabrikatebestand (Vorrräte Halbfabrikate 2450 Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 6900 Finanzaufwand, inkl. Zinsaufwand 1280* Nicht fakturierte Dienstleist. (angef. Arbeiten) 2451 Hypothekarschulden 6942 Wertschriftenaufwand
130 Aktive Rechnungsabgrenzungen (TA) 2600 Langfristige Rückstellungen 6950 (–) Finanzertrag, inkl. Zinsertrag) 1300 Bezahlter Aufwand des Folgejahres (Trans. Aktiven) 28 Eigenkapital 6952 Wertschriftenertrag 1301 Noch nicht erhaltener Ertrag (Trans. Aktiven) Eigenkapital Einzelunternehmung
14 Anlagevermögen (AV) 2800 Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres
140 Finanzanlagen 2850 Privat
1400* Wertschriften AV 2891 Jahresgewinn / Jahresverlust
1440 Aktivdarlehen Eigenkapital Personengesellschaft
7 Betriebliche Nebenerfolge
7000 Ertrag Nebenbetrieb
7010 Aufwand Nebenbetrieb
75 Erfolg aus betrieblichen Liegensch. (Immobilienerfolg)
7500 Immobilienertrag (Ertrag betriebliche Liegenschaft) 1441 Hypothekarforderungen (Kollektivgesellschaft / Kommanditgesellschaft)
7510 Immobilienaufwand (Aufwand betriebliche Liegenschaft) 1480* Beteiligungen 2800 EK Gesellschafter A zu Beginn des Geschäftsjahres
8 Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger
150 Mobile Sachanlagen 2801 EK Gesellschafter B zu Beginn des Geschäftsjahres oder periodenfremder Aufwand und Ertrag 1500* Maschinen und Apparate 2820 Privat Gesellschafter A
8000 Betriebsfremder Aufwand 1507 Produktionsanlagen im Leasing 2821 Privat Gesellschafter B
8100 Betriebsfremder Ertrag 1509* (–) Wertberichtigung Maschinen und Apparate 2891 Jahresgewinn / Jahresverlust
8500 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand 1510* Mobiliar und Einrichtungen Eigenkapital juristische Person 8510 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 1520* Büromaschinen (inkl. Informatik) (Aktiengesellschaft /GmbH, Genossenschaf, Stiftung) 8900 Direkte Steuern (juristische Personen) 1530* Fahrzeuge 280 Grundkapital 9 Abschluss / Hilfskonten (kursiv, in Klammern): 1537 Fahrzeuge im Leasing 2800 Aktienkapital / Stamm-, Anteilschein-, Stiftungskapital 9000 Erfolgsrechnung Früher gebräuchliche Kontenbezeichnungen 1540* Werkzeuge und Geräte 2810 Partizipationskapital 9100 Bilanz 160 Immobile Sachanlagen 290 Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust 9200 Gewinn oder Verlust (G/V) gemäss Erfolgsrechnung
Gliederungssystematik des Kontenrahmens 1600* Immobilien (Geschäftsliegenschaften) 2900 Gesetzliche Kapitalreserve (Agio) 9980 Durchlaufkonto
1660* Betriebsfremde Liegenschaften 2960 Freiwillige Gewinnreserven
170 Immaterielle Werte 2970 Gewinnvortrag / Verlustvortrag
1700* Patente und Lizenzen 2979 Jahresgewinn / Jahresverlust
1770* Goodwill 2980 (-) Eigene Aktien/Stamm-Ant./Ant.-Scheine/Part.-Kap.
180 Nicht einbezahltes Grundkapital
1850 Nicht einbezahltes Aktienkapital
1 Kontenklasse Aktiven
Nr. Ebene Beispiel 1606* Umbau Geschäftsliegenschaft 2950 Gesetzliche Gewinnreserven (Reserven) * Für diese Aktivkonten kann ein eigenes Wertberichtigungskonto geführt werden, auf welchem die Summe der bisherigen Abschreibungen ersichtlich ist. Diese Wertberichtigungskonten besitzen in der Regel die Endziffer 9, sind eigentlich Passivkonten und werden als Minus-Aktivkonten (–) aufgeführt.
10 Kontenhauptgruppe Umlaufvermögen
100 Kontengruppe Flüssige Mittel
1000 Einzelkonto Kasse
