Sudetendeutsche Zeitung



Scharfe Kritik an der „schengenwidrigen und permanenten Verlängerung von Kontrollen an den Binnengrenzen im Herzen Europas“ hat der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der PaneuropaUnion Deutschland, der ehemalige Europaabgeordnete Bernd Posselt, geübt.
Bayern, die Tschechische Republik und Österreich seien seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Einbeziehung aller drei Staaten in das Schengener Abkommen wieder zu dem zusammengewachsen, „was sie in der Geschichte waren, nämlich zu einem gemeinsamen Kulturund Lebensraum“, so der ehemalige Europaabgeordnete.
Diese Heimat in der Mitte Europas dürfe nicht „durch nationalstaatliche Willkür zerstückelt werden. Diese Mahnung geht an Berlin, Prag und Wien“, stellt Bernd Posselt klar.
Es ist ein Domino-Effekt, der das Schengen-Abkommen derzeit de facto außer Kraft setzt. Zunächst hatte Tschechiens Innenminister Vít Rakušan (Stan) erklärt, an der Grenze zur Slowakei wieder Personenkontrollen durchzuführen, um die Einreise von illegalen Flüchtlingen zu verhindern.
Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) reagierte sofort und wies seine Beamten an, die Grenze zur Slowakei ebenfalls stärker zu überwachen. Der Grund: In Wien befürchtete man eine Verschiebung der über Tschechien Richtung Deutschland verlaufenden Schlepperroute nach Österreich.

Auf diese Entwicklung reagierte postwendend auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und entschied, sowohl an der österreichischen als auch an der tschechischen Grenze die Schleierfahndung zu intensivieren. Gleichzeitig kritisierte Hermann den Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen als „mangelhaft“ und sagte, er rechne vermehrt mit der Einreise von illegalen Flüchtlingen über die Westbalkanroute.

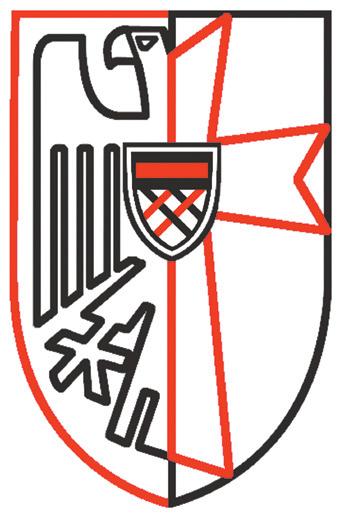
Nach dem Schengen-Abkommen, dem neben Deutschland, Österreich und Tschechien 23 weitere europäische Staaten beigetreten sind, dürfen Grenzkontrollen eigentlich nur noch an der EU-Außengrenze stattfinden. Seit der Flüchtlingskrise 2015 hat Deutschland aber nicht nur die Schleierfahndung verstärkt, sondern schengenwidrig stationäre Grenzkontrollen zu Österreich eingeführt. So wird seit Jahren am Autobahngrenzübergang Kufstein–Kiefersfelden jedes Auto bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert – was oft zu kilometerlangen Staus führt –, während es auf der parallel verlaufenden Landstraße keine stationären Grenzkontrollen mehr gibt.
Es ist ein historisches Foto, Sinnbild der europäischen Geschlossenheit gegen den Völkermörder Wladimir Putin. Auf Initiative von Tschechiens Premierminister Petr Fiala haben sich am 6. Oktober die höchsten Vertreter der europäischen Länder, des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission auf der Prager Burg zum ersten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft getroffen.

Mit der Europäischen Politischen Gemeinschaft hat Tschechien seine EU-Ratspräsidentschaft genutzt, um eine Plattform auf höchstem Niveau für informelle Debatten zwischen Vertretern demokratisch gesinnter europäischer Länder über zentrale Fragen des europäischen Kontinents zu schaffen. Weitere Treffen sind bereits in Chisinau, in Spanien und im Vereinigten Königreich geplant.
Hauptthemen des ersten Gipfels, auf dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi per Videokonferenz sprach, waren die aktuellen europäischen Probleme, die vor allem durch die russische Aggression in der Ukraine, die hohen Energiepreise und die illegale Migration verursacht werden.
Zum Auftrakt sagte der Gastgeber und Initiator, Tschechiens Premierminister Petr Fiala: „Europa ist derzeit mit vielen komplexen Problemen konfrontiert, und wir sind hier zusammengekommen, um Lösungen für diese Probleme zu diskutieren. Das schwerwiegendste Problem ist, daß es unter einem Angriffskrieg leidet. Rußland setzt seine ungerechte Aggression gegen die
Ukraine fort, und Wladimir Putin ist nicht verhandlungsbereit.


Sein einziges Ziel ist die Eroberung des Landes. Die Schritte, die Rußland letzte Woche unter-
nommen hat, bestätigen dies einmal mehr. Die Abhaltung von Referenden in den besetzten Gebieten ist ein schmutziger Trick und kann von der internationalen Ge-


meinschaft nicht ernst genommen werden.“
Man sei auf der Prager Burg zu einem Zeitpunkt zusammengekommen, „an dem ohne Über-

treibung über die Zukunft des europäischen Kontinents entschieden wird“, mahnte Fiala und erklärte: „Wir sind zu einem Zeitpunkt zusammengekommen, an dem der russische Angriffskrieg unsere gemeinsame Sicherheit und Stabilität bedroht. Es ist ein großer Erfolg, daß 44 europäische Partner, die gemeinsame Lösungen finden und zusammenarbeiten wollen, hierher gekommen sind, um dieses Thema zu erörtern.“
Im Laufe des Treffens habe man in Plenarsitzungen, thematischen Rundtischgesprächen und bilateralen Treffen über Frieden und Stabilität, Migration, Energiesicherheit und die europäische Wirtschaft diskutiert, so Fiala: „Unser gemeinsames Ziel ist es, zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit, die Stabilität und den Wohlstand Europas als Ganzes zu stärken.
Neben den gemeinsamen Sitzungen fand während des Gipfels auch eine Reihe bilateraler Treffen zwischen den Teilnehmern statt. Im Laufe des Tages traf Premierminister Petr Fiala mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sowie mit dem ukrainischen Premierminister Denys Shmyhal zusammen.
Zu den wichtigen Treffen gehörte beispielsweise das separate Treffen des türkischen Präsidenten Erdoğan mit dem armenischen Premierminister Nikola Pashinyan und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, Vertretern zweier seit langem verfeindeter Staaten.

Zu den ältesten Freunden des SL-Büroleiters in Prag und natürlich auch der gesamten Arbeit, die diese „sudetendeutsche Botschaft an der Moldau“ seit zwei Jahrzehnten leistet, gehört eindeutig Karel Pažourek aus der Pfarrei „Schwester Restituta“ im Brünner Vorort Lesná (Waldviertel).
Als sich die Kirchgänger dieser Plattenbausiedlung im Jahr 2014 wiederholt um den Bau ihrer neuen Kirche bemühten, hat-

te Pažourek die Idee, in dieser Angelegenheit das Sudetendeutsche Büro zu besuchen. SL-Büroleiter Peter Barton kontaktierte verschiedene Stellen in Politik und Kirche, die dabei behil ich sein könnten. Nicht alle waren bereit hier aktiv zu werden, letztendlich aber gelang das gute Werk.
Pažourek, der trotz seines jugendlichen Aussehens inzwischen sogar Urgroßvater geworden ist, begegnete Barton in Brünn, wo dieser sich auf einer Privatreise befand,
und lud ihn spontan ein, um über eine weitere Zusammenarbeit zu sprechen. Und wo sonst hätte es zu dieser Begegnung kommen können, wenn nicht vor der Restituta-Kirche?
Vielleicht war es doch mehr als nur ein Zufall, daß Pažourek damals bei Barton anrief, um über die Pläne seiner Pfarrei zu sprechen und auch über seinen Wunsch, die neuen Kirche in seinem Stadtviertel noch zu erleben.
In der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen findet auch in diesem Herbst in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband die traditionelle Seminarwoche statt.
U
nter dem Motto „Geschichte und Politik, Erinnerung
Sonntag, 6. November 19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung. 19.30 bis 22.00 Uhr: Prof. Dr. Stefan Samerski, Theologe, Priester und Kirchenhistoriker: „Franziskus und Kyrill – Von den Schwierigkeiten päpstlicher Friedensvermittlung in der Ukrainekrise“.
Montag, 7. November 9.00 bis 10.30 Uhr: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor: „Die Sudetendeutschen: Volksgruppe mit Zukunft“. 10.45 bis 12.15 Uhr: Petra Laurin, Journalistin, und Monika Hanika, Systemische Familientherapeutin: „Zweisprachigkeit in Kindheit und Jugend als Voraussetzung zur Überwindung von Grenzen“.
14.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe und Medienpädagoge: „Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung“.
16.00 bis 17.30 Uhr: Mathias Heider, Historiker (online): „Das Internet als neue Heimat? Chancen und Möglichkeiten beim Aufbau digitaler sozialer Netzwerke“.
Nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Pause im Bayerischen Hauptstaatsarchiv konnten jetzt neue Findmittel der Bestände des Sudetendeutschen Archivs übergeben werden.
Nicht weniger als 26 Bestände mit rund 2000 Archiveinheiten können nun recherchiert werden. Einige der Bestände hatte noch der am 6. Dezember 2021 verstorbene Dr. Helmut Demattio erarbeitet. Dessen Nachfolgerin ist seit 1. April 2022 Christine Kobler.
Letztmalig war der für das Sudetendeutsche Archiv zuständige Leiter der Abteilung V im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Thomas Paringer, dabei, der mittlerweile als Direktor des niederbayerischen Staatsarchivs nach Landshut gewechselt hat. Raimund Paleczek und Mathias Heider vom Sudetendeutsche In-
und Zukunft“ steht die zweiteilige Seminarwoche von Sonntag, 6. bis Dienstag, 8. November unter dem Fokus Ost- und Südosteuropa und von Dienstag, 8. November bis Freitag, 11. November unter dem Leitthema „Deutschland und Tschechien“ (Seminarprogramm siehe unten). Geleitet wird die Semiarwoche von Stiftungsdirektor Steffen
Hörtler und von Hildegard Schuster, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband.
Referenten sind in diesem Jahr Prof. Dr. Stefan Samerski, Petra Laurin und Monika Hanika, Prof. Dr. Franz Josef Röll, Mathias Heider, Dr. Raimund Paleczek, Dr. Jens Baumann und Prof.
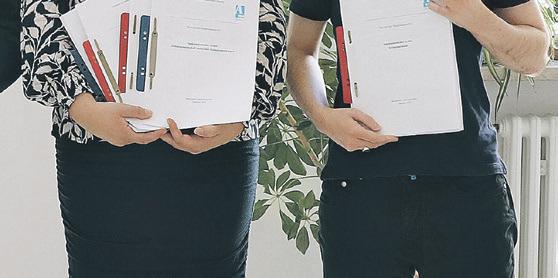


19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages. Dienstag, 8. November 9.00 bis 10.30 Uhr: Dr. Raimund Paleczek, Historiker: „Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie“.
10.15 bis 12.15 Uhr: Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen: „Vertriebenenpolitik in den östlichen Bundesländern am Beispiel Sachsen“.
13.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Helmut Altrichter, Hochschullehrer: „Krieg der Erinnerungen. Geschichte und Geschichtsbilder in Rußland und der Ukraine 1991 bis 2022“.
15.40 bis 16.10 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion.
Dienstag, 8. November 19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung.
19.30 bis 21.30 Uhr: Jan Polák, Historiker: „Warum nur? Alte Klischees und Vorurteile über den Nachbarn in den Nach-
kriegsgenerationen in Deutschland und der Tschechischen Republik“.
Mittwoch, 9. November
9.00 bis 10.30 Uhr: Jan Blažek, Autor und Dokumentarist der Nichtregierungsorganisation „Post Bellum“: „Zeitzeugenprojekte: Orte des nationalen Gedächtnisses“.
10.45 bis 12.15 Uhr: Ingrid Sauer, Archivarin, Bayerisches Hauptstaatsarchiv: „Informationsquellen zum politisch-kulturellen Erbe der Sudetendeutschen“.
14.00 bis 15:30 Uhr: Prof. Dr. Katrin Boeckh, Hochschullehrerin, IOS Regensburg/LMU München: „Geschichte und Emotionen. Tätigkeitsfelder der Forschungsstelle Kultur und Erinnerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“.
16.00 bis 17.30 Uhr: Ulrich Rümenapp: „Die Ost-West-Jugendakademie – Ein best-practice-Beispiel einer Veranstaltungsreihe für Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien“.
19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.
Donnerstag, 10. November 9.00 bis 12.30 Uhr: Werner Ho-
Dr. Helmut Altrichter, Jan Polák, Jan Blažek, Ingrid Sauer, Prof. Dr. Katrin Boeckh, Ulrich Rümenapp, Werner Honal, Dr. Veronika Hofinger, Alfred Wolf, Martin Dzingel und Christina Meinusch.
Anmeldung und weitere Informationen unter www.sudeten.de und www. heiligenhof.de
nal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher: „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“.
14.00 bis 15.30 Uhr: Dr. Veronika Hofinger, Centrum Bavaria Bohemia e.V.: „Das Grüne Band Europas – eine Landschaft mit Gedächtnis“.
16.00 bis 17.30 Uhr: Alfred Wolf, Vorsitzender Via Carolina-Goldene Straße e.V.: „Erinnerungs- und Versöhnungskultur am ehemaligen Dorf Paulusbrunn im böhmischen Wald“.
19:00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.
Freitag, 11. November
9.00 bis 10.30 Uhr: Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in Tschechien: „Gedenkstätten der Deutschen in der Tschechischen Republik als lebendige Kultur“.
10.30 bis 11.30 Uhr: Christina Meinusch, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Ein Bild von Heimat – Ausstellungsprojekt in Kooperation mit der Museologie an der Universität Würzburg“.
11.45 bis 12.15 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion und Seminarbilanz.
stitut e.V., dem Eigentümer des sudetendeutschen Archivgutes, dankten für die eindrucksvolle Arbeit.
Die neu erschlossenen Bestände mit den jeweiligen Archiveinheiten (AE).
Sammlungen: Bodenschätzungsunterlagen Karlsbad (28 AE), Domstadtl (22 AE), Hebammenbücher aus Reitendorf, Informations- und Übersetzungsdienst (182 AE), Juden in Böhmen (Slg. Inge Busl;19 AE), Kleinere Sammlungen (Slg. Bergesgrün, Heimatstube Immenstadt, Heimatforschung Dauba), Tonarchiv (452 AE; Bestand ist digitalisiert)m Sudetendeutsches Filmwerk (93 AE; Bestand ist digitalisiert), Zwittauer Heimatstube in Esslingen (100 AE)
Verbandsschriftgut:
Adalbert Stifter Verein (184 AE), Lodgman Stiftung (24 AE), kleinere Verbände, wie Förder-
verein St. Maurentzen im Böhmerwald und ARGE Kulturelle Heimatsammlungen (32 AE) sowie Heimatkreis Friedek-Mistek (20 AE)
Vor- und Nachlässe: Rüdiger Goldmann (66 AE), Roland Hoffmann (39 AE), Ernst

Leibl (90 AE), Dieter Max (106 AE), Werner Nowak (91 AE), Franz Pany (30 AE), Otfrid Pustejovsky (54 AE), Roland Schnürch (30 AE), Günter Reichert (139 AE), Heinzel-Göldner-Baumann (56 AE), Ginzel (23 AE) und Jouili-Wiatschka (23 AE).
er Vorsitzende der Gewerkschaftskonföderation, Josef Sředula, hat bei einer Demonstration auf dem Prager Wenzelsplatz die Regierung von Premierminister Petr Fiala stark kritisiert und mehr staatliche Unterstützung im Kampf gegen die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise gefordert. Sředula ist einer der Kandidaten, die sich im Januar um die Nachfolge von Staatspräsident Zeman bewerben. An der Kundgebung, zu der die Böhmisch-Mährische Konföderation der Berufsverbände aufgerufen hatte, nahmen am Samstag mehrere tausend Bürger teil.
Die Nationale Philharmonie Lemberg wird am 14. Dezember im Prager O2-Universum die Filmvorstellung „Herr der Ringe: Die Gefährten“ begleiten. Der Film von Regisseur Peter Jackson wird mit Musik des Oscar-Komponisten Howard Shore in der Originalfassung mit tschechischen Untertiteln gezeigt. Die Philharmonie Lemberg wird der Schweizer Dirigent Ludwig Wikki leiten. Die Philharmoniker aus Lemberg begehen in diesem Jahr das 120. Jubiläum. Sie studierten den ersten Teil der Filmserie für eine feierliche Vorstellung ein, die im Februar 2023 in der New Yorker Radio City Hall veranstaltet wird. In Prag findet die Vorpremiere aus Solidarität für die mehr als 90 Musiker aus der Ukraine statt.
Außenminister Jan Lipavský (Piraten) und weitere tschechische Politiker haben die Verleihung des Friedensnobelpreises an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljatzki, die russische Organisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties gewürdigt. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Markéta Pekarová Adamová (Top 09) sagte, sie unterstütze schon lange die Aktivitäten von Memorial und habe erst vor kurzem der Organisation eine Villa des Abgeordnetenhauses zur Verfügung gestellt. Der Vizevorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Abgeordnetenhauses, Jaroslav Bžoch (Ano), erklär-
te, er sehe in der Auszeichnung an die Menschenrechtler auch eine Botschaft an die verfolgten Bürger in Belarus und in Rußland, daß sie nicht vergessen werden.
Um die illegale Migration einzudämmen, ist der tschechische Innenminister Vít Rakušan (Stan) nach Griechenland und Zypern gereist. Auf Zypern unterzeichnete Rakušan ein Abkommen, wonach Tschechien die Insel mit 25 Millionen Kronen (1 Million Euro) unterstützt, um abgelehnte Asylbewerber in deren Heimat zu überführen. In Griechenland kündigte Rakušan an, daß sich Tschechien noch während der EU-Ratspräsidentschaft bemüht, die Migrationswelle auf EU-Ebene zu lösen.
Starkes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Das tschechische Kabinett unter Führung von Premierminister Petr Fiala wird am 31. Oktober nach Kiew reisen und dort gemeinsam mit den ukrainischen Regierungsmitgliedern tagen. Themen werden die Folgen des russischen Angriffskriegs und der Wiederaufbau der Ukraine sein, hat Prags Regierungssprecher Václav Smolka am Freitag mitgeteilt.
Ein Aushandelsdefizit von 1,1 Milliarden Euro hat die tschechische Statistikbehörde ČSÚ für August gemeldet. Demnach stieg der Export von Waren zwar im Vergleich mit dem Vorjahr um 27,9 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro, aber gleichzeitig kletterten die Ausgaben für den Import von Waren um 25,5 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Hauptfaktoren, so die Behörde, seien die drastischen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie.
I
n dieser Saison haben bereits 3,4 Millionen Besucher staatliche Baudenkmäler besichtigt –13 Prozent mehr als im Vorjahr. Touristenmagnet Nummer eins ist erneut das Schloß Eisgrub, so das nationale Institut für Denkmalpflege.
ISSN 0491-4546 Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich)
EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich)
Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München
IBAN: DE13 7001
7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.


Bayern hat eine großartige Po litikerin verloren, die Sudeten deutschen eine engagierte Un terstützerin: Der Tod von Barba ra Stamm hat tiefe Trauer und Bestürzung ausgelöst. Am heu tigen Freitag nimmt Bayern mit einem Trauerstaatsakt im Rah men eines Pontifikalrequiems im Würzburger Dom Abschied.
Von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Mit Barbara Stamm verband mich schon in ihren jungen Jahren als einfache Landtagsab geordnete, die sich besonders in tensiv der Europa- und der So zialpolitik widmete, eine enge und herzliche Zusammenarbeit.
Deshalb versetzte uns die Radio nachricht vom September 1987 in Begeisterung, daß Franz Josef Strauß sie als Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium auserkoren hatte. Wie sie später schmunzelnd erzählte, tat er dies mit den Worten: „Sie brauche ich für die Leberkäs-Etage.“
Unser damaliger Schirmherr hatte mit untrüglicher Sicher heit einen sehr guten Griff getan, denn aufgrund ihrer schwierigen Jugend, in der sie vieles erleben mußte, an dem andere zerbro chen wären, sowie vor dem Hin tergrund ihres tiefen christlichen Glaubens und ihrer großen Seele war „sozial“ für sie nicht nur ein politischer Begriff, sondern eine Lebenseinstellung, der sie sich mit Haut und Haar verschrieben hatte.
Unter den vielen authenti schen Politikern dieser Zeit war sie die authentischste. Bis sich dies aber herumsprach, dauer te es seine Zeit. Lachend berich tete sie von ihrem ersten Besuch in einer Gemeinde in Bayerisch Schwaben, bei dem sie Strauß vertrat. Der kernige Bürgermei ster hieß sie mit folgenden Wor ten willkommen: „Der Herr Mi nischterpräsident isch zwar verhindert, aber er hat uns sei Se
Es war eine herausragende Re de, die Barbara Stamm als Prä sidentin des Bayerischen Land tags am 15. Juli 2018 in Würz burg auf der Festveranstaltung der Sudetendeutschen Landsmannschaft gehalten hat. Die Rede macht deutlich, wie sehr Barbara Stamm aus tiefer Über zeugung die Anliegen der Ver triebenen unterstützt hat. Die Sudetendeutsche Zeitung doku mentiert die Rede in Auszügen:
Mir war es während meiner langen politischen Lauf bahn immer ein großes Anliegen, den Kontakt zu den Heimatver triebenen zu suchen und zu pfle gen.
Wenn Sie heute auf die ver gangenen Jahrzehnte zurück blicken, haben Sie zweifellos ei ne wechselvolle Geschichte vor Augen, aber auch ein jahrzehn telanges erfolgreiches Wirken. Die Sudetendeutschen, die nach Flucht und Vertreibung hierher nach Bayern gekommen sind, ha ben ihr Schicksal gemeistert und sind im Freistaat schon seit lan gem fest verankert. In der Ein ladung zur heutigen Veranstal tung stand sehr treffend, daß das zerstörte Würzburg wie kaum ei ne andere Stadt oder Region für den Wiederaufbau Bayerns steht. Dieser Erfolg ist ein großartiges Symbol für die einzigartige, ge meinsam mit den Einheimischen gelungene Integrationsleistung der Heimatvertriebenen und ih rer Nachkommen.
Der Erlaß der Verfassung von 1818 und die Ausrufung des Frei staates Bayern 1918 sind zwei Marksteine in unserer Vergan genheit, die unser Land entschei dend geprägt und den Weg zu ei nem modernen Rechts- und Ver fassungsstaat ermöglicht haben. Ab 1933 hat sich dann in furcht barer Weise gezeigt, daß all die positiven Errungenschaften kei neswegs selbstverständlich und nicht von Dauer waren. In kürze
letzten CSU-Vorstandssitzung vor ihrem Tod, also erst vor we nigen Wochen, stach sie mit ei nem temperamentvollen Diskus sionsbeitrag hervor, der alle auf horchen ließ und setzte sich nach Ende der Zusammenkunft neben mich, weil sie weiter debattieren wollte.
So hatte sie sich stets verhal ten: Mit allen geredet, über alles diskutiert und dann auch gefei ert, bis der letzte den Raum ver lassen hatte. Steife Zeremonien und inhaltsleeres Gerede haß te sie. Ich entsinne mich einer Tagung des Deutsch-Tschechi schen Gesprächsforums um die Jahrtausendwende in Hamburg, wo sie nach ungemein langwei ligen Ausführungen eines der höchsten Repräsentanten der Hansestadt Reißaus nahm und mit Milan Horáček und mir in ei ne urige Hafenkneipe fuhr, wo es eine Scholle mit gebratenem Speck und reichlich Bier gab.
kretärin gschickt.“ Aufgrund ih rer starken Persönlichkeit, ihrer unermüdliche Arbeit auf vielen
ster Zeit wurden die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Landtag abgeschafft. Das Volk war nicht mehr souverän, sondern wurde nur noch als Mas se angesehen und auch so behan delt. Der deutsche Nationalismus und Rassismus standen am An fang einer Entwicklung, die Mil lionen Menschen ihre Heimat, sehr oft auch ihr Leben kosteten. Zu den schrecklichsten Folgen gehörten für unser Volk am Ende die Erfahrungen von Flucht und Vertreibung. Welches Leid, wel che Entbehrungen und welche Trauer sich hinter den Millionen Einzelschicksalen verbergen, ist kaum zu ermessen. Über Nacht mußten die Menschen Haus und Hof verlassen, mußten alles zu rücklassen, was sie sich über vie le Generationen hart erarbeitet hatten. Sie verloren ihre heimi sche Umgebung, ihr vertrautes Umfeld.
Ohne Heimat sein, heißt lei den. – So hat es Schriftsteller Dostojewski einmal gesagt. Die Vertriebenen müssen dies seit langer Zeit erleben. Ihr Leid war nach der Flucht nicht zu Ende. Entwurzelt wurden sie auf Dörfer und Bauernhöfe zu völlig frem den Menschen verteilt und muß ten sich Gedanken machen, wie sie künftig ihren Lebensunterhalt verdienen sollten.
Die Integration der Millio nen Vertriebenen und Flüchtlin ge war eine immense Herausfor derung des sich neu bildenden deutschen Staatswesens nach der Katastrophe des Jahres 1945.
Im Zeichen des völligen Zusam menbruches wurden damals die Fundamente für den ebenso tief
greifenden wie erfolgreichen Neubeginn der späteren Bundes republik gelegt. Von Beginn an war dies ein Gemeinschaftswerk der Heimatverbliebenen wie der Heimatvertriebenen.
In keinem anderen Land Deutschlands ist nach dem Zwei ten Weltkrieg der Modernisie rungsschub so prägnant ausge fallen wie in Bayern. Hier fanden rund zwei Millionen Vertriebene vor allem aus dem Sudetenland, aber auch aus Schlesien und an deren Regionen Aufnahme. Für die gerade im Aufbau befindliche Verwaltung mögen sie eine Bela stung gewesen sein. Doch diese Menschen kamen in ihrer Mehr zahl aus hoch-industrialisierten Gebieten. Ihnen ist der Wandel Bayerns von einem überwiegend landwirtschaftlich strukturierten Land zu einem hochentwickelten Gemeinwesen in erheblichem Maße mit zu verdanken.
Sie haben ihren ungebroche nen Lebensmut, ihren Fleiß, ihr Können und ihre Lebenserfah rung in den Dienst des Aufbaus gestellt. Alle packten damals an, sie alle bewiesen Zähigkeit und Einfallsreichtum. Daß wir heute da stehen, wo wir sind, daß der Wiederaufbau nach 1945 ein Er folg wurde, daran hatten die da maligen Alt- und Neubürger gleichermaßen Anteil.
Integration bedeutete zu nächst einmal wirtschaftliche Eingliederung. Sie war im We sentlichen im ersten Jahrzehnt geschafft. Daß die Neubürger sich wirklich einlebten, daß das neue Lebensumfeld auch zur neuen Heimat wurde, das war ein Prozeß, der viel länger dauer
te und zum Teil erst den folgen den Generationen gelungen ist. Neue Bindungen zu entwickeln und aufzubauen, das braucht sei ne Zeit.
Mit den Erinnerungen an den Ort der Kindheit, an die Gebor genheit, die man dort erfahren hat, kann es so leicht kein neu er Lebensmittelpunkt aufneh men. Das Bild der ersten, der ur sprünglichen Heimat bleibt er halten – gerade auch weil ja der Neuanfang von unzähligen Schwierigkeiten begleitet war.


Es verstand sich deshalb ei gentlich von selbst, daß erste re gionale Zusammenschlüsse von Vertriebenen bereits 1945 ent standen. Gegenseitige Hilfe wur de dringend gebraucht. Diese er sten Organisationen leisteten praktische Unterstützung da bei, ein Dach über dem Kopf und Arbeit zu finden. Sie kümmer ten sich darum, durch Krieg und Flucht getrennte Familien wieder zusammenzuführen; sie wandten sich aber auch schon gegen Re gelungen, die Flüchtlinge ge genüber Alteingesessenen be nachteiligten.
Sich an der politischen Wil lensbildung in unserem Land zu beteiligen, war und ist ein Anlie gen der Vertriebenenverbände. Neben dieser Wirkung nach au ßen steht das Wirken nach innen: die Weitergabe von Nachrichten über die alte und die neue Hei mat, das Organisieren von Tref fen oder die Betreuung der Mit glieder. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat ihren Mit gliedern viel zu bieten: Informa tion und Zusammenhalt, aber auch Pflege des Kulturguts und
des Brauchtums. Die Traditionen zu bewahren, war selbstverständ liches Anliegen der Flüchtlin ge der ersten Generation. Etwas über Heimatregion und Brauch tum der Eltern und Großeltern zu erfahren, ist Anliegen der nach folgenden Generationen.
In den Familien, die es betrof fen hat, waren Geschichten über die alte Heimat und ihren Ver lust immer lebendig. In der Öf fentlichkeit ist seit einiger Zeit ein neues Interesse zu spüren. Dokumentationen befassen sich mit dem Schicksal der Vertriebe nen, Filme und Bücher zum The ma finden ein breites Echo.
Da ist es gut, daß wir noch Menschen haben, die aus eige nem Erleben berichten können, was sie erfahren oder erleiden mußten. Da ist es gut, daß bereits früher von Organisationen wie der Sudetendeutschen Lands mannschaft Quellen und Zeug nisse gesammelt wurden. Und da ist es notwendig, daß wir Orte schaffen, wo all dies angemessen aufbereitet und präsentiert wer den kann. Der ehemalige Bay erische Ministerpräsident Wil helm Hoegner hat im Jahr 1956 gesagt: „Eine Million Menschen, ein Neuntel der Bevölkerung Bayerns wird von den vertriebe nen Sudetendeutschen gestellt. In der Tat kann man von einem vierten bayerischen Stamm spre chen, der sich neben Altbayern, Schwaben und Franken nunmehr nach 1945 entwickelt hat.“
Heute, gut sechs Jahrzehn te später können wir festhalten: Die politischen Verantwortungs träger – die Bayerische Staats regierung wie der Bayerische
Ihre Arbeitsdisziplin und ih re Lust an einem zünftigen Fest gingen jahrzehntelang eine Ver bindung ein, die viele Jünge re bis zum Rand erschöpft hät te, Barbara hingegen nicht. Die Schirmherrschaft über die Su detendeutschen war für sie nicht nur eine Pflicht, der sie sich voll und ganz hingab, sondern neben ihrem Engagement für Rumäni en eine Leidenschaft. Sie kannte hunderte von Landsleuten beim Namen und fühlte sich bei Bay erns Viertem Stamm so wohl, daß ich sie im Jahr 2000, als sie unse ren Europäischen Karlspreis er hielt, „Bayerns besten Stamm“ nannte. Noch am vergangenen Pfingstfest ließ sie es sich trotz einiger Gebrechen nicht neh men, zum Sudetendeutschen Tag in Hof zu kommen. Sie war eine unserer ganz Großen und unserer Volksgruppe in tiefer Treue verbunden. Dafür bleiben wir ihr zu Dank verpflichtet und beten, daß Gott ihr das viele Gu te, das sie getan hat, überreich vergelten möge.
Landtag – haben den histori schen Worten Wilhelm Hoeg ners Taten folgen lassen und ste hen seit Jahrzehnten solidarisch an der Seite der Sudetendeut schen. Wir waren und sind uns der bewundernswerten Leistun gen der Vertriebenen bewußt.

Das 20. Jahrhundert war von vielen Strömungen und Entwick lungen gekennzeichnet. Doch nicht zuletzt war es ein Jahr hundert von Flucht und Vertrei bung. Millionen und Abermillio nen von Menschen wurden zur Flucht gezwungen, wurden ge jagt und verfolgt, wurden Hals über Kopf von Haus und Hof ver trieben. Millionen und Abermil lionen von Menschen standen von Heute auf Morgen vor dem Nichts, mußten neu Fuß fassen und sich ein neues Leben auf bauen.
Wir wissen noch nicht, was uns das 21. Jahrhundert brin gen wird. Aber daß mit neuen Migrationswellen – aus wel chen Gründen auch immer – zu rechnen ist, davon müssen wir wohl ausgehen. Vielleicht kann die Erinnerung an das Schick sal der Heimatvertriebenen, an ihr Leid, aber auch ihre geglück te Integration in eine neue Hei mat dazu beitragen, sensibler zu werden für sich anbahnen de Konflikte und die Probleme von Menschen, die in die Frem de kommen. Die Vertriebenen haben bewiesen, daß ein Neuan fang möglich ist. Sie haben Kraft, Energie und Mut gezeigt. Sie ha ben Bayern, Sie haben Würzburg und viele weitere Städte und Re gionen im Freistaat mitgeprägt und gestaltet.
Die Sudetendeutsche Lands mannschaft hat ihre Mitglieder auf diesem Weg unterstützt und begleitet und wird dies auch wei terhin tun. Dafür danke ich Ih nen von Herzen und dafür wün sche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute und Gottes reichen Segen für die Zukunft!
Unter dem „Eine Prise Sand erzählt“ thematisiert die Sand-Art-Künstlerin Nadia Ischia die Vertreibung. Foto: Nadia Ischia
Volles Programm am Samstag, 15. Oktober, im Sudetendeutschen Museum zur „Langen Nacht der Münchner Museen“.

■ 14.30 Uhr: Sand-Art-Show „Eine Prise Sand erzählt“ (25 Minuten).
■ 15.30 Uhr: Sand-Art-Workshop (30 bis 40 Minuten, ab 4 Jahren).
■ 17.30 Uhr: Sand-Art-Show „Eine Prise Sand erzählt“.
■ 19.00 Uhr: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ (45 Minuten).
■ 20.00 Uhr: Führung durch die Dauerausstellung (60 Minuten).
■ 21.00 Uhr: Laserspektakel im Museum (10 Minuten, ab 8 Jahren).
■ 21.30 Uhr: Führung durch die Dauerausstellung (60 Minuten).
■ 22.00 Uhr: Laserspektakel im Museum.
■ 22.15 Uhr: Führung durch die Sonderausstellung (45 Minuten).
■ 23.00 Uhr: Laserspektakel im Museum.
■ 23.30 Uhr: Führung durch die Dauerausstellung (45 Minuten).
Weitere Informationen unter www.sudetendeutsches-museum. de. Vorverkaufsstellen unter www. muenchner.de/museumsnacht
Er ist ein wahres Wunderwerk der Kunsttischlerei und zugleich Blickfang der aktuellen Sonderausstellung „Allerley kunststück“ im Sudetendeutschen Museum: ein prachtvoller Kabinettschrank mit Egerer Reliefintarsien, entstanden um 1680 in der Werkstatt von Johann Karl Haberstumpf.
■ Sonntag, 16. Oktober: Literatur-Brunch „Frauen schreiben Geschichte(n) II: Puchianu, Kondrat, Link“ von 11.00 bis 14.00 Uhr im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 in München.
Hilde Link (Foto links), Kristiane Kondrat (Mitte) und Carmen Elisabeth Puchianu (rechts) sind Gäste der zweiten Ausgabe der Lesereihe „Frau-
en schreiben Geschichte(n)“. Sie findet 2022 im Format eines Literatur-Brunches mit kulinarischen und musikalischen Häppchen statt. Die Themen der drei Autorinnen sind in den multikulturellen und mehrsprachigen Geschichts-, Kultur- und Sprachräumen Südosteuropas angesiedelt. Sie kamen zu ihnen auf unterschiedlichem Wege.
■ Dienstag, 25. Oktober, 18.00 bis 20.00 Uhr: „Der weiße Gesang. Die mutigen Frauen der belarussichen Revolution“. Online-Lesung und -Gespräch mit der Autorin Dorota Danielewicz.
Schon während der Präsidentschaftswahl in Belarus 2020 kam es zu langanhaltenden Protesten. Gegenkandidaten des amtierenden Präsidenten Aljaksandr Lukaschenko und gegen dessen autokratisches System wurden festgenommen oder ihre Kandidatur verhindert oder, wie im Fall der Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja, Kindesentzug angedroht. Diese Proteste gingen wegen der offensichtlichen Manipulation nach der Wahl weiter. Die Bilder von den Straßenprotesten gingen um die Welt. In vorderster Reihe bei den friedlichen Protestaktionen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit: viele, meist junge Frauen – darunter Journalistinnen, Studentinnen, Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen. Mutig sahen sie den sie umzingelnden Polizisten in die Gesichter, ließen sich nicht einschüchtern – auch nicht als zahlreiche von ihnen verhaftet, verhört, mißhandelt und des Landes verwiesen wurden. In „Der weiße Gesang“ erzählen einige von ihnen ihre Geschichte, treten heraus aus der Anonymität der Masse. Sie lassen uns teilhaben an den Ereignissen und ihren persönlichen Erfahrungen dieser Zeit, an ihrem Aufbegehren, ihren Zielen, ihrem Leben im Exil.
Anmeldung über die Webseite https://www.heiligenhof.de/unsereseminare/seminarprogramm/der-weisse-gesang-die-mutigen-frauen-derbelarussischen-revolution Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungmail mit Informationen über die Teilnahme an der Veranstaltung und den Einwahllink.

r. Sybe Wartena, Fachreferent und Möbelexperte am Bayerischen Nationalmuseum, ermöglicht in einem Vortrag am Donnerstag, 20. Oktober einen näheren Blick auf dieses außergewöhnliche Möbelstück. Unter dem Titel „Sieben Weltwunder und Wunder der Kunsttischlerei. Ein Egerer Kabinettschrank mit enzyklopädischem Programm“ wird das Referat sich sowohl mit den kunsthandwerklichen Aspekten wie auch dem komplexen Bildprogramm der Reliefintarsien befassen.
Der Schrank stellt die sieben Weltwunder der Antike dar, von den Pyramiden von Gizeh über den Koloß von Rhodos bis zu den Hängenden Gärten von Babylon. Die meisterhaften Darstellungen folgen einer Serie von Kupferstichen. Weitere allegorische Bil-

■ Samstag, 15. Oktober, 10.30 Uhr, BdV Bayreuth: Tag der Heimat in FichtelbergNeubau. Festredner: Christian Knauer, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern des Bundes der Vertriebenen. Buszubringer: Pegnitz-Wiesweiher: 9.00 Uhr; Bayreuth Bahnhof: 9.30 Uhr. Anmeldung bei Margaretha Michel, Telefon (0 92 41) 36 54 oder eMail mail@familie-michel.net oder bei Rita Tischler, Telefon (09 21) 41 75.
■ Sonntag, 16. Oktober, 14.30 Uhr, BdV-Kreisverband Limburg-Weilburg: Tag der Heimat. Festrednerin: Margarete ZieglerRaschdorf, Landesbeauftragte der Hessischen Landesregierung für Vertriebene und Spätaussiedler. Musikalische Umrahmung: Egerländer Maderln unter der Leitung von Heike Schlicht. Bürgerhaus, Hauptstraße 19, Weilburg.




■ Dienstag, 18. Oktober, 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Die Legende kehrt zurück – die Geschichte des Fußballclubs DFC Prag“. Filmvorführung und Diskussion. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 19. Oktober, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und Haus des Deutschen Ostens: „Die ehemaligen deutschen Ostgebiete und ihre Sagen, Märchen und Mythen“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 19. Oktober, 18.30 Uhr, Gerhart-HauptmannHaus: „Das jüdische Museum Czernowitz und seine Arbeit in Kriegszeiten“. Online-Vortrag von Dr. Mykola Kushnir, mit einer Einführung von Katja Schlenker. Anmeldung unter eMail info@erinnerung-lernen.de oder Telefon (02 11) 99 54 50 30.
■ Donnerstag, 20. Oktober, 9.30 Uhr, Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau: „RübezahlTage – Anekdoten von Winfried Kreutzer“. Neubaustraße 12, Würzburg.
■ Donnerstag, 20. Oktober, 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Sieben Weltwunder und Wunder der Kunsttischlerei. Ein Egerer Kabinettschrank mit enzyklopädischem Programm“. Vortrag von Dr. Sybe Wartena (siehe oben). Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
derzyklen stellen das Thema in einen kosmischen Zusammenhang. Ein zauberhaftes Detail ist die Darstellung eines verspiegelten Gartensaals im Mittelgelaß.
■ Donnerstag, 20. Oktober, 19.00 Uhr: Adalbert Stifter Verein: „Zwei Brüder – zwei Nationalitäten“. Filmsoirée mit Petra Dombrowski. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Freitag, 21. Oktober, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Festveranstaltung. Sudetendeutsches Haus, AdalbertStifter-Saal, Hochstraße 8, München.
■ Montag, 24. Oktober, 19.00 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Haus: „Deutsche Literatur aus Rumänien.“ Ein literarischer Abend mit Peter von Kapri. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Mittwoch, 26. Oktober, 19.00 Uhr: Adalbert Stifter Verein: „Hana oder das böhmische Geschenk“. Buchvorstellung und Gespräch mit Tina Stroheker. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 26. Oktober, 19.00 Uhr, Gerhart-HauptmannHaus: „Wie denkt der Kreml? Putin und andere imperiale Köpfe“. Online-Vortrag von Dr. Felix Riefer. Anmeldung unter eMail sekretariat@g-h-h.de
■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin, Bundeskulturtagung mit Exkursion ins Egerland Egerland-Kulturhaus, Marktredwitz. Anmeldung unter eMail jobst@egerlaender.de
■ Samstag, 29. Oktober, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de
■ Donnerstag, 3. November, 9.30 bis 15.00 Uhr, Museumspädagogik: „Kinderferientag für Kinder ab 6 Jahren“. Holzcollagen gestalten mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Kostenlos, ohne Anmeldung. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Freitag, 4. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro.
Der Vortrag von Dr. Sybe Wartena findet am 20. Oktober um 18 Uhr im Adalbert-Stifter-Saal statt, der Eintritt ist frei. (Ursprünglich war der Vortrag für den 6. Okto-
Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89)48 00 03 37.
■ Samstag, 5. November, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Legende kehrt zurück – die Geschichte des Fußballclubs DFC Prag“. Filmvorführung und Gespräch mit Filmemacher Thomas Oellermann (Prag). Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November, SL-Bundesverband: Seminarwoche auf dem Heiligenhof. Diese Veranstaltung richtet sich an alle, die ihren böhmischen, mährischen oder sudeten-schlesischen Wurzeln nachspüren oder etwas über Kultur und Geschichte der Sudetendeutschen erfahren möchten. Das detaillierte Programm und die Anmeldemöglichkeiten lesen Sie auf Seite 2. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Mittwoch, 9. November, 19.00 Uhr: Gerhart-HautpmannHaus. „Das Mädchen im Tagebuch. Auf der Suche nach Rywka aus dem Getto in Łódź“. Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 31. Januar 2023 gezeigt wird. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Freitag, 11. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Rübezahl-Tag (nicht nur) für Kinder“ mit dem Buchautor Ralf Pasch. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 11. bis Samstag, 12. November, Sudetendeutscher Heimatrat: Jahrestagung des Sudetendeutschen Heimatrates. Detailliertes Programm folgt. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Donnerstag, 17. November, 18.00 bis 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Kunstkammer Georg Laue: Reliefintarsien aus Eger für die fürstlichen Kunstkammern Europas“. Vortrag von Dr. Virginie Spenlé. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“
ber vorgesehen, mußte aber verschoben werden). Die Ausstellung „Allerley kunststück“ kann täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.
mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Online-Lesung der Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.
■ Samstag, 26. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmerwald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Musikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de
■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder und Familien“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
VERANSTALTUNGSKALENDEREr ist einer der ganz großen Germani sten: Peter Demetz, geboren am 21. Ok tober 1922 in Prag, Dramaturg am Deut schen Theater in Prag, Theaterdirektor in Brünn und Wien, und nach seiner Flucht Professor an der weltberühm ten Yale-Universität. Kaum bekannt ist, daß der vielfach ausgezeichnete Demetz auch ladinische Wurzeln hat, und seine Verwandschaftsverbindun gen direkt ins Sudetendeutsche Muse um nach München führen.
Von Dr. Raimund Paleczek, Vorsitzender des Sudetendeutschen Instituts
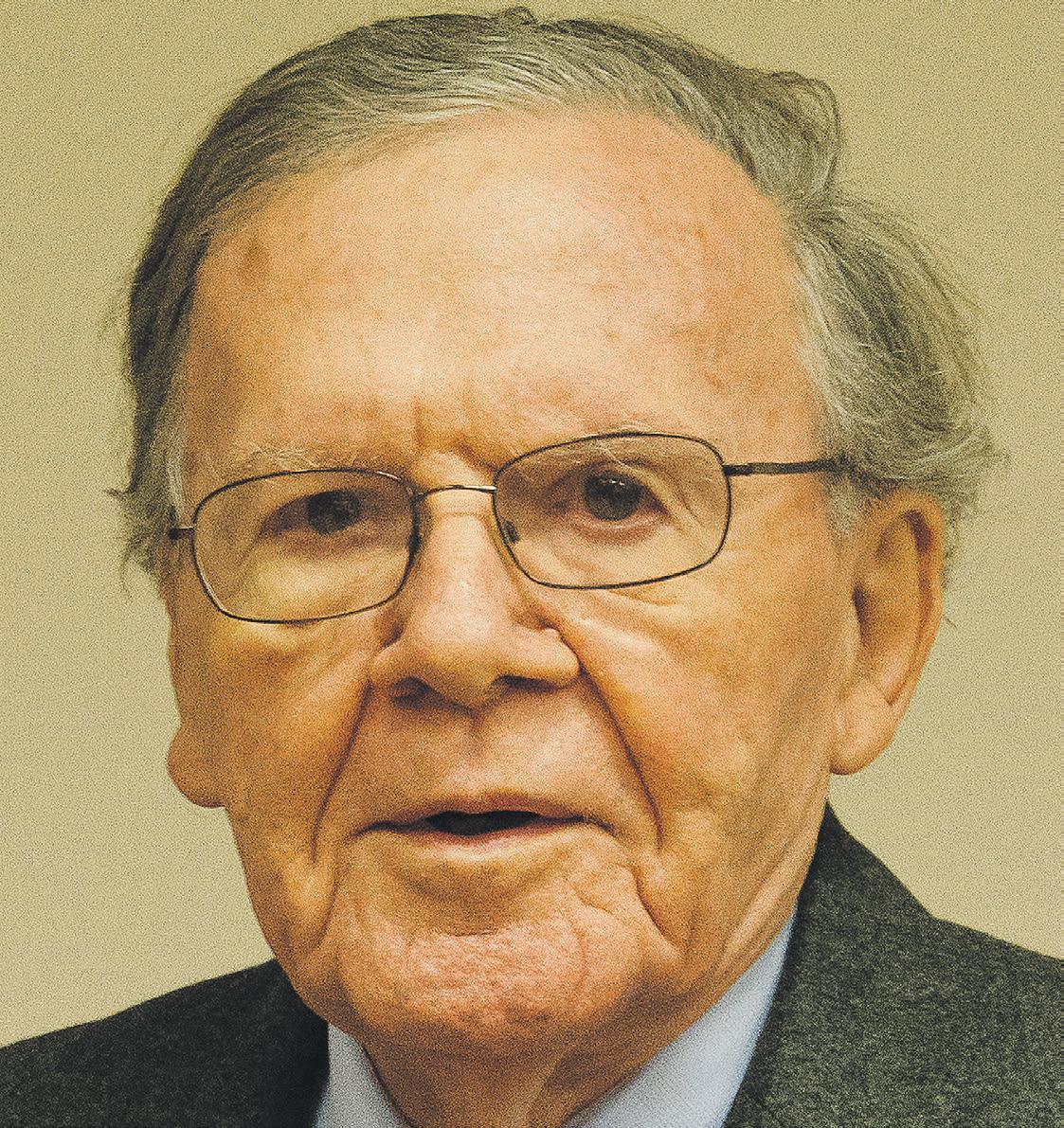
Der Familienname Demetz ist im Grödnertal weithin bekannt. We niger bekannt dürfte hier aber ein be rühmter Träger dieses Namens sein: Pe ter Demetz, emeritierter Universitäts professor an der Eliteuniversität Yale in New Haven im US-Bundesstaat Connec ticut. Hier lebte Peter Demetz, der in den drei Sprachen Deutsch, Tschechisch und Englisch beheimatet ist und in ihnen pu blizierte, fast sieben Jahrzehnte. Mittler weile verbringt er seinen Ruhestand in New Brunswick (NJ). Seine väterlichen Familienwurzeln liegen im Grödnertal, wie die beiden angeführten Zitate (Mit te) über die ladinischen Großeltern be legen. Die Erinnerung des neunjährigen Knaben Peter Demetz an seine Groß mutter ist eine Momentaufnahme, die sich ihm zeitlebens eingeprägt hat. Es gibt aber noch eine weitere Verbindung des Literaten Peter Demetz zum Gröd nertal, die Gegenstand dieses Beitra ges ist. Seit Juli 2021 leitet Dott. Stefan Planker, langjähriger Direktor des Mu seo Ladin in St. Martin in Thurn, das Su detendeutsche Museum in München. Auch dieses Museum beschäftigt sich mit der Kultur und der Geschichte einer Volksgruppe. Die Sudetendeutschen lebten über Jahrhunderte in den Län dern der böhmischen Krone und waren wie die Ladiner bis 1918 eine Volksgrup pe der österreichischen Monarchie. Pe ter Demetz und Stefan Planker sind ver wandt: sie sind Cousins 7. Grades! Ein solcher Verwandtschaftsgrad bedarf ei ner näheren Erläuterung. Zunächst aber soll sich der Blick auf den Jubilar rich ten: Professor Dr. Peter Demetz vollen det heuer sein 100. Lebensjahr.
[..] und ich erinnere mich, wie ich als Junge in sei nen [des Großvaters] zahlreichen handgeschriebenen Katalogen mit den im fernen Grödnertal hergestellten hölzernen Heiligenfiguren, Trommeln und Zügen blät terte. [..] [Die Großmutter] .. war eine Bauernfrau, die mit langen Röcken und mit einem Rosenkranz um die Taille gebunden, am Herd stand und auf ladinisch vor sich hinmurmelte.“
P. Demetz, Mein Prag, Wien 2007, S. 144 und 147. – Interview mit Peter Demetz, November 2002, ab gedruckt in: Stifter Jahrbuch, Neue Folge 17, Mün chen 2003, S. 58.
Altstädter Rathaus die jüdische Geschäftsmannstochter Anna Brod geheiratet. Für die Hochzeit war er aus der katholischen Kir che ausgetreten, damit eine Zi viltrauung stattfinden konnte. Pe ter blieb das einzige Kind dieser Ehe, die 1935 geschieden wurde. Anna Demetz heiratete in zwei ter Ehe 1936 in Brünn den jüdi schen Arzt Josef Mandel. Die se Ehe blieb kinderlos. Sohn Pe ter blieb bei seiner Mutter, bis Herbst 1938 in Brünn, danach in Prag. Während Mandel rechtzei tig nach England fliehen konnte, blieb Peters Mutter das Schick sal der Verfolgung ihres Volkes durch das nationalsozialistische Regime nicht erspart. Sie starb im Konzentrationslager Theresien stadt im nordwestlichen Böhmen. Wegen des jüdischen Elternteils mußte Peter Demetz ab 1943 auch Zwangsarbeit leisten. Das letz te halbe Jahr vor Kriegsende ver brachte er in Gestapohaft in ver schiedenen Gefängnissen. Nach dem Krieg konnte Peter Demetz als anerkannter Gegner und Op fer des NS-Regimes in Prag blei ben und Germanistik studieren. 1948 promovierte er mit einer Ar beit über den Einfluß Franz Kaf kas auf die zeitgenössische englische Li teratur. Aber noch im gleichen Jahr floh Demetz über die grüne Grenze vor dem kommunistischen Regime nach Bayern. Von 1950 bis 1952 arbeitete er bei Radio Free Europe in München, 1953 erfolgte die Auswanderung in die USA. Da sein tschechischer Studienabschluß in den USA nicht anerkannt wurde, erwarb De metz 1954 den Master of Arts und leg te 1956 an der Yale-Universität mit der Arbeit „Marx Engels and the Poets“ die Promotion zum Ph. D. ab. In Yale be gann Demetz noch im gleichen Jahr sei ne Lehrtätigkeit als Dozent für Germa nistik. Von 1962 bis zu seiner Emeritie rung 1991 war er ordentlicher Professor für Germanistik und vergleichende Lite raturwissenschaft.
Professor
über die Ahnenlinie Demetz, sondern auch über die Linie Planker/ Plankl miteinander
Grafik: Dr. Raimund Paleczek
lich. Der Großvater Josef Anton Demetz wurde am 21. Feber 1857 in Wolkenstein/Tlusel Nr. 13 im Pfarrgebiet St. Christina gebo ren, die Großmutter Maria Josefa Insam am 3. März 1856 in Pufels.
Die Großeltern von Peter Demetz waren auch entfernt miteinander verwandt: über Maria Josefa In sams Großmutter väterlicherseits, Maria Anna Demetz (1785-1830), hat sie mit ihrem Ehemann Josef Anton Demetz acht Generationen zuvor mit Jakob de Mez (ca. 15951652) einen gemeinsamen Ahn herrn. Josef Anton kam wohl zu Beginn der 1880er Jahre als Spiel warenhändler nach Innsbruck, wo zu dieser Zeit Maria Josefa In sam in einem Textilgeschäft ar beitete. Die Hochzeit fand am 4. Mai 1886 in der Domkirche St. Ja kob in Innsbruck statt. Der Fami lienüberlieferung zufolge zog das junge Brautpaar nach Oberöster reich, bevor es sich mit drei Kin dern 1891 im Herzen der Prager Altstadt niederließ. Hier und in der Umgebung lebten bereits ei nige ladinische Familien, darun ter der gleichnamige Onkel von Josef, Josef Anton senior (18221898). Als Spielwarenhändler war er in die Prager Altstadt gezo gen und hatte hier 1844 im Teynhof 641 (heute: Týn 4) neben der Teynkirche ei ne Spielwarenhandlung eröffnet. Am 25. August 1848 hat Josef Anton senior in der Altstädter Teynkirche die Tochter ei nes nordböhmischen Schloßverwalters geheiratet.
Geboren wurde Peter Demetz am 21. Oktober 1922 in der böhmischen Metro pole Prag im Stadtteil Altstadt als ein ziges Kind des Dramaturgen und Thea terregisseurs Franz Demetz (11. 8. 1895 Prag – 23. 2. 1981 ebenda) und der An na geborene Brod (2. 8. 1894 Poděbrady – 26. 6. 1943 KZ Theresienstadt). Franz Demetz, der als Künstler nur den Vorna men „Hans“ verwendete, gilt als letzter Angehöriger des berühmten Prager Li teratenkreises. Mit expressionistischen Inszenierungen am Prager Deutschen Theater erwarb er sich ab 1916 landes weites Ansehen. Von 1926 bis 1932 lei tete Hans Demetz das Deutsche Thea ter in Brünn. Franz/Hans Demetz hatte kurz nach der Gründung der Tschecho slowakei


im Prager
Seine umfangreiche Publikationsliste deckt ein breites Feld böhmischer Lite raturforschung ab. Besonderes Augen merk richtete Peter Demetz auf die Pra ger Deutsche Literatur und den Prager Literatenkreis zwischen 1900 und 1938. In Dutzenden von Essays hat er sich mit Leben und Werk der deutschspra chigen böhmischen Schriftsteller Franz
Kafka und Rainer Maria Rilke sowie den Philosophen Bernard Bolzano und Tomáš Masaryk, dem ersten Präsiden ten des Tschechoslowakischen Staates, auseinandergesetzt. Mit scharfem Ver stand analysierte Demetz die Entwick lung der zeitgenössischen deutschspra chigen Literatur. Aber auch auf deren äl teren, klassischen Vertreter Goethe und Fontane und den deutschen Realismus richtete er seine Aufmerksamkeit. Dar über hinaus kommentierte Demetz kri tisch zeitgeschichtliche Entwicklungen seiner Heimat Böhmen und Mähren, vor allem von deren Hauptstädten Prag und Brünn, denen er sich aufgrund sei ner Biographie in besonderer Weise ver bunden fühlt. Auch als Übersetzer von Werken tschechischer Autoren wie von Božena Němcovás Klassiker „Die Groß mutter“ oder der Elegien des früh ver storbenen Jiří Orten (1919-1941) ins Deutsche hat sich Peter Demetz einen Namen gemacht.
Kommen wir aber zu den ladinischen Vorfahren von Peter Demetz. Ob sich seine Großeltern schon in ihrer Heimat gekannt haben, ist ungewiß, aber mög
Dieses Geschäft übernahm offen bar 1891 Josef Anton junior, da sein fast siebzigjähriger Onkel keinen leiblichen Erben hatte. Mit Josef Anton zog auch der jüngere Bruder, Engelbert Demetz (geb. 1865), zu seinen Verwandten nach Prag. 1898 folgte seinen älteren Brüdern schließlich Alois Demetz (geb. 1873) nach Prag. Die Großeltern unseres Jubi lars erweiterten das Angebot der Spiel warenhandlung bis hin zum Verkauf von Kinderstühlen, das Geschäft florierte. Um die Jahrhundertwende konnte De metz eine Filiale in der Hybernergasse eröffnen. Die Mechanisierung der Spiel waren führte aber noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges zum Bankrott des Unternehmens.


Josef Anton Demetz starb im Allgemeinen Krankenhaus in der Prager Neustadt 1923, seine Frau

D
er sechzigste Jahrestag der Er öffnung des Zweiten Vatikani schen Konzils – ich schrieb bereits letzte Woche darüber – hat mich in den letzten Tagen veranlaßt, mich mit Papst Johannes XXIII. zu beschäftigen, der diese Kirchen versammlung einberufen hatte und ihr auch während der ersten Sit zungsperiode im Spätherbst 1962 vorstand. Ein halbes Jahr spä ter verstarb er, betrauert wie nie ein Papst zuvor. Sein Nachfolger Paul VI. übernahm den Staffelstab der Kirchenleitung und führte das Konzil – Gott sei dank – weiter.

Johannes XXIII., mit bürger lichem Namen Angelo Roncal li, stammte aus dem Bauernstand und wurde in der Ortschaft Sotto il Monte in der norditalienischen Provinz Bergamo geboren. Eine ge wisse bäuerliche Einfachheit und Bodenständigkeit hat er sich auch als Papst bewahrt. Davon zeugen vor allem die be rühmten „Zehn Gebote der Ge lassenheit“, die sich sowohl im geistlichen Ta gebuch des Pap stes wie auch in Briefen an seine Familie finden. Ich will sie hier vorstellen, weil ich der Meinung bin, daß es sich um hilfreiche Re geln für das Leben und den Glau ben handelt.
Ê Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erle ben – ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
Ë Nur für heute werde ich größ ten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in meinem Ver halten. Ich werde niemanden kriti sieren – nur mich selbst.
Ì Nur für heute werde ich in der Gewißheit glücklich sein, daß ich für das Glück geschaffen bin.
Í Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, oh ne zu verlangen, daß die Umstän de sich an meine Wünsche anpassen.
Î
Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes wichtig ist, so wichtig ist die Lektüre für das Leben der Seele.
Ï Nur für heute werde ich ei ne gute Tat vollbringen und es nie mandem erzählen.
Ð Nur für heute werde ich et was tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedan ken beleidigt fühlen, werde ich da für sorgen, daß niemand es merkt.
Ñ
Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstel len. Aber ich werde mich vor zwei Übeln hüten: vor Hetze und vor Unentschlossenheit.
Ò
Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders wer de ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist.
Ó
Nur für heute werde ich fest daran glauben, daß die gütige Vor sehung Gottes sich um mich küm mert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.
Zehn Gebote der Gelassenheit: sehr alltagstaugliche Prinzipien nicht nur für einen Papst, sondern auch für Menschen „wie Dich und mich“. Johannes XXIII. nahm sich jedes Gebot „nur für heute“ vor. Er wußte, daß jeder einzelne Tag sei ne neuen Herausforderungen hat, daß Gott aber an jedem einzelnen Tag auch Kraft gibt, die Herausfor derungen zu bestehen.
Dr. Martin Leitgöb derNatalie Pawlik, Bundesbeauf tragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, hatte nicht zu den Marienbader Ge sprächen des Sudetendeutschen Rates (Þ SdZ 39 und 40/2022) kommen können. Hier ihr Gruß wort zum Tagungsthema „Die politische Bildung in Zeiten von Populismus und digitaler Medi en – Auseinandersetzung mit der Geschichte stärkt die Zivil gesellschaft“.
gen Meinungen. All das hat ei nen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Meinungsbildung und Akzeptanz der Mehrheits bevölkerung im Hinblick auf das Zusammenleben mit Bevölke rungsgruppen anderer Herkunft.
U
nter der Perspektive von Minderheitenpolitik und Aussiedlerfragen ist politische Bildung zu jeder Zeit von gro ßer Bedeutung. Minderheitenund Aussiedlerpolitik ist häu fig mit Ängsten und Befürchtun gen auf beiden Seiten belastet: Viele Angehörige einer nationa len Minderheit oder einer Aus siedlergruppe befürchten, durch schleichende oder auch poli tisch forcierte Assimilation ih re einzigartigen Merkmale zu verlieren. Auf der anderen Sei te fürchten Teile der Aufnahme gesellschaft, durch zunehmende kulturelle und sprachliche Viel falt ihre vertraute Lebenswelt zu verlieren, oder die Spaltung ei ner vermeintlich homogenen Ge sellschaft.
Nach meiner Erfahrung kön nen beiden Gruppen ihre Sor gen durch politische und gesell
schaftliche Lernprozesse und Bil dungsarbeit genommen werden. Dazu gehört, daß sie sich mit einander austauschen und ler nen, den anderen zu verstehen. So kann veranschaulicht wer den, daß Angehörige von Min derheiten und Aussiedlerinnen und Aussiedler nicht nur positi ven Einfluß auf ihre nähere Um gebung nehmen, sondern auch vorbildlich wichtige gesellschaft liche und kulturelle Brücken zwi schen ihren Heimatstaaten und Deutschland bauen. Eine hete rogene, vielfältige Gesellschaft ist keine Belastung, sondern ei ne Chance.
Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Meinungsbildung der Bevölkerung, auch im Hin blick auf die Wahrnehmung na tionaler Minderheiten und von Aussiedlern. Ob es die traditio nellen Informationsquellen wie Presse, Radio und Fernsehen sind oder soziale Medien wie Fa cebook, Twitter und YouTube, sie beeinflussen das Wissen und die Einstellungen, bestimmen die Art der Verbreitung von Informa tionen, zeichnen Bilder und prä
Seriöse Medien haben den An spruch, die Realität mittels objek tiver Berichterstattung zu zeigen und einzuordnen.
Doch die Ge fahr von Desinformation nimmt durch die unterschiedlichen Quellen zu. Nicht alle Medien haben den Anspruch auf objek tive Berichterstattung und Kon trolle der Demokratie. Die Mei nungsbildung kann durch Wort wahl, Bilder oder das bewußte Weglassen von Informationen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, die unbewußt oder be wußt negativ gedeutet werden kann. Gerade die heutigen be wegten Zeiten belegen eine sol che Mißbrauchsgefahr durch Po pulismus, Desinformation und Fake News eindrucksvoll
Der entsetzliche Angriffs krieg Rußlands gegen die Ukrai ne, welcher seit über sieben Mo naten andauert, hält uns vor Au
gen, welche Folgen Populismus und Desinformation hervorru fen können: Verwirrung über die Fakten, daraus folgende Emo tionalisierung von kontroversen Debatten und schließlich eine verstärkte Spaltung der Gesell schaft. Bei der Bewältigung die ser Situation setze ich mich ent schieden für eine breite Sensibi lisierung der Öffentlichkeit zum Thema Desinformation und eine stärkere Kompetenz förderung der Bürge rinnen und Bürger, ins besondere in den sozi alen Netzwerken, zur kritischen Überprüfung von Informationen und Quellen ein.
Eine gut informier te Zivilgesellschaft ist eine starke Zivilgesell schaft und der Anker jeder Demokratie. Die sen Anker gilt es beson ders in so stürmischen Zeiten, wie wir sie aktu ell erleben, zu stärken. Deshalb ist es von gro ßer Bedeutung, wenn sich Medien selbstkri
tisch der Aufgabe annehmen, Minderheiten in der Öffentlich keit mit ihren Traditionen, Kul turen und Sprachgewohnheiten, und vor allem auch mit ihrer Ge schichte positiv und vielfältig zu präsentieren, zugleich aber auch ihre Probleme zu thematisieren. Dies kann die Akzeptanz und Wertschätzung durch die Mehr heitsbevölkerung deutlich erhö hen
Diejenigen, die wissen, wie man seriöse Quellen von unseri ösen Quellen unterscheidet, kön nen Falschinformationen über prüfen und Gerüchten wider sprechen. Ich möchte, daß unsere Demokratie auch zu Hause am Eßtisch verteidigt werden kann. Das geht nur mit dem richtigen und verstärkten Einsatz von po litischer Bildung. Denn schluß endlich ist politische Bildung im mer auch Demokratiebildung.
Bereits zum 14. Mal finden in diesem Jahr die Marienba der Gespräche statt. Der Sude tendeutsche Rat zeigt mit dem gemeinsamen Gesprächsforum für sudetendeutsche und tsche chische Politikerin nen und Politiker so wie für weitere Exper tinnen und Experten aus beiden Staaten, wie gelebte Völkerverstän digung funktioniert.
Im Rahmen des kon sequenten verstän digungspolitischen Ansatzes der Veran staltung fördert das Bundesministerium des Innern und für Heimat seit Jahren die Marien bader Gespräche. Ich bin mir sicher, daß auch in diesem Jahr wichtige Impulse von hier aus gehen.
Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)
Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr) Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort
Geburtsjahr, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)
Kontonr. oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Zeitung
Hochstraße 8, 81669 München
Am 18. Oktober feiert Johann Böhm, Landtagspräsident a. D., Altsprecher der Sudetendeut schen Volksgruppe und ehema liger Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, 85. Geburtstag im unterfränkischen Bad Neustadt.
Der Egerländer kam in Daßnitz im Kreis Falkenau zur Welt. Nach Wiedererrichtung der ČSR vertrieben die Tschechen den späteren Juristen und seine Fa milie. Warum das Recht in seinem Leben eine bestimmende Rolle ein nimmt, beschreibt Jo hann Böhm selbst am Schicksal der Sudeten deutschen: „Uns Sude tendeutschen hat man das Recht immer wieder streitig gemacht: 1918, als wir in ein fremdes Staatsgebilde hineingezwungen wurden, und 1945, als man uns alles nahm und uns vertrieb. Nur das Recht hat man uns nicht neh men können.“
Günther Beckstein, damals Bayerischer Ministerpräsident und Schirmherr der Sudeten deutschen, zählte in seinem Glückwunsch zum 70. Geburts tag Johann Böhms, damals Volksgruppensprecher, dessen politische Verdienste als Land tagsabgeordneter, als Leiter der

Am 23. September starb Elisabeth Beywl, eine engagierte Böhmerwäldlerin, mit 97 Jahren in München. Fünf Tage später verabschiedeten sich die DBB Ortsgruppe München und die SL Kreisgruppe München Stadt und Land mit einer Trauerfeier.
Die Trauerfeier begann mit folgenden Zeilen von Alf red Poidinger, die beschreiben, was Elisabeth Beywl wahrschein lich immer und bis an ihr Lebens ende fühlte: „Von Wäldern be grenzt und Blumen umringt / und von der Seele der Heimat bis ins Tiefste berührt, / so ging ich den Weg meiner Heimat zu. / Es blieb die märchenhafte Erinne rung und eine tiefe Dankbarkeit, / hier einmal gelebt zu haben. / Keine Worte können wiederge ben, was das Auge gesehen / und das Herz gefühlt in denen, die im Böhmerwald geboren sind.“
Elisabeth Beywl kam am 13. Februar 1925 in Hartmanit im Kreis Bergreichenstein zur Welt. Wie viele andere wurde sie nach dem Krieg aus ihrer Heimat ver

Bayerischen Staatskanzlei und als Landtagspräsident auf: „Daß Johann Böhm zweimal zum Landtagspräsidenten gewählt worden ist, belegt das Vertrauen über die Parteigrenzen hinweg und die Wertschätzung wegen seiner tiefschürfenden und verbindlichen Art, aber auch wegen sei ner korrekten Amtsfüh rung.“ Als Sprecher der Sudetendeutschen sei er dagegen bereit anzu ecken, wo es nötig sei, beziehe glasklar Stel lung, habe aber auch Respekt vor den ande ren. „Du hast nicht etwa herum geeiert, sondern es ist jedermann klar, daß Du Unrecht als Un recht anklagst, daß es aber nicht um Rache und Vergeltung geht, sondern um Gerechtigkeit“, wandte sich Beckstein direkt an Böhm.
Der damalige SL-Bundesvor sitzende Franz Pany, der 2011 von Böhm den Vorstandsvorsitz der Sudetendeutschen Stiftung übernahm, würdigte damals des sen Verdienste. Böhm gehöre zu
den Menschen, die sich mit voller Kraft einer Sache verschrieben, aber nie viel Aufhebens um die eigene Person gemacht hätten. Er halte es mit Friedrich Schil ler, der schon postuliert habe, das Werk solle den Meister lo ben. Böhm sei offen und moderat gewesen, habe den Konflikt nicht gescheut, Konflikte aber fair aus getragen. Seine Zeit als Vorsit zender der Stiftung hätten zwei große Themen bestimmt: das Su detendeutsche Museum und die grenzüberschreitende Zusam menarbeit. Vor allem die Jugend sei ihm am Herzen gelegen, und jedes Projekt, das tschechische und sudetendeutsche Jugendli che zusammenbringe, habe auf seine engagierte Fürsprache hof fen können.
Volksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert seinem Vor gänger von Herzen: „Johann Böhm ist ein echter Egerländer. Mit ihm verbindet mich vieles, so auch, daß wir beide Träger der Eibanesen-Perle sind. Bei dieser höchsten Ehrung der einzigen sudetendeutschen Faschingsge sellschaft, die gleichzeitig eine
der größten fränkischen ist, lau diert der Vorjahrespreisträger stets den nächsten. Bei mir war es Barbara Stamm, und ich hat te die Ehre, die Laudatio auf Jo hann Böhm zu halten. Als ich am Veranstaltungsort in Nürnberg eintraf, hörte ich, wie in einem Nebenraum jemand mit wun derbarer Stimme die schönsten Egerländer Lieder sang. Dies war der Landtagspräsident, der ein sam wartete und sich die Zeit mit heimatlichem Liedgut verschön te.
Johann Böhm ist aber nicht nur ein weiser, humorvoller, li terarisch und musisch begab ter und aktiver Mensch, sondern auch ein herausragender Politi ker, ein kämpferischer Volksver treter sowie ein umfassend ge bildeter Jurist. Seine bedeuten den Verdienste um eine sozial gerechte Gesellschaft, um ein le benswertes Bayern, um seine Su detendeutsche Volksgruppe und um die europäische Einigung machen ihn zu einem der wich tigsten Gestalter unseres Schirm landes, der aus den Reihen des Vierten Stammes kommt. Dafür danke ich ihm im Namen unserer Volksgruppe und ganz persön lich und wünsche ihm weiterhin viel Glück, Gesundheit und Got tes reichen Segen.“ Nadira Hurnaus
trieben und kam nach München. Schon am 1. Mai 1950 wurde sie Mitglied der SL, und bald dar auf, am 11. August 1957, schloß sie sich der 1954 in München ge gründeten Ortsgruppe des Deut schen Böhmerwaldbundes (DBB) an.
Die Pflege des heimatlichen Brauchtums in Form von Lied und Tanz, aber auch die Litera tur aus der Heimat begeister ten die junge Elisabeth. Und so war es ihr ein großes Anliegen, in München eine Böhmerwald-Kin dergruppe in den Jahren 1973 und 1974 zu gründen, deren er ste Leiterin sie war. Mit Begeiste rung arbeitete sie mit den Kin dern und leitete sie in die richti gen Bahnen.
Solange Elisabeth gesund war, verging kein Monatstreffen der Böhmerwäldler, wo sie nicht Gast war und immer wieder Vorschlä
ge für die Gestaltung dieser Ver anstaltungen einbrachte. Mit Be geisterung fuhr sie mit zu den Bundestreffen nach Passau oder zu den Jakobitreffen nach Lak kenhäuser. Auch bei den Fahrten zum Sude tendeutschen Tag war sie – solange es ihr ge sundheitlich möglich war – immer dabei. Die regelmäßigen Bastel treffen bereiteten ihr ebenso viel Spaß. Und nicht zuletzt nähte sie sich bei den Trachten nähwochen auf dem Bauernhof der Böhmerwäldler ihre eigene Böhmerwaldtracht.
Doch mit zunehmendem Al ter wurde alles beschwerlicher, und sie zog von ihrer hübschen Wohnung in Berg am Laim in das Alten- und Pflegeheim Sankt Michael, wo sie starb. Franz Ed.
Hrabe aus Winterberg schreibt: „Nun sind die heißen Feuer / in meiner Seele verglüht. / Die Welt liegt hingebreitet / wie ein verklingendes Lied. / Nun schla fen alle Schmerzen, / verschlafen zwitschert ein Vogel im Baum, / so schluchzt meine Seele noch leise, / hilflos und wie im Traum. / Nun fallen die Schlacken der Seele / im Licht, das der ruhige Mond verscheint, / Nun schlafen alle Schmer zen. / Mein Herz hat sich müde geweint.“ Insbesondere die DBB-Ortsgruppe Mün chen sowie die SL neh men nun in Dankbarkeit Abschied von einem en gagierten Mitglied. Wir werden sie in bleiben der Erinnerung behalten. Liebe Elisabeth, ruhe in Frieden.
Renate Ruchty und Renate Slawik für die DBB-Ortsgruppe München Hans Slawik für die SL-Kreisgruppe München-Stadt und Land
Seit dem Beginn der Kooperati on im Jahr 2014 finden regelmä ßig Denkmalpflegeprojekte des tschechischen Vereins Omni ci miterium (Omnium) in enger Zusammenarbeit mit der Hei matpflegerin der Sudetendeut schen und den Sudetendeut schen Heimatkreisen statt. Tat kräftige Unterstützung erhalten sie von zahlreichen freiwilligen Helfern, die sich in ihren Hei matregionen für die Rettung und den Erhalt der Friedhöfe en gagieren. Über den Einsatz bei der Restaurierung des Friedhofs in Böhmisch Pokau/Český Bu kov zur Erinnerung an die frühe ren deutschen Bewohner berich tet hier die Denkmalschütze rin Barbora Větrovská, übersetzt von der früheren Heimatpflege rin Zuzana Finger.
faßte die Ortsteile Maschkowitz/ Maškovice und Pauska/Poustka.
Der letzte Besitzer der leibeige nen Ortschaft Böhmisch Pokau mitsamt den Ortsteilen war vor 1850 die Türmitzer Herrschaft, namentlich Albert Nostitz. 1854 waren hier insgesamt 178 Men schen ansässig. Sie lebten von Ackerbau und Viehzucht. Milch, Butter und Eier waren die wich tigsten Handelsgüter der lokalen Märkte.
Einwohner, in Pauska lebten 29 und in Maschko witz 36 Einwohner. Alle waren Deut sche.
großer Trümmerhaufen. Vermut lich wurde ein Teil des Schutts auch auf den 1976 geschlossenen Ortsfriedhof gebracht.




Januar 1963 nach Pömerle einge meindet.
D
as Dorf Böhmisch Pokau oder Bokau liegt im nordöstlichen Teil des Kreises Aussig. Einst er streckte sich das Dorf über eine Fläche von 516 Hektar und um
Die Entwicklung der Industrie im nahe gelegenen Pömerle/ Povrly trug 1930 zum Bevölke rungswachstum bei. In Böhmisch Pokau wurden 161 und in jedem Ortsteil je 34 Einwohner gezählt.
1934 hatte Böhmisch Pokau 152
Das Gemeinde amt in Böhmisch Pokau entstand im Jahre 1850 auf der Grundlage der vor läufigen Gemein deverfassung von 1849. Die Gemein de wurde Teil des politischen Ge richtsbezirks Aussig. 1850 wur de das Dorf vom Dorfkomitee geleitet. Gemeindevorsteher wa ren 1876 A. Hahmann, 1885 Jo sef Klement, 1896 Wenzel Schrö
ter, 1907 Wenzel Laube, 1923, 1926, 1930 Emil Köcher und 1934 Josef Schmöss. Die Auf zählung ist auf grund fehlender Quellen nicht voll ständig.
Das Gemeinde amt funktionierte bis Mai 1945, als es durch eine örtliche Verwaltungskom mission ersetzt wurde. Die terri toriale Verwaltungsentwicklung erfuhr nach 1945 weitere Verän derungen. Böhmisch Pokau ver lor am 28. November 1962 seine Selbständigkeit und wurde am 1.
Das beherrschende Gebäu de des Dorfes war die der Geburt Johannes des Täufers geweihte Kirche, die bereits 1352 erwähnt worden war. Ende des 18. Jahr hunderts wurde sie im Barockstil umgebaut. Bis zum Zweiten Welt krieg diente die Kirche liturgi schen Zwecken. Nach dem Krieg wurde die Kirche nicht mehr in standgehalten, und schließlich wurde beschlossen, sie abzurei ßen. Im April 1976 kaufte das lo kale Nationalkomitee in Pömer le die Kirche vom Leitmeritzer Konsistorium für 7996 Kronen und ließ sie im April 1977 spren gen. Von der Kirche blieb nur ein
Heuer fand der zweite Ab schnitt der Friedhofsrenovie rung mit finanzieller Förderung des Tschechisch-Deutschen Zu kunftsfonds, des Stadtamtes Pö merle und der Diözese Leitme ritz/Litoměřice statt. Die Arbei ten führte der Verein Omnium durch. Im Laufe dieses Reno vierungsabschnitts wurden auf gebrochene Gräber gesichert, Grabsteine aus dem Bauschutt ausgegraben, das Gelände auf dem Hauptweg abgesenkt und der ursprüngliche Steinweg und die Steintreppe freigelegt. Der Friedhof wurde wieder zu einem würdigen Ort der Totenehrung und der letzten Ruhe.
Die erhaltenen Grabsteine und aufgefundenen Glastafeln wer den auf dem Friedhofsgelände aufgestellt, um pietätsvoll an die ursprüngliche deutsche Bevölke rung zu erinnern.

Die monatliche Zoom-Veranstal tung der Ackermann-Gemein de widmete sich Anfang Okto ber der Kultur. Unter dem Motto „Auf Lebensreise zwischen Bre men und Prag“ gewährte die in Bremen 1982 geborene Künstle rin Laila Seidel einen Einblick in ihr vielfältiges künstlerisches Schaffen. 45 Bildschirme waren online zugeschaltet.
eine künstlerische Arbeit ist von Personen, Situationen und Orten beeinflußt, die mir auf Reisen und Künstlersympo sien in verschiedenen Regionen der Welt begegnen“, sagte die Künstlerin Laila Seidel.
„Reisen bildet und bringt Menschen zusammen. Ohne Rei sen würde Kunst anders ausse hen“, hatte schon einleitend Mo deratorin Sandra Uhlich festge stellt. Sie erläuterte auch, daß Niklas Zimmermann die Künst lerin bei einer Skandinavien-Rei se kennengelernt und Seidel da bei ihren Bezug zur Tschechi schen Republik geschildert habe.

Ab ihrem zwölften Lebensjahr war Laila Seidel in der evange lischen Kirchengemeinde aktiv, wobei sie zunächst wenig bis kei ne Bezüge zu den böhmischen Ländern hatte. Dies änderte sich
im Jahr 1998, als sie an einem Austausch mit Jugendlichen aus Lidice teilnahm. „Das hat mir gut gefallen. Fasziniert war ich auch von der Sprache“, blickte sie zu rück. Aspekte dieses Aufenthalts setzte sie zum einen in Bilder (Acryl) um, zum anderen sollte die Tschechische Repbulik fortan zu einem wichtigen Teil ihres Le bens und Wirkens werden.
Eine Klassenfahrt führte in dieses Land. Einige Zeit später war sie in Stankau/Staňkov der art von den dortigen Verkehrs spiegeln begeistert, daß auch diese sich in ihren Werken wie derfanden. Bei Reisen nach Un garn und in die Slowakei fanden die dortigen Spiegel ebenfalls Niederschlag in dem einen oder anderen Bild, manchmal auch mit einem integrierten Selbst portrait. „Meine Begeisterung für die Tschechische Republik ist wach geblieben“, beschrieb sie diese Phase. Sie machte ei nen Tschechisch-Sprachkurs und
nahm zum Bremer Verein „Por ta Bohemica“, eine Gesellschaft für deutsch-tschechische Zusam menarbeit in Europa, Kontakt auf, um hier Kooperationen oder Projekte anzuregen.
Für die Weiterentwicklung ihres eigenen künstlerischen Schaffens waren nun Sympo sien in Böhmen sowie anderen Ländern wichtig. Die alte Tech nik der Hinterglasmalerei erlern te die Bremerin im Jahr 2009 bei
einem Symposium in Außerge fild/Kvilda. Und viele der dort geschossenen Fotos bildeten die Basis für spätere Werke. Weiter weg ging es im Jahr 2012 – nach Australien und Vietnam. In die sem Land in Asien begann das Interesse an der ScherenschnittTechnik.
Anläßlich des Gedenkens „100 Jahre Ausbruch des Ersten Welt kriegs“ nahm Seidel 2014 in Be neschau/Benešovan an einer
Gruppenausstellung zum The ma „Man spricht vom Krieg“ teil, die danach auch in Prag, Berlin, Wien und Sarajevo gezeigt wur de. Seidel wählte als Bildmotiv verschiedene Feldpostmarken, die sie als Scherenschnitte prä sentierte. Sie arbeitet dabei aber nicht mit einer Schere, sondern mit einem Skalpell, dessen Klin ge sich bewegen läßt.
Aufgrund ihres Engagements in der Tschechischen Republik gelang es Seidel schließlich auch, 2015 die zwischen Bremen und Preßburg bestehende Städtepart nerschaft zumindest im künstle rischen Bereich mit einem Aus tauschprojekt über Wasser und Fluß zu beleben. Dies konnte zwei Jahre später in der Ausstel lung „Rýchle Spoje“ (Schnelle Verbindung) vertieft werden, zu vor – 2015 – hatte Seidel im slo wakischen Nitra am Symposium „Multipoint“ teilgenommen. Die Jurte, das traditionelle Zelt der Nomaden in Zentralasien, war
dann zentrales Bildmotiv beim Internationalen Künstlertreffen 2017 in Kirgistan am Yssykköl, dem größten See des Landes. Aus beruflichen und privaten Gründen zog Laila Seidel 2019 nach Prag. Da ein größeres Ate lier fehlte, legte sie ihren Kunst schwerpunkt auf die Scheren schnitte. Ebenso nahm sie an Symposien in der Slowakei und in Lettland teil, wo aber auch größere Scherenschnitte entstan den. „Während der Corona-Pan demie war ich über jede Inspi ration froh“, erklärte sie. Da war dann auch das Feierabendbier in einem Prager Café ein will kommenes Motiv. Mit Schatten bildern beschäftigte sie sich im Sommer 2020, außerdem gab sie im heimischen Atelier im Pra ger Stadtteil Žižkov Kunst- und Deutschkurse. 2021 nahm sie am Open Art-Fest mit über 200 Aus stellern teil, aktuell ist das Pro jekt „Wildwuchs“ . Seidels neue Bilder sind abstrakter und von den Aborigines in Australien be einflußt.
Markus BauerTina Stroheker erhielt den Berthold-Auerbach-Preis. Zum siebten Mal vergab die Stadt Horb die mit 2500 Euro dotier te Auszeichnung. Die Stadt am Neckar im Südwesten BadenWürttembergs stiftete 1982 aus Anlaß des 100. Todestags des deutsch-jüdischen Schriftstel lers Berthold Auerbach den Preis. Anfangs wurde der Preis in unregelmäßigen Abständen verliehen; seit 2002 folgt die Verleihung in einem fünfjährli chen Turnus. Die Preisträgerin wurde in Ulm geboren und lebt heute in Eislingen an der Fils. Sie beschäftigte sich viel mit dem böhmischen Schriftsteller Josef Mühlberger (1903–1985) und ist Mitglied der Künstlergil de Esslingen.
Ausgezeichnet wurde Tina Stroheker für die 2021 in der Edition Klöpfer im Kröner Ver lag Stuttgart erschienene poeti sche Biografie „Hana oder Das böhmische Geschenk“. Damit sollten auch ihr Engagement zur Förderung von Frauen in Kul tur und Gesellschaft und ihr Ein satz für die Verständigung mit Osteuropa die verdiente Wür digung erfahren. Das reich illu strierte Buch widmet die Autorin ihrer verstorbenen Freundin, der Germanistin, Bürgerrechtlerin und Charta-Unterzeichnerin Ha na Jüptnerová. In 67 Al bumblättern verbin det Stroheker eine Auswahl schlich ter Familienfo tos mit sprach lich dichten, sensiblen Texten. So entsteht ein poetisches Portrait, eine ganz eigene, persönliche Art der Biographie, die das reiche Le ben einer mutigen und beein druckenden Frau in Streif lichtern spiegelt.

Die im August verstorbe nen Lyrikerin Johanna Ander ka schrieb über Strohekers Buch: „Jüptnerová lebte in Hohenelbe im Riesengebirge. Sie war Lehre
In München eröffnete an zwei Standorten die Ausstellung „Ra dio Free Europe. Stimmen aus München im Kalten Krieg“. Die Schau gibt unter anderem an hand von fünf bewegten Biogra phien Einblick in das Leben von Mitarbeitern der Radiosender Radio Free Europe und Radio Liberty. Ob am Mikrofon oder hinter den Kulissen – durch die vielfältigen Lebensgeschichten entsteht ein vielstimmiges Bild der Sender von den Anfängen in den fünfziger bis in die neunzi ger Jahre.
Radio Free Europe/Radio Li berty produzierten in Mün chen während des Kalten Krie ges Nachrichten, Kultur- und Sportprogramme in über 20 ost
rin, Dolmetscherin, Dissidentin, Brückenbauerin zwischen Deut schen und Tschechen und Chri stin. Vor allem aber war sie, wie man zwischen den Zeilen lesen kann, eine Freundin der Auto rin, jemand, der ihr trotz räumlicher Entfer nung nahe stand, sonst wäre die ses wundervol le Buch nicht in der Art und Weise ent standen, in der es sich dem Leser darbietet; of fen und mutig, berichtend und interessant und sehr, sehr poe tisch.“
Nach Jüpt nerovás Tod wurde Tina Stroheker von der Familie gebe ten, aus einer Anzahl in einem Pappkarton aufbewahrter Fotos eine Auswahl zusammenzustel len, um dadurch das Leben der Verstorbenen nochmal bewußt
werden zu las sen. Für das dar aus später ent stehende Buch wählte Stroheker 67 Fotos aus den 67 Jahren Leben der Verstorbenen aus, zu denen sie jeweils eine Ge schichte erzählt.
Die Autorin gibt sich nicht als allwissende Er zählerin, sondern als eine Chroni stin, die auf der Suche ist. Die einzelnen Albumblätter, von de nen jedes zum Nach-Fühlen und Nach-Denken einlädt, do kumentieren das freundschaftli che Sich-Annähern zweier Auto rinnen. Immer wollte Jüptnerová auch an das deutsche Erbe ihrer Region erinnern, was in Strohe kers Buch schön deutlich wird.
Diese deutsche Vergangen heit böhmischer Regionen ist Ti na Stroheker aus ihrem früheren Schaffen sehr wohl bewußt. Denn sie machte mit einigen ihrer Ar
beiten den bereits in Vergessenheit geratenen böhmi schen Schriftstel ler Josef Mühl berger (1903–1985) wieder bekannter. Mühl berger, dessen Bücher 1936 ver boten worden waren, betätig te sich zuletzt als Übersetzer tsche chischer Litera tur und zählte zu jenen Schrift stellern, deren Hauptanliegen der Gedanke der Vermittlung zwischen Deutschen und Tschechen war.

Tina Stroheker, 1948 in Ulm geboren, studierte 1967 bis 1972 Germanistik, Geschichte und Po litikwissenschaft in München. Danach unterrichtete sie zehn Jahre lang an Gymnasien in Göp pingen und Schwäbisch Hall. Seit 1983 arbeitet sie als freie Schrift stellerin. Sie war Gastschreiberin im polnischen Lodz und 1986 Sti pendiatin der Villa Massimo in
Rom. Tina Stroheker wurde 1992 mit dem Literaturpreis der Stadt Stuttgart und 2017 mit dem An dreas-Gryphius-Preis der Künstl ergilde ausgezeichnet. Unter an derem ist sie Mitglied im PENZentrum Deutschland sowie der Künstlergilde (Ý SdZ 38/2018) und engagiert sich im Förder kreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Heute lebt sie in Eislingen an der Fils.
Josef Mühlberger und Berthold Auerbach

Strohekers 2003 erschiene nes Buch „Vermessung einer Distanz“ ist ein Erfahrungsbe richt über Begegnungen mit dem Schriftsteller, über den sie bereits 1999 in „Mein Kapitel Mühlber ger. Erinnerungen an einen Au tor“ geschrieben hatte. Für ihre Verdienste um den Schriftsteller erhielt sie 2003 den Josef-Mühl berger-Preis. Bei einer Konferenz über Mühlberger im Jahr 2015 traf Stroheker schließlich auch auf Hana Jüptnerova.
Der Schriftsteller Berthold Au erbach, eigentlich Moses Baruch
europäischen Sprachen. Die amerikanischen Sender wurden bis in die siebziger Jahre von der CIA finanziert und sollten in den kommunistischen Ländern Ost europas, in denen es keine Me dienfreiheit gab, eine Gegenöf fentlichkeit herstellen.
In der Sowjetunion galt Mün chen mitunter sogar als „Haupt stadt der feindlichen Emigrati on“. Mit Störsendern, Agenten und gezielten Anschlägen wur de gegen das Wirken der Radio
sender ge kämpft. 1995 zogen die Sender nach Prag. Sie senden heu te noch in 20 Länder –unter ande rem nach Af ghanistan und jetzt wie der verstärkt nach Ruß land.
Aufgrund des Zwei ten Welt kriegs befan den sich 1945 Hunderttausende Menschen unfreiwillig in Bay ern. Menschen aus vielen euro päischen Ländern sind aus Kon zentrations- und Arbeitslagern befreit worden. Darunter befan den sich auch die von den Natio nalsozialisten als Jüdinnen und Juden Verfolgten, von denen nur wenige die Schoa überlebt hat ten. Außerdem war München für Osteuropäer, die vor den neuen kommunistischen Machthabern flüchteten, die nächstgelegene Stadt in der amerikanischen Be satzungszone. Dort angelangt kamen einige dieser Personen auf unterschiedliche Weise in Kontakt zu Radio Free Europe.
In der Galerie Einwand im Stadtmuseum München und im
Foyer des Jüdischen Museums München kommen Zeitzeugen in Video-In terviews zu Wort. Fotos und Doku mente veran schaulichen ihren Weg nach Mün chen und ih re Arbeit für die amerika nische Mili tärregierung im Kalten Krieg. Viele wirkten im Hintergrund – zum Beispiel als Redakteure, Techniker oder als Analysten bei der Auswertung osteuropäischer Nachrichten. Aufgrund ihrer Sprach- und Lan deskenntnisse konnten sie für die psychologische Kriegsführung im Kalten Krieg eingesetzt wer den. Die Arbeit bei den Sendern ermöglichte ihnen, sich in Mün chen eine Existenz aufzubauen. Graphic Novels, die in Zusam menarbeit mit Studierenden der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung in Ulm entstan den, geben Einblicke in entschei dende Momente aus dem Leben der ehemaligen Mitarbeitern. Sie zeigen, wie das Ringen um Zu gehörigkeit, Loyalität, Liebe und
Anerkennung ihr Leben im Mün chen der Nachkriegszeit prägte.
Die Geschichte der Einwande rung in den ersten Jahren nach dem Ende des Zweiten Welt kriegs wurde in deutschen Stadt museen bisher kaum behandelt. Die unmittelbare Nachkriegsge schichte aus jüdischer Perspekti ve ist dagegen von jüdischen Mu seen bereits genauer erforscht. Erstmals beleuchten nun das Münchener Stadtmuseum und
Auerbacher, wurde 1842 mit sei nen „Schwarzwälder Dorfge schichten“ bekannt, in denen er „ein ganzes Dorf vom ersten bis zum letzten Hause“ schilderte.
Die Auszeichnung der Literatin mit dem nach Auerbach benann ten Preis wurde von der Stadt Horb zu dessen 210. Geburtstag am 28. Februar bekanntgegeben und im Mai von Horbs Oberbür germeister Peter Rosenberger an Tina Stroheker im Schloß Nord stetten überreicht. In dem pracht vollen Barockschloß wurde 1986 das Berthold-Auerbach-Museum eingerichtet.
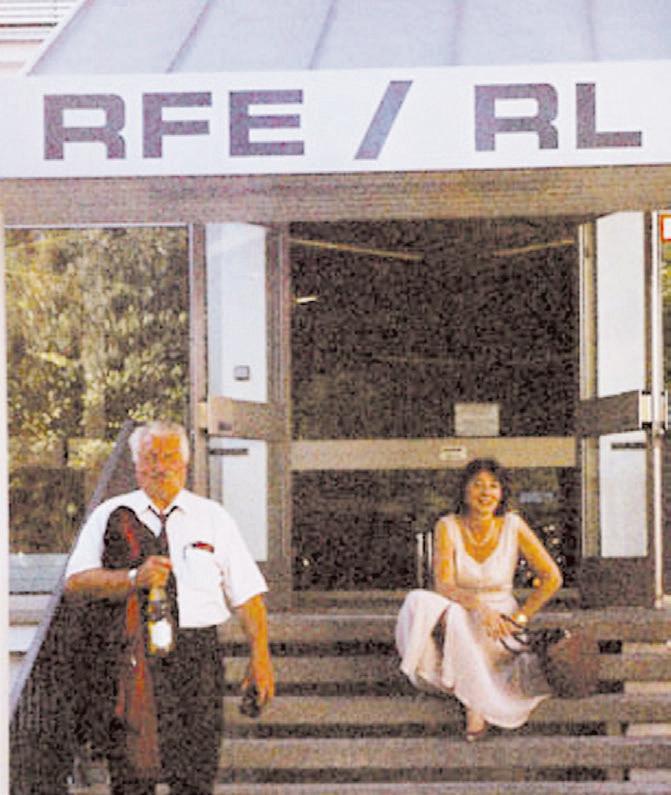
Die Laudatio zur Preisträge rin hielt Sibylle Knauss, die ei nige markante Passagen des Bu ches nachzeichnete. Das Buch sei „dem Wesen der Hana Jüptnero va auf der Spur“ – die tschechi sche Germanistin werde einfühl sam porträtiert. Es sei ein Album, ein „poetisches Porträt“, sagte Knauss. Tina Stroheker sei in ih rem Buch gelungen, aus vielen „Lebensschnitzeln“ ein Portrait von Hana Jüptnerova zu formen, das durch große Intensität beste che.
 Susanne Habel
Susanne Habel
das Jüdische Museum München mit dem Projekt „Nachkriegszeit und Migration in München“ die Diversität in der lokalen Nach kriegszeit. In mehreren Ausstel lungsprojekten werden unter schiedliche Themen dieses brei ten Spektrums behandelt. „Radio Free Europe. Stimmen aus Mün chen im Kalten Krieg“ präsen tiert nun die ersten Ergebnisse und Sammlungsgegenstände.

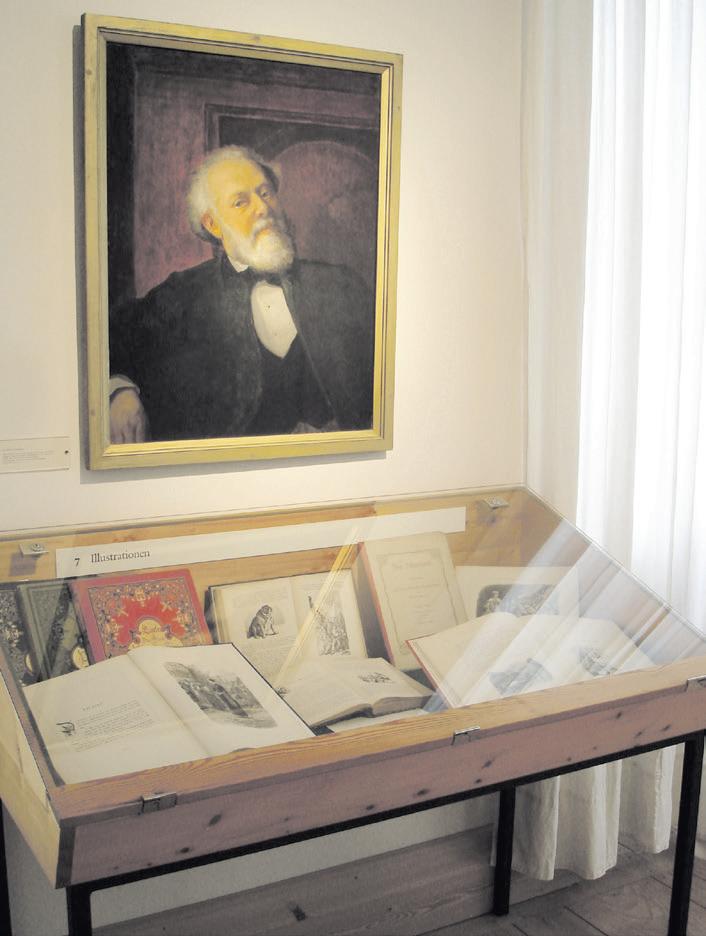

„Radio Free Europe. Stimmen aus dem kalten Krieg“ in Mün chen Stadtmuseum, Sankt-Ja kobs-Platz 1, Galerie Einwand: Dienstag bis Sonntag 14.00–18.00 Uhr. Jüdisches Museum Müchen, Sankt-Jakobs-Platz 16, Museumsfoyer: Dienstag bis Sonntag 10.00–18.00 Uhr.
 Tina Stroheker liest Mittwoch, 26. Oktober um 19.00 Uhr im Su detendeutschen Haus in Mün chen-Au, Hochstraße 8. Weitere Termine Ý www.tina-stroheker. de
Tina Stroheker liest Mittwoch, 26. Oktober um 19.00 Uhr im Su detendeutschen Haus in Mün chen-Au, Hochstraße 8. Weitere Termine Ý www.tina-stroheker. de
Mitte September sprach Klaus Mohr vom Sudetendeutschen Museum in München vor der oberpfälzischen SL-Kreisgruppe Burglengenfeld-Städtedreieck, Anfang Oktober unternahm die Kreisgruppe einen Ausflug.
men, Mähren und Sudetenschle sien in den Westen vertrieben, wo nicht immer alle gerne auf genommen wurden. In der Ab teilung „Nachkriegszeit und Neubeginn“ sehen wir eine Do
von Ullwer-Paul die Nähe zur böhmischen Heimat. Ziel war zu nächst die Felsturm-Burg Fal kenberg an der Waldnaab. Die Burg wirbt seit ihrer millionen schweren Revitalisierung 2015 zu
destag der „Resl“ mit einem Pon tifikalgottesdienst in Konners reuth begangen. Ein Teil der Mitreisenden besuchte auch das Grab der Resl auf dem Friedhof.

itte September trafen sich fast 30 Mitglieder der SL in den Heuserstuben.
Dort begrüßte Obfrau Sigrid Ullwer-Paul den Referenten Klaus Mohr. Dieser zeigte in einem Film den modernen Bau über drei Etagen, in dem rund 10 000 Exponate ausge stellt sind. Weitere 40 000 la gern im Depot, die auch für Ausstellungen ausgeliehen werden können. Der Auf bau des Museums ist chro nologisch und nach Land schaften und Regionen ge gliedert. Unter dem Schlagwort „Heimat und Glaube“ werden Katholisches, evangelisches und auch jüdisches Brauchtum doku mentiert, zum Beispiel mit einem drei Meter langen Hochzeitszug.
kumentation über das mittelfrän kische Bubenreuth, wo vertriebe ne Geigenbauer aus Schönbach im Egerland eine neue Musik industrie aufbauten, selbst Elvis Presley und die Beatles kauften dort Gitarren. Die Gablon zer Schmuckindustrie wie derum war nach Kaufbeu ren-Neugablonz vertrie ben worden. 2009 schlossen Kaufbeuren und Gablonz eine Städtepartnerschaft, was das Museum ebenfalls dokumentiert.

Mit einem Präsent dank te Sigrid Ullwer-Paul Klaus Mohr für den überaus in teressanten Einblick in das Museum und erinnerte an die Jahreshauptversamm lung am 30. Oktober in den Heuserstuben.
Recht mit dem Prädikat „Leucht turmprojekt der Oberpfalz“. Die Führung offenbarte die architek tonischen Raffinessen der mo dernen Innenausgestaltung: teils Museum, teils Hotelbetrieb über vier Geschosse mit technisch auf wendig neu eingebautem Aufzug von unten bis oben.

Die fast 1000jährige Geschich te der Burg ist kenntnisreich do kumentiert. Mehrere Stationen zeigen Bilder des früheren Be sitzers, einstigen Deutschen Bot schafters in Moskau und Wider standskämpfers gegen Adolf Hit ler, Graf Friedrich-Werner von der Schulenburg.
Leichter Regen beeinträchtig te die Besichtigung zweier Kirchenanlagen. Die Große Kappl-Kirche bei München reuth, ein Höhepunkt der Barockbaukunst von Georg Dientzenhofer, beeindruck te sowohl durch die mar kante Außengestalt als auch durch ihre erst 1934 bis 1940 neu entstandenen riesigen Deckengemälde im Inneren.

Die Abteilung „Wirtschaft und Kultur“ zeigt Thonnet-Mö bel, Kuhnert-Strümpfe, Fahrrä der und die Böhmerland, mit drei Metern das längste Motorrad der Welt, und dokumentiert den weit verbreiteten Tourismus. Nicht zuletzt die weltbekannten Kur bäder Karlsbad, Marienbad und Franzensbad zogen und ziehen unzählige Gäste an. Eine Glas ausstellung beweist, wie groß die böhmische Glaskunst war.

Eine Abteilung widmet sich dem Nationalismus und dem Na tionalstaat, eine andere dem Ver lust und der Vertreibung. Nach dem Krieg wurden rund drei Millionen Deutsche aus Böh
Anfang Oktober suchten 45 Landsleute unter der Leitung
Die erst im Sommer einge weihte Gedenkstätte lernten die Ausflügler in Konnersreuth ken nen: das Theres-Neumann-Mu seum im Schafferhof. Knapp zwei Wochen vorher hatte schon das Bistum Regensburg den 60. To
Ein kurzer Abstecher über die deutsch-tschechische Grenze brachte die Gruppe zum alten Wallfahrtsheilig tum Maria Loreto in Altkins berg bei Eger. Diese Anlage war nach dem Zweiten Weltkrieg verfallen und wurde in den Jah ren 1992 bis 2002 auf Initiative des heimatvertriebenen sudeten deutschen Unternehmers Anton Hart mit Hilfe vieler Spenden wieder renoviert. Seine Tochter Ulrika Hart informierte vor Ort über das wichtigste Lebenswerk ihres Vaters, die Rettung von Ma ria Loreto. Der Wallfahrtsort wird auch heute noch von bayerischen Pilgergruppen aufgesucht. Die Burglengenfelder besichtigten den Kreuzgang mit seinen neu gestalteten Bildern und den aus drucksstarken Plastiken von Hat to Zeidler, die Kirche und den Ziegelbau der Santa Casa mit der Schwarzen Madonna. Der Bus fuhr auch den Prozessionsweg mit Blick auf den Wondreb-Stau see nach Neukinsberg hinunter, der ursprünglichen Heimat von Anton Hart.

Dank der Zuwendung des Bundesministeriums des In nern und für Heimat und der Gemeinde Netschetin/ Nečtiny wurden auch heu er die Lesungen des letzten in der Tschechischen Repu blik in Egerländer Mundart schreibenden Autors Måla Richard Šulko veranstaltet.
den Deutschen auch die Eger länder Mundart verstehen. Gute organisatorische Ar beit hatte Alice geleistet. Ob wohl sie im Minderheitenaus schuß der Stadt Komotau ar beitet und einen kleinen Sohn hat, opfert sie ihre Zeit für die deutsche Minderheit. Vielen Dank für die jahrelange, sehr gute Zusammenarbeit.
Anfang Oktober fand die Haupt versammlung der oberfrän kischen SL-Ortsgruppe Naila statt.
O
bmann Adolf Markus blickte auf einige Großveranstaltun gen zurück. Hilfreich sei, auch die nachwachsende Generation auf ihre Wurzeln hinzuweisen. Dazu böten Geschichte und Kul tur der Heimat Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien sowie die aktuellen deutsch-tschechischen Verbindungen, zum Beispiel im Jugend- und Schüleraustausch, gute Möglichkeiten. Markus wies auch auf die sozialen Me dien, speziell auf das SudetenNetzwerk sudeten.net hin.
Nach der Totenehrung für vier im letzten Verbandsjahr verstor
bene Mitglieder freute sich Mar kus über vier neue Mitglieder und erwähnte die Betreuung und Besuche bei Krankheit und Jubi läen, Kontaktgespräche und In fo-Schriften. Bei Gedenken an das Selbstbestimmungsrecht am 4. März und an Massaker und Vertreibung nach Kriegsende 1945 sei die SL den Opfern ge genüber verpflichtet, die Wahr heit zu offerieren. Markus skiz zierte dann die Geschichte in Böhmen, Mähren und Sudeten schlesien vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Vertreibung.
Das deutsche Volk samt den Vertriebenen sei sich der Na zi-Verbrechen größtenteils be wußt und trage dafür die Kollek tiv-Verantwortung, nicht die Kol lektivschuld. Geschichte dürfe
aber nicht einseitig und die Deut schen nur als Tätervolk darge stellt werden. 15 Millionen deut sche Heimatvertriebene aus dem früheren deutschen Osten hätten besonders büßen müssen, kon statierte Adolf Markus. Zur Fort führung des sudetendeutschtschechischen Dialogs gehö re – wie in Deutschland – die tschechische Aufarbeitung des damaligen Unrechts gegen die Sudetendeutschen. Damit siche re man Frieden und Versöhnung auf der Grundlage eines gerech ten Ausgleichs dauerhaft.
In den letzten Jahren, so Mar kus, hätten wir etliche eindrucks volle Gesten des wachsenden tschechischen Respekts vor den sudetendeutschen Opfern erlebt. So beim Gedenken der Stadt
Brünn für den Brünner Todes marsch. Seit 17 Jahren gingen junge Tschechen zum Geden ken in umgekehrter Richtung ei nen Friedensmarsch, heuer mit dem Brünner Oberbürgermei ster, Stadtverordneten, dem SLLandesvorstand von Bayern und Baden-Württemberg, darun ter Steffen Hörtler, Margaretha Michel, Andreas Schmalcz und 160 weitere SL-Mitglieder. Dar über hinaus sei heuer am Brün ner Mendelplatz dem Vater der Vererbungslehre, Johann Gre gor Mendel, anläßlich seines 200. Geburtstages gedacht worden.
Der 72. Sudetendeutsche Tag in Hof und die Marienbader Ge spräche in der Heimat zeigten das zukunftssichernde grenz überschreitende Wirken der Verantwortlichen der SL. Nach dem Kassenbericht wies Markus auf die erfolgreiche Arbeit der SL-Verbandsspitze hin, so von Volksgruppensprecher Bernd Posselt, mit der Intention, die Geschichte nicht erst den Histo rikern zu überlassen. Mit einer zeitgeschichtlichen Foto- und Film-Dokumentation und einem Imbiß beendete der Obmann die Versammlung.
åla Richard lebt am Plachtin bei Netschetin und kann mit seinen 62 Jahren immer noch diese halb verges sene Sprache des deutschen Stammes in Westböhmen nicht nur dem Fachpublikum, sondern auch dem Mehrheits volk präsentieren. Daß auch die verbliebenen Egerländer dazukommen, ist selbstver ständlich. Mit seinem Sohn Vojtěch Šulko, der die Le sungen auf der Zither beglei tet, bildet er das Duo „Måla boum“.
Mitorganisator der ersten Lesung am 10. September war das Karlsbader Museum, wel ches seinen Sitz direkt gegen über dem Grandhotel Pupp hat. Die Stärkung für die Le sung war also klar. Im im alt österreichischen Stil gebau ten Hotel speisten die „Måla boum“ zu Mittag und waren damit für den Auftritt gut vor bereitet. Leider fiel die Lesung gerade auf den Tag, an dem ein Stadtmarathon stattfand. Und die Route führte direkt am Museum vorbei. Straßen sperrungen und Lärm waren also an diesem Nachmittag die Begleiter. Deswegen ka men auch nur neun Leute zur Lesung. Diese Zuhörer waren jedoch Fachleute, wie die Dis kussion sich nach der Lesung bewies.
Mitveranstalter der zwei ten Lesung war der örtli che Kulturverband der Deut schen in Komotau mit Alice Hlaváčková an der Spitze. Sie hatte diesmal das Restaurant Bei den Rittern gewählt, weil sie die Lesung mit der Herbst versammlung des Verbandes verband. Mit 17 Teilnehmern lag Komotau wieder an der Spitze der Teilnehmerzahl bei den Lesungen. Das lag nicht nur daran, daß die dort leben

Partner bei der dritte Le sung war die Hroznata-Akade mie im Stift Tepl. Eliška Rado vá begrüßte die Målaboum mit folgenden Worten: „Wir ha ben für die Lesung den wun derschönen Kapitelsaal vor bereitet, er hat aber ein klei nes ,Häkchen‘, er wird nicht geheizt.“ In den Klöstern welt weit schwitzt man nirgendwo, auch nicht bei heißen Som mertagen, im Tepler Hochland ist es aber noch viel schlim mer. Beim Betreten des ehe maligen Winterrefektoriums, welches nach 1945 komplett ausgeraubt worden war, stell te man fest, daß es dort wirk lich ein wenig kälter ist. Gut, daß sich die beiden Künstler zuvor im Klosterrestaurant ge stärkt hatten und die einein halb Stunden dann aushielten. Nur das Zitherspiel war mit den kalten Fingern ein wenig schwieriger.
Belohnt wurden die „Måla boum“ und die zwölf Zuhörer aber mit wunderbaren Dek kenfresken von Anton Waller aus dem Jahre 1913 und einer sehr guten Akustik. Man ver steht nicht, warum dort keine Stühle sind, aber wenn man auf den Bänken entlang der Fenster sitzt, hört man auch die Zither sehr gut. Für den Måla Richard war es die größ te Freude, daß zur Lesung ein Geschichtslehrer aus Marien bad gekommen war, der nicht wußte, daß es die Egerländer Mundart noch gibt. Deshalb bot Måla Richard einen Vor trag in der Schule an, damit die Kinder auch wissen, welch reiches und einzigartiges Kul turgut es im Egerland gibt.
Die Leserreihe war also wieder ein voller Erfolg, und die „Målaboum“ freuen sich schon auf die Leserreise im kommenden Jahr.



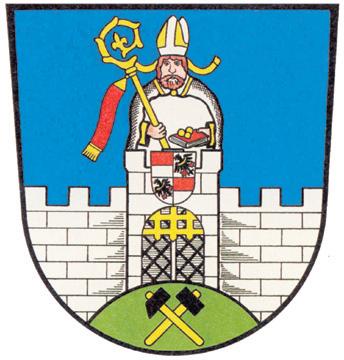



Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Tele fon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
Nachfolgend einer von Her bert Rings letzten noch unver öffentlichten Beiträgen über die Bergstadt Graupen/Krupka im böhmischen Erzgebirge:
E

ine reichliche Bildersendung mit einem herrlich gerahm ten Panoramabild von Graupen, eingesandt von Jan Kobliha, Bi lin, veranlaßte mich, über die einst berühmte und bekannte Bergstadt Graupen zu schreiben. Übrigens ist Graupen die zweit größte Stadt im Heimatkreis Te plitz-Schönau. Die Stadt Grau pen hatte im Jahr 1930 4092 Ein wohner, davon 3624 Deutsche, 364 Tschechen und 99 Auslän der. Nach der Zusammenlegung mit Mariaschein und einigen um liegenden Orten waren es etwa 6000 Einwohner.

Die Stadt Graupen liegt am südöstlichen Fuß des Erzgebir ges mit einer durchschnittlichen Seehöhe von 340 Metern. Die Entstehung der mittelalterlichen Bergstadt Graupen ist mit der Förderung von Zinn verbunden, deren Höhepunkt in das 12. und 13. Jahrhundert fällt. Man be
hauptet, daß Graupen der älteste Fundort von Zinn in Mitteleu ropa sei.
Darüber schreibt Johann Wolf gang von Goethe, der Graupen
mehrmals besuchte, in seinem Aufsatz „Aus Teplitz“ (1810): „Graupen behält immer etwas Erfreuliches durch seine Lage.
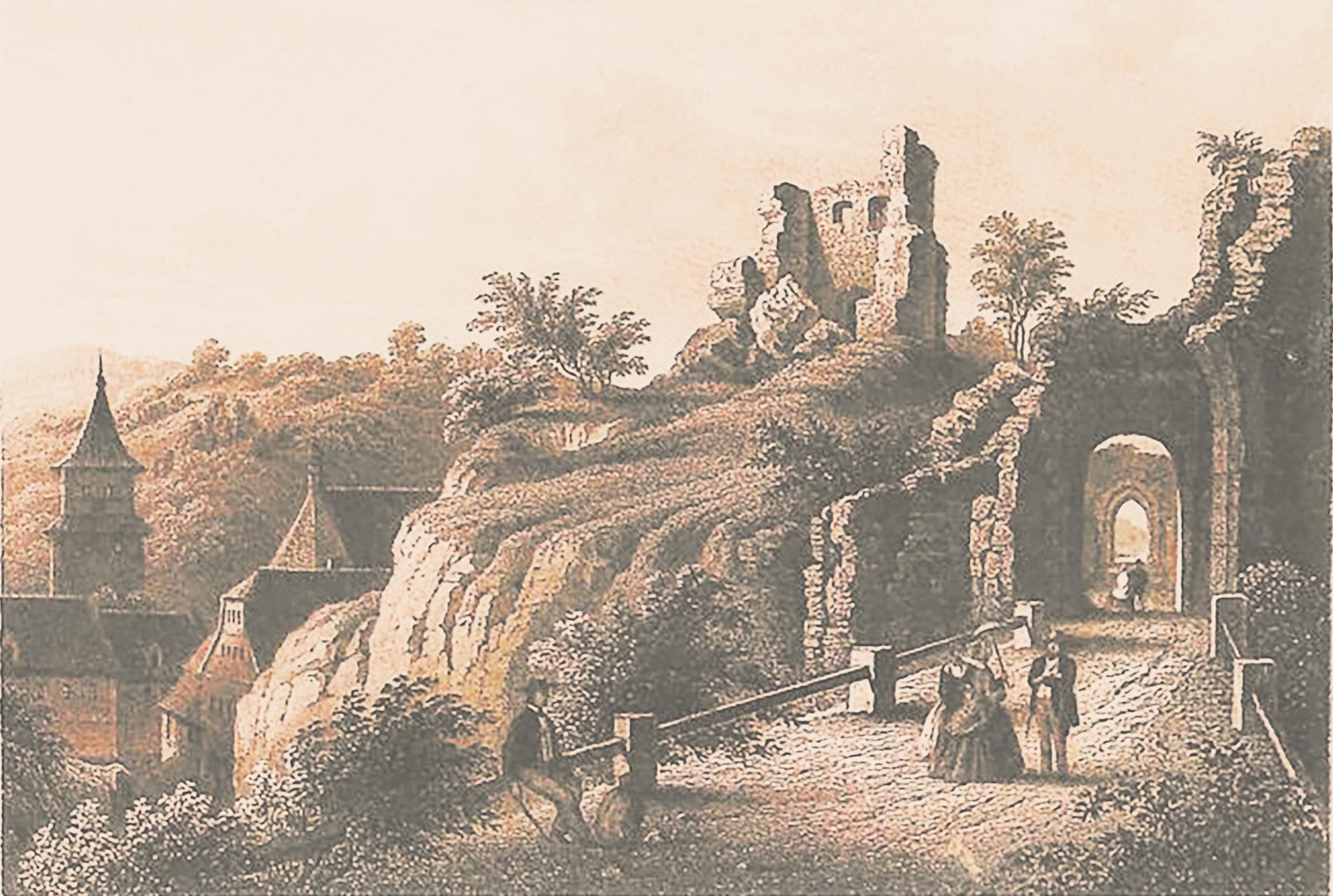
Die Aussicht von der Bühne der
ehemaligen Burg Graupen (spä ter Rosenburg) läßt gar bald die Schlucht vergessen, durch die man sich heraufgewunden hat. Der Bergbau, den sie auf schma len, aber sehr reichen, Zinngän gen im Gneis treiben, geht sach te. Die ,Zinngraupen‘, von denen das Örtchen den Namen hat, sind die schönsten der Welt. Auf der Grube ,Regina‘ fand ich die herr lichsten Anbrüche, aber, was den Mineralogen betrifft, noch keine lange Ausbeute.“

Mit der Einfuhr des billige ren ausländischen Zinns war es auch mit der Ausbeute der Grau pener Zechen vorbei. Der Berg bau erlosch, und die Bedeutung der einst blühenden Stadt ging mächtig zurück.
Wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs von Graupen er hielt die Stadt im Jahr 1479 von König Wladislaw II. das Stadt wappen und, damit verbunden, wichtige Stadtrechte. Als Folge der Zinnerzförderung kam es in diesem Jahrhundert auch zu ei nem Aufschwung von Gewerben, welche sich in Zünften zusam menschlossen.



Der Name der Stadt „Cru pa“ (1332) soll nach tschechi scher Forschung von dem Wort „krupý“ abstammen, was soviel wie „stark“, „mächtig“, „groß“ bedeutet. Der deutsche Name Graupen sei eine bloße Überset zung des tschechischen Wortes.
Dabei ist nicht zu bestreiten, daß sich nach der Völker wanderung vom 5. bis 7. Jahr hundert slawi sche Stämme in Bohemium (Böhmen) an siedelten. Die se bevorzugten besonders Ge genden an Flüs sen, weil sie sich der Viehzucht widmeten.
Der Eisen pflug wurde erst während der Ostkolonisati on durch deutsche Stämme ein geführt. Da Graupen am Fuß des Erzgebirges liegt, ist es durch aus möglich, daß sich dort zu
erst slawische Stämme ansiedel ten. Doch nach der Entdeckung des Zinnerzes durch Bergleute aus dem benachbarten Sachsen, nahm deren Einwohnerzahl rapi de zu.
Schließlich bekam der sächsi sche Edelmann Timo von Kolditz noch die Oberhoheit über die Stadt Graupen. Die ses Geschlecht erbaute auch die Burg Graupen: „Hrad Krupka“, wie auf dem zweisprachig betitelten Stich zu lesen ist. Spä ter entstand aus dieser die Rosen burg, welche ein Anziehungspunkt der Teplitzer Kur gäste war. Zur selben Zeit wie die Burg Grau pen entstand bei dem nahe gele genen Ort Hohenstein die Gei ersburg, von welcher später nur noch Ruinen übrig blieben. Fortsetzung folgt
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Das Wesen der Mundart untersuchte einst der langjährige Ronsperger Ortsbetreuer Franz Bauer.
Mundart ist die Sprache des einfachen, meist bäuerlichen Volkes, die sich deutlich von der Schriftsprache unterscheidet. Sie führt weitgehend ältere Sprachzustände in Wortbestand, in Wortformen und im Satzbau fort. Viele Wörter, die in der Hochsprache längst ausgestorben sind, leben in der Mundart kräftig weiter. Unsere Ronsperger Mundart bietet dafür anschauliche Beispiele.

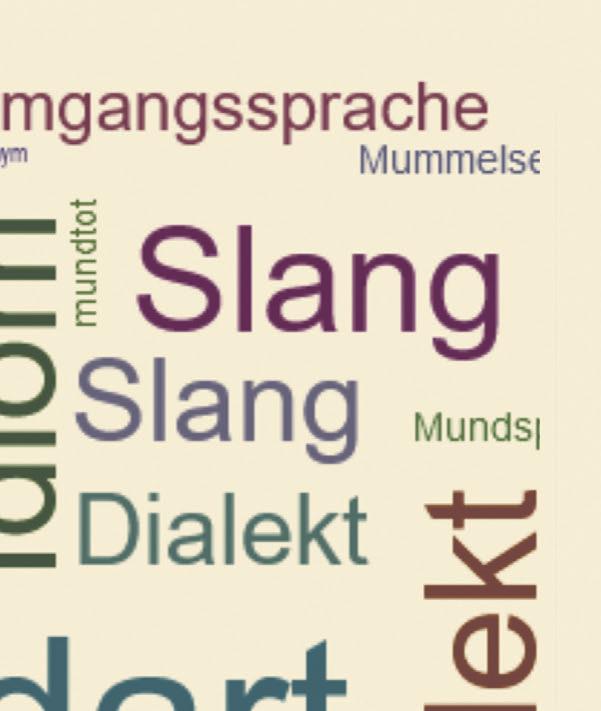
Ein im Germanischen noch allgemein gebrauchtes, vielleicht sogar indogermanisches Wort finden wir in dem Ausdruck i(n)drucken, wie wir das Wiederkäuen der Kühe bezeichneten, mittelhochdeutsch iterukken. Das mittelhochdeutsche Eigenschaftswort urez für übel kennen wir noch in unserem sich ures essen für sich an einer Sache überessen. Das mittelhochdeutsche areweiz für Erbse hat sich nahezu unverändert im mundartlichen arwas erhalten. Wer ahnt, daß im Inslich das althochdeutsche ingislahti für inneres Schlachtwerk noch existiert, obwohl es in den meisten Landschaften von dem anderen althochdeutschen Wort un-gislahti für zum Essen nicht verwendbares Schlachtwerk, später Unschlitt, verdrängt wurde? Ebenso behauptete sich mit Råtz eine mittelhochdeutsche Nebenform, in der Schriftsprache dominiert Ratte.
Alte Wortformen haben sich erhalten in der Anrede dia(r)ts an eine ältere Person. In enka, enk, enk haben wir eine Form des Fürworts vor uns, das ursprünglich die Zweiheit (Dual) bezeichnete und die sonst übliche Mehrzahl ihr, euer, euch, euch im 13. Jahrhundert schon aus der bayerischen Mundart verdrängte. Wir unterscheiden auch beim Zahlwort zwei noch die drei verschiedenen Geschlechter, was der Schriftsprache seit dem 17. Jahrhundert verloren ging. Wir sagen zwöi(n Manna für zwei Männer, zwou Köi für zwei Kühe, zwoa Weiwa für zwei Weiber.

Die Mundart, vom lebendigen Menschen gesprochen, ist nicht starr, sondern für Einflüsse durchaus offen. In unserer Gegend spielt selbstverständlich die nahe Grenze zum Tschechi-
schen eine Rolle. Das Wort Wawa für Großmutter hat seine ganz eigene Geschichte. Es ist ein altes slawisches Lallwort, bába für alte Frau, wurde als babe sogar ins Mittelhochdeutsche übernommen und lebt als Wawa bei uns weiter. Auch bei den Kosewörtern Tschitscherl für Kätzchen und Tschucherl für kleines Schwein standen das tschechische kočiči und čučeti Pate.
Wer denkt noch bei Bluzer für das verächtliche Wort für Kopf an das tschechische palice für Kolben, Schlegel, Kopf? Offenkundig ist dagegen für jeden die tschechische Herkunft von Wörtern wie Pohontsch für Kleinknecht (pohonči), Watschina für
herab und blieben hier am Leben, während sie in den höheren Kreisen wieder verschwanden. Bei uns kennt man noch das Lawoa(r für Waschschüssel (laver heißt waschen), man dischkriert, flaniert, ist blessiert; zu Hause stehen Kredenz und Stellage; egal, mischand (méchant für böse, schäbig), kuschen und kujonieren sind auch französischen Ursprungs. Daneben behaupten sich aus dem Italienischen spago für Bindfaden unser Spåchåt für Schnur, aus dem Lateinischen stante pede, extra und stambül, um nur einige der geläufigsten zu nennen.
Die Sprache der Ronsperger ist im Grunde Egerländer Mund-
gen zwischen der echten Mundart und der Schriftsprache. Für Ronsperg wird das beispielsweise in der Wortwahl deutlich.
In der Umgebung spricht man meist von der Fosnat, in der Stadt vom Fåsching, der Ronsperger sagte wohl noch Irda für Dienstag, doch kaum mehr Pfin(g)sta für Donnerstag. Auch die in den umliegenden Dörfern übliche Aussprache g für anlautendes j, etwa in Gåua, gunge Leit, Gud, machte man in Ronsperg nicht mehr mit. Man sagte Jåua für Jahr, junge Leit für junge Leute und Jud für Jude. Nur der Spitzname Flußgude und der Ausdruck Gåuamark für Mitbringsel vom Jahrmarkt wurden aus dem dörflichen Bereich unverändert übernommen.
Auch in anderen Wörtern wie Låm für Lehm statt Loam, dahoim für daheim statt dahoam oder Kne(d)l für Knödel statt Knin(d)l unterscheidet sich die Sprache der Ronsperger von der ihrer Umgebung.
Besonders kennzeichnend für den Ronsperger Dialekt ist aber die Tatsache, daß hier verschiedene Zwielaute mit a mit einfachem Selbstlaut, also ohne a gesprochen werden; dazu kommt noch eine starke Nasalierung. So sagt man in Ronsperg Bo(n statt Boa(n oder Bua(n für Bein oder für Zahn Zoh(n statt Zoa(n oder Zua(n, wie dies in den meisten Dörfern der Umgebung der Fall ist. Nach Johann Andreas Schmellers „Bayerisches Wörterbuch“ finden wir solche Nasalierung auch im Gebiet der Vils und der oberen Naab in der Oberpfalz.
Brotzeit am Nachmittag (svačina für Jause), Liwanzen (livance für gegossene Dalken) und pritsch für weg (pryč).
Der Verkehr mit jüdischen Händlern hat seinen Niederschlag gefunden in den Mundartwörtern schofel für schlecht, mischugge für verrückt, bschummeln für betrügen, Pofl für Minderwertiges und koscher für rein, unbedenklich.
Eine Gruppe von Wörtern französischer Herkunft gehört ebenfalls zum Bestand der Mundart. Sie sind nicht Überreste einer relativ kurzen Besatzungszeit. Vielmehr sanken sie aus der Sprache gehobener Schichten zu gewissen Zeiten in die Volkssprache
art, die wiederum zur großen Familie des Nordbairischen gehört. Im südlichen Egerland haben sich manche urtümlichen Formen noch erhalten, zum Beispiel kommt Noat für Nacht nach Ernst Schwarz nur noch hier in einigen Inseln vor, sonst erst wieder westlich der Rhön. Auch Formen wie schleat oder Kneat für schlecht und Knecht sind noch ursprünglicher als das auch in unserer Gegend im Vordringen begriffene schleacht, Kneacht oder gar bereits schlecht und Knecht, wie man in Ronsperg sagte.
Gerade in der Landstadt, die einen regeren Verkehr aufweist als ein kleines abgelegenes Dorf, vollzieht sich ein stärkeres Rin-
Man kann deshalb den Ronsperger Dialekt als eine Sondermundart des Egerländischen bezeichnen. Gesprochen wird diese nasalierte Stammsilbe auch in Muttersdorf und Waier, ferner in den bei Ronsperg liegenden Dörfern Semlowitz, Hoslau, Wilkenau, Schüttwa und Waldersgrün. Wir finden sie aber nicht in den genau so nahe liegenden Dörfern Sadl, Trohatin, Berg, Natschetin und Wonischen. Ob hier alte Herrschaftsverhältnisse eine Rolle spielen?
Die Zeit der Mundarten ist abgelaufen. Unsere Mundart ist durch die Vertreibung zum Tode verurteilt. Aber auch die anderen sind täglich bedroht und auf dem Rückzug begriffen durch die gleichmachende Sprache von Zeitung, Funk und Fernsehen.
Die folgende Aufstellung bringt typische Mundartwörter aus Ronsperg und seiner näheren Umgebung. Vollständigkeit kann in diesem Rahmen nicht angestrebt werden.
Frånz, Franzl für Franz; Päita für Peter; Girgl, Schorsch, Schorschl, Schurl für Georg; Wenz für Wenzel; Zenz für Vinzenz, Heini, Heinerl für Heinrich; Annerl, Nan(d)l für Anna; Håns, Schanl für Johann; Wäwel, Wettl, Betti für Barbara; Seff, Sepp, Seppl, Pepp, Pepperl für Josef; Fanni, Fannerl für
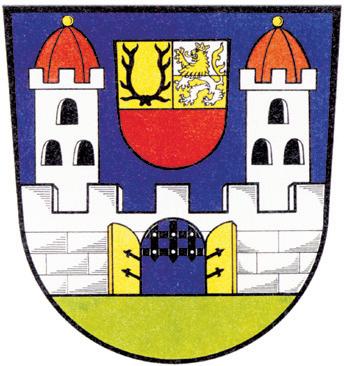
Franziska; Rettl für Margareta; Koa(r)l für Karl; Moria, Mizzi, Marie für Maria; Matz für Matthias; Zusl für Susanne; Naz für Ignaz; Ua(r)schl für Ursula.
Vätta, Tata für Vater, Bou, Bouwerl, Böiwl für Bub, Bübchen; Mutta, Mama für Mutter; Moi(d)l für Mädchen; Ha(r)la für Großvater; Dockn mittelhochdeutsch Tocke, germanisch dutkon, (Lallwort) für Puppe; Wawa für Großmutter; Vetta für Onkel, Basl für Tante; bäign für weinen; Duat (mittelhochdeutsch tote) für Pate;


rülln für laut weinen; Duate für Patin; gätzn für stottern; Bischlkind für Wickelkind; drockn für nach Worten suchen; Bischl für Steckkissen; Braigum für Bräutigam; Bischlpolsta für Steckkissen; Braat für Braut; Bischlbånd für Wickelband; Håchzat für Hochzeit; Wäign für Wiege; Badazettl für Todesanzeige; Nutschl für Schnuller; Grebmas für Begräbnis; Schladerl für Rassel; Speifleckl für Lätzchen; Freidhuaf für Friedhof.
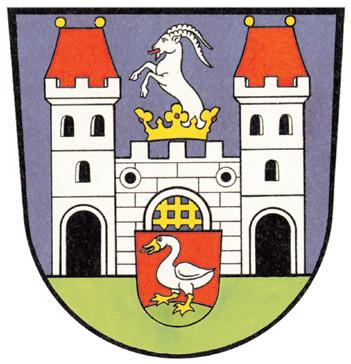
Wäidung (mittelhochdeutsch wêtuom) für Schmerz; Rufa(r)n
für Wundkruste; Måusn (mittelhochdeutsch mase) für Narbe, Fleck, Mal; Refma für Rheuma; Kinstn für Schrunde; d‘ Fleck für Masern; dräntschn für einen Wind lassen; s Hi(n)fållat für Epilepsie; Kniawl für Fingerknöchel; Strauchn für Schnupfen; d‘ Maichat für die Rückseite (der Hand); schnudern für Nase putzen; Buawl für trokkener Nasenschleim; Måterie (mittelhochdeutsch materie für Stoff, Flüssigkeit im Körper, besonders Eiter, von lateinisch materia) für Eiter; Oas, Ois für Furunkel, Knockl für Beule; Plepara für (geschwollene) Lippe.
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der zweite Teil seiner Arbeit über Pfarrer Jakob Lenz (1801–1863).
Nach den Aufzeichnungen von Pfarrer Jakob Lenz kann die zurückliegende Reparatur des Turmdaches nicht ermittelt werden, da bei der Herabnahme des Turmkopfes die vorgefundenen Pergamente und Schriften völlig verwittert und unlesbar waren. Jedoch wird gemutmaßt, daß die letzte Reparatur nicht vor dem Jahr 1729 stattfand, da der Turmkopf einige Gebete zum heiligen Johannes von Nepomuk enthielt, und dessen Heiligsprechung erst im Jahr 1729 stattgefunden hatte.
In den Jahren 1851 und 1852 entsteht die Straße vom Stadtplatz bis zur Zankstraße durch fleißiges Zusammenwirken der Bevölkerung. Auch wird der Hohlweg am südwestlichen Ende der Stadt als Anfangspunkt der nach Ronsperg und Muttersdorf führenden neu errichteten Straßen erweitert.
Aufgrund eines kaiserlichen Erlasses wird im Jahr 1850 in Böhmen und in allen anderen Ländern der Monarchie die seit Jahrhunderten bestehende Dominikal- und städtische Gerichtsbarkeit aufgehoben. Als Nachfolger werden dafür landesfürstliche Behörden eingeführt. Durch diese Neuerung erhält auch Hostau ein landfürstliches k. k. Bezirksgericht. Die Stadtverwaltung Hostaus läßt dazu ein eigenes Gebäude für 17 218 Gulden errichten. Den Grund für dieses Gerichtsgebäude schenkte Fürst Trauttmansdorff der Stadt. Das neue Gerichtsgebäude wird am 15. November 1855 feierlich durch Dechant Lenz eingeweiht und dann von k. k. Beamten übernommen. Eine Beschreibung dieses Ereignisses erschien in der „Prager Zeitung“ am 28. November 1855. Eine komplette Abschrift dieses Zeitungsartikels wird in das Memorabilienbuch aufgenommen. Darin heißt es unter anderem:

„Das eintönige und stille Leben in unserer Stadt wurde am 15. des Monats durch ein glänzendes Freudenfest unterbrochen ... schon am Vorabende überraschte die hier weilende Schauspielergesellschaft das zahlreich versammelte Publikum durch den Anblick des reichdekorirten von acht als Genien gekleideten Bürgermädchen umgebenen Bildnisses Sr. k. k. apo-
stolischen Majestät, vor welchem die freudig bewegte Zuschauermenge die Volkshymne sang. Am 15. um 9 Uhr Vormittags versammelten sich unter feierlichem Glockengeläute und Pöllerschüssen die hier stazionirten k. k. Beamten, die Stadtvertretung, die k. k. Gendarmerie, die sämmtlichen Gemeindevorstände des Amtsbezirkes, die Schuljugend und eine große Menschenmenge in der Dechanteikirche, wo der hochwürdige Herr Stadtdechant P. Jakob Lenz unter überaus zahlreicher Assistenz der Kuratgeistlichkeit des Hostauer Amtsbezirkes vor dem Hochaltar zunächst das ,Veni sancte spiritus‘ anstimmte.
Hierauf setzte sich der Festzug unter Vorantritt der Schuljugend und der Zünfte mit ihren Fahnen nach dem neuen Amtsgebäude in Bewegung; dort hielt der Herr Stadtdechant von den Stuffen des Portals herab eine der Feier des Momentes angemessene Rede, worauf während der Absingung einer von dem wackern Musterlehrer Herrn Franz Pauli gedichteten und in Choralmusik gesetzten, von dem gesammten Lehrpersonale des Amtsbezirkes meisterhaft vorgetragenen FestKantate die kirchliche Einweihung der Lokalitäten des neuen Amtgebäudes vor sich ging ... als hierauf die Versammlung in einem von dem hiesigen Herrn Kaplan P. Klaus verfaßten, von zwei k. k. Beamtenkindern vorgetragenen Festgedichte zu einem dreifachen ,Hoch‘ für unseren allgeliebten Landesvater aufgerufen wurde, da schlugen tiefgerührt die treuen Herzen dem kaiserlichen Herrn entgegen. Nachdem der Zug in derselben Ordnung in das Gotteshaus zurückgekehrt war, wurde die Volkshymne abgesungen und schließlich von dem Herrn Stadtdechant ein feierliches Hochamt und Tedeum abgehalten.“
Im Archivmaterial findet sich ein mit scharfem Ton geführter scharfer Schriftwechsel in den Jahren 1852 und 1853 über die Abhaltung des Kreuzweges. Aufgrund einer Beschwerde einiger Hostauer Bürger, namentlich Michael Schröpfer, Paul Steinbach, Johann Schmid, Adam Steinbach und Johann Thoma, an das bischöfliche Konsistorium in Budweis im März 1852 über die Weigerung des Dechanten Lenz, an den Nachmittagen der Fastensonntage eine Kreuzwegandacht durch einen Priester abzuhalten, bittet zunächst die bischöfliche Behörde durch den Bezirksvikar, Matthäus Pangerl, Dechant Lenz um Stellungnahme.

Weiden in der Oberpfalz ist die Patenstadt der Tachauer. In der dortigen evanglischen Pfarrkir che Sankt Michael stieß Heimat kreisbetreuer Wolf-Dieter Ham perl auf das Pfarrgemeindeblatt mit dem Titelthema „Flucht und Vertreibung.



chon die erste Geschichte der Bibel im Alten Testament ist eine Geschichte der Vertreibung, Adam und Eva müssen das Para dies verlassen. Geschichten vom Ursprung erzählen, wie es im mer war. Anscheinend sind Men schen nie ganz zu Hause in die ser Welt. Denn so geht es weiter.
Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, ist ein unstet Fliehen der, Abraham zieht als Migrant aus seiner Heimat und Verwandt schaft aus, von Jakob wird er zählt, daß er seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht betrog und vor seiner Rache zu seinem Onkel Laban floh. Josef wird von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft, in der Fremde macht er eine beispiellose Kar riere als rechte Hand des Pharao.
Das Buch Ruth berichtet von ei ner Israelitin, die der Hunger aus Israel nach Moab trieb, und die später, begleitet von ihrer moa bitischen Schwiegertochter Ruth, zurückkehrte, die ihrerseits ihr Glück in der neuen Heimat fand.
Die Geschichte, die bis heute die Identität des jüdischen Vol kes stiftet, ist der Auszug aus Ägypten, die geglückte Flucht aus dem Sklavendasein. Man verstand sich als freies Volk ei nes freien Gottes.
In all diesen Geschichten spie gelt sich das Schicksal eines Vol kes, das große Deportationen verkraften und verarbeiten muß te. 587 wurde das Königreich Ju da von den Babyloniern erobert und der Tempel zerstört, die Oberschicht nach Babylon ver schleppt. Obwohl die Ankömm linge mit Häusern, Vieh und Ak ker ausgestattet wurden und vermutlich keine zu große wirt schaftliche Not litten, war der Verlust der Heimat doch wohl traumatisch. Gleichzeitig begann man ganz neu über Gott nachzu denken. Gottes Nähe war nicht an ein bestimmtes Land, eine Stadt, einen Tempel gebunden. Als Herr und Schöpfer der gan zen Welt konnte er einen überall hin begleiten. Er ging alle Wege mit und führte auf neue Wege.
Was es heißt, fremd und schutzlos zu sein, wußten die Is raeliten aus eigener Erfahrung, und deshalb war in ihren Gebo ten ein für damalige Verhältnis se humanes Recht für die Frem den niedergelegt. Das göttliche Recht hatte die Aufgabe, arme und besonders gefährdete Men schen zu schützen. „Wenn ein Fremder bei euch wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken und aus beuten. Er soll wie ein Einheimi scher bei euch wohnen. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid damals in Ägypten auch Fremde gewesen.“
Der Fremde war kein Auslän der im strengen Sinn, den Be griff gab es noch nicht. Er war je denfalls kein Einheimischer, der durch seine Geburt schon im mer dazu gehört hatte. Da er aber in Palästina als Einwande rer, Flüchtling oder Wanderar beiter dauerhaft wohnte, sollte er Rechtsschutz genießen und Re
spekt. Auch er war am Sabbat von Arbeit befreit. Volle Rechtsfähig keit, die auch den Erwerb von Grund und Boden umfaßt hätte, wurde allerdings nicht gewährt.
In den Evangelien des Neu en Testaments wird Jesus als ein Mensch geschildert, der seine Heimat ganz und gar in Gott fand und deshalb auf heimatliche Bin dungen verzichtete. Jesus ver ließ sein bisheriges Leben, seine Angehörigen, seinen Beruf, sein Dorf, um von einem Ort zum an deren zu ziehen und Gott zu den Menschen zu bringen. Er genoß Gastrecht bei vielen Menschen und zog dann weiter. Frei, aber ungeschützt, war sein Leben. Die Füchse hätten ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Men schensohn aber habe keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kön ne, sagt er über sich. Matthäus erzählt schon in den Kindheits geschichten Jesu, daß er und sei ne Familie vor einem Mordan schlag des Herodes nach Ägyp ten fliehen mußten.
Die Briefe des Neuen Testa ments gehören in die Zeit, in der sich schon christliche Gemein den gebildet hatten. Sie fordern auf, Gastfreundschaft zu üben. Wandermissionare oder Glau bensflüchtlinge waren auf frem de Hilfe angewiesen. Die Aus breitung des Evangeliums wä re gar nicht möglich gewesen ohne die Gewißheit, bei Glau bensgenossen unterzukommen.
Mit der Zeit wurden Regeln ein geführt, damit das Gastrecht nicht mißbraucht wurde. Nur so konnte vielen Menschen ge holfen werden. Wenn einer län ger als drei Tage blieb, sollte er arbeiten und sein Geld verdie nen. Das Gastrecht unterschied in der Regel zwar zwischen Chri sten und Nichtchristen, aber das Augenmerk fiel auf die Not ei nes Menschen, der abgeholfen werden sollte. In der Rede Jesu Christi fällt nur noch sie ins Ge wicht. „Ich bin ein Fremder ge wesen, und ihr habt mich auf genommen.“ Im Fremden wird nicht nur der Mitmensch gese hen, der mich anrührt, Christus selbst identifiziert sich mit ihm.
Der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen schrieb umfassend über Flucht und Ver
treibung in der Bibel. Seiner Schlußfolgerung für die heuti ge Zeit schließe ich mich an. Er glaubt nicht, daß aus den bibli schen Erzählungen und Wei sungen unmittelbar Erkenntnis se darüber zu gewinnen wären, wie man heute mit Flucht- und Wanderungsbewegungen umge hen sollte, aber daß die Bibel Ge schichten und Gedanken enthält, die dazu anstiften, eine eigene Balance aus Barmherzigkeit und Besonnenheit, Nüchternheit und Nächstenliebe zu finden.“
Edith LangFlucht aus Czernowitz 1940

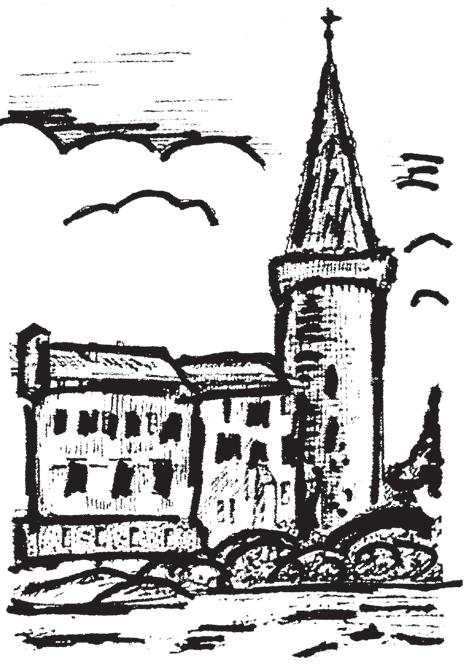
Emma Wittmann/Schmegner kam am 20. Oktober 1933 in Czernowitz, damals Bukowina, heute Teil der Ukraine, zur Welt und wuchs mit ihrem drei Jahre jüngeren Bruder bei den Großel tern auf, da beide Eltern berufstä tig waren. Ein freies Kinderleben in einem Dorf voller Möglichkei ten für unabhängige Streifzüge, die bis in die Hütte des Hofhun des führten.
1940 begann die Zeit der Ver treibung, der Flucht, der Heimat losigkeit statt der von Adolf Hit ler vollmundig angekündigten großen Umsiedelung in für die Errichtung eines Großdeutschen Reichs eroberten Ostgebiete. 1940 wird Emma Wittmann mit ihrem Bruder und ihrer Mutter in Niederschlesien in einem Lager in Lauban interniert, wo das Ver gnügen des siebenjährigen Mäd chens darin besteht, den Erwach senen das Tanzen abzuschauen, wie es zumindest bei einer Sil vesterfeier noch möglich war. Das Tanzen hat sie ihr ganzes Leben nicht mehr losgelassen. Wenn es ihr heute auch manch mal schwerfällt, bleibt sie dabei: „Auch wenn ich wehe Füße hab, getanzt wird.“
Striegau ist die nächste Station auf der Flucht nach Westen. Blei bende Erinnerungen einer Kind heit auf der Flucht: die Heraus forderung, Bäume zu erklettern, ja sogar einen Fahnenmasten zu erklimmen. Zugleich Spiel und Verstecken. 1943 erreichen sie Schloß Fürstenstein, das, auf Fel sen erbaut, bei Angriffen Schutz
in den Felsenkellern bietet. Geschlafen wird in einer Reithal le, vollgestellt mit Stockbetten, die Matratzen mit Stroh gefüllt, das immer wieder mal ausge tauscht wird. Dann liegt ein gro ßer Strohhaufen im Hof, bevor die Betten neu gefüllt werden –für die Kinder herrlich, aus dem Fenster im zweiten Stock in den Strohhaufen hinein zu hüpfen. 1943 wird der Bruder Wilhelm geboren, der Liebling des ganzen Lagers, der jedoch schon nach 10,5 Monaten stirbt.
Zur Schule nach Waldenburg muß Emma damals jeden Tag sechs Kilometer zu Fuß gehen und mittags wieder zurück. Da dort Partisanen unterwegs sind, werden die Kinder von einer äl teren Frau begleitet. Sie bleiben unversehrt. Auf der nächsten Sta tion, in Freiburg, werden am 22. Mai 1944 Zwillinge geboren. Ein halbes Jahr können sie dort in ei ner gemauerten Baracke mit Ein bauküche in der Nähe des Bahn hofs leben.
Von Breslau drängen immer mehr Flüchtlinge, die Russen kommen immer näher, so bestei gen sie eines Tages einen Zug Richtung Tschechoslowakei, fah ren durch Prag. Mit elf Jahren er lebt Emma, wie der Zug vor ihnen beschossen wird und Leichentei le neben den Gleisen liegen. In einem Lager in Haid erleben sie die letzten Tage des Krieges. Die Amerikaner beschießen Haid. Überall brennt es. Emma ent deckt in einem fremden bren nenden Haus ein Gemälde von einer Frau, die in einem Kreis von Engeln sitzt. Sie läuft in das Haus und rettet das Bild. Leider ging es irgendwann später verlo ren. Gefragt, ob sie nach Bayern möchten, werden Emma und ih re Familie auf einem Lastwagen der Amerikaner durch Ansbach nach Triesdorf zum Viehumla deplatz gebracht. Von dort holen sich Bauern Arbeitskräfte.
So kommen sie nach Willen dorf und Großbreitenbronn zum Bauern Kolb. Die Mutter arbei tet, die Kinder gehen in die Schu le, 1. bis 8. Klasse in einem Raum. Ihr Wohnraum ist sehr klein und so kalt, daß trotz Ofen die Jacke im Winter nicht ausgezogen wer den kann.
kommt der Va
ter aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause, die Mutter hatte ihn durch das Rote Kreuz suchen las sen. Emma erinnert sich, wie sie ihrem Vater überglücklich in die Arme springt. Er findet im Hüt tenwerk in Weiherhammer ei ne Anstellung und holt die Fa milie nach Weiherhammer. Dort schließt Emma die Schule nach der 8. Klasse ab. Der Wunsch, als Modistin nach Frankreich zu ge hen, bleibt ein Traum, der Vater will sie zu Hause behalten, zumal die Mutter krank wird und Emma immer mehr ihre Aufgaben über nehmen muß.
1952 bekommt Emma eine er ste Anstellung im Hotel Eiche als vierte Kraft in der Küche, dann arbeitet sie als Zimmermädchen, Vertretung des Kochs und an der Waschmaschine. Es folgen wei tere Stellen, bis sie heiratet und sich um ihre Familie kümmert. Emma Wittmann hat fünf Kinder, 18 Enkel, 20 Ur- und zwei Urur enkel.
Auf meine Frage, wie sie trotz all der Erlebnisse ihr Leben so gestalten konnte, antwortet sie: „Wir waren damals Kinder, ha ben den Krieg oft verdrängt, ha ben trotzdem gespielt und ge lacht. Und wir haben auf einan der geachtet.“ Sich um andere kümmern, das tut sie noch heute in der Familie, in ihrer Hausge meinschaft oder in der Gemein de. Elisabeth Heider
Flucht aus der Ukraine 2022
Die Ukraine, meine Heimat, ist ein sehr friedliches Land. Sie ist das Land der Dörfler und Bauern. Das Land ist reich an fruchtba ren Böden. In der Region Podil ja, wo ich herkomme, ist die Erde schwarz, und die Humusschicht ist so dick wie nirgendwo in Eu ropa. Die Leute lieben ihr Land. Dort wird noch viel zur Selbstver sorgung angebaut. Auch meine Eltern, die krankheitsbedingt in der Ukraine geblieben sind, le ben von ihrem Stück Land. Das alles klingt zunächst friedlich –bis zum 24. Februar, als der Ag gressor die Ukraine überfiel.
Ab diesem Zeitpunkt bedeu tet es für meine Eltern, in einem schrecklichen Umfeld zu über
leben. Die Rente ist, kriegsbe dingt, sehr klein geworden. Mo natlich bekommen sie gemein sam 100 Euro. Sie hoffen, daß die Rente trotz Krieg weiter gezahlt wird. Meine Mutter hat eine nicht heilende Entzündung am Fuß und kann nur noch schwer laufen, mein Vater ist seit eini gen Jahren völlig blind und von meiner Mutter abhängig. Die se Tatsachen machen mir gro ße Sorgen, zumal die benötigten Medikamente, kriegsbedingt, Mangelware sind. Man versucht sich mit Naturheilmitteln zu hel fen. Ihr Land möchten sie den noch nicht verlassen, auch auf Grund ihrer Krankheiten.
Ihre innere Flucht ist ihre Ar beit am Land und die Hoffnung, daß der Krieg bald vorbei ist und wir uns wieder treffen können.
Die Bilder von zerstörten Städ ten und Dörfern, den vielen toten Menschen erscheinen mir surre al, verstörend. Wer kann so et was wollen? Es muß ein schreck liches Gefühl sein zu fliehen, um sein eigenes Leben zu retten, und alles der Zerstörung zu über lassen, was bis zu diesem Mo ment dein Leben ausgemacht hat. Unter den registrierten Op fern in der Ukraine sind mehr als 200 Kinder.
Die Flucht ist für die Mütter oft die einzige Möglichkeit, ih re Kinder zu schützen. Ein Urin stinkt, der stärker ist als Angst. Überfüllte Züge aus der Ukraine Richtung sicheren Westen brann ten sich ins nationale Gedächt nis der Ukrainer ein. Krieg kennt viele Geschichten von Flucht, die leider nicht immer gelingt. In den ersten Tagen des Krieges lief eine Familie aus Irpin bei Kiew über 20 Kilometer zu Fuß in der Nacht mit zwei kleinen Kindern und einer 85jährigen Frau, die vor Erschöpfung einfach auf dem Feld liegen blieb. Oder die Ge schichte einer Oma, die mit ih rem kleinen Enkel aus dem zer bombten Dorf bei Kiew versuch te, mit dem Boot auf dem Fluß zu fliehen. Tage danach fand man das gekenterte Boot, später bei de Leichen.
Das sind Einzelschicksale, die sich aber im Moment täglich in der Ukraine wiederholen. Krieg verändert die Menschen. Die schrecklichen Erlebnisse hin terlassen tiefe Wunden. Das Le ben wird nie mehr so sein wie vor dem Krieg. Junge Menschen und Kinder leiden besonders an den Folgen des Krieges. Für eine mo derne, wohlbehütete Generation, die in einer unabhängigen, frei en Ukraine aufwuchs, ist dieser Krieg ein Alptraum. Es gibt eini ge, die permanent das Bedürfnis haben zu fliehen. So die 20jäh rige Irina aus Charkiw, die eine ständige Bombardierung durch russische Raketen in den ersten Wochen des Krieges miterlebte. Sie findet nirgendwo ein Gefühl der Sicherheit. Das Erlebte treibt sie immer wieder in die Flucht, dorthin, wo keine Bomben oder Raketen sie erreichen können, dennoch findet sie nirgendwo wirklich Ruhe.
Flucht ist immer mit dem schmerzhaften Verlust der Hei mat verbunden. Die geflüchte ten Menschen aus der Ukraine werden in Deutschland so herz lich aufgenommen, sie sind sehr dankbar dafür. Dennoch wollen sie schnellstmöglich wieder zu rück zu ihren Verwandten und ihren Lieben in der Heimat. Auch ich hoffe, meine Eltern bald wie derzusehen.