Zeitung


HEIMATBOTE

Andrej Babiš hofft auf den Dominoeffekt
Wenig Macht, viel Repräsenta tion: Ex-Premierminister Andrej Babiš hat immer wieder deut lich gemacht, daß er nur über schaubare Ambitionen hat, die Nachfolge von Miloš Zeman als Staatspräsident anzutreten. Doch jetzt bewirbt sich der AnoChef trotzdem um das höch ste Amt – und dies, obwohl sei ne Chancen in den vergangenen Monaten dramatisch gesunken sind. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt.

Babiš versuchte nicht einmal den Anschein zu wahren, sei ne Partei Ano hätte sich für ihn als Präsidentschaftskandidaten entschieden. Am Sonntag, einen Tag bevor die Parteigremien zu sammenkamen, verkündete der Multi-Milliardär und Ano-Chef
� Ukraine sagte DankeSelenskyj zeichnet Fiala aus
Dieser Orden ist eigentlich nur für Staatsoberhäupter vor gesehen: Für seinen persön lichen Einsatz für die Ukrai ne hat Staatspräsident Wo lodymyr Selenskyj den tschechischen Premierminister Petr Fiala mit dem Orden des Fürsten Jaroslaw des Weisen, 1. Klasse, ausgezeichnet.
Bei der Verleihung in Kiew sagte Selenskyj, die Ukrai ne bedanke sich damit für Fia las „herausragenden Beitrag zur Entwicklung der ukrainischtschechischen Beziehungen so wie für dessen Eintreten für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine“.
„Ich bin nicht nur überrascht und wirklich gerührt. Ich weiß diese Ehre sehr zu schätzen. Ich verstehe sie als Auszeichnung für das tschechische Volk, für die Tschechische Republik, für die große Unterstützung, die die Ukraine in unserem Land ge nießt“, sagte Fiala.
Um ein Zeichen der Solida rität zu setzen, hatte Fiala trotz der akuten militärischen Bedro hung mit den Regierungschefs von Polen und Slowenien bereits im März Kiew besucht. Jetzt war Fiala mit seinen wichtigsten Mi nistern erneut in die ukrainische Hauptstadt gereist. PN Bericht Seite 5

nach einem Treffen mit Präsident Miloš Zeman im Fernsehen sei ne Kandidatur. Die Parteigenos sen konnten tags drauf nur noch „Ano“ sagen, also „Ja“.

Während andere Kandidaten ihren Hut schon vor Monaten in den Ring geworfen hatten, zö gerte Babiš bis zuletzt. Aus gu tem Grund: Seit ein paar Wochen muß sich der erfolgreiche Unter nehmer vor einem Prager Gericht wegen des Vorwurfs des Subven tionsbetrugs verantworten.
Es geht um zwei Millionen Eu ro – in der Welt, in der Babiš lebt, eigentlich Peanuts, aber in der Realität drohen dem Ex-Re gierungschef sogar mehrere Jah re hinter Gittern, in jedem Fall aber viele negative Schlagzeilen.
In den Umfragen hat Babiš, der noch vor wenigen Monaten
klar in Führung lag, bereits deut lich an Boden verloren. Mittler weile gehen die Demoskopen da von aus, daß Babiš bereits im er sten Wahlgang gegen Kandidat General Petr Pavel das Nachse hen haben wird. Demnach wer den Pavel 25,4 Prozent vorherge sagt und Babiš nur 23,5 Prozent.
Die Stichwahl, da sind sich al le Beobachter einig, würde dann Pavel, der auch von den Regierungs parteien un terstützt wird, klar gewinnen.

Auch Wirt schaftsprofes sorin Danuše Nerudová, die mit 10 Prozent im ersten Wahl gang derzeit auf Platz drei liegt, würde, sollte sie gegen Babiš in eine Stichwahl kommen, beste Chancen haben, den Ex-Regie rungschef im direkten Vergleich zu besiegen.
Diese Hochrechnungen kennt auch Babiš, der alles, aber nicht
blauäuig ist. Und dem man nach sagt, daß er nichts mehr haßt als Niederlagen. Aber genau des halb könnte diese Kandidatur Sinn machen. Babiš hat nämlich noch eine Rechnung offen – mit Premierminister Petr Fiala, der ihn bei der vergangenen Parla mentswahl aus dem Amt gejagt hat. Das wahre Ziel von Babiš ist demnach nicht das Präsidenten amt, sondern das des Premier ministers, urteilt der bekann te Journalist und Buchautor Petr Nutil in einem Kommentar. Nu til beschreibt Babiš als „großen Pragmatiker“, der bei den Parla mentswahlen „zweifelsohne ein Vielfaches mehr an Siegchan cen als im Zweirundensystem der Präsidentschaftswahlen“ ha be. Nutil sieht die Präsident schaftskandidatur deshalb als
Auftakt für den Parlamentswahl kampf, also als Domino-Strate gie: „Die Kampagne von Andrej Babiš wird zweifellos auf einer Antipathie gegen die derzeiti ge Regierung aufbauen, auf ei ner massiven Mobilisierung von Menschen, die mit den Energie preisen und der hohen Inflation unzufrieden sind, und auf natio nalistischen und MöchtegernPatriotischen Erzählungen von Menschen, die gegen das Sy stem sind. Wir werden zweifel los eine starke Desinformations kampagne erleben. Babiš spielt, wie immer, nur für sich selbst, für seine eigenen Interessen, für die Interessen von Agrofert. Ich bin der festen Überzeugung, daß er in größeren Abständen denkt, als wir uns eingestehen wollen.“
Torsten Fricke„Neun Jahrzehnte Charlotte Knobloch“ – wie groß die Aner kennung für die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist, spiegelt die Rednerliste beim Festakt am Sonntag wider.
Bundespräsident Frank-Wal ter Steinmeier, Bayerns Mi nisterpräsident Markus Söder, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Dr. Josef Schu ster, Präsident des Zentralrates


der Juden in Deutschland, wür digten in der Ohel-Jakob-Syn agoge das außergewöhnliche En gagement der Brückenbauerin für Demokratie und Menschen würde.
Neben zahlreichen anderen Ehrungen hatte Charlotte Kno bloch 2019 den Europäischen Karls-Preis der Sudetendeut schen Landsmannschaft entge gengenommen.
In seiner Festrede sagte der Bundespräsident, Charlotte Kno

bloch sei „ein Glück für Deutsch land“. Ausführlich würdigte das Staatsoberhaupt Charlotte Kno bloch als mutige Frau, die die Shoa knapp überlebt hat, aber deren geliebte Großmutter von den Nazis ermordet worden ist, die dennoch die Kraft hatte, das jüdische Leben insbesondere in ihrer Heimatstadt München auf zubauen und die Verständigung zwischen Juden und Nicht-Ju den voranzutreiben.
Ministerpräsident Markus
Söder sagte, Charlotte Knobloch sei ein „Fixstern am bayerischen Firmament“, und „einfach ein toller Mensch“. Überhaupt, so stellte Söder fest, seien die Juden Bayerns fünfter Stamm.
Oberbürgermeister Dieter Reiter gratulierte mit den Wor ten: „Wie Sie sich all die Jahre und jetzt immer noch für die Be lange der jüdischen Mitbürge rinnen und Mitbürger einsetzen, ihnen eine Stimme geben, davor kann man sich wirklich nur ver
neigen. Für mich persönlich sind Sie eine Inspiration, und Sie zei gen mir, wie wichtig es ist, sich mit allem Nachdruck gegen An tisemitismus einzusetzen und al les dafür zu tun, daß sich Jüdin nen und Juden in Deutschland sicher fühlen können.“
Und Dr. Josef Schuster erklär te: „Charlotte Knobloch ist Inspi ration und Ansporn für diejeni gen, die ihr nachfolgen werden, wo auch immer.“ Torsten Fricke

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Der 1988 in der mährischen Stadt Treibitsch (geborene christlich-demokratische Politiker Šimon Heller studierte Lehramt an der Pädagogischen Fakultät in Budweis und begann 2014 seine Tätigkeit im Parlament als Referent des Abgeordneten Jan Bartošek aus seiner Partei, der KDU-ČSL.



Heute ist Heller selbst Mitglied des tschechischen Abgeordnetenhauses sowie des Senats der Südböhmischen Universität.
Der Vater von vier Kindern engagiert sich überall da, wo er Un-


recht „riecht“. Seine Kritik an der Person des Staatspräsidenten Miloš Zeman blieb nicht ohne Folgen: Er bekam, zusammen mit anderen demokratischen Politikern, keine Einladung zur o ziellen Feier anläßlich des Staatsfeiertages am 28. Oktober, die jedes Jahr auf der Burg statt ndet.
Heller besuchte auch den 72. Sudetendeutschen Tag in Hof und kehrte positiv beeindruckt von dort zurück. Die Einladung von SL-Büroleiter Peter Barton zu einem Besuch am 26. Oktober nahm er gerne an. Dabei wurde über eine weitere Zu-
sammenarbeit mit der Sudetendeutschen Botschaft des guten Willens an der Moldau gesprochen.
Wir freuen uns, daß wir in
Aussigs Hauptmann Jan Schiller zeichnet Kristina Kaiserová aus
Die tschechische Historikerin Dr. Kristina Kaiserová ist eine der Persönlichkeiten, die von Jan Schiller, Hauptmann der Region Aussig, mit dem Hejtman-Preis ausgezeichnet worden sind. Die Verleihung fand vor wenigen Tagen im feierlichen Rahmen in der BenediktRejt-Galerie in Laun statt. Nominiert hatte Kaiserová die Jan-Evangelista-Purkinje-Universität in Aussig.

Aufschlußreich ist die Begründung des Rektors der Universitäts, Prof. Dr. Martin Balej: „Die Universität hat Dr. Kaiserová für den Preis vor allem für ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Institut für Slavistik-Germa-

nistik nominiert, aber auch für ihr persönliches, fast lebenslanges Bemühen, alte Kontakte zu unseren Grenznachbarn zu erneuern, neue zu knüpfen und damit zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft beizutragen. Diese Aktivitäten sind das A und O nicht nur ihrer wissenschaftlichen Forschung, sondern auch des gesellschaftlichen Handelns, das eine große Reichweite und Resonanz findet.“
Das von Kaiserová geleitete Institut organisiert seit 1992 in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde die jährlichen Colloquia Ustensia. Deshalb ist unter den deutschen Organisatoren und Teilnehmern dieser Sommerakademie die Freude

über diese Preisverleihung natürlich besonders groß.
Kristina Kaiserová war es auch, die im Jahr 2004, also zu einer Zeit, als auf politischer Ebene in Prag eine Eiszeit gegenüber den Sudetendeutschen herrschte, die Initialzündung für die zwei Jahre später erfolgte Gründung der gemeinnützigen Kultur-, Bildungs- und wissenschaftlichen Gesellschaft Collegium Bohemicum setzte.


Das Collegium Bohemicum, dessen Aufsichtsrat Kaiserová leitet, war auch der erste Schritt zur Entstehung der Dauerausstellung „Unsere Deutschen“ im Museum der Stadt Aussig. Die Eröffnung dieser Ausstellung nach Jahren schwieriger Vorbe-



reitung am 17. November 2021 ist ganz wesentlich den langjährigen Bemühungen von Kristina Kaiserová zu verdanken.
„Wir wissen ja schon lange, was wir an Kristina Kaiserová haben. Deshalb freuen wir uns riesig, daß ihre Verdienste jetzt von Universitätsleitung und Regionalpolitik mit dem HejtmanPreis anerkannt und gewürdigt worden sind“, betonte Christoph Lippert, Bundesvorstandsmitglied der Ackermann-Gemeinde und Mit-Organisator der jährlichen Colloquia Ustensia. „Die Ackermann-Gemeinde und alle Sudetendeutschen gratulieren ihrer tschechischen Freundin ganz herzlich zu dieser hoch verdienten Auszeichnung.“

❯ Bundesversammlung in Bad Alexandersbad Wechsel an der Spitze der Seliger-Gemeinde

Auf ihrer Bundesversammlung, die im Rahmen des Jahresseminars 2022 in Bad Alexandersbad stattfand und dem Thema „Deutschland und Tschechien gemeinsam stark in schwierigen Zeiten“ gewidmet war, wählte das Präsidium Christa Naaß zur neuen Ko-Vorsitzenden der Seliger-Gemeinde – neben der bereits amtierenden Ko-Vorsitzenden Helena Päßler.
Der bisherige Ko-Vorsitzende Helmut Eikam trat aus Altersgründen zurück, wird aber weiterhin mit seiner wertvollen Erfahrung im Präsidium aktiv bleiben. In seiner Würdigung sprach Libor Rouček, ehemaliger EU-Vizeparlamentspräsident von der ČSSD und Seliger-Gemeindemitglied, sehr einfühlsam über die SG, die er seit seinen Forschungen zu den deutschtschechischen Beziehungen aus den 1980er Jahren gut kennt, und ihren Vorsitzenden Helmut Eikam. Er habe mit 17 Jahren an der Spitze der Organisation ja sogar ein Jahr länger gedient als Angela Merkel als Bundeskanzlerin, zum Nutzen der sudeten-
Umweltministerin legt Amt nieder Aus gesundheitlichen Gründen hat Umweltministerin Anna Hubáčková (KDU-ČSL) ihr Amt niedergelegt. Nachfolger soll der stellvertretende Vorsitzende der KDU-ČSL, Petr Hladík, werden. Allerdings läuft derzeit noch die Überprüfung, ob Hladík in den Korruptionsfall um städtische Wohnungen in Brünn verwickelt ist. Bis zur Klärung übernimmt Arbeitsminister Marian Jurečka (KDUČS) das Umweltressort kommissarisch mit.
Strom um 62 Prozent teurer N
egativrekord: Mit einer Steigerung von 62 (!) Prozent sind in keinem anderen EU-Land die Strompreise in der ersten Hälfte dieses Jahres so stark angestiegen wie in Tschechien, hat das Statistikamt Eurostat gemeldet. Auf den weiteren Plätzen folgen Lettland mit 59 Prozent und Dänemark mit 57 Prozent. Im Gegensatz dazu sind in einigen anderen EU-Staaten die Strompreise sogar deutlich zurückgegangen. So zahlen die Haushalte in den Niederlanden im Schnitt um 54 Prozent weniger für elektrische Energie und in Slowenien um 16 Prozent. Der Grund: Die Preisdeckelung durch den Staat und sowie der Handel mit Emissionszertifikaten.
Mehrheit der Bürger ist zufrieden
Krieg und Energiekrise zum Trotz: Eine Mehrheit der Menschen in Tschechien ist mit ihrem Leben zufrieden, hat eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM ergeben. Demnach stimmten 62 Prozent der Befragten der Aussage zu, daß sie mit ihrem bisherigen und ihrem aktuellen Leben zufrieden seien, 51 Prozent urteilten, ihnen habe es weder in der Vergangenheit an Wichtigem gefehlt, noch vermißten sie etwas Derartiges in der Gegenwart. 18 Prozent der Tschechen sind hingegen unzufrieden.
Škoda gibt in der Produktion Vollgas
Der zum Volkswagen-Konzern gehörende tschechische Autohersteller Škoda hat seine Produktion in den ersten drei Quartalen dieses Jahres um
11,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. Insgesamt verließen 647 000 Fahrzeuge die Werkshallen. Laut ŠkodaVorstandsmitglied Martin Jahn ist die Nachfrage weiterhin anhaltend hoch.
Demonstration für die Demokratie
Auf dem Prager Wenzelsplatz haben am Sonntag Zehntausende Menschen gegen Angst und Haß und für die demokratischen Werte demonstriert. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Initiative Milion chvilek (Eine Million Augenblicke für Demokratie). Bei der Veranstaltung wurde außerdem die Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht. Per Videobotschaft wandte sich auch Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, an die Demonstranten. Sie bedankte sich für die nachhaltige Unterstützung und sagte, ihr Land würde derzeit die dunkelste Zeit erleben.
Weißer Löwe: Zeman ehrt Selenskyj

Mit dem Orden des Weißen Löwen, der höchsten staatlichen Auszeichnung der Tschechischen Republik, hat Staatspräsident Miloš Zeman bei der traditionellen Ordensverleihung anläßlich des tschechischen Staatsfeiertages den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geehrt. Bereits an Pfingsten war Selenskyi für seinen mutigen Einsatz für Demokratie und Freiheit von der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem Europäischen KarlsPreis ausgezeichnet worden. Insgesamt vergab Miloš Zeman 78 Orden und Medaillen.
Prag als „Stadt der Retter“ geehrt
Besondere Wertschätzung am Staatsfeiertag: Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat der Stadt Prag am Freitag den Ehrentitel „Stadt der Retter“ verliehen. In der Begründung heißt es, der Titel werde für die Solidarität mit dem ukrainischen Volk und die umfassende Hilfe für die Ukrainer, die ihr Land verlassen mußten, verliehen. Außerdem erschien eine Sonderbriefmarke mit der Aufschrift „Jsme spolu“ (Wir sind zusammen), die die Freundschaft der beiden Länder würdigt.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546



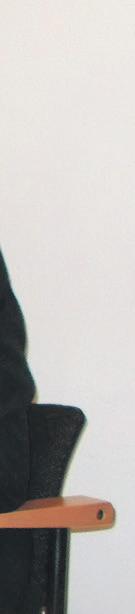
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

An welche Person aus ihrem Legen sie gedacht hat, als sie an ihrem 90. Geburtstag aufgewacht ist? „An meine Großmutter – die Hüterin unserer Familie, die wir leider verloren haben. Sie hätte sich wahnsinnig gefreut, so einen schönen Tag im Kreis der Familie zu erleben“, antwortet Charlotte Knobloch auf die Frage der Sudetendeutschen Zeitung in der Pressekonferenz zum Festakt.


Welche Bedeutung ihre Großmutter Albertine Neuland für sie hatte, insbesondere nachdem die Mutter die Familie unter dem Druck der Nazis verlassen hatte, hat Charlotte Knobloch vor Monaten im großen Interview der Sudetendeutschen Zeitung erzählt.





Auch Bundespräsident FrankWalter Steinmeier ging in seiner Festrede auf diese dunkelste aller Stunden ein: „Für Sie, die Sie erlebt haben, erleben mußten, wie Ihre über alles geliebte Großmutter Albertine Neuland Sie verließ, verlassen mußte, angeblich um auf Kur zu gehen. Aber Sie waren zu klug. Sie wußten schon in jenem Augenblick, was das bedeutete. Ein Abschied für immer. Albertine Neuland wurde deportiert, deportiert nach Theresienstadt. Sie sollte nicht zurückkehren. Jener Tag im Juni 1942 war das Ende Ihrer Kindheit, so haben Sie es immer wieder geschildert.“
Heute ist Charlotte Knobloch selbst die Hüterin der Familie –als Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Ihre Mission ist es wohl auch deshalb, vor allem die jungen Menschen für die Werte von Demokratie, Menschenrechten und Völkerverständigung zu sensibilisieren.

„Laßt euch von niemandem sagen, wen ihr zu lieben und wen ihr zu hassen habt“, antwortet Charlotte Knobloch auf die Frage, was ihre wichtigste Botschaft als Shoa-Überlebende und Zeitzeugin an die nachfolgenden Generationen ist. „Ich sage den jungen Leuten aber auch immer: Ihr habt allen Grund, euer Land zu lieben. Ich weiß, wie dieses Land, wie München, nach 1945 ausgesehen hat. Deutschland hatte damals keine Zukunft. Seid deshalb stolz darauf, wie sich dieses Land innerhalb von wenigen Jahrzehnten entwickelt hat.“
„Vergeßt niemals, was Menschen Menschen antun“

Dennoch dürfe die Erinnerung kein Ende haben, erklärte Charlotte Knobloch, warum sie als Zeitzeugin weiterhin und unermüdlich in Schulen, Universitäten und anderswo das Gespräch mit der Jugend sucht, um den „Stab der Erinnerung“ weiterzugeben, „damit Geschichte Geschichte bleibt und sich nicht wiederholt. Damit ,Nie wieder‘ nicht ,Jetzt wieder‘ wird“.


Die heutige Jugend sei weitaus interessierter, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, berichtet die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde. „Ich habe ein gutes Gefühl, daß die nächste Generation die Verantwortung, die wir ihr übertragen, auch wahrnimmt. Wir müssen allerdings auch die Voraussetzung schaffen, daß die jungen Menschen in einem friedlichen und ordentlichen Land aufwachsen können.“ In diesem Zusammenhang würde sich Knobloch ein stärkeres parteiübergreifendes Engagement insbesondere gegen den Antisemitismus wünschen. Sonntagsreden allein würden da nicht ausreichen. Charlotte Knoboch: „Vergeßt niemals, was Menschen Menschen antun.“
Unter den Gästen, die Charlotte Knobloch zu ihrem 90. Geburtstag gratulierten, waren unter anderem: IOC-Präsident Dr. Thomas Bach, Regierungspräsident a.D. Axel Bartelt, Alt-Ministerpräsident Dr. Günter Beckstein, Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Verleger Prof. Dr. Hubert Burda, Justizminister Georg Eisenreich, Publizist Prof. Dr. Michel Friedman, Staatskanzlei-Minister Dr. Florian Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann, FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Verleger Dr. Dirk Ippen, FC-Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, BayWa-Vorstandsvorsitzender Prof. Klaus Josef Lutz, Musikproduzent Leslie Mandoki, Schauspielerin Sunny Melles, Markt Arbergs Bürgermeister Jürgen Nägelein (hier wurde Charlotte Knobloch vor den Nazis versteckt), Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau, Filmproduzentin Prof. Susanne Porsche, Publizist Dr. Rachel Salamander, Landespolizeipräsident a.D. Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer und Schriftstellerin Dr. Rafael Seligmann. Torsten Fricke





Mit einer herzlichen und tiefgründigen Festrede hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Jubilarin Charlotte Knobloch gewürdigt.



Ich stehe vor Ihnen – als stolze Deutsche.“ Liebe, verehrte Charlotte Knobloch, es war still, sehr still im Plenarsaal des Deutschen Bundestags, als Sie diese Worte sagten. Diese Worte, die Sie an den Beginn Ihrer Rede am 27. Januar vergangenen Jahres in der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus stellten. Worte, die bis heute nachhallen. Welches Bekenntnis einer Frau, die als Kind verfolgt, gedemütigt, terrorisiert wurde, die unendliches Leid erlebt hat. Ich stehe vor Ihnen – als stolze Deutsche. Welche Kraft liegt in diesem Satz. Welcher Mut. Und wieviel Kraft, wieviel Mut gehört dazu, verehrte Frau Knobloch, vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags an die dunkelsten Jahre des eigenen Lebens, Ihres Lebens zu erinnern, sich selbst und uns alle! Ihre Worte damals haben mich zutiefst bewegt. ... Wir sind heute hier zusammengekommen, um eine Frau zu ehren und zu feiern, die wir alle schätzen und bewundern – wegen ihrer Kraft, ihrer Stärke, ihrer Energie, ihrer Beharrlichkeit, und ja, auch wegen ihres




Charmes. Sie ist uns allen ein Vorbild wegen ihres nie nachlassenden Engagements für die Versöhnung zwischen Juden und Nicht-Juden – und ihrem so selbstverständlichen Einsatz für unsere Demokratie. Sie, liebe Frau Knobloch, sind eine Versöhnerin und eine leidenschaftliche, streitbare Demokratin –und das schließt sich nicht aus, im Gegenteil: Sie zeigen in Ihrem täglichen Wirken seit Jahrzehn-
ten, wie sehr beides zusammengehört. Sie stehen für etwas, das nicht weniger als ein Wunder ist: daß in unserem Land jüdisches Leben wieder aufgeblüht ist, daß neue Synagogen und neue Lehrstätten entstanden sind, daß jüdisches Leben heute wieder vielfältig und in die Zukunft orientiert ist. Jüdisches Leben, das es seit 1700 Jahren in unserem Land gab und wieder gibt, daran haben wir 2021 in einem wunderbaren Fest-
jahr erinnert. Sie, liebe Frau Knobloch, haben das Menschheitsverbrechen der Shoah überlebt – und sich als Deutsche jüdischen Glaubens mit Ihrer ganzen Kraft dafür eingesetzt, daß hier in Ihrer Heimatstadt München, daß in ganz Deutschland wieder erstehen konnte, was ein für alle Mal beendet schien. ...

Ich kann kaum ermessen, welch ein unendlich weiter, schmerzhafter Weg es für Sie war

bis zu diesen Bekenntnissen. Bis zu Ihrem Satz „Ich bin eine stolze Deutsche“. ...
Sie haben Brücken gebaut über die Abgründe unserer Geschichte hinweg. Immer haben Sie das Gespräch, den Dialog gesucht für Versöhnung, für ein friedliches, aufgeklärtes Miteinander der Religionen. ...
Sie sind eine gewichtige, wichtige, eine hochgeschätzte Stimme in unserem Land, Sie scheu-
en nicht klare, deutliche Worte, Sie sind kritisch und, wenn es sein muß, auch unbequem. Zu mahnen, das begreifen Sie als eine der Aufgaben derer, die überlebt haben und die wissen, was Menschen Menschen antun können. ...
Eine wehrhafte Demokratie, genau das ist es, was Sie sich wünschen, liebe Frau Knobloch. Weil Sie wissen, wie stark die Feinde der Demokratie werden, wie schnell sich Haß und Intoleranz ausbreiten können. Weil Sie wissen, wohin Antisemitismus und jede Form von Menschenverachtung führen. Weil es gilt – wie Sie immer wieder sagen –, den Anfängen zu wehren.
„Passen Sie auf unser Land auf“ – das war Ihre Bitte damals an Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer im Bundestag, an alle Bürgerinnen und Bürger. Es ist Ihr Auftrag, der Auftrag einer stolzen Deutschen an uns. Mögen wir ihm gerecht werden!
Liebe, verehrte Frau Knobloch, „ich werde nicht schweigen, solange ich fähig sein werde, ein Wort zu sagen“, haben Sie einmal gesagt.

Ich betrachte das als ein Versprechen. Als Bundespräsident und ganz persönlich möchte ich
Ihnen heute von Herzen danken für alles, was Sie für unser Land getan haben. Sie sind ein Glück für unser Land!
Sie sind ein Glück für unser
„Im Ehrenamt verspüren wir den Herzschlag unseres Sozialstaates“
Gemeinsam mit dem Bayerischen Landtagsvizepräsidenten Karl Freller hat Sozialministerin Ulrike Scharf dem Runden Tisch Bürgerschaftliches Engagement zu seiner 25. Sitzung im Bayerischen Landtag gratuliert.
Ulrike Scharf, die auch Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist, betonte: „Das Ehrenamt leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Im Ehrenamt spüren wir den Herzschlag unseres Sozialstaates.“
Gerade in diesen unruhigen Zeiten werde deutlich, „wie kostbar das Miteinander ist“, so die Ministerin, die anerkennend feststellte: „Unsere bayerische Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, daß sich Menschen füreinander einsetzen. Ich setze auf diese bayerische Lebenseinstellung und danke den Millionen Menschen, die sich im Ehrenamt einbringen. Stärken wir auch zukünftig den Zusammenhalt – unser persönlicher Einsatz macht den Unterschied. Das Ehrenamt stiftet soziales Mitein-
■ Samstag, 5. November, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Legende kehrt zurück – die Geschichte des Fußballclubs DFC Prag“. Filmvorführung und Gespräch mit Filmemacher Thomas Oellermann (Prag). Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November, SL-Bundesverband: Seminarwoche (siehe rechts). Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Mittwoch, 9. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Rübezahl-Tag (nicht nur) für Kinder“ mit dem Buchautor Ralf Pasch. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 9. November, 19.00 Uhr: Gerhart-HautpmannHaus. „Das Mädchen im Tagebuch. Auf der Suche nach Rywka aus dem Getto in Łódź“. Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 31. Januar 2023 gezeigt
ander und schenkt menschliche Nähe. Es sorgt für unsere Sicherheit, stärkt unsere Demokratie, hält unsere Gesellschaft zusammen und macht Bayern auch zukünftig gemeinsam stark.“
Karl Freller sagte: „Bürgerschaftliches Engagement ist der
Nährstoff für unser freiheitliches Leben und unsere Demokratie!

Es ist das Fundament für eine gemeinwohlorientierte, partizipative, solidarische Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die wir – aufbauend auf unseren Werten wie Frieden, Freiheit, Achtung der
Menschenrechte und Anerkennung von Minderheiten – gewählt haben und die wir auch bereit sind zu verteidigen.“
Bei der Jubiläumssitzung begrüßte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf zusammen mit Landtagsvizepräsident Karl Frel-
ler den Festredner, Landtagspräsident a. D. Alois Glück, im Bayerischen Landtag. Scharf dankte allen Mitgliedsorganisationen des Runden Tisches und allen Vertretern für ihr Mitwirken und Mitdenken, für ihren Rat und ihre Expertise in Sachen Bürgerschaftliches Engagement: „Für das Sozialministerium waren und sind Sie stets ein zuverlässiger Partner. So soll es auch bleiben!“
Der Runde Tisch Bürgerschaftliches Engagement, der seit 2009 beim Bayerischen Sozialministerium angesiedelt ist, dient dem Austausch und der Diskussion zu den Grundsatzfragen des Bürgerschaftlichen Engagements. Hier kommen alle maßgeblichen Akteure, wie Vertreter aus Politik, Kommunalen Spitzenverbänden, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Wissenschaft sowie weiteren Organisationen aus den verschiedensten Engagementfeldern zusammen.
Der Runde Tisch gibt Anregungen, Impulse und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements einschließlich gemeinsamer Initiativen.
❯ Ausstellung in Prag „So geht Verständigung“
Die Wanderausstellung „So geht Verständigung“ ist am Mittwoch von Christa Naaß, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, in der Repräsentanz des Freistaats Bayern in Prag eröffnet worden.
Neben Naaß wurde das Präsidium des Sudetendeutschen Rates von Steffen Hörtler und Albrecht Schläger vertreten. Die Begrüßung übernahm der Leiter der Repräsentanz, Dr. Hannes Lachmann.
Die Wanderausstellung thematisiert das (sudeten-)deutschtschechische Verhältnis und wurde erstmals 2018 gezeigt.
wird. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Donnerstag, 10. November, 17.30 Uhr: Ausstellung „Charta 77 und der tschechische Widerstand“. Führung auf Einladung der Nationalratsabgeordneten Dr. Gudrun Kugler.Tschechisches Zentrum, Herrengasse 17, Wien.

■ Donnerstag, 10. November, 20.00 Uhr: 24. Sudetengespräch: „West, Ost, Nord, Süd –Wo liegt Böhmen, Tschechien?“ Referent: Dr. Robert Luft, Vorsitzender der Historischen Kommission für die böhmischen Länder. Münchener Burschenschaft Sudetia, Augustenstraße 109, München.
■ Freitag, 11. bis Samstag, 12. November, Sudetendeutscher Heimatrat: Jahrestagung des Sudetendeutschen Heimatrates. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Sonntag, 13. November,

❯ Ausstellungseröffnung am 8. November
Gestrandet im Münchner Norden
■ Dienstag, 8. November, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 in München. Die Ausstellung ist bis zum 27. Januar zu sehen.
Zur Ausstellungseröffnung sprechen Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, und Dr. Falk Bachter, der gemeinsam mit PD Dr. Peter MünchHeubner die Ausstellung kuratiert hat.
Die Ausstellung „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“, die in Kooperation mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft entstanden ist, gibt am Beispiel der bayerischen Landeshauptstadt einen Einblick in die Auswirkungen der erzwunge-
nen Massenwanderung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Dokumente zeigen, mit welch unerhörter Energie sich die Entwurzelten in ihrem Zufluchtsort ein neues Zuhause schufen. Nach einer Darstellung der allgemeinen Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen im Münchner Norden – in Freimann, Kieferngarten, Karlsfeld und Oberschleißheim/Hochbrück – liegt der Fokus der Präsentation auf den Leistungen der Neubürger beim Wiederaufbau, auf ihrer Rolle als Gründer und Gestalter neuer Ortsteile, auf Fragen ihrer politischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Integration. Sie bietet einen Gesamtüberblick über das Thema und befaßt sich zugleich mit Einzelund Familienschicksalen.
11.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Wanderausstellung „Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie“. Matinee zum Gedenken an den 9. November 1938 mit Autor Ralf Pasch. Rathaus Treptow, Raum 218, Neue Krugallee 4, Berlin.
■ Montag, 14. November, 18.00 Uhr, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich, Filmpräsentation „Die letzten Österreicher“ mit Filmregisseur Lukas Pitscheider. In einem schwer zugänglichen Dorf in den Karpatenwäldern ringen die letzten Österreicher der Ukraine mit der Frage, ob sie ihrer Heimat den Rücken kehren sollen. Haus der Heimat, Steingasse 25, A-1030 Wien.

■ Donnerstag, 17. November, 18.00 bis 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Kunstkammer Georg Laue: Reliefintarsien aus Eger für die fürstlichen Kunstkammern Europas“. Vortrag von Dr. Virginie Spenlé. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Montag, 21. November, 19.00 bis 21.00 Uhr: SL-Bundesverband: „Nuntius Alois Muench (1889–1962) – Der ‚Retter Deutschlands‘“. Vortrag von Prof. Dr. Stefan Samerski im Rahmen der Reihe „Böhmen macht Weltgeschichte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Online-Lesung der Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.
■ Samstag, 26. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmerwald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Musikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de
■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 30. November, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Wanderausstellung „Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie“. Präsentation der Ausstellung und des Begleitfilms mit Ralf Pasch. Rathaus Treptow, Raum 118, Neue Krugallee 4, Berlin.
■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: Symposium „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.30 bis 16.30 Uhr und 17.00 bis 18.00, Sudetendeutsches Museum: Finissage und Kuratorenführung durch die Ausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
„Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“
■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November: Zweiteilige Seminarwoche in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband unter dem Motto „Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“. Mehr unter www.sudeten.de und www.heiligenhof.de. Auszug.
Teil 1: Ost- und Südosteuropa
Sonntag, 6. November: Prof. Dr. Stefan Samerski, Theologe: „Franziskus und Kyrill – Von den Schwierigkeiten päpstlicher Friedensvermittlung in der Ukrainekrise“.
Montag, 7. November: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor: „Die Sudetendeutschen: Volksgruppe mit Zukunft“. Petra Laurin, Journalistin, und Monika Hanika, Systemische Familientherapeutin: „Zweisprachigkeit in Kindheit und Jugend als Voraussetzung zur Überwindung von Grenzen“. Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe: „Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung“. Mathias Heider, Historiker: „Das Internet als neue Heimat?“
Dienstag, 8. November: Dr. Raimund Paleczek, Historiker: „Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie“. Dr. Jens Baumann, Beauftragter: „Vertriebenenpolitik in den östlichen Bundesländern am Beispiel Sachsen“. Prof. Dr. Helmut Altrichter, Hochschullehrer: „Krieg der Erinnerungen. Geschichte und Geschichtsbilder in Rußland und der Ukraine 1991 bis 2022“.
Teil 2: Deutschland und Tschechien
Dienstag, 8. November: Jan Polák, Historiker: „Warum nur? Alte Klischees und Vorurteile über den Nachbarn in den Nachkriegsgenerationen in Deutschland und der Tschechischen Republik“. Mittwoch, 9. November: Jan Blažek, Autor und Dokumentarist der Nichtregierungsorganisation „Post Bellum“: „Zeitzeugenprojekte: Orte des nationalen Gedächtnisses“. Ingrid Sauer, Archivarin, Bayerisches Hauptstaatsarchiv: „Informationsquellen zum politisch-kulturellen Erbe der Sudetendeutschen“. Prof. Dr. Katrin Boeckh, Hochschullehrerin, IOS Regensburg/LMU München: „Geschichte und Emotionen. Tätigkeitsfelder der Forschungsstelle Kultur und Erinnerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“. Ulrich Rümenapp: „Die Ost-West-Jugendakademie – Ein best-practice-Beispiel einer Veranstaltungsreihe für Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien“.
Donnerstag, 10. November: Werner Honal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher: „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“. Dr. Veronika Hofinger, Centrum Bavaria Bohemia e.V.: „Das Grüne Band Europas –eine Landschaft mit Gedächtnis“. Alfred Wolf, Vorsitzender Via Carolina-Goldene Straße e.V.: „Erinnerungs- und Versöhnungskultur am ehemaligen Dorf Paulusbrunn im böhmischen Wald“.


Freitag, 11. November: Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in Tschechien: „Gedenkstätten der Deutschen in der Tschechischen Republik als lebendige Kultur“. Christina Meinusch, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Ein Bild von Heimat – Ausstellungsprojekt in Kooperation mit der Museologie an der Universität Würzburg“. Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion und Seminarbilanz. Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47
info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
 VERANSTALTUNGSKALENDER
VERANSTALTUNGSKALENDER
Ein toter Putin mit Hitlerbart zwischen der tschechischen und ukrainischen Flagge – diese Plakataktion des tschechischen Innenministeriums sorgt für heftige Kontroversen.







Innenminister sorgt mit totem Putin für Wirbel
Diese Plakataktion ist nichts für sanfte Gemüter: Zum Nationalfeiertag hat Tschechiens Innenminister Vít Rakušan (Stan) mit einer ungewöhnlichen Außenwerbung an der Fassade seines Ministeriums für Aufsehen gesorgt.

werden nicht zulassen, daß der Feind unseren Patriotismus oder unser Tschechien raubt.“
tut gut Gott sammelt die Tränen
Z
wischen den Flaggen Tschechiens und der Ukraine wird ein toter Putin in einem nicht vollständig verschlossenen Leichensack gezeigt. Zwischen Mund und Nase prangt ein schwarzes Z. Das Zeichen der russischen Angriffstruppen wirkt von weitem wie ein Schnurrbart und stellt damit die Parallele zu Hitler her. In den russischen Staatsmedien hat das Bild vom toten HitlerPutin heftigste Reaktionen ausgelöst.

„Die Feindseligkeit gegenüber Rußland hat in der Tschechischen Republik alle Grenzen überschritten, und das tschechische Innenministerium hat Putin gedroht“, empörte sich die in Moskau ansässige Nachrichtenagentur Eurasia Daily.
Vít Rakušan, der mit dieser Aktion bewußt provoziert, hat auf Twitter nachgelegt. „Wir wissen, wer unser Freund ist, der für unsere Freiheit blutet. Und wir wissen auch, wer unser Feind ist. Wir
Zustimmung bekommt Rakušan unter anderem von dem tschechischen Europaabgeordneten Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL): „Die Flaggen und das Bild von Putin sind völlig in Ordnung. Putin ist ein Massenmörder und Kriegsverbrecher, der für den Tod von mindestens 150 000 Menschen verantwortlich ist. Das müssen wir absolut unmißverständlich und ohne Umschweife sagen.“
Auf die Frage einer Zeitung, ob es nicht angemessener gewesen wäre, Putin in Handschellen vor einem Gericht statt als Leiche zu zeigen, sagte Rakušan: „Ich wünsche Putin nicht den Tod. Ich rufe nicht zur Gewalt gegen ihn auf. Aber ich möchte auf jeden Fall, daß Wladimir Putin vor ein internationales Gericht gestellt wird. Ich denke, daß Putin sich für seine Handlungen verantworten muß, für seine Gewalt, für seine Aggression, für die Art und Weise, wie er ein ganzes Volk in enormes Elend gestürzt und die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat, für das, wie er Menschen, meist Mütter mit Kindern, in eine Welt der Ungewißheit geschickt hat.“ Pavel Novotny/TF
Premierminister Fiala reist mit den wichtigsten Ministern nach Kiew
Aus Angst vor russischen Bomben geben Politiker anderer Staaten erst nach ihrer Rückkehr bekannt, in der Ukraine gewesen zu sein. Anders die tschechische Regierung. Premierminister Petr Fiala hatte bereits im Vorfeld angekündigt, mit seinen sieben wichtigsten Ministern nach Kiew zu reisen und dort erstmals seit Kriegsbeginn mit den Vertretern der ukrainischen Regierung zu beraten.
Per Zug traf die Delegation aus Prag am Montag in Kiew ein. Neben Premierminister Petr Fiala waren auch der Erste Vizepremierminister und Innenminister Vít Rakušan, der Vizepremierminister und Minister für Arbeit und Soziales Marian Jurečka, der Vizepremierminister und Gesundheitsminister Vlastimil Válek, die Verteidigungsministerin Jana Černochová, der Außenminister Jan Lipavský, der Finanzminister Zbyněk Stanjura und der Verkehrsminister Martin Kupka mit dabei.

Fiala eröffnete die erste tschechischukrainische Regierungskonsultation gemeinsam mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Šmyhal. Eines der Hauptthemen war die Solidarität mit der Ukraine und die Fortsetzung nicht nur der militärischen, sondern auch der humanitären Hilfe. Ebenfalls auf der Agenda stand die Unterstützung beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. So erörterten die tschechischen Minister mit ihren ukrainischen Amtskollegen, wie sich tschechische Unternehmen am Wiederaufbau beteiligen können.
Petr Fiala rief zum Abschluß des zweitägigen Treffens dazu auf, die Ukraine weiter zu unterstützen. „Es liegt im Interesse der ganzen Welt, daß wir weiterhin militärische Ausrüstung bereitstellen, damit die Ukrainer ihren tapferen Kampf fortsetzen und sich wirksam gegen den russischen Aggressor verteidigen können“, twitterte der tschechische Regierungschef und gab bekannt, daß sich die beiden Regierungen darauf verständigt hätten, die „Zusammenarbeit zu vertiefen und eine Reihe konkreter Schritte zu unternehmen“.

Fiala wörtlich: „Ich halte es für absolut selbstverständlich, daß die Tschechische Republik ihre humanitäre und militärische Hilfe für die Ukraine fortsetzt.“ Bislang hat Tschechien Waffen im Wert von 4,5 Milliarden Kronen (184 Millionen Euro) in die Ukraine geliefert.
Am Rande der Regierungskonsultationen haben die tschechischen Kabinettsmitglieder in Begleitung des stellvertretenden Außenministers der Ukrai-
ne und ehemaligen Botschafters in Prag, Jewhen Perebyjnis, die Allee der Courage besucht, die Präsident Wolodymyr Selenskyj im August gemeinsam mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda eröffnet hatte. In der Allee sind die Namen von Politikern und Vertretern von Partnerländern verewigt, die der Ukraine wichtige Hilfe geleistet haben.
Am 9. September enthüllte der ukrainische Präsident auch die Gedenktafel für die Ministerpräsidenten der tschechischen und polnischen Regierung, Petr Fiala und Mateusz Morawiecki, den stellvertretenden polnischen Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczyński und den ehemaligen slowenischen Ministerpräsidenten Janez Janša. Sie hatten Kiew gleich in den ersten Tagen des Krieges besucht, um zu erörtern, wie die Ukraine unterstützt werden kann, und um die Aggression zu verurteilen.
Über dem November liegt ein Schleier von Traurigkeit. Kirchlich ist dieser Monat eingerahmt vom katholischen Gedenktag Allerseelen und vom evangelischen Totensonntag. Zwei Sonntage vor dem ersten Advent wird in Deutschland darüber hinaus der Volkstrauertag begangen, der den Opfern von Gewalt und Krieg aus Geschichte und Gegenwart gewidmet ist. Diese Tage schaffen eine Stimmung von Wehmut, die durch die spätherbstliche Witterung, die absterbende Natur und die kürzer werdenden Tage noch verstärkt wird.
Viele Menschen denken im November intensiver an ihre verstorbenen Angehörigen als zu anderen Jahreszeiten. Oft ist es zum Weinen, wenn wir unsere Toten betrauern. Manchmal weint unsere Seele bloß in stiller Weise, manchmal verschaffen sich die Tränen aber auch freien Lauf und haben keinen Halt. Das gilt selbstverständlich auch über diesen Trauermonat hinaus. Wenn ein lieber Mensch stirbt, erfaßt die Trauer für gewöhnlich alle Lebensbereiche. Es wird alleine geweint und gemeinsam, zu Hause und unterwegs. Manchmal weinen wir auch stellvertretend für andere, die nicht weinen können oder wollen.
Man kann Tränen nicht herbeizwingen, man kann sie aber auch nicht festhalten und bewahren. Zuweilen versiegen sie. Zuweilen werden sie uns von zärtlichen Menschen weggewischt. Manchmal wischen wir sie auch selber weg. Oft ein wenig voreilig und schnell, weil wir uns ihrer schämen oder weil der Alltag seinen Tribut verlangt. Wir wollen und müssen stark sein, auch wenn uns innerlich schwach zumute ist. Gelegentlich bereuen wir auch Tränen, weil sich eine Situation später anders darstellt als ursprünglich. Aber auch in solchen Fällen können wir unser einstiges Weinen nicht mehr zurücknehmen.
Was wird aus all den Tränen, die je auf dieser Erde geweint wurden? Was wird aus den Tränen die Menschen ihren viel zu früh verstorbenen Angehörigen nachweinen oder Geliebte ihren Geliebten oder Eltern ihren Sternenkindern oder Mütter und Ehefrauen den gefallenen Soldaten in den vergangenen und derzeitigen Kriegen? Was wird aus den Tränen, die wegen anderer Verluste vergossen werden? Ich denke an den Verlust von Heimat, Wohlstand oder Sicherheit. Was wird aus den Tränen, die der Hunger oder Naturkatastrophen oder eben noch einmal die Kriegsnot Menschen in die Augen treibt?
In der Bibel findet sich ein Satz, der eine Perspektive schenkt. Im Buch der Psalmen spricht ein betender Mensch: „Gott, sammle meine Tränen in einem Krug.“ Was für ein wunderbarer Wunsch! Was für ein tröstliches Bild! Menschliche Tränen sind nicht verloren. Gott möge sie sorgsam bergen. Er möge sie sich zu eigen machen. Manche werden vielleicht sagen: Das ist ja bloß ein frommer Glaube. Ich sage: So fromm möchte ich sein, um dies fest zu glauben und mutig zu meinen Tränen stehen zu können.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei
Torsten Fricke
Außenminister Jan Lipavský zeigte sich nach dem Treffen optimistisch, daß es der Ukraine gelingt, die russischen Truppen zurückzuschlagen: „Wenn wir nächstes Jahr den 80. Jahrestag der Befreiung Kiews von den Nazis feiern, werden wir auch die Befreiung der gesamten Ukraine von der derzeitigen russischen Besatzung feiern.“

Der sudetendeutsche Künstler Walter Gaudnek starb spät am Abend des 23. September in Or lando in Florida. Er lebte seit sei ner Studienzeit in den Vereinig ten Staaten, kam jedoch oft nach Deutschland, um neue Werke zu zeigen und sein kleines Museum in Oberbay ern zu betreuen. Der SL-Kulturpreisträger von 1994 stellte welt weit aus.
Walter Gaudnek kam am 1. Juli 1931 in Fleyh im Kreis Dux im böhmischen Erzgebirge zur Welt, wo er auch aufwuchs. Dort mußte er miterle ben, wie sein Vater, der sich wei gerte, der NSDAP beizutreten und überdies verbotene „Feind sender“ hörte, 1944 von Na zi-Schergen verschleppt und so schwer mißhandelt wurde, daß er kurz darauf starb. Nach der Vertreibung im November 1946 – gemeinsam mit Mutter Hil degard Gaudnek, Schwester Il
se Gaudnek und den Großeltern Josef und Hedwig Selber – kam die vertriebene Familie zunächst in einem Lager in Dachau in Oberbayern unter. 1951 kaufte die Mutter ein kleines Haus in der Sandizellergasse 3 im nahen Altomünster. In die sem Häuschen gründe te Gaudnek 1997 das Gaudnek-Europa-Mu seum (GEM), das 1999 eröffnet wurde, und lebte dort oft während des Sommers, während er sonst in Florida neue Werke schuf.
Denn Walter Gaud nek war schon 1957 in die Welt hinaus gegangen. Nach dem Stu dium an der Blocherer-Schule für Kunst und der Akademie der Bil denden Künste in München bei Professor Ernst Geitlinger stu dierte er – mit einem Stipendi um – an der University of Cali fornia in Los Angeles.
Er promovierte 1968 an der New York University zum Dr. phil. mit der Arbeit „Die symbo
Unser Angebot Probeabo!
Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)
Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail Geburtsjahr, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer
DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontobezeichnung (Kontoinhaber)
Kontonr. oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 44/2022

PERSONALIEN
Walter Gaudnek †

lische Bedeutung des Kreuzes in der amerikanischen Malerei der Gegenwart“. Im selben Jahr hei ratete er dort die amerikanische Jüdin und Künstlerin Audrey Gayle Goldman, die für ihn die eigene Karriere aufgab. Mit ihr bekam er 1990 die Tochter Yve, die seinem Weg folgte und an der University of Central Florida Film (UCF) in Orlando studierte. Ab 1970 war Gaudnek Professor an der UCF, der mit 60 000 Stu denten zweitgrößten Universität der USA. Er lehrte dort Malerei, Graphikdesign, Kunstgeschich te und Kunstwissenschaft und lebte und malte immer noch in Florida, nachdem er im Frühjahr 2021 mit großen Ehren emeritiert wurde.
Gaudneks Werke waren in Ausstellungen fast weltweit zu sehen und sind auch in vielen großen Museen und Galerien vertreten. Oft kam Gaudnek nach Europa zu Vortragsreisen und Ausstellungseröffnungen. Das vom ehemaligen Altomünste rer Sparkassendirektor Siegfried Sureck ehrenamtlich betreu te Gaudnek-Europa-Museum ist voller Kunstwerke, darunter viele überdimensionale Kreu ze, antike ägyptische und christ lich-religiöse Motive im Gaud nek-typischen Pop-Art-Stil. Auch im Sudetendeutschen Haus in München stellte Gaudnek oft aus, so 2006 Engel-Figuren und 2015 „Teutonis et Bohemis ama
biles Johannes Welflin Nepomuk“.
Die Perioden in Gaudneks Kunst entsprachen zwar immer den biographischen Stationen in seinem Leben, sein Gesamtwerk überstand je doch alle Zeit strömungen unberührt. Ei ne Grundlage bildete immer die klassischfigurative Ma lerei der Mo derne mit star ker Betonung der schwarzen Konturenlinie. Diese Tradition der Linie konn te bei düsteren Themen zu rein schwarzweißen Bildern führen. Ansonsten le ben Gaudneks Werke von ih rer intensi ven Farbigkeit mit klaren Tö nen. Speziell die Aktualität seiner künst lerischen Dar stellungen und Happenings war typisch für Walter Gaud nek. Aufgrund der Reisebe
schränkungen durch Corona ver anstaltete er in den letzten bei den Jahren oft Installationen aus Modellen und Requisiten, die er als „maquettes“ in Studioausstel lungen zeigte.
Gaudnek war seit 1998 Mit glied der Sudetendeutschen Aka demie der Wissenschaften und Künste. Zu seinen Auszeichnun gen zählen neben dem Sudeten deutschen Kulturpreis für Kunst 1994 auch der University of Central Flori da Presidents Award 1999, der Internatio nal Prize Leo nardo da Vin ci – The uni versal artist 2018 und der Special Com mendation: In ternational Award Loren zo il Magnifi co in der Spar te Video Art bei der XII. Flo renz-Bienna le. Schon 2011 war Gaudnek mit der Bürger medaille des Marktes Alto münster ausge zeichnet wor den. Im dor tigen GEM sind rund 400 seiner Bilder und Skulpturen zu sehen.
Susanne Habel
Walburga Peter geehrt

Aller guten Dinge sind bekannt lich drei: bei der Hauptver sammlung der Ackermann-Ge meinde Mitte Oktober in Würz burg hatten Professor Barbara Krause aus Aachen und Mar gareta Klieber aus München vom scheidenden Bundes vorsitzenden der AckermannGemeinde Martin Kastler die Goldene Ehrennadel erhal ten. Sieben Tage später be kam Walburga Peter aus Bo denwöhr diese Ehrung vom Stellvertretenden Bundesvor sitzenden Martin Panten im Rahmen des Literarischen Ca fés (Þ Seite 9) im Café Pern steiner in Regensburg.
Die Goldene Ehrennadel ist die höchste Auszeichnung der Ackermann-Gemeinde für verdiente Mitglieder“, betonte der Diözesanvorsitzende KarlLudwig Ritzke in seiner Begrü ßung der rund 30 Gäste, dar unter seine beiden Amtsvor gänger Leonhard Fuchs und Otmar Dostal. „Im Namen des Diözesanvorstands danke ich Walburga Peter für ihr großes Engagement in der AckermannGemeinde der Diözese Regens burg“, verdeutlichte Ritzke und verwies darauf, daß sich die Ge ehrte besonders um die Korre spondenz mit den Mitgliedern bei Geburtstagen, Todesfällen und so weiter kümmere.
„Es ist toll für mich, diese ho he Auszeichnung in meiner Hei matdiözese verleihen zu dür fen“, freute sich der Stellvertre tende Bundesvorsitzende Martin Panten, der auch die Grüße des neuen Bundesvorsitzenden Al bert-Peter Rethmann überbrach te. „Die Ackermann-Gemeinde genießt in Deutschland, in der Tschechischen Republik und in der Slowakei ein hohes Ansehen – auch wegen der vielen Frauen und Männer, die aus christlicher Verantwortung einen Auftrag se hen, sich für Versöhnung und ein Miteinander von Menschen –
für neue Nachbarschaft zu enga gieren“, zitierte Panten aus den Vorgaben für die Verleihung die ser Ehrung. Es gehe also um Per sönlichkeiten, „die den Verband prägen, ihn lebendig und greif
mann-Gemeinde Bamberg ein, wo sie sechs Jahre lang Diözesan sprecherin war. Viele Jahre war sie ferner im Sozialwerk der Ak kermann-Gemeinde aktiv. Nach dem plötzlichen Tod ihres Man


ter der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Regensburg“, da im Vorstandsteam nun auch Vertre ter der jungen Generation wir ken. Da zwei ihrer Kinder in Düs seldorf oder Köln lebten, werde sie in absehbarer Zeit zurück nach Düsseldorf ziehen, aber der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Regensburg, wo sie im Diözesanvorstand tä tig sei, verbunden bleiben und mit Rat und Tat zur Seite ste hen. All diese Aspekte aus Walburga Peters Vita hätten den Bundesvorstand der Ak kermann-Gemeinde zur Ver leihung der Goldenen Ehren nadel bewogen, erklärte der Stellvertretende Bundesvorsit zende und würdigte Walbur ga Peter mit eben dieser Aus zeichnung.
bar machen und somit ein Bei spiel für Jüngere sind“.
In Chudiwa bei Neuern ge boren, mußte die nun Ausge zeichnete bereits mit vier Jah ren den Tod der Mutter erleben. Die Säuglingsfürsorgerin für den Bezirk Neuern wurde zur neuen Mutter, der Vater starb 1945 in Nürnberg bei einem Luftangriff. „Über das Auffanglager Furth im Wald kamen wir in ein Lager in Regensburg. Nach einiger Zeit ging es weiter in die Lager Bam berg und Lichtenfels. Von dort wurden wir bei einem Bauern in einem kleinen Zimmer einquar tiert. Auf dem Boden war nur Stroh, und der Bauer war nicht gerade begeistert“, hatte Peter bei einer früheren Gelegenheit ihre Erinnerungen an die Ver treibung geschildert. Nach der Mittleren Reife ging sie beruflich nach Kulmbach und trat 1953 in die Junge Aktion der Acker
nes zog sie in den 1990er Jahren von Düsseldorf nach Bodenwöhr und brachte sich schnell in die Arbeit der dortigen AckermannGemeinde ein, vor allem in die Literarischen Cafés und die über viele Jahre von Otmar Dostal or ganisierten Fahrradtou ren, bei denen sie selbst mit fuhr. Darüber hinaus nahm sie mehr als zehn Jah re lang Mäd chen aus der Slowakei, die Deutsch lern ten, für sechs bis acht Wo chen bei sich zu Hause auf. Inzwischen sei sie, so Pan ten, „die Mut
„Ich bin von der Arbeit der Ackermann-Gemeinde ge prägt“, bekannte Peter in ihrer kurzen Antwort, wobei sie be sonders den früheren Diöze sanvorsitzenden Otmar Dostal hervorhob. „Hier in Regens burg und bei der AckermannGemeinde wurde ich aufgenom men, als ob ich schon immer in Regensburg gewesen wäre“, gab sie das Lob an die AckermannMitglieder zurück, verbunden mit einem Dank an alle.
Markus BauerGartner & Gartner im Holbeinhaus
Seit kurzem wird im Augsburger Holbeinhaus die neue Ausstellung „Gartner & Gartner. Gemalte Synergien“ gezeigt. Die Zwillingsbrüder Hansjürgen und Joachim Lothar Gartner wurden 2018 von der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis ausgezeichnet. Jetzt erfüllten sie sich den Wunsch nach einer gemeinsamen Ausstelllung mit teilweise gemeinsamen Kunstwerken.
Die Brüder Gartner sind eineiige Zwillinge aus Nordböhmen. Sie wurden am 16. April 1945 in Steinschönau im Kreis Böhmisch Leipa geboren. Im Juni 1945 wurden sie mit ihrer Mutter und Großmutter vertrieben und über die Grenze nach Pirna in Sachsen transportiert, wo sie in der Nähe von Leipzig lebten. 1949 flohen die Gartners aus der Sowjetischen Besatzungszone.
Vertreibung und Flucht
In Wien, der Heimatstadt des Vaters, fand die Familie wieder zusammen. Ihr Vater war ein sehr kulturbeflissener Mann.
Die sonntäglichen Besuche im Kunsthistorischen Museum förderten das Gespür für Kunstrichtungen und Kunstauffassungen. Ihre künstlerische Ausbildung erhielten die Gartners nicht an der Wiener Kunstakademie, sondern an der Höheren BundesLehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie (HBLVA), Abteilung Design, wo sie mit Diplom abschlossen.
1965 verließen die Zwillinge Wien und gingen – zunächst als Textildesigner – in die Textilstadt Augsburg, auch um sich auf ihrer künstlerischen Suchwanderung neu zu orientieren. Sie fanden Anstellungen. Nach dem Kunstförderungspreis der Stadt Augsburg 1973 wuchs die Überzeugung, künftig den Schwerpunkt ihrer Existenz auf die künstlerische Arbeit zu konzentrieren. 1970 bezogen sie ein gemeinsames Atelier im Augsburger Holbeinhaus. Sie beteiligten sich an Ausstellungen in Augsburg und München und im europäischen Ausland.
Lebens- und Kunstwege
Hansjürgen Gartner war ab 1976 in die Gestaltung künstlerischer Raumlösungen in Bauwerken namhafter Architekten eingebunden. Joachim Lothar, pädagogisch ausgebildet, hatte 1978 bis 1984 einen Lehrauftrag für Kunsterziehung an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Augsburg. 1983 bis 1988 war er Präsident des Berufsverbands Bildender Künstler Schwaben-Nord und Augsburg. Den Zwillingen scheint das Lehren angeboren, Joachim Lothar lehrt an der HBLVA in Wien, Hansjürgen an verschiedenen Institutionen und der Volkshochschule in Augsburg.
Ebenso liegt es den Brüdern, Ausstellungen zu kuratieren. Joachim Lothar betreute internationale Austauschprojekte und Großausstellungen in Wien wie 2008 „Alfred Hrdlicka – Der Titan und die Bühne des Lebens“. Hansjürgen kuratierte 2003 das Ausstellungsprojekt „Zeichen für Frieden“ oder 2017 die Ausstellung „Gegenstand–Widerstand“ im Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg.

Beide engagieren sich auch in Künstlervereinigungen, so Joachim Lothar in der Gesellschaft bildender Künstler Österreichs – Künstlerhaus (Präsident 2006 bis 2012) und bis heute
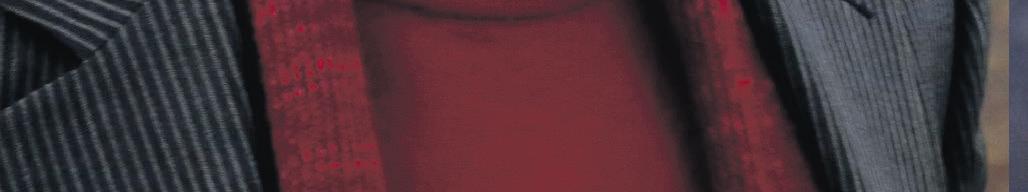





bei Bildrecht, der österreichischen Urheberrechtsgesellschaft für Bildende Kunst, Fotografie und Choreographie. Besonders zu erwähnen ist die Tätigkeit Hansjürgens für die Künstlergilde Esslingen, dem Sammelbecken ostdeutscher Künstler, der beide Gartners 1978 beitraten. Seit 2009 ist Hansjürgen ständiges Jurymitglied des von der Künstlergilde vergebenen Lovis-Corinth-Preises. In der Redaktion der Europäischen Kulturzeitschrift „Sudetenland“ ist er als Mitherausgeber für die Bildende Kunst zuständig.
Viele Auszeichnungen
Ein derartig reichhaltiges künstlerisches Schaffen und berufspolitisches Engagement bleibt nicht ohne Preise und Ehrungen. So erhielten sie 1981 die Förderpreise für Bildende Kunst der Sudetendeutschen Landsmannschaft und 1984 den Förderpreis des Lovis-Corinth-
Preises der Künstlergilde. 2008 erfolgte die Berufung in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste. Den Kunstpreis des Bezirks Schwaben erhielt 1983 Joachim Lothar und 2015 Hansjürgen. Genannt sei noch die Beteiligung der Zwillingsbrüder an der Ausstellung „Borderline-Syndrom“ in

der Kunsthalle Karlsbad 2015. Im selben Jahr wurde Hansjürgen mit dem Kunstpreis des Bezirks Schwaben und Joachim Lothar mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Schließlich folgte für beide gemeinsam 2018 der Große Sudetendeutsche Kulturpreis.
Die biographischen Entwicklungen verliefen weitgehend parallel, künstlerisch jedoch gab es schon in den achtziger Jahren einen wesentlichen Unterschied. Hansjürgen bevorzugte bei seinen Darstellungen weitgehend den Menschen, während bei Joachim Lothar die Landschaft das Thema zu sein schien. Beide bewegten sich jedoch immer stärker auf das Abstrakte zu.
Nach der langen CoronaTrennung fanden sie nun wieder zusammen und präsentieren im Holbeinhaus auch gemeinsam gestaltete Werke, die ein Drittel der Ausstellung ausmachen. Deren Titel haben sehr vielschichtige Bedeutungen, wie die Gartners erklären: Das Gemeinschaftswerk „Metanoia“ sei dem zeitaktuellen Thema der Metanoia gewidmet. In der Antike sei Metanoia die Göttin gewesen, die bei Zeus für die Menschen um Gnade und Buße bat. „Angesichts der Tragö-
dien und Katastrophen, denen sich die Menschheit zur Zeit ausgesetzt sieht, steht sie als etwas Symbolhaftes und Vorbildhaftes vor uns.“ In der Philosophie und Ethik stehe auch die Bedeutung von Metanoia für innere Umkehr, Umdenken und Neuausrichtung, also für Reflexion und Transformation.
In ähnlicher Weise hatte Hansjürgen Gartner bei der Verleihung der Großen Kulturpreise im Goldenen Saal des Rathauses in Augsburg einen verantwortungsbewußteren Umgang mit Kultur und Lebensraum gefordert.
Dies bedeute auch, nicht weiter an der Rüstungsspirale zu drehen und den Kalten Krieg nicht voranzutreiben, so der Preisträger in seiner Dankesrede von 2018. Er schloß damals mit dem – fast prophetischen – Appell: „Kultur im weitesten Sinne wäre für uns die tragende Säule für ein friedvolles Miteinander, wo Flucht und Vertreibung keinen Platz mehr hätten.“
In symbolischer Weise arbeiten die beiden Künstler bei „Metanoia“ auf gebrauchten Plakaten, auch wegen der Kurzlebigkeit der kommerziellen Plakate und der beschleunigten digitalen Welt der kurzen Momente. Demgegenüber stünden eine Entschleunigung und Langfristigkeit einer neuen beständigen Zukunft der Menschheit.
„Tenet“ der Titel einer weiteren Gemeinschaftsarbeit, sei dem Rotas-Quadrat aus der Zeit der römischen Antike entnommen, einem magischen Quadrat von Anagrammen, in dessen Mitte sich das Palindrom „Tenet“ befinde, das sich vom lateinischen tenere „halten“ ableite und auch behalten, bewahren, aber auch festhalten, umfassen und umarmen bedeute. Hansjürgen Gartner ersetzt die darin vorkommenden Buchstaben mit entsprechenden Farben, worauf Joachim Lothar mit für seine Arbeitsweise typischen Rasterbalken in schwarzer Farbe dialoghaft reagiert.
Den beiden Künstlern gelingt in diesem Bild der Versuch einer freien künstlerischen Interpretation dieser Begrifflichkeiten, und stellt einen existenziellen Bezug zu ihrer Kunst dar.
Metanoia und Tenet
Das dritte gemeinschaftliche Werk ist eine installative Videoarbeit, die keinen Titel trägt, sondern mit „∞“, dem Zeichen für Unendlichkeit, bezeichnet wird. Je drei Schattenfiguren von Hansjürgen Gartner flankieren eine hexagonale Skulptur von Joachim Lothar Gartner, die im wandfüllenden Video eine weite Ödnis umkreist.
Noch viele weitere Entdekkungen gibt es in „Gartner & Gartner“ mit ihren Synergien zu machen. Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Stockwerke im Holbeinhaus und zeigt zwei Dutzend Werke, von denen acht in gemeinschaftlicher Arbeit der Zwillingskünstler entstanden. Wer sich in eines der Stükke verliebt, kann es auch käuflich erwerben – aber die Wahl wird schwer. Susanne Habel
Bis Sonntag, 20. November: „Gartner & Gartner. Gemalte Synergien“ in Augsburg, Holbeinhaus, Vorderer Lech 20. Dienstag bis Samstag 13.00–17.00, Sonntag 11.00–17.00 Uhr. Sonntag, 6. November, 11.00
Uhr: Künstlergespräch beider Gartners mit Dr. Thomas Elsen, Leiter des H2-Zentrums für Gegenwartskunst, in Augsburg.
Viele Landsleute trafen sich trotz schlechter Wetterprogno se und Sperrung der S-BahnStammstrecke auf dem Böhmer waldplatz in München, um an den Geburtstag Adalbert Stif ters zu erinnern. Der Böhmer walddichter war am 23. Oktober 1805 zur Welt gekommen.

An dem Denkmal, das Leopold Hafner, ein Künstler und Bildhauer aus Wallern im Böh merwald, 1989 schuf, treffen sich die Böhmerwäldler in München regelmäßig zu ihrer Gedenkfeier. Sie sind stolz, daß sie das Denk mal aus eigener Kraft und mit ei genen Mitteln errichten konnten. Mit dem Lied „Af d‘ Wulda“, das die Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München sang, begann die Feier. Nach Grußwor ten vom Stadtrat Sebastian Schall und Bezirksausschußvorsitzen den Florian Ring führte Kul turreferentin Gabi Strobl durch das Programm. Sie stellte den Schriftsteller Josef Rank vor, der am 10. Juli 1816 in Friedrichsthal im Böhmerwald geboren wurde. Nach dem Gymnasium in Klattau studierte Rank 1836 bis 1838 Philosophie und ab 1841 Ju ra in Wien. Hauslehrertätigkeit und literarische Arbeiten für das „Österreichische Morgenblatt“

Am Gymnázium Jana Valeriá na Jirsíka in Budweis wurde En de September ein Deutscher Tag organisiert, an dem alle Schü ler der Schule sowie die Schüler des Partnergymnasiums im obe rösterreichischen Linz teilnah men. Auch viele deutsch-tsche chische Organisationen sowie in der Tschechischen Republik an sässige deutsche Firmen betei ligten sich an diesem Tag.
Das Kulturreferat des Adal bert-Stifter-Vereins (ASV) in München zeigte anläßlich dieses Tages zwei Wochen lang die Aus stellung „In Böhmen und Mäh ren geboren – bei uns (un)be kannt?“. Beim Aufbau sowie bei der Abholung der Ausstellung führte die Kulturreferentin für die böhmischen Länder im ASV,
Böhmerwäldler in Paulskirche
schufen Kontakte zu österreichi schen Vormärzschriftstellern wie Ignaz Franz Castelli, Moritz Hartmann, Adalbert Stifter und Nikolaus Lenau. Durch Vermitt lung Franz von Dingelstedts pu blizierte Rank 1843 „Aus dem Böhmerwalde“. Die Sammlung ethnographischer Skizzen, Sa gen, Märchen, Volkslieder und Volksnovellen reüssierte im Rah men der Dialekt- und Volkslitera tur sowie der Dorfgeschichte.
In Leipzig lernte Rank 1845 Berthold Auerbach, Gustav Küh ne und Heinrich Laube kennen und gesellte sich zu den Auto ren um die Zeitschrift „Grenz bote“. 1848 redigierte er in Wi en das Organ „Der Volksfreund, Zeitschrift für Aufklärung und Erheiterung des Volkes“ und war im Verein der Sudetendeutschen und in der Wiener Studentenle gion aktiv. Seine Wahl im August 1848 als Vertreter des Bezirks Bischofteinitz in das Frankfur ter Parlament, wo er als gemä

ßigter Liberaler unauffällig blieb, eröffnete ihm neue literarische und politische Kontakte. Seine deutsch-böhmische Haltung be günstigte im 20. Jahrhundert die Rezeption seiner Schriften.
Rank blieb nach der Auflösung des Parlaments 1849 in Stutt gart, 1851 zog er nach Frank furt am Main. 1854 bis 1859 leb te er in Weimar, schrieb Romane, Erzählungen, kulturhistorische Arbeiten und Reiseerzählun gen. Er gründete und redigier te das „Weimarer Sonntagsblatt“ und publizierte in der „Augs burger Allgemeinen Zeitung“. 1859 übersiedelte er nach Nürn berg, versuchte sich als Dramati ker mit „Unter fremder Fahne“, edierte seine 15 Bände „Ausge wählten Werke“ (1859–1863) und redigierte ein Jahr lang den „Nürnberger Kurier“. 1861 kehr te er nach Wien zurück und war bis 1874 Direktions-Sekretär des k. k. Hofoperntheaters, spä ter Generalsekretär am Wiener
Stadttheater. 1882 und 1883 redi gierte er die belletristische Zeit schrift „Die Heimat“. Die Erfah rung der dörflichen Heimat, die seinen Ruhm als Ethnograph des Böhmerwalds begründe te, und des Urban-Poli tischen aus dem vor märzlichen Wien, Leipzig und der 1848er Revolution prägen sein Werk.
Schemata ro mantischer Prosa wie Märchen, Sa gen, Geheimbünde lei, Gespenster und Mesalliancen oder tra ditionelle Opposi tionen wie Dorf ge gen Schloß, Stadt gegen Land, Volk gegen Aristo kratie bestimmen sein oft aus uferndes Erzählen. Historisch in teressant und erzählerisch ge lungen ist seine Autobiographie „Erinnerungen aus meinem Le ben“. Rank starb am 27. März
1896 in Wien. Als Intermez zi sang die Böhmerwald Singund Volkstanzgruppe München „Heimat dir Ferne“, „Auf der Prager Brück‘“ und das „Besen binderlied“.
Unter den Gästen hat te Vize-Bundesvorsit zender Hans Slawik zuvor Josef Zell meier MdL, Vorsit zender der Arbeits gruppe Vertrie bene, Aussiedler, Partnerschaftsbe ziehungen der CSULandtagsfraktion und Landesvorsitzen der der Karpaten deutschen Lands mannschaft, be grüßt. Als Vertreter der Stadt München war Stadtrat Sebastian Schall gekommen. Vom zuständi gen Bezirksausschuß MünchenBogenhausen nahm der Vorsit zende Florian Ring teil. Herzlich begrüßt wurde die Ehrenvorsit
Adalbert Stifter ist bekannt
Anna Paap, mit 120 Schülern fünf Workshops durch. Fragen wie „Wann sind die Deutschen in die böhmischen Länder ge kommen? Was war ÖsterreichUngarn? Welche Länder liegen heute auf dem Gebiet als Nach folgestaaten? Heißt Reichenberg auf tschechisch Liberec oder Příbor?“ standen im Zentrum.

Mit verschiedenen Konzepten wurden die Schüler von der sieb ten bis zur 13. Klasse eingeladen, sich mit dem Thema auseinan derzusetzen und es an Hand be
rühmter Persönlichkeiten ken nenzulernen.
Viele hatten Vorkenntnisse und wußten einiges zum Thema. „Adalbert Stifter kenne ich! Wir sind den Adalbert-Stifter-Pfad im Böhmerwald bei einem Ausflug abgelaufen,“ erzählt eine Siebt klässlerin. „Ich kenne den Na men Porsche, aber ich weiß gar nichts von ihm,“ war wiederum eine häufige Feststellung.
Die Workshops wurden auf deutsch und tschechisch oder nur auf deutsch durchgeführt, je
zende des Böhmerwaldbundes Bayern, Irmgard Micko. Ein herz liches Willkommen galt auch dem SL-Bundeskulturreferenten und Vorsitzenden der Heimat gruppe Kuhländchen-München, Ulf Broßmann, der die Fahne der Heimatgruppe trug, und seiner Frau Hildegard, der Stellvertre tenden Obfrau der SL-Kreisgrup pe München-Stadt und Land.
Weitere Ehrengäste waren vom Schlesierverein die VizeVorsitzende Bärbel Simon und die Geschäftsführerin Sieglin de Schneeberger, der Bezirksob mann der SL-Oberbayern, Jo hann Slezak, und der Vüarstäiha der Eghalanda Gmoi z‘ Mün chen, Bruno Püchner. Den För derverein des Böhmerwaldmuse ums Passau vertrat dessen Vorsit zender Franz Payer.
Besonders begrüßt wurde der Redakteur der Zeitschrift „Der Böhmerwald“ des BöhmerwaldHeimatkreises Prachatitz, Rudolf Hartauer. Hartauer ist ein Ur-UrGroßneffe von Andreas Hartauer, dem Schöpfer des Böhmerwald liedes. Auch Mitglieder der Orts gruppen des Deutschen Böh merwaldbundes aus Ingolstadt, Schrobenhausen und München waren mit Fahnen vor Ort. Die Feier endete mit dem Lied „Tief drin im Böhmerwald“ hs
nach Alter und Sprachkenntnis sen. Olga Thámová, die Orga nisatorin des Deutschen Tages, war sehr zufrieden mit dem Ver lauf. „Es ist toll, eine solche Ge legenheit für die Schüler nützen zu können. Dies ist ein wichtiges Thema. Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit.“
Dieses Jahr ist es das zwei te Mal, daß die Ausstellung an einer tschechischen Schule ge zeigt wurde. Im Juni konnte sie zwei Wochen lang von den Schü lern des Prager Gymnasiums Na Zatlance in den Schulgän gen besichtigt werden. Drei Klas sen nahmen auch dort an einem deutschsprachigen Workshop teil. Zur Zeit wird die Ausstel lung in Franzensbad und ab En de November in Taus/Domažlice gezeigt. ap



� Veranstaltung mit SchülernAnna Paap bereitet Materialien vor. Die Schüler sollen herausfinden, wel ches Jahr die Karte darstellt. Bilder: ASV Josef Rank (1816–1896) Schüler in der Ausstellung bei einem Suchspiel. Mitte: Kulturreferentin Anna Paap im Gespräch mit einer Schülerin. Rechts: Bertha von Suttner ist den Schülern nicht bekannt, sie sind jedoch interessiert. Fahnenträger Bruno Püchner, Vüarstäiha der Eghalanda Gmoi z‘ München, Professor Ulf Broßmann, Landschaft betreuer Kuhländchen, Dieter Wührl, Obmann der DBB-Ortsgruppe Schrobenhausen, mit Armin Pasta, ebenfalls DBB Schrobenhausen, sowie Michael Stempfhuber von der DBB-Ortsgruppe München. Weilimdorf
Alte Häuser gerettet
Ende Oktober traf sich die SLOrtsgruppe Stuttgart-Weilim dorf im Haus der Begegnung in Stuttgart-Giebel.
Im September wurden das denk malgerecht sanierte und mo dernisierte Alte Rathaus und das Alte Schulhaus im Herzen von Weilimdorf eröffnet. Edeltraud John, Gründerin und Vorsitzende von Pro Alt-Weil, einem Verein, der sich für den Erhalt des Ge bäudekomplexes engagierte, war auf Einladung von Obfrau Wal traud Illner gekommen, um die erfolgreiche Sanierung und Mo dernisierung des Herzstücks von Weilimdorf zu schildern. John, Vorsitzende des Weilimdorfer Heimatkreises, gab zunächst ei nen Einblick in die Geschich te Weilimdorfs und stellte in ih rer Präsentation die Entwicklung des im alten Weilimdorf verorte ten Ensembles vor.


Spannend wurde die Ge schichte, als John auf die Sanie rung des Gebäudekomplexes Altes Rathaus und Altes Schul haus zu sprechen kam. Die Stadt Stuttgart habe 2010 unter wei teren fast 90 städtischen Immo bilien die leeren Büroräume in der Ditzinger Straße 3 und 5 in Stuttgart-Weilimdorf verkau fen wollen. Das Alte Rathaus von 1605 und das Alte Schulhaus von 1765 hätten schon immer mit der Oswald-Kirche und dem Al ten Pfarrhaus das historische En semble von Weilimdorf gebildet.
Da die Weilimdorfer dieses Herz stück ihres Ortes nicht privaten Investoren überlassen wollten, habe sie, so John, mit weiteren engagierten Weilimdorfern am 18. Mai 2010 den Verein Pro AltWeil gegründet. Vereinszwecke seien gewesen, mit Öffentlich keitsarbeit und Aktionen den Er halt und die Sanierung des Ge bäudekomplexes zu erreichen und mit Spendensammlungen die Innenausstattung der beiden Häuser zu finanzieren.
Zuvor hätten die Vereine Weil imdorfer Heimatkreis und Na turfreunde sowie der Obst- und Gartenbauverein Weilimdorf Unterschriften für den NichtVerkauf des Alten Rathauses und Alten Schulhauses gesammelt. Viele Hürden in Politik und Ver waltung hätten noch gemeistert werden müssen, bis dann endlich von 2019 bis 2022 das MillionenProjekt habe saniert und moder nisiert werden können. Schließ lich sei es am 22. September fei erlich eröffnet worden.
In ihrer Präsentation stell te John dann die sanierten und modernisierten Räume des Al ten Rathauses vor. Dessen Saal könne nun für standesamtliche Hochzeiten als „Wunschtrauort“ gebucht werden. Sie biete Rat hausführungen an, bei denen ein Luftschutzkeller und zwei Arrest zellen aus dem 19. Jahrhundert besichtigt werden könnten. John beendete ihren Vortrag mit der Information, mit der Sanierung und Modernisierung des Gebäu dekomplexes Altes Rathaus und Altes Schulhaus habe sich der Vereinszweck erledigt. Deshalb habe der Verein Pro Alt-Weil am 25. Oktober beschlossen, sich aufzulösen. Helmut Heisig
Rena Dumont und „Die Mühle“

Beim jüngsten Literarischen Ca fé der Ackermann-Gemeinde (AG) in der Diözese Regensburg war die 1969 in der Tschecho slowakei geborene und nun in München lebende Autorin Re na Dumont/Zedníková zu Gast.
Sie stellte den rund 30 Zuhöre rinnen und Zuhörern ihren Ro man „Die Mühle“ vor und las einige Passagen daraus.
Über die Auto rin sowie in teressante Fakten rund um sie bezie hungsweise ihren Roman informier te die Zweite AGVorsitzende El se Gruß, die auch federführend die Literarischen Ca fés organisiert. In Nordmähren, zwi schen Brünn und Mährisch Ostrau, liegt Proßnitz/ Prostějov, der Geburts- oder ur sprüngliche Heimatort Dumonts.
Die heute 53jährige Schau spielerin und Autorin floh im Jahr 1986 mit ihrer Mutter aus der Tschechoslowakei nach Deutschland. Nach einer ersten Unterbringung in einem Lager für Asylbewerber nahe des Kö nigssees zog sie schließlich nach München, wo sie die deutsche Sprache erlernte. In Hannover studierte sie von 1990 bis 1994 an
der Hochschule für Musik und Theater Schauspiel und hatte da nach Engagements unter ande rem an den Münchener Kammer spielen, im Schauspielhaus Wien oder am Nationaltheater Prag.
Sie spielt aber auch in vielen Ki no- und TV-Produktionen mit und produzierte einige eigene
te einer Familie, deren Mitglie der politisch wenig ambitioniert sind, aber immer mit den wech selnden politischen Systemen von den 1930er bis zu den 1950er Jahren in Konflikt geraten, zuerst mit dem Nationalsozialismus, dann mit dem Kommunismus. Ebenso finden die verschiedenen Nationalitäten beziehungswei se Volksgruppen wie Tschechen, Deutsche oder Ju den ihren Nieder schlag im Roman.
� SLÖFilme. Ihr jüngstes Projekt sind Schauspielkurse für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus fer tigt sie Taschen und Schürzen –alles Unikate.
Im Jahr 2013 veröffentlichte Rena Dumont ihren ersten Ro man „Paradiessucher“. Es folgten „Der Duft meines Vaters“ (2014), „Taubes Herz“ (2015), „Der Un gewitter“ (2017) und schließlich „Die Mühle“ (2018).
Darin beschreibt sie über meh rere Jahrzehnte die Geschich
Es ist vor allem die bewegende Geschichte dreier Geschwister, die ein tragisches in times Geheimnis verbindet. Und dafür hat die Au torin viel in Archi ven recherchiert und mit Zeitzeu gen gesprochen, so daß sowohl reale Hintergründe wie auch fik tive Aspekte die Handlung des Romans prägen. Ein Vorbild für die Mühle war die Wassermühle Hoslowitz, die rund 17 Kilometer südwestlich von Strakonitz liegt und zu den ältesten Mühlen Eu ropas gehört.
Für Rena Dumont ist wichtig, daß sie als Tschechin in deut scher Sprache schreibt und so zusagen durch diese zweifache Sichtweise und Prägung Ver ständnis für beide Seiten aufbringen und letztlich auch darstellen kann. Konflikte etwa hinsicht lich des zu Beginn der 1950er Jahre sich konso lidierenden Sozialismus beziehungsweise Kom munismus zwischen ein zelnen Personen blendet sie nicht aus, sondern macht sie an Dialogen unmißverständlich fest.
Daß die Autorin mit den von ihr vorgetra genen Passagen aus dem Buch auf Begei sterung stieß, verdeut licht die Tatsache, daß alle Bücher und DVDs, die sie mitgebracht hat te, in kürzester Zeit ver kauft waren. Weitere In formationen biete www. renadumont.de
Markus BauerMaus im Geschenkpaket
Zur diesjährigen Mitgliederver sammlung der hessischen SLKreisgruppe Frankfurt am Main hatte der im letzten Jahr ge wählte neue Kreisobmann Wolf gang Spielvogel in den Saalbau in Preungesheim geladen.
Zu berichten gab es trotz Pan demie doch das eine oder an dere Ereignis. Darunter war das hervorragende „Böhmi sche Schmankerlessen“. Das soll im nächsten Jahr wieder holt werden. Man denkt über die Faschingszeit nach. Auch ein Treffen zu Weihnach ten wird noch angeregt. Hier konnten noch keine Details genannt werden. Die Kasse wurde für gut befunden, der Vorstand entlastet.
Dann ging es an die Ehrun gen. Für 20 Jahre Mitglied schaft ehrten Kreisobmann Wolfgang Spielvogel und Landesobmann Markus Har zer Reinhold Kubitschek. Ku bitschek berichtete, daß er ei
gentlich schon viel länger Mit glied sei. Nachweisbar seien allerdings nur die 20 Jahre.
Zum Ehrenmitglied ernannt wurde nach vielen Jahren Treue Anna Schweißing, die ausgerech net in der Pandemiezeit einen hohen runden Geburtstag gefei ert hatte. Das Glückwunschpaket der Kreisgruppe sei angekom
men, allerdings, so die Jubila rin, habe sich während des posta lischen Weges eine Maus in den Glückwunsch eingeschlichen, so daß das Paket sicherheitshalber erst einmal auf dem Balkon ge landet sei. Letztlich aber sei der Inhalt unangetastet gewesen, doch jetzt habe man auch noch eine Geschichte zum Paket.
Z-Award geht an Florian Reider

Mitte Oktober fand im Jazz- und Musikclub Porgy & Bess in der Wiener Innenstadt unter Anwesenheit von SLÖ-Bundesob mann Gerhard Zeihsel, seiner Gattin Reinhilde und dem süd mährischen Ortsbetreuer von Pratsch und Frischau, Gerhard Bossler, die Verleihung der Z-Awards 2022 der Joe Zawinul Foundation for Achievment statt. Namensgeber ist der le gendäre, vor 15 Jahren verstorbene Jazz-Musiker Josef Erich „Joe“ Zawinul, dessen Wurzeln im südmährischen Pratsch zu finden sind. Der heurige Gewinner des mit 3000 Euro dotierten Hauptpreises ist Florian Reider.
Seit 2020 widmet die Mu sik- und Kunst-Privatuni versität der Stadt Wien (MUK) Joe Zawinul, einem ihrer be rühmtesten Alumni, einen Ex zellenz-Preis. Der von Raiffei sen-Stadtbank Wien gespon serte Joe-Zawinul-Prize ist mit 3000 Euro versehen und er möglicht jährlich einem Stu denten die Umsetzung eines besonders kreativen Jazz-Pro jekts. Über die Vergabe ent scheidet eine renommierte Fachjury bestehend aus Lars Seniuk, Studiengangsleiter Jazz an der MUK, Viola Ham mer, Astrid Wiesinger und Philipp Gerschlauer, MUKLehrende, Helge Hinteregger, Fachreferent mica – music austria, Andreas Felber, Leiter der Ö1-Jazzredaktion, Chri stoph Huber, Leiter Porgy & Bess, und Tony Zawinul, Vor sitzender der Zawinul Founda tion for Achievement. Von sich und seiner Projektidee über zeugte diese der 26jährige Pia nist Florian Reider.
Reider ist Pianist, Kompo nist und Arrangeur. Er wird
Josef Erich „Joe“ Zawinul kam am 7. Juli 1932 in Wien zur Welt. Er war der Sohn von Josef Zawinul, dessen Mut ter eine ungarische Sintiza war und dessen Vater aus Pratsch in Südmähren stammte. Er kam aus bescheidenen Ver hältnissen, doch Zeit seines Lebens war Zawinul stolz auf seine multikulturell beeinfluß te Familie und Verwandten. Er sah sie als eine Gemeinschaft hart arbeitender, einfacher und liebenswerter Menschen. Als er am 11. September 2007 in Wien starb, war der öster reichische Musiker einer der einflußreichsten Jazzer des 20. Jahrhunderts.
Joe Zawinul prägte zu nächst als Pianist und Key boarder, dann auch als Kom ponist, Bandleader und Ar rangeur mehrere Jahrzehnte lang die internationale Musik szene. 1966 schrieb er für das „Cannonball Adderley Quin tet“ den Hit „Mercy, Mercy, Mercy“, der zu einer Referenz aufnahme des Soul Jazz wur de. 1969 komponierte er das Titelstück von Miles Davis‘ Platte „In a Si lent Way“, eines der ersten Fusion-JazzAlben, an dem er ebenso entscheidend beteiligt war, wie an dessen „revolutionä rer“ Platte „Bitches Brew“ 1970. Ende 1970 gründete er mit Wayne Shorter die stilprägende Fusi on-Gruppe „Weather Report“. Sie wurde mit vielen Auszeich nungen gewürdigt, und Josef Woodard nannte sie 2001 in „Down Beat“ die be ste Jazzband der letz ten 30 Jahre.

sein bestehendes Jazz-Trio „Full Crimp“ um ein neun köpfiges Kammerensemble erweitern und mit den Mu sikern ins Studio gehen, um dort ein Album aufzunehmen.
Im Zentrum stehen Kompo sitionen und Arrangements bereits bestehender Stücke des Trios, die Bearbeitungen für die neue Besetzung stam men alle aus seiner Feder. Er schloß bereits seine Bache lorstudien Klavier und JazzKlavier sowie den Universi tätslehrgang Instrumentalund Gesangspädagogik ab. Seit diesem Jahr setzt er sein Masterstudium Jazz-Klavier fort.
Neben seinen Erfolgen als Komponist, Arrangeur und Bandleader gilt Zawinul auch als Pionier beim Einsatz elek tronischer Instrumente. Er war einer der wenigen Musi ker, die auf einem Synthesi zer einen eigenen Klang ent wickelten. Das Merkmal sei ner späteren Kompositionen ist die Integration ethnischer Musizierstile und Elemente in den Jazz. Er entwickelte diese Klangwelt mit „Weather Re port“ und der nachfolgenden Gruppe „The Zawinul Syndi cate“ zur Meisterschaft und erhielt auf seinen Welttour neen weitere Anregungen.

Beethoven und Goethe in Teplitz

Mitte Oktober veranstaltete die oberpfälzische SL-Ortsgruppe Bad Kötzting mit der Stadt Bad Kötzting im Gasthof Zur Post ihr beliebtes Literarisches Café. Vor 33 Zuhörern referierte Dolf Schwarz über „Die Begegnung zwischen Goethe und Beethoven und ihre Bedeutung“.
Es herrschten schwierige Zeiten im Jahr 1812. In jenem Jahr hielt sich Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) auf Einladung der an Tuberkulose erkrankten österreichischen Kaiserin Maria Ludovica Beatrix von Modena (1787–1816), der dritten Frau des Kaisers Franz I. (1768–1835) von Österreich, im Kurort Teplitz auf. Dort schmiedete er mit dem Komponisten Ludwig van Beethoven (1770–1827) eine kurzfristige künstlerische Liaison. Noch im selben Jahr zog nämlich Napoleon Buonaparte (1769–1821) – den die beiden Genies ihrer Zeit in ihrem Freiheitsdrang zeitweise verehrten – gen Rußland und erlitt dort eine schmähliche Niederlage.

Wie sich die unverhoffte Begegnung Goethes mit Beethoven entwickelte, schilderte der ehemalige Studiendirektor Dolf Schwarz. Der im deutschen Sprachraum hochgeschätzte Dichter und der als genial eingestufte Komponist seien zwei gegensätzliche Charaktere gewesen, Goethe ein großer Schönling mit besten Manieren, Beethoven ein pockennarbiger kleiner Mann mit oft „unmanierlichen Gebärden“, wie ihn eine Freundin beschrieben habe. Der Drang zur holden Weiblichkeit, je jünger, desto lieber, sei aber beiden eigen gewesen.
Während Goethe gerne Umgang mit dem Adel und dem gehobenen Bürgertum des frühen 19. Jahrhunderts gepflegt habe, sei dem unter zunehmendem Gehörverlust leidenden Beethoven die Un-
terwürfigkeit gegenüber dem Hochadel verhaßt gewesen. Dennoch habe Goethe, der bei seinen häufigen Aufenthalten mehr als 100 Gedichte über Böhmen verfaßt habe, das Komponisten-Genie in dessen Hotel aufgesucht. Beethoven habe später dem Dichter bestätigt: „Es läßt sich keiner so gut komponieren wie er.“
Das Durchkomponieren von Gedichten sei Goethe allerdings immer suspekt gewesen, sagte Schwarz. Dennoch habe er durch die Begegnung mit Beethoven einen deutlich besseren Zugang zur Musik gefunden. Ebenso mit Franz Schubert, der mit „Wanderers Nachtlied“ eines der berühmtesten Werke Goethes vertont habe. Die Besucher des Literarischen Cafés hörten dies in der Version von Dietrich Fischer-Dieskau.
Mit der Musik zu Goethes Trauerspiel „Egmont“ habe Beethoven auch sein Freiheitsverlangen musikalisch ausgedrückt, erklärte Schwarz. Beethoven sei vor allem von der Figur des „Clärchens“ fasziniert gewesen, während Goethe festgestellt habe, der Komponist sei mit bewundernswertem Genie auf seine Dichtung eingegangen. „Freiheit über alles“ und „Wahrheit nie verleugnen“ sei zu einem Leitwort Beethovens geworden, der trotz seiner kleinen Gestalt und seiner unansehnlichen Erscheinung viele Liebschaften gehabt, aber nie eine Ehe geschlossen habe.
Seine 3. Sinfonie, die „Eroica“, habe Ludwig van Beethoven als eine Hommage an den von vielen Zeitgenossen verehrten Napoleon gesehen, später habe er sich aber von dem französischen Kaiser abgewandt, der mit seinen Feldzügen viel Leid über Europa gebracht habe. Sein zunehmende Taubheit, die ihn nach einem Aufenthalt in Karlsbad 1812 nach Teplitz geführt habe, habe Kontakte für Beethoven erschwert.
Alois Dachs
Impulse und Signale über die Grenzen
Großes hat im nächsten Jahr die oberfränkische Stadt Selb beziehungsweise die Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung und Durchführung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen Selb 2023 vor. Bei einem Pressegespräch informierten Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch, Pablo Schindelmann, Geschäftsführer der Gesellschaft, und Rita Skalová, Bürgermeisterin von Wildstein/ Skalná, über den Stand der Planungen.
Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen 2023 regen die Intensivierung von Kontakten und die Vernetzung von Akteuren beiderseits der Grenze an. Gemeinsame Veranstaltungen sollen die Verbundenheit zwischen den Bürgern stärken und die Vorzüge der bayerisch-tschechischen Grenzregion für Bewohner und Gäste präsentieren. Authentische Begegnungen und vielfältige Arten von Interaktion bieten ein Fundament für die Zukunft der bayerischtschechischen Beziehungen in unserer Region.“ So erklärte Pablo Schindelmann in der Einladung zum Pressegespräch die Intentionen.
Auf der Einladung war auch noch das alte Logo abgedruckt, das die Städte Selb und Asch/Aš in den Vordergrund gerückt hatte. Auf diese beiden Städte hatte sich bisher die Partnerschaftsund Begegnungsarbeit konzentriert. Bei der Pressekonferenz wurde nun das neue zweisprachige Logo präsentiert. Damit wird auch der Kreis oder die Region für mögliche Veranstaltungen und Begegnungen erweitert.

Die Zusammenarbeit wende sich an Städte, Kommunen, Vereine, Verbände, Gruppen und Einzelpersonen, sagte Schindelmann einleitend. Die Zeit vor und nach den tschechischen Kommunalwahlen im September habe zu einer kurzen Atempause bei der Arbeit geführt, da man die Wahlergebnisse und Besetzung der kommunalen Ämter oder die Zusammensetzungen der Gremien habe abwarten müssen. Danach hätten sich in der Kleinstadt Wildstein Vertreter mehrerer Städte und Gemeinden dieser Region für eine Zusammenarbeit ausgesprochen. Die Kooperation mit Aš finde ebenfalls eine Fortsetzung, müsse aber mit den neuen Kommunalpolitikern abgestimmt werden, was etwas Zeit benötige.
Schindelmann verwies auch darauf, daß die tschechischen Städte mitunter viel kleiner seien als in Bayern, was mit den historischen Aspekten der Stadterhebung zusammenhänge. Jedenfalls freue er sich über das Kommen von Wildsteins Bürgermeisterin Skalová, die das erwähnte Treffen federführend organisiert habe und Sprecherin der neun beteiligten tschechischen Kommunen sei. Bereits festgelegt ist laut Schindelmann, daß es nicht nur Veranstaltungen in Selb, sondern auch auf tschechischem Boden geben wird.

Skalová betonte die Nähe ihrer Stadt zur bayerischen und zur sächsischen Grenze. „Wir sind an grenzüberschreitende Arbeit gewöhnt“, sagte sie und nannte den Wanderweg nach Sachsen, die lange Partnerschaft mit der nordoberpfälzischen Gemeinde Neusorg im Landkreis Tirschenreuth sowie die Mitgliedschaft in der Euregio Egrensis. An den Freundschaftswochen werde ihre Stadt teilnehmen – auch als Zeichen, daß es Grenzschließungen wie 2020 – egal von welcher Seite veranlaßt – während der ersten Phase der Corona-Pandemie nie mehr wieder geben dürfe. Skalová verwies auf die deutsche Minderheit in Wildstein, zu der sie selbst gehöre und die sich an den grenzüberschreitenden Aktivitäten stark beteilige.


„Das Format der Freundschaftswochen war nie alleine auf Selb oder Asch gerichtet, sondern hatte immer den Ansatz, ein Instrument für die Völkerverständigung in dieser Region zu sein – verbunden mit dem politischen Willen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern, auch über den Zeitraum
der Freundschaftswochen hinaus“, sagte Ulrich Pötzsch. Die Freundschaftswochen seien auch so etwas wie Signalgeber für Menschen, die in diesem Zusammenhang nicht tätig seien und dadurch motiviert werden könnten. Und sie sollten Impulse für einen Ausbau der bereits bestehenden Zusammenarbeit geben. Seit 2013 gebe es einen regelmäßigen Austausch auf Bürgermeisterebene, mehrere Projekte seien bereits realisiert worden. Aber man wisse heute oft nicht, was jenseits der Grenze in den Nachbargemeinden des jeweils anderen Landes passiere, nannte Pötsch ein häufiges Defizit. Gemeinsame Plattformen als Basis für den gegenseitigen Austausch und für Begegnung seien daher wünschenswert.
Damit ging es zu den praktischen Ansätzen oder konkreten Inhalten und Veranstaltun-
Zweisprachig ist auch das neue Logo, das sich auf die zentralen Aussagen beschränkt und die Freundschaftswochen in den Mittelpunkt stellt – im Gegensatz zum bisherigen die beiden Städte nennenden Logo. Das neue Logo gibt es zudem in drei weiteren Formen, so daß es in vielerlei Kontexten verwendet werden kann. Ein Relaunch der Homepage ist für Anfang Dezember vorgesehen. „Unter dieser Flagge lassen sich jetzt viel besser unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen sammeln“, sagte Schindelmann, auch Themen rund um Heimat oder Verlust von Heimat.


Einzelne bereits fixierte Veranstaltungen werden wie beschrieben zeitnah bekanntgegeben. Die Palette der Veranstalter reicht von örtlichen Vereinen bis zu bayern- oder bundesweit agierenden Verbänden wie dem Adalbert-Stifter-Verein. Ausstellungen sind ebenso angedacht wie Sport- oder Laienmusik-Veranstaltungen. Dabei müssen natürlich die Städte und Gemeinden noch ihr Placet geben.
Von einer Gruppenreise mit Teilnehmern aus Hof, Selb sowie aus Wildstein berichtete Skalová. Sie erwähnte auch, daß in ihre Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg Tschechen gekommen seien, die zuvor im Banat gelebt hätten. Eine Veranstaltung, die sich den unterschiedlichen Wurzeln der Bewohner von Widmet widme, sei für Juni geplant. „Wenn
Der Höhepunkt war sicher das Lied „Brünn ist nit hin“ über die Belagerung Brünns durch die Schweden 1645. Es ist ein Zwiegesang zwischen den Schweden und der belagerten Stadt. Das Ende des Liedes stellt das sieges-
gen der Freundschaftswochen. Grundsätzlich sei daran zu denken, bestehende Städte- und Gemeindepartnerschaften im bayerisch-tschechischen Bereich verstärkt anzusprechen, auch außerhalb der unmittelbaren Region. Veranstaltungen werden künftig – automatisch zweisprachig – in die vom Centrum Bavaria Bohemia betreute Datenbank bbkult.net eingestellt und erscheinen parallel auf der Internetseite der Freundschaftswochen.

wir europäisch denken wollen, müssen wir das Ganze zusammenfügen, und die Leute müssen zusammenwachsen“, meinte die Bürgermeisterin. Was in einer Stadt oder Gemeinde gelinge, könne mittel- bis langfristig auch grenzüberschreitend funktionieren, so das Abschlußplädoyer von Skalová, Schindelmann und Pötzsch. In der näheren Region können später Eger/ Cheb und Waldsassen in die Aktivitäten einbezogen werden.
gewisse Nachspiel Brünns auf einer Trompete dar und zeigt passend dazu das Siegeszeichen V für Victoria auf Lateinisch oder Victory auf Englisch.
Bekanntlich zogen die Schweden damals zum ersten Mal oh-
ne Sieg ab, obwohl sie in überwältigender Überzahl gewesen waren. Zum Dank dafür wurde Brünn seinerzeit vom Kaiser zur Hauptstadt von Mähren ernannt, weil ja dadurch auch Wien gerettet worden war. Edith Breindl
Markus Bauer65 Jahre Uhrmachermeister

Anläßlich der Hundert-Jahr-Feier der Uhr macher-Innung München und Oberbayern fand im September eine sehenswerte Uh renausstellung in der Galerie Handwerk in München statt. Von gotischen Eisenuhren



Unser Heimatfreund kam am 23. Mai 1933 in Blatten dorf im Kuhländchen zur Welt. Wohlbehütet wuchs er mit drei Geschwistern auf. Sie ver brachten mit ihren Eltern ei ne glückliche Kindheit. Diese Idylle wurde jedoch durch den Zweiten Weltkrieg jäh unter brochen. Im Juli 1946 wurden sie nach Neutitschein in ein Sammellager gebracht, in dem sie drei Wochen auf den Va ter warten mußten, der in Po len gewesen war. Über Zauch tel und Prag wurden sie nach Furth im Wald abgeschoben und kamen bis nach Göppin gen.
Erhards Onkel Carl Hil scher, der seit 1939 als Juwe lier und Uhrmacher in Mün chen ansässig war, holte die Familie 1947 nach München. Kurz danach, im September 1947, begann Erhard Kah lig mit einer Uhrmacherlehre.
Als ältester Sohn hätte Er hard Landwirt werden sollen, denn seine Eltern kauften im Oktober 1947 im Hackermoos bei Dachau ein landwirtschaftli ches Gelände. Da er aber bereits eine Lehre begonnen hatte, über nahm später sein jüngerer Bru der dieses Anwesen. So spielte das Schicksal, Erhard wurde ein begnadeter Uhrmacher, eine Tä tigkeit, die er mit Leib und See le bis heute, schon lange im Ren tenalter, ausübt.
Nun hat ten es ihm die Zeitmesser an getan, und so plante er bereits im vierten Lehr jahr sein spä teres Meister stück. Ab 1952 besuchte er an den Wochen enden die Mei sterschule, die übrige Zeit ar beitete er bei seinem Onkel als Uhrmacher. Das verdiente Geld investierte er in seine Mei steruhr.
Dazu stellte er alle Berechnun gen der Zahnrä der, Achsabstän de und Platinen zusammen, zeich nete Konstrukti onspläne, gestal tete seine Tisch uhr, schnitt die gesamten Zahn räder und fertigte alle Triebteile sel ber unter Aufsicht in der Uhrma cherschule. Das Material, vor al lem Messing, war teuer, und so mußte Erhard warten, bis wieder genügend Geld angespart war. Nach mehreren Unterbrechun gen konnte er die Uhr in 1200 Ar beitsstunden im Jahr 1955 fer tigstellen. Dieses Prachtstück
über tragbare Uhren der Renaissance-, Ba rock- und Rokokozeit sowie über zeitgenös sische Uhren wurden auch Meisterwerke aus den sieben bayerischen Bezirken ausge stellt. Drei der interessantesten handgefer
war an einem repräsentativen Platz der Ausstellung zu bewundern.
tigten Einzelstücke stammten vom Uhrma chermeister Erhard Kahlig, einem Mitglied unserer Heimatgruppe Kuhländchen-Mün chen. Landschaftsbetreuer Ulf Broßmann berichtet.
erreichen. Auch dieses Spitzen stück der Uhrmacherei von Er hard Kahlig, gefertigt für die
zelstück ein aufwendiges Tour billon unter Ausschöpfung der zu Verfügung stehenden techni schen Möglichkeiten. Die not wendigen Zahnräder, Triebe sowie Platinen fertigte er in seiner eigenen Werkstatt. Die Weltkugel obenauf ist aus Na turstein mit Kunststoff überzo gen, worauf die Kontinente zu erkennen sind. Um deren ho hen Druck abzufedern und das laute Geräusch zu mildern, korrigierte er das Triebwerk am Ankerrad mit einer Fe der. Gerade dies sind die klei nen Dinge, die Erhard Kahlig ebenso beherrscht, um seine Uhren einzigartig werden zu lassen. Auch dieses außerge wöhnliche Werk wurde in der Ausstellung präsentiert.
In dieser Zeit baute er auf Wunsch auch Rolexuhren um. Er fertigte für die Gehäuse Präzisionsuhrenreifen, die mit Brillanten bestückt werden konnten. So entstand die bis her teuerste Rolexuhr.
� Blattendorf
Ein Dorf im Kuhländchen
Das Dorf Blattendorf liegt im mährischen Teil, in der Süd westecke des Kuhländchens, eingebettet in einer großen Mulde, welche sich nach Sü den öffnet. Seine Markung mit ihrer 330 Meter höchsten Erhebung gehört zum Gebiet des wasserscheidenden Berg rückens der europäischen Hauptwasserscheide zwi schen Oder und Donau.
am Ort nicht verrichtet werden konnten, mußten in der Kreis stadt Neutitschein, in Odrau, Mährisch Weißkirchen oder anderen Orten gedeckt wer den. Erst der Anbruch des In dustriezeitalters in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte bei vielen eine Wende in der Beschäftigung.
Im September 1957 legte Er hard Kahlig seine Meisterprü fung ab, am 16. November 1957 fand die Überreichung der Mei sterurkunde statt. In der Uhrma cherschule war man von Erhards exakter Präzisionsarbeit beein druckt. Deshalb erteilte die Uhr macherinnung ihm den Auftrag,
Ausbildung der Uhrmacher, fand seinen Weg in die Ausstellung. Erhard Kahlig heiratete 1959, das Ehepaar bekam zwei Söh ne. Bis zu seiner Verrentung ar beitete er bei seinem Onkel und war zuständig für die Lehrlings ausbildung, Erstellung von Ko stenangeboten sowie der Über
Die hohe Qualität von Er hard Kahligs Arbeiten sprach sich in ganz Deutschland her um, und so wurden ihm Uhren anvertraut, deren Reparaturen kaum noch jemand beherrscht. Auch heute noch finden seltene Uhren aus dem Bekanntenkreis den Weg zu Erhard Kahlig, der sie mit großer Kenntnis, großem Geschick und Wissen sowie gro ßer Erfahrung wieder zum Gehen bringt.
Ihr Blattendorfer seid‘s zu beneiden um euer schönes, stilles Dörfchen“, sagte Pa ter Stefan aus Deutsch-Jaßnik einmal, als er, zum Religions unterricht kommend, sich mü de auf einem Sessel im Schul zimmer niederließ. „Mit Rom, der ewigen Stadt, kann man Blattendorf ganz gut verglei chen, denn bei Euch geht man so wie dort von einem Hügel hinunter und den anderen hin auf.“
ein Tourbillon-Uhrwerk als An schauungsmuster für künftige Meisterprüflinge zu entwickeln. Das Tourbillon ist eine Vorrich tung, bei der das Schwing- und Hemmungssystem einer mecha nischen Uhr sich um seine Ach se dreht, um eine weniger lage abhängige Ganggenauigkeit zu
Von oben links im Uhrzeigersinn Erhard Kahligs Meisterstück von 1955, sein Meisterbrief von 1957, seine Weltzeituhr und sein Muster für ein Tourbillon.

holung, Feh lersuche, Justage und Wartung von besonders komplexen, teuren Uhren.
Während dieser Zeit war es ihm nicht möglich, seinen langgehegten Wunsch zu realisieren, eine Weltzeituhr zu konzipieren. Aber als Privat mann begann er nun mit diesem Projekt. Er berechnete die Dreh bewegungen für die Zeitzonen und die zugehörigen Uhrzeiten und entwickelte für den Antrieb als neue Konstruktion und Ein
Dieser Ta ge besuchte ich ihn, und er saß vor einer gro ßen Gemäldeu hr, er schätz te ihr Alter auf 130 Jahre. Als er sie bekam, funktionier te nichts mehr, aber er ruhte nicht, bis das al te Uhrwerk wie der die exakte Zeit am gemal ten Kirchturm zeigte, ein an deres den Stun denschlag, ei ne uralte Spiel uhr und den Wasserfall mit dem Mühlrad antrieb sowie die Seiltänzer mit dem Harlekin in der gemalten bäuerlichen Land schaft bewegte.
Das Herz des vertriebenen Kuhländlers Erhard Kahlig hängt immer noch an Blattendorf und dessen Kloster, für das er sich in tensiv einsetzt. Dennoch fand er in Bayern mit seiner lieben Fa milie und seinen außergewöhnli chen Uhren sein Glück. Wir alle wünschen dem rüstigen Lands mann noch viele gesunde Jah re, auch um bei den angenehmen Besuchen bei ihm vieles von sei nen gesammelten Schätzen aus der verlorenen Heimat, seinen Erinnerungen und seinem rei chen Wissen zu erfahren.

Nicht nur diese Hügel, auch die vielen Wasserquellen der Gemarkung dieses Dorfes schienen schon in den frühe sten Zeiten Anziehung auf die Seßhaftigkeit der Menschen ausgeübt zu haben. Daß solche vorzeitlichen Siedlungsplät ze bestanden, beweisen Fun de aus jener Zeit. Drei stän dige Siedlungsplätze wurden 1888 auf der Dorfgemarkung entdeckt. Grabungen brach ten aus der Aschenschicht der einzelnen Brandplätze über 200 Fundstücke wie Messer, Pfeilspitzen, Beile, Äxte und sonstiges Kleinwerkzeug aus Stein sowie einzelne tierische Knochenreste und geformte Gefäßscherben zu Tage.
1548 wurde Blattendorf, nachdem sich das Ländchen seit Ausgang des 13. Jahrhun derts im slawischen Herrenbe sitz befunden hatte, erstma lig unter dem Namen Blahau towice urkundlich erwähnt.
Doch die erstmalige Nennung eines Ortes bedeutet nicht gleich Gründung eines Or tes. Vielmehr dürfte das Dorf schon längst bestanden haben.
Die Gemeinde gehörte als untertäniges Dorf zur Guts herrschaft Mährisch Weißkir chen und bis 1854 zum Kreis Prerau. Durch die im selben Jahre durchgeführte Verwal tungsreform kam Blattendorf zum Kreis Neutitschein.
Landwirtschaft und Vieh zucht waren der Haupterwerb des Dorfes. Die meisten Dorf bewohner waren in der Land wirtschaft tätig und verdien ten damit ihren Lebensunter halt. Die bäuerlichen Arbeiten waren früher hauptsächlich Handarbeit und mit heute nicht zu vergleichen. Auch al te Menschen und Kinder muß ten die schweren Arbeiten mit verrichten, um damit einen Dienstboten oder Taglöhner zu ersetzen.
Dienstleistungen, welche für den täglichen Gebrauch
Viele Dorfbewohner fan den außerhalb in Neutitschein und anderen Orten Ausbil dung und Arbeit. In Blatten dorf gab es 1939 eine Erbrich terei, 16 Bauernhöfe und 31 landwirtschaftliche Kleinbe triebe. Handel und Gewerbe waren mit zwei Herren- und Damenschneidereien, einem Schuhmacher, einer Bau- und Möbelschreinerei, einer Metz gerei, einer Huf- und Wagen schmiede, einer Gemischtwa renhandlung, einer Schlos serei, einer Mühle, zwei Gastwirtschaften mit Tanz saal und Kegelbahnen und ei ner Zementwaren- und Kunst steinfabrik vertreten.
Nach der Volkszählung 1939 hatte Blattendorf 407 Ein wohner, es war ein rein deut sches Dorf. Von den einstigen stattlichen Gebäuden wurden zwölf Häuser niedergerissen, und einige sind dem Verfall nahe. Etliche Häuser wurden renoviert, welche dem Dorf ei nen freundlicheren Anblick verleihen.
Neben dem Transformato renhäuschen steht ein aus Be tonplatten gebautes Mehrfa milienhaus mit Flachdach. Die Waldkapelle der Erbrichte rei Blaschke, links neben der Straße in Richtung Pohl, wur de einst mutwillig zerstört. Die Madonnenstatue, welche den Altar zierte, wurde früh zeitig in Sicherheit gebracht und fand in der Gefallenen gedächtniskapelle einen wür digen Platz. Ebenso erging es der Klosterkapelle, in der einst täglich Gottesdienst stattfand. Der größte Teil des Inventars wurde gerettet und fand in der Gefallenengedächtniskapelle wieder Verwendung.

Zerfallen sind die Feldka pelle und das Marterl an der Straße nach Deutsch-Jaßnik. Nach der politischen Wende wurde die Kapelle durch ein Kreuz ersetzt und der Bild stock auf dem Blattendorfer Berg neu errichtet. Diese Neu gestaltung wurde auf Veran lassung der Familie Malcher, die im Heimatort verblieben war, durchgeführt. Sie über nahm auch die Pflege und In standhaltung der Gefallenen gedächtniskapelle.
Blattendorf war bis 1976 selbständig, danach wurde es nach Deutsch-Jaßnik ein gemeindet. Beim Zensus von 2001 lebten in den 59 Häusern von Blattendorf 164 Personen. Zum 1. Januar 2014 hatte das Dorf 183 Einwohner.
 Eduard Rabel/nh
Eduard Rabel/nh
Reicenberger Zeitung

Privilegien und Rechte kommen und gehen
Auf den Dörfern sol len keine Hand werker geduldet werden, damit die Handwerker in der Stadt keinen Nachteil haben. Die Zünfte sind berechtigt, solche Handwerker auch ohne Vorwis sen der Herrschaft durch die Ge richte des Dorfes aufzuheben, sie in die Gefängnisse zu werfen und jeden mit einem Taler zu bestra fen.
Hans von Berka verpflichtet sich, für seine Herrschaft und ihre Kretschmer (Schankwirte) ein eigenes Malz und Bräuhaus zu bauen. Er bestimmte, falls es nicht dazu käme, daß die Kretsch mer ihr Bier nur aus dem bürger lichen Bräuhause beziehen soll ten. Die Braugerechtigkeit wird auf die schon bestehenden, die alten Häuser beschränkt. Nach seinem Tode sollen die Bürger das Recht erhalten, sich selbst „loszulassen“. Das bedeutete, daß sie ohne die Erlaubnis der Herrschaft ihren Wohnsitz wech seln dürfen.
Als Gegenleistung für die auf gezählten Bestätigungen und Vergünstigungen trägt die Stadt Gabel 1000 Taler zur Abzahlung der kaiserlichen Steuer bei und was sonst noch nach dem Land tagsbeschluß dieses Jahr zu ent richten ist.
Hans Berka von Dauba auf Jahbel starb im Jahr 1600. 1599 hatte Margaretha von Libechov die Herrschaften Zetten und Ga bel erworben. Der Gabler Besitz bestand aus der Hälfte der Stadt mit der unteren Vorstadt, dem halben Patronatsrecht auf die Pfarrkirche und das Kloster, der Hälfte des Hospitals, dem glei chen Recht auf das Rathaus. Es gehörten dazu das Schloß Neu falkenburg samt dem Meierhof, dem Bräuhaus und der Mälze rei, ferner in Petersdorf der Mei erhof, ein Haus und die Mühle, dazu die Dörfer Böhmischdorf, Hermsdorf und Petersdorf mit ihren Robotleistungen. Margaretha Hoslauer starb schon 1601. Ihr Gemahl Wladislav Hoslauer erbte die Herrschaft.
Wie schwierig die Lage war, sieht man aus einer Bemerkung des evangelischen Pfarrers Suto rius in der Taufmatrik vom Jah
re 1602. „Die Jäblischen haben gemeint, es dürfe die Herrschaft keine Laster und Sünden stra fen. Ich als zu der Zeit ihr pfar her und Seelsorger habe gethan und auf der Cantzel verrichtet, was mir Ambtshalber gebühren wollte, und zu allem Guten ver mahnet. Bin aber in solchem So doma und Comorrha meines Le bens niemals sicher gewesen und haben sich die Jäblischen an mei ner Person vergriffen“.
Hoslauer verfuhr sehr unge recht und unchristlich mit sei nen Untertanen. Seine Knap pen schossen fortwährend vom Schloß aus in die Stadt. Einmal legten sie mutwilliger weise Feuer an. Am 21. De zember 1607 raubten seine be waffneten Knechte auf offener Straße dem Kloster Pferde und Wagen. Durch grundlose Ver folgungen verbittert und ver armt, verweigerten die Unter tanen Hoslauer den Gehor sam. Kaiser Rudolf II., dem der wahre Sachverhalt nicht hin länglich bekannt sein mochte, ordnete eine strenge Bestra fung der Aufständischen an.
Drei Untertanen sollten ihr Hab und Gut und ihr Leben verlieren. Viele andere muß ten mit schweren Gefängnis strafen die Auflehnung büßen, obwohl Hoslauer ermahnt worden war, mit seinen Unter tanen christlich zu verfahren. Hoslauer überschritt das ihm vom Kaiser vorgeschriebene Maß der Bestrafung. Er nahm an den Gablern in geradezu unmenschlicher Weise Rache.
Da erhoben sich die Unter tanen zum zweiten Mal. Nun dürfte der Kaiser den wahren Grund der Unruhen erfahren haben. Er entsandte 1609 ei gene Kommissäre nach Gabel, die Ordnung machen sollten. So erhielten die Gabler die Waisengelder, die Stadtprivi legien mit dem großen und klei nen Stadtsiegel wieder zurück.
1610 verkaufte Hoslauer die Herrschaft Gabel an Ladislaus Berka von Duba auf Drum. Weil dieser ein eifriger Katholik war, begegnete auch er verschiede nen Feindseligkeiten bei seinen lutherischen Untertanen. Ladis laus starb 1615. Die Vormund
schaft über die Kinder Ladislaus‘ übernahm Leo Burian Berka. Die ser verpfändete um 1616 Gabel an Christoph von Dohna, Herrn auf Oberwalten und Tölzeldorf. Christoph von Dohna starb 1618. Dessen Sohn Konrad von Doh na übernahm den väterlichen Be sitz. Konrad von Dohna war 1618 mit am Aufstand gegen König Ferdinand II. beteiligt. Nach der Schlacht am Weißen Berge am 8. November 1620 verlor auch er seine Besitzungen.
verstorbenen Wolf Berka. Hein rich Wolf Berka hatte eine lang jährige Auseinandersetzung mit den Dominikanern in Gabel. Er beanspruchte das Patronatsrecht über die Klosterkirche, und den Untertanen des Klosters wollte er die Ausübung des Gewerbes verbieten. Der Streit dauerte von 1627 bis 1637. Für die geleisteten Kriegsdienste wurde Heinrich Wolf Berka 1640 von Kaiser Fer dinand III. (1637–1657) in den Grafenstand erhoben mit dem Ti
zen Stadt Gabel, Neufalkenburg, Böhmischdorf, Markersdorf, Hermsdorf, Herrndorf, Peters dorf, Oberwalten, der Feste Vtel no bei Melnik samt Zubehör und Nemyslovic 1672 auch noch das Fideikommis der Berka Richen burg und Rosie. Um den Streit der Stadt mit der Herrschaft we gen des Bräuhauses zu beenden, schloß Franz Anton mit Gabel ei nen Vertrag, nach welchem die Brauberechtigung auf beide Tei le gleichmäßig aufgeteilt wurde. 1686 suchte die Pest die Ge gend von Gabel heim. Ihr fiel die Hälfte der Bewohner zum Opfer. Franz Anton war Ge heimrat des Kaisers, Statthal ter und oberster Landrichter in Böhmen. Von Kaiser Leo pold I. (1658–1705) erhielt er die erbliche Würde eines obersten Landmarschalls. Er war Gesandter an mehreren europäischen Höfen, zuletzt 1702 bei der Republik Vene dig. 1699 begann er den Bau der Sankt-Laurentius-Kirche in Gabel. Er starb am 24. April 1706 in Wien und wurde in der noch unfertigen Kirche in Ga bel begraben.

Mit Franz Anton starb der letzte des adeligen Geschlech tes der Berka von Duba. Es exi stieren aber doch noch Nach kommen dieses Geschlechtes unter dem Namen Duba und Dubsky. Aus dem Geschlecht der Berka von Duba hatten 1618 einige am Aufstand ge gen König Ferdinand II. teil genommen. Bei den nach folgenden Gerichtsverhand lungen wurden sie, wie viele andere, ihrer Güter für verlu stig erklärt. Je nach der Größe ihrer Schuld verloren manche nur einen Teil ihres Vermö gens. Einige verkauften ihre Restgüter und wanderten aus.
1867 im Besitz der Familie Pachta. In jenem Jahr sah sich Robert von Pachta gezwungen, die Herr schaft um eine Million Gulden an Baron Palme aus Sachsen zu ver kaufen, weil die Miterben, die Männer seiner drei Schwestern, ungestüm die Barauszahlung ih res Erbteiles forderten.
In den 1870er Jahren erwarb Ernst Mattausch, Fabrikant in Franzenthal bei Bensen, die Herrschaft Neufalkenburg. 1928 erbte sie der Großindustriel le Wolfgang Liebieg in Reichen berg von seinem Onkel Johann Moritz von Liebieg.
Die Hussitenkriege 1419 bis 1436
Durch eine gute Verwaltung und Rechtspflege und durch die Förderung des Acker-, Weinund Bergbaues und des Gewer bes hatte Kaiser Karl IV. (1346–1378) Böhmen zu großem Wohl stand gebracht. Karl IV. war der gebildetste Herrscher sei ner Zeit. Er sprach und schrieb fünf Sprachen. 1348 gründete er die erste deutsche Universität in Prag. Er ließ den Veitsdom, den Hradschin und die Karlsbrücke bauen. Prag wurde die erste ech te Hauptstadt des Heiligen Rö mischen Reiches deutscher Nati on. Hier entstand die neue hoch deutsche Schriftsprache.
Karl, unkriegerisch, erwarb durch kluge Diplomatie der Kro ne Böhmens, zu der auch Mäh ren gehörte, 1353 den größten Teil der Oberpfalz und bald dar auf das Egerland. 1364/67 die Lausitz, 1368 den Rest von Schle sien (Schweidnitz und Jauer) und 1373 die Mark Brandenburg, fer ner Erbansprüche auf Ungarn und Polen. So hinterließ er seinen Erben eine große Hausmacht.




Gabel übernahm der Sohn des 1615 verstorbenen Ladislaus von Berka auf Drum, Johann Dietrich von Berka. Dieser wurde später kaiserlicher Rat, Mundschenk und Landrichter der Markgraf schaft Mähren. 1623 kaufte Heinrich Wolf Berka von Duba die Herrschaft Gabel. Er war der Sohn des 1598

tel „von Hovora“. In den Jahren 1645 bis 1650 war er Präsident der Kammer und seit 1649 ober ster Hofrichter. Er starb 1651 und hinterließ die zwei minderjähri gen Söhne Franz Karl und Franz Anton.
Als Franz Anton großjährig geworden war, erhielt er außer seinen ererbten Gütern, der gan
Nachdem Graf Franz Anton Berka von Duba 1706 gestor ben war, erbte sein Stiefbruder Graf Franz Anton Nostitz die Herrschaft Gabel. 1708 kaufte sie Franziska Rosalia Kinsky, ge borene Berka. Nach ihrem Tode 1714 erbte sie Graf Wenzel Al bert von Wirbenthal, der sie 1718 an den Besitzer von Walten, Frei herrn Joachim von Pachta, ver kaufte. Die Herrschaft blieb bis
Sein Sohn Wenzel IV. (* 26. Fe bruar 1361 in Nürnberg) wurde schon 1363 zum König von Böh men gekrönt und war 1378 bis 1400 Deutscher König. In seiner Gleichgültigkeit, Trägheit und Trunksucht war er unfähig für die Lösung seiner Aufgaben als Regent. In seinem Jähzorn ließ er 1393 den Generalvikar des Erzbi stums Prag, Johannes von Nepo muk, in die Moldau stürzen. Fortsetzung folgt
Franz Appelt kehrt zurück

2011 gab Klaus-Michael Neumann im Selbstverlag das Buch „Neustadt an der Tafelfichte 1584 bis 1946. Chronik einer deutschen Stadt in Böhmen“ heraus. Das Kapitel „Die Auswanderer der Stadt und des Kreises nach Amerika“ veröffentlichen wir in der Reichenberger Zeitung in mehreren Folgen.
Die digitalisierte Welt des Internet macht eine Familienforschung in Texas zu einem einmaligen Erlebnis, und so konnte ich an Hand der auffindbaren Volkszählungen, im Amerikanischen „Census“ genannt und ab 1850 bis 1930 in Texas alle zehn Jahre durchgeführt, in der Liste von Hallettsville aus dem Jahre 1880 herausfinden, daß Franz Appelt nicht mehr bei seiner Frau Antonia lebte.
Diese Feststellung hat sich bei der weiteren Forschung als korrekt herausgestellt. Sie soll furchtbar eifersüchtig und zänkisch gewesen sein. Ob sie ihre berechtigten Gründe hatte, bleibt für uns im Dunkel der Geschichte und wird sich wohl nicht mehr klären lassen.
Franz Appelt war bereits am 25. Juli 1854 eingebürgert worden, kehrte aber 1897 allein nach Neustadt zurück und lebte als Mieter bei den Familien Rösler und Ullrich in der Liebwerdaer Gasse 163, Ecke Lusdorfer Gasse. Die Erzählungen in der Familie, daß im Jahre 1901 sein Neffe Wilhelm Appelt und zwei weitere Begleiter aus Texas in Neustadt zu Besuch angereist waren und Franz Appelt dazu bewegen wollten, nach Texas zurückzukehren, kann heute durch den Fund einer Passagierliste, aus New York vom 20. August 1901, bestätigt werden.

Als Passagiere sind verzeichnet: Wilhelm Appelt, Alter 51 Jahre, Franz Zappe, Alter 44 Jahre, und Adolph Zappe, Alter 50 Jahre. Als Herkunft ist bei allen Hallettsville angegeben. Es muß sich also um den Neffen Wilhelm Appelt (* 29. September 1850) und Sohn seines Bruders Wilhelm Appelt (* 23.November 1826) handeln, der 1871 ebenfalls mit seiner Familie nach Texas ausgewandert war. Ebenso fand sich eine Passagierliste in New York, Ankunft am 30. Mai 1911, auf der ein Adolf Kunze aus Hallettsville aus Texas, Alter 53 Jahre, und ein Franz Appelt aus Neustadt in Böhmen, Alter 14 Jahre, registriert sind. Die Familie Zappe stammt aus Ku-
Am 20. November wird Pfarrer Pavel Anderš um 13.00 Uhr die restaurierte Grabkapelle der Familie Neuhäuser und Berger auf dem Friedhof in Buschullersdorf bei Reichenberg segnen.
Häufig berichtete diese Zeitung über die verdienstvolle Arbeit des tschechischen Denkmalpflegevereins Omnium. Doch gibt es auch weniger bekannte Aktivisten und Aktivitäten.
Auf Initiative des Vereins Živo v Hájích und der Ortschronistin wurden auf dem Friedhof in Buschullersdorf/ Oldřichov v Hájích die einzige, leider schon ziemlich verfallene Grabkapelle renoviert und Gräber neu hergerichtet. Der Name des Vereins läßt sich in etwa mit „Leben in Buschullersdorf“ übersetzen.


Es handelt sich um die Grabkapelle der bedeutenden Buschullersdorfer Familie Neuhäuser, Familie des ersten Feuerwehrkommandanten, und der Familie Berger. Ergänzend habe ich die Fa-
kan und Reichenau bei Gablonz. Wilhelm Appelt und seine Frau Antonia besuchten 1906 nochmals Neustadt.
Franz Appelt regelte aber schon zu Lebzeiten auf dem Rat-
die Verträge doch, daß diese Gräber Bestand hätten, solange der Friedhof existiert. Die Grabstellen der ehemaligen Bewohner der Stadt machten über 90 Prozent der Gesamtfläche aus, und






gen des grausamen Anblicks abgebrochen worden sein.
Da die Rückwand der Grabstelle des Franz Appelt umzustürzen drohte, fehlte doch der stützende Seitenhalt, wurde sie schnell abgestützt und konnte so vor dem Totalverlust bewahrt werden. Wir sind dem unbekannten Initiator dieser Rettungsaktion heute noch dankbar für seine Weitsicht.
Als wir im August 2003 das Grab aufsuchten, bot sich uns ein Bild des Jammers. Der Bronzeadler, der in den 1980er Jahren noch hoch oben thronte und von einem fernen Land jenseits des „Großen Teiches“ kündete, war gestohlen worden, ebenso die Messingtafeln. Und die aggressiven Umwelteinflüsse hatten nicht nur den Wäldern im Isergebirge arg zugesetzt und die Tafelfichte fast baumfrei gemacht, sondern auch dem Sandstein der Grabanlage schwer zugesetzt. Das Loch in der Mauer war aber wieder geschlossen worden. So konnten wir dank der Initiative von Rostislav Jelinek aus Ferdinandsthal/Ferdinandov im Herbst 2008 mit dem Stadtamt einen Vertrag über die Instandsetzung und weitere Pflege durch uns abschließen. Im Frühjahr 2009 begannen meine Frau Raymonde und ich mit den Vorbereitungen und beendeten die Restauration am 22. August 2009 zum 425. Jahrestagfest zur Stadtgründung mit der Anbringung einer Granittafel.
Das rekonstruierte Gebäude des ehemaligen Zollamtes in Grottau/Hrádek nad Nisou im Dreiländereck Deutschland-PolenTschechische Republik fand nach vielen Jahren eine neue Bestimmung.
Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten hat die Fremdenpolizei dort nun eine neue Dienststelle, in der sowohl tschechische als auch deutsche Polizeibeamte gemeinsamen Dienst tun. Die Renovierung des Gebäudes hatte 16 Millionen Kronen gekostet.
der Stadt erhöhen werden. In Anbetracht der Kriminalität in der Stadt ist das ein großer Gewinn“, sagte der Grottauer Bürgermeister Josef Horinka bei der feierlichen Eröffnung des neuen Dienstgebäudes der Polizei.
haus in Neustadt seine Bestattung und bezahlte alles im Voraus. Er gab Anweisungen an die ausführende Firma zur Errichtung der Gruft mit der Säule, dem Adler aus Bronze, dem Wappen der amerikanischen Südstaaten, dem „Lonestar“ von Texas und der Tafel mit dem Spruch „Eine harmonische Ehe ist der Himmel auf Erden, aber Unfrieden und Eifersucht sind die Hölle. Hier ruht ein deutscher Amerikaner in Frieden“.
Das Grab wurde nach 1946 nicht mehr gepflegt und war dem Verfall preisgegeben. 1977 gab es in Neustadt einen öffentlichen Aufruf des Stadtamtes, daß alle Gräber, deren Bestand abgelaufen war und die offensichtlich nicht mehr gepflegt würden, entfernt werden. Diese Anordnung liegt im Wortlaut vor. Ob über die Verträge für die Grabstellen an den Friedhofsmauern Kenntnis bestand, ist unklar. Besagten

so machte man sich an die Beseitigung derselben. Zu diesem Zweck durchbrach man mit einem Bulldozer mit Schiebeschild die Ostmauer des Friedhofes am südlichen Ende direkt neben der Grabstelle des Franz Appelt und schob alle Grabstellen mit dem Schiebeschild zusammen.
Nach verläßlichen Augenzeugenberichten soll sich dem Betrachter ein grausames Bild geboten haben, da auf dem Platz alles voller Knochen und Schädel gewesen sei.

Diese Aktion mit dem Bulldozer soll we-

Diese Grabtafel haben wir aus schwarzem Granit mit einem Foto, den Daten und dem Spruch in Lasergravur anfertigen lassen. Die Platte wurde in der Mitte der Säule angebracht und vervollständigt wieder ein Zeugnis unserer Vorfahren in Neustadt, das zu erhalten sich auf jeden Fall gelohnt hat.
In dem neuen Dienstgebäude sind derzeit zwölf tschechische Polizeibeamte beschäftigt. Die gleiche Anzahl von Polizeibeamten aus der Bundesrepublik soll nach Erledigung der notwendigen Formalitäten hinzukommen. Wünschenswert wäre natürlich, daß auch polnische Polizisten an der tschechisch-polnischen Grenze eingesetzt werden.
Obwohl sie im vergangenen Jahr ihr Interesse bekundeten, wurde noch keine Einigung erzielt. Das Gebäude bietet jedoch Platz für bis zu 40 Personen, so daß auch für sie ausreichender Raum vorhanden wäre. Die Polizeibeamten der Polizeistation Grottau werden für das Gebiet von Krombach bis zum Wittighaus/Smědava zuständig sein und ihren Patrouillendienst tun, das heißt, nicht nur für die Region Grottau, sondern auch für die Region Friedland.
„Ich freue mich sehr, daß zusätzliche Polizeibeamte in Grottau für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen und damit das Sicherheitsgefühl in
„In der Nähe befindet sich das beliebte Naherholungsgebiet mit dem Christinasee, wo sich die Diebe in diesem Jahr vor allem auf Elektrofahrräder konzentriert haben, die im Ausland möglicherweise gefragter sind als Autos“, ergänzte der Bürgermeister. Auch das neu instand gesetzte Gebäude wurde bereits mehrfach von Dieben heimgesucht. Zuletzt im September, als eine Außenkamera gestohlen wurde. Den Dieben war es vollkommen egal, daß sie bei dem Diebstahl von der Kamera aufgenommen wurden.
Aufgabe der gemeinsamen Polizeistreifen ist nicht nur die Verhinderung von grenzüberschreitender Eigentums- und organisierter Drogenkriminalität, sondern auch die Kontrolle der illegalen Migration. Zwischen Mitte August und dem 25. Oktober haben gemeinsame tschechisch-deutsche Polizeistreifen in Sachsen zwölf illegale Migranten aus Syrien und Ägypten festgenommen, die ohne Ausweispapiere nach Europa gereist waren.
Zuletzt wurden zwei Ausländer aufgespürt und festgenommen, die sich in einem Waldstück in der Nähe von Weinau an der B 99 vor der Polizei versteckt hatten. Die beiden jungen Männer hatten keine Reisedokumente und gaben an, syrische Staatsangehörige zu sein. Am Ende stellte sich heraus, daß sie aus
milie Neuhäuser weitgehend erforscht. Vor etwa ein, zwei Jahren konnten sich noch zwei Nachfahren des Lebens erfreuen.
Ziel des Vereins war, die Reparatur so abzuschließen, daß das Grab wieder ein würdiges Wahr-
zeichen des Friedhofs darstellt. Ich denke, das ist gelungen.
Der Verein Živo v Hájích und die Gemeindeverwaltung laden mit dem Gemeindebetreuer Walter Leder die Nachkommen der Familien Neuhäuser und Berger
sowie die ehemaligen deutschen Bewohner von Buschullersdorf herzlich ein, an der Feier und Segnung der Grabkapelle teilzunehmen.
Die deutschen Grabstellen entlang der Friedhofsmauer und

ein paar wenige auf der Fläche bleiben leider ihrem Schicksal überlassen. Durch Überwucherung werden sie immer weniger sichtbar. Wir begannen, Grabstätten selbst herzurichten. Aber jedes Jahr begann diese Arbeit
erneut, wenn auch nicht so aufwendig wie beim ersten Mal. Nun haben wir fünf Grabstellen unserer Vorfahren von Fachleuten des Vereins Živo v Hájích herrichten lassen. Auch diese werden am 30. November gesegnet werden. Ich würde mich sehr freuen, Vertreter der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, vom Verein der Deutschen in Nordböhmen, vom Begegnungszentrum in Reichenberg, der Vereine Omnium und Spolek Patron, der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der Heimatpflege, der Reichenberger Zeitung und alle jene, die sich ihrer Heimat verbunden fühlen, mit der Ortschronistin Jiřina Vávrová, dem Verein Živo v Hájích und Pfarrer Pavel Andrš begrüßen zu dürfen.
Vor wenigen Tagen gab es im Bürgermeisteramt einen Wechsel. Ganz aktuell wurde zugesagt, den deutschen Teil des Friedhofs in Ordnung bringen zu lassen.
Christa Schlör
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau


Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –

Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
30. Treffen des Heimatkreisvereins Bilin
in der Patenstadt Gerolzhofen/Unterfranken von Samstag, 19. November bis Sonntag, 20. November
Programm
Samstag, 19. November
12.00 Uhr: Mittagessen im Hotel Tor zum Steigerwald, Dingolshäuser Straße 1
13.00 Uhr: Jahreshauptversammlung dort Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Wahl eines Protokollführers
3. Beschluß über die Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2019
5. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
6. Kassenbericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache über die Berichte, Entlastung des Vorstands
9. Bestimmung des Wahlleiters
10. Neuwahlen von Erstem und Zweitem Vorsitzenden, Schriftführer, Schatzmeister, bis zu neun Beisitzern sowie zwei Kassenpüfern
11. Ehrungen









12. Anregungen, Wünsche, Anträge
13. Grußworte
14. Schlußwort des Ersten Vorsitzenden
15. Totenehrung beim Kreuz des Ostens auf dem Friedhof 18.00 Uhr: Abendessen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein im Hotel Tor zum Steigerwald Sonntag, 20. November
Der Vormittag bietet die Möglichkeit zum Gottesdiensbesuch. 10.00 Uhr: Heimattreffen in der Heimatstuben in Gerolzhofen, Bilinweg 1.






Bis zum 12. November können im Hotel Tor zum Steigerwald Zimmer reserviert werden: (0 93 82) 9 74 60 oder (01 60) 96 72 68 47. Auskunft: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77 oder (01 71) 3 15 69 95, eMail dietmar.heller@deheller.de

Überraschende Eindrücke in Kirche und Schloß-Theater
An den Tagen der Architektur Ende September beziehungsweise Anfang Oktober öffneten sich in der Tschechischen Republik bekannte und unbekannte Bauwerke für die Besucher. Drei davon konnte Jutta Benešová in diesem Zeitraum besuchen –mit überraschenden Eindrücken. Sie berichtet.


Unseren treuen HeimatrufAbonnenten herzliche Glückund Segenswünsche zu ihrem Geburtstag im Monat November.
■ Heimatkreis Dux. Klaus Püchler, Heimatkreisbetreuer und Vorsitzender des Heimatkreisvereins, Vorsitzender des Stiftungsrates und Archivar, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, 10. November 1958.
■ Ossegg/Kreis Dux. SonjaSofie Stifter, Tachauer Straße 24, 95643 Tirschenreuth, 6. November 1931.
■ Herrlich/Kreis Dux. Dr. Gerold Jäger, Wagnerstraße 13, 74722 Buchen, 27. November 1937.
■ Loosch/Kreis Dux. Erika Endisch, Georg-Rückert-Straße 2/547, 65812 Bad Soden, 23. November 1920.
Der erste Besuch galt der bekannten Sankt-Peter-undPaul-Kirche in Janegg. Die Missionsgemeinschaft FATYM aus Frain an der Thaya/Vranov nad Dyjí bei Znaim hatte für diese Kirche die Patenschaft übernommen. Wir berichteten. Seit den 1990er Jahren haben die Geistlichen viel für die christliche Gemeinde in Janegg getan. Das Pfarrhaus und die Sankt-Anna-Kapelle sowie die Kapelle in Loosch wurden renoviert. Zwei Katechetinnen kümmern sich um die Christenlehre für die Jüngsten.


Außer den regelmäßigen Gottesdiensten, zu denen alle 14 Ta-
ge die Pfarrer aus Frain, dieser Stadt drei Kilometer nördlich der tschechischen Grenze zu Niederösterreich, anreisen, findet auch alljährlich eine Auto-Wallfahrt aus dem weit entfernten Südmähren nach Janegg statt. An dieser beteiligen sich auch die Mitglieder der dortigen Missionsgemeinschaft.
In diesem Jahr gab es einen erfreulichen Anlaß zum Feiern: Die Einweihung eines Fensters neben dem Altar, welches dem Heiligen Bernhard geweiht ist.
Durch Spendensammlungen, an welcher sich auch Landsleute aus Deutschland beteiligten, konnte während des Wallfahrtsgottesdienstes an einem Samstag Ende September das neue Kirchenfenster von Pater Jan Richter eingeweiht werden. Ein weiteres Buntglasfenster direkt über dem Altar ist geplant und wird den heiligen Peter darstellen.
Die Nachricht, daß im Schloß Eisenberg im Erzgebirge der Theatersaal renoviert wurde, verlockte zu einem weiteren Besuch

bei herrlichem Herbstwetter. Den Teilnehmern unseres Teplitzer Heimattreffens im vergangenen Jahr wird der Rundgang durch das von außen heruntergekommen wirkende Lobkowitz-Schloß noch in guter Erinnerung sein. Wir hatten den bereits renovierten Konzertsaal und einige weitere Ausstellungsräume besucht.
Nun ist das ehemalige Theater aufwendig erneuert worden. Die Fotos, welche den Anblick vor der Renovierung zeigen, lassen echte Bewunderung und Überraschung über das Können unserer Baumeister aufkommen. Gleichzeitig wird auch die Hoffnung bestärkt, daß langsam dieses Kleinod architektonischer Kunst zu neuem Leben erwachen wird.
Ein anschließender Spaziergang zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Schlosses zeigt das Ausmaß der Bergbautätigkeit, welche beinahe das Ende dieses Schlosses bedeutet hätte.
Fortsetzung folgt
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergFÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ HEIMATBOTE Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, eMail post@nadirahurnaus.de
Ronsperg
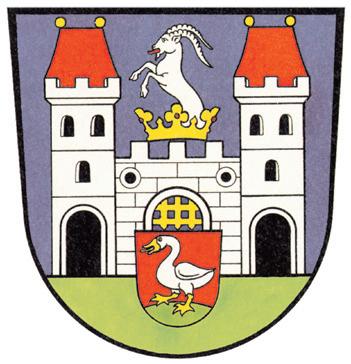

Die Volksschulen
Heinrich Cenefels und Franz Bauer dokumentieren die Geschichte der Volksschulen in Ronsperg.
Die Volksschule für Knaben
Um das Jahr 1680 werden in der Pfarrchronik in Ronsperg zum erstenmal eine Schule und ein Lehrer erwähnt. Baronin von Wunschwitz verkaufte der Stadt das „alte Schulhäusl“ um 80 Gulden und weist dem Schulmeister die unteren Räume des neu erbauten Pfarrhofs an, damit der Geistliche, wenn er aus Metzling käme, eine Bedienung habe.
Unter Maria Theresia (1717–1780), der großen Kaiserin, fand die Volksbildung eine besondere Förderung. So wurde eine allgemeine Schulordnung erlassen. In jedem Ort mit einer Pfarr- oder einer Filialkirche sollte eine sogenannte Trivialschule errichtet werden.
Baron Linker handelte also ganz im Sinne der Kaiserin, als er in Ronsperg neben dem Pfarrhof ein neues Schulhaus erbauen ließ. Die Kosten beliefen sich auf 1648 Gulden.
Ein Chronogramm gab als Baujahr 1778 an: „sCoLa ciVaM patronVs DIsCentIbVs ereXIt“.
„Die Schule, die der Patron für die Lernenden errichtet hat.“ Im Innern des Gebäudes stand über der Tür: „annVM eXstrVCtae sCoLae VIDebItIs.“
„Ihr werdet das Jahr sehen, in dem die Schule erbaut worden ist.“ Wieder kommen wir auf das Jahr 1778.
1837 waren zwei Lehrer angestellt. 1830 kam Hoslau zum Ronsperger Schulsprengel. Kleinsemlowitz und Wilkenau gehörten schon länger dazu. Da in der Folgezeit die beiden Klassen überfüllt waren, mußte eine dritte Klasse aufgemacht werden, die im alten Rathaus ihren Unterrichtsraum hatte.

Nach 1869 kam eine weitere Klasse dazu. Sie wurde jenseits der „Fawa-Bruck“ im Hause von Franz Reitmeier unterrichtet. Ob die Schwarze Schule, wie im Volksmund das Gasthaus Zum weißen Lamm beim VölklNaze hieß, nicht auch von einem alten Klassenraum ihren Namen hat? Gegen Ende des Jahrhunderts wurde dann ein Schulneubau spruchreif.
Unterhalb vom Bezirksgericht mußten zwei Bürgerhäuser weichen, und an ihrer Stelle wurde mit einem Kostenaufwand von 27 000 Gulden nach den Plänen von Ingenieur Peck aus Taus die neue Volksschule errichtet. Sie konnte am 28. Januar 1894 bezogen werden. Aus dieser Zeit sind noch folgende Lehrer in Erinnerung: Krispin, Walters, Pauli sen. und Fröhlich. Auch Karl Reimer war um die Jahrhundertwende als junger Lehrer hier tätig.
Die Volksschule wurde von Knaben besucht. 1913 betrug die Schülerzahl 231. In dieser Zeit gehörten zum Lehrkörper der Schule Oberlehrer Franz Leberl

als Leiter und die Lehrer Wilhelm Kurt, Karl Pauli und Thomas Preywisch. Die Knabenvolksschule wurde vierklassig weitergeführt bis 1940. Nur einmal um 1930 war sie eine Zeitlang dreiklassig, da mit allen Mitteln für die tschechische Schule auch deutsche Kinder abgeworben wurden.
Seit 1923 lag die Leitung in Händen von Oberlehrer Wilhelm Kurt. Ihm folgten in diesem Amt Karl Brunner, Georg Womes und Josef Holl. Als Lehrer
Graf Coudenhove. Am 7. Januar 1876 erhielt die Anstalt das Öffentlichkeitsrecht. 1879 wurde sie dreiklassig. 1891 besuchten 234 Mädchen diese Schule. 1894 erhielt sie bei einer Schülerinnenzahl von 248 eine vierte Klasse dazu. 1903 wurde unter Oberin Maria Alfreda und der Leiterin der Schule, Maria Leontia, das neue Klostergebäude, das Karl-Borromäus-Heim erbaut.
Neben dem eigentlichen Kloster beherbergte das Haus die
für Knaben und die für Mädchen, zu einer siebenklassigen gemischten Schule vereinigt. Wegen der großen Anzahl von evakuierten Kindern kam bald eine achte Klasse hinzu. Oberlehrer Heinrich Cenefels, der aus Althütten hierher versetzt worden war, erhielt die Schulleiterstelle, die nun zu einer Rektorenstelle erhoben wurde.
Groß war der Lehrermangel, da die jungen Lehrer im Felde standen. Um die Lücken zu füllen, taten die Pensionisten Karl Brunner und Franz Osterer und Frau Steiner wieder Dienst. Ferner unterrichteten an der Volksschule Anna Landkammer, Marie Liebisch, Andreas Rieß, Anna Weidner, Martha Hubatschek, Luise Kaiser, Martha Schwarzbach, Gertrud Leberl, Hilde Riederer, Erna Oschowitzer, Hedwig Schlick, Gertrud Jaklin und später auch noch für kurze Zeit Lehrer aus Schlesien, die als Flüchtlinge nach Ronsperg gekommen waren. Handarbeitslehrerin war Frieda Tragl.
Jakob Lenz und Augustin Zettl
waren außerdem zwischen den beiden Kriegen an der Schule tätig Karl Hannakam, Wenzel Losleben, Brunhilde Winkelmann, Karl Wukassinovich, Ernst Bauer, Karl Portner, Karl Maa, Othmar Behr, Franz Haas, Franz Prokosch, Rudolf Sankowitsch, Hans Zenefels und Maria Zierhut, verheiratete Holl.
Die Volksschule für Mädchen
Im Jahr 1866 rief Franz Reichsgraf von Coudenhove Schwestern aus dem Orden des heiligen Borromäus vom Mutterhaus in Prag nach Stockau. Bald übernahmen sie in Ronsperg auch den Unterricht für die Mädchen, und zwar in dem Gebäude der ehemaligen Spiritusbrennerei. 1873 bestanden dort bereits zwei Klassen einer Volks- und Industrialschule für Mädchen. Die Unterhaltungskosten dieser Schule trug
Mädchenvolksschule und eine private Bürgerschule mit Pensionat. Als Lehrerinnen der vierklassigen öffentlichen Privat-Mädchen-Volksschule sind 1913 genannt Schulleiterin Schwester Leontia Lengert, ferner als Lehrerinnnen Schwester Pulcheria Streek, Schwester Edelreda Debac und Schwester Reineldis Satinsky. Als Aushilfslehrerinnen waren tätig Anna Wiesner und Hermine Bauer.
Die Vereinigung der Volksschulen
Am 1. September 1940 wurden beide Schulen, die Volksschule


Da die Schule zunächst nicht für die vielen Klassen gebaut war, mußten zwei Klassen im Klostergebäude bleiben. Als das Kloster zum Kreisaltersheim umgewandelt wurde, wurde die Raumnot unerträglich. Deshalb wurde mitten im Krieg ein Umbau vorgenommen. Da Rektor Cenefels die Dienstwohnung nicht in Anspruch nahm und auch auf das große Konferenzzimmer verzichtet wurde, konnten durch den Umbau sieben Klassen in dem Haus Platz finden. Da man auch die Räume mit besserem direkten Licht ausstattete, wurden wirklich freundliche Unterrichtsräume gewonnen. Als man wegen der vielen Flüchtlingskinder aus Ungarn und Schlesien noch eine neunte Klasse errichten mußte, kam man aber trotzdem nicht ganz ohne Schichtunterricht aus.
Gegen Ende des Krieges aber litt der Unterricht nicht nur unter dem Lehrermangel, auch zeitweilige Einquartierung von Flüchtlingstransporten und Militär störten den Schulbetrieb. Da die Schule über keine ausreichenden Luftschutzräume verfügte und die Luftalarme sich mehrten, wurde im April 1945 die Schule geschlossen. Und sie öffnete für die deutschen Kinder, solange sie noch in Ronsperg waren, ihre Tore nicht mehr. Für die Deutschen gab es keinen Unterricht mehr.
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der letzte Teil seiner Arbeit über Pfarrer Jakob Lenz (1801–1863) und der erste Teil seiner Arbeit über Pfarrer Augustin Zettl (1805–1878).
Darüber hinaus wird die Kirche mit einem neuen Velum (Schultertuch zum Erteilen des sakramentalen Segens) beschenkt, und die Antependien (reich verzierter und bestickter Vorhang aus Stoff vor oder an den Seiten des Altarunterbaus) an den beiden Seitenaltären können ebenso dank einer Spende erneuert werden. Der Höhepunkt im kirchlichen Leben im Jahr 1857 ist der Besuch des Bischofs von Budweis, Johann Valerián Jirsík (1798–1883). Am 5. Juli spendet der Oberhirte in Hostau das Sakrament der Firmung und hält auch noch die kanonische Generalvisitation ab.

In den Jahren 1857 bis 1861 wird am Pfarrhaus einiges instand gesetzt und umgebaut. 1858 werden die Mauern des Wohngebäudes und der Stallungen ausgebessert und neu gestrichen. 1859 werden im Wohngebäude alle Fenster und die meisten Fußböden durch neue ersetzt. Ebenso werden kleinere bauliche Veränderungen im Wohnhaus vorgenommen, die helfen das Alltagsgeschehen zu rationalisieren. 1860 und 1861 werden die Schindeldächer zum einen ausgebessert und zum anderen neu eingedeckt.
Bei der letzten Eintragung des Dechanten Lenz handelt es sich um eine Abschrift einer Anfrage des bischöflichen Konsistoriums vom 14. März 1860 in Budweis hinsichtlich einer Statistik das Hostauer Benefizium betreffend. Das Konsistorium geht dabei auch der Frage nach, ob die Angaben, die der Topograph Johann Gottfried Sommer in seinem Sammelwerk „Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt“ aus den Jahren 1833 bis 1849 gemacht hat, zutreffend sind. Es liegt auch die Vermutung nahe, daß es sich hier um eine generelle Erhebung von statistischen beziehungsweise historischen Daten für das ganze Bistum handelt, die für das 1862 erscheinende Buch von Johann Trajer „Historisch-statistische Beschreibung der Diöce-
se Budweis“ Verwendung finden werden, eventuell auch als kirchliche Antwort oder Gegendarstellung zu Sommers Werk. Auch die Antwort des Dechanten Lenz auf die Anfrage aus Budweis ist im Memorabilienbuch festgehalten. Lenz bestätigt jedoch dabei, daß alle Angaben des Topographen Sommer korrekt sind.
Pfarrer Augustin Zettl
Augustin Zettl wird am 25. August 1805 in Riegerschlag/Lodhéřov geboren und am 23. Januar 1831 zum Priester geweiht. Wie bereits erwähnt, arbeitet er von 1831 bis 1843 als Kaplan in der Hostauer Seelsorge. Nach seiner Kaplanstätigkeit wird er Pfarrer in Sirb/Srby. Am 14. Dezember 1863 tritt er in Hostau das Amt des Dechanten an. Mit dem 1. Mai 1874 tritt er in den Ruhestand, lebt aber als Pensionist weiter in Hostau bis zu seinem Tod am 7. November 1878.
Zettl erhält als Pension aus den Einkünften des Hostauer Benefiziums jährlich 196 Gulden und sieben Kreuzer und das übliche Ruhegehalt aus dem Religionsfonds der k. k. Statthalterei. Unter Zettl wirken in Hostau die Kapläne Adam Ptáčník (1865–1868) und ab 1868 Karl Trnka. In den Jahren 1866 bis 1869 lebt zudem in Hostau der emeritierte Pfarrer von Schüttarschen, Personaldechant Kaspar Wawehrta (geboren am 5. Januar 1791 in Darmschlag, ordiniert am 12. August 1814), der aber weiterhin das Amt des Sekretärs des Vikariats Hostau bis zu seinem Tod am 23. April 1869 ausübt.
Dechant Zettls Aufzeichnungen umfassen den Zeitraum von 1863 bis 1874. Zu Beginn beklagt er sofort, daß es um die Wasserversorgung der gesamten Dechantei schlecht bestellt sei. Der Brunnen sei ganz ausgetrocknet und die vorhandene Pumpe vollkommen defekt. Die bestehende Wasserleitung aus dem herrschaftlichen Meierhof, über die ein Röhrkasten die Dechantei mit Wasser versorgt habe, funktioniere auch nicht. Benötigtes Wasser müsse in Fässern zur Dechantei gebracht werden, was mit viel Zeitaufwand und Beschwernissen verbunden sei. Da mit der Legung einer Wasserleitung zur Dechantei aufgrund der andauernden Baumaßnahmen im herrschaftlichen Schloß nicht zu rechnen ist, läßt Zettl den Dechanteibrunnen vertiefen. Fortsetzung folgt

Heimatbote

Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl,

Ende Oktober fand im Kleinen Sitzungssaal des historischen Rathauses von Amberg der Fest akt zur Erinnerung an „700 Jah re Verpfändung von Stadt und Land Eger“ statt. Eingeladen hatte der Egerer Landtag unter seinem Vorsitzenden Wolf-Die ter Hamperl. Hamperl, gleich zeitig Betreuer des Heimatkrei ses Tachau, berichtet.
Auf den Tag genau vor 700 Jahren, am 23. Oktober 1322, hatte der Böhmenkönig Jo hann von Luxemburg der frei en Reichsstadt Eger in Prag je ne staatsrechtliche Verfassungs urkunde unterzeichnet, die die Charta der politischen Sonder

stellung Egers in Böhmen für Jahrhunderte garantierte. Im Egerer Schrifttum wird sie der „Egerländer Freiheitsbrief“ ge nannt.
Unter den Gästen konnte ich den Oberbürgermeister der oberpfälzischen Stadt Amberg, Michael Cerny, begrüßen, au ßerdem Josef Singer, Leiter der Stabsstelle Zentrale Dienste im Amberger Rathaus, Maria Rita Sagstetter, Direktorin des Staats archivs Amberg, den Stadtarchi var Andreas Erb, die Leiterin des Stadtmuseums Judith Riß, Dieter Dörner, Vorsitzender der Zweig stelle Amberg des Historischen Vereins, Sebastian Schott vom Stadtarchiv Weiden und den Tirschen reuther Heimatfor scher Adal bert Busl.




Der Einla dung wa ren darüber hinaus Si grid UllwerPaul, Stell vertretende Obfrau der SL-Bezirks gruppe Nie derbayernOberpfalz,
und das regionale Fernsehen OTV gefolgt. Der Vorstand des Egerer Landtags war fast voll ständig mit Begleitpersonen ge kommen wie der Stellvertretende Vorsitzende Helmut Reich, Ge org Gottfried, Ute Mignon, Hel ga Burkhardt, Professor Alfred Neudörfer und Wil helm Rubick.
In seinem Gruß wort ging Oberbür germeister Cerny auf die Übernahme der Patenschaft der Stadt Amberg über die Vertriebenen aus Stadt und Land Eger im Jahr 1954 ein. Er wies auf den schö nen Wandteppich im Sitzungsaal hin, der die Jahreszahl 1954 und fol gende Worte trägt „Dem Volk, dem Recht und der Heimat treu“. Auch sein Vater stammte aus Fal kenau im Egerland. Und er dank te mir für die Veranstaltung.
Besonders herzlich hieß er den Festredner Karel Halla aus Eger willkommen. Halla ist Di rektor des Staatlichen Kreis archivs Eger und Direktor des Staatlichen Gebietsarchivs Pil sen. Außerdem ist er Vorsitzen der des Verbandes tschechischer Archivare und Initiator des bay

erisch-tschechischen Digitali sierungsprogramms „Porta fon tium“. Karel Halla sprach über „Die entfremdete Vergangenheit der böhmisch-deutschen Reichs stadt Eger“.
In perfektem Deutsch erklär te er den Zuhörern die beson dere Bedeutung der Stadt Eger, die erst mals 1061 erwähnt worden sei. Er ging auf das historische Egerland ein, die Re gio egire, und auf die Stauferzeit, die Eger 1267 zu einer freien Reichsstadt und die Burg zu einer Reichs pfalz gemacht habe. Für uns sehr interes sant zu erfahren war, daß bereits Ottokar II. (1233–1278) Eger im Sinne des Reiches erobert und man schon unter Jo hann (1296–1346) an eine ter ritoriale Verbindung zwischen Böhmen und Luxemburg ge dacht habe.
Nach der Schlacht bei Mühl dorf am 22. September 1322 kam es im Kampf um die deutsche Kö nigswürde zwischen Ludwig dem Bayern und Friedrich dem Schö nen zur Entscheidung. Ludwig siegte mit großer militärischer Unterstützung von Johann. Da

für erhielt er mit der in Regens burg am 4. Ok tober 1322 aus gestellten Ur kunde 10 000 Silbermünzen und Stadt und Land Eger zum Pfand.
Der Referent wußte dieses hi storische Ereig nis so kennt nisreich in die überregiona len Zusammen hänge und in die Entwicklung der Stadt Eger und seiner Umge bung einzubau en, daß man sei ne Liebe zu die ser Stadt fast greifen konn te. In seinen ab schließenden Worten bedauerte er den Ver lust der Bedeutung und Stel lung Egers durch die bruta le Vertreibung der Egerer 1945/46.
Seinen Vortrag hatte eine reichhaltige Bilderschau von den historischen Gebäuden der Stadt, aber auch über die wirtschaftli
che Entwicklung um 1900 beglei tet. Mit lange anhaltendem Ap plaus bedankten sich die hellwa chen Zuhörer. Ich dankte Karel Halla für seinen kenntnisreichen Vortrag sehr herzlich. Die Stadt Amberg lud anschließend zu ei nem Stehempfang mit „Amber ger Wein“, wo im Gespräch noch vieles geklärt werden konnte.
