Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung
❯

VOLKSBOTE



❯


„Damit wir als Volksgruppe lebendig bleiben“, begründet Heimatratsvorsitzender Franz Longin, warum der Heimatrat große Anstrengungen unternimmnt, um Nachkommen der Erlebnisgeneration für das ehrenamtliche Engagement zu begeistern. Mit Erfolg, wie die aktuellen Ernennungen auf der Sitzung des Heimatrates auf dem Heiligenhof belegen.

Ein klarer Wahlsieger und vier Parteien, die um den Einzug ins Abgeordnetenhaus zittern müßten, so lautet das Ergebnis der aktuellen Median-Umfrage.
Würden die tschechischen Bürger jetzt ihre Vertreter für das Abgeordnetenhaus wählen, wäre die Ano-Partei von ExPremierminister Andrej Babiš der große Gewinner. Mit 31,5 Prozent führt Ano deutlich vor allen anderen Parteien.

Die Partei ODS von Premierminister Petr Fiala käme demnach nur auf 13,5 Prozent. Während die rechtsradikale SPD mit 12 und die Piraten mit 11 Prozent sicher ins Unterhaus einziehen würden, müßten alle anderen Parteien zittern. Laut der Demoskopen kommen KDU-ČSL und Top 09 auf 6 beziehungsweise 5 Prozent. Damit entfallen auf das Bündnis Spolu aus ODS, KDUČSL und Top 09 nur 24,5 Prozent. Bei der Wahl im Oktober 2021 war das Dreierbündnis noch mit 27,8 Prozent als Wahlsieger hervorgegangen.
Auf die Bürgermeisterpartei Stan, die gemeinsam mit Spolu und den Piraten die Regierung stellt, kommen 5,5 Prozent.
Hoffnung auf einen Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus kann sich die ČSSD machen. Mit 5,5 Prozent liegen die Sozialdemokraten einen halben Prozentpunkt über der 5-Prozent-Marke. Zwar finden die nächsten Parlamentswahlen erst 2025 statt, aber im Januar entscheiden die Tschechen, wer Miloš Zeman als Staatspräsident nachfolgt. Unter den aussichtsreichen Bewerbern ist auch Ano-Chef Andrej Babiš.
Der Krieg war längst zu Ende, aber das Morden ging weiter: Im Sommer 1945 verübten Revolutionsgardisten, Soldaten und Polizisten mit Billigung der tschechoslowakischen Führung in Postelberg das schlimmste Massaker der Nachkriegsgeschichte an sudetendeutschen Landsleuten Jetzt hat das Tschechische Fernsehen eine Spielfilm-Dokumentation gesendet, die viele Tschechen aufgewühlt hat.

Wehrlose Männer, aber selbst Kinder wurden erschossen oder erschlagen. Auf bis zu 2000 Tote schätzen Experten die Opferzahlen. Jahrzehntelang wurde dieses Verbrechen in der Tschechoslowakei tot geschwiegen. Die kommunistische Regierung deckte die Mörder, die sich deshalb nie für ihre Verbrechen vor einem Gericht verantworten mußten.


Auch nach der Samtenen Revolution blieb der Genozid in Postelberg ein Tabuthema. Erst 2010, also 65 Jahre nach dem Massaker, wurde eine Gedenktafel enthüllt. Doch deren Inschrift empfinden viele Familien der Opfer als Verharmlosung des Massenmords. So wird statt von einem Genozid von „Ereignissen“ gesprochen. Und die Tatsache, daß Sudetendeutsche einzig und allein wegen ihrer deutschen Wurzeln ermordet wurden, wird mit „unschuldige Opfer“ umschrieben. Jeder Hinweis fehlt, daß es sich hier um einen Massenmord handelt, den Tschechen nach dem Krieg an ihren sudetendeutschen Nachbarn verübt haben.



Unter dem Titel „Postelberg 1945 – die tschechische Vergeltung“ hat jetzt das Tschechische Fernsehen eine SpielfilmDokumentation gesendet, die in Tschechien eine große Diskussion über die eigene Schuld an Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgelöst hat.
Was Regisseur Jakub Wehrenberg und Drehbuchautor Jan

Vávra den Zuschauern zeigen, geht unter die Haut, ist aber mit Fakten belegt – wie die „Ereignisse“ am Sonntag, 6. Juni 1945, knapp einen Monat nach dem Kriegsende:

Auf dem Kasernenhof in Postelberg harrten seit Tagen hunderte sudetendeutsche Männer im Alter von 13 bis 60 Jahren aus.
Die Nacht mußten die Männer und Jungen im Freien auf dem gepflasterten Hof liegend verbringen. Wer sich erhob, wurde sofort erschossen. Unter den Gefangenen waren fünf erschöpfte Jugendliche, die angeblich Äpfel von einem Baum gestohlen haben sollen. Sie wurden erst ausgepeitscht und dann vor ein Erschießungskommando gestellt. Ein Junge, der die erste Salve überlebt hatte, fiel auf die Knie und flehte um Gnade – vergeblich. Er wurde durch einen Schuß ins Genick getötet. Das alles geschah vor den Augen der ande-
ren gefangenen Sudetendeutschen, die mit vorgehaltener Waffe in Schach gehalten wurden. Darunter war auch der Vater eines der Jungen.

„Es ist wichtig zu sagen, daß die führenden Vertreter des Staates und der Armee damals über das Massaker Bescheid wußten und daß dieser Massenmord mit ihrer Zustimmung geschah“, begründet Drehbuchautor Jan Vávra, warum er sich dieses schwierigen Thema angenommen hat.
Daß das Massaker langfristig

leich vier Landsleuten konnten Franz Longin und SLBundesgeschäftsführer Andreas Miksch die Ernennungsurkunden aushändigen.
Im Erzgebirge-Saazerland tritt Birgit Unfug als Heimatlandschaftsbetreuerin die Nachfolge von Helmut Seemann an, der zum Ehrenlandschaftsbetreuer ernannt wurde, und übernimmt in Doppelfunktion als Kreisbetreuerin den Heimatkreis Saaz. Günther Wytopil ist neuer Kreisbetreuer des Heimatkreises Oberes Adlergebirge. Im Elbetal übernimmt Yvi Burian den Heimatkreis Leitmeritz. Und in Polzen-Neiße-Niederland ist Christa Schlör als Kreisbetreuerin für den Heimatkreis Reichenberg zuständig. Ausführlicher Bericht auf Seite 3.
geplant und von der kommunistischen Staatsführung angeordnet war, belegt auch ein Zitat des damaligen Staatspräsident Edvard Beneš, dem Architekten der Vertreibung. Beneš forderte bereits 1943 von seinem Exil in Großbritannien per Rundfunkansprache Rache und Vergeltung: „Den Deutschen wird mitleidlos und vervielfacht all das heimgezahlt werden, was sie in unseren Ländern seit 1938 begangen haben. Die ganze Nation wird sich an diesem Kampf beteiligen, es wird keinen Tschechoslowaken geben, der sich dieser Aufgabe entzieht und kein Patriot wird es versäumen, gerechte Rache für die Leiden der Nation nehmen.“
„Sie wurden getötet, nur weil sie Deutsche waren“, stellt Regisseur Jakub Wehrenberg klar. Die Ermordung der Sudetendeutschen sei immer noch ein Tabu, so der Filmemacher: „Die Tschechen haben gerne Spaß und ver-
meiden unangenehme Dinge. Das ist der Grund, warum wir das Thema wieder in die Öffentlichkeit bringen.“
Die Massaker an den Sudetendeutschen nach Kriegsende sei, so die Filmemacher, immer als Ausbruch des Volkszorns beschrieben, als spontane Vergeltung für das Verhalten der Deutschen während des Protektorats beschrieben wurden. „Das Massaker in Postelberg war jedoch eine vorbereitete und geplante Aktion des Verteidigungsnachrichtendienstes und der tschechoslowakischen Armee, die mit dem Wissen und der Zustimmung der höchsten Vertreter der Armee und des Staates, einschließlich Präsident Beneš, stattfand.“
Belegt wird dies in einer Szene, in der General Oldrich Španiel, der Leiter des Militärbüros des Präsidenten Beneš, im Prager Hotel Belvedere den Offizieren des Geheimdienstes einen klaren Befehl erteilt: „Räumt das Gebiet auf! Denken Sie daran, daß ein guter Deutscher nur ein toter Deutscher ist. Je weniger Deutsche übrig bleiben, desto weniger Feinde werden wir haben. Und je weniger Menschen die Grenze überschreiten, desto weniger Feinde werden wir haben.“
Zwar wurde 1947 von der verfassungsgebenden Nationalversammlung eine spezielle Untersuchungskommission eingesetzt, um das Massaker von Postelberg und andere Verbrechen an den sudetendeutschen Landsleuten im Zuge der Wilden Vertreibung aufzuklären, doch die parlamentarische Kommission nutze einen Trick, um nicht weiter ermitteln zu müssen. Man berief sich auf das Gesetz Nr. 115/1946, das ein Jahr nach Kriegsende von der Nationalversammlung verabschiedet worden war und mit dem alle Verbrechen an Deutschen rückwirkend amnestiert wurden.
Pavel Novotny/Torsten FrickeDer Leiter des Prager Sudetendeutschen Büros Peter Barton nutzte die Gelegenheit, um dem erst vor drei Monaten neu eingetro enen Botschafter Ungarns in der Tschechischen Republik, András Baranyi, persönlich die Arbeit seiner Einrichtung vorzustellen.
Bis jetzt konnte Barton alle ungarischen Diplomaten jeden Ranges persönlich kennen lernen und freute sich, daß er so interessierte Zuhörer und Gesprächspartner in ihnen fand. Baranyi ist wirklich ein echter Mitteleuropäer: Der in der karpatendeutschen und heute ukrainischen Stadt Munkács, ukrainisch Mukačevo, geborene Diplomat lebte lan-
ge Zeit im ostslowakischen Kaschau (ungarisch Kassa, slowakisch Košice), bevor er in die diplomatischen Dienste des Außenministeriums in Budapest eintrat. Deshalb ist dem studierten Juristen Baranyi die Problematik der nationalen Minderheiten in historischem und rechtlichem Sinne nicht fremd.


In Prag kann er sich bereits sehr schnell orientieren, weil er auch perfekt slowakisch spricht, und das ist eine Sprache, die jeder Tscheche sehr gut versteht. Barton, der neben deutschen und tschechischen Vorfahren selbst eine ungarischstämmige Herkunft hat, schätzt es sehr, daß Budapest einen Diplomaten nach Prag entsandte, der so vorteilhafte Kenntnisse besitzt.
Unter dem Titel „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte Der Heiligenhof in Bad Kissingen ihr mehrtägiges Herbstseminar mit hohem wissenschaftlichen Anspruch veranstaltet, dessen Inhalte die Sudetendeutsche Zeitung in den kommenden Ausgaben dokumentiert. Den Auftakt macht Professor Dr. Katrin Boeckh.
Im Juli dieses Jahres hat der Freistaat Bayern eine neue Forschungsstelle des Leibnitz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) und des Lehrstuhls für Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg ins Leben gerufen, die mit Professor Dr. Katrin Boeckh von einer Expertin für die Geschichte Osteuropas geleitet wird.
Schwerpunkt der Forschungsstelle sind Studien zur kulturellen Integration der aus dem östlichen Europa Vertriebenen in Bayern seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Verfolgt werden insbesondere Ansätze zur Frauen- und Emotionsforschung, zur Schulbuch- und Medienforschung sowie komparative und transnationale Analysezugänge.
In ihrer Vorstellung der neuen Forschungsstelle für „Kultur und Erinnerung, Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“ stellte Professorin Boeckh heraus, daß die Genese der Forschungsstelle eng mit der Initiative der Bayerischen Vertriebenenbeauftragten und Landtagsabgeordneten Silvia Stierstorfer zusammenhänge. Die Beauftragte habe die Notwendigkeit mit den Worten begründet: „Nach dem Zweiten Weltkrieg haben fast zwei Millionen Heimatvertriebene in Bayern eine neue Heimat gefunden. Die Vertreibung und danach die Eingliederung der Heimatvertriebenen hatten eine gewaltige Umwälzung im Herzen Europas zur Folge. Trotzdem erinnert sich die Gesellschaft an diesen Umbruch und wie er uns alle geprägt hat, heute kaum noch.“
Das Forschungsprojekt sei auch deshalb als Initialzündung gedacht gewesen, so die Professorin in ihrem umfassenden Bericht. Es soll neue Erkenntnisse darüber erbringen, wie die Vertriebenen als Brücke und Kulturvermittler im Zentrum Europas gewirkt und welchen Einfluß sie auf die kulturelle Identität Bayerns ausgeübt haben. Weiter gehe es auch darum, wie die Heimatvertriebenen die Sichtweise der hiesigen Bevölkerung auf die Nachbarländer im Osten geprägt haben und wie das wieder-
Katrin Boeckh hat Geschichte Ost- und Südosteuropas sowie Slavistik und Balkanphilologie an der Universität Regensburg und an der LudwigMaximilians-Universität München studiert, wo sie 1991 als M.A. abschloß.
An der LMU München promovierte sie 1995 zum Dr.
um deren Verhältnis zu Bayern und Deutschland geprägt habe.
Die übergreifende Thematik sei die kulturelle Integration der Heimatvertriebenen in Bayern, die oft als Erfolgsgeschichte dargestellt werde. Die Frage sei aber, ob die Betroffenen das selbst auch so sehen beziehungsweise gesehen haben und ob sie selbst so zufrieden waren mit ihrer neuen Heimat, die sie sich gar nichts selbst ausgesucht hätten. Sie seien hineingeworfen worden in eine Kriegs- und Nachkriegssituation, mit der Erfahrung der Vertreibung im Rücken, die für viele traumatisch war und den Tod von Angehörigen bedeutet habe, den Verlust von Eigentum, von Bekannten. Außerdem hätten viele lange Jahre die Hoffnung in sich getragen, daß man bald wieder zurückkehren könne. So seien und waren viele Emotionen und auch Traumata im Spiel, über die man nicht sprach und sprechen konnte, und die vielleicht über Jahre und Jahrzehnte verschüttet waren.
Viele Vertriebene kritisierten, sie seien in der Aufarbeitung des Vertreibungsschicksals „emotional nicht abgeholt und mitgenommen“ worden. Das sei der erste Ansatz, an dem sie andocken wolle, sagte Boeckh.
phil.; 2004 habilitierte sie sich ebendort im Fach Geschichte Ost- und Südosteuropas, für das sie die Venia Legendi hat. Am Osteuropa-Institut war sie bis 2008 Redakteurin der Zeitschrift „Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas“, seither ist sie wis-
Im Fokus stünde die wissenschaftliche Untersuchung lang und nachhaltig wirkender Aspekte von Flucht und Integration Vertriebener seit dem Zweiten Weltkrieg aus einer regionalen und übergreifenden sowie europäischen Perspektive. Dabei sollen eine Forschungsbasis einerseits und eine Breitenwirkung andererseits entstehen.
Weitere Aktivitäten hingen mit einem breiteren Bild auf Vertreibungen in Europa zusammen. Vertreibungen seien ein europäisches Thema, und in Ost- und Südosteuropa gebe es kaum ein Land, das im Lauf der Geschichte davon verschont geblieben sei, führte Boeckh aus.
Aktualität sei durch den russischen Krieg gegen die Ukraine gegeben und durch die Flucht vieler Ukrainerinnen. Gerade Vertriebenenverbände seien durch das Schicksal der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, aufgerüttelt.
Es gebe ein großes Bedürfnis seitens der Heimatvertriebenen, angestoßen durch den Krieg gegen die Ukraine, Fluchtbewegungen öffentlich stärker zu thematisieren. So gebe es einen inneren Zusammenhang zwischen der Community der Vertriebenen und der ukrainischen Flucht-
senschaftliche Angestellte am Arbeitsbereich Geschichte.
Ihre Forschungsgebiete sind Staat, Kirchen und ethno-konfessionelle Netzwerke im Sozialismus, Wertediskurse und imperiales Erbe im östlichen Europa sowie ethnonationale Konflikte und ihre Folgen.
Foto:Tschechien zieht in Erwägung, sich als Gastland der UN-Klimakonferenz COP 29 im Jahr 2024 zu bewerben, hat der Regierungsbeauftragte für internationale Verhandlungen in Umweltfragen, Jan Dusík, erklärt. Derzeit würde man die finanziellen und logistischen Herausforderungen prüfen. Als Alternative könne sich Tschechien auch mit einem weiteren osteuropäischen Land als Gastgeber bewerben.
Übernachtungen in tschechischen Hochschulen und Universitäten wollen Studenten gegen die aktuelle Klima-Politik demonstrieren. An der von der Bewegung Univerzity za klima (Universitäten für das Klima) organisierten Protestaktion beteiligten sich zum Auftakt Studenten in Prag und Brünn, die von Montag auf Dienstag in den Bildungseinrichtungen campierten. Weitere Proteste sind auch in Olmütz, Aussig und Königgrätz angekündigt. Den Organisatoren zufolge sollen die Veranstaltungen nicht den Lehrbetrieb behindern. Stattdessen soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß die tschechische Regierung zu wenig gegen die Klimakrise und die steigenden Energiekosten unternehme und eine wachsende Ungleichheit in der Bevölkerung hinnehme.
Fast 65 Prozent der Tschechen, also zwei von drei Bürgern, befürchtet, haben Geldsorgen und befürchten fällige Kredite nicht zurückzahlen zu können, hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Stem/Mark ergeben. Akute Probleme mit den Ratenzahlungen haben bereits sechs Prozent der Befragten. Als Gegenmaßnahme würden viele Bürger einen weiteren Job annehmen, um die Kredite zu bedienen. 40 Prozent der Befragten geben an, ihre Kosten senken zu wollen, und etwa 36 Prozent erwägen eine Verringerung oder gar Aussetzung der Raten.
um 1. Januar 2023 wird
Tschechien seine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul schließen, hat Außenminister Jan Lipavský (Piraten) entschieden. Zur Begründung sagte der Minister, daß nach seiner Einschätzung keine Verbesserung der Sicherheitslage in Afghanistan zu erwarten sei. Nach der Schließung soll die Tschechische Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad die Vertretung auch für Afghanistan übernehmen.
Hildegard Schuster
bewegung, der von sehr viel Solidarität getragen und wo auch immer wieder der europäische Gedanke herausgehoben werde. Die neuen Fluchterfahrungen sollen thematisiert werden. Man habe begonnen, Interviews mit Frauen und Männern aus der Ukraine aufzuzeichnen, um sie anschließend auszuwerten und in Bezug zu den Vertriebenenschicksalen in Bayern zu setzen.
Insbesondere sollen nachhaltige Wirkungen von Flucht und Integration Vertriebener betrachtet werden, aber nicht nur aus der bayerischen Perspektive, sondern auch aus einer transbayerischen, europäischen Perspektive. Professorin Boeckh will dazu Wissenschaftlerinnen aus den Herkunftsländern im östlichen Europa einbinden und im Rahmen einer internationalen Konferenz ausloten, wie der allgemeine Wissensstand über die Vertreibungsproblematik unter anderem in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, Polen, Ungarn und weiteren Staaten sei.
Die Vernetzung mit bestehenden Vertriebenenorganisationen und Einrichtungen wäre wünschenswert, so Professorin Boeckh abschließend.
 Hildegard Schuster
Hildegard Schuster
Schlechte Noten vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE): Im aktuellen Gleichstellungsindex landet die Tschechische Republik nur auf Platz 23 unter den 27 EU-Staaten. Vor allem im Berufsleben werden Tschechiens Frauen benachteiligt, bestätigt die Regierungsbevollmächtigte für Menschenrechte, Klára Šimáčková Laurenčíková, die Untersuchungsergebnisse des EU-Instituts. Demnach gäbe es in den tschechischen Unternehmen noch immer zu wenige Frauen in Führungspositionen. Außerdem verdienen Frauen im Durchschnitt etwa 7000 Kronen (288 Euro) pro Monat weniger als ihre männlichen Kollegen. Um mehr Gendergerechtigkeit auf dem tschechischen Arbeitsmarkt durchzusetzen, fordert
Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), hat die EU-Beitrittsverhandlungen mit Staaten wie der Ukraine und der Republik Moldau verteidigt. Sie warnte am Montag vor einem geopolitischen Vakuum vor den Toren der Europäischen Union, das nach ihren Worten „von Feinden gefüllt wird“. Sie sei sich bewußt, daß einige EU-Staaten der Aufnahme neuer Mitglieder kritisch gegenüberstünden, so Pekarová Adamová weiter. Dennoch sei die EU-Vergrößerung alternativlos. Die Parlamentschefin erklärte, hierfür sei eine Reform der Abstimmungsregeln, die Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagen hatte, nicht notwendig. Aktuell genügt das Veto eines einzigen Mitgliedsstaates, um die Aufnahme neuer Länder in die EU zu verhindern.
ISSN 0491-4546 Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Ein dichtes Programm hat sich der Heimatrat in seiner zweitä gigen Sitzung gegeben. Aktuel le Themen, die den Verantwort lichen in den Heimatlandschaf ten und -kreisen auf den Nägeln brennen, beherrschten die Dis kussion auf dem Heiligenhof.
Heimatratsvorsitzender Franz Longin machte deutlich, daß sich der Heimatrat bemühe, daß die Nachkommen weiter Ämter übernehmen. „Damit wir leben dig bleiben“, so Longin. Zu Be ginn der Veranstaltung wurde der Verstorbenen gedacht und an alle, die in der Heimat ihre Hei mat hatten, erinnert. „Wir erin nern uns an die grausamen Ver treibungen in den Jahren 1945 und 1946. Wir erinnern uns an die schwierigen Jahre der zu nächst nicht gewollten Integrati on. Es waren harte Jahre“, so der Vorsitzende, bevor er sich den Zukunftsaufgaben zuwandte. „Wir brauchen nach wie vor ein sudetendeutsches Klima, um un sere Aufgaben erfüllen zu kön nen“, führte er weiter aus.
Der Heimatrat wolle als zwei te Stütze der Landsmannschaft kräftig bleiben und sichtbarund wahrnehmbar sein. Dies sei durch Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung gelungen und solle weiter ausgebaut wer den. Die Orts- und Kreisgruppen können durch ansprechendes Werbematerial unterstützt wer den. Der Einsatz um den Erhalt der Heimatstuben sei nach wie vor erforderlich und werde un ter Hinzuziehung von Experten auch in Zukunft unterstützt. Die bewährten Online-Veranstaltun gen haben den Meinungs- und Erfahrungsaustausch das gan ze Jahr über befördert und sol len beibehalten werden. Berichte in der Sudetendeutschen Zeitung tragen dazu bei, daß der Aus tausch gelingt, so Longin in sei nen Dankesworten. Die Zeitung habe an Qualität zugelegt, jeder Amtsträger müsse zu den Abon nenten gehören.
„Wir sind keine Partei, aber ein politischer Verein“ mit einer klaren Aufgabenstellung, so Lon gin mit Blick auf die SL-Satzung. Laut Paragraph 3 habe die SL den Auftrag, „die über drei Millionen Sudetendeutschen, welche nach dem Zweiten Weltkrieg aus ih rer Heimat in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien vertrie ben und über die ganze Welt ver streut wurden, und ihre Nach kommen als politische, kulturel le und soziale Gemeinschaft zu erhalten und ihre Belange in der Heimat sowie in den Aufnahme gebieten zu wahren“. Die Sat zung müsse mit Leben erfüllt werden, so sein abschließender Appell.
Einen Blick hinter die Kulis sen der politischen Geschehnisse gewährte Peter Barton und ana lysierte Hintergründe und Zu sammenhänge. Kenntnisreich beleuchtete der langjährige Lei ter des Sudetendeutschen Bü ros in Prag die Auswirkungen der Kommunalwahlen in der Tsche chischen Republik und stand den Tagungsteilnehmern Rede und Antwort. Chancen und Möglich keiten für die künftige grenz überschreitende Zusammenar beit standen dabei im Mittel punkt.

Auch über die problembehaf teten Jahre zu Beginn seiner Tä tigkeit vor fast 20 Jahren erzählte er. Es sei nicht einfach gewesen, Fuß zu fassen. „Ich mußte in Prag viel Überzeugungsarbeiten lei sten bis man mir glaubte, daß wir nicht die unversöhnlichen Sude tendeutschen sind“, so Barton, der unter anderem auch die gute Zusammenarbeit mit den diplo
matischen Vertretungen betonte.
Die Zukunft der Sudetendeut schen Heimatstuben beleuchte ten mit Museumsdirektor Dr. Ste fan Planker und Jeanine Walcher zuständigkeitshalber gleich zwei Experten für museale Sammlun gen. Walcher, neu im Museumsteam, studierte Restaurierung, Kunsttechnologie und Konser vierungswissenschaft an der Technischen Universität Mün chen. Seit Juni 2022 ist sie im Team von Klaus Mohr für die Be treuung der vielseitigen Samm lung des Sudetendeutschen Mu seums in München zuständig.

Eingangs ging Museumsdi rektor Planker kurz auf die Ent stehungsgeschichte des Sude tendeutschen Museums ein und führte unter anderem aus: Die Grundlage des Museums bil den die musealen Sammlungen der Sudetendeutschen Stiftung sowie des ehemaligen Sudeten deutschen Archivs, heute Sude tendeutsches Institut. Mit Unter stützung der Sudetendeutschen Stiftung sei ab 1998 gezielt ge sammelt und wissenschaftlich in ventarisiert worden. Der Samm lungsbestand umfasse heute rund 40 000 Objekte, unter an derem aus den Bereichen All
tagskultur, Handwerk und In dustrie, Zeitgeschichte sowie Kunsthandwerk. Hinzu komme ein umfangreiches Schriftgutund Bildarchiv, das vom Bayeri schen Hauptstaatsarchiv betreut werde.
Die Objekte stammten über wiegend aus Schenkungen und Nachlässen von Heimatvertrie benen und deren Nachkommen sowie – vor allem in den letz ten Jahren – aus den Beständen aufgelöster Heimatstuben.
Das Sudetendeutsche Muse um ist Zeugnis der jahrhunder telangen Geschichte und Kul tur der Sudetendeutschen und wurde als Leuchtturmprojekt be zeichnet, so Planker, und weiter: „Um sich als Leuchtturmprojekt zu profilieren und zu etablieren, muß das Museum nach interna tionalem Standard arbeiten.“
Museumssammlungen sind das gegenständlich kulturel le Gedächtnis der Menschheit. Museales Sammeln ist eine kon tinuierliche Daueraufgabe. Die Sammlungsstrategie eines Mu seums trage vor allem dem ver antwortlichen Umgang mit den Objekten Rechnung und be rücksichtige die Notwendig keit von Dokumentation, Be wahrung, Konservierung sowie gegebenenfalls Restaurierung und Ausstellung jedes einzel nen Gegenstandes. Museen ha ben den Auftrag, Zeugnisse der Vergangenheit und der Gegen wart dauerhaft zu erhalten und für die Zukunft zu sichern. For schen und Dokumentieren sowie das wissenschaftliche Erschlie ßen der Sammlungsbestände sei en Kernaufgaben eines Muse ums. Das Museum erfüllt als Ort lebenslangen Lernens einen Bil dungsauftrag. Basis hierfür seien Sammlungen, originale Objek te, mit denen Ausstellungen ent wickelt werden, so Direktor Plan ker. Sein abschließender Appell: Bevor Heimatstuben ins Depot wanderten, solle im Interesse ei
ner breit gestreuten Geschichts vermittlung alles versucht wer den, sie vor Ort zu erhalten.
Das Sudetendeutsche Muse um sei ein Schutzraum für Hei matsammlungen, sagte Samm lungsleiterin Walcher und schil derte den Ablauf des Weges der Sammlungsgegenstände ins De pot des Sudetendeutschen Mu seums und ihre sach- und fach gerechte Inventarisierung sowie die Aufbewahrung der umfang reichen Sammlung. Sie stehe den Verantwortlichen in den Heimat kreisen auch gerne als Ansprech partnerin zur Verfügung. So hat sie unmittelbar zum Treffen von Betreuenden sudetendeutscher Heimatstuben am 13. März 2023 ins Sudetendeutschen Museum eingeladen.
Dr. Wolf-Dieter Hamperl gab anschließend einen Einblick in sein breites Tätigkeitsfeld. Er en gagiert sich seit Jahrzehnten eh renamtlich für die Pflege von Kultur und Geschichte des Eger landes. Hamperl ist unter ande rem Vorsitzender des Vereines „Egerer Landtag e.V.“ mit Sitz in Amberg in der Oberpfalz, Hei matkreisbetreuer von Tachau mit eigenem Heimatmuseum in Wei den und stellvertretender Vor sitzender des Sudetendeutschen Heimatrates. Anschaulich mit Blick in die Zukunft präsentier te er seine Arbeit am Beispiel des Egerer Landtages, dessen Vor sitz er vor einem Jahr übernom men hat. Der erfahrene Heimat pfleger kennt sich aus und weiß, mit wem er sprechen muß, wenn er finanzielle wie ideelle Unter stützung benötigt. So ist es ihm gelungen, den vorgefundenen Buchbestand vor der Zerschla gung zu retten und komplett an den Egerer Archivdirektor Karel Halla zu übereignen. Dort befin de sich die größte Bücherei des Egerlandes und Deutsch-Böh men, erzählte Hamperl. Halla möchte die Bücherei des Egerer Landtags als Anschlußbücherei
in die Zukunft sichern. So reih te er Beispiel an Beispiel, wie es ihm gelingt, die Schätze als sicht bares Erbe zu erhalten.


Museumsarbeit und Famili enforschung dienen der Ausein andersetzung mit der Geschich te, faßte Dr. Gernot Peter zusam men, Heimatkreisbetreuer von Prachatitz und Leiter des Böh merwaldmuseums in Wien sowie des Böhmerwaldheimatkreises Prachatitz mit dem dazugehöri gen Heimatmuseum mit Sitz im oberbayerischen Ingolstadt.
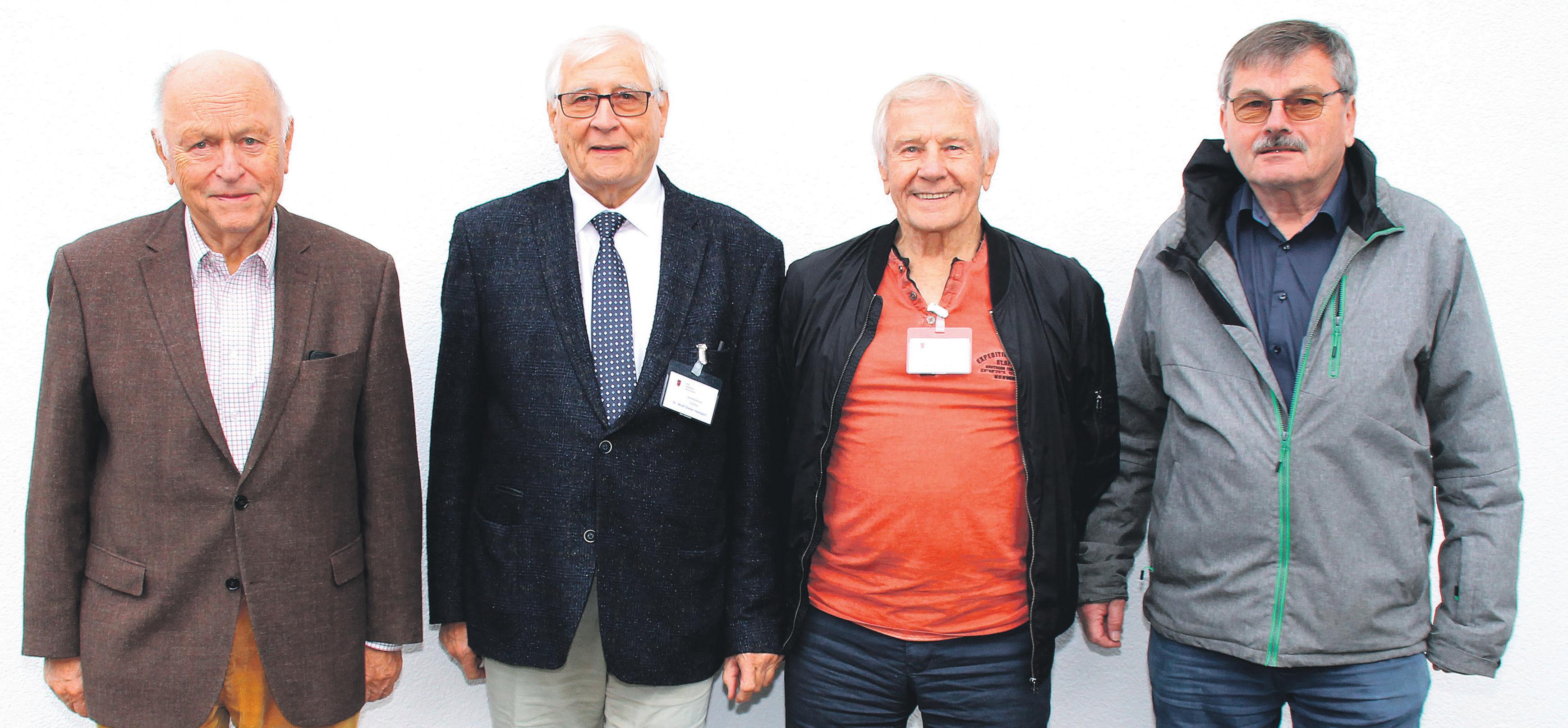
In seiner anschaulichen Zeit reise durch Geschichte und Ge schichten beider Museen stellte er den Service heraus, den Besu cher vor Ort und in der digita len Präsenz in Anspruch nehmen können. Großen Wert legt er auf die Geschichtsvermittlung durch die Unterstützung bei der Fami lienforschung und bei der Suche nach Ortschaften, Ortsplänen, Einwohnerlisten in der ange stammten Heimat, aktives Zuge hen auf die Museumsbesucher, rasche Beantwortung von schrift lichen Anfragen, Nutzung der Bi bliothek und des Fotoarchivs, Be ratung zu Reisen in die Tschechi sche Republik, Veranstaltungen und Ausstellungen.
Die Diskussion um Zukunfts ideen moderierte Longins Stell vertreter und Heimatkreisbe treuer für das Kuhländchen, Prof. Dr. Ulf Broßmann. Jugend zu ge winnen und aktiv in die Heimatarbeit einzubinden, formulierte er als eine der großen Zukunfts aufgaben. Grundsätzlich seien junge Menschen bereit, sich eh renamtlich zu engagieren, wenn sie entsprechend motiviert wer den. Daß die heutige Enkelge neration der Sudetendeutschen früh mit passenden Aufgaben an gesprochen werden, man ihnen aber auch Freiräume für die Ent wicklung eigener Vorstellungen zugestehen müsse, war die Über zeugung der vertretenen Amts träger.
Markus Decker, Beauftragter für „Moderne Netzwerkarbeit“ und „Digitale Medien“ und In itiator der zahlreichen Facebook gruppen des Heimatrates, ist da von überzeugt: „Jugendliche ha ben Interesse, sich um die Orte ihrer Großeltern zu kümmern.“
SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch verwies mit Stolz auf Sudeten.net, das neue von jungen IT-Experten in Zu sammenarbeit mit der Sudeten deutschen Landsmannschaft er arbeitete soziale Netzwerk der Sudetendeutschen. Über die ak tuelle Lage und zukünftige Ent wicklungschancen des Pro jekts berichtete Projektkoordi nator Mathias Heider Sudeten. net weise, so Heider, weiterhin wachsende Zugriffs- und Teil nehmerzahlen auf. In den ersten fünf Monaten seines Bestehens sei das Netzwerk äußerst dyna misch gewachsen und habe da bei alle Erwartungen übertrof fen.
Auf diesem Erfolg werde man sich jedoch nicht ausru hen. Stattdessen sei derzeit eine deutliche Erweiterung der Funk tionen von Sudeten.net geplant, die das Angebot für die Teilneh mer noch attraktiver machen sol le. Heider faßte die Neuerungen, deren Umsetzung für die kom menden Monate vorgesehen ist, unter dem Stichwort „Sudeten. net plus“ zusammen. Viele der Maßnahmen beträfen Verbesse rungen im Nutzer-Erlebnis, etwa Benachrichtigungen bei der An meldung neuer Teilnehmer aus der eigenen Herkunftsregion, die Einführung optionaler Nut zerkonten, eine weitere Vergrö ßerung des Ortsdatenbestandes, Optimierungen in der Suchfunk tion und eine Erweiterung der Übersetzungsmöglichkeiten.
Der wichtigste Aspekt von „Sudeten.net plus“ bestehe al lerdings in der Einführung einer völlig neuen Funktionsebene: Bislang, so Heider, habe es sich bei Sudeten.net um ein reines Personen-Netzwerk gehandelt. Dieses soll künftig um Informa tionen zu den sudetendeutschen Herkunftsorten ergänzt werden. Analog zu den Teilnehmer-Pro filen werde auch jeder Heimat ort einen eigenen Informations bereich erhalten. Dort könnten etwa Angaben zur Geschich te und Gegenwart des Ortes, hi storische und neue Bilder, Links und Veranstaltungshinweise zu finden sein. Von besonderer Be deutung sei dabei die Verknüp fung mit den am jeweiligen Ort angemeldeten Teilnehmern.
Um auch diesen Teil des Netz werks stets informativ und aktu ell zu halten, sei die Mitwirkung der Heimatlandschafts-, Heimat kreis- und Heimatortsbetreu er weiterhin unerläßlich. Immer mehr entwickle sich Sudeten.net damit zu einem Projekt und In strument des Sudetendeutschen Heimatrates.
Unter dem Motto „Sudetendeutsche Dialoge“ lädt das Sudetendeutsche Museum erstmals zu einer Konferenz ein. Ziel der zweitägigen Veranstaltung am 2. und 3. Dezember ist es, Minderheiten und Volksgruppen in Europa miteinander ins Gespräch zu bringen.
Als Ort der kulturellen Begegnung ist das Sudetendeutsche Museum in München der perfekte Ort, an dem sich ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas treffen und über ihre Besonderheiten sowie über ihren Status diskutieren können“, erklärt Dr. Stefan Planker, der Direktor des Sudetendeutschen Museums, die Idee für die Konferenz.

Welche Dimensionen das Thema hat, belegen eindrucksvolle Zahlen. Demnach leben in Europa mehr als 400 Minderheiten. Mehr als 100 Millionen Menschen, die in Europa leben, gehören einer Minderheit an. In der EU sind es mehr als 50 Millionen.
Nach den offiziellen Zahlen der EU gibt es neben den 24 Amtssprachen der Europäischen Union mehr als 60 Regionalund Minderheitensprachen. Die Gesamtzahl der Sprechenden von Minderheitensprachen wird auf 40 Millionen EU-Bürger geschätzt. In ganz Europa gibt es 90 Sprachen, darunter werden 37 als Nationalsprachen gesprochen und 53 Sprachen, die als „staatenlose Sprachen“ gelten.
Am ersten Tag der „Sudeten-
■ Montag, 21. November, 19.00 bis 21.00 Uhr, SL-Bundesverband: „Nuntius Alois Muench (1889–1962) – Der ‚Retter Deutschlands‘“. Vortrag von Prof. Dr. Stefan Samerski im Rahmen der Reihe „Böhmen macht Weltgeschichte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Dienstag, 22. November, 14.00 bis 16.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Europäische Dialoge Václav Havels. Umwelt, Grenze, Fake News – Aufgaben der tschechischen Ratspräsidentschaft“. Podiumsdiskussion mit Michael Cramer, MdEP a. D. und Initiator des EuropaRadwegs Eiserner Vorhang, Renke Deckarm, stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, Marie Bělohoubková, Architekturstudentin und Mitglied des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, und Michael Žantovský, Direktor der VáclavHavel-Bibliothek, Prag. Grußwort und Impusvortrag: Katrin Habenschaden, 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München. Grußworte: Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der LH München, und Ivana Červenková, Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München. Festsaal im Alten Rathaus, Marienplatz 15, München. Anmeldung erforderlich unter https://eveeno.com/ vhed
■ Dienstag, 22. November, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Riga“. Vortrag von Martin Brand im Rahmen der Reihe „Hafenstädte im Baltikum“. Urania „Wilhelm Foerster“, Gutenbergstraße 71, Potsdam. Anmeldung und Vorverkauf unter Telefon (03 31) 29 17 41 oder per eMail an verein@urania-potsdam.de
■ Mittwoch, 23. November, 19.00 Uhr, Kulturreferat für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München: „Von Prag
deutschen Dialoge“ werden sich geladene Volksgruppen vorstellen und über ihre kulturelle und museale Arbeit berichten. Am zweiten Tag diskutieren die Kongreßteilnehmer über die Relevanz und die Herausforderungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der Eintritt zur Konferenz ist für alle Interessierten offen und kostenlos.

Freitag, 2. Dezember 9.30 Uhr: Dr. Ortfried Kotzi-
an, „Begrüßung und Einführung zu den Sudetendeutschen Dialogen“.
9.50 Uhr: Bernd Posselt, „Die Sudetendeutschen – Bindeglied im Herzen Europas“.
10.30 Uhr: Eva Haupt, „Das Sudetendeutsche Museum –Begegnungsort für eine Volksgruppe“.
11.20 Uhr: Dr. Leander Moroder, „Die Dolomitenladiner: eine Minderheit im Aufbruch“.
12.00 Uhr: Dr. Stefan Planker, „Die Museumslandschaft in Ladinien“.
14.00 Uhr: Martin Dzingel, „Die deutsche Minderheit in Tschechien“.
14.40 Uhr: „,Unsere Deutschen‘ in Usti nad Labem/Aussig“.
15.00 Uhr: Peter Bresan, „Das Sorbische Volk in der Lausitz“.
15.40 Uhr: Christina Bogusz, „Sichtweisen im Wandel – Das Sorbische Museum als Brücke zwischen Gestern und Morgen“.
16.30 Uhr: Eva Haupt, Klaus Mohr, Dr. Stefan Planker, Nadja Schwarzenegger, Sonderführungen durch das Sudetendeutsche Museum in deutscher und ladinischer Sprache.
Samstag, 3. Dezember

9.00 Uhr: Torsten Fricke, „Die Sudetendeutsche Zeitung – The Making of News: Warum Journalisten so ticken, wie sie ticken.“
9.40 Uhr: Pablo Pallfrader, „La Usc di Ladins – Geschichte, Gegenwart und Herausforderungen der Zukunft“.
10.00 Uhr: Mateo Taibon, „Ladinische Sendungen der Rai: Die große Chance der Sichtbarkeit“.
10.20 Uhr: Dr. Cordula Ratajczak, „Die sorbische Medienlandschaft“.
11.20 Uhr: Steffen Neumann, „Die deutsche Presse in der Tschechischen Republik“.
12.00 Uhr: Torsten Fricke, Mateo Taibon, Steffen Neumann, Janek Schäfer, Fabian Riemen, „Ethnische Minderheiten und Volksgruppen in Europa im Dialog zum Thema Pressearbeit“.
■ Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. November: „Adventssingen“.
Es ist wieder soweit! Zum 59. Mal treffen sich auf dem Heiligenhof bei Bad Kissingen Alt und Jung, um mit dem traditionellen Adventssingen die Weihnachtszeit einzuläuten. Unter der Leitung von Astrid Jeßler-Wernz werden mit Schwerpunkt auf Böhmen und Mähren Chorsätze alter und neuer Meister und Lieder zur Weihnachtszeit gesungen. Auch Instrumentalgruppen werden sich zusammenfinden, wenn viele ihr Instrument mitbringen. Volkstanz steht ebenfalls auf dem Programm. Um musikalische Erinnerungen mitzunehmen, wird das Chorprogramm zusätzlich aufgenommen werden. Alle, die gerne singen und tanzen, sind herzlich willkommen.

Veranstaltet wird das Adventssingen durch das Sudetendeutsche Sozial- und Bildungswerk e.V., gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag mit dem Abendessen um 18.00 Uhr und ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende.
■ Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Dezember: Wochenendseminar „Budapest im Zentrum historischer und politischer Entwicklungen“. Veranstaltung für politisch-historisch Interessierte.
Seit mehr als 1000 Jahren ist Buda/Ofen – erst 1879 erfolgte der Zusammenschluß mit Pest – wenn auch mit Unterbrechungen in der Türkenzeit – das Zentrum ungarischer Staatlichkeit. Der ungarische Staat war dynastisch, wirtschaftlich, kulturell und religiös mit Westeuropa verbunden. Dies zeigt sich über die Dynastie der Habsburger, die seit 1526 auch Könige von Ungarn waren, wenngleich sie wegen der osmanischen Expansion bis etwa 1690 nur Teile Ungarns tatsächlich beherrschen konnten. Dies zeigt sich ebenfalls an der Einführung der deutschen Sprache als Amtssprache 1780, an der Existenz eines deutschen Bürgertums, von deutschen Handwerkern und Kaufleuten in Budapest. Die Zeit der habsburgischen Doppelmonarchie war von Sprach- und Nationalitätenkämpfen, aber auch von kulturellem und wirtschaftlichem Aufbruch geprägt. Der ungarische Staat verlor nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Territoriums, hatte aber eine fast überdimensionierte Hauptstadt mit heute rund 1,7 Millionen Einwohnern, dies heißt jeder sechste Ungar wohnt dort. Der Anteil „deutscher Geschichte“ – stets verstanden als Beziehungsgeschichte – ist eher weniger bekannt. Im Seminar sollen entsprechende Bezüge und Verbindungen nach Deutschland und Europa aufgezeigt und diskutiert werden.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
nach Wien und zurück“. OnlineVortrag von Michaela Škultéty in der Reihe „Mein Weg zu unseren Deutschen“. Der Youtube-Link wird auf der Webseite des Adalbert Stifter Vereins (www.stifterverein.de) vor Veranstaltungsbeginn veröffentlicht.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Online-Lesung der Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Donnerstag, 24. November, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Die Mährische Moderne – prekäre Autoritäten in der literarischen Familie“. Wissenschaftlicher Vortrag von Alžběta Peštová. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.
■ Samstag, 26. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmerwald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Mu-
sikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de
■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 30. November, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Wanderausstellung „Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie“. Präsentation der Ausstellung und des Begleitfilms mit Ralf Pasch. Rathaus Treptow, Raum 118, Neue Krugallee 4, Berlin.
■ Mittwoch, 30. November, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Böhmische Spuren in München: Zuzana Jürgens im Gespräch mit Rudolf Voderholzer“. Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München.
■ Mittwoch, 30. November, 19.00 bis 21.30 Uhr: „Schlesiens Wilder Westen“. Filmvorführung und Gespräch mit der Filmemacherin Ute Badura. Eintritt frei. Veranstaltung in Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin e.V. im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, Berlin.
■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. (Programm siehe oben) Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Dienstag, 6. Dezember, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Memel/Klaipėda“. Vortrag von Sonya Winterberg im Rahmen der Reihe „Hafenstädte im Baltikum“. Urania „Wilhelm Foerster“, Gutenbergstraße 71, Potsdam. Anmeldung und Vorverkauf unter Telefon (03 31) 29 17 41 oder per eMail an verein@urania-potsdam.de
■ Donnerstag, 15. Dezember, 19.00 Uhr: „Grenzenlos. Aus dem Konservatorium in die Welt“. Konzert für Klavier zu vier Händen. Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Hauses des Deutschen Ostens und des Tschechischen Zentrums München. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Eintritt frei, Spenden für die Ukraine/Bukowinahilfe (Netzwerk Gedankendach) erbeten.
■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Freitag, 27. Januar, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich: 19. Ball der Heimat (nach zwei Jahren Corona-Pause). Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34–36, Wien. Voranmeldung per eMail an sekretariat@vloe.at
■ Mittwoch, 23. November, 19.00 Uhr: „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“. Referent: Dr. Andreas Kossert. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Andreas Kossert, renommierter Experte zum Thema Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und Autor des Bestsellers „Kalte Heimat“ (2008), stellt in seinem neuen Buch die Flüchtlingsbewegung des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen geschichtlichen Zusammenhang.
Immer nah an den Einzelschicksalen und auf bewegende Weise zeigt Kossert, welche existenziellen Erfahrungen von Entwurzelung und Anfeindung mit dem Verlust der Heimat einhergehen –und warum es für Flüchtlinge
und Vertriebene zu allen Zeiten so schwer ist, in der Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Ob sie aus Ostpreußen, Syrien oder Indien flohen: Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte, und Andreas Kossert gibt ihnen mit diesem Buch eine Stimme.
Das Buch wurde mit dem NDR-Kultur-Sachbuchpreis 2020 und dem Preis für „Das politische Buch“ 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet.
Dr. Andreas Kossert (geb. 1970) studierte Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaft. Von 2001 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Seit 2010 ist er Mitarbeiter der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (Berlin).
Es war vor 100 Jahren, als Richard Coudenhove-Kalergi in einem gleichlautenden Artikel in den beiden wichtigsten liberalen Zeitungen im Berlin und Wien der 1920er Jahre, der Vossischen Zeitung und der Neuen Freien Presse, seine Idee Paneuropa an prominenter Stelle publizierte. Dies nahm die Paneuropa-Union zum Anlaß, um in Berlin auf Einladung der Tschechischen Botschaft in deren Kinosaal „100 Jahre Paneuropa und die Zukunft Europas“ zu feiern.
Der Tschechische Botschafter Tomáš Kafka erinnerte in seiner Begrüßung daran, daß es der tschechoslowakische Präsident T.G. Masaryk war, der den tschechoslowakischen Staatsbürger Richard Coudenhove-Kalergi dabei unterstützte, seinen Weg zur Gründung der Paneuropa-Union zu gehen.
Kafka begrüßte deshalb alle Paneuropäer und dankte Bernd Posselt, dem Präsidenten der Paneuropa Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, für sein Engagement für Mitteleuropa. „Wir sind ja irgendwie alle Apostel von Bernd Posselt, der sich seit vielen Jahren für Mitteleuropa einsetzt und mit seinen breiten Schultern dieses Engagement auch trägt“, sagte Kafka. Für den Botschafter sei Mitteleuropa der Ort einer gewissen Großzügigkeit. Hier gäbe man allen eine zweite Chance, und die hatten wir im letzten Jahrhundert alle bitter nötig. „Möge das Engagement der Paneuropäer auch im Lichte des Ukraine-Krieges in eine gute, bessere Zukunft für Europa führen“, so Kafka.
Benedikt Praxenthaler von der Paneuropa-Union Berlin-Brandenburg begrüßte die vielen Gäste, darunter ehemalige Botschafter, Abgesandte vieler Botschaften, Politiker aus dem Bundestag von CDU, CSU, SPD und den Grünen, aber auch die in München lebende Autorin Masumi Böttcher-Muraki, die über die Mutter von Coudenhove-Kalergi eine Biografie geschrieben hat.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den ukrainischen Bariton Sergej Ivanchuk, der bei einem humanitären Einsatz in Charkiv durch russischen Beschuß schwer verwundet wurde, dessen Stimme aber ganz unverletzt saalfüllend betörte.
Einem Impulsreferat vom Präsidenten der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt (siehe unten), schloß sich eine Podiumsdiskussion an, die der Bundesvorsitzende der Paneuropa-Jugend Deutschland, Christian Hoferer, moderierte. Auf dem Podium meldete sich Elmar Brok, fast 40 Jahre CDU-Abgeordneter im Europäischen Parlament, mit einer Erinnerung an Coudenhove-Kalergie zu Wort. Er schrieb als Zwölfjähriger handschriftlich eine Postkarte an ihn und bekam eine Antwort verbunden mit der Zusendung der Broschüren zur Europäischen Einigung, die er immer noch besäße. Brok beschrieb die Grundlage für ein glaubwürdiges und stabiles Europa, bei aller Differenz des innerstaatlichen Aufbaus in den verschiedenen Ländern, mit dem Vorhandensein von Demokratie, die so gestaltet sein müsse, daß Regierungen abgewählt werden können, und einem Rechtsstaat, der nicht die Stärke des Staates zum Ausdruck bringt, sondern Schutz des Bürgers und der Schwachen vor dem Staat realisiere.


Dann entbot Erzbischof Nikola Eterović, der Apostolische Nuntius und Doyen des Diplomatischen Korps in Deutschland, seine und die Einschätzung des Vatikans über die Wichtigkeit der christlichen Werte für die Zukunft Europas und zitierte lang die Worte von Papst Franziskus zur Verleihung des Karls-Preises 2016 an ihn, eines Preises,
der erstmalig 1950 an den Gründer der Paneuropa-Bewegung Richard Coudenhove-Kalergi gegangen war.
Milan Horáček, Menschenrechtsaktivist im Vorfeld des Prager Frühlings, Mitbegründer der Grünen in Deutschland und später Parlamentarier, beschrieb seinen Weg bis ins EU-Parlament, wo er auch auf Elmar Brok stieß.
Marie Bělohoubková, Mitglied im Beirat des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, erzählte als Stimme der Jugend ihre Erfahrung von Europa, die in den letzten drei Jahren neue Prüfungen mit der Schließung der Grenzen wegen der Corona-Pandemie und nun
noch dem massiven Aufflammen des Nationalismus durch Rußlands Angriff auf die Ukraine erlebt habe. Sie äußerte aber Dankbarkeit für die Erbauer des gegenwärtigen Europas, in dessen Freizügigkeit und Austausch ihre Generation hineingeboren wurde. Und sie vermittelte ein positives Bild der Zukunft, trotz der gegenwärtigen Erschwernisse und sicher auch Problemen beim Austausch zwischen den Ländern in der EU, da noch mehr investiert werden müsse.
Knut Abraham, Berichterstatter für die Ukraine sowie der anderen Staaten Mittel- und Osteuropas im Auswärtigen Ausschuß des Bundestages, schilderte ein Erstaunen. Er habe fünf Kinder, die alle schon viele Schuljahre absolviert hätten. Sie hätten dabei in Deutschland noch nie etwas über die Geschichte Mitteleuropas gelernt, immer nur deutsche Geschichte im nationalen Kontext. Das könne doch nicht so bleiben.
Ein Empfang in der Tschechischen Botschaft bei Budweiser Bier, Wein und Chlebíčky bot Gelegenheit zum Austausch unter Paneuropäern. Im Bauch des „Raumschiff Enterprise“, wie eine Ausstellung zu 50 Jahren Botschaftsgebäude an der Wilhelmsstraße im Stile des Brutalismus (von „Béton brut“) in diesem Jahr titelte, und das wohl bald für einen Umbau über Jahre schließen wird, konnte deutsch-tschechischer Austausch gepflegt werden.
Ulrich Miksch„100 Jahre Paneuropa ist nicht etwas, was man nur an einem Tag feiern kann“, hat Bernd Posselt, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, in seinem Impulsvortrag klargestellt.
Der überzeugte Europäer führte deshalb aus: „Wir haben damit begonnen in Nürnberg mit dem tschechischen Europaminister Mikuláš Bek und dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wenige Tage vor dem Beginn der EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens. Wir sind dann in die Tschechische Republik nach Ronsperg, den Heimatort unseres Gründers gegangen, waren in Straßburg, in der Herzkammer der europäischen Demokratie. Und dann haben wir beschlossen, wir feiern weiter in Berlin und in einigen Wochen in Wien“.
Mit seinem Appell für Europa habe sich Coudenhove-Kalergi vor allem an die europäische Jugend gewandt. Er lehnte den Nationalismus ab und sprach sich sogar gegen die Nationalstaatlichkeit aus, indem er sagte, eines Tages werde man Staat und Nation so trennen, wie man bereits Staat und Religion getrennt habe.
Posselt über die Sichtweise von Coudenhove-Kalergi: „Nationen sind nicht Gemeinschaften des Blutes, wie die Nationalisten behaupten, sondern sind Gemeinschaften des Geistes. Als Universi-
täten des Geistes verändern und entwikkeln sie sich, leisten einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben, sind aber für sich genommen viel zu klein, um diesem Europa Frieden, Stabilität und die Möglichkeit zu geben, sich in einer sehr gefährlichen Welt durchzusetzen.“
Es sei schon eindrucksvoll, so Posselt, „daß der Mann, der die europäische Einigung erfunden hat, eine japanische Mutter und einen europäischen, aus Böhmen stammenden Vater hatte“.
Coudenhove-Kalergi wurde in Tokio geboren, kam dann als Kind nach Böhmen und lebte auf Schloß Ronsperg. Er sei dort, so schrieb er später, „zwischen zwei Grenzen eingeklemmt gewesen“. „Die eine Grenze war die Staatsgrenze zwischen Böhmen und Bayern. Und die andere Grenze war die Sprachgrenze zwischen Deutschen und Tschechen in Böhmen. Beide Grenzen waren etwa zehn Kilometer jeweils entfernt.“ 1920, im Alter von 26 Jahren, habe Richard Coudenhove-Kalergi den Staatspräsidenten Masaryk auf der Prager Burg aufgesucht, um ihn für seine Idee eines geeinten Europas zu begeistern. Posselt: „Er hat gesagt: ,Herr Präsident, ich habe die Idee Europa zu einen, und Sie müssen das machen.‘ Der alte Präsident Masaryk war begeistert von dem jungen Mann, war begeistert von der Idee, hat aber gesagt: ,Junger Mann, ich kann das nicht mehr, ich bin
zu alt.‘ Er hatte ja immerhin einen Staat gegründet, aber zu mehr sah er sich nicht mehr in der Lage. Und was hat dann dieser junge Mann gemacht? Er hat gesagt: ,Gut, Herr Präsident, wenn Sie das nicht tun können, mache ich das.‘“
Für ihn, so Posselt, sei CoudenhoveKalergi der Prototyp der Bürgergesellschaft: „Unser Ziel als Paneuropa-Bewegung ist die Parlamentarisierung, Demokratisierung und Integration Europas, und da gibt es noch ungeheuer viel zu tun. Unser Jubiläum schaut nicht nur zurück, sondern wir schauen nach vorn mit
einem Trommelfeuer von Aktivitäten für die Zukunft Europas. Die europäische Einigung als solche ist eine Frage von Krieg und Frieden. Europa als Friedensidee ist das aktuelle Thema unserer Zeit. Europa muß die Flamme des Friedens hochhalten. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, europäische Einigung und Frieden sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen Generation für Generation neu erarbeitet und erkämpft werden. Und in dem Moment, in dem eine Generation schon glaubt, sie hat es in der Tasche, ist es wieder gefährdet. Und deshalb definieren wir uns als eine Friedensbewegung.“
Man müsse gegen den Nationalismus, der gegenwärtig in Europa wieder um sich greife, kämpfen und sich dafür einsetzen, daß Europa auch in der Außenpolitik handlungsfähiger wird, so der langjährige Europaabgeordnete Posselt: „Schon Coudenhove war für eine europäische Armee, für eine europäische Verteidigung. Dies ist nötig, aber wir dürfen nicht vergessen, daß es noch etwas viel wichtigeres gibt, nämlich die präventive Diplomatie, also die Fähigkeit Frieden zu stiften zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen, zwischen den Nationen. Unser Europa braucht auch eine geistig-kulturelle Dimension. Ein materialistisch-instrumentelles Europa wird nicht funktionieren.“

 Ulrich Miksch
Ulrich Miksch
Das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu. Evangelische Christen begehen am letzten Sonntag vor dem ersten Advent den Toten- oder Ewigkeitssonntag. Dabei gedenkt man der Verstorbenen, ebenso wird die Erwartung des Jüngsten Tages und der Glaube an die Auferstehung der Toten thematisiert. Die christliche Hoffnung reicht über rein innerweltliche Verläufe und Zusammenhänge hinaus. Sie hat ihr Ziel in einem alle menschlichen Vorstellungen und Erwartungen übersteigenden Zustand von Gerechtigkeit, Frieden und Wohlergehen.
In der katholischen Kirche wird der letzte Sonntag vor dem ersten Advent als Christkönigsfest gefeiert. Dieses wurde von Papst Pius XI. im Jahre 1925 eingeführt und will darauf hinweisen, daß Jesus Christus über alle irdischen Herrscher hinaus der wahre Lenker von Welt und Geschichte ist. An seiner Liebe und Treue zur Menschheit ist nicht zu rütteln. Sie übersteigt alles, was man sich sonst unter guter Herrschaft oder guter Politik vorstellt, und stiftet uns zum Vertrauen an, daß alles letztlich einmal gut werden wird. In unruhigen Zeiten, wie die Menschheit sie gerade wieder einmal erlebt, ist dieses Vertrauen um so wichtiger. Es vermag zu trösten und schenkt Zuversicht. Und, ganz wichtig, es lädt ein, selbst das Gute zu tun und damit einen Beitrag zu einem gedeihlichen Miteinander in der menschlichen Gesellschaft zu leisten.
Der Toten- oder Ewigkeitssonntag ebenso wie das Christkönigsfest läuten also die letzte Woche des Kirchenjahres ein. Bald beginnt ein neues Kirchenjahr, einen guten Monat bevor das profane Kalenderjahr ausklingt. Die kirchliche Zeitrechnung paßt sich damit nicht dem weltlichen Jahreszyklus an, sie ist antizyklisch. Warum ist das so? Wäre es nicht in vieler Hinsicht einfacher, wenn wir in der Kirche und im christlichen Leben unser Jahr ebenfalls am 31. Dezember beenden und mit dem 1. Januar ein neues beginnen würden?
Der erste Grund, warum wir dies nicht tun, hat mit dem Beginn des Advents zu tun. Damit wird ausgedrückt: Gott schafft einen neuen Anfang. Dieser Anfang ist nicht mit menschlicher Logik berechenbar. Er ist auch nicht von Menschen initiiert. Das ist allein Gottes Initiative. Er selbst wird Mensch, um das Menschengeschlecht aus Schuld und Unheil zu erlösen. Diese einmalige Initiative Gottes, die in Jesus von Nazareth ein geschichtliches Faktum wurde, wird für uns Christen in den verschiedenen Feiern des Kirchenjahres immer wieder neu aktualisiert und vergegenwärtigt. Deshalb hat die kirchliche Zeitrechnung ihren ganz eigenen Charakter.
Damit zusammenhängend liegt ein zweiter Grund für den antizyklischen Verlauf des Kirchenjahres nahe. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Römer formuliert: „Gleicht euch nicht dieser Welt an.“ Wenn wir Christen überzeugt sind, daß alles Wesentliche im Leben und in der Welt von Gott stammt und daß alles einmal gut werden wird, dann ist es eigentlich sinnvoll, dies auch durch einen anderen Jahresbeginn zu markieren.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei Ellwangen-Schönenberg


Mitte Oktober brachte die Deutsche Grammophon ein Album auf den Markt, auf dem die Bamberger Symphoniker unter Jakub Hrůša Hans Rott, Gustav Mahler und Anton Bruckner spielen.



Bekanntlich gründeten vertriebene Mitglieder des Deutschen Philharmonischen Orchesters Prag im Jahr 1946 das Bamberger Symphonieorchester. Bekannt ist auch, daß sein fünfter und gegenwärtiger Chefdirigent der 41jährige Brünner Jakub Hrůša ist. Natürlich kennen wir Gustav Mahler (1868–1911), das Musikgenie, das im mährischen Iglau aufwuchs. Und wir kennen unseren k. u. k. Landsmann Anton Bruckner (1824–1894). Doch wer ist Hans Rott? Gustav Mahler sagte, Rott sei der Begründer der neuen Symphonie, wie er sie verstehe.
Hans Rott kam 1858 im Wiener Braunhirschengrund zur Welt.
Seine Eltern Karl Matthias und Maria Rott heirateten erst 1863.
Seine Mutter starb bereits 1872.
Sein Vater war ein berühmter
Wiener Schauspieler, der seine Karriere nach einem Bühnenunfall 1874 aufgeben mußte und 1876 starb. Dennoch studierte Rott am Wiener Konservatorium und wurde Orgelund Lieblingsschüler von Anton Bruckner.
In seiner Kompositionsklasse war auch Gustav Mahler, der sein Freund wurde. Nach dem Concours für Komposition 1878 erhielten alle Kommilitonen Preise, nur Rotts Arbeit, der erste Satz seiner Symphonie, ging leer aus. Laut Bruckner soll die Prüfungskommission über die Symphonie höhnisch gelacht haben. Er, Bruckner, sei daraufhin aufgestanden und habe gesagt: „Lachen Sie nicht, von dem Mann werden Sie noch Großes hören.“ Rott schied ohne Diplom und Medaille aus der Kom-
Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)


Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail


Geburtsjahr, Heimatkreis


Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.


 Kontobezeichnung (Kontoinhaber)
Kontobezeichnung (Kontoinhaber)
Kontonr. oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 46/2022
positionsschule. Laut Abgangszeugnis hatte er die Prüfung allerdings vorzüglich bestanden. 1876 bis 1878 war Rott Organist an der Wiener Piaristenkirche. Danach widmete er sich neben Privatstunden der Komposition, vor allem seiner Sinfonie in E-Dur. Dieses Hauptwerk beurteilte Johannes Brahms jedoch schlecht, und der Dirigent Hans Richter stellte eine geplante Aufführung aus Zeitgründen zurück. Als auch noch ein Antrag auf ein staatliches Stipendium abgelehnt wurde, wollte Rott 1880 Wien verlassen, um eine Stelle als Chorleiter in Mülhausen anzutreten. Doch sein wohl von Brahms‘ Zurückweisung ausgelöster Verfolgungswahn machte ihm einen Strich durch die Rechnung.
Im Zug nach Mühlhausen wollte sich ein Mitreisender eine Zigarre anzünden. Rott bedrohte ihn mit einem Revolver, weil er überzeugt war, Brahms habe den Zug mit Dynamit füllen lassen. Rott wurde nach Wien zurückgebracht. Dort kam er in die Psychiatrische Klinik und 1881 in die Niederösterreichische LandesIrrenanstalt. Den Rest seines Lebens verbrachte er dort, empfing Freunde, komponierte ab und an, vernichtete aber auch viele seiner Werke. Nach einigen Selbstmordversuchen starb er 1884 mit 25 Jahren an Tuberkulose.
Hugo Wolf soll Brahms den Mörder Rotts genannt und Bruckner Brahms am Grabe schwere Vorwürfe gemacht ha-
ben. Mahler beklagte wie Bruckner den Verlust, den die Musik durch Rotts frühen Tod erlitten habe. 1978 entdeckte der britische Musikwissenschaftler Paul Banks bei seinen Studien über den jungen Mahler Hans Rotts künstlerischen Nachlaß, zu dem Mahler Zugang hatte. Banks witterte das Potential der Symphonie in EDur, bearbeitete die Partitur und machte sich für eine Aufführung stark. 1989 wurde die Sinfonie in Cincinnati vom Cincinnati Philharmonia Orchestra uraufgeführt. Das erregte das Interesse der Musikwelt, da Rott in diesem Werk Themen verwendet, die aus dem erst später einsetzenden symphonischen Schaffen Mahlers bekannt sind. Seither ist der Komponist kein Unbekannter mehr, aber nicht wirklich bekannt.
Hrůša war eines Nachts im Internet bei Recherchen über Bruckner und Mahler auf Rott gestoßen. Der fast unbekannte Komponist und dessen 1. Symphonie faszinierten auch ihn. Er überzeugte seine Symphoniker und die Deutsche Grammophon, das Rott-Werk zu spielen und aufzunehmen.

Von Fridemann Leipold hören wir bei BR-Klassik über das „Album der Woche“: „Einer, der wie Mahler große Stücke auf Rott hielt, war Anton Bruckner, eine Instanz in Wien. Bruckner prophezeite seinem Lieblingsschüler Rott eine große Zukunft. Überwältigend führt Jakub Hrůša vor, wie sehr Bruckners Klangwelt den jungen Rott beeinflußte. Hrůšas Begeisterung über diesen, erst 1989 uraufgeführten Geniestreich überträgt sich sofort beim Hören. Seine ungemein sorgfältig erarbeitete Interpretation ist ein starkes Plädoyer für Rotts eigentümliche Musik. Der lange Atem, die Liebe zum Detail, der Zug zum Grandiosen – alles da. Nebenbei demonstriert die Produktion auch, daß die Bamberger Symphoniker auf Weltklasse-Niveau spielen –und daß Hrůša einer der besten seiner Generation ist.“
HurnausNadira


Am 12. November feierten Bayreuths SL-Altobmann Helmut Mürling und seine Frau Christa die diamantene Hochzeit zur Erinnerung an 60 Jahre Ehe und Gemeinsamkeit.
Die Feier begann mit einem Gottesdienst in der Katholischen Kirche Sankt Bonifatius in Glashütten im oberfränkischen Landkreis Bayreuth und setzte sich mit einem Festschmaus im Landgasthof Opel in Glashütten fort. Zahlreiche Gäste hatten sich dazu eingefunden. Darunter auch der „Hockewanzel“.
Der 1937 geborene Helmut Mürling war lange Jahre Obmann der SL-Ortsgruppe Bayreuth. Er ist für seine besonderen Leistungen und seine außerordentlich verdienstvolle Mitarbeit in der Sudetendeutsche Landsmannschaft weithin bekannt und erhielt dafür zahlreiche Sudetendeutsche Auszeichnungen.
Helmut Mürling wurde als Sohn des selbständigen Feinkostkaufmanns Siegfried Mürling und seiner Gattin Anna im Jahre 1937 in Komotau geboren. Sehr schmerzlich war die Vertreibung aus seiner geliebten Heimat. Sein zehn Jahre älterer Bruder Alfred mußte den berüchtigten Komotauer Todesmarsch und ein Jahr Arbeitslager in Maltheuern durchleiden.
Nach der Vertreibung im Jahre 1946 kam die Familie zunächst nach Sachsen-Anhalt, anschließend in den Landkreis Würzburg und letztlich nach Hummeltal im Landkreis Bayreuth. Seine berufliche Laufbahn begann Helmut 1952 als Einzelhandelslehrling bei der Nordsee Deutsche Hochseefischerei. Er wurde Verkäufer und schließlich Filialleiter in Bamberg, Wetzlar, Bayreuth und Erlangen.
Sein Dokumentations-Talent, sein Umgang mit dem Internet, seine Geschichtskenntnisse und seine fotografischen Fähigkeiten sind für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Bayreuth inzwischen unentbehrlich geworden. Als Webmaster betreut er seine Heimatstadt Komotau. Der Komotauer Netzauftritt hat in-
zwischen mehr als 243 000 Aufrufe und erfüllt damit in hervorragender Weise die Öffentlichkeitsarbeit mit neuzeitlichen Medien. Außerdem begründete er weitere Internetpräsenzen wie kaaden-duppau.de sudetenbayreuth.de und oberfranken.de
Christa Mürling erblickte 1940 in Lichtenfels das Licht der Welt. Sie ist also eine waschechte Fränkin. Das war wirklich ein Lichtblick, zumindest für den Helmut. Das Leben ging rasch voran, Christa arbeitete zuletzt als Hauswirtschafterin und ist eine sehr kreative, hilfsbereite und humorvolle Frau. Die unermüdliche, langjährige Pflege ihres Sohnes Lothar war eine herausragende Leistung und hat das Ehepaar überaus viel Kraft gekostet.
Uneigennützig half Christa bei Veranstaltungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Am 30. Oktober starb Hildegard Schilling, langjähriges Mitglied der unterfränkischen SL-Ortsgruppe Bayreuth und der dortigen Eghalanda Gmoi, mit 96 Jahren in Bayreuth.
Hildegard Schilling kam am 2. Juli 1926 in Eger zur Welt. 1946 kam mit der Vertreibung aus ihrer geliebten Heimat die größte Katastrophe in ihrem Leben. Sie war eine der sudetendeutschen Frauen, die mit Liebe und großem Einsatz das heimatliche Erbe bis ins hohe Alter pflegten.
Sie pflegte das Egerländer Liedgut, die Mundart und die Tracht. Legendär sind ihre Auftritte in Egerländer Tracht und Egerländer Mundart. Sie war ei-
mit. Außerdem bastelte sie gekonnt und geschickt nicht zuletzt für Erntedank- und Weihnachtsfeiern, wo sie auch anderweitig häufig im Einsatz war.
Ein besonderes, gemeinsames Hobby waren große Reisen im eigenen Wohnwagen. Zum Beispiel in Norwegen oder Italien. Langweilig wurde es den beiden nie. Ihre Tochter Gabi Habla betreut die beiden im eigenen Wohnhaus in Hummeltal in hervorragender Weise.
Wir gratulieren von ganzem Herzen und wünschen dem Jubelpaar Glück, Gottes Segen und eine möglichst stabile Gesundheit für die hoffentlich noch vielen, gemeinsamen Lebensjahre.
Manfred Keesne echte Expertin auf diesen Gebieten. Hutzaabende, Vorträge und das traditionelle Volksliedersingen in Schloß Goldkronach sowie Ausflüge in Zusammenarbeit mit der SL fanden immer wieder großen Anklang. Mehrfach wurde sie von der Gmoi und der SL für ihren großen Einsatz geehrt.
Sie hatte ein anstrengendes, sehr arbeitsreiches Leben. Gut versorgt von ihrer Tochter Viktoria war sie in den letzten Monaten ihres Lebens in einem Bayreuther Alten- und Pflegeheim untergebracht, wo sie nun friedlich entschlief.
Die Eghalanda Gmoi und die SL danken Hildegard Schilling und behalten sie in ehrender Erinnerung. Manfred Kees
Im Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München eröffnete die neue Ausstellung „Flüchtlin ge und Vertriebene im Münch ner Norden“. Sie gibt am Bei spiel der bayerischen Landes hauptstadt einen Einblick in die Auswirkungen der Vertreibun gen nach dem Ende des Zwei ten Weltkriegs. Bei der Eröff nung sprachen HDO-Direktor Andreas Otto Weber, die beiden Ausstellungskuratoren Peter Münch-Heubner und Falk Bach ter und SL-Bundesgeschäftsfüh rer Andreas Miksch. Die Aus stellung ist eine Veranstaltung der Sudetendeutschen Lands mannschaft mit Förderung vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales über das HDO.
Bayern erlebte in den Nach kriegsjahren einen Gewinn durch Flüchtlinge und Vertrie bene“, betonte Falk Bachter.
„Und zwar sozial, wirtschaftlich und kulturell.“ Damals sei das Bild der Neuankömmlinge je doch eher negativ besetzt ge wesen, wozu die ungleiche Ver teilung der Finanzhilfen nach dem Gesetz über den Lastenaus gleich 1952 noch beigetragen ha be. Bachter unterstrich abschlie ßend noch einmal die große Auf bauleistung der Flüchtlinge und Vertriebenen, die er auch von heutigen Flüchtlingen zu erwar ten scheint.
„In unserer Ausstellung geht es um Menschen, die Geschich te selbst erlitten haben“, ergänz te Peter Münch-Heubner in sei ner kurzen Ansprache. Auch der zweite Kurator lobte die Aufbau verdienste der Neubürger im

derführenden Historikern, aber auch allen anderen an der Aus stellung Beteiligten. Der SL-Bun desgeschäftsführer freute sich in seinem Grußwort über die große
Schon
dreas Otto Weber gesagt, daß die neue Ausstellung schon seit 2017 in Planung gewesen sei. Wegen der Corona-Zwangspausen ha be sie nicht gezeigt werden kön
nen. Dann erklärte der HDO-Di rektor historische Hintergründe: „Bis 1950 kamen fast zwei Mil lionen Deutsche aus dem Osten in Bayern an, was in Bayern fast 19 Prozent der Bevölkerung aus machte.“ Sehr viele davon seien aus dem Sudetenland vertrieben worden.
Etliche von ihnen seien in spe ziellen Landkreisen unterge bracht worden. Im zerbombten München dagegen seien auf grund der weitreichenden Zer störungen kaum Möglichkeiten zur Unterbringung gewesen. So habe man im Umkreis von Mün chen Platz suchen müssen, und zwar im dünnbesiedelten Nor den der Stadt.



Die Ausstellung und die in formative Begleitbroschüre stel len ebenfalls zuerst die allgemei ne Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen dar. Geschildert wird dann die Entwicklung in der damals steppenartigen Schotter ebene nördlich und westlich von München. Die Flüchtlinge lan deten in Freimann und in Kie ferngarten zunächst auf ehema ligem Wehrmachtsgelände, in Karlsfeld in früheren Lagerkom plexen für Zwangsarbeiter und im früheren SS-Lager Hochbrück bei Oberschleißheim. Dort legten sie zunächst „wilde“ Siedlungen an. Bald darauf wurden ihnen Grundstücksparzellen als Bau grund bereitgestellt. Darauf durf ten sie in Eigenleistung „Siedler häuser“ bauen und Selbstversor gungsgärten anlegen.
Die Ansiedlung in Hochbrück bei Oberschleißheim stellt in der Ausstellung Kurator Peter Münch-Heubner am Beispiel sei ner Mutter dar. Maria Margare the Münch, geborene Rust, war mit ihrer Familie aus Netschenitz im Kreis Saaz vertrieben worden und fand im Münchener Norden eine „neue“ Heimat.


Auch die wichtige Rolle, die Kirche und Glauben damals spielten, wird beleuchtet. Ein Be spiel ist die Errichtung der „Not kirche“ Sankt Josef in Karlsfeld, die ab 1948 unter dem sudeten deutschen Pfarrer Erich Goldam mer erbaut wurde. Goldammer predigte dort bis 1967, als die Kirche abgerissen werden muß te, um Raum für Parkplätze zu schaffen. In der neuen Karlsfel der Sankt-Josefs-Kirche hängen immerhin unter fünf Glocken zwei aus der Heimat: die Glocke des Heiligen Nepomuk für die Böhmen und die Glocke der Hei ligen Hedwig für die Schlesi er. Passend zur Wichtigkeit des Glaubens schließt sich ein Ex kurs über die Entstehung der Ackermann-Gemeinde aus der Kirchlichen Hilfsstelle Süd des Pater Paulus Sladek OSA (1908–2002) und deren Leistungen bei der Versöhnungspolitik an. Susanne Habel
Bis Freitag, 27. Januar: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“ in MünchenAu, Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5. Montag bis Freitag 10.00–20.00 Uhr, Weih nachtsferien geschlossen.
Münchener Norden: „Aus einer steppenartigen Wüste machten sie blühende Regionen!“ Der Dank von Andreas Miksch galt besonders den beiden feGästeschar bei der Eröffnung im größten Veranstaltungsraum des Hauses.
bei der Begrüßung zu Beginn der Vernissage hatte An
Mit der Verleihung der Pro-ArteMedaille der Künstlergilde an Widmar Hader, den Gründungs direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts (SMI), wurde der Träger des Großen Sudetendeut schen Kulturpreises 1996 bei ei ner Festveranstaltung in Re gensburg gewürdigt.
Die Verleihung der Pro-ArteMedaille an Widmar Hader, den Gründungsdirektor des Su detendeutschen Musikinstituts, war der Höhepunkt der Festver anstaltung am Abend des ersten Novembersamstags im Festsaal des Bezirks Oberpfalz. Die co ronabedingte Verschiebung die ser Auszeichnung, bei der Mu sik des Geehrten erklingen soll te, brachte es mit sich, daß auch die Aufführung eines weiteren

Die Pro-Arte-Medaille bekom men Persönlichkeiten „für her vorragende Verdienste um die Belange der Künstlergilde, die Pflege und Weiterentwicklung des Kulturgutes aus den histo rischen deutschen Kulturland schaften des Ostens sowie den Ausbau und die Pflege der Be ziehungen zu Künstlerinnen und Künstlern der europäischen Nachbarvölker, die sich deut schem Kulturgut verbunden füh len“, steht auf der Homepage.
ten der Sudetendeutschen Aka demie der Wissenschaften und Künste sowie Gräfs Vorgänger als Fachgruppenleiter für Mu sik der Künstlergilde Esslingen, Widmar Hader. Natürlich nann te Gräf Daten aus dessen Biogra phie. Im Jahr 1941 in Elbogen an der Eger geboren, sei Hader nach der Vertreibung 1946 nach Bad Reichenhall gekommen, wo er Abitur gemacht habe. Am Salz burger Mozarteum und an der Musikhochschule Stuttgart ha
bayerischen Kloster Rohr und die Elbogener Orgelfeste gegründet. „Dabei führte er überall vor al lem böhmische, mährische und sudetenschlesische Komponi sten auf“, sagte Gräf und verwies auch auf Haders Wirken als Bio graph. Als Dirigent hätten Tour neen Hader durch europäische Staaten, Israel, Brasilien und die USA geführt, wobei immer sei ne Werke aufgeführt oder urauf führt worden seien.
Partitur zusammen mit Andreas Willscher die Orchestrierung er arbeitet habe.
Anton Reicha. Der war Kompo nist, Musikpädagoge und Flö tist und erlebte seine größten Er folge in Paris, wo er 1836 starb. Sein Quintett für Klarinette und Streichquartett in B-Dur Opus 89 paßte auch von der Beset zung her ausgezeichnet zu Ha ders Werk.
Werks für die gleiche Besetzung (Klarinette und Streichquartett) nachgeholt werden konnte.
Darauf machte der jetzige SMI-Direktor Andreas Wehr meyer in seiner Begrüßung auf merksam. Besonders hieß Wehr meyer die Familie von Widmar Hader und natürlich seinen Vor gänger willkommen.
Stellvertretend für den Ersten Vorsitzenden der Künstlergil de, Martin Kirchhoff, überbrach te Dietmar Gräf, Fachgruppenlei ter Musik der Künstlergilde, das Grußwort. Er stellte die Gilde als Selbsthilfegruppe von Künstlern 1948 unter dem Namen Künstl ergilde Esslingen in Esslingen am Neckar gegründete Instituti on vor und nannte die von ihr in den einzelnen Kategorien verlie henen Preise.
Einen „Rübezahl-Tag – (nicht nur) für Kinder“ veranstaltete die Sudetendeutsche Heimat pflege mit dem Sudetendeut schen Museum, dem Deutschen Kulturforum östliches Euro pa (DKF) und der Stiftung Kul turwerk Schlesien. Der Journa list und Buchautor Ralf Pasch präsentierte im Sudetendeut schen Haus die Wanderausstel lung über den Berggeist Rübe zahl, die er mit dem DKF reali siert hatte.

Die Ausstellung mit ihren drei Schautafeln gibt mit Tex ten, Fotografien und Illustratio nen der Zeichnerin Juliane Pie
Mit den vom Sojka Streich quartett Pilsen und dem Kla rinetten-Virtuosen Josef Lasz lo aus Regensburg aufgeführ ten Hader-Opus „Signaturen für Klarinette in A, zwei Violi nen, Viola und Violoncello“ von 2004 begann die Würdigung des Gründungsdirektors. Sechs Sät ze umfaßt diese Komposition, in der sich ruhige und lebhafte Ele mente abwechseln. Neben Lasz lo sorgten Martin Kos und Mar tin Kaplan (Violinen), Josef Fiala (Viola) und Hana Vitková (Vio loncello) für eine gelungene In terpretation, die auch Laudator Gräf als großartig lobte.

Die zentrale Würdigung galt aber dem Schöpfer dieses Wer kes, dem ehemaligen Direktor des Sudetendeutschen Musikin stituts, früheren Vizepräsiden
per Antworten auf die Fragen, wer Rü bezahl ist, wo er re giert und was der Berggeist mit Natur schutz zu tun hat“, sagte Ralf Pasch ein führend. In einem kurzen Vortrag berichtete der Ausstellungsmacher, welche Ge schichten sich Sudetendeutsche, Schlesier und Riesengebirgler über Rübezahl erzählen.

be er Musik studiert sowie die Künstlerische und Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien abgelegt. Darüber hinaus habe Hader am Geschwister-Scholl-In stitut der Maximilians-Universi tät München Politologie und Phi losophie, unter anderem beim späteren Bayerischen Staatsmi nister für Unterricht und Kultus, Hans Maier, studiert.
Das Berufs- und Tätigkeitsfeld Haders sei breit gewesen: Kom ponist, Musikpädagoge, Chorund Orchesterleiter in Stuttgart sowie Dozent für Tonsatz an der Kirchenmusikschule Rotten burg. Außerdem habe er sich in künstlerischen Unternehmun gen engagiert. Er habe die Süd mährische Sing- und Spielschar geleitet, die jährlichen Sudeten deutschen Musiktage im nieder

Als Krönung seines Wirkens könne durchaus die Berufung zum ersten Direktor des neuge gründeten Sudetendeutschen Musikinstituts in Regensburg gesehen werden, an dessen Spit ze er von 1991 bis 2006 gestan den sei. Aber auch Haders kom positorisches Œuvre sei enorm und gekennzeichnet, so Gräf, von dem häufigen Bezug auf die böhmisch-mährische Musik und Geschichte. Häufig habe er Texte sudetendeutscher Autoren ver tont oder auch des bis zur Sam tenen Revolution im Exil im Klo ster Rohr wirkenden Erzabtes des Prager Stifts Breunau, Anastáz Opasek OSB. Der Laudator er wähnte auch die hervorragende Instrumentierung der Oper „Die Kleinstädter“ nach August von Kotzebue, für die Hader ange sichts des Verlustes der Original-
Schließlich lobte Gräf Haders grandioses und ohne jeden Zwei fel geniales Meisterwerk zum Li bretto von Rudolf Mayer-Frei waldau, die Oper „Jan Hus“. Die Oper sei ein Mammutwerk, das noch auf die komplette Urauffüh rung warte, Teile seien schon öf fentlich präsentiert worden. Ab schließend nannte Gräf die unter Haders Regie erfolgte Herausga be des zweibändigen „Lexikons zur Deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren, Sudetenschle sien“ mit jeweils etwa 800 Seiten und die Betreuung von zwei No tenarchiven – des Sudetendeut schen Musikinstituts und der Künstlergilde. In der Festschrift zu Haders 70. Geburtstag seien, so Gräf, die vielen Facetten sei nes Wirkens detailliert beschrie ben worden: „18 Artikel über den Komponisten, Musikpädagogen, Dirigenten, Organisator, Brük kenbauer im deutsch-tschechi schen Kulturaustausch und nicht zuletzt über den Schatzgräber nach wertvollen, aufführungs werten Werken böhmisch-mähri scher oder sudetendeutscher Komponisten.“
Zwei Komponisten aus die sem Dunstkreis standen im wei teren Verlauf der Veranstaltung noch im Mittelpunkt. Zum ei nen der 1770 in Prag geborene
Das Sojka-Streichquartett Pil sen und Josef Laszlo boten auch hiervon eine erstklassige Mu sikaufführung. Aufmerksamkeit galt schließlich dem nach sei ner Vertreibung in Regensburg lebenden und hier am 16. Ju li 1976 verstorbenen Komponi sten Heinrich Simbriger (* 1903 in Aussig). Anläßlich des 25jähri gen Bestehens der 1997 gegrün deten Heinrich-Simbriger-Stif tung richtete deren Vorsitzen der Christof Hartmann ebenfalls den Blick auf Widmar Hader. Ha der habe die Stiftungsgründung stark unterstützt und schließlich 23 Jahre lang dem Stiftungsvor stand angehört.
Die Erstellung von Simbrigers Werkverzeichnis und die Auf führung seiner Werke seien die Hauptaufgaben Haders und sei nes Vorstandskollegen Thomas Emmerig gewesen, der 2012 un ter dem Titel „Ich bin vor allem Komponist“ eine Biographie Simbrigers veröffentlicht habe.
Veranstalter des Festaktes war das Sudetendeutsche Mu sikinstituts in Kooperation mit der Künstlergilde und der Hein rich-Simbriger-Stiftung. Wegen der Schnittmengen – auch in der Person Widmar Haders –war das äußerst sinnvoll und auf schlußreich. Markus Bauer
Zusätzlich las er einen Aus zug aus seinem entstehenden Jugendbuch. Die Geschwister Max und Emma machen sich auf, um die Urne mit der Asche ih res Urgroßvaters in dessen Hei
mat zu bringen, wie er es in sei nem „letzten Willen“ gewünscht hatte. „Mein Jugendbuch soll in einem literarischen Roadmo vie moderne Versionen der Sa gen rund um Rübezahl bieten.“ Pasch las das Kapitel, in dem die beiden Kinder bei der Elbequelle nahe Spindlermühle dem „Geist“ der sagenhaften Prinzessin Em ma begegnen. Bei der Flucht ver
gessen sie glatt die Blechbüchse mit Uropas Asche an der Quelle. Gerne hätte man jetzt schon ge wußt, wie es weitergeht mit der Suche der Geschwister, der sich die „Rübezahleologin“ Melanie angeschlossen hat. Auch Paul Hansel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kulturwerk Schle sien, fand es interessant, wie al tes Wissen in ein neues Buch
eingebaut werden soll.
Die Museumspä dagogin des Sude tendeutschen Muse ums, Nadja Schwar zenegger, hatte darüber hinaus eine Vitrinenausstellung mit Skulptu ren aus Holz für die großen Be sucher und Mitmachaktionen für die kleinen Gäste vorbereitet. Materialien wie Holzblöcke zum Rübezahl-Gestalten luden die Kinder zum Basteln ein.
Dazu gab es passenden Ge sang von einem Duo der Grup pe „Rübezahls Zwerge“. Das Buf fet mit Schlesischem Streusel
Anfang November fand die Lan deskulturtagung der SL-Lan desgruppe Hessen im RoncalliHaus in Wiesbaden statt.
Zunächst begrüßte Landesob mann Markus Harzer die Landsleute sowie Gerhard Ober mayr, CDU-Stadtverordneten vorsteher der Landshauptstadt Wiesbaden, und Margarete Zieg ler-Raschdorf, Landesbeauftrag te für Heimatvertriebene und Spätaussiedler. Obermayr lob
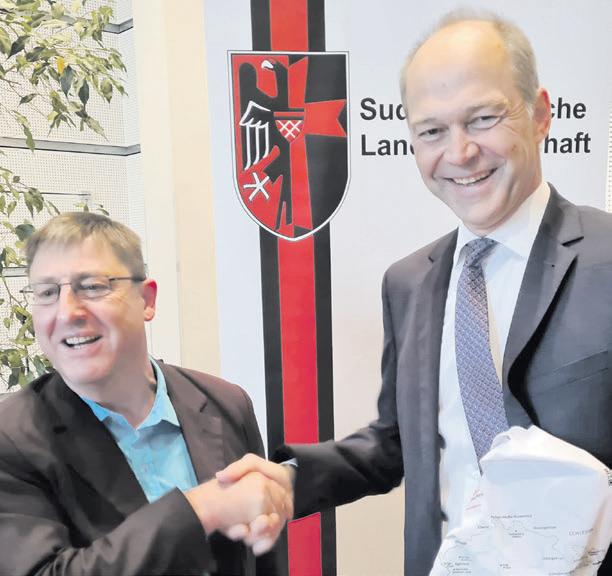
te die Lebensleistung der Hei matvertriebenen. Sie seien in all den Jahren eine spürbare Berei cherung für das Land Hessen ge worden. Wichtig sei, das zeige gegenwärtig die Ukraine, sich für die Durchsetzung der Men
schenrechte und gegen Entrech tung einzusetzen. Schon in der Charta der deutschen Heimat vertriebenen hätten sie sich für den Aufbau eines grenzenlosen Europas der Regionen ausge sprochen.
Die diesjährige SL-Kultur tagung konnte mit einem an spruchsvollen Programm auf warten. Dabei standen die Aufarbeitung des Vertreibungs geschehens mit Zeitzeugenbe richten, die Versöhnungsbereit schaft mit unseren östlichen Nachbarn und die Gewinnung Jugendlicher in Schulen für das Interesse geschichtlicher Geschehnisse über Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg im Mittelpunkt. Ein Dokumentarfilm der tschechi schen Pädagogin und Regis seurin Veronika Kupková ließ dabei Zeitzeugen im Grenz gebiet zwischen der Tschechi schen Republik und Deutsch land zu Wort kommen.
Wolfgang Spielvogel, Mar kus Harzer und Rainer Brum me gaben erste Informatio nen über das Schulprojekt
„Über unsere Schwellen hinaus“ im Rahmen der deutsch-tsche chischen Verständigung. Zwei Schulklassen aus dem hes sischen Ha nau und dem tschechischen Brünn unter suchen dabei mit ihren Ge schichtsleh rern das heuti ge Verhältnis der Nachbar länder unter dem Blickwin kel von Kennt nis und Vor urteil. Das Er gebnis soll bereits bald in Form mehrerer Dokumentarfilme zu gänglich gemacht werden.
Ein weiteres Thema war der Antisemitismus während des
Zweiten Weltkrieges. Isabel Ha selbach verglich in ihrem Refe rat „Der sudetendeutsche Oskar Schindler und Adolf Eichmann“ die unterschiedlichen Verhal tensstrukturen bei der Rettung und Vernichtung von Juden. In ihrem Grußwort hatte Mar garete Ziegler-Raschdorf ein gangs die zügige Umsetzung der Kenntnis se von Flucht und Vertrei bung in der Öffentlichkeit eingefordert. Sie bemängel te dabei die schleppende Aufarbeitung im schulischen Bereich. In die sem Zusam menhang wies sie auf die Vor teile einer all umfassenden Dokumentation dieses Themen bereiches in digitalen Portalen hin und sicherte finanzielle Un terstützung durch das hessische Innenministerium zu.
Auf ihrer Diözesantagung beschäftigte sich die Acker mann-Gemeinde (AG) der Diözese Rottenburg-Stuttgart Mitte Oktober in Schwäbisch Gmünd mit Versöhnungsge sten als zentralen Zeichen und Impulsen in Versöhnungs prozessen.
Drei Referenten sprachen über die Predigt von Pater Pau lus Sladek in Haidmühle 1955, den Kniefall von Willy Brandt in Warschau 1970 und die Bedeu tung von Gesten beim Versöh nungsprozeß in Burundi. Rainer Bendel, Geschäftsführer der Ar beitsgemeinschaft katholischer Vertriebenenorganisationen in Stuttgart, hatte die Tagung orga nisiert und leitete sie.
Otfried Pustejovsky ist ein Ur gestein der AG, Osteuropa-Hi storiker und katholischer Theo loge. 1946 hatten die Tschechen ihn mit seiner Familie aus dem mährischen Fulnek nach Bay ern vertrieben hatten. Seit 1960 beschäftigt er sich intensiv mit der Geschichte der Böhmischen Länder und der Zeitgeschichte der Tschechoslowakei, auch mit den neuesten tschechischen For schungen. Er sprach über die viel zu wenig bekannte theologischpolitische Versöhnungspredigt, die Pater Paulus Sladek am 5. Au gust 1955 in Haidmühle nur zehn Meter vom Zaun zwischen den Blöcken an der tschechoslowakischen Grenze entfernt hielt. 50 Busse hatten 700 ver söhnungsbereite Landsleu te dorthin gebracht.
Pustejovsky klärte zu nächst die Verständnisvor aussetzungen. Die Wur zel des Wortes Versöh nung sei Sühne leisten, was mit Worten und Ta ten, in gegenseitigem Ge ben und Nehmen dialo gisch geschehen müsse. Schwer sei, nach einem Verge hen oder Verbrechen die eigenen individuellen und kollektiven Er kenntnisgrenzen zu überschrei ten und fähig zu werden, eigene Schuld anzuerkennen, wie es bei spielsweise die polnischen, weni ger die deutschen Bischöfe 1965 getan hätten. In einem Streif zug durch die Geschichte nannte der Referent Beispiele für fried liche Annäherungen nach Un taten. Immer seien davor die Er kenntnis und das Eingeständ nis eigener Schuld, der Verzicht auf Rache und Vergeltung, die Überwindung innerer und äuße rer Grenzen gestanden, immer auch die Erkenntnis, daß man den ersten Schritt tun müsse, oh ne zu fragen, ob die andere Seite gleichziehen werde, denn es ge he um künftigen Frieden, nicht um Vergeltung.
So habe auch Sladek nach Vor stößen von Přemysl Pitter und
General Lev Prchala radikale Ge wissenserforschung bis in die lange Vorgeschichte beider Völ ker betrieben und Verblendung durch verächtliche Überheblich keit bei den Sudetendeutschen gegenüber ihren tschechischen und jüdischen Nachbarn einge räumt. Auch wenn beide Seiten schuldig geworden seien und das Herz sich hüben und drüben oh ne Aufrechnung wandeln müs se, hätten dennoch nunmehr die böhmischen Vertriebenen die ei gene und die Schuld ihres Volkes zu bekennen, so Sladek damals in seiner wegweisenden Pre digt, die eine Versöhnungsge ste gewesen sei. Nur über Chri stus gehe der Weg zurück in die Heimat, eine Aufgabe für Alte und Junge bis heute, so Puste jovsky konkret für das Hier und Heute.
Martin Sprungala, dessen For schungsarbeit den Fokus auf die lokale und regionale Geschich te westpolnischer Grenzbereiche richtet, thematisierte in vielen Publikationen das Zusammenle ben von Deutschen und Polen, Katholiken und Protestanten.
Dort sei Brandt unerwartet auf die Knie gesunken, eine sponta ne, nicht vom Protokoll diktier te Geste, die als Bitte um Verge bung im Namen Deutschlands für die Verbrechen gegen das jü dische Volk verstanden worden sei.
In der BRD sei Brandts Knie fall fast durchweg positiv aufge nommen worden. Nur die kon servative Presse habe die Ge ste wie auch Brandts Ostpolitik abgelehnt. Die Polen hätten sehr zurückhaltend reagiert, so Sprungala, die Medien hätten verfälschend mit einem Foto be richtet, auf dem es ausgesehen habe, als kniete Brandt vor ei nem polnischen Soldaten. Hin tergründe dafür seien die von der Propaganda forcierte antideut sche Stimmung in der Bevölke rung, die Folgen der antisemi tischen Kampagne um 1968 so wie die Entmachtung Władysław Gomulkas, des Chefs der Polni schen Vereinigten Arbeiterpar tei, gewesen.

Der neue Machthaber Ed ward Gierek habe in der Folge zeit zwar eine wirtschaftliche
Fakultät der Universität Frei burg und Mitinitiator der Frei burger Friedensgespräche.
Bei den Friedensgesprächen versuchen im Exil lebende Po litiker aus verfeindeten afrika nischen Ländern, miteinander in einen Dialog zu kommen. Maru hukiro forschte und publizierte über Frieden und Versöhnung in Burundi.
Sein Heimatland, so Maru hukiro, sei kleiner als BadenWürttemberg und habe 11,5 Mil lionen vor allem junge Einwoh ner. Burundi habe nach seiner Unabhängigkeit im Jahr 1962 ei ne Reihe von Bürgerkriegen er lebt, die Verletzungen und Trau mata hinterlassen hätten.

Eine Friedenskultur könne man aufbauen, wenn bestimm te Voraussetzungen gegeben sei en, ist der Pater überzeugt. „Oh ne gute Regierungsführung, oh ne Armutsbekämpfung und ohne Einsatz von Gerechtigkeit durch eine gut funktionierende Justiz sind alle Bemühungen um Frie den und Versöhnung zum Schei tern verurteilt.“ Versöhnung sei in einer Diktatur, wie sie derzeit mit fortwährenden Verletzungen der Menschenrechte in Burun di herrsche, nicht möglich. Denn zum Versöhnungsprozeß gehör ten nicht allein die Kontakte der Menschen untereinander, son dern auch die politische Di mension. Die Therapie der Gesellschaft als Ganzes sei wichtig, sie fange mit der Begegnung zwischen den Menschen an und setze sich über die Trauma-Bear beitung, die Erziehung und Bildung für die junge Ge neration fort. Zukunft las se sich nicht aufbauen, oh ne des Vergangenen zu ge denken.


Anfang November fand im Musikhotel Goldener Spatz in Jeßnitz das traditionelle Hei mattreffen der sachsen-an haltinischen SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld statt.
Willy Brandts Kniefall sei auch in der Bundesrepublik nicht un umstritten gewesen, ebenso we nig wie seine Ostpolitik. Als der geschichtliche Verlauf aber ge zeigt habe, daß sie zum Erfolg geführt habe, habe dies die Geste gestärkt und sie in Deutschland unangreifbar gemacht. Brandts Kniefall sei zum Narrativ der BRD und als Versöhnungsgeste empfunden worden.
Faktisch hätten Bundeskanz ler Brandt und Ministerpräsi dent Józef Cyrankiewicz am 7. Dezember 1970 im Radziwill-Pa lais den Warschauer Vertrag un terschrieben, der das Verhält nis zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen ha be regeln sollen. Teil des Staats besuchs seien zuvor die Kranz niederlegungen am Grabmal des unbekannten Soldaten und am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos gewesen.
Öffnung nach Westen betrieben, aber kein Interesse an einer Aus söhnung mit Deutschland ge habt. In offiziellen Reden, Ge sprächen und Pressekonferen zen sei der Kniefall nicht erwähnt worden. Im Osten wie im Westen sei dem Ereignis wenig Bedeu tung beigemessen worden. Zum 30. Jahrestag habe Deutschland des Kniefalls mit einem Denkmal für Brandt an der Stelle in War schau gedacht. Damals habe Po len der EU beitreten wollen und der Höhepunkt der guten Bezie hungen geherrscht. Zum 50. Jah restag sei mit einer Briefmarke und einer Gedenkmünze daran erinnert worden. Unter der PISRegierung sei Brandts Kniefall heute dagegen eine unerwünsch te Erinnerung.
Pater Deogratias Maruhukiro ist Forschungsassistent am Lehr stuhl für Caritaswissenschaft an der Katholisch-Theologischen
Nach seiner Priesterwei he habe er mit Mitstreitern 2007 in der burundischen Hauptstadt Bujumbura ein Friedens- und Wallfahrtszen trum mit der Gottesmutter als Königin der Versöhnung einge richtet. Die bis dahin getrennte Kirchen besuchenden Hutu und Tutsi hätten so an einem Ort ver eint und die Besucherzahlen in den sonntäglichen Gottesdien sten gewaltig gesteigert werden können.
Der Verein Sangwe, auf deutsch Willkommen, betreibe dort bis heute eine kirchlich in itiierte Willkommens- und Be gegnungskultur mit dem Ziel, Spannungen und Konflikte zu vermeiden und abzubauen. Dem dienten gemeinsame Sportver anstaltungen, Friedenscamps mit Tanz und Trommeln, Versöh nungsarbeit durch Theaterauf führungen beispielsweise mit zu rückkehrenden Flüchtlingen und daheimgebliebenen Dorfbewoh nern sowie interregionale Frie densfestivals. Stefan P. Teppert
Auch wenn die Teilnehmer zahlen durch Alter, Krank heit oder Tod sinken, wird an den traditionellen Veran staltungen festgehalten. Die se Heimattreffen haben eine lange Tradition, und so konn te auch SL-Kreisobfrau Anni Wischner wieder etliche Gäste begrüßen, die sich dieses Hei matfest nicht entgehen lassen wollten.
Wie immer war der erste Teil des Treffens den persön lichen Gesprächen vorbehal ten. Man möchte sich ja wie der einmal untereinander aus tauschen, was es Neues gibt seit dem letzten Treffen. Da zu gab es Kaffee und Kuchen, was dieses Treffen noch ange nehmer machte.
Der Höhepunkt war dann „Das große Fest der Volks musik“, das sich an die Ge sprächsrunde anschloß. Prä sentiert wurde dieses von Angela Novotny, der Che fin des Hauses, die alle dar auf einstimmte. Volksmu sik und Heimattreffen pas sen gut zusammen. Denn Volksmusik wurde auch in der Heimat gemacht und gerne gehört.
Zu Gehör brachtendie Volksmusik Angela Wiedl mit Tochter, der „Ur“-Schä
fer Uwe Erhardt und der Star tenor Richard Wiedl. Sie bo ten Volksmusik auf hohem Ni veau. Dabei fehlte auch das Jodeln nicht. Viele Melodi en konnten mitgesungen wer den. Inspiriert dazu wurden alle Gäste durch die Sänger, die sich auch durch das Publi kum bewegten.
Das war wieder einmal ein schönes Heimatfest, das al len gut gefallen hat, zumal sich die Darbietenden bei den Gästen persönlich mit Hand schlag verabschiedeten. Für die gelungene Veranstaltung bedankte sich die Kreisobfrau Anni Wischner bei den Sänge rinnen und Sängern. An die ser Stelle gilt unser Dank An ni Wischner, die dieses Hei mattreffen organisiert hatte, und Angela Novotny und ih rem Team, die für die kulturel le Umrahmung und die gastro nomische Betreuung gesorgt hatten.
Klaus ArendtBereits zum 54. Mal fand in der Babenbergerhalle in Klo sterneuburg, seit 1964 Paten stadt der Sudetendeutschen Landsmannschaft Öster reich (SLÖ), das Niederöster reichisch-Sudetendeutsche Volkstanzfest Leopolditanz Anfang November statt.


Dieses Fest wird alljährlich in Zusammenarbeit zwi schen der Volkstanzgruppe Klosterneu burg und der Sudetendeut schen Jugend Österreichs und mittle re Generation durchgeführt.


Die Tische wa ren herbst lich mit bun tem Laub und wohlriechen den Äpfeln geschmückt.
Diesmal gab es keiner lei CoronaVorschriften wie zum Bei spiel die Mas kenpflicht, und es konnte ein guter Be such verzeich net werden.
Die Tischplät ze waren zu 98 Prozent be reits Wochen zuvor verge ben, und es mußten Besu cher sogar auf dem Balkon untergebracht werden. Die Stimmung war wie immer be stens, und das Tanzbein wur de fleißig ge schwungen –nicht zuletzt dank der überaus guten Musik. Diesmal klappte auch die Bewirtung sehr gut, was erfreulich war.
Der Besuch von unserer Sei te war etwas schwächer als im Vorjahr. Begrüßt wurde Professor Erich Lorenz, der Landesobmann des SLÖ-Landes verbandes Wien, Niederösterreich und Burgenland. Gekommen war auch Inge Wallec zek, die Obfrau der Heimatgruppe Kuhländchen-NeutitscheinBärn. Unsere stärkste Gruppe war wie im Vorjahr der Wie ner Sudetendeutsche Volks tanzkreis, der sich im Haus der Heimat regelmäßig alle zwei Wochen zu Übungsaben den trifft. Eigentlich hätten wir auch von anderen Heimat gruppen Teilnehmer erwar tet, hier muß weiter angesetzt

werden. Der Bürgermeister von Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager, eröffne te mit launischen Worten die se Veranstaltung.
Die erste Pause gestaltete der Leiter einer Klosterneu burger Tanzschule. Mit al len Gästen wurden die ersten Schritte des lateinamerikani schen Gesellschaftstanzes Sal sa einstudiert. Die einzelnen Tanzfolgen wurden vorgeführt und von allen nachgetanzt und zwar fast fehlerlos. Al len hat es rie sigen Spaß ge macht, ein mal auch so einen Tanz zu probieren. Das war wirk lich eine sehr gute Einlage.
Im Übrigen hat dann der Tanzschullei ter bei allen anderen unse rer Volkstänze gekonnt mit getanzt.

In einer weiteren Pau se traten dann Kinder im Al ter von knapp drei bis zwölf Jahren auf. Mit diesen wurden vier leichtere Tän ze zwischen der ersten und zweiten Pau se geprobt, und das Er gebnis war bestens: Mit viel Schwung machten die Kinder mit, und der lang anhaltende Beifall war die Belohnung da für. Bis kurz vor Mitternacht wurde noch fleißig getanzt, und mit einem großen Schluß kreis und einem gemeinsamen Lied wurde dieses gelungene Brauchtumsfest be endet.
Die Vorberei tungen für das 55. Fest werden bald beginnen, dieses wird voraussicht lich am 4. Novem ber 2023 stattfin den. Dazu erwarten wir von allen sude tendeutschen Glie derungen Vertreter in unserer Patenstadt, was uns sehr freu en würde – eine bessere Ge legenheit zum Repräsentie ren gibt es nicht oft. Gleichzei tig möchten wir all jenen, die das Fest mit einer Spende un terstützt haben, recht herzlich danken. Ohne diese wäre die Durchführung nicht möglich gewesen.
Der 1948 gegründete Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken hatte für Anfang November zu seiner Herbsttagung ins Christ königshaus nach Stuttgart-Ho henheim mit Themen der Erin nerungstradition geladen, die ebenso alt sind wie er selbst. Rainer Bendel, Geschäftsfüh rer der Arbeitsgemeinschaft ka tholischer Vertriebenenorgani sationen (AKVO) in Stuttgart, hatte die vom AMK-Fonds der Deutschen Bischofskonferenz geförderte Tagung organisiert und leitete sie.
Beáta Katrebov Blehová stellte die Arbeit des Instituts für das nationale Gedächtnis (Pramet naroda) in Preßburg vor, dem sie als Wissenschaftle rin angehört. Die Tä tigkeit ihres nicht staatlichen Insti tuts bezieht sich auf die sogenannte Zeit der Unfreiheit unter kommunistischer Herrschaft in der Tschechoslowakei von 1939 bis 1989. Gegründet wurde das Institut am 28. September 2002 von Ján Langoš, einer führenden Persön lichkeit der slowaki schen Dissidenten bewegung, nach der Samtenen Revoluti on letzter Innenmi nister der ČSFR und nach Grün dung der Slowakei Abgeordneter des Nationalrates. Bis zu seinem Tod 2006 bei einem nicht von ihm verschuldeten Autounfall war Langoš Direktor des von ihm gegründeten Instituts für das Ge dächtnis des Volkes.
Die Referentin verdeutlich te den Umfang der staatlichen Überwachung. Dem Agentur netz der Staatssicherheit hätten 40 000 aktive geheime Mitarbei ter angehört. Anfang Dezember 1989 habe die umfassende Ver nichtung ihrer Akten begonnen, um Beweise für die teils verbre cherische Tätigkeit ihrer Orga ne aus dem Weg zu schaffen. Un ter dem Druck der Öffentlichkeit habe die wilde Aktenvernichtung am 8. Dezember zwar gestoppt werden können, jedoch sei der Verlust des historischen Materi als bereits so beträchtlich gewe sen, daß man heute manche Ak ten über ehemalige Dissidenten, Mitglieder der geheimen Kirche oder Exilpersönlichkeiten nicht mehr vollständig rekonstruieren könne.
Die wesentliche Aufgabe ih res Instituts, so Blehová, beste he in der Aufarbeitung der Ver gangenheit und ihrer Bewälti gung. Zur Erforschung, Analyse
und Bewertung der Zeit der Un freiheit gehörten Datenbanken, die Sammlung und systemati sche Archivierung von Quellen, die Zusammenarbeit mit Opfern, Partnerinstitutionen und der Po litik, Publikationen, Konferenzen sowie eine eigene Institutszeit schrift.
Für die besondere Beobach tung der Karpatendeutschen wählte die Referentin das Bei spiel des Redakteurs der „Preß burger Zeitung“ Anton Birkner. Sie stellte dar, wie eine Abteilung ihres Instituts den Beweis akti ven antikommunistischen Wi derstands zu führen versucht, um finanzielle Kompensationen zu rechtfertigen. Zugleich zeigte sie die Schwierigkeiten bei der Um
gelische Kirche böten humani täre Hilfe, psychologische Be ratung, Unterstützung bei der Suche nach Wohnung, Arbeit, Schule und Kindergarten, Slowa kisch-Kursen sowie Freizeitakti vitäten.
Monsignore Prachár ließ die sen Ausführungen einige Stim men christlicher Politiker sowie den Stand der öffentlichen Mei nung zum Flüchtlingsproblem in der Slowakei folgen. So stünden einer großen Hilfs- und Opferbe reitschaft Verschwörungstheori en in den sozialen Netzwerken, die Irritation durch die luxuri ösesten Autos sowie Assoziatio nen zu den ersten Erfahrungen mit Ukrainern nach 1989 wie Ma fia, Brandstifter, Halsabschnei
Diktatur des Ludaken-Regimes mit eigener rechtsextremer Ideo logie existiert.
Szabo stützte sich bei seinen Ausführungen auf Roger Griffins Definition des Faschismus von 1991. Faschisnus sei eine popu listisch-ultranationalistische, auf Neugeburt ausgerichtete Ideo logie, die das eigene Volk nicht nur in den Vordergrund, sondern über alles stelle. Sie sei ein Parti kularismus, der mit dem kanoni schen Universalismus des Chri stentums schwer zu vereinbaren sei. Trotzdem habe es Versuche einer Synthese gegeben, begün stigt vor allem durch die Front stellung gegen gemeinsame Feinde: die Juden und das kom munistische Neuheidentum.
Klerikaler Fa schismus sei ein po lemischer Begriff, der sich seit seiner Entstehung in Itali en um 1930 auf die Mitwirkung kirch licher Amtsträger beim Aufbau fa schistischer Regime in Europa und La teinamerika bezo gen habe. Er existie re nicht real oder als Ideologie, sondern lediglich durch sei ne Akteure, einzel ne Kleriker, die der Versuchung politi scher Radikalisie rung erlegen seien.
setzung dieser 2006 gesetzlich geregelten Bemühungen auf, et wa durch Überlastung des Perso nals im Institut oder mangelhafte Beweislage.

Monsignore Marián Prachár aus Karlburg, einem Stadtteil im Süden Preßburgs mit 4200 Ein wohnern, befaßte sich mit ukrai nischen Flüchtlingen in der Slo wakei als Aufgabe der Kirche. Seit März seien in seinem Land 357 000 Asylanträge gestellt wor den. Von 834 805 eingereisten Flüchtlingen seien 604 734 wie der zurückgekehrt. Demnach seien in der Slowakei rund 85 000 Geflüchtete vorübergehend ge blieben, die nicht nur aus der Ukraine gekommen seien, son dern 16 005 aus Serbien, Viet nam, Rußland und der Volksre publik China.
Die griechisch-katholische Kirche in der Ostslowakei sowie die Slowakische Katholische Ca ritas seien die ersten gewesen, die geholfen hätten, so Prachár. Außer von der Caritas werde Hil fe auch von Pfarreien, Kirchen gemeinden, Seelsorgezentren sowie verschiedenen Ordensge meinschaften und Klöstern –zum Beispiel Salesianer und Kar meliter – geleistet, aber auch die Malteserritter und die Evan
der“, Schmuggler und Autodiebe gegenüber. Aus wirtschaftlicher Sicht werde die slowakische Mi grationspolitik nicht als Bedro hung, sondern bei guter Rege lung als Chance für die Weiter entwicklung von Beschäftigung, Lohnwachstum und Lebensstan dard empfunden.
Der Referent rundete seine Darstellung mit der unpolitischfriedfertigen Stellung der ka tholischen Kirche zum (Ukrai ne-)Krieg und den Appellen von Papst Franziskus, die Spira le von Gewalt und Tod zu stop pen, ab. In Rußland dagegen be nutze Patriarch Kyrill die gleiche militante Rhetorik wie Wladi mir Putin. Während die Russen in der Ukraine sowohl russischals auch ukrainisch-orthodoxe Kirchen bombardierten, fordern ukrainische Christen seine Ex kommunikation.
Professor Miloslav Szabó, ei ner der renommiertesten slowa kischen Historiker, betrachte te die Geschichte der politischen Radikalisierung, insbesondere des katholischen Klerus, zur Zeit des Slowakischen Staates 1939 bis 1945. Dieser historisch er ste Nationalstaat der Slowaken habe auf Druck des Deutschen Reiches als ultranationalistische
Alois Hudal (1885–1963) sei die prominenteste und um strittenste Figur in der Slowa kei. Szabó nannte auch Andrej Hlinka (1864–1938), Jozef Ti so (1887–1947) und Franz Kar masin (1901–1970) als klerika le Faschisten, um sich dann aber Karol Körper (1894–1969) und insbesondere Josef Steinhübel (1902–1984) zuzuwenden.
Steinhübel sei schon in den 1930er Jahren eine repräsentati ve Figur der karpatendeutschen Partei gewesen und als einziger Deutscher im Preßburger Parla ment gesessen. Wegen seines an die Ideologie der Nationalsoziali sten in Deutschland angelehnten Einsatzes für die Anliegen, Nöte und Interessen der Deutschen in der Slowakei sei er 1945 inhaftiert und zum Tode verurteilt, schließ lich aber begnadigt und 1955 in die BRD entlassen worden. Dort sei er zum Vertriebenenseelsor ger im Bistum Rottenburg-Stutt gart ernannt worden und habe sich für den Hilfsbund Karpa tendeutscher Katholiken engagiert. Szabó betonte abschlie ßend, keine Antworten oder fer tigen Urteile
den behandelten
zu haben, sondern fortdauernde Fragen.
Stefan P. Teppert zu ProtagonistenAnfang November feierte der deutsche Kulturverband (KV) Graslitz sein großes Herbstfest. Margaretha Michel, Obfrau der SL-Bezirksgruppe Oberfran ken, Stellvertretende Obfrau der SL-Landesgruppe Bayern, Mit glied des SL-Bundesvorstandes und jüngstes Mitglied des KV Graslitz, besuchte mit Andreas Schmalcz von der Geschäftsstel le der SL Bayern das Herbstfest. Sie berichtet.


Eine miserable Wettervoraus sage! Im Erzgebirge könn te es schon schneien, geht es mir durch den Kopf. Die letzten An kündigungen sind etwas freund licher. Bei Kloster Speinshart reißt der Nebel auf, ich brauche die Sonnenbrille zum Fahren. Rechts und links säumen Bäu me mit buntem Laub die Straße. Waldsassen bückt sich wieder et was unter den Nebel. In Heili genkreuz in der Apotheke kaufe ich ein. Leider sind auch wieder mehr Produkte vom indischen Markt. Hier am Fidschimarkt geht es zu wie verrückt. Bereits um zehn Uhr vormittags drän geln sich überall Autos, dann kommt auch noch ein Bus aus Bamberg.
Angenehm ist, daß man gleich hinter dem Markt Richtung Karlsbad abbiegen kann und rasch die Schnellstraße erreicht. Wir freuen uns auf einen Kaffee auf dem Marktplatz in Ellbogen. Doch auch dieser ist voller Au tos. Wir machen eine Rundfahrt außen um die Stadt. Es geht zu rück nach Altsattel und schon kommen die Hinweise Sokolov und Kraslice, also Falkenau und Graslitz. Teilweise ist die Straße dort, wo es einst Braunkohleab bau gab, gerade, dann folgen wieder viele Kurven.
Als es wieder etwas geradeaus geht, erscheint das untere Ende von Graslitz. Schließlich landen wir in der Gaststätte Krista und finden dort die anderen Lands leute aus Lichtenfels und Kulm bach. Wie diese genehmigen wir uns eine Suppe zum Kaffee.
Um das Kulturhaus in Gras litz hat man einiges renoviert. Wir finden einen gute Parkmög lichkeit, und auch das Kulturhaus wirkt nach der Reno vierung ein ladender.
Der Saal ist festlich ge schmückt und schon jetzt ziemlich voll. Junge Leute – wir werden spä ter erfahren, daß sie Gym nasiasten aus Falkenau sind –helfen überall mit. Einige spre chen gut Deutsch. In der Nähe der Bühne sind Plätze für uns re serviert.
Am Nachbartisch sitzen die Offiziellen wie Jan Šimek, Bür germeister von Graslitz, Michal Červenka, Bürgermeister des nahegelegenen Ortes Rothau, und Rita Skalová, Bürgermeiste rin von Wildstein. Bei ihnen sitzt auch der Vorsitzende des Deut schen Kulturverbandes aus Prag, Radek Novák, der später in sei
ner Ansprache mit weiter erwor benen Deutschkenntnissen glän zen wird.
Ziemlich pünktlich beginnt die Veranstaltung. Zusätzlich zu den bereits genannten wer den noch Gäste aus Klingenthal, Schneeberg und weiteren Orten begrüßt. Flott führen Horst und Regina Gerber in das Programm ein. Man merkt kaum, daß alles in zwei Sprachen verkündet wir. Es folgen einige Grußworte der Offiziellen, und Jan Šimek aus Graslitz begrüßt die Anwesenden herzlich in flüssigem Deutsch und lobt dabei die Bedeutung der Arbeit des Kulturvereins für die Stadt.
Die Graslitzer Musikschule führt drei Tänze auf. Alles ist von besonderer Qualität. Die Kinder und jungen Mädchen gewannen ja auch 2022 zum zweiten Mal die Meisterschaft in der Tsche chischen Republik. Einen wei teren Hö hepunkt bringt Ti ni Kůtková aus Eger. Sie mach te heuer Abitur und studiert jetzt neue Sprachen in Prag. In perfektem Deutsch kündigt sie ihre Songs an, die sie in den Original sprachen singt. In den Liedern bringt sie verschiedene Nuan cen zum Ausdruck, teils dahin schmelzend wie in Franz Schu berts „Ave Maria“, teils mitrei ßend wie in Frank Sinatras „New York, New York“.
Das Mundharmonikaorche ster „Uhu“ aus Klingenthal, lei der ohne den erkrankten Dirigen ten Jürgen Just, entführt die Gä ste mit wohlbekannten Melodien in ihre Jugendzeit. Anschließend fasziniert Matěj Tvrz mit flotten Melodien auf seiner Knickblock flöte und am Keybord.
Akkordeonspieler Richard Wunderlich begleitet die Sänge rin Yvonne Deglau, die mit einem
rin Sonja Šimánková war. Sonja Šimánková wiederum ist mit ih rem Bruder Petr Rojík der Motor des Graslitzer KV.
Zunächst servieren uns Falke nauer Gymnasiasten süße Teil chen wie mit geschlagenem Ei weiß gefüllte Schaumrollen und kleine Krapfen sowie Erfri schungsgetränke und Kaffee. Später bringen sie noch reichlich mit Schinken und Ei belegte Bro te und schenken Bier und Wein aus.

Zur steigenden Stimmung passen die größtenteils wohl be kannten Melodien der Altprager Musik von Vladimír Pecháček an der Geige, Michal Žára am Kon trabaß und Radek Anděl am Ak kordeon. Allerdings werden auch Parodien in Tschechisch einge streut. Hier muß man schon fun dierte Sprachkenntnisse haben, um die Pointen zu verstehen. Das tut der Stimmung im Saal jedoch keinen Abbruch, und auch die Gäste aus Neu traubling, vom Se niorenver ein Klin genthal und vom deutschtschechi schen Kul turverein Potok aus Schneeberg und Aue schunkeln mit voller Kraft mit.
Allmählich wird es draußen düster. Das bunte Laub, das man vor den Fenstern sieht, verliert seinen Glanz. Und schon wird verkündet: „Die Busse nach Rot hau und Klingenthal fahren bald los.“ Und dann muß das Organi sationsteam wieder antreten. Al les, was vorher so liebevoll auf gebaut worden war, muß wieder aufgeräumt werden.
Da es früh dunkel wird, fah ren wir diesmal nicht gleich nach Hause. Es war schwierig noch kurzfristig ein Quartier zu be stellen für uns fünf Personen aus Oberfranken. Aber im benach barten Klingenthal bekamen wir in einem ku scheligen Hotel Zim mer.
Liederkranz von den 1920er bis zu den 1990er Jahren glänzt. Die meisten Anwesenden singen mit, und die beiden erhalten wieder holt reichhaltigen Applaus.
Eine Besonderheit der Ver anstaltung ist die Bewirtung der Gäste. Die Speisen und Geträn ke sind eine Spende des Catere ra Josef Štícha, seit Oktober Bür germeister von Zbiroh und mit hin der vierte Bürgermeister im Saal. Er war einst im Gym nasium in Rokitzan ein Schüler der ehemaligen Deutschlehre
Sonntags morgen lich tet sich bald der Nebel. In Graslitz noch ein kurzer Blick in die Kirche. Mon signore Pe ter Fořt hält die Messe. Seine mar kante Stim me ist noch an der Kirchentür deutlich zu hören. Petr Rojík or gelt wie jeden Sonntag in dieser und anderen Kirchen. In Falke nau am Markplatz noch ein kur zer Halt. Das eine Auto nimmt den Weg über Maria Kulm. Das andere steuert direkt nach Lich tenfels. Unseren Geschäftsführer Andreas Schmalcz setze ich am Bahnhof in Pegnitz ab. In der Er innerung bleibt ein schönes Tref fen mit Freunden in der Heimat. Ebenso bleibt die Freude, neue Freunde gewonnen zu haben.
Mitte November erhielt das Ege rer Stadtmuseum den restaurier ten Egerer Ofen von Willy Ruß.
Am 7. Juni 1887 kam Willibald „Willy“ Ruß in Schönfeld bei Elbogen zur Welt. Er besuchte die Fachschule für Keramik in Te plitz-Schönau und studierte Bild hauerei an der Wiener Kunstge werbeschule. Ab 1906 arbeite te er für die Wiener Werkstätte und ab 1910 als freischaffender Künstler in Wien. Nachdem er Anna Ruppert geheiratet hatte, kehrte er nach Schönfeld zurück und richtete sich dort eine kera mische Werkstatt ein.



Ruß schuf Art-Déco-Ge brauchskeramik und -Figu ren, Kruzifixus- und Mari endarstellungen, aber auch Entwürfe für Denkmale wie das Goethe-Denkmal in Marienbad. Das wohl be kannteste Werk ist jedoch sein Egerer Ofen, der nach jahrzehntelangem Marty rium und dreijähriger Re staurierung der Öffentlich keit übergeben wurde.

Nun versammelten sich rund 40 Menschen, um bei dem historischen Augen blick dabei zu sein. Nach einem Musikstück des Ascher Akkordeonspielers Patrik Labickin begrüßte Michal Beránek vom Ege rer Museum die Gäste. Nach einer kurzen Einlei tung sprach Museumsdi rektorin Martina Kulová. „Ich habe den Ofen zum ersten Mal 2016 gesehen, als ich überlegen mußte, wie wir ihn aus den Kase matten der Egerer Burg ins Mu seum kriegen.“ Den Fachvortrag über den Ofen trug Iva Votroub ková vor. Ihre ersten Worte wa ren eine Liebeserklärung an den Ofen: „Ich stamme aus Pardubitz, aber nachdem ich die Ofentei le im Kohlehaufen auf der Elbo gener Burg gesehen hatte, wurde der Ofen sofort zu meiner Her zenssache.“


Die Geschichte des Kachel ofens spiegelt die Geschichte des Egerlandes. Im Auftrag des Päd agogen und Ethnographen Jo sef Hanika schuf Ruß ein welt weit einzigartiges Werk, welches dem Museumsbesucher an ei nem einzigen Exponat das gan ze Volkstum des Egerlandes zei gen sollte. Eigentlich sollte der Ofen den 140 Quadratmeter gro ßen Ausstellungsraum beheizen. Der riesige Ofen ist 286 Zenti meter lang, 145 Zentimeter breit und 238 Zentimeter hoch. Die Idee entstand im März 1941, also im Krieg. Ab Mai 1941 wurde mit dem Sammeln von Geldern be gonnen. Die Gesamtkosten be liefen sich auf 12 000 RM, daran

beteiligte sich die Stadt Eger mit 3000 RM. Die Zusage der Gelder kam erst im Oktober 1941, der Künstler arbeitete aber schon seit dem Frühjahr daran. Der Sockel wurde als klassischer Ofen ge baut, der eigentliche Ofen wur de aber als bildhauerisches Werk aus Ton geschaffen. Dann zer sägte Ruß den Ofen und brannte die einzelnen Teile.
Die detaillierten Informatio nen über Trachten, Bräuche und Sitten sowie Lebensabschnitte eines Egerländers schöpfte Wil ly Ruß aus dem Buch „Deutsche Volkstrachten und Volksbräu che Westböhmens“ vom Karlsba der Lehrer und Volkskundler Jo
sef Hofmann. Die Farben wurden von Gustav Zindels Bildern oder aus den kolorierten Fotos vom Karlsbader Anton Drumm ent nommen. Im Oktober 1944 wur de der Ofen fertiggestellt und sollte in Eger aufgestellt werden.
Wegen der Bombardierung der Stadt wurde das Lebenswerk Ruß‘ jedoch in seinem Atelier in Schönfeld gelassen. Weil es aber nicht beheizt war, war eine große Gefahr, daß die einzelnen Keramikteile zu Schaden kom men könnten. Es kam aber noch schlimmer. Mit den sogenann ten Beneš-Dekreten wurde Willy Ruß enteignet, und sein ganzes Werk gehörte ihm nicht mehr.
1946 wurde Willy Ruß mit sei ner Familie aus dem Egerland nach Unterfranken vertrieben, wo er zunächst in Irmelshau sen, dann ab 1955 in Kleinbar dorf und schließlich ab 1963 in Merkershausen lebte. Finanziel le Engpässe und gesundheitliche Einschränkung ließen ihn bis zu seinem Tod 1974 nicht mehr an seine frühere Schaffensphase an knüpfen.

Im Februar 1946 stellte das Museum in Eger die Anfrage, ob man den Ofen dort aufstellen könne, wohin er ursprünglich ha be kommen sollen. Mittlerweile war der Ofen in Elbogen in der „Aufbewahrung“ gelandet. Aus Elbogen kam jedoch keine Ant wort, und der Ofen wurde 1948 bis 1952 im Rittersaal der Elbo gener Burg gezeigt. Das Egerer Museum schrieb und schrieb, aber Elbogen spielte toter Kä fer. 1972 wurde der Ofen we gen seiner „ideologischen Bela stung“ wieder von dort entfernt. 1982 kam ein Telefonat aus El bogen ins Egerer Museum: „Wir haben etwas für Sie im Keller.“ Nach der Reinigung nicht nur von der Kohle, in wel cher die Einzelteile „ge lagert“ waren, wurde der Ofen 1994 in den Kasemat ten der Egerer Burg ausge stellt, jedoch konnte ihn je der anfassen und weitere Beschädigungen folgten. Im Jahr 2020 beschloß man, den Ofen erneut grundlegend zu restaurie ren. Der Bezirk Karlsbad stellte 1,2 Millionen Kro nen zur Verfügung, und die Renovierungsarbei ten konnten beginnen. Die Prager Künstlerin Sylva Antona Čekalová und der Restaurator Michal Raušer brauchten dann fast drei Jahre, bis das Prachtstück fertig war. Der Grund war nicht nur Corona, sondern auch die Tatsache, daß die einzelnen Keramik-Tei le in der Egerer Burg mit Zement verbunden wor den waren und wegen der nicht ordnungsgemäßen Lagerungen Salze in die Masse eingedrun gen waren. Nicht vergessen soll te man den Rechtsstreit zwischen der Stadt Elbogen und Eger, der auch Jahre dauerte, denn Elbo gen wollte den Ofen zurückha ben.
Sylva Antona Čekalová sagte bei der Enthüllung: „Ich kenne keine andere so gute und präzise Arbeit, die eine solche Behand lung ausgehalten hätte. Dieser Ofen ist einfach ein Wunder werk.“ Für uns Egerländer ge hört der Volkstumsofen von Wil ly Ruß zu unserem geistigen Er be, das wir nur noch auf Fotos und Bildern erkunden konnten, doch jetzt wieder in 3 D bewun dern können. Mit der Darstel lung unserer Trachten aus dem weiten Egerland haben wir sie plastisch vor Augen und können uns inspirieren lassen. Besucht das Egerer Museum, und genießt auf einem riesigen Ausstellungs stück unser Egerländer Kultur gut, welches es in diesem Um fang nicht mehr gibt. mr


Das Bautzener Traditionsunter nehmen Hermann Eule Orgel bau beendete kürzlich die Re staurierung der wertvollen Or gel der Herz-Jesu-Kirche in Gablonz im Isergebirge.
Seit meiner Kindheit spiele ich Klavier. Als ich ans Kon servatorium kam, kaufte mir mein Vater ein älteres Kla vier. Es hatte einen bemer kenswert lyrischen Klang, denn es war doch ein Scholze!
Damals fand ich zum ersten Mal heraus, daß die Kla viere dieser Marke von einem besonderen Nimbus umwo ben sind. Auf diesem Klavier glänzte die Aufschrift „Schol ze – Georgswalde“. Ich frag te, was Georgswalde bedeute, und erfuhr, daß dies der deut sche Name für Jiříkov ist, eine Kleinstadt im Schluckenauer Zipfel.
Erstaunlich, wie sich dort die Klavierherherstellung ent wickelte. Da gab es eine Fa brik der weltberühmten Fir ma August Förster. Jenseits der Grenze befindet sich in Lö bau in der sächsischen Ober lausitz noch ihr Stammbetrieb. Außerdem wirkten in Georgs walde der Tastaturfabrikant Hermann Stamnitz und auch die kleinere Firma Josef Prot ze, die die Firma Scholze 1914 kaufte.
Zuvor hatte ihr Gründer, Franz Scholze, 1891 im nahen Warnsdorf eine Fabrik errich tet, die sich erfolgreich entwik kelte. Franz Scholze hatte vier Söhne, die er alle als Klavier bauer ausbilden ließ. Im Jah re 1918 übergab er den Betrieb seinen Söhnen. Die beiden äl teren Brüder, Adolf und Franz, leiteten die Fabrik in Georgs walde, während die beiden jüngeren, Rudolf und Emil, die Fabrik ihres Vaters in Warnsdorf mit ihrem Geschäftspartner Her mann Swoboda übernahmen.

Die Scholze-Pianos aus Ge orgswalde haben ihr eigenes Em blem. Kennzeichend sind die auf einem gußeisernen Rahmen in einander verschlungenen Buch staben S und G. Manchmal fin den wir den Ortsnamen Georgs walde dem Firmennamen auf der Klappe hinzugefügt. Der Stamm betrieb hat hingegen auf dem Rahmen die Buchstaben SSW für Scholzes Söhne Warnsdorf, und auch auf der Klappe wird manch mal noch Warnsdorf erwähnt.
Wir sehen die Absicht, die Produktionsorte der beiden Be triebe zu unterscheiden, ähnlich wie es bei den beiden AugustFörster-Betrieben der Fall war, wenn auch nicht immer und um jeden Preis. Was die Konstrukti on und Form betrifft, unterschei den sich die Pianos kaum. Es ist nicht bekannt, ob beide Betrie be eine gemeinsame Reihe von Opus- beziehungsweise Produk tions-Nummern verwendeten.
Die Produktion würde sich dann auf rund 10 000 Instrumente be laufen, andernfalls wäre sie dop pelt so groß.

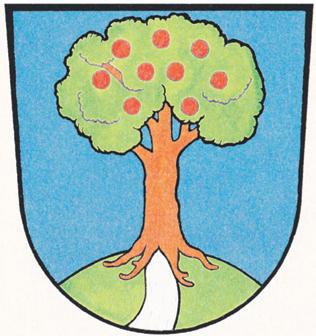



Gemeinsam nutzten sie das Klavierlager in Rumburg und die repräsentative Verkaufsstel le in Teplitz. Die Klaviermacher und Klavierstimmer streiten dar
in China in Lizenz bauen läßt.
Warum beschäftige ich mich mit dieser Geschich te? Ich habe ein Klavierge schäft mit Reparaturwerkstatt in Prag. Ich bin auch der Vor sitzende des Klavier- und Or gelmacherkreises. Scholzes Klaviere und Flügel gehören oft zu den vielen Instrumen ten, die durch meine Hände gehen. Wir restaurieren alte, schöne und wertvolle Instru mente, die Erhaltung der Ori ginaltechniken und der ur sprünglichen Form ist unse re Spezialität. Zum Beispiel kaufte das Theater in Troppau bei mir für seinen Saal einen Scholze-Flügel, Modell S von 1928, Länge 210 Zentimeter.
Im Jahre 2020 brach te mich das Schicksal in die Stadt Warnsdorf. Der Musiker Tomáš Flégr war mein Führer durch die Stadt und ihre Um gebung. Da erinnerte ich mich an die Firma Scholze und frag te, ob von ihr noch etwas üb rig sei. Unsere Suche in den örtlichen Archiven war nicht erfolgreich, aber die retten de Idee war, den Warnsdorfer Dichter und meinen langjäh rigen Freund Milan Hrabal zu fragen. Er kannte nicht nur die Stelle, wo sich am Friedhof die Grabstätte der Familie befand, sondern er wußte auch von der ehemaligen und heute noch bestehenden Fabrikhalle. Und mehr noch, er erinnerte sich, daß er jemanden kannte, der mit dem jüngsten Scholze sohn Emil persönlichen Kon takt hatte.
Die Gablonzer Kirche des Al lerheiligsten Herzen Jesu dominiert den Oberen Platz, der mit seinem großen Parkplatz ein guter Ausgangspunkt zu einer Stadtbesichtigung ist. Von die sem Platz bietet sich ein entzük kender Blick auf die Schwarz brunnwarte mit ihrem Aus sichtsturm. Der recht untypische Kirchenbau aus den dreißiger Jahren des vergangenen Jahr hunderts wirkt nüchtern und gleichzeitig geheimnisvoll und verlockt, ihn eingehender zu be trachten.

Das großzügige dreischiffige Objekt mit Querschiff, mit recht eckigem Turm an seiner Südflan ke und damals moderner Klin kerfassade wurde 1932 vollendet. Schöpfer des Kirchenbaus war der Gablonzer Jugendstil-Archi tekt Josef Zasche (1871–1957), der gleich zwei Kirchen für sei ne Heimatstadt entwarf. Mit dem Bau wurden die Firma Max Daut und zahlreiche andere örtliche Firmen beauftragt. Nur die Ele mente, für die es vor Ort keine ausreichend qualifizierten Liefe ranten gab, wurden fremden Fir men anvertraut.

blonzer dient. Außer Gottesdien sten finden in dieser Kirche auch Konzerte statt. Die Architektur der außergewöhnlich ausladen den Orgel hatte ebenfalls Josef Zasche entworfen.
Die Rückkehr der Orgel nach ihrer mehrjährige Reparatur in den Chor der Herz-Jesu-Kirche begleiteten komplizierte Manö ver, bei denen schwere Technik notwendig war. Zunächst stan den zwar alle Pfeifen auf ihrem Platz, doch um ihren ursprüngli chen Klang zurückzugewinnen, mußten sie gestimmt werden. Ein äußerst anspruchvolles Unterfan gen.
Die Orgel aus dem Jahre 1932 hatte der Holzwurm befallen. „Sie war am Ende ihrer Lebens dauer angekommen“, sagte Bo rek Tichý von der Pfarrgemein de. Dies sei die erste Überholung nach 90 Jahren Betrieb gewesen. Am ersten Novembersonntag weihte der Leitmeritzer Bischof Jan Baxant die Orgel im Rah men eines Pontifikalamtes fest lich ein. Das erste Konzert fand zwei Tage später statt. Nach der Meinung des Organisten Radek Rejšek ist die Gablonzer Orgel eine der klangreichsten in der gesamten Diözese Leitmeritz.
über, ob die Klaviere aus Warns dorf oder aus Georgswalde bes ser sind. Dies ist unnötig, denn praktisch alle Klaviere aus der Zeit von etwa 1920 bis 1945 sind großartig.
Beide Betriebe prosperier ten, der Georgswalder kaufte in der Stadt noch ein Haus als Re präsentationsverkaufsstelle hin zu. Leider widerstand sie dann aber nicht den Folgen der Welt wirtschaftskri se und wurde im Jahre 1935 li quidiert. Der Stammbetrieb in Warnsdorf kaufte dann das repräsen tative Geschäft auf. Nach dem Tod des 60jähri gen Rudolf Schol ze im Jahr 1944 leiteten Emil Scholze sen. mit seinem Sohn Emil, dem Ge schäftspartner Hermann Swobo da und einer gewissen Elfriede Stropp das Unternehmen. Der äl teste Bruder Adolf, der aus Ge orgswalde nach Warnsdorf kam, wirkte als Konstrukteur.
Dann kam, was nicht passie ren sollte – der Zweite Welt krieg und seine Folgen. Am 5. Juli 1945 wurde das Unterneh
men von einer Übergangsverwal tung übernommen und später in die staatliche Fabrik für Pia nos und Orgeln eingegliedert. In Warnsdorf endete schließlich die Klavierproduktion, andere Fir men übernahmen die Herstel lung der Pianos. Die neue kom munistische „Volksregierung“ eignete sich schamlos an, was sie wollte.

Paradoxerweise blieb die Klavier marke Scholze wie die Marken Rös ler, Petrof erhal ten. Die Schol ze-Pianos bau te man unter dem gestoh lenen Famili ennamen mun ter weiter, und zwar in verschie denen tschechi schen Betrie ben. 1958 ging die gesam te inländische Produktion von Musikinstrumenten in ein Kon glomerat von Unternehmen na mens Tschechoslowakische Mu sikinstrumente über. Nach 1991 wurden diese Marken als Wa renzeichen in einer komplizier ten Privatisierung an die Fir ma Petrof übertragen, die heu te Pianos der Marken Scholze, Rösler, Weinbach und Fibich
So lernte ich eine interessan te Persönlichkeit kennen: Karl Stein. Ich habe ihn in Tetschen besucht, wo er in einem ehema ligen alten Pfarrhaus lebt. Er gab mir nicht nur alte Scholze-Poster und das originale Briefkopfpa pier der erwähnten Klavierfirma, sondern auch zwei Fotografien. Ich erfuhr, daß Emil Scholze nach vielen Jahren in der Tschecho slowakei schließlich in die Bun desrepublik Deutschland gezo gen sei.
Um die Scholzegruft kümmer te sich dann lange Jahre Karl Steins Großmutter Anna Vedral mit ihrer Tochter Kristina. Heu te ist das Grab verwahrlost. Mehr wußte Karl über Emil Schol ze jun., den er „Onkel“ nann te, nicht zu sagen. Es bestand schließlich ein großer Altersun terschied zwischen den beiden.
Ich frage mich nun, ob das Grab nicht restauriert werden könnte, ob wir, der Klavierma cherkreis, zusammen mit der Stadt Warnsdorf nicht etwas tun könnten. Am besten wäre es, sich mit den Nachkommen der Fami lie Scholze in Verbindung zu set zen. Und so entstand der Arti kel, den Sie gerade gelesen ha ben. Werden wir jemanden von der Familie Scholze finden? Ant wort erbittet ich an eMail info@ sanson.cz Jakub Zahradník übersetzt von Karl
Das Innere der Kirche konn te nicht mehr nach Zasches Plä nen vollendet werden und blieb provisorisch. Die Tschechen in ternierten Zasche nämlich am 7. Mai 1945. Sein Büro in der Pra ger Neustadt wurde geplün dert und sein Archiv zerstört. Er wurde gezwungen, Prag zu ver lassen. Trotz Fürsprache seiner tschechischen Kollegen wurde er in die Sowjetische Besatzungszo ne vertrieben. Er war völlig mit tellos und fand eine bescheidene Unterkunft im sachsen-anhaltini schen Schackensleben in der Re gion Magdeburg. Alle Versuche, seinen Beruf wieder auszuüben und damit seinen Lebensunter halt zu bestreiten, machten die Kommunisten zunichte. Er starb verarmt im Jahr 1957.
Auf dem Hochaltar steht ei ne bronzene Christussta tue des Wiener Bildhau ers Arnold Hartig, der aus dem nahen Tannwald stammte, am Seitenal tar steht die Marmorpietà von Franz Hub. Der Altar ist deshalb so bemerkens wert, da er gleichzeitig als Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Ga

In der Tschechischen Repu blik gibt es mehr als 5700 Or geln, aber nur ein Bruchteil eig net sich als Konzertinstrument. Und nur wenige haben wie die Orgel in der Gablonzer Herz-Je su-Kirche 43 Register, weitere Nebenregister und drei Manu ale. Das Instrument von der Fir ma Rieger aus dem nordmähri schen Jägerndorf hat mehr als 2860 Pfeifen. Sie wurde wie die ganze Kirche vom sudetendeut schen Architekten Josef Zasche entworfen, auf den auch mehrere Prager Bauten zurückgehen.
Die Mittel für die Orgelreno vierung sammelt ein zu diesem Zweck in Gablonz gegründe ter Stiftungsfonds. Dank Bene fizkonzerten, Spenden und Geld von Stadt und Kreis kamen be reits 3,5 Millionen Kronen zu sammen. Die Sammlung geht weiter. Die Arbeiten werden auf rund sechs Millionen Kronen oder umgerechnet 240 000 Euro geschätzt. Petra Laurin/nh
SteinIn Friedland im heutigen Kreis Reichenberg entsteht auf dem ehemaligen Meierhof der berühmten Adelsfamilie ClamGallas eine Abteilung der berittenen Polizei, deren erste vier Pferde hier Anfang November 2021 stationiert wurden. Diese Zahl soll schrittweise erhöht werden.
Wenn alles gut läuft, werden zwei weitere Pferde gekauft, die ein Jahr lang ausgebildet werden und ein Jahr später die Reiterstaffel der Polizei in Friedland bereichern. Maximal werden zehn Pferde angeschafft. Gegenwärtig wird der Meierhof nur wenig genutzt, soll aber dank der Zusammenarbeit mit der Polizei erneuert und einer neuen Nutzung zugeführt werden.
Die Pferde für die berittene Polizei müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Bei der Auswahl der Tiere steht ihre Gesundheit an der ersten Stelle. Neben dem Mindeststockmaß von 1,65 Meter müssen die Vierbeiner gute Charaktereigenschaften haben. Sie müssen brav, geduldig und unerschrocken sein.
Der Kern des Areals besteht aus vier Gebäuden, die ein Quadrat bilden. Auf dem Gelände aus dem frühen 18. Jahrhundert, das sich in der Nähe des Schlosses befindet, sollen nach der Renovierung der Gebäude ein hippologisches Zentrum der Polizei sowie eine Werkstätte und Räume für die Schüler der Mittelschule für Land- und Forstwirtschaft entstehen.
Die Schüler werden hier ihre praktische Ausbildung absolvieren, die zur Zeit in den Räumen der Haindorfer Niederlassung der Friedländer Schule stattfindet. Sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein werden, wird das Schulareal in Haindorf verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf wird dann für die Renovierung der Gebäude auf dem Meierhof in Friedland verwendet.
In diesem Jahr wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Obwohl



sich die Polizeiabteilung noch in der Aufbauphase befindet, haben sich bereits die ersten Bewerber, die hier ihren Dienst tun möchten, gemeldet. Bei den Bewerbern handelt es sich hauptsächlich um Frauen. Das Projekt wird von den Vertretern des Reichenberger Kreisamtes unterstützt. Das Reichenberger Kreisamt wird auch die Renovierung des Meierhofes finanzieren. Die Reiterstaffel der Staatspolizei wird 20 Jahre lang als Mieter einen Teil davon nutzen.

Um das Ausbildungszentrum und die Polizeidienststelle so schnell wie möglich auf den Meierhof zu verlegen, sind einige Änderungen erforderlich. Es ist notwendig, den im Meierhof befindlichen Abfall so schnell wie möglich zu beseitigen, die Gebäude zu renovieren, damit sie die Schüler nicht gefährden,
und die Wasserleitung, die nicht mehr repariert werden kann, zu erneuern.
Das 300 Jahre alte Meierhofgelände stammt aus dem Jahr 1722. Wie die damalige Presse am 1. Juli 1936 berichtete, feierte der im weiten Umkreis anerkannte landwirtschaftliche Fachmann und Ökonomie-Oberinspektor Maximilian Neumann in Friedland im Juni 1936 sein 25jähriges Dienstjubiläum. Zu dieser Zeit stand er bereits seit 25 Jahren im Dienst der Herrschaft ClamGallas. Früher war er in Lämberg und in Grottau tätig, und seit 1928 bewirtschaftete er den Meierhof in Friedland.
Bis heute befindet sich das Clam-Gallas-Wappen über dem Eingang zum Meierhof. Die letzte größere finanzielle Investition fand hier in den 1990er Jahren statt.
Das hippologische Zentrum wird aus zwei Teilen bestehen. Aus den Ställen, in denen die Pferde aus dem Landgestüt Kladrub untergebracht werden, und dem Verwaltungsgebäude, in dem die Polizei ihre Räumlichkeiten haben wird. Die kleine ostböhmische Stadt Kladrub an der Elbe, tschechisch Kladruby nad Labem, hat mit dem Nationalgestüt eine der ältesten Pferdezuchtstätten der Tschechischen Republik.
Aus diesem Ort stammt die weltbekannte Pferderasse Altkladruber. Die Altkladruber Pferde zählen zu den ältesten Pferderassen der Welt. In der Zukunft könnte das hippologische Zentrum die Aufnahme neuer attraktiver Lehrfächer ermöglichen, die sich auf die Pferdezucht und die Reitkunst konzentrieren.
Die neu geschaffene Reiterstaffel wird die Polizei in Friedland, die mit grenzüberschreitender Kriminalität zu kämpfen hat, stärken. Die Idee, eine berittene Polizei zu gründen, kam vor zwei Jahren von der Polizei, und letztes Jahr wurde das Projekt vorgestellt. Die Nutzung des alten Meierhofs eignet sich für diesen Zweck ideal.
Da in Reichenberg und Gablonz Fußballspiele der ersten Liga gespielt werden, wird auch hier die Polizeireiterstaffel eingesetzt, um die Spiele mit hohem Risiko zu überwachen. Gerechnet wird auch mit dem Einsatz bei Demonstrationen und andere Großveranstaltungen. Außerdem werden die Pferde bei der Suche nach vermißten Personen eingesetzt. Für präventive Kontrollgänge in Stadtzentren oder Erholungsgebieten, die schwer zugänglich sind, werden Pferde der Polizei ebenfalls benötigt.
Die berittene Polizei wird auch in den Gebieten des Riesengebirgs-Nationalparks und des Isergebirges eingesetzt. Genutzt wird die berittene Polizei außerdem für die Bewachung der tschechisch-polnischen und der tschechisch-deutschen Staatsgrenze in Gebieten, in denen es nicht einfach ist, die Sicherheit mit Autos oder anderen Transportmitteln zu gewährleisten. Nach Bedarf werden die Pferde auch an andere Bezirke ausgeliehen. Bislang gibt es Reiterstaffeln der tschechischen Staatspolizei in den Städten Prag, Brünn und Zlin.
Nach ersten Schätzungen werden sich die Sanierungskosten des ehemaligen Meierhofes auf 77 Millionen Kronen belaufen.
Stanislav Beran

Im „Heimatbuch der Gerichtsbezirke Deutsch Gabel und Zwickau in Böhmen“ finden wir folgende alte Sage aus Seifersdorf.
Vor langer, langer Zeit wurde im Silberstein viel Silber gefunden. Eines Tages entdeckte ein Bergknappe eine Silberader von unermeßlichem Wert. Da erwachte in dem armen Mann die Habsucht, und er beschloß, seine Entdeckung geheim zu halten.

In der Nacht, wenn das Bergwerk von allen anderen Menschen verlassen war, arbeitete er an der Ausgrabung seines Schatzes. Je weiter er in das Gestein vordrang, desto mehr Silber glänzte ihm entgegen.
Er nahm sich vor, nicht eher zu ruhen, als bis der ganze Reichtum in seinen Händen wäre. Doch es schickte sich, daß ihn der Besitzer des Bergwerkes, und zwar in der Nacht des Palmsonntages, bei seiner Arbeit überraschte. Kurz entschlossen schlug ihn der Bergknappe mit seinem Spitzhammer nieder.
Im selben Augenblick ertönte ein furchtbarer Donnerschlag. Der ganze Berg zitterte und bebte, und die Felsen barsten und stürzten übereinander. Von dem Bergwerk war keine Spur mehr zu sehen, denn haushohe Felsen türmten sich darüber. Und seitdem hat an dieser Stelle keines Menschen Hand mehr nach Silber gegraben.

Der habsüchtige Bergknappe aber, der seinen Herrn erschlagen hatte, ist verwünscht. Seit seinem Mord muß er Jahr für Jahr bis zum Jüngsten Tage in der Tiefe des Silberberges arbeiten.
Artikel „Neue Dienststelle für tschechisch-deutsche Grenzpolizei“ über Grottau von Stanislav Beran (➝ RZ 44/2022). Der Artikel endete mit den Worten: „Am Ende“. Leider verschluckte das Layout die letzten zwei letzten Zeilen, die lauten: „Am Ende stellte sich heraus, daß sie aus Ägypten stammten.“ Und es verschluckte die Zeile mit dem Namen des Autoren Stanislav Beran. Das bedauert die Redaktion sehr.

Der Reichenberger Turm gehört zur Felsengruppe Oberwegsteine im tschechischen Teil des Lausitzer Gebirges.
Der Reichenberger Turm ist der gewaltigste unter den Felstürmen. Die Felsengruppe steht in der Nähe von Paß, einem Ortsteil von Grottau, etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel. Die Oberwegsteine bestehen aus acht einzeln stehenden Sandsteinfelsen oberhalb der Straße von Grottau nach Deutsch Gabel. Neben dem Reichenberger Turm gibt es den Übungsturm, die Große Todesgöttin, die Kleine Todesgöttin, den Gahlerturm, den Zwilling, den Falken und den Zahn.
Entlang des Südabhangs des Passerkamms verläuft der Bergsteigerpfad, der früher
fe der Oberen Kreidezeit und ist meist sehr quarzhaltig. Er beinhaltet auch kalkhaltige Bindemittel. Bis auf Ausnahmen ist dieses Gestein sehr fest mit einer glatten Oberfläche. Auf ihre Gipfel führen Kletterwege mit sehr hohen Schwierigkeitsgraden.
Die Oberwegsteine bieten außerordentlich sportliche Kletterziele. Von Bersteiger Rudolf Kauschka und seinen Gefährten wurden 1904 alle freistehenden Felsen erstbestiegen. Bekannt wird sein, daß der Weg zur Neuen Reichenberger Hütte seinen Namen trägt. Nur der Gahlerturm konnte erst im Mai 1906 bezwungen werden. Er gilt als der am schwersten zu besteigende Felsen in dieser Gruppe. Er wurde nach dem Bergsteiger Adolf Gahler benannt,
der in den Alpen tödlich verunglückte. Der gewaltige Reichenberger Turm wurde vom Bergsteigerklub Wirbelsteiner aus Reichenberg so benannt. Im August 1907 errichteten dessen Mitglieder dort oben ein eisernes Kreuz.
Die Oberwegsteine gehören wie die benachbarten Rabensteine zu den bedeutendsten Kletterzielen im böhmischen Teil des Lausitzer Gebirges. Die Besonderheit der Rabensteine ist der tiefe Einschnitt zwischen dem Nord- und dem Südteil der Gruppe. Diese Spalte ist durch vulkanische Einflüsse entstanden. Dadurch wurde der Sandstein an den Innenseiten der Spalte gefrittet und ist besonders fest. Wie die Oberwegsteine bestehen die Rabensteine aus einem sehr festen Sandstein mit einigen sehr kieseligen Konglomeratlagen.
Der Heimatkalender 2023 für Stadt und Land Reichenberg steht ab sofort zur Verfügung.

Den Reichenberger Heimatkalender für das kommende Jahr haben wir unter das Thema „Streifzug durch Stadt und Land“ gestellt. Gemeindebetreuerinnen und Gemeindebetreuer haben mit Fotos und Texten an der Gestaltung mitgewirkt.
Die Wertschätzung der Heimat und deren Vielfalt spiegeln sich in diesem Kalender wider. Im DIN-A4Format gibt es jeden Monat ein Bild aus Stadt und Land Reichenberg. Mögen diese Bilder Sie durch das Jahr 2023 begleiten.
Der Kalender ist für 10,00 Euro plus Versandkosten erhältlich beim
Heimatkreis Reichenberg Stadt und Land, Christa Schlör, Alleenstraße 68-1, 71732 Tamm, Telefon (0 71 41) 2 99 89 90, eMail mail@ heimatkreis.de
Oberweg genannt wurde. Diese Lage gab den Felsen ihren Namen. Der Sandstein stammt aus dem Cenoman, der ältesten Stu-Nach den Kommunalwahlen im September änderte sich die Füh rung mancher Rathäuser. Jut ta Benešová berichtet über die Wahlergebnisse.
In Teplitz wechselten der Ober bürgermeister und sein er ster Stellvertreter die Positio nen. Jiří Štábl (ANO) übernahm nun die Führung der Stadt. Sein Stellvertreter ist der ehemalige Oberbürgermeister Hynek Han za (ODS), welcher aber weiterhin den Kreis Teplitz im Senat vertritt.
Da beide bereits zuvor in Ko alition zusammengearbeitet ha ben, laufen die bisher beschlos senen Projekte reibungslos weiter. Beispiele sind die Rekon struktion des Teplitzer Bahnhofs, die Rekultivierung des Oberen Schloßteichs oder der Bau eines neuen Freibads. Vertreter der Opposition hatten Klage bei Ge richt eingereicht, weil angeblich Stimmen gekauft worden seien. Diese Klage wurde aber bereits mangels Beweisen vom Gericht abgelehnt.
Auch in Eichwald kam es zu ei nem Führungswechsel. Der lang jährige Bürgermeister Petr Pípal, dessen Initiative und persönli chem Einsatz die Rekonstrukti on der Mariä-Himmelfahrts-Kir che in Böhmisch Zinnwald und die langjährige Unterstützung des Grenzbuchenfestes zu ver danken ist, wurde von Jiří Kašpar (ODS) abgelöst. Pípal ist nun in der Opposition.
Eine weitere Veränderung haben die Kommunalwahlen in Graupen bewirkt. Zdeněk Matouš mußte sein Amt als Bür germeister Jan Kuzma (ANO) übergeben. Auch dabei kam es zu einer Klage gegen der Wahl ergebnisse, welche aber auch hier abgelehnt wurde.
In den beiden Städten Ko motau und Bilin müssen die Kommunalwahlen wiederholt werden. Das hat das Kreisgericht in Aussig kürzlich entschieden. Wahlbetrug sei der Grund für die Wiederholung des Urnengangs. Wie berichtet wurde, soll vor al lem Mitgliedern der Roma-Min derheit Geld angeboten worden sein, falls sie eine bestimmte Par tei wählen würden.
In Moldau im Erzgebirge wur den durch kurzfristige Anwer bung von neuen ständigen Be wohnern die Wahlen ebenfalls von Anfang an angezweifelt. Auch hier müssen sie laut Ge richt innerhalb von 30 Tagen wiederholt werden. Einige Orte wie beispielsweise Dux entschei den erst Mitte November über die neue Zusammensetzung des Stadtrates und die Wahl ihres Bürgermeisters.
Durch einen vor allem in Nordböhmen erfolgten Stim menzuwachs der Andrej-BabišBewegung ANO haben sich die Koalitionsverhandlungen mitun ter erschwert, obwohl auf Kom munalebene die konservative Partei ODS bisher an manchen Orten mit der Bewegung ANO gut zusammenarbeitete, zum Beispiel in Teplitz. Auch ein Er starken der radikaleren Gruppie rungen war festzustellen, so daß es insgesamt zu vielen Verzö gerungen in den Koalitionsver handlungen kam und noch kom men wird.













Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Tele fon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
Einer der letzten und bisher noch nicht veröffentlichten Arti kel von Herbert Ring behandelt die Legende des Felsüberhangs namens „Memento mori“

In der Umgebung von Rain wiese am Prebischtor befinden sich einige Felsüberhänge, wo am Wochenende romantisch ver anlagte Wanderer lagern. Einer dieser Schlupfwinkel heißt schon seit dem 19. Jahrhundert „Me mento mori“, zu deutsch „Sei Dir der Sterblichkeit bewußt“. Über diese Bezeichnung hört man fol gende Geschichte, welche aber nicht unbedingt den Tatsachen entsprechen muß, wie das bei solchen Überlieferungen öfter vorkommt.
Gegenüber des Hotels in Rain wiese steht das alte, einstöckige Forsthaus, dessen Portal die Jah reszahl 1794 trägt. Einst lebte
dort die Försterfamilie mit ihrem 14jährigen Sohn, welcher an Tu berkulose litt.
Einmal in der Vorweihnachts zeit machte der Förster mit sei nem Sohn einen Rundgang im Wald. Die kalte, frische Luft galt damals als einzige Medizin ge gen diese Krankheit.
Sie gerieten jedoch in einen Schneesturm. Und so versteck ten sich die beiden unter einem großen Felsüberhang unweit des Treppengrunds. Als Folge von Kälte und Erschöpfung überfiel den Jungen jedoch ein Blutsturz. Und bevor der unglückliche Va ter Hilfe herbeiholen konnte, war der Sohn tot. Der Förster ließ spä ter unter diesem Felsüberhang eine Tafel anbringen, welche an den Tod seines Kindes erinnerte.
Im Laufe der Zeit verschwand diese Gedenktafel, und ebenso
wurde die Geschichte fast ver gessen. Lebendig blieb aller dings die Bezeichnung „Memen to mori“.
Wie in jedem von Wanderern benutzten Überhang befindet sich auch in „Memento mori“ ein
Notizblock. Wer��neugierig blät tert, findet folgende Eintragung: „Ahoi! Wir genießen die letz ten Urlaubstage und den Rest der Ferien. Wir übernachteten hier und wandern zur Kirnischt (Bach) weiter. In der Nacht hat es
geregnet, jetzt aber scheint die Sonne. Ich liebe Dita! Thomas. –Ich liebe Thomas! Dita.“ Memento mori – Sei Dir des Lebens bewußt!
Karl Stein, Böhmische Schweiz, Kraft Verlag, Würzburg 1992.
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg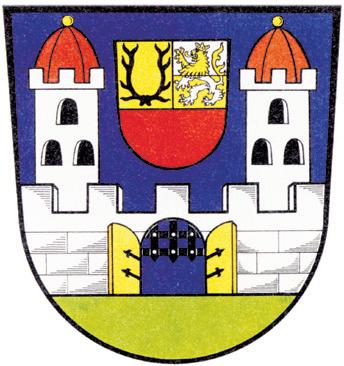

Am 23. März vor 101 Jahren kam Wilma Igger/Abeles in Mirschikau zur Welt. Sie wurde eine bekannte Germanistin und Kulturhistorikerin. Anläßlich ihres 100. Geburtstages erschien vergangenes Jahr das Buch „Böhmische Juden. Eine Kindheit auf dem Lande“. Ihr langes Leben führte sie in viele Länder.
Monika Richarz, 1993 bis 2001 Direktorin des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, gab das Buch heraus. „Es entstand im Dialog der beiden Kolleginnen, die eine enge Freundschaft und das begeisterte Interesse an der jüdischen Geschichte jenseits der Schoa verbindet“, schreibt Frauke Geyken in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
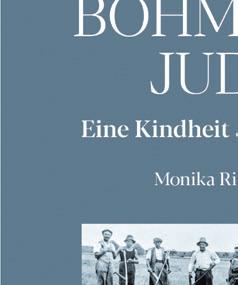
Wilma ist älteste Tochter des jüdischen Gutsbesitzers Karl Abeles und dessen Frau Elsa Abeles/Ornstein. Ihr Vater, dessen Bruder und zwei Cousins bewirtschafteten in Kompanie oder Kooperation vier Pachtgüter. In ihrem Buch schildert Wilma Iggers eine glückliche Kindheit zwischen den Gütern und der ländlichen Kleinstadt Bischofteinitz, in der sie mit den Eltern lebt, beschreibt die jüdischen Bewohner des Ortes und ihr mehrheitlich geringes religiöses Interesse. Die Familie versteht sich als deutsch, spricht aber auch Tschechisch und schickt die Tochter auf das tschechische Gymnasium in Taus.
Nach der NSDAPMachtergreifung 1933 in Deutschland kommt es im Laufe der Jahre auch in dem hauptsächlich von Deutschen bewohnten Gebiet um Bischofteinitz vermehrt zu antisemitischen Aktionen. Im September 1938 flieht die „Kompanie Abeles-Popper“ kurz nach dem Münchener Abkommen und wenige Tage vor dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in Böhmen in das Landesinnere. Von da emigrieren sie nach Kanada.

Als 17jährige kommt Wilma Abeles nach Hamilton in der kanadischen Provinz Ontario. Schnell lernt sie Englisch und schließt die High School nach einem Jahr ab. Ab 1940 studiert sie an einem kleinen College Germanistik und Romanistik. Einige Jahre später geht sie nach Chicago, um in Germanistik zu promovieren.
Georg Iggersheimer kommt als Sohn eines jüdischen Kaufmanns am 7. Dezember 1926 in Hamburg zur Welt. Sehr früh entwickelt er ein starkes Interesse an der jüdischen Kultur und Religion. Weil es zu Konflikten mit den Eltern kommt, verbringt er 1937 und 1938 in einem jüdischen Kinderheim im württembergischen Esslingen.

Im Oktober 1938, wenige Wochen vor der Reichspogromnacht, emigriert die Familie Iggersheimer über England nach Richmond in die USA. Dort nimmt Georg wie seine Eltern und seine Schwester den Nachnamen Iggers an und besucht zunächst die Highschool. Aber schon als Fünfzehnjähriger geht er in die dortige Universität. Er ist konfrontiert mit der Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung und bil-
det mit schwarzen Kommilitonen eine Studentengruppe, die sich gegen die Rassentrennung ausspricht. 1946 wechselt er an die Universität nach Chicago. Hier

ner Pekinger Universität. Ab den 1990er Jahren verbringen sie die Hälfte des Jahres in Göttingen, die andere Hälfte in Buffalo. Am 26. November 2017 stirbt Georg,

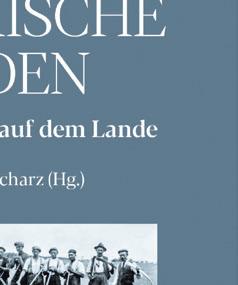
machen den dokumentarischen Wert des Buchs aus.
Auf die Initiative der Verlegerin Marion Berghahn geht „Frauenleben in Prag. Ethnische Vielfalt und kultureller Wandel seit dem 18. Jahrhundert“ zurück, das erschien, als Iggers bereits 79 Jahre alt war. Es handelt sich um Porträts von zwölf Prager Frauen aus allen ethnischen Gruppen, mit denen sich Iggers trotz aller Unterschiede wenigstens teilweise identifizieren konnte. Dafür wurden gedruckte Quellen ebenso herangezogen wie literarische Vermächtnisse aus internationalen Archiven und familiären Nachlässen.
lernen sich Georg Iggers und Wilma Abeles kennen. 1848 heiraten sie in Hamilton. Zwischen 1951 und 1956 werden dem Ehepaar drei Söhne geboren.
Seit Sommer 1945 arbeitet Wilma Iggers an ihrer Dissertation über Karl Kraus, die sie 1951 abschließt. In den 1950er Jahren lehren die Iggers an verschiedenen Colleges in den USA, darunter am Philander Smith College für Schwarze in Little Rock im Bundesstaat Arkansas. Dort beginnt ihr Engagement für die USA-Bürgerrechtsbewegung. Sie unterstützen beispielsweise mit Forschungen über das Schulsystem in Little Rock die schwarze Bürgerrechtsbewegung National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), so daß 1957 erstmals schwarze Schüler eine weiße High School besuchen können. Später sind beide auch in der Friedensbewegung aktiv. Während des Vietnamkriegs beraten sie viele Kriegsdienstverweigerer.

Nach Zwischenstationen in Arkansas, New Orleans und Chicago lassen sich die Iggers 1964 in Buffalo im Bundesstaat New York nieder, wo Wilma bald als Germanistin am Canisius College arbeitet und Georg als Historiker eine Professur an der staatlichen Universität von Buffalo bekleidet.
Seit den 1960er Jahren reist das Paar häufiger nach Europa, wo sie internationale wissenschaftliche Kontakte knüpfen. Am Anfang steht ein längerer Forschungsaufenthalt Georgs in Frankreich. 1960 lebt die Familie zunächst in der Nähe von Paris und dann im niedersächsischen Göttingen. Sie schließen in Göttingen viele Freundschaften, nicht nur an der Universität.

Seit Mitte der 1960er Jahre unternimmt das Ehepaar Forschungsreisen über den Eisernen Vorhang hinweg in die „DDR“ und in die Tschechoslowakei, wo es sich auch heimlich mit Dissidenten trifft. 1984 ist es mehrere Wochen lang als Gastdozenten an ei-
seitdem lebt Wilma allein in Amherst bei Buffalo.


Sie sammelte schon früh Zeugnisse der Sozial- und Kulturgeschichte der Juden in Böhmen und Mähren und hatte damit ihr Interessengebiet gefunden. Die Germanistin publizierte zahlreiche Aufsätze über böhmische Themen in der deutschen und tschechischen Literatur und gilt heute als ausgewiesene Expertin für böhmische Geschichte und Kultur.
In „Zwei Seiten der Geschichte. Lebensbericht aus unruhigen Zeiten“ schreibt sie: „Meine wissenschaftlichen Arbeiten, besonders über die Juden in den böhmischen Ländern, entstammen meinem Interesse an der Welt, aus der ich komme, und sind – scherzhaft ausgedrückt – eine erweiterte ‚Mischpochologie‘.“
Das zeigte sich bereits bei ihrer Dissertation über den in Böhmen geborenen jüdischen Schriftsteller Karl Kraus (* 1874 in Jitschin, † 1936 in Wien). Neben einer Einführung in Leben, Werk und Denken thematisierte sie den absoluten und zentralen Wert der Sprache bei Kraus.

In den 1980ern veröffentlichte Iggers eine Auswahl von Texten in einer Anthologie. Das 1986 erschienene Lesebuch „Die Juden in Böhmen und Mähren“ füllt eine sozial- und kulturgeschichtliche Forschungslücke, indem es Einblicke in die Vielfalt der tausendjährigen Geschichte und die eigene Lebenswelt der Juden in Böhmen und Mähren vermittelt.
Nach ihrer Emeritierung 1991 führte sie ihre Forschungen und Veröffentlichungen fort. Dem Lesebuch folgte eine Neuausgabe von „Der jüdische Gil Blas“. Autor ist Joseph Seligmann Kohn (* 1803 in Prag, † 1850 in Teplitz). Der Schelmenroman erschien erstmals 1834. In ihm erzählt ein armer Schächtersohn von seiner Jugend und seinem Aufstieg zum gebildeten Hauslehrer und geadelten Kaufmann. Die genauen Schilderungen der jüdischen Milieus, insbesondere des Kleinhandels, jüdischer Gebräuche und Riten
Iggers war auch als Expertin an der Ausstellung „Mythen der Nationen. 1945 –Arena der Erinnerungen“ beteiligt, die 2004/05 im Deutschen Historischen Museum Berlin lief. Unter dem Titel „Das verlorene Paradies“ knüpfte ihr Beitrag in dem Ausstellungskatalog ebenso an die eigene Fluchtgeschichte an wie an den Verlust des Lebens in der Erste Tschechoslowakischen Republik 1918 bis 1938. 1966 besuchte Wilma Iggers zum ersten Mal nach der Flucht Bischofteinitz. Bei den regelmäßigen Besuchen in den Folgejahren traf sie nicht nur alte Schulfreundinnen wieder, sondern lernte viele neue Bewohner ihrer Heimat kennen, mit denen sie sich anfreundete. Für ihre Verdienste verlieh Bischofteinitz ihr 2002 die Ehrenbürgerschaft. 2004 erhielt sie den Gratias-Agit-Preis, den das tschechische Außenministerium Personen für Verdienste um die „Verbreitung des guten Rufs der tschechischen Republik“ verleiht.
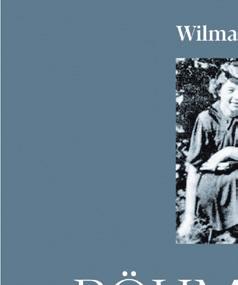
Ebenfalls 2002 erschien die mit ihrem Mann verfaßte DoppelAutobiographie „Zwei Seiten der Geschichte“ im Göttinger Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, in der beide ausführlich über ihr bewegtes Leben berichten. Gleichzeitig betätigten sich Wilma und Georg Iggers als Zeitzeugen und diskutierten auf vielen Veranstaltungen in deutschen Schulen und Universitäten über ihre Lebenserfahrungen und wissenschaftlichen Positionen.
Im Oktober 2018 kam die Familie Popper-Abeles-EksteinBrok nach 80 Jahren in Kanada im Anshe-Sholom-Tempel in Hamilton zusammen. Familienmitglied Craig Partridge hatte den böhmischen Stammbaum bis 1740 zu Partiarch Juda Lobl Popper erforscht. Für das Familientreffen erforschte er weitere 110 Jahre bis 1630. Zu den prominenten Vorfahren zählt er Juda Lobl ebenso wie Isaac Abeles und Aron Brok und bringt die Familiengeschichte in Zusammenhang mit dem Dreißigjährigen Krieg.
Die jüngsten Familienmitglieder in Hamilton waren die sieben Wochen alten Zwillinge Oliver und Jonah Loewith, das älteste Mitglied war die 97jährige Wilma Iggers der mittlerweile 200köpfigen Familie. Bei der Flucht 1938 waren sie 39 Familienmitglieder, da es Wilmas Vater Karl Abeles gelungen war, 39 Landanbau-Genehmigungen der
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der dritte Teil seiner Arbeit über Pfarrer Augustin Zettl (1805–1878).
Selbst von der Protestnote der österreichischen Bischöfe zeigt sich der Kaiser unbeeindruckt. Im Jahr 1868 sanktioniert er drei Kirchengesetze, die nach Steinbachs Ansicht auf Bestreben der Liberalen, wohl eher Deutschnationalen, vom Reichsrat verabschiedet werden, und tatsächlich eine merkliche Einschränkung des Konkordates vom 18. August 1855 zur Folge haben.
Der Papst protestiert ohne Erfolg. Vielmehr werden noch weitere Gesetze erlassen, die die Versöhnungsversuche der gerichtlichen Ehescheidungen und die Eheschließung konfessionell verschiedener Partner ermöglichen. In Bezug auf die Schulen werden Ortsschulräte eingeführt. Die Kirche Österreichs zeigt jedoch hierzu keine einheitliche Vorgehensweise. In einigen Diözesen wird den Geistlichen erlaubt, in den jeweiligen Ortsschulrat einzutreten, andere Bistümer gestatten dies nicht.
Nach Steinbachs Auffassung führt dies zur religiösen Versumpfung und Gleichgültigkeit in Böhmen. Ferner beklagt er, daß deutsche wie böhmische Geistliche in den Ortsschulräten nun lieber nationale Politik betreiben statt Seelsorge. Viele Bauern und Kleinstädter würden sich nun als Mitglieder der Ortsbeziehungsweise Bezirksschulräte als große Herren fühlen und würden deshalb von den Lehrern hofiert. Lehrer und Ortsschulräte würden beginnen, sich liberal zu zeigen, die Seelsorger zu kränken, indem sie die neuen Gesetze als Feindseligkeit des Staates gegenüber der Kirche darstellten. Das Volk stehe dieser ganzen Angelegenheit eher gleichgültig gegenüber oder erfreue sich der neuen Rivalität zwischen Kirche und Schule.
Steinbach konstatiert weiter, daß vielen Katecheten und Seelsorgern Hindernisse zur Ausübung ihrer Tätigkeiten in den Weg gelegt würden. Der katholische Gruß bei den Kindern „Gelobt sei Jesus Christus“ werde verboten und durch „Guten Abend“, „Guten Morgen“ und
„Grüß Gott“ ersetzt. Ebenso würde kein Lehrer mehr außer zur Beaufsichtigung der Kinder eine Kirche besuchen.
In der Budweiser Diözese wird aber auch der Eintritt der Geistlichen in die Ortsschulräte gestattet, vielmehr sogar angeordnet. Ebenso im Memorabilienbuch vermerkt ist, daß am 10. April 1869 Papst Pius IX. sein 50jähriges Priesterjubiläum feiert. Mit der Bulle „Aeterni Patris“ berief der Papst am 29. Juni 1868 das Erste Vatikanische Konzil nach Rom ein, das aber am 20. Oktober 1870 ausgesetzt wird. Stimmberechtigt beim Konzil waren 667 anwesende kirchliche Würdenträger.
Der Pfarrer von Schüttwa, Franz Wawák, der seit dem 9. Dezember 1846 der bischöfliche Hostauer Bezirksvikar und seit dem 14. Februar 1859 der Schuldistriktsaufseher ist, stirbt am 30. Mai 1869. Sein Nachfolger im Amt des Bezirksvikars wird der Pfarrer von Berg, Valentin Czada. Im Juni und Juli 1869 spendet der Budweiser Bischof Johann Valerian Jirsík im Hostauer und Bischofteinitzer Vikariat das Sakrament der Firmung. Am 19. Juni 1870 wird dem Hostauer Oberlehrer Franz Pauli von Kaiser Franz Joseph das silberne Verdienstkreuz mit Krone verliehen. Pauli ist auch als Musiklehrer und Organist in der Dechanteikirche tätig. Er verstirbt am 11. September 1880 im Alter von 79 Jahren.
Ein starkes Gewitter mit Hagel vernichtet am 9. Juli 1870 in der gesamten Umgebung von Hostau alle Feldfrüchte. Veranschlagt wird der Schaden mit 25 000 Gulden. Auch die Dechanteiwiese bei Hassatitz wird von Wasser und Schlamm völlig überflutet. 1871 eröffnet Bischof Jirsík in Budweis ein neues Institut für Taubstumme, in dem 79 Jugendliche im Alter von acht bis 13 Jahren aufgenommen werden können. Ohnehin verwendet der Bischof einen Großteil seines jährlichen Einkommens zur Erhaltung des bischöflichen Knabenseminars und des böhmischen Gymnasiums in Budweis. Auch in Taus wird ein Realgymnasium in den Jahren 1870 und 1871 eingerichtet. In Prag wird ein katholisch-politischer Verein für das Königreich Böhmen gegründet zur Wahrung und Förderung katholischer und patriotischer Interessen in kirchlicher, staatlicher und sozialer Hinsicht. Fortsetzung folgt
Canadian Pacific Railway zu erhalten. Nadira Hurnaus
Der erste Sonntag im Juli war schon Monate lang für eine be sondere Aktion geplant. Ran di Oppermann Moe, Professorin der Tiermedizin an der Univer sität Oslo, war mit ihrem Mann Knut und Freunden nach Rei chenau bei Waidhaus gekom men, um wieder der Heimat ihrer Mutter Gerda Opper mann und damit auch ihrer Heimat nahe zu sein.

In der Zeit vor Corona hatte ich Randi, ihren Mann und ihren Bruder ausführlich unser Tachauer Museum in Weiden gezeigt. Viele Fragen stellten die norwegischen Gäste, be sonders über die verschwun denen Dörfer. Vorfahren hat ten auch in Plan gelebt, wes wegen sie dieses schöne Städtchen be suchten und das Haus der Vorfahren am Marktplatz fanden.
In der Zwi schenzeit hat te Randi in tensiv die böhmische Geschich te ihrer Fami lie erforscht; sie hatte eine schöne Bro schüre mit vielen Fotos von Per sonen und auch Häusern dabei, um mich bei der Wanderung aus giebig in die Familiengeschich te einzuführen. Wir fuhren zur Grenze, so nahe es ging. Dann passierten wir den Grenzüber gang für Radfahrer und Fußgän ger. Einige Tafeln informieren über den Zustand des früheren Eisernen Vorhangs. Ich war über rascht, daß hier ein so bequemer und breiter Waldweg in Richtung Reichenthal führt.


Plötzlich lockte mich Randi abseits in den Wald, um mir Re ste des Dammes des Ernestinen weihers zu zeigen. Tatsächlich waren die aus festen Granitstei nen gebauten Säulen am Ran de des Wasserablasses zu se hen. Die Holzbalken waren nicht mehr da, mit denen man die Hö he des Wasserspiegels regulie ren konnte. Auch der Weiher war nicht mehr da, eine ebene mit Gras und Seggen bewachsene

Fläche zeigte die großen Ausma ße des ehemaligen Ernstinenwei hers, der den Waidhausern als Badeteich diente. 1806 waren der Stauweiher und der Ernestinen hammer gebaut worden.
im Hammerhaus gewohnt. Wo stand nun dieses? Vor uns unge fähr zehn Meter entfernt erhebt sich wie ein kleiner Wall, sehr dicht mit Büschen bewachsen. Einige von ihnen stammen vom
den Sonne ganz nahe zu sein. Ein sehr emotionaler Augenblick. Randi schickte Fotos von hier an ihre 91jährige Mutter, die nicht mehr reisen kann, nach Oslo.


Leider konnten wir hier in die ser Waldeinsamkeit nicht lan ge bleiben, weil wir noch ei nen weiteren wichtigen Ter min hatten. Randi stellte fest, daß in ihrer Ahnenreihe auch der Barockmaler Wenzel Sa muel Schmidt aus Plan, der so genannte Planer Schmidt, auf taucht. Er lebte in der Barock zeit und malte in der Fürst Löwenstein‘schen Herrschaft Schlösser und Kirchen aus. Darunter ist auch die Haider Sankt-Nikolaus-Kirche.
Anna Sudová schloß uns die Türe der Haider Kirche auf. Die norwegischen Gäste, die aus ihrem Land nüchterne, protestantische Kirchen ge wohnt sind, waren von dieser barocken Pracht überwältigt, sprachlos standen sie da. Der Hochaltar und die großartigen Wand- und Deckengemälde des Planer Schmidt erzeugten eine barocke Explosion.

Leider kann man heute nicht mehr einfach zum Ham merhaus rü bergehen.
Sumpfge biet verhindert das. So muß ten wir den langen bogenförmi gen Umweg über das Dorfzen trum von Reichenthal nehmen, den Weg nach Neuhäusl und dann nach rund 500 Metern nach Süden in einen Wald weg abbiegen. Nach weite ren 400 Metern steht rechts un ter Bäumen ein Schild, das auf den ehe maligen Erne stinenhammer verweist.

Randi führ te uns auf ei ne kleine Lich tung mit zwei Bänken aus ei nem halbier ten Baum stamm. Das Gras, von der Sonne gebleicht, stand 80 Zentimeter hoch. Links im Gebüsch das al te Hammerkreuz, das Anfang der 1990er Jahre Karl Bauer ge funden, renoviert und wieder aufgestellt hatte. Er hatte früher
alten Garten, denn sie gehören nicht in die Wildnis. Hier hat al so das Hammerhaus gestanden. Randi hatte ein Foto des Anwe sens dabei. Und natürlich kann te sie Ernestine, nach der der Ort und der Weiher benannt wurden.
Rechts steht eine mächtige Lär che, die man hier nicht vermuten würde. Der Großvater hat sie für seine Tochter gepflanzt. Aus ih rem Holz wollte er ihr eine Küche bauen lassen.
Am großen Wandgemälde hinter der Barockorgel ist in der Mitte die Mutter Kirche mit ih ren Schäfchen dargestellt. Der Hirte rechts von ihr hat der Über lieferung nach das Aussehen des Kirchenerbauers und Pfarrers Jo seph Schmidt, der auch die Ma lereien gestiftet haben soll. Der Hirte links ist von zierlichem Körperbau und trägt eine silber ne Perücke. Sicherlich hat sich hier der Maler dargestellt. So ha ben wir auch ein Selbstbild nis von Wen zel Samuel Schmidt gefun den. Randi war überglücklich, ihr Mann hatte viel zu fotogra fieren.
Am 27. November eröffnet im Archaeo-Centrum Bayern-Böh men im oberpfälzischen Bärn au die Ausstellung „Das Leben in Paulusbrunn“, die das All tagsleben in dem verschwunde nen Dorf im Bezirk Tachau do kumentiert.
authentischen Rekonstruktionen in Originalgröße und von Dar stellern in mittelalterlicher Klei dung lebensnah erfahrbar. Trä ger des Geschichtsparks ist der gemeinnützige Verein Via Caro lina – Goldene Straße.
Wir sitzen auf den Bäumen und genießen die absolute Ru he und die Schönheit der Natur. An den Abenden der vergange nen Tage waren Randi und Knut hierher gefahren, um der Heimat ihrer Mutter in der untergehen

Auf dem Rückweg zeig te ich Randi noch den böh mischen Fried hof in Neu stadtl mit dem verfremdeten Grab meiner Großmutter. Sie war schok kiert. Dann ging es zur Neumüh le, zu meinem Geburtsort. Eine Sintifrau, die mit ihren Kindern in dem nach dem Krieg erbauten Haus oberhalb der Säge wohnt, belästigte uns sehr, so daß wir schnell weiterfuhren. Mir kam nachher der Gedanke, daß es für die eigene Gefühlswelt wohl bes ser ist, wenn wie bei Randi nur mehr einige Steine an die Einöde erinnern und die Stille der Na tur wirken kann, als wenn man von Menschen in der Kontakt aufnahme zu den Resten seines Heimatortes gestört wird. Ein un vergeßlicher Tag mit Randi und Knut in unserer böhmischen Hei mat ging zu Ende, und viele Ge danken sausten auf der langen Heimfahrt durch meinen Kopf.
Petra Musilová Seidlová vom Geschichtspark Bärnau-Ta chov hatte zuvor Heimatkreisbe treuer Wolf-Dieter Hamperl ge fragt, ob sie das Text- und BildMaterial aus seinem Buch „Die verschwundenen Dörfer“ ver wenden dürfe. Im Geschichtspark in Bärnau gab Hamperl Musilová die Fotografien und das Buch mit den Texten.
Der Geschichtspark ist ein ar chäologisches Freilichtmuseum in Bärnau im östlichen Landkreis Tirschenreuth sowie in Tachau in der Pilsner Region. Es stellt das mittelalterliche Alltagsleben in der Bavaria Slavica vom 8. bis zum 14. Jahrhundert dar.
2010 begannen die Bauarbei ten an dem grenzüberschreiten den Geschichtspark, der 2011 eröffnet wurde. Das Museums konzept sieht drei Zeitfenster vor: frühmittelalterliches Dorf des 8./9. Jahrhunderts, Motte (Turmhügelburg) und Stabkir che des 11. Jahrhunderts und ei ne Siedlung des Hochmittelal ters, aufgeteilt in ländliches Ge höft und Stadthäuser aus dem 12./13. Jahrhundert. Seit 2018 sind 30 originalgetreue Gebäu de auf einem Gelände von fast elf Hektar zu besichtigen. Die Anla ge ist das größte mittelalterliche archäologische Freilichtmuseum Süddeutschlands.
Im Geschichtspark wird das mittelalterliche Alltagsleben mit
Neben dem Geschichtspark wurde 2018 das Archaeo-Cen trum Bayern-Böhmen einge weiht. Es umfaßt die Schaubau stelle einer Reisestation oder Pfalz von Kaiser Karl IV. im 14. Jahrhundert und die in einem Neubau untergebrachte Ar chaeowerkstatt. Der Königs hof wird die Holzbauten des Ge schichtsparks didaktisch durch Steinarchitektur ergänzen, da bei ermöglicht die Archaeowerk statt, die authentisch betriebene Baustelle im Sinne einer Experi mentalarchäologie wissenschaft lich zu begleiten. Das Archaeo Centrum bietet moderne La bor- und Arbeitsräume, die von Forschungsprojekten sowie der Otto-Friedrich-Universität Bam berg, der Karls-Universität Prag und der Westböhmischen Uni versität Pilsen genutzt werden. Das ArchaeoCentrum wird sepa rat von der EU gefördert.
Die Ausstellung entstand im Rahmen des Projekts „Spurensu che im Böhmischen Wald“. Das Projekt wird aus dem Programm Ziel ETZ Freistaat Bayern und Tschechische Republik finan ziert. Während der Ausstellung wird auch eine Comicpublikation vorgestellt, die im Rahmen des selben Projekts entstand. Gleich zeitig findet auf dem Gelände ein Weihnachtsmarkt statt.
Anmeldung bis 22. November 17.00 Uhr an petra.musilova@ geschichtspark.de