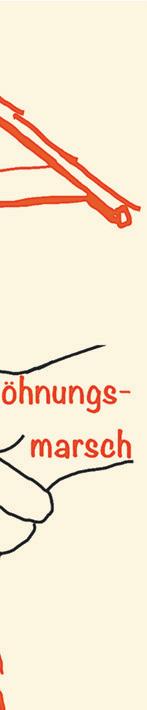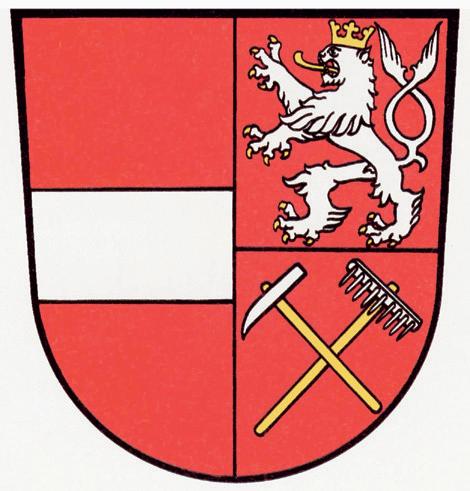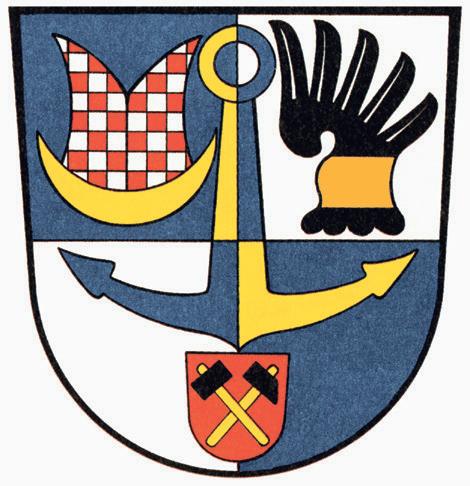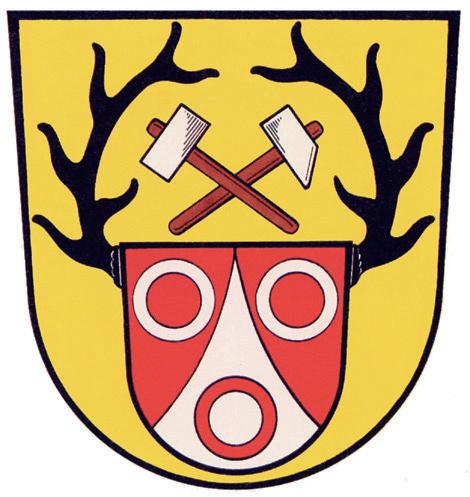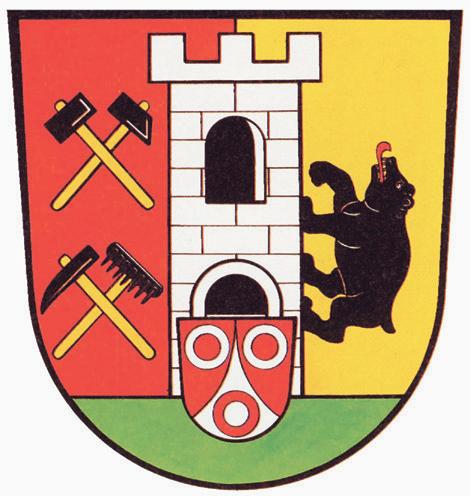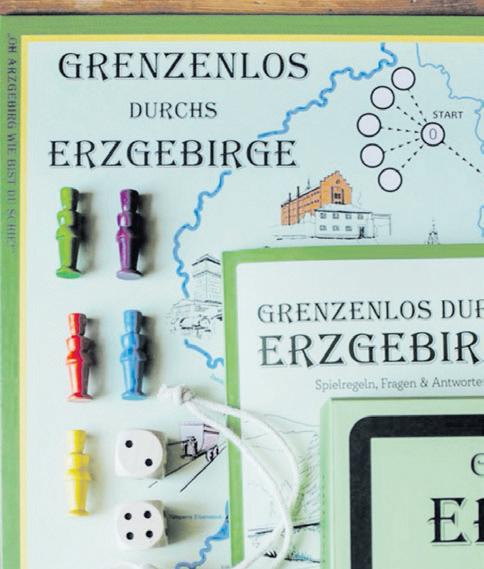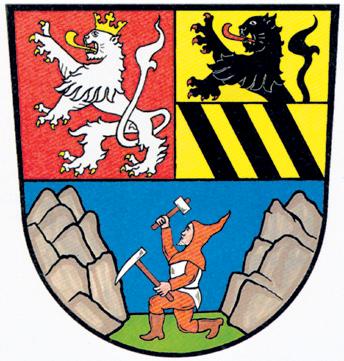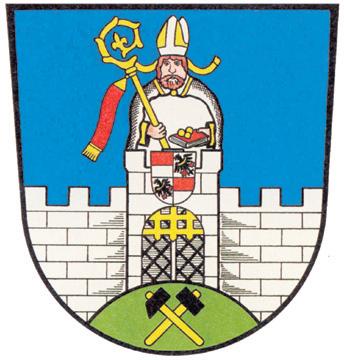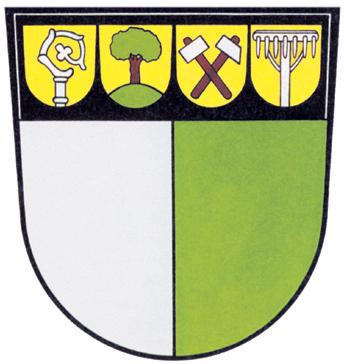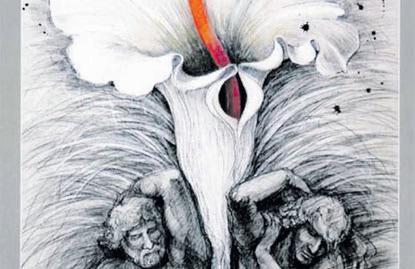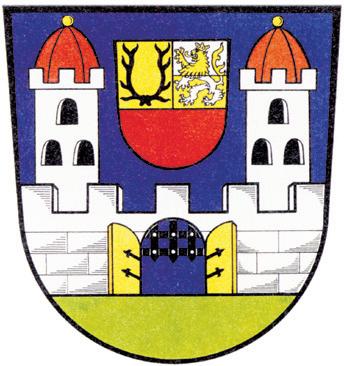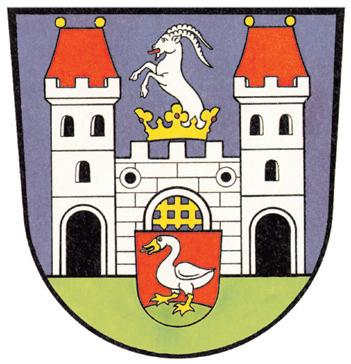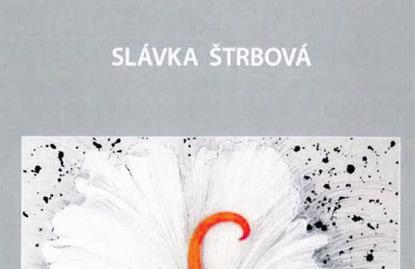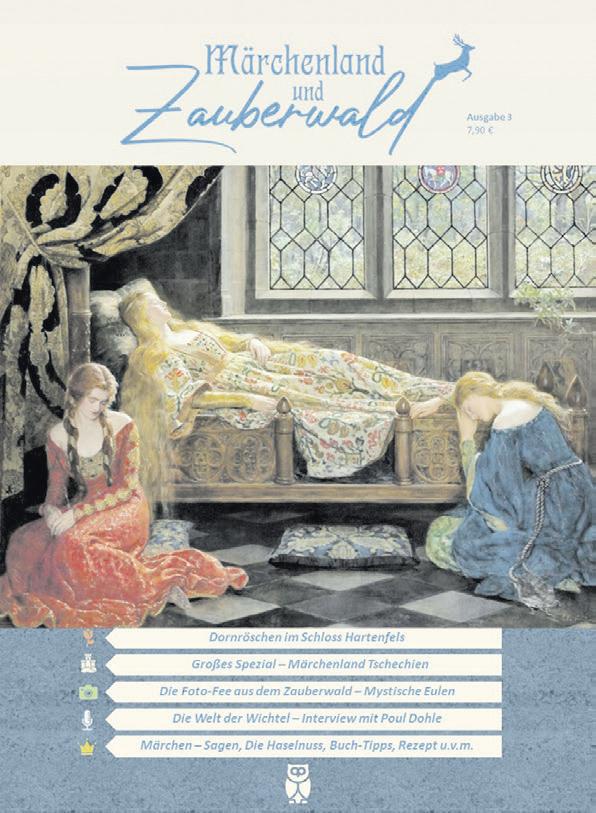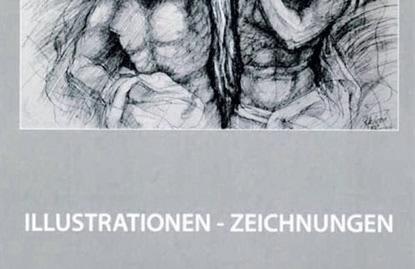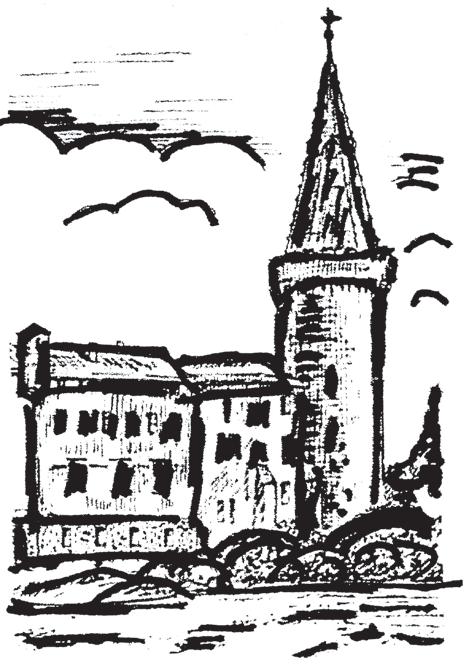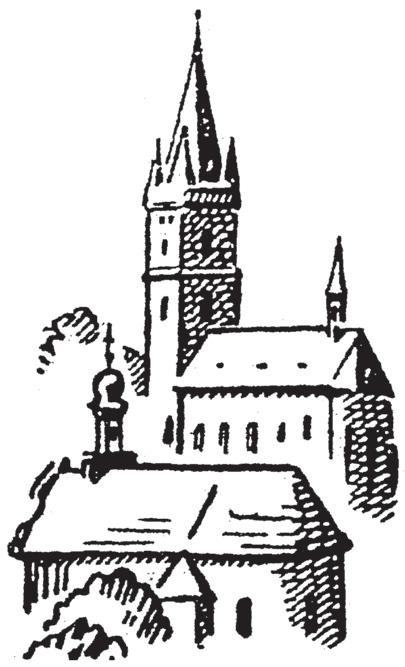Sudetendeutsche Zeitung
Weitere posthume Würdigung für den Vater der Genetik, Gregor Johann Mendel, der vor 200 Jahren geboren wurde. Das Augustinerkloster in Brünn, wo Mendel wirkte, wird zum Nationalen Denkmal erhoben.
In der Begründung des Kulturministeriums heißt es, das Augustinerkloster solle nicht nur wegen seiner kunsthistorischen
Bedeutung zum Nationalen Kulturdenkmal ernannt werden, sondern auch, weil dort Gregor Johann Mendel die bahnbrechenden Grundlagen der Genetik entwickelt hatte.
Nationale Kulturdenkmäler sind nicht nur ein Anziehungspunkt für Touristen, für sie gelten auch strengere Schutzvorschriften.
Weitere Gebäude, die auf Vor-
schlag des Kulturministeriums vom Kabinett zu Nationalen Kulturdenkmalen erklärt werden, sind das ehemalige Augustinerkloster in Stockau in Westböhmen, das Augustinerkloster in Raudnitz, die Schlösser Eisenberg, Mährisch Kromau, Rossitz und Plumenau und die Burg Eichhorn. Derzeit gibt es in Tschechien rund 350 Nationale Kulturdenkmalen.



„Staatliche Gebilde sind für die Menschen da – nicht umgekehrt“
Litauen
Präsident Nausėda in Prag
Gemeinsam mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda und der belarussischen Oppositionsführerin Sviatlana Cichanouskou hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala im Palais Liechtenstein eine internationale Konferenz über Rußlands hybriden Krieg gegen die demokratische Welt und eine Ausstellung über die Unterdrückung der Litauer unter der Sowjetunion eröffnet.
Zuvor hatten sich Fiala und Nausėda zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen, um die aktuelle Sicherheitslage in Europa zu erörtern.
Anschließend eröffneten sie gemeinsam die Ausstellung „Unter fremdem Himmel: Litauer in sowjetischen Arbeitslagern und im Exil 1940–1958“, die die dunkle Zeit der Verfolgung des litauischen Volkes während der sowjetischen Unterdrückung darstellt. Allein zwischen 1944 und 1952 wurden schätzungsweise 245 000 Litauer vom stalinistischen Regime nach Sibirien verbannt.
Fiala: „Rußland versucht, unsere Demokratie zu mißbrauchen und sie gegen uns zu wenden. Moskau ist von der Freiheit irritiert.“ Rußland habe Angst vor der Macht einer fairen Debatte und versuche, sie zu zerstören.
Der Premierminister weiter: „Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, welche Werte es wert sind, verteidigt zu werden, und wir werden nicht zulassen, daß unsere Demokratie abgeschafft wird.“


„Die Europäische Union ist für die Menschen da“, so hat der Titel gelautet, den Professor Dr. Peter Michael Huber, Richter am Bundesverfassungsgericht, für seinen Vortrag zum diesjährigen Heiligenhofgespräch gewählt hatte.
Zu der Veranstaltung hatten die Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk und die Akademie Mitteleuropa eingeladen, auch um dem 20-jährigen Bestehen der Akademie, dessen Kuratoriumsvorsitzender Prof Huber ist, und dem 70-jährigen Jubiläum des Heiligenhofs einen würdigen Rahmen zu geben.
Wer eine normale Festrede erwartet hatte, wurde positiv überrascht. Es waren alles andere als Selbstverständlichkeiten, die das langjährige Mitglied des zweiten Senats in Karlsruhe und Berichterstatter für zahlreiche prominente Entscheidungen, wie zur Verfassungsmäßigkeit des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen vortrug.
Huber, der vor seiner Berufung nach Karlsruhe kurzzeitig Innenminister von Thürigen war, hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie inne und leitet die Forschungsstelle für das Recht der Europäischen Integration. Der renommierte Jurist ließ keinen Zweifel daran, daß wir es dem sich einigenden Europa zu verdanken haben, daß wir zumindest auf dem
Gebiet der Europäischen Union seit 1945 keinen Krieg mehr erleben mußten und ein einiges Europa weiterhin der beste Garant für Frieden und Wohlstand sei.


Mit dem wachen Blick eines der Objektivität verpflichteten Richters benannte Huber jedoch nicht nur die zahlreichen aktuellen Krisen und Herausforderungen in Europa, sondern mahnte auch, den Rechtsrahmen innerhalb dessen die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten interagieren, zu respektieren.
Hier ging Huber mit den Akteuren auf der europäischen Bühne teilweise hart ins Gericht.
„Brüssel und Luxemburg sind
nicht Europa“, sagte Huber und erklärte, es handle sich vielmehr um „eine Blase, die nicht weiß, was bei den übrigen 450 Millionen EU-Bürgern los ist“. Der Staatsrechtler forderte deshalb mehr Selbstkritik und konstruktive Distanz.
„Die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union sind kein Selbstzweck. Staatliche Gebilde sind für den Menschen da – nicht umgekehrt“, so Huber. Es gelte immer Akzeptanz für die öffentliche Herrschaft zu sichern. Er sprach sich hierbei deutlich für das Subsidiaritätsprinzip aus der christlichen Soziallehre aus.
Huber: „Die Intension aller europäischen Verträge ist die Frage: Wie können Menschen nach ihrer Fasson glücklich werden?“
Der Staatsrechtler forderte deshalb, daß die EU nur dort agiert, wo es unbedingt notwendig sei und daß die Länder ein möglichst großes Maß an Selbstbestimmung behalten. Eine Flut von Rechtsvorschriften, so der Top-Jurist, führe zum „Herzinfarkt eines Rechtsstaates“. Es sollten deshalb nur die Dinge geregelt werden, „die einen Mehrwert für den Menschen haben“.
Europa sei die Ebene, auf der es darum gehe, unsere Werte zu verteidigen, die Macht des Kon-
tinents zu bündeln, um im globalen Wettbewerb zu bestehen und darum die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Eine permanente und auch schleichende Erweiterung von Detail-Kompetenzen zulasten der Mitgliedsstaaten sieht er kritisch. Für ihn ist auch die Reihenfolge der demokratischen Legitimation der europäischen Institutionen klar: „Die erste Kammer bildet der Europäische Rat, die zweite das Europaparlament“.
Auch die Europäische Zentralbank betrachtet Huber kritisch und stellte der Geldpolitik der EZB ein schlechtes Zeugnis aus: „Preisstabilität ist das wesentliche EZB-Ziel, jedoch ist deren explodierende Geldpolitik inflationsfördernd gewesen“.
„Das diesjährige Heiligenhofgespräch wurde durch diesen Vortrag eines der profiliertesten Staatsrechtler Deutschlands zu einer Sternstunde der politischen Bildung“, bedankte sich Hans Knapek, Vorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk.
Knapek unterstrich, daß dieser Vortrag und die gesamte Tätigkeit der Akademie Mitteleuropa eine Fortsetzung des Auftrags des Heiligenhofs sei, die Demokratie und ein friedliches und freiheitliches Zusammenleben in Mitteleuropa zu fördern.
Mehr über das 20jährige Jubiläum der Akademie Mitteleuropa lesen Sie in einer Würdigung von Dr. Raimund Paleczek, dem Vorsitzenden der Akademie Mitteleuropa, in dieser Ausgabe auf Seite 3. KS
Oberlandesgericht bestätigt Satzungsänderung
Auch dieser Versuch, über juristische Winkelzüge eine demokratische Entscheidung der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu kippen, ist krachend gescheitert.
Das Oberlandesgericht München hat jetzt in letzter In-
stand mehrere Beschwerden gegen die Eintragung der beschlossenen Satzungsänderungen zurückgewiesen. Den Beschwerdeführern wurde außerdem auferlegt, die kompletten Kosten für das Verfahren zu zahlen.
Die Richter stellten in ihrer Entscheidung fest, daß die 2017 von der Bundesversammlung be-
schlossene Änderung der Satzung keine Änderung des Vereinszwecks darstelle.
Im Urteil heißt es dazu: „In diesen neuen Formulierungen wird in Übereinstimmung mit der alten Fassung daran festgehalten, daß an einer gerechten Völkerund Staatenordnung mitzuwirken ist, daß Völkermord, Vertrei-
bungen, ethnische Säuberungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Diskriminierungen zu ächten sind und das Recht auf Heimat und das Selbstbestimmungsrecht aller Völker und Volksgruppen garantiert werden. Zusätzlich wurde hierzu auf die EU-Grundrechtscharta Bezug genommen. Auch die Forde-
rung nach Ausgleich betreffend Enteignungen und vertreibungsbedingtes Unrecht findet sich in dem neugefaßten § 3 der Satzung wieder. Lediglich die Formulierung wurde den politischen Entwicklungen wie beispielsweise der Gründung der Europäischen Union mit den von ihr garantierten Grundfreiheiten angepaßt.“
B 6543 Jahrgang 74 | Folge 47 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 25. November 2022 Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de
VOLKSBOTE
161. Jahrgang Bundeskulturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoin (Seite 5) ❯ Die Heimstätte von Gregor Johann Mendel in Brünn Augustinerkloster
Nationalen Kulturdenkmal
HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung Neudeker Heimatbrief
wird zum
❯ Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
❯ Verfassungsrichter Prof. Dr. Peter Michael Huber geht beim diesjährigen Heiligenhofgespräch mit der Politik ins Gericht
Präsident Gitanas Nausėda und Premierminister Petr Fiala bei der Ausstellungserö nung. Foto: Vlada CZ
❯ Besuch aus
70 Jahre Heiligenhof, 20 Jahre Akademie Mitteleuropa (von links): Stiftungsdirektor und SL-Landesobmann Steffen Hörtler, Bayerns Innen-Staatssekretär Sandro Kirchner, Dr. Günter Reichert, Geschäftsführender Vorstand der Akademie Mitteleuropa, Verfassungsrichter Prof. Dr. Peter Michael Huber und Hans Knapek, Vorstand der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk.
Foto: Heiligenhof
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Tobias Gotthardt, der Vorsitzende des Ausschusses Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen im Bayerischen Landtag, ist für das Prager Sudetendeutsche Büro kein Unbekannter.
Der Politiker der Freien Wähler hatte die Sudetendeutsche Botschaft des guten Willens an der Moldau in der Vergangenheit bereits besucht. Jetzt kam er mit einer ganzen Delegation, die die Arbeit des Prager SL-Büros kennen lernen wollte, um sich bei Büroleiter Peter Barton zu informieren.
Diese Einrichtung der Sudetendeutschen Landsmannschaft bemüht sich sei über zwanzig Jahren um eine Verständigung zwischen den ehemaligen und jetzigen Bewohnern der sudetendeutschen Heimat. Das Büro
wurde somit fester Bestandteil von Arbeitsbesuchen zahlreicher Institutionen, unter anderem von Politikern verschiedener Parteien aus Deutschland und Österreich.
Barton wies in seiner Rede auf die inzwischen erreichten Erfolge des Prager Büros hin, sowie auf weitere Aufgaben, die sich während der Zeit der tschechischen EU-Präsidentschaft natürlich intensivieren. Die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland werden zwar allgemein als sehr gut oder sogar hervorragend bezeichnet, das bedeutet jedoch nicht, daß hier bereits alles getan wurde, um auch die sudetendeutschen Anliegen zufrieden zu stellen.
Gotthardt betonte in seinem Statement, es sei seinem Ausschuß bewußt, wie wichtig die Arbeit der Sudetendeutschen für die erwähnte Verständigung sei. Deshalb ver-
sprach er weitere Hilfe für dieses hohe Ziel.
Auf dem Erinnerungsfoto (von links) Peter Barton, Delegationsleiter Tobias Gotthardt (Freie Wähler), Erster Vizepräsident des Landtags, Karl Freller (CSU), Florian Siekmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Hepp Monatzeder (Bündnis 90/Die Grünen). Kleines Bild: MdL Gotthardt überreicht Barton ein Mitbringsel aus Bayern.


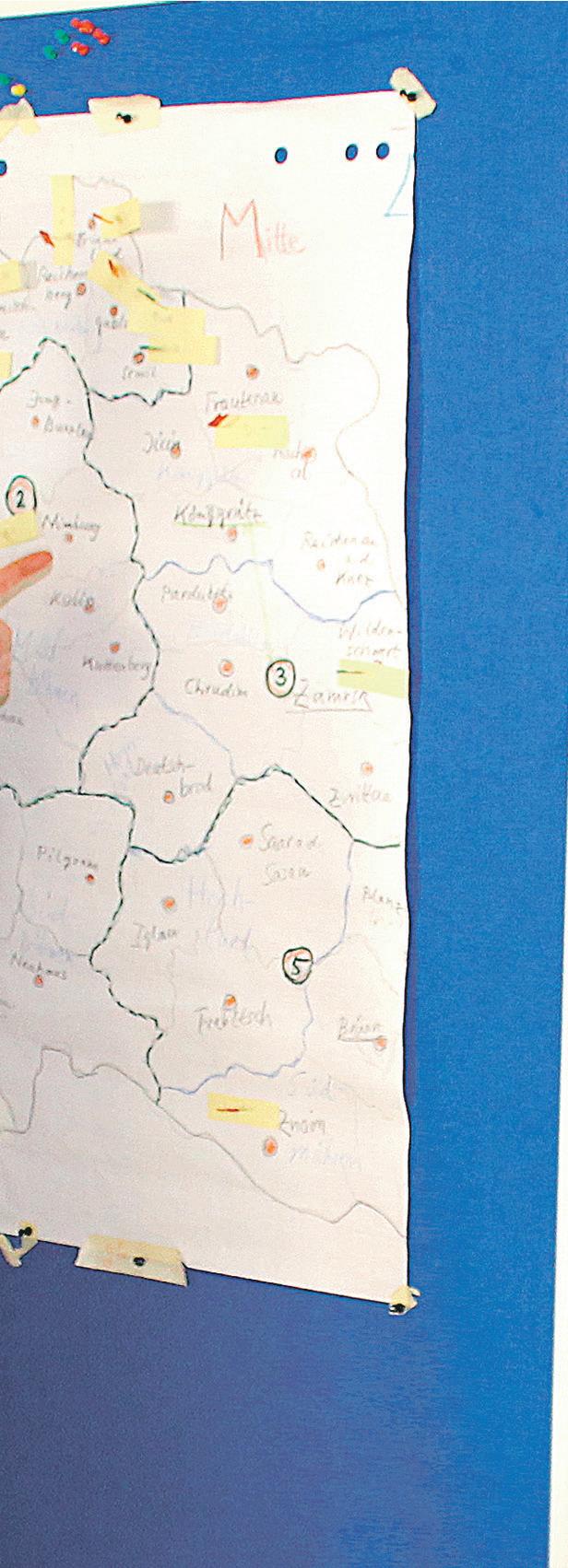
Werner Honal: So klappt es mit der eigenen Familienforschung
Unter dem Titel „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte Der Heiligenhof in Bad Kissingen ihr mehrtägiges Herbstseminar mit wissenschaftlichem Anspruch veranstaltet. Im zweiten Teil unseres Berichts richten Referenten und Seminarteilnehmer den Blick verstärkt ins Nachbarland Tschechien.

Als Vertreter der nachgeborenen Generation beleuchtet Stiftungsdirektor Steffen Hörtler geschichtliche Zusammenhänge und politische Gegebenheiten. Hörtler, stellvertretender SL-Bundesvorsitzender und Landesobmann in Bayern, ist in vielen weiteren Funktionen im Vertriebenenbereich ehrenamtlich aktiv.
In seinem Überblick wird deutlich, daß nur durch aktives Mitwirken im Verständigungsprozeß von Sudetendeutschen und Tschechen eine gemeinsame Zukunft Bestand haben wird.
Hörtler spricht unter anderem über die Entstehung des Museums in Aussig an der Elbe und der Dauerausstellung mit dem Titel „Unsere Deutschen“, die dort zu sehen ist. Gezeigt wird das Leben der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern vom Frühmittelalter bis in die Gegenwart. Es werde eine gute Zusammenarbeit der Verantwortlichen mit dem Sudetendeutschen Museum in München praktiziert. Die Ausstellung des Sudetendeutschen Rates in den Räumen der Bayerischen Repräsentanz in Prag „So geht Verständigung“ – dort bis Ende November zu sehen – sei ein weiterer Beleg für die gute Verständigungsarbeit.
Hörtler betont die gute Zusammenarbeit mit den diplomatischen Vertretern auf deutscher wie auf tschechischer Seite. Aber wenn von Politikern zu hören sei, die deutsch-tschechischen Verhältnisse seien so gut wie nie, seien die Beziehungen in Wirklichkeit doch noch problembehaftet. Es sei jedoch spürbar, daßsich etwas verändere. Aber derzeit gehörten Energie und Kernenergie, fehlende Bahnverbindungen, Flüchtlingshilfe, der russische Angriffskrieg und Inflationsraten zu den drängendsten Fragen.
Überblickt man den Gesamtprozeß der vielfältigen Verständigungsprojekte, so ist sich der Heiligenhof als sudetendeutsche Bildungsstätte seiner Verantwortung bewußt. Ulrich Rümenapp,
langjähriger Bildungsmanager, schildert seine Arbeit unter dem Motto „Die Ost-West-Jugendakademie – Ein best-practiceBeispiel einer Veranstaltungsreihe für Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien“. Die Jugendakademie hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Jugendliche und junge Erwachsene die historischen und aktuellen Verbindungen Deutschlands in die osteuropäischen Staaten aufzuzeigen.
Der deutsch-tschechische Austausch, unterstützt durch Dolmetscher und Sprachanimateure, funktioniere ausgezeichnet, so Rümenapp. Mit den teilnehmenden deutschen und tschechischen Schülern werde ausnahmslos deutsch und tschechisch gesprochen. Zum Programm des vielfältigen Themenreigens gehörten neben der Geschichtsvermittlung unter anderem Exkursionen zu Orten, an denen sich ein deutsch-tschechischer Bezug herleiten lasse, und Workshops zu Themenbereichen wie Europa, Identität, Emotionen sowie eine breite Palette gesellschaftlicher Aspekte.
Interessant für ihn, so Rümenapp, sei auch die Erfahrung, daß unter deutschen Jugendlichen und tschechischen Jugendlichen dieselben Themenbereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten diskutiert werden. Wichtig sei, daß junge Menschen miteinander ins Gespräch kommen und eventuell vorhandene Vorurteile abgebaut werden. Die geographische Nähe zu einer Grenze sage nicht wirklich etwas darüber
aus, ob man wisse, was hinter der Grenze liege, so der Bildungsmanager.
Den Blick über die Grenze zu den Archiven in der Tschechischen Republik richtet auch Werner Honal mit seinem Vortrag „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“.
Der Familienforscher fesselt die Teilnehmer mit seinem Wissen über die tschechischen Archive und Tipps für die Familiengeschichtsschreibung. Die Wurzeln der eigenen Familie so weit wie möglich in der Zeit zurück zu verfolgen und damit die eigene Herkunft besser kennenzulernen, ist für die heimatvertriebenen Sudetendeutschen von größter Wichtigkeit. Spurensuche in die Vergangenheit, um die Lükken zu schließen, die vor allem durch Krieg und Vertreibung in den Familien gerissen wurden.
Der noch in Prag geborene Studiendirektor Werner Honal hat sich seit seiner Pensionierung ganz der Familienforschung unter Zuhilfenahme der heutigen technischen Möglichkeiten verschrieben. Familien finden mit dem Internet, so sein Motto. Denn Familienforschung mit dem Internet sei für die Sudetendeutschen ein Glücksfall, weil die acht Gebietsarchive in der Tschechischen Republik weltmeisterlich digitalisiert seien, führt er aus. Sie entwickelten sich ständig weiter und würden immer besser.
Vor der Arbeit in den Archiven müsse aber klar sein, das zeigt der Referent an verschie-
denen Beispielen, nach welchem Namen und in welchem Ort Verwandte gesucht werden. Erst um 1880 seien die Familiennamen fixiert worden.
Ein spannendes Kapitel, das die grauen Zellen der Forschenden mobilisiert, ist die Suche nach dem richtigen Ortsnamen. Für tschechische Archive sollte neben dem deutschen Namen des Ortes auch dessen tschechischer Name gefunden werden. Als eine gute Hilfe stellt der Referent dazu das Ortsverzeichnis in www.genteam.at vor. Mit einer kostenlosen Anmeldung kann man es nutzen. Es hat den großen Vorteil, auch auf das zugehörige Gebietsarchiv zu verweisen. Außerdem ist angegeben, für welche Zeit in welcher Pfarrei Kirchenbücher digital verfügbar sind.
Die Gegend des gesuchten Ortes kann gut über die digitale Landkarte www.mapy.cz erkundet werden. Links oben, so führt es der Referent für den Ort Silberbach vor, kann dort auf eine Karte des 19. Jahrhunderts umgeschaltet werden, die dann auch die deutschen Namen der Ortschaften zeigt.

Hilfestellungen bei der Schrift oder bei der Ortssuche finde man bei der Forschergemeinde. Neben der www.vsff. de, die auch im Sudetendeutschen Haus in München ein Büro hat, gibt es noch eine Schwestervereinigung in Wien (www. familia-austria.at), die die vielbeachtete Mailingliste „Böhmische-Länder“ herausgibt. Hildegard Schuster

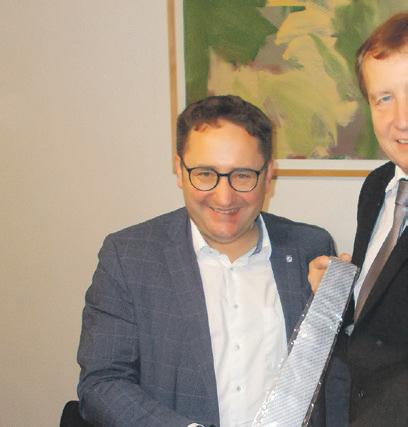
Reallöhne in Tschechien sinken
Als Nicht-Euroland leidet Tschechien stärker an der wirtschaftlichen Talfahrt als die anderen EU-Staaten. So sanken die Reallöhne wegen der hohen Inflationsrate und der schwächelnden Krone allein in diesem Jahr um durchschnittlich 8,3 Prozent. Dies geht aus einer Analyse der Investmentfirma Cyrrus hervor. Die Geldentwertung liegt damit über dem EUDurchschnitt. Besserung ist nicht in Sicht. In Tschechien lag die Inflation allein im September bei 17,8 Prozent. Auch die anderen Visegrád-Staaten melden hohe Inflationsraten, wobei die NichtEuro-Länder Ungarn und Polen mit 20,7 beziehungsweise 15,7 Prozent deutlich über der Eurozone mit 10,9 Prozent liegen. Als Euroland liegt die Slowakei dagegen mit 13,6 Prozent nur knapp über dem Durchschnitt.
1,44 Millionen Euro für Werk von Toyen
Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Das Bild „Skryt v jejich odrazech“ der surrealistischen Malerin Toyen ist am Sonntag im Prager Repräsentationshaus für 35 Millionen Kronen (1,44 Millionen Euro) versteigert worden. Das bisher für den höchsten Preis bei einer Auktion in Tschechien verkaufte Bild von Toyen bleibt „Cirkus“ (1925). Das kubistische Gemälde erstand im April vergangenen Jahres ein Käufer für fast 80 Millionen Kronen (3,3 Millionen Euro). Toyen wurde 1902 als Marie Čermínová in Prag geboren und gilt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts in Europa. Sie starb 1980 in Paris.
Tschechen essen zu viel Salz
Man ist, was man ißt: Vor ungesundem Essen hat jetzt das Staatliche Gesundheitsinstitut (SZÚ) gewarnt. Aktueller Anlaß: Die Tschechen essen zu viel Salz, im Schnitt 15 Gramm pro Tag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt dagegen maximal fünf Gramm Salz pro Tag. Laut dem Gesundheitsinstitut kann übermäßiger Salzkonsum zu Bluthochdruck und Übergewicht führen. Ein Problem sei, daß in Tschechien bereits kleine Kinder an relativ viel Salz in Speisen gewöhnt seien, hieß es weiter. Das SZÚ verwies
dabei auf eine Studie der Südböhmischen Universität in Budweis. Durch den hohen Salzkonsum in jungen Jahren erhöhe sich im späteren Leben die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen, so das Institut. Vor allem in Fast Food, warnen regelmäßig Ärzte ihre Patienten, befinden sich hohe Konzentrationen an Salz.
Erzbistum verkauft Heinrichsturm
Das Prager Erzbistum will den Heinrichsturm im Stadtzentrum verkaufen, sagte Generalvikar Jan Balík der Tageszeitung Deník N. Der Verkaufspreis für den denkmalgeschützten gotischen Bau liegt bei 75 Millionen Kronen (3,08 Millionen Euro). Der fast 68 Meter hohe Turm war früher der Glockenturm der angrenzenden Kirche St. Heinrich und Kunigunde. Er wurde 1472 bis 1475 erbaut und beherbergt unter anderem die historische Marienglocke von 1518. Heute werden die zehn Stockwerke vor allem für touristische und kulturelle Zwecke genutzt. Unter anderem gibt es dort eine Galerie, aber auch ein Restaurant. Zudem ist der Heinrichsturm ein beliebter Aussichtspunkt.

UN-Klimakonferenz
„ist ein Fiasko“
Tschechische Umweltorganisationen haben die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz (COP 27) im ägyptischen Scharm ElScheich als „Fiasko“ bezeichnet. Es sei klar, daß die Ergebnisse von den Stimmen der Lobbyisten fossiler Energieproduzenten und großer Konzerne diktiert worden seien, sagte die Klimaexpertin Miriam Macurová von Greenpeace Tschechien im Namen von mehr als 30 Organisationen.
5300 Illegale aufgegriffen
eit der Einführung der Kontrollen an der Grenze zur Slowakei Ende September haben die tschechischen Behörden dort insgesamt 5300 illegale Migranten aufgegriffen, hat der Leiter der Polizei in Südmähren, Leoš Tržil, anläßlich eines Besuchs der Verteidigungsministerin Jana Černochová (Bürgerdemokraten) am Samstag in Straßnitz erklärt. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien und wollten ursprünglich über Tschechien nach Deutschland weiterreisen.
S


Sudetendeutsche Zeitung
Freitag
und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses
·
Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 2 PRAGER SPITZEN
AKTUELL
MEINUNG
Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
ISSN 0491-4546 Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine:
18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion
❯
Herbstseminar „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“, Teil 2
Werner Honal führt in die Familienforschung ein. Fotos: Hildegard Schuster
Stiftungsdirektor Ste en Hörtler
Bildungsmanager Ulrich Rümenapp
Ein Ort des Dialogs, des frei en Denkens, der Forschung und Lehre sowie der Bildung – da für steht seit zwanzig Jahren die Akademie Mitteleuropa (AME), die das Verhältnis der Deut schen zu ihren östlichen Nach barn zum Schwerpunkt hat. Zum Jubiläum würdigt Dr. Rai mund Paleczek als Vorsitzen der der Akademie Mitteleuropa die auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen beheimatete Einrich tung und erklärt, warum es auch in Zukunft diese Brücke zu den Nachbarn braucht.
Von Dr. Raimund Paleczek
Die Jahrzehnte nach 1989/1990, die Deutschland die Einheit und den Völkern Ost mitteleuropas die Freiheit und den Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union gebracht haben, können mit den beschleu nigten wirtschaftlichen und so zialen Entwicklungen nach der Reichsgründung 1870/1871 bis zum Ersten Weltkrieg verglichen werden und haben den Regio nen jenseits des gefallenen Eiser nen Vorhangs eine Epoche des Wachstums sowie des wirtschaft lichen, sozialen und kulturellen Fortschritts gebracht.
Im Jahr 2002 beging die Su detendeutsche Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heili genhof“ in Bad Kissingen den 50. Jahrestag seit der Gründung des Sudetendeutschen Sozial werkes und dem Kauf des Hau ses. In den Jahren 2000 bis 2002 wurde der bis dahin größte Umund Erweiterungsbau des Ta gungshauses zu einer modernen Bildungsstätte mit adäquaten Übernachtungs-, Speise- und Se minarräumen getätigt. Den da maligen Verantwortlichen des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks (SSBW), vor al lem dem ehemaligen thüringi schen Staatssekretär Wolfgang Egerter, seinem Stellvertreter Rechtsanwalt Reinfried Vogler und dem Schatzmeister Volks wirt Peter Hucker, war es aber ein wichtiges Anliegen, die bei den aktuellen Anlässe – die Öff nung nach Ostmitteleuropa und die Existenz einer modernen Bil dungsstätte – zu nutzen, den Heiligenhof als politisch-histo risch-kulturelle Bildungsstätte
Dr. Raimund Paleczek ist Vor sitzender der Akademie Mit teleuropa, Vor sitzender des Sudetendeut schen Archivs und gehört dem SL-Bundesvor stand an.
mit bislang vor allem sudeten deutschem Profil zu einem erwei terten Schwerpunkt „Die Deut schen und ihre östlichen Nach barn“ weiterzuentwickeln.
So wurden Weichen gestellt, damit diese Themen der Bezie hungsgeschichte, der gemeinsa men Gegenwart und der Zukunft ein Forum – insbesondere für die nachfolgenden Generatio nen – erhalten. In der sudeten deutschen Verbandspolitik hatte sich allmählich ein Wechsel von eher konfrontativen zu kooperie renden Strukturen mit tschechi schen Gruppierungen und Part nern angebahnt. Die Bezeichnun gen „sudetendeutsch/sudety“ und ihre Ableitungen waren sei nerzeit im tschechischen Sprach raum noch negativ besetzt und konnotiert. Dieses hat sich mitt lerweile grundlegend gewandelt. Es mußte also eine Einrichtung für hochrangige Begegnungsver anstaltungen geschaffen werden, die eine positive Assoziation aus löst. Man fand hierfür den Na men „Akademie Mitteleuropa“ und entschloß sich, im Jahr 2002 einen eingetragenen Verein glei chen Namens zu gründen.
Zum Vorsitzenden wurde Dr. Günter Reichert gewählt, der
Akademie Mitteleuropa –die Brücke zu den Nachbarn
den Hauptzielgruppen – Stu denten und Jungakademiker –aufgebracht werden, so daß eine öffentliche oder private Förde rung von bis zu 90 Prozent not wendig ist. Die Veranstaltungen haben je nach Zahl und Herkunft der Referenten und Teilnehmer ein Volumen zwischen 5 000 Euro für Wochenendveranstaltungen und 30 000 Euro für ein interna tionales Wochenseminar.
Coronabedingt hat die Bil dungsarbeit in den Jahren 2020 bis 2022 gelitten. Zu Beginn der Coronakrise mußten mehrere fertig finanzierte und vorbereite te Veranstaltungen wenige Tage vor Beginn abgesagt werden. Die Pandemie ließ dann jeweils im vierten Quartal 2020 und 2021 auch kaum Veranstaltungen zu. Von 2005 bis 2021 ist es stets gelungen, die Fördermittel im notwendigen Umfang einzuwer ben. Nach Kürzungen von Pro jektmitteln im Bereich der BKM im Jahr 2022 – es geht um ei ne Summe von rund 50 000 Euro – sind mehrere Veranstaltungs formate, so die Nachwuchsger manistentagung und die Städ te- und Regionenporträts, nicht mehr durchführbar. Dies hat auch negative Auswirkungen auf die Belegung des Heiligenhofs, der die Personal- und Sachko sten auch der Akademie Mittel europa trägt.
ehemalige Präsident der Bundes zentrale für politische Bildung. Den geschäftsführenden Vor sitz übernahm Wolfgang Egerter. In geringem zeitlichen Abstand wurden 2000/2002 das „Deut sche Kulturforum östliches Euro pa“ in Potsdam, 2004 das „Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren“, 2006 die Kultur-, Bil dungs- und Forschungseinrich tung „Collegium Bohemicum“ in Aussig gegründet und – zeitlich verspätet – das Sudetendeut sche Museum in München er richtet. Alle diese Institutionen, daneben noch der Adalbert Stif ter Verein und zahlreiche Hoch schulen und zivilgesellschaftli chen Institutionen, sind enge Ko operationspartner der Akademie Mitteleuropa geworden.
Der Namensbestandteil „Aka demie“ weist auf einen beson deren Ort des Dialogs, des frei en Denkens, der Forschung und Lehre sowie der Bildung hin. Der Heiligenhof und seine Um gebung bilden durchaus eine mit dem platonischen Hain ver gleichbare Lernoase, wo persön liche Begegnungen mit einem fruchtbaren Meinungs- und Er fahrungsaustausch möglich sind. Er weist auch auf neue wichti ge Zielgruppen hin: Lernende, Studierende, Intellektuelle, For schende, Lehrende, gegenwärti ge und zukünftige Eliten: Perso nen, die neue Ideen und Welt sichten als Multiplikatoren und Entscheider am effektivsten ver breiten. Der zweite Namensbe standteil „Mitteleuropa“ ergab sich, da die Zentren des Heili gen Römischen Reiches und der nachfolgenden ÖsterreichischUngarischen Monarchie die Hauptstädte Prag, Wien und Bu dapest waren. Der Begriff „Mit teleuropa“ wurde noch vor 1989 von ungarischen, polnischen und tschechischen Intellektuel len und Dissidenten in den Jah ren des politischen Umbruchs als eine retrospektive Vision wieder belebt. Der Wunsch, nach „Mit teleuropa“ und damit in die Wer tegemeinschaft der freien Welt zurückzukommen, hat diese Vi sion Wirklichkeit werden lassen.
Die Akademie Mitteleuro pa e.V. (AME) wurde am 30. Au gust 2002 gegründet und nach knapp sechs Monaten am 21. Fe bruar 2003 ins Registergericht des zuständigen Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen. Wei tere Gründungspersönlichkei
ten neben Wolfgang Egerter und Dr. Günter Reichert – zunächst entstammten sie fast ausschließ lich dem sudetendeutschen Um feld – waren der Rechtsanwalt und Notar Dr. Dr. Herbert Gün ther Haischmann als stellvertre tender Vorsitzender und Berater in juristischen Belangen sowie als Schatzmeister der Unterneh mensberater Peter Hucker. Nach dem Tod von Wolfgang Egerter 2008 und der Wahl von Dr. Gün ter Reichert zum Vorsitzenden der Stiftung SSBW zum Jahres beginn 2009 gab es auch einen Wechsel im Vorstand der AME. Vorsitzender wurde der Sozio loge Prof. Dr. Bernhard Prosch (Universität Erlangen-Nürn berg), stellvertretender Vorsit zender Dr. Raimund Paleczek, Vorsitzender des Sudetendeut schen Instituts e.V. (München), Schatzmeisterin Diplom-Volks wirtin Utta Ott.
Seit dem unerwartet frü hen Tod von Prof. Dr. Bernhard Prosch wird die AME seit 2016 von mir als Vorsitzender und Professor Dr. Matthias Stickler (Universität Würzburg) als stell vertretender Vorsitzender, Dr. Günter Reichert als Geschäfts führender Vorsitzender sowie Ut ta Ott geleitet. Der Kreis der Mit glieder der AME umfaßt derzeit rund 30 Mitglieder; viele davon sind haupt- oder ehrenamtlich in kooperierenden Sozial-, Kulturund Wissenschaftseinrichtungen tätig.

Die Studienleitung übernahm im Jahr 2005 Gustav Binder, der vorher beim Siebenbürgen-Insti tut in Gundelsheim am Neckar einschlägige Erfahrungen bei der Organisation, Finanzierung und Suche von Teilnehmern von Bildungsveranstaltungen gesam melt hatte. Im Jahr 2014 kam Ul rich Rümenapp als Bildungsma nager dazu, der bis dahin den Sambachshof in Bad Königshofen geleitet hatte.
Dem Vorstand und dem Bil dungsleiter der AME wurde aus dem persönlichen Netzwerk der Gründer ein umfangreiches Ku ratorium zur Seite gestellt. Seit Beginn steht der Staatsrechts lehrer, vorübergehende thürin gische Innenminister und Richter des Bundesverfassungsgerich tes Prof. Dr. Peter Michael Hu ber vor, dessen Amtszeit in Karls ruhe im November nach zwölf Jahren ausgelaufen ist. Zu den Gründungskuratoren der AME
gehörten der ehemalige Diplo mat František Černý, die Publi zistin Bohumil Doležal und Jo hann Michael Möller, die Poli tiker Jerzy Miller, Janus Sepiol und Waldemar Ratay, die Pro fessoren Joachim Bahlcke, Csa ba Kiss, Karl Schmitt, Wolfgang Stock, der Wissenschaftler Dr. Peter Becher und der Manager Gert Maichel.
Einige dieser Kuratoren sind ausgeschieden, und es wur den neue Personen berufen. So sind heute die Professoren An drás F. Balogh, Ingeborg FialaFürst, Frank-Lothar Kroll, Isabel Röskau-Rydel, Michael Schwartz, Arnold Suppan, Krisztian Ungva ry, die Wissenschaftler Peter Be cher, Miroslav Kunštát, Johan nes Schönner, die Journalisten Gerhard Gnauck und Georg Paul Hefty, der ehemalige tschechi sche Kulturminister Daniel Her man, der frühere Staatsminister Hans Kaiser, der ehemalige Di plomat Axel Hartmann und die stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, Sarah Scholl-Schneider, Mitglieder des Kuratoriums.
Die ersten Bildungsaktivitäten der Akademie Mitteleuropa sind ab 2004 bemerkbar. Ausgehend von der historisch gewachse nen Rolle der Sudetendeutschen als Brücke zwischen Deutschen und Tschechen mit allen positi ven und belastenden Elementen und aufbauend auf den Erfah rungen aus der Zusammenarbeit mit Repräsentanten des ostmit teleuropäischen Exils – etwa in der Föderativen Union Europä ischer Volksgruppen – sollten die gemeinsame Kultur und Ge schichte der Deutschen im öst lichen Europa mit ihren Nach barn, die nahezu tausendjährige Beziehungsgeschichte der Deut schen mit ihren östlichen Nach barn weiter nach professionel len Standards erforscht und be kanntgemacht werden.
Es sollten Kontakte zwischen Deutschen, Tschechen, Polen, Ungarn und Rumänen sowie al len anderen Völkern und Ethni en gepflegt werden. Man soll te sich über die Vergangenheit, über gute und schlechte Zeiten des Miteinanders und Gegenein anders kennenlernen und an ei ner gemeinsamen europäischen Zukunft in einer Werte-, Kulturund Wirtschaftsgemeinschaft ar beiten. Zunächst mußten inter
essante Veranstaltungsformate, Förderer sowie ein Zielpublikum gefunden werden. Erste Anträ ge wurden beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Referat „Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ sowie im Nachbarreferat „Museen und kulturelle Vermittlung“ gestellt, ebenso beim Bundesministeri um des Innern im Bereich der „Verständigungspolitik zwischen Vertriebenenorganisationen und östlichen Nachbarn“.

Im Bereich der Kulturförde rung gemäß § 96 Bundesvertrie benen- und Flüchtlingsgesetz wurden ebenfalls beim Haus des Deutschen Ostens in München, einer Behörde des Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales des Freistaates Bayerns, gestellt und bewilligt. Neben diesen gro ßen und stetigen Förderern sei en weitere genannt, ohne de ren Zutun vieles nicht hätte rea lisiert werden können: die Robert Bosch Stiftung, der DeutschTschechische Zukunftsfonds, die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und die Deich mann-Stiftung.
Es wurden folgende dauer hafte Veranstaltungsformate entwickelt: Mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagung, Mitteleuropäische Archivarsta gung, Mitteleuropäische Städteund Regionenporträts, Mitteleu ropäische Erinnerungskulturen und Mitteleuropäische Begeg nungen.
Hinzu kommt die 2014 als Ver anstaltungsformat gegründe te „Ost-West-Jugendakademie“, die sich an Gymnasiasten aus Deutschland sowie einem ost europäischen Land – vorran gig Tschechien oder Rumänien – richtet, um die Beziehungs geschichte bis zum heutigen Tag aufzuarbeiten, Begegnung zu er möglichen und die Perspektiven für ein Zusammenleben in ei nem geeinten Europa aufzuzei gen. Seither wurden jährlich et wa ein Dutzend Wochen- und Wochenendveranstaltungen –mittlerweile insgesamt mehr als 200 – mit rund 5 000 Gästen aus Deutschland und Ostmitteleuro pa durchgeführt.
Die Akademie Mitteleuro pa benötigt jährlich für ihre Bil dungsarbeit derzeit 100 000 bis 150 000 Euro für zehn bis zwölf Veranstaltungen. Nur ein ganz geringer Beitrag davon kann von
Abschließend seien die Part ner genannt, mit denen die Aka demie Mitteleuropa gemeinsa me Veranstaltungen plant und durchführt. Es sind dies vor al lem die Germanistik-Fakultä ten der Universitäten Olmütz/ Olomouc, Troppau/Opava, Pil sen/Plzeň, Budapest, Klausen burg/Cluj-Napoca, Großwar dein/Oradea, Breslau/Wrocław, Stolp/Słupsk; die German Euro pean Studies in Prag sowie ande re ost- und ostmitteleuropäische geistes-, sozial- und wirtschafts wissenschaftliche Hochschulen mit deutscher Unterrichtsspra che.
In den letzten Jahren konnten wir auch zunehmend mit Hoch schulen in der Ukraine, etwa aus Mariupol oder Krywyj Rih ko operieren. Im November 2021 nahmen 20 Studierende und Do zenten aus diesen Städten an ei ner „Mitteleuropäischen Begeg nung“ teil. Für eine solche Be gegnung waren im März dieses Jahres erneut 20 Ukrainer an gemeldet. Der russische An griffskrieg hat diese Kooperatio nen wohl für unabsehbar lange Zeit zerstört. Eine frühere Teil nehmerin einer solchen Begeg nung aus Kiew hat ihre Flucht nach Bad Kissingen gewagt und ist dort mittlerweile Lehrerin für Flüchtlingskinder.
Wir sind vernetzt mit dem Ge org-Eckert-Institut für verglei chende Schulbuchforschung, dem Deutschen Polen-Institut in Darmstadt, dem Collegium Ca rolinum in München, dem Sie benbürgen-Institut in Gundels heim, dem Deutschen Kulturfo rum östliches Europa in Potsdam und fast allen Einrichtungen der Kultur- und Wissenschaftsar beit, die auf Grundlage des § 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes funktionie ren, etwa dem Herder-Institut in Marburg oder der Martin-OpitzBibliothek in Herne.
Es haben sich durch die Bil dungsarbeit der AME langfristi ge Freundschaften und Bezie hungen unter den Vortragenden, Teilnehmenden und Mitarbei tern entwickelt. Aus Studen ten werden über kurz oder lang Lehrer, Journalisten, Wissen schaftler, kurz Führungskräfte und Multiplikatoren. Sie werden auch im restlichen Bildungspro gramm der Einrichtungen des Sudetendeutschen Bildungs werk eingesetzt.
Diese Kontakte, dieses solide und vertrauensvolle Netzwerk und die Inhalte versprechen –eine solide Finanzierung vor ausgesetzt – eine gute Entwick lung und Zukunft der Akademie Mitteleuropa.
3 AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022
� Zum zwanzigjährigen Bestehen würdigt Vorsitzender Dr. Raimund Paleczek die Einrichtung auf dem Heiligenhof
Foto: T. Fricke
Vor 20 Jahren wurde die Akademie Mitteleuropa als Bildungs-, Forschungs- und Dialogplattform zu den östlichen Nachbarn gegründet. Ihren Sitz hat die Einrichtung auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Foto: Heiligenhof
Wien würdigt das Erbe von Richard Coudenhove-Kalergie

Gleich vier Tage dauerte die Feier, die die Paneuropa-Union Österreich zum 100jährigen Bestehen der Bewegung ausgerichtet hat.
Die Veranstaltungsserie begann am Jahrestag der Veröffentlichung des ersten Paneuropa-Aufrufes am 17. November 1922. Verfasser war der in Böhmen aufgewachsene Richard Coudenhove-Kalergi, dessen Appell für ein geeintes Europa zeitgleich in der Neuen Freien Presse in Wien sowie in der Vossischen Zeitung in Berlin erschien.
Den Schlußpunkt der Paneuropa-Tage bildete der 20. November, der 110. Geburtstag des nach Coudenhove zweiten internationalen Paneuropa-Präsidenten, des österreichischen Kaisersohnes Otto von Habsburg.

Bei der Eröffnung des Kongresses im unter Kaiser Franz Joseph errichteten prachtvollen Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz setzten sich die drei Hauptredner – der internationale Paneuropa-Präsident Alain Terrenoire aus Paris, die kosovarische Staatspräsidentin Vjosa Osmani sowie der Präsident der Paneuropa-Union Österreich, Karl von Habsburg – mit den aktuellen Weichenstellungen in der Europapolitik
■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.
■ Samstag, 26. November,
auseinander. Karl von Habsburg bezeichnete die Gründung der Paneuropa-Union 1922 als die logische Konsequenz auf den Ersten Weltkrieg.
Wie der russische Angriff auf die Ukraine beweise, sei der Kampf gegen Krieg und Nationalismus heute mindestens so notwendig wie damals. Er kritisierte, daß viele EU-Mitgliedstaaten die südosteuropäischen Kandidatenländer wie Kosovo stiefmütterlich behandelten. Die Vollmitgliedschaft der Ukraine werde zwar nicht von einem Tag auf den anderen gelingen, müsse aber systematisch angestrebt werden.
Die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, bekannte sich leidenschaftlich zur PaneuropaIdee und zur europäischen Integration: „Kosovare zu sein bedeutet zugleich, Europäer zu sein.“ Es sei für alle Europäer von überragender Bedeutung, daß die Ukraine den Krieg gewinne und auf dem ganzen Kontinent eine gerechte Friedensordnung entstehe. Ihr Land wolle so bald wie möglich dem Europarat beitreten und den EU-Kandidatenstatus erlangen. Außerdem sei es höchste Zeit, daß es endlich zu der seit Jahren versprochenen Visa-Liberalisierung komme. Sie schloß mit dem Ausruf: „Wir sa-


gen Ja zu den europäischen Werten und zur europäischen Identität!“
Alain Terrenoire plädierte für eine starke europäische Friedensmacht, bei deren Errichtung es vor allem auf drei Punkte ankomme: Aufbau einer europäischen Verteidigung, strategische Autonomie durch Stärkung der europäischen Organe sowie wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber aufsteigenden Mächten wie China.


Weitere Höhepunkte des Programms waren eine Videobotschaft des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, sieben Podien zu den künftigen Schwerpunkten der Europapolitik – davon eines mit EU-Kommissar Johannes Hahn, der einer südmährischen Familie entstammt – sowie abschließend eine Heilige Messe in der Kapuzinerkirche mit Kranzniederlegung am Sarg von Otto von Habsburg in der dortigen Kaisergruft. Den Ausklang bildete ein Empfang im Wiener Rathaus. Die Paneuropa-Union Deutschland war mit einer etwa dreißigköpfigen Delegation vertreten, die ihr Präsident Bernd Posselt, zugleich Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und der PEJ-Bundesvorsitzende Christian Hoferer leiteten.

Budapest im Zentrum historischer und politischer Entwicklungen




■ Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Dezember: Wochenendseminar „Budapest im Zentrum historischer und politischer Entwicklungen“. Veranstaltung für politisch-historisch Interessierte.
Seit mehr als 1000 Jahren ist Buda/Ofen – erst 1879 erfolgte der Zusammenschluß mit Pest – wenn auch mit Unterbrechungen in der Türkenzeit – das Zentrum ungarischer Staatlichkeit. Der ungarische Staat war dynastisch, wirtschaftlich, kulturell und religiös mit Westeuropa verbunden. Dies zeigt sich über die Dynastie der Habsburger, die seit 1526 auch Könige von Ungarn waren, wenngleich sie wegen der osmanischen Expansion bis etwa 1690 nur Teile Ungarns tatsächlich beherrschen konnten. Dies zeigt sich ebenfalls an der Einführung der deutschen Sprache als Amtssprache 1780, an der Existenz eines deutschen Bürgertums, von deutschen Handwerkern und Kaufleuten in Budapest. Die Zeit der habsburgischen Doppelmonarchie war von Sprach- und Nationalitätenkämpfen, aber auch von kulturellem und wirtschaftlichem Aufbruch geprägt. Der ungarische Staat verlor nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Territoriums, hatte aber eine fast überdimensionierte Hauptstadt mit heute rund 1,7 Millionen Einwohnern, dies heißt jeder sechste Ungar wohnt dort. Der Anteil „deutscher Geschichte“ – stets verstanden als Beziehungsgeschichte – ist eher weniger bekannt. Im Seminar sollen entsprechende Bezüge und Verbindungen nach Deutschland und Europa aufgezeigt und diskutiert werden.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmer-
wald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Musikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de
■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Dienstag, 29. November, 19.00 Uhr, Sudetendeutscher Heimatrat: „Aktuelles zum Stand der deutschen Ruhestätten in der Tschechischen Republik“. Online-Vortrag von Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in der Tschechischen Republik. Anmeldung an schuster@ sudeten.de.

■ Mittwoch, 30. November, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Böhmische Spuren in München: Zuzana Jürgens im Gespräch mit Rudolf Voderholzer“. Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München.


■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 3. Dezember, 10.00 bis 16.00 Uhr: 2. Ostdeutscher Adventsmarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.


■ Sonntag, 4. Dezember, 16.00Uhr, BdV-Kreisverband Stuttgart: 50. Stuttgarter Adventssingen. Liederhalle, Mozartsaal, Berliner Platz, Stuttgart. Eintrittskarten ab 14 Euro bei allen Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder unter Telefon (01 80) 6 70 07 33.
Verschleppt – Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiter
■ Donnerstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr, Filmsoirée mit Regisseur Alexander Landsberger: „Verschleppt – Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiter“. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Ihr Leiden begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Mindestens 450 000 deutsche Zivilisten wurden ab 1945 zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt. Weitere, mutmaßlich Hunderttausende, waren in Arbeitslagern in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Rumänien, Polen und anderen Staaten inhaftiert. Genaue Zahlen liegen bis heute nicht vor. Rechtlos und jahrelang getrennt von ihren Familien, wurden sie nicht selten das Ziel von Rache. Die Dokumentation von Alexander Landsberger klärt über die historischen Hintergründe auf und beleuchtet exemplarisch das Leben zweier Zeitzeugen, deren Schicksal lange wenig Gehör fand.
Der Regisseur Alexander Landsberger (geb. 1981) stu-
dierte Pädagogik, Psychologie und Philosophie in München. Anschließend inszenierte er verschiedene Filme für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, darunter die mehrteiligen Spielfilmdokumentationen „Charles Darwin“ (2009), „Die Geschichte der Homöopathie“ (2010), „Werner Heisenberg“ (2011), „Essen verändert die Welt“ (2012), „Der erste Bulle“ (2015) oder „Wilhelm von Humboldt“ (2017). 2014 schloß er ein Studium an der Filmakademie BadenWürttemberg ab. Sein Diplomfilm „John Mulholland – Zauberer im Kalten Krieg“ entstand als Koproduktion mit dem SWR und wurde mit dem Caligari Preis gefördert.
Neben Dokumentationen drehte Landsberger Werbeund Image-Filme. Seit 2012 inszenierte er diverse preisgekrönte Spots für die Unesco, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, Porsche Leipzig oder die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Alexander Landsberger ist Mitglied im Bundesverband Regie.
Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 4 TERMINE
VERANSTALTUNGSKALENDER
❯ Filmsoirée mit Regisseur Alexander Landsberger
Die Dokumentation „Verschleppt“ versetzt die Zuschauer mittels Graphic-Novel-Elementen zurück in die Zeit, als die deutschen Zwangsarbeiter deportiert wurden.
Foto: Tellux Film GmbH/Patrick Wagner – Visual E ects & Motion
❯ Der in Böhmen aufgewachsene Visionär verö entlichte vor 100 Jahren seinen großen Appell für ein geeintes Europa
Anzeige
Trägerin des Sudetendeutschen Museums: Sudetendeutsche Stiftung, Hochstraße 8, 81669 München Das Sudetendeutsche Museum wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Sudetendeutsches Museum Hochstraße 10 | D-81669 München www.sudetendeutsches-museum.de Scan mich! Das Sudetendeutsche Museum als Ort der kulturellen Begegnung: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas treffen sich bei dieser Konferenz, um über ihre Besonderheiten und ihren Status zu erfahren und zu diskutieren. Anhand ausgewählter Beispiele stellen sich geladene Volksgruppen (Deutsche Minderheit in Tschechien, Dolomitenladiner in Norditalien, Sorben in der Lausitz und Sudetendeutsche) vor und berichten über ihre kulturelle und museale Arbeit. 02.12. Fr Diskussion über die Relevanz und die zahlreichen Herausforderungen in der Pressearbeit. 03.12. Sa An die Konferenz schließt am 4. Dezember eine Kuratorenführung zur Ausstellung „Allerley kunststück. Reliefintarsien aus Eger“. Sudetendeutsche Dialoge: Konferenz im Museum Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog 02. – 03. Dezember 2022
Freundschaftliches Wiedersehen: Bernd Posselt (rechts) begrüßt Kosovos Staatspräsidentin Vjosa Osmani und Karl von Habsburg. Foto: Johannes Kijas
Bundeskulturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoin in Marktredwitz


Die Kulturpreise Johannes von Tepl gehen an die Trachtenbeauftragten ...
Als „Tracht des Jahres 2022“ ist die Egerländer Tracht im Frühjahr vom Deutschen Trachtenverband gewürdigt worden (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) und steht seitdem im Mittelpunkt bei zahlreichen Veranstaltungen. Einen wesentlichen Anteil an diesem großen Erfolg haben die Trachtenbeauftragten des Bundes der Eghalanda Gmoin, die jetzt bei der Bundeskulturtagung in Marktredwitz mit dem Kulturpreis Johannes von Tepl 2021 ausgezeichnet wurden. Der Kulturpreis Johannes von Tepl 2022 ging an die Egerländer Blasmusik Waldkraiburg.
Es sei schon ein „komisches Gefühl“ gewesen, sagte Christina Diederichs, die Bundeskulturwartin des Bundes der Eghalanda Gmoin, in ihrer Begrüßung: „Zwei Jahre hintereinander habe ich ein Programm für die Bundeskulturtagung in Marktredwitz geplant – und immer wieder mußte diese aus bekannten Gründen abgesagt werden.“ Jetzt habe man endlich nach vorne schauen können. „Der Durchführung einer Bundeskulturtagung im Egerland-Kulturhaus standen keine pandemiebedingten Regeln mehr entgegen. Im Gegenteil – sogar ein gemeinsamer Ausflug ins Egerland konnte ins Programm aufgenommen werden“, so Christina Diederichs.

Den Pandemieeinschränkungen zum Opfer gefallen ist im vergangenen Jahr auch die Verleihung des Egerländer Kulturpreises Johannes von Tepl 2021 an die Trachtenbeauftragten, die jetzt im Beisein des Oberbürgermeisters von Marktredwitz, Oliver Weigel, würdig nachgeholt wurde.
In seiner Laudatio hob Bundesvüarstäiha Volker Jobst die Arbeit der Trachtenbeauftragten im Bund der Eghalanda Gmoin hervor. Zunächst galt es, einen Wildwuchs aus nicht historischen Trachten zu vermeiden. Dieser Gedanke wurde bereits 1930 von Trachtenverbänden geprägt und mündete im Falle der Egerländer Trachten bereits zum 2. Egerlandtag 1953 in Würzburg in der Erkenntnis, daß schnellstmöglich die Herausgabe einer Trachtenfibel nötig ist. So entstand 1955 die „Trachtenfibel der Egerländer“. Rund 30 Jahre später brachte die Egerland-Jugend im Eigenverlag die weitbeachtete „Egerländer Trachtenfibel“ heraus. Dieses neue Werk wurde maßgeblich vom Bund der Eghalanda Gmoin und durch die Bundestrachtenwartin Leni Fritsch, unterstützt.
„Die Tracht ist ein Stück Egerland!“ – dieses sichtbare Zeichen der Heimatverbundenheit wird noch heute getragen und ist als Brauchtumspflege in der Arbeitsordnung der Egerland-Jugend verankert. Das war der Grundstein, daß bei den Bundestreffen der Egerland-Ju-

...und an die Egerländer Blasmusik Waldkraiburg
Tracht gelegt wurde, zeigte Ingrid Hammerschmied anhand zahlreicher Beispiele auf. In verschiedenen Städten im Landesverband Hessen wurden Schaufenster von Geschäften mit den Trachten dekoriert, ebenso Besucherräume in Banken und Sparkassen. Es wurden Sonderausstellungen in verschiedenen örtlichen Museen oder Heimatstuben eingerichtet. Bei Veranstaltungen in Städten, wie verkaufsoffene Sonntage, wurde auf die Tracht des Jahres hingewiesen, und Egerländer Tanzgruppen waren fester Bestandteil des Rahmenprogrammes.
Bundeskulturwartin Christina Diederichs: „Die Bedeutung der Tracht als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit dem Egerland hat seit diesem Jahr eine weitere Bedeutung gewonnen. Es ist der Arbeit aller unserer Trachtenbeauftragten, aber im Jahr 2022 Ingrid Hammerschmied im Speziellen, zu verdanken, daß unsere Egerländer Tracht
Jendsch, vier Gründe für die Entscheidung der Jury heraus. So ist die Waldkraiburger Blaskapelle eine – oder die – am längsten aktive Egerländer Blaskapelle. Die Wurzeln der Blaskapelle gehen auf die 1940er Jahre zurück. Darüber hinaus hat sich die Waldkraiburger Blaskapelle über eine lange Zeit kontinuierlich der traditionellen Egerländer Blasmusik verschrieben. Und weiterhin ist diese Blaskapelle bereits über viele Jahrzehnte hinweg ein wertvoller Teil der Egerländer Kultur. Sie steht sinnbildlich für eine gelungene Egerländer Integration in der neuen Heimat. „Und nicht zuletzt ist die Blaskapelle Waldkraiburg ein würdiger Preisträger, weil sie musikalisch und stilistisch das verkörpert, was die echte Egerländer Blasmusik ausmacht. Die Waldkraiburger Musikanten spielen nicht nur Noten – sie spielen mit dem Herzen“, so Wolfgang Jendsch.
ferat von Dr. Wolf-Dieter Hamperl unter dem Titel „Die Verpfändung des historischen Egerlandes und der Reichsstadt Eger vor 700 Jahren“. Dieses im Schulunterricht ausgeblendete Thema war für die Geschichte Europas von großer Bedeutung. Allein an der Burg zu Elbogen ließen sich die Grenzverschiebungen darstellen, erklärte Dr. Hamperl: „Früher war diese Burg die Grenzburg.“ Der ehemalige Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen Landsmannschaft stellte in seinem Vortrag noch weitere Meilensteine in den Vordergrund. So berichtete er über die Bedeutung des Adels von Luxemburg und die Rolle der Stadt Eger als Münzstadt.
Weitere Programmpunkte waren das Totengedenken, welches Erich Wetzka vorbereitet hatte, und der Besuch des Egerländer-Museums, wo derzeit die Sonderausstellung „Gustav Seeber-
gut Sehnen und Suchen
Advent hat mit Sehnsucht zu tun. „Alles beginnt mit der Sehnsucht“, schrieb die jüdische Poetin Nelly Sachs einmal in einem Gedicht. Habe ich diesen Satz in dieser Kolumne schon einmal zitiert? Gut möglich, denn er begleitet mich seit fast fünfzehn Jahren.
Damals begegnete er mir in der Vorbereitung eines kurzen Fernsehbeitrags. Es ging darin um die Sehnsucht der Weisen aus dem Morgenland, die aus ihren Gewohnheiten aufgebrochen waren, weil sie einen besonderen Stern gesehen hatten.
Diesem Stern waren sie bereit zu folgen, da er ihnen die Geburt eines besonderen Königskindes verheißen hatte. Daß sie das Königskind schließlich nicht in einem vornehmen Palast fanden, sondern im Stall von Bethlehem, ist die besondere Pointe der Geschichte im Matthäusevangelium.
Unser Weg durch den Advent auf das Weihnachtsfest zu ist mit dem Weg der Weisen aus dem Morgenland durchaus vergleichbar. Welche Sehnsucht, so frage ich mich, läßt uns, läßt mich, läßt die Kirche und die Gesellschaft dieses Jahr aufbrechen, um in vier Wochen das Geheimnis vom menschgewordenen Gott zu feiern und dem Kind in der Krippe zu begegnen?
Hat Weihnachten für uns überhaupt noch etwas Verheißungsvolles, das uns aufbrechen läßt? Oder folgen wir bloß den gewohnten und bewährten Ritualen? Oder ziehen wir Weihnachten schon etwas vor, um uns den Weg dorthin zu ersparen und dann am Heiligen Abend nur mehr dessen Ende zu feiern und in eine große Erschöpfung aufgrund der vielen Feiern vor Weihnachten zu fallen?
Diese Gefahr sehe ich besonders in diesem Jahr, weil wir nach zwei Corona-Adventen nun wieder die Möglichkeit haben, den Advent in altbekannter Weise mit viel Aktivität zu füllen. Die Stille und das innere Ausschauhalten werden es in dieser vorweihnachtlichen Zeit schwer haben.
Doch ich weiß schon, die Klage darüber hilft auch nicht weiter. So bemühe ich mich, die besondere Signatur des Advents im Jahre 2022 zu betrachten. Es gibt möglicherweise doch etwas, was die Sehnsucht entfacht, einen Weg zu gehen und schließlich zum Ziel zu finden: dem Krippenkind im Stall von Bethlehem, diesem heruntergekommenen Gott, der uns auf diese Weise zeigt, daß er uns nicht vergessen hat.
gend auch Trachtenschauen durchgeführt wurden. Die Trachtenbeauftragten im Bundesvorstand standen immer mit Rat und Tat zur Seite. Sie leisteten innerhalb der Landesverbände und Gmoin Aufklärungsarbeit, luden zu Nähkursen ein und nahmen an den Treffen der Egerland-Jugend teil.
Die Trachtenbeauftragten der letzten 50 Jahre waren Leni Fritsch, Christa Sehr, Hermine Bender, Elke Trübswetter und Ingrid Hammerschmied. Stellvertretend für alle Trachtenbeauftragten nahm Ingrid Hammerschmied den Johannes-von-Tepl-Preis 2021 entgegen.
Bei der Preisverleihung dabei war auch Amtsvorgängerin Elke Trübswetter.
Daß mit dem Titel „Tracht des Jahres“ ein neuer Fokus auf die Egerländer
in diesem Jahr so vielfältig gezeigt wurde.“


Ein großes Dankeschön sprach die Bundeskulturwartin auch der Gmoi Geretsried aus, die Bestände des Trachtenstandes erworben hat: „Wer Trachtenstoffe oder Zubehör sucht, ist nun bei der Gmoi Geretsried an der richtigen Adresse.“
Beim Ausflug ins Egerland unter Leitung von Günther Wohlrab ging es über Schlaggenwald nach Neusattl, wo der Egerländer Kulturpreis Johannes von Tepl 2022 an die Egerländer Blaskapelle Waldkraiburg unter Leitung von Anton Lenhart verliehen wurde. In seiner Laudatio stellte der Bundesbeauftragte für Egerländer/böhmische Blasmusik im Bund der Eghalanda Gmoin, Wolfgang
2022 war auch für die Egerland-Jugend ein ganz besonderes Jahr. So konnte das 50. Bundesjugendtreffen gemeinsam mit dem Jubiläum „70 Jahre Egerland-Jugend“ gefeiert werden.

Bundesjugendführer Alexander Stegmaier ließ in seiner Rede anhand der Plakate, welche jährlich zum Bundesjugendtreffen gestaltet werden, die 50 Zusammenkünfte der Egerland-Jugend Revue passieren. Dabei erinnerten sich viele Teilnehmer der Bundeskulturtagung an verdiente Egerländer, besondere Gäste, Anekdoten und die einzigartigen Geschichten, die viele Treffen in einmaliger Erinnerung zurückgelassen haben.
Gestartet war die Bundeskulturtagung mit einem hochinteressanten Re-
Eindrucksvoll und berührend war auch der Film „Die Geschichte der Sudetendeutschen am Beispiel des Egerlandes“, den Erich Wetzka mitgebracht hatte. SL-Landesobmann Steffen Hörtler erklärte im Film die Geschichte der Egerländer und zeigte anhand von Bildern und Karten die Vertreibung.
Unter dem Titel „Håns gaih huam“ erzählte Dr. Ralf Heimrath von seiner Arbeit über die Lieder der Egerländer aus Neuseeland. Und Helmut Hahn berichtete über die Geschichte der Gmoi Geretsried, die im Herbst ihr 70. Jubiläum
Der Krieg in der Ukraine hat in uns eine große Sehnsucht nach Frieden bewirkt. Würde es uns nicht gut anstehen, dieser Sehnsucht zu folgen und uns im eigenen Umfeld um Frieden zu bemühen? Und die Energiekrise? Und die Teuerung? Auch sie gehören zur Signatur des diesjährigen Advents.
Welche Sehnsucht lösen sie in uns aus? „Alles beginnt mit der Sehnsucht“, beginnt Nelly Sachs ihr Gedicht, und sie fährt fort: „Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres und Größeres.“
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei Ellwangen-Schönenberg


❯ Mut
AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 5
tut
❯
ger – Ein Münchner Maler aus Marktredwitz“ gezeigt wird. Außerdem lud der Museumsleiter Volker Dittmar zu einer Premiere ein: „Die Marktredwitzer Landschaftskrippe virtuell erleben.“
Verleihung des Kulturpreises Johannes von Tepl (von links): Dr. Ralf Heimrath, Ingrid Hammerschmied, OB Oliver Weigel, Bundesvüarstäiha Volker Jobst) Fotos: Erich Wetzka
Organisierte eine perfekte Bundeskulturtagung: Christina Diederichs, Bundeskulturwartin des Bundes der Eghalanda Gmoin.
Gemeinsam mit der örtlichen Gemeinde feierten die Egerländer in Neusattl einen zweisprachiger Gottesdienst in der Schulkirche. Die Zelebranten waren Monsignore Karl Wuchterl, Pfarrer Petr Fořt und Pfarrer Bystrik Feranec.
Bundesjugendführer Alexander Stegmaier, ließ die 50 Bundestre en der Egerland-Jugend Revue passieren.
Die Egerländer Blasmusik Waldkraiburg unter Leitung von Anton Lenhart bei der Preisverleihung in Neusattl.
Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine nach Mitteleuropa und insbesondere nach Deutschland veranlaßte den Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker, sein Herbstseminar Anfang November auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen unter den Titel „Flucht, Vertreibung und Migration in und nach Mitteleuropa – Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“ zu stellen.

Vor dem Hintergrund, daß erzwungene Wanderungsbewegungen auch im 21. Jahrhundert wie nach 1945 die Agenda der europäischen Politik bestimmen, wurden das aktuelle Fluchtgeschehen und die Vertreibung der Sudetendeutschen thematisiert. Die Soziologin Tetyana Panchenko sprach über „Fluchtbewegung aus der Ukraine: Ursprünge, aktuelle Lage und Auswirkungen für Deutschland“. Die seit März in ihrem Fachgebiet beim Münchener ifo-Zentrum für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung beschäftigte Wissenschaftlerin war zuvor Dozentin des Instituts für Politikwissenschaft an der Karazin-Universität Charkiv, deren Zerstörung sie zu Beginn mit einem Foto dokumentierte.
Mittlerweile sei eine Million Menschen aus der Ukraine un-
Flucht, Vertreibung, Migration
Sinti- und Roma-Gemeinden seien Tabu-Zonen entstanden.

Der Zuzug anderer Bevölkerungsgruppen zähle zu den eher positiven Veränderungen seit 1989. Vietnamesen bildeten eine neue Minderheit. Die Älteren wollten zurück nach Vietnam, die jüngeren nicht. Auf die Region wirke sich auch aus, daß Tschechien bei der Aufnahme der Ukrainer in der EU an zweiter Stelle stehe. Sie sei unproblematisch insbesondere für diejenigen, die seit langem dort arbeiteten. Auch hätten sich dort viele neue Deutsche angesiedelt.

Auch wenn die Grenzgebiete bislang von der Politik vernachlässigt worden seien, würden Karlsbad, Aussig und auch Ostrau mittlerweile als strukturschwach anerkannt und erhielten EU-Fördermittel. Die Montanregion Erzgebirge profitiere touristisch besonders.
ter vorübergehendem Schutzstatus in Deutschland registriert, so Panchenko. In der Gruppe der Volljährigen liege der Frauenanteil bei 74 Prozent, da für Männer ein Ausreiseverbot aus der Ukraine gelte. Angst um das eigene Leben, um die körperliche und geistige Gesundheit der Kinder, der
Unser Angebot Probeabo!
Wunsch nach Sicherheit seien vorrangige Fluchtmotive, wirtschaftliche Beweggründe seien erst später hinzugekommen, sagte Panchenko über die Ergebnisse der zwischen Mai und Juli von ifo durchgeführten, teils nicht repräsentativen Umfragen. Wertvoll sei für die meisten das Recht zu arbeiten; sie wollten sich nicht als Opfer fühlen. 48 Prozent arbeiteten bereits oder seien bereit, unter ihren Qualifikationen zu arbeiten. Nur zehn Prozent wollten die Arbeitserlaubnis nicht in Anspruch nehmen.
Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich
oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)
Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail
Geburtsjahr, Heimatkreis

Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontobezeichnung (Kontoinhaber)
Kontonr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung
Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 47/2022
Je nach beruflicher Qualifikation, familiärer Situation sowie eigener Einschätzung der Lage handele es sich bei den Geflüchteten um eine ausgesprochen heterogene Gruppe mit verschiedenen Erwartungen. 52 Prozent planten, die nächsten zwei Jahre in Deutschland zu bleiben. Die größte Gruppe der Bleibewilligen seien Studierende mit einem Anteil von 73 Prozent; 46 Prozent der seit dem 24. Februar Gekommenen wollten in die Ukraine zurückkehren.
„Deutschland ist bevorzugtes Zielland“, faßte Panchenko ihre Erhebungen zusammen. Polen habe jedoch im Oktober mit 1,4 Millionen in Europa die meisten Flüchtlinge aufgenommen, gefolgt von Deutschland mit einer Million, der Tschechischen Republik mit 500 000 und Italien mit 200 000. Die Zahlen korrelierten mit dem Anteil der ukrainischen Diaspora in den jeweiligen Ländern. Abgesehen davon, daß die Krim-Annexion von 2014 bis 2021 zu 1,5 Millionen Binnen-Vertriebenen im Land geführt habe, seien je nachdem, ob dort bereits Familienangehörige oder Freunde ansässig gewesen seien, bereits vor dem Krieg Ukrainer bevorzugt in diese Länder gegangen. Allein zwischen 1991, der Unabhängigkeit der Ukraine, und 2021, dem Jahr vor Kriegsausbruch, habe die Ukraine durch Abwanderung einen Bevölkerungsrückgang von einer Million Menschen oder 20 Prozent der Bevölkerung verkraften müssen. Bewegten in vier Migrationswellen nach der Wende und zwischen 1875 und 1914 vorwiegend wirtschaftliche Gründe, so zwangen zwischen 1945 und 1980 wie schon zwischen 1914 und 1939/41 die politischen Verhältnisse viele Menschen zur Ausreise. Die 1918 in Wien gegründete und bereits in der Zwischenkriegszeit nach Prag umgezogene Ukrainische freie Universität sei Produkt dieser politisch bedingten zweiten Auswanderungswelle gewesen.
le als Migrationszielland nicht mehr erfüllen können. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es wegen der Zerstörungen und der eigenen Not Geflüchtete in größerem Umfang nicht aufnehmen können.
Seit Beginn der wilden Vertreibungen sei die Staatsbürgerschaft Kriterium für die Aufnahme der Vertriebenen gewesen. Österreichische Staatsbürger seien zunächst nur die gewesen, die dies bereits im März 1938 gewesen seien oder vor dem Tag des Anschlusses an das Dritte Reich am 13. März 1938 in Österreich gewohnt hätten, darunter 20 000 Sudetendeutsche. 100 000 Altösterreichern unter den 600 000 deutschsprachigen der insgesamt 1,6 Millionen Displaced Persons, die bis Ende Mai 1945 nach Österreich gelangt seien, sei ebenso die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt worden. Die meisten der 600 000 Deutschen hätten jedoch 1938 für Deutschland optiert und hätten deswegen auch nach Deutschland gebracht werden müssen, zeichnete Perzi die Argumentation des damaligen niederösterreichischen Landeshauptmanns Leopold Figl nach. „Die Einreise sogenannter Flüchtlinge – Sudetendeutsche und Reichsdeutsche –ist grundsätzlich unzulässig“, habe der damalige Waidhofener Bezirkshauptmann und vormalige KZ-Insasse Johann Haushofer im Januar 1946 festgestellt.

unter schwierigen Bedingungen geführt, insbesondere in dem in der ehemaligen KZ-Außenstelle Mauthausen eingerichteten Lager Melk. Vielen sei auch die Flucht aus der sowjetischen Besatzungszone in die Westzonen gelungen, die es mit der Repatriierung nicht so ernst genommen hätten.
Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft sei lange eine große Hürde geblieben. Erst 1954 sei die Staatsbürgerschaft über das Optionengesetz kollektiv verliehen worden, und Gleichstellungsgesetze hätten die Diskriminierungsregeln aufgehoben. Zeichen der fortgeschrittenen Integration sei, daß nach 1945 75 Prozent der Sudetendeutschen Österreicher geheiratet hätten.
Zuwanderung nach Böhmen und Mähren

Kurator Petr Koura sprach über „Zuwanderung nach Böhmen und Mähren: Einblicke in die Ausstellung ,Naši Němci –Unsere Deutschen‘“. Ein Schwerpunkt sei die Erinnerung an die Zugehörigkeit Böhmens und Mährens zur Habsburgermonarchie. Es gehe nicht nur um die Sudetendeutschen, sondern um alle Deutschen sowie die Juden. Das Zusammenleben deutsch- und tschechischsprachiger Bürger werde räumlich und mit der Anordnung von Ausstellungsstücken symbolisiert.
Abschub und Repatriierung
Daß man sich mit der Staatsbürgerschaftsfrage so schwergetan habe, habe auch damit zu tun, daß die neue Nationenbildung unter der Ägide von ÖVP und KPÖ strikt kleinstaatlich ausgerichtet gewesen sei und man sich mit der Tschechoslowakei in einer Opferrolle verbunden gefühlt habe. Es habe zudem auch eine Verbundenheit mit den an Österreich grenzenden Regionen gegeben, so daß man die aus den südlichen Randgebieten stammenden Sudetendeutschen als ethnographisch Verwandte betrachtet habe und mit ihnen etwas liberaler verfahren sei als mit dem Großteil der Vertriebenen.
Die Präsentation des Gebirges als gemeinsamer Erholungsraum mit deutschem und tschechischem Liedgut gehe über in eine aus Wörterbüchern bestehende Barrikade, die zeige, daß bei der Revolution 1848 Deutsche und Tschechen zusammengestanden, aber auch, daß diese Wörterbücher zuvor nicht gebraucht worden seien. Mit dem beginnenden Nationalismus hätten sich nun die Wege getrennt. Einer führe zur Darstellung des Landtags, den Kaiser Franz Joseph I. 1913 aufgelöst habe. Zuvor sei 1912 mit Božena VikováKunětická die erste tschechische Abgeordnete gewählt worden.
„Der Umgang mit den Sudetendeutschen in Österreich seit 1945“ war das Thema von Historiker und Migrationsexperte Niklas Perzi vom Institut für Geschichte des ländlichen Raumes in Sankt Pölten. Bereits nach dem
Mit dem Potsdamer Abkommen habe sich die Lage der Sudetendeutschen in Österreich zusätzlich verschärft. Der darin vorgesehene organisierte „Abschub“ der verbliebenen Sudetendeutschen in die sowjetische und vorrangig amerikanische Besatzungszone Deutschlands habe nämlich in Form von „Repatriierungen“ ab September 1945 auch auf Österreich Anwendung gefunden, wenngleich erst im November die Anordnung zur Registrierung der Reichsdeutschen, Volksdeutschen und Staatenlosen durch die Gemeinden erfolgt sei. Nach dem Potsdamer Abkommen habe es keine organisierten Transporte nach Österreich und auch keine behördliche Hilfe gegeben, sagte Perzi. Die nur schwer beherrschbaren Grenzübertritte der Sudetendeutschen nach Österreich hätten überdies zur massenhaften Unterbringung
Der Politologe Lukaš Novotný sprach „Zur Entwicklung der tschechischen Randgebiete (,pohraničí‘) nach 1945 – Bilanz und Ausblick“. Der an der JanEvangelista-Purkyně-Universität Aussig lehrende Politikwissenschaftler und Extremismusforscher unterstrich die paradoxe Situation, daß die ärmsten tschechischen Regionen an Deutschland grenzten und dabei immer noch von 1945 geprägt würden. Die Vertreibung habe dort tiefe Spuren hinterlassen.
Es herrschten signifikante Unterschiede entlang der früheren Sprachgrenze, und zwar mit einer weit unterdurchschnittlichen Bevölkerungsdichte – allein im Bezirk Karlsbad seien 107 Ortschaften verschwunden –und hoher Arbeitslosigkeit, die auch vom Ende des Kohlenabbaus herrühre. In Aussig gebe es die meisten Insolvenzen. Auch die Region Karlsbad leide unter Wegzug. Und wegen der starken
Das Trennende soll zwar nicht übersehen, das Gemeinsame aber betont werden. Das belegte Koura mit zwei Plakaten. Das eine, so Koura, zeige Tomáš G. Masaryk. Es unterstreiche die Verbundenheit zwischen Deutschen und Tschechen, weil es dem deutsch-böhmischen Maler Emil Orlik zuzuschreiben sei und weil Masaryk bekanntlich eine deutsche Mutter gehabt habe. Das zweite Plakat zeige Franz Kafka und erinnere an den größten deutschsprachigen Schriftsteller in Böhmen. Auch politisch werde der gemeinsame Wille von Deutschen und Tschechen entlang des Parteienspektrums über das sprachlich Trennende hinweg mit dem Aufbau der Plakatgasse zur Werbung der politischen Parteien zum Ausdruck gebracht; geehrt werde der deutsche Politiker Robert Mayr-Harting, der sich gegen Konrad Henlein positioniert habe. Die Parteien seien nicht nach ethnischen, sondern nach weltanschaulichen Kriterien kontrastiert, den deutschen wie tschechischen Demokraten würden Konrad Henlein und der tschechische Faschist Radola Gajda gegenübergestellt. Tragisch sei, daß sich ein System durchgesetzt habe, das Menschen in deutsch, tschechisch und jüdisch trenne. Dies werde mit drei Wegen symbolisiert. Nur den deutschen Weg, der hinausführe in die Vertreibung, könne man durchgehen und stoße auf versteckte Gegenstände, Koffer der Vertriebenen. Man sehe aber auch Versöhnung. So werde Oskar Schindler ein gebührender Platz eingeräumt. Gegenwärtig werde eine digitale Karte von Orten entwickelt, an denen Massaker an Sudetendeutschen verübt worden seien.
Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 6
Andreas Müller FORUM
Arbeitskreis
❯
Sudetendeutsche Akademiker
Dr. Tetyana Panchenko und Dr. Petr Koura. Dr. Niklas Perzi und Dr. Lukaš Novotný.
Noch bis Sonntag, 4. Dezember findet in München das 13. Literaturfest statt. Im Literaturhaus München und an wei teren Orten der Stadt bietet es ein hoch karätiges Programm. Kernstück des Fe stivals ist das zehntägige Programm „Forum“, das dieses Jahr vom 16. bis 25. November lief. Gestaltet wurde es von der aus der Ukraine stammenden und in Wien lebenden Autorin Tanja Maljartschuk und trägt das Motto „Frei sein – Mitteleuropa neu erzählen“. Ganz zu Beginn sprach die Forum-Ku ratorin Maljartschuk mit dem Histori ker Philipp Ther und dem österreichi schen Schriftsteller Martin Pollack über „Die Tragödie Mitteleuropas“.
Im Mittelpunkt des von Tanja Maljart schuk kuratierten ,Forums‘ steht der Dialog zwischen deutschen und mittel osteuropäischen Autoren, deren Län der durch den Einfluß der ehemaligen Sowjetunion geprägt sind“, führt Tan ja Graf in das Thema ein. Die Geschäfts führerin des Literaturhauses freut sich im ausverkauften Literaturhaus über die prominenten Podiumsteilnehmer und die vielen Gäste und stellt die Kuratorin kurz vor.

Tanja Maljartschuk wurde 1983 in Iwano-Frankiwsk in der Westukraine geboren, das in der k. u. k. Zeit Stanis lau hieß. Sie studierte Philologie an der Universität Iwano-Frankiwsk und arbei tete nach dem Studium als Journalistin in Kiew.
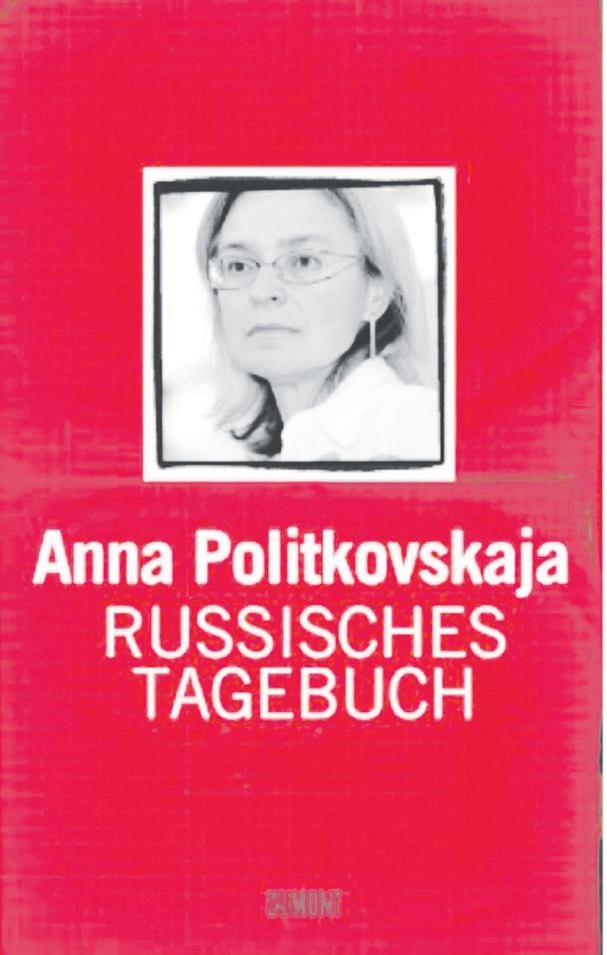

Drei Autoren aus Wien 2009 erschien auf Deutsch ihr Erzähl band „Neunprozentiger Haushaltses sig“, 2013 ihr Roman „Biografie eines zu fälligen Wunders“, 2014 „Von Hasen und anderen Europäern“ und 2019 ihr jüng ster Roman „Blauwal der Erinnerung“. Darin beschreibt sie die Niederlage der ukrainischen Staatenbildung 1919 an hand der Schicksale ukrainischer Intel lektueller, die vor den Bolschewiki ins Exil fliehen mußten und nie zurückkehr ten. 2018 erhielt Tanja Maljartschuk den Ingeborg-Bachmann-Preis und dieses Jahr, indem sie den Essayband „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“ veröffentlichte, den Usedomer Literaturpreis.
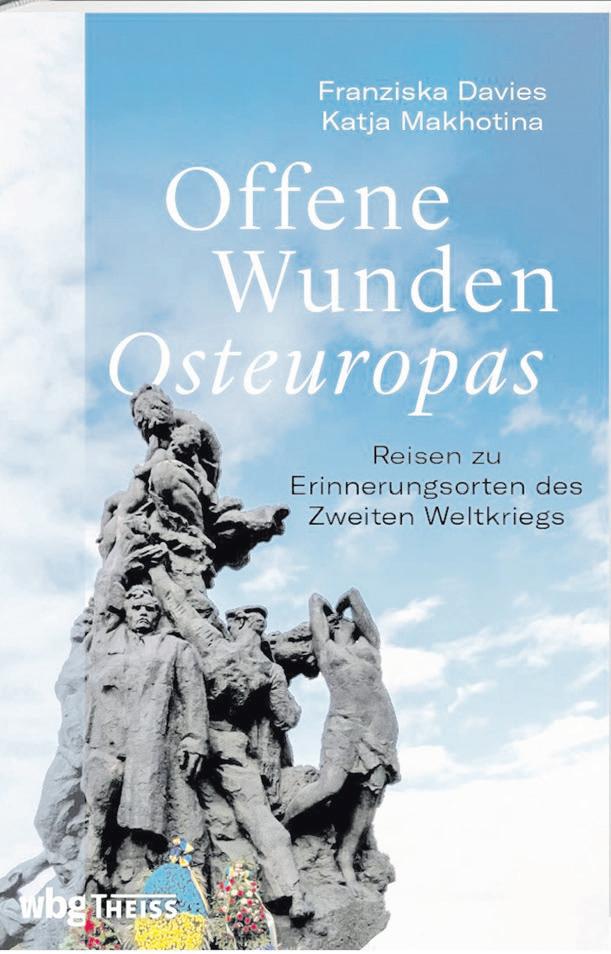
Die beiden anderen Gäste seien –wie Maljartschuk – aus Wien angereist, so Graf. Maljartschuks Gesprächspart ner sind zwei der renommiertesten Ken ner von Ostmitteleuropa und seiner Ge schichte. Der Schriftsteller und litera rische Übersetzer Martin Pollack hatte schon 1984 „Nach Galizien“ veröffent licht. Diesem „Reiseführer“ durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina folgten seither viele ähn lich gelagerte Bücher, für die er mit un zähligen Preisen ausgezeichnet wur de wie 2018 mit dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik.
Der Historiker Philipp Ther hat väter licherseits sudetendeutsche Wurzeln. Sein Vater Otto Hannes Ther war 1929 im nordböhmischen Reichenberg zur Welt
In diesem Jahr ist die Münch ner Bücherschau im Literatur haus München zu finden. Über 100 Verlage zeigen Bücher und Medien in der Galerie im Erd geschoß. Viele Romane, Sach bücher, Ratgeber, Kinder-, und Jugendbücher warten auf Leser. Dazu gibt es ein Programm aus Lesungen, Kursen und Filmen.
In der riesigen Ausstellung gibt es wieder viel zu entdecken. Be sonders interessant sind die Son derausstellungen. In ihnen wer
Frei sein – Mitteleuropa neu erzählen
dera, geschichtlich allerdings sei es im mer schon Teil des Westens gewesen, aus dem es 1945 quasi entführt worden sei. Mitteleuropa sei eine Gemeinschaft kleiner Nationen zwischen Deutschland und Rußland, deren Identität und Exi stenzrecht infrage gestellt würden.
Die drei Schriftsteller diskutieren erst die Frage, wie man die Region am be sten nennen solle: Mitteleuropa? Ost mitteleuropa? Zentraleuropa? 2002 ha be der Osteuropahistoriker Karl Schlö gel in seinem Buch „Die Mitte liegt ostwärts“ genau den Begriff „Zentraleu ropa“ geprägt, erinnert Pollack. „Jeden falls gehört die Ukraine da hinein“, be tont Ther.
Kundera habe besonders die gemein samen Werte wie Aufklärung und Frei heit geschätzt. Für diese Werte hätten die kleinen Nationen in Zentraleuropa lange kämpfen müssen, erinnert Mal jartschuk. Anfang der achtziger Jah re hätten viele Intellektuelle und Dis sidenten in den Ostblockländern die jahrzehntelange sowjetische Besatzung kritisiert, was Kundera teilweise ausge löst habe wie die SolidarnoŚĆ in Polen. „In der Ukraine waren Dichter und Dis sidenten alle im Lager oder tot“, resü miert Maljartschuk bitter.
gekommen, wurde nach der Vertreibung Leiter jugendpädagogischer Einrichtun gen und arbeitete auch als Lehrer für Mathematik und Physik in München. Dort und in Regensburg studierte der 1967 im Kleinwalsertal in Österreich ge borene Philipp Ther Neuere Geschichte, Osteuropäische Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften. Er setzte sein Studium in Wien und weiteren Univer sitäten weltweit fort. 2010 wurde er Pro fessor am Institut für Geschichte Ostmit teleuropas an der Universität Wien . Ther machte schon 2014 in seinem Bestseller „Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent“ Furore und profilierte sich in Forschung und Lehre als Experte für die Geschichte von Vertreibungen in Europa. Das tat er auch in „Die Außen seiter“ über Flucht, Flüchtlinge und In tegration im modernen Europa, das er
2018 bei einer gemeinsamen Veranstal tung vom Haus des Deutschen Ostens und dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas in Mün chen vorstellte (ÝSdZ 24/2018).
Die Diskussion im Münchener Lite raturhaus moderiert ein weiterer Sach kenner. Der Journalist und Schriftstel ler Adam Soboczynski kam im ehema ligen Thorn – dem heute polnischen Torún – 1975 zur Welt und erst 1981 nach Deutschland. Seit 2004 arbeitet er für „Die Zeit“ und schreibt Bücher wie „Polski Tango“ (2006).
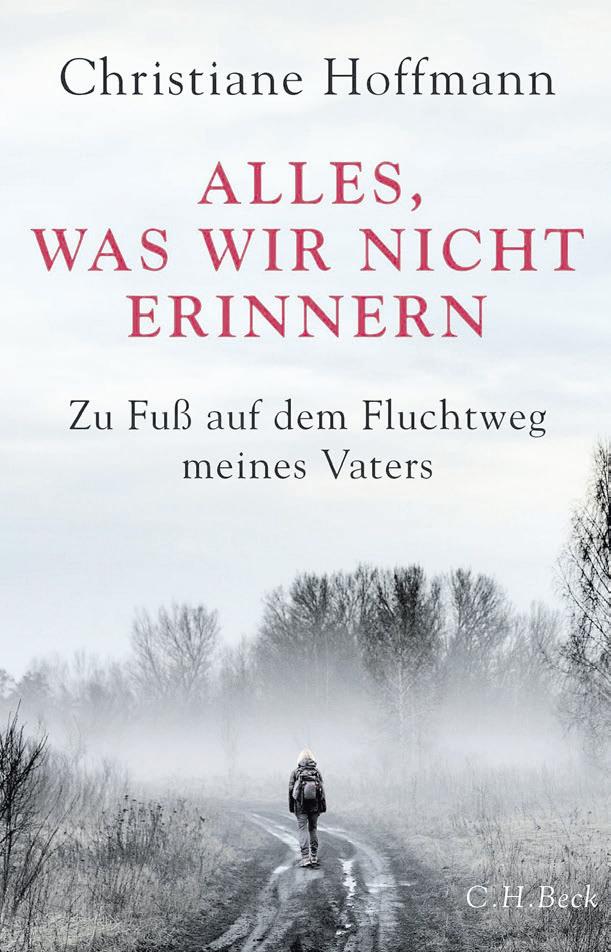
Die Beziehung zwischen West- und Mittelosteuropa solle bei dem Gespräch in literarischer und historischer Hinsicht aufgearbeitet werden, erläuert Tanja Maljartschuk. Denn seit dem Zerfall der Sowjetunion, so die Kuratorin, sei die ses Verhältnis charakterisiert durch das
Versäumnis, die Länder Mittelosteuro pas als eigenständige Staaten zu sehen: „Lange galten sie als Kolonien Rußlands, nicht als Subjekte des europäischen Dis kurses. Noch heute wird etwa die Kultur der Ukraine, trotz des Krieges, weiterhin als untrennbarer Teil des großrussischen Narrativs wahrgenommen. Dabei gehört die Ukraine mitsamt ihrer Geschichte und ihren Werten in die Reihe ihrer mit teleuropäischen Nachbarn.“
Ausgangspunkt und Zentrum der Diskussion war Milan Kunderas bril lanter Essay „Die Tragödie Mitteleuro pas“ von 1984. Der tschechische Dichter war bestrebt, den Begriff Mitteleuropa zu definieren, und setzte ihn der Dicho tomie in Ost und West entgegen. Zwar habe Mitteleuropa infolge des Zwei ten Weltkrieges in politischer Hinsicht zum Osten gehört, erklärte Milan Kun
Wegen des Eisernen Vorhangs hätten die Europäer viel zu wenig über Mittel europa gewußt, sagt Pollack. Nach dem Fall der Mauer zwischen Ost und West habe das Interesse an den östlichen Na tionen zunächst zugenommen, zu denen zunehmend auch Leute gereist seien, so Ther, später jedoch fast nur noch die Heimwehtouristen, also Flüchtlinge und Vertriebene mit ihren Nachkommen. Mit dem Eintritt vieler postkommunisti scher Länder in die Europäische Union – der der Ukraine 2004 verwehrt wor den sei – und dem wachsenden wirt schaftlichen Interesse an Rußland sei die Bedeutung dieser Nationen weiter mar ginalisiert worden.
Dummheit und Schwäche
Für Maljartschuk verschwand damit die europäisch orientierte Ukraine, die in einer verbrecherischen Art und Wei se von der sowjetisch dominierten er setzt worden sei. Sie betont, sie sei nicht gegen die russische Nation, sondern ge gen die „Russkij Mir“, die „russische Welt“, ein herrschaftliches Konzept, in dem es nur um das Imperium gehe.
Dessen Stärkung habe vor allem an der Unterschätzung Wladimir Putins im Westen gelegen, so Pollack, und auch an wirtschaflichen Gründen: „Dummheit und Schwäche.“ Fortwährendes Interes se an der Ukraine könnte diesem Staat auch helfen, in die EU und die NATO zu kommen. Die Literatur könne und solle helfen, dieses Interesse wachzuhalten.
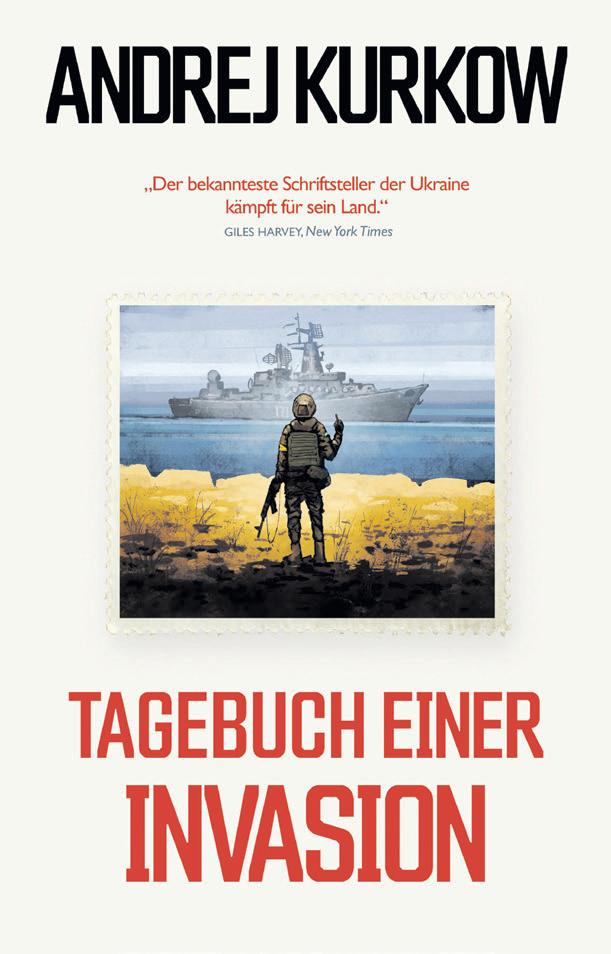
In diesem Moment dankt auch schon der Moderator den drei Schriftstellern für ihre wertvollen Aussagen. Philipp Ther fragt überrascht: „Huch? Schon so spät?“ Die spannende Diskussion hat die Zeit wie im Fluge vergehen lassen.
Susanne Habel
den viele nominierte oder schon ausgezeichnete Bücher vorge stellt. Eine Sonderschau ist dem „Bayerischen Buchpreis“ gewid met. Etliche Bücher beschäftigen sich mit Mittelosteuropa, wie die Titelbilder unten zeigen.
Das trifft auch für die Sonder ausstellung über den „Geschwi ster-Scholl-Preis“ zu. Dieses Jahr erhält der Ukrainer Andrej Kur kow am Montag, 28. November den Preis für sein „Tagebuch ei ner Invasion“ (2022). Kurkow, der die Einführungsrede zum
Münchner Literaturfest 2022 hielt, wurde 1961 in Sankt Peters burg geboren und lebte bis vor Putins Überfall auf die Ukraine in Kiew. Er lernte zehn Fremdspra chen, war Redakteur und zeit weise Gefängniswärter, Kamera
mann und Drehbuchautor. Seit 1996 ist er Schriftsteller, der Ro mane wie „Picknick auf dem Eis“ (1999) und „Der Milchmann in der Nacht“ (2009) schrieb.
Hilfreich für Eltern und Groß eltern sind die Bücher, die in den
Sonderausstellungen „Deutscher Jugendliteraturpreis 2022“ und „Die 100 besten Kinder- und Ju gendbücher“ präsentiert werden. Viele Entdeckungen sind zu ma chen, die nicht nur die Jugend begeistern dürften.
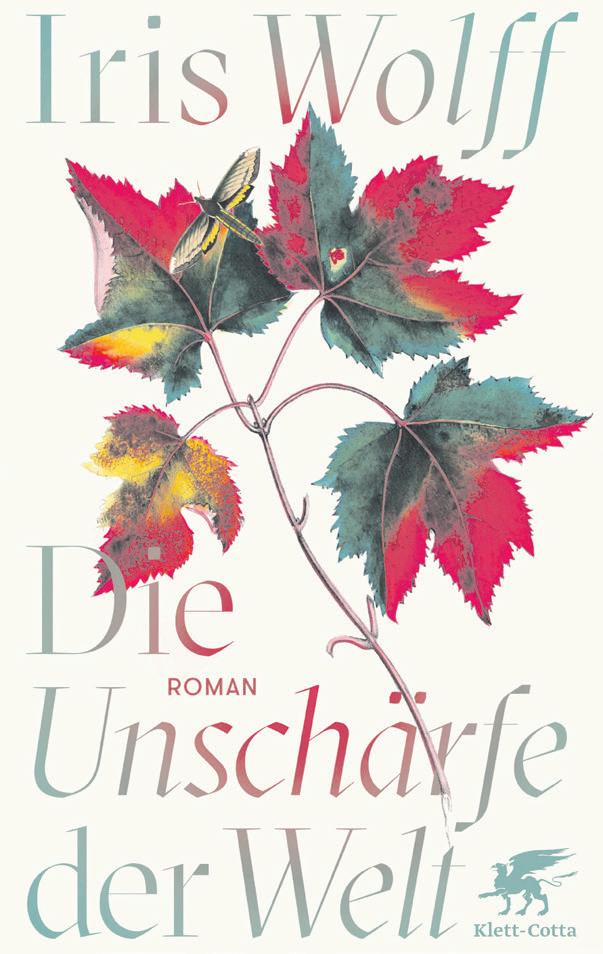
Schon Tradition sind auch die sehr subjektiven Schaus „Emp fehlungen unserer Buchhänd ler“ und „Münchner Autoren“. Hier entdeckt man jedoch auch Autoren, die nicht aus München kommen. Dazu zählt Rena Du mont aus dem mährischen Proß
nitz bei Olmütz mit ihrem neuen Buch „Die Mühle“. Hilfreich für einen Besuch ist eine vorherige Recherche auf der Internetseite, auf der man sich Merklisten von Titeln anlegen kann.
 Susanne Habel
Susanne Habel
Bis Sonntag, 4. Dezember: „63. Münchner Bücherschau“ im Literaturhaus München, Gale rie, Salvatorplatz 1, im Münche ner Bezirk Altstadt-Lehel. Täglich 8.30–23.00 Uhr. Internet: mbs. medientage-digital.de/lobby
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 7 In den Sonderausstellungen werden auch etliche
mit
zu
Geschwister-Scholl-Preises 2022.
Bücher
Bezug
Mitteleuropa
und Osteuropa gezeigt, Belletristik wie Sachbücher. Ganz rechts das neue Buch vom Gewinner
des
Professor Dr. Philip Ther, Tanja Maljartschuk, Kuratorin der diesjährigen „Forum“-Reihe, Moderator Martin Pollack, Dr. Adam Soboczynski und Tanja Graf, Geschäftsführerin des Münchener Literaturhauses.
� 63. Bücherschau in München Über 100 Verlage � Literaturfest München 2022
Professor Dr. Philip Ther, Tanja Maljartschuk, Dr. Adam Soboczynski und Martin Pollack in lebhaftem Austausch.
Banater, Böhmerwäldler und Brasilianer


Mitte November fand im Su detendeutschen Haus in Mün chen ein internationales Tanz fest statt. Die Böhmerwald Singund Volkstanzgruppe hatte alle im Großraum München begei sterten Volkstänzer zum Mitma chen eingeladen.
Banater, Böhmerwäldler, Eger länder, Kuhländler, Rübe zahls Zwerge, Riesengebirgler, Mitglieder der Sudetendeut schen Jugend und Brasilianer schwangen ganz begeistert das Tanzbein. Außerdem nahmen on line und live über den YouTube-
Kanal 50 Gruppen aus Brasilien, Italien, Portugal und der Schweiz teil. 90 Zuschauer hatten sich on line reingeklickt. Sie sahen „ein Face-to-Face-Tanztreffen von Menschen, die typische Rhyth men und Choreographien mö gen“, wie es auf YouTube be
schrieben wurde. Dort ist noch ein Zusammenschnitt von den Teilnehmern aus der ganzen Welt zu sehen, teils auch aus frü heren Jahren. Außerdem wer den im Video die teilnehmenden Gruppen beschrieben und ihre Motivation erklärt.
Musikalisch wurde das Fest von verschiedenen Musikern be gleitet. Besonders schön war zu sehen, daß gemeinsam zu tanzen über die Grenzen hinweg Natio nen verbindet und Freude Be reitet. Alle hatten viel Spaß, und es war auch für die Böhmerwald
Sing- und Volkstanzgruppe als Organisator ein voller Erfolg. Die Gruppe wird mit dieser Tradition fortfahren und näch stes Jahr im November wieder ein Tanzfest im Sudetendeut schen Haus veranstalten.


 Birgit Unfug
Birgit Unfug
Nachdem die Trachtennähwo che des Frauenarbeitskreises im Deutschen Böhmerwaldbund im letzten Jahr ausnahmsweise in den September verschoben wor den war, konnte sie in diesem Jahr wieder am traditionellen Datum stattfinden.

Für die Trachtennähwoche fan den sich 20 begeisterte Nähe rinnen im Haus der Böhmerwäld ler in Lackenhäuser ein. Unter der bewährten Leitung von Eri ka Weinert und Ursula Kisslin ger konnten die Arbeiten im Ta gungsraum, der zum Nähsaal umfunktioniert wurde, begin nen. Bei abendlichen Vorträgen erfuhren die Tagungsteilneh mer von den Referentinnen in teressante In formationen über Brauch tum und Brauchtums pflege sowie über verschie dene Näh- und Handarbeits techniken. Bei einem Diskus sionsabend sprachen die Teilnehmerin nen angeregt über ihre Ar beiten und die Referate.
Zum Einsatz kamen ange fangene Trach tenteile, die seit der letz ten Trachten nähwoche im
vergangenen Jahr auf ihre Fer tigstellung warteten, neue Pro jekte und auch wieder schöne Trachtentaschen, wichtiges Zu behör zur vollständigen Tracht, Festtagsblusen mit aufwendi gen Smokarbeiten, Spenzer oder Leiblkittel. So manche Nähe rin versuchte sich an Häkel- und Stickarbeiten.
Die Organisation lag in den Händen von Renate Slawik. Dank des guten Wetters waren
abendliche Spaziergänge um den Schwalbensee mit sportlichen Lockerungsübungen für die ge plagte Rückenmuskulatur oder zum Mahnmal der Böhmerwäld ler möglich und wurden gerne angenommen.
Der Ausflug am Mittwoch führte uns in diesem Jahr in das nahe gelegene Altreichenau zur Naturseifenmanufaktur Helene Zitzelsberger. Hier erfuhren die interessierten Teilnehmerinnen
viel Wissenswertes über Heil pflanzen und Heilkräuter, ihre Anpflanzung und Verarbeitung. Zitzelsberger erklärte den Zuhö rerinnen die Herstellung von Sal ben und Tinkturen. Heilkräuter und Heilpflanzen sind bewährte Arzneimittel der Natur. Man er fuhr, welche Inhaltsstoffe sie aus zeichnen und wie man sie ver wenden kann.

Unter Heilpflanzen werden ganz allgemein all jene Pflanzen
zusammengefaßt, die mit ihren Wirkstoffen Beschwerden und Krankheiten lindern können.
Von den Heilkräutern und Heil pflanzen dienen verschiedene Bestandteile wie Blüten, Blätter, Sproßteile, Früchte und Beeren oder Wurzeln als pflanzliche Arz neimittel. Bei einem anschließen den Rundgang durch den Garten konnten die Pflanzen in Augen schein genommen werden. Lei der ging diese schöne und har
Brigitta Schweigl-Braun
in ganz besonderer Gast er freute die Böhmerwäldlerin nen während ihrer Nähwoche: Martin Januschko, Mitglied im Deutschen Böhmerwaldbund, verbrachte einige Tage im Haus der Böhmerwälder. Er war damit beschäftigt, den Weg vom Haus in den Garten zu reparieren –wahrliche eine „schwere“ Aufga be, die Martin selbstredend be stens löste. Außerdem verwöhn te er die fleißigen Näherinnen, denn er half stets bei der Essen sausgabe, die aufgrund der Coronavor schriften nicht in gewohnter Weise durch geführt wer den konnte.
E
Als Danke schön für diese liebevolle Be treuung ließen die Teilneh merinnen es sich nicht neh men, den neu en Weg „Mar tinsweg“ zu taufen. Diesen Martins weg weihten sie mit Band und Lied ein.
monische Woche wieder viel zu schnell zu Ende, und am Freitag wurden beim obligatorischen Fo totermin die neugenähten Trach ten vorgeführt.
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 8
Renate Slawik
Leiblkittel und Naturseife
� Trachtennähwoche in Lackenhäuser
Die Teilnehmerinnen tragen alle Tracht.
Martin Januschko am Martinsweg.
�
Internationales Tanzfest 2022 im Sudetendeutschen Haus in München und online auf YouTube
online: www.youtube.com/watch?v=_3vPIZoLTz8
Mitglieder der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe im Adalbert-Stifter-Saal beim Internationalen Tanzfest mit breitem Programm
(oben Mitte). Video
Bilder: Helmut Unfug
Ein Heiliger zwischen Reformation und Restauration
Mitte November ver anstaltete die Acker mann-Gemeinde in der Erzdiözese Freiburg im Bildungshaus Sankt Bern hard in Rastatt ihren Diö zesantag.
Mit zwei Themen be faßten sich die 31 Teilnehmerinnen und Teil nehmer beim diesjährigen Diözesantag: mit Klemens Maria Hofbauer, dem Hei ligen zwischen Reformati on und Restauration, und mit dem Sudetendeut schen Museum in Mün chen. Über beide Themen referierte Raimund Palec zek, Vorsitzender des Su detendeutschen Instituts. Darüber hinaus gaben der Diö zesanvorsitzende Roland Stindl und Diözesangeschäftsführe rin Heidi Rothmaier einen Rückund Ausblick auf die Aktivitäten des Diözesanverbandes.
In seiner Begrüßung mach te Stindl deutlich, daß der Vor trag über Klemens Maria Hof bauer schon vor zwei Jahren zum 200. Todestag geplant gewesen sei, aber coronabedingt habe ver schoben werden müssen. Ebenso erinnerte Stindl an den 2020 er öffneten Pilgerweg von Hofbau ers südmährischem Geburtsort Tasswitz über Znaim, Retz und Eggenburg nach Wien sowie an viele diesem Heiligen gewidme te Vertriebenenkirchen.
Als einen „Heiligen in einer äußerst schwierigen Zeit mit vie len Parallelen zu heute“ führte Paleczek den von ihm vorgestell ten Heiligen ein. Er beschrieb das zeitliche beziehungsweise geist liche Umfeld mit katholischer Aufklärung, Johann Wolfgang von Goethe, Napoleon Buona parte und Josephinismus sowie mit den kirchlichen Entwicklun gen, auf die Hofbauer getroffen sei: Ausbau der Pfarreien, neue Diözesen, Ausbau im Schulbe reich, in gewisser Weise Büro kratisierung der Glaubensfor men, Betonung der sozial-karita tiven Aufgaben und Verlust der inneren Religiosität. Vor allem der Verlust der inne ren Religiosität sei, so Paleczek einleitend, zum Lebensthema Hofbauers geworden.
Akribisch zeichne te er das Leben und Wirken des am 26. Dezember 1751 in Tasswitz geborenen späteren Heiligen nach. Wenig erfolg reich seien die ersten sechs Lebensjahr zehnte gewesen: Zunächst habe er eine Bäckerlehre gemacht und sei Bäcker in Znaim und Wien gewesen. Zu Fuß habe er Pilger reisen nach Rom unternommen und den Entschluß gefaßt, Ein siedler zu werden. Schließlich sei er nach Wien zurückgekehrt und
habe ein Theologiestudium be gonnen.
Prägend sei für Hofbauer der Jesuit Nikolaus Joseph Albert von Diesbach gewesen. Bei wei teren Rom-Reisen habe er den Redemptoristen-Orden – auch

land, Jestetten, Triberg im Schwarzwald und Baben hausen bei Augsburg und allesamt wenig von Erfolg gekrönt gewesen, so daß er 1807 nach Warschau zurückgekehrt sei. Hier sei kurz danach Thaddäus Hübl gestorben. Trotz der 35 Mitbrüder in Warschau sei Hofbauer 1808 nach Wien zurückgekehrt und schließlich Kaplan und Rektor bei den Ursulinen geworden.
Bekannt geworden sei er in Wien für seine Pre digten, die wegen ihrer einfachen und klaren Art die Massen angezogen, aber auch zur Bespitze lung durch die Polizei ge führt hätten. Der Wiener Erzbi schof Sigismund Anton von Ho henwart habe sich für Hofbauer eingesetzt, so daß dieser weiter für die religiöse Erneuerung ha be wirken können – auch mit Einfluß auf die deutschen Orts
gen Grundlagen von Museums arbeit, die Finanzierung und För derung und in das Konzept der Dauerausstellung, die sich über fünf Stockwerke erstreckt. Mit vielen Bildern erläuterte Palec zek den Aufbau des Museums und die präsentierten Inhalte.
Abschließend gaben Diöze sanvorsitzender Roland Stindl und Diözesangeschäftsführe rin Heidi Rothmaier einen Rück blick auf die Veranstaltungen der Freiburger Ackermann-Gemein de in diesem und einen Ausblick auf Aktivitäten im kommenden Jahr. Ein Glanzpunkt wird sicher die vom 7. bis 10. September ge plante Reise in die Diözese Pil sen werden. Dabei werden zum einen das 30jährige Jubiläum des Bistums Pilsen und zum anderen die ebenso lange Partnerschaft der Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese Freiburg mit Katho liken der Diözese Pilsen gefeiert werden.
Den die Tagung abschließen den Gottesdienst zelebrierte der





Der Vorstand wird jünger
Einen Generationswech sel gab es Ende Oktober im Diözesanvorstand der Ak kermann-Gemeinde im Erz bistum Freiburg in BadenWürttemberg.
Mit Helga Barth, die noch persönlich das Schick sal der Vertreibung hatte er leben müssen, zog sich ein Verbandsurgestein und die zuletzt noch verbliebene Ver treterin der Erlebnisgenera tion aus dem Diözesanvor stand zurück. Dafür gestal ten jetzt die 30jährige Rebecca Kopřivová und der 33jähri ge Patrick Zorn die Arbeit der Ackermann-Gemeinde an der diözesanen Verbandsspitze mit.
und Sankt Bartholomäus Or tenberg besteht. Neben der pastoralen Arbeit in der Ge meinde bildet der Religions unterricht einen Schwerpunkt, dazu kommen Kurseinheiten in Freiburg.
Die Sommerfreizeit Plasto Fantasto für Kinder und Ju gendliche war 2004 auch für den in Karlsruhe geborenen und in Bruchsal lebenden Pa trick Zorn der Einstieg in die Arbeit bei der AckermannGemeinde. Seine Großeltern wurden übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben.
Ligourianer genannt – kennen gelernt, in den er mit seinem Freund Thaddäus Hübl einge treten sei. „Das war der Orden, der sich am klarsten gegen den josephinistischen Zeitgeist aus sprach“, erklärte Paleczek. Nach einem ver kürzten Noviziat sei en beide am 29. März 1785 zu Priestern ge weiht worden. Gleich zeitig hätten sie den Auftrag erhalten, den Orden und dessen Ideen nördlich der Alpen zu verbreiten.
Doch das sei im jose hinistisch geprägten Wien schwierig ge wesen. Mit der glei chen Aufgabe sei es dann nach Warschau gegangen, wo Hof bauer mit seinen Ordensbrüdern eine Armenschule, eine Hand arbeitsschule für Mädchen und ein Waisenhaus gegründet und die Volksmission gestartet habe. Weitere Stationen seien das Kur
kirchen beziehungsweise in von ihm zusammengestellten Krei sen mit zum Teil bedeutenden Personen. Hofbauers größte Lei stung sei die Zulassung des Re demptoristen-Ordens fünf Wo chen nach seinem Tod am 15. März 1820 im Habsburger Reich und in den folgenden Jahrzehn ten in vielen weiteren Ländern und damit der Einsatz für die Freiheit der Kirche von weltlichen und staatlichen Einflüssen gewesen. Felsenfeste Treue zur Kirche, per sönliches Gebet di rekt zu Gott und ab solutes Gottvertrauen seien, so Paleczek, die Grundfesten in Hof bauers Lehre.
Unter dem Titel „Wir brauchen die Er innerung“ gab Palec zek im zweiten Vortrag Einblicke in die Arbeit des Sudetendeut schen Museums, das heißt in die Gründungsgeschichte, die heuti


Geistliche Beirat Peter Bretl. In seiner Predigt nahm er Bezug auf das in der Raummitte stehende Kreuz, das – wie Fahnen, Stan darten und Banner – für Ori entierung und Standhaftigkeit steht. An Jesus könne man sich stets orientieren, „er trägt und hilft uns. In uns ist dieser Aus richtungspunkt lebendig“, so der Geistliche. Somit bedeute stand haft zu bleiben auch, unterwegs zu sein, da Christus uns da bei begleitet. Für die Verantwortungsüber nahme durch die jün geren Generationen bei der Freiburger Ak kermann-Gemeinde (Ý rechts) sprach der Geistliche Beirat gro ße Anerkennung aus. Angesichts des an diesem Tag begange nen Volkstrauertages wurde na türlich auch der verstorbenen Mitglieder des letzten Jahres ge dacht.




Im Rahmen eines Kaffeekränz chens der bayerisch-schwäbi schen SL-Ortsgruppe Meitingen ehr ten Kurt Aue, SL-Kreisobmann und BdV-Kreisvorsitzender AugsburgLand (links), Annemarie Probst, Landesvorstandsmitglied des BdVLandesverbandes Bayern (zwei te von rechts) und Meitingens SLOrtsobfrau Heike Tschauner (rechts) Liane Degortes (zweite von links) für 50 und Doris Celeste (Mitte) für zehn Jahre Treue. Kurt Aue erläuter te das Jahresprogramm 2023 und bat alle Ortsgruppen, mit der Fah ne zur BdV-Maiandacht am 19. Mai in die katholische Pfarrkirche Sankt Ulrich in Königsbrunn zu kommen.


Text: Kurt Aue, Bild: Stefan Stix
Aus einer deutsch-tschechi schen Familie stammt Rebecca Kopřivová. So wuchs sie in der mährischen Metropole Brünn mit beiden Sprachen auf. In der ersten Hälfte der 2000er Jahre fand sie zu Plasto Fan tasto, einem Veranstaltungs format der Jugendarbeit der Ackermann-Gemein de für die jüng ste Altersgrup pe ab zehn Jahren. Zu nächst war sie hier Teil nehmerin, danach Teamerin beziehungs weise Leite rin.
Die Teilnah me und Mitwirkung bei Veranstaltungen der Jun gen Aktion der AckermannGemeinde wie Winterwerk wochen, Begegnungswoche in Rohr oder später in Niederal taich folgten. Dabei war sie na türlich auch als Dolmetscherin aktiv.
Ihre musikalischen, kultu rellen und kreativen Talente bringt sie bis heute gerne bei der jährlichen Kulturveran staltung der Ackermann-Ge meinde, dem Rohrer Sommer, ein. „Das ist mir ganz wichtig, aber auch einen Ort der Ge meinschaft zu erleben“, be tont die junge Stellvertreten de Diözesanvorsitzende. Ih re Fundierung im christlichen Glauben bewog sie zum Studi um des Lehramts für Religion und Englisch, das sie in Frei burg im Breisgau absolvierte.

Beruflich hat sie nun in ei nem ähnlichen Feld Fuß ge faßt. Seit Oktober bis August 2024 ist sie Pastoralassistentin – das ist die Vorstufe zur Pa storalreferentin – in der Seel sorgeeinheit Vorderes Kinzig tal im Schwarzwald, die aus den Pfarrgemeinden Sankt Marien Gengenbach, Sankt Georg Berghaupten, Heili ge Dreifaltigkeit Ohlsbach
Die Basis seiner kirchlichen Prägung und seines Engage ments in der Ackermann-Ge meinde liegt jedoch im Mini strantendienst am Altar und als Gruppenleiter in der Orga nisation von Sommerfreizei ten und kleineren Veranstal tungen. Nach neun Jahren als Oberministrant beziehungs weise Dekanatsoberministrant im Dekanat Bruchsal wurde er zur BDKJ-Dekanatsleitung im Dekanat gewählt, was er acht Jahre ausübte.

„Ich durfte die Jugendverbän de und die Mi nistranten im Kreisju gendring, im Ortsju gendring und im De kanatsrat vertreten. Au ßerdem konnte ich unter anderem bei der Organisation der 72-Stunden-Aktion mit wirken. Mir haben diese Auf gaben immer sehr viel Freude bereitet. Darüber hinaus durf te ich als gewählter Vertreter im BDKJ-Diözesanausschuß und im Satzungsausschuß Ju gendarbeit auf Diözesanebe ne mitgestalten“, blickt Zorn zurück.
Mit Fokus auf die im Jahr 2004 begonnene Mitarbeit bei der Ackermann-Gemein de meint er: „Brücken bau en war für mich seit der Ju gend ein wichtiges Anliegen. Sei es Brücken bauen zur Völ kerverständigung, um Vorur teile abzubauen oder einfach nur die Nächstenliebe zu le ben. Aufgrund der deutschen Geschichte war es mir schon immer wichtig, daß wir dar aus unsere Lehren ziehen, da mit sich Geschichte nicht wie derholen kann. Ich denke, ge rade diese Botschaft muß man jeden Tag umsetzen. Die Ak kermann-Gemeinde zeigt seit ihrer Gründung, wie wichtig es ist, in die Zukunft zu schau en und Brücken zwischen den Menschen in Europa und weltweit zu bilden.“ Beruflich ist Zorn Softwareentwickler.
Markus Bauer
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 9 � Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese
Markus Bauer
Freiburg
Flöte, Gitarre und Schola begleiten den Gottesdienst.
Bilder: Markus Bauer
� Ackermann-Gemeinde in der Diözese Freiburg
Referent Dr. Rai mund Paleczek
Diözesanvorsitzen der Roland Stindl
Gabi Stanzel, Birgit Nauheimer, Diözesanvorsitzender Roland Stindl, Rebecca Kopřivová, Geistlicher Beirat Peter Bretl, Diözesangeschäfts führerin Heidi Rothmaier und Patrick Zorn sind der neue Vorstand der Ackermann-Gemeinde im Erzbistum Freiburg. Sandra Uhlig ist eben falls Vorstandsmitglied, aber nicht auf dem Bild. Bild: Sandra Uhlich
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 BIS28MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Geistlicher Beirat Peter Bretl feiert Gottesdienst.
Die letzten Österreicher
Der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) hatte für Mitte November ins Haus der Heimat in Wien geladen, wo Filmregisseur Lukas Pitscheider im Rahmen der VLÖ-Veranstaltungsserie „Forum Heimat“ seinen Film „Die letzten Österreicher“ vorführte.
Zunächst begrüßte VLÖ-Präsident Norbert Kapeller die Gäste, darunter SLÖBundesobmann Gerhard Zeihsel und dessen Frau Reinhilde. Er freue sich, so Kapeller, gemeinsam mit seinen VLÖ-Vorstandskolleginnen und -kollegen Lukas Pitscheider für eine Präsentation seines Filmes „Die letzten Österreicher“ gewonnen zu haben. 2020 habe der Film Premiere gefeiert.

Der Film handelt von einem von der Außenwelt nur schwer zugänglichen Dorf in den Karpatenwäldern. Dort ringen die letzten Österreicher der Ukraine mit der Frage, ob sie ihrer Heimat den Rükken kehren sollen. Königsfeld ist ein österreichisches Dorf mitten in den ukrainischen Karpaten. Soweit das Auge reicht, ist die kleine Gemeinde von dichtem Wald umgeben. Mit schweren Holzstämmen beladene Lastkraftwagen brettern durch die Talstraße, welche von tiefen Schlaglöchern durchzogen ist. Holz dominiert das Dorfbild, so auch die Häuser, deren Bauweise an jene aus dem Salzkammergut erinnert.
Am Straßenrand beobachten meist ältere Menschen das Treiben mit nostalgischem Blick. Die Vorfahren der österreichischen Bewohner wurden im 18. Jahrhundert als Waldarbeiter aus dem Salzkammergut in den Osten der damaligen Habsburgermonarchie umgesiedelt. Heute zählt die deutschsprachige Gemeinde nur noch einige wenige Dutzend Mitglieder. In einer Welle wanderte in den 1990er Jahren die Mehrheit der Bevölkerung Richtung Westen
aus, ihre Häuser übernahmen großteils Bewohner aus den Nachbardörfern. „Auswandern oder bleiben?“ ist auch heute noch die unumgänglich wichtigste Frage.
Während für manche Gemeindemitglieder die Migration als einziger Überlebensweg erscheint, schöpfen andere neue Hoffnung und wollen den Tourismus ins Tal holen. Vier Protagonisten und ihre Familien werden im Film über den Zeitraum von drei Jahren bei ihrer Lebensentscheidung begleitet.
● Elisabeth Kais hat die 84 Jahre ihres Lebens in ihrem Dorf verbracht, als sie von einem Tag auf den anderen ihr Heimatdorf verlassen muß.



● Peter Sojma ist in den 1990er Jahren nach Deutschland ausgewandert, aber bereits nach kurzer Zeit zurückgekehrt. Heute ist er als Vizebürgermeister darum bemüht, die schlechten Straßen zu reparieren, um das Tal wieder von außen zugänglich zu machen.
● Vitali Palinkasch ist Vater einer jungen Tochter. Da der Lohn von seiner Arbeit im Sägewerk nicht mehr ausreicht, um seine Familie zu ernähren, überlegt er, zum Arbeiten in die Tschechische Republik auszuwandern.
● Für Joseph Horkawtschuk war Auswandern nie eine Option, er hat den Tourismus als Einnahmequelle entdeckt und will das erste örtliche Skigebiet eröffnen. Im Westen sucht er dafür einen gebrauchten Skilift, welchen er restaurieren und auf der örtlichen Alm aufbauen will.
VLÖ-Präsident Norbert Kapeller und alle anderen Zuschauern waren von diesem Filmabend begeistert, der mit einer Diskussionsrunde mit Lukas Pitscheider endete. „Uns haben bereits zahlreiche Anfragen von anderen Organisationen erreicht, die diesen Film ebenfalls in ähnlichem Rahmen präsentieren möchten“, freut sich Kapeller über das große Echo.
Vertriebene bauen Brücken
Mitte September beging der hessische BdV-Kreisverband Groß-Gerau in Biebesheim seinen Tag der Heimat zusammen mit dem hessischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation.
Als großartige Leistung bezeichnete Ines Claus, die Vorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, die Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Sie würdigte, daß die Vertriebenen in jener Charta bereits im August 1950, nur wenige Jahre nach dem Verlust ihrer Heimat, auf Rache und Vergeltung verzichtet hätten.
„Die Vertriebenen haben in ihrer Situation aus der Geschichte gelernt, die Gegenwart mitgestaltet und damit zum Aufbau eines freien, demokratischen Europas friedvoller Staaten beigetragen.“ Mit der Verpflichtung, in einem geeinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, gehöre die Charta zu den Gründungsdokumenten der Bundesrepublik Deutschland. Sie sei als Dokument der Versöhnung stets Orientierung und Leitlinie des Handelns der Heimatvertriebenen gewesen.

Heute kämpfe die Ukraine für Demokratie und Freiheit. „Der BdV hat eine besondere Verbindung zu diesem Schicksal.“ Packe man bei Umzügen zig Kisten, habe den Vertriebenen bei der ungerechten Vertreibung meist nur eine kleine Kiste zur Verfügung gestanden. Die Erfahrungen erlaubten es den Heimatvertriebenen, eine Erinnerungskultur weiterzugeben. „Sie betreiben Transformation und setzen damit ein Signal für die Zukunft“, rief Claus aus, „denn mit Ihrer Erfahrung können Sie Zukunft schöpfen.“
Mit Blick auf das Leitwort „Vertriebene und Spätaussiedler – Brückenbauer in Europa“ meinte Bürgermeister Thomas Schell, daß auch Kommunen und Bürger Brücken bauen könnten. Diese Treffen seien nicht nur Gedenken und Brauchtumspflege. „Der BdV kann aus eigener Erfahrung mahnen.“

Schirmherr und Landrat Thomas Will erinnerte an das BdVMotto 2019, das von Menschenrechten gesprochen habe. Die würden nach dem russischen An-
griffskrieg Tag für Tag mißachtet. „Brücken werden nicht nur in der Ukraine zerstört, sondern auch zwischen Menschen.“ Will zitierte BdV-Präsident Bernd Fabritius: „Heimat ist für jede Gemeinschaft die Luft zum Atmen, Heimat ist nie ausgrenzend, sondern eine Einladung an alle, die Heimat suchen.“ Dabei verwies er auf die Geschehnisse in der Ukraine und warb für Solidarität und Hilfsbereitschaft. Wichtig sei, diesen ukrainischen Menschen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional beizustehen. „Dabei können Sie uns helfen. Wer, wenn nicht Sie, sind Experten in Sachen Migration und Integration.“
Michael Gahler MdEP stellte fest, daß sich Geschichte wiederhole. Zum zweiten Male nach 1941 sei die Ukraine angegrif-
als politischen Auftrag formuliert. Das habe den BdV bewogen, nicht nur Menschen anzusprechen, die das Schicksal der Flucht und Vertreibung hätten erleiden müssen, sondern alle Bürger, vor allem politische Verantwortungsträger in den Kommunen, auf Landes- und Bundesebene, in Gesellschaft sowie Kirchenvertreter. „Dieser Gedenktag geht uns alle an!“
Auf die Brückenbauer-Funktion der Heimatvertriebenen ging Hans-Josef Becker vom BdV-Leitungsteam ein: „Waren es nicht die deutschen Vertriebenen, die als erste nach dem Krieg die Heimat aufsuchten, Kontakte herstellten zu den neuen Bewohnern ihrer Häuser, Geld spendeten, um Kirchen und Friedhöfe wieder herzurichten – und damit Hand anlegten an ein Versöhnungswerk?“ Aus persönlichem Erleben in der Tschechische Republik nannte Becker
Neue
Bleibe im BGZ

Mitte November traf sich die mecklenburg-vorpommersche SL-Altkreisgruppe Vorpommern im Begegnungszentrum von Ribnitz-Damgarten.
Damit hatte die SL-Altkreisgruppe eine neue Bleibe in der Bernsteinstadt im jetzigen Kreis Vorpommern-Rügen gefunden. Und damit wurde auch die pessimistische Überschrift „Treffen bald nur noch in Zingst“ (➝ SdZ 40/2022) nicht wahr. Die mecklenburgische Stadt Ribnitz und die vorpommersche Stadt Damgarten hatten die Kommunisten 1950 vereint, um die Erinnerung an Pommern und die damit verbundene historische mecklenburgisch-pommersche Grenze auszulöschen.
fen worden. Wenn alte Ukrainer aussagten, daß sich die Russen schlimmer benähmen als damals die Deutschen, sei das kein Trost. Der demokratische Westen müsse alles tun, damit die Ukraine nicht dem russischen Gulag eingegliedert werde.
Helmut Brandl vom Leitungsteam des BdV-Kreisverbands hatte den Tag der Heimat eröffnet. Er wies darauf hin, daß zugleich der hessische Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation begangen werde. Diesen habe die Landesregierung vor neun Jahren

zwei Beispiele für das Errichten von Brücken selbst über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Nicht selten etwa hätten auch Heimatvertriebene Städtepartnerschaften in die Vertreibungsgebiete angestoßen und zählten zu deren Verfechtern.
Den Festakt und den anschließenden Volkstumsnachmittag gestalteten der Chor Kammerton Groß-Gerau, die Siebenbürger Musikanten Pfungstadt, die BdV-Musik- und -Gesangsgruppe Biebesheim/Dornheim sowie die Siebenbürgische Tanzgruppe Pfungstadt mit.
Das Begegnungszentrum (BGZ) steht in Bahnhofsnähe im Neubaugebiet in Ribnitz, also auf mecklenburgischem Boden, ist eine umgebaute Kaufhalle und wurde vor der Wende als ein Kaufhaus vom Konsum eröffnet. Es beherbergt einen großzügigen Veranstaltungssaal, verschiedene Gruppenräume, einen Bandproberaum und ein nett eingerichtetes Café. Mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen hießen uns die Ribnitz-Damgartner Ehrenamtlichen herzlich willkommen. Wegen aktueller Krankheiten und zunehmender Unbeweglichkeit konnte ich nur neun Heimatfreunde begrüßen. Dafür aber konnte ich Grüße von Daheimgebliebenen von Graal-Müritz bis Usedom bestellen.
Persönliche Grüße waren auch von Heimatfreundin Maria Rudlof aus Schatzlar gekommen. Sie lebt seit mehreren Jahren in einem Heim und wird Mitte Dezember 100. Geburtstag feiern.

Hauptthema des Treffens war natürlich das Aus der „Riesengebirgsheimat“ in der seit 75 Jahren gewohnten Form, was sehr bedauert wurde. Optimistisch macht jedoch, daß es prinzipiell mit der Heimatzeitung weitergeht. Die neue Form konnte mit mehreren Ausgaben, die wir von Redaktionsassistentin Birte Rudzki dankenswerterweise zu Demonstrationszwecken erhielten, vorgestellt werden.
Als bisheriger und zukünftiger Redakteur werde ich mit den Vorständen der Heimatkreise Hohenelbe und Trautenau versuchen, möglichst viel Traditionelles in die Zukunft zu retten. Einig waren wir uns auch mit den neuen Gastgebern, daß wir uns im nächsten Jahr wieder im Begegnungszentrum treffen werden.
Mitte Dezember wird es jedoch noch einmal ein Jahresabschlußtreffen in Zingst geben.
Ein wenig stolz macht uns schon, daß wir neben Rostock noch die einzige aktive SL-Kreisgruppe ohne Unterstützung des Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern sind.
Peter Barth
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 10 ❯ SL-KG Vorpommern
❯ BdV-Kreisverband Groß-Gerau/Hessen
Volkstrauertag traf sich die hessische SL-Altkreisgruppe
zur Kranzniederlegung. Vize-Kreisobmann
oder Vertreibung zum Opfer gefallen waren. Die Sudetendeutschen
Am
Schlüchtern am Gedenkstein auf dem Schlüchterner Friedhof
Dr. Bernd Giesemann gedachte der Toten, die Krieg, Flucht
stünden ganz besonders für Frieden und Aussöhnung unter Menschen und Völkern, sagte Giesemann. Das Gedenken am Volkstrauertag an Angehörige und Ahnen, die als Soldaten in den Kriegen, in Gefangenschaft, als Vertriebene oder Flüchtlinge ihr Leben verloren hätten, solle das Vergessen verhindern und stete Mahnung sein. Text:
Antje Hartelt
Siebenbürgische Tanzgruppe mit der Europafahne im Hintergrund. Bilder: BdV-Kreisverband Groß-Gerau, Harald von Haza-Radlitz
Thomas Will Ines Claus
VLÖ-Präsident
Norbert Kapeller
Regisseur Lukas Pitscheider
SL-Bundesobmann Gerhard Zeihsel und seine Frau Reinhilde in der ersten Reihe.
Peter Barth am Kopf der Kaffeetafel im Begegnungszentrum in RibnitzDamgarten.
❯ SLÖ
Maria Rudlof
Mitte November feierte die Regionalkooperation Oberpfalz und Pilsen mit einem Festakt im Spiegelsaal des Sitzes der Regierung der Oberpfalz in Regensburg ihr 20+1jähriges Bestehen.

Regierungspräsident Walter Jonas begrüßte die Gäste sowie die Redner und Referenten. Die erste Rede hielt Albert Fürakker, Bayerns Staatsminister für Finanzen und Heimat. Er hob die Bedeutung der Achse Oberpfalz –Pilsen als Modellregion für Mitteleuropa hervor. Die Tschechische Generalkonsulin Ivana

im
Červenková bezeichnete ebenfalls die Achse Oberpfalz–Pilsen als beispielhaft und erklärte, wie eng beide Regionen mittlerweile zusammenarbeiteten. Der ehemalige Landrat von Neustadt an der Waldnaab, Simon Wittmann, und der erste Regierungspräsident der Region Pilsen, Petr Zimmermann, blickten gemeinsam auf die Anfänge
der Zusammenarbeit zurück.
Im Podiumsgespräch erörterten Füracker, Červenková, Jonas, Regionalpräsident Rudolf Špoták und Bezirkstagspräsident Franz Löffler den aktuellen Stand der Zusammenarbeit sowie Projekte, die in nächster Zukunft angepackt werden müßten. Darunter auch, daß die Sprachbarrieren überwunden
würden, indem auf beiden Seiten die Sprache des Nachbarlandes verstärkt gelernt werde. Außerdem gebe es noch Ausbaupotential bei der Zugverbindung zwischen München und Prag, derzeit betrüge die Fahrzeit noch immer deutlich mehr als fünf Stunden. Wünschenswert sei der Ausbau der Beziehungen mit Südböhmen und dem Bezirk Eger-Karlsbad.
Beim anschließenden Empfang hatte ich noch Gelegenheit, mit den Gästen aus Pilsen ins Gespräch zu kommen.
Gerhard Hermann
Vom Hungerzum Versöhnungsmarsch

Im Rahmen der 26. Kulturfahrt des Heimatkreises Jägerndorf und des Heimatkreisvereins wurde mit einem Versöhnungsmarsch des Hungermarsches von Jägerndorf nach Grulich im Juni 1945 gedacht (➞ SdZ 28/2022). Auch Schüler des Gymnasiums und der Fachschule für Verkehr und Touristik in Jägerndorf beteiligten sich an dem Gedenken. Anschließend veröffentlichten beide Schulen Berichte. Kurt Schmidt, Initiator des Gedenkens, Vorsitzender des Heimatkreisvereins und Ehrenbürger von Jägerndorf, übersetzte die Berichte für die Sudetendeutsche Zeitung.
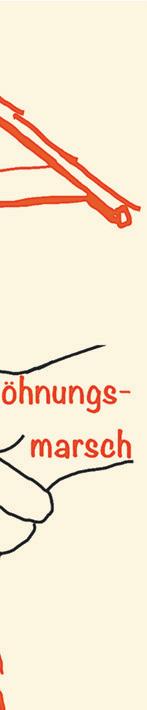
Die hessische SL-Altkreisgruppe Schlüchtern beging nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder ihren Tag der Heimat, der traditionell am Volkstrauertag stattfindet.


Nachdem das Gesangsensemble „Singsation“ die Gedenkandacht in der SanktJakobus-Kirche mit Max Drischners Chorsatz von „Der Herr ist mein Hirte“ eröffnet hatte, begrüßte Pater FranzJosef Urselmans von den Salesianern die zahlreichen Gäste. Altkreisobmann Walter Weber führte in den diesjährigen Tag der Heimat ein. Der stehe unter dem Motto „Vertriebene und Spätaussiedler – Brückenbauer in Europa“ und sei ein Gedenktag, an dem an Schicksal, Geschichte und Kultur der Hei-
matvertriebenen, der Flüchtlinge, Aussiedler und Spätaussiedler erinnert werde.
Für den erkrankten Kreisobmann Roland Dworschak übernahm sein Stellvertreter Bernd Giesemann das Totengedenken. Anschließend übernahmen die Vorstandsmitglieder Gudrun He-
berling und Gernot Strunz das allgemeine Gedenken an die verlorene Heimat und an die Toten aus „vorigen Zeiten“ und regten mit Worten wie Vertreibung, Deportation, verwaiste und vermißte Kinder oder Versöhnung und Frieden zum Nachdenken an.
Pater Urselmans hatte für sein geistliches Wort das Buch „Heimat im Wandel der Geschichte und im persönlichen Erleben“ des aus Pommern vertriebenen Martin Krause mitgebracht und zitierte daraus einige Gedanken über Heimat. Seit 2010 gestaltet „Singsation“ den Tag der Heimat der Kreisgruppe musikalisch. Wie immer hatte Chorleiterin Antje Hartelt mit den „Irischen Segenswünschen“, „This Wandering Day“ und dem Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“ passendes Liedgut ausgewählt. Mit dem „Feieromdlied“ von Anton Günther endete wie die Jahre zuvor die bemerkenswerte Veranstaltung. Anschließend traf man sich zum geselligen Beisammensein und regen Austausch im Hotel Akzent. et
Am 28. Juni beteiligten sich Schüler unseres Gymnasiums gemeinsam mit weiteren Schulen aus Jägerndorf und Olbersdorf an der lange geplanten Aktion mit der Bezeichnung „Versöhnungsmarsch“. Dieser wurde von den deutschen Jägerndorfer Landsleuten organisiert, die uns und ihren Landsleuten den sogenannten Hungermarsch vor Augen führen wollten, der sich im Juni 1945 ereignet und für 3000 Deutsche aus Jägerndorf Kummer und Leid bedeutet hatte.

Die Gruppe von annähernd 100 deutschen und tschechischen Teilnehmern traf sich am Parkplatz oberhalb der Gemeinde Gabel, wo man nicht nur die Darstellungen von Überlebenden des damaligen Marsches vernehmen konnte, sondern auch die Vorträge bedeutender Persönlichkeiten aus Jägerndorf, einschließlich Vladimir Schreiers, des Herrn Direktors unserer Schule.
Dank an alle, welche sich schon seit vielen Jahren um das Entstehen eines Gefühls der Gemeinsamkeit und des gegenseitigen Respekts zwischen deutschen und tschechischen Landsleuten aus Jägerndorf bemühen, wie wir es beim Gedenkstein, der sich bei der Synagoge befindet, hören konnten.
Einen kleinen Teil des Marsches, den die Menschen damals hatten absolvieren müssen, sind auch wir mitgegangen –aber nicht von Jägerndorf nach Grulich, von wo die Deutschen mit der Eisenbahn abtransportiert wurden, sondern von Wiese in die Stadt, in der sich „unsere Deutschen“, wie wir es oft hören können, stets wie zu Hause fühlen.



also symbolisch zur Versöhnung verschiedener Generationen und erhielt deshalb die neue Bezeichnung Pochod smíření – Versöhnungsmarsch.
Gymnasium Jägerndorf
Den Volkstrauertag begingen die oberfränkische SL-Ortsgruppe Naila, die Stadt und die Kirchen mit den Bürgern und Vereinsabordnungen vor dem Mahnmal auf dem Friedhof.

Dekan Andreas Maar bemerkte in seiner Ansprache, daß niemand von uns sich vor einem Jahr einen Krieg an den europäischen Grenzen wie den gegen die Ukrainer habe vorstellen können. Für den Glauben an das Gute im Menschen helfe wohl nur noch der Glaube an einen gerechten Gott und an die Kraft des Gebetes, die das versöhnende Zusammenwachsen im Kleinen
bis hin zu Völkergemeinschaften fördern könnten.
Bürgermeister Frank Stumpf sprach in seiner Gedenkrede über den Beginn des Volksgedenkens im Deutschen Reichstag 1922 nach dem furchtbaren Ersten Weltkrieg und über den Mißbrauch als Heldengedenktag während der Nazi-Diktatur. Nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg sei der Volkstrauertag als Gedenktag der gesamten deutschen Bevölkerung am zweiten Novembersonntag den militärischen und zivilen Opfern von Kriegen, Terror rassistischer Gewalt und Vertreibungen weltweit gewidmet.
Nach den Vernichtungskriegen in Europa, angezettelt durch die Hitler-Nazis, rege der Volkstrauertag zusätzlich zu Versöhnung an. Um so gefährlicher sei, daß durch den verbrecherischen Angriff Putins und seiner Gefolgschaft auf die Ukraine durch Bombardierungen von Städten und Sozialeinrichtungen mit Tod, Flucht und Obdachlosigkeit der Krieg als Mittel der Politik wieder in Europa zurückgekehrt sei.
Stumpf ermutigte, gerade jetzt und als Auftrag des Volkstrauertages Gegenwart und Zukunft in Frieden und Freiheit aktiv mitzugestalten, in Achtung der Men-
schenrechte und des Selbstbestimmungsrechts.
Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal der Stadt Naila gedachte der Bürgermeister der Opfer von Gewalt und Krieg und derer, die durch Gefangenschaft, Vertreibung, Massaker, rassistische und religiöse Verfolgung ihr Leben und ihre Heimat verloren hätten. Er dankte den evangelischen und katholischen Geistlichen, dem Posaunenchor Naila und für die Teilnahme der Bürger und Vereine, namentlich der Freiwilligen Feuerwehr, des THW, der Reservistenkameradschaft, des VdK und der SL Naila mit Kranz und Fahne.
Dieser Marsch, der im Unterschied zu 1945 in die entgegengesetzte Richtung zielte, führte
A
m Dienstag, den 28. Juni beteiligten sich einige Studenten der ersten Jahrgänge unserer Schule am Versöhnungsmarsch. Es handelte sich um die Erinnerung an ein Ereignis des Jahres 1945, als Hunderte deutscher Einwohner von Jägerndorf und Umgebung zuerst aus ihren Häusern getrieben und in Lager gebracht worden waren und dann den sogenannten Hungermarsch über Würbenthal und Gabel hatten antreten müssen. Von dort wurden sie in überfüllten Lastzü-
gen nach Deutschland gebracht.
Unmittelbar am Gabler Kreuz hörten Studenten der Mittelschulen von Jägerndorf die Erinnerungen von Zeitzeugen dieses traurigen Ereignisses. Um die Mittagszeit hielten beide Busse, ein tschechischer und ein deutscher, in Wiese, wo im Restaurant Zum Bison auf alle ein sättigendes und sehr schmackhaftes Mittagessen wartete.
Nachher absolvierten wir ein kurzes Stück des Hungermarsches – einschließlich des 94jährigen Herrn Kurt Schmidt, dem Hauptinitiator der ganzen Aktion. Zum Abschluß fanden wir uns vor der Synagoge ein, wo nach Vorträgen tschechische, deutsche und jüdische Lieder erklangen. Fachschule für Verkehr und Touristik Jägerndorf
VERBANDSNACHRICHTEN AUS DER HEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 11 ❯ Heimatkreis Jägerndorf/Altvater
❯ SL-Altkreisgruppe Schlüchtern/Hessen Sag mir, wo die Blumen sind ❯ SL-Ortsgruppe Naila/Oberfranken Volkstrauertag im Ukrainejahr ❯ Regionalkooperation Oberpfalz und Pilsen Jubiläum
Spiegelsaal Die Kreisgruppe in der Sankt-Jakobus-Kirche.
Gerhard Hermann und Rudolf Špoták.
Moderatorin Lucie Valentová, Bezirkstagspräsident Franz Löffler, Hejtman Rudolf Špoták, die Tschechische Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková, Finanzminister Albert Füracker und Regierungspräsident Walter Jonas. Bilder: Regierung der Oberpfalz/Kammermeier
Dekan Andreas Maar, Bürgermeister Frank Stumpf und SL-Ortsobmann Adolf Markus beim Gedenken auf dem Friedhof.
Das Zeichen des Versöhnungsmarsches ist ein Handschlag vor dem Gabelkreuz. Rechts der Sockel des Gabelkreuzes mit dem Blumenschmuck des Gedenktages.
An der Spitze des Versöhnungsmarsches der 94jährige Kurt Schmidt (rechts) und der ehemalige Jägerndorfer Bürgermeister Bedřich Marek. Schüler am HungermarschGedenkstein auf dem Synagogen-Gelände.
Neudeker Heimatbrief

für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Die Datschiburger Kickers bolzen für den guten Zweck
Bereits zum sechsten Mal seit 1992 trat die Augsburger Fußball-Wohltätigkeitsmannschaft Datschiburger Kickers in Neudek/Nejdek zu einem Benefizspiel an, wie auch die „Augsburger Allgemeine“ berichtete.
Nach längerer Pause ließen die Datschiburger Kikkers alte Kontakte einmal wieder aufleben und fuhren zum sechsten Mal zu einem Wohltätigkeitsspiel nach Neudek. In der Patenstadt kickte das Augsburger ProminentenTeam zugunsten ukrainischer Kinder.
Diese waren aus der Heimat geflohen, leben nun in Neudek und gehen dort auch zur Schule. Nicht unzufrieden waren die Kickers mit dem 2:2 (2:0) Endstand. Der ursprünglich geplante Platz in Neudek war aufgrund der starken Regenfälle unbespielbar, so daß das Spiel

kurzerhand auf einen Kunstrasenplatz im benachbarten NeuRohlau/Nová Role verlegt wurde. Auf diesem Kleinfeld konnte statt mit der vollen Mannschaftsstärke nur acht gegen acht und
torhüter Zdenko Miletic im ersten Teil der Partie ihre Erfahrung ausspielen. Sie gingen mit einem Doppelpack von Klaus Köbler mit 2:0 – Tor eins in der 15. und Tor zwei in der 32. Mi-


Selbstverständlich stand das Fußballspiel im Vordergrund, jedoch kam ein ausgiebiger Besuch der Kurstadt Karlsbad nicht zu kurz. Im Becherovka-Museum erfuhr man vieles über die Her-
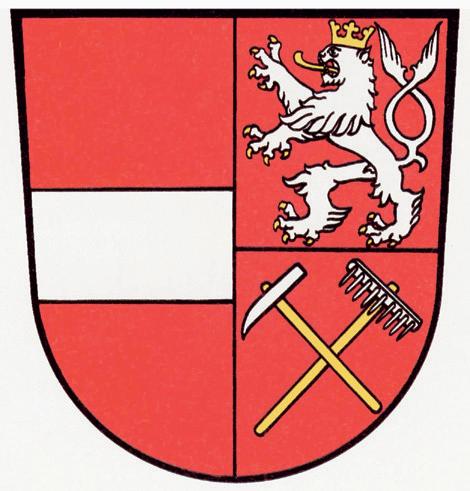

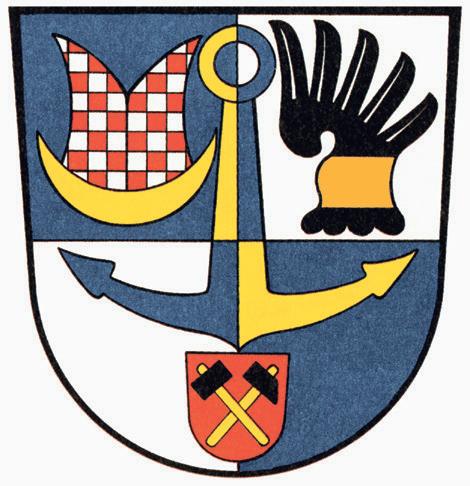

cher von der Schönheit dieses weltbekannten Kurortes überzeugen.
Der Abend klang gemütlich im Hotel Anna aus. Zusammen mit den tschechischen Spielern wurde noch viel gefachsimpelt.
Der ehemalige Bürgermeister Lubomir Vítek ließ es sich nicht nehmen, den Abend zusammen mit den Gästen aus Augsburg zu verbringen.
Neues Wissensspiel Grenzenlos durchs Erzgebirge

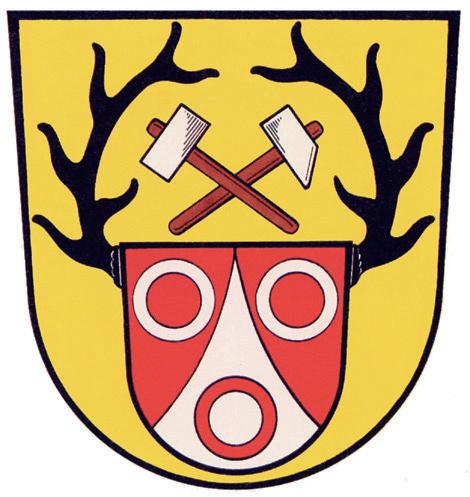
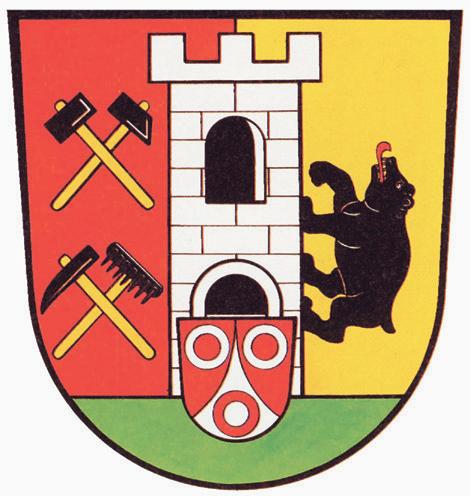
In diesem Wissensspiel hat das Erzgebirge keine politischen Grenzen. Es ist für zwei bis fünf Mitspieler und dauert 60 bis 120 Minuten. Dabei unternehmen die Spieler eine Wanderung von Chemnitz/Saská Kamenice nach Komotau/Chomutov. Diese Wanderung weckt Neugier und macht Lust, den jeweils anderen Teil des Erzgebirges zu erkunden und seine Menschen näher kennenzulernen. Auf dieser Reise passieren die Spieler 70 bemerkenswerte Städte und Dörfer, davon 45 im sächsischen und 25 im böhmischen Teil des Erzgebirges. Bei diesem Abenteuer müssen zahlreiche Fragen beantwortet und einige Berge, Flüsse und ein Stausee überwunden werden.
auf kleinere Tore gespielt werden.

Dies war ein Vorteil für die tschechischen Gastgeber, die bereits seit Monaten auf diese Partie hin trainierten. Dennoch konnten die Augsburger Altstars um den ehemaligen Bundesliga-
nute – in Führung. Doch in der Schlußphase glichen die Gastgeber in diesem Freundschaftsspiel noch aus. Ein gerechtes Ergebnis, wie am Ende auch die Augsburger Organisatorin Anita Donderer und Teamchef Uwe Nothnagel fanden.
stellung dieses Kräuterlikörs, der einst Karlsbader Becherbitter geheißen hatte, und jeder ließ sich die Verkostung munden. Bei einem ausgiebigen Spaziergang durch das Kurviertel entlang der Tepl bis hin zum legendären Hotel Pupp konnten sich die Besu-
Am Ende stand auf der Heimfahrt noch ein Abstecher in das mittelalterliche Städtchen Elbogen/ Loket auf dem Programm. Jana Motliková, eine Bekannte von Donderer, zeigte den Gästen die Altstadt, bevor in einer kleinen Brauerei zu Mittag gegessen wurde.
Am Ende lautete die einstimmige Antwort: „Es waren drei schöne Tage in der Tschechischen Republik.“ ar
Das Familienspiel „Grenzenlos durch Erzgebirge – in 70 Spielzügen von Chemnitz bis Komotau/Chomutov“ erschien Anfang November in zwei verschiedenen Ausführungen: eine robuste Familien-Edition sowie eine filigrane Liebhaber-Edition mit fünf in liebevoller Handarbeit gefertigten Holzminiaturen aus der Erzgebirgischen Holzkunstmanufaktur Wolfgang Braun. Diese ist Mitglied im Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeugmacher.
Bei der Familienedition gehen fünf handgedrechselte Nußknacker in verschiedenen Farben an den Start und versuchen, möglichst schnell und fehlerfrei über den Kamm des Erzgebirges zu wandern und auf der anderen Seite nach Komotau/Chomutov zu gelangen, dem Ziel der Reise.
Das Spiel ist komplett zweisprachig deutsch und tschechisch aufgelegt. So wie es sich für ein tschechisch-deutsches Verlegerpaar wie Kateřina Tschirner-Kosová und Jürgen Tschirner gehört. Auf der böhmischen Seite erscheinen alle Ortsnamen in tschechischer sowie in deutscher Bezeichnung
Die komplette Wertschöpfung kommt aus Deutschland, davon ein großer Teil in Sachsen. Die Spielfiguren werden in Deutschneudorf und Neuhausen hergestellt, das Spielbrett und der Karton in Annaberg-Buchholz. Alle Grafiken werden in Leipzig gezeichnet, und die Spielidee entstand auch in Leipzig. Die Endredaktion für alle Fragen und Antworten stammt aus Chemnitz, Naunhof und Olbernhau. Lediglich die Baumwollsäckchen für die Basisversion werden in Lesen Sie auf Seite 13 weiter
Ein Lichterengel, ein Nußknakker, ein Bergmann, ein Anton Günther und eine Reisigfrau sind die Spielfiguren der Liebhaberversion.
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Neudek Abertham
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg
7015 0000 0906 2126
640 (12/2022): Mittwoch, 7. Dezember. Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 12 Folge 639 · 11/2022
Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion: Lexa Wessel, eMail neudeker@ sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft,
Stadtsparkasse München – IBAN: DE69
00, BIC: SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge
Die beiden Mannschaften vor Spielbeginn.
Reisegruppe vor
auf
❯ Neudek
Bilder: Ulrich Möckel (2), Peter Faass (2),
Die
dem Sockel der Dreifaltigkeitssäule
dem Marktplatz in Elbogen.
❯
Die Augsburger Wohltätigkeits-Fußballmannschaft Datschiburger Kickers.
Dönerladen neben Brauerei in der Altstadt von Elbogen/Loket.
Doch die Liebhaberversion ist bereits ausverkauft und erscheint erst nächsten November wieder.
Anfang November kam das neue Brettspiel „Grenzenlos durchs Erzgebirge“ aus dem Hause Tschirner und Kosová auf den Markt.
München produziert, die Würfel in Elsdorf, das 150seitige Büchlein in Hamburg und Zwickau.
Das Spiel beinhaltet ein Spielbrett, fünf erzgebirgische Spielfiguren in Form von Nußknakkern in verschiedenen Farben, zwei Holzwürfel, ein Baumwollsäckchen für die Spielfiguren sowie ein 150 seitiges Büchlein mit Spielanleitung und Spielregeln.
Die bereits vergriffene Liebhaber-Edition zeichnet sich durch fünf wunderschöne, in 42 Arbeitsschritten gefertigte Miniaturen der Manufaktur Holzkunst Braun aus Oberlochmühle bei Seiffen aus – fast zu schade zum Spielen. Neben der Reisigfrau gehen Anton Günther, ein Nußknacker, ein Bergmann und ein Lichterengel an den Start. Auch diese versuchen, möglichst flott von Chemnitz über den Kamm des Erzgebirges zu wandern und auf der anderen Seite nach Komotau zu gelangen. Die Aktionsfelder auf dem Spielfeld sorgen für zusätzliche Spannung.
Nadira Hurnaus
Kateřina Tschirner-Kosová und Jürgen Tschirner: „Grenzenlos durchs Erzgebirge. Familien Edition“. (ISBN 978-3-00-0727368) Für 59 Euro plus Versandkosten erhältlich bei Verlag Tschirner & Kosová, Zum Harfenacker 13, 04179 Leipzig, Mobilfunk (01 76) 20 74 99 08 , eMail info@tschirner -kosova.de

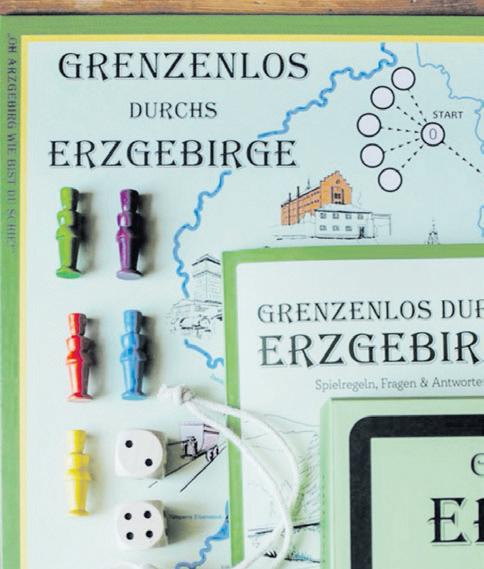
Herzensangelegenheit Kirchweih
Ende August fand die Frühbusser Kirchweih statt, über die Benjamin Hochmuth, der aus Silberbach stammt, jüngst im Magazin „Der Grenzgänger“ berichtete.
Die Frühbusser Kirchweih gehört unumstritten zu den Höhepunkten des Jahres. Dies liegt nicht nur an dem romantischen Bergstädtchen, sondern vor allem auch daran, wie Petr Rojík und seine Schwester Sonja Šimánková das Fest in jedem Jahr voller Herzblut und Heimatliebe organisieren. An diesem besonderen Tag schenken sie den Menschen das Wertvollste, das man nicht mit allem Geld der Welt kaufen kann, nämlich einige Stunden mit wunderschönen Eindrücken und umgeben von lieben Menschen.
der mit ganzer Seele lebten, solle sich auch auf die Besucher der Kirchweih übertragen. Dies konnte man zu jedem Zeitpunkt des Tages spüren.

Vormittags lud Rojík zu einer Exkursion ein. Bereits am Donnerstag vor dem Fest war wieder eine 15köpfige Truppe fleißiger, freiwilliger Helfer angerückt, welche die Kirche gründlich für das anstehende Fest säuberte.
Leider meinte es das Wetter nicht besonders gut mit uns, denn es regnete unaufhörlich. Das war für uns nicht gerade angenehm, aber für die Natur nach Wochen vollkommener Trokkenheit ein wahrer Segen. Immerhin nahmen 80 Personen an der Wanderung teil. Auch nach der Wanderung erschienen viele weitere Heimatfreunde.
stoßen würden. Zum Abschluß der Einführung öffnete Rojík unsere Herzen mit einem gesanglichen und musikalischen Vortrag des erzgebirgischen Volkssängers Anton Günther mit dem Lied „Wu de Wälder hamlich rauschen“.
Schubert auf der Frühbusser Kirchenorgel, während die talentierte Věra Smržová ihren wundervollen Gesang zum Besten gab.
Der 869 Meter hohe Stürmer ist einer der höchsten Berge des östlichen Erzgebirges auf tschechischer Seite, das sollte man bei dem neuen Spiel wissen.
WIR GRATULIEREN
Folgenden treuen Beziehern des Neudeker Heimatbriefs, die im Monat November Geburtstag haben, wünschen wir von Herzen alles Gute und noch viele schöne Jahre in Gesundheit und Zufriedenheit.
■ Bärringen. Liesl Schraut, Liegnitzer-Straße 9, 74722 Buchen, 23. November 1942;
■ Trinksaifen. Emil Herold, Diebelbachstraße 14, 86199 Augsburg, 30. November 1929.
■ Neudek. Brunhilde Kaltschnee/Roßmeisl, Vogelsbergstraße 14, 63505 Langenselbold, 3. November 1926;
Elfriede Ullmann (Tochter von Paula Fickert), An den Eichen 9 a, 64546 Mörfelden-Walldorf, 5. November 1950.
■ Neuhammer. Monika Lienert/Meindl (Ober Neuhammer 141), Jenaer Straße 4, 90522 Oberasbach, 7. November 1954;
Erika Schmidt/Zettl, Sonnenstraße 16, 86179 Augsburg, 13. November 1939.

Bereits in der Einladung zur Kirchweih am 27. August, welche in Form von Internetbeiträgen, eMails und Plakaten die Runde machte, schreibt Šimánková, daß es sich um eine Herzensangelegenheit handle. Die Liebe zur Heimat, die sie und ihr Bru-
Damit wir nicht gleich zu Anfang naß wurden, führte uns Rojík zunächst in die Kirche, um uns auf die Exkursion einzustimmen. Dabei zeigte uns der leidenschaftliche Geologe auch anhand von realen Beispielen die Mineralien und Gesteine, auf die wir während unserer Wanderung

Danach setzten wir unsere Exkursion in den Wald und in das ehemalige Bergbaugebiet fort. Dort erkundeten wir zunächst die jüngste Bergbaugeschichte anhand von noch immer existierenden Resten der ehemaligen Anlagen. Gegen Mittag gönnten wir uns eine zweistündige Pause. Gestärkt und inzwischen auch wieder trocken versammelten wir uns in der Sankt-BartholomäusKirche in Frühbuß, um gemeinsam an der Heiligen Messe teilzunehmen. Diese wurde wieder vom beliebten und für seine lebhaften und lebensnahen Predigten bekannten Pfarrer Petr Fořt zelebriert. Unterstützung erfuhr er von Pfarrer Bystrík Feranec und Pfarrer Ferdinand Kohl.
Rojík sorgte für eine gelungene musikalische Begleitung der Deutschen Messe von Franz
In der Predigt ging es diesmal darum, in sich heineinzuhorchen, warum man hier in der Frühbusser Kirche sei. Eine solche Zusammenkunft könne unserer Seele mehr geben als jeglicher materieller Besitz in dieser konsumbehafteten und schnelllebigen Welt.

Den Abschluß des Gottesdienstes bildete das FeierabendLied von Anton Günther mit musikalischer Begleitung von Rojík auf dem Keyboard.

Für nach der Heiligen Messe und für den Ausklang dieses wundervollen Tages hatte sich Rojík noch etwas Besonderes einfallen lassen. Es gab ein Kirchenkonzert mit der in der Region bekannten und begnadeten Sängerin Petra de Dios und ihren Freunden Pavla Kleinová und Natálie Fuchsová. Rojík begleitete die Damen auf dem Keyboard.
Das Trio entführte seine Zuhörer mit engelsgleichem Gesang
und zarten Violinenklängen in eine magische Welt. Das Repertoire reichte dabei von den italienischen Größen wie Giuseppe Verdi oder Giacomo Puccini bis hin zum böhmischen Komponisten Antonín Dvořák. Das Konzert endete mit der „Ode an die Freude“ des deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven und des deutschen Dichters Friedrich Schiller. Zusammen mit Petra und ihren Freunden sangen alle gemeinsam diese „Ode“ mit alternativem Text. Auch in diesem Jahr zogen uns Rojík, Šimánková und alle an der Kirchweih Mitwirkenden in den Bann des kleinen Bergstädtchens.
Das Ende dieses besonderen Tages beging ich mit einer inneren Ruhe und Freude im Herzen, und ich ließ all die schönen Ereignisse vor meinem geistigen Auge noch einmal Revue passieren. Sicherlich ging es nicht nur mir so.
Vielen Dank für dieses schöne Erlebnis – auch an meine wunderbare Heimatgemeinde Silberbach/Stříbrná für den finanziellen Beitrag zur Veranstaltung.
NEUDEKER HEIMATBRIEF Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 13
❯ Frühbuß
Das Reinigungsteam vor dem Frühbusser Kirchweihfest. Bilder: Benjamin Hochmuth (2), Sonja Šimánková (1), Ivana Varousová (1)
Die Heilige Messe anläßlich der Frühbusser Kirchweih.
Die musikalischen Akteure des Kirchenkonzertes.
Exkursionsleiter Dr. Petr Rojík.
Die Familienedition ist noch erhältlich.
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau
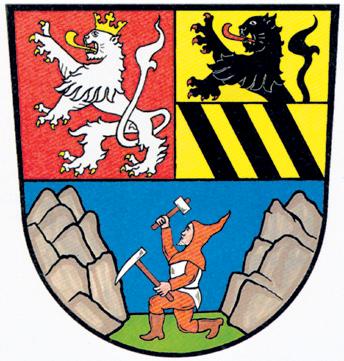




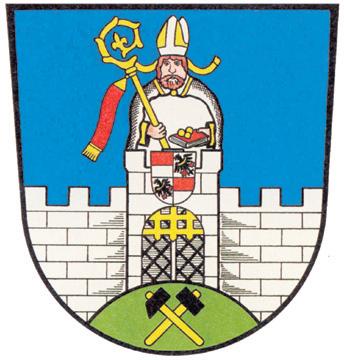
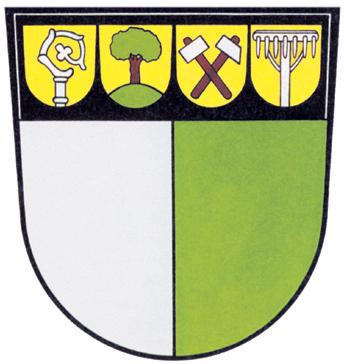


Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –
Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Tele fon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche.

Das „Lebendige Haus“ der Salesianer beginnt seine Rekonstruktion


Bei unserem letzten Heimat treffen im Juni in Teplitz-Schö nau wurde auch eine Spende für die Rekonstruktion des „Leben digen Hauses“ übergeben, um die christliche Arbeit der Teplit zer Salesianer, denen auch Pa ter Benno Beneš angehörte, zu unterstützen. Nun kann die Ar beit endlich beginnen. Da an der Eröffnung der Bauarbeiten Mit te November nur geladene Gä ste teilnehmen konnten, druk ken wir nachfolgend einen redi gierten Bericht der „Leitmeritzer Diözese“ von Dominik Faustus über dieses Geschehen ab, den Jutta Benešová übersetzte

Nach zweijähriger Vorberei tung begannen Mitte No vember die Bauarbeiten am „Le bendigen Haus“, welche etwa zwei Jahre lang dauern sollen. An der feierlichen Eröffnung der Bauarbeiten nahmen etwa 30 Personen teil, darunter auch Vertreter der Salesianer-Provinz, der Stadt Teplitz, der Leitmerit zer Diözese, des Aussiger Bezirks und der benachbarten Schulen.

„Don Bosco begann in Tu rin in einer Ka te. Trotz seines vernachlässigten Zustandes ist das Teplitzer ,Leben dige Haus‘ weit entfernt von einer Kate. Aber dahin ter steckt die glei che Idee und Mis sion: einen neu en Ort für Kinder und Jugendliche in Teplitz zu bau en, damit sie gu te Menschen und ehrliche Bürger werden können“, sagte Martin Hobza, Provin zial der Salesia ner, bei der feier lichen Eröffnung der Bauarbeiten und der Segnung des Gebäudes.
„Wir wollen einen sicheren Ort für Teplitz, an dem sich Kin der und Jugendliche in einer be schützten Umgebung mit ihren Freunden treffen, spielen, ler
nen und wachsen können. Te plitz wird uns für die nächsten 30 Jahre brauchen. Das ,Leben dige Haus‘ ist der Schlüssel da zu. Dank seiner werden wir zu ei nem besseren Leben in Teplitz
beitragen. Der Schlüssel zu einer guten Kindheit liegt in den Hän den eines jeden Spenders, eines jeden, der sich dem Projekt an schließt und hilft“, fügte Ven dulka Drobná, Leiterin des Sale
sianer-Zentrums Štěpán Trochta hinzu.
„Normalerwei se hat jede Kirche einen Turm. Über dem ,Lebendigen Haus‘ in Teplitz gibt es gleich drei solcher Türme“, betonte der Bi schof der Diöze se Leitmeritz, Jan Baxant. Damit meint er die um liegenden Hoch häuser der Wohn siedlung in Turn. Der Bischof seg nete die Arbeiten, die bis zum näch sten Jahr die erste Etappe des Um baus abschließen sollen. Der Bau wird von der Fir ma Metrostav DIZ s.r.o. durchge führt, deren Direktor Petr Ort an diesem Tag auch symbolisch mit dem Bau begann.
Bei der Feier sprach auch der neugewählte Oberbürgermeis-
ter von Teplitz, Jiří Štábl. Die ser bedankte sich in seiner Re de bei seinem Vorgänger Hynek Hanza für die Unterstützung der Stadt für dieses Projekt, wel ches er selbst als wesentlich und nützlich für die Region ansehe. Er drückte auch seine Hoffnung darüber aus, daß die Salesianer nach 30 Jahren Tätigkeit in Te plitz im „Lebendigen Haus“ ihr wahres Zuhause finden würden.
„Jede Veränderung beginnt bei jedem von uns. Ein Haus zu repa rieren ist eigentlich einfach, aber es wäre sinnlos, wenn danach nicht unser persönliches Bemü hen käme, uns selbst zu ändern“, betont Petr Kalas, Leiter der örtli chen Salesianer-Gemeinde.
Die Salesianer sind in Teplitz seit mehr als 30 Jahren in mehre ren angemieteten Gebäuden tä tig. Im Jahr 2019 hatten sie die Möglichkeit, ein eigenes Gebäu de zu kaufen und gleichzeitig ei ne alte Ruine – die ehemalige Kinderkrippe in Turn – zu ret ten. Sie entschieden sich, gerade dort ihr Zentrum zu errichten, in einem Stadtteil,
welcher als pro blematisch angesehen wird.
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
14 Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022
Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
� Teplitz-Schönau
Gruppenfoto vor Baubeginn: Bischof Jan Baxant, Martin Hobza von der Salesianer-Provinz, die Leiter des Salesianer-Zentrums Petr Karas und Vendulka Drobná, Oberbürgermeister Jiří Štábl und sein Stellvertreter Hynek Hanza, zwei Herren der Baufirma sowie Architekt Jan Hanzlík.
Vor dem „Lebendigen Haus“: Bischof Jan Baxant, Martin Hobza, Petr Karas und Vendulka Drobná. Ein Bild des geplanten „Lebendigen Hauses“ nach der Rekonstruktion. Das „Lebendige Haus“ vor der Rekonstruktion.
Bilder: salesianiteplice.cz
Das „Lebendige Haus“ der Salesianer im Teplitz-Schönauer Stadtteil Turn.
Mit dem
An der Gedenkfeier anläßlich des Volkstrauertags in der Bischofteinitzer Patenstadt Furth im Wald nahm auch der Heimatkreis Bischofteinitz teil.
Die Trauerfeier begann mit einem Gottesdienst. Dieser fand heuer nicht in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt – sie wird gegenwärtig renoviert –, sondern im Pfarrsaal des neuen Josefshauses.




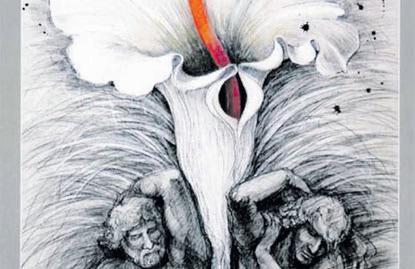
Am Friedhofsparkplatz startete dann der Trauermarsch mit Blasmusik und führte, begleitet von den Fahnenträgern, zum Gefallenendenkmal auf dem Ehrenhain.

Im September erschien die dritte Ausgabe des Magazins „Märchenland und Zauberwald“ mit „Märchenland Tschechien“ als Sonderthema.
Märchenland und Zauberwald“ heißt ein Magazin, das Karin Biela herausgibt. In der dritten Ausgabe dieses Magazins, das nun in dem von ihr gegründeten Apollon-Tempel-Verlag erschien, griff sie als großes Sonderthema tschechische Märchen auf.
Sie trug viel interessanten Lesestoff zusammen. Biela bemerkt, sie wolle mit dieser Ausgabe auch eine Brücke zum tschechischen Nachbarn bauen.

FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ HEIMATBOTE
der

Dort stellten sich die Fahnenträger der Further Soldatenund Kriegerkameradschaft, des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gedacht
gräberfürsorge, des Sozialverbandes VdK, der Feuerwehren Furth im Wald und Schafberg sowie Georg Naujokas mit den Fahnen der Bischofteinitzer vor dem Denkmal auf. Nach einer Trauerrede gedachten alle der Opfer von Gewalt.
Anschließend legten Furths Bürgermeister Sandro Bauer und der Stellvertretende Heimatkreisbetreuer Peter Gaag Kränze nieder. Danach ging es zur neuen Gedenkstätte mit den Namen aller Further Gefallenen und Vermißten des Ersten und Zweiten Weltkrieges auf dem Friedhof. Dort endete die Trauerfeier mit einem gemeinsamen Gebet.
Etwas näher wird auf Němcovás Roman „Babička“ („Die Großmutter“) von 1855 eingegangen.
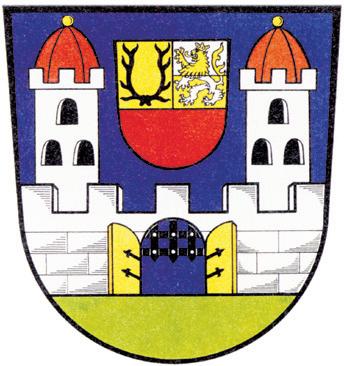

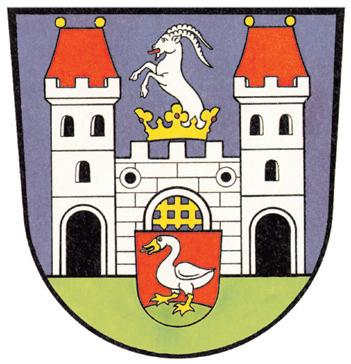
Die Pfarrer Zettl und Bräuer
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der letzte Teil seiner Arbeit über Pfarrer Augustin Zettl (1805–1878) und der erste über Pfarrer Matthias Bräuer (1817–1899).
Im Budweiser Priesterseminar wird am 24. und 25. September 1872 eine Synodalkonferenz des Bistumsklerus abgehalten. Aus jedem Vikariat nehmen der Bezirksvikar und weitere Priester teil, die vom Vikariatsklerus zuvor bestimmt worden sind. Die Beschlüsse der Synode in Budweis werden am 14. November 1872 verschickt. Über deren Inhalt schweigt sich die Eintragung im Memorabilienbuch allerdings aus.
Am 1. Mai 1873 wird in Wien die fünfte Weltausstellung eröffnet, die bis zum Herbst andauert. Ebenso kommt es im Mai 1873 zu einem Börsenzusammenbruch. 166 Aktiengesellschaften mit einem gezeichneten Kapital von 360,5 Millionen Gulden gehen Bankrott. Nach Steinbach ist die Ursache darin zu sehen, daß erstens durch die Aufhebung der Wuchergesetze durch die liberalen Kräfte der schrankenlosen Wucherfreiheit Tür und Tor geöffnet und zweitens durch gewaltige Spekulationen die Wirtschaft ungesund aufgebläht wurde. Bis April 1873 werden 1005 neue Konzessionen mit einem Kapital von vier Milliarden ausgestellt. Es kommt nach dem großen Krach zu vielen Selbstmorden unter den Börsenmännern.
Ein weiterer Eintrag betrifft das Erzbistum Prag, das vom 31. August bis zum 5. Oktober 1873 die Errichtung des Bistums 900 Jahren zuvor feiert. Vom Papst wird deshalb ein Jubiläumsablaß erteilt.
transport des Futters als Durchfahrtsrecht über die herrschaftliche Wiese zu sichern.
Pfarrer Matthias Bräuer
Matthias Bräuer kommt am 3. Februar 1817 in Roschowitz zur Welt. Er studiert am Gymnasium in Budweis und wird am 25. Juli 1842 zum Priester geweiht. 1842 kommt er für 15 Jahre als Kaplan in die Seelsorge nach Bischofteinitz. Anschließend wirkt er als Pfarrer in Melmitz und Schüttarschen. Am 13. September 1874 tritt Bräuer sein Amt als Dechant von Hostau an. Seit 1875 ist er auch Sekretär des Hostauer Vikariats. 1881 wird er zum Ehrenbürger Hostaus ernannt und wechselt am 12. März 1885 als Erzdechant nach Bischofteinitz. Dort bleibt er bis zu seiner Pensionierung 1891. 1899 stirbt Bräuer.
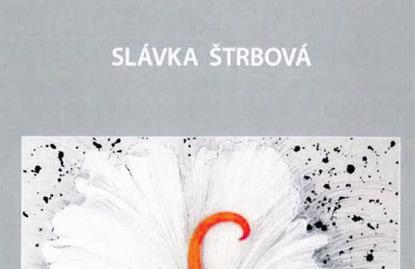
Unter ihm wirken in Hostau mehrere Kapläne: Karl Trnka bis 1879 mit einer Unterbrechung 1874, da in Hostau kurzzeitig Mathias Kolár als Kaplan eingesetzt wird, 1879 bis 1880 Josef Novák, 1880 bis 1881 Maximilian Pittermann und ab 1882 Josef Schürrer.
Dechant Bräuers Aufzeichnungen umfassen den Zeitraum 1874 bis 1885. Im Mai 1874 regeln vier neue Kirchengesetze die Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche, das staatliche Aufsichtsrecht über die Klöster, die Beträge aus den Pfründevermögen und die Anerkennung von Religionsgemeinschaften. Steinbach spricht hier offen von der Vergewaltigung der katholischen Kirche in Österreich.
Um Mitternacht am 22. November 1874 bricht in Hostau ein Feuer aus und die Scheunen der Häuser Nr. 64 von Josef Wenisch, Nr. 61 von Franziska Routschka und Nr. 66 von Peter Girg brennen komplett ab.
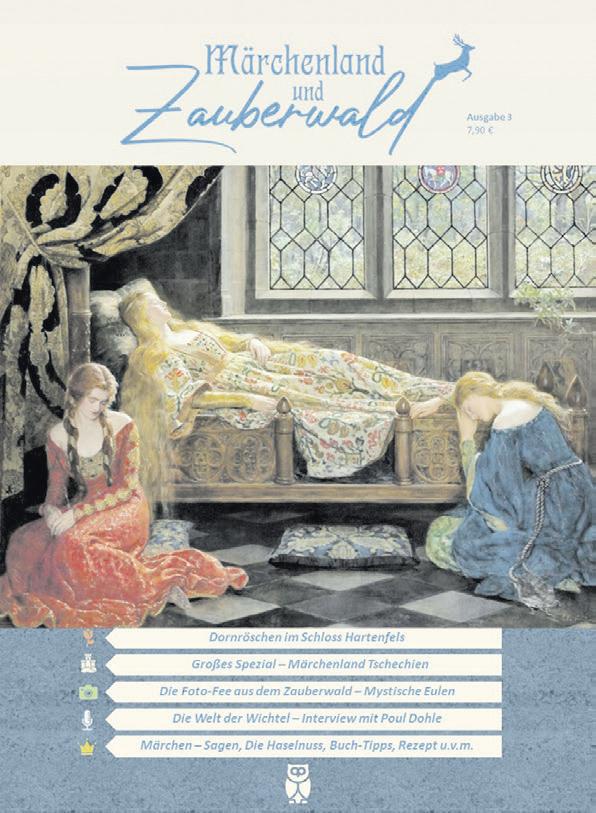
Für „Märchenland Tschechien“ war sie eigens nach Böhmen gereist. So stellt sie die Burg Schwihau, 20 Kilometer nördlich von Bischofteinitz, vor, die viele aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kennen. Die literarische Vorlage zu dieser berühmten Märchenverfilmung stammt von der auch bei Deutschen bekannten Schriftstellerin Božena Němcová (* 1820 in Wien; † 1862 in Prag), die auch in Taus und Neumark leb-
te, wo Gedenktafeln an sie erinnern. Neben Informationen über die Burg Schwihau werden auch die Veränderungen erwähnt, die für diesen Film an der Burg vorgenommen wurden und die ursprüngliche Anlage fast nicht mehr erkennen lassen. Und dann läßt Biela Němcová das Märchen über Aschenputtel erzählen. Anschließend sucht Biela die literarischen Spuren Němcovás.
Sie weist darauf hin, daß Němcová als die bedeutendste tschechische Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts gelte. 15 literarische Vorlagen sowie ihre letzten Briefe seien verfilmt worden.
Zum 200. Geburtstag der Schriftstellerin gab die Sammlerin Marta Zemanová einen Privatdruck mit Illustrationen von Slávka Štrbová heraus. Bis 3. Dezember läuft Štrbovás Ausstellung „Illustrationen – Zeichnungen“ im Rathaus in Furth im Wald.
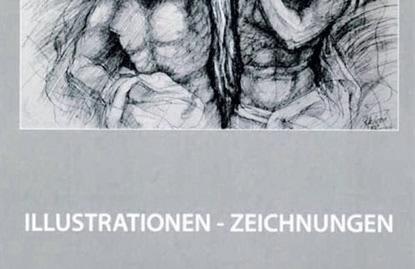
Das Magazin enthält auch eine Anleitung zum Bakken Böhmischer Kolatschen. Pit Mahlo stellt in einem Gastbeitrag faszinierende tschechische Märchenfilme vor. Und schließlich wird die Tschechische Republik auch noch als das Land der Burgen, Schlösser und Sagen geschildert. Das Magazin kann man im Online-Verlagsshop bestellen.
Karl Reitmeier
Dechant Steinbach lobt in einem Nachruf auf Zettl im Jahr 1878 des Dechanten Eifer, von dessen Vorgängern vergebene Besitzwerte wieder zurückzuerlangen. So sei es Zettl gelungen, die herrschaftliche Direktion in Bischofteinitz zu einem Grundtausch zu bewegen. Die Herrschaft habe das Feld bei der Ziegelhütte, die Dechantei den Hofacker hinter dem Dechanteigarten und den Stadtscheunen erhalten. Ferner habe Zettl die Dechanteiwiese bei Hassatitz durch stetige Betriebsamkeit korrekt abgrenzen lassen und das Recht bewahrt, den Ab-
Der Priester Johann Tichy, Sohn des Müllermeisters Josef Tichy und seiner Gemahlin Catharina, geborene Thoma aus Zwirschen, stirbt in Hostau am 18. Oktober 1876. Tichy war Kaplan in Neustadtl, wo im Mai 1876 ein Brand den Ort mit der Kirche vernichtete. Dabei zieht sich der junge Kaplan eine Erkältung zu, die sich aufgrund des Brandes zu einer Lungentuberkulose ausweitet. Der junge Priester muß seine Seelsorgstätigkeit aufgeben und zieht zu seinen Eltern nach Zwirschen. Doch tritt hier wegen des Mühlstaubes keine Linderung ein.
Fortsetzung folgt
Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 15
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Neuerscheinung Märchenland Tschechien ❯ Volkstrauertag in Furth im Wald
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Die Ausstellung läuft bis 3. Dezember im Rathaus in Furth im Wald.
Paten
Toten
❯ Hostaus
VIII
Pfarrer – Teil
Hostaus Dechanteikirche ist dem Apostel Jakobus dem Älteren geweiht.
Peter Gaag und Bürgermeister Sandro Bauer legen Kräze nieder.
Der Bischofteinitzer Fähnrich Georg Naujokas alleine und mit den anderen Fahnenabordnungen vor dem Mahnmal auf dem Further Ehrenhain.
Schriftführerin Veronika Linden, Karl-Heinz Loibl, Referent für Organisation, Peter Gaag, Stellvertretender Heimatkreisbetreuer, Regina Hildwein, Stellvertretende Heinmatkreisbetreuerin, und Günter Gröbner, Vertreter seiner Tochter und Nachfolgerin Doris Klingseisen als Referentin für Organisation und Heimatmuseum, auf dem Friedhof vor den Ehrentafeln. Rechts Peter Gaag und die Heimatkreisfahne auf dem Weg zum Friedhof. Bilder: David Skiba
64 Seiten, 7,90 Euro. (ISBN 978-39823-4273-3)
Karin Biela (Hg.): „Märchenland und Zauberwald“, Ausgabe 3. Apollon-Tempel-Verlag, München
2022;
Heimatbote
Heimatreffen und Allerheiligen

hofs und die Aufrechterhaltung seiner Pflege. Man merkt schon, daß dieser Ort gerne besucht wird.
Für Juli hatte ich zum ersten Nach-Corona-Heimattreffen der Neuhäusler eingeladen. Natürlich und wie erwartet war die Teilnehmerzahl klein. Aber die Bewertung der kleinen Gruppe lautete: „Es war wunderschön.“
Im Oktober stand meine nächste Aufgabe an. Das viele Herbstlaub, das auf den gesamten Friedhof fällt, habe ich aufgelesen und auf die Seite über den Friedhof hinaus geschafft. Das Gefallenendenkmal und die Allee hinunter zum Friedhof wurden auch gesäubert. Vor das Gefallenendenkmal und das große Kreuz auf dem Friedhof stellte ich Allerheiligenschalen. Auch manche Gräber bezog ich in meine Arbeit ein. Das Heimatbüchlein, das dort ausliegt, enthält nur lobende Worte für den Zustand des Fried-








Am 12. November feierte die gebürtige Eschowitzerin Anna Luft ihren 103. Geburtstag mit ihrem Enkel Joachim im oberbayerischen Trostberg.
Anna Luft kam als drittes
Kind der Eheleute Lamm zur Welt. In Eschowitz wuchs sie mit fünf Brüdern auf und besuchte die Volksschule. Mit 14 Jahren schloß sie die Schule ab und wurde auf den Gutshof geschickt, auf dem schon ihr Vater gearbeitet hatte. „Gerne hätte ich Blumenbinden gelernt, aber die Berufsschule war weit weg und unser Dorf klein. Ich habe alles gemacht, von

2019 hielt ich noch eine Allerseelenandacht ab. Trotz Ankündigung in der Tageszeitung waren nur wenige Leute gekommen. So beschloß ich jetzt nach der Pandemie, die auch Schuld hat am Ausbleiben der Lands-


leute, heuer keine Allerseelenandacht mehr zu veranstalten. Nur der traurige Anblick der Kirchenruine tut manchen Betrachtern weh. Hätte man ihr doch das Dach gelassen. Es hätte ersetzt werden sollen, aber es kam nicht mehr dazu. Oder wird es doch noch einmal dazu kommen?
Mit den wenigen Neuhäuslern, die ich noch kenne, bin ich
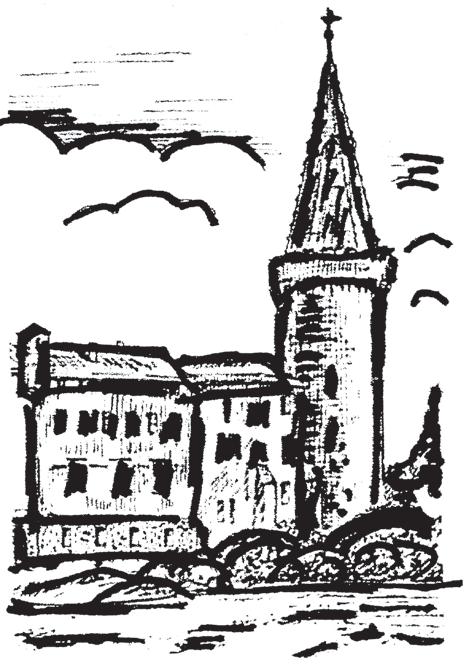
in Kontakt, schreibe ihnen Geburtstagskarten, lege ihnen oft eine Kastanie oder getrocknete Blätter von Neuhäusl dazu. Da freuen Sie sich wirklich. Denn sofort nach Erhalt bekomme ich einen Telefonanruf mit vielen Dankesworten. Und sie freuen sich, daß es noch einen Ortsbetreuer für ihr Neuhäusl gibt, der sie auch hin und wieder mit Bildern über den Zustand des Ortes informiert.

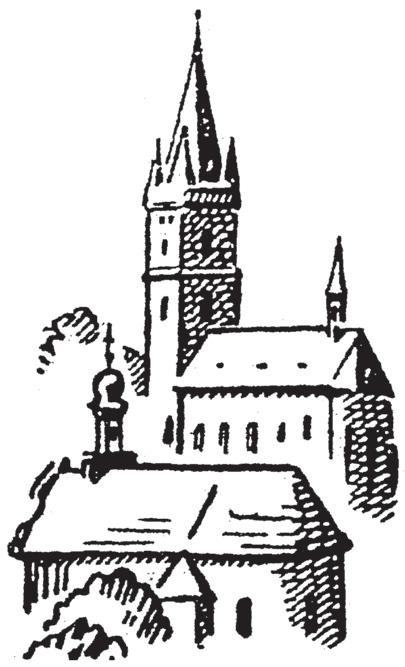
So bin ich das ganze Jahr über gut mit Arbeit und Gedanken um den Heimatort auch meiner Mutter beschäftigt. Nur in den Wintermonaten schläft auch Neuhäusl, und es wird von den dort ansässigen Menschen mit Licht im Ort versorgt.
Nun wünsche ich den Lesern eine zufriedene Adventszeit. Den Neuhäuslern, die noch heuer Geburtstag feiern können, gratuliere ich. Und für Weihnachten und das neue Jahr bitte ich von Herzen für uns alle um Gottes Segen.
Franz Hals schildert die Reize und Geheimnisse der Adventszeit in der Heimat.
Zur Adventszeit gehörte, daß wir Kinder schlaftrunken in den kalten Morgenstunden mit dem Schulränzlein am Buckel zur Roratemesse trippelten. Rötlich flackerten die Kerzenlichter im Halbdunkel der Kirche. Schemenhaft saßen die Gläubigen in den Bänken vor ihren aufgestellten Wachsstöcken und beteten. Und feierlich klang das „Tauet Himmel den Gerechten“, lateinisch „Rorate caeli desuper“. Durchfroren, aber glücklich liefen wir in unseren Holzpantoffeln zur Schule.
Die Tage wurden nun immer kürzer. In vielen Walddörfern brannte schon um vier Uhr nachmittags die kleine Petroleumlampe und in noch früherer Zeit der Kienspan. Nun rückten die Menschen zusammen, der warme Kachelofen gab Geborgenheit. Trautheit und Friede lagen über den ländlichen Heimstätten. Die Wälder standen im Rauhreif, es knackte und knisterte geheimnisvoll, die zugefrorenen Bäche murmelten, und krächzend flogen Krähenschwärme ihrer Schlafstelle zu.
Die Zeit der Hutschastuben begann. In bestimmten oder immer anderen Häusern kamen junge und alte Leute zusammen. Das war eine besinnliche, aber auch lebhafte Zeit. Wenn auf den Dächern die Schindelnägel vor Frost krachten, war es urgemütlich in den warmen Stuben. Man spielte Karten, sang alte Volkslieder, und die Frauen und Mädchen strickten oder stickten für die Aussteuer.
Als noch Flachs angebaut wurde, wurde fleißig gesponnen. Die Spinnräder schnurrten, und ununterbrochen drehte sich die Spindel der Spinnerinnen mit dem Rocken. Der Rokken war ein schön gedrechselter Stab von nicht ganz zwei Metern Höhe, hatte unten einen kleinen Dreifuß zum Stehen, oben steckte das Überrick, ein länglich run-
der Ballen Flachs. Von ihm zog die Spinnerin den Faden mit zwei Fingern, welcher sich auf der drehenden Spindel aufrollte. Am unteren Ende der Spindel befand sich der Anschpa, eine Kugel aus Glas oder Horn.
Die Spinnstube war der Ort, wo Geschichten erzählt und so mancher Aberglaube weitergegeben wurde. Sie war der Ort der Gruselgeschichten und Sagen. Diese stammen aus einer Zeit, in der das urwüchsige Volk, die niederen Schichten, ganz für sich lebte. Noch brachte keine Zeitung die täglichen Neuigkeiten ins Haus. Bücher waren rar, meistens gab es nur den Hauskalender und die Heiligenlegenden.
In diesen alten Zeiten wurden die Schulen nur unregelmäßig besucht. Was von der weiten Welt ins Dorf drang, brachte meist das Wandervolk, und das war herzlich wenig. Die Menschen hatten aber dennoch das Bedürfnis nach geistiger Unterhaltung, und so war die Spinnstube anfänglich der Ort, wo bei Dämmerlicht und noch früher beim Kienspan die Dorfbewohner zusammenkamen. Hier wurde erzählt und wurden die Erfahrungen des Lebens ausgetauscht.
Später trat fast nur die Jugend in den Vordergrund, und die Spinnstuben wurden Hutschastuben, wo sie sich im langen Advent und in den Wintermonaten mit Spiel und Scherz die Zeit vertrieb und wo so mancher alte Volksbrauch lebendig blieb.
In der AndresiNacht am 30. November wurde Blei gegossen, um die Zukunft zu deuten, indem man geschmolzenes Blei ins Wasser schüttete und die grotesken Formen zu deuten versuchte. Die Andresi-Nacht war eine unruhige Nacht, es wurde so mancher Ulk, aber auch Unfug, ausgeführt; was nicht niet- und nagelfest war, wurde abgehoben und versteckt, keine Garten- und keine Aborttür war sicher; die Alten schimpften, die Jugend hatte ihren Spaß und freute sich.
Fortsetzung folgt
der Landwirtschaft bis zur Hauswirtschaft“, erinnert sie sich an die schwere Arbeit auf den Bauernhöfen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben die Tschechen auch die Familie Lamm. Anna, ihre Mutter und zwei Brüder strandeten im Oktober 1946 zunächst im oberbayerischen Emertsham, und Anna arbeitete wieder auf einem Bauernhof. „Mit der
Sense mähen, das habe ich richtig gut gekonnt“, sagt sie.
Bei einer Veranstaltung der Sudetendeutschen lernte sie den zwölf Jahre älteren aus Marienbad stammenden Anton Luft kennen und lieben. 1955 heirateten sie, Sohn Josef kam zur Welt. Doch den Eheleuten waren nur sechs gemeinsame Jahre vergönnt. 1961 erlag Anton Luft einem Betriebsunfall.
Annas Mutter, die Anna zu sich genommen hatte, paßte auf das Kind auf, und sie konnte ar-
beiten gehen. Der Bub wuchs heran, heiratete, und das Paar bekam einen Sohn, der Joachim getauft wurde. „Das war ein bißchen wie ein zweites Kind, für das ich nun Zeit hatte“, sagt Anna Luft. Der Tod ihres 72jährigen Sohnes Sepperl 2010 traf sie hart. 2017 beschloß sie nach einigen gesundheitlichen Problemen, in das Trostberger Seniorenzentrum Pur Vital zu ziehen. Zuvor war sie viele Jahre ein treues Mitglied des Eghalanda Gmoi z‘ Trostberg gewesen.
Heimatkreisbetreuer WolfDieter Hamperl gratuliert Anna Luft von Herzen. Er wünscht ihr Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Heiterkeit und Gottes überreichen Segen. Nadira Hurnaus
Emma Weber, Ortsbetreuerin von Neuhäusl, berichtet über die diesjährigen Heimataktivitäten und zieht Bilanz.
Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 16
der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, eMail post@nadirahurnaus.de
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38
7602 0070 0002 0824
54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag
❯
für den Kreis Ta<au
Neuhäusl
❯ Eschowitz Anna
❯
Luft 103
Hutschastubn Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
Blick auf Gräber und Kreuze in dem gepflegten Neuhäusler Friedhof.
Spinnstube 1863
Emma Weber am Allerheiligentag neben dem Großen Friedhofskreuz, das Gefallenendenkmal und das Kreuz mit der Inschrift: „Zum Gedenken aller Verstorbener, die in der neuen Heimat ruhen.“
Blick vom Friedhof hinauf zur dachlosen Kirche mit dem Gefallenendenkmal vor der Sakristei. Bilder (5): Emma Weber










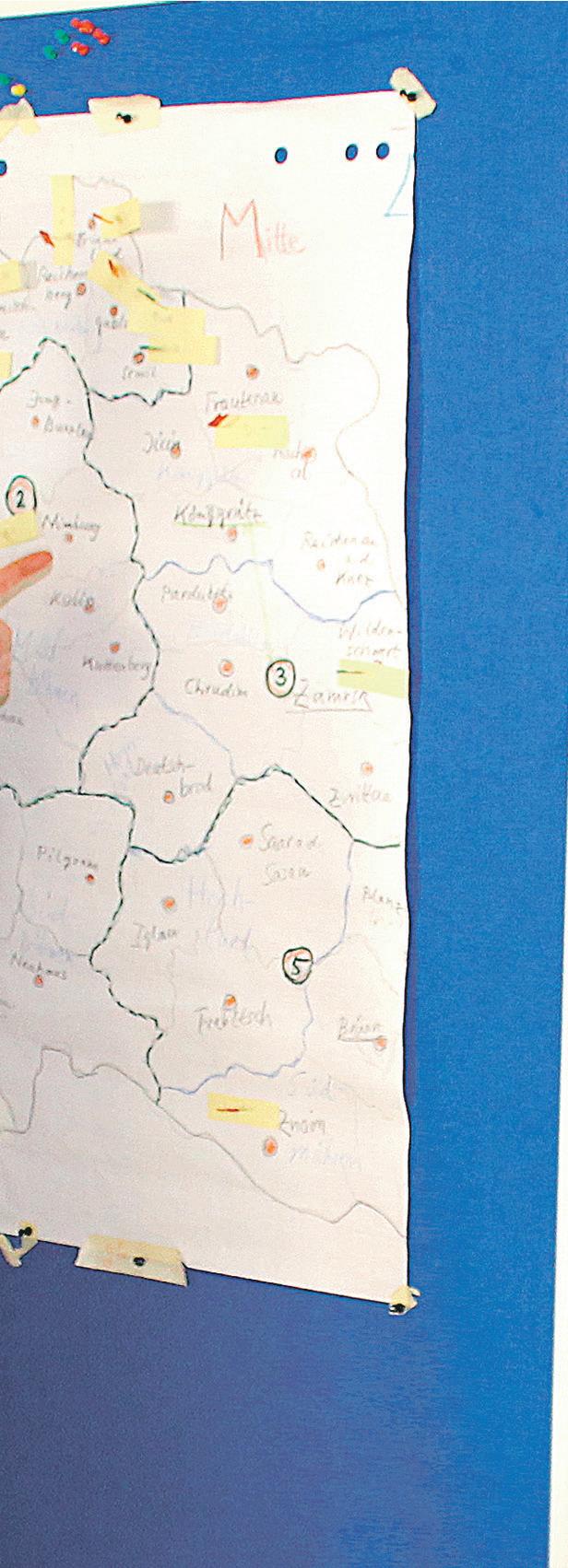



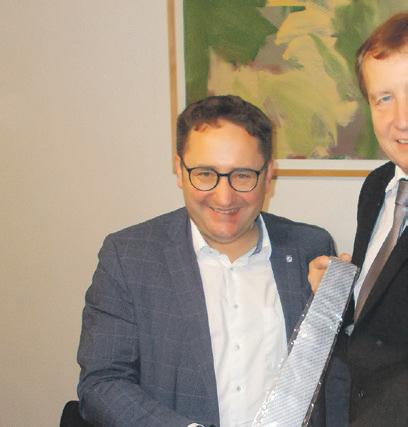







































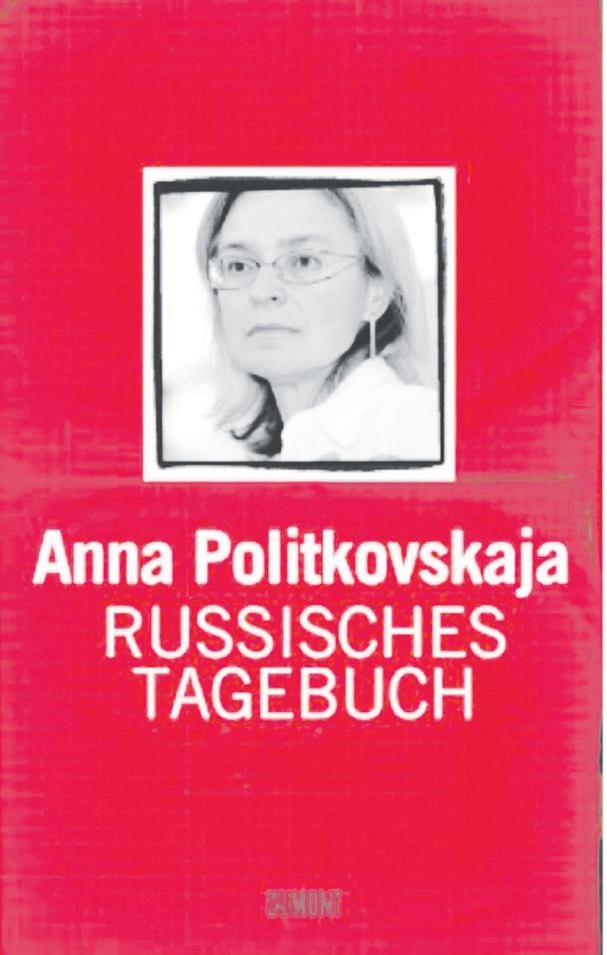

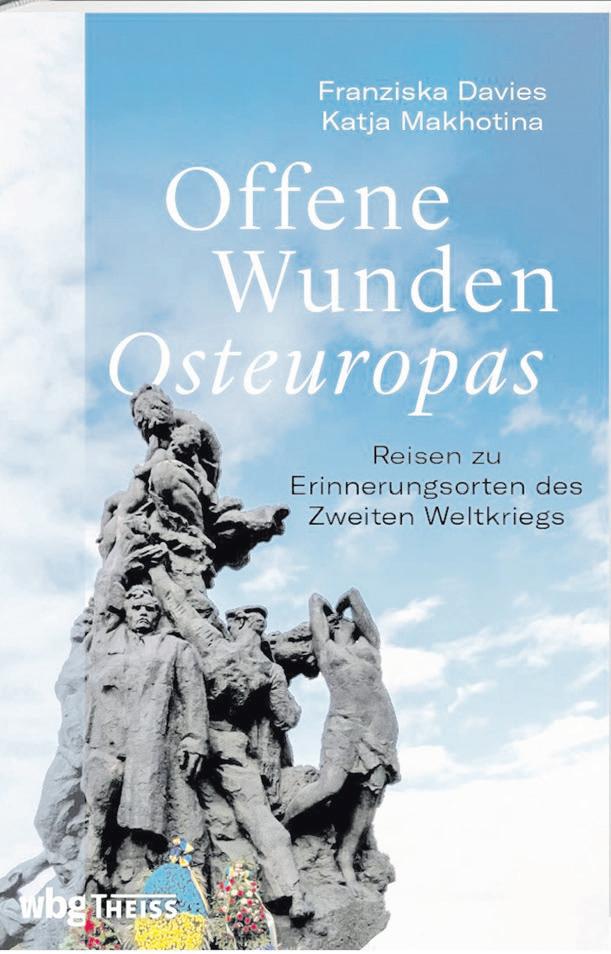
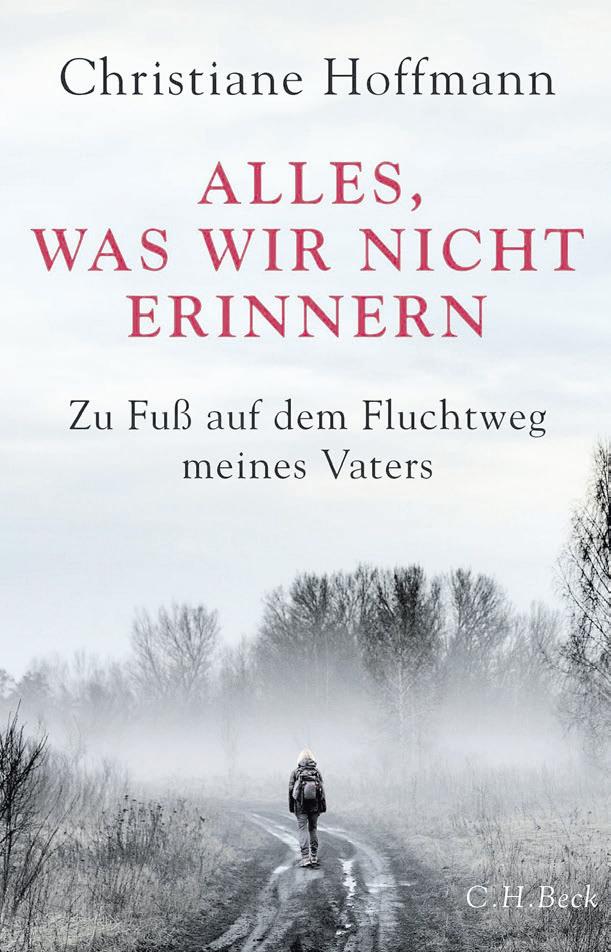
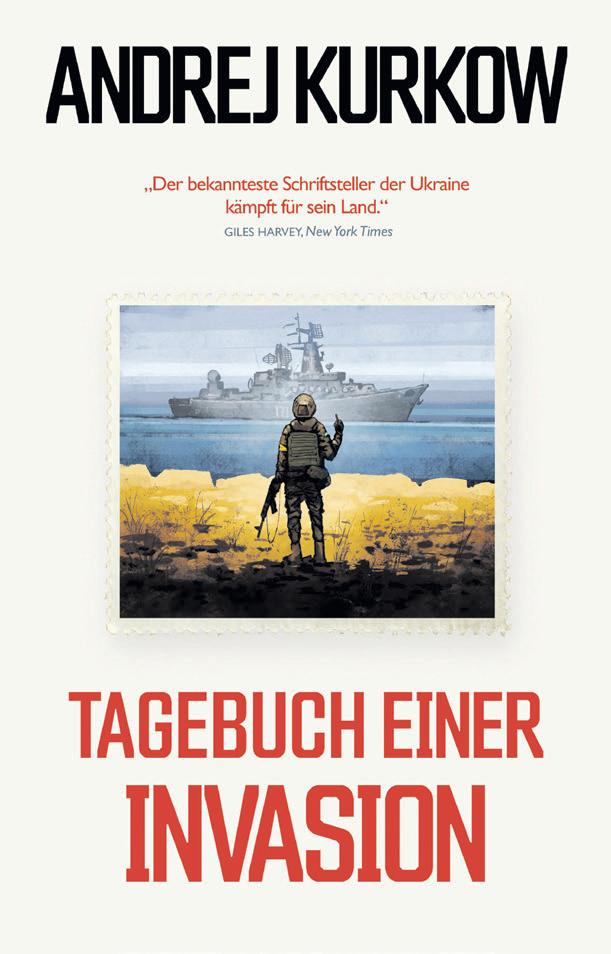
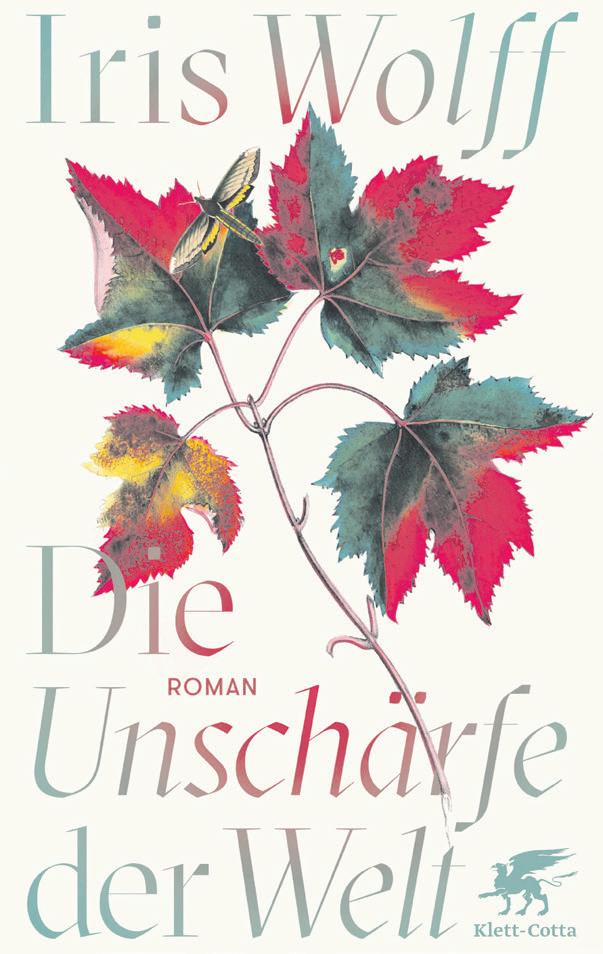
 Susanne Habel
Susanne Habel




 Birgit Unfug
Birgit Unfug