Sudetendeutsche Zeitung



Die erste Weihnachtskrippe nördlich der Alpen wurde 1562 von den Jesuiten in Prag aufge stellt. In der Folgezeit verbreite ten sich Kirchenkrippen rasch in ganz Böhmen.
Im Geiste der Aufklärung wur den die Krippen 1782 bis 1804 aus den Kirchen verbannt. Die Entstehung der häuslichen Fa milienkrippe wurde durch dieses Verbot indirekt gefördert.
Insbesondere in Nordböhmen entwickelte sich dank der kunst handwerklichen Tradition eine reiche und vielfältige Krippener zeugung. Die Spannweite reich te von der serienmäßigen Mannl malerei in Heimarbeit bis zu Aus stellungsstücken akademischer Maler. Im Biedermeier war das Krippenbesuchen fester Brauch in Stadt und Land. Auf Christ kindlmärkten wurden Krippenfi
guren gehandelt und getauscht. Gaststätten und Ausflugsziele, wie das Krippendorf Christophs grund, unterhielten Schaukrip pen als Touristenattraktionen. Liebhaber wie die Reichenberger Krippeltitsche pflegten die Über lieferung und prägten lokale Ei genarten aus.

An diese reiche Tradition knüpft das Isergebirgs-Museum Neugablonz an. Im Schaufen ster des Museums hin zum Bür gerplatz lädt bis Mariä Lichtmeß eine Krippe zum Innehalten ein. Die dargestellte Szene, die An betung der Könige, entstand im 20. Jahrhundert bei Belenes Pi ug in Spanien. Es handelt sich um kaschierte Figuren eingebe tet in einer orientalischen Land schaft. Die Krippe stammt aus dem Nachlaß von Erich Czirnich (geboren 1920 in Kukan – ge storben 2011 in Neugablonz).
Die Delegierten der Landesver sammlung der deutschen Verei ne in der Tschechischen Repu blik haben Martin Dzingel er neut zum Präsidenten gewählt.
Auf Dzingel entfielen 29 Stim men, Gegenkandidatin Petra Laurin erhielt 11 Stimmen. Ins Präsidium gewählt wur den neben Laurin und Dzingel Richard Neugebauer, Štěpánka Šichová, Erika Vosáhlová, Dr. Milan Neužil und Maximilian Schmidt.


Die Debat te um seine kommunisti sche Vergan genheit zeigt offenbar Wir kung: Präsi dentschafts kandidat Ge neral Petr Pavel, der lan ge in den Um fragen geführt hatte, verliert an Zustimmung und ist jetzt von Ex-Premierminister Andrej Babiš überholt worden.
Um als Präsidentschaftskan didat anzutreten, mußten die Bewerber die Unterstützung von mindestens 50 000 Bürgern, 20 Abgeordneten oder von zehn Senatoren nachweisen. Am ver

gangenen Freitag hatte dann das tschechische Innenministerium bekanntgegeben, daß von den 21 Bewerbern nur neun diese Vor aussetzungen erfüllen.
Laut der aktuellsten Mei nungsumfrage liegt wieder ExPremierminister Andrej Babiš mit 27,0 Prozent in Führung, dem aber dennoch nur geringe Chan

4,0 Prozent: Se nator Marek Hilšer (Stan).
cen zugerechnet werden, die ent scheidende Stichwahl zu gewin nen. Der Einzug in den zweiten Wahlgang dürfte sich zwischen den parteilosen Kandidaten, ExNato-General Petr Pavel (26,5 Prozent) und der ehemaligen Hochschulrektorin Danuše Ne rudová (23,5 Prozent), entschei den. Pavel hatte lange in Führung

Mährens Metropole Brünn ist nicht nur die zweitgrößte Stadt der Tschechischen Republik, sondern gewinnt immer mehr Einfluß in Politik und Wissen schaft. Als letztes Jahr Petr Fiala an die Spitze der tschechischen Regierung trat und etliche Mäh rer in Ministerämter berief, ti telte die Prager Presse gar, nur leicht ironisch: „Machtübernah me aus dem Osten“.
Abgesehen davon zeichnet sich die mährische Haupt stadt seit Jahren durch eine be sondere Aufgeschlossenheit gegenüber den Sudetendeut schen aus, was sich unter ande rem im jährlichen Versöhnungs marsch sowie zahlreichen weite ren Aktivitäten des von jüngeren
Tschechen getragenen „Meeting Brno“ niederschlägt.


Vor diesem Hintergrund be suchte Volksgruppensprecher Bernd Posselt wieder einmal die im Süden Mährens gelegene Kapitale. Nach jahrzehntelan ger Zusammenarbeit und Be kanntschaft mit deren nun eme ritiertem Bischof Vojtěch Cikrle galt es, dessen Nachfolger Pavel Konzbul kennenzulernen, der zu vor Religionslehrer am Bischöfli chen Gymnasium gewesen ist.

Dem gegenseitigen Kennen lernen im Bischöflichen Palais neben dem Brünner Petersdom folgte ein ausführlicher Gedan kenaustausch Posselts mit den Initiatoren von Meeting Brno, zu denen ab 1. Jänner auch der bisherige Leiter des Tschechi
schen Zentrums in Wien, Mojmír Jeřábek stoßen wird.
Jeřábek gehört zum Freun deskreis von Premierminister Petr Fiala, und Posselt kennt bei de aus der Zeit des Widerstandes gegen das kommunistische Re gime. Die Runde befaßte sich mit Zukunftsperspektiven der jährli chen Begegnungs- und Verstän digungsveranstaltung, an der mittlerweile regelmäßig mehre re Busse der SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württem berg sowie weitere Landsleute teilnehmen. Von Interesse ist da bei nicht nur das Thema Vertrei bung, das die Brünner im Geden ken an den Todesmarsch mutig aufgreifen, sondern auch die Rol le von Volksgruppen und Min derheiten im Herzen Europas.
2025 dürfte diese Frage beson ders in den Mittelpunkt rückenam 120. Jahrestag des Ausgleichs zwischen Mährern deutscher und tschechischer Mutterspra che im Jahr 1905.
Höhepunkt von Posselts Brünn-Besuch war ein Vortrag im Begegnungszentrum, dem sich eine lebhafte und alle aktuellen Fragen berührende Debatte an schloß. Vorsitzende der Instituti on ist die Literaturwissenschaft lerin Eleonora Jeřábková, die diese Funktion mit viel Schwung ausübt. Sie ist Spezialistin für deutsche Literatur aus Mähren und den böhmischen Ländern insgesamt, anerkannte Expertin für die mährische Dichterin Ma rie von Ebner-Eschenbach und gemeinsam mit ihrem Mann mit
4,0 Prozent: Jo sef Středula (ČMKOS).

Nicht meßbar: Denisa Rohano vá (ČAP).

gelegen, aber die aktuelle Debat te um seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei vor der Samtenen Revolution und sei ne eher unglücklichen Entschul digungen haben den Höhenflug des Generals jäh gebremst.
Stark aufgeholt hat dagegen Nerudová, die vor Wochen noch bei 10 Prozent lag. Die weiteren



Nicht meßbar: Jaroslav Bašta (SPD).

Nicht meßbar: Prof. Dr. Tomáš Zima.
der Aufarbeitung des schriftstel lerischen Erbes des Autors und Diplomaten Jiří Gruša, eines en gen Weggefährten von Václav Havel, betraut.
Da unter Posselts Gesprächs partnern beim Meeting Brno auch der bekannte Kommunal politiker Matěj Hollan war, at
Der leidenschaftliche Bahnfahrer und Leiter des Prager Sudetendeutschen Büros, Peter Barton, hat bei seinen Reisen auf den Schienen durch Tschechien und Deutschland bereits vieles erlebt, und seine Erfahrungen waren keineswegs nur angenehm. Trotzdem will er nicht aufgeben und ho t auf bessere, oder genauer gesagt in Sachen Pünktlichkeit, auf zuverlässigere Zeiten.

Als er neulich am Bahnhof Marktredwitz umsteigen mußte, sah er zu seiner großen Freude die Bezeichnung der alten deutschen Reichsstadt Eger. Das erlebt man nämlich auch auf deutscher Seite immer seltener. Ein
gelber Zug der Oberpfalzbahn benutzt neben dem tschechischen auch den deutschen Namen. Das ist wirklich sehr erfreulich, denn an einigen Schaltern der Deutschen Bahn wollte man ihm eine Fahrkarte nach „Tscheb“ verkaufen, als ob es sich dabei um eine Stadt in Spanien handeln würde. Ho en wir also, daß Eger auch zukünftig nicht von den Zügen der Oberpfalzbahn verschwindet.
Der frühere tschechische Kulturminister Daniel Herman (KDU-ČSL) setzte sich übrigens schon vor Jahren dafür ein, daß die historischen Namen der einstigen sudetendeutschen Städte in Böhmen nicht aus dem Wortschatz der beiden Nationen verschwinden.
Unter dem Titel „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte Der Heiligenhof in Bad Kissingen ihr mehrtägiges Herbstseminar mit hohem wissenschaftlichen Anspruch veranstaltet, dessen Inhalte die Sudetendeutsche Zeitung im Rahmen einer Serie dokumentiert.
Im Teil drei befassen sich Referenten und Seminarteilnehmer mit Projekten ihrer Versöhnungs- und Verständigungsarbeit.

Jan Blažek, Autor und Dokumentarist, stellt Zeitzeugenprojekte als Orte des nationalen Gedächtnisses vor. Die tschechische Nichtregierungsorganisation (NGO) Post Bellum beschäftige sich mit menschlichen Geschichten. „Wir machen Oral History“, sagt Blažek, „wir nehmen das auf, was uns die Menschen erzählen.“ In der Hauptsache gehe es um Menschen, die Schlüsselereignisse des 20. Jahrhunderts erlebt haben. Die gemeinnützigen Zwecken dienende Einrichtung arbeite von der Regierung unabhängig und verfolge keine wirtschaftlichen Gewinnziele.
Post Bellum steht für Menschenrechte und Demokratie und widmet sich im Dienst des Gedächtnisses der Gesellschaft der Sammlung und Dokumentation von Zeitzeugenaussagen. Mittlerweile wurden über 8000 Zeitzeugeninterviews geführt, die im Archiv publiziert werden und der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen. Selbstverständlich seien die Zusammenarbeit mit Historikern und der ständige Austausch mit dem Institut zum Studium totalitärer Regime, so Blažek.
Post Bellum arbeitet auch mit Schulen zusammen. Die Kinder führen unter fachkundiger Leitung Gespräche mit der älteren Generation und erarbeiten daraus kleine Theaterstücke. Außerdem werden Bücher über die Geschichten im Zusammenhang mit den Zeitzeugenberichten publiziert. Viel Aufmerksamkeit erreicht man mit Comic-Büchern. Das neue, vierte Comic-Buch „Odsonuté děti“ handelt von den vertriebenen Kindern. Bisher nur auf Tschechisch erschienen, soll es aber Anfang 2023 auf Deutsch herauskommen.

Blažek: „Ich wurde selbst zu einer Comic-Figur in dem Buch. Das Buch ist ein Dialog zwischen Generationen. Ein Dialog über Grenzen hinweg. Der Entstehungsprozeß ist auch ein Dialog: Zwischen mir, der die Geschichten gesammelt hat, und dem Autor, der daraus einen Comic ge-
macht hat. Wir reisen mit dem Buch durch Tschechien, stellen es an Schulen vor. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man aus so einem Comic-Buch vorliest. Das kann man nicht vorlesen, es sei denn, man spielt Theater.“
So habe man von den aufgezeichneten Gesprächen einen Film erstellt, in dem die Zeitzeugen, die eigentlichen Autoren des Buches, sprechen. So wird das Buch mit den Zeichnungen in Verbindung mit den Zeitzeugenberichten vorgestellt, was Blažek im Rahmen seines Vortrags eindrucksvoll demonstrierte. Der Film konzentriert sich auf die Vertreibung, wohingegen in dem Buch die Geschichten bis heute weitergeführt werden. „Für einen Tschechen meiner Generation ist es noch immer keine Selbstverständlichkeit, von Sudetendeutschen umgeben zu sein“, so Blažek abschließend.
Jan Polák aus Böhmisch Trübau (Česká Třebová) im Adlergebirge spricht in seinem Vortrag „Warum nur? Alte Klischees und Vorurteile über den Nachbarn in den Nachkriegsgenerationen in Deutschland und der Tschechischen Republik“ über die Entwicklungsgeschichte und alternative Sichtweisen von Deutschen und Tschechen. Polák hat die Facebookgruppe „Sudeten mit Wohlgefallen“ gegründet, in der er sich mit den unterschiedlichen Sichtweisen auseinandersetzt.
Daß man Facebook für die deutsch-tschechische Verständigungsarbeit gut nutzen kann, davon ist Referentin Monika Hanika überzeugt. Sie setzt sich seit Jahrzehnten nachhaltig für die
Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen, für den Abbau von Vorurteilen und für die Verbesserung der Zusammenarbeit ein. Ihr jüngstes Werk, das zweisprachige Märchenbuch „Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isergebirge“, hat sie mit der Journalistin Petra Laurin, Direktorin des deutsch-tschechischen Begegnungszentrums in Gablonz, herausgebracht. Die einfühlsamen Illustrationen stammen von Monika Hanika.
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in München ist eine unverzichtbare Informationsquelle zum politisch-kulturellen Erbe der Sudetendeutschen, erklärte Archivarin Ingrid Sauer in ihrem Referat. Am 9. November vor 15 Jahren sei das Sudetendeutsche Archiv vom Sudetendeutschen Haus in das Bayerische Hauptstaatsarchiv überführt worden. Seit dieser Zeit habe sich der Umfang der Archivalien verdoppelt, so Sauer.
Ins Archiv kämen alle Generationen, die jüngeren für ihre wissenschaftlichen Arbeiten, die älteren Leute eher auf Grund persönlicher Anliegen oder im Auftrag ihres Heimatkreises, erzählt sie.
Die Schwerpunkte lägen eindeutig auf der Orts- und Familienforschung. Es gebe viele Menschen aller Altersgruppen, die sich für die Geschichte ihres Wohnorts im Sudetenland interessieren und diesen beforschen wollen.
Chroniken und Bildersammlung sind einsehbar. Da täglich Neuzugänge im Archiv ankommen, lohne es sich immer, eine Anfrage zu stellen. Jüngster Neuzugang ist das Wandervo-
gelarchiv aus Waldkraiburg, das gerade verzeichnet wird. Anhand aktueller Beispiele aus diesem Neuzugang erfuhren die Seminarteilnehmer aus einer Anweisung vom April 1898, wie man sich mit wenig Wasser über einem Eimer waschen kann. Wichtig seien im Interesse aller Beteiligten die funktionierenden Netzwerke und ihr ständiger Ausbau. So sei sie mit dem Archiv auch in der deutsch-tschechischen Schulbuchkommission vertreten und könne dort mitarbeiten, erklärte die Referentin. Ingrid Sauer warb für einen Besuch des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, wo sich die „Schaltzentrale des Sudetendeutschen Archivs“ befinde.
Eine weitere Möglichkeit, das Vermächtnis der Vorfahren zu pflegen und vor dem Vergessen zu bewahren, präsentierte Heimatpflegerin Christina Meinusch mit ihrem Ausstellungsprojekt „Ein Bild von Heimat“, das sie in Kooperation mit der Museologie an der Universität Würzburg erarbeitet. Die Studierenden gehen unter anderem den Fragen nach, welche individuellen und kollektiven Heimatbilder es gibt, was die Künstler hinsichtlich Motivauswahl bewegt hat und wie dieses Bild von Heimat geprägt und transportiert wurde. Gemeinsam mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen erarbeiten eine Dozentin der Universität Würzburg und eine studentische Lehrassistentin über zwei Semester ein Konzept für eine Ausstellung, die zum Ende des Sommersemesters 2023 im Sudetendeutschen Haus Premiere haben wird.
Hildegard Schuster

Der Lebensstandard in Tschechien ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum europäischen Durchschnitt gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Kaufkraftparität fiel um zwei Prozentpunkte auf 91 Prozent des EU-Durchschnitts. Damit liegt die Tschechische Republik gleichauf mit Slowenien, leicht hinter Italien (95 Prozent) und Malta (96 Prozent) und über Spanien (84 Prozent) und Portugal (74 Prozent). Dies geht aus den Daten im Statistischen Jahrbuch 2022 hervor, das am Montag vom tschechischen Statistikamt veröffentlicht wurde.
Europas, erwarb den Autograph nach dem Ersten Weltkrieg. Nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Nazis floh die Familie in die USA. Das Manuskript wurde damals von deutschen Behörden beschlagnahmt und nach dem Zweiten Weltkrieg im Mährischen Landesmuseum aufbewahrt.
it dem Jahreswechsel soll der Mindestlohn von 16 200 Kronen (666 Euro) um 1 100 Kronen (45 Euro) beziehungsweise 6,8 Prozent angehoben werden, hat Arbeits- und Sozialminister Marian Jurečka (KDU-ČSL) vorgeschlagen. Der Gewerkschaftsdachverband ČMKOS hatte ein Plus von 3 800 Kronen (156 Euro) auf 20 000 Kronen (822 Euro) gefordert.
eit Dezember sind alle Stromerzeuger in der Tschechischen Republik verpflichtet, eine Übergewinnsteuer zu zahlen. Eine entsprechende Novellierung des Energiegesetzes hat Präsident Miloš Zeman am Montag unterzeichnet. Der Tschechische Staat verspricht sich damit jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 80 Milliarden Kronen (4 Milliarden Euro), die zur Deckung außerordentlicher Kosten im Zuge der Energiekrise verwendet werden sollen.
egen der Unterstützung Rußlands im Ukraine-Krieg ermittelt die tschechische Polizei gegen 49 Beschuldigte. Die Strafverfolgungsbehörden werden tätig, wenn jemand öffentlich den Angriff Rußlands auf die Ukraine gutheißt oder die höchsten Vertreter des Kremls lobt, so der Oberste Staatsanwalt Igor Stříž. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahren Haft.
Ein Manuskript Ludwig van Beethovens wird das Mährische Landesmuseum an die Familie Petschek zurückgeben. Es handelt sich um den Autograph zum vierten Satz des Streichquartetts B-Dur, Opus 130, der sich in den Sammlungen der Abteilung für Musikgeschichte befindet und noch bis 4. Dezember in der Kurz-Ausstellung „Abschied von Beethoven“ in der Kapelle des Damenstiftes in Brünn gezeigt wird. Die Großindustriellen- und Bankiersfamilie Petschek, einer der damals reichsten Familien
m 1. Januar soll auf der Prager Burg die weltberühmte Gemäldegalerie wiedereröffnet werden. Nachdem 2019 die Belüftungstechnik in der Galerie kaputtgegangen war, sind die Räumlichkeiten geschlossen und die Werke ausgelagert worden. Die Gemäldegalerie ist eine der bedeutendsten Kunstsammlungen in Tschechien und beinhaltet Werke unter anderem von Tizian, Rubens und Cranach sowie von weiteren Künstlern aus Renaissance und Barock.
is Ende März will der Antidrogenkoordinator der tschechischen Regierung, Jindřich Vobořil, den Entwurf eines Gesetzes vorlegen, das den regulierten Handel mit Cannabis ermöglicht. Vobořil hatte sich bereits in der Vergangenheit für die gesetzliche Verankerung einer Teil-Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. In einem ersten Entwurfspapier verwies Vobořil auch auf die potentiellen Steuereinnahmen durch einen kontrollierten Verkauf von Marihuana. Demnach sei zu erwarten, daß jährlich mehrere Milliarden Kronen zusätzlich in die Staatskasse gespült werden würden. Das entsprechende Gesetz könnte 2024 in Kraft treten.
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Seit 22. November ist Knut Abra ham Obmann der CDU/CSUFraktion im Ausschuß für Men schenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestages. Der ge bürtige Hamburger hat Vertrie benenwurzeln und beschäftigt sich seit Anbeginn seiner politi schen und diplomatischen Kar riere mit Europa sowie dem Ver hältnis von Deutschland zu Mit teleuropa. Im Fokus steht dabei auch das deutsch-tschechische Verhältnis. So ist der Bundes tagsabgeordnete Mitglied des Sudetendeutschen Rates und war bereits mehrfach zu Gast bei Sudetendeutschen Tagen.
Herr Abraham, wie kamen Sie dazu, sich mit dem Osten zu beschäftigen?
Knut Abraham: Ich stamme aus einer Vertriebenenfamilie. Mein Vater ist im einst östlichen Brandenburg, das ist die Grenz mark Posen/Westpreußen, ge boren. Die nächstgrößere Stadt ist Landsberg an der Warthe, et wa 50 Kilometer davon entfernt.
Haben Sie die Heimat Ihres Vaters schon einmal besucht?
Abraham: Ja, ich war erst in diesem Herbst mit meinen Kin dern da, um ihnen zu zeigen, wo der Großvater groß geworden ist. Mich hat wirklich gefreut, daß diese Familiengeschichte auch meine Kinder interessiert.
Sie wurden in Hamburg gebo ren. Wie haben Sie sich in Ihrer Kindheit gefühlt? Als Hamburger?
Abraham: Ich habe in der Schule immer gemerkt, daß mei ne Familie nicht aus der Ham burger Region ist. Und ich ha be meiner Oma gerne zugehört, als sie von zu Hause sprach. Und zudem komme ich aus Aumühle aus dem Sachsenwald, mit dem Ortsteil Friedrichsruh. Das heißt, die Figur Bismarck und alles, was damit zusammenhängt, war mir seit Kindesbeinen an sehr geläu fig. Der größte Teil der Familie väterlicherseits war in der DDR hängengeblieben. Also interes sierte mich die deutsche Teilung, wie auch die einstigen deutschen Ostgebiete. Und ich habe 1989 dann auch den ersten Besuch im Heimatort meines Vaters abge stattet, vor ihm. Das hat dazu bei getragen, daß mein Vater an sei ne Jugend anknüpfte und dann erst ab 1989 seine Klassentreffen wieder besuchte. Das ist das Per sönliche, warum mich der Osten interessierte.
Und politisch?
Abraham: Schon als Jugend licher habe ich mich mit Euro pa beschäftigt. Ich bin dann sehr schnell mit Bernd Posselt und Walburga von Habsburg und anderen zusammengekommen. Und die haben mir, wie auch spä ter Walburgas Vater, für den ich dann ja lange gearbeitet habe, die mitteleuropäische Welt er schlossen.
Sie interessieren sich seitdem für die Sudetendeutschen. Wa rum?
Abraham: Ich war mit Otto von Habsburg bei vielen Sude tendeutschen Tagen, und das ha be ich noch lebhaft vor Augen, was das für enorme Veranstaltun gen waren. Nun war gerade das Schicksal der Sudetendeutschen für mich sehr wegweisend, weil sich die Frage der Sudetendeut schen und der Vertreibung über irgendwelche Grenzfragen hin ausbewegte. Das Schicksal der Sudetendeutschen war nur eu ropäisch zu lösen. Für Otto von Habsburg und sein Umfeld war die Europäische Union eine mo derne Übersetzung der einsti gen Donaumonarchie. Das habe ich am Beispiel der Sudetendeut schen nicht nur gelernt, sondern auch erlebt und gespürt. Das war ein erheblicher Unterschied zur Atmosphäre, zum Beispiel bei den Ostpreußentreffen. Da ging es fast immer nur um Ostpreußen und um die Grenzen. Die Sude tendeutschen haben mir Mittel europa nahegebracht.
Ihr erstes Interesse galt aber Polen.
Abraham: Die Beschäfti
nen besonderen Blick auf Ron sperg, den Ort, wo der Gründer der Paneuropa-Idee aufgewach sen ist.
Wie sehen Sie den Unterschied zwischen dem Verhältnis zwi schen Polen und Deutschland, dem Sie ja zeitlebens auch fami liär nachgehen, und Tschechi en und Deutschland, das Sie mit mehr Abstand betrachten kön nen?
gung mit Polen begann mit dem Wunsch dorthin zu reisen. Und das ging damals, während des Kriegsrechts, nur als Fahrer von Medikamententransporten.
Und da habe ich mit Freunden von der Internationalen Gesell schaft für Menschenrechte und von der Paneuropa-Union über Jahre Medikamentenfahrten ge macht und neben den Medika menten auch Informationsmit tel transportiert. Ich war damals von der polnischen Sicht auf Eu ropa begeistert, heute ist das et was relativiert durch die PiS. Ich habe zum allerersten Male in Po len Leute getroffen, die wirk lich fest davon überzeugt waren, daß wir bald in Deutschland die Wiedervereinigung erleben wer den. Meine Freunde und ich, aufgewachsen in Hamburg und Schleswig-Holstein, waren sehr dafür. Wir wurden aber in den 1980er Jahren immer weniger. Das Thema war nicht mehr so re levant. Nur unter den Vertriebe nen gab es viele Menschen, die noch immer an die Einheit glaub ten, auch aus familiären Grün den, wie meine Großmutter, de ren Geschwister in Mecklenburg und in Vorpommern hängenge blieben waren.
Was war Ihr prägendstes Erleb nis in Polen?
Abraham: Ich habe 1987 in Warschau die Stanisław-KostkaKirche besucht, wo der Prie ster Jerzy Popiełuszko, der die Solidarność unterstützte und der 1984 ermordet wurde, wirkte und auch beerdigt wurde. Dort wa ren auf der Innenseite der Kirch mauer Solidarność-Logos und zu meinem allergrößten Erstau nen auch Logos der SolidarnośćLatvia, Estonia und Lietuva an gebracht. Das hat mich fasziniert, mit was für einer Chuzpe dort ge handelt wurde. Das war 1987 die äußerste Provokation. Und ne ben dem Baltikum interessier te mich natürlich Deutschland in diesem Zusammenhang. Die Po len, nicht daß sie alle so richtig begeistert waren, aber für sie war klar, daß die deutsche Teilung etwas komplett Künstliches ist, was nicht überleben wird. Daß das 1989 kommen würde, hat mir natürlich damals auch kein Pole vorausgesagt. Polen war für mich immer ein wichtiger Bezugs punkt. Und umso glücklicher war ich, daß ich dann fast vier Jahre bis zu meiner Wahl in den Bun destag an der Deutschen Vertre tung in Polen tätig sein konnte. Das führe ich jetzt auf neue Wei se fort. Ich bin in der DeutschPolnischen Parlamentariergrup pe und bin auch Berichterstatter
� Geboren am 4. Juni 1966 in Hamburg-Bergedorf, lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Schönewalde im Orts teil Dubro (Brandenburg).
� 1987 bis 1996 Büroleiter des Europaabgeordneten Otto von Habsburg am Deutschen Bundestag in Bonn und Ber lin, seit 1994 dessen parlamentarischer Assistent am Europä ischen Parlament in Brüssel.


� Seit 1998 Angehöriger des deutschen Auswärtigen Dien stes, Einsätze in Helsinki, Sofia, Washington und zuletzt zwi schen 2018 und 2021 als Gesandter in Warschau. Dazwischen im Bundeskanzleramt zuletzt zwischen 2015 und 2018 als Leiter des Referats für die bilateralen Beziehungen zu den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas sowie zu Zentralasien und zum Südkaukasus.
� Mitglied der Jungen Union, seit 1985 der CDU, 1990 bis 1998 Bundesvorsitzender der Jugendorganisation der Pan europa-Union, bis heute im Präsidium der Paneuropa-Union Deutschland.
� Seit 2021 Mitglied des Bundestages, ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuß, Mitglied des Sudetendeutschen Rates und seit 22. November 2022 Obmann seiner Fraktion im Ausschuß für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.
� Abraham ist Vorstandsmitglied der privaten Stiftung „Ver bundenheit mit den Deutschen im Ausland“, die der Pflege der deutschen Sprache und Kultur im Ausland dient.
für Polen für meine Fraktion, ja für ganz Mitteleuropa. Und des wegen auch der enge Kontakt zu Botschafter Kafka und zur Tsche chischen Republik.
Wie beurteilen Sie das deutschtschechische Verhältnis?
Abraham: Es wird in Berlin als viel zu selbstverständlich hinge nommen, daß wir diese exzellen ten Beziehungen haben. Sie sind wirklich sehr gut über die ver schiedensten Regierungen hin weg. Jetzt gerade besonders gut. Aber wir müssen da mehr inve stieren in das deutsch-tschechi sche und überhaupt das deutschmitteleuropäische Verhältnis. Wir müssen uns viel mehr sehen, wir müssen uns vielmehr spre chen und wir müssen, wie auch gegenüber Polen, Deutschland mehr erklären. Unsere Haltung erklären.
Was macht Tschechien beson ders im Vergleich zu Deutsch lands anderen Nachbarn?
Abraham: Zu Tschechien ha ben wir die geografisch längste Grenze. Das ist immer eine gro ße Überraschung bei Wissens spielen in Deutschland. Der zivil gesellschaftliche Austausch mit den Tschechen ist sehr lebendig. Er ist auf eine bestimmte Wei se unkomplizierter als mit Polen, aber es ist alles erfreulich, was sich da tut. Aber auf politischer Ebene müssen wir mehr tun. Und da bedarf es engagierter Abge ordneter in allen politischen La gern.
Wie den SPD-Bundestagsabge
ordneten Jörg Nürnberger, der ja fließend Tschechisch spricht?
Abraham: Über den Kolle gen Nürnberger bin ich natür lich auch sehr froh, weil er ver steht, wie in Tschechien gedacht wird, wie Deutschland gesehen wird, wie auch Bayern gesehen wird, was ja immer sehr speziell ist und nicht nur wegen der SL, aber auch.
Sie engagieren sich auch im Sudetendeutschen Rat. Warum?
Abraham: Ich bin seit einem Jahr in diesem überparteilichen Gremium dabei. Und ich fin de es sehr wichtig, daß das An liegen der SL, aber auch das deutsch-tschechische Verhältnis nicht parteipolitisch angegangen wird. Es ist ein Riesenvorteil für die Volksgruppe, daß sich da bei spielsweise auch Sozialdemokra ten engagieren. Ansonsten bin ich heimatpolitisch nicht weiter engagiert, außer im Heimatkreis meines Vaters, Schwerin an der Warthe, und in der Landsmann schaft Ost-Brandenburg. Da geht es übrigens jetzt wirklich um das Bewahren des Erbes. Heimat kreistreffen nehmen ja merklich an Intensität ab. Ich lese übrigens die Sudetendeutsche Zeitung im mer ganz, auch die einzelnen Seiten der Heimatzeitungen, die da im Titel genannt werden und unter neuem Dach noch überle ben. Da wird ja von vielen Akti vitäten berichtet, wo viele jun ge Leute, junge Tschechen und Tschechinnen engagiert sind. Und dann habe ich natürlich ei
Abraham: Der Unterschied ist enorm. Was die deutsch-pol nischen Beziehungen betrifft, sind wir in einer sehr schwieri gen Zeit mit vielen konfrontati ven Elementen. Und wenn ich an die Tagung des Sudetendeut schen Rates in Marienbad den ke – das hat mich enorm be eindruckt. Zum einen ist es ganz offensichtlich gelungen, die The men fortzuführen in gutem Gei ste jenseits der Erlebnisgenera tion. Und trotzdem authentisch zu sein. Ich war also beeindruckt auch über das große tschechi sche Interesse an dem Dialog. Ich erinnere mich an das Podium, an dem ich beteiligt war. Das war total beeindruckend, wie dort ei ne Reihe von tschechischen Poli tikern und auch Diplomaten sich zu Wort meldeten. Es war ausge sprochen aufgeschlossen und le bendig, aber auch ohne daß man so tut, als ob alles reibungslos laufen würde. Der Geist, den ich da erlebt habe, der läßt einen op timistisch sein. Ich bin wirklich erfüllt an dem Nachmittag von den Marienbader Gesprächen abgereist. Man fühlte sich bei der Tagung willkommen, aber auch in der Stadt Marienbad als Besucher.
Sie sind ja auch Berichterstat ter für die Ukraine in ihrer Frakti on, wie sehen Sie die Lage?
Abraham: Das Ergebnis die ses schrecklichen Krieges kann nur sein, daß die Ukraine die Oberhand behält und gewinnt. Denn jedes andere Szenario wä re schrecklich. Diese unglaub liche Brutalität, diese Unverfro renheit, ein im Grunde ja wehrlo ses, schwaches Nachbarland mit einem Eroberungskrieg zu über ziehen, darf sich nicht rentieren. So etwas darf sich in Europa nicht rentieren. Deshalb ist dies das zu erwünschende Ergebnis, das wir hoffentlich bald erreichen. Das zum Kurzfristigen. Und zum Mittel- und Langfristigen haben wir auch eine epochale Verän derung der Grundkoordinaten festzustellen, denn schon heu te hat dieser Krieg als Katalysa tor dafür gewirkt, daß den Men schen in Europa klargeworden ist, daß die Ukraine ein euro päischer Staat ist, der mittelfri stig Teil der EU-Familie werden wird. Das war noch vor zwei Jah ren anders. Ich sehe, wenn ich an die Generation meiner Kinder denke, wie selbstverständlich für die, die Ukraine, die ukrainische Identität und insbesondere in diesen Tagen der Demonstratio nen und der Solidarität und Soli darisierungen, etwa die ukraini sche Flagge ist. Es gibt kaum ei ne Flagge, die den Menschen in Deutschland so präsent ist mit ihren Farben blau und gelb. Es wird keine Rückkehr zu dem Sta tus quo ante geben, die Ukraine ist EU-Beitrittskandidat und wird diese Verhandlungen erfolgreich führen. Und ich sehe darin auch meine persönliche Aufgabe an, der Ukraine dabei behilflich zu sein, die erforderlichen Kriterien zu erfüllen.
Wie kann diese Unterstützung konkret aussehen?
Abraham: Ich habe zum Bei spiel aktuell einen Antrag erar beitet, den Hungertod mit vier Millionen Ukrainern, den Ho lodomor, als Völkermord anzu erkennen. Das ist mein Antrag, und wir sind die Opposition. Ich will nur nicht, daß dies ein Streit punkt im parlamentarischen, parteipolitischen Gefecht wird, das wäre der Opfer nicht würdig. Deshalb werde ich mich mit den Vertretern der Ampel-Koalition dazu ins Einvernehmen setzen. Ulrich Miksch
Die Sitzung des Stiftungsrates der Sudetendeutschen Stiftung hat erstmals Ulrike Scharf als Schirmherrschaftsministerin über die Sudetendeutschen persönlich geleitet.
In ihren einleitenden Worten betonte die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, wie wertvoll ihr Besuch beim Museumsfest im Juli war, bei dem sie sich auch von Dr. Ortried Kotzian, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, durch das Museum habe führen lassen. Ebenso wichtig seien ihre Erfahrungen bei ihrem Besuch in Prag gewesen sowie bei den Gesprächen des Sudetendeutschen Rates in Marienbad.
Im Mittelpunkt der 99. Stiftungsratssitzung standen neben den Berichten des Vorstandes die Verabschiedungen des Zweiten Nachtragshaushaltes für 2022 und des Stammhaushaltes für das Jahr 2023. Dabei wies der Verwaltungsleiter der Stiftung, Raoul Wirbals, vor allem auf die enorm gestiegenen Energiekosten für das Sudetendeutsche Haus hin und auf die noch dringend notwendigen Bau- und Bauunterhaltsmaßnahmen, wie die Errichtung des Museumscafés, den Einbau der Lüftungsanlage im Bibliotheksmagazin und
■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 3. Dezember, 10.00 bis 16.00 Uhr: 2. Ostdeutscher Adventsmarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stutt-
den Austausch des Personenaufzugs, der mit zahlreichen TÜVMängeln behaftet ist. Museumsdirektor Dr. Stefan Planker stellte die Höhepunkte der Museumsarbeit in den Sommermonaten besonders heraus. Ein Schwerpunkt war das Museumsfest im Juli, das in seiner Vielfalt und Mehrperspektivität für alle Altersgruppen vom Publikum gut angenommen und sowohl vom Stammpublikum des Sudetendeutschen Hauses als auch von neuen Besuchern außerordentlich positiv beurteilt wurde.
Der zweite große Höhepunkt war die „Lange Nacht der Münchner Museen“, in der mehr als 1000 Besucher ins Sudetendeutsche Haus und Museum kamen. Zu diesem Erfolg trug auch eine intensive Medien- und Pressearbeit bei, die beweist, daß das Sudetendeutsches Museum –auch was die Werbung angeht –auf dem richtigen Wege ist.

Schließlich dankte der Vorstandsvorsitzende Dr. Ortfried Kotzian allen Mitarbeitern der Sudetendeutschen Stiftung und des Sudetendeutschen Museums für ihr außerordentliches

Engagement. Den Stiftungsräten überreichte er den von den Architekten herausgegebenen Bildband über das Sudetendeutsche Museum und den Katalog zur Sonderausstellung „Allerley Kunstwerk. Reliefintarsien aus Eger“.

In seinem abschließenden Bericht zur politischen Situation referierte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, über die Situation nach den Senats- und Kommunalwahlen und vor den Präsidentschaftswahlen in der Tschechischen Republik. ND
Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
gart.
■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 3. Dezember,
15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –
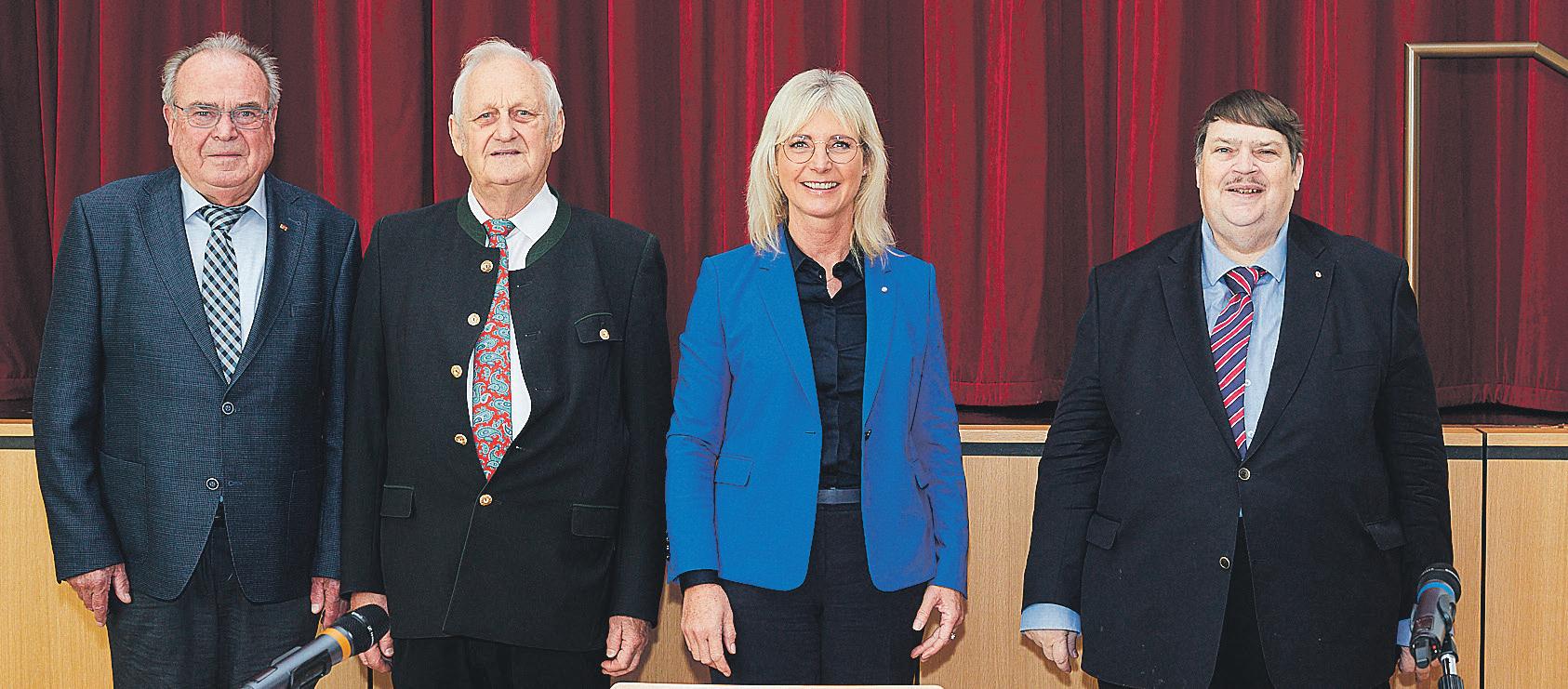
■ Sonntag, 4. Dezember, 16.00 Uhr, BdV-Kreisverband Stuttgart: 50. Stuttgarter Adventssingen. Liederhalle, Mozartsaal, Berliner Platz, Stuttgart. Eintrittskarten ab 14 Euro bei allen Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder unter Telefon (01 80) 6 70 07 33.
■ Dienstag, 6. Dezember, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Memel/Klaipėda“. Vortrag von Sonya Winterberg im Rahmen der Reihe „Hafenstädte im Baltikum“. Urania „Wilhelm Foerster“, Gutenbergstraße 71, Potsdam. Anmeldung und Vorverkauf unter Telefon (03 31) 29 17 41 oder per eMail an verein@urania-potsdam.de



■ Donnerstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Böhmerwald von fern und nah“. Lesung und Gespräch mit den Oberplaner Stifter-Stipendianten Jan Němec und Sophia Klink. Südböhmische Wissenschaftliche Bibliothek (Jihočeská vědecká knihovna), Lidická 1, Budweis.
■ Donnerstag, 15. Dezember, 19.00 Uhr: „Grenzenlos. Aus dem Konservatorium in die Welt“. Konzert für Klavier zu vier Händen. Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Hauses des Deutschen Ostens und des Tschechischen Zentrums München. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Eintritt frei.

■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Freitag, 27. Januar 2023, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34–36, Wien. Voranmeldung per eMail an sekretariat@vloe.at
■ Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Dezember: Wochenendseminar „Digitale Heimat“. Veranstaltung für Medieninteressierte.
Ursprünglich zum zwanzigsten Jubiläum des Webauftritts Siebenbuerger.de vor zwei Jahren angedacht, mußte das Seminar pandemiebedingt verschoben werden. Die Vorträge der vier Webmaster befassen sich mit dem Webauftritt von Siebenbuerger.de, sind aber als Best-Practice-Beispiel auch für Medienschaffende anderer Landsmannschaften eine wertvolle Anregung. In dem Seminar wird ein Bogen von den Anfängen der Webseite über den aktuellen Stand bis zu zukünftigen Entwicklungen gespannt. Die Teilnehmer erhalten somit die Gelegenheit, den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen zu werfen und interessante technische Details aus dem „Maschinenraum“ zu erfahren. Die Funktion der Webseite als „digitale Heimat“ wird besonders am Ortschaften-Bereich deutlich. Daher wird der Präsentation siebenbürgisch-sächsischer Heimatorte im Internet ein eigener Vortrag gewidmet. Welche Bedeutung und Funktion die Webseite für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes hat, wird vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni referiert. Manuel Krafft, IT-Referent der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), berichtet darüber, wie Jugendliche mit siebenbürgsch-sächsischen Inhalten erreicht werden können. Weitere Vorträge weiten den Blick über Siebenbuerger.de hinaus. Hermann Depner gibt Tipps, wie Vereine sich mit Kurzvideos präsentieren können, und berichtet von den Livestreams über mehrere Kanäle. Dominik Jakobi stellt die WebApp von Radio Siebenbürgen vor. Wie digitale Pinnwände als Mitmachbücher für den Dialog der Generationen genutzt werden können, wird von Helga Ritter erklärt.
Anmeldungen unter info@heiligenhof.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
■ Donnerstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr, Filmsoirée mit Regisseur Alexander Landsberger: „Verschleppt – Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiter“. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Ihr Leiden begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Mindestens 450 000 deutsche Zivilisten wurden ab 1945 zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt. Weitere, mutmaßlich Hunderttausende, waren in Arbeitslagern in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Rumänien, Polen und anderen Staaten inhaftiert. Genaue Zahlen liegen bis heute nicht vor. Rechtlos und jahrelang getrennt von ihren Familien, wurden sie nicht selten das Ziel von Rache. Die Dokumentation von Alexander Landsberger klärt über die historischen Hintergründe auf und beleuchtet exemplarisch das Leben zweier Zeitzeugen, deren Schicksal lange wenig Gehör fand.
Der Regisseur Alexander Landsberger (geboren 1981)
studierte Pädagogik, Psychologie und Philosophie in München. Anschließend inszenierte er verschiedene Filme für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, darunter die mehrteiligen Spielfilmdokumentationen „Charles Darwin“ (2009), „Die Geschichte der Homöopathie“ (2010), „Werner Heisenberg“ (2011), „Essen verändert die Welt“ (2012), „Der erste Bulle“ (2015) oder „Wilhelm von Humboldt“ (2017). 2014 schloß er ein Studium an der Filmakademie BadenWürttemberg ab. Sein Diplomfilm „John Mulholland – Zauberer im Kalten Krieg“ entstand als Koproduktion mit dem SWR und wurde mit dem Caligari Preis gefördert.
Neben Dokumentationen drehte Landsberger Werbeund Image-Filme. Seit 2012 inszenierte er diverse preisgekrönte Spots für die Unesco, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, Porsche Leipzig oder die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Alexander Landsberger ist Mitglied im Bundesverband Regie.
„Er hat Weltgeschichte geschrieben. Das wird langsam klar.“ Prof. Dr. Stefan Samerski ist die Begeisterung anzumerken, als er im Sudetendeutschen Haus seinen Vortrag über Alois Muench eröffnet, den Schlußpunkt der 2022er Vortragsreihe „Böhmen macht Weltgeschichte. Unbekanntes und Unbekannte“.
Aloysius Muenchs Vater war im Böhmerwald geboren, die Mutter in der Oberpfalz. In die USA ausgewandert, gründete das Paar in Milwaukee (Wisconsin) eine Familie, in die hinein 1889 Alois Muench als erstes von sieben Kindern geboren wurde. Er wuchs nicht nur in einer deutschen Familie auf, auch in seiner Pfarrei war Deutsch eine gängige Sprache.
In dieser Zeit wurde die katholische Kirche in den USA von den Einwanderern geprägt, von denen viele aus den deutschsprachigen Ländern kamen. Auch im Klerus bis hin zu den Bischöfen war Deutsch eine weit verbreitete Sprache. Muench entschied sich für das Priestertum und wurde 1916 geweiht. Schon früh erkannte er die soziale Frage als Auftrag für die Kirche. 1919 studierte er an der Universität Freiburg (Schweiz) und erwarb einen Doktor in Sozialwissenschaften, studierte auch jeweils kurz in Löwen, Cambridge, Oxford und an der Sorbonne in Paris. Während seines Europa-Aufenthalts begegnete er Nuntius Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII. Zurück in Milwaukee erhielt Muench einen Lehrauftrag in Sozialwissenschaften und wurde Rektor des Priesterseminars. 1935 wurde er schließlich zum Bischof von Fargo, einem kleinen Bistum im Norden der USA, ernannt. Gegen Kriegsende gab es seitens der Alliierten verschiedene Ansätze im Hinblick auf den Umgang mit Deutschland. So hing der radikale Morgenthau-Plan, der die Umwandlung eines zerschlagenen Deutschlands in einen Agrarstaat vorgesehen hatte, unheilschwanger in der Luft, als das Nachkriegsdeutschland damit beschäftigt war, das ganz normale Leben zu reorganisieren, Millionen Flüchtlinge aufzunehmen, zerstörte Städte wieder aufzubauen.
In dieser Zeit, in der das Ausmaß der deutschen Kriegsverbrechen immer mehr ans Licht kam und in den Nürnberger Prozessen vor den Augen der ganzen Welt verhandelt wurden, war die Stimmung gegenüber Deutschland mehr als schlecht – und die Zahl derer, die sich für einen besonnenen Umgang mit und gar für eine Unterstützung der notleidenden Bevölkerung einsetzten, war überschaubar. Einer von ihnen war der frühere Nuntius von Deutschland, Papst Pius XII., dem es ein großes Anliegen war, die Deutschen zu unterstützen und eine Päpstliche Mission auf deutschem Boden ins Leben zu rufen, um Hilfsgüterverteilungen umsetzen zu können.
Ein weiterer Unterstützer der Deutschen war der Erzbischof von Chigago, Samuel Stritch. Schon in den 1920er Jahren war der Erzbischof von Chicago, Samuel Stritch, auf Muench aufmerksam geworden. Beide bewegte die soziale Frage. Als Stritch 1946 zum Kardinal ernannt wurde und aus diesem Grund nach Rom reiste, nahm er Muench mit. Gegenüber dem Papst drängte Stritch darauf, den diplomatischen Kontakt
nach Deutschland nicht komplett abreißen zu lassen und die deutsche Bevölkerung zu unterstützen. Der letzte Nuntius Orsenigo war 1946 in Eichstätt gestorben, wohin er vor den Wirren des Kriegs in Berlin geflohen war.
Bei Papst Pius XII. stieß Kardinal Stritch mit seinem Anliegen auf offene Ohren. Doch „einfach so“ konnte in der damaligen Zeit auch ein Papst in Deutschland keine Fakten schaffen. Zwar war in Eichstätt auch nach dem Tod des Nuntius die Nuntiatur erhalten geblieben – für sich genommen schon ein starkes Zeichen der Verbundenheit. Doch die Ernennung eines neuen Nuntius war nicht möglich, solange kein als Staat anerkanntes Deutschland existierte. Schon recht früh hatten die USamerikanischen Bischöfe sich bei ihren Gläubigen für humanitäre Hilfe und einen Geist der Versöhnung gegenüber den Deutschen stark gemacht und Hilfsgütersammlungen organisiert. So lag es auf der Hand, einen US-amerikanischen Vertreter zu benennen.


Papst Pius XII. erinnerte sich an
nen Geist der Versöhnung und eine Ermöglichung eines echten Neuanfangs für einen deutschen Staat ein. Er scheute auch nicht das klare Wort und warnte die Besatzermächte davor, ihrerseits im Umgang mit den Deutschen das gleiche Unrecht zu begehen, das diese verübt hatten. Eindringlich mahnte er, „sich nicht in einer Siegerjustiz zu verlieren“. So hatte er sich für Alfred Krupp eingesetzt, der dann schließlich 1951 auch begnadigt worden ist. Sein Einsatz für Deutschland und
Muench, den er in den 1920er Jahren kennengelernt hatte und der nun 1946 im Gefolge von Kardinal Stritch wieder nach Rom gekommen war. Im Sommer 1946 kam Muench in Deutschland an und verteilte im Namen des Heiligen Stuhls bis 1949 insgesamt die Ladung von 950 Güterwaggons mit Hilfsgütern für die deutsche Bevölkerung. Muench hatte sich in der Nähe von Frankfurt niedergelassen, um einen kurzen Dienstweg mit der amerikanischen Verwaltung zu haben. Er richtete sich in Kronberg im Taunus ein und war damit auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Königstein, das sich in der gleichen Zeit zu einem Zentrum der Priesterausbildung und Hilfe für die Vertriebenen entwikkelte. Seinen sudetendeutschen Wurzeln gab er Gesicht und Stimme, indem er bei allen sudetendeutschen Priestertreffen in Königstein dabei war. Von Kronberg aus organisierte er die Verteilung der vatikanischen Hilfsgüter. Seine offizielle Zuständigkeit galt laut seinen von den US-Amerikanern ausgestellten Papieren den „displaced persons“ –Zwangsarbeitern, die zurück in ihre Heimat wollten.
Muench hatte immer von seinen Vettern gesprochen, wenn er von den Deutschen sprach. „Ich bin einer von euch“, das war sein Empfinden, und so ging er auch auf die Leute zu. Unermüdlich setzte er sich in den USA, wo ja viele deutsche Wurzeln hatten, und bei den zuständigen Besatzungsbehörden für ei-
die Deutschen hatte einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ihn als einen der Gründerväter der Bundesrepublik zu bezeichnen, mag ungewohnt klingen, hat aber durchaus einen Hintergrund.
1949 durfte die junge Bundesrepublik noch keine diplomatischen Beziehungen aufbauen. Daher konnte es weiter keinen Nuntius geben. Dennoch kümmerte sich Muench um die Geschäfte der Nuntiatur, die weiterhin in Eichstätt existierte. Papst Pius XII. ernannte ihn zum Erzbischof und zum „Regenten der Apostolischen Nuntiatur in Deutschland“. 1951 durften dann schließlich wieder diplomatische Beziehungen aufgegriffen werden – sogleich erfolgte die Ernennung Muenchs zum „Nuntius in Deutschland“. Die fehlende Differenzierung zwischen Ost- und Westdeutschland zeigte den Anspruch des Vatikans auf, aber auch seine Haltung im Hinblick auf die Nicht-Anerkennung der deutsch-deutschen Teilung, was in der DDR sofort zu einem Aufschrei der Empörung führte. Das Verhältnis blieb angespannt. Bis zu seiner Abberufung 1959 durfte Muench nur zweimal kurz in die DDR einreisen.
Mit seiner Ernennung siedelte Muench die Nuntiatur nach Bad Godesberg um. Traditionell ist der Nuntius der „Doyen“ des diplomatischen Korps, was wiederum zahlreiche Aufgaben mit sich brachte.
Als Nuntius war Muench ein echter

Quereinsteiger, ohne Ausbildung im diplomatischen Dienst. Doch seine Jahre in Deutschland hatten ihn wie keinen anderen auf die besonderen Herausforderungen vorbereitet.
Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Klärung der rechtlichen Grundlage des Verhältnisses der katholischen Kirche zum neuen Staat – es ging um die Konkordate. Während das Bayern-Konkordat von 1924 direkt in die neue Landesverfassung Bayerns aufgenommen wurde, hing mit dem Untergang Preußens das Preußen-Konkordat von 1929 gewissermaßen in der Luft. Daß die dort getroffenen Vereinbarungen bis heute für die Bistümer auf dem ehemals preußischen Territorium gelten, ist ein Verdienst von Alois Muench. Noch wichtiger war, daß das Reichskonkordat von 1933 vom Bundesverfassungsgericht Mitte der 1950er Jahre als weiterhin gültig anerkannt worden ist. 1959 wurde Muench schließlich abberufen und in Rom zum Kardinal ernannt. Die Jahre unermüdlichen Einsatzes hatten ihn da schon gezeichnet. Er war am Ende seiner Kräfte. Er wirkte noch bei der Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit, bevor er dann 1962 in Rom starb.
Prof. Samerski schloß seine detaillierten Ausführungen mit dem Hinweis, daß die Forschung zur Person Muenchs erst am Anfang stehe, aber es absolut wert sei, vertieft zu werden.
schen Landsmannschaft Bundesverband per eMail an info@sudeten.de oder telefonisch unter der Nummer (0 89)48 00 03 70 bestellt werden.
Der Kalender-Sendung wird ein Spendenüberweisungsträger zur freundlichen Beachtung beigelegt. Abonnenten der Sudetendeutschen Zeitung, Amtsträger und Spender bekommen den Kalender automatisch zugeschickt.
Der Begriff „Zeitenwende“ hat das Zeug zum Wort des Jahres 2022. Seit dem 24. Februar haben wir diesen Begriff oft gehört. Gemeint war damit meist die tiefgreifende Veränderung in der europäischen Sicherheitsarchitektur nach dem Angriff Rußlands auf die Ukraine, aber auch alle sonstigen Auswirkungen des Ukrainekrieges.
Wache Zeitgenossen haben allerdings schon länger das Gefühl, daß sich seit einigen Jahren Grundsätzliches verändert. Zu ihnen gehört auch Papst Franziskus, der immer wieder formuliert: „Wir leben nicht in einer Epoche des Wandels, sondern wir erleben den Wandel einer Epoche.“
Bezüglich vieler Bereiche müssen wir heute ehrlicherweise sagen: Wie es war, so ist es nicht mehr; wie es sein wird, wissen wir noch nicht.
Im Evangelium des zweiten Adventssonntags erhalten wir Einblicke in eine viel frühere Zeitenwende, nämlich die Wende vom Alten zum Neuen Bund. Johannes der Täufer war der letzte Prophet des Alten Bundes, und zugleich war er der Vorläufer Jesu von Nazareth, der den Neuen Bund begründet hat. Davon wußten die Leute, die in Scharen zu Johannes an den Jordan kamen, zwar noch nichts. Sie spürten aber sehr wahrscheinlich: Es liegt etwas Neues in der Luft. Johannes selbst hatte seinen Anker schon in die Zukunft hinein ausgeworfen. Das machte ihn für die Menschen interessant. Seine Grundbotschaft lautete: „Das Himmelreich ist nahe.“ Mit anderen Worten: Gott wendet sich uns in neuer Weise zu, er läßt uns nicht in unseren Schwierigkeiten hängen.
Wenige Jahre nach Johannes trat Jesus mit der gleichen Botschaft an. Wenn beide, Johannes und Jesus, auch von Umkehr und Gericht sprechen, dann nur vor dem Hintergrund dieser neuen Zuwendung Gottes.
Wer umkehrt hat das Vertrauen, daß sein Leben noch nicht vertan ist, sondern daß er eine neue, vielversprechende Chance hat. Umkehr beginnt mit dem Innehalten und der kritischen Bilanz: War wirklich alles gut, wie es bisher gelaufen ist? Um diese Frage kommen wir auch in der gegenwärtigen Zeitenwende nicht herum. Der Ukrainekrieg gab dazu den vorläufig letzten Anstoß. Aber die gleiche Frage gilt mit Blick auf das Klima und auf viele andere Bereiche. Auch die Kirche sollte sich dieser Frage nicht verschließen.
Gegen Ende seiner Umkehrpredigt spricht Johannes der Täufer von dem Stärkeren, der kommen wird, und sagt über ihn: „Er wird euch mit Feuer und Heiligem Geist taufen.“


Das Feuer des Heiligen Geistes kann in uns die kalte Angst vor dem Neuen vertreiben. Zugleich entfacht es die Hoffnung, daß wir in unserer Zeitenwende nicht von allen guten Geistern verlassen sind, sondern mit der Hilfe Gottes die nötige Neugierde und Kraft haben, unsere momentanen Herausforderungen anzugehen und zukunftsorientiert zu handeln.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen PfarreiEnde November ehrte Bayerns Heimatminister Albert Füracker im Rahmen der Verleihung des Dialektpreises Bayern für Dialektvereine 2022 auch den Freundeskreis sudetendeutscher Mundarten in Nürnberg mit diesem Preis.
Das Heimatministerium ist ein mächtiger Bau nahe der Nürnberger Sankt-Lorenz-Kirche. Die Gäste strömen in den Festsaal, einige in Tracht. Mundartsprecherin Ingrid Deistler, ihre Wurzel liegen im Egerland, schart ihre Leute um sich. Heimatpflegerin Christina Meinusch, Bundeskulturreferent Ulf Broßmann, die Wischauerin Rosina Reim und Margaretha Michel als Kulturreferentin der SL-Landesgruppe Bayern stoßen dazu.
Zuvor erhielten die sudetendeutschen Gäste vom Ministerium einen minutiös durchgetakteten Zeitplan. Die ersten Minuten verlaufen folgendermaßen: „17.00 Uhr Musik Dittl & Filsner. 17.03 Uhr Begrüßungsmoderation Marion Schieder. 17.05 Uhr Begrüßung Ehrengäste und
Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich
oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)
Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail
Geburtsjahr, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)
Kontonr. oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 48/2022
Festrede durch Staatsminister.“ Wann geklatscht werden soll, ist nicht angegeben, auch nicht, wann man lachen soll.
Durch das Programm führt Marion Schieder, Radiomoderatorin, Schauspielerin und Fernsehredakteurin. Sie ist vor allem für ihre unermüdliche Berichterstattung vom Münchener Oktoberfest bekannt. Nun kokettiert sie vergleichsweise flapsig mit ihrer Geburtsheimat Weiden in der Oberpfalz, mit der oberfränkischen Heimat ihres Mannes Thomas Kerschbaum und ihrem Wohnort in Niederbayern, wo ihr Kind aufwächst. Nicht jeder Landsmann ist begeistert.

Sicherlich wurden vor mehr als 60 Jahren Schüler immer wieder wegen ihres starken Dialekts bestraft. Aber auch Margaretha Michel war Lehrerin und weiß, daß man bereits Anfang der siebziger Jahre begann, Dialekt als erhaltungswürdig anzusehen.
Michel: „Ich wuchs zwischen zwei Dialekten auf, nämlich als Nachbar der Familie vom Roider Jackl in Weihmichl mit dem Niederbayerischen und dem etwas rudimentäreren Dialekt des Elbtals, der eher der Ausschmükkung als der Alltagssprache diente. Darüber hinaus war diese Familie zweisprachig, Tschechisch und Sudetendeutsch. Eben dieses Sudetendeutsch –die Sprache Rainer Maria Rilkes und Franz Kafkas – wurde in der Schule massiv beanstandet, so daß ich auch nicht mehr
Tschechisch hören sollte, um mein Deutsch zu verbessern. Dazu pflegte mein Großvater noch mit Freunden Einsprengsel und Sprichwörter der Sprachen der Monarchie, wozu auch jiddische Ausdrücke gehörten.“
Die Liste der von Führacker geehrten Vereine ist beachtlich. Manche der Ideen, vor allem, wenn es Theater oder Dialekt im Internet betrifft, wären auch für die Sudetendeutschen geeignet. Bei ihrer Vorstellung kommen die Sudetendeutschen gut weg, vor allem dank des roten Fracks und des schwarzen Zylinders von Lorenz Loserth, dessen Wurzeln in Jägerndorf liegen. Beim anschließenden Empfang pflegen die Mundartgruppen einen freundlichen Austausch. Manche Mitstreiter weisen sogar auf ihre Abstammung aus unserer Heimat hin. Im Bericht des BR-24-Newsletters existieren die Sudetendeutschen allerdings nicht. Hier fragt man sich, ob die Presse mit einer Minderheit, die im Rahmen der Gastarbeiter nach Deutschland kam, auch so verfahren wäre. Übrigens erzählt Moderatorin Schieder von Rezepten ihrer Großmutter aus dem Egerland. Beim Essen beginnt dann doch die Freundschaft mit der Heimat.
Am 12. November starb Alfred Müller, langjähriger Vorsitzender der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Augsburg, im Alter von 86 Jahren.

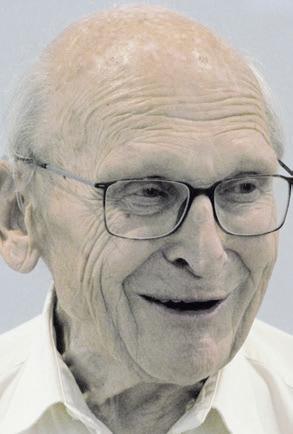

sudetendeutscher Mundarten
Jährlich treffen sich 40 Mundartfreunde in Bad Kissingen, wo der Kreis 1977 gegründet wurde. Für Leiterin Ingrid Deistler ist das sudetendeutsche Wörterbuch wichtig, das in Gießen entstand und der Auslöser für den Freundeskreis war. Die Mitglieder sprechen sudetendeutsche Mundarten, zeichnen sie auf und dokumentiern sie. Zwei jüngere Mitglieder nahmen kürzlich ihre heimischen Dialekt sprechenden Großmütter auf Tonträger auf. Sie wollen die Mundart lernen und bewahren. al

Am 20. November wäre Otto von Habsburg (1912–2011) 110 Jahre alt geworden. Daran erinnerte Heimatfreundin Irmgard Reiser mit einer roten Rose.
Im Otto-von-Habsburg-Foyer im Sudetendeutschen Haus in München hängt selbstredend ein Portrait des ältesten Sohnes von Karl I., dem letzten und von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen Kaiser von Österreich und König von Ungarn. 1916 bis 1918 war Otto von Habsburg letzter Kronprinz von Österreich-Ungarn. Außerdem war er Schriftsteller, Publizist und Politiker.
1957 bis 1973 war er Vizepräsident, 1973 bis 2004 als Nachfolger des Gründers Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi Präsident der InternationalenPaneuropa-Union.2004
bis 2011 war er deren Ehrenpräsident.
Für die CSU war er 1979 bis 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments, zum Schluß zweimal dessen Alterspräsident. Er war Mitinitiator und Schirmherr des Paneuropäischen Picknicks am 19. August 1989 an der ungarisch-österreichischen Grenze. Mit diesem Picknick begann der Fall des Eisernen Vorhangs.
Otto von Habsburg besaß die Staatsbürgerschaften von Österreich, Deutschland und Ungarn sowie die von Kroatien nach dessen Unabhängigkeit im Jahr 1991.

Just am 110. Geburtstag von Otto von Habsburg besuchte Irmgard Reiser eine Veranstaltung im Sudetendeutschen Haus. Deshalb hatte sie Otto von Habsburg eine Rose mitgebracht. Nadira Hurnaus
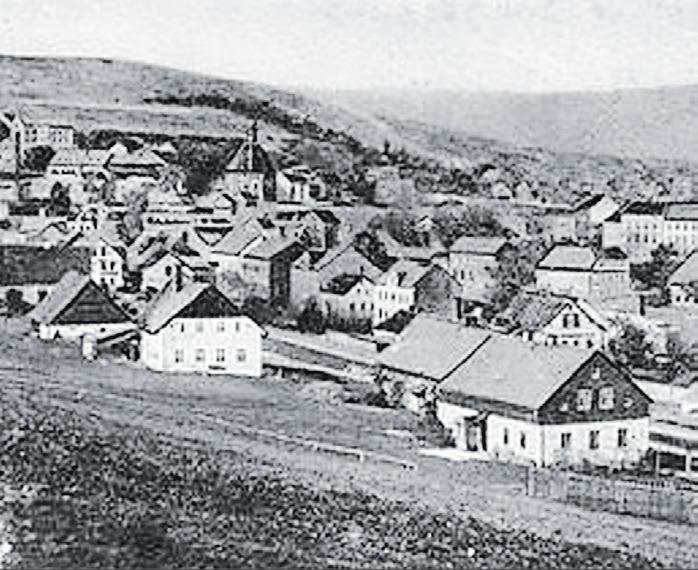
on Franz Kafka stammt der Satz: „Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.“ Mit diesem Satz überschrieb die Familie Müller ihre Todesanzeige.
Doch auch die Augsburger Ackermann-Gemeinde trauert um ihren langjährigen Diözesanvorsitzenden.
Geboren in Römerstadt im Altvatergebiet, schloß er sich bald nach der Vertreibung nach Augsburg der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde an. Schließlich wurde er 1998 zum Vorsitzenden der Akkermann-Gemeinde in der Diözese Augsburg gewählt.
Mit großer Tatkraft und Ideenreichtum führte er dieses Amt aus. Dank der Organisation von Vorträgen über geschichtliche,
politische und kulturelle Themen sowie von Reisen in die Heimat gelang es ihm immer wieder, neues Interesse und neue Mitglieder für die Ackermann-Gemeinde zu gewinnen. So trug er wesentlich zur Lebendigkeit und zum Fortbestand der Gemeinschaft bei.
Wichtig war ihm der persönliche Kontakt zu den Mitgliedern, den er zum Beispiel während Corona mit Telefonanrufen pflegte. Ebenso wichtig waren ihm auch Kontakte über die Ackermann-Gemeinde hinaus zu kirchlichen und politischen Kreisen. Die Ackermann-Gemeinde würdigte seine Verdienste im Jahr 2019 mit der Verleihung der Goldenen Ehrennadel.
Seit 2001 war er zudem Mitglied des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Augsburg. An seiner Verabschiedung aus diesem Gremium einen Tag vor seinem Tod konnte er schon nicht mehr teilnehmen.
Mathias Kotonskirend der Fahrt im Bus mit heiteren Einlagen. Unvergessen sind auch seine humorvollen Beiträge bei zahlreichen Anlässen, seine lustigen Gedichte und seine fröhlichen Witz.
Heinz Lorenz kam 1930 in Markhausen bei Falkenau im Egerland zur Welt. Dort erlebte er eine schöne Kinder- und Jugendzeit. Doch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vertrieben die Tschechen seine Familie und ihn aus der geliebten Heimat. Er strandete schließlich in Burglengenfeld, wo er zu seinem großen Glück die ebenfalls aus dem Egerland vertriebene Erna kennenlernte, und sie heirateten.
1953 trat Heinz Lorenz in die SL ein und hielt ihr fast 70 Jahre lang bis zu seinem Tod die Treue. So wie er sich mit ganzer Kraft für seine Familie einsetzte, brachte er sich auch für die Landsmannschaft ein. Er bereicherte die SL mit konstruktiven Beiträgen und seinem großen Wissensschatz über Land und Leute in Böhmen. Als aktiver Musiker im Duo „Pius und Heinz“ wurde er weit über unsere Region in ganz Deutschland und Österreich bekannt.
Akribisch organisierte er zahlreiche Fahrten. Zur Vorbereitung war er viel mit seiner Frau Erna unterwegs, dann stets noch einmal mit uns, meinem Mann Paul und mir, um die besten Bedingungen zu erkunden. Kein Wunder, daß die Reisen immer einen großen Zuspruch fanden. Darüber hinaus vermittelte Heinz den Reisekameraden viele Informationen und unterhielt sie wäh-
Hier einige Kostproben:
● „Guter Mond, wenn ich dich seh, / denk ich an meine Plage. / Du bist im Jahr nur zwölf Mal voll, / ich fast alle Tage.“
● „Besser Flöig‘n afm Kraut / als gåua koa Fleisch, / håut da Knecht gsågt / und håut se zum Ess‘n / affn Misthaufen g‘setzt.“
● „Solange du bist noch am Leben, / sollst du dein Geld doch selbst ausgeben. / Denn spätestens beim Leichenschmaus, / da geben‘s für dich die anderen aus.“
Ein bleibendes Werk schuf er mit seiner Frau und meiner Hilfe mit dem originellen, vielseitigen und handgeschriebenen Egerländer Kochbuch. Das Buch findet auch jetzt noch viele Interessenten.
Für mich war Heinz Lorenz ein echtes sudetendeutsches Urgestein und ein Vorbild. Zu Recht wurde er mit vielen Ehrungen – auch von staatlicher Seite – bedacht. In unserem Kreis war er mit seiner großen Kompetenz und seiner freundlichen, humorvollen, warmherzigen, einfach liebenswerten Art ungemein geschätzt.
Wir danken ihm für seinen enormen Einsatz in der Sudetendeutschen Landsmannschaft und für seine gute Art. Möge ihm unser Herrgott alles lohnen und ihm Frieden in der ewigen Heimat schenken.
Sigrid Ullwer-Paul Am 8. August starb Heinz Lorenz, eminenter Egerländer Musiker und Autor, mit 92 Jahren im oberpfälzischen Burglengenfeld.Bei einer Online-Veranstaltung der Sudetendeutschen Heimatpflege stellten die Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl ihre Sammlung „Geretsrieder Geschichten“ vor. Das Buch enthält Anekdoten, Originaltexte und Berichte über Einzelschicksale aus der Zeit zwischen 1946 und 1970. In der Vertriebenensiedlung Geretsried im oberbayerischen Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen waren damals auch viele Sudetendeutsche gestrandet. Helmut Hahn moderierte die Buchvorstellung, zu der sich viele Interessenten am heimischen Rechner zuschalteten.
Am 7. April 1946 traf in Geretsried der erste Transport von Vertriebenen aus dem Sudetenland ein. 554 Personen aus Graslitz wurden in das Lager Buchberg eingewiesen. Ein weiterer Transportfolgte am 19. Juni 1946 aus Tachau mit 137 Personen, die im ehemaligen Verwaltungsgebäude, dem heutigen Rathaus, untergebracht wurden. Ein dritter Transport kam am 11. Oktober 1946 mit 110 Personen aus der Karlsbader Gegend. Bei den Vertriebenen und Flüchtlingen handelt es sich vorwiegend um Frauen, Kinder und ältere Menschen, alle aus dem Egerland.
Erste Arbeitsmöglichkeiten fanden die Frauen im Lager Föhrenwald und die Männer bei den Demontagearbeiten der Rüstungswerke, der Fabrik zur Verwertung Chemischer Stoffe durch den Konzern Dynamit A. G. (DAG) und der Deutschen Sprengchemie (DSC) durch den Konzern Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff A. G. (WASAG).
In dieser Zeit beginnen die „Geretsrieder Geschichten“, die von den beiden Autoren Werner Sebb (83) und Gernot Schnabl (85) gesammelt und jetzt veröffentlicht wurden. Auf Einladung von Christina Meinusch, der Heimatpflegerin der Sude-


In diesem Jahr findet im Literaturhaus München und an weiteren Orten das 13. Literaturfest München statt.



Kernstück des Festivals ist das zehntägige Programm „Forum“, das vom 16. bis 25. November unter dem Motto „frei sein –Mitteleuropa neu erzählen“ lief. Gestaltet wurde das Forum von der aus der Ukraine stammenden Autorin Tanja Maljartschuk.
Bei der letzten Veranstaltung über „Der Rand rückt in die Mitte“ unterhielten sich der tschechische Autor Jáchym Topol und die finnisch-estnische Schrift-
Ort der Online-Präsentation ist im Rathaus der Stadt Geretsried, wo sich einst die Vertriebenen versammelten.



geführt. „Wir sitzen hier im kleinen Sitzungssaal, dem ehemaligen Versammlungsraum der Vertriebenen im heutigen Rathaus“, erläuterte Hahn. Er freue sich auf die informativen und humorvollen Berichte von Sebb und Schnabl.
Schließlich seien sie dorthin gezogen.
rische Fracht aus den USA“, in der eine Bombe selbst erzählte – ein spezielles Problem in Geretsried, da sowohl nicht explodierte Feindmunition als auch Überreste der heimischen Fabriken in den Nachkriegsjahren immer wieder auftauchten. Auch ein Nachwuchsfriseur wurde beschrieben, der zur Lehre in den Böhmerwald ging. Später kehrte er zurück, da er wieder in die Nähe von München wollte, und landete im Salon Jeisl in Geretsried.

Schnabl schilderte einen Job während seines eigenen Lehramtsstudiums, in dem er als Fließbandarbeiter in einer Fabrik arbeitete. Die Firma stellte Rechenstäbe oder -schieber her. Seine rekordschnelle Arbeit wird jedoch von den Kolleginnen gestoppt, damit keiner aus dem ruhigen Takt käme. Dann kam seine Zeit als „außerplanmäßiger Lehrer“ an der Adalbert-Stifter-Volksschule. Der verheiratete Junglehrer hatte in der fünften Klasse 53 Schüler zu betreuen, was sicher nicht einfacher war als die Arbeit des zuvor geschilderten Metzgergehilfen.
tendeutschen, boten sie bei einer Onlineveranstaltung nun daraus Kostproben.
Die Autoren wurden von Helmut Hahn, Vüarstäiha der Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried, ein-

stellerin Sofi Oksanen unter Moderation von der Literaturkritikerin Katharina Teutsch. Auf Wunsch von Forums-Kuratorin Tanja Maljartschuk sprachen alle in ihrer Muttersprache und wurden simultan von Zuzana Jürgens sowie MarjaTerttu Ruokamo gedolmetscht.
Die Schauspielerin Wiebke Puls las aus den deutschen Übersetzungen der neuesten Werke Oksanens und Topors.

Die Star-Autorin Sofi Oksanen und Jáchym Topol, deren
„Wir wollen heute ein bißchen aus dem Nähkästchen plaudern“, begann Werner Sebb. Der gebürtige Graslitzer sagte, er sei mit sechs Jahren nach Geretsried gekommen und habe immer seinen Hauptwohnsitz dort gehabt. „Ich dagegen bin bei der Vertreibung im Viehwaggon aus Tachau gekommen, was 15 Tage lang dauerte, und zuerst in Schliersee gelandet“, ergänzte Gernot Schnabl. Die Familie habe dort 14 Jahre lang gelebt, doch die Eltern hätten immer nach Geretsried gewollt: „Wir hatten dort so viele Verwandte und Freunde.“
Zur Einstimmung trug Sebb ein Mundartgedicht aus Graslitz vor. Dann lasen die Autoren abwechselnd aus ihrem Buch. Die erste Geschichte berichtete über „‘S Pepperl“ alias Josef Baumann, einem Original aus Geretsried. Der zweite Text beschrieb den damaligen örtlichen Metzger Karl Hecht, bei dem einer der Autoren als junger Mann einen Job hatte. Er habe zu Mittag von der Metzgersfrau immer zwei dickbelegte Leberwurstsemmeln erhalten, so der „Metzgersbub“. Der Metzger sei ein Choleriker gewesen. Einmal habe er ihm aufgetragen, die Schweine aus dem Transportwagen zu treiben. Eines sei ihm davongelaufen. Was Hecht dann zu ihm gesagt habe, habe ihn sein ganzes Leben lang begleitet, so der Erzähler. „Da hat der‘s Abitur, aber is‘ zu blöd, a Sau zu fangen.“ Ein Satz, der typisch ist für den authentischen Ton der „Geretsrieder Geschichten“.
jüngste Bücher vorgestellt wurden, sind erfahrene Grenzgänger, die sich mit der Verflechtung von Sprachen, Ethnien und Religionen literarisch beschäftigen.
Aus ihren Werken las die Schauspielerin Wiebke Puls Passagen, und zwar zunächst aus Oksanens aktuellem Roman „Hundepark“ (2016, deutsch 2022). In dem kri-

miartigen Buch taucht Oksanen tief ein in die Zeit nach der Wende im Osten. Sie erzählt von Olenka, die aus der Ostukraine nach Finnland fliehen muß. Ihre Karriere als Vermittlerin osteuropäischer Eizellenspenderinnen findet ein jähes Ende, als sie für das Verschwinden einer der Spenderinnen verantwort-
Andere kleine „Helden“ waren einige Geretsrieder Lausbuben, die an der Isar unentdeckte Sprengstoffe finden und diese – sorgsam aufgeteilt – an ver-
Werner Sebb, Gernot Schnabl: „Geretsrieder Geschichten“. Eigenverlag, Geretsried 2022; 170 Seiten, 12,50 Euro. Erhältlich in 82538 Geretsried bei Arbeitskreis Historisches Geretsried, Dr. Wolfgang Pintgen, Sudetenstraße 10, Telefon (0 81 71) 88 28; Buchhandlung Osiander, Telefon (0 81 71) 6 30 00, Karl-LederPlatz 3; Bürobedarf Schröter, Adalbert-Stifter-Straße 39, Telefon (0 81 71) 6 00 83; Heimatpflege der Sudetendeutschen, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 65.
schiedenen Stellen der Gemeinde hochgehen lassen. Diese Jungen aus dem Ort waren es auch, die beim Sammeln von Altmetall gegen eine kleine Belohnung zwar einen brisanten Fund machten, aber kein Geld, sondern nur eine Warnung bekamen. Die vermeintlichen Alu-Stangen erwiesen sich als vergessene amerikanische Stabbomben und mußten sachgerecht beseitigt werden.
Späte Funde von Sprengstoffen spielten in mehreren Geschichten eine Rolle, wie in „Zerstöre-
lich gemacht wird. Im Buch thematisiert Oksanen die systematische Korruption in der ehemaligen Sowjetunion und die Ausbeutung durch reiche Europäer, die immer einen Aufstieg aus niedrigen Schichten erschwert.

Eine Art Road-Movie ist Jáchym Topols „Ein empfindsamer Mensch“ (2017, deutsch 2019). Eine tschechische Schaustellerfamilie gastiert beim Shakespeare-Festival in England und wird von Brexit-Anhängern aus dem Land gejagt. Im Campingwagen reist sie Richtung Osten und gerät ins russisch-ukrainische Grenzgebiet, Europas Peripherie. Sie macht sich auf den Heimweg nach Böhmen. Dort landen sie an der Sasau/Sazawa in einer Hinterwäldlergesellschaft.
Trotz der anfänglichen Technikprobleme ergab sich eine lebhafte Diskussion. Einig waren sich die beiden Autoren darin, daß die kleineren Gebiete in der Peripherie meist viel zu bieten hätten, jedoch immer gelitten hätten unter Ausbeutung und Kolonialismus der Großmächte – sowohl der im Westen als auch der im Osten. Susanne Habel
Gernot Schnabl erinnerte sich auch gern an einen seiner besten Schüler, der gerne Dampflokomotivführer geworden wäre und es dann doch „nur“ zum Boeing-Pilot bei der Lufthansa bringt. Flugzeuge spielten auch in der Geschichte „Baby verschwunden“ eine Rolle. Denn das verschollene „Baby“ war lustigerweise ein kleines Modellflugzeug, das die Bubenclique um Sebb gebaut hatte. Ein Flugstart im Jahr 1948 in Deutschland weckte jedoch den Argwohn der amerikanischen Besatzer, die das „Baby“ abfingen und – um Aufklärung über den Flugkörper zu bekommen –die Polizei zu den Jungen schickten.
Lustig war auch die Anekdote „Die Aphroditen kommen“. In der Vertriebenensiedlung Geretsried trafen die ersten Gastarbeiterinnen aus Griechenland ein und besuchten einen Tanzabend im Gasthof Korb. Die antiken Schönheiten waren freilich nicht so schön wie erhofft.

In „Kunst & Krempel“, der Sen dungsreihe des Bayerischen Rundfunks, ist wieder einmal ein Objekt aus der Heimat be gutachtet worden. Die Vase aus Nordböhmen ist ein Erbstück.


Im Kloster Metten im nieder bayerischen Landkreis Deggen dorf, wo die Sendung „Kunst & Krempel“ des Bayerischen Rund funks diesmal haltmachte, prä sentierte ein Enkel des nordböh mischen Künstlers Otto Beran eine zierliche Glasvase in koni scher Form, die zweifach abge stuft und mit einem halbrunden Fuß ausgestattet war, der einen optischen Effekt wie bei einer Lu pe erzeugte.
Nach Aussage des Enkels, der ein pensionierter Ingenieur ist, bemalte sein Großvater mütter licherseits diese Vase während seiner Ausbildung als Glasmaler zwischen 1903 und 1905 in Stein schönau oder während seines Aufenthaltes an der Kunstakade mie in Wien bis 1907, wo er auch Kurse bei Koloman Moser, einem der Gründer der Wiener Werk stätten, absolvierte.
Der Experte Dedo von Kers senbrock-Krosigk vom Kunstpa last Düsseldorf würdigte die hervorragende Bemalung in den drei Farben schwarz, gold und grün und der zusätzlichen vierten Farbe weiß, die jedoch nur durch die Oberflächen bearbeitung des Glases, also durch die Mattierung, zustan de gekommen sei. Drei stili sierte Disteln, in ein Ornament überführt, wüchsen an der Va se empor. Und das Besondere der Bemalung sei das einer Fe derzeichnung nachempfunde ne Schwarzlot, dessen bekann tester Vertreter im Wiener Ju gendstil der Glasmaler Karl Massanetz aus Steinschönau gewesen sei.
Dessen bemalte Glasob jekte würden heute gehobe
ne fünfstellige Auktionspreise erzielen, wie der andere Experte Christoph Boullion, vereidigter Auktionator in Köln, zu berich ten wußte. Vielleicht auch des halb, weil Massanetz ab 1912 in einer eigenen Werkstatt in sei nem Heimatort Steinschönau für berühmte Glashändler wie Lob meyr und Bakalowits in Wien ge fertigt habe und noch 1918 mit 27 Jahren an der Front im Er sten Weltkrieg gefallen sei, sein Œuvre also schmal habe bleiben müssen.
Jedenfalls begeisterte die Ex perten dieses über Massanetz hinausgehende gemalte vierfar bige Dekor des Otto Beran. Sie baten den Enkel, der mit seiner Frau erschienen war, alle Unter lagen über diesen Großvater und dessen Glasvase zu sichern und
für die Forschung zur Verfügung zu stellen.
Denn bei der bisher eher dünnen Wahr nehmung von Otto Beran könne durch stärkere For schungsergeb nisse über sei ne Person auch der Wert der Glasvase stei gen, merk te Boullion an. Auf dem ge genwärtigen Kenntnisstand schätze er den Wert zwischen 800 und 1500 Euro ein, et
wa auf dem Niveau der Arbeiten von Adolf Beckert, der bei Lötz in Klostermühle in Böhmen gewirkt habe.
Ob der Enkel nach den Bera tungen im Familienkreis, die er nach der Begutachtung ankün digte, jedoch den langen Weg der Preiserhöhung durch geeig nete Forschung antreten wird, sei offen gelassen. Jedenfalls war er schon von den aufgerufenen Preisen doch so angetan, daß er sagte: „Wenn der Preis entspre chend ist, ist man immer käuf lich.“
Was bei Kunst & Krempel aber wieder einmal aufschien, war die große künstlerische und kunst gewerbliche Meisterschaft und Vielfalt in der Glasindustrie in Böhmen, die in einer symbioti schen Beziehung mit Wien stand. Das gilt auch bei dieser in ei ner Ausbildung gemalten Glas vase, die eine Meisterhand ver riet. Und wie der Experte Dedo von Kerssen brock-Krosigk so richtig be merkte, liege dank der bei den Glasfach schulen in Hai da/Nový Bor und Steinschö nau/Kame nický Šenov auch heute noch ein star ker Schwer punkt der Glasherstel lung in der Tschechischen Republik in Nordböhmen.
Ulrich MikschDie Bubenreuther Instrumen tenbauer sind weltweit vernetzt und bekannt. Der Musikinstru mentenbau und die musikali sche Spielfreude waren nach Kriegsende von vertriebenen Musikhandwerkern aus Schön bach/Kreis Eger nach Buben reuth im heutigen Kreis Erlan gen-Höchstadt eingeführt wor den. Hier stellt uns Heinz Reiß einen beispielhaften Musiker vor.
Tagsüber steht der Geigen bauer Wilhelm Roth in sei ner Werkstatt, hobelt an einem Geigenboden, gibt der Zarge die richtige Form oder leimt ein Griffbrett auf den Geigenhals. Wenn es sein muß, reicht ihm ein Acht-Stunden-Tag nicht aus.
Wenn es aber darum geht, je manden eine Freude zu berei ten, ein musikalisches Ständchen zu bringen oder eine Veranstal tung musikalisch zu umrahmen, faltet er seine traditionelle blaue Schürze zusammen, schaltet den Leimkocher aus und sagt dem kunsthandwerklichen Leben, dem Geigenbau ade. Von da an ist Roth ein musikalisches Mul titalent, ein Trompete spielender Geigenbauer.
Wir haben Wilhelm Roth die Frage gestellt: „Wie kommt ein Saiteninstrumentenbauer zur Blasmusik und mit Trompete und Saxophon auch noch zum Allein unterhalter?“ „Dieses Hobby“, so lächelt Roth etwas verschmitzt, „bescherte mir ein Bubenreuther musikalisches Urgestein.“
Alfons Plutta, Mitglied der Geigenbauerkapelle, hatte 1955 seinen schon etwas ergrauten Ka pellen-Kollegen erklärt, daß man junge Musiker benötige. „Da mit in dem musikalischen Dorf die Geigenbauerkapelle eine Zu kunft hat“, so Plutta, „werde ich eine Jugendkapelle aufbauen.“
macherinnung, erfuhr davon. Er gab seinen damals zwölfjähri gen Sohn in die Hände des ehe
maligen Militärmusikers. Plutta musterte den Knaben und stell te fest: „Du hast die Lippen für Trompete.“ Deshalb bekam der junge Wilhelm von der Firma Hüttel aus Baiersdorf sein erstes Blasinstrument.

Roth, der bisher die etwas zar teren Töne des Violinespiels im Ohr hatte, fand den tollen Klang der Trompete sehr angenehm. Noten lesen konnte er bereits, und was er beim Bedienen der Venti le seiner Trompete be achten sollte, brach te ihm der Militärmusi ker Plutta bei. Als seine Großmutter bemerkte, daß Roth die Trompe te liebte, kaufte sie ihm ein an den Saiteninstru mentenbau angelehn tes Instrument – eine Bach-Trompete Modell Stradivarius 37 aus El krat in Indiana.

Von nun an ging es aufwärts. Neben der Jugendkapelle packte Roth sein Saxophon bei der Keller-MountainBlues-Band im nahen Hausen aus, in Buben reuth war er Mitglied eines Trios für Unter haltungsmusik, und das Streichorchester enga gierte ihn für bestimmte Passagen ebenfalls.
Da sich viele Termi ne überschnitten und er noch flexibler bei kleinen Auftritten wer den wollte, begann
Roth den nächsten Schritt in sei ner musikalischen Laufbahn. Er kaufte sich ein Keyboard, lernte Gesang dazu und begann als So list seine Unterhaltungsmusik zu spielen. Seine Ausrüstung wurde dadurch auch immer umfangrei cher. Neben seiner StradivariusTrompete und dem Saxophon ge hören mittlerweile ein Abspielge rät, für den Gesang ein Headset,
ein Stereo-Boxengürtel, ein Mo biltelefon für Texte zum Ablesen und das richtige Outfit dazu. Über Einsätze macht sich Roth keine Sorgen, die kommen von selbst. Seine Auftritte reichen vom Herbstmarkt über den Se niorenclub bis zu Geburtstagsfei ern. Noten benötigt er keine, gu te Laune hat Willy immer. Und auf die Frage, was ihm am mei sten Spaß bereite, antwortet er: „Der nahe Kontakt zum Publi kum und die persönliche Freu de an der Musik.“ Lampenfie ber habe er nicht mehr, bemerkt er nebenbei. „Es ist aber trotz dem immer wieder wahnsinnig schön.“
Roths Vater Ernst-Heinrich Roth, seines Zeichens Obermeister der Streich- und ZupfinstrumentenAm Volkstrauertag hielt Horst W. Gömpel auf dem Friedhof in Schwalmstadt-Treysa im nordhessischen SchwalmEder-Kreis folgende Trauerrede.





Bereits zum dritten Mal fand die deutsch-tschechische Veranstaltung „Quo vadis, Grenzland“ statt. Während sie im ersten Jahr – im Corona-Jahr 2020 – in Präsenz in Pilsen durchgeführt wurde, präferieren die Organisatoren seither eine Online-Begegnung in Form einer Zoom-Konferenz. Auch heuer war sie wieder auf zwei Abende im November aufgeteilt. Beim ersten Abend Mitte November standen das europäische Grüne Band, Impressionen vom tschechischen Jakobsweg und Forschungen zur jüdischen Geschichte im Mittelpunkt.
Im Namen der vier Veranstalter Akkermann-Gemeinde im Bistum Regensburg, A Basta!, Deutsch-Tschechischer Kulturverein Pilsen, Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen Selb 2023 und Centrum Bavaria-Bohemia Schönsee hieß Marcus Reinert die etwas mehr als 20 deutschen und tschechischen Teilnehmer willkommen. Er rief die bisherigen „Quo vadis“-Veranstaltungen in Erinnerung und führte in die Themen der zwei Vorträge ein, die den Erhalt der Schöpfung auf beiden Seiten der Grenze, insbesondere im Grenzstreifen, und die Bedeutung religiöser Aspekte – oft auch Zeugnisse gemeinsamer Geschichte – zum Inhalt hatten. „Die gemeinsame Geschichte prägt die Region bis heute“, stellte Reinert zusammenfassend fest.


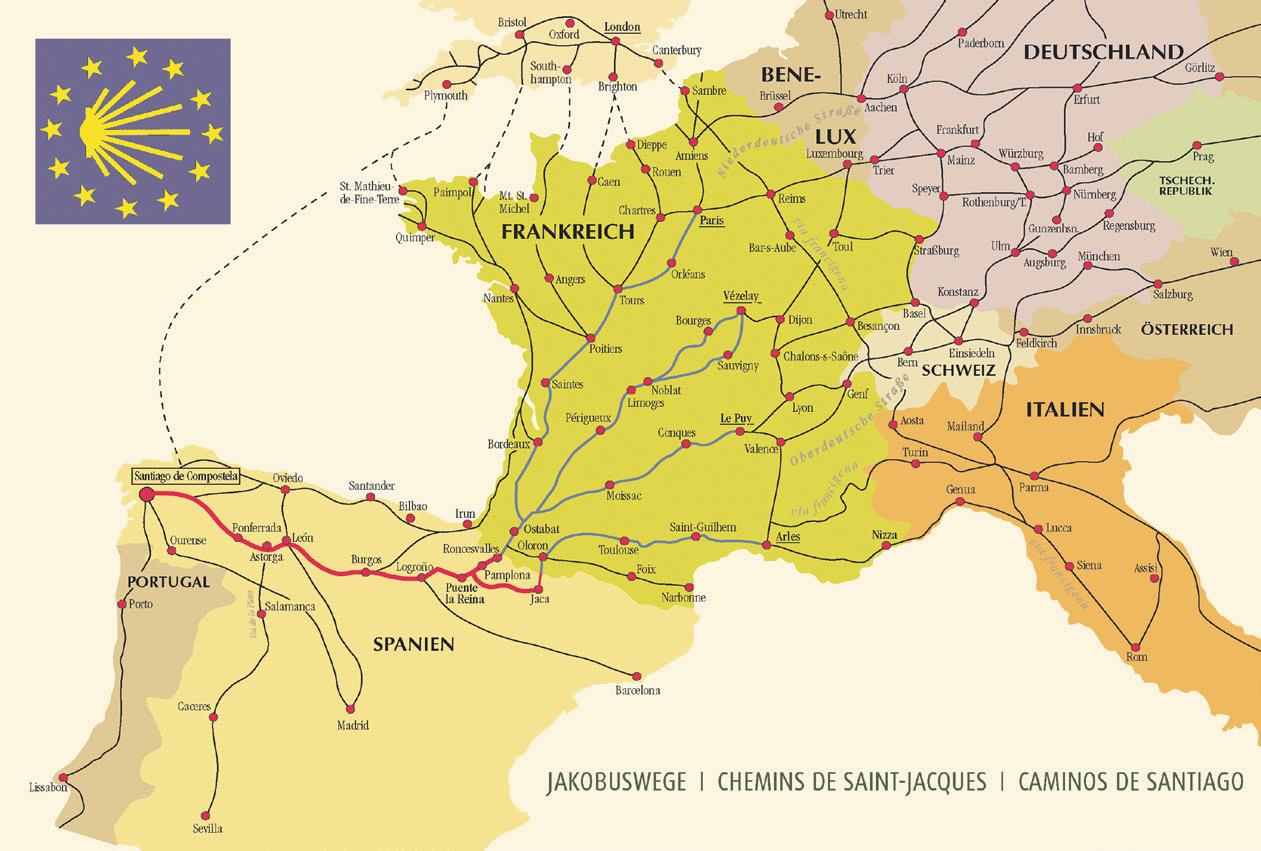

Der beim BUND Naturschutz in Bayern (BN) für das Grüne Band wirkende Projektmanager Martin Kuba referierte über das „Grüne Band – Deutschland und Europa“, das sich im Laufe der 33 Jahre seit der Grenzöffnung zu einem Biotopverbund entwickelte. „Zum Teil finden wir hier die letzten Rückzugsorte für bestimmte Tier- und Pflanzenarten“, verdeutlichte er – auch bezogen auf die 12 500 Kilometer, acht biogeographischen Regionen und 24 Staaten des Grünen Bandes. Das Grüne Band sei eine einzigartige europäische Erinnerungslandschaft, die Natur und Geschichte verbinde.
Detailliert beschrieb Kuba anhand von Grafiken und Bildern den Aufbau der Grenzanlagen zur „DDR“ und ČSSR, erwähn-
te die damit häufig verbundenen Zwangsumsiedlungen. Besonders im sogenannten Niemandsland hätten sich wertvolle Biotope erhalten können, da diese Flächen nicht genutzt worden seien. Erste Kartierungen des Grenzstreifens datierten aus Mitte der 1970er Jahre, wobei schon damals im Landkreis Coburg seltene Vogelarten gefunden worden seien. In den 1980er Jahren seien auf „DDR“-Gebiet zum Beispiel Braunkehlchen entdeckt wor-
ebenso gerne Heimat wie das breitblättrige Knabenkraut, der gelbe Frauenschuh oder Arnika.
in den Hintergrund gerückt sei.
den, was zum gegenseitigen Informationsaustausch geführt habe.

Kurz nach dem Mauerfall und der Grenzöffnung zur Tschechoslowakei habe bereits am 9. Dezember 1989 die Geburtsstunde des Grünen Bandes durch den BN in Bayern geschlagen. Zunehmende Aktivitäten in den 1990er Jahren und schließlich die einstimmig verabschiedete Resolution „Grünes Band“ sollten wertvolle Habitate und Biotope dauerhaft in diesem europäischen Grenzstreifen als ökologisches Rückgrat Europas sichern. Vor allem Bildungsarbeit und politische Arbeit seien nun angesagt gewesen sowie die Gewinnung von Unterstützern aus der Zivilgesellschaft.
Neben der Artenvielfalt hätten Relikte dieser Region wie Grenzsicherungsanlagen als Erinnerungsstücke an diese Zeit gesichert werden müssen. Etwa für die Waldbirkenmaus seien Flächen des Grünen Bandes einer von drei noch möglichen Lebensräumen. Der Laubfrosch finde hier
Natürlich berichtete Kuba auch über Rückschläge, betonte aber die völkerverbindende Wirkung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wobei er insbesondere den bayerisch-tschechischen Grenzraum – auch wegen des dichten Netzes – als Herzstück bezeichnete. Mit Perspektiven oder dem Blick auf die Strukturen und das gesamte Grüne Band, aber auch den Schwierigkeiten durch den Krieg in der Ukraine schloß Kuba. Exemplarisch nannte er noch das von August 2018 bis Dezember 2024 laufende Projekt „Grenzüberschreitende Renaturierung von Mooren zur Unterstützung der Artenvielfalt und des Wasserhaushalts im Böhmerwald und im Bayerischen Wald“.
Gänzlich andere Inhalte bot Michael Neuberger, Geschäftsführer der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Cham, mit „Brückenschläge ins Grenzland. Impressionen vom tschechischen Jakobsweg und Forschungen zur jüdischen Geschichte“. Er habe keine biographischen Bezüge nach Böhmen, sei aber von frühester Kindheit an eben mit der

Nach der Rückkehr in die Heimatregion und bei einer Veranstaltung über jüdische Geschichte im Landkreis Cham habe er festgestellt, daß der Großteil der damaligen Juden in Stadt und Landkreis Cham biographische Wurzeln in Böhmen gehabt habe. Damit seien sein tieferes Interesse an diesem Thema und sein Forschergeist geweckt worden. Dieser habe ihn in viele tschechische Orte wie Klattau oder Neumark geführt, wo aber meist keine Zeugnisse jüdischen Lebens mehr existierten. Leider beschäftigten sich nur wenige Tschechen mit diesem Thema. „Mit der Vertreibung der Deutschen ist auch Wissen der jüdischen Gemeinden verlorengegangen“, stellte Neuberger fest. Einzig – und oft versteckt – seien jüdische Friedhöfe erhalten, bisweilen aber in schlechtem Zustand.
Beim zweiten Aspekt seines Vortrags kam der Referent auf den Grenzübergang Neuaign–Neumark zurück. Hier stehe heute anstelle des Schlagbaums der Jakobsstein und weise auf den Jakobsweg hin. In der Tschechischen Republik gebe es sechs Routen des Jakobsweges, er begleite ein- bis zweimal im Jahr Pilgergruppen. Anhand von Bildern zeichnete er Begegnungen bei Veranstaltungen über den Jakobsweg ab etwa 2013 nach, wies auf den tschechischen Jakobusverein Ultreia hin und stellte fest, daß hier eine Brükke zwischen Tschechen und Deutschen entstanden sei. Coronabedingt seien die Aktivitäten zuletzt weniger geworden, doch auf beiden Seiten bestehe der Wunsch, dies wieder aufleben zu lassen, schloß Neuberger.
Nach zwei Jahren der Unterbrechung durch Corona stehen wir hier wieder gemeinsam, um der deutschen Angehörigen der Wehrmacht zu gedenken, die nicht nur im Krieg, sondern nach Kriegsende im Mai 1945 in Gefangenschaft in den Weiten Rußlands und auch auf deutschem Boden sterben mußten.
In unserem Land gab es ein völkerrechtswidriges Ereignis, das mehr als 90 Prozent unserer Bevölkerung unbekannt ist. Auf Äkkern und Wiesen waren in 23 Lagern entlang des Rheins und Neckars jeweils mehr als 100 000 Soldaten monatelang bei mangelhafter Ernährung und medizinischer Unterversorgung hinter Stacheldraht eingepfercht.

Das Kommando und die Verantwortung für dieses Kriegsverbrechen hatte General Dwight D. Eisenhower. Die Zahl der in diesen Lagern gestorben Soldaten konnte niemand zählen.

Deportation. Das geschah in den vergangenen Jahren am Kreuz des Ostens im Anschluß an das allgemeine Totengedenken. Bei der Planung für dieses Jahr haben wir uns entschieden, das an dieser Stelle stattfinden zu lassen. Das Denkmalkreuz wurde inzwischen erneuert, dafür unserem Bürgermeister Stefan Pinhard und den Städtischen Gremien ein herzliches Dankeschön.
Am vergangenen Samstag war ich mit meiner Frau Marlene – für die Anwesenden, die es nicht wissen, sie ist eine Vertriebene aus dem Sudetenland – in Wiesbaden zu einem Sudetendeutschen Treffen. Wir haben dort eine uns persönlich bekannte Lehrerin aus Kaaden in Nordböhmen, Veronica Kupková, getroffen. Sie hatte vor Jahren einen persönlichen Film über das Schicksal von vier Personen gezeigt, die die Zeit der Wilden Vertreibung 1945 aus dem Sudetenland erleben mußten. Darunter war ein Mann aus einer Mischehe, er konnte im Land bleiben.
bayerisch-tschechischen Grenze in Kontakt gewesen. Sein Vater sei bis 1968 Zollbeamter am bayerisch-tschechischen Grenzübergang von Eschlkam-Neuaign nach Neumark/Všeruby gewesen, auch wenn dieser dann für ihn, Neuberger, bis 1989
Dann wurden die Vorträge diskutiert und vertieft. Mit geistlichen und meditativen Liedern sorgte Jana Vlčková aus Pilsen – diesmal aber aus Taus – für einen ruhigen und besinnlichen Schluß der Veranstaltung.
Markus BauerDer Kanadier James Bacque führte in seinem Buch „Der geplante Tod“ die Zahl von 700 00 bis 900 000 an, Historiker erkannten 200 000 bis 250 000 Tote an. Durch einen Aufruf in der „Hessischen/ Niedersächsischen Allgemeinen“ zu diesem Thema bin ich in den Besitz von 4000 Zeitzeugen-Dokumenten gekommen, die in dem Entlassungslager Darmstadt von deutschen Soldaten in unterschiedlichem Seitenumfang verfaßt wurden.
Mein Buch über dieses Thema hatte anfangs den Titel „Rheinwiesenlager – Ein Trauerspiel in Deutschland“. Mit der erweiterten Ausgabe vom September 2022 wurde der Titel erweitert: „Rheinwiesenlager und Politische Lager“. In diesen 271 ermittelten Lagern waren in Deutschland deutsche Frauen und Männer inhaftiert, die in Adolf Hitlers Partei NSDAP und ihren Untergliederungen aktiv waren.
Alle in den Lagern Gequälten und Verstorbenen schließen wir in unser Gedenken ein.
Ich wurde angekündigt mit einem Gedenken an die Opfer von Flucht, Vertreibung und
Teile des Films wurden inzwischen in professioneller Art neu gedreht beziehungsweise ergänzt und erweitert um viele Dokumente und tschechische Presseberichte. Ein einmaliges Dokument über das Geschehen, gezeigt an vier Familienschicksalen. Aber noch umfangreicher dokumentiert ein Buch mit mehr als 700 Seiten mit dem Titel „Blutiger Sommer 1945“ des Tschechen Jiří Padevět die Verbrechen seiner Landsleute. Auf jeweils zwei
Seiten sind die einzelnen Tatabläufe mit Fotos und Text in den verschiedenen Orten und Gebieten dargestellt.
Wir gedenken all der Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation aus ihrer Heimat in allen ehemaligen deutschen Ostgebieten. Menschen wurden gequält, vergewaltigt, erschlagen, erhängt oder erschossen. Und wer Glück hatte, wurde 1946 in Viehwaggons mit 30 Personen in der Phase der sogenannten ordnungsgemäßen und humanen Vertreibung aus seiner Heimat Sudetenland abtransportiert.
Ende November fand die vorweihnachtliche Jahres abschlußfeier der badenwürttembergischen SL-Kreis gruppe Stuttgart und der Heimatgruppe des Deut schen Böhmerwaldbundes (DBB) Stuttgart im Haus der Heimat in Stuttgart statt.



Unter den zahlreichen Be suchern der Jahresab schlußfeier war die weih nachtliche Vorfreude bereits zu spüren. So stimmten sich die Heimatvertrie benen bei Kaffee und köstlichem Christstollen auf das be vorstehen de Christ fest ein.
Unter dem Leitwort „Weih nachten im Böhmer wald“ sorg ten Elisabeth und Stefanie Januschko, die Trägerinnen des kulturel len Förderpreises der SL, und ihre Eltern Martin und Sabi ne Januschko für die entspre chende musikalische Umrah mung des Nachmittags.
Auch einige Ehrengäste, wie Birgit Kern, die Bundes vorsitzende des Deutschen Böhmerwaldbundes, Gerda Ott, die Bundesfrauenrefe rentin der Sudetendeutschen Landsmannschaft, und Rudolf Tauber, der Vorsitzende der Böhmerwaldgruppe Stuttgart, waren ins Haus der Heimat gekommen, um sich zusam men mit den anderen Sude tendeutschen auf die Adventsund Weihnachtszeit einzu stimmen.


Waltraud Illner, die Ob frau der SL-Kreisgruppe Stutt gart, erinnerte in ihren Ein gangsworten an die Stimmun gen aus der Weihnachtszeit, die besonders an die Kindheit
und die Heimat denken las sen. Dabei habe sie tiefen Re spekt vor den Heimatvertrie benen der Erlebnisgenerati on, die trotz der schrecklichen Erfahrung der Vertreibung auf beeindruckende Weise den Dialog und die Zusammenar beit mit den Nachkommen je ner Menschen pflegten, die ihnen nicht wohlgesonnen ge wesen seien.
Kreisobfrau Waltraud Ill ner machte aber auch deut lich, daß die heimatlichen Tra ditionen und Bräuche gepflegt werden müßten und nicht in Ver gessen heit gera ten dürf ten. Dabei sei es Auf gabe, die Kultur der angestamm ten Heimat auch den nach folgenden Gene rationen weiterzuge ben.


Familie Januschko, die aus dem oberbayerischen Puch heim nach Stuttgart gekom men war, bot bei ihrem musi kalischen Streifzug durch die Weihnachtszeit ein tolles Pro gramm mit Gesang und Instru mentalmusik, unterlegt mit schönen Gedichten in Mund art und adventlichen Ge schichten. Neben den Eltern Martin und Sabine Januschko zählten dazu auch die Töchter und Zwillingsschwestern Eli sabeth und Stefanie Janusch ko, die im Jahr 2020 in der Ka tegorie „Darstellende Kultur“ den kulturellen Förderpreis der Sudetendeutschen Lands mannschaft erhalten hatten. Inzwischen treten die beiden Musikerinnen auch als das Duo „Zwolinge“ auf und ver öffentlichten bereits ihre er ste CD, die den Titel „Skippo“ trägt. Helmut Heisig
Mitte Oktober unternahm die bayerische SL-Bezirksgruppe Mittelfranken einen dreitägigen Ausflug nach Nordböhmen.
Kultur ist das Bindeglied zwi schen Menschen unter schiedlicher Länder, Sprachen und Religionen über Grenzen hinweg. Dabei ist sie angewie sen auf Begegnung und Verstän digung, auf Verständnis sowie Überwindung von Vergangenem und Voreingenommenheit. Die ser Erkenntnis folgend, nahmen 41 Landsleute an der Fahrt in die Heimat teil.
Christoph Lippert, Obmann der mittelfränkischen SLKreisgruppe Erlangen und ehemaliger SL-Bundes geschäftsführer, hatte die Dreitagesfahrt nach Aus sig/Ústí nad Labem und Tetschen-Bodenbach/ Děčín bestens vorbereitet. Nachdem Bezirksobmann Eberhard Heiser die Lands leute begrüßt hatte, hob Lippert hervor, das Ziel die ser Fahrt sei das Erleben des vom Zusammenleben der Böhmen und böhmischen Deutschen geprägten Land strichs an der Elbe. Die Ge burt des Nationalismus im 19. Jahrhundert, Unzufrie denheit und reale oder ver mutete Ungerechtigkeiten seien der Nährboden für die zunehmende Entfremdung und Konfrontation zwischen wei ten Teilen der beiden Nationen gewesen, was nach dem Zweiten Weltkrieg mit Billigung der Sie germächte zur Vertreibung der Sudetendeutschen geführt habe.
Bereits bei der Anfahrt wech selte sich Schönes mit Ergreifen dem. Bei Lobositz/Lovosice ver ließ der Bus die neue Autobahn nach Aussig, um auf der alten Trasse bei Sonnenschein durch das herbstliche Elbetal zu fahren.
Kurz vor Aussig informierte Reiseleiter Lippert über das Aus siger Massaker. Für die mächti ge Explosion im Stadtteil Schön priesen am 31. Juli 1945 habe man die deutsche Partisanenor ganisation Werwolf verantwort lich gemacht. Legionäre und Ma rodeure, die verdächtigerweise schon am Vortag aus Prag in Aus sig eingetroffen seien und sich mit Knüppeln bewaffnet hätten, hätten eine schreckliche Hetz jagd auf Deutsche begonnen, die an ihren weißen Armbinden er kennbar gewesen seien. Insbe sondere auf der Beneš-Brücke habe der Mob gewütet, habe deutsche Passanten in die Elbe geworfen und auf die Überleben den geschossen.






Ernsthafte deutsche und tschechische Historiker glaub ten heute, daß die Vorkommnisse von Prag aus inszeniert worden seien, um die gerade beginnende Potsdamer Konferenz zu beein flussen. Seit 2005 erinnere eine von der Stadt Aussig angebrach te Gedenktafel auf der Brücke an diese schlimmen Ereignisse.
Ein Gedenken an dieser Tafel mit Niederlegung eines Gebin des war die erste Station. Dann ging es zur Ausstellung „Unsere Deutschen“ beim Collegium Bo hemicum im Gebäude des Aus siger Stadtmuseums. Das Colle gium Bohemicum ist ein Institut
für die Geschichte der Deutschen in den Böhmischen Ländern und widmet sich den deutsch-tsche chischen Beziehungen und dem Kulturerbe der deutschsprachi gen Bevölkerung in Böhmen.
Bei der Präsentation von Aus stellungsstücken wird besonde rer Wert darauf gelegt, authenti sche Stücke mit moderner Tech nik zu kombinieren. Nicht nur das Böhmerland-Motorrad, das in Aussig und München gezeigt wird, macht die Verwandtschaft mit dem Sudetendeutschen Mu seum deutlich. Der Tag endete nach dem Beziehen der Zimmer im Hotel Česká Koruna, früher
bach. Das Mahnmal für die Ge fallenen des Ersten Weltkriegs aus den 1930er Jahren war nach der Vertreibung zerstört worden. Die Initiative von Tetschener Ar chivaren und das Geld aus dem tschechischen Verteidigungsmi nisterium hatten 2016 eine ori ginalgetreue Rekonstruktion er möglicht.
Nächstes Ziel war das Stadt museum Tetschen mit der Aus stellung „Hoffnung – Enttäu schung – Angst“ über das Le ben der Deutschen in der Region von 1938 bis 1946. Gezeigt wur den Bilder der Euphorie beim Einmarsch der Wehrmacht nach
Die SL-Landesgruppe Berlin ver trat den SL-Bundesverband bei der Internationalen Gedenkfei er des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Volks trauertag in Berlin.
Der Opfer von Krieg und Ge walt zu gedenken – das ist das zentrale Motto des Volks bundes Deutsche Kriegsgräber fürsorge am Volkstrauertag. Da bei geht es um die Kriegstoten aller Länder. Die Gedenkfeier fand auf dem ehemaligen Stand ortfriedhof an der Lilienthalstra ße zu Berlin-Neukölln statt, „der zentralen Gedenkstätte unserer Organisation“, wie VolksbundGeneralsekretär Dirk Backen diese bezeichnete. Eine Abord nung uniformierter Fackelträger des Wachbataillons der Bundes wehr verlieh der abendlichen Ge denkfeier am 12. November ei nen feierlichen Anstrich.

Einer mittlerweile über Jahr zehnte gepflegten Tradition fol gend, legte der SL-Landesob mann Rudolf D. Fischer in Ver tretung von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und SL-Bundesvor sitzender, vor Ort einen Gedenk kranz nieder.
Der Einladung des Volksbun des zur Teilnahme an dieser Ge denkfeier folgten zahlreiche, dar unter auch viele internationale Gäste. Das waren vor allem die Militärattachés zahlreicher Län der von Chile bis Tansania. Be grüßt wurden auch der Vize-Ge neralinspekteur der Bundeswehr, Markus Laubenthal, und die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl.
Krone, im Schloß Tetschen mit einem Vortrag der Historikerin Marcela Zemanová über die Fa milie Thun, die dort über Jahr hunderte ansässig war.
Der zweite Tag begann mit ei nem kurzen Fußweg zum Schloß. Die engagierten Archivare Jan Němec und Petr Joza zeigten das dort untergebrachte staatliche Kreisarchiv Tetschen, das auch für die ehemaligen Kreise Rum burg, Schluckenau, Warnsdorf und Böhmisch Kamnitz zustän dig ist. Inzwischen beherbergt es 2,5 Regal-Kilometer. Die ältesten Archivalien sind ein Stadtbuch von Böhmisch Kamnitz von 1380 und ein Privilegium der Tetsche ner Schuhmacherzunft von 1384.

Besondere Aufmerksamkeit fand die Heimatstube von Tet schen-Bodenbach, die der Hei matkreisverein vor seiner Auf lösung 2018 aus Nördlingen an das Tetschener Archiv abgege ben hatte, und die dort vorbild lich präsentiert und verwaltet wird. Die Archivare berichteten von permanent vielen Anfragen nachgeborener Tetschener nach ihren Vorfahren, die nach Re cherche in der umfangreichen Heimatdatei meist beantwortet werden könnten.
Durch die herrschaftlichen Räume im Schloß führte Helena Šimáková. Als einige von ganz wenigen Deutschen war sie nicht vertrieben worden, durfte in Tet schen bleiben und lebt bis heute im Anwesen ihrer deutschen Vor fahren. Den prächtigen Räumen im Schloß ist nicht mehr anzuse hen, wie schlimm das russische Militär dort von 1968 bis 1989 ge wütet hatte. Das gesamte Anwe sen war in den Folgejahren auf wendig renoviert und neu mö bliert worden.
Nach dem Mittagessen führ te Šimáková zunächst zum Ge fallenendenkmal von Boden
dem Münchener Abkommen ebenso wie erst kürzlich gefun dene Fotos aus dem Alltagsleben in jener Zeit. Die Ausstellung er innerte an das Zwangsarbeiterla ger Rabstein und an Luftangriffe, Zerstörung, Angst und Flucht zu Kriegsende.
Bei einem Spaziergang am Elbufer mit herrlichem Blick auf das Schloß wurde das im Muse um Erlebte verarbeitet. Der Tag endete mit einem Volkstums abend im Gewölbekeller des Pi vovarská Restaurace Kapitán. Bei Musik und lustigen Vorträgen lö ste sich die Anspannung der letz ten beiden Tage.
Für die Heimfahrt hatte sich Lippert noch einen Höhepunkt ausgedacht: eine Kahnfahrt durch die Edmundsklamm in der Böhmischen Schweiz. Sie muß te ausfallen, da die Klamm nach den verheerenden Waldbränden in den Vorwochen noch nicht wieder zugänglich war. Aber der Fußweg zum Prebischtor war kurz vor der Reise wieder eröff net worden.
So machten sich die Teilneh mer auf den einstündigen Auf stieg durch abgebrannten Wald und über verbrannte Erde. Glück licherweise hatte das Feuer das Prebischtor selbst und die Ga stronomie dort nicht beschädigt. Der großartige Ausblick jedoch wurde durch verbrannten Wald rings um die Höhe des Prebisch tors getrübt. Nach dieser Vor mittagswanderung ging es wei ter mit dem Bus durch das herr liche Elbetal über die sächsische Grenze. Nach einem guten Essen und viel Gesprächsstoff im Ho tel-Restaurant Zur grünen Linde in Großschirma und der abendli chen Rückkehr in Lauf, Rückers dorf und Nürnberg endete diese erlebnisreiche Reise in die Hei mat der Vorfahren.
Nachdem das Stabsmusik korps der Bundeswehr „The Water Is Wide“ intoniert hat te, sprach Generalleutnant Mar kus Laubenthal und betonte: „Friede und Freiheit, Demokra tie und Rechtsstaatlichkeit sind durchaus keine Selbstverständ lichkeit.“ Er kritisierte die völ kerrechtswidrigen Ziele, die das russische Regime in der Ukrai ne verfolgt. Dann zitierte er mit Blick auf die Opfer des Krieges im Osten den ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss mit den Worten: „Das Op fer der Toten ist unsere Verpflich tung zum Frieden.“ Vielmehr be stehe die historische Verpflich tung der Deutschen darin, nie wieder gleichgültig gegenüber den Opfern von Krieg und Ge walt zu sein.
Der feierlichen Kranznieder legung, akustisch untermalt von einem Trommelwirbel, folgten das Totengedenken, vorgetragen vom Volksbund-Präsidenten und General a. D. Wolfgang Schnei derhan, sowie ein ökumenisches Gebet. Mit dem Lied vom „Guten Kameraden“ und der deutschen Nationalhymne endete diese würdevolle Gedenkfeier. rufi
Schüler des Gymnasiums aus Podersam/Podbořany in der Saazer Pfanne in Nordwestböhmen besuchten im Spätherbst die Podersam-Jechnitzer Heimatstube im oberfränkischen Kronach.
Zum Heimatmuseum waren ein drittes Mal tschechische Schüler aus dem Heimatkreis angereist. Im Spätherbst begaben sich die von zwei Lehrerinnen begleiteten 47 tschechischen Gymnasiasten auf Spurensuche in unserer Heimatstube. Diese liegt gegenüber dem neuen Rathaus von Kronach.
Vor Ort berichtete ich, die Leiterin der Heimatstube, über die Geschichte von Kronach und die früheren Verbindungen nach Böhmen, insbesondere zu dem Bezirk Podersam. So hätten die Porzellanfabriken wie Rosenthal, Kaiser und so weiter ihr Kaolin, den Rohstoff für das Porzellan, von dort bezogen. Nachweislich hätten auch die Granitwerke Granit und die Brauereien ihren Hopfen aus der Region Podersam gekauft.
Eine große Bezirkskarte der Region östlich von Karlsbad, erläuternde Texte über die Ausstellungsgegenstände und die Dokumentation der Vertreibung führen in die Geschichte des Heimatkreises ein. Die ausgestellten persönlichen Erinnerungsstükke machen die Vergangenheit lebendig. In mehr als 100 Leitzordnern und 100 Klappwandtafeln befinden sich Unterlagen von allen Orten des Podersamer und Jechnitzer Gebietes. Neun Städte, zwei Marktflekken und weitere 81 selbständige Gemeinden – von Alberitz bis Zürau – gehören dazu.
ČerňanskýDer Riesengebirgler Johann Faltis war ein Leinenindustrieller und Begründer der mechanischen Flachsspinnerei in Österreich, deren Mittelpunkt Trautenau war.




Johann Faltis kam am 6. April 1796 in Nieder Wölsdorf bei Königinhof nahe Trautenau zur Welt. Nach der Ausbildung im Prager Handelshaus Neupauer & Co. trat er 1820 in das väterliche Geschäft für Kolonial-, Material- und Leinenwaren in Schurz bei Königinhof ein. 1823 gründete er in Trautenau eine Leinenmanufaktur und Leinenweberei. 1832 war Johann Faltis vorübergehend Leiter der Graf Harrach‘schen Leinenfabrikation in Starkenbach im Riesengebirge und in Janowitz in Mähren sowie Leiter der Warenniederlage in Wien. Anschließend baute er ein eigenes Industrieunternehmen auf, das zu einem der erfolgreichsten der Österreich-Ungarischen Monarchie wurde.
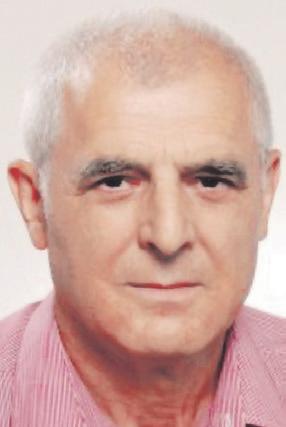
Anschließend an die Erstinformationen wurden zwei Gruppen gebildet. So besichtigte ein Teil der Schüler zuerst die historische Altstadt von Kronach. Die andere erkundete die Heimatstube. Zuerst eine kurze Vorstellung meinerseits. Ich, Ute Bräuer, kam 1941 in Podersam zur Welt und wurde 1946 vertrieben. Beim ersten Transport im April 1946 kamen 400 Personen aus dem Kreis Podersam, zu dem Jechnitz gehörte, in den Landkreis Kronach. Deshalb übernahm 1955 Kronach die Patenschaft für die Vertriebenen der ehemaligen Gerichtsbezirke Podersam und Jechnitz. Daher befindet sich auch die Heimatstube in Kronach.
Die Schüler waren von ihren Lehrkräften gut vorbereitet worden. Außer Schülern aus Podersam waren auch Schüler aus Kriegern, Petersburg, Strojeditz und so weiter dabei. Besonders beeindruckt waren sie von den vielen historischen Ansichtskarten. Es machte sie betroffen zu erkennen, was alles zerstört worden war und deshalb nicht mehr vorhanden ist. Ihnen wurden dazu auch von ihren Lehrerinnen Aufgaben gestellt. Sie mußten zum Beispiel Texte in das Tschechische übersetzen.
Mit Interesse sichteten sie auch die Unterlagen über den Hopfenanbau. Zu sehen gibt es auch Hopfenviertel oder Hopfenmaß in Holz und Blech sowie eine Sammlung von Hopfenblecheln oder Hopfenmarken. Für jedes volle Hopfenviertel gab es ein Blechl, das später gegen Geld eingelöst wurde.
Nach eineinhalb Stunden war Schichtwechsel. Die zweite Gruppe war genauso begeistert über die Dinge, die zu erforschen waren. Bei der zweiten Gruppe war die Enkelin des ehemaligen Bürgermeisters Josef Čerňansky dabei. Er hatte 1994 als erster Bürgermeister die Heimatstube von Podersam besucht.
Sie freute sich über das Foto ihres Großvaters im Besucherbuch.
Der Tag endete mit einem Besuch der Ausstellung „550 Jahre Lucas Cranach“ auf der Festung Rosenberg. Uta Bräuer
1835 ließ Johann Faltis englische Fachkräfte kommen, mit denen er in Pottendorf in Niederösterreich eine Werkstatt zur Erzeugung von Flachsspinnmaschinen mit Holzspindeln aufbaute. Er ließ 1836 in Jungbuch in Böhmen die ersten in Österreich gebauten Flachsspinnmaschinen aufstellen und stattete das dortige Werk mit englischen Antriebsmaschinen aus. Er erweiterte diese Produktion von 1848 bis 1864 durch den Aufbau weiterer Flachsgarnspinnereien im Flußtal der Aupa in und bei Trautenau. Nach 1864 gründete er weitere Unternehmen in Hainitz bei Bautzen in Sachsen und in Liebau im Landkreis Landeshut in Niederschlesien.
Bei der im Jahr 1864 mit seinem Geschäftspartner Emil Grützner gegründeten Flachsgarnspinnerei Grützner und Faltis in Hainitz übergab Johann Faltis 1866 seine Firmenanteile an seine Tochter Anna Porak/ Faltis (* 23. Mai 1823 in Schurz bei Königinhof) als stille Gesellschafterin. 1882 übergab Emil Grützner seine Anteile an dem Unternehmen in Hainitz Johann Faltis‘ Enkel Alfons Porak (1851–1910), einem Sohn der Anna Porak/Faltis und des Anton Porak (1815–1892). Anton Porak war Arzt und Politiker, nach 1854 praktizierender Arzt in Trautenau, 1861 bis 1866 Bürgermeister von Trautenau und Reichsratsabgeordneter. Die Fabrikation in Hainitz hatte in dieser Zeit 13 000 Spindeln, be-
hann Faltis Erben beherrschte bis 1918 den europäischen Flachsmarkt. Seit 1885 war der Enkel
auf einer Karte von 1873.

Ernst Franz Xaver Porak (1849–1918) öffentlicher Gesellschafter der Firma Johann Faltis Erben in Trautenau, Hainitz und Liebau. Der Großindustrielle war ebenfalls ein Sohn der bereits oben erwähnten Eheleute Anton und Anna Porak/Faltis. 1895 wurde er in den Adelsstand erhoben und erhielt den Namenszusatz de Varna.

Trautenau und kleinere Firmen festigten den Ruf Trautenaus als internationalen Mittelpunkt der Leinenproduktion und des Leinenhandels. Eine wöchentliche, 1875 vom Industriellen Aloys Haase (1811–1878) gegründete Garnbörse und ein jährlich abgehaltener Flachsmarkt fanden europaweites Interesse und machten die Stadt Trautenau nach dem Stadtbrand von 1864 und dem PreußischÖsterreichischen Krieg des Jahres 1866 zu einer wohlhabenden, aus Stein gebauten Stadt.

Hainitz auf einer Karte von 1884 mit altem Dorfkern im Osten, Fabrik, Kapelle und katholischem Friedhof an der Spree im Westen. Rechts eine Aktie über 1000 RM der Flachsspinnerei Hainitz AG vom Juli 1942.
schäftigte etwa 700 Arbeiter und bestand bis zum Jahre 1931.
Im Jahre 1858 erblindete Johann Faltis, leitete die Firmengruppe der Leinenindustrie unter Mithilfe von Angehörigen weiter und starb am 18. Februar 1876 in Trautenau. Die Firma Jo-
Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs blieb Trautenau im Riesengebirge der Mittelpunkt der Flachsindustrie der Österreich-Ungarischen Monarchie. Die Flachsspinnereien Johann Faltis Erben mit 40 000 Spindeln und etwa 2000 Beschäftigten, die Firma Aloys Haase mit 27 000 Spindeln und etwa 1300 Beschäftigten, die Firma Gebrüder Walzel in Parschnitz, einem Vorort von
Nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 bescherten die folgende Inflation und das Wegbrechen der gewachsenen Absatzmöglichkeiten durch Handelsbeschränkungen der Regierung in Prag den Beschäftigten des Industriegebietes Trautenau eine Massenarbeitslosigkeit. Die Firma Faltis Erben kam in finanzielle Schwierigkeiten.
1938 schlossen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien das Münchner Abkommen, und die Truppen des Deutschen Reiches marschierten in das Sudetenland ein. Am Ende des Zweiten Weltkriegs besetzte die Sowjetarmee das Sudetenland. Anschließend enteigneten die tschechoslowakischen Behörden die deutsche Bevölkerung Trautenaus und vertrieben sie. Die Stadt verarmte, und die Firma Johann Faltis Erben in Trautenau hörte auf zu bestehen.
Nadira HurnausDie Sanierungsarbeiten an der Gruftkapelle auf dem Friedhof in Buschullersdorf wurden im September offiziell abgeschlos sen (Þ RZ 44/2022). Mitte No vember segnete der Haindorfer Pfarrer Pavel Andrš die Kapel le, in der sich fünf Zinksärge mit den sterblichen Überresten der bedeutenden Familien Neuhäu ser und Berger befinden.







Am 4. Dezember 1890 wur de die offizielle Genehmi gung für den Bau des Friedhofs erteilt, und am 1. April 1891 be gannen die Arbeiten. Die erste Beerdigung fand hier am 7. Ju li 1891 statt. Beerdigt wurde Ju lia Pfeifer aus Haus Nr. 141. Am 27. August 1892 wurde die Lei chenhalle mit einer Glocke aus gestattet, die von Robert Zels mann aus Reichenberg geliefert wurde. Die Glocke ist zum ersten Mal bei der Beerdigung von Te resia Preibisch aus Haus Nr. 48 geläutet worden. Ein Jahr nach der Gründung des Friedhofs –im September 1892 – kaufte der Fabrikant Franz Neuhäuser die erste Gruftstelle.
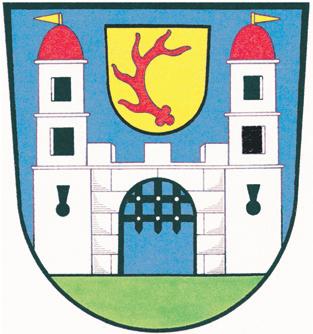
Für die Wiederherstellung dieser Gruftkapelle, die sich jah relang in einem erbärmlichen Zustand befunden und um die sich niemand gekümmert hatte und die nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei in Vergessen heit geraten war, setzte sich der Bürgerverein Živo v Hájích (Le ben in Buschullersdorf) ein. Au ßer der Kapelle segnete Pfarrer Pavel Andřs noch fünf weitere deutsche Gräber.
Der Verein hatte mit der Fried hofssanierung einen Beitrag zur tschechisch-deutschen Aussöh nung geleistet, die nach wie vor ein aktuelles Thema ist. Der 2013 von der Buschullersdorfer Chro nistin und Stellvertretenden Bür germeisterin Jiřina Vávrová mit begründete Verein organisiert seit dieser Zeit kulturelle Ver anstaltungen und versucht, Bu schullersdorf zu verschönern.
Die Sanierung der Gruftkapel le begann 2016 und war bis jetzt das größte Pro jekt des Vereins.
Die Gemein de Buschullers dorf, die tsche chisch Oldřichov v Hájích heißt, befindet sich im Isergebirge neun Kilometer nörd lich von Rei chenberg und hat rund 800 Ein wohner. Durch den Ort führt die Straße von Rei chenberg über Einsiedel nach Friedland und Raspenau. Der kleine Ort, dessen Geschich te man bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen kann, war Be standteil der ehemaligen Herr schaft Friedland in Nordböhmen.
Pfarrer Pavel Andrš dankte der Feuerwehr und den vielen frei willigen Helfern, die daran betei ligt waren, die Gruftkapelle in ih ren ursprünglichen Zustand zu


versetzen. Nachdem Pfar rer Andrš die nahezu 60 Be sucher begrüßt hatte, erläu terte Vizebürgermeisterin Vávrová die Geschichte der Gruft. Trotz der seit Tagen herrschenden Kälte drän gelten sich die vielen Besu cher auf dem Platz vor der Gruft. Anschließend gab es für sie warmen Kaffee, Tee und Kuchen.
Glücklicherweise steht die Gruftkapelle – ein Ver mächtnis von Menschen, die hier vor vielen Jahren gelebt haben – nicht unter Denkmalschutz. Sie ist Ei gentum der Gemeinde. Der Verein hat sie von der Ge meinde für einen symboli schen Preis von einer Krone für die Dauer von zehn Jah ren gemietet.

„Ich glaube, daß die Ge meinde froh war, daß sie sich nicht mit der Renovie rung befassen muß. Offen bar hat man erwartet, daß die Gruft eines Tages ein stürzt oder daß sie jemand renoviert. Die Renovie rungsarbeiten hat der Ver ein übernommen und traf eine Vereinbarung mit der Feuer wehr, die uns half, weil der erste Kommandant der örtlichen Feu erwehr in dieser Gruft beerdigt wurde. Unter den Feuerwehrhel fern befanden sich auch Zimmer leute und Dachdecker, so daß die Gruft im Jahr 2017 ein neu es Dach bekam. In den folgenden Jahren wurden der Innen- und Außenputz und der Innenstuck erneuert und die Reinigung der Umgebung durchgeführt“, sagte Jiřina Vávrová.
Nachdem das Kupferdach von der Gruftkapelle gestohlen wor den war, drohte das Gebäude einzustürzen. Ziel des Vereins war es, den weiteren Verfall zu
die Gruft des ersten Komman danten der örtlichen Feuerwehr, Franz Neuhäuser, eines Tages einstürzt“, bedauerte die Chroni stin Jiřina Vávrová.
An der Seite seiner Frau The kla Berger, geborene Neuhäuser, die wegen einer Krankheit jahre lang besonders pflegebedürftig gewesen war und am 2. Dezem ber 1931 in ihrem 76. Lebensjahr starb, fand in der Familiengruft auch Franz Berger, der Kret scham- oder Dorfgasthofbesitzer, seine letzte Ruhe. Am 2. Novem ber 1937 hatte er noch im Kreis seiner Kinder und Enkel frisch und seinem Alter angemessen seinen 90. Geburtstag feiern kön nen. Anläßlich des besonderen Geburtstags be kam der Jubilar an diesem Tag viele Glückwün sche. Kurze Zeit danach – am 21. November 1937 – ist er seiner Frau Thekla nach fast sechs Jahren in die Ewigkeit gefolgt.
1931) und Franz Berger (* 2. No vember 1847, † 21. November 1937).
Bei den Zinksärgen sind teil weise Beschädigungen erkenn bar. Nach dem Krieg wurden viele deutsche Grüfte aufgebro chen, die Särge aufgerissen und die Leichen ausgeplündert. Die Spuren, die man bei der Eröff nung der Gruft entdeckte, las sen vermuten, daß auch in Bu schullersdorf Diebe am Werk waren.
Wie damals berichtet wurde, war auch der Na me Franz Berger nicht nur bei der damaligen Bevöl kerung des Ortes, son dern auch im Bezirk Fried land ein bekannter Begriff. Heute kennt kaum jemand sein Schicksal. Seine Ar beit erstreckte sich nicht nur auf seinen Wohnort. Auch im öffentlichen Le ben war er vielseitig tätig. Berger war jahrelang Mit glied der Bezirksvertretung und Mitglied mehrerer Be rufsgenossenschaften und Organisationen. Auch im Verband der Feuerwehr war er ein äußerst aktiver Funk tionär. Berger war Besitzer des Kretschams in Buschul lersdorf, wohin er einge heiratet hatte. Zuvor – am 3. April 1862 – hatte der Fabrikbesitzer Franz Neu häuser aus Haus Nr. 161 den Kretscham gekauft. 1904 überließ er den Kret scham mit der Gartenwirt schaft in Nr. 85 seiner am 11. Juli 1856 in Buschullers dorf geborenen Tochter Thekla, verehelichte Berger († 2. Dezem ber 1931), und deren am 24. No vember 1879 angetrauten Gat ten Franz Berger. Dieser war am 1. November 1847 in Philipps grund Nr. 4 als Sohn des am 18. Dezember 1873 verstorbenen dortigen Kretschamspächters Franz Berger und dessen Frau Theresia, geborene Prokop aus Friedland, zur Welt gekommen.

Aufgrund der bewilligten Sat zungsänderung fand am Kom mandantentag am 21. Febru ar 1904 in Friedland die Neu wahl des Verbandsausschusses der Feuerwehr statt, bei der auch Franz Berger gewählt wurde. Der Landesverband für Feuerwehrund Rettungswesen überreich te ihm in Würdigung seiner Ver dienste Ehrenabzeichen für 25, 40, 50 und 60 Jahre Treue.
Aber auch in der Gemeinde vertretung, in verschiedenen Ge meindekommissionen, im Turn verein, im Kameradschaftsverein und im Bund der Deutschen war er tätig. Besonders die Raiffei senkasse, deren Obmannstellver treter Berger 28 Jahre lang war, fand in ihm einen Förderer und Mitarbeiter. Sein ältester Sohn Richard fiel am 8. August 1917 an der russischen Front. Sein Name steht auf dem Gefallenendenk mal, das sich auch auf dem Fried hof gegenüber der Gruftkapelle befindet.

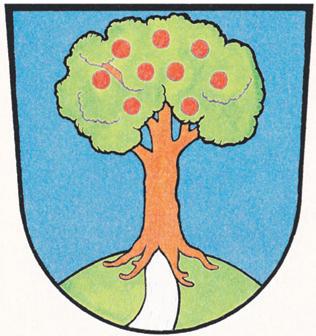
Die Mitglieder des Vereines waren sich einig gewesen, daß die Würde dieser Gruftkapelle, die ein Schandfleck auf dem örtli chen Friedhof gewesen war, wie der hergestellt werden müsse. Die Gruft bekam ihr ursprüngli ches Aussehen zurück. Den Ein gang schützt jetzt ein verschließ bares Eisengitter.
verhindern. Im Dezember 2015 wurde das Dach der Gruftkapel le vorübergehend mit einer Plane abgedeckt.
„Wir können nicht so tun, als ob die deutschen Bewoh ner nie hier gelebt hätten. Es scheint menschenunwürdig, daß die Grabsteine der verstorbe nen ehemaligen deutschen Ein wohner in den Brennnesseln lie gen und man darauf wartet, daß

Auf den zwei schwarzen Glas platten, die sich an der Wand in der Grabkapelle befinden, sind die fünf Namen der Verstorbe nen vermerkt, die hier ihre letz te Ruhe fanden. Thekla Neu häuser, geborene Kretschmer († 7. Februar 1901), Franz Neu häuser (*1825, † 17. Dezember 1903), Richard Berger (* 27. April 1914, † 13. Dezember 1916), The kla Berger, geborene Neuhäu ser (* 11. Juli 1856, † 2. Dezember
Der erste Verein, der in Bu schullersdof ins Leben trat, war die Freiwillige Feuerwehr, die im März 1871 gegründet wur de. Die Anregung zur Gründung der Feuerwehr gaben Ferdinand Köhler aus Haus Nr. 184, Franz Neuhäuser aus Haus Nr. 6, Jo sef Peuker aus Haus Nr. 5, Karl Neuhäuser aus Haus Nr. 88 und Wilhelm Neuhäuser aus Haus Nr. 149. Mit einem Umlaufzettel zum Beitritt aufgefordert, mel deten sich in kurzer Zeit 70 Mann. Franz Neuhäuser wur de zum ersten Kom mandanten gewählt. Er war ein promi nenter und bedeu tender Bürger und Geschäftsmann. Am 30. August 1896 fei erte der Feuerwehr verein 25jähriges, am 27. August 1911 40jähriges, 1921 50jähriges und am 7. Juni 1931 60jähri ges Bestandsfest.
Nach der Eingliederung der Gemeinde Buschullersdorf in den Bezirk Reichenberg mach te er sich auch dort nützlich. Ber ger war auch ein verdienter Feu erwehrveteran. Seit 1872 war er Mitglied der Feuerwehr Bu schullersdorf, deren Ehren-Ver waltungsratsmitglied er war, und diente ihr 65 Jahre und zehn Mo nate. Während dieser Zeit war er ein aktiver Förderer des Feuer wehr- und Rettungswesens. Auch der Bezirks-Feuerwehrverband Friedland, dessen Ausschußmit glied er durch Jahrzehnte war, ernannte Berger zum Ehrenaus schußmitglied.
An die ursprüngliche deutsch sprachige Bevölkerung, die das wirtschaftliche und kulturel le Leben in diesen Regionen be deutend mitprägte, erinnern heute nur noch die Gruftkapel le und die wenigen Gräber mit der deutschen Schrift, die sich an der Friedhofsmauer befinden. Nach dem letzten Transport im Oktober 1946 sind von den ur sprünglich 1500 Einwohnern nur noch etwa 15 deutsche Famili en im Dorf geblieben. Auf dem einst deutschen Friedhof zerstör ten Kinder im Jahr 1967 insge samt 116 deutsche Gräber. In den siebziger Jahren wurden die Re ste der Gräber von dem Friedhof entfernt.
Dem Verein ging es nicht nur darum, den Friedhof schön aus sehen zu lassen. Mit der Reno vierung der Gruftkapelle gelang ihm auch, ein Stück unserer Hei matgeschichte zu erhalten. Die Renovierung bot auch die Ge legenheit, die Nachkriegsge schichte in Buschullersdorf auf zuarbeiten und die ursprüng lichen Vertriebenen mit den neuen Bewohnern zu verbinden. Jeder, der den Friedhof besucht, ist erstaunt über die großartige Arbeit, die der Verein hier leistete. Daß die Gruftkapelle heute sorgfältig restau riert ist und von weitem strahlt, das ist vor allem dem Bürgerverein Le ben in Buschullersdorf und der Stellvertreten den Bürgermeisterin Jiřina Vávrová zu ver danken. Als nächstes ist die Sanierung der Friedhofsmauer eingeplant.
Stanislav BeranHeimatkreis und Gemeindebe treuer gratulieren allen treu en Abonnenten aus dem Kreis Deutsch Gabel, die im Dezem ber Geburtstag feiern, und wün schen von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
n Glasert – Geburtstag: Am 18. Reinhard Görner (Haus-Nr. 1), Im Borngarten 8, 36166 Hau netal, 90 Jahre. Othmar Zinner
n Finkendorf – Geburtstag: Am 18. Ilse Redlinger (Witwe von Franz Redlinger, Schwarzpfütz Nr. 15), Schleiermacherstraße 21, 71229 Leonberg, 99 Jahre.
Othmar Zinner
n Großmergthal – Geburts tag: Am 4. Anna Goth (HausNr. 129), Witzenberger Stra ße 4a, 87764 Legau, 98 Jahre.
Othmar Zinner
n Hennersdorf – Geburtstag: Am 18. Dr. Josef Gürlich (HausNr. 137), Potsdamer Straße 7, 14669 Ketzin, 92 Jahre.

Rosl Machtolf

Die neue, Wenzel getaufte Glok ke für die Kapelle der Heili gen Dreifaltigkeit in Proschwitz wurde Ende Oktober unter Be teiligung vieler Besucher feier lich eingeweiht. Die Gemein de Proschwitz/Proseč pod Ještědem liegt neun Kilometer südlich des Stadtzentrums von Reichenberg.



Nach fast 100 Jahren erklingt jetzt in der Dreifaltigkeitska pelle jeden Tag die neue Glocke, die dem heiligen Wenzel gewid met ist. Die Kapelle wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun derts erbaut. Die erste Repara tur wurde 1826 durchgeführt, die nächste folgte 1883. Im Jahr 2005 wurde das Gebäude der Kapelle komplett saniert, als ihr Ende we gen ihres baufälligen Zustands unmittelbar bevorstand.
Die neue Glocke ist die drit te Glocke, die in der Gemeinde installiert wurde. Während des Ersten Weltkriegs wurde die er ste Glocke eingeschmolzen, die zweite wurde in den neunziger Jahren des vergangenen Jahr hunderts gestohlen. Die neue Glocke wurde aus einer öffentli chen Spendensammlung finan ziert, in der sich nach 17 Jahren rund 65 000 Kronen angesam melt hatten. Insgesamt wurden für die neue Glocke 150 000 Kro nen bezahlt. Den Rest finanzierte die Gemeinde Proschwitz.
Die neue Glocke wurde vom Glockengießermeister Michal Votruba aus dem südböhmischen Myslkovice/Miskowitz nach ei nem Entwurf des Bildhauers Vá clav Hrůza aus Soběslav/Sobies lau – ebenfalls in Südböhmen – nach einer 400 Jahre alten
Technik in eine Aluminiumform gegossen. Die Glocke ist aus Bronze, hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern und erklingt im Ton c3. Der Reichenberger Militärkaplan Hauptmann Petr Šabaka war die zentrale Person vor Ort, der die Gäste begrüß te, die Rede hielt und die Glok ke segnete. Jetzt läutet die Wen zel-Glocke jeden Abend zwei Mi nuten lang vom Glockenturm der Dreifaltigkeitskapelle.
Der wertvollste Teil der Kapel le ist der original erhaltene Al tar mit dem Bild des heiligen Jo hannes von Nepomuk, der wahr scheinlich aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammt. Die Ge meinde Proschwitz bemüht sich um die Aufnahme der Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit in die Liste der Kulturdenkmale.
Stanislav Beran
Der 14 Meter hohe Weih nachtsbaum ist eine 45 Jahre alte Fichte aus dem Reichenber ger Stadtteil Am Kranich. Die Grundstückseigentümer woll ten den Baum aus Sicherheits gründen fällen, da er in un mittelbarer Nähe von Häusern stand. Insgesamt waren zehn Angebote für den diesjährigen Weihnachtsbaum im Rathaus eingegangen. Ausschlagge bend für die Wahl dieser Fich te waren das Aussehen des Baumes und die Erreichbar keit seines Standortes.
Der Baum wurde am Don nerstag, 17. November um 9.00 Uhr morgens gefällt. Die Fällung und Verladung des Baumes dauerten mehr als zwei Stunden. Viele Men schen schauten zu. Etwa um 11.30 Uhr fuhr der Lastwa gen los Richtung Marktplatz vor dem Rathaus, wo er etwa ei ne Stunde später eintraf. Die Feuerwehrleute machten ihn kürzer und verankerten ihn. In den folgenden Tagen wurde der Baum geschmückt. Traditionell wird der Weihnachtsbaum mit Schmuck dekoriert, den Kin der der Kindergärten und Schü
ler der Grundschulen in Rei chenberg basteln. Darüber hin aus erhielt er in diesem Jahr eine sparsamere LED-Beleuch tung. Die Christbaumbeleuch
ein Postkasten für die Briefe an den Weihnachtsmann unter dem Weihnachtsbaum.
Der Weihnachtsbaum ist eine Fichte aus einem Privatgarten.
der Kinderchor der Gablonzer Grundschule.
Bis Ende November fand im Ga blonzer Zentrum für Wiederver wendung in der Smetana-Straße ein Totalausverkauf der Bestän de statt. Alles kostete zehn Kro nen. Im „Re-Use-Zentrum“ wer den verschiedene Sachen zur Wiederverwendung angeboten.
Der Lagerraum muß vor dem Winter geleert werden. Im Angebot waren Kinderwagen und -sitze, Kleinmöbel, Geschirr, Sportgeräte oder Gegenstän de aller Art, die sonst auf dem Müll gelandet wären. Da das La gerhaus aufgrund von Energie sparmaßnahmen über den Win ter nicht beheizt werden kann, bot die Stadt Ga blonz bis Ende November einen Totalausverkauf an. Alle Gegen stände wurden zu einem ein heitlichen Preis von zehn Kro nen angeboten“, sagte Lenka Opočenská, Ga blonzer Stellver tretende Ober bürgermeisterin für Umwelt und Stadtstrategie, und fügte hinzu, daß der Verkauf
nicht das Ende des Wiederver wendungszentrums sein werde. Wenn der Winter vorbei sei, wer de es wieder möglich sein, Sa chen zu bringen und zu kaufen.
Das „Re-Use-Zentrum“ wur de am 3. Januar im Sammelhof in der Smetana-Straße eröffnet und war die ganze Woche außer sonn tags geöffnet. Die Sachen, die die Leute hier abgaben, konnten von anderen gekauft werden. Den Er lös verwendete die Gemeinde für die Wiederherstellung der Grün anlagen der Stadt Gablonz.
„Seit Betriebsbeginn erwirt schaftete das Wiederverwen dungszentrum 96 400 Kronen“, sagte Barbora Šnytrová, Leite rin der örtlichen Wirtschaftsver waltung. Sie fügt hinzu: „Vielen Dank an alle, die uns bei der Ab fallvermeidung helfen. Viele Dinge, die sonst auf der Müll deponie gelan det wären, ha ben dank des Wiederverwer tungszentrums einen neuen Be sitzer gefunden.“
 Stanislav Beran
Stanislav Beran
Seit Anfang Dezember sind die Wälder um Gablonz für drei Mo nate nachts gesperrt. Grund ist die überhöhte Anzahl von Wild schweinen, die nun von den Jä gern in dem gesperrten Jagd gebiet sicher kontrolliert und reguliert wird.
Stadtrand, auf Wiesen in der Nä he von Wohnsiedlungen finden, wo es oft reichlich Nahrung für sie gibt. Deshalb plant die Stadt Gablonz strenge Maßnahmen zur Regulierung der Wildschwei ne“, sagte der Ga blonzer Oberbür germeister Miloš Vele.
tung wurde feierlich am letzten Novemberfreitag erstmals einge schaltet. Seitdem erlischt sie je den Tag um Mitternacht.
Der Weihnachtsmarkt eröff nete am Mittwoch und wird am 23. Dezember enden. Der Baum wird bis zum Dreikönigstag auf dem Marktplatz vor dem histori schen Rathaus stehen. Dort erwarten die Be sucher eine mechani sche Krippe, Auftritte von Kindern aus Rei chenberger Schulen und Kindergärten, verschiedene Musik gruppen, das Christ kindlbüro und vieles mehr. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Riesenrad auf dem Platz geben.




om ersten bis zum zweiten Ad ventssonntag steht
Der Baum wurde am 21. Novem ber morgens um 8.00 Uhr von Mitarbeitern der Technischen Dienste gefällt. Die ursprüngli che Länge von 18 Metern mußte aus Sicherheitsgründen auf zwölf Meter gekürzt werden. Seit dem Montag vor dem ersten Advent steht der Weihnachts baum mitten auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Gablonz an der Neiße.
Am ersten Advent um 17.00 Uhr schal teten Oberbürgermei ster Miloš Vele und Pfarrer Štěpán Smo len die Beleuchtung am mittlerweile ge schmückten Weih nachtsbaum feier lich ein. Bereits seit 15.00 Uhr waren die Buden auf dem Marktplatz geöff net. Für weihnachtli che Stimmung sorg te „Iuventus Gaude“,
Seit dem 21. November steht auch auf dem Markt platz in Friedland ein Weih nachtsbaum. Auch hier han delt es sich um eine Fichte, die ursprünglich zum Fällen be stimmt war und aus Rückers dorf stammt. In den folgenden Tagen wurde der zehn Me ter hohe Weihnachtsbaum mit Weihnachtssternen und Lich terketten geschmückt. Am er sten Advent wurden auch hier abends die Weihnachtslich ter feierlich eingeschaltet. An diesem Tag konnten sich jung und alt an den Ständen mit weihnachtlichen Schman kerln und kleinen Geschen ken auf dem Marktplatz, an Kunstworkshops im Rathaus und in der Ausstellungshalle, an weihnachtlichen Darbietun gen von Kindern der örtlichen Kunstschule, an einem Kon zert der Gruppe „Maxíci“ und an einer hölzernen Weihnachts krippe mit lebenden Tieren im Rathaushof erfreuen.
Die Schließung des Waldes betrifft das Gebiet um Proschwitzer Kamm, Radl und Rehgrund. „Das Verbot gilt vom 1. Dezember bis Ende Februar. Vorher war das nicht möglich, weil noch viele Pilzsammler in den Wäldern un terwegs waren. Viele Leute führ ten auch ihre Hunde, die nicht angeleint waren, Gassi. Oft lau fen Menschen auch nachts durch den Wald. Die Wildschweine ha ben nicht die Ruhe, die sie am
Dazu gehört beispielswei se das Aufstellen von Fangkäfigen und Fotofallen zur Überwachung der Wildbewe gung oder die be reits erwähnte Waldsperrung. „Die Sperrung eines Teils des Jagdgebiets ist notwendig, um die Bewegung von Wildschwei nen einzuschränken. Es han delt sich hauptsächlich um die westliche Grenze der Stadt Ga blonz vom Rehgrund in Richtung Proschwitz. Stanislav Beran
Rainer Pisks väterliche Wurzeln liegen in Leimgruben bei Bö sig im ehemaligen Kreis Dauba. Auf sein Betreiben wurde 2021 in seinem brandenburgischen Wohnort Falkenberg an der Elster ein Ver triebenen-Mahn mal errichtet (Þ RZ 9/2022). Unbekannte zerstörten es vor eini gen Wochen.
Kürzlich besichtig te der lokale Bun destagsabgeordnete Knut Abraham (Ý In terview Seite 3) den Tatort in un mittelbarer Nähe des Bahnho fes von Falkenberg. Er ermutigte Rainer Pisk und dessen Mitstrei ter, ein neues Denkmal zu errich ten, und versprach, mit ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln zu helfen.
Mittlerweile rief Pisk eine neue Spendenaktion ins Leben, um an dem Bahnhof, auf dem nach Kriegsende viele Vertriebene gestran det waren, einen neu en Gedenkstein wider das Vergessen und für die Opfer von Krieg, Flucht und Vertrei bung aufstellen zu können. Pisk: „Wir hoffen, daß wir die be nötigten Mittel zu sammen bekommen.“
Spendenkonto: Eisenbahnför derverein Falkenberg an der Elster, Sparkasse Elbe-Elster – IBAN: DE 34 1805 1000 3320 11 3088, Verwendungszweck: Gedenkstein





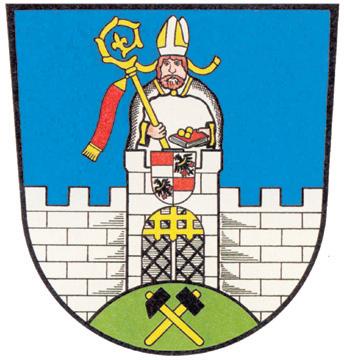

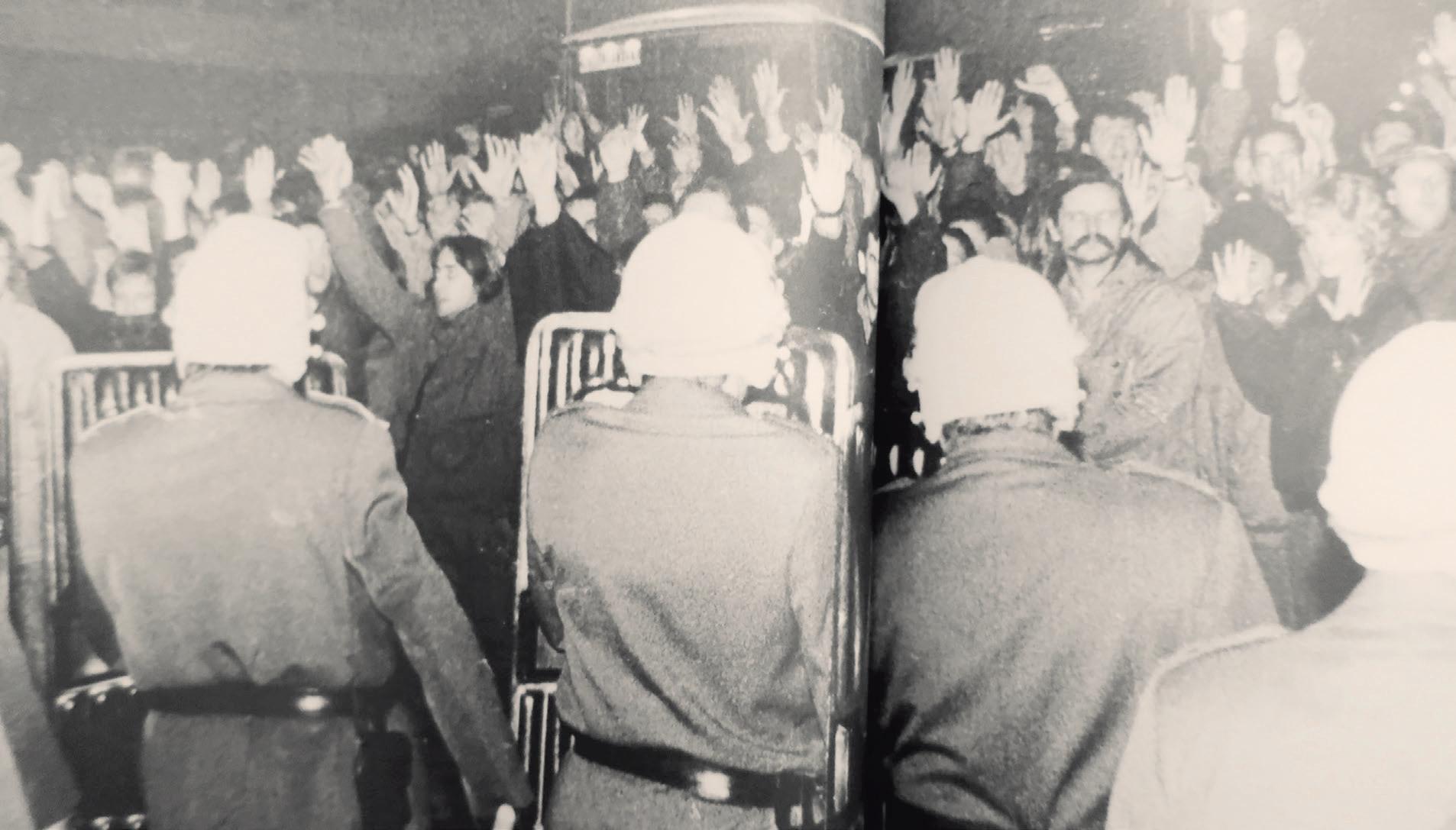





und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Tele fon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
Ende November fand in der Au la des Teplitzer Gymnasiums ei ne Podiumsdiskussion über die ökologischen Protestkundge bungen Anfang November 1989 in Teplitz statt. Diese brachten durch den nachfolgenden poli tischen Aufstand der Studenten in Prag als Samtene Revolution 1989 das Ende der kommunisti schen Herrschaft in der Tsche choslowakei. Wenn heute un sere Jugend auf die Straße geht und sich gegen den Klimawan del einsetzt, sollten die jungen Menschen wissen, daß ihre El tern vor 33 Jahren auf die Stra ßen gingen, um für saubere Luft zu kämpfen. Jutta Benešová be richtet.

Die Umweltsituation in Nord böhmen war in den 1980er Jahren verheerend für Mensch und Natur. Dies war eine Folge der intensiven industriellen Tä tigkeit und vor allem des Koh lebergbaus ohne Berücksichti gung jeglicher Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Ver meidung von Luftverschmut zung. Vor allem in den Winter monaten, als zu den Industriemissionen noch die örtlichen Kohleheizungen der Haushalte hinzukamen, waren die Konzen trationen der Schadstoffe sogar die höchsten im Weltmaßstab. Infolgedessen gab es dort ei
ne der niedrigsten Lebenserwar tungen in der gesamten Tsche choslowakei, und die Wälder im Erzgebirge waren durch den sau ren Regen erschreckend dezi miert.
Für das damalige Regime war die Industrieproduktion wichti
ger als die Gesundheit der Men schen. Die Unzufriedenheit der nordböhmischen Bevölkerung stieg ständig und äußerte sich endlich im November 1989 in Te plitz in zunächst ungenehmig ten ökologischen Protestkund gebungen.
Dazu hatte ein Lehrling mit seinen Freunden Flugblätter in der ganzen Stadt verteilt und für den 11. November 1989 zu einer Protestkundgebung aufgefor dert. Motoviert wurde der Jun ge durch die ständigen Asthma anfälle seiner kleinen Schwester.
Die Kinder litten am meisten un ter der Luftverschmutzung. So mit waren es auch zunächst et wa 800 vorwiegend junge Eltern, welche sich auf dem Schulplatz in Teplitz trafen und mit Trans parenten, auf denen sie „Saube re Luft“ und „Gesundheit für un
sere Kinder“ forderten, durch die Innenstadt zogen.
Auch an den nachfolgenden Tagen wiederholten sich die Proteste unter Beteiligung ei ner breiten Schicht der Bevölke rung – diesmal aber bereits un ter Aufsicht der tschechischen Si cherheitskräfte und der Polizei, welche, voll ausgerüstet mit Hel men, Schlagstöcken und Hun den, die Protestierenden um zingelten. Dabei erfolgten auch einige Übergriffe mit Inhaftie rungen, welche die Situation zu nehmend verschärfte.
Eine Gymnasiallehrerin und ein Mediziner, welcher im Te plitzer Hygieneinstitut arbeite te, setzten danach mit einigen Gleichgesinnten eine Petition auf. In dieser wurde das Kreis Komitee der Kommunistischen Partei in Teplitz dazu aufgefor dert, eine Anhörung der Teplit zer Bevölkerung im Winter Sta dion durchzuführen.
Die Protestkundgebungen in Teplitz wurden durch Presse und Fernsehen bekannt gegeben, wo bei sich spontan die Prager Stu denten mit den Teplitzern soli darisch erklärten. Die Situation nahm politische Formen an und gipfelte schließlich in dem Auf stand der Studenten in Prag am 17. November, welcher den Sturz des damaligen Regimes brachte. Fortsetzung folgt
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergWeder aus der Zeit, da Pobiezowicz ein kleines Dorf war beziehungsweise zur Stadt erhoben wurde, also im 14. und 15. Jahrhundert, noch aus dem 16. Jahrhundert, als Ronsperg einen ziemlichen Aufschwung nahm, sind uns Angaben über Zahl und Zusammensetzung der Bewohner überliefert.
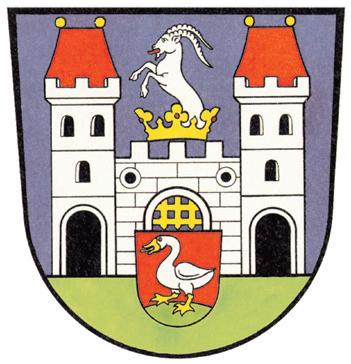
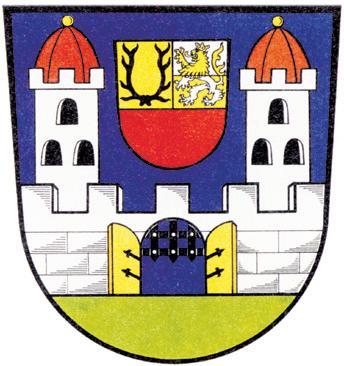



Von besonderem Interesse ist für uns aber die Frage, ob Pobiezowicz oder Ronsperg eine deutsche oder eine tschechische Bevölkerung hatte. Auch dafür fehlt eine direkte Überlieferung. Sicher erinnert der Flurname Ouderl, von tschechisch údoli für Tal, an die einst tschechische Besiedlung unserer Gegend. Gerade vom alten Rokesin aus leuchtet diese Bezeichnung besonders ein. Ob auch Groukov ein ähnliches Alter hat und ebenfalls tschechischen Ursprungs ist?
Neben den Flurnamen erlauben vor allem Urkundentexte einen Schluß auf die Sprache der Bevölkerung. Die älteste Urkunde von 1424 hat einen lateinischen Text, die des Jahres 1502 von Dobrohost von Ramsperg über die Namensgebung ist tschechisch abgefaßt. Die erste deutsche Urkunde stammt aus dem Jahre 1530, ausgestellt von Albrecht von Guttenstein, der seinerseits tschechisch unterschrieb. Dann wechseln deutsche und tschechische Urkunden einander ab. Die letzte tschechische stammt aus dem Jahr 1653.


Wir müssen also annehmen, daß die Bevölkerung Ronspergs
in diesen frühen Zeiten überwiegend tschechisch war, wohl auch um 1500, als Ronsperg seinen deutschen Namen erhielt. Dieser kann kaum als Argument für eine deutsche Bevölkerung ins Feld geführt werden, da es damals auch beim tschechischen Adel schon lange üblich war, sich deutsche Namen zu geben.
Allerdings begann Anfang des 16. Jahrhunderts allmählich die deutsche Siedlungstätigkeit in Böhmen wieder. Das 1548 gegossene Steuerglöckchen, das vom Rathausturm am Schulberg die Steuerschuldner an die Termine erinnerte, trug noch eine tschechische Aufschrift. Doch mit der Förderung des Protestantismus durch die Schwanberger scheint auch das deutsche Element in Ronsperg eine Stärkung erfahren zu haben, zumal das Geschlecht der Schwanberger selbst bereits völlig eingedeutscht war.
Einen wertvollen Hinweis auf die Zunahme des deutschen Bevölkerungsanteils gibt ein Aktenstück im Ronsperger Archiv, und zwar die Schrift „Stadtrecht des Königreiches Behaimb in einer kurzen Summa verfasset und aus behaimischer in die deutsche Sprach transferirett Anno 1586“.
Diese Übersetzung scheint notwendig geworden zu sein, weil die neu Hinzugezogenen nicht mehr so die tschechische Sprache beherrschten, wie man es bei den alteingesessenen Deutschen noch annehmen kann.
Vor und um 1600 beobachten wir im Gerichtsbezirk Ronsperg ganz allgemein die Eindeutschung verschiedener bisher tschechischer Ortsnamen wie Vranow zu Frohnau, Vlkanow zu Wilkenau oder Parezow zu Parisau. Und wenn wir aus den Personennamen einen gewissen Schluß ziehen dürfen, so erhielt auch Ronsperg um 1600 oder bald nachher eine deutsche Mehrheit. Zur gleichen Zeit beginnen auch die deutschen Eintragungen im Grundbuch, 1635 werden sie rein deutsch. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ist also Ronsperg eine deutsche Stadt.
Einschlafen dürfen, wenn man müde ist Eine Last fallen lassen können die man lange getragen hat das ist eine tröstliche, eine wunderbare Sache (Hermann Hesse)
Als der Ort 1623 an Severin Thalo verkauft wurde, wohnten „70 Angesessene samt Häusler“ in Ronsperg, die der Obrigkeit jährlich für das Braurecht und die Entlassung aus der Untertänigkeit Zins zahlten. Außerdem waren zwölf Bürger mit Pferden am Ronsperger Meierhof zu Ackerrobot und Fuhrleistungen verpflichtet, die übrigen ohne Gespann hatten zwei Tage „Schnittrobot“ zu leisten.
Auch in Ronsperg schlug der Dreißigjährige Krieg tiefe Wunden. Die „Rulla“, eine Statistik aus dem Jahre 1654, zählt für das „Statek Ronspergk“ zwölf größere Hauswirte, acht Chaluppner, 27 Gärtner (Häusler), von denen einige erst 1652 und 1654 neu angesiedelt worden waren. Noch verödet waren 24 Anwesen.
Wir sehen, wie sehr die Bevölkerung in diesen drei Jahrzehnten durch Seuchen und Kriegseinwirkungen dezimiert wurde. In der „Topographie des Königreiches Böhmen“ von Jaroslaus Schaller aus dem Jahr 1789 lesen wir über die Herrschaft Ronsperg, daß der „gemeine Mann“ hier „deutsch allein“ spricht. Die Stadt und ihre Umgebung haben also eine rein deutsche Bevölkerung. Über Einwohnerzahlen erfahren wir nichts, die Zahl der Hausnummern beträgt in Ronsperg 128.

Im folgenden halben Jahrhundert nahm die Stadt einen raschen Aufschwung. 1839 finden wir hier 1928 Einwohner, wovon neben 30 jüdischen Familien mit 212 Personen 26 Häuser mit 496 Einwohnern noch der Herrschaft untertan waren. Erst durch das Gesetz über die Bauernbefreiung vom 7. September 1848 wurden auch sie frei. 1893 zählte die Stadt 1854 Bewohner.
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der zweite Teil über Pfarrer Matthias Bräuer (1817–1899).

Nach dem Brand in Neustadtl wird der dortige an Lungentuberkulose erkrankte Kaplan Johann Tichy schließlich im Haus des Bezirkssekretärs in Hostau, Franz Masanz, aufgenommen, um dort richtig gepflegt zu werden. Seine Lungentuberkulose ist jedoch dermaßen fortgeschritten, daß er stirbt. Sein ehemaliger Vorgesetzter, der Pfarrer von Neustadtl, Andreas Hochmut, setzt ihn am 20. Oktober 1876 im Hostauer Friedhof bei. Insgesamt sind 18 Priester zu den Trauerfeierlichkeiten in Hostau gekommen.
Am 8. Dezember 1876 um 20.00 Uhr bricht erneut ein Brand in Hostau aus, und zwar in Haus Nr. 77. Ungünstiger Wind facht die Flammen an, so daß auch die Häuser Nr. 72 bis 74 sowie 77 bis 79 und schließlich auch noch das Bräuhaus zerstört werden. 1877 werden in Böhmen in Folge des in Kraft getretenen Grundbuchgesetzes von 1874 die Grundbücher neu angelegt. Da die neuen Eintragungen oft nicht gewissenhaft genug gemacht werden, kommt es bis zu sechs Jahre danach zu Reklamationen der ursprünglichen Besitzer. Trotz allem kostet den Staat die Anfertigung der neuen Grundbücher 17 Millionen Gulden.








Steinbach zieht verbal hart ins Gericht mit Kommunen, die sich kirchliche Friedhöfe als Gemeindefriedhöfe ins Grundbuch eintragen lassen. Mit Genugtuung vermerkt er, daß das k.k. Verwaltungsgericht in Wien jedoch in

den meisten Fällen die Friedhöfe wieder der Kirche zuspricht.
Ein allgemeiner österreichischer Katholikentag wird am 30. Mai 1877 abgehalten. 3000 Teilnehmer aus allen Ländern Österreichs kommen nach Wien. Nach Steinbach bleibt der Katholikentag allerdings ohne praktische Erfolge, da die Beschlüsse über die angestrebte konfessionelle Schule von der liberalen Regierung und der liberalen Mehrheit des Reichsrates nicht in Erwägung gezogen werden. Mitte Juni 1877 reisen zehn Geistliche aus den Diözesen Budweis/ České Budějovice, Königgrätz/ Hradec Králové und Olmütz/Olomouc zusammen von Prag über Bremen nach Nordamerika, um dort in Omaha im Bundesstaat Nebraska mehrere böhmische Seelsorgestationen zu betreuen. In Bremen schließen sich ihnen 50 Schulschwestern an, die die Leitung der Schulen in Omaha übernehmen werden.
Am 19. Juni 1877 kommt es zu einem großen Brand in Muttersdorf, das eine halbe Stunde von Hostau entfernt ist. Dabei brennen 38 Wohnhäuser, 26 Scheunen und 18 Stallungen ab. Feuerwehren aus der ganzen Umgebung eilen herbei, aus Hostau, Ronsperg, Haid, Schmolau, Heiligenkreuz, Weißensulz, Neustadtl, Plöß, sogar aus dem bayerischen Stadlern und Dittersdorf. Auch der Hostauer Christoph Bauriedl, Obmann des Hostauer Bezirksausschusses, leistet mit einem Gespann die ganze Nacht hindurch Wasserzufuhren. Der Muttersdorfer Pfarrer, Mathias Krim, zieht sich während des Feuers ein Rückenmarksleiden zu, das ihn bis zu seinem Tod am 8. Juli 1879 ans Krankenbett fesselt.
Fortsetzung folgt
Deine Kinder:
Deine Enkel:
Mit 2104 Einwohnern im Jahre 1913 erreichte Ronsperg seinen höchsten Einwohnerstand, denn nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1930 hatte Ronsperg 1989, am 17. Mai 1939 1990 Bewohner. Dieser Bevölkerungsstillstand, ja Rückgang im Laufe der letzten Jahrzehnte erklärt sich aus dem Mangel an Arbeitsplätzen.
■ Weißensulz. Josef Brix (Zenken Schousta), 92 Jahre.
Regina Hildwein Ortsbetreuerin

Herzlich gratulieren wir im Dezember Herbert Gröbner, Ortsbetreuer von Meeden, am 2. zum 97. Geburtstag; Maria Hagenauer, Mitarbeiterin von Tscharlowitz, am 5. zum 90. Geburtstag; Josef Rothmaier, Ortsbetreuer von Natschetin, am 9. zum 92. Geburtstag; Barbara Knott, Ortsbetreuerin von Waier, am 16. zum 86. Geburtstag; Regina Hildwein, Ortsbetreue-
rin von Weißensulz, am 21. zum 68. Geburtstag und Cäcilie Berndt, ehemalige Ortsbetreuerin von Heiligenkreuz, am 25. zum 84. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute, noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat.
Peter Pawlik Heimatkreisbetreuer Viele waren gezwungen, ihr Brot anderswo zu verdienen. Franz Bauer
Reinhold Wurdak, der Ortsbe treuer von Maschakotten, infor miert die Landsleute und Hei matfreunde über Aktivitäten und Vorgänge in der Heimat im vergehenden Jahr.
Am 9. Juli trafen wir Mascha kottener uns wieder nach dem Altzedlischer Heimat gottesdienst am Kuaner Dorf platz. Dieses Mal bestand un sere Gruppe nur aus vier Per sonen, nämlich aus unserem mit 93 Jahren Ortsältesten Jo sef Ries, aus seinen zwei Söh nen Markus und Georg sowie aus mir. Die Familie Ries hatte sich bereits am Vortag bei un serem holländischen Freund Robert van Es einquartiert, der schon viel für die Verschöne rung und Renovierung unseres Dorfes getan hat.


An den meisten Häusern und Anwesen wird gerichtet und modernisiert. Der abge brannte Vilwertenhof Nr. 10 wird wieder aufgebaut und steht kurz vor der Fertigstel lung. Die Renovierung der An nerlkapelle haben die Arbeiter von Robert van Es ausgeführt und beendet. Zudem sagte mir Robert, daß er mein Elternhaus Nr. 39 inte Schneider (Wurdak Johann) erworben habe. Sobald die letzte Bewohnerin ausgezo gen sei, könne ich es besichtigen. Ich sagte, daß ich im Spätherbst wieder käme und mich bei ihm melden würde. Zum Abschluß machten wir unser Gruppenfo to vor dem Blaslkreuz der Fami lie Ries.
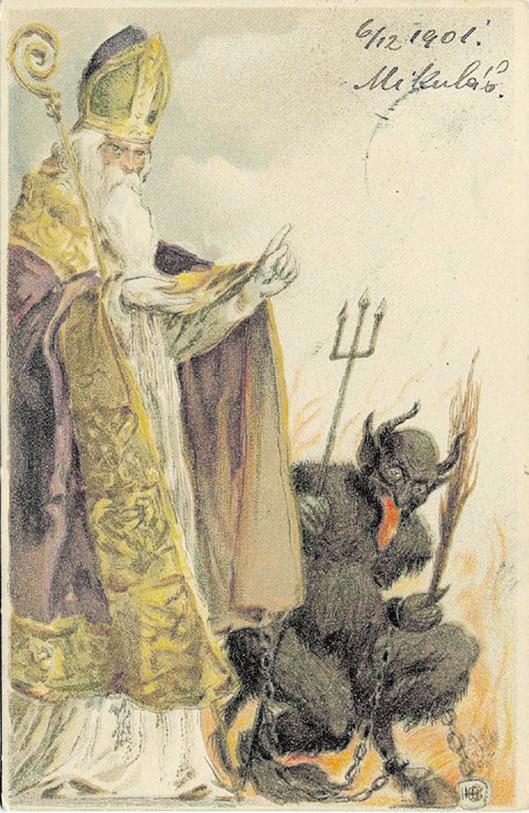
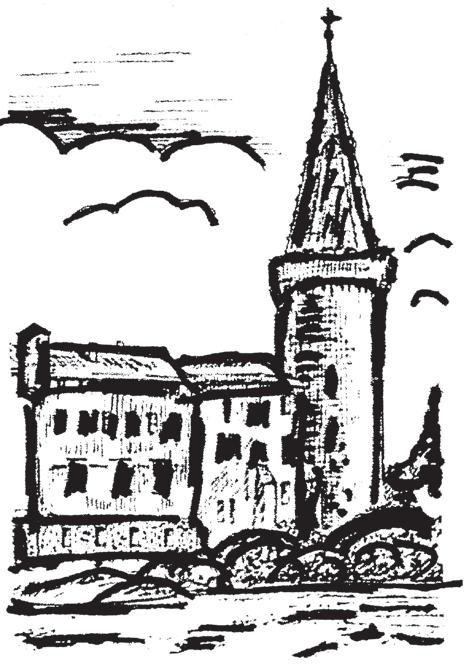

Mit der Marktbetreuerin von Altzedlisch, Sieglinde Wolf, hat te ich vereinbart, daß wir nach Allerheiligen in die Heimat un serer Vorfahren reisen, um den baulichen Zustand der Kirche zu prüfen und das Grab von Sieglin des Urgroßvater zu pflegen. Am
Franz Lockl, Sieglindes Urgroß vater, der bereits im Jahre 1924 im Alter von 57 Jahren starb.
Ich hatte Gartengeräte und Heckenschere dabei. Auf dem Grab befinden sich ein Buchs baum sowie eine Eibe vom Grab meiner Eltern in Schwabach, das
richtet und den Zustand der Fen ster. Optisch waren keine Schä den zu erkennen. Es ist wichtig, daß kein Wasser ins Gebäude eindringt, denn dies beschleu nigt den schleichenden Zerfall. Wir kamen zu dem Ergebnis, daß die Kirche derzeit in einem soli den Zustand ist. Wegen Coro na waren jedoch die Arbeiten an der Elektroanlage nicht wei tergeführt worden.
Nun machten wir uns auf den Weg nach Maschakotten.
Robert erwartete uns schon und zeigte mir dann das Erd geschoß im ehemaligen Haus meiner Eltern, das nach dem Auszug der letzten Besitzerin leer stand. Den ersten Stock hat er noch an eine ukrainische Familie vermietet. Der Zustand der Wohnung war katastro phal und ich war froh, daß die ser Anblick meiner Mutter und meinem Vater erspart blieb.


Nur noch eine alte Leuch te und ein ehemals einge mauertes Fenster erinnern an die Zeit vor der Vertreibung.
Franz Hals schildert die Rei ze und Geheimnisse in der Ad ventszeit in der Heimat. Hier der zweite Teil.
Ende November und An fang Dezember klangen aber auch von überall her von früh bis abends die harten Schläge der Dreschflegel, eine schwere, heu te unbekannte Arbeit, meist der Frauen. In den Scheu nen wurden die Garben auf der Tenne mit den Ähren zusammen breit gelegt. Die Drescherin nen, meistens vier oder sechs, schwangen den Dreschflegel aus Hart holz, ungefähr 60 Zen timeter lang und sechs Zentimeter im Durch messer, der mit der Stohaube aus Schweinsleder am Sto oder dem Stiel einer unge fähr 1,80 Meter langen Stange befestigt war.
Erst wurden die Garben ab gebauscht, dann die Bänder ge löst, alles mit den Rechen breit geschichtet und wieder kräftig ausgedroschen. Nun wurde das Stroh schön ausgeschüttelt und in Garben gebunden. Das Korn wurde in Haufen zusammenge schaufelt, um dann später ge reinigt zu wer den. In alter Zeit tat man dies mit der Wurfschau fel, später mit der Putzmühle.
Der Nikolaus tag war dann der Tag der Kin der. Als Bischof verkleidet, zog er von Haus zu Haus, die Kinder zu beschenken und zu ermah nen; aber auch der Zemberer trieb sein Unwe sen, er trug die Verkleidung des Teufels und zog eine Kette hinter sich her. Er war sehr gefürchtet, da er auch in die Hutschastuben kam und man che Maid mit der Rute züchtigte. In dieser Zeit wurden den Kin dern in die Doppelfenster Zuk kerwaren gelegt, und am Mor

gen war die Freude groß, denn das Christkindel hatte es ja hin gelegt.
In Tachau wurde in den Ad ventstagen in der Klosterkirche der Sternlsegen gespendet. Die se Andachten wurden auch ger ne von der Landbevölkerung be sucht. Trotz des oftmals weiten Weges war es ein schönes Erleb nis, zur Nachtzeit den weiten Weg zu gehen. Eine in der Mitte aufgestellte Mut tergottes-Statue wurde von neun leuchtenden Sternen umrahmt, da her der Name Sternl segen. Es war schön für die Kinder, wenn vor ne das Silberglöck lein läutete. Wenn al le niederknieten und beteten, hieß es, „das Christkindel läutet“, und die El tern steckten den Kindern ver stohlen eine Kleinigkeit in ih re Taschen, was die Freude dann noch vergrößerte.
Der Thoamas- oder Thomas markt am 21. Dezember war der Einkaufstag für die meisten Weihnachtsgeschenke. Folgen der alter Brauch war lange Zeit lebendig: Der Fürst ließ aus sei nen Wäldern Holz zum Markt platz fahren, wel ches dann an die Armen ver teilt wurde. Im Kloster schenk te die Fürstin ih rerseits den Ar men Kuchen und Backwaren. Der Fischpfalter war von vielen Leu ten, welche den Weihnachtskarp fen einkauften, belagert.
Am Ende des Jahres führte der Türmer der Erz dekanalkirche mit einer Later ne eine Musik kapelle rund um den Marktplatz, wo er für seine treue Wachhal tung Spenden einsammelte. Auch die Kaminfeger und Brief träger trugen ihre Kalender in die Häuser und wurden dafür mit Spenden bedacht. Dieser Brauch war auch auf den Dörfern üblich.
Von Herzen gratulieren wir fol genden treuen Abonnenten des Tachauer Heimatboten zum Ge burtstag im Dezember.

9. November machten wir diesen Ausflug. Ich hatte auch Robert informiert, daß ich an diesem Tag mein Elternhaus besichtigen möchte.
Am Friedhof in Altzedlisch rei nigten wir zuerst die beiden Erin nerungstafeln an unsere Vorfah ren, die wir im Jahre 2014 hatten anbringen lassen, und stellten Schmuck und Kerzen hin. Da nach pflegten wir das Grab von
ich im Jahre 2014 nach 40 Jahren aufgelöst und die besagte Eibe nach Altzedlisch verpflanzt hat te. Nach dem Zuschnitt und der Grabpflege reinigten wir noch den Gedenkstein und stellten ei ne Kerze auf.
Wir besichtigten dann die Kir che und prüften, ob Schäden vorliegen. Dies war nicht der Fall, ich hatte mein Augenmerk hauptsächlich auf das Dach ge
Robert spürte meine Enttäu schung und meinte, ich solle wieder vorbei schauen, wenn er alles renoviert habe. Danach zeigte er uns noch seine Stallun gen mit den Rindern, die er dort zur Fleischproduktion hält. Zu dem hat er sich auf Jagdausflü ge spezialisiert und betreut Gä ste aus ganz Europa. Nach dem Besuch und der Besichtigung der renovierten Annerlkapelle machten wir uns zufrieden, aber auch ernüchtert auf
n Altzedlisch. Am 11. Helmut Gebert (Goldern), 81 Jahre, und am 19. Rosa Worzischek/Wil helm (Willum), 97 Jahre.
Sieglinde Wolf Marktbetreuerin
n Tachau. Am 26. Gretl Fi schinger, geborene Standfest, (Fabrikstraße), 92 Jahre. Gernot Schnabl Stadtbetreuer
n Maschakotten. Am 12. Alois Herget (Trummla, HausNr. 15), 88 Jahre.
Reinhold Wurdak Ortsbetreuer
Herzlich gratulieren wir im Dezember Franz Wiltschka, Orts betreuer von Wurken, am 2. zum 89. Geburtstag.
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit sowie Gottes Segen und danken für alle Arbeit für unsere Heimat. Sieglinde Wolf