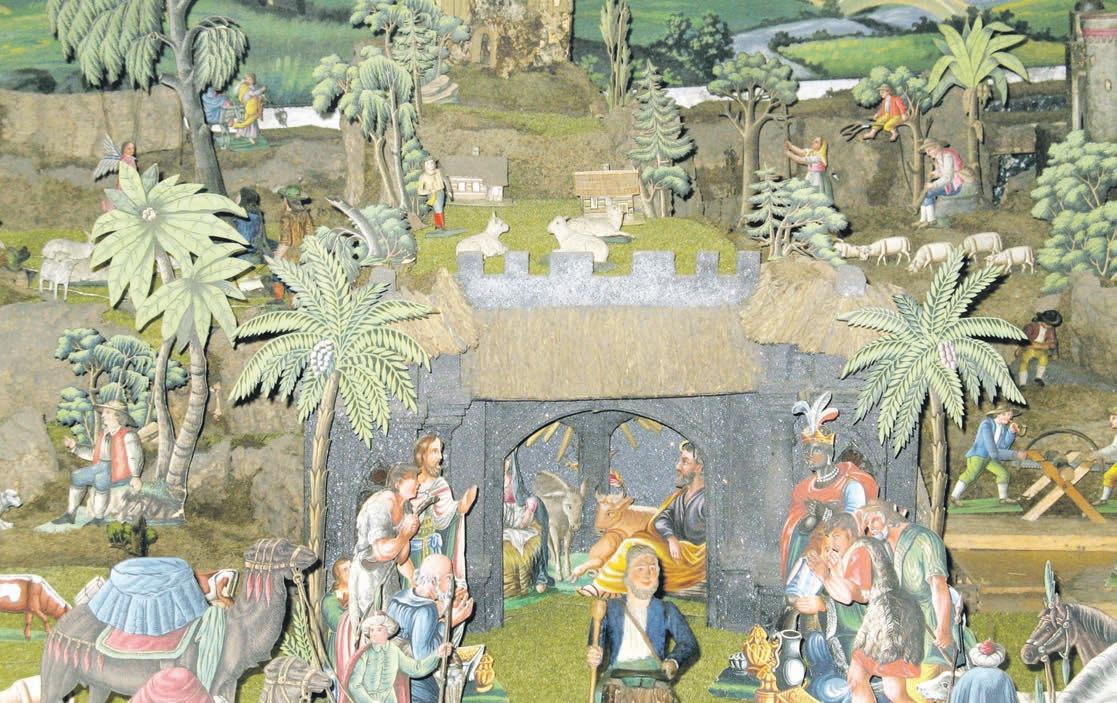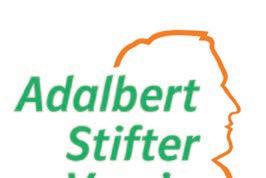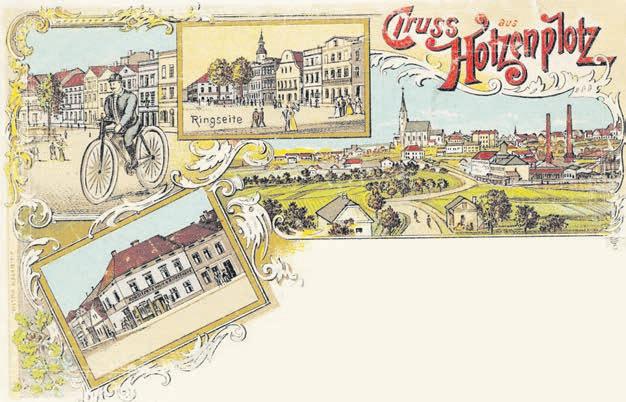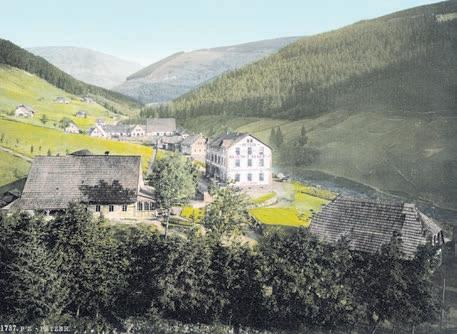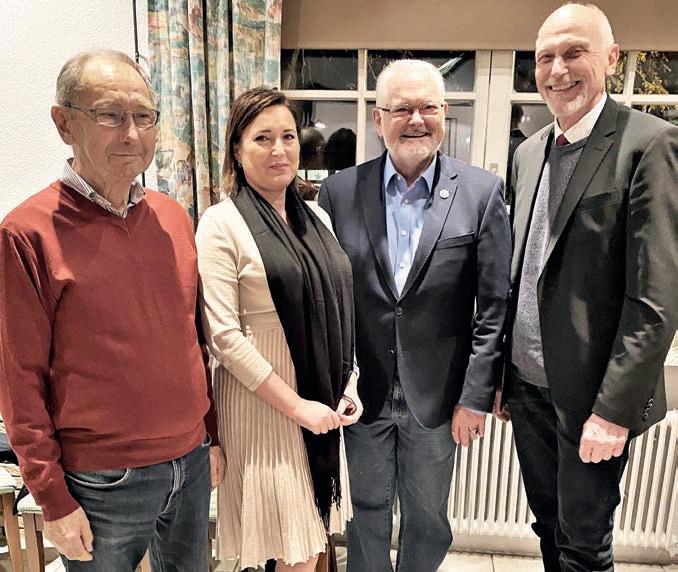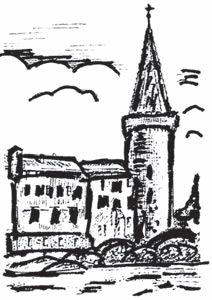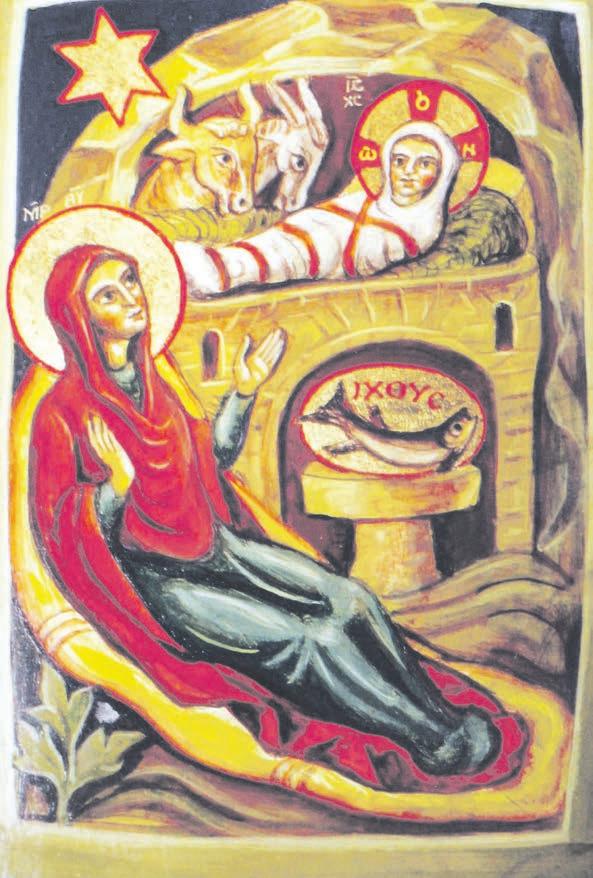AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Andreas Schmalcz (Foto Mitte) kümmert sich um sehr vieles in der Landesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Man begegnet ihm meistens dort, wo „etwas los ist“. Aus Anlaß seiner letzten Reise nach Prag besuchte er das dortige Sudetendeutsche Büro, um mit dessen Leiter Peter Barton (Foto links) über die neuesten Entwicklungen der (sudeten)deutsch-tschechischen Beziehungen zu diskutieren. Außerdem hatte er die Gelegenheit, Radek Novak (Foto rechts), den neuen Vorsitzenden des Kulturverbands der Deutschen (KV), also der ältesten Vertretung der Heimatverbliebenen in der
Tschechischen Republik, besser kennen zu lernen, als dies bisher bei der kurzen Begegnung einer gemeinsamen Veranstaltung möglich war.
Novak sprach über die Pläne seiner Organisation für das Jahr 2023, die sich nicht nur dem Thema Kultur widmen, sondern sich auch mit Themen des ö entlichen Lebens und der Politik befassen, kurz, mit allem, was die Bürger mit deutschen Wurzeln dieses Landes betri t.
Schmalcz freute sich zu erfahren, wie gut das Prager Sudetendeutsche Büro mit den Heimatverbliebenen zusammenarbeitet und welche Zukunftspläne sie haben. Anschließend besuchte er noch das Haus der nationalen Minderheiten (DNM), den Sitz des Kulturverbands, um an
dessen allmonatlichen Tre en teilzunehmen.
Diesmal war es die Vorsitzende der KV-Grundorganisation Prag Irene Novak selbst, die den Teilneh-
mern einen interessanten Vortrag über die Beziehungen zwischen Gablonz an der Neiße und Neugablonz in Bayern präsentierte.
Deutsche Sprache und Kultur im Ausland fördern und bewahren
Die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland und die Einrichtungen der Sudetendeutschen streben eine engere Zusammenarbeit an.
Zu einem ausführlichen Gedankenaustausch konnte Volksgruppensprecher Bernd Posselt den Vorsitzenden des Stiftungsrates, den früheren Bundestagsabgeordneten sowie Minderheitenbeauftragten, Hartmut Koschyk mit seiner sudetendeutschen Ehefrau Gudrun sowie den Geschäftsführer der Stiftung, Sebastian Machnitzke, im Sudetendeutschen Haus begrüßen.
Auf Sudetendeutscher Seite waren darüber hinaus Dr. Stefan Planker, Direktor des Sudetendeutschen Museums, Dr. Raimund Paleczek, Leiter des Bereichs Historische Forschung und Archiv des Sudetendeutschen Museums, sowie SL-Bundesgeschäftsführer Andres Miksch vertreten.



Posselt erinnerte eingangs an die finanzielle Unterstützung der Regierung Merkel für den Museumsbau, für die sich Koschyk stark gemacht habe. Künftig böten insbesondere die Sudetendeutschen Vereinigungen im Ausland, wie zum Beispiel in Buenos Aires, Argentinien, Ansatz-
punkte für eine konstruktive Zusammenarbeit.
In seiner Vorstellung der Stiftung betonte Hartmut Koschyk deren Tätigkeit in Mittel- und Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion sowie in Lateinamerika. Ziele seien unter anderem die Förderung und Erhaltung
der deutschen Sprache, der Kultur und des Brauchtums der im Ausland lebenden Deutschen. Er verwies dabei auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und auf die von ihm initiierte erfolgreiche literarische-musikalische Lesereise aus der Weihnachtserzählung „Die Flucht nach Ägypten“ von Otfried Peußler unter anderem in Prag (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).
Damit hatte er auch das Interesse von Musemsdirektor Stefan Planker geweckt, der das Sudetendeutsche Museum als das zentrale Museum der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern vorstellte. Planker berichtete von der Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Adalbert Stifter Verein zum 100. Geburtstage von Otfried Preußler und will die Lesung ins Programm aufnehmen. Hildegard Schuster
Künstlerhaus Empfang der Generalkonsulin
Aus Anlaß der zu Ende gehenden EU-Ratspräsidentschaft hat das Generalkonsulat der Tschechischen Republik in München zusammen mit der Europäischen Bewegung zu einem Emfpang in das Münchner Künstlerhaus eingeladen.
Die tschechischen Künstler Jan Čech (Piano) und Zuzana Vojtová (Violine) begeisterten mit ihren musikalischen Darbietungen das Publikum.
Ein Grußwort des Freistaates Bayern überbrachte Tobias Gotthardt, Vorsitzender des Landtagsausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen.
Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková ging in ihrer Rede insbsondere auf die Schwerpunkte der tschechischen Ratspräsidentschaft ein. ZS
bauen in Tschechien Waffen
Tschechien wird mehrere Tausend Experten aus der Ukraine aufnehmen, die in den hiesigen Waffenfabriken an gemeinsamen Projekten arbeiten sollen, hat der stellvertretende tschechische Verteidigungsminister, Tomáš Kopečný bekannt gegeben. Die Absprache sei bei den Verhandlungen von Premierminister Petr Fiala (ODS) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oktober getroffen worden, so Kopečný weiter. Das Ziel der Zusammenarbeit sei es demnach, gemeinsame Produktionskapazitäten zu schaffen und sicherzustellen, daß die ukrainischen Fachleute in einer sicheren Umgebung arbeiten können. Dabei soll es vor allem um die Reparatur und Modernisierung schwerer Kampftechnik gehen. Laut Kopečný sollen schon in der ersten Hälfte des kommenden Jahres die ersten wichtigen Waffensysteme in Tschechien hergestellt beziehungsweise repariert werden.
Europäische Hilfe für Energiekonzern
Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Montag mitteilte, geht der Zuwachs auf die Zuwanderung mit einem Plus von 21 400 Menschen zurück. Nicht eingerechnet sind dabei die 409 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die ein vorübergehendes Schutzvisum haben. Der sogenannte biologische Faktor ist dagegen rückläufig. Zwischen Januar und September gab es in Tschechien 11 200 mehr Todesfälle als Geburten.
steigt auf 16,2 Prozent
E
s ist das höchste Darlehen, das die Europäische Investitionsbank (EIB) bislang in Tschechien bereitgestellt hat: 790 Millionen Euro erhält der halbstaatliche Energiekonzern ČEZ für die Modernisierung und den Ausbau des nationalen Verteilernetzes sowie für Investitionen in erneuerbare Energien. Laut ČEZ können mit dem zugesagten Kredit weitere 2,2 Gigawatt grüner Strom produziert werden, was fast der Leistung zweier mittlerer Atomkraftwerke entspricht.
Telefonieren in Tschechien zu teuer
Die Preise für das Telefonieren und die Nutzung mobiler Daten sind in Tschechien weiterhin mit die höchsten in Europa, hat der tschechische Oberste Rechnungshof (NKÚ) kritisiert. Die Versteigerung der Frequenzen habe bisher nicht zu einer Senkung geführt.
Bevölkerung in Tschechien wächst
In den ersten neun Monaten dieses Jahres ist die Bevölkerung Tschechiens um 10 200 Menschen auf insgesamt 10,527 Millionen angestiegen. Wie das
Die Verbraucherpreise in Tschechien lagen im November um 16,2 Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres, hat das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) mitgeteilt. Im Oktober hatte der Unterschied im Jahresvergleich noch 15,1 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat lag die Inflation im November um 1,2 Prozent höher. Grund für den Anstieg sind vor allem die Kosten für Wohnen und Energie, aber auch höhere Lebensmittelpreise. So hatte in der vergangenen Woche das Staatsunternehmen Tschechische Bahnen (ČD) angekündigt, mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan die Ticketpreise um 15 Prozent anzuheben. Im Jahresvergleich steigt die Inflationsrate in Tschechien seit 13 Monaten ununterbrochen an.
Skisaison eröffnet
In den tschechischen Gebirgen ist am Wochenende die Skisaison eröffnet worden. In zahlreichen Skiarealen wurden zum ersten Mal die Lifte angestellt, und es fiel auch frischer Schnee. Aus dem Riesengebirge werden 20 bis 40 Zentimeter Naturschnee gemeldet. In Spindlermühle waren etwa 4000 Wintersportler unterwegs.
Wieder Kritik an Präsident Zemann
S
taatspräsident Miloš Zeman hat indirekt bestätigt, daß er die Ernennung eines neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts in Erwägung zieht, obwohl die Amtszeit von Verfassungsrichter Pavel Rychetský erst im August kommenden Jahres endet, also nach der Amtszeit Zemans. Kritiker haben eine vorzeitige Ernennung bereits als verfassungswidrig abgelehnt.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 2 PRAGER SPITZEN
für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
❯ Stiftungsratsvorsitzender Hartmut Koschyk zu Gesprächen mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt in München
Ukrainer
Inflation
Generalkonuslin Dr. Ivana
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes
GmbH, Druck
·
·
Gespräch über eine engere Zusammenarbeit (von rechts): Ex-MdB Hartmut Koschyk von der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Gudrun Koschyk, Dr. Raimund Paleczek und Stiftungsgeschäftsführer Sebastian Machnitzke. Foto: H. Schuster
Červenková, Landesobmann Ste en Hörtler, Andreas Schmalcz von der SLLandesgeschäftsstelle, Dr. Alfred Lange, Landesvorsitzender des Bundes der Danziger, und Hans Knapek, Vorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk. Foto: Katerina Lepic
neues Jahr! Gebr. Geiselberger
und Verlag Martin-Moser-Straße 23 · 84503 Altötting · Tel. 08671 5065-0
vertrieb@ geiselberger.de
www.geiselberger.de Gebr. Geiselberger GmbH, Druck und Verlag Martin-Moser-Straße 23 . 84503 Altötting . Telefon 08671 5065-0 vertrieb@geiselberger.de . www.geiselberger.de ❯ Münchner
Anzeige
Blick in das Depot des Isergebirgs-Museums
Die Papierkrippen von Neugablonz

Das Isergebirgs-Museum in Neugablonz nennt eine große Sammlung von für das IserJeschken-Gebiet typischen Papierkrippen sein eigen. Diesen Fundus mit über 2 000 Figuren hat das Mu-
allem dem leidenschaftlichen Engagement des 96jährigen Willi Lang zu verdanken. Lang wurde in Radl südwestlich von Gablonz an der Neiße geboren und besuchte die Schule in Proschwitz an der Neiße. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg und erlebte das Kriegsende in Schleswig-Holstein, bevor er 1948 zu seiner Familie stieß, die es durch Flucht und Vertreibung in die Nähe von Kaufbeuren verschlagen hatte. Seit 1951 wohnt der außerordentlich rüstige Rentner in Neugablonz. Immer schon, so Lang, habe er sich für die Erinnerung an die alte Heimat engagiert. Mitte der 1980er Jahre, nach Ende seines Arbeitslebens als Bankangestellter, intensivierte er sein heimatkundliches Engagement.
Damals, so erinnert sich Willi Lang, sei die Idee geboren worden, Papierkrippen im 1976 fertiggestellten Gablonzer Haus auszustellen: „Wir hatten aber nichts vorzuweisen.“ „Dann kümmerst Du Dich darum“, lautete die Antwort seiner Mitstreiter, und Willi Lang hatte einen Auftrag. Einen Auftrag, dem er leidenschaftlich nachkam und der ihn bis heute nicht ruhen läßt.
Über Jahrzehnte hinweg nutzte er alle seine Kontakte, sprach Menschen an, die ebenso die Tradition der Papierkrippen pflegten, und trug so ein gewaltiges Arsenal an handgefertigten, originalen Krippenfiguren aus Papier oder Karton zusammen. Neben einigen von Laien gemalten Exponaten waren vor allem künstlerisch besonders hochwertige, von hauptberuflichen, akademischen Malern gestaltete Figuren darunter.

Die Figuren lagern, fein säuberlich in Kartons verpackt, im Depot des Isergebirgs-Museums Neugablonz. Lediglich fünf besonders hochwertige Krippen von den bedeutendsten Krippenmalern sind ständig zu besichtigen, darunter eine prächtige Landschaftskrippe aus Proschwitz an

der Neiße. Die bewegliche Papierkrippe im Heimatstil wurde von mehreren Malern geschaffen, unter anderem von dem Krippenmaler Adolf Hildebrand (1862–1945) ab 1890.
Vielerorts erkennt der aufmerksame Besucher in der bei der Restaurierung im Jahre 1987 von Helmut Krusche gestalteten idyllisch-naiven Landschaft Details, die die Herkunft der Krippe aus dem Isergebirge verraten und Hinweise auf das Leben in der Region geben. Das reicht vom typischen Isergebirgshäuschen mit seinen weiß gestrichenen Balken, über Bauern und Handwerker bei der Arbeit bis hin zu einer Dampfeisenbahn, die über ein Viadukt fährt. 45 der über 400 wunderbar handgemalten Papierfiguren (Öl und Aquarell auf Karton) sind über ein verborgenes Seilzugsystem beweglich. Neben den Papierfiguren sind vereinzelt geschnitzte Figuren zu sehen, die auch Drehbewegungen ermöglichen.
Lang hat die Krippe als Kind oft besucht. Naheliegend, daß er mit dem Krippenbesitzer, dem Musiker Franz Wetschernik, den es als Spätaussiedler in den 1950er Jahren ins Ostallgäu
verschlagen hatte, Kontakt aufnahm. Der vermachte die Krippe dem Museum. Lang: „Der gute Mann hatte bei seiner Reise neben seinen privaten Gegenständen nur seine Geige und eine kleine Kiste mit den Krippenfiguren dabei. Das seien Kinderspielzeuge, habe er dem Zöllner erklärt, als der beim Durchfilzen die Figuren entdeckte.“ Zuviel zum Mitnehmen. Der Zöllner stellte Wetschernik vor die Wahl: „Entweder die Figuren oder die Geige!“ Glücklicherweise entschied sich der für die Krippenfiguren.
Während das Neugablonzer Museum ständig fünf besonders hochwertige Krippen zeigt, werden die vielen anderen Exponate von Zeit zu Zeit thematisch für Sonderausstellungen zusammengestellt und erfreuen dann die Besucher. Die nächste Krippensonderausstellung im Isergebirgs-Museum wird – da ist sich Museumsleiterin Ute Hultsch ganz sicher – 2024 gezeigt. Aktuell (noch bis zum 8. Januar) ist die Sonderausstellung „Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1969“ zu sehen.


Daß die Papierkrippen in Vergessenheit geraten, wenn er einst
■ Das Isergebirgs-Museum Neugablonz ist von Dienstag bis Sonntag von 13.00 bis 17.00 geöffnet und zeigt Exponate zu den Themen „Glas–Schmuck–Industrie“. Der Museumsrundgang führt durch fünf Räume auf zwei Stockwerken, in denen die Geschichte der Sudetendeutschen im Isergebirge und der Neubeginn in Kaufbeuren, ihre Kultur, ihr Alltag, ihre Industrie und ihr Schicksal lebendig werden. Noch bis zum 8. Januar 2023 läuft die Sonderausstellung „Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1969“.

Adresse: Bürgerplatz 1, Kaufbeuren, Telefon: (0 83 41) 96 50 18. Internet: www. isergebirgs-museum.de

Es war schon immer unsere Stärke, dass wir Innovation, höchste Qualität, Systemverständnis und Fertigungskompetenz kombinieren. Und genau da machen wir beim Thema Digitalisierung weiter: Wir schauen im Rahmen unserer Digitalagenda, wie wir diese Kompetenzen und Wettbewerbsvorteile unternehmensweit stärken können. Über allem steht das Ziel, digitalen Mehrwert für uns und unsere Kunden zu schaffen. we-pioneer-motion.com
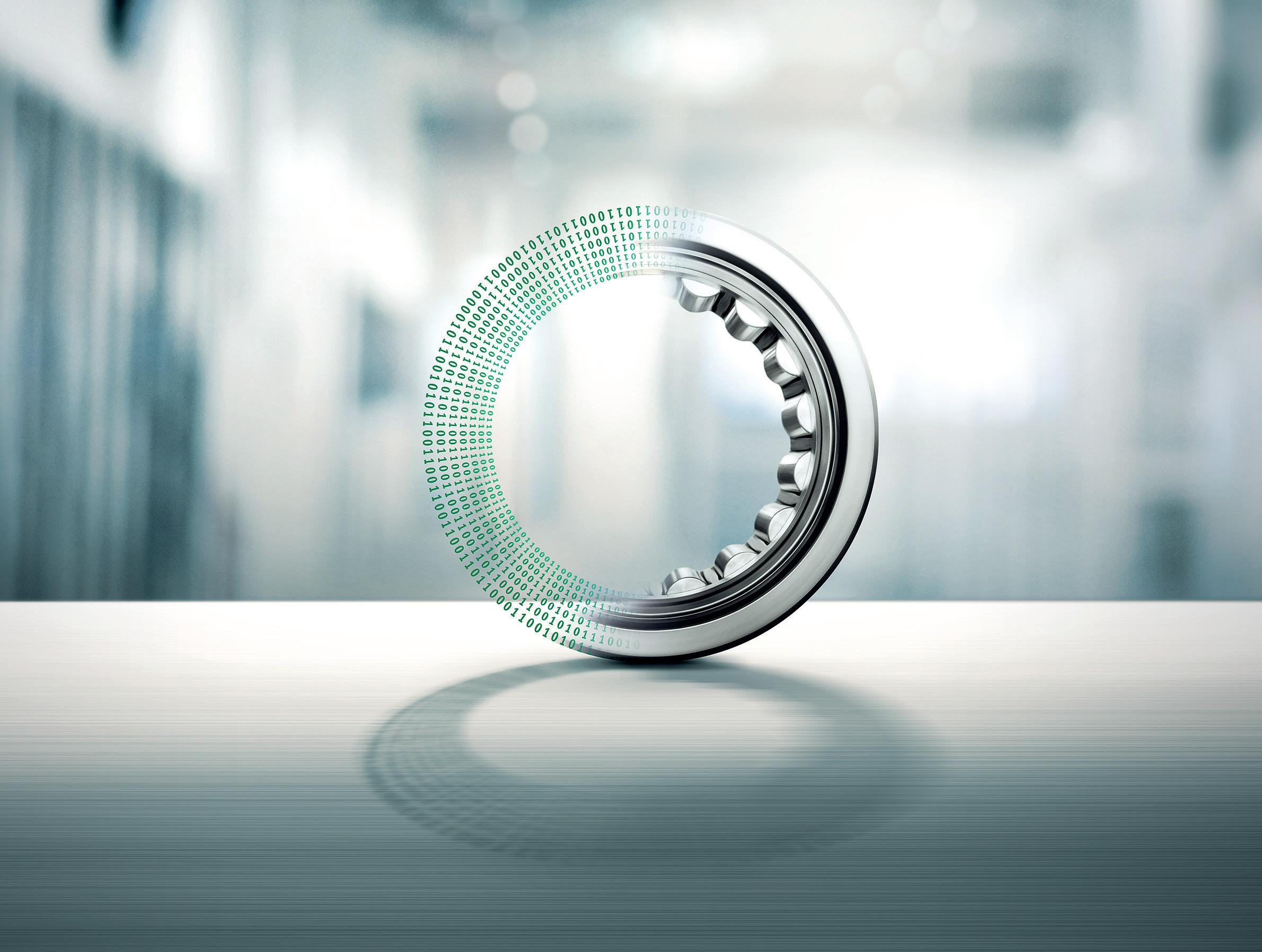
3 AKTUELLES Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022
Prächtige Landschaftskrippe aus Proschwitz an der Neiße. Die bewegliche Papierkrippe im Heimatstil wurde von mehreren Malern gescha en.
900305_Image Digitalisierung HI2_326x152_DE_ZEITUNG.indd 1 28.06.2021 14:05:53
Was uns analog stark gemacht hat, macht uns digital noch stärker. We pioneer motion
sein Amt aufgibt, das fürchtet Willi Lang nicht. Mit Reinhold Streicher gibt es bereits einen Nachfolger, der sich bereits jetzt gemeinsam mit ihm um die riesige Sammlung kümmert.
Klaus D. Treude
Willi Lang, Ute Hultsch und Reinhold Streicher zeigen Exponate aus der groen Sammlung der Papierkrippen des Isergebirgs-Museums.
Die kunstvoll bemalten Kartonguren stellen die Geburt von Jesus Christus mit Maria und Josef dar.
Fotos: Klaus D. Treude
Weltberühmtes Quartett spielt im Sudetendeutschen Haus auf
■ Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau: Neujahrskonzert mit dem Wihan Quartett Prag. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
Die renommierte Fachzeitschrift International Record Review hat das Wihan Quartett aus Prag als „eines der besten Quartette der Welt“ geadelt. Seit über 35 Jahren stehen die Musiker auf der Bühne und haben sich rund um den Globus einen hervorragenden Ruf als Interpreten der tschechischen Komponisten sowie der klassischen, romantischen und modernern Meisterwerke des Streichquartett-Repertoires erworben.

So wurde die Einspielung von Dvořák Op. 34/Op. 105 von MusicWeb International zur „Aufnahme des Jahres“ gewählt, und der Kritiker des BBC Music Magazines jubelte über die Interpretation von Dvořák Op. 61: „Dies ist die beste Aufnahme, die mir

■ Noch bis Freitag, 23. Dezember, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband, Ausstellung zu Waltsch: „Gemeinsam für die Heimat“. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, SL-Bundesgeschäftsstelle, Hochstraße 8, München.
■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. In den Weihnachtsferien geschlossen. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Samstag, 17. Dezember, 17.00, Duo Connessione: Weihnachtliche Abendmusik. Gespielt werden Werke böhmischer und deutscher Barockmusik und der Vorklassik. Erlöserkirche, Schwandorf. Weitere Auftritte: Montag, 27. Dezember, 17.00 Uhr, St. Sebastian, Untersimonswald; Freitag, 30. Dezember, 17.00 Uhr, St. Urban, FreiburgHerdern.
■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10,
bisher untergekommen ist.“ Die Veröffentlichung von Schuberts G-Dur bewertete die International Record Review mit „Outstanding“, und die Sunday Times schrieb: „Dies ist ein Spiel von höchster Qualität. Das Tempo

München.
erlaubt es, den harmonischen Reichtum dieser außergewöhnlichen Musik voll auszukosten.“
Das Wihan-Quartett hat zahlreiche internationale Wettbewerbe gewonnen, darunter das Prager Frühlingsfestival und das
VERANSTALTUNGSKALENDER
■ Sonntag, 8. Januar 2023, 15.00 bis 16.00 Uhr, SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land: Neujahrsgottesdienst der Vertriebenen in München.
Es zelebrieren Msgr. Dieter Olbrich, Msgr. Karl Wuchterl, Dekan Adolf Rossipal und Pfarrer Mathias Kotonski. Für die musikalische Umrahmung sorgt der „Chor der Sudetendeutschen Landsmannschaft“, bestehend aus der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, der Egerländer Gmoi z‘ Geretsried und dem Iglauer Singkreis München unter der Leitung von Roland Hammerschmied. Die Orgel spielt Thomas Schmid. Kirche St. Michael, Neuhauser Straße 6, München.
■ Samstag, 14. Januar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: Bericht von der Fahrt nach Aussig und Tetschen im Oktober 2022. Vortrag von Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Freitag, 27. Januar, Ver-
„Der Wind fegt eisig ums Haus, dicke Flocken fallen vom Himmel, Plätzchenduft und Kerzenschein erfüllen den Raum ...“
band der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel, Wien. Anmeldung an eMail sekretariat@vloe.at
■ Samstag, 28. Januar, 15.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.
■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen (auch in deutscher Sprache) unter www.jiz50.cz
Osaka Chamber Festa. Für alle Musikfreunde wird damit der Auftritt der vier tschechischen Ausnahmemusiker am Samstag, 21. Januar, im Sudetendeutschen Haus zum ersten Kulturhöhepunkt des Jahres 2023.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Bilder-Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
„Der Wind fegt eisig ums Haus, dicke Flocken fallen vom Himmel, Plätzchenduft und Kerzenschein erfüllen den Raum ...“
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.
Für Otfried Preußler, unseren weltberühmten Kinderbuchautor aus Reichenberg, war dies die schönste Zeit im Jahr. Im Jahr 2023 gedenken wir seiner aus Anlass seines 100. Geburtstages und seines 10. Todestages.
■ Mittwoch, 15. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein frohes, friedvolles und erholsames Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2023 allzeit Gottes reichen Segen, Gesundheit, Kraft und vor allem viel Lebensmut und Optimismus.
■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
Ihre Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft
-
Für Otfried Preußler, unseren weltberühmten Kinderbuchautor aus Reichenberg, war dies die schönste Zeit im Jahr. Im Jahr 2023 gedenken wir seiner aus Anlass seines 100. Geburtstages und seines 10. Todestages.
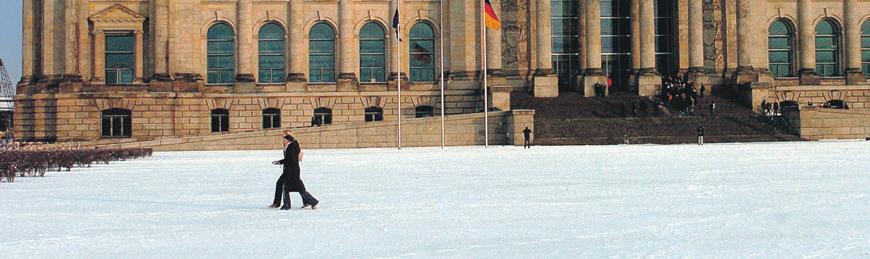
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein frohes, friedvolles und erholsames Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2023 allzeit Gottes reichen Segen, Gesundheit, Kraft und vor allem viel Lebensmut und Optimismus.


Ihre Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Steffen Hörtler Landesobmann
Margaretha Michel · Hannelore Heller
Dr. Sigrid Ullwer-Paul Eberhard Heiser · Bernhard Moder Stellvertretende Landesobleute Andreas Schmalcz Landesgeschäftsstelle
So funktioniert Politik
■ Montag, 9. bis Mittwoch, 11. Januar 2023: „Politische Akteure und Verfahren in Deutschland und Europa“. Seminar mit der Konferenzsimulation „Der Bundestag entscheidet“. Veranstaltung für Multiplikatoren und politisch Interessierte.
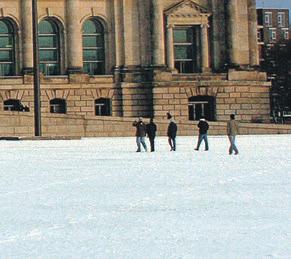


Das Seminar vermittelt in erster Linie die grundlegenden Kenntnisse über das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Neben fundamentalen Verfassungs- und Institutionenkenntnissen werden spezifische Probleme des deutschen Regierungssystems beleuchtet. Im Mittel-
punkt stehen dabei die Analyse der Struktur und der Arbeitsweise politischer Institutionen, die im politischen System laufenden Prozesse unter Berücksichtigung von einflußnehmenden Akteuren sowie ausgewählte Beispiele der innenpolitischen Entwicklung. Eine Konferenzsimulation verdeutlicht die theoretischen Ausführungen.
Ein ergänzender Blick auf die Geschichte, den institutionellen Aufbau und verschiedene Politiken der Europäischen Union rundet das Seminar ab und zeigt zudem Hintergründe und Lösungsansätze für aktuelle europäische Herausforderungen.
Das Foto zeigt das Reichstagsgebäude in Berlin, in dem der Deutsche Bundestag seinen Sitz hat (Foto: Deutscher Bundestag/Achim Melde)
Fragen und Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
Filmsoirée über die Ostsee
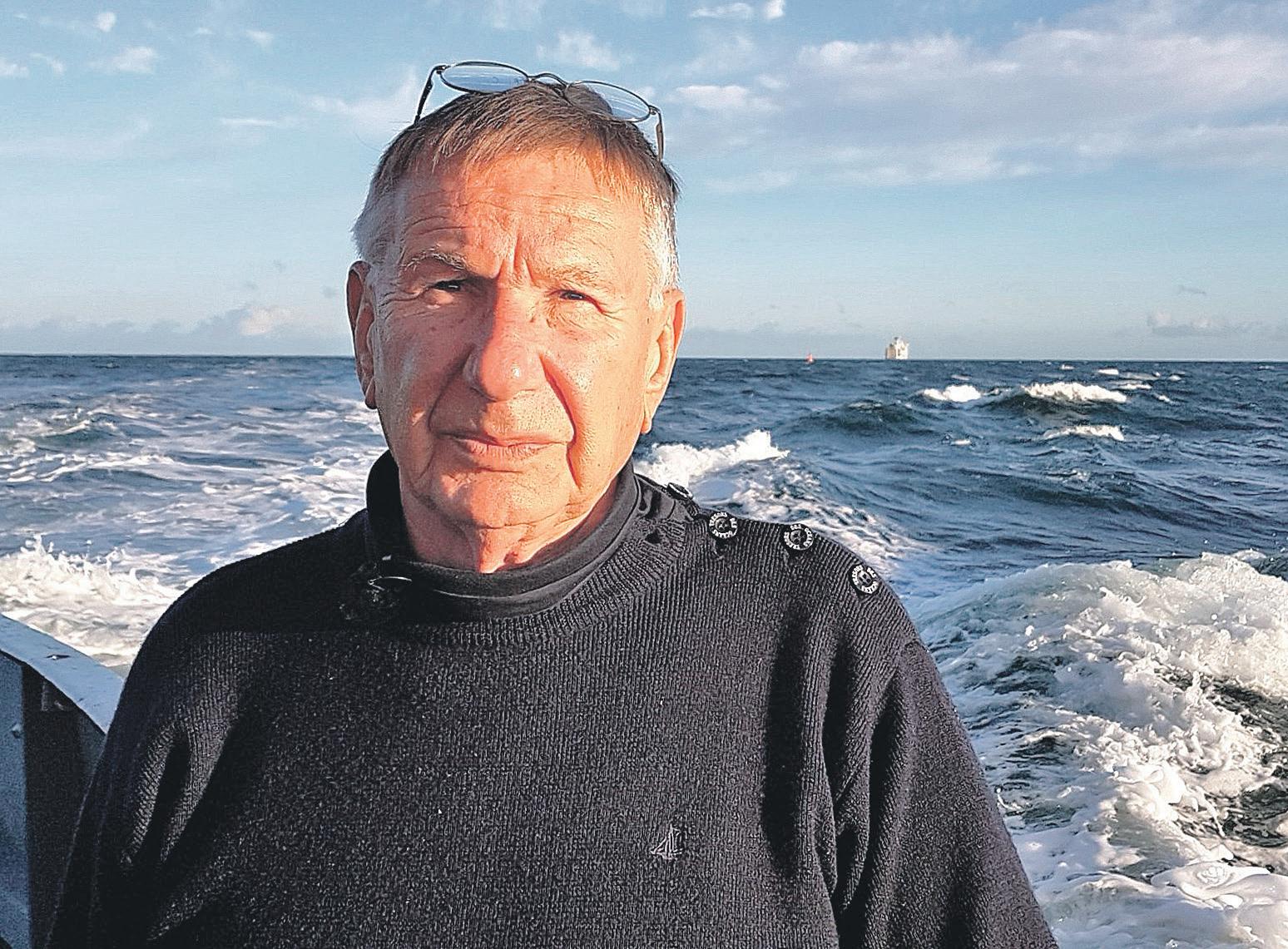
Volker Koepp und die Doku „Seestück“
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Minister der Justiz und Europa a.D., Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
Steffen Hörtler Landesobmann
Margaretha Michel · Hannelore Heller Dr. Sigrid Ullwer-Paul · Eberhard Heiser · Bernhard Moder Stellvertretende Landesobleute
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
Andreas Schmalcz Landesgeschäftsstelle
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
Anzeige
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. In dem Film erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
Der Niederlandverlag
wünscht allen Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023.
neues Jahr 2023.

Niederlandverlag
Johannes Liessel · Waldmeisterstraße 14 · 80935 München · eMail: niederlandverlag@aol.com
■ Dienstag, 10. Januar 2023, 19.00 Uhr: Filmsoirée „Seestück“. Referent: Volker Koepp. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Vor der magischen Naturkulisse der Ostsee begegnet der Film Menschen, die an den deutschen, polnischen, skandinavischen, baltischen und russischen Küsten dieses Binnenmeers leben. Sie erzählen von ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Erinnerungen und Hoffnungen und entwerfen dabei ein Bild von unserer Gegenwart, in der ökologische Probleme, politische OstWest-Konflikte und nationale Sichtweisen auf globale Entwicklungen allgegenwärtig sind. Viele Bilder und Gespräche aus den Drehtagen des Jahres 2017 lassen die unheilvolle Entwicklung der kommenden Jahre vorausahnen.
„Hintergrund ist stets die Geschichte, ich aber will die
Gegenwart erzählen“, lautet das Motto von Volker Koepp. Der 1944 in Stettin geborene Filmemacher studierte an der Technischen Universität Dresden und an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg, wo er 1969 sein Diplom erwarb. Im Anschluß war er bis 1991 als Regisseur im DEFAStudio für Dokumentarfilm in Potsdam-Babelsberg und Berlin tätig. Danach machte er sich als Regisseur, Autor und Produzent selbstständig und gründete „Vineta Film“. Seine zahlreichen Dokumentarfilme, die Regionen und Gebiete mit ihren historischen Entwicklungen und Eigenarten erkunden und dabei Landschaften wie Menschen gleichermaßen in den Mittelpunkt rücken, gewannen in Deutschland und international verschiedene Preise. 2014 bekam Volker Koepp das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.
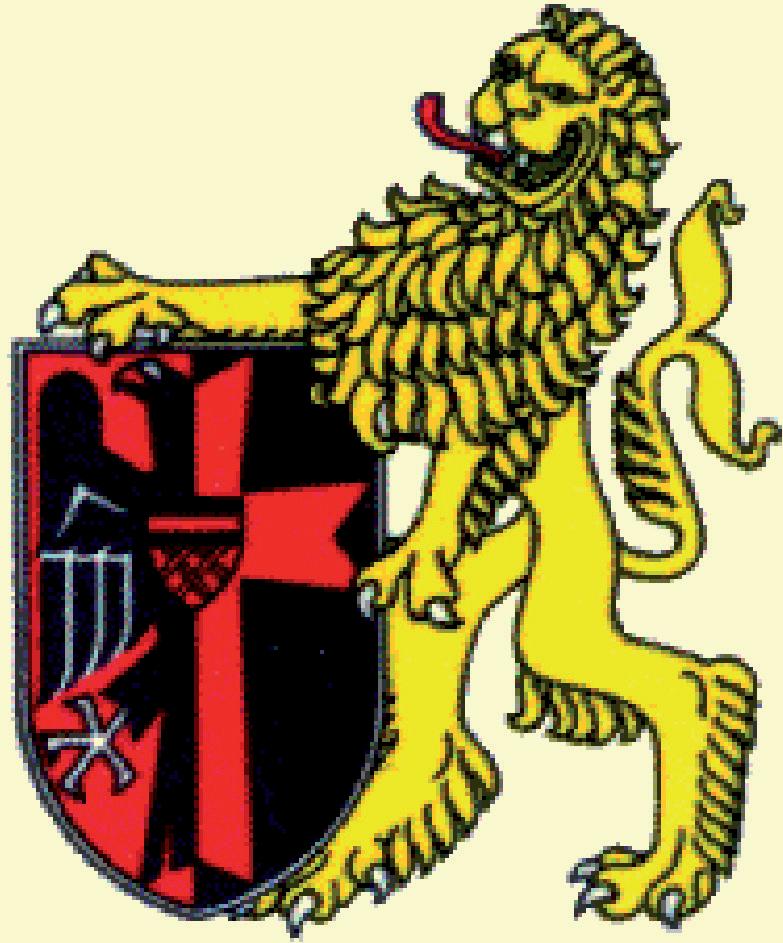
Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 4 TERMINE
❯
Das Wihan Quartett mit Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Michal Kanka und Jakub Čepický. Foto: Petra Hajska
Dokumentar lmer Volker Koepp auf der Ostsee. Foto: Salzgeber
❯
Wihan Quartett gibt am Samstag, 21. Januar, Konzert – der Eintritt ist frei
Anzeige
Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf beim Spatenstich umrahmt von Staatssekretär Sandro Kirchner (4. von links), Ste en Hörtler (6. von links) und Hans Knapek (7. von links). Das Luftbild (Foto links) gibt wieder, wie der Heiligenhof derzeit strukturiert ist. Das Modell (Foto rechts) zeigt, wie der große Erweiterungsbau den Heiligehof ergänzt. Hier soll vor allem Platz für eine moderne Küche, einen großen Speisesaal und mehrere Seminarräume gescha en werden.



„Hier trifft sich das geeinte Europa, hier werden Grenzen überwunden“
Festlicher Spatenstich am Samstag auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen mit Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und vielen weiteren Gästen aus Politik und Gesellschaft. Geplant ist, den Erweiterungsbau mit einer modernen Küche, einem großen Speisesaal und mehreren Seminarräumen im Sommer 2024 in Betrieb zu nehmen.


In ihrer Festrede unterstrich Staatsministerin Ulrike Scharf die große Bedeutung der Institution der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk: „Der Heiligenhof hat sich von der ersten Begegnungsstätte für Sudetendeutsche zu einem grenzüberschreitenden Jugendbegegnungszentrum entwickelt. Hier, an diesem historischen Ort, trifft sich das geeinte Europa, hier werden Grenzen überwunden! Die Sensibilisierung der nächsten Generationen für Völkerverständigung, den Wert eines geeinten und friedlichen Europas und die Stärkung der Demokratie sind wichtige Zukunftsarbeit. Ich freue mich sehr, daß wir den Erweiterungsbau des Heiligenhofs mit zwei Millionen Euro unterstützen können!“
Die Bildungs- und Begegnungsstätte war die erste Immobilie, die nach Enteignung und Vertreibung von Sudetendeutschen erworben werden konnte. Damit ist der Heiligenhof die erste Heimstätte der Vertriebenen in Bayern. Heute werden hier vor allem für junge Menschen Seminare und Tagungen zur Auseinandersetzung mit der Geschichte, dem Schicksal und der Leistung der Sudetendeutschen durchgeführt, um so den grenzüberschreitenden Austausch zu stärken.
Nahe der bisherigen Gebäude entsteht ein Bauwerk, in dem ein größerer Speisesaal, die Küche und Seminarräume untergebracht sein werden. Besonders zu verdanken ist dieses Projekt den „Vätern der Baumaßnahme“ Dr. Günter Reichert, Reinfried Vogler und Peter Sliwka, die mit wegweisenden Gedanken und Ideen das Projekt seit 2018 in Gang brachten und dem Spatenstich beiwohnten. Der Anlaß: Bei Vollauslastung stößt die Infrastruktur des Heiligenhofs – vor allem Küche und Speiseräume –seit Jahren an ihre Grenze. Daher gab es schon längere Zeit Überlegungen und Planungen für eine Erweiterung, die auch die damaligen Schirmherrschaftsministerinnen Kerstin Schreyer und Carolina Trautner unterstützten.
Breite Unterstützung für den Heiligenhof
In seiner Begrüßung hießt Steffen Hörtler in seiner Funktion als Direktor der Stiftung Sudetendeutsches Sozialund Bildungswerk rund 250 Gäste willkommen und sagte: „Ich bin überwältigt von der Teilnahme.“ An Staatsministerin
Scharf gewandt erklärte Hörtler, daß Ulrike Scharf nach ihrem Amtsantritt „sofort Interesse für den Heiligenhof“ gezeigt habe. Staatssekretär Sandro Kirchner sei, so der Direktor, „immer für den Heiligenhof da und an dessen Bildungsarbeit interessiert“. Das Gleiche gelte für Landrat Thomas Bold, der „massiv zum Bau beigetragen“ habe. Hörtler verwies besonders auf Ausgleichsflächen, die für Streuobstwiesen und die Pflanzung von Bäumen ausgewiesen werden. „Ihr erster Entwurf hat uns schon begeistert“, betonte Hörtler in Richtung Architekt Stefan Buttler.
Heiligenhof auch in Zukunft gefragt
Seine Freude über den Start der Bauarbeiten drückte in seinem Grußwort Hans Knapek, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, aus. „Heute ist ein bedeutsamer, symbolträchtiger und
❯
freudiger Tag“, stellte Knapek fest und blickte kurz auf die jüngste Historie des Hauses zurück. „Wir wollen unseren Auftrag fortsetzen: Bildung und Begegnung über und mit Mittel- und Osteuropa – und sudetendeutsche Heimstätte bleiben.“ Dazu würden, so Knapek, die künftigen Räume im Neubau wesentlich beitragen.
Zu Beginn der 70-jährigen Geschichte des Heiligenhofs habe, so Knapek, die Betreuung junger entwurzelter Sudetendeutscher im Zentrum gestanden, die Vermittlung der Struktur und Werte der parlamentarischen Demokratie und des Europagedankens. Später sei die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas als Bildungsinhalt ebenso dazugekommen wie Informationen über die Länder Mittel- und Osteuropas –der Einsatz für die Wiedervereinigung Deutschlands und ein vereintes Europa.
„Nach der Wende wurde der Heiligenhof zu einer Begegnungsstätte von West und Ost mit Vertretern und Teil-
nehmern aus diesem Raum. Es erfolgt eine Bildungs- und Begegnungsarbeit, die sich sehen lassen kann. Der Heiligenhof hat weiterhin einen Auftrag zu erfüllen“, faßte Knapek zusammen. Dabei nannte er mit Verweis auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aktuelle Bedrohung demokratischer Institutionen durch Reichsbürger die Themen Flucht und Vertreibung sowie Verteidigung der europäischen Einigung und der demokratischen Staatsform.
Knapek: „Die sudetendeutsche Bildungsstätte Heiligenhof hat also auch in Zukunft alle Hände voll zu tun.“
Leuchtturmprojekt und Aushängeschild
Als Leuchtturmprojekt bezeichnete Staatssekretär Sandro Kirchner den künftigen Neubau des Heiligenhofs, der quasi Botschafter und Aushängeschild für die Stadt und den Landkreis Bad Kissingen sei. „Der Heiligenhof ist eine Bildungsstätte, in der miteinander gesprochen und eine hervorragende inhaltliche Arbeit geleistet wird“, lobte Kirchner. Er erwartet mit dem Erweiterungsbau auch neue Aspekte und weitere Meilensteine. Vor allem denjenigen, die mit Ideen und Visionen den Heiligenhof voranbringen, galt sein Dank.
Besonders an Stiftungsdirektor Hörtler richtete Landrat Thomas Bold seine Anerkennung. Wie die bisherigen Gebäude müsse künftig auch das neue mit Leben gefüllt werden. Bolds Dank ging auch an Staatsministerin Scharf für die Fördermittel, an die Stiftung und an alle Politiker in den unterschiedlichen Ebenen. „Völkerverständigung ist heute wichtiger denn je. Der Heiligenhof ist ein Aushängeschild und steht für internationale Bildungsarbeit und Gastfreundschaft“, so der Landkreischef..
Strahlkraft in ganz Europa
Staatsministerin Ulrike Scharf, Innen-Staatssekretär Sandro Kirchner, Bad Kissingens Landrat Thomas Bold, Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel mit den Bürgermeistern Anton Schick und Thomas Leiner, MdL Dr. Helmut Kaltenhauser (Vertriebenenpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion), Kreis- und Bezirksrätin Karin Renner Thomas Vollkommer (stellvertretender Direktor des Hauses des Deutschen Ostens), Architekt Stefan Buttler (Architekturbüro Planwerk), Thomas Alles und Flo-

rian Grunert vom Bauunternehmen Schick-Bau, Kreis- und Stadtbrandinspektor Harald Albert Dr. Ortfried Kotzian, Hans Knapek, Christian Leber, Robert Wild, Andreas Kukuk, Hagen Novotny und Frank Altrichter von der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Baden-Württembergs Landesobmann Klaus Hoffmann, Kurt Aue (SL Bayern), Roland Jäger (SL-Ortsverband Bad Kissingen), SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch, Rainer Lehni (Bundesvorsitzender der Siebenbürger Sachsen), Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk Roland Friedrich (Direktor der Sparkasse Bad Kissingen) und die ehemalige Hausleiterin Traudl Kukuk
Den Beitrag des Heiligenhofs für den Kurort Bad Kissingen stellte Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel in den Mittelpunkt seines Grußwortes. „Hier ist ein ganz spezifischer Teil des Lebens. Der Heiligenhof ist nicht nur lokal und regional aktiv, sondern auch im nationalen und europäischen Rahmen. Darauf sind wir sehr stolz“, erklärte das Stadtoberhaupt.
Auf einige Charakteristika des künftigen Gebäudes ging abschließend Architekt Stefan Buttler ein. Grundsätzlich werde das zweigeschossige Bauwerk zur Weiterentwicklung des Heiligenhof beitragen. Es sollte ein offenes Haus mit einem uneingeschränkten Blick – auch auf die Natur – werden. Den Bauherren bescheinigte Buttler Mut – auch wegen der Tatsache, in schwierigen Zeiten zu investieren. Markus Bauer


Friede auf Erden


Ganz oben auf der weihnachtlichen Wunschliste steht jedes Jahr der Friede. Das Fest der Geburt Jesu gilt auch für Menschen, die wenig mit dem Glauben zu tun haben, als das Friedensfest schlechthin. Dahinter steht die Erfahrung, daß der Frieden ein sehr zerbrechliches Gut ist. Schnell kann es mit dem Frieden vorbei sein. Schnell kann sich das Miteinander in ein Gegeneinander verwandeln. Das kennen wir aus unserem persönlichen Zusammenleben mit anderen Menschen wie aus dem Zusammenleben von gesellschaftlichen oder religiösen Gruppen, von Völkern und Nationen.
Unsere Sehnsucht an Weihnachten ist, daß es Waffenstillstand gibt, Ruhe von Wortgefechten, von gegenseitigen Sticheleien und Provokationen, von Streit und Gewalt, ja auch von Waffengewalt in den kriegerischen Auseinandersetzungen unserer Gegenwart. Wenigstens für diese paar Tage im Jahr wünschen wir uns eine heilige Zeit herbei, von der wir im sonstigen Leben kaum zu träumen wagen, weil wir wissen: Wir Menschen können aus eigener Kraft den Frieden kaum schaffen und noch weniger dauerhaft bewahren. Leider hat uns diese bittere Wahrheit das zurückliegende Jahr mit dem Krieg Rußlands gegen die Ukraine wieder allzu deutlich vor Augen geführt.
Die Friedenssehnsucht ist an Weihnachten auch deswegen so groß, weil die biblische Erzählung von der Menschwerdung Gottes selbst die Botschaft vom Frieden ausdrücklich in sich birgt. Nachdem ein Engel den Hirten auf den Feldern die Geburt Jesu als „große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll“, ankündigte und sie auf das Kind in der Krippe als „Zeichen“ verweist, läßt sich „ein großes himmlisches Heer“ mit den Worten vernehmen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ In allen Gottesdiensten am Heiligen Abend, aber auch bei privaten Weihnachtsfeiern wird das Jahr für Jahr verkündet und wirkt wie Balsam für unsere Seele.
Noch deutlicher spricht ein Abschnitt aus dem Prophetenbuch Jesaja vom Frieden. Er wird in den Christmetten als Lesung vorgetragen. „Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel in Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Friede sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt bis in Ewigkeit.“
Ist das alles nur ein frommer Wunsch? Im Kleinen können wir wohl schon unseren Beitrag für den Frieden leisten, indem wir das weihnachtliche Licht in unser Herz einlassen und damit zu Licht- und Friedensträgern werden. Was die Ukraine und alle anderen Kriegsschauplätze der Welt betrifft, beten wir inniglich, daß das Wunder des Friedens wahr werde!
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Pfarrei


Ellwangen-Schönenberg ❯ Mut tut gut
AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 5
❯ Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf beim Spatenstich für den Erweitungsbau auf dem Heiligenhof:
Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf mit (von links) den Sudetendeutschen Robert Wild, Dr. Ortfried Kotzian, Dr. Günter Reichert, Ste en Hörtler, Reinfried Vogler, Hans Knapek, Peter Sliwka und Christian Leber. Fotos: Markus Bauer (2)/Der Heiligenhof (2)
Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft und aus der sudetendeutschen Familie nahmen an dem Spatenstich auf dem Heiligenhof.
Festlicher Spatenstich auf dem Heiligenhof Auszug aus der Gästeliste
Foto: Mediaservice Novotny
Solidarität mit den Uiguren

Den „Tag der Anerkennung des Völkermords an den Uiguren“ am 9. sowie den „Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember nahmen die exil-uigurischen Organisationen in München zum Anlaß, vor dem Chinesischen Generalkonsulat zu demonstrieren.
Einer der Hauptredner war der langjährige CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland.
Posselt wandte sich in seiner Kundgebungsrede gegen den Vorwurf, die Demonstranten und er seien anti-chinesisch: „Antichinesisch ist das diktatorische Verbrecherregime in Peking!“ Menschenrechte seien unteilbar, „und wenn wir für die Freiheit der Uiguren eintreten, so tun wir dies auch für die anderen Nationalitäten der so genannten Volksrepublik, nicht zuletzt auch für die Chinesen selbst.“
Posselt forderte deshalb den Rücktritt von Präsident Xi und dessen Regierung: „Der Genozid an den im Westen Chinas lebenden Uiguren ist doppelter Völkermord. In Konzentrationslagern, in denen mindestens eine Million Uiguren einsitzt, wird deren physische Existenz vielfach vernichtet. Gleichzeitig unternimmt das totalitäre System, das in China herrscht, alles, um die kulturelle und religiöse Identität dieser Menschen zu zerstören.“ Es sei die Verpflichtung aller Demokraten, jede Form von Unterdrückung, Völkermord und Menschenrechtsverletzungen zu ächten.
Sudetendeutscher Tag 2024: Zum Ulrichs-Jahr in Augsburg
Zwei Sudetendeutsche vor der Skulptur des Heiligen Ulrich: Volksgruppensprecher Bernd Posselt traf in Augsburg mit dem dortigen Diözesanbischof Bertram Meier zusammen, dessen Mutter aus Domsdorf im Kreis Freiwaldau in Sudetenschlesien stammt.



Der Bischof ist Nachfolger des Bistumsgründers St. Ulrich, der im Jahr 955 in der Schlacht auf dem Lechfeld die heranstürmenden, damals noch heidnischen Ungarn besiegte, die daraufhin in ihre heutige pannonische Heimat zurückkehrten und den christlichen Glauben annahmen.

Die Diözese wird wie schon in früheren Jahrzehnten vom Juli 2023 bis Anfang Juli 2024 ein europaweit ausstrahlendes Ulrichs-Jahr begehen. Der Bischof machte nun der Sudetendeutschen Volksgruppe den ehrenvollen Vorschlag, in diesen großen internationalen Rahmen an Pfingsten 2024 den Sudetendeutschen Tag einzubinden. Wenige Tage nach der Begegnung zwischen dem Bischof und Posselt beschloß der SL-Bundesvorstand, dieser Einladung zu folgen und – nach dem Sudetendeutschen Tag nächstes Jahr in Regensburg – 2024 wieder einmal nach Augsburg zu gehen.
Zu den weiteren Themen, die der Sprecher mit Bertram Meier, der sich seiner sudetendeutschen Wurzeln sehr bewußt ist, erörterte, gehörte die Diözesanpartner-
Tschechische und deutsche Familien besuchen in großer Zahl den grenzüberschreitenden Geschichtspark Bärnau, der zur Hälfte in der Oberpfalz und zur anderen Hälfte im Egerland liegt. Zu ihnen stieß jetzt auch der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, der im Archaeozentrum beim Geschichtspark die beeindruckende Ausstellung „Das Leben in Paulusbrunn“ eröffnete.
Die von der tschechischen Projektleiterin Petra MusilováSeidlová gestaltete Schau stellt das Alltagsleben und die Geschichte des heute verschwundenen sudetendeutschen Ortes im Bezirk Tachau dar.
Alfred Wolf, Vorsitzender des Vereins „Via Carolina – Goldene Straße“, nannte das Projekt einen Meilenstein für die grenzüberschreitende Arbeit zwischen Bayern und Böhmen. Direkt an der Goldenen Straße gelegen, auf der mit Kaiser Karl IV. ein großer Europäer 52mal gereist sei, entstehe ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsvermittlung.
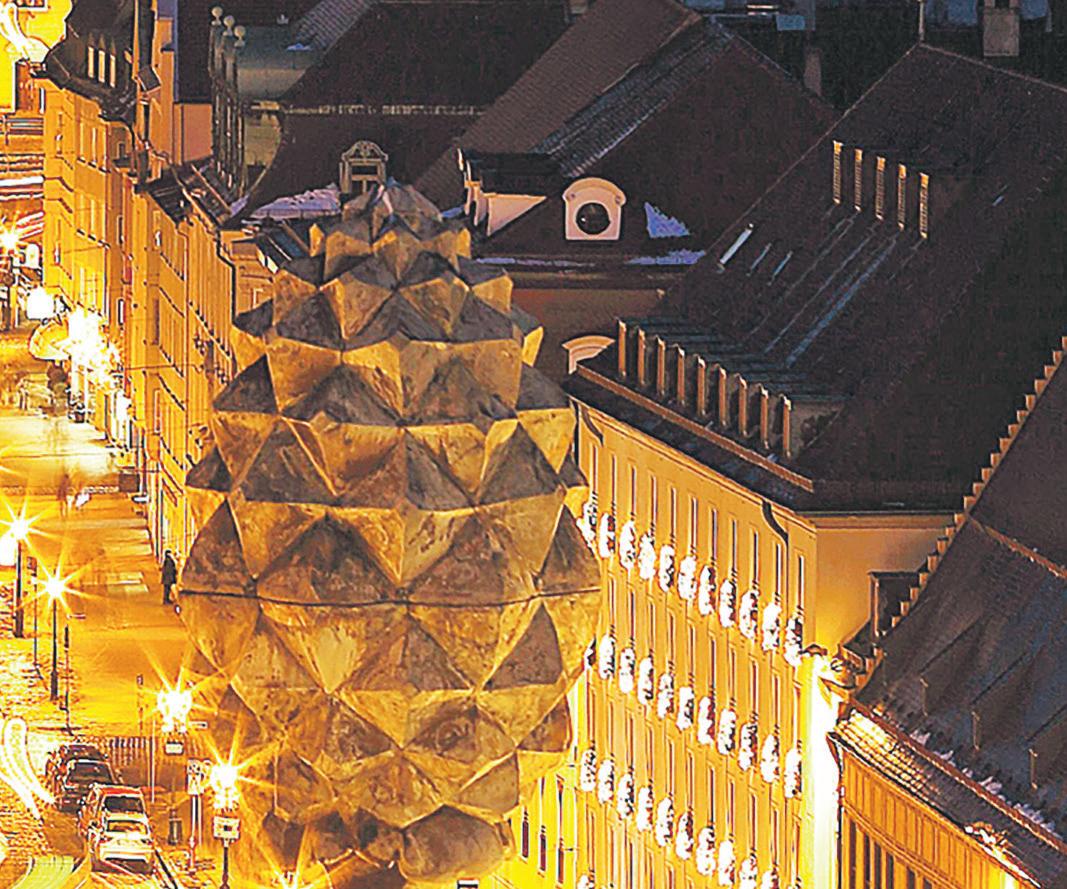
Bernd Posselt warnte in seiner

Rede, zu der zahlreiche tschechische, sudetendeutsche und bayerische Gäste gekommen waren, scharf vor erneuten Tendenzen
zu innereuropäischen Grenzschließungen. Ein tschechischdeutsches Gemeinschaftswerk wie der Geschichtspark lebe da-
von, daß das Land diesseits und jenseits der einstigen Trennungslinien wieder zu einem gemeinsamen Lebens- und Kulturraum zusammenwachse.
Beeindruckend sei, daß die Geschichte von Paulusbrunn vor allem von Schülern und Studenten aufgearbeitet werde. Dies zeige, daß es für Verständigung und Versöhnung wesentlich sei, unbequeme geschichtliche Sachverhalte nicht zu verdrängen, sondern wahrheitsgemäß darzustellen. Die Arbeit in und um Paulusbrunn bezeichnete er als „Investition in die Zukunft”.
Der Sprecher besichtigte auch die historische Böttger-Säule in der ansonsten verschwundenen Gemeinde, die jetzt als dauerhafter Erinnerungs- und Versöhnungsort etabliert werden soll, von dem Schulklassen und Universitäten auf beiden Seiten der Grenze profitieren können.
Posselts Besuch war vom stellvertretenden Landrat des Kreises Tirschenreuth, Toni Dutz, initiiert worden, der auch Bürgermeister von Wiesau und als Egerländer Mitglied des SLBundesvorstandes ist.

Augsburg ist sowohl Patenstadt
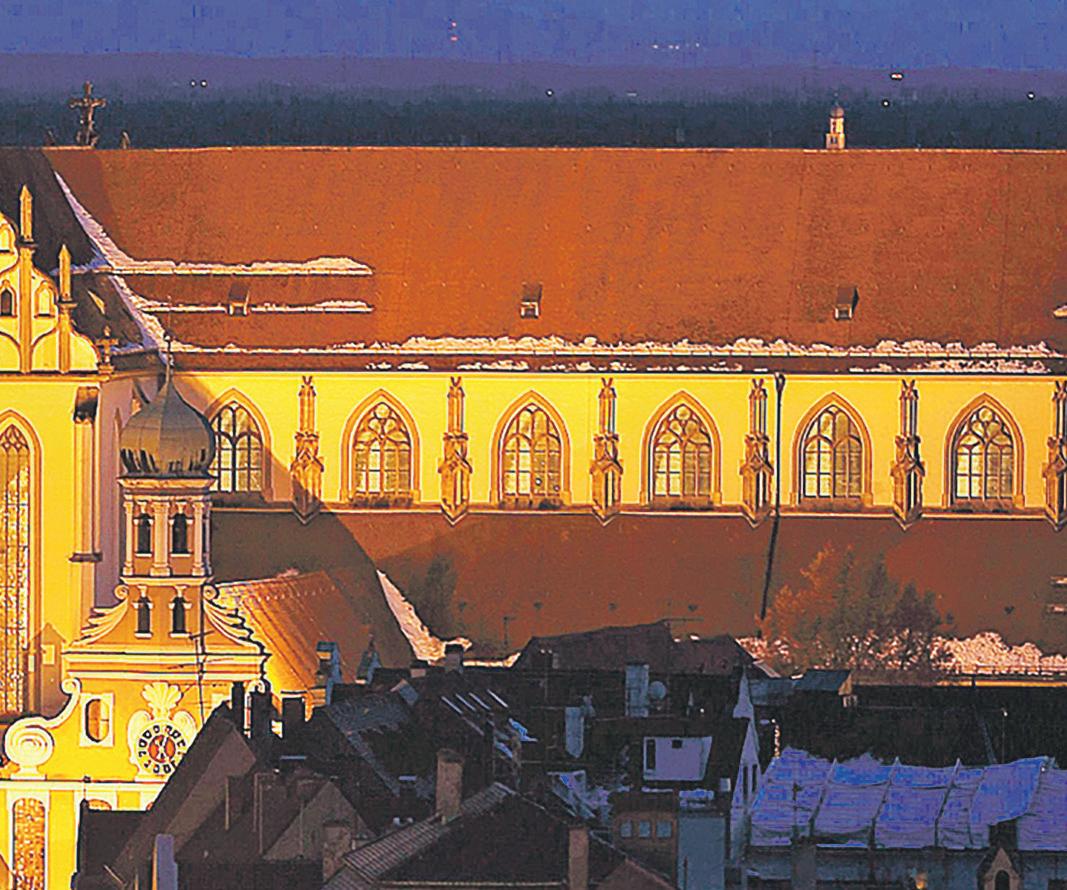
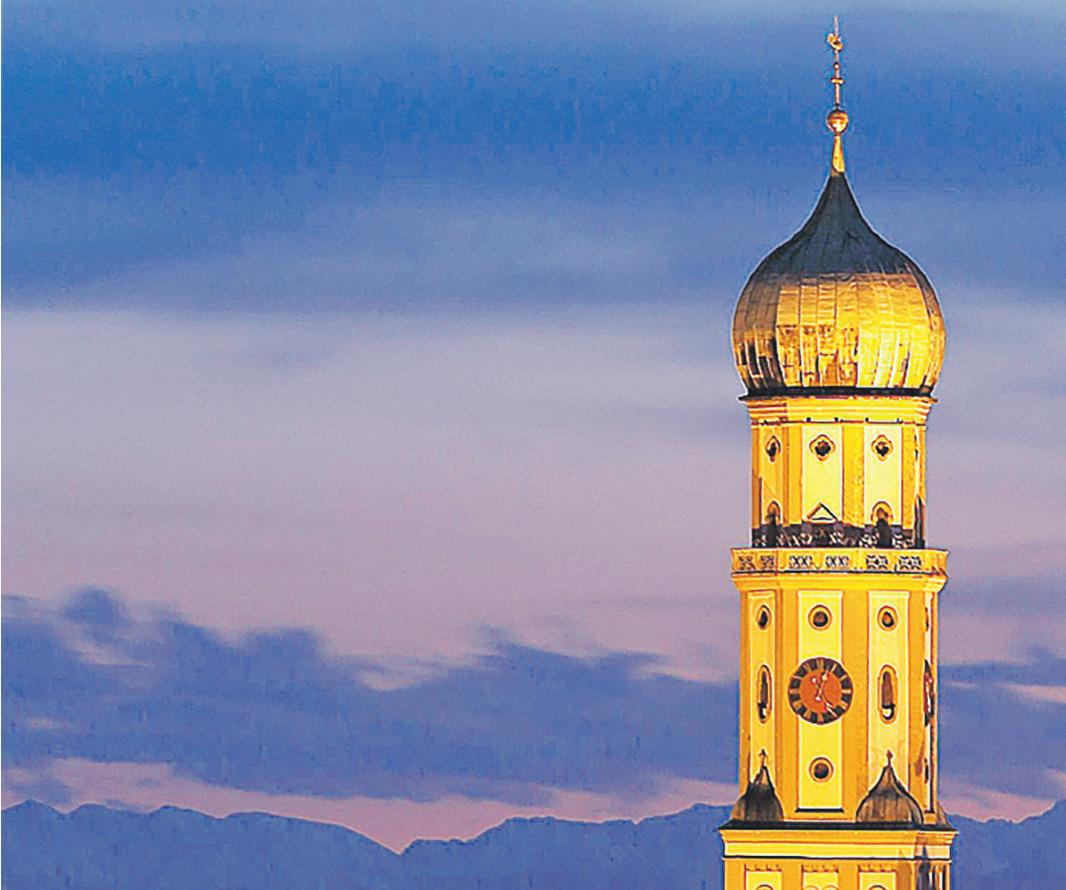
Vertriebenen aus der nordböhmischen Metropole als auch durch Städtepartnerschaft mit dieser verbunden.
❯ Ulrichsjubiläum
Mit dem Ohr des Herzens
Mit einem Jubiläumsjahr begeht das Bistum Augsburg 2023/24 unter dem Leitwort „Mit dem Ohr des Herzens“ den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe und den 1050. Todestag des heiligen Bistumspatrons Ulrich.
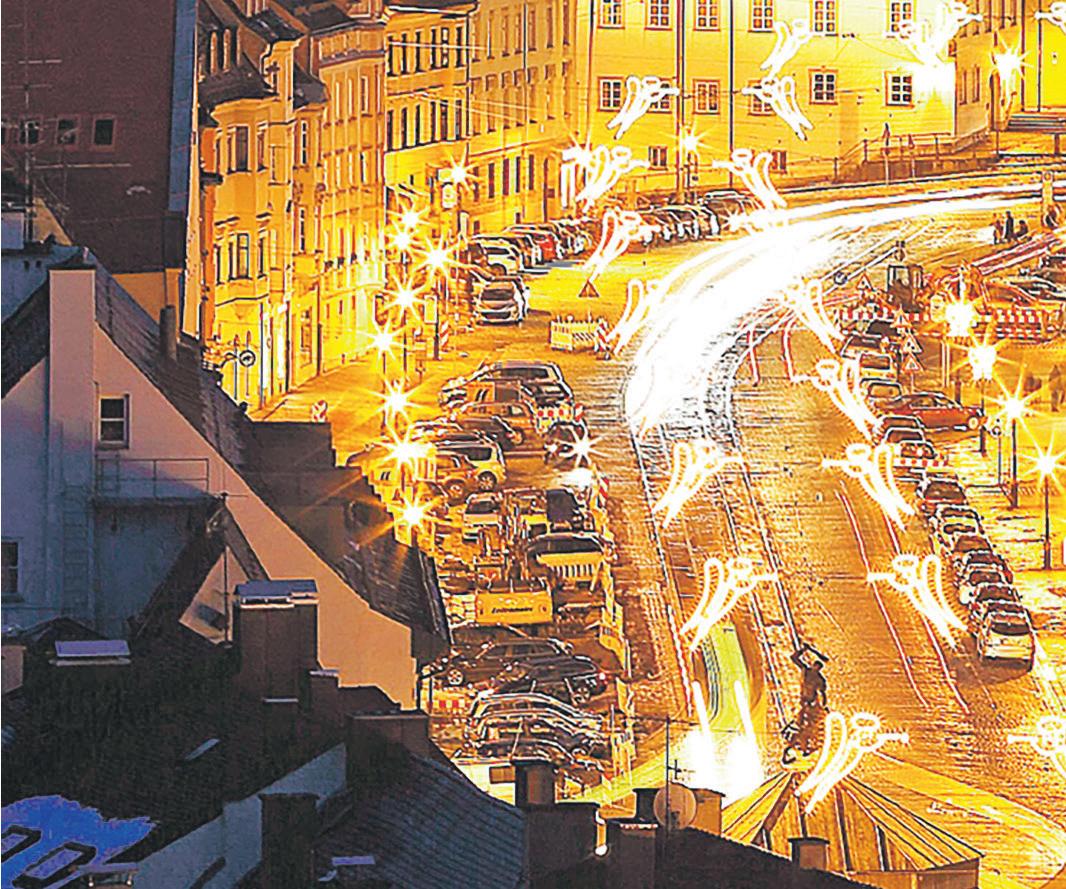
Auch ein Schneesturm hat ihn nicht gestoppt: Volksgruppensprecher Bernd Posselt ist auch bei widrigen Wetterbedingungen zur Stelle, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.



Am Samstag sprach der langjährige CSU-Europaabgeordnete vor der Ludwig-Maximilians-Universität zu den Ukraine-Flüchtlingen und deren Unterstützern, die alle zwei Wochen auf die Straße gehen, um gegen Krieg und Völkermord
U

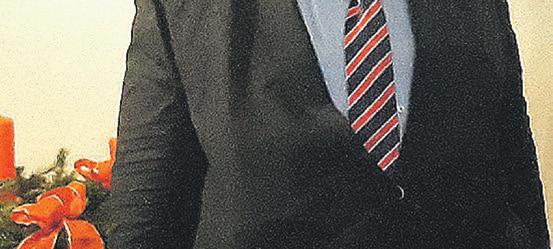

lrich wurde 890 geboren und 923 zum Bischof geweiht. Er verstarb 973. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Mit dem Ohr des Herzens“, das daran erinnert, daß der Heilige Ulrich „mit dem Herzen hörte“ und auf die Nöte der Menschen seiner Zeit einging.
Die offizielle Eröffnung des Ulrichs-Jahres findet am Montag, 3. Juli 2023, in der Basilika St. Ulrich und Afra statt, der sich eine Ulrichs-Woche anschließt, die mit einem großen Fest auf dem Rathausplatz in Augsburg endet. Der Sudetendeutsche Tag findet dann zum Ende des Ulrichs-Jahrs vom 17. bis 19. Mai 2024 in der schwäbischen Hauptstadt statt.






Bereits im Vorfeld des Ulrichs-Jahrs sind mehrere Gottesdienste im gesamten Bistum und Wallfahrten geplant. Mehr Informationen unter www. ulrichsjubiläum.de
Flagge zu zeigen. Posselt hatte bereits Ende der 1990er Jahre vor Putin gewarnt und steht deshalb auf der schwarzen Liste des russischen Machthabers.
AKTUELLES Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16.12.2022 6
❯ Demo gegen China
Bernd Posselt, Toni Dutz und der gebürtige Paulusbrunner Josef Wallerer.
Bernd Posselt bei der Demo vor dem Chinesischen Generalkonsulat.
❯
SL-Bundesvorstand nimmt Einladung von Diözesanbischof Betram Meier mit großer Freude an
schaft zwischen den Bistümern Augsburg und Königgrätz sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit der Stadt Augsburg mit Reichenberg.
der
Volksgruppensprecher Bernd Posselt und Diözesanbischof Bertram Meier. Im Hintergrund eine Skulptur des Heiligen Ulrich. Foto: Johannes Kijas
Die Kirche St. Ulrich und Afra thront vor dem Alpenpanorama über Augsburg. Die Päpstliche Basilika zählt zu den letzten spätgotischen Kirchenbauten in Schwaben und ist Wallfahrtskirche für die Augsburger Bistumsheiligen Ulrich, Afra und Simpertus Foto: Regio Augsburg Tourismus GmbH, Norbert Liesz
❯
Volksgruppensprecher Bernd Posselt besuchte Geschichtspark Bärnau
Nur eine Säule erinnert noch an das verschwundene Dorf Paulusbrunn
Vor der Böttger-Säule (von links): Alfred Wolf, Toni Dutz, Bernd Posselt, Václav Vrbík und Stefan Wolters, der wissenschaftliche Leiter des Geschichtsparks. Fotos: Johannes Kijas
❯ Bernd
Posselt spricht zu ukrainischen Flüchtlingen Flagge zeigen gegen Krieg und Völkermord
Volksgruppensprecher Bernd Posselt spricht vor der Ludwig-MaximiliansUniversität zu den ge üchteten Ukrainern. Fotos: Mediaservice Novotny
Demo-Begegnung: Bernd Posselt und Kabarettist Christian Springer.
Der Heilige Ulrich. Foto: Bistum Augsburg
: Das digitale Angebot wird ausgebaut
Sudeten.net entwickelt sich weiter: Im kommenden Jahr wird das soziale Netzwerk der Sudetendeutschen um neue Funktionen ergänzt.
Das digitale Angebot ging anläßlich des Sudetendeutschen Tages vor rund sechs Monaten an den Start. Seitdem erlaubt es Sudeten.net Interessenten aller Generationen, sich über das Internet zu vernetzen. Zentral ist dabei die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, deren Vorfahren aus den gleichen
Orten stammen wie die eigene Familie.
Von Beginn an wurde dieses Angebot gut aufgenommen –die Zugriffs- und Teilnehmerzahlen der Seite steigen beständig. Parallel zur wachsenden Nutzerbasis konnten auch die der virtuellen Landkarte zugrunde liegenden Ortsdaten verbessert und erweitert werden. Im neuen Jahr wird das Netzwerk nun um eine zusätzliche Funktionsebene ausgebaut.
Bislang verbindet Sudeten.net in erster Linie Menschen; künf-
tig sollen auch die räumlich-organisatorischen Strukturen (Heimatlandschaften, Heimatkreise und Heimatorte) eine größere Rolle spielen. So wird jeder sudetendeutsche Herkunftsort einen eigenen Informationsbereich erhalten. Dort können etwa Angaben zu Geschichte und Gegenwart, Dokumente, historische und aktuelle Bilder, Links und Veranstaltungshinweise präsentiert werden.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Verbindung des neuen Orts- mit dem bestehenden Per-
Digitale Informationskanäle werden weiter ausgebaut
sonennetzwerk. Die Ortsseiten sollen zu virtuellen Anlaufpunkten für alle werden, die sich für die jeweiligen Gemeinden interessieren. Die Heimatortsgemeinschaften erhalten dadurch auch die Gelegenheit, für ihre Aktivitäten zu werben.
Die Umsetzung der Erweiterungen erfolgt in den ersten Monaten des Jahres 2023. Im Anschluß wird die Aufgabe darin bestehen, das neue Ortsnetzwerk mit Leben und Informationen zu füllen. Für die Nutzer ist Sudeten.net gratis. Mathias Heider
Instagram, Facebook und YouTube: So folgen Sie der Landsmannschaft
Informationen über Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien finden Sie zum einen in der Sudetendeutschen Zeitung, aber auch in den digitalen Informationsangeboten der Sudetendeutschen Landsmannschaft.



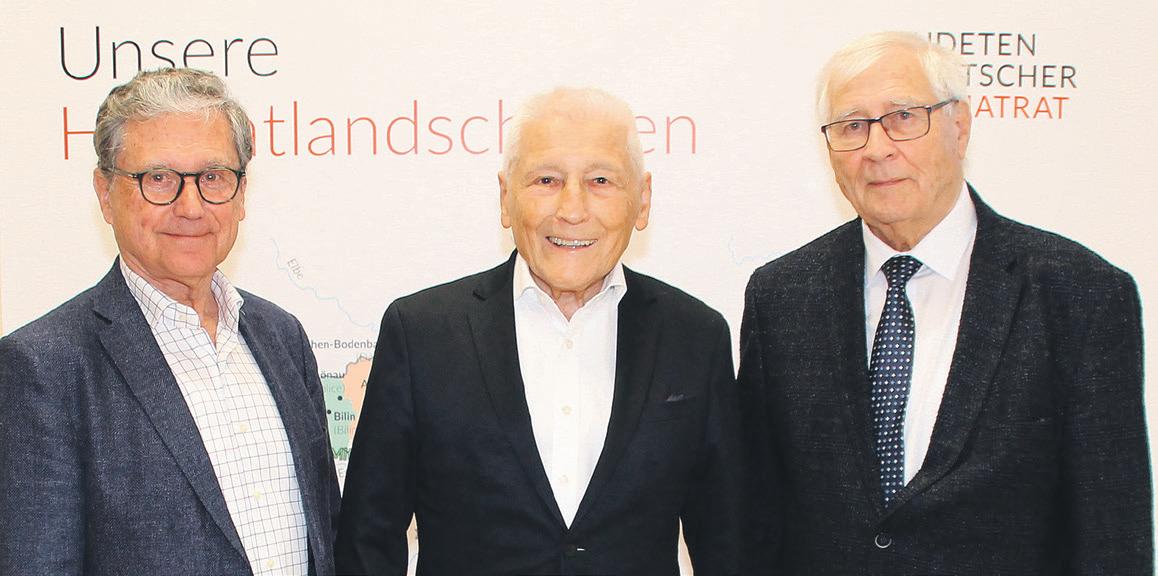
Vom Andreastag bis Heilige Drei Könige: Die Landsmannschaft informiert in diesen Wochen mit dem Instagram-Account @sudeten.de über sudetendeutsches Brauchtum während der Advents- und Weih-
nachtszeit. So erfahren die Leser, auf welche Art und Weise junge Frauen früher im Egerland zum Andreastag am 30. November mehr über ihren künftigen Ehemann herauszufinden versuchten, und warum Kinder im Erzgebirge und Böhmerwald dereinst den Nikolaus nicht ersehnt, sondern gefürchtet haben.
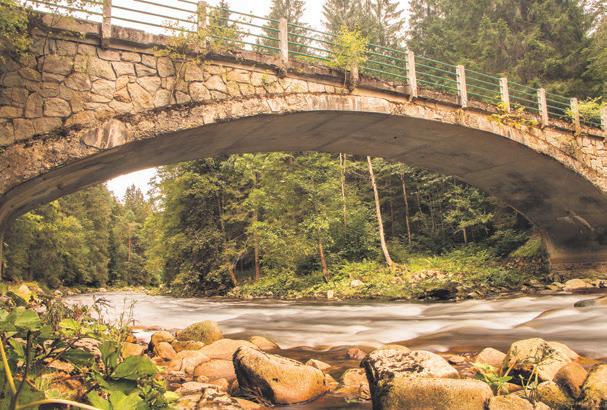
Zudem werden rund ums Jahr Bilder aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, Hinweise auf Veranstaltungen, Rückblicke und vieles mehr veröffentlicht.
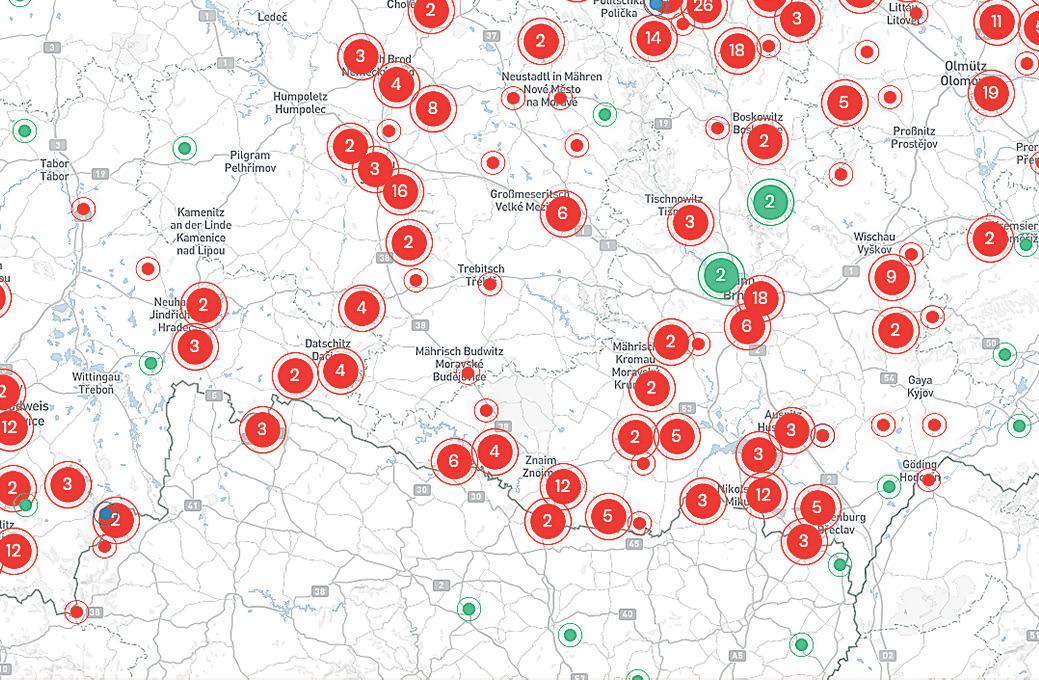
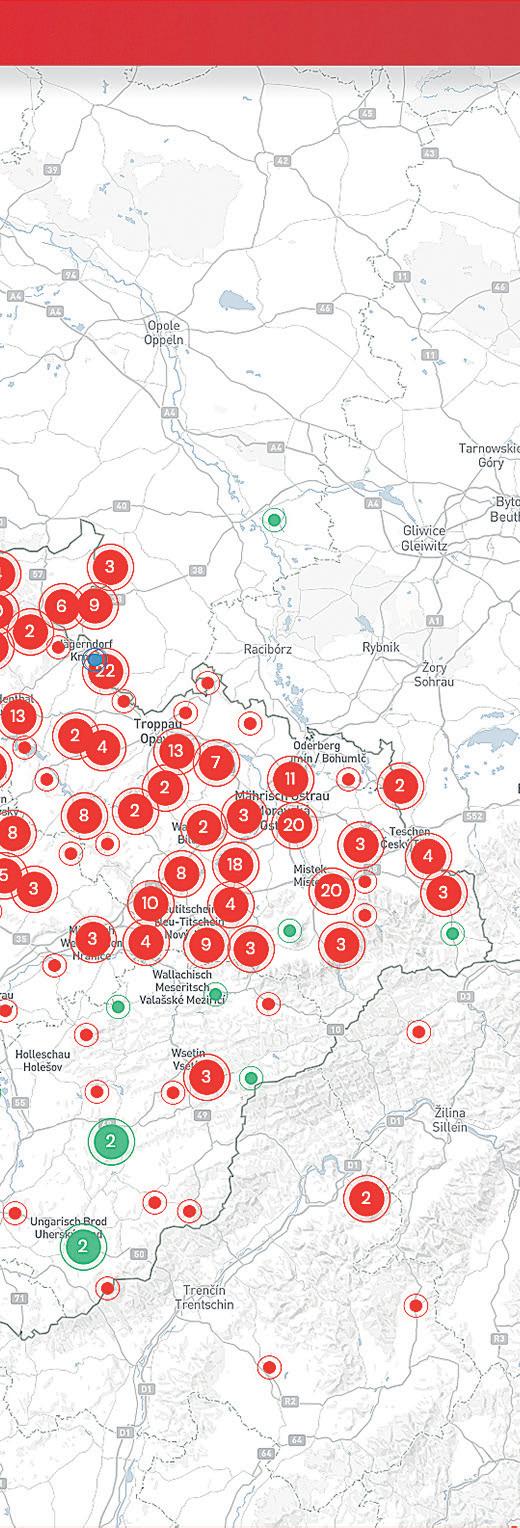
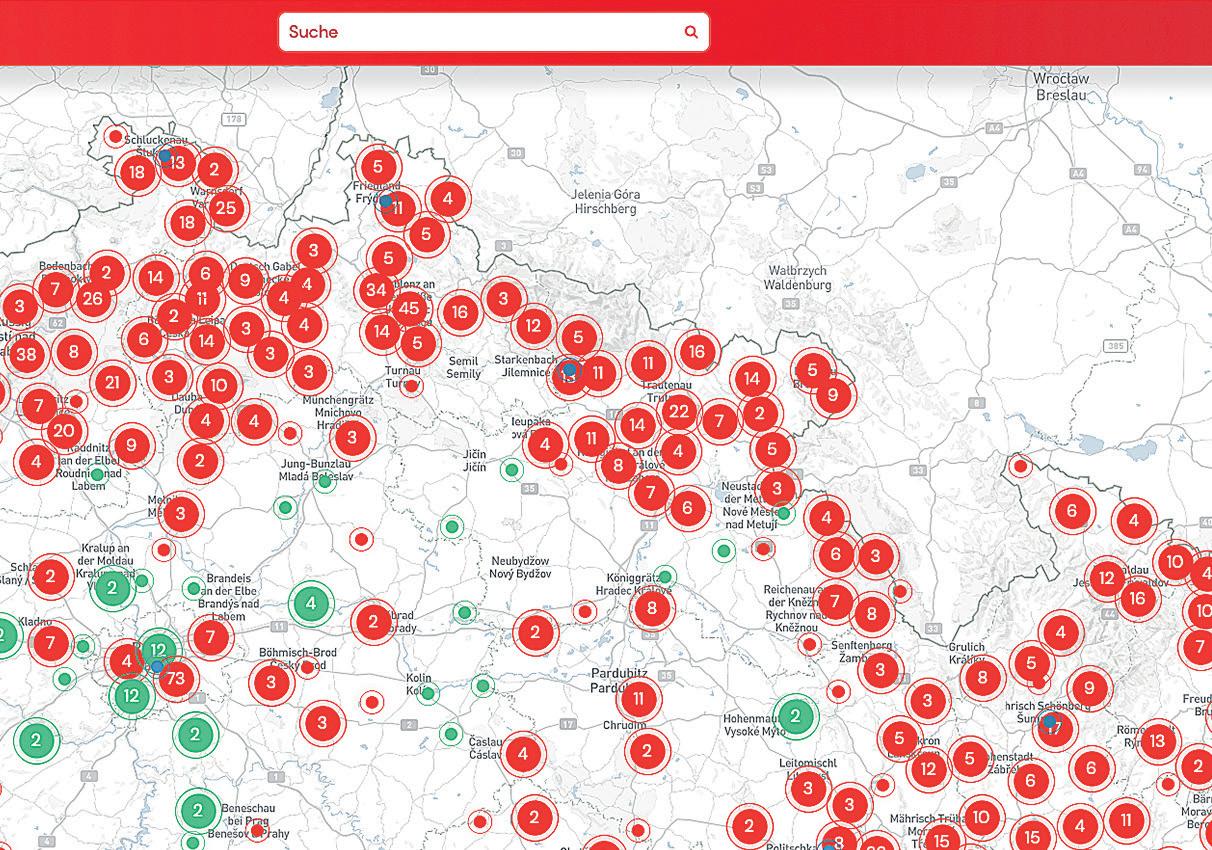
Auch im YouTube-Kanal der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist Adventliches und Weihnachtliches abrufbar: Erika Weinert präsentiert böhmischen Perlen-Christbaumschmuck, Oswald Fuchs liest mundartliche Gedichte im Böhmerwald-Dialekt zu Weihnachten und Stefanie und Elisabeth Januschko spielen Musikstücke zur Advents- und Weihnachtszeit.

Mehr bei YouTube (www. youtube.com) und „Wir Sudetendeutschen“ (@Sudeten).
Für aktuelle Informationen und regen Austausch ist nach wie vor Facebook (@sudeten.de) die erste Adresse. Eine Vielzahl von Informationen präsentiert außerdem die Internetpräsenz www. sudeten.de, die im Laufe des nächsten Jahres in neuem Glanz und mit noch mehr Inhalten erscheinen wird. Und die digitale Ausgabe der Sudetendeutschen Zeitung erscheint für Digital-Abonnenten auf der Plattform www.issuu.com
Dr. Kathrin Krogner
Gemeinsam ist viel Neues entstanden
Liebe Landsleute,
für den Sudetendeutschen Heimatrat geht wieder ein arbeitsreiches Jahr geht zu Ende. Mein Dank gilt Ihnen in den Heimatlandschaften, -kreisen und -gemeinden für Ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz und für das gute Miteinander, durch das wir die Herausforderungen meistern konnten. Ebenso danke ich allen Mitarbeitern und Partnern, insbesondere unserer Sudetendeutschen Zeitung, die diese super Leistung durch ihr Engagement ermöglicht haben. Der Geschäftsführung in der Sudetendeutschen Landsmannschaft und allen Mitarbeitern mein besonderer Dank und hohe Anerkennung. Gemeinsam ist viel Neues entstanden, und unsere Zusammenarbeit war von Erfolg begleitet.

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder neue Mitarbeiter für die vielfältigen Aufgaben in unseren Heimatlandschaften gewinnen. Hier gilt es am Ball zu bleiben und weiter um neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben. Mein Wunsch ist es, daß wir im kommenden Jahr noch mehr Gesicht zeigen und unsere Heimatlandschafts-, Heimatkreis- und Heimatgemeindebetreuerinnen und -betreuer mit ihren Zielsetzungen in dieser Zeitung vorstellen.
Die bewährten Online-Veranstaltungen haben den Meinungs- und Erfahrungsaustausch das ganze Jahr über befördert und sollen beibehalten werden.
Unsere 14 Facebook-Gruppen der SL-Heimatgliederung entwickeln sich erfreulich weiter. Fast 600 neue Mitglieder wurden gewonnen, mehr als 2 600 Beiträge eingestellt, circa 5 900 Kommentare verfaßt. 47 000 Reaktionen erfolgten auf die Beiträge, berichtet der Initiator zahlreicher Facebook-Gruppen des Sudetendeutschen Heimatrates, Markus Decker, unser Beauftragter für „Moderne Netzwerkarbeit“ und „Digitale Medien“.
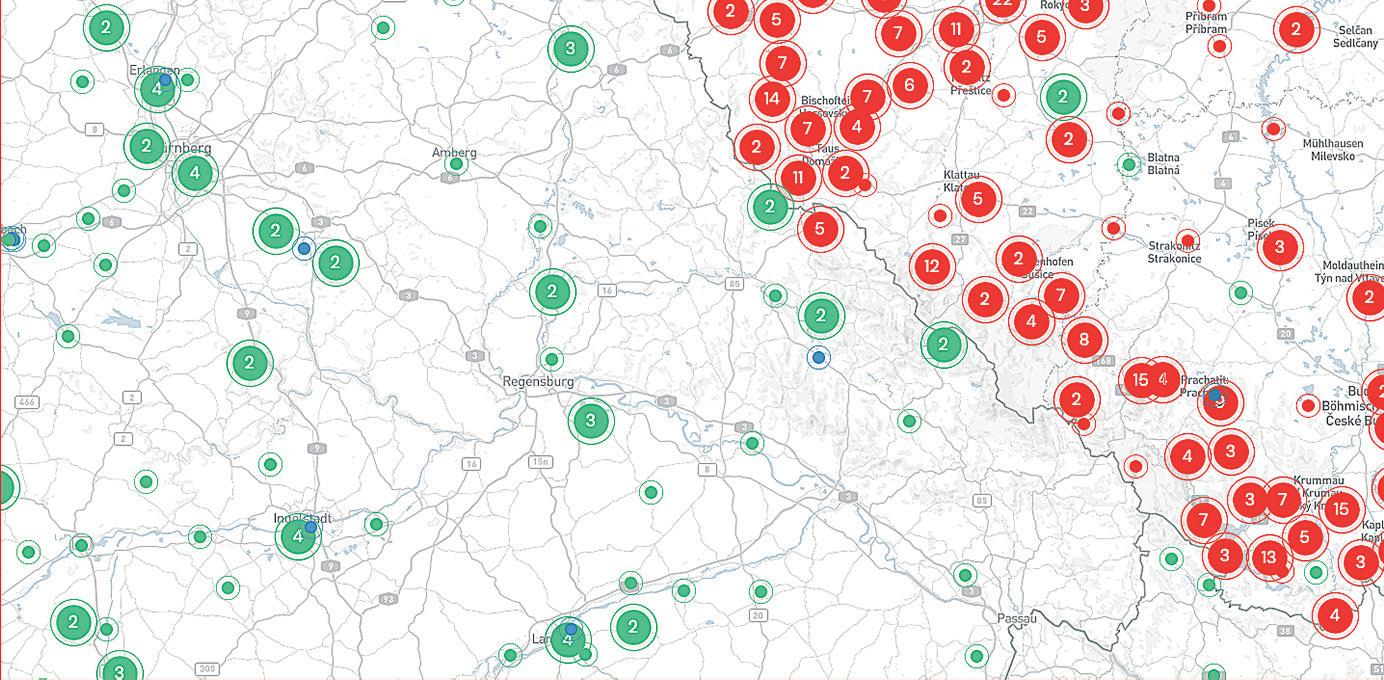
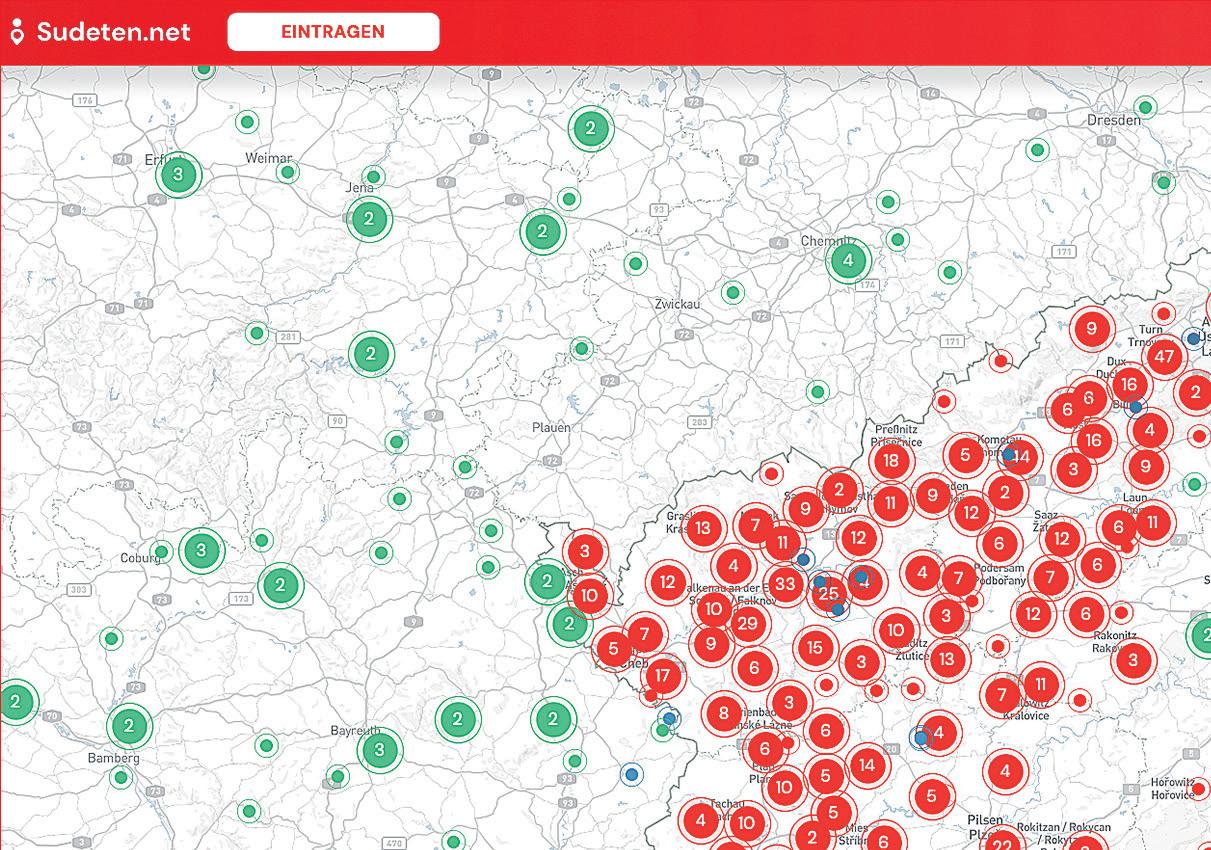
Das neue einzigartige Netzwerk Sudeten.net, das hinsichtlich Anwendermöglichkeiten mit unserer Unterstützung weiter ausgebaut und optimiert wird, ist mit den Facebook-Gruppen digital verbunden. Durch das Zusammenspiel dieser beiden Medien können wir einen weiteren Anschub für einen erfolgreichen digitalen Informationsaustausch erwarten.
Gemeinsam werden wir uns auch weiter für den Erhalt der deutschen Gräber in der Tschechischen Republik einsetzen. Die im Februar bevorstehende internationale Konferenz unter der Schirmherrschaft des Tschechischen Außenministeriums zum Thema erfordert in Zusammenarbeit mit unseren Landsleuten in der Tschechischen Republik unsere Mitwirkung.
So schaue ich erwartungsfroh auf das kommende Jahr und freue mich mit Ihnen auf neue Aufgaben. Der Heimatrat wird durch seine Aktivitäten weiterhin sichtbar und wahrnehmbar bleiben und seine Wirkung weiter ausbauen.
Von Herzen wünsche ich, auch namens meiner Stellvertreter Prof. Dr. Ulf Broßmann und Dr. Wolf-Dieter Hamperl, ein friedvolles Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und hoffe, daß Sie die Freude des Weihnachtsfestes genießen können. Für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen Glück, Gesundheit und allzeit Gottes Segen und freue mich auf einen guten Start voller Ideen und Kraft für neue Aufgaben. Ihr Franz Longin
Wer den Kalender „Heimat in Bildern“ noch nicht hat, muß sich beeilen. Es sind nur noch wenige Exemplare vorrätig.
Der Kalender kann gratis bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft bestellt werden, und zwar per eMail an info@sudeten.de oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 70.
7 AKTUELLES Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 ❯ Digitale Plattform verbindet Menschen und fördert den Dialog
Sudeten.net
Die Plattform sudeten.net ermöglicht den Kontakt zu anderen Menschen, die sich für Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien interessieren
❯ Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrats
Franz Longin (Mitte), Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates, mit seinen Stellvertretern Prof. Dr. Ulf Broßmann und Dr. WolfDieter Hamperl. Foto: Hildegard Schuster
❯
❯ Nur noch wenige Kalender vorrätig Heimat in Bildern Das Titelbild des SL-Kalenders Das Foto für die erste Januarhälfte Anzeige
2022 – ein besonderes Jahr in Kürze

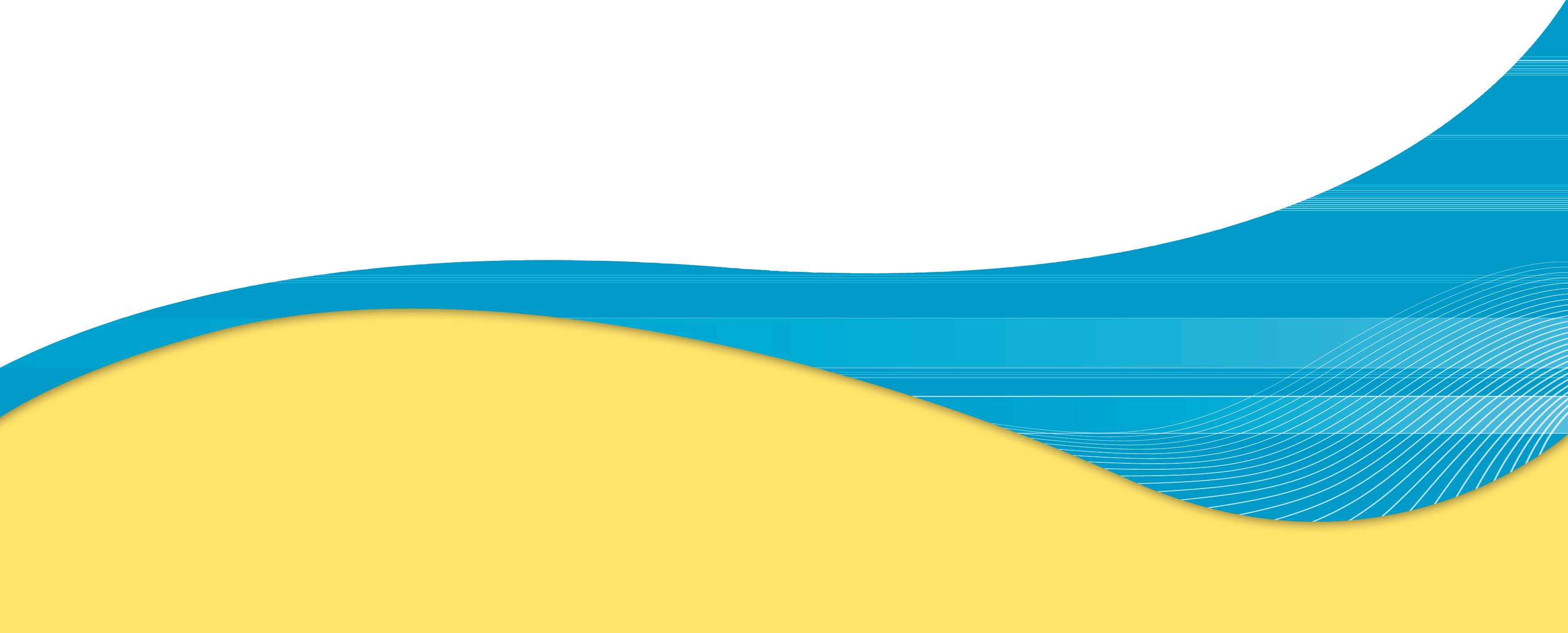

Auch 2022 wurden in der Vertriebenpolitik Weichen gestellt.
Bernd Posselt: Als Präsident der Paneuropa-Union hielt Posselt bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der Initiative in der Tschechischen Botschaft in Berlin die Festrede.


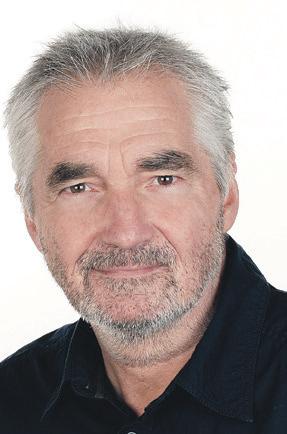
Christa Naaß: Die Präsidentin der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates wurde im Oktober in Bad Alexandersbad zur Co-Bundesvorsitzenden der Seliger-Gemeinde gewählt. Zweite Co-Vorsitzende ist weiterhin Helena Päßler







Natalie Pawlik: Die 1992 in Wostok in Rußland geborene SPD-Bundestagsabgeordnete hat im April den ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten und Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Prof. Dr. Bernd Fabritius, als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten abgelöst.
Petr Fiala: Der tschechische Ministerpräsident hat seine Kontakte nach Deutschland gestärkt. Er traf in Berlin und in Prag mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Außerdem reiste Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach Prag.
2022


das Jahr der Egerländer Tracht


Was für ein Jahr für die Egerländer Gmoin: Der Deutsche Trachtenverband zeichnet die Egerländer Tracht als „Tracht des Jahres 2022“ aus, zum ersten Mal findet ein Bundestreffen der Egerland-Jugend in der Tschechischen Republik statt, und beim traditionellen Schützen- und Trachtenumzug begleiten die Egerländer die Kutsche des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf das Münchner Oktoberfest.
Bereits 2016 hatte der Bund der Egalanda Gmoin begonnen, eine umfassende Dokumentation der eigenen Tracht auszuarbeiten. Am 23. April 2022 wurde diese langjährige Arbeit belohnt.

Auf der Delegiertentagung des Deutschen Trachtenverbandes in Wendlingen am Neckar zeichneten Verbandspräsident Knut Kreuch und der stellvertretende Ministerpräsident von BadenWürttemberg, Thomas Strobl, die Egerländer Tracht als „Tracht des Jahres“ aus.

Der nächste Höhepunkt war Mitte Mai das Doppel-Jubiläum 50. Bundestreffen der EgerlandJugend und 70 Jahre EgerlandJugend. Zum ersten Mal fand diese Veranstaltung im Egerland statt. In Elbogen begeisterten die Egerländer mit ihren öffentlichen Tanz-, Musik- und Trachtenvorführungen auch die Passanten.
Auf dem Sudetendeutschen
Tag wurde diese Egerländer Initiative von mehreren Rednern ausdrücklich gelobt. „Diese Wertschätzung, die uns von vielen Sudetendeutschen, aber auch von der Politik auf dem Sudetendeutschen Tag entgegengebracht wurde, ist eine große Auszeichnung für uns. Es ist schön, daß wir wahrgenommen werden“, freute sich Bundesjugendführer Alexander Stegmaier im Interview mit der Sudetendeutschen Zeitung.

Die nächsten Höhepunkte waren dann die Teilnahme am Bundestrachtenfest im Juni in Bruck in der Oberpfalz und am Gredinger Trachtenmarkt im September 2022, der größten Trachtenveranstaltung Deutschlands.
Beim größten Volksfest der Welt, dem Münchner Oktoberfest, wurde dann der Egalanda Gmoin eine besondere Ehre zu teil. Die Trachten- und Musikabordnung durfte im Zugabschnitt des Bayerischen Ministerpräsidenten durch die Landeshauptstadt marschieren und somit den Schirmherrn der Sudetedeutschen Volksgruppe, Ministerpräsident Markus Söder, und dessen Ehefrau Karin BaumüllerSöder, bis zu Theresienwiese eskortieren. Bundesvüarstäiha Volker Jobst: „ Das war natürlich eine besondere Ehre.“ T. Fricke

Sudetendeutsche
JAHRESRÜCKBLICK Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16.12.2022 8
❯ Namen und Nachrichten
Zeitzeugen, die die Vertreibung erlebt haben, Sudetendeutsche, die sich für ihre Landsleute engagieren, Politiker in Deutschland und Tschechien, die das Verhältnis zwischen den beiden Staaten gestalten, sowie bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, denen die deutsch-tschechische Freundschaft wichtig ist, kommen in den Sudetendeutschen Gesprächen
❯
Interview-Serie der Sudetendeutschen Zeitung
Klaus Ho mann Evi Strehl
Gerda Ott
Jenny Schon Margarete Ziegler-Raschdorf
Vor ihrem 90. Geburtstag gab Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde und Trägerin des Karls-Preises, der Sudetendeutschen Zeitung ein großes Interview.
Pavel Novotny Susanne Keller-Giger
Verla steht für Von Ehrlich Reichenberger Löwen Apotheke Apothekertradition im Zeichen der Raute Seit 1949 in Tutzing Die meistgekaufte Magnesium-Marke aus Ihrer Apotheke IH 04/2022 www.verla.de Anz_Magnesium Verla Dragees_Sudetendeutsche Zeitung_326x152_0522.indd 1 24.05.22 11:23 Anzeige ❯ Tracht des Jahres, Veranstaltungspremiere im Egerland und Oktoberfest-Einzug
Andreas Raab
–
Bundesvüarstäiha Volker Jobst mit Familie vor der Burg Elbogen.
Daniel Mielcarek
Ira Peter
Die Eghalanda Gmoin beim Oktoberfest-Umzug. Foto: Torsten Fricke
❯ Gedenken an Landsleute und Unterstützer
Die Toten des Jahres Gespräche
zu Wort. Mit dieser 2021 gestarteten Serie stellen wir Menschen vor und bauen Brücken – frei nach der Reporterlegende Egon Erwin Kisch: „Nichts ist verblüffender als die Wahrheit, nichts exotischer als unsere Umwelt, nichts phantastischer als die Wirklichkeit.“
2022 – endlich wieder ein Jahr mit persönlichen Begegnungen
„Wir Sudetendeutschen sind wieder da“, hat Volksgruppensprecher Bernd Posselt gleich zu Beginn seiner Festrede auf dem 72. Sudetendeutschen Tag vor Tausenden Landsleuten in der vollbesetzten Halle in Hof festgestellt.
Das traditionelle Pfingsttreffen stand in diesem Jahr unter dem Motto „Dialog überwindet Grenzen“ und endete erstmals am Pfingstmontag mit einer Wallfahrt ins Egerland.
Nach der Pandemie konnte die Sudetendeutsche Volksgruppe nahtlos an die lange Tradition der Sudetendeutschen Tage anknüpfen und zum ersten Mal in der über 70jährigen Geschichte zwei Staatspräsidenten mit dem Europäischen Karls-Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft auszeichnen: Klaus Iohannis, Staatspräsident von Rumänien, erhielt von Bernd Posselt den Karls-Preis 2020, der pandemiebedingt vor zwei Jahren nicht überreicht werden konnte. Das Staatsoberhaupt wurde bei seiner Reise nach Hof von seiner Frau Carmen begleitet.
Der Karls-Preis 2022 ging an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für dessen mutigen und vorbildhaften Einsatz gegen Krieg und Völkermord und für Demokratie und Europa. Stellvertretend für Selenskyi nahm die ukrainische Akademikerin Olga Kovalchuk diese höchste Auszeichnung der Sudetendeutschen entgegen.

Zum ersten Mal nach der Pandemie konnten auch die Herzstücke eines Sudetendeutschen Tages wieder stattfinden, wie der Volkstumsabend, das Böhmische
Am 2. Januar starb Stanislav Burachovic, Historiker, Publizist und Bäderspezialist, mit 71 Jahren in Karlsbad.


Am 17. Januar starb der aus dem nordböhmischen Blottendorf bei Haida im ehemaligen Kreis Böhmisch Leipa stammende Otto Hörtler im thüringischen Meuselwitz im Altenburger Land mit 84 Jahren.
Am 17. Februar starb František Lobkowicz OPraem seit 1996 erster Bischof des neuen Bistums Ostrau-Troppau, mit 74 Jahren in Mährisch Ostrau.
Eleonore Schönborn, die Mutter des SL-Karls-Preisträgers und Wiener Erzbischofs Christoph Kardinal Schönborn, starb am 25. Februar im österreichischen Schruns. Am 14. April wäre sie 102 Jahre alt geworden.
Am 15. März starb Otto Liebert, ein aus Stecknitz im Saazer Land vertriebener Landsmann und ein unvergessener und unermüdlicher Leserbriefschreiber, im Alter von 95 Jahren im niedersächsischen Hameln.
Am 23. März starb die langjährige US-Außenministerin Madeleine Korbel Albright in ihrer Wahlheimatstadt Washington, D.C. Die am 15. Mai 1937 als Marie Jana Körbelová in Prag geborene Politikerin stammte aus einer jüdischen Familie, die nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Wehrmacht vor den Nazis flüchtete.
Am 3. April starb der Egerländer Josef Döllner, Ehrenpräsident des Ost-West-Wirtschafts-Forums Bayern und leidenschaftlicher Förderer der Wallfahrtsstätte Maria Kulm, im 89. Lebensjahr im oberbayerischen Murnau.


Am 14. April starb Herbert Müller, langjähriger Stellvertretender Obmann der SLKreisgruppe und Stellvertretender Vorsitzender des BdVKreisverbandes Augsburger Land sowie Obmann der bayerisch-schwäbischen SL-Ortsgruppe Gersthofen mit Wurzeln im Elbetal, nach langer schwerer Krankheit kurz vor seinem 80. Geburtstag in Gersthofen.



Am 11. Mai starb Marie Anna Steffke, eine vielseitig engagierte, verdienstvolle Sudetendeutsche und christliche Brückenbauerin aus dem Kuhländchen, im 91. Lebensjahr im Krankenhaus im oberfränkischen Hof an der Saale.
Am 7. Juli starb der aus Komotau stammende Wilhelm Platz, ein engagiertes Mitglied der Ackermann-Gemeinde, nach langer schwerer Krankheit mit 88 Jahren in Frankfurt am Main.
Am 5. August starb die mährische Schriftstellerin und Lyrikerin Johanna Anderka mit 89 Jahren in Ulm-Wiblingen.


Am 8. August starb Heinz Lorenz, eminenter Egerländer Musiker und Autor, mit 92 Jahren im oberpfälzischen Burglengenfeld.
Am 19. August starb Erich Pawlu, Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises für Literatur 1986 aus dem Altvaterland, mit 88 Jahren im bayerisch-schwäbischen Dillingen.
Anna Cernohorsky wurde 1909 im böhmischen Molschen geboren und war bis zu ihrem Tod am 18. September, kurz nach ihrem 113. Geburtstag, die älteste Frau Deutschlands. Nach der Vertreibung hatte die gelernte Damenmaßschneiderin im sächsischen Bautzen eine neue Heimat gefunden.
Am 23. September starb Elisabeth Beywl eine engagierte Böhmerwäldlerin, mit 97 Jahren in München.
Der sudetendeutsche Künstler Walter Gaudnek starb spät am Abend des 23. September in Orlando in Florida. Er lebte seit seiner Studienzeit in den Vereinigten Staaten, kam jedoch oft nach Deutschland, um neue Werke zu zeigen und sein kleines Museum in Oberbayern zu betreuen. Der SL-Kulturpreisträger von 1994 stellte weltweit aus.
Am 25. September starb Wolfgang Heisinger, langjähriger Obmann der bayerischschwäbischen SL-Ortsgruppe Augsburg-Hochzoll, mit 75 Jahren. Er diente der SL mehr als 43 Jahre als Ortsobmann und war in weiteren Ämtern auf Kreis- und Bezirksebene tätig.
Am 27. September starb Otto Reigl, ein großer Mäzen der sudetendeutschen Sache, mit 87 Jahren in München.
Am 3. Oktober starb Alois Hiebl, singender Diakon aus dem Böhmerwald sowie beliebter und mit zahlreichen Auszeichnungen geehrter Obmann der oberpfälzischen SLKreisgruppe Cham, mit 81 Jahren in Cham.
Dorffest und die Ausstellung mit den vielen Ständen.
Den traditionellen Auftakt des Pfingsttreffens bildete die festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend, an der in diesem Jahr Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und die neue Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Natalie Pawlik, teilnahmen.

Eine weitere Premiere fand vor allem in der Tschechischen Republik große Beachtung: Zum ersten Mal wurde auf einem Sudetendeutschen Tag auch die tschechische Nationalhymne gespielt – eine Würdigung für die vielen tschechischen Landsleute, die zum Pfingsttreffen nach Hof gereist waren. TF
Am 20. Mai starb Burgi Erler/Scholz, eine engagierte Riesengebirglerin, mit 80 Jahren im mittelfränkischen Forchheim.
Am 19. Juni starb Otto Riedl, langjähriger SL- und BdV-Aktivist aus dem Egerland, mit 85 Jahren im hessischen Löhnberg.
Die Schriftstellerin und bildende Künstlerin Erica Pedretti verstarb am 14. Juli im Schweizer Kanton Graubünden im Alter von 92 Jahren.
Berühmt wurde Pedretti für ihre Bücher, in denen sie sich oft mit ihrer mährischen Herkunftsheimat beschäftigte.

Dafür wurde sie 2019 beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur ausgezeichnet.
Am 5. Oktober starb die langjährige Präsidentin des Bayerischen Landtags und und Trägerin des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Barbara Stamm, kurz vor ihrem 78. Geburtstag in ihrer Heimatstadt Würzburg. Von 1993 bis 2017 war Stamm als stellvertretende Vorsitzende Mitglied in Präsidium und Parteivorstand der CSU.
Am 30. Oktober starb Hildegard Schilling, langjähriges Mitglied der unterfränkischen SL-Ortsgruppe Bayreuth und der dortigen Eghalanda Gmoi, mit 96 Jahren in Bayreuth.
Am 12. November starb Alfred Müller, langjähriger Vorsitzender der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Augsburg, im Alter von 86 Jahren.
9 JAHRESRÜCKBLICK Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16.12.2022
Ministerin Ulrike Scharf bei der Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen in München. Fotos: Mediaservice Novotny (2), U. Miksch, A.Egeresi, T. Fricke (6), privat (6)
Alexander Stegmaier
Volker Jobst
❯ Erstes Pfingsttreffen nach der Pandemie fand in Hof mit prominenten Gästen und Tausenden von Landsleuten statt
Hielten die Festreden: Der Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, und Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Fotos: Torsten Fricke (4)
Festlicher Einzug bei der Hauptkundgebung am P ngstsonntag (von links): Ministerpräsident Markus Söder, Vize Hubert Aiwanger, Pavel Bělobrádek, Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Ministerin Ulrike Scharf und SL-Landesobmann Ste en Hörtler. Foto: Torsten Fricke
Karls-Preisträgerin Barbara Stamm (29.10.1944–5.10.2022)
Knut Abraham
Dr. Erwin Knapek
Prof. Hans-Dieter Zimmermann
Prof. Dr. Bernd Fabritius (links), Präsident des Bundes der Vertriebenen, und Ste en Hörtler (rechts), Stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie Landesobmann Bayern, begrüßten Klaus Iohannis, Staatspräsident von Rumänien und Träger des Europäischen Karls-Preises, sowie dessen Ehefrau Carmen vor der Festhalle.
Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Unser Angebot!
Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)
Adresse:
Name, Vorname
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Fürst Karl Schwarzenberg 85
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief
Am 10. Dezember feierte Karl Fürst von Schwarzenberg, Politiker, Forstwirt, Unternehmer und Träger des Europäischen Menschenrechtspreises des Europarates, 85. Geburtstag.
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Straße, Hausnummer
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Postleitzahl, Ort
Telefon
E-Mail
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)
Neudeker Heimatbrief, für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Geburtsdatum, Heimatkreis
Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Datum, Unterschrift
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)
Karl Fürst von Schwarzenberg ist ein Sproß der Linie von Orlik. Er kam als zweites von vier Kindern von Karl Schwarzenberg (1911–1986) und Antonie Leontine Schwarzenberg, geborene Prinzessin zu Fürstenberg (1905–1988), zur Welt. Seine Mutter war in Österreich aufgewachsen, sprach Deutsch und Tschechisch, sein Vater war nationaltschechisch orientiert und sprach mit den Kindern nur tschechisch. Das Kind Karl besuchte tschechischsprachige Schulen, im Elternhaus wurde zwischen Deutsch und Tschechisch wochenweise gewechselt. Schwarzenberg spricht Tschechisch in einer für moderne tschechische Ohren etwas altertümlich anmutenden Form.
Als er zehn Jahre alt war, übernahmen die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei, und die Familie floh nach Wien. Dort studierte er Jura, wechselte aber dann zum Forstwirtschaftsstudium nach München. 1960 adoptierte ihn sein Onkel Heinrich Schwarzenberg (1903–1965) aus dem Hause Schwarzenberg-Krumau-Frauenberg. Nach dem Tod des Onkels 1965 trat er dessen Erbe in Österreich und Deutschland an und wurde 1979, als Heinrichs älterer Bruder Joseph (1900–1979) kinderlos starb, Familienoberhaupt. Der Tod seines Adoptivvaters zwang ihn zum Abbruch des Studiums und zum Verwalten des Familieneigentums.
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der unverzüglich mit.
Datum, Unterschrift
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Bankleitzahl oder BIC
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Datum, Unterschrift
Bankleitzahl oder BIC
In den achtziger Jahren war er Vorsitzender der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte. Damals begann er auf dem Schwarzenbergschen Stammschloß in Franken, die Tschechischen Exilaktivitäten zu unterstützen. Er organisierte Konferenzen und siedelte das Dokumentationszentrum zur Förderung der unabhängigen tschechoslowakischen Literatur von Professor Vilém Prečan auf seinem Schloß an.
Sofort nach der Samtenen Revolution ging er nach Prag und leitete die Präsidentenkanzlei
� Silberne Ehrennadel des BdV
von Václav Havel. Seine Übersicht in internationalen Angelegenheiten war ein wichtiges Bauelement der erneuerten Präsidentschaftskompetenz. Gleichzeitig wirkte er auch bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ihn in einige Konfliktregionen zu Verhandlungen schickte. Nach dem Ende der ersten Präsidentschaftsperiode Václav Havels zog er sich zunächst von der politischen Bühne zurück und verwaltete das Familieneigentum.
Von 2004 bis 2010 war er Senator und in der Regierung von Mirek Topolánek von 2007 bis 2009 Außenminister. Als zunächst für die Grünen gewählter Abgeordneter wollte er die tschechische politische Szene beleben und gründete 2009 die neue proeuropäische und liberale Partei TOP 09. Nach langer Zeit als Parteivorsitzender zog er sich allmählich zurück und ist heute ihr Ehrenvorsitzender.
Bei der Präsidentschaftswahl 2013 kandidierte er gegen Miloš Zeman. Bekannt sind seine kritischen Worte über die BenešDekrete, die den Kandidaten Zeman zu intensivem Mobbing motivierten. Vielleicht deshalb gewann Zeman schließlich die Wahl mit knappem Vorsprung. Schwarzenbergs Humor ist bekannt, und seine Reaktionen auch auf das Geschehen 2013 waren scharf. Doch seine Bonmots bleiben witzig, während Zeman – in der Isolierung seiner Funktion – immer grobschlächtiger wurde und das Land an Chinesen und Russen verkaufte. Ein Präsident Schwarzenberg hätte die Tschechische Republik näher zur freien Welt gezogen.
Das Volk erzählt sich über Karl Schwarzenberg Anekdoten. Sein Nuscheln und seine Schlafhaltung im Parlament sind legendär. Doch gleichzeitig gab es Beobachter, die genau merkten, wie gescheit er zur Sache redete, wenn er die Augen öffnete und blitzschnell etwas kommentierte. Ein Treffen mit ihm war wie eine frische Brise.
Anläßlich des 65. Geburtstages von Schwarzenberg schreibt Jacques Schuster in der Tages-

zeitung „Die Welt“ 2002: „Der Tscheche und Schweizer mit deutschem, Prager und Wiener Wohnsitz […] war es, der als Chef der Prager Präsidialkanzlei an der Seite von Havel ab 1990 den Anstoß für die deutsch-tschechische Annäherung gab. Bis heute – längst vom Amt befreit –drängt er die böhmischen Freunde zur Wahrhaftigkeit und die Deutschen zur Geduld. Verbliebene wie Vertriebene stehen ihm gleichermaßen nah. ‚Ich habe eben mehrere Patriotismen.‘
Karl Schwarzenberg – der Wanderer zwischen den Welten, einer, der an Joseph von Trotta aus dem ‚Radetzkymarsch‘ erinnert, aber auch an Schwejk und die Figuren aus Johann Nestroys Wiener Wirklichkeit; kurz, ein Mitteleuropäer, der in Regionen, nicht in Staaten denkt, einer, der mit Mißtrauen geimpft ist gegen die Infektion patriotischer Begeisterung. Wer, wenn nicht er, wäre in der Lage, hinter den Kulissen die Gemüter auf beiden Seiten zu beruhigen? ‚Ein Amt in Böhmen strebe ich nicht mehr an, aber wenn ich gebraucht werden sollte, werde ich helfen, wo ich kann.‘“ jš/nh
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, gratuliert dem großen Europäer aus altem Fürstenhaus von Herzen zum 85. Geburtstag.
Fürst Schwarzenberg lernte ich vor Jahrzehnten kennen und schätzen, als er auf Vorschlag des österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky, der ebenfalls böhmische und mährische Wurzeln besaß, die Präsidentschaft des Internationalen Helsinki-Komitees übernahm. Dieser grenzübergreifenden Menschenrechtsorganisation, die im Gefolge der KSZE-Konferenz in Finnland entstanden war, verlieh Schwarzenberg, der damals den kommunistischen Machtbereich nicht betreten durfte, kräftige Impulse. Seine Unterstützung für die tschechoslowakische Freiheitsbewegung gegen den Kommunismus ist legendär. Der aus Böhmen vertriebe-
ne Fürst stellte sowohl seinen fränkischen Stammsitz in Schloß Scheinfeld als auch sein Wiener Palais und sein steirisches Schloß Murau ganz in den Dienst seiner Aktivitäten, die auch Unterstützung für das Exil umfaßten. Sein Europäertum ist vorbildlich und von beeindruckender Selbstverständlichkeit. Unsere Volksgruppe und das tschechische Volk verdanken ihm mutige Weichenstellungen im Verständigungsprozeß, für die er bei seiner Präsidentschaftskandidatur von Nationalisten und Kommunisten mit Haß und Spott überzogen wurde. Wenn er auch damals nicht das höchste Staatsamt erlangte, bewies er mit seiner Kandidatur, daß fast 50 Prozent des tschechischen Volkes hinter ihm standen, nachdem er eindeutig die Vertreibung der Sudetendeutschen verurteilt und in einer von Millionen gesehenen Fernsehsendung betont hatte, daß Edvard Beneš heute vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag kommen müßte.
Ich habe es sehr genossen, auf vielen Gebieten mit ihm zusammenzuarbeiten, etwa bei der ersten tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, bei der Unterstützung des EU-Beitritts von Kroatien sowie bei der Trennung zwischen südlicher und östlicher EU-Partnerschaftspolitik. Vorher waren die nichteuropäischen Mittelmeerstaaten und unsere östlichen Nachbarn in derselben Kategorie. Die Trennung ermöglicht bis heute, einem zutiefst europäischen Land wie der Ukraine die nötige europäische Unterstützung zu gewährleisten.
Besonders hat mich gefreut, daß ich mit ihm 2015 auf einer Liste von 89 Europäern stand, denen Wladimir Putin bereits damals die Einreise nach Rußland verboten hat, weil wir uns für Menschenrechte und gegen das russische Vorherrschaftsstreben in Europa engagieren. Fürst Schwarzenberg ist nicht nur ein Staatsmann von europäischem Format, sondern auch ein zu klaren Aussagen und überaus gescheiten Provokationen neigender Intellektueller mit unerschöpflichem Humor. Ich danke ihm für seine Verdienste und wünsche ihm zum Geburtstag viel Glück, Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen.
Steffen Hörtler und Paul Hansel geehrt
Weiter hob Knauer Hörtlers Engagement im Sudetendeutschen Rat, im Kuratorium der Sudetendeutschen Stiftung, als Schatzmeister im Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker und im Landesvertriebenenbeirat hervor.
Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift
Mit der Silbernen Ehrennadel des Bundes der Vertriebenen wurden im Rahmen eines festlichen Abendessens des BdVLandesausschusses der Obmann der SL-Landesgruppe Bayern, Steffen Hörtler, und der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kulturwerk Schlesien, Paul Hansel, im Haus des Deutschen Ostens in München ausgezeichnet. BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer würdigte beide Persönlichkeiten als „Felsen in der BdV-Brandung“.

Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
E-Mail svg@sudeten.de
Kontoinhaber
Steffen Hörtler, der seit einem Jahr auch dem Präsidium des BdV angehöre, habe sich seit 2007 große Verdienste zunächst als Geschäftsführer und später als Stiftungsdirektor des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks sowie bei der Sanierung und Erweiterung des Heiligenhofs erworben. Mit großem Elan übe er seit 2014 das Amt des SL-Landesobmannes und daneben das des Stellvertretenden Bundesvorsitzenden seiner Landsmannschaft aus.
Steffen Hörtler begann 1998 auf der Burg Hohenberg seinen beruflichen Werdegang. Als junger Absolvent der Hochschule
Fulda zeigte er so viel Engagement, daß er bereits nach kurzer Zeit die Betriebsleitung auf der Burg Hohenberg übertragen bekam. Er entwickelte die Einrichtung mit der Anerkennung als Bildungsstätte, durch die Veranstaltung von deutsch-tschechischen Jugendbegegnungen und durch Fremdbelegungen zu einem rentablen Betrieb weiter.
Damit konnte bereits der damals
notleidende Heiligenhof finanziell unterstützt werden. Als 2003 die Stelle der Leitung am Heiligenhof zu besetzen war, lief die Entscheidung fast zwangsläufig auf Steffen Hörtler hinaus. Nicht hoch genug eingeschätzt werden kann auch das ehrenamtliche Engagement von Ministerialdirigent a. D. Paul Hansel aus Vaterstetten. Im BdVLandesverband Bayern nimmt er als Landesvermögensverwalter, Jurymitglied für die Vergabe des Kulturpreises und Vorsitzender des BdV-Bezirksverbandes Oberbayern herausragende Funktionen ein. Weiter ist er als Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung Kulturwerk Schlesien, Stellvertretender Kulturreferent der Landsmannschaft Oberschlesien im Kreisverband München, Stellvertretender Vorsitzender im Schlesier-Verein München und als Schriftführer im Landesvorstand der Landmannschaft Schlesien tätig. Seit 2014 gehört er als Vertreter des BdV dem Medienrat des Freistaates Bayern an. Susanne Marb
FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 10
PERSONALIEN
Adresse: Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail Geburtsdatum,
Unser Angebot!
Heimatkreis
E-Mail svg@sudeten.de
Adresse: Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail Geburtsdatum, Heimatkreis
� Unermüdlicher Versöhner und begnadeter Provokateur
Bild: Susanne Marb
Paul Hansel, Christian Knauer und Steffen Hörtler.
Zum ersten Mal seit 2016 fand im Sudetendeutschen Haus –nach Renovierung des Hauses sowie Corona-Ausfall – wieder ein böhmisch-mährisch-schlesischer Weihnachtsmarkt statt. Veranstaltet wurde der Markt am ersten Adventssamstag von der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch. Die Veranstaltung hatte ihr Mitarbeiter Andreas Schmalcz perfekt organisiert. Nach der Begrüßung durch die Heimatpflegerin hielt der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Ortfried Kotzian, eine Ansprache. Die Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München sang viele weihnachtliche Lieder.

Heute gibt es nach langer Pause hier wieder ein weihnachtliches Treffen“, freut sich Ortfried Kotzian. „Das ist einfach nur schön!“ Der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung meint, daß solche wiederkehrenden Termine wie Adventsmärkte zu den wichtigen Bräuchen im Jahresablauf zählten. „Feste machen Strukturen!“ Zum Jahresende würden sie auch helfen, mit Altem abzuschließen und Neues zu beginnen. „Ich wünsche allen viel Vergnügen“, ruft Kotzian. „Und greifen Sie an den Ständen forsch in die Tasche!“ Zuvor begrüßte Christina Meinusch die Gäste und gestand: „Das ist mein erster Adventsmarkt als Heimatpflegerin.“ Denn 2021 habe der Markt wegen der Pandemie nicht stattfinden dürfen. Auch sie betont, wie wichtig Bräuche für die Erhaltung heimatlichen Kulturgutes und für persönliche Erinnerungen seien.
Und gelebte Erinnerungen sind überall zu sehen. Christbaumschmuck aus Glas und Per-
Gelebte Erinnerungen
len, böhmisches Kristall, geklöppelte Spitzen und gestrickte Mützen, bunte Bilder und Krippenfiguren, knusprige Plätzchen und anderes Gebäck sind an den Ständen ausgebreitet.
Die Gäste strömen in Scharen in das Sudetendeutsche Haus.
Im Foyer offeriert die Chefin vom Alten Bezirksamt im Haus des Deutschen Ostens (HDO), Annerose Kloos, ein Kuchenbuffet und herzhafte Snacks wie Fettbrot und Fleischpflanzerl.
Die Schmankerl lassen sich die Gäste auf gedeckten Tischen im Adalbert-Stifter-Saal schmekken.
Im Saal sitzt auch eine kleine Klöppelrunde unter Leitung von Marie-Luise Kotzian, die live ih-
sengrüner Blumennähen, an einem Tisch demonstriert.
Erika Weinert und Waltraud Valentin warten mit Christbaumschmuck und Kunsthandwerk aus dem Böhmerwald auf. Ergänzt werden die Böhmerwäldler Standl von Ingrid Heigl mit ihrem Bastelstand und Jean McIntyre mit einem Tisch voller Geschenkkarten.

schen Bereich und bieten Johannisbeerlikör und Kürbis-Marmelade sowie echten Stonsdorfer in kleinen Stamperln an.
Christine Rösch aus dem Kuhländchen offeriert duftende Kiechlen, Seidentücher und gebastelte Weihnachtskarten. Die SL-Volkstumspreisträgerin von 2020 ist wie immer fröhlich und wunderbar gekleidet.
Am Stand der Wischauer biten Rosina Reim, Tochter Monika Ofner-Reim und Schwester Christine Legner ihre beliebten Marmeladen und Leckereien an.

Schmuck und Publikationen. Anna Freisinger präsentiert ihre selbstgebastelten Weihnachtszeitarbeiten. Traditionelle Handarbeiten gibt es auch bei Christa Wenzel aus Teplitz-Schönau, und Petra Rupp hat an ihrem Stand Trachtentaschen und -schmuck aufgehängt.





Wie immer stellt Rudi Saiko kunstvolle, selbstgesteckte Adventskränze, Türschmuck aus Tannengrün und Kerzen zur Schau, die schnell Abnehmer finden. Der KUBULA-Laden für Tschechische Kultur aus München ist unter Leitung von Michael Locher mit Kalendern, Büchern und buntem Holzspielzeug auch wieder dabei.
So viele Stände sind gemeldet worden, daß sie sich bis in den Gang vor dem Adalbert-StifterSaal ausdehnen. Hier steht der diesjährige SL-Publizistikpreisträger Edwin Bude und hat Hörbücher und CDs anzubieten. Bei Friederike Niesner daneben liegen Scherenschnitte und andere Kunstwerke ihres verstorbenen Mannes Wolfgang Niesner auf dem Tisch.
Und einen Neuzugang hat der Markt auch. An einem Stand im Foyer repräsentieren Kirsten Langwalder und Felix Fischer die Altvaterregion sowie Riesenund Isergebirge. Fischer erklärt zu seinen Plakaten: „Wir nennen uns die ,Isar-Gebirgler‘, um eine Verbundenheit von ,alter‘ und ,neuer‘ Heimat zu betonen!“ Bei ihm gibt es gegen eine Spende frische Plätzchen und deren ausgedruckte Rezepte gleich dazu.

re traditionelle Kunst zeigt. Dazu gehört auch Ilse Karlbauer aus dem Erzgebirge, die die Herstellung von Nadelspitze, das Gos-
Sieglinde Schneeberger vom Schlesierverein München liefert schlesische Advents- und Weihnachtsspezialitäten. Auch „Rübezahls Zwerge“ unter Siegfried Lange kommen aus dem schlesi-
Anita Köstler und Helmut Kindl von der Egerländer Gmoi z‘ Ingolstadt vertreten das Egerland mit selbstgestrickten Sokken und Mützen, Häkeldeckchen, handgebastelten Strohund Perlensternen, Egerländer


So decken sich die Gäste –darunter SL-Bundeskulturreferent Ulf Broßmann und Bernhard Loos MdB – gern mit den einzigartigen Spezialitäten ein und plaudern bei Glühwein und Kuchen über die Adventszeit.
Susanne Habel
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 11
� Böhmisch-mährisch-schlesischer Adventsmarkt 2022
Leckereien und Rezepte aus dem Kuhländchen.
Heimatpflegerin Christina Meinusch, Dr. Ortfried Kotzian und die Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München.
Der Adalbert-Stifter-Saal verwandelt sich dieses Jahr endlich wieder in einen riesigen Weihnachtsmarkt mit Tischen voller heimatlicher Handarbeiten, Kunsthandwerk und Leckereien.
Bilder: Susanne Habel
Der Stand der Abordnung der Böhmerwäldler.
Klöppelkunst von Ilse Karlbauer und Marie-Luise Kotzian. Rudi Saiko und seine Adventsgestecke.
Christel Rösch am Stand der Kuhländler.
Rosina Reim mit Spezialitäten der Wischauer.
Neuzugang Felix Fischer, ein Isartaler aus dem Adlergebirge.
Die Heimatpflege der Sudetendeutschen veranstaltete zum Advent im Sudetendeutschen Haus ein musikalischliterarisches Meisterstück. Die „Weihnachtliche Abendmusik“ mit dem Duo „Connessione“ bot Werke aus dem 18. Jahrhundert. Das Konzert mit der Violinistin Carina Kaltenbach-Schonhardt und dem SL-Musikpreisträger Tomáš Spurný an der Orgel umrahmte Carsten Drexler mit Lesungen einiger Texte von Angelus Silesius.

Heute wird uns eine feine Zusammenstellung von weihnachtlicher Abendmusik geboten“, sagte Christina Meinusch. „Die Musikauswahl stammt von Komponisten aus Böhmen und meist aus dem 18. Jahrhundert“, erläuterte die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen im Adalbert-Stifter-Saal. Zwischen den vorklassischen Musikstükken werden Texte von Angelus Silesius vorgelesen, die mein Ehemann Carsten Drexler liest.“
Die Heimatpflegerin stellte auch die Musiker vor, die auf der Galerie des Adalbert-Stifter-Saals bei der Orgel saßen. Das Duo „Connessione“ war schon einmal im Sudetendeutschen Haus in München gewesen und ist auch beim letzten Sudetendeutschen Tag gemeinsam aufgetreten. Die Musiker sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Duo.
Das Duo „Connessione“
Die in Freiburg im Breisgau geborene Violinistin Carina Kaltenbach-Schonhardt schloß ihr Studium mit dem Konzertexamen ab und ergänzte ihre Ausbildung in Wien bei Yair Kless und Rainer Küchl. Durch die Teilnahme an Meisterkursen für Neue und Alte Musik wie an der Ensemble-Akademie des Freiburger Barockorchesters entdeckte sie ihre Begeisterung für die Barockvioline und den Klang der Darmsaiten. Sie konzertiert in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen und unterrichtet als freischaffende Musikerin im badischen Waldkirch.

Begleitet wurde die Geigerin von Tomáš Spurný an der Orgel des Sudetendeutschen Hauses. Der Musiker kam 1965 im mittelböhmischen Beraun zur Welt und wuchs in Strakonitz im Böhmerwald auf. Er studierte Klavier am Prager Konservatorium und Musikwissenschaften an der Karls-Universität in Prag. Nach seiner Spezialisierung auf das Fach Alte Musik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und einem Kirchenmusikstudium wirk-

Christina Meinusch, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, veranstaltete am Nikolaustag ein „Offenes Adventssingen“ im Sudetendeutschen Haus in München. Die Veranstaltung leitete der Musikkenner Erich Sepp, der eine Reihe recht unbekannter und neuer Lieder ausgewählt hatte.


te er als Korrepetitor bei musikalischen Meisterkursen mit und trat bei Festivals und Konzerten im In- und Ausland auf. 2014 wurde er mit dem SL-Kulturpreis
Hand an und begleitet mit dem Akkordeon. Erst wenn eine Strophe gut auswendig läuft, ist der Blick aufs Notenblatt erlaubt. Von diesen Liedblättern hat Sepp inzwischen über 300 gestaltet.
für Musik ausgezeichnet, nachdem er schon zuvor mehrfach überragend auf Sudetendeutschen Tagen aufgetreten war.
Gemeinsam spielte das Duo weihnachtliche Stücke von Josef Ferdinand Norbert Seger (1716–1682), Wenzeslaus Wodiczka/Václav Vodička
(1715–1774), Franz Xaver Brixi/ František Xaver Brixi (1732–1771), Johann Baptist Kucharz/Jan Křitel Kuchař (1751–1829) und Georg Friedrich Händel (1685–1759). Das Programm hatte Musik-Multitalent Tomáš Spurný zusammengestellt. Er bot damit einen schönen Querschnitt durch die damalige böhmisch-europäische Musikszene.
Als erstes erklangen die Toccata in D-Dur und die Fuga in D-Dur von Josef Ferdinand Seger, von dem später noch die Fuga De Tempori Natalis zu hören war. Dies deutete das weihnachtliche Thema des Konzertes schon gut an.
Das hörte man auch beim zweiten Stück, der Sonate in C-Dur von Wenzeslaus Wodiczka, bei der die Violine von der Galerie zart herunterklang. Von Wodiczka gab es dann noch die Sonate in G-Dur. Die folgende Pastorella in D-Dur von Franz Xaver Brixi schlug leichtere, heitere Töne an wie auch die Pastorella in G-Dur von Johann Baptist Kucharz.
Händel und Silesius
Höhepunkt war die Sonate in A-Dur von Georg Friedrich Händel, die beide Musiker eindringlich im verdunkelten Saal präsentierten, wofür sie stürmischen Applaus erhielten.
Zwischen allen Musikstücken erklangen Ausschnitte aus der biblischen Weihnachtsgeschichte und Texte des Barockdichters Angelus Silesius (1624–1677), gelesen von Carsten Drexler. Der Ehemann von Christina Meinusch saß vor einem Adventskranz auf der Bühne und beeindruckte mit seiner ruhigen Intonation.
Die Verse von Silesius berührten heute wie vor mehr als dreihundert Jahren, so auch in dem Gedicht „Auf die Krippe Jesu“.
Hier liegt das wehrte Kind, Der Jungfrau erste Blum; Der Engel Freud und Lust Der Menschen Preis und Ruhm. Soll er dein Heiland sein Und dich zu Gott erheben, So mußt du nicht sehr weit von seiner Krippe leben.
„Nicht sehr weit von der Krippe leben“ – eine gute Ermahnung in Tagen von Krieg, Corona und Krisen. Diese Mahnung des Dichters klang in den Köpfen noch nach, als die Gäste im Ottovon-Habsburg-Foyer bei einem kleinen Empfang am Weihnachtsbaum Glühwein und Gebäck genossen.
scho glei dumpa“. Dieses beliebte Lied sei jedoch viel jünger und stamme aus einem Krippenspiel von Pfarrer Anton Reidinger, der in Oberösterreich gewirkt habe, ließ Sepp wissen.
Susanne Habel
chischen Lied aus Mähren. Durch den „Heidom-Dideldom“-Refrain im Hintergrund klang das Lied fast wie ein Orchester und begeisterte alle. „Noch mal“, rief eine Mitsängerin. Es gab eine Reprise.
M
it einem aktuellen Lied ging es los: „Wann da Nikolaus kimmt“ aus Oberfranken, das schnell erlernt war. Sepp geht vor allem immer pädagogisch und nach psychologischen Erkenntnissen vor. Zunächst lernen alle die erste Strophe rein nach Gehör und aus der Erinnerung, oft auch gleich mehrstimmig. Sepp deutet nur die Tonhöhen mit der
Mit Verkündigungsliedern wie „Ach, mein Seel‘, fang an zu singen“, das im oberdeutschen Raum verbreitet war, und „Es steht ein‘ Lind im Himmelreich“ ging es weiter. Der Text des Linden-Lieds, in dem der Jungfrau Maria die Geburt Jesu angekündigt werde, sei schon in der Straßburger Liederhandschrift von um 1430 erfaßt gewesen, so Erich Sepp. Er erläutert immer
auch den historischen Hintergrund der Lieder.
Danach kam ein Gesang aus dem steiermärkischen Salzkammergut. In „Nàchtn spàt“ geht es um einen Zimmermann in Bethlehem, der Herberge sucht. Erich Sepp erklärte, daß die Umschrift à eine sehr helle Aussprache des Vokals andeuten solle. Der Singleiter verfügt als ehemaliger Leiter der Volksmusikabteilung des bayerischen Landesvereins für Heimatpflege über ein immenses Wissen über Volksliedkultur, Musikgeschichte und Mundarten, das er auch verständlich vermittelt.
Der gebürtige Oberbayer kam 1944 in Landsberg am Lech zur Welt und ist mit Ingrid, einer Teschenerin aus Sudetenschlesien, verheiratet. Sie unterstützt ihn bei der Recherche und bei Veran-
staltungen wie dem Offenen Singen. Auch beim Adventssingen im Sudetendeutschen Haus war Ingrid Sepp zur Hand, um die gut gestalteten Notenblätter mit Textstrophen und Erläuterungen im Adalbert-Stifter-Saal herumzureichen.

Bei längeren, mehrstrophigen Texten waren die Blätter eine große Hilfe, etwa bei „Inmitten der Nacht“ aus dem Glatzer Ländchen, einem Gebirgskessel zwischen Schlesien und Böhmen. Darin geht es um die Hirten auf dem Feld, bei denen die Engel ein „Gloria“ singen.
Ein Ohrwurm wurde schnell „Der Nußknacker“, in dem man das Knacken regelrecht hören konnte. Den ursprünglichen Text von Eugen Hubrich habe seine Frau jedoch stark abgeändert, so Sepp. „Ja, der Text war zu brutal“, rief Ingrid Sepp dazwischen. „Da fraß der Nußknacker am Schluß die Kinder.“
In einer Pause gönnten sich alle Glühwein und Gebäck im Otto-von-Habsburg-Foyer. Spontan stimmten einige von Sepps Schülern einen „Jodler“ an.
Nach der Pause sang man „Frohlocket, ihr Menschen“, ein Sternsingerlied aus Laufen an der Salzach aus dem 19. Jahrhundert. Den Sängern fiel auf, daß dessen Melodie ganz ähnlich klingt wie die von „Es wird
In „Frohlocket, ihr Menschen“ erfahren alle vom freudigen Geschehen „zu Bethlehem drunten in an alten Stall“, das sie sich ansehen sollten.
Und prompt hieß das nächste Lied „Macht euch alle auf zum Stall nach Bethlehem“, wie ein Volkslied aus Polen hieß, das Christmaria Knabl und Alexander Ziegert, der ehemalige Dompfarrer von Bautzen, schön übersetzt hatten. „Selbst die Tiere neigen vor dem Kinde sich, / Weise mit Geschenken nahen königlich. / Gott soll gepriesen werden! / Friede ist nun auf Erden. / Gloria, Gloria!“
Die tiefen Männerstimmen bildeten mit ihrem „heidom, heidom, heidom“ den Hintergrund beim nächsten, mehrstimmigen Lied. „Gold‘nes Blatt vom Himmelsbaum“ ist die deutsche Fassung von „Pásli ovde valasi, pri betlemskom salasi“, einem tsche-
Ähnlich begeistert waren die Sänger auch von „Freu dich, Erd‘ und Sternenzelt“, der deutschen Nachdichtung eines tschechischen Weihnachtsliedes aus dem 15. Jahrhundert für die bischöfliche Diözese Leitmeritz von 1844. Dieses „Böhmische Halleluja“ – wie es auch genannt wird –habe eigentlich mehr als zehn Strophen gehabt, bemerkte Sepp. „Wir singen es wegen der Aufforderung in der fünften Strophe „Hört‘s ihr Menschen groß und klein, Halleluja, Friede soll auf Eerden sein, Halleluja!“, die man auch auf den UkraineKrieg beziehen könne. Diese Botschaft beeindruckte die Sänger. Darunter gab es Neulinge, die wohl dank Mundpropaganda dazugefunden hatten. Alle freuten sich
adventliche
Ankündigung,
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 12
über das
Liedgut und die
daß Sepp ein „Offenes Weihnachtssingen“ zwischen Heiligabend und Dreikönig in seinem Heimatort Höhenkirchen bei München plane. Susanne Habel
Orgel und Violine vereint � Adventssingen mit Erich Sepp im Sudetendeutschen Haus Erd’ und Sternenzelt
� Weihnachtliche Abendmusik in München
Tomáš Spurný an der Orgel des Sudetendeutschen Hauses und die Violinistin Carina Kaltenbach-Schonhardt.
Carsten Drexler und seine Ehefrau Christina Meinusch, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Bilder: Susanne Habel
Christina Meinusch, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, und Singleiter Dr. Erich Sepp.
Ingrid Sepp verteilt Notenblätter.
Bilder: Susanne Habel
Lesereise durch die Tschechische Republik
Tina Stroheker berichtet über ihre kürzliche Lesereise mit ihrem neuesten Werk in der Tschechischen Republik. Sie stellte dort ihr Buch „Hana oder Das böhmische Geschenk. Ein Album“ über die Dissidentin Hana Jüptnerová (Ý SdZ 39/2022) vor.
Am 17. November gedenken die Menschen in der Tschechischen Republik sowohl der Studentenproteste 1939 gegen die Schließung der Hochschulen während der deutschen Okkupation als auch der Samtenen Revolution 1989. Letztere bedeutete das Ende des kommunistischen Staates, Václav Havel wurde Staatspräsident. Eine bis dahin politisch unliebsame Lehrerin aus dem Riesengebirgsstädtchen Hohenelbe/Vrchlabí, die ihren Beruf nicht ausüben konnte, skizzierte diese Umbruchszeit später mit dem Satz: „Es gab nur Freude.“ Die Lehrerin hieß Hana Jüptnerová.
Sie hatte Václav Havel gekannt, sich immer wieder bei ihm im nahen Dorf Silberstein/Hrádeček Bücher ausleihen und innere Stärkung holen können. Diese hatte sie bitter nötig, nachdem sie mutig die Charta 77 unterzeichnet und für den im Gefängnis gestorbenen Dissidenten Pavel Wonka 1988 eine Totenrede gehalten hatte. Nach 1989 wurde die Versöhnung zwischen Deut
schen und Tschechen ein neuer Schwerpunkt ihres Lebens. Hana wurde im Januar 1952 in Trautenau/Trutnov geboren, lebte bis auf die Studienjahre in Hohenelbe und starb im Oktober 2019 im Hospiz von Rothkosteletz/Červený Kostelec an Krebs. Ich hatte die Freude, in den letzten vier Jahren ihres Lebens mit ihr befreundet zu sein, nachdem wir uns auf einer Konferenz über den in Trautenau geborenen Schriftsteller Josef Mühlberger (1903–1985) in seiner Heimatstadt kennengelernt hatten, und bei der die Germanistin Jüptnerová dolmetschte. 2021 erschien mein Buch, „Hana oder Das böhmische Geschenk. Ein Album“, das der Prager Verlag Kalich unter dem Titel „Knížka o Haně“ („Das HanaBuch“) in einer tschechischen Übersetzung des Dichters Jonáš Hájek herausgab. das Buch versammelt Prosaminiaturen und Fotos aus Hanas Leben.
Und mit der Novemberreise konnte ich – meist gemeinsam mit Jonáš –bei acht Lesungen das Buch vorstellen. So reisten wir zwischen Hohenelbe, Königgrätz /Hradec Králové, Trautenau, Kolin/ Kolín, Olmütz/Olomouc, Brünn/ Brno und Aussig/Ustí nad Labem durch das Land. Jede Lesung hatte ihre eigene Atmo
sphäre, weil sie ihr eigenes Publikum hatte. Dem versuchten wir bei der Auswahl der Texte und Bilder gerecht zu werden.








In Hohenelbe, Hanas Städtchen, war der Saal des Riesengebirgsmuseums voll mit Menschen, die sie gekannt, bewundert und geliebt hatten. Erinnerungen wurden ausgetauscht, Freude an den Fotos geäußert, gelacht und manche Träne weggewischt. Im Begegnungszentrum in Trautenau führte Štěpánka Šichová durch den Abend. Jára Jirásek las die tschechischen Texte.



In der Galerie Suterén in Königgrätz waren Weggefährtinnen und Weggefährten Hanas gekommen. Die Lyrikerin Lenka Chytilová, Hanas Freundin seit Brünner Studentinnenzeiten, las hier auf tschechisch.
Die kleine, feine Buchhandlung Modrá Sova/ Blaue Eule hatte in Kolin eingeladen. Wie schön: Besonders um Bücher für


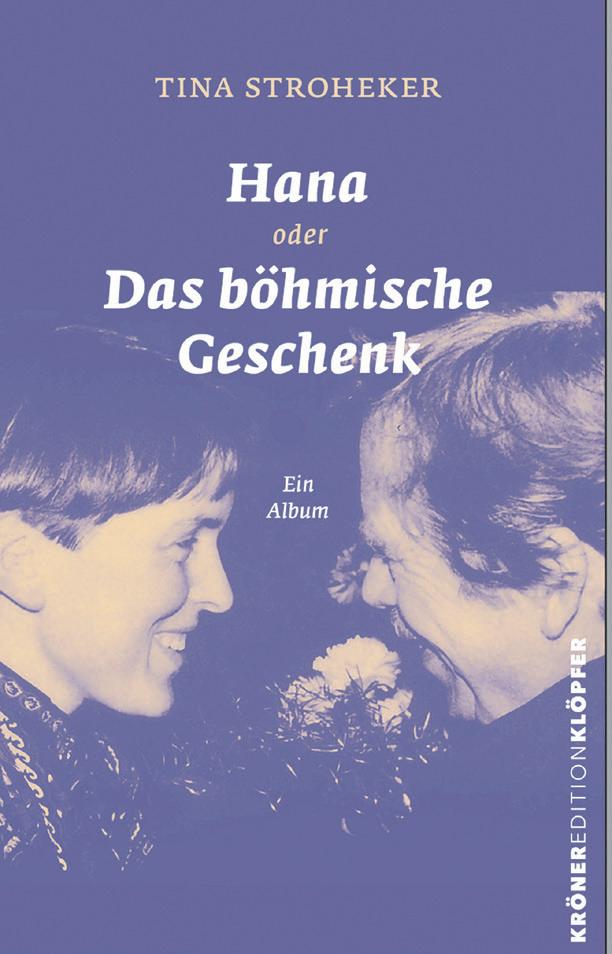
Kinder und Jugendliche, für unsere Zukunft also, bemüht man sich dort.
Dann gab es drei Lesungen, bei denen im Publikum Studenten sowie Dozenten der Germanistik überwogen. Hier interessierte man sich stark für die deutschen Texte, und es wurden Fragen der literarischen Form bedacht.
In Olmütz traf man sich unter der Moderation der Germanistikprofessorin Inge Fialová in der Wissenschaftlichen Bibliothek.
In Brünn moderierte Zdeněk Mareček in der Mährischen Landesbibliothek. Nach der Lesung wurden zudem Sieger eines von ihm organisierten Übersetzungswettbewerbs bekanntgegeben.

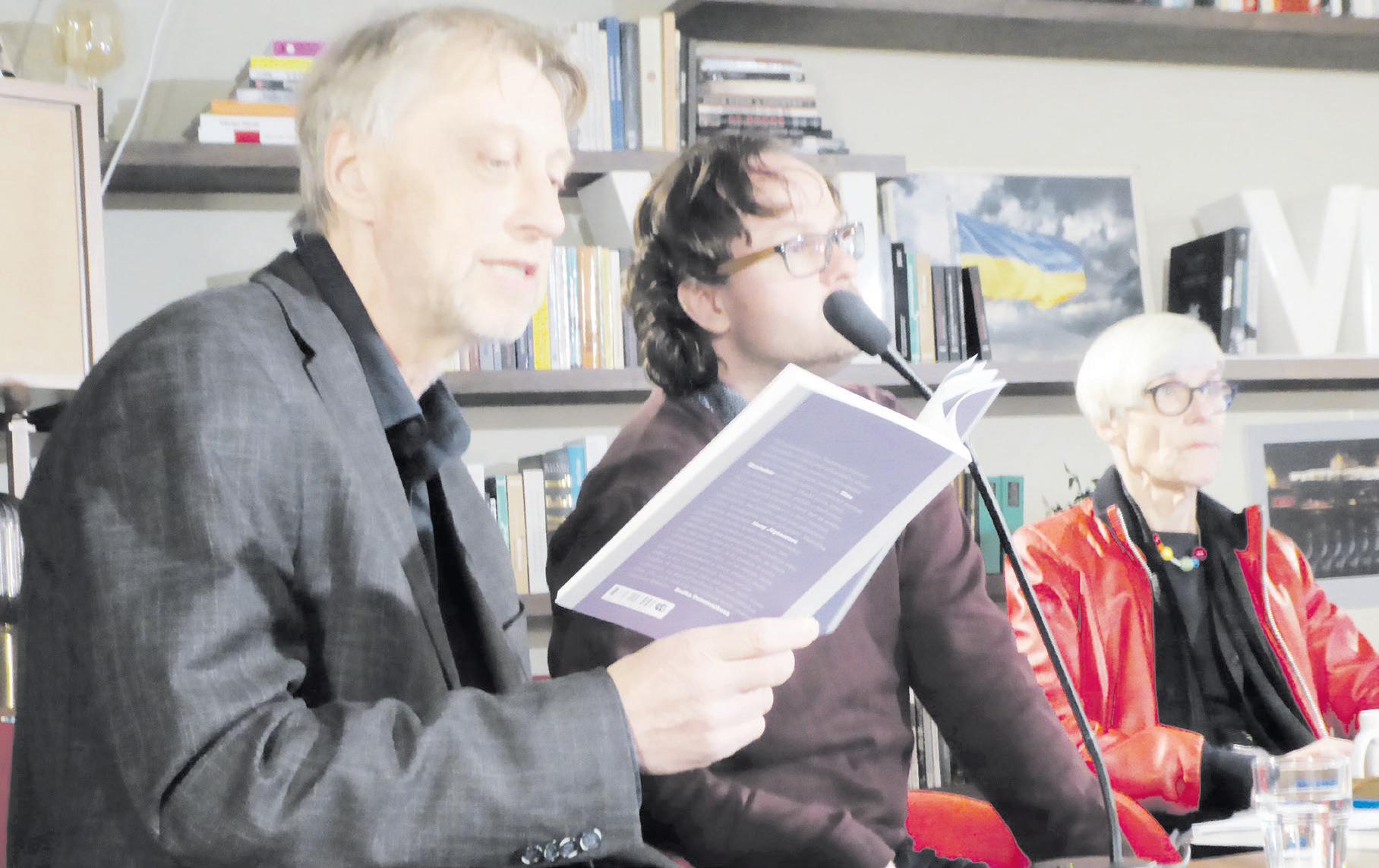
In Aussigs Nordböhmischer Forschungsbibliothek erfuhren die zahlreichen Gäste dank Fragen von Renata Cornejo Aufschlußreiches über Jonáš‘ Arbeit an der Übersetzung.
Am Staatsfeiertag 17. November, an dem ganz Prag auf den Füßen zu sein schien, strömten Interessierte in die VáclavHavelBibliothek, wo unser Kollege Jáchym Topol den Abend leitete. Hätte ein Veranstaltungsort passender sein können? Natürlich stand hier die Dissidentin im Mittelpunkt, doch es kamen auch Hanas Bescheidenheit, Frömmigkeit, Leidenschaftlichkeit und ihr Humor zur Sprache. Jáchym Topol, der, obgleich jünger, ein Weggefährte Havels
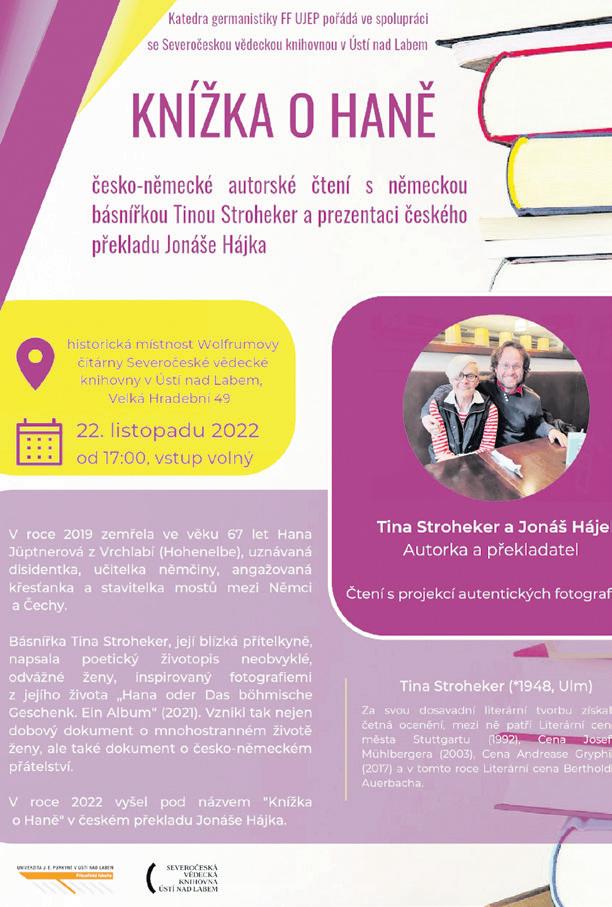
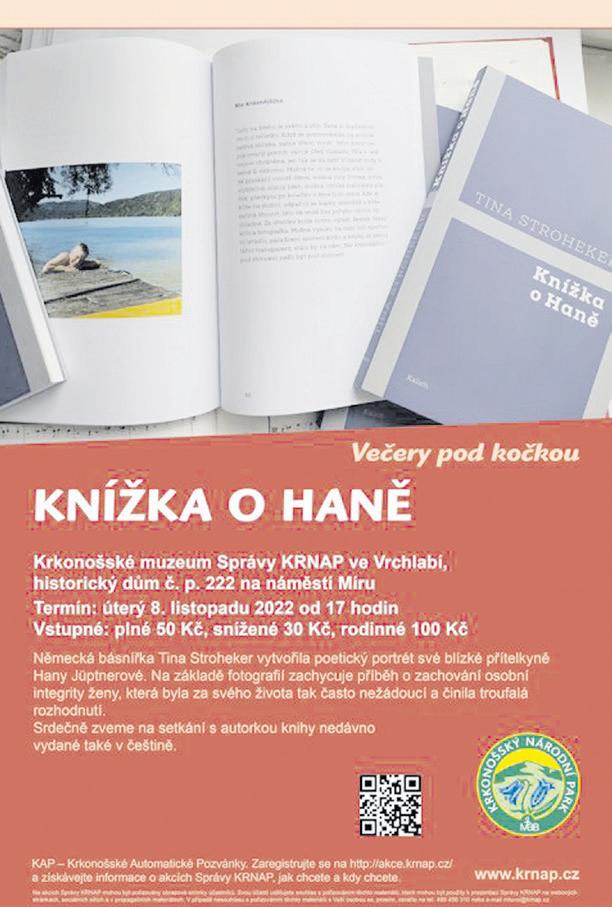
war, hob hervor, wie froh er sei, daß das Buch eine Dissidentin aus der Provinz vorstelle. An diese Menschen müsse unbedingt mehr erinnert werden.
Nicht, daß nicht auch Zeit für private Unternehmungen geblieben wäre. Beispielsweise bummelten wir am 17. November mit der Anglistin Míša Čanková, einer Freundin Hanas, auf der Prager Nationalallee und sprachen über Europa. Nieselregen hielt uns nicht ab. Wir lernten die Familie meines Übersetzers kennen. Gedichte seiner Frau Natálie Paterová publizierte übrigens der Leipziger Verlag Hochroth. Und wir sahen uns die lohnenswerte Dauerausstellung „Naši Němci/ Unsere Deutschen“ im Stadtmuseum von Aussig an. Und überall – das ist mein wichtigster Eindruck der Reise – begegnete ich Menschen, die sich für Demokratie einsetzen. Also: Freundinnen und Freunden!
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 13 � Bericht einer Schriftstellerin
Lesung im Riesengebirgsmuseum in Hohenelbe mit gut 80 Gästen. Vorne der Übersetzer Jonáš Hájek und Tina Stroheker. Bild: Jakub Kašpar.
Tina Stroheker umarmt ihren Übersetzer Jonáš Hájek vor der Lesung in Olmütz. Rechts: Gespräch in Brünn mit Dr. Zdenĕk Mareček.
Bei
der
Lesung in der Václav-Havel- Bibliothek begrüßt der Schriftsteller Jachym Topol (links) das große Publikum (rechts).
Plakat der Lesung in Hohenelbe. Plakat der Lesung in Hohenelbe.
Bilder (4): Peter Ritz
oder Das
160 Seiten, 67
24 Euro. (ISBN 978-3520-75901-6) SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 . BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Tina Stroheker: „Hana
böhmische Geschenk“. Kröner Verlag, Stuttgart 2021;
Abbildungen,
Weihnachten soll abgescha t werden
Die Nachricht platzte wie eine Bombe mitten in die heftigsten Weihnachtsvorbereitungen. Erschrocken ließen die Englein alles liegen und stehen und sammelten sich zu schwirrenden, flügelschlagenden Knäueln. Rauschgold knisterte, Federn flogen durch die Luft. Eine Zeitlang übertönte ihr jammerndes Geplapper alle anderen Geräusche in der himmlischen Werkstatt.
Die Zwerge – von Natur aus cholerisch und zu übertriebenen Gefühlsausbrüchen neigend – rauften sich die Bärte, rissen die Zipfelmützen von den Köpfen und trampelten wild darauf herum. Selbst Sankt Nikolaus, gerade dabei, sich einen falschen Bart anzukleben, hielt erschrocken inne und mußte sich mit zitternden Beinen auf einen halbvoll beladenen Schlitten setzen.
„Habt ihr schon gehört“, schallte es durch den Raum, „Weihnachten soll abgeschafft werden!“
„Aber das ist doch ...“
„Das gibt es ja gar nicht!“
„Jetzt schlägt‘s aber dreizehn!“
Die Empörung war allgemein. Es dauerte eine Weile, bis sich Knecht Ruprecht, der dienstfertige Begleiter des mildtätigen Mannes, Gehör verschaffen konnte. Er hatte sich das Weihnachtsglöckchen des Christkinds geschnappt und war auf eine Stehleiter geklettert. Nun klingelte er so heftig, daß fast der Glockenschwengel davongeflogen wäre.

Heilige und unheilige Geschichten
Zuzana Finger, Übersetzerin und ehemalige Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, las beim 19. Bundesweiten Vorlesetag Mitte November im niedersächsischen
Wilhelmshaven das Gedicht „Wir sind nur fremder Welten Spiegelungen“ von Helmut Glatz (* 1939 in Eger,† 2021 in Landsberg am Lech), worüber wir vergangene Woche be-
riecht denn hier so brenzlig?“
„Um Himmelswillen, die Weihnachtsplätzchen“, entfuhr es einem Rauschgoldengel. Man hatte in der Aufregung ganz vergessen, das Weihnachtsgebäck aus dem Ofen zu nehmen. Die Zimtsterne und Kokosplätzchen waren schwarz wie Kohle. Da war nichts mehr zu retten. „Auch das noch“, seufzte Knecht Ruprecht mit ergebenem Augenaufschlag. „Unser Defizit steigt ins Unermeßliche.“
„Aber was wird aus uns? Was wird aus der Firma?“
Das Gesicht des heiligen Nikolaus war von Gram zerfurcht, seine Stirn hatte sich in tausend Falten gelegt. Jetzt kam Knecht Ruprecht wieder in Fahrt.
richteten. Vor mehr als zehn Jahren hatte Helmut Glatz der Sudetendeutschen Zeitung folgende Weihnachtsnachtsgeschichten geschickt.
den. Ihre Augen waren groß und rund, und manche hatten sich mit Tränen gefüllt. Die Zwerge hockten, dumpf vor sich hinbrütend, auf dem Boden und knirschten mit den Zähnen. Selbst die Rehlein und der alte Elch vor dem Weihnachtsschlitten senkten melancholisch die Köpfe.
In diesem Augenblick wurde die Türe aufgerissen. Ein Osterhase von der Liköreierproduktion stürzte herein. „Habt ihr es schon gehört“, rief er in die traurige Stille. „Regierungswechsel in Berlin. Der neue Wirtschaftsminister hat großzügige Subventionen in Aussicht gestellt. Die Produktion läuft unvermindert weiter.“

fräulein auf den Hellmairplatz hinunter. Eine Vielzahl von Buden war hier aufgebaut. Und aus den Buden schwebten unzählige Gerüche zu ihnen herauf, einer köstlicher als der andere. „Un-

mel. Der kommt jedes Jahr“, erklärte Wendelin sachkundig. „Er verteilt Geschenke an die Kinder. Nüsse, Plätzchen, Lebkuchen und so weiter.“ „Ein mildtätiger Mann aus dem Himmel?“, staunte das Taubenfräulein ehrfürchtig. „Dann hat er sicher auch etwas für uns hungerleidende Vögel mitgebracht.“ „I wo“, winkte Wendelin mit einer Flügelspitze ab. „Die Kinder essen alles ratzeputz auf. Da bleibt kein Krümelchen übrig. Ich kenne das vom letzten Jahr.“
Der Nikolaus unter ihnen hatte inzwischen seinen großen Sack geöffnet. Nun holte er eine Tüte nach der anderen heraus, um sie an die herandrängenden Kinder zu verteilen. „O weh, o weh“, jammerte Mirabella.
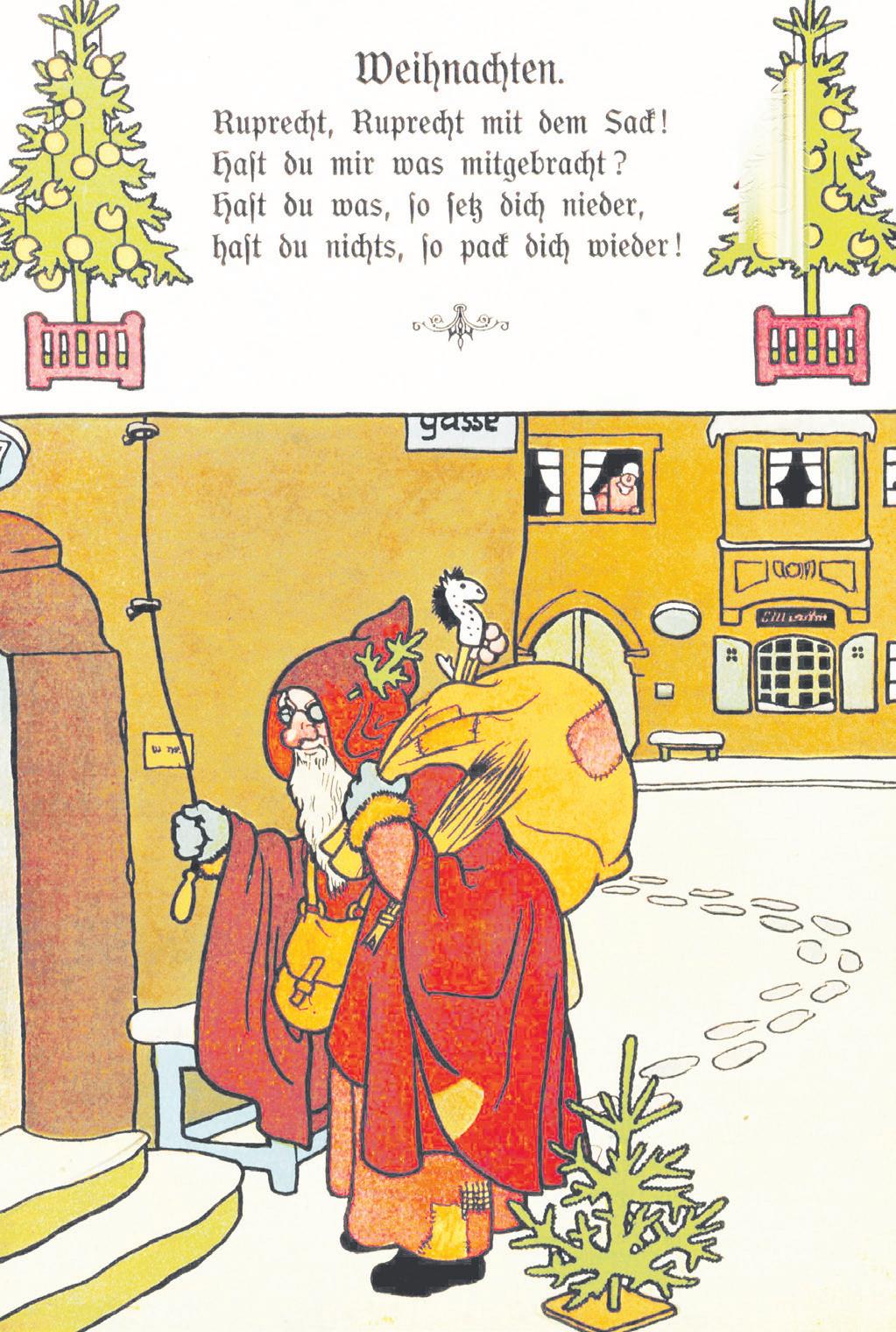
„Alles wird den Menschen geschenkt. Und an uns arme Tiere denkt niemand.“
„Haben Sie etwas anderes erwartet“, fragte der Stadttauber.
„Die Menschen denken nur an sich. Sehen Sie: Schon hat er die letzte Tüte in der Hand. Und auch die wird ein Menschenkind erhalten.“
Während der Revolution der Würde vom 21. November 2013 bis 26. Februar 2014 auf dem Majdan, dem Platz der Unabhängigkeit, in Kiew trägt dieses Nikolausplakat die Inschrift: „Lang lebe der heilige Nikolaus. Väterchen Frost, verschwinde!“ Bild: Аимаина хикари
„Es ist tatsächlich so!“, rief er.
„Die Konzernleitung trägt sich mit dem Gedanken, Weihnachten abzustoßen. Die Produktion soll eingestellt werden.“
Wieder erhob sich ein aufgeregtes Stimmengewirr, das wie das Tosen eines wilden Bergflusses durch die himmlische Fertigungshalle flutete.
„Aber das Geschäft geht doch blendend!“, schallte er. „Wir arbeiten wie immer auf Hochtouren! Die Auftragsbücher sind voll!“
„Ich habe noch nie so viele Engagements gehabt wie heuer“, brummte Sankt Nikolaus mit brüchiger Stimme.
Knecht Ruprecht gestikulierte und zappelte so heftig, daß er fast von der Leiter gefallen wäre. „Ruhe!“, brüllte er. „So laßt mich doch ausreden!“ Nach und nach wurde es wieder still.
„Natürlich habt ihr recht!“, meinte er schließlich. „Das Geschäft geht blendend, die Menschen feiern Weihnachten wie verrückt. Aber...“ Und jetzt senkte sich seine Stimme und nahm einen geheimnisvollen Ton an: „Habt ihr schon von den Billigangeboten aus Fernost gehört?“
Betretenes Schweigen war die Antwort. Es war so still geworden, daß man eine Stecknadel hätte fallen hören.
„Ich komme gerade von der Konzernleitung“, berichtete der Krampus weiter. „Sankt Petrus macht sich wirklich ernsthafte Sorgen. Unseren Informationen
zufolge sind ganze Schiffsladungen aus China unterwegs. Berge von Weihnachtsbäumen. Aus Polyester und PVC, aufklappbar, mit eingebauter Sicherheitsberieselung. Unsere altmodischen Christbäume aus den heimischen Wäldern sind längst passé. Weihnachtskerzen mit Lichtorgeleffekt. Mal rot, mal grün, mal blau. Ihr könnt euch sicher vorstellen, daß wir auf unseren antiquierten Wachsmodellen sitzenbleiben. Aber das ist noch lange nicht alles! Christbaumständer, drehbar, mit eingebautem CD-Player. Der Baum rotiert, in geisterhaftes blaues Licht gehüllt, langsam um sich selber, während dazu das eingespeiste automatische Weihnachtsliederprogramm ertönt. ‚Silent night, holy night‘, ‚Jingle bells‘ und all die anderen allseits beliebten ChristmasSongs ...“

Knecht Ruprecht wäre beinahe ein wenig ins Schwärmen geraten. Aber er riß sich zusammen. „Christbaumkugeln ,Made in Hongkong‘! Engelshaar aus Singapur! Lametta aus Korea! Alles zu einem solchen Spottpreis, daß wir beim besten Willen nicht mehr mithalten können. Ja, sogar ein Posten Englein soll dabei sein. Im Japanlook. Schlitzäugig, mit schwarzen Haaren. Und sexy, sexy, kann ich euch sagen! Was
„Kopf hoch“, rief er. „Wir dürfen in dieser Situation nicht resignieren. Das ist das Schlimmste, was wir tun können! Ich habe als Personalratsvorsitzender natürlich sofort darauf bestanden, einen Sozialplan aufzustellen. Du, Nikolaus, wirst pensioniert. Schließlich bist du nicht mehr der Jüngste. Und wir sind die alljährliche Sorge los, wie du die unzähligen Vereins- und Betriebsweihnachtsfeiern, die Visiten auf den Christkindlmärkten und die eisigen Schlittenfahrten durchstehen wirst. Neuerdings mutet man dir ja sogar zu, dich von Hausdächern abzuseilen und an Kaufhausfassaden herumzuklettern. Mir selber wurde ein Posten
Weihnachten war, zumindest bis zur nächsten Legislaturperiode, gerettet.
an einer Teilhauptschule in Aussicht gestellt. Als Hausmeister. Eine solche Stelle käme meiner bisherigen Beschäftigung am nächsten, hat man gesagt. Und auch für die anderen ist die Lage nicht hoffnungslos. Die Firma Luzifer & Co. hat nämlich bereits ihr Interesse angemeldet, den ganzen Laden aufzukaufen. Sie will einen Teil der Belegschaft mitübernehmen. Das gilt vor allem für die Englein. Die Konzernleitung will in Bälde in ernsthafte Verhandlungen eintreten. Also, Kopf hoch, und laßt den Mut nicht sinken“, wiederholte Knecht Ruprecht mit fester Stimme.
Aber der Mut wollte sich nicht einstellen. Im Gegenteil. Allgemeine Niedergeschlagenheit machte sich breit. Die Englein ließen die Flügel hängen und blickten traurig auf ihren Personalratsvorsitzen-
Wendelin und Mirabella Wendelin hatte sein Federkleid dick aufgeplustert und klapperte heftig mit dem Schnabel. Ihn fror. Mitfühlend rückte Mirabella, das junge Taubenfräulein, ein Taubentapperl näher an ihn heran. „Saukalt heute, was?“, schüttelte sie sich. Der alte Stadttauber nickte heftig mit dem Kopf. „Das kann man wohl sagen“, brummte er. „Und dazu keinen Bissen im Bauch. Wenn ich nicht bald etwas zu essen bekommen, falle ich um und bin mausetot.“ „Meinen Sie, daß man es wagen kann“, fragte Mirabella nach einer Weile zögernd und blickte sehnsüchtig nach untenn „sich einen Bissen zu holen?“ Wendelin war ganz entsetzt. „Dort, in diesem Trubel?“ Er schlug so aufgeregt mit den Flügeln, daß ihm der eisige Dezemberwind ins Gefieder fuhr und einige weiche Flaumfedern aus dem Kleid riß. Wie eine kleine, weiße Wolke wirbelte sie über den Platz. „Auch das noch!“, ärgerte sich der Tauber. „Und dabei habe ich in dieser Kälte absolut nichts zu verschenken.“
Die beiden Tauben saßen auf dem Dach der Stadtpfarrkirche, genauer gesagt, auf der Dachrinne, die am Seitenschiff entlanglief. Soeben begann im Inneren des Gebäudes die Orgel zu spielen. Die Töne fluteten mit Macht durch den Raum und ließen das Gewölbe erzittern. Sogar die Dachrinne draußen vibrierte ein wenig von der gewaltigen Musik.
„Mozart“, stellte Mirabella sachkundig fest. „Ich liebe Mozart.“ „Bach ist mir lieber“, gab Wendelin mürrisch zurück. „Der kitzelt so schön in den Beinen.“ „Ach, was hilft das Kitzeln, wenn wir nichts im Magen haben“, seufzte sie. „Und dabei duftet es von überallher so verlockend. Sollte man nicht doch einmal versuchen, einen kleinen Happen zu stibitzen?“
Wieder blickte das Tauben-
terstehen Sie sich!“, wies der alte Stadttauber seine Nachbarin zurecht. „Die vielen Menschenbeine werden Sie glattweg zertrampeln!“
„Dort drüben – riechen Sie es? – dort drüben wird Punsch ausgeschenkt.“ Mirabella hatte den Schnabel erhoben und sog schnuppernd die Luft ein. „Gibt es etwas Wunderbareres als den würzigen Duft heißen Punsches?“ „Ich mache mir nichts aus Punschduft“, erklärte Wendelin kühl. „Davon kriegt man nicht einmal einen Rausch.“
„Und dort! Dort drüben!“ Mirabella wurde ganz aufgeregt. „Dort werden Maroni geröstet.“ „Was soll ich mit heißen Maroni?“ Der Stadttauber machte einen kleinen Sprung. Beinahe hätte ihn der Wind von seinem luftigen Sitz heruntergefegt. „Maroni haben Schalen. Und Schalen sind hart und machen einem den Schnabel schartig. Soll ich mir wegen ein paar Maroni einen Nußknacker engagieren?“ Seine Nachbarin aber ereiferte sich immer mehr. „Und die Plätzchen. Und die heißen Waffeln. Und an einer Bude gibt es sogar Grünkern-Knäckebrot mit heißer Butter.“ „Hören Sie bloß auf damit“, jammerte Wendelin. „Mir wird ganz schlecht vor Hunger, wenn ich Sie so reden höre.“
Plötzlich fuhr der Kopf des Taubenfräuleins aufgeregt nach unten. „Was ist denn das“, gurrte sie. „Da laufen alle Menschen auf einem Fleck zusammen. Und die vielen Kinder! Wo kommen denn die vielen Kinder her?“ Auf dem Platz unter ihnen gab es auf einmal ein entsetzliches Gedränge. Ein Mann mit einer hohen Mütze und einem weiten Umhang war aufgetaucht. Im Nu war er von Leuten umringt. Und immer mehr Menschen eilten herbei.
„Das ist der Nikolaus. Ein mildtätiger Mann aus dem Him-

„Aber wenn er doch vom Himmel kommt! Und wir Tiere sind ja auch Gottes Geschöpfe“, wiederholte Mirabella hartnäckig. „Wenn ich es Ihnen sage“, rief Wendelin ärgerlich.
„Sogar der Himmel hat uns vergessen.“
In diesem Augenblick geschah etwas, das später in Taubenkreisen als Wunder bezeichnet wurde. Wieder hatte sich ein Windstoß erhoben. Er jagte den Rauch der Kastanienrösterei in Fetzen über den Platz, er zerzauste die Haare der Leute, er bauschte den weiten Umhang des heiligen Nikolaus auf. Und er wirbelte auch eine kleine Flaumfeder – wir erinnern uns, sie stammte aus dem Unterkleid des Stadttaubers – in die Höhe. Als sich der Windstoß wieder legte, senkte sich auch das Federchen schaukelnd nach unten. Und dann setzte es sich, so mir nichts, dir nichts, gerade auf die Nase des heiligen Mannes. Da geschah es.

Der Nikolaus mußte entsetzlich niesen, und dabei glitt die letzte Tüte aus seiner Hand. Sie fiel auf den Boden, und aus dem aufgeplatzten Papier rollten die Plätzchen und Lebkuchen und Nüsse und Äpfel. Zwar bückten sich die umstehenden Kinder sofort nach den verstreuten Köstlichkeiten, aber manches blieb liegen, wurde im Gewühl übersehen oder von den Menschenstiefeln zertreten.
Und als der heilige Mann schließlich gegangen war, als die Leute sich verlaufen hatten und die Budenbesitzer die Rollläden herunterließen, da hüpften zwei weiße Tauen eifrig pickend über den Platz. „Oh, ein Anisplätzchen“, rief Mirabella begeistert. „Zwei Krümel von einem Lebkuchen!“, stellte Wendelin zufrieden fest. „Und hier der Zacken eines Zimtsterns. Und Mandelsplitter. Und Schokoladenstreusel. Mein Magen macht einen Luftsprung nach dem anderen.“
Später, als es sich die beiden satt und zufrieden an ihrem Schlafplatz neben einem warmen Kamin bequem gemacht hatten, rückte Mirabella ganz eng an ihren Tauberich heran und meinte mit verträumter Stimme: „Ich glaube, jetzt ist die Weihnachtszeit auch für uns angebrochen.“


KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 14 ❯
Weihnachten
Weihnachtsbäume aus PVC mit Kerzen mit vielfarbigen Lichtorgeleffekten im Einkaufszentrum Harbour City in Hongkong.
Fritz Schönpflug: Kaiser „Franz Joseph I. als Nikolo mit Krampus“ (um 1900).
Gertrud Caspari: „Kinderhumor für Auge und Ohr“ (1906).
Erinnerungsarbeit und Bahnstreckenträume
Ende November fand die zweite Online-Sitzung „Quo vadis, Grenzland“ statt. Das war eine Gemeinschaftsveranstaltung des Pilsener Deutsch-tschechischen Kulturvereins A Basta!, der Ackermann-Gemeinde im Bistum Regensburg, der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen Selb 2023 und des Centrums Bavaria-Bohemia (CeBB) in Schönsee. Die Teilnehmer verfolgten die Vorträge aus Bayern, Böhmen und Hessen. Markus Bauer berichtet.
Nach der Begrüßung durch Marcus Reinert sprach CeBB-Leiterin Veronika Hofinger. Sie sagte, das Grenzland sei für das CeBB ein wichtiges Thema und seit Jahren Bestandteil ihrer Arbeit. Der lange Streifen entlang der Grenze, der als Folge der Vertreibung der Deutschen kaum besiedelt gewesen sei, habe im Laufe der Jahrzehnte in der Natur viel entstehen lassen. Diese Region sei aber auch eine Erinnerungslandschaft mit kulturhistorischen Komponenten und damit für Tourismus und Erinnerungsarbeit wichtig.
Diese Aspekte vertiefte David Vereš, der beim CeBB für die Redaktion von bbkult.net sowie für Kooperationen und Projekte zuständig ist. „Das Grüne Band und die Erinnerungskultur“ war Thema seines Referats. Einleitend schilderte er die Werte grenzüberschreitender Kulturarbeit. Diese lasse die Grenze verschwinden für eine gute Nachbarschaft zwischen den Bayern und Tschechen, für Zukunftsperspektiven in den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen und für europäische Integration. Mit Veranstaltungen, Projekten und Aktionen versuche das CeBB, das Interesse am Nachbarland zu wecken und das Kulturleben zu bereichern.

Kurz ging Vereš auf das mehr als 12 500 Kilometer lange Grüne Band und seine Strukturen, die Geschichte mit der Gründung am 9. Dezember 1989 und die Ziele ein. „Die Initiative Grünes Band Europa ist eine einzigartige Chance für den grenzüberschreitenden Austausch und die Kooperation im Naturschutz, in der Regionalentwicklung und im Naturtourismus sowie für die Entwicklung einer europäischen Zivilgesellschaft, die das gemeinsame natürliche und kulturelle Erbe schützt.“
Dann widmete sich Vereš den Rahmenbedingungen im Oberpfälzer und Böhmerwald. Für das CeBB stünden historische Kulturlandschaften und Erinne-
rungsorte sowie sanfter Tourismus und ländliche Entwicklung im Fokus. Mit Luftbildern zeigte er, daß der Grenzstreifen auf bayerischer Seite viel dünner ist als auf tschechischer. Das liege an den früheren Grenzanlagen. Daher gebe es dort größere Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere.
Vereš definierte Erinnerungskultur folgendermaßen: „Erinnerungskultur bezeichnet den Umgang des Einzelnen und der Gesellschaft mit der eigenen Vergangenheit und Geschichte. Erinnerungskulturen sind die historisch und kulturell variablen Ausprägungen des kollektiven Gedächtnises.“ Wichtig sei zudem die Multiperspektivität, also das Zulassen von mehreren Sichtweisen.
Unter diesen Gesichtspunkten ist beim CeBB ein seit Juli 2021 bis Juni 2024 laufendes GrünesBand-Projekt angesiedelt. Dabei geht es darum, die Inhalte und Themen zu interpretieren und zu dokumentieren, sie zu vernetzen und daraus gemeinsam zu lernen und Perspektiven zu entwickeln sowie die Informationen durch öffentliche Veranstaltungen zu vermitteln. Einige bereits durchgeführte oder angedachte Veranstaltungen stellte Vereš vor.
Gerade aufgebaut oder geplant wird außerdem eine Webseite mit interaktiven Inhalten. Exemplarisch für die praktische Erinnerungsarbeit stellte Vereš die Aktivitäten rund um die verlassene Ansiedlung Bügellohe vor. Mit der Präsentation der digitalen Plattform Grünes Band und deren Perspektiven schloß Vereš.





Martin Sarnezki, Mitglied des Fördervereins Ilztalbahn, sprach über die historische bayerischböhmische Eisenbahnlinie von Passau nach Budweis. Dabei ging er auf Geschichte, Gegenwart und Zukunft ein. Bis 1945 gab es diese Bahnverbindung, heute existiert nur noch ein Teil, der Rest ist stillgelegt.
Sarnezki charakterisierte zunächst diese zwischen Donau und Moldau gelegene Region, das Höhenprofil im unteren Bayerischen Wald beziehungsweise Böhmerwald und nannte einige markante touristische Ziele wie Passau, Oberplan, Moldaustausee, Krummau und Budweis. Was er nicht verstehe, so Sar-
nezki, sei die heutige Dauer der 180 Kilometer langen Zugreise von Passau nach Budweis über Linz von mindestens vier Stunden und 20 Minuten.
Sarnezki führte, ausgehend von dem alten Handelsweg Goldener Steig, frühere Bahnlinien oder Streckennetze beiderseits der Grenze an: Ilztalbahn von Passau nach Freyung, Vereinigte Böhmerwald-Lokalbahnen mit einer Linie nach Budweis von Salnau über Oberplan und Krummau oder die Strecke von Waldkirchen über Haidmühle nach Neuthal. In einem Staatsvertrag zwischen dem Königreich Bayern und der k. u. k.-Monarchie seien 1904 die Rahmenbedingungen für das grenzüberschreitende Bahnnetz und den Ausbau vereinbart worden. Dabei sei es auch um das Schließen von Netzlücken gegangen, weniger um wirtschaftliche Erfolge. Sarnezki streifte weitere Bahnen wie die Mühlkreisbahn in Oberösterreich.
Nach dem Ersten Weltkrieg hätten sich mit neuen Trägern für die Bahnen in den beiden neuen Staaten die Voraussetzungen verändert. Nach dem Münchener Abkommen habe es erneut Änderungen bei der Organisation des Bahnbetriebs gegeben. Zum ersten Mal sei nun ein durchgehender Zugverkehr von Passau nach Budweis möglich gewesen. Diese Entwicklung habe 1945/1946 geendet.
Nach der Vertreibung der Deutschen und der Entvölkerung der grenznahen Regionen im Böhmerwald zu Bayern sei mit dem Ende des Abschubs der Bahnverkehr über die Grenze bei Haidmühle zusammengebrochen. Die Bahnlinien im Böhmerwald seien aber für den Personen- und Güterverkehr zunächst bestehen geblieben. Wegen des Aufbaus großräumiger Grenzanlagen auf der östlichen Grenzseite seien der grenzüberschreitende Bahnverkehr dann doch unterbrochen, Bahngleise demontiert und der Personenverkehr eingestellt worden.
Ab den 1970er Jahren hätten in Bayern touristische Angebote wie der Alpen-See-Expreß oder der TEE zugenommen, ehe Anfang der 1980er Jahre der Betrieb wegen Schäden an der Kachletbrücke über die Donau bei Passau eingestellt oder durch Busse
ersetzt worden sei. 2005 habe das Eisenbahnbundesamt die Strekke von Passau nach Freyung endgültig stillgelegt, habe sie aber nicht entwidmet. Andere Strekken seien ebenfalls stillgelegt, die Gleisanlagen demontiert und die Flächen an die Kommunen oder die Bayerischen Staatsforsten verkauft worden. So sei auf der Strecke Waldkirchen nach Haidmühle der Adalbert-StifterRadwanderweg errichtet worden, der aber als touristischer Anziehungspunkt gescheitert sei.
Gegen den Trassenverkauf der Strecke Passau nach Freyung und für die Reaktivierung des Personenverkehrs sei der Förderverein Ilztalbahn gegründet worden, der zudem die Ilztalbahn GmbH ins Leben gerufen habe. 2007 sei ein Pachtvertrag über die Strekke mit der DB Netz AG gelungen. 2008 seien EU-Fördermittel für die Errichtung eines grenzüberschreitenden ÖPNV-Netzes zwischen Bayern und der Tschechischen Republik im Rahmen des Nahverkehrskonzepts Donau-Ilz-Moldau beantragt und in Aussicht gestellt worden.
Dafür sollten Strecken und Bahnhöfe saniert und Anschlußbuslinien eingerichtet werden. Schließlich habe als konzessioniertes Unternehmen die RheinSieg-Eisenbahn GmbH Bonn mit ins Boot geholt werden können. 2010 habe die erste Publikumsfahrt auf dem sanierten Streckenabschnitt zwischen Freyung und Waldkirchen stattgefunden.
2011 sei auch das Teilstück von Passau nach Waldkirchen fertig gewesen, so daß ein durchgängiger Fahrbetrieb auf der Gesamtstrecke als Touristikverkehr an Wochenenden und Feiertagen in der Sommersaison mit freiwilligem, ehrenamtlichem Personal möglich geworden sei. Auch die EU-Förderung habe das Projekt abgesichert und optimiert.
Der ab 2019 beabsichtigte Plan, die Strecke Waldkirchen nach Neuthal wieder zu errichten, habe aufgegeben werden müssen. Auch Corona habe die Restaurierung des Bahnhofs Waldkirchen als Dokumentationszentrum oder Museum schwierig gemacht. Dazu kämen aktuelle finanzielle Probleme.

„Das Projekt der Wiedererrichtung der durchgehenden Bahnverbindung von Passau nach Budweis ist vorerst gescheitert“, resümierte Sarnezki. Der Förderverein Ilztalbahn renoviere nun den Bahnhof in Waldkirchen mit eigenen Mitteln und mit Zuschüssen des Bezirks Niederbayern und des Landesamtes für Denkmalpflege zur Errichtung des Museums.
Wenig optimistisch war Sarnezkis Ausblick auf die Ilztalbahn. Aus eigenen Mitteln sei der Betrieb nur noch für sechs Jahre sicherzustellen. Hier sei vor allem die Bayerische Eisenbahngesellschaft gefragt, ein Unternehmen für den Schienenpersonennahverkehr auf dieser Strecke zu gewinnen.
Mit geistlich-meditativen Liedern bereicherte Jana Vlčková, begleitet von Antonín Strnad an der zweiten Gitarre, die Veranstaltung. Nächstes Jahr werde „Quo vadis, Grenzland“ wieder in Präsenz in Pilsen stattfinden, verkündete Jean Ritzke-Rutherford von der Regensburger Akkermann-Gemeinde zum Schluß.
Christoph Zalder, Manuel Hagel MdL, Iris Ripsam, Thomas Strobl, Bärbel Häring und Klaus Hoffmann. Bild: Helmut Heisig
Bei der 70-Jahr-Feier der Union der Vertriebenen und Flüchtlinge Baden-Württemberg (UdVF) im Stuttgarter Ratskeller würdigte Thomas Strobl, baden-württembergischer Innenminister und Landesbeauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler, den wertvollen Beitrag der Vertriebenenorganisation in der CDU. Dabei verwies er auch auf die Lebensleistung der Vertriebenen und Flüchtlingen, die trotz des Verlustes ihrer Heimat und des erlittenen Leids beim Aufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg tatkräftig mitangepackt und mit ihren Stimmen die Gründung Baden-Württembergs erst möglich gemacht hätten.
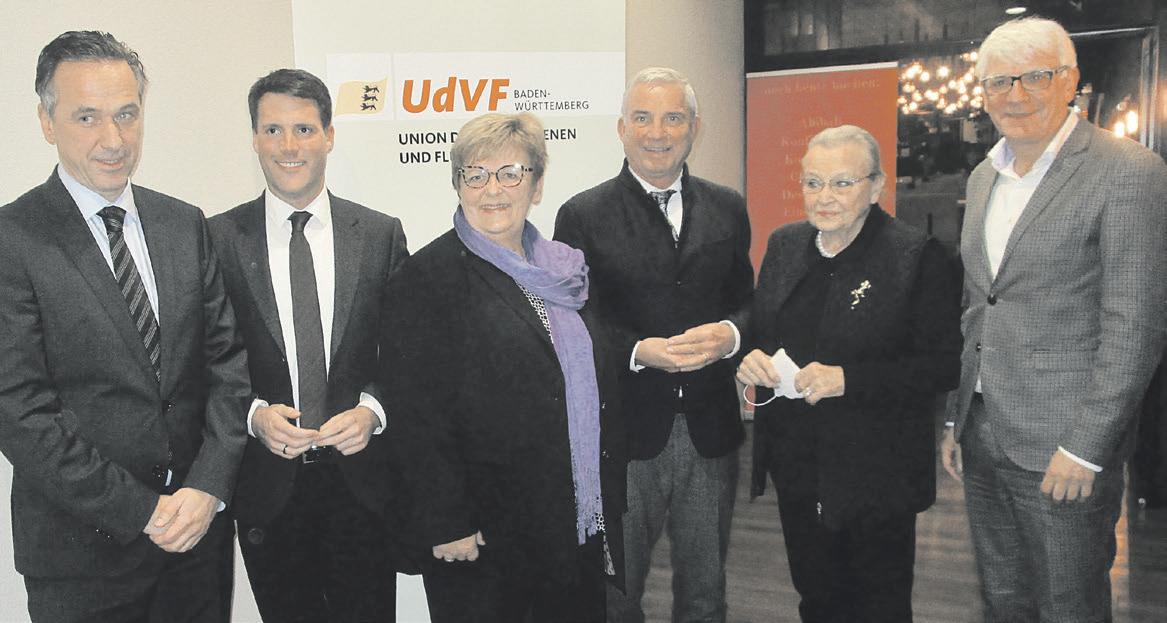
sie zwar auf ihr Menschenrecht auf die Heimat bestünden, aber auf Rache und Vergeltung verzichten und an einem gemeinsamen Europa mitarbeiten wollten. Zwei Jahre später habe sich in der CDU eine Gruppe zusammengetan, die die Interessen der Vertriebenen und Flüchtlinge in die Partei habe hineintragen wollen.
U






nter den Gästen begrüßte der Stellvertretende UdVF-Landesvorsitzende Klaus Hoffmann neben Festredner Thomas Strobl den Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Manuel Hagel MdL, Konrad Epple MdL, Reinhard Löffler MdL, die Stuttgarter Stadträtin und UdVF-Landesvorsitzende Iris Ripsam, AltStadträtin Bärbel Häring, Regionalrat a. D. Hans-Werner Carlhoff, den Stellvertretenden OMV-Bundesvorsitzenden Christoph Zalder, den Stuttgarter CDU-Kreisvorsitzenden Thrasivoulos Malliaras und den Vize-Landesvorsitzenden der Europa-Union, Florian Ziegenbalg. Auch Christine Czaja, die Tochter des langjährigen Bundestagsabgeordneten und ehemaligen BdV-Bundesvorsitzenden Herbert Czaja (1914–1997), war gekommen und freute sich über die Würdigung ihres Vaters in Strobls Festrede.
Strobl erinnerte zunächst an das Leid der Vertriebenen und Flüchtlinge, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges Haus und Hof und ihre Heimat hätten verlassen müssen, nur weil sie Deutsche gewesen seien. Dabei lobte er deren unbändigen Willen, sich im zerstörten Deutschland nicht dem Schicksal zu ergeben, sondern die Ärmel hochzukrempeln und mit den Einheimischen das Land wiederaufzubauen. Auch wenn die Sprache und Kultur der Vertriebenen und Flüchtlinge viel Gemeinsames mit der neuen Heimat verbunden habe, so hätten die Neuangekommenen doch auch Härte aus der heimischen Bevölkerung erfahren, die den Neuanfang nicht leichtgemacht habe.
Am 5. August 1950 hätten die Vertriebenen und Flüchtlinge mit der Verkündung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen in Stuttgart zum Ausdruck gebracht, daß
Nun erinnerte Strobl an die Anfänge der UdVF in Baden-Württemberg und an deren Gründung vor 70 Jahren und würdigte Herbert Czaja, der zu den UdVF-Mitbegründern in Baden-Württemberg zähle und viele Jahre deren Vorsitzender gewesen sei. „Die CDU ist dankbar und stolz, Czaja in ihren Reihen gehabt zu haben.“ Zur Gründerzeit der UdVF sei Czaja noch Stuttgarter Stadtrat gewesen, 1953 sei er in den Deutschen Bundestag gewählt worden, dem er 37 Jahre lang als direkt gewählter Abgeordneter für den Stuttgarter Norden angehört habe.
Der aus dem oberschlesischen Teschen stammende Politiker habe für die Interessen der Vertriebenen und Flüchtlinge gekämpft und geholfen, zahlreiche Gesetze wie das Bundesvertriebenengesetz und das Lastenausgleichsgesetz durchzusetzen. „Hierzu leistete auch die UdVF einen großen Beitrag und wurde zum Brückenbauer zwischen den Menschen.“
Strobl nannte die zahlreichen Aktionen der UdVF wie die Gedenktage am 17. Juni, an denen sie an den Mauerbau erinnert und deutlich gemacht habe, daß sie sich mit der Teilung Deutschlands und Europas nie abfinden werde. „Die CDU und besonders die UdVF haben immer an die Deutsche Einheit geglaubt, auch wenn das Bekenntnis dazu nicht immer einfach war.“
Bis heute sei das Engagement der UdVF für die Anliegen von Aussiedlern und Spätaussiedlern ein wichtiger Bestandteil der politischen Arbeit der Vereinigung. Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und die folgende Fluchtbewegung Richtung Deutschland sei eine neue Herausforderung, die seit dem 24. Februar 160 000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg geführt habe. Die aktuelle politische Lage im Bereich der Flüchtlingspolitik stelle vor allem die Kommunen vor große Herausforderungen.
Helmut Heisig

VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 15 � Ackermann-Gemeinde
im Bistum Regensburg
Christoph Zalder forderte zum Schluß, daß Vertreibungsdekrete in Europa keinen Platz mehr haben dürften und Vertreibung geächtet werde müsse. Baden-Württemberg
�
UdVF-Landesverband
70. Geburtstag
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 . BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
zum
nen
Die historische Zugstrecke von Passau nach Budweis
Mit diesem Plakat wirbt Dr. Herbert Czaja im Wahlkampf 1976.
Von der verlassenen Ansiedlung Bügellohe sind heute
Großteil nur noch Rui-
vorhanden. Bild: Markus Bauer
Das Grüne Band und die Erinnerungskultur
Der Nikolaus hatte seinen Dienst wohl schon beendet. Denn am Abend seines Gedenktags waren 62 Computer zum monatlichen Zoom der Ackermann-Gemeinde zugeschaltet. Vielleicht lag es aber auch an der Referentin Ivana Červenková. Sie ist seit 1. April Generalkonsulin der Tschechischen Republik mit Sitz in München und zuständig für den Freistaat Bayern sowie die Länder Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz. Červenková sprach vor allem über die seit 1. Juli bis zum Jahresende dauernde tschechische EU-Ratspräsidentschaft.
Moderator Rainer Karlitschek stellte die aus Budweis stammende Diplomatin zu Beginn des Zooms vor. Sie sei seit 1992 im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik tätig, unter anderem mit Stationen in Bonn an der Seite von Botschafter Jiří Gruša, Bern und Wien. Über all diese Stationen habe die promovierte Juristin das Thema Völkerrecht immer wieder begleitet.
Europa als Aufgabe
deutlich. „Ich reise viel durch die Regierungsbezirke und rede viel mit den Landräten und Regierungspräsidenten“, faßte sie ihre einleitenden Worte zusammen.
Das Motto „Europa als Aufgabe“ sei für den Jahresbeginn 2022 konzipiert worden. Es habe ermuntern sollen, die Herausforderungen für Europa neu zu überdenken. Mit dem Krieg Rußlands gegen die Ukraine gebe es nun gänzlich andere Aufgaben wie Bewältigung der Flücht-
nötigen Finanzmitteln vor allem darum, daß die Ukraine ein freies und prosperierendes Land werde. Eine gemeinsame Lösung aller EU-Staaten sei, so die Generalkonsulin, vor allem im Bereich der Energie mit Erdgas oder Strom zu finden.
Die Reduzierung des Gasverbrauchs und gemeinsame Gaseinkäufe habe die Tschechische Republik in der Eigenschaft als EU-Ratspräsident angeregt, allerdings hätten einige Staaten dann eigene Maßnahmen auf den Weg gebracht. Da die Tschechen zu 97 Prozent von russischem Gas abhängig seien, sei der tschechische Staat hier besonders gefordert. Schließlich müßten die europäische Verteidigungskapazität gestärkt, die Ukraine gemeinsam militärisch unterstützt werden.
Advent mit Ehrungen
Zur Adventsfeier der hessischen Kreisgruppe Schlüchtern waren zahlreiche Mitglieder und Gäste Anfang Dezember ins Hotel Akzent in Schlüchtern gekommen.
Zu Beginn ernannten SL-Landesobmann Markus Harzer und Kreisobmann Roland Dworschak Gudrun Heberling sowie Alt-Kreisobmann Walter Weber und dessen Ehefrau Gesine zu Ehrenmitgliedern. Harzer hob die Bedeutung der 2006 wieder gegründeten und somit jüngsten Kreisgruppe der SL-Landesgruppe Hessen hervor.
Bei Kaffee und Kuchen genoß man anschließend das vorweihnachtliche Programm. Dieses hatten Mitglieder vorbereitet und boten es nun dar. Die „Egerländer Boum“ und Pauline Starick an der Violine begleiteten die Adventsfeier musikalisch. Sogar der heilige Nikolaus alias Gernot Strunz genoß die kurzweilige Feier. Antje Hartelt
Anfang Dezember eröffnete eine bayerisch-böhmische Ausstellung in der Egerländer Stadt Fleißen.
In Fleißen lebten bis 1945 vor allem Deutsche. Deren Vertreibung und die Liquidierung der dortigen Textilindustrie traf die Region schwer. Die junge Stadtführung und deren europäische Offenheit lassen den Ort wieder aufblühen. Im Rahmen des Projekts „Bayerisch-böhmische Ausstellungen über die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte und die gemeinsame geologische Vergangenheit“ entstand ein Museum in der ehemaligen Textilfabrik von Johann Lehrmann. Am 1. Dezember eröffnete die Exposition im Wert von 85 Millionen Kronen.
Zunächst trug das Duo „Målaboum“ aus Richard Šulko und Sohn Vojtěch das Egerländer Volkslied „Asm Eghalånd bin i(ch“ vor. Sie sollten die ganze Eröffnung musikalisch begleiten. Dann begrüßte der deutschstämmige Bürgermeister Petr Schaller die Gäste und erzählte die lange Geschichte des Museums. Das Ausstellungskonzept stellte Viktor Braunreiter vor. Er begann mit dem Gedicht

Beim Blick auf die EU-Ratspräsidentschaft erinnerte Karlitschek an die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz an der Prager Karls-Universität Ende August und an das aus der bekannten Rede Václav Havels bei der Verleihung des Internationalen Karlspreises 1996 in Aachen stammende Motto der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft „Europa als Aufgabe“.
Ergänzend zu Karlitscheks Informationen erklärte Červenková, daß sie an der Deutsch-Tschechischen Erklärung und der Erarbeitung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie weiterer bilateraler Abkommen beteiligt gewesen sei. Die jetzige Tätigkeitsregion komme ihr sehr entgegen, da sie gerne ihre Familie in Budweis besuche. Sie habe sich inzwischen gut eingearbeitet, bekannte sie und verwies auf gegenseitige Besuche tschechischer und bayerischer Minister sowie auf das Treffen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit dem tschechischen Premier Petr Fiala im Juli.
„Wir haben gute tschechischbayerische Beziehungen“, verdeutlichte die Generalkonsulin.
Das machte sie auch an den vielen grenzüberschreitenden Aktivitäten in Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern
„Ein Stück Heimat“, zu dem ihn der Schelmenroman „Simplicius Simplicissimus“ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen inspiriert habe. Am Beispiel der Familie Päsold schilderte er die jahrhundertelange Geschichte der Fleißener.
Eine Partnerstadt von Fleißen ist das oberpfälzische Erbendorf. Die Städte verbindet die geologische Erbendorfinie. Bürgermeister Johannes Reger überbrachte die Grüße von Erbendorf. Mit ihm war Altbürgermeister Hans Donko gekommen, der mit Schaller das Projekt 2018 gestartet hatte. Auf deutscher Seite entsteht ein Partner-Museum, das eine Dokumentations- und Gedenkstätte für Flucht und Vertreibung wird. Hauptthemen sind das Dritte Reich in Erbendorf und Umgebung, Flucht und Vertreibung von Deutschen und deren Integration in der Fremde.

Petra Ernstberger, Geschäftsführerin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, schilderte die Aktivitäten und Projekte des Fonds, der nicht nur der Völkerverständigung von Deutschen und Tschechen dient, sondern
lingskrise, Wiederaufbau der Ukraine, europäische Verteidigungssicherheit, Energiesicherheit, strategische Widerstandsfähigkeit sowohl der europäischen Wirtschaft als auch der demokratischen Institutionen. „Europa steht vor neuen Aufgaben. Das Ziel ist, Europa zu stärken und robust zu machen sowie die humanitäre und wirtschaftliche Krise zu bewältigen.“
Humanitäre Hilfe beziehe sich aktuell vor allem auf die Ukraine. Červenková nannte Daten aus ihrem Land. Das habe 400 000 Ukrainer aufgenommen. Und sie verwies auf die ähnliche Mentalität von Tschechen und Ukrainern. Außerdem hätten viele Ukrainer Verwandte in der Tschechischen Republik, weshalb sie dorthin kämen.
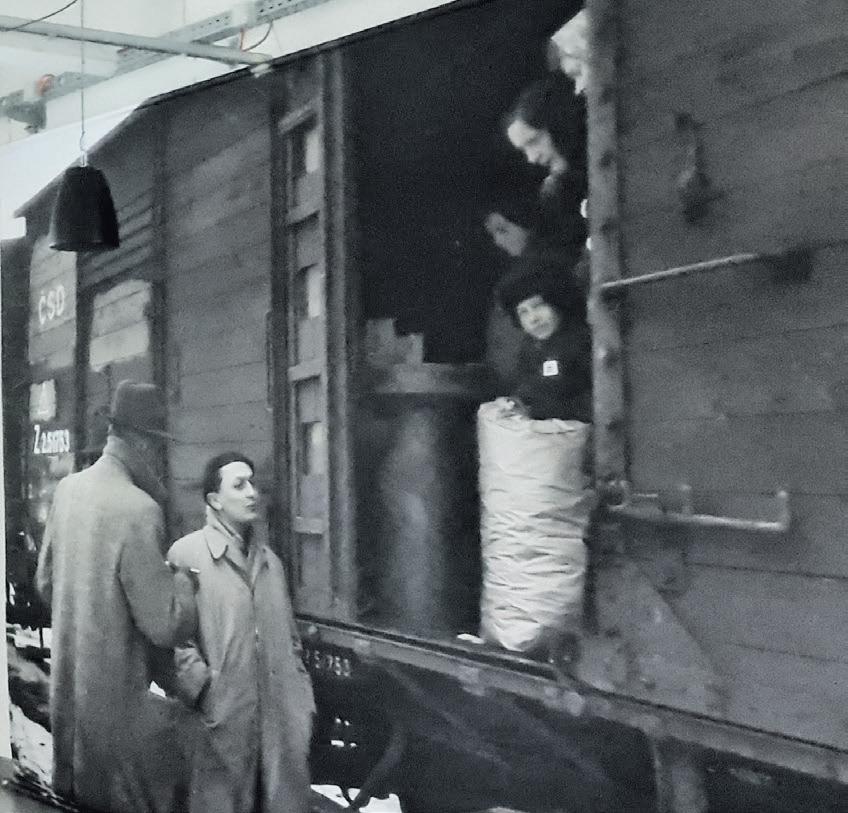
Eine weitere Aufgabe sei die militärische Unterstützung der Ukraine mit Geld und Waffenlieferungen sowie die Ausbildung ukrainischer Soldaten in der EU, vor allem in Deutschland und in ihrer Heimat. Beim Wiederaufbau der Ukraine gehe es neben den
Weitere für die tschechische EU-Ratspräsidentschaft wichtige Themen seien angesichts der aktuellen Entwicklungen in den Hintergrund gerückt. So die EU-Beitrittsperspektiven für die Länder auf dem Balkan. Červenková verwies auf die erste Tagung der Europäischen Politischen Gemeinschaft aus 44 Ländern am 6. Oktober in Prag und auf die erste seit zehn

Jahren wieder stattgefundene gemeinsame Sitzung von EU und Israel.
„Wir waren viel mit den großen Themen befaßt. Die Tschechische Republik hat die EU-Ratspräsidentschaft mit Würde und großem Engagement ausgeübt“, lautete die vorläufige Bilanz der Generalkonsulin. Am 1. Januar übernimmt Schweden die EU-Ratspräsidentschaft für die folgenden sechs Monate.
In der anschließenden Diskussions- und Fragerunde sprach Karlitschek die Besonderheit einer EU-Ratspräsidentschaft an. „Es war anders als beim ersten Mal. Nach dem Lissabon-Vertrag gibt es nun etwas andere Strukturen“, erklärte Červenková. Dazu gehörten unter anderem Veranstaltungen im jeweiligen Land.
Burkard Steppacher von der Konrad-Adenauer-Stiftung fragte nach dem Machtverhältnis zwischen der EU-Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat. Derzeit gebe es wegen der aktuellen Gegebenheiten keine Gedanken über Neustrukturierungen in der EU, so die Generalkonsulin. Die
manchmal etwas wacklige Einigkeit der europäischen Staaten deutete Bernhard Dick an, konkret Versuche von Staatschefs, für ihre Stimme ein Geschäft herauszuholen, oder das Vorpreschen von Bundeskanzler Scholz bei der Gaspreisbremse.
Eine Aufgabe der EU-Ratspräsidentschaft sei auch, Kompromisse zu suchen, so Červenková. Aktuell sei das Embargo gegen russisches Öl ein Test für Europa. Bis jetzt habe man immer Lösungen auf EU-Ebene gefunden. Aktuell bereite ihr die Flüchtlingswelle aus der Türkei Sorgen, weshalb Grenzkontrollen seitens der Slowakei und Gespräche mit Serbien vereinbart worden seien.
Abschließend fragte Rainer Karlitschek, was von der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft bleiben solle. Červenková blickte auf Corona zurück, das Europa einige Zeit etwas zersplittert habe. „Jedes Land spielte für sich selbst.“ Daher sei heute um so mehr der Einsatz für die Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft wichtig, also die Abhängigkeit von China und anderen Ländern zu minimieren. „Das Thema von Václav Havel kommt auf den Tisch, man muß es neu überdenken.“ Und sie nannte neben bekannten aktuellen Themen Klimawandel und den Umgang mit falschen Nachrichten. Markus Bauer
Europa – altgriechisch Εύρώπη Eurόpē – ist eine Gestalt der griechischen Mythologie und die Tochter des phönizischen Königs Agenor und der Telephassa. Zeus verliebte sich in sie und verwandelte sich wegen seiner argwöhnischen Gattin Hera in einen Stier. Sein Bote Hermes trieb eine Stierherde in die Nähe der am Strand von Sidon spielenden Europa, die der Zeus-Stier auf seinem Rücken entführte. Er schwamm mit ihr nach Matala auf der Insel Kreta, wo er sich zurückverwandelte. Der Verbindung mit dem Gott entsprangen die drei Kinder Minos, Rhadamanthys und Sarpedon. Auf Grund einer Verheißung der Aphrodite wurde der fremde Erdteil nach Europa benannt.

auch das gemeinsame Kulturgut rettet. Über das Projekt in Fleißen sagte Ernstberger: „Dieses Projekt ist so richtig von unten gekommen, was mich am meisten freut. Und man kann es heute auch so richtig spüren.“
Vom Sudetendeutschen Museum in München war Raimund Paleczek, Vorsitzender des Sudetendeutschen Instituts, gekommen. München hatte auch einige Exponate nach Fleißen verliehen. Ein ganz besonderer Gast war der Eichenzeller Gemeindevertreter Joachim Bohl. In Eichenzell waren 1946 rund 500 Vertriebene aus Fleißen gestrandet, darunter der damals zehnjährige Adolf Penzel.
Penzel engagierte sich mehr als 30 Jahre lang ehrenamtlich für die Egerländer und die Gemeinde Eichenzell. Zeit seines Lebens setzte er sich für das kulturelle Erbe der Egerländer und für die Aussöhnung ein. Sein Verdienst war, daß 2012 die Partnerschaftsurkunde zwischen Fließen und Eichenzell unterschrieben wurde. Er starb vergangenes Jahr.

Vor der Führung durch die Ausstellung präsentierte der
Verein Post Bellum sein Projekt „Gedächtnis des Volkes“. Der Direktor der Karlsbader Niederlassung, Lukáš Květoň, erklärte das Projekt, in dem Zeitzeugen über ihre Schicksale erzählen.
Danach sprach Filip Dušek, der Inhaber die Firma Elroz Invest in Fleißen. Dušek schilderte die Geschichte des Gebäudes der einst zweitgrößten Textilfirma in Fleißen. Deren Inhaber, die Päsolds, erlebten am eigenen Leib, wie die Weltgeschehnisse das Schicksal ändern können. Eric Walter Päsold hatte in Langley bei London sein Textilgeschäft nach langen Bemühungen eröffnet und war ein erfolgreicher Lieferant von Marks & Spencer und Woolworth. Der Zweite Weltkrieg kam, Päsold mußte in die Britische Armee einrücken und gegen seinen Bruder in der Wehrmacht kämpfen. Nach dem Krieg bekamen Erich und sein Bruder Rolf Päsold das Recht, ihr Vorkriegseigentum zurückzubekommen, die Firmenanteile

von Ingo Päsold und Sylvie Nebel wurden jedoch konfisziert. Beim kommunistischen Umsturz 1948 wurde die Firma enteignet.
Schließlich folgte die Führung durch die Dauerausstellung. Sie ist interaktiv und mit Liebe zum Detail. Neben dem persönlichen Zeugnis von Adolf Penzel, der mit einem Video die Ausstellung begleitet, kann man nachgespielte Szenen in weiteren Videos sehen, die die Ereignisse 1938 sowie die Vertreibung 1945/46 zeigen. Man wird Teil der Geschehnisse, und der kalte Schweiß läuft einem über den Rücken.
Ein wichtiger Teil widmet sich der Geologie. Die Animation im Keller des Museums, wo die Erdplatten-Bewegungen auf einer breiten Leinwand dargestellt werden, ist sehenswert und auch für die kleinen Besucher interessant.
Neben den Industrien und dem Zweiten Weltkrieg gewidmete Ausstellungsabteilungen sind wohl am interessantesten die Teile über Vertreibung und Volkstum. Die in tatsächlicher Größe aufgeführte Szene mit der Verladung der Deutschen in einen Viehwagon ist schmerzhaft. Wenn man versucht, den 20 Kilogramm schweren Vertreibungskoffer zu packen, stellt man fest, daß man nichts Wertvolles mitnehmen dürfte.
An der Abteilung, in der das Vereinsleben und das Volkstum gezeigt werden, beteiligte sich auch der Bund der Deutschen in Böhmen, also der Egerländer Verein in der deutschen Minderheit mit einem Film. Ab April 2023 soll dieses monumentale Museum, welches gut die Museen in Aussig und München ergänzt, für die breite Öffentlichkeit geöffnet werden. Hut ab vor Petr Schaller!
VERBANDSNACHRICHTEN AUS DER HEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 16 � SL-KG
Schlüchtern
� Fleißen
Egerland
� Ackermann-Gemeinde
im
Neues Museum eröffnet
Hessens SL-Landesobmann Markus Harzer und Schlüchterns SLKreisobmann Roland Dworschak ehern
das treue SL-Mitglied Gudrun Heberling.
Dr. Ivana Čer venková. Bild: Nadira Hurnaus
Rainer Karlitschek
Blick in die Ausstellung.
Tizian: „Raub der Europa“, um 1560. Die „Malaboum“
Neudeker Heimatbrief
für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Am 9. Dezember feierte der gebürtige Aberthamer Josef Grimm, Neudeks Heimatkreisbetreuer, Vorsitzender der Heimatgruppe „Glück auf“ – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg und zuständig für den Neudeker Heimatbrief, im bayerisch-schwäbischen Augsburg mit seiner Frau Ingrid 80. Geburtstag.
Josef Grimm 80
Vorsitzende Heinrich Hegen verstorben war, drohte die Heimatgruppe auseinanderzufallen, teils alters-, teils gesundsbedingt. Die Stadt hätte das Museum geräumt. Alles wäre weg gewesen.
Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek als eingetragener Verein gegründet mit Josef Grimm als erstem Vorsitzenden, Herbert Götz als seinem Stellvertreter und mir als Schriftführerin und Kassiererin.
Die Heimatgruppe „Glück auf“ wünscht ihren Landsleuten von Herzen frohe Weihnachten.

Mit dem Bild eines Winterwaldes bei Bärringen von Ludmilla Anderle wünscht die Heimatgruppe „Glück auf“ – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Die Zusammenarbeit der Zeitschriften „Neudeker Heimatbrief“, „Der Grenzgänger“ und „Krušnohorský Herzgebirge Luft“ besteht nun schon seit neun Jahren. Sie wurde im Dezember 2013 von den Verantwortlichen der drei Zeitschriften in Neudek vereinbart. Seitdem trug sie erfolgreich zu einem vielfältigen Informationsaustausch für die jeweiligen Leser bei.
Der Neudeker Heimatbrief wird im Juni 2023 75 Jahre alt. Allerdings be-

stand die Befürchtung, daß er mangels Autoren aus dem eigenen Leserkreis und aus der tschechischen Zeitschrift „Krušnohorský Herzgebirge Luft“ das Jubiläum nicht überleben würde. Diese Gefahr scheint nun gebannt, und so hoffen wir, daß die Zusammenarbeit der drei Zeitschriften auch im kommenden Jahr weiter bestehen wird.
Einige Mitglieder der Heimatgruppe lernten durch eigene Krankheit oder durch Unfälle enger Familienmitglieder das hohe Gut der Gesundheit zu schätzen. Hoffen wir, daß uns im neuen Jahr die Gesundheit und der Frieden erhalten bleibt.
Das unten stehende Weihnachtsgedicht von Pepp Grimm (1899–1961) rundet den Weihnachtsgruß ab.
Im Jahr 1946 wurde er mit seinen Eltern und Schwestern vertrieben. Die Familie strandete in Bayerns Schwaben. In Dillingen ging er zur Schule. Nach dem Abitur studierte er Theologie. Allerdings schwenkte er alsbald mehr in Richtung Technik. Jahrelang war er sehr aktiv beim katholischen Malteser Hilfsdienst. Beruflich war er bei der Holz-Berufsgenossenschaft. Sein Vater war im Neudeker Heimatbrief als Vetter Pepp bekannt. Er schrieb viele Geschichten und Gedichte über die Heimat wie das Weihnachtsgedicht „Mei Krippl“ (➝ links unten). In unserem Museum in Augsburg existiert sogar eine Miniatur von Abertham. Mit der wollte Vetter Pepp seinen Kindern die Heimat zeigen. Sohn Josef lernt den Aberthamer Dialekt, den er akzentfrei spricht. Das beweist er bei Mundart-Vorträgen. Erst nach seiner Pensionierung fand er Zeit, sich mit seiner Geburtsheimat zu beschäftigen. In den sechziger Jahren war er das erste Mal in Abertham und zutiefst enttäuscht. Von seinen Eltern hatte er immer gehört, wie schön es dort sei. Doch das war bei seinem ersten Besuch nach der Vertreibung überhaupt nicht der Fall.
Da ergriff Herbert Götz die Initiative. Er und ich hatten bei unserem ersten offiziellen Heimatbesuch im April 1991 den Namen „Die Kinder von damals“ erhalten und pflegten seitdem regen Kon-
In einer Satzung hielten wir fest, daß ein Vereinszweck die Pflege der grenzüberschreitenden Völkerverständigung ist. Das klappt bis zum heutigen Tage sehr gut. Das Museum wird gepflegt –Josef Grimm führt Interessenten durch das Museum und erklärt gerne professionel alles. Außerdem ist er zuständig für den Neudeker Heimatbrief. Er sammelt Material, schreibt Berichte, übersetzt tschechische Artikel und besorgt Bildmaterial. Schon seit vielen Jahren belegt er bei der Volkshochschule in Augsburg Tschechisch-Kurse.
Ingrid und Josef Grimm wenige Tage vor dem Geburtstag auf dem Wiener Christkindlmarkt, zu dem die Globetrotter von Passau mit der MS Albertina auf der Donau anreisten.


takt mit unserem Geburtsort. Wir konnten also auf der einen Seite nicht unsere Heimatliebe pflegen und auf der anderen Seite die Heimatgruppe sterben lassen. Nach Rücksprache mit Josef Grimm kamen wir zu dem Entschluß für eine Fortsetzung – allerdings als ein ordentlich eingetragener Verein.

Wir wünschen Josef Grimm noch lange viel Gesundheit, wir arbeiten gerne mit ihm zusammen. Wir fahren gerne mit ihm zu den Sudetendeutschen Tagen, wo wir schon seit vielen Jahren mit einem Stand vertreten sind. Auch bei unseren Busreisen hören die Landsleute und Freunde begeistert seine kundigen Berichte über die Geschichte der Deutschen in Böhmen. Das beginnt mit der ersten Einwanderungswelle von Deutschen in Böhmen vor 1000 Jahren, reicht bis zur Vertreibung und der nach der Samtenen Revolution und dem Fall des Eisernen Vorhangs einsetzenden Verständigung und Versöhnung.
Bei der früheren Heimatgruppe war er Archivar. Allerdings herrschten dort Unstimmigkeiten. Nachdem 2012 der letzte
WIR GRATULIEREN
Folgenden treuen Beziehern des Neudeker Heimatbriefs, die im Dezember Geburtstag feiern, wünschen wir von Herzen alles Gute, viele schöne Jahre in Gesundheit und Gottes überreichen Segen.
■ Abertham. Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, 9. Dezember 1942.



Christa Schmalbach, Schwertges Weg 22, 40670 Meerbusch, 24. Dezember 1941.
■ Bernau. Professor Dr. Erich Zettl, Hebelstraße 3, 78464 Konstanz, 30. Dezember 1934.
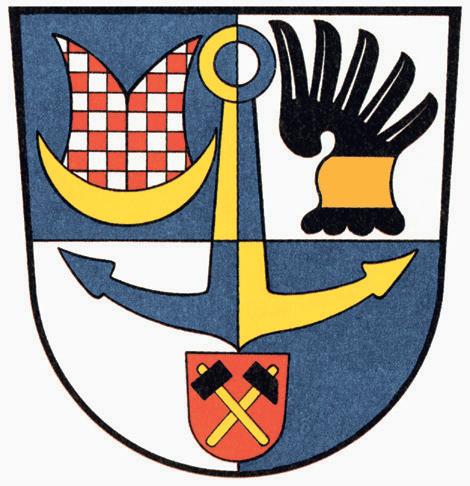
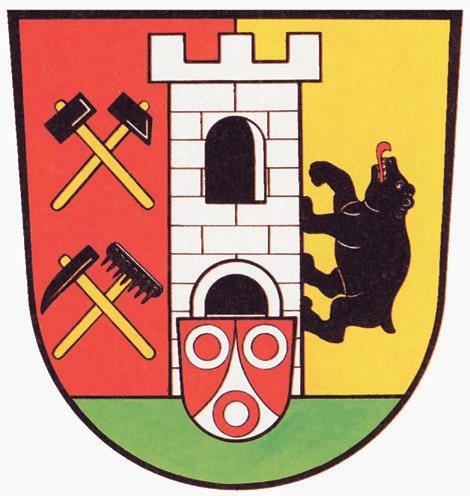
■ Kohling. Ewald Friedl, Höhenweg 16, 92284 Poppenricht, 13. Dezember 1926.

■ Neuhammer. Ernst Pilz (Bahnhofstraße 283), Hellersdorfer Straße 95, 12619 Berlin, 17. Dezember 1923.
So wurde im Frühjahr 2013 die neue Heimatgruppe unter dem Namen Heimatgruppe „Glück auf“ – Freunde des
Wir, die Heimatgruppe „Glück Auf“, danken unserem Josef für seinen Einsatz für unsere Heimat und für die wunderbare Zusammenarbeit. Uns wünschen wir, daß es noch lange so bleibt, und ihm wünschen wir Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Anita Donderer
Die dem heiligen Johannes von Nepomuk (1345–1393) geweihte Kirche in Neuhammer entstand im Jahre 1789.

Bild: Patrik Paprika
Neues Museum
Mitte November konnte nach einer langen Planungs- und Bauphase mit vielen Rückschlägen endlich das neue Museum in Abertham eingeweiht werden.


Das neue Musum ist dreigeteilt und beinhaltet die Lederhandschuhherstellung, den Bergbau und einen multimedialen Teil, den man mit 3D-Brille betrachtet und der eine sehr interessante „Zeitmaschine“ hat.
Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Samstag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr. Eintritt für Erwachsene 150, für Kinder, Rentner und Studenten 100, für Gruppen ab sechs Personen mit Führung 200 und für Schulklassen 80 Kronen. Das Museums steht in der Rooseveltova 31, 36235 Abertamy gegenüber der Kirche der Vierzehn Nothelfer im Zentrum Aberthams.
Aus „Der
Grenzgänger“
Josef Grimm Helmut Günther Anita Donderer
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Neudek Abertham
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg
– IBAN: DE69 7015 0000 0906 2126 00, BIC:
Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 17 Folge
Das Museum steht gegenüber der Vierzehn-Nothelfer-Kirche im Zentrum Aberthams
Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion: Lexa Wessel, eMail neudeker@ sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft,
Stadtsparkasse München
SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge 641 (1/2023): Mittwoch, 18. Januar.
640 · 12/2022
❯ Abertham
❯ Abertham
Nähraum des Museums.
Ulrich Möckel berichtet über die Frömmigkeit der Bergleute im Erzgebirge.
Die Arbeit der Bergleute war zu jeder Zeit körperlich schwer und gefährlich. Niemand wußte, ob der Bergmann nach der nächsten Schicht wieder gesund zu Hause ankommen würde. Deshalb waren der christliche Glaube und die daraus resultierende Frömmigkeit ein wichtiger Halt im Leben dieser Menschen.
Eine bedeutende Rolle spielte dabei der Augustinermönch und Theologe Martin Luther. Dieser veröffentlichte am 31. Oktober 1517 in Wittenberg seine 95 Thesen zur Reformierung der katholischen Kirche. Luther konnte sich damit jedoch auf dem Wormser Reichstag 1521 nicht durchsetzen und mußte danach um sein Leben fürchten.
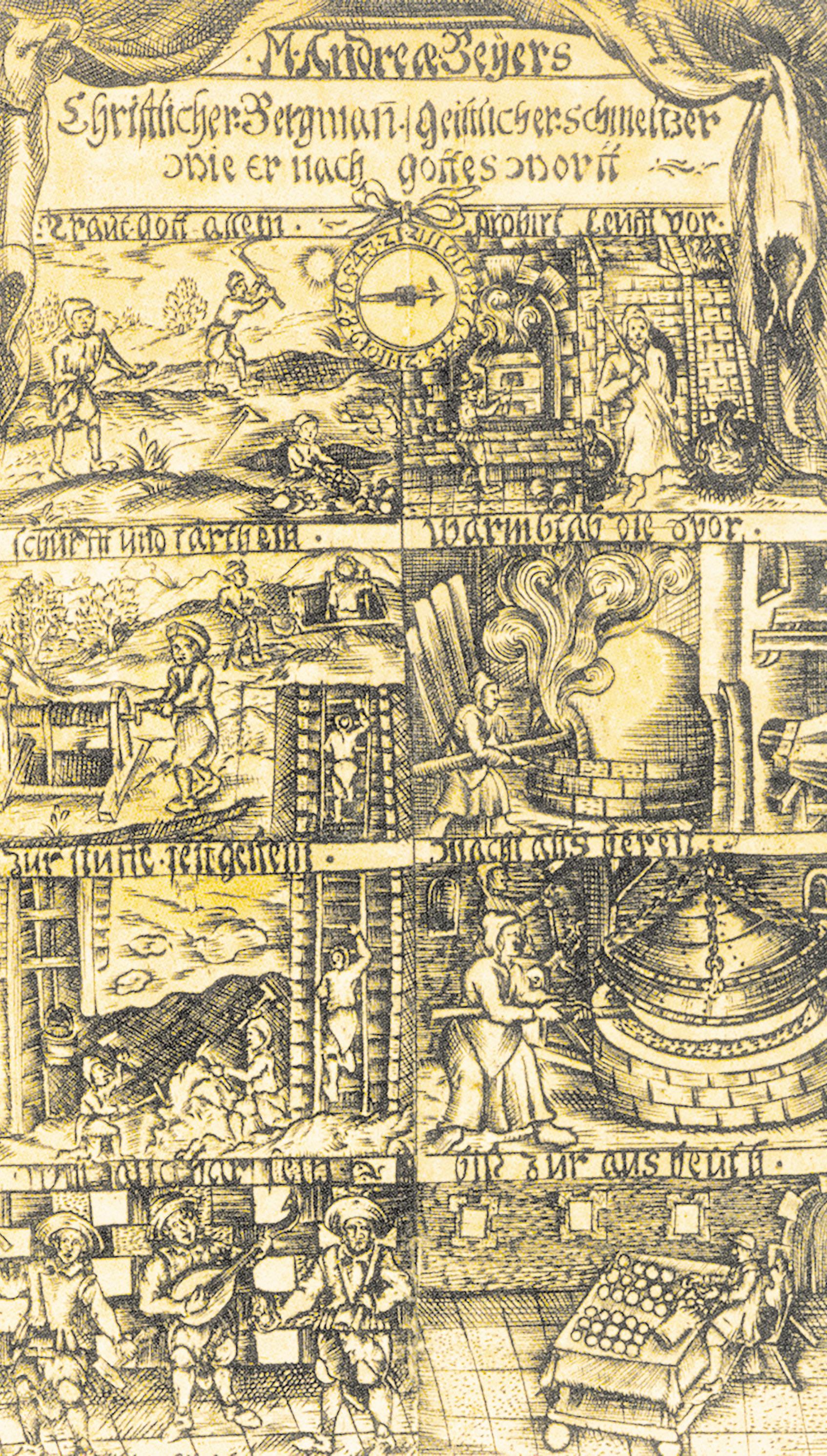
Der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise (1463–1525), veranlaßte deshalb, Luther nach einem vorgetäuschten Überfall auf der Wartburg bei Eisenach in Schutzhaft zu nehmen.
Stille und Zeit verhalfen ihm zu einer seiner produktivsten Schaffensperioden. Aus Langeweile griff er zur Feder und übersetzte das Neue Testament in nur zehn Wochen in die deutsche Sprache. Von nun an konnten alle Menschen die Bibel lesen oder verständlich hören, welche bisher nur des Griechischen und des Lateinischen mächtigen Menschen vorbehalten war.
Infolgedessen spalteten sich die reformierten Christen von den katholischen ab und wurden evangelisch. Ein bedeutender Vertreter der Reformation im westlichen böhmischen Erzgebirge war der in Joachimsthal als deutscher Pfarrer und lutherischer Reformator bis zu seinem Tod 1565 wirkende Johannes Mathesius.
Luthers Lehre stieß bei den erzgebirgischen Bewohnern, besonders bei den Bergleuten, auf offene Ohren. Er belebte die alte Lehre wieder, die besagt, daß jeder Christ mit der Taufe dazu beauftragt sei, mit Gottes Wort und Gebet zu leben. Dies berechtigte die Bergleute dazu, ihre Andachten vor Schichtbeginn und nach Schichtende ohne Geistliche zu halten. Dies wird heute als Hauptgrund dafür angesehen, daß sich das reformatorische Gedankengut im Erzgebirge so gut und schnell verbreitete.
In Böhmen wurden danach die evangelischen Christengemein-
O Herr, verlaß den Bergmann nicht!
den im Zuge der Gegenreformation zurück zum katholischen Glauben gedrängt. Wer sich dem widersetzte, flüchtete oder wurde nach Sachsen, das bis heute überwiegend evangelisch ist, ausgewiesen.
Gebet, Andacht und fromme bergmännische Lieder bestimmten über drei Jahrhunderte lang das Leben der Bergleute. Wenn man deren Tagesablauf betrachtet, so standen sie meist um 3.00 Uhr früh auf und gingen zu
ein Orgelpositiv. Im Gegensatz zu den Kirchenorgeln waren die Orgelpositive kleine, transportable Orgeln mit technischer Minimalausstattung. Vier dieser Instrumente aus dem Freiberger Raum sind heute noch erhalten.
Das Huthaus war für den Bergmann nicht nur für seine Andacht bedeutend. Das Huthaus diente auch dem Kleidungswechsel, denn bei der harten Arbeit war die Kleidung von Schweiß und Tropfwasser durchnäßt. Der Weg zur Familie dauerte oft über eine Stunde. Somit war der Wäschewechsel besonders im Winter wichtig, um nicht zu erkranken.
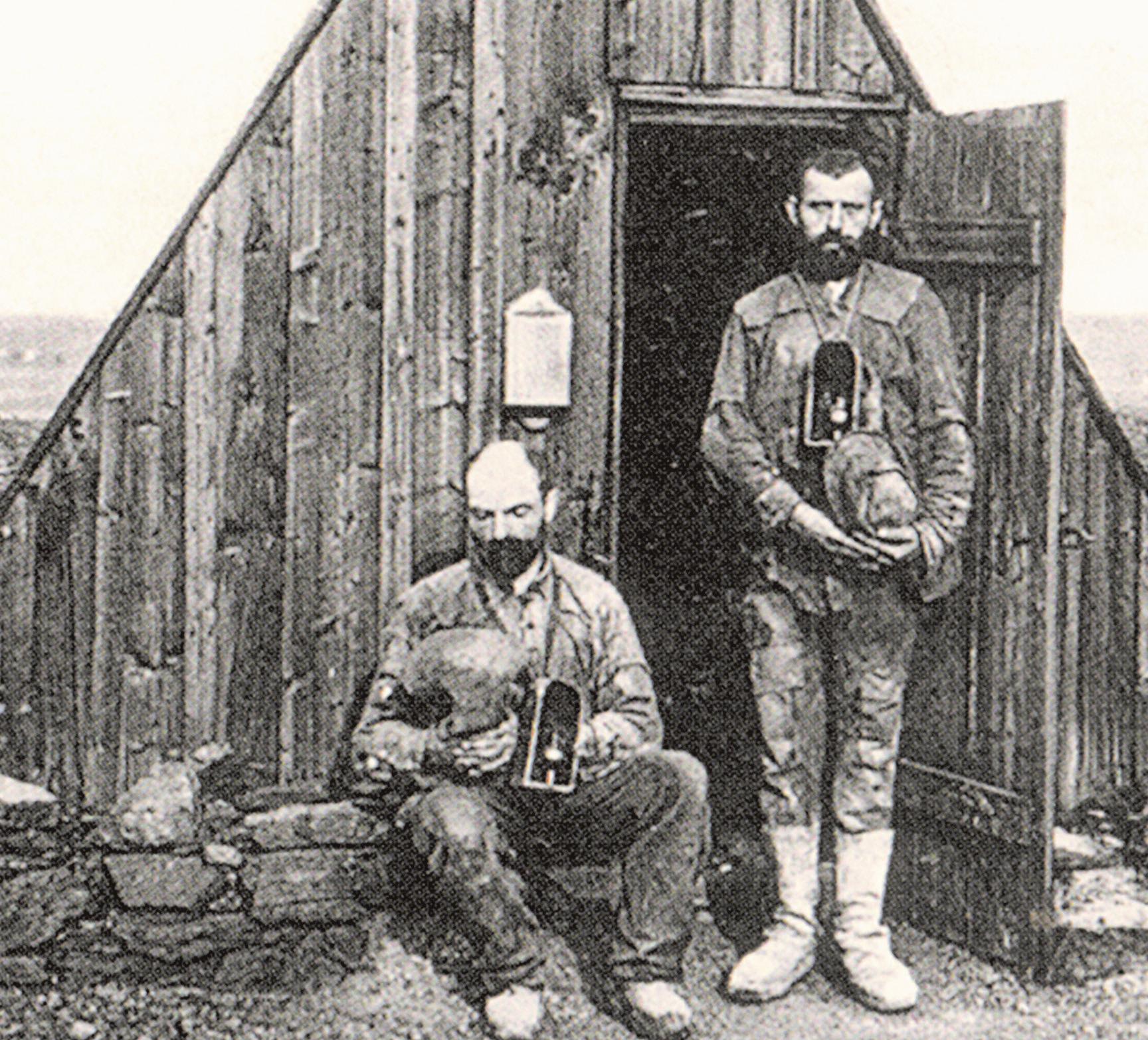
Carl Gustav Adalbert von Weißbach war in Freiberg Bergmeister und schrieb 1833: „Der Sinn für Frömmigkeit und Religiosität entwickelt sich bei der augenscheinlichen Gefahr, in welcher Leben und Gesundheit des Bergmannes stündlich schwebt, um so natürlicher.
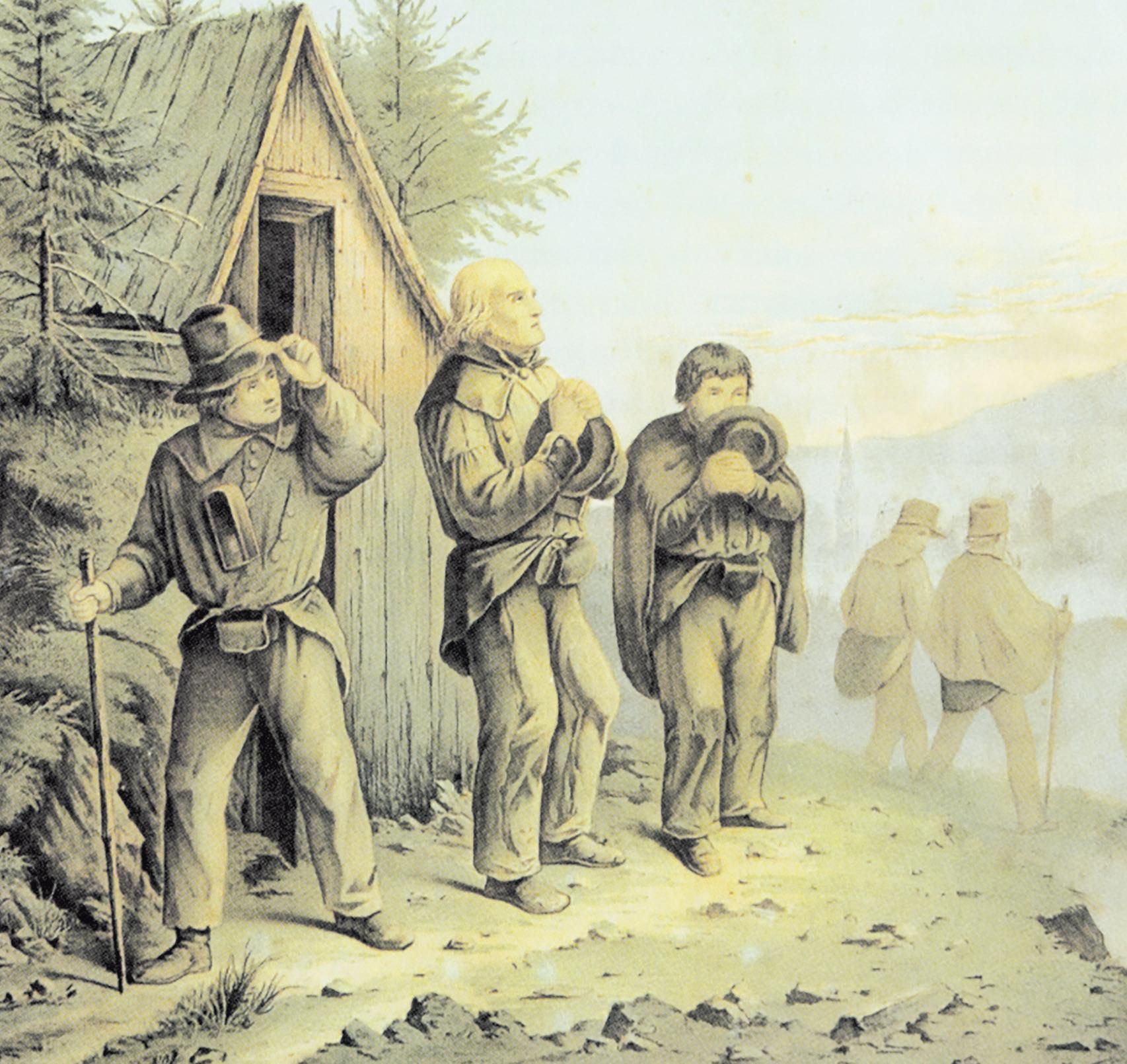
Jahrhundert in den Gebetsstuben in Gebrauch. Im 19. Jahrhundert druckte man die Berggebete und Berglieder in großer Zahl als Bücher. Diese nutzten die Bergleute in den Betstuben und Kauen ihres Bergwerkes vor und nach der Schicht. Darin wurden auch alte Lieder aus dem 16. und 17. Jahrhundert aufgenommen.
Nach der Abnutzung der überlieferten Bücher kann darauf geschlossen werden, welche Lieder sehr oft gesungen wurden. Der Text eines Liedes lautet: „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende! Ein Grubenkleid – ein Totenkleid. Drum falt‘ ich betend meine Hände und flehe um Barmherzigkeit. O Herr, du meine Zuversicht: verlaß, verlaß den Bergmann nicht!“
Jedoch gab es auch Fälle, bei denen Bergleute nicht regelmäßig an den obligatorischen Gebeten teilnahmen. Diese zogen die Kritik der Obrigkeit auf sich. Auch wurde mitunter die fehlende Ehrfurcht der Betenden kritisiert. So ist in einem Bericht der Radegrube bei Freiberg zu lesen, daß das Gebet „von allen Anwesenden zu gleicher Zeit laut hergebetet, was oft in ein dumpfes Gemurmel ausartet, und nicht herzerhebend und andächtig klingt.“
solche Betstube, vorzüglich während des Gesanges, ein wahrhaft ergreifender. Wohl mancher der hier Versammelten ahnt nicht, daß er sein letztes Gebet verrich-
dem Essen betete und Gott dafür dankte. Am Morgen wurde der Schutz Gottes für den Tag erbeten und am Abend dafür gedankt. Höhepunkt war für die Familie der sonntägliche Kirchgang und für die Bergmänner die Bergmesse, an der sie in ihrem Habit teilnahmen. Alles ist im Wandel begriffen. Der Bergsegen verließ das Erzgebirge und die Menschen wand-
ihrem Bergwerk. Man setzte sich anfänglich vor der Einfahrt in der Kaue zusammen oder stand bei schönem Wetter davor. Man betete, sang Lieder, und ein begnadeter Redner hielt eine kurze Andacht. Grundtenor dieser Andacht waren die Bitten nach einer gesunden Rückkehr zur Familie und nach reichem Bergsegen.
Die amtliche Einführung dieser bergmännischen Andacht geht auf die Anordnung des Bergverwalters Paul Steiger im Jahr 1595 zurück. Darin heißt es, daß „die Bergleuthe vor den Einfahren eine Viertel Stunde bethen müßen“. Aber auch schon früher gab es Stätten, um die Bergleute zur Frömmigkeit anzuhalten. Eine davon befindet sich zwischen Brand-Erbisdorf und Freiberg. Das sind die Drei Kreuze, die schon 1578 errichtet wurden.
Später wurden bei Gruben, in denen viele Menschen arbeiteten, Hut- oder Zechenhäuser errichtet, das sind zentrale Verwaltungsgebäude eines Bergwerks, worin die Bergleute sich vor der Schicht zu einer Andacht versammelten. Der dafür benutzte Raum hieß je nach Größe Betstube oder Betsaal. In einigen stand sogar
Er wird deshalb durch das vor und nach jeder Schicht gehaltene gemeinschaftliche Gebet auf der Grube sowie durch die von Zeit zu Zeit gehaltenen besonderen Berg-Gottesdienste mit den Bergpredigten in den Kirchen mit Sorgfalt genährt und gefördert. Selbst das Gemüt des Fremden, dem vielleicht bei feierlicher
Oberberghauptmann Siegmund August Wolfgang Freiherr von Herder erließ deshalb 1835 Verordnungen. In einer steht: „Auf allen Gruben, wo mehr als drei Mann anfahren, sind die vorschriftsmäßigen Andachtsübungen vor und nach der Schicht abzuhalten und ist hiernach das Gebet auf allen Zechen, wo es zur Ungebühr unterlassen worden, alsbald wieder einzuführen, und dessen pünktliche Abhaltung nachdrücklich einzuschärfen.“
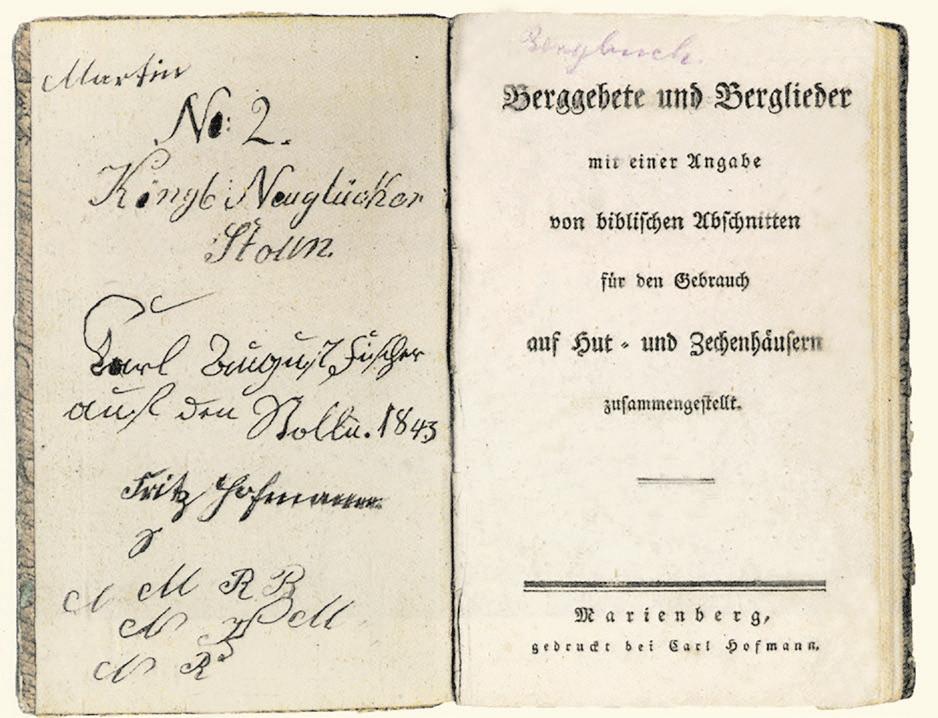
Morgenstille aus den zerstreuten Zechenhäusern der Frühgesang der Anfahrenden entgegentönt, wird ergriffen, wenn er in eine Betstube eintritt und die ernste erdfarbene Schar sich dem Schutze des Höchsten für ihren eben anzutretenden gefahrvollen Berufsweg erflehen hört.“
Einzelne Gesang- und Gebetbücher sind schon seit dem 18.
Eduard Heuchler, Lehrer für Zeichen- und Zivilbaukunst an der Bergakademie Freiberg, beschreibt 1857 in „Die Bergknappen in ihren Berufs- und Familienleben“, wie eine Andacht vor Schichtbeginn abläuft: „Hat sich nun die Mannschaft der Grube (bei einer größeren Grube wird von einem kleinen Thurme mit einer Glocke geläutet) pünktlich eingefunden, denn Säumige werden um Geld gestraft, beginnt in der geräumigen Betstube ein gemeinschaftliches Gebet mit Gesang, wobei öfters auch eine kleine Orgel oder ein [Orgel]Positiv zur Mitwirkung gezogen wird. Das Bergvolk (die gemeinen Bergleute) sitzt auf Bänken, die Ober- und Untersteiger sowie die Ganghäuer an Tafeln. Da jeder sein Grubenlicht brennt, wenn das Morgengebet noch in die Dunkelheit fällt, so ist der Einblick in eine
tete und daß man ihn vielleicht verstümmelt oder tot in diesen Raum zurückbringt. Doch weg mit diesen Gedanken, sie umdüstern das Gemüth und machen zaghaft für den gefahrvollen Beruf. Stehen wir doch überall unter Gottes allmächtigem Schutz!“
Gebete und Andachten beschränkten sich nicht nur auf die gefährliche Arbeit der Bergleute. Die Erzgebirgler waren gottesfürchtige Menschen. Und so wurde in den kleinen Häuschen bei den Familien ebenfalls gebetet und wurden fromme Lieder gesungen. Vieles, was man nicht erklären konnte oder dem man ohnmächtig gegenüberstand, wurde in Gottes Hände gelegt.
Damit Gott nach Möglichkeit Schaden abwende und Hilfe gewähre, war für diese meist armen Menschen ein gottesfürchtiges Leben die Voraussetzung. Dazu gehörte, daß man vor und nach
ten sich zwangsläufig anderen Beschäftigungen zu, die oft weniger gefährlich waren. Auch die Gesellschaftsordnungen änderten sich. Und der ab 1945 bis 1989 regierende Sozialismus war einer der ärgsten Feinde der Gottesfurcht und des Glaubens.
Auch wenn die Kirchen im sächsischen Erzgebirge heute weniger besucht werden als vor 100 Jahren, gibt es in jedem Dorf eine Kirchgemeinde. Besonders im oberen Erzgebirge gibt es strenge Glaubensgemeinschaften, die nicht unter dem Dach der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen vereint sind und konservativ sind. So lebt der evangelische Glaube heute ohne die Berufsbergleute weiter. Berggottesdienste gibt es vereinzelt noch, wobei die Traditionsbergbruderschaften in ihrem farbenfrohen Habit diesem einen würdigen Rahmen verleihen.

NEUDEKER HEIMATBRIEF Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 18
Berggebetsbuch des Marienberger Bergreviers um 1845.
�
Frömmigkeit im Erzgebirge
vor ihrer Kaue.
Andreas Beyer: „Der christliche Bergmann oder der bergmännische Christ“, Kupferstich (1681). Bilder: Archiv Ulrich Möckel Betende Bergleute
Meno Mühling: „Betende Bergleute vor der Kaue“, (um 1850).
Betstube im Huthaus der Grube Alte Hoffnung Gottes in Kleinvoigtsberg um 1910.
Die Regionalbibliothek in der Wissenschaftlichen Bibliothek in Reichenberg beherbergt nicht nur Tausende von Büchern in den Regalen, die der Besucher auf den ersten Blick sieht. Viele Bücher und andere Druckerzeugnisse sind im Hintergrund der Bibliothek verborgen. Dort lagern selten ausgeliehene Bücher, Fachpublikationen, fremdsprachige Werke und nicht zuletzt historische Bücher. Diese wertvollen Bücher werden nicht verliehen. Sie können nur in der Bibliothek angesehen werden. Zu ihnen gehören die Bücher der ehemaligen Bibliothek des ehemaligen Franziskanerklosters in Haindorf, deren erster Teil aus Prag nach Reichenberg gebracht wurde.
Um die Bedeutung der Bibliothek in Haindorf zu verstehen, muß man weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Der Wallfahrtsort Haindorf mit der Kirche Mariä Heimsuchung ist einer der ältesten Marienwalfahrtsorte in Nordböhmen. Das Wunder, das den Wallfahrtsort berühmt machte, geschah an der Wende vom zwölften zum 13. Jahrhundert.
Der Legende nach wurde dieser alte Wallfahrtsort bereits 1211 gegründet. In jenem Jahr entstand an der Stelle der jetzigen Basilika eine erste hölzerne Kapelle. Im Laufe der Zeit war sie jedoch für die vielen Pilger zu klein. Wegen der zunehmenden Berühmtheit des Ortes wurde 1252 die hölzerne von einer steinernen Kapelle mit einem gotischen Gewölbe ersetzt. Sie ist noch heute Teil der Kirche und heißt Waldsteinkapelle.
Mehrmals wechselte die Kirche ihren Besitzer. An der Stelle der gotischen Kapelle baute das Geschlecht Bieberstein Ende des 13. Jahrhunderts eine gotische Kirche. 1558 verkaufte Kaiser Ferdinand I. das Herrschaftsgut an die protestantische Familie von Redern, die alle katholischen Kirchen auf ihrem Gut zu protestantischen Kirchen umwidmen ließ. Unter ihrer Herrschaft wurde die katholische Kirche in Haindorf wegen der zahlreichen katholischen Wallfahrten geschlossen. Herzog Albrecht von Wallenstein, der Generalissimus der kaiserlichen Armee im Dreißigjährigen Krieg, kaufte das Anwesen im Herbst 1622 und eröffnete die Wallfahrtskirche wieder.
Damals begann ein ständiger Anstieg der Pilgerzahl.
Kurz nach dem Mord an Herzog Albrecht von Wallenstein am 25. Februar 1634 in Eger erwarb die Familie Gallas 1636 Wallensteins Besitz. An der selben Stelle wurde 1722 bis 1729 die zweitürmige Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung errichtet.
Das heutige Erscheinungsbild des Wallfahrtsortes wurde maßgeblich von den Familien Gallas und Clam-Gallas geprägt. Während ihrer Herrschaft erreichte der Ruhm des Wallfahrtsortes seinen Höhepunkt. Im 17. Jahrhundert sollen bis zu 80 000 Pilger pro Jahr gekommen sein. An manchen Wallfahrten nahmen bis zu 7000 Pilger teil. So viele Pilger erforderten einen ständigen geistlichen, geistigen und körperlichen Dienst.
Nach der Genehmigung des Prager Erzbischofs Johann Friedrich von Waldstein (* 18. August 1642 in Wien, † 3. Juni 1694 in Dux) 1691 wurde auf Wunsch von Franz Ferdinand Graf Gallas von Campo (* 1635) und dessen Frau Johanna Emerientia GräfinGaschin von Rosenberg (1646–1735) mit dem Bau des Klosters neben der Kirche in der Form begonnen, in der das Kloster bis heute erhalten ist. Anfang April 1691 wurden hier die ersten sieben Franziskaner aufgenommen. Die barocke Klosteranlage für den Orden entwarf der Architekt Marco Antonio Canevalle. Am 27. April 1692, zwei Monate nachdem Haindorf feierlich an die Franziskaner übergeben worden war, legte der Provinzial und Pater Amando Hermann den Grundstein.
Die Fertigstellung wurde auf das Jahr 1695 terminiert. Obwohl die Klosteranlage rechtzeitig fertig war, wurde sie erst im folgenden Jahr bezogen. Die Übergabe an die Haindorfer Franziskaner hatte sich wegen des Todes von Franz Ferdinand Gallas verzögert. Dieser hatte das gesamte
Reicenberger Zeitung






Kloster auf eigene Kosten errichten lassen. Die offizielleÜbergabe erfolgte im März 1698 durch den Landeshauptmann Christian Karl Platz von Ehrenthal (* 28. Februar 1663 in Reichenberg, † 5. August 1722 in Friedland).
Der erste Vorsteher des Klosters war Pater Januar Šidlo, erster Vikar war Pater Emerlich Brener.
Während der Regierung von Kaiser Josef II., einer Zeit, in der Klöster und Klosterkirchen geschlossen wurden, konnte Haindorfs Kloster gerettet werden. Die Zahl der dort untergebrachten Franziskaner wurde reduziert, aber das Kloster blieb erhalten, weil von Anfang an die Stifter Gallas, deren Verwandte und deren Nachfolger, die Grafen von Clam-Gallas, den Klosterbetrieb finanzierten



Die Entstehung der Klosterbibliothek geht ebenfalls auf das Jahr 1692 zurück. Nachdem Franz Ferdinand Graf Gallas am 4. Januar 1697 in Prag gestorben war, baute seine Frau Johanna Emerentia das Areal weiter aus. Einer der größten Buchspender war bereits zuvor Franz Ferdinand Gallas gewesen. Schon der erste Bücherkatalog von 1692 dokumentierte rund 400 Bände. Der Bestand der Bibliothek wuchs ständig. Die meisten Bücher waren Schenkungen. Auch der Rest der Franziskanerbibliothek von Görlitz fand hier seinen Platz. Die letzten Schätzungen vor der Auflösungder Bibliothek nannten 4500 registrierte Bücher.
Die Klosterbibliothek erlebte zwei Katastrophen. 1761 überstand sie den Klosterbrand, bei dem das Feuer den Großteil der Bücher vernichtete. Die zweite Katastrophe kam zwei Jahre nach dem kommunistischen Umsturz.
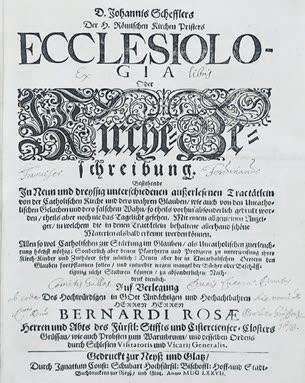
In der Nacht vom 13. auf den 14. April 1950 kam es im Rahmen der „Aktion K“ – K stand für Kloster – zu einer Tragödie, bei der die Orden und das religiöse Leben in der Tschechoslowakei liquidiert wurden. Die Brutalität dieser Aktion wird auch als Tschechoslowakische Bartholomäusnacht
bezeichnet. Die nächste Aktion folgte zwei Wochen später.
In der Nacht vom 27. auf den 28. April schlugen die Volksarmee und die Volksmiliz er-

tet“. Die registrierten Bücher wurden dann auf sehr unglückliche Weise sortiert, indem man zwölfjährige Kinder mit dieser Aufgabe betraute, die die Bücher nach Alter und Bedeutung verteilten.
Ursprünglich sollte die Klosterbibliothek von Haindorf nach Reichenberg gebracht werden. Bevor das allerdings geschehen konnte, wurden die Bücher in das Paulinerkloster nach Woborschischt gebracht, und dann in das 1952 gegründete Denkmal des nationalen Schrifttums im Prager Kloster Strahow.

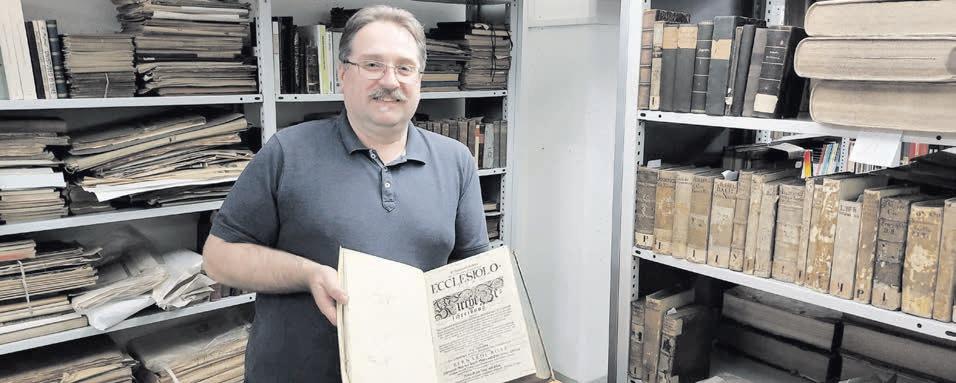

neut zu. Die Kirche mit dem Kloster wurde von der Staatssicherheit besetzt. Damals wurden in der Tschechoslowakei insgesamt 247 Männerklöster liquidiert und rund 2500 Mönche verhaftet. Die dritte und letzte Aktion, bei der 670 Frauenklöster mit rund 11 900 Ordensschwestern aufgelöst und die Klöster enteignet wurden, erfolgte im Herbst. Ein Teil der Ordensschwestern wurde 1950 in Weißwasser in Schlesien im nordmährischen Bezirk Freiwaldau interniert.

Auch das Kloster Haindorf wurde unter den neuen kommunistischen Machthabern zu einem Internierungslager für Mönche, später für Ordensschwestern, das 1955 seine Existenz beendete. Später wurde das Gebäude des Klosters als Schule, Speisesaal und Hort für die Schüler genutzt. Der Klostergarten wurde zu einem Schulgarten und Spielplatz für Kinder. In den 1970er Jahren wurde das Klostergebäude zur Ruine. In den 1980er Jahren fielmehr als die Hälfte des Klostergartens einer neuen Straße zum Opfer. An den ursprünglichen Klostergarten erinnert nur eine rechteckige Rasenflächean der Hauptzufahrt zur Kirche.
Das Ende des Klosters bedeutete auch das Ende der Klosterbibliothek. Sie wurde auf äußerst seltsame Art zerstört. Nach Angaben von Zeugen ist bekannt, daß es neben den katalogisierten Büchern auch eine Reihe von nicht registrierten Büchern gab, die nach der Vertreibung der Deutschen aus Haindorf und Umgebung ursprünglich in die Bibliothek eingegliedert werden sollten. Die nicht katalogisierten Bücher wurden in die Papierfabrik nach Ferdinandsthal gebracht und vernichtet oder „wiederverwer-
Während dieser Umzüge kam es zu weiteren unqualifizierten Umsortierungen und Verlusten. Von den ursprünglich rund 4500 Büchern blieben 1200 erhalten. Der Inhalt besteht hauptsächlich aus alten Drucken, die zwischen 1500 und 1800 erschienen waren. Aus dem 19. Jahrhundert stammen die wenigsten. Was den Inhalt der Bücher betrifft, so überwiegen Bücher über Theologie und Religion gefolgt von Rechtsbüchern, historischen Büchern und Wörterbüchern. Die Bücher sind meistens Deutsch oder Lateinisch geschrieben.
Nach der Wende erhielten die Franziskaner ihre Bücher zurück, darunter auch die Reste der Bibliothek von Haindorf.
Sie beschlossen, die Bücher an die Orte zurückzubringen, von denen sie entwendet worden waren. Da es keine Möglichkeit gab, die Bibliothek nach Haindorf zurückzubringen, weil es da keine Franziskaner mehr gibt, wandten sie sich an die Regionale wissenschaftliche Bibliothek in Reichenberg, die der Annahme der bibliophilen Schätze zustimmte. Die Bücher bleiben im Besitz der Franziskaner. Die Bibliothek von Reichenberg könnte die Bücher von den Franziskanern kaufen, aber im Moment ist es nicht möglich, da der Kauf mehrere Millionen Kronen kosten würde.

Die Übernahme der historischen Bücher ist für die Regionale wissenschaftliche Bibliothek von großer Bedeutung, wie Dana Petrýdesová, Direktorin der Bibliothek in Reichenberg, bestätigt: „Das ist eine weitere Möglichkeit, zur Entwicklung des Interesses an der regionalen Geschichte beizutragen, was eine unserer wichtigen Aufgaben ist. Nach der Bearbeitung werden die Bestände der Bibliothek für Studenten und andere Wissenschaftler zur Verfügung stehen, die die Dokumente bei uns studieren können.“
Der erste Teil der Haindorfer Bibliothek wurde in der er-
sten Hälfte 2022 nach Reichenberg gebracht. Vorläufigwurden 489 Titel geliefert. Schritt für Schritt sollen die restlichen Bücher übergeben werden. Möglich, daß man noch Bücher fidet, die in anderen Sammlungen landeten, so daß ihre Gesamtzahl auf 1500 bis 1800 steigen könnte. Nach Schätzungen der Reichenberger Bibliothek wird die Katalogisierung der erhaltenen Haindorfer Bücher drei bis fünf Jahre dauern. Die Bücher werden nicht im Tresor aufbewahrt, sondern auf Wunsch der Franziskaner der Öffentlichkeit für Forschungszwecke zugänglich gemacht. Wer etwas aus der geretteten Sammlung sehen will, muß Mitglied der Bibliothek sein und genau wissen, was er sehen will. Bei dem Studium dieser historischen Bücher aus Jahrhunderten ist natürlich Vorsicht geboten.
Das Kloster, das sich in einem verkommenen Zustand befand, hatte der am 20. Juni 1948 in Christofsgrund geborene Pater Miloš Raban nach der Samtenen Revolution gerettet. Bis heute ist keiner der Verantwortlichen für die Folgen der kommunistischen Verwüstung verfolgt worden.
Mit der finanziellenUnterstützung der EU, des TschechischDeutschen Zukunftsfonds und von Spendern aus dem Kreis der vertriebenen Deutschen, der Nachkommen der Familie Clam-Gallas und des Unternehmers Dalibor Dědek wurde das gesamte Areal renoviert.




Pater Raban beteiligte sich maßgeblich daran, das ehemalige Franziskanerkloster in ein repräsentatives Internationales Zentrum der geistlichen Erneuerung zu verwandeln. Das wurde 2001 feierlich eröffnet, und Raban war dessen erster Direktor.
Nach seiner Emigration und seinem Studium in Deutschland und Italien wurde er am 9. November 1985 in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom zum Priester geweiht. 1985 bis 1990 war er in Frankfurt am Main tätig. 1990 kehrte er in die Tschechoslowakei zurück. Im September 1990 kam er nach Haindorf, wo er als Pfarrer wirkte.
Am 7. Januar 2011 starb er in den frühen Morgenstunden nach langer und schwerer Krankheit mit 62 Jahren im Reichenberger Krankenhaus. Der Leitmeritzer Bischof Jan Baxant zelebrierte das Requiem für den katholischen Priester, Theologen, Pädagogen und Dekan Miloš Raban zehn Tage später in der Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung. Anschließend fand Miloš Raban seine letzte Ruhe in der Krypta unter der Wallfahrtskirche. Stanislav Beran
 Ein
Ein
alter Katalog des Bücherbestandes.
Kloster und Wallfahrtskirche. Bilder (5): Stanislav Beran
Václav Kříček, Leiter der bibliographischen Abteilung, mit Schefflers „Kirchenbeschreibung“ von 1677. Rechts die erste Seite im Detai Haindorfs
❯ Bibliothek des ehemaligen Franziskanerklosters in Haindorf/Kreis Friedland
Klosterbibliothek 1930.
Prag
Ölgemälde von Miloš Raban. SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 . BIS28MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Bücher ziehen von
nach Reichenberg
Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel Kreis Friedland Kreis Gablonz Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 19 Nordböhmi [
[ au Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (080 51) 80 60 96, eMail rz@sudeten.de
e Um
Gesegnete Weihnachten und ein friedvolles 2023 wünschen wir allen Landsleuten auch im Namen der Gemeindebetreuer. Wir danken allen Heimatfreunden für ihre Treue und Unterstützung sowie allen Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
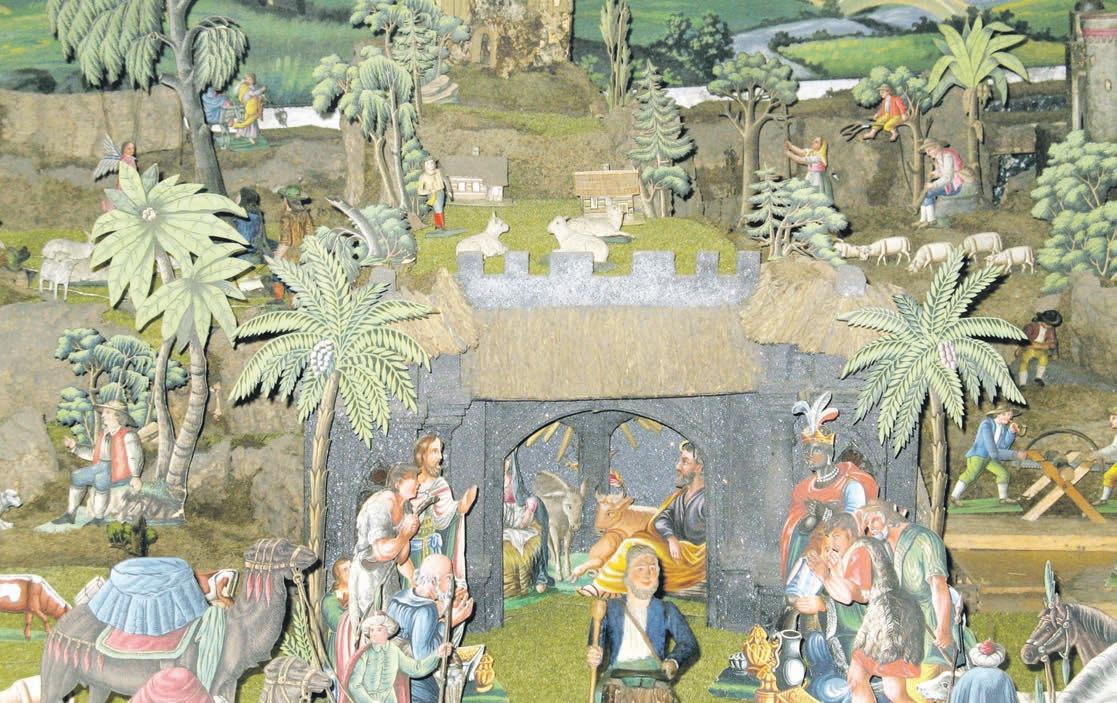
Heimatkreis Deutsch Gabel/Zwickau Othmar Zinner
■ Deutsch Gabel: Othmar Zinner, Fastlingerring 267, 85716 Unterschleißheim, Telefon (0 89) 3 10 73 83, eMail othmar.zinner@gmx.net
■ Brins: Walter Seidel, Zscher bener Straße 9, 06124 Halle, Telefon (03 45) 2 51 89 83, eMail waseidel24 @yahoo.de


■ Deutsch Pankraz: Helga Hofmann, Lauinger Straße 18/I, 80997 München, Telefon (0 89) 1 41 42 62.
■ Finkendorf: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
■ Glasert: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
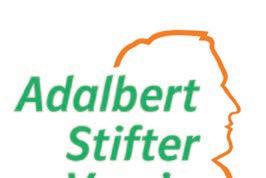
■ Groß Herrndorf: Ullrich Herbert, Georg-Scheer-
Straße 57, 58119 Hagen, Telefon (0 23 34) 20 80, eMail herbertullrich@arcor.de
■ Groß Walten: Hildegard Ulrich, Schneewittchenstraße 26, 12524 Ber-
lin, Telefon (0 30) 6 72 23 74.
■ Hennersdorf: Rosl Mach tolf, Hirschgasse 21, 71397 Leutenbach, Telefon (0 71 95) 6 57 54.
Bitte um Beiträge über Otfried Preußler
Für die internationale Tagung über Leben und Werk Otfried Preußlers vom 19. bis 21. Oktober in Reichenberg bittet der Adalbert-Stifter-Verein (ASV) um Themenvorschläge für mediale und transkulturelle Zusammenhänge in Leben und Werk des Kinderbuchautors. Einsendeschluß ist der 15. Februar.
Im neuen Jahr jährt sich der Geburtstag des bekannten Kinderbuchautors Otfried Preußler zum 100. Mal. Er kam am 20. Oktober 1923 in Reichenberg zur Welt, machte dort 1942 Notabitur, die Wehrmacht zog ihn ein, und die Sowjets nahmen ihn an der Ostfront gefangen. Nach seiner Entlassung 1949 ging er ins oberbayerische Rosenheim und wurde Lehrer im benachbarten Stephanskirchen. Nach schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend („Erntelager Geyer“, 1944) hatte Preußler 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit „Der kleine Wassermann“, basierend auf Sagen seiner nordböhmischen Heimat, und erhielt den Deutschen Jugendbuchpreis.
Otfried Preußler

■ Hermsdorf: Anita Grimm-Flähmig, Sonnenstraße 88, 91550 Dinkelsbühl, Telefon (0 98 51) 17 49, Mobil (01 70) 3 80 71 83, Fax (0 32 22) 2 46 79 01, eMail
■ Johnsdorf: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
■ Kleinmergthal, Großmergthal: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
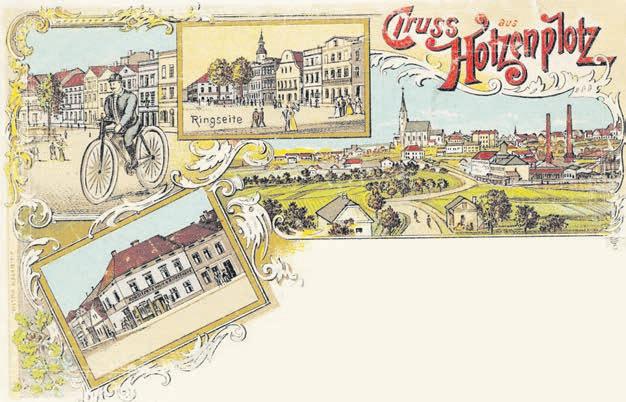
■ Kleingrün: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
■ Kriesdorf: Christian Schwarz, Krajnc-Straße 12a, A-6060 Hall, Mobil (0 04 36 99) 11 12 59 56 oder (01 76) 99 93 30 39, eMail chris@clcs.at
■ Krombach: Johanna Platz, Karl-HalbigStraße 37, 99887 Gräfenhain, Telefon (0 36 24) 31 18 10, eMail norbert. platz@gmx.de
■ Kunnersdorf: Steffi Runge, Käthe-KollwitzStraße 3, 08499 Mylau, Telefon (0 37 65) 3 22 36, eMail runge.steffi@gmx. de
■ Lämberg: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
■ Postrum: Ilse Kreissl, Otto-Götzen-Weg 19, 40470 Düsseldorf, Telefon (02 11) 62 79 29.
■ Ringelshain: Gerhard Weiß,Alfred-Brehm-Straße 2, 99099 Erfurt, Telefon (03 61) 421 63 01.
■ Röhrsdorf: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
■ Schneckendorf: Johanna Gering, Budapester Straße 10, 66510 Apolda, Telefon (0 36 44) 56 28 89, Mobil (01 78) 3 05 01 35, eMail johanna.gering@web.de.
■ Schönbach: Inge Zelfel, Drosselweg 5, 84478 Waldkraiburg, Telefon (0 86 38) 8 12 31.
■ Seifersdorf: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
■ Zwickau: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
anita2000.ahnenforschung @t-online.de
■ Hoffnung: Ursula Schütz, Hauptstraße 34, 97437 Haßfurt, Telefon (0 95 21) 6 19 02 23.
■ Niederlichtenwalde, Oberlichtenwalde: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
■ Petersdorf: Unbesetzt; Othmar Zinner ➝ Deutsch Gabel.
Wer eine Ortsbetreuung übernehmen möchte, wende sich an den Kreisbetreuer. Wer spenden möchte, nutze das Konto des Heimatkreises: Othmar Zinner, HypoVereins bank München, IBAN: DE76 7002 0270 0015 6666 98, BIC: HYVEDEMMXXX.
Im Jahr darauf folgte „Die kleine Hexe“, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte Räuber Hotzenplotz. Hotzen-
plotz ist der Name eines Ortes und eines Flusses in Nordmähren. Zwei weitere Teile erschienen 1969 und 1973. Eine sorbische Sage verarbeitete Preußler hingegen in seinem Buch über den Zauberlehrling Krabat, für das er erneut den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Bald schon kam es zu intermedialen Adaptionen in Hörspielen, Puppentheater und Verfi lmungen wie 1974 „Der Räuber Hotzenplotz“, 1977 „°arod˛j˝v u˙eˆ/ Krabat“, 2008 „Krabat“, 2018 „Die kleine Hexe“. Anläßlich des Jubiläums sollen Otfried Preußlers Leben, sein Werk und seine Rezeption in einem breiten kulturhistorischen Kontext in einer internationalen Tagung in Reichenberg gewürdigt werden. Neben Beiträgen über seinen familiären und anderen Hintergrund, seine Jugendzeit in Reichenberg und seine Verlags-, Übersetzungs- und Redaktionsnetzwerke auch während des Kalten Krieges sollen kulturübergreifene Zusammenhänge in Bayern, Böhmen und der Lausitz wie in „Der Räuber
Hotzenplotz“, „Der kleine Wassermann“ oder „Krabat“ sowie die mediale Verarbeitung seiner Bücher im Mittelpunkt stehen. Die Werke für Erwachsene wie „Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil“ oder „Ich bin ein Geschichtenerzähler“ wären im Zusammenhang der deutschsprachigen Vertriebenenliteratur zu betrachten. Preußlers internationale Rezeption – etwa durch Übersetzungen – auch jenseits seiner Heimatländer ist ebenso zu berücksichtigen wie die Nichtakzeptanz oder Akzeptanz Preußlers in der Tschechischen Republik nach 1989.
Die Bitte um Beiträge richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus historischen, literatur- und kunstwissenschaftlichen sowie allgemein kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Wir bitten um Skizzen mit bis zu 2000 Zeichen für Vorträge mit einer Länge von 20 Minuten. Abrisse können auf Deutsch, Tschechisch und Englisch eingereicht werden. Bitte senden Sie die Skizze mit Ihrem Namen, Ihrem Titel und dem Namen Ihrer Forschungseinrichtung und der Angabe Ihrer Forschungsschwerpunkte bis zum 15. Februar an einen der Organisatoren. Die Veranstalter zahlen Reise und Unterbringung. Eine Benachrichtigung über die Annahme erfolgt bis Mitte März. Die Publikation der Beiträge ist vorgesehen.
Veranstalter sind der ASV München, das Institut für tschechische Literatur der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ú°L AV °R), die Wissenschaftliche Bibliothek in Reichenberg in Kooperation mit der Technischen Universität in Reichenberg. Konzeption und Organisation der Tagung obliegen Franziska Mayer vom ASV, eMail mayer@stifterverein.de und Václav Petrbok vom Ú°L AV °R, eMail petrbok@ucl.cas.cz
Heimaterde für die Großmutter
Petzer liegt unter der 1602 Meter hohen Schneekoppe auf 769 Metern über dem Meeresspiegel im Riesengebirge. Das dortige Hotel Hv˜zda, das heißt Stern, hatte ein Deutscher vor 115 Jahren erbaut.



Stefan Meergansen war ein Tischler und baute dieses Haus 1907. In der Zwischenkriegszeit wurde es zu einer Pension. 1945 wurden die damaligen Besitzer namens Bauer enteignet und vertrieben. Der aktuelle Besitzer Marko Holera kümmert sich um das Hotel besser als die sozialistischen Gewerkschaften vor 1989. Auf den Internetseiten des Hotels schreibt er: „Bis 1907 gab es auf dem unbebauten Grund am Grünbach nur vier Hütten von Bergbau-
ern. Das Hotel wurde 1907 von Stefan Meergans unter dem Namen Frühlingsheim erbaut und war das erste neue Gebäude für Touristen in diesem Teil von Petzer. Der Bau eines dreistöckigen Hauses war für damalige Verhältnisse ein großes Unterfangen.

Das Gasthaus im Fachwerkerdgeschoß ist seit mehr als 90 Jahren im Dauerbetrieb und bewahrte sein ursprüngliches Aussehen. Während des Ersten Weltkriegs hörte der Tourismus auf und kehrte erst nach 1923 mit den Bauarbeiten um den Grünbach in die Berge zurück. In den Jahren 1928 bis 1931 wurden entlang der Schotterstraße zehn Häuser gebaut oder komplett umgebaut, weitere wurden vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Dadurch entstand die einzige
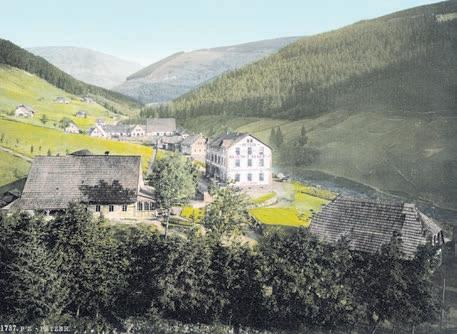


und damit Hauptstraße im Bergdorf. Nach 1938 wurde hier ganze 50 Jahre lang nicht gebaut.“
Carmen Bussmann ist die Urenkelin der vertriebenen Besitzer Bauer. Kürzlich schrieb sie dem Hotel: „Sehr geehrtes Team des Hotels Hv˛zda! Meine Großmutter wurde in diesem Hotel geboren – Hilde Hommel, geborene Bauer. Damals war das Hotel im Besitz ihrer Eltern Franz und Emma Bauer. Meine Großmutter starb nun im Alter von 94 Jahren. Bei ihrem Begräbnis möchte ich etwas Heimaterde auf ihr Grab streuen. Ich glaube, sie wäre sehr glücklich. Wären Sie so freundlich, mir ein kleines Säckchen Erde zu schicken?“ Marko Holera war gerührt und schickte Carmen Bussmann sofort ein Säckchen mit Heimaterde.
Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 20
REICHENBERGER ZEITUNG
❯ Petzer unter der Schneekoppe im Riesengebirge
Grußkarte von 1898 aus dem damals österreichisch-schleschischen Hotzenplotz.
Diese Isergebirgskrippe „Bethlehem“ schuf Gustav Simon (1873–1953) in 60jähriger Bauzeit.
Das Hotel Hv˜zda oder Hotel Stern in Petzer im Riesengebirge. Heimatkreis Deutsch Gabel
❯
❯ Adalbert-Stifter-Verein
Frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr
Die vier Bauden in Petzer vor 1907, an denen sich der Grünbach entlang schlängelt.
Das wachsende Petzer mit dem neuen Hotel in der Mitte neben dem Grünbach nach 1907.
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau






Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (0160) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
❯ Heimatkreis Bilin



Stabwechsel im Vorstand
Mitte November fand die Jahreshauptversammlung des Heimatkreisvereins Bilin im Hotel zum Steigerwald im unterfränkischen Gerolzhofen statt.
Frohe Weihnachten
Liebe Landsleute, ich danke allen, die an unserem Heimattreffen in Teplitz-Schönau im Juni teilnahmen. Ausdrücklich danke ich Jutta Benešová für den Reisebericht und der Familie Obermann für die Fotografien.
Das nächste Heimattreffen findet voraussichtlich von Donnerstag, 31. August, bis Sonntag, 3. September, statt. Programm und Einladungen werde ich rechtzeitig verschicken.
Am Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr veranstaltet unser Verein Teplitz-Schönauer Freundeskreis wieder ein Neujahrskonzert im Sudetendeutschen Haus in München, zu dem wir herzlich einladen. Für das Konzert konnten wir das bedeutende, weltweit auftretende „Wihan-Quartett“ aus Prag gewinnen. Nun erwartet uns es ein musikalischer Hochgenuß. Das Programm werden wir vorab veröffentlichen. Der Namensgeber des Quartetts war übrigens Hanuš Wihan (1855–1920), ein tschechischer Cellist und Zeitge-

In den Vorweihnachtswochen, in denen der Duft frischen Gebäcks durch die Räume zieht, führt uns eine Ausstellung über die Bäckerei der Familie Kaschik im Teplitzer Schloßmuseum in die 1920er und 1930er Jahre.


Die Bäckerei befand sich im Haus Zum Abendstern, Nr. 306/15 in der Steinbadgasse. Hier wurde bereits in den 1870er Jahren eine Bäckerei gegründet, die die Familie Kaschik kurz nach der Jahrhundertwende übernahm und bis zum Zweiten Weltkrieg führte.
Warum nun gerade diese Bäkkerei? Im Juni 1998 bot die damalige Besitzerin des Hauses, Alžběta Parmová, dem Teplitzer Museum eine reichhaltige Kol-
nosse von Antonín Dvořak und Josef Suk.
Unser Verein Teplitz-Schönauer Freundeskreis unterstützt wieder viele Projekte in der Heimat. Dafür bitte ich um Spenden auf folgendes Spendenkonto: Teplitz-Schönau-Freunde e. V., IBAN DE45 7004 0048 0796 6906 00. Bitte Adresse angeben, damit wir gegebenenfalls eine Spendenbescheinigung ausstellen können. Vielen Dank für die schon eingegangene Spenden. Unsere Internetseite finden Sie unter www.teplitz-schoenaufreunde.com
Von Herzen wünsche ich unseren Mitgliedern und Freunden des Vereins, den Mitarbeitern der SL und der SdZ sowie den Lesern des Heimatrufes ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.
Ihr
Zunächst begrüßte der Vereinsvorsitzende Josef Liebscher die Landsleute. Gerolzhofens Zweiter Bürgermeister Erich Servatius und die Hrobschitzer Bürgermeisterin Janá Syslová sprachen Grußworte. Das neue Mitglied Ilse Liebetanz aus Twerdina stellte sich mit Erinnerungen an die Heimat vor und dankte Syslová und dem Heimatkreisverein für die Renovierung der Kirche in Merschlitz.
Liebschers Rechenschaftsbericht dolmetschte Karl Poppek simultan für die tschechischen Gäste. 2019, so Liebscher, habe die Druckerei für das „Borschen-Echo“ gewechselt. Die Schrift habe statt 60 nun 80 Seiten. Die Chronik werde weitergeführt.
Am 7. Januar 2019 hätten Syslová, Dietmar und Kriemhild Heller eine Audienz bei Bischof Jan Baxant in Leitmeritz gehabt. Dabei sei die Situation der Kirchen und Friedhöfe in Hrobschitz und Umgebung zur Sprache gekommen.
tige Ausstellung beigesteuert habe.
2020 seien zwei „BorschenEchos“ erschienen. Die Vorstandssitzung und der Sudetendeutsche Tag seien 2020 coronabedingt ausgefallen.
2021 habe die Folge 50 des „Borschen-Echos“ die Fortsetzung und das Ende der Chronik, 600 Jahre Hussitenüberfall und
tern von Gerolzhofen, Bilin und Hrobschitz für die immer hervorragende Zusammenarbeit. Bürgermeisterin Syslová danktei Liebscher mit einem Geschenk.
Der Schatzmeister skizzierte die Mitgliederentwicklung der Jahre 2919 bis 2021. Ende 2021 habe der Verein 103 Mitglieder gehabt. Dann berichtete er über die Kassenlage der Jahre 2019
Vor der Wahl der Beisitzer erklärte Janá Syslová ihren Beitritt als Mitglied des Heimatkreisvereins. Daraufhin wurden Alois Hartmann, Ute Schülke, Karl Poppek und Syslová zu Beisitzern gewählt. Kassenprüfer bleiben Karl-Heinz Plattig und Gabriela Liebscher.
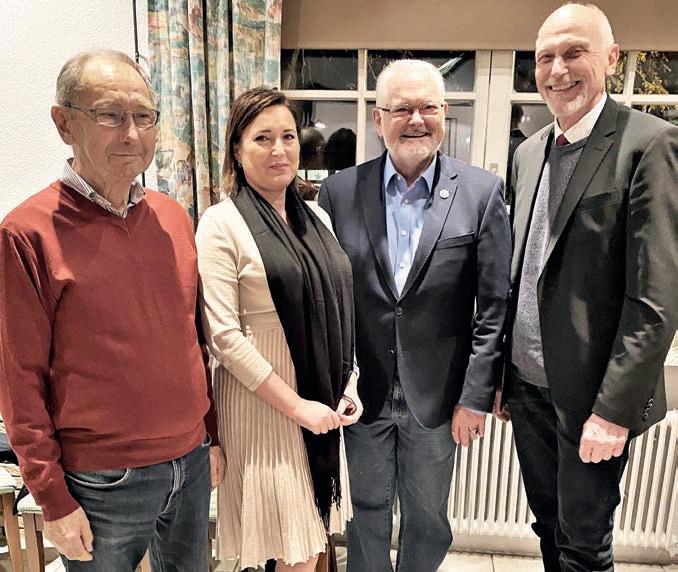
Vor 30 Jahren übernahm die Stadt Gerolzhofen die Patenschaft über den Heimatkreisverein und bietet den Landsleuten und ihrer Heimatstube im Gebäude der Volkshochschule am Bilinweg ein Zuhause. Wegen dieses Jubiläums berichtete Plattig in einem sehr persönlichen Rückblick über seine Leben von der Kindheit in Bilin bis zur Vertreibung von dort.
Viele weitere wichtige Wendepunkte in seinem privaten Leben und seiner beruflichen Laufbahn folgten. Seine Verbindung in die Heimat aber habe nie nachgelassen.
„Weil“, wie er sagte, „wir statt Streit um Vergangenes das positive Gespräch mit tschechischen Freunden mit Blick in die Zukunft suchten. Und die Biliner machten nun alle positiven Entwicklungen gerne mit.“
Erhard Spacek Heimatkreisbetreuer und Vereinsvorsitzender
Die Biliner seien beim Sudetendeutschen Tag 2019 in Regensburg und 2022 in Hof mit einem Stand vertreten und Dietmar und Kriemhild Heller beim Gedenkmarsch in Brünn 2019 gewesen. Im September 2019 habe das 11. Heimattreffen in Bilin und Hrobschitz stattgefunden. Dabei sei auch das 110jährige Jubiläum des Biliner Rathauses gefeiert worden, zu dem der Verein zahlreiche Bilder und Dokumente für die dor-
Jan Hus‘ Reise nach Konstanz sowie die Ortsbeschreibung Sinke veröffentlicht. Er, Liebscher, habe Anfragen zu sechs Ortssuchen, einer Familiensuche und acht Personensuchen erhalten.
2022 sei eine Anfrage aus Regensburg wegen Stolpersteinen gekommen. Er, so der Vorsitzende, stelle nun aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten zur Verfügung. Er danke den Vertre-
bis 2021. Die Kassenprüfer Walter Egerer und Mario Nalke verbürgten sich für die Richtigkeit der Angaben, und der Vorstand wurde einstimmig entlastet.
Die Wahl leitete Ernst Servatius. Dietmar Heller wurde zum Ersten Vorsitzenden, Josef Liebscher zum Zweiten Vorsitzenden, Kriemhild Heller zur Schriftführerin und Mario Nalke zum neuen Schatzmeister gewählt.
Anschließend folgten Ehrungen. Josef Liebscher, Walter Egerer, Karl-Heinz Plattig, Roland Lukasch, Karl Poppek, Alois Hartmann, Georg Wodraschke und Wolfgang Hilgers erhielten als Dank und Anerkennung für die Verdienste um die Sudetendeutsche Landsmannschaft eine Urkunde, unterzeichnet von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Vorsitzender der Bundes-SL, sowie eine Medaille. Nadira Hurnaus
lektion von Gegenständen und Dokumenten aus der einstigen Bäckerei Kaschik an. Das Museum erhielt dadurch die einmalige Gelegenheit, eine Ausstellung über den damaligen Bäckereibetrieb zu gestalten und gleichzeitig auch mit dem reichhaltigen Leben der damaligen Teplitzer Caféhäuser bekannt zu machen.
Die Bäckerei Kaschik verkaufte damals Brot, Gebäck und Konditoreiwaren. Dazu sehen wir in der Ausstellung die Innenausstattung der Bäckerei mit
dem Verkaufspult, ergänzt durch die Abbildung von Konditoreierzeugnissen, Kopien zeitgenössischer Zeitungen und Rezepte. Dazu gehört natürlich auch die Ausstattung der Bäckerei wie verschiedene Formen für Brot und Gebäck, Geschirr und Hilfsgeräte oder Körbe für den Transport von Brot und Brötchen. Nicht zuletzt werden auch persönliche Dokumente, Fotos und Ausstattung der Wohnung der Bäckerfamilie wie Möbel, Wohntextilien oder Spielsachen gezeigt.
Pavlína Boušková erkannte als Kuratorin der Aus-
stellung im Rahmen dieser Bäckereiausstellung die Möglichkeit, gleichzeitig das Teplitzer Publikum mit dem vielfältigen Angebot der Teplitzer Caféhäuser und Konditoreien bekannt zu machen. So sehen wir zusätzlich eine reichhaltige Fotodokumentation der berühmtesten Cafés wie der Café-Salon am Kaiserbad, das bekannte Theater-Café, aber auch Werbeplakate von Pieschel‘s Café und Conditorei in der Meissnerstraße, Café Wien und der Fenstergucker in der Graupnergasse, Concordie und Café Corso – alles Namen, die dem damaligen Teplitzer Publikum und den Kurgästen be-
stens bekannt waren. In Schönau gab es das Café mit Konditorei Pokorny, Birke und Ulbrich, in Turn Haus Imperator und Linde. Kurz – eine Rückkehr in die „gute alte Zeit“.
Die Ausstellungeröffnung hatte am 4. November stattgefunden. Einführende Wor-

te sprach die Historikerin Pavlina Bouškova und die Direktorin des Museums, Jana Ličková. Zur musikalischen Untermalung hörten wir kesse Caféhauslieder aus der Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts. Einige Museumsangestellte hatte sich in zeitgenössische Kleidung gehüllt und vertieften damit die Atmosphäre der 1920er Jahre.
Bis zum 18. Dezember ist die Ausstellung in der Reitschule des Museums zu sehen.
Jutta Benešová
Blick in die Bäckereiausstellung.
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
21 Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022
Josef Liebscher, die Hrobschitzer Bürgermeisterin Janá Syslová, Dietmar Heller und Gerolzhofens Zweiter Bürgermeister Erich Servatius.
❯ Heimatkreis Teplitz-Schönau
Bäckerausstattung
Zu Weihnachten auf dem Teplitzer Schloßplatz.
❯ Teplitzer Schloßmuseum Die Bäckerei der Familie Kaschik
Pavlína Boušková und Jana Ličková.
HEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ
Segensreiche Weihnachten sowie ein glückliches und erfülltes neues Jahr
F
rohe und gesegnete Weihnachten sowie ein erfolgreiches Jahr 2023 wünschen den Landsleuten des Heimatkreises Bischofteinitz, ihren Angehörigen, den Bewohnern unserer Patenstadt Furth im Wald, den Landsleuten aus den Heimatkreisen Tachau und Mies, den ehemaligen Bezirken Taus und Pilsen, den Mitarbeitern, den Lesern unseres BischofteinitzerHeimatboten , den Heimatverbliebenen sowie allen Freunden unserer Heimatgemeinschaft der Vorstand und der Kreisrat des Heimatkreises Bischofteinitz in der SL mit Sitz in Furth imWald.
■ Internetadresse: www. bischofteinitz.de

■ Kreisbetreuer und Landschaftsbetreuer Egerland: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otterfi ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de
■ Stellvertretender Kreisbetreuer: Peter Gaag (➝ Heiligenkreuz, Haselberg).
■ Stellvertretende Kreisbetreuerin: Regina Hildwein (➝ Weißensulz).
■ Kassenverwalter: Josef Simon (➝ Kreisbildstelle).
■ Stellvertretender Kassenverwalter: Andreas Miksch, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otterfi ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, eMail miksch.andreas@web.de
■ Schriftführung: Veronika Linden, Riesstraße 84/0, 80993 München, Telefon (0 89) 1 40 25 78 eMail w.linden@tonline.de
■ Stellvertretende Schriftführung: Sonja Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otterfi ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@ t-online.de
■ Museum: Peter Pawlik (➝ Kreisbetreuer).
■ Organisation: Doris Klingseisen, Zum Ponnholz 16, 93473 Arnschwang, Telefon (0 99 77) 90 39 86, eMail d.klingseisen@ gmx.de und Karl-Heinz Loibl (➝ Altparisau, Neuparisau).
■ Kreisbildstelle: Josef Simon, Eibenstraße 1, 91207 Lauf, Telefon (0 91 23) 98 81 67, eMail simon.48@gmx.de
■ Kreisfahnen: Georg Naujokas, Oberrappendorf 62, 93437 Furth im Wald, Telefon (0 99 73) 97 89.
■ Patenbürgermeister: Sandro Bauer, Rathaus, Burgstraße 1, 93437 Furth im Wald, Telefon (0 99 73) 50 90, Telefax 5 09 50, eMail buergermeister@furth.de
■ Kulturreferent: Heinz Winklmüller, Rathaus, Burgstraße 1, 93437 Furth im Wald, Telefon (0 99 73) 50 90, Telefax 5 09 50, eMail poststelle@furth.de
■ Wallfahrtskirche: Pfarrer Karl-Heinz Seidl, Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Rosenstraße 2, 93437 Furth im Wald, Telefon (0 99 73) 13 37, Telefax 13 32, eMail furthiw@bistumregensburg.de
■ Redaktion Heimatbote –offizielles Organ des Heimatkreises Bischofteinitz: Sonja und Pe-
ter Pawlik (➝ Stellvertretende Schriftführerin, Kreisbetreuer).
■ Internet: Peter Gaag (➝ Heiligenkreuz, Haselberg).
■ Heimatverbliebene Deutsche im Kreis Bischofteinitz: Marta Klement (➝ Sirb); Marianne Maurer (➝ Kleinsemlowitz); Inge Burešová, Josefa Hory, °. p. 105, Malé P˛edm˝stí, CZ346 01 Horšovský Týn.
■ Ehrenkreisrat: Günter Gröbner, Kirchbichlweg 4, 93476 Blaibach, Telefon (0 99 41) 4 07 78 98, Mobilfunk (01 71) 8 13 88 63, eMail guenter. groebner@web.de
derna, Unterfeldstraße 4, 76149 Karlsruhe, eMail dani.mcg@web. de
■ Grafenried, Anger, Seeg, Haselberg: Thomas Schrödl, Gartenstraße 17, 69168 Wiesloch, Telefon (0 62 22) 3 17 09 41, eMail thomas-schroedl@gmx.de
■ Großgorschin, Kleingorschin, Pfaffenberg, Putzbühl: Roland Liebl, Paul-GerhardtStraße 14, 71672 Marbach, Telefon (0 71 44) 3 91 77, eMail roland. liebl@gmx.net
■ Heiligenkreuz, Haselberg: Peter Gaag, Fridinger Straße 8, 70619 Stuttgart, Telefon (07 11)
■ Kleinsemlowitz: Marianne Maurer, Banater Straße 57, 93073 Neutraubling, Telefon/ Telefax (0 94 01) 29 22, eMail markus-maurer@gmx.de
■ Linz: Margarete Lang, Am Judengarten 3, 97957 Wittighausen, Telefon (0 93 47) 3 40.

■ Meeden: Herbert Gröbner, Kleestraße 10, 86199 Augsburg, Telefon (08 21) 9 23 01.
■ Münchsdorf: Josef Urban, Adalbert-Stifter-Weg 29, 74736 Hardheim, Telefon (0 62 83) 85 46.
■ Murchowa: Anna Hitzler, Vogelherdstraße 2, 90574 Roßtal, Telefon (09 1 27) 82 75.
bachstraße 14, 73479 Ellwangen, Telefon (0 79 65) 28 64, eMail franz.landkammer@t-online.de
■ Neubäu, Fuchsberg: Johanna Fabian, Fichtenstraße 4, 86504 Merching, Telefon (0 82 33) 9 28 65.
■ Neugramatin: Alfred Dittrich, Waldstraße 1, 93095 Hagelstadt, Telefon (0 94 53) 12 54, eMail juergen.dittrich67@tonline.de
94 91 41, eMail info@liebl-guss. de
■ Pscheß, Sichrowa: Franz Vogl, Kirschenweg 41, 86169 Augsburg, Telefon/Telefax (08 21) 70 17 68.
■ Rindl: Walter Schröpfer, Kapuzinergasse 7, 71263 Weil der Stadt, Telefon (0 70 33) 13 85 55, eMail walter-schroepfer @t-online.de

■ Pirk: Annemarie Ziehfreund, Burgvogtstraße 5, 86316 Friedberg, Telefon (08 21) 6 34 71.
■ Plöß, Wenzelsdorf: Gott-
■ Ronsperg: Gertrud Schubert, Eichelgasse 52, 97877 Wertheim, Telefon (0 93 42) 76 56.
■ Sadl: Herbert Gagalick, Fliederweg 4, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon (0 93 41) 24 48, eMail herbertgagalick@t-online.de
■ Schiefernau: Sigmar Mahal, Trifter Weg 115, 56072 Koblenz, Telefon (02 61) 2 57 80.
■ Schmolau, Karlbach, Rosenberg: Anneliese Seidl, Leindlweg 3, 93152 Nittendorf, Telefon (0 94 04) 87 93, eMail tomseidl@t-online.de
■ Schüttwa: Franz Metschl, Kaiserweg 12, 91541 Rothenburg ob der Tauber, Telefon (0 98 61) 39 08, eMail gretl.franz@gmx.net
■ Sirb, Rouden: Marta Klement, Hirschbrunnweg 10, 93426 Roding, Telefon (0 94 69) 4 58.
■ Stockau: Adolf Buchauer, Lindenweg 2, 74915 Waibstadt, Telefon (0 72 63) 43 70; Thomas Hastreiter, bei Armstrong, Ansbacher Straße 5, 80796 München, eMail hastreiter@gmx.de
■ Tannawa: Claudia Jodl, Zum Großen Busch 27, 42327 Wuppertal, Telefon (0 20 58) 92 04, eMail cjodl@gmx.de
■ Wassersuppen, Haselbach: Josef Klein, Obere Bräu hausstraße 11, 93449 Waldmünchen, Telefon (0 99 72) 82 02.
■ Ehrenkreisrat: Gottfried Leibl (➝ Plöß).
■ Ehrenkreisrat: Walter Schröpfer (➝ Rindl).
■ Ehrenkreisrat: Hans Laubmeier, Tremmelhauserhöhe 13, 93138 Lappersdorf, Telefon (0 94 04) 86 00, eMail hans. laubmeier@web.de
Ortsbetreuer

■ Altgramatin: Peter Gaag (➝ Heiligenkreuz, Haselberg).
■ Altparisau, Neuparisau: Karl-Heinz Loibl, Kapellenweg 5a, 93449 Waldmünchen, Telefon (0 99 72) 81 61, eMail kaheiloibl@ gmx.de
■ Amplatz: Gita Reiter, Scheibelweg 1, 93339 Riedenburg, Telefon (0 94 42) 12 92, eMail greiter@ t-online.de
■ Bischofteinitz: Heidrun Böttinger, Rechbergstraße 36, 73779 Deizisau, Telefon (0 71 53) 2 35 58, eMail heidrunboett@tonline.de
■ Dobraken, Zwirschen: Walter Gimpl, Schönbornstraße 23, 97980 Bad Mergentheim, Telefon/Telefax (0 79 31) 82 11.
■ Eisendorf, Franzelhütte: Waldemar Hansl, Sonnenstraße 5, 92693 Eslarn, Telefon (0 96 53) 13 12, eMail fewohansl@gmx.de

■ Frohnau: Christine Spa-
4 76 07 25, Telefax 4 76 07 26, eMail peter.gaag@t-online.de
■ Holubschen, Garassen, Wabitz: Franz Vogl, Kirschenweg 41, 86169 Augsburg, Telefon/Telefax (08 21)70 17 68.
■ Hostau: Stefan Stippler, eMail ob@hostau.org
■
■ Natschetin: Josef Rothmaier, Buheleite 31, 97340 Marktbreit, Telefon (0 93 32) 16 44.
■ Neid, Franzbrunnhütte, Friedrichshof, Schnaggenmühl: Franz J. Landkammer, Laub-
fried Leibl, Freihöls 3, 92421 Schwandorf, Telefon (0 94 31) 93 28, Telefax 96 16 29, eMail leiblwaffen@web.de
■ Pössigkau, Zemschen: Wolfgang Georg Liebl, Johannesstraße 21, 75233 Tiefenbronn, Telefon (0 72 34)
■ Weißensulz: Regina Hildwein, Ruhseugstraße 27a, 92421 Schwandorf, Telefon/Telefax (0 94 31) 28 74, eMail hildfra@gmx.de
■ Wittana: Peter Pawlik (➝ Kreisbetreuer).
■ Worowitz: Josef Steinbach, Roggenweg 16, 89233 Neu-Ulm, Telefon (07 31) 71 02 58.
Danke für und Bitte um Mitarbeit
Einer unserer aktivsten Mitstreiter hat sich aus gesundheitlichen Gründen von der Arbeit für seine Heimat zurückziehen müssen. Wir danken unserem Ehrenkreisrat Josef Friedrich für seine Lebensleistung für den Heimatkreis. Am 3. März verstarb der Ortsbetreuer von Dinkowitz, unser Landsmann Ernst Hitzler. Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Bisher konnten leider noch keine Nachfolger gewonnen werden.
Die Liste der Orte ohne Betreuer bleibt lang, und es wird immer schwieriger, für ausgeschiedene Ortsbetreuer Nachfolger zu gewinnen. Dennoch ist es wichtig, diese Arbeit nicht weiter auf immer weniger Schultern zu konzentrieren. Ich
bitte daher die Landsleute aus den nachstehenden Heimatgemeinden mir bei der Suche nach neuen Ortsbetreuern zu helfen.
Wenn Sie sich bei mir melden, dann bedeutet dies nicht gleichzeitig, daß Sie die Ortsbetreuung selbst übernehmen wollen. Bitte sprechen Sie auch jüngere Menschen an, selbst wenn diese nicht mehr in der Heimat geboren sind.
In einigen Fällen werden Ortsbetreuer bereits von jüngeren Menschen unterstützt – eine sehr erfolgreiche Vorgehensweise. Der Vorstand hat deshalb beschlossen, daß Ortsbetreuer bei Bedarf von einem Paten aus
dem Vorstand unterstützt werden.
Folgende Orte sind gegenwärtig ohne Betreuung:
Althütten, Berg, Bernstein, Blisowa, Dinkowitz, Dobrowa, Gibacht, Glaserau, Großmallowa, Haschowa, Hochsemlowitz, Horouschen, Hoslau, Horschau, Kleinmallowa, Kotzoura, Kschakau, Kscheberscham,Liebeswar, Maschowitz, Mauthaus, Melmitz, Meßhals, Metzling, Mirkowitz, Mirschikau, Mogolzen, Mukowa, Nahoschitz, Nemlowitz, Nemtschitz, Neubäu (Mauthaus), Nimvorgut, Obermedelzen, Podraßnitz, Potzowitz, Raschnitz, Ruhstein, Schilligkau, Schlat-
tin, Schlewitz, Schüttarschen, Schwanenbrückl, Schwarzach, Semeschitz, Sichdichfür, Straßhütte, Taschlowitz, Trebnitz, Trohatin, Tscharlowitz, Tschernahora, Unterhütte, Untermedelzen, Vollmau, Waier, Waldersgrün, Wasserau, Wassertrompeten, Webrowa, Weirowa, Wiedlitz, Wilkenau, Wistersitz, Wonischen, Wostirschen, Wottawa, Zeisermühl, Zetschin, Zetschowitz und Zwingau. Meine Anschrift steht oben im Impressum.

Für Ihre Unterstützung danke ich im voraus und verbleibe mit heimatlichen Grüßen Ihr
Peter Pawlik Heimatkreisbeteuer und Vereinsvorsitzender
Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 22
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otterÿ ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMailpeter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai° eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA.Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, eMail post@nadirahurnaus.de
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Muttersdorf: Roland Liebl (➝ Großgorschin).
❯
Der Heimatkreis Bischofteinitz wünscht
Schüler der Volksschule in Grafenried führen 1932 ein Krippenspiel auf.
Bild: Heimatkreisarchiv
Heimatbote
für den Kreis Ta<au
Der Heimatkreis Tachau wünscht
Gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr
Frohe Weihnachten und ein gesundes 2023 wünschen Vorstand und Kreisrat des Heimatkreises allen Landsleuten aus dem Kreis Tachau, den Einwohnern der Patenstadt Weiden in der Oberpfalz, den Mitarbeitern des Heimatboten, den treuen Heimatboten-Beziehern sowie allen Freunden und Förderern des Heimatkreises Tachau.

Heimatkreis Tachau
Kreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt an der Alz, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl@ online.de, Internet www.tachau.de
Kreisratsmitglieder
Stellvertretende Kreisbetreuer: Manfred Klemm (➝ Tirna) und Dr. Dorith Müller (➝ Galtenhof).
Erste Schriftführerin: Ludmilla Himmel, (➝ Schönbrunn). Zweiter Schriftführer: Lothar Meitner (➝ Tissa).
Erste Kassenleiterin: Paula Marterer, Nanga-Parbat-Straße 42, 80992 München, Telefon (089) 14 68 67. Zweiter Kassenleiter: Lothar Meitner (➝ Tissa).
Beisitzer: Gernot Schnabl (➝ Tachau), Gerhard Reichl (➝ Neudorf).
Erster Kassenprüfer: Reinhold Wurdak (➝ Maschakotten). Zweite Kassenprüferin: Sieglinde Wolf (➝ Altzedlisch).
Fachreferenten
Tachauer Heimatmuseum: Dr. Sebastian Schott, Pfarrplatz 4, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 4 70 39 09, eMail sebastian.schott@ weiden.de
Familienforschung: Manfred Kassekkert (➝ Ringelberg).
Die Ortsbetreuer
■ Albersdorf: ➝ Heimatkreis.
■ Altfürstenhütte: Albert Kick (➝ Neulosimthal).
■ Altsattel: Stefan Riederle, Zum Eulenberg 5, 89335 Ichenhausen, Telefon/Telefax (0 82 23) 40 99 12, eMail st.riederle@gmx.de
■ Altzedlisch: Sieglinde Wolf, Wettersteinstraße 51, 90471 Nürnberg, Telefon (09 11) 81 68 68 88, eMail si.wolf@ web.de
■ Bernetzreith: Manfred Klemm (➝ Tirna).
■ Böhmischdorf: Erwin Scherer, Dietersgrüner Weg 15, 95659 Arzberg, Telefon (0 92 33) 96 30, eMail ekf.scherer@ gmx.de
■ Böhmisch Neuhäusl: Thomas Brandel, Am Feldbüchel 2, 94571 Schaufling, Telefon (0 99 04) 74 72.
■ Brand: ➝ Heimatkreis.
■ Darmschlag: Hildegard Schmitt, Obere Watt 16, 96149 Breitengüßbach, Telefon (0 95 44) 10 84.
■ Dehenten: ➝ Heimatkreis.
■ Drißgloben: Ernst Adler, Bornwiesenweg 17, 61184 Karben, Telefon (0 60 39) 74 49.
■ Elsch: ➝ Heimatkreis.
■ Eschowitz: ➝ Heimatkreis.
■ Frauenreith: ➝ Heimatkreis.
■ Galtenhof: Dr. Dorith Müller, Georg-Stefan-Straße 43c, 90453 Nürnberg, Telefon (09 11) 89 21 17 31, Mobilfunk (01 51) 56 36 29 20, eMail dorith.mueller @web.de
■ Girnberg: ➝ Heimatkreis.
■ Godrusch: Franz Schart, Kirchstra-
ße 5, 87782 Unteregg, Telefon (0 82 69) 5 38, Mobilfunk (01 75) 1 90 82 98, eMail f.schart@gmx.de
■ Gossau: Dr. Wolf-Dieter Hamperl (➝ Heimatkreis).
■ Großgropitzreith: Franz Härtl, Weiherstraße 20, 63128 Dietzenbach, Telefon (0 60 74) 2 32 59.
■ Großmaierhöfen: ➝ Heimatkreis.
■ Großwonetitz: ➝ Heimatkreis.
■ Haid: Felix Marterer, Nanga-Parbat-Straße 42, 80992 München, Telefon (0 89) 14 68 67.
■ Hals: Gerhard Stich, Mönchsberg 17, 68789 Sankt Leon-Rot, Telefon (0 62 27) 5 00 57.
■ Helldroth: ➝ Heimatkreis.
■ Hesselsdorf: Anna Knarr, An der Bohle 7, 82319 Starnberg, Telefon (0 81 51) 1 59 88, eMail ruthomann@gmx. net
■ Innichen: Sieglinde Wolf (➝ Altzedlisch).
■ Juratin: ➝ Heimatkreis.
■ Kleingropitzreith: ➝ Heimatkreis.
■ Kleinmaierhöfen: ➝ Heimatkreis.
■ Kleinwonetitz: ➝ Heimatkreis.
■ Konraditz: ➝ Heimatkreis.
■ Labant: Marianne Gäbler, Lobensteiner Straße 15, 07549 Gera, Telefon (03 65) 3 10 68.
■ Langendörflas Miroslav Křížek, Dlouhý Újezd 171, CZ-347 01 Tachov, Telefon (0 04 20) 7 37 72 03 65, eMail semi. piskvorka@gmail.com
■ Lohm: Margret Buchner, Pfarrer-Mießlinger-Straße 1d, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 14 23 36 39.
■ Lusen: Heidi Renn, Kolpingstraße 17, 79787 Lauchringen, Telefon (0 77 41) 80 74 96, eMail heidemarie.renn@arcor. de
■ Malkowitz, Mallowitz: Karl Friedrich Damm, Niedergründauer Straße 22, 63505 Langenselbold, Telefon (0 61 84) 18 26, eMail karldamm@t-online.de
■ Maschakotten: Reinhold Wurdak, Neustädter Straße 142a, 90431 Nürnberg, Telefon (09 11) 3 26 37 39, eMail reinhold-wurdak @t-online.de
■ Mauthdorf: ➝ Heimatkreis.
■ Milles: ➝ Heimatkreis.
■ Molgau: ➝ Heimatkreis.
■ Neudorf: Gerhard Reichl, Stettiner Straße 5, 92665 Altenstadt, Telefon (0 96 02) 66 62, eMail gereichl@gmail. com
■ Neuhäusl: Emma Weber, Lohma 26, 92714 Pleystein, Telefon (096 54) 9 12 04, eMail weber-pleystein@t-online. de
■ Neulosimthal: Albert Kick, Faisl-
bach 5, 92697 Georgenberg, Telefon (0 96 58) 3 15. Stellvertreter: Alfred Roscher, Holznerweg 4, 84508 Burgkirchen, Telefon (086 79) 3 06 95 68.
■ Neustadtl: Walter Höring, JohannSebastian-Bach-Straße 43, 87724 Ottobeuren, eMail walter_hoering@gmx.de

■ Neuzedlisch: Manfred Maschauer, Höhenweg 8, 89257 Illertissen, Telefon (0 73 03) 37 51, Telefax 90 02 89, eMail vorstand@heimatverein-neuzedlisch.de.
■ Ostrau, Neuwirtshaus: Felix Marterer (➝ Haid).
■ Petlarnbrand: ➝ Heimatkreis.
■ Pfraumberg: Waltraud Gregor, Ziegetsdorfer Straße 5a, 93051 Regensburg, Telefon (09 41) 9 06 72. Stellvertreterin: Christine Obermeier, Lindenweg 18, 93142 Ponholz, Telefon (094 71) 30 12 83, eMail ch.ob.gen@freenet.de
■ Pirkau: ➝ Heimatkreis.
■ Purschau: Sybille Bräuner, Hauptstraße 32, 06198 Salzatal, Mobilfunk (01 76) 36 91 57 52, eMail bille1978@ outlook.de
■ Rail: ➝ Heimatkreis.
■ Roßhaupt: Helga Kett und Stellvertreter Heribert Kett, Sophienstraße 5, 92648 Vohenstrauß, Telefon (096 51) 6 17.
■ Sankt Katharina: ➝ Heimatkreis.
■ Schönbrunn: Ludmilla Himmel, Am Daubhaus 6, 65239 Hochheim, Telefon (0 61 46) 83 54 94, eMail ludmillahimmel@t-online.de
■ Schönwald: ➝ Heimatkreis.
■ Schossenreith: Josef Magerl, Wolframstraße 9, 82515 Wolfratshausen, Telefon (0 81 71) 1 81 69.
■ Sorghof: ➝ Heimatkreis.
■ Speierling: Stefan Heller, Hauptstraße 81, 61184 Okarben, Telefon (0 60 39) 93 21 40, eMail s.heller@soulclub.de
■ Stiebenreith: ➝ Heimatkreis.
■ Strachowitz: Werner Schlosser, Hirtenweg 3, 91567 Herrieden, Telefon (0 98 25) 54 58.
■ Tachau: Gernot Schnabl, Ahornweg 7, 82547 Eurasburg, Telefon/Telefax (0 81 79) 82 24, eMail gernot. schnabl@t-online.de
■ Thiergarten: ➝ Heimatkreis.
■ Tholl: Heidi Renn (➝ Lusen).
■ Tirna: Manfred Klemm, Herzog-Arnulf-Straße 37, 85604 Zorneding, Telefon (0 81 06) 2 01 69, eMail klemmmanfred@t -online.de
■ Tissa: Lothar Meitner, Hildebrandstraße 25, 40215 Düsseldorf, eMail meitner. lothar@yahoo.com
■ Turban: Dr. Wolf-Dieter Hamperl (➝ Heimatkreis).
■ Tutz: ➝ Heimatkreis.
■ Ujest: ➝ Heimatkreis.
■ Ulliersreith: ➝ Heimatkreis.
■ Uschau: Sieglinde Wolf (➝ Altzedlisch).
■ Waldheim: ➝ Heimatkreis.
■ Walk: Erwin Hamperl, Hinter den Gärten 20, 75245 Neulingen, Telefon (0 72 37) 95 63.
■ Weschekun: ➝ Heimatkreis.


■ Wittingreith: ➝ Heimatkreis.
■ Ratzau:
■
■
■ Pernartitz: Anton Schwegler, Haydnstraße 11, 89269 Vöhringen, Telefon (0 73 06) 55 75.
■ Petlarn: ➝ Heimatkreis.
■
■ Ringelberg: Manfred Kassekkert, Sonnleite 2, 83365 Nußdorf, Telefon (0 86 69) 3 57 13 87, eMail kasseckertmanfred@web.de
■ Wosant: Stefan Kapusta, Unterbissingen 10, 86657 Bissingen, Telefon (0 90 84) 5 44, eMail kapusta@ egerlaender.de
■ Woschnitz: ➝ Heimatkreis.
■ Wurken: Franz Wiltschka, Hainbergstraße 19, 90547 Stein, Telefon (09 11) 67 47 79.
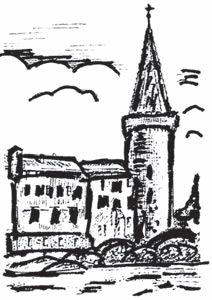
■ Wusleben: ➝ Heimatkreis.
■ Zummern: Dr. Wolf-Dieter Hamperl (➝ Heimatkreis).
Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 23
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (0961) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE387602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, eMail post@nadirahurnaus.de
Pabelsdorf: ➝ Heimatkreis.
Paulusbrunn, Hermannsreith, Wittichsthal, Vorder Paulusbrunn, Hinter Paulusbrunn, Inselthal, Goldbach: Helmut Gleißner, Postfach 1211, 95668 Bärnau, Telefon (0 96 35) 13 12.
Johann Marschick und Stellvertreterin Helga Ernst, Götzenmühlweg 20, 61350 Bad Homburg, Telefon (0 61 72) 8 25 77.
Reichenthal: Sieglinde Wolf (➝ Altzedlisch).
Weihnachtsikone von Maria Ampelia Theyerl OSB. Die 1908 in Pleschnitz im Kreis Mies geborene Egerländerin starb 2004 als Benediktinerin in der Abtei Frauenchiemsee in Oberbayern. Bild: Herbert Fischer
❯
Das Reich des Christkindls
Der aus Hals stammende Franz Löw schildert heimatliche Sitten und Gebräuche in der Weihnachtszeit.
Draußen vom Walde komm‘ ich her, ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr.“ So läßt Theodor Storm Knecht Ruprecht sprechen. „Es weihnachtet“ ist eine Verheißung, denn Anfang Dezember rückt das Weihnachtsfest ganz nah. Manchmal war zu dieser Zeit die Witterung regnerisch und unfreundlich, sogar etwas warm. Wir sagten dann: „Es ist unweihnachtlich.“ Wenn aber über Nacht Frost kam, morgens weiße Flocken dicht vom Himmel fielen,der Schnee die Fluren bedeckte, dicke, lange Eiszapfen von den Dächern hingen, die Wälder unter ihrer weißen Last ächzten und unter den Schuhsohlen der Schnee knirschte, dann war die richtige Weihnachtszeit gekommen. Dann herrschte Weihnachtsstimmung im Lande.
Nun begann überall in den Städten und auf dem Land das Rüsten der Menschen für das kommende Fest. Tannenzweiglein wurden hinter Bilder und Kreuze gesteckt, ein heimliches Treiben erfaßte jung und alt. Die Weihnachtszeit ist begrenzt vom ersten Advent bis Neujahr. Der heute schon allzufrüh einsetzende Trubel der Geschäftswelt verzerrt und verkennt den wahren Sinn des Weihnachtsfestes.
Wer waren denn die Ersten, die überhaupt Christfreuden empfanden und sie sich holen gingen? Das waren arme Hirten auf den Fluren rings um Bethlehem, und ihre Freuden waren, daß der Langersehnte nun endlich da war. Folgen wir heute auch noch diesen Spuren?

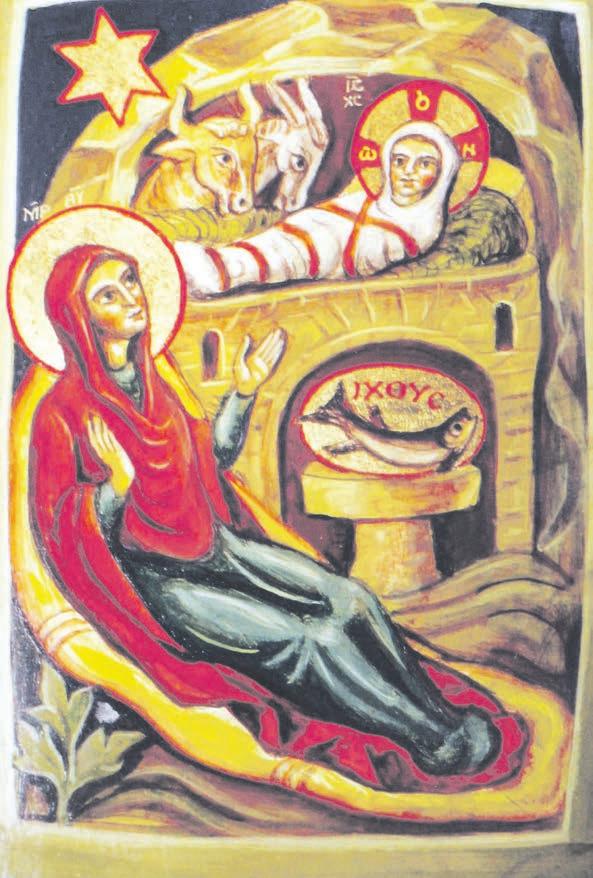
Wir erlebten noch den Zauber der Weihnacht, der unsere Heimat in jenen Tagen so schön machte. Warm und geborgen steckten die Wintersaaten unter der schützenden Schneedecke, alles schillerte und glitzerte wie Kristall, wenn Rauhreif die Wälder umhüllte.
In den warmen Stuben wurden Weihnachtsstollen und die kleinen Weihnachtsplätzchen, die Båchala, die größte Freude der Kinder, gebacken, denn da durften sie auch naschen. Die Båchala wurden jedem Gast vorgesetzt und mitgegeben. Dörrzwetschgen und Hutzeln wurden gekocht und kaltgestellt.
körperten so richtig die Weihnachtsbotschaft. Jede Familie versuchte, trotz geringer Mittel das Fest so schön wie möglich zu gestalten.


Wenn es dunkel wurde und Ruhe im Ort eintrat, bereitete die Hausmutter das Abendessen zu. Auch die Tiere wurden gut versorgt, sie sollten auch spüren, daß Weihnacht ist. Strohschüsseln, sogenannte Loabschüsseln zum Brotbacken, mit Hafer und Apfelschnitzel wurden draußen aufgestellt, „damit das Christkind anhalte und die Pferdchen fressen können“, so wurde den Kindern gesagt.
War die ganze Familie beisammen, wurde die Haustür abgeschlossen, wahrscheinlich zum Zeichen der Herbergsu-



ter Fisch und die in manchen Orten sehr beliebte Fischbröih. Selten fehlte Apfelstrudel, Strietzel, Tee mit viel böhmischem Rum oder Punsch. Zum Schluß kamen die kaltgestellten Zwetschgen und Hutzeln, der Saft wurde getrunken und war köstlich erfrischend. Dazwischen wurden Nüsse geknabbert und ein Apfel durchschnitten; man durfte keinen Kern zerschneiden, sonst mußte man im nächsten Jahr sterben.
Wer in dieser Zeit einmal vor die Haustür trat und in den kalten Winterabend horchte, in die winterliche Nacht, zumal bei Sternenlicht, der spürte den Frieden der Weihnacht im Herzen. War aufgegessen, wurde den Tieren im Stalle das Gleck – das sind Hafer, Äpfel und andere Abfälle – gegeben. In der Heiligen Nacht sollte niemand Not leiden.

Die Sage ging um, daß in dieser Nacht um Mitternacht die Tiere im Stall miteinander sprechen. Die älteren Kinder nahmen die Kleinen auf den Rücken, die ein Körbchen mit Abfällen vom Tisch trugen. Diese Abfälle wurden vor die Bäumen geworfen mit einem Sprüchlein, daß sie wieder recht viele Früchte im kommenden Jahr tragen sollten. Dann wurden die Kinder zu Bett gebracht, der Christbaum geschmückt und die Geschenke bereitgelegt.
Um Mitternacht gingen die Erwachsenen zur Christmette. Große Opfer brachten die Bewohner der Dörfer, die keine Kirche hatten. Sie gingen oft stundenlang durch tiefen Schnee zur Pfarrkirche. Mit einer kleinen Laterne in der Hand stapften sie durch die dunkle Nacht, um die Geburt Christi mitfeiern zu können. Und so manchem klang auf dem Heimweg „Stille Nacht, heilige Nacht“ im Herzen weiter.
Posselt eröffnet Ausstellung

Paulusbrunn war eine der größten Ansiedlungen im Böhmischen Wald im Grenzgebiet zu Bayern. Mehr als 1500 Einwohner von Hermannsreith bis Neu Windischgrätz wohnten hier bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Zur Ausstellungseröffnung „Das Leben in Paulusbrunn“ war mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt ein prominenter Gast in Bärnau. Auch gebürtige Paulusbrunner und viele Nachfahren sowie tschechische Gäste aus dem Nachbarland waren gekommen.
zischen Kreises Tirschenreuth, konnte sich wegen seiner sudetendeutschen Wurzeln bestens in die Thematik einfühlen und unterstrich die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den tschechischen Nachbarn. Die Arbeit des Vereins sei enorm wichtig und müsse unterstützt werden.







1978 lehrte sie am Gymnasium der Benediktinerinnenabtei Frauenwörth im Chiemsee. Danach entfaltete sie all ihre künstlerischen Fähigkeiten bis zu ihrem Tod 2004. Bild: Herbert Fischer
Wer den Heiligen Abend in den Dörfern erlebte, war ergriffen von der feierlichen Stimmung, die über dem Land lag. Die einsamen Dörfer und Siedlungen in ihrer Einfachheit, ihrem oft so ärmlichen Charakter, zeigten Friede und ver-
che von Maria und Josef, die auch überall verschlossene Türen vorgefunden hatten. Man ging auch in diesen Stunden der Dämmerung in kein anderes Haus. War der Tisch gedeckt, sprach der Hausvater laut die Gebete vor. Man dankte Gott für Speis‘ und Trank und betete für alle Verstorbenen.
Die Speisen waren gegenüber heute einfacher, aber reichlich und gut. Fleisch wurde am Heiligen Abend nicht gegessen, höchstens gebackener oder gekoch-

Der Christmorgen brachte Kindern und Eltern die langersehnten Freuden. Diese Geschenke waren oft gering, und doch brachte das kleinste von ihnen Freude ins Haus. Die Menschen waren noch bescheiden, und das Geld war schwer zu verdienen.
Ich erinnere mich so gerne an die Vorweihnachtstage und -woche, in denen in einer Werkstätte meines Elternhauses die vielen Holzpferde, Schimmel, Füchse, Rappen standen, die alle neu gestrichen und bemalt wurden, denn oft hatten sie schon Generationen zuvor als Spielzeug gedient. Kleine Wiegen, Tischchen mit niedlichen Stühlen, Puppenstuben und vieles andere kam noch hinzu. In dieser Zeit durften wir Kinder diese Werkstatt nicht betreten, denn sie war das Reich des Christkindels.

Ein Meilenstein in der Entwicklungsarbeit des Vereins Via Carolina –Goldene Straße ist, das ehemalige sudentendeutsche Dorf Paulusbrunn als einen dauerhaften Erinnerungs- und Versöhnungsort vor allem für junge Menschen, Schulklassen und Universitäten auf beiden Seiten der Grenze zu etablieren. Mit dem grenzüberschreitenden Projekt „Spurensuche im Böhmischen Wald“ mit dem tschechischen Via-Carolina-Partner MAS Zlatá cesta aus Tachau und unterstützt von Mitteln des EU-Programms „Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tschechische Republik“ stellte der Verein mit seiner ARGE Paulusbrunn die Weichen, das Bewußtsein für historische Ereignisse zu schärfen und den pädagogischen Auftrag unterhaltsam zu erfüllen.

Via-Carolina-Vorsitzender Alfred Wolf begrüßte die zahlreichen Gäste und stellte die Besonderheit des Dorfes Paulusbrunn vor. Direkt an der Goldenen Straße gelegen, auf der mit Kaiser Karl IV. ein großer Europäer 52 Mal gereist sei, entstehe ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsvermittlung. Er danke vor allem Projektleiterin Petra MusilováSeidlová und der ARGE Paulusbrunn mit Rainer Christoph an der Spitze für die Erarbeitung der Ausstellung.
Musilová-Seidlová und Christoph stellten den Inhalt der Ausstellung und vieles Interessante um Paulusbrunn vor. Toni Dutz, Vize-Landrat des oberpfäl-

„Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, daß die Geschichte kein toter Staat ist. Demokratie, europäische Einigung und Versöhnung sind Werte, die sich jede Generation hart erarbeiten muß. Gerade wenn eine Generation denkt, sie habe sie erreicht, sind sie wieder für die nächste Generation bedroht.“ Mit diesen Worten eröffnete Posselt die Ausstellung „Das Leben in Paulusbrunn“.

Die Ausstellung zeige, wie Tschechen und Deutsche in einem gemeinsamen Kulturraum in einem freundschaftlichen Verhältnis lebten, bevor die Wirren des 20. Jahrhunderts mit Krieg, Vertreibung und Eisernem Vorhang für die Trennung gesorgt hätten. In eindrucksvollen Worten lobte Posselt die grenzüberschreitende Einmaligkeit der geleisteten Arbeit des Vereins Via Carolina – Goldene Straße. Der Geschichtspark sei eine wichtige Investition in die europäische Zukunft. Als Freizeitzentrum, als Kulturzentrum, aber auch als Zukunftszentrum trage er dazu bei, grenzüberschreitende Probleme zu lösen. Er wolle sich nach Kräften bemühen, die Arbeit des Vereins zu unterstützen.

Im Rahmen des Projektes „Spurensuche im Böhmischen Wald“ war eine Publikation in Form von Comic-Geschichten erstellt worden, die die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Paulusbrunn illustrieren soll, verwirklicht von Kunststudenten von beiden Seiten der Grenze. Diese werden als Unterrichtsmaterialien für Schulen auf beiden Seiten der Grenze bereitgestellt. Eine Vielzahl der Studenten war ebenfalls zur Ausstellungseröffnung gekommen.
Ingrid Leser
HEIMATBOTE KREIS TACHAU Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 24 ❯ Weihnachten in der Heimat
❯
Das Leben in Paulusbrunn
Alfred Wolf, Volksgruppensprecher Bernd Posselt und Toni Dutz, Vizelandrat von Tirschenreuth, Mitglied des SL-Bundesvorstandes und der Sudetendeutschen Bundesversammlung. Bild: Michal Kratochvil
Telefon
00
09 www.presse-druck.de WIR DRUCKEN DIE SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG IN EINEM DER MODERNSTEN DRUCKZENTREN EUROPAS. PRESSE-DRUCK REALISIERT IHR KONZEPT. VON DER DATEI BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT –QUALIFIZIERTES KNOW-HOW UNTER DEM DACH EINES VERLÄSSLICHEN PARTNERS. UNSERE EXPERTEN WARTEN AUF SIE. FORDERN SIE UNS!
Weihnachtskrippenikone von Ampelia Theyerl OSB. Sie kam als Anna 1908 in Pleschnitz/Kreis Mies zur Welt. Mit 19 Jahren wurde sie Kreuzschwester in Eger, mit 27 promovierte sie an der Prager Karls-Universität. Bis zur Verstaatlichung ihrer Ordensschule 1939 unterrichtete sie dort als Professorin. 1942 verließ sie die Heimat und widmete sich in der Abtei Herstelle in Niedersachsen der Mysterientheologie und der Kunst. Von 1958 bis
08 21/777-28
Fax 08 21/777-28
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 . BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G












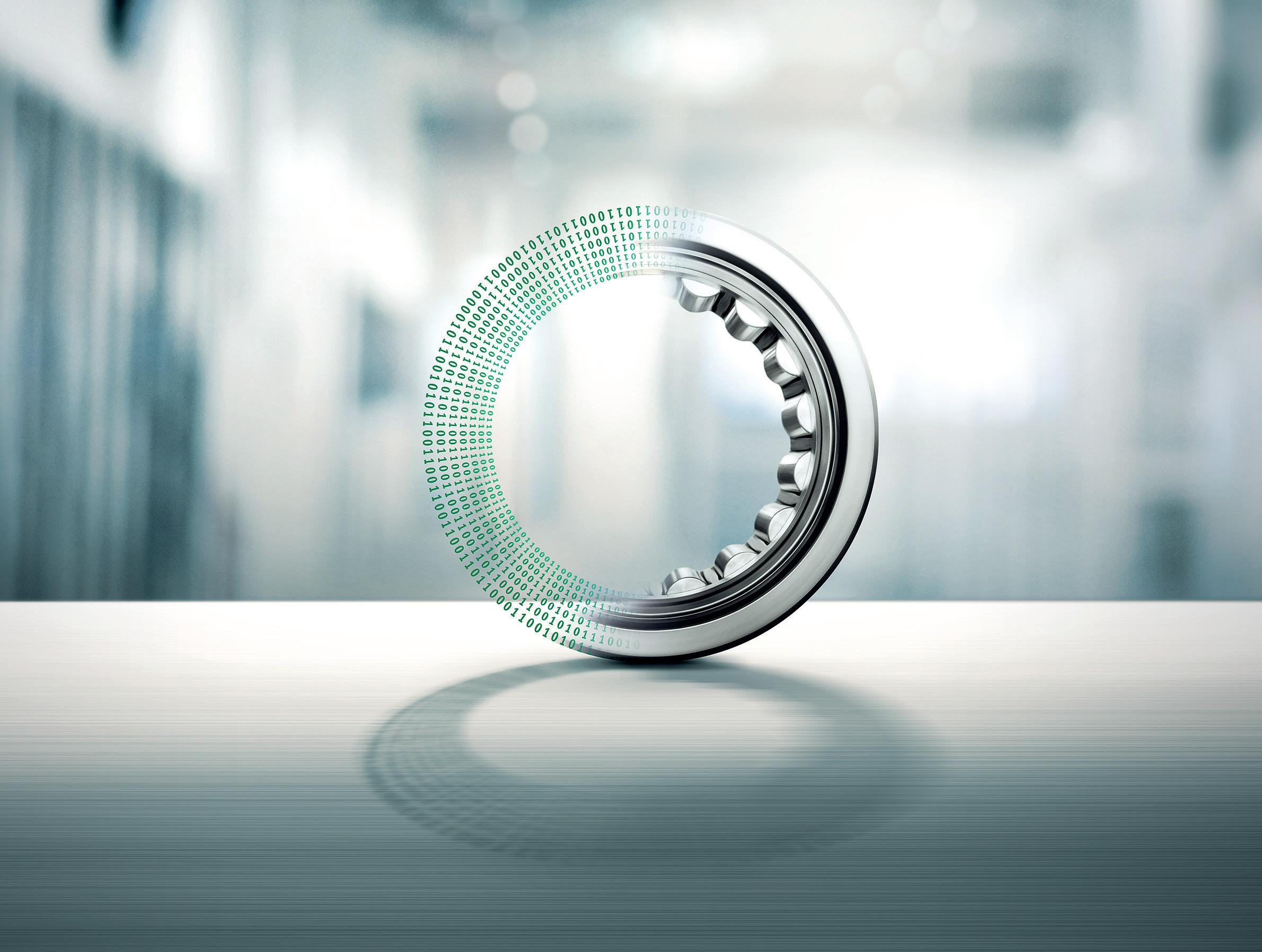



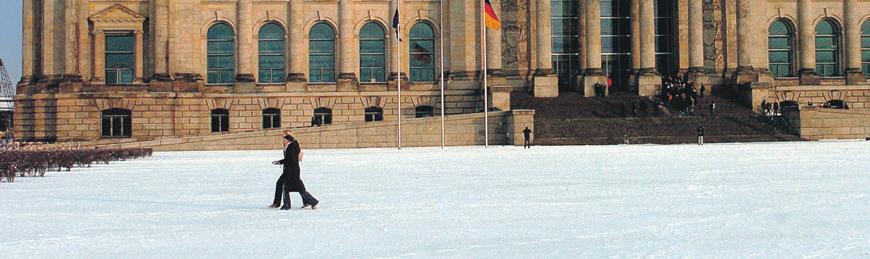


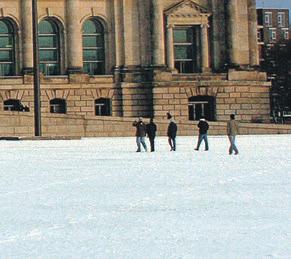


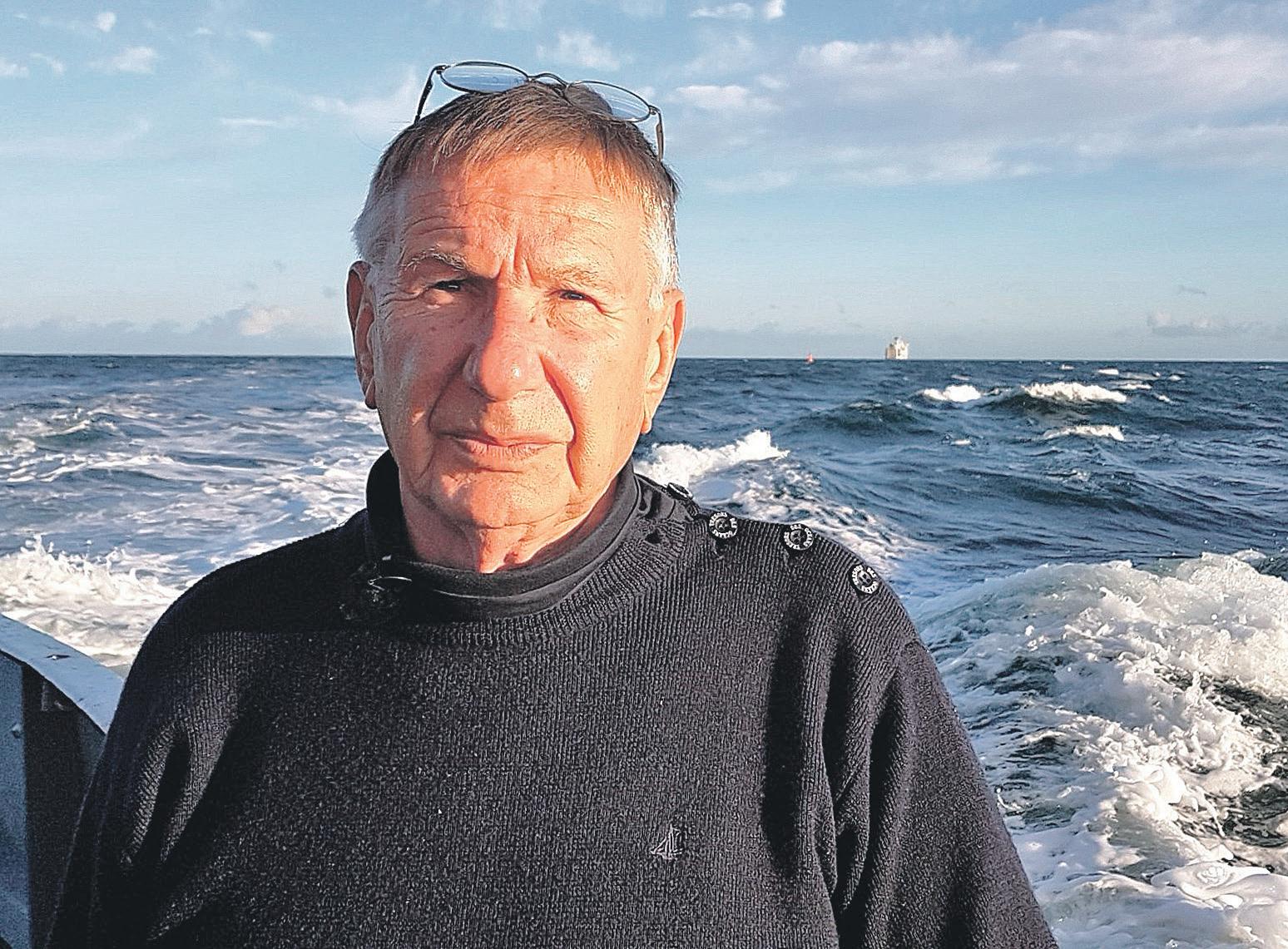

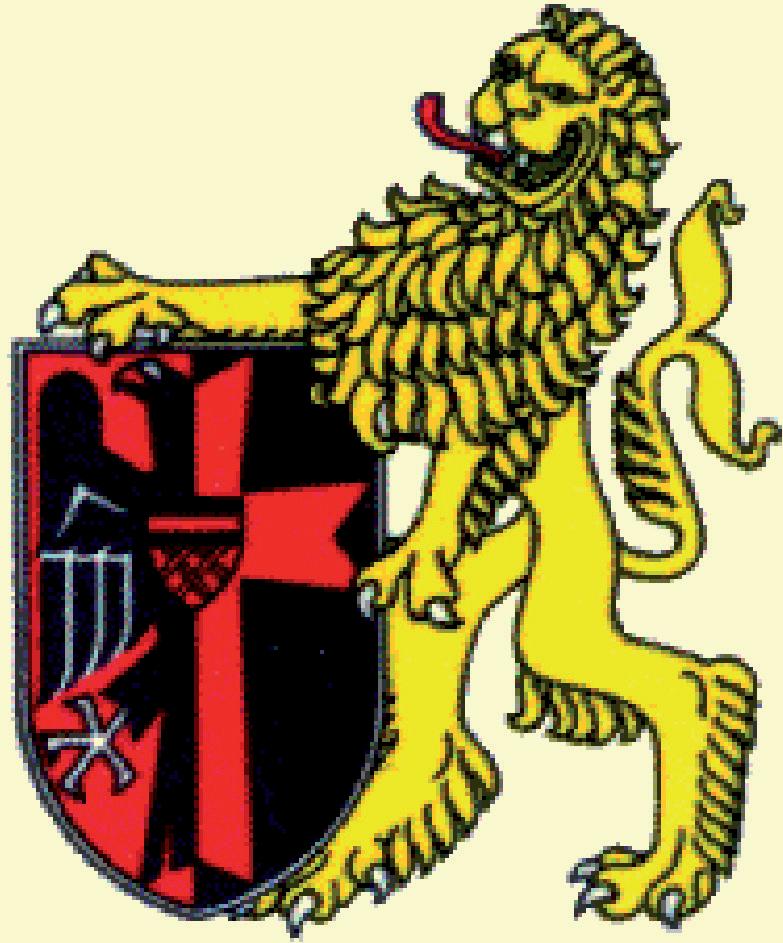

















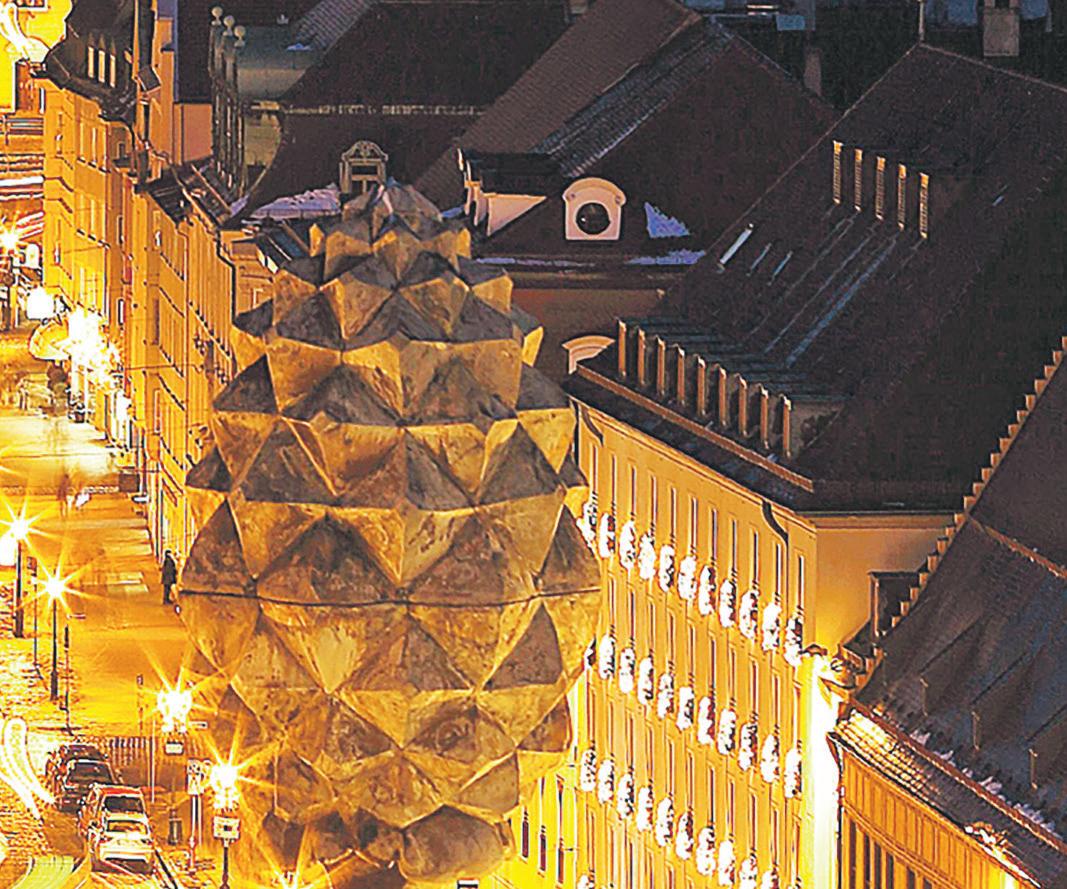


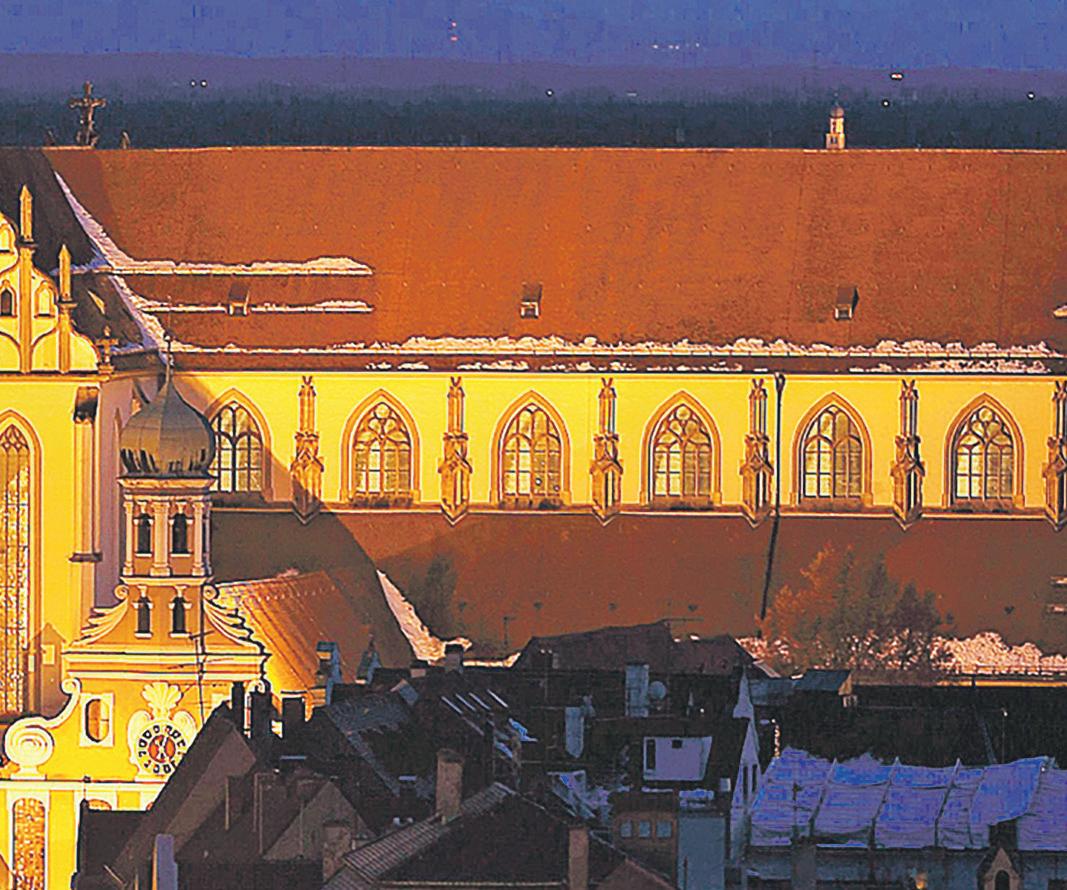
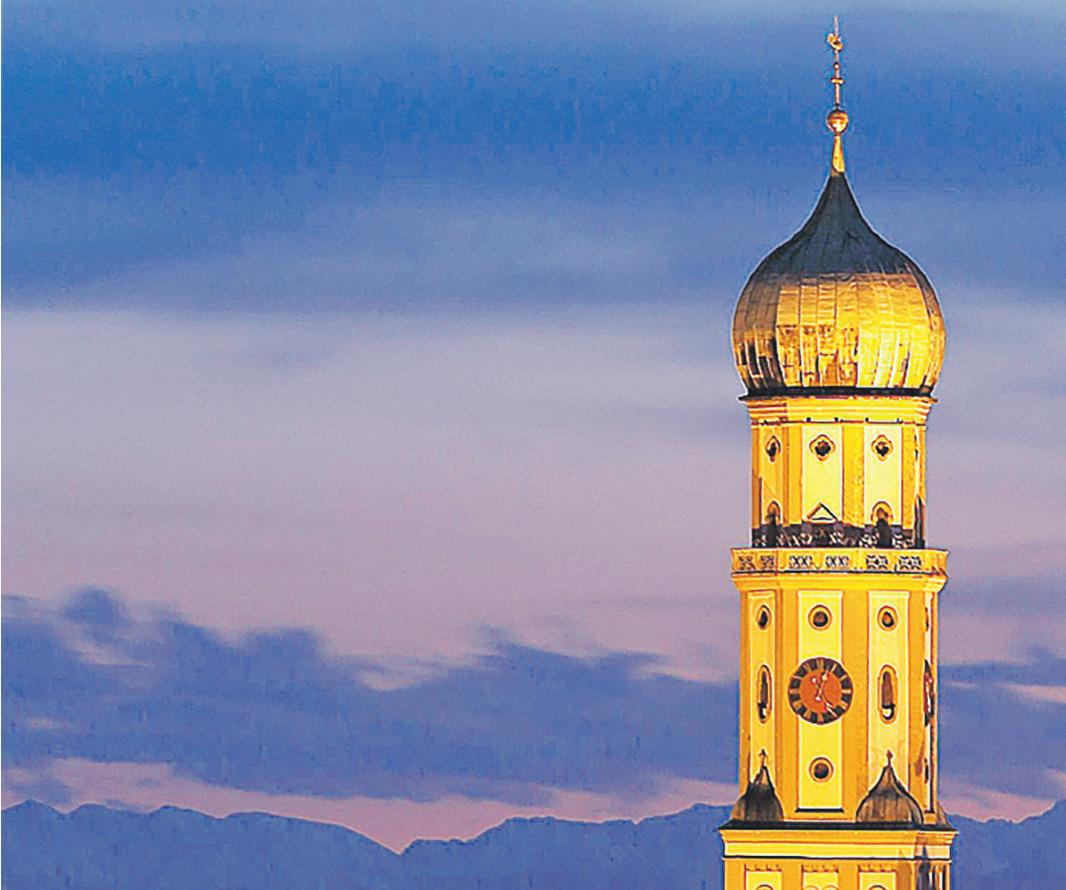
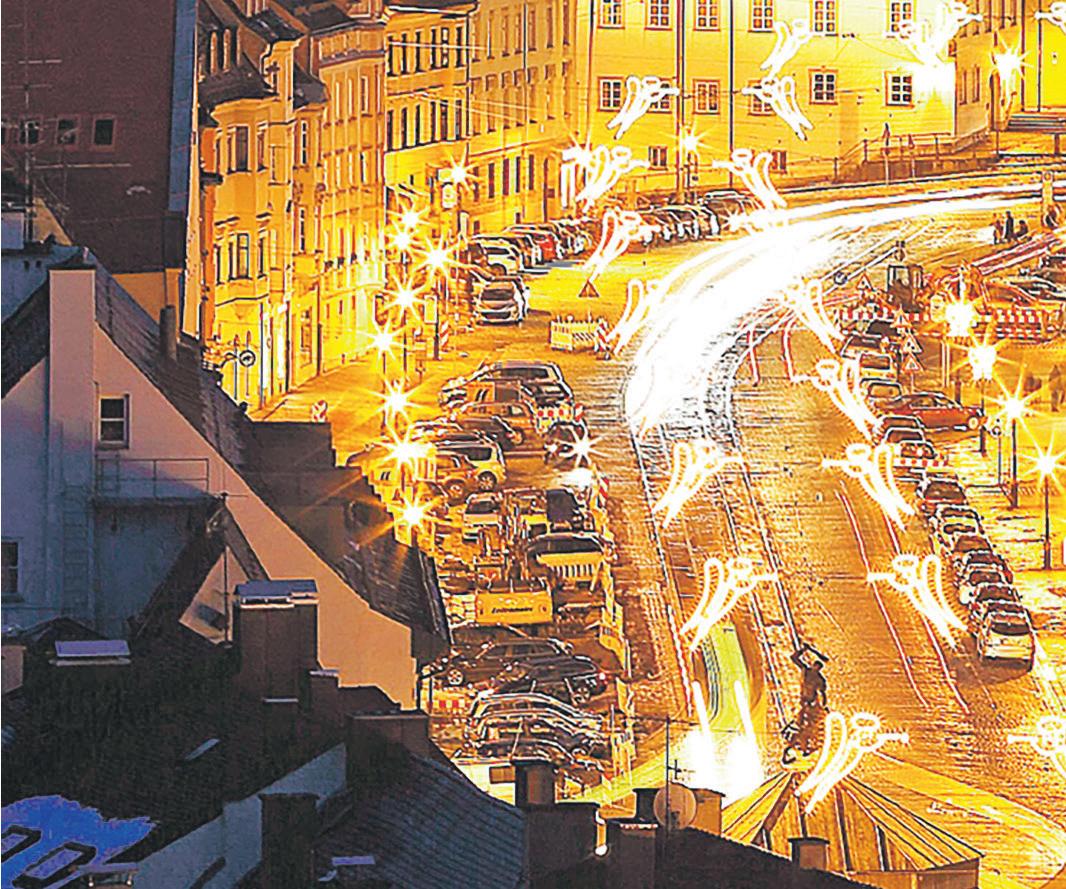




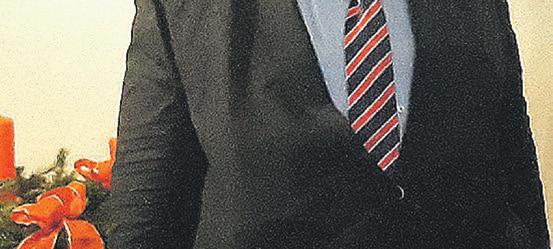










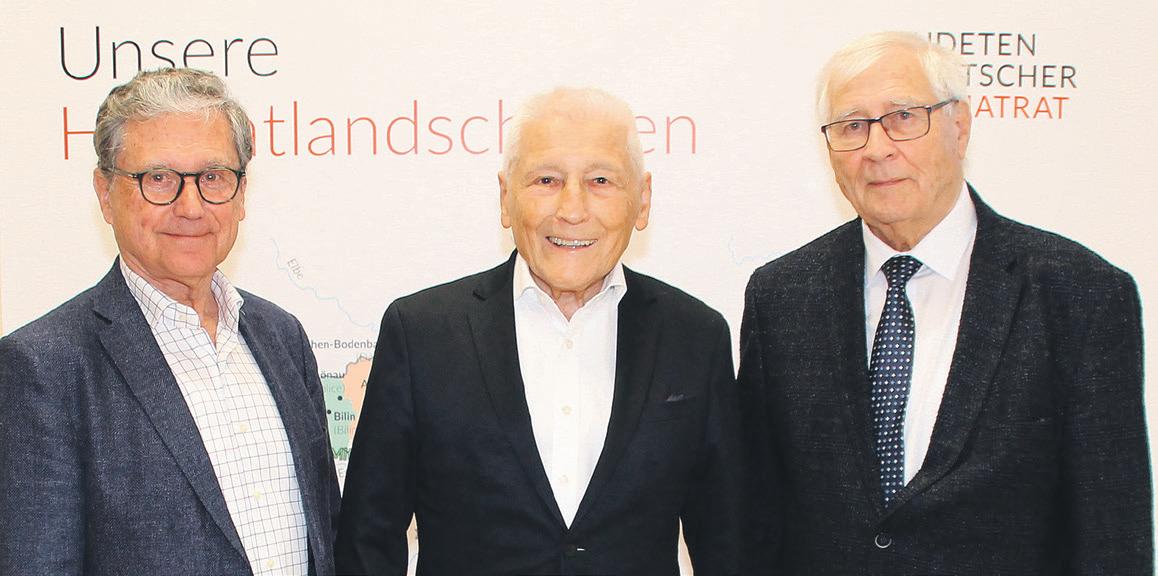
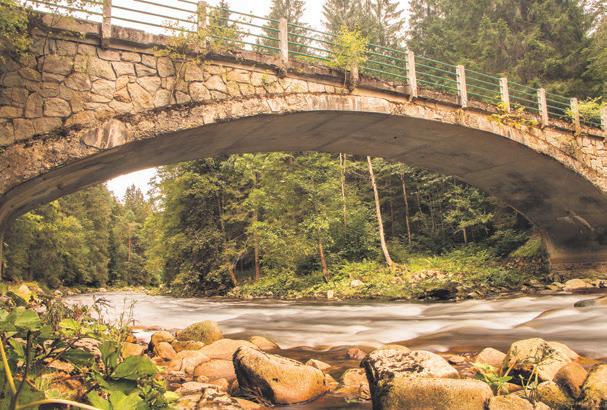
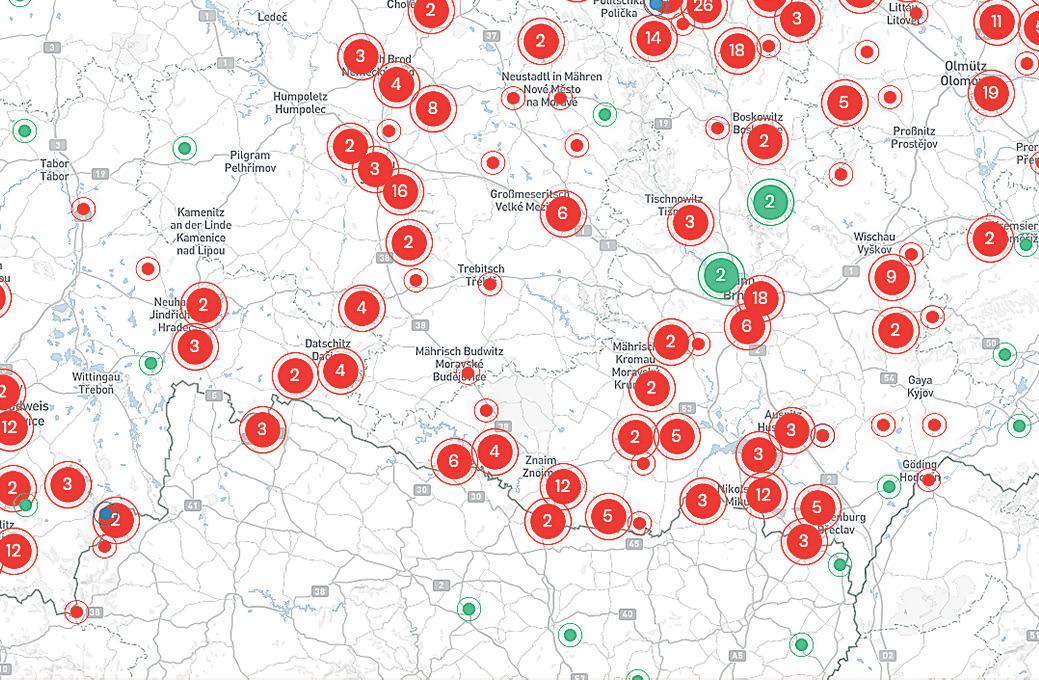
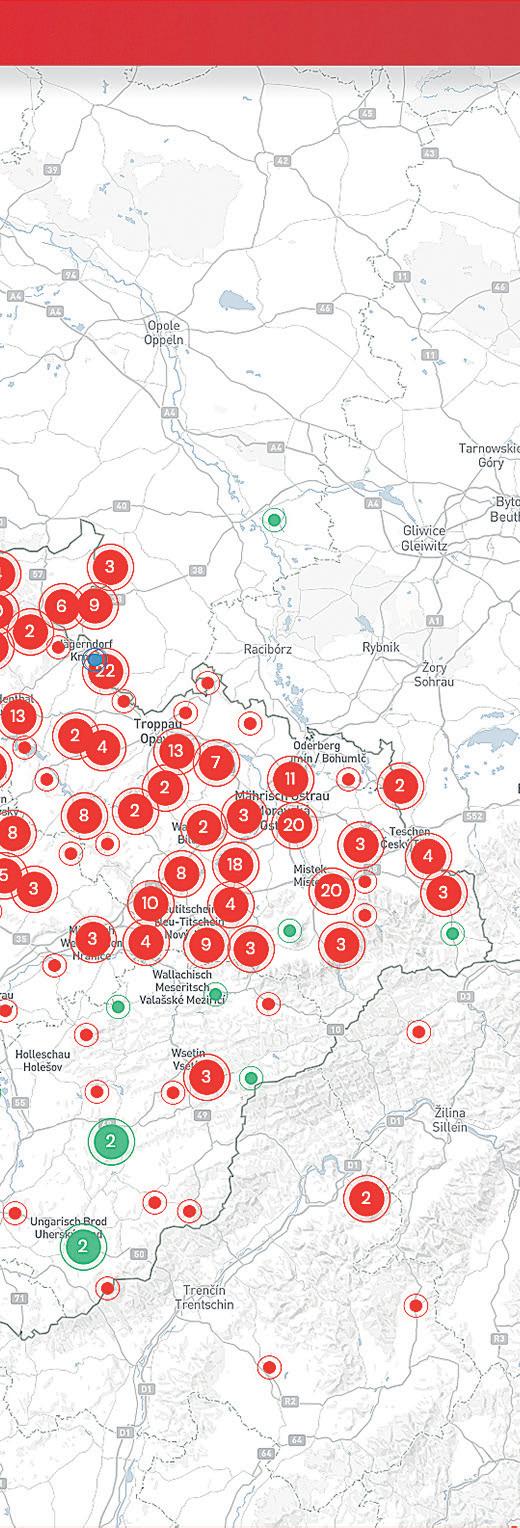
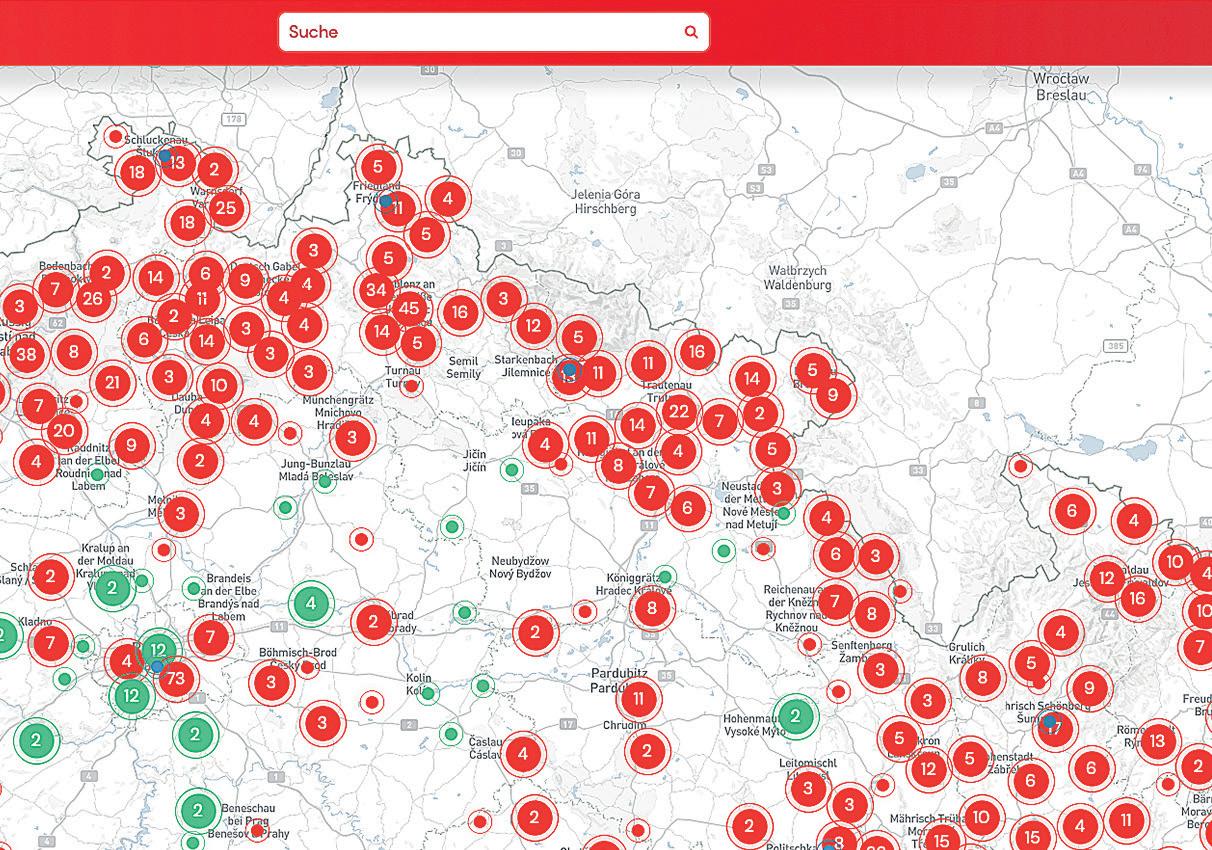


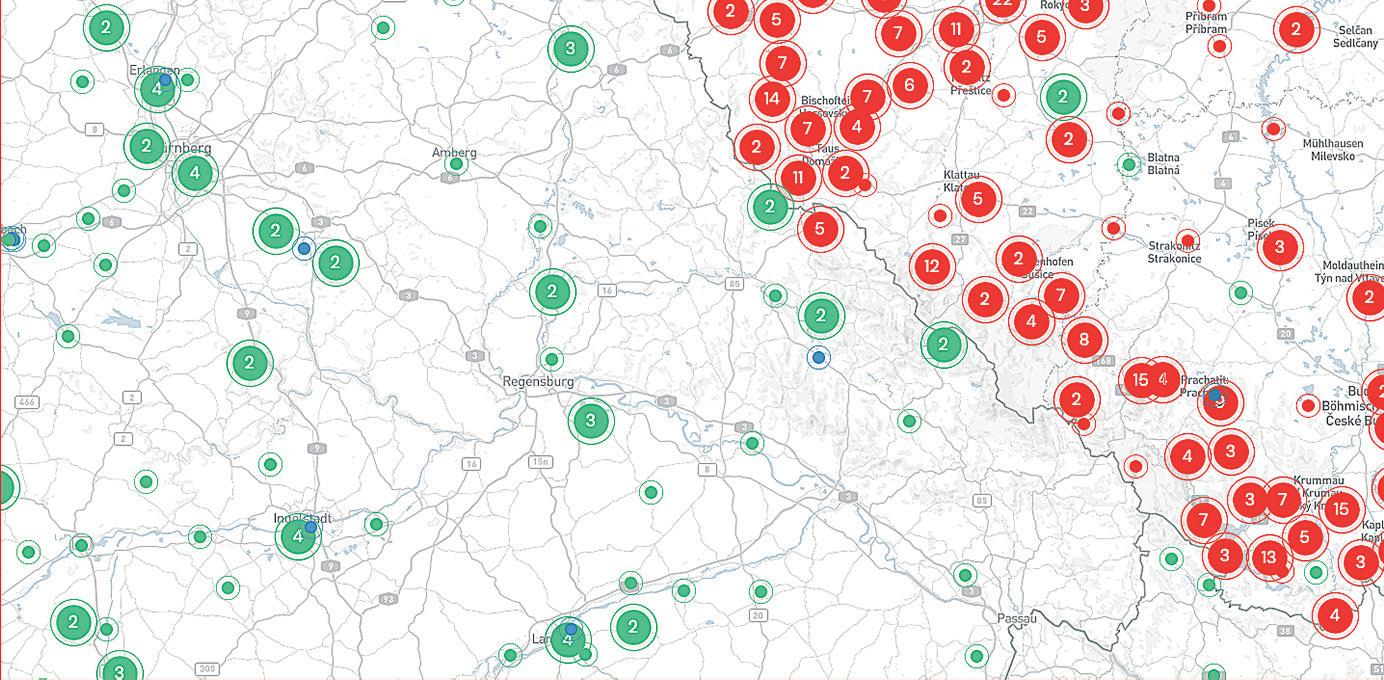
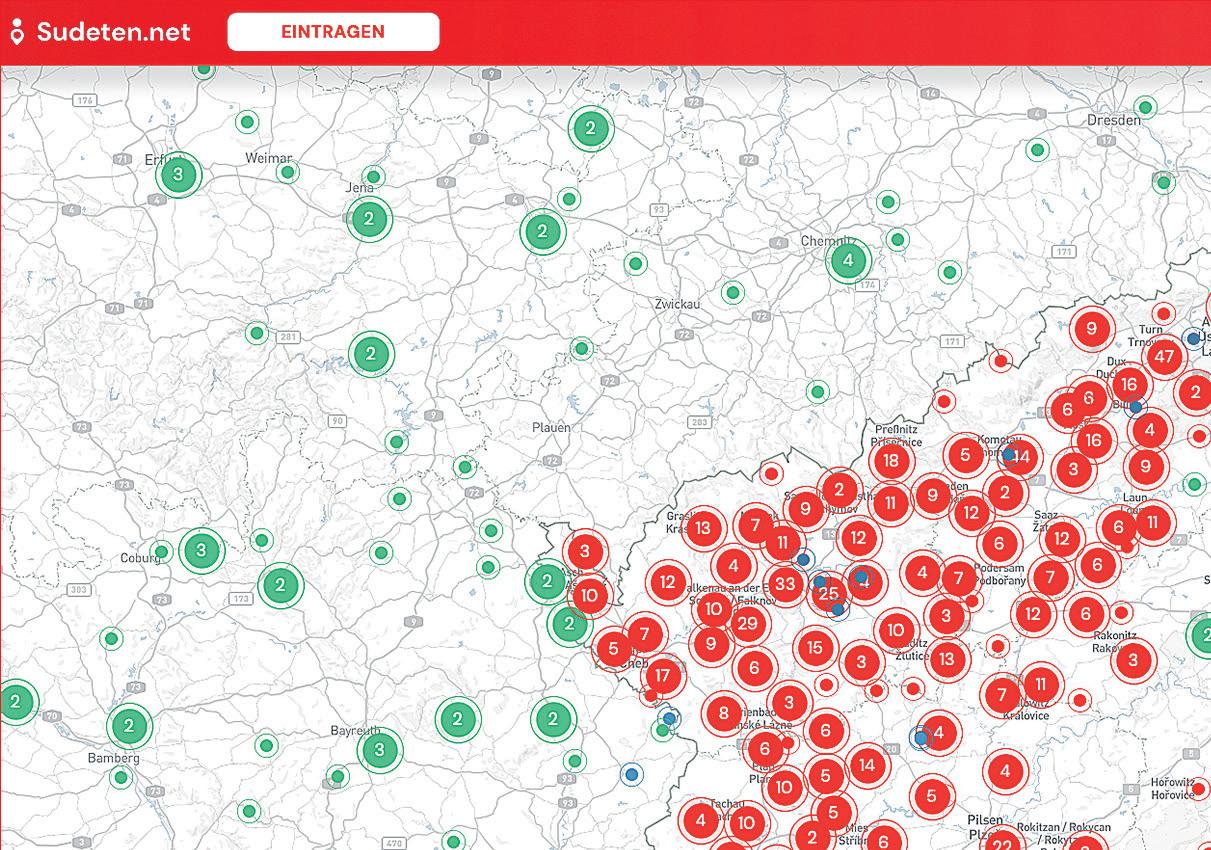

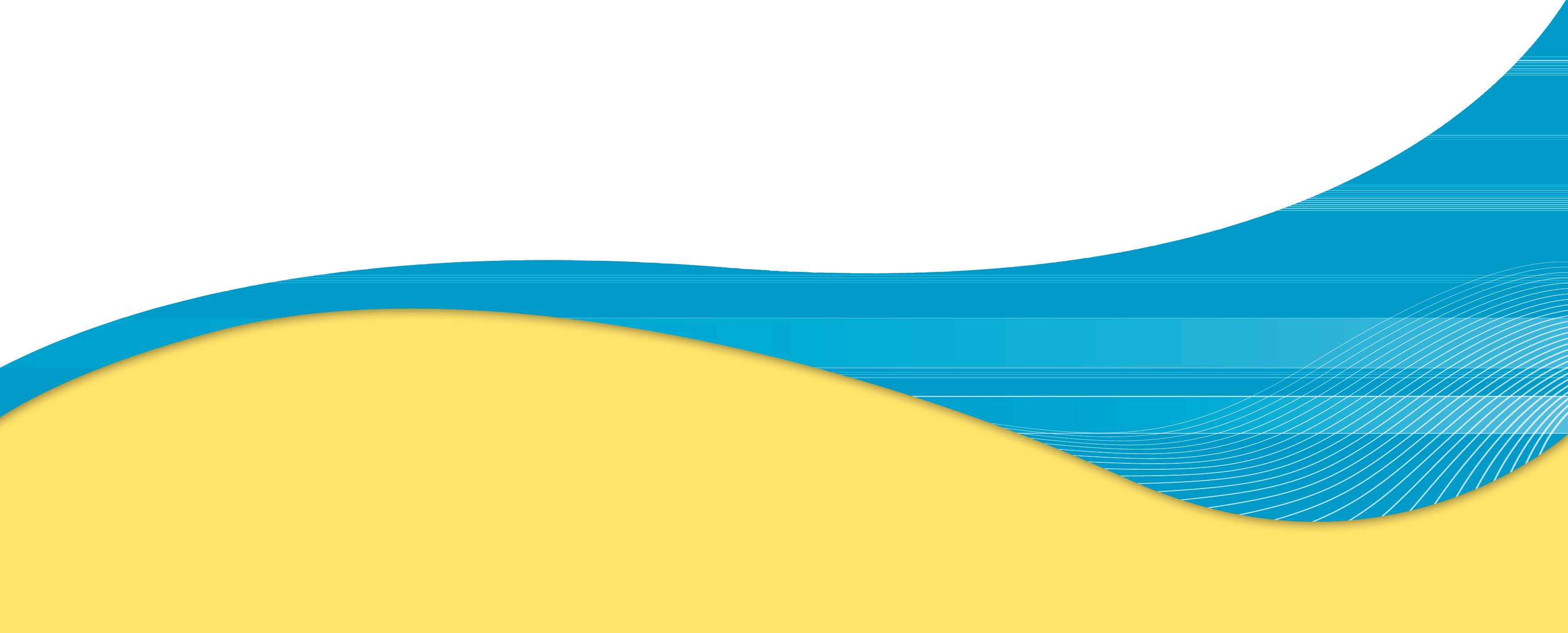



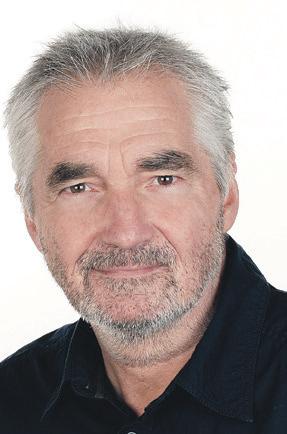



























































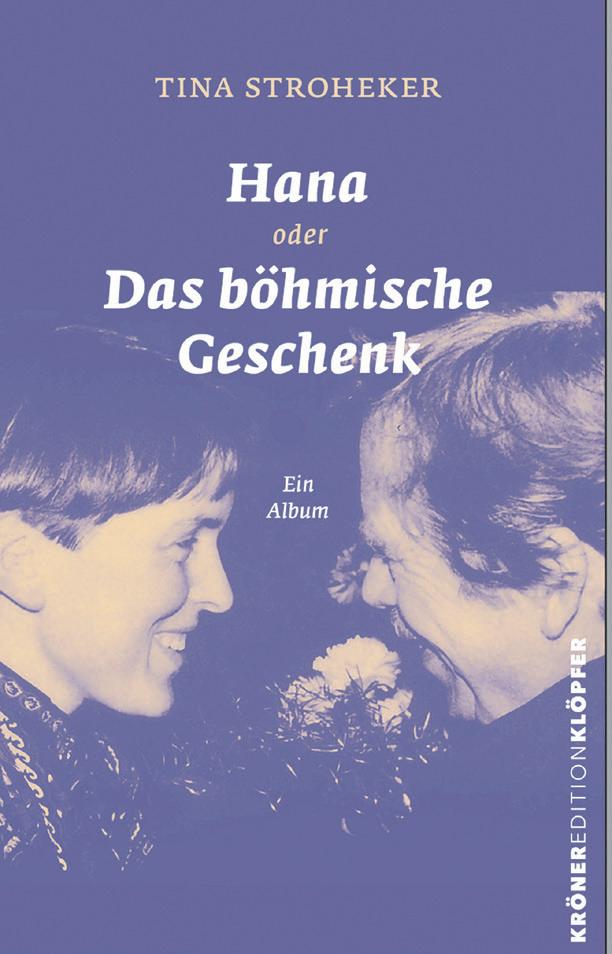

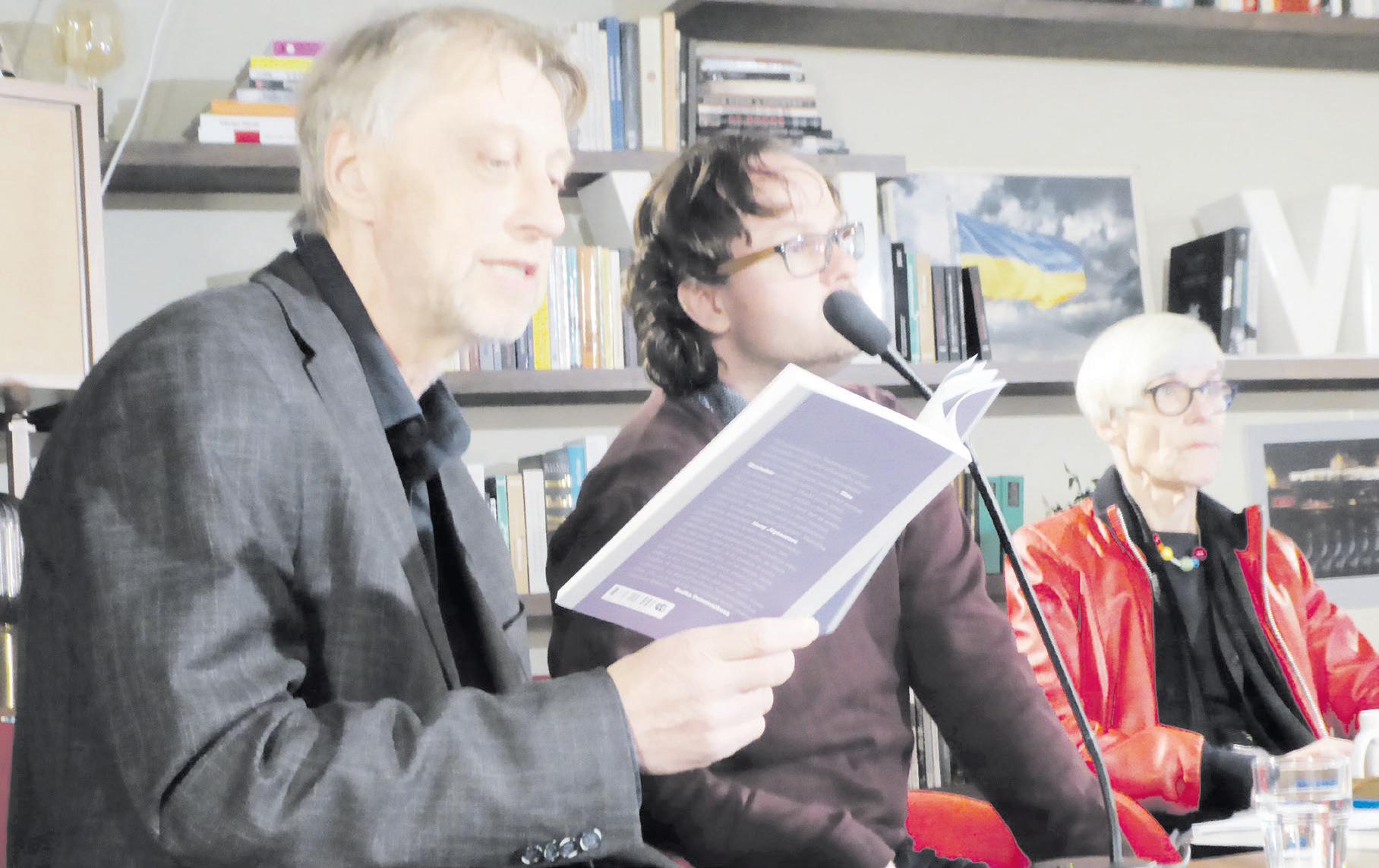
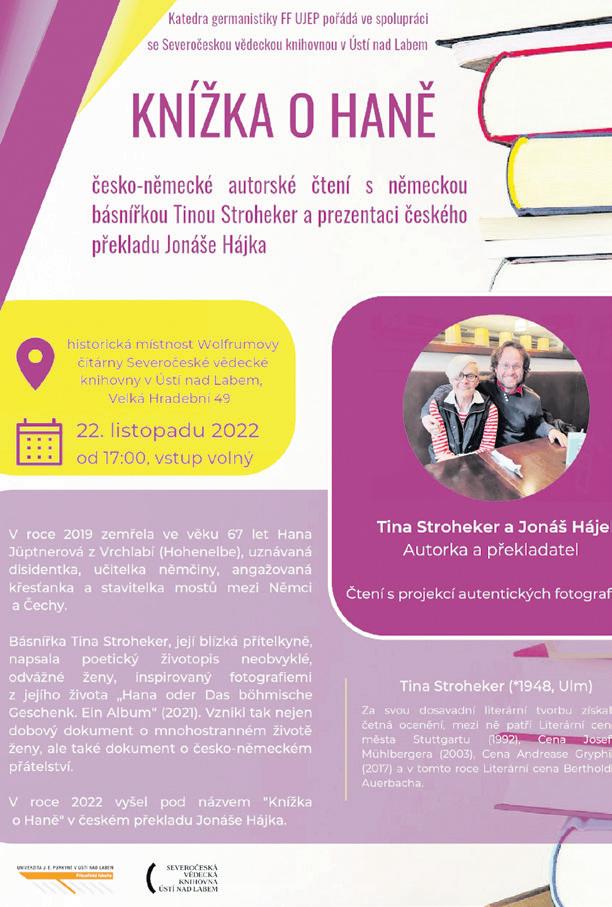
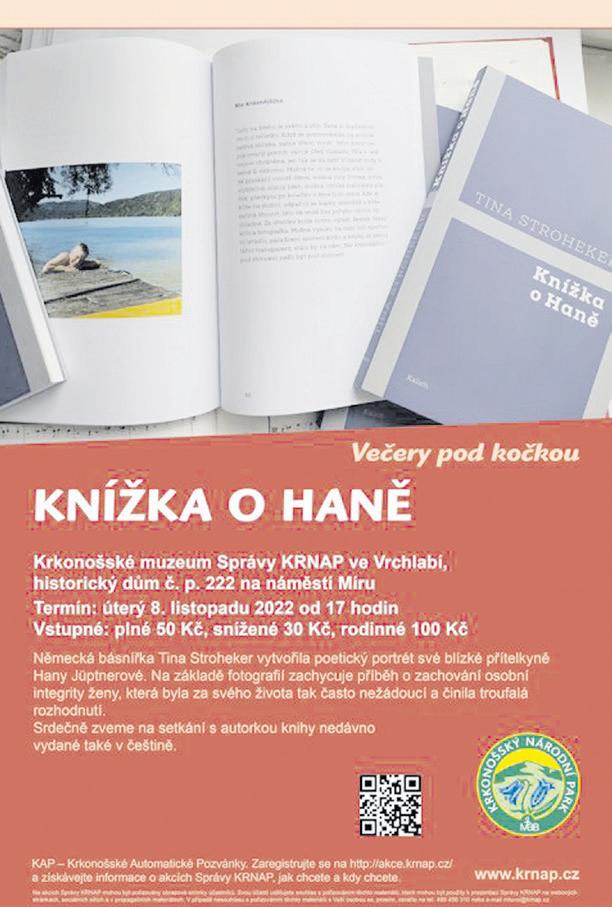



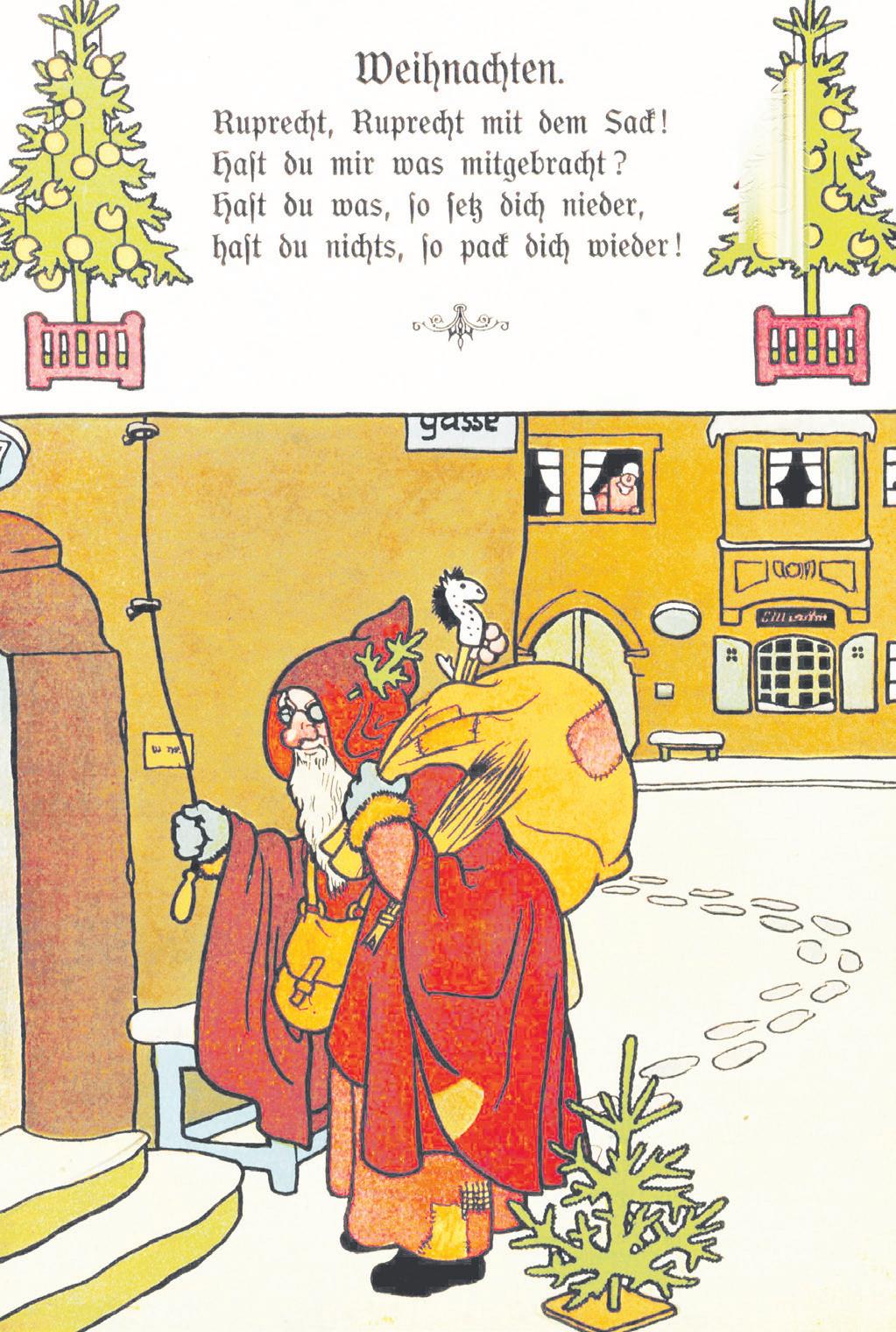








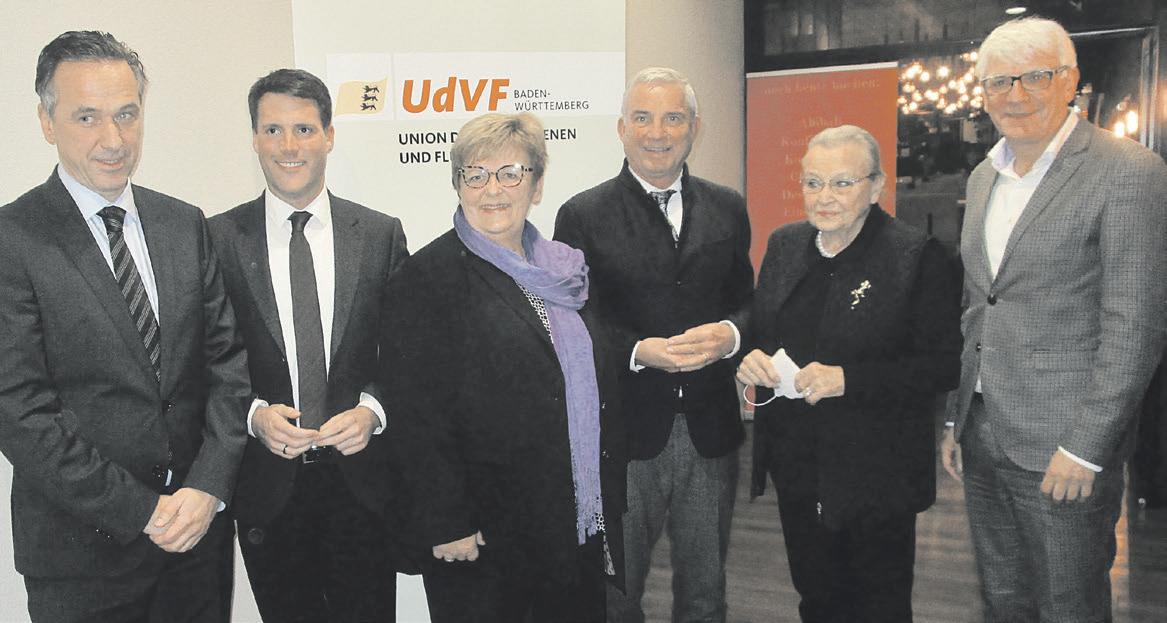



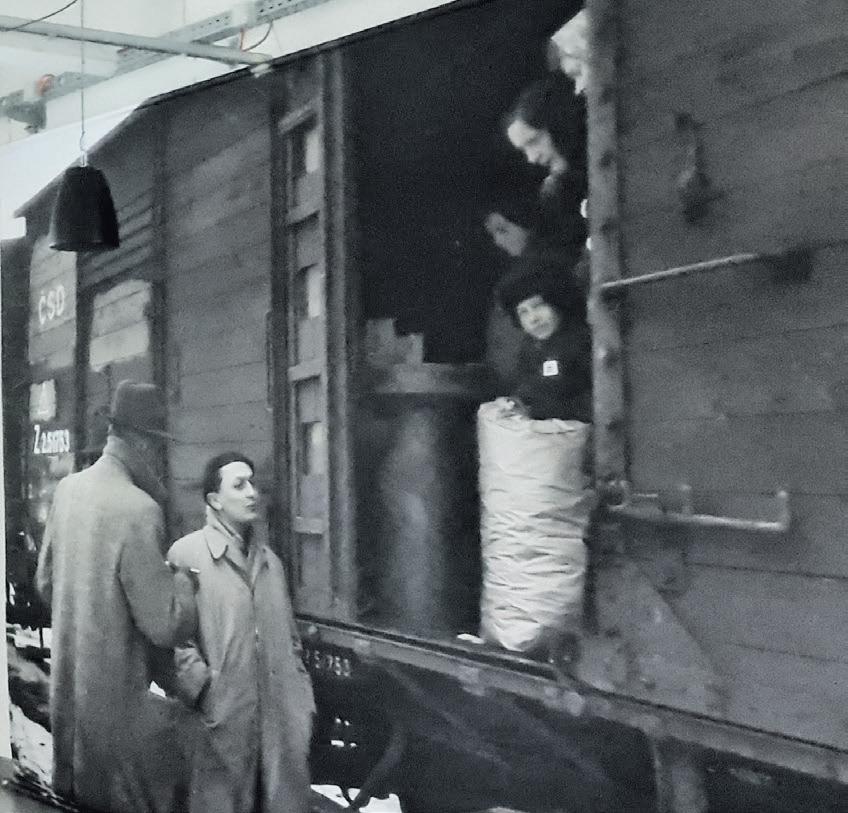












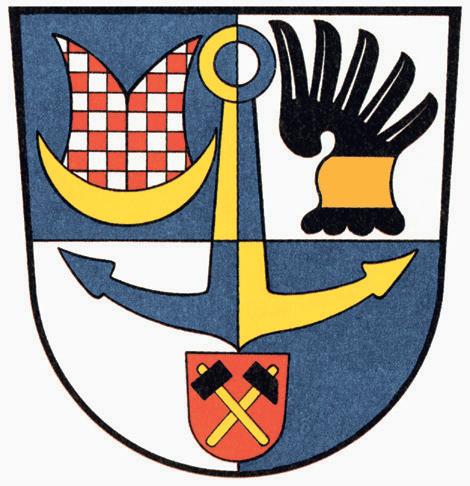
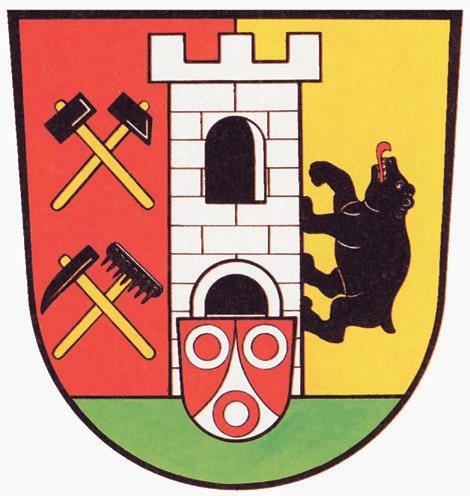




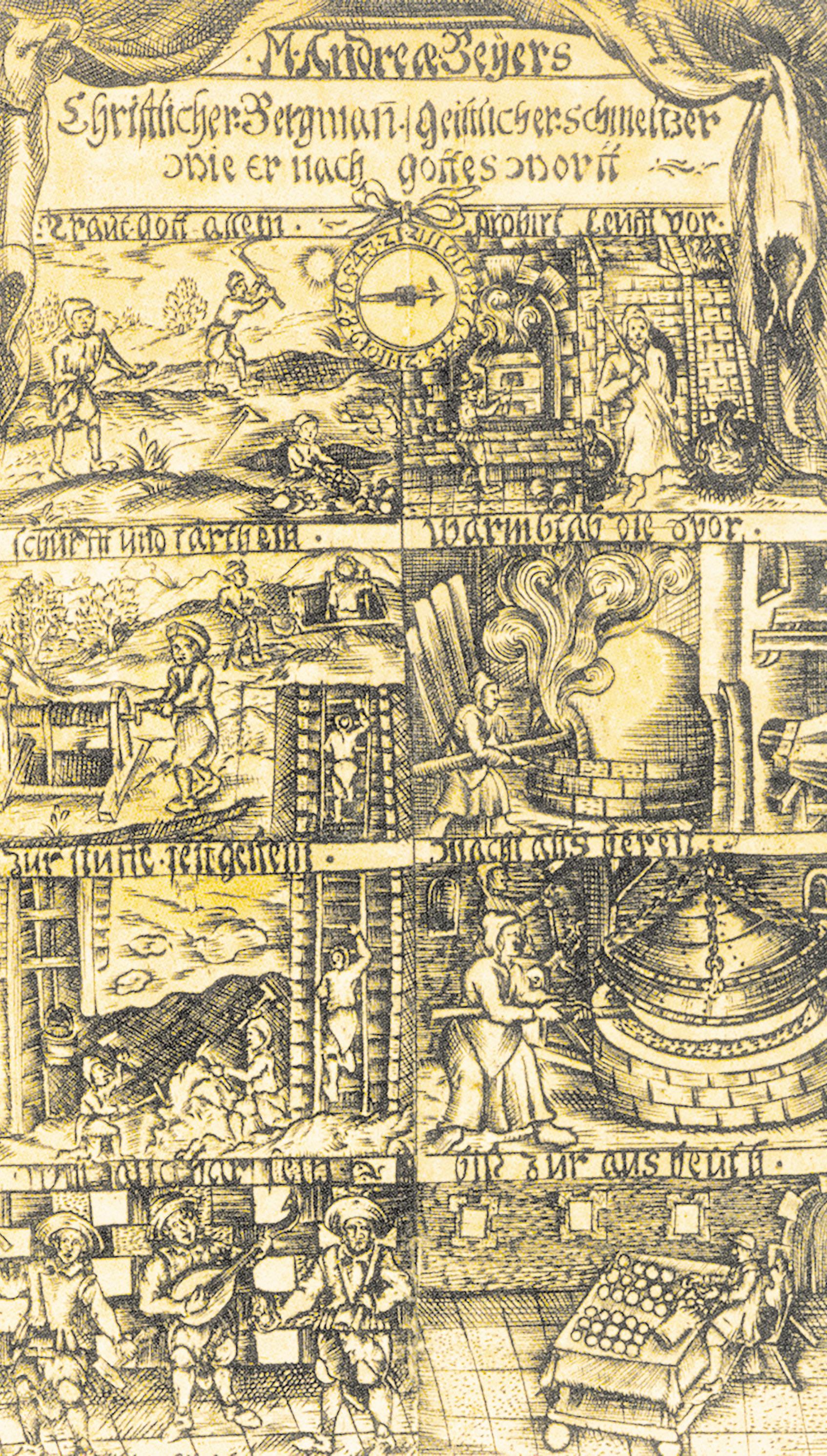
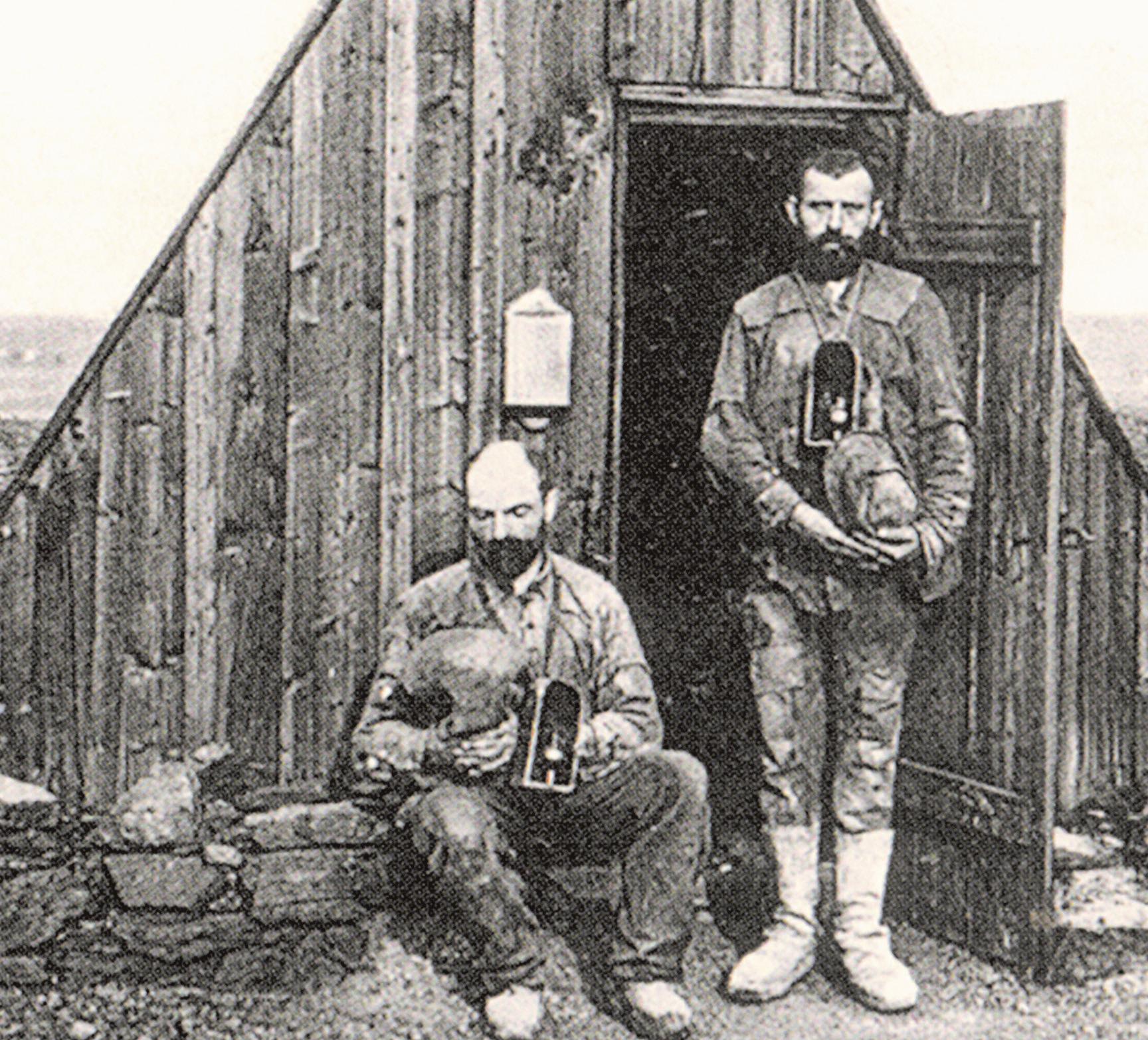
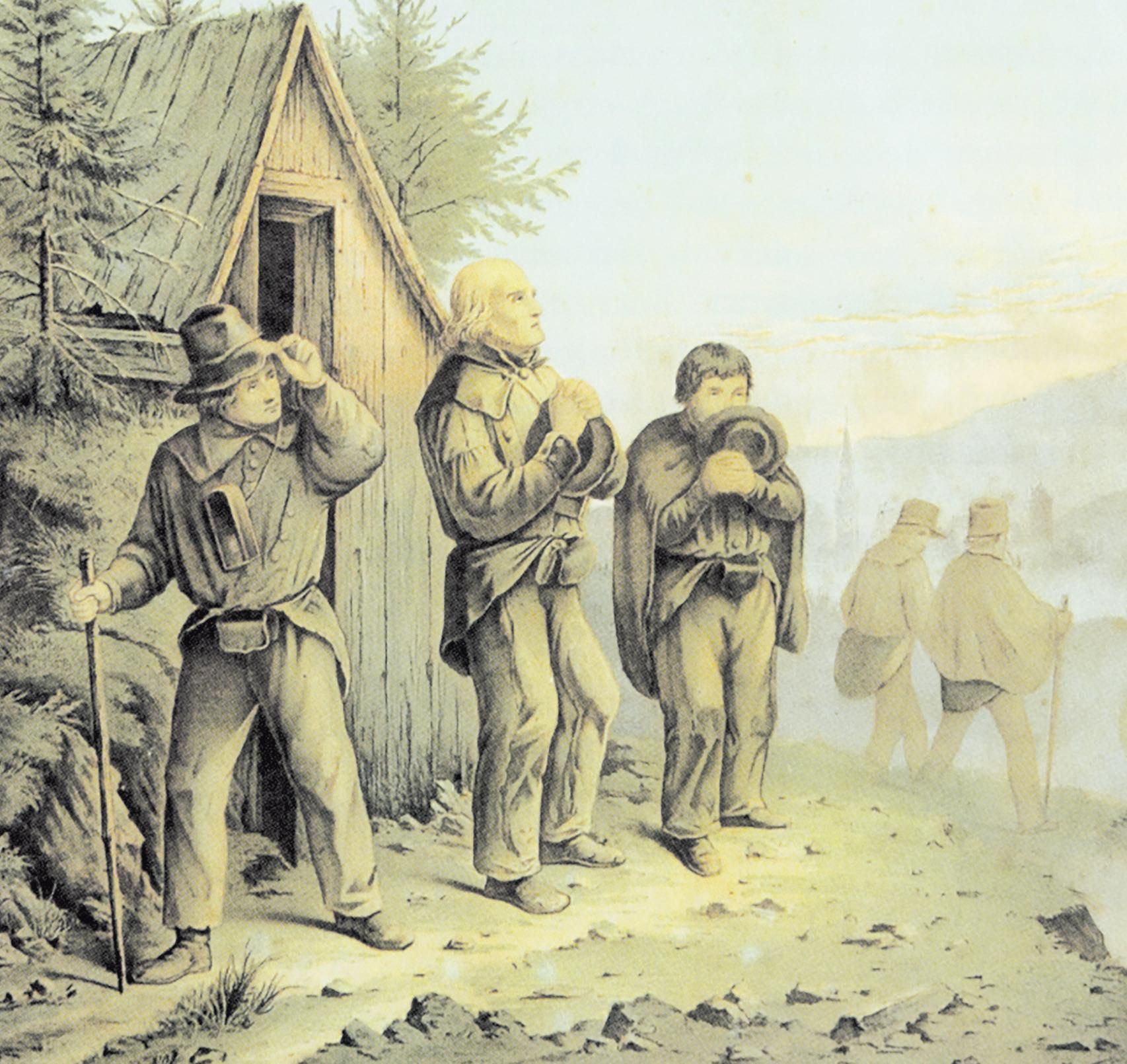
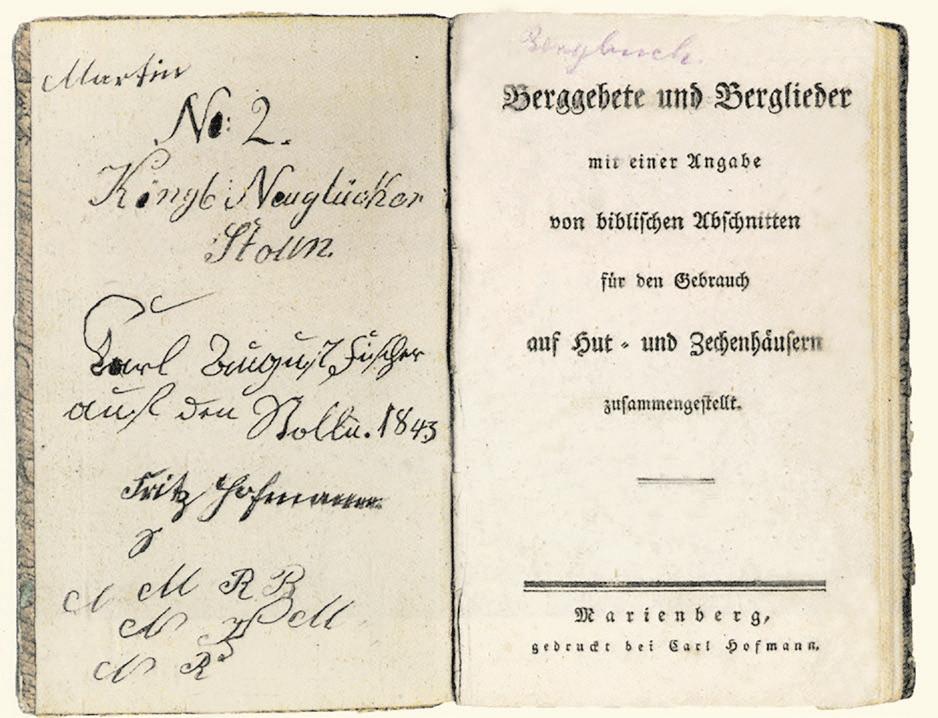







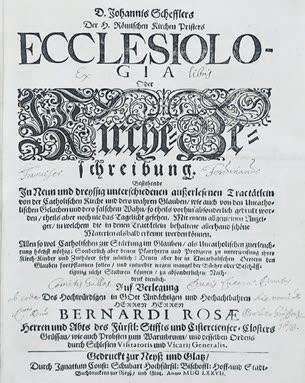

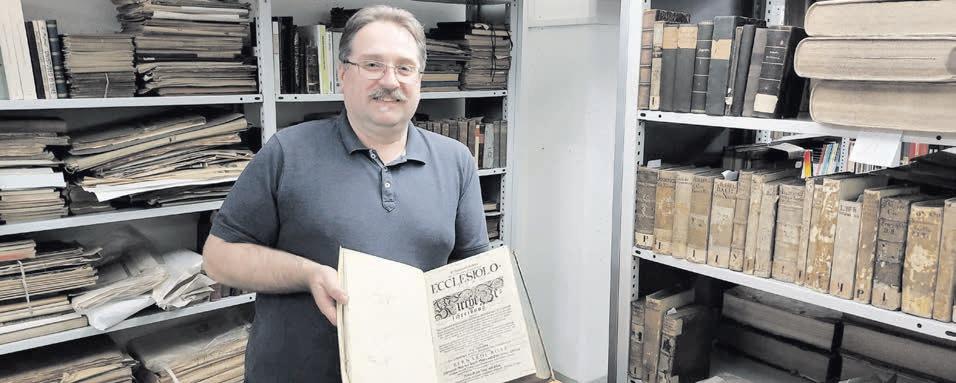







 Ein
Ein