mit Telefon
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Zum Jahresauftakt
Egerländer stark vertreten
Beim traditionellen Neujahrsgottesdienst der Vertriebenen in der Kirche St. Michael in München hat die Egerländer Gmoi z‘ Geretsried gemeinsam mit der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München und dem Iglauer Singkreis den „Chor der Sudetendeutschen“ gestellt (Bericht Seite 7).





In der ersten Ausgabe des Jahres sind die Egerländer auch in der Sudetendeutschen Zeitung stark vertreten. In dieser Woche erscheinen die neuen Heimatseiten der folgenden Titel: Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote, Egerer Zeitung, Der Egerländer, Falkenauer Heimatbrief, Elbogener Heimatbrief, Karlsbader Zeitung und Luditzer Heimatbrief. Viel Spaß beim Lesen.
Bundeskulturtagung 2022

Ehrungen Alte Weisen Neue Freunde mußte diese aus bekannten Gründen abge-rung einer Bundeskulturtagung im Eger--gesund, hoffentlich kommen alle Teilneh--vüa(r)staiha Volker Jobst zahlreiche Besu-Verpfändung des EgerlandesSchulunterricht völlig ausgeblendete The-Burg die Grenzburg. Herr Dr. Hamperl hob -
mit



Erbe fruchtbar machen Auch wir sind Wenzelskrone
besonderes Jahr: „50 Bundesjugendtreffen“Bundesjugendführung den Archiven -




Bundestreffen der Egerland-Jugend Revueten, die viele Treffen einmaliger Erin--tungen in Schulturnhallen und Klassenräu-----
die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
B 04053
Von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Heimatzeitung
Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaft liches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
überparteiliches
Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“ In eigener Sache! Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
Landkreis




vereinigt mit vereinigt mit 72. JAHRGANG Dezember 2022 FOLGE 11 66. JAHRGANG Jänner 2016 FOLGE
Fiala trickst Zeman aus


Petr Hladík soll neuer Umweltminister werden. Das hatte Premierminister Petr Fiala entschieden. Doch Staatspräsident Miloš Zeman weigert sich seit Wochen, den Politiker der KDU˜SL zu ernennen, weil er ihn für ungeeignet hält. Am Staatsoberhaupt vorbei übernahm Hladík jetzt dennoch die Führung des Umweltministeriums –als Staatssekretär.
Er habe größtmögliche Kompetenzen erhalten und werde das Ministerium im Kabinett und im Parlament sowie auf internationaler Ebene vertreten, erklärte Hladík nach der Berufung.
Pro forma steht an der Spitze des Umweltministerium weiterhin interimsmäßig Vizepremierminister und Arbeitsminister Marian Jure˜ka (KDU-°SL).
Die Regierung hatte Zemans Blockade in der Vergangenheit mehrfach als verfassungswidriges bezeichnet.
In wenigen Tagen wird in Prag für kurze Zeit die St.-WenzelsKrone öffentlich präsentiert, die sich normalerweise streng verschlossen in einer speziellen Kammer der St.-Wenzels-Kapelle im Veitsdom befindet und nur zu besonderen Anlässen herausgeholt wird. Dem müssen, entsprechend einer Verfügung des habsburgischen Kaisers Leopold II. in seiner Funktion als Böhmischer König, die sieben Schlüsselinhaber für den Schrein, in dem sie aufbewahrt wird, zustimmen. Dies sind heute der Staatspräsident, der Premierminister, der Prager Erzbischof, die Präsidenten des Abgeordnetenhauses und des Senats, der Dekan des Metropolitankapitels der St.-Veits-Kathedrale und der Oberbürgermeister der Stadt Prag. Schon die Zusammensetzung dieses Kreises zeugt von einer alten Geschichte, denn sie verbindet den sehr laizistischen tschechischen Staat in einer inzwischen sehr ungewöhnlichen Weise mit den Spitzen der hohen Geistlichkeit.
A


Die Wenzelskrone ist das Symbol für die Länder der Böhmischen Krone und wird nur zu besonderen Anlässen ö˜ entlich gezeigt.
anläßlich seiner Krönung 1347 in Auftrag, entschied, daß sie dem ersten Landespatron St. Wenzel geweiht sein sollte, und fügte in ihrem Zeichen endgültig Böhmen, Mähren und Schlesien zu einer Einheit zusammen.
Jahrzehnten an jedem Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten unseren nach Karl IV. benannten Europäischen Karls-Preis.

Erinnert sei etwa an den katholischen Reformtheologen Bernard Bolzano, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in moderner Form an die Idee eines übernationalen böhmisch-mährischschlesischen Landespatriotismus, wie er in der Wenzelskrone zum Ausdruck kommt, anknüpfen wollte.

Europa, Mitteleuropa und die Böhmischen Länder waren durch Nationalismus, totalitäre Ideologien, Krieg sowie kollektive Entrechtung und Vertreibung im 20. Jahrhundert Schauplatz eines beispiellosen Zerstörungswerkes. Hätte man vor hundert Jahren auf unseren Landsmann Richard Graf Coudenhove-Kalergi, den prophetischen Gründer der Paneuropa-Bewegung und ebenfalls Träger unseres KarlsPreises, gehört, wäre unserem Kontinent all dies erspart geblieben.
kehr nach Europa“ zum gemeinsamen Ziel von Tschechen und Slowaken erklärten. Havel hatte noch in der Umbruchzeit den Mut, den alles vergiftenden Kollektivschuld-Gedanken eindeutig zu verurteilen und die Vertreibung unserer Volksgruppe als „zutiefst unmoralische Tat“ zu brandmarken.
Seitdem gab es manchen schweren Rückschlag, aber auch viele Fortschritte, insbesondere in den letzten Jahren. In den letzten sechs Monaten hat die derzeitige tschechische Regierung eine vorbildliche EU-Ratspräsidentschaft ausgeübt, die bewies, daß man mit Mut nationalistische Vorurteile besiegen und Schatten der Vergangenheit überwinden kann. Es ist zu hoffen, daß die Wahl des tschechischen Staatspräsidenten, die unmittelbar bevorsteht, diesen Prozeß weiter voranbringt.
Dieser große Europäer aus dem im Westen des Heiligen Römischen Reiches verwurzelten Haus Luxemburg, dessen Mutter der tschechischen Gründerdynastie der P˛emysliden angehörte, der am französischen Hof erzogen wurde und sich zuerst in Italien als Statthalter seines Vaters bewährte, ist dieser wichtigsten Insignie der böhmischen Königswürde auf dreierlei Weise besonders verbunden: Er gab sie
nlaß dieser fünften Präsentation der Kroninsignien im 21. Jahrhundert ist wohl die friedliche Trennung der Tschechoslowakei und die anschließende Gründung der Tschechischen Republik durch Václav Havel vor 30 Jahren. Die letzte Zurschaustellung der Krone erfolgte 2016 anläßlich des 700. Geburtstages von Kaiser Karl IV.Das Reich der Heiligen Wenzelskrone war auch die Heimat unserer Vorfahren. Die Idee, die sie verkörpert, ist übernational und europäisch. Das kommt schon in der Gestaltung dieser kostbaren Staatsreliquie zum Ausdruck. Sie lehnt sich an Vorbilder aus der P˛emyslidenzeit an, in ihr wurde ein wertvoller goldener Gürtel aus dem damaligen französischen Königshaus verarbeitet, und an der Spitze des Kreuzes, das der Tradition nach einen Dorn aus der Dornenkrone Christi enthält, ist ein byzantinischer Saphir angebracht.
Die Präsentation läßt also eine Zeit lebendig werden, in der Prag und die Böhmischen Länder auch geistig und kulturell das Zentrum des christlichen Abendlandes als Vorläufer der europäischen Einigung waren. Ganz in diesem Geist verleihen wir seit
Dieser Kaiser schuf mit der Goldenen Bulle eine in ganz Mitteleuropa gültige, völkerverbindende Verfassungs- und Rechtsordnung. Er beherrschte fließend nicht nur seine deutsche Vaterund seine tschechische Muttersprache, sondern auch Französisch, Italienisch und Latein. Den deutschen Kurfürsten empfahl er, ihre Kinder ebenfalls mehrsprachig zu erziehen und dabei das Tschechische nicht zu vergessen, denn auch dieses gehöre zum Heiligen Römischen Reich, dessen Herrscher ihre Söhne in dieser Wahlmonarchie werden könnten.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht uninteressant, daß seit Jahren bei Meinungsumfragen auch junge Tschechen immer wieder erklären, Karl IV. sei die bedeutendste Persönlichkeit in der Geschichte ihres Landes gewesen. Hier gibt es für Tschechen wie für Sudetendeutsche noch manchen gemeinsamen Schatz zu heben.
Ende der 1940er Jahre gelang wenigstens im freien Westen Europas der Neuaufbruch, zu dem unsere Vorfahren mit dem Wiesbadener Abkommen zwischen Exiltschechen und Sudetendeutschen sowie mit der Charta der deutschen Heimatvertriebenen einen wesentlichen und einzigartigen Beitrag geleistet haben.
Vom Zeitgeist oftmals heftig attackiert, haben wir stets darauf hingewiesen, daß das europäische Einigungswerk keineswegs am Eisernen Vorhang, also am Böhmerwald enden darf, und unermüdlich für die Freiheit aller Europäer gekämpft.
Unter besonders großen Opfern taten dies unsere sudetendeutschen Landsleute in der damaligen DDR und jene, die in der kommunistischen Tschechoslowakei Widerstand gegen das Regime leisteten, ob sie tschechischer oder deutscher Zunge waren.
Ich war 1989 selbst dabei, als Hunderttausende von Demonstranten, mit Václav Havel an der Spitze, auf den Prager Burgberg zogen, den Rücktritt des kommunistischen Diktators Gustáv Husák forderten und die „Rück-
Noch gibt es viel zu tun, weshalb auf allen Seiten nicht Maulhelden, sondern konkrete Verständigungsarbeiter gebraucht werden. Unsere Landsmannschaft und deren Partner im tschechischen Volk haben in den letzten Jahren vor allem in der Wurzelheimat unserer Volksgruppe gezeigt, daß wir dazu bereit und fähig sind. In zweieinhalb Jahren begehen wir nicht nur den 80. Jahrestag von Kriegsende und Vertreibung, sondern auch den 120. Jahrestag jenes Mährischen Ausgleiches von 1905, mit dem unsere Ahnen damals das bis heute beste Modell der Lösung eines Nationalitätenkonflikts entwickelt haben. Die kurze Zeit bis dahin müssen wir nutzen, um in wesentlichen Punkten weitere Annäherungen zu erzielen, die als Startbahn für eine bessere Zukunft dienen können. Die Rückkehr von Krieg und Nationalismus direkt vor unserer Haustür mahnt, diese Aufgaben gemeinsam anzugehen, ganz im Sinne des Mottos unseres Sudetendeutschen Tages zu Pfingsten in Regensburg: „Schicksalsgemeinschaft Europa“.
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Wie sieht das einst vortre˜liche Palais Elbe in der Národní 27 (Ferdinandstraße) heute aus?
Der Sitz der früheren deutschen Versicherung Elbe wirkt zwischen den beiden größeren Gebäuden etwas in den Hintergrund gedrängt. Sein Erbauer Arthur Payr wurde 1880 in Bregenz geboren, studierte Architektur in München und später in Wien. Von 1917 bis zu seinem Tod 1937 war er Professor für Architektur an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag und
dort gleichzeitig auch Dekan der Fakultät für Architektur. Nach seinem Tod am 25. Februar 1937 verö˜ entlichte das Sudetendeutsche Jahrbuch einen Nachruf auf ihn. Begraben wurde Payr auf dem Evangelischen Friedhof in Prag-Straschnitz. Der begabte Architekt war Mitglied der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik. Er engagierte sich auch politisch und kandidierte in der Parlamentswahl im Jahr 1920 für die Deutschdemokratische Freiheitspartei. Seine Werke können wir auch außer-
Freispruch im Endspurt: Babiš bleibt im Rennen

Das berühmte Kinderspiel „Die Reise nach Jerusalem“ läßt grüßen. Von 21 Bewerbern um das Amt des Staatspräsidenten wurden nur neun zur Wahl zugelassen. Einer davon, Gewerkschaftschef Josef St˜edula, warf bereits das Handtuch, da seit Wochen nur drei Kandidaten laut Meinungsumfragen realistische Chancen haben. Da waren es nur noch acht. An diesem Wochenende nähert sich „Die Reise in die Prager Burg“ dem nächsten Höhepunkt: zwei Stühle für drei Kontrahenten.
Professorin Dr. Danuše Nerudová, General Petr Pavel und Ex-Premierminister Andrej Babiš liegen vor dem ersten Wahlgang annährend gleich auf. Keiner der Kandidaten hat eine realistische Chance, im ersten Durchgang über 50 Prozent der Stimmen zu erzielen und damit direkt Nachfolger von Staatspräsident Miloš Zeman zu werden.

Sicher ist nur, daß einer der drei Kandidaten an diesem Wochenende der große Verlierer sein wird und nicht in die Stichwahl einzieht, die am 27. und 28. Januar stattfindet.
Besonders spannend dürfte das Abschneiden von Ex-Premierminister Andrej Babiš werden. Der Multi-Milliardär hatte bis zum Schluß gezögert, überhaupt ins Präsidentschaftsrennen einzusteigen, nachdem der alte Korruptionsfall „Storchennest“ neu aufgerollt worden war (Sudetendeutsche Zeitung berichtete mehrfach). Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage und forderte drei Jahre Gefängnis für Babiš.
Am Montag, kurz nach neun Uhr, sorgte dann das Prager Gericht für eine Sensation: Babiš
und seine mitangeklagte Geschäftspartnerin wurden freigesprochen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft kann noch Berufung einlegen. Dennoch: Mit diesem Freispruch im Wahlkampf-Endspurt bleibt Babiš im Rennen um das Präsidentenamt.
Der Ano-Chef schaltete deshalb sofort in den Angriffsmodus und warf seinen Gegnern vor, die aus seiner Sicht haltlosen Vorwürfe seit Jahren für Wahlkampfzwecke zu mißbrauchen. „Für meine Familie und mich war dies ein großes Trauma. Sechs
Jahre lang mußten wir gegen Unwahrheiten und falsche Informationen ankämpfen. Darum bin ich froh, daß das Gericht die Argumente meiner Verteidigung anerkannt hat“, so Babiš.
Noch vor dem Freispruch gingen die meisten Wahlbeobachter davon aus, daß Babiš zwar der Sprung in die Stichwahl gelingen werde, aber daß der Ano-Populist dann gegen Danuše Nerudová beziehungsweise General Petr Pavel, die beide von der politischen Mitte unterstützt werden, unterliegt.


Doch mit dem Freispruch könnte sich das Blatt endgül-
tig wenden. Es wird in jedem Fall eng. General Petr Pavel, der lange in den Umfragen geführt hatte, ist bereits wegen seiner früheren Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei ins Straucheln geraten, vor allem wegen seiner hilflos wirkenden Entschuldigungen.
Und Danuše Nerudová dürfte mit ihrem flapsig-ironischen Spruch „Ich bin eine Frau, jung, und gut aussehend. Das ist mein größtes Handicap“ insbesondere viele ältere Wählerinnen vor den Kopf gestoßen haben. Fakt ist, daß die ohne Frage attraktive Hochschullehrerin in den vergangenen Wochen Boden gegenüber ihren beiden männlichen Konkurrenten verloren hat.
So sagt das Institut Ipsos 28,6 Prozent für Babiš, 27,8 Prozent für Pavel und nur 24,6 Prozent für Nerudová voraus. Laut Institut Median liegt Pavel mit 29,5 Prozent in Führung, Babiš folgt mit 26,5 Prozent auf Platz zwei und Nerudová ist mit 21 Prozent nur auf Rang drei.

Sowohl Pavel als auch Nerudová haben, und diese Karte spielt Babiš seit Wochen, keine politische Erfahrung – was in diesen schwierigen und fordernden Zeiten ein echtes Manko in der Stichwahl werden dürfte, zumal Babiš keine Scheu hat, komplexe Sachverhalte auf einen populistisch-einfachen Nenner zu bringen. So tourte der Milliardär im Sommer, als die Megakrise aus Krieg in der Ukraine, Millionen an Flüchtlingen, drohender Energieknappheit und galoppierender Inflation Fahrt aufnahm, mit einem einfachen Spruch auf seinem Wohnmobil durchs Land: „Unter Babiš war alles besser.“
Pavel Novotny/Torsten Fricke
Deutlich weniger Gas verbraucht
Der Gasverbrauch in Tschechien ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 um 19,2 Prozent zurückgegangen. Bereinigt um den Einfluß des ungewöhnlich milden Winters und weiterer Faktoren handelt es sich um Einsparungen in Höhe von 12,9 Prozent, hat das AnalyseUnternehmen Amper Meteo ermittelt.
Ratspräsidentschaft war „ein Erfolg“
In einem Interview mit dem englischsprachigen Dienst von Radio Prag hat der tschechische Außenminister Jan Lipavský (Piraten) ein positives Fazit nach der sechsmonatigen tschechischen EU-Ratspräsidentschaft gezogen. Lipavský: „Wir haben Europa gezeigt, daß wir ein konstruktiver Partner sind. Wir haben Fähigkeiten als Manager bewiesen, sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben einige wichtige Kompromisse erzielt. Vor allem die Sanktionen gegen Rußland oder die Debatte über die Energiesicherheit und die Energiekrise, die Wladimir Putin zu verantworten hat, waren heiße Eisen. Wir haben die EU durch diese Probleme hindurchgelotst, genau das war unsere Rolle.“
Neue Stimme in den Trambahnen
den im aktuellen Jahr nicht in der Schule zu Mittag essen können. Im Jahr 2022 mußte nur jedes achte Kind auf das Mittagessen verzichten. Dies teilte am Montag die Nichtregierungsorganisation Women for Women mit. Die Organisation zahlt bedürftigen Kindern in Tschechien das Schulessen. Wie Women for Women in einer Pressemitteilung informierte, gehe man davon aus, in diesem Jahr die Kosten für das Mittagessen von bis zu 20 000 Schülern zu übernehmen. Laut Bildungsministerium kostet ein Mittagessen in der Schulkantine aktuell im Schnitt 34 Kronen (1,40 Euro).
Zeman setzt auf China
Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman hat am Montag mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping telefoniert. Die beiden Staatsoberhäupter hätten über die Beziehungen zwischen beiden Ländern und die Stellung tschechischer Unternehmen am chinesischen Markt gesprochen, sagte Zemans Sprecher. China könne Zeman zufolge eine zentrale Rolle bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine spielen. Präsident Zeman unterstützt seit langem eine intensive Zusammenarbeit mit dem asiatischen Land. Hierfür wird das tschechische Staatsoberhaupt angesichts der Menschenrechtsverletzungen in China oft kritisiert.
S
eit Montag sind in den Prager Trambahnen neue Ansagen zu hören, welche vom Schauspieler Jan Vondrá°ek eingelesen wurden. Vondrá°ek war bei einer Abstimmung unter den Fahrgästen als neue Stimme der Verkehrsbetriebe gewählt worden. Der Schauspieler und Synchronsprecher löst Dagmar Hazdrová ab, die fast 30 Jahre lang den Prager Verkehrsbetrieben ihre Stimme geliehen hat. Ab dem Frühjahr soll Vondrá°eks Stimme auch in den Prager Bussen zu hören sein. Insgesamt müssen über 10 000 Ansagen neu eingesprochen werden.
Hungern in der Schule
Jedes sechste Kind in Tschechien wird aus finanziellen Grün-
Arbeitslosenquote steigt leicht an
D
ie Arbeitslosigkeit ist im Dezember in Tschechien auf 3,7 Prozent angestiegen. In den drei vorherliegenden Monaten hatte der Wert bei 3,5 Prozent gelegen. Darüber informierte am Montag das tschechische Arbeitsamt. Verschiedenen Analysten zufolge sei der leichte Anstieg der Arbeitslosenquote zu erwarten gewesen, da im Dezember viele Saisonarbeiter ihre Arbeit verlieren würden und zahlreiche Arbeitsverträge endeten. Am höchsten war die Arbeitslosigkeit im Dezember vergangenen Jahres im Kreis Aussig mit 5,5 Prozent. Im Kreis Mährisch-Schlesien hatten 5,1 Prozent der Menschen keine Anstellung.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Widmar Hader hat nicht nur Musikgeschichte geschrieben – wobei vieles, wie sein gewaltiges Opus „Jan Hus“, noch einer umfassenden Würdigung bedarf –, sondern auch sudetendeutsche, mitteleuropäische und europäische Geschichte.
Knapp zwei Monate nach der Samtenen Revolution in Prag veranstaltete der Conservative Council on Central and Eastern Europe, der viel zur Unterstützung der tschechischen und der polnischen Widerstandsbewegung gegen den Kommunismus getan hat, gemeinsam mit der so-
Im 82. Lebensjahr ist der bedeutende sudetendeutsche Komponist, Musikpädagoge, Chor- und Orchesterleiter sowie Direktor des von ihm 1990 initiierten Sudetendeutschen Musikinstituts Widmar Hader am Abend des Dreikönigstags in Regensburg im Kreise seiner Familie für immer eingeschlafen.
Noch im November vergangenen Jahres konnte er in Regensburg im Festsaal des Bezirks Oberpfalz die Pro-Arte-Medaille der KünstlerGilde für sein Lebenswerk entgegennehmen. Viele Auszeichnungen für sein Schaffen erhielt er in seinem Leben. So schon 1961 den Sudetendeutschen Kulturpreis für Musik, 1975 den Förderpreis des Johann-Wenzel-Stamitz-Preises, dann 2011 den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis selbst, 1980 die Adalbert-Stifter-Medaille, 1988 den Südmährischen Kulturpreis und schließlich 1996 den Großen Sudetendeutschen Kulturpreis. Er wurde 1987 in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste berufen, deren Vizepräsident er war und mit deren Pro-meritis-Medaille sie ihn ehrte.

Der am 22. Juni 1941 in Elbogen im Egerland geborene Wid-
� Sonntag, 29. Januar Requiem
für Widmar Hader

Am Sonntag, 29. Januar 2023, findetum 15.00 Uhr in St. Vitus in Regensburg (Ludwig-Thoma-Straße 14) ein Requiem für Widmar Hader statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind.
mar Hader kam mit seiner Familie nach der Vertreibung nach Bad Reichenhall, wo er eine erste musikalische Ausbildung erhielt und das Abitur machte. Musik studierte er in Salzburg am Mozarteum und in Stuttgart an der dortigen Musikhochschule, wo er 1965 mit der künstlerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien abschloß. Es schlossen sich noch zwei Jahre in München an, wo er Politologie und Philosophie am Geschwister-Scholl-Institut der LMU studierte, unter anderem bei Professor Hans Maier, und 1967 mit der wissenschaftlichen Prüfung zum Lehramt für Gymnasien seine Studien beendete.
Von 1968 bis 1990 in Stuttgart war er tätig als Komponist, Musikpädagoge, Chor- und Orchesterleiter sowie als Dozent für Tonsatz und Gehörbildung an der Kirchenmusikschule Rottenburg. Aber auch in anderen künstlerischen Unternehmungen engagierte er sich. So leitete er von 1973 bis 1992 die Südmährische Sing- und Spielschar, die jährlich stattfindendenSudetendeutschen Musiktage im niederbayrischen Kloster Rohr und gründete 1990 die Elbogener Orgelfeste, die bis 2005 stattfanden. Überall führte Hader vor allem böhmische, mährische und sude-


Komponist der Zukunft
eben legalisierten, vorher verbotenen tschechischen PaneuropaUnion einen Kongreß in Prag.
Daran nahmen so berühmte Persönlichkeiten wie die spätere amerikanische Außenministerin Madeleine Albright, Fürst Karl Schwarzenberg, der Vorsitzende der slowakischen Christdemokraten und neue Vizepremier der Slowakei, Ján Čarnogurský, Präsidentenbruder Ivan Havel und Rudolf Kučera teil, der den paneuropäischen Flügel der Charta 77 leitete und die bis-
her illegale Zeitschrift Střední Evropa(Mitteleuropa) herausgab.
Zu den Eingeladenen zählte auch ich und wurde gebeten, jemanden aus der Sudetendeutschen Landsmannschaft mitzubringen, in der ich damals noch keine höhere Funktion hatte, aber mich europapolitisch engagierte. Die Wahl fielauf Widmar Hader, weil er als großer Musiker Barrieren überwinden konnte und als kluger Diplomat bekannt war.
Schon in den ersten Stunden
dieses sehr illustren Prager Kongresses im „Savarin“ am Graben freundete er sich mit dem tschechischen Hauptveranstalter Marian Švejda an, und die beiden beschlossen, in den Sommerferien die von der Zerstörung bedrohte Kirche im nordböhmischen Gersdorf sowie den Friedhof im benachbarten Böhmisch Kamnitz in Eigenarbeit zu erneuern.
Daran beteiligten sich die von Widmar Hader zu internationaler Berühmtheit geführte Südmähri-
sche Sing- und Spielschar sowie die tschechische Einwohnerschaft der Gemeinden. Dies war das erste tschechisch-sudetendeutsche Gemeinschaftsprojekt seit der Vertreibung, dem viele hundert weitere folgen sollten.
Widmar Hader war eben nicht nur musikalisch ein Pionier, sondern auch auf dem Gebiet der Verständigung. Durch seine doppelte Verwurzelung in Südmähren und im Egerland, wo er die Elbogener Orgeltage begründete, sowie durch seinen immer
„Für eine bessere Welt durch die Musik und mit der Musik“
weiter fortgesetzten Einsatz in Nordböhmen deckte er die ganze Volksgruppe in dem Bestreben ab, Harmonie und Gleichklang zu schaffen, wo Disharmonien jahrzehntelang grausame Schäden angerichtet hatten. Dieser überzeugte Christ, Sudetendeutsche und Europäer hat uns alle geprägt, unterstützt von seiner großartigen Frau sowie seinen Kindern und Enkeln, die sein ganzer Stolz waren und sich ebenfalls in unserer Gemeinschaft engagieren.
Lieber Widmar, wir sind Dir zutiefst zu Dank verpflihtet und mit Dir und Deiner Familie im Gebet verbunden! Dein Werk ist groß und wird aus dem Abstand der Jahre immer größer werden.
tenschlesische Komponisten auf. Aber auch eigene Kompositionen waren Gegenstand von Tourneen Haders als Dirigent durch europäische Staaten, Israel, Brasilien und die USA.
Krönung seines Lebens für die Musik war sicherlich die Leitung des von ihm initiierten Sudetendeutschen Musikinstituts (SMI) in Regensburg, an dessen Spitze er von der Gründung 1991 bis 2006 stand. Unter seiner Herausgeberschaft entstand im Jahre 2000 das zweibändige Lexikon der deutschen Musikkultur in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Be-

reits 1995 bahnte das SMI eine enge Kooperation mit dem Musikwissenschaftlichen Institut der Masaryk-Universität in Brünn an, weitere Kooperationen mit den Universitäten in Olmütz und Ostrau sowie mit der Tschechischen Akademie der Wissenschaften folgten.
Haders Kompositionen beziehen sich häufigauf Gegebenheiten der böhmisch-mährischen Historie und Kultur. Er vertonte sudetendeutsche Autoren und schuf zum Libretto von Rudolf Mayer-Freiwaldau die Oper „Jan Hus“ – ein Mammutwerk, dessen komplette Uraufführung
noch nicht in Angriff genommen wurde. Nur Teile wurden bisher öffentlich aufgeführt.
Der Nachruf auf Widmar Ha-
der von Andreas Meixner in der Mittelbayerischen Zeitung für die Stadt Regensburg gibt einen charakteristischen Ton der Per-
sönlichkeit, die von uns gegangen ist: „Das persönliche Erleben und Wirken in einer nach den Kriegswirren neu aufblühenden und sich entwickelnden Kulturlandschaft machten aus Widmer Hader einen stets zugewandten und freundlichen Menschen, der sich der hohen persönlichen Verantwortung in der Gesellschaft nach 1945 bewußt war und sein künstlerisches, erzieherisches sowie kulturpolitisches Streben danach ausrichtete – für eine bessere Welt durch die Musik und mit der Musik. Das ist sein großer bleibender Verdienst, über den Tod hinaus.“
In vielen Facetten seines Wirkens folgte ihm sein Sohn Wolfram Hader, der 2004 den Laurentius-Musikverlag in Frankfurt am Main gründete, ob in der Leitung der Südmährischen Singund Spielschar, die seit 2005 Moravia Cantat (Mähren singt) heißt, oder in der Berufung zum ordentlichen Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, wo er seit 2019 Sekretär der Klasse der Künste und Kunstwissenschaften ist.
In seiner Familie lebt der engagierte sudetendeutsche Musiker und Pädagoge fort.

Konzert am 21. Januar
Der Eintritt ist frei – das Programm Weltklasse: Das berühmte Wihan Quartett aus Prag gibt am Samstag, 21. Januar, im Sudetendeutschen Haus (Hochstraße 8) ein Neujahrskonzert. Beginn ist um 19.00 Uhr.
Als Interpret der tschechischen Komponisten sowie der klassischen, romantischen und modernen Meisterwerke des Streichquartett-Repertoires hat das Wihan Quartett einen erstklassigen Ruf. So bezeichnete das renommierte Fachmagazin International Record Review die vier Prager Künstler als „eines der besten Quartette der Welt“.

Spurensuche auf dem Heiligenhof
Das Thema Flucht und Vertreibung ist auch über 70 Jahre nach Kriegsende hochaktuell. Neben den Opfern von damals stehen immer stärker die Generationen der Nachgeborenen im Fokus. Was beschäftigt die Kinder und Enkel der Vertriebenen? Welche Hilfen erfahren sie bei der Suche nach ihrer Identität?
Hilfsangebote bietet der Heiligenhof in Bad Kissingen. Die sudetendeutsche Bildungs- und Begegnungsstätte lädt gemeinsam mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft vom 3. bis 5. Februar zum Seminarwochenende ein. Zielgruppe sind insbesondere die Nachgeborenen der Vertriebenen, die ihren böhmischen, mährischen oder schlesischen Wurzeln nachspüren oder
■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. Vom 24. Dezember bis 8. Januar geschlossen. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Samstag, 14. Januar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: Bericht von der Fahrt nach Aussig und Tetschen im Oktober 2022. Vortrag von Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 21. Januar, 13.00 bis 15.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum, Workshop im Winter: „Es schneit!“ Gemeinsam entdecken Kinder und Familien glitzernde Winterwelten und gestalten mit Nadja Schwarzenegger eigene Schneekugeln. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. Anmeldung per eMail an anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau: Neujahrskonzert mit dem Wihan Quartett aus Prag. Eintritt frei (siehe oben). Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 27. Januar, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel, Wien. Anmeldung an eMail sekretariat@vloe.at
■ Samstag, 28. und Sonntag, 29. Januar, Bund der Egerländer Gmoi: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fi-
etwas über Kultur und Geschichte der Sudetendeutschen erfahren und sich mit Landsleuten austauschen möchten.
Das Programm: ■ Freitag, 3. Februar 2023 18.00 Uhr: Abendessen.
19.00 Uhr: Begrüßung, Vorstellungsrunde, Einführung in das Seminarthema, Abfrage der Erwartungen. Moderation: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor, Bad Kissingen und Hildegard Schuster, Referentin für Presseund Öffentlichkeitsarbeit, München.
19.30 Uhr: Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen. Referent: Werner Honal, Studiendirektor i. R., Philologe, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher, Unterschleißheim.
■ Samstag, 4. Februar 2023
9.00 Uhr: Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung. Referent: Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe und Medienpädagoge, Maintal.
10.45 Uhr: Das Internet als neue Heimat? Chancen und Möglichkeiten zum Aufbau digitaler sozialer Netzwerke. Referent: Mathias Heider, Historiker, München (online).
14.00 Uhr: Die Unesco und das Weltkulturerbe Bad Kissingen: Die Sicherung der Vergangenheit für die Zukunft im Rahmen einer grenzübergreifenden Kooperation, Stadtführung durch Bad Kissingen. Referent: Gustav Binder, HpM, Bad Kissingen.
19.30: Uhr Film „Kde domov muj“ (Wo ist meine Heimat?) von Ond˜ej Valchᘠmit anschlie-
kentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Samstag, 28. Januar, Sudetendeutscher Rat: Plenum. Programm und Örtlichkeiten folgen.
■ Samstag, 28. Januar, 15.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.
■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen unter www.jiz50.cz
■ Mittwoch, 15. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové M˜sto na Morav˜).
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard
Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.
■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad.
■ Sonntag, 7. Mai: Volkswa-

ßender Diskussion. Referent: Dr. Günter Reichert, Präsident a.D. der Bundeszentrale für politische Bildung, Bad Honnef.
■ Sonntag, 5. Februar 2023 9.00 Uhr: Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie. Referent: Dr. Raimund Paleczek, Historiker, München 11.30 Uhr: Seminarauswertung und Ergebnissicherung. 12.30 Uhr: Mittagessen und anschließend Abreise.
Die Seminargebühr beträgt bei voller Verpflegung für das gesamte Wochenende 80,00 Euro im Doppelzimmer (plus 3,90 Euro Kurtaxe sowie gegebenenfalls 20,00 Euro Einzelzimmerzuschlag für zwei Nächte).
Anmeldungen per eMail an: info@heiligenhof.de oder schuster@sudeten.de
gen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.
■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské náb˜. 306, Holešovice, Prag.
■ Samstag, 17. Juni, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf und SL-Stadtkreis Stuttgart: Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft Stadtkreis Stuttgart und OG StuttgartWeilimdorf mit Prof. Birgit Keil. Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn.
Die Weiße Rose
■ Samstag, 21. Januar 2023, 16.00 bis 18.00 Uhr: Online-Seminar „Die Widerstandsgruppe Weiße Rose – Vorstellung eines Geschichtsprojekts“. Gespräch
„Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den Ihr um euer Herz gelegt habt.“ Die Widerstandsgruppe um Hans und Sophie Scholl (Foto) lief Sturm gegen die grausamen Verbrechen des NS-Regimes. Angetrieben von tiefem Mitgefühl für die Opfer schrieben sie Flugblätter, die teilweise auch heute noch nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Insgesamt waren an den Aktionen der Weißen Rose weit über 50 Personen beteiligt. Im Vortrag wird der Referent auf einzelne Mitglieder der Weißen Rose näher eingehen und einzelne Flugblätter genauer unter die Lupe nehmen.





Registrieren Sie sich bitte unter https://zoom.us/meeting/register/ tJIkcuiqqT8sGNVtuz2Lv4l96WSIUvRCUX1x
Den Link finden Sie auch unter www.heiligenhof.de
Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting.
Fragen und Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47
info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
Kirchenburgen in Siebenbürgen
■ Dienstag, 17. Januar 2023, 19.00 Uhr: Podiumsdiskussion „Zukunft der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft“. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Die Veranstaltung zur Situation der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft richtet sich an eine interessierte Öffentlichkeit sowie an Akteure aus Gesellschaft und Politik mit Bezug zu Siebenbürgen.
Bei der international besetzten Veranstaltung werden Fachleute und Entscheidungsträger aus Rumänien und Deutschland über den Zustand des deutschen Kulturerbes in der Region sowie über Wege eines möglichst effektiven und langfristigen Erhalts diskutieren.
Der für seine Arbeit an historischen Gebäuden für Architekturpreise nominierte

Hermannstädter Architekt Tudor Pavelescu wird zur Einführung ein Impulsreferat über seine Arbeit an Kirchenburgen, unter anderem im Rahmen des „Dächerprogramms 2022“ der Stiftung Kirchenburgen, halten.
Grußwort: Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien.
Podiumsteilnehmer: Dr. Konrad Gündisch (Historiker), Friedrich Gunesch (Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kirchenburgen), Rainer Lehni (Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.) Moderation: Dr. Iris Oberth (Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen e.V.).
Anmeldung erforderlich telefonisch unter (0 89) 4 49 99 30 oder per eMail an poststelle@ hdo.bayern.de



„Eine Liebe, die den Verzicht der Wahrheit voraussetzt, ist keine Liebe“
Von Prof. Dr. Stefan SamerskiIn den letzten Tagen sind zahlreiche Nachrufe und Würdigungen über den Papst aus Deutschland, Benedikt XVI., erschienen. Sie sind so unterschiedlich wie die jeweiligen Perspektiven der Autoren. Aus der Sicht eines Papsthistorikers seien hier nur einige Bemerkungen gestattet.
Schaut man auf die enorme Lebensleistung des Menschen, des Gelehrten, des Bischofs und des Papstes, gibt es zunächst und vor allem Grund, dankbar zu sein. Unzählige erinnern sich an Begegnungen mit einem stets ruhigen, aufmerksamen, zuhörenden und klugen Geistlichen, der sein Gegenüber immer als Person und Geschöpf Gottes wahrnahm.
Mir persönlich, der ihn in den 1990er Jahren häufiger im Vatikan getroffen hatte, bleibt er als ganz bescheidener, wohlwollender, sich selbst zurücknehmender Kardinal in Erinnerung, mit dem man über alle Fragen der Kirche und der Kultur mit Gewinn sprechen konnte. Er brillierte nicht nur in den unterschiedlichen theologischen Disziplinen, sondern auch auf den Gebieten der Kunst, Literatur und Musik. Auch dort verfügte er über profunde Kenntnisse, die er auf den Punkt bringen konnte. Oft liegt Brillianz, vor allem aber tiefes Verständnis, gerade in der Kürze! Die Bedeutung seines reichen theologischen Schrifttums wird mit den Jahren noch wachsen. Er hat es immer verstanden, vom Menschen auszugehen und jedem Einzelnen Orientierung geben zu wollen. Sein Medium war das Wort, das sich besonders als Papst an jeden richtete und jeden erreichen woll-
te. Da er in geschichtlichen Dimensionen denken konnte, waren ihm Brüche und Abbrüche nicht willkommen. Das gehört auch zum Hintergrund für etliche seiner Entscheidungen als Kardinal und Papst.
Joseph Ratzinger hatte zwar nicht Flucht, Vertreibung oder Heimatverlust erleiden müssen, fand sich aber sehr einfühlsam in dieses Schicksal ein. Mehrfach hob er als Erzbischof von München und Freising etliche Heilige aus dem deutschen Osten hervor, indem er sie als Brückenbauer und Patrone der Einheit von Ost und West würdigte, wie etwa Hedwig von Schlesien, Dorothea von Montau (unweit Danzigs), Maximilian Kolbe, Johannes von Nepomuk und Johann Nepomuk Neumann. „Das kostbarste Erbe der Heimat ist der Glaube. Wo er lebt, da ist die Heimat unverloren“, so der Kardinal 1979. Gerade Johannes von Nepomuk, der nicht nur auf der Brücke steht, sondern auch eine Brücke zwischen beiden Völkern sein will, habe „das Beste böhmischen Wesens verkörpert“. Denn die Kirche ist weder lateinisch noch griechisch noch slawisch, sondern katholisch – so sein Vorgänger im Ersten Weltkrieg, Papst Benedikt XV. Versöhnung, Verbindung brauchen aber den Geist der Wahrheit.
„Eine Liebe, die den Verzicht der Wahrheit voraussetzt, ist keine wahre Liebe“, so der damalige Kardinal Ratzinger. So zeigt sich der heimgegangene Pontifex Maximus auch hier als der gute Hausvater, der aus seinem reichen (theologischen und kulturellen) Schatz Altes und Neues hervorholt (Mt. 13,52).

Das Grab von Benedikt XVI.
Zahlreiche Päpste haben in den Vatikanischen Grotten unter dem Petersdom die letzte Ruhe gefunden – jetzt auch der am 31. Dezember 2022 verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI.
Der Vatikan hat die letzte Ruhestätte für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Über seinem Grab, bedeckt mit einer weißen Marmorplatte mit seinem Namen, ist eine steinernes Relief an der Wand angebracht.
Bernd Posselt: „Segensreiche Einrichtungen“
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, hat den 25. Gründungstag des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und des DeutschTschechischen Gesprächsforums zum Anlaß genommen, die positive Entwicklung im Verhältnis zwischen Sudetendeutschen und Tschechen öffentlich zu würdigen.
Posselt: „Auch wenn noch einiges an Arbeit vor uns liegt, haben sich beide Institutionen, an denen von Anfang an führende Repräsentanten der Sudetendeutschen maßgeblich beteiligt waren, als stabile Brücke der Verständigung erwiesen.“ Es sei wichtig, diese „segensreichen Einrichtungen auch für die Zukunft fortzuführen, denn sie sind inzwischen zum Modell für Ausgleichsund Versöhnungsprozesse geworden, derer eine Welt voller nationaler Spannungen dringend bedarf“, ergänzte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und erklärte, daß die Sudetendeutschen entschlossen seien, „die gute Nachbarschaft im Herzen Europas weiter zu festigen“.
Bernd Posselt gehört dem DeutschTschechischen Gesprächsforum seit der Gründung ununterbrochen als Beirat an und leitet mit Milan Horá˛ek die Arbeitsgruppe „Dialog ohne Tabus“ .
Tschechische Wirtschaftszeitung interviewt Volksgruppensprecher
Die angesehene Hospodá˜ské noviny (auf deutsch Wirtschaftszeitung) ist einer der wichtigsten Stimmen in der tschechischen Medienlandschaft. Zum Jahreswechsel und dem Ende der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft hat das Blatt Bernd Posselt in seiner Doppelfunktion als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und als langjähriger Abgeordneter des Europäischen Parlaments interviewt und dabei Themen angesprochen, die auch außerhalb der Tschechischen Republik auf Interesse stoßen.
Gleich in der Überschrift weist die Zeitung auf einen scheinbaren Widerspruch hin, den Bernd Posselt aufklärt: „,Ich bin stolz auf Sie, daß Sie die EU-Ratspräsidentschaft innehaben‘, sagt der Vorsitzende der Sudetendeutschen, der gegen den tschechischen Beitritt zur Union gestimmt hat“, ist das Interview überschrieben.
Er habe damals vor zwei Jahrzehnten bewußt ein Zeichen setzen und die Verständigung anmahnen wollen, konterte Posselt. In seiner Rede im EU-Parlament habe er dennoch den Beitritt der Tschechischen Republik als schönsten Tag seines Lebens gewürdigt, da die Heimat auch seiner Familie damit Mitglied der Europäischen Union geworden ist. Wa-
rum er in der Abstimmung mit Nein votierte, erklärte Posselt so: „Ich habe dagegen gestimmt, weil ich spürte, daß auf tschechischer Seite nicht genug für eine Aussöhnung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen getan worden ist. Es war eine Botschaft an Prag, und ich war nicht glücklich darüber.“
Mittlerweile sei aber, so der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der auch seit Anbeginn Beirat im DeutschTschechischen Gesprächsforum ist (siehe links), viel erreicht worden. Heu-


te, so erklärte Posselt in der Hospodá˜ské noviny, würde er mit Ja stimmen.

Auch Posselts Fazit nach sechs Monaten tschechischer Ratspräsidentschaft fällt grundwegs positiv aus: „Im Jahr 1979 begann ich im Europaparlament als parlamentarischer Assistent zu arbeiten, danach war ich selbst zwanzig Jahre Europaparlamentarier, und weil die Ratspräsidentschaften alle halbe Jahre wechseln, erlebte ich wirklich viele Präsidentschaften. Konkret 85. Und ich muß sagen, daß von den 85 die tschechische Ratspräsidentschaft eine der besten war.“ Europaminister Mikuláš Bek habe ein sehr gutes Kontaktnetz im Europaparlament aufgebaut, und Tschechien habe sich sehr gut vorbereitet.
Die Solidaritätsreise von Premierminister Petr Fiala gleich zu Begin des russischen Angriffskriegs nach Kiew sei eine starke Geste gewesen und habe Tschechien zu einem Vorreiter der Unterstützung der Ukraine gemacht. Posselt: „Als Mensch mit böhmischen Wurzeln bin ich auch ein wenig stolz auf dieses Ergebnis.“

Pilger und Missionar
D
ie letzte Kolumne im alten Jahr widmete ich dem Prager Jesulein, und mit demselben Thema beginne ich die erste Kolumne im neuen Jahr. Dies aus einem besonderen Grund. Unser am Silvestertag verstorbener Papst emeritus Benedikt XVI. besuchte im September 2009 die Tschechische Republik. Seine erste Station war auf eigenen Wunsch das Prager Jesulein. Anläßlich seines Todes zitiere ich, was er dort sagte:
„Die Figur des Jesuskindes läßt uns mit der Zartheit seiner Kindheit auch die Nähe Gottes und seine Liebe verspüren. Wir verstehen, wie kostbar wir in seinen Augen sind, denn gerade durch Jesus sind wir unsererseits Kinder Gottes geworden. Jeder Mensch ist Kind Gottes und darum unser Bruder, und als solcher muß er angenommen und geachtet werden. Möge unsere Gesellschaft doch diese Wirklichkeit verstehen! Dann würde jeder Mensch nicht nur für das geachtet, was er hat, sondern für das, was er ist, denn im Antlitz eines jeden Menschen scheint ohne Unterschied der Rasse oder Kultur das Bild Gottes auf.“
Ich finde, daß diese Sätze eine treffliche Orientierung für das neue Jahr bieten, welches zum großen Teil noch wie ein unbekanntes Land vor uns liegt. Es ist so wie mit vielen Texten von Papst Benedikt. Manches Goldkorn aus ihnen wird uns auch nach Jahren und Jahrzehnten noch ansprechen und uns Wegweisung sein. Deswegen bin ich für seinen achtjährigen Dienst als Petrusnachfolger dankbar.
Sein Reiseziel hatte der Papst 2009 mit Bedacht ausgewählt. Er verstand die Reise zugleich als eine Pilgerfahrt und als eine Mission. Der Pilger Benedikt wollte damals ein Land im Herzen Europas besuchen, das von jahrhundertealtem geistlichen Reichtum geprägt ist. Deswegen gehörte zu seinem Programm neben der Andacht beim Prager Jesulein auch eine Begegnung mit Priestern, Ordensleuten und engagierten Laienchristen im Veitsdom sowie große Gottesdienste in Brünn und Altbunzlau. Als Missionar wandte sich Benedikt hingegen an ein Land, das beispielhaft für die Entchristlichung Europas in unserer Zeit steht.

Als der Papst wenig später zurück blickte, widmete er sich der Frage, wie die Kirche den Agnostikern und Atheisten begegnen solle. „Wenn wir von neuer Evangelisierung sprechen, erschrecken diese Menschen vielleicht. Sie wollen sich nicht als Objekt von Mission sehen und ihre Freiheit des Denkens und Wollens nicht aufgeben.“ Der Papst war aber zutiefst davon überzeugt, daß jeder Mensch ein Gottsucher sei. Daraus folgerte er: „Als ersten Schritt von Evangelisierung müssen wir versuchen, diese Suche wachzuhalten; uns bemühen, daß der Mensch die Gottesfrage als wesentliche Frage seiner Existenz nicht beiseite schiebt.“


Benedikt XVI. beschrieb mit diesen Worten, so scheint mir, eine der wichtigsten Aufgabe der Kirche in Europa für das 21. Jahrhundert: die Gottsuche wachhalten. Er hat sich zeitlebens redlich und aufopferungsvoll darum bemüht. Noch einmal: Danke, Papst Benedikt!
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Pfarrei Ellwangen-SchönenbergIn der Sankt-Michaels-Kirche in München feierten die Landsleute ihren Neujahrsgottesdienst. Die Hauptzelebranten der Feier waren Monsignore Dieter Olbrich, Präses der sudetendeutschen Katholiken, und Monsignore Karl Wuchterl, ehemaliger Visitator und Ehrenvorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks, sowie Dekan Adolf Rossipal und Pfarrer Mathias Kotonski. Die musikalische Gestaltung übernahm der „Sudetendeutsche Chor“ aus Mitgliedern der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, der Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried, der Iglauer Stub‘nmusik München und des Iglauer Singkreises München unter Gesamtleitung von Roland Hammerschmied. An der Michaels-Orgel wirkte – wie jedes Jahr seit 1981 – der sudetendeutsche Landsmann und Chordirektor Thomas Schmid. Gemeinsam mit ihm hatte Hans Slawik, Obmann der SLKreisgruppe München Stadt und Land, die Organisation der glänzenden Jahresauftaktveranstaltung übernommen.


Wir feiern heute den Tag der Taufe von Jesus Christus“, erinnerte Präses Dieter Olbrich zu Beginn seiner Neujahrspredigt am ersten Sonntag nach Epiphanias. Die entsprechende Passage aus dem Matthäusevangelium hatte Pfarrer Matthias Kotonski gelesen. Maria Anna Bittner hatte den passenden Text aus dem Buch Jesaja im Alten Testament vorgetragen.
In seiner ersten Neujahrspredigt nach der Corona-Pandemie sprach Monsignore Olbrich über die Sternsinger, die zwischen Weihnacht und Dreikönigvon Haus zu Haus gehen. Diese Tradition stamme von den drei Weisen, die im Neuen Testament vertrauensvoll einer Himmelserscheinung bis zur Krippe gefolgt seien: „Im Stern ging den Weisen ein Licht auf!“ Auch uns solle ein Stern leiten, und wir Jesus vertrauen und folgen. Seine Botschaft solle unser Leben im Alltag prägen, betonte der Zelebrant.


Gedenken an Benedikt XVI.
Gedenken wolle er, so Olbrich, auch des ehemaligen Papstes Benedikt XVI., der am letzten Tag des alten Jahres verstorben sei. Papst Benedikt sei den Sudetendeutschen sehr verbunden gewesen. „Ich selbst traf den emeritierten Papst am Wenzelstag 2016 in Rom“, erinnerte er sich. Er sei damals mit einer Delegation unter Führung von Miloslav Kardinal Vlk aus Prag, mit Bischof František Václav Lobkowicz von OstrauTroppau, Weihbischof Reinhard Hauke und Martin Kastler, damals Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde, im Vatikan gewesen. Benedikt XVI. habe sich sehr darüber gefreut, daß Deutsche und Tschechen gemeinsame Kirchenfeiern abhielten und gesagt: „Das ist echte Friedensarbeit!“
Nach der Predigt las Birgit Unfug die schlichten, aber sehr packend formulierten Fürbitten vor. Darin wurde etwa um
Stern über Bethlehem
Gnade für die Opfer von Krieg und Gewalt und alle Gläubigen jeglicher Konfession gebeten.
Eingangs hatte Hans Slawik die vielen gläubigen Landsleute zum Neujahrsgottesdienst für Vertriebene in der lichtdurchflueten Michaelskirche begrüßt. Der Gruß des Vize-Bundesvorsitzenden des Deutschen Böhmerwaldbunds galt neben der Bundesvorsitzenden der Karpatendeutschen, Brunhilde ReitmeierZwick, und dem Landesvorsitzenden des Schlesiervereins, Gotthard Schneider, besonders dem Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, und Steffen Hörtler, dem SL-Landesobmann in Bayern. Zwischen den beiden Landsleuten saß die tschechische Generalkonsulin Ivana Červenková, die erstmals an diesem Neujahrsgottesdienst teilnahm.


Präses Olbrich und Monsignore Wuchterl bereiteten gemeinsam mit den Pfarrern Kotonski und Rossipal die Heilige Kommunion vor. Derweil intonierte die Iglauer Stubenmusik sanfte Klänge aus der Iglauer Andachtsmesse – eine überaus festliche Gabenbereitung, deren Wirkung sich keiner entziehen konnte. Aber auch der gesamte Gottesdienst war ein beeindruckendes Fest. Neben der Kraft der Gebete lag das an der Macht der herrlichen Musik, die die ganze Neujahrsmesse durchzog. Der „Chor der Sudetendeutschen Landsmannschaft“ unter Leitung von Roland Hammerschmied mit Mitgliedern der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, der Eghalanda Gmoi z’ Geretsried, dem Iglauer Singkreis und der Iglauer Stubenmusik bot ein gewaltiges Musikprogramm: Beim Einzug der Fahnen hatten schon alle „Nun freut euch, ihr Christen“ gesungen.
Nach dem Sanctus erklang „Heilig, heilig, heilig“ aus der Deutschen Messe von Franz Schubert und nach der Wandlung jubelte der Chor den „Andachtsjodler“. Zum Agnus Dei gab es das gospelartige Lied „Stern über Bethlehem“, und bei der Kommunionsausteilung schmetterte der Chor das flote „Vater unser“, vertont von der Komponistin und Sängerin Hanne Haller.
Dank der Orgelbegleitung von Thomas Schmid, der aus Bautsch im Kreis Bärn stammt, war der Klang der traditionellen Lieder überaus glanzvoll. Die ursprüngliche Sandtner-Orgel wurde 2011 reorganisiert und erweitert von der österreichischen OrgelbaufirmaRieger, die im 19. Jahrhundert im mährischen Jägerndorf gegründet worden war. Beim gemeinsamen Schlußlied „Stille Nacht“ ertönte die Michaelsorgel mit allen 75 Registern. Dazu hatte Schmid auch eine recht unbekannte Strophe ausgewählt. Und so sangen nach dem festlichen Fahnenauszug am Ende alle gemeinsam: „Stille Nacht, Heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht, aus des Himmels goldenen Höh‘n, uns der Gnade Fülle läßt sehn: Jesum
in Menschengestalt.“Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) hat die Ausstellung „Wachsen und Vergehen. Sieglinde Bottesch – Bernard Schultze“ um drei Wochen verlängert. Die Werke der siebenbürgischen Künstlerin Sieglinde Bottesch und des pommerschen Künstlers Bernard Schultze können die Besucherinnen und Besucher somit noch bis Sonntag, 29. Januar besichtigen. Während der Verlängerungszeit im Januar kommen noch weitere Programmpunkte hinzu – darunter eine Mitmachführung und eine Kuratorenführung.
Die Ausstellung „Wachsen und Vergehen“ führt zwei Künstlerpositionen zusammen, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam zu haben scheinen. Die Künstlerin Sieglinde Bottesch, geboren 1938 in Hermannstadt/Sibiu in Siebenbürgen (heute in Rumänien), durchlief während ihrer künstlerischen Laufbahn mehrere Wechsel. Ihre frühen fiurativen Arbeiten waren von Paul Klee sowie der Ursprünglichkeit bäuerlicher Kunst und Kinderzeichnungen inspiriert.
Ab Mitte der siebziger Jahre rückten alltägliche Dinge und vor allem die Natur in den Mittelpunkt. Entscheidender Einschnitt in Botteschs Leben brachte das Jahr 1987, als sie aus Rumänien nach Deutschland emigrierte. „Ich suchte einen
Mit dem Jahr 2023 ist das Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) in Regensburg in sein neues Ausstellungsjahr gestartet. Die aktuell laufende Ausstellung „Wachsen und Vergehen. Sieglinde Bottesch –Bernard Schultze“ ist noch bis Ende Januar zu sehen (Þ oben).
Das KOG hat für 2023 zwei neue, umfangreiche Ausstellungsprojekte vorbereitet. Vom 31. März bis zum 18. Juni zeigt die Ausstellung „Emil Orlik an Max Lehrs. Künstlerpost aus aller Welt“ eine einzigartige Sammlung an illustrierten Briefen und Karten des sudetendeutschen Künstlers Emil Orlik, der am 21. Juli 1870 in Prag geboren wurde. Auch die umfassende Korrespondenz des Grafiers Emil Orlik mit dem befreundeten Kunsthistoriker Max Lehrs wird dokumentiert.
Rund 440 Briefe und Postkarten schickte Emil Orlik zwischen 1898 und 1930 an seinen Freund Max. Der Kunsthistoriker war in dieser Zeit am Dresdner Kupferstichkabinett und später als Direktor des Berliner Kupferstichkabinetts (1904–1908) tätig, bevor er als Direktor des königlichen Kupferstich-Kabinetts nach Dresden zurückkehrte. Orliks Post ließ er sorgfältig in drei Alben binden. Seine Schriftstücke an Max Lehrs hatte Orlik zumeist mit farbigen Zeichnungen bereichert, gelegentlich findensich auch Proben von seinen druckgrafishen Arbeiten.
Wachsen und Vergehen
Weg, um mich selbst zu finden, um mich orten zu können. Der Dialog mit der Natur, mit dem Organischen, war ein Weg zu mir selbst,“ blickt sie im Interview für den Ausstellungskatalog zurück.

Die Plastiken und Zeichnungen von Sieglinde Bottesch rükken jeweils ein Objekt in den Mittelpunkt. Ihre klaren Formen sind vertraut und neuartig zugleich.
Die wertvolle Korrespondenzsammlung wurde noch nicht vollständig publiziert. Erschienen ist bisher nur eine Auswahl, die der Adalbert-Stifter-Verein 1981 unter dem Titel „Malergrüße“ herausgegebenen hat. Zitate einzelner Textstellen findensich in der Orlik-Literatur. Dank des kürzlich angekauften Grafiscanners ist es nun möglich gewesen, alle Briefe und Postkarten professionell zu digitalisieren. Die Scans bilden zum einen die Basis für die vollständige Bearbeitung und Edition des Bestandes in Form eines Katalogs. Zum anderen bieten sie die Möglichkeit, einzelne Blätter aus dem Band zu präsentieren.
Die reich illustrierten Briefe und Karten geben in Wort und Bild Aufschluß über Orliks Leben sowie seine künstlerischen Vorhaben zwischen 1898 und 1930. Das komplette Konvolut befindetsich heute in der Grafischen Sammlung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie, die insgesamt mehr als 2000 Einzelblätter von Emil Orlik verwahrt.
Die Ausstellung über Orlik stellt die einzigartige Korrespondenzsammlung des Künstlers somit erstmals vollständig der Öffentlichkeit vor. Die drei Alben mit den gebundenen Originalen kann man aufgeschlagen in Vitrinen bewundern. Vergrößerte Reproduktionen an den Wänden zeigen besondere Stücke im Detail. Auf einem Bildschirm lassen sich sämtliche Briefe und Karten
Bernard Schultze, geboren 1915 in Schneidemühl/Piła in Pommern (heute in Polen), zählt zusammen mit Karl Otto Götz, Otto Greis und Heinz Kreutz zu den führenden Persönlichkeiten der informellen Kunst in Deutschland. Die vier fanden 1952 in der Künstlergruppe „Quadriga“ zusammen und gehörten zu den ersten deutschen Künstlern, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg den Austausch mit der internationalen Kunstszene suchten. Inspirierend war für sie die Auseinandersetzung mit künstlerischen Ansätzen, bei denen der Schaffensvorgang als ein nicht vom Verstand gesteuerter, intuitiver Prozeß im Mittelpunkt steht. Für Schultze waren es insbesondere Werke von Jean-Paul Riopelle, eines Vertreters des Action-Painting, sowie Arbeiten
von Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze), einem Vorreiter des Tachismus und Informel, die er 1951 in Paris kennenlernte.
Mit seinen „Migofs“, einer von ihm eigens erfundenen und benannten Spezies, verlieh Schultze zwitterhaften Übergangsformen einen dreidimensionalen Körper. Sie sind das Ergebnis von Schultzes Ausweiten der zweidimensionalen Arbeiten ins Räumliche.
durchblättern und von allen Seiten betrachten. In der Zusammenschau mit thematisch passenden Arbeiten und Skizzenbuchseiten aus dem reichen Orlik-Bestand der Grafishen Sammlung ergibt sich ein spannender Einblick in die Lebenswelt des Künstlers.
Die Besucherinnen und Besucher können auch Orliks zahlreiche Reisen mitverfolgen, bekommen aber auch eine Vorstellung von Orliks vielfältigen druckgrafishen Techniken, mit denen er fortlaufend experimentierte. Orlik starb am 28. September 1932 in Berlin.
Über die Sommerferien zeigt das KOG eine thematische Auswahl an Werken aus seinen Beständen. Die Besucherinnen und Besucher können diese unter anderem im Rahmen von Führungen anläßlich der REWAGNächte 2023 bewundern, die traditionell am ersten AugustWochenende stattfinden.Die Dauerausstellung bleibt trotz der Baumaßnahme im abgekoppelten Grafitrakt bis auf wenige Säle weiterhin zugänglich.
Ab Herbst, und zwar vom 7. Oktober bis 7. Januar, beleuchtet die Ausstellung „We love Picasso“ den Einflußvon Pablo Picasso auf die Kunstszene im östlichen Europa. 2023 ist PabloPicasso-Jahr. Anläßlich seines 50. Todestages steuert das KOG einen Beitrag zur Rezeptionsgeschichte des Künstlers bei. Im Mittelpunkt der Ausstellung
Bernard Schultzes Werke überwältigen durch ihre intensive Farbigkeit und organische Strukturen mit einer Fülle an Details, die sich nur manchmal als Figuren, Gegenstände oder deren Fragmente identifizieren lassen. Mit seinem charakteristischen Stil prägte Schultze entscheidend die abstrakte Kunstströmung des Informel in Deutschland mit. Schultze starb am 14. April 2005 in Köln.
In der Ausstellung stehen sich rund 60 Zeichnungen, Plastiken und Installationen von Sieglinde Bottesch und rund 30 Grafiken, Plastiken und Gemälde von Bernard Schultze gegenüber. Was jedoch sowohl die Künstlerin als auch den Künstler verbindet, ist die Faszination von den Verwandlungsprozessen in der Natur, den Übergängen, den Metamorphosen. Dieser gemeinsame Nenner „Wachsen und Vergehen“ bietet ein Wechselspiel zwischen Parallelen und Gegensätzen. Beide Künstler laden dazu ein, bei der Betrachtung der Werke eigene Gedanken und Assoziationen zu entwickeln.
Bis Sonntag, 29. Januar: „Wachsen und Vergehen. Sieglinde Bottesch – Bernard Schultze“ in Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Doktor-Johann-Maier-Straße 5. Dienstag bis Sonntag 10.00–17.00 Uhr. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Katalog 17 Euro.




„We love Picasso“ steht der Vorreiter wechselnder Stilrichtungen als Impulsgeber und Vorbild für die zeitgenössische Kunstszene in Mittel- und Osteuropa. Die umfangreiche Zusammenschau präsentiert Werke ausgewählter Künstlerinnen und Künstler insbesondere aus Polen und der Tschechischen und Slowakischen Republik, die Picassos Motive und seinen Stil aufgegriffen und weitergeführt haben.
Barrierearm und inklusiv sind die beiden Stichworte, auf denen der Fokus beim Ausbauen des Begleitprogramms liegt. „Dank eines Förderprojekts konnten wir Konzepte für Führungen für Blinde und Sehbehinderte entwickeln und Erfahrungswerte bei Führungen mit Gebärdendolmetscher sammeln,“ beschreibt Direktorin Agnes Tieze. „Ab 2023 wird beides fester Bestandteil unseres Vermittlungsangebotes.“
Provenienzforschung
Mit der Verlängerung des bisherigen Projekts zur Provenienzforschung dank der Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist ein wichtiger Bestandteil der Museumsarbeit am KOG weiterhin gesichert. Geprüft werden Werke, die sich als Leihgaben der Bundesrepublik Deutschland in der Sammlung des Museums befindenund in ihrer Herkunftsgeschichte Provenienzlücken in den Jahren 1933 bis 1945 aufweisen.
Polsterzipfel auf dem altösterreichischen Gmundner Keramik-Klassiker Grüngeflammt.

Weihnachten in der Familie
Mitte Dezember fand traditionsgemäß die Weihnachtsfeier der sachsen-anhaltinischen SLKreisgruppe Anhalt-Bitterfeld nun endlich wieder nach der Corona-Zeit im Musikhotel Goldener Spatz in Jeßnitz statt.

Der Titel „Weihnachten in der Familie“ paßte so recht zu diesem Treffen. Über die Jahre ist die Gemeinschaft der Vertriebenen in der Kreisgruppe in Bitterfeld wie eine Familie zusammen gewachsen. Zu dieser Weihnachtsfeier konnte Kreisobfrau Anni Wischner trotz Alter, Krankheit und sonstigen Problemen doch eine große Anzahl der Mitglieder begrüßen.

schneudorf und die Fahrt nach Aussig zur Teilnahme an der Gedenkfeier für die ermordeten Deutschen, die in Aussig von der Brücke in die Elbe gestürzt worden seien, gehört. Die Kreisgruppe habe auch am Tag der Heimat des BdV in der Hansestadt Gardelegen teilgenommen. Alle anderen Veranstaltungen, die im
hatte der Oberbürgermeister den richtigen Zeitpunkt mit seiner Ansprache genutzt, denn anschließend begann das Weihnachtsprogramm.


Das eröffnete Schneekönigin Angela Novotny. Mit Weihnachtsliedern, Geschichten und Bräuchen führte sie durch das Programm. Im festlich dekorierten Haus konnte im Kerzenschein und bei vertrauten Weihnachtsliedern der Alltag einmal vergessen werden. Beim Lied vom Schneemann wirkte der allseits bekannte singende Obmann der sachsen-anhaltinischen SLKreisgruppe Wittenberg, Gustav Reinert, als Schneemann mit.
Zur Weihnachtsfeier der Kuhländler Heimatgruppe München, die nach einer zweijährigen Pause wieder im Haus des Deutschen Ostens Mitte Dezember begangen wurde, waren mehr als 20 Gäste bekommen.
Zunächst begrüßte Ulf Broßmann, Betreuer der Heimatlandschaft Kuhländchen, ein neues Mitglied sowie Hans Slawik, den Obmann der oberbayerischen SL-Kreisgruppe München. Mit einer Schweigeminute wurde anschließend des verstorbenen Mitglieds Käthe Heuwing, geborene Bittner, gedacht.
Zu vielen Treffen der Kuhländler hatte sie Neutitscheiner Polsterzipfel gemacht. Es handelt sich dabei um Plätzchen, bei denen Aprikosenmarmelade und Speisequark vermischt und in ein Stück Blätterteig eingewickelt werden. Käthe Heuwing war im Alter von 87 Jahren überraschend gestorben. Sie hatte ihr erstes Lebensjahrzehnt noch in Neutitschein verbracht.
Ulf Broßmann hob ihren feinen, zurückhaltenden Charakter hervor. Sie habe einmal gesagt, erinnerte sich einer der Mitfeiernden, daß sie mit sehr vielen Leuten in Neutitschein verwandt gewesen sei. Sie habe aber nichts davon gehabt, weil ihre Verwandten entweder langfristig verreist oder weggezogen seien.
Fritz Höpp war eigens aus Wiesbaden gekommen, um Einblicke in den alten Kuhländler Dialekt zu geben. Selbst kundige Sprachteilnehmer mußten feststellen, daß ihnen mangels Gebrauch dieser Sprache nicht mehr alles geläufig war.
Broßmann führte danach in den Brauch des Christkindlesgehens ein, der im Kirchenjahr zwischen dem Besuch des Heiligen Nikolaus und dem der Heiligen Drei Könige lag. Dabei fragt die heilige Maria – wie der Nikolaus – nach dem Betragen der Kinder und die Engel tragen –wie die Heiligen Drei Könige –Kronen. Das Besondere an diesem Brauch war, daß während des Besuchs der Kinder eine Art Krippentheater gespielt wurde. Dieser Brauch war ein Heischebrauch, bei dem Gaben gefordert oder erbeten werden. Daß die Hirten Dialekt sprachen, wenn sie unter sich waren, mit den Engeln jedoch Hochdeutsch, zeigt, wie Bräuche oft in einem Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichem „Oben“ und „Unten“ ihre Form gewinnen.

Anna Maria Fischer las in zwei Einzelauftritten je eine Geschichte vor. Die erste endete damit, daß eine bereits gerupfte Gans einen Pullover gestrickt bekam und nicht nur den ganzen gegenwärtigen Winter, sondern noch weitere sieben Jahre lebte.
Immer wieder waren es Weihnachtslieder, die, vom Klavichord Hans Hitzlers begleitet, die Feiernden zu einem Chor vereinten. Viele Damen hatten darüber hinaus reichlich Kuchen gebacken. Nicht zuletzt der Kaffee sorgte für anregende Gespräche.
Hans-Karl FischerBegrüßen konnte sie auch als Ehrengäste den Landtagsabgeordneten Lars Jören Zimmer, Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk, Günther Sturm, Vorstandsmitglied des Heimatvereins Bitterfeld, den ehemaligen Obmann der SLLandesgruppe Sachsen-Anhalt, Hans Joachim Nerke, mit seiner Frau Margit sowie den Obmann der SL-Kreisgruppe Wittenberg, Gustav Reinert.
Nach der Begrüßung wurde erst einmal zu Mittag gegessen. Bevor das Programm „Weihnachten in der Familie“ begann, blickte Kreisobfrau Anni Wischner auf das vergehende Jahr zurück. Alle geplanten Maßnahmen seien, wenn auch mit deutlich verringerter Personenzahl, durchgeführt worden. Dazu hätten beispielsweise die Fahrt nach Deut-
Arbeitsplan festgelegt worden seien, seien ebenfalls durchgeführt worden.
Traditionsgemäß wurden die Geburtstagskinder geehrt. Anschließend sprach Oberbürgermeister Schenk. Er ging darauf ein, wie wichtig es sei, die Vertreibung nicht zu vergessen und die heimatlichen Traditionen zu pflegen. Er würdigte diesbezüglich die Arbeit der Kreisgruppe. Mit einer persönlichen Spende von ihm und seiner Frau wolle er die Arbeit der SL in der Traditionspflege unterstützen.
Natürlich durften Kaffee und Weihnachtskuchen bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. Da
Was außerdem gut beim Publikum ankam, war der Auftritt der Ukrainerin Anelina. Anelina trug das alte deutsche Weihnachtslied „Leise rieselt der Schnee“ in Deutsch, anschließend ein Weihnachtslied auf Ukrainisch vor.

Als Weihnachtsfrau und Weihnachtsmann traten dann Uta Carina und Andreas Gieseke auf. Franziska und Florian gaben eine Tanzeinlage. Es wäre zuviel, hier alle Details des Programms zu schildern. Es war eine gelungene Weihnachtsfeier mit einem schönen Programm, das allen gefiel. Zum Abschluß sangen Künstler und Gäste gemeinsam das schöne Weihnachtslied „Je süßer die Glocken klingen“. Kreisobfrau Anni Wischner dankte zum Schluß den Künstlern, dem Team des Musikhotels und allen Landsleuten. Klaus Arendt




Nach Monaten krankheitsbedingten Ausfalls und Abwesenheit von allen Terminen trat Manfred Hüber erstmals wieder in seiner Funktion als Vorsitzender des hessischen BdV-Kreisverbandes Wetzlar-Gießen in der Öffentlichkeit auf. Und zwar beim weihnachtlichen Jahresabschluß seiner Organisation in der Stadthalle Aßlar Mitte Dezember, wohin immerhin gut 80 Besucherinnen und Besucher den Weg gefunden hatten.
Ende November fand das Adventssingen des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes (SSBW) auf dem Heiligenhog im unterfränkischen Bad Kissingen statt.
Wie schwierig war doch das Comeback des Heiligenhofer Adventssingens im Jahr 2021 gewesen: Die Corona-Zahlen stiegen, Kontakte wurden eingeschränkt, Weihnachtsmärkte in manchen Bundesländern vollständig abgesagt – aber das Fritz-Jeßler-Adventssingen des SSBW fand unter jede Menge Auflagen trotzdem statt.
Und 2022? 2022 war es total normal: keine Testauflagen, kei-


ne Abstandsregeln, und sogar ein Weinkellerbesuch war wieder erlaubt.
33 Sängerinnen und Sänger traten zum 59. Adventssingen an, um ein von Chorleiterin Astrid Jeßler-Wernz zusammengestelltes, vielseitiges Programm zu erarbeiten, das sudetendeutsche Weihnachtslieder, solche aus anderen ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten, Kirchenmusik sowie internationale Weihnachtslieder einschloß. Dazu nach drei Jahren endlich wieder Volkstanzen mit Martina Blankenstein. Und auch eine größere Instrumentalgruppe bildete sich.
Der Abschlußabend am Samstag vor dem ersten Advent wä-
re beinahe zu einem Privatkonzert für Traudl Kukuk geworden, wenn sich nicht nach einer halben Stunde vier Schülerinnen in das Publikum gesetzt hätten, die zu einer gleichzeitig im Haus tagenden Gruppe gehörten. Vom Auftritt des Chores waren sie so begeistert, daß sie sich nach dem Konzert dem Chor im Weinkeller anschlossen, noch einige ihrer Kolleginnen und Kollegen mitbrachten und alle gemeinsam Weihnachtslieder sangen.
So war dieses Adventssingen nicht nur endlich wieder total normal, sondern auch eine besondere Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit.


 Bernhard Goldhammer
Bernhard Goldhammer
Die Vertriebenen und ihre Verbände müssen zusammenstehen und heute wie auch in der Zukunft auf das Recht auf Heimat hinweisen“, so der Kreisvorsitzende Manfred Hüber angesichts des völkerrechtswidrigen russischen Überfalls auf die Ukraine, in dessen Folge erneut das Recht auf Heimat von Millionen Menschen gefährdet sei und mit Füßen getreten werde. Deshalb sei das Wirken der Vertriebenen und ihrer Verbände nach wie vor aktuell und zeitlos. Zu Wahrung und Stärkung des Rechts auf Heimat und für eine Verständigung zwischen den Völkern sei Frieden die unbedingte Voraussetzung. Sich dafür aktiv einzusetzen ist laut Hüber seit Jahrzehnten Programm und Motivation der Vertriebenenverbände. Diese Verbände seien im Übrigen entstanden, als es gegolten habe, entwurzelten Menschen zu helfen. In diesem Zusammenhang dankte Hüber dem ehemaligen Landtags- und Bundestagsabgeordneten sowie langjährigen CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer für dessen kontinuierlichen und erfolgreichen Einsatz für die Belange der Vertriebenen: „HansJürgen Irmer hat sich nachhaltig verdient gemacht.“
Wenn Heimat verloren sei und Frieden nicht mehr herrsche, dann werde der Verlust erst richtig deutlich, so Irmer. Im Falle der Ukrainer handele es sich um echte Flüchtlinge, die ihre Heimat kriegsbedingt verlassen hätten, dorthin aber
nahezu alle wieder zurückkehren wollten. Es gelte, zwischen verfolgten Flüchtlingen und jenen zu unterscheiden, die aus rein wirtschaftlichen Gründen zu uns kämen. Damit allerdings sei unser Land letztlich überfordert. Irmer lobte die 1950 verabschiedete Charta der Vertriebenen, in der das Grundrecht auf Heimat postuliert, zugleich aber auf Rache und Vergeltung verzichtet werde, als „größte Leistung“ des BdV und als wichtige Grundlage für Frieden und Freiheit in Europa.
Landrat Wolfgang Schuster wies in seinem Grußwort ebenfalls auf die „harten Zeiten“ hin, die aktuell herrschten. Was heute zum Beispiel in der Ukraine geschehe, erinnere fatal an 1945/46: „Vertreibung verstößt gegen das Völkerrecht –damals wie heute.“ Und daß in Folge der Ereignisse Kreise und Kommunen in Deutschland, die zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet und auch bereit seien, mittlerweile fast überfordert seien, gehöre auch zur Realität.
Jenseits der Bezugnahme der Ehrengäste aus der heimischen Kommunalpolitik auf die aktuellen übergeordneten Ereignisse und ihre Bezüge zum Schicksal der Vertriebenen erlebten die Teilnehmer der von Kuno Kutz und Gabriele Eichenauer organisierten und gut besuchten BdV-Weihnachtsfeier in der festlich geschmückten Stadthalle Aßlar insgesamt drei besinnliche Stunden. Musikalisch entscheidend und einfühlsam mitgestaltet hatte die Feststunden das „Busekker Quartett“ mit kurzen, auf Advent und Weihnachten bezogenen Beiträgen des Stellvertretenden BdVKreisvorsitzenden Michael Hundertmark, der Vorstandsmitglieder Roland Jankowsky, Frank Steinraths, Ingeborg Storm und Herma Kindermann. Schließlich kam der heilige Nikolaus alias Manfred Drexler und rundete die Weihnachtsfeier harmonisch ab. Franz Ewert
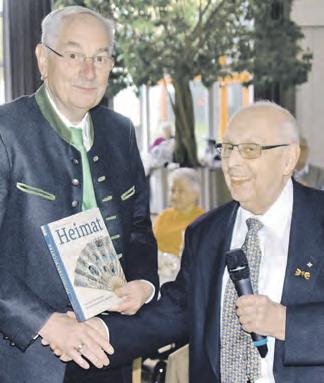
Von Corona befreit
Von Corona und seinen Folgen befreit, traf sich vom 28. Dezember bis zum 1. Januar der Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker samt Freunden und Verwandten, zeitweise bis zu 21 Personen, auf dem Heiligenhof zum erholsamen Jahreswechsel.
Am ersten Abend präsentierte Günter Reichert den Film des Studenten Ondřej Valchář aus Wekelsdorf „Kde domov můj. Die verlorene Heimat“ mit deutschen und tschechischen Untertiteln von Dagmar Heeg. Der Film dokumentiert Aussagen sudetendeutscher und tschechischer Teilnehmer an Veranstaltungen des Heimatkreises Braunau im Braunauer Land und am Heiligenhof, vor allem die Gefühle über den Heimatverlust oder über die Folgen der Vertreibung für das Heimatgebiet.
Eindrucksvoll auf tschechischer Seite sind die Aussagen des Braunauer Bürgermeisters und des römisch-katholischen Dekans für die Braunauer Region. Sie beklagen das Fehlen des historischen und kulturellen Bewußtseins der jetzigen Bevölkerung und dessen Folgen für die ökologische, ökonomische und soziale Entwicklung der früher deutsch besiedelten und wirtschaftlich wie kulturell hoch entwickelten Gebiete.
Beachtenswert schildert eine tschechische Archivarin aus Wekelsdorf die Vertreibung der Deutschen aus dem Braunauer Land. Die Aussagen eines Dozenten der Universität Pardubitz über die Zahl der Toten der Vertreibung entspricht weitgehend der offiziellentschechischen Position. Die Intention des Films wird im Schlußlied des Autors deutlich, in dem er die Frage aufwirft, wer denn eigentlich „unsere“, also die Geschichte des Braunauer Landes, schreibe oder schreiben solle.
Der Film fand große Zustimmung, verbunden mit der Hoffnung, daß sich Valchář, der mit dem SL-Förderpreis für Literatur und Publizistik 2022 ausgezeichnet worden war, weiter in dieses Thema vertiefen möge.
Nach dem gemeinsamen Singen am folgenden Morgen referierte Steffen Hörtler, Leiter des Heiligenhofs und Stellvertretender SL-Bundesvorsitzender, über „Erfahrungen und Perspektiven der Sudetendeutschen Heimatpolitik“. Im Gegensatz zur wenig interessierten Bundespolitik sei die Unterstützung der sudetendeutschen Aktivitäten und Anliegen in Bayern groß. So zeigten sich auch fast alle Fraktionen im Landtag, oft im Gegensatz zu ihrer Haltung auf Bundesebene, sehr aufgeschlossen. Die massive Förderung durch die Landesregierung, insbesondere beim Bau des Sudetendeutschen Museums, die Förderung der Jugendbegegnungen und des Ausbaus des Heiligenhofs seien beispielhaft.
Neben der CSU lobte Hörtler vor allem die sozialdemokratische Seliger-Gemeinde, die sich stark im Sudetendeutschen Rat engagiere und in der bayerischen SPD eine bedeutende Stimme habe. In Bayern treibe die SPD mit den Freien Wählern sogar die CSU bei Bedarf an. Angesichts des geringeren Interesses mancher jüngeren Nachwuchspolitiker lasse sich
aber kaum sagen, wie lange sudetendeutsche Interessen noch diesen Stellenwert behielten.
In Tschechien gebe es einige Politiker, die an einer Verständigung interessiert seien. Darüber hinaus lasse sich aber kaum eine Veränderung erkennen. Seit Horst Seehofers Entspannungsinitiative habe sich Bayern stets um ein gutes Verhältnis insbesondere zu Premier Andrej Babiš bemüht. Dem sei entgegengekommen, daß die Tschechen Angela Merkels Flüchtlingspolitik abgelehnt und daher die Nähe zu Bayern gesucht hätten. Staatspräsident Miloš Zeman habe vom neuen Premier Petr Fiala verlangt, nicht mit den Sudetendeutschen zusammenzuarbeiten.
Seit die SL die Aufhebung der Dekrete von Edvard Beneš nicht mehr in den Mittelpunkt stelle, betrachte Prag diese Frage als erledigt. Da dies auch in Berlin so gesehen wer de, sehe die tschechische Regierung heute wieder die Bundesregierung als den wichtigsten Ansprechpartner.
Ein Lichtblick sei die Haltung der letzten drei Deutschen Botschafter in Prag zur SL. Das Bundesinnenministerium fördere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiterhin, doch Kulturstaatsministerin Claudia Roth habe die Kulturförderung unter Umgehung des § 96 des Vertriebenengesetzes, mit Ausnahme konkreter institutioneller gesetzlicher Verpflihtungen, beendet.
Sehr gute Arbeit leisteten die Heimatkreise in Verbindung mit den lokalen Institutionen und Initiativen ihres Heimatgebietes. Viele Aktionen gingen von ihnen aus. Auf dieser Ebene wachse die Bereitschaft vor allem junger Leute zur Zusammenarbeit und Aufarbeitung. Für die Weiterführung wichtiger Formate wie des Brünner Marsches für das Leben müsse weiter gesorgt werden. Hörtler bewertete die Kulturarbeit als gut, die politische Arbeit aber als schwierig, da deutsche Politiker, außer Markus Söder, über die Sudetendeutsche Frage nur sprächen, wenn Sudetendeutsche anwesend seien.

Die Runde der vier Männer, die das böhmisch-altösterreichische Kartenspiel Mariasch pfleten, freute sich über zwei weitere Mitspieler.
deutschland gefloene Autorin – ihr Vater sei 1943 gefallen –habe in Hessen maturiert und eine Lehrerausbildung gemacht.
In mehreren Büchern schildere sie Erfahrungen und Erlebnisse im Dienst des Auswärtigen Amtes als Deutschlehrerin in lateinamerikanischen Ländern.
Die größte Bedeutung, weit über Deutschland hinaus, hätten ihre Bücher über die Gefahren der Atomkraft erreicht. „Die letzten Kinder von Schewenborn“ (1983) über die Folgen eines Atombombenabwurfs im Raum Fulda und „Die Wolke“ (1987) über die Folgen eines möglichen Reaktorunfalls mitten in Deutschland, 1988 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, seien Lesestoff an Gymnasien.
Was Pausewangs Bücher auszeichne, sei die trotz ihrer inhaltlichen Tiefe und politischen Aussage auch für Kinder und Jugendliche verständliche Sprache.


Die Bände über den „Räuber Grapsch“ zeigten ihre kindgerechte Fantasie.
In den autobiographischen drei Bänden „Rosinkawiese“ habe sie ihrer sudetendeutschen Heimat, dem kargen Leben im Bergland und der Vertreibung mit ihren Grausamkeiten ein Denkmal gesetzt. Die Schilderung der Freundschaft mit den neuen tschechischen Bewohnern ihres böhmischen Anwesens bilde den versöhnlichen Schluß.
Ein Interview von Radio Österreich 1 mit Gudrun Pausewang anläßlich ihres 90. Geburtstages ergänzte den Vortrag. Dabei faszinierten die geistige Klarheit der Autorin und der anheimelnde nordböhmische Sprachklang.
Der zweite Tag widmete sich der Erkundung der weiteren Umgebung des Heiligenhofs. Nach dem Morgensingen führte eine Busfahrt unter der Leitung von Marianne Wigand vom Heiligenhof zu Sehenswürdigkeiten. Erste Station war die wuchtige Probsteikirche des kleinen Ortes Thulba, die den Charakter ihres romanischen Ursprungs noch immer erkennen ließ. Als Kirchenführer hatte Wigand ihren Vater engagiert, den Mesner der Kirche. Er erläuterte die Geschichte des Baus, der teilweisen Zerstörung, der verschiedenen Wiederaufbauphasen und der Anpassung an spätere Vorstellungen.
den mächtigen Pfeilern der Vierung ruhe, sei beibehalten worden.
Von dem ehemals angeschlossenen Kloster, das im Bauernkrieg zerstört worden sei, sei nur noch eine Reihe von Säulchen und Bögen des Kreuzgangs erhalten. Bemerkenswert sei auch der großzügige Bau der Neuen Propstei, in dem von Anfang an auch die Schule des Ortes untergebracht gewesen sei.
Nach dem Mittagessen in Thulba im Gasthof zum Stern ging es nach Hammelburg. Die Besichtigung dieses alten Weinorts fand vom Bus aus statt, der dafür eigens eine Schleife durch die Ortsmitte fuhr. Weiter ging es auf der abenteuerlichen Zufahrtsstraße hinauf zur Burg Saaleck oberhalb des Ortes.
Nachmittags erwartete uns eine Weinprobe in dem neben der Burg liegenden Weingut der Familie Lang. Wir betraten eine Lagerhalle, die kaum wärmer war als die feuchtkalte Umgebung. Dort wurden uns die Situation des Weinbaus, die moderne Produktion und vieles mehr erklärt, bevor wir nach dem Durchgang zwischen den stählernen und hölzernen Gärgefäßen in einen Raum mit Bänken und Tischen gelangten. Hier wurde uns, noch immer in Winterkleidung, zur Verkostung von vier edlen Weinen ein nur von einer einzigen Bäckerei produziertes Gebäck gereicht. Das Weinseminar, als das sich die Veranstaltung entpuppte, wurde mit Hinweisen, wie Wein zu genießen und zu beurteilen sei, fortgeführt. Dann ging es zum Heiligenhof zum Abendessen. Manche machten sich danach zum Kurkonzert auf.
Der Silvestertag begann mit einer Singrunde. Danach besuchte eine größere Gruppe in Garitz das Grab von Erich Kukuk, dem früheren, langjährigen Leiter des Heiligenhofs. Wer noch gut zu Fuß war, erreichte auf dem Besinnungsweg am Waldrand den Friedhof, wo wir uns mit Traudl Kukuk trafen. Mit den Liedern „Wahre Freundschaft“ und „Heimat dir ferne“ ehrten wir das Andenken Erichs und besichtigten die große Krippe in der Kirche.
Bethlehem hofft auf Normalität
Mitte Dezember traf sich die niederbayerische SL-Kreisgruppe Regen-Viechtach in Regen zur Kreishauptversammlung und feierte anschließend Weihnachten.
ie Ortsobmänner Arnulf


D





Am literarischen Abend stellte Ute Reichert-Flögel die 1928 in Wichstadtl im Adlergebirge geborene und 2020 im oberfränkischen Baunach verstorbene Schriftstellerin Gudrun Pausewang vor. Deren mehr als 100 Bücher seien international 500 Millionen mal aufgelegt worden.
Die 1945 mit Mutter und fünf Geschwistern zu Fuß nach West-
Bereits im frühen neunten Jahrhundert habe es eine Vorgängerkirche gegeben, die 816 Sankt Michael geweiht worden sei. Die heutige Kirche entspreche noch weitgehend der romanischen 1141 geweihten Sankt-Lambertus-Kirche, von der die Apsis noch erhalten sei, wo einige Stellen bewußt den Blick auf das Mauerwerk offen ließen. Auch die kleinen Fenster hinter der Stelle des ehemaligen Hochaltars seien noch romanisch, wenn auch mit moderner, bunter Verglasung. Nach der Zerstörung im Bauernkrieg seien die Wände mit hoch gelegenen Fenstern aufgelockert worden. Spätere Zeiten seien durch zwei barocke Grabdenkmale vertreten. Der zentrale Turm, der auf
Der Abend begann mit einer zeitweise etwas chaotischen Polonaise im engen Foyer und dem Einzug zum großartigen Buffet. Nach dem Genuß der erlesenen Speisen begann das Silvesterprogramm, das Gudrun Heißig aus zahlreichen Beiträgen, teils Fundstücke aus der Literatur, teils eigene kleine Gedichten, zusammenstellen konnte. Dazwischen versammelten sich immer wieder Tanzbegeisterte auf der kleinen Tanzflähe, meisterlich begleitet von Karl-Werner Kronier am Keyboard. Am Anfang feierten wir den Geburtstag von Brigitte Kühnel, die mit höherprozentigen Genüssen dankte
Ein kurzer Weg führte mit Fakkeln zum Aussichtspunkt gegenüber der Kissalis-Therme, von wo ein Teil der Stadt überblickt werden konnte. Vor dem Jahreswechsel wuchs die Zahl der Raketen und Böllerklänge von Minute zu Minute. Um Mitternacht stiegen Garben von bunten Raketen auf allen Seiten der Stadt auf. Wir begrüßten das Jahr 2023 mit der Nationalhymne und dem Lied „Heimat dir ferne“.

Nach der Rückkehr auf den Heiligenhof begann die zweite Geburtstagsfeier. Klaus Franz öffnete eine Flasche Sekt nach der anderen. Doch anderthalb Stunden nach Mitternacht strebten auch die Hartnäckigsten ihrem Bett zu. Nach dem Frühstück machten sich die Teilnehmer etwas müde, aber voll von schönen Eindrücken auf den Nachhauseweg. etl, rt, ng, Kurt Heißig
Illing, Fritz Pfafflund Christian Weber, gleichzeitig Bezirks- und Kreisobmann, sowie zahlreiche Vorstandsmitglieder und Delegierte aus den Ortsgruppen waren gekommen. Nach der Begrüßung hielt Weber das Totengedenken ab. Man gedachte der verstorbenen Sudetendeutschen und derjenigen, die im Zuge der Vertreibung ihr Leben verloren hatten. Insbesondere gedachte die Kreisgruppe der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Sie war im Oktober mit 77 Jahren in Würzburg gestorben. Stamm war der Volksgruppe in tiefer Treue verbunden gewesen. Weber wies darauf hin, daß aufgrund der Lebenserfahrungen der Heimatvertriebenen die derzeitigen Flüchtlingsströme auf der Welt sehr aufmerksam verfolgt würden. Man wisse, was Menschen durchmachten, die ihre Heimat verlassen müßten. Verlust der Heimat sowie Flucht und Vertreibung hätten sich bei den Sudetendeutschen stark eingeprägt. Gemeinschaftliche Veranstaltungen und Diskussionen in der Landsmannschaft hülfen bei der Verarbeitung des Erlebten.
Nach Verlesung des Protokolls der letzten Kreishauptversammlung, der Tätigkeitsberichte und der anschließenden Entlastung des Vorstandes erfolgten die Neuwahlen. Christian Weber wurde als Kreisobmann wiedergewählt. Seine Vorfahren stammen mütterlicherseits aus Markt Eisenstein, und auch väterlicherseits stammen viele Vorfahren aus dem Böhmerwald.
Webers Stellvertreter sind Arnulf Illing, Fritz Pfafflund Harald Steiner. Schriftführerin ist Anne Weber. Michael Fremuth ist zuständig für die Vermögensverwaltung, Karin Pfafflund Rosemarie Wolf sind zuständig für die Kassenprüfung. Ermelinde Illing ist Frauenreferentin, Arnulf Illing fungiert als Kulturreferent, Beisitzer sind Agathe Rademacher und Horst Wolf. Als Delegierte in die Bezirks- und Landesversammlung wurden Arnulf Illing und als Stellvertreter Michael Fremuth ge-

wählt. Weber dankte für das Vertrauen und die Bereitschaft, für weitere vier Jahre ein Ehrenamt zu übernehmen.
Er wies darauf hin, daß man sich glücklich schätzen müsse, daß die Sudetendeutsche Volksgruppe 76 Jahre nach der Vertreibung in Bayern eine respektierte Organisation sowie politisch und gesellschaftlich akzeptiert sei. Gerade für die Unterstützung vor Ort sei man dankbar. Rosemarie Wolf nannte in diesem Zusammenhang das Vertriebenendenkmal auf dem Zwieseler Friedhof. Regelmäßig würden Blumen gespendet und Kerzen angezündet. Dafür ein herzliches Dankeschön an Jürgen Steyer und Rudolf Gadamer.

Christian Weber zeichnete Michael Fremuth mit der Verdienstmedaille der SL-Landesgruppe Bayern aus. Fremuth sei seit 18 Jahren Kassenwart der Kreisgruppe Regen-Viechtach. Zudem habe er zehn Jahre lang die Kasse der SL-Bezirksgruppe Niederbayern-Oberpfalz verwaltet. Bezirksobmann Weber sprach Michael Fremuth dafür seinen herzlichen Dank aus und gratulierte ihm zu der hohen Auszeichnung.
Harald Steiner zeigte Ansichtsexemplare des neu erschienenen zweiten Bandes „Im Lande der Künischen Freibauern“ und wies darauf hin, daß diese nun käuflih zu erwerben seien.
In der anschließenden Weihnachtsfeier wurden Weihnachtslieder gesungen, und Anne und Christian Weber berichteten mit Fotos aus dem Heiligen Land von ihrer Pilgerreise. Sie zeigten Bilder vom See Genezareth, Nazareth, Berg Tabor, Jerusalem und Bethlehem. Im Geburtsort von Jesus Christus hoffe man auf eine Rückkehr zur Normalität. In den letzten zwei Jahren seien coronabedingt im Advent nur wenige ausländische Pilger gekommen. 2022 seien wieder viele Menschen zur Geburtsgrotte gekommen. Zukunftssorgen überschatteten das Westjordanland. Der Konflit zwischen Israel und den Palästinensern sei allgegenwärtig, Furcht vor einer neuen Gewaltspirale mache sich breit. Die Zahl der Christen werde immer weniger. Viele junge palästinensische Christen verließen das Heilige Land. Die Informationen über die palästinensischen christlichen Gemeinden und deren Situation stimmten die Landsleute nachdenklich. nr
Drei Hessen mit Wurzeln in Aussig
Der Lebensmittelpunkt von Thorsten Stolz, Yvi Burian und Bernd Klippel ist der hessische Main-Kinzig-Kreis, in dem sie sich in Kreis- und Kommunalpolitik ebenso wie im sozialen Bereich engagieren. Allerdings besteht zwischen Stolz aus Gelnhausen, Burian aus Büdingen und dem Linsengerichter Bernd Klippel eine ganz besondere Verbindung. Alle drei haben familiäre Wurzeln in Aussig.
Thorsten Stolz ist seit 2017 Landrat für den Main-KinzigKreis und bewirbt sich als SPDKandidat für eine weitere Amtszeit. Die Wahl findet am 29. Januar statt. Bereits zuvor lenkte er zehn Jahre lang als Bürgermeister die Wege seiner Heimatstadt Gelnhausen.
Seine Großeltern stammen aus Aussig. Als unermüdlicher Fürsprecher für Aussöhnung und Zusammenhalt setzt er sich besonders für die Partnerschaften zwischen den Städten und Gemeinden in der gesamten Europäischen Union ein, wobei sein Augenmerk vor allem auf der Kontaktpflegemit den osteuropäischen Ländern liegt. Stolz: „Ein Schrecken wie der Zweite Weltkrieg mit allen furchtbaren Folgen für den gesamten Kontinent darf sich niemals wiederholen. Miteinander reden, gemeinsame Projekte angehen und der
� KV Graslitz/Egerlandkulturelle Austausch sind hierfür die wesentlichen Grundlagen.“
Thorsten Stolz hat sich wiederholt deutlich zu Europa und den europäischen Werten bekannt, welche seit Ende des letzten Weltkrieges Frieden und Freiheit garantieren. Er danke allen herzlich, die gerade in der heutigen Zeit des zunehmenden Rechtspopulismus ein unglaublich wichtiges Zeichen für Frieden, Freiheit, Solidarität, für unsere Demokratie und vor allem für Menschlichkeit setzten. Seine Botschaft an die Bürger: „Laßt nicht nach in eurem Engagement
Tschechischen Republik bilden ein wichtiges Bindeglied zwischen den Vertreibungsgebieten und dem neuen Zuhause. Gleichzeitig sind sie Anlaufstellen für alle, die generationsübergreifend ihre Wurzeln in den Böhmischen Ländern suchen.
Als aktives Mitglied im BdVKreisverband Hanau-Main-Kinzig und in der SL-Kreisgruppe Hanau-Stadt und -Land brachte sich Yvi Burian bereits mehrfach ein. Mehrjährige Erfahrungen in sozialen Organisationen und Vereinen ergänzen ihr Engagement in der Erinnerungsund Versöhnungskultur hinsichtlich Flucht, Vertreibung und Deportation.
Bernd Klippel aus Linsengericht-Eidengesäß ist als Sohn einer Mutter aus Aussig seit vielen Jahren SL-Mitglied und Obmann der SL-Kreisgruppe Gelnhausen. Und er ist aktives Mitglied der Seliger-Gemeinde, der Gesinnungsgemeinschaft der Sudetendeutschen Sozialdemokraten.

für unser gemeinsames demokratisches Europa.“
Yvi Burian ist seit November Heimatkreisbetreuerin von Leitmeritz in der Heimatlandschaft Elbetal. Die Heimatlandschaften, Heimatkreise, Heimatgemeinden, Begegnungszentren sowie die Vereine und der Kulturverband der Deutschen in der
Sie kam im hessischen Büdingen als Kind einer sudetendeutschen Familie väterlicherseits und einer oberschlesischen Familie mütterlicherseits zur Welt. Besonders prägte sie ihre Großmutter aus Aussig, die den Großvater aus Leitmeritz auch über den Tod hinaus treu geliebt und von Büdingen aus die durch Flucht und Vertreibung verstreuten familiären Verbindungen zusammengehalten hatte. Burian: „Die Verbundenheit mit dem Elbetal zu spüren, auch dort seelisch zu Hause zu sein sowie gleichzeitig in Hessen ein Zuhause zu haben und gleichermaßen die europäischen Werte zu leben, ist der Leitgedanke.“
Seit 2016 ist er Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung für die Heimatlandschaft Elbetal, zu der die ehemaligen Landkreise Leitmeritz, Aussig und Tetschen-Bodenbach gehören. Die Sudetendeutsche Bundesversammlung wurde einst als Exilparlament gegründet. Sie ist seit Jahrzehnten aktiver Mittler zwischen alter und neuer Heimat und leistet ihren Beitrag zur Pflegeder freundschaftlichen Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen.
Für die SPD seiner Heimatgemeinde Linsengericht sitzt Klippel im Gemeindeparlament und vertritt seinen SPD-Ortsverein als zweiter SPD-Vorsitzender. Er gilt als Mann der Kontakte, die weit über Ortsverein und Unterbezirk hinausgehen. Bernd Klippel sieht sich als Netzwerker auf allen Ebenen seiner zahlreichen Aktivitäten: „Miteinander ins Gespräch kommen, bereit sein zuzuhören, gemeinsam Ideen umsetzen und Lösungen findensind der einzig richtige Weg, den Frieden und die Demokratie in Europa dauerhaft zu sichern.“
Adventsfahrt ins deutsche Erzgebirge
Mitte Dezember unternahmen die Mitglieder des Kulturverbandes Graslitz einen Ausflugentlang der deutschtschechischen Grenze im Erzgebirge.


Wunderschön war, die zunehmend verschneite Landschaft aus dem Busfenster zu betrachten. Unsere erste Station war Johanngeorgenstadt, wo wir in die Stadtgeschichte eingeführt wurden und unter anderem den Schwibbogen und die Pyramide sahen, die die größten der Welt sind und nach und nach unter freiem Himmel von dem Unternehmer Siegfried Ott in den Jahren 2014 und 2015 errichtet worden waren.
Im Jahr 2019 schenkte er der Stadt ein weiteres Wahrzeichen – den Exulantenzug aus 14 geschnitzten Holzfiuren, die die Vertreibung der Protestanten aus der Bergstadt Platten im Jahr 1653 darstellen. Kurfürst Johann Georg gestattete diesen Flüchtlingen, eine Siedlung auf dem örtlichen Hügel Fastenberg zu errichten, und die neue Siedlung wurde auf seinen Wunsch hin nach ihm benannt. Außerdem sahen wir einen nachgebauten Pferdegöpel, der für die Bergleute sehr hilfreich war.
Anschließend fuhren wir mit der Fichtelbergbahn vom Bahnhof Oberwiesenthal nach Neudorf. Mit Volldampf verließen wir den Kurort Oberwiesenthal auf 914 Metern Höhe. Die Bahn hatte ein Tempo von 25 Stundenki-
lometern und ist auch im Winter ein schönes Erlebnis. In den Fenstern der kleinen Erzgebirgshäuser stehen Räuchermännchen, Schwibbögen und die Pyramiden der Erzgebirgsdörfer laufen auf Hochtouren.
In Neudorf angekommen, erwartete uns ein lekkeres Mittagessen in der Gaststätte Kaiserhof. Anschließend gingen wir basteln. In der Firma Huss wurde uns beigebracht, wie man Räucherkerzen herstellt. Die Firma Huss, die schon seit 1930 besteht,
ist für ihre Räucherkerzen oder Weihrichkarzle bekannt. Wir stellten eigene Weihrichkarzle aus einem Jahresteig her. Die von Hand geformten Weihrichkarzle-Unikate, die wir nach einer Stunde in einen kleinen Faltkarton legten, durften wir natürlich mit nach Hause nehmen. Wir hatten dabei sehr viel Spaß.
Einmal im Jahr erwachen die einzigartigen Schnitzfiuren der Marktpyramide in AnnabergBuchholz zum Leben, mischen

sich unters Volk und erzählen Stadt-, Bergbau- und Weihnachtsgeschichten. Und rundherum stehen Stände mit typisch erzgebirgischen Produkten. Hier gönnten wir uns auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein und verwöhnten unseren Gaumen.
Einige von uns besuchten auch die Bergkirche Sankt Marien, die ganz nahe am Weihnachtsmarkt steht. Die zwischen 1502 und 1511 erbaute Bergkirche ist die einzige bergmännische Sonderkirche in Sachsen. Sie wurde von den Bergleuten für die Bergleute erbaut. In der Bergkirche wird der sogenannte Annaberger Krippenweg präsentiert.
Dabei handelt es sich um eine bergmännische Weihnachtskrippe, die aus holzgeschnitzten Großfiuren besteht. Sie sollen die Verbindung von erzgebirgischem Bergbau und christlichem Glauben zeigen. Beispielsweise symbolisiert ein Bergmann die Josefsfiur der Krippe. Auch andere Figuren entstammen der Welt des erzgebirgischen Bergbaus. Daneben findensich Figuren aus dem Leben einer gründerzeitlichen erzgebirgischen Stadt. Der Annaberger Krippenweg hat 35 Figuren.


Dank gebührt Organisatorin Sonja Šimánková, den Dolmetscherinnen Gerda Hazuchová und Karin Pacholíková, Jitka Marešová für ihre Hilfe, Petr Rojík für seine Erklärungen und Hans Hermann Breuer für seine finanzielle Unerstützung. aá
Niklas in Netschetin
Mitte Dezember feierte der Bund der Deutschen in Böhmen mit Sitz in Netschetin Advent. Ihr Vorsitzender Richard Šulko oder Måla Richard berichtet.
Die Adventsbegegnung gehört bei allen Vereinen, und nicht nur bei denen, zu den beliebtesten Aktionen im Jahreslauf. Auch wir Egerländer aus Netschetin konnten nach zwei Jahren Corona-Pause wieder unsere Kostüme für den Niklas, den Zempara und den Engel aus dem Schrank holen und unsere Mitglieder nach Netschetin in das Gasthaus Am Rathaus einladen.
Die größte Sorge ist aber immer, wer die drei Personen darstellen soll. Diesmal schlupfte ich in das Gewand des heiligen Nikolaus. Weil ich in der Kirche auch die Rolle eines Akolythen ausübe, war ich von den Anwesenden auch der höchstqualifiziete. Den Zempara oder Teufel machte Terezie Jindřichová aus Elbogen und den Engel ihre Tochter Anna.


Am Anfang der Begegnung erklang das Weihnachtslied „Alle Jahre wieder.“ Vojtěch Šulko, der mit seiner Zither die Begegnung begleitete, konnte nach zwei Jahren wieder die Noten für die schönsten deutschen Weihnachtslieder auspacken. Ein Lied aber kommt aus dem Egerland: das Hirtenlied „Kumm, Brouda Mirtl“. Damit wird auch das Egerländer Kulturgut lebendig gehalten. Textvorträge ergänzten die Weihnachtslieder, diesmal stammten sie aus dem Buch „Ållahånd aas‘n Eghalånd“ von Toni Schuster.

Für die Kleinsten hat Irene Šulková eine schöne Beschäftigung vorbereitet: Pumper-
nickel verzieren. Pumpernikkel aus dem Egerland ist eine lebkuchenartige Leckerei, die es ähnlich auch im Fichtelgebirge gibt. Vor einer Woche gebacken, wurden die sehr gut riechenden, in verschiedensten Formen ausgestochenen Pumpernickel auf den Tisch gelegt, und das Bemalen konnte losgehen. „Welche Farbe soll ich denn nehmen?“, fragte die kleine Karoline die Oma Irene. „Die schönste Farbe ist die weiße“, meinte die Oma, „aber wenn man mehrere Farben hat, kann man es doch viel interessanter machen, oder?“
Nach einer Stunde musikalischen Programms kam der spannende Augenblick: Mit einer Kette rumpelte der Zempara in den Raum und suchte nach Kindern, die das ganze Jahr nicht brav gewesen waren. Sein Sack für den Transport in die Hölle hielt er bereit und wartete, wie die Kleinsten das Versprechen aufsagen: „Ich werde schön brav sein und meinen Eltern gehorchen.“ Der Niklas verteilte dann mit dem Engel Süßigkeiten, und der offizielle Teil war zu Ende.
Es war schön warm in der Stube, gutes Essen gab es auch, und deshalb blieben die Gäste noch sitzen bis es dunkel wurde. Beim Auseinandergehen wurde noch die Netschetiner Krippe am Marktplatz besucht, und dann ging es wieder nach Hause.

Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Zelten in Schloßgärtnerei



Seit den Überschwemmungen im Jahr 2010 ist der Campingplatz in Friedland geschlossen. Die Leitung der Stadt plant jetzt einen schrittweisen Umbau des Campingplatzes, der sich seit Mitte der 1960er Jahre auf dem Gelände der ehemaligen Clam-Gallasschen Schloßgärtnerei neben der Schloßbrauerei befindet.Gebaut wurde der Campingplatz damals unter der Leitung von Jakub Dvořáček.

Der Campingplatz soll heuer wiedereröffnet werden. Die Sanitäranlagen werden renoviert, eine neue Rezeption wird gebaut, das Gebiet wird an das Abwassersystem angeschlossen, die öffentliche Beleuchtung wird erneuert und die internen Zufahrtsstraßen werden ausgebaut. Die Stadtverwaltung möchte damit nach 13 Jahren ohne Campingplatz wieder mehr Touristen in die Stadt locken.
„Viele Menschen haben begonnen, interessante Orte in unserem Land zu besuchen, und Corona hat uns dabei ein wenig geholfen. Die Menschen sind von den Hotels auf ihre eigenen Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte umgestiegen und fahren ins ganze Land, um verschiedene touristische Ziele zu besuchen“, erklärte der Stellvertretende Bürgermeister von Friedland, Jiří Stodůlka (ODS), warum das Rathaus beschlossen hatte, den Campingplatz wiederzueröffnen.
Seiner Meinung nach fehlte es der Stadt an solchen Unterbringungskapazitäten. „Damit sie ein paar Tage bei uns bleiben und sich die ganze Umgebung von Friedland in Ruhe ansehen können. Wir wollen ihnen hervorragende Einrichtungen auf dem Campingplatz bieten, egal ob sie mit einem Zelt oder einem Wohnwagen kommen“, fügte er
hinzu. Die Stadt hat daher mehrere Etappen für die Renovierung des Campingplatzes vorbereitet. Die erste Etappe sieht die
wird. Die Begrenzungsmauer des Campingplatzes wird noch nicht saniert, hier wird vorübergehend ein Mobilzaun installiert.
leicht steht das Haus auch unter Denkmalschutz. Traurig und unverständlich ist, daß die Stadt Friedland mit dem Stellvertretenden Bürgermeister Jiří Stodůlka (ODS) erst 13 Jahre nach den Überschwemmungen davon Kenntnis genommen hat, daß der Stadt ein Campingplatz fehlt und zu diesem Schluß gekommen ist.
Am 1. Januar wurde das Wasser in der nordböhmischen Stadt Friedland um 6,3 Prozent auf 146,76 Kronen pro Kubikmeter inklusive Mehrwertsteuer teurer und gehört damit weiterhin zum teuersten Wasser im Land.
Für eine vierköpfigeFamilie mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 144 Kubikmetern bedeutet dies eine monatliche Erhöhung von 103 Kronen. 2022 betrug der Preis für Wasser und Abwasser bei der Friedländer Wassergesellschaft 138,23 Kronen pro Kubikmeter.
Die Gesellschaft habe die Wasser- und Abwassergebühren vor allem aufgrund höherer Stromkosten erhöht, sagte Petr Olyšar, Direktor der Friedländer Wassergesellschaft. Olyšar ist Mitglied der Demokratischen Bürgerpartei (ODS), wurde in Reichenberg geboren und lebt mit seiner Familie in Reichenberg.
„Im Vergleich zum starken Anstieg der Kosten für andere Le-
grundlegende Renovierung und den Bau von allem, was für den Aufenthalt der Touristen auf dem Campingplatz notwendig ist, vor, die anderen umfassen beispielsweise den Bau eines Schwimmbads.
In dem ersten Jahr der Bauarbeiten werden die bestehenden sozialen Einrichtungen instand gesetzt und ihre Kapazität erhöht. Und es werden Strom- und Wasserleitungen gebaut, um die Wasser- und Stromanschlüsse zu ermöglichen. Ein neuer Rezeptionsraum mit Aufenthaltsraum für das Personal, eine Toilette, ein Bistro und eine Bar mit überdachten Sitzgelegenheiten werden gebaut und ein Internetanschluß wird eingerichtet.
Die Gloriette, ein offener Gartenpavillon, wird auch rekonstruiert, wobei die alte Baukonstruktion des Verkaufskiosks verschwindet und die ursprüngliche gewölbte Konstruktion mit Fresken, die von antiken Säulen getragen wird, wiederhergestellt

„Leider werden wir in dieser ersten Phase nicht mit der Erneuerung der Mauer fortfahren, da sie unter Denkmalschutz steht und ihre Restaurie-
Aus der Vergangenheit ist folgender traurige Vorfall aus der Schloßgärtnerei bekannt: Wie damals gemeldet wurde, entlud sich am Dienstag, dem 23. Juli 1929 gegen 18.00 Uhr über Friedland nach tagelanger, übermäßiger Hitze ein Gewitter, das von Hagelschlag schwerster Art begleitet wurde. Eine Stunde später brach das Unwetter neuerdings los, und die ganze folgende Nacht war von Gewitterschwüle erfüllt, die sich gegen 5.00 Uhr morgens dann nochmals in hef-
Zwei Musikanten
Erhard Ressel, auch Bück-DichErhard genannt, spielte Geige und wohnte im Hotel BückDich. Und Josef „Josi“ Scherl aus der Ostritzer Straße spielte auf der Ziehharmonika.

Diesen Alleinunterhaltern gelang in Friedland, jeden mit ihrer Musik in Schwung zu bringen. Sie traten überall auf, wo sie mit ihrer Musik Freude bereiten konnten. Hauptort von Josis Auftritten war das Gasthaus Zur Vorstadt mit einem Vereinszimmer, wo er sich mit anderen Musikern abwechselte. Beide gehörten zu den wenigen Deutschen, die nach 1945 in Friedland bleiben konnten. Sie starben in den 1960er Jahren.


der Privatisierung wurde es geschlossen. Als das Schild mit dem tschechischen Namen vom Gebäude entfernt wurde, erschien an der Fassade der Anfang des deutschen Namens der Gaststätte ZUR, der 1945 nicht entfernt

rung sehr kostspielig ist. Wir haben jetzt nicht die notwendigen Millionen Kronen für diese Aktion. Deshalb werden wir die Reparatur an der zerstörten Mauer auf die nächsten Jahre verschieben“, sagte der derzeitige Bürgermeister Dan Ramzer, der aus Reichenberg stammt und in Wustung lebt.
Ob die Ruine des Hauses des ehemaligen Gärtners der bekannten ehemaligen ClamGallasschen Schloßgärtnerei auch renoviert wird, das ist leider noch nicht bekannt. Viel-

tigen elektrischen Entladungen Luft machte.
Das Unwetter brachte leider beträchtliches Unheil über einen Teil des Bezirkes. Der Hagelschauer prasselte mit unerhörter Wucht nieder, wie er seit Jahrzehnten in unserer Gegend nicht mehr aufgetreten ist. Es filen Hagelkörner, die teilweise so groß wie ein Ei waren mit einem Gewicht von 50 Gramm, denen viele Scheiben der Gewächshäuser zum Opfer fielen.In der Schloßgärtnerei in Friedland zerschlug der Hagel Glasscheiben in großer Anzahl. In den Gärten erlitten die Gemüseernte und insbesondere die damals ohnehin wenig aussichtsreiche Obsternte schweren Schaden.“
Stanislav BeranDas sogenannte Hotel Bück-Dich in der Görlitzergasse 315, das früher unter Denkmalschutz stand, wurde 2013 abgerissen, um den Verkauf des privaten Grundstücks zu erleichtern. Das alte, historische Umgebindehaus gehörte zu den ältesten Gebäuden der Stadt.
Auch das Friedländer Gasthaus Zur Vorstadt mit Metzgerei existiert nicht mehr. Nach

wurde. Traurig, daß die Besucher im Zentrum der 7500-SeelenStadt Friedland kein Restaurant finden,in dem sie zu Mittag essen können. Früher gab es das Hotel Wallensteiner, den Reichshof und das Weiße Roß. Das ist Vergangenheit. Stanislav Beran

Tschechischer Wasserpreisrekord
bensbedürfnisse und zum Anstieg des Wasserpreises in anderen Wasserwerken ist der Wasserpreis in der Region Friedland wirklich nur geringfügig höher. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die Energiepreise vergangenes Jahr erheblich stiegen, nämlich um 138 Prozent, was sich bereits in den diesjährigen Wasserpreisen niedergeschlägt. Daher werden sich weitere Erhöhungen der Energiepreise nicht so dramatisch auf die Wasserpreise im nächsten Jahr auswirken. Außerdem konnten wir durch Netzmaßnahmen Einsparungen erzielen und haben einen kostengünstigeren Investitionsplan für das nächste Jahr aufgestellt“, sagte Olyšar.
Die Erhöhung des Wasserpreises wird sich auch dadurch be-

merkbar machen, daß die Friedländer Wassergesellschaft ab dem nächsten Jahr 39 Prozent mehr für die sogenannte Leistungskomponente des Stroms zahlen wird als in diesem Jahr. „Das bedeutet, daß die Kosten dafür um 900 000 Kronen höher
liegen werden. Der Wasserpreis steigt auch aufgrund der 15prozentigen Inflation,die alles von Material über Chemikalien bis hin zu Kraftstoffen teurer macht. Auch das Oberflähenwasser im Elbe-Einzugsgebiet verteuerte sich um 9,5 Prozent“, so der Di-
rektor der Friedländer Wassergesellschaft.
Der Anstieg des Wasserpreises sei auch auf die Erhöhung der Löhne für die Beschäftigten der Wassergesellschaft und den Einsatz einer neuen Chemikalie zur Absenkung des Phosphorgehalts in den Kläranlagen in Haindorf und Neustadt an der Tafelfihte zurückzuführen. Die Friedländer Wassergesellschaft versorgt 24 000 Einwohner im Friedländer Ausläufer mit Wasser. Die Wasser- und Abwassergebühren bezahlen die Einwohner von Friedland, Haindorf, Neustadt an der Tafelfihte und Raspenau. In den anderen 13 Gemeinden der Region Friedland, die von der Wassergesellschaft versorgt werden, zahlen die Einwohner nur Wassergebühren. Für sie steigt der
Preis im nächsten Jahr um 2,8 Prozent.
Die meisten Menschen im Landkreis Reichenberg versorgt die Nordböhmische Wassergesellschaft. Ab diesem Jahr stieg auch bei ihr der Preis um 14 Prozent. Trotz allem bezahlen ihre Kunden weniger als die Kunden der Friedländer Wassergesellschaft. Hier zahlen die Kunden jetzt 128,11 Kronen pro Kubikmeter inklusive Mehrwertsteuer, 16 Kronen mehr als 2022. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bedeutet dies etwa 150 Kronen mehr pro Monat. Nach Angaben der Nordböhmischen Wassergesellschaft sind die massiven Investitionen in die Modernisierung und der Ausbau der Infrastruktur Hauptgründe für den höheren Preis. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Wassergesellschaft in Friedland ist der Friedländer Bürgermeister Dan Ramzer von der Demokratischen Bürgerpartei (ODS).
Stanislav Beran Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel
Alte Bilder neu entdeckt
Hie und da findetman in Museumsdepots und Archiven Fotos und Erinnerungsstücke, über deren einstige Besitzer wenig bekannt ist. Dazu gehört der im Nordböhmischen Museum in Reichenberg aufbewahrte Nachlaß des Auto- und Motorrad-Rennfahrers Franz Liebieg.
Franz Liebieg soll aus einer Nebenlinie der Industriellenfamilie Liebieg stammen“, sagt Anna Dařbujanová, Kuratorin der Sammlung historischer Fotografiendes Nordböhmischen Museums. Er wurde um 1895 geboren.

In den zwanziger und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war er einer der besten regionalen Rennfahrer.
Die Franz-Liebieg-Bilder dokumentieren seine sportlichen Leistungen in den Jahren 1927 bis 1937. Erhalten sind 19 Kartons, je 43 mal 30 Zentimeter
groß, mit goldverzierten Kanten und aufgeklebten Fotos, meist mit Bezug zum Rennsport. Unter den 207 Fotografienunterschiedlicher Größe und Qualität, teilweise nur mit einem Handvermerk versehen, befindensich auch alte Zeitungausschnitte. „Ein kleinerer Teil der Aufnahmen stammt von bekannten Fotografen, beispielsweise aus den Reichenberger Ateliers von Carl G. Springer oder Richard Krüger“, sagt Dařbujanová.
Franz Liebieg nahm an vielen Wettbewerben teil, vor allem an den Bergrennen von Saskal auf den Jeschken oder im sächsischen Lückendorf. Außerdem fuhr er die Motorrad-Rundstrecke in Paulsdorf bei Reichenberg. Die Autorennen bestritt er als Amateur auf Amilcar Grand Sport oder Amilcar Grand Prix des französischen RennwagenHerstellers Amilcar, die Motor-
radrennen mit dem britischen Triumph Klasse 350 Kubikzentimeter. Zu seinen interessantesten Rennen gehörten Ecce Homo in Sternberg, wo er 1927 mit seinem Motorrad den 7. Platz belegte, sowie die Tschechoslowakische Tourist Trophy (1925–1927) und das Automobil- und Motorradrennen auf der Altvater-Bahn. Ecce Homo absolvierte er auch später auf Amilcar.

„Die Textilbarone Liebieg hinterließen im Reichenberger Bezirk viele Spuren, vom Kulturmäzenatentum über die Finanzierung wichtiger Stadtbauwerke und die Errichtung so-
zialer Wohnsiedlungen, der Liebiegstadt, bis hin zu ausgelebter Begeisterung für den Automobilsport. Eine Fotodokumentation über die frühen Jahre des tschechischen Motorsports zu besitzen, ist einfach toll“, freut sich Květa Vinklátová, Landesbeauftragte für Kultur, Denkmalschutz und Tourismus.
Der Motorsport führte Franz Liebieg mit dem Mercedesfahrer Ernst Mahla, einem Stahlwarenfabrikanten aus Morchenstern/Smržovka, zusammen. Mit ihm bestritt er mehrere Rennen. Dem Sport widmete er sich auch in seiner Freizeit, er spielte Ten-
Reichenberger Burschenschaft Saxo-Borussianis und fuhr Ski. Darüber hinaus war er bei gesellschaftlichen Veranstaltungen ein gern gesehener Gast und pflege gute Kontakte zum Kunstverein Metznerbund. Zweck dieses Vereins deutschsprachiger bildender Künstler, der 1918 in der neuen Tschechoslowakei entstanden war, war, die künstlerischen, gesellschaftlichen und sozioökonomischen Interessen seiner Mitglieder besser durchsetzen zu können.
„In den kommenden Jahren wollen wir die Fotos von den Pappkartons ablösen, restaurieren und digitalisieren lassen und das Thema auch für die Öffentlichkeit aufbereiten. Dabei versprechen wir uns neue Erkenntnisse über diesen zu Unrecht vergessenen Rennfahrer, eine Persönlichkeit des Reichenberger Motorsports der Zwischenkriegszeit“, erklärt Anna Dařbujanová. Petra Laurin
Heimatkreis- und -gemeindebetreuer gratulieren allen treuen RZ-Abonennten, die im Januar Geburtstag, Hochzeitstag, ein Jubiläum oder sonst ein Ereignis feiern, und wünschen alles Gute, vor allem Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit. Den Kranken wünschen wir baldige Genesung und jenen, denen es gut geht, daß es so bleibe.
n Heimatkreis – Geburtstage: Am 8. Inge Zelfel/Kunze, Ortsbetreuerin von Schönbach, Drosselweg 5, 84478 Waldkraiburg, 88 Jahre, am 9. Johanna Platz/Hanisch, Gemeindebetreuerin von Krombach mit den Ortsteilen Juliusthal und Schanzendorf, Karl-Halbig-Straße 37, 99887 Gräfenhain, 81 Jahre, am 24. Walter Seidel, Ortsbetreuer von Brins, Zscherbener Straße 9, 06124 Halle, eMail waseidel24@ yahoo.de, 83 Jahre, und am 30. Johanna Gering/Seidel, Ortsbetreuerin von Schneckendorf, Budapester Straße 10, 99510 Apolda, 84 Jahre.
Herzlich danken wir unseren Gemeindebetreuern und Mitarbeitern für ihre aufopferungsvolle Arbeit für unsere gemeinsame Heimat im vergangenen Jahr. Othmar Zinner
n Kriesdorf – Geburtstag: Am 28. Franz Schäfer (Niederdorf. 16), Steinkuhle 5, 38304 Wolfenbüttel, 84 Jahre. Christian Schwarz
n Deutsch Gabel – Geburtstag: Am 27. Josef Jannoch, Arzbergstraße 49a, 98587 SteinbachHallenberg, 92 Jahre.
Othmar Zinner Helga Hecht
Wir suchen Bundesbrüder
Wolfgang Hein ist der Sohn von Anton Hein, der 1918 die Burschenschaft Saxo-Borussia zu Reichenberg gründete, und Enkel des Anton Hein, der das Papier- und Schreibwarengeschäft Hein in Reichenberg besaß. Er schreibt:
Wichtig für uns ist, Kontakte zu Nachkommen der alten Saxo-Borussen zu bekommen. Die haben vielleicht noch alte Fotos, Couleurartikel wie Band und Mütze oder Schläger. Aber auch Anekdoten und Geschichten liegen uns am Herzen.
ger Zeitung über ein Treffen der Saxo-Borussia in Korntal, einem Stadtteil von Kornstadt-Münchingen in BadenWürttemberg. Ich zitiere:
„Die Alten Herren trafen sich zu einem fröhlichen Beisammensein in Korntal bei Stuttgart. Das ist schon Tradition: 1982 in Nürnberg, 1983 im Taunus, 1984 in Ahrweiler und 1985 in Korntal. Vorbereitung und Organisation lagen in den Händen des Alten Herren (AH) Hans Brosche und seiner Frau Herta, die das vorbildlich mit Lust und Liebe taten.
100semestrigen Stiftungsfest in Geisenheim 1968 vorführen. Wir hatten viel Freude dar-
Anfang Januar wurden die Tiere nahe Neustadt an der Tafelfihte gefunden, eines bei Lusdorf an der Tafelfihte und das andere bei Bad Liebwerda“, sagte der Direktor der staatlichen Veterinärverwaltung der Region Reichenberg. Beide Funde fielenin das sogenannte Infektionsgebiet, das die Tierärzte aber vorerst nicht ausweiten würden, ergänzte er.
Wegen der Pestgefahr herrschen in der Region Friedland auf einer Fläche von 200 Quadratkilometern strenge Regeln. Dort sind die Jagd auf Wildschweine und das Füttern der Tiere verboten.
Die Bewegung der Menschen in der Landschaft ist beschränkt. Das betroffene Gebiet erstreckt sich entlang der gesamten Staatsgrenze im Friedländer Ausläufer und geht weiter bis in Richtung Raspenau. Auf der einen Seite von Raspenau grenzt das Gebiet an Dittersbach und auf der anderen Seite an Haindorf. Ziel ist, die Ausbreitung der Seuche zu hemmen und die Einschleppung der Pest in Haushalte und landwirtschaftliche Betriebe zu verhindern.
Das Infektionsgebiet riefen Tierärzten nach dem Fund eines toten Wildschweins in der Nähe von Heinersdorf an der Tafelfihte aus, das am 1. Dezember positiv getestet worden war. Inzwischen sind drei positive Fälle aufgetreten, und die Seuche hat sich an die südliche Grenze der Zone und da-

mit Reichenberg angenähert. „Wir werden die Zone so lassen, wie sie jetzt ist, wir würden nur die Grenze verschieben, wenn sie in die Pufferzone hineinragt“, sagte der Direktor der regionalen Veterinärverwaltung.
Die Pufferzone, die sogenannte Sperrzone I, hatte die Veterinärverwaltung vor Weihnachten festgelegt. Sie schließt an die Infektionszone an und umfaßt 65 Katastergebiete mit einer Fläche von 531 Quadratkilometern. In diesem Gebiet dürfen nur ausgebildete Jäger Wildschweine jagen. Das Gebiet umfaßt unter anderem Gablonz, wo im Dezember damit begonnen wurde, die überhöhte Zahl der Wildschweine zu fangen, die die Einwohner der Stadt belästigten. Die mit dem Fang verbundenen Verfolgungsjagden sind kein Verstoß gegen die Verordnung.
Experten zufolge ist das ASP-Virus sehr widerstandsfähig, auch gegen niedrige Temperaturen, so kann es beispielsweise in gefrorenem Fleisch mehrere Jahre überleben. Die Krankheit ist weder für Menschen noch für Hunde gefährlich. Aber auch ein Mensch oder ein Hund, der eine infiziere Umgebung betritt, kann ein Überträger werden. Deshalb darf man in der Infektionszone nur auf markierten Wegen spazieren gehen, und es ist verboten, Hunde im Wald frei herumlaufen zu lassen. Die größte Infektionsquelle sind die toten Wildschweine. In der Infektionszone werden sie von den Jägern intensiv gesucht. Für jedes gefundene tote Wildschwein erhalten sie 3000 Kronen. Stanislav Beran
Meine Söhne, weitere Bundesbrüder und ich digitalisierten Originaltonbandaufnahmen von 1968, auf denen man die Stimmen von meinem Vater Karl Hein sowie von Richter Edi (Eduard), Streit Edi (Edmund) und anderen hört.
Wer weiß etwas über ein 1968 von Bundesbruder Richter Edi (Eduard) an ein „Haus“ (Heimatverein oder ähnliches) überreichtes „Werk“ (selbst angefertigter Stadtplan von Reichenberg mit den Namen und Häusern aller Saxo-Borussen einschließlich Kindern und Enkelkindern), welches neun Quadratmeter groß sein soll? Dieses Werk interessiert uns als Saxo-Borussen sehr. Zumindest eine kleinere Kopie wäre für uns Gold wert. Das Werk hatte Richter Edi 1968 auf Band ausführlich beschrieben.
Namentlich suchen wir auch Nachkommen von Franz-Louis Kalwach, Rolf Leubner, Richard Mai, Josef Pohl, Hanns Brosche sowie Alfred, Fritz und Herbert Endler. Außerdem stehen noch viele andere Namen auf unserer alten Mitgliederliste. Wir kennen auch die Wohnorte mit den Adressen, wo alle Saxo-Borussen im März 1984 lebten.

Anfang September werden wir nach Reichenberg fahren. Der Kontakt zu Petra Laurin ist hergestellt und wird weiter gepflegt.Nun hoffen wir auf Informationen an mich, Wolfgang Hein, Borbecker Straße 6, 26127 Oldenburg, eMail saxoborussia-oldenburg@freenet.de
Am 25. Oktober 1985 berichtete Rolf Leubner in der Reichenber-
Am 27. September 1985 erreichten wir Korntal, trafen uns im Landschloßhotel, in dem wir auch wohnen konnten. Bei reger Unterhaltung und bester Stimmung verging die Zeit, abends aßen wir im Restaurant Harmonie. Wir blieben bis gegen Mitternacht beisammen.

Am nächsten Morgen brachte uns ein Autobus nach Leonberg, ein altes, reizendes Fachwerkstädtchen, und mit einigen Umwegen zum Schloß Solitude bei Stuttgart. Herta Brosche machte uns auf alle Sehenswürdigkeiten aufmerksam. Im Schloßrestaurant Solitude trafen wir uns zum Mittagessen.
Nach einem kleinen Spaziergang und der Rückfahrt trafen wir uns im Landschloßhotel zu Kuchen und Kaffee wieder, wo uns eine Überraschung serviert
an, mußten aber leider feststellen, daß schon viele nicht mehr unter uns sein können.
Am Abend trafen wir uns im Restaurant Seegarten in der Stadthalle von Korntal zu einem Festessen. Der Saal war mit unseren Farben geschmückt, die Tafel besonders geschmackvoll mit Kerzenlichtern und Blumen dekoriert. Es war festlich und trotzdem gemütlich. Die Begrüßung nahm ich vor und mußte leider auch mitteilen, wer im vergangenen Jahr durch Tod abberufen worden war: AH Georg Billig, AH Heribert Klinger, AH Bruno Knesch, AH Franz Kalwach, AH Walter Hoffmann, AH Josef Pohl, Bundesschwester Alice Beier und Annemarie Böhm, die Frau unseres AH Molly Böhm in Venezuela.
Die Sommerzeit endete in dieser Nacht, so daß wir eine Stunde länger beisammen sein konnten. Es war ein harmonisches und fröhliches Beisammensein, das wir 1986 in Korntal wiederholen wollen. Dank an unseren AH Brosche und seine Frau Herta und ein gesundes Wiedersehen.“
wurde. Wolfgang Hein, der Sohn unseres Gründungsseniors, konnte uns die Tonbänder von unseremDie tschechischen Kommunalwahlen hatten Ende September stattgefunden. Im Oktober wurde die Wahl in Moldau gerichtlich für ungültig erklärt und Neuwahlen angesetzt. Bisher scheint in der Gemeinde alles darauf hin zu deuten, daß die Wahlen diesmal nach den Regeln verliefen. Also ohne „schwarze Seelen“, die sich in Moldau nur formal zum Daueraufenthalt gemeldet hatten, um konkrete Kandidaten zu wählen.
Laut Alteingesessener wurde diesmal kein Druck ähnlichen Charakters auf die Abstimmung ausgeübt. „Allgemein sind nun die Bewohner etwas im Zweifel, ob es überhaupt einen Sinn hat, erneut an der Wahl teilzunehmen,“ meinte Eva Kardová aus der Bewegung SPOLU/Gemeinsam.
Moldaus Bürgermeisterin Lenka Nováková hatte kurz vor den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr entschieden, 46 Wahlteilnehmer aus den Wahllisten zu streichen. Als Grund hatte sie angegeben, daß diese überhaupt nicht in der Gemeinde lebten, dort nichts besäßen und keinerlei Beziehungen zu Moldau hätten. Einige von ihnen hätten sich erst kurz vor der Wahl in der Gemeinde angemeldet, andere seien bereits als „schwarze Seelen“ aus den vergangenen Jahren eingetragen gewesen. Der Vorsitzende der Wahlkommission hatte diese Personen jedoch zur Wahl im September zugelassen.
Das Bezirksgericht in Aussig hatte anschließend auf Grund von Beschwerden über eine Manipu-
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau












Bilin
Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatk reis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96 eMail post@nadirahurnaus.de


lierung der Wahlen beschlossen, daß die aus dem Wahlverzeichnis gestrichenen Personen in Moldau kein Wahlrecht hätten. Laut veröffentlichter abschließender Entscheidung war es dadurch zu einem ungesetzlichen Verlauf der Wahlen durch die örtliche Wahlkommission und zu einer groben Beeinflussungdes Wahl-
deren Vorsitzender in das Wahlverzeichnis eingreifen. „In diesem Beschluß des Gerichts ist das eindeutig mehrmals erwähnt. Es würde sich um einen ungesetzlichen Eingriff der Wahlkommission handeln“, betonte Bürgermeisterin Nováková.
Diese hatte erneut eine Anzahl von Wählern aus der Liste gestrichen, die als „schwarze Seelen“ bereits im vergangenen Jahr von der Wählerliste gestrichen worden waren, aber damals durch den Vorsitzenden der Wahlkommission widerrechtlich zugelassen wurden.






Am 1. Januar berichtete Jaroslav Krupka in der Teplitzer Tageszeitung „Teplický deník“ über die Teilung der Tschechoslowakischen Republik 1992/1993. Jutta Benešová übertrug den Beitrag für den Heimatruf ins Deutsche.

Am Abend gingen sie als Bürger der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik schlafen, und am Morgen erwachten sie als Bürger entweder der Tschechischen oder der Slowakischen Republik. Daß ein gemeinsamer Staat in Zukunft eine komplizierte Angelegenheit werden sollte, zeigte sich bald nach der Samtenen Revolution im November 1989. Das bekundete auch deutlich die Antwort eines slowakischen Seniors bei einer Umfrage der Zeitung „Mladý svět“ (Junge Welt): „Während der Slowakischen Republik ging es uns sehr gut. Nach dem Krieg zahlte man für eine Slowakische Krone mit drei Tschechischen Kronen!“ Dabei berücksichtigte er die faschistische Vergangenheit dieses Staates nicht, denn die Vorteile der staatlichen Selbständigkeit überwogen offensichtlich in seinen Erinnerungen.
Bereits im Januar 1990 rief der Entwurf eines neuen Staatswappens große Proteste hervor. Das hatte Václav Havel der damaligen Föderalversammlung vorgelegt, doch leider ohne sich zuvor mit den Parlamentariern oder Fachleuten zu beraten. Dieser Schritt komplizierte auch die Verhandlungen über die neue Bezeichnung des Staates, indem die Diskussion über einen Bindestrich zwischen den Worten Tschecho und Slowakisch begann.
„Das riß die Slowaken vom Sitz und schickte sie auf die Straße… Während der Proteste erklang auch zum ersten Mal die Forderung nach einer unabhängigen Slowakei. Der slowakische Kampf hing mit den Bemühungen zusammen, die Slowakei sichtbarer zu machen. Ihrer Meinung nach bedeutete der Begriff ,tschechoslowakisch‘ nur ,tschechisch‘. Die Slowaken würden demnach für Tschechen gehalten. Mit einer Änderung der Bezeichnung zu ,Slowaken‘ hofften sie, daß die Welt sie als selbständiger sehe“, führte dazu in seiner Arbeit „Verfassungsaspekte des Untergangs der tschechoslowakischen Föderation“ der Historiker Jan Hádek an.
Spannungen rief auch die Asymmetrie vieler Institutionen hervor. So wirkte zum Beispiel auf tschechischem Boden das Československá televize, das Tschechoslowakische Fernsehen, während in der Slowakei gleichlaufend das Slovenská televízia entstand. Gleichzeitig zeigten sich in der Slowakei Tendenzen, eine Slovenská policie, eine Slowakische Polizei, eine Slovenská armáda, eine Slowakische Armee, und eine Slowakische Nationalbank zu gründen.
slowakischen Nation geltend gemacht wurde. Daraufhin dankte Präsident Václav Havel ab. Und zwei pragmatische Politiker, die die Parlamentswahlen im Juni 1992 gewannen, kamen zu Wort: Václav Klaus an der Spitze der ODS in Tschechien, Vladimír Mečiar als Vorsitzender der HZDS in der Slowakei. Die beiden Männer einigten sich bereits am 8. Juli 1992 in der Villa Tugendhat in Brünn auf die Teilung der Föderation und unterzeichneten diese Vereinbarung bei einem weiteren Treffen dort am 26. August.

„Klaus war wie Mečiar vor allem Pragmatiker. Ihre Gespräche im Juni und Juli 1992 waren eigentlich gar keine wirklichen Verhandlungen“, kommentierte der britische Historiker Tony Judt. Die beiden Männer hätten von Anfang an die Teilung des Staates angestrebt. Am 1. Januar 1993 erreichten ihre Bemühungen ihren Höhepunkt: die Ausrufung der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik.
ergebnisses gekommen. „Die örtliche Wahlkommission ist im Verlauf der Wahlen nicht berechtigt, die Richtigkeit einer Streichung von Personen durch das Gemeindeamt aus der ständigen Wahlliste des Ortes zu überprüfen“, hatte in der Entscheidung der Senatsvorsitzende Petr Černý geschrieben. Die Wiederholung der Wahlen erfolgte nun auf Grund des gesetzlichen Beschlusses über die Ungültigkeit der Septemberwahlen ohne diese „schwarzen Seelen“.


Die Wahlkommission trat in gleicher Zusammensetzung auf – mit dem Vorsitzenden Oldřich Kozler, den die Okamura-Bewegung SPD nominiert hatte. Gemäß Beschluß des Bezirksgerichts durften weder die Mitglieder der Wahlkommission noch
Laut Aussigs Stellvertretendem Bezirkshauptmann Jiří Řehák erfolgte am Samstag in Moldau ein Kampf um die demokratischen Prinzipien der Wahlen in unserem Staat. „Auch hier führt eine Gruppe von Menschen mit Hilfe angeheuerter ,Wähler‘ die grundlegendste Errungenschaft der Demokratie – freie Wahlen – in Zweifel, um eine Gemeinde mit enormem wirtschaftlichen Potential zu kontrollieren. Moldau ist eine so kleine Gemeinde, daß 20 angeheuerte Nicht-Bürger das Wahlergebnis ändern können – und hatten es auch im September geändert. Die erhöhte Aufmerksamkeit der gesellschaftlichen Kräfte hilft wenigstens etwas, so daß wir hoffen, daß sich die Strafverfolgungseinrichtungen gegen Manipulationen und unlautere Pläne wehren werden. Das Bezirksgericht hatte schon einmal eingegriffen“, äußerte sich Řehák dazu.
Bei Redaktionsschluß waren die Wahlergebnisse noch nicht bekannt. Aber wir bleiben am Ball und halten unsere Leser auf dem Laufenden. Jutta Benešová
Öl ins Feuer goß der heutige Staatspräsident Miloš Zeman. Er war damals Berichterstatter der Verhandlungskommission der Föderalversammlung und hatte vorgeschlagen, daß die neue Bezeichnung der Republik auf Tschechisch „Tschechoslowakische föderative Republik“ und auf Slowakisch „Tschecho-Slowakische föderative Republik“ lauten und darüber nur in der Nationalversammlung abgestimmt werden solle. Diese Abstimmung fand schließlich auch statt, und die Bezeichnung wurde im Verfassungsrecht verankert.
Zur gegenseitigen Entfremdung trug auch bei, daß die Slowakei weit stärker vom Rückgang der Rüstungsproduktion und dem Zusammenbruch der Ostmärkte betroffen war. Slowakische Nationalisten warfen der tschechischen Seite vor, diese Tatsachen bei der Wirtschaftsreform nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. All dies führte zu einer Situation, in der ein Verbleib in einer gemeinsamen Föderation unmöglich war.
Der eigentliche Teilungsprozeß wurde dann durch die Erklärung des Slowakischen Nationalrates vom 17. Juli 1992 eingeleitet, in der die Oberhoheit als Grundlage eines souveränen Staates erklärt und das natürliche Selbstbestimmungsrecht der
Tschechische Soldaten, die um die Jahreswende 1992 und 1993 in UNPROFOR-Einheiten im ehemaligen Jugoslawien gedient hatten, erinnerten sich später daran, wie manchmal serbische oder kroatische bewaffnete Männer sie eingeladen hätten, mit ihnen auf die andere Seite zu schießen, und gesagt hätten, daß die Erfahrung für sie nützlich sein werde, wenn sie dann gegen die Slowakei kämpfen würden. Die Nachricht von der bevorstehenden Teilung der Tschechoslowakei bedrohte sie in gewissem Maße in ihrer Mission, weil sie an Respekt vor den Serben und Kroaten zu verlieren begannen. Dieser kehrte erst zurück, als klar wurde, daß die Teilung der Tschechoslowakei tatsächlich friedlich verlaufen war, ohne einen einzigen Schuß oder eine einzige Gewaltdemonstration. Diese Teilung eines Staates war damals wirklich einzigartig in Europa.
Am Samstag gingen die Bürger von Moldau bei Teplitz-Schönau erneut zu den Wahlurnen. Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergDie Pflege des heimatlichen Brauchtums, Völkerverständigung, Eintreten für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, für Toleranz und Menschenwürde – all diesen Zielen hatte sich die Egerländer Trachtengruppe des Heimatkreises Bischofteinitz im hessischen Wolfershausen, heute ein Ortsteil von Melsungen, verschrieben. Sie wäre vergangenes Jahr 75 Jahre alt geworden. Doch diese einst weit über das Melsunger Land hinaus bekannte und beliebte Gruppe gibt es leider nicht mehr. Sie mußte sich auflösen.

Es ist traurig, aber es war leider keiner mehr da, die Gruppe zu leiten“, sagt Albert Reis. Der heute 82jährige Friseurmeister aus Neuenbrunslar war seit 1983 Mitglied, leitete viele Jahre den

Sudetenland nach Wolfershausen, sein Vater war in Gefangenschaft. Knapp 10 000 Heimatvertriebene fanden 1946 im Altkreis Melsungen ein neues Zuhause, sehr viele aus dem Sudetenland. Sie kamen in Viehwaggons in den Bahnhöfen Melsungen, Gensungen und Guxhagen an. Sie wurden überwiegend freundlich aufgenommen. Die Sudetendeutschen sind bekannt für ihren Fleiß, viele Flüchtlinge bau-
mal aus Dankbarkeit für die Aufnahme im Nachkriegsjahr 1946, nachdem sie aus der angestammten Heimat, dem Sudetenland, vertrieben worden waren.
Chor, erlebte ungezählte Auftritte im In- und Ausland. Karmen Kiefner (54) ist von Geburt an Mitglied, „eigentlich schon im Mutterleib“, sagt sie mit Stolz. Ihr Vater Rudolf war der Initiator und Gründer der Trachtengruppe, seine Ehefrau Rosemarie eine vorbildliche Unterstützung.


Christa Fröhlich (75) stammt aus Wolfershausen. Ihr Mann kam als sechsjähriger Junge damals mit seiner Mutter aus dem
ten sich im Melsunger Land eine neue Existenz auf.
Auch die Familie Kiefner, und Rudolf Kiefner war auch als Kommunalpolitiker die treibende Kraft für viele Initiativen. Dazu gehört auch das Ehrenmal in Form eines Kreuzes am Wolfershäuser Friedhof. In Erinnerung an die Opfer der Vertreibung schenkten die Sudetendeutschen der Gemeinde Wolfershausen am 18. Juni 1961 das Ehren-


Nur 50 Kilogramm Gepäck hatten die Heimatvertriebenen mitnehmen dürfen. Viele wollten auf ihre schöne Tracht nicht verzichten und nahmen sie mit. Sie ist ein Fundament der Egerländer Trachtengruppe in Wolfershausen. Diese hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Kulturerbe der verlorenen Heimat, die Volkstracht, den Volkstanz und das Volkslied im Bewußtsein aller Mitbürger lebendig zu erhalten. Der Beitrag der Vertriebenen zu Versöhnung und Verständigung ist immer wieder gewürdigt worden. Unter anderem beim Tag der Heimat, der früher jedes Jahr gefeiert wurde. Unter anderem auf dem Heiligenberg nahe Felsberg in Nordhessen, für den die Vertriebenen 1952 die Glocke der Heimat stifteten. Auch Pfarrer der katholischen und evangelischen Kirche würdigten das Engagement der Heimatvertriebenen mehrfach.
Die Egerländer Trachtengruppe des Heimatkreises Bischofteinitz war viele Jahrzehnte fester Bestandteil ungezählter Veranstaltungen weit über Wolfershausen hinaus. Silvester 1946 saßen einige Heimatvertriebene aus dem Eger-
land im Gasthaus Braunhardt in Wolfershausen. Ein Heimatlied wurde angestimmt. Die gute Stimmung war der Anlaß, eine kleine Sing- und Spielgruppe zu gründen. „Die damals noch jungen Leute waren ganz begeistert“, berichtete die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ zum 50. Jubiläum der Trachtengruppe. Mit dem Lied „Dort, tief im Böhmerwald“ hatte alles angefangen. Rudolf Gruber hält in der Chronik fest: „Wir jungen Leute waren mit Begeisterung dabei, und es zeigte sich, daß der Wille zum ,Dennoch‘ viel größer war, als wir vermutet hatten.“




Die Sing- und Spielgruppe wurde um eine Theatergruppe erweitert, Volkstänze wurden einstudiert. Schon beim ersten öffentlichen Auftritt am 3. Juli 1949 auf dem Heiligenberg gab es viel Anerkennung. „Es waren viele, schöne Jahre“,



sagen Albert Reis und Christa Fröhlich übereinstimmend. Unvergessen sind Auftritte im In- und Ausland, bei den Hes-

Rudolf Kiefner setzte immer auf Aussöhnung. Er wurde mehrfach als die unermüdlich treibende Kraft der Egerländer Trachtengruppe des Heimatkreises Bischofteinitz gewürdigt. Der aus Bischofteinitz stammende Industriekaufmann starb im Februar 1993 im Alter von 59 Jahren in seiner zweiten Heimat Wolfershausen an einer heimstückischen Krankheit. Kiefner wurde als ein Idealist gewürdigt, der sich frei fühlte von Haß und Rachegefühlen. „Trotzdem beton-

sentagen und den Heimatkreistreffen in Furth im Wald. 1986 war die Trachtengruppe offizieller Vertreter Deutschlands bei der Expo im kanadischen Vancouver. In New Ulm im USA-Bundesstaat Minnesota wurde auf Initiative Kiefners ein Denkmal aufgestellt. Auf dem sind alle Familien aufgeführt, die 1860 aus dem Kreis Bischofteinitz nach Minnesota ausgewandert waren. „Kiefner hatte so gute Beziehungen, daß die Lufthansa den deutschen Stein kostenlos transportierte“, erinnert sich Albert Reis. Und er schwärmt heute noch, wenn er von den Auftritten der Gruppe in Finnland, Schweden, Dänemark, Österreich, Italien, Frankreich, England, Schottland und der Tschechoslowakei berichtet.





te er immer, daß die Vertreibung seiner Landsleute aus dem Sudetenland ein ungeheurer und unvergeßlicher Willkürakt gewesen sei“, schreibt der Heimatchronist Otto Wiegand. „Rudolf Kiefner trug schwer an dem Erbe, aber er blickte nach vorn“, hieß es. Kiefner setzte stets auf Aussöhnung und Neubeginn.
Kiefner hatte viele Auszeichnungen. Dazu gehören das Bundesverdienstkreuz, der Ehrenbrief des Landes Hessen, das Große Goldene Ehrenzeichen und der Volkstumspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie die Adalbert-StifterMedaille. Für die CDU arbeitete er im Kreistag und im Felsberger Stadtparlament. Die Stadt ernannte ihn zum Ehrenstadtrat. Nach Kiefners Tod leiteten seine Töchter Karmen und Martina die Gruppe. 1996 übernahm Jo-
sef Friedrich den Vorsitz bis zur Auflösung. Manfred SchaakeHeimatbote

für den Kreis Ta<au
Egerlands begabtester und fähigster Maler
Fast hätte Heimatkreisbetreuer Wolf-Dieter Hamperl das Jubiläum übersehen. Vor 100 Jahren, am 7. März 1922, starb Franz Rumpler im Alter von 73 Jahren in Wien an einer Lungenentzündung. Er war am 4. Dezember 1848 in Tachau zur Welt gekommen und der wohl berühmteste Sohn der Tachauer Region sowie der fähigste und begabteste akademische Maler des Egerlandes. Wolf-Dieter Hamperl und Gertrud Träger berichten.

Franz Rumpler wuchs in einem ärmlichen Milieu auf. Vom Vater, einem Bildschnitzer, hatte er das Talent. Der fürstlich Windisch-Grätz‘sche Archivar Josef Hofherr erkannte sein Können, weshalb der Fürst den 15jährigen nach Wien schickte und ihm den Besuch der Wiener Akademie Sankt Anna ermöglichte. Nach dieser Vorbereitungszeit kam Rumpler 1865 in die Klasse von Carl Wurzinger, dann lernte er bei Professor Albert Zimmermann die Landschaftsmalerei und schließlich bei Eduard von Engerth die Figurenmalerei.

1872 hatte er seine Studien abgeschlossen und erhielt für seine frühen Bilder schon herausragende Ehrungen, so die goldene
Medaille der Wiener Weltausstellung, die goldene Karl-Ludwig-Medaille der Wiener Künstlergenossenschaft und die Große Goldene Medaille der Internationalen Kunstausstellung im Glaspalast in München.
Bei einem Heimaturlaub in Tachau 1874 schuf er das Hochaltarbild der Maria Magdalena für die Klosterkirche der Franziskaner, das heute noch zu bewundern ist. In weiteren Aufenthalten in Tachau restaurierte er die Kreuzwegstationen in der Franziskanerkirche und das Hochaltarbild sowie das Altarbild am Engelaltar in der Erzdekanalkirche in Tachau.
1875 lernte er in Bayern den berühmten Maler Hans Makart kennen und begleitete ihn auf einer Reise nach Italien. Durch seine gekonnten Porträts lernte er den bekannten Pariser Kunsthändler Charles Sedelmayer kennen,


der ihm Aufträge verschaffte und ihm einen einjährigen Aufenthalt in Paris ermöglichte. Ein großes Gruppenbild der Familie Sedelmayer zierte die Moderne Prager Galerie, die Deutsche Galerie in Prag hatte 1929 einen eigenen Rumplersaal. 1879 lieferte Rumpler großformatige Federzeichnungen zum bekannten Makart-Festzug für das Museum der Stadt Wien. 1886 lieferte er Illustrationen für den Band „Böhmen“ des sogenannten Kronprinz-Ludwig-Werkes „Die österreich-ungarische Monarchie in Wort und Bild“.
Das Jahr 1885 brachte die Berufung zum Professor der allgemeinen Malschule an der k. u. k. Akademie für Bildende Kunst in Wien. 1897 wurde er zum Leiter der neuen Meisterklasse für Historienmalerei der Akademie berufen. Rumpler leitete diese Klasse bis 1919. zu seinen Schülern gehörten beispielsweise Rudolf Böttger und Fritz Pontini aus Franzensbad.
1897 lief im Kunstsalon Miethke eine große Ausstellung über das Gesamtwerk des Künstlers mit 107 Ölbildern und 123 Aquarellen und Zeichnungen. Rumplers wirtschaftlich denkende Frau Marie unterstützte dabei den Kunsthändler Miethke. Die gesamte Wiener Presse feierte den Künstler. Selbst Kaiser Franz Joseph I. besuchte die Ausstellung und erwarb Bilder.


Im Jahr 1900 zog Franz Rumpler nach Klosterneuburg und errichtete dort vier Jahre später ein Wohnhaus mit Atelier. Der Klosterneuburger Künstlerbund verlieh die Franz-Rumpler-Medaille als höchste Auszeichnung. 1891 bis 1913 verbrachte Franz Rumpler jeden Sommer in seiner Ge-

burtsstadt Tachau. Am 27. April 1897 verlieh die Stadt Tachau dem Künstler das Ehrenbürgerrecht. Später wurde an seinem Geburtshaus eine Gedenktafel angebracht.
In Tachau entstanden die Porträts von Bürgermeister Heinrich Swoboda und Notar Karl Krobshofer. Im Eleonorenhaus hingen zwei Heiligenbilder, in der Kapelle in Ulliersreith befand sich ein Altarbild der Wetterheiligen Johannes und Paulus von ihm. Seiner Heimatstadt widmete er eine neue Wappenzeichnung, die außer dem böhmischen Löwen zwei Symbole zeigt, drei Sterne und eine Adlerkralle, welche an


Sein künstlerischer
(1860–1929) gemäß ihrer testamentarischen Bestimmung zu Gunsten Wiener Blindeninstitute versteigert.

 Steinen des Kirchturms zu sehen sind.
Steinen des Kirchturms zu sehen sind.
Das Aussiger Theater

Seit der Eröffnung am 21. September 1909 gaben hier namhafte Künstler aus Oper, Operette, Schauspiel und Ballett ein Gastspiel. Seine Glanzzeit erlebte das Theater gleich nach seiner Eröffnung. Damals bot es im Parkett, auf den Rängen und den seitlichen Logen rund 1000 Personen Platz. Diese Kapazität wurde bald nicht mehr benötigt wegen der Konkurrenz durch den neuen Teplitzer Theaterpalast, aber auch durch den Aufstieg von Kino und Rundfunk. Ende der 1990er Jahre wurden die Ränge ganz geschlossen. Wer es sich leisten konnte, hatte damals ein Theaterabonnement. Nach den Abendvorstellungen, die oft erst gegen 23.00 Uhr endeten, wurden extra Straßenbahnen – die sog. „Theaterwagen“ – eingesetzt, die vor den Seitenausgängen des Stadttheaters warteten, wo auf der Umfahrung der Hauptpost zu diesem Zweck extra ein Gleis verlegt war.
kw Quelle: Kurt Neis, Text- und Bildband Aussig, 2014 Fotos: Archiv
� Erinnerungen


Auf Schusters Rappen
Hie und da tu ich einen Kniefall aufs Betbankl, denn treu tragen mich noch heute meine alten Füße. Gerade sehe ich von einer Höhe von nur noch Einsdreiundfünfzig auf sie herab! Noch kann ich füßläufigvon A nach B gelangen, sofern beide Punkte nicht zu weit voneinander entfernt sind.
Einen Blick werfe ich auf mein ältestes Foto, es zeigt mich im antiken Braun dieser Zeit, 1934. Ich sitze da, babybespeckt, und zeige meine pummeligen Füßchen her. Noch sind sie wohlgeformt!

Heute lautet die Diagnose: Knickfüße mit Hammerzehen beidseitig – und wenn ich nicht aufpasse, so lachen mich auch noch Hühneraugen an. Wie das wohl gekommen ist? Könnten meine volksmundig auch „Plattfüße“ genannten Füße schimpfen, so würden sie mich eine „Ausbeuterin“ schelten. Aber konnte ich denn anders? Lest selbst!
Ich lernte laufen. Im Album gibt es nur kleine SchwarzweißFotos, da stehe ich an Mutters Hand und habe hohe Schuhe an, so hießen die bei uns, im Gegensatz zu Niederschuhen, die hierzulande Schnürstiefel und Halbschuhe heißen. Natürlich gab es damals noch keine Lauflernshuhe...
Unser Stodttheater
Ej Schmuckstickl in unser Stodt, hon mir mit unsn Theater gehott. Es wor ej Prochtbau, in barock‘schen Stile, mit Auffohrt fier Gutshn un Automobile. Es wor schun su, dos gonze Haus soh jo vo außn sehr gutt aus!
Un drinne erscht! Ich konn eich sogn, do hotts de Sproche enn verschlogn: Dr Sool wor ejne Aagnweide, austappeziert mit ruter Seide. De Stukkatur in weiß un gold, un on de Decke wor ej Bild gemolt. Kristallglosluster sorgtn fier Liht, mol helle, gedämpft, un monchmol aa nich. De Sitzplätze worn eicht ungelogn dorchwags mit rutn Somt bezogn. Un guldiche Nummern worn draufgestickt, un komod, doß moncher is eingenickt. De Treppn aus Marmor, un in Foajee, do stond doch ej Gobelin-Kanapee, un Sessl, stilechtes Biedermeier!
Wie „viernahm“ dos wor, wor ungeheier!
Wer Theaternorr wor, hot, wie sich‘s gebiehrt, wingstns enn Stommsitz abbonniert. Kom dr Theaterobnd ron, wurs beste Klejd glei ongezogn. Do wurde gebodt uns Hoor naufgedreht, de Gusche bemohlt un „Ruusch“ aufgelegt. Mit Kelnischwossr dr Busn besprengt, on de Ohrn de guldichn Ringln gehängt. Dann gings in Trobb uff de Stroßnbohn, denn om Ochte fing pintlich de Vorstellung on. Weil unser Theater wos uff sich hielt, wurn Schauspiele, Opern un Oprettn gespielt.
Wer in ej siches Theater kimmt, dar werd ganz feierlich gestimmt.

Und olle worn gutt aufgelegt, vorn Spiegl wurde sich rimgedreht, hot nochn Theaterzettl gefrogt, dann mochte mr sichs uff senn Sesssl komod. Nohm ‘n Gucker raus, guckte ej bissl rim, de Musiker tot‘n de Geign schun stimm‘n. Mr heert‘s, die gobn sich ollerhand Miehe, dr Eiserne Vorhang ging in de Hiehe. Ols dunkl wor, kom dr Kapellmejstr rein, der hob sei Steckl, un de Musik setzt ein. Ihr wißt ju olle, wie scheen die spieltn –poor Leite in Zuckerletutn wiehltn, glei gings „Pst, Pst“ un „Ruhe, bitte“, dann hust‘t wieder enner, ej anderer mitte, ols ejne raunzt: „Dos mocht mich konfus“, ging dr Vorhang nauf und de Vorstellung lus.
In dr Pause tot‘n de Leite sich drängn, im Foajee un uffn Gängn.
Do wure hien un hargehorcht, de Klejder un Frisurn beschnorcht, un wos su in dr Stodt possiert, do drieber wure dischkeriert.
Ej Geklingl zeichte jedsmol on, subald dr neechste Akt kom dron.
Om Schluß dr Vorstellung gobs grußn Applaus, de Kinstler kom ejnzln, dann olle zom raus. Nochn Theater wors ieblich aa auszugiehn, mol ins „Savoj“, mol ins „Kaffee Wien“, ins „Grand“ mol, zun „Fousek“, zun „Falk“, in de „Pust“, zun Bummln hottn mir immer Lust!
‘S wor mejstns speete in dr Nocht, ols mir sich hobn uffn Hemmwag gemocht. Schnell gings noch zu enn Werschtlstand un vertilgte enn Knocker, direkt aus dr Hand!
Su fond ej Theaterobnd sej Ende... och, wemmr dos noch mol drlabn kennte!
-Ln- (leicht gekürzt) aus AB 01/1975
Ein Foto von 1923 (nicht von der Autorin) zeigt deutlich: Jung und Alt trugen damals Schnürstiefel.
Meine Kindersommer waren dann bestimmt durch viel Barfußlaufen. Wobei ich mich einmal für eine Zeit verweigerte, weil ich auf einer Wiese in eine Biene getreten war. Auf mein entsetzliches Geschrei hin war die gesamte Nachbarschaft zusammengelaufen.
Aber dann wurde ich zum „Eisernen Siegfried“, was meine Sohlen anbelangte, wir machten sogar Wettrennen über den Stoppelacker oder über den Schotterweg vor unserem Haus.
Auf meinem Kommunionbild sind ein paar braune Riemchensandalen festgehalten, die ich sehr gerne trug. Dazu hatte mir Mutter weiße Kniestrümpfe mit Bommeln gestrickt. Doch bald wurde Leder so knapp, daß mich das nächste Erinnerungsbild in Klappersandalen vorführt. Die Sohle bildeten durch Scharniere verbundene Holz-
teile, das Oberteil altrosa Stoff
Millefiori,wunderschön! Das Geklapper beim Laufen fand ich auch höchst ergötzlich. Vertrieben wurde ich mit Oma, Mutter und Tante in weinroten Niederschuhen, noch ziemlich funkelnagelneu, die auf die letzten Abschnitte der Punktekarte daheim gekauft worden waren.
Ich lief im fremden Land wieder viel barfuß. Im Winter, der sehr streng war, dachte ich mit Wehmut an das heimatliche Schuhwerk, hohe Schuhe, bzw. bei feuchtem Wetter auch Gummigaloschen, die man einfach über die Potschen ziehen konnte, dann mit Druckknöpfen oder Reißverschluß schloß. Und natürlich hatten wir alle richtige Skischuhe, derbes Schuhwerk, das mit Lederfett behandelt werden mußte. Man trug sie auch ohne Ski, aber sie waren schwer an den Füßen. Beliebt waren auch Filzstiefel, an den Schäften für uns Mädchen oft mit kunstledernen Herzchen verziert. Die Gamaschenzeit aber war schon passé.
Der schlimme Winter 1945/46 war bereits angebrochen, und Mutter und ich mußten uns durch hohen Schnee im Winterwald mit Holzschuhen, die richtig dicke Sohlen hatten, mühen. So wurde der Grundstein für die spätere Diagnose Knicksenkfüße mit Hammerzehen gelegt. Doch so erfroren die Füße wenigstens nicht. Fortgesetzt wurde das Werk dann noch mit den Igelitschuhen aus Kunststoff, die bei großer Sommerhitze „pappelweich“ und bei Frostgraden starr wie ein Brett wurden.
Da ich als Lehrerin dann viel auf den Beinen sein mußte, litt ich bald große Schmerzen und mußte sogar einen Winter lang in zwar ganz dicken Schafwollsocken, doch mit Pantoletten an den Füßen täglich zum Unterricht, weil ich nur just diese Sohlen aushalten konnte. Ich ließ mir dann auf Rezept ein Paar orthopädische Schuhe anfertigen, die so steinhart waren, daß ich sie in der Ecke stehen lassen mußte. Allerdings hatten sich die Füße nach einem Jahr so hübsch „verformt“, daß ich nun im Schuhgeschäft sogar unter den „normalen“ Schuhen aussuchen konnte, was für meine deformierten Füße infrage kam. Ich fand auch meistens etwas, günstig, weich aber leider meist unmodern. Auf jeden Fall leisteten mir diese Schuhe im Sommer und Winter gute Dienste. So schaffte ich 46 Arbeitsjahre (die ersten sechs Jahre als Bauernmagd und Gymnasiastin), 40 Jahre dann als Lehrerin, Hausfrau, Mutter und Großmutter. Allerdings mache ich nie mit bei dem Spiel „Zeigt her eure Füßchen“, schicke aber ein Dankgebet zum Himmel.
Susanne Felke aus „Unser Niederland“ 11/2017.
Foto: privat kw
Auch Peter Rosegger besuchte unsere Heimat
Die „Leitmeritzer Zeitung“ berichtete in ihrer Ausgabe vom 2. April 1920: Die Elbe als Touristenweg muss nicht erst entdeckt werden. Es waren Zeiten der Freizügigkeit, da mancher vielleicht geglaubt hat, seine Wege müssen ihn weit wegführen von der Heimat, zumindest in die Alpen oder womöglich in den Himalaja oder auf den Popocatepetl. Heute dürften es viele als eine besondere Glücksgabe des Schicksals begrüßen, eine Fahrt durchs liebe Elbetal machen zu können, das Elbetal eines Ludwig Richter und Peter Rosegger. Ja, Rosegger! Dieser größte Sohn des Alpenlandes hat die Elbe ge-
kannt und geschätzt. Schon im Frühsommer 1870 wanderte der junge Mann durch unsere Gaue, und sein damaliges Wanderbuch bringt reizende Bilder dieser Reise. Die „Schweiz an der Elbe“ müsse von der kunstfertigen Meisterhand der Riesen gebaut worden sein. Es ist eigentlich eine große Bildhauerarbeit der Natur mit der Symmetrie der Kunst vereinigt. „Mir hat‘s wohlgetan in diesem Kleinalpenländchen“ meint Rosegger am Schluss des Kapitels, und jedem wird es wohltun, der seinen Spuren folgt. Der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger wurde am 31.Juli 1843 in Alpl bei Krieglach
als Sohn eines armen Waldbauern geboren und starb am 26. Juni 1918 in Krieglach/Obersteiermark. Dank seines erzählerischen Talents und seines schlichten, volksverbundenen Humors erlangten seine Veröffentlichungen „Die Schriften des Waldschulmeisters“ (1875), „Waldheimat“ (1877) und „Als ich noch der Waldbauernbub war“(1902) große Beliebtheit. Sie sind heute noch eine beliebte Lektüre.
Kaum noch bekannt ist Peter Roseggers Besuch in Aussig, wo er 1897 bei einer Veranstaltung des Kaufmännischen Vereins aus eigenen Dichtungen las. Eine große Ehrung erfuhr Rosegger in Aussig auf dem vom Prager Maler Prof. Karl Krattner nach Ideen von Prof. Josef Martin geschaffenen Wandgemälde im großen Vortragssaal der 1912 eröffneten Volksbücherei am Materniplatz. Es musste nach dem politischen Umsturz 1918 als eine Erinnerung an die Zeiten Kaiser Franz Josephs verhängt werden. Während des Zweiten Weltkrieges von Bomben schwer beschädigt, wurde das von Eduard Jakob Weinmann der Stadt gewidmete Gebäude nach Kriegsende von den Tschechen abgebrochen. Eine weitere Ehrung, die ebenfalls 1945 von den Tschechen beseitigt wurde, erfuhr Rosegger in Aussig
durch die Namensgebung der Parkanlage, welche 1913 anstelle des 1892 aufgelassenen Aussiger Friedhofs an der Kleischer Straße entstanden war. Der Schriftsteller hatte in jenen Jahren wohlhabende Gönner zu einer Tausend-Kronen-Spende für den Deutschen Schulverein aufgerufen und sich dadurch bei den Tschechen unbeliebt gemacht. Geblieben ist die Erinnerung an den Volksschriftsteller durch die am 27.7.1943 von der Deutschen Reichspost herausgegebenen beiden Sonderbriefmarken zu seinem 100. Geburtstag sowie die beiden am 12.9.1931 und am 20.6.1968 von der Österreichischen Post edierten beiden Sonderpostwertzeichen.
Helmut Hoffmann
� Buchvorstellung Was geschah in Aussig am 31. Juli 1945?
Der 31. Juli ist für uns Aussiger seit Jahrzehnten ein Gedenktag an das Massaker an der deutschen Bevölkerung auf der Aussiger Brücke.
Anlass war die Explosion des Munitionsdepots in Schönpriesen am 31.7.1945. Nach neuesten Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, daß der Anschlag auf das Depot eine gezielte Aktion des tschechoslowakischen Innenministeriums war.
Ziel der Aktion war, einen für das Ausland klar erkennbaren Grund zu schaffen, die restlose Vertreibung der deutschen Minderheit aus dem Sudetenland zu vollziehen. Sofort nach der Explosion wurden deutsche Zivilisten von tschechischen Revolutionsgarden ohne nähere Untersuchung als vermeintlich Schuldige ausgemacht.
Dieses Buch dokumentiert anhand von Archiv-Funden akribisch, was genau am 31. Juli 1945 in Aussig passierte. Das Buch ist für uns insofern interessant, weil es von tschechischen Wissenschaftlern erarbeitet wurde, unter Mitarbeit von Dr. Vladimir Kaiser, der 34 Jahre das Archiv in Aussig geleitet hat und vielen von uns persönlich bekannt ist.
Das Buch ist zweisprachig (deutsch, tschechisch), mit einem Vorwort von Dr. Petr Koura, Direktor des Collegium Bohemicum.
Verlag Tschirner & Kosová Zum Harfenacker 13 04179 Leipzig Tel. +49 176 20749908
Bestellungen: info@tschirner-kosova.de 248 Seiten, 39,80 € (zzgl. Versandkosten) ISBN 978-3-00-072367-4

„Der Naturfreund“ Winter 1932


„Der Naturfreund“ war die seit dem 19. Jh. erschienene Zeitschrift des Touristen-Vereins „Die Naturfreunde“ für seine Mitglieder in Österreich, der Schweiz und Böhmen. Herausgeber, Verleger und Redakteur für die Tschechoslowakei war 1932 Theodor Dietl in Aussig, Marktplatz 11.
Auszüge aus der Ausgabe Jänner/Feber 1932:
Die Wintertouristik der Arbeiter in der Tschechoslowakei
Dem Schneeschuhlauf wird in der Tschechoslowakei durch die staatliche Behörde Unterstützung und Förderung zuteil. Einerseits stellt das Staatsamt für Körpererziehung kostenlos Fachlehrer für die Heranbildung von Skikursleitern und Wintersportlehrern zur Verfügung und gewährt fallweise einen Reisezuschuß, andererseits räumt die Bahnverwaltung den Wintersportverbänden Begünstigungen ein. Letztere bestehen darin, daß für bestimmte Strecken, welche ins Wintersportgebiet führen, der Fahrpreis um 33 von Hundert für den Einzelfahrer billiger ist und daß von größeren Städ-
ten mit zahlreichen Wintersportlern Sonderzüge abgefertigt werden (Prag - Riesengebirge, Brünn -Altvater, Prag - Tatra).
Die besondere Betreuung der Wintertouristik auf Skiern durch den Verband hat selbstredend Erfolge gezeitigt, wie nachstehende Zahlen bekunden: 1924: 80 Ortsgruppen mit 1700 Mitgliedern, davon 21 Wintersportgruppen mit 284 Mitgliedern.
1930/31: 98 Orstgruppen mit 9300 Mitgliedern, davon 56 Wintersportgruppen mit 1350 Mitgliedern.
Skiwachsschieber
Es gibt eine recht umfangreiche Literatur über die Wachseltechnik. Doch sind die meisten Bücher und Tabellen so umständlich, daß ihr praktischer Wert für den Tourenfahrer gering ist, der nicht Wachssorten im Gewicht von etwa 1 kg mitschleppen kann. Hans Konrad und
Ing. E. Frischauf haben nun einen Skiwachsschieber ersonnen, der schon bedeutend einfacher und praktischer ist und um 50 g zu erhalten ist. Freilich sind auch in ihm noch allzusehr die teuren ausländischen Wachssorten berücksichtigt und die Abstufung in Temperaturen und Schneebeschaffenheit zu reichhaltig. Schließlich müßte man auch hier zehn Wachssorten in Betracht ziehen und zumindest einen Teil mitführen, denn in der Stadt läßt sich doch nicht die genaue Beschaffenheit feststellen.
Schont das Wild
Wenn die Scheedecke in beträchtlicher Höhe die Berge bedeckt, so ist für das Wild eine böse Zeit angebrochen. Schmalhans wird Küchenmeister und nur mit Mühe können sich die Tiere im Schnee, gar wenn er weich und flaumigist, fortbewegen. Es gilt also, unsere anmutigen und schlanken Tiere des
Waldes und der Berge zu schonen und nicht durch Lärm zu erschrecken. Es ist zwar nur ein Märchen, das immer wieder aufgetischt wird, daß die Skifahrer wie besessen das Wild aufstöbern und jagen, aber es ist schon möglich, daß ein Skifahrer, ohne daß er es beabsichtigt, ein Wild stört. Es mögen daher unsere Brettelfahrer recht vorsichtig sein und, wenn ein Wild aufgescheucht wird, nicht in der Fluchtrichtung weiterfahren. Im hohen Schnee bleiben die Tiere, wenn sie verjagt werden, oft stecken und gehen an Entkräftung kläglich zugrunde. Die südseitig ausgeaperten Hänge sind meist die einzigen Äsungsplätze. Der Skifahrer, dem ja Schneehänge viel willkommener sein müssen, meide sie daher, damit die ohnehin hart mitgenommenen Tiere ihr spärliches Futter in Ruhe verzehren können. „Der Naturfreund“, Heft 1/2, Jänner, Februar 1932, eingesandt von H. Gliniorz
Dass mein Freund Herbert Lorenz, geb. am 18.1.1923 in Aussig, Industriestraße, heuer seinen 100. Geburtstag feiern kann, verdankt er seinen guten Genen, aber auch seinem Gottvertrauen, seiner Cleverness, seinem starken Willen und viel Glück. Nach einer behüteten Kindheit wurde er 1942 schon mit 19 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen. Nach Kriegsende und Gefangenschaft konnte er 1946 nicht mehr nach Aussig zurückkehren. Herberts neues Zuhause wurde Estenfeld bei Würzburg, wo er seine Frau Elfriede kennen lernte. Sohn Alfred und Schwiegertochter Anni

n 99. Geburtstag: Am 25. 1. Herr Heinz HERBINGER aus Nestersitz in 84489 Burghausen, Robert-Koch-Str. 17 a. n 94. Geburtstag: Am 18. 1.
Frau Liesl WENZEL geb. Eibicht aus Nestomitz in 39307 Genthin, Baumschulenweg 32. n 92. Geburtstag: Am 4. 1. Frau Marianne JESKOLSKI geb. Fischer aus Hohenstein. – Am 18. 1. Frau Inge RIEDERBROCKS geb. Schneider aus Nestomitz, Reindlitzer Straße in 83301Traunreut, Berliner Str. 29. –Am 24. 1. Herr Rudolf WERNER aus Pockau, Hauptstraße 342 in 06258 Schkopau, Piesteritzstr. 1. n 91. Geburtstag: Am 9. 1. Frau Marianne SCHNEIDER geb. Heinrich aus Stöben. –Am 2. 2. Herr Oskar DÜRR aus Schwaden. n 89. Geburtstag: Am 18. 1.

Herr Gerhard PARTON aus Habrowan Nr. 2. – Am 29. 1. Frau Ilse SCHMIDT aus Ebersdorf in 01705 Freital, Auf der Scheibe 1. n 88. Geburtstag: Am 1. 1. Herr Werner BAHR aus Danzig. –Am 9. 1. Frau Martha SCHILD geb. Hortig aus Mosern in 99755 Ellrich, Str. der Freundschaft 30. –Am 29. 1. Frau Erika KROY geb. Heide aus Hindenburg. n 87. Geburtstag: Am 7. 1. Herr Herbert LORENZ aus Peterswald 511.
sorgen jetzt für sein körperliches und seelisches Wohl. Herbert war jahrzehntelang Vorsitzender der VdK in Estenfeld und ist noch aktiv bei den Senioren, sorgt an der elektrischen Orgel für Stimmung oder hält Vorträge über seine Heimat, die er nicht vergessen kann.
Lieber Herbert, wir wünschen Dir Fitness, Gesundheit und weiterhin Freude am Leben! Herzlichen Glückwunsch! Karin im Namen Deiner Freunde
n 86. Geburtstag: Am 26. 1. Herr Wolfgang JANKA aus Aussig in 06217 Merseburg, Sorbenweg 6. n 84. Geburtstag: Am 26. 1. Frau Christa GUTMANN geb. Struppe aus Nestomitz, Elbstr. in 96515 Sonnenberg, Ackerstr. 36. n 83. Geburtstag: Am 16. 1. Herr Heinz WATZKE aus Leschtine. – Am 20. 1. Frau Edith Anna HAASE aus Peterswald 301.– Am 24. 1. Frau Helga GOWARSCH aus Gratschen Nr. 2. n 82. Geburtstag: Am 2. 1. Herr Heinz-Joachim WINDRICH aus Marschen Nr. 6 (Sohn von Emil-Hermann Windrich, Futter-, Düngemittel- und Kohlengroßhandel) in 36282 Hauneck, Birkenstr. 7. – Am 23. 1. Frau Gudrun SACHS geb. Philipp aus Hohenstein (Kinderheim), später Straden 30. – Am 2. 2. Herr Siegfried STOBER aus Aussig in 46419 Isselburg-Werth, Binnenstr. 25. – Am 2. 2. Herr Hans-Jürgen ARLT aus Budowe. n 80. Geburtstag: Am 12. 1. Herr Helmut ORTNER aus Schreckenstein. – Am 24. 1.
Herr Hans STADELMANN (Ehemann von Reinhilde Stadelmann, Nordböhmen-Heimatwerk e.V.) aus Elpersdorf / Franken. n 74. Geburtstag: Am 17. 1. Herr Otto GOLDAMMER (Vorfahren aus Schreckenstein und Kojeditz) in 64285 Darmstadt, Aßmuthweg 8.
WIR BETRAUERN
Die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit Zahorschan

Sie steht auf einem Hügel im Ort Zahorschan und ist von allen Seiten weithin zusehen. Sie bildet einen markanten Blickpunkt in der Umgebung von Kreschitz. Leider ist sie nach dem Krieg, wie bereits mehrfach berichtet, verfallen. Die Wände hatten Risse, das Dach war undicht und das Mobiliar zerstört. Die Figuren der Heiligen Peter und Paul, die Orgel, der Taufstein und auch die Figur des Hl. Nepumuk wurden an anderen Stellen eingelagert.
Darüber hat Franz Wieder in der Ausgabe 6/2022 des „Leitmeritzer Heimatboten“ ausführlich geschrieben. Kurz gesagt: Der Anblick war trostlos. Dies änderte sich jedoch, als sich vor circa zehn Jahren eine klei-
ne Gruppe von Zahorschaner Bürgern zu einer Initiative zusammenschloss, um ihren Ort zu verschönern und insbesondere die Kirche vor dem vollständigen Zerfall zu retten.
Viel hat diese Gruppe um ihre Vorsitzende Jarmila Jandová bereits erreicht. So wurde das Dach neu gedeckt und die Fassade in der für das Barock typischen Farbgebung rot-weiß gestrichen.


Der alleinstehende Glockenturm, übrigens eine sehr seltene Bauweise einer frühbarocken Kirche, ist vollständig saniert. Die ersten Arbeiten zur Restauration der Gemälde an den Gewölbedecken wurden durchgeführt.


Gegenwärtig sind Handwerker dabei, die zerbrochenen Fenster durch neue Bleiverglasun-
gen zu ersetzen. All diese Anstrengungen führten dazu, daß am 11. Juni 2022 ein Konzert des Ensemble Guillaume zur feierliche Eröffnung der Kirche stattfand (ein Videoclip dazu befi ndet sich auf der benannten Internetseite).

Nach vielen Jahren konnte dann am 24. Juli 2022 die erste Messe durch Monsignore Jan Baxant, den Bischof von Leitmeritz, zelebriert werden.
Natürlich bleibt noch sehr viel zu tun und wie bei allen derartigen Sanierungsmaßnamen kann nur so viel getan werden, wie Geld dafür vorhanden ist. Dafür hat der Verein „Pro Zahořany“ ein öffentliches Spendenkonto eingerichtet, wo jeder Einblick nehmen kann. Man kann dem Verein „Pro
Hopfenanbau in Auscha
Der Anbau von Hopfen wurde durch die Jesuiten schon um 1665 betrieben. In einer Schrift von 1732 wurde die Qualität des Hopfen aus Auscha als besonders guter Hopfen Böhmens abgehandelt.
Was den Hopfen betraf, gab es viele Vorschriften, um die Reinheit dieses Hopfens zu erhalten. Hopfenhändler, die sich nicht an diese Vorschriften hielten, bekamen hohe Geldstrafen. In der Universitätsbibliothek von Prag ist diesbezüglich nachzulesen, daß der Gehalt und die Blüte vornehmer ist als die übrigen Gattungen Böhmens. Auscha stand immer im Wettbewerb mit Saaz. Hopfenarbeiter arbeiteten damals von 5 Uhr früh bis 19 Uhr am Abend. Ihr Lohn war genau geregelt.
Aller Hopfen wurde auf der Stadtwaage gewogen und die sog. Zichen (Hopfensäcke) wurden gleich mit dem Stadtwappen versiegelt. Es gibt noch einen drei Minuten langen Schmal fi lm


in schwarz-weiß über den Hopfenanbau 1936 in Auscha. Der Titel ist: „Die Hopfenstadt Auscha –der weltbekannte Auschaer Hopfen“.
Auch in der Neuzeit war der Hopfenanbau der Auschaer Bauern eher ein Nebenerwerb. Er war immer mit dem Risiko eines Ernteausfalls verbunden. Das P flücken der Hopfendolden war mühselig und mußte schnell gehen. Deshalb wurden Fremdarbeiter als Hopfenpflücker angeworben. Es waren Frauen und Männer, die auch während der Erntezeit bei dem Bauern untergebracht und verköstigt wurden. Entlohnt wurde nach der Menge des gepflückten Hopfens. Das Bargeld wurde erst nach dem Ende der Ernte ausbezahlt, um Diebstähle unter den Erntehelfern zu vermeiden.
Aufkäufer erwarben bei den Bauern die Hopfenernte. Sie vermittelten den Hopfen dann an die Besitzer der Hopfenmagazine, denn dort wurde er getrocknet, versiegelt und verschickt.
Mir sind drei große Hopfenmagazine von Auscha bis 1945 bekannt. In besonderer Erinnerung ist mir die Firma Schwarz. Schwarz war ein jüdischer alteingesessener Mitbürger, der umfangreiche Ländereien um Auscha herum besaß und eine große Villa bewohnte, die er hatte bauen lassen. Diese Villa gibt es noch heute. Sie war später das Postamt der Stadt.
Nachdem der Hopfen versandfertig war und in die großen Zichen gepresst worden war, mußten die Hopfensäcke von einer vereidigten Person versiegelt werden, bevor es auf die Reise in die Welt ging. Von Leitmeritz wurde der Hopfen dann auf Elbkähne verladen und nach Hamburg verschifft. Die Zichen waren durch ihr Gewicht und die Packform bei den Schiffen als Ballast begehrt.
Die jüdische Familie Schwarz verließ noch rechtzeitig vor dem Zugriff der Nazis Deutschland und ging nach New York, später nach Florida. Ihr ganzer Besitz
Zahořany“ nur wünschen, daß es ihnen gelingt, dieses Kleinod wieder in seiner ursprünglichen Form herzustellen. Auf einem guten Weg dahin sind sie.
Gerhard Liedloff
Internetseite: http://prozahorany.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/ kostelZahorany Spendenkonto: IBAN: CZ29 2010 0000 0024 0049 4651
BIC: FIOBCZPPXXX Bank: Fio banka, a.s. Inhaber: Spolek Pro Zahořany Kontakt: Ing. Jarmila Jandová Zahořany 13, 411 48 Křešice E-mail: jarka.jandova@seznam.cz Tel.: 00420 723958486
Yvi Burian für Leitmeritz
Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde,
Für den Heimatkreis Leitmeritz im nordböhmischen Elbetal möchte ich gerne künftig als Heimatkreisbetreuerin in der sudetendeutschen Landsmannschaft tätig werden und mich vorstellen. Ich bin als Mitglied in der Kreisgruppe Hanau Stadt und Land der Sudetendeutschen Landsmannschaft und im BdVKreisverband Hanau-Main-Kinzig aktiv.

Im Jahr 1971 wurde ich, Yvi Burian, im hessischen Büdingen als Abkömmling einer sudetendeutschen Familie väterlicherseits und einer oberschlesischen Familie mütterlicherseits geboren und dort römisch-katholisch getauft. Besonders prägend war meine geliebte Großmutter Hertha Burian, geborene Riedl aus Aussig, die meinen Großvater Kurt Burian (aus Leitmeritz) das ganze Leben lang und darüber hinaus treu geliebt und die durch Flucht und Vertreibung sehr verstreuten familiären Verbindungen zusammen gehalten hatte. Nun bemühe ich mich, in ähnlicher Art und Weise die Verbindungen zusammenzuhalten.
Leitmeritz stellt einen Schwerpunkt dar, da sich dort noch eine Familiengrabstätte befi ndet und auch das ehemalige Wohngebäude von meinem Urgroßvater Wenzel Burian, Bürgerschuldirektor in Leitmeritz, sowie weiteren Familienangehörigen.
Auf dem Sudetendeutschen Tag 2022 in Hof kam der erste Impuls der Heimatkreisbetreuung auf. Daraufhin war ich in diesem Sommer zweimal in Böhmen, so-
wohl ein paar Tage in Leitmeritz als auch ein paar Tage in Aussig, zum Gedenken an das Massaker in Aussig. Das Heimatgefühl, in Leitmeritz an der Elbe und Umgebung den Boden der Wurzelheimat unter meinen Füßen zu spüren, auf sich wirken zu lassen und zu merken, daß sich die Seele dort unzertrennlich verbunden und zu Hause fühlt, gibt die Zuversicht, daß es richtig ist, diesen Weg weiter zu gehen.
Für meine Heimatkreisbetreuung Leitmeritz gilt es nun zunächst, was es noch an heimatlichen Anknüpfpunkten gibt, mit Ansprechpartnern zu eruieren, um dies zu bewahren und zu erhalten. Auch für die Nachkommen, welche möglicherweise doch irgendwann einmal Fragen haben werden und Interesse an der eigenen Abstammung und Herkunft fi nden, braucht es solche Anlaufstellen, um dies generationsübergreifend in die Zukunft tragen zu können. Einige Kontakte konnte ich bereits knüpfen und auf weitere Kontakte, Gespräche und Anregungen freue ich mich natürlich sehr.
Mit ganz herzlichen landsmannschaftlichen Grüßen!
Ivy Burianwurde enteignet.
Nach unserer Vertreibung aus Auscha in die SBZ ging ich 1957 in den Westen. Einige Jahre später, Herr Schwarz war wohl durch einen Bericht von mir auf mich aufmerksam geworden, erhielt ich von ihm eine Einladung nach New York. Damals kostete so ein Flug ca. 10.000 D-Mark, das konnte ich mir nicht leisten. Mir ist aber bekannt, daß er immer bei der Steubenparade in New York mitmarschiert ist.
Unsere Beziehungen vor der Nazizeit zu der Familie Schwarz waren sehr gut. Meine Groß-
mutter betrieb auf dem Markt von Auscha einen Kleintierhandel. Die Familie Schwarz bezog von ihr regelmäßig kleine Zicklein. Mein Vater war selbständiger Lackierer und Malermeister und hätte in der kalten Winterzeit kein Einkommen gehabt, denn es wurden keine Zimmer oder Hausfassaden gestrichen, die Räumlichkeiten waren zu kalt und zu nass. Damals wurden die Zimmerwände zuerst mit einer entsprechenden Farbe grundiert, danach mittels Schablonen Blumenmuster. aufgetragen. Während dieser kalten Jahres-
zeit arbeitete Vater im Hopfenmagazin der Familie Schwarz als vereidigter Kontrolleur und war für das Verplomben der Hopfensäcke zuständig.
Der Auschaer Hopfen war ein sogenannter Rothopfen, der bei den Bierbrauern in der ganzen Welt begehrt war. Auch heute wird Hopfen in Auscha angebaut, aber die Ernte erfolgt mit Maschinen und die Hopfenpflücker sind Geschichte. Der Hopfen aus Auscha wird über Saaz vertrieben. – Quelle: Geschichte der Stadt Auscha, Josef Jarschel, 1922. Hans Stelzig

Der älteste tschechische Satz
…in der Geschichte des Schrifttums.
Die Gründungsurkunde des Leitmeritzer Kapitels aus dem Jahr 1057 stellt ein außergewöhnliches schriftliches Zeitzeugnis in der tschechischen Geschichte dar. Es handelt sich um das älteste original erhaltene Schriftstück, welches in Böhmen entstand und trägt zugleich eine Inschrift, welche für den ältesten überhaupt auf Tschechisch geschriebenen Satz gehalten wird.
Das Dokument überstand beinahe tausend Jahre alle Kriege, Naturkatastrophen und andere unbekannte Wendungen des Schicksals und verließ dabei ausnahmsweise auch nicht Leitmeritz. Dort wird es bis heute im Tresor des Staatlichen Regionalarchivs aufbewahrt.
Die Nachricht aus den nebligen Anfängen der tschechischen Staatlichkeit wurde durch den Fürsten Spytihněv II. hinterlassen, welcher um das Jahr 1057 bei der Leitmeritzer Burg das Kapitel respektive eine Fürstengemeinschaft gründete. Es handelte sich um einen großen Akt, welcher Leitmeritz auf der gesellschaftlichen Leiter voranbrachte, nicht nur in Form einer prunkvollen Basilika, aber auch durch eine Stärkung des Bildungssektors. Für den Fürsten stellte das Kapitel einen strategischen Akt dar, mit welcher er den Weg zur ersehnten Krone erreichen wollte, auch wenn diese erst 30 Jahre später sein Nachfolger Vratislav II. bekam. Ein auf Latein geschriebener Text rechnet
aus, was Spytihněv dem Kapitel spendete. Kurz zusammengefaßt waren das 20 Dörfer, 100 Pferde, 100 Schafe, 30 Kühe, 70 Schweine, Weiden und Weinberge. Zusätzlich werden 12 Landwirte erwähnt: Maur, Malý, Dobrák oder Bič und Sud sind die ersten bekannten Einwohner der Leitmeritzer Region. Diese Daten stammen aus der einzigen authentischen schriftlichen Quelle für Erkenntnisse über Böhmen aus dem 11. Jahrhundert. Ein weiteres ähnliches Papier ist über 100 Jahre jünger, erst aus der Regierungszeit von Soběslav II. bekannt.
Tschechisch tauchte in Dokumenten erst etwa 150 Jahre später auf. Die beim Kapitel bestehende Schule kultivierte in der damaligen Zeit die tschechische Sprache. Die Sprache entwickelte sich um das 10. Jahrhundert herum, aber literarische
Vu daheeme
Drei kurze Anedoten in Mundart zum Thema Leibesgenüsse sendete ein gebürtiger Schüttenitzer:
Mamme, konnst man o enne Buttaschniete schmiern?“ froht dar Franzl. Dar Tate: „Woss bistn du fa ee Lausa, du frisst ju wie ee Schaindrascha, du host doch schunn drai Schnietn gassn, du frisst uns die Hoore vunn Kuppe.“ „Mier honn halt bai Schturchns die Gense john missn, dou hobb iech halt vill Hunga.“ woor die Antwort. „Woss misstn ia aa die Gense john, dou ward die alde Schturchin sicha hibsch woss gesoht honn!“ soht dar Tate drauf. –
„Mamme kenntn ma haite mou Libanzn zunn Mittiche mochn, die hottma schunn suu lange nimej?“ „Nu jo, froh halt
mou die Gruußl, iech hobb ain Goortn no zu vill zu mochn.“ Dou froht ar halt: „Gruußl, kennste haite mou Libanzn bockn, mit Sirup, doss wierd ma schmeckn.“ „Nu jo, wenn de mier ee bissl halfn tust.“ „Nu frailich, hal fiech da dabaine.“ –
Wie iech ejmou vu draußn ai die Kichche kumm bie, doufur obba uffn Houfe mit daan andan Karlln uffn Houfe rimgerietn bie, „wie die Mamme sohte“, hotte iech halt enn beerischn Hunga. Soht die Gruußl: „Iech waar da halt enn gruußn Rettl vunn Bruute obschnaidn, ooda willste ee Rampftl?“ (Ee rundes Bruut hout ju ville Rampftln.) „Iech waar da halt Schpaak drau flejn, ooda willste Schpaakfettn? Iech kennde aa guude Buitta draufschmiern, Vitello waad da nie schmeckn!“ Georg Pohlai
Werke auf Tschechisch sind erst ab Ende des 13. Jahrhunderts bekannt. Der Leitmeritzer Satz, eigentlich zwei Sätze, stellt keinen elaborierten Text dar. Es handelt sich um eine rein pragmatische Mitteilung mit primitiver Rechtschreibung. „Pauel dal gest ploscouicih zemu Wlah dalgest dolas zemu bogu isuiatemu scepanu seduema dusnico bogucea asedlatu.“ (Übersetzung: Pavel gab Boden in Ploskovice und Vlach gab Gott und der Kirche des Hl. Stefans Boden in Dolany inklusive der Untertanen Bogučeja und Sedlaty.)
Die Einstellung, daß es sich wirklich um den ersten tschechischen Satz handelte, konsoldierte sich in Expertenkreisen im Jahr 1936 und hat sich nicht mehr geändert. Etwa in der gleichen Zeit entbrannte ein Streit über die Echtheit der einzelnen Dokumente. Der führende
tschechische Historiker Václav Hrubý bezeichnete sie als späte Fälschung, seine Anhänger entkräfteten diese Zweifel jedoch mehrheitlich.
Das Dokument stellt neben den seltenen Quellen einen symbolischen Markstein in der Geschichte von Leitmeritz dar, welches im Jahr 1655 Bischofssitz wurde und infolge das Kapitel zum Domkapitel erhob.
Tschechisch, welches immer noch am Anfang stand, teilte sich in dieser Zeit den Platz in den Dokumenten mit der deutschen Sprache. Zur Position der Hauptsprache in amtlichen Dokumenten kam es durch die Josefi nischen Reformen im Jahr 1739, dann verschwand es völlig aus den of fi ziellen Dokumenten. Am längsten blieb Tschechisch symbolisch bei den Predigten in den örtlichen Kirchen. M.Krsek/Museum Leitmeritz
� Buchvorstellung Wer war Hockewanzel?

Eine Spurensuche
von Wolfgang Hennig, Manfred Kees 92 Seiten, gebunden, 2021 Preis: 24,80 € ISBN 978-3-00-069462-2
Aus dem Vorwort, Dr. Wolfgang Hennig: „Als ich noch ein Kind war, erzählte mir mein Großvater, der 1883 in Karbitz bei Aussig geboren wurde, humorvolle Geschichten vom Hockewanzel. Insbesondere ist mir diejenige noch in Erinnerung, bei der Hockewanzel sich vor dem Bischöfl ichen Konsortium auszog, da er unterstellte, allein zu sein. Leider starb der Großvater, als ich 14 Jahre alt war. Als er 1945 aus dem Sudetenland ausgewiesen worden war, durfte er nur in ganz geringen Mengen Gepäck mitnehmen. Zum Glück hat er es
Erfreuliche Korrektur meines Berichts
Dieser wurde im LHB, Ausgabe September/Oktober 2022, S. 8f., abgedruckt.
Da ich häu fig die Heimat besuchte, jedoch das letzte Mal vor etwa drei oder vier Jahren (auch coronabedingt), trifft das in meinem Bericht Geschilderte noch für jene Zeit zu.
Neuerdings berichtete mir ein Nachfahre der Familie Tattermann (Erika), daß sich zwischenzeitlich erfreulicherweise etwas mit der Kirche getan hat. Der Nachfahre, Gerhard Liedloff, fuhr kürzlich durch Zahorschan und berichtete mir das, was er in einer eigenen Zusammenfassung in diesem LHB schreibt. Ich
habe mich also, Gottseidank, in meiner Vermutung, unsere Kirche sei wohl dem Untergang preisgegeben, erfreulicherweise geirrt. Es hat sich offenbar in Zahorschan eine Gruppe von Bürgern in einem Verein namens „Pro Zahořany“ u. a. zur Rettung der Kirche zusammengeschlossen. Obwohl ich in den letzten 10 Jahren mehrfach meinen Hausberg Křemin und Zahorschan besuchte, habe ich von dem besagten Verein nie etwas gehört.

Daß die Kirche am 11. Juni 2022 mit einem Konzert wiedereröffnet und am 24. Juli 2022 eine Messe vom Leitmeritzer Bischof zelebriert wurde, wie Gerhard Liedloff berichtet, hätte ich
nicht mehr erwartet. Natürlich freut mich das als letzten Ministranten vor der Vertreibung sehr (siehe meine in Mundart geschriebene Geschichte im LHB vom Mai/Juni 2006, S. 2006ff.) und ich hätte mich mit 86 Jahren auch wieder als den ersten der neu eingeweihten Kirche zur Verfügung gestellt. Mit dem zukünftigen Zustand der Kirche habe ich mich zum ersten Mal über eine Selbsttäuschung gefreut.
Trotz meiner Behinderungen möchte ich im nächsten Frühjahr nach Böhmen fahren und persönlich Kontakt mit dem Verein „Pro Zahořany“ aufnehmen.
Franz Wiedernicht vergessen, seine Ahnenunterlagen einzupacken, wahrscheinlich nicht zuletzt, da seine Mutter eine geborene Hocke war. Somit war es mir dann bei der späteren Ahnenforschung möglich, zu sehen, dass mein fünffacher Ur-Großonkel ein gewisser Wenzel Hocke, genannt Hockewanzel, war. Dann packte es mich und ich wollte mehr über diesen Mann wissen.“ SdP (Zu Alois Hofmann, LHB 11/2021)
� Poesie Dar Wind
Dar Wind wejht aus, dar Wind wejht ei, Ar wejht on Glück und on Ejlend verbei.
Ar singt ver Lust und ar soot (= sagt) ver Lejd, wie unsar Lab‘n und olles verwejht.
Ar singt‚ n Kinda sei Wieg‘nlied, ar singt, wenn de Muttar on Sorga (= am Sarge) kniet.
Ar wejht no über de Gräbar hie –wenn ich lange vergass‘n bie.
95 Jahre 27.01.1928, Margit Otholt, geb. Pöschel, fr. Leitmeritz 16.01.1928, Elfriede Spiegel, geb. Budweiser, früher Proboscht 15.01.1928, Herta Köhler, früher Kottomirsch 90 Jahre 20.01.1933, Edith Schimetschke, früher Leitmeritz 13.01.1933, Kurt Hammer, früher Alt-Thein 08.01.1933, Anna Glott, geb. Müller, früher Krscheschow 85 Jahre 16.01.1938, Karl Kratzmann, früher Groß-Hubina 80 Jahre 23.01.1943, Rosemarie Schütz, geb. Stefan, früher Schüttenitz 70 Jahre 13.01.1953, Harald Voigt, früher Wedlitz
Bleiswedel 25.01.1944, Erhard Hortsch Brotzen 06.01.1927, Rudolf Tutte Graber 05.01.1935, Margarete Watzka, geborene Heinrich Gießdorf 16.01.1932, Hedwig Bauer Groß-Nutschnitz 30.01.1937, Edith Fröhlich, geborene Schubert Groß-Tschernosek 25.01.1926, Waltraud Bartonitz, geborene Hoche Julienau 21.01.1926, Marie Böhm Kamaik 06.01.1935, Erwin Dorant Kninitz 03.01.1949, Frank Hudler Konoged 02.01.1929, Siegfried J. Kaulfuß Leitmeritz 25.01.1922, Herbert Kolouch 29.01.1930, Edith Tatsch 02.01.1935, Ernst Fischer 21.01.1936, Erich Dressler 30.01.1942, Karl Lamac 14.01.1925, Gertraud O. Werner Lewin 15.01.1941, Brigitta Itterheim, geborene Czech Liebeschitz 30.01.1930, Franz Schubert 23.01.1932, Wilhelm Pilz Littnitz 18.01.1944, Ingrid Richter, geborene Töpper Michelsberg 24.01.1926, Waltraud Liesner, geborene Höhne
Mirschowitz Nr. 41 15.01.1941, Reinhard Nowak München 04.01.1949, Erwin Hareiner Mutzke 21.01.1925, Anna Laube 01.01.1936, Helene Book, geborene Weigel Neudörfel 07.01.1930, Erna Reifenrath, geborene Tröster Pistian 19.01.1934, Inge Hefele, geborene Jirsch Pitschkowitz 28.01.1934, Karl Hackel 28.01.1937, Karl Turke 17.01.1955, Manfred Böhm Pohorz 25.01.1942, Christa Jarosch, geborene Gaube Polepp 02.01.1937, Leopoldine Lunk, geborene Sywall Radaun
18.01.1935, Johanna Sebastian, geborene Hornitschek Rzettaun 25.01.1924, Reinhold Jahnel Schüttenitz 07.01.1939, Kurt Stefan Selz 17.01.1941, Helmar Hocke Suttom 12.01.1936, Ernestine Richter, geborene Plescher Triebsch 31.01.1932, Isolde Graubner, geborene Gertler 28.01.1951, Rudolf Lösel 29.01.1951, Kurt Klingohr Tschakowitz 29.01.1949, Gabi Giussoni, geborene Schneider Tschalositz 26.01.1934, Erika Cramer Tschersing 29.01.1937, Franz Fucke jun. Tschischkowitz 16.01.1929, Leopoldine Letzien, geborene Teuschel 06.01.1931, Margarete Schmitz, geborene Tietze Wchinitz 11.01.1926, Aloisia Petelka, geborene Grusser Wegstädtl 17.01.1942, Gerlinde Heß, geborene Geppert Wocken 05.01.1935, Inge Dettler, geborene Müller Zahorschan 02.01.1941, Manfred J. Trojan
Josef Schlucke

Wir
� Unseren Toten zum ehrenden Gedenken
24.10.2022
Friedrich Seidel Wesendorf, im Alter von 95 Jahren, früher Leitmeritz
Auscha. Sven Pillat
10.11.2022
Dr. med. Günther Sinke Weimar, im Alter von 81 Jahren, früher Petrowitz
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA BUNDESZEITING
vereinigt mit H. Preußler Druck und Versand GmbH & Co. KG Telefon 09 11 9 54 78 0 · Fax 09 11 54 24 86 Nr. 11 · Dezember 2022
Verantwortlich von seiten des Egerer Landtags: Dr. Wolf-Dieter Hamperl. Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Sie erhalten heute unsere erste Ausgabe der Egerer Zeitung innerhalb der Sudetendeutschen Zeitung
Von 1846 bis zur Vertreibung gab es die Egerer Zeitung in Eger, und seit 1952 gibt es sie in Deutschland. Darauf können wir stolz sein.

Da in der Heimat die Falkenauer auch die Egerer Zeitung
gelesen haben, haben wir uns mit dem Falkenauer Heimatbrief zusammengetan, den Sie ebenfalls in dieser Ausgabe lesen köbnnen. So finden Sie also auch Neuigkeiten über den Nachbarkreis.
Wenn Sie diese Ausgabe deer Sudetendeutschen Zeitung bereits durchgeblättert haben, haben Sie gemerkt, daß Sie jetzt so umfangreich wie noch nie über das Egerland informiert werden:

Eger mit Falkenau und Elbogen, Karlsbad mit Luditz, Bischofteinitz, Tachau und Der Egerländer. Wir wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Vorsitzender des Egerer Landtag e.V. und Gerhard Hampl, Vorsitzender des Heimatverbandes der Falkenauer e.V.
Geigen zu bauen liegt ihm im
Blut

Der junge Schönbacher Geigenbauer Michal Rácz ist als Unternehmer des Jahres 2022 des Karlsbader Kreises ausgezeichnet worden.
Schon als Kind hat er in der Werkstatt seinem Vater Peter Rácz über die Schulter geschaut. Sein erstes Musikinstrument vollendete Michal dann im Alter von elf Jahren. Das Kunsthandwerk des Geigenbauens liegt dem jungen Schönbacher also im Blut.
Im Jahre 2013 bekam Michal Rácz die Chance, an einem Fachpraktikum in Anchorage in den USA teilzunehmen. Dort erwarb er wichtiges Erfahrungswissen für den Bau und die Reparatur von Streichinstrumenten. Heute stellt er nicht nur seine eigenen Instrumente her, sondern spezialisiert sich zielgerichtet auf die Reparatur und Restauration aller Arten von Streichinstrumenten.
Roland Feix: Ein Leben für das Egerland und den Unimog

„Dem Volk, dem Recht und der Heimat treu“, so ist es auf dem Wandteppich im Rathaussaal der Patenstadt für Eger und den Landkreis Eger in Amberg zu lesen. Der Wandteppich wurde 1954 anläßlich der Patenschaft durch die Stadt Amberg vom Egerer Landtag e.V. übergeben.
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung
Damals war Roland Feix bereits 26 Jahre alt. Geboren wurde er 1928 in Falkenau, kam aber als Kleinkind nach Eger. Eine spannende, aber auch ereignisreiche und letztendlich traurige Zeit mußte er in seiner Heimatstadt Eger erleben. Wie alle Kinder und Jugendlichen damals wurde er unbefangen in die aufregende und katastrophale Epoche hineingeboren. Roland Feix besuchte die evangelische Volksschule, anschließend die Oberschule und die Staatliche Ingenieursschule in Eger.
Beim Bauen seiner Instrumente orientiert er sich bewußt an den Erfahrungen und technologischen Erkenntnissen alter Geigenbaumeister und stellt aus natürlichen Harzen seinen eigenen Lack gemäß einer über hundert Jahre alten Rezeptur her. Aber nicht nur deshalb sind seine Instrumente in aller Welt bekannt.
„Dieses Handwerk übe ich mit großer Liebe aus, und es bedeutet für mich mehr als Arbeit und Broterwerb. Meine Meisterinstrumente entstehen in reiner Handarbeit in Anlehnung an die Vorbilder Alter Meister, vornehmlich der Modelle von Antonio Stradivari, Guaneri del Gesú oder Domenico Montagnama. Gerne auch unter Anleitung meines Vaters, der für mich auch heute noch ein großes Vorbild ist“. Das Material seiner Instrumente ist mindestens 30 Jahre altes Holz. Nd
Was anfänglich für die Kinder als Abenteuer begann, zum Beispiel als „Wandervogel“, Fanfarenzug und Laienspielgruppe mit zehn bis 14 Jahren, wurde immer mehr zur traurigen Gewißheit. Jungvolk und Hitlerjugend im Anschluß ab 14 Jahren zeigten deutlich die böse Absicht dieser Gemeinschaften. Solche Lageraufenthalte, zum Beispiel in Altrohlau, dienten überwiegend der vormilitärischen Ausbildung. Mit 17 Jahren wurde dann für Roland Feix 1944/45 der brutale Einsatz beim Volkssturm die bittere Realität.
Im Mai 1945 kam er, wie er selbst sagte, „Gott sei Dank“ in amerikanische Kriegsgefangenschaft am Flughafen in Eger. Nach vier Wochen wurde er entlassen. Leider wurde im Juni 1945 diese geglaubte Freiheit durch tschechische Polizisten auf einem Bauernhof in Sirmitz wieder abrupt beendet. Die bekannten grundlosen Verdächtigungen, zum Beispiel Mitglied beim Wehrwolf, sind auch Roland Feix nicht erspart geblieben.
Jetzt begann für ihn die Tortur: Im Gefängnis in Eger wurden er und neun weitere Insassen in eine Zelle von zwei auf fünf Meter mit nur einer Matratze eingesperrt. Tagsüber wurden sie unter Bewachung zu Arbeitseinsätzen in Eger gebracht.
Im November 1945 transportierte man die Gefangenen in ein offenes Lager nach Neurohlau ab, dort waren sie vermehrt schikaniert worden. Kritische Situationen zwischen Leben und Tod mußte er als Heranwachsender erleben. Ab Frühjahr 1946 kamen sie zum Arbeitseinsatz in die SKFahrradwerke nach Eger.
Im Sommer 1946 erfuhren die Gefangenen, daß sie ins Innere der Tschechoslowakei oder gar nach Rußland verlegt werden sollen. Deshalb entschlossen sich Feix und vier weitere Gefangene zu fliehen. Mit Schnaps haben sie die slowakische Wachmannschaft eingeschläfert und flüchteten um Mitternacht in ein Feld.
Die Flucht nach Schirnding am nächsten Tag glückte, leider hatten sie keine Dokumente bei sich.
Die Amerikaner wollten sie deshalb in die Tschechoslowakei zurückschicken. Sie schlichen sich jedoch in einen Transportzug mit Vertriebenen und erreichten glücklich Gießen in Hessen.
Nach der obligatorischen Entlausung bekamen sie dann einen Flüchtlingsausweis und Arbeit in der Landwirtschaft bei der Ernte.
Über den Suchdienst fand er seine Eltern in Mittelfranken wieder. Mangels Ausbildungsmöglichkeiten ging Roland Feix nach Marktredwitz. Durch einen
Bekannten bekam er dort Arbeit, war Praktikant bei der Maschinenfabrik Flottmann in Marktredwitz und machte nach der Währungsreform die Gesellenprüfung. Er engagierte sich, zusammen mit Dr. Hermann Braun, wieder bei seinen Egerländern als Jugendleiter, im Hilfs- und Kulturverein und anderen Organisationen.

Mangels Studienmöglichkeiten hatte Roland Feix trotzdem Glück im Unglück. Ein Angebot von Unimog, übrigens ein Akronym für Universal-Motor-Gerät und später Teil der Daimler AG, hat nun sein gesamtes erfolgreiches Berufsleben geprägt und auch sein Rentenalter ab 1993. Er übersiedelte nach Göppingen und Gaggenau 1949. Seit dieser Zeit gehört er mit zu den Pionieren der Unimog-Familie.

Es war eine Berufung, welche das Leben von Roland Feix bei Unimog bis heute bestimmt:
Seine wichtigsten Stationen: 1951: Auftrag in Südtirol, Slowenien, Kroatien den Unimog vorzustellen.
1952 bis 1960: Einführung des Unimog in Argentinien und in Nachbarländern.

1960 bis 1967: In Bogota (Kolumbien) verantwortlicher Betreuer für den gesamten Markt in Lateinamerika und der Karibik.
1967: Familiengründung in Buenos Aires.
1967 bis 1993: Rückkehr nach Deutschland. Von Gaggenau aus Export-Referent für Lateinamerika und europäische Länder.
Ab 1993 bis heute: Mitinitiator bei der Einrichtung des Unimog -Museums in Gaggenau und bis heute aktiv bei Museumsführungen.
Gründung des Unimog-Clubs mit heute 8000 Mitgliedern weltweit.
Roland Feix ist aber immer „dem Volk, dem Recht und der Heimat treu“ geblieben: Als Mitglied beim Egerer Landtag e.V. war er Vertreter der Vorsitzenden Prof. Dr. Schreiner und DiplomIngenier Uhl.
Zu unserer Veranstaltung „700 Jahre Verpfändung der Stadt Eger und des Landkreises“ am 23. Oktober 2022 kam er selbstverständlich von Gaggenau nach Amberg.
Der Egerer Landtag und alle Landsleute sagen deshalb: Lieber Roland Feix, danke für Ihren außerordentlich großen, treuen Einsatz bei unserem Heimatverband und alles Gute für die Zukunft, vor allem weiter Gesundheit. Herzliche Glückwünsche zu Ihrem 95. Geburtstag am 3. Januar 2023.“
Gottfried Georgdem Rad auf Jobsuche
In dem Text wird auch geschildert, wie Feix seinen Traumjob bekam.
„Nach seiner Flucht aus dem Sudetenland bestritt der damals 21 Jahre junge Mann im März 1949 ein Praktikum in Marktredwitz. Der Zufall wollte es, daßein Bekannter ihm eine Broschü re zeigte, die sein Leben für immer verändern sollte. Zu sehen war ein neuartiges Gefährt: ein Universal-Motor-Gerät, kurz Unimog. Der technikinteressierte Roland Feix war elektrisiert und bewarb sich sofort bei der Maschinenfabrik Boehringer.
Mit dieser Broschüre begann die gemeinsame Geschichte von Roland Feix und dem Unimog.
Zwar erhielt Roland Feix postwendend die ersehnte Einladung zum Vorstellungsgespräch, doch stand er gleichzeitig vor einem Problem: Wie sollte er als nahezu mittelloser Mann nach Göppingen gelangen? Ausgestattet mit jeder Menge Motivation, entschied er sich für das Fahrrad und radelte die gut 400 Kilometer. Eine lohnende Entscheidung, wie sich zeigte, denn nach kurzem Gespräch wurde Roland Feix per Handschlag eingestellt.“
� Egerer Landtag
Bericht des Vorstands
Am Samstag, den 5. November 2022 kam der Vorstand des Egerer Landtag e.V. im Haus des Deutschen Ostens in München zu einer Sitzung zusammen.
In München deshalb, weil man sich am Nachmittag die wohl einmalige Ausstellung über die Egerer Reliefintarsien ansehen wollte. Durch die Ausstellung führte der Vorsitzende Dr. Wolf-Dieter Hamperl. Die weiteren Punkte befaßten sich mit dem Egerer Kulturgut in der Geschäftsstelle in Amberg. Dr. Wolf-Dieter Hamperl berichtete, daß die Archivierungsarbeiten am Vereinsarchiv in der zeitlichen Planung sind. Das Staatsarchiv Amberg unter der Leitung von Dr. Maria Rita Sagstatter, hat sich bereit erklärt, unsere Archivbestände in seinen Besitz zu übernehmen. Die Bildbestände werden das Depot des Sudetendeutschen Museums in München bereichern.
Unter Allgemeines wurde über den Verbleib der Fahne von Maria Weiher diskutiert. Dr. Wolf-Dieter Hamperl stellte in Aussicht, daß die verbleibenden Arbeiten der Archivierung des Heimatkundlichen Archivs und die Digitalisierung des Fotoarchivs im Jahr 2023 abgeschlossen werden können. Auch über eine Beteiligung an der Erneuerung des Marienbader Museums in Bad Neualbenreuth durch Egerer Exponate wurde gesprochen.
Neues aus der Geschäftsstelle
Die Arbeiten dort gehen trotz Corona-Befall planmäßig voran. Leonhard Strobel ist bei der Archivierung der Egerer Zeitung, des letzten, sehr umfangreichen Bestandes des Vereinsarchivs angekommen. Wir haben beschlossen, daß Leonhard Strobel anschließend das eher übersichtliche Heimatkundliche Archiv bearbeitet. Voraussichtlich werden Ende Februar diese Arbeiten abgeschlossen sein.
Dr. Maria Rita Sagstatter hat uns am 22. Dezember noch einmal besucht, um uns bei bestimmten Beständen zu beraten.
Die Ordnung der Fotobestände ist deshalb sehr zeitraubend, weil viele der Fotos aufgeklebt und in Ordnern gesammelt worden sind. Die Fotos konnten nur teilweise gelöst werden. mußten also samt Papier ausgeschnitten und beschriftet werden.
Ich habe die Bestände in Fachbereiche gegliedert wie „Egertal“, „Eger – Burg“, „Eger –Kirchen“, „Eger – Marktplatz“, „Eger – Plätze und Straßen“, „Egerland – ländliches Bauen (Fachwerk)“, „Egerland –Trachten“ und so weiter. Der Fotobestand ist umfangreich, ich schätze ihn auf 3000 Exemplare.

Die Software wurde von Klaus Mohr übernommen, der sie für das Sudetendeutsche Archiv entwickelt hat. Hard- und Software richtet Markus Soyka ein, für die Digitalisierung des Fotobestandes konnte die Studentin Leah Soyka gewonnen werden.
Wegen der Erneuerung des in die Jahre gekommenen Marienbader Museums in der alten Posthalterei in Bad Neualbenreuth und einer Beteiligung des Egerer Landtag e.V. fand am 12. Januar 2023 ein erstes Treffen in der Frais statt.
Dr. Wolf-Dieter HamperlNeue Heimat für wertvolle alte Bücher
Im ehemaligen Stadtarchiv Eger, dem heutigen Bezirksarchiv Cheb, befindetsich in einem sehr hohen, großen Raum des ehemaligen Franziskanerklosters die „Deutsche Bibliothek“, die ausschließlich deutschsprachige Bücher aus dem Egerland und DeutschBöhmen beinhaltet.
Der Bestand umfaßt an die 23 000 Bücher und ist in hohen Regalen gesammelt. Wenn das Auge höher an die Decke schweift, sehen wir dort eine bemalte Holzkassettendecke, die aus der 1908 abgerissenen Frühmeßkirche in Schönbach stammt. Sie wurde hier eingebaut. Diese Bibliothek ist meines Wissens die größte Bibliothek des Egerlandes.
Dieser großartige Bücherbestand wurde von den Archivaren des Egerer Stadtarchivs aufgebaut: Georg Schmid, Vinzenz Pröckl, Heinrich Gradl, Dr. Karl Siegl und zuletzt von Dr. Heribert Sturm. Diese Bibliothek endet im Jahr 1945.
Die Bibliothek hat die Jahre der Vertreibung unversehrt überstanden und wurde von verständigen tschechischen Archivaren im Verborgenen gehalten. Sie steht heute so wie 1945 da.
Bestandsgeschichte
n Das Staatliche Bezirksarchiv ist die Nachfolgeinstitution des Archivs der Stadt Eger, das 1732 als selbständige Abteilung der Stadtverwaltung konstituiert wurde. Die Gründung einer eigenen Bibliothek geht auf die Initiative von Georg Schmidt (1844–1885) zurück, der als Gründer Bestände nach dem Vorbild des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg zusammenführen wollte.
n Den historischen Grundstock der Bibliothek bildet die alte Magistratsbibliothek der Stadt Eger, die von Georg Schmidt in den Jahren 1869/70 von der städtischen Kanzlei separiert und durch eine neu angelegte Sammlung der Chroniken und Zeitungen ergänzt wurde. Eine Erweiterung in Form einer Handbibliothek erfolgte in den Jahren 1895 bis 1934 durch Karl Siegl (1851–
Der Gebäudekomplex des ehemaligen Clarissinenklosters und heutigen Bezirksarchivs in Eger. Im Hintergrund die Franziskanerkirche und die Gebäude des ehemaligen Franziskanerklosters, in dem sich die Direktion des Archivs und auch die Deutsche Bibliothek befinden Foto: Wolf-Dieter Hamperl

In der Zeit von 1945 bis heute sind nur vereinzelt deutsche Bücher über das Egerland hinzugekommen. Es ergibt sich jetzt die Möglichkeit, diesem großartigen Buchbestand des ehemals deutschen Stadtarchivs in Eger die Bücher des Egerer Landtag e.V. hinzuzufügen.
Diese etwa 1500 Bände umfas-
� Zahlen und Fakten
sende Büchersammlung erstellten die 1945/46 aus Stadt und Land Eger Vertriebenen in ihrer Patenstadt Amberg.
Diese Bücher dokumentieren die Geschichte und das Leben der Vertriebenen von 1948 bis 2000. Sie sollen deutschen und tschechischen Studenten und Wissenschaftlern zugängig sein.
Dies ist umso wichtiger, da in der kommunistischen Zeit Bücher aus dem Westen verboten waren und große Wissenslücken in der tschechischen Bevölkerung bestehen. In Eger konnte sie sich über unsere Geschichte aus erster Hand informieren.
Deshalb bin ich dafür, daß beide Bibliotheken zusammengeführt werden. Das hat auch seinen Grund in der Tatsache, daß unsere Patenstadt Amberg die Bibliothek des Egerer Landtags nicht übernimmt. Man argumentiert so, daß niemand nach diesem Egerer Kulturgut in Amberg suchen würde.
Der inventarisierte Buchbestand wurde folgenden Institutionen in Deutschland angeboten: Patenstadt Amberg, der Wissenschaftlichen Bibliothek im Sudetendeutschen Haus in München, der Osteuropa-Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek München, der Egerland-Bücherei in Marktredwitz, der MartinOpitz-Bibliothek in Herne und dem Herder-Institut in Marburg.
Alle diese Bibliotheken wollen nur je einen Teil der Bücher, die doppelten oder uninteressanten Bücher würden sie anderen Büchereien oder Antiquariaten anbieten.
Nur das ehemalige Egerer Stadtarchiv unter seinem Leitenden Direktor Mgr. Karel Halla ist daran interessiert, die Bibliothek als Ganzes zu übernehmen und als Zeitzeuge der vorhandenen Deutschen Bibliothek hinzuzufügen. Sie soll als Ganzes in dem Raum der Deutschen Bibliothek erhalten bleiben und uns jeder Zeit zugängig sein.
Auch ich konnte mir eine solche Entscheidung vor zwei Jahren nicht vorstellen, aber wenn man erkennen muß, daß hier niemand Interesse an der Sammlung hat, ist es nur rational, die Bücher dorthin zu geben, wo sie eine Zukunft haben und gebraucht werden.
Und noch eines ist wichtig: Die Bücher wurden nach 1952 käuflich erworben, es sind keine Bücher dabei, die im Fluchtgepäck gewesen wären. Sie sind mit dem Stempel Egerer Zeitung versehen und wenn nicht, werden sie jetzt mit dem Stempel Egerer Landtag e.V. gekennzeichnet.
Der Vorstand des Egerer Landtag e.V. hat bei der Vorstandssitzung am 1. Oktober nach langer Diskussion meinem Vorschlag mit sechs Stimmen bei einer Gegenstimme zugestimmt.
Dr. Wolf-Dieter Hamperl
Die Deutsche Bibliothek in Eger
1943). Der Schwerpunkt der Ergänzungen lag bei der regionalen Literatur zur Geschichte der Region um Eger und der Deutschen in Böhmen.
n Heribert Sturm (1904–1981) baute die eigentliche Archivbibliothek in den Jahren 1934 bis 1946 auf, die nach 1945 unter der Bezeichnung Deutsche Bibliothek fortbestand. Unabhängig von der alten Magistratsbibliothek sammelte sie Bücher zur Geschichte und Landeskunde. Nach 1945 entstand als eine selbständige Abteilung die sogenannte Tschechische Bibliothek, die heutige Studienbibliothek, die die laufende Produktion zeitgenössischer Werke ab 1945 umfaßt.
Da es sich bei der Deutschen Bibliothek um einen geschlossenen historischen Bestand der Jahre 1895 bis 1946 handelt, der nach 1945 nicht mehr ergänzt wurde, wurde 1990 als vierte Abteilung eine Sammlung moderner regionaler Literatur zur Ergänzung eingerichtet. Sie umfaßt weitere Werke zur Geschichte des Egerlandes und zur Geschichte der Deutschen in Böhmen, die später unter anderem durch Schenkungen von Heimatverbänden in die Bibliothek kamen.
Demgemäß gilt die Sammlung regionaler Literatur als Fortsetzung der Deutschen Bibliothek. Neben diesen vier Abteilungen des Bibliotheksbestandes exi-
stieren seit 1872 gesondert eine Zeitschriftensammlung als Teil der Handbibliothek und eine Periodikasammlung des Archivs als Teil der Deutschen Bibliothek sowie eine Sondersammlung der Schuljahresberichte.
Bestand
n Chronologische Übersicht und Übersicht nach Sprachen:
Der Gesamtbestand der Bibliothek umfaßt cira 30 000 Titel in etwa 40 000 Bdn. Sie verteilen sich auf die alte Magistratsbibliothek (2749 Bde), die Deutsche Bibliothek (18 200 Titel in 18 900 Bdn), die Studienbibliothek (6403 Titel in 8000 Bdn), die Sammlung moderner regionaler Literatur (2174 Titel in 2292
Bdn) und die Zeitschriften- und Periodikasammlung (766 Titel in 6876 Bdn). Die Sondersammlung der Schuljahresberichte umfaßt weitere 60 000 Bde und ist separat aufgestellt.
n Den wichtigsten Teil der Magistratsbibliothek bilden - neben den Inkunabeln und ältesten Werken wie Johann Philipp Abelins Theatrum Europaeum, hrsg. von Matthäus Merian (Frankfurt a. M. 1635–1667) - ca. 1400 Bde aus dem 17. Jh , vorwiegend zu Recht und Verwaltung.
n Die Zeitschriften- und Periodikasammlung mit ihren 766 Titeln (in 6876 Bdn) umfaßt in relativer Vollständigkeit alle regionalen Ausgaben des Egerlandes ab der Mitte des 19. Jhs und die bedeutendsten Titel deutschsprachiger Periodika in Böhmen, so z. B. die Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jaromír Bohác
vereinigt mit
Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46

Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland

❯ Heimatverband Herzlichen Glückwunsch

Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats. 73. Jahrgang
Der Heimatverband der Falkenauer e.V. gratuliert seinen Januar-Geborenen.
Jänner
101. Geburtstag: Fritsch Wilhelm (Falkenau), 21. Januar.
100. Mannert Andreas (Schönfeld-Falkenau) 7. 99. Brandl-Krauth geb. Brandl 12.
96. Sommer Margarethe geb. Hahn (Maria-Kulm) 3.



Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist
2023
95. Hering Erna geb. Fenkl (Ebmeth) 3.
95. Wildner Irma geb. Höfer (Boden) 4.
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
93. Röcken Anna geb. Kumpera (Lauterbach-Dorf) 1. 92. Werner Anton (Falkenau) 2. 92. Lippert Josef (MaraiKulm) 5. 90. Kalb Anna geb. Lenkl (Lauterbach-Dorf) 3.
90. Hahn Brunhilde geb. Burckl (Maria-Kulm) 31. 88. Dörfler Wilhelm (Loch) 28. 87. Dörfler Herbert (Loch) 18.

87. Kreuzer Rudolf (Birndorf) 18.
86. Putz Rudolf (Falkenau) 18. 86. Gremmelmaier Maria geb. Richter (Kirchenbirk) 6. 83. Träger Dr. med. Siegfreid (Liebautal) 8. 82. Reichmann Dr. Alfred (Ruditzgrün) 1. 81. Schulze Renate geb. Künzl (Haberspirk) 20. 80. Glöckner Franz (Unterneugrün) 5.

80. Heinz Gerhard (Falkenau) 7. 80. Mayer Rosemarie geb. Böhm (Rollessengrün) 31. 79. Neuhörl Josef (Pichlberg) 21. 75. Kneißl Dr. med. Manfred (Forchheim) 17.
Elbogener erfand die Trinkkur
Karlsbad ist für seine Trinkkuren weltberühmt. Erfunden hat sie aber ein Arzt aus Elbogen.
Vor 500 Jahren, 1522, verfaßte Dr. Václav Payer (1488–1537) ein Traktat über die Heilwirkungen des Karlsbader Mineralwassers.
Bis dahin wurde das Quellwasser ausschließlich für Langzeitbäder genutzt. Mit der Veröffentlichung wurde bekannt, daß langes Baden in heißem Mineralwasser der Gesundheit nicht zuträglich ist. Auf Grundlage seiner Forschungsergebnisse empfahl Payer, das Mineralwasser zu trinken. Payers Wassertherapien werden auch heute noch erfolgreich praktiziert.
Vor einiger Zeit stieß ich auf einen Nachdruck eines Buches, wovon sich Originale in unserer Bibliothek in Schwandorf befinden. Sein Titel lautet: „Denkwürdigkeiten der Stadt Falkenau an der Eger und ihrer nächsten Umgebung“ von Michael Pelleter, Erzdechant in Falkenau a.d. Eger. Falkenau 1876, Druck von Müller & Weiser.



M
Der Verfasser schreibt in der Einleitung: „Vorliegende Schrift enthält Bruchstücke aus der Geschichte einer kleinen Landstadt. So mühevoll es war, sie aus alten Handschriften und Urkunden zu sammeln, so schwierig war die Verbindung des ungegliederten Stoffes zu einem halbwegs genießbaren Ganzen.“
Nach den ersten Seiten, auf denen der Verfasser auf die Geologie des Falkenauer Beckens mit seinen Mineral- und Kohlevorkommen eingeht, folgt ein interessanter Abschnitt über die Frühgeschichte dieser Gegend:
„Die eigentliche Geschichte Böhmens beginnt sehr spät, aber auf diese, von der Hauptstadt entlegenen Thäler hat sie ganz
❯Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.
Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
1923, also genau vor hundert Jahren, wurde diese Postkarte mit 30 Heller frankiert und abgestempelt. Jetzt wird sie auf der Auktionsplattform eBay von einem Bieter mit Sitz in Singapur versteigert.






Das Motiv, den Aussichtsturm von Falkenau an der Eger, sucht man heute vergeblich.
❯ Auszüge aus dem historischen Werk „Denkwürdigkeiten der Stadt Falkenau“
vergessen. Wir wissen daher nicht mehr, wann und von wem sie zuerst bewohnt wurden, noch welchem Volksstamme die ersten Ansiedelungen angehörten. Bekannt ist nur, daß zur Zeit der Errichtung des Prager Bistums 973 die alte Landschaft Zettlitz, der nachmalige Elbogner Kreis innerhalb seiner Grenzen lag, somit vielleicht auch schon dem böhmischen Herzogthume einverleibt war.“
Gegend schon früher begonnen haben, denn im 13. Jahrhundert finden sich schon viele deutsche Ortsnamen, darunter einige mit bereits städtischer Verfassung. So wird Lichtenstadt bereits 1219 als Markt (filla forensis) angeführt und Königsberg wird bereits 1232 Stadt.
it dem Erlös dieser Auflage sollte ein Beitrag zur Wiederherstellung des abgebrannten Kirchturmdaches geleistet werden. Interessanterweise wurde dieser Nachdruck in den USA von „Nabu Public Domain Reprints“ hergestellt. In einer vorangestellten ersten Seite wird auf Englisch darauf verwiesen, daß man eine Reproduktion eines vor 1923 hergestellten Originals in Händen hält, was man frei vertreiben könne, da kein Individuum Copyright-Rechte beanspruchen könne.Diese Ausgabe erschien 1822. ❯ 8.


Damals dürfte die Bevölkerung der hiesigen Gegend noch größtenteils slavisch gewesen sein. Es ließe sich sonst nicht erklären, woher die vielen fremdartigen Ortsnamen herrühren. Teschwitz, Zieditz oder Daßnitz sind ebensowenig deutschen Ursprunges wie Theussau, Prösau, Lanz, Thein und andere mehr.
Eine Seite weiter schreibt der Autor: „Soll Falkenau als eine ursprünglich deutsche Ansiedlung gelten, so könnte sie vor dem 11. Jahrhundert in der Art nicht entstanden sein; denn vor dieser Zeit hatte selbst das Egerland noch eine vorwiegend slavische Bevölkerung.“
Er verweist auf Palacký, der sagt: „Deutsche Kolonien erscheinen in Böhmen urkundlich seit dem Jahre 1203, zuerst im heutigen Leitmeritzer Kreise, dann im Elbogner und Saazer.“
Weiter schreibt er, in Wirklichkeit werden sie in hiesiger
Pelleters Arbeit ist hier nicht hoch genug zu bewerten, insbesondere, daß er Quellen zu denen er Zugang hatte, studierte und diese auch angegeben hat. Außer Acht läßt er aber frühere Besiedelungen dieses Raumes, wie zum Beispiel durch Markomannen während der Völkerwanderung. Nicht zu vergessen keltische Siedlungen, die von Archäologen in diesem Raum auch nachgewiesen wurden. Ganz zu schweigen von Neandertalern, von denen jeder von uns noch DNA-Reste in sich trägt, wie die neuesten Forschungen bewiesen haben. Aber das konnte Pelleter 1876 noch nicht wissen Nicht ahnen konnte Pelleter, daß einige Jahre später fast die gesamte Bevölkerung des Falkenau-Elbogner Gebietes vertrieben werden sollte. Eine solche Vertreibung hat es in diesem Raume nie gegeben, keine Kelten, keine Markomannen und keine Slaven wurden jemals vertrieben. Auch 1938 keine einheimischen Tschechen. Mit dieser Vertreibung wurden auch die vertrieben, von denen Pelleter als Slaven spricht. Denn auch sie sind neben Neandertalern und Kelten ein Teil von uns.
Nur zwei Jahre nach 1946 verabschiedeten die Vereinten Nationen 1948 ihre „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“.
Gerhard Hampl
Dezember 2022,
Donnerstag, 8. Dezember 2022, 16.45 Uhr: Im Egerland bebt die Erde. Die Richterskala schlägt bis auf 3,1 aus. Selbst im Vogtland ist die Erschütterung noch zu spüren.
ab einer Magnitude von 2,0. Vieles spricht dafür, daß es sich diesmal aber nicht um den Beginn eines für die Gegend typischen Schwarmbebens handelt.


U
rsache waren zwei Erdstöße in fünf Kilometern Tiefe. Diesmal wurde vom Geophysikalischen Institut der Prager Akademie der Wissenschaften das Epizentrum jedoch nicht, wie bei den Schwarmbeben der Vergangenheit, in der Gegend des Dorfes Neukirchen, sondern einige Kilometer nördlich unmittelbar vor der Stadt Schönbach lokalisiert.


Zwar wurden diesmal den Behörden weder Sach- noch Personenschäden gemeldet, jedoch klirrten in Eger und sogar in Falkenau recht wahrnehmbar die Gläser in den Vitrinen der Wohnstuben.
Von Menschen wahrgenommen werden können Erdbeben
Was sind Schwarmbeben? Die Geophysik bezeichnet eine bestimmte Abfolge von Erderschütterungen als Erdbebenschwarm oder Schwarmbeben. In bestimmten Regionen der Erdkruste treten dabei mehrere Erdbeben innerhalb eines begrenzten Zeitraums auf. Sie haben meist eine ähnliche Stärke, ihre Häufung kann mehrere Tage bis etwa zu einem Jahr andauern. Heftigere Erdbebenschwärme, wie der von 1985/86, treten circa alle 74 Jahre auf, kleinere alle drei Jahre. Zuletzt kam es im Jahr 2018 im Egerland und im angrenzenden Vogtland zu mehreren spürbaren Schwarmbeben. Damals hatten die Beben eine Magnitude von 4,5 und waren bis ins 150 Kilometer entfernte Nürnberg zu spüren. Nd
vereinigt mit
AUS DEM BEZIRK
In eigener Sache!
Heimatkreis Karlsbad, Heimatkreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollak, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22.
Spendenkonto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparkasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KSKarlsbader Zeitung –
Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Neujahrsbotschaft von Kreisbetreuerin Dr. Pia EschbaumerHeimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V. 72. JAHRGANG Dezember 2022 66. JAHRGANG Jänner 2016 FOLGE 1
Unsere Karlsbader Zeitung hat eine neue Heimat
Liebe Leserinnen und Leser – ob Sie nun selbst noch in Karlsbad oder einer der Gemeinden in seinem Kreis geboren sind, ob Ihre Vorfahren von dort her stammen oder ob Sie einfach Interesse an dieser schönen Gegend und ihrer Geschichte haben – seien Sie herzlich begrüßt!
Wir hoffen, daß Sie der Karlsbader Zeitung auch an diesem neuen Ort gewogen und treu bleiben, wenn Sie bislang schon Abonnent waren, oder daß wir Sie neu zu unserer Leserschar hinzugewinnen können. Bitte seien Sie anfangs nachsichtig, wenn nicht alles zu Ihrer Zufriedenheit ausfällt – melden Sie sich, um Kritik zu üben oder Anregungen zu geben, damit wir uns verbessern können!
Wie gewohnt, wollen wir erst einmal denjenigen zum Geburtstag gratulieren, die sich als Gemeindebetreuer oder in einer anderen Funktion für den Hei-
matverband der Karlsbader einsetzen beziehungsweise dies lange Zeit getan haben. Im Jänner beglückwünschen wir zum 91. Geburtstag am 2. Januar Rudi Hannawald, GB Sittmesgrün, 95698 Neualbenreuth; 84. Geburtstag am 2. Januar Rudolf Preis, GB Altrohlau, 77948 Friesenheim; 83. Geburtstag am 16. Januar Alfred Lihl, GB Ruppelsgrün, 91327 Gößweinstein; 70. Geburtstag am 31. Januar Helmut Roßmann, GB Marletzgrün, 64397 Modautal; 68. Geburtstag am 22. Januar Wolfram Schmidt, GB Pullwitz, 91413 Neustadt an der Aisch..
Wie gern hätte ich auch Bernhard Knaut, dem GB von Tüppelsgrün zum 57. Geburtstag am 31. Januar gratuliert, doch wie in der Dezember-Ausgabe unserer Zeitung gemeldet, ist er bereits Ende Oktober verstorben. Seine Beiträge waren eine Bereiche-
� Mitteilungen des Heimatverbandes
rung für unsere Zeitung, wir haben sie immer mit Genuß gelesen.
Meinen letzten Bericht an Sie habe ich Ende Oktober für die Dezember-Ausgabe geschrieben. Nun sitze ich Ende Dezember an der Arbeit für die JännerAusgabe – da hätte ich mich früher schon um den Feber kümmern müssen. Grund dafür: Der Redaktionsschluß liegt bei der Sudetendeutschen Zeitung wesentlich später, außerdem wurde unser „Badeblatt“ vom PreußlerVerlag bislang immer zum Monatsbeginn oder kurz davor ausgeliefert, jetzt erscheint es etwa eine Woche später.
Das wären dann also ruhige Wochen bis in den Dezember hinein gewesen? Nun, angesichts des „Umzugs“ unserer Karlsbader Zeitung war dem nicht so – es gab viel Material zu ordnen und zu überlegen. Es kamen auch viele besorgte Nachfragen von Landsleuten, so daß
vieles andere zunächst liegengeblieben ist.
Am 11. und 12. November habe ich wieder an der jährlichen Sitzung des Heimatrates auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen teilgenommen, die erneut interessante Vorträge mit vielfältigen Anregungen gebracht hat, insbesondere für das Projekt des Heimatverbandes zum Friedhof in Karlsbad, das wir im kommenden Jahr nun verstärkt betreiben wollen – ich werde wieder darüber berichten. Auch in unserem Museum in Wiesbaden steht ein Termin an.

Das neue Jahr ist noch jung. Ich hoffe, es wird für Sie alle, wie auch für den Heimatverband und die Karlsbader Zeitung, ein gutes und erfolgreiches Jahr.
Karlsbad vor 100 Jahren
Informationen für alle Heimatfreunde
Liebe Heimatfreunde von Karlsbad und Umgebung! Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen – hier einige Worte zur Jahreswende:
Gottes Segen begleite Dich in das neue Jahr.
Er schenke Dir Zuversicht und Wagemut für alles Schwere. Er schenke Dir Hoffnung und Energie für alles Leichte. Er schenke Dir Geduld und Liebe für alles dazwischen. Gottes Segen begleite Dich heute und alle Tage.
Spenden an den Heimatverband der Karlsbader im November und Dezember 2022. 315,00 Euro sind auf unserem Konto ein-
gegangen, und dafür danken wir sehr herzlich. Namentlich nennen wir: Gerda Pickert (Nürnberg), Helga Mölcher (Laubach), Albin Peter (Neuburg, Gemeindebetreuer von Pirkenhammer), Erwin Zwerschina (Gemeindebetreuer von Drahowitz). 50 Euro haben wir erhalten für das Karlsbader Museum in Wiesbaden.


Wenn Sie uns mit einer Spenden unterstützen wollen: Heimatverband der Karlsbader e.V. Kreissparkasse München IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC:BYLADEM1KS.
Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung oder wollen Sie ungenannt bleiben, dann melden Sie sich bitte oder vermer-
ken dies auf dem Überweisungsträger.
Mitgliedschaft im Heimatverband der Karlsbader e.V.: Wenn Sie bereit sind, uns mit Ihrer Mitgliedschaft zu unterstützen, dann rufen Sie mich bitte an, ich sende Ihnen umgehend ein Beitrittsformular zu.
Geburtstage: Folgenden Mitgliedern gratulieren wir herzlich zu ihrem Geburtstag im Januar: 84. am 2. Preis, Rudolf, 77948 Friesenheim – 82. am 6. Feicht, Christa, 91443 Scheinfeld – 44. am 8. Padua, Pavel, CZ-36 301 Ostrov – 87. am 16. Angermeier, Franka, 86853 Langerringen – 83. am 16. Lihl, Alfred, 91327 Gößweinstein – 83. am 19. Götz,
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich vor allem das Wichtigste: Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße von der Kreisbetreuerin Pia Eschbaumer n 1. Januar 1923: Die Stadt kann am 1. des Monats die Gehälter nicht auszahlen, weil das Drei-Millionen-Darlehen noch nicht flüssigist. Neujahrskonzert der Stadtschützen am Markt.
Helmut, 87600 Kaufbeuren –60. am 21. Schimmer-Leisterer, Gabriele, 64367 Mühltal.

Karlsbader Museum und Archiv in Wiesbaden, Oranienstraße 3: Jeden 1. Samstag im Monat ist das Museum für Besucher geöffnet von 11.00 bis 13.00 Uhr. Für Februar 2023 ist das Samstag, der 4. Februar. Das Ehepaar Dr. Horst und Christa Engel erwartet gerne Ihren Besuch. In besonderen Fällen kann ein anderer Besuchstermin vereinbart werden, bitte anrufen bei Dr. Engel (06 41) 4 24 22. Zu erreichen ist das Museum vom Hauptbahnhof Wiesbaden mit der Buslinie 16 bis Ausstieg Landesbibliothek.
Unsere Bücherecke:
n 2. Januar 1923: Die Staatsfachschule für Porzellanindustrie wird im ehemaligen Hotel „Wiener Hof“ eröffnet.
n 4. Januar 1923: Der Karoli-Club begeht sein 30jähriges Bestandsjubiläum. Eine Hilfsschule für geistig zurückgebliebene Kinder wird im Kindergartengebäude Panorama-Straße eröffnet. Als Lehrkräfte wurden die Lehrer Otto Nemetz als Leiter und Alfred Doroschkin angestellt.
n 14. Januar 1923: Ein Motorradunfall ereignet sich in der Egerstraße, es gibt zwei Verletzte.
n 16. Januar 1923: Die Stadt Dortmund wird von den Franzosen besetzt. Die Deutsche Mark stürzt weiter ab. n 17. Januar 1923: Magazinbrand in der Villa Danzer.
Die nächste Vorstandssitzung findetam 2. März um 15.00 Uhr im Egerländer Hof statt.
Zum Geburtstag herzliche Glückwünsche für Gesundheit und Wohlergehen allen, die im Januar geboren sind. Am 6. zum 74. Irene Kasakova; am 8. zum 44. Pavel Padua; am 8. zum 51. Gerhard Stiefel; am 16. zum 68. Jarmila Krausova; am 17. zum 88. Josef Hess; am 18. zum 73. Peter Krebs; am 23. zum 92. Frantisek Bauml.
Zur Nikolausfeier traf sich die Karlsbader Gruppe am 8. Dezember 2022 im Egerländer Hof zur fröhlichen Runde und feierte dabei den 90. Geburtstag von Truda Holubova. Wir waren in innigen Gedanken dabei.

n Einwohnerverzeichnis der Kurstadt Karlsbad, der Stadt Fischern und der Marktgemeinde Drahowitz. Es handelt sich um die 324 Seiten des äußerst seltenen Adreßbuches von 1938/39 mit dem Redaktionsstand von 1937. Preis: 29,00 Euro
n Karlsbader Historische Schriften Band 2. Eine kenntnisreiche Betrachtung über Karlsbad als Kur- und Genesungsstadt. Preis: 19,80 Euro.
n Karlsbader Schicksalstage 1939 bis 1946. Von Prof. Dr. Rudolf Schönbach. Preis: 4,50 Euro.
n Zwischen Grenzen und Zeiten. Egerländer Landsleute erzählen, zusammengestellt von Hans Bohn. Preis: 6,00 Euro.
Alle Preise inklusive Porto und Verpackung.
Kontaktdaten: Susanne Pollak, Estinger Straße 15, 82140 Olching, Tel. (0 81 42) 1 23 03, eMail heimatverband@carlsbad. de Bleiben Sie gesund. Ihre Susanne Pollak
Attentat auf Finanzminister Dr. Alois Rašín durch den 19jährigen Versicherungsbeamten Josef Sougal, einen erklärten Kommunisten. Rašín, ein radikaler Widersacher der österreichischen Monarchie und Mitbegründer der Tschechoslowakei, erlag Wochen später am 18. Februar den schweren Schußverletzungen.
n 6. Januar 1923: Zimmerbrand im Haus Polonia.
n 8. Januar 1923: In Prag beginnt der Schwurgerichtsprozeß wegen Spionage gegen den Abgeordneten Dr. Baeran und Karl Schwalbe. Am 19. wird Baeran zu vier Jahren und Schwalbe zu drei Jahren verurteilt.
Der Kanzleidirektor der Karlsbader Sparkasse und frühere Stadtvertreter Ladislaus Lampel stirbt im Alter von 73 Jahren.
n 9. Januar 1923: Die Stadt Essen wird von den Franzosen besetzt.
n 13. Januar 1923: Das Amtshaus der Bezirkskrankenkassa wird wegen ungünstiger Bedingungen nicht gebaut.
n 19. Januar 1923: Die Dreikreuzberg-Kuppe soll abgewaldet werden. Karlsbader Naturfreunde sind dagegen. Eine Kommission wird eingesetzt, die sich damit befaßt, aber nichts ausrichtet. Die Umgebung wird von Valutabettlern überschwemmt, die sich im Tage 30 bis 40 Kronen erbetteln und in Deutschland den 100fachen Wert in Mark erhalten. Die geplante Eröffnung einer Suppenanstalt unterbleibt wegen zu geringer Anmeldung der armen Bevölkerung.
n 20. Januar 1923: Die Eisenbäder werden an Max Schröder auf drei Jahre um jährlich 3600 Kronen verpachtet.
n 21. Januar 1923: Die Nr. 16 der Deutschen Tageszeitung wird wegen vier der Zensur mißhaltener Zeilen beschlagnahmt.
n 23. Januar 1923: Zivilingenieur und Hausbesitzer Gustav Müller stirbt im 75. Lebensjahr. Er wurde 1891 von Gablonz nach Karlsbad berufen und entwarf das Talsperrenprojekt. Er gehörte in den Jahren 1895 bis 1908 der Stadtvertretung an.

n 25. Januar 1923: Wegen Verstaatlichung der städtischen Sicherheitswache gehen viele Polizisten frühzeitig in den Ruhestand.
Wegen der Übernahme des Central-Kinos gibt es erregte Debatten im Stadtverordneten-Kollegium.
n 26. Januar 1923: Tau-Regenwetter tritt ein.
n 28. Januar 1923: Eine sozialdemokratische Protestversammlung gegen die Ruhrbesetzung findetstatt. Die alldeutsche Protestversammlung wurde verboten.
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-ManetinDezember ... und Friede den Menschen auf Erden. Holzschnitt W. Klemm � Januar 1923 Von Rudi Baier � Bund der Deutschen – Landschaft Egerland – Ortsgruppe Karlsbad Truda Holubova: Feier zum 90. Auch der Nikolaus gratulierte Truda Holubova zum 90. Geburtstag. Dr. Alois Rašín. Foto: Wikipedia Nach der schweren Überschwemmung von Karlsbad am 24. November 1890 wurden unter Leitung des Ingenieurs Gustav Müller mehrere Talsperren geplant. Noch heute ist die Talsperre Pirkenhammer in Betrieb.
Karlsbad Stadt
Gemeindebetreuerin Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad. de
Ein neues Jahr beginnt, und für einige aus unserem Kreise im Jänner auch ein neues Lebensjahr. Alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen wünschen wir herzlichst zum: 101. am 29.
Heintzen/Kinast Erika (Sprudelstraße); 95. am 02. Hofmann Rudolf (Schulgasse); 89. am 11. Hlawatsch/Lux Henriette (Lutherstraße); 87. am 16. Angermeier /Larcher Franka; 74. am 06.
Kašaková /Padua Irena (Karlsbader Ortsvorsitzende des Bundes der Deutschen).
Leider muß ich wieder einen Todesfall melden: Kurz nach Weihnachten verstarb am 28.12.2022 Rudolf Kühnl, geb. 17.08.1929, der in Karlsbad am Schillerplatz/Theatergasse zuhause war und zuletzt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn lebte. Ein trauriger Ausklang des Jahres für seine Angehörigen, denen wir unsere herzliche Anteilnahme aussprechen wollen.
Am 29. Dezember lief auf dem Fernsehsender Arte eine interessante Reportage mit dem Titel „Eine Kur für Karlsbad: Wenn der Rubel nicht mehr rollt“. Ich bin viele Jahre mit gemischten Gefühlen durch die Stadt gelaufen: Einerseits haben die Gäste aus Rußland sicherlich sehr dazu beigetragen, daß Gebäude erhalten und saniert wurden, daß der Kurbetrieb florierte, sie haben viel Geld in Restaurants und Geschäften (Schmuck, Moser-Glas) ausgegeben. Andererseits habe ich ihr oft protziges und ungehobeltes Auftreten, ihre Dominanz als unangenehm empfunden.

Wie der gesamte Tourismus hat Karlsbad unter der CovidPandemie gelitten, und nun, wo das einigermaßen überstanden ist, bleiben wegen des Krieges gegen die Ukraine die Gäste aus Rußland weg – und sie verkaufen daher ihre Immobilien, die sie zahlreich besitzen (angeblich sind beziehungsweise waren etwa 20 Prozent der Immobilien in der Altstadt in russischer Hand).

All das ist für einen Kurort wie Karlsbad natürlich sehr bedrohlich, viele Dienstleister, Hotels oder Geschäfte haben die Zeit nicht oder nur mit Mühe überstanden, müssen nun wegen der ausbleibenden solventen Klientel aus Rußland immer noch bangen. Doch langsam geht es wieder aufwärts. Man orientiert sich um, zieht Besucher aus Ländern an, die früher nicht gekommen sind, wozu sicherlich auch der junge Status als Unesco-Welterbe beiträgt. Die russische Dominanz weicht einer internationalen Vielfalt – war es nicht vor langer Zeit auch schon so?
Bei meinen kurzen Aufenthalten im letzten Sommer habe ich die neue Atmosphäre bereits gespürt. Fahren Sie doch auch wieder einmal an die Tepl und machen sich selbst ein Bild.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erlebnisreiches, gesundes Neues Jahr 2023.
Ihre Pia Eschbaumer
Im Stadtkreis: Drahowitz
Gemeindebetreuer Erwin Zwerschina, Am Lohgraben 21, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Telefon (0 96 61) 31 52, Fax (0 96 61) 8 13 78 37




Über 70 Jahre festigte unser „Badeblatt“, die „Karlsbader Zeitung“, in gewohnter DIN A4-Größe auf glattem Papier, bequem archivierbar, allmonat-
Nachrichten aus den Gemeinden
Allen Lesern und ihren Angehörigen wünschen wir ein gesundes, glückliches und friedvolles Jahr 2023! Mögen Ihre Wünsche in diesem Jahr in Erfüllung gehen, und vor allem: Bleiben Sie gesund!
Aufmerksame Leser unserer Karlsbader Zeitung „im alten Gewand“ haben längst bemerkt, daß viele Gemeinden verwaist sind, also keine
Ortsbetreuer mehr haben, und die Geburtstage von mir jeweils aus dem Vorjahr übernommen wurden. Außerdem können etliche Gemeindebetreuer – wie auch ich – nicht auf eine Kartei zurückgreifen, die über die Jahre stets auf dem Laufenden gehalten wurde; auch hier wurden die Geburtstage von Jahr zu Jahr fortgeschrieben, ohne Kenntnis, ob dies noch den Tatsachen entsprach.
Wir haben uns deshalb entschieden, die Nennung der Geburtstage zu entschlacken und als Basis erst einmal nur die Abonnenten (Stand 2021), Gemeindebetreuer und Mitglieder des Heimatverbandes aufzulisten. Jedem Ortsbetreuer steht es aber frei, weitere Personen hinzuzufügen.
Außerdem werden künftig alle Berichte, die ausschließlich Geburtstage nennen, zusammen-
gefaßt, dies heißt am Ende der Gemeindeberichte gibt es einen Abschnitt „Geburtstagsgrüße in weitere Gemeinden“, wo alle betroffenen Orte alphabetisch aufgelistet werden.
Wir werden sehen, ob sich das Konzept bewährt, wenn nicht – man kann auch wieder etwas ändern. Bitte haben Sie Geduld, bis alles sich eingespielt hat. Pia Eschbaumer
Projekt auf und gründeten die „Wasserbaugesellschaft Karlsbader Land“. Es zeigten mehrere Gemeinden Interesse, nur Karlsbad, das Wasser am nötigsten hatte, verzichtete und blieb bei dem chlorversetzten Egerwasser. Aus finanziellen Gründen blieben nur noch Altrohlau und Tüppelsgrün übrig.
lich unsere Bindung an die angestammte Heimat. Mit dem 31. Dezember 2022 ist das nunmehr Geschichte. Angekündigt wurde das Geschehen in dem fast historisch anmutenden Rundbrief unserer Kreisbetreuerin Dr. Pia Eschbaumer.
Nun sind wir, mit unseren Sudetendeutschen Heimatfreunden aller Bezirke, unter dem Dach der Sudetendeutschen Zeitung, bei sogar billiger gewordenem Bezug, wie ich meine gut aufgehoben. Der Aufforderung zur Beibehaltung des Abonnements sollten wir alle spontan Folge leisten.
Im Jänner gratulieren wir herzlich zum 94. Geburtstag am 6. Emma Feigl in 93057 Regensburg, Dolomitenstraße 5a – 92. am 30. Helga Stark/Däubner, 74906 Bad Rappenau, Salinenstraße 7 – 90. am 16. Hofmann /Müller Gertrud, 35325 Mücke, Ober Ohmer Straße 4 – 80. am 29. Graßl Rainer, 93173 Gonnersdorf, Angerstraße 6. Sterbefall: Am 30. Oktober 2022 verstarb Marianne Meiser / Knoll, geboren am 11. März 1930 in Drahowitz, Yorkplatz 10, zuletzt 64686 Lautertal, Neunkirchner Straße 37. Sie war Abonnentin der Karlsbader Zeitung von Anfang an, besuchte die Drahowitzer Treffen, bis ihre schwere Erkrankung es nicht mehr zuließ. Unsere Anteilnahme ergeht an alle Angehörigen, besonders Tochter Gabi und Sohn Peter, denn ihren Gatten hat sie schon vor acht Jahren verloren.
Zum Sudetendeutschen Tag in Regensburg sehen wir uns an Pfingsten hoffentlich wieder zahlreich, desgleichen zum Drahowitzer Treffen am 10. September in Roßtal, das hofft Euer Erwin Zwerschina
Fischern
Gemeindebetreuerin Helga Müller, Zimmerloh 17, 08258 Markneukirchen, Telefon (03 74 22) 76 36 50.
Herzlichen Glückwünsche allen Fischernern, die im Jänner Geburtstag feiern, besonders zum: 93. am 6. Degen Getraud, 64291 Darmstadt; 78. am 30. Meier/Groß Kristine, 87435 Kempten. Alles Gute zum Geburtstag, Glück und Gesundheit für 2023. Eure Helga Müller
Kohlhau
Gemeindebetreuer Albin Häring, Clemens-Brentano-Straße. 22, 35043 Marburg/L.Cappel, Telefon/Fax (0 64 21) 4 53 02.
Liebe Kohlhauer Landsleute, ich hoffe, Sie haben das neue Jahr in Ruhe, Zufriedenheit und vor allem bei zufriedenstellender Gesundheit beginnen können. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben wir – nur wenige sind wir noch, die eigene Erinnerungen an die alte Heimat haben können – auch im neuen Jahr in Gedanken und vielleicht auch durch telefonische und schriftliche Kontakte verbunden!
Im Monat Januar gratuliere ich zwei Landsleuten herzlich zum Geburtstag, nämlich: zum 88. am 17. Josef Hess in Kohlhau (Kolova 90); zum 83. am 29. Herbert Schmidt, 93346 Ihrlerstein.
Auch möchte ich in diesem Monat wieder an das „Donawitzer Fest“ am 6. Januar (Hl. Drei König) erinnern. Einige von uns haben es ja noch in der alten Heimat erlebt. Es war der krönende Abschluß der Weihnachtszeit und wurde sowohl in der Kirche als auch in den Familien festlich begangen.
Und die Kohlhauer gehörten ja zum Kirchsprengel Donawitz und waren deshalb immer dabei, besonders dann, wenn verwandtschaftliche Beziehungen bestanden. In der Erinnerung daran gibt es auch in meiner Famile an diesem Tag immer wieder „Striezela“ (=Kräppel).
Albin Häring
Meierhöfen
Gemeindebetreuerin Helga Müller, Zimmerloh 17, 08258 Markneukirchen, Tel. (03 74 22) 76 36 50.

Herzliche Glückwünsche an alle im Januar Geborenen, besonders zum: 96. am 5. Daniel/ Pfeiffer Erna, 35576 Wetzlar; 86. am 13. Geyer/Oehl Alice, 65199 Wiesbaden; 84. am 14. Zettl Christa, 61184 Karben; 74. am 6.1, Kasákova/Padua Irene, CZ 36010 Karlovy Vary-Sedlec.
Wünsche schönen Geburtstag und alles Gute für das Jahr 2023.
Es grüßt Helga Müller
Im Landkreis: Altrohlau

Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Tel. (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf.Preis@ t-online.de



„A glücksölichs neis Gaua!“ Mögen Gesundheit, Glück und Erfolg unsere immerwährenden Begleiter sein. Mit diesen Wünschen verbinde ich meinen herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Alles Gute zum Geburtstag wünschen wir zum 95. am 13. Bartsch/Zinner Marianne, 84. am 2. Preis Rudi, 81. am 13. Foglar Antonin.
Nachfrage: Als ich versuchte, telefonischen Kontakt zu Herta Bechtold/Hess und Elvire Fritsch/Haag aufzunehmen, wurde mir stets mitgeteilt,
daß es diese gewählten Rufnummern nicht mehr gibt. Bei mehreren Anrufen bei Leni Fiedl/Eckhardt sowie bei Elisabeth Zettl/ Fischer ertönte zwar das Freizeichen, aber es nahm niemand ab. Über diesbezügliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
In der November-Ausgabe schrieb ich von der Wasserknappheit in Altrohlau um das Jahr 1892 und vom gescheiterten Versuch, das Wasser der Zwietra Quelle per Windmotor in das Bassin an der Neudeker Straße einzuspeisen. Deshalb ließ die Gemeinde 1892 in der „Klinge“, am westlichen Abhang des Hutberges gelegen, zwei Quellen fassen. Das Wasser wurde ebenfalls dem Behälter in der Neudeker Straße zugeführt, es reichte aber nicht aus. Der Plan, das Wasser aus dem Erzgebirge zu entnehmen, erwies sich als zu kostspielig. Somit wurde auf die Rohlau, die genügend Wasser führte, zurückgegriffen. So verunreinigt wie später war sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dazu wurden am Köttighäusl (Meran-Winkel Nummer 476) Drainagen verlegt und ein Pumpkraftwerk errichtet. Diese Maßnahmen hatten sich bewährt, aber die Abwässer aus der Industrie in Neudek und Neurohlau ließen schon bald das Wasser braun aus den Hähnen fließen. Es erschien wie ein Wunder, daß es dadurch in Altrohlau keine Epidemien gab.
Es blieb nur noch, den früheren Plan umzusetzen, das Wasser aus dem Erzgebirge zu nutzen. Der damalige Bürgermeister August Pecher und sein Stellvertreter Karl Panenka griffen das
Ohne Verzug wurde die Rohlauquelle bei Frühbuß besichtigt und festgestellt, daß die Wasserschüttung ausreichend war. Aber die Länge von 25 Kilometern war enorm, so daß man in Hohenstollen, Neuvoigtsgrün und Kammersgrün suchte und einige passende Quellen fand. Insgesamt wurden, bei einer Länge der Wasserleitung von 16 Kilometern, 17 Quellen für Altrohlau und drei Quellen für Tüppelsgrün ausgenutzt. Die Baugenehmigung erhielt die „Nordböhmische Wasserbau AG“, die Kosten wurden mit 4 622 823 Kc veranschlagt, wovon 50 Prozent der Staat beisteuerte. Das erste Sammelbekken wurde am Zusammenstoß der Täler von Neuvoigtsgrün und Kammersgrün errichtet. Auch Tüppelsgrün wurde von diesem Bassin aus mit Wasser versorgt. Das Altrohlauer Wasser nahm seinen Weg über Sittmesgrün zum neuen Bassin, das am Westhang des Hutberges in runder Form mit vier Kammern erbaut wurde. Bei der probeweisen Durchspülung des Ortsnetzes platzten wegen des hohen Drukkes viele Rohre, so daß das gesamte Ortsnetz gründlich überholt werden mußte. Als das Wasser endlich allen zugänglich war, stellte sich heraus, daß bei normalem Wasserverbrauch nicht die veranschlagten 6,8 Liter pro Sekunde, sondern nur 4,6 Liter benötigt wurden. Der sich ergebende Wasserüberschuß konnte somit an Fischern und Meierhöfen verkauft werden.
Diese neue Wasserversorgung wurde von Bürgermeister August Pecher geplant und bis zu seinem Tod 1927 betreut. Die Vollendung des Baues erfolgte mit tatkräftiger Unterstützung des nachfolgenden Bürgermeisters Josef Möser im Jahre 1931. Seitdem hatte Altrohlau immer ein einwandfreies und gesundes Gebirgsquellwasser.


In der nächsten Folge erscheint die Aufzeichnung vom städtischen Wassermeister Franz Kolb über den Bau der neuen Wasserleitung.
Eine schöne Winterzeit wünscht allen Leserinnen und Lesern Rudi Preis
Grasengrün
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf.Kreisl@ gmx.de
Allen Geburtstagskindern im Januar, auch den hier nicht genannten, viele gute Wünsche, vor allem recht gute Gesundheit im neuen Lebensjahr. Ich hoffe und wünsche mir, daß alle gesund und glücklich im neuen Jahr 2023 angekommen sind. 90 am 28. Gretel Diefenbach, 65232 Taunusstein-Bleidenstadt; 86 am 23. Herbert Schmidt, 89537 Giengen a.d. Brenz; 83 am 03. Liselotte Rau, 85221 Dachau. Januar ist’s, wir müssen uns beim Schreiben der Jahreszahl 2023 an den neuen Dreier gewöhnen. Lassen Sie uns gemeinsam in dieses neue Jahr gehen, halten wir weiterhin guten Kontakt untereinander, telefonisch und schriftlich, schildern Sie mir Ihre Geschichten, Ihre Erlebnisse, die Sie noch haben von der alten Heimat, sofern Sie sich noch erinnern können. Ich freue mich schon auf den Kontakt mit Ihnen und bin gespannt was ich neues erfahren werde.
Fortsetzung nächste SeiteBarbara Bayer machte die Karlsbader Oblaten berühmt

Bayer Barbara, geborene Nasler, Karlsbader Oblatenbäckerei, geboren in Lubenz bei Luditz, geboren am 25. Mai 1827, verstorben in Karlsbad am 18. Nov. 1887.
Barbara Nasler kam als junge
Frau nach Karlsbad, wurde Beschließerin und heiratete 1854 den einzigen Karlsbader Polizisten, Michael Bayer. Sie guckte das Oblatenbacken ab, versuchte es auch, verbesserte den Teig und verfeinerte die Füllung, backte die Oblaten schön gleichmäßig und gründete schließlich 1867 die erste gewerbliche Oblatenbäckerei.
In den Backplatten war eingraviert: „Karlsbader Oblaten – Barbara Bayer“, eine Spezialität. Die vornehmen Kurgäste und der Adel waren die Hauptkunden. 1867 lernte auch Kaiser Wilhelm die Karlsbader Oblaten schätzen. 1884 erhielt Frau Bayer den Titel eines königlich-preußischen Hoflieferanten. Der Betrieb mußte vergrößert werden, und der Versand erfolgte in viele Länder. Nach dem Tode von Barbara Bayer übernahm ihr ältester Sohn Karl Bayer die Oblatenbäkkerei und führte die Erzeu-gung nach altbewährtem Geheimre-
zept weiter. Der Versand erfolgte nun auch an den spanischen, russischen, holländischen, serbischen, rumänischen, bayerischen und österreichischen Hof. Karl Bayer erhielt am 17. August 1899 den Titel „k.k. Hoflieferant“, was damals ein ungeheures Aufsehen hervorrief.

Auf Messen und Ausstellungen wurde diese Karlsbader Spezialität weitesten Krei-sen be-
kannt. Viele Medaillen und Ehrendiplome wurden verliehen. Die Erweiterung des Betriebes führte zu einer Oblatenfabrik 1912. Bayer Oblaten kamen zu Weltruhm. Karl Bayer d. Ä. übergab seinem Sohn Karl Bayer d.J. die Oblatenbäckerei. Kurz nach seinem Tod 1934 übernahm dessen Sohn Herbert Bayer in der dritten Generation nach Barbara Bayer den Betrieb.
Im Karlsbader Friedhof erinnert eine größere Grabsteinanlage an die im Grab ruhenden Mitglieder der Familie: Michael Bayer (1812–1899), Barbara Bayer (1826–1887, Begründer der Karlsbader Oblaten-Industrie), Karl Bayer (1856–1932, Schöpfer des Weltrufes der Karlsbader Oblaten), Emanuela Bayer (1856-1927).

Am 19. April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde die Bäckerei der Familie Bayer bei einem US-amerikanischen Luftangriff auf Karlsbad von Brandbomben getroffen und schwer beschädigt. Doch das eigentliche Unglück stand noch aus.
Im Jahr 1946 erlitt auch die Familie Bayer das Schicksal der Sudetendeutschen. Die Eigentümer der Großbäckerei „Karlsbader Oblaten“ wurden auf Grund der Beneš-Dekrete enteignet und vertrieben.

Die Familie gelangte nach Geretsried in Oberbayern.
Hier baute das Ehepaar Herbert und Wilma Bayer 1948 sein Unternehmen wieder auf und begann in einem alten Bunker an der Sudetenstraße mit der Produktion der „Karlsbader Oblaten“ nach ihrem Originalrezept. Eine angrenzende Hütte diente als Wohnhaus und Lebensmittelladen.




Bis zu 75 Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen in seiner besten Zeit. „Aus gesundheitlichen Gründen mußten meine Eltern die Firma dann 1963 aufgeben“, erinnert sich Tochter Christa Bayer. Die Familie zog daraufhin nach Donaueschingen um.

Der Nikolaus im Egerland
Geburtstag.
Einer der großen Violinisten
Vor hundert Jahren, am 5. Januar 1923, starb in Berlin der aus Luditz stammende Emanuel Wirth, „der beste Violin-Lehrer seiner Generation“, wie der große Violinist August Wilhelmj einst feststellte.

Am 18. Oktober 1842 wurde Wirth in Luditz geboren. Nach seiner Schulzeit zog er nach Berlin und war dort als Assistent von Joseph Joachim an der Hochschule für Musik als Lehrer für Violine und Bratsche tätig. Zu seinen Schülern zählen unter anderen Gabriele Wietrowetz, Albert Stoessel und Edmund Severn.
Daneben spielte Emanuel Wirth fast 30 Jahre lang, von 1877 bis 1906, Viola im seinerzeit sehr
Bei uns zu Hause war es immer so: Jedes Jahr, wenn der Nikolaustag nahte, warteten wir Buben schon wochenlang vorher darauf, daß der seltsame Mann, den man nur in der Adventszeit zu sehen bekam, mit viel Klirren und Poltern in die Stube trat. Und man konnte sich wahrhaftig kaum satt an ihm sehen. Da hing ihm der rote Mantel breit und faltenreich um die Schultern und fiel bauschig bis auf die Stiefel hinab, die man nur bei den weitausholenden Schritten hervorblitzen sah. Ja wirklich, sie blinkten! Denn es lag noch der festgefrorene Schnee darauf, durch den der himmlische Bote auf seinem weitem Weg gegangen war. Und dieser Schnee hing ihm auch in dem langen Bart, der bis zu dem goldenen Gürtel hinunterreichte. Oder war dieser Bart schon so weiß, weil Sankt Nikolaus älter war als die ältesten Männer, die wir kannten? Diese hatten uns ja erzählt, daß der bärtige Gesell auch schon zu ihnen gekommen war, als sie noch ganz kleine Buben gewesen waren. Wer konnte das wissen?
Krasch
Ortsbetreuerin Christel Suß, eMail chrsubadhom@yahoo.de
20. Januar 1938: Maria Roßbach, geb.Heidl, 96523 Steinbach, Weber.
29. Januar 1943: Gerlinde Löser, geb. Führling, Bad Langensalza, Nogla.
30. Januar 1945: Anneliese Heidl, geb. Heidl, Frankfurt/ Main, Weber.

7. Februar 1928: Julia Rauner, geb. Kraus, Bad Nauheim, Schmagl, Frau vom Pepp.
13. Februar 19031: Brigitte Lang, Bad Langensalza,Giergn, Frau vom Pepp.

15. Februar 1936: Traudl Wetzel, Waha, Thiersheim, unterern Hamla
27. Februar 1941: Dr.Walter Führling, Halle-Neustadt, oberer Nogla.
27. Februar 1949: Bruno Führling, Bad Langensalza, oberer Nogla.
27. Februar 1940 Helga Stieding Lang Tonnaerstr.11, 99947 Bad Langensalza Giergen.
Nachruf: Gertrud Büchner geb. Plitz (Battl Tischl) ist am 19. Oktober 2022 im Alter von 87 Jahren verstorben.
und
29. Januar: Helga Knitt, geb. Stark, Solms-Lahn, 84. Geburtstag.
Maria Stock
21. Januar: Erika Brunner (Forsthaus), Schmitten-Brombach, 93. Geburtstag.
21. Januar: Ernst Grimm (Koal Luis), München, 86. Geburtstag.
23. Januar: Fritz Nürnberger (Konsum), Solnhofen, 89. Geburtstag.
27. Januar: Gerhard Nürnberger (Hein Koal), Solnhofen, 79. Geburtstag.
Ortsbetreuer Walter Schopf, eMail iwschopf@t-online.de
3. Januar: Horst Schopf, Schöfweg, 79. Geburtstag.
14. Januar: Maria Rösler, geb. Schopf, Erlangen, 93. Geburtstag.
30. Januar: Franz Stark, Regen, 96. Geburtstag.
Lindles
Langgrün
Ortsbetreuer Klaus Dunzendorfer, eMail k.dunzendorfer @t-online.de
6. Januar: Werner Sacher (Obere Mühle), Straubing, 88. Geburtstag.
7. Januar: Anna Merkl (Houkn), Schwabach, 79. Geburtstag. 79
19. Januar: Erna Weber, geb. Bröckl (Mundl-Wenzl), Traisching-Wilting, 84. Geburtstag.
Bei uns zu Hause war es immer so: Jedes Jahr, wenn der Nikolaustag nahte, warteten wir Buben schon wochenlang vorher darauf, daß der seltsame Mann, den man nur in der Adventszeit zu sehen bekam, mit viel Klirren und Poltern in die Stube trat. Und man konnte sich wahrhaftig kaum satt an ihm sehen. Da hing ihm der rote Mantel breit und faltenreich um die Schultern und fiel bauschig bis auf die Stiefel hinab, die man nur bei den weitausholenden Schritten hervorblitzen sah. Ja wirklich, sie blinkten! Denn es lag noch der festgefrorene Schnee darauf, durch den der himmlische Bote auf seinem weitem Weg gegangen war. Und dieser Schnee hing ihm auch in dem langen Bart, der bis zu dem goldenen Gürtel hinunterreichte. Oder war dieser Bart schon so weiß, weil Sankt Nikolaus älter war als die ältesten Männer, die wir kannten? Diese hatten uns ja erzählt, daß der bärtige Gesell auch schon zu ihnen gekommen war, als sie noch ganz kleine Buben gewesen waren. Wer konnte das wissen? Sah man doch nicht, ob auch sein Rücken schon schwach und gekrümmt war, wie ihn das Alter formt, denn über diesem hing der mächtige Sack, in dessen Tiefe unsere Blicke so gerne gedrungen wären und dessen Inhalt man doch niemals ganz zu sehen bekam. Nur oben, wo der Sack zugebunden war und wo sich der dicke Strick, der ihn so streng verschloß, gelockert hatte, dort guckten ein paar von
31. Januar: Horst Brunner (Hainara), Treuchtlingen, 83. Geburtstag.
Groß Werscheditz
Ortsbetreuer Walter Schopf, eMail iwschopf@t-online.de
18. Januar: Werner Schopf, Grävenwiesbach, 83. Geburtstag.
22. Januar: Reinhold Leistner, Groß Heirath-Rossach, 80. Geburtstag.
29. Januar: Erich Tausch (Dollanka), Tann-Rüte (Schweiz), 88.
Ortsbetreuer Walter Schopf, eMail iwschopf@t-online.de

6. Januar: Anton Hans Rabas, Niederau, 92. Geburtstag. Hinweis an die Ortsbetreuer
Bitte schicken Sie die Liste als normales Textformat (keine eingescannten Kopien, keine ExcelDateien, keine handschriftlichen Listen) rechtzeitig per eMail an egerland@sudeten.de
Im Egerland schreibt BMW Auto-Geschichte
6000 Fußballfelder für BMW und die Zukunft des Autofahrens: Noch im Juni werden die Münchner Autobauer ihr 600 Hektar großes Testzentrum mit sechs Teststrecken bei Falkenau im Egerland in Betrieb nehmen.


Man habe sich, so erklärt der zuständige Projektleiter von BMW, Andreas Heb (siehe Interview rechts), aus mehreren Gründen für den Standort bei Falkenau im Egerland entschieden. Neben der Nähe zur Unternehmenszentrale in München hatten auch Umweltschutzgründe eine wichtige Rolle gespielt. So wurde das gigantische Testzentrum in einem ehemaligen Braunkohletagebau gebaut. Allein die sogenannte New Technology Area ist 90 000 Quadratmeter groß. Hier lassen sich über drei Anlaufspuren Assistenzsysteme und das Verhalten bei Querverkehr sowie Notbrems- und Ausweichsituationen optimal testen.
In direkter Nachbarschaft zu diesem gigantischen AsphaltQuadrat befindetsich der sechs Kilometer lange sogenannte Autonomous Driving Highway, ein autobahnähnlicher Rundkurs mit Auf- und Abfahrtsszenarien, für die Erprobung von autonomen Fahrzeugen auf Autobahnen.


Die Test-Autobahn wurde mit zwei Funktionsspuren und einer Nothaltespur sowie Schilderbrücken und einer mehr als 1000 Meter langen Geraden realitätsnah ausgestattet.
Christian Schneider, Projektleiter BMW i7, verbindet mit dem Testzentrum im Egerland bereits hohe Erwartungen –den Sprung von Level 2plus auf 3 beim autonomen Fahren.
Derzeit ist das Flaggschiff von BMW nur für Level 2plus zugelassen. Bedeutet: Die Limousine fährt zum Beispiel auf der Autobahn weitgehend autonom, der Fahrer ist aber dennoch verpflihtet, den Verkehr permanent zu überwachen und in Gefahrensituationen sofort einzugreifen. Anders bei Level 3, wo
der Wagen selbstständig und ohne menschlichen Eingriff auf definieren Strecken, wie Autobahnen, unterwegs ist. Dann darf der Fahrer sogar Zeitung lesen oder sich den Kindern auf den Rücksitzen zuwenden – bis das System ein Problem meldet.
„Das ist noch mal ein deutlicher Sprung“, stapelt Schneider die hochkomplexe Herausforderung an die Autobauer tief. Was der BMW-Manager nicht sagt: Im Gegensatz zu Konkurrent Tesla will BMW erst dann das autonome Fahren propagieren, wenn es nachhaltig getestet wurde und alle denkbaren Probleme gemeistert hat. Tesla sorgt dagegen immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. So sind allein in den USA bei 90 Prozent aller tödlichen Unfälle in Folge von autonomen Fahrens Autos von Tesla involviert.
„Wir werden sicherstellen, daß das System nach den höchsten Sicherheitsstandards konzipiert und entwickelt wird und daß es die allgemeine Sicherheit auf der Straße erhöht. Auf diese Weise können Kunden die Zeit und Freiheit, die sie auf ihrem täglichen Arbeitsweg gewinnen, voll ausschöpfen“, erklärt Schneider die Strategie der Münchner Autobauer.
Neben dem Egerland ist auch in der benachbarten Oberpfalz die Freude über die BMW-Investition von 300 Millionen Euro groß. So berichtet Bernd Sommer, Bürgermeister von Waldsassen, daß in seiner Gemeinde derzeit Hunderte von Wohnungen gebaut sowie Parzellen für Ein- und Mehrfamilienhäuser ausgewiesen werden – eine historische Wende. Seit über drei Jahrzehnten hatte es in Waldsassen keine Neubauten mehr gegeben, erklärt das Stadtoberhaupt: „Das hätten wir mit keinem Marketingkonzept und keiner Rückkehrkampagne erreichen können, was diese Betriebsansiedlung eines renommierten Unternehmens ausgelöst hat.“ Torsten Fricke
„Hier in Falkenau haben wir ideale Bedingungen“
Andreas Heb, Projektmanager für das Future Mobility Development Center, FMDC, erklärt, warum BMW diese Teststrecke braucht und warum man sich als Standort für Falkenau im Egerland entschieden hat.
H
err Heb, wann hat BMW das Projekt FMDC gestartet?
Andreas Heb: Mitte 2014 wurde eine neue Testgelände-Strategie in Betracht gezogen.
Wie viele mögliche Standorte wurden unter die Lupe genommen, und warum hat sich BMW für Falkenau entschieden?
Heb: Wir haben mehr als 80 mögliche Standorte in Deutschland und im benachbarten Ausland in Betracht gezogen. Hier in Falkenau haben wir ideale Bedingungen für unser zukünftiges Mobilitätsentwicklungszentrum gefunden. Zum einen ist Falkenau nur zweieinhalb Stunden von unserer Entwicklungszentrale in München entfernt,
und zum anderen haben wir hier ein ehemaliges Bergbaugebiet, also eine Brachflähe, so daß wir als nachhaltige Premiummarke keine wertvollen Grünflähen versiegeln.
Was genau wird im FMDC getestet und entwickelt?

Heb: Das neue Entwicklungszentrum, das in Falkenau gebaut wird, ist für uns sehr wichtig, um unsere Testkapazitäten für die nächsten Schritte in Richtung Digitalisierung, Elektromobilität und natürlich hochautomatisiertes Fahren zu erweitern.

Wie viele Autos werden dort maximal fahren?
Heb: Wir rechnen damit, daß ab Juni 2023 täglich bis zu hundert Testautos fahren werden.
