Kameraden
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung
HEIMATBOTE




VOLKSBOTE


Stichwahl um das Präsidentenamt:
gegen
für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge
helfen. -






� Ministerin Ulrike Scharf


mich ein gepflegter Herr in Zivil ansprach und sich nach meinem Beruf erkundigte. Wahrheitsgemäß antwortete ich „noch gar nichts“. Er hatte bald herausgefunden, daß ich Absolvent einer höheren Schule sein müßte und bot mir an, hier zu bleiben. Ich fragte ihn,kurs. Wenn ich nur angenommen hätte! Bestimmt wäre ich ein Lehrer und ein guter Kommunist geworden, wie die größeren Nazis, als ich einer war, in Bonn zu guten DeIn diesem Lager kamen wir mit Heimkehrern aus westlichen Gefangenencamps zusammen. Als manch einer von ihnen erzählte, sie hätten ebenfalls hungern müssen, wollte ich dies nicht glauben. Ich hielt es für schmutzige Propaganda, die Amis hätten vor hun-Tabak kaufen müssen, denn nur so hätten sie auch Zigaretten bekommen, den Tobak warf man weg. Die Quarantäne dauerte 40 Tage und ging für mich wieder Erwarten sehr schnell vorbei. Eines Tages kam ein russischer Offizier Stiefelspitze an und forschte „schto bolnoj“ (was hast du für eine Krankheit)? Sofort fielen mir die Worte meines Doktors ein, dessen glücklicher Putzer ich war, und ich antwortete mit Eifer „Tubera“! Waldeck. Wie man vermuten kann, lag die Klinik in einer Ecke des Waldes. Schwester Ursel, den Name werde ich nie vergessen, war meine -
Kriegsopfer Wer in die Prager Burg einzieht, entscheidet sich bei der Stichwahl zwischen General Petr Pavel (links) und Ex-Premierminister Andrej Babiš (rechts). Fotos: Mediaservice Novotny (7), Facebook (2)
In den nächsten zwei Jahren werden in Bayern insgesamt drei Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) in Qualifizierungsprojekte für Menschen mit Fluchtund Migrationshintergrund investiert. Damit soll die Entwicklung innovativer Lösungen zur Integration dieser Zielgruppe in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt gefördert werden.
Staatsministerin Scharf: „Eine gute berufliche Qualifikation ist und bleibt die beste Voraussetzung für eine langfristige Integration in den Arbeitsmarkt. Mit dem Aufruf ,Berufliche Qualifizierung zur Integration in den Arbeitsmarkt – Chancen für die Zukunft‘ wird dies gezielt in den Mittelpunkt gerückt.“
Ein Fokus im Rahmen der Förderung liegt speziell auf Frauen und Jugendlichen mit Fluchtund Migrationshintergrund.

„Die Mehrzahl der derzeit ankommenden Flüchtenden aus der Ukraine sind Frauen und Kinder. Deshalb ist es mir sehr wichtig, daß die Projekte besonders Frauen, aber auch Jugendlichen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln. So erleichtern wir den Einstieg in den Arbeitsmarkt und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs“, erläutert die Ministerin weiter.
Innovative Projekte, die ausgewählt werden, können mit 80 Prozent der Gesamtkosten aus dem ESF+ gefördert werden.
Die Bewerbungsfrist endet am 15. März. Mehr Informationen www.esf.bayern.de
Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,41 Prozentpunkten hat der unabhängige Kandidat General Petr Pavel den ersten Durchgang der tschechischen Präsidentschaftswahl vor Ex-Premierminister und AnoChef Andrej Babiš gewonnen. Die Entscheidung, wer Nachfolger von Staatsoberhaupt Miloš Zeman wird, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten darf, fällt in der Stichwahl, die am 27. und 28. Januar stattfindet.
Während die Demoskopen noch einen Dreikampf zwischen Pavel, Babiš und der Wirtschaftsprofessorin Danuše Nerudová um den Einzug in die Stichwahl vorhergesagt hatten, war die Entscheidung am Ende deutlich. General Petr Pavel erhielt mit 1 975 056 Stimmen 35,40 Pro-


zent und gewann damit den ersten Wahlgang. Mit nur 22 843 Stimmen Abstand kam Andrej Babiš mit 1 952 213 Stimmen beziehungsweise 34,99 Prozent auf Platz zwei. Mit nur 777 022 Stimmen beziehungsweise 13,93 Porzent landete Nerudová abgeschlagen auf dem dritten Platz. Die weiteren Ergebnisse: 4. Pavel Fischer, 6,75 Prozent; 5. Jaroslav Bašta 4,45 Prozent; 6. Marek Hilšer, 2,56 Prozent; 7. Karel Diviš, 1,35 Prozent und 8. Tomáš Zima, 0,55 Prozent.
Viele Experten hatten in der Vergangenheit betont, Babiš habe in einer Stichwahl keine Chance, da die im ersten Wahlgang unterlegenen Kandidaten ihre Wähler dazu aufrufen würden, dessen demokratischen Gegenkandidaten in der Stichwahl zu unterstützen – also General Petr Pavel. Ob diese Rechnung
So stimmte Bayern ab
Unter der kommunistischen Herrschaft flüchteten damals im Kalten Krieg viele tschechische Bürgerrechtler in den Westen und ließen sich bevorzugt in München nieder.
Die Wahlen im Tschechischen Generalkonsulat der bayerischen Landeshauptstadt haben deshalb von jeher eine besondere Bedeutung.
aufgeht, wird sich zeigen. Skepsis ist aber angebracht.
In die Karten von Babiš spielt auch, daß ihn vier Tage vor dem ersten Wahlgang das Prager Stadtgericht vom Vorwurf der Korruption in Sachen Storchennest freigesprochen hat. Außerdem gilt der ehemalige Premierminister – ganz Populist – als exzellenter Wahlkämpfer.

Babiš ließ deshalb keine Zeit verstreichen und ging nach Auszählung der Stimmen gleich in den direkten Angriff über.
Er ziehe den Hut vor Pavel, so giftete Babiš, weil dieser es „als in Rußland ausgebildeter kommunistischer Geheimdienstoffizier bis in den Nato-Militärausschuß geschafft“ habe. Schützenhilfe bekam Babiš umgehend vom scheidenden Präsidenten Zeman, der nicht nur erklärte, er werde Babiš wählen, sondern unterstellte, der unabhängige Pavel sei ein Kandidat der Regierung. General Pavel konterte mit der Bemerkung, bei der Stichwahl werde es zum Zusammenprall zweier Welten kommen. Die eine Welt, vertreten durch Babiš und Zeman, stehe für Chaos, Versagen und persönliche Bereicherung. „Dagegen steht meine Welt dafür, fair, anständig und würdevoll zu sein und zu versuchen, Lösungen anzubieten.“

Auch der tschechische Premierminister Petr Fiala ging in die Offensive und beschuldigte Babiš und dessen Partei Ano, gezielt Desinformationen zu verbreiten. So werde behauptet, daß die Regierung nach den Präsidentschaftswahlen restriktive Maßnahmen plane.
Fiala: „Die zweite Runde der Präsidentschaftswahl wird ein schwieriger Wertekampf. Populismus, Lügen und Anlehnung an Moskau stehen gegen unsere Werte von Demokratie, Respekt vor der Verfassung und prowestliche Orientierung. Ich rufe deshalb alle Bürger auf, Petr Pavel zu unterstützen.“
Pavel Novotny/Torsten Fricke
Petr Štefánek: „Die Präsidentschaft von Miloš Zeman war eine große Schande für unsere Nation. Ich habe mich für einen würdevollen Kandidaten entschieden. Ich wünsche mir einen Präsidenten, der als Vorbild auftritt und jene Werte vertritt, zu denen
auch ich mich bekenne.“
Ulehlová: „Das war keine sehr gute Präsidentschaft, und ich hoffe, daß jetzt eine Veränderung eintritt. Ich setze auf einen Präsidenten, der offen für Europa und tolerant ist. Ein Staatsoberhaupt soll das Land vereinen und nicht wie Zeman die Gesellschaft

Immer
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
gut informiert zu sein.“

Das ist die Devise von Peter Barton für seine Tätigkeit als Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag.
Wenn es um die deutsche Reichsstadt Eger geht, kann er sich immer auf die Hilfe zweier Egerer verlassen, die ihn bei seiner Arbeit kräftig unterstützen. Das ist zum einen Wilhelm Simeon (Kulturverband Eger/ Prag), der außerdem seit einem Jahr als Fachmann für PC-Arbeit im SL-Büro tätig ist. Simeon stammt aus einer alteingesessenen deutschen Egerer Familie. Seine Mutter, Václava Simeonová, verfaßt Beiträge für die regio-
nale Internetzeitung „Živé Chebsko“ (Lebendiges Egerland), die für all jene von Interesse ist, die selbst kleinste Informationen aus dieser Region erfahren möchten (www. zivechebsko.cz).
Der andere Egerer, Gerhard Hermann, ist Beirat des Landesvorstandes der Paneuropa-Gruppe. Die Verbundenheit Bartons mit den Heimatverbliebenen kam bereits nach der Gründung des Sudetendeutschen Büros zustande, als Barton die damalige Geschäftsführerin des Begegnungszentrums Balthasar Neumann, Christa Hrubá, besuchte und diese Zusammenarbeit setzt er nun mit den beiden stolzen Egerern Simeon und Hermann fort. Barton
Netzwerken zum neuen Jahr in Berlin, München und Prag
Beim Treffen in der Bayerischen Repräsentanz in Prag und den Neujahrsempfängen des Bayerischen Ministerpräsidenten in München und des Bundespräsidenten in Berlin haben Vertreter der Vertriebenen die Chance genutzt, um mit der Politik im Gespräch zu bleiben.



Es ist mir eine besondere Ehre, die deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler und ihre Verbände hier zu vertreten und damit auch unsere Anliegen noch sichtbarer zu machen und im Gespräch zu halten“, erklärte der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, und bedankte sich damit für die Einladung zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Schloß Bellevue.
Fabritius nutzte auf dem Empfang die Gelegenheit, Bundeskanzler Olaf Scholz zu danken, der mit vielen Mitgliedern der Bundesregierung ebenfalls anwesend war. Scholz hatte zu Jahresbeginn zugesagt, beim BdVJahresempfang am 28. März die Festansprache zu halten.

„Dies ist ein Zeichen der Verbundenheit mit den von uns vertretenen Menschen und Themen“, so der BdV-Präsident.
Mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil besprach Fabritius die Rentensituation der Aussiedler und Spätaussiedler. So sei die Ausgestaltung des beschlossenen Härtefallfonds für Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge und Härtefälle aus dem Ost-WestÜberleitungsprozeß „bedauerlicherweise unzureichend“.


Der BdV habe hierzu Verbesserungsvorschläge und setze sich überdies nach wie vor für Korrekturen des Fremdrentengesetzes ein. Hierzu wurde weiterer Austausch auf Staatssekretärsebene vereinbart. Als höchste Repräsentantin des Deutschen Bundestages war die Parlamentspräsidentin, Bärbel Bas, anwesend, die der BdV-Präsident herzlich zur Teilnahme an den Verbandsveranstaltungen einlud.
Besonders freute sich Fabritius über das Wiedersehen mit Vertretern des Minderheitenrates, wie etwa dem Vorsitzenden des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, oder
dem Vorsitzenden der Domowina des sorbischen Volkes, David Statnik.
Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder zum Neujahrsempfang eingeladen. Über 1800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport nahmen an dem festlichen Jahresauftakt in der Bayerischen Residenz teil, darunter auch Steffen Hörtler. Der Landesobmann Bayern und stellvertretende Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft traf dort Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Sie freue sich und sei stolz, daß der Sudetendeutsche Tag 2024 in ihrer Heimatstadt
stattfinde, berichtete Hörtler von dem Gespräch.
Auch in Prag stand gleich zum Jahresbeginn das Netzwerken auf dem Programm. Die Bayerische Repräsentanz lud zum Neujahrsempfang. Die für Europa und Internationales zuständige Staatsministerin Melanie Huml nutzte die Reise in die tschechische Hauptstadt auch für Arbeitsgespräche und traf sich unter anderem mit Tschechiens Wissenschaftsminister Martin Baxa. Themen waren unter anderem die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023 zum Thema Barock in Regensburg und Prag sowie die Präsidentschaftswahlen in Tschechien.
Ministerin Huml erklärte zur Bedeutung der Bayerischen Repräsentanz in Prag: „Vor acht Jahren haben wir im Palais Chotek unsere Vertretung eröffnet. Heute ist dieses Palais zu einem Haus der Freundschaft geworden: Treffpunkt, Plattform für gegenseitigen Austausch und Schaufenster Bayerns in Tschechien. Zu diesem großen Erfolg beigetragen haben auch die Menschen in Tschechien. Wer hier ist, merkt sofort: Dieses kleine Stück Bayern in Prag ist nicht nur willkommen, sondern gehört zu dieser kulturell so unglaublich reichen und einzigartigen Stadt. Dafür sind wir sehr dankbar.“
Präsidententreffen in Nordböhmen

Der scheidende tschechische Präsident Miloš Zeman wird am 24. Januar im nordböhmischen Nachod mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda zusammentreffen. Die Themen der Beratungen werden die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Weiterentwicklung des Tourismus sowie die Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Staaten sein. Die Begegnung findet auf Einladung des Bürgermeisters von Nachod, Jan Birke, statt. Zuletzt haben sich die beiden Staatsoberhäupter Ende April vergangenen Jahres auf der Prager Burg getroffen. Damals ließ Zeman verlauten, Polen sei in der Abwehr der Aggression Rußlands in der Ukraine zum wichtigsten Verteidiger der europäischen Werte geworden.
Cyberkriminalität hat sich verdoppelt
leitet. Mit dem Gesetz setzt auch Tschechien eine entsprechende EU-Verordnung um.
RegioJet kommt nach Deutschland
Die tschechische private Bahngesellschaft RegioJet hat die Zulassung für den Schienenpersonenverkehr in Deutschland erhalten. RegioJet-Geschäftsführer Jakub Svoboda erklärte, sein Unternehmen plane, Verbindungen von Tschechien nach Deutschland sowie in andere westeuropäische Länder anzubieten. RegioJet hatte bereits in der Vergangenheit versucht, Verbindungen nach Deutschland einzurichten. Eine entsprechende Kooperation mit der Deutschen Bahn, um EuroCity-Züge zwischen Prag und Berlin zu betreiben, war allerdings gescheitert. RegioJet ist bereits in der Slowakei, Österreich, Ungarn und Polen tätig.
D
ie Kriminalität ist in Tschechien im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen, hat Polizeipräsident Martin Vondrášek am Freitag auf einer Pressekonferenz erläutert. Demnach registrierte die Polizei insgesamt 181 991 Straftaten, was seit 2021 einer Zunahme von 18,8 Prozent entspricht. Den weiteren Angaben zufolge wurden 2022 in Tschechien 150 Morde verübt, das waren 45 mehr als im Jahr zuvor. Besonders dramatisch ist die Entwicklung der Cyberkriminalität. Hier hat sich die Anzahl der Straftaten auf insgesamt 18 554 Fälle verdoppelt. Selbst der Präsidentschaftswahlkampf blieb von Cyberangriffen nicht verschont. So wurden am Freitag die Webseiten der Präsidentschaftskandidaten Petr Pavel und Tomáš Zima lahmgelegt. Ersten Erkenntnissen nach kam der Hackerangriff aus Rußland.
Gesetz gegen Terrorpropaganda
Ein Gesetz, das es Webseitenbetreibern verbietet, terroristische Inhalte zu verbreiten, hat die erste Hürde genommen und ist am Freitag im Abgeordnetenhaus ohne Gegenstimmen verabschiedet worden. Der Entwurf wird jetzt an den Senat weiterge-
12. Oktober wird Tag der Samizdat
In Tschechien soll der Samizdat (auf deutsch „Selbstverlag“) mit einem besonderen Tag gewürdigt werden. Die Regierung hat einen Antrag von einer Gruppe von Koalitionsabgeordneten unterstützt, wonach der 12. Oktober zum Tag des Samizdat werden soll. Damit will man an die Produktion und die Verbreitung von alternativer, nicht systemkonformer, Literatur über nichtoffizielle Kanäle erinnern. Am 12. Oktober 1988 schrieb eine Gruppe von 92 tschechischen und slowakischen SamizdatVerlegern einen offenen Brief an den damaligen kommunistischen Staatspräsidenten Gustáv Husák, in dem sie die Inhaftierung des christlichen Aktivisten Ivan Polanský verurteilten.
toter Bergmann bei Erdbeben
In der Kohlegrube ČSMJih in der Region Karwin in Mährisch-Schlesien hat ein Erdbeben am Donnerstag ein Unglück ausgelöst. Dabei kam ein Bergmann ums Leben, fünf Arbeiter erlitten schwere und weitere Personen leichtere Verletzungen, hat die Fördergesellschaft OKD mitgeteilt.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

fügt hinzu: „Es freut mich, gerade in dieser Stadt, die für die Sudetendeutschen eine enorme Bedeutung
hat, zwei so erfahrene und entgegenkommende Unterstützer gefunden zu haben.“
Politik
EinTorsten Fricke In der Bayerischen Repräsentanz in Prag (von links): Radek Novák, Irene Novák, Ex-Ministerin Michaela Tominová, Ex-Minister Daniel Hermann, Beauftragte Sylvia Stierstorfer, Peter Barton, Ministerin Melanie Huml, Ste en Hörtler und Christa Naaß. Rechts: Botschafter Andreas Künne und Ste en Hörtler. Fotos: Bayerische Repräsentanz in Prag/Václav Bacovský Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten in München: Ste en Hörtler mit First Lady Karin Baumüller-Söder und Markus Söder. Rechts: Nina Hieronymus vom Sozialministerium, Ste en Hörtler und Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf. BdV-Präsident Bernd Fabritius Bundeskanzler Olaf Scholz
Es ist hinlänglich bekannt: Ohne Ehrenamt sähe das Land ärmer aus. Auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft und mit ihr viele weitere sudetendeutsche Vereinigungen leben vom Ehrenamt.
Manche Ehrenamtliche sind regelrecht in das sudetendeutsche Verbandswesen hineingewachsen, so wie Birgit Unfug. Beide Eltern stammen aus Böhmen: Ihre Mutter aus dem Böhmerwald, ihr Vater ist in Böhmisch Meiseritsch geboren. Die Familie väterlicherseits ist oft umgezogen, aufgewachsen ist der Vater in Saaz. Nach 1945 fanden die Eltern in Bayern ein neues Zuhause.
Als Birgit Unfug elf Jahre alt war, zog die Familie von Kelheim nach München um und kam in ein Umfeld, in dem die Geschichte der Deutschen aus dem östlichen Europa stark präsent war. Die Familie bezog nämlich eine Wohnung im Haus des Deutschen Ostens (HDO) – „da war es logisch, daß ich mit der Geschichte der Deutschen aus dem östlichen Europa aufwuchs und auch aktiv ein Teil des Ganzen wurde“, sagt Birgit Unfug heute. Zudem war ihr Vater Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Eghalanda Gmoi.
Mit zwölf Jahren zog es auch Birgit zu der Egerländer Jugend. Zudem nahm sie an einem Zeltlager der Deutschen Jugend des Ostens (heute Deutsche Jugend in Europa) teil. Sie wurde selbst aktiv in der djo, ein Engagement, das sie viele Jahre begleitete. Mit 15 Jahren war sie im Bezirksvorstand, später wurde sie Landesvorsitzende Bayern, ein Amt, das sie bis 2007 ausübte.
Aus der Jugend ist sie rausgewachsen, aktiv ist Birgit Unfug noch immer – auf verschiedenen Ebenen. Sie singt und tanzt bei der Böhmerwälder Sing- und Volkstanzgruppe München, sie engagiert sich für die SL-Kreisgruppe München und ist Mitglied der Bundesversammlung.

Seit wenigen Wochen hat sie zudem eine neue Aufgabe dazu bekommen: Sie ist Landschaftsbetreuerin für die Heimatlandschaft Erzgebirge-Saazerland. Das heißt, sie wird Anfragen von Leuten bekommen, die auf der Suche nach Informationen zu ihren Vorfahren sind, die aus dem Gebiet stammen, die nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Gegend suchen oder Gegenstände aus der Region abgeben wollen und vieles mehr.
Das alles nimmt durchaus Zeit in Anspruch, rund zwei Stunden am Tag, dazu kommen viele Wochenenden – nicht wenig, erst recht nicht, wenn man hauptberuflich in so einem anspruchsvollen Beruf wie Krankenschwester tätig ist. Was sie antreibt? „Ich möchte, daß die sudetendeutsche Geschichte und auch die Kultur weitergegeben werden, und daß wir die Verbindung zu unseren tschechischen Nachbarn, aber auch zu anderen Vertreibungsgebieten suchen.“
Ein Aktiver aus der Erlebnisgeneration ist Kurt Aue. 1944 wurde er in Arnsdorf im Kreis Jägerndorf geboren. Davon wußte er jedoch nicht viel, als er als Bub in Bayern aufwuchs. Zwar wurde er als Kind von anderen als Flüchtling bezeichnet, aber beim Fußballspielen war schnell unwichtig, wer man war oder woher man kam. Bayern war für Kurt Aue Heimat. Die Geschichte seiner Vertreibung kannte er als kleiner Bub nicht. Er kannte aber einen Besucher aus Tschechien, der ab und an bei seinen Eltern zu Gast war. Später erfuhr Aue, daß dieser ihm als Eineinhalbjährigen das Leben gerettet hatte: Damals wurde er mit seiner Mutter aus Arnsdorf vertrieben – in einem Viehwaggon, aus dem der kleine Junge rausfiel. Ein tschechischer Mann fand ihn und brachte ihn unter Einsatz seines Lebens zu der Mutter zurück,
Ehrensache Ehrenamt
Burian Wurzelheimat ist. „Die Befassung damit tut der Seele gut“, sagt sie. Ihr großes Anliegen ist es zu vermitteln: zwischen ihren Angehörigen, aber auch zwischen den Generationen. „Wenn den Vorfahren die Augen zugehen, gehen den Nachfahren die Augen auf“, diese Erfahrung hat Yvi Burian gemacht, weshalb ihr die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte so wichtig geworden ist. Zugleich möchte sie anderen helfen, die eigenen Wurzeln zu entdecken. Dafür sorgt sie jetzt als Heimatkreisbetreuerin von Leitmeritz. Als solche steht sie all denen mit Rat und Tat zur Seite, deren Vorfahren aus Leitmeritz kommen und beispielsweise Fragen zur Ahnenforschung, zu Aufenthalten in Leitmeritz haben oder nach Kontakten vor Ort suchen. Das Amt hat Yvi Burian vor kurzem übernommen. Schon im Vorfeld ist sie dafür nach Leitmeritz und Aussig gereist. In Leitmeritz befindet sich unter anderem auch eine Familiengrabstätte des Urgroßvaters, der dort einst als Bürgerschuldirektor tätig war. Nun baut sie ihre Kontakte aus, zum Beispiel nach Fulda, der Partnerstadt von Leitmeritz, die vor einigen Jahren die Bestände des mittlerweile aufgelösten Heimatkreisvereins übernommen hat. Außerdem plant Yvi Burian, einen Tschechischkurs in Aussig zu besuchen.
Ein großes Vorbild war für sie ihre Großmutter: „Für mich war meine in Aussig geborene Oma eine ganz wichtige, prägende Person“, erklärt sie. „Sie hat alle Familienangehörigen zusammengehalten.“ Die familiären Bindungen sind Yvi Burian sehr wichtig. Zu ihrer Familie gehört übrigens auch Utta Fischer, geborene Martin, die Frau des berühmten Monaco-Franze Helmut Fischer – auch sie eine geborene Leitmeritzerin.
die er mithilfe des Roten Kreuzes ausfindig machte. Dieser Umstand hat Kurt Aue sehr geprägt: Dialog und Verständigung mit Tschechien sind ihm ein wichtiges Anliegen und zugleich eine Selbstverständlichkeit.
Seit 50 Jahren ist Aue mittlerweile in der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv. Als junger Kreis- und Stadtrat in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) hat er sich für die Belange der Vertriebenen eingesetzt. Seit 20 Jahren ist er Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Augsburger Land. Er ist außerdem im Landesvorstand Bayern der SL, stellvertretender Bezirksobmann von Schwaben, Kreisobmann Augsburg-Land sowie Ortsobmann von Königsbrunn und Wehringen. Bei so vielen Aufgaben kommen einige Stunden am Tag zusammen: Etwa fünf Stunden am Tag widmet er täglich der Kommunikation mit den Mitgliedern der SL, der Vorbereitung von Veranstaltungen und anderen organisatorischen Aufgaben. „Manchmal hocke ich auch den ganzen Tag da“, sagt er. „Das Ehrenamt ist wichtig“, findet er und fügt hinzu: „Ich kann jedem Rentner, der
jammert oder sich langweilt, das Ehrenamt empfehlen. Wenn ich was tue, bin ich gesünder.“
Ebenfalls viel Zeit auf das Ehrenamt verwendet Lorenz Loserth, der aus der sogenannten Enkelgeneration stammt. Über die Ahnenforschung ist er in Kontakt mit gebürtigen Sudetendeutschen gekommen. Irgendwann bat einer von ihnen Loserth, die Stelle des Ortsbetreuers von Lobenstein zu übernehmen, dem Ort, aus dem seine Großeltern stammten. Loserth sagte zu und kam mit immer mehr Landsleuten in Kontakt und tauchte so ein in eine faszinierende Kultur, die für ihn zugleich „fremd und exotisch und doch familiär vertraut“ ist. Begeistert von der Vielfalt der sudetendeutschen Institutionen, trat er der Landsmannschaft bei und engagierte sich immer mehr für den Erhalt und die Weitergabe sudetendeutscher Kultur. So gestaltete er etwa die Seite der Heimatlandschaft Altvater neu. Das Ergebnis ist beeindrukkend: Jetzt finden sich auf www. heimatlandschaft-altvater.eu umfangreiche Informationen über das Altvatergebirge, über sudetendeutsche Themen und Institutionen allgemein, über Ahnen-

forschung, Trachten, Dialekte und vieles mehr. Die Homepage und ihre Neugestaltung können paradigmatisch für etwas stehen, was Loserth in den sudetendeutschen Einrichtungen allgemein beobachtet: „Ich sehe viele Mängel und gleichzeitig auch viele Möglichkeiten, diese zu beheben.“ Das motiviere ihn.
Mittlerweile widmet er fast seine ganze Freizeit der Sache: „Ich betreue die Facebookgruppe der Heimatlandschaft Altvater und die Heimatlandschaftseite, ich inventarisiere die Jägerndorfer Heimatstube und arbeite an deren Neukonzeption mit, ich schreibe für die Heimatzeitschriften, ich unterstütze die Heimatfahrten, ich vermittle mir anvertraute sudetendeutsche Literatur an öffentliche Bibliotheken, ich dokumentiere und pflege das Gebirgsschlesische, ich abonniere Heimatzeitungen, ich führe meine Tracht aus, ich pflege Kontakt nach Tschechien und führe durchs Sudetendeutsche Museum.“ Wer hören will, wie gut Loserth mittlerweile das Gebirgsschlesische beherrscht, sollte beim YouTube-Kanal der Sudetendeutschen Landsmannschaft vorbeischauen: Dort finden sich
mehrere Videos von Lesungen mit Loserth.
Verbunden mit seinem Engagement sind viele lustige, bewegende und schöne Momente. So war es ihm eine Freude, als er seine ersten Beiträge im Jägerdorfer Heimatbrief abgedruckt sah. Eine 93jährige Dame rief ihn deswegen an, und sie vereinbarten ein Treffen: „Sie hatte erwartet, daß sie einen älteren Herrn treffen würde. Doch ich war damals 37.“
Auch andere Begegnungen sind ihm gut in Erinnerung geblieben: „Einem Herrn von 88 Jahren kamen die Freudentränen, als er mich in meiner Tracht am Sudetendeutschen Tag sah, eine alte Dame rief mich an, um mir ein schlesisches Schimpfwort zu sagen, an das sie durch einen meiner Artikel erinnert wurde. Landsleute haben mir unter Tränen von ihren Fluchterfahrungen berichtet, und tschechische Schüler haben mit uns Deutschen bei einer Gedenkfeier ein deutsches Lied gesungen.“

Für Yvi Burian, 51 Jahre, ist das Engagement in der SL eine „Herzensangelegenheit“. Ihre Großeltern stammen aus dem Elbetal, eine Gegend, die für Yvi
Ehrenamtskarte als Wertschätzung
In vielen Bundesländern wird das ehrenamtliche Engagement seit Jahren mit der Ehrenamtskarte wertgeschätzt, die Ehrenamtler auf Antrag erhalten.
So erhalten beispielsweise in Bayern die Inhaber der Ehrenamtskarte kostenlosen Eintritt bei allen staatlichen Schlössern und Burgen, Museen und Sammlungen sowie Rabatte bei der Bayerischen Seenschifffahrt. Auch Kommunen und Unterneh-
men steuern eigene Angebote bei.
Die zuständige Staatsministerin Ulrike Scharf erklärt, warum das Ehrenamt unverzichtbar ist: „Ehrenamtliches Engagement ist ein großes Geschenk, das sich die Menschen in unserem Land gegenseitig machen. Sie stärken damit den Zusammenhalt und schaffen ein gemeinsames Miteinander in der Bevölkerung.“
Allein in Bayern, so die Ministerin, engagieren sich 41 Pro-



zent der Bürger über 14 Jahre ehrenamtlich. „Das sind fast 4,7 Millionen Menschen. Was für eine Power von ihnen ausgeht“, sagt Scharf und erklärt, daß diese Menschen „für ihren Einsatz unsere tiefe Wertschätzung“ verdienen. Die Ministerin: „Die Bayerische Ehrenamtskarte ist ein sichtbares Zeichen der persönlichen Anerkennung. Seit 2011 haben über 200 000 Menschen dieses Dankeschön erhalten. Das ist deutschlandweit spitze.“
In der SL fühlt sie sich sehr gut aufgehoben. „Hier bin ich richtig“, meint sie. Ihre Großmutter und ihr Vater waren Mitglieder der SL, eine familiäre Vorprägung war also vorhanden. Letztlich überzeugt sich selbst der Landsmannschaft anzuschließen, hat sie ein Vortrag von Bernd Klippel bei ihr in der Region. Klippel ist Mitglied der SL-Bundesversammlung und hat bei seinem Besuch in Gelnhausen von der Ukraine-Resolution der Bundesversammlung im März 2022 berichtet. Das hat Yvi Burian, die in verschiedenen sozialen Vereinen aktiv ist, sofort angesprochen. Im Juni war sie erstmals beim Sudetendeutschen Tag. Dort und auf weiteren Terminen habe sie sich sehr wohl gefühlt, viele gute Gespräche geführt, unter anderem mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt, dem ehemaligen Europaabgeordneten Milan Horáček sowie mit der Heimatlandschaftsbetreuerin vom Elbetal, Ingeburg Alesi. Diese sprach Yvi Burian auch gleich auf eine mögliche Betreuung des Heimatkreises an. Bei einem Besuch im Sudetendeutschen Museum und in der Bundesgeschäftsstelle in München bestätigte sich die Bereitschaft sich aktiv zu engagieren. Und nur wenige Monate später, im November 2022, folgte auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen die offizielle Ernennung von Yvi Burian zur Heimatkreisbetreuerin.
Neben der Familienforschung gehört das Laufen zu ihren großen Leidenschaften: „Wer einmal einen Halbmarathon absolviert hat, weiß, daß man Ausdauer und Disziplin braucht.“ Diese beiden Eigenschaften werden ihr nun auch bei ihrer neuen Tätigkeit zugutekommen.
Aber auch wer nicht so viel Zeit investieren kann, findet in den sudetendeutschen Einrichtungen sicherlich ein Betätigungsfeld, meint Burian und rät: „Man kann zum Beispiel auch an einzelnen Projekten mitwirken.“
Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
Wenn die Symmetrie der Natur verwirrt
■ Ausstellung „Symmetrie der Natur – Natur der Symmetrie“, Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, München. Vernissage: Donnerstag, 26. Januar, 19.00 Uhr; Ausstellungszeitraum: Freitag, 27. Januar bis Freitag, 3. März. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Die Blütenzeit beginnt: Im Rahmen des Flower Power Festivals zeigt das Tschechische Zentrum München symmetrische Blumen‐ und Pflanzenbilder des Fotografen Daniel Kreissl.
Die Symmetrie ist keine menschliche Erfindung. Auch in der Natur ist sie sehr häufig anzutreffen – bei Blüten und Blättern, Schneeflocken, Schmetterlingen oder Seesternen. Sie verleiht uns ein Gefühl der Harmonie und Ordnung inmitten von Chaos.
Mit seinen geheimnisvollen symmetrischen Bildern enthüllt der tschechische Fotograf Daniel Kreissl fraktale Strukturen in Wurzeln, dornigen Sträuchern und Kletterpflanzen im Blütenrausch. Er fotografiert vor allem in der Abenddämmerung, und dabei entsteht oft der Eindruck von mythischen Kreaturen und unbekannten Landschaften, die plötzlich aus der Dunkelheit hervortreten. Diesen Effekt erklärt er
■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Samstag, 21. Januar, 13.00 bis 15.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum, Workshop im Winter: „Es schneit!“ Gemeinsam entdecken Kinder und Familien glitzernde Winterwelten und gestalten mit Nadja Schwarzenegger eigene Schneekugeln. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. Anmeldung per eMail an anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag.
Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 21. Januar, 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz): Junge Musiker begrüßen das neue Jahr. Es musizieren talentierte Nachwuchsmusiker aus Regensburg und der Oberpfalz unter Mitwirkung tschechischer Gäste aus der Region Pilsen. Auf dem Programm stehen Werke vom Barock bis in die Gegenwart in solistischer und kammermusikalischer Besetzung. Festsaal des Bezirks Oberpfalz, Ludwig-Thoma-Str. 14, 93051 Regensburg. Eintritt frei.
■ Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau: Neujahrskonzert mit dem Wihan Quartett aus Prag. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 26. Januar, 17.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Dorpat und die Grüne Kiste. Eine deutschbaltische Familien- und Fotografiegeschichte.“ Lesung mit Autorin Sophie Pannitschka. Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, Magdeburg, sowie am Freitag, 27. Januar, 19.00 Uhr, im Brömsehaus, Am Berge 35, Lüneburg. Eintritt ist frei.

■ Freitag, 27. Januar, 18.00 Uhr, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel, Wien. Anmeldung an eMail sekretariat@vloe.at
■ Samstag, 28. und Sonntag,
wie folgt: „Wenn Sie auf meinen Fotografien fantasievolle Gestalten sehen, denke ich, daß es sich dabei um Kreaturen aus der Welt des Unterbewußtseins handelt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Alles, was symmetrisch
ist und obendrein angedeutete Augen hat, interpretieren wir als Lebewesen, und wir sehen sie auch dort, wo sie ganz sicher nicht sind.“
Zur Vernissage am 26. Januar führt der Künstler zusammen
VERANSTALTUNGSKALENDER
29. Januar, Bund der Egerländer Gmoi: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Samstag, 28. Januar, Sudetendeutscher Rat: Plenum. Programm und Örtlichkeiten folgen.
■ Samstag, 28. Januar, 15.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Sonntag, 29. Januar, 15.00 Uhr: Requiem für Widmar Hader. Musikalisch gestaltet wird das Requiem von Andreas Willscher und Dietmar Gräf (Orgel) und Moravia Cantat; zelebrieren wird Monsignore Karl Wuchterl, der Ehrenvorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerks. Die Urnenbeisetzung findet am Folgetag im Familienkreis statt Kirche St. Vitus, Ludwig-ThomaStraße, Regensburg.
■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.
■ Freitag, 3. Februar, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Krieg in Europa –weit weg und nah dran“. Vortrag und Gespräch mit Martin Panten, stellvertretender Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.
■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen unter www.jiz50.cz
■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2. Puchheim. Eintritt frei.
■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-Metz-
Halle, Volkhardtstraße, Zirndorf. Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregi-
mit Kuratorin Dr. Eva Čapková in die Ausstellung ein. Der Abend wird musikalisch umrahmt durch symmetrische Kompositionen, gespielt von Václav Salvet, Keyboard, und Katerina Stegemann, Flöte.
on. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad.
■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.
■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).
■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Ausführliches Programm folgt.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.
■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
Europa zwischen
Mauerfall und Ukrainekrieg
■ Sonntag, 29. Januar bis Freitag, 3. Februar: Tagung „Europa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg“.
Mit dem Überfall Rußlands auf die Ukraine ist – mit Ausnahme der Balkankriege – eine fast achtzigjährige Epoche des Friedens in Europa zu Ende gegangen. Insbesondere der Fall der Berliner Mauer, die (meist) friedlichen und erfolgreichen Revolutionen in Europa 1989/1990, der Nato-Beitritt fast aller ostmittel- und südosteuropäische Länder und die Erweiterung der Europäischen Union haben in Europa eine wirtschaftliche und soziale Dynamik ausgelöst, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. Daß man Georgien und der Ukraine 2008 den Nato-Beitritt verwehrt und den Westbalkanländern lange Zeit keine EU-Beitrittsperspektive geboten hat, hat Rußland bewogen, sich in Europa Einflußsphären zu sichern und dabei auch militärische Mittel einzusetzen. Weder der Georgienkrieg 2008 noch die Besetzung der Krim sowie der Krieg im Donbaß ab 2014 haben deutsche und europäische Politiker wachgerüttelt. Jetzt herrscht in Europa Kireg. Wie konnte es dazu kommen? Läßt sich der militärische Konflikt begrenzen? Sind Auswege möglich?
Die Referenten sind: Dr. Meinolf Arens („Rußlandbilder in Deutschland“), Dr. Katharina Haberkorn („Krieg in der Ukraine. Wiederholte Fluchtbewegungen und historische Traumata im historischen Kontext“), Dr. Victor Krieger („Die Gründung der Sowjetunion 1922 und ihr Weiterleben nach dem Zerfall 1991“), Ulrich Feldmann („Krisenherde in der Welt“), Herbert Danzer („Rußland und der Westen – sicherheitspolitische Analysen eines Zeitzeugen“), Dr. Otfrid Pustejovsky („Verdrängen, Vergessen, Erinnern. Deutschland und Europa im 20./21. Jahrhundert. Der neue Blick der Tschechen und Slowaken auf die Sudetendeutschen“), Monika Wittek („Die Lage der deutschen Minderheit in Polen nach 1989“), Dr. Udo Metzinger („Globale amerikanische Außenpolitik 1990 bis 2023. Konzepte und Fehler“ sowie „Die Rückkehr des russischen Imperialismus – warum Putins Ratio nicht mehr die unsrige ist“) und Prof. Dr. Felix Ackermann („Die Gegenwart des Krieges. Wie der Krieg in der Ukraine das Erinnern an den Zweiten Weltkrieg verändert“).
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
Gedenktag für vertriebene Ungarndeutsche
Veranstaltung im Adalbert-Stifter-Saal
■ Dienstag, 31. Januar, 18.00 Uhr: Gedenkveranstaltung anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen. Veranstaltungsort: Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München.
Das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern und das Haus des Deutschen Ostens laden anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen zu einer Gedenkveranstaltung mit anschließendem Empfang ein.

Die Grußworte sprechen Emmerich Ritter, Mitglied des ungarischen Parlaments, und
MdL Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.

Anschließend referiert Dr. habil. Márta Müller über das Thema „Von der Wiege bis zur Hochschule – Aktuelle Tendenzen des ungarndeutschen Schulwesens“.
Im Anschluß an die Veranstaltung laden das HDO und das Ungarische Generalkonsulat zu einem Empfang ein. Anmeldung bis zum 23. Januar per eMail an einladung-muenchen@mfa. gov.hu oder per Telefon unter (0 89) 9 62 28 02 00.
 Der Tagungsbeitrag für die voraussichtlich vom BMI geförderte Veranstaltung beträgt 200 Euro pro Person, jeweils inklusive Programm, Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 10,00 Euro pro Tag. Die ermäßigte Kurtaxe beträgt 1,95 Euro pro Tag. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldungen sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefax: (09 71) 71 47 47 oder per eMail an: hoertler@heiligenhof.de. Kennwort: „Zwischen Mauerfall...“
Der Tagungsbeitrag für die voraussichtlich vom BMI geförderte Veranstaltung beträgt 200 Euro pro Person, jeweils inklusive Programm, Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 10,00 Euro pro Tag. Die ermäßigte Kurtaxe beträgt 1,95 Euro pro Tag. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldungen sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefax: (09 71) 71 47 47 oder per eMail an: hoertler@heiligenhof.de. Kennwort: „Zwischen Mauerfall...“
Gedenken an Jan Palach
Diese Szene grenzenloser Verzweiflung hat sich tief in die tschechische Seele eingegraben. Aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings und den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten hat sich am 16. Januar 1969 der Prager Student Jan Palach auf dem Wenzelsplatz selbst verbrannt.
Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist das Drama wieder ins öffentliche Bewußtsein gerückt, zumal Kreml-Machthaber Wladimir Putin die Taktik von damals – ein schneller Panzervorstoß und die Besetzung wichtiger Schaltzentralen – im Frühjahr 2022 auch beim Sturm auf Kiew einsetzen wollte, aber scheiterte.
Anläßlich des Gedenkens an Jan Palach sagte Tschechiens Premierminister Petr Fiala, es sei wichtig, an Menschen zu erinnern, die große Opfer für Freiheit und Demokratie in Kauf genommen haben. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), legte am Gedenkort vor dem Nationalmuseum Blumen nieder. Sie sagte, daß Jan Palachs Tat zum Zusam-
menbruch des totalitären Regimes beigetragen habe. Bildungsminister Vladimír Balaš
Der 20-jährige
drei Ta-
Stalins Befehl 7161: Zwangsarbeit als Rache an unschuldigen Deutschen
Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin startete mit einer Vorstellung eines dokumentarischen Foto-Text-Buchs des Luxemburgers Marc Schroeder in das neue Jahr.

Im großen Vortragssaal begrüßte die Direktorin Gundula Bavendamm die Partner dieser Buchvorstellung: den Autor Marc Schroeder, die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim, Heinke Fabritius, das Rumänische Kulturinstitut, die Deutsch-Rumänische Gesellschaft und den Kulturreferenten der luxemburgischen Botschaft, Guido Jansen-Recken.


Nach geschichtlich einführenden Worten von Fabritius schloß sich ein Einführungsfilm mit kurzen Erzählsequenzen der Protagonisten des Buches an, dann diskutierte Andreas Kossert vom Dokumentationszentrum mit dem Autor Marc Schroeder und Heinke Fabritius über die Beweggründe und die Gestaltung des Buches.
Was war der Befehl 7161, der als Titel des Buches auf Englisch „Order 7161“ fungiert? Am 16. Dezember 1944 unterzeichnete Stalin den Befehl 7161ss, einen geheimen Beschluß des Staatskomitees für Verteidigung zur „Mobilisierung und Internierung aller arbeitsfähigen Deutschen, Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren, Frauen von 18 bis 30 Jahren“ aus Rumänien, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien und der Tschechoslowakei.
Die Deportation zur Zwangsarbeit sollte dem Wiederaufbau der Sowjetunion dienen und galt als Reparationsleistung für die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Von den 112 480 Männern und Frauen gehörte die Mehrzahl mit 69 332 Personen der deutschen Minderheit in Rumänien an. Unter den Zwangsarbeitern waren aber auch 215 Deutsche aus der Tschechoslowakei.
Alle Stalin-Opfer sollten zum Wiederaufbau der Bergwerke im Donezbecken und im Kaukasus sowie in der Schwerindustrie und den Hüttenwerken eingesetzt werden. Zwischen zwölf und 20 Prozent überlebten die schwierigen Lebensund Arbeitsbedingungen nicht. Ende 1949 kehrten die ersten wieder nach Rumänien zurück.
Der Luxemburger Fotograf Marc Schroeder stieß 2010 in einem Artikel der „Zeit“ über Rumäniendeutsche in einem Altersheim in Hermannstadt erstmalig auf diese Minderheit, und es interessierte ihn auch deshalb, weil die Vorfahren der Siebenbürger Sachsen im 12. Jahrhundert beginnend aus dem luxemburgischen Raum gekommen waren, was noch immer sprachlich im deutschen

Dialekt der Siebenbürger nachweisbar ist. Bei einer ersten Erkundungsreise im Oktober 2010 durch Rumänien erfuhr er dann von der Deportation der Rumäniendeutschen und begann in den Archiven systematisch zu recherchieren.
Über die Jahre traf er insgesamt 40 Betroffene, die er im Buch namentlich nennt und zeigt. Die Aussagen der Opfer, die im Buch chronologisch zum Ablauf der Deportation und der Zeit davor und danach geordnet sind, hat er anonymisiert und nur mit männlich oder weiblich zugeordnet. Dabei entsteht ein Bild der kollektiven Erfahrungen der Betroffenen. Die Fotografien, meistens schwarz-weiß, zeigen Winterlandschaften und Landschaften aus dem fahrenden Zug – so wie zu der Zeit, als die Deportationen im Winter 1945 begannen.
Alltagsszenen im Leben der Depor-

tierten heute, alte Fotografien, Dokumente des Lagerlebens, Postkarten, Schriftstücke, die ihm die portraitierten Rumäniendeutschen zeigten. Aber auch Farbbilder mischen sich in den Erzählmodus des Buches. Sie lassen die Schönheit der rumänischen Landschaften aufscheinen, und sie bildeten auch bei den Porträts einen Abschluß. In den Tagen nach den Gesprächen über ihre Erlebnisse während der Deportation machte Marc Schroeder jeweils noch ein farbiges Portrait in der eigenen Wohnung. Es ist der irgendwie versöhnliche Schlußpunkt eines Lebens und dessen schrecklicher prägender Erlebnisse, über die die Betroffenen meist niemandem vorher je so detailliert berichtet hatten.
Schroeder erzählt von den Mühen der Entstehung des Buches, das im Oktober 2022 auf der Short List eines FotobuchWettbewerbs der Paris Photo-Messe nominiert wurde und im niederländischen Breda beim Verlag „The Eriskay Connection“ auf deutsch und englisch herausgegeben wurde, wobei die englische Ausgabe bereits ausverkauft ist.

Er berichtet im Gespräch, wie stark der Druck für ihn wurde, angesichts der Verantwortung, die er wegen der vielen offenherzigen Begegnungen und Erzählungen seiner Portraitierten spürte, da nun immer mehr seiner Protagonisten verstarben. Mittlerweile, so schätzt
er, leben nur noch zwei oder drei dieser 40 Portraitierten. Es mußte unbedingt zur Publikation kommen, die dann auch vom Nationalen Kulturfonds Luxemburgs und vom Förderprogramm Publishing Romania des Rumänischen Kulturinstituts unterstützt wurde.


Begeistert von den Filmaufnahmen, die am Anfang der Veranstaltung von den Portraitierten gezeigt wurden, forderte ein Zuschauer den Autoren und Fotografen Marc Schroeder auf, unbedingt eine Filmdokumentation nachzuschieben. Dafür bräuchte Schroeder allerdings einen versierten Schnittmeister, und irgendwie hat ihn das Projekt mit den vielen Portraits und den tiefen emotional fordernden Begegnungen über die Jahre so ausgelaugt, daß er in der letzten Zeit nur Landschaften und keine Menschen mehr fotografierte. Aber vielleicht lassen ihn die Rumäniendeutschen und ihr Deportationsschicksal doch nicht ganz los, und wir können alsbald einen Dokumentarfilm mit Portraits sehen. Die Aufnahmen, die er machte, hat er jedenfalls noch gespeichert und sie sind ein Dokument über den Tod der Betroffenen hinaus, wie schon das gut orchestrierte Buch, das, wie die Direktorin Bavendamm anmerkte, bereits kurz nach Erscheinen Eingang

Ein Blick voll Mitgefühl
E

in Bibelwort als Überschrift für das ganze Jahr – diesem Ziel dienen die sogenannten Jahreslosungen. Von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wird jeweils ein Wort aus der Heiligen Schrift ausgesucht und den Christen im deutschsprachigen Raum als geistliches Motto für das neue Kalenderjahr angeboten. Der Brauch stammt ursprünglich aus dem evangelischen Bereich, deswegen spielt er dort bis heute eine besondere Rolle. Es wäre jedoch wünschenswert, wenn die Jahreslosungen auch in den anderen Konfessionen Widerhall fänden. Deswegen nütze ich gerne meine wöchentliche Kolumne, um das Bibelwort für 2023 vorzustellen. Es stammt aus dem Buch Genesis und heißt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Wenn wir dieses Wort tatsächlich als Leitsatz für das noch junge Jahr wählen wollen, ist es sinnvoll, sich persönlich zu fragen: Was löst dieses Wort an Gedanken und Gefühlen in uns aus? Möglicherweise haben wir ja nicht nur positive Assoziationen. In vielen Kirchengebäuden finden wir das Symbol eines Dreiecks mit einem Auge in der Mitte. Vor allem Kindern gegenüber wurde dieses Symbol früher oft so gedeutet: „Der Herrgott sieht alles. Nimm dich in Acht. Vor ihm kannst du nichts verbergen.“ Wieviel Unheil wurde mit Sätzen wie diesen in Kinderseelen angerichtet? Manche Menschen leiden auch im Erwachsenenalter noch unter ihren Folgen. Deswegen gilt es, den lebensfreundlichen Motiven der diesjährigen Jahreslosung auf die Spur zu kommen.
Unser Bibelvers ist im Buch Genesis eingebettet in die Geschichte von der Sklavin Hagar, die stellvertretend für ihre unfruchtbare Herrin Sara von deren Mann Abraham ein Kind bekommen mußte. Heute würde man diesen Umstand wohl Zwangsleihmutterschaft nennen. Hagar fühlte sich in ihrer Menschen- und Mutterwürde mißbraucht. In ihrer großen Verzweiflung floh sie in die Wüste. Dort begegnete sie einem Engel. Von ihm erfuhr sie, daß ihr Schicksal Gott nicht egal sei und daß er an ihrem Leiden Anteil nehme. Diese Erfahrung gab ihr neues Vertrauen. Sie hatte wieder Mut zum Weiterleben. Und so formte sich in ihr die Überzeugung, die sie dankbar zum Himmel schickte: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Hier ist also von einem Gott die Rede, der nicht mit einem kontrollierenden, sondern mit einem mitfühlenden Auge über uns wacht. Wer sich wie Hagar im Leben als Erfüllungsgehilfe des Glücks anderer Menschen fühlt, wer sich als bloße Nummer erlebt oder in seiner Umgebung oft übersehen wird, der darf vor und mit einem solchen Gott aufatmen. Der kurze Ausruf der Sklavin von Abraham und Sara ist ein Glaubensbekenntnis, aber er lädt uns auch ein, unsere eigene Aufmerksamkeit zu überprüfen. Hinschauen, nicht wegschauen, das Leid von Menschen wahrnehmen und ihnen Nähe zeigen – das sollte nicht nur Gottes, sondern auch unser Bemühen kennzeichnen. Insofern also ein gutes, wirklich lebensfreundliches Leitmotiv für 2023.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Pfarrei Ellwangen-Schönenberg
Liesel Liptak 100
Am 24. Dezember feierte Elisabeth Charlotte „Liesel“ Liptak/Haidl mit ihren Töchtern Andrea und Christiane im sauerländischen Warstein ihren 100. Geburtstag.

Im Jahr 1922 war der Heilige Abend ein Sonntag. An diesem Sonntag kam Liesel Liptak als Elisabeth Charlotte Haidl im egerländischen Dallwitz bei Karlsbad zur Welt. Nach dem Abitur in Karlsbad ging sie nach Prag. Dort studierte sie Biologie als Hauptfach, außerdem Erdkunde und Geschichte. Ihr Geschichtsprofessor war Anton Ernstberger, der Bruder ihrer Mutter. 1941 lernte sie in Prag den zwei Jahre älteren Medizinstudenten Andreas „Andor“ Liptak kennen. Liptak stammte aus Käsmark in der Zips. Sein Vater, Johann Liptak, ist allen Karpatendeutschen nicht nur als Heimatforscher ein Begriff. In Käsmark leitete er das deutsche evangelische Gymnasium, und nach dem Krieg und seiner Vertreibung hatte er großen Anteil an der Sammlung aller Karpatendeutscher.
Andor gestand Liesel 1942 beim Kaffee im Künstlercafé Manes an der Moldau seine Liebe. Dann machte Andor Examen, und die Wehrmacht zog ihn zum
Kriegsdienst ein. 1945 erlebte Liesel das Kriegsende in Prag. 2012, in Liesel Liptaks 90. Lebensjahr, veröffentlichte die Sudetendeutsche Zeitung unter dem Titel „Mein Kriegsende in Prag“ in fünf Folgen ihre Erinnerungen an die Schrecken im Nachkriegsprag.
Schließlich mußte sie Prag ver- und die begonnene Doktorarbeit zurücklassen.
Nach einigen Monaten Zwangsarbeit lebte sie mit Mutter und Schwester bis zum „geordneten Abschub“ weitere Monate in Landek im Kreis Tepl. Die Vertreibung brachte die Frauen 1946 nach Fauerbach vor der Höhe in Hessen. Dort fand Liesel Arbeit im Gemeindeamt. Im Wintersemester 1947/48 begann sie an der Universität Marburg erneut eine Doktorarbeit.

1948 wurde Andor Liptak aus ägyptischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Seine Schwester Susanne hatte Heinz Hahne aus Warstein geheiratet. Deshalb hatte Andor Liptak dort eine Anlaufstelle und wurde dort ansässig. In Warstein trat er eine
Stelle an der Lungenklinik Stillenberg an, an deren Aufbau er maßgeblich beteiligt war und deren Leitender Direktor er werden sollte.
1950 heirateten Liesel und Andor und lebten fortan gemeinsam in Warstein. Die folgenden drei Jahre arbeitete Liesel als Laborantin in der Lungenfachklinik. Am 10. November 1953 kam Tochter Andrea, am 2. Mai 1956 Tochter Christiane zur Welt. Später en-

❯ Ackermann-Gemeinde
Weihnachten im Heiligen Land
Dem weihnachtlichen Festkreis war die erste Zoom-Veranstaltung der Ackermann-Gemeinde im neuen Jahr gewidmet. „Weihnachten im Heiligen Land. Wie in Jerusalem und Bethlehem die Geburt Jesu gefeiert wird“ lautete das Thema, für das sich zahlreiche Ackermänner- und frau-
In seiner Begrüßung ging Moderator Rainer Karlitschek natürlich auch auf den Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI., des vormaligen Münchener Erzbischofs Joseph Kardinal Ratzinger ein, der mehrmals an Veranstaltungen der AckermannGemeinde teilgenommen habe. Den Referenten stellte Sandra Uhlich vor.
gagierte sie sich bis weit in ihre 90er Jahre ehrenamtlich im Warsteiner Turnverein.
Als die Lungenklinik 1985 schloß, ging der verbeamtete Facharzt in Pension, und das Paar erlebte 15 wunderbare gemeinsame Jahre. Im Jahr 2000 erkrankte Andor Liptak an Krebs. Er starb im August 2005 mit 85 Jahren. Die letzten zwei Jahre hatte seine Liesel ihn liebevoll zu Hause gepflegt.
Mittlerweile vergingen weitere knappe zwei Jahrzehnte, und Liesel Liptak hat seit dem Heiligen Abend ein ganzes Jahrhundert hinter sich. Das gelang ihr mit Klugheit, Zufriedenheit und Heiterkeit. Die Landsleute gratulieren von ganzem Herzen.
Nadira HurnausNorberta Steingruber und Herbert Kinzel geehrt

Die bayerisch-schwäbische SLKreisgruppe Augsburg-Land ehrte zwei ihrer Mitglieder.
Mitte Januar erhielt Norberta Steingruber, Obfrau der SLOrtsgruppe Bobingen, im Auftrag von Volksgruppensprecher Bernd Posselt und dem erkrankten Kurt Aue, Obmann der SLKreisguppe Augsburg-Land, aus den Händen des Stellvertretenden Kreisobmanns Leo Schön die Rudolf-Lodgman-Plakette mit Urkunde, die höchste Auszeichnung der Volksgruppe. Mehr als 70 Jahre lang, so Schön, habe Steingruber in verschiedenen Funktionen für die SL gewirkt.
Ende Dezember ehrten im Rathaus der bayerisch-schwäbischen Gemeinde Oberottmarshausen Bürgermeister Andreas Reiter, Kurt Aue, Obmann der SLKreisgruppe Augsburg-Land, sowie seine Stellvertreterin Christa Eichler den Oberottmarshausener Bürger Herbert Kinzel für die ehrenamtliche Tätigkeit bei der SL-Ortsgruppe Königsbrunn/ Wehringen mit dem Großen Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft. 30 Jahre lang war Kinzel Fahnenträger der SL-Ortsguppe Königsbrunn/ Wehringen und Beisitzer im SLOrtsvorstand. te

en an 50 Bildschirmen interessierten. Referent des Abends war Gregor Buß, Professor für Katholische Theologie, Anthropologie, Ethik und Soziallehre an der Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen in Paderborn und 2013 bis 2015 Geistlicher Beirat der Jungen Aktion.
zwei Prozent aus, die Katholiken weit weniger als ein Prozent. Andererseits seien die Städte Jerusalem und Bethlehem für Katholiken oder Christen von großer Bedeutung – natürlich auch zu Weihnachten. In Palästina seien 98 Prozent Sunniten, zwei Prozent Christen. Davon wiederum gehörten 52 Prozent der grie-

gehörige anderer Konfessionen dieses Angebot gerne an. Die griechisch-orthodoxen Christen feierten bekanntlich erst am 6., die armenisch-orthodoxen Christen am 18. Januar Weihnachten. „Es werden drei unterschiedliche Weihnachtsfeste mit entsprechenden Liturgien und Traditionen gefeiert. Doch
Bereits nach dem Abitur leistete Gregor Buß einen Freiwilligendienst in einem Kinderheim in Jerusalem. Es folgte das Diplom-Theologie- und Lehramtsstudium für katholische Religionslehre und Englisch an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wobei Buß 2001/2002 ein Auslandsstudium an der Hebräischen Universität Jerusalem mit den Schwerpunkten Judaistik und Philosophie absolvierte. Zur Promotion ging es an die Universität Erfurt und an die Karls-Universität Prag, wo er über den damals dort wirkenden Professor Albert-Peter Rethmann mit der Ackermann-Gemeinde in Kontakt kam.

Seine berufliche Laufbahn begann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Weltkirche und Mission, das an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main angesiedelt ist. 2012 bis 2013 war er Lehrstuhlvertreter für das Fach Missionswissenschaft und außereuropäische Theologien an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 2013 bis 2015 Referent für Missionsfragen, interreligiösen Dialog und Afrika im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn.
2015 bis 2020 wirkte Buß erneut in Israel. Zunächst bis 2019 als Postdoktorand an der Martin Buber Society of Fellows in the Humanities and Social Sciences (Hebräische Universität Jerusalem) sowie bis 2020 als Akademischer Direktor am Bat Kol Christian Center for Jewish Studies (Kloster Ratisbonne, Jerusalem). 2020 bis 2021 war er Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Abrahamitische Religionen mit Schwerpunkt Islam und interreligiöser Dialog (Theologische Fakultät Trier), seit 2021 ist er Professor für Katholische Theologie, Anthropologie, Ethik und Soziallehre an der Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen in Paderborn.
Er wolle für die bunte religiöse Landschaft in Israel und Palästina sensibilisieren, gab Buß einleitend als grundlegende Motivation für seinen Vortrag an. Dabei betonte er auch, daß das Weihnachtsfest dort nur eine sehr geringe Minderheit betreffe. Dies bekräftigte er anhand von Zahlen.
In Israel bilde die jüdische Religion mit 80 Prozent die Mehrheit, gefolgt von den Muslimen mit 14 Prozent. Die Christen machten wie die Drusen lediglich
chisch-orthodoxen und 31 Prozent der römisch-katholischen Kirche an. Zu bedenken sei, daß der Status der geteilten Stadt Jerusalem umstritten sei und Bethlehem auf palästinensischem Gebiet liege. Was sich auch auf die Ausübung von Bräuchen an Weihnachten auswirken könne.

Arabische Christen in Israel stellten schon mal einen großen Weihnachtsbaum auf einer Mauer auf, um ihren Glauben und ihre Religion deutlich sichtbar zu machen. Andererseits organisiere die Stadt Jerusalem die Ausgabe von Weihnachtsbäumen. „Die jüdische Stadtverwaltung ist bemüht, die Christen zu unterstützen“, erklärte Buß. Näher am damaligen Geschehen seien die arabischen Christen in Palästina, das heiße in Bethlehem, wo sich die Geburtskirche befinde. Hier stünden ein klassischer Weihnachtsbaum und eine von den Franziskanern aufgebaute Krippe. Selbst der Grenzwall zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten sei mit einem weihnachtlichen Graffiti versehen.
Für die deutschen Christen biete die Dormitio-Abtei der Benediktiner auf dem Berg Zion in Jerusalem Weihnachtsgottesdienste. Hier gebe es auch den Brauch, auf einer langen Papierrolle die Namen der Personen festzuhalten, für die bei den Meßfeiern gebetet werden solle. Diese Rolle werde dann in der Heiligen Nacht die zehn Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem getragen und vor der Krippe abgelegt. „Heuer standen 84 000 Namen auf der Rolle“, berichtete Buß. Für evangelische Christen gebe es am ersten Advent in der Erlöserkirche einen Adventsbasar mit typischen deutschen Weihnachtsspeisen und -getränken. Natürlich nähmen auch An-
für die Mehrheit spielt Weihnachten keine Bedeutung“, faßte Buß zusammen. Weihnachtsmärkte seien für die Bevölkerung interessant, ebenso christliche Weihnachtslieder, weshalb viele jüdische Einwohner von Kirche zu Kirche zögen, um die Weihnachtsmusik zu genießen. Aus diesem Grund werde die Christmette zu später Stunde am Heiligen Abend nur intern in der Gemeinde bekanntgegeben. Andererseits falle auch das jüdische Chanukka-Fest in diese Zeit –ebenfalls verbunden mit Kerzenlicht und süßen Speisen wie Krapfen. Mit einem Bild aus Haifa, wo zur Weihnachtszeit ein Weihnachtsbaum, der Davidstern und ein islamischer Halbmond nebeneinander aufgestellt sind und damit die drei Religionen in eine Eintracht gebracht werden, schloß Buß seinen Vortrag.
Die Diskussionsbeiträge beinhalteten die Verbreitung europäischer beziehungsweise amerikanischer Weihnachtstraditionen wie Weihnachtsmann, Tannenbaum oder rote Mützen auch in diesen Regionen, die Bedeutung Jesu im Islam und die Rolle des Christentums dort. Buß bestätigte, daß die Tannenbaumtradition auch in Israel und Palästina verbreitet sei. Die Geburtsgeschichte Jesu sei zwar auch im Koran festgehalten, die Religionen trenne aber, so Buß, der Gedanke der Inkarnation, daß Jesus Gott und Mensch zugleich sei. „Es gibt keine Bekämpfung des Christentums, keinen Kreuzzug gegen das Christentum“, stellte Gregor Buß fest und rückte die Funktion des Brückenschlagens durch die Christen in den Mittelpunkt, also die Kooperation mit den anderen Religionen.
Schon oft stellte der aus dem Böhmerwald stammende Autor und Erzähler Reinhold Fink schöne Stücke aus seiner Sammlung von Postkarten, Andenken und Erinnerungsstücken in dieser Zeitung vor. In einer der alten Veröffentlichungen vom 1884 gegründeten Deutschen Böhmerwaldbund entdeckte er den Budweiser Zeichner und Maler Franz Landspersky, über den er hier berichtet.

Die Spurensuche nach diesem Zeichner und Maler gestaltet sich nicht einfach. Daten und weiterführende Informationen aus seinem Leben sind spärlich gesät, auch fehlte seither ein Gesamtüberblick in der Heimatliteratur über seine Werke. Verschiedene Indizien, seien es die Geburts-, Hochzeits- und Sterbematrikel, etliche Veröffentlichungen seines künstlerischen Schaffens und zeitgenössische Zeitungsartikel ergeben jedoch einige Hinweise.
Wettbewerb in Budweis
Franz Karl Landspersky wurde am 7. März 1874 als Sohn des Keramikers Karl Landspersky und dessen Frau Antonia Katharina geboren. Eine frühe Erwähnung von Franz Landspersky findet sich in einem Bericht des Verwaltungsausschusses des Städtischen Museums von Budweis für die Jahre 1892 und 1893. Hier fand am 17. Mai 1892 eine Ausstellung der gewerblichen Schülerarbeiten statt, und etliche davon wurden für ihre Arbeit ausgezeichnet. Der Bürgermeister
Der Autor
Reinhold Finks Vorfahren stammen aus dem Kreis Krummau im Böhmerwald, was zu einer lebenslangen Beschäftigung des Ingenieurs mit dieser Region führte. Fink war nach einem Studium des Maschinenbaus als Diplom-Ingenieur (FH) über 20 Jahre lang im Bereich Entwicklung und Konstruktion und anschließend im leitenden Ideenmanagement tätig. Fink veröffentlichte Romane und kulturelle und heimatliche Abhandlungen und engagiert sich im Deutschen Böhmerwaldbund.
Josef Kneissl verlieh die Prämien, Widmungen in Gold und Silber und Medaillen des Deutschen Böhmerwaldbundes.
Unter den Preisträgern war auch Franz Landspersky. Als Porzellanmaler bei der bekannten Firma L. & C. Hardtmuth erhielt er den vierten Preis für seine Geschirrmalereien.
Am 9. Juni 1909 heiratete der 35jährige Franz die 15 Jahre jüngere Zimmermannstochter Maria Řiha in Budweis. Sein Beruf war in der Hochzeitsmatrikel mit Bauzeichner angegeben.
� Das Leben des Franz Landspersky
Budweiser Künstler
Der Deutsche Böhmerwaldbund gab ab den 1890er Jahren etliche Ansichtskarten heraus. Einige Künstlerkarten davon sind von Franz Landspersky signiert. Die ab 1909 erschienenen Ansichten zeigen einen Blick auf Oberplan, „Heilgruß aus Stifters Heimat“, und Trachtenpaare beim Volkstanz aus der „Deutschen Sprachinsel Budweis“. Aus der Zeit des Ersten Weltkrieges stammen zwei Propagandakarten „Hand weg!“, die einen germanischen Krieger zeigen, der das bedrohte Budweis verteidigt. 1918 erschien mit dem Bildnis von Adalbert Stifter und dem Plöckensteiner See eine Gedenkkarte zur „50sten Jahrung des Todestages“ des Dichters.

im Maßstab 1:50 000, die der Deutsche Böhmerwaldbund in Budweis herausbringt. Der Ausschnitt zeigt die Gegend um Oberplan.
Rosenberg an der Moldau und dessen alte Schloßanlage oder auf ein altes Bauernhaus bei Böhmisch Röhren. Alle Kartenmotive sind mit dem Abzeichen des Deutschen Böhmerwaldbundes versehen. So auch eine Karte, die das deutsche und tschechische Sprachgebiet und dessen Grenze im Böhmerwald zeigt.
Andere Karten zeigen heimatliche Motive, sei es ein Blick auf
Eine Gruppe in der prächtigen Tracht der Budweiser deutschen Sprachinsel führt einen Volkstanz vor.

Für den Deutschen Böhmerwaldbund zeichnete Landspersky um das Jahr 1910 eine
„Übersichtskarte für den südlichen und mittleren Böhmerwald“. Im Jahr 1911 erschien sein gezeichneter Stadtplan von Budweis. Ein tschechischer Stadtplan von České Budějovice ist unterzeichnet mit: „Kres Fr. Landspersky, městský stavební asistent, 1923“ (Zeichnung Fr. Landspersky, städtischer Bauassistent, 1923).

Auch andere Pläne zeichnete Landspersky, beispielsweise die 1911 veröffentlichte Zeichnung „3. Viertel der inneren Stadt Budweis aus dem Jahre 1824 mit den (schwarz schraffirt) eingezeichneten Juden-Häusern und Friedhof“. Im vom Böhmerwaldbund herausgegebenen „Führer durch den Böhmerwald“, beispielsweise in der 5. Auflage von 1929, zeichnete Landspersky einzelne Landkarten.
Landspersky war tätig in der Wandergesellschaft Leitersteiner. Dieser Zusammenschluß, vornehmlich aus jungen Turnern bestehend und benannt nach einer Felsgruppe auf dem Kamm des Schöninger-Berges, organisierte ab 1906 Wanderungen durch den Böhmerwald. Sie trafen sich in Budweis im Gasthaus Orth in der Linzer Straße zu Planungen und auch zu kulturellen Veranstaltungen und Vorträgen.
lung der Leitersteiner berichtet. Franz Landspersky wurde als Zeugwart und sein Bruder Karl als Obmann gewählt.
Das „Prager Tagblatt“ berichtete am 6. Juni 1906 über die Gauturnfahrt des Maltsch-Moldau-Turngaues nach Rosenberg. Bei den Turnwettkämpfen am Gauturntag errang Franz Landspersky den zweiten Platz von den 33 angetretenen Turnern. Im Jahr 1907, so das „Prager Tagblatt“ vom 10. Januar, wurde er in Budweis in den Turnrat des Deutschen Turnvereins gewählt. Im „Prager Tagblatt“ vom 21. März 1908, findet sich ein Bericht über eine Veranstaltung der Tischgesellschaft Adler Gmoa in Budweis, zu der auch Bürgermeister Josef Taschek erschien.
Im Rahmen der Tagung wurde ein von Landspersky „prächtig ausgeführtes Diplom“ als Anerkennung des „nationalbewußten Wirkens“ überreicht.
Als Revident des städtischen Bauamtes wird Landspersky im 1930 erschienenen „Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis“ von Karl Kratochwil und Alois Meerwald bezeichnet. Von Landspersky sind 13 Bilder, Zeichnungen und Fotos veröffentlicht. So zeichnete er nach einer alten Vorlage einen „Blick auf Budweis von der
Lannaschen Schiffswerft aus“. „Das ehemalige Linzer oder Krummauer Tor“ zeigt die Befestigungsmauern des Zwingers. Weit in die Stadtgeschichte zurück führt das Bild „Das Budweiser Rathaus im 16. Jahrhundert“ mit dem 1555 erbauten Rathaus und dessen Turm. 1727 bis 1730 wurde das alte Rathaus von einem italienischen Baumeister im Stil der Renaissance umgebaut, dies zeichnete Landspersky mit dem Bild „Das Budweiser Rathaus zu Ende des 18. Jahrhunderts“. Etliche Häuser und Bauwerke der Stadt Budweis finden sich auf seinen Zeichnungen, so etwa das „ehemalige Großbräuhaus mit dem Henkerturm“ oder der „ehemalige Mandaturm vom Zwinger aus gesehen“.
Budweis im Bild
Ein historisches Bild zeigt die „Budweiser Stadtpfarr- und Domkirche bis zum Jahr 1912“, danach wurde das Gotteshaus umgestaltet. Ein altes, prächtiges Bürgerhaus mit einer Barockfassade, das „Neuwerthhaus in der Traubengasse“ erinnert an die Zeit des österreichischen Architekten Fischer von Erlach (1656–1723). Eine Federzeichnung zeigt die „Ecke Ringplatz-Landstraße zu Beginn des 17. Jahrhunderts“.
Das Leben der Familie endete tragisch. In den Tagen zwischen dem 10. und 12. Mai 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, begingen Franz Landspersky, seine Frau Maria und deren 1931 geborene Tochter Hilda in der Roseggerstraße 35 in Budweis Selbstmord.
Künstlerpostkarte von Rosenberg an der Moldau, Deutscher Böhmerwaldbund, Nr. 25.

Der „talentierte Maler“ Franz Landspersky „stellte seine Kunst in den Sinn der Sache“. Bald wurde auch der Obmann des Deutschen Böhmerwaldbundes, Josef Taschek, auf diese jungen Leute aufmerksam und besuchte regelmäßig ihre Treffen und Unternehmungen. In der Folge wandelten sich die Leitersteiner zu einer touristischen Böhmerwaldbundesgruppe. In der Budweiser Zeitung vom 16. Januar 1912 wurde über die Hauptversamm-
„Das Budweiser Rathaus zu Ende des 18. Jahrhunderts“ in „Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis“ (1930).

Im Haus des Deutschen Ostens in München (HDO) wurde in der Programmreihe „Ostsee – Mehr als nur ein Meer“ der Film „Seestück“ (2018) von Volker Koepp gezeigt. Kloepp gab im Gespräch mit HDO-Direktor Andreas Otto Weber Auskunft über sein Werk.
Wenn ich an Seestücke denke, dann denke ich zuerst an die großen filmischen Bilder, die ich mit oder ohne Kamera an der Ostsee erlebt habe“, erläuterte Volke Koepp. „Natürlich sind es auch die Darstellungen in der Malerei, die immer wieder in Gedanken aufscheinen.“ Schließlich sei der Begriff Seestück ein fester Terminus in der Bildenden Kunst, gebräuchlicher noch als Landstück. Sein Film „Seestück“ ist ein Film über die Meereslandschaft der Ostsee und die Menschen, die an ihren Küsten leben – ganz im Sinne der aktuellen HDO-Programmreihe. Denn die Küstenbewohner im geographischen Raum der Ostsee teilen eine lange Geschichte, nicht nur des kulturellen Austauschs und Handels, sondern auch der Kriege, Teilungen und Vertreibungen.

Massive Umweltprobleme
Die Gegenwart ist geprägt von den Hoffnungen und Enttäuschungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Immer wieder brechen alte und neue Konflikte auf. Hinzu kommen massive Umweltprobleme. Wie die Verschmutzung der Ostsee durch Müll oder Gifte und Düngereintrag aus der Landwirtschaft. Der Rückgang der Fischbestände trifft vor allem die kleinen Familienbetriebe der Fischer, deren

Volker Koepps „Seestück“

Arbeitsplatz die Ostsee war und ist. Quer durch Naturschutzräume werden Gaspipelines am Meeresboden verlegt. Offshore-Windanlagen entstehen in großer Zahl, Häfen werden für Großtanker erweitert. Millionen Menschen überqueren die Ostsee auf riesigen Kreuzfahrtschiffen.
Die Ostsee ist auch Industriegelände.
Vor diesem Hintergrund erzählen im Film die Protagonisten – sensibel befragt von Volker Koepp – von ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Ängsten und Hoffnungen. Sie entwerfen ein Bild von unserer Gegenwart, in der ökologische Probleme, politische OstWest-Konflikte und nationale Sichtweisen auf globale Entwicklungen treffen. Auch die Ukraine, während der Drehzeit schon massiv von Wladimir Putin bedroht, ist mehrfach Thema. In der Region zwischen Weichsel im Westen und Wolga im Osten hatte Koepp schon 2012/2013 „In Sarmatien“ gedreht und auch die ukrainischen Städte Odessa, Lemberg und Tschernowitz dargestellt.
In „Seestück“ geht es zusätzlich auch um die Mythen und
Geschichten über das Baltische Meer, das seit jeher Maler, Literaten und Philosophen inspirierte. Die Gespräche im Film kreisen so auch um Caspar David Friedrich, Nikolaus Kopernikus, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant.
Koepp beginnt seine filmische Reise auf der deutschen Insel Usedom und reist weiter über den Greifswalder Bodden und Rügen zur schwedischen Schärenküste bei Simpnäs. Von dort geht es nach Königsberg, zum lettischen Strand am Kap Kolka


und zum estnischen Fischerdorf Lindi. Dann zurück zu den Fischern vor Usedom, nach Warnemünde und zum Badeort Swinemünde, von Rügen auf die dänische Insel Bornholm und über Lettland zum russischen Teil der Kurischen Nehrung und wieder zurück nach Greifswald.

Gedanklich schließt „Seestück“ im Besonderen an Koepps vorhergehenden Film „Landstück“ an, der 2015 in der Ukkermark gedreht wurde und von Bodenspekulation und den ökologischen Folgen einer industri-
ellen Landwirtschaft erzählt. Ähnlich werden auch in „Seestück“ besonders der Raubbau und die Umweltsünden des Menschen angeprangert. Ein Meeresforscher faßt die Geschichte der Ostsee zusammen: „Zuerst ein Binnenmeer mit Süßwasser, dann ein Meer mit Salzwasser und heute mit Brackwasser.“




Mit „Seestück“ schließt Volker Koepp zudem einen filmischen Zyklus ab, den er mit „Berlin-Stettin“ (2010) begann. „In Sarmatien“ (2013) erweiterte Koepp den Blick auf die Region östlich der Weichsel und zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee. Mit „Landstück“ (2016) kehrte er in die Ukkermark nördlich Berlins zurück.
In „Seestück“ mischt der Regisseur in seine Beschreibung ostdeutscher Lebensräume auch Autobiografisches. Wie in den Filmen zuvor spiegeln sich hier die großen Bögen der Historie in den Lebensläufen der Menschen und ihrer Gegenwart.

Den Filmemacher hatte eingangs Andreas Otto Weber vorgestellt: „Wir haben heute einen außergewöhnlichen Gast“, freute


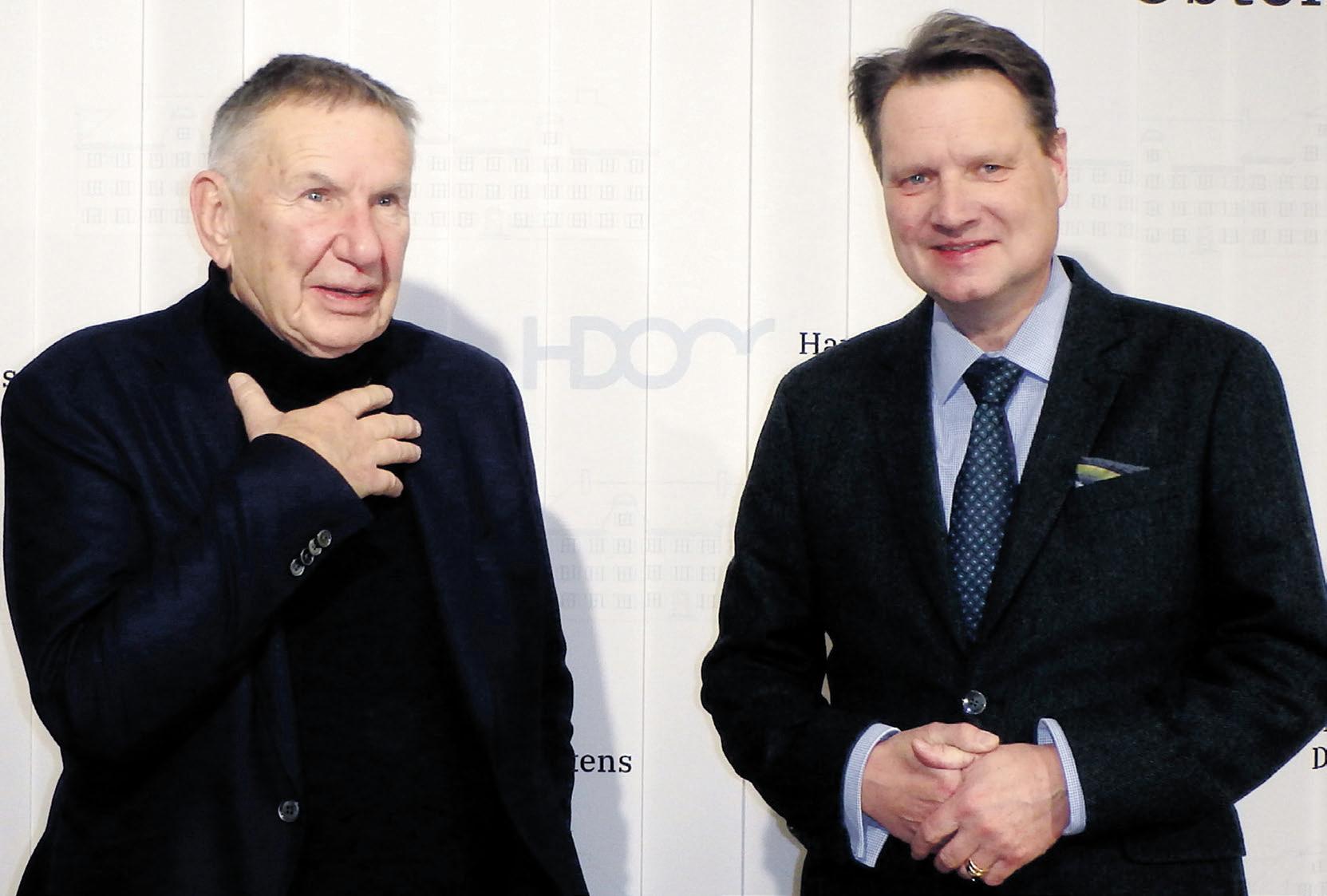
sich der HDO-Direktor. Geboren 1944 im pommerschen Stettin, studierte Volker Koepp an der Technischen Universität Dresden und an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg, wo er 1969 sein Diplom machte. Anschließend arbeitete er bis 1991 als Regisseur im DEFA-Studio für Dokumentarfilm in Potsdam und Berlin.
Danach machte Koepp sich als Regisseur, Autor und Produzent selbstständig und gründete „Vineta Film“. Er gewann international Preise, so den Georg-DehioPreis des Deutschen Kulturforums östliches Europa für den Film „Die Wismut“ (1993), den Direktor Weber besonders erwähnenswert fand. Erst vor zwei Wochen wurde Koepp in der Kleinstadt Wittstock in Brandenburg, über die er eine siebenteilige Reihe gedreht hatte, mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet. Susanne Habel
Gudrun Gaube und Sabine Dietrich berichten über das vergangene Vereinsjahr der thüringischen SL-Ortsgruppe Altenburg.
Im Februar fuhren wir an zwei Wochenenden mit 50 Personen pro Fahrt zum Schnitzelfranz nach Wildstein im böhmischen Vogtland. Diese Fahrten sind begehrt. Bei gutem Essen, leckerem Bier, original böhmischer Musik herrscht eine tolle Stimmung. Bei einer kleinen Rundfahrt kann man sich vom Essen und Trinken erholen und sich an der Landschaft erfreuen. Am Abend geht es dann leider wieder nach Hause. Ortsobmann Erhard Roth organisiert diese Fahrten für die Ortsgruppen Altenburg, Meuselwitz, Lucka und Langenleuba.
Im Frühjahr trafen wir uns nach der langen Coronapause zu einer Kaffeerunde. Alle waren freudig zu dieser gemütlichen Veranstaltung gekommen. Mit einem Kleinbus fuhren wir am Pfingstsonntag zum Sudetendeutschen Tag nach Hof. Alle sieben Insassen waren gespannt auf das große Programm in der Stadthalle, und sie wurden auch nicht enttäuscht. Es war viel los.
Jährlicher Höhepunkt in der Vereinsarbeit sind die beiden Sechs-Tages-Fahrten ins Riesengebirge nach Spindlermühle.
Unser Hotel, in dem wir seit rund 20 Jahren Gäste sind, bietet zum Frühstück und Abendessen ein großes Büffet. Gepflegte Gaststätten, eine Wellness-Oase und viele Sportmöglichkeiten laden ein. Beim Bowlingabend und der Tanzveranstaltung werden überflüssige Pfunde abgebaut. Mit wechselnden Tagestouren und der Bewirtung unterwegs sind die Tage gut ausgefüllt. Ein großer Dank gebührt unserer Reiseleiterin Margit Bartosová. Dank ihrer Kompetenz und ihres Frohsinns ist sie von allen gern gesehen und zählt schon zu uns.
Im Oktober fanden die letzten Fahrten nach Wildstein statt. Bei denen fahren die Landsleute der Ortsgruppe Ronneburg im Kreis Greiz gerne mit.
Letzter Höhepunkt des Jahres war die Weihnachtsfeier. Bei Kaffee, Stollen, Lebkuchen und Plätzchen dachten wir an frühere Zeiten und waren auf den Basar gespannt. Er bot schöne Dinge aus der Aesculap-Apotheke, der Klosterapotheke und kleine Geschenke, die durch private Spenden von den Spendenempfängern als Dank geschickt wurden. Vielen Dank an diese beiden Apotheken und die Spender. Bei einem Programm der Kinder des Kindergartens Spatzennest verging die Zeit im Fluge. Vielen Dank den Kindern für die lustige Darbietung. Zum Schluß erhielt jeder ein Weihnachtssäckchen, das gespannt begutachtet wurde. Wie schon seit vielen Jahren wurde eine Spendenaktion für die Elterninitiative krebskranker Kinder in Jena durchgeführt, bei der 322,50 Euro eingingen und die bereits überwiesen wurden. Unsere Gruppe hat 32 Mitglieder. 2022 starben vier Mitglieder, zwei Mitglieder sind neu. Erhard Roth organisiert das Programm und alle Veranstaltungen. Wir danken unserem Obmann für seine ehrenamtliche Arbeit von Herzen.
Ein halbes Jahrhundert Handarbeit
Anfang Januar fand wieder die traditionelle Werk- und Handarbeitswoche auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen statt, zu der Traudl Kukuk nun schon mehr als 50 Jahre einlädt. Die Wurzeln der Teilnehmer liegen seit jeher vornehmlich in den ehemaligen ostdeutschen Gebieten wie dem Sudetenland oder Schlesien.


Klöppeln, Malen, Sticken, Weben, Stricken, Knüpfen: So vielfältig waren wieder die Handarbeiten der Damen, die der Einladung zum Heiligenhof gefolgt waren. Egal ob einfach oder anspruchsvoll und aufwendig gearbeitet, Handarbeiten vereinen Kreativität und Entspannung mit
Leidenschaft, Können und Tradition. So mannigfaltig wie die Materialien und Techniken waren die Ergebnisse.
Nicht außer Acht zu lassen ist, daß Handarbeit verbindet. So konnten die Teilnehmerinnen, die schon viele Jahre zu den Werkwochen kommen, aber auch Neulinge ihr Wissen und ihre Erfahrungen austauschen und Neues lernen. Wichtig für die Teilnehmer sind aber auch die tiefe freundschaftliche Verbundenheit untereinander sowie die familiäre Atmosphäre. Man ist schließlich miteinander alt geworden. Aber man freut sich auch über Neue.
Mitbegründer der traditionellen Werk- und Handarbeitswo-

chen in der Bildungs- und Begegnungsstätte Heiligenhof waren Erich Kukuk und die Niederschlesierin Gerda Benz, die in Herne im Ruhrgebiet ein neues Zuhause gefunden hatte. Ihre Tochter führt ihre Tradition weiter. Älteste Teilnehmerin war heuer die 92jährige Mittelfränkin Käthe Teletzky, deren Mann aus dem Sudetenland vertrieben worden war. Sie ist seit 1980 ununterbrochen dabei.
Die nächste Werk- und Handarbeitswoche Anfang Januar 2024 ist bereits geplant. Interessierte können sich ab November beim Heiligenhof informieren und anmelden: Telefon (09 71) 7 14 70, eMail info@heiligenhof. de Wolfgang Theissig
Mit Musik ins neue Jahr
Der KV Graslitz startete mit wunderbarer Musik ins neue Jahr. Zunächst bot das Karlsbader Stadttheater ein Neujahrskonzert, dann gab Chorea Nova aus Neurohlau ein Dreikönigskonzert.
Die Ankunft des neuen Jahres begrüßten die Mitglieder des Kulturverbandes in Graslitz mit einem Konzert des Karlsbader Stadttheaters. Mit dem Johann-Strauss-Orchester „Die flotten Geister“ aus dem oberfränkischen Coburg und seinen Solisten, der Sopranistin Luisa Albrecht und dem Tenor Milan Vlček, ließen wir uns von den wunderschönen und unvergänglichen Melodien von Johann Strauss mitreißen. Diese waren von den schönsten Walzern Franz Lehars, Emmerich Kalmans, Oskar Nedbals aus den Operetten „Giuditta“, „Gräfin Mariza“, „Die Csardásfürstin“ und „Polnisches Blut“ durchwoben.

Die Kompositionen von Johann Schrammel, Jules Massenet, Robert Stolz und Philipp Fahrbach füllten uns mit Temperament und Zuversicht. Diese Veranstaltung hatten das Kulturministerium und die Städte Graslitz und Rothau unterstützt.
Marešová
Der Kulturverband Graslitz veranstaltete mit der römisch-katholischen Kirchengemeinde in der Fronleichnamskirche in Graslitz ein Dreikönigskonzert. Der Chor „Chorea Nova“ aus Neurohlau bei Karlsbad stellte sich vor. Den 20köpfigen gemischten Chor leitete Pavlína Petříková.

„Chorea Nova“ wurde 2004 gegründet. Während der regelmäßigen Proben in der Grund-
Weihnachtslieder, Volkslieder und Evergreens von Jiří Suchý und Jiří Šlitr.
Die Angehörigen der Pfarrgemeinde Graslitz unter der Leitung von Pater Bystrík Feranec hatten die Fronleichnamskirche festlich geschmückt, sie beleuchtet und eine große Weihnachtskrippe zugänglich gemacht. So erlebten die Konzertbesucher eine wunderbare Atmosphäre, die an die Mitternachtsmesse erinnerte.

Heiligen

schule erklingt und erzittert das Gebäude von den vielen Stimmen. Es spricht sich herum, daß die Mitglieder des Chores sehr erzählfreudig sind. Die einzige Möglichkeit, so viele Menschen zu beherrschen, besteht darin, gemeinsam zu singen, am besten vielstimmig. Die Mitglieder des Ensembles singen vor Freude und haben viel Vergnügen bei den Proben. Das Konzert in Graslitz bot Kirchenmusik, Spirituals,
Festliche Erlebnisse nahmen die Besucher mit nach Hause. Fast 100 Menschen aus Graslitz und Umgebung und sogar aus Klingenthal im sächsischen Vogtlandkreis hatten sich in der Kirche versammelt. Das Publikum war erstaunt über das perfekte Zusammenspiel und das Können der Chorsänger, der Pianistin, der Geigerspielerin und der sensiblen und souveränen Leitung der Dirigentin Pavlína Petříková. Die Auswahl der Kompositionen war auch sehr vielfältig, neuartig und ging über die übliche Auswahl von Liedern bei ähnlichen Chören hinaus. Die Interpreten selbst lobten die perfekte Akustik der großen Fronleichnamskirche. Sie versprachen sich und uns, gerne wiederzukommen.


Die von der Tschechischen Caritas organisierte Dreikönigssammlung fand in Netschetin und Umgebung heuer schon zum vierten Mal statt.
Die Christen im Bund der Deutschen in Böhmen organisierten mit der Manetiner Pfarrei, der Gemeinde Netschetin, deren Grundschule und Museum eine dreitägige Sammlung für das Haus des heiligen Laurentius in Metzling bei Taus. In diesem Haus wird geistig kranken Menschen geholfen, ihre sozialen Fähigkeiten zurückzubekommen und sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern.
ne trug. Die „echten“ Heiligen Drei Könige waren Richard Šulko der Jüngere, Kristýna Šulková und Karoline Šulková.
Heuer wurden so viele Häuser besucht, wie noch nie. Deswegen dauerte der Rundgang in dem kleinen Dorf zwei Stunden. Das erfreulichste war, daß einige schon warteten, um das Dreikönigszeichen CMB auf ihre Tür zu bekommen. Speziell erwähne ich die drei Neubauten unter der Dorfkapelle, das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft der Dorfgemeinschaft.
D
en Anfang machte bei Frühlingswetter der Måla Richard an seinem Haus. „Christus segne dieses Haus“ („Christus mansionem benedicat“), sagte er und änderte mit einer gesegneten Kreide die Jahreszahl von 22 auf 23. Dann ging die Dreikönigsgruppe zum zweiten Haus bei der Dorfeinfahrt. Eigentlich waren es in diesem Jahr vier Könige, weil die verantwortliche Leiterin der Sammlung, Irena Šulková, auch eine Kro-
Für den kleinen Balthasar, welchen die vierjährige Karoline darstellte, kam der Höhenpunkt jedoch bei der letzten Station: Der Rodeo-Pferde-Züchter Petr Stříbrný hob sie in den Sattel, und die kleine Karoline war ganz glücklich. Interessant war, daß sie auf dem Pferderücken keine Angst hatte, welche sie aber beim Singen von Weihnachtsliedern gezeigt hatte. Danke an alle Spender, die trotz der angespannten finanziellen Lage an Menschen denken, denen es wirklich schlecht geht. do
 Jitka
Petr Rojík
Jitka
Petr Rojík
Anna Tomaschko erinnert sich an das Ende des Zweiten Weltkrieges, als ihre heile, dörfliche Welt verloren ging und nie mehr zurückkehrte.
Die Front rückte näher, schon hörten wir fernen Kanonendonner, Angst und Unsicherheit breiteten sich aus. Auch wir hatten schon erfahren, was Mädchen und Frauen von den russischen Soldaten angetan wird. Wie sollten wir versuchen, uns zu schützen? Niemand wußte Rat. In den Nowak-Fabriken war es mit dem geregelten Arbeitsalltag vorbei. Als alles still stand, lag eines Morgens ein Haufen Arbeitsschuhe im Hinterhof. Aber als ehrliche Leute trauten sich nur wenige, ein Paar zu nehmen. Auch in der Hutfabrik herrschte Chaos. Die Türen standen offen, die schönen Damenhüte lagen überall verstreut. Wir jungen Mädchen schauten neugierig in die Zimmer, setzten auch den einen oder anderen Hut auf, aber der Spaß blieb auf der Strecke.



Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht bedingungslos, der Krieg in Europa war damit offiziell beendet. An diesem Tag kamen deutsche Soldaten auf dem Rückzug in den Ort und machten kurze Rast.
Als sie am Morgen weiterzogen, schlossen sich ihnen etliche junge Mädchen an, in der Hoffnung auf Sicherheit. Diese war jedoch trügerisch, denn bald holten sie die Besatzer ein, und sie waren ihnen ausgeliefert.
Der 9. Mai 1945 war ein wunderschöner Frühlingstag, doch niemand konnte sich an der Natur erfreuen. Zu groß war die Ungewißheit, was wir an diesem Tag noch fürchten müssen. Nachmittags um drei Uhr waren schon die ersten russischen Pferdewagen durch das Dorf gerollt. Als aber alles ruhig blieb, schöpften wir Hoffnung. Die Nachbarn versammelten sich, um mehr Schutz in der Gemeinschaft zu haben. Als wir uns abends warme Sachen holen wollten, war der Weg versperrt. 15 Soldaten drängten in unsere Stube. Wir mußten Kartoffeln braten, dann schleppten sie eine große Kanne voll Wodka

herein, von dem sie sich reichlich bedienten. Dies hatte zur Folge, daß sie meine Schwester und mich immer mehr bedrängten. Gerettet hat uns ein russischer Offizier, der plötzlich in der Tür stand. Die Mutter mußte Stroh holen, und er befahl den Soldaten, sich hinzulegen.
Zur Mittagszeit des nächsten Tages stolperte ein betrunkener Mongole zur Tür herein und bedrohte die Mutter mit dem Gewehr. Wir flüchteten, seine Schüsse verfehlten uns. Wir wußten aber nun, daß wir nicht zu

schwer arbeiten und Hunger und Mißhandlungen ertragen mußten. Manche wurden zu längeren Haftstrafen verurteilt und konnten erst spät zu ihren Frauen aussiedeln. Noch gefürchteter war ein Lager bei Olmütz, als Hölle von Hodolein berüchtigt. 900 Menschen, auch Kinder, wurden dort ermordet. Eine Tafel am Altvaterturm erinnert an die Opfer.
Der erst 14jährige Oswald Kopal und der alte Eugen Nowak sollten das Gefallenendenkmal in Brodek zerstören, für die beiden ein hartes Stück Arbeit. Trotz der schadenfrohen tschechischen Gaffer gelang es dem jungen Oswald, die Gedenkschrift von 1903, die im Sockel deponiert war, mit einer List in Sicherheit zu bringen. Ein wertvolles Dokument war gerettet.
Die meisten Bewohner hatten aber ihre Sachen gut versteckt, eingemauert oder vergraben. Mit den anderen Schikanen hatte man sich abgefunden wie mit der Armbinde mit dem weißen N oder der Sperrstunde um 21 Uhr.
Die Gerüchte über die Vertreibung aus der Heimat breiteten sich aus, aber niemand wollte sie glauben. Im Juli 1946 war unser Schicksal besiegelt. Der erste Transport verließ Deutsch Brodek. Erst mit dem Lastauto in das Lager Lutein, wo nochmal kontrolliert und manches liebe Erinnerungsstück weggenommen wurde.
Im Jahr 1880 gründete Eugen Nowak I. im Sprachinselort Deutsch Brodek die erste mährische Strohhutfabrik.
Eugen Nowak II., geboren 1873, bekam von seinem Vater Eugen Nowak I. zur Hochzeit mit Juliane Bittner als Ausstattung einige Nähmaschinen und Hutpressen. Ein paar geschickte Arbeiter standen ihm zur Seite, und so konnte er 1904 im Hause seiner Frau eine eigene Existenz aufbauen. Nach sechs Ehejahren starb Juliane. Tochter Krimhilde verlor ihre Mutter. Seine zweite Frau wurde die Handarbeitslehrerin Marie Grulich aus Runarz. Sie schenkte ihm drei Söhne: Eugen, Otto und Josef. Die Betriebsräume mußten bald erweitert werden, denn das Sortiment wurde umfangreicher. Filz
Hause bleiben konnten. Bei der Familie in Ölhütten, wo ich das Pflichtjahr gemacht hatte, fanden wir mit anderen Mädchen im Hohlraum des Schüttbodens Schutz und überstanden so die ärgsten Tage. Viele Frauen haben Schlimmes erlebt. Auch Kinder wurden durch die Vergewaltigungen gezeugt. In Panik versuchten mehrere Frauen, sich das Leben zu nehmen.
Jeder Tag brachte neue Schrecken. Bürgerschuldirektor Gustav Schmid wurde in seiner Wohnung erschossen. Elf deutsche Fernmeldesoldaten wurden brutal ermordet und verstümmelt vor dem Friedhof abgelegt. Die ganze Bevölkerung mußte vom Marktplatz aus an ihnen vorbei laufen.
Im Sommer 1945 wurden viele Männer aus der Sprachinsel nach Littau ins Lager gebracht, wo sie

Schon bald begann auch die Enteignung der Bauern. Josef Gröpl aus Döschna erzählt: „Im tschechischen Nachbarort wohnte eine Familie mit sechs Söhnen, die auch schon Familie hatten. Im Herbst 1945 kam der älteste, Bonifatius, und suchte sich den schönsten Bauernhof aus, zwang kurz vor Weihnachten die Bewohner binnen weniger Stunden das Haus zu verlassen, ohne sich um deren Unterkunft zu kümmern. Kurze Zeit später suchte er für seinen Bruder einen Besitz. Am 20. Februar, einem stürmisch kalten Tag, stand er um sieben Uhr vor unserer Tür und forderte uns auf, das Haus binnen drei Stunden zu räumen.
In Eile packten wir ein paar Sachen und brachten sie zu meiner Großtante. Um 10 Uhr verwehrte er uns den Zutritt ins Haus. So standen wir draußen in der Kälte und mußten uns eine Bleibe suchen.“
Auf diese Weise ergaunerten sich auch die anderen Brüder einen Hof. Die jungen Mädchen wurden von den Bauern aus den umliegenden tschechischen Dörfern zur Arbeit geholt. Ich durfte erst einen Tag vor der Aussiedelung heim. Täglich zogen die Plünderer durch das Dorf. Alles, was mehr oder minder wertvoll erschien, wurde mitgenommen.
Dann, 30 Personen mit je 70 Kilogramm Gepäck in Güterwaggons gepfercht, ging es nach langer Fahrt über die Grenze Richtung Württemberg. Vier weitere Transporte folgten. Nach Hessen, Ober- und Unterfranken. Lehrer Kuba erreichte bei den Behörden, daß Familien, Freunde und Nachbarn auf Wunsch zusammen ausgesiedelt wurden. Am schmerzlichsten war die Vertreibung für die alten Leute. Manche hofften bis an ihr Lebensende auf die Heimkehr.
Der Anfang in der neuen Heimat war schwer. Hunger und Wohnungsnot entmutigten die Menschen. Doch nach ein paar schwierigen Jahren wurden die neuen Mitbürger, auch unsere tüchtigen, fleißigen Sprachinsler, in ihrer Leistung anerkannt. Sie hatten die erlernten Fähigkeiten gleich wieder eingesetzt, sich eine neue Existenz geschaffen und Häuser gebaut. Ihre Kinder besuchten zum Teil die höhere Schule und studierten. So konnten sich viele ein erfolgreiches Leben sichern.
Daß die Landsleute sich nicht ganz aus den Augen verloren, dafür sorgte wiederum Familie Kuba. Schon 1947 wurden Adressen gesammelt und mit Bleistift auf Postkarten die Einladungen zu einem Treffen der Sprachinsler nach Limburg an der Lahn geschrieben und verschickt. Allmählich wurden alle Aufenthaltsorte bekannt, und aus aller Welt strömten die Landsleute zusammen, um alljährlich zu unserer „Foahrt“ an Peter und Paul um den 29. Juni ein fröhliches Wiedersehen zu feiern. Pfarrer Madea, der alle ehemaligen Pfarrkinder noch mit Namen kannte, hielt mit Pfarrer Pollak den Gottesdienst in der Stadtkirche. Gesungen wurde die vertraute Deutsche Messe von Franz Schubert.
Im August 2021 eröffnete die private Dauerausstellung „Sprachinsel Deutsch Brodek“ in Deutsch Brodek im früheren Kreis Mährisch Trübau und einst der Hauptort der Sprachinsel am Südostrand des Schönhengstgaus. Sie erinnert an die Deutschen, die einst vertrieben worden waren (Þ SdZ 1+2/2022). Im August feierte das Museum ersten Geburtstag, und eine Gedenktafel wurde enthüllt.


Nowak, gebeten, im Himmel Fürsprache für gutes Wetter zu halten. Der Vormittag stand im Zeichen der letzten Vorbereitungen und leichter Nervosität.





und anderes Geflecht kamen dazu. Auf elektrischen Nähmaschinen wurden neben Herrenhüten auch moderne Damenhüte hergestellt, geschmückt mit Blüten und Ranken traten sie die Reise in alle Welt an.
Die Söhne Eugen und Otto besuchten die Handelsschule und stiegen in den väterlichen Betrieb ein. Otto kaufte mit seinem Vater die ehemalige Fabrik Aberle und stellte dort Schuhe her, im Krieg auch Gasmasken. Außerdem gründeten die Brüder eine Fabrik zur Produktion von Herrenbekleidung, mit einer Zweigstelle in
Wachtl. Eugen jun. holte sich eine Frau, Isolde Grammel, aus einem Erbhof in Mährisch Neustadt, und bekam zwei Söhne.

Otto heiratete die Lehrerin Gertrud Helfert und hatte einen Sohn.
Eugen Nowak war ein geachteter Unternehmer, dem das Wohl seiner Arbeiter und seiner Heimat am Herzen lag. Er war auch Bürgermeister und Förderer kultureller Belange. Das Schicksal setzte ihm hart zu. Keiner seiner Söhne überlebte den Krieg. Josef fiel als Kradfahrer in Polen, Otto blieb in Stalingrad vermißt, Eugen floh
Anfang Mai 1945 mit einer deutschen Truppe, die von Partisanen bei Stefanau bei Olmütz überfallen wurde. Der Vater verlor nicht nur seine Söhne, sondern durch die Vertreibung auch sein Lebenswerk. Viele Menschen der Sprachinsel sind ihm Dank schuldig. Dank der Verdienstmöglichkeit in den Betrieben konnten sie ihren Lebensunterhalt sichern. Eugen Nowak starb 1949 mit 76 Jahren, seine Frau Marie 1962 mit 88 Jahren. Sie lebte zuletzt in Geborgenheit bei ihrer Stieftochter und Schwiegersohn Heinrich Fischer in Mittelbrüden bei Backnang in Baden-Württemberg.
In der Hutfabrik waren 100 Arbeiter, in der Schuhfabrik 125 Arbeiter plus 25 Heimarbeiter, in der Kleiderfabrik 35 Arbeiter und in Wachtl 45 Arbeiter beschäftigt.
Initiatoren waren die heutigen Deutsch Brodeker Simona Hedbávná, Vlastimil Štěpánek und Aneta Valentová. Sie sind Geschwister und wollen, daß auch in der Sprachinsel deren einstige deutsche Bewohner, deren Schicksal und die Nachkriegsereignisse nicht vergessen werden.
Deshalb errichteten sie die private Dauerausstellung im Haus Nr. 252 in Deutsch Brodek. In einem Brief, den Simona und Aneta dem vertriebenen Deutsch Brodeker Johann Aberle zu Weihnachten schickten, schreiben sie:
„Wir schicken Ihnen ein paar Fotos. Die Enthüllung der Gedenktafel war wunderschön. Es war ein unglaublicher Tag. Am Morgen wurden wir vom Regen geweckt. Wir haben alle Vorfahren, darunter auch Bürgermeister Eugen
Am Mittag kamen die unmittelbare Familie und Pfarrer Tomáš Klíč zum Essen zu uns. Nach dem Mittagessen gingen wir zu der Kirche, in der das Treffen stattfand. Als wir aus dem Haus gingen, schien die Sonne über Brodek. Eine Prozession von ungefähr 100 Menschen ging von der Kirche zum Friedhof. Dort war alles für die Enthüllung der Gedenktafel vorbereitet. Unser Vati hielt eine Rede, der Pfarrer erläuterte die Gedenktafel, eine Verwandte las einen Auszug aus Deinem Brief vor.


Die tschechische und die deutsche Nationalhymne wurden gespielt. Anschließend gab es für alle Besucher eine Party in unserem Garten. Es gab Führungen durch die Ausstellung. Es war ein schönes Sonntagstreffen. Wir schicken auch einige Fotos von der Entdeckung des alten deutschen Friedhofs in Ölhütten. Alles ist von Bäumen und Büschen überwuchert. Wir möchten im Frühjahr mit dem Restaurieren beginnen, damit der Friedhof wieder ein würdiger Ort wird.“ Nadira Hurnaus

Reicenberger Zeitung

[ e Um [ au
Der lange Kampf gegen die Hussiten

Im Jahre 1400 setzten die Kurfürsten Wenzel IV. als Deutschen König ab. Die Verurteilung und Verbrennung des Reformators Jan Hus 1415 in Konstanz hatte in Böhmen eine große Gärung hervorgerufen. Die Erstürmung des Neustädter Rathauses in Prag 1419 war der Anfang des offenen Aufruhrs. An der Aufregung über dieses Ereignis starb König Wenzel IV. Die böhmischen Barone wollten Siegmund, Wenzels Bruder und rechtmäßiger Nachfolger, nicht als König anerkennen. Sie boten dem Großfürsten von Litauen, Alexander Witold, die Krone an, welcher 5000 Mann nach Böhmen schickte.
Die Lage der katholischen Geistlichkeit in Prag war bedrohlich geworden. 1420 verließen viele Domherren mit dem Domschatz die Stadt und suchten Schutz in dem von Kaiser Karl IV. 1369 gegründeten Cölestinerkloster Oybin. Später begaben sie sich in die gut befestigte Stadt Zittau. Die Bewohner der Lausitz und jene Nordböhmens unter den Grundherren der Berka von Duba und der Dohna von Grafenstein blieben dem katholischen Glauben treu und dem rechtmäßigen Thronfolger ergeben.
Die Tschechen sahen in den Todesurteilen des Konzils von Konstanz eine Beleidigung der Nation und betrachteten sich als das auserwählte heilige Volk, die Kirchenversammlung aber als abgefallen von der christlichen Lehre. Sie waren bereit, die Lehre von Hus und ihre Sonderstellung gegen jedermann zu verteidigen.


Sie gingen in den Hussitenkriegen mit dem Mut der Verzweiflung und einer neuen Kampfweise zum Angriff über und blieben gegen die Zahl überlegener Ritter und Kreuzheere lange Zeit siegreich. Auch im Lager der Kreuzfahrer gab es Freunde der Hussiten, die Verwirrung stifteten. Kennzeichnend ist, daß Prokop der Kahle, der nach dem Tod Zizkas die Führung übernahm, auf seinen Zügen nach Deutschland mit 45 000 Mann ausrückte und mit 70 000 Mann zurückkehr-
te. Trotzdem war die Nation im Innern nicht einig. Den gemäßigten Utraquisten standen die radikalen Taboriten gegenüber, die die arme Urkirche ohne Heiligenverehrung, ohne Mönchtum und Prunk der Gottesdienste vertraten. Ihre einzige Richtschnur war die Heilige Schrift.
Die Kalixtiner forderten in den Prager Artikeln 1420 außer dem Sub utraque specie – Spendung des Abenmahls in beiderlei Gestalt – das Wort der freien Predigt, die Wiederherstellung der Ordnung durch die gesetzte Obrigkeit und daß die Kirche jede weltliche Gewalt und ihre Besitztümer aufgebe. Dieses Programm, das auch das der Prager Universität genannt werden darf, entsprach dem materiellen Interesse des böhmischen Adels, der mit dem König allein herrschen und sich die Kirchengüter aneignen wollte.
Was die bäuerlichen und kleinbürgerlichen Scharen zusammenhielt, waren der Fanatismus und das Bewußtsein des Existenzkampfes gegenüber einer feindlichen Welt und der Ruhm beispielloser Erfolge. Der Verteidigungskampf ließ das Land veröden, schwere Hungersnöte folgten. Auf Beutezügen mußte man seit 1426 in den Nachbarländern den Hunger stillen.
Die Partei der Hussiten wuchs auch im nördlichen Böhmen. Mit zunehmender Stärke wurde ihr Auftreten immer kühner. Die Besitzungen der Wartenberger und die Städte der Oberlausitz, welche treu zu König Sigismund – von 1410 bis 1437 deutscher König – hielten, wurden die Zielpunkte der hussitischen Angriffe. Da schlossen sich die Herren von Tetschen, Grafenstein, Roynungen bei Pankraz, Friedland, Wartenberg, Ralsko und andere zusammen und hielten 1422 mit den Lausitzern zu Bensen, Leipa, Gabel, Zittau und Löbau Beratungen ab, um ein gemeinsames Vorgehen gegen die Hussiten zu erzielen.
Bis zum Jahr 1423 haben die Hussiten Gabel in größerer Anzahl nicht berührt. Während der ersten Kriegsjahre waren sie im Innern und im Süden des Landes viel beschäftigt. Als die ersten Scharen der Hussiten gegen die Lausitz vorrückten, gelang es dem Bund unter Führung Herzog Heinrichs von Glogau, den Feind zurückzudrängen. Als der Bund alle Anträge der Hussiten verwarf, rüstete sich Zizka selbst, des Königs Sigismund treue Anhänger zu züchtigen. Aber noch
men. Dieser hatte den Hussiten bei Petersdorf einige Proviantwagen mit Heringen abgenommen. Da Boček aber die hochgelegene Burg auf dem Falkenberg, die im Jahr 1347 von Hans von Dohna auf Grafenstein erbaut worden war, nicht einnehmen konnte, wandte er sich gegen die Straßenburg Karlsfried bei Lükkendorf. Die Zittauer Besatzung war aber den Hussiten nicht gewachsen. Nach kurzer Belagerung wurde die Burg eingenommen und zerstört.

Am 19. Mai 1426 erschienen die Hussiten, geführt von Johann Rohač, abermals vor Leipa und zerstörten die Stadt, obwohl die Oberlausitzer zu Hilfe herbeigeeilt waren. Seitdem blieb Leipa in den Händen der Hussiten. Mit Sigismund von Wartenberg war im Jahre 1426 das ganze Adelsgeschlecht der Wartenberger hussitisch geworden. Von den Burgen Wartenberg, Dewin und Lämberg aus bekämpften nun die Hussiten die Lausitz.
Um 1429 hatte sich der Hussit Jan Kolouch auf dem Falkenberge festgesetzt und beunruhigte die ganze Gegend, besonders das Gebiet der Sechsstädte und das Kloster Oybin. Die Lausitzer Städte zahlten ihm 100 Schock Groschen, damit er Frieden halte. Doch alles war vergeblich. Da beschlossen die Lausitzer, die Burg zu zerstören. Noch ehe es dazu kam, brannte die Falkenburg ab. Der Schaden scheint aber nicht groß gewesen zu sein. Ende 1431 hatte sie Kolouch wieder hergestellt.
Als Kaiser Sigismund im Jahr 1436 endlich nach vielem Blutvergießen von den böhmischen Baronen als König von Böhmen anerkannt worden war, befand sich unter denjenigen, die dem König weiterhin Widerstand leisteten, auch Jan Kolouch auf dem Falkenberg. Die Lausitzer erhielten daher am 19. Februar 1437 den Befehl, den Ruhestörer zu bestrafen. Während sie dazu rüsteten, kam die Nachricht, daß die Falkenburg abermals in Flammen stehe.
nungen auf der Freudenhöhe bei Pankraz an sich und zerstörten sie.
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Falkenburg von den Sechsstädten abermals zerstört, weil sich verschiedenes Raubgesindel darin eingenistet hatte. Erst im 30jährigen Krieg wurde sie vollständig demoliert.
Die Wartenberger Fehde

Zu Beginn der Hussitenkriege war das Geschlecht der Wartenberger den Sechsstädten ein wohlmeinender Freund und Verbündeter. Zum Bund der Sechsstädte gehörten Bautzen, Zittau, Görlitz, Kamenz, Lauban und Löbau. Dieses Verhältnis änderte sich 1425. Die Wartenberger wurden Verbündete der Hussiten. Nun begannen die langjährigen erbitterten Kämpfe gegen die Lausitz, die man die „Wartenberger Fehde“ nennt.
Von ihren festen Burgen Tollenstein, Roll, Wartenberg, Lämberg und ab 1429 auch vom Falkenberg unternahmen sie ihre Raubzüge hauptsächlich nach den beiden schon damals blühenden und reichen Städten Zittau und Görlitz. Schon gleich nach Ostern 1425 zog Johann von Wartenberg vom Tollenstein aus mit seinen Scharen nach Görlitz. Sie verwüsteten die Dörfer ringsum und raubten eine große Menge Vieh.



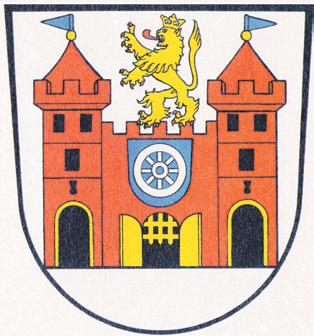
hielten Johann von Wartenberg und Johann von Michalovic auf dem Bösig gute Wacht und benachrichtigten die Zittauer von dem drohenden Überfall. Glücklicherweise ging die Gefahr vorüber, denn die Hussiten wandten sich nach Karlstein.
In den ersten Monaten des Jahres 1424 erschien der Hussitenführer Hynek Boček von Poděbrad mit einem Heerhaufen, um an Heinrich von Dohna auf Falkenburg Rache zu neh-
Im August 1425 kamen die Taboriten in unsere Gegend. Nachdem sie Weißwasser, Leipa und Niemes verbrannt hatten, rückten sie gegen Gabel vor. Sie zerstörten und beraubten das Dominikanerkloster und richteten in der ganzen Gegend große Verwüstungen an. Von Gabel zogen die Hussiten gegen Zittau. Sie konnten aber diese Stadt nicht einnehmen, weil sie gut befestigt war und von Görlitz Hilfe erhalten hatte.
Der Kaiser erließ am 24. April einen zweiten Auftrag, in dem den Ständen befohlen wurde, die Burg niederzureißen, so daß von diesem Raubnest kein Stein auf dem andern bleibe. Im selbenJahr starb der Kaiser. Kolouch aber baute die Falkenburg in aller Eile wieder auf und überließ sie dem ehemaligen hussitischen Hauptmann Nikolaus Sokol von Lämberg. Um diese Zeit brachten die Sechsstädte die Burg Roy-
Als Nikolaus von Ponikau, Hauptmann von Zittau, von diesen Verheerungen des Wartenbergers hörte, beschloß er, die über Oderwitz und Herwigsdorf zurückkehrenden Räuber in einem Hinterhalt bei Spitzhennersdorf zu überfallen. Allein der Wartenberger hatte davon erfahren und ließ das geraubte Vieh über Gersdorf nach Rumburg treiben. Er griff die Zittauer von zwei Seiten an und brachte ihnen eine vollständige Niederlage bei. Nikolaus von Ponikau geriet in Gefangenschaft und wurde auf den Tollenstein gebracht. Erst nach langen Verhandlungen zu Schluckenau und Warnsdorf erlangte er kurz vor Pfingsten die Freiheit. Fortsetzung folgt
Josefa Appelt heiratet Bierproduzenten

2011 gab Klaus-Michael Neumann im Selbstverlag das Buch „Neustadt an der Tafelfichte 1584 bis 1946. Chronik einer deutschen Stadt in Böhmen“ heraus. Das Kapitel „Die Auswanderer der Stadt und des Kreises nach Amerika“ veröffentlichen wir in der Reichenberger Zeitung in mehreren Folgen.
Die 1853 mit auf diese Reise gegangene Schwester des Franz Appelt, Josefa Appelt (* 25. März 1833 in Neustadt), blieb aber in La Grange, im Fayette County.

Dort heiratete sie am 20. November 1855 den am 26. Dezember 1846 aus Sachsen mit seinem Bruder Karl Emanuel (*1817) eingewanderten Heinrich Ludwig Kreische (*1821).

Heinrich Ludwig Kreische hatte bereits am 17. Januar 1849 172 Hektar Land von Carl Willrich auf dem Bluff, rund eine Meile südwestlich von La Grange direkt am Colorado River, gekauft und noch im selben Jahr dort ein Haus gebaut. Dieses Haus mußte 1856 und 1861 erweitert werden, denn bald stellten sich Kinder ein, es wurden sechs an der Zahl: Henry Louis (1856–1920), Anna Louise (1857–1940), Otto

Das Denkmal auf

Das Haus hatte nach der letzten Erweiterung 14 Zimmer, denn im Jahre 1860 wurde auch eine Brauerei fertiggestellt, und man wird sicherlich am Anfang Zimmer für die Mitarbeiter der Brauerei benötigt haben. Es war die erste Brauerei, die in Texas errichtet wurde. Sein Schwager Franz Appelt schenkte das Kreische-Bier in seinem Saloon in Hallettsville in großen Mengen aus.
ste Katholische Kirche in Hostyn, und 1869 half er die zweite Katholische Kirche in Hostyn zu errichten, obwohl er seine Brauerei schon seit neun Jahren betrieb.
einer Krypta aus Granit beigesetzt und ein Denkmal mit den Namen errichtet. Heute ist es ein nationales Denkmal.
Der Stadtrat von Friedland beschloß, im Haus Nr. 99 auf dem Marktplatz neue Wohnungen zu errichten. Er hat damit eine klare Richtung für die Nutzung des seit 2009 leerstehenden Gebäudes vorgegeben. Das Gebäude, in dem früher die Staatspolizei untergebracht war, wird künftig neben Wohnungen auch Geschäftsräume beherbergen. Im Erdgeschoß sollen die Büroräume der Stadtpolizei untergebracht werden.

Auf der Grundlage eines Vertrags zwischen der Stadt Friedland und der Kreisstadt Reichenberg waren früher Streifen der Reichenberger Stadtpolizei 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf dem Gebiet der Stadt Friedland tätig. Als die Stadt Friedland 2021 aus Reichenberg erfuhr, daß die Stadtpolizei Reichenberg nicht mehr für sie tätig
Das war ein Vorfall, bei
am 17. September 1842
die USA-Stadt
in Texas – 36 texanische Milizsoldaten von mexikanischen Soldaten getötet wurden. Es gehörte zu den zahlreichen bewaffneten Konflikten um das Gebiet zwischen den Flüssen Rio Grande und Nueces, die die Republik Texas zu kontrollieren versuchte, nachdem sie 1836 ihre Unabhängigkeit erlangt hatte.


In den ersten Jahren nach seiner Ankunft im Fayette County arbeitete Heinrich Ludwig Kreische aber als Architekt und errichtete 1853 das erste freistehende Gefängnis. Bis dahin waren die Gefangenen im Büro des Sheriffs festgehalten worden. 1855 baute er das dritte Rathaus des Fayette County, das 1890 zerstört wurde. 1856 errichtete er die er-

Inzwischen war auch der Landbesitz auf 300 Hektar angewachsen. Das gesamte Anwesen war auf einem rund 70 Meter hohen Berg errichtet, auf dem Monument Hill mit Eichen- und Zedernwäldern und einem herrlichen Blick auf den Colorado River. Hier kämpften 1842 die Menschen für ihre Unabhängigkeit von Texas in der Dawson-Schlacht gegen die Mexikaner. Die Opfer der Schlacht wurden in
Die sechs Kinder, drei Jungen und drei Mädchen, arbeiteten mit in der Brauerei, auf der, von Heinrich Ludwig Kreische neu angelegten, Fähre und im neu errichteten Tanzpalast. Viele Volksfeste wurden hier gefeiert. Aus dieser Zeit existieren noch viele Fotos von den Festen, die immer große Menschenmengen zeigen. Alle sechs Kinder blieben unverheiratet.
Heinrich Ludwig Kreische gründete auch den ersten Schützenverein, der noch heute existiert.
Im Jahre 1882 beluden Heinrich Ludwig Kreische und seine Arbeiter ein großes Gespann mit Steinen zum Bau eines weiteren Gebäudes.
Das Gespann kam ins Rollen, und Kreische geriet unter die Räder. Er starb kurz darauf an den Folgen des Unfalles am 15. März 1882. Auf sei-
nen Wunsch wurde er auf einem, eigens für die Familie errichteten Friedhof in der Nähe des Hauses auf dem Bluff bestattet. Hier wurden auch Josefa Appelt und vier der Kinder beigesetzt. Um 1940 wurde in La Grange ein großes Familiengrab errichtet, und alle Familienmitglieder fanden dort ihre letzte Ruhestätte.
Am 20. November war Franziska Appelt (* 15. Juni 1829), die Schwester von Franz und Josefa Appelt, in Galveston gelandet und zu ihrer Schwester nach La Grange gegangen. Dort heiratete sie am 14. Oktober Heinrich Ruhland. Sie starb bei der Geburt ihres Sohnes Henry 1858. Ihr Grab existiert noch heute.
sein will, baute man trotz einiger Bedenken eine eigene Stadtpolizei auf.
Nach nur einem Jahr Betrieb der Stadtpolizei in Friedland stellte sich heraus, daß die Entscheidung, eine eigene Stadtpolizei einzurichten, richtig war und die Befürchtungen unnötig waren.
Die Städtische Polizei in Friedland ist jetzt im zweiten Jahr ihres Bestehens vollzählig. Seit dem 1. Januar verfügt sie über einen Befehlshaber, fünf Polizisten und drei Polizistinnen. Drei neue Polizisten warten jedoch noch auf eine Grundausbildung und Prüfung, so daß die Stadtpo-
lizei erst ab März voll einsatzfähig sein wird. Die Städtische Polizei bietet den Bürgern einen 24-Stunden-Dienst. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet sie mit der Polizei der Tschechischen Republik zusammen. Den Bau von Wohnungen in dem
Haus Nr. 99 beschloß der Stadtrat vor allem deshalb, weil seit längerer Zeit Wohnungsmangel herrscht.
Ein großes Glück ist, daß sich die Stadt an dieses Gebäude, das seit 14 Jahren leersteht, erinnert hat. Sicher ist, daß es sich
nicht um eine kleine Investition handeln wird. Immerhin belaufen sich die Kosten für die Erstellung der Wohnungen auf 50 Millionen Kronen. Deshalb werden die Stadtverordneten entscheiden, ob der Umbau aus dem städtischen Haushalt, mit einem Zuschuß oder mit einem Bankkredit finanziert werden soll.
Das Gebäude wird gegenwärtig schrittweise rekonstruiert. Die komplette Renovierung der Fassade wurde im vergangenen Jahr durchgeführt. Als nächstes soll das gesamte Gebäude in statischer Hinsicht gesichert werden. Dies wird Gegen-
stand einer neuen Projektdokumentation sein, mit deren Ausarbeitung bereits begonnen wurde. Es wird nicht mehr in das Haus hineinregnen. Außerdem wurden die Fenster ausgetauscht und die Fassade renoviert. Als die Renovierungsarbeiten bereits in vollem Gange waren, stellte sich bei einer bautechnischen Untersuchung leider heraus, daß die Fußböden in einem schlechten Zustand waren. Ohne ihre Reparatur wäre die Restaurierung des Gebäudes nicht vorangekommen.
Die Stadt beauftragte daher die Erstellung einer Projektdokumentation zur statischen Sicherung der Räume einschließlich aller Etagen, dem Einbau eines Aufzugs, Brandschutzmaßnahmen, der erforderlichen Instandsetzung des Treppenhauses und der Umnutzung zu Wohneinheiten. Stanislav Beran

für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau





Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Moldau

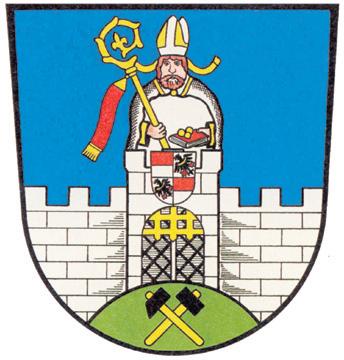



Warum die Wahlen so wichtig sind
Warum die Wahlen in Moldau so wichtig sind, erklärt Steffen Neumann, Träger des Ersten Preises der ersten Verleihung des „Johnny“-Klein-Preises für deutsch-tschechische Verständigung 2016.
Die Tradition erwacht
Zu einer nachweihnachtlichen Zusammenkunft trafen sich Ende Dezember im Waldstein‘schen Schloß in Oberleutensdorf Vertreter des Georgendorfer Vereins, des Teplitzer Vereins als Herausgeber der „Erzgebirgs-Zeitung/ Krušnohorské noviny“ und der Vorsitzende des Georgendorfer Vereins Petr Fišer mit den weiteren Mitgliedern des Redaktionsrates Vlasta Mládková, Jan Setvák und Robert Hochel. Hochel designt die Zeitung in beiden Sprachversionen. Als Mitglieder des Teplitzer Vereins und neu aufgenommene Mitarbeiter des Redaktionsrates waren Jutta Benešová und ihr Mann Ivan eingeladen. Benešová berichtet.
Nach einem Rundgang durch die Weihnachtsausstellung im Schloß mit einem Abstecher zur historischen Spielwarenausstellung der Firma Heller und Schiller (HUSCH) und der „Tuchfabric zu OberLeidensdorf“ gingen wir über den weihnachtlich geschmückten Markt zum Restaurant Benar am hiesigen Theater. Bei einem freundschaftlichen, vorabendlichen Menü gab es viel zu erzählen und zu planen. Ende 2022 war die tschechische Jahresausgabe der „Krušnohorské noviny“ erschienen. Die deutsche Ausgabe der „Erzgebirgs-Zeitung“ steht bevor. 2022 brachte aber auch viele neue Projekte, und ein kleiner Rückblick läßt erahnen, daß ohne die Mithilfe aller Mitglieder der bestehenden Vereine dies alles kaum zu schaffen gewesen wäre.
Die Erzgebirgsvereine haben eine lange Tradition. Die heutigen Vereine knüpfen lose an die Tätigkeit des Nordböhmischen Gebirgsvereins-Verbandes an, der 1882 in Karlsbad gegründet wurde, seit 1885 seinen Sitz in Brüx und Oberleutensdorf und 1887 in Teplitz hatte. Diesen Verband von Vereinen hatte das Interesse an dem historischen und kulturellen Erbe der Region verbunden, aber auch der Naturreichtum, der Tourismus und nicht zuletzt das Interesse an der Unterstützung der hiesigen Wirtschaft. Die Geschichte der neuen Erzgebirgsvereine und ihre Zeitschrift erfährt man über den Link erzgebirgs-zeitung.de
Es war ein langer Weg, bevor an diese Vereinstradition angeknüpft werden konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben trotz
der Vertreibung der Deutschen und trotz des kommunistischen Regimes viele verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen erhalten oder wurden bei der Zusammenarbeit zwischen DDR und Tschechoslowakei neu geknüpft. So verwunderte es nicht, als 2011 im böhmischen Georgendorf der Georgendorfer Verein (Českojiřetínský spolek) – Verein zur Belebung des Erzgebirges gegründet wurde, sich Gleichgesinnte auch auf der sächsischen Seite fanden, in diesem Fall der Heimatgeschichtsverein RechenbergBienenmühle. Aber auch heimatkundlich Interessierte aus den umliegenden Orten des Erzgebirges beteiligten sich hilfreich bei Projekten des Vereins. 2021 wurde der Teplitzer Verein gegründet. Er geht aus dem Konzept des Georgendorfer Vereins hervor, der damals zehn Jahre seiner erfolgreichen Tätigkeit in der Region feierte, und schließt sich dessen Projekten in der Teplitzer Region an. Zu den Gründungsmitgliedern des neuen Teplitzer Vereins gehörten Hana Truncová (1924–2022), Ehrenbürgerin der Stadt Teplitz und Zeitzeugin der historischen Redaktion der „Erzgebirgs-Zeitung“, als Studentin des letzten Chefredakteurs und Professors an der Handelsakademie, Gustav Müller, in Teplitz-Schönau, und Jiří Wolf, Historiker und Bibliograph, der an den Museen in Dux und Teplitz arbeitet. Seine Vorträge und öffentlichen Tätigkeiten geben tiefe Einblicke in die
Elisabeth-Kirche in Teplitz. Auf Grund eines gemeinsamen Antrags sagte der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds dem Teplitzer Pfarramt kürzlich umgerechnet 24 000 Euro für die Reparatur des Daches zu.

Die Tätigkeiten des Georgendorfer und Teplitzer Vereins sind durch das verbindende Projekt „Krušnohorské noviny/Erzgebirgs-Zeitung“ eng miteinander verflochten. Die „ErzgebirgsZeitung“ in den jetzigen beiden Sprachversionen ist für die beiden Vereine – ebenso wie vor mehr als 130 Jahren für die Vereinsvorgänger – das Aushängeschild ihrer Tätigkeit. 2022 erhielten ihre Mitarbeiter zum dritten Mal den prestigeträchtigen Preis des Syndikats der Journalisten der Tschechischen Republik und des Vereins Pro Bohemia. Im letzten, nun 25. Jahr des Wettbewerbs gewann „Krušnohorské noviny/Erzgebirgs-Zeitung“ den ersten Platz in der Kategorie Publizistik. Und als besondere Anerkennung wird diese Zeitschrift nun alljährlich in das Web-Archiv der Nationalbibliothek in Prag aufgenommen.
Am Wochenende fanden die tschechischen Präsidentschaftswahlen statt (Ý Seite 1). Für die meisten Tschechen sind sie die wichtigsten Wahlen seit langem. Doch für die Menschen in dem kleinen Grenzdorf Moldau im Erzgebirge waren die Wahlen am Samstag davor mindestens genauso wichtig. Der Vizehauptmann des Bezirks Aussig, Jiří Řehák nannte sie sogar „den Kampf um die demokratischen Grundlagen in unserem Staat“. Was war passiert?
fen. Da hält man sich mit Hürden, die so eine Praxis womöglich einschränken könnten, zurück“, sagte vor den letzten Wahlen der Politologe Lukáš Novotný, der das Problem für unlösbar hält.
Vergangenheit dieser Region. Seine Mitarbeit an der „Erzgebirgs-Zeitung“ in beiden Sprachversionen ist nicht hoch genug einzuschätzen.
Als Beispiel einer grenzüberschreitenden Tätigkeit beteiligte sich der Teplitzer Verein mit Unterstützung des deutschen Vereins Teplitz-Schönau Freundeskreis 2022 an der Beschaffung von Finanzmitteln für die Rekonstruktion des Daches der Sankt-
Im Nachkriegsböhmen waren viele Kulturschätze verloren gegangen, und durch die starke Industrialisierung hatte die Erzgebirgsregion ihre Attraktivität verloren. Das Kulturerbe, das uns die deutschen Bewohner hinterließen, zu erneuern und der jungen Generation die gemeinsame Vergangenheit nahe zu bringen, ist die Hauptaufgabe der beiden Vereine. Deswegen arbeiten sie mit Gemeinden und Institutionen, mit Schulen und Unternehmen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet zusammen. Sie sind in den letzten Jahren auch die Koordinatoren der tschechischsächsischen Interessengruppe „Moldauer Eisenbahn“ und bemühen sich beiderseits intensiv um eine Wiederanbindung der Strecken Teplitz–Brüx und des Teplitzer Semmering an die Freiberger Eisenbahn. Vereinszweck ist aber auch, Initiativen der Bevölkerung zugunsten des Erzgebirges zu unterstützen, gute nachbarliche Beziehungen zu pflegen und im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit die gemeinsamen historischen Bindungen zu erneuern. Dabei erfüllen die neuen Vereine eine wichtige Rolle in der UNESCO-Erzgebirgsregion.
Die kleine Gemeinde direkt an der Grenze zu Sachsen mußte ihre Kommunalwahlen vom letzten September wiederholen. Das Bezirksgericht in Aussig hatte einer Beschwerde zweier Wahllisten stattgegeben. Eine der zwei Listen führt die bisherige Bürgermeisterin Lenka Nováková. Und sie hatte kurz vor den Wahlen entschieden, 46 Personen aus dem Wahlverzeichnis zu streichen. Grund waren verdächtig viele Zuzüge vor den Wahlen. Der Verdacht kam auf, daß dieser Zuzug kein Zufall, sondern gesteuert sei. Und es war auch offensichtlich, wer hinter der Aktion stand. Denn die Zuzügler meldeten sich alle unter ein und derselben Adresse an. Das Objekt gehört der Spitzenkandidatin für die rechtspopulistische Partei Svoboda a primá demokracie (SPD), deutsch Freiheit und direkte Demokratie, Iveta Boudišová.
Der Wahlleiter Oldřich Kozler, ebenfalls SPD, erkannte die Streichung nicht an und ließ im September auch die wählen, die von der Bürgermeisterin aus dem Wählerverzeichnis entfernt worden waren. Daß danach die SPD die Wahlen mit drei der neun Sitze gewann, überraschte niemanden mehr. Doch das Bezirksgericht gab den Beschwerdeführern recht. Kozler hatte seine Kompetenzen überschritten.
Dabei war der Schritt, die Wähler aus dem Verzeichnis zu streichen, riskant. Das Wahlrecht ist auch in Tschechien ein hohes Gut, genauso wie die freie Wahl des Wohnsitzes. Nicht wenige sahen deshalb ein Dilemma. Die offensichtliche Wahlmanipulation in einer kleinen Gemeinde reiche für eine Anpassung des Wahlrechts nicht aus. „Tschechien hat langfristig mit einer niedrigen Wahlbeteiligung zu kämp-
Doch sowohl die Liste von Lenka Nováková, als auch die Kandidaten von SPOLU, einem Parteienbündnis aus Liberalen (ODS) und Christdemokraten (KDUČSL), hatten es satt, daß wieder einige Dutzend Angeworbene über das Schicksal ihres Dorfes abstimmen. „Für uns waren diese Wahlen der Anfang, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Eva Kardová. Die 61jährige gehört zu jenen, die schon seit den 1970er Jahren und damit am längsten in Moldau leben. Davon gibt es aber nicht viele. „Normal ist leider ein ständiges Kommen und Gehen“, sagt sie. Sie begründet das mit der fehlenden Perspektive und verbindet das mit einem Namen: Jaroslav Pok, der seit über 16 Jahren das Geschehen in der Gemeinde bestimmt und nun unter dem Dach der SPD seine Macht
Mit dieser Erfahrung wußte sie auch, wohin sie sich wenden muß, um das Dilemma rund um die Scheinwähler zu lösen. „Wir holten uns Unterstützung bei der Gemeinde Karlova Studánka in Mähren, in der schon einmal so etwas ähnliches vorgefallen ist und die sich erfolgreich gewehrt hat“, verrät Eva Kardová, Kandidatin der KDU-ČSL und frühere Vizebürgermeisterin.
„Die dortige Bürgermeisterin hatte die Wähler auch gestrichen. Dieser Fall ging bis zum Verfassungsgericht, wo die Bürgermeisterin recht bekam“, erklärt Kardová. Außerdem vereinbarten die beiden Listen, für Anwalts- und Gerichtskosten aufzukommen. Am Ende gab ihnen das Gericht recht.
Am Samstag durften wieder nur jene wählen, die tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt in Moldau haben. Auch wenn diesmal nur 38 Wähler gestrichen wurden. Das Ergebnis bestätigte den Manipulationsverdacht: Die SPD erhielt nur noch einen Sitz. „Die SPD wurde von den eigenen Kandidaten und dann nur noch von vier weiteren Personen gewählt. Das ist realistisch“, faßt Eva Kardová zusammen. Das reichte trotzdem noch für einen Sitz. Je drei Sitze gewannen aber die Liste der Bürgermeisterin und SPOLU. „Wir haben ein gemeinsames Programm.
erhalten will. „Am Anfang war er für viele die Hoffnung, weil er versprach zu investieren und große Ideen hatte“, erinnert sich Kardová, die auch lange zu seinen Unterstützern gehörte. Doch die Ideen platzten oder bestanden aus zwielichtigen Projekten wie einem riesigen illegalen Solarkraftwerk und einem geplanten Windpark in einem Naturschutzgebiet, zu dem es nie kam.
Die neueste Idee ist ein Immobilienprojekt nahe dem Skigebiet Stürmer. „Letztlich waren das immer private Geschäfte von Herrn Pok. Die Gemeinde hatte davon nichts“, sagt Kardová. Das Ergebnis von 16 Jahren Pok ist überall zu sehen. Moldau hat veraltete Technik, als eine der wenigen tschechischen Gemeinden kein schnelles Internet, baufällige Gebäude, eine veraltete Wasserversorgung und geschlossene Gaststätten und Hotels.

„Auch der Winterdienst ist ein großes Problem, dabei sollte das bei uns die Grundlage sein“, zählt Kardová auf. Das Dorf bräuchte Kontinuität und die Zusammenarbeit aller. „Das Dorf kann nicht Sache nur eines einzelnen Menschen sein“, weiß Kardová aus jahrelanger Tätigkeit in der Dorfverwaltung.
Mit dieser Mehrheit können wir den Ort gestalten“, freut sich Kardová. Doch ob es so weit kommt, ist immer noch nicht sicher. Bereits am Samstag legten mehrere Personen Beschwerde ein, diesmal jene Wähler, die aus dem Verzeichnis gestrichen worden waren. Unzufrieden ist auch die vierte Wahlliste um Jiří Wasserbauer, der vor allem Mitglieder der Feuerwehr um sich hat. Er hatte zwar im September auch die Neuanmeldungen kritisiert, aber nicht geklagt. „Daß Jiří Wasserbauer sich nicht der Klage angeschlossen hat, war für uns ein Zeichen, daß er es nicht ernst meint“, entgegnet Eva Kardová. Doch Wasserbauer sah nicht die Notwendigkeit einer Klage. „Aus meiner Sicht hatten wir nach den letzten Wahlen genug Stimmen, und wir hätten alle zusammen regieren können. Jetzt haben die beiden Wahlgruppierungen genug Stimmen und brauchen uns nicht mehr“, sagt er. Er bezweifelt auch, daß es rechtens ist, daß eine Kandidatin entscheidet, wer wählen darf und wer nicht. Sollten die Wahlen gültig sein, wartet auf die Gemeindeführung offensichtlich noch die wichtige Aufgabe, die Gräben im Dorf zu überwinden.
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergFÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ HEIMATBOTE
Weihnachtliche Ehrung
Eine schöne Tradition war, daß kurz vor Weihnachten alle Helfer eingeladen wurden, die sich bei den Ausgrabungen in Grafenried verdient gemacht hatten. Die letzten beiden Jahre fielen diese Treffen Corona zum Opfer. Doch nun war das Treffen endlich wieder möglich und fand im Dezember in der Alten Post in Klentsch statt.
Hans Laubmeier hatte zwar die Ortsbetreuung für Grafenried längst in jüngere Hände abgegeben, doch für diese Vorweihnachtsfeier übernahm er wieder die Organisation und bereitete alles bestens vor. Diesmal hatte sich sogar noch der Bezirk Pilsen in der Person des Regionsrates und Tourismusbeauftragten Libor Picka eingeschaltet. Der Pilsner Regierung war es nämlich ein großes Anliegen, die wichtigsten Personen des Projekts mit einer Urkunde und Geschenken zu ehren. Dazu war sogar das tschechische Fernsehen gekommen. Doch nur Hans Laubmeier konnte geehrt werden, denn die beiden Ausgraber Helmut Roith und Alois Rötzer fehlten.
Libor Picka bemerkte, daß die tschechische Seite die Bemühungen von bayerischer Seite schätze, die dazu geführt haben, Grafenried wieder zum Leben zu erwecken. Deshalb danke er allen Ehrenamtlichen, die sich für den Ort eingesetzt hätten. Pikka räumte ein, „daß die Behörden manchmal nicht so viel Verständnis für das hatten, was wir wollten.“ Er bezeichnete Grafenried als einen einzigartigen Ort, den man der Öffentlichkeit gerne zeigen könne. Wie im Herbst besprochen, gehe es nun noch darum, das Schloß, in dem später auch die Schule untergebracht gewesen sei, zu sichern. Danach seien die Arbeiten fertig.

„Was entdeckt werden sollte, das ist bereits entdeckt, und das andere wollen wir ruhen lassen“, sagte Picka. Auch der Pilsner Bezirk wisse sehr genau Bescheid über den Ort Grafenried, der eine immer größere Rolle im Tourismus in der Pilsner Region spiele. Er freue sich, daß nun einige Ehrungen für die Leute vorgenommen werden könnten, die sich bei den Aktivitäten in Grafenried verdient gemacht hätten. Dabei nannte er Hans Laubmeier, Helmut Roith und Alois Rötzer, wobei er bedauerte, daß die beide Letztgenannten nicht gekommen seien.
Waldmünchens Bürgermeister Markus Ackermann bedankte sich für die gute Zusammenar-
beit über all die Jahre. Alle hätten grenzüberschreitend an der Entwicklung dieses Projektes gearbeitet, das ein hervorragender Ort der lokalen Geschichte sei. Grafenried sei zu einem Ort geworden, an dem die Gründe für die europäische Idee sehr gut aufgezeigt werden könnten. Auch für die hiesige Region auf bayerischer Seite werde Grafenried für den Tourismus immer interessanter. Ackermann informierte, daß deswegen auf bayerischer Seite noch ein Parkplatz
rund zehn Jahren eingeführt habe, als Karel Smutný noch Bürgermeister gewesen sei. Diese Tradition sei unter dessen Nachfolger Jan Bozděch fortgesetzt worden, bis Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Deshalb sei er um so erfreuter, daß nun diese Zusammenkunft wieder habe anberaumt werden können.
Laubmeier nutzte die Gelegenheit auch, um einen Rückblick auf den Beginn der Aktivitäten in Grafenried zu geben, die
Neben Karel Smutný erwähnte Laubmeier auch weitere Unterstützer für das Projekt „Ausgrabungen in Grafenried“ wie den Bürgermeister von Wassersuppen, Ivan Bartošek, Jan Bozděch, Zuzana Langpaulová/ Uhrová, Josef Hetzl, Walter Urban und den ehemaligen Forstdirektor Jan Benda. Von Jan Benda sei die Idee gekommen, das bei der Freilegung des Geländes gesicherte Holz in das Biomasseheizkraftwerk nach Waldmünchen zu liefern.
Zu den ersten Arbeiten habe die Freilegung der Kirche gehört. Als Ortsbetreuer habe er die Idee zu den Grafenrieder Treffen mit einem Gottesdient in der ehemaligen Kirche gehabt, wobei ihn besonders gefreut habe, daß einmal sogar der Pilsner Bischof und mit diesem sechs weitere Geistliche gekommen seien. Er ließ dann die weiteren Aktivitäten noch einmal Revue passieren und richtete insbesondere einen besonderen Dank an die Ausgraber Helmut Roith und Alois Rötzer.

„Wären sie nicht gewesen, wäre Grafenried nicht das, was es heute ist“, lobte er. Helmut Roith könne man durchaus als einen Grafenrieder bezeichnen. Sehr gefreut habe ihn, daß für das Schloß noch eine Lösung habe gefunden werden können. Sein Dank richtete sich auch an die Stadt Waldmünchen für die Unterstützung. Nicht unerwähnt ließ Laubmeier, daß neben der Europäischen Union auch ehemalige Bewohner mit Spendengeldern die Maßnahmen unterstützt hätten. Er kam zu dem Ergebnis: „Es hat sich gelohnt.“
Pfarrer Matthias Bräuer
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der fünfte Teil über Pfarrer Matthias Bräuer (1817–1899).
de, findet am 7. September 1879 statt. Mit Erlaubnis der Budweiser Diözesanleitung feiert Dechant Bräuer eine Feldmesse zur Fahnenweihe. Der Vorstand des Veteranenvereins ist Johann Thoma.
angelegt und auch die Zugangsstraße ausgebaut werde, damit die Infrastruktur passe. Weil Grafenried eine Erfolgsgeschichte sei, hätten Laubmeier, Roith und Rötzer Dank und Anerkennung verdient. Er nannte Grafenried ein sehr gutes Beispiel für beste nachbarschaftliche Zusammenarbeit.
Picka überreichte dann Hans Laubmeier eine Urkunde und ein symbolisches Geschenk in Form von Bier aus Pilsen. Er bat Laubmeier, die Urkunden und Geschenke für Roith und Rötzer jenen zu bringen.
Hans Laubmeier, Initiator der Ausgrabungen in Grafenried, bedankte sich für die Auszeichnung und erwähnte, daß er die Treffen für die Helfer in Grafenried kurz vor Weihnachten in Klentsch vor



mit einem zufälligen Treffen kurz nach der Grenzöffnung in Laubmeiers Geburtsort Seeg mit dem Historiker Zdeněk Procházka begonnen hätten. Procházka habe eine Broschüre dabei gehabt, die er ihm, Laubmeier, gegeben habe. Bei diesem Treffen habe man sich, so gut es aufgrund der Sprachbarriere gegangen sei, ausgetauscht und sei seitdem in Verbindung geblieben. Marie Bretlová – mittlerweile verheiratete Schöntag – habe wertvolle Dolmetscher-Dienste geleistet. Laubmeier erinnerte sich zum Beispiel an mehrere gemeinsame Treffen im Archiv in Bischofteinitz. Der damalige Waldmünchener Bürgermeister Franz Löffler habe ihm auch geholfen, weitere Kontakte ins Nachbarland zu knüpfen.
Zdeněk Procházka gestand, daß er bei seinem ersten Besuch in Seeg im Jahre 1986 für eine Publikation und dann beim ersten Zusammentreffen mit Hans Laubmeier niemals auf die Idee gekommen wäre, daß sich daraus einmal so ein Projekt entwickeln könne.
Der ehemalige Leiter der Städtischen Wälder Taus, Jan Benda, erinnerte sich ebenfalls an Treffen und Aktionen und informierte auch darüber, daß er zuletzt schwere Schicksalsschläge habe verkraften müssen. Er erinnerte aber auch an den verstorbenen Wanderführer Franz Reimer, der sehr interessante Führungen in Grafenried gemacht habe.
Anschließend verteilte Laubmeier noch Geschenke, ehe man das Treffen bei Kaffee sowie belegten Brötchen
I




m März 1879 ordnet das bischöfliche Konsistorium in Budweis im Einvernehmen mit den k. k. Bezirksgerichten an, daß künftig Seelsorger auch Insassen von Gefängnissen im Religionsunterricht zu unterweisen haben.
Der Hostauer Lehrer Wenzl Nikl stirbt am 23. März 1879 im Alter von 96 Jahren. Steinbach lobt Nikl als fleißigen und gewissenhaften Lehrer mit christlicher Gesinnung. Zudem war Nikl als Organist tätig und bekam vom Budweiser Bischof Jan Valerián Jirsík im Jahr 1869 das goldene Verdienstkreuz mit der Krone verliehen.
Am 24. April 1879 feiert das Kaiserpaar Franz Joseph I. und Elisabeth seine silberne Hochzeit. Steinbach bemerkt, daß auch in Hostau wie in allen Pfarrkirchen der Diözese Budweis und aller Bistümer Österreichs Festgottesdienste zum Dank der Eheschließung vor 25 Jahren gefeiert worden seien.
Die Fahnenweihe des Hostauer Veteranenvereins, der im Sommer 1874 gegründet wur-
Am 7. Oktober 1879 brennt das Wohnhaus des Gastwirts Johann Schmid mit zugehöriger Scheune völlig nieder. Brandstiftung wird vermutet. Das Gebäude, das nach dem Brand 1877 wieder neu errichtet wurde, ist nicht versichert. Ebenso durch Brandstiftung verursacht brennen am 30. Oktober 1879 die Häuser Nr. 93 bis 98 sowie Nr. 82 und 83 komplett ab. Der Schaden wird auf 9000 Gulden geschätzt. Laut Steinbach wird ein unschuldiger Mann der Brandlegung bezichtigt, der kurz darauf nach Amerika auswandert.
Am 18. Dezember 1879 brennt es in Hostau erneut.
Das Haus Nr. 50 des Josef Landhauser wird ebenfalls durch Brandstiftung ein Raub der Flammen. In Hostau befürchtet man nun, daß der Brandstifter Brände in der ganzen Vorstadt legen könnte. Es kommt zu weiteren Bränden, wiederum bedingt durch Brandstiftung. Am 22. Mai 1880 brennt die Scheune des Adam Steinbach von Nr. 151 ab, wodurch die Häuser Nr. 151, 153 und 84 ebenfalls komplett vernichtet werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf 3000 Gulden.
Fortsetzung folgt





WIR GRATULIEREN
Wir gratulieren unserer treuen Abonnentin zum Geburtstag im Januar und wünschen von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes reichen Segen.
■ Schmolau. Am 6. Maria Lehn (Holuba), Kärntener Straße 46, 68753 Waghäusel, 88 Jahre. Anneliese Seidl Ortsbetreuerin
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im Januar Gottfried Leibl, Ortsbetreuer von Plöß/Wenzelsdorf, am 10. zum 86. Geburtstag; Adolf Buchauer, Ortsbetreuer von Stockau, am 21. zum 83. Geburtstag und Josef Schmid, ehemaliger



Ortsbetreuer von Podraßnitz, am 22. zum 97. Geburtstag. Wir wünschen noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter Pawlik
 und Stollen ausklingen ließ. Karl Reitmeier
und Stollen ausklingen ließ. Karl Reitmeier
Heimatbote

für den Kreis Ta<au WIR BETRAUERN
■ Reichenthal. Am 2. Dezember, nur wenige Wochen nach seinem 91. Geburtstag, starb Erwin Klotz, der langjährige Ortsbetreuer von Reichenthal. Er war am 27. Oktober 1931 in Reichenthal zur Welt gekommen. Dort wuchs er mit seiner Schwester Resl auf und besuchte die Bürgerschule in Roßhaupt. Erwins Vater, ein begeisterter Musikant, starb bereits im November 1938.
Erwin flüchtete 1945 bei Nacht und Nebel aus seinem Heimatdorf, nachdem durchgesickert war, daß er mit seinem Kameraden Otto Kilbert zur Zwangsarbeit ins Landesinnere verpflichtet werden sollte.
Herzen. Regelmäßig schrieb er über Reichenthal im Tachauer Heimatboten. Nach der Grenzöffnung organisierte er Treffen im oberpfälzischen Reichenau beziehungsweise im böhmischen Reichenthal, Maiandachten im Heimatdorf am Kreuz oder am Mühlweiher, Gottesdienste in Reichenau, wo er auch einen Gedenkstein aufstellen ließ, und Weihnachtsfeiern in Reichenthal. So bescherte er seinen Landsleuten viele unvergeßliche Stunden. Die Reichenthaler danken Erwin von Herzen für seinen Einsatz!
Omas Böhmische Küche
Meine Oma Marie Oppermann, Neuhammer Marie genannt, war die letzte Besitzerin des Hauses Reichenthal 29 bei Neuhäusl im Kreis Tachau.







Bis zu ihrem Todestag schwärmte meine Oma vom Leben auf dem Neuhammer. Dort hatten ihre Ururgroßeltern, der Hammermeister Johann Stöckl und seine Frau Margaretha, geborene Stich, um 1814 das sogenannte Hammermeisterhaus, später auch das Kommissärenhaus genannt, auf dem Neuhammer erbauten. Das Haus blieb in Omas Besitz bis zur Vertreibung 1946. Nach der Vertreibung verschlug es sie und meine Mutter nach München und dann weiter nach Norwegen, wo sie mit ihrer Tochter Gerda, dem norwegischen Schwiegersohn und uns Enkeln bis zu ihrem Tod 1980 in einem Haus lebte.

Oma erzählte immer wieder von schönen Kindheits- und Jugenderinnerungen vom Neuhammer, und ich freute mich als Kind besonders über ihre Kochkünste. Diese Kochkunst hatte sie von ihrer hoch geschätzten Großmutter, der Maria Amalia Stöckl, gelernt. Für uns in Norwegen war diese Küche um so exotischer. Bei niemanden sonst gab es Omas Baunkerle und süße Apfelbaunkerle, Omas Böhmische Kartoffelsuppe und nicht zu vergessen leckeren Dotsch mit Schwommerbroih, und jede Menge andere Pilzgerichte. Oma schwärmte immer wieder: „Man brauchte auf dem Neuhammer nur aus dem Haus und in den Wald zu gehen, da fand man so viele Schwammerl, daß man immer genug zu essen hatte.“
Viele der guten Zutaten für Omas Küche wurden im Garten auf dem Neuhammer angebaut wie Äpfel, Zwetschgen für die guten Zwetschgenknödel, Kartoffeln, Kräuter, Radi, Zuckerrüben, Bohnen, Mangold oder Weizen. Oma erzählte mir von der freitäglichen oder samstäglichen Prozedur des „Radi-Schnabulierens“ zusammen mit ihrem Vater Ge-
org. Im Garten wurden die größten und schönsten Rettiche ausgesucht, gewaschen und mit dem Rettichschneider in hauchdünne Scheibchen geschnitten. Sie wurden eingesalzen, kamen in ein passendes Gefäß und nachdem der Vater dieses begutachtet hatte, ob alles seine Richtigkeit hat, ging es ab nach Reichenthal in Säckels Restauration. Dort gab es frisches Brot und Butter und vor allem das süffige Faßbier zusam-
Werktagsdipfl war eine Art böhmisches Allzweck-Geschirr, aus dem auch Suppen wie Omas gute Einlaufsuppe aus Hühnerbrühe mit verquirltem Ei gegessen wurde. In die Suppe gab Oma auch reichlich selbst angebaute Petersilie und sonstige Kräuter und Zwiebel, fein gehackt mit dem Wiegemesser ihrer Großmutter Maria Amalia Stöckl





lichen Eintragung im Familienrezeptbuch, „sehr gut nach fettem Essen, überhaupt sehr gut für den Magen“ war.
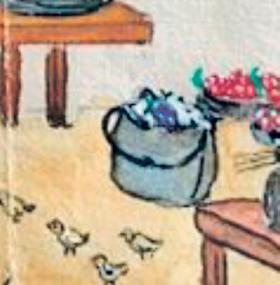



1946 fand die Familie Klotz dann in Pleystein in der Oberpfalz ein neues Zuhause. Nach der Lehrzeit und Arbeitsstellen in Nürnberg bei MAN sowie bei der Firma Grundig in Vohenstrauß wechselte Erwin Klotz 1963 zum Landkreis Vohenstrauß und arbeitete als Beamter in der Verwaltung. 1957 heiratete er Anna Zehent, 1959 wurde Sohn Karl-Heinz geboren. Seine Frau Anna starb 2019, kurz darauf ging er ins Pflegeheim Wohnen am Kreuzberg in Pleystein.




Das feierliche Requiem für unseren lieben Verstorbenen fand am 8. Dezember in der Stadtpfarrkirche Pleystein statt. Es wurde von Stadtpfarrer Adam Karolczak zelebriert und von einer Sängergruppe musikalisch gestaltet. Viele Freunde und Bekannte sowie eine Blaskapelle begleiteten ihn auf seinem letzten Weg.

men mit dem mitgebrachten Radi-Salat.
Und man hatte immer frische Eier von den Hühnern, die nachts unter dem Balkon ihren Stall hatten und ansonsten frei herumliefen. Hin und wieder gab es auch Hühnerfrikassee. Die Familie saß gerne vor dem Haus und genoß eine Tasse Kaffee in einer großen ortstypischen Tasse, dem Werktagsdipfl, serviert zusammen mit frischem Gebäck. Das
Man hatte auch eine Ziege, die besonders in den mageren Kriegs- und dem Nachkriegsjahren 1945 und 1946 der Familie wertvolle Ziegenmilch gab. Beim guten Nachbarn, dem Heger Schmidt, gab es ab und zu Honig und sogar mal frische Kuhmilch.
Im Garten gab es auch rote und schwarze Johannisbeersträucher. Die Beeren waren für Urgroßvater Georg Herrmanns guten „Schnaps von schwarzen Johannisbeeren“, der, laut seiner eigenhändigen handschrift-
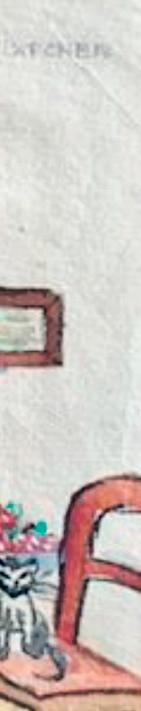

Ansonsten schenkte der Wald Mengen von Schwarzbeeren, Waldhimbeeren und Preiselbeeren zum Einwecken. Leckeres frisch gebackenes Brot dazu wurde bei der Familie Bauer in der Zana-Mühle beim Mühlweiher bei Reichenthal eingekauft. Hier wurde das wohlduftende Brot in großen Körben angeboten. Sonst kaufte man Lebensmittel und andere Notwendigkeiten wie Petroleum oder Karbid für die Lampen beim Adolf Schön in Neuhäusl ein, ab und zu auch bei Anton Fröhlich in Neuhäusl oder beim Stich in Reichenthal. Man mußte für die Einkäufe meistens weit zu Fuß laufen.
Wenn ich mir das nun als Erwachsene überlege, verstehe ich, daß das Kochen und der ganze Haushalt auf Omas geliebtem Neuhammer ganz schön anstrengend gewesen sein muß. Kein Strom und kein Wasser im Haus. Also mußte man Holz und Kohle für den Ofen ins Haus tragen. Das Wasser zum Kochen, für den Abwasch und für die Kleiderwäsche mußte vom Grenzbach geholt und in schweren Wasserkübeln 500 Meter bergauf getragen werden.

Oma hatte oft Sommergäste auf dem Neuhammer. Da wurde natürlich besonders gut und ausgiebig gekocht. Eine lustige Zeichnung bekam sie von einer guten Freundin, die um 1936 Ferientage auf dem Neuhammer verbrachte. Die Zeichnung zeigt meine Urgroßmutter Mathilde Herrmann/Stöckl beim Abwaschen, meine Mutter Gerda planschend in der Badewanne, und große Körbe voll Beeren stehen bereit zum Verarbeiten. Sie nannte das Bild „Herrmann Muttis Mittagsschläfchen“.
Die gute Böhmische Küche bedeutete viel Arbeit, und es war von einem echten Mittagsschläfchen auf dem Neuhammer bestimmt nur ganz selten die Rede.
Randi Oppermann Moe
Erwin war bei vielen Pleysteiner Vereinen eine feste Größe. Im TSV war er kurz nach dessen Wiedergründung als Spieler aktiv, dann über viele Jahre als Trainer der Seniorenmannschaft. Im Männergesangsverein 1895 war er als Sänger tätig und brachte sich als Schriftführer und Chronist ein. Beim VdK-Ortsverband war er ebenfalls Schriftführer. Viele Jahre berichtete er auch als freier Mitarbeiter der Heimatzeitung „Der Neue Tag“ über die Ereignisse in Pleystein.
Auch der Heimatkreis Tachau und das Dorf Reichenthal trauern um einen treuen Landsmann. Bevor er das Amt 2019 aus Krankheitsgründen an mich weitergab, war er seit 1986 Ortsbetreuer. Dafür sei ihm auch im Namen der Ortsbetreuerkollegen und im Namen von Heimatkreisbetreuer Wolf-Dieter Hamperl herzlich gedankt.
Erst am 23. Dezember 1989, als bei Neuhäusl der Grenzzaun durchtrennt wurde, konnte er zusammen mit Rosl Dobner und ihrem Mann wieder nach Reichenthal hinunterfahren. Die Heimat war kaum noch zu erkennen, und trotzdem war es einer der schönsten Tage seines Lebens. In den 33 Jahren des Wirkens für seine Heimat zeigte er immer wieder, wie wichtig ihm das Heimatdorf war, das er mit 14 Jahren hatte verlassen müssen.
Auch während der Zeit des Eisernen Vorhangs und gerade dann war seine Heimat ein wichtiger Teil seines Lebens und Denkens. Er trug die Heimat tief im
Allen Angehörigen und Freunden sprechen die Reichenthaler und der Heimatkreis Tachau ihr tiefes Mitgefühl aus. Erwin wird uns sehr fehlen und immer einen Platz in unseren Herzen haben. Erwin, ruhe in Frieden!
Folgenden Worten in einem Nachruf eines engen Freundes ist nichts mehr hinzuzufügen: „Nach seinem Tod bleiben uns die unterschiedlichsten Gedanken und Emotionen. Da sind Momente der Nachdenklichkeit, neben Trauer die Leere, und es wird uns bewußt, daß wir unsere Zeit nicht mehr mit diesem liebenswerten Menschen verbringen dürfen.“
Sieglinde Wolf Ortsbetreuerin


■ Großgropitzreith. Am 6. Oktober starb Franz Härtl, der langjährige Ortsbetreuer von Großgropitzreith, in Dietzenbach, der Kreisstadt des Landkreises Offenbach in Hessen. Am 13. Februar wäre er 87 Jahre alt geworden.
Er übernahm seine ehrenamtliche Ortsbetreuung 2006 von Marianne Pichl. Maßgebend war er an der Renovierung der HerzJesu-Kapelle, der Zierde des Dorfes, beteiligt. Bis zum Schluß hatte er auch einen Schlüssel für seine Kapelle.
Eine Ehre war für ihn, an den Heimatkreistreffen und oft auch an den Sudetendeutschen Tagen teilzunehmen. Doch mußte er leider in den letzten Jahren öfters wegen Krankheit absagen. Ich danke unserem Landsmann für die sehr gute Betreuung seines Geburtsdorfes. Der Herr gebe ihm die ewige Ruhe.
Wolf-Dieter Hamperl Heimatkreisbetreuer
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im Januar Karl Friedrich Damm, Ortsbetreuer von Malkowitz und Mallowitz, am 21. zum 86 Geburtstag, Heidi Renn, Ortsbetreuerin von Lusen und Tholl, am 24. zum 75 Geburtstag sowie Heribert

und Helga Kett, Ortsbetreuer von Roßhaupt, am 23. und am 25. zum 79 Geburtstag. Wir wünschen alles erdenklich Gute, Gesundheit sowie Gottes Segen und danken für alle Arbeit für unsere Heimat. Sieglinde Wolf

Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen)
Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Sigrid Lichtenthäler. Redaktion: Kathrin Hoffmann, eMail: isergebirge@sudeten.de Redaktionsschluß: Jeweils am 5. des Erscheinungsmonats.
Liebe Landsleute, jetzt, ab 2023, berichtet die Sudetendeutsche Zeitung von unserem schönen Städtchen Mährisch Neustadt. Viele kennen es, einige noch nicht, deshalb stelle ich es kurz vor:
Vor 800 Jahren, 1223, wurde Mährisch Neustadt/ Uničov gegründet und liegt auf 235 Metern in der Hanna-Ebene zwischen Olmütz (etwa 30 Kilometer entfernt) und Mährisch Schönberg. Es ist das älteste mit Stadtrechten ausgezeichnete Gemeinwesen in Mähren. Schon im Mittelalter war Mährisch Neustadt eine bedeutende mährische Siedlung, und im Jahre 1770 traf sich hier sogar der österreichische Kaiser Josef II. mit dem Preußenkönig Friedrich II., und die Stadt war für eine Woche Zentrum der Macht.
Bis 1850 war Mährisch Neustadt königliche Stadt mit landwirtschaftlichem Charakter, in der sich die Industrie allmählich entwickelte. 1850 entstand hier die erste Zuckerfabrik in Mähren, Eisenbahn, Telefon und auch das Schulwesen entwickelten sich schnell. Die vielen schönen, meist barocken Baudenkmale werden im Laufe der Zeit vorgestellt, auch der Stadtplatz mit seinen beachtlichen 13 719 Quadratmetern. 1946, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde die deutsche Bevölkerung ausgesiedelt. 1956 übernahm die Stadt Limburg die Patenschaft für die aus ihrer Heimat vertriebenen Mährisch-Neustädter Deutschen.
1956 übernahm die Stadt Limburg die Patenschaft für die aus ihrer Heimat vertriebenen Mährisch-Neustädter Deutschen. Sigrid Lichtenthäler
❯ Neu in der Sudetendeutschen Zeitung
Mährisch Neustadt im Isergebirge
❯ Die Marien-Pest-Säule
Zum Dank und zum Gedenken
ten zur Errichtung eines Denkund Dankmales ist nichts bekannt; lediglich ein Ratsprotokoll vom 12. Juli 1729 gibt über den Standort Auskunft, und noch im selben Jahr wurde der Grundstein auf dem Stadtplatz nördlich vom Rathaus gelegt. Weil abzusehen war, daß das Denkmal bis zur Heiligspre-
Als erstes wird das bedeutendste Barockdenkmal der Stadt, die Mariensäule, vorgestellt.

Am 11. September 1743, also vor 280 Jahren, wurde sie nach 14jähriger Bauzeit feierlich eingeweiht. Informationen von Otto Kühnert, Reinhold Huttarsch und Frau Dr. Zatloukalova liegen dem Bericht zugrunde.
Die Bürgerschaft von Mährisch Neustadt hatte sich – wie viele andere Nachbarstädte auch – zur Errichtung eines Denk- und Dankmales entschlossen. Anlässe dafür waren das Ende der Beulenpest 1715, die überstandene Hussitengefahr, die Heiligsprechung von Johann von Nepomuk 1729 und die anstehende Heiligsprechung von Johannes Sarkander. Er war von 1609 bis 1610 Vizepfarrer in Mährisch Neustadt, seine Seligsprechung erfolgte jedoch erst 1860.

Über die Vorbereitungsarbei-
chung von Johann von Nepomuk, die ja schon für 1729 vorgesehen war, nicht fertig wird, wurde dem Bildhauer Georg Anton Heinz, der seit 1726 Bürger von Mährisch Neustadt war, der Auftrag erteilt, rasch eine kleinere Nepomuk-Statue zu schaffen, die im Mai 1734 eingeweiht wurde.
An dem Denkmal, der „Mariensäule“, wurde inzwischen eifrig gearbeitet. Der Dechant Franz Ludwig Panenka spendete Geld, sein Nachfolger, Dechant Andreas Richter aus Mährisch Neustadt, brachte das künstlerische Verständnis mit. Wenzel Render (1669–1733) aus Olmütz, ein bedeutender Säulenbauer, arbeitete eifrig an dem Denkmal, nach seinem Tode übernahm Georg Anton Heinz die Arbeit. Aber er erkrankte schwer, deshalb schaltete man den Bildhauer Severin Tischler aus Mährisch-Trübau ein. Tischler hatte den Auftrag, 13 Figuren zu schaffen, darun-
ter die obere, die Jungfrau Maria mit Weltkugel. Tischler arbeitete mit drei Gesellen (Franz Seidel, Ignaz Winkler und Mathes, dessen Familiennamen nicht bekannt ist) in den Jahren 1737, 1739 und 1740. Nach Beendigung des 1. Schlesischen Krieges, in dem die Stadt besetzt war und zusätzlich noch die Seuche ausbrach, nahm Georg Anton Heinz die Bildhauerarbeit wieder auf und krönte sie mit der monumentalen Marienfigur, die mit Trompetenschall und Paukenschlägen auf die Säule gesetzt wurde. Für Postament und Pyramide wurde Sandstein aus Wojes verwendet, für die Figuren der weichere Blosdorfer Sandstein. Als Goldschläger war Jakob Grünwald aus Olmütz eingesetzt, der 78 Bücher doppelten Goldes verbrauchte. Unter anderem waren noch 26 Zentner Klammereisen nötig und 110 Eimer Leinöl aus Mährisch Trübau. Wohltäter spendeten in den Jahren 1729 bis 1743 für das herrliche Werk 1772 Gulden. Das meiste Geld erhielten Severin Tischler und Georg Anton Heinz. Ignaz Winkler, ein Geselle von Tischler, wurde für acht Engel bezahlt, die Maler Jakob Zink und Ignaz Oderlitz und der Goldschlager Grünwald erhielten auch ihren Arbeitslohn, insgesamt wurden 5654 Gulden ausgegeben.

Die Einweihung der Mariensäule war am 11. September 1743. Sie erfolgte durch den Mährisch Neustädter Landsmann Johann Josef Glätzl, den damaligen Rektor der Bruderschaft der Jungfrau Maria und des heiligen Johannes von Nepomuk und den Probst des Augustinerklosters in Sternberg. Die Predigt hielt Dechant Andreas Richter.
Das Monument, aus heimischem Stein und von Lands-
leuten geschaffen, wurde 21 Meter hoch, die aus einem quadratischen Sockel emporwachsende Säule mit der drei Meter hohen Jungfrau Maria zeigt in den nischenartig gerundeten Seiten vergoldete Reliefbilder: Mirakelbild mit Stadtansicht, Märtyrertod des heiligen Johann von Nepomuk und den seligen Jo-

hannes Sarkander. Die Eckfiguren unten stellen die Heiligen Josef, Florian, Georg, Judas Thaddäus dar, die obigen Karl Borromäus, Bartholomäus, Jakobus den Älteren, Johannes Sarkander.


Figuren in den Nischen: Johann von Nepomuk, Andreas, Barbara, Anto-

Die Mariensäule mit dem Rathaus im Hintergrund.
Eine der Eck guren ist die des Heiligen Florian, der unter anderem Schutzpatron der Bäcker, Schornsteinfeger und Bierbrauer sowie gegen Feuer und Dürre ist.
nius von Padua. Hoch oben thront die Figur der Maria mit Kind, datiert von 1743 mit den Initialen GAH.

Den Schöpfern des Werkes gehört ein Dank dafür, daß dieses Denkmal seit 280 Jahren in Mährisch Neustadt steht, das bedeutendste Barockdenkmal der Stadt ist und zu den schönsten Mariensäulen Mährens zählt.
 Der Kopf der drei Meter großen Muttergottes-Statue mit dem Jesuskind.
Der Kopf der drei Meter großen Muttergottes-Statue mit dem Jesuskind.
Zdenko Vodička –Baumeister und Bürgermeister
Er fuhr in ein Hamburger Sanatorium, um sich am Herzen behandeln zu lassen, kehrte aber von dieser Reise nicht mehr lebend zurück. Der Mährisch Neustädter Bürgermeister und Unternehmer Zdenko Vodička starb am 20. September 1922 im Alter von 61 Jahren. Sein Körper wurde überführt, und eine Woche später war die Beerdigung am Mährisch Neustädter Friedhof. Dem Sarg folgten Tausende Bürger, in vorderster Linie der frühere Bürgermeister Franz Schischma, Vizebürgermeister Karl Marzelli, Johann Zemsky, Bürgermeister der umliegenden Städte, Repräsentanten der Behörden, Gewerbevereine und Schulen. Ein nicht endender Zug durch die Stadt, in der alle Geschäfte geschlossen blieben, die Fenster verdunkelt und die Straßenlampen mit Trauerflor behängt waren.
Der Junge, dem man den Namen Kazimir Zdenko gab, wurde am 1. April 1861 in Merotin als zweites von drei Kindern des Vinzenz Vodička und seiner Frau Marie Juliana, geborene Dresler, geboren. Die Mutter stammte aus Littau von der Familie des örtlichen Bäckers Anton Dresler. Der Großvater Anton Lindner, Zdenkos Urgroßvater, war damals Besitzer einer Littauer Mühle. Die Familie des Vaters lebte als Kleinbauern, aber Zdenkos Vater Vinzenz ging einen anderen Weg: Er wurde Baumeister. Und weil er große Ambitionen hatte, brauchte er Geld. Als 26jähriger heiratete er 1850 in Merotin die zwölf Jahre ältere Marie Haykov, eine Pfarrköchin und Grundbesitzerin. Nachdem sie 1857 gestorben war, heiratete Vinzenz mit 38 Jahren zum zweiten Mal. In der Ehe kamen drei Kinder zur Welt – die älteste Maria Aurelia, nach ihr Kasimir Zdenko und Emilia Olga. Aus den Mädchen wurden Wirtschafterinnen, während Zdenko in den Spuren sei-
n Die Bewohner werden gebeten, kein Speiseöl oder Fette in die Kanalisation zu kippen, denn dort verbindet sich Fettiges nicht mit Wasser und verstopft Abfluß und Rohrleitung.
n Als Bürgermeister für Mährisch-Neustadt wurde für weitere vier Jahre Radek Vincour von der ODS gewählt. Er bedankte sich danach für das in ihn gesetzte Vertrauen und hofft, daß er
nes Vaters blieb. Er wurde Ingenieur, 1887 erhielt er die Konzession als Gewerbe-Baumeister und ein Jahr später übernahm er die Baufirma seines Vaters. 1890 heiratete Zdenko Theresa Zanger, die sechs Jahre jüngere Tochter des Mährisch Neustädter Kaufmanns Franz Zanger. Ein Jahr später wurde ihnen Sohn Herbert geboren, drei Jahre später der zweite Sohn Egon. Während der nächsten Jahre baute Zdenko Vodička mit Fleiß
heute den Namen seiner Frau Therese.
Zdenko Vodička hinterließ nicht nur Spuren in der Stadt, in der er lebte, sondern in ganz Mähren. Er konstruierte das Deutsche Haus im benachbarten Littau, baute die Stadtämter in Niklasdorf und Deutsch Liebau und Siedlungshäuser in Freudenthal. Zu seinem Prestigebau gehörte das Bad-Hotel Altvater in Freiwaldau, das 1903 ursprünglich als Soldatenanstalt

präsentativsten Objekten Freiwaldauer Bäder.
Für die Firma Vodička war der Umbau von Schloß Busau, dem Wohnsitz des Ordens der Deutschritter, offenkundig der bedeutendste, neben dem Aufbau des Sanatoriums in Zuckmantel.
1914 vereinigte sich die Firma Vodička mit zwei weiteren und bildete die Vodička-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die bis ins Jahr 1920 so firmierte, da-
schuldigt hatte. Aus dem Wiener Gefängnis kam er nach einigen Tagen frei, aber die Erfahrungen aus dem österreichischen Arrest konnte er niemals vergessen.
Während des Krieges beteiligte sich die Firma Vodička am Aufbau von Baracken für das Soldatenkrankenhaus in Olmütz, Vodička selbst betrieb einen regen Handel und der Krieg schadete der Firma grundsätzlich nicht. Seine Söhne machten am Mährisch Neustädter Gym-
Insgesamt engagierte sich Zdenko Vodička in Mährisch Neustadt nicht nur als Baumeister, sondern auch als Politiker. Ab 1894 war er Gemeindevertreter, danach Mitglied im Verwaltungsrat der Zuckerfabrik und der Brauerei, war in vielen örtlichen Vereinen und als Pferdeliebhaber Vorsitzender des Reitervereins. 1919 wurde er Bürgermeister in Mährisch Neustadt. Seine erste Amtshandlung war, hier das Gymnasium zu halten und für die sich streitende tschechische Minderheit für den Bau einer tschechischen Schule zu sorgen. Auch war die Wohnungskrise zu lösen. Er bereitete einen Antrag für die Wohnungsgenossenschaft vor zum Bau von 52 charakteristischen Häusern in der Olmützer- und KrankenhausGasse, die mit städtischen und staatlichen Geldern unterstützt wurden.
Oben: Diese Villa in der Nähe des Bahnhofs war der Wohnsitz vonBaumeister Zdenko Vodička (1860–1922) und seiner Frau Theresa Zanger. Ihr zuliebe gab er der Villa den Namen „Theresienhof“.



Das Krankenhaus in Mährisch Neustadt (links) geht wie das 1903 fertiggestellte Altvater-Sanatorium in Freiwaldau auf den Ingenieur Zdenko Vodička zurück .
den größten Mährisch Neustädter Baubetrieb und zwei Ziegeleien auf. Er handelte nicht nur mit Ziegeln, sondern auch mit Steinen vom Galgenberg und widmete sich vor allem dem Bauen. Man sagt, daß ohne seine Bemühungen Mährisch Neustadt heute nicht so aussehen würde. Er hat Gebäude restauriert wie die Pfarrkirche und Klosterkirche, neue Objekte gebaut wie die Mädchen-Volks- und Bürgerschule, das Krankenhaus, Millerhaus und vieles mehr. Vodičkas eigenes Haus beim Bahnhof trägt
für den Offiziersnachwuchs errichtet wurde. Wegen finanzieller Probleme wechselte der Besitzer, und ab 1910 diente der Bau als Sanatorium zur Heilbehandlung mit Radiumtherapie. Der dreistöckige Bau hatte hundert luxuriöse Zimmer mit Bad und Zentralheizung, Frühstücksraum, Kultur- und Geselligkeitssäle, Sportplatz, einen versteckten Säulengang, überdachtes Schwimmbad und weitere Innenund Außen-Sportplätze. Heute steht das Hotel nicht mehr, zu seiner Zeit gehörte es zu den re-
nach änderte sie ihre Rechtsform in Gesellschaft mit Partner.
Daß es im VodičkaUnternehmen Schwierigkeiten gab, zeigen eindeutig die vielen Streitigkeiten, von denen ein nicht geringer Teil auch vor dem Richter ausgetragen wurde. 1916 wurde Vodička in Wien festgehalten und inhaftiert, es verbreitete sich das Gerücht, daß er wegen Landesverrat einsaß. Es zeigte sich jedoch, daß er festgehalten wurde wegen einer Anzeige seines Gesellschafters, den er vorher der Veruntreuung be-
und die Angestellten der Stadtverwaltung jedem Bürger bei Problemen behilflich sein können. Die nächsten vier Jahre würden sicher nicht leicht, er glaube aber, daß Mährisch Neustadt eine Stadt sein werde, in der jeder Bürger gut leben könne.
n 37 Bäume können für Kinder, die in den Jahren 2020 bis
2022 geboren wurden, gepflanzt werden. Bedingung sind der Wohnsitz in Mährisch Neustadt und eine Anmeldung der Eltern mit persönlichen Angaben. Den Eltern wird anschließend ein Erinnerungszertifikat übergeben.
n Einen Gutschein über 5000 Kronen für den Kauf eines Handys erhielten zwei Siebenjährige,
die in einer kritischen Situation nicht kopflos handelten und die Feuerwehr um Hilfe riefen.
Drei Freunde hielten sich in einer einsamen Ziegelei mit ihren Trittrollern auf. Einer der Jungen übersah beim Spielen die Grube, fiel hinein und hatte plötzlich Wasser unter sich. Einer seiner Freunde hörte etwas fallen und einen Schrei. Erst dachte er, daß
nasium Abitur, Herbert studierte noch vor Kriegsbeginn Technik und wurde Ingenieur, Egon beendete sein Studium erst 1921 und wurde Doktor des Rechts. Beide waren an der Front, Herbert als Oberleutnant beim Regiment der Feldkanoniere zuerst an der russischen, später an der italienischen Front, Egon als Leutnant bei der Artillerie in Italien. Beide erhielten Auszeichnungen, Egon die bronzene und silberne Medaille Zweiter Klasse für Tapferkeit und das Karls-Soldatenkreuz.
Zdenko Vodička selbst hatte sein Ende nicht erwartet. Mit ihm verlor die Stadt eine prägende Führerpersönlichkeit, einen Menschen, der Mährisch Neustadt mit seinem Charakter einen Stempel aufdrückte. Er beherrschte das Deutsche und das Tschechische, und obwohl er seine tschechische Nationalität verleugnete, widersetzte er sich nicht aus Prinzip gegen tschechische Ansprüche, sondern weil ihm als Unternehmer nicht der Sinn danach stand. Seine Vision war, eine moderne Stadt aufzubauen. Er wollte den Fluß regulieren, die Eisenbahnverbindung von Mährisch Neustadt nach Langendorf und bis nach Friedrichsdorf vorantreiben. Dies war ihm nicht gegönnt. Er starb vor etwas mehr als 100 Jahren; er sollte jedoch nicht vergessen werden.
Nikola HirnerováAus dem „Mährisch Neustädter Berichterstatter“ vom August 2022, übersetzt und leicht gekürzt von Sigrid Lichtenthäler.
der Kamerad ihm einen Streich spiele. Dann schaute er aber genauer hin und erfaßte die Situation. Die Jungen wollten nun den Freund aus der Grube herausziehen, was aber nicht gelang. Beim Rettungsversuch fiel auch noch das Handy eines der Jungen in die Grube und liegt bis jetzt noch dort. Die Jungen behielten jedoch die Ruhe, und der, der in
die Grube gefallen war, warf sein Handy nach oben. Damit riefen seine Freunde die Feuerwehr. Die erschien nach fünf Minuten und meinte, daß die Buben dem Verunglückten das Leben gerettet hätten, weil es in dem kalten und tiefen Wasser um Minuten ging. Es kam also Hilfe in letzter Minute.
Übersetzt und gekürzt von Sigrid Lichtenthäler.
Achtmal abgebrannt
Das mächtige Gotteshaus mit seinem hochragenden Dach und den beiden ungleichen Türmen prägt wesentlich die Silhouette der Stadt. 1325 bis 1350 wurde es als gotische, dreischiffige Hallenkirche erbaut, 50 mal 20 Meter groß mit Kreuzgewölbe, 15 Strebepfeilern und Spitzbogentor. 1450 erfolgte der Anbau der Sakristei als Kapelle für die tschechischen Utraquisten (gemäßigte Richtung der Hussiten, die den Laienkelch beim Abendmahl forderten), später wurde die Sakristei von den deutschen Katholiken genutzt. Die Josefs-Kapelle an der Südseite der Kirche entstand 1713, an ihrer Außenwand befand sich das kleine Relief „Kreuzigung“ aus dem Jahre 1521.
Die Kirche brannte seit ihrem Aufbau insgesamt achtmal aus. An ihren Neuaufbau nach dem Großbrand während des Dreißigjährigen Krieges erinnert eine Gedenktafel im unteren Teil des Nordkirchturms. Schlimm wurde
die Kirche auch beim Brand im Jahre 1779 beschädigt: Damals schmolzen die Glocken, und das einstürzende Kreuzgewölbe vernichtete den Hochaltar, die Ratsstühle und die Fresken von 1750.
Das Kirchenschiff ersetzte man später durch ein Barockgewölbe.
Die bei Bränden beschädigten Türme wurden im 17. und 19. Jahrhundert ausgebaut und bedacht. Der südliche achteckige Turm mit einer Uhr aus dem Jahre 1819 gehörte als Wachturm zur Stadtbefestigung und mußte von der Stadt unterhalten werden.
Wegen Geldmangels stand er nach Bränden von 1643 bis 1795 als Ruine da. Nach der Gründungssage wird dieser Turm „Hundsturm“ genannt, er trägt auf halber Höhe einen Wasserspeier in Hundeform. Am Treppentürmchen befindet sich eine kleine gotische Statue, die volkstümlich als „Stadtgründer Theoderich“ bezeichnet wird. Wahrscheinlich stellt sie aber den heiligen Bischof Prokopes dar, den Neusiedler bei der Stadtgründung mitbrachten.
Der Nordturm, Stutz- oder Glockenturm genannt, ist viereckig und trägt vier Glocken. Das SanktusGlöckchen hängt in dem 1726 erbauten Dachreiter. 1889 bekam der Turm bei der Renovierung einen Helm von Ingenieur Zdenko Vodička.
Hochaltar und Kanzel, im hochgotischen Stil, wurden anläßlich der Instandsetzung der Kirche 1891 und 1895 errichtet. In den barocken Seitenal-

tären befinden sich vier wertvolle Holzskulpturen von G. A. Heinz aus der Zeit um 1740. An der Ostseite ist das Mirakelbild „Unserer Lieben Frau zum Wachsstockgelübde“ zu sehen. Das Gelöbnisbild zeigt Mährisch Neustadt mit „obschwebender“ Madonna im blauen Mantel, im Vordergrund eine kniende Frau. In den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts erfolgte eine umfangreiche Renovierung der Mariä-HimmelfahrtKirche, die hauptsächlich auf Initiative des damaligen Pfarrers Maximilian Jarosch zurückzuführen ist. Die Bedachung der beiden Türme und das Dach des Kirchenschiffs wurden erneuert und eine Fassadenrekonstruktion vorgenommen. Dabei entdeckte man sogar eine original gotische Leibung. Die ursprünglichen Rücksprünge der gotischen Fenster blieben bei der Renovierung stehen, und das gotische Portal – einzigartig in Mähren – erhielt eine neue gotische Blendung. Immer wieder ist man von Gestalt und Form des Portals, das die hohe Kunst der Steinmetze und deren hochwertige Arbeit zeigt, beeindruckt.
Sigrid Lichtenthäler
Pater Johann Parsch
1890 begrüßte er in Neutitschein, zusammen mit weiteren Repräsentanten der Stadt, den Erzherzog Eugen HabsburgLothringen, der wegen der Organisation des größten Soldatenmanövers in Neutitschein anreiste und im August zelebrierte er eine große Feldmesse zum 60. Geburtstag des Kaisers Franz Josef I. 1893 verwaltete er das Neutitscheiner Dekanat und unterrichtete Religion an der deutschen Mittelschule in Neutitschein.


der ältesten Karten von der Innenansicht der Pfarrkirche. 2005 wurde zwar dieselbe Karte bekannt, aber die stammte aus dem Jahre 1967.

Parsch war deutscher Priester und Verteidiger der alten Ordnung der Habsburger Monarchie. Sein Verhältnis zu den Tschechen im deutschen Neutitschein hat er in ausführlichen Studien erläutert, aber die Stadt war mit dem Nationalitäten-Geplänkel des kommenden 20. Jahrhunderts nicht zu vergleichen.
Heute erinnern wir uns an den Mährisch Neustädter Landsmann Johann Parsch: Priester, Pfarrer, Dekan und Zeremonienmeister.
Geboren wurde er in der deutschen Kleinstadt Mährisch Neustadt am 29. Oktober 1847 und wuchs in einer deutschen Familie auf. Während der Gymnasiums-Jahre lebte er in Kremsier, danach entschied er sich für ein Studium der Theologie. Das Priesterseminar besuchte er gemeinsam mit dem zukünftigen Olmützer Erzbischof Theodor Kahn. Geweiht wurden beide am Feiertag des heiligen Cyril im Jahre 1871. Sechs Jahre später wurde Johann Parsch der Pfarrei in Neutitschein zugeteilt. Von 1877 bis 1879 unterrichtete er Religion in Blauda, ab 1882 wirkte er als Pfarrer in Neutitschein und ab 1888 in Schönau/Neutitschein. Dann zog er in die Pfarrei nach Neutitschein, wo er mit seiner Mutter Anna Parsch (geboren am 16. Juni 1827 in Mährisch Neustadt) lebte, dem Kaplan Franz Koupil aus Bilsek, der Köchin Klothilda Kness aus Littau und dem Dienstmädchen Marie Bittner.
Viele Vermerke bezeugen, daß er sich auch bei den Förderern eingliederte; sorgfältig führte er die Pfarreichronik. 1896 traf er sich wieder mit seinem Mitschüler Theodor Kahn, diesmal in seinem Dekanat, als der Erzbischof einen Krankenbesuch machte, was dieser häufig praktizierte.
Von Franz Josef I. erhielt Johann Parsch 1903 das „Österreichische allgemeine Ritterverdienstkreuz des Ordens Franz Josef“ und wurde Ehrendomherr beim Kollegial-Domkapitel in Kremsier. Am Ende seines Lebens wurde er noch zum ehrenhaften Mitbürger von Neutitschein, den Gemeinden Söhle und Blauda, ernannt. Johann Parsch starb am 16. Januar 1916 in Neutitschein und wurde am neuen Stadtfriedhof beerdigt.

Bei der Sammlung von Bildern und Fotomaterial des staatlichen Archives von Neutitschein liegen auch aus dem Nachlaß des Dekans einige Postkarten, die an ihn adressiert waren und die aus verschiedenen Ecken Europas kamen. Unter ihnen waren die viel in Anspruch genommene –und für den Mährisch Neustädter Philologen eine der bedeutendsten – die Futurologie-Ansichtskarte „Mährisch Neustadt in der Zukunft“ und eine außergewöhnliche vom Altar der Allerheiligsten Dreifaltigkeit der Mährisch Neustädter Pfarrkirche. Diese Ansichtskarte stammt aus dem Jahre 1904 und ist eine
Dekan Parsch ließ kaum eine Gelegenheit aus, seine Heimatstadt Mährisch Neustadt zu besuchen, wie die Pfarrchronik-Ein-
träge des damaligen Verwalters der Mährisch Neustädter Kirche, Pater August Liewehr, bezeugen. Regelmäßig nahm Parsch am Wachsstockfest teil, hielt in der Kirche während des Gottesdienstes eine Ansprache oder nahm nach der Tradition mit einer Wachskerze in der Hand an der Prozession von der Kirche zur Mariensäule am Stadtplatz teil. Antonín Hampl
Aus dem „Mährisch-Neustädter Berichterstatter“ vom 20. September 2022, übersetzt und leicht gekürzt von Sigrid Lichtenthäler.
90. Geburtstag am 16. Olga Simmen/Kiesewetter in Tambach-Dietharz; 89. Geburtstag am 3. Gottfried Mühl in Kaufbeuren-Neugablonz; 88. Geburtstag am 18. Annelies Fritz/Ulbrich in Neuötting; 85. Geburtstag am 7. Dr. Dieter Piwernetz in Nürnberg; 78. Geburtstag am 11. KlausDieter Siegmund in Karlsruhe; am 21. Roswitha Theileis/Kolb in Kaufbeuren-Neugablonz; 77. Geburtstag am 26. Gertraud Theileis/Gast in Nagold;

74. Geburtstag am 1. Ute Schlegel/Havlik in Weidenberg; am 26. Karin Theileis in Garbsen;
70. Geburtstag am 5. Brigitte Zöpfel/Tomesch in München; am 15. Josef Hausmann in Dösingen; 68. Geburtstag am 4. Brigitte Posselt in Altdorf; am 25. Renate Domin/Prade in KaufbeurenNeugablonz; 62. Geburtstag am 18. Gabriele Neubert/Havlik in Röslau; 30. Geburtstag am 19. Lena Liebau in Marburg Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Schumburg-Gistei/Unterschwarzbrunn: Im Februar gratuliert die Ortsgemeinschaft zum 78. Geburtstag am 19. Februar Heinz Dimter in Ettlingen. Hans Theileis Ortsbetreuer

■ Labau-Pintschei: Ende des letzten Jahres mußten wir von zwei Heimatfreunden Abschied nehmen: Am 13. November 2022 starb Edith Reckziegel/Hübner (*13. November 2022), Sudetenstraße 109, 87600 Kaufbeuren-Neugablonz, im Alter von 94 Jahren. Am 27. November 2022 starb Annemarie Theileis (*11. Mai 1935), Sachsenstraße 2a, 64297 Darmstadt, im Alter von 87 Jahren. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Friedrichswald: Erich Lorenz verstarb im Alter von 93 Jahren Ballenstadt/Harz. Um ihn trauern seine Ehefrau Jutta, und die Kinder Sabine, Bernd und Axel mit Familien.

Auf der Walz

Familie Alois Kunz



V
on unserem Großvater Brosig ist leider wenig bekannt, aber es ist viel über ihn erzählt worden. Ich habe ihn einige Male gesehen, wenn er bei einer Taufe oder bei einem Geburtstag in Freiwaldau zu Besuch war oder wenn wir ihn in seinem Haus in Zuckmantel, Am Bahnsteig, besucht haben. Ich bin aber zweimal allein mit der Bahn zu ihm gefahren – nach meiner Erinnerung war es 1943 und 1944 und schließlich im April 1945 kurz vor dem Ende des Krieges, als ich allein mit einem Verpflegungskonvoi nach Niklasdorf und von da zu Fuß nach Zuckmantel gelaufen bin, um der „Mannschaft“ (drei Tanten) beim Packen zu helfen.
Er hatte in seinem großen Garten eine ganze Reihe von Obstbäumen, darunter zwei Herzkirschenbäume, von denen ich mich kaum trennen konnte, und auch zwei Nußbäume mit sogenannten Papiernüssen (Das sind Nüsse mit einer ganz dünnen Schale, die man mit einem leichten Druck ohne Nußknacker öffnen konnte.).
Ich kann mich an irgendwelche Gespräche mit ihm nicht erinnern. Und so nachträglich betrachtet, war er wahrscheinlich froh, wenn ich wieder aus dem Haus war. Vielleicht war ich ihm auch zu „umtriebig“, und es war schon nicht leicht, mich von einem Kirschbaum herunter zu holen, wenn ich diesen erstmal „in Besitz“ genommen hatte. Möglicherweise wären wir uns etwas näher gekommen, wenn er mir etwas gezeigt oder von seinem Beruf, von seiner Jugend oder von seinen Wanderjahren etwas erzählt hätte, aber das war ja früher auch nicht üblich, daß man sich mit den Kindern etwas mehr beschäftigte.
Aus der frühen Zeit in Saubsdorf, wo er geheiratet hat und seine Tischlerei aufgebaut hatte, habe ich Näheres nur aus den Erzählungen von meiner Tante und meiner Mutter erfahren. Wie er aus dem kleinen Ort Elbe in Mähren nach Saubsdorf in Österreich-Schlesien gekommen ist, bleibt ungeklärt, aber Saubsdorf war offenbar das Ende seiner Wanderschaft, auf die er sich etwa im Alter von 25 Jahren begeben hatte, um etwas von der Welt zu sehen und für seinen Beruf zu lernen. Die ganz große Welt, nämlich mit seinem Vater und seiner Schwester nach Amerika auszuwandern, dieses Abenteuer wollte er sich wohl nicht
zumuten, und er hat mit seiner Entscheidung wohl Recht behalten, da sein Vater nach drei Jahren wieder zurückkehrte, weil er in Amerika nicht „Fuß fassen“ konnte.
Er blieb also in seinem kleinen Ort Elbe, erlernte das Tischlerhandwerk und schloß die Lehre mit der Gesellenprüfung ab. Nun stand ihm die Welt offen, er mußte nicht in seinem Geburts-




hen, daß er den Weg nach preußisch Schlesien gesucht hat, da er aus einem rein-deutschen Gebiet stammt und daher die böhmischen Sprache kaum kannte und außerdem die Strecke von seinem Heimatort Elbe bis zum „Glazer Kessel“ in zwei bis drei Tagesmärschen zu bewältigen war. Von da aus ist er vermutlich nach Bayern gewandert. Wie lange er in seinen einzelnen Stationen geblieben ist, läßt sich nicht mehr feststellen.
ort bleiben, als Geselle konnte er nun auf „Wanderschaft“ gehen, wie das damals allgemein üblich war. Er muß vorher in eine „Gesellenbruderschaft“ eingetreten sein, ohne die man außerhalb der unmittelbaren Heimatgrenzen in der Fremde nicht die erforderlichen Kontakte zu den Arbeitsstellen finden konnte, denn die Gesellenbruderschaften richteten überall HandwerksHerbergen ein, die den „fahrenden“ Gesellen gegen geringes Entgelt Kost und Unterkunft boten. Die Tischlergesellen wurden übrigens scherzhafterweise auch „Hobeloffiziere“ genannt.

All sein Hab und Gut verstaute der wandernde Geselle in einem Wanderbündel, auch „Charlottenburger“ genannt, in dem nur das Allernötigste Platz fand.
Zur Ausrüstung gehörte auch der Wanderstab, in der Regel ein von Natur aus am oberen Ende gedrehter Holzstab.
Das silberne Gehänge an der Weste und bei vielen auch ein Ohrring dagegen reichte aus, dem Gesellen im Todesfall ein würdiges Begräbnis zu bezahlen. Hatte sich ein Geselle unehrenhaft verhalten, wurde dieser zum „Schlitzohr“ gemacht: der Ohrring wurde ihm ausgerissen.
Es ist nicht bekannt, wie lange er innerhalb der mährischen Grenzen geblieben ist und ob er auch im böhmischen Bereich vorübergehend Fuß gefaßt hat. Man kann eher davon ausge-
Da könnte sein „Wanderbuch“ Auskunft geben, der wichtigste Gegenstand, den ein Wandergeselle bei sich trug. Das Wanderbuch enthielt praktisch den Gesellenbrief und die Daten, wann und wo sich der Wandergeselle im Laufe seiner Wanderschaft aufgehalten hat. Dieses Wanderbuch hat der Großvater auch mit seinen wichtigen Ausweispapieren bei der Vertreibung gerettet, aber nach seinem Tod ist das wohl alles verloren gegangen. Von meiner Tante habe ich jedenfalls nicht gehört, wo sein Nachlaß hingekommen ist. Da ein Onkel seine Finger mit im Spiel hatte, liegt die Vermutung nahe, daß er die „Papiere“ entsorgt hat, da er sich ja für die Familienhistorie nicht interessiert hat und im Wesentlichen mit „Scheffeln“ beschäftigt war.

Auf seiner dreijährigen Wandertour ist der Großvater schließlich bis nach Frankfurt am Main gekommen. Leider ist nicht bekannt, in welcher Ecke er damals gewesen ist. Auch die Route von Frankfurt aus bis nach Saubsdorf, wo er seine Wandertour beendet hat, „seßhaft“ wurde und schließlich seine Frau heiratete, ist nicht bekannt. Er hätte wahrscheinlich über seine Erlebnisse und besonderen Begebenheiten viel erzählen oder alles auch aufschreiben können, aber dazu ist er damals wahrscheinlich nicht gekommen, da der Aufbau der Existenz und die Gründung der Familie Vorrang hatten. Rudolf Heider

Die Gesellenbruderschaften hatten ein strenges Reglement: Die Handwerksgesellen – auch Tippelbrüder genannt – mußten, wenn sie „auf die Walz gehen wollten“, ledig, schuldenfrei und ohne Vorstrafen sein und durften das 30. Lebensjahr nicht vollendet haben. Bereits im 15. Jahrhundert wurde der Brauch der „Walz“ zur Voraussetzung, den Meistertitel zu erwerben. Die Wanderzeit entwickelte sich im Laufe der Zeit zur hohen Schule des Handwerks.
Schon

