Serie Ehrensache Ehrenamt: Dr. Hans-Peter Sang im Portrait (Seite 5)
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung
HEIMATBOTE
Jahrgang 75 | Folge 5 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 3. Februar 2023
VOLKSBOTE
HEIMATZEITUNGEN
Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutsche Zeitung
❯ „Wir brauchen mehr denn je starke demokratische Netzwerke und tragfähige Partnerschaften mit den Demokratien in Ostmitteleuropa“

Reicenberger Zeitung


Sudetendeutschen Landsmannschaft
Sudetendeutsche Zeitung
Zeitung


HEIMATBOTE
HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Neudeker Heimatbrief
Neudeker Heimatbrief
HEIMATBOTE




VOLKSBOTE
Sudetendeutscher Rat warnt vor Kürzungen
VOLKSBOTE
VOLKSBOTE
VOLKSBOTE


des Vertriebenen-Etats
der Einladung, an dieser Sitzung des Sudetendeutschen Rates teilzunehmen, nicht folgte. Ebenfalls eingeladen, aber nicht anwesend war Natalie Pawlik (SPD), die seit April 2022 Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten ist.

❯ Härtefallfonds
Scharf:
„Der Bund muß liefern“

„Im Weihnachtswald“ Salesel um 1900 74. Jahrgang November/Dezember 2022 Folge 11/12 Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe MITTEILUNGSBLATT FÜR STADT UND KREIS LEITMERITZ Wichtiger Hinweis auf Seite 203 u. 204 „Im Weihnachtswald“ Salesel um 1900 74. Jahrgang November/Dezember 2022 Folge 11/12 Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe MITTEILUNGSBLATT FÜR STADT UND KREIS LEITMERITZ Wichtiger Hinweis auf Seite 203 u. 204
Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hat die Bundesregierung aufgefordert, die Voraussetzungen für den Vollzug des Härtefallfonds bei Öl und Pellets zu schaffen: „Diese Hängepartie der Ampel belastet den Geldbeutel unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Mitte Dezember hatte der Bund einen Härtefallfonds für Öl und Pellets mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro angekündigt, der parallel zur Gas- und Strompreisbremse eingeführt werden soll, und die Länder mit der Umsetzung beauftragt. Vor allem für die Bewohner des ländlichen Raums wäre dieser Energiekostenzuschuß eine Entlastung. Doch passiert ist nichts, klagt
Das Kulturgut der deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussiedler sei „ein wichtiger und selbstverständlicher Teil unserer gesamtdeutschen Kultur“, erklärte Dr. Bernd Fabritius, der Präsident des Bundes der Vertriebenen, in seiner Brandrede auf der Plenarsitzung des Sudetendeutschen Rates am Samstag in München und rechnete vor:
„Rund ein Drittel der Deutschen ist familiär mit diesem Schicksal verbunden.“
Dem gegenüber werde im aktuellen Etat für die Kultur- und Medienpolitik des Bundes, der immerhin rund 2,39 Milliarden Euro umfaßt, die Kulturarbeit nach Paragraph 96 des Bundesvertriebenengesetzes mit nur 0,82 Prozent berücksichtigt. Der ohnehin schon niedrige Etat war für dieses Jahr von 20,7 Mil-
Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes des Vertriebenen, warnt vor den Kürzungen aus Berlin. Links das Präsidium des Sudetendeutschen Rates (von links): Ex-MdL Albrecht Schläger (verdeckt), SL-Landesobmann Ste en Hörtler, MdB Stephan Mayer, Generalsekretärin Christa Naaß, und der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, MdEP a. D. Bernd Posselt.



lionen Euro um fast fünf Prozent auf 19,7 Millionen Euro gekürzt worden. „Soll das der Wert sein, den die aktuelle Bundesregierung unseren Einrichtungen, Museen und insbesondere unseren Kulturveranstaltungen und -projekten, unseren andauernden Bemühungen um einen aktiven Kulturerhalt nachweislich beimißt?“, fragte Fabritius .
Fabritius verglich dabei den Bundesetat mit dem Kulturetat der Landeshauptstadt München, der mit 245 Millionen Euro mehr als das Zehnfache beträgt.
Fabritius unterstrich, daß es sich bei der Förderung nach Paragraph 96 nicht um eine „Geste der Großmütigkeit gegenüber den Vertriebenen“ handle, sondern um eine gesetzliche

Verpflichtung: „Bund und Länder müssen in Zukunft dafür sorgen, daß die Vorgaben aus dem Bundesvertriebenengesetz nach Punkt und Komma auf Dauer erfüllt werden.“
Zuständig für den Kulturetat, und damit für die Kulturförderung nach Paragraph 96, ist Staatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), die
Fabritius: „Man muß es realistischerweise so klar sagen: Vertriebene und Spätaussiedler gehören leider nicht zum bevorzugten Zielpublikum innerhalb der Handlungsbreiter dieser Bundesregierung.“
Immerhin: Rita Hagl-Kehl, Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, versprach, daß sie „sich nach Kräften bemühen“ werde, „hier etwas zu tun“. Die ehemalige Justiz-Staatssekretärin engagiert sich unter anderem als Vorsitzende des Kuratoriums der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen: „Ich kann nur bestätigen: Was da gemacht wird, ist unbezahlbar. Es ist ganz wichtig, daß Menschen Wurzeln haben und wissen, wo sie herkommen.“
Mehr über die Sitzung des Sudetendeutschen Rates auf Seite 3. Torsten Fricke
Präsident Petr Pavel: „Mögen Wahrheit, Ehre und Würde in unser ganzes Land zurückkehren“
Staatsministerin Scharf: „Seitdem ist in Berlin noch nicht einmal klar, welches Ressort innerhalb der Bundesregierung sich darum kümmert. Wir brauchen endlich Klarheit bei den Rahmenbedingungen, sodaß wir mit der Umsetzung beginnen können und die Bürgerinnen und Bürger die finanzielle Unterstützung erhalten. Der Bund muß außerdem die Vollzugskosten der Länder übernehmen.“
Staatsministerin Ulrike Scharf.

Scharf weiter: „Die Bürgerinnen und Bürger fragen sich zurecht, wann mit der geplanten Unterstützung gerechnet werden kann. Bayern bereitet sich vor, soweit dies angesichts des Schweigens im Bund derzeit möglich ist: Die Vorbereitungen in meinem Ministerium laufen auf Hochtouren, allerdings können wir das Geld des Bundes erst auszahlen, wenn uns Details und Rahmenbedingungen vorliegen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Situation unterstützen. Dafür muß die Bundesregierung aber aktiv werden.“ TF
In einer ersten Reaktion twitterte Pavel: „Mögen Wahrheit, Ehre und Würde in unser ganzes Land zurückkehren.“ Der neue Staatspräsident spielte damit auf die schmutzigen Wahlkampftricks an, die bis zum Schluß die Abstimmung überschattet hatten. Tiefpunkt waren erfundene Meldungen unmittelbar vor der Stichwahl, daß Pavel verstorben oder hirntot im Koma liege. Erste Ermittlungen ergaben, daß diese Lügen von russischen Servern aus massenhaft verbreitet wurden.
Direkt nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses räumte Babiš seine Niederlage ein und gratulierte dem Kontrahenten zum Sieg – allerdings mit der Spitze, er wünsche, daß Pavel ein Präsident aller sein und für die Interessen Tschechiens kämpfen werde.

Pavel konterte weise und twitterte: „Beim Sieg der Werte gibt es keine Gewinner und Verlierer. Wir sind eine Gemeinschaft,
Dieses Bild twitterte Petr Pavel kurz nach seiner Wahl zum neuen Staatspräsidenten verbunden mit seiner Botschaft „Mögen Wahrheit, Ehre und Würde in unser ganzes Land zurückkehren“. Fotos: Twitter, Petr Pavel
und wir müssen zusammenhalten. Danke.“
Premierminister Petr Fiala (ODS) nahm das Ergebnis mit Erleichterung auf und erklärte: „Auf die Prager Burg kommt ein Präsident, der sich zum Ziel gesetzt hat, die unterschiedlichen Ansichten zu vereinen und die Stimmung zu beruhigen. Dies ist unglaublich wichtig für unsere gemeinsame erfolgreiche Zu-

kunft.“ Der frühere Senator Daniel Kroupa warnte dagegen im öffentlichen Tschechischen Fernsehen, daß das Wahlergebnis die Spaltung der tschechischen Gesell-
schaft offenlege. So stimmten vor allem die Städte und vorwiegend junge Menschen für Petr Pavel, wohingegen Andrej Babiš in ländlicheren Gegenden und bei älteren Menschen punkten konnte. Kroupa: „Vor allem die jungen Leute haben klar gemacht, daß es um ihre Zukunft geht. Sie haben in der Stichwahl den Ausschlag gegeben.“ Pavel wurde als Sohn einer Soldatenfamilie am 1. November 1961 in Plan südlich von Marienbad geboren und stieg innerhalb der tschechischen Armee bis zum Generalstabschef auf, bevor er 2018 als erster Soldat aus einem frühen Ostblockland zum Vorsitzenden des Militärausschusses der Nato gewählt wurde. Als Soldat war Pavel bei den Operationen Enduring Freedom (2003) in Katar und UNProfor (1992 bis 1993) im ehemaligen Jugoslawien im Einsatz. Dort gelang es Pavel mit einer FallschirmjägerEinheit französische Soldaten, die infolge einer kroatischen Offensive eingeschlossen waren, zu evakuieren. Dafür wurde er von Verteidigungsminister Pierre Joxe mit dem Militärverdienstkreuz mit bronzenem Stern ausgezeichnet.

Pavel selbst bezeichnet seine politische Position als „rechts der Mitte“ und befürwortet die militärische Unterstützung der Ukraine. Pavel ist mit Eva Pavlová verheiratet. Das Paar hat drei Kinder, Jan, Petr und Eva. In seiner Freizeit ist Pavel begeisterter Motorrad- und Skifahrer. Torsten Fricke

Mit einer deutlichen Resolution hat der Sudetendeutsche Rat, dem auch Bundestagsabgeordnete der Regierungskoalition angehören, die Kürzung des Etats für die Kulturarbeit nach Paragraph 96 des Bundesvertriebenengesetzes um fast fünf Prozent einhellig kritisiert.Foto: Torsten Fricke ❯ Klarer Wahlsieg in der Stichwahl gegen Ex-Premierminister Andrej Babiš
Am Ende war es ein klares Ergebnis: Mit 58,32 Prozent hat General Petr Pavel die Stichwahl deutlich gegen Ex-Premierminister Andrej Babiš (Ano) gewonnen und wird am 8. März die Amtsgeschäfte von Miloš Zeman übernehmen, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Pavel ist der zweite Staatspräsident Tschechiens, der direkt vom Volk gewählt worden ist. Die Wahlbeteiligung war mit 70,3 Prozent so hoch wie noch nie.
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Der gebürtige Teplitzer Erhard
Spacek begann seine Karriere als Koch im Münchener Gasthaus „Goldene Stadt“. Später gründete er in der bayerischen Hauptstadt sein eigenes Lokal mit dem Namen St. Wenzel. Nicht nur tschechische Flüchtlinge konnten dort Spaceks
Kochkünste genießen, sondern auch unsere sudetendeutschen
Landsleute. Später zog er von München nach Pirna um, denn von dort aus kann er sich am Besten um die Sudetendeutschen in
Sachsen kümmern, deren Schicksal ihm sehr am Herzen liegt.
SL-Büroleiter Peter Barton traf sich mit Spacek im Dresdener historischen Coselpalais, gleich gegenüber der Frauenkirche, um mit ihm die zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem Prager Sudetendeutschen Büro und den sächsischen Landsleuten zu besprechen. Die Nähe der Landeshauptstadt zu Prag bietet dafür die besten Möglichkeiten. Und wie immer werden wir unsere Leser darüber informieren, wie sich dieses Projekt entwickelt.

❯ Volksgruppensprecher Bernd Posselt würdigt beim Requiem den am 6. Januar verstorbenen Widmar Hader:
Leitfigur unserer hochmusikalischen Volksgruppe“
Serben geben Immobilie zurück
In Belgrad haben der serbische Präsident Aleksandar Vučić und das tschechische Staatsoberhaupt Miloš Zeman ein Memorandum unterzeichnet, in dem sich Serbien verpflichtet, das Tschechische Haus in Belgrad der Tschechischen Republik zurückzugeben. Das in den 1920er Jahren errichtete Gebäude war in den 1960er Jahren von Jugoslawien beschlagnahmt worden. Das Tschechische Haus in Belgrad soll als Sitz des Tschechischen Zentrums sowie tschechischer Organisationen und Firmen dienen.
Trauer um Ex-Außenminister
Der ehemalige tschechische Außenminister Jaroslav Šedivý ist am Samstag im Alter von 93 Jahren verstorben. Der studierte Historiker und Slawist arbeitete seit 1957 am Institut für internationale Politik und Wirtschaft in Prag. Nach dem Prager Frühling von 1968 wurde er inhaftiert und schlug sich nach seiner Entlassung unter anderem als Fensterputzer durch. Er publizierte unter mehreren Pseudonymen. Nach der Samtenen Revolution von 1989 war Šedivý als Diplomat tätig und diente als Botschafter in mehreren Staaten Europas. Von 1997 bis 1998 war er Außenminister der Tschechischen Republik.

Requiem für Widmar Hader: Die Familie Hader und Bernd Posselt (erste Reihe) mit der Trauergemeinde.
Widmar Hader, schmunzelnd am Klavier, auf dem die Partitur seiner Oper „Jan Hus“ aufgeschlagen ist. Mit diesem Bild nahmen nicht nur die Familienangehörigen, sondern viele Sudetendeutsche sowie Weggefährten, Schüler und Freunde in der Kirche St. Vitus in Regensburg am letzten Januar-Sonntag beim Requiem Abschied von „einem der wenigen Universalisten unserer Zeit“, wie es Bernd Posselt, der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, in seiner Ansprache ausdrückte.
Monsignore Karl Wuch-
terl, der Ehrenvorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerks, zollte den Angehörigen hohe Anerkennung, daß sie den nun Verstorbenen „beim langen Abschied“ begleitet haben. Der Gottesdienst diene auch zum Dank für alles, was Widmar Hader geleistet und geschenkt hat.
In der Sudetendeutschen Zeitung hatte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, das Wirken des Gründungsdirektors des Sudetendeutschen Musikinstituts und auf vielen Feldern aktiven Lehrers, Komponisten und Wissenschaftlers bereits gewürdigt. Nun ergriff er beim Requiem persönlich das Wort – auch als „Freund unseres Widmar und seiner ganzen Familie“.
Posselt erinnerte an den Tag, an dem er Hader kennengelernt hat – Anfang Juni 1976 beim Sudetendeutschen Tag im Neuen Schloß in Stuttgart. Auf dem Festabend war auch Musik von Hader gespielt worden. „Ich war begeistert von diesem Abend. Beim anschließenden Empfang dachte ich mir: ‚Diesen Hader muß ich jetzt kennenlernen.‘ Was mich von Anfang an an Widmar Hader beeindruckt hat, war die Breite seiner Persönlichkeit, die Fülle der Gaben, die Universalität dieser Persönlichkeit“, führte Posselt aus. Er würdigte Hader als die „musikalische Leitfigur unserer hochmusikalischen Volksgruppe“, der sich für die Schöpfer und Werke der Musik aus Böhmen, Mähren und Schlesien einsetzte und sie förderte und entdeckte. Doch neben den Tätigkeiten als Kompo-
nist, Dirigent, Musiker und Musikwissenschaftler habe sich Hader für viele andere Themen, wie Religion, Geschichte und Politik, interessiert. „Widmar Hader war einer der wenigen Universalisten, die es in unserer Zeit noch gegeben hat, wo alles nur noch verengt und spezialisiert wird. Er hat zusammengeführt und nicht geteilt“, so der Volksgruppensprecher. Posselt schilderte eine weitere zentrale Begegnung mit Hader am 14. Januar 1990 beim ersten großen offiziellen Europa-Kongreß der Paneuropa-Bewegung nach der Samtenen Revolution in Prag. „Ich stand damals vor der Frage: ‚Wie bringe ich die Sudetendeutsche Volksgruppe in den Kongreß ein?‘ Die Rote Armee war noch im Land, es gab Putschgerüchte, Václav Havel residierte noch nicht auf der Burg, es war eine hochbrisante Situation. Da dachte ich mir: die ideale Persönlichkeit, um die Sudetendeutschen in diesem Rahmen zu präsentieren, ist Widmar Hader. Widmar Hader – Diplomat, Volksdiplomat und zugleich ein kluger und weiser Mann mit künstlerischem und kulturellen Hintergrund –kam zu dieser Zusammenkunft“, blickte Posselt zurück. An dem Kongreß nahmen unter anderem die spätere US-Außenministerin Madeleine Albright, Fürst Karl von Schwarzenberg und Václav Havels Bruder Ivan teil. In kürzester Zeit habe Hader bei dieser Veranstaltung den tschechischen Hauptveranstalter Marian Švejda kennengelernt, der in Nordböhmen ein Wochenendhaus besaß und sich für die Rettung der von der Zerstörung bedrohten Kirche in Gersdorf sowie des in der Nachbarschaft befindlichen Friedhofs in Böhmisch Kamnitz einsetzte und die Sudetendeutschen um Hilfe und Unterstützung bat. „Widmar sagte sofort Ja. Zusammen mit der Südmährischen Sing- und Spielschar hat er im Sommer 1990 das erste große tschechisch-sudetendeutsche Gemeinschaftsprojekt gestartet zur Renovierung, Sanierung und Wiederherstellung des Friedhofs und der Kirche. Tausende sol-
cher Projekte folgten – aber der Pionier ist Widmar Hader.“ Das Handeln habe Hader ausgezeichnet, so Posselt, der weitere Beispiele nannte: Gründung und Aufbau des Sudetendeutschen Musikinstituts, Herausgabe des Lexikons zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien, die Orgeltage in Elbogen, viele grenzüberschreitende Aktivitäten. „Er war immer bescheiden, immer sachlich, sanft und humorvoll. Widmar Hader war nicht nur ein ganz Großer der Musik und Kultur. Widmar Hader war ein ganz Großer unserer Volksgruppe und weit darüber hinaus“, betonte Posselt. Er wies schließlich auch darauf hin, daß Hader den jetzigen tschechischen Europaminister Mikuláš Bek, der zuvor Rektor der Masaryk-Universität in Brünn war, eben aufgrund dieser Funktion kannte und mit diesem als Musikwissenschaftler zusammengearbeitet hat. Auch diese Episode belege das „umfassende enzyklopädische Wirken Widmar Haders“, daher würden die vielen Freunde und Weggefährten auch nach dem Tod mit Hader verbunden bleiben. „Deshalb verneige ich mich heute und verneigen wir uns heute vor einem der ganz Großen“, schloß Posselt seine Ansprache.
Die zentralen Aussagen aus den zwei Lesungen und dem Evangelium erläuterte der Zelebrant des Requiems, Monsignore Karl Wuchterl. „Sie verkünden uns die Hoffnung, die Jesus uns gebracht hat“, stellte der Geistliche den Gedanken der Auferstehung an den Beginn seiner Predigt. „Richtig geborgen fühlen wir uns nur in der Liebe eines Menschen“, erklärte der Geistliche und kam damit zur Würdigung der Person Widmar Hader. Denn diese Geborgenheit in der Liebe eines Menschen hat im Jahr 1966 mit der Eheschließung mit seiner Frau Ingrid begonnen, aus der drei Kinder sowie Enkel und Urenkelin hervorgingen.


Diese Liebe habe immer fortbestanden, auch wenn Widmar Hader „hart für den Erfolg arbeiten mußte“, so Wuchterl weiter.

Entstanden sei aber „ein gewaltiges Werk“, das nur aus einem Grund so ausfiel: Widmar Hader habe immer Zeit für die Familie gehabt, „er war ein wichtiger Familienmensch, er war sehr präsent. Es haben immer alle mitgearbeitet – bei jedem Unternehmen.“
Widmar Haders letzten Lebensjahre seien mühsam gewesen. Vor allem sei es schlimm für ihn gewesen, nicht mehr komponieren und sich auf diese Weise mitteilen zu können. „In Ihrer Aufmerksamkeit, Zuwendung und Ihrer Fürsorge hat er sich gut aufgehoben, geborgen gefühlt. In den letzten 14 Tagen war er bereit, Abschied zu nehmen.“
Das Requiem gestalteten einige Wegbegleiter Haders: Die Orgel spielten Dr. Dietmar Gräf und Andreas Willscher, der Chor „Moravia Cantat“, dirigiert von Widmar Haders Sohn Wolfram, sang mehrere Werke auch aus Widmar Haders Feder. Wolfram Hader und zwei Sänger des Chores wirkten als Kantoren beim Kyrie, Tilman John (Chorsänger) trug die Lesungen und Fürbitten vor – letztere mit sehr persönlichen Bezügen zum Verstorbenen.
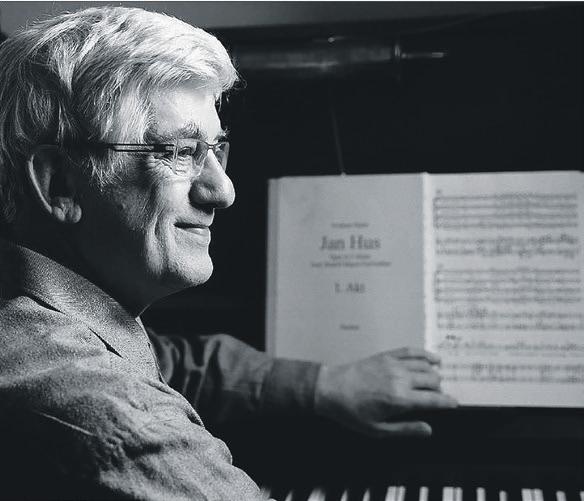
Neben Johann Sebastian Bachs „Alle Menschen müssen sterben“ waren folgende Werke zu hören: Widmar Hader: Die auf den Herrn vertrauen (Psalm 125) – Chor, Widmar Hader: Meditation über das SarkanderLied (Orgel), Andreas Willscher: In Paradisum – Orgel, Widmar Hader: Gebet (aus: Drei Abendlieder nach Texten von Christian Morgenstern) – Chor, Leon Kornitzer: Trost (Chor).
Astrid Hader trug nach der Kommunion eine Meditation (Text des Heiligen Augustinus) vor und dankte den die Mitgestaltung des Requiems tragenden Personen sowie den zahlreichen Trauergästen, welche die St.-Vitus-Kirche bis auf den letzten Platz füllten. Unter den Gästen waren der SL-Landesobmann Bayern, Steffen Hörtler, sowie Mitglieder der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste und Weggefährten des Sudetendeutschen Musikinstituts. Markus





habe mich mit dem neugewählten Präsidenten getroffen und eine angenehme und konstruktive Debatte über die tschechische Außenpolitik geführt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin froh, daß wir die gleichen Ansichten über die Richtung der Tschechischen Republik haben“, erklärte Lipavský nach dem Treffen.
China kritisiert Telefongespräch
Der neugewählte tschechische Präsident Petr Pavel hat am Montag mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Jing-wen telefoniert – und damit die Kritik Chinas auf sich gezogen. Pavel twitterte nach dem 15minütigen Gespräch, er habe der Präsidentin für ihre Glückwünsche gedankt und ihr versichert, daß Taiwan und die Tschechische Republik die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte teilten und ihre Partnerschaft weiter stärken würden. China betrachtet Taiwan als „abtrünnige Provinz“. Die meisten Staats- und Regierungschefs meiden deshalb offizielle Kontakte zu Taiwan, um Peking nicht zu provozieren.
Kunsthistoriker
Jiří Šetlík verstorben
Gasverbrauch um 19 Prozent gesunken
Der Gasverbrauch in Tschechien ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 81,5 Terrawattstunden gesunken, hat die Energieregulationsbehörde bekanntgegeben. Die Gründe seien der milde Winter und die dramatische Erhöhung der Energiepreise.
Außenminister beim Präsidenten
Der neugewählte Präsident Petr Pavel hat am Montag Außenminister Jan Lipavský (Piraten) empfangen, um die Eckpunkte der tschechischen Außenpolitik zu besprechen. „Ich
Der tschechische Kunsthistoriker Jiří Šetlík ist am Samstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Šetlík war eine der führenden Persönlichkeiten der tschechischen Kunstszene in den 1960er Jahren. Er leitete die Sammlung moderner Kunst in der Nationalgalerie Prag und war auch Direktor des Kunstgewerbemuseums. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings erhielt Šetlík ein Berufsverbot und durfte nicht unterrichten. Seine Essays über tschechische Künstler wurden in den 1980er Jahren im Samizdat veröffentlicht. Nach der Wende von 1989 lehrte er an der Kunstgewerbeschule in Prag und leitete von 1996 bis 2001 den Lehrstuhl für Kunst- und Architekturgeschichte an der Fakultät für Architektur der Technischen Universität in Reichenberg. Im Jahr 2014 erhielt er die Medaille Artis bohemiae amicis des Kulturministeriums für sein Lebenswerk.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

„MusikalischeBauer Zelebrant Monsignore Karl Wuchterl, Ehrenvorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks. Fotos: M. Bauer
❯ Kritik an den Kürzungen im Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien:
Paragraph 96 ist das Fundament unserer Arbeit“
Man sollte die aktuellen Mittelkürzungen nicht durch eine Parteibrille betrachten und kritisieren, sondern das Gespräch mit Claudia Roth, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien suchen, warb Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, für ein gemeinsames Vorgehen des Sudetendeutschen Rates, dem sowohl Abgeordnete der AmpelKoalition als auch der CDU und CSU angehören.

Leon Eckert, MdB der Grünen und damit ein Parteifreund von Claudia Roth, wollte sogar noch einen Schritt weitergehen und die Verabschiedung der Resolution vertagen. „Man kann beides machen, zumal die Resolution sehr sachlich und ohne Schaum vor dem Mund formuliert ist“, überzeugte dagegen MdB Stephan Mayer den Sudetendeutschen Rat, der die Resolution dann ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung annahm.
Zuvor hatten insbesondere die Mitglieder, die aktiv in der Bildungs- und Verständigungsarbeit engagiert sind, die Kürzungen kritisiert.
Reinfried Vogler, Ehrenpräsident der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen: „Dieses Thema ist vielfach von Ideologie, aber vor allem von Unkenntnis gesteuert. Die aktuelle Debatte ist insbesondere deshalb gefährlich, weil nicht einzelne Projekte, sondern der Paragraph 96 als ganzes ins Visier genommen wird. Der Paragraph 96 ist das Fundament unserer Arbeit. Es ist ein Angriff auf die gesamtdeutsche Kulturarbeit.“

Hans Knapek, der Vorsitzende des Sudetendeutschen Sozialund Bildungswerks, schilderte, welche Auswirkungen die Kürzungen auf den Heiligenhof haben: „Wir haben vor zwanzig Jahren die Akademie Mitteleuropa gegründet, um für die Idee eines gemeinsamen demokratischen Europas zu werben und weit über den sudetendeutschen Bereich Bildungs- und Begegnungsarbeit zu leisten. Zig Tausende vor allem junger Menschen haben sich seitdem auf dem Heiligenhof zu Seminaren getroffen. Die aktuellen Kürzungen schaden unserer Bildungsarbeit und dem Bemühen, Versöhnung und Begegnung voranzutreiben.“
Ergänzend erklärte Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor des Heiligenhofs und Landesobmann











❯ Resolution im Wortlaut:








Entschließung des Sudetendeutschen Rates für den Erhalt einer ausreichenden Förderung zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlingen und zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung nach Paragraph 95 Bundesvertriebenengesetz.
Ein demokratisches Europa braucht den Dialog.
Vor 70 Jahren, am 19. Mai 1953, trat das Bundesvertriebenengesetz in Kraft: „Bund und Länder haben entsprechend ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zuständigkeit das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewußtsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten, Archive, Museen und Bibliotheken zu sichern, zu ergänzen und auszuwerten sowie Einrichtungen des Kunstschaffens und der Ausbildung sicherzustellen und zu fördern. Sie haben Wissenschaft und Forschung bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Vertreibung und der
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
18 Millionen Euro
stehen bis 2027 bereit
„Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ist eine 25jährige Erfolgsgeschichte“, hat MdB Rita Hagl-Kehl, die Vorsitzende des Verwaltungsrates der völkerverbindenden Organisation, Bilanz gezogen.


Ob Kulturförderung, Schüleraustausch, Dialog- oder Fachtagungen oder die Rettung von Denkmälern, der DeutschTschechische Zukunftsfonds unterstütze in vielen Bereichen, sagte Hagl-Kehl. Die Zahlen sind durchaus eindrucksvoll. Seit 1988 hat der Zukunftsfonds insgesamt knapp 74 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und damit rund 12 600 Projekte gefördert. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds wurde als Ergebnis der Deutsch-Tschechischen

Erklärung vom 21. Januar 1997 gegründet. Die Laufzeit wurde 2017, zum 20. Jahrestag der Erklärung, um weitere zehn Jahre bis 2027 verlängert. Deutschland und Tschechien stellen dafür insgesamt 18 Millionen Euro für die Förderung weiterer grenzüberschreitender Projekte zur Verfügung.
Bayern: „Viele der guten Kontakte, die wir heute auf allen Ebenen in die tschechische Politik haben, gründen darauf, daß unsere Gesprächspartner als Kinder oder Jugendliche auf dem Heiligenhof zu Gast werden. Das ist auch ein Ausfluß der wichtigen Arbeit des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Um so unverständlicher ist es, daß die Bundesregierung im April 2022 die Förderung auf 0 Euro heruntergefahren hat.“
Die Fakten überzeugten auch jene Mitglieder des Sudetendeutschen Rates, die für die SPD im Landtag oder Bundestag sitzen. So machten die SPD-Bundestagsabgeordneten Rita HaglKehl und Jörg Nürnberger sowie der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib in ihren Redebeiträgen deutlich, daß sie das Thema noch einmal in ihre Gremien mitnehmen. Torsten Fricke
des Sudetendeutschen Rates: Selb benennt Platz nach Václav Havel
Auf seiner Sitzung im Januar 2022 hatte der Sudetendeutsche Rat einstimmig beschlossen, Städte und Gemeinden in Deutschland aufzurufen, Straßen und Plätze nach Václav Havel zu benennen. In ihrem Rechenschaftsbericht konnte Generalsekretärin Christa Naaß einen ersten Erfolg vermelden.
Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge ergeben, sowie die Weiterentwicklung der Kulturleistungen der Vertriebenen und Flüchtlinge zu fördern. Die Bundesregierung berichtet jährlich dem Bundestag über das von ihr Veranlaßte.“
Gerade in einer Zeit, in der die liberalen Demokratien durch Populisten, europafeindliche Kräfte und autoritäre Regime sowie den Ukraine-Krieg mit Millionen von Flüchtlingen vor großen Herausforderungen stehen, ist es wichtig, die Bande zwischen den Demokratien in Europa zu stärken.
Wir brauchen mehr denn je starke demokratische Netzwerke und tragfähige Partnerschaften mit den Demokratien in Ostmitteleuropa.
Diese Netzwerke entstehen nicht von allein. Sie bauen auf langjährigen Kontakten und Partnerschaften zu Wissenschafts- und Kultureinrichtungen sowie zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen, die es bereits im In- und Ausland gibt und die gut funktionieren, auf.
Es gilt – gerade in dieser

schwierigen Zeit – diese; sowie die dazu notwendige Infrastruktur zu stärken und nicht durch Mittelkürzungen zu schwächen. Dies ist um so weniger nachvollziehbar als der Gesamthaushalt des BKM (Anm. d. Red.: Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien) für 2023 angestiegen ist.
Durch diese Kürzungen beziehungsweise Streichungen werden gerade diejenigen, die zum Teil mit großem ehrenamtlichen Engagement für Frieden und Freiheit, für Völkerverständigung sowie für Menschen- und Minderheitenrechte eintreten, geschwächt.
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien wird aufgefordert, die aktive Kulturarbeit der Vertriebenen, Spätaussiedler und ihrer Verbände nach Paragraph 96 Bundesvertriebenengesetz auch zukünftig sicher zu fördern und von den finanziellen Kürzungen im Bereich der Projektmittel Abstand zu nehmen.
❯ Generalkonsulin Ivana Červenková

Seit 1. April 2022 vertritt Dr. Ivana Červenková die Tschechische Republik in München als Generalkonsulin. Zuvor war die promovierte Juristin, die perfekt Deutsch spricht, in Bonn, Bern und Wien tätig.







Lange Zeit seien, so erinnerte Červenková in ihrem Vortrag, die Beziehungen zwischen Bayern und Tschechien schwierig gewesen. Die berühmte Rede im Jahr 2013 des damaligen Premierministers Petr Nečas im Bayerischen Landtag habe das Eis gebrochen und sei Meilenstein in der Annäherung gewesen.


„Nečas Rede liegt bei mir auf dem Schreibtisch und ist noch immer eine Quelle der Inspiration“, so Červenková. Heute seien die Beziehungen zwischen Bayern und Tschechien sehr gut. An
Pfingsten 2022, so erinnerte sich Červenková, sei sie in Hof das erste Mal Gast auf einem Sudetendeutschen Tag gewesen und habe viele schöne Eindrücke mitgenommen. „Gute Beziehungen können nicht von oben, von den Regierenden, verordnet werden, sondern haben ihre Basis bei den Menschen.“
Vor 30 Jahren, am 26. Januar 1993, ist Václav Havel mit großer Mehrheit zum ersten Präsidenten der Tschechischen Republik gewählt worden. Sein Engagement im Rahmen der Samtenen Revolution sowie für Menschenrechte, Demokratie und Versöhnung ist auch heute noch unvergessen. Havel starb im Alter von 75 Jahren am 18. Dezember 2011. Aus Anlaß seines zehnten Todestages hatte zunächst Bernd Posselt, der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und einer der Wegbegleiter von Havel, eine Initiative gestartet, den Vorkämpfer für Demokratie und Freiheit auch in Deutschland zu ehren. Dieser Initiative schloß sich der Sudetendeutschen Rat mit einem einstimmigen Votum an. Christa Naaß berichtete jetzt, sie habe daraufhin die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene angeschrieben und appelliert, Straße und Plätze nach Havel zu benennnen. Erster Erfolg: „Albrecht Schläger hat es geschafft, daß der Stadtrat von Selb einstimmig entschieden hat, dem Platz auf dem Bahnhofsgelände den Namen des tschechischen Politikers zu geben“, informierte Christa Naaß.
Einer der Höhepunkte im Jahresprogramm des Sudetendeutsches Rates sind die Marienbader Gespräche. Im vergangenen Jahr hielt erstmals mit Ulrike Scharf, Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, eine offizielle Amtsinhaberin aus Deutschland die Festrede in dem weltbekannten böhmischen Kurort.
In diesem Jahr finden die Marienbader Gespräche vom 5. bis 7. Mai statt. Das Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien“.
Ebenfalls ein Dauererfolg ist die Ausstellung „So geht Verständigung – dorozumění“, die 2018 in der Bayerischen Staatskanzlei in München Premiere hatte. 2022 wurde die Ausstellung in Passau sowie in der Bayerischen Residenz in Prag gezeigt.
Überschattet wurde das 2022 vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Naaß: „Gerade weil der Angriffskrieg von Putin auch ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft ist und einen Versuch darstellt, Europa zu spalten, sind wir als Demokratinnen und Demokraten gefordert, unsere Demokratie zu verteidigen.“
In ihrer Funktion als Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung hatte Naaß deshalb eine Resolution initiiert, die den russischen Angriff auf die Ukraine mit deutlichen Worten verurteilt. Dieser Erklärung wurde von der Bundesversammlung in der März-Sitzung einstimmig verabschiedet.
❯ Volksgruppensprecher
Bernd Posselt Geheime Kontakte zum späteren Regierungschef
Aus aktuellem Anlaß, der Wahl des neuen Staatsoberhauptes in der Tschechischen Republik, räumte Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, mit einem in Deutschland weit verbreiteten Mißverständnis auf.
Der Name des aktuellen tschechischen Staatspräsidenten sei, so Posselt, auch jenseits des Landes gut bekannt, während den jeweiligen Premierminister oft nur Experten kennen. Dabei, so erklärte Posselt, habe das Staatsoberhaupt in Prag nur kaum mehr Kompetenzen als sein deutscher Amtskollege.
„Dieses Mißverständnis liegt wohl zum einen in der Größe des ersten Präsidenten, Václav Havel, begründet und in dem prachtvollen Amtssitz, der Prager
Burg“, so Posselt. Viel wichtiger für die (sudeten-)deutsch-tschechische Politik sei aber Petr Fiala als Premierminister. Diesen, so erzählte Posselt, kenne er noch persönlich aus den Zeiten der kommunistischen Diktatur, als er heimlich an einer UntergrundUniversität in Brünn Kontakt zu Oppositionellen hatte.



„Ein demokratisches Europa braucht den Dialog“Rita Hagl-Kehl, Vorsitzende des Verwaltungsrates des Zukunftsfonds. Christa Naaß, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, informierte über die Arbeit des vergangengen Jahres. Fotos (12): Torsten Fricke MdB Stephan Mayer.
„Der❯ MdB Rita Hagl-Kehl, ❯ Erster Erfolg für Initiative MdB Leon Ekkert. Ehrenpräsident Reinfried Vogler. MdL Volkmar Halbleib. Bürgermeister Toni Dutz. MdB Jörg Nürnberger. Heike Maas, SLBundesvorstand MdB Florian Oßner.
„Nečas Rede liegt bei mir auf dem Schreibtisch“Tschechiens Generalkonsulin in München, Dr. Ivana Červenková. Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.
❯ Bewerbungen bis zum 30. April beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds:
Sprachassistenz: Mit einem
Stipendium nach Tschechien
Wer Auslandserfahrung vorweisen kann, ist bei der Jobsuche klar im Vorteil. Für Studenten bietet der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds deshalb ein attraktives Stipendienprogramm als Sprachassistenz an tschechischen Grundschulen an.
Sprachkenntnisse sind der Grundstein für gute Nachbarschaft und freundschaftliche Beziehungen. Die Förderung des Deutsch- beziehungsweise Tschechischunterrichts im jeweiligen Nachbarland ist deshalb eines der wesentlichen Ziele der Deutsch-Tschechischen Erklärung.
■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte
Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.
■ Freitag, 3. Februar, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde
Augsburg: „Krieg in Europa –weit weg und nah dran“. Vortrag und Gespräch mit Martin Panten, stellvertretender Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.
■ Freitag, 3. Februar, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Filmpräsentation „Trautenau und Riesengebirgsvorland“. Der neue Film vom Filmstudio Sirius erzählt die Geschichte und Entwicklung der Beziehungen von Deutschen und Tschechen in der Region Trautenau. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 9. Februar, 19.00 Uhr, Kulturreferat für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München: „Schön und gewaltig“. Die Schauspielerin Susanne Schroeder liest Texte über Naturgewalten und die Schönheit der Natur von Adalbert Stifter, Gustav Leutelt, Josef Mühlberger und Karel Klostermann, musikalisch umrahmt von Jana Bezpalcová. Begleitveranstaltung zur Ausstellung Mensch, Natur und ihre Katastrophen. Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München, Eintritt frei.
■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen unter www.jiz50.cz
■ Samstag, 11. Februar, 10.30 bis 15.30 Uhr, Landesfrauenreferentin Dr. Sigrid Ullwer-Paul: Landesfrauentagung Bayern. Neben verschiedenen Mundartsprechern werden Heimatpflegerin Christian Meinusch und die stellvertretende Bezirksfrauenreferentin von Niederbayern/ Oberpfalz, Helga Olbrich, referieren. Kolping-Haus, AdolphKolping-Straße 1, Regensburg. Anmeldung bei der SL-Landesgruppe Bayern unter Telefon (0 89) 4 80 03 46 oder per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by.de
■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2, Puchheim. Eintritt
Im Rahmen des Programms „Deutsch-Tschechische Stipendien für Sprachassistenz im Nachbarland“ können Studenten als Muttersprachler an tschechischen Grundschulen beim Deutschunterricht unterstützen. Das Stipendium ist mit 850 Euro pro Monat dotiert, und die Aufenthaltsdauer beträgt drei bis zehn Monate.
Das Stipendienprogramm richtet sich in erster Linie an bayerische Studenten, insbesondere des Fachs „Deutsch als Fremdsprache“. Darüber hinaus können auch Bewerber aus anderen Bundesländern berücksichtigt werden oder, in begründe-
frei.
ten Ausnahmefällen, junge Abiturienten, die noch nicht mit dem Studium begonnen haben. Das Höchstalter beträgt 29 Jahre, tschechische Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Weitere Informationen auf der Webseite des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unter www. fondbudoucnosti.cz/de/
Im Gegenzug vergibt der Freistaat Bayern für das Schuljahr 2023/24 Stipendien für Studenten aus der Tschechischen Republik, die als Muttersprachler an einer Gastschule in Bayern die Lehrkräfte im Tschechischunterricht unterstützen. Weitere Informationen unter www.
VERANSTALTUNGSKALENDER
■ Mittwoch, 15. Februar, 18.00 Uhr: Das Vocal Ensembel
Mixed Voices unter Leitung von Roland Hammerschmied gestaltet den musikalischen Teil des Abendgottesdienstes. Im Anschluß folgt ein 30minütiges
Konzert. St. Michael, Neuhauser Straße, München.
■ Donnerstag, 16. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Hannah. Ein gewöhnliches Leben“. Dokumentarfilm über Hana Frejková, die sich künstlerisch mit dem für ihre Familie traumatischen Antisemitismus in der Tschechoslowakei auseinandersetzt. Begleitet durch einen Kurzvortrag von Martin Schulze-Wessel, der die Slánský-Prozesse, in deren Rahmen unter anderem Ludvík Frejka zum Tode verurteilt wurde, in den geschichtlichen Kontext einordnet.
Moderation: Zuzana Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Collegium Carolinum und der Petra-Kelly-Stiftung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München, Eintritt frei.
■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-MetzHalle, Volkhardtstraße, Zirndorf.
Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.
■ Dienstag, 28. Februar, 18.30 Uhr, Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und

Künste: „Goethe in Böhmen –oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.
■ Dienstag, 28. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter
Verein: „Tschechien erlesen. Deutsch-tschechische Familiengeschichten“. Alice Horáčková (Rozpůlený dům; Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika
Jonášová (Ada 2022) setzen sich in ihren Werken kritisch mit dem deutsch-tschechischen Zusammenleben anhand ihrer persönlichen Familiengeschichte auseinander. Moderation: Zuzana
Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Tschechischen Zentrum München. Tschechisches Zentrum München, Prinzregentenstraße 7, München, Eintritt frei.
■ Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Český klub Zürich in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder: „Arnošt Lustig: Tacheles“. Autor und Journalist Karel Hvížďala stellt dem Schweizer Publikum sein Buch über Arnošt Lustig vor, der kurz vor seinem Tod in Form von Gesprächen Einblick in sein bewegtes Leben gewährte. Mo-
bayern.de/staatskanzlei/ bayern-in-prag/ Neben dem SprachassistenzStipendium fördert der DeutschTschechische Zukunftsfonds auch jedes Jahr acht ein- und zweisemestrige Studienaufenthalte von deutschen und tschechischen Studenten an Universitäten im Nachbarland. Eine wichtige Voraussetzung ist ein außerordentliches Interesse an Sprache, Alltag, akademischer Forschung und Kultur des Nachbarlandes. Eine weitere Bedingung ist die Planung eines konkreten wissenschaftlichen Projekts mit deutsch-tschechischer Thematik.
deration: Eva Lustigová. Bar und Buchhandlung „sphères“, Hardturmstraße 68, Zürich.
■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.
■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad.
Erinnerung neu gedacht? Das Lukiškės-Gefängnis in Wilna
■ Samstag, 11. Februar, 16.00 bis 18.00 Uhr: Onlineseminar „Erinnerung neu gedacht? Von der Umnutzung eines NKVD- und Gestapo-Gefängnisses in Litauen“. Gespräch mit Prof. Dr. Felix Ackermann, Professor für Public History. Veranstaltung für historisch-politisch Interessierte.
■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.
■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).
■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.

■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.
Das Lukiškės-Gefängnis (Foto) in Wilna (Vilnius), der Hauptstadt Litauens, ist ein Mikrokosmos der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Baltikum. Es wurde vom Deutschen Reich in zwei Weltkriegen für die Durchführung von Repressionen genutzt. Von 1941 bis 1942 befand sich hier ein Durchgangslager für Wilnaer Juden auf dem Weg zur Erschießungsstätte in Panerai. Die doppelte Sowjetisierung Litauens fand in den Gefängnismauern unter der Aufsicht des NKVD statt. Noch Ende der 1940er Jahre wurden politische Gegner hingerichtet, die zuvor in Lukiškės in Untersuchungshaft festgehalten wurden. Der Gefängniskomplex wurde noch bis 2017 genutzt. Seither wird er Schritt für Schritt zu einem Kulturzentrum umgewandelt. Im Sommer lädt eine Jägermeister-Bar zum Verweilen ein, und Netflix drehte hier eine Staffel der Erfolgs-Serie „Stranger Things“. Das Projekt Lukiškės 2.0 ist ein Sinnbild für den Aufbruch von Litauen ins 21. Jahrhundert, über dem stets der Schatten des 20. Jahrhunderts liegt. Teilnehmer können sich über den Link https://zoom.us/meeting/ register/tJIsf--gqzMqG9cjTvZT8mWRzM3xgrAeRrUH anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Heiligenhofs (www.heiligenhof.de) unter Unsere Seminare/Seminarprogramm.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
❯ Vortrag von Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer
Heiratsmigration aus Böhmen nach Bayern?

■ Donnerstag, 9. Februar, 18.30 Uhr: Vortrag „Heiratsmigration aus Böhmen nach Bayern? Ein Blick in die Bronzezeit“. Referent: Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München.

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts „Zeiten des Umbruchs“ ist es gelungen, völlig neue Einblikke in die spannenden Prozesse gesellschaftlicher Entwicklung im Lechtal um Augsburg und Umgebung an der Wende von der Steinzeit zur Bronzezeit zwischen 2500 und 1500 vor Christus zu gewinnen. So kann man heute auf ganz neuartige Weise dörfliches Leben in schriftlosen Kulturen beschreiben – von eingeheirateten fremden Frauen und der täglichen Ernährung bis hin zu Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen Gehöften und Handelskontakten in weit entfernte Regionen. Besonders spannend war die Erkenntnis, daß ein Groß-
Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer. Foto: privat

teil der Frauen aus der Ferne, höchstwahrscheinlich aus Böhmen und Mitteldeutschland ins Lechtal kam.
Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer ist seit 2016 Professor für Prähistorische Archäologie an der LMU München und Ko-Direktor des Max-Planck Harvard Forschungszentrums für die archäologisch-naturwissenschaftliche Erforschung des antiken Mittelmeerraums am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (Leipzig).
� Serie Ehrensache Ehrenamt: Portrait über den Heimatkreisbetreuer von Marienbad und Umgebung
Dr. Hans-Peter Sang: Engagierter
Brückenbauer zur Wurzelheimat
Dr. Hans-Peter Sang ist als Heimatkreisbetreuer von Marienbad und Umgebung Ansprechpartner für alle, deren Vorfahren aus dem Ort stammen.
Denjenigen, die der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) angehören, sind sie wohlbekannt; für viele Außenstehende sind sie oft die ersten Ansprechpartner innerhalb der SL: die Heimatkreis- und Heimatortsbetreuer. Denn ihre Aufgabe ist es, die Brükke zu den Orten zu bilden, die die Sudetendeutschen nach 1945 verlassen mußten. In der Regel kennen die Orts- und Kreisbetreuer die Geschichte der jeweiligen Orte sehr genau, sie kennen auch die heutigen Gegebenheiten, die Archive ebenso wie die Übernachtungsmöglichkeiten, sie pflegen Kontakte zu den Menschen, die selbst oder deren Vorfahren aus diesem Ort stammen, und zunehmend auch zu den Menschen, die heute an diesen Orten wohnen.
Einer dieser Heimatkreisbetreuer ist Hans-Peter Sang, zuständig für Marienbad und Umgebung. „An mich wenden sich meist Personen, deren Eltern oder Großeltern aus der Gegend kommen“, berichtet er. „Viele wollen wissen, wo die Orte sind, aus denen ihre Vorfahren vertrieben wurden, wie die Orte heute heißen, ob ich geschichtliche Kenntnisse zu Marienbad und den umliegenden Orten habe.“
Auch er selbst hat Vorfahren aus Marienbad: Seine Mutter stammt von dort. Schon früh engagierte sie sich im Heimatverband der Marienbader. So kam auch der Sohn Ende der 1970er Jahre dazu. Das Interesse für die Vergangenheit der Vorfahren verbindet ihn mit seiner Frau, deren Eltern ebenfalls aus dem Egerland stammen.
Für Geschichte begeistert sich HansPeter Sang allgemein. Neben Mathematik, Physik und Information studierte er Neuere Geschichte und wurde in dem Fach auch promoviert. Sein Interesse für Wissenschaftsgeschichte führte den Realschullehrer zu mehreren Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten. Zudem war er mehrere Jahre lang Gastforscher am Deutschen Museum in München.
Nebenher war er ehrenamtlich sehr aktiv: Rund 30 Jahre lang war er stellvertretender Vorsitzender des Heimatverbandes der Marienbader; seit wenigen Jahren ist er Vorsitzender. In seiner Amtszeit kümmerte sich der Verband unter anderem darum, in Marienbad ein neues Goethe-Denkmal errichten zu lassen. Mehrfach war der Dichter in dem böhmischen Kurort zu Gast gewesen, hatte geologische Studien betrieben und schließlich seine vermutlich letzte große Liebe kennengelernt. Als diese ihn verschmähte, verschaffte der Dichter seinem Leiden mit einem Gedicht Ausdruck und Marienbad einen festen Platz in der Literaturgeschichte – der Marienbader Elegie sei Dank. Ein aus Anlaß des 100. Todestags Goethes in Marienbad errichtetes Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Nach
Heimatkreisbetreuer
dem Fall des Eisernen Vorhangs sorgte der Heimatverband der Marienbader gemeinsam mit der Stadt Marienbad dafür, daß ein neues errichtet werden konnte. Außerdem setzte sich der Verein dafür ein, daß die Grabdenkmäler deutscher Hoteliers restauriert wurden.
Die Zusammenarbeit mit der tschechischen Stadtverwaltung in Marienbad habe sich nach 1989 stark verändert, berichtet Hans-Peter Sang: Vor 1989 sei eine deutsche Vergangenheit der Gegend geleugnet worden, weshalb Widerstand gegen eine Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen bestanden habe.

„Inzwischen hat sich die Atmosphäre
sehr zum Besseren gewandelt. Heute haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit Marienbad. Dies betrifft sowohl die politische Ebene – wir haben freundschaftliche Kontakte mit verschiedenen Bürgermeistern aus der Umgebung von Marienbad – als auch die kulturelle Ebene“, sagt Sang. Wichtig ist Sang auch der Austausch innerhalb des Vereins. In den letzten eineinhalb Jahren hat er den Heimatbrief neu strukturiert. Lange hatten die rund 500 Bezieher dort vor allem Nachdrucke alter Artikel aus den 1950er Jahren vorgefunden. Also ermunterte Sang seine Landsleute, neue Artikel zu verfas-
sen, etwa über ihre Besuche in Marienbad sowie über aktuelle Themen, die die Stadt betreffen. Über den Heimatbrief ergäben sich häufig gute Gespräche, erzählt Sang: „Oftmals rufen unsere Landsleute wegen eines nicht erhaltenen Heimatbriefes an, und im Laufe des Gespräches kommt man auf viele andere Themen. Auch die Kontakte, die ich in Tschechien geknüpft habe, sind sehr bereichernd. In den allermeisten Fällen herrscht großes Interesse von tschechischer Seite an der Vergangenheit im Sudetenland.“
Daß ein Interesse an der sudetendeutschen Geschichte besteht, zeige auch die Grenzlandheimatstube des Heimatkreises Marienbad in Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz. Neben Nachfahren von Vertriebenen aus dem Kreis Marienbad sowie Besuchern aus Tschechien kämen auch viele Kurgäste – wie Marienbad ist auch Neualbenreuth ein staatlich anerkannter Kurort. Aktuell finden die Besucher in der Alten Posthalterei, einem schönen alten Fachwerkhaus, eine noch etwas unübersichtliche Ausstellung vor.
An einigen Exponaten fehlen zudem Informationstafeln. Das soll sich nun ändern. Mit Hilfe von Historikern und Museumsfachleuten sollen die Exponate inventarisiert und eine neue Ausstellung konzipiert werden. Viel Arbeit sei damit verbunden, dennoch ist Sang zuversichtlich: „Die Gemeinde ist uns eine große Hilfe und zeigt großes Interesse, daß die Heimatstube in Zukunft ein attraktives Erscheinungsbild abgeben soll.“ Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
� Ringvorlesung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste am 28. Februar
Johann Wolfgang von Goethe, die Liebe und die böhmischen Bäder

Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, Der ich noch erst den Göttern Liebling war; Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gütern, reicher an Gefahr; Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennen mich, und richten mich zugrunde.
(Schlußstrophe der Marienbader Elegie)
1114 Tage hat Johann Wolfgang von Goethe in Böhmen verbracht, in der Regel, um zu kuren und Kontakt zur Damenwelt zu halten. Zwölfmal besuchte der Dichterfürst Karlsbad, dreimal Marienbad und je einmal Teplitz und das Riesengebirge.


Ausgerechnet in Marienbad erlitt der Mann, den man heute als „Womanizer“ beschreiben würde, seine schlimmste Abfuhr. Im Sommer 1821 reiste der 71Jährige nach Marienbad und verliebte sich dort in die 17jährige Ulrike von Levetzow. Zwei Jahre später hielt Goethe formell bei der Mutter, Amalie von Levetzow, um die Hand der jungen Frau
an. Die Antwort war für Goethe niederschmetternd: „Das Fräulein hätte noch gar keine Lust zu heiraten“, hieß es in dem Schreiben. Goethes größte persönliche Niederlage wurde gleichzeitig zum Höhepunkt seiner Schaffenskraft. In der Marienbader Elegie, einem Klagelied, verarbeitete Goethe seine Abfuhr. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig beschrieb das lyrische Dokument später als das „bedeutendste, persönlich intimste Gedicht seines Alters“ und widmete der Entstehung und Geschichte ein volles Kapitel in seiner berühmten Sammlung historischer Miniaturen „Sternstunden der Menschheit“. Für Zweig enthalten die Verse „eine der

An den 8. Februar 2020 habe ich eine genaue Erinnerung. Es war ein Samstag, und in Prag fand die Jahreskonferenz der tschechischen Ackermann-Gemeinde statt. Tagsüber waren wir im Tagungshotel in Prag-Wrschowitz. Am späten Nachmittag ging es dann mit allen Konferenzteilnehmern in einer vollbesetzten 22er Trambahn an das andere Ende der Stadt, nämlich auf den Weißen Berg, wo wir in der Kirche des BenediktinerinnenKlosters einen ökumenischen Gottesdienst feierten. Aus mehreren christlichen Konfessionen waren Geistliche zugegen. Kurz vor Beginn der Feier standen wir ruhig und gesammelt in der Sakristei, als eine evangelische Kollegin einen heftigen Nießanfall bekam. Darauf reagierte ein anderer Kollege: „Na, ist das schon die chinesische Grippe?“ Alle, die in der Sakristei waren, lachten daraufhin herzlich.
Corona war damals noch weit weg. Die Medien berichteten zwar schon, aber in Europa wurde das Covid-19-Virus kaum als große Gefahr gesehen. Von Experten vielleicht schon, aber nicht von der öffentlichen Meinung. Wie meine kleine Geschichte zeigt: Man lachte darüber. Daß aus der Krankheit im fernen China eine Pandemie werden würde, ahnten Anfang Februar 2020 nur wenige. Einen Monat später sah die Lage ganz anders aus. Ich erinnere mich auch daran sehr genau.
Anfang März vor drei Jahren war ich in Wien, um die Feier des 200. Todestages von Klemens Maria Hofbauer vorzubereiten. Am 9. März hatten wir eine Pressekonferenz, um die Medien über die geplanten Feierlichkeiten zu informieren. Zwei Tage später mußten wir dann aber alles absagen, weil die österreichische Regierung umfassende Kontaktbeschränkungen verordnet hatte. Zum Lachen war zu diesem Zeitpunkt niemandem mehr.
Jetzt, im Februar/März 2023, haben wir, so scheint es, die schwierige Zeit der Pandemie hinter uns gebracht. Unser alltägliches Leben mit den vielen Begegnungen in Arbeit und Freizeit kann wieder wie eh und je stattfinden. Kindergärten, Schulen und Universitäten funktionieren wieder normal. Das Reisen ist praktisch ohne Einschränkungen möglich. Und in der derzeitigen Faschingszeit gibt es wieder viele gesellige Veranstaltungen. Schließlich bin ich persönlich froh, daß auch das kirchliche Leben den Weg zurück in die Normalität gefunden hat. Mittlerweile ist die Gesellschaft wieder mit vielen anderen Herausforderungen beschäftigt. Fast könnte einem die Frage in den Sinn kommen: „Corona – war da was?“ FFP2-Masken und PCR- oder Antigentests gehören nur mehr sehr am Rande zu unserem Alltag. Fast vergessen sind Begriffe wie „Inzidenzzahl“ oder „3G-Regel“.
reinsten Strophen über das Gefühl der Hingabe und Liebe, die jemals die deutsche und irgendeine Sprache geschaffen“. Goethe und Böhmen sind auch Thema einer Ringvorlesung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, die am Dienstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, in München stattfindet. Referent ist der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Wynfrid Kriegleder von der Universität Wien. Der genaue Titel lautet „Goethe in Böhmen
– oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.
Mein Plädoyer: Vergessen wir nicht, was wir aufgrund der Pandemie erlebt und durchgemacht haben, aber sind wir vor allem froh und dankbar, daß wir jetzt offensichtlich durch sind. Widmen wir uns der Gegenwart und Zukunft! Und ein Zweites: Versuchen wir zwischenmenschliche und gesellschaftliche Gräben, die sich in den letzten Jahren aufgetan haben, wieder zuzuschütten! Alle Menschen guten Willens können dazu ihren Beitrag leisten.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
❯ Brünn, Auschwitz, Santa Cruz
Gottlieb malt für Mengele
Am 27. Januar gedachte der Deutsche Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus. Ein Opfer, das den Holocaust überlebte, war Annemarie Dina Gottlieb, die am 21. Januar vor 100 Jahren in Brünn zur Welt gekommen war.
Annemarie Dina Gottlieb wurde in eine jüdische Brünner Familie geboren. Als die Deutschen 1939 in ihre Heimat einfielen, lebte sie in Prag, wo sie an der Akademie der Bildenden Künste studierte. Bald wurde als Jüdin Dina von der Akademie ausgeschlossen. 1942 kamen sie und ihre Mutter Johanna in das KZ Theresienstadt, 1943 nach Auschwitz.
1944 bemalte die 21jährige Dina, sie trug die Häftlingsnummer 61016, im Kinderblock für eine Kinderaufführung die Wände mit Walt Disneys Figuren von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Der berüchtigte SSArzt Josef Mengele, der den Kinderblock befehligte, ließ nach der Künstlerin suchen. Dann wies er Dina Gottlieb an, die internierten Sinti und Roma zu portraitieren, da deren
Hautfarbe auf den Fotografien nicht gut zu erkennen sei. Gottlieb stimmte unter der Bedingung zu, daß auch das Leben ihrer Mutter verschont werde.
Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen der 322. Infanteriedivision der I. Ukrainischen Front das KZ. Nach der Befreiung ging Gottlieb nach Paris. Dort lernte sie den USAAnimationskünstler Art Babbitt kennen, der sich die Disney-Figur „Goofy“ ausgedacht hatte. Zusammen zog das Paar nach Kalifornien und heiratete 1949. Dort kamen die Töchter Michele und Karin zur Welt, und dort machte Dina Babitt ebenfalls Animationen für Zeichentrickfilme – unter anderem für Warner Brothers und Hanna-Barbera. 1963 ließ sich das Paar scheiden
Im Staatlichen Museum
Auschwitz-Birkenau sind sieben ihrer Portraits von Roma-Häftlingen erhalten. Diese waren in den frühen 1970er Jahren außerhalb des Lagers entdeckt und dem Museum verkauft worden. Die Beteiligten hatten

anscheinend nicht gewußt, daß Gottlieb noch lebte, und zwar in Kalifornien als Dina Babbitt. Das Museum bat Babbitt 1973, zum Standort Auschwitz zurückzukehren, um ihre Arbeit zu identifizieren. Nachdem sie dies getan hatte, wurde ihr mitgeteilt, daß das Museum ihr nicht erlauben würde, ihre Gemälde mit nach Hause zu nehmen. Babbitt beantragte offiziell die Rückgabe ihrer Gemälde, aber das Museum wies ihre Ansprüche zurück. Die USA-Regierung beteiligte sich an einschlägigen Resolutionen des Repräsentantenhauses und des Senats. Rafael Medoff, Gründungsdirektor des David-Wyman-Instituts für Holocaust-Studien, und der Zeichner und Graphiker Neal Adams setzten sich für Babbitts Bemühungen ein. Mit Text von Medoff illustrierte Adams ei-
PERSONALIEN
❯ Ehrenobermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen
ne Comic-Dokumentation über Babbitt, die Comiczeichner Joe Kubert einfärbte und wofür Comicautor Stan Lee die Einführung schrieb.
2008 leiteten Adams, das Wyman Institute und der Herausgeber von Vanguard Publications, J. David Spurlock, eine Petitionskampagne, in der über 450 Comiczeichner und Karikaturisten das Museum Auschwitz-Birkenau aufforderten, Babbitts sieben Portraits zurückzugeben. Vergeblich. Piotr Cywiński, Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, schrieb, er gebe auch nicht jenen das Lagertor zurück, die es gegossen hätten.

Dina Babitt starb am 29. Juli 2009 mit 86 Jahren in Felton im kalifornischen Verwaltungsbezirk Santa Cruz ohne ihre Bilder zurückbekommen zu haben.


Ernst-Heinrich Roth 85
Am 23. Januar feierte ErnstHeinrich Roth, ein Urgestein des Geigenbaus, im mittelfränksichen Bubenreuth 85. Geburtstag.
Wenn man heutigen Geigenbaumeistern die Frage stellt: „Wo hast Du Dein Handwerk erlernt?“, so bekommt man überwiegend die Antwort: „Bei Ernst-Heinrich Roth.“ Der Ehrenobermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen kann auf eine mehr als 100jährige Tradition seiner Geigenbaumeisterwerkstatt zurückblicken. Und wie vielen Auszubildenden er beibrachte, welches Holz klingt, kann er auf Anhieb gar nicht sagen. ErnstHeinrich Roth ist mittlerweile in Bubenreuth ein geigenbauendes Urgestein. Nun feierte er in seiner zupackenden und direkt auf den Kern kommenden, fast unnachahmlichen Art Geburtstag.
Ernst-Heinrich Roth wurde 1938 noch in Markneukirchen im Vogtland in Sachsen geboren. Nach der Schule war es für den siebten Generationsnachfolger der Roth-Dynastie eine Selbstverständlichkeit, eine Ausbildung zum Geigenbauer zu absolvieren. Er begann seine Lehre bei Willy Dölling in der Firma Louis Dölling junior.
kammer Nürnberg die Meisterprüfung ablegte. Anschließend folgten Auslandsaufenthalte in den USA, Schweden, Schweiz und England zur Vervollkommnung seines Fachwissens. Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1961 übernahm Ernst-Heinrich die Werkstatt. Roth hat sich besondere Verdienste um die Berufsausbildung in seinem Betrieb erworben. In seiner Meisterwerkstätte wurden zahlreiche Lehrlinge ausgebildet, welche zum Teil Kammer-, Landes- und Bundessieger im
Vorstand des Bundesinnungsverbandes für das Musikinstrumenten-Handwerk. Roth war 15 Jahre lang Mitglied des Vorstands der Kreishandwerkerschaft und viele Jahre in der Vollversammlung der Handwerkskammer engagiert.
Während seiner über 50jährigen Berufserfahrung konnte der Geigenbaumeister bei nationalen und internationalen Wettbewerben mehrere Preise erzielen. Anläßlich der Musikmesse 1992 in Frankfurt am Main wurde Ernst-Heinrich Roth für
das Bubenreuther Geigenbauerhandwerk sich in der Musikwelt einen ausgezeichneten Ruf erwarb.
Als Mitglied des Gemeinderates vertrat Roth von 1996 bis 2002 nicht nur die Interessen der heimatvertriebenen Geigenbauer, ihm lag das Wohl seiner zweiten Heimat sehr am Herzen. Seit 2014 hat sich Roth den Senioren verschrieben. Er leitet heute mit viel Schwung und Elan den Bubenreuther Seniorenclub.
5/2023
Innungsobermeister Günter Lobe, Ernst-Heinrich Roth und Bürgermeister Norbert Stumpf. Bilder: Heinz Reiß


Nach der Übersiedlung vollendete er seine Ausbildung unter dem Lehrmeister Willibald Raab an der Bubenreuther Fachschule für Streichinstrumentenbau. Über fünf Jahre arbeitete ErnstHeinrich als Geselle noch bei seinem Vater, bis er 1961 als damals 23jähriger vor der Handwerks-
Saiteninstrumentenbau wurden. Viele seiner „Azubis“ erreichten anerkennende Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Von 1965 bis 2008 war Ernst-Heinrich Roth ehrenamtlich in den Berufsorganisationen seines Handwerks als Obermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen tätig. Roth war mit 27 Jahren der jüngste Innungsobermeister der Handwerkskammer von Mittelfranken und mit 43 Dienstjahren auch der am längsten tätige. Von 1988 bis 2003 wirkte Roth außerdem mit großem Engagement im
seine Violine Modell Nr. 62 der Deutsche MusikinstrumentenPreis des Bundeswirtschaftsministeriums zuerkannt.
Ernst-Heinrich Roth leitete seine Werkstatt mit Umsicht und Geschick und vor allem mit Bedacht auf Wahrung der herkömmlichen Qualität der Produktpalette. Mittlerweile leitet sein Sohn Wilhelm die Firma mit. Die achte Generation ist somit bereit, in die Fußstapfen der Roth‘schen Hierarchie zu treten. Mit all seinem Engagement war Ernst-Heinrich Roth in hohem Maße daran beteiligt, daß
Ernst-Heinrich Roth ist Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, und die Gemeinde Bubenreuth verlieh ihm 1993 die Bürgermedaille. Von der Handwerkskammer für Mittelfranken wurde Roth für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Rahmen der Handwerksorganisation mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Ein bedeutender Kommunalpolitiker stellte Ernst-Heinrich Roth einmal die Frage, ob er dem Herzen nach ein Markneukirchener oder ein Bubenreuther sei. Roth antwortete salomonisch: „Aus tiefstem Herzen bin ich ein Geigenbauer.“
Den Reigen der Gratulanten führte Bubenreuths Erster Bürgermeister Norbert Stumpf an. Ihm folgten Pfarrerin Christiane Stahlmann sowie zahlreiche Seniorinnen und Senioren des Seniorenclubs. Die riesige Schar der Gratulanten aus der Musikinstrumentenbranche führte sein Nachfolger als Innungsobermeister, Günter Lobe, an. Heinz Reiß
Im Sudetendeutschen Haus in München wurden bei einer Festlichen Stunde die letztjährigen Förderpreise der Sudetendeutschen Landsmannschaft an Nachwuchstalente verliehen. Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, und Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, hielten Festansprachen. SL-Bundeskulturreferent Ulf Broßmann überreichte gemeinsam mit Posselt die Preise, deren Dotierung das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales – das Schirmherrschaftsministerium – über das Haus des Deutschen Ostens (HDO) fördert. Die Sudetendeutsche Stiftung bezuschußt die Veranstaltung.

Seit dem 17. Januar wird in Prag die Heilige Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert mit Zepter und Reichsapfel im Original ausgestellt“, freut sich Posselt. Die goldene Krone symbolisiere ein Land, in dem ursprünglich mehrere Nationen, Kulturen und Sprachen existiert hätten, so der Volksgruppensprecher. Kultur sei früher auch nicht nur an Sprache und Nation ausgerichtet gewesen. „Die Kultur war europäisch, regional und übernational!“
Lebendige Kultur
Dazu habe auch die Kultur der Sudetendeutschen gezählt, die man erhalten müsse, wie es inzwischen auch im Sudetendeutschen Museum geschehe. „Das soll aber nicht nur in musealer, sondern auch in lebendiger Form geschehen.“ Genau dies täten die jährlich gekürten Förderpreisträger. „Deshalb ist diese Verleihung für mich der schönste Termin im Jahr“, betont Posselt.
„Wegen des Krieges in der Ukraine ist Kultur um so nötiger, denn sie hat eine Friedensfunktion.“ Die Ukraine gehöre zumindest in ihrem Westen zu Europa und zu dessen gemeinsamem Kulturerbe. Denn Kultur sei eine Hauptsache und verbinde Menschen und Völker. „Daher leisten die jungen Menschen, die sich der Kultur widmen, einen friedensstiftenden Beitrag“, lobt der
Die Zukunft der Volksgruppe
Sprecher die Förderpreisträger, denen er freundlich gratuliert.
Zuvor begrüßte Ortfried
Kotzian die vielen Gäste der Preisverleihung im AdalbertStifter-Saal und hielt eine kleine Rede. Der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung spricht über Jugend als Garanten der Zukunft der Volksgruppe und seine Hoffnung, daß nach Coronaplage und trotz Kriegsverbrechen endlich ein wenig „Normalität“ einkehren könnte. Kotzian erinnert daran, daß die Förderpreise nur an verdiente Persönlichkeiten im Alter von unter 35 Jahren vergeben würden und bedankt sich bei den sechs Preisträgern, denen er ebenfalls herzlich gratuliert.
Diesen einleitenden Worten schließt sich auch Armin Rosin an, der als Vertreter der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste ein knackiges Grußwort spricht: „Wir Akademiemitglieder hoffen, viele der Preisträger auch einmal bei uns aufnehmen zu können“, so der Musikprofessor, der auch zur Jury der sudetendeutschen Preise gehört. Ulf Broßmann eröffnet die Verleihung der Förderpreise an die sechs Preisträger, die er großartig moderiert. Der SL-Bundeskulturreferent stellt kurz die Jury vor. Zu den Laudatoren zählen dieses Jahr Heimatpflegerin Christina Meinusch, Andreas Wehrmeyer, der Direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts (SMI) in Regensburg, der Musikverleger Wolfram Hader, der österreichische Wissenschaftler Fritz Bertlwieser und Kirsten Langenwalder, die Pressereferentin des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge. Sie verlesen ihre aussagekräftigen Laudationes. Alle Preisträger präsentieren sich dazu mit Kostproben aus ihrem verdienstvollen Schaffen.
Die Preisträgerin für Darstellende und Ausübende Kunst erlebten die Gäste schon bei der Begrüßung: Lisa Maria Kebinger singt eingangs die Arie „Il segreto per esser felici“ aus der Oper „Lucrezia Borgia“ von Gaetano Donizetti. Dabei wird die junge Solo-Altistin von Christoph Hauser am Flügel begleitet, wie auch bei ihren weiteren Auftritten im Laufe der Verleihung. Mit Bravour präsentiert die 1994 in Mün-
chen geborene Opernsängerin noch drei Kunstlieder von Franz Schubert, zwei „Zigeunermelodien“ von Antonín Dvořák und die „Habanera“ aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet. Der begeisterte Applaus bestätigt nur, was Andreas Wehrmeyer in seiner Laudatio sagt: „Stets trifft die junge Sängerin in Stimme und Ausdruck den Wesenskern der ihr anvertrauten Stücke!“ Geprägt sei Kebinger

stark von der Unterstützung ihrer Familie, so der SMI-Direktor. Ähnlich wichtig sei ihre Herkunft, denn ihre Großmutter Irma aus dem südmährischen Groß Steurowitz/Kreis Nikolsburg habe selbst als junge Frau ihre Heimat verlassen müssen. Das „Neuland“, das Kebinger auf der Suche nach ihren Wurzeln entdeckt habe, wolle sie auch auf musikalischem Gebiet fruchtbar machen – getragen von dem Gedanken, „daß das kulturelle Erbe der Sudetendeutschen nur weiterleben kann, wenn sich junge Menschen auch auf künstlerischem Weg damit auseinandersetzen“.
Diese Aussage trifft sicher auf alle Preisträger zu, so auch auf Julia Bertlwieser. Julia habe schon als Kind gern gemalt, sagt ihr Laudator Fritz Bertlwieser und sei ebenfalls familiär beeinflußt. „Bei Julia schwingen die handwerklichen Gene ihres Vaters Georg sowie ihres Großvaters Johann Bertlwieser mit, der die einsturzgefährdete Kirche von Sankt Thoma im Böhmerwald gerettet und renoviert hat.“
In diesen siebenjährigen Restaurierungsprozeß seien alle Familienmitglieder von Julia eingebunden worden, so ihr Großcousin Fritz, der Mitglied der Sudetendeutschen Akademie ist.

Für ihre Arbeit als Bühnenmalerin wird die 1992 in Miltenberg am Main geborene Julia Bertlwieser mit dem Förderpreis für Bildende Kunst und Architektur ausgezeichnet. Wie genau ihre Arbeit am Königlich dramatischen Theater in Stockholm aussieht, beschreibt sie in einer Powerpoint-Präsentation.

Die Fotos zeigen, wie sie stehend riesige Bühnenprospekte bemalt, die schließlich den Hintergrund einer Theateraufführung bilden. Sie müsse in ihrer Malerei auch verschiedene Materialien nachahmen oder auf alt trimmen, so
Bertlwieser, und sich auch verschiedene Malstile aneignen wie den Jugendstil für ein Bühnenbild, das sie zeigt.
Zu zeigen hat der nächste Preisträger auch so einiges, denn für die Vorstellung von Leonard Willscher stehen mehrere Schlaginstrumente auf der Bühne des Adalbert-Stifter-Saals. Auf ihnen erklingt nun eine Komposition des Preisträgers für Musik, der aus einer Dynastie von Musikern stammt: „Leonards Vater ist der Komponist und Organist Andreas Willscher, der Enkel des bekannten Troppauer Dichterkomponisten Gustav Willscher“, erläutert Wolfram Hader. Der Laudator stammt mit seinem jüngst verstorbenen Vater Widmar Hader ebenfalls von einem großen Komponisten ab. Nach einem Schulmusik-Studium habe Leonard Willscher noch ein Studium der Musiktheorie und der Komposition absolviert, so Wolfram Hader. Willschers Motivation, neue Musik zu schreiben, resultiere nicht aus dem Interesse, ultra-innovativ zu sein. „Er will eher über eine Symbiose von älterer und neuer Musik das klanglich darstellen, was er im Inneren hört“, faßt Hader zusammen.

Reisen durch All und Zeit Der Musikpreisträger stellt sich mit seiner Komposition „Cassini“ vor, benannt nach der Weltraumsonde, die zum Saturn flog. Das „Konzert für Multi-Percussion-Setup“ wird von einer Schlagzeugprofessorin aufgeführt. Cornelia Monske freut sich, bei der Preisverleihung musizieren zu dürfen, da ihre Mutter aus dem Glatzer Ländchen stamme, wie sie sagt. Die Interpretin empfiehlt, das Kopfkino einzuschalten und sich eine Weltraumreise vorzustellen, wie Cassini sie 1997 bis 2007 unternommen habe. Dann läßt sie die Batterie an Schlaginstrumenten auf der Bühne ertönen, und alle fliegen geistig zum Mars und zurück.
Keine Reise durch das All, sondern durch die Zeit bietet der Preisträger für Wissenschaft, den Broßmann vorstellt: Luděk Němec, geboren 1999 in Krumau Bitte umblättern
Dort habe seine Familie in Böhmisch Röhren im Kreis Prachatitz ein Ferienhaus gehabt, so Laudator Broßmann. Němec habe schon mit 16 Jahren sein erstes Buch „Krásná Hora – Schönberg im Böhmerwald, Geschichte eines vergessenen BöhmerwaldDorfes“ verfaßt. „Dieser engagierte, fleißige, verläßliche junge Mann, der sich zudem noch als Kommunikationstalent ausweist, ist heute schon ein wichtiger Brückenbauer zwischen der deutsch-tschechischen Sprachund Ländergrenze, aber auch zwischen den Generationen.“
Němec stellt seine Motivation und Leistungen in sehr gutem Deutsch mit einer Bilderpräsen-
tation vor und zeigt Ansichten von einstigen Böhmerwaldorten, deren Vergangenheit er wieder freilegen will. „In der historischen Forschung ist Multiperspektivität nötig, nicht einseitige Geschichtsbilder“, faßt Němec zusammen, der seit 2019 an der Universität Wien studiert.
Genauso engagiert sind die beiden Preisträger für Volkstumspflege: „Anna-Lena Hamperl hat in nur vier Monaten den Buchbestand des Vereins Egerer Landtag sortiert und inventarisiert“, so Christina Meinusch.

„260 Bücher zu Eger, 530 Bücher zum Egerland und 607 Bücher zum Thema Sudetenland, insgesamt knapp 1400 Bücher“, lobt


� Fortsetzung von Seite 7
Die Zukunft
die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Anna-Lena Hamperl, geboren 1998 in Trostberg im Kreis Traunstein, ist Lehramtsstudentin mit den Fächern Kunst und Englisch. Die Tochter des ehemaligen Bundeskulturreferenten Wolf-Dieter Hamperl stellt in einem Powerpointvortrag ihre Mammutaufgabe vor. „Meine Arbeit geschah im Rahmen des Projektes ,Digitalisie-
rung von Heimatstuben‘, initiiert von der Beauftragten für Flüchtlinge und Vertriebene im Bayerischen Landtag, Sylvia Stierstorfer MdL“, so Anna-Lena Hamperl. Als Nachfolgeprojekt sei inzwischen auch die „Inventarisierung und Digitalisierung des Vereinsarchivs des Egerer Landtags“ vom Haus des Deutschen Ostens genehmigt worden. Auch an diesem Projekt sei sie bei der


Vorsortierung der bis zu 70 Jahre alten Archivbestände beteiligt.
Der zweite Preis für Volkstumspflege geht an Jan Vrána, den als Laudatorin Kirsten Langenwalder portraitiert: „Jan schrieb seine Abiturarbeit über ,Die Gewinnung von Bodenschätzen in Rochlitz an der Iser‘“, so die Pressereferentin des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge. „Unser Preisträger steht exemplarisch für diejenigen der tschechischen Nachfolgegeneration, die sich damit beschäftigen, was in ihrem Land passiert ist, und sich mit der Historie differenziert auseinandersetzen.“




Jan „Honza“ Vrána, der 2003
in Jungbunzlau zur Welt kam, wird mit seiner berührenden Rede und Bilderpräsentation über Rochlitz an der Iser, wo er aufgewachsen ist, zum Publikumsliebling im Saal. Zum Abschluß seines Vortrags singt er eine neugedichtete Strophe des „Riesengebirgsliedes“.
Ergriffen meldet sich Bernd Posselt zu Wort und dankt allen Preisträgern und Laudatoren für den „großartigen Nachmittag“. „Heute wurde wieder klar, warum dies meine Lieblingsveranstaltung ist, und daß man angesichts dieser jungen Menschen optimistisch in die Zukunft blikken kann“, lautet das Schlußwort des Sprechers. Susanne Habel

Man sagte mir: „Sie müssen ein Buch schreiben! Jetzt, da jeder Mensch seine Memoiren schreibt und irgend etwas enthüllt, dürfen Sie nicht zurückstehen!“ „Aber ich habe doch nichts zu enthüllen, und das, was ich erlebte, interessiert keinen Menschen.“ „Ja, meinen Sie denn, daß die Leute alles interessiert, was geschrieben wird? Lächerlich! Schreiben Sie nur ruhig ein Buch, erzählen Sie irgend etwas, auch wenn es noch so blödsinnig ist, ein Mensch in Ihrer Stellung muß einmal ein Buch geschrieben haben.“
So entschloß ich mich denn, dies Büchlein zu verfassen, und lasse es –wie viele vor mir so innig sagten – hinausflattern. Sollte es irgend jemandem gefallen, so bitte ich, mich davon freundlichst verständigen zu wollen, ich werde mich von Herzen freuen.
Zu sagen habe ich nicht viel. Nur von fröhlichen Dingen will ich erzählen, aus lieber alter Vorkriegszeit, da uns allen noch die Sonne schien und wir sorgenloser waren als heute.
Man riet mir, meinen Werdegang mit den Worten zu beginnen: „Ich war ein Wunderknabe, da schmierte man mich mit Salizyltalg ein – darauf wurde es besser!“ Ich wies diesen Gedanken weit von mir. Ich schmücke mich nie mit fremden Federn, ich habe selber Federn genug, und außerdem halte ich es nicht für schicklich.
Ich will auch, so gut es geht, vermeiden, von mir als Künstler zu sprechen. Dies soll nur in den allerdringendsten Fällen geschehen. Nicht über Kunst oder das Singen will ich reden, nicht, wo der Ton sitzen oder das Gaumensegel stehen soll, nein, das weiß ich nämlich selber nicht. Außerdem fände sich leicht jemand, der mich für einen Idioten erklärte, und ich könnte ihm nicht einmal das Gegenteil beweisen. Nein, beileibe nicht. Nur erinnern will ich mich, und das wenige, was ich zu sagen habe, will auch nicht den Anspruch auf den Schillerpreis erheben.
Nun „flattre“ hinaus, du erste und, wie der Titel sagt, auch letzte Frucht meines Geistes, und was ich dir wünsche, ist die Güte und Nachsicht des lieben Lesers. Der Verfasser
Werdegang
Meine Kinderjahre waren traurig. Not und Elend, soweit ich zurückdenken kann. Mutter Sorge stand an meiner Wiege, bis zu dem Augenblick, da mich ein gütiges Geschick meinem geliebten Lehrer Robinson zuführte, der meine Stimme erkannte.
Am 18. August bin ich geboren. Am 18. August, mit Kaiser Franz Joseph zugleich. Eine Königin hat mich zur Welt gebracht, die Hebamme hieß Frau König, und mit Papst Leo XIII. feierte ich meinen Namenstag. Also eine strahlende Vorbedeutung. Ich bin in Mährisch Schönberg in der kleinen Mühle zur Welt gekommen, infolgedessen Müllerssohn. Durch das letzte Fenster im ersten Stock habe ich das Licht der Welt erblickt. Eine Gedenktafel ist noch nicht dort, aber man hat mir versprochen, sofort, sowie ich tot bin, kommt eine hin. Nun, das eilt nicht. Allerdings weiß ich mich an die Mühle und den rauschenden Bach nicht mehr zu erinnern. Meine Erinnerung beginnt erst in Brünn, wo mein Vater, nachdem er sein Vermögen verloren hatte, in der Tuchfabrik Offermann einen Magazineurposten bekleidete.
Auch das Bild, das mich als Baby zeigt, ist sehr interessant, weil es dem lieben Leser respektive der reizenden Leserin vor Augen führt, wie sehr ich mich seither verändert habe. Einige behaupten, zu meinem Vorteil, andere wieder meinen, ich sei damals schöner gewesen. Ich selbst kann das nicht so beurteilen.
Ich absolvierte mit denkbar günstigstem Erfolg den Kindergarten. Als ich dann in die richtige Schule kam, sollen mir diese Erfolge nicht mehr so treu geblieben sein. Allerdings möchte ich an dieser Stelle dem Gerücht, ich sei elf Jahre in die erste Klasse gegangen, auf das bestimmteste entgegentreten und dieses als mindestens stark übertrieben bezeichnen.
Es herrschte nur eine Stimme: „Der Bengel ist unerträglich!“
Ich wuchs trotzdem heran und kam in die Realschule. Ich war zum Offizier bestimmt worden, sollte vier Realschulklassen absolvieren und dann in die Kadettenschule übertreten. Man erwog auch, ob ich nicht Staatsbeamter werden solle, von denen es damals im Volks-
� Autobiographische Geschichten des Tenors Leo Slezak, der vor 150 Jahren in Mährisch Schönberg zur Welt kam
Meine sämtlichen Werke
Leo Slezak (* 18. August 1873 in Mährisch Schönberg, † 1. Juni 1946 in Rottach-Egern, war mit 1,95 Metern und 150 Kilogramm der größte und eindrucksvollste deutsche Tenor des vorigen Jahrhunderts. Der gefeierte Wagner-Interpret gastierte nicht nur in Eu-


mund hieß: „Die haben zwar nichts, aber das haben sie sicher!“
Doch keines von beiden sollte sich erfüllen. Durch das Lesen von Indianerbüchern fühlte ich mich meist in der Prärie und sog all den von Edelmut triefenden Unsinn in mich auf. Wenn einmal zufällig ein Schulkollege etwas verbrochen hatte und ausnahmsweise nicht ich derjenige war, nahm ich‘s auf mich und büßte die Strafe mit dem Gefühl ab, ein Held zu sein.
Diese eigenen und fremden Delikte summierten sich zu solch erdrückender Fülle, daß man mir eines Tages erklärte, auf meine weitere Mitwirkung in der vierten Realklasse verzichten zu müssen. Ich sah mich plötzlich mit meinem Reißbrett und den Schulbüchern auf der Straße. Ich hatte ausstudiert.
Meine Schulzeugnisse aus dieser Zeit geben einen recht traurigen Einblick in den Mangel an Wohlwollen und Verständnis, den man mir von seiten meiner Lehrer entgegenbrachte. Fast in jedem Zeugnis ist, neben einem „minderentsprechend“ in sittlichem Betragen, auch noch ein liebloses „Ruhestörer“ in der Rubrik für besondere Anmerkungen zu lesen. Diese Bezeichnung ist mir allerdings bis auf den heutigen Tag, namentlich bei den Proben, treu geblieben.
ropa, sondern auch in den USA. Er sang unter dem Dirigat von Arturo Toscanini und Gustav Mahler. Außerdem machte er im Radio und im Film Karriere. So spielte er neben Zarah Leander, Magda Schneider, Hans Moser und Heinz Rühmann. Er hinterließ 400 Schallplat-
sehr verzweifelt über dieses gewaltsame Durchkreuzen ihrer Pläne, berieten, was nun aus mir werden solle. Weiterstudieren könne ich nicht, es bliebe also nur ein Handwerk. „Gärtner!“, rief ich begeistert. In Blumen wandeln, dem Gezwitscher der Vögel lauschen – herrlich! Gärtner!
ten und 40 Filme. Und er hatte Humor. Viel Humor. Seine Erlebnisse veröffentlichte er in „Meine sämtlichen Werke“ (1921), „Der Wortbruch“ (1927) und „Rückfall“ (1940) voller weltvergnügten Frohsinns. Hier eine erste Kostprobe zum Auftakt des Jubeljahres.
te. Er mußte rettungslos krepieren. Seit dieser Zeit rührt meine Abneigung gegen alles Geschnitzte und Laubgesägte her.
In all dem düstern Grau in Grau verklärten meine Theaterpläne unser trauriges Leben. Ich wußte meiner lieben Mutter die Zukunft so schön zu schildern, daß sie oft das Sticken vergaß und mir glückselig in das Land der Träume folgte. Luftschlösser wurden gebaut, und ich sah mich als Rivalen Girardis [Der österreichische Tenor Alexander Girardi lebte von 1850 bis 1918 und war Schauspieler und Operettensänger.]. Alle Not hatte ein Ende, mitten in der Nacht strahlte uns beiden die hellste Sonne.
Zum Theaterbesuch langte es nicht, selbst nicht zu einem allerbescheidensten Platz. Da lernte ich einen Chorsänger kennen, durch dessen Vermittlung ich ins Stadttheater eingeführt wurde. Ich durfte mitstatieren. Mit hier und da verabreichten zehn Kreuzern wußte ich mir das Wohlwollen und die Förderung des Statistenhäuptlings zu erwerben und war dort bald heimisch. Man wies mir, kraft obiger Protektion, die am wenigsten zerrissenen Trikots und am besten erhaltenen Kostüme zu.
Da sein, die Luft atmen, in der Welt herumgehen dürfen: Ich war wie betrunken vor Glück und starrte jeden Schauspieler als höheres Wesen an. Und der Komiker war für mich einfach der Gipfel des Beneidenswerten.
Dieses Slezak-Portrait schuf der Maler, Karikaturist, Cartoonist, Illustrator und Kinderbuchautor Hans Johann Georg Traxler. Traxler kam am 21. Mai 1929 in Herrlich im Kreis Dux zur Welt, wuchs in Sangerberg im Kreis Marienbad auf und lebt heute in Frankfurt am Main. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Frankfurter Schule.

Diese Lieblosigkeiten sollen ihren Grund in der unerschöpflichen Erfindungsgabe gefunden haben, mit welcher ich immer neue Abarten von Lausbübereien gebar. Hervorzuheben wäre das Einreiben der Bänke mit Knoblauch sowie das Streuen von Kirsch- und Zwetschgenkernen auf die Erde und hauptsächlich auf den resonanzreichen Katheder, mit dem scheinbar unabsichtlichen Drauftreten und den damit verbundenen kanonenschußartigen Detonationen. Dies alles wurde mir von seiten meiner Professoren in ganz animoser Weise übel ausgelegt.
Ich möchte an dieser Stelle der herzlichen Hoffnung Ausdruck geben, daß mein Sohn Walter diese Zeilen nicht vorzeitig in die Hand bekommt, weil ich glaube, begründete Befürchtung hegen zu müssen, daß er sich speziell in dieser Hinsicht seinen Vater als Vorbild nimmt. Der Offizier und der Staatsbeamte waren somit erledigt. Meine Eltern,
Mein guter Vater suchte mir zwar diese etwas absurde Berufswahl auszureden, aber ich blieb dabei. Man fand einen Lehrlingsposten für mich im oberösterreichischen Gmünden am Traunsee in der Rosenvilla der Erzherzogin Elisabeth. Der Abschied von den Eltern war schwer. Ich ging zum ersten Mal in die Fremde. Meine engelsgute, geliebte Mutter gab mir all ihre Güte mit auf den Weg. Ich fühlte zum ersten Mal die große Traurigkeit im Herzen.
Als Hofgärtnerlehrling wurde ich meist zum Ribisel-(Johannisbeer-)Austragen, Mistfahren und Gemüse-aufden-Markt-Rudern verwendet. Beim Ribiselaustragen lernte ich ganz besonders interessante Feinheiten kennen. Man unterschied gerebelte und ungerebelte Ribisel. Die gerebelten waren schon von den Stielen abgeschürft, die ungerebelten waren dies noch nicht. Das Mistfahren teilte sich auch in verschiedene Arten von Mist ein: Kuh-,
Pferde- und Bockmist – zu welch letzterem ich diese meine bescheidene Schilderung nicht gerne hinzugezählt haben möchte. Nach ungefähr drei bis vier Monaten verkaufte die Erzherzogin den Besitz, der Hofgärtner wurde versetzt, und ich mußte wieder heim. Meine Gärtneridylle war zu Ende. Nun suchte mir mein Vater selbst einen Beruf aus. Maschinenschlosser sollte ich werden. Ich wurde es, lernte drei Jahre bei Brandt & L‘ huillier in Brünn und besuchte die Werkmeisterschule. In dieser Zeit packte mich der Theaterteufel. Ich wollte Komiker werden und schnitt Grimassen, daß meine liebe Mutter oft der quälenden Sorge Ausdruck gab, daß mir das Gesicht einmal so stehenbleiben würde. Besonders selig war ich, wenn mich die Leute auf der Straße für einen Schauspieler hielten. Zu diesem Behufe blieb ich oft unvermittelt, mit einem Reclambuch in der Hand wie selbstvergessen stehen, rollte die Augen und schrie plötzlich: „Ha, Verruchter!“ Die Leute um mich herum erschraken. Einige beurteilten dies ungewohnte Benehmen wohlwollend und lachten, andere schimpften, und wenn ich nicht irre, so habe ich auch einmal von einem Herrn, der wenig für Kunst übrig hatte, ein paar Ohrfeigen bekommen.
Damit beschließe ich die Tage meiner Kindheit und reife bis zum nächsten Kapitel zum Jüngling heran.
Freudlos wie meine Kindheit ließ sich auch das Jünglingsalter an. Von sechs Uhr früh bis sechs Uhr abends am Schraubstock, in harter schwerer Arbeit. Als Löhnung ein paar Kreuzer, daheim Not und Sorge, denn es fehlte das Nötigste. Meine arme liebe Mutter immer über die Stickerei gebeugt. Ich mußte, um noch ein weniges hinzuzuverdienen, die halben Nächte Laubsägearbeiten machen, Vogelbauer, Tintenzeuge und derlei mehr, das dann auf Lose ausgespielt und jedem, der es gewann, ein Born rastlosen Ärgers wurde. Mit Schaudern denke ich an die Tintenzeuge zurück, die ich schnitzte. Sie waren sehr geschmacklos und als Tintenzeuge nicht zu verwenden. Unbrauchbar auch die Vogelbauer. Jeder Vogel war zu bedauern, der in meinen Käfig hinein muß-
Mein Vater sah mein Fernbleiben des Abends mit scheelen Blicken an und schnitt jeden Versuch, ihn von der ungeheuren Rentabilität des Bühnenberufes zu überzeugen, kurzweg ab, meist mit den Worten: „Auf dich warten sie beim Theater! – Willst du Wolkenschieber werden oder Möbelträger? – Bleib bei deinem Handwerk, verzettle dich nicht, sonst wird nie etwas aus dir!“ Ich lernte humoristische Vorträge, kopierte alles, was ich sah, und lebte immer in einer anderen Welt. Welch einen wohltuenden Einfluß dies auf meinen Schlosserberuf ausübte, läßt sich leicht erraten. Nachdem ich drei Jahre lang die Schlosserei gelernt hatte, kam ich in die Werkmeisterschule. Außerdem war ich ein gewiegter Statist und Volksmurmler geworden und stellte in Verschwörungen derart meinen Mann, daß sich das Publikum höchst befremdet fragte, wer denn dieser aufdringliche Longinus sei, der da so mit Händen und Füßen um sich schlage. Einzelne Chorstellen, die mir im Ohr geblieben waren, brüllte ich mit, daß mir fast die Halsadern platzten.
So geschah es auch eines Abends in der Oper „Bajazzo“ von Ruggero Leoncavallo. Den Tonio sang Adolf Robinson. Ich schreie neben ihm wie ein Zahnbrecher, er dreht sich überrascht um, sieht mich an und flüstert mir zu: „Melden Sie sich nach der Vorstellung in meiner Garderobe, ich habe Ihnen etwas zu sagen.“ Hochklopfenden Herzens erwartete ich ihn. Er sagte: „Mir scheint, Sie haben eine schöne Stimme. Kommen Sie morgen vormittag zu mir, ich werde Sie prüfen.“ Daheim schilderte ich meiner lieben Mutter dieses ungewöhnliche Erlebnis in den glühendsten Farben. Der nächste Morgen kam, statt in die Schule ging ich zu Robinson. Er empfing mich sehr freundlich und fragte, ob ich ihm etwas vorsingen könne. Ich konnte nichts anderes als Couplets, und so sang ich denn:
„A so a Kongoneger hat‘s halt guat!“ Robinson konstatierte einen Heldentenor! Wie ich heimkam, weiß ich nicht. Lange Überredung hat es gekostet, meinen Vater zu bewegen, seine Erlaubnis zum Singenlernen zu geben. Erst als ihm Robinson persönlich versicherte, daß man mir, wenn ich fleißig arbeitete, eine günstige Zukunft prophezeien könne, willigte er ein.
So kam ich denn auf den Weg, den mir mein Lehrer gewiesen hatte, und auf dem er mich mit zielbewußter Hand führte. Gefühle innigster Dankbarkeit für ihn und seine verehrte, so herzensgute Frau verbinden mich bis zum heutigen Tag mit ihm. Alles, was ich geworden bin, danke ich ihm und seiner väterlichen Güte! Doch hinter all dem Glück stand das schreckliche Gespenst, die Not, die einmal nicht zu bannen war. Alle Bemühungen, einen Gönner zu finden, der mir über die böse Zeit des Studiums hinweggeholfen hätte, schlugen fehl.
Die schwere Arbeit am Schraubstock und beim Schmiedefeuer vertrug sich nicht mit dem Singen. So fand ich den Ausweg, freiwillig zum Militär zu gehen, um dort die freie Zeit zum Singen zu benützen. Ich wurde Soldat.
� SL-Ortsgruppe Bayreuth/Oberfranken
Lesung über „Die Anderen“
Für Ende Januar hatten die oberfränkische SL-Ortsgruppe Bayreuth, das Evangelische Bildungswerk Bayreuth und die Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Bayreuth (DTG) zu einer Lesung mit Kateřina Kovačková, SL-Förderpreisträgerin für Publizistik 2018, über das Thema „Die Anderen“ eingeladen.


Die Hölle, das sind die anderen“, so brachte es der große Philosoph Jean-Paul Sartre auf den Punkt. Ganz so schlimm ist es vielleicht nicht; aber dennoch: Die Anderen, das Andere ist oft fremd, ungewohnt, eigenartig, macht vielleicht sogar Angst. Dieses Gefühl zieht sich durch viele Generationen und Kulturen. Ein spannendes Thema und eine beinahe leidenschaftliche

Johannes Urzidil (* 1896 in Prag, † 1970 in Rom) und Jean-Paul Sartre (* 1905 in Paris, †
Referentin hielten die Zuhörer in Bann.
An diesem Abend wurde es dazu konkret. Autorin Kateřiná Kovačková gab anhand der deutschböhmischen Autoren Gerhard Tietz, Josef Holub, Johannes Urzidil und Otfried Preußler einen Einblick in die Mechanismen stereotyper Denkmuster hinsichtlich der „Eigenen“ und der „Anderen“, vor allem der Tschechen und der Deutschen.
Welche Grundmuster zwischen Slawen und Germanen sind dabei zu beobachten? Besonderen Wert legte Kateřiná Kovačková auf Paradigmen der Psychologie, die uns auf unterschiedliche Weise menschliches Verhalten und Erleben erklären. Wie wir denken und auf Veränderungen reagieren. Ist Verhalten eigentlich ange-
boren oder erlernt? Die Genetik bildet das Fundament, das sich in Wechselwirkung mit der Umwelt und eigenen Erfahrungen entsprechend entwickelt.
Zur Vertiefung der Kontakte und zum Abbau von Vorurteilen und stereotyper Denkmuster gab es anschließend eine Verkostung mährischer Weine. Auch dies ein gelungener Gedanken- und Erfahrungsaustausch.
Die böhmische Autorin Kateřiná Kovačková, die meist in deutscher Sprache publiziert, stammt aus Pilsen. Sie studierte Germanistik und Kunst in Pilsen sowie in Regensburg, München und Berlin. Ihre Doktorarbeit über die Figuren der Anderen in der deutschböhmischen Exilliteratur wurde beim Rogeon-Verlag publiziert und ist neben der Print-Ausgabe mittlerweile auch als eBook erhältlich.
Manfred Kees


auf
� Südmähren
Klinker aus Schattau
Jüngst erschien der zweisprachige Katalog „150 Jahre der Tonwarenfabrik in Šatov 1873 bis 2023. Rückblick auf die Geschichte der Fabrik von Klára Piscová. Harald Hofbauer berichtet.

Zum 150. Jubiläum der ehemaligen Klinkerfabrik im weiland rein deutschen Marktflecken Schattau bei Znaim in Südmähren gratulierte sich der tschechische Ort Šatov bereits ein Jahr vorher. Schattau hatte großes Glück, die Bakkalaureats- (2020) und Magisterarbeit (2022) von Klára Piscová an der Masaryk-Universität in Brünn als Stoff für die gleichnamige Wanderausstellung zu gewinnen. Auf wetterfesten Wandtafeln und mit gefälligen Fabrikaten wie Mustern von Steingutwaren oder Fliesen aller Art wurde bereits letzten Sommer im südmährischen Schattau und Gnadlersdorf sowie im niederösterreichischen Unterretzbach und Retz die Firma anhand von Fotos und Archivakten zweisprachig präsentiert.
� SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf/Baden-Württemberg
Union steht an unserer Seite
Im Rahmen des Monatsnachmittages der baden-württembergischen SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf mit Zuffenhausen, Stammheim, Rot, Zazenhausen, Freiberg und Mönchsfeld war der Stuttgarter CDU-Bundestagsabgeordnete und Obmann der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuß für Kultur und Medien, Maximilian Mörseburg, ins Haus der Begegnung in Stuttgart-Giebel gekommen, um dort über seine bundespolitische Arbeit und die aktuelle politische Lage in Deutschland zu berichten.
Obfrau Waltraud Illner freute sich sehr, den christdemokratischen Bundespolitiker, der bei der Bundestagswahl 2021 das Direktmandat im nördlichen Stuttgarter Wahlkreis erlangt hatte, in den Reihen der Heimatvertriebenen begrüßen zu können.
Maximilian Mörseburg machte in seinem Vortrag dann auch sogleich deutlich, daß er die Gedenk- und Kulturarbeit der Landsmannschaften für eine bedeutende Arbeit halte. Es sei eine gemeinsame Aufgabe, stets des Leides während der Flucht und Vertreibung zu gedenken und an die Folgegenerationen weiterzugeben. Auch der in der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ festgehaltene Wunsch nach einem freien und geeinten Europa, in dem Völker ohne Furcht und Zwang leben könnten, habe angesichts des völkerrechtswidrigen Krieges in der Ukraine nicht an Aktualität verloren.

„Als Union stehen wir an Ihrer Seite“, versicherte Maximili-

an Mörseburg. An dieser Stelle sprach er auch die Härtefallregelung bei der Ost-West-Rentenüberleitung an.
Dieser von der Vorgänger-Bundesregierung beschlossene Fonds von einer Milliarde Euro, der zur Abmilderung finanzieller Härtefälle im Sinne der Rentengerechtigkeit für Spätaussiedler eingerichtet worden sei, sei nun von der Ampel-Koalition um die Hälfte gekürzt worden.
Auch sei die solide Haushaltspolitik des Bundes aufgegeben worden, betrage doch die für 2023 geplante Schuldenaufnahme fast 107 Milliarden Euro und sei damit doppelt so hoch wie die offiziell ausgewiesene Neuverschuldung von knapp 46 Milliarden Euro.
Im Bereich der Sozialpolitik sieht der CDU-Bundespolitiker mit dem sogenannten Bürgergeld die Gefahr, daß das Prinzip
„Fördern und Fordern“ aufgegeben werde und damit den Zusammenhalt und das Gerechtigkeitsempfinden der Gesellschaft bedrohe. Auch der politisch festgelegte Mindestlohn, der zugleich die Entmachtung der Mindestlohnkommission bedeute, ziele in die falsche Richtung und bedürfe einer Kurskorrektur.
Natürlich sprach Maximilian Mörseburg auch das Thema Wirtschaft an, sind doch viele Unternehmen in Deutschland aufgrund der Energiekrise in ihrer Existenz bedroht. Deshalb gelte es gerade in dieser Krisensituation auf Eigenverantwortung und Marktwirtschaft zu setzen.
Als Obmann der CDU-/CSUBundestagsfraktion im Ausschuß für Kultur und Medien gehört der Stuttgarter CDU-Bundestagsabgeordnete auch einer Kommission an, die sich mit der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befassen soll. So sei es notwendig, sich die Strukturen der Medienanstalten anzuschauen und sich mit den Programminhalten zu befassen.
In Sachen Kultur ließ Maximilian Mörseburg zum Abschluß die Runde im Haus der Begegnung in Giebel noch wissen, daß er in einer Rede im Deutschen Bundestag mit großem Unverständnis auf die Forderung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), die Inschrift am Humboldt-Forum zu überdecken und auf ein Kreuz auf der Kuppel zu verzichten, geantwortet und sich für ein Bekenntnis zur deutschen kulturellen Identität ausgesprochen habe. Helmut Heisig
steige mit der viergeteilten 400 Quadratzentimeter großen Platte. In vielen Gängen, Vorzimmern und Kirchenhallen fanden sich die in verschiedenen Mustern bunt gestalteten Jugendstil-Bodenfließen, auch in meinem Elternhaus. Faszinierend sind auch die vielen alten Postkarten mit dem Weichbild des Marktes Schattau wie Karten mit rauchenden Schloten.
Der Bogen der Chronik spannt sich von 1873 bis zum Ersten Weltkrieg. Danach wird die Zeit in der ČSR, die Zeit 1938 bis 1945 bis es zur Katastrophe kam und bis zum Liquidieren des Areals 2008 beschrieben.
Ergänzend hätte ich das Areal mit einer Farbreproduktion aus dem Stabilen Kataster topographisch illustriert, aber da schlägt mein Geometerherz durch. Der Werksplan ohne Umgebung, ohne Nordpfeil und ohne Maßstab auf Seite 55 ist ein bißchen dürftig für eine Orientierung.
Jetzt kurz vor Weihnachten liegt bereits der gedruckte Katalog vor. Der reich bebilderte Text ist wie die Ausstellungstafeln zweisprachig. Allerdings ist es schade, daß die deutsche Übersetzung der Buchausgabe nicht lektoriert wurde.
Ein zweiter Minuspunkt ist die chronische Nichtnennung der deutschen Bezeichnung von Šatov, wiewohl man aber bei allen anderen genannten Orten die uralten deutschen Namen zum Glück noch wußte wie bei Znaim, Unter Themenau. Der Schreibfehler bei Grandlersdorf statt Gnadlersdorf sei verziehen. Kolin aber ist auf deutsch mit „Köln“ eher unbekannt. Doch wollen wir nicht Flöhe suchen. Schön ist, den heute völlig aus dem Sprachgebrauch verschwundenen Begriff „Trottoirplatten“ als Übersetzung von „Chodniková dlažba“ zu lesen, aber so steht es eben in den auch abgedruckten schönen Musterkatalogen. Auch gelang der Übersetzerin fast immer, die Jahreszahlen im deutschen Text um 100 Jahre zu verjüngen. Die bunten Fotobeispiele samt den Reproduktionen der alten Katalogseiten, als die Fabrik „vormals C. Schlimp“ in Wien I., Seilergasse Nr. 14 ihr Bureau hatte, entschädigen beim Blättern aber alle Satz- und Textschwächen.
Nahezu alle Durchzugsstraßen waren seinerzeit mit den gelbtönig-glasierten Klinkersteinen fischgrätartig gepflastert, so auch früher die Znaimer Straße in Retz, die Geh-
Eines läßt die Verfasserin im Unklaren: Gibt es die riesige Gartenvase für die Weltausstellung 1900 in Paris noch im Pariser Luxemburg-Park? Und wer erfreut sich heute wo in Schattau an der beschriebenen Kopie?
Ein Aufkochen des Nationalitätenproblems mußte leider auch sein. Der Antifaschist und gebürtige DeutschSchattauer Eduard Hofstetter war als österreichischer Bundesheer-Unteroffizier 1929 bis 1937 Spitzel für den ČSRNachrichtendienst. U-Haft in Krems-Stein und KZ überlebte er und kehrte nach 1945 nach Schattau zurück. Ob er als Deutscher nicht auch Opfer von Edvard Beneš wurde oder bleiben durfte, erfährt man nicht.

Inwieweit manches aus dem ehemals deutschen Schattau ausgeblendet wurde, wissen nur die wenigen Alt-Schattauer Zeitzeugen. Die letzte Ortsbetreuerin von Schattau, Agnes Schleinzer, starb kürzlich hochbetagt.
Übrigens ist Únavov das alte Winau. Im Resümee „Möglichkeit eines Wiederaufbaues“ des Werkes schreibt Klára Piscová, daß es wohl genug Kaolin in der Winauer-Gegend gebe, aber nur ein völliger Neubau wäre konkurrenzfähig und wirtschaftlich.
Layout, Hochglanzpapier und Druck sind hervorragend. Der Zitatenapparat ist erfüllt, führt zur Quelle, wie es sein soll für ein Buch, das seine Wurzeln aus zwei wissenschaftlichen Arbeiten hat. Leider fehlt eine Vita der Verfasserin. Dennoch: Das Buch muß in die Heimatbibliothek!

❯ Troppau
Gottfried Rothacker –


ein zu Recht vergessener Autor
Anläßlich seines zehnten Todestages erschien im Juli 1951 in der „Troppauer Heimat-Chronik“ („THC“) ein Bericht über Gottfried Rothacker, der von der Sudetendeutschen Zeitung – die saß damals noch im oberfränkischen Bayreuth – im Juni 1951 übernommen worden war.
Robert Hohlbaum, der Verfasser dieses Artikels, bezieht sich insbesondere auf das Hauptwerk „Das Dorf an der Grenze“, das Gottfried Rothakker berühmt gemacht hatte. Er lobt diesen Roman als „einen der größten Bucherfolge dieser Jahre“. Laut der Internet-Enzyklopädie „Wikipedia“ hatte er bis 1944 eine Gesamtauflage von 250 000 Exemplaren. Außerdem lobt Hohlbaum
Rothacker für das große Verdienst, die sudetendeutsche Frage zu einer allgemein deutschen gemacht zu haben und ihre Weltgeltung vorzubereiten, die sie heute nach schweren Blutopfern sich errungen habe.



Auch was die literarische Qualität betrifft, findet er nur lobende Worte:
„Scheinbar kunstlos, in Wahrheit mit höchsten Kunstmitteln geschrieben, und doch jedes Wort durch Herzblut von Herzblut gezeugt, keine chauvinistische Phrase, aber auch kein Satz, der nicht ein stilles Bekenntnis zu Heimat und Volk gewesen wäre.“ Nach der Lektüre von „Das Dorf an der Grenze“ kann man sich über solche Lobpreisungen nur wundern, da es sich meines Erachtens um ein übles Machwerk handelt, was Inhalt, Aussage und sprachliche Gestaltung betrifft. Die Antwort auf die Frage, warum das eigene Urteil
so gravierend von dem des Rezensenten abweicht, findet man ebenfalls bei „Wikipedia“. Hier erfährt man, daß Rothacker, der als Bruno Nowak 1901 in Troppau zur Welt gekommen war, bereits als Student radikaler Anhänger deutschnationaler Ideen gewesen und 1926 in die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei eingetreten sei. Bis 1935 hatte er unter seinem Geburtsnamen veröffentlicht, legte ihn dann aber ab, weil ihm Nowak nicht deutsch genug klang.

Die völlig kritikfreie Eloge des Rezensenten Hohlbaum, der 1886 in Jägerndorf im Altvaterland zur Welt gekommen war, erklärt sich durch dessen politisch-ideologische Orientierung. Diese läßt eine geistige Verwandtschaft zu Nowak alias Rothacker erkennen.

Im Jahr 1961 erschien unter der Überschrift „Gottfried Rothakker zum 60. Geburtstag“ ein weiterer Beitrag in der

„THC“ über Leben und Werk von Rothacker, der sich im Tenor vom ersteren nicht unterscheidet. Er beginnt mit „Unser Troppauer Dichter Gottfried Rothakker (Dr. Bruno Nowak)“ und verweist darauf, daß dieser für sein Buch „Die Kinder von Kirwang“ einen Literaturpreis erhalten habe. Verschwiegen wird allerdings, daß es sich hierbei um den Hans-Schemm-Preis des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB) handelt.
Der Verfasser dieses Beitrags zeichnet nicht namentlich, das Kürzel „pb“ das dem Text vorangestellt ist, steht für Paul Buhl, den 1995 verstorbenen langjährigen Ersten Vorsitzenden der Heimatkreisgemeinschaft Troppau und Schriftleiter der „THC“. Für die hatte er eine Vielzahl von Beiträgen verfaßt, meist unter seinem Namen, aber auch unter dem Kürzel „pb“. Auch in Paul Buhls Stadtlexikon „Troppau von A bis Z“, das

1973 im Münchener AufstiegVerlag erschien, wird Rothakker erwähnt, verbunden mit dem Hinweis, daß der 1936 erschienene Roman „Das Dorf an der Grenze“, damit ist Tabor gemeint, eine Riesenauflage erlebt habe.




Der Germanist Karsten Rinas –von 1997 bis 2006 wissenschaftlicher Assistent beziehungsweise DAAD-Lektor an der Schlesischen Universität Troppau – beschäftigte sich im Rahmen von Forschungen über die sogenannte Grenzlandliteratur mit Rothacker. Er verweist dar-
auf, daß in der NS-Grenzlandliteratur häufiger rassistisches Gedankengut verwendet worden sei. In Rothacker sieht er einen Vertreter dieses Genres, dessen Briefroman „Das Dorf an der Grenze“ das radikalste Werk dieser Art darstelle. Er begründet dies damit, „daß der Roman eine massiv antitschechische Tendenz besitzt“.
Zu einer ähnlichen Wertung kommt Jürgen Hillesheim: „Gottfried Rothackers ,Das Dorf an der Grenze‘ tat mit seiner deutlichen Geringschätzung alles NichtDeutschen und zur Manipulation des Lesers zweifellos seinen Dienst innerhalb des NS-Propagandaapparates.“ In der „Deutschen biographischen Enzyklopädie“ wird Rothakker folgendermaßen charakterisiert: „Seine Werke sind von Rassismus und Antisemitismus bestimmt.“
Angesichts dieser Analysen erscheinen die Beiträge der „THC“–auch wenn sie länger zurückliegen – unter einem besonderen Licht. Dieter Aust
Am 10. Februar feiert das Neue Rathaus im nordböhmischen Gablonz sein 90jähriges Bestehen.



Der Stadtrat trat am 10. Februar 1933 zum ersten Mal im großen Sitzungssaal des funktionalistischen Gebäudes zusammen. Das Gebäude war bis ins kleinste Detail von dem Reichenberger Architekten Karl Winter entworfen worden, und die Stadt hatte 22 Millionen Kronen in den Bau investiert. Das 1931 bis 1933 im funktionalistischen Stil erbaute Neue Rathaus ist ein bedeutendes Gebäude der Zwischenkriegsarchitektur und das wichtigste und bekannteste Bauwerk von Karl Winter. Es wurde zu Beginn der Bankenkrise in nur zwei Jahren gebaut. Die Stadt hat sich wegen des Baues hoch verschuldet.


Der bauliche Teil wurde wie geplant fertig gestellt, aber an der künstlerischen Gestaltung mußte gespart werden. Von der ursprünglich von Winter geplanten Dekoration wurde nur das große Relief mit den Motiven der Glasmacherberufe im Ratssaal realisiert. Der Sokkel für die Statue eines Glasmachers auf der Treppe vor dem Rathaus blieb leer, die allegorischen Skulpturen, die oben an der Fassade stehen sollten, wurden nicht verwirklicht, und für einige Beleuchtungselemente war kein Geld übrig.
Das Gebäude wurde in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten errichtet. Zu dieser Zeit herrschten eine Wirtschaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit. Schon bei der ersten Ratssit-
Reicenberger Zeitung


Redaktion:









Unser Nordböhmen-Korrespondent Stanislav Beran war in kommunistischer Zeit ins Münchener Exil und nach dem Fall des Eisernen Vorhang wieder zurück nach Friedland gegangen. Er verfolgte ein Gerichtsverfahren, dessen Gegenstand die Klage eines Maueropfers war.
Im Juli 1989 ahnte Thomas Bartsch, damals 23 Jahre alt und Bürger der DDR, nicht, daß der Eiserne Vorhang in wenigen Monaten fallen würde. Und weil er in den Westen wollte, versuchte er, die tschechoslowakischösterreichische Grenze zu überqueren. Die tschechoslowakischen Grenzsoldaten eröffneten jedoch das Feuer auf ihn und trafen ihn am rechten Knie.
Thomas Bartsch verlor das Bewußtsein und kam erst in einem Krankenhaus in Pilsen wieder zu sich. Eine Woche lang wurde er in der Tschechoslowakei festgehalten und dann an die ostdeutschen Sicherheitsbehörden (Stasi) übergeben. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis studierte Thomas Bartsch Zahnmedizin und eröffnete eine Privatpraxis im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale.
zung im Neuen Rathaus wurde über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Stadt und über die Verdoppelung der Alkoholsteuer zur finanziellen Unterstützung der Stadt gesprochen. Der Vorschlag wurde drei Monate später verabschiedet.
Zum Rathaus gehörten damals auch ein Kino und ein Restaurant, die dazu beitrugen, die
Bauschulden zu begleichen. Das genaue Datum der Fertigstellung des Rathauses ist angeblich nicht bekannt. Die Bauarbeiten wurden am 29. Oktober 1932 abgeschlossen, und an diesem Tag wurde das erste Mal in dem Kino ein Film gezeigt. Erst im Januar 1933 wurde der offizielle Teil des Gebäudes bezogen und der Restaurantbetrieb allmählich auf-
genommen, aber die erste Ratssitzung fand, wie erwähnt, erst am 10. Februar statt. Heute wird dieser Tag als der Tag der Eröffnung des Rathauses betrachtet.
In den letzten Jahren investierte Gablonz mehrere zehn Millionen Kronen, um dem Rathaus sein ursprüngliches Aussehen aus den 1930er Jahren zurückzugeben. Renoviert wurde die Fassade des historischen Gebäudes einschließlich der Fenster und des Turms. Auch im Inneren des Gebäudes wurden Arbeiten durchgeführt. Die sichtbarsten Veränderungen zeigen die Sitzungssäle, an denen seit 2016 gearbeitet wurde. Die Gipskartonverkleidung, die einige der ursprünglichen, inzwischen restaurierten Holzteile verdeckte, wurde entfernt.

In den Sitzungssälen wurden wegen des massiven Holzwurmbefalls neue Parkettböden verlegt. Unter der Vertäfelung entdeckten die Arbeiter die ursprüngliche versenkbare Tür, die den Hauptsaal von dem angrenzenden Aufenthaltsraum trennte. In den 1970er Jahren deckten Arbeiter außerdem auch den großen ursprünglichen ovalen Tisch des Hauptsitzungssaals mit Kunststoff, der nach der Restaurierung wieder dorthin zurückgebracht werden konnte. Fehlende Elemente wie Tische oder Stühle, aber auch die Beleuchtung, wurden durch Nachbildungen nach Winters Originalentwürfen ersetzt. Den Eingang schmükken inzwischen Lampen nach den Originalentwürfen von Winter, für die zur Zeit des Baus kein Geld vorhanden war. Stanislav Beran
dem beim Versuch, den Eisernen Vorhang zu überqueren, tschechoslowakische Grenzsoldaten ins Knie geschossen hätten. Die tschechischen Gerichte hätten ihm nur 5550 Kronen als Entschädigung für seine Verletzungen zugesprochen, das müsse noch einmal verhandelt werden. Nun werden sich die Gerichte erneut mit der Frage der angemessenen Entschädigung befassen müssen. Bartsch, der dauerhafte gesundheitliche Probleme hat, hält den Betrag für unverhältnismäßig niedrig.
Trotz mehrerer Operationen konnte die Funktion des Knies jedoch nicht wiederhergestellt werden. Nach 30 Jahren erfuhr Thomas Bartsch über die „Plattform für Europäische Erinnerung und Gewissen“, daß er in der Tschechischen Republik einen Antrag auf gerichtliche Rehabilitierung stellen kann. Er reichte daher einen Antrag beim Bezirksgericht in Taus/Domažlice in der westböhmischen Pilsener Region ein, dem stattgegeben wurde. Der Vorsitzende des Senats räumte ein, daß Thomas Bartsch ungerechtfertigt verfolgt worden sei, weil er versucht habe, die Tschechoslowakei zu verlassen.
Das Justizministerium zahlte Thomas Bartsch daraufhin eine Entschädigung von 1027 Kronen für die unrechtmäßige Einschränkung seiner persönlichen Freiheit. Was die gesundheitliche Beeinträchtigung angeht, so überließen die Beamten des Ministeriums die Entscheidung darüber dem Gericht. Der Richter des Bezirksgerichts Prag 2 sprach Thomas Bartsch 5550 Kronen für seine gesundheitlichen Schäden zu. Er entschied aber auch, daß Bartsch 1200 Kronen Gerichtskosten an das Justizministerium zahlen müsse.
Bartsch legte Einspruch ein. Der Senat des Prager Stadtgerichts gewährte keine Erhöhung, räumte aber ein, daß es ungerecht wäre, bei einer so geringen Entschädigung dem Ministerium die Prozeßkosten zahlen zu müssen. Bartsch hielt die Entschädigung von 5550 Kronen für seine lebenslange Behinderung jedoch für Hohn und klagte vor dem Verfassungsgericht.
Das tschechische Verfassungsgericht in Brünn traf Mitte Januar folgende Entscheidung: Das Verfassungsgericht unterstütze den Deutschen Thomas Bartsch,
„Das Verfassungsgericht hat festgestellt, daß die Gerichte einen unverhältnismäßig niedrigen finanziellen Ausgleich gewählt haben. Sie hatten ihre Entscheidung auf eine Verordnung über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten gestützt. Dieser Fall hätte viel sensibler bewertet werden müssen und die außergewöhnlichen Umstände hätten berücksichtigt werden müssen“, sagte Richter Vojtěch Šimíček. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts sind es die außergewöhnlichen Umstände, die eine Erhöhung des Schmerzensgeldes im Vergleich zu den nach dem damaligen Erlaß zuerkannten Punkten erlauben. Auch Rechtsanwalt Lubomír Müller bezeichnete den ursprünglichen Betrag angesichts der lebenslangen körperlichen Verstümmelung von Bartsch als Hohn.
„Die Entschädigung ist nicht als Verhöhnung gedacht, sondern als Genugtuung“, sagte Müller. Er schlug das Fünffache vor, also 27 750 Kronen. Selbst dann wäre der Betrag immer noch weit unter den Summen, die gegenwärtig für Verletzungen mit Dauerfolgen gewährt würden. Die Justiz müsse sich an den Regeln der jeweiligen Zeit orientieren. Sie könne den Betrag jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände erhöhen.
Šimíček wies auch auf die psychischen Auswirkungen des Ereignisses hin. Seiner Meinung nach konnte Bartsch nicht wissen, daß der kommunistische Totalitarismus kurz vor dem Zusammenbruch gestanden habe und ihm keine weiteren Repressionen drohen würden. „Niemand konnte wissen, daß in wenigen Monaten die Berliner Mauer fallen würde“, sagte er.
Nach der Entscheidung der Verfassungsrichter wird der Fall an das erstinstanzliche Gericht zurückverwiesen. „Es wird den Amtsgerichten obliegen, nach dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ihre früheren Tatsachenfeststellungen und die bereits getroffenen rechtlichen Schlußfolgerungen weiterzuverfolgen und erneut zu versuchen, einen angemessenen Entschädigungsbetrag zu finden, der dem Beschwerdeführer im Rahmen des Gerichtsverfahrens zugesprochen werden kann“, heißt es in dem Urteil.
Dies war ein Verstoß gegen den internationalen Vertrag über bürgerliche Rechte. In Europa gilt die Menschenrechtskonvention, und die schließt Folter aus.

Frühere Ostritzer Straße saniert
Ende Oktober endete die 90 Millionen Kronen teure dreijährige Erneuerung der Straße Kodešova in Friedland.
In Friedland wurde die Komplettsanierung der Straße Kodešova, der früheren Ostritzer Straße, die vom Stadtzentrum zum Friedhof und weiter nach Wiegsdorf führt, nach drei Jahren abgeschlossen und von der Stadt übernommen. Die Baukosten beliefen sich auf umgerechnet 3 780 000 Euro. Die Baufirma Metrostav hatte mit einem Mangel an Arbeitern zu kämpfen. Jetzt ist der 1612 Meter lange Abschnitt der Straße wieder befahrbar.
Diese Straße ist Teil der drittklassigen Kreisstraße, und die Stadtverwaltung in Friedland versucht seit fünf Jahren, sie zu sanieren. Der Bau wurde in drei Phasen unterteilt, wofür die Region Reichenberg, die Stadt Friedland und das Wasserwerk Friedland einen finanziellen Beitrag leisteten. Der Auftrag wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung an die Firma Metrostav vergeben. Ursprünglich sollte die Wiederherstellung der Straße in zwei Jahren abgeschlossen sein, aber am Ende war man froh, als sie nach drei Jahren fertig war.
Die Straße wurde komplett renoviert, einschließlich der Stromund Wasserleitungen. Alles, was auf dieser Straße getan werden konnte, wurde getan. Die Stadt Friedland ließ Gehwege, eine öffentliche Beleuchtung und in Zusammenarbeit mit der Region Reichenberg ein Regenwasserkanalsystem bauen. Der Bau kostete die Stadt Friedland umgerechnet 1 510 000 Euro. Dort, wo es kein Abwassersystem gab, wurde


eine provisorische Fußgängerbrücke bauen, damit die Stadtbewohner nicht um die Baustelle herumlaufen mußten. Das Rathaus konnte sich auch nicht mit dem Eigentümer auf den Kauf eines Grundstücks in dem Bereich einigen, in dem die Stützmauer errichtet werden sollte. Daher ist die Bürgersteigbreite an diesen Stellen auf einer Länge von etwa 30 Metern schmaler. Das Rathaus war bereit, umgerechnet 40 000
Das Jagdverbot und die Beschränkungen für das Betreten der Wälder gelten in der Region Friedland nicht mehr.
In der Region Friedland waren im Dezember und Januar tote, mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) infizierte Wildschweine gefunden worden. Nun wurde in einem fast 200 Quadratkilometer großen Gebiet das Verbot der Jagd auf Wildtiere aufgehoben. Auch das Verbot, sich jenseits der ausgewiesenen Wege aufzuhalten, wurde aufgehoben.
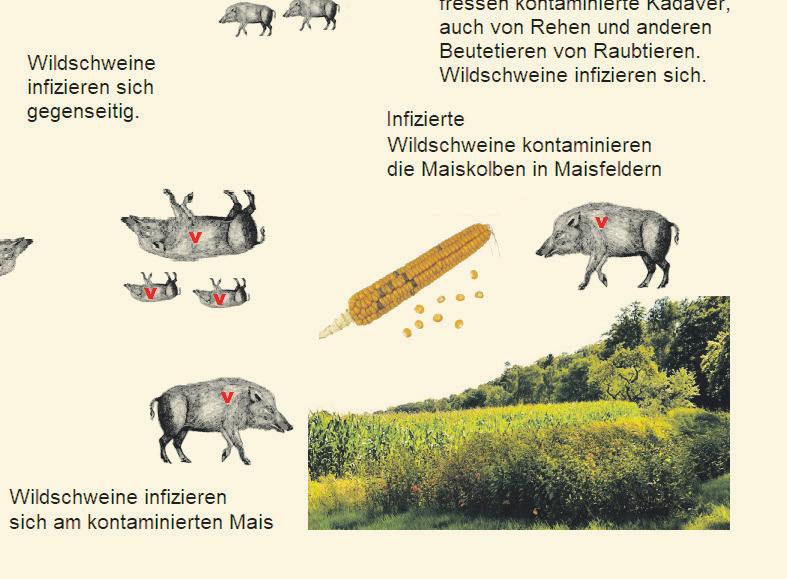
Seit 20. Januar können sich auch die Bewohner der Region und Touristen in dem ausgewiesenen Gebiet frei bewegen. Dennoch werden die Bürger gebeten, sich in der freien Natur vorsichtig zu verhalten und Funde von toten Wildschweinen unverzüglich dem Veterinäramt der Region Reichenberg oder dem örtlichen Jagdverein zu melden.
Am 1. Februar übernahm das Verkehrsunternehmen ČSAD Slaný, das zum ICOM-Transportkonzern gehört und die öffentliche Ausschreibung gewonnen hatte, den Linienbusverkehr in Gablonz und Umgebung bis Ende Januar 2028 und ersetzt die Gesellschaft Umbrella Coach & Busses.
Die Stadt Gablonz schloß im November einen Vertrag mit dem neuen Unternehmen über
1 370 000 gefahrene Kilometer pro Jahr. Für den Einsatz schaffte das Busunternehmen 23 neue, zwölf Meter lange Busse des Typs Mercedes-Benz Conecto an, die bis zu 101 Reisende aufnehmen können. Darüber hinaus kaufte sie vier acht Meter lange RošeroHybridbusse auf Iveco-DailyFahrgestellen, die im langsameren Stadtverkehr eine wirtschaftlichere Lösung sind. Im November waren die Busse auf der Busmesse Czechbus in Prag ausgestellt worden.
Mitte Januar wurden auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Gablonz die neuen Hybridbusse mit kombiniertem Diesel- und Elektroantrieb vorgestellt. Dieser Antrieb soll im Vergleich zu her-
das Abwassersystem gebaut, das dann von der Wassergesellschaft Friedland übernommen wurde. Letztere beteiligte sich ebenfalls an den Bauarbeiten und nutzte diese, um das Wasserversorgungs- und Abwassersystem zu rekonstruieren.
Beim Bau gab es auch Komplikationen. Wegen des Abrisses der Brücke, die über die Rasnitz führte, mußten die Bauarbeiter
Kronen in den Kauf des Grundstücks und den Bau einer neuen Stützmauer zu investieren, aber es war nicht möglich, das Grundstück zu bekommen.
Eine peinliche Angelegenheit war die Beseitigung des Bauschutts der sanierten Straße. Der Schutt wurde von der Straße entfernt und zum Parkplatz vor dem Friedhof gebracht, wo er unrechtmäßig abgeladen wurde. Die Be-

Neue Linienbusse
kömmlichen Dieselmotoren acht
Prozent Kraftstoff einsparen. Die Öffentlichkeit konnte sie den ganzen Nachmittag über besichtigen. Die Hybridbusse der neuen Gablonzer Busflotte bieten hohe Sicherheitsstandards für Fahrgäste und Fahrer. Sie sind mit Hybridantrieb, Blindenleitsystem, barrierefreiem Zugang und Wi-Fi-Anschluß ausgestattet.


Für weiteren Komfort sorgen neben der bisherigen Fahrzeugausstattung wie Informationssystem, Haltestellenansage und Klimaanlage auch Liniennummern-Markierungen auf der linken Fahrzeugseite, ein moderner
LCD-Bildschirm, der die innere Linientafel ersetzt und den Strekkenverlauf der jeweiligen Buslinie sowie weitere Informationen anzeigt. Außerdem können die Fahrgäste während der Fahrt ganz einfach ihre kleinen Elektrogeräte wie Handys mit USBLadekabeln auftanken.
Für Wärme in den Mercedes-Bussen wird in den Wintermonaten eine Warmwasserheizung mit Heizkörpern sorgen, die die Abwärme des Motorkühlkreislaufs als erste Wärmequelle nutzt. Reicht diese nicht aus, was auf einer Buslinie mit niedrigen Betriebsgeschwindigkeiten und
sucher des Friedhofs konnten nirgendwo ihre Autos parken. Auf meine Anfrage, warum die Schutthaufen nicht woanders deponiert worden seien, erhielt ich vom Jiří Stodulka folgende schriftliche Antwort: „Nach Abschluß der Bauarbeiten, wird der Bauschutt vom Parkplatz vor dem Friedhof beseitigt.“ Es ist traurig, aber wahr, daß der Parkplatz vor dem Friedhof in Friedland während der Sanierung der Ostritzer Straße als Schuttabladestelle diente. Neben dem Straßenbelag wurden auch die Stützmauer und die Brücke neu gebaut, was insgesamt umgerechnet 1 470 000 Euro kostete. Die Elektrizitätswerke ČEZ waren ebenfalls mit der Verlegung von Stromleitungen am Bau beteiligt, und auch ein Teil der Gasleitung wurde im Rahmen der Bauarbeiten verlegt. Zum Bau gehörte außerdem der Umbau von drei Bahnübergängen, der von der Eisenbahnverwaltung auf eigene Kosten durchgeführt wurde.
„Ich hoffe, daß wir uns viele Jahre lang an der neuen Straße freuen werden“, sagte zum Schluß Jiří Stodůlka, der Stellvertretende Bürgermeister von Friedland. Stanislav Beran
Außerdem können Wildschweine und Erzeugnisse von Schweinen nach Genehmigung des Veterinäramtes aus dem Gebiet abtransportiert werden. Mit der neuen Verordnung wird auch die Bezeichnung des Gebiets von Infektionszone in Sperrzone II geändert.


Das Jagdverbot in 28 Katastergebieten war seit Anfang Dezember in Kraft. Für die Jagd auf Wildschweine wurden neue restriktive Vorschriften erlassen. Nur noch ausgebildete Jäger dürfen sie abschießen, und jedes erlegte Tier muß auf ASP getestet und bis zum Vorliegen des Testergebnisses sicher gelagert werden.
Der Verzehr von Fleisch von Wildschweinen, die in diesem Gebiet erlegt wurden, ist nur im Haushalt des Jägers möglich. Wildschweinefleisch dürfen nur zugelassene Firmen für Wildfleisch vermarkten. Für jedes erlegte Wildschwein hat der Jäger Anspruch auf 1000 Kronen. Der Einsatz von Jagdhunden bei der Jagd auf Wild in dem Gebiet ist verboten, da sie ein Risiko hinsichtlich der passiven Ausbreitung der Seuche sind.

In der neuen Verordnung sind auch die Ausnahmen festgelegt, unter denen Hausschweine, ihr Fleisch und ihre Erzeugnisse aus der Sperrzone II verlagert werden dürfen. Das Verbot der Freilandhaltung von Schweinen gilt bis auf wenige begründete Ausnahmen auch in Zukunft.
An die Sperrzone II schließt sich im Süden eine Pufferzone an, die Sperrzone I. Dieses Gebiet umfaßt 65 Katastergebiete mit einer Gesamtfläche von 531 Quadratkilometern. Hier dürfen nur ausgebildete Jäger Wildschweine erlegen. Jedes erlegte oder gefundene Wildschwein wird auf die ASP untersucht, und die Jäger erhalten eine Belohnung. Die Verlagerung von Hausschweinen, Schweinefleisch sowie von Wildschweinefleisch aus diesem Gebiet ist eingeschränkt.
ASP ist eine akute Krankheit, die der klassischen Schweinepest ähnelt, aber tödlich ist. Es gibt kein Heilmittel, so daß infizierte Tiere getötet werden müssen. Die größte Infektionsquelle sind tote Wildschweine. Experten zufolge ist das ASP-Virus sehr widerstandsfähig, auch gegenüber niedrigen Temperaturen, und kann in gefrorenem Fleisch jahrelang überleben. ASP ist für Menschen und Hunde ungefährlich, sie können die Seuche aber übertragen. Stanislav Beran
häufigen Türöffnungen bei Frost nicht zu verhindern ist, kann ein 30 Kilowatt starkes unabhängiges Dieselheizgerät zugeschaltet werden. Das erhält die Kühlmitteltemperatur automatisch aufrecht, damit der Motor nicht auskühlt und die Heizleistung im Innenraum nicht geringer wird.
Das Angebot an öffentlichen Verkehrslinien bleibt unverändert, einschließlich der Linie 103, die zum Krankenhausgelände führt. Die Firma ČSAD Slaný hatte zuvor bereits die Fahrpläne für 2023 übernommen, um die Arbeitsfahrten vorzubereiten. Sie ist in der Industriezone Gablonz-Reinowitz untergebracht. Alle Busse werden für Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen leicht zugänglich sein. Die Fahrpreise bleiben unverändert und können weiterhin in bar, mit Opuscard oder mit Bankkarte bezahlt werden. Die Beförderung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist für Senioren über 70 Jahre weiterhin im Stadtgebiet von Gablonz und Reichenberg kostenlos. Bedingung ist der Nachweis des Alters durch einen Personalausweis oder Reisepaß. Stanislav Beran
Übertragungswege der Afrikanischen Schweinepest.
KREIS REICHENBERG
Marion Hübner, die Tochter eines verstorbenen Landsmannes, teilte mir mit, daß im Nachlaß ihres Vaters die Reichenberger Heimatblätter der Jahre 2001 bis 2014 vorhanden seien. Diese Jahrgänge möchte sie gerne an jemanden abgeben,
der daran Interesse hat. Auch für Familiengeschichtsforscher könnten solche Heimatblätter ein Fundus sein.
Marion Hübner erwartet Ihren Anruf, Telefon (01 51) 59 18 62 73. Christa Schlör Heimatkreisbetreuerin
KREIS DEUTSCH GABEL
Heimatkreis und Gemeindebetreuer gratulieren allen treuen RZ-Abonnenten, die im Februar Geburtstag oder sonst ein Ereignis begehen, und wünschen von Herzen alles Gute, Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit.
■ Deutsch Gabel – Geburtstag: Am 28. Gisela Koch/Müller
(Witwe von Helmut Koch, Rinnegasse 343), Waldring 12, 39340 Haldensleben, 94 Jahre.
Othmar Zinner
Helga Hecht
■ Kunnersdorf – Geburtstag: Am 16. Greta Düll/Sitte (HausNr. 72), Waldstraße 5a, 91341 Röttenbach, 73 Jahre.
Steffi Runge
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau
Dux OsseggIn einer Zeit der Düsen- und Überschallflugzeuge sollten wir uns daran erinnern, daß vor etwas mehr als 100 Jahren auch Teplitz-Schönau eine wichtige Rolle im Luftverkehr spielte. Damals schwebten die ersten Luftschiffe und Gasballons über der Stadt und eröffneten den Fortschritt Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.
Als Exponat des Monats hatte das Teplitzer Schloßmuseum in seinem Foyer dazu eine Ansichtskarte aus den 1870er Jahren ausgestellt. Anfänglich wurden auf diesen Ansichtskarten Reklameaufschriften veröffentlicht, mit zunehmender Beliebtheit der Ansichtskarten kamen Abbildungen bekannter Gebäude, Kurhäuser, Landschaften und weitere Motive hinzu, historische, heimatkundliche, religiöse, politische und technische Themen betreffend.
Warum nun gerade Teplitz-Schönau?
Am 29. Januar 1911 wurde im Restaurant Lindenhof in der Lindenstraße der Deutsche Verein für Luftschiffahrt und Aviatik in Böhmen gegründet. Der Vorstand des Vereins, an der Spitze mit dem Industriellen Adolf Mitscherlich, setzte sich aus Vertretern der Stadt, Ärzten und weiteren Honoratioren zusammen. Für die damals außerordentliche Beliebtheit der Luftschiffahrt nannte sich der Verein bald darauf Deutscher Luftfahrt-Verein in Böhmen mit Sitz in Teplitz-Schönau, der den Raum von Eger bis Reichenberg einnahm. Schon damals bot sich als Start- und Landeplatz das freie Gelände auf dem Wacholderberg an, der auch heute noch ein bekannter Flugplatz für ultraleichte Sportflugzeuge ist.
Bekannt sind auch mehrere Gasballons, die um 1911/12 aus Teplitz-Schönau, aber auch aus Aussig starteten. Der Ballon „Dresden“ mit einem Rauminhalt von 1437 Kubikmetern mit Ingenieur Karl Korn und zwei Passagieren, dem Oberst Hermann von Hoernes und dem Direktor der Kupferhütte in Pömmerle bei Aussig, startete aus Teplitz-Schönau; der Ballon „Böhmen“ mit einem Rauminhalt von 1680 Kubikmetern, den die Gräfin Waldstein getauft hatte, startete vom Gelände der Schicht-Werke in Aussig mit Oberst Hermann von Hoernes, Adolf Merck und Friedrich Frank aus Teplitz-Schönau.
Interessant ist auch der Flug des Physikers Victor Franz Hess (1883–1964), der bahnbrechende Messungen bei einem Ballonflug aus Aussig durchführte. Damals war er 29 Jahre alt und arbeitete als Assistent im Institut für Radiumforschung an der Wiener Akademie der Wissenschaften. Im April 1912 begann er mit den praktischen Messungen der Erdradioaktivität. Auf seinen ersten Ballonflug begab er sich aus Wien.

Hess plante jedoch Messungen in größeren Höhen, wofür Wien ungeeignet war. Er brauchte einen besseren Ballon und geeignetere Umgebung, so daß er einen neuen Startplatz suchte. Das wurde Aussig, in dessen Nähe es den Deutschen Luftfahrt-Verein in Böhmen gab, der ihm den Ballon „Böhmen“ zur
Bilin Teplitz-Schönau

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Nobelpreisträger
Victor Franz Hess
Victor Franz Hess kam am 24. Juni 1883 auf Schloß Waldstein bei Deutschfeistritz in der Steiermark zur Welt und starb am 17. Dezember 1964 in Mount Vernon im USA-Bundesstaat New York.
Er war der Sohn von Vinzenz Heß und dessen Frau Seraphine Großbauer Edle von Waldstätt. In Graz ging er ins Gymnasium und studierte an der KarlFranzens-Universität, wo er promovierte. 1906 und 1907 arbeitete er am Mineralogischen Institut der Universität Wien. 1908 bis 1920 war er Honorarprofessor für Medizinische Physik an der Wiener Tierärztlichen Hochschule. 1937 erhielt er dort das Ehrendoktorat.
1910 bis 1920 arbeitete er nach einer kurzen Zeit am 2. Physikalischen Institut der Universität Wien, wo ihn Egon Schweidler mit den neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der Radioaktivität vertraut machte, am neu gegründeten Institut für Radiumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als Assistent unter Stefan Meyer. Im Ersten Weltkrieg leitete er die Röntgenabteilung eines Lazaretts.
� Teplitz-Schönau




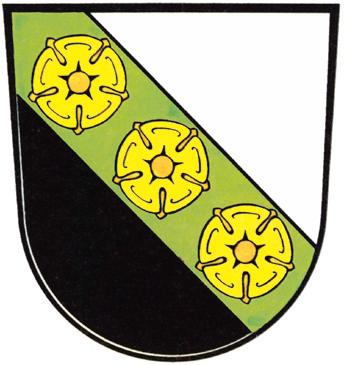

Gasballons und Luftschiffe über der Stadt
Wilhelm Hoffory, und neben Hess war drittes Mitglied der Crew der Meteorologe Willi Wolf. Mit dem Ballon „Böhmen“ ging es von Aussig die Elbe entlang, über die sächsische Schweiz und über die Oberlausitz nach Cottbus. Beim Aufstieg fiel die Temperatur auf minus zehn Grad Celsius. Schlimmer war jedoch der rasch sinkende Luftdruck. Er löste bei Hess Höhenkrankheit aus. Der 29jährige inhalierte Sauerstoff. In 5350 Metern Höhe entschloß er sich zur Umkehr. Mit zwei Metern pro Sekunde sank der Ballon auf den Scharmützelsee zu. Dort, 50 Kilometer südöstlich von Berlin, setzte der Korb glatt auf einer sandigen Wiese auf.
Verfügung stellte. Für ihn war besonders wichtig, daß er hier vor allem das nötige Ballongas Wasserstoff von der Firma Österreichischer Verband für chemische und metallurgische Produktion
– heute Spolchemie – in Aussig bekommen konnte.
Er startete also am 7. August 1912 um 6.12 Uhr auf dem Areal der Chemiewerke. Pilot des Ballons war Hauptmann
Während des Fluges hatte Hess Messungen der Radioaktivität in verschiedenen Höhen durchgeführt und war zu der Erkenntnis gekommen, daß die Intensität mit zunehmender Entfernung von der Erdoberfläche zunimmt und demnach die Strahlung nicht irdischen, sondern kosmischen Ursprungs ist.
Damit bestätigte er definitiv die Existenz einer kosmischen Strahlung. Diese Entdeckung von Hess war von grundlegender Bedeutung für die Weiterentwicklung der Elementarteilchenphysik.
Für diese Forschungsleistung erhielt Victor Franz Hess im Jahre 1936 den Nobelpreis für Physik (Ý rechts).
1912 kaufte die Firma Schicht in Aussig einen 600 Kubikmeter großen Ballon für Aussichtsrundflüge. Der erste Versuchsflug fand am 22. Dezember 1912 statt und startete in Teplitz-Schönau. Am 11. Mai 1914 wurden der Ballon „Böhmen“ und „Schicht“ der österreichischen Heeresverwaltung übergeben. Im Ersten Weltkrieg wurden Gasballons zu Aufklärungsflügen eingesetzt.
Der Zeppelin auf der Postkarte als Exponat des Monats mit der Ansicht des Schönauer Parks und bedeutenden Gebäuden wurde zwar übermalt, hat aber tatsächlich am 4. Mai 1917 die Stadt überquert. An dieses Ereignis bleiben nur nostalgische Erinnerungen in Form von Ansichtskarten. Jutta Benešová


Bei einer Ballonfahrt von Aussig in Böhmen nach Pieskow in Brandenburg entdeckte er die Kosmische Strahlung (Ý links). 1919 wurde er außerordentlicher Professor an der Universität Graz, dann ging er für zwei Jahre in den USA, wo er die medizinische Anwendung von Radium erforschte. Zurück in Graz, beschäftigte er sich vornehmlich mit der Luftelektrizität.

Ab 1931 leitete er als Professor an der Universität Innsbruckdas neue Institut für Strahlenforschung, mußte sich aber auch wegen Radiumverbrennungen einer Daumenamputation und einer Kehlkopfoperation unterziehen.
1934 bis 1938 gehörte er dem Bundeskulturrat im Ständestaat an. 1936 erhielt er mit Carl David Anderson den Nobelpreis für Physik für jene Arbeiten, die in Wien 1912 zur Entdeckung der Kosmischen Strahlung geführt hatten. 1937 wurde er neuerlich an die Karl-Franzens-Universität Graz berufen.
Der Kosmopolit und Katholik lehnte den Nationalsozialismu ab. Nach dem Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich wurde er verhaftet. Am 28. Mai 1938 wurde der 55jährige in den Ruhestand versetzt und im September 1938 ohne Pensionsanspruch entlassen. Zudem mußte er das Nobelpreisgeld gegen deutsche Reichsschatzscheine umtauschen. Im selben Jahr emigrierte er mit seiner jüdischen Frau in die USA, wo er an der Fordham University in New York City seine Arbeiten fortsetzte. 1944 erhielt er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg reiste er noch mehrmals nach Hause. Seine letzte Ruhe fand Victor Franz Hess auf dem Friedhof in White Plains.
WIR GRATULIEREN

Allen treuen Heimatruf-Abonnenten wünschen wir herzliche Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag im Februar:
n Bilin. Professor Dr. Karl-Heinz Plattig, Steinforststraße 30, 91056 Erlangen, 6. Februar 1931.
n Meronitz/Kreis Bilin. Josef Liebscher, Grießweg 8, 88486 Kirchberg, 11. Februar 1949.
Ladowitz Klostergrab Graupen NiklasbergHEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ



Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


❯ Hostaus Pfarrer – Teil XIII
Pfarrer Matthias Bräuer
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der sechste Teil über Pfarrer Matthias Bräuer (1817–1899).

❯ Ronsperg
Heimatliche Redensarten
Jede Mundart hat einen reichen Schatz an Redewendungen, die im Laufe der Jahre in die Hochsprache Eingang fanden und somit Allgemeinbesitz wurden. Wer kennt nicht die Redewendung, daß einer ein Gesicht mache wie sieben Tage Regenwetter? Aber wer kann heute noch mit Sicherheit sagen, welcher deutsche Stamm sie zuerst gebrauchte?

Alle Redensarten der Schriftsprache werden auch im Ronsperger Dialekt gebraucht. So lautet auf Ronspergisch: „‘s Menschn W(i)lln is sa(n) Himmelreich“, „Dös is Wassa af sa(n) M(üh)l“ oder „Den sticht da Hlowan“ — um nur einige zu nennen — genau so wie die schriftdeutsche Version.



Darüber hinaus gibt es aber eine Reihe von Ausdrücken, die mit ihrer kraftvollen Sprache, mit ihrem Bilderreichtum und nicht zuletzt mit ihrer Originalität viel über das Denken und Fühlen unseres Stammes aussagen. Auffallend sind die vielen Bilder, die gebraucht werden, um verschiedene Sachverhalte auszudrücken. Hier einige Beispiele: Der draht se wöi‘s Würschtl in Kraut. Der håt a Nosn wöi a Kumpf. Der håt a Gsicht wöi a Kulöffl (Kochlöffel). Der håt a Gschau wöi a Grebmasloda (Begräbniseinlader). Der håt a Gschau wöi a Vospreng-
ta (Versprengter). Der håt Lietzn (dumme Angewohnheiten) wöi a ålts Ruaß. Der håt ‘s Hirn dafröiat (erfroren). Der håt eine mit da P(e)lzkäppm (dumm) dawischt. Der håt se sein Schmettn scho oogschöpft (Gewinn erzielt). Der håt blehbat (Blehbara Unterlippe, blehban mit der Unterlippe zittern, aus Angst oder Wut). Der hatscht wöi da Hatscheloia (Krummstiefel). Der is wöi a Denglhåmma (haut immer in die selbe Kerbe, läßt nicht locker,

Tschohpl, a Urschl, a Ro(n)fl (törichtes Weib).
Der kniert (kreischt) vo Naot. Der ko(n) vor latta Naot d‘ Zähn niat vodeckn. Der raucht wöi a Misthaffm. Der rennt hinta mir her wöi ‘s Kaiwi hinta da Kouh (unselbständig). Der reißt Maal aaf wöi a Stodltaoa (Scheunentor).
durch Fäulnis vernichtet. Steinbach führt an, daß von 84 von der Dechantei geernteten Säcken nur 50 zu gebrauchen gewesen seien.
plagt). Der is sua dumm, daß ‘n d‘ Gäns beißn. Der is z‘sammgonga wöi ‘s Stankauer Touch (abgenommen, geschrumpft). Der is a Såfrånhansl (profitgierig). Der is dahost (ängstlich wie ein Hase).
Döi is long wöi a Heigeign (Gestell zum Heuaufhängen).
Döi is a ålts Feghfeia. Döi is a






Der schaut wöi a Döib (Dieb). Der schaut wöi a o(n)brennta Hondscha (angebrannter Handschuh). Der schaut wöi d‘ Katz in Kolena (Kalender). Der schaut wöi a Gonsara afm Dorschnbietzl (Gänserich auf einem Weißrübenstückchen). Der schaut mit ‘n rechte Augh ins linke Leiwltaschl (schielt). Der schaut as wöi a z‘såmmgfrorne Dau(n)tschkn (Zwetschke). Der schnarcht wöi a Råtz (Ratte). Der speit wöi a Haochzathund (Hund auf einer Hochzeit). Der stinkt wöi a Ültis (Iltis). Der vozöigt ‘s Zeich wöi d‘ Katz die junga. Die bisher genannten Redewendungen veranschaulichen Tätigkeiten oder Eigenschaften durch vergleichende Bilder. Kompliziertere Wendungen sind zum Beispiel:
Da oine zöigt wista, da ona hott (links und rechts aus der Fuhrmannsprache). Dao wird da Hulzstaoß aa bål(d) a(n) fålln (ein Kind wird erwartet). Döi kannt da Teifl niat schäna mit ‘n Schu(b)-karrn z‘såmmschöibm.
Und sollten Kinder gerade dazu kommen, wenn gegessen wird, dann heißt es: „Gi(b ‘nan wos, daß ‘nan ‘s Harztröpfl niat fållt!“ „ Is da(n Voda a GIosa?“, wird der gefragt, der anderen die Sicht nimmt. Ein Ungeduldiger muß sich sagen lassen: „Wennst niat warte ko(nn)st, åffa gäihst dawal schäi(n staad zou!“ Und daß Familienangelegenheiten nicht in die Öffentlichkeit dringen sollen, verdeutlicht der Spruch: „Wos in Haus kocht wird, soll in Haus gessn wern!“
Es ist das Vorrecht der Mundart, in kraftvoller Aussage die Volksverbundenheit zu zeigen. Die Bilder, die hier gebraucht werden, stammen alle aus dem Lebens- und Arbeitsbereich des Volkes und erscheinen einem Außenstehenden derber, als sie gemeint sind.

Der schind‘t d‘Laus um an P(ö)lz. Der laot an Blehbara (Kraftausdruck für Unterlippe) henkn. Ich ko(n me niat afm Kuapf st(ö)lln (ich kann mich nicht zerreißen). Gäih hoim, da(n Mouda z(öh)lt d‘Kinna, ‘s gscheitste fahlt a ra. Mir san fei(n aa niat af da Wåssersuppm dahergschwumma kumma! Der haot G(ö)ld wöi Mist! Der schmeckt an Dreek bå da Finza (Finsternis). Wenn d‘ Löi(b) fållt, åffa fållts, ganz gleich, ob af a Raosnstaudan oda af an Kouhdreek. Jede Sau bleibt bå ihrn Truach (Trog). In d‘Händ g‘speit is in d‘ Arwat gschissn! Wenn der sua long wa(r, wöi er blöd is, kannt er an Mond am Arsch lekken. Der foahrt ummanond wöi da Furz in da Lotarn.
Josef RothmaierAm Ostermontag, 10. April 1882, wird das Haus Nr. 36 des Anton Gasche vollständig zerstört. Die Scheune des Johann Schreiner von Nr. 120 brennt am Kirchweihsonntag im Jahr 1883 ebenfalls komplett nieder. Steinbach beleuchtet die Aussaat und Ernte in den folgenden Jahren kritisch. Durch eine hartnäkkige Eisdekke auf der Dechanteiwiese bei Hassatitz im Frühjahr 1880 wird fast der ganze Graswuchs vernichtet. Ebenso erfrieren die Kornaussaaten durch einen ungewöhnlich starken Frost am 20. Mai. Im Jahr 1882 wird eben diese Wiese durch dreimaligen Gewitterregen dermaßen überschwemmt, daß das Heu nur noch als Stallstreu verwendet werden kann. Die Kartoffelernte wird zu zwei Dritteln
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG




Im Oktober 1884 wird der Hostauer Mesner Karl Schmid nach 50 Jahren Mesnerdienst in den Ruhestand versetzt. Kaspar Liebermann ist ab dem 1. November sein Nachfolger. Seine Anstellung hat das fürstliche Patronatsamt verfügt. Steinbach sieht sich hier wieder auf den Plan gerufen, die Rechte der Pfarrherren zu verteidigen. Nach Steinbach ist es nicht die Aufgabe des Patronatsamtes, eine Mesnerstelle zu besetzen, sondern diese fällt in die Zuständigkeit des jeweiligen Pfarrers, da sonst dem Pfarrer ungeeignet erscheinende Personen trotzdem eingestellt würden. Steinbach gibt aber zu, daß mit Kaspar Liebermann eine günstige Wahl getroffen worden sei. Abschließend mahnt Steinbach seine Nachfolger dennoch eindringlich, nicht auf das Recht zu verzichten, kirchliche Dienstboten selbst zu ernennen. Fortsetzung folgt
Hostaus Dechanteikirche ist dem Apostel Jakobus dem Älteren geweiht.


WIR GRATULIEREN
Im Februar gratulieren wir herzlich folgenden Abonnenten des Bischofteinitzer Heimatboten zum Geburtstag und wünschen Gesundheit und Gottes Segen:
■ Kleinsemlowitz. Am 26. Jo-

sef Eberl (Wallisch, Haus-Nr. 29), 87 Jahre. Marianne Maurer
■ Kscheberscham. Oswald Rothmeier (Bocharer) in Garmisch-Partenkirchen, 81 Jahre. Maria Schnobrich
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im Februar Georg Naujokas, Fähnrich, am 4. zum 82. Geburtstag; Josef Masanz, ehemaliger Ortsbetreuer von Mukowa, am 7. zum 90. Geburtstag; Alfred Dittrich, Ortsbetreuer von Neugramatin, am 21. zum 80. Geburtstag; Marianne Maurer, Ortsbetreuerin von Kleinsemlowitz, am 23. zum 81. Geburtstag; Roland Liebl, Ortsbetreuer von Großgorschin, am 23. zum 71. Geburtstag; Hans Wal-
linger, ehemaliger Berichterstatter von Wassersuppen, am 24. zum 93. Geburtstag; Peter Gaag, Ortsbetreuer von Heiligenkreuz, am 24. zum 62. Geburtstag und Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, am 25. zum 51. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter
Pawlik HeimatkreisbetreuerHeimatbote für
den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de





� Kindheit in Waidhaus – Folge II

Meine Mutter war die Loreley
Wolf-Dieter Hamperl erzählt in dieser Folge von seiner Familie und über die Entlassung seines Vaters aus Kriegsgefangenschaft.
In der kleinen Landwirtschaft erlebten wir alles, vom Füttern der Schweine bis zum Abziehen des Fells des eben getöteten, vorher geliebten Stallhasen. Im Erdgeschoß der Scheune befand sich eine Waschküche, wo wir in größeren Abständen im Bottich gebadet und in Decken eingewickelt in die Wohnung getragen wurden. In dem Raum wurde im Herbst aus Zuckerrüben Sirup gekocht.
Die Besitzer ließen uns in dem riesigen Garten große Freiheiten. So saßen wir auf dem Kirschbaum, später dann auf dem Kricherlbaum und ließen uns die Früchte schmekken. Nur einmal merkte ich, daß der Garten nicht uns gehörte. In einem kleinen Leiterwagen mußten wir in den Ferien das Fallobst einsammeln, und da wurde mir schon deutlich gemacht, daß die Äpfel den Hausbesitzern gehören. Zweimal im Jahr war der Geruch im Garten unerträglich, wenn „Brüllhannes“ die Versitzgrube aushob und den Inhalt mit dem Holzkarren im Garten unter den Obstbäumen verteilte. Der „Brüllhannes“ hatte immer eine Schirmmütze wie ein Kapitän auf und trug Hemden ohne Kragen. Er war groß und stark und hatte einen bedeutenden Schnurbart. „Brüllhannes“ hieß er bei uns, weil er eine so mächtige Stimme hatte. Weil Heiner so sehr an Asthma litt, fuhr die Familie Wolf meist in den Sommerferien nach Bad Reichenhall in Kur. Der Chauffeur war ein gewisser Herr Federlein. Von Walti erhielt ich immer eine Karte mit der Ansicht des Gebirges samt Gondelbahn. Traumhaft! Ich schrieb ihm zurück, weil er sich nach dem Befinden seiner Henne erkundigt hatte. Jeder von uns hatte damals ein fast zahmes, rotbraunes Lieblingshuhn, mit dem wir herumsausten. Natürlich gehörte zu einem so gro-
ßen Besitz ein großer Hund. Dieser war ein scharfer Wachhund, vor dem ich große Angst hatte und der tagsüber in einem Hundezwinger untergebracht war. Am Abend holte ihn der Nachtwächter zur Bewachung des Sägewerkplatzes ab. Denn viele
Heinrich Wolf, der Besitzer der Dampfsäge, war ein Bruder meines Großvaters Anton Wolf. Frau Hilpert, die Frau des Hafnermeisters, war eine Verwandte von Großvater. Von ihr durfte ich jeden zweiten Tag die Milch holen. Oft schwamm in der Milch
res Essen machen. Ich denke da nur an den Dotsch mit Schwammerlsoße oder Preiselbeeren mit Rahm, an die vorzüglichen Rouladen, an den so guten Apfelstrudel oder an die Liwanzen. Natürlich gab es keinen Sonntag ohne Kuchen.
Seit Weihnachten 1946 weiß Wolf-Dieter Hamperls Mutter, daß ihr Mann Kriegsgefangener – Prisoner of War – der Amerikaner ist. Hier ein Brief vom Januar 1946 aus Kornwestheim. Vater Josef Hamperl kann gut zeichnen. Oft legt er den Briefen Bilder wie den vom Nikolaus bei. Bilder: Archiv Wolf-Dieter Hamperl


Mein Vater kam am 3. April 1947 mit dem Eslarner Bockel von Moosburg in Waidhaus an. Wir freuten uns natürlich sehr auf unseren Vati, schließlich hatten wir ihn bisher nur vom Erzählen der Mutter und von seinen Briefen her gekannt. Ich war etwas über vier Jahre alt und wir mußten uns alle erst aneinander gewöhnen. Vater war seit 1940 im Krieg und seit dem 2. Mai 1945 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Er war abgemagert und hatte stets mit dem Magen zu tun. Mutti mußte für ihn oft etwas besonders Mageres und fettarm kochen. Auf Hefeteig bekam er Sodbrennen. Wir Kinder durften ihn einseifen und rasieren (ohne Klinge), die Haare naß machen und ihn frisieren. Dabei mußten wir auf seine Narbe an der rechten Schläfe besonders aufpassen.

Emma Weber, die Ortsbetreuerin von Neuhäusl, berichtet über eine kleine Rundfahrt ins Böhmische zum Jahresende.
Menschen hatten damals große Not und stahlen Holz.
Unsere Familie
Wie schon erwähnt, zogen wir im Januar 1946 vom Kreuzwirtanwesen zum großen Wohnhaus von Heinrich Wolf senior in der Eslarner Straße 130, heute 18 bis 20. Ein Jahr später, am 5. Feber 1947 zogen wir ins Lermerhaus.
Dort hatten wir eine schöne EinZimmer-Wohnung mit WC und Wasseranschluß auf dem Gang. Bis 1951 blieben wir dort. Meine Mutter war als junge Frau von 25 Jahren mit ihren beiden Kindern nach Waidhaus gekommen. Sie brachte uns in die Freiheit. Sie sorgte für uns, übernahm unsere Erziehung und stellte die Ernährung sicher. An dieser Stelle muß ich sagen, daß wir es in Waidhaus schon gut hatten.
ein Stück Butter. Die Kreuzwirtin Anna Grötsch war eine Tante meiner Mutter mütterlicherseits. Die spätere Kreuzwirtmare war eine Cousine meiner Mutter. So hatten wir doch zahlreiche Verwandte in Waidhaus, und alle halfen, und wir hatten keine Not zu leiden.
Meine Mutter hat unsere Wohnung immer schön hergerichtet, hat Tischdecken und Kissen mit Blüten und Blattmustern bestickt, für Ingrid und mich Pullover gestrickt und Kleider genäht. Ich erinnere mich auch, daß einmal für zwei oder drei Tage eine Schneiderin da war und zwei wunderschöne Kleider, eines mit Blümchenmuster und ein tiefblaues nähte.
Meine Mutter war schlank und groß und fiel durch ihre Haartracht auf. Sie flocht jeden Tag zwei lange Zöpfe, die sie als kronenförmige Hochfrisur trug. Sie war eine vorzügliche Köchin und konnte bis zu ihrem Lebensende aus wenigem ein wunderba-
Der Bahnhof in Waidhaus übersteht die Jahrzehnte unverändert, auch wenn heute kein Bockl mehr ankommt. Dort erwartet die Hamperl-Rest-Familie nach dem Zweiten Weltkrieg lange vergebens auf Ehemann und Vater Josef. Oben Vater Josef Hamperls entwertete Zugfahrkarte für die Strecke von Moosburg nach Waidhaus am 3. April 1947. Mit dieser Fahrkarte gelangt er vom Lager in Moosburg endgültig nach Hause.
Da er so lange im Krieg gewesen war, von dem ich mir ja nichts vorstellen konnte, mußte er sich immer wieder die gleichen Fragen gefallen lassen. Tante Emmerl hatte zwei Fotoalben mit Bildern vom tschechischen und deutschen Militär über die Grenze gerettet. Immer am Sonntagmorgen blätterten wir im Bett die Alben durch und ich wollte alles wissen. Am öftesten habe ich ihn gefragt, ob er mit den Panzern auch auf Menschen geschossen habe. Er sagte dann immer, er habe danebengeschossen. Dann war ich zufrieden. Öfters erzählte er mir, daß er für mich von der Instandsetzungsgruppe der Panzereinheit einen kleinen Spielzeugpanzer habe bauen lassen, den sie leider bei einem Marsch durch die Sümpfe beim Peipussee in Lettland hätten zurücklassen müssen. Über die Kriegserlebnisse erzählte er nur, wenn man nicht aufhörte zu fragen. Bis zum Abschluß der Entnazifizierung arbeitete mein Vater, er war 1947 36 Jahre alt, als Waldaufseher und Sägewerksarbeiter. Da er leichtere Arbeit vorzog, bemalte er mit seinem Freund Josef Böhm Holzkästchen und Vasen beim Hilpert. Vor Ostern bemalten sie Osterdekorationen. Ab 1950 war er als Berufsschullehrer tätig. In Waidhaus und Umgebung war er als „Hamperllehrer“ bekannt. Er war streng, aber beliebt. Daß wir uns in Waidhaus sehr wohl fühlten und die Waidhauser auch keine Probleme mit uns hatten, beweist folgend Begebenheit. In Waidhaus fand aus irgendeinem Anlaß ein Festzug statt. Ein Wagen war der Loreley und dem Rhein gewidmet. Und wer saß auf dem Felsen über dem Rhein? Meine Mutter mit ihren langen blonden Haaren. Auch Tante Emmerl war dabei, sie hatte ebenso schöne lange Haare. Fortsetzung folgt
Mit meinem Mann fuhr ich nach Bärnau in der Oberpfalz, dann weiter über die dortigen Grenze in die Tschechische Republik zu dem verschwundenen Ort Paulusbrunn. Als Ortsbetreuerin von Neuhäusl interessierte mich der Zustand des Paulusbrunner Friedhofes. Nachdem ich dort ein wenig verweilt hatte, sah ich auch die renovierte Böttgersäule. Der Besuch dieses Ortes und der Anblick der Säule taten mir gut.
Weiter ging die Fahrt Richtung Plan. Als nächstes hielten wir im Ort Galtenhof, doch den deutschen Namen fand ich erst später heraus. Tschechisch heißt dieser Ort Branka und ist ein Teil der Gemeinde Hals. Wir gingen zu Fuß ins Dorfzentrum. Mitten auf dem Dorfplatz war ich freudig überrascht, denn dort begrüßte uns ein bescheidener, mit bunten Kugeln bestückter Christbaum. Die kleine Kapelle war offen, befand sich in einem sehr guten Zustand und war mit einer Krippe weihnachtlich geschmückt. Ich stellte mir die Frage, wer wohl der gute Mensch gewesen sein mag, der hier in diesen einsamen Ort so viel Liebe hineingesteckt hatte, um ihn so zu gestalten. Oftmals hielten wir in kleineren Orten, und ich bestaunte oft die Einfachheit der geschmückten weihnachtlichen Fenster. In Plan/Plana kehrten wir in einem Gasthaus ein. Auch hier stand ein wunderschöner großer Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz.
Nur mit großen goldenen Kugeln geschmückt und mit Beleuchtung. Das gab dem Platz eine weihnachtliche Atmosphäre. Die weitere Tour führte uns über Tachau Richtung Waidhaus. Nächster Halt war Schönwald/Lesna. Auch hier stand in dörflicher Atmosphäre zu meiner Freude ein ganz besonders geschmückter Baum mit vielen kleinen Paketen und Kugeln. Auch hier bat ich meinen Mann, den Baum mit der Kirche im Hintergrund für mich als Erinnerung zu fotografieren. Denn bei mir zu Hause ist der Weihnachtsbaum auch immer mit den alten Kugeln meiner böhmischen Mama geschmückt. Das letzte Ziel kurz vor der Ausreise aus der Tschechischen Republik war natürlich Neuhäusl. Ich hatte eine Harke dabei und habe am Kriegerdenkmal die Erde etwas aufgelockert, ein bißchen Ordnung gemacht, und wie immer eine Kerze angezündet. Es wurde bereits dunkel, und nun ging eine wunderschöne historische Fahrt für mich und meinen Mann zu Ende.

Um den deutschen Namen des Ortes Branka zu erfahren, rief ich später Gerhard Stich, den Ortsbetreuer von Hals, an. Leider war er nicht zu Hause. Deshalb rief ich dann Helmut Gleißner, den Heimatbetreuer von Paulusbrunn, an. Er wußte sofort den deutschen Ortsnamen von Branka: Galtenhof. Er sagte, ich könne ihn jederzeit anrufen, wenn ich mal wieder eine Frage hätte. Nun sind wir schon wieder am Beginn des neuen Jahres. Dennoch wünsche ich allen Lesern und Bekannten ein gesundes und frohes neues Jahr.

Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

Betreuer der Heimatkreise – Aussig: Brigitta Gottmann, Hebbelweg 8, 58513 Lüdenscheid, Tel. 02351 51153, eMail: brigitta.gottmann@t-online.de – Kulm: Rosemarie Kraus, Alte Schulstr. 14, 96272 Hochstadt, Tel. 09574 2929805, eMail: krausrosemarie65@gmail.com – Peterswald, Königswald: Renate von Babka, 71522 Backnang, Hessigheimerstr. 15, Tel. 0171 1418060, eMail: renatevonbabka@web.de – Graupen, Mariaschein, Hohenstein, Marschen: Peter-Paul Reinert, 30823 Garbsen, Im Moorgarten 2 B, Tel. 05137 875928 – Redaktion: Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: aussiger-bote@t-online.de – Redaktionsschluss: jeweils der 15. des Vormonats.
� Zum 100. Geburtstag von
Die Kunst zu leben!
Am 12. Februar 2023 wird unser Aussiger Künstler Gerhard Steppes-Michel 100 Jahre alt. Der Wunsch, den er in seiner Geburtstagsrede zum 95. Geburtstag äußerte, dass sein Zug zur Ewigkeit doch Verspätung haben möge, „denn in euer und in Gottes Ohr, ich hab ja noch so vieles vor!“, wurde erhört.

ne eingezogen. Die Jahre als Erster Wachoffizier auf dem Geleitboot „Elbe“ in Norwegen prägten ihn auch künstlerisch. Fast 20 Mal besuchte er in späteren Jahren mit Frau und Familie Norwegen, Spitzbergen, Island und die Antarktis, um die Landschaft, das Meer oder Fjorde bei Nordlicht auf die Leinwand zu bannen. Das besondere Licht des Nordens hat es ihm angetan.
Nach der Vertreibung kam er nach Bayern und trat 1946 in die Bayerische Finanzverwaltung ein, wo er 41 Jahre tätig war, die letzten sieben Jahre als Vorsteher des Finanzamts Grafenau. Daneben engagierte er sich im gesellschaftlichen Leben und in der Kommunalpolitik. Seit 1950 lebt der Jubilar in Schönberg im Bayerischen Wald, wo er mit seiner Frau Lisa († 2008) und seinen vier Söhnen eine zweite Heimat gefunden hat.
Seine künstlerische Begabung wurde bereits in Aussig gefördert, durch seinen Onkel Franz Michel und seinen Kunsterzieher Prof. Josef Patzak („Blinzl“).
Er machte einfach weiter. Die tägliche Arbeit in seinem Atelier, die Ausstellungen, und nicht zuletzt sein Buch, das anläßlich seines 100. Geburtstags erscheint, und mit dem er sich selbst ein Denkmal setzt, fordern ihn und halten ihn fit. Für das Jahr 2023 stehen zwei Vernissagen im Kalender. Wen wundert es da, daß man den 100-Jährigen nicht im Lehnstuhl, sondern bei der Arbeit antrifft. Wer im Hier und Jetzt Ziele verfolgt, hat keine Zeit für die Ewigkeit...
Gerhard Steppes-Michel betont, dass Kreativität keine Altersgrenze kennt. Der Künstler habe noch nie so gut verkauft wie in den letzten Jahren: „Das Wichtigste aber ist, dass ich gesund bin und mir meine Zufriedenheit und Ausgeglichenheit bewahre.“
Bevorzugte Themen sind
Landschaften und abstrakte Kompositionen. Durch das Setzen von Licht und Schatten bei Wolken, Wald und Wasser zaubert er Stimmungen hervor, die Dramatik oder Ruhe ausstrahlen, Wachsen und Verfall widerspiegeln. Die letzten Jahre wurden die Schachten mit ihren eigenartigen Licht- und Nebelstimmungen zum Lieblingsmotiv des Künstlers, wie auch sein Buch „Kraft und Wandel in den Schachten“ zeigt. Diese Schönheit und Vergänglichkeit der Natur berührt nicht nur seine Kunstfreunde im Bayerischen Wald, zu den Vernissagen begrüßt er seine Fangemeinde aus allen Teilen Deutschlands. In seinen Bildern wendet er verschiedenste Techniken an, von Pastellkreiden über Ölfarben bis zum filigranen Holzschnitt.
Gerhard Steppes-Michel wurde am 12. Februar 1923 in Aussig geboren. Nach dem Abitur 1942 wurde er zur Kriegsmari-
Schon in jungen Jahren hatte er hier auch seine ersten sportlichen Erfolge als Skispringer und Bergsteiger. Damals konnte man noch von Aussig bis Tellnitz im Erzgebirge mit der „Elektrischen“ fahren. Aber das reichte ihm nicht.
Neben den Gipfeln des Matterhorns und des Mont Blanc bezwang er als junger Mann über dreißig „Dreitausender“!
Der Jubilar bildete sich künstlerisch weiter und erhielt seine wesentliche Prägung durch die Malerin Erica Steppes, seine spätere Adoptivmutter.
Gerhard Steppes-Michel ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern/ Oberpfalz und weiterer Künstlervereinigungen. 1966 war er Gründungsmitglied des Bayerwaldkreises e. V., und bis zur Auflösung der Künstlervereinigung 1997 deren ehrenamtlicher Geschäftsführer.
Für seine Verdienste um die Kunst im Bayerischen Wald wurde ihm 1983 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Neben weiteren Auszeichnungen freute er sich besonders, als ihm 2005 von der Sudetendeutschen Landsmannschaft die Adalbert-Stifter-Medaille überreicht wurde.
Wir dürfen heute einem wahrhaft großen Sohn der Stadt Aussig zu seinem 100. Geburtstag gratulieren und ihm weiterhin Gesundheit und die Kraft wünschen, um auch künftig mit Freude seiner künstlerischen Tätigkeit nachzugehen.
Nochmals zurück zum „Zug in die Ewigkeit“ ... bei den heutigen Zuständen der Bahn ist auf jeden Fall mit weiteren Verzögerungen zu rechnen...
Herzlichen Glückwunsch im Namen aller Heimat- und Kunstfreunde Karin Wende-Fuchs
� Aus der Region Wolfrum Schloß Skrytin wird wieder zur Attraktion
Länger als gedacht ziehen sich die Renovierungsarbeiten am ehemaligen Wolfrum Schloß Skrytin bei Dubkowitz (Bezirk Tetschen) hin, aber jetzt sieht man deutliche Fortschritte. 2016 verliebte sich der Textilhändler Martin Hausenblas in das verfallene Gemäuer hoch über der Elbe und erwarb das Anwesen.
Gerhard Michel, Karl-Heinz Reimeier Kraft und Wandel in den Schachten.
100 Jahre. Was für eine Zeit für einen Menschen. Wenig Zeit für einen Baum. Keine Zeit für eine Landschaft. Das Leben ist steter Wandel.
Aus Wandel entsteht im besten Fall Kraft. Gerhard Michels Bilder zeigen die Kraft des Wandels in den Schachten. Die Gedichte von Karl-Heinz Reimeier erzählen von der Kraft des Wandels der Gefühle.

Was für eine Herausforderung, den Wandel eines Jahrhunderts leben und das Miteinander erfahren zu dürfen.
22 x 28 cm, 100 Seiten

Hardcover: D 25,00 € (A 25,75 €)
978-3-947171-45-3
Lichtland
Verlagsauslieferung Schönberg

Lerchenweg 24, 94513 Schönberg
Tel.: +49 (0)8554-943606
Email: shop@lichtland.eu
Das Schloß hat eine lange Geschiche. Ende des 19. Jh. von Rudolf Richter erbaut, kaufte es 1914 Ludwig Wolfrum, der jüngste Sohn des Textilfabrikanten Carl Georg Wolfrum. Er wurde als Bankier reich und ging als großzügiger Mäzen in die Geschichte der Stadt Aussig ein. Das gesamte Anwesen thront hoch über der Elbe und diente dem damals über 66-Jährigen und seiner Frau Marie als repräsentativer Landsitz. Wolfrum war fasziniert von der Gegend, ließ in der Nähe seine Grabstätte errichten, baute den Nahverkehr aus und markierte Wanderwege zu seinem Schloß Skrytin. Bis zur Vertreibung 1945 blieb das Schloß im Besitz der Familie Wolfrum. Es wurde verstaatlicht und diente 45 Jahre lang verschiedenen volkseigenen Betrieben als Erholungszentrum. Auf alten Postkarten sieht man, dass zu diesem Zweck das Gelände dicht mit Bungalows bebaut wurde, sogar ein Schwimmbad befand sich hier.
1990 kaufte ein Unternehmer das Anwesen, die Kredite wurden nicht bezahlt, das Schloß fiel an die Bank und verkam zusehends. Innerhalb von 20 Jahren wurde es von Vandalen und Dieben vollständig verwüstet. Bis 2011 der Aussiger Textilunternehmer und Philanthrop Martin Hausenblas zufällig in die Gegend kam und von dem alten Gemäuer fasziniert war. Er kaufte es einem Spekulanten ab und restauriert es seit 2016 von Grund auf im ursprünglichen Stil der Neorenaissance.
Das Schloß, das dank Solarzellen auf dem Schindeldach komplett energieunabhängig wird, ist zwar als sein Wohnsitz gedacht, große Teile der Umgebung sollen aber offen für Besucher bleiben. Rund um das Schloß soll ein Park mit zwei Teichen entstehen, wo heute noch Schafe grasen, wird Wein angebaut. Außerdem entsteht ein hölzerner Aussichtsturm für den Blick ins Elbetal. Schöne Aussichten für 2023! kw Quelle: Sächsische Zeitung, 26.11.2016, Foto: DalniceD8-turistika 2018

Die Petschek-Dynastie
Die schönsten Villen Aussigs verdanken wir einer Unternehmerfamilie, den Petscheks. Ignaz Petschek (*14.6.1857 in Kolin, † 15.2.1934 in Aussig) begründete die Stammlinie der Unternehmerdynastie Petschek, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zu den reichsten jüdischen Familien in Europa zählte.
Laut Zeitungsberichten war Ignaz Petschek Mitte der 1920er Jahre sogar der reichste Tscheche, noch vor dem Schuhfabrikanten Thomas Bata.
Wieso Tscheche? Iganz Petschek stammte aus Kolin, seine Frau Helene Bloch aus Brünn. Der Ehe entstammten 7 Kinder, 6 Knaben und 1 Mädchen.
Mit seinem ein Jahr älteren Bruder Julius, mit dem er zunächst sehr erfolgreich als Unternehmer in der nordböhmischen Montanindustrie agierte, kam es während des Ersten Weltkriegs zum Bruch und beide lieferten sich jahrelang erbitterte Kämpfe um die Marktmacht, auch in der Öffentlichkeit.
Unabhängig voneinander bauten Ignaz und Julius Petschek nach Gründung der Weimarer Republik 1919 ihre Vormachtstellung in Deutschland aus. Durch geschicktes Agieren auf dem Aktienmarkt gewannen sie bis 1932 großen Einfluß auf das mitteldeutsche und ostelbische Braunkohlen-Syndikat. Gemäß der Washingtoner Erklärung im Jahr 1918 waren die Brüder tschechische Staatsbürger geworden. Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, die unter der Weimarer Republik mit einer Hyperinflation zu kämpfen hatten, verzeichnete die tschechischen Republik einen Aufschwung. So übernahmen sie Bergbauaktien,
� Sudetendeutsches Museum
die in Deutschland aus Angst vor einer Verstaatlichung hektisch unter Preis verkauft wurden. Ende der 1920er Jahre kontrollierten die Brüder 50 Prozent der europäischen Kohlenerzeuung und 30 Prozent der deutschen Braunkohlewerke. Zurück zu den Anfängen. Ignaz Petschek absolvierte nach sechs Klassen Gymnasium ein Praktikum beim Prager Bankverein. Zu dem Kreditinstitut gehörte ein Kohlenkontor in Aussig, wo er im Januar 1874 eine Festanstellung erhielt. Der Aussiger Großhändler Eduard J. Weinmann übernahm den Prager Bankverein mitsamt dem Kohlenkontor in Aussig. Petschek wurde in jungen Jahren Prokurist dieses Kohlenkontors. Aber
Verstehen Sie das?
Besucher schmunzeln beim Anblick dieses Plakats aus dem 19. Jahrhundert, das im Sudetendeutschen Museum in München gezeigt wird. Der Drucker, ein Deutschböhme,
verkürzte deutsche Wörter, indem er Buchstaben mit tschechischen Akzenten (Hakeln) versah. Rechts in der Vitrine steht noch die deutsch/tschechische Schreibmaschine. kw
bereits mit 23 Jahren gründete er sein erstes eigenes Unternehmen:
„I. Petschek Aussig a.d. Elbe“. Als Kommissionshändler nutzte er anfangs das Familienkapital und die familiären Kontakte seiner Frau zum Bankhaus „Jacquier & Securius“.
Der Aufstieg der Petschek-Brüder war gezeichnet von skrupellosen Übernahmen, Krisen und Abstürzen an den Aktienmärkten. Seitens der Politik, Wirtschaft und der öffentlichen Meinung stieß Petschek immer mehr auf Widerstand. Am aufsehenerregendsten waren die Prozesse im Frühjahr 1930, die sog. „Petschek-Affäre“, in die sogar der tschechoslowakische Außenminister Edvard Benesch verwickelt war. Schon da-
mals ging es um Einflußnahme ausländischer Regierungen auf die Energiewirtschaft des Deutschen Reiches.
Ignaz Petschek war Mitglied der wirtschaftsliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP), die für einen Einheitsstaat und gegen einen Sozialstaat eintrat. Einflußreiche Parteimitglieder unterstützten ihn bei seinem Expansionskurs. In dieser Zeit übernahm Ignaz Petschek verschiedene Zeitungen, darunter die „Neue Leipziger Zeitung“.
Ganz anders zeigte sich Ignaz Petschek als angesehener Bürger Aussigs. In seiner Heimatstadt tat er sich durch große Spenden für wohltätige Zwecke hervor. Dazu zählten u.a. die Baufinanzierung für ein Säuglingsheim, ein Kinderpavillon im Aussiger Krankenhaus, ein Kindererziehungsheim und ein Sanatorium für Tuberkulose-Patienten. Überhaupt tat er sich als Kämpfer gegen die Verbreitung der Tuberkulose hervor. Er stellte dem Deutschen Landeshilfsverein für Lungenkranke in Böhmen 100.000 Kronen für den Bau eines Genesungsheims zur Verfügung. Als geeigneter Platz fiel die Wahl auf einen Grundbesitz auf einem Höhenrücken in der Nähe von Spiegelsberg bei Pockau. Bereits im Jahr 1908 konnte die Einrichtung feierlich eröffnet werden.
Als Ignaz Petschek am 15. Feber 1934 im Alter von 77 Jahren starb, war er in Aussig ein hoch angesehener Bürger. Er hinterließ ein geschätztes Vermögen von 232 Millionen RM, das entspricht heute ungefähr einer Kaufkraft von 1,7 Milliarden Euro. kw Quelle: Wiener Bauindustriezeitung, 12.3.1909, wikipedia Fotos: Archiv
� Spielerisch durch die Heimat Grenzenlos durchs Erzgebirge
Helmut Hoffmann ist tot. Jeder Aussiger Bote-Leser kannte seinen Namen. Am 24. Jänner 2023 verstarb er 82-jährig in Altenkunstadt. Seine Tochter Bettina sagte, er sei im Sessel eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Wir können es noch nicht fassen. Keine Beiträge mehr von unserem „HeHo“? Bis zuletzt war er für viele Heimatzeitungen aktiv, aber seine Heimat war Türmitz, seine Artikel das Gerüst unseres Aussiger Boten. Für die nächste Zeit gibt es noch eine Reihe unveröffentlichter Berichte, so dass er für uns lebendig bleibt. Jedes Jahr im Dezember traf ein dickes Kuvert mit Beiträgen ein, aufgeteilt nach den Monaten des kommenden Jahres, und wehe, wir mussten aus Platzgründen einen Beitrag verschieben oder kürzen. Er hat sich ja auch viel Arbeit gemacht, auf eigene Kosten recher-
Sudetendeutsches Museum. Fotograf: Weise. � Aus dem Fundus von Helmut Hoffmann

Sensationeller
Rilke-Nachlaß bald öffentlich
Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach (BadenWürttemberg) hat mit Hilfe öffentlicher und privater Geldgeber ein riesiges Konvolut von Schriften und Materialien Rainer Maria Rilkes (1875 - 1926) erworben. Der Nachlaß befand sich seit fast 100 Jahren im Privatbesitz der Familie in Gernsbach und wurde zuletzt von seiner Enkelin Hella Sieber-Rilke archiviert und nur wenigen Fachleuten zugänglich gemacht. Nach ihrem Tod wurde die Sammlung, eines der bedeutendsten Autorenarchive des 20. Jahrhunderts, vom Literaturarchiv erworben. Die Direktion hat 70 Jahre auf diesen „Jahrhunderterwerb“ hingearbeitet. Nach einer zunächst ein bis zwei Jahre währenden Erschließung und Erforschung des fantas-

Der „Tschirner & Kosová-Verlag“ in Leipzig hat ein Brettspiel herausgebracht: „Grenzenlos durchs Erzgebirge“! Dieses Spiel könnte auch bei den Nachfahren Begeisterung auslösen. Die Liebhaber-Edition zeichnet sich durch fünf wunderschöne, in 42 Arbeitsschritten gefertigte Miniaturen der Manufaktur Holzkunst Braun aus Oberlochmühle bei Seiffen aus – fast zu schade zum Spielen (aber man kann sie ja beim häufigen Gebrauch durch herkömmliche Spielsteine ersetzen): neben der Reisigfrau gehen Anton Günther, ein Nussknacker, ein Bergmann und ein Lichterengel an den Start und versuchen, möglichst flott von Chemnitz, dem

Startort, über den Kamm des Erzgebirges zu wandern und auf der anderen Seite nach Komotau zu gelangen, dem Ziel der Reise. Bei diesem Abenteuer sind aber viele gar nicht so einfache Fragen zu beantworten (quasi „Heimspiel“ für echte Erzgebirgler – und solche, die es werden wollen!) und einige Berge, Flüsse und ein Stausee zu überwinden. Die Aktionsfelder auf dem Spielfeld sorgen für zusätzliche Spannung. Familien-Edition 59,00 € zzgl. Versandkosten, Auslieferung erfolgt nach Vorauszahlung. Verlag Tschirner & Kosova, Zum Harfenacker 13, 04179 Leipzig, Tel. +49 176 20749908. ISBN 978-3-00-072736-8 info@tschirner-kosova.de
tischen Bestands, wird es digitalisiert. Eine erste Ausstellung auf Basis der Neuerwerbungen wurde für Ende 2025 zum 150. Geburtstag Rilkes angekündigt. Das Archivgut umfasst mehr als 10.000 handschriftliche Seiten, ca. 8.800 Briefe, etwa 470 Bücher und Zeitschriften, 131 bisher unbekannte Zeichnungen, 85 Skizzen, 360 Fotografien sowie Tagebücher aus allen Lebensphasen des Schriftstellers. Der Türmitzer Oberlehrer und Heimatforscher Joseph Fleischmann (1878 - 1943) konnte Rilkes väterliche Stammlinie anhand der Grund- und Kirchenbücher lückenlos belegen. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts waren Rilkes Vorfahren Bauern und Handwerker in Nieder-Türmitz (gekürzt). Helmut Hoffmann Das Erzgebirgsspiel.

Foto: Tschirner & Kosová Verlag
chiert, Bücher studiert und in alter Manier in Bibliotheken und Kirchenbüchern geforscht. Seine Tochter Bettina versprach, für den März-Boten eine Vita über ihren Vater zu verfassen.
Ein arbeitsreiches Leben ging zu Ende. Möge Helmut Hoffmann in Gottes Frieden ruhen. Karin Wende-Fuchs im Namen aller Heimatfreunde und Leser des Aussiger Boten
� Gruß aus Aussig „Daheeme – aber alleene“
Diese Überschrift diktierte mir Hansi Adamec, verbunden mit der Bitte, euch alle sehr herzlich zu grüßen. Er bedankt sich für die vielen guten Wünsche zu seinem Geburtstag, zu Weih-
Große Trauer um Helmut Hoffmann WIR
n 100. Geburtstag: Am 12. 2.
Herr Gerhard STEPPES-MICHEL aus Aussig, Dr. Hasner-Straße.

n 98. Geburtstag: Am 22. 2.
Frau Ilse BERLIN geb. Hasche aus Tillisch in 18059 Rostock, K.Tucholsky-Str. 25.
n 97. Geburtstag: Am 8. 2.
Frau Rosemarie MATIASKO geb. Povolny aus Salesel. – Am 28. 2.
Frau Doris KLIEMANNEL aus Aussig, Tel. 001 514 979 8077.
n 96. Geburtstag: Am 17. 2.
Frau Charlotte REIF geb. Grimm aus Aussig-Schönpriesen in 65187 Wiesbaden, Feldbergstraße 13.
n 95. Geburtstag: Am 20.2.
Frau Maria STRAHL geb. Mattausch aus Morawan in 17373 Ueckermünde, Lübecker Str. 16.
n 93. Geburtstag: Am 18. 2.
Herr Wolfgang EGGERT aus Schwaden.
n 92. Geburtstag: Am 5. 2.
Herr Herbert STOLLE aus Saubernitz. – Am 10. 2. Herr Walter SCHMIDT aus Liesdorf in 71711 Steinheim, Riedstr. 49.


n 91. Geburtstag: Am 20. 2.
Frau Antonia DIEMUNSCH geb. Hrdlicka aus Aussig-Lerchenfeld, Am Laden 55 in 64380 Roßdorf bei Darmstadt, Riedgasse 28 a.
n 90. Geburtstag: Am 16. 2.
Frau Hilde LASER geb. Wallisch aus Peterswald Nr. 448 in 01896 Ohorn, Weberstr. 1. – Am 16. 2.
Frau Christel EHRT geb. Klösel aus Schönpriesen in 90449 Nürnberg, Röthenbacher-Hauptstraße
33 a. – Am 21. 2. Frau Walli GROHMANN geb. Galfe aus Stöben.
n 89. Geburtstag: Am 15. 2.
Frau Hildegard GOMILLE geb. Heinzel aus Aussig-Kleische, Laubenhof.
n 88. Geburtstag: Am 7. 2.
Herr Willi HOHLEY aus Nestomitz. – Am 5. 3. Frau Brigitte GRIESBACH geb. Richter aus Birnai Nr. 7 in 09618 Brand-Erbisdorf, Langenau, Im Engen 4. n 87. Geburtstag: Am 8. 2.
Frau Liane JUNG geb. Franze (Richter Liane) aus Peterswald.
nachten und fürs neue Jahr. Er ist nicht vergessen, aber ziemlich einsam in seinem Zimmer, in seinem Bett, das er nicht mehr allein verlassen kann. Auch seinen Computer – für ihn noch lange Zeit das Tor zur Welt – kann er nicht mehr bedienen. Aber Anrufe nimmt er gern entgegen, Mobil: +420 728147089. Alles Gute Hansi! kw
n 86. Geburtstag: Am 11. 2.
Herr Leo PAUL aus Schöbritz. – Am 25. 2. Frau Waltraud DISCHERT geb. Netter aus Schönpriesen in 36251 Bad Hersfeld, Überm Dorf 6. – Am 26. 2. Frau Christa HORN geb. Burghart aus Karbitz, Aussiger Straße. n 85. Geburtstag: Am 23. 2. Frau Ingeborg THIELSCH (Tochter von Rat Martl) aus Voitsdorf/ Schönwald. – Am 26. 2. Frau Gretl PFEIFFER geb. Rechner aus Aussig in 07318 Saalfeld, Pirmasenser Str. 12.
n 84. Geburtstag: Am 6. 2. Herr Dipl.-Ing. Christian KROITZSCH aus Aussig, Dresdner Str. in 89081 Ulm, JohannesWeißer-Weg 2. n 82. Geburtstag: Am 8. 2. Herr Manfred HRDINA aus Aussig, Kleischer Str. 61 in 85221 Dachau, Paula-Wimmer-Str. 24. – Am 20. 2. Frau Heide LUNGHAMER geb. Ulrich aus Aussig, Helmut-Lang-Str. 3 in 74193 Schwaigern, OT Stetten, Oststr. 24. – Am 1. 3. Frau Christa DOERING aus Aussig in 06237 Leuna, Bunsenstr. 27. – Am 7. 3. Frau Renate WOLF (Gattin von Rainer Wolf aus Arnsdorf) in 06124 Halle-Neustadt, Stolberger Str. 14. n 81. Geburtstag: Am 4. 3. Herr Peter MÜHLE aus Leitmeritz. n 78. Geburtstag: Am 25. 2. Frau Rosemarie HRDINA (Ehefrau von Manfred HRDINA aus Aussig) aus Hochofen, Kr. Neudek in 85221 Dachau, PaulaWimmer-Str. 24. – Am 7. 3. Frau Ilse von FREYBURG geb. Spazier aus Bürgstein. n 72. Geburtstag: Am 5. 2. Frau Regina SIELAND geb. Ibl aus Modlan (Tochter von Sieglinde Ibl geb. Vojik aus Modlan) in 37281 Wanfried, Wallstr. 8 a. n 58. Geburtstag: Am 22. 2. Herr Gernot HEGENBART (Eltern Horst Hegenbart aus Schreckenstein) in 71229 Leonberg, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10.
Der Kampf ums Bier

Nicht das Pilsener, sondern das Leitmeritzer Bier hätte in den tschechischen Kneipen als Hauptmarke den heimischen Biermarkt beherrschen können.
Beide Städte gehörten noch im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Bierproduzenten in Böhmen. Sie teilten sich auch das Absatzgebiet auf dem Biermarkt der Hauptstadt Prag. Im Jahr 1860 fand dann ein Schnitt zwischen den Liebhabern des goldenen Getränks aus Pilsen und Leitmeritz statt. Aus diesem Kampf entstand der Spaßverein Schlaraffia. Leider unterlagen dort die Anhänger des Leitmeritzer Bieres. Die europäische Statistik der Bierproduktion führt im Jahr 1867 gerade Österreich als die Biergroßmacht Kontinentaleuropas auf und nennt außerdem drei Zentren, in denen der schaumige Saft gebraut wurde: Wien und Umgebung, Pilsen und Leitmeritz. In dieser Zeit standen in Leitmeritz zwei Brauereien –Bürgerbräu aus dem Jahr 1720 und Elbschlößchen, welches im

Jahr 1858 gegründet wurde. Die Bürgerbräu-Brauerei war die erste moderne industrielle Aktienbrauerei in den Böhmischen Ländern. Aus der Weinstadt Leitmeritz wurde das Bier in die weitere Umgebung ausgeliefert.
In Prag wurde es in der legendären Wirtschaft Freund gezapft, welche durch die kunstliebende Gesellschaft des Direktors des Ständetheaters Franz Thomé besucht wurde.

Über dem Leitmeritzer Gerstensaft dachte man sich im Jahr 1859 einen Spaßverein aus, welcher Scherze über elitäre Bünde wie die Freimaurer oder den Künstlerbund Arcádia machte.
Sie gaben sich ritterliche Namen und begannen die Rituale des Bundes auszuarbeiten. Das Hauptaugenmerk sollte hierbei auf Kunst und Humor liegen.
Natürlich mußten sie mit ihren humoristischen Séancen warten, bis der letzte Gast gegangen war.
Dies dauerte meist bis lang in die Nacht, sodaß die Notwendigkeit bestand, sich nach einem geeigneteren Lokal umzuschauen.
❯ Wie es früher war – Techobusitz
Der Umzug geschah im Oktober 1860 und wurde zur ersten Bestandsprobe für den neuen Bund. Sie brachten nämlich die Liebhaber des Pilsner und des Leitmeritzer Bieres, welches sie in ihrer neu aufgespürten Basis „Zum Hopfenstock“ ausschenkten, gegeneinander auf. Es flammte ein Kampf auf, bei welchem Messer gezückt, Fäuste in die Luft gereckt und mit Kampfgeschrei gerufen wurde: „Für das Leitmeritzer Bier! Für das Pilsner Bier!“
Der Kämpfer für das Leitmeritzer Bier, Graf Gleichen (der Opernsänger Albert Eilers), stach dem Ritter Calikot (sein bürgerlicher Name ist nicht bekannt), einem Verteidiger des Pilsner Bieres, in den Hintern. Die Details der dramatischen Szene hielt eine meisterhafte Zeichnung des Ritters Pastranus (der Schauspieler František Kolář jun.) fest. Der Streit beruhigte sich schnell bei einem Schluck des – von nun an – Pilsner Bieres. In der neuen Wirtschaft hatte die Gesell-

schaft mehr Privatsphäre, gab sich den Namen Schlaraffia und wurde in Kürze weltbekannt. Es entstanden dutzende Zweigstellen – sogenannte Reiche – in vielen weiteren Ländern, nicht nur in Europa. Es wuchs ein weltweites Netz mit zehntausenden, oft berühmten Mitgliedern der Gesellschaft. Das Reich mit dem Namen Castellum Albiense wirkte ab dem Jahr 1896 auch in Leitmeritz, ihren Stützpunkt hatten sie im Wirtshaus „Labuť“, wo sich heute eine Gasthausbrauerei befi ndet.
Die Schlaraffen wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis auseinandergetrieben. In ihren Herkunftsländern hatten sie auch nach dem Krieg keinen besseren Stand, da ihre Späße als „dekadente bourgeoise und deutsche Unterhaltung“ galten. Hinter der tschechischen Grenze gibt es sie aber bis heute, leider ist jedoch wenig bekannt über die grundlegende Rolle des Leitmeritzer Bieres bei Gründung des Bundes.
Geschichtliches zur Gemeinde Techobusitz
cebook-Gruppe zu gründen, die er „Litoměřicko očima cizince, který se zamiloval“ genannt hat.
Die deutsche Übersetzung vermittelt seine Zuneigung für die Stadt: Leitmeritz, gesehen durch die Augen eines Ausländers, der sich (in die Stadt) verliebt hat.
Jeden Tag veröffentlicht er dort ein Foto, das der aktuellen Jahreszeit entspricht und, mit technischem Können aufgenommen, eine aktuelle Momentaufnahme liefert. Straßenzüge, historische Gebäude, schöne Details – und selbstverständlich die Elbe faszinieren den Fotografen und erfreuen die stetig wachsende Gemeinde von Mitgliedern, die der Gruppe auf der Internetplattform Facebook folgen.

Die meisten seiner Abonnenten wohnen ebenfalls in Leitmeritz, inzwischen gibt es jedoch auch Mitglieder aus anderen Ländern, bis hin zu den USA und Kanada. Da diese meist im Lau-
❯ Wie es früher war – der Winter
pe unter den Fotos dazu austauschen, indem sie Kommentare absenden, die dann für alle lesbar und auch beantwortbar sind.
Die Stadt Leitmeritz sowie die Marketingabteilung arbeiten mit Bach zusammen, sodaß der offizielle, für 2023 erschienene Kalender, elf seiner Fotos enthält. Seine Ehefrau hat ebenfalls einen Kalender mit Fotos der Stadt herausgebracht.

Um der Facebook-Gruppe beizutreten, rufen Sie im Internet den Link https://www.facebook. com/groups/594916535044242 auf und wählen Sie „Gruppe beitreten“ an. Damit können Sie Fotos kommentieren und alle Inhalte betrachten.
Seit Januar 2022 kann man die Fotos von Bach ebenso auf der kostenlosen Soziale-MedienPlattform Instagram betrachten, im Internet sowie auf dem internettauglichen Smartphone. Sie fi nden ihn dort unter dem Namen rainerbach.lito Heike Thiele
Winterimpressionen aus der alten Heimat
Georg Pohlai aus Schüttenitz erinnert mit seinem Foto an die Aufgabenverteilung im Winter.

Die Winter waren bei uns oft lang und kalt. In dieser Jahreszeit wurde das Holz geschla-
Die sechs Kilometer von Leitmeritz entfernt liegende Gemeinde ist 1397 als Tyechobuzicz erstmals urkundlich erwähnt worden.
erfolg-

(Techobuzycze),
Verfasser namens Müller von „Dechobutz“. Techobusitz in der jetzigen Schreibweise wurde in den Jahren 1787 und 1833 so benannt. Im letztgenannten Jahr wurde es in Ploschkowitz eingepfarrt und eingeschult. Mit der Zeit erfolgten Veränderungen.
Im Jahre 1866 wurde schließlich ein neues Gemeindehaus mit einem schmucken Türmchen erbaut. Weitere, umfangreiche Baumaßnahmen erfolgen auf Initiative des damaligen Gemeindevorstehers Franz Brosche hin.
Anno 1887 lebten in zwanzig
Häusern 114 deutsche Einwohner. 1930 kam ein weiteres Haus hinzu und die Zahl der Einwohner erhöhte sich auf 136, davon 127 Deutsche. Nach der Vertreibung waren im Jahr 2011 sechzig Bewohner in den 22 Häusern zu fi nden. Sven Pillat

gen und oft mußte es mit dem Schlitten eingefahren werden. Das konnte hier der Bauernsohn besorgen, der gerade auf Urlaub zu Hause war. Aus: „Fotos von damals aus Dörfern am Südrand

�
Geschichte/Drahobus
bei Gastorf
Drahobus – eine Sammlung
Mario Illmann, engagierter Heimatforscher, hat diese Datensammlung zu Drahobus aus Leitmeritzer Boten der Vorkriegszeit zusammengestellt.
04.04.1901: † Franz Schüller mit 58 Jahren.
02.07.1902: † Marianne Tutte mit 64 Jahren.
09.02.1903: Gutsverwalter Suk feiert seine silberne Hochzeit.
20.04.1903: † Elisabeth Dobisch, geb. Schröter, mit 54 Jahren.
22.11.1904: Trauung der Mathilde Jenak mit Franz Till, Lehrer in Drahobus.
29.12.1904: In Drahobus wird eine heidnische Begräbnisstätte entdeckt.
11.11.1905: Das Haus Nr. 11 der Eheleute Franz und Marie Gärtner brennt ab.

22.01.1908: † Veteran Josef Kusebauch mit 72 Jahren.
05.12.1909: † in Drahobus: Josef Wilde aus Liebenau mit 74 Jahren.
09.07.1912: † Elisabeth Neumann, geb. Wieder, mit 86 Jahren.
� Mundart
† Gutsverwaltergattin Marie Suk.
17.08.1915: † Anton Richter mit 76 Jahren.
21.01.1916: † ehemaliger Gemeindevorsteher Wenzel Benatzky mit 56 Jahren.
13.10.1918: † Hermine Steinitz, geb. Neumann, mit 32 Jahren.
25.01.1919: Trauung des Landwirts Josef Jandausch aus Drahobus mit Anna Tutte aus Welleschitz in Gastorf.
15.08.1919: Abschiedsfeier zu Ehren des Oberlehrers Karl Josef Wilde, der nach 38jähriger Dienstzeit an der dortigen Schule
Ai Gedankn… oda ee Traam
dathie wu Auscha liegen kunnde und doss „Tauber Land“, sah iech ock Puusch und kenne Barge. Dar nechste Puckl iss dar Reif (bimsch: Rip). Dann sah iech unse Schtoodt, dann lange nischt mej, erscht dann die Hosnburg. Die Kotze sah iech halt und die Lauda Hehe. Waita driebn daan Koschtial, die Rodebaile und daan Lobosch. Bai gudn Watta sah iech vielleicht nochn Donnersberg (Milleschauer) undn Kletschn, obba ganzbai mier nochn Radischkn. Ebb iech olle Barge sahn konn, wess siech nie, suu hobbse iech halt ain Kuppe. Alle Mundarttexte: Georg Pohlai
Iech schtieh aufn Satansbargl bai Schittenz und gucke suu immering (ringsim).
Hinda mier dar Kraizbarg mit daan Felsn, dar ausn Beem rausguckt, iech kenn n ols Robnschteen. Bissl waita, schunn grissa, schunn ee klenna Barg, dar Porschna Roobnschteen. Bissl waita, suu naabn Porschn, dar Guldbarg. Drej iech miech waita, sah iechn Geltsch liegn. Bissl waita wag und dahinda noch ganz ain Dunste, daar Roon, danabn daar Wilhoscht. Waita gedrejt,
� Leserbriefe
Zwej Jaaga wulltn n Hoosn schissn, zaitlich ai dar Frieh. S woor no nie ganz Toog. Enna vu Kalitz, enna vu Poorschn. Dou sain se halt undan Kraizbarge durch die Rasn geschlichn, heertn woss roschln. – Die honn sich getruffn.
Woorn zwej Fleeh ai dar Schtoodt ain Kino. S woor schunn schpäjte und aa finstrich. Bejde woorn vu Schittenz. Sohht dar eene: „Gieh ma durch die Allee hemm, oda namma uns n Hund?“
90 Jahre – wie ich wurde, was ich heute bin
Im Alter von 90 Jahren zieht
Kurt Hammer aus Hanau Bilanz über stetig wechselnde Staatszugehörigkeiten und Währungen seiner Vergangenheit.
Staatszugehörigkeit: Bei ihrer Geburt waren meine Eltern Österreicher, 1933 wurde ich als tschechoslowakischer Staatsangehöriger geboren.
Am zehnten Oktober 1938 wurde ich, ohne meinen Willen, Staatsangehöriger des Deutschen Reiches. Nach dem achten Mai 1945 war ich staatenloser Bewohner der Tschechoslowakei. Mein Onkel, Ernst Hammer, wurde von Sowjets erschossen, ohne daß Ermittlungen eingelei-
in den Ruhestand tritt.
11.10.1920: Trauung der Henriette Friedrich mit Emil Heller aus Drahobus in Straschnitz.
02.08.1922: Versorgung des Dorfes mit Strom durch das Transformatorenhaus in Auscha.
16.09.1924: Man zahlt in Drahobus 2.000 Kronen für 50 Kilo Hopfen.
07.06.1925: Gauverbandstag des Feuerwehrgauverbandes Nr. 52.
27.08.1925: Ein fünfjähriger Junge der Roma/Sinti ertrinkt.
24.02.1927: † in Nixdorf: Antonie Wilde, geb. Hoppe, aus Drahobus mit 71 Jahren.
29.05.1927: Das 50jährige Gründungsfest der Feuerwehr.
05.06.1927: Weihe des Kriegerdenkmales in Drahobus.
16.11.1927: † Theresia Ringel, geb. Eisert, mit 28 Jahren.
27.01.1928: Der anderthalb Jahre alte Sohn des Bindermeisters Walzel fällt in siedendes Wasser und verstirbt [Drahobus Nr. 14].
02.01.1929: † Gastwirt Wenzel Schwederle.
� Buchvorstellung
16.03.1929: † Landwirt Josef Wurm in Leitmeritz.
19.02.1930: † Frisörgattin Henriette Heller mit 31 Jahren [Nr. 16].
08.03.1930: † Gastwirt Wenzel Schwederle mit 43 Jahren.
03.09.1931: Infolge eines Blitzschlages brennt ein Anwesen nieder.
14.08.1932: Die Scheune des Landwirtes Friedrich brennt.
11.10.1932: Scheune und Schuppen des Landwirtes Thiel brennen nieder [Diehl Nr. 50?].
18.12.1932: † Landwirt Wenzel Kusebauch in Aussig.
23.03.1933: Scheunenbrand.
18.06.1933: Motorspritzenweihe und Verbandsfest des 52. Feuerwehrgauverbandes in Drahobus.
19.09.1933: Die Scheune des Landwirts H. Diehl brennt nieder.
16.11.1935: † Witwe Agnes Wied.

23.11.1937: Trauung der Marie Stelzig, geb. Hübel, mit Landwirt Tutte aus Drahobus in Liebeschitz. Mario Illmann, Einsender: Sven Pillat
Prag –

k. u. k. Sehnsuchtsort
von Gregor Gatscher-Riedl
276 Seiten, gebunden, 09/2022
Preis: 29,90 €
ISBN 978-3-99103-073-7
Kral Verlag
Tel.: +43 (0) 2672 82236 Bestellungen: office@kral-verlag.at
Im zarten Alter von 21 Jahren wurde der gebürtige Prager Franz Werfel, ein fleißiger Kaffeehausbesucher, als „aufregendster Lyriker deutscher Sprache“ bezeichnet.
„Und es brodelt und werfelt, es kafkat und kischt – wie wenn Rilke und Meyrink sich mischt“
– ob dieses Zitat nun von Karl Kraus oder Anton Kuh stammt, ist nicht so wesentlich wie die Tatsache, daß Prag dank all dieser Künstler damals, in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts, die literarische Hauptstadt von Mitteleuropa, wenn nicht ganz Europa, war.
Der bekannte Autor, Historiker und Politologe Gregor Gatscher-Riedl beschreibt in dem uns vorliegenden Buch das „dunkel-schöne Märchen einer Stadt in der Mitte Europas“, wo das Winkelwerk mittelalterlicher Gassen und Treppen unvermutet auf die Weite barocker Plätze trifft. Das bündelte schon vor Generationen Vorstellungen
� Poesie
von einer guten, alten Zeit, die die Gegenwart schon damals nicht einlösen konnte. Daß sich unter den Habsburgern das politische Gravitationszentrum nach Wien verschoben hatte und Mitteleuropas heimliche Metropole zur Provinzstadt degradiert wurde, hat sie der schwarz-gelben Dynastie (leider) nie verziehen. Im literarischen und gesellschaftlichen Leben sah es – bis zum Zweiten Weltkrieg – ohnedies anders aus… Wie gewohnt, besticht der Band „Prag“ aus der Verlagsreihe „K. u. K. Sehnsuchtsorte“ (es gibt auch ein Buch über das böhmische Bäderdreieck) durch viele Hintergrund- und Detailinformationen sowie das umfangreiche und sorgfältig ausgewählte Bildmaterial. SdP
� Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
100 Jahre
01.02.1923, Karl Lischka, früher Kosten bei Türmitz
95 Jahre
13.02.1928, Prof. Dr Kurt Werner, früher Graber
12.02.1928, Sonja Hünert, geborene Siegert, früher Auscha
11.02.1928, Hildegard Schirmer, geb. Mohr, früher Tupadl
09.02.1928, Hildegard Fechner, geb. Ciboch, früher Wegstädtl
04.02.1928, Gertrud Gaube geb. Maresch, früher Pitschkowitz
90 Jahre
23.02.1933, Gerda Tanger, geb. Petersik, früher Malitschen
12.02.1933, Marianne Langer, geb. Lorenz, früher Leitmeritz
07.02.1933, Herbert Füssel, früher Leitmeritz
04.02.1933, Margit Detzner, geb. Richter, früher Zebus
02.02.1933, Hans Usler, früher Leitmeritz
80 Jahre
27.02.1943, Wolfgang Melzer, früher Brschehor
08.02.1943, Ursula Rakow, geb.Fürtig, früher Leitmeritz 03.02.1943, Sieglinde Kerber, geb. Wirl, früher Leitmeritz
75 Jahre
10.02.1948, Alois Hofmann
65 Jahre
14.02.1958, Robert Tode, früher Oberkoblitz
Auscha
27.02.1940, Ingrid Sattler, geborene Eichler
Babina
05.02.1935, Ernst Hikisch
Binowe
29.02.1940, Franz Laube
Drahobus
14.02.1932, Emma Bagatsch, geborene Peschel Fröhlichsdorf
13.02.1929, Berta Winkel, geborene Stelzig
Gastorf
23.02.1932, Elfriede Streitenberger, geborene Tobsch
Graber
11.02.1947, Dr. Johannes Kirchhof Groß-Tschernosek
27.02.1950, Hugo Wilfert Hlinay
02.02.1941, Veronika Hillenbrand, geborene Welk
Kninitz
13.02.1932, Adele Baumann, geborene Wunder
Kochowitz-Gastorf
13.02.1935, Emil Flache
Kotzauer
05.02.1932, Margit Kurs, geborene Kronwald
Krscheschitz
19.02.1927, Eva Hildebrand, geborene Lischke
28.02.1934, Margit Henzchen, geborene Grunt
Kutlitz
16.02.1935, Willibald Schubert
Laden
07.02.1934, Margarete Ulber, geborene Schlucke
Leitmeritz
21.02.1924, Josefine Withelm, geborene Danner
25.02.1927, Helga Ott, geborene Wilczek
07.02.1929, Edith Grimm, geborene Weirauch
02.02.1931, Elisabeth Maurer
15.02.1942, Barbara Prislin, geborene Stummer
05.02.1939, Dieter Niklas
Lichtowitz
19.02.1932, Gerlinde Chitralla, geborene Protschke
23.02.1939, Germana Goblirsch, geborene Grünzner
Lobositz
16.02.1941, Dr. Gerhard Gregori
Lucka
18.02.1939, Wilfried Heller
Molschen
20.02.1952, Annegret Losch
Morgendorf
02.02.1934, Ingeborg Bernhardt, geborene Hocke
Naschowitz
20.02.1931, Walter Klemmer
Nieder-Gügel
28.02.1944, Helmut Rauch
Nieder-Wessig
02.02.1932, Margit Willert, geborene Pilz
Prosmik
06.02.1935, Marie Savouret, geborene Fieber
Robitsch
18.02.1941, Erika Becker, geborene Pappert
Roche
01.02.1934, Alfred Borde
17.02.1940, Helmut Borde
Rschepnitz
06.02.1930, Alfred Gudera
01.02.1940, Erika Voigt, geborene Nowak
Ruschowan
10.02.1929, Franz Semsch
22.02.1930, Herta Senf, geborene Schneider
Schüttenitz
10.02.1931, Hildegard Pechwitz
10.02.1934, Ingeborg Bremer, geborene Haase
Sebusein
03.02.1930, Friedrich Neumann
Skalitz bei Schüttenitz

18.02.1939, Edith Kley, geborene Knytl
Sobenitz
03.02.1934, Doris Mlynarczuk, geborene Badel
Taschow
20.02.1931, Ludmilla Lobers, geborene Schröter
13.02.1939, Harald Melzer
22.02.1970, Mario Kurt Melzer
Techobusitz
09.02.1929, Gertrud Friedrichs, geborene Süßemilch
Trebnitz
10.02.1940, Dr. med. Edeltraud
Haus, geborene Petersik
Triebsch
20.02.1962, Andreas Pilnei
Tschalositz
20.02.1929, Christl Glott
Tschersing
16.02.1941, Siegfried Schneider
Wchinitz
19.02.1935, Richard Pieke
Webrutz
14.02.1937, Valerie Salewski, geborene Hocke
Wegstädtl
21.02.1930, Alfred Strotzer
03.02.1937, Helmut Geppert
Werbitz
26.02.1936, Leontine Deckert, geborene Palme
Wocken
04.02.1957, Annelies Bretschneider, geborene Reichelt
Wopparn
13.02.1941, Margarete Gräf, geborene Poddany
Zahorschan
15.02.1934, Margit Maaß, geborene Trojan
Zebus
tet wurden. Ab Oktober 1946 war ich Bewohner der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, danach DDR. Durch den Sprung über einen Bach wurde ich 1951 dann Bewohner Westdeutschlands. Mit einem Personalausweis und Flüchtlingsausweis A im Jahr 1989 wurde ich Gesamtdeutscher und Europäer (inklusive Führerschein). Eine Änderung dieser Staatsbürgerschaft erwarte ich nun nicht mehr.
Währungen in 90 Jahren: Die Zahlungsmittel in meinem Leben sind, ähnlich der Staatszugehörigkeiten, wechselnd. KCK, CK, RM, DM Ost, DM West, Euro. Aus meiner Sicht hat es sich gelohnt zu leben. Kurt Hammer
Und abends, wenn am Himmel die Wolken ostwärts zieh‘n, dann lehne ich am Fenster und schaue zu euch hin. Um mich versinken Räume, die Ferne wird mir nah, ich stehe dort und träume, und dann, dann bin ich da, wo in den ersten Jahren die Kindheit ich vollbracht.
Die Berge an der Elbe beschritt ich manchesmal. Ich kenne alle Fluren und kenne jedes Tal.
Ich bin so manche Stunde darüber hinweggeschweift, wenn sommers spät die Saaten zur Ernte ausgereift. Wie lacht ihr mir, ihr Straßen, wo ich oft getollt.
Still grüßt ihr mich, ihr Märkte, im letzten Abendgold. Und ihr, ihr alten Häuser, ihr habt noch euer Gesicht, der langen Jahre Dauer veränderte euch nicht.
Singt noch am Friedhof drüben die Nachtigall ihr Lied, wenn über unserm Städtchen die Nacht herüberzieht?
Sie singt des Lebens Freude und singt des Lebens Leid noch einmal den Entschlafenen in kurzer Sommerszeit.
Und morgens, wenn am Himmel die Wolken ostwärts zieh‘n, dann schreit ich durch die Straßen der fremden Stadt dahin. Verfasser unbekannt, Einsender: Georg Pohlai
26.02.1944, Roswitha Neuffer, geborene Rimpel
05.02.1945, Siglind Wanschka, geborene Krolopp
15.02.1930, Isfried Grusser
� Unseren Toten zum ehrenden Gedenken
23.12.2022
Irene Steinmetzer, geb. Ankert, Massen/Niederlausitz, im Alter von 100 Jahren, früher Webrutz
Liebe Leser, ich habe ein wichtiges Anliegen: Bitte teilen Sie mir als Redakteurin weiterhin mit, wenn jemand verstorben ist. Nur so kann ich die Geburtstagsliste im Heimatboten aktuell halten. Sie können
mich telefonisch unter der Rufnummer 02271 805630, per eMail unter thiele.heike@gmx.de oder postalisch unter der Adresse Eulengasse 16 in 50189 Elsdorf erreichen. Herzlichen Dank. Heike Thiele
