Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung













Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft












Als „Vertreter der böhmischen Heimat des Paneuropa-Gründers Richard Graf Coudenhove-Kalergi“ hat der Vorsitzende der Paneuropa-Union Nordrhein-Westfalen, Karl Alexander Mandl, sowohl die tschechische Generalkonsulin in Düsseldorf, Kristina Larischová, als auch den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, begrüßt. Letzterer war gemeinsam mit dem Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei und Europaminister Nathanael Liminski Festredner anläßlich der Kölner Feierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen der Paneuropa-Bewegung.
Auch für Liminski hatte Mandl einen geschichtsbewußten Hinweis bereit, der mit dem 60. Jahrestag des deutsch-französischen Élysée-Vertrages im Janu-




❯ Das Europäische Museums Forum gibt den Gewinner am 6. Mai in Barcelona bekannt
Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich
■ Museum Schloßberg, Graz;
■ Andenne Museum Space, Belgien; ■ FeliXart Museum, Belgien; ■ Olympia-Museum Sarajevo, Bosnien und Herzegowina; ■ Stadtmuseum von Rijeka, Kroatien; ■ Oliven-Museum Klis, Kroatien; ■ Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Prag;
■ Arbeiter-Museum Dänemark;

■ University of Tartu Museum, Estland; ■ The Franciscans, Frankreich; ■ Ilia Chavchavadze Literary Memorial Museum. Museum of the Tbilisi Museums Union, Georgien; ■ Otar Lordkipanidze Vani Archeological Museum of Georgian National Museum, Georgien; ■ Deutsches Museum Nürnberg; ■ Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Berlin;
■ Sudetendeutsches Museum, München; ■ Riga Stradiņš University Anatomy Museum, Lettland; ■ Depot Boijmans Van Beuningen, Niederlande; ■ Queen Louis Adit Complex. Kohlebergbau-Museum, Zabrze, Polen;
■ Casa Fernando Pessoa, Portugal; ■ Museum of Lagos Dr. José Formosinho, Portugal; ■ Casa Batlló, Spanien;

■ Chillida Leku, Spanien; ■ L‘Etno, Valenzia; ■ Abtei Payerne, Schweiz;


■ Kunsthaus Zürich; ■ Musée Atelier Audemars Piguet, Le Brassus Schweiz; ■ Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne; ■ Museo di Val Verzasca Sonogno, Schweiz; ■ Stiftsarchiv St. Gallen; ■ Schweizerisches
Agrarmuseum Burgrain; ■ 23,5

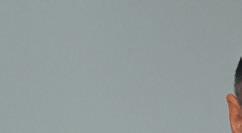

Hrant Dink Hafıza Mekânı Hikâyesi, Istanbul; ■ Polizei-Museum, Istanbul; ■ Thackray Museum of Medicine, Leeds, Großbritannien.
ar zusammenhing: Der Minister sei selbst ein Kind der deutschfranzösischen Versöhnung. Dieser bestätigte: Seine französische Mutter und sein deutscher Vater, der bekannte Journalist Jürgen Liminski, hätten sich seinerzeit im Rahmen des durch den Élysée-Vertrag ins Leben gerufenen Deutsch-Französischen Jugendwerks kennengelernt.







Generalkonsulin Kristina Larischová machte wiederum deutlich, daß es in paneuropäischem Geist gelungen sei, Brücken zwischen Tschechen und Sudetendeutschen zu schlagen.
Posselt, der auch Präsident der Paneuropa-Union Deutschland ist, nutzte die Feierlichkeit im Kölner Hotel Excelsior zu einem Aufruf, gemeinsam und mit allen Kräften gegen die Rückkehr von Krieg und Nationalismus ins Herz Europas anzugehen.


„Allein die Nominierung ist eine großartige Auszeichnung“, freut sich Museumsdirektor Dr. Stefan Planker. Das Sudetendeutsche Museum in München steht im Finale um den Preis „Europäisches Museum des Jahres“. Der Titel wird am 6. Mai auf der Jahrestagung des Europäischen Museums Forums in Barcelona verliehen. Im Wettbewerb stehen noch 32 weitere Museen aus ganz Europa, darunter mit dem Deutschen Museum in Nürnberg und dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhung in Berlin zwei Konkurrenten aus Deutschland.


Das 1977 gegründete Europäische Museums Forum (EMF) zeichnet jährlich ein Museum als Europäisches Museum aus. Bereits vier Mal ging die Auszeichnung nach Deutschland: 1978 an das Städtische Museum Schloß Rheydt in Mönchengladbach, 1992 an das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, 2007 an das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhafen und 2010 an das Ozeaneum in Stralsund.

Das von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und Volksgruppensprecher Bernd Posselt am 12. Oktober 2020 eröffnete Sudetendeutsche Museum beschreibt auf 1200 Quadratmetern 1100 Jahre Geschichte der Deutschen, Tschechen und Juden in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien. Als Institution der Völkerverständigung sind alle Texte und Medien dreisprachig in Deutsch, Tschechisch und Englisch konzipiert. Ein Schwerpunkt der Dauerausstellung ist das Thema Nationalismus im 19. Jahrhundert, das als Kernproblem zwischen Tschechen und Sudetendeutschen aufgearbeitet wird.

Neben der Dauerausstellung werden regelmäßig Sonderausstellungen und Veranstaltungen
angeboten. So fand im November erstmals die Konferenz „Sudetendeutsche Dialoge“ statt, bei der ethnische Minderheiten und Volksgruppen sich ausgetauscht haben. Mit drei hochwertigen Sonderausstellungen hat das Sudetendeutsche Museum ebenfalls bereits Akzente gesetzt. Unter dem Titel „Von

Böhmen in die Ardèche“ wurden im Herbst 2021 neue Bilder von Werner Reinisch gezeigt, der 1930 im Egerland geboren wurde und heute in Frankreich lebt. Es folgte eine Sonderausstellung über Weihnachtskrippen aus Böhmen und Mähren, deren Exponate bei der Vertreibung oft unter Lebensgefahr gerettet wur-
den, wie der Titel „Alles andere ist zu ersetzen...“ andeutet. Ein weiterer Höhepunkt war die in der zweiten Jahreshälfte 2022 gezeigte Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Reliefintarsien aus Eger.
In diesem Jahr, so verrät Dr. Planker, wird es zwei Sonderausstellungen geben: „Ein bisschen
Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten“ vom 21. Juni bis 12. November und „So ein Theater! Marionetten aus Böhmen und Mähren“ vom 8. Dezember bis 13. Februar 2024. Anlaß der Preußler-Sonderausstellung ist der 100. Geburtstages des weltberühmten Kinderbuchautors, der am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren wurde und vor zehn Jahren am 18. Februar 2013 in Prien am Chiemsee verstorben ist.
Dr. Planker: „,Der kleine Wassermann‘, ,Die kleine Hexe‘ und der ,Räuber Hotzenplotz‘ sind Klassiker der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur und verzaubern bis heute Kinder und Erwachsene. Wir werden deshalb ein umfangreiches Begleitprogramm zur Sonderausstellung auf die Beine stellen und damit hoffentlich auch viele Kinder und Jugendlichen begeistern.“ Überhaupt unternimmt das Sudetendeutsche Museum große Anstrengungen, um auch die Jugend anzusprechen. So lädt Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger während der Faschingsferien zu einem Workshop „Tanz auf Papier“ (siehe auch Seite 4) ein und bietet im Rahmen des Ostermarktes der Heimatpflegerin eine offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien an.
Dr. Planker: „Das Sudetendeutsche Museum ist ein lebendiges Museum und ein Ort der kulturellen Begegnung. Es lohnt sich deshalb, das Sudetendeutsche Museum immer wieder zu besuchen und neue Dinge zu entdecken.“
Geöffnet ist das Sudetendeutsche Museum dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Das Haus an der Hochstraße 10 liegt nur wenige Gehminuten vom S-Bahnhof Rosenheimer Platz entfernt. Mehr unter www. sudetendeutsches-museum.de Torsten Fricke
Die Botschafter der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind immer gern gesehene Gäste im Sudetendeutschen
Büro. Der bisherige Botschafter Dominik Furgler stammt aus der deutschsprachigen Stadt St. Gallen, unweit der bayerischen Grenze. Sein Nachfolger
Philippe Guex hat Französisch als Muttersprache und ist mit Recht stolz auf seine Geburtsstadt Fribourg/Freiburg.
Bei seinem Besuch vor wenigen Tagen im Prager SL-Büro galt sein Interesse auch den bereits erreichten Erfolgen um gerechten Ausgleich und Verständi-
gung zwischen dem tschechischen Volk und den Sudetendeutschen.
Für Barton war der Besuch des Schweizer Diplomaten auch symbolisch wertvoll: Als Barton 2002 von München nach Prag wechselte, um dort die sudetendeutsche Vertretung des guten Willens mit aufzubauen, nahm er die Fürbitten des H. Petrus Canisius SJ mit sich, denn dieser kam auch von München in die Hauptstadt Böhmens, um dort die erste Jesuitenvertretung in einem damals schwierigen Land zu errichten. Das Lebenswerk von Canisius endete am 21.12.1597 gerade in Fribourg / Freiburg, wo er auch begraben ist.

❯ Wochenendseminar „Spurensuche“ vom 3. bis 5. Februar 2023 in Bad Kissingen, Teil I

Hoher Besuch am Heiligenhof: Im Rahmen des Seminars der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Zusammenarbeit mit der sudetendeutschen
Bildungsstätte Heiligenhof haben sich die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner über Sudeten.net, das soziale Netzwerk der Sudetendeutschen, informiert.
Die Entwicklung des digitalen
Projektes war durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales maßgeblich gefördert worden. Bereits beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten 2022 in Hof hatte sich der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder vom Ergebnis äußerst beeindruckt gezeigt.



Gegenüber Steffen Hörtler, stellvertretender SL-Bundesvorsitzender und Stiftungsdirektor des Heiligenhofs, äußerte Söder damals den Wunsch, ihm und seinen Kabinettsmitgliedern auch weiterhin über den Fortgang von Sudeten.net zu berichten.
Dieser Bitte konnte Hörtler nun nachkommen: Gemeinsam mit Mathias Heider von der SL-Bundesgeschäftsstelle informierte er die beiden Mitglieder der Staatsregierung Gerlach und Kirchner über die Hintergründe, Funktionsweisen und Zukunftsperspektiven des Netzwerks.
Für MdL Judith Gerlach, seit 2018 erste Bayerische Staatsministerin für Digitales, verband sich damit auch persönliches Interesse: Sie habe, so Gerlach, erst kürzlich von weiter zurückliegenden möglichen sudetendeutschen Wurzeln ihrer Familie erfahren, denen sie nun nachspüren wolle. Dabei könne eine digitale Plattform wie Sudeten. net äußerst hilfreich sein.
Positiv äußerte sich auch MdL Sandro Kirchner, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Inneren: Mit Sudeten.net sei eine Möglichkeit geschaffen worden, Wissen über Heimat und Herkunft von einer Generation auf die nächste zu übertragen. Die Entwicklung der Webseite sei eine sinnvolle Investition des Freistaats in die sudetendeutsche Jugendarbeit.
Beeindruckt zeigten sich die beiden Kabinettsmitglieder auch von der großen Zahl der Teilnehmer am Netzwerk. Mathias
Heider konnte bestätigen, daß Sudeten.net das am schnellsten wachsende soziale Medium der Sudetendeutschen Landsmannschaft bilde. Das Projekt solle daher weiter ausgebaut werden (wir haben berichtet) und bereits in den kommenden Monaten zusätzliche Funktionalitäten erhalten.
Abschließend dankte Steffen Hörtler der Staatsregierung für ihre finanzielle Unterstützung, ohne die das soziale Netzwerk
Auf dem Heiligenhof begrüßte Stiftungsdirektor und SL-Landesobmann Ste en Hörtler (rechts) Digital-Staatsministerin Judith Gerlach und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner zur Sudeten.net-Präsentation.

der Sudetendeutschen nicht hätte verwirklicht werden können. Der Badkommissar
Gustav Binder, im Hauptberuf Studienleiter des Heiligenhofs, im Nebenberuf „Badkommissar“, das heißt Stadtführer in einer historischen Gestalt aus der Zeit um 1910, führte die Seminarteilnehmer durch die Weltkulturerbestadt Bad Kissingen. 2021 wurde Bad Kissingen gemeinsam mit den drei böhmischen Bädern Karlsbad, Marienbad und Franzensbad und weiteren Kurorten zum Unesco-Weltkulturerbe erhoben. Bad Kissingen ist eines von fünf bayerischen Staatsbädern und besitzt sieben Heilquellen, davon vier Trinkquellen und drei Badequellen. Zunächst etablierte sich die Trinkkur. Die beiden wichtigsten Quellen heißen nach dem siebenbürgischen Fürsten Ferenc Rakoczi I. und den Panduren (ungarischen Kämpfern in den Kuruzzenkriegen) und wurden vom aus dem Egerland stammenden Architekten
Balthasar Neumann entdeckt, als er zum Zwecke der Anlage des ältesten Kurparks weltweit die Fränkische Saale verlegte. Das Heilwasser hilft vor allem gegen Magen- und Darmerkrankungen. Durch diese Heilwirkungen wurde Kissingen weltberühmt. Balthasar Neumann, ab 1720 Erbauer der Würzburger fürstbischöflichen Residenz, eines der größten Barockschlösser in Europa und ebenfalls Weltkulturerbe, legte im Auftrag der Landesherren – der Fürstbischöfe – 1738 den Kurgarten in Bad Kissingen als französischen Landschafts-
garten an. Er ist nach wie vor das Aushängeschild Bad Kissingens und wird dreimal im Jahr neu bepflanzt. Im Sommer zieren weit über 100 Palmen diesen Garten und 20 000 Blumen. Balthasar Neumann hat vor allem für die damaligen katholischen Bischöfe, Kirchen und Schlösser gebaut. In der napoleonischen Zeit kam Franken zu Bayern, und die Wittelsbacher, zuvor Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich, wurden zu Königen erhoben. Sie bauten ihre Hauptstadt München nach klassischen Architekturvorbildern aus und schickten einige ihrer berühmtesten Architekten
Petr Pavel lädt




Präsidenten ein
Zur Amtseinführung des neugewählten tschechischen Präsidenten Petr Pavel werden auch die Staatsoberhäupter der Nachbarstaaten eingeladen, hat die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), angekündigt. Pavel, so Pekarová, könne damit eine neue Tradition begründen. Die gemeinsame Sitzung des Abgeordnetenhauses und des Senats, bei der Pavel seinen Eid ablegen wird, findet am 9. März im Vladislavsaal auf der Prager Burg statt. Die designierte Leiterin der Präsidialkanzlei, Jana Vohralíková, sagte, daß es keine Militärparade zur Amtseinführung geben werde. Eingeladen werden Vohralíková zufolge auch Pavels Amtsvorgänger Miloš Zeman und Václav Klaus sowie die Witwe von Václav Havel, Dagmar Havlová.
Präsident Zeman gibt klein bei
Noch-Staatspräsident Miloš Zeman wird vor Ende seiner Amtszeit am 8. März keinen neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts ernennen, hat Premierminister Petr Fiala (ODS) am Sonntag nach einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt erklärt. Zeman hatte ursprünglich angekündigt, einen neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts zu ernennen. Derzeit hat dieses Amt noch bis August Pavel Rychetský inne. Mehrere Verfassungsrichter und auch Premierminister Fiala hatten Zemans Plan abgelehnt.
mehr im Stande war, den Sinn des Prozesses zu verstehen.
Höchstes Defizit seit EU-Beitritt
Mit dem höchsten Defizit seit dem EU-Beitritt hat Tschechiens Außenhandel das Jahr 2022 abgeschlossen. Wie das Statistikamt bekanntgab, beträgt das Minus 198,1 Milliarden Kronen (8,3 Milliarden Euro). Grund sind vor allem die höheren Preise für Öl und Gas in Folge des russischen Angriffskriegs und der Sanktionen.
Bis zu minus
29 Grad Celsius
Der Winter ist doch noch kalt geworden. An mehreren Orten in Tschechien wurden am Montag Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt gemessen. So meldete die Wetterstation Perla bei Außergefild im Böhmerwald minus 29 Grad Celsius. Wegen der großen Kälte gelten derzeit für mehrere Gegenden Tschechiens Wetterwarnungen. Rekordwerte wurden allerdings nicht erreicht. So hatte man 2012 in Außergefild sogar minus 39 Grad gemessen.
Kritikerpreise für den Film „Arvéd“
in die Provinz, wo sie großartige Bauten hinterließen. Für Bad Kissingen sind das vor allem Friedrich von Gärtner, Johann Gottfried Gutensohn und Max Littmann. Ersterer hat in Kissingen 1838 die Arkaden mit dem Konversationssaal, das Krughaus, das Gebetshaus für die Protestanten sowie die Ludwigsbrücke konzipiert. Johann Gottfried Gutensohn ist in Bad Kissingen mit vier Gebäuden vertreten: dem Hotel Kalv von Hess, der Boxberger-Apotheke, dem Balling-Haus und dem Westendhaus. Max Littmann ist einer der ganz großen Theaterarchitekten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hat in Bad Kissingen 1905 das Kurtheater, 1911 bis 1913 die Wandelhalle, den Regentenbau, den Maxbrunnen sowie 1926 das Kurhausbad gebaut.
Aufgrund des Zusammenbruchs des Tourismus sind nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge und Vertriebene aus früheren deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten in Bad Kissingen untergebracht worden.
So wurde auch die 1952 zum Verkauf stehende Herrenvilla Heiligenhof von Sudetendeutschen entdeckt und vom damaligen Sudetendeutschen Sozialwerk zum Zwecke der Jugendund Verbandsarbeit ausgebaut.
Diesem Zweck dient der Heiligenhof in veränderter und stets erneuerter Form bis in die Gegenwart. In Bad Kissingen wurden daher auch die Bundesverbände der Deutschen Jugend des Ostens sowie der Sudentendeutschen Jugend gegründet. Auch diese Einrichtungen bestehen bis heute.
Der frühere kommunistische Premierminister und ehemalige Minister für Inneres und Landwirtschaft, Lubomír Štrougal, ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Gegen Štrougal, der während der kommunistischen Diktatur 19 Jahre lang Mitglied des Kabinetts war, wurde zuletzt wegen der Tötung von Flüchtlingen an der tschechoslowakischen Grenze ermittelt. Das Strafverfahren wurde allerdings eingestellt, da Štrougal mehreren Gutachten zufolge nicht
Den tschechischen Kritikerpreis für den besten Film 2022 hat am Samstagabend „Arvéd“ von Vojtěch Mašek gewonnen. Das Mystery-Psychodrama über den Denunzianten und Okkultisten Jiří Arvéd Smíchovský bekam auch die Preise für das beste Drehbuch und den besten Darsteller. Als bester Regisseur wurde Adam Sedlák für „Banger“ ausgezeichnet, die Geschichte eines Drogendealers, gedreht auf einem Mobiltelefon.
Historische Tram fährt durch Prag
Seit Sonntag ist in Prag die historische Tram Tatra K2 unterwegs. Die Wagen, deren Produktion 1977 eingestellt wurde und die zuletzt in Preßburg als Fahrschulfahrzeuge im Einsatz waren, werden auf den historischen Linien 42 und 41 sowie auf der aktuellen Linie 23 eingesetzt.
ISSN 0491-4546


Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
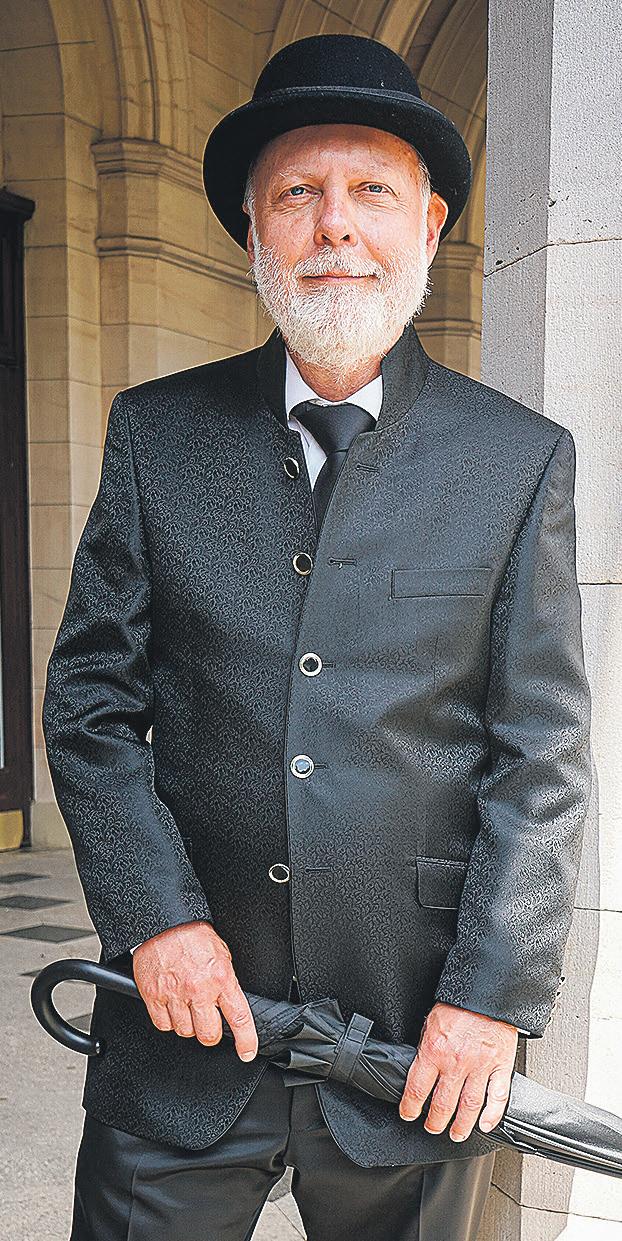


Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
„Ehrensache Ehrenamt“
Aus dem Leben der Stadt Geretsried ist sie nicht wegzudenken: die Egerländer Gmoi z‘ Geretsried. Zu ihren Aktiven gehört Helmut Hahn, ein Ehrenamtler durch und durch, den das Vorbild seines Egerländer Vaters und seines ungarndeutschen Großvaters motiviert, sich in und für die Gemeinde auf verschiedenen Ebenen zu engagieren.
Geretsried ist mit 26 000 Einwohnern die größte Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und gleichzeitig eine sehr junge Stadt. Die Stadterhebung erfolgte im Jahr 1970 – Geretsried ist eine der Städte, die durch die Vertreibung von Sudetendeutschen und ihrer Aufnahme in Bayern entstanden sind.
Als 1946 Heimatvertriebene aus dem Egerland auf dem Gebiet des heutigen Geretsried ankamen, fanden sie südlich von Wolfratshausen nur die Reste zweier demontierter Munitionsfabriken sowie ein ehemaliges Arbeiterlager und ein ehemaliges Verwaltungsgebäude vor. In dem Arbeiterlager und dem Verwaltungsgebäude wurden die aus Graslitz, Karlsbad und Tachau vertriebenen Egerländer untergebracht. Aus dieser vorübergehenden Behausung erwuchs nach und nach eine Gemeinde mit Handwerksbetrieben und Industrieansiedlungen. 1949 wurden auf dem Gelände der Munitionsfabriken erste Wohnungen gebaut, ein Jahr später wurde schließlich die Gemeinde Geretsried gegründet.
Folgt man einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 1949, so waren die Egerländer damals von zwei Zielen geprägt gewesen: erstens von dem Wunsch, Anerkennung bei der ortsansässigen Bevölkerung zu gewinnen „durch den Beweis des guten Willens und durch Leistungen“ und zweitens vom Bestreben, ihr Brauchtum und ihre Kultur zu erhalten. Entsprechend wurde schon 1946 eine Sing-, Spiel- und Tanzgruppe ins Leben gerufen, 1951 folgte die Gründung der Eghalanda Gmoi. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte Hans Hahn, damals 23 Jahre alt und gebürtig aus Sittmesgrün im Egerland. In Geretsried lernte er seine Frau Anni kennen, eine Donauschwäbin aus dem ungarischen Pusztavám, das sie gleichsam hatte verlassen müssen. Sie heirateten und gründeten eine Familie. Bereits mit neun Jahren tanzte Sohn Helmut in der Kindergruppe der Eghalanda Gmoi. Hans Hahn war sehr aktiv in vielen Vereinen und Institutionen, erinnert sich sein Sohn Helmut, der erst zwölf Jahre alt war, als sein Vater 46-jährig starb. Das Engagement seines Vaters hat den Sohn sehr geprägt, genauso wie sein ungarndeutscher Großvater: Sein halbes Dorf habe dieser per Pferdetreck nach Bayern gebracht und noch während des Krieges mit einem gemieteten Viehwaggon gut 30 Verwandte aus der damaligen Tschechoslowakei gerettet, erinnert sich der Enkel: „Sich zu kümmern und nicht untätig zusehen war bei meinem Vater und meinem Großvater normal.“
Diese Haltung hat Helmut Hahn übernommen. Die Liste der Vereine, in denen er tätig ist, ist lang. Er ist selbst Vüarstäiha der Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried e.V., aktiv im Bund der Egerländer Gmoin, außerdem bei den Deutschen aus Ungarn und den Siebenbürger Sachsen. Zudem spielt Hahn die Tuba bei der Gartenberger Bunkerblasmusik, die
❯ Rußlanddeutsche Söder und Scharf beim BKDR
Gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Rußland (BKDR) in Nürnberg besucht. Söder lobte deren Engagement für den Freistaat anläßlich des Doppeljubiläums: „30 Jahre Spätaussiedler in Bayern und vier Jahre Bayerisches Kulturzentrum der Deutschen aus Rußland in Nürnberg. Es ist mir eine Freude und Ehre heute hier zu sein. Großer Respekt und Dank für die Spätaussiedler- und Vertriebenenverbände. Sie sind die eigentlichen Botschafter für Frieden und Miteinander. Sie schlagen Brücken, suchen Verbindungen und leben Gemeinsamkeiten. Sie sind ein wertvoller Teil des Freistaats Bayern. Wer seine Wurzeln verliert, der verliert sich irgendwann selbst.“

Egerländern aktiv sind, sodaß das Engagement bei den Egerländern die gesamte Familie verbindet: „Es macht uns als Familie eine große Freude, wenn wir bei der Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried, der Gartenberger Bunker Blasmusik oder der Egerland Jugend gemeinsam singen, tanzen oder Musik spielen.“
Die Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried ist die größte und aktivste in Deutschland. Mit ihren Aktivitäten hat sie sich fest in das Kulturleben von Geretsried eingeschrieben. Im Winter feiert sie dort die Egerländer Fosnat mit einem Weiberfaschingsball und Maskenball. Am Faschingsdienstag sind sie in der Stadt mit einem eigenen Stand vertreten.
er mitgegründet hat und die nach einem Geretsrieder Stadtteil benannt ist. Er übernimmt Dienste im Geretsrieder Heimatmuseum, an dessen Entstehung sein Vater federführend beteiligt war. Außerdem kümmert er sich um die Städtepartnerschaft mit dem norwegischen Eidsvoll, unterstützt aktiv den Arbeitskreis Historisches Geretsried und passiv die Freiwillige Feuerwehr ebenso wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), den Deutschen Alpenverein, das Rote Kreuz und einige weitere.
Soviel Einsatz hat ihm mehrere Ehrungen eingebracht, unter anderem das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für besondere Verdienste in Ehrenamt und zuletzt im vergangenen Jahr den Kulturpreis der Stadt Geretsried. Es hat ihn aber auch viel Zeit gekostet und –wie er anläßlich der Kulturpreisverleihung 2022 bekannt hat –an den Rand eines Burn-Outs gebracht. Kraft schöpft er „aus dem unglaublichen Zusammenhalt, den es bei den Egerländern gibt und der uns zu einer großen Fa-
milie macht“ und dank seiner Familie. Seine Frau Bärbel stammt aus Hessen, ihre Eltern aus Gehrsdorf in Nordböhmen und aus Iglau. Kennengelernt haben sich Bärbel und Helmut Hahn auf dem Bundestreffen der Egerland Jugend 1986 in Geretsried und anschließend immer wieder auf Treffen gesehen. Als Bärbel Ende der 1990er Jahre beruflich nach Murnau und Starnberg ging, wurden die beiden ein Paar. Sie haben zwei Töchter, Leonie und Johanna, die ebenfalls bei den

❯ Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verachtfachte sich die Einwohnerzahl Vertriebenestadt Geretsried
Dort, wo sich heute die Stadt Geretsried befindet, war früher der Forst von Wolfratshausen.
Hier, südlich von Wolfrathausen und rund dreißig Kilometer von München entfernt, wurden 1938 zwei Munitionsfabriken errichtet. In Massenwohnlager waren die Arbeiter untergebracht, viele von ihnen Zwangsarbeiter aus Polen, Rußland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien.
Nach Kriegsende ließ die amerikanische Militärregierung den Rüstungsbetrieb demontieren. Das nördlich gelegene La-
ger Föhrenwald bei Wolfratshaus, ursprünglich erbaut als Wohnsiedlung für die Beschäftigten der Munitionsfabrik Dynamit Aktiengesellschaft, wurde nach Kriegsende zum Auffanglager für jüdische Displaced Persons, die überwiegend aus dem östlichen Europa stammten. Der nationalsozialistischen Judenvernichtung entkommen, war Föhrenwald für sie nun eine Zwischenstation, von der aus sie nach Israel, in die USA oder nach Kanada auszuwandern hofften.
Das weiter südlich gelegene Lager Buchberg wurde ab 1946 zunächst zur provisorischen
Wohnstätte für heimatvertriebene Egerländer aus Graslitz, Karlsbad und Tachau. Die kleine Ortschaft Geretsried hatte 1945 nur 261 bodenständige Einwohner. Durch die Heimatvertriebene verachtfachte sich diese Zahl bis 1950, weshalb zum 1. April 1950 eine neue Gemeinde gegründet wurde.
Namensgebend wurde mit Geretsried eine Ortschaft, deren Ursprünge auf das 11. Jahrhundert zurückgehen. Bei der Gründung hatte die neue Gemeinde 2152 Einwohner, Ende 1960 waren es 7334 und heute sind es etwa 25 000.
Wenn dann am Karfreitag und Karsamstag die Kirchenglokken schweigen, gehen die sogenannten Ratschenkinder mit ihren selbst gebauten Ratschen dreimal täglich durch den Ortsteil Gartenberg und kündigen so das bevorstehende Osterfest an.





Am 1. Mai stellt dann die Gmoi den Egerländer Maibaum auf, der von allen Geretsrieder Trachtengruppen, also den Siebenbürger Sachsen, den Deutschen aus Ungarn, den Banater Schwaben, der Griechischen Gemeinde und eben den Egerländer angetanzt wird. Die Sonnenwendfeier begeht die Gmoi mit einem Fest für die ganze Familie. Auch vom Geretsrieder Christkindlmarkt sind die Egerländer und ihr Stand nicht mehr wegzudenken, wo die Gmoi Liwanzen und Bahschnitz verkauft. Letzteres ist ein Brot, das auf heißer Ofenplatte geröstet und mit Knoblauch und selbst ausgelassenem Schweineschmalz bestrichen wird.
Zu den festen Terminen im Jahreskreis gehört zudem der Sudetendeutsche Tag, den die Gmoi mit Musik- und Tanzdarbietungen sowie durch das Tragen ihrer Egerländer Tracht bereichert. Aber auch außerhalb des sudetendeutschen Kulturlebens sind die Egerländer aus Geretsried bekannt: Alljährlich sind sie fester Bestandteil des Oktoberfestzugs und treten während der Wiesn mit ihren Tänzen auf der Oidn Wiesn auf.
 Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, sagte: „Vor 30 Jahren ist das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz in Kraft getreten – ein Meilenstein der Integration der Deutschen aus Rußland, der im BKDR aktiv gelebt wird. Dieses Gesetz hat vielen Menschen den Weg in unsere Gesellschaft erleichtert. Es hat zentrale Bedeutung, dass über Geschichte, Schicksal und Kultur der Deutschen aus Rußland informiert wird. Heute feiern wir gemeinsam die wichtige politische Weichenstellung von 1993 und sind dankbar für das Engagement der Deutschen aus Rußland in unserer Gesellschaft. Sie sind Vorbilder der Völkerverständigung. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist dies wichtiger denn je.“
Das Gesetz regelte die Spätaussiedlung. Demnach ist Spätaussiedler der, der das Herkunftsland im Wege des Aufnahmeverfahrens nach dem 31. Dezember 1992 verläßt beziehungsweise verlassen hat.
Das Gesetz war ein Paradigmenwechsel beim sogenannten Kriegsfolgenschicksal. Es konnten nicht nur Ehegatten und minderjährige Kinder, sondern alle unmittelbaren Verwandten in den Aufnahmebescheid des Spätaussiedlers einbezogen werden. „Für viele Familien machte dies die Entscheidung, ob sie ausreisen sollen oder nicht, unendlich viel leichter: Jetzt konnten sie trotz Ausreise zusammenbleiben. Das war eine großartige familienfreundliche Ausweitung der Aufnahme“, so die Staatsministerin.
Dr. Viktor Krieger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am BKDR, wies in seinem Vortrag darauf hin, daß das kollektive Kriegsfolgenschicksal, das heißt die Annahme fortwirkender Benachteiligungen für die deutschen Minderheiten, nur bei Personen aus den Staaten der ehemaligen UdSSR, ausgenommen der baltische Staaten, anerkannt werde. Seitdem wurden etwa 1,7 Millionen Personen als Spätaussiedler aus den postsowjetischen Staaten aufgenommen. Insgesamt leben in Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen mit rußlanddeutschen Wurzeln. Davon circa 400 000 in Bayern.

■ Samstag, 11. Februar, 10.30 bis 15.30 Uhr, Landesfrauenreferentin Dr. Sigrid Ullwer-Paul: Landesfrauentagung Bayern. Neben verschiedenen Mundartsprechern werden Heimatpflegerin Christina Meinusch und die stellvertretende Bezirksfrauenreferentin von Niederbayern/ Oberpfalz, Helga Olbrich, referieren. Kolping-Haus, AdolphKolping-Straße 1, Regensburg. Anmeldung bei der SL-Landesgruppe Bayern unter Telefon (0 89) 4 80 03 46 oder per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by.de
■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2, Puchheim. Eintritt frei.
■ Mittwoch, 15. Februar, 18.00 Uhr: Das Vocal Ensemble Mixed Voices unter Leitung von Roland Hammerschmied gestaltet den musikalischen Teil des Abendgottesdienstes. Im Anschluß folgt ein 30minütiges Konzert. St. Michael, Neuhauser Straße, München.
■ Donnerstag, 16. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Hannah. Ein gewöhnliches Leben“. Dokumentarfilm über Hana Frejková, die sich künstlerisch mit dem für ihre Familie traumatischen Antisemitismus in der Tschechoslowakei auseinandersetzt. Begleitet durch einen Kurzvortrag von Martin Schulze-Wessel, der die Slánský-Prozesse, in deren Rahmen unter anderem Ludvík Frejka zum Tode verurteilt wurde, in den geschichtlichen Kontext einordnet. Moderation: Zuzana Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Collegium Carolinum und der Petra-Kelly-Stiftung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Eintritt frei.
■ Samstag, 18. Februar, 13.30 bis 16.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Frankfurt am Main: Böhmisches Schmankerlessen im Restaurant Prager Botschaft. Neben gutem Essen gibt es Kurzvorträge und schwungvolle böhmische Musik mit dem beliebten Duo Katrin Liedtke und Rudi Mohr. Voranmeldung an die Geschäftsstelle unter Telefon (06 11) 30 37 68 (8.30 bis 13.30 Uhr). Restaurant Prager Botschaft, Im Prüfling 28, Frankfurt am Main.
■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-MetzHalle, Volkhardtstraße, Zirndorf. Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.
■ Donnerstag, 23. Februar, 13.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Tanz auf Papier. Wir bringen Museumsobjekte und eigene Zeichnungen in Bewegung“. Workshop mit Nadja Schwarzenegger für Kinder ab 10 Jahren in den Faschingsferien. Anmeldung erbeten bis 14. Februar an eMail anmeldung@sudetendeutschesmuseum.de
■ Dienstag, 28. Februar, 18.30 Uhr, Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste: „Goethe in Böhmen –oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.
■ Dienstag, 28. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Tschechien erlesen. Deutsch-tschechische Familiengeschichten“. Alice Horáčková (Rozpůlený dům; Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika Jonášová (Ada, 2022) setzen sich in ihren Werken kritisch mit dem deutsch-tschechischen Zusammenleben anhand ihrer persönlichen Familiengeschichte aus-
einander. Moderation: Zuzana Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Tschechischen Zentrum München. Tschechisches Zentrum München, Prinzregentenstraße 7, München, Eintritt frei.
■ Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Český klub Zürich in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder: „Arnošt Lustig: Tacheles“. Autor und Journalist Karel Hvížďala stellt dem Schweizer Publikum sein Buch über Arnošt Lustig vor, der kurz vor seinem Tod in Form von Gesprächen Einblick in sein bewegtes Leben gewährte. Moderation: Eva Lustigová. Bar und Buchhandlung „sphères“, Hardturmstraße 68, Zürich.
■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).
■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 12. März, Tschechisches
Zentrum: Mittel Punkt Europa
Filmfest 2023. Das 2016 gegründete Festival des mittel(ost)europäischen Films präsentiert jedes Jahr handverlesene Produktionen aus den östlichen Nachbarländern Polen, Tschechien, Ungarn, Belarus sowie der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter www.mittelpunkteuropa.de. Filmmuseum München, Sankt-Jakobs-Platz 1, München.
■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: Sudetendeutsches Gedenken zum 104. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht 78 Jahre nach Beginn der Vertreibung. Festredner MdEP a.D. Andreas Mölzer. Musikalische Umrahmung durch das Bläserquartett Weinviertler Buam. Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Mittwoch, 8. März, 13.00 bis 22.30 Uhr: Weltfrauentag im Sudetendeutschen Museum in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum München. 13.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus Mohr. 16.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus Mohr. 19.30 Uhr: Konzert der tschechischen Frauenrockgruppe K2 im Adalbert-Stifter-Saal. Hochstraße 10 und 8, München.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Montag, 13. März, 11.00 bis 17.00 Uhr: „Unsere Heimatsammlung“. Treffen für Betreuer sudetendeutscher Heimatstuben. Anmeldung bis 6. März unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
■ Mittwoch, 15. März, 19.00 Uhr: „Erinnerungen an das Internierungslager Hodolein in Olmütz – Das Tagebuch der Dr. Erika Fröhmel“. Vortrag und Podiumsdiskussion. Ein Forscherteam um Prof. Anabel Buchenau von der University of North Carolina at Charlotte folgte den Spuren der zunächst unbekannten Autorin eines maschinengeschriebenen Büchleins, das bei einer Auktion in Detroit verkauft wurde. Sie stießen auf die Vita der leitenden Lagerärztin des tschechischen Internierungslagers für Sudetendeutsche in Hodolein, aus deren Bericht über Jahrzehnte anonymisiert zitiert wurde. Es entfaltet sich die Ge-

schichte des berüchtigten Lagers und der Erinnerung daran. Zugleich geht es exemplarisch um die Möglichkeiten, über 75 Jahre danach Spuren zu finden in deutschen und tschechischen Archiven. Eintritt frei. Dokumentationszentrum Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, Berlin.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 26. März, 9.00 bis 16.00 Uhr: Landesfrühjahrstagung „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“ (siehe auch Seite 13). Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.
■ Sonntag, 26. März, 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Auf a Melange im Café Central“. Konzeption im Auftrag des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg mit Anna-Sophia Krauss (Violine), Christoph Weber (Klavier), Carsten Eichenberger in der Rolle des Kellners Leopold und Iris Marie Kotzian (Sopran). Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.
■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 17.00 Uhr: „Offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien zum Ostermarkt der Heimatpflegerin“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
■ Dienstag, 18. April, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Heimaterinnerungen. Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren mit Autorin Gunda Achterhold. Weitere Termine am 2., 16. und 30. Mai sowie 13. Juni. Teilnahmegebühr pro Termin: 15 Euro. Anmeldung erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Das diesjährige Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien“. Marienbad. Weitere Informationen über die Geschäftsstelle des Sudetendeutschen Rates unter

Telefon (089) 48 00 03 60 oder per eMail an sudetenrat@aol.com
■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.
■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).
■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr: Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: Themenführung durch die Dauerausstellung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Sammlungsleiter Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00 Uhr: Familienführungen mit der Museums-pädagogin Nadja Schwarzenegger. Anmeldung bis 19. Mai unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de erwünscht. 14.00 bis 15.00 Uhr:
„Götz Fehr: Tu Austria felix“ –eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“ im AdalbertStifter-Saal. 16.00 bis 17.00 Uhr : Themenführung durch die Dauerausstellung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Kuratorin Eva Haupt. 18.00 bis 18.30 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“ im Adalbert-StifterSaal.
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise, die Verleihung des Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Ausführliches Programm folgt.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.

■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.
Programm folgt.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
❯ Podiumsgespräch am Dienstag, 14. Februar
■ Dienstag, 14. Februar, 19.00 Uhr: Podiumsgespräch: „Steppenkinder und die Ukraine – Über die ukrainischen Bezüge der Rußlanddeutschen früher und heute“.
Teilnehmer: Edwin Warkentin (Detmold) und Ira Peter (Mannheim). Moderation: Professor Dr. Andreas Otto Weber (Direktor des HDO).

Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München. Was haben Rußlanddeutsche mit der Ukraine zu tun?
Insbesondere in dem Jahr des Krieges Rußlands in der Ukraine stellen Ira Peter und Edwin Warkentin das unter Beweis. In „Steppenkinder. Der Aussiedler-Podcast“ sprechen die beiden über ukrainische Regionen, in denen deutsche Ge-
meinschaften seit deren Ansiedlung unter den Zaren bis zu den stalinistischen Repressionen lebten.
Ira Peter ist Medien- und Kulturschaffende und war 2021 Stadtschreiberin des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Odessa.
Edwin Warkentin leitet das Kulturreferat für Rußlanddeutsche am Museum für rußlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold und war bis 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag unter anderem mit Fragen der europäischen Perspektiven der Ukraine betraut.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kulturreferat für Rußlanddeutsche am Museum für rußlanddeutsche Kulturgeschichte statt.
■ Samstag, 11. Februar, 16.00 bis 18.00 Uhr: Onlineseminar „Erinnerung neu gedacht? Von der Umnutzung eines NKVD- und Gestapo-Gefängnisses in Litauen“. Gespräch mit Prof. Dr. Felix Ackermann, Professor für Public History. Veranstaltung für historisch-politisch Interessierte.
Das Lukiškės-Gefängnis (Foto) in Wilna (Vilnius), der Hauptstadt Litau-
ens, ist ein Mikrokosmos der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Baltikum. Es wurde vom Deutschen Reich in zwei Weltkriegen für die Durchführung von Repressionen genutzt. Von 1941 bis 1942 befand sich hier ein Durchgangslager für Wilnaer Juden auf dem Weg zur Erschießungsstätte in Panerai. Die doppelte Sowjetisierung Litauens fand in den Gefängnismauern unter der Aufsicht des NKVD statt. Noch Ende der 1940er Jahre wurden politische Gegner hingerichtet, die zuvor in Lukiškės in Untersuchungshaft festgehalten wurden. Der Gefängniskomplex wurde noch bis 2017 genutzt. Seither wird er Schritt für Schritt zu einem Kulturzentrum umgewandelt. Im Sommer lädt eine Jägermeister-Bar zum Verweilen ein, und Netflix drehte hier eine Staffel der Erfolgs-Serie „Stranger Things“. Das Projekt Lukiškės 2.0 ist ein Sinnbild für den Aufbruch von Litauen ins 21. Jahrhundert, über dem stets der Schatten des 20. Jahrhunderts liegt. Teilnehmer können sich über den Link https://zoom.us/meeting/ register/tJIsf--gqzMqG9cjTvZT8mWRzM3xgrAeRrUH anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Heiligenhofs (www.heiligenhof.de) unter Unsere Seminare/Seminarprogramm.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
� Gedenkveranstaltung in der Tschechischen Botschaft an den Holocaust-Überlebenden und Brückenbauer Felix Kolmer
Im Rahmen des 78. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz, dem Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, hat die Tschechische Botschaft in Berlin einen Abend dem Gedenken an Felix Kolmer gewidmet, „den Mann, der uns alle besser werden ließ“.
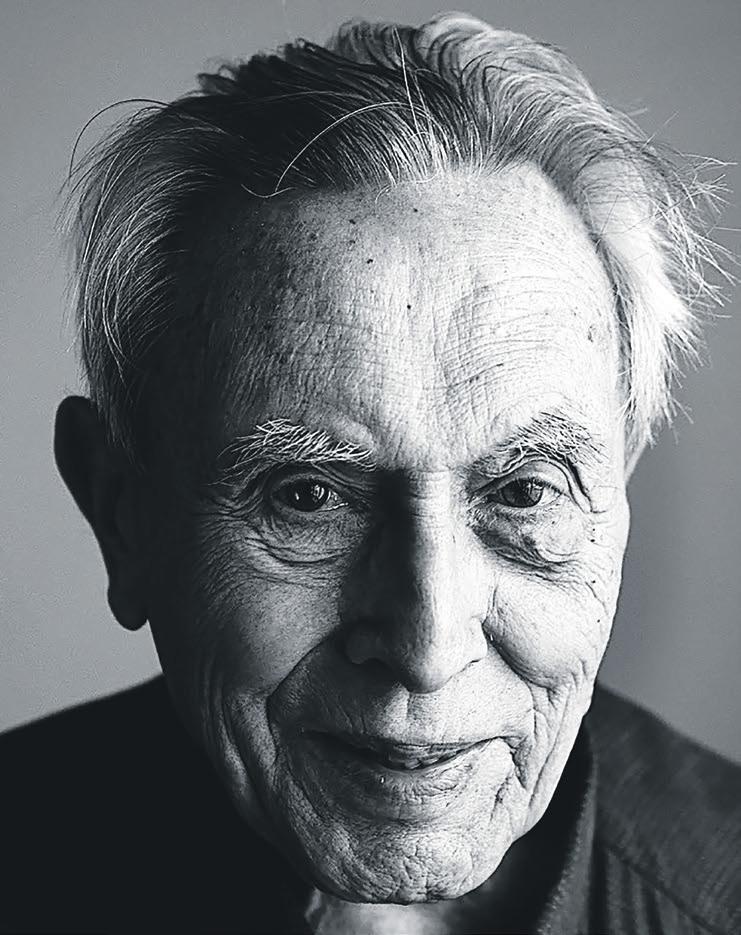
Der Prager Jude, der im vergangenen Jahr noch seinen 100. Geburtstag feiern konnte, verstarb am 5. August im jüdischen Altersheim Hagibor in seiner Geburtsstadt, und viele Bekannte und Freunde aus Berlin und Prag trafen sich zu seinem Andenken.
Auf dem Podium im Kinosaal der Botschaft erinnerten Botschafter Tomáš Kafka, Schriftsteller und Exekutivdirektor des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, Marta Malá vom Holocaust Fond, Auschwitz-Komitee der Tschechischen Republik, die ehemalige Schulleiterin des LeibnitzGymnasiums in Berlin, Christina Rösch, und die Enkelin Michaela Rozov vom Auschwitz-Komitee Tschechiens, die ein Buch zu ihres Großvaters 100. Geburtstag herausgab, an Felix Kolmer.

Sein Wirken war geprägt von den Erfahrungen in den Konzentrationslagern in Theresienstadt und Auschwitz. Er war darum bis zuletzt Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, aber auch eine gewichtige Stimme der deutsch-tschechischen Verständigung, wo er sich vor allem für die Entschädigung aller Überlebenden der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager und die Zwangsarbeiter einsetzte und wo er viele Jahre im Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond mitarbeitete. Gerade in den letzten zwanzig Jahren suchte er als Zeitzeuge das Gespräch mit jungen Menschen in Deutschland, häufig in Berliner Schulen.
Rückblick: Der Lebensweg von Felix Kolmer nahm am 24. November 1941 einen dramatischen Verlauf, als er als Mitglied des sogenannten Aufbaukommandos, bestehend aus 342 jungen Juden, nach Theresienstadt transportiert wurde, wo sie die schreckliche Aufgabe hatten, ein Konzentrationslager zu errichten. Dort war er drei Jahre lang, seine Mutter verstarb zwei Tage nach ihrer Ankunft im Dezember 1941, seine Großmutter und Liane Forgácsová, die er am 14. Juni 1944 im Ghetto heiratete, wurden ebenso nach Theresienstadt deportiert. Am 16. Oktober 1944 wurde Kolmer nach Auschwitz verschleppt, wo die Überlebenschancen extrem gering waren. Mit viel Glück überlebte er viele gefährliche Situationen und floh schließlich bei einem Luftangriff der Alliierten.

Nach dem Krieg studierte er an der Fakultät für Elektrotechnik der Tschechischen Technischen Universität Prag, wurde ein weltweit anerkannter Akustiker, wobei er beispielsweise auch für die Akustik des ehemaligen Parlamentsgebäudes der Ersten Republik, dem Rudolfinum in Prag, das wieder zu einem Konzerthaus umgebaut wurde, verantwortlich zeichnete.
Als Professor lehrte er an der Filmund Fernsehfakultät der Akademie der Musischen Künste (FAMU), veröffentlichte 180 wissenschaftliche Publikationen und sieben Bücher, hielt Vorträge in der ganzen Welt und war Mitglied der Internationalen Akustikkommission der Unesco und korrespondierendes Mitglied der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften.
Nach dem Tod seiner Frau Liane im Jahr 1984 lebte er mit Véra Bezecná, einer Tschechin aus Wien, die nach dem Anschluß Österreichs als politischer Flüchtling nach Prag kam und mit der er schon aus seiner Gymnasialzeit befreundet war, zusammen. Gemeinsam setzten sie sich für die Rechte der Opfer des Naziterrors ein.
Botschafter Kafka erinnerte an Kolmers Rolle als faktischer Außenminister der Holocaust-Opfer, Christoph Heubner an die freundliche Art Felix Kolmers, der schon früh für sich beschloß, nicht hassen zu wollen. Marta Malá erzählte von ihrer ersten Begegnung vor zwanzig Jahren im Holocaust-Komitee und den letzten drei Jahren seines Lebens schon in Hagibor, wo sie keine gemeinsamen Bildungs- oder Erinnerungsrei-
Der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 ist seit 1996 in Deutschland und seit 2005 international der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Zwischen 1940 und Januar 1945 waren knapp über 400 000 Häftlinge in den drei Konzentrationslagern Auschwitz und seinen Nebenlagern registriert. Durch die vielen unregistrierten Opfer lag die Gesamtzahl jedoch weit höher, denn die meisten Deportierten wurden ohne Registrierung unmittelbar von der Rampe ins Gas geschickt. Allein die Anzahl der nach Auschwitz deportierten oder dort geborenen Kinder liegt bei etwa 232 000, von denen wiederum nur wenige überlebten. In den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende waren Teile der Häftlingsunterlagen verschollen, es konnten daher vielfach nur Schätzungen publiziert werden. Die Zahl der Ermordeten beläuft sich demnach auf 1,1 bis 1,5 Millionen.
Foto: Archives of the Auschwitz Memorial

Aus der Schublade holte ich ein kleines altes Portrait eines gutmütig und klug aussehenden Rabbiners mit der noblen Kopfbedeckung osteuropäischer Juden heraus. Eine schöne Sache, die an die guten Zeiten erinnert, als Juden in Europa noch relativ unbehelligt gelebt haben, aus dem 19. Jahrhundert, lange vor dem Holocaust, denke ich mir. Ich freute mich sehr über diese hübsche Kleinigkeit. Wie Oma Véra liebe ich Antiquitäten, und ich dankte Opa Felix herzlich. Aber wie immer ist es noch nicht erledigt. ,Warte bitte‘, sagte er, ,das Wichtigste dazu, muß ich dir noch sagen.‘
Gegenwärtig ist Fasching. Nachdem in den letzten zwei Jahren die „Fünfte Jahreszeit“ aufgrund von Corona nur sehr eingeschränkt gefeiert werden konnte, finden jetzt wieder viele Veranstaltungen statt. Von den Organisatoren der zahlreichen Bälle, Umzüge und Prunksitzungen ist zu hören, daß sie mit dem Besucherzustrom sehr zufrieden seien. Das ausgelassene Feiern, die Freude, das Lachen und das Fröhlichsein haben wir also nicht verlernt. Gut so!
Wer sich nur dem Ernst des Lebens hingibt, wer die Regelmäßigkeit des Alltags niemals zu unterbrechen wagt, der kann auf Dauer nicht glücklich werden. Es braucht Zeiten und Orte, an denen wir „Fünfe auch mal gerade sein lassen“, wie das bekannte Sprichwort sagt. Der Fasching ist auf diese Weise ein Ventil, durch das wir manchen Druck, der sich in unserem Leben immer wieder aufstaut, ablassen. Unser menschliches Dasein verliert dadurch an Schwere. Oftmals ergeben sich nach Situationen ausgelassener Fröhlichkeit sogar neue Perspektiven, von denen wir vorher noch gar nichts ahnten.
sen nach Auschwitz mehr unternehmen konnten, er aber immer noch für den Flüchtlingsfonds und die Umwandlung des Auschwitz-Komitees arbeitete. Die Schulleiterin im Ruhestand, Christina Rösch, die auch in Prag arbeitete, wo sie Kolmer Mitte der 1990er Jahre kennenlernte, berichtete über ihren und ihres Mannes Anstoß zu Zeitzeugen-Begegnungen in Berliner Schulen, die Kolmer sofort zusagte und was für eine fruchtbare Art diese Begegnungen mit der Jugend das waren. Das siebte Enkelkind von Felix Kolmer, Michaela Rozov, präsentierte das Foto-Buch „Ein Versprechen F. K.“ zum 100. Geburtstag von Felix Kolmer, das im Positif-Verlag Prag herausgegeben wurde und 2022 einen Preis des Tschechischen Zentrums für Literatur für
das schönste Buch des Jahres gewonnen hat. Das Beiheft zum Buch versammelt eine Vielzahl von Erinnerungen an Begegnungen mit Felix Kolmar, so auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem ehemaligen deutschen Botschafter Christoph Israng oder dem deutschen Beiratsvorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Christian Schmidt.
Ihr Großvater habe das Buch noch gesehen, erzählte die Enkelin und berichtete von der letzten Begegnung: „Es war im Sommer, Ende Juni 2022. Mit 100 Jahren und zwei Monaten war sein Gehirn klar wie immer. Und wie immer hatte er einen genauen Plan. Mein Großvater sagte: ,Siehst du dort diese kleine Schublade? Darin ist ein Geschenk von mir für deine Arbeit an dem Buch.‘
Und er begann zu erzählen: ,Dieses Bild gehörte meiner ersten Frau Liane, die ich in Theresienstadt heiratete. Ihr Onkel war ein Manager in Kladno. In einem der größten Unternehmen in Böhmen, das einer jüdischen Familie gehörte. Dort war der Onkel angestellt. Und dieses kleine Bild hatte er in seiner Kanzlei aufgehängt. Als die SS mit ihren tschechischen Helfern kam, um das Unternehmen zu arisieren, wollte der treue Manager den Verbrechern keine Dokumente übergeben. Und wurde dort gnadenlos direkt in seiner Kanzlei totgeschlagen, ermordet. Seine Frau, die später kam, um die Leiche zu identifizieren, nahm das Bild mit zu sich nach Hause. Der alte Rabbiner auf dem Bild hat den Mord gesehen. Jetzt sehe ich den Mord auch, durch seine Augen.‘ Ja, jetzt weiß ich, es sind keine süßen Memorabilien, die mein Großvater verschenkte. Es ist eine weitere der Millionen Tragödien, die während des Holocausts geschehen sind, und von der Felix Kolmer erzählt hat.“
Das Buch, das seine Enkelin vorstellte, enthält neben historischen und neueren Fotos von Felix Kolmer und seinen Lebensorten auch viele kurze Zitate zu seinen Erlebnissen, aber auch Einsichten, wie: „Die Jugend. Offen über die Lager zu sprechen und sich an sie zu erinnern, ist der einzige Weg, um möglicherweise zu verhindern, daß so etwas noch einmal passiert. Ich sage möglicherweise, denn man kann sich nie sicher sein, und der Antisemitismus ist wieder auf dem Vormarsch. Allerdings kann es Antisemitismus auch ohne nur einen einzigen Juden geben.“
Gedachten in der Tschechischen Botschaft des Holocaust-Überlebenden und Brückenbauers Felix Kolmer (von links): Christina Rösch, ehemalige Schulleiterin des Leibnitz-Gymnasiums in Berlin, Christoph Heubner, Geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Tomáš Kafka, Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin, Marta Malá, Holocaust Fond, Auschwitz-Komitee der Tschechischen Republik, und Enkelin Michaela Rozov, Herausgeberin des Buches über Felix Kolmer. Foto: Ulrich Miksch
Und an anderer Stelle: „Jahrestag. Wie erlebe ich den Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager? Er weckt Erinnerungen an die Zeit, als ich selbst in Auschwitz war. An das, was ich dort gesehen und erlebt habe. Ich war zum Sterben bestimmt. Ich kann nicht einmal sagen, daß ich dazu ,verurteilt‘ wurde, denn es gab keinen Prozeß. Ich sollte einfach nicht weiterleben. Aber ich habe es geschafft…“ Ulrich Miksch
Was zum Feiern im Fasching unverzichtbar dazugehört, ist das gesellige Miteinander. Wir können uns zwar auch freuen, wenn wir alleine sind, jedoch läßt sich in Gemeinschaft leichter lachen und ausgelassener feiern. Oft lernen wir einander in der Ausgelassenheit erst richtig kennen, weil dann ansonsten verborgene Seiten oder unerkannte Talente ans Licht kommen. Was in einem Menschen alles steckt, kommt erst so richtig heraus, wenn er sich in froher Gemeinschaft selbst vergißt. Nicht jedem ist von vornherein anzumerken, daß er beispielsweise ein begnadeter Witzeerzähler oder ein begabter Tänzer ist. Mein Eindruck ist: Dieses Kennenlernen von anderen Seiten bei unseren Mitmenschen vertieft die Gemeinschaft untereinander.
Welche Rolle spielt der Fasching eigentlich im christlichen Glauben? Zuerst einmal: Nichts wahrhaft Menschliches sollte uns Christen gänzlich fremd sein. Unmittelbar fällt mir dazu aber ein Satz aus dem Psalm 100 ein: „Dient dem Herrn in Fröhlichkeit!“ Man muß zwar als Christ nicht ausschließlich fröhlich sein. Menschliche Nöte und Schicksalsschläge, gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen, Katastrophen wie zuletzt das schreckliche Erdbeben in der Türkei müssen uns selbstverständlich unter die Haut gehen. Gerade wir dürfen Fröhlichkeit nicht einfach nur vorgaukeln.
Auf der anderen Seite ist die Fröhlichkeit ein Erweis, daß das Leben stärker ist als alle Mächte des Todes in unserer Welt. Der legendäre Pater Brown aus den Kriminalromanen von Gilbert Keith Chesterton sagt an einer Stelle: „Humor ist eine Erscheinungsform der Religion.“ So möge uns gerade als Christen das Lachen nicht im Halse stecken bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen frohen Fasching!
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
6/2023
� Verdienstvolles Mitglied der Bundesversammlung aus dem Isergebirge

Am 7. Februar feierte Dieter Piwernetz, Verdienstvolles Mitglied der Bundesversammlung aus dem Isergebirge, im mittelfränkischen Nürnberg seinen 85. Geburtstag.

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommen zwei tschechische Spielfreunde zu dem siebenjährigen Dieter Piwernetz in sein Elternhaus in Labau bei Gablonz. Sie fragen nach seinen Briefmarken. Er hatte eine schöne Sammlung von seinen Eltern bekommen. Sie nehmen die Marken und sagen: „Das sind unsere.“ So wurden seine Briefmarken requiriert. Sein Wohnort Labau lag an der Sprachgrenze. Wie in den meisten dortigen Familien war man zweisprachig und kannte keine Unterschiede. In Labau war ein Onkel Bürgermeister, ein anderer Onkel war Bürgermeister im tschechischen Nachbarort. Auch in der Geburtsstadt Gablonz war man weltläufig. Deutsche und einige Tschechen erzeugten Glaswaren. Juden, die sogenannten Verleger, verkauften die Erzeugnisse in alle Welt. Bei den Werktätigen war ein gewisser Wohlstand vorhanden. Dennoch hatten die Sozialdemokraten und etwas weniger die Kommunisten viele Anhänger. Die Stadt hatte ein hohes Steueraufkommen, was sie in Gestaltung und Infrastruktur steckte. Die Steuerabgaben für den tschechischen Staat waren hoch. Gablonz war auch kein Lieblingsplatz der Nazis, kriegswichtige Industrie fehlte dort.
In einer Beziehung funktionierten die familiären Beziehungen in der Familie Piwernetz noch. Der tschechische Bürgermeisteronkel verhinderte, daß sein deutscher Vetter gelyncht wurde. Aber damit ergoß sich die Rache über die Restfamilie,
die danach von der wilden Vertreibung getroffen wurde. Vielleicht weil sein Vater noch in Gefangenschaft war und die Mutter mit drei kleinen Kindern und die Großmutter nur als unnütze Esser galten.
Mutter Piwernetz erhielt eine halbe Stunde Aufschub, um ein bißchen Wäsche in den Kinderwagen zum drei Monate alten Säugling zu packen, die größeren Kinder erhielten ein Rucksackl. So stand man fast ohne Gepäck auf der Straße. Die fünf Menschen wurden auf einen Lastwagen verladen und zum Bahnhof Gablonz gekarrt. Von dort ging es im Viehwaggon Richtung Zittau. Von da an hieß es tagsüber laufen, laufen, laufen und nachts eine Scheune zum Schlafen finden. Ziel war ein Ort bei Meißen, wo es Verwandte gab. Und wo man auch weitere Angehörige traf. Der kleine Bruder litt an Auszehrung und starb bei Meißen. Noch heute erinnert sich Dieter Piwernetz an den kümmerlichen weißen Sarg, hinter dem er herlief. Doch die Familie erhielt keine Erlaubnis, in den Ort zu ziehen. Weiter ging es durch mehrere Lager bis in die Nähe von Weimar. Dort fand der aus der Kriegsgefangenschaft entlassene Vater seine Familie.
Im bayerischen Fichtelgebirge konnte man nach einem Erlaß von Bayerns Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ab 1945 wieder im Glasgewerbe arbeiten. Im Oktober 1946 durfte die Familie Piwernetz aus der Sowjetischen Besatzungszone ausreisen, und wieder ging es in ein Lager. Diesmal war es die große Anlage am Bindlacher Berg in Oberfranken. Nach einigem Suchen fand man Unterschlupf in Goldkronach
� Unermüdliche Landsmännin aus dem Erzgebirge
Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief von Gertrud „Gerti“ Mitlehner aus Lichtenfels, der mich sehr erfreute. Ist man bei der oberfränkischen SL-Ortsgruppe Lichtenfels, wird man stets von dieser kleinen zierlichen Frau empfangen, die sich immer freundlich um einen bemüht. Kein Mensch ahnt dabei, daß sie schon 96 Jahre alt ist und gerade erst die Leitung der Frauengruppe abgab.
und begann dort mit der Produktion. Mit Hilfe von Mitteln des Marschallplans gelang es, in Weidenberg eine neue Arbeitsstätte mit bescheidenem Wohnhaus aufzubauen. Dieter Piwernetz lebte nun in der Mitte von vertriebenen Sudetendeutschen. Er knüpfte aber rasch Beziehungen zu einheimischen Kindern. Außerdem gründete er eine SdJ-Ortsgruppe. Man machte gemeinsame Unternehmungen. Das Trauma des Krieges wurde schwächer. Ein Onkel ging in die Heimat zurück, da seine tschechische Frau nicht ausreisen durfte. Dieter sollte den Betrieb in Weidenberg übernehmen. Als Jugendlicher arbeitete er als Glasdrucker und Glasschleifer im elterlichen Betrieb Piwernetz & Co. in der Werksiedlung Weidenberg. 1953 bis 1956 machte er außerdem eine Lehre als Industriekaufmann im elterlichen Betrieb, die er mit einer Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer abschloß. Er sah aber in der Glasindustrie keine Zukunft, ging wieder zur Schule und machte 1961 Abitur.
Schon immer war er ein genauer Beobachter und Beschreiber der Natur und ihrer Lebewesen. Deshalb studierte er an der Universität Erlangen Zoologie, Botanik, Chemie, Physik und Geologie, diplomierte und promovierte zum Doktor der Naturwissenschaften. Dazu kam eine junge Familie.
1967 wurde er Leiter des Behringkontors im hessischen Marburg, 1976 wissenschaftlicher Leiter bei der IMMUNO Deutschland des Österreichischen Instituts für Haemoderivate und Impfstoffe in Wien. Dort
war er Mitbegründer des Berufsbildes „Pharmareferent“. Ab 1979 leitete er die Dienststelle für das Fischereiwesen des Bezirks Mittelfranken. 1977 bis 1996 lehrte er nebenbei Rhetorik an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.
Unzählig sind seine ehrenamtlichen Nebentätigkeiten für die Fischerei und für das Jagdwesen. Ebenso sammelt er leidenschaftlich Briefmarken und ist ein kundiger Philatelist und auch hier ehrenamtlich tätig. Er veröffentlichte zahlreiche Artikel und Bücher.
Solange er berufstätig war, war die Heimat weit weg, vielleicht auch bewußt etwas vergessen. Er hat in der neuen Heimat seinen Frieden gefunden, und seit der Pensionierung beschäftigt er sich intensiv mit seiner Geburtsregion. Er ist Zweiter Vorsitzender des Werksiedlungsvereins Weidenberg, Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung und arbeitet intensiv mit. Er ist Obmann der SL-Ortsgruppe Weidenberg, Vize-Obmann der SL-Kreisgruppe Bayreuth und Viezeobmann der SL-Bezirksgruppe Oberfranken.
2017 erschien seine „Geschichte der Werksiedlung“. Sie verkaufte sich wie warme Semmeln. Er arbeitet unter anderem an einer Postgeschichte des Sudetenlandes. Sie soll demnächst erscheinen.
Seine Freunde, die SL und viele andere Gemeinschaften wünschen dem Jubilar alles Gute zum Geburtstag. Möge ihm seine Schaffenskraft noch lange erhalten bleiben. Aber es ist schon lange kein Geheimnis mehr, daß hoher Arbeitseinsatz verbunden mit großen geistigen Leistungen vor Demenz und anderen Alterserscheinungen schützt. Margaretha Michel
� Rühriger Kreisobmann aus dem Altvaterland
In einer Feierstunde wurde Berthold Streit, Obmann der oberfänkischen SL-Kreisgruppe Höchstadt an der Aisch, mit der Urkunde „Dank- und Anerkennung“ geehrt, verbunden mit dem Dank der Bezirksobfrau Margaretha Michel, der Kreisund der Ortsgruppe Höchstadt.
G
eboren wurde Gerti 1926 in Kap Arcona auf Rügen. Ihr Vater war dort bei der Marine. Das muß eine Außenstelle der alten österreichischen Armee, eventuell auch der neuen tschechischen Marine gewesen sein. Jedenfalls wurde seine Arbeitsstelle einige Zeit nach ihrer Geburt aufgelöst, und die Familie kehrte zurück nach Kupferberg im Erzgebirge. Dort wuchs Gerti auf, besuchte die Handelsschule und arbeitete dank ihrer guten Ausbildung in verschiedenen Betrieben. Sie ist bekannt für ihre schön gestalteten Geburtstagsgratulationen und SL-Feiern.
Nun zu ihrem Brief, in dem sie schreibt: „Im Laufe unserer Adventsfeier habe ich von unserer Kreisobfrau Heidi Engelhardt eine Dank-Urkunde mit Medaille überreicht bekommen. Die Urkunde war von Volksgruppensprecher Bernd Posselt unterschrieben. Ich war total überrascht, habe aber trotz Nachfrage keine weitere Antwort bekommen. Klar war mir aber, daß die Auszeichnung eine große Ehre bedeutet und auch Freude bereiten soll. Erst bei der nächsten Begegnung habe ich erfahren, daß Sie, liebe Frau Michel, die Urheberin für meine große Überraschung waren.

Ich möchte ihnen heute mit diesem Schreiben ganz herzlichen Dank sagen für ihre Aufmerksamkeit und ihre Bemühungen in dieser Sache. Diese tolle Urkunde hat den richtigen Platz bekommen, nämlich in meinem Ordner mit der Beschriftung ,Mein Leben. Meine Heimat‘.“
Für die kommende Zeit alles Gute sowie Gottes Segen für Gesundheit und Zufriedenheit.
Margaretha MichelSeit 2013 ist Berthold Streit, der aus dem Altvaterland stammt, Nachfolger von Hans Tischer als Kreisobmann. Zur Ehrung hatte Kurt Renner, der Vermögensverwalter der Kreisgruppe, Folgendes gesagt: „Ich kenne Berthold seit mehr als 30 Jahren. Er hat sich in diesen Jahren ausgezeichnet durch seine vielen Freundschaftsdienste und durch eine starke vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ich möchte hier nur einige Stichpunkte nennen: Seit mehr als 30 Jahren ist Berthold Streit Mitglied in der SL-Ortsgruppe und seitdem Vermögensverwalter mit großer Leidenschaft. Er hat neben dem soliden Geldgeschäft eine sehr hoch einzuschätzende Eigenschaft. Er zeichnet sich nämlich auch
durch seine sehr soziale Ader aus, wie zahlreiche Besuche bei und Gespräche mit den Mitgliedern beweisen. Ich erinnere an die von ihm organisierten und durchgeführten Omnibusreisen, unter anderem auch in unsere Heimat. Als wir noch mit einem Stand am Höchstadter Altstadtfest vertreten waren, half er immer mit großer Bereitschaft mit.
An zahlreichen Veranstaltungen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene nahm er teil und wirkte mit. Fast immer war er Besucher des Sudetendeutschen Tages und organisierte Busfahrten dorthin. Die Weihnachtsfeiern der Ortsgruppe hat er mitorganisiert und als Vortragender die Feiern verschönt. Damit möchte ich die Aufzählung beenden, obwohl noch einiges zu nennen wäre.
Lieber Herr Streit, Sie führten mit großer Kraft und Leidenschaft all diese Tätigkeiten durch. Ich habe großen Respekt vor dieser immensen Leistung und der praktizierten Nächstenliebe. Dafür danke ich Ihnen und wünsche alles Gute.“ tr
Auf Einladung von Christina Meinusch, der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, zeigte der Dokumentarfilmer JörgPeter Schilling im Sudetendeutschen Haus in München sein neues Werk. Sein Film „Trautenau und das Riesengebirgsvorland. Begegnungen mit Deutschen und Tschechen“ geht jetzt auf Deutschlandtournee und ist auch als DVD käuflich. Andreas Schmalcz, Mitarbeiter der Sudetendeutschen Heimatpflege, sorgte für den makellosen Ablauf der Filmvorführung.



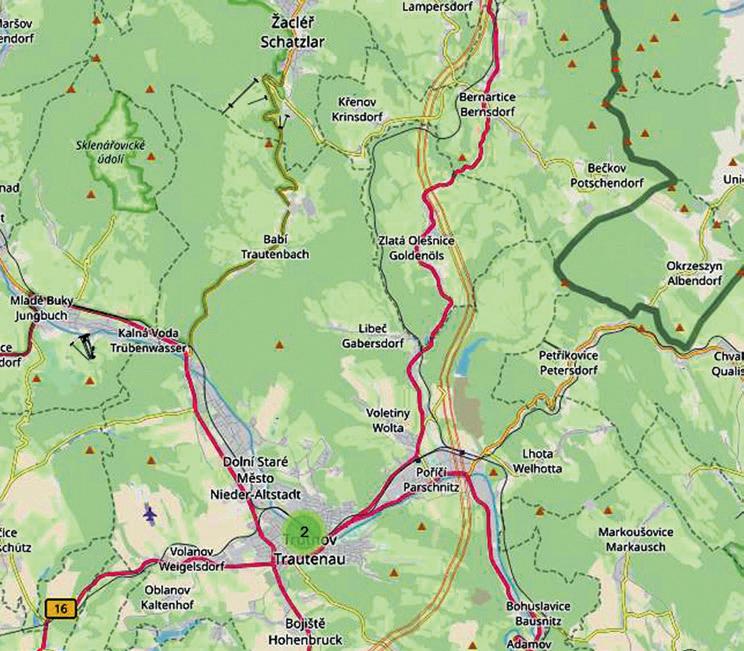

F
ür meinen neuen Film sind wir nach Trautenau, in das Riesengebirgsvorland und in das Rehorngebirge gereist“, so JörgPeter Schilling. „Wir haben viele heimatverbliebene Sudetendeutsche getroffen und über ihr Leben befragt“, erzählte Filmemacher aus dem Thüringer Wald.

„Der Film präsentiert Schicksale, Lebenswege und gemeinsame Projekte von Tschechen und Deutschen. Zugleich werden interessante Menschen vorgestellt, die sich für die Erhaltung des kulturellen Erbes der Region einsetzen.“

Dieser Film sei ebenso vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unterstützt worden wie vier ähnliche Dokumentationen von Schilling zuvor. Seine Premiere habe der Film vergangenen September in der Stadt Trautenau/Trutnov erlebt und sei danach in deren Partnerstadt Würzburg gezeigt worden. Sie seien an ihren Drehorten auf viel freundliches Interesse der heimatverbliebenen Deutschen gestoßen, erinnerte sich Schilling.
„Aber auch viele tschechische Bewohner und besonders junge Tschechen erforschen und pflegen die deutsche Vergangenheit der Region.“
Auch für diesen, seinen neuesten Film habe er viel recherchiert und mit Historikern gesprochen, so Schilling, was in der historischen Einleitung in der Anfangssequenz des Films deut-

lich wird. Dort wird erläutert, daß in der Region bis 1945 fast ausschließlich die Nachkommen der deutschen Siedler gelebt hätten, die teilweise schon im 13. Jahrhundert gekommen seien. Bei der Vertreibung nach Ende des Zweiten Weltkrieges hätten auch die böhmischen Riesengebirg-
ler bis auf wenige Ausnahmen ihre Heimat verlassen müssen, erinnerte Schilling. Aber dennoch habe er als Drehbuchautor und Regisseur noch viele deutschstämmige Menschen getroffen und zahlreiche Spuren der deutschen Vergangenheit entdeckt. Dokumentiert ist diese Suche in
wunderbaren Bildern: hügelige Landschaften, einige schmukke Häuser, Reste von Ruinen, Wasserläufe und Felder, frühere Bergwerke und heutige Straßen, überlieferte und neue Handwerke. Die filmische Reise bewegt sich – leider ohne Karte – vor allem im Riesengebirgsvorland bis hinauf auf die Schneekoppe und in das Rehorngebirge. Schilling behandelt das politische, soziale und kulturelle Zusammenleben der Menschen, die in der Region lebten und leben. Im Riesengebirgsvorland gab es viele Spezialisten, die im Gegensatz zur deutschstämmigen Bevölkerung in den anderen Landesteilen in ihrer Heimat bleiben durften. In der Bergstadt Schatzlar/Žacléř hat noch heute jeder zehnte Einwohner deutsche Wurzeln. Deshalb blieb hier auch der alte Dialekt bis heute erhalten.
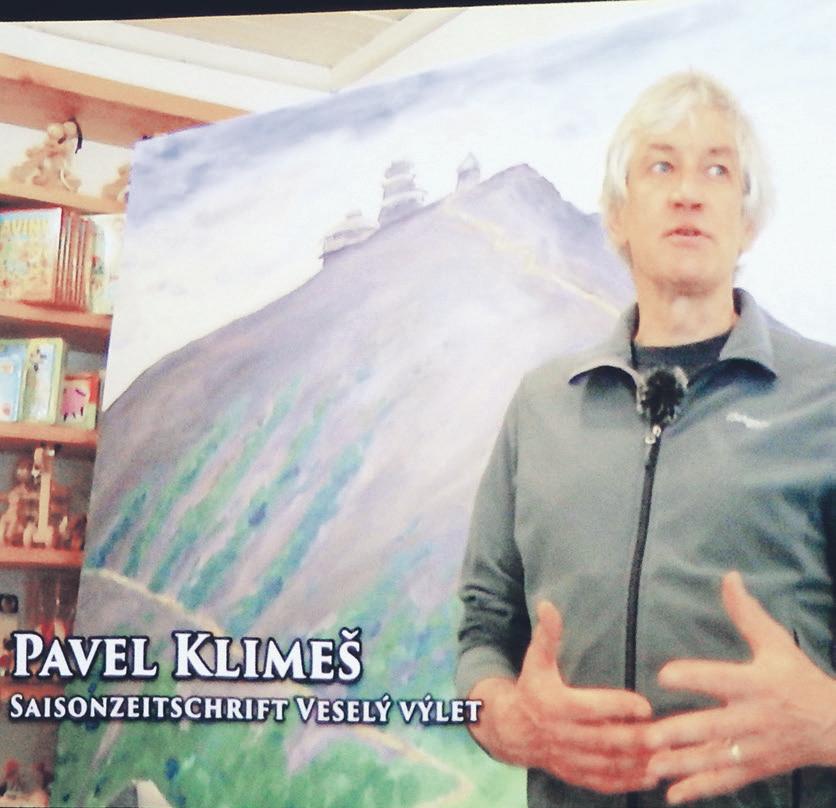

Und das „Paurische“ wird wieder gepflegt und bewahrt, etwa von Petr Kuráň am Begegnungszentrum Trautenau in einem speziellen Projekt. Inzwischen wächst auch auf tschechischer Seite das Interesse an der Geschichte der Region, und es gibt eine rege Zusammenarbeit von deutschen und tschechischen Vereinen sowie engagierten Privatleuten. Und so werden die deutschen Traditionen gepflegt. Das hat sich vor allem der Verein für deutsch-tschechische Verständigung zur Aufgabe gemacht. Daneben gibt es seit 2008 eine Städtepartnerschaft zwischen Trautenau und Würzburg, von der beide Bürgermeister – Christian Schuchardt und Ivan Adamec – in dem großartigen Film schwärmen.


Susanne Habel
Jörg-Peter Schilling: „Trautenau und das Riesengebirgsvorland. Begegnungen mit Deutschen und Tschechen“. Filmstudios Sirius, Meura 2022, 80 Minuten, 19,95 Euro. Bezug: Filmstudios Sirius, Ortsstraße 2e, 98744 Meura, Telefon (03 67 01) 2 08 95, eMail info@filmstudio-sirius.de
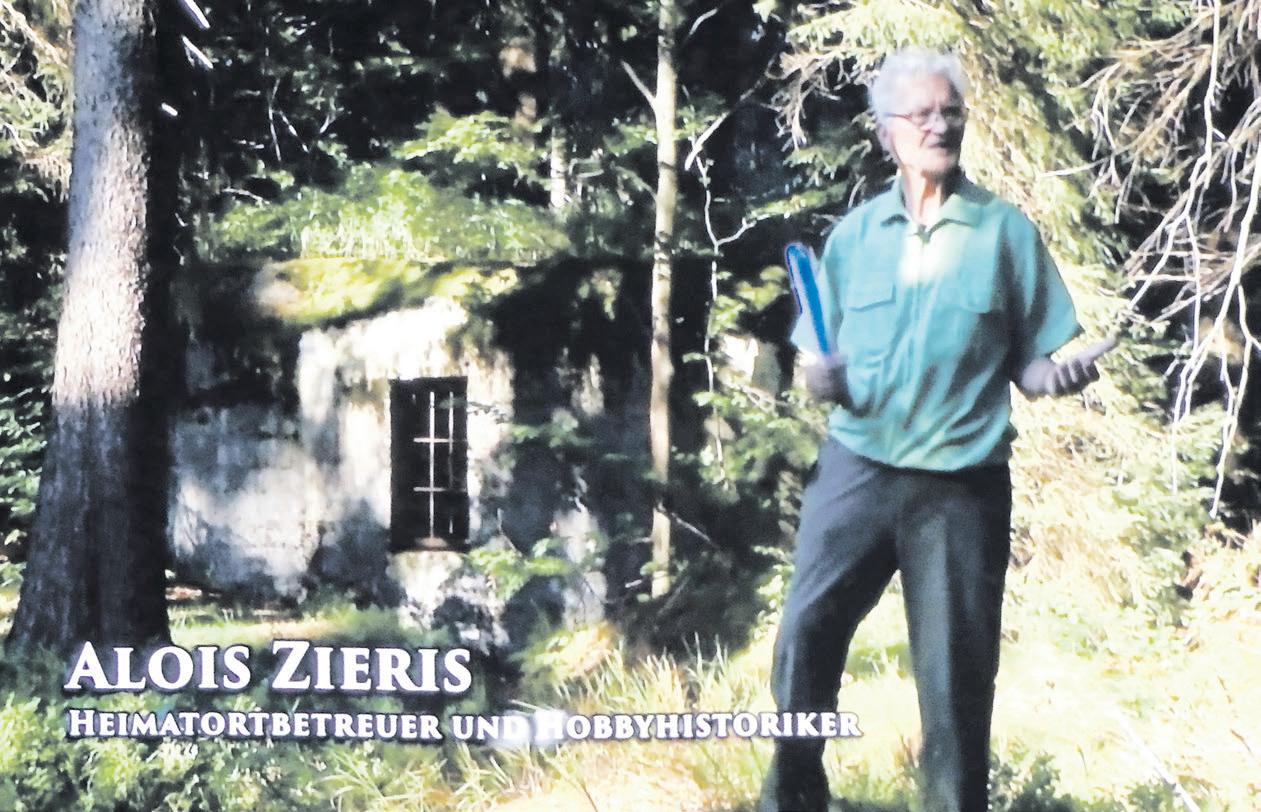

Das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern und das Münchener Haus des Deutschen Ostens (HDO) haben wieder gemeinsam zum Gedenktag für die vertriebenen Ungarndeutschen in München eingeladen. Im Sudetendeutschen Haus hielten der ungarische Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó, Imre Ritter, Parlamentsabgeordneter der Ungarndeutschen, und die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer MdL, Ansprachen. Den Festvortrag „Von der Wiege bis zur Hochschule“ über aktuelle Tendenzen des ungarndeutschen Schulwesens lieferte die Germanistin Márta Müller (Budapest). Der HDO-Direktor Andreas Otto Weber sprach vor einem Empfang mit ungarischen Spezialitäten das Schlußwort.
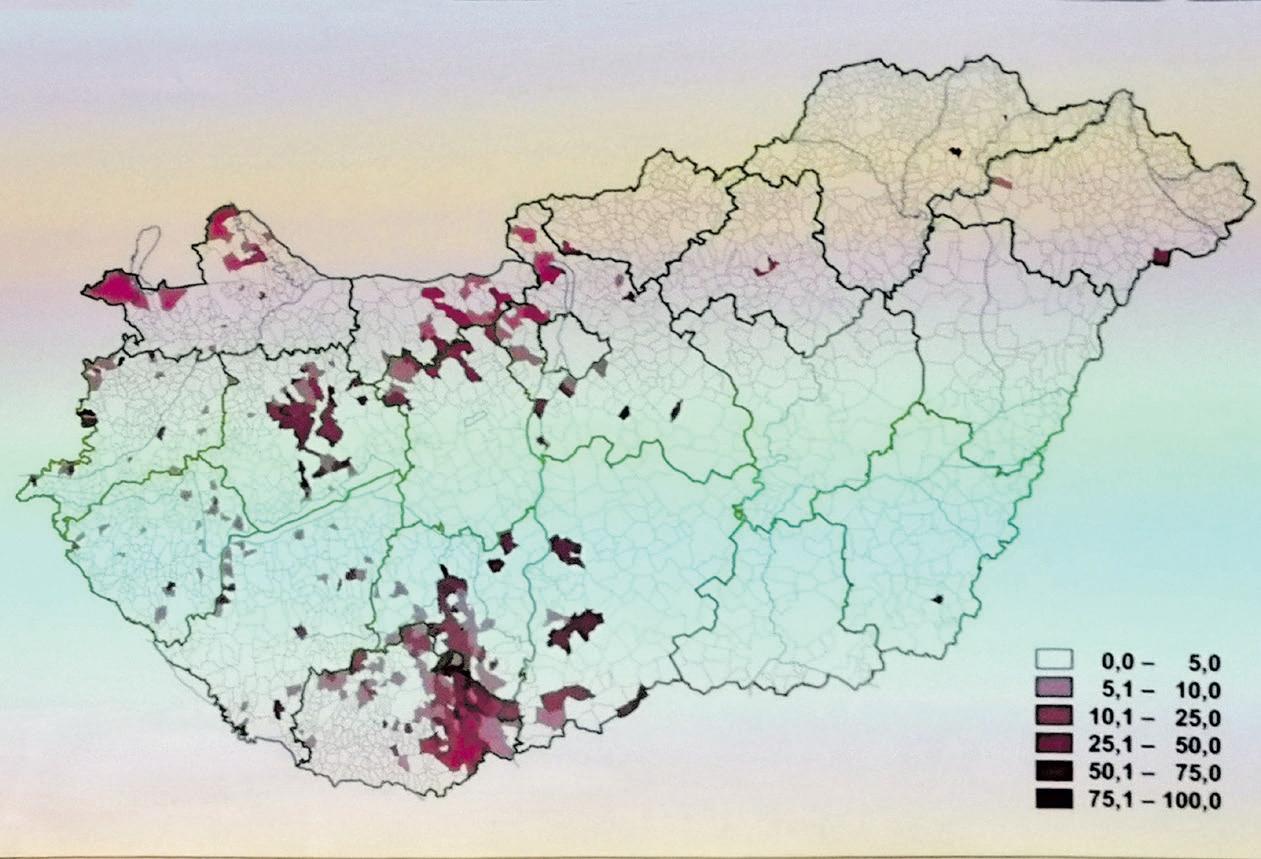
Die Sprachkompetenz der Deutschsprechenden nahm in der letzten Zeit ständig zu“, freute sich Márta Müller. Dies habe jedoch vor allem für die Hochsprache gegolten, und nicht die lokalen Mundarten, so die Budapester Germanistin. Bei ihrem Bildervortrag zeigte sie die Sprachsituation. Die heutigen Ungarndeutschen lebten vor allem in drei großen Regionen, in denen sie Umfragen durchgeführt habe. Sie habe, so Müller, in ihren Erhebungen zu deren Spracheinstellungen her-
ausgefunden, daß Angehörige der älteren Generation gute Deutschkenntnisse besonders wichtig für Ausbildung und Studium hielten, jüngere dagegen mehr für das Berufsleben. Wohl einzigartig in Europa sei, daß für Jüngere das Englische weniger wichtig als das Deutsche sei. Deutsch gelte für 53 Prozent der Befragten der älteren Generation als „wichtige Weltsprache“, bei den Jüngeren immerhin noch 47 Prozent.
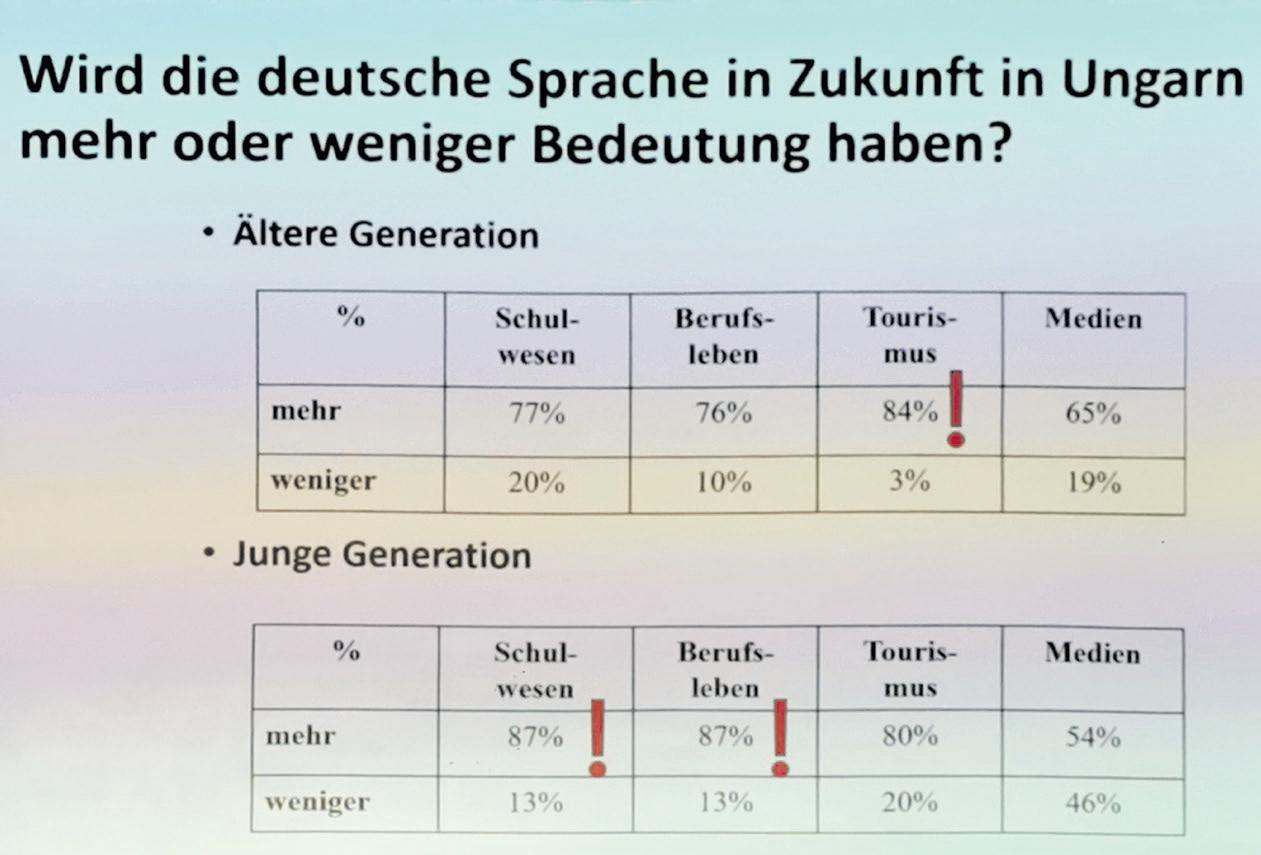
Deutsch als Minderheitenprache (DAM) – und zwar auch für Nicht-Ungarndeutsche – gebe es vom Kindergarten über Schulen bis hin zu den Hochschulen, allerdings nicht überall gleich stark. Im Kindergarten gebe es für die Kleinen der Minderheit entweder alles in Deutsch oder auch gemischt Ungarisch und Deutsch.
An Schulen werde Deutsch als Fremdsprache flächendeckend angeboten; Deutsch im kompletten Fachunterricht sei nicht überall möglich. Beim „Muttersprachlichen Programm“, besonders in Regio-
nen mit vielen Ungarndeutschen, würden alle Fächer auf deutsch unterrichtet, zusätzlich auch ungarische Sprache und Literatur.
Beim „zweisprachigen Programm“ sei mindestens die Hälfte des Unterrichts auf Deutsch. Beim „sprachlehrenden Programm“ sei Ungarisch die Hauptunterrichtssprache, ein hoher Anteil der Unterrichtsstunden jedoch auf Deutsch.
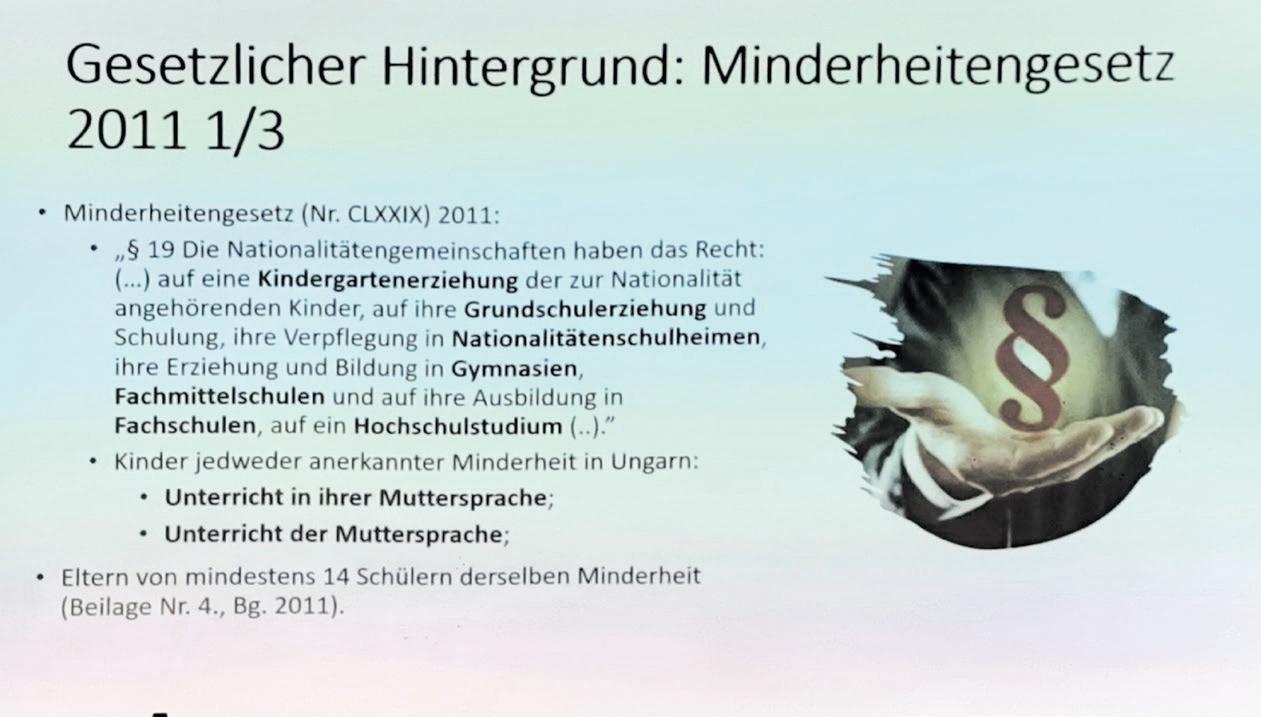
Deutschangebote von Anfang an Auch an den Universitäten gebe es weite DAM-Angebote auf Deutsch, so Studiengänge für Kindergarten- und Grundschulpädagogik sowie Hauptstudiengänge für Bachelor, Master und Lehramt. Nach ihren spannenden Ausführungen schloß die Referentin unter Applaus mit „Taunk schäi fias Zuhean!“, was jeder verstand.
Für die so starke Stellung des Deutschen gibt es einen soliden gesetzlichen Hintergrund in Form von Parlamentsbeschlüssen und Gesetzen, wie Márta Müller erklärt hatte. Details darüber lie-
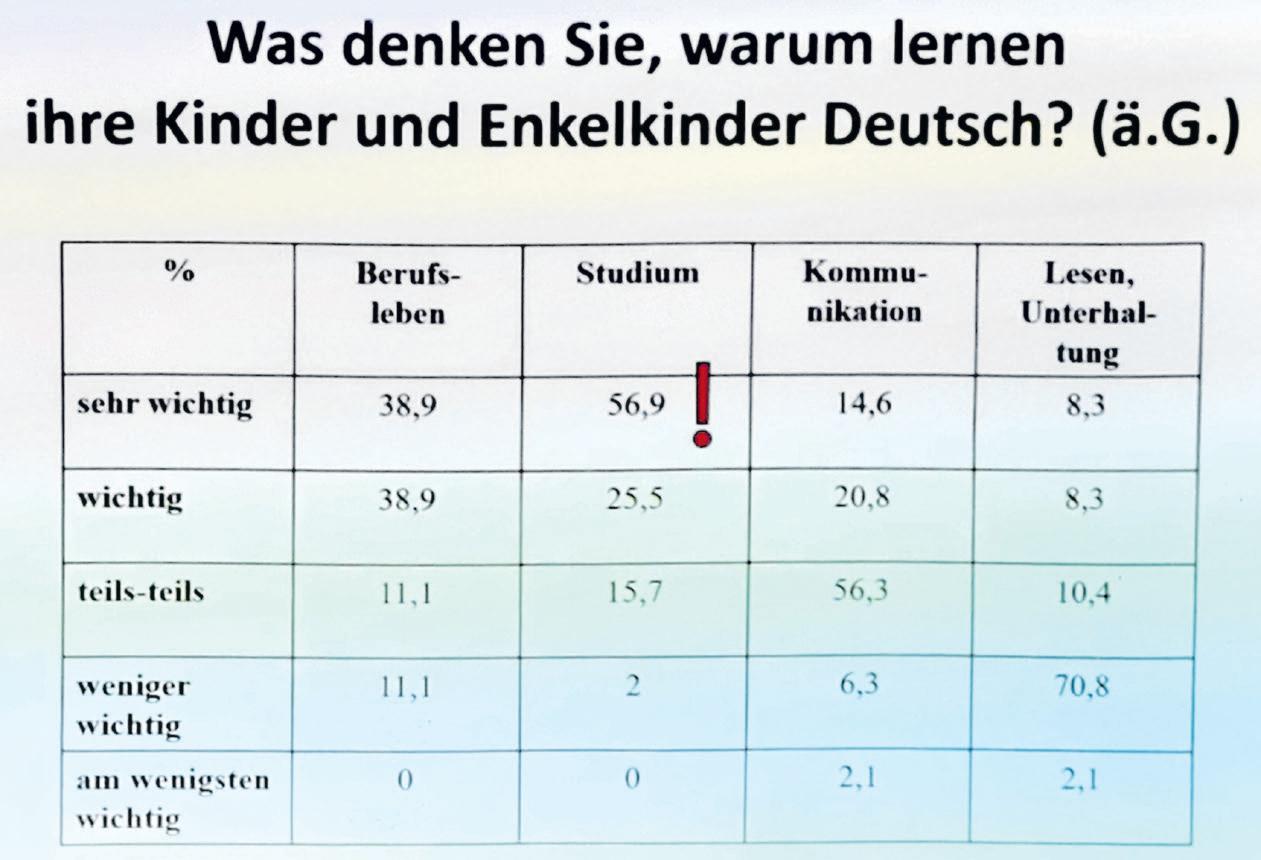

ferte Emmerich (Imre) Ritter in einem kurzen historischen Rückblick. Die Minderheitenpolitik in Ungarn habe eine lange Tradition, besonders seit sich – bereits 1990 – das ungarische Parlament von der Vertreibung und Verschleppung der Ungarndeutschen distanziert habe. Seit 1993 gebe es auf Basis des Minderheitengesetzes sowie des Wahlgesetzes die Grundlage für Selbstverwaltungen auf lokaler und Komitatsebene. Heute zähle das System Hunderte lokale deutsche Nationalitätenselbstverwaltungen mit verschiedenen Rechten und Pflichten. Man habe im Parlament einen Nationalitätenausschuß formiert, der selbstständig Gesetze ausarbeiten, Modifizierungen einbringen und Meinungen äußern könne. Diesem Nationalitätenausschuß sei auch gelungen, die Schulgesetzgebung durchzusetzen, über die die Festrednerin gesprochen habe.


„Wir Ungarndeuschen haben viele Sünden vergeben, aber wir sollten diese Sünden nicht vergessen angesichts der heutigen Sünden anderer“, forderte Ritter
im Zusammenhang mit den vielen Ungarndeutschen, die in der geplagten Ukraine lebten. Er resümierte: „Ungarn ist das einzige nicht-deutsche Land in Europa, in dem Kinder vom Kindergarten bis zur Universität in deutscher Sprache gebildet werden können.“
„Ich freue mich, nach Jahren der Pandemie wieder bei diesem Gedenktag zu sein“, betonte Sylvia Stierstorfer in ihrem überaus herzlichen Grußwort. „Die Ungarndeutschen sind Brückenbauer“, so die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Da sie selbst Tochter einer Vertriebenenfamilie sei, wisse sie um den wichtigen Bildungsauftrag aller Zeitgenossen, Ursachen und Fakten über die Vertreibungen zu vermitteln. „Geschichtsbewußtsein ist wichtig.“
Dazu solle auch der Schüleraustausch intensiviert werden. Zur weiteren Vermittlung zähle außerdem eine von Bayern gemeinsam mit dem HDO geplante Ausstellung über „Frauen und Kinder bei
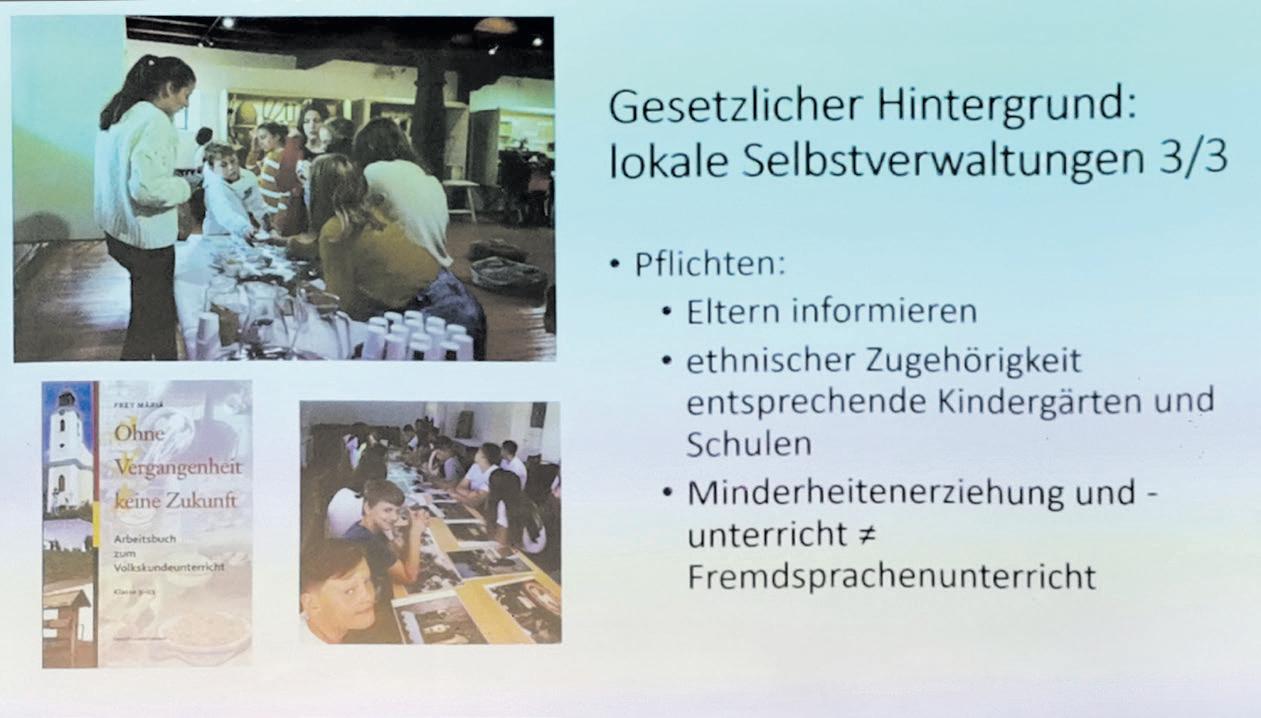
Flucht und Vertreibung“, die sicher auch viele junge Leute erreichen solle.
Eingangs hatte der Generalkonsul von Ungarn in München alle herzlich begrüßt. „Ich erlebe immer wieder gerne das große Interesse an unserer jährlichen Gedenkveranstaltung“, betonte Gábor Tordai-Lejkó. Als musikalische Umrahmung erklangen deutsche Lieder. Der aus dem Banat stammende Franz Metz begleitete am Flügel den Tenor Wilfried Michel bei Liedern von Felix MendelssohnBartholdy und Robert Schumann.
Vorbildliche Leistung Schließlich hielt der HDO-Direktor das Schlußwort. Andreas Otto Weber erinnerte daran, daß sein Haus gemeinsam mit dem Ungarischen Generalkonsulat schon seit 2014 den Gedenktag habe feiern dürfen. Besonders freue er sich über die erfolgreiche Gestaltung des Deutschunterrichts in Ungarn, wie sie im Festvortrag geschildert worden sei. „In anderen Herkunftsländern der deutschen Vertriebenen wurde bisher leider nicht so viel getan.“
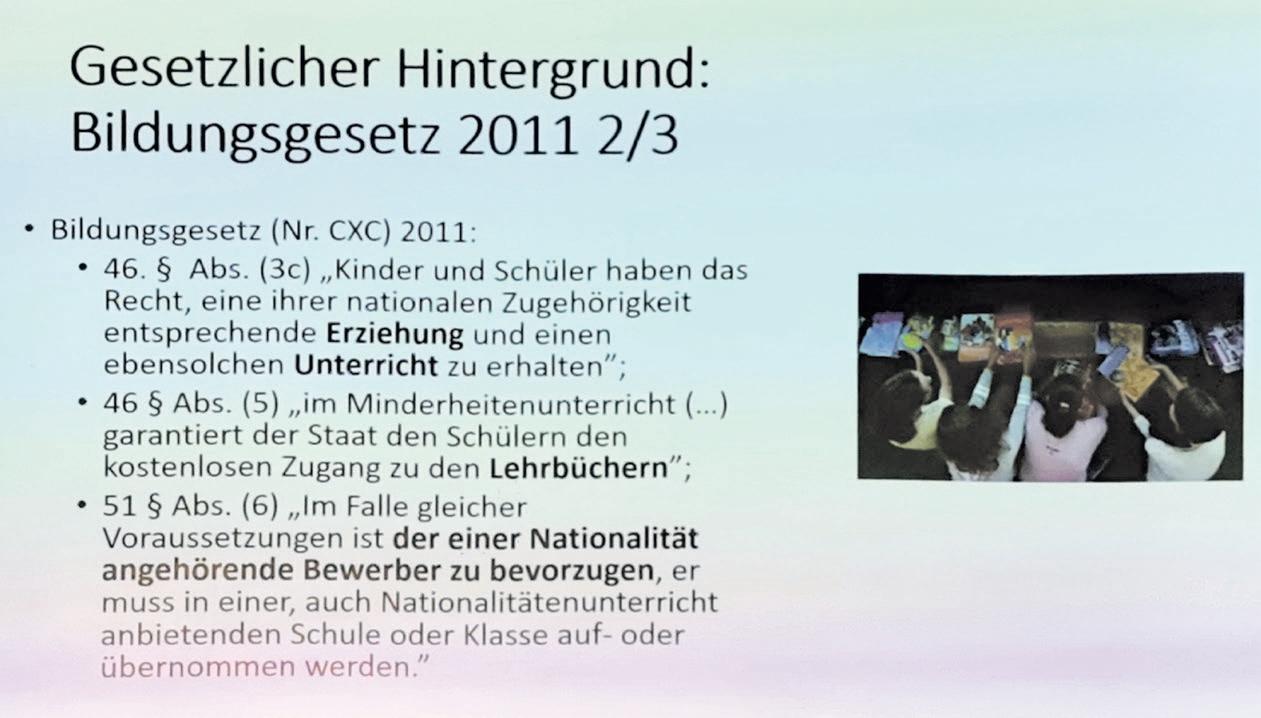
Im Bildungswesen hat Ungarn für seine vertriebenen Deutschen offenbar Vorbildliches geleistet, war die einhellige Meinung beim Empfang mit ungarischem Wein und regionalen Leckereien.
Susanne Habelvon Deutschstämmigen in Ungarn. und Einstellung

Ausstellungsplakat

❯ SL-KG Gelnhausen



Vergessener Widerstand


Mitte Januar eröffnete im MainKinzig-Forum im hessischen Gelnhausen die Ausstellung
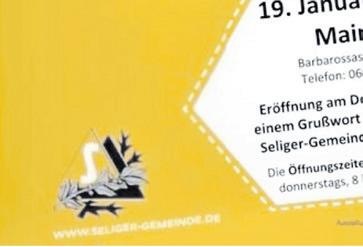
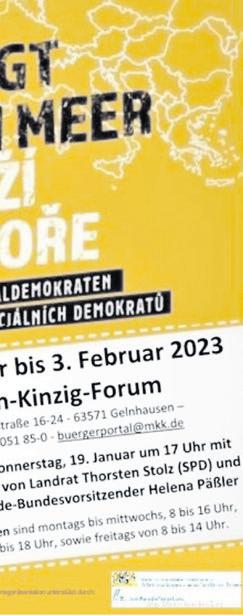
„Böhmen liegt nicht am Meer“ der Seliger-Gemeinde über die Widerstandskämpfer, die von den Deutschen aus der Tschechoslowakei vertrieben worden waren. Sie lief bis 3. Februar.
Die Wanderausstellung, die Hessens SL-Landesobmann Markus Harzer und Bernd Klippel, Obmann der SL-Kreisgruppe Gelnhausen und Mitglied der Seliger-Gemeinde, in die Barbarossastadt geholt hatten, sah Harzer als Chance, die vergessenen Heimatlosen ins Bewußtsein zu rükken.

In ihrem Gedicht „Böhmen liegt nicht am Meer“ zeigt Ingeborg Bachmann, daß das Meer keine Grenzen kennt. So mußten auch die Sozialdemokraten aus Böhmen und Mähren eine neue Heimat suchen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten Zehntausende aus den Grenzgebieten der ČSR Vertriebene die Altkreise Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern. Für viele Sudetendeutsche war dies die zweite Entrechtung. Wenige Jahre zuvor waren unzählige von ihnen in KZ verschleppt worden, weil sie sich gegen Adolf Hitler und für den Frieden eingesetzt hatten.
„Und trotzdem waren wir in Deutschland nicht willkommen“, erinnert sich Helena Päßler, Ko-Vorsitzende der SeligerGemeinde, an ihre Flucht und ihre Ankunft jenseits der Heimat. „,Wann nimmt das endlich ein Ende‘, so wurden meine Familie und ich 1965 in einem Flüchtlingslager begrüßt.“
Landrat Thorsten Stolz betonte, daß Geschichte da sei, um aus ihr zu lernen. „Die Heimatlosen, die aus dem Sudetenland herkamen, wurden nicht mit offenen Armen empfangen. Das sollte uns eine Mahnung sein, stets menschlich mit Geflüchteten umzugehen.“ Stolz sagte, daß in Europa nur Frieden geschaffen werden könne, wenn wir Vorurteile abbauten und nicht auf dem beharrten, was damals gewesen sei. Ein jeder solle sich an die Geschichte erinnern, aber gleichzeitig lernen, aufeinander zuzugehen und Versöhnung zu üben. Mit ihrer Ausstellung „Böhmen liegt nicht am Meer“ thematisiert die Seliger-Gemeinde Austausch und Versöhnung, die Stolz forderte.
„Wir wollen die Geschichten jener vorstellen, die gegen Nationalsozialismus und für Freiheit und Demokratie kämpften. Die danach in ein Exil fliehen mußten, in dem sie nicht willkommen waren“, stellte Markus Harzer die Ausstellung vor.
„Wir wollen mehr deutsch-tschechischen Austausch.“ Doch nicht nur das, „die Ausstellung soll ebenfalls zu einer Versöhnung beitragen, indem sie in beiden Sprachen präsentiert wird“, fügte Päßler hinzu. „Sie zeigt, daß es Deutsche auf dem Gebiet der Tschechischen Republik gegeben hat. Und daß sie nicht alle Nazis waren, was den Menschen nach dem Krieg jahrzehntelang suggeriert wurde.“
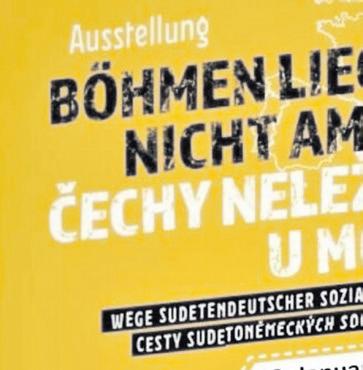
❯ SL-Kreisgruppe Burglengenfeld-Städtedreieck/Oberpfalz
Ende Januar besichtigte die oberpfälzische SL-Kreisgruppe Burglengenfeld-Städtedreieck die Krippenausstellung in Regensburg, durch die der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer führte.

Die meisten der 18 Teilnehmer, die auch aus Schwandorf kamen, schwärmten hinterher von der Schönheit der in mehreren Räumen ausgestellten Krippen und der sehr sachkundigen Führung des Bischofs. So erklärte er sowohl theologische
Aspekte. Ein Beispiel war das gebundene Lamm bei der Krippe. Dieses weise auf den Opfertod Christi hin. Er verdeutlichte auch die Besonderheit von böhmischen Krippen mit Zitaten aus Otfried Preußlers „Die Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil“ oder das Typische einer prachtvollen Neapolitanischen Krippe mit einer kurzen Lesung aus Johann Wolfgang von Goethes „Italienischer Reise“ aus dem Jahre 1787. Mit einem Wort: Bischof Rudolf Voderholzer kennt sich bei
Krippen aus. Er kennt sich in der europäischen, aber auch in der südamerikanischen und in der afrikanischen Krippenlandschaft aus. Und er hat gute Beziehungen zu Krippenbauern in seinem Bistum. So eröffnete er vergangenes Jahr im oberpfälzischen Plößberg die Krippenschau. Darüber hinaus unterhält er Kontakte auch über die deutschtschechische Grenze hinweg mit Kenntnis der dortigen Krippentradition wie Papierkrippen oder Grulicher Krippen. Natürlich lud Bischof Rudolf Voderholzer die sudetendeutschen Krippenfreunde auch wieder ein, an Mariä Himmelfahrt am 15. August zu dem von ihm zelebrierten Hochamt in die Heimat nach Kladrau in Westböhmen zu kommen.
❯ SL-Kreisgruppe Kulmbach/Oberfranken



Ende Januar fand die Jahreshauptversammlung der oberfränkischen SL-Kreisgruppe Kulmbach statt.
Kreisobmann Adolf Markus freute sich über die Teilnahme der SL-Mitglieder aus Kulmbach, Marktleugast-Mannsflur und Untersteinach sowie über den Besuch der SL-Landesvizeund Bezirksobfrau Margaretha Michel und von Horst-Peter Wagner. Durch den verbrecherischen Angriffskrieg Putin-Rußlands und die dadurch verursachten Ukraine- und anderen Fluchtbewegungen kämen bei der Erlebnisgeneration die schrecklichen Vertreibungsschicksale wieder hoch, sagte Markus angesichts der Äußerungen von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen der Nachkriegsjahre. In Haß- und Rachefeldzügen seien aufgehetzte tschechische Milizen und sowjetische Rotarmisten gegen die sudetendeutsche Zivilbevölkerung jeden Alters vorgegangen. Hunderttausende Zivilisten seien umgekommen. Und dies nach Kriegsende, noch bevor die amerikanisch-britischen Siegermächte während der Potsdamer Konferenz im August 1945 sich von Edvard Beneš und Josef Stalin zur Vertreibung von über drei Mil-
lionen Sudetendeutschen hätten überreden lassen. Diese menschen- und völkerrechtswidrigen Vertreibungsverbrechen einer fast 1000jährigen Volksgruppe dürften heute nicht totgeschwiegen oder geschichtsfälschend interpretiert werden. Markus: „Ein Problem ist nur gelöst, wenn es gerecht gelöst ist.“
Margaretha Michel berichtete über wachsende Versöhnungsbeispiele zwischen Sudetendeutschen, der SL-Führung und tschechischen Bürgern, Gruppen, Politikern und Journalisten. Sie erwähnte lobend die Unterstützungen der Bayerischen Regierung und nannte die Förderung des Vertriebenen- und Integrations-Forschungsprojekts des Leibniz-Instituts der Universität Regensburg.
Vorausschauend wies Michel auf den Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Regensburg, auf den Brünner Friedensmarsch und auf die Vertriebenen-Wallfahrt nach Gößweinstein Anfang September hin.
Markus erzählte über den 1961 in Schweinfurt geborenen HorstPeter Wagner, daß dieser Sohn eines Sudetendeutschen aus Kaaden und einer Unterfränkin sowie Inhaber einer Werbeagentur sei und in Kulmbach wohne. Seit über einem Jahrzehnt liege
ein Schwerpunkt seiner Arbeiten auf der Erstellung von Dokumentarfilmen und Zeitzeugenberichten. Vorwiegend gehe es dabei um Flucht und Vertreibung gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, hauptsächlich aus den sudetendeutschen Gebieten.
Er sei ursprünglich auf den Spuren seines Großvaters aus Brüx gewesen, der einer deutschtschechischen Familie entstammt sei. Erst die Beschäftigung mit der Heimat und der Vergangenheit seiner Vorfahren habe ihm die kulturelle Vielfalt Böhmens bewußt gemacht. Gleichzeitig sei ihm diese ans Herz gewachsen. Ihm liege vor allem daran, das böhmische Geschichts- und Kulturerbe zu erhalten. Wagner sei sich sicher, daß dazu die Aufarbeitung der Vergangenheit gehöre und dadurch die gemeinsamen Wurzeln beider Völker eines Tages zur echten Versöhnung beider Staaten führen würden.
Eingangs hatten alle der Kriegs- und Vertreibungsopfer und aller Verstorbener der Erlebnis- und Bekenntnisgeneration und des Holocausts gedacht. Kreisobmann Adolf Markus nannte die Namen der verstorbenen SL-Mitglieder des vergangenen Jahres und würdigte den verstorbenen Papst Benedikt XVI. als bayerischen und sudetendeutschen Papst, als weisen und tiefgläubigen Christenoberhirten und Menschen.
Mit großem Dank für ihre Mitarbeit in der SL ehrten Michel und Markus namens Volksgruppensprecher Bernd Posselt Gislinde Schuster-Namer und Helga Kudlich mit der SL-Verdienstmedaille sowie Christine Wala mit dem großen SL-Ehrenzeichen.
Mit herzlichem Dank für die treue Mitarbeit aller SL-Mitglieder der Kreisgruppe Kulmbach und dem Singen bekannter Heimatlieder wie dem Böhmerwaldund Riesengebirgs-Lied endete der Nachmittag hoffnungsvoll. fs
❯ Kuhländchen
Mitte Januar trafen sich etwa 20 Mitglieder der Kuhländler Heimatgruppe München zu einem sowohl lehrreichen als auch unterhaltsamen Nachmittag.
Zu Beginn der Veranstaltung gratulierte Ulf Broßmann, Betreuer der Heimatlandschaft Kuhländchen, der Böhmerwäldlerin Renate Slawik zum 75. Geburtstag. Danach wurde an die Neujahrsmesse erinnert. Ein Zuhörer ließ seine Tonaufzeichnungen vom Sudetendeutschen Chor auf seinem Mobiltelefon erklingen. Danach sprach Hans Slawik über den Böhmerwald. Er begann seinen Vortrag mit dem Bayerischen Wald, indem er von einem gemeinsamen Siedlungsgebiet von Böhmen und Bayern sprach. In Budweis sei das Verhältnis von Deutschen und Tschechen stets halbehalbe gewesen. Auch Teile des Mühl- und des Waldviertels, die heute auf österreichischer Seite lägen, gehörten zum Böhmerwald. Im Mittelalter sei es dort unermeßlich kalt gewesen. Die Durchschnittstemperatur habe drei bis sechs Grad betragen und sei mit starken Schneefällen verbunden gewesen. So sei es in den Dörfern um den Dreisessel auch noch später üblich gewesen, daß man im Winter eingesperrt gewesen sei und sich die Wege habe freischaufeln müssen.
Witigonen und Rosenberger hätten das Gebiet beherrscht.
Die Rosenberger seien die Förderer Adalbert Stifters gewesen.
größer werdenden Stadt Wien. Die Holzscheite seien ziemlich klein gewesen. Der Bau des Rosenauer SchwarzenbergKanals in den Jahren 1775 bis 1778 habe den Transport zur Donau erleichtert. Dennoch seien viele Flößer dabei ums Leben gekommen. Wenn sie ins Wasser gefallen seien, seien die Holzscheite rasch über sie hinweg geschwommen. Besonders Nichtschwimmer, die man wegen ihrer größeren Vorsicht ausgewählt habe, seien nicht mehr unter dem Holz hervor gekommen.
Hans Slawik ging danach noch auf die Betriebe der böhmischen Glasbläser und der Papierindustrie ein, die mit 350 bis 1000 Mitarbeitern für spätmittelalterliche Verhältnisse ziemlich groß gewesen seien. Slawiks Vortrag war sachlich, aber reichhaltig. Er ließ kaum ein Wissensgebiet aus.
Danach wurde noch ein Musik-Video gezeigt, in dem einzelne Bilder den Lauf der Moldau nachzeichneten, wie er in Smetanas gleichnamiger Sinfonie durch Töne kenntlich gemacht wird.
Das Adalbert-Stifter-Denkmal steht auf einem Absatz nördlich des Plöckensteins über der Seewand zum Plöckensteiner See nur einen Kilometer nordöstlich vom Dreiländereck Deutschland–Österreich–ČR.
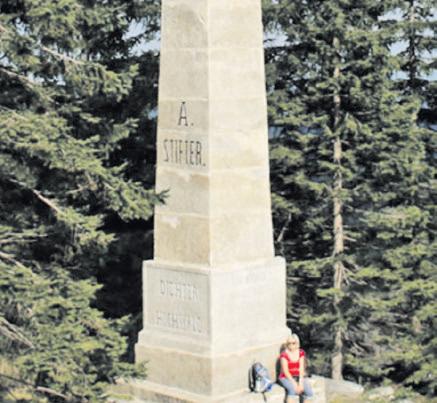

Die Moldau, die auf der bayerischen Seite bei Finsterau entspringe, münde hinter Prag in die Elbe. Sie wandere durch den heutigen Stausee bei Oberplan. Die herzförmige Schleife des Flusses, die vom See bedeckt werde, könne man bei Niedrigstand des Wassers im Winter durch das Eis hindurch noch erkennen.

Die Böhmerwäldler hätten von der Flößerei gelebt, insbesondere vom Verkauf des Holzes für die Öfen der immer
Als gebürtiger Passauer finde ich es recht erfreulich, daß man sich nach der Wende von 1990 mehr auf die Gemeinsamkeiten als auf das Trennende zwischen Bayern und Böhmen besinnt. Denn zur Zeit des Eisernen Vorhanges konnte man das, was auf eine Einheit von Bayerischem und Böhmerwald hindeutete, nur erahnen: die AdalbertStifter-Höhe bei Obernzell, wo die Stiftersche Romanfigur Witiko von der Donau in den Wald hinein abbiegt; die „Böhmerwald-Mappe“ Alfred Kubins; das Rosenbergerhaus am breitesten Eingang zum Passauer Domplatz; die „Grenzwaldsagen“ von Franz Xaver Siebzehnriebl (1891–1981), in denen von Schmugglern und Wilderern mit kohlebeschmierten Gesichtern die Rede ist. Da die Grenze zu war, war es wohl das Einfachste, von Gemeinsamkeiten nichts wissen zu wollen.


 Hans-Karl Fischer
Hans-Karl Fischer



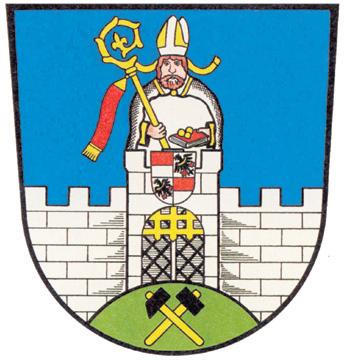
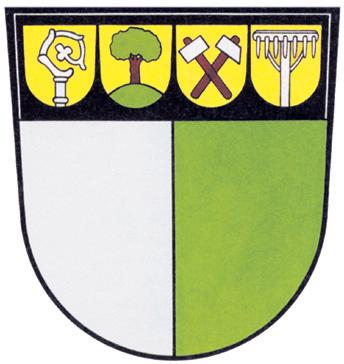

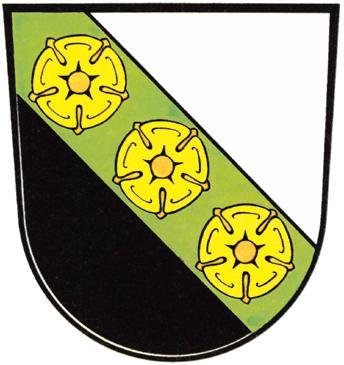

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Karl Uherr

Die Organisation der Vereinten Nationen erklärte 2022 zum Jahr des Glases. Das Teplitzer Schloßmuseum als Teil der nordböhmischen Glasregion widmete dieser Tradition der Glasherstellung, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, eine Ausstellung. Das Museum verfügt über eine reichhaltige Sammlung an Glaserzeugnissen der hiesigen Produktion. Für die Ausstellung von Mai bis September vergangenen Jahres wählten die Kuratoren auch solche Gegenstände, die thematisch gleichzeitig mit der reichen Tradition der Teplitzer Bäder verbunden waren.

Teplitz war viele Jahrhunderte ein Zentrum des kulturellen und künstlerischen Lebens. Handwerker und Künstler aus der weiten Umgebung des weltbekannten Bades kamen während der Saison hierher, um ihre Kunst den Kurgästen anzubieten. Zu den begehrten Waren gehörten dabei Gläser mit eingravierten Motiven von Teplitz und Umgebung, die von den Künstlern auf Bestellung und nach grafischen Vorlagen graviert wurden. Andere beliebte Souvenirs waren Briefbeschwerer aus Glas, Schmuck und andere kleinere Glasgegenstände. Die Ausstellung zeigte den Weg von der Herstellung in den Glashütten, den sogenannten heißen Techniken, bis zur nachfolgenden künstlerischen Gravierung, den kalten Techniken. Die kalten Techniken wurden in der Ausstellung in einer Kollektion von gravierten Gläsern als Teplitzer Souvenirs gezeigt. Hermann Hallwich (1838–1913), in Teplitz geboren und ein bekannter Historiker, Politiker und Mitglied des Teplitzer Museumsvereins, war ein leidenschaftlicher Sammler historischer Artefakte. Seine genau katalogisierte Sammlung von 232 gravierten Andenken-Gläsern hatte sein Sohn Gustav 1913 dem Teplitzer Museum übereignet. Als Vertreter der heißen Techniken präsentierte sich ein En-

semble von künstlerischen Hüttenglas-Erzeugnissen der Glashütte in Tischau, die in den 1960er Jahren auf Weltausstellungen gezeigt wurden. Die Tischauer Glashütte stellte auch Glasstangen her, die als Ausgangsprodukt für die Gablonzer Bijouterie und Herstellung von Glasperlen dienten. Diese Technik wurde ebenfalls in der

rich Salomon Fischmann (1850–1900). Zum 1. Januar 1883 trat als Gesellschafter noch Julius Fischmann (1851–1934) ein, und die Firma änderte ihren Namen in S. Fischmann Söhne.
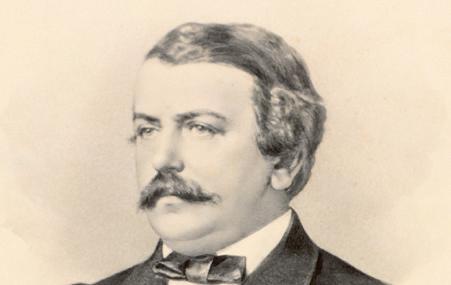
Eine alte Glashütte in Tischau, auch unter der Bezeichnung Eintrachthütte bekannt, war um 1868 entstanden. Fischmanns hatten diese ab 1883 in Pacht,
trieb weiter. Die Produktion endete aber 1964 wegen des Braunkohlebergbaus in Tischau und fand ihre Fortsetzung in den Moser-Werken in Karlsbad. Dort wurde dann um 1970 das Tischauer Programm aus der Produktion genommen. An die berühmteste Zeit der Glashütte in Eichwald-Tischau erinnert auch eine tschechische Publikation, die eine der Kuratoren der Ausstellung, Jitka Bažantová, zusammengestellt hatte; sie beschreibt darin vor allem das künstlerische Glas im Zeitraum 1956 bis 1964.
Graupen Niklasberg

Das große Interesse der Bürger an der Wahl des tschechischen Staatsoberhauptes klingt allmählich ab. Nun können wir uns einer etwas geringeren, aber dennoch nicht weniger wichtigen Persönlichkeit zuwenden.
Der Teplitzer Bürgermeister Karl Uherr ist eine historischen Persönlichkeit, an deren 200. Geburtstag wir erinnern.
Karl Uherr wurde am 12. Januar 1823 in die Familie des Webermeisters Vincenz Uherr geboren. Der junge Karl entschied sich für die Laufbahn eines Ökonomen und trat 1837 in den Dienst des Fürsten Edmund von Clary und Aldringen als Schreiber des Rentenamts. Bald darauf befaßte er sich mit Immobilien, mietete vom Fürsten das Fürstenbad und von der Stadt den Cursalon mit Restaurant.
Der Beginn seiner kommunalen Tätigkeit fällt in das Jahr 1856, als er zum Stadtrat ernannt wurde. Im Februar 1858 wurde er nach der Abdankung des Bürgermeisters Josef Sprengler amtierender Stadtrat und am 12. Februar 1861 zum Bürgermeister gewählt. Drei Jahre später gab er diesen Posten auf und wurde von Karl Stöhr abgelöst.
reichen Baugeschehen in Teplitz. 1858 beteiligte sich Uherr an der Gründung der Teplitzer Sparkasse, und die Aussig-Teplitzer Eisenbahn wurde in Betrieb genommen. Die Stadt modernisierte ihr Wasserleitungssystem und führte eine mit Gas betriebene Straßenbeleuchtung ein. 1874 wurde feierlich das StadtTheater eröffnet, und anstelle des ehemaligen Stadtgottesackers in der Lindenstraße entstand eine Parkanlage, die nach Johann Gottfried Seume benannt wurde, dessen Grab noch heute hier zu finden ist. Das Schulwesen erfuhr eine starke Erweiterung. 1860 begann der Unterricht in der Volksund Bürgerschule auf dem Schulplatz, der heute Beneš-Platz heißt. 1875 öffneten das deutsche Staatsgymnasium, das heute die Grohmann-Villa mit Stadtbibliothek beherbergt, und die Fachschule für Keramik und verwandtes Kunstgewerbe in der Allee-Gasse ihre Pforten.
Ausstellung vorgestellt. Das Teplitzer Museum bereitete sie in Zusammenarbeit mit privaten Sammlern, mit dem Museum in Reichenberg und Gablonz und der berühmten Karlsbader Firma Moser vor.
Das Familienunternehmen
Salomon Fischmann & Söhne, Glashütte und Glas-Großhandel, gründete der jüdische Kaufmann Salomon Fischmann (um 1820 bis 1880) im Jahr 1855 in Prag. Seine vier Söhne Karl Gottlieb, Heinrich Salomon, Bernard und Julius übernahmen 1871 die Firma, und gemeinsam mit weiteren Generationen schufen sie eine sehr bekannte Produktionsstätte von Verpackungs-, Flachund Bau-Glas.
In das Handelsregister des Landgerichts Leitmeritz wurde am 13. Juni 1876 das Zweigwerk in Tischau eingetragen, wobei sich das Hauptwerk bereits in Prag befand. Offene Gesellschafter waren Karl Gottlieb Fischmann (1844–1928) und Hein-
und sieben Jahre später erwarben sie die Glashütte für 13 000 Gulden.
Anfangs stellte man hier Flachglas manuell her, aber in den 1920er Jahren wurden bereits Glasstangen für die Gablonzer Bijouterie in allen Farben hergestellt, die dort zu Glasperlen verarbeitet wurden, dazu Stangen für Handtücher, Glasleisten für Portale und PreßglasLinsen als Reflektoren. Ab den 1930er Jahren begann man mit der Herstellung von künstlerisch geformtem Hüttenglas, womit die Firma den größten Erfolg hatte. Um 1925 waren hier etwa 50 Arbeiter beschäftigt. Die Produktion wurde 1941 eingestellt.

Nach dem Krieg arbeitete die Glashütte als volkseigener Be-
Außer der Historie der Glashütte enthält die Publikation eine Reihe von Fotografien und Angaben über die Designer der Fabrik. Die schweren und voluminösen Vasen, Aschenbecher und Schalen dienten vor allem als Geschenkartikel. Zu ihrer Zeit wurden diese Kunstwerke auf bedeutenden Ausstellungen wie der Expo 58 in Brüssel, der Expo 67 in Montreal sowie der Expo 70 in Osaka und in renommierten Fachzeitschriften präsentiert. Heute sind Glaserzeugnisse aus Tischau vor allem beliebte Sammlerobjekte.

Im Zusammenhang mit dem Jahr des Glases entstand dank der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Eichwald und Bannewitz in Sachsen mit finanzieller Unterstützung der Euroregion Elbe/Labe ein Dokumentarfilm des Regisseurs Martin Studecký über die mittelalterlichen und gegenwärtigen Glashütten im Erzgebirge. Erst 1966 wurden die ersten Spuren historischer Glashütten im Erzgebirge gefunden. Dank intensiver archäologischer Untersuchungen konnte in den 1990er Jahren ein mittelalterlicher Glasofen in der Nähe von Moldau errichtet werden. Dieses Experiment gilt als einzigartig in Europa. Als deutsche oder tschechische DVD „Auf den Spuren der Glasherstellung im Erzgebirge“ wird dieses Dokument der neuen Ausgabe der „Erzgebirgs-Zeitung“ beigelegt. Jutta Benešová
Damit endete aber Uherrs Karriere nicht, denn am 29. Dezember 1871 wurde er erneut zum Bürgermeister gewählt. Und dieses Amt übte er gewissenhaft bis zu seinem Tod aus. Er starb am 30. August 1882 in seinem Haus namens Weißes Lamm auf dem heute nicht mehr existierenden Badeplatz. Nach ihm wurde eine nach Schönau führende Straße benannt, die heute KollarovaStraße heißt.

Die Amtszeit von Karl Uherr war von großen Veränderungen geprägt – dem Beginn der Industrialisierung und einem umfang-
Die Stadt mußte auch gewaltige Probleme lösen, die mit dem Unglück im Döllinger-Schacht bei Dux 1879 zusammenhingen. Damals versiegte in Teplitz die Urquelle und mit ihr weitere Quellen der Stadt. Mit Hilfe von Hydrogeologen, unter anderen mit Professor Gustav Laube, einem Sohn der Stadt Teplitz, gelang es, die Urquelle erneut für den Bäderbetrieb aufzufinden. Karl Uherr wurde nicht nur zum Ehrenbürger der Stadt ernannt, sondern war auch Inhaber des königlich-preußischen Roten-Adler-Ordens III. und IV. Klasse. Ferner wurden seine Verdienste mit dem königlich-sächsischen Albrechts-Orden I. Klasse und dem Orden des Herzogtums Baden gewürdigt. Kaiser Franz Joseph I. verlieh ihm das Goldene Verdienstkreuz mit Krone. Jutta Benešová
Ladowitz KlostergrabBischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Hostaus Pfarrer – Teil XIV





Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der erste Teil über Pfarrer Peter Steinbach (1843–1917).
❯ Gerti Schubert/Ubl: „Tief drin im Böhmerwald, Ronsperg, da liegt mein Heimatort“ – Teil I
Ronspergs Ortsbetreuerin Gertrud Schubert/Ubl schrieb ihre Erinnerungen an Flucht und Neuanfang nieder und ließ sie als kleines Heft für ihre Familie und Landsleute drucken, das im Februar 2012 erschien. Der Heimatbote darf mit ihrer freundlichen Genehmigung das Kapitel „Die Flucht“ in mehreren Folgen veröffentlichen.
In Ronsperg im Böhmerwald nahe der bayerischen Grenze nach Furth im Wald kam ich am 16. März 1931 zur Welt. Ab 1932 wohnten wir im neu erbauten Haus in der Lagerhausstraße 350, im sogenannten Neuen Viertel etwas außerhalb des kleinen Städtchens mit rund 3000 Einwohnern. Ich verlebte eine schöne Kinderzeit, zwar ohne Geschwister, aber mit einigen Freundinnen und Freunden in unserer Straße. Ich ging in den Kindergarten, kam mit sechs Jahren in die Volksschule und dann in die Bürgerschule. Nach zwei Jahren wechselte ich in die Oberschule in Bischofteinitz. Der Ort ist zwölf Kilometer von Ronsperg entfernt, und mein Vater war dort geboren.
Während des Krieges fuhr ich mit den anderen Ronsperger Schülern täglich mit dem Zug zur Schule. Das war eine lange Fahrt, die Züge fuhren damals noch sehr langsam und hielten an allen kleinen Bahnhöfen. Im März 1945 wurde es gefährlich, mit dem Zug zu fahren, denn die Tiefflieger schossen immer häufiger auf die Züge. Unsere Eltern ließen uns nicht mehr mit dem Zug fahren. Und so radelten wir die zwölf Kilometer zur Schule und zurück. Doch lange konnten wir das auch nicht mehr machen, denn als die Tiefflieger auch uns angriffen und uns nur noch ein Sprung in den Straßengraben rettete, blieben wir lieber zu Hause.
Am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende, Ronsperg wurde von den Amerikanern eingenommen und besetzt.
Den Krieg hatten wir sonst gut überstanden, hatten immer genügend zu essen, und auch Papi war nur kurze Zeit beim Militär. Als Zahnarzt war er unabkömmlich gestellt, um die Bevölkerung zahnärztlich zu versorgen. Mit anderen Worten: Uns ging es gut, und ich war ein wohlbehütetes Töchterchen. Aber das änderte sich bald.

Die Amerikaner zogen sich als Besatzer langsam zurück. Jetzt kamen die Tschechen in unser
sudetendeutsches Gebiet, raubten und plünderten. Im Mai oder Juni war mein Vater mittags bei meiner Mutter in der Küche, als ein tschechischer Polizist kam. Er nahm meinen Vater wegen einer Aussage mit auf das Amtsgericht, von wo nun der lokale tschechische Nationalausschuß Národ-
Und wartete und wartete und wartete. Gegen Abend, als sie immer noch nicht zurückgekommen waren, beschloß ich, zu meiner Großmutter zu gehen und ihr zu berichten.
Großmutter lebte am anderen Ende des Städchens. Unterwegs erfuhr ich, daß auch weite-
Inzwischen hatten die Tschechen viele deutsche Hausbesitzer eingesperrt und trieben sie zum Arbeiten auf die Felder. Man sah morgens die Laster kommen, auf die die Gefangenen aufgeladen wurden. Abends wurden sie todmüde und hungrig zurückgebracht und wieder in die Kohlenkeller des Gerichts gesperrt.
Peter Steinbach wird am 27. Dezember 1843 in Kschakau geboren und am 19. Juli 1868 zum Priester geweiht. Anschließend ist er bis 1869 Kaplan in Metzling, dann in der sprachlich gemischten Seelsorge in Mogolzen tätig. Von 1872 bis 1875 übt er das Amt des Schloßkaplans in Zetschowitz aus, um von 1875 bis 1885 als Pfarrer in Berg zu wirken. Am 16. August 1885 übernimmt Steinbach das Amt des Dechanten von Hostau.
ní výbor herrschte. Meine Mutter regte sich sehr auf. Sie ahnte wohl nichts Gutes. Sie schickte mich zur Bahnhofswirtschaft, die der Bruder meines Vaters gepachtet hatte. Dort sollte ich mich erkundigen, ob auch mein Onkel abgeholt worden war. Er war noch da, und ich ging wieder. Auf dem Nachhauseweg kam mir ein Spielkamerad aus unserer Straße entgegen und gab mir unseren Haus-



re Ronsperger verhaftet und vom Národní výbor eingesperrt worden seien. Die Nacht verbrachte ich bei Großmutter, und am nächsten Tag gingen wir ins Elternhaus. Bald erschien der tschechische Kommissar Springer, der mir erklärte, daß das Haus jetzt ihm gehöre und ich jeden Morgen zum Putzen zu erscheinen habe. Von meinen Sachen durfte ich weder Kleidung noch sonst etwas mitnehmen. Nicht einmal
Ich kann oder will mich nicht mehr daran erinnern, meine Eltern auf den Lastern gesehen zu haben. Der Kommissar hatte mich fest im Griff und zum Putzen verurteilt. Immer wieder wurde ich mit der Frage gequält, wo mein Vater das Gold versteckt habe, das er als Zahnarzt besitzen müsse. Ich kannte das Versteck, hätte es aber nie verraten. So vergingen die Arbeitstage immer wieder mit dem Hinweis, daß mir in unserem Haus und in unserem Garten nichts mehr gehöre, auch nicht die Kirschen. Langsam ging der Sommer zu Ende. Das Wetter war herrlich, und meine österreichische Freundin wollte mit mir baden gehen. Aber auch mein Badeanzug war tschechisches Eigentum geworden. Ich hatte nichts zum Anziehen. Meine Freundin meinte, daß wir vom Kommissar den Badeanzug bekämen.
So gingen wir zu meinem Elternhaus, doch der „Herr“ war nicht zu Hause. Einen Schlüssel besaß ich nicht mehr. Ausgerechnet in unserem Wohnzimmer im Erdgeschoß, wo auch mein Badeanzug aufgehoben war, stand das Fenster offen. In unserem Leichtsinn stiegen wir ein und holten den Badeanzug. Ein tschechischer Nachbar, der sich ebenfalls ein deutsches Haus angeeignet hatte, muß uns gesehen haben.

Ab 1891 ist er zunächst Sekretär und schließlich ab 1900 Vikar des Hostauer Vikariats. 1909 erfolgt seine Ernennung zum päpstlichen Ehrenkaplan (Monsignore). Im Jahr 1915 verzichtet er auf das Amt des Vikars. Mit fast 32 Jahren ist Steinbach der am längsten wirkende Dechant in Hostau. Am 17. April 1917 stirbt Steinbach in Hostau an den Folgen einer Lungenentzündung. Gemäß seinem Wunsch wird er in seinem Geburtsort Kschakau beigesetzt.
Unter Steinbach wirken in Hostau die Kapläne Josef Schürrer bis 1886, Michael Ring 1886 bis 1887, der später langjährige Pfarrer in Grafenried und kurz vor seinem Tod 1937 zum Ehrendomherr in Budweis ernannt wird, Emmanuel Stanék 1887 bis 1889, Josef Randa 1890 bis 1892, Wenzel Hojda 1892 bis 1896, Wenzel Pavelka 1897 bis 1898, Wenzel Knetl 1899 bis 1901, Ottokar Holub 1901 bis 1909 und schließlich František Lorenc ab 1911.


Aufzeichnungen
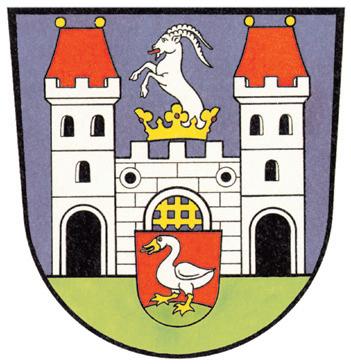
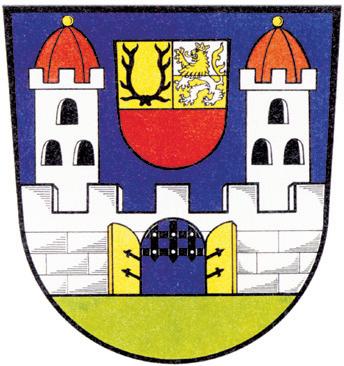
Ebenso bemängelt er, daß bei seinem Amtsantritt die Einsegnung von Verstorbenen nicht in der Kirche, sondern am Ringplatz vor dem Kaufmannsgewölbe stattgefunden habe, vor dem üblicherweise auch der Viehmarkt abgehalten werde. Vom viehischen Treiben gestört, ordnet Steinbach an, daß ab sofort alle Einsegnungen in der Kirche vorgenommen würden und anschließend die Verstorbenen zum Friedhof zu bringen seien. Auch im Jahr 1886 nimmt Steinbach weitere Änderungen in der Seelsorgspraxis vor. In Hostau wird künftig vor einem Versehgang eines Priester mit der kleinen Turmglocke geläutet, damit die Gläubigen Gelegenheit bekommen, den Segen des Allerheiligsten zu empfangen und jener Ablässe der Kirche teilhaftig zu werden, die durch Beten für Kranke oder deren Angehörige gewährt werden. Von liberalen Elementen, die dieser Einführung argwöhnisch gegenüberstehen, spricht Steinbach despektierlich.
Mit dem 21. März 1886 ordnet Steinbach ferner an, daß Kreuzwegandachten künftig nur noch an Sonn- und Feiertagen stattfinden, da die Andachten an Werktagen nur von wenigen Leuten besucht würden. Ebenso werden in Hostau die bisher hier nicht praktizierten Maiandachten mit kurzem Vortrag, lauretanischer Litanei und sakramentalem Segen eingeführt.
schlüssel. Meine Mutter war auch abgeholt worden. Ich ging ins Haus, es war leer, nur Peggy, unser Hund, kam mir entgegen. Ich drückte ihn ganz fest, nahm ihn in den Arm und setzte mich mit ihm auf die Außentreppe unseres Hauses. Dort wartete ich auf meine Eltern.
unseren Hund durfte ich behalten. Er kam in eine ehemalige Kaserne, die das RAD-Lager beherbergt hatte. Als ich später daran vorbeiging, hörte ich ihn jämmerlich heulen. Auch er gehörte zu den Deutschen und wurde von den Tschechen gehaßt. Eines Tages hörte ich ihn nicht mehr.
Als ich am nächsten Morgen zum Putzen erschien, schrie mich der Kommissar an, wo der tschechische Brief sei, der im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch gelegen habe. Ich erklärte ihm, daß es nur der Badeanzug gewesen sei, den ich mir geholt hätte. Ansonsten habe mich nichts interessiert, schon gar nicht ein tschechischer Brief, da ich sowieso kein Tschechisch könne. Der Kommissar war wütend und ließ mich von einem tschechischen Soldaten abführen und einsperren. Auch für mich war der Kohlenkeller unter dem Amtsgericht gut genug. So kam ich völlig unerwartet zu meiner Mutter und etwa weiteren 20 Frauen in das Verließ. Fortsetzung folgt


Im Jahr 1885 erhält die Diözese Budweis den neuen Oberhirten Martin Josef Řiha (1839–1907). Sein Vorgänger, der Bischof Franz de Paula Graf von Schönborn-Buchheim-Wolfsthal (1844–1899), wird neuer Erzbischof in Prag. Řiha war zuvor Professor an der Theologischen Fakultät in Budweis. Dechant Steinbach erbittet von Gott für Řiha eine lange Amtszeit in Budweis.

Bei der Übernahme der Dechantei bemerkt Steinbach, daß nur einmal mit zwei Glocken kurz vor einem Gottesdienst angeläutet wird und nach wenigen Minuten bereits die Feier beginnt. Steinbach bemängelt, daß dieser Brauch die Verspätung vieler Kirchgänger unterstütze. Um dies zu unterbinden, ordnet er an, daß künftig 15 Minuten vor dem Gottesdienst mit der großen Glocke, und schließlich kurz vor Beginn der Feier mit zwei Glokken zusammengeläutet werde. Mit Genugtuung stellt Steinbach nach einigen Monaten fest, daß diese neue Seelsorgsanordnung Früchte trägt.
Am 4. Juli 1886 wird für die Hostauer Kirche ein Verschönerungsverein ins Leben gerufen. Ziel ist, durch Beiträge der Vereinsmitglieder das Ausmalen der Dechanteikirche voranzutreiben und Neuanschaffungen für die Kirche durchzuführen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt vier Kreuzer monatlich. Die verstorbene Franziska Thoma, geborene Bauer, hinterläßt im März 1886 der Hostauer Dechanteikirche nach Abzug von Gebühren 89 Gulden und 50 Kreuzer. Dafür wird eine Lampe beim Hochaltar gekauft. 1886 werden die Dechanteigebäude Instand gesetzt. Die Dächer an den Stallungen und Wohngebäuden werden ausgebessert, wo auch Mauern verputzt und schließlich mit einem neuen weißen Anstrich versehen werden. Ebenso wird die Hauspflasterung durch viereckige Ziegel ersetzt. Die Gesamtsumme der Reparaturen beläuft sich auf 235 Gulden 69 Kreuzer. Eine Verletzung der Rechte der Dechantei ruft Steinbach auf den Plan. Die Gemeinden Zwirschen und Mirkowitz weigern sich, den in der Fassion des Hostauer Dechants festgesetzten Pfingstgroschenbetrag von jährlich 72 Kreuzer zu zahlen. Steinbach klagt diesen Betrag bei der k. k. Bezirksbehörde ein und erhält Recht. Jedoch hat die Klage nach Steinbachs Ansicht mehr Kosten als Einnahmen verursacht. Die Gerichtsgebühren betragen insgesamt 65 Kreuzer. Fortsetzung folgt
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86
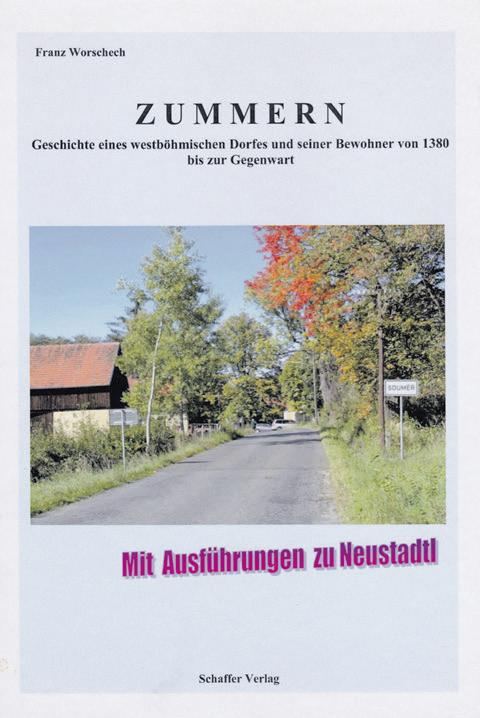
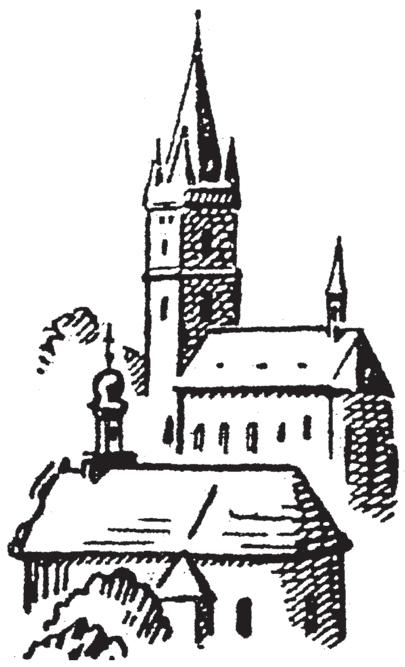
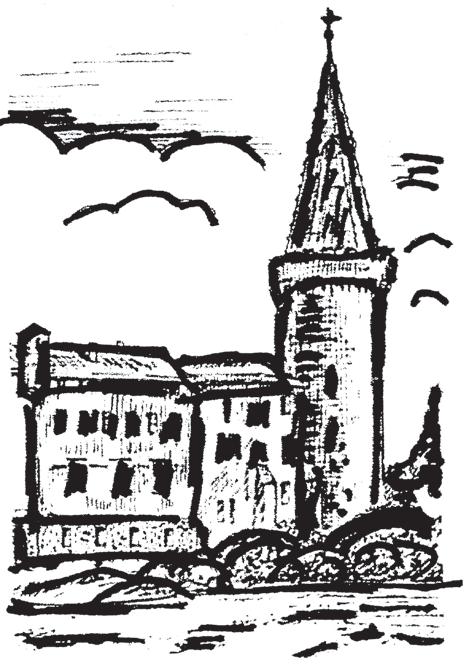
27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Kindheit in Waidhaus – Folge III

Wolf-Dieter Hamperl erzählt in dieser Folge von Kindergarten und Schule, Unfällen und Nachbarn.
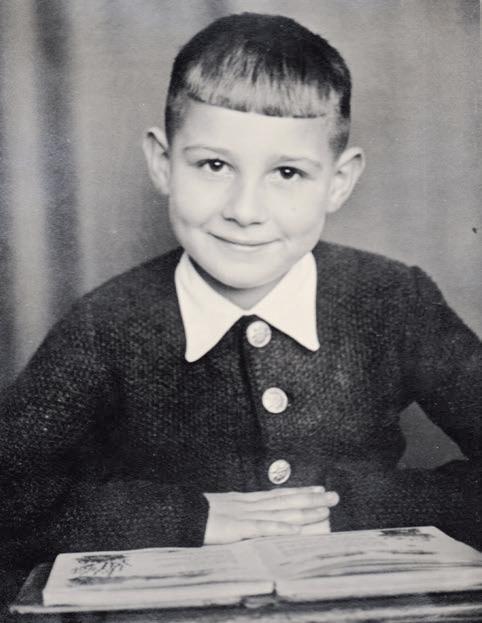
Als ich fünf Jahre alt war, durfte ich in den nahen Kindergarten gehen, der von Klosterfrauen geführt wurde. Nach dem Morgengebet stürmten wir an die runden Spieltische. Jeder wollte der erste sein und seine Lieblingsholzklötze sichern. Daraus wurden Lastwagen gebaut und diese über die grüne Tischplatte geschoben. Eine Abwechslung war die Rutschbahn.

Nachmittags war eine Ruhezeit eingeplant. Wir schliefen auf amerikanischen Feldbetten unter grauen Militärdekken. Die Schwestern sangen viel mit uns und probten kleine Theaterstücke mit uns.
So durfte ich beim Osterhasenspiel den Kindern kleine Zuckereier in die Hände legen. Beim Theaterspiel „Ich bin der Doktor Allesgut“ durfte ich den Doktor spielen.
Zu Fasching machten uns die Schwestern aus Zeitungspapier hohe Hüte, die sie mit rotem und blauem Glitzerpapier beklebten. Diese Hüte wurden uns aufgesetzt, und so zogen wir Kindergartenkinder als kleiner Faschingszug durch die Hauptstraße. Immer wieder mußten wir uns in Reihe aufstellen, und jeder bekam eine große Rippe EszetSchokolade, wohl ein Geschenk der Amerikaner.
Das Haus, in dem der Kindergarten war, beherbergte auch ein Altenheim. Das war sehr praktisch, weil uns die noch rüstigen Rentner Spielsachen wie Stekkenpferde bastelten. Mir hat es im Kindergarten so gut gefallen, daß ich als Schulkind immer wieder am Nachmittag den Kindergarten besuchte.

Ein einschneidendes Erlebnis war der Bruch von Elle und Speiche meines rechten Arms.
Das war 1948. In jenem Winter fiel wenig Schnee, und ich „ranschelte“ vor dem Gartenzaun einen kleinen Hang hinab und stürzte. Ich hatte heftige Schmerzen im rechten Handgelenk und konnte die Hand nicht mehr heben.
Schreiend lief ich nach Hause.
Zuerst zog mein
Vater mir einen schönen Anzug an, dann legte er mich auf einen Schlitten und brachte mich zu Dr. Ludwig Lissauer. Der richtete den Bruch unter noch größeren Schmerzen ein und stellte ihn in einem Oberarmgips ruhig. Ein solcher Bruch bedeutete
damals Bettruhe für zwei Wochen. Walti besuchte mich öfters und versorgte mich mit eingemachtem Obst. Die Entfernung des Gipsverbandes nach sechs Wochen habe ich nur in Teilen und unter starken Schmerzen überstanden, denn die Polsterung bestand damals aus Zeitungspapier und das lag eng an der Haut. So verletzte er beim stückweisen Entfernen des Gipses immer wieder die Haut mit der Schere. Aber alles verheilte sehr gut. Dr. Lissauer war ein Wiener Arzt und ei-
fingen, den nächsten nannten, dann den ersten und zweiten zusammensprachen und so weiter. Ganze Wörter zu erkennen, habe ich erst viel später gelernt.
Ich mußte auch zu Hause viel lesen. Mein Vater setzte mich neben sich in den Polsterstuhl, er las die Zeitung, und ich mußte ihm aus dem Lesebuch vorlesen. Auch in der Ferienzeit hat mich mein Vater unterrichtet: Schönschreiben, Ornamente Zeichnen in der obersten und untersten Zeile der Seite und natürlich Lesen. In Rechnen war ich besser.
dung des Kindes. Beste Zusammenarbeit mit der Schule (Vater selbst Lehrer). Der Junge kommt immer sauber und gepflegt zur Schule.“
Meine Neigungen werden so beschrieben: „Ein begeisterter Zeichner und Maler. Die Schulleistungen beruhen gleichmäßig auf Fleiß und Begabung.“ Meine Lehrerin formulierte meine Verstandesanlagen als „guter Beobachter, rege Fantasie, guter Zeichner, intelligent“. Und schließlich stellt Ruth Bertelshofer am 12. Juli 1950 meine Charaktereigenschaften als „ordnungsliebend, ehrgeizig, rasches Arbeitstempo, zuverlässig, selbständig und Einfluß auf andere“ dar. Mein Zeugnis war auch dementsprechend.
In Franz Worschechs Buch „Zummern. Geschichte eines westböhmischen Dorfes und seine Bewohner von 1380 bis zur Gegenwart“ ist folgender Artikel aus der Beilage „Böhmerwaldbote“ des „Westböhmischen Grenzboten“ vom 28. Februar 1914 abgebildet.

gentlich ausgebildeter Chirurg. Ich frage mich, wie er von Wien nach Waidhaus gekommen ist. Er war ein guter Arzt und mit einem schokoladebraunen VW Käfer unterwegs. Wenn er mich sah, kurbelte er das Fenster herunter, rief mich zu sich und überprüfte, ob alles gut verheilt ist. Am 1. September 1949 begann für mich die Schulzeit. Um 9.00 Uhr waren Mutti und ich im großen Schulgebäude gegenüber der Kirche, dem heutigen Rathaus. Viele Erstklässler waren mit ihren Müttern gekommen. Ich hatte einen neuen Schulranzen bekommen, der dunkelbraun lackiert war. Unsere Lehrerin in der ersten Klasse war Ruth Bertelshofer. Nach den allgemeinen Worten auch des Schulleiters wurde den Müttern mitgeteilt, was wir bräuchten: eine hölzerne Griffelschachtel mit bemaltem Schub. Darin befanden sich Griffel aus Schiefer. Auch die Schiefertafel war damals aus Schiefer, und man mußte sehr aufpassen, daß sie nicht zerbrach. An der Tafel hingen rechts an einer Schnur ein Gummischwamm zum Abwaschen und ein Lappen zum Trocknen der Tafel. In meiner großen Schultüte waren natürlich Farbstifte, aber auch Schokoladenriegel mit Zitronen- und Orangenfüllung. Ich ging gerne in die Schule, wie sich das für den Sohn eines Lehrers auch gehört. Das Lesebuch „Mein erstes Buch“ mit rotem Einband kaufte mir mein Vater. Ich sollte viel lesen, weil ich mich da wirklich nicht leichttat. Wir haben das Lesen gelernt, indem wir immer mit dem ersten Buchstaben an-
Das Addieren und Subtrahieren lernten wir an der Holzperlenrechenmaschine, später dann mit kleinen Pappkartons mit fünf, sieben, acht oder neun Punkten wie Dominosteine. So erhielten wir eine Vorstellung, daß drei weniger ist als sieben.
Mein ganz besondere Vorliebe galt dem Zeichnen und Malen. So hatte ich immer eine schöne Schachtel mit Farbstiften und Zeichenpapier. Die Liebe zu Büchern erbte ich von meinem Vater. Er hatte durch die Vertreibung seine Bücher verloren. Nur vier Bücher hatten meine Tanten über die Grenze getragen, eine dreibändige Schiller-Ausgabe mit weißen Deckeln und rotem Rücken und das dicke Buch „Volkshafte Dichtung der Zeit“, heute ein Dokument der völkischen Literatur des Dritten Reiches. Mein Vater schrieb die Verlage nach Remittenden an; so bekam er kostenlos eine kleine Bücherei zusammen, unbedeutend, daß die Bücher kleine Fehler oder Schäden hatten.
In meinen Unterlagen erhielt sich ein von meinem Vater abgeschriebenes Dokument mit der „Feststellung von Tatsachen zur Kennzeichnung des Schülers“, wohl eine interne Beurteilung. Danach war ich groß, schlank und nie krank (körperliche Verfassung). Der zweite Punkt beurteilte die Umwelteinflüsse: „Die Eltern haben größtes Interesse an der Erziehung und Ausbil-
In der zweiten Klasse hatten wir dann die schlanke große Lehrerin Else Rossa. Sie war etwas herber in der Art und nicht so herzlich wie Frau Bertelshofer. Für gute Leistungen und braves Verhalten erhielten wir kleine „gut“-Kärtchen, für zehnmal „gut“ ein Heiligenbild oder ein Bild mit einer Zeichnung und einem Spruch oder Gedicht.
Ich hatte von der Eslarner Straße bis zur Schule einen eher weiten Schulweg. Den ging ich nach dem ersten Mal mit der Mutter natürlich allein oder mit Schulkameraden bei jedem Wetter. Die immer wieder beschriebenen Ausgrenzungen von Flüchtlingskindern erlebte ich in Waidhaus nicht. Mein Vater verbot, daß wir den derben Oberpfälzer Dialekt sprachen, so haben wir Hochdeutsch geredet und sind dadurch schon aufgefallen.
Schulleiter war damals Franz Maier, der aus einem Dorf, ich denke Wosant oder Wusleben, im ehemaligen Kreis Tachau stammte und den mein Vater von früher kannte. Bei ihm waren wir einmal eingeladen. Er hatte eine sehr schöne Wohnung, und ich durfte mit einem grauen Blechflugzeug spielen, das er mir dann sogar schenkte.
Ein anderer Lehrer war Hauptlehrer Gustav Böhm, ein gemütlicher älterer Herr. Seine Frau litt an Brustkrebs und mußte sterben. Ihr Tod konfrontierte mich zum ersten Mal mit dem „Krebs“ und seiner tödlichen Wirkung. Das Wort „Krebs“ und der Tod, wie war das zu verstehen? Fortsetzung folgt
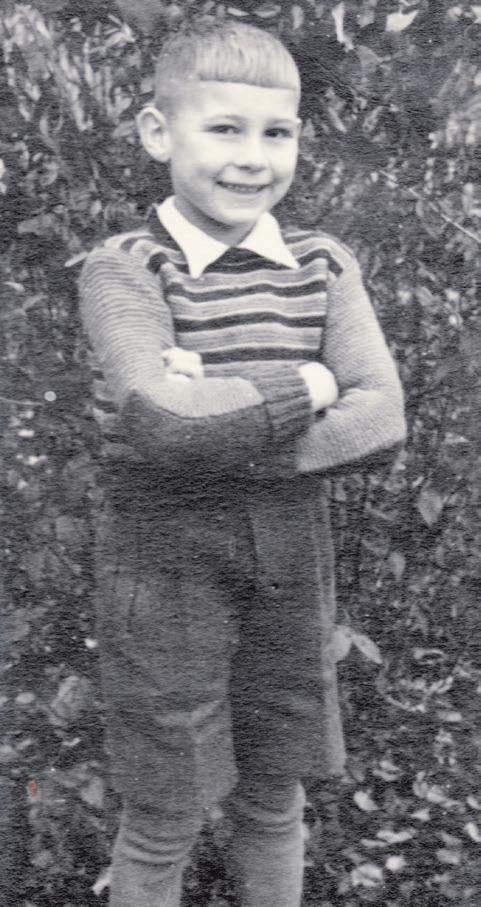
Zummern. (Blutiger Fasching.) Wozu ungezügelte Leidenschaft führen kann, das beweist das blutige Eifersuchts-Drama, das sich in unserem Dorfe in der Nacht von Sonntag auf Montag abspielte. Der 23jährige Zimmergehilfe Josef Frank aus Zummern brachte dem 37jährigen Häuslerssohn Michael Richter aus Godrusch eine so gefährliche Stichwunde bei, daß ärztlicher und priesterlicher Beistand in Anspruch genommen werden mußte. Der Täter wurde noch Montag vormittags verhaftet.“
Franz Worschech: „Zummern. Geschichte eines westböhmischen Dorfes und seiner Bewohner von 1380 bis zur Gegenwart“, Band 1 in der Reihe „Geschichte und Kultur Westböhmens. Schaffer-Verlag, Weiherhammer 2014; 242 Seiten. (ISBN 978-39816157-0-8)
Der verletzte Michael Richter war mein Großvater, der Vater meiner Mutter Katharina Schart/Richter. Harl – so nennen die Egerländer ihre Großväter – hat den Anschlag, Gott sei Dank, überlebt und gut überstanden. Er starb am 3. Dezember 1965, im gesegneten Alter von 89 Jahren fern der Heimat in Unteregg im Unterallgäu eines natürlichen Todes. Franz J. Schart
Ortsbetreuer von Godrusch
Eine weitere Nachricht in derselben Ausgabe des „Böhmerwaldboten“ berichtet über eine Faschingsbelustigung.
„Lustig in Ehren kann niemand verwehren; dies kann füglich auch von den heurigen Fa-
schingsaufführungen in unserem Städtchen gesagt werden. ,Zeppelin N. 99‘ am Montag und auch der ,tanzende Bajazzo‘ am Dienstag machten den Verantwortlichen alle Ehre. Besonders viel Spaß für Groß und Klein verursachte Herr ,Bajazzo‘ mit seiner Reklame-Tafel durch seine posierlichen Sprünge sowie durch seine schlagfertigen Witze als Kellner beim Konzert im Bahnhofshotel. Herr ,Bajazzo‘ besitzt ohne Zweifel großes Komikertalent.“ Im Fasching 1938 ereignete sich in Zummern ein tragisches Unglück. Auch dies belegt Worschech mit einem Zeitungsartikel aus dem „Westböhmischen Grenzboten“ vom 19. August 1938. „Zummern. Am 27. Feber hatte die hiesige Jugend eine Faschingsunterhaltung. Um sich zu maskieren, gingen die jüngeren Leute auf den Dachboden des Gasthauses Josef Andreas Wag, wo sie sich umziehen wollten. Bei dieser Gelegenheit fand der 18jährige Anton H. in einer Ecke des Dachbodens ein Flobertgewehr. Er nahm es in seine Hände, legte es zum Scherz auf seinen Freund, den Maurerlehrling Josef Lang, an und drückte ab. Die Waffe war jedoch geladen, und die Kugel drang dem Lang in den Hals, so daß er nach wenigen Minuten starb. Der entsetzliche Vorfall hatte jetzt am Egerer Kreisgericht ein Nachspiel. Der 28jährige Gastwirt Josef Andreas Wag, der zur Zeit des Vorfalls bei der Waffenübung war, wurde wegen Vergehens gegen die Sicherheit zu drei Monaten Arrest verurteilt.“
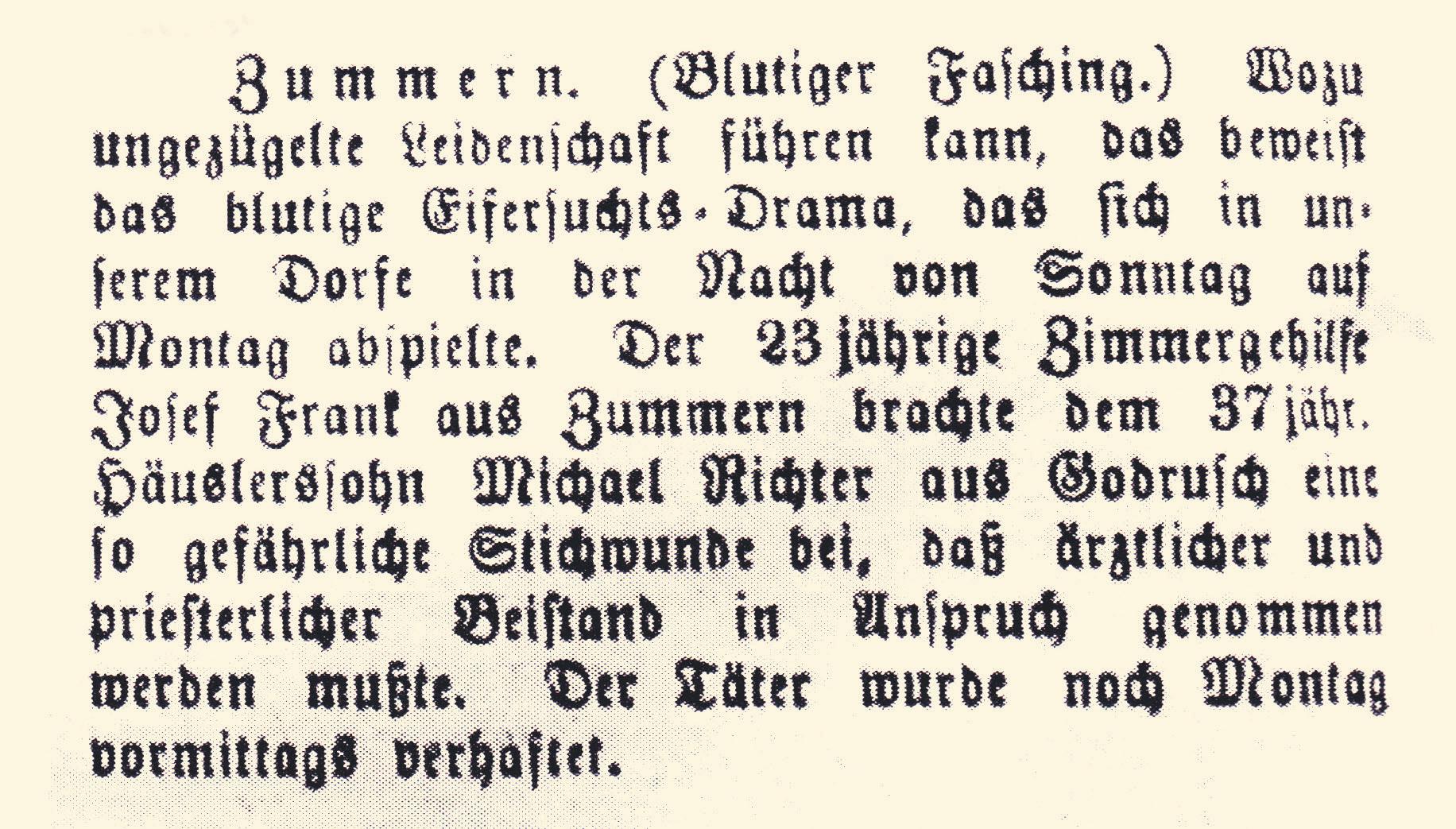
Bund der Eghalanda Gmoin e. V., Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, Telefon (0 92 31) 6 612 51, Telefax (0 92 31) 66 12 52, eMail bundesvorstand@egerlaender.de
Bundesvüarstäiha (Bundesvorsitzender): Volker Jobst. Spendenkonto:
❯ Die nächsten
■ Sonntag, 12. Februar, Egerland-Jugend Hessen: Landesjugendtag und Tanzseminar in Hungen. 9.30 Uhr Beginn Landesjugendtag; 13.30 Uhr Beginn Tanzseminar mit DJO-Referent Hartmut Liebscher. Anmeldung: hafer@egerlaender.de
■ Samstag, 18. Februar, Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball mit der Musik Original Geigenbauerkapelle Bubenreuth. Paul-Metz-Halle, Zirndorf. Vorverkauf: Roland Tauscheck, Telefon (09 11) 46 13 10.
■ Freitag, 10. bis Sonntag, 12. März, Bundesführung der Egerland-Jugend: Klausurtagung der BdEG-Bundesjugendführung in Aidhausen.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, Egerländer Gmoi Offenbach: Jahreshauptversammlung. Emil-Renk Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Anmeldung unter eMail: iris.plank@egerlaenderoffenbach.de
■ Sonntag, 26. März, 9.00 Uhr, Egerländer Landesverband
Hessen: Landesfrühjahrstagung unter dem Motto „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“. Ab 9.30 Uhr Vorträge, Geschichten, Fotos und Aufzeichnungen von 70 Jahren Egerländer Landesverband und 70 Jahre Egerland Jugend musikalisch umrahmt von Christa & Jürgen; 13.30 Uhr Hutza-Nachmittag mit Fotos und Eindrükken der sieben Jahrzehnte mit Liedern, Tänzen und Mundartvorträgen. Anmeldungen an Jürgen Mückstein, Gansahrweg 2a, 35423 Lich oder eMail juergen-mueckstein@t-online.de

Veranstaltungsort: Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.
■ Sonntag, 2. April, 14.30 Uhr, Egerländer Gmoi Dillenburg: Frühlingskaffee. Anmeldungen an Hans-Jürgen Ramisch unter eMail info@ egerlaender-dillenburg.de Veranstaltungsort: Dorfgemeinschaftshaus, Dillenburg-Eibach.
■ Freitag, 21. April, Egerland-Kulturhaus-Stiftung: 100. Sitzung. Veranstaltungsort: Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
❯ Energiesparen anno dazumal mit der Kochkiste

Kurz aufkochen, dann den Topf für eineinhalb Stunden in der möglichst gut isolierten Kochkiste verstauen, und fertig ist das Kartoffelgulasch.
Wie man anno dazumal mit minimalem Energieaufwand Speisen zubereitet hat, hat sich BR-Reporter Paul Enghofer im Egerland-Museum in Marktredwitz von der Museums-Mitarbeiterin Andrea Wagner zeigen lassen.

Die Kochkiste spart rund drei Viertel der Energie, heißt es in ei-
nem alten Kochbuch. In neueren Quellen ist von 30 bis 90 Prozent die Rede. Als Fausregel gilt: Ein Sechstel der Kochzeit sollen die Speisen auf dem Herd vorgekocht werden und dann ungefähr das Dreifache der normalen Kochzeit in der Kiste garen. Regelmäßig veranstaltet das Egerland-Museum Kochkurse mit der Kochkiste.
Die Reportage aus der Reihe Zwischen Spessart und Karwendel und das Rezept sind in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks (www.br.de) abrufbar.
Hohe Ehre für ein Egerländer
Urgestein: Albert Reich ist für sein über 50-jähriges Engagement für die Egerländer Kultur von Oberbürgermeister Oliver Weigel mit der Silbernen Verdienstmedaille der Stadt Marktredwitz ausgezeichnet worden.
undesvüarstäiha Volker

B

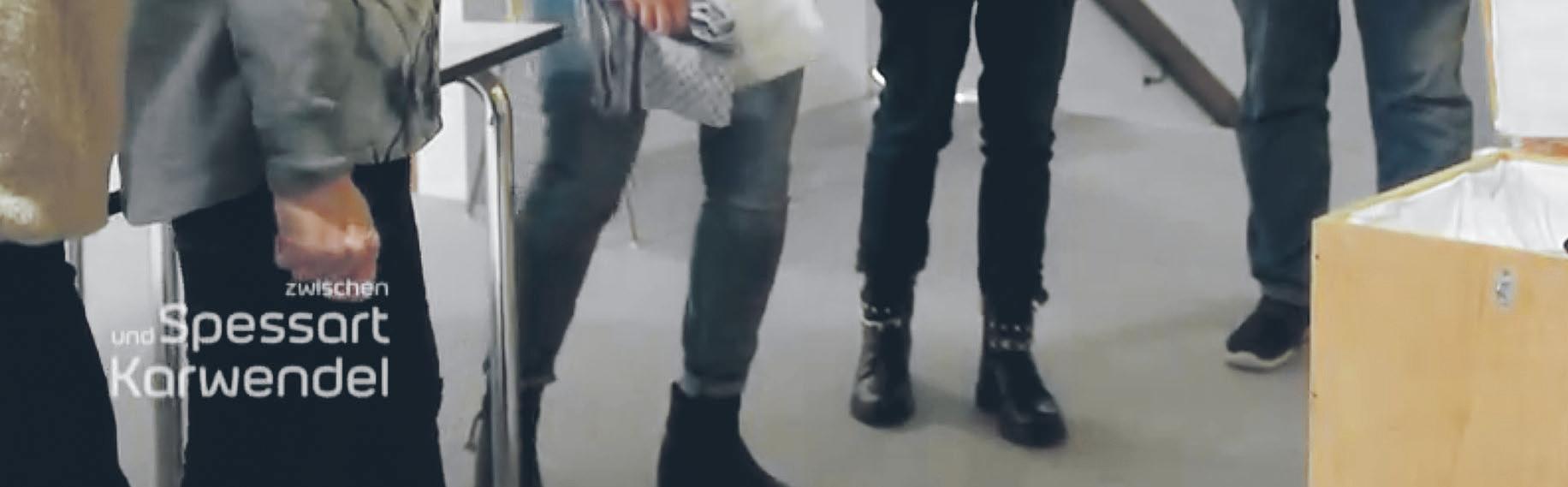
Jobst: „Wir verdanken Albert Reich mehr als man mit Worten ausdrücken kann. Durch sein Wirken ist er eine Egerländer Institution. Über ein halbes Jahrhundert hat sich Albert Reich um die Pflege und Bewahrung der Egerländer Kultur in Marktredwitz verdient gemacht.“
haupt in der Laudatio. Ebenso hat Albert Reich, geboren übrigens nicht im Egerland, sondern in Prag, die Bundestreffen der Egerland-Jugend ins Leben ge-

schließend: „Es freut mich sehr, daß Du heute extra aus Stuttgart angereist bist und ich Dir nun die Medaille und eine Urkunde für Dein großes Werk persönlich
vater betrieb die Nostitz‘sche Brettsäge in Lobstal bei Falkenau. Die Vertreibung brachte die Familie nach Stuttgart, wo Al-
terließ er als Kulturreferent der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie des Bundes der Vertriebenen in Baden-Württemberg und leitete viele Jahre das Haus der Heimat in Stuttgart.
Das Lieblingsprojekt des bestens vernetzten Reich ist der von ihm und Willi Stark gegründete Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender (AEK). Er ging aus einem Treffen Egerländer Mundartdichter im Jahre 1974 hervor. Zu den herausragenden Kunst-Persönlichkeiten, die bei Veranstaltungen des Egerländer Kulturarbeitskreises auftraten, gehörten Literaturpapst Professor Walter Höllerer, der über das Weltei referierte, Ernest Hofmann-Igl, der seine genialen Bronzeplastiken präsentierte, und Professor Hans Erich Slany, der weltbekannte Produkte designt hatte.
rufen, die bis heute regelmäßig stattfinden.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda
Gmoin: Bundeshauptversammlung im Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz. Anmeldungen an Volker Jobst unter eMail Jobst@ egerlaender.de
Schon zu seinem 70. Geburtstag bekam Albert Reich für sein Schaffen eine hohe Ehrung der Stadt Marktredwitz: den kleinen Brunnenlöwen. Im Zuge seines 90. Geburtstags am 22. September entschied der Stadtrat, ihn erneut auszuzeichnen. Auf dem Neujahrsempfang überreichte ihm OB Oliver Weigel die silberne Verdienstmedaille. „Wir alle schätzen Dich als langjährigen ersten Vorsitzenden des Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender – den AEK hattest Du seinerzeit gemeinsam mit Willi Stark gegründet. Seit der Gründung wurden viele bedeutende Ausstellungen, Konzerte und Symposien mit hochinteressanten Themen organisiert.“, sagte das Stadtober-
„Man kennt Dein Wirken aber auch aus dem Stiftungskuratorium der Egerland-KulturhausStiftung, aus dem Beirat für das Egerland-Museum und natürlich auch als Bundeskulturwart des Bundes der Eghalanda Gmoin e.V. – um nur die wichtigsten Funktionen zu nennen“, zählte Oliver Weigel auf und sagte ab-
überreichen darf.“ Auch Reich selbst richtete anschließend noch ein paar Worte an die Gäste des Neujahrsempfangs: „Es ist mir eine große Ehre, diese hohe Auszeichnung der Stadt Marktredwitz entgegenzunehmen.“
Geboren wurde Albert Reich am 22. September 1932 in Prag, hatte aber starke Wurzeln ins Egerland. Sein Vater stammte aus Ebmeth im Kaiserwald, der Groß-
bert Reich heute noch lebt. Bereits 1951 engagierte er sich im Gmoirat Stuttgart. 1961 gründete Reich die Sing- und Spielgruppe der Eghalanda Gmoi z‘ Stuttgart und wurde Landesvorsitzender der Gmoin von Baden-Württemberg. In den 1960er Jahren veranstaltete er mit Ernst Mosch und dessen Original Egerländer Musikanten unvergessene Faschingsbälle. Große Spuren hin-
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.

„Seit 1990 verstand es Albert Reich, auch tschechische Journalisten, Historiker und Volkskundler in seine Tagungsprogramme einzubauen“, schrieb Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Vorsitzender des Egerer Landtags, in der Würdigung zum 90. Geburtstag in der Sudetendeutschen Zeitung
Hamperl: „Jedes Mal ging man im Bewußtsein auseinander, daß die Egerländer Kultur bedeutend ist und weiterlebt. Und das hat uns und mir Albert Reich mitgegeben.“ Torsten Fricke
❯ Bayerns Innenminister gratuliert Marktredwitzer Altoberbürgermeisterin Dr. Birgit Seelbinder zum 75. Geburtstag:
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat der Altoberbürgermeisterin der Stadt Marktredwitz, Dr. Birgit Seelbinder, zum 75. Geburtstag am 22. Januar gratuliert und ihr für das grenzüberschreitende Engagement als Präsidentin der Euregio Egrensis gedankt.
Herrmann schreibt in seinem
Glückwunschbrief: „Während Ihrer 24jährigen Amtszeit als Oberbürgermeisterin der Stadt Marktredwitz haben Sie
sich kompetent und tatkräftig den mit diesem Amt verbundenen verantwortungsvollen Aufgaben gestellt und maßgeblich zur positiven Entwicklung Ihrer Heimatstadt beigetragen.“
Besonders am Herzen sei Dr. Seelbinder die Bildungspolitik gelegen. So konnte auf deren Initiative hin der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement in Marktredwitz angesiedelt werden. Herrmann weiter: „Anstehende Herausforde-
rungen haben Sie stets tatkräftig angepackt, wie etwa den Bau der Autobahn A93 im Stadtgebiet, die Erweiterung des Egerland-Kulturhauses oder die Neugestaltung der Industriebrache der ehemaligen chemischen Fabrik von Markredwitz, auf deren Gelände das Kösseine-EinkaufsCentrum entstand.“
Herrmann würdigte auch das Engagement als Präsidentin der Euregio-Egrensis-Arbeitsgemeinschaft Bayern, in der sie sich 28 Jahre lang intensiv und erfolg-
reich für das grenzüberschreitende Zusammenwirken mit dem benachbarten Tschechien stark gemacht hat.
Herrmann: „Zahlreiche gemeinsame Projekte konnten durch Ihre Unterstützung verwirklicht werden, wie etwa das Deutsch-Tschechische Gastschuljahr oder die DeutschTschechische Fußballschule. Die Euregio Egrensis gilt heute als Musterbeispiel für eine gelungene grenzüberschreitende Organisation.“
Egerer Landtag e. V., Geschäftsstelle in 92224 Amberg, Paradeplatz 11; Vorsitzender: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de Stellvertretende
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA BUNDESZEITING vereinigt mit
Vorsitzende: Helmut Reich und Dr. Ursula Schüller Für die Egerer Zeitung zuständig: Prof. Dr.-Ing. Alfred Neudörfer, eMail A.Neudoerfer@gmx.de – Kassenführung: Ute Mignon, eMail ute.mignon@online.de Spenden an: Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN: DE73 7525 0000 0240 1051 22 – BIC: BYLADEM 1 ABG
H. Preußler Druck und Versand GmbH & Co. KG
Verantwortlich vonseiten des Egerer Landtag e. V.: Dr. Wolf-Dieter Hamperl – Redaktion: Torsten Fricke, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
❯ Entdeckt im Fotoarchiv des Egerer Landtags
In den Fotobeständen des Egerer Landtags wurden bei der Sichtung der Bestände auch zahlreiche Winterfotos entdeckt, besonders aus dem Ort Perlsberg. Der fast 900 Meter hoch gelegene Ort lag am Nordosthang des Judenhau, des höchsten Bergs des Kaiserwaldes.
Nicht im Erzgebirge, sondern im nahe Kaiserwald suchte und fand man ausreichend Schnee zum Wintersport, der in den 1920er und 1930er Jahren ja noch in seinen Kinderschuhen steckte. Dieses Hochland dehnt sich zwischen Karlsbad, Marienbad und dem Egerer Becken aus. Der Nordrand fällt steil zum Egerer Graben ab, der es gegen das Erzgebirge abgrenzt. Seine höchste Erhebung ist mit 983 Meter der erwähnte Judenhau. Perlsberg hatte eine lockere Siedlungsform, es gab Ober- und Unter-Perlsberg.

Von Westen gelangte man über Amonsgrün und Miltigau, von Norden über Schönficht und von Süden her über Bad Königswart nach Perlsberg. Die meisten
Das alte Landheim des Egerer Wandervogel in Perlsberg, das nach dem Brand durch das Ernst-Hatzak-Jugendheim ersetzt wurde.
Häuser waren Holzhäuser, erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden einige Steinhäuser, wie das Schulhaus. Das wohl bekannteste Gebäude war das Gasthaus „Zur Waldschlucht“ des Johann Hammerschmied. Hier war der Deutsche Turnverein zu Hause.
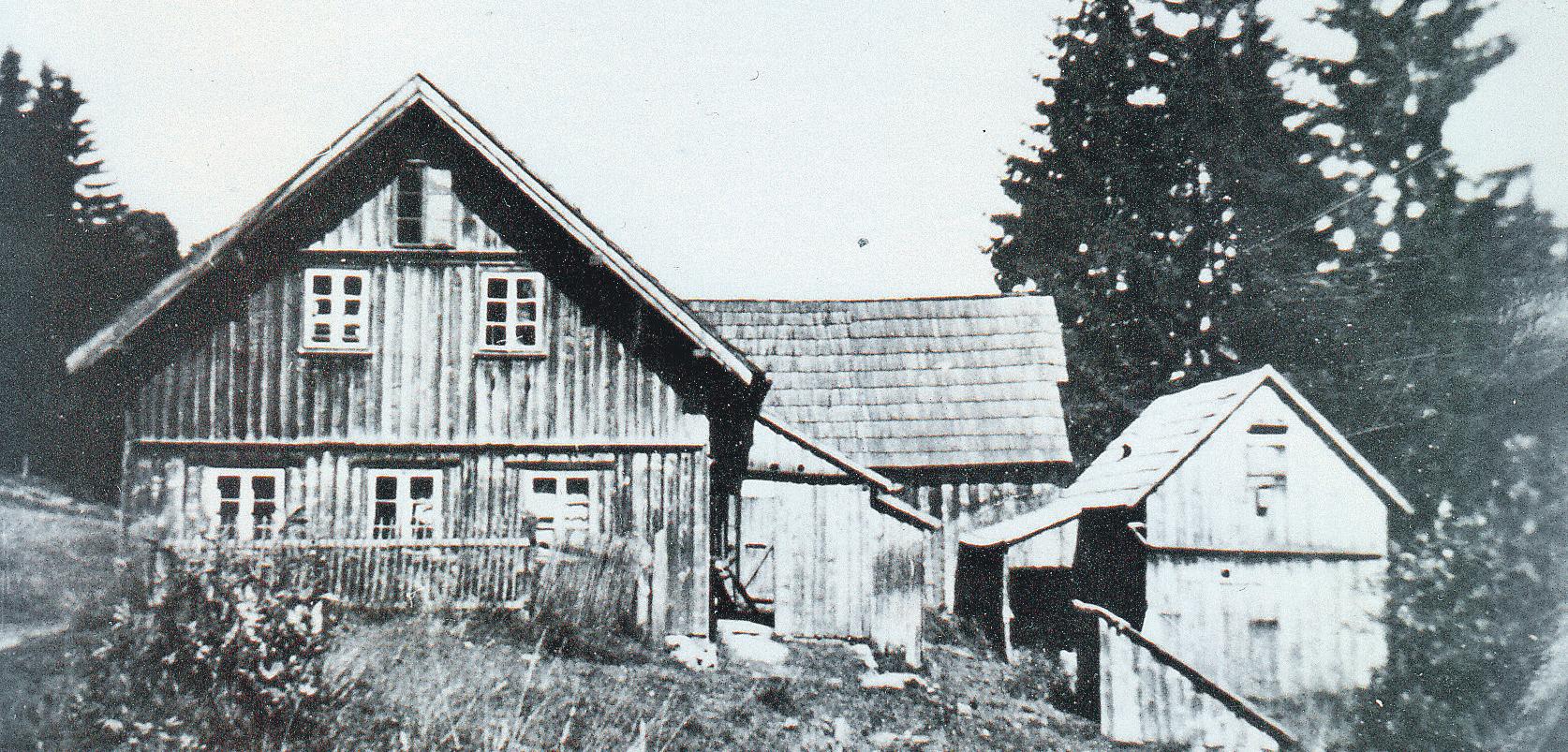

Im Jahr 1932 gründeten die jungen Leute in Oberperlberg einen Turnverein, der dem Egerland-Jahnmal-Turngau und somit dem Deutschen Turnerbund angeschlossen war. Das zweite Gasthaus lag auf der Rath und gehörte Josef Hoy-
er. Von hier oben konnte man das übrige Oberperlsberg gut überblicken. Der Blick schweifte über die herrlichen Nadelwälder hin bis zum Erzgebirge. Im Ortsteil Pfefferland waren die Winterstürme besonders zu spüren, die schneidend scharf daher sausten und viel Schnee brachten. Auf der Hut lag das langgestreckte Gasthaus „Kaiserwald“, das der Gastwirt und Fleischhauer Karl Hofmann betrieb. Hier kehrten die Wanderer und Sommerfrischler gerne ein oder wohnten dort. Der Blick
von hier oben in das Liebautal zeigte die Ferienhäuser des Falkenauer Baumeisters Theierl und des Egerer Ofensetzers Hausenblaß. Weiter unten lag das ErnstHatzak-Jugendheim des Egerer Wandervogel. Weiter unten stand das im schönen alpenländischen Stil erbaute Forsthaus, in dem der weithin bekannte Revierförster Franz Haberzettl regierte. Der abfallende Steilhang zum Liebaubach im Ortsteil Gasse war ein begehrter Rodelplatz.
In einer nicht näher bestimmbaren Beilage einer Wochenendausgabe erschien damals ein Artikel unter der Überschrift „Schneeläufe des Turnvereins Eger in Perlsberg“. Perlsberg wird das Dorado der Egerer Schneeschuhläufer und Abfahrer genannt. Vereinskämpfe wurden in der Abfahrt vom Judenhau und im Schneeschuhlaufen veranstaltet.

Heute findet nur der Kundige noch zwei oder drei Steinhäuser, sonst ist von dem beliebten Dorf mit der längsten Abfahrtsmöglichkeit nichts übrig geblieben. Dr. Wolf-Dieter Hamperl
❯ Das Projekt wurde im vergangenen Jahr vom Nationalen Denkmalamt mit dem Preis Patrimonium pro futuro ausgezeichnet
Der Egerer Hausberg zum Erlernen des Skifahrens war der Grünberg bei St. Anna. Fotos: Egerer Landtag


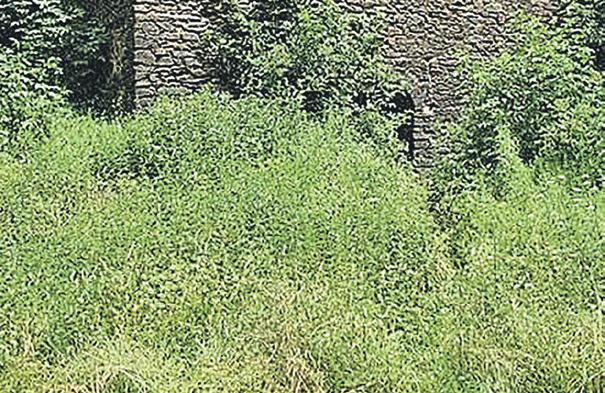

Am linken Ufer der Eger, neun Kilometer nordwestlich von der Stadt Eger, lag seit dem Mittelalter die Siedlung Markhausen (heute Pomezná). Sie ist auch im Verzeichnis der 1322 verpfändeten Ortschaften des Egerlandes aufgeführt und kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Denn sie war ursprünglich wohl ein befestigter Herrensitz eines Egerer Ministerialengeschlechts. Daran erinnerte über Jahrhunderte hinweg ein in den Bauernhof mit der Hausnummer 1 integrierter alter Wehrturm.
Die Ortschaft wurde mehrmals zerstört (1462, 1521 und im Dreißigjährigen Krieg), jedoch immer wieder aufgebaut. Fast endgültig dem Erdboden gleichgemacht wurde das Dorf aber nach 1945 durch die tschechoslowakischen Grenztruppen. Diese Barbarei überlebten nur das um 1930 in die Dorfmühle integrierte kleine Wasserkraftwerk und der imposante gotische Festungsturm – wenn auch arg lädiert. Heute sind der Turm und die Reste des Anwesens ein wahrer Lichtblick und ein beredtes Beispiel dafür, welche Anstrengungen die Enkelgeneration der Neusiedler unternimmt, um die noch vorhandenen Reste von historisch wertvoller Bausubstanz zu retten und zu erhalten.
Peter Jaška, geboren 1982 in Eger und Absolvent der Karlsuniversität, erwarb 2015 das Grundstück und erkannte als Historiker sofort, von welcher Bedeutung die inzwischen von der Natur überwucherten Ruinen sind. Er entschloß sich, einen erheblichen Teil seiner eigenen Mittel und Zeit für die Erhaltung des wertvollen Baudenkmals auf-
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer
Die Computersimulation (oben) zeigt, wie der Wehrhof wiederentstehen soll. Links: Der Wehrturm um 1900. Rechts: Vor der Sanierung sind vom Wehrturm nur die Grundmauern erhalten. Unten: Dank vieler Unterstützer geht der Wiederaufbau des Stallgebäudes voran.

geschoß des Stallgebäudes erfolgreich originalgetreu hochgezogen. Letztes Jahr gelang es noch, den Außenkeller zu restaurieren. Ein weiterer Erfolg waren die Sanierung beziehungsweise Erneuerung aller Sparren sowie der Anschluß des Areals an das elektrische Versorgungsnetz. Darüber hinaus hat das Staatliche Liegenschaftsamt in Prag entschieden, die Zufahrtsstraße zur Örtlichkeit komplett zu sanieren und sie kartographisch festzulegen. Damit kehrt die historisch bedeutende Festung langsam, aber sicher auf die offiziellen Landkarten zurück. Danach hat sich das Team auf zwei weitere Hauptgebäude konzentriert. Anhand des Studiums historischer Fotografien und zugänglicher Unterlagen ist es gelungen, alle Restaurierungsprojekte des ursprünglichen Fachwerkhauses und der Scheune abzuschließen und mit zeitgemäßer Designsoftware detailliert durchzuplanen und zu visualisieren.
zuwenden und dessen Rekonstruktion nach den Grundsätzen der Denkmalpflege anhand der bisherigen Ergebnisse der bauhistorischen Untersuchung des Objektes durchzuführen. Dabei arbeitete Jaška mit dem Nationalen Denkmalamt NPÚ Prag und dem Museum der Stadt Eger zusammen und wurde von freiwilligen Helfern unterstützt.
Grundlage der Rekonstruktion mußte eine gut aufgearbeitete baugeschichtliche Bestands-
aufnahme mit anschließender interdisziplinärer archäologischer Forschung unter maximaler Nutzung zeitgemäßer Planungs- und Dokumentationssoftware sein.
2015 begannen die Arbeiten zur Rettung der Turmruine, die sich bereits in einem desolaten Zustand befand und vom endgültigen Zerfall bedroht war. Das Bauwerk war ohne Dach, Decken und Böden. Der Innen- und Außenputz war abgefallen, die oberen Teile des Umfassungsmau-
erwerks waren nur in Teilen erhalten. Die Bergungsarbeiten konzentrierten sich zunächst auf die Sicherung der Relikte des gotischen Turms. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf das Wiederverwenden von Originalbaustoffen und das Einhalten historischer handwerklicher Verfahren gelegt. Die provisorische Überdachung verhindert vorerst einen weiteren Verfall des Mauerwerks und die Zerstörung der erhaltenen Reste des historischen
Putzes. Weiterhin wurden Teile des Umfassungsmauerwerks geschlossen und rekonstruiert sowie Fußböden eingebaut und die oberen Bereiche des Turmes durch eine eingebaute Treppe zugänglich gemacht. Der ursprüngliche Eingang wurde mit einer Nachbildung der historischen Tür versehen.
Nach der Restaurierung der Umfassungsmauern der Festung wurde dank der tatkräftigen Hilfe einer Bürgerinitiative das Erd-
Das Team ist überzeugt, das Scheunengebäude nächstes Jahr fertigzustellen – obwohl die Fertigstellung des Daches und des Fachwerks eine echte Herausforderung darstellt. Ziel ist es, 2025 eine Ausstellung auf dem Areal zu eröffnen und das 800jährige Jubiläum seit der ersten schriftlichen Erwähnung von Markhausen zu feiern. Der letztes Jahr erteilte Preis Patrimonium pro futuro des Nationalen Denkmalamtes bewertet und hebt damit hervor, was alles auf dem Gebiet der Denkmalpflege hier erreicht wurde, und würdigt aber auch alle diejenigen, die zu diesem bedeutenden Ergebnis beigetragen haben. Prof. Dr. Alfred Neudörfer
FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN
Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de
Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de
Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de
Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46 Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
❯ Heimatverband
73. Jahrgang
Dank und Glückwunsch
Groß-Werscheditz, Ortsbetreuer Walter Schopf
Marita Thüringer, geb. Katter, in Grävenwiesbach, am 7. Februa zum 73. Geburtstag.
Maria Stock, Ortsbetreuer
Walter Schopf
Marianne Kämmerer, geb. Fischer in Feldatal am 23. Februar zum 77. Geburtstag.
❯ Der Parteisekretär der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Falkenau arbeitete für den Abgeordneten Franz Katz
November/Dezember 2022 Nr. 6
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Otto Frank war Parteisekretär der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Falkenau und Mitarbeiter des Abge-
Ingrid Schott, geb. Tausch, in Wehrheim am 25. Februar zum 80. Geburtstag.
ordneten Franz Katz (siehe unten). Frank konnte rechtzeitig vor den Nazis über Prag und Polen nach England fliehen und
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist
baute sich dann nach dem Krieg eine neue Existenz in Kanada auf. Seine Erinnerungen hat Otto Frank auf mehreren Schreib-
maschinenseiten festgehalten. Vermutlich stammte dieses Zeitzeugendokumennt, das Gerhard Hampl in der Falkenauer Hei-
matstube in Schwandorf entdeckt hat, aus den 1970er Jahren. Teil 1: Flucht und Einschiffung nach England.

Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler
Hildegard Tausch, geb.
Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 mehr möglich ist

Kaunzner, in Oberursel am 29. Februar zum 99. Geburtstag.
Spenden:


Reinhard Hanke, 20 Euro.
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.
Friedrich Waibel, 40 Euro.
Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Christoph Sölch, 15 Euro
Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber)
Geburtstage:
24. Februar: Dr. med. Adolf
Frank, Regensburg (90.).
1. Februar: Dr. med. Wolf-Dieter Hamperl, Altenmarkt (80.).
14. Februar: Elmar Heimerl, Nürnberg (80.).
17. Februar: Gerhard Pecher, Frankfurt (92.).
25. Februar: Hans Pribul, Geisenheim (93.).
16. Februar: Wilhelm Rössler, Sigmaringen (96.).
3. Februar: Gertraud Schmidt, Lahnau (91.).
Jeder kennt die Worte unseres alten Volksliedes: „Ach, es ist ja so schwer aus der Heimat zu gehen, wenn die Hoffnung nicht wär‘ auf ein Wiedersehen“. Als wir vor 40 Jahren unsere Heimat verließen, wußten wir nicht, ob wir uns jemals wiedersehen werden, und hatten auch gar keine Zeit, um uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir hatten die Wahl zwischen dem Konzentrationslager oder rechtzeitig in eines der noch freien Länder zu entkommen.
Ich war damals 26 Jahre alt, war schon sechs Jahre im Falkenauer Parteisekretariat bei unserem Abgeordneten Franz Katz angestellt. Nebenbei spielte ich schon jahrelang in einer Tanzkapelle Klavier und Akkordeon. Meistens spielten wir an Samstagen und Sonntagen im Bergarbeiterheim in Falkenau.
Als dann nach Hitlers aufrührerischer Rede im September 1938 die Sache für uns brenzlich wurde, fuhr ich auf Anraten mit einigen Freunden nach Prag, um abzuwarten, was kommt. Wir waren damals fest überzeugt, daß ein neuer Krieg nur eine Frage der Zeit sei und daß die Westmächte und Rußland die kleine Tschechoslowakei nicht im Stiche lassen werden. Es kam aber anders, als wir erwartet hatten.
❯ Maierhöfen
Im November verstarb die aus Maierhöfen stammende Bertl Telin, geborene Reich, im 96. Lebensjahr.
Bertl Telin war in erster Ehe mit einem Herrn Hacker verheiratet, der bereits in jungen Jahren am Schacht tödlich verunglückte. Aus erster und zweiter Ehe entstammen je eine Tochter, von denen die jüngere vor einigen Jahren verstorben ist.
Bertl Telin wohnte zunächst am Katzengiebel, bevor sie in ein Haus nach Prösau übersiedelte.
In Prösau zog sie im Alter in ein Wohnheim. Als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, verbrachte sie ihre letzten Jahre in einem Pflegeheim in Reichenau. Unsere Anteilnahme und unser aufrichtiges Beileid gilt ihrer Tochter und ihren Angehörigen.
Unna Herrgot låu se sölligh rouha! Gerhard Hampl
Das einzig Gute, was uns das Münchner Abkommen brachte, war, daß wir noch einige Tage Zeit hatten, um uns zu entschließen, was wir machen sollen. Ich fuhr dann nochmals nach Falkenau zurück und holte mir noch einige Sachen, unter anderem auch mein Akkordeon, was ich seither noch nie bereut habe.
Da ich einen gültigen Reisepaß hatte, wurde ich in Prag gleich in den ersten Flüchtlingstransport, der über Polen nach England gehen sollte, eingeteilt. Wir waren die Versuchskaninchen. Einige der Genossen hatten damals Bedenken, da ja zu der Zeit die Polen sehr freundlich mit Hitler waren und Hermann Göring gerade auf einem Jagdurlaub beim polnischen Präsidenten weilte. Man war nicht sicher, wie sich die Polen verhalten werden, manche befürchteten sogar, daß man uns glatt an die Gestapo ausliefern werde. Man versicherte uns aber, daß der englische Abgeordnete der Arbeiterpartei, David Greenfell, mit uns fahren werde, sodaß wir nichts zu befürchten hätten.
Nun, das hat die meisten von uns beruhigt. Jung war ich, ledig war ich, und Abenteuerlust hatte ich auch, also komme, was mag, sagte ich mir.
Wir trafen uns dann am Bahnhof in Prag – es waren ungefähr 15 Genossen – und es wurde uns gesagt, daß wir in die Slowakei fahren und von dort aus
über Polen. Schon im Zug in die Slowakei mußte ich mein Akkordeon auspacken, und es dauerte nicht lange und wir hatten eine wunderbare Stimmung im Wagen. Deutsche Lieder wurden gesungen, und als ich dann mit tschechischen Polkas anfing, ging auch gleich die Tanzerei los. Einige der mitfahrenden Gäste waren begeistert, so eine schöne Bahnfahrt hätten sie noch nie mitgemacht. Genosse Greenfell wollte dann auch mal das Akkordeon ausprobieren und spielte uns ein englisches Volkslied vor, das wir damals allerdings noch nicht mitsingen konnten.
Bevor es an die polnische Grenze ging, mußten wir in einen Lokalzug umsteigen, der nur aus einem Wagen bestand. Weiters wurden wir informiert, daß wir nur eine gewisse Summe tschechisches Geld über die Grenze nehmen dürfen. Die Bahnfahrt ging durch endlose öde Felder, bis wir endlich zu einem kleinen Haus kamen. Der Zug hielt an, das heißt der Wagen hielt an, wir dachten, es sei ein Bahnhof. Es war aber ein Laden, der alles mögliche verkaufte, unter anderem auch Schnaps. Es wurde uns gesagt: „Nun habt ihr Gelegenheit, euer übriges tschechisches Geld los zu werden.“ Da es aber nicht allzuviel zu kaufen gab, fingen wir an, den im Laden anwesenden Slowaken Schnaps zu kaufen, der Lokomotivführer kam dann auch noch dazu, und es dauerte ungefähr eine Stunde, bis alles wieder in Bewegung kam. Der Besitzer des Ladens, ein Slowake, war schon so gut in Stimmung, er wollte mit uns nach England kommen, kletterte auf den Zug und ließ sich nicht abbringen. Wir mußten seine Frau holen, die ihn dann buchstäblich vom Wagen herunter zerren mußte.
Obzwar wir eigentlich nur Durchreisende waren, ließen es sich die polnischen Zollbeamten
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Kai Raab (Inhaber)
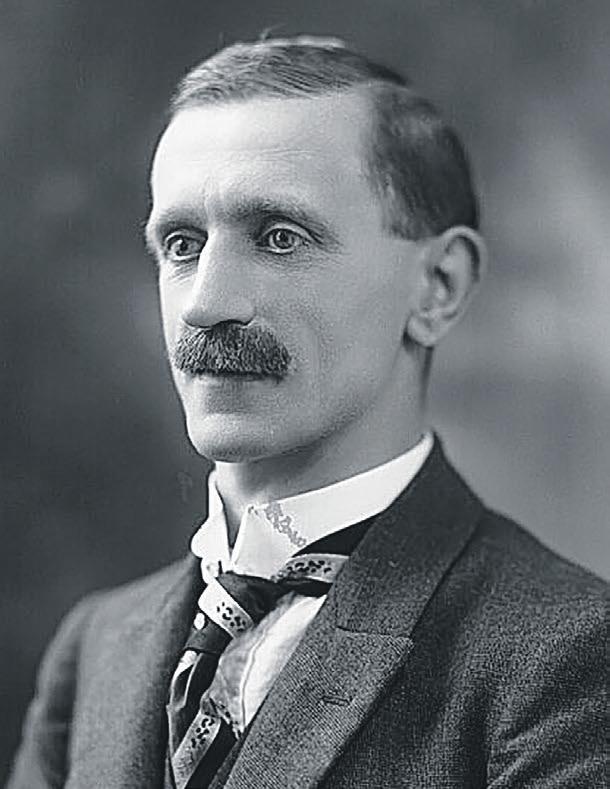
Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
nicht nehmen, uns gründlich zu untersuchen. Als ich an die Reihe kam, mußte ich ebenfalls alles aufmachen, und er zeigte auf einen Metallkanister in meinem Koffer, und fragte in perfektem Deutsch: „Was haben Sie da drinnen?“ Ich sagte ihm, es wäre eine Gasmaske. Wir bekamen da-
mals in 1938 doch alle Gasmasken zugeteilt, und in meinem jugendlichen Übermut wollte ich eben die Gasmaske auch mitnehmen als Andenken. Der Zollbeamte wollte die Gasmaske sehen, schüttelte sie, ob nichts drinnen war, und fragte wiederum: „Wozu brauchen Sie eine Gasmaske?“ Ich sagte ihm: „Der Hitler wird ja bald Krieg machen. Er kommt auch zu Ihnen noch in Polen.“ Er sagte mir darauf, er solle nur kommen: „Wir sind gerüstet und werden ihm den Garaus machen.“ Ich dachte nur, hoffentlich hast du recht.
Als er dann das Akkordeon sah, ging es wieder an, auspakken, schütteln, ob ich keine Diamanten da drinnen versteckt hätte. Dann fragte er: „Können Sie auch spielen?“ Auf meine bejahende Antwort sagte er: „Dann spielen Sie mal.“ Ich ließ mir das nicht zweimal sagen und fing mit einer schneidigen Polka an. Es waren ungefähr 300 Leute im Zollamt, und im nu hatte ich ei-
❯ Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei


nen großen Kreis um mich herum und manche wollten schon Tanzen anfangen. Der Zollbeamte winkte mir ab, aber ich tat so, als würde ich ihn nicht sehen, dachte mir eben, hätte er mich nicht gefragt. Bis dann ein hoher Beamter auf mich zukam und sagte: „Um Gottes Willen, hören Sie auf zu spielen. Das ist doch ein Zollhaus und kein Wirtshaus.“ „Ja“, sagte ich, „der Zollbeamte wollte wissen, ob ich spielen kann.“ „Na, ist schon gut“, sagte er, „jetzt wissen wir es schon, daß Sie spielen können.“ Unter großem Applaus der Zuhörer packte ich dann mein Akkordeon wieder ein. Wir fuhren dann weiter nach Krakau, und es wurde uns gesagt, daß wir über Nacht dort bleiben müssen. Wir wurden in ein Hotel einquartiert und mußten alle unsere Reisepässe abgeben. Damals wußten wir nicht, warum und wieso, heute wissen wir es, welchen Einfluß die Gestapo schon damals hatte. Die Behörden in Polen arbeiteten damals schon mit der Gestapo zusammen, und wäre einer von uns auf der Schwarzen Liste der Gestapo gewesen, wäre er von den Polen in Haft genommen und der Gestapo ausgeliefert worden. Auf unserer Fahrt nach Gdingen konnte ich mein Akkordeon nicht auspacken, da es Nacht war und viele der Mitreisenden im Wagen schliefen und ich nicht stören wollte. In Gdingen wurden wir nochmals über Nacht einquartiert, wußten aber nicht, warum. Am nächsten Morgen übersiedelten wir dann auf ein englisches Schiff, ich glaube „Baltrover“ war der Name. Teil 2 erscheint in der nächsten Ausgabe des Falkenauer Heimatbriefs und Elbogener Heimatbriefs am 10. März.
Die Gedenktafel am ehemaligen Haus der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Karlsbad erinnert auch an den Gewerkschaftssekretär und Politiker Franz Katz.
Katz wurde am 25. September 1887 in Janessen geboren und verstarb am 2. August 1955 in London. Er arbeitete zunächst als Bergmann und gehörte 1908 zu den Delegierten bei der Versammlung des Verbandes jugendlicher Arbeiter Österreichs. Später wurde Katz Gewerkschaftssekretär in Falkenau und Mitglied des Gemeinderats.
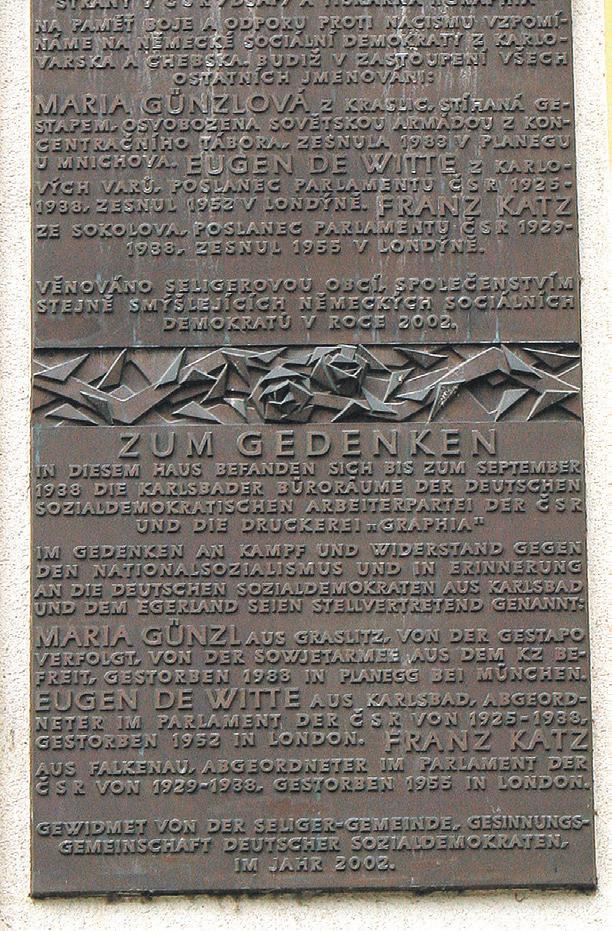
Anschluß des Sudetenlandes an das nationalsozialistische Deutsche Reich 1938 verlor er wie alle Abgeordneten aus den Sudeten den Abgeordnetensitz in Prag und floh vor der nationalsozialistischen Verfolgung nach London. Dort engagierte er sich unter den sudetendeutschen und ab 1939 tschechoslowakischen Exilpolitikern und leitete die „Treugemeinschaft der Exilgruppe der sudetendeutschen Sozialdemokraten“, der auch Wenzel Jaksch angehörte. Unter den Exilanten vertrat er in Opposition zu Edvard Beneš das Selbstbestimmungsrecht der sudetendeutschen Bevölkerung und forderte eine Volksabstimmung. Die
Katz war von 1926 bis 1938 Abgeordneter im Tschechoslowakischen Abgeordnetenhaus. Beim
Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V. � Botschaft von Kreisbetreuerin

Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Heimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.
Heimatkreis Karlsbad, Heimatkreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de
Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollak, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22.
Liebe Leser aus der schönen Stadt Karlsbad – ob Sie nun selbst noch in Karlsbad oder einer der Gemeinden in seinem Kreis geboren sind, Ihre Vorfahren von dort stammen oder Sie einfach Interesse an dieser schönen Gegend und ihrer Geschichte haben – seien Sie herzlich begrüßt!
Nun halten Sie schon die zweite Ausgabe der Karlsbader Zeitung im Mantel der Sudetendeutschen Zeitung in Händen. So, wie Sie sich an das neue Format gewöhnen müssen, muß ich mich
Spendenkonto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparkasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KS –Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
Dr. Pia Eschbaumer
mit den neuen Abläufen vertraut machen – nach und nach spielt sich das ein.
Wir vom Heimatverband der Karlsbader hoffen, daß es uns gelingt, Ihr Interesse zu gewinnen und zu erhalten. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Anregungen oder Kritik haben – wir bemühen uns!
Der Wechsel zur Sudetendeutschen Zeitung ist ein geeigneter Zeitpunkt, um Rückschau zu halten auf die Geschichte des Karlsbader Badeblattes, wie der Untertitel unserer Zeitung lautet. Dies hat dankenswerterweise mein
Kollege Rudi Baier übernommen – und so fasse ich mich selbst heute kurz.
Aber nicht fehlen dürfen die Geburtstagsglückwünsche an unsere Gemeindebetreuer, denen wir herzlich gratulieren, für ihren Einsatz danken und für das neue Lebensjahr Gesundheit und Lebensfreude wünschen.
Im Februar beglückwünschen wir zum
87. Geburtstag am 18. Februar Albin Häring, GB Kohlhau, 35043 Marburg;


80. Geburtstag am 4. Februar Dr. Peter Rau, GB Langgrün,
91359 Leutenbach;
76. Geburtstag am 28. Februar Ulrike Kramer /Schlosser, koop. GB Sittmesgrün, 90471 Nürnberg.
Außerdem möchte ich Sie auf den Beitrag von Ladislav Helsner hinweisen (Seite 19), der den heutigen Bewohnern von Karlsbad die deutsche Geschichte des Kurortes nahebringen möchte, unter anderem indem er sich bemüht, eine Ausstellung zu dem Maler und Bildhauer Wilhelm Hager in die Stadt zu holen. Herzliche Grüße von Kreisbetreuerin Pia Eschbaumer
Die Laufbahn der Familie Gottl und ihre letzte Ruhestätte:
Gottl Rudolf, Realitätenbesitzer und Fabrikbesitzer in Karlsbad-Fischern, Gründer der Kaolinerde-Schlämmerei, welche ab 1875 auch die Erzeugung fertiger Porzellanmassen und Glasuren vornahm. Die Porzellanmasse wurde unter anderem nach Deutschland und Skandinavien transportiert.
Am 26. September 1868 heiratete er die Müllerstochter
Emilie Anger aus Schlackenwerth. Im Jahr 1892 wurde das Unternehmen in die Zettlitzer Kaolinwerke AG umgewandelt. Als Verwaltungsrat leitete er deren Vorstand. In Fischern engagierte er sich in der Kommunalpolitik.
Er war Bürgermeister und Ehrenbürger von Fischern. Er beteiligte sich am Bau eines Altenheims, welches er weiterhin finanziell unterstützte. Er trug einen beträchtlichen Geldbetrag zum Bau der geplan-
ten zweiten katholischen Kirche in Karlsbad bei. Sein Sohn Viktor (1872–1934) war Vorstandsvorsitzender und Generaldirek-
tor der neuen AG. Sein Sohn August (1875–1957) übernahm, nach dem Tod seines Vaters, die Leitung des Unternehmens. Die-
vor
ses wurde 1946 verstaatlicht und änderte seitdem mehrmals seinen Namen. Die mehrteilige Grabstätte der Familie liegt an der südlichen Friedhofsmauer unweit des Haupteingangs. In der Grabstätte ruhen Rudolf Gottl, geboren am 31. Dezember 1841, und verstorben am 26. Dezember 1909 in Karlsbad-Fischern, sowie seine Ehefrau Emilie, geborene Anger, geboren am 24. Dezember 1848 und verstorben am 31. Juli 1911. Zudem ruhen dort Med. Univ. Dr. Julius Putzler-Kolbenschlag, geboren am 28. Januar 1854 und verstorben am 6. Mai 1892, seine Ehefrau Emma Jahn, geborene Gottl, geboren am 3. September 1869, und verstorben am 20. März 1937, sowie Flora Gottl, geborene Schäferling, geboren am 25. Juli 1874 und verstorben am 30. September 1903.



Baier Rudi
Egerländer Biogr. Lexikon
n 1. Februar 1923: Nach tagelangem Regen tritt Frost und Schneewetter ein, dann plötzliches Tauwetter bis zum 31. Januar, am 1. Februar Hochwasser. Die Geschäftsleute der Alten Wiese räumen ihre Geschäfte und bringen ihre Waren in Sicherheit.

n 2. Februar 1923: Franz Schram, Ziegeleibesitzer, stirbt im Alter von 79 Jahren.
n 3. Februar 1923: Neuerliche Hochwassergefahr infolge rascher Schneeschmelze. Der Pegel steigt bei der Johannisbrücke auf 2,20 Meter. Teilweise spült das Wasser über die Teplmauern.
n 6. Februar 1923: Badearzt M.U. Dr. Adolf Charmatz verstirbt im 54. Lebensjahr infolge Schlaganfalls, er übte die ärztliche Praxis seit 1898 aus.
P. Josef Bergmann, gewesener Kaplan in Karlsbad, zuletzt Pfarrer bei Sankt Karl in Wien, wird zum Kommandeur bei Sankt Bartholomä in Eger ernannt.
n 12. Februar 1923: Der Brotpreis wird herabgesetzt. Ein Laib Weißbrot, 1400 Gramm schwer, kostet nun 3,30 Kronen.
n 16. Februar 1923: Unentgeltliche Kohlenabgabe an Stadtarme.
n 17. Februar 1923: Amalie Kolbenheyer, geborene Hein, Mutter des großen Dichters Erwin Guido Kolbenheyer, verstirbt im Alter von 67 Jahren in Bozen.
n 18. Februar 1923:
Dr. Alois Rašin, Finanzminister, stirbt an den Folgen des auf ihn am 5. Januar/Jänner verübten
Revolver-Attentats.
n 21. Februar 1923: In Karlsbad wird ein Gewerbeschulinspektorat errichtet und mit dessen Leitung der Professor der deutschen Fachschule für Installateure in Budweis, Ing. Anton Turba, betraut.
n 22. Februar 1923: Die Gastwirte müssen die Aufschriften zuerst in tschechischer und danach in deutscher Sprache anbringen, ebenso müssen die Speisekarten doppelsprachig sein.
n 25. Februar 1923: Protestversammlungen gegen das Gesetz zum Schutz der Republik veranstalten die Sozialdemokraten am Becher-Platz und die Kommunisten im Schützenhaus.
n 26. Februar 1923: Wilhelm Stöttner, Schlosser, begeht Selbstmord durch Erschießen.
Die Mark verliert an Wert, 100 Mark = 15 hč.
n 28. Februar 1923: Einbruch im Haus Riel. Die Diebe erbeuten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Kronen. Später wird das Stubenmädchen rasch verhaftet.
Das Stadtverordneten-Kollegium beschließt folgenden Lohnabbau: Arbeiterlöhne 12,5 Prozent, Anschaffungsbeiträge 50 Prozent, Überstundenzuschlag 50 Prozent. Das dadurch erzielte Mindererfordernis ergibt 1 302 000 Kronen.
n 28. Februar 1923: Die Stadtvertretung ermächtigt den Stadtrat zur Aufnahme von Anleihen im Betrag von 9 Millionen Kronen.
Karlsbad Stadt
Gemeindebetreuerin Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de
Allen Karlsbadern, die im Februar/Feber ihren Geburtstag feiern, möchten wir an dieser Stelle herzlich gratulieren, unter ihnen namentlich unseren Abonnenten zum: 95. am 19. Traudl Kleedorfer/Fritsch (Martinique), A-6300 Wörgl; 87. am 25. Christa Thiemann (Pöschlhof), 35321 Laubach; 84. am 21.
Prof. Armin Rosin (Elbogner Str.), 70182 Stuttgart. Die besten Wünsche für ein gesundes und frohes neues Lebensjahr!
Mit dem Fest Mariä Lichtmeß am 2. Februar endet nach dem Kirchenkalender die Weihnachtszeit – jetzt ist endgültig die Zeit gekommen, die Weihnachtsdekoration abzuhängen!
Danach kann sich dann jeder, der mag, in den Faschingstrubel stürzen, der heuer knapp drei Wochen dauert: Am 22. Februar beginnt mit dem Aschermittwoch schon die Fastenzeit.
Da Ostern von dem FrühjahrsVollmond abhängt, die Fastenzeit aber immer 40 Tage dauert, „leidet“ darunter der Fasching, so daß er einmal kürzer, einmal länger ausfällt – heuer liegt er etwa im Durchschnitt. Über Bräuche, die mit Lichtmeß, weiteren Feiertagen und dem Fasching verbunden sind, schreiben auf diesen Seiten die Gemeindebetreuer Wolfram Schmidt unter Pullwitz, Rudi Kreisl unter So-
die „Maschkera“ vergangen sein – und am 14. war dann schon Schluß damit, denn so früh lag damals der Aschermittwoch.
In der Familie Gebhardt-Koller-Roth gab es dann aber doch Anlaß zu großer Freude – bitte erlauben Sie mir diesen privaten
Rückblick: Nach schwerer Geburt kamen dort Zwillingsbuben zur Welt.
Einen schönen Februar/Feber wünscht Ihnen Ihre Pia Eschbaumer

Im Landkreis: Altrohlau
Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Tel. (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf.Preis@ t-online.de Herzliche
Geburtstagsglückwünsche gehen im Februar zum 95. am 6. an Franz Heinrich, 72285 Pfalzgrafenweiler; zum 89. am 18. an Erna Bolkart/Graser, 89257 Illertissen. Alles Gute, Glück und Gesundheit auch allen anderen Geburtstagskindern aus Altrohlau!
In der Januar-Ausgabe berichtete ich von der Altrohlauer Wasserversorgung und erwähnte, daß der Altrohlauer Wassermeister Franz Kolb den folgenden interessanten Bericht unter dem Titel „Der Bau der Wasserleitung“ niederschrieb. Nach dem Tod von August Pecher 1927 erfolgte der Bau mit tatkräftiger Unterstützung des nachfolgenden Bürgermeisters Josef Möser im Jahr 1931. Die Bau-Ausführung über-
Sekunde; der Grundbesitzer erhielt somit 12 000 Kronen Entschädigung.
Um bei den Messungen eine klare Übersicht zu bekommen, wurden die Quellen mit fortlaufenden Nummern versehen:
–Quellen 1-4: Weinkauf, Kammersgrün;
–Quellen 5-7: Bräutigam, Kammersgrün;
–Quellen 8-10: Schösser, Kammersgrün;
–Quelle 11: Berger, Tüppelsgrün;
–Quelle 12: Lauber, Tüppelsgrün;
–Quelle 13: Harlesch, Hohenstollen;

–Quellen 14-16: Götz, Hohenstollen;
–Quelle 17: Rau, Voigtsgrün;
–Quelle 18: Weinkauf, Kammersgrün;
–Quellen 19-20: Schöberl, Neuvoigtsgrün;
Im Staatsforst am Wölfling wurde eine Quelle gemeinsam mit Fischern erschlossen, wovon Altrohlau 25 Prozent des Wassers erhielt. Für einen Kubikmeter Wasser hatte Altrohlau 30 Heller an Fischer zu entrichten. Die Länge des Rohrstranges vom Wölfling bis zum neuen Hochbehälter am Hutberg betrug 13 Kilometer und vom Hohenstollen bis zum Behälter drei Kilometer, so daß die Gesamtlänge der Zuleitung 16 Kilometer betrug. Der Hochbehälter am Hutberg faßte 800 Kubikmeter Wasser.
Im gesamten Ortsbereich wurden 40 Hydranten eingebaut, um bei Brandfällen eine gute Wasserversorgung zu gewährleisten. Darunter waren 22 Überflut- und 18 Unterfluthydranten. Im Sommer 1931 wurde das Wasser erstmals aus den neu erschlossenen Quellgebieten ins Altrohlauer
Familie Roth – zum Gedenken
Die Gemeindebetreuerin Pia Eschbaumer gedenkt ihrer verstorbenen Verwandten:
An meine beiden Onkel, die ich leider nicht kennenlernen durfte:
Egon und Fredi (Alfred)
Karlsbad 25. Februar/Feber 1923
Monte Cassino 15. März 1944 bei Königsberg 23. Januar/Jänner 1945 und an ihre kleine Schwester, meine liebe Mutter

Deli (Adele) verheiratete Eschbaumer
Karlsbad 4. März 1928 München 21. März 2010 die als Jugendliche erst ihre beiden geliebten Brüder verlor und dann, zusammen mit ihrer verwitweten Mutter und einer Großtante, aus der vertrauten Heimat vertrieben wurde.
Im Namen der Ortsbetreuer senden wir auch allen Geburtstagskindern des Februars aus den zuvor nicht aufgeführten Gemeinden die besten Wünsche für ihr neues Lebensjahr, Gesundheit und Wohlergehen. Besonders gratulieren wir den nun namentlich genannten treuen Abonnenten der Karlsbader Zeitung!
Wichtig: Wenn Sie persönlich gratulieren möchten, dann wenden Sie sich wegen der genauen Adresse bitte an die Kreisbetreuerin! Aich
13. Februar: Emma Ott/ Hauptmann, 595145 Oberkotzau, 100. Geburtstag.
9. Februar: Ida Bauer/Lang, 89231 Neu-Ulm, 93. Geburtstag.
Zur Faschingszeit 1938 in Altrohlau: Der ATUS-Unionsball „Paris bei Nacht“.

dau-Halmgrün-Großenteich, Rudi Preis unter Altrohlau – schauen Sie doch einmal hinein!
Heuer wird aus verschiedenen Gründen Rückschau ins Jahr 1923 gehalten. In Deutschland begann das Unheil mit der Besetzung des Ruhrgebiets ab Mitte Januar/Jänner, in deren Folge die Inflation rasch in unvorstellbare Höhen anschwoll. Doch wie hat sich das in den Nachbarländern ausgewirkt? Was haben die Karlsbader davon mitbekommen, waren sie betroffen?
Im Februar dürfte das kaum noch ein Thema gewesen sein, aber trotzdem hatte man große Sorgen: Wie wir unter „Karlsbad vor 100 Jahren“ lesen können, hat es gleich zu Monatsbeginn ein heftiges Hochwasser der Tepl gegeben. Die Älteren werden sich mit Schrecken an die verheerende Überschwemmung vom 24. November 1890 erinnert haben – und man hatte mit dem Bau der längst geplanten Talsperre bei Pirkenhammer noch nicht einmal begonnen. Da wird vielen wohl die Lust auf
nahm die Nordböhmische Wasserbau AG. Die Gesamtleitung hatte der Oberingenieur Knöpfl, als Bauleiter fungierte Willi Katze. Die Stadt Altrohlau stellte für die Erd- und Betonarbeiten den Stadtpolier Wenzel Schwarz zur Oberaufsicht ab und für die Rohrstrangverlegung den Wassermeister Franz Kolb. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 7 Millionen Kronen. Die Hälfte der Summe übernahm der Staat, da die Arbeiten als „Notstandsbauten“ eingestuft wurden. Die Messungen vor der Erschließung der Quellen fanden in den Jahren 1925 bis 1928 statt. Die Quellen schütteten bis zu 20 Liter pro Sekunde Wasser aus. Insgesamt wurden 17 Quellen für Altrohlau und drei Quellen für Tüppelsgrün erschlossen. Für einen Sekundenliter erschlossenes Wasser mußte Altrohlau 10 000 Kronen an die Besitzer der Grundstücke zahlen, auf denen die Quellen lagen, zum Beispiel die Quelle Nummer 13, Schüttung bei trockener Jahreszeit gemessen 0,4 Liter pro
Ortsnetz geleitet.
Die Quellen in der „Klinge“ waren für die Altrohlauer Versorgung nicht mehr notwendig. 1937 zeigte Zettlitz Interesse für das Klingewasser. Und schon 1938 wurden auf Kosten von Zettlitz diese Quellen mit einem neuen Rohrstrang entlang des Hutberges in den Zettlitzer Hochbehälter eingespeist. Ein Vertrag hinsichtlich des Wasserbezugs wurde auf 30 Jahre abgeschlossen, wobei 6 Pfennige pro Kubikmeter berechnet wurden. Die Wasserversorgung Altrohlaus war somit die modernste im Regierungsbezirk Eger, was auch allgemein anerkannt wurde.
Fasching in Altrohlau
Im Egerland gab es einst zwei Festlichkeiten, welche man ausgiebig mit Musik und Tanz ausgelassen gefeiert hat: „d‘Kirwa“ und „d‘Fasching“. Vor Beginn der langen Fastenzeit war dies die letzte Gelegenheit zum Fortsetzung nächste Seite
12. Februar: Anneliese Hotz/ Weick, 64846 Groß-Zimmern, 84. Geburtstag.
Dallwitz
15. Februar: Ulrike Harth/ Stöckl, 96163 Gundelsheim, 84. Geburtstag.
Donawitz
3. Februar: Wilhelm Lohwasser, 33699 Bielefeld, 94. Geburtstag.
Drahowitz
16. Februar: Hans Loh (Egertalstr. 82), 65618 Niederselters, 91. Geburtstag.
27. Februar: Dr. dent. Heinz Mannl (Schiffhäuser 41), 88. Geburtstag.
8. Februar: Christine Schneider/Blendinger, 91099 Poxdorf, 72. Geburtstag.
24. Februar: Gerhard Horst, 35325 Mücke, 69. Geburtstag.
Engelhaus
7. Februar: Gerdi Schlossbauer, 85221 Dachau, 82. Geburtstag.
Fischern
7. Februar: Manfred Böhm, 38112 Braunschweig, 83. Geburtstag.
Kohlhau
18. Februar: Albin Häring, 35043 Marburg, 87. Geburtstag.
Lessau
19. Februar: Helga Kreisl/Lorenz, 90455 Nürnberg, 66. Geburtstag.
Marletzgrün
10. Februar: Elisabeth Haid (ehem. GB), 64367 Mühltal, 96. Geburtstag.
Meierhöfen
15. Februar: Ilse Wieland/ Kitzmann, 95643 Tirschenreuth, 83. Geburtstag.
17. Februar: Sylvia Borowski, 06712 Zeitz, 73. Geburtstag.
Pirkenhammer
26. Februar: Ernst Thoma, 65343 Eltville, 94. Geburtstag.
Rossnitz
27. Februar: Rudolf Pschorn, 96476 Bad Rodach, 90. Geburtstag.

Schlackenwerth
9. Februar: Gudrun Foh, 82178 Puchheim, 88 Geburtstag.
10. Februar: Brigitte Streb, 91154 Roth, 80 Geburtstag.
Schönfeld
20. Februar: Erich Rödl, 64589 Stockstadt, 93. Geburtstag.
10. Februar: Anna Kaske/ Denn, 65795 Hattersheim/Main, 82. Geburtstag.
Hinweis an die Ortsbetreuer
Bitte schicken Sie die Liste als normales Textformat (keine eingescannten Kopien, keine ExcelDateien, keine handschriftlichen Listen) rechtzeitig per eMail an egerland@sudeten.de
ausgiebigen Schmausen und zu Tollerei. Auch wenn durch die rege Vereinstätigkeit das bunte Treiben gleich nach Neujahr begann, blieb die Zeit vom „Fetten Donnerstag“ bis zum „Aschermittwoch“ der Gipfel des Faschings. In diese Zeit fielen auch die Hauptveranstaltungen, unter anderem der Feuerwehrball, der Turner- und Sängerball, der Sportler- und der Jägerball oder die vielen Hausbälle im „Schwanzräima“ und „Bummelstübl“.
Den Auftakt machte der „Fette Donnerstag“, da mußte unbedingt gemaschkert werden. Der Lumpenball bei „Kohlert“ war ein „unbedingtes Muß“: Die feschen „alten Jungfern“ stellten die Mode der Urgroßmutter zur Schau. Und zum Abschluß hieß es stets: „Manna, woars heint wieda schäi!“
Bei aller Tanzerei, allem Trinken und aller Maschkerade wurde das gute Essen nicht verachtet. Krapfen fehlten in keinem Haus, und auf den Dörfern mußte manches Schwein sein Leben lassen.
An tollen Einfällen fehlte es nie, und in Altrohlau war immer etwas Besonderes los. Zum Beispiel spielte im Hotel Siegl einmal die Regimentsmusik des 73. Infanterie-Regiments zum Tanz auf. Die Umzüge und Ballnächte waren stets bestens besucht und standen unter einem ausgesuchten Motto.
Eine närrische, lustige Faschingszeit mit viel Spaß und Freude wünscht allen Lesern Rudi Preis
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx. de An den Anfang möchte ich ein großes Dankeschön stellen und all jenen Landsleuten Danke sagen, die mich wieder zum Jahreswechsel in Anerkennung meiner Arbeit mit einer Spende unterstützt haben. Ich bin überwältigt, es ist schön, daß ich auf meine Grasengrüner Landsleute zählen kann! Der Weihnachtsbrief 2022 bescherte mir viele positive Rückmeldungen, telefonisch wie auch schriftlich, was mich sehr gefreut hat. Sollte ich hier jemanden „übersehen“ haben, bitte sprechen Sie mich an.
Unser Franz Leicht, aus dem Fuchsloch, durfte am 22. Dezember 2022 seinen 88. Geburtstag in Höchstädt feiern. Auf dem Heimweg von Memmingen am 21. Dezember machte ich einen Schwenk nach Höchstädt auf einen kurzen Besuch. Er und seine Frau haben sich sehr gefreut,
und beim „riadn“ sind uns viele alte Egerländer Wörter eingefallen. Beiden geht es wieder besser, dem Alter entsprechend, wie man sagt. Liebe Familie Leicht, herzlichen Dank, auch von meiner Frau, für die freundliche Aufnahme und weiterhin alles Gute. Jetzt sind wir mitten in der „Fosnat“, die Mitte des Monats erreicht ihren Höhepunkt. Nach dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Wir werden sehen, wer dabei seine guten Vorsätze, die er sich zum Jahreswechsel vorgenommen hat, verwirklichen wird.
In diesem Sinn „gröißt Enk allå recht schöin“ Rudi Kreisl
Gemeindebetreuerin Magdalena Geißler, Karlsbader Straße
8, 91083 Baiersdorf-Hagenau, Telefon (0 91 33) 33 24; Heimatstube in 90513 Zirndorf, Fürtrefflicher Straße 8; betreut von Christina RöschKranholdt, Egloffsteiner Ring
6, 96146 Altendorf, Telefon (0 95 45) 35 98 13.
Lichtenstadt im Februar 2023
– wir gratulieren herzlich zum: 98. am 24. Elisabeth Eigler, geboren Fischer, 64546 MörfeldenWalldorf; 91. am 24. Josef Weps, 45699 Herten; 88. am 9. Gudrun Foh, 82171 Puchheim; 87. am 28. Christl (Therese) Häuser, 80939 München; 83. am 28. Erna Lechler, geboren Leipert, 90408 Nürnberg; 81. am 1. Renate Beck, 89269 Vöhringen; 80. am 4. Peter Rau.

„Ich wünsche dir, daß du das Glück niemals suchen mußt. Ich wünsche dir, daß es dich findet, wo immer du auch bist.“ (Unbekannt)
Viermal im Jahr fahre ich mit Christina und Daniel nach Lichtenstadt, um die Gedenkstätte auf dem Friedhof zu pflegen. Wir jäten Unkraut, füllen den Kies auf, bepflanzen die Schalen je nach Jahreszeit und zünden auch Kerzen an. Alleine könnte ich das nicht mehr bewältigen, und ich bin sehr froh, daß sich die beiden auch für meine alte Heimat interessieren. Die Gräber sind fast alle hergerichtet: entweder mit frischen Blumen oder es stehen Kunstblumen auf den Gräbern. Der Friedhof ist in einem guten Zustand. Die Stadt Lichtenstadt/Hroznětín sorgt dafür, daß immer gemäht wird. Auch Gräber, um die sich leider niemand mehr kümmern kann, sind dabei.


Bei unserem Ausflug darf ein Besuch bei Stjena (Tochter von Juli Elster) nicht fehlen. Wir werden bei ihr immer sehr herzlich aufgenommen und bewirtet. Im Gepäck hatten wir für sie auch kleine Geschenke dabei.
Magdalena GeißlerPullwitz
Gemeindebetreuer Wolfram Schmidt, Am Buchberg 24a, 91413 Neustadt/A., Telefon (0 91 61) 72 00 Liebe Pullwitzer, im Februar 2023 gibt es keine Pullwitzer Geburtstagskinder zu vermelden. Deshalb möchte ich an einen besonderen Brauch erinnern: Mariä Lichtmeß. Am 2. Februar 2023 wird Mariä Lichtmeß, das Fest zur Darstellung des Herrn, im Tempel 40 Tage nach Weihnachten gefeiert.





In vielen Gegenden ist Mariä Lichtmeß der Tag, an dem der Weihnachtsschmuck wieder aus den Kirchen und Häusern entfernt wird. Generell werden an Mariä Lichtmeß alle Kerzen geweiht, die im Verlauf eines Kirchenjahres gebraucht werden. Auch im Bauernjahr hatte früher der 2. Februar eine große Bedeutung: Die Aussaat begann an diesem Tag. Dabei gilt die Bauernregel: „Lichtmeß im Klee – Ostern im Schnee“.
An diesem Tag endete für die Diener und Hausangestellten auch traditionell das Arbeitsverhältnis bei ihren Herren. Die Knechte und Mägde hatten Gelegenheit, Verwandte zu besuchen und feierten gemeinsam. Sie bekamen ihren Restlohn und hatten Gelegenheit, mit all ihrem Besitz und ihrem Kleinvieh umzuziehen und sich einem neuen Herrn anzuschließen. Daraus sind auch die heute noch bestehenden Lichtmeß-Märkte entstanden, bei denen Handel getrieben und Kleinvieh verkauft wird.
In einem früheren Pullwitzer Bericht wurde geschrieben, daß am 2. Februar in der MariaMagdalena-Kirche in Haid auch für die umliegenden Gemeinden Weihwasser, Weihrauch und Kreide geweiht wurde. Die Weihe fand am späten Nachmittag statt. Nach der Rückkehr aus der Kirche wurde das ganze Haus nach altem Brauch mit Weihrauch ausgeräuchert. Vielleicht können sich noch einige Pullwitzer an diesen Brauch erinnern.
Es grüßt Sie recht herzlich Ihr Wolfram Schmidt


Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de
An den Anfang möchte ich ein großes Dankeschön stellen, all jenen Landsleuten Danke sagen, die mich wieder zum Jahreswechsel in Anerkennung meiner Arbeit mit einer Spende unterstützt haben. Ich
bin überwältigt, es ist schön, daß ich auf meine Rodisforter Landsleute zählen kann! Der Weihnachtsbrief 2022 bescherte mir viele positive Rückmeldungen, telefonisch wie auch schriftlich, was mich sehr gefreut hat. Sollte ich hier jemanden „übersehen“ haben, bitte sprechen Sie mich an. Lichtmeß haben wir bereits hinter uns, wir sind mitten in der „Fosnat“, und Mitte des Monats beginnt die Fastenzeit. Wenn man aus dem Fenster blickte, fehlte bis Januar noch jeglicher Schnee. Stattdessen war es eher grün als weiß. Damit wir zumindest ein wenig etwas von Kälte, Eis und Schnee haben, habe ich für Euch ein „Wintergedicht“ ausgesucht:
„Winta“ von J. Urban
Oanzuagn, Gott za Lob u Preis, håut d‘Natuar a Klåi(d)l, wöis åls Bra(u)tkload, zoart u weiß, oa(n)zöigt a gungs Måi(d)l.
Wöi dös glänzt, åch, wöi dös glöißt ümandüm u schimmart!
Schöia s‘ Augnlöicht ma valöißt, wals sua blendt u flimmart.
Jedan, wears non siaht, dean låcht s‘ Herz vuar Freid unbande; wöi a Wunna is döi Pråcht –leida non neat bstande.
Allen Rodisforter Geburtstagskindern im Februar viele gu-
te Wünsche, vor allem recht gute Gesundheit im neuen Lebensjahr; namentlich erwähnt sei als Abonnent der Karlsbader Zeitung mit dem 83. Geburtstag am 11. Rainer Keim, 34132 Kassel. „Bleibt’s ma g’sund bis zan März, es gröißt enk ålla recht schöi“ Rudi Kreisl
Schneidmühl
Gemeindebetreuer Rudi Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de
Im Februar gratulieren wir zum 72. am 5. Herlinde Kurz, geboren Müller, in 84140 Gangkofen. Wir wünschen ihr und allen, die im Januar Geburtstag feiern, die allerbesten Glückwünsche, Gesundheit und Wohlergehen. Den Kranken wünschen wir gute Besserung. Für die vielen Weihnachts- und Neujahrswünsche einschließlich der Zuwendungen für die Portokasse möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Euer Gemeindebetreuer Rudi Baier
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx. de An den Anfang möchte ich ein großes Dankeschön stellen, all jenen Landsleuten Danke sagen, die mich wieder zum Jahreswechsel in Anerkennung meiner Arbeit, mit einer Spende unterstützt haben. Ich bin überwältigt, es ist schön, daß ich auf meine Landsleute zählen kann! Der Weihnachtsbrief 2022 bescherte mir viele positive Rückmeldungen, telefonisch wie auch schriftlich, was mich sehr gefreut
hat. Sollte ich hier jemanden „übersehen“ haben, bitte sprechen Sie mich an. Noch ist der Frühling weit. Oft setzt der Winter zu Beginn des Jahres mit Schnee und Kälte richtig ein, aber das neue Leben regt sich schon schüchtern. Zu Mariä Lichtmeß (2. Februar/ Feber), welches als Anfang des Vorfrühlings gilt, soll die Sonne, deren Wärme schon spürbar geworden ist, wenigstens so lange scheinen wie der Bauer ein Pferd sattelt (Sittmesgrün). Aber Sturm und Schnee sieht man wohl lieber zu dieser Jahreszeit.
Dieser Marientag hat seinen Namen von der Kerzenweihe der katholischen Kirche erhalten, welche wahrscheinlich im Anschluß an ein römisches Sühnefest eingeführt wurde. Die kirchlich geweihte Kerze wird als Wetterkerze bei schweren Gewittern angezündet (Janessen), weil sie als wirksames Mittel gegen Blitzund Hagelschlag gilt. Noch häufiger wird sie als Sterbekerze verwendet. Die Krippe wird an diesem Tag zum letzten Mal beleuchtet und dann abgeräumt (Altrohlau, Dallwitz, Ziegelhütten). Am 3. Februar besuchen Gläubige die Frühmesse und lassen sich zur Vorbeugung gegen Halskrankheiten den Blasiussegen erteilen, oder, wie man in Zwetbau sagt, „einblaseln“.
Der Valentinstag (14. Februar) gilt als Unglückstag für das Vieh (Lappersdorf, Zwetbau, Weheditz). An ihm soll man kein Tier schlachten (Drahowitz), keine Hennen ansetzen (Zwetbau) und keine Kälber abnehmen (Mühldorf), überhaupt nichts anpakken, da alles umfällt (Haid).
An Matthias (24. Februar) schütteln die Kinder die Obstbäume, damit es viel Obst geben wird (Weheditz). In Rodisfort geschieht es, um dadurch die bösen Geister zu vertreiben. In diesem Brauch erkennen wir einen zu verschiedenen Zeiten des Jahres, besonders in den Zwölften geübten „Fruchtbarkeitszauber“. Jetzt ist die geeignete Zeit, die neuen „Fruchtbarkeitsgeister“ zu gewinnen. Die zahlreichen Abwehr- und Segensbräuche dieses Jahresabschnitts vereinigen sich vielfach in der Fastnacht. Ich wünsche allen eine schöne Fastnacht-Fosnad-Fosnet- und Faschingszeit. „Es gröißt Enk alla recht schöin“ Rudi Kreisl
Ladislav Helsner und Jindřich Nový haben die Lebensgeschichte von Wilhelm Hager, Maler sowie Bildhauer und Soldat im Zweiten Weltkrieg, ergründet. Helsner erzählt:
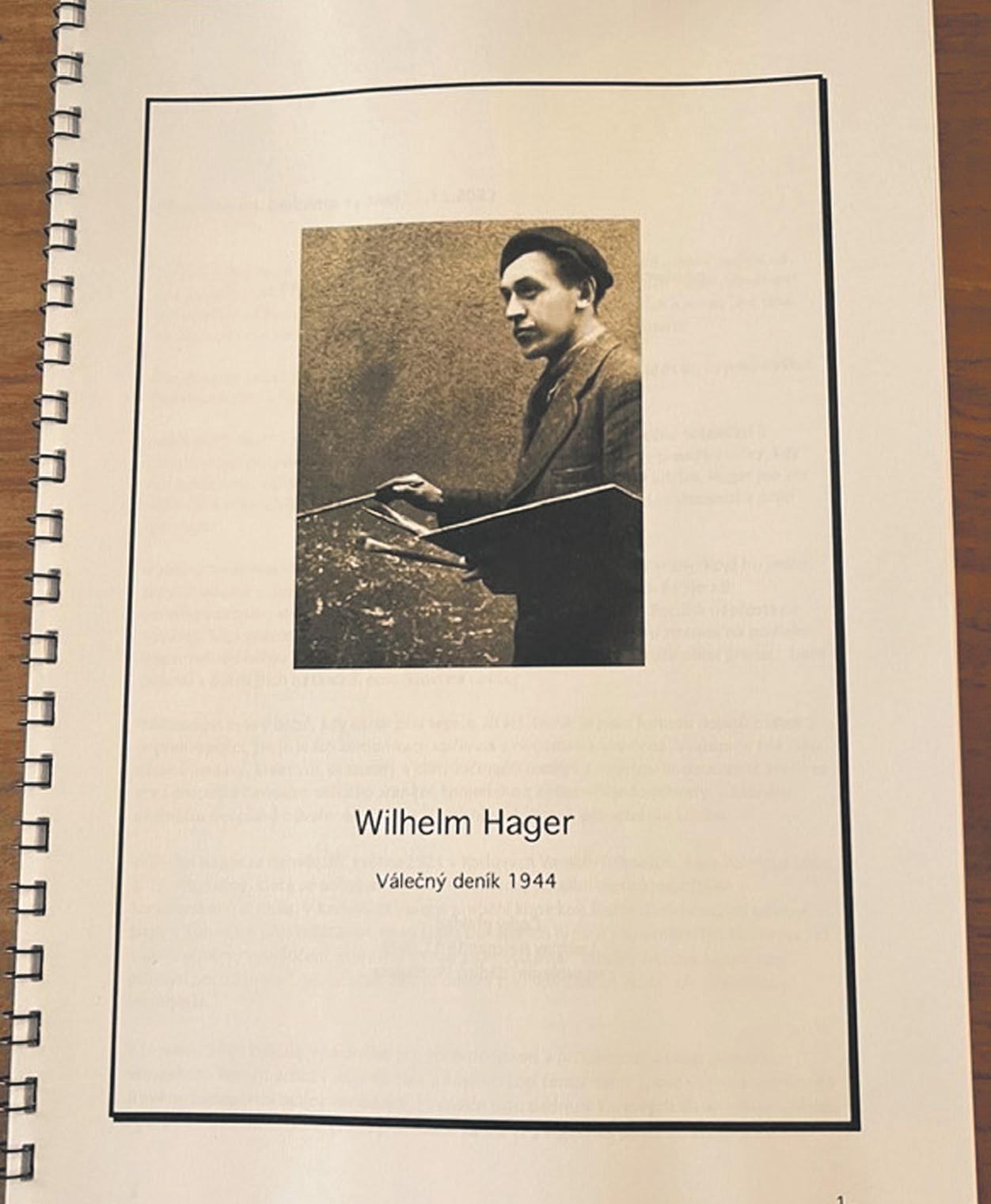
Dies war wieder einmal mehr oder weniger ein Zufall, daß aus meinem Kontakt zu Jindrich Nový und dem Karlsbader Verein „Wir leben in Donitz e.V.“ eine spannende Geschichte entstehen sollte. Diesmal ist es uns gelungen, in das Leben des deutschen Bildhauers und Malers Wilhelm Hager, der am 26. Mai 1921 in Karlsbad-Donitz geboren wurde, einzutauchen.
Wir hatten nämlich in Marktredwitz, auf der deutschen Seite des Egerlandes, eine Ausstellung unter dem Titel „Wilhelm Hager – Akademischer Bildhauer und Maler“ entdeckt. Die Karlsbader Zeitung informierte darüber 2022 und regte uns damit zu diesem Ausstellungsbesuch an.
In der Ausstellung faszinierte uns vor allem das Selbstbildnis von Hager, welches er im Frühjahr 1945 in Karlsbad am Sterbebett seiner Mutter Margarethe in Donitz gemalt hatte, kurz bevor die Wohnung am 19. April 1945 im Bombenhagel verschwand.


Dies hat uns derart fasziniert, daß wir uns gesagt haben: So eine Ausstellung müßte heutzutage doch auch in Karlsbad möglich sein.
Hager stammt aus Karlsbad. Wie sich nach und nach herausstellte, umgab ihn eine überaus spannende Lebensgeschichte.
Dabei handelt es sich um die Geschichte eines jungen deutschen Soldaten, welcher während des Krieges in Italien einen Reifungsprozeß durchgemacht und dies in einem Kriegstagebuch, das erst 2017 in Deutschland erschienen ist, festgehalten hat.
Diese Geschichte erzählten wir nun dem tschechischen Publikum am 27. November 2022 auf dem „31. Historischen Seminar Karl Nejdl‘s“ im Elisabethbad zu Karlsbad. Dies verbanden wir mit der Absicht, dadurch Interesse für eine Ausstellung in Karlsbad zu wecken. Wir haben dem Publikum, neben dem Original des erwähnten Selbstbildnisses, auch zwei weitere Werke des Künstlers nach Karlsbad ins Seminar gebracht. Damit auch die heutigen Karlsbader diese

Geschichte nachvollziehen können, habe ich das Kriegstagebuch ins Tschechische übertragen.
Warum haben wir uns die Mühe gemacht, das gesamte Tagebuch ins Tschechische zu übersetzen, obwohl die Auflage minimal und überdies rein privat wurde?
Das Tagebuch hat uns aus vielen Gründen „gepackt“. Wir halten es für ein seltenes und einzigartiges Zeugnis des Mutes eines jungen Künstlers, der als Soldat unter militärischem Eid, mitten im Krieg stehend, als ihm Strafen drohten, sich nicht scheute, die Verlogenheit der Nazi-Ideologie, insbesondere in der Kunst, anzuprangern. Er geht noch viel weiter als nur anzuprangern: Er malt förmlich gegen die Verlogenheit an. Somit war er 1944 in einem Wehrmachtscasino gerade dabei, ein Bild der Arena von Verona anzufertigen, als er von einem Leutnant mit Vorwürfen angegangen wurde, daß die Farben „des Geschmieres“ unmöglich seien und es sich wohl um den Stil „irgendeines Juden der entarteten Kunst“ handle. Als der Leutnant nicht aufhörte, gegen den Malkasten trat und das Bild plötzlich am Fußboden landete, sammelte es Hager auf und schlug es dem Leutnant zusammen mit seiner Malerpalette um die beiden Gesichtshälften –nicht ohne spätere Folgen. Hager war erst 23 Jahre alt, als er solche Geschichten in das Tagebuch in Form von Briefen an seine Mutter geschrieben hatte. Und es ist überraschend, wie ehrlich und ungewöhnlich offen ihre Kommunikation war.
Sein Militäreinsatz in Norditalien endete bei einer Nachrichten- und Propagandaeinheit der deutschen Wehrmacht. Und als er im Juli 1944 dieses Tagebuch zusammen mit seinen frisch gemalten Bildern in eine hölzerne Transportkiste legte, hoffte er, daß seine Eltern diese Kiste bald in Karlsbad öffnen und sich über seine neuen Bilder und das Tagebuch freuen würden. Der Krieg neigte sich dem Ende zu, und die Militärpost war leider nicht in der Lage, die Transportkiste nach Karlsbad zuzustellen. Die Kiste und das Tagebuch verschwanden für sieben Jahre ins Unbekannte. Hager selbst hatte anschei-
nend mehr Glück und kam noch vor Kriegsende, Anfang Februar 1945, zu seinen Eltern nach Karlsbad zurück. Er wurde am 28. Januar 1945 als hundertprozentiger Kriegsinvalide aus der Wehrmacht entlassen und wog nur noch 47 Kilogramm. Zu Hause in Karlsbad-Donitz angekommen, eskalierte seine Situation schnell und dramatisch.
Zunächst starb seine geliebte Mutter Margareta Hager schon
Ende Februar 1945 in der Familienwohnung, die sich in der heutigen Šumavská-Straße befand. Als ob dieses eine Unglück nicht schon genug wäre, fiel am 19. April 1945 eine amerikanische Fliegerbombe auf das Haus und zerstörte es. Sein Zuhause und seine Mutter waren nun fort.
Hager muß gewußt haben, was ihn in dieser Situation erwartete und wie es sein würde, wenn das
Dritte Reich endgültig zusammengebrochen ist. Ihm war klar, daß ihn in Karlsbad keine gute Zukunft erwartete. Daher wurde er schnell aktiv, um nicht bald in einem Wagon eines Vertreibungszugs nach Deutschland zu landen. Er nahm sein Schicksal selbst in die Hand und wandte sich an das tschechoslowakische Repatriierungsbüro in Karlsbad.
Im Büro der Repatriierungskommission bat er um Hilfe bei der Rückkehr nach Hause „nach Dänemark“. Er erklärte, daß er in Odense geboren und in Karlsbad zum Modelleur ausgebildet worden sei. Diese Rolle des dänischen Porzellanmodelleurs spielte er mit offensichtlichem Geschick. Sobald er diesen offiziellen tschechischen Repatriierungsausweis mit internationaler Gültigkeit besaß, hatte er schon weitgehend gewonnen. Denn mit Hilfe dieses Ausweises hatte er einen Anspruch auf Lebensmittelmarken und mußte keine weiße Armbinde tragen, die ihn als Deutschen gekennzeichnet hätte. Mit Hilfe dieses „Husarenstückes“ ist er im Sommer 1945 nach Bamberg gekommen, und er begann mit dem Aufbau seiner künstlerischen Existenz.
Erst sieben Jahre nach Kriegsende erhielt Hager am 17. Oktober 1952 in Illingen einen Brief aus München. Darin wurde ihm mitgeteilt, daß seine Kiste mitsamt Tagebuch aus Italien existiere und er sie entweder selbst abholen oder auf eigene Kosten
per Spedition zusenden lassen könne. Dieses Wunder verdankte Hager den Amerikanern und ihrem „Munich Central Collecting Point“. Die amerikanische Militärregierung hatte ihn nach dem Krieg eingerichtet, um sich um sichergestellte Kunstwerke zu kümmern, die größtenteils aus staatlich organisiertem Kunstraub während der NS-Zeit stammten.
Das Tagebuch war also bereits 1952 wieder „auf der Welt“. Aber bis 2017 wurde es nicht verwendet. Erst 2017 wurde die Handschrift in eine Textdatei übertragen und in Buchform herausgegeben.
Wenn man aber das Büchlein zu Ende gelesen hat, wird man feststellen, daß es weniger den Krieg beschreibt als den Transformationsprozess eines jungen Künstlers, der die glückliche Möglichkeit bekam, in Italien zu verweilen. Dieser Aufenthalt und sowohl die Besuche der Galerien von Verona und Mailand als auch der Kuratoren dieser Galerien, verhalfen ihm, die negative Rolle der gleichgeschalteten Kunst der Hitlerzeit in Deutschland besser zu verstehen.
In Italien konnte er Gemälde verschiedener Künstler studieren, darunter auch von Vincent van Gogh, Amedeo Modigliani, Oskar Kokoschka, Claude Monet oder Lyonel Feininger. Diese waren in Deutschland meist schon als „entartete“ Kunst abqualifiziert und befanden sich unter Verschluß. Diese Beobachtungen halfen ihm dabei, zu erkennen, worum es bei wahrer und echter Kunst geht.
Wir haben nach der Lektüre des Kriegstagebuches die Überzeugung gewonnen, daß es wohl nur mit Hilfe dieses Tagebuchs von 1944 möglich sei, zu verstehen, um welche edle Persönlichkeit es sich bei Hager handelte, auf die sowohl die Deutschen wie auch die Tschechen stolz sein können.
Im Jahr 1980 erhielt Hager den Kulturpreis für Bildende Kunst der Sudetendeutschen Landsmannschaft und 1981 die Plakette des Heimatverbands der Karlsbader in Wiesbaden für herausragende künstlerische Leistung. Die Karlsbader Keramische Fachschule hatte Hager im Jahr 1997 mit dem Titel eines Ehrenprofessors ausgezeichnet.
❯ Reparieren statt Wegwerfen: Peter Kahlich hat Nachhaltigkeit von seinem in Eger geborenen Großvater Alfred Kahlich geerbt
Alfred Kahlich (1906–1994) hat wahrscheinlich das eine oder andere Gerät, mit dem sich sein Enkel jetzt intensiv beschäftigt, gekannt oder sogar benutzt. Der Großvater ist in Schloppenhof bei Eger aufgewachsen, hat dort bis 1933 gelebt und als Dreher gearbeitet. Sein Enkel Peter Kahlich wuchs in Neumarkt in der Oberpfalz auf, ist heute 60 Jahre alt und fasziniert von alter Technik. Er restauriert dieses „technische Kulturgut“, wie er die Apparate gerne bezeichnet, für sich sowie für Freunde und Interessenten aus der Szene.
Die aufkommenden nationalen Spannungen in der 1918 gegründeten Tschechoslowakei veranlaßten Alfred Kahlich und seine Familie, im Jahr 1933 die angestammte Heimat zu verlassen und nach München umzusiedeln. Daß dies damals nicht einfach war, weiß Peter Kahlich aus Erzählungen seiner Vorfahren: „Die Großmutter hat alles – darunter auch Geld und Schmuck – im Kinderwagen, in dem mein Onkel als Säugling lag, herausgeschmuggelt.“
Als Kind ist Peter Kahlich mit den Großeltern ein paar Mal in Grenznähe zu Schloppenhof gefahren. „Das war ein sehnsüchtiges Hinüberschauen“, erinnert er sich. Nach der Wende war dann 1990/91 eine Exkursion nach Eger möglich, wo der Großvater dem Enkel den Standort des früheren Hauses zeigte. Der Ort selbst mußte damals den
Grenzanlagen weichen. „Mein Opa konnte sich auf Tschechisch mit den Leuten unterhalten“, erzählt Kahlich, der mit den Geschichten und Erlebnissen seines Großvaters aufgewachsen ist. Besonders prägend waren dabei die Schildungen über die Natur, die noch heute seine Tätigkeit und sein Engagement für Nachhaltigkeit beeinflussen.
Vor allem sind es Radio- und Fernsehgeräte, die Peter Kahlich bearbeitet. Egal ob ein Zenith 809 von 1934 der in Chicago angesiedelten Firma Zenith Electronics Corporation, ein Radio der Firma Berrens aus Paris, Geräte von Philips und Telefunken oder ein Fernseher Rembrandt 852.


















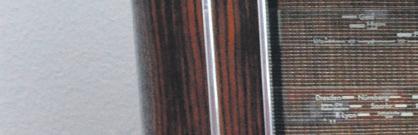

Eher zufällig kam Peter Kahlich zu diesem Bereich. Während seiner Gymnasialzeit machte er einen Ferienjob bei einem Antiquitätenhändler. „Hier bin ich mit den alten Dingen konfrontiert worden und dann dem Thema verfallen“, erinnert er sich an diese für ihn prägende Zeit Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre. So entschloß er sich, nach dem Abitur eine Ausbildung zum Restaurator zu absolvieren. Kurze Zeit war er nach der Lehre in diesem Beruf tätig, ehe der Dienst in der Bundeswehr für vier Jahre sein Leben bestimmte – und ihn vom Restaurieren und den alten Schätzen (zunächst) wegbrachte.
Nach der Bundeswehr übernahm er für zwei Jahre die Leitung einer Tankstelle, bevor er eine Ausbildung zum Zahntechni-
ker machte. Anschließend war er in Deutschland und der Schweiz tätig, wobei die Laborleitung, die computergestützte Konstruktion und Fertigung von Implantaten und diese Wissenschaft insgesamt seine Schwerpunkte waren.
Mit 44 Jahren startete er beruflich nochmals neu durch – im Feld der hochmodernen Technik bei der Firma Infineon. Hier war er bis 2013 im Mikrochip-Analytiklabor unter anderem für Röntgen- und Ultraschallmikroskopie zuständig. Doch 2014 hieß es „zurück zu den Wurzeln“, zum Restaurieren: Der Oberpfälzer startete als freischaffender Restaurator von technischem Kulturgut, verbunden mit einem Antiquitätenhandel.
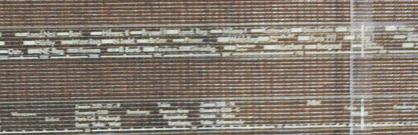
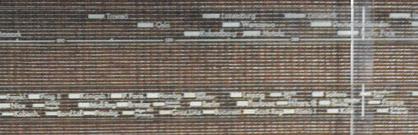
„Ich war und bin bis heute einfach angetan von der einnehmenden Ästhetik, der logischen Funktionalität, der oft genialen Konstruktion und dem angenehmen wie schönen Material der alten Dinge“, begründet der Restaurator seine Entscheidung für dieses Arbeitsfeld. Dabei verweist er auf sinnlich erfahrbare beziehungsweise ertastbare Aspekte wie beispielsweise ein herrliches Holzfurnier, Schellackpolituren und den wunderbaren Geruch dieser Materialien.
Auch sind zum Beispiel Metalle , wie Kupfer, Messing, Eisen, oder Nickel bei den alten Geräten in der Regel ihrem Zweck entsprechend gewählt. Damit wurde dann auch ein „ansprechendes Ganzes geschaffen“, so Peter Kahlich. Und um genau dieses

ansprechende Ganze geht es ihm in erster Linie. Die allerhöchste Zufriedenheit stellt sich bei ihm ein, wenn das Gerät – ganz egal, aus welcher Zeitepoche – optisch etwas hermacht und natürlich auch funktioniert. Fast immer stellt er Fotos, bisweilen sogar akustische Eindrücke, auf seiner Facebook-Seite ins weltweite Netz und weist damit auf seine Tätigkeit hin.
Auf dieser Ebene läuft auch das Geschäft. Den herkömmlichen Ablauf, daß jemand ein kaputtes Gerät zu ihm zum Reparieren bringt, lehnt er ab. „Reparaturen für Kunden rentieren sich nicht. Die haben oft eine abgehobene Erwartungshaltung und verkennen, daß man mehr als zehn Euro verlangen muß, um zu überleben. Außerdem verhinderten das Handwerksgesetz und die Haftungsfrage jede Reparatur für Kunden“, erklärt er, warum er stattdessen Geräte kauft, restauriert und wieder verkauft.
Ein Millionär wird er damit nicht, will er aber auch nicht werden. Er fühle sich „glücklich“, darüber hinaus sei er immer schon bescheiden gewesen, bekennt der Restaurator: „Ich freue mich allerdings schon am Abend auf den kommenden Tag und die Arbeit – und den feinen Kaffee aus meiner Faemina. Das dürfte bei vielen Werktätigen eher nicht der Fall sein. Aber die fahren halt dann SUVs anstatt wie ich einen alten und damit nachhaltigen Polo.“

Faema ist übrigens eine tradi-






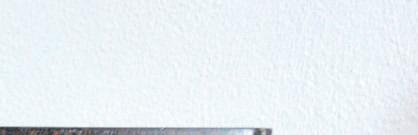
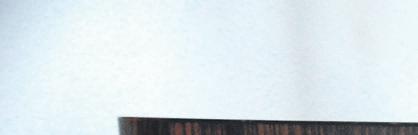

tionsreiche Top-Marke für Kaffeemaschinen aus Italien.
Seinen VW-Polo hatte er Anfang Dezember bei einem Freund zum Durchchecken, um das Auto ein weiteres Mal durch die TüvPrüfung zu bringen, was dann auch gelungen ist. Nachhaltigkeit ist für ihn in allen Bereichen ein hoher Wert. „Es ist ein Wahnsinn, wie unsere dekadente Gesellschaft verschwenderisch und gedankenlos mit den endlichen Ressourcen umgeht. Die alten Dinge wurden früher nachhaltig gebaut und konnten repariert werden“, sagt Kahlich.
Nein, im Müll landen die Geräte bei ihm nie. Das wäre auch schade bei diesen Kulturgütern, die meist vor vielen Jahrzehnten, manchmal sogar vor einem Jahrhundert, gebaut und benutzt wurden. Oft kann man heute mit den Namen der Gerätschaften gar nichts mehr anfangen, geschweige denn die Funktionen einordnen.
Was hat es zum Beispiel mit einem Telegraphengalvanometer auf sich? Ein Galvanometer im Allgemeinen ist ein elektrisches Messinstrument zum Nachweis kleinster Gleich- und Wechselströme. Beim Telegraphengalvanometer handelt es sich um ein solches Gerät, das in der Telegrafie, also der Übermittlung codierter Nachrichten über eine geographische Distanz, bei der keine Objekte zwischen Sendeund Empfangsort bewegt werden, zum Einsatz kam. Ein solches Galvanometer aus dem Jahr
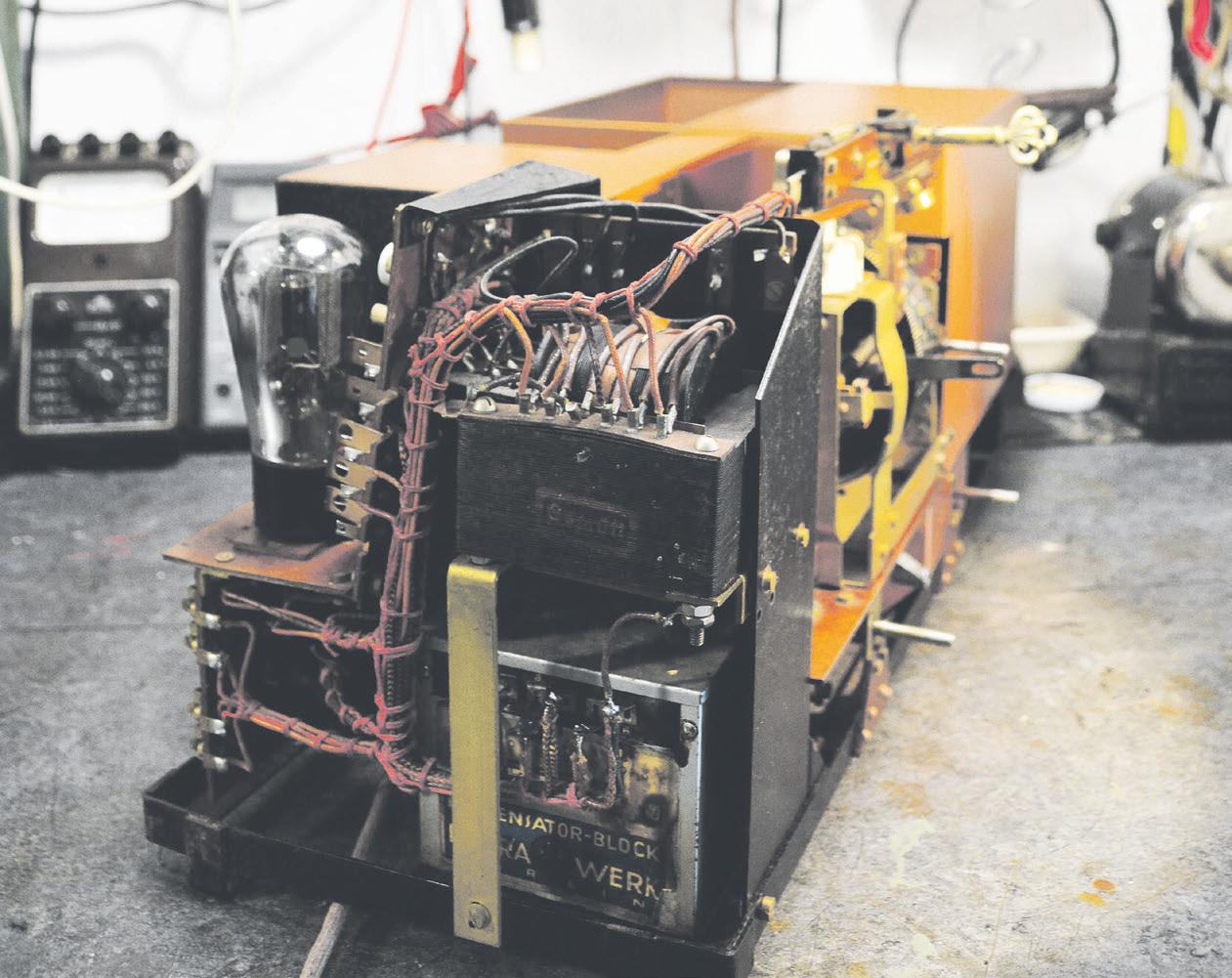







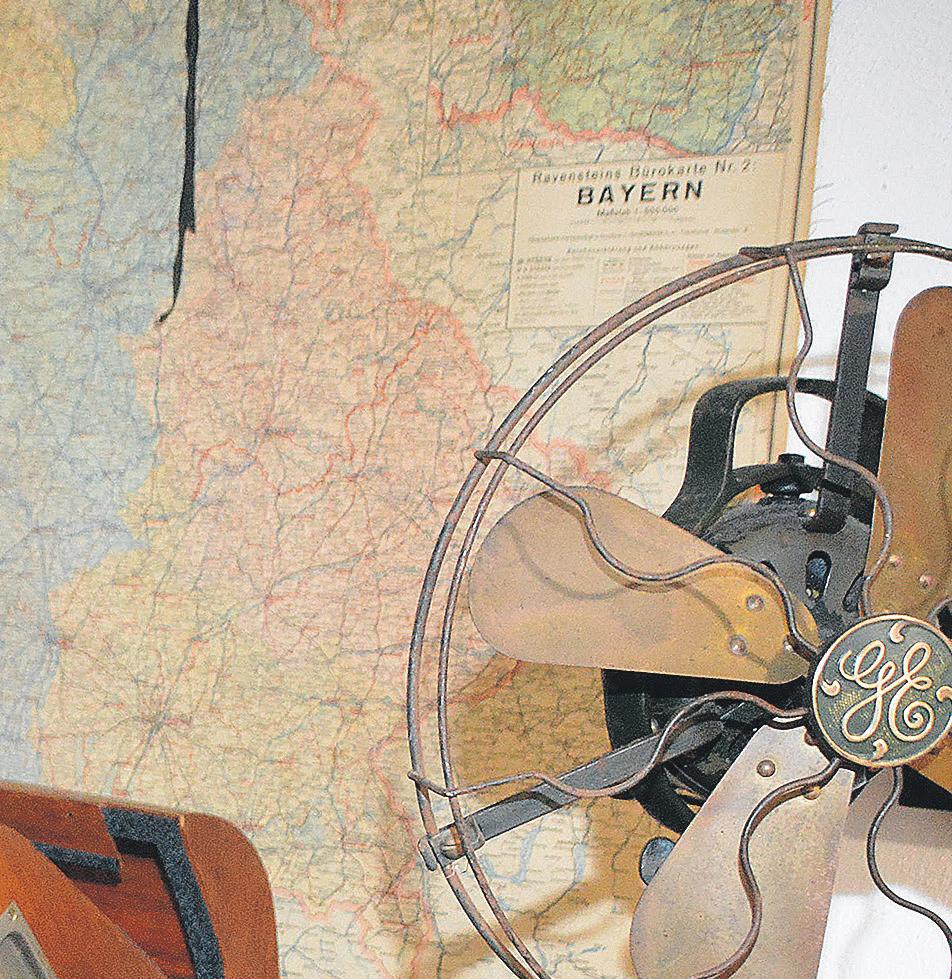

1867 war bislang das älteste Gerät, das der Restaurator repariert hat. Am kompliziertesten war für ihn, so erinnert sich Kahlich, ein Fernsehapparat der DDR-Firma Rembrandt von 1954. Der FE 852 Rembrandt war das erste von der DDR entwickelte TV-Gerät und sollte ursprünglich ausschließlich in die Sowjetunion exportiert werden. Da die UdSSR dann aber die Abnahme verweigerte, kam der Fernseher ab 1953 in der DDR zum Verkauf. Die Bildschirmgröße betrug 24 mal 18 Zentimeter, zentral arbeitete eine Rundkolbenbildröhre. Bis 1954 – dann wurde umgestellt – wurden die Programme in der Ostblockfernsehnorm OIRT ausgestrahlt.
Am längsten gewerkelt hat er an einem Groß-Empfänger 898WK von Telefunken aus dem Jahr 1938. Mit diesem in einem Holzgehäuse eingebauten Rundfunkgerät konnte man Lang-, Kurz- und Mittelwelle empfangen – also zahlreiche Radiosender. „Ein furchtbar schönes Gerät, aber auch furchtbar kompliziert. Alleine das Auseinanderbauen dauert fast einen Tag“, berichtet der Spezialist für alte Technik.






Vor allem Geräte vor 1960 sind gut zu reparieren. Die Bauweise war eben so, daß Reparaturen möglich waren. Es gab wenig bis kein Plastik, die Bauteile waren geschraubt und nicht geklebt sowie logisch aufgebaut – also mit den Mitteln des Handwerks zu reparieren. Markus Bauer
