Premiere: Lehrerfortbildung im Sudetendeutschen Museum (Seite 2)
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung
HEIMATBOTE

Jahrgang 75 | Folge 7 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 17. Februar 2023
Sudetendeutsche Zeitung
VOLKSBOTE


� Noch vor der Amtsübernahme hat das künftige Staatsoberhaupt die Eckpfeiler seines Politikstils skizziert
Zeitung Mitteilungsblatt für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge
kurs. Wenn ich nur angenommen
Präsident Petr Pavel geht auf
Distanz zu Vorgänger Zeman
Noch vor der Amtsübernahme am 9. März geht Tschechiens künftiger Präsident Petr Pavel auf Distanz zu seinem Vorgänger Miloš Zeman. Das neue Staatsoberhaupt, das als Oberbefehlshaber der Tschechischen Streitkräfte auch die Außenpolitik des Landes mitgestaltet, sieht insbesondere die von Zeman über Jahre favorisierte Nähe zu Moskau und Peking kritisch und appelliert, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen. Auch in der Verwaltung des Präsidialamtes setzt Pavel bereits Zeichen.
� Amtseinführung

Pavel wird am 9. März vereidigt
Die feierliche Amtseinführung des Staatspräsidenten Petr Pavel findet am Donnerstag, 9. März, im Vladislav-Saal der Prager Burg statt. Unter den Gästen werden Abgeordnete und Senatoren sowie Staatsoberhäupter der Nachbarländer sein.
mich an, ob er nicht in ein Krankenhaus verlegt Die Schwester hieß wie ich und rief sogleich eine Ambulanz an. Wir kamen in ein kurzes Gespräch. Als sie hörte, daß ich Sudetendeutscher sei und ohne einen Pfennig dastand, öffnete sie eine Schublade ihres Schreibtisches und übergab mir einen verschlosdie man ihr mit der Auflage gegeben hätte, sie einem würdigen Heimkehrer auszuhändigen. Meinen Hinweis, ob ich denn so eine Person sei, tat sie mit ihrer Erfahrung im Umgang mit Menschen ab. Diese Sammlung und 100,– DM sind alles, war ich für die der Wiedergutmachung für den Verlust meines elterlichen Erbes, wie dem Verbot eine Universität zu besuchen, da ich als Angehöriger der Waffen-SS automatisch zum Verbrecher gestempelt, als gute Christdemokraten in Bonn Volksvertreter spielen. Verzeihung, sie sind wohl „Exkameraden“. Die Lok war bereit, uns heim ins Reich zu bringen, einem Spruch des toten Hitler folgend. Man brachte uns in das, was vom Reich übrig geblieben war. Ich vergaß
� Ministerin Ulrike Scharf
Freistaat übernimmt
Gema-Kosten



Teuer und kompliziert: Auch ehrenamtliche Initiativen, die öffentliche Veranstaltungen organisieren und dabei Musik darbieten, müssen dies bei der Musikverwertungsgesellschaft
Gema melden und werden dann entsprechend zur Kasse gebeten. In Bayern wird das jetzt geändert, hat die zuständige Sozialministerin Ulrike Scharf angekündigt. Die Erleichterung für die Ehrenamtlichen betrifft allein im Jahr 2023 rund 45 000 Veranstaltungen in Bayern.
Selbst Veranstaltungen, die religiösen, kulturellen oder sozialen Belangen dienen und die nachweislich keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen, sind gebührenpflichtig, erklärt die Gema. Auch wenn die Verwertungsgesellschaft in diesen Fällen 15 Prozent Rabatt einräumt, kann die Rechnung schnell dreistellig werden. Und wer seine Veranstaltung nicht anmeldet, riskiert empfindliche Geldstrafen.
Nach einem Kabinettsbeschluß hat der Freistaat jetzt einen Pauschalvertrag mit der Gema abgeschlossen, der nichtkommerzielle Veranstaltungen von ehrenamtlichen Organisationen in Bayern abdeckt, wenn der Eintritt frei ist.
Staatsministerin Ulrike Scharf: „Im Ehrenamt spüren wir den Herzschlag unseres Sozialstaats. Wir stärken das bürgerschaftliche Engagement und setzen ein deutliches Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Unsere Ehrenamtlichen werden mit dem Pauschalvertrag der Gema gezielt entlastet – weniger Bürokratie und weniger Kosten. Bayern ist gemeinsam stark.“
Bei kostenfreien Musikveranstaltungen sollen zukünftig für die Veranstalter nur eine einmalige digitale Registrierung bei der Gema und die Meldung der Veranstaltung erforderlich sein. Für den Pauschalvertrag stellt der Freistaat Bayern jährlich insgesamt 1,5 Million Euro zur Verfügung.
In einem Interview mit dem USNachrichtensender Bloomberg sprach sich Pavel, der als erster General aus einem ehemaligen Ostblockstaat von 2015 bis 2018 Vorsitzender des Nato-Militärausschusses war, für eine nachhaltige Unterstützung der Ukraine aus und schloß dabei die Lieferung von Kampfjets nicht aus: „Die Ukraine kann die russischen Truppen aus ihrem Land drängen und die vollständige Souveränität über das ganze Land wiedererlangen. Mit unserer Unterstützung ist dieses Ziel erreichbar. Wir dürfen die Ukraine nicht fallen lassen. Es geht um unsere Prinzipien und Werte. Wir müssen Rußland zwingen, internationales Recht einzuhalten.“
Die Diskussion über die Lieferung von Kampfjets sei emotional geführt, aber man solle keine Art von modernen Waffen ausschließen. Tabu seien nur der Einsatz von Atomwaffen und die direkte Beteiligung der Nato mit Soldaten, erklärte Pavel. Die Sorge vieler Menschen, Putin könnte die Nato als Kriegspartei ansehen und angreifen, teilt Pavel nicht. „Rußlands Taktik ist es, zu eskalieren, um weiter eskalieren zu können und damit für Verunsicherung in den demokratischen Gesellschaften zu sorgen. Aber auch wir als Nato haben Atomwaffen. Auch wenn wir die niemals einsetzen wollen, sind wir bereit, wenn es notwendig ist. Daran müssen wir Rußland erinnern.“
Miloš Zeman empfing seinen Nachfolger Petr Pavel am Montag auf Schloß Lana. F.: Vlada CZ/Mediaservice Novotny

Auf die Frage, ob dieser Krieg am Ende nur über Verhandlungen und Kompromisse beendet werden könne, sagte Pavel: „Wenn wir akzeptieren, daß ein Angriffskrieg für den Aggressor erfolgreich ist, zerstören wir das System der internationalen Gemeinschaft. Deshalb dürften wir in keinem Fall die Ukraine unter Druck setzen, Zugeständnisse zu machen. Einzig die Ukraine kann entscheiden, ob und wie sie verhandelt. Wir alle wollen Frieden, aber manchmal muß man für Frieden kämpfen und Opfer bringen.“
Pavel sprach sich in dem Interview dafür aus, die Ukraine nach dem Ende des Krieges in die EU und in die Nato aufzunehmen. „Wenn man sowohl die EU als auch die Nato als Gemeinschaft von Werten, Stabilität und Partnerschaft versteht, hat es die Ukraine verdient, Teil davon zu sein.“
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger geht Pavel auch auf Distanz zu China und zeigt sich unbeeindruckt von der heftigen Kritik Pekings an einem Te-
lefongespräch mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) „Frau Präsidentin hat mich angerufen, um mir zu gratulieren. Es ist schon ein Akt der Höflichkeit, so einen Anruf anzunehmen“, konterte Pavel und sagte, er respektiere Pekings Ein-China-Politik, erwarte aber umgekehrt, man solle auch das ZweiStaaten-Prinzip mit einem demokratischen Taiwan akzeptieren. Überhaupt solle Europa einem zunehmend selbstbewußten China nüchtern begegnen und „sich nicht drängen“ lassen.
Zum Thema Euro-Einführung sagte Pavel, diese Debatte würde in Tschechien hochemotional geführt und müsse erst auf eine sachliche Ebene gebracht werden. Wegen der hohen Inflation und der großen Staatsverschuldung sei eine schnelle Einführung derzeit jedoch nicht möglich. Pavel: „Die Einführung des Euro ist nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann. Die positiven Aspekte sind weitaus größer als die möglichen Risiken.“
Sichtbar wird der neue Kurs


� Volksgruppensprecher Bernd Posselt hielt die Doppel-Eröffnungsrede
des tschechischen Staatsoberhaupts auch auf der Prager Burg, dem Amtssitz. Zum ersten Mal wird dort mit Jana Vohrálíková eine Frau als Kanzler die Präsidialverwaltung führen. Die zweite starke Frau wird Markéta Řeháková sein, die als Kommunikationschefin in Pavels Wahlkampfteam mitgearbeitet hatte. Sie wird das Amt des Präsidentensprechers übernehmen.
Klar ist auch, daß Pavel der Tradition seiner Vorgänger folgt und als erstes in die Slowakei reist. Der zweite Staatsbesuch führt dann nach Polen, wo sein Gegenkandidat Andrej Babiš mit dem Satz, er würde bei einem russischen Angriff auf Polen keine tschechischen Soldaten entsenden, viel Porzellan zerschlagen hat. Noch vor seiner Amtsübernahme will Pavel sich mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda auf der Münchner Sicherheitskonferenz treffen, die vom heutigen Freitag bis Sonntag im Hotel Bayerischer Hof stattfindet und an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnimmt.

Vermutlich noch im März
Der Ablauf ist klar geregelt: Der designierte Präsident leistet den Eid, indem er seine Hand auf die Verfassung legt, die der Präsident des Senats in den Händen hält. Dann wird die Nationalhymne gespielt. Es folgen 21 Salutschüsse. Anschließend hält der neue Präsident seine Antrittsrede als Staatsoberhaupt der Tschechischen Republik.
steht eine Reise in die Ukraine an. Am 6. Mai wird Pavel dann die Tschechische Republik bei der Krönung des britischen Königs Charles III. vertreten. Auch die Einlösung seines Versprechens, die tschechische Gesellschaft wieder zu einen, will Pavel umgehend angehen. Er hat deshalb angekündigt, die drei Regionen Tschechiens zu besuchen, in denen Babiš bei der Wahl mehr Stimmen als er erhalten hat – Mährisch-Schlesien, Aussig und Karlsbad. Dies seien, so Pavel, „Regionen, in denen sich größere Probleme angesammelt haben als in anderen Regionen“. Angekündigt hat Pavel auch, sich bei seinen Initiativen mit der Regierung abzustimmen –im Gegensatz zu Vorgänger Zeman, der immer wieder versucht hatte, die Arbeit von Premierminister Petr Fiala zu sabotieren. Obwohl der Präsident keine exekutive Macht hat, hat Pavel erklärt, er wolle generell die Kommunikation des Staates mit der Öffentlichkeit verbessern.
Pavel Novotny/Torsten Fricke
Zwei Ausstellungen im Centrum Bavaria Bohemia
Volksgruppensprecher Bernd Posselt besucht regelmäßig das Centrum Bavaria Bohemia an der oberpfälzisch-böhmischen Grenze, das für den Freistaat Bayern tschechisch-deutsche Gemeinschaftsprojekte koordiniert und außerdem Schaltstelle für das „Grüne Band“ ist, welches den Raum des ehemaligen Eisernen Vorhanges neu gestaltet und sich dabei auch der verschwundenen sudetendeutschen Dörfer annimmt.

Die Leiterin des Centrums, Veronika Hofinger, ist aufgrund ihrer vielfachen Qualifikation wie auch aufgrund ihrer familiären Wurzeln die ideale Mittlerin
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Tschechen und Sudetendeutschen.
Derzeit beherbergt das Haus in Schönsee zwei Ausstellungen aus der Tschechischen Republik.
Die eine Ausstellung hat der Historiker Petr Pavelec vom Denkmalamt Budweis im Auftrag der Tschechischen Regierung gestaltet. Sie zeigt zweisprachig aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der Paneuropa-Union Schautafeln über deren sudetendeutschen Gründer, Richard Graf Coudenhove-Kalergi, dessen Familie und dessen wegweisende Idee.
Die andere Schau steuerte die Václav-Havel-Bibliothek in Prag
bei. Sie dokumentiert den Dichterpräsidenten in seiner Eigenschaft als Europäer.
Bei der Eröffnung beider Ausstellungen hielt Volksgruppensprecher Bernd Posselt vor zahlreichem tschechisch-deutschen Publikum die Festrede.
Weitere Festredner waren die Leiterin des Tschechischen Zentrums in München, Blanka Návratová, der Bürgermeister von Ronsperg, der tschechischen Partnerstadt von Schönsee, Martin Kopecký, sowie Petr Pavelec, der bei dieser Gelegenheit seinen neuen Prachtband über böhmische Adelige im diplomatischen Dienst der HabsburgerMonarchie präsentierte.
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Die Sudetendeutsche Zeitung hat am 12. November 2021
über den tschechischen Autor František Jílek berichtet, der SLBüroleiter Peter Barton besucht hat, um ihn über seine Dramatisierung von Rudolf Slawitscheks Kinderbuch „Anastasius Katzenschlucker – der große Zauberer“ zu informieren.
Das Schicksal war zu dem Prager Deutschen Slawitschek ausgesprochen grausam, denn er wurde im Mai 1945 im Alter von 64 Jahren in den Straßen Prags ermordet. Jílek überarbeitete das Buch „Anastasius“ zu einem Hörbuch, und der Interpret
❯
Viktor Preiss, ein berühmter Schauspieler, wurde dafür vor kurzem mit einem Sonderpreis der Herausgebervereinigung AVA ausgezeichnet. Das Buch „Anastasius“ durfte während der kurzen Zeit des Prager Frühlings erscheinen. Barton, ein leidenschaftlicher Antiquariatsbesucher- und Sammler, hat es in einem dieser Geschäfte erworben und diesen seltenen Fund dann Jílek gezeigt.




Thema „Migration, Flucht, Vertreibung als kollektives Erlebnis gestern und heute“
Erste Lehrerfortbildung im Sudetendeutschen Museum
Unter dem Titel „Migration, Flucht, Vertreibung als kollektives Erlebnis gestern und heute“ hat die erste Lehrerfortbildung im Sudetendeutschen Haus und im Sudetendeutschen Museum stattgefunden.
Das Tagesseminar wurde gemeinsam von Nadja Schwarzenegger und Dr. Raimund Paleczek vom Sudetendeutschem Museum, der Bayerischen Museumsakademie sowie von Markus Wagner und Christine Rogler vom Museumspädagogischen Zentrum in München organisiert. Ziel war es, das Sudetendeutsche Museum als Erinnerungsort und Lernforum zu den Themen Migration, Flucht und Vertreibung vor allem bei Lehrern bekannter zu machen. Hierzu wurden unter anderem Vermittlungsmöglichkeiten für Schulklassen aufgezeigt.

Die über 30 Teilnehmer erhielten am Vormittag mit dem Vortrag „Böhmisch oder Deutsch?“ von Dr. Paleczek einen Überblick über die Geschichte der Sudetendeutschen von den Siedlungsanfängen des Landes bis in die Gegenwart. Im Fokus standen die sprachlichen Gegeben-
Unter dem Titel „Böhmisch oder Deutsch?“ gab Dr. Raimund Paleczek vom Sudetendeutschen Museum den Lehrern einen Überblick über die Geschichte der Sudetendeutschen. Foto: Lidia Ciotta
heiten und ihre Entwicklung in den Ländern der böhmischen Krone. Im Anschluß daran führte Dr. Paleczek die Seminarteilnehmer durch die Dauerausstellung. Am Nachmittag stellte Ulrike Fügl aus Regensburg die breit gefächerte Arbeit von Tandem, dem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch, vor. Das Tagungsthema wurde inhaltlich in zwei Arbeitsgruppen vertieft. In der ersten Gruppe wurden unter Lei-
tung von Christoph Huber „Perspektiven auf Heimat und Migration am Beispiel literarischer Werke“ herausgearbeitet. Anhand ausgewählter klassischer sowie zeitgenössischer Texte diskutierte die Gruppe die Begriffe Heimat, Fernweh und Migration als überzeitliche und nur schwer allgemein verständliche Phänomene, weil sie in ihrem gefühlsmäßigen Erleben zutiefst individueller Natur sind.
Im Mittelpunkt der zweiten
❯ Erste Sitzung des neuen Wissenschaftlichen Beirats für das Sudetendeutsche Museum
Auf seiner ersten Sitzung hat der neue Wissenschaftliche Beirat für das Sudetendeutsche Museum Prof. Dr. Hans-Martin Hinz als Vorsitzenden bestätigt.
Hinz hat fast drei Jahrzehnte als Mitglied der Geschäftsführung des Deutschen Historischen Museums in Berlin gewirkt, war von 2010 bis 2016 Präsident des International Coucil of Museums (ICOM) und kurzzeitig Staatsekretär für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Berlin. Zum Stellvertreter wurde Dr. Dirk Blübaum, Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, gewählt. Dem neuen Wissenschaftlichen Beitrat für das Sudetendeutsche Museum gehören außerdem an: Christina Bogusz, Direktorin des Sorbischen Museums Bautzen; Hansjürgen Gartner, Augsburg, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste; PhDr. Miroslav Kunštat, Ph.D., Prag, Sozialwissenschaftliche Fakultät der Karls-Universität Prag; Mgr. Martina Lehmannová, Prag, Tschechisches Nationalkomitee von ICOM; Christina Meinusch, München, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen; Mgr. Blanka

Mouralová, Prag, ehemals Leiterin Collegium Bohemicum, Aussig; Dr. Martin Posselt, Kaufbeuren-Neugablonz, Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Isergebirgsmuseum Neugablonz; Dr. Reinhard Riepertinger, Kempten, Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg, und Hans Joachim Westholt, Bonn, ehemals Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Vorsitzende des Vorstandes der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian, skizzierte in seiner Rede die neuen
Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirats: „Seit 2007 hat das Vorläufergremium in regelmäßigen Abständen getagt und sich über Baufortschritt, Gestaltung und Einrichtung des Museums Gedanken gemacht. 22 Sitzungen fanden statt unter der Leitung von Dr. Yorck Langenstein und Prof. Dr. Hans-Martin Hinz bis zur festlichen Abschlußsitzung am 15. Oktober 2021. Es bedurfte eines ‚langen Atems‘, und es wurden Meilensteine beschritten, um das von der Bayerischen Staatsregierung ausgerufene
Wirtschaft hinkt der EU hinterher
Die tschechische Wirtschaft wird im ersten Quartal 2023 stagnieren und bis Jahresende ein Wachstum von nur 0,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aufweisen, sagt eine makroökonomische Prognose der Europäischen Kommission voraus. Damit liegt Tschechien deutlich unter dem prognostizierten EU-Durchschnitt von plus 0,8 Prozent beim BIP. Eine Konjunkturerholung erwartet die Kommission für Tschechien erst im kommenden Jahr. 2022 hatte das Wachstum in Tschechien noch 2,5 Prozent betragen.
Tschechiens Boxer boykottieren WM
Gruppe unter Leitung von Dr. Monika Müller vom Staatsinstitut für Schulqualität und Susanne Mäckl vom Friedrich-Alexander-Gymnasium in Neustadt an der Aisch stand die Frage „Wie wird über Migration, Flucht und Vertreibung gesprochen?“. An verschiedenen Stationen der Dauerausstellung erarbeitete die Gruppe die Bedeutung des Heimatbegriffes sowie den emotionalen und den versachlichten Aspekt von Flucht, Vertreibung und Integration im Aufnahmeland.
Das Thema „Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg“ wird in bayerischen Schulbüchern ohne Zeitzeugenberichte lediglich auf der Ebene von Sachinformation thematisiert. Im Mittelpunkt der Abschlußrunde unter Leitung von Nadja Schwarzenegger und Markus Wagner diskutierten die Teilnehmer verschiedene Zugänge und Verständnisse von Heimat, ihrem Verlust und dem privaten und öffentlichen Umgang damit sowie in der pädagogischen Vermittlung. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Bayerischen Museumsakademie und dem Museumspädagogischen Zentrum ist geplant.
Weil der Weltboxverband IBA trotz des russischen Angriffskriegs Sportler aus Rußland und Weißrußland zu den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen zuläßt, hat die tschechische Boxer-Assoziation (ČBA) einen Boykott beschlossen. Die Box-WM der Frauen findet im März in Indien statt, die der Männer im Mai in Usbekistan. Ihren Boykott haben ebenfalls schon die USA oder auch Irland bekanntgegeben.
Gemäldegalerie erneut geschlossen
Auf und schon wieder zu: Die Gemäldegalerie, einer der beliebtesten Tourismusmagneten auf der Prager Burg, ist wegen einer erneuten Störung der Belüftungstechnik bis auf weiteres geschlossen. Die Räumlichkeiten mußten bereits 2019 wegen Reparaturarbeiten an der Klimaanlage geschlossen werden und wurde erst am 1. Januar dieses Jahres wiedereröffnet. Gezeigt werden in der Gemäldegalerie Werke von Tizian, Rubens, Tintoretto und Cranach.
Nachholbedarf bei
grüner Energie
Erneuerbare Energiequellen hatten bei der Stromgewinnung in Tschechien im vergangenen Jahr nur einen Anteil von 3,7 Prozent – was meilenweit unter dem EU-Durchschnitt von 22 Prozent liegt, hat der Minister
für Industrie und Handel, Jozef Síkela (parteilos), bekanntgegeben. Tschechien würde zudem auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinterherhinken, fügte Síkela an. Die Wind- und Photovoltaikanlagen erzeugten in den ersten neun Monaten 2022 insgesamt 2,5 Terrawattstunden Energie. Die Gesamtproduktion lag in diesem Zeitraum bei 62,2 Terrawattstunden. Der Großteil stammte aus Kohleund Kernkraftwerken.
100. Geburtstag von György Ligeti
Im Rudolfinum hat das Sinfonieorchester des Tschechischen Rundfunks am Montag mit einem Konzert an den 100. Geburtstag des österreichisch-ungarischen Komponisten György Ligeti erinnert. Petr Popelka dirigierte das Concert Românesc, das Stück Lontano sowie das Konzert für Geige und Orchester. Ligeti gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und als Repräsentant der Neuen Musik. Er wurde am 28. Mai 1923 in Siebenbürgen geboren. Sein Vater, ein hochdekorierter Wehrmachts-Veteran des Ersten Weltkriegs, und sein jüngerer Bruder wurden von den Nazis im KZ ermordet. Nach dem Ende des Volksaufstands in Ungarn floh er im Dezember 1956 gemeinsam mit Veronika Spitz, seiner späteren Frau, nach Wien. Dabei konnte er nur einige wenige Partituren mitnehmen, wie das Konzert Românesc von 1951. Ligeti starb am 12. Juni 2006 in Wien.
Putins Botschafter bleibt in Prag
Tschechien wird vorerst nicht dem Aufruf der baltischen Staaten folgen und den russischen Botschafter ausweisen, hat der stellvertretende Außenminister Martin Dvořák (Stan) erklärt. Die Zahl der zugelassenen Diplomaten an der russischen Botschaft in Prag sei jedoch kurz nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine deutlich reduziert worden. Auch die Stadt Prag hatte ihren Protest gegen Putins Kriegs deultich gemacht und mehrere Straßen im Bereich der russischen Botschaft nach ukrainischen Helden benannt.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
‚Leuchtturmprojekt bayerischer Kulturlandschaft‘ zu realisieren. Nun ist das Sudetendeutsche Museum fast fertig und die Anforderungen eines Wissenschaftlichen Beirates an den laufenden Betrieb eines Museums werden andere sein.“
Für die Zukunft wolle der Wissenschaftliche Beirat – so die einhellige Meinung des Gremiums – seine gesamte Fachkompetenz für das Sudetendeutsche Museum einbringen und vor allem die Sonderausstellungen beratend begleiten.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Prof. Dr. Hans-Martin Hinz als Beirats-Vorsitzender bestätigtDer neue Wissenschaftliche Beitrat mit Dr. Ortfried Kotzian (Mitte). Foto: Daniel Mielcarek
� Serie „Ehrensache Ehrenamt“: Anita Donderer engagiert sich seit Jahrzehnten für ihren Geburtsort Neudek
Kinder von damals – Brückenbauer von heute
Sie kannten sich von Kindesbeinen an, gar noch länger: Anita Donderer und Herbert Götz. Ihre Mütter waren schon seit Schulzeiten Freundinnen, ihre Väter fuhren zusammen Radrennen – damals im Egerland. Mit nur neun Monaten Abstand wurden Anita und Herbert im Jahr 1939 in Neudek beziehungsweise in Bernau bei Neudek geboren. 51 Jahre später sitzen sie anläßlich des 80. Geburtstags von Anita Donderers Vater im Juni 1990 zusammen und fassen einen Plan: Gemeinsam wollen sie in ihre Geburtsstadt in die Tschechoslowakei reisen.
Für Anita Donderer wäre das nicht die erste Fahrt. Schon öfter war sie mit ihren Eltern in Neudek gewesen – und auch anschließend immer wieder. 1968 waren sie das erste Mal da, als die Einreise mit Visum für sie möglich war. Bei diesen Besuchen zeigten die Eltern ihrer Tochter auch ihr Geburtshaus und die Häuser der Großeltern. Vor allem aber zog es sie auf den Neudeker Friedhof. Hier lag die Tante begraben. Mit 31 Jahren starb sie kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, um das sich Anita Donderers Eltern dann kümmerten. Das war im Juni 1946, drei Monate vor der Vertreibung.
Und nun, im Jahr 1990, bestand für Anita Donderer und ihren Bekannten Herbert Götz die Möglichkeit, visumsfrei in die „alte Heimat“ zu reisen. Doch die Eltern sind nicht überzeugt von dem Plan, sie, die damals doch noch Kinder waren, würden sich gar nicht vor Ort auskennen. Wie wollen sie mit dem Auto alleine dort unterwegs sein? Also organisierten Donderer und Götz einen Bus und luden alle Interessierten ein, sie auf dieser Fahrt zu begleiten. Für viele der Angemeldeten sollte es die erste Fahrt nach Neudek seit der Vertreibung werden.
Vor der Fahrt nahmen Donderer und Götz Kontakt mit dem amtierenden Bürgermeister auf, und so wurde die Gruppe vor Ort offiziell vom Bürgermeister und vom Stadtrat begrüßt. Die Ansprachen, sowohl von tschechischer als auch von deutscher Seite, waren sehr auf Völkerverständigung ausgerichtet, erinnert sich Anita Donderer: „Dieser herzliche Empfang war der Anfang einer bis heute andauernden Freundschaft.“ Auch die Augsburger Allgemeine schrieb über diese Fahrt der „Kinder von damals“ ins heutige Nejdek.
Diese Bezeichnung – Kinder von damals – sollte ihnen bleiben. Schon drei Monate nach ihrem ersten Besuch folgte ein weiterer Besuch in Neudek – Bürgermeister Jiří Bydžovský lud Donderer und Götz ein, um die erneute Weihe der Kirche zu feiern. Da Augsburg mittlerweile Patenstadt von Neudek war, baten Donderer und Götz den damaligen Oberbürgermeister Dr. Peter Menacher, sie zu begleiten, was er tat. Weitere Interessierte schlossen sich an, so daß erneut ein voller Bus von Augsburg nach Neudek fuhr.
Die Patenschaft Augsburgs für Neudek füllte sich nach und nach mit immer mehr Leben.
Anita Donderer nutzte dafür ihre Kontakte. Lange Jahre hatte sie für Max Gutmann gearbeitet, einen erfolgreichen Unternehmer, der in Augsburg sowohl die Universität als auch den Sport unterstützte. Mit den „Datschiburger Kickers“ gründete Gutmann 1965 eine Fußballmannschaft, bestehend aus Prominenten, die zu wohltätigen Zwecken antraten. 1992 stand diese Mannschaft auf dem Platz von Karlsbad und spielte gegen eine tschechische Mannschaft. Die Schirmherr-
schaft übernahm Olga Havelová, die Frau des damaligen Präsidenten Václav Havel. Der Erlös des Spiels kam dem SOS-Kinderdorf im Karlsbader Stadtteil Aich zugute, dem ersten in der Tschechoslowakei gegründeten SOSKinderdorf.

Weitere sportliche Begegnungen in Tschechien und Deutschland folgten – so zum Beispiel im Jahr 1995, als in Neudek die Datschiburger Kickers gegen frühere tschechische Nationalspieler antraten – zugunsten des örtlichen Kindergartens.
Mit von der Partie war außerdem der bekannte tschechische Langstreckenläufer Emil Zátopek. In Zusammenhang mit den Fußballspielen fanden mehrfach Krankenhilfsmittel ihren Weg von
Deutschland nach Tschechien, wofür sich Präsident Václav Havel persönlich bei Donderer und Götz mit zwei Dankesschreiben erkenntlich zeigte.
Da auch „Musik verbindet“, sangen der Neudeker Kirchenchor und der Kolping-Männerchor gemeinsam – jeweils in Augsburg und in Neudek.
Gemeinsam bauten die „Kinder von damals“ ihre Kontakte nach Neudek aus: „Wir konnten in der Zwischenzeit in Neudek viele Freunde gewinnen, angefangen von der Stadtverwaltung und dem im Jahre 1999 gegründeten Verein Jde o Nejdek“, sagt Anita Donderer. Dieser Verein, dessen Name wörtlich übersetzt „Es geht um Neudek“ bedeutet, ist eine Bürgerinitiative, die
sich unter anderem für Denkmalschutz, die Erforschung der Lokalgeschichte, Naturschutz und die regionale Entwicklung einsetzt. Für die Kinder von damals wurde der Verein zu einem wichtigen Partner.
In Zusammenarbeit mit dem Verein Jde o Nejdek wurde im Jahr 2016 ein Gedenkstein auf dem Friedhof in Neudek errichtet. In deutscher und tschechischer Sprache erinnert er an all diejenigen, die dort bis 1946 ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Sowohl der Augsburger Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl als auch der Neudeker Bürgermeister Lubomír Vitek waren bei der Enthüllung dabei.
Bereits seit dem Jahr 2007 sind die früheren und die heutigen
� 1930 waren 97 Prozent der über 9000 Bürger deutscher Abstammung
Neudeks lange Stadtgeschichte
Gegen Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts soll Ritter Konrad Plick die Wehrburg Neudek angelegt haben. Der romanisch-gotische Turm ist noch heute das Wahrzeichen der Stadt. Mit dem Burgbau ließen sich Zinnseifner, die aus Oberfranken stammten, als erste Bewohner in Neudek nieder.

Im Jahr 1444 gelangte die Herrschaft an Graf Mathias Schlick, welche bis Ende des 16. Jahrhunderts bei seinen Erben verblieb. Die Grafen Schlick verliehen Neudek ein eigenes Stadtwappen, förderten den Bergbau
und verhalfen dem Ort zur Blüte. 1454 erfolgte die Errichtung einer Zinnschmelze. Im Jahre 1494 ist erstmals urkundlich das Neudeker Waldzinnrecht erwähnt, ein Vorläufer der späteren Bergordnung, die den Zinnseifenbergbau in der Herrschaft Neudek regelte. 1545 erhielt das Revier ein eigenes Bergamt mit Bergmeister.
1800 zählte Neudek 282 Häuser und rund 1800 Einwohner. Der erste nicht adlige Besitzer der Herrschaft war der Großhändler Anton Waagner aus Leitmeritz, der Neudek 1810 erwarb.
Im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert entwickelte sich die Stadt zu einem bedeutsamen Industriestandort. Hier waren unter anderem die Eisenwerke AG RothauNeudek, Kammgarnspinnereien und Betriebe der Holz- und Papierfabrikation ansässig.
Seit 1847 befand sich dort auch der Firmensitz der Spitzenfabrik Anton Gottschald & Comp., das als ältestes und bedeutendstes Unternehmen der Spitzenerzeugung im Kaisertum Österreich galt.
Bis 1930 wuchs die Bevölkerung auf über 9000 Bürger an. 97 Prozent waren deutscher Abstammung.
Mit dem Generationenwechsel veränderte sich die Gruppe: 2012 löste sich die alte Neudeker Heimatgruppe auf, Anfang 2013 wurde die „Neudeker Heimatgruppe ‚Glück auf‘ – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg e.V.“ gegründet. Erster Vorsitzender wurde Josef Grimm, der ebenfalls aus der Karlsbader Region, nämlich aus Abertham, stammte.
Grimm ist außerdem Heimatkreisbetreuer, schreibt viel für die Sudetendeutsche Zeitung, gibt kundig Antwort auf die Nachfragen der Nachkommen und kümmert sich um das Neudeker Heimatmuseum. Kommen Besucher aus Tschechien, verständigt er sich mit ihnen auf Tschechisch, das er in der Volkshochschule gelernt hat.
„Unser Motto war immer: ‚Wir wollen eine Brücke sein, eine Brücke von Land zu Land, eine Brücke von Stadt zu Stadt, eine Brücke von Mensch zu Mensch, vor allem aber eine Brücke von Herz zu Herz‘“, sagt Anita Donderer. 2015 wurden sie und Herbert Götz in Neudek als „Persönlichkeiten von Neudek“ ausgezeichnet. Elf Personen haben bisher den Titel verliehen bekommen, darunter sind Donderer und Götz bisher die einzigen Deutschen.
Auch in Bayern wurde das ehrenamtliche Engagement gewürdigt: So wurden Anita Donderer und Herbert Götz vom damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer mit dem „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt“, von der Stadt Augsburg mit der Verdienstmedaille, von der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem „Großen Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft“ und von der Heimatgruppe mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Einwohner von Neudek alljährlich beim Sudetendeutschen Tag mit einem gemeinsamen Stand vertreten. Damit waren und sind sie nach wie vor Vorreiter beim Sudetendeutschen Tag.
Diesen unbeschwerten Kontakt, den die „Kinder von damals“ mit ihrem Heimatort pflegten, konnten damals nicht alle nachvollziehen. Anita Donderer erinnert sich: „In Augsburg-Göggingen gab es eine Gruppe aus früheren Neudekern, die sich als Neudeker Heimatgruppe für Heimattreffen in Augsburg sehr eingesetzt hat, jedoch aufgrund von Vorurteilen und natürlich bösen Erinnerungen es nicht übers Herz gebracht hat, nach Neudek zu fahren. Sie hatten zum Teil kein Verständnis für uns.“
Im Dezember 2020 verstarb Herbert Götz. Zu seiner Gedenkfeier im September 2021 reisten aus Neudek der frühere Bürgermeister Lubomír Vitek und Dr. Pavel Andrs als Vorsitzender der Bürgerinitiative für Neudek an. Zu diesem Zeitpunkt bestand die deutsch-tschechische Freundschaft zwischen den früheren und den gegenwärtigen Bewohnern Neudeks bereits seit 30 Jahren, was einen Monat später, im Oktober 2021, im Kinosaal von Neudek feierlich begangen wurde.
Die Zusammenarbeit setzt sich fort. Auch in diesem Jahr werden sie beim Sudetendeutsche Tag wieder dabei sein und die „Beispielhafte Freundschaft zwischen Augsburg und Neudek/Nejdek“ vorstellen.
Für die Zukunft hat Anita Donderer nur einen großen Wunsch: „Wir hoffen, daß diese Brücke, die wir in über 30 Jahren gebaut haben, Bestand hat und auch weiterhin bestehen wird.“
Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
� Mehrtägiges Seminar der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Sudetendeutschen Bildungsstätte „Der Heiligenhof“
„Spurensuche in der Vergangenheit – Identität für die Zukunft?“
Unter dem Titel „Spurensuche in der Vergangenheit – Identität für die Zukunft?“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen ein mehrtägiges Seminar angeboten.


Im Mittelpunkt des Interesses der Teilnehmer, allesamt mit familiären Wurzeln in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien, standen neben der Familienforschung ihre Identität und Möglichkeiten der Vernetzung untereinander. Die virtuelle Heimat im Internet spielt dabei eine große Rolle. Das kulturelle Erbe zu erforschen, zu pflegen und an nachrückende Generationen weiterzugeben, wird als bedeutungsvoll für die Bewußtseins- und Identitätsbildung gesehen.
Martin Dzingel
Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in der Tschechischen Republik, dem Dachverband der deutschen Minderheit, bildete mit seinen identitätserhaltenden Projekten und Arbeitsbeispielen den Auftakt.
Man könne der Identität mit zeitgemäßen Angeboten mehr Attraktivität verleihen, ist Dzingel überzeugt. Dialekt zum Beispiel sei ein starkes Identifikationsmerkmal, weiß der unermüdliche Kämpfer für den Erhalt der deutschen Sprache und der Dialektpflege in seiner Heimat und präsentierte das von der Landesversammlung kürzlich herausgegebene Märchenbuch sowie das dazu passende Hörbuch über Märchen und Sagen der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Interessierte können Buch und Hörbuch kostenlos bestellen per eMail an sekretariat@ landesversammlung.cz
Ein weiteres Beispiel sei der Erhalt der Grab- und Gedenkstätten in der Tschechischen Republik. Auch das zähle zu den identitätsstiftenden Maßnahmen. Im Rahmen eines deutsch-tschechischen Kongresses, der in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft abgehalten werde, soll ein entsprechender Maßnahmenkatalog erarbeitet werden mit dem Ziel, die steinernen Zeugen der deutschen Geschichte zu erhalten.
Prof. Dr. Franz Josef Röll
Anschaulich und spannend beleuchtete der bekannte Soziologe und Medienpädagoge Prof. Dr. Franz Josef Röll aus Maintal das Heimatverständnis in einer digitalen Lebenswelt mit seinem Vortrag über „Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung“.
Der Vater seiner Frau sei Sudetendeutscher gewesen, erzählte Röll eingangs und sicherte sich so die ungeteilte Aufmerksamkeit für seinen spannenden und einfühlsamen Vortrag. Seine wissenschaftlichen Ausführungen wurden anhand der Schilderung seiner familiären Lebensumstände verständlich und nachvollziehbar.
Im Mittelpunkt der von der ersten bis zur letzten Minute spannenden Ausführungen standen Fragen, was Heimat und Heimatpflege im Zeitalter der Digitalisierung bedeuten, aber auch, ob virtuelle Räume Heimat sein können, indem sie Sinn stiften und Vergemeinschaftung
ermöglichen. Dabei geht es um verschiedene Aspekte der Heimat im Netz, um Heimatbegriffe und Heimatpflege im digitalen Zeitalter.

Der Begriff Heimat habe im Laufe der Zeit viele unterschiedliche Definitionen und Bedeutungszuschreibungen erfahren. Dies erstrecke sich vom Mittelalter über die Romantik hinweg in die Zeit des Nationalsozialismus bis ins Heute. Von besonderem Interesse sei in der heutigen Zeit die Platzierung des Begriffs in der digitalen Medienwelt, da diese Welt bereits ein Teil des Habitats von Kindern und Jugendlichen sei, so Röll. Im Zeitalter der Digitalen Medien verliere Heimat ihre raumbezogene Bestimmung. Vielmehr treten die Aspekte „Aneignung einer vertrauten Lebenswelt“ und „Ausbildung sozialer Zugehörigkeiten“ in den Vordergrund. „Lebens- und alltagsweltliche Interaktionen, Bekanntschaften, Freundschaften und Nachbarschaften charakterisieren die Heimat als sozialen Raum“, so Röll. Und damit könne natürlich auch über soziale Netzwerke ein Gefühl von Heimat, von Zugehörigkeit entstehen.
Man könne sich über räumliche Grenzen hinweg in seiner Sprache, seinem Dialekt austauschen, an gemeinsame Erfahrungen anknüpfen und in geteilten Erinnerungen schwelgen. Nun kom-
Links: Digitalministerin Judith Gerlach, Innenstaatssekretär Sandro Kirchner und Steffen Hörtler, Direktor der Bildungsstätte „Der Heiligenhof“ und Landesobmann Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
me es darauf an, virale Räume zur Verfügung zu stellen und zu gestalten. „Wir können Furcht vor neuen Medien haben, wir dürfen nur keine Angst vor ihnen haben“, so Röll.
Dr. Günter Reichert

Den Film „Kde domov muj“ (Wo ist meine Heimat?) des jungen Tschechen Ondřej Valchař präsentierte Dr. Günter Reichert, ehemals Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung.
Der Dokumentarfilm beschreibt eindrucksvoll Schicksale von Braunauer Bürgern, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dieser Region vertrieben wurden. Neben der Vermittlung der historischen Ereignisse und Fakten bemüht sich der Dokumentarfilm vor allem, die soziokulturellen Grundlagen dieser Problematik hervorzuheben. Der Fokus liegt auf den Menschen. Hervorgehoben werden die Liebe zur Heimat und die Verbundenheit zum Braunauer Ländchen, die auch weiterhin bestehen und sogar an die nächsten Generationen weitergegeben werden.
Dieser Dokumentarfilm will nicht spalten, er will verbinden. Das gesamte Werk ist vom Gedanken der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses durchzogen, die Vorwürfe und Ressentiments heilen können.
Wer sich mit Ahnenforschung beschäftig, taucht in die eigene Familiengeschichte ein. Das Internet wird immer mehr zu einem Hilfsmittel rund um die Familienforschung. Es hilft unter anderem Hindernisse, die das Aufspüren der familiären Wurzeln ins Stocken bringen, zu beseitigen. Wie man die Familienforschung am besten beginnt, an welche Stellen man sich wenden kann, was möglich ist, wenn man in eine Sackgasse gelangt, und vieles mehr erläuterte Werner Honal, Studiendirektor a. D. und Philologe von der Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher. In seiner Präsentation über die „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“ schilderte er eindrucksvoll die Wege und Instrumente für das Aufspüren der Vorfahren im Netz. Für ihn ist sudetendeutsche Familienforschung nicht alleine ein Instrument zur Ansammlung von Daten, sondern das Instrument, die Kulturgeschichte im Herzland Europas, in Böhmen, Mähren und Schlesien, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher e.V. (VSFF) könne steigende Mitgliederzahlen verzeichnen.
Viele Angehörige der jüngeren Generation befaßten sich, vor allem in den sozialen Netzwerken, mit der Erforschung der Familiengeschichten. Das Interesse der jungen Generation an Familienforschung nehme ständig weiter zu. Die Homepage der VSFF (www. sudetendeutsche-familienforscher.de) biete unter anderem viele Forschungshilfen wie zum Beispiel: Übersicht über Gebietsarchive, Forschungsgruppen, VSFFDatenbanken, Gebietsarchive in der Tschechischen Republik, Kirchenbuchverzeichnisse, Ortsindex Sudetenland, Mailinglisten, Häuserlisten, Transportlisten und ein Genealogisches Wörterbuch.
Hildegard Schuster
Der Journalist und Fernsehmoderator Peter Hahne brachte vor knapp 20 Jahren ein Buch mit dem Titel „Schluß mit lustig“ heraus. Der Untertitel lautete „Das Ende der Spaßgesellschaft“. Das Buch war ein Bestseller. Insgesamt wurde es mehr als 80mal neu aufgelegt. Offensichtlich hat der Buchtitel viele aufhorchen lassen. Die Botschaft des Autors, daß es einer neuen Ernsthaftigkeit in unser aller Leben bedürfe, fand scheinbar offene Ohren.
Mittlerweile haben wir durch die Krisen der vergangenen Jahre manche Probe aufs Exempel für die von Hahne geforderte Ernsthaftigkeit erlebt. Ein Umdenkprozeß hat eingesetzt. Egal ob im Umgang mit Corona oder mit dem Ukraine-Krieg, mit der Energiekrise oder mit den zahlreichen anderen Herausforderungen unserer schwierigen Zeit: Es gab in den letzten Jahren manche Momente, in denen wir von allgemeiner Lustigkeit weit entfernt waren. Es war dann wirklich Ernsthaftigkeit gefordert, um in unserer Gesellschaft gemeinsam durchzukommen.
Auch im persönlichen Leben gibt es immer wieder Situationen, in denen Fröhlichkeit und gute Laune vorübergehend keinen Platz mehr haben. Wenn beispielsweise eine schwere Krankheit diagnostiziert wird, wenn es einen Todesfall im persönlichen Umfeld gibt, wenn jemand seine Arbeit verliert, wenn wir Streit und Hader erleben, wenn aus irgendeinem Grund kaum mehr Hoffnung vorhanden ist, dann ist ebenfalls Schluß mit lustig. Solche Situationen suchen wir uns nicht aus, aber niemand ist vor ihnen gänzlich gefeit.
Wenn in diesen Tagen die Faschingszeit zugleich an ihren Höhepunkt und an ihr Ende kommt und mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, dann erinnert uns diese Zäsur unter anderem daran, daß uns das Leben manchmal großen Ernst abfordert. Wir sollen nicht unvorbereitet in solche Situationen hineingeraten. Die Fastenzeit will uns darauf vorbereiten. Mindestens ist das meines Erachtens eine der Sinndimensionen dieser besonderen Jahreszeit zwischen Fasching und Ostern.
Das Leben fordert mehr, als daß es nur mir persönlich gut geht, daß ich bloß selbst einigermaßen sorglos weiterkomme oder daß ausschließlich meine eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. In der Fastenzeit geht es um eine gesunde Selbstlosigkeit. Das hat nicht vorrangig etwas mit Kasteiung zu tun, sondern zunächst mit der Frage, was mir über meine egoistischen Einzelinteressen hinaus wichtig ist und ob ich bereit bin, meine Lebensenergie dafür einzusetzen.
Viele Menschen, die wir als Vorbilder verehren, sind gerade deswegen dazu geworden, weil sie nicht immer nur ihr eigene Bedürfnisse und Wünsche beachteten, sondern einen größeren Nutzen suchten. So stelle ich mir am Beginn der Fastenzeit folgende Fragen:
l Was ist für mich der größere Nutzen meines Lebens?
l Was tue ich dafür, ihn zu erfüllen?
l Möchte ich selbst Vorbild für andere sein?
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München


Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
Mundartsprecher Måla Richard Šulko, seit langem erfolgreich für die heimatverbliebenen Egerländer nicht nur im Kreis Luditz im Einsatz, erzählt vom Fasching in Plachtin. Das Dorf Plachtin, in dem der Måla Richard lebt, wurde 1670 gegründet und gehört heute zur Gemeinde Netschetin. Und Netschetin ist der Sitz des Bundes der Deutschen in Böhmen, eines Vereins der Deutschen in Westböhmen, deren Vorsitzender der Måla Richard ist.
Dös Gschichtal, woos i(ch enk haint da(r)zühl, soll sua in dreißicha Gouhan des letzten Jahrhunnerts påssiart saa. Am Faschingdöinsta is am Plachtin, asm letztan Haisl untan im Dorf bam ‘Dögler da Maschkarazugh lousgånga. Dabaa woar a hålwas Dorf, waal Plachtin nua 51 Hausnumma(r g‘hått håut.
Uwa ålla wichticha G‘staltån woar dabaa: da „Laffa(r“, dear stammt von vuarn g‘laffan is (dian håut da kloina Potina Ru-
❯ Gschichtal asm östlichan Eghalånd Kuhlnschwårz
7/2023
am Dorfend Richtung Annischau, is dös aastrengend genou(ch. Wen man(n uwa nu dabaa tånz(a) n mou, is dös nu schlimma(r. Dabaa påssiert aa v(ü)l lustichas. In dian Gouha woar da ersta „Karambol“ scho(n ban „Vei(t)n“: Da „Råuchfångkhiara“ is üwa seina Leit(a)n g‘stolpart u is in Stråuangråbn hi(ngfluagn. Dabaa håut ear seina Leit(a)n kaputt g‘måcht. Ear håut nimma(r g‘wußt, woos ear dian gånzan Zugh måch(a)n soll. Dåu is ihm woos aag‘fållan. „I(ch tou döi Leit mit Ruß beschmieran!“

Der Text des „Plachtiner Heimatliedes“ ist von Måla Richard Šulko, die Melodie von Hatto Zeidler.
di g‘macht), da „Hanswurst“, da „Bojaz“, da „Bär“, da „Bärfäihara“, da „Fleischhåcka(r“,
da „Råuchfångkhiara“ u da „Dokto(r“. Ven ma(n va untan im Dorf affigäiht, bis zam „Soahler“
Dös woar uwa woos. Kuhlnschwårz waor damåls ‘s gånza Durf. ‘S is uwa niat nu(ch dian schwårtz(a)n Mua(n wås g‘schea(h. Aa dian Bär håust da(r)wischt. Åls ear bei Målas rumtånzt is, is ear am Gartanzaun hängan bliebn u håut si(ch saa Föll aafg‘rissan! D‘ Leit håbn glåcht, uwa(r åls dian ihr G‘sicht da „Råuchfångkhiara“ mitara(r schwårzen Krem beschmiert håut, is dös Låchn ållan aasgånga. U sua is dös weita(r u weita(r gånga, bis ma(n Na(ch)mittågh fertich woar. Am Åubnd is offa(r tånzt wuarn. Dös Wirtshaus bam Hofschneida woar schäi(n voll, uwa oins woar an dian Åubnd ånnarscht. Ålla håbn schwårza G‘sichta g‘hått, waal ma(n döi Krem niat håut kinna åwaschn. Bis haint tout ma(n si(ch an döi Fosnat vo damåls darinnan!



Netschetin mit Plachtin in deutscher Zeit.
❯ Engagierter sudetendeutscher Lehrer
PERSONALIEN
Ernst Korn †


Am 21. Dezember starb der Egerländer Ernst Korn nach längerer Krankheit mit 95 Jahren in München.
Ernst Korn kam am 13. Oktober 1927 in Neumarkt im Tepler Hochland zur Welt. Dort besuchte er die Volksschule, anschließend ging er auf die Bürgerschule in Weseritz. Die Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Mies konnte er nicht beenden, denn am 13. Oktober 1944 wurde er zum Reichsarbeitsdienst nach Laxenburg nahe Wien eingezogen. Ab Januar 1945 war er Kriegsoffiziersbewerber bei der Luftwaffe. Nur drei Monate lang wurde er als Melder in einem Sturmzug in Schlesien eingesetzt.
Am 9. Mai 1945 kam er an der Nordostgrenze Böhmens in tschechische Gefangenschaft. Die Tschechen übergaben ihn an die polnische Miliz, und er leistete fast vier Jahre lang Zwangsarbeit in mehreren Lagern in Polen. Schwerstarbeit, Hunger, Unterernährung – dies blieb nicht ohne gesundheitliche Schäden.



Seine Mutter starb Ende 1945, sein Vater wurde 1946 vertrieben. Erst Anfang 1949 wurde er aus der Gefangenschaft im Warschauer Ghetto entlassen und kam nach Pfronten in BayerischSchwaben. Dort sah er seinen inzwischen erneut verheirateten Vater wieder.
Seinen Traum, Lehrer zu werden, hatte er nie aufgegeben. Im April 1949 setzte er seine Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Lauingen an der Donau fort, wo er 1951 die Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen mit Auszeichnung abschloß. Nach Berufstätigkeit an
einer Volksschule im Allgäu und der Zweiten Prüfung wurde er 1955 zum Lehrer ernannt. Dann machte er ein Sonderstudium für das Lehramt an Mittelschulen für Deutsch und Englisch, ein Nachholstudium in Latein, ein Russisch-Examen, ein Sonderstudium der französischen Sprache und Literatur an der Sorbonne in Paris und ein Zusatzexamen für das Lehramt an Mittelschulen in Französisch. 1962 wurde er Mittelschuloberlehrer, 1970 Studienrat, 1973 Oberstudienrat, 1976 Studiendirektor und 1987 Oberstudiendirektor. Dazwischen war er Vertreter des Direktors an der staatlichen Realschule in Gauting, Prüfer am Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen in München, Hospitationslehrer für Englisch und Französisch an der Realschule in Gauting und wirkte an der Neugestaltung des Englischlehrplanes für Realschulen mit. Er war auch Dozent an der Volkshochschule (VHS) in Lindau für Russisch und Französisch und Stellvertretender VHS-Leiter. Er unterrichtete Englisch und Französisch am Institut der Englischen Fräuleins in Lindau, gab Seminare für Englischlehrer an Volkschulen und unterrichtete Russisch am Bodenseegymnasium in Lindau. Darüber hinaus war er Mitautor an der Neufassung mehrerer Schulbücher und bereiste zu Studienzwecken viele Länder.
Schon früh engagierte er sich in der Vertriebenenarbeit. Seit 1965 ist er Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutscher Lehrer und Erzieher, deren Vorsitzender er 1985 bis 1999
war. Seit 1965 war er Mitglied des Heimatkreises Plan-Weseritz, ab 1983 bis zu seiner Erkrankung geschätzter Mitarbeiter in der Schriftleitung des „Heimatbriefes“.
In seinem Buch „Spuren hinterm Zaun“, das auch in englischer Sprache erschien, schilderte er seine Erfahrungen in der Gefangenschaft, die ihn sehr geprägt hatten. Viele Beiträge in sudetendeutschen Publikationen tragen seine Handschrift, aber auch Bücher für Fremdsprachenlehrer sind von ihm erschienen.
Er war ein heimattreuer, kämpferischer Egerländer und seinem Geburtsort Neumarkt zeitlebens eng verbunden. Das Unrecht der Vertreibung beschäftigte ihn sehr, und in vielen Beiträgen, auch im „Heimatbrief“, setzte er sich – stets fundiert und kritisch – mit diesem Thema auseinander. In vielen Institutionen brachte er sich ein und bereicherte diese – immer hilfsbereit, zuverlässig und überaus freundlich – mit seinem immensen Wissen. Dafür erhielt er zahlreiche hohe Auszeichnungen.
Sein Tod hinterläßt eine große Lücke, die nicht mehr zu schließen ist. Heimatkreis und „Heimatbrief“ trauern mit allen Landsleuten um diesen verdienten Landsmann. Groß ist der Verlust für seine Familie, auf die er so stolz war. Gerne erzählte er von seinen Kindern, den Enkeln, und ganz besondere Freude bereiteten ihm seine Urenkel. Ihnen allen wird er fehlen. Ein erfülltes Leben fand sein Ende. Möge ihm nun all das Gute vergolten werden, das er auf Erden tat. All seinen Angehörigen, im Besonderen seiner Frau Marga, gilt unsere herzliche Anteilnahme. Christine Ludwig Regine Löffler-Klemsche
❯ Verdiente Landsmännin
Pöchmann †
Am 3. Februar starb die höchst verdienstvolle Böhmerwäldlerin Anna Pöchmann mit 100 Jahren im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck.
Anna Pöchmann verbrachte ihren Lebendsabend bis zu ihrem Tod mit ihrem Sohn Johann in der eigenen Wohnung in Kirchheim unter Teck, wohin sie die Vertreibung einst verschlagen hatte. Sie war am 25. Juli 1922 in Eisengrub bei Höritz im Böhmerwald zur Welt gekommen. Anläßlich ihres 100. Geburtstages veröffentlichte die Sudetendeutsche Zeitung (➝ SdZ 33+34/2022) ihre Erinnerungen. Bis zuletzt war sie in ihrer Heimat tief verwurzelt. Immer wieder fand sie ein Thema, das sie recherchierte und niederschrieb. Das sind Zeitdokumente für die Familie und für den Böhmerwaldbund, denn sie veröffentlichte vieles in dessen entsprechenden Heimatzeitungen. Mit ihr verlieren wir eine Landsmännin, die die Heimat noch bewußt erlebte, viel von daheim wußte und es dokumentierte. Wir werden sie in guter Erinnerung behalten und ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Wer so gewirkt in seinem Leben, / wer so erfüllte seine Pflicht / und stets sein Bestes hat gegeben / der stirbt auch im Tode nicht. Gerda Ott
Trauerfeier mit Urnenbeisetzung Donnerstag, 2. März, 13.00 Uhr auf den Alten Friedhof in Kirchheim unter Teck.
Bei der Präsentation werden auch schöne Bilder gezeigt, wie hier mit der Preßburger Burg und dem Sankt-Martinsdom. Das Video ist noch zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=7zoXfeJrPYA
Das Deutsche Kulturforum östliches Europa in Potsdam (DKF) hat eine neue Publikation vorgestellt. Live und digital auf YouTube stellte Renata Sako-Hoess ihr neuestes Werk über ihre Geburtsstadt Preßburg/Bratislava vor. Dieser neue „Literarische Reiseführer“ mit großartigen Illustrationen führt durch Geschichte und Literatur der Hauptstadt der Slowakei. Ausgewählte Texte aus dem Buch las der aus dem Sudetenland stammende Schauspieler Thomas Birnstiel. Die Pianistinnen Eva Herrmann und Inna Schur lieferten gemeinsam mit dem Geiger Markus Koppe eine passende musikalische Umrahmung der Präsentation.
In ihrem neuesten „literarischen Reiseführer“ stellt Renata Sako-Hoess die slowakische Hauptstadt durch das Prisma von Autoren aus mehreren Jahrhunderten vor. In ihrem Vortrag erinnert sie daran, daß Preßburg (ungarisch Pozsony, bis 1919 slowakisch Prešporok, seit 1919 Bratislava) von drei Ethnien und Sprachen geprägt war: „Mehrsprachigkeit war prägend für die hier geborenen und lebenden Literaturschaffenden.“
Das erkennt man schon an historischen Aufschriften an Häusern oder Straßen und an den Autoren, aus deren Werken der mütterlicherseits aus Franzensbad im Egerland stammende Schauspieler Thomas Birnstiel im Laufe der Präsentation einfühlsam und packend liest. Natürlich sind die Texte zum Nachlesen in der Druckausgabe zu finden.

Zu hören sind beispielsweise die literarischen Stimmen von Ivan Horváth (1904–1960) mit seinem Prosatext „Laco und Bratislava“ (1928), in dem der slowakische Schriftsteller auch auf den Gründungsmythos Preßburgs eingeht. Der jüdischstämmige Juraj Špitzer (1919–1995) beschreibt den „Grauen Alltag“
Otfried Preußlers Buch „Der Räuber Hotzenplotz“ wird anläßlich des Doppeljubiläums des nordböhmischen Schriftstellers, der am 20. Oktober vor 100 Jahren zur Welt kam und dessen Tod sich am morgigen 18. Februar zum zehnten Mal jährt, mit einem Singspiel an der Staatsoper Stuttgart gefeiert.
Komponist Sebastian Schwab scheute vor Preußlers „Räuber Hotzenplotz“ nicht zurück. Er komponierte ein Singspiel in acht Bildern, das Anfang Februar in der ausverkauften Oper von
Spaziergang durch Preßburg
der Stadt. Der deutschsprachige Schriftsteller und Übersetzer Alfred Marnau (1918–1999) nimmt den Zuhörer (oder Leser) mit auf den „Steinernen Gang“. Die Publizistin und Frauenrechtlerin Elsa Grailich (1880–1969) schildert in ihren autobiografischen Aufzeichnungen einige „Preßburger Interieurs“ (1930). Vertre-
ten sind auch ungarische Schriftsteller aus Preßburg, wie Sándor Petőfi (1823–1849) mit seinem melancholischen „Abschied“. Der Journalist Karl Benyovszky schrieb viel über Preßburg und wurde mit einem Auszug aus seinen „Preßburger Ghettobildern“ (1932) vorgestellt. Er porträtierte in einem Buch den bedeuten-
den Preßburger Komponisten Johann Nepomuk Hummel (1778 –1837) als „Mensch und Künstler“ (1934).
Hier zeigt sich die Stärke der Präsentation: Neben der Zusammenfassung von Autorin SakoHoess kann man erst einen Auszug aus dem Buch und dann auch etwas aus einer Komposition Johann Nepomuk Hummels (1778–1837) hören. Dessen „Sonate Opus 92 zu vier Händen“ tragen die Pianistinnen Eva Herrmann und Inna Schur und der Geiger Markus Koppe zauberhaft vor. Die Musiker bieten auch die „Melodie in F“ von Anton Rubinstein (1829–1894), zwei „Charakterstücke“ von Ján Levoslav Bella (1843–1936) und das „Rondo zu vier Händen“ aus Ludwig van Beethovens (1770–1827) Sonate Opus 6.
Mit kurzen Musikstücken werden auch die Preßburger Komponisten Ernst von Dohnányi (1877–1960), Franz Schmidt
(1874–1939) und der ungarnstämmige Miska Hauser (1822 –1887) vorgestellt.
So ergänzt die Musik in der Einspielung die historischen Bilder und Buchtexte. In diesen kommen auch noch der Schauspieler Július Satinský (1941–2002) mit einem Auszug aus „Ein halbes Jahrhundert mit Bratislava“ (2002) zu Wort, außerdem der Autor Ladislav Mňačko (1919–1994) mit „Die siebente Nacht“ (1968) und die gebildete Fleischhauerstochter Therese Schröer (1804–1885), aus deren „Briefen und Blättern“ (1928) Thomas Birnstiel liest.
Die Präsentation des Deutschen Kulturforums (DKF) –entstanden in Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Musikinstitut und dem AdalbertStifter-Verein sowie Swantje Volkmann, Kulturreferentin im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm – ist ein kleines Gesamtkunstwerk. Sie macht Lust

vielen Kindern, Eltern und Großeltern als Familienvorstellung besucht wurde. Elena Tzavara, Anne X. Weber und Susanne Lütje liefern Libretto und Liedtexte. Florian Ziemen, Generalmusikdirektor am Theater für Niedersachsen in Hildesheim, weiß am Dirigentenpult sehr einfühlend die vielen Spontanszenen, dieses naiv-bunten Kasperletheaters zu unterstützen. Elisabeth Vogetseder gestaltete die Bühnenbilder kasperltheaterartig. Jeder Hauptakteur „bewohnt“ seine eigene Vorhangkulisse, die sich in Farbe und Pracht unterscheiden.

� Neues Singspiel über den „Räuber Hotzenplotz“
Preußler als Oper
Franz Hawlata wuselt – als Räuber Hotzenplotz staffiert –bereits vor der Aufführung durch das Foyer, wo zahlreiche Fahndungsplakate nach dem „gesuchten Räuber“ hängen. Der Bariton schlüpft in diese Rolle, wirkt flink und hinterlistig. Hotzenplotzs Opfer, die Großmutter (Maria Theresia Ullrich), zieht gefühlsmäßig den Bogen vom Glücksgefühl über den Besitz einer Kaffeemühle bis zu Herzschmerz, als ihr Hotzenplotz die Mühle raubt. Wachtmeister Dimpfelmoser (Torsten Hofmann) nimmt sich mit entschiedener staatlicher Gewalt dieser Sache an.
Die beiden Bengel der Großmutter, Seppel (Dominic Große) und Kas-
perl (Elliott Carlton Hines) machen in Abstimmung mit Großmutter ihr eigenes Ding. Die beiden Schlaumeier beschriften eine Zweiradkarre mit dem Hinweis „Vorsicht Gold“ und versehen sie mit einem Spundloch am Boden zur Wegmarkierung. Hotzenplotz kommt hinter diese Fal-
auf diesen „Reiseführer“ von Renata Sako-Hoess über Preßburg, in dem sie ganz praktisch sechs kulturhistorische „Stadtspaziergänge“ vorschlägt.
Damit tritt ihr Buch auch die Nachfolge an von anderen „Reiseführern“ des DKF, das weitere ähnliche Publikationen aufgelegt hat: über Galizien oder Oberschlesien (beide von Marcin Wiatr), Breslau oder das Böhmische Bäderdreieck (Roswitha Schieb), Danzig (Peter Oliver Loew), das Hirschberger Tal in Schlesien oder das südliche Siebenbürgen (Arne Franke) und die Dobrudscha (Josef Sallanz) sowie andere Regionen des ehemaligen Deutschen Ostens.
Susanne Habel
Renata Sako-Hoess: „Literarischer Reiseführer Preßburg/Bratislava. Sechs Stadtspaziergänge“. Mit Abbildungen, Zeittafel, Register und zweisprachigen Karten. DKF, Potsdam 2022; 276 Seiten, 15,30 Euro. (ISBN 978-3936168-68-6) Erhältlich bei: Deutsches Kulturforum östliches Europa, Ariane Afsari, Berliner Straße 135, Haus K1, 14467 Potsdam; Telefon (03 31) 20 09 80, eMail deutsches@kulturforum.info





le, die geeignet sein sollte, seine Höhle ausfindig zu machen. Er erkennt im Waldboden eine Doppelspur, die ihm erlaubt, die beiden Jungen getrennt zu fassen. Seppel behält er selbst, und Kasperl gibt er weiter an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann (Heinz Göhring).
Die Buben vertauschen im Verlauf der Handlung ihre Mützen, was für weitere Verwirrung sorgt. Der eine muß Stiefel putzen, der andere Kartoffeln schälen. Alle Ausbruchsversuche gehen schief. Erst die zur Unke verzauberte Fee Amaryllis gibt
Kasperl einen Tip für die Flucht, gegen dessen Versprechen, ein Zauberkraut zu bringen, was auch gelingt.
Dankbar für ihre Entzauberung
mit dem Kraut gibt
Fee Amaryllis Kasperl einen Zauberring, mit dem er Hotzenplotz zum Gimpel verzaubert und so dem
Wachtmeister Dimpfelmoser ausliefert. Über einen weiteren Zauberspruch kommt die Kaffeemühle zurück an die Großmutter, deren Figur schreitend, tanzend und schwebend das Publikum in ihren Bann zieht.
So endet das Singspiel viel zu schnell mit einem inhaftierten „Gimpel“ Hotzenplotz, einer überglücklichen Großmutter, zwei jugendlichen Helden und Zwackelmann, der keine Lust mehr hat, Zauberer sein zu wollen.
Das Publikum fiebert bis zuletzt mit, angefacht von Gesten und Animationen der Darsteller. Mit vier Vorhängen und stehendem Applaus endete die fulminante Inszenierung.
Oswald J. Haberhauer
Singspiel „Der Räuber Hotzenplotz“ von Sebastian Schwab. Staatsoper Stuttgart, Opernhaus, Oberer Schloßgarten 6. Aufführungen am 3., 13., 20. März und am 26., 28., 30. April. Karten: Telefonische Bestellung unter (07 11) 20 20 90. Internet www.staatsoperstuttgart.de/spielplan/a-z/ der-raeuber-hotzenplotz/

Anfang Februar gab das Abaco-Orchester im Herkulessaal in der Residenz in München ein fulminantes Konzert. Das studentische Ensemble präsentierte Gustav Mahlers sechste Sinfonie in a-Moll und begeisterte unter dem deutsch-türkischen Dirigenten Alexander Sinan Binder das Publikum im fast vollbesetzten Herkulessaal.

Das Konzert war übrigens das beste, was ich vom Abaco je gehört habe!“ oder „Vielen Dank nochmal für das großartige Konzert. Eine sehr interessantes und ergreifendes Werk, wunderbar gespielt von diesem Orchester!“
– So lauteten nach dem jüngsten Auftritt des Abaco-Orchesters in München spontan zwei Stimmen aus dem Publikum. Das Orchester hatte schon mehrfach Symphonien des 1860 in Iglau geborenen Komponistenfürsten präsentiert, darunter 2015 unter dem Rubrum „Mahler 2“ die Zweite mit 250 Sängern von drei Gastchören in der damals noch bespielten Philharmonie im Gasteig (Ý SdZ 11/2015).

Die „Tragische“
Jetzt war die 6. Symphonie dran. Sie entstand in der Sommerfrische 1903 und 1904 in Mahlers Komponierhäuschen in Maiernigg in Kärnten, nur einen Spaziergang durch den Wald von seiner Villa am Wörthersee entfernt. Das waren glückliche Zeiten. Der in Iglau geborene Musiker war zu dieser Zeit als Dirigent in Wien hochangesehen und frischgebackener Vater. Seine Kinder wurden Ende 1902 und im Juni 1904 geboren. Seiner künstlerischen Entfaltung stand nichts im Weg. Von einer Schaffenskrise kann ebenfalls nicht die Rede sein; im Gegenteil, begann er doch direkt nach der Vollendung seiner 5. Symphonie wieder zu komponieren. Nach der 3. und 4. Symphonie kreierte Mah-
Mahlers Sechste
musik-Konzerte. Dennoch bot das Orchester mit drei erfolgreichen Projekten im vergangenen Jahr endlich auch wieder Konzerte als Symphonieorchester, wenn jedoch noch in vergleichsweise kleinen Besetzungen. Sehr schwer fiel dem Ensemble dabei der Abschied vom damaligen Dirigenten, dem Belarusen Vitali Alekseenok, der das Orchester von 2018 bis 2022 geleitet hatte und seit kurzem als Kapellmeister an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf tätig ist.
Sein Vorgänger, der 1981 im lothringischen Forbach geborene Joseph Bastian, hatte das AbacoOrchester von 2011 bis 2018 dirigiert und tourte danach als freier Dirigent durch die ganze Welt. Erfreulicherweise entschieden sich die Münchener Symphoniker ab der Spielzeit 2023/24 für Bastian als neuen Chefdirigenten und künstlerischen Leiter.
Wiedergeburtsauftritt
Das AbacoOrchester
ler mit der 5. und 6. Symphonie wieder instrumentale Werke.
Die vorangegangenen Symphonien hatten alle in einem optimistischen Grundton geendet, und selbst Mahlers „Kindertotenlieder“ (Ý SdZ 07/2020) klangen verhältnismäßig mild aus. Daher überrascht der düster-resignierende Schluß der Sechsten, die auch die „Tragische“ genannt werden sollte, was bis heute biographisch nicht abschließend begründet werden konnte. Dennoch legt die Intensität des Werkes nahe, daß Mahler hier tiefere Gefühlszustände verarbeitete.
Interessant ist daher auch die Erinnerung seiner Frau Alma an den Tag, an dem er ihr das neue Werk auf dem Klavier im Komponierhäuschen vorspielte: „Wir weinten damals beide. So tief fühlten wir diese Musik und was sie vorahnend verriet.“ Mahler
selbst sagte darüber: „Meine VI. wird Rätsel aufgeben, an die sich nur eine Generation heranwagen darf, die meine ersten fünf in sich aufgenommen und verdaut hat.“
Im Herkulessaal spielte das Abaco-Orchester die Symphonie in der von Mahler präferierten Fassung: I. Allegro energico; II. Andante moderato; III. Scherzo; IV. Finale, Sostenuto – Allegro moderato – Allegro energico. Es beeindruckte diesmal besonders mit dem intensiven Streicherklang und den berückenden Trompeten. Das „Tragische“ kam gut in den zwei „Hammerschlägen“ im vierten Satz zur Geltung, die das Schlagwerk hervorragend meisterte. Die Tonexplosionen sollten die zwei Schicksalsschläge Mahlers – den Tod des einen Kindes und Verlust seiner Stelle in Wien – vorausgesagt haben.

Fast könnte man meinen, das Ensemble ging mit diesem Wie-
dergeburtsauftritt auf seine (und unsere) jüngere Geschichte ein, denn die 6. Symphonie von Gustav Mahler könnte mit ihrer Tragik und ihrer gewaltigen Instrumentierung auch Symbol für viele aktuelle Themen der heutigen Zeit sein: Vor fast genau drei Jahren hatte das Abaco-Orchester das letzte Mal im Herkulessaal gespielt, als es am 9. Februar 2020 dort Schostakowitschs 7. Symphonie aufführte. Mit 113 Musikern auf der Bühne war dies auch das letzte Konzert, das das Ensemble in einer so großen Besetzung spielen konnte.
Nur wenige Wochen nach diesem großartigen Konzert (Ý SdZ 7/2020) begann auch für das Abaco-Orchester die pandemiebedingte Pause, die es dazu brachte, bereits groß geplante Projekte abzusagen – statt Beethoven 9 und Mahler 3 gab es nun zunächst nur Kammer-
Alexander Sinan Binder begeisterte als der aktuelle Chef des Abaco-Orchesters von Anfang an das Ensemble und im Herkulessaal auch schnell das große Publikum. Der 1990 im oberbayerischen Dachau geborene Binder ist seit Juli 2022 Chefdirigent und musikalischer Leiter des Abaco-Orchesters. Er studierte Orchesterleitung an der RobertSchumann-Hochschule Düsseldorf und an der Zürcher Hochschule der Künste und besuchte viele Meisterklassen. Seine Tätigkeit als Dirigent umfaßt sowohl Symphonik als auch Oper, und er stand bereits am Pult international renommierter Klangkörper. Zuletzt war er Erster Kapellmeister am Luzerner Theater. Sein Start beim Abaco-Orchester ist ganz dem Geist des Ensembles verpflichtet: Junge Musiker zu großen Leistungen anzuspornen und Hörern jeden Alters unvergeßliche Erlebnisse zu bescheren. Susanne Habel
Das Abaco-Orchester besteht aus Studenten und jungen Berufstätigen, die sich neben Studium und Beruf mit großer Leidenschaft der Musik widmen und sich allwöchentlich zur Probenarbeit treffen. Das Ensemble besteht aus über 100 hingebungsvollen Instrumentalisten. Viele Musiker waren Mitglieder der deutschen Landesjugendorchester, des Bundesjugendorchesters und Preisträger bei „Jugend musiziert”. Einige hatten sogar ein Musikstudium begonnen, bevor sie sich für ein anderes Studium entschieden. So ist das Niveau für ein Laienorchester sehr hoch. Große Konzerte aufzuführen bedeutet für das sich selbst finanzierende Orchester einen Kraftakt. Schließlich stellen sich die jungen Musiker der Herausforderung, ein musikalisch und organisatorisch anspruchsvolles und aufwendiges Werk auf die Bühne zu bringen.
In den inzwischen 35 Jahren seines Bestehens hat das Orchester viele symphonische Werke aufgeführt. Daß dabei die Fünften Symphonien großer Komponisten wie Beethoven, Mahler, Prokofjew, Schostakowitsch oder Tschaikowsky bevorzugt werden, ist nur ein Gerücht. Immer wieder werden auch Werke aufgegriffen, die selten in den Programmen der Profi-Orchester auftauchen, wie beispielsweise das Violinkonzert des Brünners Erich Wolfgang Korngold oder „Das Klagende Lied” des Mährers Gustav Mahler.
Die Vielfalt an sudetendeutschen Dialekten und Mundarten ist auch heute noch lebendig. Das wurde bei der Landesfrauentagung der SL-Landesgruppe Bayern im Kolpinghaus in Regensburg deutlich.
Gut 40 Frauen und einige Männer aus ganz Bayern trafen sich, um sich – vor allem anhand von Geschichten und Gedichten – mit dem Thema „Mundarten im Sudetenland“ zu beschäftigen. Der Jahreszeit entsprechend ging es im Hauptvortrag außerdem um den Fasching in den sudetendeutschen Gebieten. Und auch der Regensburger
Bischof Rudolf Voderholzer stattete den Frauen wieder einen Besuch ab.
Traditionell eröffnet das Böhmische Trio aus Burglengenfeld – Rosa Mehringer, Marianne Fuchs und Hannelore Götz – die Frauentagung mit einem Begrüßungslied und umrahmt die Veranstaltung mit einigen dem jeweiligen Thema angepaßten Stücken. So war es auch diesmal. Das Totengedenken galt besonders der im vergangenen Jahr verstorbenen früheren Landtagspräsidentin und Sozial- beziehungsweise Schirmherrschaftsministerin Barbara Stamm. Landesfrauenreferentin Sigrid Ullwer-Paul erinnerte an die vielen Begegnungen mit ihr und bedauerte, daß Steffen Hörtler und Toni Dutz als Vertreter der SLLandesvorstandes wegen einer parallelen Vorstandssitzung in München wieder weg mußten.


Der SL-Landesobmann Hörtler gratulierte Tagungsleiterin
Ullwer-Paul nachträglich zum 80. Geburtstag am 21. Januar (Ý SdZ 3/2023) und zeigte sich in seinem Grußwort erfreut über das Ergebnis der Präsidentenwahl in der Tschechischen Republik – auch wenn das knappe Wahlergebnis verdeutliche, daß ein Teil der Tschechen gespalten sei. Der frühere Ministerpräsident und jetzt unterlegene Präsidentschaftskandidat Andrej Babiš habe nichts gegen die Sudetendeutschen, aber auch kein Interesse an ihnen, so der Landesobmann.
Der neue Staatspräsident Petr Pavel sei zwar fünf Jahre lang in der Kommunistischen Partei gewesen. Doch angesichts seiner NATO-Tätigkeit und seiner Positionen im Wahlkampf sei seine proeuropäische Haltung deutlich geworden. „Die Mehrheit hat sich für einen Europakurs entschieden“, interpretierte Hörtler das Wahlergebnis. Im Wahlkampf habe das Thema Sudetendeutsche oder Vertriebene keine Rolle gespielt.

„Mich stimmt optimistisch, wie sich das in Tschechien entwickelt hat“, drückte Hörtler seine Freude aus und verwies auf die vielen Verbände, Universitäten, Städte und Gemeinden, die inzwischen zu Partnern geworden seien. Besonders hob er dabei die mährische Hauptstadt Brünn hervor, wo seit gut zehn Jahren an den Brünner Todesmarsch von 1945 erinnert und nun traditionell der Friedensmarsch mit einem umfangreichen Rahmenprogramm organisiert werde, die Stadt sogar einen Empfang gebe und den Verlust von Kultur und Menschen durch die Ereignisse von damals bedauere.
� Frauentagung der SL-Landesgruppe Bayern
Mundart und Fasching in der Heimat

Anerkennung zollte Hörtler auch dem Deutschen Botschafter in Prag, Andreas Künne, der beim Friedensmarsch 2022 die letzten fünf Kilometer mitmarschiert sei und damit auch die sudetendeutschen Belange gut vertrete. Auch der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder sei inzwischen, so Hörtler, zu seinem Antrittsbesuch in Prag gewesen und habe die Themen der Sudetendeutschen dort angesprochen.
Deutliche Kritik übte Hörtler an der Reduzierung der Fördermittel durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die grüne Staatsministerin Claudia Roth, im Bereich der Förderung der Kulturarbeit der Vertriebenen. So müßten nicht nur bewährte Veranstaltungen gestrichen werden, sondern beispielsweise auch der von
detendeutschen, Christina Meinusch, für die Vorbereitung und Durchführung der Tagung.
Über „Mundarten im Sudetenland“ gab Ullwer-Paul einen Überblick, welche Mundart konkret in welchen Regionen oder Sprachinseln vertreten ist. Nordbayerisch oder Oberpfälzisch im Egerland, Mittelbayerisch im Böhmerwald bis nach Mähren, Schlesisch in den nördlichen Gebieten wie Iser-, Riesen-, Adler- und Altvatergebirge sowie im Kuhländchen, Ostfränkisch im Erzgebirge, Obersächsisch
Fahnenschwingen, Schwerttanz, Laternentänze, Maschkererzug, Hutza-Abende, Tanz und Bälle, Schlachtfest mit viel Fleisch und viel fettem Essen, Pflugziehen gehört. Beliebte Verkleidungen seien beispielsweise der Lafferer, der Hanswurst, die Wilden Männer, der Bär mit Bärentreiber, das Rössel und der Narr gewesen. Was heute die Prinzenpaare seien, seien einst der Plotzknecht und die Plotzmahd bei Bällen gewesen. Darüber hinaus habe es da und dort Faschingskomitees gegeben, die sich um die Orga-
den bereits erwähnten Dürrekrapfen. Michael Käsbauer aus dem oberbayerischen Erding spielte mit seiner „böhmischen“
Harmonika das Couplet vom Schaukelstuhl, das seine Mutter Elisabeth aus Rodisfort bei Eger aufgeschrieben hatte. Die heute in Dresden lebende und in Düsseldorf geborene Eva Lubas bewahrte den Dialekt ihrer aus Plan stammenden Mutter und trug eine kurze Geschichte im Dialekt dieser Region vor.
Auch Bischof Voderholzer war gekommen und sprach ein Grußwort. Die Mundart des Couplets – während dieses Vortrags stieß er zur Tagung – war ihm natürlich nicht fremd, schließlich stammen seine mütterlichen Vorfahren auch aus Böhmen, konkret aus Kladrau im Egerland. Nach dem heiteren Lied und der Begrüßung durch Sigrid Ullwer-
Festgottesdienstes am oder um den 15. August, kommt Bischof Rudolf jedes Jahr, seit es möglich ist, in diese „größte Kirche Westböhmens mit der ganz speziellen Barockgotik“, um mit den noch lebenden Vertriebenen aus Kladrau sowie Einheimischen aus dieser Region die festliche Eucharistie zu feiern.
Natürlich gebe es am Marktplatz von Kladrau an diesem Tag auch das Volksfest. „Wir müssen ihnen zumindest zeigen, warum sie dieses Fest feiern“, begründete der Bischof augenzwinkernd sein pastorales Tun jährlich um den 15. August in Kladrau. Seine Großelter seien am 16. Juni 1946 vertrieben worden. Seine Mutter sei bereits im Winter 1945/46 schwarz über die Grenze „abghaut“. „Sie war in der Lehrerbildungsanstalt in Mies, und sie war in einem Alter, wo sie befürchten mußte, daß sie ins Landesinnere deportiert wird. Sie landete dann zunächst in der Nähe von Würzburg, war dann in Aschaffenburg und studierte Lehramt. Dann kam sie nach Südbayern in die Nähe von Wasserburg, wo auch die Großmutter mit den drei noch minderjährigen Brüdern meiner Mutter angekommen war. Schließlich kam auch der Großvater aus der Gefangenschaft zurück, so daß wieder alle beisammen waren“, erzählte der Bischof. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Frömmigkeit der Großmutter, die auch ihn geprägt habe.
der Seliger-Gemeinde vergebene Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis. Trotz vieler Gespräche habe man bisher nichts erreicht, betonte Hörtler und sprach von Einschnitten hinsichtlich der Vertriebenenarbeit. „Das hat nichts mit Politikarbeit zu tun.“
Abschließend widmete er sich dem Krieg Rußlands gegen die Ukraine. Die Sudetendeutschen und viele andere Vertriebenenverbände hätten immer hingehört, was der östliche Nachbar gesagt habe. Doch der Großteil der deutschen Bevölkerung und der Politik habe nicht darauf gehört, deutete Hörtler bereits früher wahrnehmbare Warnungen vor Rußland oder Wladimir Putin an. „Wer könnte ein besseres Bindeglied sein als wir, die Vertriebenen beziehungsweise Sudetendeutschen?“
Christian Weber, Obmann der SL-Bezirksgruppe Niederbayern und Oberpfalz, erinnerte in seinem Grußwort an die seit 1951 bestehende Patenschaft der Stadt Regensburg über die Sudetendeutsche Volksgruppe. „Viele vertriebene Sudetendeutsche haben in Regensburg und Umland eine neue Heimat gefunden“, blickte er zurück und dankte stellvertretend für alle Frauen Sigrid Ullwer-Paul für die engagierte Arbeit. „Ohne die Frauen gäbe es die Sudetendeutsche Landsmannschaft heute nicht mehr“, mutmaßte Weber.


Ullwer-Paul las das schriftliche Grußwort der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer MdL, vor. Darin bezog sich Stierstorfer auf das Tagungsthema und betonte die Einzigartigkeit und Vielfalt der Dialekte. Die Landtagsabgeordnete dankte der Landesfrauenreferentin und der Heimatpflegerin der Su-

im Elbetal mit Aussig, TetschenBodenbach, Leitmeritz und Mittelbayerisch in der Brünner und Wischauer Sprachinsel. Mittelund Nordbayerisch herrsche in der Iglauer Sprachinsel, Ostfränkisch im Schönhengstgau. Der fünften Jahreszeit entsprechend, referierte Christina Meinusch über sudetendeutsche Faschingstraditionen und berichtete von höchst unterschiedlichen närrischen Bräuchen in den einzelnen Heimatlandschaften. Zunächst erläuterte sie allgemeine Aspekte des Faschings beziehungsweise der Fastnacht, die vor allem in katholischen Gegenden verbreitet sei. Während in der Heimat meist die Bezeichnung Fastnacht verbreitet gewesen sei, sei meist in der neuen Heimat der Name Fasching für die närrische Zeit üblich.
Meinusch verwies auch auf die wesentlichen Elemente. Zeit der Sinneslust und Völlerei vor der Fastenzeit, verkehrte Welt und Umdrehen der Hierarchien, Äußern unbequemer Wahrheiten, Freiheit, sich außerhalb der eigenen sonst üblichen Rolle zu bewegen. Vor allem Zünften, Handwerksgilden oder Vereinen habe die Durchführung der Veranstaltungen oblegen. Unterschiede habe es zwischen städtischen und ländlichen Bräuchen gegeben. Die Feiern hätten zwischen Unsinnigem Donnerstag und Faschingsdienstag stattgefunden, am Aschermittwoch habe es Abschiedszeremonien gegeben. Doch schon nach Dreikönig hätten die Vorbereitungen wie das Nähen der Kostüme für die heißen Tage begonnen. Zu den Ritualen hätten
nisation der Veranstaltungen gekümmert hätten. Am Aschermittwoch hätten Beerdigungsriten stattgefunden, bei denen bestimmte Fastnachtssymbole verbrannt, ertränkt oder beerdigt worden seien. Verbreitet seien auch mit Aberglauben verbundene Sprüche oder Handlungen gewesen. Und natürlich habe es auch Krapfen und anderes Schmalzgebäck gegeben. Die Dürrekrapfen sind ein spezielles Schmalzgebäck aus der Wischauer Gegend, die die die Tagungsteilnehmer schnabulieren konnten. Mit Erzählungen, Gedichten und einem Couplet in unterschiedlichen Mundarten vertieften einzelne Tagungsteilnehmer diese Thematik, einige Texte griffen andere Feste des Jahres oder andere Themen auf. Helga Olbrich, die Stellvertretende Bezirksfrauenreferentin für Niederbayern und Oberpfalz, berichtete, daß sie als Kind maskiert und verkleidet durch‘s Dorf zu den Nachbarkindern gelaufen sei. Ferner sei zur Faschingszeit auch das Theaterspiel verbreitet gewesen – mit viel Gesang und Tanz. Und der Dialekt sei dabei wichtig gewesen als Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer bestimmten regionalen Gruppe.
Richard Šulko oder Måla Richard erläuterte die jüngste Etappe seiner bis ins Jahr 1765 zurückreichenden Familiengeschichte sowie die Herkunft seines Hausnamens Måla. Danach las er im egerländischen Dialekt eine Faschingsanekdote vor. In die Wischauer Sprachinsel lockte Rosina Reim sowohl mit einer Geschichte als auch mit
Paul ergriff der Bischof das Wort. „I kua’s aa a weng“, kommentierte er sein Eghalandrisch. Von der Großmutter und Mutter sowie von den Onkeln hatte er den Dialekt aus deren Heimat viele Jahre lang gehört. „Wir, die nachgeborene Generation, haben die Mundart zu Hause nicht mehr gesprochen, aber die Großeltern und die Familie haben untereinander nur Eghalanderisch gesprochen“, erklärte er.
Natürlich informierte er über die familiäre Herkunft mütterlicherseits. Kladrau bei Mies mit dem altehrwürdigen früheren Benediktinerstift sei bereits 1785 säkularisiert worden. „Für mei Großmutter war des nicht das Kloster, sondern das Schluaß – also das Schloß“, erläuterte er wiederum in Mundart und nannte die historischen Fakten zur Begründung der Schloßentstehung und schließlich des jährlichen Schloßfestes zum Patrozinium der Klosterkirche an Mariä Himmelfahrt am 15. August.
„Das war in den Erzählungen meiner Großmutter so viel wie Weihnachten und Ostern und alles zusammen. Da war am Marktplatz ein Ringelspiel. Es war ein Volksfest, eine ganze Woche lang ist gefeiert worden“, schilderte er die Festivität. Zum Patrozinium, also zur Feier des
Besonders geprägt habe ihn, so der Bischof, eine weitere sudetendeutsche Person. Das sei der Religionslehrer am Gymnasium in München, der Kapuzinerpater Victricius R. Berndt aus Waltsch/ Valeč bei Karlsbad, gewesen. Dieser sei nach dem Zweiten Weltkrieg in Eichstätt zum Priester geweiht worden und dann in der Vertriebenenseelsorge tätig gewesen. „Durch die josephinische Liturgiereform waren die Katholiken aus dem Sudetenland schon viel mehr daran gewöhnt, den Volksgesang zu praktizieren – die Schubert- und die HaydnMesse, die schlesische Maiandacht und viele andere Sachen. Die hiesigen Pfarrer haben es nicht glauben können, daß hier die Leute singen“, gab Bischof Rudolf die Erinnerungen des Paters wieder. Pater Victrizius habe einen hervorragenden Religionsunterricht gehalten. So trugen für den Bistumschef viele Faktoren zu seinem theologischen und schließlich bischöflichen Wirken bei: das Glaubenszeugnis der Großmutter, der Eltern und des Paters Victricius R. Berndt.


Mit Bezug auf die volkskundliche Tagungsthematik erwähnte er schließlich das von ihm mit Begeisterung ausgeübte Sammeln von Weihnachtskrippen. die SLKreisgruppe Burglengenfeld/ Städtedreieck habe erst kürzlich die Sammlung besichtigt (Ý SdZ 6/2023). Hierbei verwies er auf eine Krippe, welche sogar die Flucht aus dem Schluckenauer Zipfel mitgemacht habe. „Ein schönes Element, um über den eigenen Glauben und die Wurzeln nachzudenken und zu sprechen“, schloß der Bischof.
Mit einem von Helga Olbrich in ihrer Mundart vorgetragenen Gebet endete die diesjährige Frauentagung. Markus Bauer

❯ BdV-Landesverband Bayern

Vertriebene bei Grünen im Landtag
Für Ende Januar hatte Katharina Schulze MdL, Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, den BdV-Landesverband Bayern zu einem Frühstück ins Maximilianeum eingeladen.
Phantomschmerzen



Anfang Februar fand die Jahreshauptversammlung der bayerisch-schwäbischen SLKreisgruppe Augsburg-Land mit der Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld im Königsbrunner Hotel Zeller statt.




Kreisobmann Kurt Aue sagte: „Die Sudetendeutschen waren schon immer speziell. Bereits in Zeiten, als es den Begriff Sudetendeutsch noch nicht gab. Damals waren sie Böhmen, Mährer, Österreichisch-Schlesier, deren Muttersprache Deutsch war. Zu ihnen gehörten Hans Kudlich, Gregor Mendel, Marie von Ebner-Eschenbach, Sigmund Freud, Franz Kafka oder Edmund Husserl.“ Weiter sagte Aue, der auch Beisitzer im Vorstand der Landesgruppe ist: „Einst waren die Böhmischen Länder, die heute Tschechische Republik heißen und nach dem Krieg gründlich ethnisch gesäubert worden waren, ein zweisprachiges Land. Beide Volksgruppen lebten meist friedlich miteinander, gemischte Ehen waren gang und gäbe. Deshalb tragen viele Tschechen Namen wie Klaus, Wagner oder Radl, manche Deutschböhmen heißen Konwitschny, Dworschak oder Zischka.“
Die Deutschen hätten alle Voraussetzungen gehabt, mit den Tschechen ein Staatsvolk zu bilden. Diese Chance sei verwirkt. Doch um sich dies offen einzugestehen, habe es 70 Jahre gebraucht. Nun träten die Letzten ab, die die Vertreibung noch erlebt hätten, nun breche sich Realismus die Bahn und halte sogar Einzug in die Statuten. Die Sudetendeutschen forderten keine Erstattung mehr für die Enteignungen bei Kriegsende. Dennoch verursache dieser irreversible Eingriff in das über Jahrhunderte gewachsene deutsch-tschechische Gemeinwesen Phantomschmerzen. Vielleicht mehr auf der tschechischen Seite als bei den Nachkommen der Vertriebenen. Denn die Spuren der Vergangenheit bildeten heute für die neuen Bewohner die Kulisse ihres Alltags. Sie erinnerten, manchmal unverhofft, an die verlorene Gemeinsamkeit. Und würfen Fragen auf: „War die eigene tschechische Identität vielleicht immer schon eine binationale und keine slawisch-homogene?“
Seit dem 19. Jahrhundert hätten Nationalisten von Generation zu Generation den Tschechen das Bild vom deutschen Urfeind eingeflößt, bis es fast alle geglaubt hätten.
Mit der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik 1918 seien die Deutschen, mit über drei Millionen immerhin ein Drittel der Bewohner, zur Minderheit im eigenen Land erklärt worden. Diese Kränkung habe tief gesessen. Viele, zu viele hätten sich 20 Jahre später dem Diktator aus Berlin in die Arme geworfen. „Sie taten das gern, auftrumpfend, jubelnd. Mit schrecklichen Folgen für die Tschechen. Das war mehr als nur ein Riß.“
Für tschechische Deutschenhasser gäbe es bis heute nur die kollektive Schuld. Bis heute gelte für sie: „Sie wollten heim ins Reich, also wurden sie dahingeschickt.“ Am Ende habe man sogar den wenigen deutschsprachigen Juden, die die Nazizeit überlebt hätten, nahegelegt, das Land zu verlassen. „Das war eine barbarische Reaktion auf die Barbarei der Nazibesatzung, ein kultureller Genozid. Zugleich ein selbstzerstörerischer Akt der Tschechen, dessen Ausmaß erst Jahrzehnte später reflektiert wird.“ Bei der Versammlung der SLOrtsgruppe Aichach im Nachbarkreis AichachFriedberg, zu der Ortsobmann Gert-Peter Schwank eingeladen hatte, habe Landesobmann Steffen Hörtler über die deutsch-tschechischen Beziehungen gesprochen (➝ Seite 10). Er habe sie als stark verbesserungswürdig dargestellt. Wichtig und richtig sei, habe Hörtler gesagt, mit dem tschechischem Volk und seiner Regierung Kontakt aufzunehmen, um das Verhältnis zu verbessern.
Schließlich gab Aue das Programm für die Kreis- und die Ortsgruppe bekannt. Im Mai finde in Wehringen eine Mutter- und Vatertagsfeier statt. Am Pfingstsonntag fahre man zum Sudetendeutschen Tag. Er, so Aue, wolle versuchen, ob eine Fahrt mit der Kreisgruppe Aichach-Friedberg möglich sei. Zu Fronleichnam nehme man an der Prozession teil. Am 17. Juni gedenke man der Toten bei Flucht und Vertreibung im Neuen Königsbrunner Friedhof. Für September sei eine Fahrt in die Heimat geplant. Geplant sei auch ein Vortrag vom BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer. Eine Teilnahme am Volkstrauertag in Königsbrunn und Wehringen sei vorgesehen. Die Weihnachtsfeier finde Anfang Dezember in Wehringen statt. Außerdem seien Wanderausstellungen über das Sudetenland geplant. te
Wir freuen uns sehr über den Besuch, uns ist sehr an einem regelmäßigen Austausch gelegen. Das heutige Gespräch mit dem BdV soll der Auftakt für einen regelmäßigen Meinungsaustausch sein“, begrüßte Katharina Schulze den BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer, dessen Stellvertreterin Herta Daniel und BdV-Landesschatzmeister Paul Hansel. Auch wenn das letzte Treffen mit der damaligen Fraktionsvorsitzenden Margarete Bause und dem Geschäftsführenden BdV-Landesvorstand fast sechs Jahre zurücklag, waren die Kontakte nie ganz abgebrochen. So war Knauer ein gern gesehener Gast bei der Verfassungsfeier der Fraktion auf Herrenchiemsee oder bei der Stallwächterparty in München. Erstmals wurde im vergangenen Jahr ein BdV-Vertreter zum Landesparteitag eingeladen und mit viel Applaus begrüßt.
Der Wille zum engeren Gedankenaustausch wurde in den letzten Monaten nicht nur durch die hochrangige Teilnahme der Fraktion an der Gedenkfeier für die Opfer von Flucht und Vertreibung in der Bayerischen Staatskanzlei deutlich. Neben der Vertriebenenpolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion, Gülseren Demirel, waren 2022 auch Landtagsvizepräsident Thomas Gehring und der Parlamentarische Geschäftsführer Jürgen Mistol der entsprechenden Einladung Markus Söders gefolgt. Die damaligen Gespräche mit der BdVLeitung führten schließlich zu einem Besuch Mistols und Gehrings im Sudetendeutschen Museum, dem sich auch die unterfränkische Abgeordnete Kerstin Celina angeschlossen hatte. Celina stand anschließend BdVLandesvorstandsmitgliedern in
deren Geschäftsstelle Rede und Antwort.


Seine Mitgliedschaft im Rundfunkrat nutzte Knauer über all die Jahre, um vor allem über die Landtagsabgeordneten Martin Runge, Verena Osgyan und Susanne Kurz Wünsche an die Fraktion zu einschlägigen Beratungen in den Landtagsausschüssen heranzutragen. So war es nicht verwunderlich, daß er zu Beginn feststellte, daß es mit Ausnahme von Hessen wohl kaum ein Bundesland gebe, in dem es seit Jahren ein konstruktives Bemühen beider Seiten gebe, sich über die Arbeit der Vertriebenenverbände und deren Anliegen auszutauschen. Einig war man sich allerdings, daß noch vieles ausbaufähig sei. Hierzu sei die Landtagsfraktion, so Schulze, bereit.
Landesschatzmeister Paul Hansel freute sich über die gezielten Fragen zu den BdV-Themen. Auf großes Interesse stieß auch die Rentenproblematik der Aussiedler und Spätaussiedler. Kundig wies die Ehrenvorsitzende der Siebenbürger Sachsen, Herta Daniel, auf einige Benachteiligungen im Fremdrentengesetz (FRG) mit der Folge drohender Altersarmut bei den Betroffenen hin. Daniel erinnerte an die Kürzung der Entgeltpunkte aus FRG-Zeiten um ein Sechstel, die Deckelung der Anzahl der Entgeltpunkte aus FRG-Zeiten auf 25 oder 40 und die Einführung des Faktors 0,6 bei einem Rentenbeginn ab 1. Oktober 1996 durch das Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz vom September 1996. Dieser Fak-
len im Rentenrecht aus der OstWest-Rentenüberleitung Spät-/ Aussiedlern und jüdischen Kontingentflüchtlingen dienen sollen. Diese Regelung sei nun von der neuen Bundesregierung völlig unzureichend umgesetzt worden. Die Bundesmittel seien um die Hälfte gekürzt, die Länder aus der ursprünglich angedachten Pflicht zur Beteiligung entlassen worden. Andererseits gehörten zum Kreis der Anspruchsberechtigten nur Spätaussiedler (Aufnahme in Deutschland ab 1. Januar 1993) und nicht Aussiedler (Aufnahme in Deutschland bis zum 31. Dezember 1992). Obwohl rund 750 000 Spät-/Aussiedler Rentenbezieher nach dem FRG seien, seien wegen der eng gesetzten Bedingungen nur 60 000 bis 70 000 antragsberechtigt für die geplante Einmalzahlung von 2500 Euro.
Die BdV-Vertreter beklagten auch die Kürzung der Projektmittel auf Bundesebene. Bei den wenigen Mitteln, die bislang zur Verfügung stünden, sei bereits der Rotstift angesetzt worden. Das gefährde viele projektgeförderte Institutionen in ihrer Existenz. Kontakte und Beziehungen – Brücken in Europa –, die durch die Corona-Krise schon genug gelitten hätten, drohten endgültig zusammenzubrechen.
Aus dem Stadium, daß der BdV bei den Grünen sich in der Kiste Feind befinde, über den man eigentlich nichts wisse, wie es vor mehr als 20 Jahren die damalige Landesvorsitzende und heutige baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper beim ersten Zusammentreffen von BdV und Grünen humorvoll bezeichnet habe, sei man längst heraus. Der gemeinsame Kampf gegen einen stumpfen Nationalismus, gepaart mit Antisemitismus und Rassismus, sowie das Eintreten für ein freiheitliches und demokratisches Europa bildeten eine stabile Grundlage für den Austausch.
Positiv angetan waren die BdVVertreter von der ausgesprochen guten Vorbereitung der Grünen-Politiker auf das Gespräch.
❯ SL-Ortsgruppe Rückersdorf/Mittelfranken



tor sei angesichts der niedrigen DDR-Renten nach der Wiedervereinigung für FRG-Renten zur Vermeidung von sozialen Ungleichheiten eingeführt worden.
Während bei den DDR-Renten eine Dynamisierung eingeführt worden sei, die den Rentenwert bis 2024 auf 100 Prozent des Westniveaus ansteigen lasse, fehle diese Dynamisierung bei den Altersrenten für ihre betroffenen Landsleute. So drohten bei den Renten nach den FRG-Kürzungen von mehr als bis zu 50 Prozent, bezogen auf die individuelle Lebensarbeitsleistung.
Als unzulänglich bezeichnete sie den von der letzten Bundesregierung 2021 beschlossenen Härtefallfonds. Je eine Milliarde Euro hätten von Bund und Ländern zur Abmilderung von Härtefäl-
Wenn man bedenke, daß die Kultur der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler ein Viertel der bundesdeutschen Gesellschaft berühre, brächten ihre Verbände kein Verständnis hierfür auf. Beunruhigt habe die Landsmannschaften auch die Ankündigung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die Grundsätze der Kulturförderung nach § 96 Bundesvertriebenengesetz überarbeiten zu wollen.
Gerade die letzten beiden Punkte wolle sie, so Schulze, an Roth herantragen. Schulze plädierte dafür, anhand konkreter Informationen aus dem Ministerium weiterzudiskutieren. Zudem regte sie einen Meinungsaustausch des bayerischen BdV mit Roth, die aus Augsburg stamme, an. Susanne Marb
Schockanruf und Enkeltrick
Anfang Februar sprach Kriminaloberkommissarin Petra Kröpfl von der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach, Abteilung sicherheitstechnische Prävention, vor der mittelfränkischen SL-Ortsgruppe Rückersdorf über „Sicher leben im Alter“.
Obfrau Bärbel Anclam dankte zunächst, daß so viele Mitglieder und Gäste gekommen waren. Danach stellte sie Petra Kröpfl vor und übergab ihr das Mikrofon.
Da in jüngster Zeit immer mehr Senioren Opfer krimineller Machenschaften würden, so Kröpfl, sehe die Polizei einen großen Handlungsbedarf bei der Seniorenarbeit. Dabei gehe es vor allem um Ratschläge, wie die Opfer eine bestimmte für sie schlechte Situation meistern könnten. Die derzeit häufigsten Trickbetrügereien seien Schockanrufe, Enkeltricks, falsche Polizisten, Haustürgeschäfte und Lotterieversprechen. Auch das Internet werde mit falschen eMails genutzt, und die Whats-
Apps via Mobiltelefon blieben ebenfalls nicht verschont.

Bei den Tätern handele es sich überwiegend um professionell geschulte Verbrecher. Die säßen in Callcentern – auch im Ausland – und versuchten, mit unlauteren Mitteln bei Senioren an Geld zu kommen.


Auf jeden einzelnen der oben genannten Tricks ging Petra Kröpfl im Detail ein. Häufig werde versucht, so Kröpfl, persönliche Daten, Bankverbindungen oder Verstecke von Bargeld und Schmuck in der Wohnung zu erkunden. Wichtig sei, zunächst



einmal Ruhe zu bewahren und überaus mißtrauisch zu sein.
So könne bei einem Anruf im Display des Telefons nie die Rufnummer 110 erscheinen, und die Polizei werde auch nie Fragen über die finanzielle Situation stellen. Am besten lege man den Telefonhörer einfach auf. Dann solle man selbst die Polizei unter 110 anrufen und den Vorfall melden.
In schweren Fällen sei es ratsam, eine Person seines Vertrauens anzurufen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Polizei habe außerdem Aus-


weise im Scheckkartenformat, die man sich unbedingt, wenn ein Täter persönlich an der Tür steht, zeigen lassen sollte. Vereinzelt würden auch noch Dienstmarken gezeigt, die aber nur noch ganz selten zum Einsatz kämen. Bärbel Anclam dankte Kröpfl herzlich und überreichte ihr ein Präsent vom Rückersdorfer Wochenmarkt. Anschließend konnten sich die Zuhörer an einem Buffet voller Canapés gütlich tun. Schließlich traten die Besucher gestärkt, begeistert und mit den vielfältigsten Eindrükken den Heimweg an. Ein ganz großer Dank geht an Bärbel Anclam für die tolle Organisation und an das Helferteam – saisonal waren diese im Faschingslook – für ihren Einsatz beim Herrichten des Buffets und der ganzen Veranstaltung.
Die SL-Ortsgruppe Rückersdorf lädt alle Mitglieder und interessierte Mitbürger zu einem weiteren Vortrag am 1. März über „Erfindungen aus Lauf“ ein. Referentin wird die Laufer Archivarin
❯ SL-Ortsgruppe Aichach/Bayerisch-Schwaben
Landsleute zeigen Flagge

Gastredner beim Monatstreffen der bayerisch-schwäbischen SLOrtsgruppe Aichach Mitte Februar im Gasthaus Specht war Bayerns Landsobmann Steffen Hörtler.


Lob für die großartige Umsetzung der Patenschaftsverpflichtungen gegenüber der Sudetendeutschen Volksgruppe zollte SL-Landesobmann Steffen Hörtler der Bayerischen Staatsregierung und den Landtagsfraktionen von CSU, SPD und Freien Wählern. Die Fertigstellung des Sudetendeutschen Museums in München sowie die stete Unterstützung von grenzüberschreitenden Begegnungen und Kulturprojekten belegten das positive Handeln. Deutliche Kritik galt dagegen der Bundespolitik.
Seit Jahrzehnten könne man beobachten, daß diese kein wirkliches Interesse an den sudetendeutschen Fragen habe. Im Zusammenhang mit der Vertreibung der drei Millionen Landsleute lasse man offene Fragen unter den Tisch fallen. „In Berlin wird offenkundig nach dem Leitsatz gehandelt, die Beziehungen mit dem Nachbarland nicht mit Fragen aus der Vergangenheit zu belasten“, so Hörtler.

Trotz der ständigen Verbesserung der deutsch-tschechischen Beziehungen herrschten in vielen Bereichen grundlegende Meinungsunterschiede. Als Beispiele nannte Hörtler die Flüchtlingspolitik, die Energieversorgung und den schleppenden Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur. Auch bezüglich des Ukrainekrieges seien die Tschechen viel entschlossener. Obwohl man in der Asylpolitik weit auseinanderliege, habe die Tschechische Republik im Verhältnis zu Bayern hier viermal so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen.
Viele tschechische Politiker, vornehmlich aus den Reihen der Christ- und Sozialdemokraten sowie der Grünen, die den Mut gehabt hätten, in offizielle Gespräche mit den Vertriebenen zu treten, seien später auch aus diesem Grund abgewählt worden.
❯ Brünner Ausnahmetalent



Der Flieger und Weltrekordhalter Josef „Joschi“ Starkbaum starb am 12. Jänner mit 89 Jahren im niederösterreichischen Sankt Pölten.

Am 22. März 1934 kam Joschi in der südmährischen Metropole Brünn zur Welt. Im Zuge der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg strandete er in Wien. Er wurde Verkehrspilot und war Kapitän bei den Austrian Airlines (AUA). Außerdem stellte er zahlreiche Rekorde im Ballonfahren auf, war Mitglied der Hochbegabtenvereinigung Mensa Österreich und des Österreichischen Aero-Clubs.

kriminierenden Gesetze bei Delegationsreisen an den richtigen Stellen deutlich angesprochen.
Begeistert war der Gast aus dem unterfränkischen Bad Kissingen beim vorangegangenen Besuch der SL-Heimatstube in der alten Mädchenschule, dem Anton-Günther-Denkmal und dem Vertriebenenkreuz im Alten Friedhof. Er könne dem Ortsverband nur großes Lob für dessen erfolgreiche Arbeit zollen, sagte Hörtler. Es komme nicht von ungefähr, daß die Ortsgruppe ihre Mitgliederzahl in den letzten Jahren um 50 Prozent habe steigern können. Daß die Sudetendeutschen in Aichach mit dem ganzjährigen Hissen der sudetendeutsche Fahne vor der Heimatstube Flagge zeigten, sei wohl einmalig im Freistaat.



Christian Knauer, Steffen Hörtler, Werner Schwab und Gert-Peter Schwank: Obmann Schwank ehrte in Anwesenheit von Hörtler Schwab für 30jährige und Altlandrat Knauer für 40jährige Treue zur Ortsgruppe. Die Jubilare hatten sich zur Amtszeit der bereits verstorbenen Ortsobleute Hans Pösselt und Inge Linhart der SL angeschlossen. Gerne erinnern sie sich an die Errichtung des Anton-Günther-Denkmals im Aichacher Stadtpark, die Umgestaltung der Gedenkstätte am alten Friedhof und die Totalsanierung der Heimatstube in der alten Mädchenschule. Bild und Text: Susanne Marb

Die Beziehungen zwischen der Landsmannschaft und tschechischen Politikern entwickelten sich erfreulicherweise kontinuierlich. Dies habe nicht zuletzt der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer mit der Änderung der bayerischen Politik gegenüber dem Nachbarland ermöglicht. Dennoch sei der Dialog immer wieder mit Rückschlägen verbunden.
Trotzdem sei man für die unmittelbaren Kontakte dankbar, weil man das Ziel habe, die gemeinsame Geschichte mit den Nachbarn wahrhaftig aufzuarbeiten.
Um den Dialog und das zunehmend positive Echo aus der Tschechischen Republik nicht zu gefährden, habe man sich bei der Thematisierung der BenešDekrete etwas zurückgenommen. Dennoch würden diese dis-
SL-Ortsobmann Gert-Peter Schwank, der sich über ein volles Nebenzimmer im Gasthaus Specht freute, würdigte den Vortrag Hörtlers als Sternstunde in der jüngeren Geschichte seiner Ortsgruppe. Besonders freute er sich über den Besuch von SLKreisobmann Ernst Wollrab, der in wenigen Wochen sein Amt in jüngere Hände legt.
An seine Mitglieder gewandt, appellierte er, weiterhin für den Besuch der SL-Veranstaltungen zu werben. Für 10. März seien ein Totengedenken für die MärzOpfer der Volksgruppe, die Uraufführung eines Films über die Heimatvertriebenen in Bayern und eine Vorstellung des BdV durch dessen Landesvorsitzenden Christian Knauer geplant.
Auf 15 000 Höhenmetern erkennt man deutlich die Erdkrümmung, und auch die Sterne sind am hellen Tag zu erahnen. Doch für diesen Ausblick ist keine Zeit. Der Brenner in der offenen Kabine muß wieder in Gang gesetzt werden. Es herrschen 60 Grad unter Null. Der Brenner in diesem Korb, dessen Aluwände längst dickes Eis tragen, soll nicht wärmen. Er hat wichtigeres zu tun, als den Mann zu wärmen, der versucht, ihn wieder zu zünden.
Völlige Ruhe herrscht. Nur das Zischen des Atems durch eine Sauerstoffmaske ist zu vernehmen. Dabei will jeder Atemzug überlegt sein, denn es kostet Kraft, gegen den starken Sauerstoffdruck auszuatmen. Die niedrigen Temperaturen hatten nämlich ein Ventil in der Maske vereisen und im offenen Zustand verklemmen lassen. Blind müssen alle Griffe sitzen, denn die Brille des Mannes ist ebenfalls vereist. Und es muß rasch gehen, denn dieser Brenner hat nur den Zweck, die Luft im Ballon darüber, einem Heißluftballon, aufzuheizen. Gelingt das Zünden nicht, kühlt die Luft, und er sinkt.
Die Physik läßt sich nicht beugen. Ist der Brenner erloschen, kann er in dieser Höhe nicht wieder gezündet werden. Der Ballon fällt. Die Ruhe weicht dem Fahrtwind. 15 000 Meter, fast doppelt so hoch wie der Mount Everest, geht es immer schneller nach unten. Die große Ballonhülle ist nicht mehr stolz aufgebläht, sondern nur ein wild flatterndes Tuch, das den Korb nur mäßig davon abhält in wenigen Minuten auf der harten Erde aufzuschlagen.
zünden. Gelingt das nicht binnen der nächsten 3000 Meter, bleibt nur der Fallschirm für die eigene Rettung. Aber das bringt den Ballonfahrer nicht aus der Ruhe. Der heißt Josef „Joschi“ Starkbaum und ist der wohl weltweit beste Ballonfahrer aller Zeiten.
Joschi führte öfter Rekordfahrten durch, und zwar erfolgreich. Im Jahr 1983 stellte er einen Höhenrekord mit 13 670 Metern auf ohne Druckanzug und ohne Druckkabine.
Starkbaum nahm zudem erfolgreich an zahlreichen Wettfahrten teil. Er hält den Rekord, siebenmal den GordonBennett-Cup gewonnen zu haben: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 und 1993. Bei diesem Rennen geht es nur um eines: Wer kommt mit einem Gasballon am weitesten, egal wie. Damit ist der GordonBennett-Cup einer der härtesten Wettbewerbe, die jemals erdacht wurden.
Und so ergab es sich bei einem dieser Rennen, während alle Mitbewerber ihre Ballons bereits wieder eingepackt hatten und längst beim Abendessen saßen, daß Joschi gerade die Küste der Adria erreichte und in einem Ballon nachts Kurs auf‘s offene Meer nahm. Joschis Vorsprung wurde dann auch einmal in Tagen gemessen. 1988 und 1990 gewann Josef Starkbaum zudem die Ballonweltmeisterschaft. Sollte das Wetter mal nicht so geeignet für Ballonfahrten sein, so bestritt Joschi, der nachweislich über einen ungewöhnlich hohen Intelligenzquotienten verfügte, Motorrad- oder Autorennen.
Am ersten Februarsamstag erlebten Deutsche und Tschechen im prunkvollen Saal des Kulturhauses Beseda in Pilsen eine rauschende Ballnacht: den 13. Deutsch-Tschechischen Repräsentations- und Kulturball.

Neben Prominenz aus Politik und Wirtschaft genossen viele Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Medienleute und Tanzbegeisterte aus beiden Ländern Musik und Programm des DeutschTschechischen Repräsentationsund Kulturballs, den die Agentur Excellent Pilsen in Kooperation mit dem Centrum Bavaria Bohe-
Links weht die Sudeten-Flagge vor der Heimatstube, oben steht das Anton-Günther-Denkmal und rechts ragt das Vertriebenendenkmal in die Höhe. Bilder (3): Steffen Hörtler
mia (CeBB) zum 13. Mal veranstaltete. Glanzvoll war der Rahmen auch in diesem Jahr. Naht-
los knüpfte der Pilsener Ball nach zwei Jahren Corona-Pause an das 2007 erstmals auf dem Pilsner Parkett in Szene gesetzte grenzüberschreitende Ereignis an. Der Ball ist fast ein gesellschaftliches Muß, bei dem sich freundschaftlich verbundene Tschechen und Deutsche in der Metropole Westböhmens ein Stelldichein geben. Das taten sie nicht nur tanzend im imposanten Tanzsaal,
sondern auch am Rand des Geschehens im Foyer, an der Bar oder am Buffet. Die Schirmherrschaft lag in den Händen des Tschechischen Kulturministers Martin Baxa. Er ist dem CeBB seit der Eröffnung im Jahr 2006 zuerst als Regionsrat für Kultur, dann als Pilsner Oberbürgermei-

Dennoch bleibt der Mann im Korb gelassen. Mit kaum veränderter Atemfrequenz sichert er seinen Fallschirm und kratzt das Eis vom Glas des Höhenmessers. 10 000 Meter freier Fall, nur mäßig gebremst, dann hätte der Mann eine Chance, in geringeren Höhen den Brenner wieder zu




Ausgestattet mit diesem Talent, war es Joschi auch auf der geschilderten Rekord-Ballonfahrt gelungen, rechtzeitig, wenn auch spät, den Brenner zu zünden und den Ballon sanft abzubremsen. Der Rekord bei dieser Fahrt 1988 betrug 15 360 Meter. Joschi Starkbaum prahlte nicht mit seinen Erfolgen. Doch wer das Glück hatte, die Geschichten seiner Abenteuer von ihm erzählt bekommen zu haben, der war begeistert, beeindruckt und durfte staunen. Wer noch mehr Glück hatte und mit ihm vielleicht ein Abenteuer miterlebte, der wird den bestechend einfachen Zugang zu komplexen Zusammenhängen und den Humor, wie man damit letztlich umgehen kann, ebenso wenig vergessen wie manch eines seiner treffenden Statements.
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 25. Januar um 11.00 Uhr auf dem Städtischen Friedhof in Sankt Pölten statt.



ster und jetzt als Minister sehr freundschaftlich verbunden.
Der abwechslungsreiche Ball mit Musik des Tanzorchesters Miroslav Novotny, mit Showtanzauftritten und großer Tombola war ganz nach dem Geschmack der Oberpfälzer Gäste von Bavaria Bohemia, dem Trägerverein des Centrums Bavaria Bohemia. Unter ihnen waren die Zweite Vorsitzende Irene Träxler und Richard Brunner, langjähri-
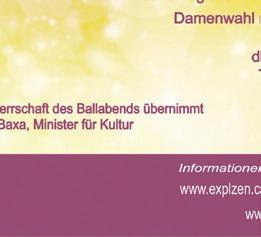



ges Vorstandsmitglied von Bavaria Bohemia. Regens Vizelandrat Helmut Plenk und Geschäftsführerin Judith Weinberger-Singh hatten den Ball im Namen der Arberland REGio eröffnet und die rund 500 Gäste aus beiden Ländern begrüßt.

Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de




❯ Hoch Dobern/Kreis Tetschen-Bodenbach





Auf der Walz oder Die hohe Schule des Handwerks
Inspiriert von Rudolf Heiders Artikel „Auf der Walz“ (➞ Zuckmantler Heimatbrief 3/2023), erinnere ich an einen Wandergesellen aus meiner Familie.
Der Wandergeselle in der Ahnenreihe unserer Familie hieß Florian Ignaz Ritschel, kam am 26. April 1826 in Hoch Dobern im Kreis Tetschen-Bodenbach zur Welt, durchlief diese hohe Schule des Handwerks und brachte es zum Gründer der Horn- und SteinnußFabriken in Hoch Dobern und Franzenthal. Die Firmengründung fiel in die Zeit der Industrialisierung. Die hatte in Großbritannien begonnen, erfaßte ganz Europa und wurde auch in den böhmischen Ländern von mutigen Männern mit Unternehmergeist genutzt.
Florian Ritschel hatte das Töpferhandwerk erlernt. Nach seiner Gesellenprüfung ging er 1843 auf die Walz oder Wanderschaft. Ausgestattet wurde er mit einem Wanderbuch, ausgestellt am 18. Juni 1843, in dem seine persönlichen Daten festgehalten waren und mit dem er sich überall ausweisen konnte. Außerdem erhielt er die typische Kleidung. Sie bestand aus einem spitzen Hut, einem Frack, Strumpfhosen und einem Felleisen. Das ist ein spezieller lederner Rucksack für Gesellen auf Wanderschaft.


Über familiäre Umwege und trotz der Wirren der Vertreibung, bei der Familien in alle Winde zerstreut wurden, besitzen wir sein Wanderbuch. Das ist ein historisches Kleinod. Anhand des Wanderbuches lassen sich die Stationen seiner Wanderschaft exakt nachvollziehen.
Folgende Orte sind aufgeführt: Leitmeritz, Prag, Iglau, Znaim, Korneuburg, Wien, Stockerau, Linz, über den Semmering nach Graz, Sloweniens Hauptstadt Laibach, Klagenfurt, Salzburg, Gmunden, Wels, Eger und Karlsbad.
Das Wanderbuch ist deutsch und tschechisch verfaßt. Die ausstellende Behörde ist Josef Mathias Graf Thun Hohenstein, der Name der Behörde lautet Amt, der Wohnsitz ist Bensen im Kreis Leitmeritz im Land Böhmen. Diesen Angaben folgen die oben genannten Stationen mit den jeweiligen amtlichen Eintragungen. Im Mai 1844 kehrte er zurück.
In seinen Erinnerungen schreibt er, die angeschlagene Gesundheit seiner Kindheitstage sei wie weggeblasen gewesen, die Wanderschaft in der frischen Luft mit all den körperlichen Herausforderungen habe ihm eine gute Kondition beschert. So gestählt wandte er sich einem anderen Handwerk zu. Bei einem Vetter hatte er gelernt, Hornknöpfe herzustellen.
Als dieser seinen Betrieb aufgab, um nach Amerika auszuwandern, übernahm
er den Betrieb mit all den Gerätschaften. Er kaufte in der Umgebung sämtliche Klauen auf, diese wurden ausgekocht und daraus Hornknöpfe gefertigt.
Die waren damals sehr begehrte Artikel, denn Plastik hatte man noch nicht erfunden. Von der Bezirkshauptmannschaft in Bensen erhielt er 1854 folgende behördliche Bewilligung:

„Die Erzeugung gepreßter Hornknöpfe und der Verkauf derselben durch Florian Ritschel in Dobern unterliegt keinem Anstande, wenn derselbe für diese Beschäftigung den Erwerbssteuerschein löset und zu Berufe bei dem k. u. k. Steueramte in Bensen sich meldet. Zugleich wird derselbe aufgefordert, einen Beitrag für den Armenfonds beim Bürgermeisteramt zu erlegen.“
Der Absatz florierte, und die Fertigungsstätte wurde zu eng. Ritschel errichtete neue Gebäude und investierte in neue Maschinen. 1856 besuchte er zum ersten Mal die Leipziger Messe, und zwar zu Fuß mit Hornknöpfen im Rucksack. Das nächste Mal fuhr er mit einem Hundegespann, dann zu Pferd und schließlich mit der Bahn. So besuchte er alle Jahre die Messen in Leipzig und später in Frankfurt am Main. Diese Besuche waren erfolgreich, und er wurde die Waren reißend los. Zur Produktion der Horn- kam nun die der Steinnußknöpfe hinzu. Zum Kundenkreis gehörten die Monturdepots der k. u. k. Armee und später das Schweizer und türkische Militär. Daß das Unternehmen solch eine Prosperität erfuhr, war in erster Linie Ritschels Unternehmergeist, seinem Wagemut und seinem Fleiß zu verdanken, aber auch seinen tüchtigen Arbeitern und Angestellten, für die er eine glückliche Hand hatte. Für seine Neubauten heuerte er italienische Ar-

beiter an, baute für sie und ihre Familien kleine Wohnhäuser. Als die neuen Fabrikgebäude fertig waren, schulte er diese Arbeiter auf die Knopfproduktion um. So sicherte er sich eine treue Belegschaft.
1860 war er ein wohlhabender Mann, aber unverheiratet. Da die Fabrik nicht mehr seinen vollen Einsatz erforderte, beschloß er, sich nach einer Frau umzusehen, um eine Familie zu gründen. Seine Wahl fiel auf die 18jährige Tochter des reichen Korn-Bauern. Damit mehrte sich der Besitz noch um landwirtschaftliche Latifundien. Aus der Ehe gingen 15 Kinder hervor, von denen drei Söhne und sechs Töchter überlebten.

Als Florian Ritschel am 4. April 1916 wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag starb, hinterließ er seinen Nachkommen ein beträchtliches Vermögen und ein florierendes Unternehmen. Seinen ältesten Sohn Emil, der als Erbe der Fabrik auserkoren und zum Studium nach Prag entsandt worden war, enterbte er auf der Stelle, nachdem er erfahren hatte, daß Emil sein Studium nie angetreten hatte. Nun erbte der zweitälteste Sohn Alfred die Fabrik, die 1929 75jähriges Bestehen feierte. Man blickte voller Stolz auf die Jahrzehnte des Erfolges zurück, nicht zuletzt dank eines treuen Stammes von Mitarbeitern. Viele waren seit drei Generationen im Unternehmen.
Der dritte Sohn Wenzel erbte die 80 Hektar umfassenden landwirtschaftlichen Betriebe. Auch Wenzel war ein begnadeter Unternehmer. Er mehrte
❯ Starkenbach im Riesengebirge
Graf verdrängt
Rübezahl
Die rund sechs Meter hohe Eisskulptur von Graf Johann Nepomuk Harrach dominiert seit kurzem den Marktplatz in Starkenbach.
Im Winter ziert für gewöhnlich eine Rübezahl-Eisskulptur das Zentrum der Stadt, die als westliches Tor ins Riesengebirge bekannt ist. Doch heuer entschied sich die Stadt für den Grafen Harrach. Der Starkenbacher Künstler Josef Dufek modellierte die Skulptur mit seinen Helfern binnen drei Tagen. „Es war eine schreckliche Arbeit. Diesmal haben wir die Skulptur nicht aus Schnee geschaffen, sondern aus steinharten Eis. Mein ganzer Körper tut mir jetzt noch weh“, sagte er. Strenger Frost von minus 17 Grad begleitete seine Arbeit, so daß Eismetze ihre Schaufeln und ihr übliches Schneewerkzeug gegen schwere Kettensägen eintauschen mußten. Der Herrscher des Riesengebirges, Rübezahl, wurde anläßlich des Harrachjahres von Johann Harrach, einst Besitzer des Schlosses Starkenbach, ersetzt. Dieses Jahr wurde von den Denkmalschützern im Rahmen des 13. Jahrgangs des Projekts „Auf den Spuren der Adelsgeschlechter“ zum Harrachjahr ausgerufen. „Die Harrachs haben in Starkenbach tiefe Spuren hinterlassen, deshalb paßt es und ist witzig, daran zu erinnern“, sagte Bürgermeister David Hlaváč. Laut Dufek sind aber die konservativen Anwohner der Gebirgsstadt von der neuen Winterdominante des Markplatzes nicht so begeistert. „Rübezhal ist halt Rübezahl“, hätten ihm schon mehrere Leute via Sozialen Medien geschrieben.

Als Vorlage diente ein Foto aus dem Museum in Starkenbach. Dufeks EisHarrach sitzt auf einem Stuhl und hat das Stammwappen vor sich liegen. Das fertige Werk begoß die Feuerwehr mit Wasser, und der Frost härtete die Skulptur aus. „Ein paar wilde Kinder werden
ihm sicherlich nicht schaden“, meinte Dufek.
Bereits seit mehr als 100 Jahren gehören die riesigen Schneeskulpturen zu Starkenbach. Meistens handelt es sich um Rübezahl. Allein von Dufek stammen mindestens 25 Skulpturen. Zumindest einmal stand bereits eine andere Gestalt auf dem Marktplatz, nämlich die von Jan Buchar (1859–1932), einem Pionier des Wander- und Skisports. Seit 1701 besaßen die Harrachs die Stadt und die Grundherrschaft Starkenbach. Johann Nepomuk Graf von Harrach lebte 1828 bis 1909. Er kam in Wien zur Welt, hatte aber zum Riesengebirge eine enge Beziehung. Er setzte sich für die Bevölkerung des Riesengebirges ein. Diese konnte den Reichtum der Wälder für den eigenen Bedarf nutzen. Ihm gelang auch, die Riesengebirgsstraße und den Eisenbahnverkehr zu realisieren. Das Riesengebirge war damals ein armes Gebiet, deswegen half ihm der Tourismus, der dort dank des Grafen zu erblühen begann. Seine Liebe zur und seine Erfurcht vor der Bergwelt zeigten sich daran, daß er 1904 auf 60 Hektar das erste Naturreservat anlegte. Er gründete auch Brauereien und ließ 1892 die ersten Skier ins Riesengebirge bringen, wodurch Starkenbach zur Wiege des tschechischen Skisports wurde. Bereits seit 1894 wird hier der Skisport durch den Böhmischen Riesengebirgsverein SKI, den ältesten eigenständigen Skiverein in den böhmischen Ländern organisiert. Er trug beträchtlich zum Aufbau des Nationaltheaters in Prag bei und zum Aufschwung des heutigen Prager Nationalmuseums. Heuer jähren sich mehrere wichtige Ereignisse der Harracher. Vor 400 Jahren bestieg Ernst Adalbert von Harrach den Stuhl des Erzbischofs von Prag, und ebenfalls vor 400 Jahren heiratete Isabella Katharina von Harrach Albrecht von Wallenstein. Petra Laurin
sein Vermögen mit dem Kauf von Beteiligungen wie an einer Glashütte, an der örtlichen Raiffeisenbank oder an einem Omnibus-Unternehmen.
❯ Rumburg

D





ie Steinnuß ist der Samen der Steinnußpalmen. Die Palmen wachsen vor allem in Ecuador. Der Blütenstand der männlichen Pflanze ist ein fleischiger Kolben mit dichten Blüten, die betäubend riechen. Die weiblichen Pflanzen produzieren jährlich 20 kopfgroße, krustige, holzige und bedornte Fruchtballen, die am Stamm hängen und wegen ihrer Härte nur mit der Axt oder Machete geerntet werden. Sie sind in Kammern gegliedert und enthalten in Fruchtfleisch eingebettete Samen bis zur Größe eines Hühnereis.
Die Nüsse sind weich und enthalten eine Flüssigkeit. Die zur Verarbeitung ausgewählten Nüsse werden mehrere Monate an der Sonne getrocknet. Dabei werden sie so hart wie Knochen. Unter der braunschwarzen Haut erscheint ein elfenbeinfarbenes Material, das sich sägen, fräsen, drechseln, schnitzen, polieren und färben läßt. Es blättert nicht und ist unempfindlich gegenüber Stoß und Abrieb. Sonnenlicht läßt es nachdunkeln. Durch Erhitzung im Feuer kann der Oberfläche ein hellbrauner Farbton gegeben werden.

Der enterbte Sohn Emil ließ sich in Wien nieder. Dort machte er bei der österreichischen Bundesbahn Karriere und führte ein geruhsames Leben. So entging er der Vertreibung und Enteignung. Die Töchter wurden mit einer guten Aussteuer und Geld bedacht, wovon jede ein Haus bauen konnte.
Soweit die Kurzfassung über eine Karriere, die als Handwerksbursche auf der Walz begann und als erfolgreicher Unternehmer endete. 1945 war mit der Vertreibung der Deutschen das erarbeitete Vermögen für die Nachkommen für immer verloren und der Niedergang der industriellen Mittelschicht des Sudetenlandes besiegelt. Sieglinde Vendolsky
Stadt plant weitere Radare
Die Stadt Rumburg beantragte erneut eine Genehmigung für Standorte, an denen die Polizei mit einem mobilen Radar die Geschwindigkeit der Autos messen kann.
Seit vorigem Jahr blitzen bereits an mehreren Stellen Geschwindigkeitsmesser. Die Behörden genehmigten damals aber nicht alle Stellen, an denen nach Meinung von Stadt und Polizei die Fahrer gebremst werden
sollten. „Das alles machen wir, um die Sicherheit an den Straßen zu gewährleisten“, erklärte Bürgermeister Lumír Kus die Lage. Die Messungen zeigten die ersten Früchte. Im ersten Halbjahr 2021 wurde durchschnittlich bei jeder zwölften Messung eine Geschwindigkeitsübertretung festgestellt. Im ersten Halbjahr 2022 registrierten die Radare bereits eine Verbesserung, nur jede 20. Messung registrierte eine zu hohe Geschwindigkeit. Petra Laurin
Schon oft machte Heimatkreisbetreuerin Christa Schlör Ferien in der Heimat ihrer Vorfahren und besuchte die Gegend um Reichenberg. Nun berichtet sie von den Orten, in denen sie war.
Philippsgrund
Philippsgrund, im Volksmund der Hemmrich, ist ein Ortsteil der Gemeinde Buschullersdorf. Es entstand im 18. Jahrhundert im Tal unterhalb des Hemmrichs. Benannt wurde das zur Herrschaft Friedland gehörige Dorf nach Philipp Josef von Gallas, dem letzten Grafen von Gallas. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften wurde Philippsgrund 1850 nach Buschullersdorf im Bezirk Friedland eingemeindet. 1875 wurde der Eisenbahnbau von Reichenberg nach Seidenberg vollendet und in Philippsgrund die Bahnstation Buschullersdorf errichtet. 1920 wurde das Dorf in den Bezirk Reichenberg umgegliedert. Touristisch erwähnt wird das seit 1999 geschützte Buchenwaldgebiet, hier mit dem Gipfel des Spitzbergs.
Buschullersdorf
Die Besiedlung des oberen Görsbachtales erfolgte im 14. Jahrhundert. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Holzfällersiedlung Ulrichsdorf 1381 im Urbar der Herrschaft Friedland. Man nimmt an, daß das Dorf nach dem Besitzer der Herrschaft, Ulrich von Bieberstein, benannt wurde. Die ersten Siedler stammten aus Kratzau und Schönborn. In der Berní rula – ein 1654 erstelltes Untertanenverzeichnis für Böhmen – ist der Ort als Wes Ulesdorf verzeichnet. Später erhielt das Dorf zur Unterscheidung von gleichnamigen Ortschaften den Namen Buschullersdorf, der seit der Errichtung der Pfarrei in Einsiedel nachweisbar ist. Nach der Aufhebung der Erbuntertänigkeit bildete Buschullersdorf mit Philippsgrund ab 1850 eine politische Gemeinde im Gerichtsbezirk Friedland.
Einsiedel
Ehedem waren nur wenige Gewerbe auf den Isergebirgsdörfern zu finden. Zu den ältesten Gewerbszweigen gehören die Leinweberei und die Tuchmacherei. Letztere wurde vereinzelt bis in die jüngere Zeit betrieben. Von den Bedarfsgewerben haben sich zuerst das Mühlen- und Schmiedegewerbe eingebürgert.
Die Ausübung eines Handwerks oder Gewerbes war früher an die obrigkeitliche Genehmigung gebunden.
Die 1848 erfolgte Aufhebung des Untertänigkeitsverhältnisses machte auch den Gewerbestand frei, unabhängig von der Grundherrschaft. Das letzte Opfer, die Ablösung der Lasten, wurde gern gebracht. Die Gewerbefreiheit zeitigte ein rascheres Aufblühen und eine Vermehrung der einzelnen Gewerbezweige.
Zu den Sehenswürdigkeiten von Einsiedel zählt die barocke Kirche Sankt Nikolaus. Sie wurde 1739 bis 1740 nach Plänen von Johann Fugenauer aus Neustadt

Über Berge und durch Täler
an der Tafelfichte erbaut. 1774 wurde der Kirchturm vollendet. Das erwähnenswerte Pfarrhaus wurde 1767 erbaut. Die Statue des heiligen Johannes von Nepomuk stammt aus dem Jahre 1861. Die Eisenbahn war der mächtigste Bahnbrecher der Kultur. Im Juni 1875 war der Ausbau der Südnorddeutschen Verbindungsbahn von Reichenberg über Friedland bis an die Landesgrenze bei TschernhausenSeidenberg fertig. Die Südnorddeutsche Verbindungsbahn, die 1908 verstaatlicht wurde, weist in Einsiedel seit ihrem Bestand eine Station (Nr. 192) auf. 1924 erhielt die Bahnstation den Namen Mníšek u Liberce.


Voigtsbach
Die zur Herrschaft Reichenberg gehörige Ansiedlung Voigtsbach wurde 1559 erstmals im Reichenberger Stadtbuch erwähnt. Der Ort lag im Grenzbereich zur Herrschaft Friedland, die die umliegenden Wälder besaß. Voigtsbach war Sitz eines herrschaftlichen Vogts. Der Vogtshof war das heutige Anwesen Nr. 11. Besitzer waren die Herren von Redern. Ab 1700 erfolgte in einem Privathaus in Einsiedel der Schulunterricht. Gepfarrt war das Dorf zur Kirche Sankt Nikolaus in Einsiedel. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaft bildete Voigtsbach ab 1850 mit den Ansiedlungen Bethlehem und Hasengrund eine politische Gemeinde im Bezirk Reichenberg. Nach einer zwischen 1846 und 1888 aufgetretenen Serie verheerender Hochwasser im Isergebirge erfolgte 1904 bis 1906 unterhalb des Dorfes der Bau einer kleinen Talsperre am Voigtsbach.
Mühlscheibe
An der Grenze zwischen Einsiedel und Neundorf wurde zwischen 1904 und 1906 nach Plänen von Otto Intze die Talsperre Mühlscheibe gebaut. Die Talsperre wurde wie die in Voigtsbach und viele andere nach der Serie katastrophaler Hochwasser in den Jahren 1846 bis 1888 gebaut. Das Ziel war, das Gebiet vor Hochwasser zu schützen und den Wasserdurchfluß während der trockenen Monate zu verbessern.
Neundorf
Der Ort wurde 1464 erstmals als Nywensdorf erwähnt. Damalige Besitzer waren die Biebersteiner. Der nächste Besitzer Heinrich von Kyaw ließ im Ort ein Schlößchen errichten, das zum Herrschaftssitz wurde. Nach
mehreren Besitzerwechseln verkaufte Johann Joachim Pachta von Rayowa Neundorf 1712 an Wenzel Graf Gallas, der die Herrschaft Neundorf an seinen Besitz in Reichenberg anschloß. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war Neundorf eine Gemeinde im Gerichtsbezirk Kratzau beziehungsweise Bezirk Reichenberg. Die ehemals protestantische Kirche wurde 1616 von Gräfin Katharina von Redern gestiftet. Als Neundorf wieder katholisch wurde, fand die Weihe der Kirche zu Ehren Mariä Himmelfahrt statt. 1782 wurde das Gotteshaus umgebaut.
Neudörfel
Das Dorf wurde im 16. Jahrhundert auf den Fluren des
Gutes Neundorf gegründet. 1690 bestand das Dorf aus 20 Anwesen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts blieb Neudörfel der Allodialherrschaft Reichenberg untertänig. Nach der Aufhebung der Grundherrschaften wurde Neudörfel 1850 ein Ortsteil von Neundorf. Seit 1924 wurde auch der tschechische Ortsname Nová Víska verwendet.
Hoheneck
Die eine Viertelstunde westlich von Neundorf an einem Bächlein gelegene Ortschaft Hoheneck hat ihren Namen von dem Hohen Vorwerk auf der Hohen Ecke, einer Grundbezeichnung, die schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auftritt. Das auf dem Hohenekker Berg stehende Vorwerk war jedenfalls das erste Gebäude der nachmaligen Ortschaft. Am 20. September 1586 starb Christoph von Hohberg und Kunnersdorf auf der Hoheneck. Sein in die Mauer des Kratzauer Pfarrhauses eingemauerter Grabstein zeigt eine ganze Ritterfigur.
1832 bestand Hoheneck, auch Saugraben genannt, aus 45 Häusern mit 320 deutschsprachigen Einwohnern. Am Görsbach arbeiteten eine Mühle sowie die Baumwollspinnerei und Kattunweberei von Gottlob Meusel. Pfarrort war Neundorf. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Hoheneck ab 1850 einen Ortsteil der Gemeinde Neundorf. Seit den 1870er Jahren wurde Hoheneck als amtlicher Ortsname verwendet.
Christophsgrund
Christophsgrund liegt idyllisch im Tal des Eckersbachs. Die vielen Umgebindehäuser sind noch in ihrer typischen Bauweise erhalten geblieben. Die Gemeinde war eine alte Köhler- und Schmugglersiedlung, die laut Legende der Köhler namens Christophorus im 15. Jahrhundert gründete. An einigen Stellen sieht man noch heute Spuren des Bergbaus.
Neben der schönen Natur lockt die Gemeinde mit ihren historischen Denkmalen wie der Kirche, dem hölzernem Glokkenturm und der Statue des heiligen Johannes von Nepomuk auf der Steinbrücke über den Eckersbach. Das wertvollste Denkmal ist die dem heiligen Christoph geweihte frühbarocke Holzkirche. Michael Schöbel, ein Zimmerermeister aus Seifersdorf, baute die Kirche mit seinen vier Helfern 1683 bis 1684. Sie ist eine der wenigen mit Schiefer gedeckten Schurzholzbauten. Die Wände sowie die Decke tragen 15 Bilder aus Christi Leben.

An die Ortschaft Christophsgrund knüpft die Siedlung Neuland an, die sich vom mächtigen Eisenbahnviadukt hoch hinauf bis unterhalb des Jeschken zieht. Der 30 Meter hohe und über 14 Pfeiler führende Viadukt mit einer Länge von 198 Metern ist ein technisches Denkmal.
Jeschken
Der Jeschken ist Reichenbergs Hausberg. Das Bauwerk auf seinem Gipfel ist zur Dominante der Region geworden. Die ehemaligen deutschen Reichenberger nennen ihn liebevoll „Vater Jeschken“.
1876 wurde der erste fünf Meter hohe Holzaussichtsturm ge-

baut. 1889 ersetzte ihn ein weiterer hölzerner Aussichtsturm, der jedoch 1902 wegen seines schlechten Zustands abgerissen werden mußte. Fünf Jahre später wurde auf dem Gipfel ein Berghotel gebaut, das der Architekt Ernst Schäfer entworfen hatte. Das Hotel brannte 1963 ab. 1966 bis 1973 entstand der futuristische 99,86 Meter hohe Fernsehturm nach den Plänen des Architekten Karel Hubáček. Dieser wurde dafür mit dem Auguste-Perret-Preis der Union Internationale des Architectes ausgezeichnet, und der Turm erhielt auch den Titel Bauwerk des Jahrhunderts.
Zum Gipfel führt eine Kabinenseilbahn. Im Erdgeschoß des Turms ist eine gedeckte Aussichtsplattform. Eine schöne Aussicht bieten auch Restaurant und Café im oberen Stockwerk.
 Alt Harzdorf
Alt Harzdorf
Altharzdorf ist heute ein Ortsteil von Reichenberg. Er liegt östlich der Stadt in einem Tal zwischen den Ausläufern des Isergebirges und dem Proschwitzer Kamm. Das Dorf wurde 1540 erstmals urkundlich erwähnt. Die ersten Siedler kamen in eine unwirtliche Gegend, die teilweise mit Urwald bedeckt war. Grundherr Rulko von Bieberstein ließ von Lokatoren Siedler anwerben, denen Grund und Boden gegen Entgelt überlassen wurde. Die ersten Siedler waren Köhler, Harzkratzer und Bauern. Neben Zimmerleuten waren zunächst Strumpfwirker ansässig. Die Strumpfwirkerei erlebte Ende des 18. Jahrhunderts eine Blüte, die ein Börsenkrach in Wien beendete. Auch Industrie ließ sich hier nieder, denn Wasserkraft war reichlich vorhanden. Nach starken Regenfällen und Wolkenbrüchen brachen mehrmals verheerende Hochwasser über das Tal herein, die schließlich eine Talsperre notwendig machte. Diese wurde 1902 bis 1904 zwischen Alt Harzdorf und Reichenberg unter Leitung von Otto Adolf Ludwig Intze gebaut. Radl
Die Gemeinde liegt nordwestlich von Reichenau bei Gablonz über dem Tal der Mohelka im Jeschkengebirge. Die erste urkundliche Erwähnung datiert 1419. Damals verkaufte das Kloster in Münchengrätz die Pfarrei Reichenau mit der Gemeinde Radl an Heinrich von Waldstein. Die ursprünglich tschechische Gemeinde erhielt durch Zuwanderung und Assimilation vermutlich ab dem 18. Jahrhundert eine deutsche Bevölkerungsmehrheit. Bei der Volkszählung 1930 waren von 1737 Einwohnern 61 Tschechen. Sie lebten vornehmlich von Land- und Viehwirtschaft. Im 19. Jahrhundert entstanden einige kleinere Industriebetriebe, die vornehmlich Textilien und Schmuck herstellten. Radl war ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Gemeinde im Gerichtsbezirk Gablonz. An der Stelle der heutigen Kirche der Heiligsten Dreifaltigkeit stand ursprünglich eine aus den Jahren 1725 bis 1776 stammende Kapelle.


für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau
Dux OsseggBilin Teplitz-Schönau








Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

❯ Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg

Holocaust-Gedenken in der Lindenstraße
Die Sudetendeutsche Hütte liegt in der Granatspitzgruppe südlich des Felbertauerntunnels zwischen Matrei in Osttirol und Kals am Großglockner.
❯ Der Teplitz-Schönauer Karl Jirsch
Opfer einer Alpenkatastrophe
Jutta Benešová berichtet über die Ahnenforschung der Familie Jirsch aus Teplitz.
Wenige Tage nachdem mein Artikel über den bekannten Teplitzer Architekten Gustav Adolf Jirsch (➝ HR 11/2022)

erschienen war, bekam ich eine Anfrage von unserem Leser Klaus Svojanovsky. Als ehemaliger Vorsitzender der Sektion Sudeten des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist er eng mit der Geschichte der 1929 in der Granatspitzgruppe in Osttirol eröffneten Sudetendeutschen Hütte verbunden. Svojanovsky berichtet, daß es in der Nähe dieser Hütte einen Bergwanderweg gebe, der den Namen „Dr. Karl Jirsch“ trage. „Der von mir genannte Dr. Karl Jirsch, der Namensgeber des Weges von der Felbertauernstraße hinauf zur Sudetendeutschen Hütte, muß sich beim Hüttenbau oder kurz danach seine Verdienste erworben haben, also in der 1920er und/oder 1930er Jahren. Wenn Sie mir also etwas über die Familie des Gustav Jirsch sagen könnten, wäre ich sehr dankbar.“
steigerverein Lokomotive Teplice finden: Karl Jirsch kam am 28. Januar 1876 in Budapest zur Welt, was der Wirkungsstätte von Wenzel Jirsch entsprechen würde und ihn zum potentiellen Vater von Karl als jüngerem Bruder von Gustav Adolf werden läßt. Leider ist eine Einsichtnahme in die Geburtsurkunde in Budapest kaum möglich. Zumindest aber gab es eine enge verwandtschaftliche Beziehung, denn Karl Jirsch ist bei der Todesanzeige von dem jung verstorbenen Gustav Adolf als enges Familienmitglied genannt. Warum wird ihm aber nun ein Wanderweg in den Alpen gewid-
nach Sankt Christina, etwa 20 Kilometer von Brixen entfernt, gebracht wurden.“ Hinzugefügt wurde, daß Karl Jirsch der Direktor der Nordböhmischen Kohlenhandels-AG gewesen und ob seiner fachlichen Fähigkeiten in Berufskreisen außerordentlich geschätzt worden sei. Über seinen Weggefährten wird berichtet, daß Lindemann seit 24 Jahren im Büro des Ingenieurs Max Stange in Teplitz-Schönau tätig gewesen sei.
schaft zu, daß er sich nicht wohl fühle. Er wurde aufgefordert, das Felsband zurückzugehen, wohin ihm die anderen folgen wollten. Er erklärte sich hierzu außerstande. Darauf rief Dr. Jirsch dem Herrn im Felsen zu, Herrn Lindemann das gut gesicherte Seil zuzuwerfen. Herr Lindemann ergriff das Seil, und die Gefahr schien abgewendet. In diesem Augenblick ließ Herr Lindemann das Seil los und stürzte ungefähr 50 Meter ab.
Das Holocaust-Denkmal in der Lindenstraße in Teplitz-Schönau wurde 1995 errichtet und erinnert an die Zerstörung der Teplitzer Synagoge, die im März 1938 in der Kristallnacht niederbrannte. Das Denkmal erinnert gleichzeitig an die Opfer des Nationalsozialismus. Alljährlich findet hier eine Gedenkfeier statt. In diesem Jahr wurde dabei auch an die Befreiung des Konzentrationslagers AuschwitzBirkenau vor 74. Jahren erinnert. Jutta Benešová berichtet.


Dank-Anzeige in den „Teplitz-Schönauer Nachrichten“ vom 10. April 1909 für Anteilnahme am Tod von Gustav Adolf Jirsch.
Zunächst wandte ich mich an das Schloßmuseum in Teplitz. Mein herzlicher Dank gilt der Historikerin Pavlina Boušková, die unter anderem die Geburtsurkunde von Gustav Adolf Jirsch fand. Dieser kam am 8. Juli 1871 in Teplitz in der Langengasse 31 als Sohn des Wenzel Jirsch, Inspektor der Staatsbahn in Temeswar und später Oberinspektor der österreichischen Staatsbahn in Budapest, und Agnes Johanna, geborene Siegmund, zur Welt. Gustav Adolf Jirsch heiratete 1899 Therese Niessl, deren Großvater der bekannte Teplitzer Bürgermeister Karl Stöhr (1833–1896) war. Kinder aus dieser Ehe sind nicht bekannt. Leider starb Gustav Adolf bereits 1909 im Alter von 38 Jahren an einem chronischen Leiden. Und nun zu dem „unbekannten“ Karl Jirsch. Auch hier konnte Boušková Informationen bei dem 1956 gegründeten Berg-

Natürlich erweckt diese Nachricht Interesse an dem unglücklichen Verlauf dieser Bergtour. Und auch hier hatte Boušková im „Teplitz-Schönauer Anzeiger“ Erfolg. Am 8. August 1937 titelte er: „Zum Bergtod der beiden Teplitzer Alpinisten – Zur Absturzkatastrophe des Bergrats Dr. Jirsch und Ing. Lindemann“. Ich zitiere leicht gekürzt: „Obwohl verschiedene Nachrichten über die Katastrophe nach Teplitz gelangten, konnten sie kein Bild des Unglücks geben, … da die einzigen Zeugen, ein Herr vom Teplitzer Alpenverein und seine Gattin, beide ausgezeichnete Alpinisten, noch von Teplitz abwesend sind.
Kondolenz-Anzeige in den „Teplitz-Schönauer Nachrichten“ vom 3. August 1937 zum Tod von Dr. Karl Jirsch.
met? Und hier wurde Boušková im „Teplitz-Schönauer Anzeiger“ fündig. Am 31. Juli 1937 erschien dieser kurze Artikel:

„Zwei Teplitzer Alpinisten in den Dolomiten tödlich abgestürzt! Die beiden Verunglückten, zwei gewiegte Alpinisten und bekannte Funktionäre des Teplitzer Alpenvereins – Dr. Jirsch war jahrelang Obmann und Dr. Lindemann Wegwart dieses Vereins – hatten eine Bergbesteigung im AmpezzoGebiet unternommen. Über den nähren Hergang des Unglücks ist hier bisher nichts Näheres bekannt geworden. Fest steht nur, daß die Leichen der zwei Bergsteiger bereits geborgen und
Die nachfolgenden Mitteilungen dürften indes den traurigen Vorfall in Umrissen so wiedergeben, wie er sich abspielte.
Nach gründlicher Vorbereitung einer Alpentour in den Dolomiten wurde nach bereits erfolgter erfolgreicher Besteigung von drei Gipfeln die Ersteigung des Langkofels im Grödener Tal in Angriff genommen. Alle vier befanden sich in ausgezeichneter Verfassung und waren in bester Stimmung. Am Donnerstag, den 29. Juli mittags kamen sie nach Überwindung der schwierigsten Stellen in ungefähr 3000 Metern Höhe auf ein Felsband. Das Ehepaar hatte dasselbe bereits überschritten und befand sich in sicherem Fels. Ebenso Herr Ing. Lindemann. Herr Dr. Jirsch stand am Ende des Bandes.
In dieser Situation rief Herr Ing. Lindemann der ersten Seil-
Nach Ansicht der Beteiligten konnte nichts anderes als ein Herzschlag eingetreten sein. Herr Dr. Jirsch, der Herrn Lindemann im Felsen nicht sehen konnte, glaubte wahrscheinlich, da es sich nur um Sekunden handelte, Herrn Lindemann gesichert und außer Gefahr.
Auch fehlte ihm am Felsband jede Möglichkeit einer Sicherung. Nur so ist es zu erklären, daß er von dem Abgestürzten mitgerissen wurde und von einem Felsen in eine Eisrinne 200 Meter tief tödlich abstürzte. Von Sankt Christina aus wurde eine aus neun erprobten Bergführern bestehende Bergungskolonne entsendet, der es in mühevoller Arbeit gelang, die beiden Abgestürzten am 31. Juli mittags nach Sankt Christina zu bergen. Nach dieser Schilderung ist nur ein ganz unvorhergesehener Zwischenfall, dem jeder Bergsteiger naturgemäß ausgesetzt ist, an der Katastrophe Schuld …

Herr Bergrat Dr. Jirsch wurde am 1. August [1937] auf dem Bergfriedhof von Sankt Christina – nach seinem Sinne in seinen geliebten Bergen – von Bergführern im Beisein seiner Angehörigen zur ewigen Ruhe gebettet.“ Auch eine Gedenktafel mit seinem Namen soll es an der Nussigscharte in den Hohen Tauern geben.



Über die Geschichte der Bergvereine in Böhmen und die Sudetendeutsche Hütte bietet das Internet Informationen einschließlich eines Berichts von Klaus Svojanovsky über „90 Jahre Sudetendeutsche Hütte“: https://www.alpenvereinschwaben.de/unsere-gruppen/ gruppen-stuttgart/sudeten/
Zu diesem Pietätsakt gekommen waren Michael Lichtenstein, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Teplitz, Danny Vaněk, Kantor (Chazan) des Bundes jüdischer Gemeinden in der Tschechischen Republik und Gottesdienstleiter in der Jerusalems- oder Jubiläumssynagoge in Prag, Karolina Žákovská, Vorsitzende des Aussiger Bezirksausschusses für nationale Minderheiten, Oberbürgermeister Jiří Štábl, Hynek Hanza, Mitglied des Senats des Tschechischen Parlaments, und Michal Kučera, Mitglied des Abgeordnetenhauses des Tschechischen Parlaments.


nen. Der Kinderchor der MusikGrundschule sang zum Abschluß der Feier jüdische Lieder. Es ist zur guten Tradition geworden, daß an diesen Feierlichkeiten auch Grundschulklassen und Studenten der Gewerbeschulen in Teplitz teilnehmen. Schließlich ist es wichtig, daß diese erschütternden Ereignisse der Vergangenheit im Bewußtsein der Jugend erhalten bleiben. Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust fällt auf den 27. Januar und wurde von den Vereinten Nationen in ihrer Vollversammlung 2005 am
Das Holocaust-Denkmal erinnert auch an die zerstörte Synagoge.
Vitali Makonda, Mitglied des Vorstands der Jüdischen Gemeinde Teplitz, sprach hebräisch das Gebet für die Verstorbe-

1. November 2005 ausgerufen. Die Tschechische Republik hatte diesen Tag bereits im Jahre 2000 zum besonderen Gedenktag erklärt und anschließend 2004 gesetzlich als Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und der Prävention von Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestimmt. Unter Teilnahme zahlreicher Teplitzer Bürger wurden nach den Ansprachen und dem Gebet feierlich Kränze und Blumen an dem Denkmal niedergelegt. Dabei wurden auch symbolisch Steinchen auf dem Gedenkstein abgelegt. Diese Feier in der Lindenstraße stand wie stets unter der sorgsamen Aufsicht der Stadt-Polizei von Teplitz.
Die Synagoge 1906.
 Ladowitz Klostergrab
Ladowitz Klostergrab
HEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ


Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Zeitzeugen
Der tschechische Verein Post Bellum und das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im oberpfälzischen Schönsee betreiben das deutsch-tschechische Schülerprojekt „Geschichten unserer Nachbarn“. Von Januar bis September hatte der zweite Jahrgang des Projekts stattgefunden. Karl Reitmeier berichtet.

❯ Gerti Schubert-Ubl: „Tief drin im Böhmerwald, Ronsperg, da liegt mein Heimatort“ – Teil II
Angespuckt und beschimpft

Ronspergs Ortsbetreuerin Gertrud Schubert/Ubl schrieb ihre Erinnerungen an Flucht und Neuanfang nieder und ließ sie als kleines Heft für ihre Familie und Landsleute drucken, das im Februar 2012 erschien. Der Heimatbote veröffentlicht mit ihrer freundlichen Genehmigung das Kapitel „Die Flucht“ in mehreren Folgen.
Mutter und ich fielen uns im Kohlenkeller unter dem Amtsgericht in die Arme und weinten bitterlich. So sahen wir uns nach Wochen zum ersten Mal wieder. Einerseits waren wir vereint, andererseits voller Sorge, wie es weitergehen wird. Der Gefängnisraum der Männer lag gegenüber. Bei meiner Einlieferung war zufällig mein Vater am Guckloch. Er sah mich, hatte aber keine Ahnung, was passiert war.
Der Kellerraum war sehr eng für die vielen Frauen. Und dann kam auch ich noch mit meinen 14 Jahren dazu. Wenigsten hatten wir Stroh auf dem Boden. Morgens wurde ich vom Wachposten in den oberen Stock in das Zimmer vom Kommissar geführt, wo ich immer wieder nach dem Brief gefragt und dann wieder in den Keller abgeführt wurde. Tagsüber arbeiteten die Frauen und Männer auf den Feldern, ich wurde von einem Wachposten im Ort zu Arbeiten geführt wie Wasserbrunnen putzen und andere Arbeiten, die ich vergessen habe.
Abends lagen wir alle müde auf unserem Stroh. Offen blieb ein kleines Fenster nach oben. Durch dieses kam einige Male abends ein kleines Päckchen geflogen. Anfangs waren wir alle sehr erschrocken. Mutige haben es geöffnet, und als etwas Eßbares darin war, legte sich zwar die Angst, doch der Verdacht, daß es vergiftet sein könnte, ließ uns fast verzweifeln. Wir hatten alle Hunger, und Wurst war für uns ein Fremdwort geworden.
Eine ehemalige Hausnachbarin faßte Mut und probierte zuerst, bevor ich essen durfte. Die Päckchen kamen erst durch das Fenster, nachdem ich eingesperrt worden war. So nahm man an, daß sie für mich bestimmt wa-
ren. Ich hatte mich freiwillig zum Küchendienst gemeldet, scheinbar war da ein Posten, dem ich leid tat, und er versuchte, mir wenigstens so etwas zu essen zu geben.
Eine Woche verbrachte ich in diesem Gefängnis, jeden Tag
Meine Freundin, die als Österreicherin immer noch in Deutschland bei uns war, versuchte beim Amerikaner, dies zu verhindern. Die Amerikaner waren immer noch bei uns, ließen aber die Tschechen schalten und walten. Die Freundin hatte Gehör gefun-
Aus Pilsen und Umgebung machten das Pilsener Gymnasium Luďka Pika, die Grundschule in Markt Eisenstein und das Gymnasium in Schüttenhofen mit. In der Oberpfalz schlossen sich die Doktor-Eisenbarth-Mittelschule Oberviechtach unter Konrektor Christian Schreiner und die Montessori-Schule Schönthal unter Lehrer Vladimír Foist an.


dem Gefangenenlager Chrastawitz wurde öfter genannt.
dasselbe Spiel: Verhör und dann wieder zurück in den Keller. Ich hatte ein reines Gewissen. Und dann endlich die Freilassung. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Die Frauen und Männer kamen eines Nachts, auf Laster verladen, von Ronsperg weg. Keiner wußte, wohin. Für uns Zurückgebliebene hatte sich der Kommissar etwas Besonderes einfallen lassen. Größtenteils die Kinder der Inhaftierten, aber auch andere Deutsche, erhielten den Befehl, sich am Bahnhof mit Essen für ein paar Tage und warmer Kleidung – im Sommer –zu einer bestimmten Zeit einzufinden. Die Angst, nach Sibirien abgeschoben zu werden, ließ uns nicht los.
den. Wir waren unter der Aufsicht von Kommissar Springer bereits alle am Bahnhof versammelt. Zum Glück hatte der Zug Verspätung, so daß Zeit zum Verhandeln war. Der Kommissar gab schließlich nach. Großmutter, bei der ich die ganze Zeit lebte, war glücklich, als ich wieder heim kam. Aber die Freude hielt nur ein paar Tage.
Wir erhielten vom Kommissar wieder den Befehl, uns am Bahnhof einzufinden, diesmal ohne Hinweis auf warme Kleidung. Und diesmal hatten wir keine Chance, die Reise ins Ungewisse anzutreten. Ungewiß war auch immer noch der Verbleib der Gefangenen, unserer Eltern. Man hatte zwar Vermutungen, Genaues wußte man nicht. Taus mit

Unser Abtransport von Ronsperg unter Bewachung von tschechischen Posten verlief programmgemäß. Irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo, hielt der Zug, wir stiegen aus und, von tschechischen Soldaten angeführt und bewacht, marschierten wir los. Wir kamen durch etliche tschechische Dörfer. Man konnte meinen, die Leute hätten schon auf uns gewartet. Es gab viele Steine, die für uns bestimmt waren, aber noch schlimmer war, die tschechische Spucke zu ertragen. Das war ekelerregend, und wir konnten und durften uns nicht wehren. Die Schimpfworte taten uns nicht weh, und so marschierten wir durch einige Dörfer, bis wir in Putzlitz/Puclice, unserem Arbeitsort, ankamen. Auch dort wurden wir erwartet. Am Dorfplatz wurden wir im Kreis aufgestellt und wie Vieh behandelt. Jeder Bauer konnte sich sein Opfer aussuchen. Ich landete auf einem größeren Bauernhof mit Bauer, Bäuerin, Sohn und Magd. Der Bauer sprach etwas Deutsch. Bei der tschechischen Magd im Zimmer, neben den Ställen, war meine Unterkunft. Schon eher wollte ich meine Freundin Herta erwähnen, wir kannten uns seit Kindertagen. Unsere Eltern waren eng befreundet. Auch sie war mit 17 Jahren dabei und stets bemüht, auf ihre kleine 14jährige Freundin aufzupassen. Auch ihre Eltern waren interniert. Sie wurde ebenfalls von einem Bauern ausgesucht.
So arbeiteten wir alle von morgens bis abends ohne Geld, nur fürs Essen, in der Landwirtschaft unter dem Zwang der über uns Herrschenden. Wir wußten nicht, wo unsere Eltern waren, und sie wußten nichts von uns. Eines Tages hieß es, die Kinder, deren Eltern inhaftiert seien, dürften sie besuchen. Wir zweifelten, wir glaubten nicht, daß das wahr werden würden. Das war unfaßbar für uns. Aber als wir dann wirklich nach Chrastawitz fahren konnten – wie, weiß ich nicht mehr –, waren wir einfach nur glücklich. Fortsetzung folgt
Die Aufgabe war, einen Zeitzeugen eines wichtigen Ereignisses des 20. Jahrhunderts zu finden, seine Geschichte anzuhören, sie festzuhalten und zum Schluß zu präsentieren. Im Frühjahr schulte Zuzana Verešová, die Koordinatorin für Bayern, die Lehrer. Sie führte in die Methodik ein und beschrieb die verschiedenen Phasen und den Zeitplan. Nach Absprache mit jeder Schule veranstaltete sie vor Ort mit den Lehrern Motivationsveranstaltungen für die Schüler. Auf dieser Grundlage wurden die Schülerteams gebildet. Zeitzeugen der oberpfälzischen Schulen waren Gertraud Zeitler, Günther Borutta, Miroslav Beneš und ich.
Gertraud Zeitler erinnerte sich an die zufällige Entstehung einer lebenslangen Freundschaft mit einer gewissen Frau Helena während des Bestehens des Eisernen Vorhangs, die durch den Fund eines Luftballons mit einer Adresse entstand. Miroslav Beneš sprach mit den Schülern über das Schicksal des Gedenksteins im Dorf Premirschen/Brnířov.
Günther Borutta, ein ehemaliger Grenzpolizist, erzählte den Schülern, wie er während des Kalten Krieges und trotz der Bedrohung seines Lebens versuchte, Kontakt zu Menschen aus Böhmen aufzunehmen. Und ich, ein noch immer aktiver Redakteur, teilte mit den Schülern mein lebenslanges Interesse und meine Sorge um gute deutsch-tschechische Beziehungen.
Zunächst nahmen alle Teams am Workshop „Wie filmt man einen Zeitzeugen“ teil, den die Koordinatorin leitete. Dabei lernten die Kinder und Jugendlichen die Grundsätze der Aufzeichnung eines Interviews mit lebenslangen Erinnerungen kennen und lern-
ten, wie man Aufnahmetechniken anwendet. Im Mai und Juni trafen sich die Zeitzeugen und die Dokumentarfilmemacher. Die Erzählungen wurden meist mit einem Diktiergerät, einem Video und einer Kamera aufgenommen. Die vorbereiteten Fragen ergänzten nach und nach spontane Fragen, die sich aus dem Interview ergaben. Einige Zeitzeugen zeigten den Schülern zeitgenössische Fotos und anderes Material, das mit ihrem Leben zusammenhängt. Nach dem Treffen mit den Zeitzeugen nahmen die Teams am Workshop „Wie erzählt man eine Geschichte“ teil. Der machte die Schüler mit den Grundlagen der Erzähltechnik vertraut und half ihnen, die Memoiren zu erfassen, bevor sie einen Radio-, Video- oder Animationsbericht vorbereiten.
Kürzlich wurde nun das Projekt mit der Vorführung des entstandenen Films im CeBB in Schönsee abgeschlossen. Alle waren von dem interessanten Dokumentarfilm begeistert. Vor der Präsentation waren die Schüler der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule mit David Vereš vom CeBB zum geschichtlich interessanten Ort Bügellohe gewandert. Damit hatten sie sich auf die Spuren der einstigen Grenzwächter begeben. Dort gab Vereš interessante Informationen und erklärte auch das 2019 von der Universität Pilsen geschaffene Kunstwerk.
Die Schüler marschierten dann an der Weißbach-Quelle vorbei auf tschechisches Territorium, wo Vereš noch die Grenzschließung während der Pandemie kommentierte und auf die „Samstage für die Nachbarschaft“ verwies. Danach erhielten die Schüler im CeBB eine Hausführung, in deren Verlauf ihnen die vielfältigen Tätigkeiten dieser grenzüberschreitenden Einrichtung vorgestellt wurden. Nach der Filmvorführung standen die Zeitzeugen für weitere Fragen zur Verfügung.

Die Euregio Böhmerwald-Südwestböhmen unterstützt das Projekt im Rahmen des Ziel-ETZ-Programms und der MERO Deutschland GmbH finanziell.
Die Zeitzeugen-Berichte bietet www.pribehynasichsousedu.cz/ cesko-nemecke-pribehy-nasichsousedu/pribehy-bez-hranicgeschichten-ohne-grenzen/
Der Film läuft bei Post Bellum www.pribehynasichsousedu. cz/prezentace/cesko-nemeckepribehy-bez-hranic
Heimatbote für
den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de






Wolf-Dieter Hamperl erzählt in dieser Folge von einer elektrischen Eisenbahn, Schulspeisung und dem Türkenhaus.
In den Weihnachtsferien 1949 oder 1950 waren wir bei dem Hagendorfer Schullehrer Berger eingeladen. Seit 1976 ist Hagendorf ein Ortsteil von Waidhaus. Der hatte in einem Klassenraum eine riesige elektrische Eisenbahn aufgebaut und ließ sie laufen. Es handelte sich nicht um eine Schmalspurbahn, sondern um das größere Modell. In den Waggons brannten Lichter, sie waren mit Bänken und Figuren ausgestattet. In der Lokomotive saß ein
❯ Altzedlisch in Bildern
Tierische Fosnat
Fosnat war im Kreis Tachau ein besonderes Ereignis. Es gab viele Bräuche, und jedes Dorf feierte auf seine Weise. Man tanzte ausgiebig, die Hausfrauen backten „Köichla“, „Kråpfn“ und Kuchen.
Die alten Fotos belegen, daß die Fosnat in Altzedlisch nicht nur mit Tanzveranstaltungen – auch der reiferen Jugend –, sondern auch mit Umzügen durch den Markt gefeiert wurde. Diese Umzüge fanden bis in die dreißiger Jahre hinein am Faschingsdienstag statt. Beliebt waren Tiere wie Rindviecher, Pferde, Elefanten oder Kamele, in denen jeweils zwei Leute steckten. Aber auch ein Schwanenwagen rollte mit.

Dafür machten sich zwei Landsleute sehr viel Arbeit und ergänzten sich sehr gut: Josef Arnold (Bola) stellte die Tiere her und sein Bruder Andreas (Tüchlweber), der wohl ein großes Talent für das Nähen hatte, die Garderobe, die dazu paßte.
Die Kostüme und die Tiere wurden dann später an die Gemeinde verkauft. In der Familie von Josef Arnold, die nach der Vertreibung in der Nähe von Halle wohnte, wurde erzählt, daß die Altzedlischer Faschingskostüme sogar in einem Dorf bei Pilsen bekannt waren! Wahrscheinlich waren sie von den Zedlischern dorthin verkauft worden.





Schöne Fosnat wünscht Sieglinde Wolf

Ein Elefant wollt bummeln gehen, sich das schöne Zedlisch besehn.

❯ Kindheit in Waidhaus – Folge IV
Griesbrei für den Bernhardiner
Lokführer. In der Dämmerung wirkte die Eisenbahn mit ihren beleuchteten Häusern und Bahnübergängen grandios. Ich hatte so etwas Schönes noch nie gesehen. Da sah meine Aufziehlokomotive mit drei Waggons auf Gleisen zum Zusammenstecken ärmlich aus. Ich kann mich gut erinnern, daß wir Schulspeisung erhielten. Wir hatten alle noch die Wehrmachts-Eßgeschirre, und in die-
sen faßten wir Reisbrei, Griesbrei, unterschiedliche Suppen, Bisquit mit Kakao und anderes. Manchmal hatte ich keinen Appetit, weil die Mutter etwas Besseres gekocht hatte, dann brachten wir unser Essen dem kranken Bernhardiner, der im Heizraum der Dampfsäge lag. Wir dachten, wir würden ihm etwas Gutes tun. Ein Schulfreund aus dieser Zeit war Helmut Karges, der in
der Wohnung uns gegenüber wohnte. Lina Ries hatte ja dort gewohnt, benötigte die Wohnung aber nicht mehr, weil sie Großvater Anton Wolf geheiratet hatte und ins Türkenhaus in der Hauptstraße gezogen war.
Weitere zwei Zimmer neben uns hatten der Zollbeamte Matthäus
Schmitt und seine Frau gemietet. Vom Flur ging man zuerst ins Schlafzimmer und von dort in die gemütliche Wohnküche. Sie hatten einen Sohn Hansi, der wohl noch in Kriegsgefangenschaft war. Er muß bei der Marine gewesen sein, weil eine Matrosenpuppe auf der Couch an ihn erinnerte. Frau Schmitt zeigte mir Fotos von ihm, erzählte viel und zeigte mir auch seine Kinderlocken, die sie in einem Kuvert aufbewahrte. Das faszinierte mich natürlich. Fortsetzung folgt

Heimatkundliches Mitteilungsblatt für die Vertriebenen aus dem Isergebirge/Organ des Gablonzer Heimatkreises e.V.
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, eMail isergebirge@zeitung.de – Betre : Isergebirgs-Rundschau
❯ Mauke – die Band zu Besuch im Isergebirge



Eindrucksvolle Erlebnisse
Gegründet 2006, hatte Mauke – die Band 2009 ihren Durchbruch und begeistert seitdem ihr Publikum. Neben Konzerten im Kulturstadl Bonhofen und der musikalischen Gestaltung des Schwabentags des Bezirks gehören Auftritte bei Festivals und in der Heimat



ebenso zum Programm. Im Juni 2017 besuchte die Band, die 2013 den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren und 2019 den „Dialektpreis Bayern“ erhielt, nach 2015 zum zweiten Mal Gablonz. Einige Bilder erinnern an diese einzigartige Reise.
❯ Gablonz
Paurische Grüße
Liebe Gablinzr und liebe
Nopprn! Dou seid ock olle schiene gegrisst ei unsr neuen Heimatzeitung. Mr sein jo ock noch a klintsches Hoffl, mr sitts jo o dan Geburtstagn , die de immr wingr warn, obr mr kon de Zeit halt ne ufhaln, nauer.
Iech war vrsuchn dos iech immr a bissl wos vu drhejme berichte und dos unse liebe Heimatsprouche, s Paurische ne ganz ausstirbt. Itze hoff mr halt uf a holbwajgs gudes Juhr 2023, mir honns jo leidr ne ann Händn, obr dr Herrgout word uns ne vrlossn.
Beim herzlichen Empfang im Rathaus von Gablonz/Jablonec, durchgeführt von Lukáš Pleticha, damals stellver-
tretender Bürgermeister, wurde den Musikern von Mauke – die Band die Ehre zuteil, ins Goldene Buch der Stadt Jablonec aufgenommen zu werden.

■ Gablonz. In KaufbeurenNeugablonz verstarb am 6. November 2022 Hans Feix, Metallwarenfabrikant (Firma Josef Feix Söhne in der Blumengasse), im Alter vom 93 Jahren. Seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
■ Jaberlich. Am 27. Dezember verstarb nach langer Leidenszeit unsere liebe Heimatfreundin Herta Endler/Wagner im Alter von 89 Jahren. Ihren Kindern mit Familien gilt unser herzliches Beileid.
■ Tannwald. Im gesegneten Alter von fast 103 Jahren ver-
Ein kleines Konzert im Riegerhaus, dem Haus der deutsch-tschechischen Verständigung, in Reinowitz gehört schon zum P ichtprogramm. Vielen Dank an Petra Laurin für die Einladung.
Die Königshöhe/Královka zählt zu den bekanntesten steinernen Aussichtstürmen im Isergebirge. Bei gutem Wetter – wir wir es hatten – hat man einen herrlichen Weitblick über das Isergebirge, das Riesengebirge, das Böhmische Paradies, Polen, Deutschland und auf den Jeschken/Ještěd.

Im März gratulieren wir herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
■ Gablonz. Zum 93. am 15. Heribert Jung aus der Neudorfer Straße 9, jetzt Rieden bei Kaufbeuren; zum 88. am 25. Günter Ullrich aus der Rehrundgasse 14, jetzt Villingen-Schwenningen; zum 86. am 16. Herta Richter/ Roscher aus der Gebirgsstraße 124a, jetzt Neugablonz; zum 85. am 13. Oskar Maschke aus der Wiener Straße 45, jetzt Schwäbisch Hall; zum 81. am 9. Frank Ullrich aus der Hochstraße 10, jetzt Radibor; zum 78. am 14. Maria Hartig/ Scheibler aus der Gebirgsstraße, jetzt Enns/Österreich;
Beim Konzert auf der Sonnenterrasse auf dem Jeschken hatten wir bei richtig tollem Wetter viele Zuhörer. Primator Petr Beitl mit Gattin und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse mit Katja Brauner sind zu diesem Konzert extra angereist. Bilder: Familie Schaurich
WIR GRATULIEREN
zum 78. am 22. Margit Hledik/ Hofirek in Gablonz, Waldzeile. Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!
Thomas Schönhoff Ortsbetreuer
■ Johannesberg. Zum 93. am 19. Resi Herzig/Wünsch in Aichwald; zum 92. am 22. Werner Odechnal in Heuchlingen; zum 82. am 14. Margit Weiß/ Bergmann in Kaufbeuren; zum 90. am 13. Brigitte Böhm/ Bittner in Tambach-Dietharz.

Allen „Gehonnsbargr-Jubilaren“ herzliche Glückwünsche Thomas Schönhoff Karteiführer
■ Kukan. Zum 89. am 31. Gertrud Gerhardt/Storch; zum 86. am 24. Gottfried Zappe in New York/USA; nachträglich zum 100. am 19. Lisa Lorenz in Neugablonz. Thomas Schönhoff Ortsbetreuer
■ Ober-Maxdorf. Zum 75. am 27. Christa Dressler/Umann (Brothäuser) in KaufbeurenNeugablonz. Liebe Christa, zum Geburtstag „olles Gude“ und noch viel Freude mit den Bastelkursen im Isergebirgsmuseum!
■ Labau-Pintschau. Zum 100. am 14. Helene Zimmermann/ Hauser in Ennsdorf/Österreich;
zum 91. am 7. Luise Woithe/ Vater in Germaringen; zum 82. am 16. Hannelore Janser in Laupheim; zum 76. am 5. Doris Purkart/ Dubetz in Kaufbeuren-Neugablonz; zum 76. am 12. Dr. Josef Fabian-Krause in Greiling; zum 76. am 29. Rudi Stiening in Pforzen; zum 73. am 31. Marianne Theileis in Mettenheim;
zum 70. am 5. Dr. Elfi JungStrauß/Jung in Ebersberg; zum 70. am 25. Willi Schmid in Pforzen;
zum 70. am 28. Peter Theileis in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 16. am 2. Tanja Theileis in Lamerdingen. Hans Theileis Ortsbetreuer
Dou bleibt ock schiene gesund und muntr und losst sich ne de Uhrn vullblousn vu dan Verrickthejtn, die se uns täglich ann Nachrichtn serviern. Wenn mr dou de Hälfte drvoune glejbt, is mr su noch ogeschmeert genung. Vu dan ibr zwantsch Urtschoftn ann Bezorke Gablunz sein mr itze grode noche fömf Ortsbetreuer – mr war halt erne s beste draus machen, nauer! Asdann bis zun nächstn Moule: „Gout behittn“! Thomas Schönhof
schied am 2. Januar die begeisterte Turnerin und Sportlerin Gretl Pohl/Lippmann aus OberTannwald in Neugablonz. Ihrem Sohn Ingolf mit Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
■ Grünwald. Im Seniorenheim Mauerstetten-Steinholz verstarb am 14. Dezember 2022 nach einem arbeitsreichen Leben Gerlinde Tippelt/Noßwitz im Alter von 88 Jahren. Zusammen mit ihrem Gatten Ernst führte sie über Jahrzehnte die bekannte Gärtnerei Tippelt in Neugablonz. Ihren Angehörigen gilt unsere herzliche Teilnahme.
Thomas SchönhoffBilder: jiz50.cz
❯ Größter Volkslanglauf Jizerská 50

Die Geschichte des im Isergebirge stattfindenden LanglaufWettbewerbs über 50 Kilometer (Jizerská 50) reicht bis in das Jahr 1968 zurück. Damals fand der Wettbewerb zum ersten Mal statt – jedoch als Trainingslauf, um Bergsteiger auf die neue Saison vorzubereiten.

Heute besteht der Isergebirgslauf, an dem sowohl Profisportler als auch Amateure teilnehmen, aus unterschiedlich lan-
gen Einzelwettbewerben vom Sprint bis zum 50-KilometerLauf. Auch ein Kinderrennen und Staffelläufe werden ausgetragen. Startpunkt ist in Friedrichswald, der 50 Kilometer lange Hauptkurs führt am Wittighaus vorbei. Seit 2008 gehört der Lauf zur tschechischen Ski-Tour und seit 2011 zu der Rennserie Ski Classics. Was die Teilnehmerzahl betrifft, handelt es sich um den größten Volkslanglauf in Mitteleuropa!
Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen)
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Hoffmann, eMail isergebirge@zeitung.de – Betreff: Sternberger Heimat-Post
Liebe Landsleute, in der letzten Ausgabe der Sternberger Heimat-Post haben wir Mährisch Neustadt (das allerdings nicht im Isergebirge liegt – die Redaktion bittet um Entschuldigung), vorgestellt. Nun folgen weitere Informationen über die Stadt. Das Rathaus verdient einige Erklärungen; außerdem beginnen wir einen Rundgang um den Stadtplatz. Die Aufzeichnungen dazu stammen von Walter Nimmerrichter, der ab 1928 selbst am Stadtplatz Nr. 5 wohnte. Heute sind manche Angaben zum Beispiel über die Wachsstockfrauen überholt. Seht das bitte nach.
Sigrid Lichtenthäler
WIR GRATULIEREN
Im März gratulieren wir folgenden ehemaligen Bewohnern von Mährisch Neustadt zum Geburtstag. Am
1. Werner Wenzel (Olmützer Gasse) zum 80. in Naumburg; Doris Wottke/Brosig (Müglitzer Gasse) zum 82. in Jesteburg;
2. Irmgard Kessler/Fock (Olmützer Gasse) zum 81. in Frankfurt am Main;
4. Manfred Reimer (Flurgasse) zum 83. in Esslingen;
5. Manfred Heidenreich (Olmützer Gasse) zum 79. in GroßGerau; Wilfried Kafka (Stadtplatz) zum 86. in Passau;
6. Waltraude Steininger/ Heinrich (Schönberger Gasse) zum 93. in Würzburg;
7. Martha Hampel/Leither (Klementgasse) zum 87. in Hünfelden;
8. Auguste Becht/Frieb (Mittelgasse) zum 86. in Niedernhausen;
9. Helga Vanderhout/Parneth (Herrengasse) zum 83. in Winnipeg/Manitoba;
10. Elisabeth Meister/Nather (Siedlung) zum 81. in Kassel;
11. Leopoldine Eisinger/ Wepil (Siedlung) zum 87. in Brechen;
12. Hermann Klapka (Müglitzer Gasse) zum 90. in Trausnitz;
13. Peter Ambroz (Herrengasse) zum 78. in Australien; Marianne Marget/Vater (Müglitzer Gasse) zum 94. in Seeshaupt;
15. Peter Kawan (Wallgasse) zum 83. in Hemhofen;
16. Kozusnicek Winkler/Brixel (Mittelgasse) zum 92. in Kaufungen;
19. Kurt Lindenthal (Olmützer Gasse) zum 96. in JettingenScheppach;
21. Anna Binanzer/Kleibl (Wallgasse) zum 84. in Fellbach; Erhard Ernet (Müglitzer Gasse) zum 91. in Frankfurt am Main; Erich Röttel (Feldgasse) zum 81. in Büttelborn;
22. Margarete Geyer/Steiger (Müglitzer Gasse) zum 89. in Aichtal-Grötzingen;
23. Anton Bartel (Herrengasse) zum 87. in Groß-Zimmern; Horst-Alfred Schenk (Wallgasse) zum 82. in Heidelberg;
24. Waltraud Faßbender/ Schötta (Müglitzer Gasse) zum 80. in Wolfhagen; Margit Schultheiß/Anderlitschka (Sternberger Gasse) zum 86. in Limburg;
25. Dieter Nowak (Schönberger Gasse) zum 81. in Paunzhausen;
26. Wolfgang Hejny (Flurgasse) zum 78. in Idstein;
27. Brigitte Walter/Illing (Müglitzer Gasse) zum 83. in Büttelborn;
31. Gerlinde Arnold/Langer (Sternberger Gasse) zum 88. in Riedstadt. Sigrid Lichtenthäler
Wer vom Bahnhof und der Schönberger Gasse her kommend erstmals den Stadtplatz betrat, war wohl von dem schönen Stadtbild entzückt: Mitten auf dem Platz, mit 13 719 Quadratmetern der drittgrößte vor Mähren, das stattliche Rathaus (Ý Seite 19), dessen schmuckes Äußere nicht erkennen ließ, daß es bereits auf Jahrhunderte zurückblicken konnte und das die Stürme der Hussitenzeit, des Schwedeneinfalls, Pest und Brände überdauerte, das aber auch glanzvolle Feste erlebte, so die Zusammenkunft des Kaisers Joseph II. mit dem Preußenkönig Friedrich dem Großen, und auf dessen Turm in luftiger Höhe noch vor wenig mehr als hundert Jahren der „Turnermeister“, auch Türmer oder Stadtpfeifer genannt, mit seinem Gesellen des Amtes waltete und dem Volk den Schlag der rinnenden Stunden pfeifend verkündete, und das schließlich 1891 von Zdendo Vodička renoviert wurde. So entzückte das Rathaus durch seinen Turm mit den vier Türmchen in den Ecken, mit der 1763 erbauten Freitreppe an der Ostfront und durch die schönen Renaissancegiebel.
� Ein Spaziergang durch Mährisch Neustadt – Folge I
Ein Platz mit Geschichte
ten und schafften, wenigstens in Kürze anführen, soweit dies noch möglich ist. Den stichwortartigen Angaben werden die Hausnummern vorangestellt.
Nr. 1: Rathaus: Auskocherei Aschl. –Spengler Schwenk (später im Haus Latzel 22). – Fleischhauer Dostal.

Nordseite des Stadtplatzes
Nr. 28: Neubau von 1898. Zum Stadtplatz hin die Schmalseite des Skurekschen Hauses. Die Reichenberger und Brünner Stoffe, die man hier erhielt, waren von ausgezeichneter Qualität. Als die deutschen Truppen 1938 einmarschierten, waren die Stoffe innerhalb weniger Tage ausverkauft. Alois Skurek, Obmann des Männergesangvereins Mährisch Neustadt.


gebracht. Angestellte: Schmidt und Rolf Zimmermann, vorher Major Smekal und Rosa Röttl, verehelichte Kronfuß, die als Witwe in Wien lebt. Nach dem Anschluß an Deutschland wurde diese Bankfiliale aufgelöst.
Nr. 24: Die großen Schaufenster enthielten vielerlei Eisenwaren und Haushaltsartikel. Besitzerin dieser Eisenhandlung war Anna Kozusnicek, geborene Dworak. Die Töchter Mitzi, verehelichte Fryde, und Anni und der Sohn Otto sind tot. Anni nahm oft an Skiausflügen und Radpartien teil. Tochter Peppi, verehelicht mit Modelhart, dem Direktor der Landwirtschaftlichen Schule in Neustadt, lebt in der Bundesrepublik.
Nr. 23: Dieses Haus gehörte und be-
kraut später das Pretzner-Haus Nr. 35 übernommen hatte, eröffnete hier Grete Kozusnicek, geschiedene Frau des Otto Kozusnicek, ein Nährmittelgeschäft. Oben aber wohnten: Frau Zanger, Familie Hertha und Rolf Zimmermann, Birnkraut und Ing. Pauer. Wir überqueren nun die Müglitzer Gasse und stehen vor dem Haus Nr. 20: Ein weiträumiges Haus zwischen Kirchenplatz und Stadtplatz mit Wohnung und Notariat von Karl Marzelli, der ab 1922 Bürgermeister war. Sein Mitarbeiter war Alois Pechatschek. Im Erdgeschoß war der Laden des Uhrmachers Uhrner. Später war hier ein Schnittwarengeschäft.
Nr. 19: Besitzerin Hertha Beichel, geborene Hauke. Lehrer Beichel mit Frau und Tochter nahm sich beim Russeneinmarsch 1945 das Leben. Der Sohn war aber bei der Wehrmacht und überlebte so das traurige Geschick seiner Eltern und Schwester. Er lebt irgendwo in der Bundesrepublik.
Nach rechts schweifend wurde der Blick sogleich von der herrlichen, über 21 Meter hohen Mariensäule gefangengenommen, einem Wunderwerk aus der Zeit des Barock (Ý Sternberger Heimat-Post 3/2023). Noch weiter rechts erblickte man im Hintergrund das stattliche Zangersche Bürgerhaus, dessen schöner Giebel wohl mit den Rathausgiebeln in Wettstreit treten wollte. Über die weitere Reihe von Bürgerhäusern auf der Westseite des Platzes ragten die beiden ungleichen Türme der Stadtkirche hervor, so als wenn sie sagen wollten: „Nun, sind wir etwa nichts?“ Schon das Aussehen der beiden Türme besagte, daß es nicht Zwillingsbrüder sind. Während der eine mit dem Wiederaufbau der Kirche nach dem großen Schwedenbrand 1656 erstand (die Spitze erhielt er aber erst anläßlich der Renovierung 1889), wurde der südliche, der oben achteckige „städtische Kirchturm“ oder „Hundsturm“ wahrscheinlich erst 1668 wiedererbaut. Doch er richtete einmal Unheil an. Dr. Kux berichtete: „In den Nachmittagsstunden des 7. Dezember 1868 wütete ein Orkan von solcher Stärke, daß außer mehreren Vorstadtscheuern auch das Krankenhaus beim Friedhof zerstört und ein Brett von der Randverschalung unter dem Blechdach des Hundsturms bis auf den Stadtplatz geschleudert wurde und eine vor Nr. 32 (damals Daubrawa-Apotheke, zu unserer Zeit das Babutzky-Haus) passierende Bürgersfrau erschlug.“
Fürwahr, es bot dieser Blick von der Einmündung der Schönberger Gasse her ein prächtiges Stadtbild. Wir aber wollen im Geiste einen Rundgang um den Stadtplatz machen und nicht nur die Häuser, sondern auch das Leben in ihnen und die Menschen, die einst in ihnen wohn-
Töchter: Camilla, verehelichte Rabenseifner, und Hertha, verehelichte Ullrich, leben in der Bundesrepublik.
Nr. 27: Ein großes Einfahrtstor führt in den Gasthof „Schwarzer Adler“. Wirt: Karl Gabriel. Im ersten Stock war der Musikvereinssaal, in dem die Proben des Chores, des Orchesters und für die Theateraufführungen stattfanden. Wer erinnert sich nicht an die Carl-Maria-von-Weber-, an die Franz-Schubert-, an die BeethovenFeier, an die vielen Singspiele und Operetten usw.!
Nr. 26: Gasthof zum Schwan. Wirtsleute: Otto Seuchter und Frau Edith, geborene Rohm.
Nr. 25: Ein historisch bedeutungsvolles Haus. In ihm wohnte bei dem Treffen von Kaiser Joseph II. mit dem Preußenkönig Friedrich dem Großen im Jahre 1770 die königliche Majestät. Das Gefolge des Königs war in den vorhin genannten Nachbarhäusern 26 und 27 untergebracht. Der Kaiser, der im Zangerschen Haus wohnte, eilte sogleich auf den Stadtplatz, als er die Kunde vom Eintreffen des Königs erhielt. Es war am 3. September 1770. Er ging ihm entgegen, und vor diesem Hause erfolgte auf offener Szene in Gegenwart einer jubelnden Menschenmenge die herzliche Begrüßung. Am 7. September reiste König Friedrich wieder ab. Besitzer dieses Hauses war 1923 Edmund Englisch. Im Erdgeschoß war die Deutsche Bank unter-
wohnte Lehrer Karl Baier, der nach seinem Übertritt in den Ruhestand noch aktiv als Leiter der gewerblichen Berufsschule war. Die Tochter Grete, verheiratet mit Tierarzt Riedinger aus Salbnus, lebt in 6536 Langeslosheim und ist eine noch jugendliche Wachsstockfrau. Im Erdgeschoß dieses Hauses hatte der Konfektionär Heinrich Wagner seinen Laden. Er vermochte mit einem reichhaltigen Lager seine Kunden zufriedenzustellen.
Nr. 22: Besitzerin Anna Latzel. In diesem Hause wohnte der Spenglermeister Schwenk. Die Tochter Maria, verehelichte Mauler, lebt mit ihrem Gemahl Johann in Waiblingen, Donauschwabenstraße 27. Beide sind regelmäßige Besucher des Treffens in Felbach. In der Ecke zwischen Nord- und Westseite befand sich eine ganz kurze Sackgasse mit Tor zum Hofe des Zangerhauses. Eines Nachts zu später Stunde strebte eine bekannte Neustädter Persönlichkeit – mit bereits benebelten Sinnen aus der Weinstube Göttlicher kommend – ihrer Wohnung zu. Doch statt durch die Müglitzer Gasse und das Meedler Tor zu torkeln, verirrte er sich in diese kurze Sackgasse und fand hier das Tor verschlossen. In der Meinung, es sei das Meedler Tor, das man aus purer Bosheit verschlossen habe, machte er nicht wenig Krach.
Nr. 21: Das Haus mit dem schönen Giebel. Eine Marmortafel verkündet, daß in diesem Hause in jenem Jahr des Treffens der beiden Herrscher Kaiser Joseph II. wohnte. Zu unserer Zeit diente das Erdgeschoß prosaischeren Zwecken, denn da konnte man sich bei Birnkraut mit allerlei Köstlichkeiten für den Magen eindecken.
Früher betrieb dieses Geschäft der Besitzer Max Zanger, weshalb man vom Zangerschen Haus sprach. Nachdem Birn-
Bei Fortsetzung des Rundganges öffnet sich nun rechts die Kirchengasse mit dem Blick auf die Ostfront der Kirche mit dem 1668 geschaffenen Gnadenbild „Unserer lieben Frauen allda“, das in der Erinnerung an die Errettung der Stadt vor den Hussiten gemalt wurde. Maria schwebt über der Stadt und breitet schützend ihren Mantel über ihr aus.

Nr. 18: Der Weg führt an dem Gebäude des Spar- und Vorschußvereines vorbei, in dem als Leiter Herr Schmachtl, später Leo Schaal aus Salbnus wirkte. Im Obergeschoß wohnte die Familie des Lehrers Franz Kadlcik (Götz), der sich als Dirigent des Orchesters des Musikvereins, als Theaterspieler und als Bibliothekar um das Kulturleben in Neustadt große Verdienste erwarb.
Nr. 17: Wir stehen vor der reichhaltigen Auslage des Glasermeisters Ignaz Gabriel mit schönem böhmischen Kristallglas. Später führte das Glasergeschäft Josef Wenzlitschke, der als Gesangsvereinsmitglied und vor allem als Feuerwehrhauptmann sehr rührig war. Seine Witwe Grete, geborene Schaal aus Schröffelsdorf, lebt in 612 Michelau. Sie verschönt die feierlichen Messen der Wachsstockfeste durch Gesangs-Soli.
Nr. 16: Besitzer Emil Kessler. Im Erdgeschoß befanden sich das Ledergeschäft und die Drogerie Nekel „Zum weißen Kreuz“, die aber am Montag meist geschlossen war.
Nr. 15: Gebäude der Treublitzer Bezirksvorschußkasse. Hier hatte Fritz Schötta ein Schnittwarengeschäft. Nach der Übersiedlung ins Haus Nr. 9 übernahm das Geschäftslokal ein Tscheche.
Nr. 14: Besitzer Edmund Kloß. Im Erdgeschoß befand sich ein Gasthaus. Im Obergeschoß wohnte Frau Hüttisch, Witwe nach dem Primar aus Deutsch Liebau.
Nr. 13: Gasthaus der Frau Anna Schwanzer, später Weinstube Göttlicher, ein recht beliebtes Lokal. Wir überqueren nun die Gymnasialgasse und kommen zur Häuserreihe der Südseite des Stadtplatzes. Wird fortgesetzt
Das Rathaus gehört zu den herausragenden Gebäuden von Mährisch Neustadt und wurde ursprünglich als Kaufhaus und Markthalle etwa 1350 errichtet. Nach einer großen Renovierung im Jahre 1891 präsentierte sich das Rathaus im Renaissancestil. Die ostseitige Freitreppe entstand im Jahre 1763 und die Dreifaltigkeitskapelle im Westtrakt 1692. In der Nordostekke befindet sich der 45 Meter hohe Wachtturm mit Uhr und Rundgang. Das Rathaus diente nach Kauf- und Markthalle als Sitz für Rat und Verwaltung, 1850 wurde es an das Bezirks- und Amtsgericht vermietet.


� Mährisch Neustadt

Erst Kauf-, dann Rathaus
Folgendes konnte ich, hauptsächlich aus Aufzeichnungen von Erich Mandel, zu der Geschichte des Rathauses ausfindig machen:
Das Rathaus wurde etwa 1350 als Kaufhaus und Markthalle inmitten des Ringes erbaut. Erforderlich war der Bau vermutlich wegen der beiden Jahrmärkte, die in Neustadt in den Jahren 1354 und 1372 stattfanden und jeweils acht Tage dauerten. Auch das im Jahre 1364 der Stadt gewährte „Stapelrecht“, das durchreisende Handelsleute verpflichtete, ihre Waren für drei Tage und mehr in Neustadt zum Verkauf auszulegen, forderte diesen Bau. Den Händlern mußte nämlich zur feuer- und wettersicheren Unterbringung ihrer wertvollen Warenladungen ein Kauf- und Warenlagerhaus zur Verfügung gestellt werden. Die Raumeinteilung im Erdgeschoß des heutigen Rathauses läßt den seinerzeitigen Zweck erkennen, es enthält eine Durchfahrt in Nordsüdrichtung, zwei Ausfahrten in Ostwestrichtung und seitwärts zehn Gewölbenischen. Im Obergeschoß war eine Ratsstube als Tagungsraum für die Stadtverwaltung eingerichtet, so
� Auch nach 100 Jahren noch ein Rätsel
Schlußpunkt hinter einem häuslichen Drama?
Donnerstag, 4. Januar 1923, ein nebeliger Tag. Karl Lorenz, ein Tagelöhner aus Mährisch Neustadt, macht am Nachmittag zwischen Wiesen beim Galgenberg einen Spaziergang und sieht dort einen Mann liegen. Er macht ein paar Schritte auf ihn zu, und gleich ist ihm klar, daß er einen Toten vor sich hat. Weste und Hemd sind mit Blut beschmiert und deuten auf eine gewalttätige Tat hin. Ohne Zögern eilt Karl Lorenz nach Mährisch Neustadt zur Gendarmerie, um seinen Fund anzuzeigen.
Die Gendarmen brechen sofort Richtung Meedl/Galgenberg auf. Die Identifikation des Toten ist schnell klar: Der Mann trägt einen Tabaksbeutel bei sich, und in ihm befindet sich eine ärztliche Bescheinigung, ausgestellt vom Chefarzt des Mährisch Neustädter Krankenhauses, Dr. Franz Klameth, und die lautet auf den Namen Franz Leicher, Jahrgang 1865, wohnhaft im Haus Meedl Nr. 48. Am Hals des Toten klafft eine Schnittwunde; Blut ist jedoch nur an den Kleidern und nicht in der Umgebung des Leichnams. Dort liegen nur ein Stock und ein Riemen vom Rucksack. Eines ist also klar: Die Tat spielte sich woanders ab, der Mann mußte von irgendjemandem hierher gelegt worden sein. Aus Mährisch Neustadt wird die Gerichtskommission gerufen, der Chefarzt Klameth beschaut den Körper, stellt den gewalttätigen Tod fest und läßt den Toten zur Obduktion wegbringen.
daß das Kaufhaus gleichzeitig als Rathaus fungierte. Der Turm mit anfangs vielleicht 30 Metern Höhe wurde vermutlich gleichzeitig mit der Markthalle als Bestandteil der Stadtbefestigung als Holzturm erbaut. Er diente als Symbol der „königlichen Stadt“ durch seine vier Türmchen an den Dachekken und war auch Beobachtungsturm, vom dem aus der „Türmer“ mit seinen Gesellen im Kriegsfalle das Heranrücken des Feindes meldete, bei Brandgefahr Alarm schlug und den Bürgern die Tageszeiten durch Pfeifmusik verkündete. Der Türmer wurde in Neustadt bis zum Jahre 1823 von der Stadt beschäftigt.

1692 Anbau der Dreifaltigkeitskapelle an der Westseite in Form einer Rotunde.
1763 Anbau der Freitreppe an der Ostseite des Rathauses als repräsentativer Aufgang zu den im Obergeschoß untergebrachten Amtsräumen des Stadtrates.
1852 Turmerhöhung auf 45 Meter zu der heute markanten Form.
1890 Renovierung der Außenfassade auf die heutige Barockgestalt durch Baumeister Zdenko Vodička. Sigrid Lichtenthäler
Der Pathologe stellt fest, daß die Todesursache Verbluten als Fol ge der etwa sechs Zentimeter langen und zwei Finger breiten Schnittwunde ist, die sich an der Halsschlagader entlangzieht. Der Schlag wurde mit einem scharfen Gegenstand ausgeführt, offensichtlich mit einem Taschen- oder Schustermesser. Der Täter schlug Leicher zuerst mit der Scheide auf den Hals, dann folgte der Schnitt. Der Tod trat aber nicht sofort ein, das Opfer lebte noch eine Zeitlang. Eine weitere Verletzung findet man am Körper und eine verhältnismäßig frische Wunde an der Hand, die jedoch für den Tod nicht verantwortlich ist.
Die Gendarmen durchsuchen die Gegend und forschen nach Mordwaffe und weiteren Spuren. Erst am zweiten Tag finden sie bei Meedl, etwa 500 Meter von der Stelle entfernt, wo der Tote lag, Blut im Gras, Schotter und Lehmbrocken, so als wäre über das Feld ein Körper gezogen worden. Weiter liegen ein Taschentuch da, ein Pfeifenrohr, ein Notizbuch und das ärztliche Zeugnis von Leicher, das irgendjemand ins Wasser geworfen hatte. Wo das Verbrechen sich abspielte, ist nicht deutlich auszumachen.

Weiter forscht man danach, wer Franz Leicher war: ein 57jähriger Arbeiter, zur Zeit arbeitslos. Er lebte in einem Meedler Häuschen mit seiner drei Jahre jüngeren Frau Marie, der Tochter Anna, dem 27jährigen Sohn Franz, Schwiegertochter Hermine und einem Enkel. Nach den ersten Verhören ist klar, daß die häuslichen Verhältnisse äußerst unerfreulich waren. Der Vater bekam nicht genug zu essen, ging oft betteln und mußte früh schlafen gehen. Zum täglichen Ablauf gehörte Streit mit Kindern und
der Frau, von der er öfter blutig geschlagen wurde; davon stammen auch die älteren Verletzungen am Körper. Die Abwesenheit des Vaters beunruhigte die Familie angeblich nicht. Er ging am 3. Januar vor 7 Uhr aus dem Haus, und Frau und Sohn dachten, daß er im Krankenhaus sei, wo er angeblich auch ab und zu war. Die Wunde an der Hand hatten ihm Frau und Schwiegertochter vor Weihnachten zugefügt, denn durch Leichers Schuld hatte sich der kleine Enkel am Kopf verletzt.
Das Verhör, die häuslichen Verhältnisse und ein nicht nachweisbares Alibi werfen den Mordverdacht auf Leichers 27jährigen Sohn Franz, der Schuhmacher war. Die Gendarmen durchsuchen deshalb das Haus und finden ein Taschentuch und Messer, beides voller Blut. Der dreijährige Sohn von Leicher plapperte noch, daß den Alten der Papa stach, und zeigt dabei auf den Hals. Der junge Leicher wird verhaftet und kommt in Mährisch Neustadt in Haft, desgleichen seine Mutter und Schwester. Alle bestreiten die Tat.
beide gingen Richtung Meedl.
In dieser Zeit, etwa zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, begegneten ihnen die Arbeiter Johann Hlavacek und Ludwig Alt. Sie blieben bei den beiden stehen, und mit verstecktem Sarkasmus fragte einer: „Ja wie, Leicher, hast du dir wieder einen Tröster gekauft?“
Der antwortete: „Wie könnte ich mir etwas kaufen? Geld habe ich nicht, Arbeit habe ich nicht und verdiene nichts.“ Ludwig Alt fragte Leicher, ob ihm denn nicht jemand etwas leiht. Er bekam zur Antwort: „Mir würde keiner etwas leihen, nicht einmal meine Frau. Und wenn ich nach Hause komme, bekomme ich Schläge, aber kein Essen!“ Dann forderte Antoch Leicher zum Weitergehen auf und sagte: „Komm, ich bleibe bei dir für eine Nacht.“
in dem der Obergerichtsrat Prochazka den Vorsitz hat, dort weiter Streit. Als Verteidiger fungieren die Rechtsanwälte Löwy und Sedlacek. In drei Tagen werden 39 Zeugen befragt. Der junge Leicher leugnet die Schuld, ein Alibi gibt ihm die Zeugin Marie Krobot, die sich bei ihm hatte Schuhe machen lassen. Sachverständige stellen fest, daß das Mordwerkzeug ein Schustermesser gewesen sein könnte oder ein scharfes Taschenmesser. Dagegen steht die Zeugenaussage des Josef Antoch, eines Menschen mit zweifelhaftem Ruf, den auch seine Geliebte, eine gewisse Tschauner, für einen Lügner und Trunkenbold hält.
Die Gendarmen befragen jedoch auch weitere Zeugen. Jetzt steht als zentrale Figur der 57jährige Knecht aus Langendorf, Josef Antoch, da, der aufgrund einer Aussage am 9. Januar in Deutsch Liebau verhaftet wird.
Danach ging Franz Leicher erst nach Mährisch Neustadt, auf dem Rückweg hielt er bei dem Gasthof „Roter Frack“ an, der unterhalb des Galgenbergs auf dem Weg nach Meedl steht. Die Besitzer Ferdinand und Mathilde Meixner sagen aus, daß er ungefähr um 11 Uhr dort ankam. Zuerst war er alleine, dann setzte er sich an den Nachbartisch, an welchem schon seit Herrgottsfrühe der ungefähr gleichalte Knecht Josef Antoch saß. Die Wirtin beschrieb, daß Leicher weinte und daß sie ihn nach der Ursache fragte, worauf er ausweichend antwortete.

Im Gespräch mit Antoch vertraute Leicher ihm an, daß seine Frau ihn schlecht behandelt und die Kinder nicht besser sind. Antoch zahlte für Leicher den Schnaps, und beide Männer saßen im geselligen Gespräch etwa bis 16 Uhr zusammen. Dann sagte Antoch, daß er zum Zug müsse. Leicher bot ihm an, daß er bei ihm übernachten könne, und
Hlavacek und Alt hörten dann, daß Leicher mit dem Fuhrwerk nach Hause mitfahren wollte, aber Antoch den Weg durch die Wiesen vorschlug. Was sich in der folgenden Stunde ereignete, ist ein Geheimnis. Sicher ist, daß Antoch etwa eine halbe Stunde später in die Gastwirtschaft zurückkehrt und auf die Frage, wo er Leicher ließ, antwortete: „Sicher beschmiert man sich mit ihm. Ich könnte mich ohrfeigen!“ Nach dem Vorwurf der Gastwirtin, daß er seinen Kameraden verlassen hat, sagte er, indem er auf seine Kleidung und Schuhe zeigt, beschmiert mit Dreck: „Schauen Sie mich an, so kann ich doch nicht wegfahren!“ Antoch bestellte sich noch ein Achtel Schnaps und fuhr dann zum Stall der Wirtschaft „Zum weißen Widder“, um sich auszuschlafen.
Als die Gendarmen nach vier Tagen nachforschen, entdekken sie, daß bei Antoch Leichers Mantel und Hosen sind. Weiter stellen sie fest, daß er für sechs Kronen und ein Stück Brot Leichers Mütze verkauft hat – er wird in Haft genommen.
Antochs Aussage ist unglaubwürdig, mehrmals ändert er sie nach Gegenüberstellung mit Zeugen. Erst fand er nur die Sachen, dann beteiligte er sich am Mord, den der junge Leicher begangen hat, hat aber den Alten nicht erschlagen. Über seinen Anteil am Mord besteht kein Zweifel. Wer aber versetzte den tödlichen Schlag? Wer ist der Mörder? Im Juli 1923 landet der Fall vor dem Olmützer Gericht,
Und wie ist die Version von Antoch? Als sie vom Weg einbogen in die Felder, sah Antoch zwischen den Bäumen eine Gestalt und fragte, wer das sei. „Das ist mein Sohn“, entgegnete Leicher. Der junge Mann kam zu ihnen und ging ein Stück des Weges stumm mit ihnen. Auf einmal schlug der junge Leicher heftig seinem Vater auf den Kopf, und der stürzte zu Boden. Dann nahm er vom Vater Mantel und Hosen, gab beides Antoch und sagte: „Hier hast du es, es ist deines.“ Dann brachten sie gemeinsam den Alten zum Graben, wo ihn der junge Leicher einfach liegen ließ. Der Vater verblutete dann offensichtlich. Mehr weiß Antoch nicht. Bei der Verhandlung jedoch änderte er seine Aussage und behauptete, daß der junge Leicher nach dem Stoß noch dem Alten in den Hals stach, sie dann gemeinsam den Körper zum Wasser schleppten, wo ihn der junge Leicher abwusch und auch das benutzte Taschentuch nebst Schustermesser. Sie beide wuschen sich dann auch ab und legten den Alten an den Platz, wo er am 4. Januar gefunden wurde. Weil dies alles so geschah, hätte Antoch Angst bekommen und bei der Verhandlung dem jungen Leicher nicht in die Augen schauen können. Eine Schuld am Mord leugnet er, räumt sie aber durch die Hilfe beim Verlegen des Körpers ein. Indizien jedoch gibt es genug.
Das Schwurgericht entscheidet nach der Verhandlung so: Franz Leicher Junior wird freigesprochen, Josef Antoch zum Tode durch den Strang verurteilt. Antochs Anwalt legt im Namen seines Mandanten Beschwerde ein, denn die Sachverständigen hatten bei der Verhandlung festgestellt, daß das Verbrechen nicht von einem einzelnen Mensch begangen sein konnte. Das Höchste Gericht jedoch stellte im Dezember 1923 fest, daß es auch ohne eine Mittäterschaft keinen Zweifel an Antochs Schuld gibt, während an der Schuld des jungen Leicher berechtigte Zweifel bestehen. Und im Zweifelsfalle muß zum Vorteil des Angeklagten entschieden werden. Die Todesstrafe für Josef Antoch bestätigt das Höchste Gericht in Brünn.
Wie genau sich der Mord an Franz Leicher Senior abspielte, bleibt auch nach 100 Jahren ein Geheimnis. Bei diesem Fall gibt es jedoch keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Todesstrafe. Nikola Hirnerová
Aus dem „Mährisch Neustädter Berichterstatter“ vom Januar 2023, übersetzt und leicht gekürzt von Sigrid Lichtenthäler.
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats.
❯ Der Schriftsteller Viktor Heeger


Schlesischer Rosegger
Viktor Heeger war ein Hauptvertreter der gebirgsschlesischen Mundartdichtung und Heimatbewegung im Troppauer Land. Seine Lebensgeschichte ist die unserer Vorfahren und getrübt von Krieg, Verfolgung und Krankheit.
Der Schriftsteller Viktor Emanuel Heeger wurde am 28. April 1858 in Zuckmantel (damals Kreis Freiwaldau) als Sohn eines fürstbischöflichen Revierförsters geboren. In seinem engeren und weiteren Lebensbereich stand ihm ein abwechslungsreiches, ja sogar bewegtes Leben bevor. Die wichtigsten Stationen seines Lebens waren Troppau, Freudenthal, Brunn, Wien, Olmütz, Graz und Gräfenberg bei Freiwaldau. In Troppau besuchte er die Volksschule, die Realschule und die Lehrerbildungsanstalt. Nach Troppau kehrte er 33 Jahre später zurück, um seine Tätigkeit als Wanderlehrer der „Nordmark“ und als Geschäftsführer der „Deutschen Post“ aufzunehmen, und nach nochmaliger längerer Unterbrechung kam er endgültig nach Troppau zurück und beendete dort seinen Lebensweg.
Die berufliche Laufbahn führte ihn zunächst nach Freudenthal, wo er als Lehrer und Bürgerschullehrer unterrichtete. In Brünn widmete er sich vorwiegend redaktioneller Arbeit und ging seinen politischen Interessen nach. Eine steile Karriere brachte das Mandat eines Reichsratsabgeordneten und die Übersiedlung nach Wien mit sich. In Olmütz ließ er sich als Wanderlehrer des „Bundes der Deutschen Nordmährens“ nieder, in Graz als Wanderlehrer der „Südmark“. Seinen Lebensabend verbrachte Viktor Heeger in seinem „Koppenhaus“ am Grafenberg bei Freiwaldau, und dort schrieb er auch seine „Koppenbriefe“, jene Zeitungsaufsätze, die ihm den Beinamen „Koppenvater“ eintrugen.
Verdienste auf literarischem Gebiet erwarb sich Viktor Heeger vor allem als Epiker und Dramatiker. Seine „Geschichten vom alten Haiman“ (1888), humoristische Erzählungen in schlesischer Mundart, brachten erste Resonanz. 1895 erschien der zweite Teil, und heute weiß man, daß Heeger mit seinem „Vater Haiman“ einen besonderen literarischen Typus erschaffen hat.
Mundartgeschichten, aber auch

Gedichte enthält der Band „Köper-
nikel und Arnika“ (1909). Mit dem ein Jahr vorher veröffentlichten „Kobersteiner“ ging er neue Wege; der Dichter gestaltet eine Heimatsage in der Form eines Epos. Den „SchubertSchmied“ (1928) wertet Heeger selbst als eine „schlesische Dorfgeschichte“.

Wie erfolgreich Viktor Heeger die Zeiten überdauert hat, beweist die Tatsa-
aber auch verpflichtet, für volkstümliche Bühnenstücke zu sorgen. Mit dem Bühnenstück „Wunderkur“ (1913) gelang ihm der erste große Wurf, und die Bühnenstücke „Hans Kudlich“ und „Der Pfeifla-Schuster“ (beide 1914) gehörten zum Standardrepertoire der meisten Volksbühnen und wurden selbst in Wien gern gespielt. Soweit
❯ Gebirgsschlesische
Mundart
Lorke und Luhsche
Über die Mundart, in der Viktor Heeger seine Texte verfaßte, weiß Wikipedia Folgendes:
Das Gebirgsschlesische (die gebirgsschlesische Mundart, der gebirgsschlesische Dialekt, früher bekannt als schlesische Gebirgsmundart oder schlesischer Gebirgsdialekt) ist ein Dialekt des Ostmitteldeutschen.
che, daß außer Neuauflagen postum zwei weitere Bände erscheinen konnten, deren Inhalt sich aus dem literarischen Erbe des Dichters ergeben hat: die „Koppenbriefe“ (1960) und „Grüße der Heimat“ (1962). Ein besonderes Anliegen war es dem Dichter, Literatur in die Bevölkerung zu tragen. Dazu schien ihm das Volkstheater als besonders gut geeignet. Er gründete als erste schlesische Volksbühne die „Reihwiesner“ (1912) in der Gemeinde Reihwiesen, und Dutzende Städte bzw. Dörfer griffen diese Anregung auf. Jetzt fühlte sich Heeger

Mei Grüne Schles
Ols enser Herrgott hot amol, dan grünen Wald daschoffen

Do hot a meiner Seele wohl eis schworze nei getroffen, Denn ensre A‘de, dos wes Got hot schieners nie zu weisen, und wa‘n Wald ols Heimat hot da sol sich glecklich preisen.
sich Heeger der Mundart bediente –und darin sah er geradezu eine Verpflichtung –, mußte er die durch die Mundart bedingte Begrenzung seines Schaffens in Kauf nehmen. Es bleibt ihm jedoch das Verdienst, den südschlesischen Dialekt in der Literatur verankert zu haben.
Als er am 5. August 1935 in Troppau gestorben war, brachten die Tageszeitungen und viele Zeitschriften ausführliche Nachrufe und Würdigungen über Viktor Heeger. Damals kannte man ihn landauf, landab als den „Dichter der grünen Schles“, als den „Koppenvater“, als den „schlesischen Rosegger“. Das Schicksal, das seine Landsleute zehn Jahre nach seinem Tode ereilte, und der zeitliche Abstand, der zur Abklärung führt, haben es mit sich gebracht, daß Heegers Popularität zwar ein wenig verblaßt ist, aber vergessen hat man ihn keinesfalls. So nannte die Stadt Freiwaldau anläßlich des 70. Geburtstags des Dichters den Weg, der durch die Klageallee führt, Viktor-Heeger-Weg. Auch die Literaturgeschichtsschreibung hat ihn nicht vergessen – im Gegenteil: Man hat Viktor Heeger und seine literarischen Werke einer kritischen Analyse unterzogen – und sie haben die bestanden. Daher nimmt Viktor Heeger im Kreise der Heimatdichter, die ihre eigene literarische Landschaft vertreten, den Ehrenplatz des bedeutendsten sudetenschlesischen Mundart- und Heimatdichters ein. Rudolf Heider
Literatur: Josef Walter König: Ihr Wort wirkt weiter. Wolfratshausen, 1966.
Josef Walter König: Viktor-Heeger-Bibliographie. Wolfratshausen, 1966.

Der Dialekt wurde in den Sudeten, also sowohl im Süden der früher preußischen Provinzen Niederschlesien (in den Gebieten um Hirschberg und Waldenburg bis Neiße) und Oberschlesien als auch im Norden Mährens und Österreichisch-Schlesiens und im äußersten Nordosten Böhmens, gesprochen. Die im Bereich des Lausitzer Berglandes und der Grafschaft Glatz gesprochenen Mundarten wurden nicht als Teil des Gebirgsschlesischen gesehen. Nach Flucht und Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg wird dieser Dialekt weitgehend nur noch in der Diaspora gesprochen und ist akut vom Aussterben bedroht. Das im Raum der Sudeten gesprochene Gebirgsschlesisch war eine sehr differenzierte Mundart. Sogar die Bewohner voneinander nicht weit entfernter Dörfer hatten eine sprachliche Eigenart. Im Allgemeinen ist das Gebirgsschlesische ein Teil des Ostmitteldeutschen, allerdings mit Begriffen, die aus der polnischen oder tschechischen Sprache stammen.
Auf dem Youtube-Kanal der Sudetendeutschen Landsmannschaft finden Sie Lesungen in verschiedenen Mundarten der Heimat. Angela Zumstein aus Merkelsdorf im Riesengebirge trägt „Baache“ im Gebirgsschlesischen vor: https://youtu.be/o2uYXzpkaHA
Faschingslost Faschingslost! Juchei, juche!
Hui, fliegen de Röckla ei de Höh‘, Jed‘s Quorkgesicht wird feierrot, Grußvoter denkt nie oa sein Spoht Ond mit‘n Harlen em de Welt, Tanzt‘s Herz eim Leibe a no met. Ja, Foschingslost is schorfer Wend. Verkühl Dich nie, du hübsches Kend, Ober‘sch Herzla popel nie orscht ein –Siech, dmol muß‘s gebrochen sein!
Viktor HeegerSchlesische Bauern-Cantate

Recit.
Ich? Söll doas Mensch noch nahma müssa?
Ich? Berna-Caspers-Paltzers Moid?
Ju nahma wielchse uffs Gewissa. Sä meent, ich hätser zugesoit; Doas wiel ich wull ne Lüga strohffa, Ich hoase mie as zwantzig mohl Uffs Hä geläht, an do beschlohffa; Allene doachse nahma sohl, Doas ihs nu wuhl ke Warck ver mich. Aria.
Su eh Pursche, wie ich bin, Wächst nich hinger alla Zoima. Ju verwuhr! ver su an Nickel Dächt mich, wür ich noch ah Brickel Goarze stoadlich an ze schin. Su ah Pursche, wie ich bin, Wächst nich hinger alla Zoima.
Daniel Stoppe
Mei grüne Schles‘, die hält ols Braut dan grünen Wald emschlonga, da Herrgott hot dos Poor getraut und die Engerln hons besonga
Und läh ich mich zur letzten Ruh, amol noch dan Gefrätte, dann beste deutsches Landla du, mei letztes grünes Bette. Und wenn da Herrgott sprecht he, du Megst nuff ein Himmel fliegen? Do sä ich lost mich doch ein Ruh
Ols arma Sender liegen.

Denn‘s kon bei eich ein Himmelreich

Da Wald nie schiener rauschen, warum soll ich fürs Himmelreich mei grüne Schles‘ vertauschen.
Arno Lubos: Geschichte der Literatur Schlesiens; II. Band. München, 1967.
Josef Walter König: Heimat im Widerschein. Heidenheim an der Brenz, 1978.



Josef Walter König: Viktor Heeger in der neueren Literaturgeschichtsschreibung. In: Altvater-Jahrbuch 1983. Heidenheim an der Brenz.
Humor
Wenn ich jemanden das höchste Glück der Welt schenken könnte, ich gäbe ihm nur den Humor, den Gott mir als das wertvollste Himmelsgeschenk in die Wiege legte.
Er ist der größte Wunderdoktor, der alte unheilbar scheinende Leiden erträglich macht oder gänzlich ausheilt, den Bazillus der Schwermut, des Griesgrams, der Raunzeritis im Entstehen tötet und den Lebensweg mit Sonne und Genuß überschüttet.
Viktor Heeger
