Kalender erinnert an verschwundene Orte im Erzgebirge (Seite 5)
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung

VOLKSBOTE HEIMATBOTE
Sudetendeutsche Zeitung
Jahrgang 75 | Folge 8 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 24. Februar 2023
Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutschen Landsmannschaft
Zeitung
Neudeker Heimatbrief
Zeitung







❯ Tag des Selbstbestimmungsrechts der Völker Gedenken
HEIMATBOTE
Neudeker Heimatbrief
HEIMATBOTE




Heimatbrief













VOLKSBOTE
VOLKSBOTE
an den 4. März 1919

Sudetendeutsche Zeitung
VOLKSBOTE



Neudeker Heimatbrief
VOLKSBOTE HEIMATBOTE
Dieses Bild ist das Symbol der blutigen Niederschlagung der friedlichen Proteste durch tschechoslowakische Truppen am








54 Tote, davon allein 25 in Kaaden: Der friedliche Protest der Sudetendeutschen für das Selbstbestimmungsrecht der Völker wurde am 4. März 1919 von tschechoslowakischen Truppen blutig niedergeschlagen.
Der Nationalismus, der später mit Hitlers Nationalsozialisten ganz Europa in eine Katastrophe führte, nahm damit seinen Lauf.
Nach dem Ende der CoronaBeschränkungen wird in diesem Jahr wieder in einer Reihe von Veranstaltungen an die Morde, deren Täter nie ermittelt und nie bestraft wurden, erinnert.
An der Gedenkstätte auf
dem Friedhof der Stadt Kaaden spricht am Samstag, 4. März, Margaretha Michel, stellvertretende Landesobfrau der SLLandesgruppe Bayern. Die zentrale Gedenkveranstaltung der SL-Landesgruppe BadenWürttemberg findet am Sonntag, 5. März, im Haus der Heimat in Stuttgart statt. Gastredner ist MdL Guido Wolf, ehemaliger Minister der Justiz und für Europa. Und auf der Veranstaltung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich im Haus der Heimat in Wien erinnert am Samstag MdEP a. D. Andreas Mölzer an den Massenmord. Alle Termine siehe Seite 4
❯ Das neue Staatsoberhaupt kündigte ein weiteres Treffen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder im Mai in Selb an
Tschechiens Präsident Petr Pavel auf
Vorstellungsrunde in München
Tschechiens Außenminister Jan Lipavský mit Generalkonsulin Ivana Červenková auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Foto: Mediaservice Novotny
❯ Sicherheitskonferenz





Lipavský vertrat Regierung
Mit Außenminister Jan Lipavský (Piratenpartei) war auch ein Mitglied der tschechischen Regierung auf der Münchner Sicherheitskonferenz vertreten.
Tschechiens oberster Diplomat nutzte das internationale Treffen im Hotel Bayerischer Hof, um Gespräche mit seinen Amtskollegen aus Finnland, Jordanien, der Mongolei, dem Kosovo und den Philippinen zu führen. Zu den Themen gehörten das sich verändernde internationale Sicherheitsumfeld angesichts der russischen Aggression in der Ukraine, Antworten auf neue Bedrohungen, die Rolle Frankreichs und Deutschlands in der europäischen Sicherheit sowie die Lage im Iran.



Außerdem nahm Lipavský an dem Treffen des designierten Präsidenten Petr Pavel mit dem polnischen Staatsoberhaupt Andrzej Duda teil.

Auf einer Podiumsdiskussion äußerte sich Lipavský besorgt über die Bedrohung der Demokratie durch Desinformationskampagnen.: „Der Kampf gegen Desinformation ist eine langfristige Herausforderung für die europäischen Demokratien und ihre Gesellschaften. Es ist schwierig, aber notwendig, genau zu definieren, gegen welche Desinformation wir auf welche Weise vorgehen, um die Meinungsfreiheit zu respektieren.“
Acht bilaterale Verhandlungen, zehn informelle Treffen und ein Auftritt bei einer Podiumsdiskussion: Petr Pavel, ab 9. März neues Staatsoberhaupt der Tschechischen Republik, hat die Münchner Sicherheitskonferenz genutzt, um sich bei den europäischen Nachbarn vorzustellen. Es war Pavels erste Auslandsreise nach der Wahl. „Als Präsident möchte ich dazu beitragen, unser Ansehen wiederherzustellen und zu zeigen, daß wir für die kommenden Jahre ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner sind“, erklärte Pavel seine Visite und twittere, er habe in München versucht zu zeigen, „daß die Tschechische Republik zu einer aktiven, koordinierten und nachvollziehbaren Außenpolitik auch auf der Ebene des Präsidenten“ zurückgekehrt sei.
Pavel war aus Karlsbad angereist, wo er den ersten Teil seines Versprechens eingelöst hat, jene Regionen zu besuchen, die mehrheitlich für seinen unterlegenden Konkurrenten Andrej Babiš gestimmt hatten. Keine leichte Reise. In Karlsbad wurde Pavel bei der Eröffnung eines Eishockeyspiels von einigen Zuschauern ausgepfiffen, in Eger seine Fahrzeugkolonne mit Eiern beworfen.
Karlsbad, aber auch die Regionen Aussig und der MährischSchlesische Kreis, die Pavel nach seiner Amtsübernahme besuchen wird, leiden unter großen strukturellen Problemen. „Meiner Meinung nach besteht die Rolle des Präsidenten darin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Deshalb bin ich als Zuhörer in die Karlsbader Region gereist, um mit den örtlichen Bürgermeistern, Industrievertretern, Studenten und Bürgern über die Hauptprobleme der jeweiligen Region zu sprechen“, sagte Pavel anschließend.
In München traf Pavel dann als ersten deutschen Politiker den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. „Ich ha-










Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über das Tre en mit Petr Pavel: „Es war mir ein Vergnügen, lieber General Pavel. Ich denke an die Bande, die die Tschechische Republik und Frankreich verbinden. Wir werden sie weiter stärken. Ich denke auch an Ihren Heldenmut, als Sie 1993 im ehemaligen Jugoslawien 53 französische Soldaten retteten, die unter Beschuß geraten waren. Freundlich und respektvoll.“




be dem Ministerpräsidenten die Probleme, die wir in Karlsbad besprochen haben, vorgetragen. Es gab eine große Bereitschaft, diese Probleme anzugehen“, sagte Pavel der Sudetendeutschen Zeitung und kündigte an, im Mai zu den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftstagen nach Selb zu
Petr Pavel über das Tre en mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda: „Die Beziehungen zu unseren polnischen Freunden sind von großer Bedeutung, umso mehr in diesen schwierigen Zeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ein baldiges Tre en in Warschau.“
reisen. „Ich werde den Ministerpräsidenten dort wiedersehen, und ich gehe davon aus, daß wir darüber sprechen werden, wie wir konkret die Dinge angehen können, die in der Karlsbader Region wirklich Probleme bereiten, wie zum Beispiel die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Petr Pavel über das Tre en mit dem litauischen Präsidenten Gitanas
Nausėda: „Wir teilen viel mehr als nur die Sicht auf Sicherheitsrisiken.

Aus diesem Grund habe ich Gitanas
Nausėda auch versichert, daß unser Bekenntnis zu Artikel 5 des Nordatlantikvertrags unbestreitbar ist. Vielen Dank für die Einladung nach Vilnius und für die Diskussion zu den Themen, die uns bereits im Juli auf dem Nato-Gipfel erwarten.“


Gesundheitsbereich und die Kooperation zwischen Polizei, Feuerwehr und anderen Kräften“, so Pavel im Gespräch mit der Sudetendeutschen Zeitung

Überschattet wurde die Münchner Sicherheitskonferenz vom mittlerweile ein Jahr andauernden russischen Angriffs-
krieg auf die Ukraine. Pavel, der als erster General eines ehemaligen Ostblockstaates von 2015 bis 2018 Vorsitzender des NatoMilitärausschusses war, forderte auf einer Panel-Diskussion im Hotel Bayerischer Hof, die Lage realistisch zu analysieren und auch Friedensgespräche nicht auszuschließen: „Niemand sollte die Ukrainer zu Zugeständnissen drängen, solange es eine echte Siegchance gibt, aber man sollte auch keine unerfüllbaren Hoffnungen und Erwartungen ohne wirkliche Grundlage wecken. Jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine. Es kann eine Situation entstehen, in der die Ukraine selbst der Meinung ist, daß der Preis für die Befreiung des bisher besetzten Territoriums zu hoch ist und die Ressourcen unzureichend sind. Aber nur die Ukraine kann eine solche Entscheidung treffen.“
Im Gespräch mit der Sudetendeutschen Zeitung sprach sich Pavel auch für weitere Rüstungsinvestitionen aus sowie für die Einhaltung der Nato-Vorgabe, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben: „Die Regierung von Petr Fiala hat sich darauf festgelegt, die zwei Prozent bis zu 2024 zu erfüllen, wie es aber jetzt aussieht, hat sich die Obergrenze zur Untergrenze entwickelt. So nähert sich beispielsweise Polen bereits der Marke von vier Prozent, in anderen Ländern sind es bereits über zwei Prozent. Ich denke, wir sollten uns nicht davon leiten lassen, wo wir die Meßlatte setzen, sondern zuerst den materiellen Bedarf definieren und dann ableiten, wie viel es uns kosten wird.“
Zu seinen weiteren Plänen sagte Pavel: „Nach der Amtseinführung auf der Prager Burg werde ich zu meinem ersten Staatsbesuch in die Slowakei reisen, dann nach Polen und am 21. März zu einem Staatsbesuch nach Berlin, wo ich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen werde.“
Pavel Novotny/Torsten Fricke


AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft und SL-Landesobmann Bayern, Ste en Hörtler, ist oft unterwegs nach Prag. Das gilt auch für die unermüdliche Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, Christa Naaß.
Anläßlich ihres letzten gemeinsamen Besuches in der Hauptstadt Tschechiens trafen sich die beiden mit dem Leiter der sudetendeutschen „Botschaft des guten Willens“, Peter Barton, in dessen Büro in der Thomasgasse.
Bei Ka ee und Kuchen besprachen die drei Zukunftspläne und Strategie der diesjährigen sudetendeutschen Politik in der Tschechischen Republik.
Christa Naaß präsentierte Barton in ihrem Dossier, was sie sich in der Verständigungsarbeit zwischen den Sudetendeutschen und den Tschechen vorstellt.
Das Prager Sudetendeutsche Büro, zwischen den beiden Kammern des tschechischen Parlaments gelegen, bleibt im Mittelpunkt der Bemühungen einer positiven Entwicklung sudetendeutscher Politik zur Tschechischen Republik.
❯ Seliger-Gemeinde würdigt Volkmar Gabert zum 100. Geburtstag und 20. Todestag

Erinnerungen an einen großen Sudetendeutschen
Tschechen für Anti-Rußland-Kurs
Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unterstützt mit 60 Prozent eine klare Mehrheit der Tschechen die Politik des Westens gegen Moskau, hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Stem ergeben. Ein Drittel der Tschechen sei sich dagegen unsicher, und fünf Prozent erklärten, sie seien pro-russisch.
Flüchtlinge arbeiten und zahlen Steuern
Sieben von zehn Flüchtlingen aus der Ukraine, die derzeit in Tschechien Schutz suchen und arbeiten, sind Frauen. Insgesamt waren Ende Januar 94 000 Flüchtlinge in Tschechien beschäftigt. Mit 190 400 hatten seit Kriegsbeginn mehr als doppelt so viele Flüchtlinge ein Visum mit einer Arbeitserlaubnis erhalten. Einige kehrten bereits in ihre Heimat zurück oder gaben ihre Arbeit auf, sagte eine Sprecherin des Arbeitsamtes. Laut Arbeitsminister Marian Jurečka (KDU–ČSL) haben die Flüchtlinge bis Ende letzten Jahres fast 8 Milliarden Kronen (340 Millionen Euro) an Steuern an den tschechischen Staat gezahlt.
Café Karel erinnert an Karel Gott
Zu Ehren des 2019 verstorbenen Sängers Karel Gott wurde jetzt in der Passage des Theaters Divadlo v Dlouhé im Stadtzentrum das Café Karel eröffnet. Das Café, das mit vielen Bildern des Künstlers dekoriert ist, wurde von dem Produzenten Miroslav Kolodziej und dem Journalisten Luboš Procházka initiiert. Mit dem Café wolle man einen Ort schaffen, an dem sich Fans von Karel Gott aus Tschechien und anderen Ländern treffen könnten, so Procházka.
Am Grab von Volkmar Gabert in Unterhaching (von links): die ehemalige Landtagsabgeordnete und Volkmar-Gabert-Biographin Hildegard Kronawitter, SPD-Landtagskandidatin Christine Himmelberg, Jürgen Salzhuber, Ehrenvorsitzender des AWO-Kreisverbandes, Dr. Helmut Eikam, ehemaliger Bundesvorsitzender der Seliger-Gemeinde, Dr. Nasser Ahmed, Co-Generalsekretär der Bayern-SPD, Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Christa Naaß, Co-Bundesvorsitzender der Seliger-Gemeinde und Präsidentin der SL-Bundesversammlung, sowie Peter Wesselowsky, Landesvorsitzender der Seliger-Gemeinde. Fotos: Torsten Fricke

Unter seiner Führung als Parteivorsitzender hat die bayerische SPD 1966 ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielt: 35,8 Prozent. An diesen Erfolg, aber vor allem an sein unermüdliches Engagement für Demokratie und Menschenrechte erinnerte die Seliger-Gemeinde am Sonntag in Unterhaching und würdigte den 100. Geburtstag und 20. Todestag von Volkmar Gabert.
Geboren wurde Volkmar Gabert am 11. März 1923 in Dreihunken in Nordböhmen. Nach der Rückkehr aus der Emigration vor den Nazis war er von 1950 bis 1978 Mitglied des Bayerischen Landtags, von 1963 bis 1972 Vorsitzender der SPD in Bayern, von 1979 bis 1984 Mitglied des Europäischen Parlaments und ab 1986 viele Jahre Bundesvorsitzender der Seeliger-Gemeinde. Kurz vor seinem 80. Geburtstag verstarb Gabert am 19. Februar 2003 und fand seine letzte Ruhestätte in Unterhaching.
Daß Gaberts Wirken auch zwei Jahrzehnte nach seinem Tod nicht vergessen ist, zeigte die hochrangige Rednerliste: Christa Naaß, Co-Bundesvorsitzende der Seliger-Gemeinde und Präsidentin der SL-Bundesversammlung, Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Bayerischen Landtags und in dieser Funktion ein Nachfolger von Gabert, Dr. Nasser Ahmed, der neue Co-Generalsekretär der Bayern-SPD, der extra aus Nürnberg angereist war, und Peter Wesselowsky, der Landesvorsitzende der Seliger-Gemeinde. Ebenfalls am Grab waren SL-
Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann sowie die ehemalige Landtagsabgeordnete Hildegard Kronawitter, die in ihrem 1996 erschienenen Buch „Gespräche mit Volkmar Gabert.
Ein politisches Leben“ das Vermächtnis des großen Sozialdemokraten und langjährigen Vorsitzenden der Seliger-Gemeinde festgehalten hat.
„Die Kräfte der Freiheit unterstützen“ laute das diesjährige Motto der Seliger-Gemeinde, sagte Christa Naaß in ihrer Gedenkrede, und erklärte, dies gehe zurück auf ein großes Zitat von Volkmar Gabert, das gerade heute wieder aktuell sei: „In der ganzen Welt gibt es ein Auf und Ab zwischen Freiheit und Unterdrückung. Es ist unsere Aufgabe, alles zu tun, die Kräfte der Freiheit zu unterstützen.“
„Was Freiheit auf der einen und Unterdrückung auf der anderen Seite bedeuten, hat Volkmar Gabert als 15jähriger bereits erfahren müssen, als er mit seinen Eltern vor den Nationalsozialisten nach Prag floh und von dort aus im Jahr 1939 nach England emigrierte. Dort betätigte er sich bei der sozialistischen Exiljugend und wirkte im Exilvorstand der sudetendeutschen Sozialdemokraten unter Wenzel Jaksch mit“, so Naaß. Gabert wurde bereits früh sozialdemokratisch geprägt, erinnerte Markus Rinderspacher: „Seine Eltern, beide Lehrer, waren Mitglieder der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Wie viele ihrer sozialdemokratischen Gesinnungsgenossen mußten die Gaberts vor
den Nationalsozialisten aus ihrer Heimat fliehen.“ In seinem Exil in England schlug sich Gabert als Landarbeiter, Monteur und Eisendreher durch und gehörte dem Exilvorstand der sudetendeutschen Sozialdemokraten an. Nach dem Krieg kam er mit der US-Armee nach München und engagierte sich für die vertriebenen Sudetendeutschen.
„1950 wurde er mit nur 27 Jahren als jüngster Abgeordneter in den Bayerischen Landtag gewählt“, sagte Rinderspacher und würdigte auch Gaberts Rolle für das Zustandekommen der Deutsch-Tschechischen Erklärung und dessen Wirken im Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds: „Was heute relativ selbstverständlich klingt, war in den 1960er und 1970er Jahren alles andere als selbstverständlich. Die Versöhnungspolitik der SPD unter Willy Brandt war hochumstritten, insbesondere unter den Vertriebenen. Es waren Menschen wie Volkmar Gabert, die die Brücke geschlagen haben zwischen den Heimatvertriebenen und der SPD. Gabert war prinzipientreu, charakterfest und tolerant.“
Peter Wesselowsky, Landesvorsitzender der Seliger-Gemeinde, stellte heraus, daß nicht nur Volkmar Gabert hier seine letzte Ruhestätte gefunden habe, sondern auch dessen Ehefrau Inge, die sich viele Jahre als Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Bayern engagiert hatte. „Das war eine ideale, kongeniale Partnerschaft.“
Die Grabinschrift „Dem Men-

schen verbunden“ passe auf beide. Gabert sei eine der Persönlichkeiten gewesen, die nach dem Krieg maßgeblich die Demokratie in Deutschland aufgebaut haben. „Er war ein großer Europäer. Seine Vision war, daß Frieden, Freiheit und Fortschritt zusammenwirken müssen. Solidarität darf kein leerer Begriff sein.“
„Wir verneigen uns vor einem unserer ganz Großen“, sagte Dr. Nasser Ahmed, der neue Co-Generalsekretär der Bayern-SPD. Volkmar Gaberts Wahlerfolg von 35,8 Prozent sei auch heute noch die Meßlatte und zeige, was die Sozialdemokraten in Bayern erreichen könnten.
Gaberts Werdegang vom Exilanten und Heimatvertriebenen zu einem der führenden Politiker Bayerns sei beachtlich. „Das zeigt auch, was die Stärke Bayerns ausmacht, die Vielfalt. Es zeigt auch, was man in unserem Land erreichen kann – mit und durch die Sozialdemokratie“, so Ahmed. Volkmar Gabert sei deshalb Vorbild für alle nachkommenden Generationen.
„Gabert hat durch die Sozialdemokratie die Kraft gefunden, dem Wahnsinn des Krieges, dem Nationalismus und dem Faschismus die Demokratie entgegenzusetzen und Bayern durch Integration und Modernisierung zu bereichern“, sagte Ahmed und fügte an, daß auch sein Vater vor Krieg und Diktatur geflohen sei. „Er hat meinen Bruder und mich dazu erzogen, daß es sich immer lohnt, für Freiheit, Gleichheit und Solidarität zu kämpfen.“ Torsten Fricke
aus den Niederlanden und Belgien. Einsparungen beim Verbrauch trugen ebenfalls dazu bei, die Abhängigkeit von Rußland zu verringern, hat Industrieund Handelsminister Jozef Síkela (parteilos) mitgeteilt. In den letzten fünf Monaten ist der Anteil der russischen Gasimporte in die Tschechische Republik bereits auf 2,2 Prozent gesunken. In den Vorjahren lag der Anteil noch bei rund 97 Prozent.
Tontechniker für Oscar nominiert
Bei der Verleihung des englischen Filmpreises Bafta Awards ist am Sonntag in London der tschechische Tontechniker Viktor Prášil für seine Arbeit am deutschen Antikriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ mit dem Preis für den besten Ton ausgezeichnet worden. Mit dem Werk ist Prášil auch für einen Oscar nominiert. In anderen Kategorien könnten für ihre Arbeit an dem Film auch drei weitere Tschechen mit einem Academy Award ausgezeichnet werden. Die Oscars werden in diesem Jahr am 13. März verliehen.
Militärhilfe
für die Ukraine
Kein Gas mehr aus Rußland
Die Gaseinfuhren aus Rußland in die Tschechische Republik sind im Januar auf null zurückgegangen. Das Land ersetze russisches Gas durch Gasimporte aus Norwegen und LNG
Die Tschechische Republik hat der Ukraine bisher ungenutztes Militärmaterial aus den Beständen der tschechischen Armee im Wert von rund 4,8 Milliarden Kronen (200 Millionen Euro) gespendet. Auch tschechische Rüstungsunternehmen liefern Waffen in die Ukraine und haben Militärmaterial im Wert von mehr als 50 Milliarden Kronen in das von Rußland angegriffene Land exportiert, hat ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärt. Im Januar erhielt Tschechien dafür eine erste Entschädigung in Höhe von 6,5 Millionen Euro von der Europäischen Union. Auch die USA sagten Geld für die Modernisierung der tschechischen Armee zu, die Summe soll bei 200 Millionen US-Dollar liegen. Die Tschechische Republik sei einer der Hauptlieferanten von Militärausrüstung für die Ukraine, und zwar sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zur Größe des Landes, so Verteidigungsministerin Jan Černochová (ODS).
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

ZKZ
Mit Leib und Seele für den Böhmerwald

März 2023 • 76. Jahrgang 5,20 Euro MeinLeben mitmeinerKunst
Karl Klostermann „Böhmerwaldskizzen“

Das Glasmuseum in Frauenau
Die Papierfabrik „Moldaumühl“
Im Gespräch mit Franz X. Höller
Dr. Gernot Peter, Heimatkreisbetreuer von Prachatitz.
Das Ehrenamt kennt keine Grenzen: Zwischen Wien, dem Böhmerwald und Ingolstadt ist Dr. Gernot Peter als Heimatkreisbetreuer unterwegs.
Die erste Berührung mit der Familiengeschichte hatte der 1962 in Wien geborene Gernot Peter, als eine Großtante immer wieder von den landschaftlichen Schönheiten des Böhmerwalds erzählte. Später fand er alte Fotos bei seinen Großmüttern und begann bald, die ersten Stammtafeln zu zeichnen, um sich in der weit verzweigten Verwandtschaft zurechtzufinden. Es folgten Besuche bei nahen und entfernten Verwandten im In- und Ausland.
„Rechtzeitig fragen, das Gehörte aufschreiben, Fotos beschriften, Dokumente sammeln und kategorisieren, ist für jeden Familienforscher das Um und Auf“, das ist Peters Motto. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs reiste Peter nach Böhmen und erkundete dort die Herkunftsorte seiner Familie.
Seine Vorfahren stammen aus dem Böhmerwald, dem Egerland, dem Erzgebirge und Nordböhmen. Die väterliche Linie lebte in Buchwald (Bučina), dem einstmals höchstgelegenen besiedelten Ort des Böhmerwalds an der bayerischen Grenze bei Finsterau. Der Ort und auch die umliegenden Gemeinden wurden nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstört und verschwanden von der Landkarte.

Die Familie war von der Vertreibung jedoch nicht betroffen, da bereits der Urgroßvater Franz Peter als Lehrer in Niederösterreich Arbeit fand, und der Großvater Oskar Peter war Arzt in Krems an der Donau.
Die mütterlichen Vorfahren stammen aus dem Egerland aus Orten zwischen Staab (Stod) und Mies (Stříbro) und aus der Klattauer Gegend. Auch hier ging der Urgroßvater nach Österreich, um in Wien bei der Postund Telegraphendirektion eine Karriere aufzubauen. In Wien und in Krems wuchs auch Gernot Peter auf.
Die Parallelen zwischen den Schilderungen der inzwischen in Deutschland lebenden Verwandten, die über Flucht und Vertreibung aus eigenem Erleben berichteten, und dem gleichzeitig tobenden Jugoslawien-Krieg veranlaßten Peter, sich ab den 1990er Jahren für die Verständigung über die Grenzen hinweg
zu engagieren. So nahm die Familie Flüchtlinge aus Bosnien auf und betreute sie über längere Zeit.
Die Erforschung der Familiengeschichte brachte Gernot Peter in Berührung mit dem literarischen Nachlaß seines UrUrgroßonkels, des Böhmerwald-Schriftstellers Johann Peter (1858–1935). So entstand im Laufe der Jahre nicht nur eine Sammlung von über 80 000 Personen mit ihren familiengeschichtlichen Daten, sondern auch der Kontakt zum Böhmer-
waldmuseum Wien, dem Gernot Peter seit 1995 angehört und dessen ehrenamtliche Leitung er seit 1998 neben seinem Beruf als Projektmanager einer international tätigen Bank ausübt.
Seit dieser Zeit wurde das Museum einem größeren Besucherkreis bekannt gemacht, die Sammlung laufend ergänzt und archiviert sowie zahlreiche Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Böhmerwaldbund Wien organisiert.

Zahlreiche Vorträge hat Gernot Peter im In- und Ausland be-
reits gehalten und so die Kontakte des Museums ausgebaut.


Im Jahr 2016 übernahm Peter zusätzlich den Vorsitz des Böhmerwaldheimatkreises Prachatitz mit Sitz in Ingolstadt. Der Heimatkreis betreut ein Museum über Stadt und Landkreis Prachatitz in Ingolstadt und die Bischof-Neumann-Kapelle auf dem Dreisesselberg. Er gibt weiters die Monatsschrift „Böhmerwäldler Heimatbrief“ heraus, eine der drei noch existierenden Zeitschriften über den Böhmerwald, dessen historische Ausgaben im vergangenen Jahr vollständig digitalisiert wurden.
Seit 2019 erscheint die Zeitschrift unter dem Titel „Der Böhmerwald“ und mit einem neuen professionellen Layout. „Der Böhmerwald“ wird monatlich an Abonnenten in Deutschland, Österreich und Tschechien verschickt und ist im östlichen Bayern auch in Geschäften erhältlich. „Durch dieses Konzept konnten viele neue Abonnenten aus dem Grenzgebiet gewonnen werden“, berichtet Peter. Neben den jährlichen Sonderausstellungen im Böhmerwaldmuseum Wien erwähnt Gernot Peter die laufenden Projekte, die ihm besonders am Herzen liegen. In Ingolstadt wird derzeit das Heimatmuseum neugestal-

tet. Auch die umfangreichen Archivierungsarbeiten sollen heuer abgeschlossen werden. Nicht zuletzt durch die Übernahme der Heimatstube Bergreichenstein wurde die Sammlung in den letzten Jahren deutlich erweitert.
Weiters bereiten die ehrenamtlichen Mitglieder des Heimatkreises das jährliche Treffen im April vor, das heuer mit Unterstützung von Schülern aus zwei Gymnasien in Ingolstadt und Prachatitz gestaltet wird. Die bayerisch-tschechische Schulpartnerschaft kam auf Vermittlung von Gernot Peter mit der Unterstützung der Schuldirektoren zustande, worüber er sich besonders freut. „Schulpartnerschaften sind nicht nur wichtig für das gegenseitige Verständnis über geographische und sprachliche Grenzen hinweg, sie bieten auch die Möglichkeit, die gemeinsame Geschichte mit allen Höhen und Tiefen und ihre Lehren daraus in Erinnerung zu rufen und der jungen Generation zu vermitteln“, ist Peter überzeugt.
Ein weiteres Projekt, das in Zusammenarbeit der Böhmerwaldmuseen Wien und Passau unter Federführung des Böhmerwaldbunds Oberösterreich angelaufen ist, umfaßt die Neugestaltung und inhaltliche Erweiterung
❯ Sonderausstellung zum 100. Geburtstag des weltberühmten Schriftstellers aus Reichenberg

Die aktuelle März-Ausgabe der Zeitschrift „Der Böhmerwald“.
der „Historischen Datenbank Böhmerwald“, die im Internet unter www.bwb-ooe.at aufrufbar ist und nach Abschluß die weltweit größte Quelle für Fotografien aus dem historischen Böhmerwald darstellen wird.
Neben diesen inhaltlichen Schwerpunkten für 2023 besteht das Tagesgeschäft aus der Mitwirkung am Entstehen der jeweils nächsten Ausgaben der Zeitschrift „Der Böhmerwald“ und der Gestaltung der nächsten Sonderausstellungen in den Museen in Wien und Ingolstadt. Seit 2023 gehört Peter auch der Jury der Sudetendeutschen Landsmannschaft an, die über die Vergabe von Förder- und Kulturpreisen entscheidet. Für seine Verdienste wurde Gernot Peter 2022 mit dem Kulturpreis der Stadt Passau für die Böhmerwäldler ausgezeichnet (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). In seiner Dankesrede betonte Peter, daß er die Auszeichnung vor allem als eine Anerkennung für eine langjährige Teamarbeit betrachte. Eine besonders intensive Zusammenarbeit verbindet ihn mit Franz Kreuss, dem Leiter des Böhmerwaldbundes Wien und stellvertretenden Leiter des Wiener Böhmerwaldmuseums, sowie mit Rudolf Hartauer, dem Schriftleiter der Zeitschrift „Der Böhmerwald“, mit Hans Schopf vom Morsak-Ohetaler Verlag und mit Edmund Koch und Oswin Dotzauer in Ingolstadt.
Mit dem in Krummau geborenen Luděk Němec konnte erstmals ein junger Tscheche als zweiter Vorsitzender des Böhmerwaldheimatkreises Prachatitz gewonnen werden, der in Wien Geschichte studiert und sich bereits als Buchautor einen Namen gemacht hat.
Gernot Peter hat im Laufe der Jahre ein großes Netzwerk an Kontakten aufgebaut und versteht sich als Brückenbauer zwischen der Vertriebenengeneration und den Nachfolgegenerationen sowie zu den heutigen Bewohnern des Böhmerwaldes, deren Interesse an der Geschichte im Steigen begriffen ist.
„Dieses Engagement wäre ohne die Unterstützung und Hilfe meiner Frau Christina nicht möglich“, so Peter, der auch bei seinen Vorträgen immer wieder auf die Wichtigkeit der Unterstützung durch die Familie für das Ehrenamt hinweist.
Sudetendeutsches Museum würdigt Otfried Preußler
Sein 20. Todestag am 18. Februar verstrich ohne große öffentliche Aufmerksamkeit, aber zum 100. Geburtstag am 20. Oktober wird mit einer Reihe von Veranstaltungen an den weltberühmten Schriftsteller Otfried Preußler erinnert.
Höhepunkt des Otfried-Preußler-Gedenkens ist eine Son-
derausstellung des Sudetendeutschen Museums, die unter dem Titel „Ein bisschen Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten“ am 20. Juli eröffnet und bis zum 12. November gezeigt wird. Begleitet wird die Sonderausstellung mit einer Reihe von Veranstaltungen.
Der in Reichenberg geborene Schriftsteller schuf 32 Kinder-
bücher, die in 55 Sprachen übersetzt, und eine Gesamtauflage von 50 Millionen Exemplaren erreichten. Die bekanntesten Titel sind „Der Räuber Hotzenplotz“, „Das kleine Gespenst“ und „Die kleine Hexe“. Bereits als Kind geprägt wurde Preußler durch seine Großmutter Dora, die ihm viele böhmische Sagen erzählt hatte. Auch sein Vater, mit dem
er oft im Isergebirge unterwegs war, war eine wichtige Bezugsperson.
1979 wurde Preußler von der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis ausgezeichnet. Es folgten viele weitere Ehrungen, wie das Große Bundesverdienstkreuz und der Bayerische Verdienstorden.
„Zukunft vorbei?“ Paneuropäer diskutieren über unser Europa
Unter dem Motto „Zukunft vorbei?“ lädt die Paneuropa-Union Deutschland in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatskanzlei und dem Europäischen Institut für politische, wirtschaftliche und soziale Fragen zum traditionellen Andechser Europatag ein, der am Samstag, 25. und Sonntag, 26. März zum 59. Mal im Klostergasthof Andechs stattfindet.

Die EU-Konferenz zur Zukunft Europas hat nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Das Europaparlament fordert nun einen Konvent zur EUReform. Als Paneuropäer wollen wir in Andechs Gedanken entwickeln, um uns in diesen Prozeß kompetent und aktiv einzubringen“, erklärt Bernd Posselt, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, das Tagungsmotto.
Das Programm
Samstag, 11.00 Uhr: Begrüßung durch Bernd Posselt. Geistliches Grußwort Pater Valentin Ziegler OSB, Kloster Andechs.
11.30 Uhr: Prof. Wilfried Loth, Universität Duisburg-Essen, „Europas Einigung. Eine unvoll-

■ Dienstag, 28. Februar, 18.30 Uhr, Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste: „Goethe in Böhmen –oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.

■ Dienstag, 28. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Tschechien erlesen. Deutsch-tschechische Familiengeschichten“. Alice Horáčková (Rozpůlený dům; Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika Jonášová (Ada, 2022) setzen sich in ihren Werken kritisch mit dem deutsch-tschechischen Zusammenleben anhand ihrer persönlichen Familiengeschichte auseinander. Moderation: Zuzana Jürgens. Tschechisches Zentrum München, Prinzregentenstraße 7, München, Eintritt frei.
■ Dienstag, 28. Februar, 18.00 bis 19.30 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Die Donau – 3000 Kilometer Europa“. Vortrag und Podiumsdiskussion mit Dr. Márton Méhes. Landesvertretung von Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, Berlin.

■ Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Český klub Zürich in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder: „Arnošt Lustig: Tacheles“. Autor und Journalist Karel Hvížďala stellt sein Buch über Arnošt Lustig vor, der ihm kurz vor seinem Tod Einblick in sein bewegtes Leben gewährt hatte. Bar und Buchhandlung „sphères“, Hardturmstraße 68, Zürich.
■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 12. März, Tschechisches Zentrum: Mittel Punkt Europa Filmfest 2023. Das 2016 gegründete Festival des mittel(ost)europäischen Films präsentiert jedes Jahr handverlesene Produktionen aus den östlichen Nachbarländern Polen, Tschechien, Ungarn, Belarus sowie der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter www.mittelpunkteuropa.de. Filmmuseum München, Sankt-Jakobs-Platz 1, München.
■ Samstag, 4. März, 13.00 bis 17.00 Uhr, Kuhländler Tanzgruppe in Kooperation mit der Sudetendeutschen Heimatpfle-
Bernd Posselt, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, mit dem Europaabgeordneten Manfred Weber und Paneuropa-Bundesgeschäftsführer Johannes Kijas.






endete Geschichte“.

13.45 Uhr: Ismail Ertug MdEP (SPD), Mitglied des Verkehrsausschusses im Europäischen Parlament, „Mehr Zusammenhalt für Europa: Schnellbahn-Magistralen und transeuropäische Netze“.
15.00 Uhr: Marlene Mortler MdEP (CSU), Mitglied des Landwirtschaftsausschusses im Europäischen Parlament, „Ernährungssicherheit Europas in Zei-

ten weltpolitischer Krisen“.
16.30 Uhr: General a. d. Walter Spindler, Präsidiumsmitglied der Paneuropa-Union Deutschland, „Europäische Verteidigungsgemeinschaft – Schritte jenseits des Status quo“.

17.30 Uhr: Bernd Posselt, „Außenpolitische Souveränität –wann macht sich Europa auf den Weg?“
19.00 Uhr: Bühnengespräch „Genuß verbindet – die kulina-
VERANSTALTUNGSKALENDER
ge: Kuhländler Tänze, Tanzkurs mit und ohne Vorkenntnisse. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Teilnahme nur mit Voranmeldung unter Telefon (089) 48 00 03 65 oder per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Heimatkreis KaadenDuppau: Erinnerung an die Opfer des 4. März 1919 an der Gedenkstätte auf dem Friedhof der Stadt Kaaden. 13.45 Uhr Treffen am Haupteingang des Friedhofs neben dem Omnibusbahnhof.
Ansprechpartner: Margaretha
Michel (0 92 31) 36 54.
■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: Sudetendeutsches Gedenken zum 104. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht 78 Jahre nach Beginn der Vertreibung. Festredner MdEP a.D. Andreas Mölzer. Musikalische Umrahmung durch das Bläserquartett Weinviertler Buam. Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.
■ Samstag, 4. März, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Nürnberg: Gedenkfeier für das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen im Jahre 1919. Mahnmal „Flucht und Vertreibung“, Hallplatz, Nürnberg.
■ Sonntag, 5. März, 9.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Hof: Gedenkgottesdienst für die Opfer des 4. März 1919. Die Gedenkrede hält Bezirksobfrau Margaretha Michel. Pfarrkirche Maria-Königin des Friedens, Badstraße 19, Bad Steben.
■ Sonntag, 5. März, 10.00 bis 15.00 Uhr, Kuhländler Tanzgruppe in Kooperation mit der Sudetendeutschen Heimatpflege: Kuhländler Tänze, Tanzkurs mit und ohne Vorkenntnisse. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Teilnahme nur mit Voranmeldung unter Telefon (089) 48 00 03 65 oder per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Mittwoch, 8. März, 13.00
rische Dimension Europas“ mit Dr. Peter Peter, Dozent für Gastrosophie und Kulinaristik an der Universität Salzburg.
20.00 Uhr: Gemeinsames Abendessen und paneuropäisches Beisammensein.
Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche zu Ehren des Heiligen Benedikt.
10.30 bis 13.00 Uhr: Diskussionsforum „Hat das Christentum Relevanz für ein sich einigendes Europa?“ unter anderem mit Prof. Ingeborg Gabriel (Institut für Sozialethik an der Universität Wien), MdEP Manfred Weber (Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei), Marian Offman (Jüdische Gemeinde, Beauftragter der Landeshauptstadt München für den interreligiösen Dialog) und Prof. Davor Džalto (serbisch-orthodoxer Theologe an der Universität Stockholm und Ikonenmaler).
Moderation: Dr. Dirk H. Voß, Verfassungsrechtler und internationaler Vizepräsident der Paneuropa-Union.


Anmeldungen an das Paneuropa-Büro, Dachauer Straße 17, 80335 München, Telefon (0 89) 55 46 83, Telefax (0 89) 99 95 49 14, eMail paneuropa-union@ t-online.de
März unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
❯ Das Museum Flugt in Oksb
øl

Deutsche Flüchtlinge in Dänemark

■ Dienstag, 7. März, 19.00
Uhr: „Deutsche auf der Flucht: Die deutschen Flüchtlinge in Dänemark 1945–49 und das neue Museum Flugt“. Referent: John V. Jensen (Museum zur Flucht in Dänemark).
Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
bis 22.30 Uhr: Weltfrauentag im Sudetendeutschen Museum in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum München. 13.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus Mohr. 16.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus Mohr. 19.30 Uhr: Konzert der tschechischen Frauenrockgruppe K2 im Adalbert-Stifter-Saal. Hochstraße 10 und 8, München.
■ Donnerstag, 9. März, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde München: Literarisches Café: Rena Dumont liest aus ihrem Buch „Die Mühle“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Eintritt: 10 Euro.
■ Donnerstag, 9. März bis Freitag, 14. April: BdV-Landesverband Hessen: Wanderausstellung des Hauses des Deutschen Ostens: „Wer bin Ich? Wer sind Wir? – Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags 10.00 bis 17.00 Uhr, freitags 10.00 bis 14.00 Uhr. Haus der Heimat, Friedrichstraße 35, Wiesbaden.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe MünchenStadt und -Land: Veranstaltung „Tag des Selbstbestimmungsrechts zur Erinnerung an den 4. März 1919 im Sudetenland und die Volksabstimmung am 20. März 1921 in Oberschlesien“.
Festredner: Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung. Sudetendeutsches Haus, AdalbertStifter-Saal, Hochstraße 8, München.
■ Montag, 13. März, 11.00 bis 17.00 Uhr: „Unsere Heimatsammlung“. Treffen für Betreuer sudetendeutscher Heimatstuben. Anmeldung bis 6.
■ Mittwoch, 15. März, 19.00 Uhr: „Erinnerungen an das Internierungslager Hodolein in Olmütz – Das Tagebuch der Dr. Erika Frömel“. Vortrag und Podiumsdiskussion. Dokumentationszentrum Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, Berlin.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 26. März, 9.00 bis 16.00 Uhr: Landesfrühjahrstagung „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“ . Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.
■ Sonntag, 26. März, 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Auf a Melange im Café Central“. Konzeption im Auftrag des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg mit Anna-Sophia Krauss (Violine), Christoph Weber (Klavier), Carsten Eichenberger in der Rolle des Kellners Leopold und Iris Marie Kotzian (Sopran). Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.






■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Buchpräsentation mit Dr. Eva Haberl, Direktorin der Regionalcaritas Schlukkenau: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“. Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 , München. Unkostenbeitrag 20 Euro pro Person für eine Verkostung von drei Gerichten aus dem Kochbuch. Anmeldung unter eMail poststelle@hdo. bayern.de
Von Februar bis Mai 1945 kamen etwa 240 000 deutsche Flüchtlinge aus dem östlichen Europa nach Dänemark, wo sich bereits rund 100 000 verwundete Wehrmachtsangehörige aufhielten. Viele befanden sich nach der Flucht in einem körperlich schlechten Zustand; die Kindersterblichkeit war insbesondere in den Monaten vor und nach der deutschen Kapitulation im Frühjahr 1945 beträchtlich.
 John V. Jensen studierte
John V. Jensen studierte
– nach Aufenthalten in London, München und Prien am Chiemsee – Geschichte, Philosophie und Literatur an der Universität Aarhus in Dänemark sowie an der Universität Greifswald. Einer Beschäftigung an der Königlichen Bibliothek in Aarhus folgte 2005 die Anstellung als Museumsinspektor bei den Varde-Museen, zu denen das Museum FLUGT zählt. Seitdem setzt er sich mit dem Thema deutscher Vertriebener und Flüchtlinge in Dänemark auseinander, wozu er mehrere Artikel und Bücher verfaßte, unter anderem das vor kurzem erschienene Werk „Deutsche auf der Flucht“. Aktuell forscht er zum Flüchtlingslager in Oksbøl sowie zur demokratischen Ausbildung in den dänischen Flüchtlingslagern.
1000 Jahre Nachbarschaft von Tschechen und Deutschen
■ Dienstag, 7. März, 18.00 bis 20.00 Uhr: Onlineseminar „1000 Jahre Nachbarschaft“. Gespräch mit Prof. Dr. Arnold Suppan, em. Hochschuldozent aus Wien. Veranstaltung für historisch-politisch Interessierte. In diesem Seminar wird der Referent Prof. Dr. Arnold Suppan (Foto: Österreichische Akademie der Wissenschaften/Elia Zilberberg) ausgewählte Ausschnitte aus seinem Buch vortragen, die die nachbarschaftliche Entwicklung der deutsch- und tschechischsprachigen Einwohner im Donau- und Sudetenraum vom 9. bis ins beginnende 21. Jahrhundert darstellen. Hierbei werden vorerst die Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Heiligen Römischen Reich unter den verschiedenen Herrschergeschlechtern – besonders der Přemysliden, Babenberger, Luxemburger und frühen Habsburger –verglichen, ab 1526 die gemeinsame Geschichte in der Habsburgermonarchie mit den Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg und den Reformen unter Maria Theresia und Joseph II. dargestellt. Besonders hervorgehoben wird das Jahrhundert der nationalen „Konfliktgemeinschaft“ – der österreichisch-tschechischen wie der tschechisch-deutschen – zwischen 1848 und 1948, das sowohl das Zeitalter Franz Josephs und den Ersten Weltkrieg als auch die Erste Republik in Österreich und der Tschechoslowakei, sowie die Zivilisationsbrüche in der Zeit der NS-Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges, schließlich Vertreibung und Zwangsaussiedlung nach 1945 erfaßt.

Die Darstellung berücksichtigt die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung über die Jahrhunderte ebenso wie die Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Eigene Schwerpunkte stellen der Vertrag von Saint-Germain 1919, das Münchener Abkommen 1938 und die Beneš-Dekrete dar. Abschließend werden die Trennung durch den Eisernen Vorhang, die gesellschaftspolitische Wende von 1989/90 und die neue Nachbarschaft in der EU erörtert.
Interessierte können sich über den Link https://zoom.us/ meeting/register/tJ0pdOigrzkpEtRYNyBklT0AVNh9M-vHYyRZ anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Heiligenhofs (www.heiligenhof.de) unter Unsere Seminare/Seminarprogramm.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
� Alles begann 2018 mit einer Dokumentation über verschwundene Gasthäuser im sächsisch-böhmischen Erzgebirge
Kalender „Verschwundene Orte“
zeigt
die Folgen der Vertreibung
Die Verbindung zwischen Breitenbrunn auf sächsischer Seite und Abertham auf der böhmischen Seite des Erzgebirges ist in den letzten beiden Jahrzehnten wieder viel enger geworden. Viele Initiativen stehen dafür, wie die Wiedererrichtung der Nepomuk-Kapelle in Halbemeile 2013 (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). Bemerkenswert ist auch das Kalenderprojekt „Verschwundenen Orten am Erzgebirgskamm“, das der Breitenbrunner Klaus Franke initiiert und mit historischen Fotografien, Postkarten und Lageskizzen ergänzt hat. Nach vier Ausgaben erschien 2023 der vorerst letzte Kalender.
Überreicht hatte Klaus Franke eines der letzten Kalenderexemplare in der Fernsehsendung „Riverboat“ des Mitteldeutschen Rundfunks dem Moderator Jörg Kachelmann. Im Eingangstext unter einem reproduzierten Ölgemälde von Gustav Zindel (1883-1959) aus der Zeit der Monarchie, welches die Huldigung des Erzgebirges durch Kaiser Franz Joseph I. zeigt, schreiben die Autoren, zu sehen seien in diesem Kalender wieder völlig verschwundene Orte oder einstige Ortschaften, von denen noch einzelne Häuser beziehungsweise Gebäudereste erhalten sind. „Das Dorfleben wie es früher war, mit Kirche, Gemeindeamt, Schule, Gasthäuser und landwirtschaftlichen Bauerngehöften ist nicht mehr zu finden. Die Natur hat sich diese Gebiete zurückerobert. Deshalb haben die verlassenen Orte einen Hauch von Romantik. Das Schicksal der Bewohner, die ihre Häuser und Gehöfte damals verloren, ob durch die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschböhmen, durch Talsperrenbau oder Sperrzonen, berührt viele Menschen. Heute gibt es nur noch wenige einzelne ständig bewohnte Häuser abseits der Zivilisation. Ein solches Leben im Gebirge ist besonders im Winter heute kaum denkbar. Einige noch vorhandene Wohngebäude werden als Wochenendhäuser oder Urlaubsunterkünfte in ruhiger Lage genutzt. Unser Anliegen ist es, an die Geschichte zu erinnern und daran, wie hart das Leben der Bewohner am Erzgebirgskamm früher war.“
Wie gewohnt auf Deutsch und auf Tschechisch informiert der diesjährige Kalender über Ortschaften vor allem auf tschechischem Gebiet wie Pechöfen, Ziegenschacht, Arletzgrün und Honnersgrün, Kaff, Kunau und Haadorf, Pöllma, Mühlhäuser, Goldenhöhe, Wölfing, Wenkau oder Ullersgrün, die alle mehr oder weniger verschwunden sind. Aber vor allem auch über Neuoberhaus auf deutschem Gebiet, das zwischen 1950 und 1956 zu einer Siedlung mit Baracken mit bis zu 3000 Menschen, die darin wohnten und für die Wismut und den Uranabbau arbeiteten, ausgebaut wurde. Nach vielen verschiedenen Nachnutzungen wurde Neuoberhaus 1992 komplett rückgebaut und das Areal aufgeforstet.
Angefangen hatte alles mit einem Kalender 2018 über verschwundene Ausflugs-Gaststätten im sächsisch-böhmischen Erzgebirge. „Diese Gasthäuser“, wie die Autoren damals schrieben, „waren meist aus purer Not entstanden: Die Leute waren arm, betrieben eine kleine Landwirtschaft, arbeiteten außerdem noch im Bergwerk oder als Waldarbeiter. Als die waldreiche Region später zu Erholungszwecken angepriesen wurde, machten sich die ersten Sommerfrischler auf, das Erzgebirge zu erwandern – eine willkommene Gelegenheit, Gästezimmer anzubieten und eine kleine Gaststube einzurichten.“ Keine der beschriebenen Ausflugsgaststätten seien mehr zu finden. Was bliebe, sei die Erinnerung an einstige Einfachheit, Geselligkeit und Schönheit.
Der enorme Zuspruch zu diesem ersten Kalender der beiden Erzgebirgsvereine Breitenbrunn und Abertham in der Region veranlaßte die Autoren, 2020 einen Kalender mit ganzen verschwundenen Ortschaften aufzulegen. Der Materialreichtum reichte nun bis zu jener aktuellen vierten Auflage in diesem Jahr 2023 mit immer wieder neuen Motiven aus der Vergangenheit und ihres heutigen Zustandes. Interessant an die-

� Mut tut gut

Ausschau

In einer Radiosendung des SWR hörte ich kürzlich ein Interview mit Roman Dubasevych, einem gebürtigen Ukrainer, der als Kulturwissenschaftler an der Universität Greifswald lehrt. Thema des ganzen Interviews war der nunmehr seit einem Jahr anhaltende Krieg in der Ukraine. Es ging um die Hintergründe des Krieges im geschichtlichen Verhältnis zwischen der Ukraine und Rußland sowie dessen Auswirkungen auf das Empfinden des ukrainischen Volkes. Wie jeder Krieg ist auch der derzeitige für die unmittelbar Betroffenen ein schrecklich überwältigendes Ereignis, das alte Traumata wachruft und neue schafft. Die allermeisten Menschen in der Ukraine werden durch den Krieg nicht mehr dieselben sein, die sie vor dem Krieg waren.
Nach der Vertreibung der deutschen Bewohner standen viele Gebäude in Preßnitz und Umgebung leer. Mit dem Bau der Talsperre Preßnitz in den 1970er Jahren wurden dann mehrere Orte, wie Dörnsdorf und Reischdorf, abgesiedelt und abgerissen. Auch Preßnitz, das erstmals 1335 urkundlich erwähnt wurde, war dem Untergang geweiht. Am 6. Juni 1973 wurden um 19.27 Uhr mit 700 Kilogramm Dynamit das Schloß und weitere Häuser am Marktplatz gesprengt. Diese Sprengung wurde in einem tschechischen Dokumentarfilm festgehalten und diente als Kulisse des deutschen TVFilms „Traumstadt“ von Regisseur Johannes Schaaf. Anfang 1974 standen nur noch wenige Häuser von Preßnitz. Zuletzt wurde das Rathaus abgerissen. Der Bauschutt wurde im Preßnitz-Staudamm, einem Schüttdamm verwendet. Das ehemalige Stadtgebiet liegt versunken unter der Wasseroberfläche.

Roman Dubasevych erinnerte am Beginn des Interviews an ein Bild von Walter Benjamin (1892–1940). Der berühmte jüdische Philosoph schrieb in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs eine thesenhafte Abhandlung mit dem Titel „Über den Begriff der Geschichte“.
Angeregt durch eine Zeichnung von Paul Klee (1879–1940) spricht er darin vom „Engel der Geschichte“. Dieser Engel hat sein Gesicht nicht nach vorne gewendet, sondern er blickt zurück in die Vergangenheit. Von dorther weht ihm unablässig ein starker Wind ins Gesicht und in die aufgespannten Flügel, der ihn in die Zukunft treibt. Sein Blick bleibt aber in der Vergangenheit verhaftet. Der Engel ist gewissermaßen dazu verdammt, das stets wachsende heillose Geschehen der menschlichen Geschichte zu sehen. Immer neue Trümmer werden ihm vor die Füße geschleudert. Mich berührt das Bild vom „Engel der Geschichte“. Es ist ein Bild, in welchem ich meine Gefühle im Rückblick auf die Monate seit dem 24. Februar 2022 wiederfinde. Wie viele Menschen starre ich nach wie vor auf das Unheil des Krieges in der Ukraine, der an jenem Tag mit dem Überfall Rußlands begonnen hat. Auch wenn die Auswirkungen des Krieges in unseren Breiten bisher geringer waren als zunächst befürchtet, habe ich doch die Schrekken vor meinen inneren Augen, welche die vom Krieg unmittelbar Betroffenen Tag für Tag erleben müssen. Ich denke beispielsweise an zwei ukrainische Mitbrüder aus unserem Redemptoristenorden, die vor Wochen verschleppt wurden und von denen man bisher nicht weiß, wo sie sind und wie es ihnen geht. Ich denke an die Eltern und die Ehefrauen von gefallenen Soldaten. Ich denke an Menschen, die ihre Heimat verloren haben.
Nach der Vertreibung der deutschen Bewohner von Königsmühle wurden die Häuser abgerissen oder zerfielen. Über die Jahrzehnte kehrte die Natur ins Tal zurück, allerdings wegen des Gebirgsklimas und der kurzen Vegetationsphase nur sehr langsam. Im Unterschied zu anderen verschwundenen Orten ist Königsmühle deshalb bis heute nicht vollständig überwuchert. Repros: Ulrich Miksch
sem grenzüberschreitenden Projekt, das aus der Nachbarschaft geboren wurde, sind die Bezüge zu früheren tschechischen Initiativen. Das Ausstellungs- und Buchprojekt „Verschwundenes Sudetenland“ der Initiative Antikomplex benutzte Anfang der 2000er Jahre erstmals die Strategie alte Fotografien, zumeist auf Postkarten gedruckt und mannigfach als Sammelgegenstand im heutigen Tschechien, aber auch in Deutschland und Österreich gefeiert, mit der Situation der Landschaft heute direkt zu vergleichen. Die nebeneinandergestellten Fotografien, von der Zeit der deutschen Besiedlung und kulturellen Nutzung der Landschaft meist vom Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Zeit um die
Jahrtausendwende rund hundert Jahre später, wo sich die Natur die kultivierte Landschaft wieder zurückgeholt hatte, verwiesen auf den kulturellen Verlust durch die Vertreibung der deutschen Bevölkerung und die zumeist fehlende Wiederbesiedlung der „Grenzgebiete“ – ganz ohne Kommentar.

Die einprägsamen geschichtlichen Exkurse zu den Kalenderbildern in den vier Kalendern der Erzgebirgsvereine Breitenbrunn und Abertham von 2020 bis 2023 versuchen die Verluste zu bilanzieren, aber auch die Schönheit des Erzgebirges zu zeigen. Mittlerweile sind alle Ausgaben vergriffen. Weitere Auflagen sind derzeit nicht geplant. Ulrich Miksch
Das Hammerwerk Obermittweida befand sich unterhalb der Vereinigung von Kleiner und Großer Mittweida. 1546 wurde es als Eisenhütte mit einem Zerrennfeuer erstmals urkundlich erwähnt. 1788 bestanden in Obermittweida ein Hochofen, zwei Frischund Stabfeuer, ein Blechfeuer und ein Zinnhaus. Das Eisenwerk war bis 1860 in Betrieb. Bis 1878 arbeitete noch eine Schaufelhütte, bevor das enge Tal ein Zentrum der Papierherstellung und Holzschleiferei wurde. Bekannt wurde das Tal als Sommerfrische mit dem Genesungsheim Casino Nitzschhammer, das im Zweiten Weltkrieg als Landjahrlager und in der DDR-Zeit als Kindererholungsheim genutzt wurde. Das Gebiet ist heute durch das Unterbecken des Pumpspeicherwerks Markersbach überflutet. Die Bewohner wurden ab 1968 ausgesiedelt.
Walter Benjamin schreibt über den „Engel der Geschichte“: „Er möchte wohl verweilen, die Toten und das Zerschlagene zusammenfügen.“ Doch es ist ein ohnmächtiger Engel. Ohnmacht ist ein Gefühl, das auch mich im Blick auf den Ukrainekrieg und auf andere Katastrophen unserer Gegenwart umfängt. So wünsche ich mir einen Engel herbei, der hilft, nach vorne zu schauen. Dem ukrainischen Volk selbst scheint ein solcher Engel der Hoffnung nicht unbekannt, sonst hätte es schon längst den Mut verloren. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Meine Erfahrung ist: Es lohnt sich, täglich nach dem Engel der Hoffnung Ausschau zu halten.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München
� Maria Kulm
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Geschichte der Fußwallfahrt
Maria Kulm ist der größte und bekannteste Wallfahrtsort in Westböhmen. Er liegt zwischen Eger und Falkenau nahe der bayerischen und der sächsischen Grenze. Der Ort wurde 1341 erstmals urkundlich erwähnt. 1383 wurden für die Wallfahrtsstätte zwei Priesterstellen gestiftet. Damals pilgerten das ganze Jahr hindurch Wallfahrer nach Maria Kulm, doch der Hauptkonkurstag war das Pfingstfest. Der in der Oberpfalz beheimatete Verein Maria Kulmer Fußwallfahrt berichtet.
Alten Beschreibungen zufolge kamen bis zu 70 000 Wallfahrer aus den Bezirken Eger, Falkenau, Karlsbad, Marienbad, Tepl, Luditz, Plan, Tachau, Mies, Asch, Bischofteinitz, Graslitz, Neudek und Sankt Joachimstal. Auch aus zahlreichen Orten der Oberpfalz und aus Oberfranken kamen noch im 19. Jahrhundert alljährlich große Wallfahrtsprozessionen, zu denen sich oft mehrere Gemeinden zusammengetan hatten. Anfang des 20. Jahrhunderts übernahm Johann Lukas, der Stoabauer von Tröglersricht bei Weiden, von seinem Vater das Amt des Leiters der Wallfahrt aus unserer Gegend.
Alljährlich führte er am Freitag vor Pfingsten die Wallfahrer von der Wallfahrtskirche Sankt Nikolaus bei Floß zur Loreto bei Altkinsberg. Dort beteten die Pilger den große Kreuzweg, übernachteten in den vielen Kapellen und zogen anderntags mit
Am heutigen 24. Februar feiert Helmut Eikam, langjähriger Ko-Vorsitzender und derzeitiges Präsidiumsmitglied der Seliger-Gemeinde, der Gesinnungsgemeinschaft Sudetendeutscher Sozialdemokraten, im oberbayerischen Schrobenhausen seinen 80. Geburtstag.

Geboren wurde er in Eger. Bei der Vertreibung 1946 kam der Dreijährige mit seiner Familie mit einem Transport nach Schrobenhausen in Oberbayern. Damals war fast die Hälfte der Schrobenhausener Einwohner Vertriebene, meistens aus dem Egerland. Schrobenhausen ließ den bodenständigen Helmut Eikam sein Leben lang nicht mehr los.
anderen Wallfahrtsgruppen nach Kulm weiter, wo sie Pfingsten feierten. Bereits am Sonntag Mittag traten sie den Rückweg an.
Trotz des Wallfahrtsverbotes in der NS-Zeit wurde noch 1942 nach Maria Kulm gepilgert. Doch bereits beim Weggang war die Ortspolizei zugegen. Beim Rückweg mußte die Prozession aufgelöst werden, und der Stoabauer versteckte sich mit dem Tröglersrichter Vortragekreuz im Wald, um der Verhaftung zu entgehen. Danach pilgerten nur noch wenige ohne Kreuz nach Maria Kulm. Gegen Kriegsende und während der Zeit des Eisernen Vorhangs konnte man nicht mehr nach Maria Kulm pilgern. Doch allen Besuchern seiner Gaststätte und seinen Enkeln erzählte der Stoabauer bis zu seinem Tod 1974 von der Kulmer Wallfahrt.
Blick auf die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt und Sankt Maria Magdalena in Maria Kulm.
In weiser Voraussicht besang er eine Kassette mit den alten Wallfahrtsliedern. Und sein Vorbetbuch, mit Tinte in altdeutscher Schrift geschrieben, hielt die Familie Lukas nebst alten Wallfahrtsandenken in Ehren.
So bildete sich mit den zwei Enkelinnen des Stoabauern nach der Grenzöffnung eine Gruppe, die beschloß, die Wallfahrt wieder aufzunehmen. Die gesammelten Wallfahrtsgebete und -lieder wurden neu gefaßt, der alte Wallfahrtsweg erkundet. So machte sich im September 1990 die erste Wallfahrtsgruppe mit 30 Pilgern von Sankt Quirin bei Neustadt an der Waldnaab zum böhmischen Hochfest der Gottesmutter auf den Weg.
Seit 1990 treffen sich nun die Wallfahrer jedes Jahr Ende September/Anfang Oktober in Sankt
PERSONALIEN
� Langjähriger Ko-Vorsitzender der Seliger-Gemeinde
Helmut Eikam 80
alla moda“: ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle.
Seine Liebe zu Frankreich spiegelt sich auch in seinem Buch „Sur le Pont“ wider, in dem er Anekdoten über die Städtepartnerschaft zwischen Schrobenhausen und Thiers in Frankreich zusammentrug.
Quirin, um wieder nach Maria Kulm aufzubrechen. Die Teilnehmerzahl verzehnfachte sich in den vergangenen Jahren.
Wir gedenken aller Wallfahrer, die seit der Wiederaufnahme der Fußwallfahrt nach Maria Kulm 1990 aus unserer Gemeinschaft verstarben. In unser Gebet schließen wir alle Wallfahrer ein, die vor uns den Wallfahrtsweg nach Maria Kulm gingen und aus der Ewigkeit unsere Wallfahrt begleiten.
Folgendes Gebet schrieb Herbert Baumann aus Weiden in der Oberpfalz. Bei der Außenrestauration 1993 wurde es in die rechte vergoldete Kirchturmkugel eingeschlossen:
„Heilige Gottesmutter Maria, unsere liebe Frau von Maria Kulm. Seit langer Zeit blickst du mit dem Jesuskind auf deinem Arm herüber in unsere Heimat.
Wir sind nach der langen Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Eisernen Vorhangs nach der Grenzöffnung wieder aufgebrochen, um nach alter Tradition alljährlich zu Fuß dein Gnadenbild in Maria Kulm aufzusuchen und dich um deine Hilfe zu bitten.
Wir empfehlen dir die Menschen, die zu dir kommen. Breite deinen Segen aus über ihr Land. Verleihe uns und unseren Nachkommen Frieden und laß uns nach der irdischen Pilgerzeit einmal für immer bei dir sein. In dankbarer Verbundenheit konnten wir ein kleines bißchen mithelfen, daß dein Heiligtum in neuem Glanz erstrahlt.“
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
8/2023
Er besuchte in Schrobenhausen die Volksschule und das Gymnasium, welches er 1963 mit dem Abitur abschloß. Das Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften führte ihn an die Universitäten in München und Mainz. Die beiden juristischen Staatsprüfungen legte er 1968 und 1971 in Bayern ab. Danach folgten ein Rechtsreferendariat am Landgericht Augsburg und bei der Regierung von Schwaben. Seit 1972 ist er Rechtsanwalt in Ingolstadt und Schrobenhausen. 1978 promovierte er sich an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz mit einer Arbeit über das Verfassungsrecht.
Geht man der Frage nach, was ein Jurist an Fähigkeiten mitbringen soll, dann stößt man unter anderem auf folgende Antwort: Freude am Umgang mit der Sprache und am logisch-deduktiven Denken. Beides trifft auf den leidenschaftlichen Juristen Eikam zu.
Wer ihn kennt, kennt seine Freude an Sprache. Er ist rhetorisch gewandt, und zwar nicht nur im Juristendeutsch. Gewandt nutzt er neben Deutsch weitere Sprachen wie Französisch, Englisch und Italienisch. Vor allem aber beherrscht er das Eghalandrische perfekt. Dies paart sich mit „beaucoup de charme“, „a great sense of humour“ und „eleganza
Als dreijähriger Bub an der Hand seiner Mutter aus dem Sudetenland vertrieben, gehört er zu der Generation, die die Folgen des Zweiten Weltkrieges bewußt erlebte und daraus die Konsequenz zog: „Nie wieder Krieg!“ Und so begann er Brücken zu bauen nach West und Ost, zu anderen Menschen und Kulturen.
Weit über die offiziellen Kontakte der Stadt Schrobenhausen hinaus baute er als langjähriger Stadtrat, SPD-Fraktionsvorsitzender, Zweiter Bürgermeister, Verwaltungsrat der Sparkasse Schrobenhausen und Kreisrat Kontakte nach England, Österreich und Frankreich auf. „Brücken haben nur dann einen Sinn, wenn Menschen darüber gehen.“ Dieser Satz war in den 36 Jahren seiner Kommunalpolitik, seinen 55 Jahren in der SPD und seinem jahrzehntelangen Wirken in der Seliger-Gemeinde immer sein Antrieb für vielfältige Aktivitäten.
Seine Belesenheit und sein historisches Wissen machen ihn zum begehrten Gesprächspartner. Bei Besuchen in den Partnerstädten Thiers in Frankreich und Bridgnorth in England soll er Politiker und Verwaltungsfachleute in fundierte Diskussionen über Geschichte und Politik in ihrer Muttersprache verwickelt haben.
Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit der Silbernen und Goldenen Bürgermedaille der Stadt Schrobenhausen,
der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze und der Bayerischen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Wichtig für die Seliger-Gemeinde sind aber die Brücken, die er zu seiner Heimat, zu seiner frühen Kindheit, zum Egerland schlug.
Der Wallfahrtskirche Maria Kulm gelten seit Jahrzehnten seine Zuneigung und sein Engagement. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Wallfahrtskirche Maria Kulm sowie Großmeister des Laienordens der Herren vom Kreuz mit dem Roten Stern. Jährlich organisiert er eine Wallfahrt nach Maria Kulm mit einer Messe in der barokken Wallfahrtskirche.

2005 wurde er mit Albrecht Schläger zum Bundesvorsitzenden der Seliger-Gemeinde gewählt. Bis 2019 arbeitete diese Doppelspitze erfolgreich und harmonisch. 2019 bis 2022 setzte Eikam diese Arbeit mit Helene Päßler als Ko-Vorsitzender weiter fort. Mit dem Präsidium und dem Vorstand gelang es ihm, die Seliger-Gemeinde auf ihrem hohen Niveau zu halten, auszubauen und im Sinne von Josef Seliger und Volkmar Gabert weiterzuführen. Bei zahlreichen Terminen repräsentierte er unsere Seliger-Gemeinde im In- und Ausland. Dabei war ihm der Brünner Versöhnungsmarsch ein besonderes Anliegen.
Bei der Bundesversammlung im Herbst reichte er seinen Stab an mich weiter. Nach der erfolgreichen Männer-Doppelspitze führt nun eine weibliche Doppelspitze die Seliger-Gemeinde.
Ich danke Helmut, daß er uns weiterhin im Präsidium unterstützt und in der Jury des Wenzel-Jaksch-Gedächtnis-Preises mitwirkt. Als Generalsekretärin des Sudetendeutschen Ra-
tes danke ich ihm auch für seine langjährige Mitarbeit in dieser Institution. Selbstverständlich kommt er jedes Jahr zu den deutsch-tschechischen Marienbader Gesprächen des Rates in die Egerländer Heimat. Am 1. Juli wird die SeligerGemeinde ihrem langjährigen Vorsitzenden beim Vertriebenenempfang der SPD-Landtagsfraktion im Maximilianeum mit dem Wenzel-Jaksch-GedächtnisPreis danken.
Namens unserer Gesinnungsgemeinschaft, aber auch ganz persönlich, gratuliere ich Helmut Eikam von Herzen zum Geburtstag und hoffe, daß er uns und die sudetendeutsche Großfamilie noch viele Jahre in Gesundheit begleitet. Christa Naaß Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde
elmut Eikam ist eine Persönlichkeit von ganz besonderem Zuschnitt, hochgebildet und tief in der Geschichte seiner böhmischen Heimat verwurzelt. Als Sozialdemokrat und Katholik hat er entscheidenden Anteil daran, daß die sudetendeutsche Wallfahrt nach Maria Kulm nicht nur am Leben blieb, sondern generationenübergreifend erneuert wurde.
Der noble, nach wie vor sehr jugendlich wirkende Egerländer ist durch und durch Europäer bei gleichzeitiger Verwurzelung in der Kommunalpolitik. Sein kluger Rat, seine grenzüberschreitenden Aktivitäten und seine Rolle als Wegbereiter des Brükkenschlags zum tschechischen Volk sind für unsere landsmannschaftliche Arbeit von überragender Bedeutung. Ich danke ihm für seinen Einsatz und wünsche ihm zum Geburtstag namens der Sudetendeutschen Volksgruppe, aber auch ganz persönlich, weiterhin viel Erfolg, Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Bernd Posselt Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Im Sudetendeutschen Haus in München zeigte der Adalbert-Stifter-Verein (ASV) „Hannah. Ein gewöhnliches Leben“. Der Film beruht auf dem Leben von Hana Frejková, deren sudetendeutscher Vater Ludwig Freund/Ludvík Frejka nach einem Schauprozeß in der kommunistischen Tschechoslowakei 1952 hingerichtet wurde. Eine historische Einführung bot Martin Schulze-Wessel. Der Leiter des Collegiums Carolinum (CC) in München hielt einen Kurzvortrag über die Slánský-Prozesse, bei denen auch Frejka verurteilt wurde. Nach der Filmvorführung sprach ASV-Geschäftsführerin Zuzana Jürgens mit Hana Frejková über deren Leben.

Vor mehr als siebzig Jahren, im November 1952, wurden in der Tschechoslowakei im sogenannten Slánský-Prozeß 14 Mitglieder der Kommunistischen Partei zum Tode verurteilt und hingerichtet“, so begann Martin Schulze-Wessel. „Elf davon waren Juden“, erinnerte der CCDirektor. Die Angeklagten seien der trotzkistisch-titoistischzionistischen Verschwörung und der wirtschaftlichen Sabotage bezichtigt worden.
Einer von ihnen, Ludvík Frejka – „eine bemerkenswerte Figur“ – sei schon 1923 in die kommunistische Partei eingetreten und daher 1939 ins Londoner Exil gegangen. Der als Ludwig Freund in Reichenberg geborene Sudetendeutsche jüdischer Herkunft sei nach Kriegsende nach Prag zurückgekehrt. Er habe die tschechische Bürgerschaft angenommen und seinen Namen offiziell zu Ludvík Frejka geändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei er Sekretär der Zentralen Planungskommission gewesen, in einer Zeit des sozialen Aufbruchs. Bei den Slánský-Prozessen, die nach Muster der Sowjetunion in den dreißiger Jahren und mit Hilfe sowjetischer Berater geführt worden seien, sei Frejka zum Tod verurteilt worden, endete Schulze-Wessels Einführung.
„Ludvík Frejkas damals siebenjährige Tochter Hana und ihre Mutter Elsbeth, eine aus Ham-
Der Adalbert-Stifter-Verein hat einen Originalbrief seines Namensgebers als Dauerleihgabe an das Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich übergeben. Bei einer Veranstaltung zum Adalbert-StifterGedenktag im Stifter-Haus im oberösterreichischen Linz, in der auch die eben erschienenen
Briefbände der historisch-kritischen Stifter-Ausgabe präsentiert wurden, gaben ASV-Geschäftsführerin Zuzana Jürgens und ASV-Vorstandsvorsitzender
Peter Becher das Autograph der Direktorin des Adalbert-StifterInstituts, Petra-Maria Dallinger.


Der Origina-Brief Adalbert Stifters an seinen Verleger
Gustav Heckenast vom 31. August 1857 wurde dem AdalbertStifter-Verein (ASV) Ende 2021 von Klaus Martin zum Kauf angeboten, der kurz darauf ver-
Kein gewöhnliches Leben
probleme. Im Elternhaus spricht man zunächst deutsch, nach der Rückkehr in die ČSSR jedoch tschechisch, was die in Hamburg geborene Mutter erst richtig lernen muß. „Sie wollte nicht Deutsch sprechen, damit auch ich es in der Öffentlichkeit nicht spreche“, so Hana Frejková. „Das war ja direkt nach dem Krieg, die Gesellschaft war dem Deutschen nicht sonderlich zugeneigt, die Eltern hatten Angst.“ Dieses Verstummen habe auch sie ereilt, erzählt Hana Frejková später, nachdem sie längere Zeit eine Psychoanalyse durchlaufen habe. Dargestellt wird die junge Hana von der Schauspielerin Markéta Jandová, einem Alter Ego von Hana Frejková im Film. Jandová erzählt in dem Zwei-Personen-Drama auf der Leinwand über ihre Schauspielausbildung, unterstützt von der in einer Fabrik schuftenden Mutter. Die echte Hana Frejková erinnert sich im Film an ihre Heirat mit einem Psychoanalytiker, während sie in ihrer Küche für ein Pichelsteiner – „ein Rezept meiner deutschen Mutter“ – Zwiebeln und Möhren schnippelt.
burg stammende Schauspielerin, wurden nach der Hinrichtung des Vaters aus Prag in das Isergebirge verbannt“, führte Zuzana Jürgens die Biographie fort. Nachdem die Verbannung 1960 gelockert worden sei, habe Frejková Schauspiel und Gesang an der Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst in


Brünn und an der Akademie der musischen Künste in Prag studiert und als freie Künstlerin in nationalen und internationalen Theatern gewirkt. Auch bei großen Filmen habe sie mitgespielt, etwa in „Anthropoid“ (2016) über das Heydrich-Attentat oder „Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narnia“ (2008).
„Mit ihrem familiären Trauma setzt Hana Frejková sich bis heute auseinander“, so Zuzana Jürgens. Über ihre Lebensgeschichte habe Frejková 2007 das autobiographische Buch „Divný kořeny“ (Seltsame Wurzeln) und ein darauf basierendes Drama veröffentlicht und außerdem einen Film gemacht.
Der halbstündige Dokumentarfilm „Hannah – Ein gewöhnliches Leben“ auf der Leinwand im Adalbert-Stifter-Saal zeigt in kurzen Erinnerungssequenzen Hanas Leben, angefangen mit der ersten Begegnung ihrer Eltern, beide Kommunisten, und der Emigration nach England. Weiter geht es über die Sprach-
Die Slanský-Prozesse
„Nach meinem Buch und dem Theaterstück über mein Leben hat mich die Regisseurin Milenka Čechová wegen einer Verfilmung angesprochen“, antwortete Frejková auf die Frage von Jürgens nach der Entstehung des Films . Der Film sei freilich nicht identisch mit dem Theaterstück. Vieles sei improvisiert worden, wie etwa die Küchenszene. „Und ich habe mich darin seelisch sehr entblößt, was mich viel Mut gekostet hat.“


Bei einer der Fragen aus dem Publikum antwortete Frejková, daß ihr Vater als deutscher Jude nur wegen seiner kommunistischen und antifaschistischen Aktivitäten nach Kriegsende in der ČSSR habe bleiben dürfen. 1963 sei er allerdings juristisch und politisch rehabilitiert worden. Ihre große Leistung bei der Aufarbeitung ihrer Traumata kommentierte sie nur schlicht: „Das ist alles Geschichte.“
Susanne Habel



starb. Er hatte den Brief von seinem Großvater, einem Dresdener Antiquitätenhändler, geerbt.
Ebenso wie Martins Erben hatte er den Wunsch gehegt, daß das Autograph an den ASV geht, der selbst allerdings kein eigenes Archiv hat.
Anfang 2022 konnte der Verein den Brief von den Erben erwerben. Mit der Übergabe ans Linzer Institut befindet sich das Stück nun an einem Ort, der sowohl die professionelle Aufbewahrung und Erschließung gewährleistet, als auch für Stifter-Forscher aus aller Welt gut zugänglich ist.
Der Brief stammt aus der Korrekturphase des „Nachsommers“ (1857), des ersten großen Romans des böhmisch-österreichischen Autors. Das Brieforiginal galt bereits den Herausgebern der „Prag-Reichenberger Ausgabe“ von 1929 (Band 36, Seiten
58–60) als verschollen. Die erste Briefausgabe des Stifter-Freundes Johannes Aprent (Heckenast 1869, Band 2) hatte ihn lediglich gekürzt abgedruckt.
In dem Brief bittet Stifter seinen Verleger, einen Fehler bei der Beschreibung der weiblichen Hauptfigur, Natalie, ausbessern zu lassen. Tatsächlich ist die Augenfarbe Natalies (und die ihrer familiären Parallelfiguren) im Text bedeutungstragend. Immer wieder wird auf ihre schwarzen Augen verwiesen.
Offenbar hatte Stifter die fehlerhafte Textstelle, in der von den „hellen braunen Augen“ Natalies die Rede ist, in Steyr verfaßt und vergessen, in seinen Aufzeichnungen mit den wichtigsten Figurenmerkmalen nachzusehen: „Ich muß besessen gewesen sein.“
Das Postscriptum, in dem Stifter das Fehlen einiger Korrektur-
bögen moniert, war bisher unbekannt, konnte aber – auch das eine Korrektur in letzter Minute – noch in den Ende 2021 erschienenen Briefband der historisch-kritischen Gesamtausgabe (Band 11,3, Briefe 1854–1858) aufgenommen werden.
Schönes Keramikrelief als Familienschatz
In „Kunst & Krempel“, einer Sendungsreihe des Bayerischen Rundfunks, ist wieder einmal ein Objekt aus der Heimat begutachtet worden. Das Keramikrelief aus Turn, seit 1942 Stadtteil von TeplitzSchönau, ist ein Familienerbstück.
Eine Wienerin war diesmal nach Herzogenburg in der Nähe der niederösterreichischen Landshauptstadt Sankt Pöltens in das Augustinerchorherrenstift gekommen. Sie wollte bei der Sendung des Bayerischen Rundfunks „Kunst & Krempel“ vom 28. Januar ihr Familienerbstück vorstellen: ein Keramikrelief, das die Signatur des Bildhauers Albin Döbrich (1872–1945) trägt. Die Bildplatte habe einst bei ihren Großeltern, die in etwa zur gleichen Zeit wie Döbrich gelebt hätten, über dem Jugendstilklavier gehangen und mit dessen Ornamentik harmoniert, erzählte die Wienerin. Der Experte Samuel Wittwer von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam bezeichnete es
stilistisch der Wiener Secession zugehörig, eben auch dem Jugendstil. Er beschrieb die Plat
te als kompakt aus einem Stück, aber verschiedene Materialien vortäuschend. Wittwer schilder
te den Rahmen, der aus Bronze gemacht zu sein scheine, dann das Bildfenster – beinahe ein Bildschirm – mit einer säenden Frau in einer Landschaft, bei dem man an eine geschnittene Holztafel denken könne. Auch die Vergoldung einiger Partien der Bekleidung der Frau wurde thematisiert. Dennoch sei alles Keramik, bemalt nach dem Brennen, also eine Kaltmalerei auf keramischem Grund. Die Datierung schätzte Wittwer auf 1910 oder vielleicht gar 1914/15, da im Krieg eben die Frauen die Arbeit auf den Höfen allein hätten verrichten müssen. Aber auf der Keramikplatte gebe es keine Hinweise, keine Datierung, keinen Hersteller, nur den Namen des Bildhauers Albin Döbrich, der aber vor allem Reiterfiguren in Porzellan entworfen habe. Da griff die Expertin Anke Wendl vom Auktionshaus Wendl in Rudolstadt in
die Begutachtung ein. Der Name Döbrich verweise auf den sagenhaft erfolgreichen Unternehmer Ernst Wahliß (1836–1900), der aus einem kleinen Porzellangeschäft in Wien ein großes Geschäft mit Dependancen in London und wohl auch in Paris gemacht habe. Ein schillernder Unternehmer, der auch der Begründer des modernen Tourismus im Raum des Wörthersees durch die Entwicklung von Pörtschach gewesen sei. Wahliß kaufte 1894 die Stellmacher‘sche Porcellanfabrik in Turn bei Teplitz und entwickelte sie zu einer florierenden Werkstätte mit 500 bis 600 Arbeitern, die LuxusArtikel in Porzellan, kunstvoll ausgeführte Speiseservice und vor allem mit vollendeter Kunst ausgeführte Arbeiten nach AltWiener Art herstellten. Die Stücke wurden ausschließlich nach von hervorragenden Künstlern angefertigten Model
Im Tschechischen Zentrum München (TZM) läuft derzeit die Ausstellung „Symmetrie der Natur/Natur der Symmetrie“ mit ungewöhnlichen Fotografien von Daniel Kreissl, der deutsche Wurzeln hat.

Die Symmetrie ist keine menschliche Erfindung.
Auch in der Natur ist sie sehr häufig anzutreffen – bei Blüten und Blättern, Schneeflocken, Schmetterlingen oder Seesternen. Sie verleiht ein Gefühl der Harmonie und Ordnung inmitten von Chaos.
Mit seinen geheimnisvollen, detailreichen Bildern enthüllt der tschechische Fotograf Daniel Kreissl fraktale Strukturen in Wurzeln, dornigen Sträuchern
� Ausstellung in München


Fotokünstler aus Böhmen


und Kletterpflanzen im Blütenrausch. Er fotografiert vor allem in der Abenddämmerung, und dabei entsteht oft der Eindruck von fantastischen Kreaturen und unbekannten Landschaften, die plötzlich aus der Dunkelheit hervortreten: „Ich versuche, das einzufangen, was tagsüber nicht sichtbar ist, und eine einzigartige Sicht auf die Welt zu schaffen.“ Einige seiner Werke rufen im Betrachter die Vorstellung von Geistern und Dämonen
hervor, die von der Leinwand aus verzaubern, andere grenzen an der Schwelle zur Abstraktion.
Daniel Kreissl, geboren 1974 im mittelböhmischen Beraun/ Beroun, wuchs in einer Künstlerfamilie auf, zu der auch ein deutschstämmiger Uropa gehörte, und fotografierte seit seiner Kindheit. 1994 nahm er ein Studium der Fotografie an der Schlesischen Universität in Troppau/ Opava auf, wo er mit Licht, Belichtung und nichttraditionellen
Techniken zu experimentieren begann. Kreissls primäres Interesse gilt der inszenierten Fotografie. In jüngster Zeit widmet er sich jedoch auch der symmetrischen Fotografie, bei der das zentrale Motiv an einer oder mehreren Achsen gespiegelt wird. Der KünstlerFotograf stellt regelmäßig alleine und zusammen mit anderen Künstlern aus. „Dies ist seine erste Einzelausstellung in Deutschland“, erläutert die Kuratorin Eva Čapková.
Die Ausstellung „Symmetrie der Natur/Natur der Symmetrie“ findet im Rahmen des „Flower Power Festivals 2023“ in München statt. Hier dreht sich alles um die Blüte, im wörtlichen, aber auch im übertragenen Sinn. Wissenschaft, Nachhaltigkeit, Pflanzenvielfalt, Gartenkunst, Klimawandel, Biodiversität, Ästhetik, Lebensqualität – das und vieles mehr sind denkbare Themen, die inszeniert werden können, sei es mit Ausstellungen, Kursen, Spa
len ausgeführt. Wahliß‘ früher Tod mit 64 Jahren führte das Unternehmen in die Hände seiner Söhne. Der jüngste übernahm 1910 die TurnTeplitzer Fabrik. Dort entstanden dann auch neue keramische Produkte. Der Artikel „50 Jahre Geschichte des Porzellanhauses Ernst Wahliß“ in der Wiener Tageszeitung „Neue Freie Presse“ vom 7. November 1913 schildert die Entwicklung des Unternehmens: „Inzwischen vollzogen sich große Umwälzungen im Kunstgewerbe und im Geschmack eines bedeutenden Teiles des Publikums. Die moderne Richtung gewann an Boden. Damit trat eine große und schwere Aufgabe an die Firma Ernst Wahliß heran, die führende Stellung in der Keramik auch auf dem Gebiete des modernen Kunstgewerbes zu erringen. Es bedurfte jahrelangen Studiums, jahrelanger kostspieliger Versuche auf technischem wie auf künstlerischem Gebiete, aber die Tat gelang, die Firma hat ihr weitgestecktes Ziel erreicht.“ Was über die Wiener SerapisFayence, die die Firma entwikkelt hatte, dort geschrieben wurde, traf wohl auch auf die Produkte der TurnTeplitzer Fabrik zu, die für die moderne Zeit typische Keramik schuf. Leider wurde die Fabrik im Ersten Weltkrieg zeitweise geschlossen. Sie wurde 1921 Teil der Porzellanfabrik Union AG und stellte 1929 ihre Produktion ein.
Die Auktionatorin Wendl hatte so ein Keramikrelief noch nie bei einer Versteigerung gesehen, schätzte den Wert jedoch auf 600 bis 700 Euro. Verkaufen wird die Wienerin ihr Erbstück sicher nicht. Es ist wohl an den angestammten Platz in Wien zurückgekehrt. Dort zeugt es über dem Jugendstilklavier von der Kunst und Fertigkeit der TurnTeplitzer am Ende der Habsburger Monarchie. Ulrich Miksch
ziergängen, Theateraufführungen, Installationen und mehr. Drinnen, draußen und digital sind die Spielplätze des Festivals, so etwa das Kulturzentrum Gasteig, der Botanische Garten MünchenNymphenburg, das Naturkundemuseum Bayern und die Kunsthalle München. Mit den Themen Natur, Kultur, Stadt und Blüte, die die Kernidee des Festivals beschreiben, können sich viele Akteure identifizieren und sie umsetzen.
Bis Freitag, 3. März: „Symmetrie der Natur/Natur der Symmetrie“ in München, Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7. Montag bis Mittwoch 13.00–17.00, Donnerstag 13.00–19.00, Freitag 12.00–15.00 Uhr.
Großes Interesse – mehr als 60 Frauen und Männer an den Bildschirmen – weckte am Abend des ersten Dienstags im Februar die monatliche ZoomVeranstaltung der AckermannGemeinde. Unter dem Titel „Melde gehorsamst, ich kann nix dafür“ war der Kultur-Zoom diesmal Jaroslav Hašek gewidmet, der vor 100 Jahren gestorben ist. Der Regensburger Literaturwissenschaftler und Vorleser Arthur Schnabl erzählte und las von einem Schriftsteller, der selbst eine literarische Erfindung sein könnte.
Den vielseitigen Referenten des Zooms, Arthur Schnabl, stellte Moderatorin Sandra Uhlich vor. Er sei Literaturwissenschaftler, Germanist, Historiker, Reisejournalist, Vermittler von tschechischer, österreichischer und italienischer Literatur, Reiseleiter, Herausgeber von Hörbüchern und Literaturführern, Vorleser und Rezitator – kurzum die richtige Person, um Hašek und dessen literarisches Werk entsprechend zu würdigen. Auch gemäß seinem Leitspruch: „Dichter sind immer noch die besten Botschafter eines Landstrichs und einer Epoche.“


Hinsichtlich des Reisens nannte Uhlich noch weitere „Titel“ Schnabls: „ReiseErsinner und Reise-Besinner, Reise-Luftschiffer und Reise-Magier.“
„Melde gehorsamst, Herr Oberleitnant, ich bin wieder da!“ Mit diesem bestens bekannten Ausspruch des braven Soldaten Schwejk begrüßte Arthur Schnabl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zooms. Er freue sich über den erneuten Kontakt zur AckermannGemeinde, zumal er beim Literarischen Café der AckermannGemeinde im Bistum Regensburg bereits Referent gewesen sei. Mit Blick auf die ihm in der Begrüßung/ Vorstellung zugewiesenen Attribute kam er sofort auf diejenigen von Jaroslav Hašek: Schriftsteller, Schauspieler, Comedian, Sprachtalent auf der einen Seite – Herumtreiber, verantwortungsloses Subjekt, Bigamist, Säufer auf der anderen Seite.
Schnabl begann seine Ausführungen mit der letztgenannten Eigenschaft. Zwar habe es der sowjetische Kommunismus geschafft, daß Hašek vier Jahre lang nicht getrunken habe. Doch es sei ein trauriger Beweis für die Dekadenz der Prager bürgerlichen Gesellschaft, daß sich Hašek, nachdem er wieder in Prag gewesen sei, in zweieinhalb Jahren zu Tode gesoffen habe. Andererseits wäre aber einer der tollsten und schönsten humoristischen Romane der Weltliteratur nicht entstanden – „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“.
Wahrscheinlich habe es beide
Erfahrungen gebraucht: Hašeks Erlebnisse im Ersten Weltkrieg und die Inspirationen durch den Alkohol. Doch bereits vor 1914 sei er in Prag als Autor von mehr als 1500 humoristischen Feuilletons und Geschichten bekannt gewesen. Die hätten sein satirisches Talent offenbart, aber oft ohne seinen Namen. „Er war schon vor dem Ersten Weltkrieg in Prag ein ziemlich bekannter Humorist, Anarchist, ja eine ‚Stadtratte‘, der alle Kneipen, alle Schlupfwinkel kannte, überall wohnte“, beschrieb Schnabl Hašek in jener Epoche.


Ein zentraler Gegenstand in Hašeks Schaffen sei die k. u. k
Melde gehorsamst, ich kann nix dafür!
Monarchie gewesen, konkret die staatlichen Autoritäten wie Militär, Polizei und Kirche. Aber auch Geschichten über Bürger sowie Spitzen gegen die bürgerliche Moral, die er ins Komisch-Lächerliche gezogen habe. Am Beispiel der vorgelesenen Hašek-

„Er konnte wie ein Pfarrer predigen, wie ein Wissenschaftler sprechen, analysieren. Er konnte wie ein Jurist argumentieren und wie ein Politiker polemisieren. Und jede dieser Professionen hat man ihm geglaubt“, beschrieb Schnabl. Er bezeichnete den Schriftsteller auch als einen der ersten öffentlichen Comedians – auch wegen der Gründung der Partei des gemäßigten Fortschritts im Rahmen der Gesetze, der ersten Spaßpartei Europas. „Ohne Jaroslav Hašek gäbe es keinen Hape Kerkeling“, urteilte Schnabl – vor allem auf Basis der Erzählungen von Hašeks Freunden, da Texte oder Dokumente von ihm selbst aus diesem Segment leider nicht erhalten sind.
ausgabe militärischer Zeitschriften der Roten Armee verantwortlich gewesen und sogar Stadtkommandant in Bugulma in der heutigen zu Rußland gehörenden Republik Tatarstan geworden. Auch diese Episode habe Hašek verarbeitet – „beste und herrlichste Satire“, so Schnabl. Außerdem habe Hašek bereits damals seine Beziehung zum Kommunismus revidiert, da er die Unmenschlichkeit im kommunistischen System erkannt habe.



rakter eines unruhigen Herumtreibers. „Er hat es nie lange irgendwo ausgehalten, auch nicht bei seiner Frau und seinem Söhnchen.“
Herumgezogen als Ausdruck der Flucht vor dem bürgerlichen Leben und vor den Kompromissen, die man dafür machen müsse, sei Hašek auch innerhalb Eu-
Feedback auf Hašeks Romanfigur. Nun, nach dem Krieg, dem Niedergang der habsburgischen Monarchie und als eigener Staat mit eigener Armee – da habe man doch nicht der Volksgenosse eines solch dubiosen Antihelden sein wollen.
„Kritiker sahen Schwejk am liebsten dort, wo er entstanden war – in der Gosse. Hašeks Spott über den österreichischen Militarismus war zudem auch etwas zweifelhaft, denn man war sich nicht sicher, ob er nicht das Militär generell verhöhnte – also auch die neue, glorreiche tschechoslowakische Armee.“ Schnabl stellte klar, daß Hašeks Schwejk bis 1989 beim tschechoslowakischen Militär und in Büchereien verboten war.

Geschichte „Mein Abenteuer mit einem nackten Jungen“ erläuterte der Literaturwissenschaftler den Stil: „Grandios im Aufbau der Exposition. Sagenhaft, was ihm immer einfällt. Und am Ende merkt er: ‚Ich hab Durst, habe kein Geld mehr – jetzt aber schnell zu Ende bringen!‘“ Wie mit einem Beil hacke Hašek die Geschichte ab, was auch in vielen anderen Erzählungen so oder ähnlich geschehe.

Viele von Hašeks Erlebnissen und Taten oder Untaten dienten als Basis für seine Erzählungen. „Eine der grandiosesten Fähigkeiten sind seine Stilparodien. Er konnte jeden Jargon sprechen“, vertiefte Schnabl. Exemplarisch nannte er den Artikel über die Entdeckung eines Flohs aus der Urzeit, worüber er als Redakteur der Zeitschrift „Die Welt der Tiere“ im Jahr 1910 berichtet habe. Die Geschichte habe sich als Ente entpuppt, und Hašek sei diesen Job losgewesen. „Es war eine meisterhafte Parodie auf den Wissenschaftsbetrieb“, faßte Schnabl diese Begebenheit zusammen, auf die einige Zeitschriften und Einrichtungen hereingefallen seien.
Das Attentat von Sarajevo am 28. Juli 1914 bedeutete den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und auch die Rekrutierung Hašeks zum Militär. Die Erfahrungen als Soldat wurden zum Muster für seine Romanfigur des Schwejk wie auch für viele Nebenfiguren. Bereits in der Szene, wo Schwejk quasi als Krüppel im Rollstuhl zur Musterung gefahren wird, deutet sich die Intention des Autors an: „Demontage der staatlichen Autoritäten durch übertriebene Loyalität und durch total überzogenen Gehorsam. Schwejk entwaffnet seine Feinde vielfach durch reine Torheit – oder vielleicht auch nicht?“, fragte Schnabl.
Im Roman gerate der Held, da er eine russische Uniform trage, in österreichische Kriegsgefangenschaft.
Hašek selbst habe sich freiwillig in russische Gefangenschaft begeben, da er nicht für die österreichische Monarchie habe kämpfen oder gar sterben wollen. Er sei dort in die Wirren der gerade ausbrechenden sowjetischen Revolution gekommen. „Sein Anarchisten-Herz entdeckt die Liebe zum Kommunismus, und er bleibt. Er macht Karriere im sowjetischen militärischen Apparat“, schilderte der Referent diese Phase in Hašeks Vita.
Da Hašek sprachbegabt gewesen sei, sei er bis nach Sibirien und Zentralasien gekommen. Er sei unter anderem für die Her-
1920 sei er nach vier Jahren trotz einer Ehefrau in Prag in Begleitung einer Russin aus der Sowjetunion nach Prag und in sein altes Leben zurückgekehrt. Zur Finanzierung habe er wieder schreiben müssen. Dabei habe er sich an eine Figur erinnert, die er schon vor dem Krieg ein wenig ausprobiert habe – einen Ur-Schwejk, eine trottelhafte, hölzerne Witzfigur, die man nicht für viel habe gebrauchen können. „Durch die Kriegserfahrungen und die Versuche, selbst am Leben zu bleiben, zu tarnen, zu täuschen, verpaßte er diesem Schwejk ein intellektuelles Janus-Gesicht. Zwei Seiten, der behördlich anerkannte Idiot Josef Schwejk.“
„Ist Schwejk nun ein Schlaumeier oder ein Idiot? Oder beides?“ Schnabl gab die Antwort: „Schwejk ist ein dummer Schlaumeier, der sich als raffinierter Idiot tarnt. Ein normaler Idiot könnte die Waffe, die der Schwejk gegen die ganzen verfolgenden Autoritäten benützt, überhaupt nicht handhaben. Denn die Waffe von Schwejk ist die Sprache. Er redet sich nicht nur aus allem heraus – das wäre die Methode von einem Schlaumeier. Nein – er entwaffnet sein Gegenüber regelrecht mit der Fülle dieser grotesken Geschichten.“ Zu umschreiben am besten mit Logorrhoe oder Sprechdurchfall.

Bisweilen werde Schwejk auch als wiedergeborener, moderner Odysseus gesehen, der von einer abenteuerlichen Kalamität in die andere getrieben werde und all diese Stationen unbeschadet überstehe. Schwejks Irrungen durch die vielen böhmischen Dörfer spiegelten die Wanderungen Hašeks wider, seinen Cha-
ropas: von Ungarn in die Slowakei, von dort nach Bayern und wieder zurück nach Böhmen. „Er hat den bayerischen Gefängnissen, in denen er wegen Landstreicherei gelandet ist, aber die höchste Qualität ausgesprochen.“ In seiner Kurzgeschichte „Rechtspflege in Bayern“ sei dies beschrieben.

Die Schwejk-Geschichten seien nach und nach entstanden. Freunde Hašeks hätten für den Abdruck in Heften gesorgt und diese im Häuserverkauf angeboten. Das sei das erste verdiente Geld für den Autor nach dem Krieg gewesen. Josef Lada, der Zeichner von Kater Mikesch, habe die Titelblätter gestaltet und so das berühmte Schwejk-Erscheinungsbild geschaffen, was sehr zum Erfolg beigetragen habe.


„Aber in der damaligen Tschechoslowakei mochte kaum jemand den Schwejk. Er war eher ein Insidertyp für die unangepaßten anarchischen Künstler. In den bürgerlichen Kreisen wollte man von dieser fragwürdigen Figur überhaupt nichts wissen: ein betrügerischer Hundehändler als Repräsentant des ruhmreichen tschechischen Volkes, das eben erst das habsburgische Joch abgeschüttelt hat?“ So beschrieb Schnabl das zeitgenössische
Wegen seines exzessiven Lebens seien Hašeks Herz und Leber massiv geschädigt gewesen. Er sei am 3. Januar 1923 im Alter von 39 Jahren gestorben. Die SchwejkErzählungen seien unvollendet, die fiktiven Protagonisten quasi auf ewige Zeiten in ihren Etappen und Irrungen hängen geblieben.
In die Weltliteratur habe es Schwejk letztlich mit der Übertragung ins Deutsche durch die Prager Journalistin und Übersetzerin Grete Reiner geschafft, die dadurch auch als Urheberin des Böhmakelns in der Literatur bezeichnet werden dürfe. „Schwejk und seine Kumpanen sprechen ein Umgangs-Tschechisch, für das es in der hochdeutschen Sprache keine Entsprechung, keinen Dialekt gibt. Reiner sucht sich das Idiom, das die tschechischen Unterschichten verwendeten, wenn sie deutsch sprechen mußten. Also deutsch-österreichische Sätze, leicht verdreht durch die tschechische Grammatik und veredelt durch die tschechische Aussprache. Humorfreie, aber politisch sehr korrekte Zeitgenossen stoßen sich ziemlich heftig an dieser Übersetzung, weil sie angeblich einen respektlosen Umgang mit der tschechischen Sprache und mit dem tschechischen Volk darstellt“, erklärte Referent Schnabl. Aus dieser Übersetzung habe der Schriftsteller Max Brod – ebenfalls ein deutschsprachiger Jude – eine Drama-Fassung geschaffen, die der bekannte Theaterregisseur Erwin Piscator mit dem ebenfalls berühmten Sänger, Schauspieler und Komiker Max Pallenberg in Berlin auf die Bühne gebracht habe – eine der teuersten Inszenierungen jener Zeit. Als Multiplikator habe der Journalist Kurt Tucholsky gewirkt, der auch für den Roman geworben habe. Das erfolgreiche Theaterstück sei daraufhin auch in Paris aufgeführt worden, und von dort sei es zurück nach Prag und in den Rang der Weltliteratur gelangt. Eine vor etlichen Jahren erschienene Neuübersetzung von Antonín Brousek bezeichnete Schnabl als „hochdeutschen Aufguß, schmeckt wie alkoholfreies Bier“.
Freunde hätten Hašek kurz vor seinem Tod nach Lipnitz ins Grenzgebiet von Böhmen und Mähren gebracht in der Hoffnung, daß er sich dort auskuriere. Aber auch da habe es ein Wirtshaus gegeben… Am äußersten Rand des dortigen Friedhofs an der Friedhofsmauer sei er begraben. Die Ruhestätte sei heute natürlich ein Wallfahrtsort für Hašek-Freunde, die ihm gerne Bier ins Grab schütteten. Das dortige Wirtshaus Zur Böhmischen Krone werde übrigens von Hašeks Enkel beziehungsweise Urenkel geführt. Markus Bauer
❯ Ackermann-Gemeinde im Bistum Regensburg
Visionen für das Leben im Auge behalten
❯ SL-Ortsgruppe Cham/Oberpfalz

Junger Obmann will



Zukunft gestalten
Am 3. Oktober starb Alois Hiebl, langjähriger Obmann der oberpfälzischen SLOrts- und Kreisgruppe Cham (➞ SdZ 42/ 2022). Mittlerweile wählte die Ortsgruppe einen neuen Obmann. Er heißt Dominik Götz.
Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wählte die Ortsgruppe Dominik Götz zum neuen Obmann und Elke Pecher zu seiner Stellvertreterin. Bernhard Siegl wurde Vermögensverwalter, Christine Kumschier Schriftführerin, Beisitzer wurden Karl Wartha und Ingrid Röhsler, Kassenprüfer Karl und Anna Wartha. Die Wahl des Chamer Kreisobmanns steht noch aus. Derweil führt die Stellvertretende Kreisobfrau Elke Pecher die Kreisgruppe. Unter dem Titel „Ein Verein, der wichtig bleibt“ stellt Melanie Schmid Dominik Götz in der „Chamer Zeitung“ vor.


„Mit Alois Hiebl hat Dominik Götz eine lange Freundschaft verbunden. Götz sah in ihm ein Vorbild im Glauben wie als Mensch. Nun tritt er als Obmann der Chamer Sudentendeutschen in dessen große Fußstapfen. ,Ich habe großen Respekt vor Alois Hiebls Lebensleistung‘, sagt der 33jährige. Im Redemptoristenkloster, wo Götz und Hiebl sich kennen und schätzen lernten, engagiert sich Götz als Kommunionhelfer und Lektor. Auch beim Krippenspiel packt er mit an. Das Ehrenamt, den Dienst am Nächsten sieht er als christlichen Auftrag.
Götz ist verheiratet und Religionslehrer. Religionspädagogik studierte er in Benediktbeuern. Seine Arbeit macht ihm Spaß. Im Glauben findet er Halt und Zuversicht. Eine seiner großen Leidenschaften ist das Reisen. Nach Indonesien, wo seine Frau herstammt, oder aber auch in die Tschechische Republik.
Seine Arbeit und seine Ehrenämter ergänzen sich. Götz spricht in der Schule wie im Gotteshaus vor einer Gruppe Menschen. Und im Religionsunterricht versucht er, den Kindern die Schicksale der Heimatvertriebenen näherzubringen. Mit dem Ukrainekrieg bekamen die Erlebnisse der Sudetendeutschen eine traurige Aktualität. Viele Menschen in Cham haben Geflüchtete als Vorfahren. So auch Götz.
,Meine Großmutter mütterlicherseits floh aber nicht aus Böhmen, sondern von Wien nach Amberg.‘ Kennengelernt
hat er seine Oma leider nie. Und doch hat ihr Schicksal das Leben seiner Mutter und sein eigenes geprägt. ,Als jemand, der seine Heimat nie verlassen mußte, kann man nicht nachvollziehen, was diese Menschen durchmachen mußten.‘ Sie konnten nur das Nötigste ihrer Habseligkeiten auf der Flucht mitnehmen, wenn sie es denn nicht unterwegs verloren haben. Sie waren auf Hilfe von Fremden angewiesen, die Mitleid zeigten. Wichtig sei, diese Schicksale nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Daher seien Menschen wie Hiebl, die die Flucht am eigenen Leib erlebt hätten und von ihren Erlebnissen erzählten, so wichtig, um den nachfolgenden Generationen als Mahnung zu dienen. Vielen falle es jedoch schwer, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten – damals wie heute. Und die alte Heimat, die gebe es nicht mehr. Viele der Dörfer auf tschechischem Boden sein verschwunden. Keine Kirche schlage mehr zum Gebet, keine Bank im Schatten vor dem Haus lade mehr zu einem ruhigen Ratsch ein. Das sei ein Schicksal, das nie wieder passieren dürfe – und doch immer wieder passiere. Heute und morgen. 28 Mitglieder hat die Chamer Gruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktuell. Götz zählt zu den Jüngsten. Und er hat sich viel vorgenommen: Er möchte den Verein verjüngen. ,Viele können mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft nichts anfangen und sagen sogar, das gehört sich aufgehört‘, schüttelt Götz den Kopf. Er dagegen möchte gezielt die Jüngeren ansprechen und den älteren Mitgliedern weiterhin ihre gewohnten Programmpunkte im Jahreslauf anbieten. ,Besonders gut angenommen werden die Maiandacht und die Adventsfeier.‘ Seit vier, fünf Jahren engagiert sich Dominik Götz in der SL. Über Alois Hiebl wurde er Mitglied. Bewunderung schwingt in seiner Stimme mit, als er von den Besuchen mit Hiebl in der Tschechischen Republik spricht. ,Er erzählte offen von seiner eigenen Familiengeschichte.‘ Daher ist sein Tod ein großer Verlust für die SL. Viele der Mitglieder konnten sich mit ihm identifizieren. Sie schätzten seine Art, seinen tiefen Glauben. In seinem Sinne möchte Götz die SL-Gruppe in die Zukunft führen.“
Ihren außergewöhnlichen Lebensweg erzählte – in einigen ausgewählten Etappen – beim jüngsten Literarischen Café der Ackermann-Gemeinde im Bistum Regensburg Christa Olbrich aus Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz. In ihrem Buch „Von der Kuhmagd zur Professorin“ hat sie ihre Biographie niedergelegt. Bei ihrem Vortrag im Regensburger Café Pernsteiner gab sie den rund 30 Zuhörenden den Rat, an Visionen dranzubleiben und diese nach Möglichkeit auch zu realisieren – und vor allem, so ihr Lebensmotto, „mit Mut und ohne Angst durch das Leben zu gehen“.


Nach der Begrüßung durch Bernhard Dick vom Diözesanvorstand stellte der frühere Diözesanvorsitzende Leonhard Fuchs die Autorin beziehungsweise ihr Buch kurz vor. Fuchs und Olbrich wohnen im selben Ort und kennen sich von dort. Fuchs hob den Untertitel des Buches „Ein Leben voller Herausforderungen“ besonders hervor.
Denn die im Jahr 1945 Geborene wurde 1946 mit dem Bruder und den Eltern aus der Heimat in Mährisch Schönberg vertrieben, verbrachte die Kindheit und Jugend in Mittelfranken, ehe es dann in die Oberpfalz ging. Prägend für Olbrich war unter anderem auch das Leben im Wald, in einer „Naturvilla“ mit allerlei Tieren. Von der Krankenhaushelferin arbeitete sie sich bis zur Professorin hinauf, wobei sie auf diesem Weg immer wieder beruflich, zum Teil auch privat, große Herausforderungen lösen oder Schicksalsschläge aushalten mußte.
Bei ihrem Vortrag im Literarischen Café wählte Olbrich drei
Aspekte aus: Erlebnisse beziehungsweise Eindrücke in der Kindheit im Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung, zeitgeschichtliche Aspekte aus den 1960er und 1970er Jahren insbesondere hinsichtlich des damaligen Frauen- und Männerbildes sowie ein persönliches und prägendes Erlebnis bei einer Südafrika-Reise. Und aus diesen Vorkommnissen resultierten schließlich Ratschläge an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Durchgängig und alle Lebensabschnitte verbindend sind bei Christa Olbrich die Visionen. Bereits in der von Mangel geprägten Kindheit sagte sie sich: „Wenn ich einmal groß bin, dann baue ich meinen Eltern ein Haus.“ Oder: „Dann schaue ich mir die große weite Welt an.“ Christa Olbrich dazu: „Die Visionen aus der Kindheit waren das Fundament für das Leben. Das hat mir Kraft gegeben, die Visionen zu erfüllen.“ Ein Ausflug zu Verwandten an die Nordsee oder eine Kinderverschickung nach Luzern in die Schweiz waren die ersten Erfahrungen in diesem Bereich. Die Entscheidung ihrer Mutter, daß die Tochter eine Kuhmagd werden sollte, widersprach den Visionen. „Aber es gab damals keine andere Perspektive“, so die Buchautorin zurückblickend.
Eine weitere Vision hatte Olbrich hinsichtlich ihres beruflichen Weges. Sie hatte es doch in den Krankenpflegebereich ge-
schafft. Doch die Vision sagte ihr, daß damit ihre berufliche Karriere noch nicht zu Ende sei. Damals, in den 1960er und 1970er Jahren, gab es das Telekolleg, mit dem man sich weiterbilden konnte. Aber – die Frau mußte damals ihren Ehemann fragen oder um Erlaubnis bitten, solche Angebote wahrnehmen zu
für sie besser hätte sein können. Die dritte Anekdote betraf das private Leben: eine arge Enttäuschung durch ihren Ehemann bei einer Reise nach Südafrika, die zur Ehescheidung führte. Doch auch aus diesem Erlebnis half ihr eine Vision. „Ich kann nicht von der Erde fallen“, beschreibt Olbrich dieses herbe Ereignis beziehungsweise die damit zusammenhängende Vision. Fünf Ratschläge gab sie abschließend, basierend auf ihren Visionen und Erfahrungen:
● Genau beobachten, welche Visionen man hat. Wenn etwas aus dem Herzen kommt und Freude macht, sollte man dies umsetzen.
dürfen. Das Bild von Mann und Frau war noch patriarchalisch geprägt, eine Frau mit Ende 20 wurde durchaus als „tüchtiges Mädchen“ bezeichnet. Olbrich wollte nach der Mittleren Reife auch das Abitur nachholen, das sie schließlich auch schaffte – wenn auch nicht mit einer Numerus-Clausus-Note. Nach einer Wartezeit erhielt sie schließlich einen Studienplatz für Medizin, die Doktorarbeit wollte sie über ein Pflege-Thema machen, was aber – sei es wegen der von einigen Professoren bezweifelten Wissenschaftlichkeit des Themas oder weil sie Frau war – zu einigen Schwierigkeiten führte. Letztlich aber gelang auch das mit einem Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung, auch wenn die Anerkennung


● Die Vorstellung konkret visualisieren und das Gefühl mit hineinnehmen, die Freude spüren.
● Mutig entscheiden, Mut und Vertrauen geben Sicherheit, daß es gelingen wird.
● Gelassen sein und es –falls nötig – wieder loslassen können. Gelassenheit und Offenheit ermöglichen, daß sich die Dinge entwickeln.
● Dankbarkeit – daraus entwickeln sich Sicherheit, Kraft und Stärke, insgesamt die positiven Seiten.



„Das Leben ist stets von Wandel geprägt“, stellte Christa Olbrich abschließend fest. Die Ratschläge könnten beitragen, daß jeder wieder mehr der eigene Schöpfer seines Lebens wird. Markus Bauer
❯ SL-Kreisgruppe Bayreuth/Oberfranken
Aber feiern tun wir doch



Aber feiern tun wir doch, und das nicht nur zur Sommerszeit, nein auch im Winter, wenn es schneit: Das war das Motto der oberfränkischen SL-Kreisgruppe Bayreuth bei ihrem jüngsten Treffen.

Feiern ist zwar etwas übertrieben in der jetzigen unsicheren Weltlage, aber die Landsleute lassen sich trotzdem den Humor nicht nehmen. Der Stellvertretende Kreisobmann Helmut Hempel hatte die Heimatfreunde der Ortsgruppen Fichtelberg, Warmensteinach, Weidenberg und Gäste aus Bayreuth sowie die Kreis-, Bezirksund Vize-Landesobfrau
Margaretha Michel zu einer Zusammenkunft

Mitte Februar nach Bischofsgrün, den heilklimatischen Luftkurort des Fichtelgebirges und Heimat von „Jakob“, dem größten Schneemann der Welt, eingeladen.
Bei gutem Gebäck, Kaffee oder Tee traf man sich im Café Ruckdeschel im Ortsteil Birnstengel, um sich über das Programm für das erste Halbjahr auszutauschen. In der Hauptsache ging es um die Fahrt zum Sudetendeutschen Tag, der wieder zu Pfingsten in der DonauArena in Regensburg stattfindet. An einer Busfahrt, die für Pfingstsonntag geplant ist, sind
die meisten Landsleuten interessiert, es kommt aber auf die Beteiligung und die Buskosten an. Natürlich kam beim Beisammensein die Mundart, in der Hauptsache vom Heimatdichter des Isergebirges, Heinz Kleinert, zum Vortrag, die Landsmann Rudolf Kiesewetter, der das Paurische noch beherrscht, vortrug. Auch Obmann Hempel beteiligte sich mit einem Beitrag in Mundart und trug einen Auszug eines Stanzel-Liedes vor: „Schiefe Absätze und in jedem Strumpf ein Loch, aber feiern, feiern tun wir doch. Und das nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit.“ Geschneit hat es nicht, der Tag zeigte sich von seiner schönsten Seite, es herrschte herrliches Winterwetter mit blauem Himmel, was den Gästen in guter Erinnerung bleibt. tl
❯ VLÖ

Zu Gast im Hohen Haus
Mitte Februar folgte der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) der herzlichen Einladung der ÖVP-Vertriebenensprecherin Gudrun Kugler für eine Besichtigung des neu renovierten Parlaments.
Dabei konnten die VLÖ-Vorstandsmitglieder, Funktionäre und Freunde des Hauses der Heimat in Wien nach dem Eintreffen im komplett neu gestalteten Besucherbereich des Parlaments nähere Eindrücke im Zuge einer Be-
sichtigung sammeln. Diese führte unter anderem durch die Säulenhalle, den Plenarsaal, den Reichsratssitzungssaal sowie durch den Sitzungssaal des Bundesrates.
Im Zuge des Rundgangs durch das Hohe Haus am Ring ergab sich ein zufälliges Oberösterreicher-Treffen. Landeshauptmann Thomas Stelzer und ÖVP-Klubobmann August Wöginger tauschten sich unter anderem mit VLÖPräsident Norbert Kapeller, mit Manfred Schuller, Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich und
❯ SL-Ortsgruppe Bad Kötzting/Miltach in der Oberpfalz
VLÖ-Vizepräsident, und dessen Gattin Ingrid sowie dem SLÖ-Landesobmann Peter Ludwig aus.
Auf Einladung der Nationalratsabgeordneten Gudrun Kugler trafen die Teilnehmer an der Führung anschließend im Parlamentsklub der ÖVP zu einem Gedankenaustausch zusammen, wobei VLÖ-Präsident Norbert Kapeller und die Landsleute Kugler herzlich für ihr Engagement im Sinne der Heimatvertriebenen und Heimatverbliebenen sowie für ihre Unterstützung auf parlamentarischer Ebene dankten.

Nach Entlastung närrisch geworden
Mitte Februar fand die Jahreshauptversammlung der oberpfälzischen SLOrtsgruppe Bad Kötzting/Miltach in Bad Kötzting statt.
Nach der Begrüßung sagte Ortsobfrau Elke Pecher, daß das landsmannschaftliche Leben nach Corona nur sehr gemächlich wieder in Fahrt gekommen sei. Zu den anberaumten Treffen im Café Weixel in der Ziegelhütte zum Plauschen und Austauschen von Erzählungen und Erlebnissen seien nicht viele gekommen. Manchmal habe es zufällige Begegnungen im Kurpark gegeben.

Immerhin hätten vergangenes Jahr zwei Literarische Cafés stattgefunden. Im April habe Leonhard Fuchs über das Leben und das Werk des Schriftstellers Ota Filip gesprochen. Und im Oktober habe Dolf Schwarz einen Vortrag über die Begegnung von Johann Wolfgang von Goethe und Ludwig van Beethoven im Jahre 1812 im böhmischen Kurort Teplitz gehalten. Obwohl die Ortsgruppe 2022 keine Busfahrten unternommen habe, so Pecher, habe sie am Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Hof an der Saale teilgenommen. Ebenso teilgenommen habe die Ortsgruppe an den Feierlichkei-
❯ Eghalanda Gmoi z‘ Nürnberg
ten anläßlich des Volkstrauertages in Bad Kötzting. Die alljährliche adventliche Stunde habe die Ortsgruppe im Hotel Amberger Hof begangen.
In der Hoffnung, daß dieses Jahr hinsichtlich der SL etwas reger werde, teilte Pecher folgende Planungen mit: Teilnahme am Märzgedenken der Kreisgruppe Cham in der Chamer Klosterkirche, En-
❯ SL in den neuen Bundesländern und das Riesengebirge PR für die Heimat
Der gebürtige Trautenauer Peter Barth war 1991 Mitbegründer der SLKreisgruppe Bitterfeld und der SLLandesgruppe Sachsen-Anhalt. 1992 wurde er Mitglied und Protokollführer des Riesengebirgler Heimatkreises Trautenau. Nach seinem Umzug nach Barth gründete er die SLKreisgruppe Nordvorpommern und arbeitete in der SL-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Er organisierte die zweijährlichen Nordtreffen der Riesengebirgler. Außerdem war er bis Ende 2022 Schriftleiter der „Riesengebirgsheimat“ für die Heimatkreise Hohenelbe und Trautenau. Der versierte Heimataktivist blickt zurück auf die Öffentlichkeitsarbeit seiner SLGruppen und seiner Heimatkreise.
Kugelschreiber der SL-Kreisgruppe Nordvorpommern und Taschenkalender der SL-Kreisgruppe Bitterfeld.




de März ein Literarisches Café im Hotel Post, ein zweites Literarisches Café werde im zweiten Halbjahr folgen. Im April werde ein Treffen mit der Ortsgruppe Cham im Studio im Chamer Kolpinghaus Hotel am Regenbogen stattfinden. Eine Maiandacht in der Vollmauer Kapelle bei Furth im Wald sei fest eingeplant. Zu einer weiteren Maiandacht mit der Ortsgruppe Cham werde man sich Ende Mai in Langwald bei Pösing


mit anschließender Einkehr im Garten von Christine Kumschier treffen. Am Pfingstsonntag werde die Ortsgruppe am Sudetendeutschen Tag in der Donau-Arena in Regensburg teilnehmen. Die Erzähl- und Spielenachmittage sollen weiterhin jeweils an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Ziegelhütte/ Café Weixel durchgeführt werden.
Vermögensverwalter Max Seiderer erstattete seinen Bericht, der zu keinerlei Beanstandungen Anlaß gab. Ihm und dem Vorstand wurde einstimmig die Entlastung erteilt. Schließlich ehrten Obfrau Pecher und ihre Stellvertreterinnen langjährige Mitglieder für ihre Treue. Mit Urkunden geehrt wurden Marianne Bielmeier, Herta Lankes, Friederike Urban-Ferstl, Sieglinde Dolzer, Josef Hacker und Elke Bergmann für 20, Franz Zieris für 25 sowie Klaus und Marianne Heiduk für 45 Jahre Treue. Aus gesundheitlichen Gründen waren nicht alle Ausgezeichneten zur Versammlung gekommen.
Zu guter Letzt wurde aus der Jahreshauptversammlung eine ausgelassene Faschingsfeier. Die Landsleute hatten nämlich ihre mitgenommene Verkleidung angelegt und verbrachten nun heitere Stunden.

Es is halt wieder schei gwenn!
Mitte Februar widmete sich die Eghalanda Gmoi z‘ Nürnberg im dortigen Haus der Heimat der Fastnacht.
Vüarstäihare Ingrid Deistler hatte zu diesem unterhaltsamen und lehrreichen Nachmittag eingeladen – und vie-
le Egerländer und andere Sudetendeutsche waren gekommen. Deistler hatte eigens den Halblandsmann Erich Ameseder engagiert, der über Faschingsbräuche in Franken referierte.
Wissenswert ist, daß es 1449 in Nürnberg den allerersten Faschingszug gab
und gegenwärtig die Sendung „Fastnacht in Franken“ die erfolgreichste Faschingssehfernsendung ist. Deistler ergänzte, daß ein Teil der Bräuche wie der Schwertertanz von Nürnberg aus nach Eger und in den Böhmerwald gelangt sei. Jedenfalls gefiel der Vortrag von Erich Ameseder allen. Als dann auch noch Ingrid Deistler mit ihrer Gitarre und ihr Sohn Gerald mit seinem Dudelsack aufspielten, wurde es einem warm ums Herz. Der Nichtegerländer lobt: „Es ist halt wieder schei gwenn!“ al

Auch für uns Landsleute ist Öffentlichkeitsarbeit von Bedeutung. Wir weisen auf unsere Veranstaltungstermine hin und berichten später über diese. Dies ist auch deshalb wichtig, da wir nur so Akzeptanz in der Öffentlichkeit erreichen. Die Königsklasse ist das Fernsehen, da hier schon der technische Aufwand wesentlich umfangreicher als beim Rundfunk ist. Eine Berichterstattung ist nicht einfach zu erreichen und nur durch intensive Vorarbeit möglich. Und dann beträgt die Sendezeit eine Minute und 30 Sekunden. Etwas einfacher ist es dagegen beim Hörfunk, zum Beispiel mit Veranstaltungshinweisen. Bei Interviews gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: beim Sender oder vor Ort. Ersteres ist natürlich verhältnismäßig theoretisch. Ein Interview vor Ort erfolgt in einer wesentlich stimmungsvolleren Atmosphäre.
Relativ einfach ist es, in der regionalen Presse Fuß zu fassen. Dabei spielt der persönliche Bekanntheitsgrad eine große Rolle. Regelmäßige Festtagsgrüße helfen, die Türen offenzuhalten. Bei Veranstaltungen sollte man jeweils von Fall zu Fall entscheiden, ob man die Berichterstattung selbst übernimmt. Berichtet man selber, weiß man, wovon man berichtet und kann den Inhalt bestimmen. Oder lädt man lieber einen Repor-
Briefmarke zum 5. Nordtreffen der Riesengebirgler 2007 in Rostock in MecklenburgVorpommern.


Das Fernsehen bei den Treffen der SLLandesgruppe Mecklenburg-Vorpommern 2007 oben und 2009 unten.
ter ein? Das könnte für die Bilder von Vorteil sein und sichert einen günstigeren Termin sowie Platz für die Veröffentlichung. Schwieriger ist, bei überregionalen Zeitungen Fuß zu fassen. Aber auch da gibt es einen Trick, den Umweg über Nachrichten-Agenturen. Eine Information von ADN wird natürlich eher akzeptiert als eine persönliche Meldung von Peter Barth. Die Öffentlichkeit vor Ort bietet eine weitere Möglichkeit der PR. So kann man sich bei Volksfesten mit einem eigenen Stand oder bei Umzügen mit einer mitlaufenden Gruppe präsentieren. Ein weiteres Werbemittel ist die Briefmarke. Sicherlich wäre es vermessen, die Herausgabe einer offiziellen Briefmarke der Deutschen Post zu versuchen, aber durchaus realistisch bei den inzwischen fast überall installierten Privatposten wie Post-Modern in Dresden oder Biber-Post in Berlin. Diese Unternehmen stehen häufig im Verbund mit Zeitungsverlagen, da diese bereits über ein gut vernetztes Verteilungssystem verfügen. Im Nordosten Deutschlands sind es Nord-Brief sowie ehemals Ridas. Für das 9. Nordtreffen der Riesengebirgler 1999 in Rostock gaben wir mit Ridas eine Briefmarke mit der aufgehenden Sonne hinter der Schneekoppe heraus. Auch kann man die in der Wirtschaft üblichen Mittel wie Werbekugelschreiber oder Werbetaschenkalender nutzen. Nicht zu vergessen ist auch die interne Öffentlichkeitsarbeit. Da ist zuerst die Presse zu erwähnen: die Sudetendeutsche Zeitung, die verschiedenen Heimatzeitungen, aber auch die „Prager Volkszeitung“ sowie die „Sudetenpost“ in Österreich. Beim Sudetendeutschen Tag bieten sich neben dem passiven Besuch ebenfalls PR-Möglichkeiten wie ein eigener Stand, der Einmarsch mit den Trachtengruppen oder die Beteiligung an Mundartvorträgen. Wir haben also mannigfaltige Möglichkeiten, unser Anliegen in der Öffentlichkeit zu publizieren. Entsprechend der Orts-, Kreis-, Bezirksund Landesebenen sollten wir diese Möglichkeiten nutzen.

Neudek Abertham

Neudeker Heimatbrief

für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Folge 642 · 2/2023
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft, Stadtsparkasse München – IBAN: DE69 7015 0000 0906 2126 00, BIC: SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge 643 (3/2023): Mittwoch, 15. März.


❯ Im Heimatmuseum in Augsburg-Göggingen
Auf den Spuren der Ahnen
Vor zwei Jahren stieß Conrad Fink auf einen Karton mit Fotoalben und Briefen. Die gehörten zum Nachlaß seiner väterlichen Großeltern. Auch Gegenstände aus dem Haushalt der Großeltern und eine Tonbandaufzeichung seiner Großmutter fanden er noch. Er berichtet.

Mit Edwin Bude auf Dreh-Tour
Edwin Bude, bekannt als Macher schöner SudetenlandFilme und Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises für Literatur und Publizistik 2022, dreht einen Film über die Eisenbahn im Sudetenland.
Dafür informierte sich Bude kürzlich im Neudeker Heimatmuseum in AugsburgGöggingen bei Josef Grimm, Vorsitzender der Heimatgruppe „Glück auf“. Grimm erzählte viel über die Planung und Entstehung der Bahnlinie zwischen Karlsbad und Johanngeorgenstadt. Früher wurde diese Strecke mit der Postkutsche bedient. Vom letzten Postillon Adolf Hermann ist die Uniform ausgestellt, für die sich Bude interessierte. Ursprünglich sollte die Bahnlinie mehr östlich über Merkelsgrün gebaut werden. Dort wäre aber wegen der hohen Steigung ein Streckenabschnitt als Zahnradbahn nötig gewesen. So wurde die Strekke von Karlsbad, auch wegen der Wollkämmerei, über Neudek gebaut und am 15. Mai 1899 in Betrieb genommen. Heute heißt sie ErzgebirgsSemmering. Wir empfahlen Bude diese romantische Strecke für seinen Film, und ich begleitete ihn Ende Januar ins Erzgebirge. Unser Quartier war das Hotel Anna in Neudek. Gleich am Tag der Anreise machte Bude Aufnahmen am Karlsbader Bahnhof. Der Obere Bahnhof war gerade umgebaut worden, von einer neuen Brücke über die Gleise konnte Bude die ankommenden und abfahrenden Züge genau beobachten.
An vergangene Zeiten erinnert das erhaltene Vordach des alten Bahnhofs. Am Abend trafen wir uns mit unseren Nejdker-Freunden von der Bürgerorganisation JoN (Jde o Nejdek – Wir sind für Neudek). Sie halfen uns wieder und gaben gute Ratschläge. „Einen Sechser im Lotto“ nannte Bude das Treffen mit Hans Kemr, der bis zu seiner Rente diese Strecke als Lokführer befahren hatte.


Am nächsten Morgen trafen wir uns mit Hans Kemr am Neu-

deker Bahnhof. Dabei konnte ich auch über meine Erinnerungen an das Lager neben dem Bahnhof berichten, wo wir 1946 ein paar Tage bis zum Abtransport Richtung Westen interniert waren. Ich erzählte, wie die Viehwaggons mit den Kisten und Säkken beladen, wir Kinder und gebrechliche Menschen in den Wagen gehoben wurden und daß der Zug kurz vor Mitternacht losfuhr. Es flossen viele Tränen. Jetzt kam unser Zug, Lokführer
a. D. Hans Kemr kannte natürlich das Zugpersonal. Ein paar kurze Gespräche – und Bude durfte vorne zum Lokführer und ihn bei seiner Arbeit filmen. Nach den Haltestellen Hochofen und Eibenberg wurde es immer winterlicher. Frau Holle hatte es zuvor kräftig schneien lassen, und Petrus schickte eine Kälte, die die Zweige der Bäume mit glitzerndem Raureif überzuckerte. Eine Winterfahrt wie im Märchenbuch.

das Handschuhmacher-Handwerk, zeigte die verschiedenen Maschinen und Arbeitsgeräte. Alles ist anschaulich und ansprechend platziert. Im oberen Stockwerk kann der Besucher viele Mineralien aus Abertham und Umgebung bestaunen. Höhepunkt ist die „Zeitreise“.
Eine Tür zu einer Kabine öffnet sich. Wir treten ein. Die Türe schließt sich, und unsere Zeitreise in die Vergangenenheit beginnt. Eine Frauenstimme erklärt, und wir gehen in einen Stollen. Dort sehen wir Bergleute bei ihrer schweren Arbeit und lauschen ihren Gesprächen. Zum Schluß verabschiedet sich ein Bergmännchen von uns, und wir treten wieder hinaus in die Wirklichkeit.
Das Ganze dauerte zehn Minuten. Wir waren zuerst mit den Bergleuten beim Silberabbau. Eine zweite Zeitreise informierte uns über den Uranabbau. Außerdem gibt es eine Zeitreise über den Erzabbau. Ein Besuch des neuen Handschuh-Museums von Abertham ist empfehlenswert.
Ein kurzer Aufenthalt zur Stärkung in Breitenbach, ehe wir mit dem selben Zug, der nach Johanngeorgenstadt weiter gefahren war, wieder in Richtung Neudek und Karlsbad zurückfahren konnten. Bei der Rückfahrt kamen wir am Unteren Bahnhof an, so daß beide Karlsbader Bahnhöfe im Film festgehalten sind.
Am nächsten Tag fuhren wir mit Budes Allradantrieb-Auto die Strecke parallel zum Gleis entlang. Wieder half Hans Kemr, der die Fahrpläne im Kopf hatte. So waren wir an markanten Punkten wie dem Viadukt bei Bärringen oder der Brücke über die beiden Brückenbogen in Neuhammer, wenn der Zug passierte. Warten war angesagt, wenn der Zug Verspätung hatte. Dies war auf der langen freien Fläche vor dem Bahnhof in Platten der Fall. Die Landschaft mit den verschneiten Tannen und von dickem Rauhreif überzogenen Ästen entschädigte uns für das Warten. Dann kam der Zug und schlängelte sich durch die Landschaft Richtung Bahnhof.
Auf der Rückfahrt besuchten wir das neue Aberthamer Museum. Lenka Löffler erzählte uns und erklärte ausführlich über

Das weckte meine Neugierde, und ich begann, nach den Wurzeln meiner Vorfahren zu suchen. Die Bildunterschriften machten mich auf die Gemeinden Hochofen, Trinksaifen und Neudek aufmerksam. Im Internet fand ich unter sudetendeutschefamilienforscher.de die Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher. Hier verschaffte mir Jürgen Heidrich Zugang zu Porta Fontium (portafontium.eu), einem bayerisch-tschechischen Netzwerk digitaler Geschichtsquellen mit einer digitalen Sammlung von Kirchenbüchern oder Pfarrmatriken. Das sind von Pfarrern angelegte Verzeichnisse über Taufen, Trauungen und Todesfälle.
Bald fand ich dort noch mehr Informationen über meine Vorfahren und deren Leben im Kreis Neudek. Auch fand ich weitere Unterstützer in Deutschland und in der Tschechischen Republik,
die mir bei meinen Studien und Nachforschungen halfen. Zu ihnen gehören Anita Donderer und Josef Grimm in Augsburg oder Adolf Hochmuth, der die Treffen beim Beerbreifest in Trinksaifen und Hochofen organisiert.




Von Ulrich Möckel, dem Herausgeber von „Der Grenzgänger“, stammt die informative Broschüre „Trinksaifen und Hochofen“, die über das böhmische Doppeldorf und seine Bewohner berichtet. Zwischenzeitlich habe ich auch Kontakt zu Gerhard Fuchs aufgenommen, der über seine Familie im Kreis Neudek forscht und mit mir entfernt verwandt ist, sowie zu Tobias Leistner, der Postkarten des Landschaftsfotographen Rupert Fuchs sammelt.
Auch Tschechen boten mir wichtige Hilfe. So besorgte mir Pavel Andrš als Historiker und Archivar für Neudek die Geburtsurkunde meines Vaters, der 1920 geboren wurde. Er stellte auch den Kontakt zu Martin Litavský, einem Steinmetz in Neudek, her. Litavský ist der heutige Besitzer des Hauses Nr. 295 in Neudek, in dem meine Großmutter und mein Vater zur Welt kamen. Roman Kloc, Trinksaifener mit deutschen Wurzeln, halfen mir ebenfalls sehr. Beim Entzif-
Am letzten Tag wollte Edwin Bude noch einiges in Neudek filmen. Zuerst gingen wir auf den Friedhof. Dort zeigte ich Bude den 2016 errichteten Gedenkstein für alle, die bis 1946 dort in der Heimaterde ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Bemerkenswert ist, daß das Grabkreuz von Herbert Götz, versehen mit einer kleinen Gedenktafel, rechts des Steins noch seinen Platz fand. Zur Stadt gehören der Blick zur Kirche, der Turm und oben zur „Schönen Aussicht“. Am Turmfelsen entdeckten wir die Gedenktafel für den Missionar Ignaz Sichelbarth (* 1708 in Neudek, † 1780 in Peking). Am Ufer der Rohlau erinnert ein Gedenkstein mit Relief an Johann Wolfgang von Goethe, der 1786 den Neudeker Turm zeichnete. Unsere Vorgänger von der Heimatgruppe „Glück auf“ schenkten der Stadt Augsburg zu ihrer 2000-Jahr-Feier ein Glasfenster mit dieser Zeichnung, das im Verwaltungsgebäude neben dem Augsburger Rathaus seinen Platz fand. Nun sind wir auf Edwin Budes Film „Die Eisenbahn im Sudetenland“ mit vielen Aufnahmen aus Neudek und Umgebung gespannt. Mir wurde nach diesen Tagen erneut bewußt, wie schön unsere Heimat ist. Anita

 Donderer
Donderer
fern der Matriken und der Briefe half Roswitha Schweichel und das Team der Sütterlin-Schreibstube der AWO Konstanz.
All diesen Menschen danke ich von Herzen. Dank des Augsburger Stadtarchivs konnte ich Kontakte zu einer Familie Dürmaier in Augsburg knüpfen, deren Vorfahren von den Familien Fink und Stöckner im Kreis Neudek stammen. Eine meiner Verwandten in Augsburg ist eine geborene Stöckner. Sie kam im Haus Nr. 229 in Bernau zur Welt.
Auch dieses Haus existiert noch.
Wie viele andere Sudetendeutsche fanden die Stöckners in Augsburg eine neue Heimat.
Auch sie haben noch zahlreiche
Unterlagen und Fotos von ihren Vorfahren über unsere gemeinsame Familiengeschichte und halfen mir sehr. Die Verwandten halfen, einen Stammbaum der Familien Stöckner-Fink zu erstellen. Mittlerweile verfestigte sich unser Kontakt, und ich hatte Gelegenheit, meine Verwandten Anfang August in Augsburg zu treffen. Dabei stand auch ein gemeinsamer Besuch des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg-Göggingen auf dem Programm.
Bei unserem Besuch des Heimatmuseums empfingen uns Anita Donderer und Josef Grimm von der Heimatgruppe „Glück auf“ – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg. Josef Grimm, der aus Abertham stammt, führte uns durch das Museum.

Neben der Besichtigung der vielen gut erhaltenen und wertvollen Ausstellungsstücke aus der Heimat war für uns auch interessant, konkrete Informationen über unsere Familien und deren Heimatgemeinden zu finden. Auch hier ist das Museum eine Fundgrube. Es beherbergt eine Literatursammlung über die Sudetendeutschen sowie Einzelordner mit Hinweisen über die Teilgemeinden, so Neudek, Trinksaifen und Hochofen. Über Familien gibt es gebundene Kompendien ihrer Geschichte.
Eine Besonderheit ist die Sammlung des Fotografen Rupert Fuchs, dessen Bilder sich in nahezu allen Alben der ehemaligen Bewohner des Kreises Neudek finden. Im Museum sind seine Plattenkamera aus Holz und seine Plattenkästchen ausgestellt. Rupert Fuchs ist in Neuhammer geboren und hatte ein Fotostudio. Er machte rund 2000 Landschaftsaufnahmen aus der Gegend. Diese finden sich sehr häufig als Postkarten in den Alben auch unserer Familien.
Auch viele Familien- und Gruppenfotos in den Alben gehen auf ihn zurück. Wir dankten Josef Grimm und Anita Donderer für die Führung mit einer Spende für die Heimatgruppe „Glück auf“.
Wir wollen die Kontakte weiter pflegen, und ich plane, die Heimat meiner Ahnen zu besuchen. Ich habe gerade erst angefangen, mich mit der Geschichte meiner Vorfahren aus dem böhmischen Erzgebirge zu beschäftigen und habe noch viele Fragen zu meiner Herkunft und unseren Familien Fink, Fuchs, Stöckner, Glöckner, Herold und Lill. Sofern sich jemand mit der Geschichte dieser Familien beschäftigt hat, würde es mich freuen, wenn er zu mir Kontakt aufnimmt: Conrad Fink, Im Kirchfeld 38, 71691 Freiberg am Neckar.
Ein Tierpark zum Vogelschutz
Neben Bärringen gab es früher auch einen Tierpark in Neudek. Heute erinnern noch das Eingangstor und die Fundamente der Gebäude daran. Während seines kurzen Bestehens war es jedoch ein sehr beliebter Ort bei der lokalen Bevölkerung.
Auch in der Gegend um Neudek war das Fangen und Züchten von Vögeln ein großes Hobby, aber eigentlich war es Tierquälerei. Deshalb wurde auch dieser „Sport“ gesetzlich verboten. Um die private Vogelzucht zu verhindern, gründeten einige Enthusiasten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Februar 1919 den Allgemeinen Kanarienzucht- und Vogeschutzverein in Karlsbad. Adolf Heger, Wenzel Jungbauer, Johann Ullmann, Fritz Lein, Anton Pecher, Ignaz und Karl Garreis aus Bernau wurden ebenfalls Mitglieder dieser Vereinigung und bildeten die Sektion Neudek. Diese Sektion wuchs im Laufe der Zeit, bis sie die Zahl der Karlsbader Mitglieder übertraf, so daß der Sitz des Vereins nach Neudek verlegt wurde. Die damalige Stadtverwaltung von Neudek war dem Verein gegenüber sehr freundlich gesinnt und stellte ihm mehrere Hektar bewaldetes Land in der Nähe des Kreuzberg-Gebietes zur Verfügung. Der Verein erhielt auch verschiedene Subventionen und andere Unterstützung, und die
Eisenwerke und zahlreiche Geschäftsleute in Neudek scheuten keine Kosten für ihre Beiträge.
Der Aufbau des Zoos begann im Mai 1933, und laut der zeitge-
Bänke aufgestellt, Sträucher gepflanzt, Vogelkästen für nistende Vögel angebracht und Gehege für andere Tiere wie Hirsche, Rehe, Füchse, Hasen, Eichhörnchen und verschiedene Raubvögel gebaut. Ein Esel diente nicht nur dazu, Heu zu transportieren, sondern Kinder konnten auch auf ihm reiten.
Alle Mitglieder des Vereins beteiligten sich an dieser Arbeit und bauten im Laufe der Zeit sogar eine kleine gemütliche Sitzecke, in der Jausen und Getränke verkauft wurden und in der sich die Besucher nach einigen Stunden der Erkundung des Zoos ausruhen konnten.
Der Zoo war für die Öffentlichkeit Montag bis Samstag von 8.00 bis 18.00 und an Sonn- und Feiertagen von 6.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis betrug eine Krone für einen Erwachsenen und 20 Heller für ein Kind unter 16 Jahren. Arbeitslose erhielten eine Ermäßigung. Für 20 Kronen konnte man eine Jahreskarte kaufen, die nicht nur den Besitzer der Karte, sondern auch seine Kinder bis 16 Jahre zum Eintritt in den Tierpark für das ganze Jahr berechtigte.
Neudek. Die Miniatur hat wie der Schloßturm einen trapezförmigen Grundriß, so daß ihre vier Kanten von Süden aus gleichzeitig zu sehen sind.
Traurig ist, daß das gesamte Zoogelände nach 1945 verfiel und nach der Vertreibung der deutschen Bewohner nur noch ein Torso übrig blieb: das Eingangstor, der Stein mit der Gedenktafel von Heinrich Lumpe, die Fundamente von Bänken und kleinen Gebäuden.

In seinen Erinnerungen „Wie‘s daheim einst war“ schreibt der Neudeker Franz Achtner Folgendes.
Im dichtesten Waldgebiet war die Anlage mit viel Idealismus von den Neudeker Vogelschutzfreunden angelegt worden. Wie viele haben um 1935 ihre Freizeit geopfert, unentgeltlich und keine Mühe gescheut, dieses schöne Erholungsgebiet zu schaffen.
Man legte Wege an, baute kleine Käfige für Äffchen, weiße Mäuse, Vögel, Hamster, Terrarien für Kreuzottern, Blindschleichen und Echsen, säumte Waldwiesen ein für Rehe, und auch ein Esel bekam sein Teilchen zugewiesen, errichtete schließlich eine große Gaststätte gleich beim Eingang. Sie faßte weit über 100 Personen, und die mächtigen Glasfenster ringsum ließen den Blick in den dichten, dunklen Wald frei. An heißen Sommertagen wurden zusätzlich viele Bänke und Tische un-
nössischen Presse öffnete er am Sonntag, 20. Mai 1934, zum ersten Mal seine Pforten. Das gesamte Gelände wurde eingezäunt, Wege wurden angelegt,
Die Tiere wurden von den Mitgliedern des Vereins gefüttert und versorgt, was vor allem im Winter nicht einfach war. Johann Ullmann, David Pecher und Karl Lohwasser sind für ihr Engagement besonders hervorzuheben. Anton Pecher, Adolf Ullmann, Franz Pecher und David Pecher waren zu dieser Zeit Mitglieder des Verwaltungsrates. Auch Heinrich Lumpe aus Aussig (1859–1936), der Mäzen und Gründer des 1914 eröffneten großen Natur- und Vogelparks, genannt „Lumpepark“, stand den Züchtern mit Rat und Tat zur Seite. Interessanterweise war er mit einer Reihe von Attraktionen und Kuriositäten geschmückt wie einer Burgruine, Höhlen und märchenhaften Szenen.
Der Zoo in Neudek war nach dem in Aussig einer der schönsten und größten in der Tschechoslowakei, und Heinrich Lumpe besuchte den dortigen, noch unvollendeten Zoo im Sommer 1933 persönlich. Ihm zu Ehren wurde sogar ein Gedenkstein errichtet.

Im Zoo konnte man auch ein Lebkuchenhaus mit den Figuren von Hänsel und Gretel sowie einer Wildhüterpuppe besichtigen. Es gab auch das sogenannte Mäuseschloß, das im Frühjahr 1936 von den Gebrüdern Baumann gebaut wurde. Die Miniatur, die stellenweise bis zu fünf Meter hoch ist, war wahrscheinlich eine Art romantische Vorstellung der Autoren von der ursprünglichen Form der Burg in


Vom Winde verweht
ter den niederen Fichtenbeständen aufgestellt, und von der oft erbärmlichen Hitze merkte man dort nichts. Die Gastwirtschaft war dem Höhenrestaurant Schöne Aussicht angeschlossen, und die Zweigstelle Vogelschutzpark betreute vorwiegend die Wirtin, Frau Putz.
Bis zum Eingang des Vogelschutzparkes war es nur noch ein Katzensprung. Unser erster Blick galt der geräumigen Gaststube mit den großen Glasfenstern. War hier etwas los, nahmen wir Platz, aber meistens landeten wir gegenüber in der kleinen Holzbude, wo ein Herd stand und die eigentliche Küche der Gaststätte war. Wenn man die besagte Bude betrat, stand links der Ofen, daneben eine Anrichte mit einer Art Kredenz, an der Längsseite, wenn es überhaupt eine gab, denn das Zimmerchen war fast quadratisch, ein Divan, rechts eine Eckbank, ein Tisch und vor dem Tisch zwei oder drei Stühle. Aber ganz rechts, gleich ne-
ben der Tür, stand die „Hauptperson“, ein Grammophon.
Wenn man vorne beim Eingang zum Vogelschutzpark das Gelände betrat, klangen einem oft die „Alten Kameraden“, der „Einzugsmarsch der Gladiatoren“ oder ein Wiener Walzer entgegen und wiesen uns den Weg in die kleine Bude. Damals gab es nur Schellackplatten, man mußte für das Grammophon Nadeln parat halten und fleißig die Kurbel drehen. Am schlimmsten war der dran, der in der Nähe vom Grammophon saß, der mußte die Nadeln wechseln und die Kurbel leiern. Ungerecht ging es aber nicht zu. Freiwillig hat sich jeder einmal als „Kapellmeister“ betätigt und die Platten aufgelegt. Es gab so an die 40 Stück, und an „Ptattennachwuchs“ war 1940 bis 1944 nicht zu denken. Hunderte Male haben wir das Geleier gehört, und ebensooft haben



wir die Scheiben immer wieder aufgelegt. Brenzlich wurde es, als es im dritten Kriegsjahr fast keine Grammophonnadeln mehr gab. Da haben wir uns halt hingesetzt und die Spitzen wieder angefeilt.
Es wäre eine unverzeihliche Unterlassungssünde, wenn ich unsere Herbergsmutter, die Frau Putz, vergessen würde. Wie gesagt, war sie die Wirtin von der Schönen Aussicht. Herr Putz bewirtete drüben die Gastwirtschaft und Frau Putz den Vogelschutzpark. 1939 bis 1945 alles auf Marken! Frau Putz kannte unsere hungrigen Mäuler, daher befand sich in ihrer großen Tasche immer eine gewaltige Schüssel voller Kartoffelsalat, wenn sie gegen 15.00 Uhr durch den Wald kam. Auch gab es häufig Wurst oder Käse mit Brot. Frau Putz hat oft gesagt: „Geh Bou, laß deine Marken stecken.“
2014 führte die Stadt die erste Phase der Restaurierung des Mäuseschlosses durch, administrative Probleme, die später behoben wurden, verhinderten weitere Arbeiten. Vor einigen Jahren kam ein Pavillon hinzu, und in diesem Sommer wurden in der Nähe des ursprünglichen Zooeingangs neue pädagogische Spielelemente installiert, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen dazu anregen, die Natur auf interessante Weise kennenzulernen. Für die kommenden Jahre sind die Restaurierung dieses Schlosses und die weitere Verschönerung des ehemaligen Zoogeländes angedacht.
Pavel Andrš in „Krušnohorský Herzgebirge Luft“, übersetzt von Josef Grimm
Wenn es herbstelte und die Abende schon kürzer und kühler wurden, war es besonders schön in der molligen Wärme der kleinen Bude. Wir schürten den Herd, bis die Platten glühten. Holz hatten wir genug ringsum im Wald. Frau Putz meinte oft: „Macht nur langsam, ihr zünd‘ mir ja die Bude an.“ Schöne unvergeßliche Stunden verbrachten wir dort oben, doch es war Krieg. So mancher Kamerad oder gute Bekannte lenkte, kaum war er die ersten Stunden daheim auf Fronturlaub, seine Schritte zum Vogelschutzpark. Er wußte, dort findet er viele alte Freunde. Wie oft haben wir uns dort oben von den Kumpels verabschiedet, wenn sie wieder an die Front mußten. Für so viele war es der letzte Abschied. Sie kamen nie wieder. Auch unser Vogelschutzpark hat sich in ein Nichts aufgelöst. Auch er kommt nie wieder. Vom Winde verweht.
Dux Ossegg
Klostergrab
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau
Bilin Teplitz-Schönau
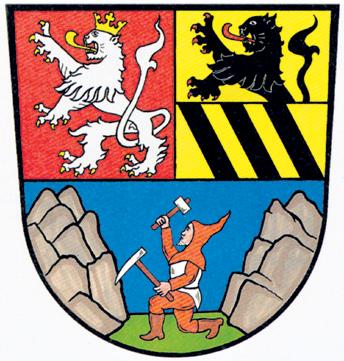







Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Prager Flair in Eichwald
Das Informationszentrum in Eichwald im ehemaligen Kreis Teplitz-Schönau befindet sich in einem früheren Kino, das 2012/13 zum „Haus mit blauem Blut“ umgebaut wurde und in der ersten Etage eine Ausstellung der Erzeugnisse der Eichwalder Porzellanfabrik Český porcelán mit dem typischen Zwiebelmuster-Geschirr zeigt. In Vitrinen sind gleichzeitig auch Erzeugnisse weiterer böhmischer Porzellanfabriken zu sehen, vor allem auch figurale Erzeug-
Der Gedanke, Porzellanminiaturen realer Gebäude zu gestalten, entstand bereits 1991. Als Vorlagen für die ersten Modelle dienten vor allem historische Gebäude des alten Prag. So sehen wir zum Beispiel die beiden Kleinseitener Brückentürme an der Karlsbrücke. Einer dieser Türme stammt aus dem 12. Jahrhundert, als die Teplitzer Klostergründerin Königin Judith von Thüringen die erste steinerne Brücke in Prag errichten ließ.


Auch die Altneusynagoge in Prag, eines der ältesten und wertvollsten jüdischen Denkmale aus dem 13. Jahrhundert, diente als Vorlage.
Aus den einzelnen Porzellanhäusern lassen sich ganze Ensembles von Straßen und Plätzen zusammenstellen, die glaubwürdig bekannte Orte wie das Goldene Gäßchen auf der Prager Burg, den Altstädter Ring mit seinem historischen Rathaus, die Teynkirche und das KinskyPalais sowie den Stadtteil Kleinseite in Prag darstellen. Jedes Modell ist manuell angefertigt und auf seine Art ein Original. Wegen des großen Interesses an dieser Kollektion von Miniaturen erweitert die Firma ihr Angebot ständig, das nun bereits 80 Modelle realer Bauten umfaßt, die nicht nur hinsichtlich ihrer Architektur, sondern auch ihrer historischen
nisse der Porzellanmanufaktur Royal Dux. Im Erdgeschosse hat das Eichwalder Informationszentrum seinen Sitz und lädt seit 8. Februar zur Ausstellung „Little Houses. Architektur in Porzellan“ ein. Diese Ausstellung zeigt die Erzeugnisse der Firma Art Studio Genetrix in Ohníč/Wohonsch, die sich mit der Herstellung manuell erzeugter Miniaturen historischer Häuser und Denkmale aus Porzellan befaßt.



Vergangenheit von Bedeutung sind. So finden wir darunter bedeutende Denkmale aus der gesamten Tschechischen Republik wie die romanische Rotunde auf dem SanktGeorgsBerg und die Wallfahrtskirche des heiligen Johannes
von Nepomuk im mährischen Saar, die heute zum UNESCOKulturerbe gehört. Alle diese Miniaturen wurden bereits weltweit zu Sammlerobjekten.
An dem Projekt arbeitete im Verlauf von Jahrzehnten eine Reihe bekannter Designer und Modellierer. Die Werkstatt in Wohonsch organisiert auch Workshops für Erwachsene und Kinder. Die Firma ist ein Familienunternehmen von Miroslav Kadlec, der über sich selbst sagt:
„Wir sind nicht nur eine Werkstatt zur Herstellung von Keramik, sondern wir sind auch ein ‚Asyl für dreibeinige
Kätzchen‘. Fast jeder, der an unserem Projekt mitwirkt, hat irgendein physisches oder mentales Handicap. Das ist der Mehrwert zu unserer nicht leichten Arbeit. Den Menschen, die in der heutigen Zeit nur schwer einen angemessenen Wirkungsbereich finden, geben wir Arbeit und die Chance eines vollwertigen Lebens Bereits seit Tausenden von Jahren begleitet die Herstellung von Keramik die Menschheit. Die Art der Herstellung hat sich seither wenig verändert, abgesehen von der serienmäßigen Produktion. Wir inspirieren uns vor allem an Techniken unserer Vorfahren und tauchen gern unsere Hände tief in die weiche Modelliermasse, lassen darin ein Stück von uns selbst, und bei jedem Öffnen des Brennofens zittern wir vor Erwartung, ob und wie es uns diesmal gelungen ist.“ Außer den Miniaturen stellt die Firma auch Gebrauchskeramik her.

Die Ausstellung zeigt viele Miniaturgebäude. Daneben informieren Texttafeln über die Geschichte der bedeutendsten Gebäude. Jutta Benešová
Die Ausstellung läuft bis 8. März im Eichwalder Informationszentrum Montag bis Freitag 9.00–16.00 Uhr.
Graupen Niklasberg
� Zum 20. Todestag eines Sozialdemokraten aus Dreihunken
Volkmar Gabert
Am Sonntag gedachte die Seliger-Gemeinde des 20. Todestages des am 11. März vor 100 Jahren in Dreihunken im späteren Kreis Teplitz-Schönau geborenen Landsmannes und führenden bayerischen SPD-Politikers Volkmar Gabert an seinem Grab auf dem Friedhof im oberbayerischen Unterhaching (Þ Seite 2).
Volkmar Gabert war in erster Linie Sozialdemokrat, langjähriger Landeschef und Abgeordneter seiner Partei, aber er stand auch von 1986 bis zu seinem Tod der SeligerGemeinde vor. Von seinen Vorgängern in diesem Amt stand Wenzel Jaksch als Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung ihm am nächsten. Dessen Nachfolger Ernst Paul und Adolf Hasenöhrl hatten vor allem aufgrund der deutschen Politik gegenüber den damals kommunistischen Staaten Ostmitteleuropas ein distanzierteres Verhältnis; aber Gabert verstand ungeachtet seiner hohen Positionen innerhalb seiner Partei diesen Abstand aufgrund seiner menschlichen Qualitäten zu überwinden und erwies damit der Einheit der Sudetendeutschen Volksgruppe große Dienste. Dafür erhielt er 1997 den Europäischen KarlsPreis der Landsmannschaft. Sein Interesse an und seine politische Unterstützung der Schaffung eines europäischen Volksgruppenrechtes waren nicht nur ein Ergebnis seiner Erfahrungen als Vertriebener, sondern auch ein Indiz seines grundsätzlichen Glaubens an die Notwendigkeit von Fairneß in der Behandlung nationaler Minderheiten. Aus ähnlichen Gründen beteiligte er sich nach 1998 – ungeachtet seiner bereits fortgeschrittenen schweren Erkrankung – auch als Mitglied des Verwaltungsrates an den umfangreichen Aufgaben des DeutschTschechischen Zukunftsfonds.

strie. Abends engagierte er sich bald als Vorsitzender einer Jugendgruppe der Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten in London und später als kooptiertes Mitglied des Vorstandes der von Wenzel Jaksch geleiteten Exilorganisation.
Diese Erfahrungen, verstärkt durch Schulungen der Fabian Society in der Labour Party, und die Auseinandersetzungen Jakschs mit der Exilregierung Edvard Benešs wegen dessen Vertreibungspolitik beeinflußten seine spätere politische Haltung entscheidend –nicht nur gesellschaftspolitisch oder das deutschtschechische Verhältnis betreffend, sondern auch hinsichtlich seines Eintretens für die Integration Europas. Nach Kriegsende, als die Rückkehr aus dem Exil lange nicht möglich war, wurde Gabert 1946 als politisch unbelastet Übersetzer bei der USABesatzungsmacht in München. Als einer der ersten Sudetendeutschen im Westen nahm er Berichte über Verfolgung und Vertreibung der Landsleute entgegen und leitete sie nach England an Jaksch weiter. Gabert war auch eine der ersten Kontaktpersonen in München, welchen Emissäre wie Emil Werner von der gescheiterten Wiedergründung der DSAP in der Heimat und der antideutschen Haltung der dortigen Behörden berichteten.
Volkmar Gaberts Grab in Unterhaching bei München.
Gabert entstammt einer alten nordböhmischen sozialdemokratischen Familie. Sein Vater, Oberlehrer in einem dörflichen Vorort von TeplitzSchönau, war seinen vier Kindern ein Beispiel an sozialdemokratischer Loyalität, aber er war auch ein Kritiker der ungerechten Politik gegenüber den Deutschen in der Ersten Republik. Selbstverständlich ordnete sich Volkmar wie seine Geschwister in die damals lebensumfassenden Organisationen der Arbeiterbewegung ein. Er war Mitglied der Roten Falken, der Sozialistischen Arbeiterjugend, der sozialdemokratischen Naturfreunde und des ArbeiterTurn und Sportbundes. Dies war nicht nur Zeitvertreib, sondern politischer Lebensinhalt und Vorbereitung auf sein Leben als Erwachsener.
1938 war er 15 Jahre alt. Damals mußte er mit seiner Familie nach England ins Exil. Sein Vater und sein ältester Bruder waren als sozialdemokratische Funktionäre hochgefährdet, so daß die Familie nicht im zunächst als sicher geltenden Prag bleiben konnte, wohin sie aus Nordböhmen geflüchtet war. Er mußte deshalb bereits in früher Jugend arbeiten. Er arbeitete in der Landwirtschaft, auf dem Bau und als Dreher in der metallverarbeitenden Indu
1948, als sich auch die Neubürger am politischen Leben beteiligten, wurde er Vorsitzender der Jusos in München; 1950 kam er in den Landtag, dem er bis 1979 angehörte. 1962 bis 1976 leitete er die SPDLandtagsfraktion, 1963 bis 1972 war er SPDLandesvorsitzender. 1962 und 1966 erzielte er mit 35,3 und 35,8 Prozent bisher nicht wieder erreichte Ergebnisse für seine Partei. 1964 bis 1979 war er Mitglied des SPDBundesvorstandes, ab 1979 für eine Wahlperiode Europaabgeordneter. 1971 bis 1988 war er Geschäftsführender Vorsitzender die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Sozialisten im Alpenraum und 1971 bis 1989 Vorsitzender der SPDBildungseinrichtung GeorgvonVollmarAkademie. Gabert war eine Herausforderung für seine eher konservativen Landsleute. Daß er dennoch gute und oft freundschaftliche Verbindungen zu ihnen hatte, lag an seiner ausgleichenden und selten polemischen Persönlichkeit. Wir erinnern uns an ausführliche Gespräche Gaberts mit Franz Neubauer und Johann Böhm in Brannenburg und bei Sitzungen des Sudetendeutschen Rates, welchem er viele Jahre an prominenter Stelle angehörte. Gaberts politische und humanistische Grundstimmung bestimmte seine Haltung gegenüber den Tschechen. Er war nicht begeistert von der deutschtschechischen Erklärung von 1997, weil sie die Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit belaste. Er stellte sich dennoch den Herausforderungen im Verwaltungsrat des Zukunftsfonds, weil er mehr an die Zukunft als an die Vergangenheit glaubte. Die gute Entwicklung des deutschtschechischen Verhältnisses in den vergangenen Jahren bestätigt seine Haltung. Martin K. Bachstein
LadowitzHEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ


Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Neue Prinzen und neuer Kinderdrache
Der „Drachenstich“ in der Bischofteinitzer Patenstadt Furth im Wald ist das älteste Volksschauspiel Deutschlands. Heuer findet es vom 4. bis 20. August statt. Gerade wurde das Prinzenpaar 2023, Rebecca Bauer und Alexander Pongratz, gekürt, und der Kinderdrachenstich erhält einen neuen Drachen.

❯ Gerti Schubert-Ubl: „Tief drin im Böhmerwald, Ronsperg, da liegt mein Heimatort“ – Teil III
Erstes Asyl nach der Flucht

Ronspergs Ortsbetreuerin Gertrud Schubert/Ubl schrieb ihre Erinnerungen an Flucht und Neuanfang nieder und ließ sie als kleines Heft für ihre Familie und Landsleute drucken, das im Februar 2012 erschien. Der Heimatbote veröffentlicht mit ihrer freundlichen Genehmigung das Kapitel „Die Flucht“ in mehreren Folgen.
Das Ganze war möglich geworden, nachdem meine Mutter offensichtlich zur vollsten Zufriedenheit bei einem Offizier gearbeitet hatte, und er zu ihr sagte:



„Du hast Deine Arbeit so gut gemacht, daß du einen Wunsch frei hast.“ Meine Mutter hatte für alle Mütter geantwortet: „Wir wollen unsere Kinder sehen.“ Damit hatte der Tscheche wohl nicht gerechnet. Vielleicht hatte er erwartet, daß sie sich etwas zu essen wünscht. Dennoch hielt er sein Wort, und es kam zu dem Treffen mit unseren Müttern.

Wir sahen zum ersten Mal die Baracke, in der sie festgehalten und untergebracht waren, von außen. Und wir konnten unsere Mütter – durch einen Stacheldraht von uns getrennt – sehen. Die Freude und der große Schmerz waren auf beiden Seiten zu sehen. Wir konnten nur kurze Zeit miteinander sprechen, aber die paar Worte meiner Mutter höre ich noch immer: „Sieh zu, daß du nach Linz flüchten kannst, wo die Tante dich aufnehmen wird – wenn sie noch lebt.“ Weiter sagte meine Mutter unter Tränen: „Wir kommen hier nicht mehr lebend raus.“ Dann war die Besuchszeit zu Ende. Die
Mütter wurden wieder ins Lager abgeführt, und wir mußten zurück zu unserer Arbeit bei den Bauern.
Ob wir mit Lastern oder sonstwie zu unseren Müttern und zurück kamen, weiß ich nicht mehr.
Warum eigentlich? Solche Fragen beschäftigen mich öfter. Habe ich das alles verdrängt?




Bin ich damals gar nicht zum Denken gekommen? Ich weiß es nicht.
Für meine Freundin Herta stand jedenfalls fest, so schnell wie möglich unserer „Gefangenschaft“ zu entkommen und nach Österreich zu unseren Tanten zu gelangen. Sie heckte einen Plan aus, sagte ihrem Bauern, sie leide an entsetzlichem Durchfall, vermutlich habe sie Ruhr. Der Bauer bekam Angst und schickte Herta weg. Da sie mich nicht zurücklassen wollte, sagte sie meinem Bauern, daß sie mich vielleicht schon angesteckt habe. So viel war ich meinem Bauern wohl nicht wert als Arbeitskraft, und er ließ auch mich gehen. Wahrscheinlich steckte auch die Bäuerin dahinter. Die mochte mich nicht und war wütend, daß sich nach dem Einfahren der Ernte meine Garben beim Hochstemmen auf den Boden immer auflösten und herunterfielen. Sie schimpfte fürchterlich mit mir und sagte in gebrochenem Deutsch: „Solchen Leuten müßte man in die Hände
scheißen.“ So endete unsere Zeit in Putzlitz.
Ich war wieder bei meiner Großmutter, Herta wohl auch, ich weiß es nicht mehr. Herta war sehr aktiv und erfuhr von einem Bekannten, der die Rücktransporte der bei uns lebenden Österreicher begleitete, die Termine. Wir hatten Glück, erhielten Papiere, die uns als Österreicher auswiesen. Und so konnten wir in einem Transport mitfahren.
In Viehwaggons saßen wir dicht gedrängt zwischen Kisten auf dem Boden. So ging es Richtung Grenze. Die Strecke bis dahin erschien uns unendlich. Uns saß die Angst im Nakken, von tschechischen Kontrolleuren entdeckt zu werden. Bis zur österreichichschen Grenze waren sie unsere Bewacher. Dann waren wir endlich in Freiheit, den Tschechen lebend und unbeschadet, zumindest körperlich, entkommen.
Ungewiß blieb, wie es weitergeht. Nach Tagen hielten wir in Linz auf einem Nebenbahnhof nahe dem Stahlkonzern Voest.
Nach Ebelsberg, wo die Tante lebte, waren es wenige Kilometer. Die Freude war riesig, als wir uns sahen, doch das Entsetzen groß, daß ich ohne Eltern kam.
Die Tante wußte nichts von den Vorgängen in der Tschechei und der Internierung. Ein paar Tage dauerte es noch, bis ich aus
dem Transport entlassen werden konnte. Tante kam jeden Tag zu uns und versorgte uns mit Essen. Herta fuhr mit dem Transport weiter bis Wien, da dort eine ihrer Tanten lebte. Die Trennung fiel uns nicht leicht.
Ich wurde bei Tante, Onkel und ihrem sechsjährigen Franzi herzlich aufgenommen. Meine Eltern wußten nicht, ob ich nach Österreich geflüchtet und dort angekommen war. Sie wußten nicht, ob ich noch lebe. Ebenso schrecklich war meine Ungewißheit über das Schicksal meiner Eltern. Lebten sie noch? Wie ging es ihnen? Wie überstehen sie die Demütigungen und die Strapazen?
In Ebelsberg war ich wieder ein freier Mensch und brauchte keine Gelbe Binde mehr zu tragen, das Kennzeichen, eine Deutsche zu sein, brauchte keine Angst mehr zu haben.

Aber auch Österreich nahm uns Geflüchtete nicht mit offenen Armen auf. Wir waren für sie Fremde, Staatenlose. Deshalb konnte ich nicht zur Schule gehen. Mein letzter Schultag daheim war etwa im April 1945, und nun, im Oktober, ging es in Ebelsberg nicht weiter.
Tantes Beziehungen ließen mich durch einen Ausweis zur Österreicherin werden, und damit war auch wieder ein Schulbesuch möglich. Im November wurde ich Schülerin des Realgymnasiums der Kreuzschwestern in Linz. Das waren katholische Schwestern, die mich liebevoll aufnahmen, wahrscheinlich von Tante über mein Schcksal informiert. Fortsetzung folgt
Mit fünf Jahren sammelte Rebecca Bauer erste Erfahrungen mit dem Mittelalter beim Cave Gladium. Als Flötenspielerin trat sie mit acht Jahren dem Spielmannszug „Grenzfähnlein“ bei und blieb aktiv. Sie schauspielert seit Jahren, ist Reiterin, war Ministrantin und ist Feuerwehr-Mitglied. Sie war Flötistin beim Kinderdrachenstich und Standartenreiterin beim Kinderfestzug. Seit 2013 ist sie in der Rolle einer Moriskin beim großen Drachenstich dabei. Gleitschirmfliegen ist ihr leidenschaftliches Hobby. Bereits Uropa Englbert Kolbeck und Opa Alfred Bauer waren Kirchhofschützen. Der Vater Sandro Bauer war 1990 Ritter und ist seit Jahren ein Hauptdarsteller im Stück. Auch Bruder Bastian ist als Trommler und Mitglied der Drachenmannschaft beim Festspiel dabei. Nach der Hochschulreife im Robert-Schuman-Gymnasium ging Rebecca nach Passau. An der Berufsfachschule für PTA absolvierte sie 2019 den Abschluß als staatlich geprüfte pharmazeutisch-technische Assistentin. Seit 2020 studiert sie an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Bioanalytik und strebt den Bachelor-Abschluß an.
Als Stadtplatz-Kind hatte Alexander Pongratz keine Chance, sich der Further fünften Jahreszeit zu entziehen. Eines seiner ersten Spielzeuge war ein kleines Holzschwert. Die Familie wirkt seit Jahrzehnten beim Drachenstich mit, meistens mit Pferden. Der Vater war 1984 Ritter. Mit seinem Bruder spielte Alexander immer schon „Ritter“.


Erstes Drachenstich-Highlight war 2005, als sein Cousin Stefan Simeth Ritter war.

Jene Saison erlebte der damals Zehnjährige intensiv mit und beschloß, auch Ritter zu werden. Als er 2006 als Hinterteil des Drachens beim Kinderdrachenstich eine erste kleine Sprechrolle bekam, packte ihn das SchauspielFieber. Schon bald wurde er als Gehwolf und später als Raphael im Festspiel von Regisseur Alexander Etzel-Ragusa auserwählt. Alexander freut, nach der trüben Corona-Zeit die Chance zu bekommen, den Ritter darzustellen. 2013 bis 2019 studierte Alexander Agrarmanagement an der TU München/Weihenstephan. Aktuell ist er Bereichsleiter bei der Albert-Kerbl-GmbH, Europas größtem Produzenten und Großhändler für Tierzuchtbedarf.
Der Further „Drachenstich“ wurde 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Der „Kleine Drachenstich“ soll insbesondere Kinder und Jugendliche zur Mitwirkung am örtlichen Brauchtum motivieren. Das Bayerische Heimatministerium unterstützt nun den Verein Historisches Kinderfest Furth im Wald bei der Anschaffung eines neuen Drachens für den „Further Kinderdrachenstich“ mit 19 000 Euro. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker sagte anläßlich der Förderzusage aus dem Förderprogramm Regionalkultur:




„Allen Beteiligten danke ich für ihr Engagement und wünsche viel Freude mit dem neuen Drachen.“
In der Drachenstichfestwoche in Furth im Wald wird zwei Mal „Der kleine Drachenstich“ in der Drachensticharena am Stadtplatz aufgeführt. Die Aufführungen sind fester Bestandteil des Drachenstichprogramms und mit dem Festzug ein Großereignis für Kinder. Der von den Kindern liebevoll Hugo genannte Drache wird nach 25 Jahren nun ersetzt.



Heimatbote
für den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de






Wolf-Dieter Hamperls Onkel Hans Bär wird zunächst als vermißt erklärt. Schließlich erfährt seine Frau Marie Bär/Wolf, daß der Lehrer und Oberleutnant Hans Bär am 30. April 1945 bei Breslau gefallen ist. Hans Bär wird für tot erklärt. Auf dem Alten Friedhof an der Südseite der Waidhauser Pfarrkirche erhält er ein Gefallenenkreuz. Im Jahr 1948 heiratet Emmerl Wolf den Peppi Schücker aus Haid. Das Foto zeigt Lina Ganter, Peppi Schücker, Emmerl Wolf und Anton Wolf im Garten an der Eisenbahnstrecke. Die Braut Emmerl Wolf, verheiratete Schücker, mit ihren Schwestern Lina Wolf, Anna Hamperl und Marie Bär.



Wolf-Dieter Hamperl erzählt in dieser Folge von Spielsachen, Winter- und Sommerspielen, Kartoffelkäfern, Kreuzottern und Pilzen.
Unsere Etagennachbarn, die Schmitts, waren lustige Leute und ließen in dieser vergnügungsfreudigen Zeit keinen Faschingsball aus. In der Früh fand ich dann immer ein lustiges Faschingshütchen vor der Türe liegen. Die drei Parteien im ersten Stock kamen ohne Streit aus. Sie hatten im Gang eine gemeinsame Wasserstelle mit einem schweren Gußeisenbecken und eine Toilette, ein Plumpsklo. Ich hatte immer Angst, daß ich da hineinfalle und in der Grube lande. Auch der Geruch dort war bedeutend.
Spielsachen
Meine ersten Spielsachen bekam ich vom Christkind. Das waren ein Bulldog, grau angestrichen mit roten Rädern, und ein Anhänger, ebenfalls aus Holz. Onkel Toni war wohl der Handwerker. Von meinem Paten Seppl erhielt ich zum nächsten Weihnachtsfest einen Motorradfahrer aus Blech, den man aufziehen konnte und der im Kreis fuhr. Das Jahr darauf war ein Zug mit zusammensteckbaren Schienen dran. Ein besonderes Geschenk waren die Bleifiguren von Karl Sommer. Ich erhielt einen Karton mit dem Set „Wald“: Jäger mit Hund, Laub- und Nadelbäume, Zäune, Büsche, Enten und Rehe. Der Jäger war schon etwa fünf Zentimeter hoch, sein Gewand grün, ein Gewehr über der Schulter. Man konnte die Figuren stellen wie man wollte. Als Unterlage hatte ich ein Papier, auf dem ein Teich eingezeichnet war. Da kamen die Enten drauf. Was ich noch hatte, war ein großes Fachwerkhaus aus Blei. Karl Sommer stammte auch aus Haid, er war nach Mies verzogen und hatte dort mit Autos zu tun. 1943 hatten meine Eltern das Haus Brauhausgasse 377 in Haid von ihm gekauft. Nun hatte er in Waidhaus eine Bleigießerei im Hinterhof von Haus Altenöder eingerichtet. Onkel Seppl und auch Wenzel arbeiteten bei ihm. Sie entfernten die Überstände und bemalten die Figuren. Bei Karl Sommer in der Werkstatt sah ich den ersten Papagei. 1950 wanderte er nach Argentinien aus. Ich erinnere mich gut daran, wie wir ihn alle am Bahnhof ver-
� Kindheit in Waidhaus – Folge V Ranscheln und heizeln
abschiedeten. Die Spielsachen, die das Christkindl brachte, holte es um Mariä Lichtmeß herum wieder ab.
Winter und Sommer
Die Winter waren kälter, härter als heute, Schnee hatte es auch nicht so viel, wie wir es hier im Voralpenland manchmal erleben, aber der eisige Böhmische wehte. Wir haben Eisbahnen gemacht, damit wir ranscheln oder heizeln konnten. Das hat Spaß gemacht. Zwischen dem Gasthof Biehler und dem Lermer-Haus standen damals noch keine Häuser. Die Fläche war eine Mulde mit einem kleinen Teich. Der fror zu. Da wir „Hudora“-Schlittschuhe zu Weihnachten bekom-
men hatten, die man an die hohen Winterschuhe anschrauben konnte, räumten wir Wege auf dem Eis frei und kurvten um die Wette. Besonders interessant war dies dann, wenn es wärmer wurde und das Eis schmolz. Dann schlugen wir Eisplatten und zogen sie heraus. Daß wir vollkommen durchnäßt nach Hause kamen und geschimpft wurden, war auch klar.
Die Straßen waren damals nicht mit Salz, sondern mit Splitt gestreut, der Schnee war festgefahren. Zuweilen fuhr ein Bulldog mit Anhänger die Straße hinauf ins Dorf, wir hängten uns hinten an und ließen uns hinaufziehen, dann ging es mit den Schlittschuhen wieder hinab.
Am 5. Dezember kam der heilige Nikolaus in einem schönen
roten Gewand. Er hatte eine Mitra auf und weiße Handschuhe an. Aus einem goldenen Buch las er vor, was wir nicht richtig gemacht hatten und wo wir uns verbessern könnten. Dann mußten wir ein Vaterunser vorbeten, und dann gab‘s ein weißes Säckchen mit Süßigkeiten, Nüssen und Obst. Die Rute lieferte der Krampus, ein wilder Geselle im Pelzgewand und mit einer Kette um die Hüfte. Er machte angsterregenden Lärm und warf einige Äpfel unter den Ofen. Dann verschwanden sie wieder. Mir fiel schon die Ähnlichkeit des heiligen Bischofs mit Onkel Seppl auf. Vielleicht eine Stunde später wurde es vorübergehend lauter im Haus, und ich schaute im Treppenhaus nach. Da sah ich doch an die zehn Bischofstäbe
vor dem Salon an die Wand gelehnt. Es mußte zu einem Nikolaus-Treffen gekommen sein.
Zu Weihnachten war es auch früher nicht immer schon kalt. Wir hatten ja nur ein Zimmer. Damit Mutter den Christbaum schmücken und das Zimmer weihnachtlich herrichten konnte, mußte Vater mit uns spazierengehen. Bei so einem langen Spaziergang zwischen der WolfSäge und dem Kindergarten hat sich hinter einer Wolkenbank der Himmel kurz aufgetan, und der Mond hat wohl kurz durchgeleuchtet.
In meiner Fantasie war ich fest davon überzeugt, daß das Christkind von unserer Wohnung weggeflogen sei. Wir sind sofort nach Hause, und ich fand das schön geschmückte Zimmer mit dem
Christbaum vor. An Geschenke kann ich mich nicht mehr genau erinnern, nur daß wir eine Fichte hatten, an der viel Lametta und ausschließlich Silberkugeln hingen. Besonders gefallen haben mir die mittelgroßen Kugeln, die nach innen kegelförmig eingezogen waren und wie ein Kristall glänzten.
Es muß 1949 gewesen sein, da habe ich eine Eisenbahn auf zusammensteckbaren Gleisen bekommen. Die Lokomotive war zum Aufziehen und dann recht schnell. Ich habe sie immer im Zimmer der Länge nach sausen lassen, denn in dieser Richtung waren auch die etwas unebenen Holzbretter verlegt. Nach den Weihnachtsferien hat uns die Lehrerin aufgefordert, unsere Autos zum Rennen mitzubringen. Ich nahm die Lokomotive mit und habe prompt gesiegt. Der Christbaum wurde am 2. Februar, an Mariä Lichtmeß, abgeleert und der Schmuck verpackt.
Schon wegen der langen Sommerferien haben wir viele Erinnerungen an diese Zeit. Eigene Fahrräder hatte keiner von uns, höchstens einen übertragenen Roller. Meist waren wir mit einem alten Reifen unterwegs, den wir mit einem Stecken antrieben. Wir fuhren mit aufs Feld und fuhren mit Kleinbauern am Abend Gras heim.
Einmal waren wir zum Sammeln von Kartoffelkäfern mit der Klasse unterwegs. Jeder hatte eine Blechbüchse und sollte sie vollkriegen. Einmal durften wir ganz oben auf einem Heuwagen neben dem Wiesbaum sitzen. Das war großartig, die Blätter der Zweige der Bäume am Straßenrand streiften uns. Das waren Erlebnisse! Sonst durften wir Kornmandeln mit aufstellen und mit dem Rommel die liegengebliebenen Halme zusammenrechen. Wir sammelten auch Ähren in einer Tasche für die Hühner.
In den Sommerferien gingen wir zum Nordhang des nahen Ulrichsberges, um Himbeeren zu pflücken. Dazu mußten wir hohe Winterschuhe anziehen. Wir hatten furchtbare Angst vor Kreuzottern. Sie lauerten überall. Auch Pilze brachten wir mit nach Hause. Die Herren- oder Steinpilze, die Birkenpilze und Rotkappen aßen wir als Pilzsauce mit Dotsch. Eierschwammerl brieten wir an und verrührten sie mit Eiern. Eine Köstlichkeit. Fortsetzung folgt
Heimatblatt für die Kreise Hohenelbe und Trautenau
Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. – 1. Vorsitzende: Verena Schindler, Telefon 0391 5565987, eMail: info@hohenelbe.de, www.hohenelbe.de – Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. – 1. Vorsitzender Wigbert Baumann, Telefon 0931 32090657 – Geschäftsstelle Riesengebirgsstube (Museum-Bibliothek-Archiv), Neubaustr. 12, 97070 Würzburg, Telefon 0931 12141, eMail: riesengebirge-trautenau@freenet.de – www.trautenau.de – Redaktion: Karin WendeFuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Telefon 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: Riesengebirgsheimat@t-online.de – Redaktionsschluss: jeweils der 15. des Vormonats.
� Trautenau – Hohenbruck


Über alle Grenzen
Vielleicht liegt es daran, daß die heutige Erlebnisgeneration die Vertreibung als Kinder erlebt hat und deshalb neugierig ist auf das, was sie zurücklassen mußte. Vielleicht können die Menschen auch deshalb besser mit ihren Kindern und Enkeln darüber reden, weil sie – bei aller Not – nicht in dem Maße wie die Erwachsenen von Existenzängsten, Verletzungen und Sorgen betroffen waren.
Ein besonders gutes Beispiel, wie eine Familie die Vergangenheit aufgearbeitet hat, ist die Familie Richter aus TrautenauHohenbruck.
Da ist der fast 60-jährige Ralf Richter, Sohn von Toni Richter aus Hohenbruck. Toni ist bereits verstorben. Von seinen fünf Geschwistern leben noch drei. Wir alle kennen einen, unseren HOB Harald Richter, wohnhaft in Bad Honnef (86).

Sein Neffe Ralf Richter ist ein echter Typ, ein „Kölsche Jung“ und eng mit dem Eishockey ver-
� Kulturwochenende in Rochlitz
bunden, seit über 40 Jahren Zeitnehmer bei den „Kölner Haien“. Außerdem liebt und lebt er die „Rockabilly“-Musik und besucht einmal jährlich seine Freunde in den USA. Und er engagiert sich für Trautenau. Ralf Richter ist das beste Beispiel für die Kinder/Enkelgeneration, die sich aktiv für die Heimat und die deutschtschechische Verständigung

Rochlitz erklang
Am Wochenende 19. bis 21. August 2022 fanden interessante musikalisch-literarische Tage unter dem Motto „Rokytnice zní“ („Rochlitz klingt“) in Rochlitz an der Iser statt. Ein Veranstaltungsort war dabei die Rochlitzer Pfarrkirche St. Michael.

Fulminanter Auftakt der musikalisch-literarischen Tage am Freitagabend, 19. August 2022:
„Die Feier der Musik“
Es herrschte eine feierliche Stimmung an jenem Freitagabend im August 2022, als das „Barlen-Ensemble“ in die Rochlitzer Pfarrkirche St. Michael zur
„Feier der Musik“ lud. Initiiert von den Gründerinnen des Barlen-Ensembles, der mittlerweile in Deutschland lebenden Bratschistin Barbara Linke-Holická sowie der Geigerin Lenka Ma-

chová (Geigerin in der Tschechischen Philharmonie), kamen Musizierende aus Deutschland und der Tschechischen Republik zusammen, um Werke von Komponisten beider Länder darzubieten.
Das Publikum in der vollbesetzten Kirche lauschte begeistert den Kompositionen von Jan Václav Stamic, Erwin Schulhoff, Antonín Dvořák, Johann Sebastian Bach sowie Wolfgang Amadeus Mozart.
Übersetzt man die tschechischsprachige Internetseite des Barlen-Ensembles, liest man: „Natur und Kunst sind untrennbar miteinander verbunden. Und deshalb gehört die Musik nach Rochlitz, zwischen die Berge, zwischen Wiesen und Wälder, in die schönen Räume der Kirche St. Michael und die Umgebung.“
Das spürte man bei der hochprofessionellen Darbietung.
Den beiden Musikerinnen, die persönlich viel mit Rochlitz zu tun haben, liegt sehr am Herzen, daß in Rochlitz an der Iser das Musikleben wieder eine Zukunft hat.
So wurde das Ensemble gegründet, um mehr klassische Musik und Kunst nach Rochlitz zu bringen sowie in der Historie nach Künstlern zu suchen. Ein besonderes Anliegen ist es dabei,
über die Grenze hinweg einsetzt.
Ralf Richter: „Meine Wurzeln liegen in Hohenbruck, Kreis Trautenau (tschechisch „Bojišt “), mütterlicherseits in Mainz. Die Liebe zur Heimat meines Vaters treibt mich seit den frühen 2000er Jahren mindestens einmal im Jahr nach Trautenau. Gefühlt eine Ewigkeit bin ich als Schriftführer Mitglied im Vorstand des Riesen-
gebirgler Heimatkreises Riesengebirge / Trautenau Würzburg e. V. und lege übrigens Wert darauf, daß wir auch tschechische Mitglieder im Verein haben. Meine Facebook-Seite findet man unter: www.facebook.com/ ralf.richter.3781.“ Und wie stellt man eine Verbindung zwischen seinem Rockabillyclub „Jailhouse Rebels“ mit
der Jugend in der alten Heimat her? Ganz einfach, man fährt mit interessierten Clubmitgliedern nach Trautenau und lässt es dort krachen. Musik verbindet bekanntlich, dazu Gulasch und Bier und die Verständigung klappt. Diese Untergruppierung der „Jailhouse Rebels“ bekam von Ralf sogar einen eigenen Namen und ein Label:„Rübezahls Rebel-
Briefe, geben ein tolles Zeugnis von Zerrissenheit und vor allem von der Suche nach Authentizität, Wahrhaftigkeit und Heimat in sich selbst.
Deswegen möchten wir dieses Künstlers, der aus Rochlitz stammt, nun gedenken und uns mit seinen Texten etwas auseinandersetzen.
Wir werden Texte mit Musik kombinieren und so einen Raum
len – Krakonošovi Rebelové“. Das Label tragen natürlich auch die Riesengebirgler stolz auf ihren T-Shirts. Das ist gelebte Völkerverständigung.

Im Oktober 2022 waren Ralf und sein Onkel Harald anlässlich des 30-jährigen Bestehens des BGZ Trautenau (Verein für deutsch-tschechische Verständigung) gemeinsam in der Heimat. Ralf fuhr seinen Onkel zum Aussiedlungsbahnhof Trübenwasser (Kalná Voda), wo er zum letzten Mal im November 1946 stand, einen Tag vor seinem 9. Geburtstag. „Es war gespenstisch. Kalná Voda ist bis heute ein kleiner Bahnhof geblieben und das heruntergekommene Gebäude ist offensichtlich bewohnt, was man an der Satellitenschüssel erkennen kann“, berichtet Ralf Richter. Die Umgebung lud nicht zum Verweilen ein.
Auch diese Erinnerungen holen einen immer wieder ein, aber es gilt nach vorne zu schauen –über alle Grenzen hinweg. kw Quelle: Ralf Richter
zurzeit in Rochlitz lebt.
Die anschließende Lesung aus Fühmanns Erzählung „Das Judenauto“ wurde musikalisch umrahmt von Barbara Linke-Holická , Bratsche, Lenka Machova, Geige, sowie Hana BaborakovaShabuova, Cello, vom BaborakEnsemble.
Abschlußbild mit allen Musizierenden.
die deutsch-tschechische Verständigung durch Kunst, Musik, Literatur sowie Theater „anzukurbeln“, zumal in Rochlitz Sport und Tourismus im Vordergrund stehen.

So wurde der „Verein zur Erneuerung des Musiklebens in Rochlitz an der Iser e. V.“ gegründet.
Der Verein bringt Musiker und Musikliebhaber aus nah und fern zusammen, die sich in irgendeiner Weise an zukünftig immer reger werdenden Veranstaltungen von Live-Musik und -Kunst in Rochlitz und in der Region beteiligen möchten.
Musikalisch-literarischer Abend zur Erinnerung an Franz Fühmanns 100. Geburtstag im Januar 2022: „Wie weit reicht das Erinnern?“
Am Sonntagabend, den 21.08.2022 fanden sich Interessierte verschiedener Altersgruppen im Rochlitzer Kulturhaus zusammen. Jener Abend war Franz Fühmann gewidmet, der am 15.
Januar 1922 als Sohn des Apothekers Josef Rudolf Fühmann geboren wurde.

„Ich finde, die Persönlichkeit Fühmanns, seine Essays und seine Bücher, Gedanken und seine
für Gedanken und Nachsinnen schaffen“, so Barbara Linke-Holická als sie bezüglich der musikalisch-literarischen Tage Kontakt mit dem Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. aufnahm.

Einführung durch Tomáš Petrá
Zu Beginn des Abends fand eine Einführung zu Franz Fühmann statt, moderiert von niemand Geringerem als Tomáš Petráň – ehemaliger Dekan der Filmakademie in Prag, Filmemacher und Kameramann, welcher
Die Lesung durch Martin Polách, Schauspieler aus dem Theater F. X. Šaldy in Reichenberg, war äußerst dynamisch und kurzweilig und auch für jemanden, der der tschechischen Sprache nicht mächtig ist, ein Genuß. Es war eine sehr stimmige Veranstaltung. Auch wenn der Abend ausschließlich in tschechischer Sprache gehalten wurde, war er doch sehr interessant, weil man spürte, dass die Musik sehr gut auf die Lesung abgestimmt war.
Rochlitz erklang auch in Gablonz und Aussig
Ein Teil des Kultur-Festivals wurde im Haus Reinowitz (Haus der Deutsch-Tschechischen Verständigung) in Gablonz an der Neiße wiederholt sowie in Aussig durch das Collegium Bohemicum im Rahmen der Deutsch-Tschechischen Kulturtage, welche bis Mitte Oktober 2022 stattfanden. Die Schirmherrschaft der Veranstaltungen übernahm der Tschechische Botschafter in Deutschland, Tomáš Kafka. Kirsten Langenwalder München/Rochlitz
Fotos: K. Langenwalder
� Hermannseifen
Einladung zum Treffen in Hermannseifen vom 18.05.23 bis 21.05.23
Tagungsort: Hotel AURI
54372 Rudnik, 13
eMail: recepce@hotelauri.cz
18.05.23: Anreise
16 Uhr: Zusammenkunft in der Gaststätte des Hotels. Begrüßung und Vereinbarung von Aktionen in Interessensgruppen.
19.05.23: Gemeinsamer Ausflug in das Museum Kuks. Busabfahrt
9 Uhr am Sturmgasthof. Nach einer Führung im Schloß Kuks Weiterfahrt in einen Landgasthof mit böhmischer Küche zum gemeinsamen Mittagessen. Rückfahrt nach Hermannseifen, Ankunft ca. 16 Uhr.
Ab 19 Uhr: Treffen im Hotel AURI zum Abendessen und Informationsaustausch.
20.05.23: Individuelle Unternehmungen in Interessensgruppen.
17 Uhr: Besuch eines Konzerts
BERICHTE AUS DEN HEIMATKREISEN
� Kottwitz Treffen in Kottwitz

� Güntersdorf
von Alt- und Neubürgern in der Hermannseifener Kirche, ausgeführt durch Musikstudenten
Programm: Werke von Haydn, Danzi, Rejcha, Bach. Dauer: ca.
1 Stunde.
19 Uhr: Zusammenkunft im Hotel mit Bürgern von Rudnik, Abendessen. Auswertung des Treffens, Besprechung weiterer Projekte und Gestaltung eines Treffens
2024.
Aktuell haben bereits 30 Personen Unterkunft im Hotel AURI
gebucht.
21.05.23: Abreise oder Urlaubsfortsetzung
Die Organisatoren: Olga Hajkova und Rudolf Fiedler, Rudnik und Dresden.
Rückfragen an: Rudolf Fiedler, Sarrasanistraße 11, 01097 Dresden
Mail: r.r.o.fiedler@gmail.com
Tel. : 01522 1993305
� Hohenelbe Dipl.-Ing. Theodor Petera
In der letzten „Riesengebirgsheimat“ wurde der Tod von Dipl.-Ing. Theodor Petera, geboren am 28.03.1940 in Hohenelbe, verstorben am 19.09.2022 in Burbach, gemeldet. Der Familie von Dipl.-Ing. Theodor Petera gilt unsere herzliche Anteilnahme.
Liebe Kottwitzer, am Sonntag, den 2. Juli 2023 um 10 Uhr wollen wir uns wieder zum Gottesdienst in Kottwitz treffen. Bitte meldet Euch bei mir an, wenn Ihr kommen wollt und beachtet die Mitteilungen in den kommenden RGH-Heimatseiten in der Sudetendeutschen Zeitung.
� Niederhof
Am Samstag, den 1. Juli findet die Wallfahrt zum Brünnl in Ketzelsdorf statt. Vielleicht könnt Ihr es so einrichten, daß wir uns bereits dort treffen. Beachtet die Hinweise unter Ketzelsdorf beim Heimatkreis Trautenau. HOB Gudrun Bönisch, Tel. 08377 1293
Herzlichen Dank!
HOBs gesucht!
Der Name „Petera“ ist untrennbar mit der Automobilindustrie in Hohenelbe verbunden. Sein Urgroßvater Ignaz Theodor Petera (1840-1904) hatte 1864 zunächst eine Firma gegründet, zur Herstellung von Pferdegeschirren, -kutschen und -schlit-
� Hohenelbe
ten sowie Reitsätteln und Skiern. Ab 1908 konzentrierte man sich immer mehr auf den Karosseriebau. Ein Auto mit vornehmer „Petera-Karosserie“ erhielt sogar der österreichische Kaiser Franz Josef I. zu seinem Diamantenen Thronjubiläum. Im Jahr 1945 wurde die Firma „Ig.Th. Petera & Söhne“ aufgrund der Beneš-Dekrete enteignet und unter die tschechische Volsksverwaltung gestellt. Bald darauf, 1946, fand eine Angliederung an die Škoda-Werke in Mladá Boleslav (Jungbunzlau) und in Hohenelbe statt, wo nun die Fahrzeuge auf der Basis von Škoda-PKWs gefertigt wurden. Seit Anfang der 90er Jahre ist wiederum Škoda eine hundertprozentige Tochter der Volkswagen AG. 2018 wurde das Jubiläum „110 Jahre Automobilbau in Hohenelbe“ gefeiert. HOB Ingrid Mainert (Waengler), Tel. 06039 2255
Roland Pittermann
Im November 2022 verstarb Roland Pittermann in Hagen. Bärbel Hamatschek schrieb dazu: „Er wurde am 10. August 1938 in Hohenelbe geboren. Seine

� Mittellangenau
Eltern, Martel und Max Pittermann, hatten in Hohenelbe an der Ecke rechts neben der Dekanalkirche ein Haushalts- und Spielwarengeschäft. Seine beiden Brüder sind schon vor längerer Zeit durch tragische Unfälle ums Leben gekommen. Vor 10 Jahren ist auch seine Frau gestorben. An seiner Geburtsstadt hing er sehr. In der Vor-Coronazeit hat er Hohenelbe meist einmal im Jahr mit einer Busgesellschaft besucht. Seinen beiden Söhnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.
HOB Ingrid Mainert (Waengler) Tel. 06039 2255.
Siegrid Seltenreich
Wieder ist die Heimatgemeinschaft um eine beeindruckende Persönlichkeit ärmer geworden. Im Januar erreichte uns die Meldung, daß Siegrid Seltenreich, die am 29. Februar 91 Jahre alt geworden wäre, ihren Geburtstag nicht mehr erlebt hat. Sie ist am 04.09.2022 friedlich in ihrem Zuhause in Meckesheim eingeschlafen. Um die Verstorbene trauern ihre sechs Kinder, acht Enkel und acht Urenkel. In Anlehnung an den tröstenden Spruch auf ihrer Traueranzeige „Aus der Heimat einst vertrieben, die du doch so sehr geliebt, gehst du in den ewigen Frieden, wo der Herr dir
Heimat gibt“ entbiete ich den Angehörigen im Namen der Long‘schen unser aufrichtiges Beileid. HOB Verena Schindler, Tel. 0391 5565987
F
ür die vielen Grüße und Wünsche zu meinem 86. Geburtstag bedanke ich mich sehr herzlich! Statue des Hl. Joseph
Die Restaurierung der Statue des Hl. Joseph am Erzplatz in Niederhof soll als Gemeinschaftsprojekt von uns Deutschen, der Gemeinde und den Einwohnern von Dolní Dvůr/Niederhof sowie dem Zukunftsfonds bis Sommer 2023
� Wichtige Mitteilung
durchgeführt werden. Die Weihe wird während eines Gemeindetreffens stattfinden. Dazu erfolgen demnächst briefliche Mitteilungen an die „letzten“ Niederhofer, sowie Näheres auf der Homepage des Heimatkreises: www.hohenelbe.de HOB Niederhof, Erich Kraus, Tel. 0351 4718868, eMail: brigitte.und.erich.kraus@web.de
Liebe HOB-Kollegen,
die Ihr den eMail- oder Postweg nutzt: bitte sendet mir Eure HOB-Listen, denn ich will sie in Würzburg speichern, damit diese wichtigen Daten nicht verloren gehen und späteren Generationen zur Verfügung stehen. Nach Möglichkeit sollten in diesen Listen auch die bereits Ver-
� Bernsdorf – Berggraben
Das Ehepaar Hösel gibt aus gesundheitlichen Gründen die Heimatortsbetreuung für Güntersdorf, Ketzelsdorf, Königreich II, Komar und Söberle mit sofortiger Wirkung auf. Wir, die Riesengebirgler bedanken uns sehr herzlich für die jahrelange aufopfernde Arbeit und wünsche dem Ehepaar Hösel ein langes gesundes Leben und viel Freude am „Nichtstun“. Somit ist das Nennen der Geburtstagskinder Geschichte. Es gibt nur eine Möglichkeit, daß sich jemand angesprochen fühlt und dieses ehrenvolle Amt über-
nimmt. Dazu werde ich, Günter Henke, HOB-Sprecher, die Namen digital erfassen und einem Interessenten zur Verfügung stellen. Weiter werde ich die Geburtstage für Güntersdorf für die nächsten 4 bis 5 Monate übernehmen. Dann allerdings erlischt meine Bereitschaft, dies weiterhin zu tun, denn wie Sie/ Ihr aus „Unterschriften“ erkennen könnt, habe ich bereits mehr als gut ist übernommen. Also rüttelt Eure Kinder oder Enkelkinder wach!
Mit heimatlichen Grüßen Euer HOB Günter Henke
Ehrenabzeichen in Gold für unseren
Peter Barth
storbenen vermerkt sein. Auch die „Nichtdigitalen“ HOBs bitte ich um Überlassung von Kopien der betreffenden Listen. Für Eure Bemühungen bedankt sich der Riesengebirgler Heimatverein und im Besonderen Euer HOB-Sprecher Günter Henke, Email: henke.g-f@t-online.de
Neues aus der Heimat
Neuer Heimatbrief
Am 19.12.2022 wurde wieder ein Heimatbrief erstellt. Wer ihn bisher nicht bezogen hat, aber daran interessiert ist, bitte bei mir melden. Wenn Sie bisher Bezieher des Heimatbriefes waren und ihn nicht mehr wollen, bitte unbedingt abmelden, um mir unnötige Druckund Portokosten zu sparen. Ausstellung über die Eisenbahn Über die Ausstellung, die vergangenen Sommer im Museum Schatzlar stattfand, habe ich hochwertige pdf-Dateien der Ausstellungstafeln zu den Ortschaften Bernsdorf und Lampersdorf erhalten.
� Freiheit
TV-Serie „Ansichtskarten“
Im Tschechischen Fernsehen bildet die Serie „Ansichtskarten“ das Leben in den ehemals deutschsprachigen Regionen ab. Die 5. Folge ist der Stadt Trautenau (Trutnov) gewidmet und entstand unter Beteiligung des Vereins für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau-Riesengebirge e.V.. Playback - Link zur Sendung: https://www.ceskatelevize.cz/ porady/15085698761-pohlednice/222411033430005/ HOB Peter Stächelin, Tel. 08171 26363
Treffen vom 15.09. bis 17.09.2023
Seit 2019 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Auerbach/Reumtengrün und Svoboda n. Upou, zu deutsch Freiheit, meinem Geburtsort. Das Projekt wird vom SMI unterstützt und gefördert. Ich hatte darüber schon mehrfach berichtet. Das nächste Treffen findet vom 15.09. bis 17.09.2023 in Svoboda/ Freiheit statt, anlässlich des Rudolffestes. Die Organisation für die Fahrt ist in vollem Gange. Interessenten melden sich bitte bei mir.
� Radowenz
Das Rudolffest geht zurück auf den Habsburgischen Kaiser Rudolf II. (15521612), Kaiser des Hl. Römischen Reichs, König von Böhmen und Ungarn sowie Erzherzog von Österreich. Er verlieh „Freiheit am güldenen Rehorn“ im 16. Jahrhundert das Stadtrecht. Die Erhebung zur Stadt wird noch heute mit dem Rudolffest gefeiert. Herbert Gall, Eibenweg 4, 08209 Auerbach/Vogtl., Tel. 03744 2413660, eMail: gallhr@online.de
Besuch in der alten Heimat
Im Oktober 2022 haben wir mit unserem Enkel und seiner Freundin bei schönstem Herbstwetter die alte Heimat besucht. Übernachtet haben wir im Hotel „Patria“ in Trautenau. Unser Enkel wollte ja so viel wissen über die Heimat seiner Vorfahren und wir freuten uns, ihm viel zeigen und erklären zu können. Wir haben natürlich auch die „Highlights“ besucht, die Schneekoppe und den Schwarzenberg. Die jungen Leute waren begeistert! Sie wollen in diesem Jahr sogar noch einmal zum Wandern ins Riesengebirge fahren. Eine große Überraschung erwartete uns auf dem Trautenauer Ringplatz. Durch Zufall trafen wir dort unseren Heimatfreund Helmut Hiemer, der mit seinem Sohn Reiner einige Tage im Ho-
tel „Adam“ verbracht hatte. Leider war die Zeit zu kurz, denn die beiden mussten noch am selben Tag nach Hause zurück. Es grüßt euch HOB W. Thole
Der Heimatkreis Hohenelbe/ Riesengebirge e. V. und der Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. gratulieren Landsmann Peter Barth zu seinem 86. Geburtstag.

Am 8. Februar beging unser langjähriger verdienter Redakteur der „Riesengebirgsheimat“
Peter Barth seinen 86. Geburtstag. Unser Glückwunschschreiben ist gleichzeitig ein Dankesschreiben für seinen unermüdlichen Einsatz, die Erinnerung an die Heimat wachzuhalten und für die Anliegen der Landsleute - mit Stift und Feder - einzutreten.
Über den Jubilar ist schon viel geschrieben worden - hauptsächlich zu seinen runden und halbrunden Geburtstagen, und viel geschrieben hat er auch selbst. Deshalb sollen an dieser Stelle nur die wichtigsten Stationen seines Lebens und Schaffens genannt werden.
Peter Barth wurde am 8. Februar 1937 in Trautenau geboren. Seine Familie wurde im August 1946 aus der Heimat vertrieben und fand in dem Ostseeort Zingst eine Bleibe.
Trotz des schweren Schicksalsschlags und des mühsamen Neubeginns in der sowjetischen Besatzungszone nahm
Peter Barth sein Leben zielstrebig in die Hand. Nach dem Abitur in der Stadt Barth folgte ein Chemiestudium an der Universität in Greifswald, danach die Berufstätigkeit als Diplomchemiker im Chemiekombinat Bitterfeld, der späteren Chemie AG Bitterfeld-Wolfen. Mehr als 40 Patente zeugen von seiner erfolgreichen Arbeit in Forschung und Entwicklung in der chemischen Industrie.
Seine berufliche Tätigkeit ist aber nur eine Erfolgsstory im Leben von Peter Barth. Die andere Erfolgsstory ist seine journalistische Tätigkeit, die er schon im Alter von 15 Jahren – mit dem Schreiben seiner ersten Beiträge für die Ostsee-Zeitung – begann und die ihren Höhepunkt in der Redaktion der Heimatzeitung „Riesengebirgsheimat“ fand.
Dazwischen liegen viele Jahre seines Engagements in der SLKreisgruppe Bitterfeld, in der SLLandesgruppe Sachsen-Anhalt, in der SL-Kreisgruppe Nord-Vorpommern, deren Kreisobmann Peter Barth heute noch ist, im Landesvorstand MecklenburgVorpommern, als Schriftführer und Pressereferent im Vorstand des Riesengebirgler Heimatkreises Trautenau und als Initiator zahlreicher RiesengebirglerNordtreffen in Rostock. Ein Highlight war die 2006 von ihm kreierte Privatpost-Briefmarke mit dem Motiv der aufgehenden Sonne hinter der Schneekoppe, welche seine Einladungsschreiben an die Riesengebirgler zierte.
Die Liste seiner Verdienste ist lang, lang ist auch die Liste seiner Beiträge und Veröffentlichungen – originell ist sein Namenskürzel „PeBa“. Insbesondere mit der Übernahme der Redaktion der „Riesengebirgsheimat“ im Jahr 2005 hat sich Peter Barth unschätzbare Verdienste um die Heimat erworben. Mit journalistischem Geschick und Gestaltungsvermögen hat er der Zeitung ein unverwechselbares „Gesicht“ gegeben. Dafür hat ihm der HK Hohenelbe/Riesengebirge 2011 die Ehrennadel in Gold verliehen.
Mit dem Aus des HelmutPreußler-Verlags Ende 2022 kam auch das Aus für Peter Barth als Redakteur der „Riesengebirgsheimat“. Dies bedauern wir sehr, hat er doch viel Zeit und Herzblut in seine redaktionelle Tätigkeit investiert.
Der Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. verleiht Peter Barth in Würdigung seiner herausragenden Verdienste um die Heimat das Ehrenabzeichen in Gold – die höchste Verdienstauszeichnung und damit die höchste Anerkennung, die der Heimatkreis ausspricht. Peter Barth war und bleibt eine tragende Säule der Heimatkreise Trautenau und Hohenelbe! Stellvertretend für die Heimatkreise Hohenelbe und Trautenau sichern wir dem Jubilar unsere Verbundenheit zu und wünschen ihm für das neue Lebensjahr alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Optimismus, vor allem aber Gottes Schutz und Segen.
Christian Eichmann Ehrenvorsitzender HK Hohenelbe/Riesengebirge Verena Schindler 1. Vorsitzende HK Hohenelbe/Riesengebirge Wigbert Baumann
Wigbert Baumann
 1. Vorsitzender Riesengebirgler HK Trautenau
1. Vorsitzender Riesengebirgler HK Trautenau
