Ulrike Scharf: Seit einem Jahr
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung



VOLKSBOTE HEIMATBOTE





Sudetendeutsche Zeitung
❯ Vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg
Deutsche Botschaft in Ukraine-Farben
Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs wurde die Deutsche Botschaft in Prag in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angestrahlt.

Der Deutsche Botschafter Andreas Künne dokumentierte damit die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine.
Vor dem Gebäude nahm Künne außerdem eine Videoansprache auf – in exzellentem Tschechisch –, die anschließend über Twitter verbreitet wurde. Seine Botschaft: „Wir, Tschechen und Deutsche, teilen nicht nur gemeinsame Grenzen, sondern auch Werte wie Freiheit und De-
Es liegt in der Familie . . .
Der Einstieg von Renáta Kellnerová ist nicht das erste Investment einer tschechischen Milliardärsfamilie in ProSiebenSat1.
Über seine Holding Czech Media Invest (CMI) hatte der Investor Daniel Křetínský (47) 2020 bis zu zwölf Prozent der Anteile an dem Münchner Medienunternehmen übernommen und später mit Gewinn veräußert.


Der Liebhaber italienischer Sportwagen und Miteigentümer des Fußballclubs Sparta Prag ist in der Branche kein Unbekannter. Der mehrfache Milliardär ist Großaktionär des Handelskonzerns Metro und hat Vattenfalls
Anteile am deutschen Braunkohle-Geschäft übernommen. Und er ist privat mit der neuen ProSiebenSat1-Großaktionärin
Renáta Kellnerová verbunden:
Tochter Anna Kellnerová (26), eine bekannte Springreiterin, und Křetínský sind seit 2017 ein Paar.
Die geschäftliche Verbindung reicht aber noch weiter zurück.
Petr Kellner und Křetínský waren Geschäftspartner und gründeten 2009 mit einem Partner die EPH als Holding für Beteiligungen im Energiesektor. „Kellner gab das meiste Geld, Křetínský fädelte die meisten Deals ein –eine Win-win-Situation für beiden Partner“, berichtete das Manager Magazin. Weitere Gemeinsamkeit: Wie einst Kellner meidet auch Křetínský die Öffentlichkeit. Torsten Fricke


mokratie. Die Ukraine kämpft seit einem Jahr für diese Werte und damit für uns alle. Deshalb unterstützen wir die Ukraine. Und wir werden dies so lange tun wie es nötig ist.“ Künne war anschließend auch unter den Zuschauern eines eindrucksvollen Videomappings, mit dem die Hilfsorganisation Člověk v tísni (Menschen in Not) am Gebäude des Innenministeriums im Prager Stadtteil Letná an den Überfall auf die Ukraine durch die russischen Truppen erinnert hatte. Zudem wurde mit weiteren Veranstaltungen in Prag an den Kriegsbeginn vor einem Jahr gedacht. Seite 3
Kampf um ProSiebenSat1: Tschechiens reichste Frau bremst Berlusconi aus
„Unsere Beziehungen zum Freistaat Bayern werden immer besser.“ Auf deutsch hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala am Donnerstag einen TwitterBeitrag von Bayerns Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann kommentiert und geteilt. Der Auslöser war eine Wirtschaftsmeldung von hoher medienpolitischer Bedeutung: Über ihr Investmentunternehmen PPF hat Tschechiens reichste Frau, Renáta Kellnerová, am 21. Februar ihren Anteil am deutschösterreichischen Medienkonzern ProSiebenSat1 aufgestockt und damit die Übernahmepläne des Großaktionärs Silvio Berlusconi vorerst beendet.

Kellnerová ist die Witwe von Petr Kellner, der 1991 die PPF Group gegründet und zu einem der größten Investmentund Finanzunternehmen in Mittel- und Osteuropa entwickelt hat. Laut des Wirtschaftsmagazins Forbes war der am 20. Mai

1964 in Böhmisch Leipa geborene Kellner mit einem Vermögen von 15,6 Milliarden US-Dollar der reichste Tscheche und belegte 2019 Platz 73 in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Am 27. März 2021 kam der 56-jährige bei einem Hubschrauber-Absturz während einer Heliskiing-Tour in Alaska ums Leben (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).
Der Vater von vier Kindern hatte zeitlebens öffentliche Auftritte vermieden, auch um die Privatsphäre seiner Familie zu schützen. In einem seiner seltenen Interviews beschrieb sich Kellner als introvertiert und konservativ. Er glaube an die liberale Demokratie, den freien Markt und den Kapitalismus, habe aber auch eine starke sozialen Ader. Sein Motto: „Ich möchte ein tschechisches Unternehmen aufbauen, auf das die Tschechen stolz sind.“ In der Corona-Pandemie hat dann Kellner zusammen mit weiteren Unternehmen ein mehrere hundert Millionen Kronen umfassendes Hilfspaket auf den Weg gebracht.

Kellner, dessen Vision seine Witwe fortführt, ist damit so ziemlich genau das Gegenteil von Silvio Berlusconi, der über sein Unternehmen MediaForEuropa mit 22,72 Prozent der größte Aktionär des Münchner Medienhauses ist. Als der ehemalige italienische Ministerpräsident im Dezember beantragte, seinen Anteil auf
29,9 Prozent zu erhöhen, waren die Kartellbehörden in Österreich und Deutschland alarmiert. So lautete der Antrag, den die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde am 13. Dezember 2022 von Berlusconis Anwälten erhielt, auf „Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE, Deutschland, durch
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Niederlande“.


Die öffentliche Debatte, die Berlusconi dadurch auslöste, zeigte Wirkung. Am 27. Januar wurde die sogenannte Zusammenschlußanmeldung zurückgezogen.
Bereits im Vorfeld hatte der Deutsche Journalistenverband vor einem „Einfluß auf die journalistischen Inhalte und einen Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit“ gewarnt. Der DJVBundesvorsitzende Frank Überall kritisierte, daß der RechtsaußenPolitiker Berlusconi seinen italienischen Fernsehkonzern in der Vergangenheit immer wieder als politisches Instrument eigener Interessen mißbraucht habe.
Am 21. Februar meldete dann der tschechische Konzern PPF, 9,1 Prozent der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE erworben zu haben. In der Erklärung stellt sich PPF dabei auch hinter das aktuelle Management: „PPF ist überzeugt, daß die digitale Transformation von ProSieben Werte für alle Aktionäre schaffen wird. PPF freut sich darauf, mit dem Management und dem Aufsichtsrat von ProSieben in diesem Digitalisierungsprozeß zusammenzuarbeiten. PPF ist ein aktiver Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT). Die Central European Media Enterprises (CME) von PPF

betreibt mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa.“
Das im Oktober 2020 von PPF erworbene Unternehmen CME verfügt derzeit über 34 TV-Kanäle und erreicht laut des aktuellen Geschäftsberichts 45 Millionen Zuschauer in Tschechien, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien. CME verfügt dafür über hochwertige TV-Rechte und überträgt über seine Sportsender auch die UEFA Champions League sowie die Live-Spiele der Bundesliga und der ersten Ligen in Italien und Spanien, der Seria A und La Liga. Zusätzlich hat sich CME die Übertragungsrechte der Fußball-Europameisterschaften 2024 und 2028 gesichert.
Vor diesem Hintergrund, daß ein starker Partner mit Knowhow beim Münchner Medien-Unternehmen eingestiegen ist, positionierte sich Bayerns Staatsminister Florian Herrmann, der als Staatskanzleichef das Medien-Ressort verantwortet, eindeutig: „Die Beteiligung der PPF Group an ProSiebenSat.1 Media SE ist ein großartiges Signal, das den Medienstandort München stärkt“, twitterte Herrmann und schrieb, die ProSiebenSat1-Gruppe leiste „einen wichtigen Beitrag für die Medienvielfalt in Deutschland“ und sei ein Aushängeschild für den Medienstandort Bayern. Torsten Fricke
 ❯ Renáta Kellnerová steigt über ihr Unternehmen PPF Group zum zweitgrößten Aktionär auf
❯ Renáta Kellnerová steigt über ihr Unternehmen PPF Group zum zweitgrößten Aktionär auf
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Der Leiter des Prager Sudetendeutschen Büros, Peter Barton, ist in der Landeshauptstadt Böhmens regelmäßig unterwegs auf deutschen Spuren. Diesmal führt er die Leser unserer Zeitung direkt in das Herz der Metropole.

Der Architekt und Hochschulprofessor Karl Jaray wurde 1878 in Wien geboren, seine Familie stammte aber aus dem ungarischen Temeschwar. Nach dem Studium in Wien wurde er 1904 Dozent und 1908 Professor an der Prager Deutschen Technischen Hochschule. Während der Zeit von 1909 bis1912 war er außerdem als Chefredakteur der Zeitschrift „Technische Blätter“ tätig.
Im Jahr 1925 kehrte er nach Wien zurück und mußte später wegen seiner jüdischen Herkunft emigrieren. Karl Jaray starb am 29. November 1947 in Buenos Aires.

Aus der Zeit von Jarays Wirken in Prag stammen mehrere Mietshäuser. So realisierte Jaray gemeinsam
Heftiger Streit um Renten-Erhöhung
mit dem Architekten Rudolf Hildebrand das Gebäude der damaligen Eskomptbank Am Graben (Na Příkopě) Nr. 969, also an einem bis heute prominenten Ort.

❯ Am 23. Februar übernahm die CSU-Politikerin die Ressorts Arbeit, Familie und Soziales, einen Tag später begann der Krieg

Schirmherrschaftsministerin








Ulrike Scharf ein Jahr im Amt




Einarbeiten konnte sie sich nicht: Am 23. Februar 2022 wurde Ulrike Scharf als Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales vereidigt. Einen Tag später, am 24. Februar, begann Rußlands Angriffskrieg auf die Ukraine, was die größte Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa auslöste. Bereits in den ersten Kriegswochen suchten über 3,5 Millionen Menschen Schutz – viele davon in Bayern.
Als Sozialministerin liegt die Versorgung der Kriegsflüchtlinge in ihrem Verantwortungsbereich. Scharf organisierte deshalb umgehend einen runden Tisch mit mehreren Hilfsorganisationen. Ein erstes Ergebnis war eine ukrainisch- und russischsprachige Telefon-Hotline, um Flüchtlingen niederschwellig Hilfe und Informationen anzubieten. Auch direkte Gespräche mit den Flüchtlingen, wie bei einem Besuch der Erstaufnahme am Münchner Hauptbahnhof, gehörten zu Scharfs Kaltstartprogramm.

Dabei wäre das Arbeitspensum auch ohne Krieg eine Herausforderung. Scharfs Ministerium managt sieben Milliarden Euro pro Jahr. Das Aufgabenspektrum ist dabei vielfältig. Im Vordergrund stehen die sozialpolitischen Probleme und damit die Familienpolitik, die Arbeitsmarktpolitik, die Frauenpolitik sowie die Kinderbetreuung, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und die Politik für Senioren und Aussiedler.


Die Sudetendeutschen schätzen Ulrike Scharf insbesondere als Schirmherrschaftsministerin.

Und auch in dieser Funktion hat die empathische Politikerin einen prallvollen Terminkalender und verbrachte die Pfingsttage beim Sudetendeutschen Tag in Hof, wo sie mit vielen Landsleuten direkt ins Gespräch kam.

Als erste Ministerin einer Bundes- oder Landesregierung reiste Scharf im September nach Böhmen, um auf Einladung des Sudetendeutschen Rates die Eröffnungsrede der Marienbader Gespräche zu halten.


Auch in Prag war Scharf bereits, um Brücken zu bauen. So stand in der tschechischen Hauptstadt neben dem Besuch des Sudetendeutschen Büros ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Marian Jurečka auf dem Programm. Und im Dezember legte die Ministerin beim Spatenstich für den Erweitungsbau auf dem

Heiligenhof selbst Hand an. „Die Sensibilisierung der nächsten Generationen für Völkerverständigung, den Wert eines geeinten und friedlichen Europas und die Stärkung der Demokratie sind wichtige Zukunftsarbeit“, lobte Scharf dabei die Arbeit der Sudetendeutschen Bildungs- und Begegnungsstätte in Bad Kissingen, deren Ausbau der Freistaat
Bayern mit zwei Millionen Euro unterstützt.

Anläßlich ihres Jahrestages als Ministerin zieht Ulrike Scharf eine positive Bilanz: „Die Verantwortung für das Ministerium des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Bayern zu tragen, ist mein Auftrag, dem ich jeden Tag verantwortungsvoll, mit großer Dankbarkeit, Demut und viel

Wegen der hohen Inflation müßten die Renten im Juni im Schnitt um 75 Euro steigen, so sieht es ein Gesetz vor, das die Regierung von Premierminister Petr Fiala aber in dieser Woche außer Kraft setzen will. Stattdessen soll es, so Arbeits- und Sozialminister Marian Jurečka (KDU-ČSL), nur ein Plus von 2,3 Prozent geben, was im Schnitt 42 Euro ausmachen würde. Die Regierung will damit die arbeitende Bevölkerung entlasten und argumentiert, daß das Rentenniveau mittlerweile bei 48 Prozent des Durchschnittslohns liegt –was vergleichbar mit Deutschland ist. Im Namen der Opposition kündigte Ano-Chef Andrej Babiš der Regierung „die Hölle“ an. Man werde alle Register ziehen, sagte auch Ano-Vizechefin und Ex-Finanzministerin Alena Schillerová und warf der Regierung vor, aus Schlamperei bei der Haushaltsplanung gesetzeswidrig zu handeln.
ÖPNV-Bus fährt mit Wasserstoff
Die Prager Verkehrsbetriebe werden in diesem Frühjahr einen Bus testen, der mit Wasserstoff angetrieben wird, hat Generaldirektor Petr Witowski mitgeteilt. Demnach soll der Bus auf der Linie 170 eingesetzt werden, die die Stadtteile Jižní Město und Barrandov miteinander verbindet. Bereits seit längerem testen die Prager Verkehrsbetriebe Elektro- und Oberleitungsbusse.
Sberbank-Kunden erhalten Geld zurück

Fast ein Jahr nachdem der russischen Sberbank in Tschechien die Bankenlizenz wegen der Sanktionen entzogen worden war und das Unternehmen seinen Betrieb hatte einstellen müssen, haben bisher über 87 000 Kunden über die Filialen der Komerční banka ihre Einlagen zurückerhalten. Auf Grundlage des Garantiesystems des Finanzmarktes (GSFT) wurden über 25 Milliarden Kronen (1 Milliarde Euro) ausgezahlt, was 98 Prozent des Gesamtvolumens der Sberbank CZ beträgt. Die Finanzmenge ist die bisher größte

in der tschechischen Geschichte. Mit der Auszahlung begonnen wurde am 9. März 2022. Die verbleibenden rund 34 000 Kunden haben nun noch zwei Jahre lang Zeit, um ihre Anlagen zu sichern.
Barbora Krejčíková holt Turniersieg
Tschechiens Tennisprofi Barbora Krejčíková hat das Finale des WTA-1000-Turniers in Dubai gewonnen. Die Gewinnerin der French Open 2021 besiegte im Finale die Weltranglistenerste, Iga Świątek aus Polen, mit 6:4 und 6:2. Bereits im Oktober hatte die Tschechin die Polin in Ostrau in drei Sätzen mit 5:7, 7:6 und 6:3 geschlagen.
César für „My Sunny Maad“
Die tschechisch-französischslowakische Co-Produktion „My Sunny Maad“ der tschechischen Regisseurin Michaela Pavlátová ist am Freitag mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet worden. Der Animationsfilm erzählt die Geschichte einer tschechischen Frau, die der Liebe halber nach Afghanistan zieht. In Frankreich bekam der Film gute Kritiken und wurde bereits zuvor beim Festival d’Animation Annecy mit einem Preis gewürdigt.

Ivo Vondrák verläßt Ano-Partei


Ivo Vondrák, Hauptmann des Kreises Mährisch-Schlesien, hat die Partei Ano verlassen. Seine Entscheidung gab der Politiker nach einer Vorstandssitzung bekannt und kündigte an, sein Amt als Hauptmann weiter auszuführen. Schon seit längerem hatte Vondrák öffentlich die Ausrichtung der populistischen Partei Ano kritisiert. Zum endgültigen Zerwürfnis kam es, als Vondrák bei der Präsidentschaftswahl nicht seinen Parteichef Andrej Babiš unterstützte, sondern dessen Kontrahenten und späteren Wahlsieger Petr Pavel. Der stellvertretende AnoParteivorsitzende Karel Havlíček sagte, er halte den Schritt für rational, könne sich jedoch nicht vorstellen, daß Vondrák ohne die Unterstützung durch die AnoPartei Hauptmann bleibe.


Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546







Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;


Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
Freude nachgehe. Hier schlägt das Herz des bayerischen Sozialstaats, hier ist Bayern gemeinsam stark. Krisen, Herausforderungen und Probleme gehen wir kraftvoll und aktiv an und arbeiten an den besten Lösungen für die Menschen im Freistaat. Letztlich stehen hinter jeder Entscheidung, hinter jedem Erfolg Menschen.“ Torsten Fricke

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Der neu gewählte Staatspräsident Petr Pavel sprach am Samstagabend auf der Solidaritätskundgebung für die Ukraine in Prag.
Unter dem Motto „Ich sehe klar, was getan werden muß“, haben am Samstagabend Tausende Menschen in Prag an den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor einem Jahr erinnert. Nach einer Kundgebung im Letna-Park fand ein Konzert vor der russischen Botschaft statt, das von einer Band aus Charkiw und einem ukrainischen Kinderchor eröffnet wurde. Zu den Rednern gehörten Tschechiens neu gewählter Staatspräsident Petr Pavel und der Deutsche Botschafter Andreas Künne.

In der deutschen Politik sind alle Vergleiche mit Adolf Hitler wegen der geschichtsrevisionistischen Relativierung des Holocausts und der damit einhergehenden Verharmlosung der unvorstellbaren Nazi-Verbrechen ein Tabu. Anders in der Tschechischen Republik, dessen Staatsgebiet damals auf Befehl Hitlers von der Wehrmacht besetzt wurde.
Vor diesem Hintergrund bekam Petr Pavel, der am 9. März ins Amt des Staatspräsidenten eingeführt wird, von den Demon-
❯ Tschechiens neues Staatsoberhaupt zieht bei der Ausnutzung von Minderheiten Parallelen zu Wladimir Putin
Präsident Pavel: „Hitler hat die Sudetendeutschen mißbraucht“
stranten großen Beifall, als er in seiner Rede auf der Solidaritätskundgebung für die Ukraine den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Adolf Hitler verglich.



Laut Pavel ist es erstaunlich, wie viele Gemeinsamkeiten die Tschechische Republik mit der Ukraine hat: „Denn damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat sich Hitler genauso verhalten, wie sich Putin jetzt gegenüber der Ukraine verhält. Hitler hat die deutsche Minderheit in unserem Sudetenland mißbraucht, Hass gesät und Gewalt geschürt, die er dann als Vorwand für die Unterdrückung nutzte.“

Pavel fügte hinzu, daß sich die Ukraine aber gegen die Invasoren wehre und dafür Respekt verdiene. Der erste Jahrestag sei einerseits traurig, weil es sich um einen Krieg handele, der bereits „enorme Opfer gefordert“ habe, andererseits sei es ein ermutigender Jahrestag, weil die Ukraine sich heldenhaft verteidige.
Putin habe seinem Land schweren Schaden zugefügt. Weltweit würden die Russen als Barbaren mißachtet werden, fügte er hinzu. Pavel unterstrich erneut die
Rolle Chinas bei der Beendigung des Kriegs. „China ist ein wichtiger wirtschaftlicher und politischer Partner für Rußland. Wir erwarten mehr Initiative von China, diesen Krieg zu stoppen.“
Erstmals sprach mit Botschafter Andreas Künne auch ein offizieller Vertreter der Bundesrepublik Deutschland auf einer Demonstration in Prag. Auf

Tschechisch versprach Künne, Deutschland werde der Ukraine so lange wie nötig helfen.

Bijan Sabet, Botschafter der USA in Prag, sagte: „Ich bin stolz darauf, heute hier bei Ihnen zu stehen und meine einfache Botschaft zu wiederholen: Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir stehen zu Ihnen, und wir gehen nirgendwo hin. Ruhm für die Ukraine!“
Der Publizist und Schriftsteller Jiří Padevět erinnerte am Samstag auch an den 75. Jahrestag des kommunistischen Putsches in der Tschechoslowakei sowie an den 73. Jahrestag des Todes des Pfarrers Josef Toufar infolge der Folter durch StB-Offiziere: „Versuchen wir, diesen Marsch wenigstens zu nutzen, um dem Aggressor zu sagen, daß wir auf der Seite der Ukraine stehen, auf der Seite der freien Welt, die sich gegen die östliche Despotie wehrt.“
Die gleiche Parallele hatte zuvor Senatspräsident Miloš Vystrčil am Vormittag bei einer Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Niederschlagung der Studentenproteste gezogen: „Das Thema ist heute besonders aktuell, denn es sind 366
Tage seit dem Beginn der russischen Aggression in der Ukraine vergangen. Dabei geht es auch um die Unterdrückung der Freiheit, um den Raub der Demokratie, der Souveränität und der Fähigkeit der Ukraine, unabhängige Entscheidungen zu treffen.



Hier muß die Position der Tschechischen Republik klar sein. Wir müssen die Ukraine unterstützen, denn dies ist etwas Ähnliches wie das, was 1948 in der Tschechoslowakei hätte geschehen müssen. Wir hätten uns für die Studenten und für eine verfassungsmäßige Lösung einsetzen sollen“, sagte er.
„Wir haben damals gegen denselben Feind gekämpft, der heute in der Ukraine unschuldige Menschen massakriert, zerstört und tötet. Es spielt keine Rolle, ob damals Joseph Stalin oder Leonid Iljitsch Breschnew
an der Macht waren oder heute Wladimir Putin“, sagte Antonín Kyncl, einer der letzten überlebenden Teilnehmer des Studentenmarsches von 1948. Im Februar vor 75 Jahren zogen tschechische Studenten zweimal zur Prager Burg. Beim ersten Mal, am 23. Februar, schaffte es eine dreiköpfige Delegation, bis zu Präsident Edvard Beneš vorzudringen. Zwei Tage später zogen rund 5000 Demonstranten Richtung Prager Burg. Sie wurden jedoch in der Nerudová-Straße von Polizisten blokkiert, bei deren Eingreifen der Student Josef Řehounek erschossen und verstümmelt wurde. An den Universitäten wurden nach der kommunistischen Machtergreifung im Februar Studenten und Akademiker überprüft und von den Hochschulen verwiesen. Pavel Novotny/Torsten Fricke
Um das Grauen des Krieges deutlich zu machen, projizierte die Nichtregierungsorganisaton Menschen in Not zum Jahrestag des russischen Angri skriegs auf die Ukraine ein eindrucksvolles Videomapping auf die Außenfassade des tscheschischen Innenministeriums.

❯ „Ein Beispiel für die Spitzenarchitektur des Späthistorismus, deren Qualität den regionalen Verhältnissen weit überlegen ist.“

Harthmuth-Villa ist jetzt ein Kulturdenkmal

Der Urgroßvater Joseph Hardtmuth erfand in Niederösterreich den Bleistift und gründete in Wien ein Unternehmen. Der Großvater verlegte den Firmensitz nach Budweis. Der Vater führte das Unternehmen zum Weltmarktführer. Und unter Franz Edler von Harthmuth folgten Niederlassungen unter anderem in Paris, Mailand, London und New York sowie die Entwicklung des Koh-i-Noor-Hardtmuth-Stifts, eines Zeichenstifts in zwölf Gradationen, der 1889 auf der Weltausstellung in Paris vorgestellt wurde.



Der erfolgreiche Unternehmer beauftragte 1911 Johann

Stepan mit dem Bau einer zweigeschossigen Villa mit Mansardendach im neobarocken Stil als Familiensitz.






„Die Villa ist ein Beispiel für einen repräsentativen Wohnsitz eines prominenten Industriellen und gleichzeitig ein Beispiel für die Spitzenarchitektur des Späthistorismus, deren Qualität den regionalen Verhältnissen weit überlegen ist. Die großzügige Konzeption des Gesamtprojekts wurde durch den umgebenden Garten unterstrichen, der leider nicht in seiner ursprünglichen Größe und in seinem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben ist“, erklärt das tschechische Kulturministerium, warum die Villa
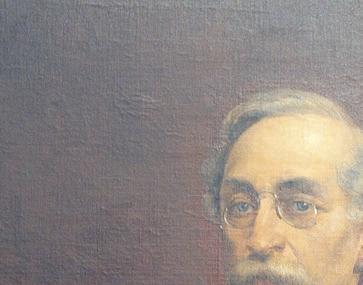
mit Wirkung vom 22. Dezember 2022 in die Liste der nationalen Kulturdenkmäler aufgenommen und somit unter Schutz gestellt worden ist.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlitt die Familie Harthmuth das Schicksal vieler Sudetendeutscher. Sie wurden enteignet und vertrieben.
Im österreichischen Attnang baute die Familie ein neues Unternehmen auf, das bis zum Konkurs im Jahr 1996 existierte.


Die Produktionsstätte in Budweis wurde von den kommunistischen Machthabern verstaatlicht. Nach der Samtenen Revolution wurde das Unternehmen 1992 privatisiert. TF

Stiftungsrat und Vorstand bestätigt

Auf seiner turnusmäßigen Sitzung hat der Stiftungsrat des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks (SSBW) auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen die Zuwahl der Mitglieder, die von außerhalb des Stifters nominiert werden, beschlossen sowie den Vorstand des Stiftungsrates und den Stiftungsvorstand neu gewählt.

Gruppenfoto
■ Noch bis Sonntag, 12. März, Tschechisches Zentrum: Mittel Punkt Europa Filmfest 2023. Das 2016 gegründete Festival des mittel(ost)europäischen Films präsentiert jedes Jahr handverlesene Produktionen aus den östlichen Nachbarländern Polen, Tschechien, Ungarn, Belarus sowie der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter www. mittelpunkteuropa.de. Filmmuseum München, Sankt-JakobsPlatz 1, München.

■ Samstag, 4. März, 10.30 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Kranzniederlegung zum 4. März 1919. Mahnmal für die Charta der deutschen Heimatvertriebenen im Kurpark von Bad Cannstatt.
■ Samstag, 4. März, 13.00 bis 17.00 Uhr, Kuhländler Tanzgruppe in Kooperation mit der Sudetendeutschen Heimatpflege: Kuhländler Tänze, Tanzkurs mit und ohne Vorkenntnisse. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Teilnahme nur mit Voranmeldung unter Telefon (089) 48 00 03 65 oder per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Heimatkreis KaadenDuppau: Erinnerung an die Opfer des 4. März 1919 an der Gedenkstätte auf dem Friedhof der Stadt Kaaden. 13.45 Uhr Treffen am Haupteingang des Friedhofs neben dem Omnibusbahnhof. Ansprechpartner: Margaretha Michel (0 92 31) 36 54.
■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: Sudetendeutsches Gedenken zum 104. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht 78 Jahre nach Beginn der Vertreibung. Festredner MdEP a.D. Andreas Mölzer. Musikalische Umrahmung durch das Bläserquartett Weinviertler Buam. Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.
■ Samstag, 4. März, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Nürnberg: Gedenkfeier für das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen im Jahre 1919. Mahnmal „Flucht und Vertreibung“, Hallplatz, Nürnberg.
■ Sonntag, 5. März, 9.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Hof: Gedenkgottesdienst für die Opfer des 4. März 1919. Die Gedenkrede hält Bezirksobfrau Margaretha Michel. Pfarrkirche Maria-Königin des Friedens, Badstraße 19, Bad Steben.
■ Sonntag, 5. März, 10.00 bis 15.00 Uhr, Kuhländler Tanzgruppe in Kooperation mit der Sudetendeutschen Heimatpflege: Kuhländler Tänze, Tanzkurs mit und ohne Vorkenntnisse. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Teilnahme nur mit Voranmeldung unter Telefon (089) 48 00 03 65 oder per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-
Unter der Leitung des Vorsitzenden des Stiftungsrates, Dr. Ortfried Kotzian, wurden die vorgeschlagenen Persönlichkeiten aufgenommen. Für den Freistaat Bayern ist dies Ministerialrat Dr. Wolfgang Freytag, für die Akademie Mitteleuropa Utta Ott, für die Stadt Bad Kissingen Oberbürgermeister Dr. Dirk

VERANSTALTUNGSKALENDER
Württemberg, Zentrale 4.-MärzFeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Montag, 6. März, 14.00 Uhr: Altvater-Runde Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Dienstag, 7. März, 14.00 Uhr: Deutscher Böhmerwaldbund Heimatgruppe Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Mittwoch, 8. März, 13.00 bis 22.30 Uhr: Weltfrauentag im Sudetendeutschen Museum in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum München. 13.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus
Mohr. 16.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus
Mohr. 19.30 Uhr: Konzert der tschechischen Frauenrockgruppe K2 im Adalbert-Stifter-Saal. Hochstraße 10 und 8, München.
■ Donnerstag, 9. März, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde München: Literarisches Ca-
fé: Rena Dumont liest aus ihrem Buch „Die Mühle“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Eintritt: 10 Euro.
■ Donnerstag, 9. März bis Freitag, 14. April: BdV-Landesverband Hessen: Wanderausstellung des Hauses des Deutschen Ostens: „Wer bin Ich? Wer sind Wir? – Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags 10.00 bis 17.00 Uhr, freitags 10.00 bis 14.00 Uhr. Haus der Heimat, Friedrichstraße 35, Wiesbaden.
■ Samstag, 11. März, 10.00 bis 14.30 Uhr, Südmährerbund: Südmährische Kulturtagung (Präsenz und online). Altes Rathaus, Hauptstraße19, Geislingen.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe MünchenStadt und -Land: Veranstaltung „Tag des Selbstbestimmungsrechts zur Erinnerung an den 4. März 1919 im Sudetenland und die Volksabstimmung am 20. März 1921 in Oberschlesien“.
Festredner: Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung. Sudetendeutsches Haus, AdalbertStifter-Saal, Hochstraße 8, München.
■ Sonntag, 12. März, 13.00 bis 19.00 Uhr: Egerländer Gmoi
Vogel und für die Sudetendeutsche Landsmannschaft Klaus Hoffmann, stellvertretender SLBundesvorsitzender und SL-Landesobmann Baden-Württemberg.
Der neukonstituierte Stiftungsrat wählte im Anschluss erneut Dr. Ortfried Kotzian zum Vorsitzenden und Regierungsdirektor Frank Altrichter zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrats.
Daraufhin wurde der Stiftungsvorstand neu gewählt. Als Kandidaten standen die bisherigen Amtsträger zur Verfügung und wurden wiedergewählt: Zum Vorsitzenden Hans Knapek, zum Stellvertreter Christian Leber und zum Schatzmeister Robert Wild.
Stuttgart: Gmoihauptversammlung. Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Montag, 13. März, 11.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Unsere Heimatsammlung“. Treffen für Betreuer sudetendeutscher Heimatstuben. Hochstraße 8, München. Anmeldung bis 6. März unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
■ Mittwoch, 15. März, 14.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Heilbronn: Sudetendeutscher Nachmittag. Haus der Heimat, Horkheimer Straße 30, Heilbronn.
■ Mittwoch, 15. März, 19.00 Uhr: „Erinnerungen an das Internierungslager Hodolein in Olmütz – Das Tagebuch der Dr. Erika Frömel“. Vortrag und Podiumsdiskussion. Dokumentationszentrum Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, Berlin.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 25. bis Sonntag, 26. März:, Paneuropa-Union Deutschland: 59. Andechser Europatag. Anmeldung und Programm: www.paneuropa.org
■ Sonntag, 26. März, 9.00 bis 16.00 Uhr: Landesfrühjahrstagung „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“ . Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.
■ Sonntag, 26. März, 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Auf a Melange im Café Central“. Konzeption im Auftrag des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg mit Anna-Sophia Krauss (Violine), Christoph Weber (Klavier), Carsten Eichenberger in der Rolle des Kellners Leopold und Iris Marie Kotzian (Sopran). Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.


■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Buchpräsentation mit Dr. Eva Habel, Direktorin der Regionalcaritas Schlukkenau: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“. Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 , München. Unkostenbeitrag 20 Euro pro Person für eine
Verkostung von drei Gerichten aus dem Kochbuch. Anmeldung unter eMail poststelle@hdo. bayern.de

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsche Heimatpflege: BöhmischMährisch-Schlesischer Ostermarkt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 17.00 Uhr: „Offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien zum Ostermarkt der Heimatpflegerin“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Montag, 3. April, 14.00 Uhr: Altvater-Runde Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Dienstag, 4. April, 14.00 Uhr: Deutscher Böhmerwaldbund Heimatgruppe Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Dienstag, 18. April, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Heimaterinnerungen. Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren mit Autorin Gunda Achterhold. Weitere Termine am 2., 16. und 30. Mai sowie 13. Juni. Teilnahmegebühr pro Termin: 15 Euro. Anmeldung erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Sonntag, 23. April, 10.00 bis 17.00 Uhr, Walther-HenselGesellschaft: Sonntagssingen. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Das diesjährige Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien.“ Programm folgt.
❯ Das Museum Flugt in Oksb øl
Deutsche Flüchtlinge in Dänemark

■ Dienstag, 7. März, 19.00
Uhr: „Deutsche auf der Flucht: Die deutschen Flüchtlinge in Dänemark 1945–49 und das neue Museum Flugt“. Referent: John V. Jensen (Museum zur Flucht in Dänemark).
Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Von Februar bis Mai 1945 kamen etwa 240 000 deutsche Flüchtlinge aus dem östlichen Europa nach Dänemark, wo sich bereits rund 100 000 verwundete Wehrmachtsangehörige aufhielten. Viele befanden sich nach der Flucht in einem körperlich schlechten Zustand; die Kindersterblichkeit war insbesondere in den Monaten vor und nach der deutschen Kapitulation im Frühjahr 1945 beträchtlich.

John V. Jensen studierte
– nach Aufenthalten in London, München und Prien am Chiemsee – Geschichte, Philosophie und Literatur an der Universität Aarhus in Dänemark sowie an der Universität Greifswald. Einer Beschäftigung an der Königlichen Bibliothek in Aarhus folgte 2005 die Anstellung als Museumsinspektor bei den Varde-Museen, zu denen das Museum FLUGT zählt. Seitdem setzt er sich mit dem Thema deutscher Vertriebener und Flüchtlinge in Dänemark auseinander, wozu er mehrere Artikel und Bücher verfaßte, unter anderem das vor kurzem erschienene Werk „Deutsche auf der Flucht“. Aktuell forscht er zum Flüchtlingslager in Oksbøl sowie zur demokratischen Ausbildung in den dänischen Flüchtlingslagern.
1000 Jahre Nachbarschaft von Tschechen und Deutschen
■ Dienstag, 7. März, 18.00 bis 20.00 Uhr: Onlineseminar „1000 Jahre Nachbarschaft“. Gespräch mit Prof. Dr. Arnold Suppan, em. Hochschuldozent aus Wien. Veranstaltung für historisch-politisch Interessierte. In diesem Seminar wird der Referent Prof. Dr. Arnold Suppan (Foto: Österreichische Akademie der Wissenschaften/Elia Zilberberg) ausgewählte Ausschnitte aus seinem Buch vortragen, die die nachbarschaftliche Entwicklung der deutsch- und tschechischsprachigen Einwohner im Donau- und Sudetenraum vom 9. bis ins beginnende 21. Jahrhundert darstellen. Hierbei werden vorerst die Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Heiligen Römischen Reich unter den verschiedenen Herrschergeschlechtern – besonders der Přemysliden, Babenberger, Luxemburger und frühen Habsburger –verglichen, ab 1526 die gemeinsame Geschichte in der Habsburgermonarchie mit den Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg und den Reformen unter Maria Theresia und Joseph II. dargestellt. Besonders hervorgehoben wird das Jahrhundert der nationalen „Konfliktgemeinschaft“ – der österreichisch-tschechischen wie der tschechisch-deutschen – zwischen 1848 und 1948, das sowohl das Zeitalter Franz Josephs und den Ersten Weltkrieg als auch die Erste Republik in Österreich und der Tschechoslowakei, sowie die Zivilisationsbrüche in der Zeit der NS-Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges, schließlich Vertreibung und Zwangsaussiedlung nach 1945 erfaßt.
Die Darstellung berücksichtigt die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung über die Jahrhunderte ebenso wie die Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Eigene Schwerpunkte stellen der Vertrag von Saint-Germain 1919, das Münchener Abkommen 1938 und die Beneš-Dekrete dar. Abschließend werden die Trennung durch den Eisernen Vorhang, die gesellschaftspolitische Wende von 1989/90 und die neue Nachbarschaft in der EU erörtert.
Interessierte können sich über den Link https://zoom.us/ meeting/register/tJ0pdOigrzkpEtRYNyBklT0AVNh9M-vHYyRZ anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Heiligenhofs (www.heiligenhof.de) unter Unsere Seminare/Seminarprogramm.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
❯ Serie „Ehrensache Ehrenamt“: Michael Stempfhuber ist Altbayer und engagiert sich trotzdem in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Erster Stamm trifft vierten Stamm
Michael Stempfhuber hat keine sudetendeutschen Wurzeln – und ist dennoch seit fast 50 Jahren mit Begeisterung in der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv.
Zuerst war da das Instrument: Als Jugendlicher in den 1970er Jahren lernte der heute 64-Jährige, Akkordeon zu spielen. Immer nur in der heimischen Küche die Tasten zu drücken, erschien ihm aber bald langweilig. „Ich wollte meine Kunst unter Leute bringen“, sagt er. Er überlegte, bei einem Trachtenverein anzufragen. Da kamen ihm die Egerländer zuvor. Diese traten bei einem bunten Nachmittag im örtlichen Pfarrheim auf. Stempfhuber war auch da, man kam ins Gespräch. „Wir brauchen Akkordeonspieler. Magst du mitmachen?“, fragten die Egerländer ihn. Also war er fortan bei der Egerländer Gmoi dabei.

Dort fühlte er sich schnell wohl. Da seine Mutter aus der Oberpfalz stammt, deren Dialekt mit dem Egerländischen eng verwandt ist, fand er sich sprachlich gut in der Gmoi zurecht. Ein Exot war er als Altbayer unter all den Sudetendeutschen nie. „Es gab mehrere, die zufällig dabei waren“, erinnert Stempfhuber sich, „weil sie von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen mitgenommen wurden.“ An den Sudetendeutschen gefalle ihm der Facettenreichtum: Während in Oberbayern überwiegend die Miesbacher Tracht getragen werde, seien die Trachten bei den Sudetendeutschen sehr unterschiedlich.



Ende der 1980er Jahre kam Stempfhuber dann zu der Böhmerwald Singund Volkstanzgruppe in München. Mit ihnen war er 1987 in den USA, wo sie an der Steuben Parade teilnahmen, einem großen alljährlichen Umzug der Deutschamerikaner in New York City.
Im Jahr 1993 unternahmen die Böhmerwäldler abermals eine große Reise, diesmal nach Südamerika, zuerst nach Paraguay, wo 60 Jahre zuvor Siedler aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind mehrfach Menschen aus den böhmischen Ländern in die beiden Amerikas ausgewandert, sodaß heute ihre Nachkommen an verschiedenen Orten in Übersee zu finden sind.
Im Urwald von Paraguay, etwa 220 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Asunción gelegen, gründeten Aussiedler im Jahr 1933 eine Kolonie, die sie Sudetia nannten. Sie versuchten, sich mit Hilfe von Landwirtschaft ein Auskommen zu schaffen, was sie vor eine große Herausforderung stellte, denn nicht alle der Siedler hatten einen Beruf in der Landwirtschaft gelernt. In der Folge blieben nicht alle. Manche reisten zurück nach Europa, andere fanden in einer der großen südamerikanischen Städte ein Auskommen.
Die, die blieben, pflanzten Zuckerrohr und Yerba an. Letzterer wird auch Mate-Strauch genannt, dessen Blätter als Tee getrunken werden. Zwischenzeitlich versuchten sie sich auch mit Bienenzucht, Weinbau und dem Anbau von Mais und Soja.
Die ersten Auswandererkinder wurden zunächst in einem Privathaus unterrichtet. Schon 1935 folgte der Bau ei-
❯ Kolonie Sudetia in Paraguay
Vor 90 Jahren gegründet
im Urwald eine Kolonie gegründet hatten, die sie Sudetia nannten. Das 60-jährige Jubiläum feierten sie mit Gästen aus Deutschland. Danach ging es für diese weiter nach Brasilien, wohin ebenfalls Sudetendeutsche ausgewandert waren. Stempfhuber erzählt: „Im Rahmen einer Rundreise besuchten wir unter anderem die Nachkommen sudetendeutscher und donauschwäbischer Einwanderer in Brasilien.“
Doch auch ohne Auslandsreisen haben die Böhmerwäldler einen vollen Terminplan: Sie beteiligen sich an vielen Veranstaltungen der Sudetendeutschen im Jahreskreis, beispielsweise am sudetendeutschen Neujahrsgottesdienst im Januar, am Tag des Selbstbestimmungsrechts im März, natürlich am Böhmerwaldtreffen sowie an den Jakobitreffen in Passau und Lackenhäuser und an der Gedenkfeier am Adalbert-Stifter-Denkmal in München, am Tag der Heimat, am Vertriebenengedenktag der bayerischen Staatsregierung und natürlich am Sudetendeutschen Tag.
Beim Sudetendeutschen Tag ist Stempfhuber schon seit fast 30 Jahren dabei, bislang als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Heimatpflege, seit vergangenem Jahr als sogenannter Hallengeist. Die Hallengeister sind die guten Seelen des Sudetendeutschen Tags. „Wir sind die ganze Woche vorm Sudetendeutschen Tag vor Ort und die letzten, die heimfahren“, sagt Stempfhuber. In der Zeit sorgen die freiwilligen Helfer dafür, daß alles ringsum paßt, etwa, daß die Transparente hängen, Bänke und Stühle richtig stehen und alles an seinem Platz ist. Viel Arbeit, die Stempfhuber gerne macht: „Es ist jedes Jahr ein Treffen mit Bekannten, die man im Laufe der Zeit kennengelernt hat. Für uns ist es wie ein Volksfest.“


Übrigens: Der 73. Sudetendeutsche Tag steht schon fest im Terminplan: Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai in Regensburg.
 Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
Dr. Kathrin Krogner-Kornalik



nes Schulhauses, in dem eine private deutschsprachige Schule untergebracht war. 1945 wurde sie von einer spanischsprachigen staatlichen Schule abgelöst. 1960 wurde dann die „Sudetendeutsche Heimatschule“ gegründet.
Bereits die erste Gruppe von Einwanderern brachte einen katholischen Priester mit ins südamerikanische Exil, der eine kleine Kirche bauen sollte. Der Plan scheiterte, es kam zum Zerwürfnis zwischen Siedlern und Pater, der daraufhin die Kolonie wieder verließ. Nun wurden die Siedler von einem Priester aus der etwa 30 Kilometer entfernten Kolonie Independencia seelsorgerisch betreut.

Einmal im Monat ritt er mit dem Pferd nach Sudetia, um dort die Heilige Messe zu feiern und die Sakramente zu spenden. 1960 konnte schließlich eine Kirche errichtet werden.
Rund um den Jahreswechsel fiel mir ein Gebet in die Hände, das mich unmittelbar ansprach, weil ich mich gut darin wiederfand. Angeblich handelt es sich um einen Segensspruch aus Irland. Die ersten beiden Absätze dieses Gebetes lauten: „Du Gott der Anfänge, segne mich, wenn ich deinen Ruf höre, wenn deine Stimme mich lockt zu Aufbruch und Neubeginn. / Du Gott der Anfänge, behüte mich, wenn ich loslasse und Abschied nehme, wenn ich dankbar zurückschaue auf das, was hinter mir liegt.“

Daß mich dieses Gebet ansprach, hängt mit meiner derzeitigen Lebenssituation zusammen, die von einer Veränderung bestimmt wird. Überall in unserer weltweiten Ordensgemeinschaft der Redemptoristen werden gerade neue Provinzleitungen gewählt. Die einzelnen Teilgebiete der Ordensgemeinschaft, die sogenannten Provinzen, erhalten dabei neue Führungsmannschaften. An der Spitze der Provinzleitung steht jeweils der Provinzial. Er ist der Ordensobere und trägt die Gesamtverantwortung.
In den letzten Wochen wählten auch wir in unserer süddeutschösterreichischen Redemptoristenprovinz. Da der bisherige Provinzial sich nach vielen Jahren nicht mehr für die Aufgabe zur Verfügung stellen wollte, war die Spannung groß. Für wen würden sich die Mitbrüder entscheiden? Schon im November und Dezember gab es zwei Briefwahlgänge unter allen Provinzmitgliedern, welche aber noch zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt hatten. Mitte Januar fand mit dem Provinzkapitel eine Art Delegiertenversammlung statt. Diese sollte den Provinzial wählen.
Der „Deutsche Sportverein Sudetia“ ist sichtbares Zeichen der sudetendeutschen Wurzeln. Die Bewohner feierten dann auch ausgiebig, als die DFB-Elf 2014 im Nachbarland Brasilien Fußball-Weltmeister wurde. Fotos: Facebook

❯ Vor 50 Jahren wurde die 485 Meter lange und 42 Meter hohe Brücke für den Verkehr freigegeben

Kontakte zur Sudetendeutschen Landsmannschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatte, wurden in den 1970er und 1980er Jahren geknüpft. Dr. Walter Becher als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe besuchte die Kolonie im Jahr 1974, 1983 reiste sein Nachfolger Franz Neubauer anläßlich der 50-Jahr-Feier der Kolonie nach Paraguay. KKK
Nusle-Brücke: Ein Bauwerk des Jahrhunderts
Sie ist von monströser Häßlichkeit, diente Hunderten von Selbstmördern als Plattform für den Sprung in den Tod und wurde zunächst nach dem ersten kommunistischen Präsidenten Klement Gottwald benannt: Vor 50 Jahren, am 22. Februar 1973, wurde die Nusle-Brücke für den Verkehr freigegeben und 2000 zum „Bauwerk des Jahrhunderts“ in der Kategorie Verkehrsbauten ernannt.
Nach der Bauzeit von 1965 bis 1973 hatten die damaligen Machthaber den Eröffnungstermin der Brücke bewußt gewählt. Das Ereignis wurde als Teil der Feierlichkeiten zum 25-jährigen
Jubiläum der kommunistischen Machtübernahme für die eigene Propaganda genutzt. Dennoch stand die Verbindung zwischen Prag 2 und Prag 4 zunächst unter keinem guten Stern. Rund 350 Menschen nutzten in den folgenden Jahren die 42 Meter hohe Brücke, um in den Tod zu springen. Erst aufwändige Sicherheitsmaßnamen stoppten diese Verzweiflungstaten.
Heute ist die dreispurige Nusle-Brükke eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Prag, die von 160 000 Autos pro Tag benutzt wird. Hinzu kommen 750 UBahn-Züge, die in einer Röhre, die sich unterhalb der Fahrbahn befindet, verkehren. TF Seit 50 Jahren verbindet die Nusle-Brücke
Die Wahl traf mich. Ganz überrascht war ich nicht, weil die Signale bereits zuvor darauf hingedeutet hatten. Ich hatte mich also geistig schon ein wenig darauf einstellen können. Dennoch ist dies ein wahrhaftig neuer Anfang. Auf absehbare Zeit heißt das auch, daß ich die Wallfahrtspfarrei am Schönenberg, die ich erst im September 2020 übernommen hatte, wieder verlassen werde, spätestens dann, wenn ein Nachfolger als Pfarrer gefunden ist. Aber schon jetzt bin ich mit der neuen Aufgabe der Ordensleitung betraut.

Gott sei Dank bin ich bei dieser Aufgabe nicht allein. Mir wurde –ebenfalls durch Wahl – ein gutes Team zur Seite gestellt. So gehe ich mit Hoffnung an die neue Aufgabe heran, auch wenn die Herausforderungen nicht klein sind. Als Redemptoristen sind wir „Missionare der Hoffnung in den Fußspuren des Erlösers Jesus Christus“, wie es unser letztes Generalkapitel formulierte. So vertraue ich, daß auch mein Dienst in der Ordensleitung eine Mission der Hoffnung wird. Tiefster Grund der Hoffnung ist immer Gott, der alle Wege unsers Lebens begleitet.
So schließe ich meine Gedanken mit dem letzten Absatz des Segensgebetes, das mich gegenwärtig stark begleitet: „Du Gott der Anfänge, laß dein Gesicht leuchten über mir, wenn ich in Vertrauen und Zuversicht einen neuen Schritt wage auf dem Weg meines Glaubens.“
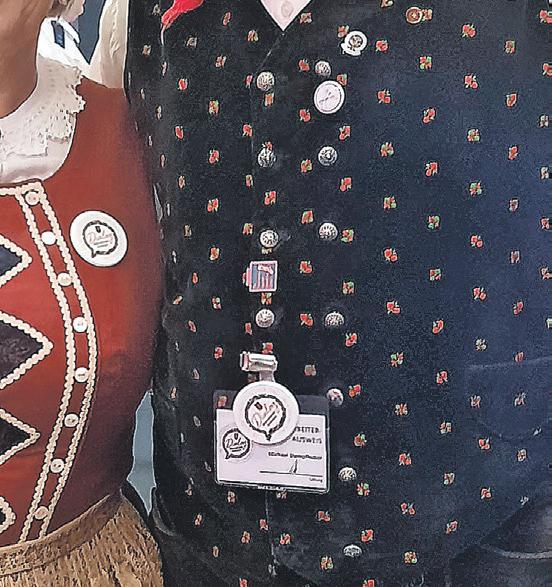 Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen


Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:

Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de 9/2023
PERSONALIEN
❯ Gefeierte Literatin aus Südmähren
Ilse Tielsch †

Am 21. Februar starb die Schriftstellerin Ilse Tielsch/Felzmann, Trägerin des SL-Kulturpreises 1983, einen Monat vor ihrem 94. Geburtstag im Kreise ihrer Familie in Wien.
Hans Weigel (1908–1991), der österreichische Schriftsteller und gefürchtete Theaterkritiker: „Wenn der Kafka und der Orwell als gemeinsame Tochter die Ilse Aichinger gehabt hätten, und die wiederum eine Verbindung mit Herzmanovsky-Orlando eingegangen wäre, dann wäre die Ilse Tielsch-Felzmann herausgekommen, mit Mark Twain als Vater.“
Dem war aber nicht so. Vielmehr kam Ilse Felzmann am 20. März 1929 im südmährischen
Auspitz bei Nikolsburg auf die Welt. Beeinflußt von ihrem Elternhaus, in dem Künstler und Literaten verkehrten, beschäftigte sie sich bald mit Dichtung und Theater. Bereits als Kind schrieb sie Gedichte. Im April 1945 fand sie auf der Flucht vor der nahenden Front Aufnahme auf einem Bauernhof im oberösterreichischen Schlierbach, wo sie Landarbeit verrichtete. Ihr gelang jedoch, den Schulbesuch im Herbst in Linz fortzusetzen und 1946 zu den inzwischen vertriebenen und nach Wien gelangten Eltern zurückzukehren.
Dort studierte sie Zeitungswissenschaft und Germanistik. 1953 promovierte sie mit „Die Wochenschrift ,Die Zeit‘ als Spiegel literarischen und kulturellen Lebens in Wien um die Jahrhundertwende“. 1949 wurde ihr die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Über ih-
ren Kommilitonen Erich Neuberg fand sie Anschluß an die Autoren- und Schauspielergruppe „Theater der Neuundvierzig“ im Café Dobner, zu der Helmut Qualtinger gehörte. 1950 heiratete sie Rudolf Tielsch und bekam ihr erstes Kind. Nun mußte sie Studium und Lebensunterhalt mit Brotarbeit verdienen. Erst 1964 erschien ihr erstes Lyrikbändchen in der Reihe „Neue Dichtung aus Österreich“. Dieser Publikation schickte sie in einer ersten öffentlichen Lesung folgendes Motto voraus, an das sie sich seitdem hielt: „Ich pfeife auf Rekorde / wenn alle rennen / will ich als Letzte / irgendwo weit hinten / wo es noch leise ist / meine eigenen / langsamen Wege gehen.“ Drei in dieser Zeit entstandenen Hörspiele strahlte der ORF aus, 1974 erschien ein erster Prosaband. In satirischen Erzählungen übte Tielsch Zeit- und Gesellschaftskritik. Die ersten Bücher veröffentlichte sie als Ilse Tielsch-Felzmann, änderte dies jedoch 1979 auf Weigels Rat in Tielsch.
„Die Ahnenpyramide“ brachte 1980 den Durchbruch. Dieses sich über vier Jahrhunderte erstreckende Familienepos behandelt Tielschs Herzensthema: die Vergangenheit und den Verlust der Heimat. Mit den Folgebänden „Heimatsuchen“ und „Die Früchte der Tränen“ schuf sie ein auch von der Fachwelt anerkanntes Werk über die Siedlungs- und Kulturgeschichte Südmährens am Beispiel einer Familie bis zur Vertreibung.
❯ Verdienter Freund und Musiker
Fritz Hochwälder schrieb
1980: „,Die Ahnenpyramide‘ habe ich mehrmals mit Erschütterung gelesen … Irgendwie erinnert mich diese Geschichte von der Austreibung und Vernichtung der Siedler in Böhmen und Mähren an ,Die Buddenbrooks‘. Bei Mann handelt es sich um den Verfall einer Familie, bei Tielsch hingegen um die Vernichtung eines friedlichen Volkes, das sich Heimat geschaffen hatte, und ihrer im Strudel einer Wahnsinnszeit verlustig ging.“
„Heimat ist“, sagte Tielsch, „wo Du das Recht hast zu leben, zu sterben, begraben zu werden, wo wir unseren unverwechselbaren Dialekt gelernt haben, wo mein Bewußtsein geprägt worden ist, wo man Kindern sagen kann: ,Das ist Eure Heimat!‘“ 1990 bis 1999 war sie erste Vizepräsidentin des österreichischen PEN-Clubs. Ihre Texte, Gedichte und Bücher wurden in 24 Ländern publiziert und in deren Sprachen übersetzt. Seit 1965 ehren sie zahllose Preise und Auszeichungen. Dazu gehören der Südmährische Kulturpreis 1981, der Große Kulturpreis der SL 1983, der Schönhengster Kulturpreis 1998 und der FranzTheodor-Csokor-Preis des österreichischen PEN-Clubs für ihr Lebenswerk 2017. 1981 wurde sie als ordentliches Mitglied der Klasse der Künste und Kunstwissenschaften in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste berufen.
Wir Sudetendeutschen betrauern den Tod dieser schöpferischen und begnadeten Autorin. Und wir danken Ilse Tielsch, die wahrlich für uns sprach und dies kunstvoll und wahrhaftig tat.
Gerhard Zeihsel/nhJosef Prell †
Am 7. Februar starb Josef Prell, ein Landsmann qua Ehe und Musiker der oberfränkischen SL-Kreisgruppe Bayreuth und der oberfränkischen SL-Ortsgruppe Pegnitz, mit 88 Jahren.

Josef Prell kam am 9. April 1934 in einem Bahnwärterhäuschen an der Strecke zwischen Pegnitz und Prag zur Welt. Der Vater arbeitete an der Bahnstrecke. Dazu betrieb die Familie eine kleine Landwirtschaft: ein paar Schafe, Ziegen, etwas Anbau von Kartoffeln und Getreide. Es war immer knapp. Für ein Instrument oder Musikunterricht reichte das Geld nicht. Er erlernte den Beruf des Schlossers.
Anschließend arbeitete er im Pegnitzer Bergwerk und war für Maschinen zuständig. Schließlich kam er zur KSB, einer großen Pumpenfabrik vor Ort. Für die Firma war er viel auf Montage. Später hatte er immer seine kleine Trompete dabei, und wenn er andere Musiker traf, spielte er mit ihnen. Musik spielte in seiner Freizeit eine immer größere Rolle. Blasmusik, vor allem die Böhmische, faszinierte ihn. Vielleicht spielten die Ahnen hier eine Rolle. Josefs Vater stammte nämlich aus Röslau an der Eger, einem Ort nahe der Stadt Eger.
Zu den Sudetendeutschen kam Josef über seine Frau Anni. Sie stammt aus Nedoveska bei Dauba in Nordböhmen. Damals gehörte das Dörfchen aus 16 Häusern zu Draschen, heute ist das Gebiet ein Daubaer Stadtteil.
1990 besuchten Josef und Anni zum ersten Mal die Heimat. Beide waren sehr ängstlich. Was wird übrig sein vom Elternhaus?
Anni: „Ich war überrascht und habe mich unendlich gefreut. Die Häuser standen und waren anscheinend bewohnt.“
Bei einem späteren Besuch sahen sie, daß Annis altes Elternhaus, ein Umgebindehaus, besonders sorgfältig renoviert worden war. „Ich bin heute noch stolz darauf“, sagt Anni. Sie fragte den neuen Besitzer, ob sie in das Haus dürfe, und wurde freundlich empfangen. Josef und Anni wollten nichts zurückhaben. Sie waren froh, in Pegnitz ein gemütliches Heim zu haben. Dennoch waren sie mit ihren Erinnerungen Zeitzeugen der sudetendeutschen Geschichte.
Allerdings vermag Anni noch weitere Aspekte zu erzählen. Ihre Mutter stammte nämlich aus Nixdorf bei Schluckenau. Gute Leute brachten sie als Kind nach Dauba, da es in Nixdorf für sie nicht genug zu essen gab. Die Mutter starb 1944 an TBC. Anni war erst acht Jahre alt. Der Vater war im Krieg, und Anni zog mit den Pflegeeltern der Mutter in die SBZ, ein bitteres Vertreibungsschicksal.
Sie kamen nach Kühlungsborn an der Ostsee. Ein schöner Ort, aber eine schlechte Unterkunft, kein richtiger Kochherd und die Großeltern waren krank. Anni war fast zwölf Jahre alt. Ihr Großvater suchte ihr eine Stelle, wo sie Kinder hütete und reichlich zu essen bekam. Sie fand Anschluß bei der katholischen Jugend. Dann starben die Großeltern nacheinander. Der Vater war nach seiner Entlassung na-
Prags neuer Bürgermeister Bohuslav Svoboda mit Amtskette.

❯ Prager Rathaus
Fünf Monate nach der Kommunalwahl bilden das Wahlbündnis Spolu aus ODS, TOP ‘09 und KDU-ČSL mit dem Bündnis aus Piraten und STAN eine neue Hauptstadtkoalition. Prager Oberbürgermeister ist Bohuslav Svoboda (ODS), der bereits 2010 bis 2013 dieses Amt bekleidete. Die Opposition besteht aus ANO, SPD und der früheren liberalen Regierungspartei „Prag für sich/Praha sobě“.

Die Oppositionsparteien kritisierten vor der Wahl, Svoboda habe sein Mandat im Abgeordnetenhaus nicht niedergelegt. Die Bewegung ANO, die in der Kommunalwahl dem Bündnis Spolu unterlegen war, sich aber als stärkste Einzelpartei betrachtet, kritisierte die Zusammensetzung der Koalition, wählte aber dennoch geschlossen Svoboda.
he Pegnitz untergekommen, aber Anni brauchte eine Zuzugserlaubnis nach Bayern. Sie absolvierte die Schule, reiste einige Zeit durch die SBZ und besuchte Verwandte. Im sächsischen Sebnitz bekam sie die Gelegenheit, Blumenbinderei zu erlernen. Das gefiel ihr. Und nachts hörte sie die Hunde aus dem nahen Nixdorf, dem Heimatort ihrer Mutter, bellen. Dann zog sie nach Bayern, und für Anni begann die schlimmste Zeit ihres Lebens. Der Vater arbeitete als Knecht. Anni konnte bei ihm nur kurze Zeit bleiben. Verkäuferin hätte sie gerne gelernt. Schließlich bekam sie eine Stelle im Haushalt bei dem Textilfabrikanten Horn aus Asch. Nach einiger Zeit fand sie eine Stelle als Verkäuferin bei einem Bäcker. Drei Wochen später starb der Bäcker plötzlich. Seine Witwe war hilflos. Anni machte den Laden auf, der Betrieb ging weiter, und sie arbeitete und arbeitete. Sie blieb bis zur Hochzeit mit Josef 1964. Das war sicher nicht immer einfach. Aber das arme Flüchtlingsmädchen bekam von der Bäckerin eine komplette Ausstattung mit, sogar Geschirr von Hutschenreuther.
Josef und Anni waren in vielen Vereinen. Aber in den letzten 15 Jahren hat Josef Prell nicht nur für Musik gesorgt. Er hat sich sehr für die Heimat seiner Frau interessiert, war bei allen Veranstaltungen und man konnte immer mit seiner Unterstützung rechnen. Möge er in Frieden ruhen. al
„Ich danke allen, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben. Die Tatsache, daß unsere Stadt einen Bürgermeister hat, ist nach all diesen Monaten eine gute Nachricht. Die Wahl eines Bürgermeisters ist der Beginn neuer Arbeit, harter Arbeit und Veränderung. Ich verspreche, daß ich und die Koalition sofort mit der Arbeit beginnen werden“, sagte Svoboda. Er wisse, was die Prager bräuchten. Er erklärte, daß die Stadtregierung mit der Landesregierung gut zusammenarbeiten werde. „Prag ist nicht nur die größte Stadt, sondern auch die Hauptstadt. Sie ist die Visitenkarte unseres Staates, ein eigenständiger Organismus, der mit der Regierung verbunden sein und mit ihr zusammenarbeiten muß, denn Prag macht eine ganze Reihe von Dingen nicht für sich selbst, sondern auch für den ganzen Staat.“ Svoboda ist Gynäkologe und arbeitete an der Geburtsklinik des Unikrankenhauses in den Prager Weinbergen, war 1992 bis 1998 Präsident der Tschechischen Ärztekammer und 2002 bis 2009 Dekan der 3. Medizinischen Fakultät der Karls-Universität Prag. 2010 wurde er erstmals Prager Oberbürgermeister. Seine Koalition mit der liberalen TOP ‘09 zerbrach, und sein Stellvertreter Tomáš Hudeček bootete ihn mit einem fliegenden Koalitionswechsel seiner TOP‘09 aus. Seitdem ist das Verhältnis zwischen ihm und der TOP ‘09 gespannt. Seit 2010 sitzt Svoboda im Prager Rathaus und seit 2013 für die ODS im Abgeordnetenhaus. Er ist Chef der Prager ODS und war 2014 bis 2018 Vorsteher des 2. Prager Gemeindebezirkes.
2023 ist Temeswar/Timișoara im westlichen Rumänien Kulturhauptstadt Europas. Aus diesem Anlaß veranstaltet das Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München die Programmreihe „Temeswar 2023: Die Kulturhauptstadt kommt nach München“. Als ersten Programmpunkt wird im HDO eine Auswahl aus dem Werk Bruno
Maria Bradts präsentiert. Der gebürtige Temeschwarer lebt heute im mittelfränkischen Fürth. Bei der Ausstellungseröffnung

sprachen Bruno Maria Bradt und seine Künstlerkollegin Susanne Leutsch sowie HDO-Direktor Andreas Otto Weber.
Das Hauptinteresse in Bradts künstlerischem Schaffen gilt den Menschen“, erläuterte Susanne Leutsch. „Immer wieder erzählen seine meist großformatigen Bilder von Menschen“, so die Künstlerin, die in zweiter Ehe mit Bradt verheiratet ist. Leutsch betonte, daß Bradt die Linien interessierten, die das Leben hinterlasse und allem ein unverwechselbares Gesicht gebe:
„Freude, Hoffnung und Liebe, aber auch Trauer, Schmerz und Leid, eingegraben in die Haut, die uns einhüllt.“
Dafür suche er sich als erstes Menschen als Modelle, um sie später im Studio profimäßig fotografieren zu lassen. Die Fotos bearbeite er im Computer, wo er geeignete Aufnahmen auswähle und schließlich zu einer Komposition verbinde, die als Grundlage für die eigentliche künstlerische Arbeit dienten. Seine Zeichnungen bestünden aus vielen Bleistiftlinien, die mehr oder weniger dicht oder übereinandergelagert die Schraffur ergäben, die dann Licht und Schatten sehen ließen. Bradts Werke seien allesamt Bleistiftzeichnungen auf grauem Buchbinderkarton. Lediglich die Farbakzente fhre er mit Acrylfarbe oder Gouache aus und akzentuiere mit Pastellkreide, so die Künstlerin. Bradt stellt manchmal auch Botschaften in Form von ausge-
Blick in die Ausstellung im Haus des Deutschen Ostens.
� Neue Ausstellung mit Werken von Künstler aus Temesvar in München
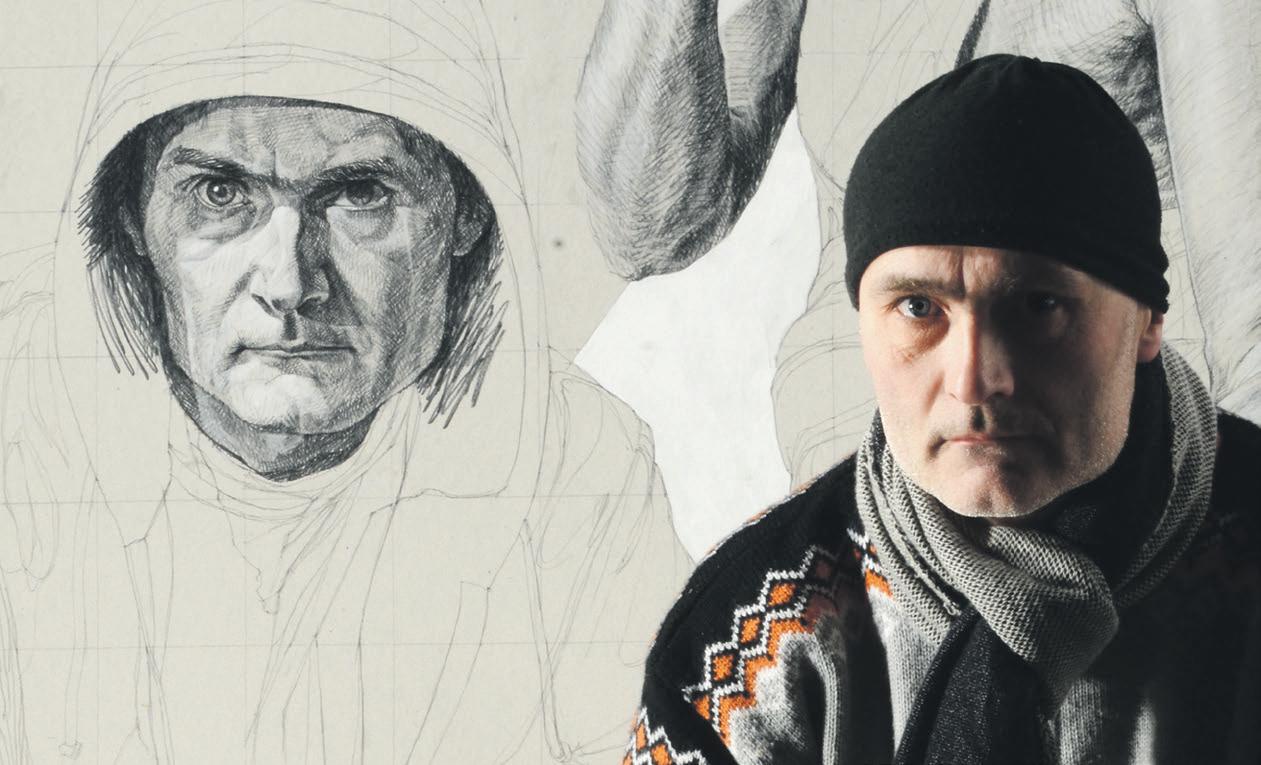


Fantastische Zeichnungen
Diese Techniken ergeben erstaunliche, umfassende Werke, die teilweise sogar aus mehreren Tafeln bestehen; es gibt aber auch Einzelportraits. In den Ausstellungsräumen des HDO kann man auf Entdeckungsreise gehen. Die Schau bietet anschauliche Beispiele von Bradts großen, auf den ersten Blick sehr gegenständlichen Zeichenwerken. Dabei wird die genaue Darstellungsweise durch Assoziationen und Gefühle überhöht, so daß man von einem phantastischem Realismus sprechen könnte.

Im letzten Raum der Ausstellung ist auch ein Bradtsches Großwerk zu sehen. Auf mehreren Tafeln stellt er hier zwölf Menschen dar, die den Betrachter ebenso berühren, wie offenbar den Künstler selbst. Dieses Werk heißt „Zwölf“ und erinnert wohl nicht zufällig an Bradts mehrteiliges Kunstwerk „Apostel“.
Der Künstler kann sich allerdings auch selbst anschaulich inszenieren. Bei einer Veranstaltung im Rahmenprogramm, „Talks in der Ausstellung“ merkte man, daß Bruno Maria Bradts Bilder nicht nur vom starken visuellen Ausdruck leben. Sie werden vielmehr in ihrer Wirkung noch verstärkt durch die Kommunikation mit dem Künstler, der die ästhetischen und lebensgeschichtlichen Kontexte aufzeigt, in denen sie entstanden sind. „Es war sehr beeindruckend, Bruno Bradt – der auch ein begnadeter Erzähler ist – beim Austausch mit seinen Zuhörern zu beobachten“, erinnert sich Lilia Antipow. Die HDO-Öffentlichkeitsreferentin schwärmte vom lebendigen Vortrag des Künstlers: „Eine Performance für sich!“

Susanne Habel
Bei der Vernissage: Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammmlung, Bruno Maria Bradt, HDO-Direktor Professor Dr. Andreas Otto Weber, der Münchener Stadtrat Dr. Florian Roth, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Susanne

wählten Texten sowie aus Liedern und Gedichten oder der Heiligen Schrift in seine Zeichnungen hinein. Von der Bibel beeinflußt ist sicher das von ihm „Leidensmachtkampf“ betitelte
Bild. Es zeigt Bradt selbst in kreuzigungsähnlicher Pose, nackt, nur ein weißes Tuch im Lendenbereich, und auf dem Kopf seine typische Mütze. Auf dem Bild wird aus dem Lied „Die Flut“ von
Joachim Witt und Peter Heppner zitiert, in dem es heißt:
„Und du rufst in die Nacht Und du flehst um Wundermacht Um ‘ne bessre Welt zum Leben Doch es wird keine andere geben
Wann kommt die Flut Und du rufst in die Welt Daß sie dir nicht mehr gefällt Du willst ‘ne Schönere erleben Doch es wird keine andere geben Wann kommt die Flut“
Bis Freitag, 28. April: „Bruno Maria Bradt. Eine Werkschau“ in München-Au, Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5. Montag bis Freitag 10.00–20.00 Uhr. „Talk in der Ausstellung mit Bruno Maria Bradt“ im HDO, Donnerstag, 30. März, 17.00 Uhr.
Bruno Maria Bradt wurde
1962 in Temeswar/ Timișoara im Banat geboren. Nach dem Besuch des Kunstgymnasiums studierte er an der Kunsthochschule in Klausenburg anfänglich Industriedesign.
1984 siedelte er nach Deutschland über. Es folgte das Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg in der Klasse Professor Heinz Schillingers.
In den folgenden Jahren arbeitete
� Künstler aus dem Banat
Bruno Maria Bradt
Bradt als Grafikdesigner bei mehreren Unternehmen und anschließend als Artdirektor bei Agenturen in Nürnberg und Coburg. Derzeit ist Bruno Maria Bradt als freiberuflicher Grafikdesigner und Künstler in Fürth tätig. Bradts Werk wird mittlerweile überregional und international wahrgenommen. Einzelausstellungen fanden in sakralen Räumen wie der Egidienkirche und Herz-Jesu-Kirche in Nürn-
berg, der SanktMarkus-Kirche in Erlangen und der Augustinerkirche in Würzburg statt, außerdem in der Galerie am Theresienstein in Hof sowie in der Galerie Atzenhofer in Nürnberg. Im Fürther Stadttheater war er in der Ausstellung „Von Mensch zu Mensch” zu sehen. An zahlreichen Gemeinschaftsausstellungen in der fränkischen Region und darüber hinaus nahm und nimmt er teil, so etwa bei der Münchener Künstlergenossenschaft. Auch in seiner Herkunftsheimat war er wieder zu sehen: So stellten das Brukenthal-Museum und das Museum für zeitgenössische Kunst in Herrmannstadt/Sibiu, das Kunstmuseum Klausenburg/Cluj-Napoca, die Cassa Muresenilor Kronstadt/Brașov oder
Gemeinsam mit der Heimatpflege der Sudetendeutschen veranstaltet das Haus des Deutschen Ostens (HDO) von Dienstag, 11. bis Donnerstag, 13. April im Bildungszentrum Kloster Banz in Bad Staffelstein im oberfränkischen Kreis Lichtenfels das Seminar „Was uns anzieht: Trachten der Deutschen aus dem östlichen Europa zwischen Ästhetik, Politik und Mode“.
� Seminar über ostdeutsche Trachten
Was uns anzieht
Die Tracht ist ein kulturelles Zeichen und ein Mittel der kulturellen Kommunikation. Bedeutung und Funktion der Tracht sagt etwas dem Trachtenträger – und der Gesellschaft über den Trachtträger. Wer etwas anzieht, zeigt, was ihn anzieht.
Das Seminar „Was uns anzieht“ von HDO und Sudetendeutscher Heimatpflege in Kloster Banz befaßt sich mit den Trachten
der Deutschen aus dem östlichen Europa: aus Böhmen und Mähren – besonders Wischauer und Egerländer –, Schlesien und Pommern, dem donauschwäbischen Raum wie Ungarn, Ost- und Westbanat/Batschka, Siebenbürgen und Gottscheer Land/ Krain. Neben der Entwicklung der heimatlichen Trachten vor 1945 wird insbesondere die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, sprich die Jahrzehnte nach Flucht und Vertreibung, in den Blick genommen.
Anmeldung bis Dienstag, 28. März bei Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, telefonisch unter (0 89) 4 49 99 30 oder eMail poststelle@hdo. bayern.de. Teilnahmebeitrag 130 Euro pro Person für Tagungsteilnahme, zwei Übernachtungen und Vollpension; Bezahlung bei der Anreise.
Gerhard Steppes-Michel: „Aussig“, „Fjord“ und „Schönberg“.

� Zum 100. Geburtstag des in Aussig geborenen Künstlers Gerhard Steppes-Michel
Auf der Suche nach der Schönheit der Schöpfung
Kürzlich feierte der Aussiger Künstler Gerhard Steppes-Michel 100. Geburtstag. Etwa 5000 Bilder und Tausende Skizzen vermeldet sein Werkverzeichnis. In seinem jetzigen Wohnort Schönberg im niederbayerischen Kreis Freyung-Grafenau im Bayerischen Wald ist er eine Berühmtheit, und dort eröffnete Mitte Februar eine Ausstellung seiner Bilder.

Gerhard Michel kam am 12. Februar 1923 im nordböhmischen Aussig zur Welt. Sein zeichnerisches Talent erkannte bereits sein langjährigen
Kunsterzieher Josef Patzak in der Schule in Aussig und förderte ihn. In den 1940er Jahren fiel ihm auf einer Berghütte eine Zeitschrift mit Beiträgen über Kriegsschiffe in die Hände. So trat er
1942 der Kriegsmarine bei, die er nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit Auszeichnung und einem hohen Dienstgrad verließ.
Die Einsätze bei der Marine hatten in ihm die Leidenschaft für das Meer und die nordische Landschaft geweckt. Später unternahm er viele Reisen nach Norwegen, Island und in die Antarktis. Seine Bilder zeigen unvergleichliche Landschaften, die einmal so beschrieben wurden:
„Es gibt keinen Künstler, der Wasser und Himmel so malen kann wie der Mensch aus dem Bayerischen Wald.“
Steppes-Michel gehörte 1942 der letzten Abiturklasse in Aussig an. Gleich nach dem Krieg gelangte er mit seiner ersten Frau nach Dillingen, wo ihm nach zwei Semestern Philosophie und Theologie 1946 ein Arbeitsplatz in der Finanzverwaltung angeboten wurde.
Er brachte es bis zum Leiter der Finanzämter in Viechtach und in Grafenau. Sein politisches Engagement war auch beachtlich: 1964 bis 1968 im Kreistag (Freie Wähler), seit 1968 im Vorstand des CSU-Ortsvereins Schönberg (CSU). Seit 1950 lebt er in Schönberg, einem Markt im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. Künstlerisch prägten ihn dort besonders die Malerinnen Amalie Stubenrauch und
� Ausstellung im Franziskanerinnenkloster


Erica Steppes, die 1983 seine Adoptivmutter wurde – daher der Doppelname. 1966 war er Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Bayerwaldkreis und bis zur Auflösung 1997 deren ehrenamtlicher Geschäftsführer.
nung und zum Holzschnitt. Zu seinem 70. Geburtstag schenkte Steppes-Michel Schönberg die Bayerwaldkreis-Galerie.
Zu seinem 70. und 80. Geburtstag erschienen im MorsakVerlag Grafenau die Bücher „Der
Fressenden Haus in Regen im Kunst-, Kultur- und Vereinshaus Schönberg (KuK) in Schönberglaufen.
Mitte Februar eröffnete die Steppes-Michel-Ausstellung im KuK eröffnet. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Buch „Kraft und Wandel in den Schachten“ den mehr als 200 geladenen Gästen aus Politik, Kultur und Kirche, Freunde, Weggefährten und Familie präsentiert.
Zuletzt sei im November der ExPräsident des Bayerischen WaldVeriens und Regierungsvizepräsident a.D., Heinz Huther, gestorben. Dieser sei über Jahrzehnte sein guter Freund gewesen, der bereits schwer gezeichnet das Vorwort zu seinem Buch geschrieben habe.
In jungen Jahren bezwang er als Bergsteiger mehr als 30 Dreitausender. Die Krönung waren das Matterhorn und der Mont Blanc. Erst eine Knieverletzung beim Absturz am Kitzsteinhorn zwang den Bergsteiger, kürzer zu treten. Im Bayerischen Wald war Michel-Steppes maßgeblich am Aufbau des Wintersports beteiligt. Als Skispringer absolvierte er 1950/1951 116 Sprünge auf der Kadernberger Schanze nahe Schönberg. Später galt sein Ehrgeiz dem Skilanglauf. Bevorzugte Themen von Steppes-Michel sind die Landschaft des Bayerischen Waldes, die nordische Landschaft, das Meer und abstrakte Kompositionen. Die Palette seiner künstlerischen Ausdrucksmittel reicht vom Pastell über Ölkreide, Tempera- und Aquarellmalerei bis zur Zeich-
Maler Gerhard Michel“ und „Naturlandschaften“. Der zweimal Verwitwete hat vier Söhne, drei Enkel und drei Urenkel und bekocht sich weiter selbst in seiner Wohnung, die er auch selbständig mit Holz beheizt.
Steppes-Michel wurde 1983 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, 1984 und 1994 mit dem Kulturpreis des Landkreises Freyung-Grafenau, 1996 mit dem Kulturpreis des Bayerischen Wald-Vereins und 2004 mit der Adalbert-Stifter-Medaille der SL geehrt. Zum 100. Geburtstag erschien das druckfrische MichelBuch „Kraft und Wandel in den Schachten“, das sich Kunstfreunde sicher besorgen werden. Oder sie besuchen eine der drei Ausstellungen, die anläßlich seines Geburtstages im Spital Hengersberg im Kreis Deggendorf, im
Laudatoren waren Pfarrer Michael Bauer, Bürgermeister Martin Pichler, Niederbayerns Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich, der Landrat Sebastian Gruber, KuK-Vorsitzender Bernd Bachhuber, die Bezirksvorsitzende der Bayerischen Finanzgewerkschaft, Birgit Fuchs, die Verlagsleiterin von Lichtland, Hannelore Hopfer, sowie der Lyriker und Freund Karl-Heinz Reimeier, dem man auch die stimmungsvollen Texte zu den Bildern im Buch verdankt. Harmonische Klänge von Claudia Forster an der Harfe untermalten die Veranstaltung.
In den zwei Stunden wurde ein sehr lebendiges Bild von Gerhard Steppes-Michel gezeichnet. Mit Konsequenz, Freude und Leidenschaft brachte er es fertig, jung alt zu werden. Und er bewies, daß Kreativität keine Altersgrenze kennt.
In seinem Schlußwort bedauerte der Jubilar, daß viele liebe Menschen nicht mehr lebten.
Eine Wahrheit gebe er uns mit auf den Weg: „Der Künstler ist kein Erfinder. Künstler ist, wer ernsthaft die Schönheit der Schöpfung in der Natur sucht. Mir ist es ein Anliegen die Mitmenschen zu erfreuen, ihnen zu zeigen wie schön Gottes Erde ist, die wir schon aus Dankbarkeit zu erhalten haben.“ kwf/sh
Gerhard Michel, Karl-Heinz Reimeier: „Kraft und Wandel in den Schachten“. Lichtland Verlag, Schönberg 2023; 100 Seiten, 25 Euro. (ISBN 9783947171453)

Globale Zerstörung und technoide Verödung
Mitte Februar eröffnete in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis eine Ausstellung mit Werken des mährischen Künstlers Klaus Kugler. Stefan P. Teppert berichtet.


Drei Dutzend Bilder von Klaus Kugler hängen im Kloster


der Franziskanerinnen der ewigen Anbetung in Schwäbisch Gmünd. Die kleine Ausstellung steckt voller Andeutungen, Symbole und Metaphern aus der abendländischen Überlieferung.
Zugleich beschäftigen sich zahlreiche Motive mit brandaktuellen Problemen. Thematisiert
wird die globale Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und die damit einhergehende technoide Verödung. Zur militärischen Aufrüstung mit Raketen gehören hinter Fahnen und Propaganda in ihr Verderben laufende Massen.
Mit zahlreichen Zitaten etwa aus der griechischen Mythologie mit Charons Barke, aus dem Christentum, aus der verkrusteten Institution Kirche mit dem Gekreuzigten, aus der Kunstgeschichte mit Matthias Grünewald und Gerhard Richter, aus der Astronomie mit Johannes Kepler, aus der Musik mit Joseph Haydns Schöpfung sowie aus der Literatur mit Dante Alighieri und Romain Rolland erweist sich Kugler als Brückenbauer zwischen altmeisterlicher Tradition und akuter Weltlage.
Nicht allein ihrer Thematik wegen hinterlassen diese virtuos gestalteten Radierungen, Kupferstiche, Feder- und Pinselzeichnungen von kleinem und mitt-
lerem Format bleibende, nachdenklich stimmende Eindrücke, sondern auch wegen ihrer verblüffend detaillierten, zu immer neuen Entdeckungen einladenden Darstellungsweise mit ihren visionären, oft düster-phantastischen, ja apokalyptisch anmutenden Bildräumen.
Zunächst erfaßt der Betrachter die vordergründigen Umrisse, bei genauerem Hinsehen eröffnen sich im Miniaturbereich von feinsten Strichen modellierte Gestalten, Szenarien und Perspektiven. Sie provozieren frappante Assoziationen und erweitern den Deutungshorizont.
Klaus Kugler kam 1942 im mährischen Wostitz im Kreis Nikolsburg Zur Welt. Als er drei Jahre alt war, wurden die Deutschen aus Böhmen und Mähren vertrieben. Seine Eltern bauten sich eine neue Existenz in Deutschland auf. Kugler studierte an der Stuttgarter Kunstakademie, bevor er in Wien die Meisterschule für Grafik besuchte.
Seit 1969 bis zu seinem Ruhestand 2005 war Kugler als Kunsterzieher in Weil der Stadt tätig. 1979 bezog er sein Atelier in Simmozheim im Kreis Claw. Er wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet.
Die von der Ackermann-Gemeinde in Stuttgart organisierte Ausstellung läuft bis 26. März. Ein 50seitiges Begleitheft mit kommentierten Abbildungen der Kugler-Werke kann man käuflich erwerben.
Die letzte Träne des Golem

Der Golem ist ab dem frühen Mittelalter in Mitteleuropa die Bezeichnung für eine Figur der jüdischen Literatur und Mystik. Dabei handelt es sich um ein von Weisen mit Buchstabenmystik aus Lehm gebildetes, stummes, menschenähnliches Wesen, das oft gewaltige Größe und Kraft besitzt und Aufträge ausführen kann. Er ist seinem Schöpfer oder Meister unterworfen und besitzt keinen freien Willen. Hier die Nacherzählung einer deutschen Sage aus Prag von Vladimír Hulpach mit Illustrationen von Karel Franta
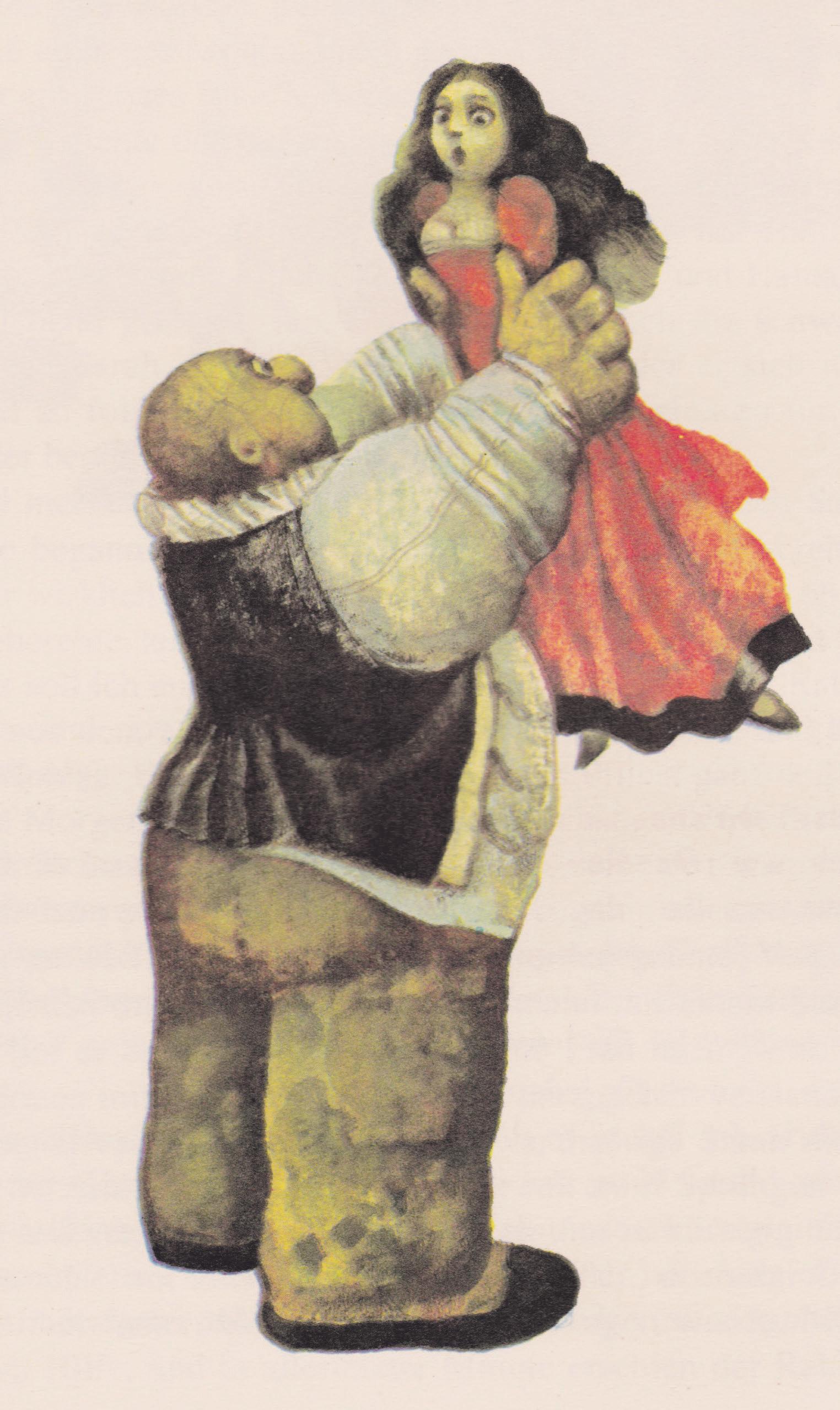

Die Prager Judenstadt ist so alt wie Prag selbst, nach einer alten Prophezeiung wurde sie sogar 72 Jahre früher am rechten Moldauufer gegründet, noch bevor der Stammvater der Böhmen ins Land gezogen kam. Die Judenstadt lebte seit alters her ihr besonderes und für die übrigen Bewohner der Stadt oft geheimnisvolles Leben. Die Juden erlebten hier so manche unglücklichen Jahre, in denen sie Plünderungen über sich ergehen lassen mußten, und Zeiten, in denen man sie mit Gewalt vertrieb, doch auch gute Jahre.
Und gerade in einer solchen Zeit wurde der hohe Rabbi Löw durch seine Weisheit, seine Gelehrsamkeit und durch Wundertaten berühmt, die der Kunst angesehener Magier in nichts nachstanden. Sein eigentlicher Name war Jehuda ben Bezalel, also Juda, Sohn des Bezalel, und bei seiner Geburt sah er zweifellos einen Glücksstern über sich, der sowohl sein Leben als auch das des gesamten Ghettos von nun an begleiten sollte.
Der Rabbi verstand es, an der Seite seiner Frau Perl die Mächtigen und Gelehrten dieser Welt, zu denen er oft geladen wurde und unter denen er auch seine Bildung fand, für die Angelegenheiten der Judenstadt geneigt zu machen. So wird beispielsweise erzählt, wie er sich mit Kaiser Rudolf unterhielt und ihm zur Freude auf dem Hradschin vor den ungläubigen Augen aller die Stammväter der Juden, angefangen bei Abraham, hervorzauberte.
Oder wie er in seinem kleinen, einfachen Häuschen in der Breiten Gasse die Illusion von weiträumigen Schloßsälen mit Teppichen, venezianischen Spiegeln, Marmorsäulen und einem Festbankett für das Gefolge des Herrschers zu wecken wußte.
Und auch andere wundersame Taten werden ihm zugeschrieben. Die wunderbarste jedoch war die Schöpfung des Golem, eines künstlichen Menschen aus Lehm. Und als der Rabbiner dem Golem schließlich ein Pergamentblatt mit dem Schem, dem Namen Gottes, unter die Zunge geschoben hatte, stand der Riese auf, schaute sich mit seinen Lehmaugen um, streckte seine lehmigen Arme und Beine, um von nun an seinem Herrn zu dienen. Zu diesem Zweck, so sei noch gesagt, bekam er natürlich auch eine echte Dienerkleidung. Weil der Golem Kraft hatte wie kein zweiter und aufs Wort gehorchte, begannen die Hausfrauen in der ganzen Judenstadt alsbald, ihn sich auszuleihen, auch wenn er oftmals etwas verdarb. Einmal brachte er vom Markt statt nur eines Fisches gleich einen ganzen Korb voll Karpfen mit, statt Reisig zum Anfeuern riß er an der Moldau einen ganzen Baumstamm aus, statt einer Truhe quartierte er ein ganzes Haus auf die Straße aus. Am liebsten diente der Golem im Haus des vermögenden Kaufmanns Isaak, der unweit der Synagoge wohnte. Rebekka, des Kaufmanns Frau, verstand es von allen Hausfrauen weit und breit am besten, nicht nur Hammel oder Gans zuzubereiten, sondern auch Tscholent, gefüllten Fisch und Hamantascherl, die der Riese liebend gern mochte. Zudem war da noch die schwarzhaarige und schwarzäugige Sarah, ein lebhaftes Mädchen, an dem er sich nicht satt sehen konnte. Und so folgte er Sarah, wenn er gerade nichts zu tun hatte, wie ein Schatten oder beobachtete sie von seiner Küchenbank aus. Sehr bald merkten dies nicht nur die Eltern, sondern auch Sarahs Freundinnen, und sie begannen, sie aus Spaß mit ihrem stummen Verehrer zu necken. Und das war wirklich nur im Scherz, denn lange schien es, als ob der Golem nur Befehlen gehorchte, zu eigenen Gedanken oder Taten indes nicht fähig war. Doch was soll ich euch sagen: Jeden Sonnabend nahm der Rabbi dem Golem den Zettel mit dem Schem aus dem Mund, um seinen Körper abzutöten, und belebte ihn erst wieder am Montag. Einmal jedoch hatte er seine
Pflicht ganz und gar vergessen. An jenem Morgen saß der Golem zwar zunächst ganz friedlich auf seiner beliebten Bank in Isaaks Haus, wobei er, wie es seine Art war, sich hin und her wiegte, doch dann stand er plötzlich auf und begann, alles zu zerstören und aus dem Fenster zu werfen, wessen er habhaft werden konnte. Vergeblich rang Rebekka die Hände, umsonst schlug der Kaufmann mit einem Stock auf ihn ein. Schließlich lief er zum Rabbi, während seine Frau
und ungestüm zu küssen. Sarah versuchte mit aller Kraft, sich loszureißen, doch der Golem umklammerte sie immer fester, bis ihr schwarz vor Augen wurde. Mit letzter Kraft schrie sie um Hilfe, und in allerletzter Minute erschien der Rabbi im Haus. Er hatte den Gesang des Sabbatpsalmes unterbrechen müssen, und seine alten Augen leuchteten vor Grimm. Der Golem ließ das Mädchen sogleich los. Ganz kleinlaut folgte er dem Alten. Sie gingen nicht weit. Der
„Leg dich hin und schlaf für immer ein, Golem, denn deine Kraft ist keine Hilfe mehr für uns, sondern für jeden eine Drohung!“
Da aber gewahrte der Rabbi in des Dieners stummem Gesicht eine so flehentliche, so menschliche Bitte, ihn doch leben zu lassen und seine harte Entscheidung rückgängig zu machen, daß er schauderte. Doch er blieb dabei. Als der Golem sich folgsam auf den von jahrelangem Staub und Spinnweben bedeckten Boden gelegt hatte, nahm er ihm schließlich den Zettel mit dem magischen Schem aus dem Mund.
Der gewaltige Riese zerfiel in einen unförmigen Haufen Lehm, und nur sein Gesicht behielt seine einstige Form. Darin sah der Rabbi etwas, was ihn zu tiefem Nachdenken bewegte: eine echte menschliche Träne! Nun kehrte er zu den Gläubigen zurück und begann erneut, den 92. Psalm zu singen, der den nahenden Sabbat ankündigte. Jahre vergingen. Rabbi Löw vollbrachte noch viele gute Taten für die Judenstadt, bildete zahlreiche bedeutende Schüler im Talmud und anderen Lehren aus und hatte in der Tat schon ein gesegnetes Alter erreicht, als das Ghetto wieder einmal vom schwarzen Tod heimgesucht wurde. Die Menschen starben wie die Fliegen, und die Leichenkarren rumpelten unentwegt über das Pflaster. Der weise Alte suchte das Haus des Lebens auf, den alten jüdischen Friedhof. Er hoffte gerade an dieser Stätte die Seinen von der tödlichen Seuche befreien zu können. Und richtig:
Dort, auf einem der Grabsteine, saß der schwarze Tod, in eine lange Pergamentrolle vertieft.
los in der Finsternis der Nacht, während der Rabbi nach Hause ging. Und wie sehr er sich auch den Kopf zerbrach: Warum der Sensenmann ihm gedroht hatte, das fand er nicht heraus. Doch wußte er sehr wohl, daß jener jetzt versuchen würde, ihm um jeden Preis beizukommen, vor allem, weil die Pest aus der Judenstadt abgezogen war, nachdem er das Pergament vernichtet hatte. Bis weit in die Nacht studierte der Rabbi in Büchern und überlegte stundenlang, sein weißes Kinn in die Hand gestützt, wie dem Knochenmann beizukommen sei.
Schließlich beschaffte er sich ein Glöckchen, ganz schwarz, dessen Klingeln ihm jedesmal verriet, wenn der Tod in der Nähe war. Zwar nahm dieser stets eine andere Gestalt an, vom Bettler an der Haustür bis hin zum Adligen, der die Weisheiten des Talmud studieren wollte, doch das Glöckchen verriet ihn jedesmal, so daß der Rabbi sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Schließlich kam der Tag, an dem der Rabbi seinen 100. Geburtstag beging.
Zu seinem Haus in der Breiten Gasse kamen Kutschen gefahren, strömten die Freunde, Verwandten und Schüler. Der Greis gedachte längst vergangener Zeiten, und mit jedem plauderte er ein wenig. Als ihn dann die Müdigkeit überkam und er sich danach sehnte, allein zu sein, machte er sich in die düstere Synagoge auf, wo er in stiller Betrachtung verharrte, bis ihn seine Schritte wie von selbst hinauf auf den Boden zum Golem führten.
nach Sarah rief, die schon immer am besten mit dem Riesen aus Lehm umzugehen verstand.
Doch diesmal vermochte selbst die schwarzhaarige Sarah nichts auszurichten. Sobald der Golem sie gewahrte, war er mit zwei Sprüngen bei ihr, zog sie in die Arme und versuchte, sie wild
Rabbi führte den Diener ins Innere der Altneusynagoge, in die Synagoge also, die dem Tempel in Jerusalem am meisten ähnelte, denn von dort hatten die Engel angeblich das ursprüngliche Mauerwerk herbeigebracht. Wortlos gingen sie auf den Dachboden, und dort sprach der Alte:
Als sich der Rabbi ihm unbemerkt näherte, sah er im Mondenschein, daß die Rolle in seinen Händen ein Verzeichnis all derer war, die noch am Leben waren, und sein Name stand ganz oben auf der Liste. Er überlegte nicht lange. Schnell riß er dem Knochenmann das Pergament aus der spindeldürren, knöchernen Hand und zerriß es in Stücke. Der Tod musterte ihn mit bösem Blick, bevor er sprach: „Das hättest du nicht tun sollen! Selbst du bist nicht ganz ohne Schuld und hast kein Recht, den Todesengel ungestraft zu vertreiben. Merke dir das gut!“ Daraufhin verschwand der Knochenmann laut
Der Haufen Lehm hatte sich schon längst in dem umliegenden Schutt verloren, doch noch immer waren Kopf und Gesicht des Dieners zu erkennen. Plötzlich erstarrte der Rabbiner: Auf dem Gesicht schimmerte erneut eine lebendige menschliche Träne, wie einst, als er dem Golem das Leben nahm.
„Also an dir bin ich schuldig geworden“, flüsterte der Greis, von der unerwarteten Erkenntnis überrascht. Und als ob er nicht hörte, daß sein Schutzglöckchen wie wild im Kaftan zu läuten begann, beugte er sich nieder, um dem Golem die Träne abzuwischen. Doch mitten in der Bewegung erstarrte sein alter Körper und fiel entseelt neben den tönernen Diener zu Boden. Aus der Träne auf dem Gesicht des Golem war nämlich ganz unverhofft der gefürchtete Malach Hamawod, der Engel des Todes, getreten.
85
Am 25. Februar feierte Josef Plahl, SL- und BdV-Aktivist aus dem Egerland, im hessischen Weilburg seinen 85. Geburtstag.

Zur Welt kam Josef Plahl in Zeidlweid im Kreis Marienbad, das zum Egerländer Bäderdreieck mit Franzensbad und Karlsbad zählt. Unweit liegt auch die ehemals Freie Reichs- und Stauferstadt Eger. Bereits mit acht Jahren mußte er mit seinen Eltern und Geschwistern im Juli 1946 die geliebte Heimat Egerland verlassen. Das neue Zuhause wurde Weilmünster in Hessen, wo ein neuer Lebensabschnitt mit vielerlei Entbehrungen begann. 1968 heiratete er in Weilburg die aus Mähren stammende Dorith Czerny. Kennengelernt hatte sich das Paar bei der Jungen Aktion der AckermannGemeinde. Aus der Ehe gingen eine Tochter und ein Sohn hervor.
Bald engagierte sich Plahl für die Heilung des Vertriebenenschicksals seiner Landsleute, das Gemeinwohl seiner Mitmenschen und die Völkerverständigung. So gehörte er 35 Jahre lang dem Magistrat von Weilburg oder der Stadtverordnetenversammlung an. Fast 30 Jahre lang war er Mitglied des Kreistages oder des Kreisausschusses des Landkreises Limburg-Weilburg.
31 Jahre lang war er Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Weilburg. Auch in kirchlichen Gremien in der Pfarrei Heilig-Kreuz Weilburg und im Bezirk Limburg engagierte er sich.
2004 wurde er zum Vorsitzenden des BdV-Kreisverbandes Limburg-Weilburg gewählt. Außerdem bekleidet er seit 38 Jahren das Amt des Stellvertretenden SL-Kreisobmanns und ist Mitglied im BdV-Landesvorstand.
2011 nahm er von der aktiven Kommunalpolitik Abschied und widmete sich sozialen Belangen. Er war Mitglied der Seniorenbeiräte der Stadt Weilburg und des Landkreises Limburg-Weilburg.
Ebenso war er ab 2007 Stellvertretender Vorsitzender des VdKOrtsverbandes Weilburg und seit 2011 dessen Vorsitzender.
Sein ehrlicher Charakter, sein Elan und seine Kenntnisse über den deutschen Osten erwiesen sich über Jahre hinweg als Segen für den Verband. In den Jahren als Kreisvorsitzender hat er sich zu einem profunden Kenner der Geschichte der ehemaligen Gebiete Ostdeutschlands und des Sudetenlandes entwickelt. Sein Hauptanliegen ist, den Menschen klar zu machen, daß die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten Europas nicht nur eine Sache der Vertriebenen selbst, sondern eine Angelegenheit des gesamten deutschen Volkes ist.
Daß er ein ausgezeichneter 85er ist, verdeutlichen seine zahlreichen Ehrungen wie die Verleihung des Landesehrenbriefes, das Große SL-Ehrenzeichen und das Bundesverdienstkreuz am Bande. Diese Auszeichnungen hat sich Josef Plahl in seinem mehr als 55 Jahre langen ehrenamtlichen Wirken wahrlich verdient.
❯ SL-Ortsverband Naila/Oberfranken
Selbstbestimmungsrecht akut verletzt
104 Jahre nach der völkerrechtswidrigen tschechischen Annexion des von Deutschen kultivierten Sudetenlandes und ein Jahr nach dem verbrecherischen
Kriegsbeginn Wladimir Putins gegen die Ukraine gedachte die oberfränkische SL-Ortsgruppe Naila mit Bürgern der Region Ende Februar der Märztoten und der Opfer im Kampf für das Selbstbestimmungsrecht und der Vertreibungen.
Das Gedenken begann mit einem Gottesdienst für die Opfer von Krieg, Terror und des Kampfes für das Selbstbestimmungsrecht, zelebriert von Dekan Andreas Seliger und Pastor Jürgen Kämpf. Bürgermeister und Vize-Landrat Frank Stumpf gedachte in den Fürbitten der sudetendeutschen Opfer des Selbstbestimmungsrechts vom 4. März 1919. Er erinnerte an die Vertriebenencharta von 1950 mit Gewaltverzicht und Europabekenntnis. In seiner Schilderung der militärischen Besetzung des Sudetenlandes und der folgenden Verletzungen des Selbstbe-
gewalt hätten die Tschechen die Sudetendeutschen in den Tschechoslowakischen Nationalstaat gepreßt. Dem hätten sie angehören wollen, sich aber zwangsweise unterordnen müssen. Entgegen dem vom USA-Präsidenten Woodrow Wilson vergeblich proklamierten Recht auf Selbstbestimmung der Volksgruppen hätten der tschechische Staatspräsident Tomáš G. Masaryk und sein späterer Außenminister Edvard Beněs das Sudetenland besetzt und annektiert.
Als die Sudetendeutschen friedlich und unbewaffnet am 4. März 1919 für ihr Selbstbestimmungsrecht demonstriert hätten, habe tschechisches Militär mit Maschinengewehr-Salven in die Menge geschossen. 54 Tote und in der Folgezeit bis zu 2000 Tote und Verletzte seien die Blutopfer der tschechischen Scheindemokratie gewesen. Die habe den Weg für die Machtergreifung der Hitler-Nazis und das Erstarken des Stalin-Bolschewismus geebnet.
Die Sudetendeutschen seien wirtschaftlich, schulisch, po-
ne sich die tschechische Regierung nicht zu ihren Völkerrechtsverbrechen zwischen 1918 und 1938 und der Nachkriegsvertreibung, konstatierte Markus.
Bettina Müller gedachte anläßlich des 100. Todestages von Karl I. diseses letzten Kaisers der Habsburger Monarchie und des letzten Königs des Kronlands Böhmen. Diesen habe Papst Johannes Paul II. 2004 als Friedenskaiser seliggesprochen. Vergeblich habe er versucht, den Ersten Weltkrieg vorzeitig zu beenden. Seine Pläne eines Nationalitäten-Bundesstaates seien nicht verwirklicht worden.
Horst Kaschel würdigte die enormen Lebensleistungen des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. als Mensch, als Gelehrter und Erzbischof auch im Hinblick auf die Vertreibung. Erzbischof Ratzinger habe gemahnt, dieses Unrecht um der Versöhnung willen nicht zu verschweigen und auf Wahrheit nicht zu verzichten.
Die März-Ereignisse 1919 und der Ukraine-Krieg Putins mahnten uns, so Obmann Adolf Markus, aus ihnen die Lehren zu ziehen, den Aufstand für Recht und Selbstbestimmung nicht in eine historische Lüge umzufälschen und unter Bezug auf die Vertriebenen-Charta für eine friedliche, starke Europäische Gemeinschaft nachhaltig zu arbeiten. Die Toten des 4. März würden zu einem bürgerlichen Engagement für einen gemeinschaftlichen Zusammenhalt verpflichten, mit der nachwachsenden Generation für eine ehrliche Völkerverständigung zu arbeiten.
stimmungsrechts skizzierte er die unseligen Entwicklungen für Sudetendeutsche und Tschechen durch den Nazieinmarsch. Sie hätten im Zeiten Weltkrieg mit folgender Enteignung und Vertreibung der mehr als drei Millionen Sudetendeutschen geendet. SL-Vizebezirksobmann Adolf Markus schilderte die Tragödie der Sudetendeutschen Volksgruppe, die 1918 mit dem Zerfall des Vielvölkerstaates der österreichisch-ungarischen Monarchie begonnen habe. Mit Waffen-
litisch und sozial benachteiligt worden. Die Tschechisierung habe tschechische Betriebe bei Staatsaufträgen massiv bevorzugt. 500 000 sudetendeutsche Arbeitslose, zunehmende Lebensmittel- und Kohleknappheit und eine von der Weltwirtschaftskrise 1929 verstärkte großer Not seien die Folgen gewesen. Und das, obwohl in den sudetendeutschen Gebieten 73 Prozent der Industrien der ehemaligen Donaumonarchie gelegen seien. Bis heute beken-
Die heutigen Politiker und Medien sollten nicht nur nach Opportunität, sondern nach geschichtlicher Wahrheit gerecht handeln zur Sicherung des inneren und äußeren Friedens. Zusammen mit der Gemeinde gedachten alle der 80 Millionen weltweit Flüchtenden, aktuell der Ukraine- und Erdbebenopfer in Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit. In diesem Gedenken legten Dekan Andreas Seliger, Bürgermeister Frank Stumpf und Vizebezirksobmann Adolf Markus einen Kranz am Sudetendeutschen Ehrenmal nieder.
Wolfgang Zenker †

Am 6. Dezember starb Wolfgang Zenker, aus Brünn stammender Lehrer der klassischen Anatomie, mit 97 Jahren in Pfäffikon bei Zürich.
Wolfgang Zenker kam am 14. Februar 1925 in der mährischen Metropole Brünn als Sohn eines Zahnarztes zur Welt. Er absolvierte das humanistische Gymnasium und maturierte 1944 in Latein und Griechisch. Nach einem Semester Medizin in Prag zog ihn die Wehrmacht ein. Dank seiner Begabung für das Cello-Spiel wurde er als Rekrut vom Fronteinsatz vorerst zurückgestellt, weil der Kommandant ihn im Battailons-Orchester brauchte.
1944 wurde er zum Sanitätsdienst nach Libau in Lettland einberufen. Diese Hafenstadt war gegen Kriegsende auf dem Landweg abgeschnitten, er kam jedoch 1945 mit einem Schiff noch rechtzeitig weg und landete in Schleswig-Holstein. Seine Eltern waren bei Beginn der Vertreibung der Deutschen von Brünn nach Wien geflohen, wo er sie
nach langer Ungewißheit 1946 fand. Sein Vater arbeitete wieder als Zahnarzt, Wolfgang Zenker setzte sein Medizinstudium fort und erlebte die Jahre der Besatzung durch die Aliierten.
So zerbombt Wien war, so sehr erwachten Kunst und Kultur wieder. Zenker erlebte diese Zeit des Wiederaufbaus und dann den Staatsvertrag 1955 mit folgendem Abzug der Besatzungsmächte mit. Er war als Student schon Demonstrator am Anatomischen Institut und beschrieb 1953 das Organum juxtaorale. Er blieb der Anatomie treu.
Ich durfte den jungen Dozenten 1963/64 in der brillanten Vorlesung und Übung „Hirnsektion“ erleben. 1964 wurde er an den Lehrstuhl der neuen Ruhr-Universität nach Bochum berufen, 1969 kehrte er als Ordinarius für Anatomie an die Universität Wien zurück. Er war bei zahlreichen Anatomie-Lehrbüchern Mitherausgeber und trug stets viele interessante Kapitel
Bildnis von Dora Kallmus des Künstlers Oskar Stocker, installiert auf der Fassade des jüdischen Gemeindezentrums in Graz am Tage ihrer Exhumierung und Wiederbeisetzung auf dem jüdischen Friedhof von Graz.

❯ Zum 60. Todestag von Madam D‘ Ora
Prager Pionierin der Portaitfotografie
Madame D‘ Ora alias Dora Kallmus kam am 20. März 1881 als Dora Philippine Kallmus, Tochter des Hof- und Gerichtsadvokaten Philipp Kallmus (1842–1918) und der Malvine Kallmus, geborene Sonnenberg (1853–1892), in Wien zur Welt.

Der Vater war ein Prager Deutscher. Dessen Eltern Karl Kallmus (1802–1873) und Sarah Kallmus, geborene Schulhof (1824–1904), waren logischerweise ebenfalls Prager Deutsche. Mütterlicherseits stammten die Vorfahren aus Grabing/Krapina in Kroatien, das bis 1918 zur Habsburger Monarchie gehörte. Dora Kallmus hatte eine Schwester, Anna Malvine Kallmus, mit der sie ein Leben lang sehr verbunden war. Anna kam 1878 in Wien zur Welt und 1944 im KZ Auschwitz um.
Dora Kallmus wuchs in einer großbürgerlichen jüdischen Familie in der Wiener Altstadt auf. Die Mutter starb 1892 bereits mit 39 Jahren, weshalb Dora von der Prager Großmutter in Wien aufgezogen wurde. Sie wollte Schauspielerin werden, was die Familie nicht billigte. Deshalb beschloß sie im Jahr 1900, Fotografin zu werden. Frauen war damals die Fotografenlehre verwehrt, ebenso die Ausbildung an der k. u. k. Lehr- und Versuchsanstalt für Fotografie und Reproduktionsverfahren in Wien.
bei. Als ein weiterer Ruf kam und nachdem die 1968er-Bewegung den universitären Boden in Wien stark verändert hatte, wechselte er 1977 an die Universität Zürich. Dort hatte er bis zu seiner Emeritierung 1992 den Lehrstuhl für Anatomie inne. Bei seiner Emeritierung spielte er wieder selbst das Cello.
1987 wurde er Präsident der Gesellschaft für Anatomie, der internationalen paneuropäischen wissenschaftlichen Gesellschaft seines Faches. Er war korrespondierendes Mitglied im Ausland der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und wurde 1990 in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste berufen. Seine Frau, die Kinderärztin Christine Zenker, die mit ihm schon ins Gymnasium in Brünn gegangen war, hatte er 1953 in der Wiener Hofburgkapelle geheiratet. Günter J. Krejs
Allerdings erhielt sie eine Sondererlaubnis, an Vorträgen teilzunehmen. Die Königlich Kaiserliche Photographische Gesellschaft nahm Dora Kallmus 1905 als erstes weibliches Mitglied auf. Zur weiteren Ausbildung ging sie nach Berlin. Dort stand die künstlerische Fotografie im Vordergrund. Nicola Perscheid bildete Dora in Fotografie, Kopie und Retusche von Jänner bis Mai 1907 aus. Perscheid bezeichnete Kallmus in ihrem Zeugnis „als bisher beste Schülerin“.
1907 erhielt sie in Wien einen Gewerbeschein. Danach richtete sie sich im Wiener Gemeindebezirk 1 Innere Stadt, Wipplingerstraße 24 ein elegantes Atelier ein und legte sich den Künstlernamen Madame d‘ Ora zu. Im Herbst 1907 eröffnete sie zusammen mit Arthur Benda (1885–1969) das Atelier D’ Ora. Durch Ausstellungen, Veröffentlichungen in Zeitschriften und Wer-
beblättern wurde sie auch international sehr bekannt. Sie erhielt kaiserliche Aufträge wie die Krönung Kaiser Karls zum König von Ungarn oder eine Portraitserie der kaiserlichen Familie.
Von 1915 an beschäftigte sie sich intensiv mit dem Thema „Tanz“. Ab 1917 war sie dabei als inländische und internationale Modefotografin mit großem Erfolg tätig. 1919 ließ sich Dora Kallmus in der Evangelischen Pfarre Augsburgischen Bekenntnisses Wien Innere Stadt taufen. 1921 bis 1926 unterhielt sie ein Sommeratelier in Karlsbad. Ab 1925 führte sie auch in Paris ein eigenes Atelier und zog sich 1927 ganz nach Paris zurück, wobei sie ihr Wiener Atelier an Arthur Benda verkaufte. Bis zu ihrer Übersiedlung nach Paris wohnte sie mit ihrer Schwester Anna zusammen.
Nach dem Einmarsch der Nazis in Frankreich 1940 verkaufte sie auch ihr Pariser Atelier und versteckte sich in Südfrankreich in einem Kloster und in einem Bauernhof in der Ardèche. 1946/47 besuchte sie erstmals wieder Österreich und machte Aufnahmen in den Flüchtlingslagern, zum Beispiel von Donauschwaben. Sie verließ erstmals ihr Atelier und machte Aufnahmen vom Elend und der Resignation von Flüchtlingen. 1950 bis 1959 entstanden die schockierenden Pariser Schlachthausbilder, die die Grausamkeit des Massenschlachtens dokumentieren.
Bei einem Unfall 1959 verlor Dora Kallmus ihr Gedächtnis, wurde pflegebedürftig und übersiedelte 1961 wieder nach Österreich. Dort zog sie sich in das nach dem Zweiten Weltkrieg restituierte Haus ihrer Familie in Frohnleiten in der Steiermark zurück und starb dort am 30. Oktober 1963.
Zu ihren Kunden und Kundinnen hatten neben dem österreichischen Kaiserhaus Alma Mahler-Werfel, Alexander Girardi, Marie GutheidSchoder, Adolf Loos, Arthur Schnitzler, Max Reinhardt, Berta Zuckerkandl, Anna Sacher, Gustav Klimt, Emilie Flöge, Karl Kraus, die Schwestern Grete und Elsa Wiesenthal, Tina Blau, Maria Jeritza, Josephine Baker, Maurice Chevalier, Anna Pawlowa, Coco Chanel, Somerset Maugham, Yehudi Menuhin und Marc Chagall gehört.
Ludwig Niestelberger

In Techobusitz kam Margaretha Michels Vater Franz Stiebitz im Juli 1899 zur Welt. Das Dorf liegt im rechtselbischen Teil des Böhmischen Mittelgebirges am Ploschkowitzer Bach. Michel berichtet über ihre Vorfahren.
Franz Stiebitz hatte den Hof, die sogenannte Klügelwirtschaft, von seinen Eltern geerbt, genauer gesagt über die mütterliche Linie. Seine Mutter Frieda Stiebitz, geborene Tanzer, hatte den Hof von ihrem Großvater Franz Brosche übertragen bekommen. Mein Vater baute das Anwesen zur Musterwirtschaft aus und besaß mit Herrn Neumann eine Baumschule. 1931 starb in Groß Tschernosek plötzlich sein Onkel Alfred Stiebitz.
Onkel Alfred hatte den großen Meierhof, der der Familie Schicht aus Aussig gehörte, vor Ort bewirtschaftet. Die in Ringelshain und Aussig ansäßige Unternehmerfamilie Schicht, mit der man befreundet war, trug meinem Vater an, die Pacht in Tschernosek weiterzuführen. Und auch dort baute er einen Musterbetrieb auf.
Zu diesem gehörte eine Abmelkwirtschaft, um die Margarinewerke in Aussig regelmäßig mit der notwendigen Milch zu beliefern. Ich wohnte deshalb zuerst in Groß Tschernosek, nach Kriegsende bei den mütterlichen Großeltern auf der Zahortschmühle bei Werbitz. In Techobusitz residierten nach 1931 die Großeltern Frieda und Julius Stiebitz.
Nun zurück zum eingangs erwähnten Franz Brosche. Dieser war 46 Jahre lang Gemeindevorsteher in Techobusitz. Er stammte aus kleinen Verhältnissen. Er soll auch als Wandermusikant sein Auskommen gesucht haben. Wenn ich schreibe „er soll“‚ so beziehe ich mich auf Bruno Tanzer, den Bruder von Frieda Stiebitz/Tanzer, der um 1965 eine Familienchronik schrieb. Das ist eine dunkle Erinnerung, die auch irrig sein kann, also keinesfalls verbürgt ist.
Bruno Tanzer: „Die Gebetbücher, die Franz Brosche später mit der Hand schrieb und die er um einen Gulden verkaufte, zeigen eine gute, an den Duktus des alternden Goethe erinnern-
Moderne Landwirtschaft und die Ehre eines Offiziers
der er seine Begabung entfalten konnte. Er war vielseitig begabt: Klugheit, Sparsamkeit, Härte, Zähigkeit und Nüchternheit. Wo diese Eigenschaften zusammentreffen, bleibt der Erfolg nicht aus. Und die Erfolge zeigten sich bei Franz Brosche sehr bald. Schon als junger Bauer wurde er Gemeindevorsteher, blieb es 50 Jahre lang und wurde da-
de Handschrift und waren mit bäuerlich-bunten Initialen geschmückt. Brosches Aufstieg begann mit seiner Einheirat in den Techobusitzer Klügelhof, so benannt nach einem früheren Besitzer, durch die Ehe mit der Bauerntochter Theresia Fiedler. Hier gewann er die Plattform, auf
für mit dem Franz-Josefs-Orden ausgezeichnet. Die Wirtschaft wuchs, er stieg in den Hopfenbau und Hopfenhandel ein, wurde Schwiegervater des reichen Hopfenhändlers Leonard Tanzer aus Sangerberg bei Marienbad [des Vaters von Frieda Stiebitz/ Tanzer], baute ein großes Haus


in Leitmeritz [Brosches Gasthof in der Langen Gasse]. Er stattete seine beiden Töchter reichlich aus, kaufte in Sangerberg die Wirtschaft seines Schwiegersohns und hinterließ, als er im Jahre 1897 mit 84 Jahren starb, neben seinem Grund- und Hausbesitz noch ein Barvermögen von fast 100 000 Gulden, was in heutiger [1960] Währung umgerechnet einer guten Million DM entspricht. Er war bekannt für seine Härte. Er war sehr hart und gar kein Gemütsmensch: Der Bruschn-Vata hatte, nachdem er arm wie eine Kirchenmaus in Techobusitz eingeheiratet hatte, nicht nur exzellent gewirtschaftet, sondern vor allem mit den Adeligen vom Schloß Ploschkowitz gute Geschäfte gemacht. Diese waren immer in Geldnot. Durch Geldverleih mit hohen Zinsen verdiente er ein Vermögen.“



Onkel Alfred Storch, der Schwager meines Vaters, weist auf die Landwirtschaft hin. „Der vorzügliche Ackerboden, darunter noch Ausläufer der hervorragenden Schwarzerde des kaiserlichen Gutes Ploschkowitz mit Ackerzahlen [Die Skala mög-
licher Ackerwertzahlen reicht von 1 für sehr schlecht bis 100 für sehr gut.] von 80 bis 100 und das gesegnete Klima des Leitmeritzer Landes, die Zugehörigkeit zum Hopfenanbaugebiet mit anerkannten Spitzenqualitäten und eine bevorzugte Obstlage –früher gab es auch Weinbau –machten Techobusitz zu einem kleinen Paradies und ermöglichten auf dem relativ kleinen Besitz mit etwas mehr als 30 Hektar beinahe den Lebensstandard eines Gutshofes. Der Bruschn-Vata zog sich später mit seiner zweiten Frau in ein ihm gleichfalls gehörendes Haus in Techobusitz, die Schmiede, früher ein Gasthaus, aufs Altenteil zurück.“
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgreich verband. Durch den altösterreichischen Politiker Franz Křepek (1855–1936), einen Freund Tomáš Masaryks und der Stiebitz-Familie, kam Franz in die Politik und wurde Mitglied im deutschen Bund der Landwirte in der Tschechoslowakischen Republik. Er unterstützte Konrad Henlein später maßgeblich –ohne von einem Anschluß an das Reich zu träumen. Er war auch über den Einfluß Adolf Hitlers auf die Sudetendeutsche Partei sehr enttäuscht und versuchte, das Schlimmste zu verhindern. Im Dritten Reich wurde er später Landesbauernführer des Sudetenlandes.
Meines Vaters Schwester Fanny Storch hatte nur freundliche Erinnerungen an ihr Elternhaus und an das in lieblicher landschaftlicher Umgebung gelegene Heimatdörfchen Techobusitz. Dessen fünf stattliche Bauernhöfe und ebenso viele gut gehaltene Kleinbauernstellen bezeugten den Wohlstand seiner Bewohner. Zweifellos hat das Beispiel zeitgemäßer Wirtschaftsmethoden wie Sortenwahl und Fruchtfolgegestaltung zum wirtschaftlichen Fortschritt von Techobusitz maßgeblich beigetragen. Die benachbarte Familie Gärtner wirtschaftete sicher noch besser, was heute noch am prächtigen Haus erkennbar ist. Im Gärtnerhof kauft man immer noch gutes Techobusitzer Obst.

Mein Vater Franz (1899–1945) war nach Aussage seines Schwagers ein echter Stiebitz: klug, praktisch, gebildet und mit leicht ironischem Einschlag. Er besuchte nach dem Abitur an der Leitmeritzer Realschule die Landwirtschaftliche Hochschule in Tetschen-Liebwerth und arbeitete dann auf dem väterlichen Hof in Techobusitz und dem später hinzugepachteten Gut Groß Tschernosek als moderner Landwirt, indem er erprobtes Althergebrachtes mit


Sein Schwager Alfred Storch schrieb in seiner Chronik: „Er war weder ein Fanatiker noch ein Fantast und sah die Dinge, die auf uns zukamen, klar: ,Wenn es schief geht, kostet es den Kopf‘, sagte er einmal. Aber er sah doch nicht ganz richtig, sonst wäre er nach dem Umsturz nicht in der Tschechoslowakei geblieben, im festen Vertrauen auf seine reine Weste. Denn, was hilft die reine Weste: ,Wenn man den Hund prügeln will, findet man schon einen Stecken‘, sagt ein altes Sprichwort. Und die Tschechen fanden einen brauchbaren Stekken. Zwar konnten sie dem Landesbauernführer Franz Stiebitz kein Kriegsverbrechen nachweisen, aber sie warfen ihm vor, daß er dem sudetendeutschen Freikorps angehört und damit als tschechoslowakischer Reserveoffizier – der er nicht war – Fahnenflucht begangen habe. Sie hängten ihn nach einem Scheinprozeß am 12. Dezember 1945. Er hatte sich als ehemaliger österreichischer Offizier geweigert, auf den tschechischen Staat zu schwören und war vom tschechischen Staat zum gemeinen Soldaten degradiert worden. Vielleicht sei noch eine Anmerkung erlaubt. In seiner Zeit als Mitglied des Bundes der Landwirte bemühte er sich intensiv um einen Ausgleich mit den tschechischen Agrariern. Franz Stiebitz sprach nicht nur hervorragend Tschechisch. Beim Schweinschlachten traf man sich auch mit der weiteren tschechischen Verwandtschaft, und beide Seiten waren bestrebt, die Entwicklung des Zusammenlebens zu verbessern.“
Nach dem Krieg habe ich viele Diskussionen in der Familie und mit ehemaligen Gefährten erlebt. Man hatte gerne im alten Österreich gelebt, ohne den Kaiser anzuhimmeln. Mein mütterlicher Großvater Professor Adolf Pokorny sprach immer davon, daß die neue Tschechoslowakische Republik zwischen Rußland und Deutschland zum Spielball werde. Dazu kam die hohe Industriedichte in der Heimat, die dann wirklich den Absatz der erzeugten Waren schier unmöglich machte. Und 1948 arbeitete mein Großvater Pokorny wieder als Dolmetscher für Tschechen, die neuen Emigranten im damaligen München.
Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de










Blick auf den Friedensplatz mit Pestsäule.
� Die Geschichte der nordböhmischen Stadt Deutsch Gabel – Teil VI
Nicht jeder liebt die Habsburger
Im Frühjahr 1426 suchten
18 000 Hussiten das nördliche Böhmen heim, und die rauchenden Ruinen der Städte Weißwasser, Leipa, Niemes und Gabel bezeichneten ihren Weg. In Gabel beraubten und zerstörten sie das Dominikanerkloster und richteten in der ganzen Gegend große Verwüstungen an. Herrndorf wurde noch 90 Jahre später als verwüstetes Dorf bezeichnet.
Im folgenden Jahre 1427 fand Johann von Wartenberg wieder eine Gelegenheit, Zittau mit seinen Landsknechten heimzusuchen. Er war einem Zittauer Juden namens Smuhl Geld schuldig. Da er die bedeutende Summe nicht zahlen wollte, ließ der Jude Tuch pfänden, das dem Wartenberger gehörte. Darüber erzürnt, fiel Johann von Wartenberg sengend und brennend in die Lausitz ein. Die Zittauer überfielen ihn jedoch auf dem Heimweg und nahmen ihm eine große Menge des geraubten Viehs wieder ab.
Als 1428 ein hussitisches Heer unter Führung eines gewissen Kralowetz in die Lausitz zog, war auch Johann von Wartenberg unter ihnen. Er befehligte wie gewöhnlich die Reiterei. Bei diesem Zuge wurde die Gegend um Löbau geplündert und die Stadt selbst belagert. Auf dem Rückzug wurden die Hussiten geschlagen und verloren 600 Mann, 400 Mann wurden gefangengenommen. Am 1. Januar im folgenden Jahr 1429 wurde Löbau eingeäschert. Unter den hussitischen Führern war wieder Johann von Wartenberg mit seinem Sohn Jonas von Ralsco. Im Herbst des selben Jahres belagerte Johann von Wartenberg vergebens den Oybin mit seinem Cölestinerkloster. Von Oybin wegziehend, verwüstete er die Gegend um Zittau.
Dann wandte er sich gegen Görlitz, wo er große Grausamkeiten verübte. Anschließend herrschte einige Jahre Ruhe. 1433 hatte Jonas von Ralsco dem Lausitzer Landvogt Thimo von Kolditz das Schloß Grafenstein bei Grottau um 400 Schock Groschen angeboten. Als dieser jedoch mit den Zittauer Bürgern das Schloß in Besitz nehmen wollte, griffen ihn die im Schloß versteckten Feinde an. Acht Zittauer wurden getötet, 26 gerieten in Gefangenschaft. Diese hinterhältige Tat zu rächen, nahmen die Zittauer den vermeintlichen Urheber Jonas von Ralsco gefangen, und am 21. Dezember 1433 wurde er gevierteilt. Dieses Blutgericht war für das ganze mächtige Geschlecht der Wartenberger der Anlaß zu einem Rachekrieg gegen die Zittauer. Besonders das Haupt des Geschlechtes, Sigmund von Tetschen, und der Vater des Hingerichteten, Johann von Wartenberg, gerieten am meisten in Wut. Bald waren die Dörfer um Zittau in Aschehaufen verwandelt. Der Zittauer Chronist sagt, daß Sigmund von Tetschen von den Burgen Kamnitz und Dewin aus den Lausitzern mehr Schaden zugefügt habe als alle Hussiten zusammen. Da beschlossen die Sechsstädte einen Zug nach Böhmen, um die Landesbeschädiger auf ihren eigenen Burgen aufzusuchen. Dazu ließ man in Breslau eine eigene Kanone gießen. Der Landvogt selbst leitete den Zug. Mit 9000 Mann zu Fuß und zu Pferd überschritt man die Grenze und wandte sich zunächst gegen Tetschen und dann nach Bürgstein. Dort trieb der Raubritter Miksch Panczarz von Schwoika sein Unwesen. Seine Burg wurde zerstört und die umliegenden Teiche abgestochen. Das gleiche Schicksal traf auch das Raubschloß Hohen-
leipa bei Dittersbach sowie die Schlösser Rybnov-Rübenau bei Hohlen, Drum, Kamnitz, Friedewalde, Falkenstein und die Städte Sandau und Kamnitz. Die Burgen Roll und Dewin konnten sie jedoch nicht einnehmen. Dafür verwüsteten sie um Pfingsten 1441 durch 14 Tage die Besitzungen der Wartenberger und zogen dann heim. Durch diesen Einfall zum Frieden gezwungen, verkaufte Johann von Wartenberg an die Sechsstädte die Raubburgen Winterstein und Karlsfried, welche dann zerstört wurden. Die Wartenberger Fehde hatte hiermit ihr Ende erreicht.





Das Geschlecht der Wartenberger war König Georg von Podiebrad (1458–1471) treu ergeben. Im hohen Alter wurde Johann von Wartenberg im Jahre 1462 von König Georg – er war der Führer der Calixtiner, bei seiner Königswahl war er im Geheimen katholisch geworden –zum Landvogt der Oberlausitz ernannt. 1464 starb Johann von Wartenberg und wurde im Barfüßerkloster zu Bautzen begraben.
Der Dreißigjährige Krieg
1618 bis 1648
Mit dem Majestätsbrief von 1609 suchte Kaiser Rudolf II. (1574–1612), der in Prag residierte, die böhmischen protestantischen Stände zu gewinnen. Gewissensfreiheit, freie Religionsausübung und anderes mehr wurden ihnen zugesichert. Da weder Kaiser Rudolf II. noch sein Bruder Kaiser Matt-
hias (1612–1619) leibliche Erben hatten, willigte Matthias ein, daß Erzherzog Ferdinand von Graz König von Böhmen werde.
Im Juni 1617 wurde Ferdinand, nicht ohne Widerspruch einiger böhmischer Barone, vom Prager Landtag als König von Böhmen angenommen. Den Kern der Gesellschaft, der über das Schicksal des Landes entschied, bildeten damals zehn bis zwölf Geschlechter, aufgeteilt in 25 bis 30 Familien, insgesamt rund 1000 Personen. Der neue König Ferdinand unternahm eine Huldigungsreise durch Mähren und Schlesien. Auf seiner Rückreise kam er über Zittau am 8. Oktober 1617 auch nach Gabel. Das Mittagessen nahm er im Gasthaus Zedlitz bei Walten ein.
Die böhmischen Barone waren schon 1614 entschlossen, die Habsburger abzulehnen. Sie boten damals dem Kurfürsten von Sachsen die böhmische Königskrone an. Die Gelegenheit, den Habsburger wieder abzuschütteln, kam bald. Die unterschiedliche Auslegung des Majestätsbriefes war die Ursache. Protestantische Herren hatten in Klostergrab auf dem Grunde, welcher dem Erzbischof gehörte, und in Braunau, das den Benediktinern gehörte, protestantische Kirchen gebaut. Im Auftrag der Regierung wurde die Kirche in Klostergrab niedergerissen und die in Braunau gesperrt. Auf ihre Beschwerde bei König Ferdinand über dieses Vorgehen der Regierung erhielten die böhmischen Stände eine scharfe Rüge zurück.
Die Unzufriedenheit der böhmischen Barone entlud sich am 23. Mai 1618 im Zweiten Prager Fenstersturz. Urheber war Graf Matthias Thurn. Unter ihm drangen bewaffnete protestantische Barone ins königliche Schloß auf dem Hradschin ein und warfen nach alter Sitte, sich mißliebiger Personen zu entledigen, die Statthalter Graf Martinitz und Graf Stavata und den Geheimschreiber Fabricius zum Fenster hinaus in den Schloßgraben. Schüsse wurden ihnen nachgefeuert. Obwohl verletzt, kamen alle drei mit dem Leben davon.
Die Aufständischen bemächtigten sich der königlichen Kammergüter und Einnahmen, setzten Beamte ein und ab, warben Truppen und ernannten 30 Direktoren zur Verwaltung des Königreiches. Am 19. August 1619 setzten die böhmischen Stände König Ferdinand ab und wählten den jungen 23jährigen calvinischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen. Trotz der Warnung seiner Freunde und seines Schwiegervater König Jakob I. von England nahm er die Krone an.
Im nächsten Jahr unternahm auch dieser neue König eine Huldigungsreise nach Mähren, Schlesien und die Lausitz, die damals zum Königreich Böhmen gehörten. Von Zittau aus wollte der König nach Bautzen. Als er aber vernahm, daß die Kaiserlichen Prag bedrohten, änderte er seinen Plan und reiste von Zittau über Gabel nach Süden. Am 12. März 1620 fuhr Friedrich V. in einem roten Wagen durch Gabel. Er selber war auch rot gekleidet, Durch die Königswahl Friedrichs V. hatte sich die Lage so zugespitzt, daß Verhandlungen aussichtslos geworden waren. Von allen Seiten wurde zum Kriege gerüstet.
Der Landvogt der Lausitz, Oberst-Landrichter Graf Joachim Andreas Schlick, Herr auf Passau und Elbogen, war einer der führenden Männer beim Aufstand der böhmischen Barone. Auch Konrad von Dohna, Herr auf Oberwalten, Tölzeldorf und Gabel, war beteiligt. Ferner nahmen von den drei Söhnen des Johann von Dohna, die Herrn auf Umberg, Vladislav und Otto, sowie Hynek von Waldstein, der seit 1619 pfandrechtlicher Mitbesitzer von Lämberg war, am Aufstand gegen Ferdinand II. teil.
Joachim Andreas Schlick verlegte seinen Sitz nach Zittau. Er verlangte, im angrenzenden Böhmen die nötigen Pferde und Fuhrleute in Bereitschaft zu halten. Auch von seinem Schwiegervater, König Jakob I. von England, erhielt Friedrich V. Unterstützung. Englische Soldaten kamen am 7. Juli 1620 nach Gabel. Es waren zehn Fähnlein zu Fuß mit Musketen und langen Spießen. Man mußte ihnen in Gabel Speise und Trank geben: 20 Faß Bier, acht Rinder, Schafe, Hühner, Gänse und viel Brot. Sie hatten ein hitziges Fieber mitgebracht, an dem viele starben. Auch Einheimische ergriff diese ansteckende Krankheit. Viele, besonders Leute in den mittleren Jahren, starben daran. Manche von den Erkrankten wurden wahnsinnig.
Andere Truppendurchzüge, die dem Pfalzgrafen Hilfe brachten, folgten. Am 25. August kamen fünf Fähnlein Fußvolk aus dem Königgrätzer Kreis. Das lose Volk lagerte in der Stadt und auf den Dörfern. Am 23. September erschienen 800 Mann aus dem Saazer Kreis. 500 Mann blieben eine Nacht in Gabel, die anderen lagen in Hermsdorf. Am nächsten Tag zogen sie gen Zittau. Fortsetzung folgt
❯ Gablonz
Ostritzergasse Nr. 615 unter dem Bahnübergang: Die ehemalige Fleischerei Heinrich Patzak.

Historische Bilder von Friedland





Die Schmiede neben dem Schloßteich: In den 1960er Jahren arbeitete hier noch der Hufschmied Josef Jungwirth. Bilder: Stanislav Beran
Eine Bäckerei namens Topf
Jiří Koláček war ein Landwirt und trainierte Pferde, später arbeitete er in einem Kunstatelier, nun ist er ein erfolgreicher Bäkker.
Das ist ganz einfach passiert.
Ich wollte ein Brot kaufen, das ich als Kind bei meinem Großvater gegessen hatte, aber ich konnte es nirgends finden“, erinnert sich Koláček. Er fing also an, das Brot selbst zu backen, monatelang experimentierte er. Zuerst buk er für seine Familie, dann für Freunde und Nachbarn. Heute ist er in der ganzen Tschechischen Republik bekannt, und auch in Deutschland blüht sein Geschäft. „Es ist nichts Kompliziertes. Qualität und Handwerkskunst sind für uns heilig, und die Deutschen wissen das zu schätzen, oft sogar mehr als unsere Leute“, erklärt der Bäcker.
Vor acht Jahren weckten alte Fotos mit seinem Großvater die Erinnerung an das alte gute Brot bei ihm. Er dachte bei den Bildern gleich an den Geschmack und den Geruch des Roggenbrotes. Er nahm seine Tochter Michaela in die Leitung der neuen Bäckerfirma Koláčkova pekárna (Koláčeks Bäckerei) auf.
Im ersten Jahr arbeiteten drei Leute in der Bäckerei. Heute hat sie rund 30 Mitarbeiter und macht einen Jahresumsatz von umgerechnet 1,2 Millionen Euro. Koláčeks backen täglich rund 2000 Brote, die sie selbst in der gesamten Tschechischen Republik und dreimal wöchentlich an Geschäfte von Zittau bis Dresden liefern. Auch Koláčeks Tochter ist keine gelernte Bäckerin. Zum Backen brachte sie, genau wie ihren Vater, die Leidenschaft für gute Lebensmittel und feines Essen. Sie lebte ursprünglich in Prag, wo sie obdachlosen Frauen half, ein neues und besseres Leben zu starten. Sie brachte ihnen zum Beispiel bei, wie man einkauft, einen Haushalt führt, kocht und backt und vor allem, wie man seine Arbeit verkauft. Alle diese Dinge waren in der
❯ Ausflug ins Isergebirge
Bäckerei Koláček von großem Nutzen. Im Familienunternehmen ist Michaela für die Konditorei und für das vor zwei Jahren eröffnete Bistro
Hrnec (Topf) an der Rooseveltova, der nach dem USA-Präsidenten
Franklin Delano Roosevelt benannten Straße, in Gablonz verantwortlich. Ihr Vater kümmert sich um das Brot und die Bäckerei, die ihren Sitz in einer ehemaligen Teppichspinnerei in Johannesberg hat.



Mittlerweile bietet die Bäckerei nicht nur Roggenbrot, sondern auch glutenfreie Ware. Die meisten Produkte werden in Bio-
keine gefrorenen Halbfabrikate“, erklärt Michaela. „Am Anfang haben wir Mehl im gewöhnlichen Laden gekauft, schon da konnte man einen großen Unterschied beobachten“, betont sie. Koláčeks beziehen ihr Getreide nun direkt vom Bauern und lassen es in einer nahen Familienmühle mahlen.
„Dank dessen wissen wir, daß das Mehl nicht vermischt und chemisch behandelt wurde“, sagt der Bäcker.
Das Interesse der Deutschen testete die Isergebirgsbäckerei zum ersten Mal bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin schon vor Jahren. Ihr erster und
Online-Supermarkt Knuspr in München“, erzählt Koláček. Für ihn besteht kein Unterschied, ob er das Brot nach Prag und Brünn liefert oder nach Herrnhut und München.
Was den Geschmack betreffe, gäben die Deutschen weniger Kümmel ins Brot, so Koláček. Neben Brot sei bei den Deutschen auch süße Backware, vor allem Kuchen mit Quark und Mohn, sehr beliebt. Zur Zeit hat die tschechische Bäckerei schon einen eigenen Handelsvertreter im Dreiländereck und plant, dort auch eine GmbH zu gründen. Der Hauptgrund dazu ist, daß einige deutsche Kunden lokale Produzenten bevorzugen. „Die Bürokratie dort ist vielleicht noch schlimmer als in der Tschechischen Republik. Für jedes Papier braucht man etwa 30 Stempel“, scherzt Koláček.
Manche Dinge funktionierten hinter der Grenze, also in Deutschland, wieder einfacher. Vor allem, wenn man etwas mündlich vereinbare, gelte das auch immer. Und während in der Tschechischen Republik die Meinung weit verbreitet sei, daß Bioprodukte im Grunde genommen nur ein Betrug seien, um den Leuten mehr Geld aus den Taschen zu holen, brauche man dem deutschen Kunden die BioPhilosophie nicht zu erklären. „Das Reformhaus verbreitet sie seit 1932“, bemerkt Koláček.
Helga Haller, gebürtige Laipaerin und Obfrau der Passauer SL, mit Tomáš Cidlina 2021 in Passau. Rechts und links Prospekt der zweisprachigen Cidlina-Ausstellung über vertriebene Böhmisch Laipaer.

Im Herbst erschien das Buch „Leipsche“ in deutscher Übersetztung. Leipsche ist ein Buch der Erinnerung – aber nicht nur das.
Qualität gebacken, insbesondere für den deutschen Markt. Kolačeks stellen zucker-, laktose- und glutenfreie Süßwaren her. „Wir backen hauptsächlich mit glutenfreien Zutaten, verwenden Bio-Buchweizen anstelle von Weißmehl, süßen mit Datteln und verwenden 100 Prozent frischen Apfelsaft anstatt Milch. Keine chemischen Mischungen,


bis heute zufriedener ständiger Kunde ist das Reformhaus Paul im sächsischen Zittau. Die dortige Industrie- und Handelskammer (IHK) half maßgeblich, neue Kontakte zu knüpfen. Auf der Liste der zwei Dutzend Verkäufer, die regelmäßig beliefert werden, stehen auch zwei Rewe-Kaufhäuser in Dresden. „Jetzt verhandeln wir mit Aldi und auch mit dem
Die Lieferungen nach Deutschland betrügen etwa fünf Prozent des Produktionsvolumens, aber rund 80 Prozent der Backzutaten stammten aus Deutschland – vor allem Biomehl, Öle oder Getreide. „Der Preis, aber vor allem die Qualität, ist halt besser“, erklärt Bäcker Koláček. Er bemühe sich immer, mit den Endkunden engen Kontakt zu halten und zu pflegen. „Wir wissen, was und aus welchen Zutaten wir backen, und unsere Kunden können sich auf uns verlassen.“ Das Vertrauen der Kunden sei ihm sehr wichtig und öffne auch neue Türen. Petra Laurin
Räuberhöhle bei Raspenau

In einem Dickicht verborgen diente eine Höhle einst Peter Vorbach, dem berüchtigten Räuber des Isergebirges, als Versteck, in dem er auch seine Beute hortete.
Der legendäre Wegelagerer trieb im 15. Jahrhundert sein Unwesen in den tiefen Wäldern des Hemmrichsattels, wo seit dem Mittelalter die Handelsroute von Böhmen nach Sachsen verlief. Vorbachs Leben endete im November 1470 am Galgen in Görlitz.
Die Räuberhöhle kann heute noch besichtigt werden, allerdings ist es nicht so einfach, sie zu finden. Abseits der Touristenpfade, rund 1,5 Kilometer nördlich von Hemmrich befindet sich im Granitfelsen an der Raspenauer Seite des
Nesselberges ein enger Korridor, der in einer niedrigen Öffnung mündet.
Der Gang von zwei Metern Länge und kaum einem Meter Höhe verbirgt sich im dichten Gebüsch zwischen Felsblökken. Die Höhle ist sieben Meter lang, 2,5 Meter
breit und zwei Meter hoch. „Die Region Friedland wurde bis heute kaum für den Tourismus erschlossen. Um so interessanter ist sie für diejenigen, die für ihre Ausflüge eine ruhige Gegend jenseits der Touristenströme suchen. Nur von Raspenau oder Haindorf bietet sich dem Betrachter ein imposanter Ausblick, der das Isergebirge wie eine riesige Gebirgskette erscheinen läßt“, sagt Květa Vinklátová, Reichenbergs Regionalbeauftragte für Kultur, Denkmalschutz und Tourismus. Petra Laurin
Tomáš Cidlina, der Verfasser von „Leipsche“, dem gebräuchlichen sudetendeutschen Namen von Böhmisch Leipa, ist mir leider nicht bekannt, obwohl unser sudetendeutscher Heimatkreis Düsseldorf schon zweimal im Nachbarort Reichstadt (Zákupy) und in Haida und Hirschberg zu Besuch war.
Aus Reichstadt sandte mir der dortige Museumsleiter Zdeněk Rydygr nun die deutsche Ausgabe dieser Heimatgeschichte zu. Sie ist eine beeindruckende Veröffentlichung des Leipaer Historikers und Museumsleiters Tomáš Cidlina. Der weiß sich nämlich nicht nur der Stadtgeschichte, sondern auch den aus dieser Stadt 1945/1946 vom tschechoslowakischen Edvard-Beneš-Regime vertriebenen Sudetendeutschen verpflichtet.
ausführlichen Überblick über die Entwicklung des Ortes bis in die Nachkriegszeit der Jahre 1945/1947, stets in Verbindung mit den allgemeinen deutsch-sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen von 1918/1938/1939. Die Vertreibung von 5000 Menschen auf einem Fußmarsch nach Sachsen am 15. Juni 1945 wird ohne Beschönigung berichtet.

Tomáš Cidlina: „Leipsche“, deutsch von Alois Hartl. Verlag Voda na mlýn, Böhmisch Leipa 2022, 408 Seiten, 20 Euro. (ISBN: 978-80-9082644-1)







1930 hatte die Stadt 13 715 Einwohner, davon 78 Prozent deutsche und 22 Prozent tschechische Bürger. Ihre alte Geschichte ist mit den Adelsfamilien der Leipa, Berka von Duba, Waldstein, Kaunitz und anderen verknüpft. Sie war über die Jahrhunderte deutsch und katholisch. Cidlina gibt zunächst einen
„Der Schmerz über den Verlust der Heimat ist für uns heute unvorstellbar“, lautet dazu eine Bewertung. Der Autor bleibt aber dabei nicht stehen. In ausführlichen Lebensgeschichten wird das Schicksal von acht Frauen und Männern berichtet, die er persönlich gesprochen hat oder besuchen konnte. Alte und neue Fotos und Dokumente veranschaulichen die wechselvollen Erlebnisse dieser sudetendeutschen Vertriebenen aus Böhmisch Leipa. Das sind Beispiele für die millionenfache Vertreibung aus dem Sudetenland und die Zerstreuung in den verbliebenen deutschen Gebieten. Man kann nur hoffen, daß die tschechische Ausgabe viele Bewohner von Böhmisch Leipa (Ĉeska Lipa) und darüber hinaus erreicht. Er widmet seine Publikation den „Vertriebenen und denen, die vertrieben werden“. Das ist auch im Jahr 2023 von höchster Aktualität. Rüdiger Goldmann
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau





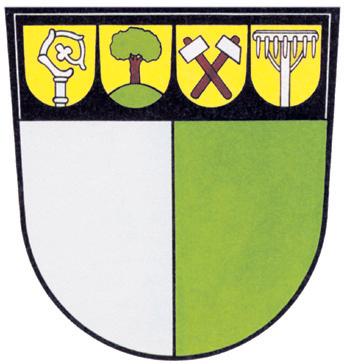


 Dux Ossegg
Dux Ossegg
Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Walter Kolarz aus Teplitz-Schönau

Vergessener Rußlandexperte
Der Kirchenhistoriker Professor Rudolf Grulich erinnert an Walter Kolarz, einen vergessenen Rußlandexperten aus Teplitz.
Der nun schon ein Jahr dauernde Krieg Moskaus gegen die Ukraine ist eine Tragödie und um so schmerzhafter auch das Fehlen eines brillanten Fachmanns wie des aus Nordböhmen stammenden Walter Kolarz. Auf der Münchener Sicherheitskonferenz bezeichnete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Wladimir Putins Verbrechen als neokolonialistischen Angriffskrieg. Walter Kolarz hatte bereits 1952 sein Werk über den Völkermord der Sowjetunion „Rußland und seine Kolonien“ betitelt.
Obwohl er bis heute nicht übertroffene Standard-Werke geschrieben hatte, die in verschiedene Sprachen übersetzt wurden, ist Walter Kolarz nach seinem frühen Tod fast vergessen. Dabei ist aber seine Darstellung der nationalen und religiösen Vielfalt in der alten Sowjetunion immer noch unumgänglich, um Konfliktherde und Auseinandersetzungen ethnischer und religiöser Gruppen in den Nachfolgestaaten der UdSSR zu verstehen.
Walter Kolarz wurde 1912 im nordböhmischen Kurort Teplitz-Schönau geboren, „in einer Kleinstadt, die durch ihre Heilquellen auch Goethe, Beethoven und österreichische Kaiserinnen angezogen hatte und in der ein beispielhaftes kulturelles Leben herrschte, ja die eine der geistig lebendigsten Städte unserer Heimat“ war, schrieb Emil Franzel. Sein Vater war städtischer Kurdirektor, die Mutter stammte aus einer jüdischen Familie.

Nach dem Besuch des Gymnasiums in seiner Vaterstadt studierte Kolarz in Prag an der Freien Schule für Politische Wissenschaften, an der auch Erich Franzel lehrte. Schon früh hatte sich Kolarz in der sozialistischen Jugend engagiert, da für ihn als getaufter Halbjude die Partei zu jener Zeit eine Art ErsatzKirche war. Später fand er seine geistige Heimat in der katholischen Kirche.
Als er 1958 bei der Jahresversammlung des Sudetendeutschen Priesterwerks in Königstein referierte, überließ er Prälat Adolf ein Manuskript über seinen religiösen Werdegang, das nach seinem Tod veröffentlicht wurde und das mit der Einleitung von Emil Franzel eine
aufschlußreiche Analyse des sudetendeutschen Katholizismus ist.
1934 ging Kolarz als Zeitungskorrespondent nach Berlin, von wo er aber schon 1936 ausgewiesen wurde. Im selben Jahr ließ er sich in Paris nieder, wo er eine Russin heiratete. 1939 ging er nach London, wo er für die Osteuropa-Abteilung der British Broadcasting Corporation (BBC) arbeitete, seit 1949 als Abteilungsleiter. In seiner Pariser Zeit war er ausländischer Korrespondent in Spanien und begann dort bereits am Sinn des Bürgerkrieges als einer sozialistischen Revolution zu zweifeln. Deshalb erforschte er das Land, in dem der marxistischleninistische Kommunismus bereits herrschte: die Sowjetunion. Es entstanden, zunächst auf Deutsch, Bücher wie „Stalin und das Ewige Rußland“, die ins Englische übersetzt wurden.
Eines seiner Standardwerke, „Russia and her Colonies“, erschien 1952 auf Englisch und erst vier Jahre später in deutscher Übersetzung mit einem abgeschwächten Titel „Die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion“. Es ist wie sein Buch „Religion in the Sovietunion“, das erst nach seinem Tode auf Deutsch erschien, bis heute unübertroffen. Akribisch, aber lebendig und lesbar, informiert Kolarz in beiden Büchern buchstäblich auch über die kleinsten ethnischen und religiösen Gruppen und zeigt die sowjetische Taktik des „Divide et impera“, um den Klassenfeind, die Religion, ja alle „Gegner“ zu überwinden.


Kolarz starb erst 50jährig 1962 in London. Posthum erschien „Religion und Communism in Africa“. Nachrufe auf ihn erschienen unter anderem in „The Times“, „The Guardian“ und „Catholic Herald“; in Deutschland in „Die Brücke“; „Volksbote“, „Sudetendeutscher Artikeldienst“, „Sudetenland“ und „Sudetenjahrbuch“.

2012 wurde er anläßlich seines 100. Geburtstages in den „Ostdeutschen Gedenktagen“ gewürdigt.
Zu seinem posthum erschienenen
Bekenntnis „Mein religiöser Werdegang“ im ersten Band des Archivs für Kirchengeschichte von BöhmenMähren-Schlesien schrieb Emil Franzel

1965 eine Einleitung, die heute noch lesenswert ist, um den sudetendeutschen Katholizismus und die historisch geprägte Religion Böhmens zu verstehen.
❯ Teplitz

Abenteuerliche Bäderreise
1859 erschien das Büchlein „Schultze und Müller in Teplitz. Eine abenteuerliche Bäderreise“ mit 40 Illustrationen des Schriftstellers, Malers, Zeichners und Karikatu-








Von Aussig nach Teplitz
Schultze. Na, da seh mal an, Müller. Eene Maschine von vier Eselkraft, des is merkwürdig. (Zum Conducteur) Sie, wozu is denn des eigentlich?
Conducteur. Schauns‘, wir fahren von hier aus fast immer bergan, und da müssen wir Vorspann haben. Es geht freilich langsam, aber herunter gehts noch langsamer. Schultze. Ja warum denn?
Conducteur. Weil dann der Zug sonst leicht ins Laufen kommt, und in Bodenbach statt in Aussig anhalten könnte. Schultze. Na, nur kenne Übereilung, is ne jute alte Regel.
Ein Bauer am Weg. Herr Conducteur, ‘s ham sich eben e paar hinten druf gesetzt. Conducteur. Wollt ihr runter ihr Spitzbuben, alle Tage setzt ihr euch hinten drauf. Nich einmal sonntags nehmt ihr ein Billet. Rrrrrunter sag ich. Nu wart.
(Er holt eine Peitsche vom Wagen und läuft hinter. Die blinden Passagiere springen herab, laufen eine Strecke hinterher und setzen sich wieder auf, sowie der Conducteur im Waggon ist.)
(Ein Bauer, der nebenher geht, pocht ans Fenster und bittet Schultze um ein bißchen Feuer, was er erhält.)
Conducteur. Nun, lieber Freund, wollen Sie vielleicht einsteigen?
Der Bauer. Nee, mei guter Herr Conducteur, ‘s thut mer leid, aber ich muß halt um Viere in Teplitz sein, un Sie kommen erst um Fünfe hin. Ich will immer vorausgehen. Ham se vielleicht was zu bestellen?
Conducteur. Danke! Es ist ein Kreuz mit der Strecke, meine Herren. Alles setzt sich hinten drauf oder läuft vorne weg.
risten Carl August Reinhardt (1818–1877) im Berliner Verlag U. Hofmann und Companie. Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek, der das alte Büchlein besitzt, wählte zur Ver-
Schultze. Sagen Sie mal, was sind denn das für eine Menge Kreuze und Gedenksteine, die hier längs der Eisenbahn stehen? War hier ein Kirchhof?
Conducteur. Ach nein. Das sind bloß Andenken und Votivtafeln an die Actionäre dieser Bahn, die hier zu Grunde gegangen sind. Die Strekke zwischen hier und Aussig ist nun einmal verhängnisvoll. Erst mußten die Leute im Stellwagen ersticken, und nun müssen sie an den Actien draufgehen. Es sind gerade jetzt viele zu haben. Wollen Sie welche? Ich kann Ihnen das Stück mit 15 Kreuzer ablassen.
Schultze. Danke! Wir machen seit Cosel-Oberberg nicht mehr in Actien.
Conducteur. Na um den Preis können Sie noch mal drin machen.
Müller. Wenn Sie drei Gulden zugeben, nehm‘ ich zehn Stück. Conducteur. Na, damit nur einmal wieder jemand „nimmt“. Hier. (Er gibt zehn Actien und drei Gulden.)

öffentlichung im Heimatruf die zwei Kapitel „Von Aussig nach Teplitz“ und „Schultze und Müller vor dem Teplitzer Bahnhof“ aus.
Schultze. O Weh, Müller, Du bist doch jemacht. Fünf Gulden hättst Du rauskriegen müssen, wie sie jetzt stehen.
Conducteur. Na, der Cours bessert sich vielleicht bald, denn übermorgen wollen drei russische Fürsten erster Klasse fahren. – Teplitz, meine Herren!
Schultze und Müller vor dem Teplitzer Bahnhof
Schultze. Droschke! Droschke!
Alles sieht ihn verwundert an. Einer fragt ihn: „Rosumisch bobolski?“
Schultze. Ach Unsinn! Ne Droschke will ick haben.
Teplitzer. Ach so! Ich dachte, sie sprächen Russisch und wären Russen. Was ist denn das, ene Droschke?
Schultze. O Du jerechter, is denn hier schon alles stockböhmisch? Ne Droschke is en Pferd mit en Wagen hinten dran!
Teplitzer. Ach Herr Jes‘, enen Eenspenner ment er. Hee, Eenspenner, hier her! E paar Badegäste!
Der Einspänner kommt angefahren. „Wollen die Herren nach der Stadt?“
Schultze. Ja! Hier im Bahnhof gedenken wir nicht zu bleiben. Was kost es denn?
Kutscher. Mit den Gebäcke
da? (Er sieht sich vorsichtig um und sagt dann leise) Vier Gulden. Müller. Was! Kreuzhimmelmohrenschocksteinkohlen Donnerwetter, Du Halunke, siehst Du uns etwa für Potsdamer an? Wo ist die Polizei?
Schultze. Ja, Polizei – Polizei!!!

Kutscher (bittend). Ach um Jeses Gotteswillen, meine guten Herrchens, ich hatte ja bloß e Späßchen gemacht, ich fahre se vor 36 Kreuzer, wo Sie hinwollen. Schultze. Aha! Also is die Taxe wahrscheinlich 24 Kreuzer.
Kutscher. Na, wo wollen Sie denn hin?
Schultze guckt Müllern verblüfft an. Ja, wo wollen mer denn hin?
Müller. Na, nach Teplitz. Schultze. Ja, wir können doch nich in janz Teplitz uf enmal wohnen, Dämelsack.
Ein Kellner. Vielleicht Stadt London, meine Herren? Schultze. Richtig, da wollte ja och Naplejon der Onkel wohnen, er kam aber nich hin. Also Stadt London.
Kellner. Dann bemühen Sie sich nur erjebenst in diesen Omnibus hier, der von London extra rausgeschickt wird.
Schultze und Müller steigen ein. Der einspännige Kutscher schwer aufatmend: „Das waren gewiß e paar Berliner!!!“
Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergFÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ HEIMATBOTE

Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ WottawaDer hussitische Dorfrichter
Folgende Sage rankt sich um den hussitischen Dorfrichter von Wottawa.
❯ Gerti Schubert-Ubl: „Tief drin im Böhmerwald, Ronsperg, da liegt mein Heimatort“ – Teil IV und Schluß
Ich hätte noch so viele Fragen





Ronspergs Ortsbetreuerin Gertrud Schubert/Ubl schrieb ihre Erinnerungen an Flucht und Neuanfang nieder und ließ sie als kleines Heft für ihre Familie und Landsleute drucken, das im Februar 2012 erschien. Der Heimatbote veröffentlicht mit ihrer freundlichen Genehmigung das Kapitel „Die Flucht“ in mehreren Folgen.
Im Hause Denkmayr, so hieß meine Tante mit Nachnamen, erlebte ich eine schöne Zeit. Da ich nicht viel zum Anziehen hatte, sorgte meine Tante dafür. Sie führte in ihrem Geschäft Stoffe. Anni, meine neue Freundin, lernte Schneiderin, und so saßen wir oft zusammen und nähten uns etwas. Wenn es möglich war, das gleiche. Dirndl waren sehr gefragt. Aus einer karierten Decke bekam ich einen Wintermantel, denn es war inzwischen kalt geworden, und es ging auf Weihnachten zu. Tante versuchte alles, mir in dieser schweren Zeit zu helfen. Doch am Heiligen Abend, als alle mit ihren Geschenken beschäftigt waren, verschwand ich bei Käthe auf dem Hof und weinte bitterlich. Tante suchte mich, und als sie mich fand, weinten wir zusammen. Das waren die traurigsten Weihnachten meines Lebens.
Bei meinem Transport war auch ein Geschwisterpaar aus Ronsperg dabei, Karl und Mizzi Kohout. Sie hatten keine Verwandten in Österreich. Sie verließen die Heimat, weil die Tschechen sie von ihren Eltern und ihrem Hof fortholen wollten. Zufällig wurden im Ebelsberger Schloß eine Küchenhilfe und ein Helfer für Feldarbeit gesucht. Tante hatte gute Beziehungen zum Baron und vermittelte sie. Die beiden waren glücklich, eine Unterkunft und Arbeit zu haben, und waren Tante dankbar.
So waren wir also zu dritt aus Ronsperg in Ebelsberg. Karl und Mizzi waren fleißig und wurden gut aufgenommen. Ich traf mich öfter mit ihnen im Schloß, da dort die Schwägerin meiner Tante mit ihren zwei Jungens, Heri und Franzi, etwa in meinem Alter, wohnte. Wir hatten uns schon häufig in den Ferien gesehen. So vergingen die Monate. Es wurde Frühling, der Sommer kam. Aber die Ungewißheit über die Eltern und die Großmutter, die allein zurückgeblieben war, wich nicht. Großmutters Mutter,
sie war wohl so um die 90 Jahre alt, hatten die Tschechen zusammen mit einigen anderen Leuten ins Altersheim gesteckt. Man hörte bald nichts mehr von ihnen.
Der Juli 1946 kam. Ich erhielt eine Ansichtskarte aus Wertheim am Main in Baden. Ich war verwundert darüber, Wertheim hatte ich schon mal in der Schule gehört, in Erdkunde, aber wer sollte mir von da schreiben?
Die Karte trug die Handschrift meines Vaters und war das erste Lebenszeichen meiner Eltern nach 13 Monaten in Gefangenschaft. Tantes Adresse kannten sie ja, und ich kann mir vorstellen, wie groß ihre Hoffnung war, daß ich bei ihr bin. Am liebsten wäre ich gleich nach Wertheim gefahren, ich konnte mir ja nicht vorstellen, unter welchen Einschränkungen sie dort lebten.
Meine Eltern waren mit Groß-
erzählen. Das konnte sie besonders gut, auch schon, als ich noch klein war.
Für mich kamen die zweiten Weihnachten, die ich ohne meine Eltern verbrachte, und ich wollte dann doch zu ihnen. Im Januar 1947 war es wieder ein Transport, der mich von Linz-Ebelsberg nach Deutschland brachte. Der Winter war sehr kalt, der kleine Kanonenofen im Viehwaggon schaffte es nicht, gegen die eisige Kälte anzukämpfen. Wir waren zwar in Linz mit Lebensmitteln versorgt worden. Auch Tante hatte mir allerhand mitgegeben, aber Brot, Wurst und alles andere war steinhart gefroren.
Wir fuhren wohl zügig nach Frankfurt am Main durch. Ich war mit meinen 16 Jahren laut Ausweis als Krankenschwester eingesetzt. Warum? Wieso? Ich fragte Tante, die alles organisiert hatte, nie danach. Heute kann sie mir nicht mehr antworten.
erst jetzt klar. Ein stiller Ruf nach meiner Mutter brachte wie ein Wunder den Zug in Bewegung. Eiligst warfen wir das Gepäck aus dem Zug, sprangen hinterher und sahen dem rollenden Zug nach. Da standen wir nun wieder in der Eiseskälte und warteten auf den Anschlußzug nach Wertheim. Beim Schaffner erfuhren wir, daß wir in Kreuzwertheim ankämen, da die Eisenbahnbrükke nach Wertheim gesprengt worden sei. Doch dank der eisigen Temperaturen sei der Main zugefroren, und man könne über das Eis nach Wertheim gehen. Und so war es dann auch. Sogar mit unserem ganzen Gepäck trug uns das Eis.
mutter und anderen Vertriebenen in einem Transport nach Deutschland gekommen. Der Transport hatte die Bevölkerung von Ronsperg aufgenommen, war dann über Taus gefahren, um dort die Gefangenen aus dem Internierungslager Chrastawitz dazuzuladen. Ursprünglich sollten die Leute in die Ulmer Gegend in Bayersich-Schwaben kommen, wurden dann aber nach Gerlachsheim gebracht und von dort in die umliegenden Orte verteilt.
Mein Vater hatte sich für Wertheim interessiert, und viele Ronsperger schlossen sich ihm an. Ihre erste Unterkunft war der Reinhardshof in Wertheim. Die Zeit muß schlimm gewesen sein. Die Räume waren vollgestopft mit Menschen, das Essen war knapp, man kochte im Freien. Aber die Vertriebenen waren wieder freie Menschen, befreit von den Schikanen der Tschechen.
Nach und nach verteilte man die Neulinge in Wertheim. Meine Eltern bekamen mit Großmutter ein Zimmer von rund 18 Quadratmetern bei Familie Eitel zugewiesen. Die Familie Eitel nahm sie gut auf und war froh, eine Großmutter für ihre beiden kleinen Kinder zu haben. Sie hatte viel Zeit, mit ihnen zu spielen und ihnen Geschichten zu

Da der Transport vorerst in ein Auffanglager zur Ungezieferbeseitigung kommen sollte, setzte ich mich mit meinem Gepäck vom Transport ab. Ich wollte doch zu meinen Eltern. Da stand ich nun mutterseelenallein auf dem Bahnhof, umringt von meinem vielen Gepäck. Eine große Zieharmonika hatte ich auch dabei. Herta hatte sie von Wien nach Linz gebracht, damit ihr Bruder Edi bei einer Musikkapelle in Wertheim Geld verdienen kann.
Ein Mann sah mich hilflos herumstehen und fragte, wohin ich wolle. Wertheim war ihm nicht unbekannt, und er bot an, mich zu meinen Eltern zu bringen. Ich war sehr froh über die Hilfsbereitschaft, alleine hätte ich es mit dem vielen Gepäck wohl nicht geschafft, in die überfüllten Züge zu kommen. Streckenweise war das Bremshaus unser Zugabteil, wo dann das Gepäck blieb? Ich weiß es nicht mehr.
Jedenfalls kamen wir nach Mitternacht in Lohr am Main an, von wo der Anschlußzug nach Wertheim erst später gehen sollte. Es war eiskalt, ein leerer Zug stand am Bahnsteig. Nach Auskunft eines Bahnangestellten sollte der Zug erst am frühen Morgen weiterfahren. Wir waren recht froh darüber, verstauten mein Gepäck und freuten uns auf einen Sitzplatz, wenn auch in einem ungeheizten Waggon.

Daß mich der Unbekannte nicht ohne Absicht nach Wertheim bringen wollte, wurde mir
In Wertheim fragten wir nach der Hämmelsgasse, der neuen Unterkunft meiner Eltern. Es war morgens halb fünf Uhr früh, als ich an der Haustür klingelte. Frau Eitel, die Hausbesitzerin, öffnete, sah mich erstaunt an und führte mich zu dem Zimmerchen meiner Eltern. Nur Großmutter war da, sprachlos, mich mit einem Fremden zu sehen. Meine Eltern waren schon früh aufgestanden, um die gesammelten Bucheckern gegen Öl in der Mühle Reicholzheim einzutauschen. Ihr Erstaunen und ihre Freude waren riesig, mich endlich wiederzuhaben, trotz aller Not. Der Fremde bekam Geld für seine Hilfe und Rückreise. Von ihm habe ich nie wieder etwas gehört.
Herta kam später aus Wien zu ihren Eltern nach Wertheim. Die hatten nämlich ebenfalls hier ein neues Zuhause gefunden.
Die Erzählungen meiner Eltern vom Gefängnis waren sehr spährlich, als sie merkten, wie sie mich belasteten. Ich fing immer an zu weinen. Nur mein Vater wollte, daß die Greueltaten, die den Männern angetan worden waren, nicht vergessen werden. Er wollte, daß ich sie weitererzähle. Er erlebte sie oft und überlebte sie Gott sei Dank.
Das Schlimmste außer Hunger war, daß sie sich im Winter in Reihen nackt aufstellen mußten. Dann kamen die Pferdeschlächter, wie sie von den Gefangenen genannt wurden, zählten ab, um jeden Vierten oder Fünften, je nach Laune, niederzumetzeln. Mit Bayonetten schlitzten sie die Körper auf, schreiend und blutend mußten ihre stehen gebliebenen Kameraden sie auf Lastwagen verladen. Mein Vater sagte, er höre die Schreie noch immer.
Es gäbe noch manches aus dem Lager zu berichten von Hunger, Schlägen, Vergewaltigungen. Aber ich möchte damit Schluß machen. Vielleicht lesen meine Kinder oder Enkel einmal diese Seiten und sagen wie ich heute: „Ich hätte noch so viele Fragen.“
Mitte des 15. Jahrhunderts ritt der hussitische Dorfrichter von Wottawa über die nahe Landesgrenze nach Neukirchen, um dort seine Geschäfte zu besorgen. Angeheitert begab er sich abends auf den Heimweg. Sein Weg führte ihn an einer Waldkapelle mit einem Marienbild vorbei. Als der Hussite das Bild sah, errötete er vor Haß, stieg vom Roß, band es an einen Baum und stürmte in die Kapelle. Hier sprach er die Mariestatue an und begehrte Antwort. Da diese nicht erfolgte, riß er das stumme Bild vom Altar und schleuderte es in den nahen Brunnen. Beim Besteigen des Rosses gewahrte der Hussite die Statue an der selben Stelle auf dem Altar. Wutentbrannt warf er sie abermals in den Brunnen, dessen Wasser von da an als heilsam erkannt wurde. Nun lenkte er seine Schritte wieder in die Kapelle und sah die Statue erneut an der alten Stelle. Ergrimmt riß er sie nochmal herunter und spaltete mit seinem Schwert die gleißende Krone und das Haupt Mariens bis tief in die Stirn zum rechten Auge. Sogleich rann rotes, frisches Blut über Stirn und Wan-
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 BIS28MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3.






gen der Statue. Der rohe Richter versuchte vergeblich das Blut abzuwischen. Noch heute zeigt man den Pilgern in der Klosterkirche zu Heiligenkreuz das zerspaltete Gesicht Mariens. Von unbändiger Angst erfaßt, versuchte der hussitische Richter zu fliehen, aber sein Roß bäumte sich auf und wich nicht von der Stelle. Rasch sprang der Hussite aus dem Sattel und zog an den Zügeln, um vorwärts zu kommen. Doch das Tier war wie an den Boden gefesselt. Nun wollte der Richter allein die Flucht ergreifen, aber er vermochte kein Glied zu rühren und fühlte sich wie versteinert. Er entkam auch nicht, nachdem er die Hufeisen des Rosses entfernt hatte. Wieder in die Kapelle schreitend, brachen beim Anlitz der blutenden Wunde sein hartes Herz und Gemüt. Knieend flehte er zu Gott. Am nächsten Tag sahen zwei des Weges reitende Männer das unbeschlagene Roß und fanden in der Kapelle vor der blutenden Statue den auf dem Boden liegenden Mann. Die beiden Männer fragten nach seinem Anliegen, und als er zitternd seine ruchlose Rohheit gebeichtet hatte, konnte er reitend seine Heimat wieder erreichen. Bei Gericht gestand er seinen Frevel und wurde ein eifriger Christ.
Ritter sind keine Prinzen
Zu dem Artikel „Neue Prinzen und neuer Kinderdrache“ über den diesjährigen Drachenstich in Furth im Wald (➝ HB 8/2023)


Gerade lese ich den Heimatboten und muß einen gravierenden Fehler feststellen! Es gibt zwar in Furth viele Prinzen oder solche, die sich dafür halten, aber beim
Im März gratulieren wir folgenden Abonnenten des Bischofteinitzer Heimatboten zum Geburtstag und wünschen Gesundheit und Gottes Segen:
■ Heiligenkreuz, Haselberg. Am 2. Maria Egl (Binna), 90 Jahre, und am 13. Eduard Brix (Brix‘n), 89 Jahre. Peter Gaag Ortsbetreuer
Drachenstich gibt es keine Prinzen beziehungsweise kein Prinzenpaar, sondern ein Ritterpaar. Renate Breu Hauptamt 93437 Furth im Wald

Wir bedauern den Fehler in dem Beitrag, der zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag entstand. Da waren wohl zu viele Faschingsprinzenpaare unterwegs und verdrängten das Ritterpaar. Die Redaktion
■ Zetschowitz. Am 26. Johann Prokosch (Konaschousta, Haus-Nr. 31), Ölbronner Straße 11, 75245 Neulingen, 92 Jahre.Josef Friedrich mit Frau Maria Ortsbetreuer
■ Kscheberscham. Walter Bernklau in Blaustein-Dietingen, 94 Jahre. Maria Schnobrich Ortsbetreuerin
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im März Karl Gagalick, Ortsbetreuer von Sadl, am 3. zum 83. Geburtstag; Walter Gimpl, Ortsbetreuer von Dobraken und Zwirschen, am 7. zum 94. Geburtstag; Josef Hoffmann, ehemaliger Ortsbetreuer von Eisendorf, am 8. zum 88. Geburtstag; Dr. Waldemar Nowey, Bildungsforscher, am 11.

zum 96. Geburtstag und Annemarie Ziehfreund, Ortsbetreuerin von Pirk, am 30. zum 82. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter Pawlik Heimatkreisbetreuer

Heimatbote
für den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de




� Kindheit in Waidhaus – Folge VI und Schluß
Baden mit Ringelnatter
Wolf-Dieter Hamperl erzählt in dieser letzten Folge von der Währungsreform, Hochzeiten, Beerdigungen und dem Umzug nach Vohenstrauß.
Auf dem Weg von der Säge nach Burkhartsrieth kam man an die Pfreimd mit einer Furt. Für Fußgänger war ein Steg gebaut. Oberhalb der Furt war die Pfreimd etwas tiefer, so daß man schön baden konnte. Einmal kam mir eine Ringelnatter entgegengeschwommen. Ich hatte solche Angst, daß ich nie mehr dort badete. Die schweren Rösser, die die Woche über Langholz zu bringen hatten, durften am Samstagnachmittag in die Pfreimd. Das gefiel ihnen sichtlich, die Knechte wuschen sie und kämmten die Mähnen.
Auf dem langen Weg zur Pfreimd war auf der linken Seite eine tiefe Mulde, wohl eine ehemalige Sandgrube. Sträucher wuchsen an ihren Rändern, aber auch in der Tiefe.
Dorthinein warfen die Waidhauser ihre Abfälle. Und wir Buben gingen dort auf Suche nach Brauchbarem. Wir fanden auch immer etwas, schöne tiefblaue Medikamentenfläschchen oder einen kaputten Kinderwagen, dem wir die Räder abbauten. Alte Munition suchten wir nie und fanden sie auch nie zufällig.
1949 kam die Währungsreform. Den Schwarzhändlern wurde damit das Handwerk gelegt. Jeder hatte 40 DM, und plötzlich konnte man alles kaufen. Ich kann mich nur mehr daran erinnern, daß wir die kleinen 50PfennigScheine zu einem Bündel banden und an einem Schalter abgaben, wohl im Rathaus. Die neuen Münzen und Scheine wurden lange bestaunt. Von der USABesatzungsmacht merkten wir nicht viel. Öfters stand ein Jeep an der nahen Feldscheune gegenüber der Friedenskirche, die Soldaten machten Pause, rauchten oder kauten Kaugummi. Uns Buben lockten
Öfters wurden wir zum Schuster geschickt, um Schuhe zum Besohlen zu bringen. In einem mittelgroßen Raum lag ein Berg von alten Schuhen. Mittendrin saß der Schuster auf einem Hocker und arbeitete an einem Schuh. Besonders interessant war, wenn er Ledersohlen mit Holzstiften befestigte. Er befestigte auch neue Schlösser an alten Aktentaschen oder zwickte Ösen in Gürtel. Man mußte schon wissen, wie die Schuhe aussahen, die man abholen wollte, damit man sie in dem Schuhberg fand.
Das Lehrerehepaar Böhm mit der kleinen Hamperlfamilie aus Ingrid, Mama Anna, Papa Josef und Wolf-Dieter.

Einmal durfte ich mit zum Holzrücken auf den Waidhauser Sulzberg. Dabei mußte das Pferd die schweren Bäume an Ketten bergauf ziehen. Da das Pferd das nicht so schnell schaffte, wie der Knecht wollte, schlug der Mann auf das Pferd mit der Rückseite der Axt ein. Vor Schreck lief ich weg. Mir tat das arme Pferd so leid. Gerne erinnere ich mich an die Kartoffelernte im Herbst. Ein Pferd mit einem Roderer warf die Kartoffeln und Steine zur Seite.
Unsere Aufgabe war, die Kartoffeln in Eisennetzkörben zu sammeln, ehe sie auf den bereitgestellten Wagen geschüttet wurden. War der voll, wurde der Wagen nach Hause gezogen und die Kartoffeln über eine Holzrinne durch das Kellerfenster der Bauernhäuser in den kühlen Keller geschüttet. Auch zum Steineklauben wurden wir manchmal motiviert, die dann an den Feldrain geschüttet wurden. Ganz besonders schön war der Frühling, vor allem der Mai. Der Flieder blühte und duftete, und die Landkinder gingen am Abend in die Maiandacht.
Es wurden so schöne Lieder gesungen, die Gebete waren nicht zu lange und dann durften wir noch im Dorf herumstreunen. Um acht Uhr abends, spätestens eine Viertelstunde später, mußten wir wieder daheim sein, dann Füße waschen und ins Bett gehen. Es gab noch keinen Fernseher, und wir hatten auch keinen Radioapparat, bis in Vohenstrauß ein Saba gekauft wurde. Welche Ruhe!
sie mit Schokolade. Immer wieder konnte man einen kleinen Konvoi von Militärfahrzeugen auf der Reichsstraße kommen sehen. Sie fuhren zur Grenze. Der Eiserne Vorhang war 1948 entstanden, eine Isolierung des Dorfes für Jahrzehnte. Nur ganz selten sahen wir einen ausländischen Lastwagen, der die Grenze passiert hatte. 1948 erfuhr man auch von einem Krieg im fernen Korea, weit weg. Aber wir sangen: „Ei, ei, ei Korea, der Krieg kommt immer näher, da schießen wir mit Katzendreck und schießen alle Russen weg.“ Die Männer rauchten damals Zigaretten der Marken Zuban oder Mokri. Was hatte das mit uns zu tun. An den Zigarettenschachteln konnte man einen Streifen freilegen, der eine Zahl trug. Diese sammelten wir. Denn dafür erhielten wir Bilder für Sammelbücher. Die meisten fanden wir damals immer am Montag im Wirtshaus am Zollhaus. Im Ort gab es einige hochinteressante Stellen, wo wir längere Zeit verweilten und zuschauten. Zum Beispiel bei der Schmiede gegenüber dem Alten Rathaus. Dort waren oft Pferde angebunden. Der Knecht oder Bauer beruhigte sein Pferd und hielt den Unterschenkel fest, während der Schmied das heiße Hufeisen einbrannte und festnagelte. Auch wenn keine Pferde beschlagen wurden, sahen wir gerne dem Schmied bei seiner interessanten Arbeit zu.
Zum Friseur Sollfrank ging ich alle vier Wochen zum Haareschneiden. Wir erhielten da einen heute wieder hochmodernen Haarschnitt. Alles kurz. nur ganz oben ein längeres Haupthaar. Einen Scheitel ließen meine Haare nicht zu. Der Friseurmeister ließ uns Buben immer länger sitzen. Er sagte, die Männer müßten arbeiten und hätten keine Zeit, länger zu warten. So mußten wir manchmal eine Stunde lang warten. Der Vorteil war, daß der Friseur Sollfrank einige Illustrierte hatte, die von Skandalen oder Kriegshelden berichteten. Dort lernten wir die kühnen Stukaflieger und die tapferen UBootKommandanten kennen. So wurde damals der Krieg aufgearbeitet.
Hochzeiten und Beerdigungen
ich mitfahren. Ein Erlebnis. Eine Hochzeit der anderen Art war die von Großvater Anton Wolf und Lina Ries in der Kirche Mariä Himmelfahrt an der Eslarner Straße. Ich kann mich nur mehr daran erinnern, daß mein Vater und Schücker Peppi in einen Lachkrampf verfielen, als der Pfarrer sagte: „Bis daß der Tod Euch scheide.“ Sie lachten wohl, weil die Eheleute für damalige Verhältnisse schon etwas betagt waren. An Taufen kann ich mich nicht erinnern, aber an Beerdigungen. Der Friedhof ist für Kinder ein unheimlicher Ort, den man freiwillig nicht besucht. Noch gruseliger war, wenn wir im Leichenhaus das Licht brennen sahen. Der Religionslehrer hatte uns beigebracht, daß wir dann hingehen, den Toten mit Weihwasser besprengen und ein Vaterunser beten sollten. Das haben wir manchmal getan.

In Erinnerung geblieben sind mir die großen Beerdigungen der Kreuzwirtin Anna Grötsch, einer geborenen Höring aus der Neumühle. Sie war am 16. Juli 1952 im Alter von 58 Jahren an Brustkrebs gestorben wie auch die Frau von Hauptlehrer Gustav Böhm. Auch die Beerdigung von Sägewerksbesitzer Wolf Heinrich, gestorben am 29. März 1961, war ein großes Ereignis, wenn auch die Brüder Anton und Heinrich Wolf verfeindet waren und kein Wort mit einander gesprochen haben, was das Verhältnis der Familien etwas betrübte.
� Neuzedlisch
Pater
Franz de Paula 80
Am 20. Januar feierte Pater Franz de Paula (Otto Sigmund), unser Neuzedlischer Landsmann, seinen 80. Geburtstag im westfälischen Münster.
tigen SanktPaulusDom zuständig.
Der Unfalltod von Förster
Martin Wassermann am 14. Juli 1948 konfrontiert den kleinen Wolf-Dieter Hamperl mit dem Tod. Wassermann wohnte im nahen Forsthaus, wo die Kinder oft mit seiner Tochter spielten.

1948 lebte die Großfamilie Wolf noch in Waidhaus, und für 1949 kündigten sich einige Hochzeiten an. So heiratete im Feber Onkel Toni Irmgard Grötsch. Sie stammte aus dem Gasthof Grötsch nahe der Kirche. Wir wurden wieder schön eingekleidet, und Ingrid und ich wurden als kleines Ehepaar abfotografiert. Für Kinder sind Hochzeiten immer eine große Besonderheit. Man lernt Gaststätten und ungewohntes Essen kennen. Die Hochzeit von Tante Line mit Sepp Gollwitzer fand im Bauernhaus in Spielhof statt. Man hatte ein großes Zimmer im Erdgeschoß ausgeräumt und eine große Tafel aufgebaut. Mir blieb die Versteigerung des Brautschuhs in Erinnerung. Der wurde zuerst heimlich der Braut geraubt und dann meistbietend versteigert. In der Nacht fuhr Onkel Toni die Familien mit dem Buckelford nach Hause. Da ich damals schon gerne im Auto fuhr, durfte
Eine besondere Beerdigung war die von Revierförster Martin Wassermann. Er war mit dem Motorrad mit nur 38 Jahren in Braunetsrieth bei Vohenstrauß an einen Baum gefahren. Die Familie Wassermann bewohnte das schöne Forsthaus mit dem idyllischen Garten. Mit Tochter Christl spielten wir öfters Hochzeit. Großmutti war mit Frau Wassermann befreundet, und beide fuhren wöchentlich nach Weiden ins Café Weiß zur Erholung vom Waidhauser Landleben.
Umzug nach Vohenstrauß
In Waidhaus lebten damals noch immer alle Mitglieder der Großfamilie Wolf. Großvater war immer noch der Überzeugung, daß diese Vertreibung nicht endgültig sei. Er hatte am Bahngelände einen Holzhandel aufgemacht und Grubenholz per Bahn in das Ruhrgebiet geliefert. Tante Marie wohnte noch im Haus an der Säge. Onkel Toni hatte geheiratet und bezog eine Barakke am Holzplatz. Willi und Wenzel wohnten in Hagendorf. Tante Line heiratete nach Spielhof. Da Vater die landwirtschaftliche Kreisberufsschule in Vohenstrauß aufbauen sollte, zogen wir im August 1951 in die Kreisstadt. Die Möbel transportierte ein Lastwagen der Firma Randig. In Vohenstrauß bezogen wir eine frisch erbaute ZweizimmerWohnung mit Wohnküche, Bad und WC in einem Bau der Baugenossenschaft am Braunetsrieder Weg 318. So schön und frei wie in Waidhaus konnte ich im Mietshaus in Vohenstrauß nicht mehr leben.
Er wurde in Neuzedlisch geboren und lebte nach der Vertreibung zunächst in Mittelfranken. Später war er in Dillingen an der Donau, Laufen an der Salzach und wieder in Dillingen, wo er 1970 zum Priester geweiht wurde. Viele Wirkungsorte folgten. Zuletzt war er Klinikseelsorger in Aschaffenburg und war auf dem Käppele in Würzburg tätig. Seit Ende 2013 lebt er nun in Münster in Westfalen. Dort ist er hauptsächlich für Beichten und Gespräche im dor

Pater Franz hängt sehr an seiner Heimat im Böhmerwald, und so kommt er auch seit 1993 jedes Jahr nach Altzedlisch und feiert dort mit uns den Heimatgottesdienst. Seine Predigten sind immer wieder beeindruckend. Für seinen großen Einsatz danken wir ihm sehr herzlich. Die Landsleute aus dem Kirchsprengel Altzedlisch gratulieren Pater Franz nachträglich zum 80. Geburtstag und wünschen ihm weiterhin viel Gesundheit, Energie, Freude am Leben und Gottes Segen. Wir freuen uns, daß er auch in diesem Jahr den Gottesdienst mit uns feiern wird! Sieglinde Wolf
WIR GRATULIEREN
Wir gratulieren folgenden treuen Abonnenten des Tachauer Heimatboten, die im März Geburtstag feiern, und wünschen von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes überrreichen Segen.
n Hesselsdorf. Am 7. Brigitte Langguth, Brückenstraße 35, 99098 Erfurt, 77 Jahre.
Anni Knarr
Ortsbetreuerin
n Neuzedlisch. Am 1. Walter Fischer (Fischerpäiter Walter), 99 Jahre. Christine Harinko Schriftführerin
n Roßhaupt. Am 17. Angela Lohner/Herbst, 94 Jahre. Helga und Heribert Kett Ortsbetreuer
n Haid. Am 13. Katharina Jugelt/Sedelmayer (Töpferstraße 154) in Berlin, 98 Jahre. Felix Marterer Stadtbetreuer
n Pfraumberg. Am 30. Ilse Orendt (Schwind Ilse), 103 Jahre, und am 17. Anna Erhart (Gattin von Honsmichl Koarl, HausNr. 209), 97 Jahre.
Waltraud Gregor Stadtbetreuerin
Herzlich gratulieren wir im März Stefan Kapusta, Ortsbetreuer von Wosant, am 23. zum 57. Geburtstag, Emma Weber, Ortsbetreuerin von Neuhäusl, am 31. zum 68. Geburtstag und Reinhold Wurdak, Ortsbetreuer von Maschakotten, am 31. zum 70. Geburtstag. Wir wünschen alles erdenklich Gute, Gesundheit sowie Gottes Segen und danken für alle Arbeit für unsere Heimat. Sieglinde Wolf
Über diese Landschaft schrieb der Maler Ludwig Richter (1803 - 1884), der uns vor allem durch sein Bild „Überfahrt am Schreckenstein“ bekannt ist, in sein Tagebuch:
Ich entschloß mich also, durch das Elbtal nach dem böhmischen Mittelgebirge bei Teplitz zu gehen, wohin ich seit meiner italienischen Reise nicht wieder gekommen war.

Ich war überrascht von der Schönheit der Gegend, und als ich an einem wunderschönen Morgen bei Sebusein über die Elbe fuhr und die Umgebung mich an italienische Gegenden erinnerte, tauchte zum ersten
Male der Gedanke in mir auf, warum willst du denn in weiter Ferne suchen, was du in deiner Nähe haben kannst? Lerne nur diese Schöheit in ihrer Eigenartigkeit zu erfassen, sie wird rühren, wird gefallen, wie es dir selbst gefällt. Bald griff ich zur Mappe und zum Skizzenbuch, und ein Motiv nach dem anderen stellte sich mir dar und wurde zu Papier gebracht.
Von Sebusein bis Kamaik ist eine Fülle der schönsten und großartigsten Landschaftsbilder ausgeschüttet. Nach zehn oder zwölf Tagen kehrte ich mit einer kleinen Anzahl Studien und noch bedeutenderen fruchtbaren Eindrücken nach Meißen zurück.

Von dieser Zeit an wandte sich mein Streben wieder ganz
Adrian Ludwig Richter (geboren 28.09.1803 in Friedrichstadt bei Dresden, gestorben 19.06.1884 in Dresden) war einer der großen Maler und Zeichner seiner Zeit. Das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt, denn bereits sein Vater Carl August Richter war ein bekannter Kupferstecher und Dozent an der Dresdner Kunstakademie; sein Großvater war Kammerherr
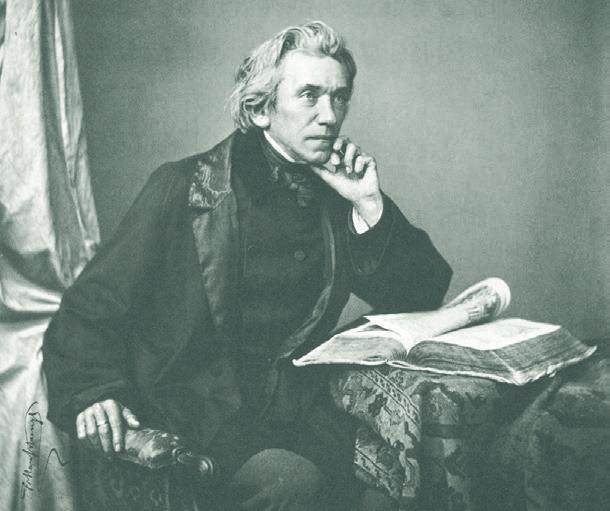
� Meldungen
Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe
 � Heimat
� Heimat
Aus Böhmens Hain und Flur
08641 6999521, Mobil 0157 32215766,
der heimischen Natur zu. Alle die tiefgehenden Eindrücke aus der Jugendzeit lebten damit wieder auf und erneuten sich an den nämlichen oder verwandten Gegenständen, und immer freudiger durchdrang mich dieses neue Leben. Wenn ich in den letzten Jahren meine Begeisterung nur an meinen italienischen Naturstudien und der immer blasser werdenden Erinnerung an dieselben entzünden konnte, so empfand ich jetzt das Glück, täglich frisch aus der Quelle schöpfen zu können. Jetzt wurde mir alles, was mich umgab, auch das Geringste, die alltäglichste Gegenwart, interessanter, weil Gegenstand malerischer Beobachtung. Konnte ich jetzt nicht alles brauchen? War nicht Feld und Busch, Haus und Hütte, Menschen wie Tiere, jedes Pflänzchen und jeder Zaun und alles mein, was sich am Himmel bewegte und was die Erde trägt? Die bis zum Krankhaften gesteigerte Sehnsucht nach Italien war von hier an gebrochen oder störte mich doch nicht mehr, offene Augen für das Schöne zu haben, das in meiner Nähe lag und woran ich täglich studieren konnte.
Quelle: „Lebenserinnerungen eines deutschen Malers“ (1885). Das Fragment wurde von seinem Sohn Heinrich Richter ergänzt. Aus „Dischkurieren“, Ausg. 08/2022, Margaretha Michel.
bei Johann Georg Graf von Schönfeld auf Schloß Wachau und später ebenfalls Kupferstecher.
Ein Stipendium ermöglichte es Ludwig Richter, an der Kunstakademie in Dresden zu studieren. Prägend waren die Jahre von 1823 bis 1826, die der 20-Jährige in Rom verbrachte. Hier schloß er Freundschaften mit anderen deutschen Malern.
Zurück in Dresden heiratete er
Martin Krsek für Aussig!
Martin Krsek ist uns seit Jahren als Historiker im Stadtmuseum Aussig bekannt. Im Herbst 2022 wurde er zum Senator für Aussig gewählt und tritt als parteiloses Mitglied im „Senatsklub SEN 21 und Piraten“ für die Region ein.

Daß er damit keine einfache Aufgabe übernommen hat, wußte er. Zur Zeit kämpft er an der Seite der ehemaligen Bürgermeister von Aussig, Petr Gandalovic und Jan Kubata, um den Erhalt des historischen Ver-
waltungsgebäudes der ehem. Schichtfabrik. Die Vorbereitungen zum Abriß hatten bereits begonnen, als es Krsek gelang, für Freitag, den 17. Feber eine außerordentliche Ratssitzung einzuberufen. Er schlägt der Stadt vor, das alte Verwaltungsgebäude zu kaufen und mit Hilfe von Subventionen zu sanieren: „Dieses Haus ist ein Denkmal für die goldene Ära von Aussig, als bedeutende Geschäftsleute hier ihre Imperien errichteten. Die Schichtfabrik gehörte vor dem Krieg zu den größten Waschmittel- und Lebensmittelunternehmen Europas. Ich dachte, daß die primitive Ära, in der wir einfach abreißen, in Aussig vorbei sei. Was hier geschieht, ist Barbarei.“ Über sein Anliegen und seine Arbeit als Senator spricht der Historiker Martin Krsek auf seinem You TubeKanal, auf Facebook und im Internet in tschechischer Sprache unter www. martinkrsek.cz kw
Quelle: www.martinkrsek.cz
1827 Augusta Freudenberg und lehrte sieben Jahre an der Staatlichen Zeichenschule in Meißen. 1836 wurde er als Nachfolger seines Vaters als Lehrkraft an die Dresdner Kunstakademie für die Landschaftsklasse berufen.
Für die Reihe „Das malerische und romantische Deutschland“ des Leipziger Verlegers Georg Wigand durchwanderte er 1837 auch das Elbtal und das Riesengebirge. Er bekannte sich
zur Heimat und hatte hier vielleicht seine beste schöpferische Phase, was sich in seinen Bildern widerspiegelt.
Für sein Gemälde „Brautzug im Frühling“ von 1847, erhielt Richter 1855 die Goldene Medaille auf der Weltausstellung in Paris. 1859 wurde er mit dem Ehrendoktortitel der Universität Leipzig ausgezeichnet.
Wegen eines Augenleidens musste Ludwig Richter 1873 das Malen und
� Festakt zum 100. Geburtstag und Buchpräsentation
Zeichnen aufgeben und schied 1876 aus der Kunstakademie in Dresden aus.
Am 19. Juni 1884 verstarb Ludwig Richter und wurde mit einem Staatsbegräbnis auf dem Neuen Katholischen Friedhof in DresdenFriedrichstadt beigesetzt. kw Quelle: wikipedia Foto: wikipedia: Ludwig Richter, gemalt von Franz Hanfstaengl
Gerhard Steppes-Michel: 100 Jahre im Zeich(n)en der Natur.
Unser Aussiger Künstler Gerhard Steppes-Michel veröffentlichte anläßlich seines 100. Geburtstags am 12. Feber 2023 sein Buch „Kraft und Wandel in den Schachten“ * (siehe AB vom 03.02.2023). Am 17. Feber wurde im Rahmen eines Festakts im Kulturhaus des Marktes Schönberg/Bayer. Wald die Kunstausstellung mit den Originalen eröffnet und gleichzeitig die druckfrischen Bücher präsentiert.
Über 200 geladene Gäste aus Kultur, Politik, Wirtschaft, aber auch seine große Familie, Freunde und Wegbegleiter erlebten einen topfitten Jubilar, der es sich nicht nehmen ließ, nach über zwei Stunden Anprachen und Laudatio selbst das Schlußwort zu sprechen. Während sich das Publikum längst am Buffet erfreute, saß Gerhard Steppes-Michel noch über eine Stunde im Saal, plauderte mit den Gästen
Von rechts: Gerhard SteppesMichel, Karin Wende-Fuchs in der Ausstellung. Fotos: Josef Fuchs

und signierte sein Buch. Wie er selbst im Schlußwort sagte, ist es ihm ein Anliegen, mit seinen Bildern aufzuzeigen, wie schön Gottes Erde ist, die wir schon aus Dankbarkeit zu erhalten haben. Schachten sind meist vom Menschen geschaffene Lich-
Von links: Der Jubilar, Bürgermeister Martin Pichler, Landrat Sebastian Gruber, Verlagsleiterin Birgit Fuchs.
tungen in hoch gelegenen Wäldern, wie im Bayerischen Wald, die früher als Weideflächen genutzt wurden. Die Wiesen mit vereinzelten Baumgruppen befinden sich überwiegend auf Hochplateaus und stellen historische Kulturlandschaftselemente dar. kw

Helmut Hoffmann
Sein Tod am 24.01.2023 kam für uns völlig unerwartet. Woran denkt man in solch einem Moment? Jeder Mensch ist einzigartig, geprägt von Lebenserfahrung durch verschiedenste Dinge, die einem im Leben widerfahren, schönen und weniger schönen. Wie von jedem von uns kann man sagen, Helmut Hoffmann ist einzigartig.
Wollen wir ein kurzes Resümee seines Lebens geben, wohlwissend, daß es nur angerissen, niemals vollständig sein wird.
Geboren wurde er am 17.04.1940 in der Gebirgsstraße NC 444 in Aussig-Türmitz im großelterlichen Haus. Ein Wunschkind! Seine ersten Lebensjahre waren vom 2. Weltkrieg und der Nachkriegszeit geprägt. Mit 5 Jahren musste er am Tag des Hochfestes „Peter und Paul“ mit seiner Mutter Martha und seinen Großeltern Franz und Anna Werner – wie sagte er immer, innerhalb von 10 Minuten – seine Heimat verlassen. Für das Kind war dieser Abtransport, der in offenen Kohlewaggons bei wechselhaftem, meist regnerischem Wetter erfolgte, sicherlich nicht so traumatisie-
� Persönlichkeiten
rend wie für seine Mutter und vor allem die Großeltern. Die Vertreibung führte ihn und seine Angehörigen zuerst nach Nackel in Brandenburg. Auch dort hat er noch oft von vielen Erlebnissen berichtet. Das Erlebte war tief in seiner Erinnerung eingebrannt und oftmals in Erzählungen wieder lebendig geworden. Im Mai 1946 hat der zweite Anlauf der Übersiedelung in den Westen geklappt. Hier in Altenkunstadt trafen sie sich wieder mit dem Vater Willibald Hoffmann. Viele Geschichten aus dieser schweren Zeit des Neuanfanges wurden in unserer Familie immer wieder erzählt. Themen waren u.a. die Wohnungsnot und die Zwangseinquartierung bei einer einheimischen Familie. Eine Zeit, in der das tägliche Überleben aus Ährenlesen, Kartoffelund Zuckerrübenstoppeln und samstäglichen Holzaktionen bestand, sowie „abwechslungsreichen“ Mittagessen aus Pilz/ Kartoffel- und Kartoffel/PilzGerichten. Jahrelang konnte er danach keine Pilze mehr essen. Eine Zeit, die wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen können. In Altenkunstadt besuchte er die Volksschule und entschied sich danach für eine kaufmännische
Ausbildung in Lichtenfels, die er 1957 mit Bravour abschloß. Zusammen mit seinem Vater baute er 1963 ein Zweifamilienhaus in Altenkunstadt, in dem er bis zu seinem Tode lebte. Sein 63-jähriger Vater wurde ihm durch einen Schlaganfall genommen, seine Mutter verstarb 1998 im hohen Alter von 94 Jahren. In diesem Haus gründete er seine Familie. Er ehelichte 1964 Frau Ingrid Erben, wohnhaft in Kulmbach, ebenfalls eine Vertriebene aus Hohenelbe (Riesengebirge). Er war Taufpate von Thilo Erben, seinem Neffen, als auch Trauzeuge bei seinem Schwager Günter Erben. Seine Ehefrau Ingrid verstarb nach schwerer Krankheit 2011 – ein einschneidendes Ereignis. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Sein Sohn Dietmar Hoffmann (1967) und seine zwei Töchter Betti-
Wenzel Jaksch (1896 - 1966)
na und Christine (1970). Seine Tochter Christine schenkte ihm zwei Enkel, Tobias und Daniel, über die er sich sehr freute.
Seine Lehrzeit verbachte er bei H. & O. Schulze in Lichtenfels. Sein beruflicher Werdegang als kaufmännischer Angestellter führte ihn über Burgkunstadt bis Kulmbach.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit war er an seiner Ahnenforschung interessiert, den Stammbaum seiner Kinder erforschte er mit viel Ausdauer über etliche Generationen zurück. Nicht nur seine Ahnen haben ihn interessiert, nein, auch die Geschichte der Menschen in Böhmen. Daher ist es nicht verwunderlich, daß er ab 1968 als freier Mitarbeiter beim Aussiger Boten sowie anderen Heimatblättern kräftig mitwirkte. Wie freudig erwartete er immer das
Ein Streiter für die Menschenrechte der Vertriebenen
Im Angesicht von Krieg und Krisen rückt die Vertriebenenpolitik häufig in den Hintergrund. Deshalb möchten wir an dieser Stelle an Wenzel Jaksch erinnern, den unbeugsamen Streiter für die Menschenrechte der Vertriebenen, für das Selbstbestimmungsrecht und die Demokratie.
Wenzel Jaksch wurde am 25.09.1896 in Langstrobnitz geboren und starb am 2.11.1966 in Wiesbaden an den Folgen eines Verkehrsunfalls.
1924 wurde er in den Parteivorstand der DSAG (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik) gewählt und war von 1929 bis 1938 Mitglied des tschechoslowakischen Abgeordnetenhauses. Ganz im Sinne des Parteigründers Josef Seliger stärkte er den deutschnationalen Flügel der Partei und warb für die programmatische Festlegung auf einen „Volkssozialismus“, einen gegen die Sowjetunion gerichteten „abendländischen Sozialismus“.
Das konnten Sie nicht verstehen!
Im Feber-Boten hatten wir ein Foto aus dem Sudetendeutschen Museum veröffentlicht, auf dem man leider nicht erkennen konnte, was im Text beschrieben wurde. Hier noch einmal die Abbildungen mit den entsprechend „deutsch-tschechisierten“ Wörtern.
Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung und leidenschaftlicher Führer durch das Sudetendeutsche Museum klärte uns weiter auf:
Nach dem Münchner Abkommen 1938 ging Jaksch mit britischer Hilfe in die Emigration und rief bereits 1939 in London die „Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten“ (TG) ins Leben. Im Herbst 1940 wies er das Angebot Edvard Benešs zurück, in den tschechoslowakischen Staatsrat einzutreten, mit der Aussicht das Amt des Vizepräsidenten zu bekleiden, weil ihm die geforderte Garantie einer völligen Autonomie der Sudetendeutschen verweigert wurde. In den letzten Kriegsjahren versuchte Jaksch, durch Berufung auf die Atlantik-Charta, eine neue Grundlage für seine „großdeutsche“ Politik zu schaffen und bestand noch 1944 auf der „Unantastbarkeit“ der deutschen Vorkriegsgrenzen. Noch in London engagierte er sich erfolglos gegen die Beneš-Dekrete. Auch die Abspaltung eines kommunistischen Flügels innerhalb der TG konnte er nicht verhindern. Weil die Vertreibung auch
� Berichtigung

die sudetendeutschen Sozialdemokraten traf, mußte er in London bleiben. Umso mehr versuchte die TG von dort aus, die Vertreibung und den Genozid an den Sudetendeutschen anzuprangern und den vertriebenen Mitbürgern zu helfen. So gelang es, durch gute Beziehungen der TG zu Schweden, zwischen 1938 und 1955 rund 5000 Sudetendeutsche in Schweden unterzubringen.
Wenzel Jaksch stand unter Beobachtung der USA-Behörden, vor allem aber agitierte die ČSR gegen ihn. Englische und amerikanische Diplomaten sprachen sich gegen seine Heimkehr aus. Man fürchtete, bei der bevorstehenden Wahl 1948 in der ČSR könnte sich Jaksch zum Führer der Unzufriedenen unter den Vertriebenen aufschwingen. Nach Beratungen der Siegermächte und dem Einsatz des SPD-Parteivorstands durfte er schließlich am 13. Feber 1949 aus dem britischen Exil nach Westdeutschland zurückkehren. Als SPD-Mitglied übernahm er de-
Verstehen Sie das?
Bei dem Text an der Wand in unmittelbarer Nähe der Schreibmaschine, die in deutscher und tschechischer Sprache mit einer Tastatur schreiben kann, handelt es sich nicht um ein „Plakat aus dem 19. Jahrhundert“, sondern um eine Installation aus dem Entstehungsjahr des Sudetendeutschen Museums
2020, die in humorvoller Weise auf das „Böhmakeln“, das auch
„Kuchl-böhmisch“ genannt wurde, hinweisen soll. Die verwendeten Beispiele oder Wörter sind dem Buch von Götz Fehr, Fernkurs in Böhmisch, entnommen, mit dem Unterttel „Ajnfírung in špráchliche und kulináriše Špecialitétn fon Land und Lajtn ajnšlislich Fichern jeglicher Art“, erschienen als Insel Taschenbuch 1333 im Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1991.

Zuschicken des Heimatblattes, wehe, es kam einmal verspätet. Bereits 1993 wurde er mit einer Dankesurkunde des Heimatkreises Leitmeritz für seinen ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet. Eine weitere Ehrung für seine Mitarbeit am Leitmeritzer Heimatboten erfolgte 2001 mit der Verleihung der „Ulrich-vonEschenbach-Plakette“ durch den Heimatkreisverband Leitmeritz in Fulda. 1989 führte ihn erstmals wieder eine Reise in seine Heimat Böhmen, die er mit den Worten beschrieb: „Eine Reise von daheim nach Hause“. Hier besuchte er auch sein Geburtshaus in der Gebirgsstraße in Türmitz, welches er im Alter von 5 Jahren verlassen mußte. Der damalige Hausbesitzer nahm uns freundlich auf und führte uns durch das ganze Haus. Mein Vater erkannte noch das alte gußeiserne Waschbecken auf dem Treppenabsatz, allerdings fehlten die Radieschen, welche dort zum Waschen abgelegt wurden. Noch einige Male reiste er mit seiner Frau oder Tochter in die alte Heimat, viele Berichte von diesen Fahrten finden sich in den Heimatblättern wieder. Die letzte Reise erfolgte 2019, bei der er zum letzten Mal Gelegenheit hatte, über die Elbebrücke nach Schreckenstein zu laufen oder sich in der Stadtkirche die Aussiger Madonna von Mengs anzuschauen. Altenkunstadt ist ihm eine Heimat geworden, aber seine Wurzeln hat er niemals vergessen. Bis zuletzt blieb er daher seiner schriftstellerischen Arbeit und seiner Heimat treu und hat
bis heute die Heimatblätter mit Artikeln und Lesestoff versorgt. In Altenkunstadt hat er über 30 Jahre ein kirchliches Ehrenamt bekleidet. Hier wirkte er 30 Jahre als Lektor und Kommunionhelfer, ebenso war er für eine Legislaturperiode im Pfarrgemeinderat. Weiterhin hat er sich für den Unterricht der Erstkommunionkinder, sowie bei der redaktionellen Bearbeitung des Kirchenführers für die Pfarrkirche als auch der Filialkirche in Pfaffendorf engagiert. Was macht einen Menschen aus? Sein Beruf, seine Familie, seine Interessen, sein Humor und Witz, sein Wesen? Ich denke, seine Familie und sein besonders tiefes Interesse an der Heimatgeschichte sowohl Böhmens als auch Oberfrankens, haben ihn am Ende seines Lebensweges zu einem zufriedenen Menschen gemacht. Seine tiefe Verbundenheit mit der Heimat erkennt man an seinem vor langen Jahren ausgesprochenen Wunsch, daß zu seiner Beerdigung das heimatliche Lied „Feierabend“ von Anton Günther gesungen werden möchte. Dieser letzte Wunsch wurde ihm bei seinem Requiem am 01.02.2023 in Altenkunstadt von Frau Kral, der Tochter von Rosemarie Kraus, erfüllt – einer begnadeten Sängerin. Auch hier schließt sich ein Kreis. Gedenken wir unseres Landsmanns Helmut Hoffmann in tiefer Verbundenheit und vertrauen wir darauf, daß er seine letzte Heimat gefunden hat.
WIR GRATULIEREN

n 102. Geburtstag: Am 20. 3.
Frau Sieglinde HOFFMANN geb. Michel (Linda) aus Schreckenstein in 06667 Weißenfels, Kirschweg 94.
n 88. Geburtstag: Am 5. 3.
ren zentrale Flüchtlingsbetreuung.

1953 wurde er in den Deutschen Bundestag gewählt, dem er vier Legislaturperioden bis zu seinem Tod angehörte. Sein Einsatz galt der Vertriebenen-Politik, von 1951 bis 1966 als Leiter der Seliger-Gemeinde, von 1959 bis 1961 als Präsident der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, ab 1961 als deren Vizepräsident. 1964 wurde er, als bisher einziger Sozialdemokrat, zum Präsidenten des Bundes der Vertriebenen gewählt. Dieses Amt hatte er bis zu seinem Tod inne.
Ehrungen, vom Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bis zur Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen oder der RudolfLodgman-Plakette, zeugen von seinem jahrzehntelangen Engagement für die Heimatvertriebenen. Nach ihm ist der Wenzel-JakschGedächtnispreis der Seliger-Gemeinde benannt. kw
Quelle: Heimatbrief Plan Weseritz 1/22, wikipedia
Der Autor Götz Fehr ist 1918 im südböhmischen Budweis geboren, studierte Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte an der deutschen Karls-Universität Prag, wo er 1943 zum Dr. phil. promovierte. Nach dem Krieg gehörte er zu denen, die das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes aufbauten. Von 1962-1979 war er Vorstandsmitglied bei „inter nationes“, der Mittler-Organisation für deutsche Kultur im Ausland. Er starb 1982 in Bonn. kw
Quelle: Dr. Ortfried Kotzian
n 97. Geburtstag: Am 14. 3.
Frau Erika HAGENAUER geb. Manka aus Arbesau in 18059 Rostock, Nobelstr. 12. – Am
19. 3. Frau Edeltraud KÜHNEL geb. Pusch aus Prödlitz.
Frau Kühnel würde sich über Kontakt-Aufnahme freuen, Tel. 036741-57822. – Am 22. 3.
Frau Ilse MEIER (Oskar Ilse) aus Schönwald.
n 96. Geburtstag: Am 24.3.
Frau Annelies ZECHEL geb. Franze (Richter A.) aus Peterswald Nr. 542 in 63512 Hainburg, Wendelinusstr. 28.
– Am 27. 3. Olly LIEDTKE geb. Rühr aus Schöbritz in 23996 Bad Kleinen, Uferweg 13.
– Am 29. 3. Frau Gerti EIBICH geb. Heinrich aus Schreckenstein, (Gasth.b. Walter Heinrich) in 82362 Weilheim, Wichernstr. 23.
n 95. Geburtstag: Am 14. 3. Herr Wolfgang HOCKE aus Sobochleben. – Am 26. 3. Frau Margit MÜHLE geb. Eichler aus Ebersdorf.

n 93. Geburtstag: Am 19. 3.
Herr Erhard SOUTSCHEK aus Schöbritz.
n 92. Geburtstag: Am 12. 3.
Frau Christel SCHÜLKE geb. Stolle aus Leitmeritz / Schwaden in 99198 Großmölsen, Hauptstr.
37. – Am 15. 3. Frau Christine WITT geb. Ritschel (Fried Christel) aus Peterswald. – Am 26. 3. Herr Erich H. WEISS aus Türmitz in 84079Bruckberg, Dammstr. 9.
n 91. Geburtstag: Am 17. 3.
Frau Gertrud SCHMIDT aus Weigersdorf-Liesdorf in 71711 Steinheim, Riedstr. 49.
n 90. Geburtstag: Am 16. 3.
Herr Dr. Karl-Heinz SCHILLER aus Herbitz.
n 89. Geburtstag: Am 19. 3.
Herr Horst FIEDLER aus Aussig, Fabrikstr. 19 a in 34131KasselBad Wilhelmshöhe, Im Druselstal 12, Augustinum App. A 322-13.
Frau Brigitte GRIESBACH geb. Richter aus Birnai Nr. 7 in 09618 Brand-Erbisdorf, Langenau, Im Engen 4. n 87. Geburtstag: Am 20. 3. Frau Dr. Christine BARTSCH geb. Kretschmer aus Salesel. n 86. Geburtstag: Am 28. 3. Frau Christel KÖPPE geb. Wirbik aus Nestomitz in 39576 Stendal, Bergstr. 19 C. –Am 30. 3. Frau Magdalena FRIES (Ehefrau v. Josef Fries aus Aussig, Kl. Wallstr.) aus Krainsdorf, Schlesien in 07768 Kahla, Bachstr. 65.
n 84. Geburtstag: Am 19. 3. Herr Adolf KLEMMER aus Waltirsche in 99734 Nordhausen, Weberstr. 9. – Am 31. 3. Frau Margit POMPLITZ (Krauspenhaar M.) aus Schönwald in 01816 Bad Gottleuba, Hellendorfer Str. 30.
n 83. Geburtstag: Am 31.3. Herr Friedrich FLACH aus Schwaden.
n 81. Geburtstag: Am 12. 3. Herr Horst KÜHNEL, (Sohn v. Schuster Gretl) aus Streckenwald. – Am 15. 3. Frau Gisela FRITSCHE geb. Löffler aus Aussig. – Am 31. 3. Frau Ingeborg DUPRÉ aus Aussig in 39104 Magdeburg, Jakobstr. 28. – Am 31. 3. Frau Ursula SCHRÖDER geb. Karger aus Schreckenstein, in 17154 Neukalen, Krumme Str. 9 n 78. Geburtstag: Am 11. 3. Frau Christa KLONICKI aus Schönpriesen.
n 66. Geburtstag: Am12. 3. Herr Norbert SCHINDLER (Sohn von Irmengard Schindler aus Seesitz in Roth).
Liebe Heimatfreunde!
Bitte melden Sie Todesfälle auch weiterhin der Redaktion. Auch Geburtstage, die noch nicht veröffentlicht sind (mit Datenschutzerklärung!), nehmen wir gern in die Liste auf.

Redaktion Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, eMail: aussigerbote@t-online.de. Herzlichen Dank!

Familien aus Leitmeritz




finden sich wieder
Eleonora Glück, gebürtige Leitmeritzerin, hat Besuch bekommen und von ihren Lebenserinnerungen berichtet.
Durch Bekanntmachung der neuen Heimatkreisbetreuerin Yvi Burian im Leitmeritzer Heimatboten erkannte Eleonora Glück, geb. Zappe und aus Leitmeritz, den Namen Burian und meldete sich zügig bei ihr.
Frau Glück berichtete, daß sie als Kind in Leitmeritz beim HNO-Arzt Dr. med. Franz Burian gewesen war. „Das ist ein Bruder meines Großvaters“ freute sich Frau Burian. Auch die Buchhandlung der Familie Martin am Marktplatz und die Gast-
❯ Kultur
stätte mit Metzgerei der Familie Peisker in Pokratitz, welche beide zum Kreis der Familie Burian gehörten, sind Frau Glück gut bekannt. Beide vereinbarten zeitnah ein persönliches Treffen. Vom frühen Nachmittag bis zum späteren Abend waren beide stundenlang im Gespräch vertieft. Eleonora Glück wurde im Jahr 1926 in Leitmeritz als Tochter vom selbstständigen Elektromeister Franz Zappe und Anna Zappe, geb. Sapurka, geboren und wuchs dort mit ihrem fünf Jahre älteren Bruder Franz Zappe auf. Die Familie lebte in der Rudolfsgasse, nicht weit vom Marktplatz. Ihr Großvater rich-
tete dort ein Lebensmittelgeschäft ein. Dort im Vorhaus habe ein großer Eiskasten gestanden, erinnerte sie sich. Dort hinein kamen mehrmals im Jahr große längliche Eisblöcke, die im Winter aus der zugefrorenen Elbe herausgesägt wurden und im Elbschloßbrauhaus in den Kellerräumen gelagert wurden. Diese wurden dann in Pferdefuhrwerken das Jahr über ausgefahren. Sie wunderte sich als Kind immer, was da aus dem Kasten herauströpfelte.

Auch von ihren Ausflügen zum Hausberg, dem Radobil, und auch von dem Brauch, „auf Wechsel“ zu gehen, um die jeweils andere Landessprache zu lernen,
berichtete Eleonora Glück. Viele weitere ihrer Lebenserinnerungen hat sie bereits sorgfältig aufgeschrieben.
Im Jahr 1946 erfolgte nach dem Krieg die Vertreibung und Ankunft in Hessen, Kreis Gelnhausen, im ehemaligen Schullandheim der Stadt Frankfurt auf der Wegscheide bei Bad Orb, das zu diesem Zeitpunkt für Heimatvertriebene genutzt wurde.



Yvi Burian brachte liebe Grüße an Frau Glück von ihren Angehörigen, der Familie Dr. Diether Rudolf Burian, mit und durfte nach vielen schönen gemeinsamen Stunden ebenso liebe Grüße wieder zurück an ihre Angehörigen mitnehmen. Yvi Burian
Pawlatsche, Pawlatsch oder Pablâtsch
Ein dankbares Objekt der Handwerkerkunst sind ehedem die in den Obergeschoßen älterer Bauernhäuser üblichen offenen Lauben gewesen, „Pawlatschen“ nannt.
Der Pawlatsch (oder die Pawlatsche) diente auch zum Trocknen von Feldfrüchten.
Doch war diese Bauweise keineswegs auf das Dorf beschränkt. In einem Aufsatz über die Leitmeritzer Stadtmundart liest man:
„Pawlatsch ist die Bezeichnung für einen gedeckten oder ungedeckten, meist hölzernen, balkonartigen Umgang um ein Haus, eine Art Galerie oder Terrasse in einem Obergeschoß.“
Dieses Holzgebilde war also außen an der Hauswand angebaut.
In ganz Böhmen baute man gern mit diesem Laubengang im Obergeschoß. Wie auf einem Balkon konnte man da ins Freie treten, befand sich aber noch unterhalb des Hausdaches.
Zuweilen waren die hintereinander liegenden Kammern im Obergeschoß auch nur über diesen Ausgang zu erreichen. Eine neuere akademische Defi niti-
on dieses eigentlich vieldeutigen Wortes lautet in Auszügen: „Pawlatsche“, die – 1. balkonartiger, hölzerner und offener Vorbau/Gang mit Überdachung an einer oder mehreren Hausseiten;
2. erhöhte Holzbühne, Podium;
3. wackliges Gestell, Gerüst.
In der Leitmeritzer Mundart war der längliche, balkonartige Vorbau männlichen Geschlechts, also der „Pawlātsch, Pavlatsch“, ebenso mit b, der
„Pablâtsch“. Anderswo ist das Wort dann weiblich, so zum Beispiel im bayrisch-österreichischen Sprachgebiet: Da war, beziehungsweise ist die Pawlatsche a) ein offener Gang an einer Hofseite eines Hauses, b) ein baufälliges Haus oder c) eine Bühne aus Brettern. Die „Bawládschn“ spielte im alten Wien eine große Rolle. Dort verstand man darunter zunächst die offenen Gänge auf der Hofseite der Häu-
ser, von denen aus der Zugang zu den einzelnen Wohnungen erfolgte; später kamen noch andere Bedeutungen hinzu. Die „Pawlātsch‘n“ war die offene Holzveranda im ersten Stock auf der Hofseite älterer Häuser und die „Bawalaatsch‘n“ war in Eger beheimatet. In Schlesien tauchten noch weitere Schreibweisen und zusätzliche Bedeutungen auf: die „Pabbasch“, „Boblatsche“ und „Pawelatsch“.
❯ Wie es früher war
Wie Leitmeritz zu seinem Namen kam
Woher meine Großmutter alle ihre Geschichten hatte, das ist mir unergründlich. Die Leitmeritzer wußten nicht, wie sie ihre Stadt nennen sollten. Einige Einwohner wurden Zeuge, als eine ältere Frau schwer bepackt – sie wollte wohl zum Markt –über die Elbbrücke ging, stolperte und hinfiel. Dabei rief sie aus: „Dou leit mer itz!“ (Da liegt man jetzt.) Leitmeritz liegt heute noch da, wenn sie auch Litoměř ice genannt wird.
Es muß wohl eine andere Frau gewesen sein, die auch schwer bepackt dem Leitmeritzer Markt zustrebte. Ein Mann wunderte sich über die vielen Taschen, Körbe und anderen Gefäße und war wohl neugierig, was sie da alles mit sich trug. Deshalb fragte er sie: „Was haben Sie denn in der Tasche?“ „Mou!“ „Und was da im Korb?“ „Ou mou!“ „Und in dem Beutel?“ „O no Mou!“ „Und in Ihrem Rucksack?“ „Ou no Mou Mou!“
Erläuterung: Mau – Mohn; „Ou no mou Mou!“ – „Auch noch mal Mohn!“
Es muß wohl kurz vor dem ersten Weltkrieg gewesen sein, als in Watislaw große Aufregung herrschte, denn es ging die Kunde, daß ein Zeppelin den Ort überfliegen sollte. Der Lehrer Heinze sagte zu seinen Schülern, zu denen auch meine Mutter damals gehörte: „Wir machen eine
Wie man sieht, schwankte das grammatische Geschlecht zwischen männlich und weiblich, der Anfangsbuchstabe zwischen p und b, der Mittelkonsonant zwischen v, w und b.
Wanderung auf den Radelstein – im Volksmund auch Radken genannt – um den Zeppelin noch besser zu sehen. Zieht euch recht warm an, denn da oben ist es noch recht schön kalt!“ So holte meine Großmutter den besonders schön gestrickten roten Schal heraus und band ihn ihrer Tochter Annl um. So ging’s auf den Radken. Als ihre Tochter wieder nach Hause kam, fiel meiner Großmutter als erstes sofort auf: „Annl, wo hast du denn den Schal?“ Weinend gestand meine Mutter, daß sie ihn irgendwo verloren hätte. Meine Großmutter packte ihre Annl an die Hand, und fort ging es auf die Schalsuche. Der Zeppelin war natürlich schon lange weg, aber leider der schöne, rote Schal auch. Jeder weiß, daß am 28. Juni 1914 der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo erschossen worden sind. Wie erfuhr das damals meine Großmutter? Telefone gab es kaum. Es muß ein Sonntag gewesen sein, als sie vor Hantschels Kaufladen eine Kutsche vorfahren sah. Neugierig trat sie näher. Ein Mann stieg aus und erkundigte sich im Laden, wo hier der Gemeindevorsteher wohne. Der Gemeindevorsteher war der Cousin meiner Großmutter. So erfuhr sie mit als erste von dem Mord in Sarajevo. Es könnte aber auch die Nachricht von Österreichs Kriegserklärung an Serbien gewesen sein. Rudolf Rosenkranz Herzlichen Dank für Ihre Einsendungen, Herr Rosenkranz!
„pavłoč“ in einst von Sorben bewohnten Gebieten ist ebenfalls als mögliche Quelle in Erwägung zu ziehen. Im Tschechischen gehört das Wort –mundartlich auch „povlač“ –
Für die ostmitteldeutschen Dialekte im Gebiet von Thüringen bis Niederschlesien gab es die „Pobelatsche“ (Gestell, Gerüst), mit zahlreichen Nebenformen und abweichenden Bedeutungen.
Der Ausdruck wird von dem weiblichen tschechischen Wort „pavlač“ (ein Hängeboden, Söller, Balkon, Gang) abgeleitet; die jedoch inzwischen ausgestorbene altsorbische Entsprechung
zum Zeitwort „vléci“ (schleppen, schleifen), welches wiederum von der urslawischen Wurzel „volk-“, „velk-“ (ziehen) stammt. Die slawische Vorsilbe „pa-“ entspricht den griechischen Wörtern „pseudo-“, „para-“ und den deutschen Entsprechungen „Neben-“ und „Nach-“. Erich Hofmann Sven Pillat schoß die Fotos obiger Häuser mit Pawlatschen während einiger Reisen in die alte Heimat.
� Geschichte/Molschen bei Gastorf
Molschen – Sammlung Teil 1
Der in der Heimatforschung engagierte Mario Illmann hat diese Sammlung zusammengestellt.
12.11.1904 Trauung in Lewin: Emilie Strowick aus Zierde und Adolf Czerwenka, Müllermeister in Molschen.
22.11.1904 Trauung in Drahobus: Mathilde Jenak und Franz Till, Lehrer.
25.11.1904 † Müllergattin Marie Czerwenka mit 56 Jahren.
28.11.1904 † Ausgedinger Josef Stolle mit 85 Jahren.
07.12.1904 Es gerät Maschinenbesitzer Vinzenz Beinert in die Dreschmaschine und es werden ihm beide Beine zerschmettert.
31.08.1905 † Anton Kobolle mit 19 Jahren.
12.05.1908 Trauung in Theresienstadt: Therese Baum aus Theresienstadt und Franz Ramsch, Kaufmann in Molschen.
24.04.1912 † Marie Wurbs, geb. Krombholz, mit 37 Jahren.
04.05.1912 Trauung in Liebeschitz: Anna Sentner und Robert Rößler, Lehrer in Molschen.
29.01.1913 Trauung in Molschen: Marie Kobolla und Adolf Tutte.
15.12.1913 † Wirtschaftsbesitzer Josef Palme mit 66 Jahren.
10.01.1914 † Wirtschaftsbesitzergattin Anna Kobolla, geb. Proboscht, mit 54 Jahren.
17.02.1914 Trauung in Molschen: Marie Herrmann und Franz Behr aus Brschehor.
28.08.1915 † Anna Diel mit 30(?) Jahren.
� Geschichte/Dauba
28.10.1915 Der Gemeindevorsteher wird in den Bezirksschulrat von Dauba gewählt.
05.12.1915 † Wirtschaftsbesitzer
Franz Kollowsky aus Molschen, in Raschowitz, mit 70 Jahren.
18.06.1916 † Rosina Woborschil mit 86 Jahren.
22.10.1916 † Wirtschaftsbesitzer Wenzel Kusebauch mit 80 Jahren.
23.11.1916 † Josef Wosazek (gefallen).
17.12.1916 † Korporal Schönfeld (gefallen).
31.02.1917 † Ausgedinger Wenzel
Görnert mit 84 Jahren.
01.08.1918 † Ausgedinger Wenzel Jarsch mit 69 Jahren.
17.11.1918 † Auszügler Ignaz Woborschil mit 81 Jahren.
22.11.1918 † Franz Jandausch mit 70 Jahren.
03.08.1920 Landwirtschaftliche Arbeiter in Molschen streiken.
24.08.1920 Der erste Hopfen mit

6.000 Kronen per Meterzentner wird verkauft.
05.10.1920 Hopfen wird zu 4.050 Kronen bis zu 4.100 Kronen verkauft.
21.03.1922 † Wirtschaftsbesitzer Franz Schulle mit 76 Jahren.
23.10.1923 † Gastwirt Wenzel Ullrich mit 76 Jahren.
05.03.1924 † Privatier Anton Tutte mit 77 Jahren.
10.04.1924 † Realitätenbesitzerin Antonia Palme.
10.08.1924 Enthüllung des Kriegerdenkmales in Molschen.
13.08.1924 † Josef Diehl mit 91 Jahren.
27.08.1924 Abschiedsfeier für Lehrer Straka.
28.08.1924 Man zahlt 1.600 Kronen für 50 Kilo Hopfen.
24.05.1925 Glockenweihe in Molschen.
� Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
95 Jahre
30.03.1928, Ingeborg Heil, geb. Haspel, früher Lobositz
18.03.1928, Richard Christen, früher Prosmik
10.03.1928, Anna Kretschmer , geb. Porsch, früher Molschen
08.03.1928, Eva Buschek, geb. Lerch, früher Maschnitz
07.03.1928, Dr. Marianne Schultz, geb. Ramisch, früher Leitmeritz
06.03.1928, Ernst Wünsch, früher Domaschitz
06.03.1928, Irene Klimt, geborene Schroder, fr. Auscha
03.03.1928, Helga Hocke, früher Drahobus
90 Jahre
25.03.1933, Brigitte Ruthsatz , geb. Brünnich, früher Molschen
16.03.1933, Ernestine Böhm, geb. Wolf, fr. Nieder-Sebirsche
Lobositz
25.03.1924, Elisabeth Ziep, geborene Schneider
27.03.1937, Wernfried Steinitz
07.03.1942, Hans Dedek
Malitschen
19.03.1936, Ingeborg Gänßle
Michelsberg
02.03.1929, Helga Kundt
03.03.1940, Franz Horn
Mladei
22.03.1932, Helga Dauer, geborene Reichelt
Molschen
15.03.1940, Annemarie Hiller, geborene Wurbs
Neuland
11.03.1922, Sophie Dennstedt, geborene Köcher
25.03.1927, Herta Hegenbarth, geborene Kühnel
Ober-Wessig
29.07.1925 † Franz Mattausch mit 73 Jahren.
28.08.1925 4.000 Kronen für 50 kg Hopfen werden gezahlt.
02.09.1925 4.150 Kronen für 50 kg Hopfen werden gezahlt.
14.12.1925 † Theresia Woborschil mit 78 Jahren.
06.01.1926 † Katharina Willner mit 90 Jahren.
04.11.1926 † Ausgedingerin Anna Schulle, mit 68 Jahren, in Polepp.
12.04.1927 † Theresia Kobolla, geb. Semsch, mit 89 Jahren.
06.05.1927 † Wenzel Hermann mit 72 Jahren.
23.09.1927 † Emanuel Löwy mit 69 Jahren.
27.02.1928 † Theresia Willner mit 72 Jahren. Mario Illmann,
Einsender: Sven Pillat
Zur Geschichte der Stadt Dauba
Dauba ist in der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts als Dorf gegründet worden.
Im 13. Jahrhundert wurde der Stadtturm (um den Marktplatz) von deutschen Zuwanderern errichtet. 1391 war Dauba bereits eine Stadt mit Marktgerechtigkeit und 1408 wurde hier eine Schule erwähnt. Die Einwohner waren in der Hauptsache Ackerbürger, leibeigen und fronpflichtig den Herren Berka von Duba und Lipa, dem mächtigsten Adelsgeschlecht Nordböhmens. Die Robotpflicht (Fron) erlosch erst mit der Aufhebung der Leibeigenschaft durch Josef II. (1781) und in ihren letzten Ü berresten 1848. 1744-1760 war der Bau der Daubaer Kirche, der dritten seit
� Mundart/Skalitz
dem Bestehen der Stadt. I n wirtschaftlicher Beziehung spielte der Hopfenbau und Hopfenhandel bis in die neueste Zeit eine wichtige Rolle. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte Dauba die größten Hopfenmärkte des Kontinents. Daubaer Hopfen und Daubaer Mohn, wegen seiner lichten Farbe als Bäckermohn geschätzt, waren von jeher wichtige Ausfuhrartikel. Dauba wurde mehrmals durch verheerende Brände heimgesucht, so besonders in den Jahren 1692 und 1845. Auch die Pest forderte mehrmals bedeutende Opfer (Pestfriedhof).
Einwohner: Dauba mit Rabsgraben, Kleinmühle, Roßpresse und Schwihof beherbergte 1893 in 258 Häusern 1.810 Einwohner.
Ai (S)kalitz
Wemma kenne Schule nouchmittich hottn, sainma imma draußn iebaroll rimmgerittn.
Ba i dar Kotze, bai dar Lorejte, uffn Satansbargl und mejchmou aa a in Puusch bai dar Aisiedelai. Uffte woorn die Kalitza Karlln aus dar Schule dabai.
Vornewag dar Tauschn Richad aus menna Klasse. Dou sainma halt hinda daan Willn ain Puusch gemocht, honn uns gehoscht oda Raiba und Schande geschpielt. Und wail ma aa olle enne Zwistl hottn, homma halt auf die Beeme gezielt, und wenn Aichkatzln dou woorn, aa uff die geschussn – obba nie getruffn. Wenn groode Schwemme gewoxn sain, homma aa die gesuchcht. Mier honn obba ock Lischkn und Herrnpilze gekannt.
A i Kalitz woor ju aa ee grußa Taich, vill grissa olls ai Schittenz
dar Taich bai Rupprichs Gosthause und Honsikns Lausche z somm. Obba dou homma mit langn Gertn ock klenne Schiffln fohrn lussn. Nouch Porschn saima hechstns mou gangn, wemma uff n Roobnstejn zunn Schpieln gang sain. Dar Bruda vun Erhard Fujera woor zwoor su alt wie iech und aa ai menna Klasse, obba dou hobb iech kenne Arinnarung. Bejde gibt‘s aa nimmej.
Woss zun Schmunzln
Die Gretl iss no nie lange ai dar Schule. Jetz sull se Werta schraibn mit hindn „en“, wie assn, schpieln, lasn und suu. Die Annl, bissl elda, die houts faustdicke hindan Ohrn, soht: „Iech half dar ee bissl.“ Und dou sohtse: „Schraib halt mou: einen –sausen– lassen!“ Georg Pohlai
Im Jahre 1930 zählte Dauba 1.417 und 1939 1.461 Einwohner. Brauchtum: Zu den Festzeiten besonderes Gebäck: Weihnachtsstriezel, Faschingskrapfen, Osterbrot, Pfingstkuchen. Weihnachten: Bleigießen. An Ostern, wenn die Glocken schwiegen, durchzog eine Schar von Kindern mit Klappern und Schnarren die Stadt, um das Läuten zu ersetzen. Am Gründonnerstag gingen die Kinder, in Sprüchen um Gaben bittend, in die Häuser. Beim Ausläuten der Faste (Ostern) schüttelte man die Obstbäume, damit sie reichlich Früchte legten. Nach dem Palmsonntag steckte man geweihte Palmzweige (Salweide) zum Schutze gegen Schäden in die Saaten Sehenswürdigkeiten: Daubas

� Mundart/Schüttenitz
katholische Kirche „Kreuzerhöhung“, 1744-1760 im spätitalienischen Stil er r ichtet. Als Baumeister vermutet man Anselmo Martino Lurago (1701-1765), den Schwiegersohn und Mitarbeiter des berühmten Kilian Ignaz Dientzenhofer. Die Dreifaltigkeitssäule auf dem R ing zur Erinnerung an die Pest im Jahre 1680.

15.03.1933, Johanna Wricke, geb. Schiele, früher Malitschen
11.03.1933, Lydia Wittenburg , geb. Kirsch, früher Neu Kaliß
85 Jahre
23.03.1938, Bruno Schindelka, früher Auscha
02.03.1938, Irene Elies, geb. Liehmann, früher Leitmeritz 75 Jahre
04.03.1948, Margit Schubert, früher Leitmeritz
Auscha
14.03.1931, Peter Walter
21.03.1934, Erwin Richter
Gastorf
06.03.1921, Margarete Kutschka, geborene Patzner
02.03.1930, Henriette Simon, geborene Proksch
Graber
02.03.1940, Gerda Langer, geborene Werner
Groß-Tschernosek
04.03.1942, Peter Mühle
Hermsdorf
03.03.1931, Helmut Tille
Julienau
03.03.1931, Hertha Fietzek, geborene Klimpel
Leitmeritz
14.03.1925, Maria Auffermann, geborene Patzelt
16.03.1929, Henriette Strimaitis, geborene Kuhn
15.03.1931, Doris Paasche, geborene Sputh
29.03.1931, Barbara Nebermann, geborene Guthke
09.03.1936, Erhard Nowak
25.03.1936, Richard Heidrich
11.03.1940, Karin Sand, geborene Vielgut

31.03.1936, Wilhelm Püschel
Pitschkowitz
09.03.1930, Eduard Hofmann
03.03.1937, Hedwig Mitter
Pohorschan
09.03.1934, Margit Scharrer, geborene Seemann
Polepp
31.03.1937, Gottfried Ramsch
Radaun
09.03.1934, Maria Hobeck, geborene Patz
Robitsch
28.03.1944, Waltraud Mainka, geborene Beck
Salesel
12.03.1939, Horst Arlt
Schüttenitz
07.03.1936, Edwin Storch
12.03.1934, Ingeborg Kamann, geborene Trojan
Sebusein
29.03.1939, Ewald Fanta
Skalitz bei Schüttenitz
03.03.1935, Karl Hille
Skalitz bei Lobositz
09.03.1937, Franz Zimmermann
Taschow
01.03.1936, Helene Weindl, geborene Wilhelm
Tschakowitz
30.03.1931, Gertrud Burkard, geborene Schneider
Tschischkowitz
06.03.1931, Helga Rehnicke, geborene Jablonsky
Tupadl
12.03.1936, Maria Zimmermann, geborene Strotzer
Wedlitz
16.03.1927, Maria Bartl, geborene Knechtel
28.03.1932, Sieglinde Lau, geborene Franz
Zahorschan
02.03.1946, Herbert Süssemilch
04.03.1947, Hermann Seger
Lewin
18.03.1929, Anton Maier
Liebeschitz
17.03.1934, Elisabeth Köhler, geborene Schubert
24.03.1940, Gunther Weber
Litschnitz
19.03.1954, Marie-Luise Miller, geborene Bender
Die Festmasse
Josef Grunert hat das Gedicht nach dem Dialekt vor 1896 verfasst und Georg Pohlai hat es aus seiner Erinnerung in die Sprechweise der 30er und 40er Jahre übertragen.
Dar Teich Willi und iech sain uns eejnig, doss iss ai Schittenz possiat.
Ai enn Dorfe woorn de Pauan olle musikalisch goor, toutn uffn Sunntich lauan, denn dou gongs uffs Karchn-Chor.
Blusn tichtich di Trumpejtn, strichn Gaig und Rumplboss, Pumpatoon und aa Klanejtn heert ma ohne Undaloß.
Uff dar Orgl soß dar Kanter, dar zug zwelf Regista raus, saine Aagn ni vawndt'r, glutzte wie doss Ejchltaus. Ejmou woor zunn Karchnfeste gruße Masse ai-schtudiert; klappn sullte olls uffs beste, draimou worsche
durchprobiert. S Credo woor e schweres Bissl, ofongs hout ganz hibsch geflackt, dann verlurn poor n Schlissl, andre fondn nie n Takt. Denn bai goor suu villn Noutn wurdn olle ganz vawarrt, ville, die nie ocht gaan toutn,
honn woss folsches naigeplarrt. Su woorn olle durchennada, s pfief und quietschte farchtalich, wockln tout schunn doss Galanda, Kantar bieß vor Golle siech. Dou, uff ejmou woom se schtille, sohgn rimm und heertn auf, Laite, mit und ohne Brille, gucktn schunn zunn Chore nauf.
Bain Oltor sugoor dar Pater, mochte schunn ee schiech Gesicht, Schustaseff, dar Bolkntratar, kimmt vawundat vier und schpricht: "Woss, hout ihr jetz imgeschmissn und vakokart ganz und goor?"
Ausflüge: Felsendorf Draschen, Schloß Hauska, Burg Bösig, Ruine Altperstein, Liboch an der Elbe, Wüstes Schloß, Burgruine Habichtstein, die Burg Kokorschin mit dem Kokorschiner Tal und vor allem die Daubaer Schweiz mit zahlreichen Naturschönheiten. Quelle: Sudetenland. Doppelband 17/18 der Reihe „Die Deutschen Heimatführer“, 1939. Helmut Hoffmann 16.09.2022 Alois Schubert
Kanter brillt: "Du warschts wull wissen, doss 's ee schweres Credo woor!" Schusta schpricht: "Doss iss zunn Plotzn, s konn ju ni zusomm nschtimm, Ia tut schunn ain Credo poptzn, und iech loutsche no ain Gloria rim."
Josef Grunert aus Schittenz, Georg Pohlai (Foto und Text)
02.03.1931, Erika Liedloff, geborene Tattermann
Tschersing (Vater)
03.03.1954, Helga Seel, geborene Weihrauch � Poesie
Krieg
Ein besonders schrecklich Wort, wir haben‘s öfter schon erlebt. Krieg bedeutet immer Mord, wenn ringsherum die Erde bebt.
Individuen, die Kriege machen, haben weder Skrupel noch Verstand, sonst wäre ihnen ein Kinderlachen angenehmer als Bombenhagel über dem Land.
� Unseren Toten zum ehrenden Gedenken
