Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung


VOLKSBOTE HEIMATBOTE





Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft






Jahrgang 75 | Folge 10 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 10. März 2023
� Weltweit renommierter Klimaexperte rechnet mit deutlich höherem Aufwand beim Anbau von Hopfen und Wintergerste
Neudeker
FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
B 04053
B 04053
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland
In eigener Sache! Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.
daß eine Weiterführung der Helmut Preußler mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG

Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
72. JAHRGANG Dezember 2022 FOLGE 11
� Streit im Parlament
370 Änderungsanträge und Redebeiträge, die Stunden andauerten: Mit allen parlamentarischen Tricks hat die Opposition mit einer fünftägigen Dauerdebatte versucht, die von der Fiala-Regierung eingebrachte Rentenpassung zu verhindern. Bislang ohne Erfolg.
Laut Gesetz hätte die Durchschnittsrente im Juni um 1770 Kronen (74 Euro) steigen müssen. Mit einer Gesetzesnovelle hat die Regierung von Premierminister Petr Fiala den Anstieg jetzt aber auf 760 Kronen (32 Euro) gekürzt, um den angespannten Staatshaushalt nicht weiter zu belasten.
Die beiden Oppositionsparteien, die populistische Ano und die rechtsradikale SPD, deren Wählerpotentiale überwiegend aus Rentnern mit geringem Einkommen bestehen, hatten erbitterten Widerstand angekündigt und versuchten im Parlament mit einer Rekordzahl an Änderungsanträgen und stundenlangen Redebeiträgen das Gesetz zu verhindern.
Aber auch die Regierungskoalition von Premierminister Petr Fiala griff tief in die parlamentarische Trickkiste und behandelte die Gesetzesnovelle im „beschleunigten Verfahren des legislativen Notstands“.
Nach fünf Tagen Dauerstreit wurde die Novelle dann verabschiedet. Das letzte Kapitel dürfte dennoch noch nicht gesprochen sein. Als nächstes befaßt sich der Senat mit der Causa. Und Karel Havlíček, Ano-Abgeordneter aus Budweis, kündigte bereits den nächsten Schritt an: „Wir werden Verfassungsbeschwerde einreichen.“ TF
VOLKSBOTE






Beim Bierpreis hört der Spaß auf – da waren sich die Menschen in Bayern und Böhmen schon immer einig. Spätestens seit 1844 gilt in beiden Bierregionen die politische Regel: Eine deutliche Preiserhöhung übersteht keine Regierung.
An jedem Stammtisch ist das Bier-Waterloo von Bayerns König Ludwig I. bekannt. Als der Kini im März 1844 eine Erhöhung des Bierpreises um einen Pfennig ankündigte, kam es in München umgehend zu Ausschreitungen. Und die Soldaten, die der Monarch gegen die Bürger in Marsch setzte, verweigerten den Befehl. Folge: Ludwig I. mußte nicht nur die Bierpreiserhöhung kassieren, sondern im Münchner Hofbräuhaus das Bier um 25 Prozent billiger anbieten, „um dem Militär und der arbeitenden Klasse einen gesunden und wohlfeilen Trunk zu bieten“.
Die erste Bierrevolution war somit ein Erfolg.
Auch in Tschechien sind die Bürger beim Bierpreis spaßbefreit. Mit einem Konsum von über 130 Litern Bier im Jahr sind die Tschechen BierWeltmeister und jede Erhöhung schmälert das Haushaltsbudget entsprechend stark.
Allein im Januar betrug die Inflation in Tschechien schwindelerregende 17,5 Prozent. Insbesondere die Energiekosten explodieren, weil Tschechien zusätzlich zu den anderen EU-Staaten noch unter einer schwächelnden Krone leidet.
Beim Bierbrauen wird viel Wärme und viel Kälte benötigt.
Brauerei sind demnach energieintensive Unternehmen. Hinzu kommen höhere Kosten für Rohstoffe und Transport. Doch es könnte noch schlimmer kommen, weitaus schlimmer.
„Im Zuge des Klimawandels kann sich der Bierpreis bis 2050 verfünffachen. Vielleicht auch schon viel früher, je nachdem, wie schnell wir fossile Brennstoffe verbrennen und wie schnell die globale Erwärmung voranschreitet“, warnt Prof. Dr. Dabo Guan gegenüber der Sudetendeutschen Zeitung
Der weltweit renommierte Experte forscht auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels, lehrt an mehreren Universitäten und ist unter anderem Chefberater für die Koordination der internationalen Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich Klimawandel.

Hopfen und Wintergerste, die
beiden wichtigsten Zutaten des Bieres, seien besonders klimaanfällig, erklärt Guan, der nur wenig Hoffnung hat, daß uns das Bier auch in Zukunft noch mundet: „Biotechnologieunternehmen arbeiten an gentechnischen Lösungen zur Verbesserung der Dürre- und Hitzestreßresistenz von Kulturpflanzen, allerdings kann die Qualität der Kulturpflanzen darunter leiden. Mit anderen Worten: Der Geschmack des Bieres wird anders sein. Die beste Lösung wäre es, so schnell wie möglich weltweit Netto-NullEmissionen zu erreichen.“
Besonders in der Region Saaz, wo seit dem 11. Jahrhundert Hopfen angebaut wird, ist man alarmiert, schließlich gibt der Saazer Hopfen dem weltberühmten Pilsner Urquell seine unverwechselbare Note. Hier versucht man bereits mit High Tech die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen und setzt da-
bei auf eine Kooperation mit dem Softwareriesen Microsoft. „Im Jahr 2021 haben wir das Projekt Pro CHMEL ins Leben gerufen, bei dem wir mit dem Hopfeninstitut, dem Hopfenanbauverband und Microsoft zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Auswirkungen des Klimawandels und der Wetterschwankungen auf den Hopfenanbau mit moderner Technik zu überwachen“, erklärt Zdeněk Kovář, Pressesprecher der Pilsner-Urquell-Brauerei.
Dabei werden mit speziellen Sensoren, den so genannten Hopfen-EKGs, Witterungsschwankungen sowie die Menge an Feuchtigkeit und Nährstoffen im Boden überwacht.
Ab diesem Jahr sollen die Hopfenbauern eine App erhalten, die darüber informiert, wann und wie sie den Hopfen effizient bewässern und dabei das knappe Wasser sparen können. Torsten Fricke
� „Tschechisches Bier ist in Symbol des Nationalstolzes “ Böhmische Bierkultur soll Weltkulturerbe werden
„Tschechisches Bier ist ein Symbol des Nationalstolzes, und die tschechische Bierkultur ist ein weltweites Phänomen. Deshalb bemüht sich der tschechische Brauerei- und Mälzereiverband um die Aufnahme der tschechischen Bierkultur in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco“, erklärt Zdeněk Kovář, Pressesprecher der weltberühmten Pilsner-Urquell-Brauerei.
Im ersten Schritt werde die Eintragung auf regionaler Ebene beantragt, also in die Liste der immateriellen Güter der traditionellen Volkskultur der Region Pilsen. Im zweiten Schritt soll dann die Eintragung auf nationaler Ebene folgen, was eine Grundvoraussetzung ist, damit das Kulturministerium im dritten Schritt den Antrag an die Unesco stellen kann.
„Zum jetzigen Zeitpunkt läßt sich jedoch noch nicht abschätzen, wann die tschechische Bierkultur in die Unesco-Liste des
immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden könnte“, so Kovář zur Sudetendeutschen Zeitung Der Brauereiverband schätzt, daß ab 2026 die Eintragung erfolgen könnte – also rechtzeitig vor dem 185. Jubiläum des Pilsners. Das berühmte Untergärige war weltweit erstmals am 11. November 1842 in Pilsen ausgeschenkt worden. Gebraut hatte es übrigens ein Niederbayer, der Braumeister Joseph Groll aus Vilshofen.
Zu Ehren des Gerstensaftes entsteht derzeit in Prag das „Erlebniszentrum Pilsner Urquell“, das in der zweiten Aprilhälfte eröffnet werden soll. Kovář: „Es wird ausländischen Touristen und tschechischen Bierliebhabern eine interaktive Erlebnisausstellung bieten, die sie durch die Geschichte des Bierbrauens und insbesondere durch die Geschichte und Gegenwart des legendären Pilsner Lagerbiers führen wird.“ TF

Böhmen und Bier: Mit über 130 Litern pro Jahr sind die Tschechen Bier-Weltmeister. Foto: Pilsner Urquell
� Pilotprojekt in der Hallertau könnte auch in Böhmen Schule machen Sonnenschutz mit Photovoltaik
Wie in der Region Saaz so spürt man auch in der Hallertau, Deutschlands größtem Hopfenanbaugebiet nördlich von München, die negativen Auswirkungen des Klimawandels.
Als Gegenmaßnahme wird dort in diesem Sommer ein Pilotprojekt gestartet, das nicht nur den Hopfen schützt, sondern gleichzeitig grünen Strom liefert.
Hopfen reagiert sehr empfindlich auf zu viel Sonne, erklärt Dr. Bernhard Gruber, einer der Initiatoren von AgrarEnergie. Die ersten Versuche, ähnlich wie
bei Terrassen mit Markisen den Hopfen zu schützen, scheiterten schnell.
„Der Hopfen wächst bis zu sechs Meter hoch. Keine Markise könnte einem Sturm Stand halten“, erklärt Gruber.
Die Lösung, die derzeit in Neuhub bei Au in der Hallertau installiert wird, ist ohnehin überzeugender: Photovoltaiksenso-

ren in Röhren. Der Hopfen wird dadurch teilweise beschattet und ist vor zu viel Sonne, Starkregen und Hagel geschützt. Gleichzeitig produzieren die PhotovoltaikRöhren grünen Strom.
Gruber: „In der Hallertau wird auf rund 17 200 Hektar Hopfen angebaut. Würde man diese gesamte Fläche mit den Photovoltaik-Röhren überbauen, könnte man dadurch ein Kernkraftwerk ersetzen.“
Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Hochschule in Weihenstephan und dem Fraunhofer-Institut. TF

Die tschechische Wikipedia behauptet, daß der Gründer der Prager Blindenanstalt, Dr. Alois Klar, „ein tschechischer Philologe und Philanthrop“ war, was eindeutig nicht stimmen kann, da er 1763 in Auscha (Úštěk, Foto unten links) im Bezirk Leitmeritz geboren wurde, wo sich sogar noch in der Zwischenkriegszeit fast alle Einwohner zur deutschen Nationalität bekannten.
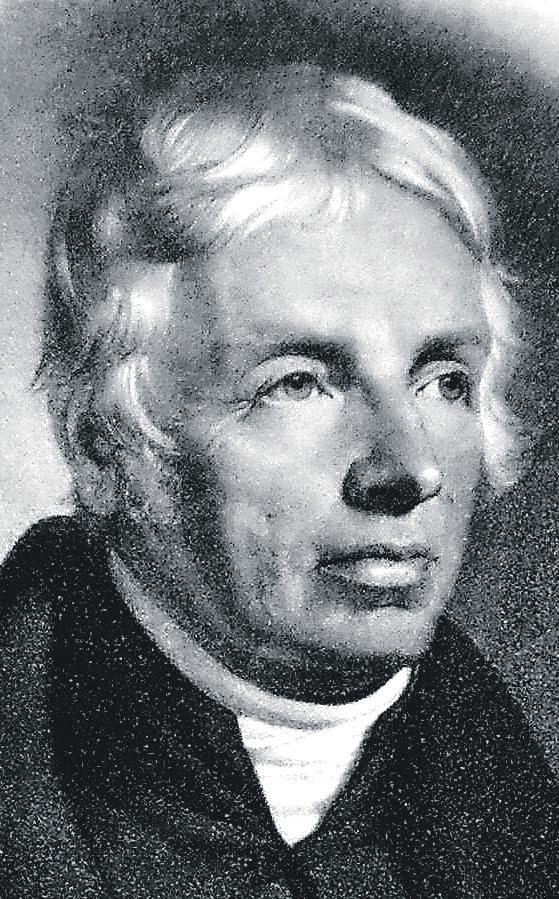
Klars Arbeit, die ganz besonders den bedürftigen Blinden galt, wurde von seinem Sohn Paul Alois Klar fortgesetzt. Dieser wurde durch seine eigene großzügige karitative Tätigkeit in der Hauptstadt sehr beliebt. Die blaue Gedenktafel am Haus, das sich nicht weit vom Prager Sudetendeutschen Büro be ndet, erinnert an Vater und Sohn.

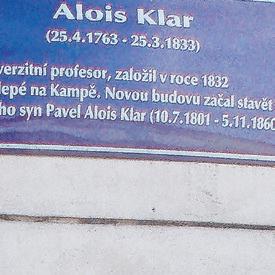
Pauls Name wurde hier zu „Pavel“ geändert, aber das Haus dient bis heute seinem ursprünglichen Zweck (Foto rechts).


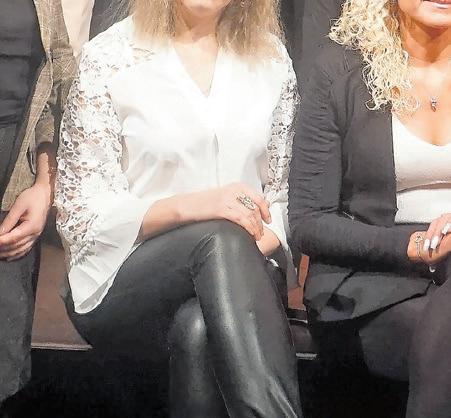



Viel bekannter ist bei den Pragern die sehr verkehrsbelebte Stra-

ße „Klárov“, wo sich mehrere Straßenbahnlinien an der UBahnhaltestelle Malostranská kreuzen, das zeigt auch die rote Tafel ganz oben auf dem Bild. In der Vergangenheit hatte Klárov auch den deutschen Namen Klarplatz.

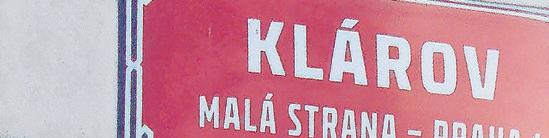
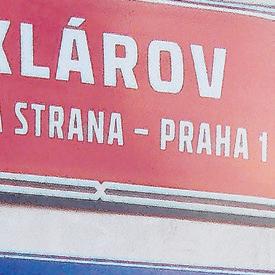

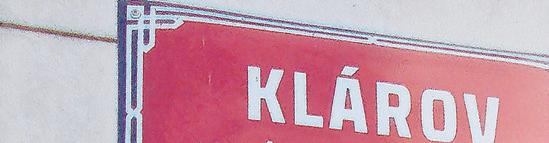
SL-Büroleiter Peter Barton wollte mit diesem Bericht den sudetendeutschen Gründer Alois Klar ehren, der vor 190 Jahren, am 25. März 1833, in Prag verstorben ist. Sein Werk dient der tschechischen Ö entlichkeit bis heute.
Was lange währt, wird endlich gut: Neun Jahre nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hat die tschechische Biathlon-Staffel der Frauen jetzt nachträglich die Bronzemedaille erhalten. Der Grund: Die russische Staffel, die ursprünglich Silber gewonnen hatte, ist mittlerweile des Dopings überführt und disqualifiziert worden. Die vier Tschechinnen Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová und Eva Puskarčíková erhielten ihre Bronzemedaillen während des Biathlon-Weltcups am Wochenende in Neustadtl in Mähren.
Petr Pavels



zi-Mörders Reinhard Heydrich durch tschechische Kommandosoldaten, die bis April verlängert wurde. Größtes Projekt in diesem Jahr ist die Sonderausstellung „Barock in Bayern und Böhmen“, die ab Dezember zu sehen sein wird.

Fotos: Wikipedia/ PeterBarton
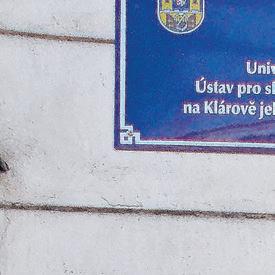
❯ Beauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf initiierte Empfang für den Alt-Ministerpräsidenten




Als ehemaliger Fallschirmjäger und passionierter Motorradfahrer gehörte das Wort Zögern noch nie zu seinem Wortschatz: Petr Pavel, Ex-General und seit Donnerstag frisch vereidigter Staatspräsident, will in den kommenden 100 Tagen alle Nachbarländer Tschechiens sowie EU und Nato in Brüssel besuchen. Zudem plant Pavel einen Staatsbesuch in die Ukraine. Mit den Reisen wolle er zum Ausdruck bringen, daß „die Tschechische Republik auch auf Ebene des Staatspräsidenten wieder eine aktive Außenpolitik betreibe“, erläuterte Petr Pavel – was durchaus als deutliche Kritik an Amtsvorgänger Miloš Zeman verstanden werden kann. Seine erste Reise führt das neue Staatsoberhaupt traditionell in die Slowakei. Danach besucht Pavel Polen und am 21. und 22. März Deutschland. Im Mai sollen dann Österreich und Ungarn an der Reihe sein.


Tschechiens Premierminister Petr Fiala (ODS) und Außenminister Jan Lipavský (Piraten) haben zur Freilassung des weißrussischen Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki aufgerufen. Dieser war am Freitag in Minsk zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil ihm „Schmuggel und die Finanzierung öffentlicher Unruhen“ vorgeworfen wurden. Fiala bezeichnete die Gerichtsverhandlung gegen Bjaljazki und weitere Bürgerrechtler als „Schauprozeß“ des weißrussischen Machthabers Alexander Lukaschenko und forderte die Freilassung der politischen Gefangenen. Lipavský bewertete die Verurteilungen als „Spitze des Zynismus und weiteren Akt des Unrechts durch das Lukaschenko-Regime“. Die Wahrheit lasse sich aber nicht zum Schweigen bringen, so der tschechische Außenminister.

Schneckenbahn
München – Prag




Zwölf Jahre, von 2010 bis 2022, war Volker Bouffier hessischer Ministerpräsident und ein verläßlicher Ansprechpartner für die Vertriebenen. Da sein Abschied im vergangenen Jahr coronabedingt nur in einem kleinen Kreis stattfinden konnte, hat die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, jetzt die Initiative ergriffen und ein Dankestreffen mit den Vertretern der Landsmannschaften und der Vertriebenenverbände organisiert.
Der Wunsch nach einem solchen Treffen sei in den letzten Monaten des Öfteren aus dem Kreise der Vertriebenenverbände an sie herangetragen worden, erklärte die Landesbeauftragte ihr Engagement. Der Grund: Das letzte Treffen mit Volker Bouffier fand mit ausgewähltem Adressatenkreis beim Hessischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation und zentralem Tag der Heimat des BdV in Schloß Biebrich im September 2021 statt. An diesem Tag hatte Volker Bouffier letztmalig die Festrede gehalten. Wegen der zu diesem Zeitpunkt strengen Corona-Auflagen konnten damals nur wenige Vertreter der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler am Gedenktag teilnehmen.





Das traditionelle Jahresgespräch des Ministerpräsidenten mit den Verbänden der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler mußte auf Grund der Pandemie seitdem ebenfalls entfallen.
„Es freut mich sehr, daß es
Alt-Ministerpräsident Volker Bou er im Kreis der Vertreter der Vertriebenenverbände und Landsmannschaften. Initiiert hatte das Tre en die Beauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf. Fotos: HMDIS Hessen
gelungen ist, ein persönliches Abschiedstreffen mit unserem ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier in der stimmungsvollen Atmosphäre des Theaters im Pariser Hof hier in Wiesbaden zu organisieren. Die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler in Hessen haben Volker Bouffier viel zu verdanken, daher konnte ich den Wunsch nach einem solchen Abschiedstreffen sehr gut nachvollziehen und habe gerne, gemeinsam mit meiner Stabsstelle, die Vorbereitung des Treffens übernommen“, sagte Margarete Ziegler-Raschdorf in ihrer Begrüßung. An dem Treffen nahmen unter anderem Mitglieder des BdVLandesvorstandes und der BdVKreisverbände teil, die Vorsitzenden der Landsmannschaften sowie die Projektleiterinnen der Begegnungs- und Beratungsstellen für Spätaussiedler. „Die Hessisches Landesregierung hat die Gedenk- und Kul-



turarbeit der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler immer gerne und gut gefördert und unterstützt und tut dies auch weiterhin. Denn wir alle wissen, was das Land Hessen gerade den Heimatvertriebenen zu verdanken hat. Ich schätze sehr, daß der Bund der Vertriebenen, aber auch die Landsmannschaften und Vertriebenenverbände ganz allgemein den Mut finden, neue Wege zu beschreiten, um an das Schicksal von Heimatvertriebenen und Spätaussiedlern zu erinnern. Seien es Digitalportale, Videos und Podcasts oder auch digital erfaßte Heimatstuben, die man sich im Internet anschauen kann – all dies mag dazu beitragen, auch jüngere Generationen auf diesen Teil der deutschen Geschichte aufmerksam zu machen“, betonte Alt-Ministerpräsident Volker Bouffier.
Weiterhin machte Bouffier deutlich, daß auch über 75 Jahre nach Flucht und Vertreibung das Thema eine große gesellschaftli-
che Bedeutung habe und gerade im Hinblick auf den nun schon seit über einem Jahr andauernden Angriffskrieg Rußlands auf die Ukraine leider aktueller sei denn je.
Die Vertreter der Landsmannschaften und Verbände nutzten die Gelegenheit des Treffens, um sich mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten und der Landesbeauftragten über aktuelle politische Themen auszutauschen, vor allem aber, um sich bei Volker Bouffier persönlich für seinen jahrelangen Einsatz für ihre Interessen herzlich zu bedanken.



Vom Bund der Vertriebenen ist Bouffier bereits mit der Ehrenplakette für das Jahr 2020, der höchsten Auszeichnung des BdV, geehrt worden.
BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius sagte damals in seiner Laudatio am 26. November 2021: „Volker Bouffier hat sich in besonderem Maße um die vom Bund der Vertriebenen vertretenen Menschen und deren Anliegen verdient gemacht. Es ist insbesondere seinem persönlichen Einsatz zu verdanken, daß die traditionell in fruchtbarem Boden wurzelnde vertriebenenpolitische Arbeit im Land Hessen in den letzten Jahren sowohl noch tiefere Wurzeln schlagen als auch frisch austreiben konnte.“
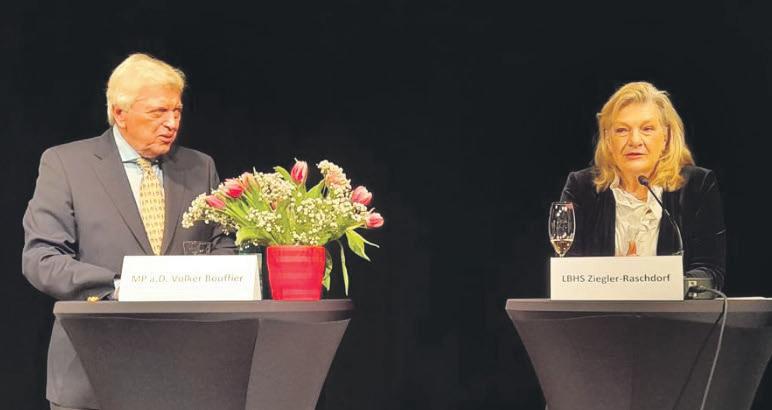





Bei allen hessischen Projekten zum Thema sei „die Handschrift eines Ministerpräsidenten und eines Menschen erkennbar, der ganz selbstverständlich überzeugt davon ist, daß Flucht und Vertreibung zur gesamtdeutschen Geschichte gehören“, lobte Fabritius das nachhaltige Engagement.
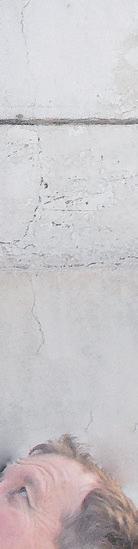




Über eine Million Menschen haben im vergangenen Jahr das Nationalmuseum in Prag besucht. Man habe bewiesen, daß ein Museumsrundgang aktuell und interessant sein könne, sagte der Leiter der Institution, Michal Lukeš. Eine der am besten besuchten Sonderausstellungen thematisiert die erfolgreiche Ausschaltung des Na-

Die Bahnfahrt zwischen München und Prag dauere genauso lang „wie zu Zeiten von Kaiser Franz-Joseph und König Ludwig I.“, hatte Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, bereits 2016 in einem Interview mit dem Bayernkurier geklagt. Passiert ist seitdem nichts, aber jetzt gibt es zumindest Hoffnung. Die Bahnstrecke zwischen Pilsen und München soll beschleunigt modernisiert werden, haben der tschechische Verkehrsminister Martin Kupka (ODS) und sein deutscher Amtskollege Volker Wissing (FDP) am Freitag in Berlin vereinbart. Ein entsprechendes Memorandum beider Staaten soll demnach bis Ende dieses Sommers ausgearbeitet werden. Derzeit braucht der Zug für die 430 Kilometer lange Strecke von München über Pilsen nach Prag rund fünfeinhalb Stunden.
ISSN 0491-4546


Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.



Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de


Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

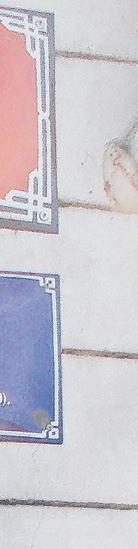
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.


Das von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte „Manifest für Frieden“ hat auch in der Tschechischen Republik Besorgnis über die künftige Haltung der deutschen Öffentlichkeit zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst. In einem Gastkommentar, der ursprünglich in der Zeitung
Die Welt erschienen ist, erklärt Tschechiens Botschafter in Berlin, Tomáš Kafka, seine Besorgnis.
Von Botschafter Tomáš Kafka
Wir Tschechen blicken auf eine schmerzhafte Geschichte mit Deutschland zurück. Umso unverständlicher ist mir der Erfolg von Alice Schwarzers jüngstem Ukraine-Manifest: Was ist nur aus der deutschen Spezialdisziplin geworden – der Tugend, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen?
Eines sollte vorneweg unmißverständlich geklärt werden. Manifeste als Genre gehören in jede zivilisierte Gesellschaft. Das Gleiche gilt auch für das Recht, Manifeste zu verfassen oder zu unterschreiben. Dieses Recht ist sowohl im politischen als auch im kulturellen Bereich unantastbar, egal wie klug, inspirierend oder auch provokativ und kurzgedacht sie sein mögen.
Ich selber hatte das Vergnü-
� Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka zum „Manifest für Frieden“
gen, etliche Manifeste selbst mitzutragen, und zwar sowohl vor der politischen Wende in meinem Land als auch danach. Unter diesen Manifesten findet sich übrigens auch eines, das fordert, daß Tschechien wieder eine Monarchie werden sollte.
Ob ich es wieder tun würde, ist schwer zu sagen. Tatsache ist, daß mich heute mit dem Blick auf die aktuelle Weltlage eher andere Sorgen umtreiben. Ich denke dabei vor allem an den russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin mit dieser Sorge sicher nicht allein. Davon zeugt unter anderem die Debatte, die in Deutschland in Bezug auf das „Manifest für Frieden“ entflammte. Es ist zwar schon eine Weile her, daß dieses Manifest veröffentlicht wurde, doch es schlägt immer noch hohe Wellen – nicht nur in der Medienlandschaft. Dieses Manifest darf daher nicht auf die leichte Schultergenommen werden, auch nicht im europäischen Ausland. Das Manifest mit seiner Aufforderung, Waffenlieferungen zu stoppen, wendet sich zwar an
� Internationaler Wirtschaftsrat tagte im Auswärtigen Amt
den Bundeskanzler, aber als jemand, der sich als europäischer Partner, Nachbar und Freund Deutschlands versteht, möchte auch ich mich dazu äußern. Das scheint mir für mein Land und mich wichtig zu sein. Ich hoffe, daß mich die inzwischen langwierige, feste und aufrichtige Partnerschaft zwischen
Deutschland und seinen Nachbarländern dazu berechtigt, ganz kurz auf das „Manifest für Frieden“ zu reagieren – auch wenn ich nicht gefragt wurde. Ich verspreche, daß ich mich kurzfassen werde.
Zuvor muß ich aber noch eine Bemerkung loswerden. Vaclav Havel, der einstige Präsident
Unter der rhetorischen Frage „Tschechien – ein Land mit Potential?“ hat der Internationale Wirtschaftsrat (IWR) zu einer Diskussionsrunde ins Auswärtige Amt eingeladen.
Mit dabei waren Botschafter
Tomáš Kafka und sein Wirtschaftsattaché Ondřej Karas, der stellvertretende Vorsitzender der Parlamentariergruppe SlowakeiTschechien-Ungarn, MdB Jörg Nürnberger (SPD), der Verkaufsmanager der Jekko Deutschland GmbH, Carsten Bielefeld aus Herne und der geschäftsführende Vorstand der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Wirtschaftsvereinigung, Georg Weißler aus Frankfurt am Main. Die Moderation übernahm die Wirtschaftsjuristin und Dolmetscherin Anna Stvrtecky, die in Asch geboren wurde, über 20 Jahre in Preßburg gelebt und sudetendeutsche Wurzeln hat.
In seinem Eingangsstatement verwies Botschafter Kafka auf die besonderen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Tschechien und Deutschland. Das Handelsvolumen betrage mittlerweile 120 Milliarden Euro, Platz zehn in den Außenwirtschaftsbeziehungen Deutschlands. Im Zuge der Energiewende käme es jetzt darauf an, die guten Wirtschaftsbeziehungen erfolgreich in das digitale Zeitalter zu überführen.
Kafka: „In der Zeit unserer EU-Ratspräsidentschaft haben wir immer gesagt: Visionen ja, aber mit Augenmaß.“
Jörg Nürnberger, der nur 25 Kilometer von der tschechischen Grenze aufgewachsen ist, beschrieb seine Heimat, das Fichtelgebirge, als viel näher zu Prag als zu Frankfurt, München oder Berlin gelegen. Er habe in Bayreuth studiert und dort die tschechische Sprache erlernt, das hätte ihm nach dem Mauerfall sehr
genützt. Die Tschechische Republik sei ein Land mit hohen kulturellen Standards, er sei seit über 20 Jahren mit einer Tschechin verheiratet und habe zwei Kinder, die zweisprachig aufwachsen. Nürnberger: „Sie sehen daran, daß unsere Beziehungen in Mitteleuropa sehr eng und intensiv werden können und auch auf Dauer angelegt sind.“
In seiner Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt habe er, so berichtete Nürnberger, verschiedene Phasen erlebt. Am Anfang eine gewisse Goldgräberstimmung, mit günstigen Anbindungen und niedrigen Arbeitskosten, aber auch großen Turbulenzen, dann eine gewisse Konsolidierung, die heute in eine Wirtschaft mündet, die vor allem in Lieferket-
ten europäischen Unternehmen zuarbeitet. Jetzt stehe Tschechien aber vor der Herausforderung, die Wertschöpfung mehr ins eigene Land zu transferieren.
Nürnberger: „In Tschechien gibt es hervorragende Ingenieure und Wissenschaftler, auch in der Grundlagenforschung. Beispielhaft ist die Nanotechnologie, in der Tschechien Weltspitze ist.“
Er beobachte, so der Bundestagsabgeordnete, auch die Rückkehr von Produktionen aus Südostasien oder China nach Europa. Er, so erklärte der SPDBundestagsabgeordnete, mache gern für Tschechien als Standort Werbung, zumal erst die kürzlich stattgefundenen Präsidentschaftswahlen zeigten, daß
meines Landes, versuchte in den 1990er-Jahren die längst fällige deutsch-tschechische Versöhnung endlich voranzubringen. Er wollte definieren, was Deutschland für uns in Tschechien bedeutet. Er benutzte damals zwei Begriffe. Schmerz und Inspiration. In den folgenden zwanzig Jahren ist es uns, dank des unermüdlichen Einsatzes auf beiden Seiten, gelungen, den Schmerz zu minimieren und die Inspiration sogar zu verstärken.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Inspiration bestand in der Art und Weise, wie sich die deutsche Gesellschaft mit der eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt hat.
Die Vergangenheitsbewältigung, um es etwas salopp zu sagen, war aus unserer Sicht im Laufe der Jahre zur deutschen Spezialdisziplin geworden. Wir waren froh, daß wir uns immer wieder von Deutschland etwas abschauen konnten, egal wie schmerzhaft es für uns auch sein mochte.
Nun zurück zu dem Manifest. Ich will nicht ungerecht sein,
muß aber sagen, daß ich bei der Lektüre zwar Hinweise auf die Kriegsgeschichte im Allgemeinen finde, doch so gut wie gar nichts, was man als Lehre aus der modernen europäischen Geschichte verstehen könnte. Man findet kaum eine Unterscheidung zwischen Tätern und Opfern und liest auch keinen Appell, daß man auch diesmal den Anfängen – die eindeutig aus Putins Rußland kommen – wehren sollte.
Was man dagegen findet, ist eine Menge Angst. Diese Angst erscheint nicht nur als Gefühl, sondern indirekt auch als Argument dafür, daß man auf Gerechtigkeit und historische Lehren diesmal verzichten sollte. Angst zu haben, ist menschlich, und Angst hat man auch in den europäischen Partnerländern. Angst habe auch ich. Doch das sollte nicht der Grund sein, warum man ausgerechnet in Deutschland, im Land unserer Inspiration, auf die Lehre aus der Vergangenheitsbewältigung verzichtet.
Ich hoffe, daß die öffentliche Debatte zu diesem Ergebnis führen wird. Dann könnte auch das „Manifest für Frieden“ – von den Unterzeichnern schätze ich manche persönlich – etwas Positives erwirken. Auch bei uns, den europäischen Partnern.
Tschechien eine gefestigte politische Stabilität habe.
Carsten Bielefeld, der einen in Witten ansäßigen Hersteller von Sonderkranmaschinen vertritt, berichtete von enormen Wachstumsraten, die seine Firma in Tschechien seit 2019 erlebe. Um 50 Prozent sei der Verkauf angestiegen, und das zeige, wie aufnahmefähig dieser Markt sei. Seine Firma verfolge seit zwei Jahren die erfolgreiche Strategie, dieselbetriebene Baumaschinen auf Elektroantrieb umzurüsten.
Georg Weißler machte eine kleine historische Erinnerung. Frankfurt sei bis 1989 das Zentrum der tschechoslowakischen Handelskontakte gewesen. Nach 1990 waren zwar die institutionellen Kontakte nicht mehr vorhanden, aber die menschlichen Kontakte seien geblieben. So habe die Deutsch-Tschechoslowakische beziehungsweise spätere Deutsch-Tschechische Wirtschaftsvereinigung auch einen Standort in Frankfurt. Anfangs sie die vordringliche Arbeit der Wirtschaftsvereinigung die Übersetzung der Gesetzestexte gewesen, aber auch heute gehe man pragmatisch vor. „Wir organisieren Kooperationen mit Unternehmen. Vor neun Jahren begannen wir uns mit dem Photovoltaik-Boom, um die Verknüpfung von Clustern zu kümmern“, so Weißler. Die Wirtschaftsvereinigung habe auch besonders gute Beziehungen zur Universität in Reichenberg, der einzigen Hochschule, an der noch Textilingenieure ausgebildet werden. Weißler fügte in seinem Statement noch weitere Beispiele aus der Praxis an und machte so die vielfältigen wirtschaftlichen Vernetzungen zwischen deutschen und tschechischen Unternehmen deutlich. Ulrich Miksch
� Volksgruppensprecher Bernd Posselt



Seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine ist Volksgruppensprecher Bernd Posselt auch außerhalb der Sudetendeutschen Volksgruppe ein ständig angefragter Experte. Am Samstag hielt der langjährige Europaabgeordnete beim Jahresempfang des Schützengaus München Süd-West die Festrede.
Wir leben in einer sehr ernsten Zeit“, sagte Posselt, aber die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Jahr verkündet hat, seit bereits 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs eingetreten.
„Damals wurde vom Ende der Geschichte gesprochen, vom endgültigen Sieg der Demokratie. Und alle, die wie ich zur Vorsicht mahnten, galten als Spielverderber“, erinnerte sich Posselt. Als erster Abgeordneter des Europaparlaments hatte Bernd Posselt bereits am 7. Oktober
1999 vor einem ehemaligen KGBOffizier namens Wladimir Putin gewarnt, der dann vier Monate später zum russischen Präsidenten aufgestiegen ist. „Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte sich Putin geschworen: ,Ich werde die Sowjetunion im Geiste Stalins wiederrichten.‘
Diesem Ziel hat er sein ganzes Leben konsequent gewidmet.“
Er habe, so der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgrup-

pe, über Putin kein Geheimwissen gehabt. „Es war damals schon klar, welchen Weg er gehen wird, aber bei uns im Westen wurde das ignoriert, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Der zweite Tschetschenien-Krieg, den Putin 1999 bewußt unter einem Vorwand losgetreten hatte, sei trotz der über 100 000 Toten im Westen nicht beachtet worden. „Seitdem hat Putin einen Krieg nach dem anderen geführt, unter anderem in Georgien, im Osten der Ukraine und in Syrien.“ Er sei, so Posselt, ob seiner Kritik an Putin alles andere als antirussisch: „Ich habe viele russische Freunde gehabt, darunter zahlreiche Bürgerrechtler und Journalisten. Von diesen persönlichen Freunden ist kein einziger mehr am Leben. Und in keinem einzigen Fall wurden die Mörder ermittelt und vor Gericht gestellt.“
Putins Kriegsziel sei ein Eurasien von Wladiwostok bis Lissabon, warnte Posselt und appellierte, die Ukraine weiterhin auch mit Waffen zu unterstützen: „Ich bin nicht für Krieg. Niemand, der noch ganz bei Trost ist, kann für Krieg sein. Aber wir müssen endlich Realisten werden. Wir müssen die Ukraine unterstützen – nicht aus Mitleid, sondern im ureigensten Interesse. Wir sind nicht Kriegspartei, wir sind das Kriegsziel.“
Pavel Novotny/Torsten Fricke„Nicht Kriegspartei, sondern Kriegsziel“
März
In Auspitz (Hustopeče), ein paar Kilometer südlich von Brünn, befindet sich Mitteleuropas größte Mandelplantage mit 1200 Bäumen. Jedes Jahr Ende März wird mit einem Mandel- und Weinfest die Mandelblüte gefeiert. In diesem Jahr findet das Stadtfest von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. März statt.

In den Restaurants und an den Ständen werden an den drei Tagen nicht nur süße und salzige Mandel-Spezialitäten angeboten, sondern auch Mandel-Bier und ein Mandel-Weinbrand nach dem Originalrezept des einstigen Verwalters der Mandelplantage, Rudolf Poslušný. Der Mandelanbau in Auspitz hat eine lange Geschichte, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Neu angelegt wurde die Mandel-Plantage 1949 mit damals 50 000 Mandel-Bäumen. Die
� Serie Ehrensache Ehrenamt: Das Mitglied des erweiterten SL-Landesvorstands engagiert sich seit seinem 16. Lebensjahr

Schon seit 50 Jahren ist Dr. Wolfgang Theissig in der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv. „Ehrenamtliche Tätigkeit war immer ein Teil meines Lebens, und insbesondere von der Sudetendeutschen Landsmannschaft komme ich nicht los“, sagt der heute 67-jährige.
Mit 16 Jahren kam er durch einen guten Freund zur Deutschen Jugend des Ostens (DJO, heute Deutsche Jugend in Europa – djo) und zur Sudetendeutschen Jugend, die der DJO angehörte. 1971 gründete Theissig die Ortsgruppe Trostberg mit, die er einige Jahr lang – bis zum Beginn seines Wehrdiensts – leitete.
Die Gruppen unter dem Dach der DJO hatten damals unterschiedliche Ausrichtungen. Die Gruppe Trostberg war musisch-kulturell geprägt. „Wir haben in der Hauptsache sudetendeutsche, bayerische und auch andere Volkstänze und Lieder einstudiert, die wir dann bei verschiedenen Anlässen wie zum Beispiel Muttertagsfeiern, Weihnachtsfeiern, Faschingsbälle, Jahreshauptversammlungen der SL und der Egerländer Gmoi oder auch im Altenheim Trostberg aufgeführt haben.“
Daß die Gruppe dabei ein hohes Niveau erreichte, bewies sie bei mehreren Wettkämpfen, so zum Beispiel bei den musisch-kulturellen Landesspielen der DJO in Regensburg. Gleich zweimal wurde die Gruppe Trostberg gemeinsam mit der DJO-Gruppe Waldkraiburg mit dem ersten Preis ausgezeichnet: für ein Kabarett, das sie selbstgestaltet hatten und für ihre Leistungen im Volkstanz.
Wettbewerbe in verschiedenen Disziplinen wie Sport, Tanz, Musik und Spiel waren damals auch fester Bestandteil
des Jugendprogramms der Sudetendeutschen Tage. Mehrere Hunderte Jugendliche kamen zusammen, schliefen in Zeltlagern und maßen sich in sportlichen Leistungen, in Wissensabfragen und künstlerischen Darbietungen. Auch hier war die Ortsgruppe Trostberg gemeinsam mit der Gruppe Waldkraiburg erfolgreich: 1974 belegte sie beispielsweise in Nürnberg gleich zweimal den ersten Platz –sowohl im musischen als auch im sportlichen Wettbewerb.
Zu den weiteren Unternehmungen unter dem Dach der DJO gehörten sogenannte Volkstumsfahrten in Länder und Gegenden mit nationalen Minderheiten, um sich mit ihnen auszutauschen und gemeinsam zu tanzen und zu musizieren. Auf mehreren solchen Fahrten war Wolfgang Theissig dabei. Er und seine Gruppe traten beispielsweise im Burgenland und in Irland auf. Gruppen aus Irland kamen umgekehrt mehrfach nach Waldkraiburg, das unweit von Trostberg liegt. Daraus entstanden
� Bayerns Staatsministerin Ulrike Scharf ruft zur Teilnahme auf
Freundschaften und Bekanntschaften, die teilweise bis heute halten.
„Letztes Jahr haben meine Frau und ich den Sohn des irischen Organisators besucht, den ich noch als kleinen Jungen kannte und fast fünfzig Jahre nicht gesehen habe. Wir haben uns trotzdem sofort erkannt, und die Freude war groß“, berichtet Theissig.
Als Betreuer hat Theissig außerdem Zeltlager der Sudetendeutschen Jugend und Kinderfreizeiten am Haus Sudetenland in Waldkraiburg begleitet. Sein Studium der Chemie führte ihn nach München, wo er einige Jahre lang gemeinsam mit einer Freundin eine DJO-Gruppe leitete. Im Tiroler Städtchen Kirchbichl im Bezirk Kufstein veranstaltete die DJO damals Kinderfreizeiten, die Theissig mitorganisierte. Diese Arbeit habe ihn sehr geprägt, erzählt er: „Ich habe viel gelernt und viel mitgenommen und viele Leute kennengelernt.“
Nach dem Studium, das er mit der Promotion abschloß, arbeitete er bis
zum Renteneintritt in einer großen Gutachterorganisation. Er zog wieder in die Nähe von Waldkraiburg. Von der Jugendarbeit kam er in die Verbandsarbeit der SL: 1996 wurde er stellvertretender Ortsobmann von Waldkraiburg, 2008 Kreisobmann von Mühldorf und seit 2018 ist er Mitglied des erweiterten Landesvorstands der SL.
Der Dialog ist ihm wichtig, auch und gerade im Kleinen. Mit Menschen aus seinem Umfeld spricht er über die Sudetendeutschen und ihre Geschichte und stellt dabei immer wieder fest, daß diesbezüglich oftmals Wissenslücken bestehen. Ihm ist es wichtig, diese zu füllen und aufzuklären, zum Beispiel darüber, daß sich die Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen läßt und daß die böhmischen Länder lange zur Habsburgermonarchie gehört haben.
In seiner Familie, die mütterlicherseits aus Bilin und väterlicherseits aus Tetschen-Bodenbach stammt, wurde sehr viel über Geschichte und über die familiären Wurzeln erzählt. Und es bewegt Wolfgang Theissig immer wieder, wenn auf den regionalen Treffen Sudetendeutsche von ihrer Geschichte beziehungsweise von der ihrer Familie erzählen.
Für Theissig, der über sich selbst sagt, er sei „mit Leib und Seele ein sudetendeutscher Bayer“, ist der Fortbestand der sudetendeutschen Kultur(en) –der Dialekte, des Brauchtums, der Musik, des Tanzes – ein großes Anliegen. Deswegen setzt er sich dafür ein, daß sich auch jüngere Menschen dafür begeistern und daß Geschichte und Kultur des vierten Stammes Bayerns mehr und mehr Menschen bekannt werden.
Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
Das digitale Projekt „Jugend gemeinsam für Europa“ geht in die zweite Phase. Noch bis Sonntag, 12. März, können junge Menschen aus Bayern und Tschechien in einer Online-Umfrage darüber abstimmen, welche Ideen für ein stärkeres und nachhaltigeres Europa ihnen besonders am Herzen liegen.
Die für Jugend zuständige Staatsministerin Ulrike Scharf ruft zu einer breiten Teilnahme auf: „Die Zusammenarbeit unserer bayerischen Jugend mit den tschechischen Nachbarn ist wichtiger denn je. Ich lade alle Jugendlichen herzlich ein, sich an dem digitalen bayerisch-tschechischen Projekt ,Jugend gemeinsam für Europa‘ zu beteiligen.“
Seit Beginn des Projekts „Jugend ge-
meinsam für Europa“ im Dezember 2022 sind mehr als 300 Ideen eingegangen, wie Europa weiterentwickelt werden kann. Dafür wurden bis Februar junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren aus der bayerisch-tschechischen Grenzregion gebeten, Vorschläge für ein besseres Miteinander zu entwickeln. Über die 50 beliebtesten und umstrittensten Vorschläge in dem jeweiligen Land kann jetzt über die tschechischen und deutschen Plattformen abgestimmt werden. Die Ergebnisse sollen am 3. Mai vorgestellt und dann ab Juni im Rahmen von bayerisch-tschechischen Jugenddialogen diskutiert werden, um konkrete Handlungsempfehlungen und Initiativen in den Grenzregionen zu erarbeiten. Für die Stärkung der EU und deren
Schwester Teodora Shulak ist noch keine 45 Jahre alt. Zehn Jahre lang war sie Provinzoberin für den ukrainischen Zweig der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser, einer mit den Redemptoristen verwandten weiblichen Ordensgemeinschaft. Im Herbst 2022 wurde sie zur Generaloberin ihrer Gemeinschaft gewählt. Mitte Februar übersiedelte sie für diese Funktion nach Deutschland.
Zum ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine am vorletzten Freitag lud ich die junge Generaloberin in unsere Schönenbergkirche ein, um in zwei Gottesdiensten über die traurige Lage ihres Heimatlandes zu sprechen, aber auch über die Frage: Woher kommt die Kraft, die mitten in dieser Dunkelheit Mut und Hoffnung schenkt? Manches, was sie erzählte, berührte mich so, daß ich es mitteilen möchte.
Da ist zum Beispiel die Erfahrung, die Schwester Teodora vergangenen Sommer in Tschernihiw machte. Als gelernte Psychologin und Psychotherapeutin war sie mehrere Wochen in der schwer kriegsgeschädigten Stadt, um den Menschen in ihren seelischen Nöten beizustehen. Ein Drittel der Wohnhäuser war zerstört. Die Ordensfrau traf eine Familie, die ihr Wohnhaus durch einen Bombeneinschlag verloren hatte und jetzt in einer Garage wohnte. Neben der Garage war eine blühender Gemüse- und Blumengarten angelegt. Auf ihre verblüffte Frage, wie man mitten im Krieg so viel Energie in die Pflege eines Gartens investieren könne, antwortete die Mutter: „Wir müssen uns hier unter allen Umständen für das Leben entscheiden. Die Pflanzen erinnern uns daran, daß wir für das Leben berufen sind.“
Eine andere Erfahrung, die Schwester Teodora mitteilte: Einer ihrer engsten Freunde verteidigt wie viele andere als Soldat sein Vaterland gegen die russische Armee. Als er einmal Fronturlaub hatte, fragte sie ihn, ob es ihm nicht schwerfalle, nach dieser Urlaubszeit wieder an die Kriegsfront zurückzukehren. Er verneinte. Die wichtigste Motivation für ihn sei, daß seine Kinder später einmal nicht in einem Unrechtsregime leben müßten. Er wolle ihnen ein Leben in Freiheit und Demokratie ermöglichen, selbst wenn er für dieses Ziel den Tod riskiere. Schwester Teodora erinnerte an das Wort aus dem Johannesevangelium: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt.“
Werte spielen, so die Initiatoren, die europäischen Grenzregionen eine entscheidende und zentrale Rolle. „Sie verbinden die Bürger in ihrem unmittelbaren Umfeld und tragen zur Förderung einer gemeinsamen Identität bei, ohne daß der Filter des Nationalismus oder der Zugehörigkeit zu einem Land aufgesetzt wird.“
Realisiert wird das vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales geförderte Projekt von dem Verein Initiative Offene Gesellschaft gemeinsam mit den Kooperationspartnern Make.org und eKairos.
Der Link zur Abstimmung: www.make.org/DE/ consultation/gemeinsameuropa/ selection
Wie geht man mit dem Streß um, fragte ich die Ordensfrau, mitten im Krieg zu leben und immer wieder in Kellern und Bunkern Schutz vor Raketen suchen zu müssen? Tief durchatmen, sagte sie, die Panik nicht an sich heranlassen, rational handeln und durch das ständige Wiederholen des Namens Jesu einen Trost finden, den nur der Himmel schenken könne.
Die Ukraine war mir durch die Begegnung mit Schwester Teodora sehr, sehr nahe. Sie sollte uns allen weiterhin nahe bleiben. Auch dadurch erfahren die Menschen dort nämlich Kraft und Hoffnung.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
❯ Politikerderblecken auf dem Münchener Nockherberg
Nach drei Jahren Pause fand am Freitagabend wieder die alljährliche analoge Probe des Starkbiers Salvator in der Paulaner Festhalle auf dem Nockherberg in München statt. Als Hauptstadt eines Bundeslandes mit vier Stämmen waren unter den geladenen Gästen und den Mitwirkenden auch Angehörige des Vierten Stammes, der Sudetendeutschen.
Prominenteste Sudetendeutsche war die langjährige Landesmutter Bayerns, Karin Stoiber. Sie war 1946 als Dreijährige aus Buchau im Kreis Luditz im Egerland vertriebenen worden. Seit 2007 ist sie Ehrenmitglied der SL. Gekommen war auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Dessen mütterliche Wurzeln lie-
gen in Marienbad, zu denen er sich bekennt. Die Liebe zu Bädern blieb: 2002 bis 2013 war er Bürgermeister des Kneippkurortes Bad Wörrishofen im Unterallgäu.
Die Fastenpredigt hielt der 38jährige Unterallgäuer Maxi Schafroth. Sein Politikerderblekken mündete in ein ruhiges und ernstes Nachdenken über Krieg, Frieden und Freiheit, vor allem
über Redefreiheit, die ihm erlaube, das zu sagen, was er gerade über die Politiker gesagt habe. Die Derbleckten antworteten mit stehendem Applaus. Zu Maxi Schafroths Auftritten gehört der Chor der Jungen Union Miesbach, die acapella absurd-witzig gstanzlte. Ein Chormitglied ist Franziskus Posselt, dessen väterliche Wurzeln im Isergebirge liegen, der Mitglied der Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler Ortsgruppe München und Neffe von Volksgruppensprecher Bernd Posselt ist.

Übrigens: Die Adresse des Salvatorkellers von Paulaner am Nockherberg lautet Hochstraße 77, die des Sudetendeutschen Museums Hochstraße 10 und die des Sudetendeutschen Hauses Hochstraße 8. Nadira Hurnaus
10/2023
Am morgigen 11. März feiert Ernst Polierer, langjähriger Vorsitzender der Ortsgruppe Landshut des Deutschen Böhmerwaldbundes, in Altdorf seinen 80. Geburtstag.
eboren wurde er am 11. März
G
1943 in Zeisau/Čížov in der Iglauer Sprachinsel. Seine Mutter Rosa Polierer/Langhans war am 21. August 1910 in Hilbersdorf/Heroltice ebenfalls in der Iglauer Sprachinsel zur Welt gekommen. Zwar war der Kontakt mit den tschechischen Nachbarn völlig normal, man traf sich bei allerlei Festivitäten oder im beruflichen Umgang, Eheschließungen zwischen den beiden Sprachgruppen blieben aber eine Seltenheit. So verließ sie den elterlichen Hof erst, nachdem sie 1939 den Schuster Franz Polierer geheiratet hatte, und zog in dessen Haus in Zeisau.
Das Leben war damals entbehrungsreich. Franz Polierer wurde von der Wehrmacht eingezogen, Rosa Polierer mußte die kleine Landwirtschaft allein versorgen und bekam trotz des Krieges innerhalb von fünf Jahren drei Kinder. Der Zusammenbruch des verbrecherischen Naziregimes war nicht aufzuhalten. Die Front rückte immer näher, und damit stand das Leben der Familie vor massiven Umwälzungen.

Das Ende der deutschen Besatzung führte sehr schnell zu den sogenannten wilden Vertreibungen. Auch die Iglauer Sprachinsel war davon betroffen, wenn auch nicht in der Form, daß die deutsche Bevölkerung sofort nach Österreich abgeschoben werden sollte. Die Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, durch verschiedene Zwischenlager geschickt, und sie mußten Zwangsarbeit leisten. Dann kam der Tag, an dem auch Ernst mit seiner Mutter, seiner Schwester Anna, seinem Bruder Franzi und den Großeltern aus dem Haus getrieben wurde. Die Mutter mußte mehr als ein Jahr lang bei landwirtschaftlichen Einrichtungen in Innerböhmen Zwangsarbeit leisten. Die Kinder – zwei, vier und sechs Jahre alt – waren die allermeiste Zeit auf sich selbst gestellt. Hoffnung keimte auf, als sie alle im Jahr 1946 wieder nach Zeisau zurückkehrten, aber diese stellte sich als trügerisch heraus, denn kurze Zeit darauf kam der Ausweisungsbefehl. Die ganze Familie wurde im offenen Vieh-
waggon nach Bayern transportiert, Angst und unmenschliche hygienische Zustände inklusive. Die Odyssee war mit der Ankunft im Aufnahmelager Ganacker bei Landau noch nicht beendet, im Juni 1946 wurde die Familie in einem Hof in Gerzen im Altlandkreis Vilsbiburg zwangseinquartiert.
Ohne Verschulden waren die Polierers in die Realität des derbbäuerlichen Niederbayerns geschwemmt, wo jemand nur nach dem zählte, was er besaß. Die Familie besaß nichts mehr, außer ihrer menschlichen Würde, die man ihr auch noch gerne genommen hätte. Aber die Kinder mußten irgendwie versorgt werden. Der Mutter wurde angeboten, über den Sommer hinweg bei der Ernte zu helfen. Mehr als etwas zu Essen für die Familie bekam sie zwar nicht, aber zumindest mußte sie nicht mehr als Bittstellerin auftreten.
Als sogenanntes Obdach bot man der Familie den Pferdestall, wo man auf blankem Stroh sein Nachlager errichten mußte.
Erst als es im Oktober empfindlich kalt wurde, räumte man eine Holzhütte frei, die seit Jahren nicht mehr bewohnt gewesen war. Wieder mußten sich die Kinder den ganzen Tag über bis spät abends selbst beschäftigen und wuchsen quasi auf der Straße auf. Und als ob die Lage nicht schon schrecklich genug gewesen wäre, ereilte sie ein weiterer schrecklicher Schicksalsschlag. 1947 verunglückte der sechsjährige Bruder Franzi: Er wurde von einem Lastwagen überfahren. Im selben Jahr kehrte der Vater Josef zur Familie zurück. Das Leben mußte irgendwie weitergehen, zwei weitere Kinder hatten Hunger und wollten eine Zukunft. Die Kinder gingen in die Schule und trugen durch Hilfsarbeiten bei den Bauernhöfen auch ein wenig zum extrem kargen Familieneinkommen bei. Was man aber besaß, waren familiärer Zusammenhalt und Unterstützung sowie Erziehung und Hoffnung auf bessere Zeiten. Daß diese nur durch Bildung zu erreichen waren, das war allen klar. Für den Besuch eines Gymnasiums hätten die finanziellen Mittel zwar nie gereicht, aber so mußte man sich eben anderweitig fortbilden.
Ernst war wohl der erste Schüler der Volksschule Gerzen, der die gesamte Schulbibliothek ausgelesen hatte. Mit 14 Jahren
schloß er die Volksschule ab und ging bei einem Vilsbiburger Autohaus in die Lehre als Einzelhandelskaufmann. Sein Lehrlingsgehalt reichte kaum für die Busfahrt zur Arbeitsstelle, weshalb er die Strecke, wann immer möglich, mit dem Fahrrad bewältigte.
Nach drei Jahren Ausbildungszeit beschloß er, eine Tätigkeit bei der Firma PfeifferAutomaten in Landshut anzunehmen, und zog deshalb nach Landshut. Dort lernte er 1963 Hannelore Peckl aus Hohenfurt im Böhmerwald kennen. Bei den Böhmerwäldlern in Landshut wurde er gerne aufgenommen.
Im Jahr 1965 trat er bei der Stadt Landshut in die Beamtenlaufbahn ein. 1968 fand die Hochzeit mit Hannelore statt. Aus der Ehe entstammen die Kinder Michael und Peter Paul, der 2012 bis 2018 Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Jugend werden sollte. Bei der Stadtverwaltung brachte Ernst es bis zum Leiter des Städtischen Versicherungsamtes. 2005 trat er in den wohlverdienten Ruhestand.
Als die Heimatgruppe des Deutschen Böhmerwaldbundes in Landshut nach einer Auflösung im Jahr 1976 wiedergegründet wurde, war Ernst von Anfang an dabei. Er war leitend in der Jugendgruppe Landshut tätig, die damals sehr aktiv war. So hatte die Jugendgruppe Landshut bei den Bundesjugendspielen des Deutschen Böhmerwaldbundes mehrmals vordere Plätze belegt. In Friedrichshafen wurden die Landshuter Böhmerwäldler sogar Bundessieger. Seit 2003 ist Ernst Vorsitzender der Ortsgruppe Landshut des Deutschen Böhmerwaldbundes.
Dank seiner Heimatliebe und seines besonnenen, ausgleichenden Wesens war er auch ein beliebter Mitarbeiter beim Landesverband des Deutschen Böhmerwaldbundes. Für seine Verdienste zeichnete der Deutsche Böhmerwaldbund ihn 2004 mit dem Ehrenabzeichen in Gold aus. Seit vielen Jahren ist Ernst darüber hinaus Schriftführer in der niederbayerischen SL-Ortsgruppe Altdorf und der SL-Kreisgruppe Landshut. Lieber Ernst, wir wünschen Dir zum Geburtstag alles Gute, daß Deine Schaffenskraft noch lange anhält und daß Du neben der Arbeit für den Böhmerwald und die Sudetendeutsche Landsmannschaft noch genügend Zeit für Deine beiden Enkel Elias und David übrig hast. Hans Slawik
Am letzten Augustsonntag 2020 zelebriert der Redemptoristenpater Dr. Martin Leitgöb in der Kirche Sankt Johannes von Nepomuk am Felsen seinen letzten Gottesdienst als Seelsorger der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Prag. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits seit einem Viertel Jahr Kolumnist der „Sudetendeutschen Zeitung“. Anschließend wird er Seelsorger der katholischen Pfarrei EllwangenSchönenberg in Württemberg und betreut die Wallfahrtskirche Zu unserer lieben Frau auf dem 530 Meter hohen Schönenberg.



Bild: Martin Kastler
Mut tut gut Zu der „Mut-tut-gut“-Kolumne „Mission der Hoffnung“, in der Autor Pater Martin Leitgöb CSsR über seine Wahl zum Provinzial der Redemptoristen Wien/München berichtet (➝ SdZ 9/2023).
Die Kolumne, die Pater Martin Leitgöb seit dem 24. April 2020, also seit fast drei Jahren, Woche für Woche für uns schreibt, zeichnent verblüffende Aktualität, faszinierende Vielfalt und tröstlicher Tiefgang aus.
Dr. Martin Leitgöb CSsRVergangene Woche fragte sich der qualitätsverwöhnte Leser verwundert, warum ihm die bereits fünf Wochen zuvor erschienene Kolumne „Mission der Hoffnung“ erneut präsentiert wurde.
Des Rätsels Lösung: Was nicht passieren darf, geschah. Im Eifer des Endredaktionsgefechts fand eine Verwechslung statt. Und aus diesem Grund erscheint auch erst heute Leitgöbs für vergangene Woche geschriebene Ukraine-Kolumne „Für das Leben berufen“. Wir bedauern die Verwechslung und entschuldigen uns bei Autor Martin Leitgöb und unseren Lesern. Die Redaktion
Die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste lud zur Ringveranstaltung und Buchvorstellung in das Sudetendeutsche Haus in München ein. Den Festvortrag „Goethe in Böhmen“ hielt der Germanist Wynfried Kriegleder. Er erläuterte darin, wie sich der Blick des Prager Dichters Johannes Urzidil auf Johann Wolfgang von Goethe im Laufe von 30 Jahren änderte. Der junge Pianist Julius Zeman umrahmte das Festkolloquium musikalisch.
Johannes Urzidil war ein echter Prager“, begann Kriegleder. „Seine Mutter Elise war eine geborene Metzeles und eine zum Katholizismus konvertierte Jüdin, sein Vater Josef ein deutschnationaler Westböhme.“ Kurz faßte er das Leben des Schriftstellers zusammen: Der 1896 in Prag geborene Johannes Urzidil sei inmitten dieser mitteleuropäischen Metropole aufgewachsen. Noch während der Schulzeit habe er 1913 unter dem Pseudonym „Hans Elmar“ seine ersten Gedichte im „Prager Tagblatt“ veröffentlicht, bald darauf – er habe von klein auf neben Deutsch auch fließend Tschechisch gesprochen – seien Übersetzungen von Gedichten des tschechischen Lyrikers Otokar Březina gefolgt. In dieser Zeit habe er sich auch mit deutschen und tschechischen Literaten angefreundet.
Studium bei August Sauer


Von 1914 bis 1918 studierte Urzidil an der deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag Germanistik – so auch bei August Sauer – Slawistik und Kunstgeschichte. Im November 1918 wurde Urzidil Übersetzer am Deutschen Generalkonsulat in Prag – 1919 wurde es zur Botschaft erhoben – und war von 1918 bis 1939 journalistischer Korrespondent sowie ab 1923 auch noch für die Prager „Bohemia“ tätig. Der expressionistische Gedichtband „Sturz der Verdammten“, 1919 in der renommierten Reihe „Der jüngste Tag“ des Kurt-Wolff-Verlages in Leipzig erschienen, war sein erstes Buch. 1922 heiratete er die Lyrikerin Gertrude Thieberger (1898–1977), die aus einer jüdischen Gelehrtenfamilie stammte.
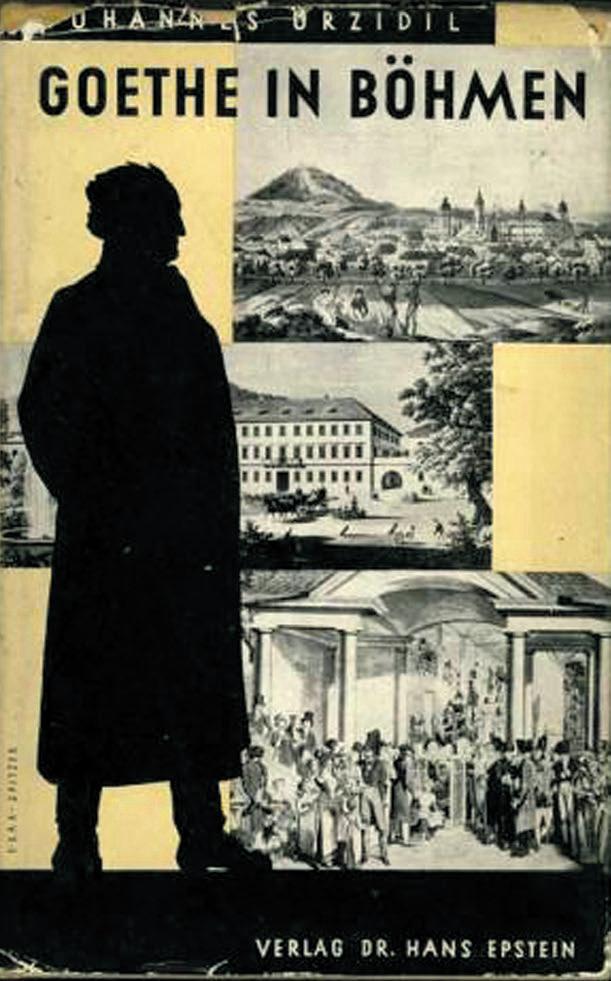
1930 kam sein Gedichtband „Die Stimme“ heraus und 1932 die erste Fassung seiner umfangreichen Studie „Goethe in Böhmen“ im Verlag Dr. Hans Epstein, deren zweite, stark überarbeitete und erweiterte Fassung 1962 bei Artemis in Zürich erschien.
Nach Adolf Hitlers Machtübernahme 1933 wurde Urzidil als Nichtarier aus dem di-
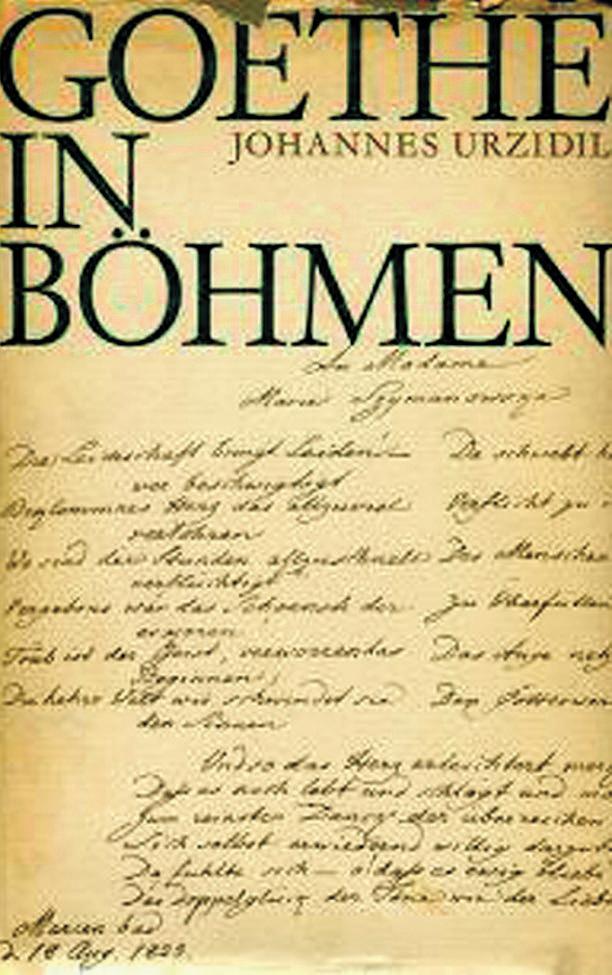
zialismus schon in einer prekären Situation gelebt. Damals sei Urzidil noch dem Narrativ gefolgt von „Goethe als dem größten deutschen Dichter, der eine besondere Beziehung zum deutschen Böhmen“ gehabt habe. Goethe habe für ihn quasi eine Personifikation von Böhmen bedeutet. Probleme habe Urzidil wohl nur mit Goethes Unverständnis für moderne Musik wie der von Beethoven und dessen mangelnder Identifikation mit der ,deutschen Sache‘ aufgrund der Begeisterung des Dichterfürsten für Napoleon gehabt. Nach dem Zwischenkonzept „Goethe und die böhmische Welt“ und aufgrund seiner politisch-historischen Erfahrungen, die er habe machen müssen, habe sich Urzidils Goethe-Bild gewandelt: „Er sah ihn jetzt als Europäer, sogar als Weltbürger!“ Nun habe Urzidil Goethe als profunden Musikkenner dargestellt, der auch die epochale Bedeutung Beethovens erkannt und politisch zu einem tiefergehenden Verständnis gefunden habe. Dazu lieferte Kriegleder Zitate aus beiden Versionen. „Urzidil selbst hatte zum ,Hinternationalismus‘ erst im amerikanischen Exil gefunden – und Goethe war ihm dabei eine große Hilfe“, lautete Kriegleders Resümee. „Wir alle danken unserem Festredner für seine Forschungsergebnisse und den großartigen Vortrag“, bedankte sich Günter J. Krejs bei Kriegleder. Der Akademiepräsident hatte eingangs eine große Gästeschar zur ersten Ringveranstaltung 2023 begrüßt. Festredner aus Wien
Den Festredner stellte Veit Neumann, der Sekretar des Geisteswissenschaftlichen Klasse, vor. Wynfrid Kriegleder sei am 12. April 1958 in Obernberg am Inn zur Welt gekommen. 1977 bis 1985 habe er Germanistik in Wien studiert. 1984 sei seine Sponsion zum Magister (Lehramt für höhere Schulen) an der Universität Wien erfolgt. Dort sei er 1985 zum Dr. phil. promoviert worden.
plomatischen Dienst des Deutschen Reiches entlassen, auch seine Korrespondententätigkeit für die deutsche Presse mußte er einstellen. Die folgenden Jahre verbrachten Urzidil und seine Frau zum Teil in Josefsthal bei Glöckelberg im Böhmerwald. Im Juni 1939, drei Monate nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Prag, gelang es Urzidil –der nach den Nürnberger Gesetzen wegen seiner jüdischen Frau nicht als Halbjude, sondern selbst als Jude galt – und sei-
ner Frau, den deutschen Machtbereich zu verlassen. Über Italien kamen sie nach England, wo Urzidil in Kontakt zur tschechoslowakischen Exilregierung unter Edvard Beneš stand. 1941 gelang die Übersiedlung in die USA, wo sie zunächst in beengten materiellen Verhältnissen in New York leben mußten.
Nach dem Krieg arbeitete Urzidil ab 1951 für die ÖsterreichAbteilung des Senders Voice of America. 1955 veröffentlichte er als Buch die 1945 schon in New
York publizierte Erzählung „Der Trauermantel“ über Adalbert Stifter. 1956 erschien der Erzählband „Die verlorene Geliebte“. Johannes Urzidil hatte sich inzwischen als „hinternational“ eingestuft, was sicher auch dem Erlebnis des Exils in den demokratischen USA zu verdanken ist, und eine Art Lebensmaxime wurde. Nach weiteren erfolgreichen Büchern und großen Vortragsreisen starb er 1970 in Rom, wo er auf dem Campo Santo Teutonico begraben wurde.
Bei der Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie stellten AltPräsident Herbert Zeman und Herbert Schrittesser ihre gemeinsame neue Studie „Wirtschaft und Wissenschaft im alten Österreich – Vom Schwarzen Kameel in Wien zur Deutschen KarlFerdinandsUniversität in Prag“ vor.


� Buchvorstellung
„Nach der Erstfassung des Buches ,Goethe in Böhmen‘ 1932 brachte Urzidil eine im US-amerikanischen Exil verfaßte, wesentlich erweiterte und modifizierte Version dieses Buches heraus“, so Kriegleder. Vor dem Hintergrund der Biographie Urzidils habe er beide Versionen in vieler Hinsicht verglichen, und zwar besonders im Hinblick auf Musik und Politik, wo sich im Lauf der 30 Jahre viel verändert habe.
1932 habe Urzidil während des aufkommenden Nationalso-
Bis 1997 habe er als Universitätsassistent an der Universität Wien gewirkt. 1997 habe er sich dort für Neuere deutsche Literaturwissenschaft habilitiert. Seit 1997 lehre und forsche er als außerordentlicher Professor an der Universität Wien. Mehrere Stipendien und Gastdozenturen im Ausland rundeten seine große internationale Karriere ab. 2014 sei er zum ordentlichen Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste in der Geisteswissenschaftlichen Klasse berufen worden.
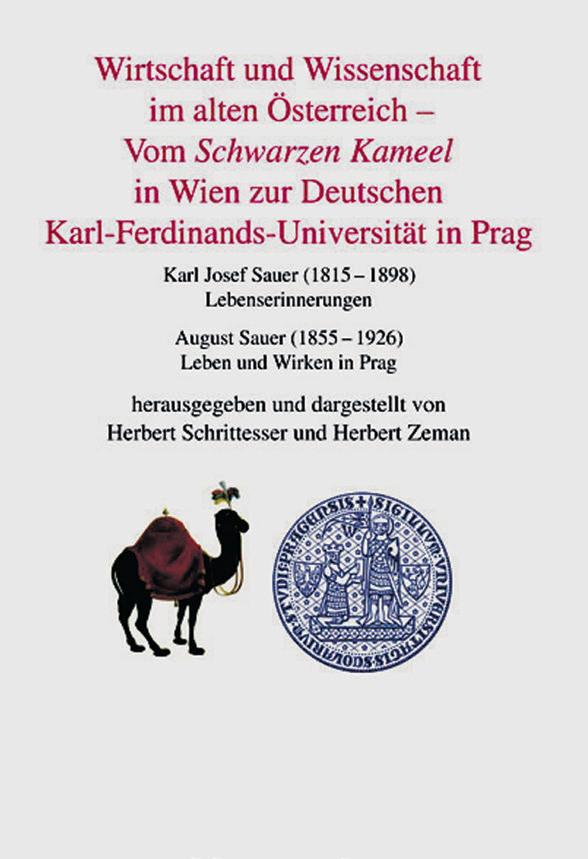
Susanne Habel
Passend zur Buchvorstellung seines Vater Herbert Zeman spielt Julius Zeman am Flügel Stücke aus der Zeit August Sauers (1855–1926). Großartig klingen bei ihm „Stille Betrachtung an einem Herbstabend“ und „Erinnerung“ von Anton Bruckner (1824–1896) sowie „Poème“ aus der Sammlung „Nálada“ von Zdeněk Fibich (1850–1900). Zum Ausklang präsentiert Julius Zeman ein lebendiges Potpourri nach den „Geschichten aus dem Wienerwald“ von Johann Strauß Sohn (1825–1899).
Die Memoiren Karl Josef Sauers, des Vaters des Literarhistorikers August Sauer, zeichnen ein detailgetreues Bild des Lebens im Wien des 19. Jahrhunderts aus der Perspektive eines Angestellten jener Tage“, so Herbert Zeman. Sauer senior sei aus Böhmen nach Wien gekommen und habe in seinen Erinnerungen zahllose interessante Episoden geschildert. „Und mein Mitherausgeber
Herbert Schrittesser saß sehr lange daran, alles abzuschreiben und mit Erläuterungen zu versehen“, betonte der frühere Präsident der Sudetendeutschen Akademie, der auch einige Passagen aus dem Buch las.
Dem bedeutenden Literarhistoriker August Sauer (1855–1926) gelte der zweite Teil des Buches. „Bei ihm hat Johannes Urzidil an der Deutschen KarlFerdinands-Universität in Prag auch studiert“, stellte er die Beziehung zum großen Festvortrag her. Es ist die biographische und wissenschaftsgeschichtliche Darstellung eines Gelehrten, dessen rastloses Leben im Dienst der Wissenschaft stand, ein Leben im farbenvollen Untergang einer zu Ende gehenden Zeit.
Herbert Schrittesser/ Herbert Zeman: „Wirtschaft und Wissenschaft im alten Österreich. Vom Schwarzen Kameel in Wien zur Deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag“. Lit-Verlag, Wien 2022; 484 Seiten, 59,90 Euro. (ISBN 9783-643-51124-9)
� Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und KünsteAkademie-Präsident Professor Dr. Günter J. Krejs, Pianist Julius Zeman, der Festredner Professor Dr. Wynfried Kriegleder, Alt-Akademiepräsident Professor Dr. Herbert Zeman, Dr. Herbert Schrittesser und Professor Dr. Veit Neumann. Bilder: Susanne Habel Präsident Dr. Günter J. Krejs bedankt sich bei Professor Dr. Wynfried Kriegleder für den Vortrag, in dem der Germanist die beiden Versionen von Johannes Urzidils Buch „Goethe in Böhmen“ vergleicht. Rechts die Titelseiten der Ausgaben von 1932 und 1962. Bilder (4): Susanne Habel Dr. Herbert Schrittesser und Professor Dr. Herbert Zeman stellen das neue Buch vor.
❯ Vor 70 Jahren entstanden die Leitsätze von Blaubeuren

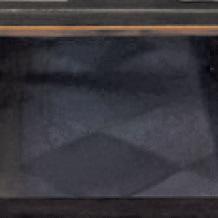

Heuer ist es 70 Jahre her, daß sich 1953 im schwäbischen Blaubeuren sudetendeutsche, schlesische und südostdeutsche Erzieher, Volksbildner, Priester und Sozialarbeiter zu einer Arbeitstagung trafen, die sich mit der Frage beschäftigte, wie das Kulturgut und volkhafte Erbe der Vertriebenen in Deutschland als Kraft der Überwindung der gei-
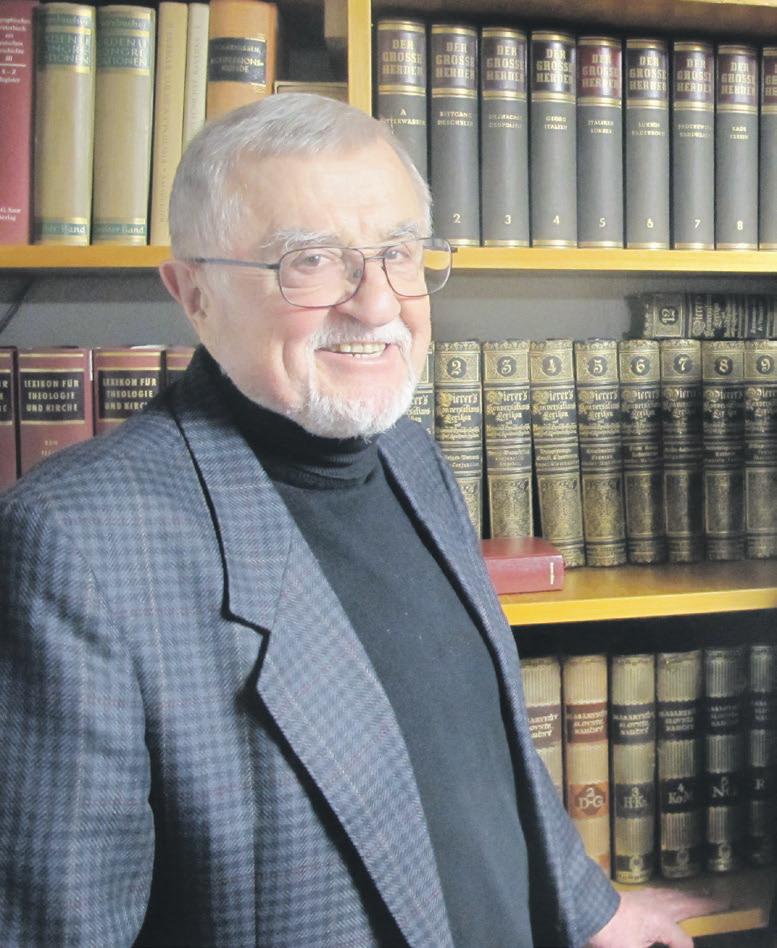
Die damals von den Teilnehmern erarbeiteten Leitgedanken waren für die katholische Vertriebenenarbeit wegweisend. Als Pater Paulus Sladek zehn Jahre später seine Grundsätze über die „Kulturaufgabe der Vertriebenen“ schrieb, fügte er dem Sonderdruck von „Christ unterwegs“ diese Blaubeurener Leitsätze an. Schon damals sahen die Verantwortlichen die Arbeit an einem gesamtdeutschen Geschichtsbild als wesentlich an, das Ost- und Ostmitteleuropa einbezog und das von einer eu-
stigen Entwurzelung fruchtbar gemacht werden könne. Dazu eingeladen hatte damals die katholische Arbeitsstelle für Heimatvertriebene (Süd) in München in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde, der Eichendorffgilde und dem Arbeitskreis südostdeutscher Katholiken, dem Sankt-Gerhards-Werk. Rudolf Grulich berichtet.
ropäischen Gesinnung und Verpflichtung getragen sein sollte.
Später wurde bei der Diskussion über das Zentrum gegen Vertreibung und seinen Standort viel zu wenig beachtet, daß es gerade auch die Vertriebenen waren, die zum Beispiel in ihrer Charta vom 5. August 1950 bereits den Europagedanken hervorgehoben hatten. Nüchtern stellte man 1953 aber auch fest, daß die Vertreibung aus der Heimat den Überlieferungsbestand der vertriebenen Volksgruppen ernsthaft gefährdet habe, daß sich aber am besten alle jene Kultur- und Traditionswerte behauptet hätten, die im christlich-religiösen Glaubensbereich verankert gewesen seien: „Nur jenes ostdeutsche Brauchtum, das wieder seßhaft und sichtbar wird, dürfte die Zeitwende überdauern.“
Die Verantwortlichen von 1953 sahen, daß durch die Erschütterung der Kriegs- und Nachkriegszeit den Vertriebenen auch neue Formen des Kulturgutes zuwuchsen, die in ihren besten Bin-

dungen ebenso zu pflegen seien wie die alten Traditionen: „Es wäre eine Illusion, würden wir uns der Hoffnung hingeben, daß das ostdeutsche Volksgut in seiner Gesamtheit zu erhalten ist.“ In jeweils fünf Leitsätzen wird dann von der Aufgabe gesprochen, das religiöse Brauchtum zu erhalten und die Pflege des Familienbewußtseins zu intensivieren. Sieben Jahrzehnte danach ist darüber eine ehrliche Bestandsaufnahme angebracht. Die Entchristlichung und Säkularisierung der letzten Jahrzehnte machte auch vor den katholischen Vertriebenen nicht halt. Wenn Papst Johannes Paul II. bei seinem ersten Besuch in der damaligen Tschechoslowakei 1990 im mährischen Velehrad eine Neu-Evangelisierung Europas forderte, so gilt das auch für die 1999 von der Deutschen Bischofskonferenz neu organisierte, aber inzwischen zur Abwicklung frei gegebene Vertriebenenseelsorge. Auf den Dokumenten der Europäischen Bischofssynode vom Jahr 1991 wie „Zeugen Christi sein, der uns befreit hat“ oder auf dem Millenniumsschreiben des Papstes hätte auch die aktive Vertriebenenpastoral des 3. Jahrtausends fußen müssen.


1953 wurde festgestellt: „Religiöses Brauchtum ist Ausdruck der tiefsten metaphysischen Verankerung und der religiösen Anlagen eines Volkes. Sein Untergang bedeutet einen ernstlichen Substanzverlust jedes Volkstums. Seine Pflege muß daher wesentliches Anliegen landsmannschaftlicher Arbeit sein.“
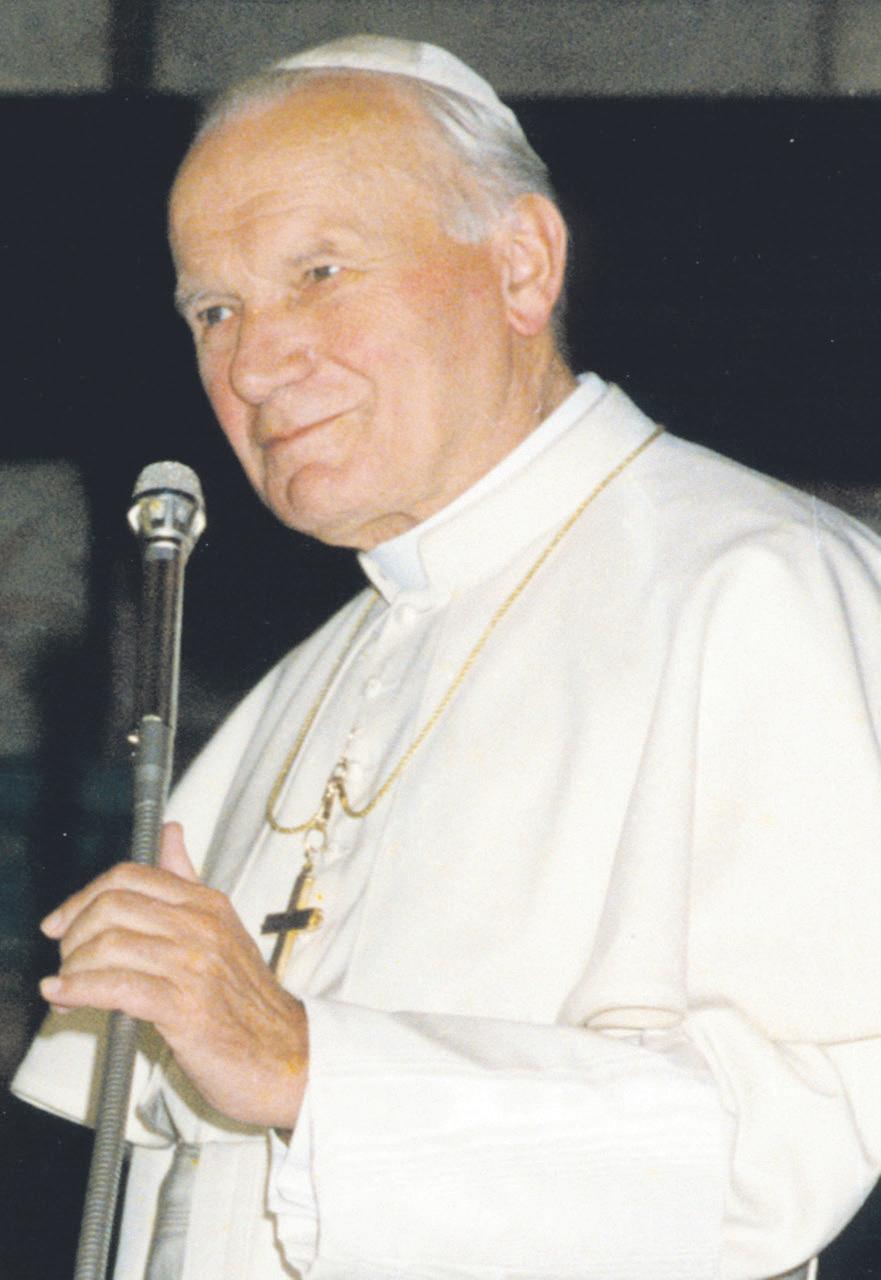


Ferner wird betont, daß die Kirche an der Erhaltung und Pflege des Brauchtums unseres Volkes den größten Anteil habe. Deshalb sei es: „Aufgabe aller verantwortlichen Stellen wie vor allem der landsmannschaftlichen Gruppen, der kulturellen Vereinigungen, der Schulen und der Kirche, das religiöse Brauchtum vor der Säkularisierung und der Verkitschung zu bewahren, an seiner lebendigen Weiterentwicklung mitzuarbeiten und die auf dieses Ziel gerichteten Bemühungen sowie die Neu-





ansätze echten Brauchtums zu unterstützen.“
Unterschieden wird dabei die Aufgabe der rein wissenschaftlichen Volkskunde, die ein möglichst vollständiges Bild zu entwerfen hat, und die strenge Sichtung der praktischen Brauchtumspflege: „Das Überholte, das den heutigen Anschauungen nicht mehr entspricht, ist auszuschalten und das Lebendige und Lebenswerte zu entwickeln und zu verbreiten.“
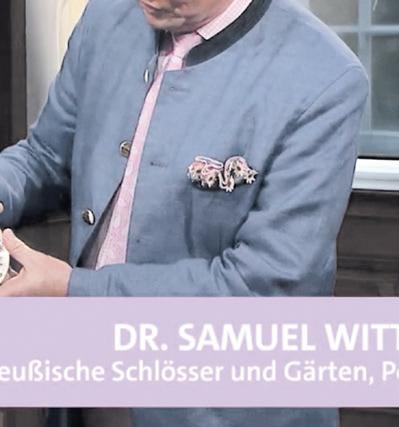
Gleiches gilt von den Aussagen der Leitsätze über die Pflege des Familienbewußtseins. Abschließend heißt es: „Mit Befriedigung wurde zur Kenntnis genommen, daß die Schulbücher des Bayerischen Schulbuchverlages das ostdeutsche Kulturerbe bereits teilweise berücksichtigen. Der Verlust der alten Heimatgebiete und die Vertreibung der ostdeutschen Volksgruppen erfordern es, daß die Leistung der Ostdeutschen in Geschichte und Kultur zum lebendigen Besitztum des ganzen Volkes gemacht wird. Darum muß sie in Schulbüchern und Unterricht einen entsprechenden Raum finden.“ Wie sieht es damit heute aus? Halloween-Spektakel haben längst die alten Allerseelenbräuche abgelöst. Wenn die türkischen Gastarbeiter das Ende des Ramadan feiern, wird dies in deutschen Fernsehanstalten mehr zur Kenntnis gebracht als die christliche Fastenzeit und Ostern. Andererseits läßt eine gewissenlose Reklame und Geldmacherei bereits im Totenmonat November Nikoläuse und Christstollen lange vor Advent und Weihnachten in die Verkaufsauslagen bringen, und schon am Aschermittwoch liegen Osterhasen in den Verkaufsregalen. Wird es uns gelingen, das noch Lebendige und Lebenswerte ostdeutscher Kultur weiter zu entwickeln und zu verbreiten?

In der Bibliothek des Augustiner-Chorherren-Stifts im niederösterreichischen Herzogenburg suchte eine Mutter für ihre Tochter Rat, ob das über mehrere Ecken von einer englischen Gräfin in Wien geschenkte Kaffeeservice Kunst oder doch nur Krempel sei. Die Tochter hatte bereits im Wiener Auktionshaus Dorotheum nachgefragt. Weder das Auktionshaus noch ein Altwarenhändler konnten etwas mit ihrem Porzellanservice anfangen. Die Expertise der Anfang Februar ausgestrahlten BR-Sendung „Kunst und Krempel“ war nun die letzte Instanz für die Entscheidung der Tochter, ob man das eigenwillig geformte farbenfrohe Porzellan aufheben oder wegtun sollte.

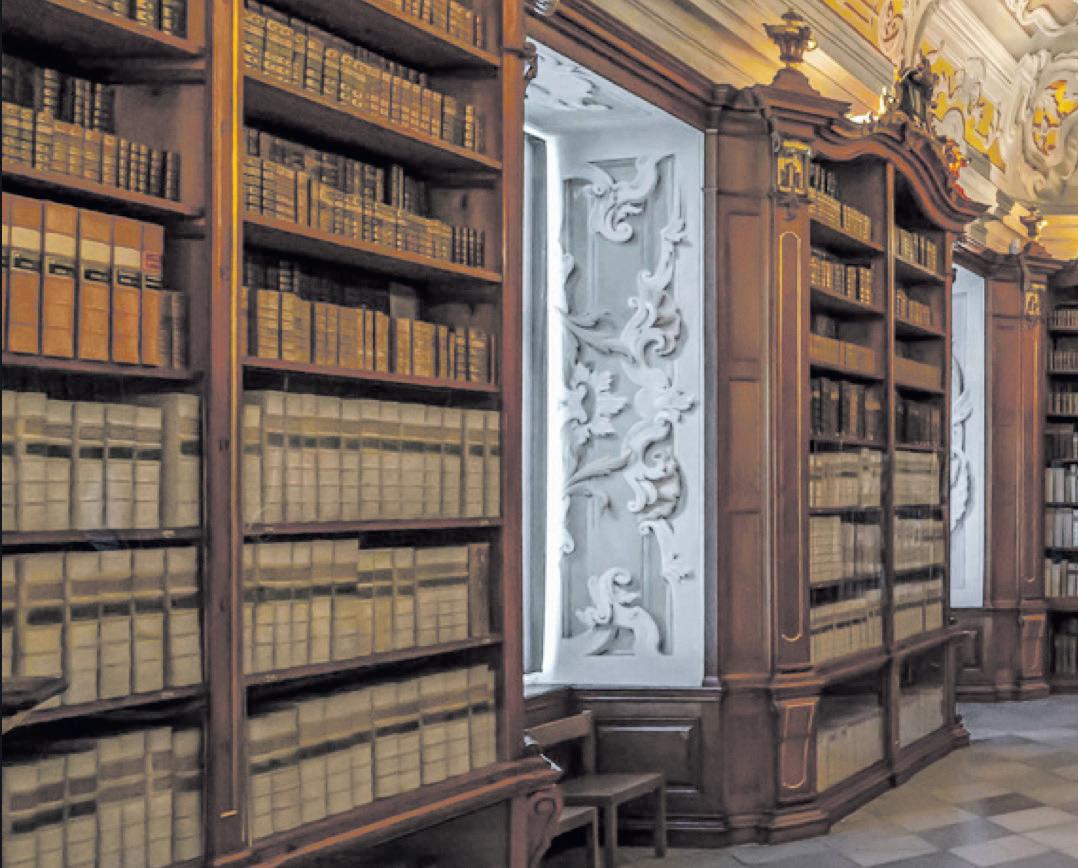





Die Experten rieten zum Aufheben und taxierten einen Wert von 300 bis 500 Euro mit der Tendenz einer höheren Einschätzung, wenn man den Hintergrund dieses besonderen Einzelstücks herausfinden könne. Doch wie kamen sie zu diesem Urteil? Der Porzellanexperte von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Potsdam, Samuel Wittwer, erkannte in dem Kaffeeservice für sechs Personen, dem nur der Kannendeckel fehlt, ein klassisches Porzellangedeck, bei dem die ausschließlich von Hand ausgeführte Malerei mit ihren leuchtenden Farben auffalle. Auch das Porzellan habe teilweise eine leicht gelbe Färbung, und die Vergoldung besteche mit Besonderheiten. Die am Boden des Porzellans eingepreßten Buchstaben T und K verrieten die Marke.

Das veranlaßte Anke Wendl, Auktionatorin aus Rudolstadt, das Service in Böhmen zu verorten. „TK“ stehe für „Thun Klösterle“. Das Geschlecht der Thuns und Hohensteins existiere seit


dem 13. Jahrhundert. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hätten die Thuns das Schloß in Klösterle an der Eger zwischen Erz- und Duppauer Gebirge bezogen. Die Manufaktur sei natürlich jüngeren Datums. Kurz vor 1800 sei


mit Thüringer Fachleuten diese Porzellanmanufaktur gegründet worden, 1820 hätten die Thuns die Manufaktur übernommen und sie zu großer Bedeutung geführt. Sie hätten auch für das Kaiserhaus gearbeitet. Die eingepreßte Marke sei bis 1913 verwendet worden. Also müsse das Service vorher entstanden sein.

Die unpraktische Henkelform und das Dekor legten eine Spur, in welchem Zusammenhang dieses einmalige Service hergestellt worden sein könne, sagte Wittwer. Es erinnere ihn an ungarische oder tschechische Volkskunst. Und man denke an die Milleniumsausstellung von Budapest 1896 oder die Allgemeine Landesausstellung in Prag 1891, wo ur-ungarische oder ur-tschechische Formen gesucht und propagiert worden seien.
So erinnerten die zum Anfassen ungeeigneten Henkel an Hirtengefäße aus Holz, aus denen man Milch getrunken habe und die damals ein Verkaufsschlager gewesen seien. Auch das Dekor
sei aufwendig gemalt und spiegle einen tschechischen Nationalstil. Deshalb könne man das Service in die Zeit der Ausstellung um 1891 datieren, wenn es nicht sogar eigens für diese Ausstellung gemacht worden sei. Anke Wendl fügte an, daß sie diese Henkelform noch nie bei anderen Servicen gesehen habe. Aber ThunKlösterle habe immer für besondere Spezialitäten wie rosa Porzellan gestanden und besteche mit hoher Qualität. Alles sei von Hand gemalt und nicht vorgedruckt. Was die Experten in der Kürze der Zeit nicht ansprechen konnten, kann aber im Blick auf dieses besondere Porzellanservice ergänzt werden. Noch heute kann man im Schloßmuseum in Klösterle eine Porzellanausstellung bewundern, die auf die zweitälteste Porzellanmanufaktur in Böhmen verweist. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß die Thunsche Porzellanmanufaktur durchaus zur Allgemeinen Landesausstellung in Prag 1891 etwas beisteuerte. Sie war zwar eine Leistungsschau der tschechischen Industrie unter Boykott der meisten deutschen Industriellen, erhielt aber auch viel Beachtung in der deutschen Öffentlichkeit der Zeit. Denn unter den Mitgliedern des General-Komitees der Organisation dieser Industrieschau war auch der spätere Ministerpräsident Österreichs und langjährige Statthalter in Prag, Graf Franz Thun, zwar aus der Tetschener Linie, aber immer bemüht einen tschechisch-deutschen Ausgleich in Böhmen zu erreichen.
Jedenfalls antwortete die Mutter der Besitzerin des seltenen Porzellanservices nach der Expertenberatung bei Kunst und Krempel auf die Frage, was sie denn nun ihrer Tochter raten werde: „Sie soll das Service behalten, weil es doch etwas Besonderes ist.“ Ulrich Miksch

� SL-Ortsgruppe Passau/Niederbayern
Am 4. März gedachte die niederbayerische SL-Ortsgruppe Passau der Toten des 4. März 1919 und des Selbstbestimmungsrechts der Völker im Passauer Gasthof Aschenberger. Gedenkrednerin war Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates und Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, deren Eltern aus Tachau im Egerland stammen.

Peter Pontz, Obmann der SLKreisgruppe Passau, begrüßte die Gäste und hieß Christa Naaß willkommen. Um die Landsleute auf das Gedenken einzustimmen, las er einen Bericht über die Geschehnisse am 4. März 1919 aus der „Deutschen Leipaer Zeitung“ vom 8. März 1919 vor. Gregor Berg-Bach, Jonathan Groß und Peter Slowioczek begleiteten das Gedenken mit Stücken aus Wolfgang Amadeus Mozarts Trio für Oboe, Klarinette und Fagott Nr. 2 in B-Dur. Naaß gratulierte zunächst Ortsobfrau Helga Heller, der Grande Dame der SL Passau, nachträglich zur Silbernen Verdienstmedaille der Landesgruppe Bayern. Heller war vor 95 Jahren in Böhmisch Leipa zur Welt gekommen. Diese März-Gedenk-Feier sei, so Naaß, angesichts des am 24. Februar 2022 von Wladimir Putin begonnenen Krieges gegen die Ukraine wichtig – auch als mahnende Erinnerung. Immer wenn nationalistisches Denken die Oberhand bekomme, wenn Minderheiten ausgegrenzt würden, werde das Selbstbestimmungsrecht der Völker mißachtet, komme es zu Menschenrechtsverletzungen, zu Vertreibungen, zu Krieg. Gestern wie heute erlebten wir aber auch, wie Minderheiten instrumentalisiert würden, um Gebietsforderungen stellen zu können. Aus ihrer Erfahrung heraus kämpften die Sudetendeutschen für die Rechte von Minderheiten und Volksgruppen weltweit.
So habe der Sudetendeutsche Rat eine Resolution für die Durchsetzung eines Europäischen Volksgruppen- und Minderheitenrechts verabschiedet. Angesichts des russischen Angriffes auf die Ukraine habe die Seliger-Gemeinde in einer Resolution das Einstellen des Krieges gefordert. Die Sudetendeutsche Bundesversammlung habe in einer Entschließung ebenfalls den Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt.
Der 4. März 1919 sei Teil der Vergangenheit, vor der man nicht die Augen verschließen dürfe und der Grund sein müsse, für das Recht auf Heimat und das Selbstbestimmungsrecht aller Völker einzutreten. Detailliert schilderte Naaß die Ursachen und Hintergründe, den Ablauf und die Folgen der Verbrechen vom 4. März 1919 im Sudetenland.
� Zum 150. Geburtstag des Beskidenmalers Hugo Baar aus dem Kuhländchen
Der Landschaftsmaler Hugo Baar kam am 3. März 1873 in Neutitschein im Kuhländchen zur Welt und starb am 18. Juni 1912 im oberbayerischen München. Hans-Karl Fischer berichtet.


In meinem Artikel zum 110. Todestag von Hugo Baar mußte ich offen lassen, warum der Maler der Beskiden, des Gebirges im Süden von Neutitschein, kein einziges Bild von seiner Heimatstadt gemalt hatte. Die Vermutung lag nahe, daß die rege Bautätigkeit, die von seiner Kindheit kaum etwas übrig gelassen hatte, die Ursache war. Nun soll die Auswertung von vier zeitgenössischen Berichten dazu beitragen, das Verhältnis Hugo Baars zu seiner Heimatstadt aufzuklären. Ich fand sie in einem anonymen Aufsatz, den ein tschechischer Kenner Hugo Baars vor 30 Jahren geschrieben hatte.
Buchhandlung von Reiner Hosch in Neutitschein ein Winterbild auszustellen. Er bat die Redaktion der ,Deutschen Volkszeitung‘, daß sich einer von den damaligen Kunstkritikern aus Neutitschein zu seinem Werk äußere. Der Bitte entledigte sich der Kritiker mit den Worten: ,Ich bitte, daß man mir die Aufgabe erläßt; der junge Mann tat mir nichts; warum sollte ich ihm weh tun?‘“


gen. Aber seine malerische Entwicklung spielte sich in den Beskiden ab.
Kubiena hatte Baar zu dieser Zeit bereits recht viele Motive der Beskiden nahe gebracht. Mittlerweile hatte der Maler in seiner Heimatstadt zwar Anerkennung gefunden; diese Anerkennung spiegelt jedoch zu einem bestimmten Teil diejenige in anderen Städten sowie durch andere Personen.
Bitter gerächt hätten sich der Ausschluß der Deutschen von der Mitwirkung an der tschechoslowakischen Verfassung, der disproportionale Abbau von deutschen Beamten, die Benachteiligung deutscher Firmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und die Hilflosigkeit des Staates gegenüber der folgenden hohen Arbeitslosigkeit in den deutschen Siedlungsgebieten.
Die Tschechisierungspolitik habe den Grundstein dafür gelegt, daß die meisten Sudetendeutschen 1938 das Münchener Abkommen begrüßt hätten. „Was folgte, wissen wir: der Zweite Weltkrieg mit mehr als 60 Millionen Toten.“ Ihm wiederum seien die Vertreibung der Sudetendeutschen, die mehr als 40jährige Spaltung Europas und tiefgreifende Verletzungen im Bewußtsein der Völker gefolgt, die bis heute nachwirkten.
Naaß: „Für uns alle war es unvorstellbar, 77 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, nach dem unermeßlichen Leid durch Flucht und Vertreibung, nach einer Politik des Ausgleichs und der Verständigung und dem Fall des Eisernen Vorhangs, daß sich in Europa derartige Ereignisse wiederholen könnten.“

Bereits im Wiesbadener Abkommen von 1950 sei das Ziel einer auf freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes und Freiheit beruhender Ordnung in einem freien und demokratischen Europa deutlich formuliert worden. Das sei ein Ziel, an dem 73 Jahre später immer noch und immer wieder gearbeitet werden müsse.
„Denn auch unser Haus Europa hat in den vergangenen Jahren große Risse bekommen. Erfreulich, daß die EU in der Ukraine-Krise wieder zusammenwächst und sich auf gemeinsame Positionen verständigt.“
„Wir wollen heute nicht nur an die März-Opfer erinnern, sondern uns auch solidarisch mit der Ukraine und den Ukrainern erklären. Von dieser Gedenkveranstaltung soll das Signal ausgehen: Krieg, Flucht und Vertreibung dürfen keinen Platz mehr in Europa haben. Es geht um unsere wichtigsten Werte – hier, in der Ukraine und überall auf der Welt. Es geht um Frieden und Freiheit, um Demokratie und Menschlichkeit!“ Mit diesem eindringlichen Appell schloß Christa Naaß.
Marianne Kretschmer las das Gedicht „Zum 4. März“ von K. N. Mrasek. Anschließend ehrte Kreisobmann Peter Pontz zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zur SL. Nach der Europahymne und dem Deutschlandlied dankte Ortsobfrau Helga Heller Christa Naaß für ihre bewegende Gedenkrede und den Landsleuten für ihr Kommen. Nadira Hurnaus
Alles hatte so gut begonnen. Hugo Baar hatte ein Bild für die Weinstube Liewehr gemalt, mit dem er die Aufmerksamkeit der kunstsinnigen Kleinstädter gewann: „In der Zeit, wo Hugo Baar an der Kunstgewerbeschule in Wien studierte, überraschte er seine Landsleute mit einer Arbeit in größerem Stil für Liewehrs Weinstube in Neutitschein. Es war ein Wandgemälde, reich an Figuren.“
Wenn es wahr ist, daß Hugo Baar das Bild für die ortsbekannte Weinstube in seiner Wiener Zeit malte, dann handelte es sich um die Jahre 1892 bis 1895 oder 1896 bis 1897. Damals wollte er noch Dekorationsmaler werden. Bereits der Autor dieses Berichts spricht von dem Fresko in der Vergangenheit. Wahrscheinlich hatte es einen sehr geselligen Inhalt, wie es einer Weinstube entsprach.
Die Überraschung für die Neutitscheiner bestand darin, daß ein 20jähriger ein solches Bild vollenden konnte. Überraschend ist dieses unbekannte Gemälde nicht weniger im Nachhinein. Wie kam der spätere Landschaftsmaler dazu, Bilder von Menschengruppen zu malen, die überdies bewundert wurden? Als Hugo Baar den Trachtenumzug der Kuhländler zum 60. Thronjubiläum Kaiser Franz Josephs I. organisierte, führte er gleichfalls Gruppenbilder auf: von der Hochzeit seiner Großeltern im Jahre 1821. Liewehrs Weinstube in Neutitschein war eine Künstlerkneipe, mit der es in Neutitschein nur noch die Goldene Sonne aufnehmen konnte. Doch sollen in der Weinstube nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Künstler verkehrt haben, die von auswärts wieder einmal in ihrer Heimatstadt vorbeisahen. Solange das Bild dort hing, konnte jeder, der sich für Kunst interessierte, sehen, daß es mit Hugo Baar einiges auf sich hatte. Er galt als Hoffnung. Aber eine Hoffnung muß allen gefallen; wenn sie das nicht mehr tut, ist sie keine Hoffnung mehr. Ein Bericht aus den Jahren, in denen Hugo Baar Malerei in München studierte, lautet folgendermaßen: „Er traf auf Schwierigkeiten und Unverständnis, und das auch in der Heimat. Er nahm seine malerische Kunst ernst, bemühte sich, die Aufmerksamkeit der Künstlerkreise zu gewinnen, und deshalb versuchte er einmal, im Schaufenster der
Bemerkenswert ist, daß sie sich dem ersten Anschein nach in einer Sphäre vollendeter Höflichkeit abzuspielen scheint. Angedeutet wird jedoch, daß ein sehr unhöflicher Verriß dabei herauskommen würde, wenn der Gebetene der Bitte nachkommen würde. Die Gnädigkeit seines Verhaltens rührte sicherlich daher, daß er sich bei der allzu geringfügigen Einschätzung des Jugendstils und des Symbolismus von Hugo Baar mit vielen Neutitscheinern einig wußte.
Er wies es von sich, ein Urteil abzugeben, das nur das Echo des allgemeinen Urteils sein konnte. Einzig mit dem Ausdruck „der junge Mann“ ging der Feuilletonist in die Vollen. Er unterstellte der Kunst Hugo Baars angesichts der Zahl seiner Jahre Vorläufigkeit. Die Buchhandlung Reiner Hosch lag übrigens an der Ecke von Stadtplatz und Laudongasse.
Eine weitere Geschichte ist die Aufschrift auf dem großen Bild Friedrich Kubienas (1860–1922), das diesen auf einer Waldlichtung zeigt. Friedrich Kubiena, der vorübergehend sogar Vorsitzender der Neutitscheiner Sektion des Beskidenvereins war, zählte zur Zeit seiner Ehrung erst 44 Jahre. Als Volksschullehrer begann man bereits in sehr jungen Jahren zu unterrichten. Die Aufschrift auf der Rückseite des mehr als zwei Meter breiten und mehr als ei-
Der Sagenforscher Josef Ullrich schreibt in seiner Biographie über Hugo Baar über das Jahr 1907: „Bis in den späten Herbst malte Baar hauptsächlich in Öl und Pastell. Dann machte er einen Versuch mit Temperafarben, die ihm einst als Muster geschickt worden waren. Der Versuch gelang so, daß Pastell und Öl nicht mehr an die Reihe kamen. Auch seine Technik änderte er so, daß sie dem neuen Material entsprach. Sobald er mit seinen ersten Temperabildern (…) vor seinen Wiener Freunden erschien, staunten sie über die durchgreifende Wendung in der Malart (…). Seine Bildung kennzeichneten sich durch eine seltene Frische.“
Hugo Baar war 34 Jahre alt, als ihm mit dem Wechsel der Farbenart eine wesentliche Verbesserung seiner Bilder glückte. Dieser Wechsel ging durch einen Zufall vor sich. Der Maler versuchte es mit Temperafarben, weil er sie von früher her besaß. Waren ihm die anderen Farben ausgegangen? Der Wechsel tat seinen Bildern so gut, daß er fortan bei Temperafarben blieb.
nen Meter hohen Bildes von 1904 lautet: „Mein Freund aus den Beskiden“. Warum war Friedrich Kubiena nicht der „Freund aus Neutitschein“? Das Bild mit dem auf einer Lichtung sitzenden Gefeierten soll während des Dienstjubiläums im Rathaus oder davor auf dem Stadtplatz ausgestellt worden sein.

Hugo Baar hat einerseits im Alter von etwas mehr als 33 Jahren das erreicht, wohin er zehn Jahre vorher mit der Darbietung eines seiner Bilder in der Schaufensterauslage des Buchhändlers Reiner Hosch gestrebt hatte: daß sich die Neutitscheiner mit seiner Malerei beschäfti-
Auffällig an der Geschichte ist meines Erachtens, daß es Hugo Baars Wiener Freunde waren, die die Verbesserung seiner Bilder erkannten. Hugo Baar wohnte 1907 jedoch seit einem Jahr in Neutitschein. Wenn es Josef Ullrich, Zeichenlehrer und von daher ein halber Fachmann, war, der dies aufschrieb, gewinnt die Geschichte an Glaubwürdigkeit. Der Biograph sprang damit über seinen eigenen Schatten. Er beteuerte, daß nicht er selber es gewesen sei, der die Verbesserung von Baars Landschaften erkannt habe, sondern die Maler des Wiener Hagenbundes. Das sagt über Hugo Baars Verhältnis zu Neutitschein viel aus. Die scheinbare Nebenaussage korrespondiert mit einer andern. Hugo Baars Wiener Bekannte soll erst bei seinem Tod aufgefallen sein, daß der Beskidenmaler sechs Jahre zuvor nach Neutitschein gezogen war. Er muß also zumindest so häufig in Wien gewesen sein, daß man glaubte, sein Lebensmittelpunkt habe auch nach dem Frühjahr 1906 in der Metropole des k. u. k. Reiches gelegen.
Obwohl Hugo Baar sich mit der Einrichtung einer Heimatstube und mit der Organisation des Umzugs zu Ehren des Kaisers Franz Joseph I. für seine Heimatstadt engagierte und auch vier Porträts für eine Bürgermeistergalerie schuf, muß das Verhältnis zu seiner Heimatstadt zwar als spannend, aber auch als angespannt bezeichnet werden.



Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Dreihunken/Kreis Teplitz-Schönau

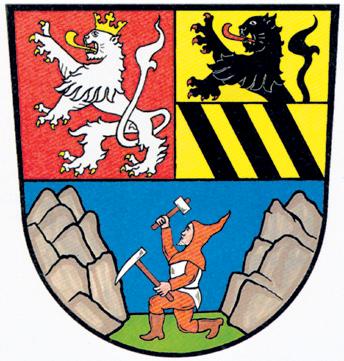


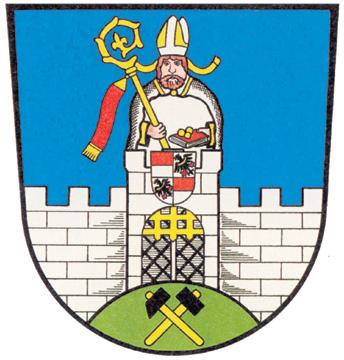
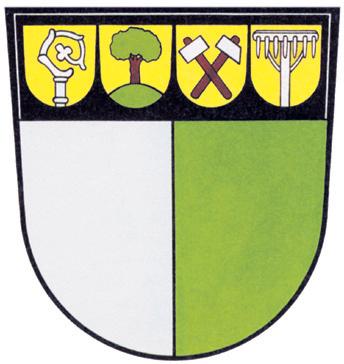

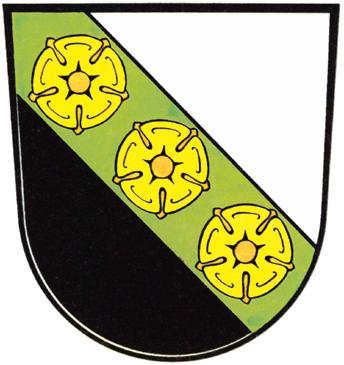

Blick auf das Biliner Schloß Lobkowicz, im Hintergrund der Borschen. Bild: Urbex by Rychy
Am morgigen 11. März vor 100 Jahren kam Volkmar Gabert in Dreihunken, heute ein Stadtteil von Schönwald, zur Welt. Erst kürzlich gedachten wir seines zehnten Todestages (➞ HR 8/2023). Aus Anlaß seines Geburtstages erinnern wir an das Anbringen einer Gedenktafel an seinem Geburtshaus 2016 und das Aufstellen von Informationstafeln über den größten Sohn Dreihunkens in der Ortsmitte im September 2019.
terpartei in der Tschechoslowakischen Republik (DSAP) beigetreten. Volkmar sei hier nach dem Vorbild seiner Eltern im Einsatz für die Arbeiterbewegung aufgewachsen.
❯ Die Lobkowicz-Brauerei in Bilin – Teil 1
Auf der ganzen Welt gibt es junge Leute, die ihre Abenteuerlust befriedigen, indem sie – meist ohne Erlaubnis – verlassene und verfallende Häuser, Villen oder Industrieobjekte fotografieren und über das Internet ihre Erlebnisse mitteilen. So machen sie auf vernachlässigte Gebäude aufmerksam. Oft sind ihre Bilder und Beschreibungen die letzten Dokumentationen, die von historisch wertvollen Nachlässen existieren, bevor sie abgerissen werden. Diese weltweite Bewegung nennt sich Urban Exploration (Urbex). Unsere Korrespondentin Jutta Benešová nahm Kontakt mit einem Urban Explorer (Urbexer), nennen wir ihn Lukas, auf, um etwas über den derzeitigen Zustand der alten Lobkowicz-Brauerei in Bilin zu erfahren. Lukas hatte die Stadt Bilin offiziell um Erlaubnis gebeten, die verfallene Brauerei besuchen zu dürfen, da er erfahren hatte, daß die Stadt eine Rekonstruktion plant. Ausgerüstet mit Fotoapparat und Drohne für Außenaufnahmen begab er sich im August auf diese interessante Besichtigung. Mit seinem Einverständnis veröffentlicht der Heimatruf seinen von Jutta Benšova leicht gekürzten und übersetzten Bericht in Fortsetzungen.
Das letzte Jahr war ein Wendepunkt für mich, da ich zu dem zurückgekehrt bin, was mir im Leben wirklich Spaß macht. Erforschen, etwas Mystik und vor allem Ruhe – Ruhe von der Außenwelt. Niemand eilt an verlassenen Orten zur Arbeit oder eilt nach Hause. Im Gegenteil, hier vergeht die Zeit langsam, aber nicht immer sicher. Heute nehme ich euch mit an einen Ort, der mir meine Lust auf neues Schaffen zurückgegeben hat. Lehnt euch zurück, holt euch eine Tasse Tee und nehmt euch einen Moment Zeit, um euch zu entspannen, genau wie ich es getan habe.
Anfang August nahm ich mit der Stadt Bilin über ihre offizielle Webseite Kontakt auf. Ich schrieb, daß ich ein Angebot für sie habe. Im Garten hatten wir das historische FußbodenPflaster aus dem Hotel Zum Löwen, das sich auf dem Marktplatz in Bilin befindet. Das Hotel wurde zwar in den 1990er Jahren renoviert, dabei wurde aber dieses Pflaster entfernt und von einem neuen ersetzt.



Ich bot an, das Pflaster der Stadt, aus der es entfernt worden war, zurückzugeben, zum Beispiel für einen der Teile
■ Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: Heimattreffen in Teplitz-Schönau. Das Programm erscheint im Mai.




der Brauerei als Symbol der verlorenen Vergangenheit. Wir einigten uns auf die Übergabe, und ich fragte, ob sie mich zum Fotografieren in die Brauerei lassen würden. Es war nicht so einfach sich zu einigen, da das Gelände in einem desolaten Zustand ist. Aber nun kann ich euch Fotos von dem großen Areal der Schloßbrauerei zeigen.
Die Geschichte der Brauerei reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die älteste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1615. Sie wurde von der Familie Lobkowicz im Tal des Lukower Bachs direkt unterhalb des Schlosses gebaut und von Anfang an mit dem angrenzenden Wirtschaftshof verbunden. Dieser wurde im Laufe der Zeit zu einem vollwertigen Bestandteil der Brauerei und ist heute auch der älteste Teil der Anlage. Im Jahr 1660 brach in der Brauerei ein Brand aus, dessen Folgen schnell beseitigt wurden.
Die Brauerei wurde weiter ausgebaut, zum Beispiel in Richtung Brauerei-Platz. Dabei erhielt das Gebäude ein schönes Volutenschild, auf dem wir die Jahreszahl 1695 und darunter die Inschrift „Brauerei“ finden. Mit den Jahren und der Steigerung der Produktion kamen auch viele Modernisierungen hinzu. Dazu gehörten zum Beispiel größere Umbauten zwischen 1798 und 1810 nach den Plänen von Ingenieur Witschiegl. Im Felsmassiv direkt unterhalb des Schlosses wurde 1880 ein neuer Lagerkeller samt Verbindungsgang direkt zum Schloß errichtet. Fortsetzung folgt
Am Geburts- und Wohnhaus von Karls-Preisträger Volkmar Gabert in Dreihunken weist seit 2016 eine Gedenktafel auf ein Kapitel sudetendeutscher Geschichte hin. Der Text ist in tschechischer und deutscher Sprache eingraviert und lautet: „In diesem Haus wohnte bis 1938 der deutsche Sozialdemokrat Volkmar Gabert 1923–2003. Nach dem Exil in Großbritannien wirkte er als führender Sozialdemokrat in Bayern, Deutschland und Europa.“ Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek hatte die Information über das Geburtshaus von Martin Rak, einem Lehrer des Teplitzer Gymnasiums, erhalten. Die ČSSD organisierte und finanzierte die Gedenktafel. Der damalige Bürgermeister Petr Pípal hatte zur Übergabefeier öffentlich und gezielt Persönlichkeiten der örtlichen Politik sowie Bürgermeister und Räte der lokalen ČSSD eingeladen.
Beim feierlichen Empfang im Rathaus begrüßte er besonders Inge Aures, Vizepräsidentin des Bayerischen Landtages, Peter Wesselowsky vom Bundesvorstand der Seliger-Gemeinde, Renate Slawik, Geschäftsführerin der Seliger-Gemeinde und langjährige Mitarbeiterin Volkmar Gaberts, sowie Erhard Spacek. Der Bürgermeister fand es wichtig und gut, auf die Geschichte ehemaliger sudetendeutscher Landsleute hinzuweisen, die sich in der Tschechoslowakischen Republik Verdienste um das friedliche Zusammenleben und um die Demokratie erworben hätten.
Ihn hätten viele soziale, kulturelle und sportliche Organisationen wie Sportverband, Naturfreunde, Falken oder Volksbühne geprägt. Schon als Jugendlicher hätten ihn die sozialdemokratischen Ideale Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität begeistert. Nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in das Sudetenland am 29. September 1938 sei der


Republik Gewicht. Sie wurde gehört –bis hinauf in die Prager Burg zu Zeiten von Staatspräsident Václav Havel. Er hat mitten in den dunklen Zeiten des Kalten Krieges den Grundstein dafür gelegt, daß sich die Tschechische Republik und Bayern heute als gute Nachbarn verstehen.“
1950 wurde er mit nur 27 Jahren in den Bayerischen Landtag gewählt, dem er bis 1979 angehörte. Er führte die Landtagsfraktion und als Landesvorsitzender die bayerische SPD zu Rekordergebnissen bei den Landtagswahlen 1962 mit 35,3 Prozent und 1966 mit 35,8 Prozent. Mit den Sozialdemokraten, vor allem jenen aus dem Sudetenland, arbeitete er erfolgreich an der Entwicklung Bayerns vom Agrarstaat zu einem modernen Industrieland. Er erzielte besondere Erfolge etwa im Kampf um die Einführung der christlichen Gemeinschaftsschule oder beim Volksbegehren für Rundfunkfreiheit. Ab 1979 wirkte er im Europäischen Parlament. Dort setzte er sich maßgeblich für die Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen ein.

Dreihunken 2016: Der damalige Bürgermeister Petr Pípal und Inge Aures, damalige Vizepräsidentin des Bayerischen Landtages, vor der gerade enthüllten Volkmar-Gabert-Gedenktafel an Gaberts Geburtshaus.
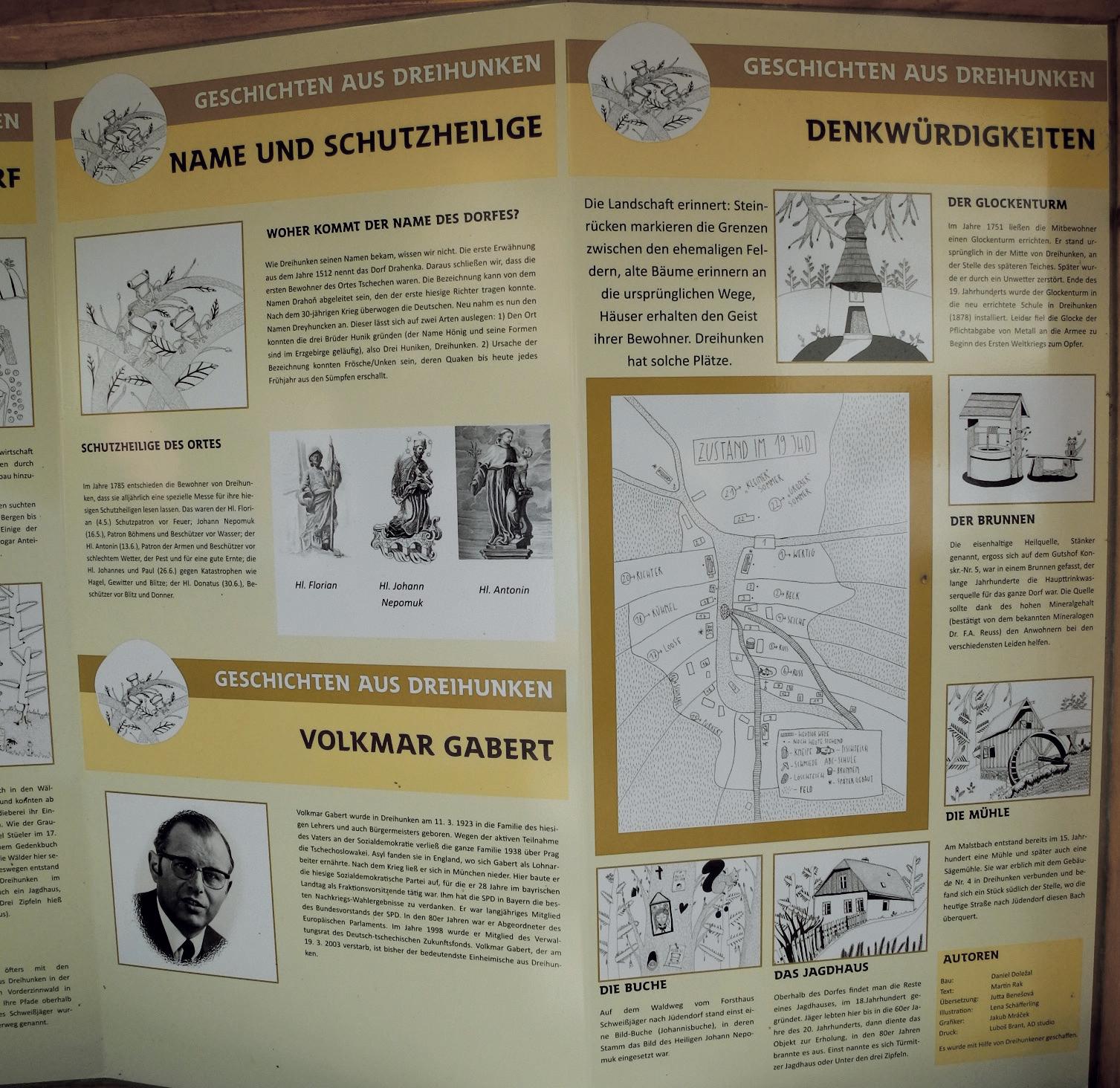
Familie Gabert noch die Flucht über Polen nach England gelungen. 1945 habe Volkmar Gabert nicht mehr in seine Heimat zurückkehren können und sei ein Vertriebener geworden. In München habe er ein neues Zuhause und in Bayern eine politische Wirkungsstätte gefunden.
Vor Gaberts Geburtshaus hatte sich eine stattliche Zahl Bürger versammelt. Peter Wesselowsky schilderte in seiner Ansprache den Lebenslauf von Volkmar Gabert, der in diesem Haus als zweites von vier Kindern der Lehrerfamilie Gabert zur Welt gekommen sei. Der Vater, ein tüchtiger Lehrer, sei bereits 1919 der Deutschen Sozialdemokratischen Arbei-
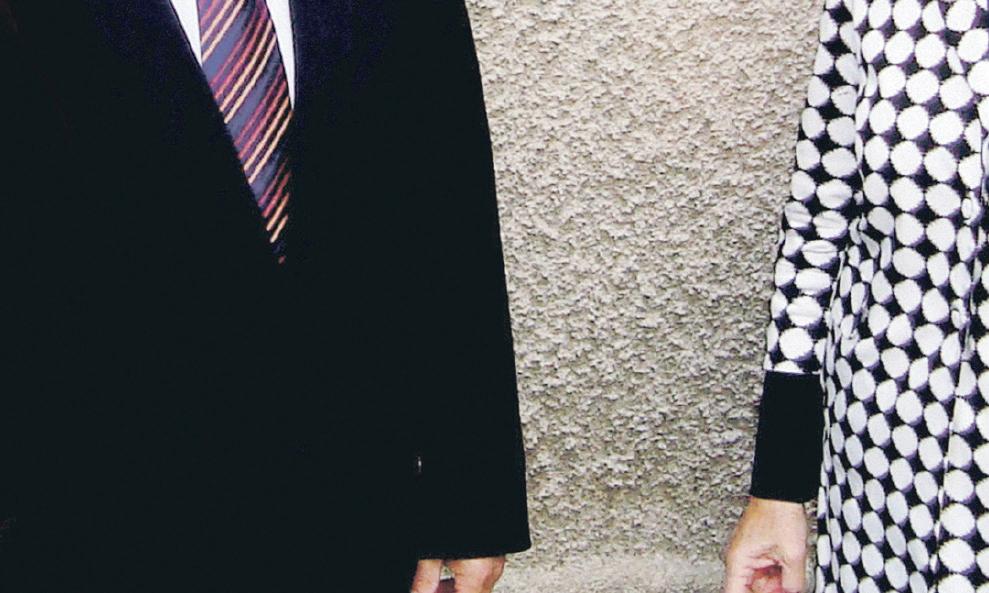
Inge Aures MdL, eine seiner Nachfolgerinnen im Amt des Landtagsvizepräsidenten: „Gabert gehörte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der bayerischen SPD. Er hat die Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen maßgeblich vorangetrieben und war in beiden Ländern hochgeachtet. Seine Stimme hatte auch in der Tschechischen
Als Vorsitzender der Seliger-Gemeinde und Mitglied im Verwaltungsrat des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds war er Wegbereiter zu einer Zeit, als viele noch Vorbehalte gegen eine Aussöhnung hatten. Den Europäischen KarlsPreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der ihm 1997 verliehen wurde, verstand er als eine besondere Würdigung seines Bemühens um Ausgleich, letztlich auch für seinen exemplarischen Lebensweg. Das Anbringen der Gedenktafel, das öffentliche Bekenntnis, gereichte den Verantwortlichen zur Ehre und ist Ansporn für die Zukunftsgestaltung.
An einem Septemberwochenende drei Jahre später feierte die Seliger-Gemeinde in Teplitz-Schönau mit SPD und ČSSD 100 Jahre DSAP. Bei dieser Gelegenheit unternahmen die Teilnehmer bei herrlichem Spätsommerwetter eine Bustour zu wichtigen Stätten der DSAP. Unter Leitung von Thomas Oellermann von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag machte man auch Halt am Elternhaus von Volkmar Gabert in Dreihunken. In der Ortsmitte konnten die Genossen eine deutsch-tschechische Gedenkausstellung ansehen, die dem größten Sohn Dreihunkens, Volkmar Gabert, gewidmet war.
Dreihunken 2019: Der deutsche Teil der Gabert-Ausstellung, daneben Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek, Libor Rouček, ehemaliger Vizepräsident des Europaparlaments, und Martin Rak mit einer Fotografie von Dreihunken in deutscher Zeit. Bilder (2): Ulrich Miksch
 Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
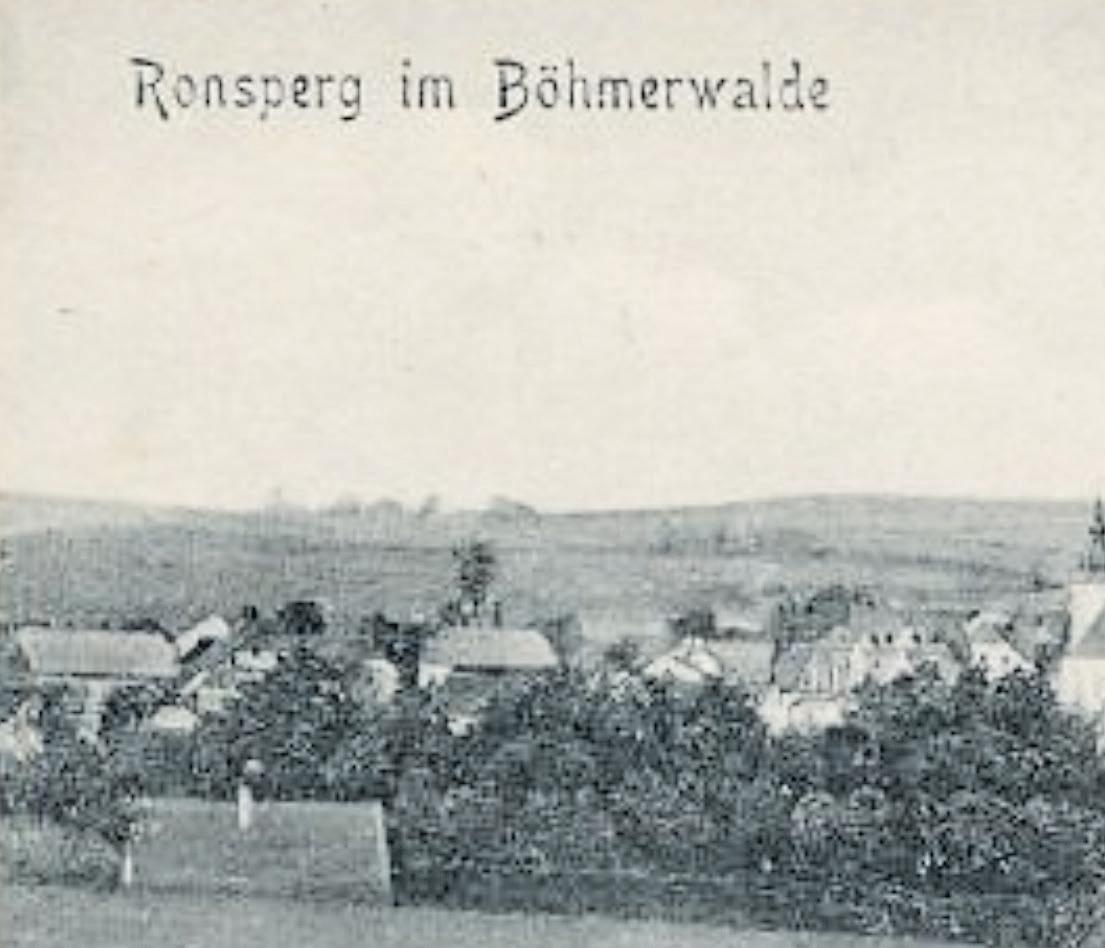
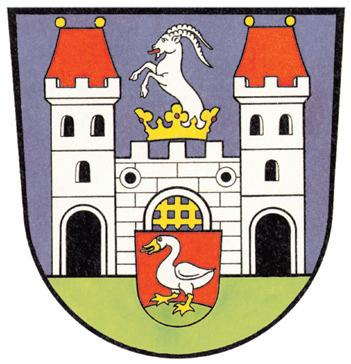
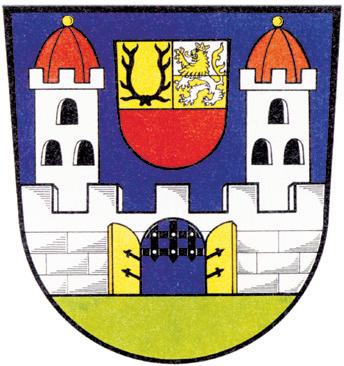
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


❯ Hostaus Pfarrer – Teil XV





Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der zweite Teil über Pfarrer Peter Steinbach (1843–1917).
In Grammatin hat die Dechantei ein Feld verpachtet. Die Pächter weigern sich, die Pacht zu zahlen, da Bauern aus Grammatin seit Jahren mit ihren Gespannen über dieses Feld fahren. Steinbach überredet die Pächter, den Bauern aufzulauern, um sie dingfest zu machen.
Die besitzstörenden Bauern werden anschließend von Steinbach bei der k. k. Finanzprokuratur in Prag auf Besitzstörung an Pfarrgemeindegrund angezeigt.
❯ Ronsperg


Heinrich Cenefels überliefert eine Anekdote über das Ronsperger Wirtshausleben.
Während das Gasthaus Krone meist Mittwoch und Samstag die durstigen Gäste kaum fassen konnte, war das Reinlwirtshaus das Ziel vieler Ronsperger Bürger am Sonntag. Trotz des großen Gastzimmers mit drei langen Tischen herrschte hier immer echte Ronsperger Gemütlichkeit. Besonders gesucht war diese Gaststätte im Sommer an einem schwülen Tag, wenn die zahlreichen Spaziergänger sich im letzten Augenblick vor einem Regen in die rasch erreichbare schützende Einkehrstube im Reinlgaßl flüchten konnten. Sie war rasch gefüllt, und der tüchtige Reinlwirt hatte alle Hände voll zu tun, um die durstigen Kehlen so rasch wie möglich zu befriedigen.
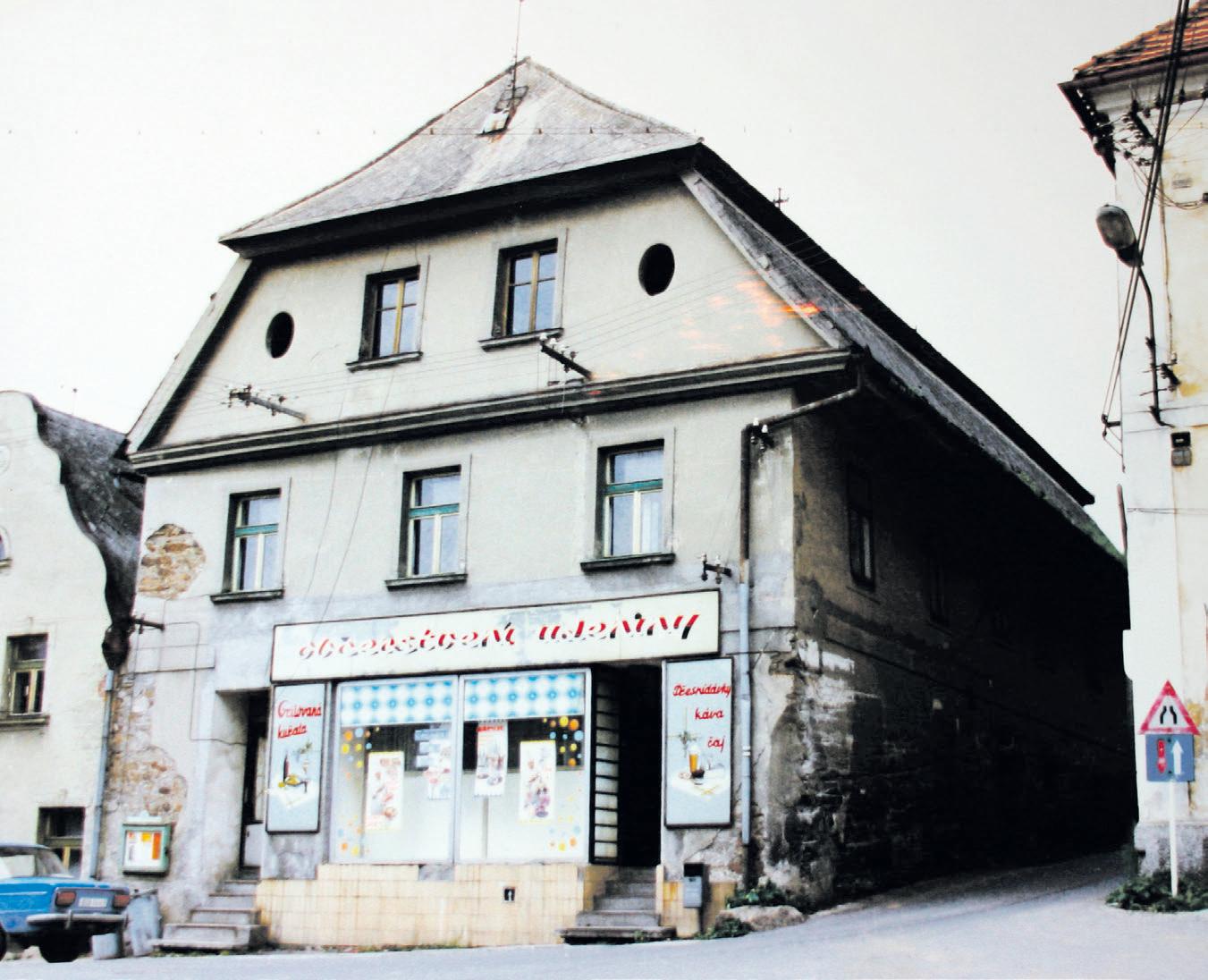
Bald hatten sich je drei oder vier Kartennarren zu einer Mariagepartie zusammengefunden, während die übrigen Gäste schwatzten und lachten und so auf ihre Rechnung kamen. Draußen konnte es dann regnen, wie es wollte, sie waren ja unter Dach. Rasch war der Abend vorbei, und erst die herannahende Mitternacht und eventuell unser umsichtiger Nachtwächter bewirkten, daß sich der große Raum wieder nach und nach leerte, denn am Montag mußten ja unsere Bürger wieder an ihre Arbeit.
Nur am Kopfende des Mitteltisches klopfte noch eine Kartenpartie die Tischplatte, und die Kontra und Re, Sub, Tutti Frutti und Steyrerwagl flogen nur so hin und her. Diese Partie hatte außer den üblichen Kiebitzen auch einen weiblichen Kiebitz, die Frau eines Mitspielers. Nennen wir sie Gisa und ihn, den Mann, Karl. Dieses Ehepaar, nicht mehr jung an Jahren, war auch sonst unzertrennlich. Die Freunde des Mannes mochten diese Anhänglichkeit nicht, besonders nicht am Biertisch,
und gerade heute blieb sie wieder bis über Mitternacht, die getreue Hüterin ihres Ehegesponses.
Da hatte einer die Idee, Frau Gisa abzuschütteln. Das Bedürfnis, die durch die Kehle eingegossene Flüssigkeit wieder loszuwerden, spüren Kartenspieler gewohnheitsgemäß zur gleichen Zeit. Ein gegenseitiges Augenzwinkern war das Zeichen, dann war‘s wieder soweit. Karl schloß sich den drei übrigen Spielern ohne Argwohn an, und Gisa konnte ob ihrer guten Erziehung nicht mitgehen. Draußen im fin-
steren Reinlgaßl wurde der ahnungslose Karl in das vor dem Wirtshaus parkende Auto eines Mitspielers verfrachtet, dasselbe ohne Lärm mit Leerlauf durch Anschieben über den sanft abfallenden Ringplatz in Bewegung gesetzt und dann ab Heschahaus Richtung Stockau in rasche Fahrt gebracht. In der Wirtsstube wartete Frau Gisa vergebens auf die Rückkehr der Spieler. Böses ahnend, eilte sie nach einer Weile ins Freie, und siehe da, es regnete immer noch, aber ihr Mann und die Spieler waren spurlos verschwunden.
Nein, doch nicht spurlos, denn der Regen machte auf dem nichtasphaltierten Ringplatz die Spur des abgefahrenen Autos deutlich sichtbar, die in Richtung Stockau wies. Kurzentschlossen klingelte sie den Taxi-Chauffeur Franz aus dem Nachbarhaus heraus und fuhr den Ausreißern nach. Und wirklich: Die Spur führte zum Gasthaus Rieß nach Stockau. Die Augen der vier Spieler sollen sehr groß gewesen sein, als Frau Gisa wie eine Rachegöttin bei ihnen auftauchte.
Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. Während Frau Gisa dem vermeintlichen Ausreißer, ihrem Mann, die Leviten las, verständigten sich die anderen Männer über einen weiteren Schabernack. Der Taxifahrer wurde vorsichtig eingeweiht und nach guter Entlohnung zum Heimfahren bewogen.
Weil sich Karl nicht schuldig fühlte, nahm er den Tadel seiner Frau keineswegs stillschweigend hin. Diese eheliche Auseinandersetzung nutzten die drei übrigen Spieler, um so rasch wie möglich ins Freie zu flüchten und mit dem Auto Richtung Ronsperg davonzubrausen.
Zu spät bemerkten Karl und Gisa den neuen Streich, und was das Schrecklichste war, es regnete immer noch unaufhörlich. Ja, aber Karl mußte früh im Dienst sein.
In Stockau gab‘s damals noch kein Taxi. Also blieb als einzige Möglichkeit heimzukommen ein Fußmarsch. Arm in Arm zogen beide heim, und dieser etwa fünf bis sechs Kilometer lange Weg im stärksten Regen ließ an beiden keinen trockenen Faden. Über das Gesprächsthema auf diesem nassen Heimweg weiß der Erzähler nichts.
Tatsache aber war, daß am nächsten Sonntag wieder beide gemeinsam im Reinlwirtshaus eintrafen, was als Zeichen einer guten Ehe gewertet werden kann. Denn dort folgt auf Regen auch immer wieder Sonnenschein.
für das Bild Mariens. Franziska Thoma schenkt zwei neue Weihwasserkessel aus Zinkblech, Anna Grasser zwei neue Handtücher. Im Presbyterium werden die zwei neuen Bilder „Herz Jesu“ und „Herz Mariä“ auf Veranlassung der Clara Watzl aufgehängt. Klara Hujer spendet zwei Altarpolster, vier Handtücher, sechs Purifikatorien, zwei gehäkelte Antependien und zwölf Rosen für die Altarwachskerzen. Maria Kremlička schenkt der Kirche neue Fähnchen für die Ministranten und vier Ministrantengewänder. Ludwig Kremlička, Bezirksgerichtsadjunkt, läßt den kleinen silbernen Kelch vergolden und ein neues Etui anfertigen. Die Schale des Kelches ist mit acht böhmischen Granaten besetzt.
Es kommt zum Prozeß. Steinbach bekommt Recht. Die Angeklagten werden zur Zahlung von je fünf Gulden und der Übernahme der Prozeßkosten verurteilt. Die angrenzenden Nachbarn gestatten daraufhin, um die Felder zu schonen, daß ein Teil von jedem Feld zum öffentlichen Weg geschlagen wird, bis der öffentliche Weg von Hostau nach Grammatin hergestellt ist.
Viele Wohltäter der Pfarrei helfen, die Kirche in Hostau zu schmükken. Henriette Jost, Gattin des Domänendirektors in Bischofteinitz, schenkt der Kirche eine Lampe, die am Altar der Geißelung Christi befestigt wird.
7 3.




Peter Girg und dessen Ehefrau spenden für die versperrte Muttergottes eine neue silberne Kette, da die alte gestohlen wurde. Klara Hujer, Bezirksrichtersgattin, überläßt der Kirche drei neue Altartücher. Josefine Marahs, Steuereinnehmersgattin, spendet zum Schmücken des Maialtars einen Altarvorhang im Wert von zehn Gulden, Magdalene Lobenstein schenkt der Kirche künstliche Blumenstöcke.
26 . BIS28 . MAI 20 2 3 IN



Josepha Marahs spendet eine kleine Votivlampe für die versperrte Muttergottes um 16 Gulden. Johann und Josepha Marahs schenken gemeinsam für 29 Gulden 70 Kreuzer eine Lampe für den Muttergottesaltar. Katharina Lang läßt für 72 Gulden ein neues Kleid mit echter Goldstickerei für die versperrte Muttergottes anfertigen. Bertha Gradmann aus Prag spendet einen neuen Kanzelbehang aus Glasperlenstickerei. Über alle Spenden ist Steinbach sehr erfreut und erbittet für seine Wohltäter Gottes Segen. Im Februar 1887 wird als weitere Bereicherung der Liturgie der Blasius-Segen in Hostau eingeführt, dessen Erteilung hier noch nicht üblich war. Im Sommer 1887 wird das Dach des Kirchturmes mit weißgrauer Ölfarbe gestrichen. Insgesamt entstehen Kosten um 118 Gulden.
Maria Schmid, Kaufmannsgattin, spendet auch ein Altartuch. Karoline Plačnik, Notarsgattin, sendet der Kirche künstliche Blumen und eine Seidenschleife für den Maialtar. Franziska Thoma läßt die Josefsstatue in der Kirchenvorhalle staffieren. Susanna Hubl, Mutter des Postmeisters, läßt die Kronen von der Statue der versperrten Muttergottes und des Jesukindes in Wien vergolden. Maria Girg läßt Leuchter bei den Kreuzwegbildern anbringen.
Franz Routschka schenkt der Kirche einen steinernen Weihwasserkessel, der in der Vorhalle aufgestellt wird. Die fürstliche Köchin opfert ebenfalls zwei künstliche Blumenstöcke. Anna Halla aus Muttersdorf spendet einen künstlichen Blumenkranz
Zur Rubrik „Wir gratulieren“ mit den Glückwünschen für die Geburtstagskinder aus Heiligenkreuz und Haselberg im März (➝ HB 9/2023) bittet Ortsbetreuer Peter Gaag um Folgen-
Anfang des Jahres 1888 erhält Steinbach eine anonyme Spende in Höhe von 100 Gulden mit dem Auftrag, dafür die Dreifaltigkeitsstatue auf dem Ringplatz wieder instandzusetzen. Die Heiligenstatuen sind stark beschädigt, die Johannesstatue sogar ohne Kopf.
Der Kirchenverschönerungsverein beauftragt den Maler Ignaz Amerling aus Taus im Sommer 1888 mit der Ausmalung der Dechanteikirche. Sowohl durch die Beiträge der Vereinsmitglieder als auch zahlreicher Spender, unter anderem der Fürstin Anna von Trauttmansdorff-Liechtenstein (1820–1908), kann das Projekt verwirklicht werden. Pfarrer Peter Steinbach schwärmt vom Eifer der Wohltäter. Er gelobt, ihrer täglich in der Meßfeier zu gedenken. Die Kosten belaufen sich auf 513 Gulden 90 Kreuzer. Fortsetzung folgt
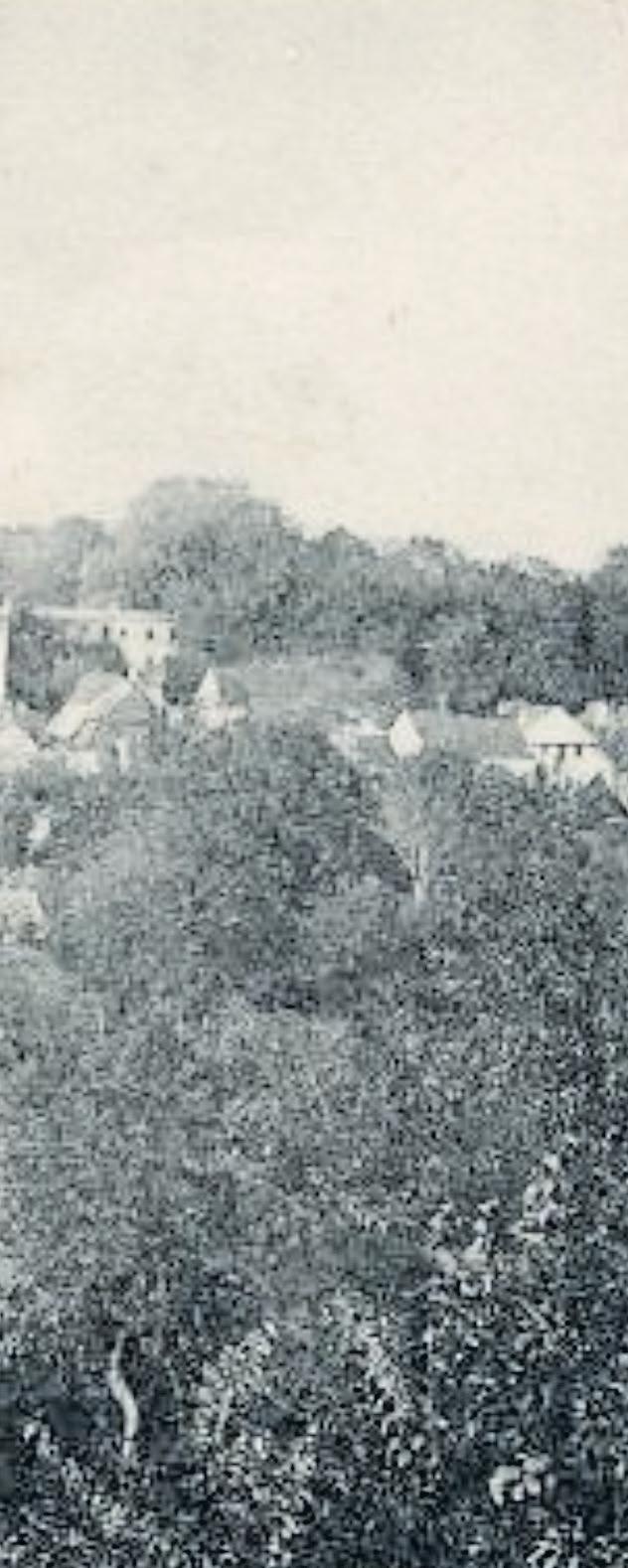
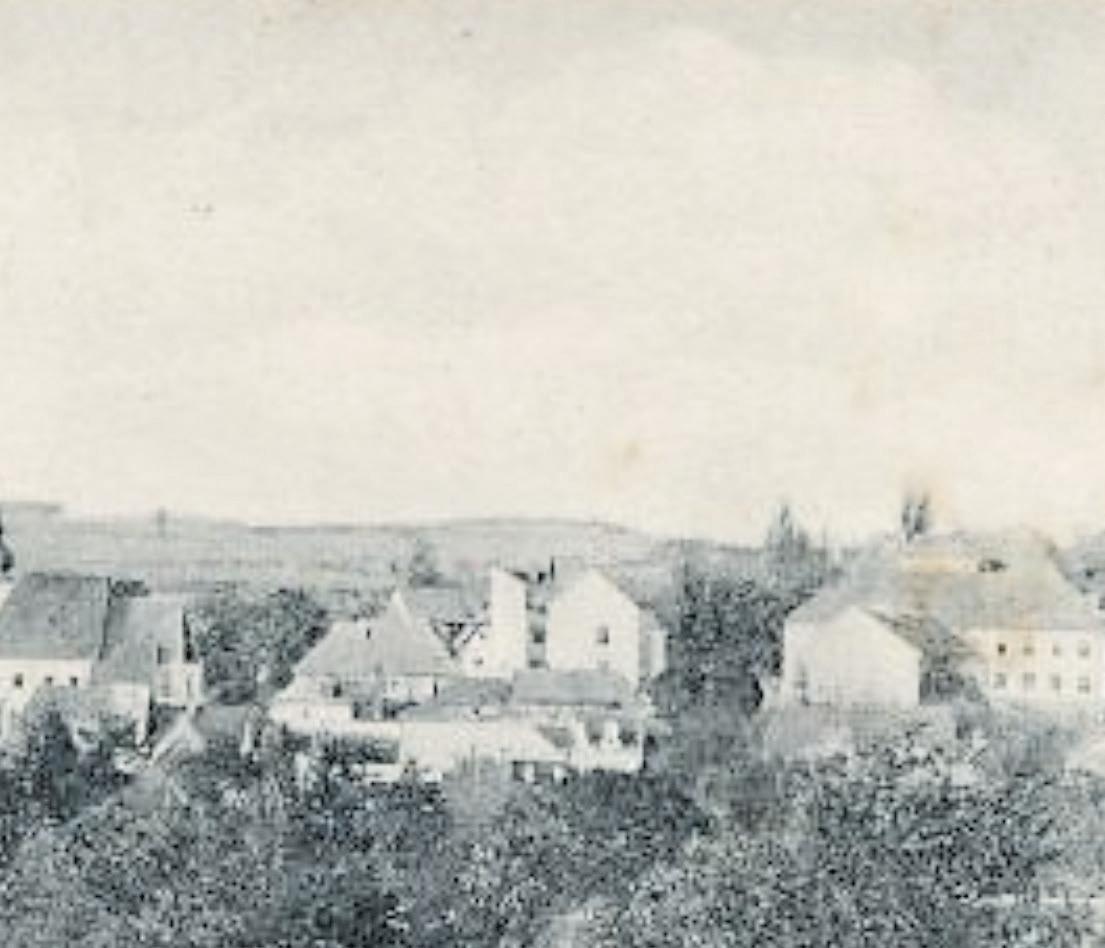
de Berichtigung: Maria Egl ist am 2. März 1932 geboren und somit nicht 90, sondern 91 Jahre alt, Eduard Brix kam am 13. März 1933 zur Welt und ist somit nicht 89, sondern 90 Jahre alt.

Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


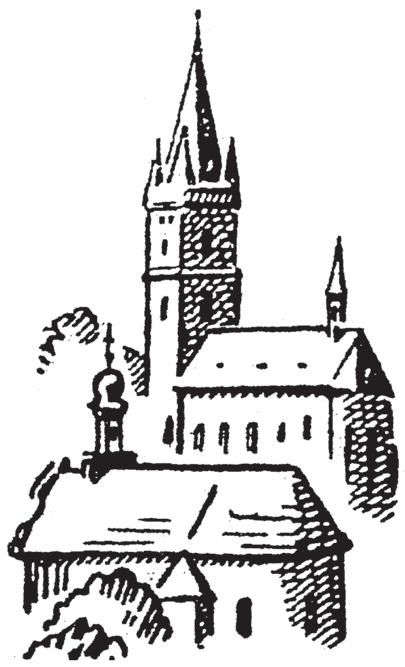

� Tachauer Umkreis
Dieser Text stammt aus der Zeit der Erfassung geschmiedeter antiker Grab- und Wegkreuze, die ab 1924 auch im Tachauer Umkreis eine immer stärkere Beachtung fanden. Mit Ludwig Walch zeichnete ich
Geschmiedete Grab und Wegkreuze sind im allgemeinen Erzeugnisse des 18. und 19. Jahrhunderts. Stilelemente des Barock, des Rokoko und des Klassizismus finden sich verarbeitet. Abgelöst wurden die handgeschmiedeten Kreuze durch das Gußkreuz, dieses wiederum durch steinerne Grabdenkmale verschiedener Art, wie sie früher nur reichen Bürgern und vor allem den Adeligen vorbehalten waren.
Einige geschmiedete Kreuze tragen die Züge echten Kunsthandwerks – zum Beispiel das bekannte Kuttenplaner Kreuz, abgebildet in Josef Schmutzers Buch „Über Grenzen hinweg“ –, teils auch sind sie in Ausführung und Symbolik der Volkskunst zuzuweisen. Im Tachauer Umkreis wurden die Wegkreuze, aber auch viele Grabkreuze nach der Vertreibung aus der Heimat mit anderen Flur und Totendenkmalen von den Neusiedlern entfernt und zerstört, da ein staatlicher tschechischer Denkmalschutz erst um 1947 und damals nur für die wichtigsten Denkmale einsetzte. Schon aus diesem Grunde ist es nötig, Daten über Schmiedekreuze festzuhalten.
Wegkreuze
Die ältesten Wegkreuze stammen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und tragen mit den Akanthusformen an den Volutenenden noch ganz die Züge des Barock. Von Sankt Anna bei Plan bis gegen Haid fanden sich Reste solcher Flurdenkmale. An der Straße nach Naketendörflas stand zum Beispiel ein Wegkreuz, dessen Volutenenden der oberen Kreuzfelder in besonders ausgewogene Akanthen ausliefen. Stilistisch gehörte das Denkmal also etwa der Zeit um 1740 an. Es hatte ein Gegenstück im Planer Wegkreuz, das in Plan vor dem Haus Nr. 42 in der Bahnhofstraße errichtet worden war.
Jüngeren Epochen gehörten folgende Wegkreuze an: An der alten Straße von Tachau nach Großgropitzreith stand eines, das rund 180 Zentimeter hoch und angeblich von Franz Eckert aus Großgropitzreith um 1865 geschmiedet worden war. Es sollte an den plötzlichen Tod eines alten Mannes an dieser Stelle erinnern. An der Straße zwischen Tachau und Tissa, hinter Tirna, befand sich an einem Feldweg ein geschmiedetes Wegkreuz mit der Jahreszahl 1752 im Sockel. Es sollte, so wollte es die Volkssage, an den einstmaligen Friedhof des Kirchsprengels Tissa erinnern. Vielleicht ist dies die Unterlegung eines zweiten, jüngeren Vorfalls. Stilistisch zeigte das Kreuz Formen des Klassizismus, es ist demnach jünger als der Sockel selbst.
diese Denkmale des Schmiedekunsthandwerks und der Kunstschlosserei, aber auch der Volkskunst schlechthin auf. Dabei zeigte sich, daß hier der Raum östlich des Oberpfälzer Waldes, also im Umkreis von Tach-
Unweit vom Tachauer Stadtteil Fohra stand ein geschmiedetes Wegkreuz, das aus Anlaß eines Unfalles errichtet worden sein soll, als nämlich ein hochbeladener Erntewagen umkippte und dabei ein Bauer ums Leben kam. Der Schmied von Schossenreith soll das Kreuz geschmiedet haben, erzählte man. Rundeisendekor in den Kreuzfeldern! Ein Votivkreuz am Rahmgraben bei Tachau am Mühlbach mit der Jahreszahl 1777 im Sokkel und dem Marienmonogramm
au, Haid und Plan, eine richtige Schmiedeprovinz war. Sie war unterschiedlich zum benachbarten Rang, zum Tepler Hochland und östlichen Kaiserwald, unterschiedlich auch zum Mieser und Staaber Unterland.
soll vom Urgroßvater des seinerzeitigen Gerbermeisters Kanzler aus Tachau errichtet worden sein, als „dort ein schwarzer Hund um Mitternacht umging und die Leute erschreckte“. Rundeisendekor!
Ein solches Wegkreuz stand auch in Tachau beim Pschiererschmied. Als es 1871 eine große Überschwemmung gab, die sogar Häuser mitriß und Menschen das Leben kostete, soll der Roppertschmied das Kreuz als Votiv angefertigt haben. Einfachste Formen!
Grabkreuze
Von den Grabkreuzen befanden sich die besten Stücke am Friedhof in Altzedlisch und am Alten Tachauer Friedhof. Von den Tachauern seien Folgende aufgeführt:
Das Kreuz des Johann Schusser, das in den Beginn der Pseudostilentwürfe fiel – Schusser starb 1892 –, 190 Zentimeter hoch war und ein wappenähnliches Namensschild trug. Der Stab war gedreht und in einen behauenen Stein versenkt.
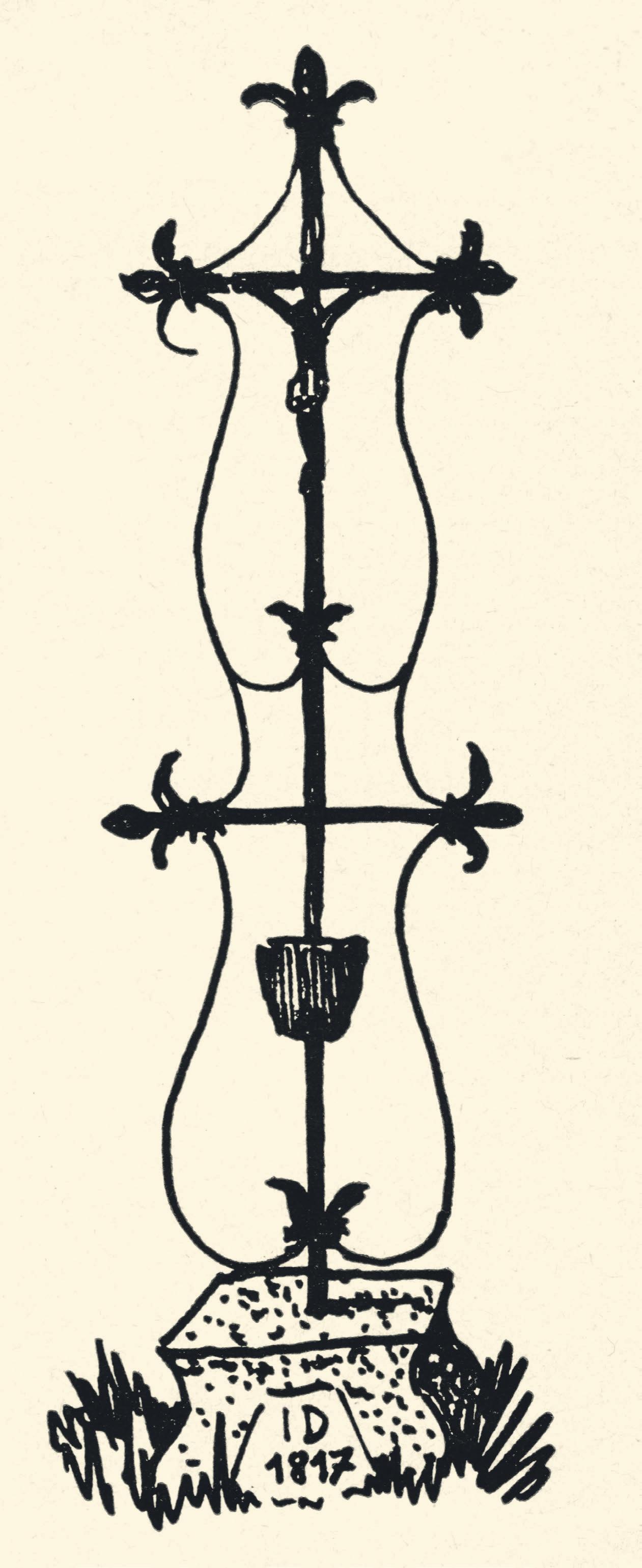
Dem 1906 verstorbenen Anton Kraus aus Wittingreith wurde ein Kreuz gesetzt, gleichfalls dem industriell beeinflußten Pseudostil zugehörig, mit kleinen Voluten in den oberen Kreuzfüllungen und einer Fortführung derselben zum unteren Kreuzstab.
Auch das Kreuz für Katharina Zeidler aus Mauthdorf – sie starb 1911 – zeigte diesen „Niedergang“ origineller Formung.
Auf dem Altzedlischer Friedhof war eines der stilechtesten das Kreuz von Adam und Anna Meier mit dem Sockeldatum 1884, einer Kreuzhöhe von 1,5 Metern und einem Runddach aus Blech versehen.
Ebenso ausgewogen, doch phantasiereicher war ein Kreuz, das wir hier abbilden und das die Sockelinschrift „I. D. 1817“ aufwies. Ganz ähnliche Typen fand ich auch auf dem Friedhof in Bruck am Hammer und auf dem Friedhof von Netschetin bei Manetin.
Es wären natürlich noch viele andere Schmiedekreuze des Tachauer Umkreises aufzuzählen, doch haben diese Zeilen nur den Zweck, unsere Landsleute zu erinnern, daß auch die alte Volksschmiedekunst in der Heimat beachtliche Denkmale schuf, die nun leider verloren und zerstört sind.
Zum Schluß wäre noch die Frage zu klären, woher die alten Schmiede ihre Anregungen und Lehren erhielten, um solche Kreuze zu formen und ihnen teils stilecht oder pseudostilangelehnt oder volkskunstmäßig gerecht zu werden. Auf alle Fälle nicht aus der benachbarten Oberpfalz. Eine Monographie der Ostoberpfälzer Schmiedekreuze, an der ich arbeite, wird dies beweisen.
Die auf die Wanderschaft gehenden Gesellen des Tachauer Umkreises dürften eher aus Österreich inspiriert worden sein, doch haben sie diese Anregungen auf ihre vereinfachte Art neu umgesetzt. Viele der Meister aber schufen aus dem Stegreif, aus freier Hand. Jene verwendeten Stilelemente allgemeiner Art, zum Beispiel die große Volute, den Akanthus oder den Lorbeerkranz der Klassizistik, diese hingegen schufen intuitive Volkskunst. Anton Bergmann
Wolf-Dieter Hamperl: „Wilhelm Vierling. Ein fast vergessener Weidener Künstler“. Eigenverlag, Altenmarkt 2020; 136 Seiten, 19,90 Euro. Erhältlich bei Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de
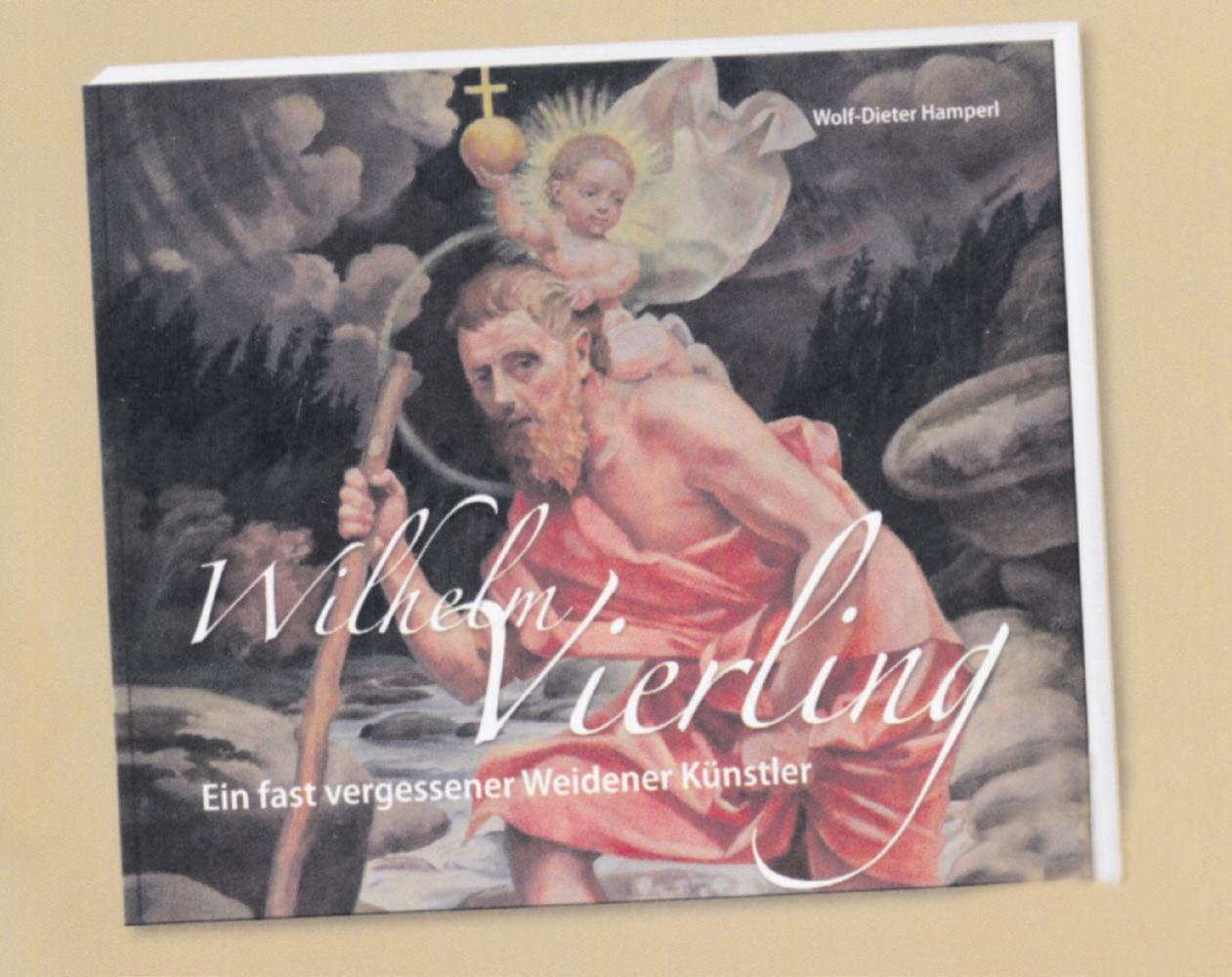
� Zweisprachige Neuerscheinung
In der Adventszeit erschien das jüngste von Kreisbetreuer WolfDieter Hamperl herausgegebene Buch. Es ist zweisprachig und trägt den Titel „Ich war zwölf Jahre im Grenzgebiet (1948–1959). Byl jsem dvanact let v pohranici (1948-1959)“. Hamperl berichtet.
Monsignore Jaroslav Baštář schrieb 1971 die Erinnerungen an seine Zeit im „Grenzland“ im mittelböhmischen Kladen nieder und veröffentlichte sie im Pfarrbrief. Er war im Inneren Böhmens zur Welt gekommen und im Jahr 1940 in Prag zum Priester geweiht worden. 1948 wurde er zur ethischen Betreuung der frisch angesiedelten tschechischen Bevölkerung nach Neustadtl/Stráž u Tachova berufen. Die dortige Bevölkerung hatte einen Seelsorger angefordert. Baštář betreute von Neustadtl aus ein riesiges Gebiet. Zu diesem gehörten die Pfarreien Neustadtl, Haid/Bor, Pfraumberg/ Přimda, Sankt Katharina/Svatá Kateřina, Roßhaupt/Rozvadov, Neuhäusl/Nové Domky und Neudorf/Nová Ves. 1946 war die deutsche Bevölkerung vertrieben worden, neue Siedler waren gekommen. Baštář beschreibt, wer die Handwerksbetriebe übernommen hat, wer die Gemeinde führte. Zu Weihnachten 1948 war er freudig empfangen worden, 1959 war man froh, daß er den Ort verließ.
Baštář beschreibt, was er vorfand, wie die Neusied
ler lebten und was er von den früher hier lebenden Deutschen erfahren konnte. Er führt uns vor Augen, wie in zehn Jahren die Gesellschaft in eine kommunistische, atheistische gewandelt wurde. Auch die einfachen Verhältnisse im Pfarrhaus, der Mangel an Lebensmitteln und die fehlende Infrastruktur machten die Seelsorge schwer. Es dauerte, bis er ein Motorrad bekam, um die Kirchen seiner großen Pfarrei besuchen und Gottesdienst halten zu können.
Wolf-Dieter Hamperl (Hrsg.), Jaroslav Baštář: „Ich war zwölf Jahre im Grenzgebiet (1948–1959). Byl jsem dvanact let v pohranici (1948–1959)“, Schriften zur Tachauer Heimatgeschichte, Band 14. Battenberg-Gietl-Verlag, Regenstauf 2022; 136 Seiten, 17,80 Euro. Erhältlich nur bei Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de
Als ich mit Monsignore Vladimír Born auf dem Haider Friedhof das Grab seines Vorgängers Miloš Fiala besuchte, erzählte er mir von einem Pater Jaroslav Baštář, der ein Buch über seine Zeit hier geschrieben habe. Den Text gab er mir nicht, den erhielt ich über Gerhard Reichl von Antonín Hofmeister aus Molgau. Der Text beeindruckte mich so, daß ich ihn von David Veres übersetzen ließ. Pfarrer Klaus Öhrlein ergänzte den Text, Nadira Hurnaus redigierte ihn. Rudolf Voderholzer und Tomáš Holub, die Bischöfe der Nachbarbistümer Regensburg und Pilsen, schrieben ermutigende Grußworte. Nur wenige unserer Heimatbücher berichten, was in der Heimat, nach der man so Heimweh hatte, nach der Vertreibung geschah. Baštářs Erinnerungen schließen diese Lükke eindrucksvoll. Das Buch bereichern Bilder aus den 1960er und 1970er Jahren. Ein Bild des zerstörten Pfarrhauses in Neustadtl ziert das Titelblatt.
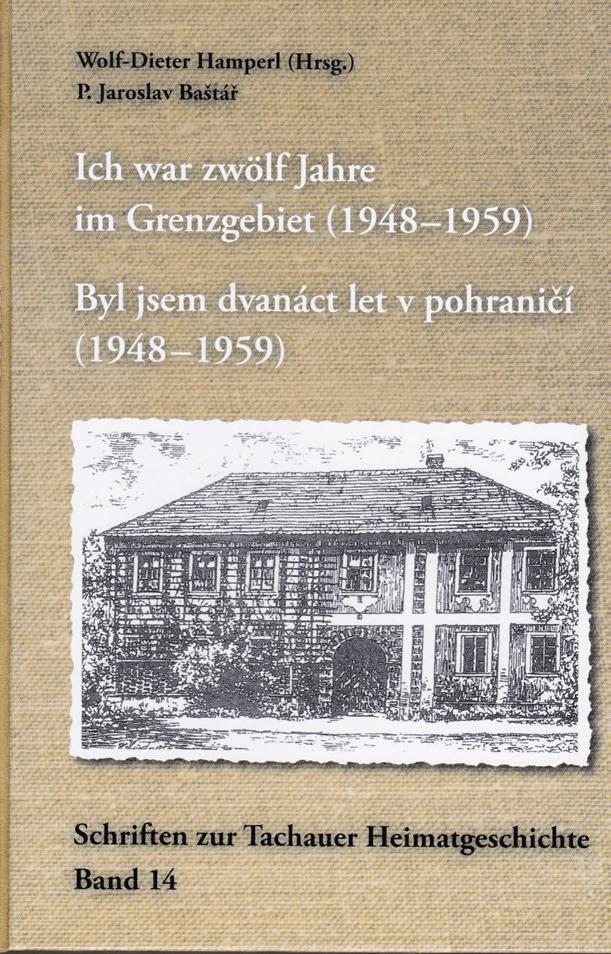
Bund der Eghalanda Gmoin e. V., Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz,
❯ Die nächsten Termine
Egerländer







Kalender
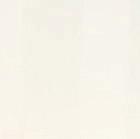



■ Samstag, 11. März, 15.00

Uhr: Jahreshauptversammlung der Egerländer Gmoi Offenbach. Emil-Renk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Anmeldung unter eMail: iris.plank@egerlaenderoffenbach.de
■ Sonntag, 26. März, 9.00


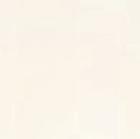
Uhr: Landesfrühjahrstagung unter dem Motto „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“. Programm: Ab 9.30

Uhr Vorträge, Geschichten, Fotos und Aufzeichnungen von 70 Jahren Egerländer Landesverband und 70 Jahre EgerlandJugend musikalisch umrahmt von Christa & Jürgen; 12.30 Uhr Mittagessen; 13.30 Uhr HutzaNachmittag mit Fotos und Eindrücken der sieben Jahrzehnte mit Liedern, Tänzen und Mundartvorträgen. Anmeldungen an Jürgen Mückstein, Gansahrweg 2a, 35423 Lich oder eMail juergen-mueckstein@t-online.de

Veranstaltungsort: Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.
■ Sonntag, 2. April, 14.30 Uhr: Frühlingskaffee. Egerländer Gmoi Dillenburg. Anmeldungen an Hans-Jürgen Ramisch unter eMail info@ egerlaender-dillenburg.de Veranstaltungsort: Dorfgemeinschaftshaus, Dillenburg-Eibach.




■ Freitag, 21. April: 100. Sitzung der Egerland-KulturhausStiftung. Veranstaltungsort: Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April: Bundeshauptversammlung des Bundes der Eghalanda Gmoin. Anmeldungen an Volker Jobst unter eMail Jobst@ egerlaender.de Veranstaltungsort: Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Freitag, 28. bis Sonntag, 30. April: Deutscher Trachtentag in Schönberg/Probstei in Schleswig-Holstein mit Bekanntgabe der Tracht des Jahres 2023. Auszug aus dem Programm: Samstag, 13.00 Uhr: Landestrachtenfest in der Fußgängerzone Schönberg. Sonntag, 10.00 Uhr: Trachtengottesdienst in der Evangelischen Kirche Schönberg.
❯ „Mixed Voices“ unter Leitung von Roland Hammerschmied







Das Geretsrieder Vokalensemble Mixed Voices hat im Februar den Abendgottesdienst anläßlich des Welttags der Kranken in der Münchener Jesuitenkirche St. Michael in der Innenstadt musikalisch begleitet.


Im Anschluß an die Heilige Messe mit Kranken und ihren Angehörigen sowie Medizinern, Therapeuten, Pflegekräften und zahlreichen Sudetendeutschen hat der Chor Stücke aus seinem geistlichen Chorprogramm präsentiert. Seit 30 Jahren gibt es das Vokalensemble Mixed Voices unter seinem Leiter Roland Hammerschmied. In Sudetendeutschen Kreisen ist der Egerländer besser bekannt mit seiner Gartenberger Bunkerblasmusik.
St. Michael, die wunderschö-
nem Kirche in der Innenstadt mit sehr guter Akustik, bot einen würdigen Rahmen für den Auftritt und ermöglichte einen Hörgenuß der besonderen Art. Zum musikalischen Repertoire gehörte passend zur aktuellen Lage das Lied „Verleih uns Frieden“ von Heinrich Schütz. Der Komponist des Frühbarocks veröffentlichte das Stück 1648 – dem Jahr, in dem der Dreißigjährige Krieg mit dem Westfälischen Frieden endlich endete. Die Sänger des Vokalensembles wußten mit ihrer Stimmkraft zu überzeugen und lieferten ein beeindruckendes Konzert ab. Mit Solos von Roland Hammerschmied „Ain’t got time to die“ und Kathrin Oberender „Zünd a Liacht für dich an“ wurden die Konzertbesucher zum Abschluß beschenkt. Hildegard Schuster
❯ Grenzüberschreitendes Regionalfest vom 19. Mai bis 6. August und 30 Jahre Euregio Egrensis mit Jubiläumsfeier am 21. April in Eger


Im Rahmen der BayerischTschechischen Freundschaftswochen wird Tschechiens neues Staatsoberhaupt Petr Pavel nach Selb reisen und dort Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder erneut treffen.


bad, Falkenau, Eger und Asch. Neben Besuchen von sozialen Einrichtungen und Unternehmen suchte Pavel das direkte Gespräch mit den Bürgern.
Auf einer Pressekonferenz sagte Pavel anschließend, es sei wichtig, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern, um die Abwanderung junger Menschen zu stoppen. Obwohl strukturschwach, böte die Karlsbader Region eine schöne Landschaft und viele Möglichkeiten. Als Problemfelder nannte Pavel die Verkehrsinfrastruktur und mangelnde Bildungsmöglichkeiten.

Veranstaltungsreihe sei „ein absoluter Glücksfall für die Stadt Selb und unterstützt nachhaltig die gute Zusammenarbeit mit unserer tschechischen Nachbarregion“, erklärte Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch.
■ Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Mai: 73. Sudetendeutscher Tag unter dem Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“. Veranstaltungsort: Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.
Er werde Markus Söder im Mai in Selb wiedersehen, hatte Pavel nach seinem Treffen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz der Sudetendeutschen Zeitung gesagt und angefügt: „Ich gehe davon aus, daß wir darüber sprechen werden, wie wir konkret die Dinge angehen können, die in der Karlsbader Region wirklich Probleme bereiten.“ Direkt nach seiner Wahl zum Staatsoberhaupt hatte Pavel ein erstes Versprechen eingelöst und die strukturschwache Region besucht, die mehrheitlich für seinen Konkurrenten Andrej Babiš gestimmt hatte. Stationen auf seiner zweitägigen Reise durch das Egerland waren Sankt Joachimsthal (Jáchymov), Schlackenwerth (Ostrov), Karls-


Nach der letzten Volkszählung von 2021 lebten in der Karlsbader Region 279 103 Menschen, ein Rückgang um 5,6 Prozent binnen zehn Jahren.
Weitere Themen, die Pavel in Selb mit Söder besprechen will, sind Kooperationen im Gesundheitsbereich sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr.
Neben dem Präsidentenbesuch wird die Region in diesem Jahr noch aus einem anderen Grund überregionale Aufmerk-
samkeit bekommen. Vor 30 Jahren, am 3. Februar 1993, wurde in Eger die Euregio Egrensis als grenzüberschreitende Institution gegründet. Bayern, Sachsen/ Thüringen und Böhmen vereinbarten damals, „im Geiste guter Nachbarschaft und Freundschaft die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Entwicklung“ zu koordinieren und zu

fördern. Das Jubiläum soll im Rahmen einer Festveranstaltung am 21. April in Eger begangen werden.
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer
Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen stehen dann in den zwölf Wochen vom 19. Mai bis 6. August auf dem Programm (mehr unter www. freundschaftswochen2023.eu).
Die grenzüberschreitende
❯ Egerland-Jugend hat beim Landesjugendtag in Hungen einen neuen Vorstand gewählt
Und Vítězslav Kokoř, Bürgermeister von Asch, ergänzte: „Ich wünsche mir, daß die BayerischTschechischen Freundschaftswochen dazu beitragen, aus Nachbarschaft Partnerschaft zu machen. Eine solche grenzüberschreitende Partnerschaft bezieht alle Bürgerinnen und Bürger auf allen Ebenen ein.“ Jan Kuchař (Stan), Mitglied des tschechischen Parlaments: „Die aktive Vertiefung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Bayern und der Tschechischen Republik bereichert den Alltag in beiden Ländern –sie läßt Grenzen in Landkarten und Köpfen verschwinden, hilft beim Aneignen der Sprache und Ideen und trägt so zum europäischen Gedanken der Freundschaft und Zusammenarbeit der Menschen und ihrer Nationen bei.“ Torsten Fricke




Die Jugendorganisation der Egerländer in Hessen hat Anfang Februar auf dem Landesjugendtag in Hungen einen neuen Vorstand gewählt.
Seit 2010 stand Mona Hafer (Gmoi Dillenburg) an der Spitze der Egerlandjugend Hessen – bis 2020 gemeinsam mit Katharina König (Gmoi Offenbach).
Aktuell ist Mona Hafer zusätzlich als Kassenwartin des Landesverbandes Hessen sowie in
der Bundesjugendführung und im Gmoirat aktiv. Aus persönlichen Gründen stand die Mutter von Zwillingen nicht mehr für das Amt der Landesjugendführerin zur Verfügung, ist aber weiterhin im Vorstand aktiv.

Christian Meinl (Gmoi Herborn) wurde einstimmig von der Versammlung zum neuen Landesjugendführer gewählt. Er ist bereits seit Jahren in der Jugendorganisation sowie im Gmoirat engagiert. In der Bundesorganisation ist Christian Meinl stell-







vertretender Organisationsleiter.






Als seine Stellvertreter in der Landesjugend wurden Matthias Meinl, der dieses Amt seit Jahren ausübt, und Melanie Herrmann gewählt. Die weiteren Vorstandspositionen übernehmen Nina Müller, Katharina König, Edith Zaschka-Domes, Felix Mückstein, Mona Hafer und Sven Lehmann. Edith Zaschka-Domes bedankte sich im Namen des alten Vorstandes bei Mona Hafer mit
einem kurzen Rückblick auf die gemeinsam geleisteten Projekte und die langjährige gute Zusammenarbeit.
Bundesjugendführer Alexander Stegmaier sprach Mona Hafer für ihren nachhaltigen Einsatz ebenfalls seine Wertschätzung aus. Dem neuen Vorstand wünschte er viel Erfolg für die Amtsführung. Seinen Abschluß fand der Jugendtag in einem von Hartmut Liebscher geleiteten Tanzseminar.
Hans-Jürgen Ramisch
„Die Tante kommt“ heißt das neue Werk des in Egerländer Kreisen hochgeschätzten Autors Hatto Zeidler. Der Titel irritiert zunächst, weil auf dem Cover der Autor selbst in Lapplandausrüstung abgelichtet ist.

Das neue Buch beinhaltet 38 kurze Geschichten. Erstmals werden Erzählungen verschiedener Regionen und Zeitumstände präsentiert. Zunächst geht es um die Tücken des Alltags. Voller Humor, Selbstironie und der dem Autor eigenen, satirischen Beobachtungsgabe nimmt Zeidler den Leser mit. Humorvoll, heiter und zuweilen ein wenig bissig erfahren wir vom drohenden „Besuch der Tante“ oder von dem Vorsatz „Nie wieder Lappland“. Ich bin an „Der alte Mann und das Meer“ erinnert.
Besonders amüsiert die Geschichte „Der Schutzpatron“. Nur noch katholisch ausgerichtete Verlage versenden Kalender mit den Namenstagsheiligen.
Heute nennt man frisch Geborene gerne wieder „Toni“. Aber wer kennt noch den Heiligen Antonius, der beim Suchen und Finden half, wenn man ein Vaterunser gebetet hatte. Den Heiligen Nikolaus kennt man nur als „Weihnachtsmann“, nicht als gütigen Helfer in der Not, zum Beispiel bei schwerem Seegang.
Weil der moderne Mensch keinen „Schutz von oben“ mehr braucht, kennt er auch seinen Schutzpatron nicht mehr. Eine letzte Chance hat da der Heilige Christophorus, der vor Verkehrsunfällen helfen soll. Sein Medaillon ziert die Armaturenbretter schneller Autos und schicker Motorboote.
Köstlich auch die Schilderung über die Mentalität unserer Kinder und Enkel. Das Handy führt dazu, keinen festen Termin mehr zu vereinbaren. Jederzeit können Ort und Zeit neu bestimmt werden. Während des Fluges fällt einem ein, daß der Wellensittich noch im Zimmer fliegt. Beim Zwischenstopp erhält Papa oder Opa den Auftrag, das arme Tier einzufangen und zu füttern und auch die Papiere auf der Tischplatte an die Uni zu schicken, für das nächste Semester. Was wird werden, wenn es die zuverlässigen „Alten“ nicht mehr gibt?
Hatto Zeidler: „Die Tante kommt“, J. S. Klotz Verlagshaus, 2022, ISBN 9 78 39 49 76 30 14.
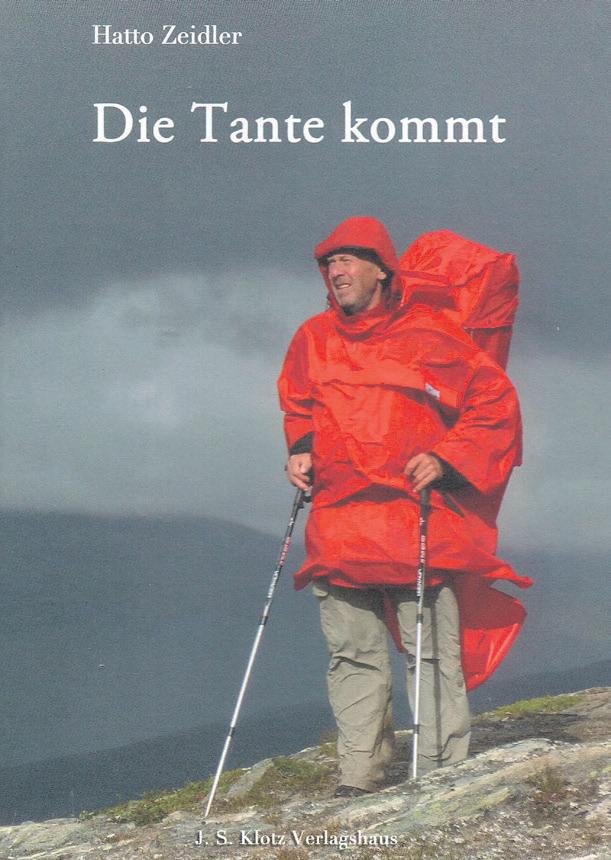
Dr. Wolf-Dieter Hamperl
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA BUNDESZEITING vereinigt mit H. Preußler Druck und Versand GmbH & Co. KG
Egerer Landtag e. V., Geschäftsstelle in 92224 Amberg, Paradeplatz 11;
Vorsitzender: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de Stellvertretende Vorsitzende: Helmut Reich und Dr. Ursula Schüller Für die Egerer Zeitung zuständig: Prof. Dr.-Ing. Alfred Neudörfer, eMail A.Neudoerfer@gmx.de – Kassenführung: Ute Mignon, eMail ute.mignon@online.de Spenden an: Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN: DE73 7525 0000 0240 1051 22 – BIC: BYLADEM 1 ABG
Verantwortlich vonseiten des Egerer Landtag e. V.: Dr. Wolf-Dieter Hamperl – Redaktion: Torsten Fricke, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� In ihrem Buch „Alles, was wir erinnern – Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“ erinnert Christiane Hoffmann an die damaligen Vorkommnisse
In dem spannenden Buch von Christiane Hoffmann „Alles, was wir nicht erinnern – Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“ kommt am Ende der Ort Klinghart im Landkreis Eger vor.
Am 22. Jänner 1945 haben die Rosenthaler ihr Dorf, nahe an der Oder und südlich von Breslau gelegen, auf Raten der Wehrmacht verlassen. Sie sind in einem Treck von 55 Gespannen, drei davon Ochsengespanne, vor der sich nähernden russischen Front nach Westen geflohen. In 33 Etappen haben sie am 2. März 1945 Klinghart im Landkreis
wachsenen halfen den Egerländern Bauern, die Kinder besuchten die Dorfschule.
In Klinghart lebten 547 Menschen, die höchste Hausnummer war 100. Seit 1770 hatte man eine Schule, 1426 wurde die Kirche St. Katharina erstmals urkundlich erwähnt.
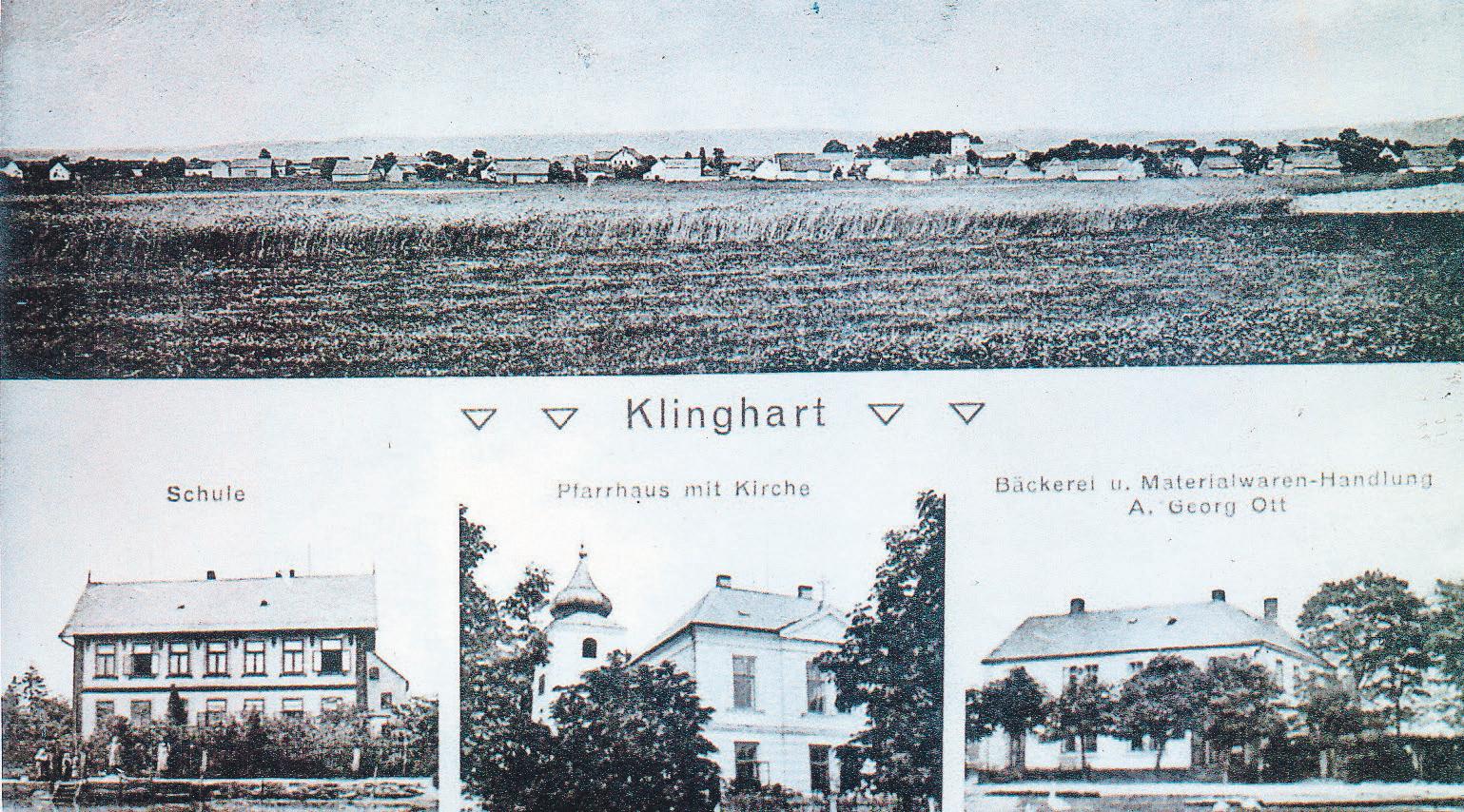
Von Westen näherte sich die amerikanische Armee, am 19. April wurde Eger bombardiert, den Feuerschein konnte man in Klinghart gut sehen. Am 6. Mai rollten die amerikanischen Panzer in Klinghart ein, die Häuser waren weiß beflaggt. Das Land war nun amerikanisch besetzt.
Neiße und die Oder waren gesprengt, eine Rückkehr nach Rosenthal war unmöglich.
Mutter und Sohn Hoffmann merkten nicht, wie die anderen loszogen, ließen Pferd und Wagen in Klinghart zurück und gelangten im zweiten Versuch über die Grenze nach Bad Brambach ins Vogtland. „Zwei Menschen, zwei Bündel bleiben zurück“ schreibt Christiane Hoffmann über die Großmutter und ihren Vater.
In den Dorfchroniken erfahren wir nichts von diesen Einquartierungen. Im heutigen Krizovatka fragte Christiane Hoffmann dort lebende Menschen nach diesem damaligen Flüchtlingszug, aber keiner wußte etwas davon.
Die Fluchtroute der Schlesier aus Rosenthal führte über 558 Kilometer bis nach Klinghart. Aus: Christiane Hoffmann, „Alles, was wir erinnern“
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
Eger erreicht, 558 Kilometer haben sie zurückgelegt. Ihr Weg führte nicht über das Innere Böhmens, sondern über Schweidnitz, Greiffenberg, Zittau, Aussig und entlang der Eger bis nach Klinghart im Landkreis Eger. Dort und in den benachbarten Ortschaften Nonnengrün, Mühlberg, Frauenreuth und Unterschossenreuth wurden die erschöpften Menschen und Tiere den Höfen und Schulen zugeteilt. Warum zogen sie nicht weiter ins „Reich“?, fragt man sich heute. Die Er-
Nach wenigen Wochen verbreitete sich das Gerücht, daß die Tschechen das Land übernähmen und die Flüchtlinge ihre Pferde und Wagen verlören. Anstatt weiter ins „Reich“ zu ziehen, zogen die Rosenthaler verzweifelt wieder in Richtung Heimat, diesmal in kleineren Gruppen. Über den Grenzbach und die tschechisch-deutsche Grenze kamen sie unbehelligt. Anschließend versuchten sie über Dresden in ihr Heimatdorf zu kommen. Doch die Brücken über die
� Heimatpflegerin Christina Meinusch
Im südlichen Egerland wissen wir, daß die Schlesier mit ihren Trecks quer durch Böhmen fuhren, über Prag, Pilsen, Mies und Pfraumberg. Der steile Anstieg vom Haider Land in das 800 Meter hoch gelegene Pfraumberg stoppte sie. Die Einheimischen wie zum Beispiel mein Großvater Anton Wolf von der Neumühle (Hausnummer 40) leisteten mit ihren Pferden Vorspanndienste oder zogen mit dem Lanz-Bulldog die Wagen hoch. In unserem Fotoarchiv haben sich drei Fotos von solchen Fluchtgespannen erhalten.
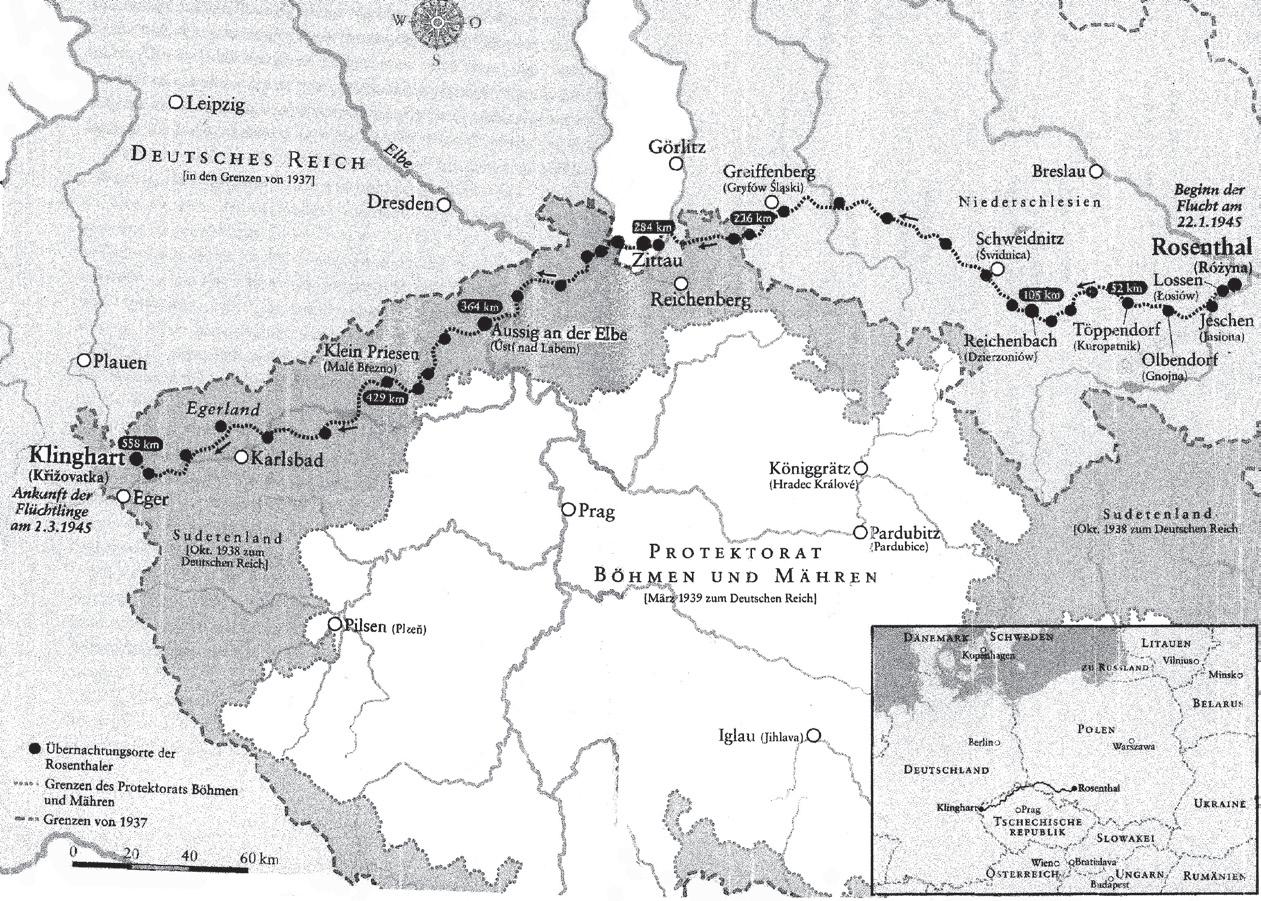
Das Buch von Christiane Hoffmann „Alles, was wir nicht erinnern – Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“ (C. H. Beck, München 2022, ISBN 9 78 34 06 78 49 34) ist eines der besten Bücher über das Thema Flucht und Vertreibung, das in den letzten Jahren erschienen ist.
Dr. Wolf-Dieter HamperlDer Treck zieht durch ein unbekanntes Dorf. Die Flucht vor den Russen nach Westen ging über 33 Etappen. Fotos: Archiv Egerer Landtag
Der Treck der Schlesier auf der Flucht im Feber 1945. Das Bild wurde von dem Wildsteiner Roman Schreiner eingesandt.



Vor einem Jahr war die Erfassung der Bücher unserer Vereinsbibliothek in Amberg im Endspurt. Der Egerländer Landtag e. V. schlug Anna-Lena Hamperl für einen der Förderpreise der Sudetendeutschen Landsmannschaft vor, die dieses wichtige Projekt umgesetzt hat. Die Jury stimmte zu, und am 28. Januar 2023 wurden die Preise in einer festlichen Veranstaltung im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses in München überreicht (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).
Die Würdigung der Preisträgerin übernahm die Sudetendeutsche Heimatpflegerin
Christina Meinusch: „Ich freue mich, daß ich die Laudatio auf die Nachwuchswissenschaftlerin und angehende Lehrerin Anna-Lena Hamperl halten darf, die heute mit dem Förderpreis für Volkstumspflege ausgezeichnet wird.
Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Heimatpflegerin Christina Meinusch und SL-Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann gratulieren Anna-Lena Hamperl zum Förderpreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der Kategorie Volkstumspflege. Foto: Erich Hemmel
Nach dem Abitur besuchte
Anna-Lena Hamperl ein Jahr die Werkbund Werkschule Nürnberg, um ihre künstlerischen Anlagen in der Praxis zu erweitern, und seit 2017 studiert sie an der Julius-von-Liebig-Universität in Gießen die Fächer Englisch
und Kunst für das höhere Lehramt. 2019 verbrachte sie ein Auslandssemester in Melbourne in Australien.
Durch ihre universitäre Ausbildung und ihren familiären Bezug zum Egerland brachte sie die besten Voraussetzungen mit, um
den Verein Egerer Landtag e. V. bei der Erfassung seiner Vereinsbibliothek zu unterstützen.
Der Vorstand des Egerer Landtag e.V. hatte im Jahr 2021 beschlossen, die Bestände seiner Geschäftsstelle in Amberg zu inventarisieren. Dies geschah im Rahmen des Projektes Digitalisierung von Heimatstuben, welches die Beauftragte für Flüchtlinge und Vertriebene im Bayerischen Landtag, MdL Sylvia Stierstorfer, initiiert hatte. Im Zeitraum vom 1. November 2021 bis 28. Februar 2022 mußte laut Bewilligungsbescheid die Erfassung der Vereinsbibliothek erfolgen. Da zunächst interessierte Personen absagten, übernahm Anna-Lena Hamperl kurz entschlossen diese Arbeit. Der von Anna-Lena Hamperl katagolisierte Buchbestand umfaßt 260 Bücher zu Eger, 530 Bücher zum Egerland und 607 Bücher zum Thema Sudetenland, also insgesamt knapp 1400 Bücher.
Als Nachfolgeprojekt wurde die Inventarisierung und Digitalisierung des Vereinsarchivs des Egerer Landtags vom Haus des Deutschen Ostens genehmigt. Auch an diesem Projekt ist AnnaLena Hamperl bei der Vorsortierung der bis zu 70 Jahre alten Archivbeständen beteiligt.
Diese Arbeiten erforderten überdurchschnittliches Engagement und Interesse an der Thematik, und beides hat die heute Ausgezeichnete unter Beweis gestellt.
Für die Erfassung des Bibliothekbestandes und Mitarbeit bei der Erfassung der Archivbestände, welche Vereinsarchiv und Heimatkundliches Archiv umfassen wird Anna-Lena Hamperl, die mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag zum Erhalt von Egerländer Kultur und Geschichte geleistet hat, heute mit dem Förderpreis für Volkstumspflege ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!“
FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN
Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de
Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de

Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de
Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46 Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
❯ Heimatverband
❯ Der Parteisekretär der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Falkenau arbeitete für den Abgeordneten Franz Katz
November/Dezember 2022 Nr. 6
73. Jahrgang
Herzlichen
Glückwunsch
Der Heimatverband der Falkenauer gratuliert herzlich den im März geborenen Landsleuten zum Geburtstag.
103. Geburtstag: Pittner, Anna, geb. Peter (Zwodau), 07.03.1920.
100.: Bachmaier, Irma (Buckwa. Katzengiebel), 29.01.1923.
98.: Hillenbrand, Gretl, geb. Ulsperger (Wudingrün), 12.03.1925.
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Otto Frank war Parteisekretär der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Falkenau und konnte rechtzeitig vor
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
den Nazis über Prag und Polen nach England fliehen. Später baute sich der Sudetendeutsche in Kanada eine neue Exi-
stenz auf. Seine Erinnerungen hat Otto Frank auf mehreren Schreibmaschinenseiten festgehalten. Vermutlich stammte die-
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist
ses Zeitzeugendokumennt, das Gerhard Hampl in der Falkenauer Heimatstube in Schwandorf entdeckt hat, aus den 1970er
Jahren. Im zweiten Teil erzählt Frank über die Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal und die Kriegsjahre in England.
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler
96.: Pilz, Ida, geb. Klier (Lanz), 02.02.1927.
96.: Ruths, Irmtraud, geb. Hemmer (Falkenau), 11.03.1927.
Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 mehr möglich ist
94.: Wehr, Erna, geb. Düringer (Maria-Kulm), 17.03.1929.
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.
Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber)
93.: Östreicher, Josef (ZieditzKönigsberg), 10.03.1930.
93.: Harseim, Ilse, geb. Knorr (Schönbrunn), 12.03.1930.
93.: Wettengl, Aloisia, geb. Götz (Zieditz), 19.03.1930.

92.: Schmidt, Maria, geb. Hoier (Oberneugrün), 06.03.1931.
91.: Seidl, Berthold (Königsberg), 23.03.1923.
91.: Frohna, Anton (Falkenau), 25.03.1923.
90.: Schülle, Adelheid (Teschwitz), 13.03.1933
90.: Glaßl, Walter (Lobs), 24.03.1933

89.: Harbauer, Wilhelm (Kirchenbirk), 12.03.1934.
89.: Wald, Gertrud, geb. Pleyer (Unterreichenau), 17.03.1934.
88.: Beer, Berta (Zieditz), 01.03.1935.
87.: Pleyl, Reinhard (Zieditz), 14.03.1936.
87.: Walter, Iris, geb. Kempf (Falkenau), 16.03.1936.
87.: Bässler, Herbert (Haberspirk), 30.03.1936.
85.: Koryciak, Ingrid, geb. Schmid (Lauterbach-Dorf), 08.03.1938.
85.: Solf, Waltraud, geb. Brandl (Lobs), 27.03.1938.
84.: Christl, Anneliese, geb. Glassl (Thein-Lanz), 05.03.1939.
83.: Schachner, Olga, geb. Schmied (Schaben), 16.03.1940.
83.: Albert, Rosemarie (Pochlowitz), 24.03.1940.
81.: Albrecht, Karin, geb. Fritsch (Falkenau), 19.03.1942.
80.: Kliebhahn, Otto (EgerTreunitz), 02.03.1943.
80.: Dietz, Monika, geb. Glässl (Tiefengrün), 19.03.1943.
79.: Grollmuss, Renate, geb. Pöllmann (Grasseth), 29.03.1944.
77.: Lill, Ilona, geb. Blohmann (Haberspirk), 12.03.1946
71.: Obermeier, Christine (Ponholz in der Oberpfalz), 09.03.1952.

An unsere erste Mahlzeit am Schiff kann ich mich noch heute gut erinnern. Uns gingen die Augen auf, was da alles am Tisch stand, es war für die meisten von uns ein Schlaraffenland. Wir wollten aber vornehm sein und uns nicht überessen. Wir beobachteten dann, wie der Steward die Tische abräumte und alle Eßwaren, die noch am Tisch standen, in einen Sack steckte, Brot, Butter pfundweise, Gurken, Fleisch und was sonst noch da war. Dann ging er an Deck und schüttete den ganzen Sack ins Meer. Wir wollten unseren Augen nicht glauben und fragten ihn, wieso er das gute Essen wegwerfen kann. Er gab uns zur Antwort: „Das ist Vorschrift, was einmal am Tisch war, darf kein zweites Mal hingestellt werden!“
Bei der nächsten Mahlzeit war es aus mit der Vornehmheit, jeder stopfte sich voll so gut er konnte, und desto mehr wir aßen, desto mehr stellte der Stewart auf den Tisch. Ich glaube, auf der Fahrt von Gdingen nach London, die ungefähr acht Tage dauerte, hat jeder einige Pfunde zugelegt. Es dauerte natürlich am Schiff nicht lange, und wieder mußte ich das Akkordeon auspacken. Es wurde gesungen und getanzt, es waren ja auch andere Gäste am Schiff, und jeden Tag und Abend gab es Musik.
Am zweiten Tag kam der Schiffsoffizier zu mir und sagte, der Kapitän läßt anfragen, ob ich heute Abend die Gäste unterhalten könnte, die vorne am Deck 1. Klasse fahren. Ich hatte natürlich nichts einzuwenden, und so war ich bald mit allem Personal am Schiff, vom Kapitän herunter, gut bekannt.
Es war ein wunderbarer sonniger Tag, als wir durch den KielKanal (Anm. d. Red.: Kiel Canal ist die internationale Bezeichnung des Nord-Ostsee-Kanals) fuhren. Ich hielt mich die meiste Zeit an Deck auf, da wir schon in der Schule vom Kiel-Kanal gelernt haben, und zu meiner Schulzeit hätte ich nie gedacht, daß ich einmal durchfahren würde. Die Fahrt durch den Kanal dauert ungefähr acht bis neun Stunden und ist sehr interessant.
Am Nachmittag mußte ich wieder Akkordeon spielen am Deck, wir begegneten vielen Schiffen und man hat sich gegenseitig zugewunken. Mir kam dann die Idee, warum nicht etwas spielen, zur Begrüßung der anderen Schiffe. Bei den deutschen Schiffen war es einfach, wir kannten ja genug Lieder. Als uns dann ein italienisches Schiff begegnete, spielte ich „O sole mio“, für ein polnisches Schiff spielte ich eine Polka, für ein englisches Schiff „Home, sweet home“, das einzige englische Lied, das ich damals kannte. Als aber dann ein
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Kai Raab (Inhaber)
Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
An Bord des englischen Schi es „Baltrover“: Otto Frank (vierter von links) und seinen Freunden gelang die Flucht vor den Nazis von Polen durch den Nord-Ostsee-Kanal nach England. Fotos: Familie Frank

russisches Schiff kam, da dachte ich, soll alles der Teufel holen, ob es den Nazis am Ufer paßt oder nicht, jetzt wird „Die Inter-
ne Ahnung, wohin es geht. Wir machten uns aber keine Sorgen, ich schon gar nicht. Als wir dann mitten in der Nacht an unserem
zenden von großen, bequemen Sesseln und Sofas, unten im Basement war auch ein Billardzimmer, auch ein großer Tanzsaal
Als es sich in der Umgebung herumredete, bekam ich so viele Einladungen, an verschiedenen Konzerten der örtlichen Organisationen mitzuwirken, und habe heute noch die Dankschreiben, die ich für meine Mitwirkung erhielt. Man hat es in Schottland einen Konzertabend genannt, aber es waren bloß Varieté-Abende mit Buntem Programm, was zu der Zeit populär war. Ende 1941 bis 1944 arbeitete ich dann in Glasgow bei der Genossenschaft, und hatte wenig mit Musik zu tun. Im August 1944 wurde ich zur Englischen Armee einberufen. Nach ungefähr acht Tagen in der Armee, als wir gerade in einem großen Saale, ungefähr 300 Soldaten, einer Intelligenzprüfung unterzogen wurden, kam ein Offizier in den Saal und fragte, ob jemand hier sei, der Klavier spielt. Niemand meldete sich, und ich zögerte auch. Mir fiel gerade die Geschichte von der alten Österreichischen Armee ein, die mein Vater oft erzählte. Man fragte auch, wer kann Klavierspielen, vortreten und in die Küche Kartoffel schälen! Nun ich dachte mir, das ist bestimmt auch so ein Trick. Als dann der Offizier nochmals fragte, „es muß doch jemand da sein, der Klavier spielen kann“, da hoben zwei bis drei ihre Hand und ich auch mit.
Ich wurde dann zum Regimentskapellmeister geschickt, der mir Noten ans Klavier legte, die ich spielen mußte. Er wollte sehen, ob ich Notenlesen kann. Er muß aber sehr zufrieden gewesen sein, denn er sagte mir: „Ich werde dich anfordern für die Regimentskapelle, erst mußt du aber dein Training vollenden.“ Nach zweieinhalb Monaten war ich dann in der Kapelle, wo ich wiederum schöne Zeiten für die nächsten drei Jahre hatte.


Gruppenfoto der britischen Militärkapelle, in der Otto Frank (zweite Reihe, sechster von links) spielte.
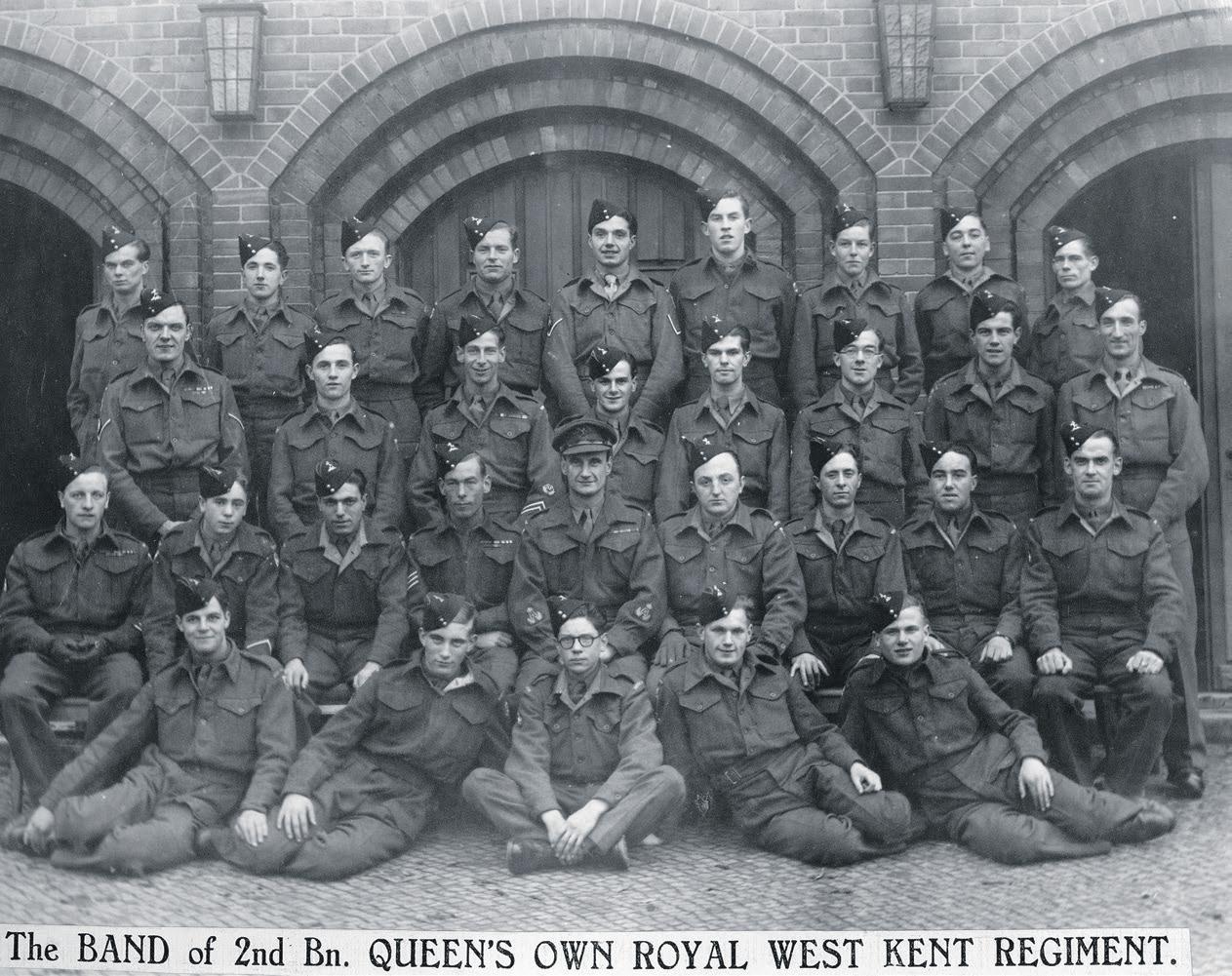

nationale“ gespielt. Einige meiner Freunde kamen ganz entsetzt auf mich zugelaufen: „Um Gottes Willen, hör doch auf mit der Internationalen, du bringst uns ja alle in Gefahr“.
Es sah aber nicht so aus, als ob irgendeine Gefahr vorhanden gewesen wäre. Die alten Seemänner und Arbeiter, die am Ufer standen mit ihren Schiffsmützen, schauten bloß schmunzelnd zu, vielleicht hat es ihnen gutgetan, daß sie wieder mal „Die Internationale“ hörten.
Nach Ankunft in London wurde ich einer Gruppe zugeteilt, die am nächsten Morgen nach Schottland fahren sollte. Wir waren ungefähr 40 Genossen im Autobus, hatten natürlich kei-
Endziel ankamen, wollten wir unseren Augen nicht glauben. Es war ja wie ein Schloß, wo man uns einquartierte. Dollarbeg hieß das Haus, es gehörte einmal einem reichen Lord, der es dann an die „Workers Traveller Association“ verkaufte, das ist die Urlaubsorganisation der englischen Gewerkschaften.
Als wir uns bei Tageslicht am nächsten Morgen umschauten, kamen wir aus dem Staunen nicht heraus. Es war wirklich wie ein Schloß, mit wunderbarem Garten, Tennisplatz, Golfplatz, und ringsherum sehr gepflegter Rasen. Im Hause selber gab es kaltes und warmes Wasser und Bad in fast jedem Zimmer, Speisesaal, Aufenthaltsräume mit Dut-

Die Erkennungsmarke (unten rechts) aus Franks Armeezeit.
mit großem Grand-Piano, und auch in einem der Gesellschaftsräume stand ein Grand-Piano.
Es war natürlich selbstverständlich, daß die Musiziererei am ersten Tage anfing und nicht aufhörte, bis wir nach fast zwei Jahren nach Glasgow übersiedelten. Als dann um die Weihnachtszeit die ersten Urlaubsgäste im Hause ankamen, kam ich nicht zur Ruhe, jeden Abend mußte ich zum Tanz spielen. Jeden Samstag oder Sonntag gab es ein Konzert unter Mitwirkung der Gäste. Meistens waren es Sänger, die ich dann am Klavier begleiten mußte. Ich möchte fast sagen, die zwei Jahre in Dollarbeg waren fast die schönsten Jahre meines Lebens.
Als der Kapellmeister herausfand, daß ich Schreibmaschinen schreiben und auch orchestrieren kann, wurde ich gleich zum Sekretär der Kapelle befördert. Es brachte mir zwar nicht mehr Geld, aber ich war freier als so manch anderer Soldat. In der Tanzkapelle spielte ich dann Klavier, am Marsch bekam ich ein Tigerfell umgehängt und mußte die große Trommel spielen. Und wenn wir ein Konzert gaben, spielte ich Tympanies, Glockenspiel, und was sonst noch zur Percussionsession gehört. Ich lernte noch Xylophon dazu, und oft mußte ich Solo spielen, Akkordeon oder Xylophon. Unsere Militärkapelle spielte manchmal wochenlang in den verschiedenen Seebädern, und wir hatten die schönsten Zeiten. Teil 3 „Das neue Leben in Kanada“ erscheint in der nächsten Ausgabe.

Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der
Heimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Heimatkreis Karlsbad, Heimatkreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollak, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22.
Spendenkonto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparkasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KS –Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
66. JAHRGANG Jänner 2016 FOLGE 1
72. JAHRGANG Dezember 2022
Liebe Leser – ob Sie nun selbst noch in Karlsbad oder einer der Gemeinden in seinem Kreis geboren sind, ob Ihre Vorfahren von dort her stammen oder ob Sie einfach Interesse an dieser schönen Gegend und ihrer Geschichte haben – seien Sie herzlich begrüßt.
In dieser Ausgabe finden Sie den ersten Teil von Rudi Baiers Bericht zur Geschichte unserer Karlsbader Zeitung. Eine Fortsetzung ist dann für die nächste Ausgabe geplant, welche wegen der Ostertage schon am 31. März erscheinen wird.
Wie es Tradition ist, wollen wir hier denjenigen unserer Mitglieder zum Geburtstag gratulieren, die sich ehrenamtlich für unseren Heimatverein engagieren oder das lange getan haben. Herzlichen Dank an Euch, Glück und Gesundheit für ein gutes neues Lebensjahr!
93. Geburtstag am 4. März Gerhard Fritsch, ehem. GB Putschirn, 91074 Herzogenaurach;
88. Geburtstag am 5. März Alfred Schneider, GB Welchau, 97453 Schonungen;
86. Geburtstag am 12. März Christl Hafner/Schlosser, koop. GB Sittmesgrün, 91242 Ottensoos;
Mitteilungen des Heimatverbandes
Liebe Heimatfreunde, liebe Leser der Karlsbader Zeitung!
Ich freue mich darüber, daß Sie unsere Beiträge in der Sudetendeutschen Zeitung lesen und uns weiterhin gewogen bleiben.
Die kalten Monate sind eher ruhig im Vereinsleben, und so habe ich an zwei Veranstaltungen in München teilgenommen.
Am Sonntag, 8. Januar 2023, war ich zum feierlichen Neujahresgottesdienst in der Sankt-Michaels-Kirche in München (siehe Seite 13). Unter den vielen Besuchern konnte ich Dr. Kerkenbusch mit ihrem Ehemann begrüßen, wir kennen uns vom „Karlsbader Stammtisch München“ im Kolpinghaus. Doch der Stammtisch kommt seit vielen Jahren nicht mehr zusammen.
Am Samstag, 28. Januar 2023, besuchte ich eine Veranstaltung im Sudetendeutschen Haus München, welche von der Jugend gestaltet wurde. Alljährlich werden an junge Künstler und Wissenschaftler Kulturelle Förderpreise verliehen. Alle sechs Teilnehmer (davon zwei aus der Tschechischen Republik), darunter Bildende Kunst, Architektur, Darstellende Kunst, Musik, Wissenschaft, sowie Volkstumspflege, haben mit viel Freude ihr Fach präsentiert und wurden mit Anerkennung und großem Applaus ausgezeichnet. Wahre Brückenbauer Europas!
Präsidentenwahl in der Tschechischen Republik Ergebnis in
Karlsbad: Petr Pavel 56,91 Prozent, Andrej Babiš 43,08 Prozent – übermittelt von unserem Heimatfreund und Mitglied im Heimatverband der Karlsbader e.V. Pavel Padua; vielen Dank, lieber Pavel.
Aus dem Europäischen Parlament: Bestnoten gab es für den Ratsvorsitz des tschechischen Europaministers Mikuláš Bek im zweiten Halbjahr 2022. Jetzt ist der ehemalige Rektor der Universität Brünn als tschechischer Vertreter in der nächsten EUKommission im Gespräch.
Für Spenden bedanken wir uns sehr herzlich! 180,00 Euro sind 2023 eingegangen. Namentlich darf ich nennen: Gerda Pikkert (Nürnberg); Hildegard Köp-
pel; Manfred Hubl (Straubing); Dr. Horst Engel (Gießen); Peter Böhme (Frankfurt) und Manfred Hüber (Leun). Wenn Sie uns mit einer Spende weiterhin unterstützen wollen; hier ist die Bankverbindung:
Empfänger: Heimatverband der Karlsbader e.V.; Kreissparkasse München; IBAN:
DE31 7025 0150 0070 5523 44;
BIC: BY LA DE M1 KS; Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung oder wollen Sie ungenannt bleiben, dann rufen Sie bitte an: (0 81 42) 1 23 03 oder Sie vermerken das auf dem Überweisungsträger.
Karlsbader Museum und Archiv in Wiesbaden, Oranienstra-

82. Geburtstag am 16. März Dr. Peter Küffner, Erster Vorsitzender des HVdK e.V., 84036 Landshut;
64. Geburtstag am 2. März Pia Eschbaumer, GB Karlsbad-Stadt, Kreisbetreuerin.

Besonders hervorheben möchte ich den 85. Geburtstag am 24. März von Dr. Horst Engel, Leiter des Museums der Karlsbader in Wiesbaden, stellv. GB Drahowitz, 35394 Gießen – denn ohne ihn, und seine liebe Frau Christa, hätte unser Museum in Wiesbaden keinen Bestand; bitte lesen Sie die Würdigung vom Kollegen Zwerschina unter Drahowitz. Ein sehr verdientes Mitglied unseres Heimatverbandes war auch Dr. Rudolf Schönbach, dessen Todestag sich soeben jährte (s. Karlsbader Zeitung 4/2022, S. 10 und 5/2022, S. 9). Zu seinem Gedenken hat der HVdK an seinem Grab ein Gesteck in unseren Farben Rot und Weiß niedergelegt. Seine Untersuchungen zur Geschichte unserer Heimat sind es immer wert, gelesen zu werden. Und so werden wir bei Gelegenheit den einen oder anderen an dieser Stelle wieder abdrucken.
Herzliche Grüße von der Kreisbetreuerin Pia Eschbaumer
ße 3: Jeden ersten Samstag im Monat ist das Museum für Besucher geöffnet von 11.00 bis 13.00 Uhr. Dr. Horst Engel und seine Frau Christa erwarten gern Ihren Besuch an diesem Tag, nur in besonderen Fällen kann ein anderer Besuchstermin vereinbart werden. Dann bitte anrufen bei Dr. Engel (06 41) 4 24 22. Zu erreichen ist das Museum vom Hauptbahnhof mit der Buslinie 16 bis Ausstieg Landesbibliothek.
Mitgliedschaft im Heimatverband der Karlsbader e.V.: Wenn Sie uns bei der Heimatarbeit mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen wollen, rufen Sie mich bitte an, ich sende Ihnen gerne ein Beitrittsformular zu. Telefon Pollak (0 81 42) 1 23 03.
Bund der Deutschen – Landschaft Egerland – Ortsgruppe Karlsbad: Wir haben noch Winterferien, am 2. März und am 6. April 2023 Vorstandssitzung mit Kaffeeklatsch im Egerländer Hof Karlsbad.
Geburtstage: Zum Geburtstag gratulieren wir allen Freunden, die im Februar und März geboren sind. Wir wünschen viel Gesundheit und alles Gute im neuen Lebensjahr!
85. am 18. Februar Julie Dalkka; – 83. am 21. Jiri Vanicek; – 73. am 5. März Monika Aksamitova; – 87. am 9. Marketa Dvorakova; – 84. am 9. Krista Hruba; – 25. am 11. Klarka Klyeisenova; – 61. am 18. Josef Hess; Bitte umblättern
Der Komponist Richard Strauß. Bild: Wikipedia



n 1. März 1923: Das Ehrenmitglied der freiwilligen Feuerwehr, Wilhelm Weisshaupt, spendet aus Anlaß seiner 50jährigen Zugehörigkeit am 1. Juni 1922 zur Gründung eines Wilhelm-Weisshaupt-Fondes 1000,00 Kronen.
n 3. März 1923: Die Bezirkskrankenkasse zahlte in der letzten Woche 110.000,00 Kč an Krankenunterstützung aus.
Das Staatsrealgymnasium veranstaltet eine Akademie im Schützenhaus.
n 4. März 1923: Der Kurbesuch ist derzeit noch gleich null. Die Ursache ist der Marksturz im Deutschen Reich.
100 M = 15 ¼ Kč.
Ein trauriger Gedenktag für die Sudetendeutschen. Vor vier Jahren fielen 108 friedliche deutsche Bürger der tschechischen Soldateska zum Opfer.
n 8. März 1923: Das Gesetz zum Schutz der Republik und das Gesetz über den Staatsgerichtshof tritt in Kraft.
n 9. März 1923: Versammlung von Interessenten zur Hebung der Kurfrequenz beruft die Egerer Handelskammer ein.
n 10./11. März 1923: Das Kurorchester führt gemeinsam mit dem Aussiger Stadttheaterorchester die „Alpensymphonie“ von Richard Strauß zum ersten Mal im Schützenhaus auf.

Die Auto-Raserei wird, besonders bei Regenwetter, zur Stadt-
plage.
n 11. März 1923: Die Zahnradbahn zum Dreikreuzberg geht im Unterbau der Vollendung entgegen.
n 16. März 1923: Das Kurorchester wird gegenüber dem Vorjahre um drei Bläser vermehrt.
Der erste schöne Tag in diesem Jahr.
n 17. März 1923: Eine große Volksversammlung findet im Kurhause statt, in der Abgeordneter Rudolf Lodgmann spricht.
n 20. März 1923: Messerstecherei von Betrunkenen nachts um 2.00 Uhr auf der Egerbrücke.
n 21. März 1923: Auf Anordnung des Bezirksschulamtes treffen sich alle Direktoren, Oberlehrer und Schulleiter aller Schulen im Bezirk Karlsbad mit dem Bezirksschulinspektor, um die schwebenden erziehlich unterrichtlichen Fragen und administrativen Angelegenheiten aufgrund der neuen gesetzlichen Bestimmungen zu besprechen.
n 26. März 1923: Der Ortsschulrat von Karlsbad gibt Anweisung, daß in allen Unterrichtsräumen und Gängen der Schulen das Rauchen verboten ist.
n 29. März 1923: Otto Laasch, Direktor der Handelsakademie, wird in den Staatsdienst übernommen.
� Mitteilungen des Heimatverbandes – Fortsetzung Seite 16
– 67. am 21. Peter Zimmermann. Wir wünschen Euch eine erholsame Winterzeit im verschneiten Egerland!
Unsere Bücherecke: n Einwohnerverzeichnis der
Kurstadt Karlsbad, der Stadt Fischern und der Marktgemeinde Drahowitz. Dabei handelt es sich um die 324 Seiten des äußerst seltenen Adreßbuches von 1938/1939, Redaktionsstand von
� Verdiente Karlsbader und deren Grabstätten
1937, Preis: 29,00 Euro.
n Karlsbader Historische Schriften Band 2 . Eine kenntnisreiche Betrachtung über Karlsbad als Kur- und Genesungsstadt, Preis: 19,80 Euro.
Rudi Baier berichtet über den Maler Kordik Georg und seine Grabstätte:
Kordik Georg, berühmter Maler, stammte aus Wetzelsberg/Niederbayern. Schon in früher Jugend zeigte er Neigung zur Malerei. Er wollte Künstler werden, seine Eltern waren arm und wollten, daß Georg Priester wird.
Er besuchte das Gymnasium in Straubing, verließ 1836 das Lateinstudium und besuchte die
königliche Kunstakademie in München. Dort wurde er Schüler des Malers Peter Cornelius. Er blieb an dieser Schule bis zum Jahr 1839. Im Jahr 1841 übersiedelte er nach Karlsbad, das seine zweite Heimat wurde. Dort lernte er Josef Labitzky kennen, der damals Musikdirektor war, und porträtierte ihn. Dieses Portrait verschaffte ihm in Karlsbad Zutritt zu dem in der Kurstadt weilenden Adel, der Kordik bald mit Aufträgen für Portraits versah.
Er knüpfte mit dem schwedischen Ministerpräsidenten, Grafen Löwenhjehn, Beziehungen an. Er wurde nach Schweden eingeladen und malte die berühmte Tänzerin Taglioni, die Königin und Kronprinzessin.
Mit dem Empfehlungsschreiben ging er nach Rußland, um Mitglieder des Kaiserhauses zu malen. Auf seiner zwölfjährigen Reise, die ihn unter anderem nach Moskau, Italien, in den nahen Orient, Griechenland und Georgien führte, kehrte er nach Karlsbad zurück und ließ sich 1853 in Karlsbad bleibend nieder. Er erwarb das Haus „Gartental“ (später Sankt Joseph) und hat in demselben seine zahlreichen Sammlungen aufgestellt.
Sein Grabmal auf dem Karlsbader Friedhof ist das Werk seines Prager Freundes, des Bildhauers Thomas Slidern, mit dem Kordik zu Lebzeiten in regem Briefwechsel gestanden hatte. Seine vielen Werke befinden sich vor allem in Schweden, Moskau, Leningrad und Tiflis.
Eine renovierte Grabtafel am verwitterten Grabmal trägt folgende Inschrift: „Georg Kordik, Akademischer Maler und Hausbesitzer in Karlsbad – geb. zu Wetzelsberg in Baiern 31. Juli 1818, gest. in Karlsbad 2. März 1886“. Darunter ein Vierzeiler: „Will des Griffels zartes Walten, will des Pinsels muthig Schalten, sich dem reichsten Sinne bequemen, darfst getrost den Lorbeer nehmen. Goethe.“
n Karlsbader Schicksalstage 1939 bis 1946. Von Prof. Dr. Rudolf Schönbach. Preis: 4,50 Euro. n Zwischen Grenzen und Zeiten. Egerländer Landsleute erzählen, zusammengestellt von
Hans Bohn. Preis: 6,00 Euro.
Alle Preise inklusive Porto und Verpackung.
Kontaktdaten: Susanne Pollak, Estinger Straße 15, 82140 Olching, Telefon (0 81 42) 1 23 03,
eMail heimatverband@carlsbad. de Alles Gute und reichlich Sonnenstrahlen zum Wärmen.
Ihre Susanne Pollak
� Aus der Geschichte des Karlsbader Badeblattes (1861–1951) – Teil I
Von Rudi Baier
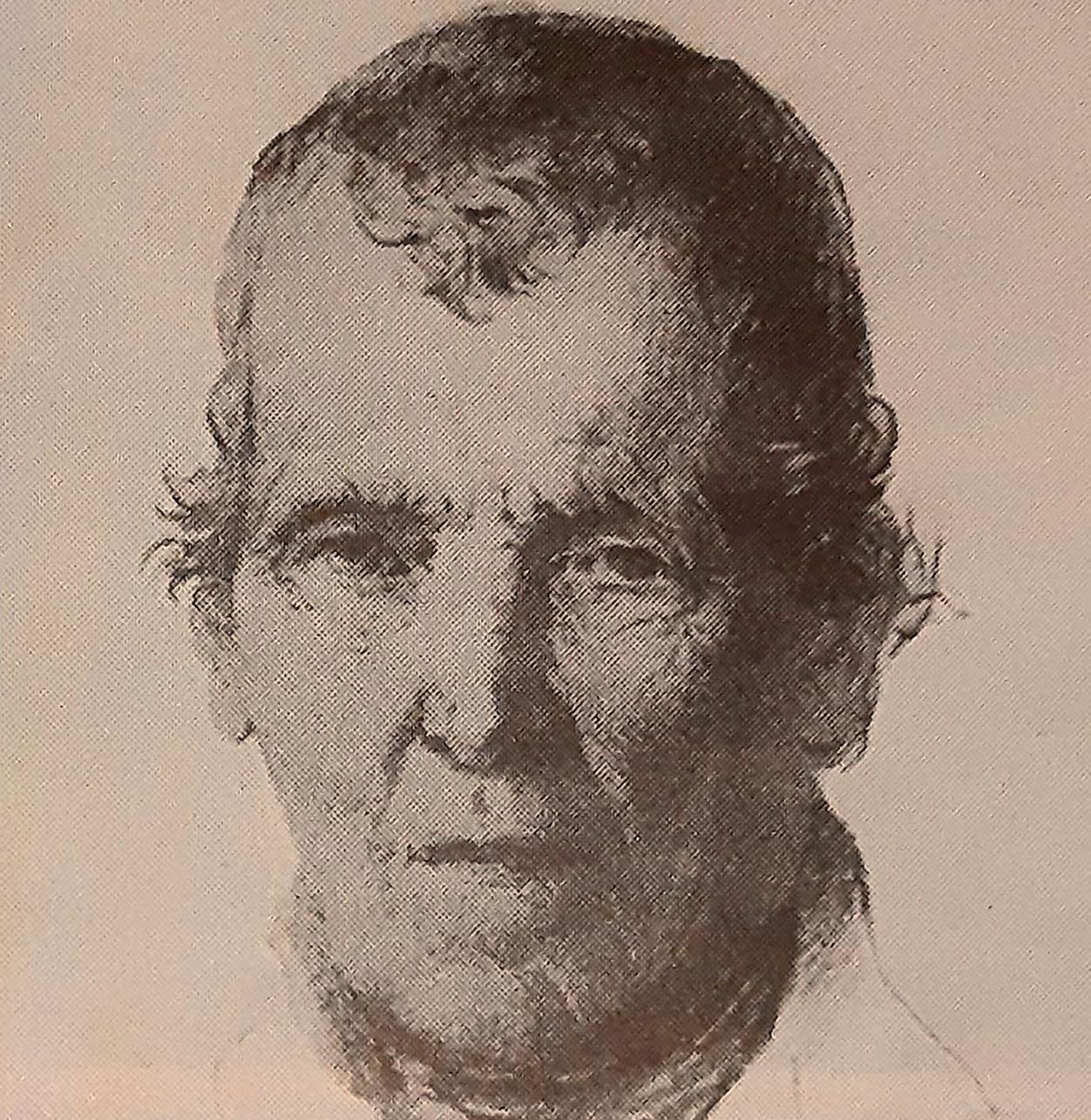
In der ersten Ausgabe des Karlsbader Badeblattes vom 1. Januar 1951 erschien von A. E. Rudolf über das Karlsbader Badeblatt der nachfolgende Bericht.
Mit dem Zeitungswesen in Karlsbad ist der Name der Buchdruckerfamilie Franieck aufs innigste verknüpft. Ihr Begründer, der Buchdrucker Franz Franieck, wurde 1770 in Prag geboren.
Im Jahr 1788 kam er nach Karlsbad und trat in die in diesem Jahr gegründete Buchdrukkerei des Johann Nep. Ferd. Schönfeld auf der Alten Wiese „Zum Maltheserkreuz“ ein. Inzwischen ist er 1793 in der Drukkerei der Witwe Sabine Fritsche in Eger tätig. Von dort aus bewirbt er sich um eine Buchdrukkerkonzession in Karlsbad.
Nach Überwindung mannigfacher Schwierigkeiten bei den damaligen Behörden erhielt er 1793 die Bewilligung, eine Buchdruckerei in Karlsbad zu errichten, jedoch mit der Beschränkung: „Daß nur Gelegenheitsund andere kleine Gedichte, Avertissements und dergleichen Gegenstände nach vorgegangener Zensur des kgl. Kreisamtes in Druck gelegt werden dürfen, in Beziehung der wichtigeren Gegenstände es aber bei der ordentlichen Zensur sein Verbleiben haben müsse.“
Im vormärzlichen Böhmen war es nicht so einfach eine Buchdruckereikonzession zu erhalten. Die Zensurvorschriften wurden sehr streng gehandhabt, und Druckereikonzessionen wurden aus Gründen der besseren Überwachung nur in Kreisstädten erteilt. Dabei ist es bezeichnend, daß vor 1848 in ganz Böhmen nur vier Provinzzeitungen erlaubt waren, und zwar in Pilsen, Saaz, Eger und Brüx. So konnte es Franz Franieck als großen Erfolg buchen, in Karlsbad eine
Druckerei führen zu dürfen. Er übernahm die Druckerei Schönfeld auf der „Alten Wiese“. Neben verschiedenen Druckaufträgen für die Kurgäste, unter denen sich sogar solche wie Johann Wolfgang von Goethe befanden, wie zum Beispiel die geologische Schrift „Zur Kenntnis der böhmischen Gebirge“ und mehrere Gelegenheitsgedichte, erschienen im Laufe der Jahre in der Druckerei Franieck zahlreiche Buchveröffentlichungen. Und seit 1795 erschien die Karlsbader Kur- und Badegästeliste, die durch 150 Jahre, nur wenige Jahre ausgenommen, bei Franieck gedruckt wurde.
Franieck heiratete 1795 die Karlsbader Meßnerstochter Johanna Mathes. Der Ehe entsprossen zwei Söhne, Franz und Karl Franieck. Nach dem frühen Tod von Franz Franieck führte seine tatkräftige Witwe die Druckerei bis zur Großjährigkeit der Söhne weiter. Sie gliederte 1811 eine Buchhandlung und später eine Leihbücherei an.

Als sie am 5. Dezember 1833 starb, übernahmen Franz und Karl Franieck die Druckerei, die sie unter dem Namen Gebrüder Franieck weiterführten. Die Franiecks spielten im öffentlichen Leben Karlsbads eine bedeutende Rolle.
Besonders Franz Franieck erwarb sich große Verdienste als Hauptmann des Karlsbader Schützenkorps, das seinem unvergeßlichen Kommandanten auch ein Denkmal setzte. Er errichtete eine Steindruckerei, war Mitglied der Gemeindevertretung und betätigte sich auch schriftstellerisch sehr produktiv.

Wenn es seinem Vater und auch nachher seiner Mutter nicht gelang, die Bewilligung zur Herausgabe einer Zeitung zu erreichen, ist es der Initiative Franz Franiecks zu danken, daß Karlsbad bereits 1840 eine solche er-
hielt. Sie erschien in diesem Jahr unter dem Titel „Unterhaltungs-, Auskunfts- und Anzeigenblatt von Carlsbad und anderen Curorten Böhmens“. Das „Unterhaltungsblatt“ kam wöchentlich zweimal, Mittwoch vier und Sonntag sechs Seiten stark, in Klein-Quart-Format heraus. Es war zweispaltig in Fraktur gedruckt. Das Abonnement kostete von Anfang Mai bis Ende September 1 Fl. C M. Das Blatt war ausgezeichnet redigiert und zählte bedeutende Schriftsteller zu seinen Mitarbeitern. Besonders die Feder des berühmten Karlsbader Arztes und Schriftstellers Dr. Rudolf Mannl (1812–1863) verlieh ihm ein hohes, literarisches Niveau.
Leider konnte sich die Zeitung nur zwei Jahre halten und ging 1841 wieder ein. Erst nach Inkrafttreten der Pressefreiheit, im Revolutionsjahr 1849, konnten die Gebrüder Franieck wieder an die Herausgabe einer Zeitung denken.
Am 20. April des genannten Jahres erschienen in ihrem Verlag die „Wochenblätter für Freiheit und Gesetz“, eine vorwiegend politische Zeitung, die als Streit- und Gedenkschrift große Bedeutung hatte. In ihr kamen bekannte Publizisten, unter anderem Freiherr von Andrian, zu Worte, welche die März-Revolution mit vorbereiteten. Aber auch die „Wochenblätter für Freiheit und Gesetz“ hatten keine lange Lebensdauer. Am 31. Dezember erschien die letzte Folge.
Nun vergingen zwölf Jahre, bis Karlsbad wieder zu einer eigenen Zeitung kam. In dieser Zeit waren die interessierten Leser auf die „Deutsche Zeitung Bohemia“ angewiesen, die seit 1832 als Tageszeitung in Prag herauskam und fast in jeder Folge ausführliche Berichte aus Karlsbad brachte.
Fortsetzung folgt
Karlsbad Stadt
Gemeindebetreuerin Pia
Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de
Liebe Karlsbader, heuer liegt der März komplett in der Fastenzeit – wie es der einzelne hält mit der inneren Einkehr, dem Verzicht auf Genüsse welcher Art auch immer, der Mäßigung, bleibt heutzutage jedem selbst überlassen, während das in früheren Zeiten durch Kirche, Gesellschaft und „Obrigkeit“ stark vorgegeben war.
Gar nicht passend erscheint mir ein „Brauch“ wie die politischen Aschermittwochstreffen, bei denen keinerlei Mäßigung hinsichtlich der Attacken auf „Gegner“ geübt wird. Lustiger, wenn auch ebenso fremd in der Fastenzeit, ist dabei das „Derblecken“ beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg in München.
Und für mich gab es im Kindergarten einmal keine Feier, als mein Geburtstag (2. März), wie auch heuer, nach dem Aschermittwoch lag. Damals hat mich das sehr geschmerzt. Heute lege ich keinen Wert mehr auf das Feiern – aber kein Geburtstagskind soll sich davon abhalten lassen. Hauptsache, viele Menschen denken an einen und gratulieren, sei es schriftlich, telefonisch oder bei einem Besuch.
Herzliche Geburtstagsgrüße an alle Leser, besonders den nun genannten; allen wünschen wir einen schönen Tag, Gesundheit und Wohlergehen für das neue Lebensjahr. Wir gratulieren zum: – 93. am 25. Strnad / Völk, Maria (Kantstr.), 50933 Köln; – 90. am 28. Stöckl, Anton (Röhrengasse), 73630 Remshalden; – 82. am 16. Dr. Küffner, Peter (Prager Gasse), 84036 Landshut.
Leider hat mich eine Todesnachricht erreicht:
Schon am 20. Dezember 2022 ist in seinem 95. Lebensjahr Erich Pösch an seinem letzten Wohnort Mainleus verstorben; die Beisetzung fand am 17. Februar/Feber in Wilmersreuth statt.
Geboren wurde er am 2. Oktober 1928 in Karlsbad, wo seine Familie ein Papierwarengeschäft betrieb. Seiner Frau, den Kindern, Enkeln und allen Anghörigen gilt unsere herzliche Anteilnahme.
Wie tröstlich der Spruch in der Traueranzeige:
„Glücklich, glücklich nenn´ ich den, dem des Daseins letzte Stunde schlägt in seiner Kinder Mitte. Solches Scheiden heißt nicht Sterben; denn er lebt im Angedenken, lebt in seines Wirkens Früchten, lebt in seiner Kinder Taten, lebt in seiner Enkel Mund.“
Der Frühling naht: Schon schmücken Schneeglöckchen und Krokusse die Frühlingswiesen, vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich schon die ersten Blüten an Forsythienbüschen gesehen, und auch der Silberahorn vor meinem Fenster treibt kräftig seine Blütenstände aus.
Am Montag, den 20. März, ist Frühlingsanfang, und am Sonntag, den 26. März, stellen wir wieder auf die Sommerzeit um – und schon am 31. März erscheint die nächste Ausgabe der Karlsbader Zeitung
Bis dahin herzliche Grüße, Ihre Pia Eschbaumer

Gemeindebetreuer Erwin Zwerschina, Am Lohgraben 21, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Telefon (0 96 61) 31 52, Fax (0 96 61)


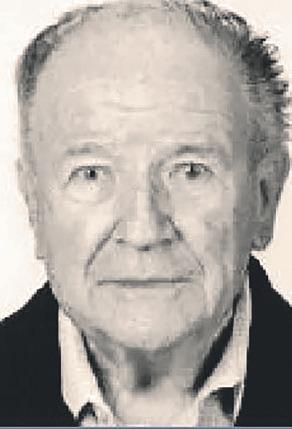
8 13 78 37
Im März möchte ich zwei Jubilare besonders begrüßen. Seinen 85. Geburtstag am 24. feiert Dr. Horst Engel in 35394 Gießen, August-Messer-Str. 4. Er ist seit 19 Jahren mein Stellvertreter in der Ortsbetreuung von Drahowitz.

Wir wohnten daheim in der Danziger Straße, er im oberern Eckhaus links, ich im unteren Eckhaus rechts, wenn man von Norden nach Süden blickt. Trotzdem kannten wir einander daheim nicht. Nach der Vertreibung kamen wir erstmals 1983 in Wetzlar zusammen, als ich die Gemeindebetreuung von Drahowitz übernahm.
Doch dann verfiel unser Horst der Arbeit für das „Karlsbader Museum“ in unserer Patenstadt Wiesbaden praktisch mit Herz und Seele. Zunächst noch im Verbund mit den Heimatfreunden Ascherl, Loh, Schuster und Thoma in der Welfenstraße, einer äußerst provisorischen Bleibe in einem Kellergeschoß, doch seit der endgültigen Etablierung in der Oranienstraße als alleiniger Leiter seit dem 18. Februar/ Feber 2011.
Bei den monatlichen Öffnungszeiten für Museumsbesucher an den ersten Samstagen bestreitet er die über 98 Kilometer lange Fahrt von Gießen nach Wiesbaden stets in Begleitung seiner ebenso engagierten Gattin Christa. Zwei zerstörerische Wasserleitungsschäden im Gebäude mit ihren langzeitlichen Folgen bürdeten den beiden bis an ihre Grenzen gehende Belastungen auf. Daneben belastete sie die langjährig schwelende Unsicherheit über die zukünftige Bleibe unseres Museums, die zu folgenschweren Schädigungen der Gesundheit der Eheleute führte.
Umso herzlicher soll Dich, lieber Horst, an der Seite Deiner Christa, mein heutiger Geburtstagswunsch für eine Festigung Deines Allgemeinbefindens erreichen!
Nur einen Tag später, am 25. März, darf Adolf Gellen, Inhaber seines „Kapellenhof“-Imperiums in Roßtal, auf 85 Jahre eines reich erfüllten Lebens zurückblicken. Auch ihn kannte ich daheim noch nicht, denn der Besuch der Gaststätte seiner Eltern am jenseitigen Egerufer war für einen minderjährigen Lausbuben damals tabu. Umso mehr wuchs mit den Jahren der immer enger werdende Kontakt von uns Drahowitzern mit ihm und seiner Gattin Erna, da sie nach der Vertreibung ab den 1970er Jahren unsere alljährlichen Treffen mit böhmischfränkischer Küche und fürsorglicher Unterkunft bereicherten.
Wie immer, so auch diesmal, bedachte Adolf unsere Gemeindekasse mit einer großzügigen Zuwendung, wofür ihm unser aller Dank ausgesprochen sei, verbunden mit dem Wunsch nach Erhalt eines brauchbaren Gesundheitszustandes und die zufriedenstellende Zusammenarbeit mit der Pächterfamilie Lienerth.
Adolf GellenEine Erzählung von Adolf Gellen über sein Leben: „Am lin-
ken Egerufer, im Stadtteil Weheditz des weltberühmten Kurortes Karlsbad, kam ich am 25. März 1938 zur Welt. Das Gasthaus,,Felsenmühle“ betrieben meine Eltern Josef und Margarete Gellen, geborene Simon, selbst bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als ich noch im Februar/Feber 1944 eingeschult wurde. Doch im Frühjahr 1945 erfolgte die Besetzung durch die Sowjetarmee. In fieberhafter Eile mußten unsere Frauen vorher die weißen Felder und das Hakenkreuz äus den Fahnen trennen, denn rote Beflaggung wurde im Rundfunk befohlen.


Im Gefolge der russischen Soldaten zogen tschechoslowakische Miliz, Polizei und plündernde Horden im gesamten Sudetenland ein. Schulen, Behörden und alle öffentlichen Einrichtungen deutschen Ursprungs wurden aufgelöst. In den Geschäften, Betrieben und Fabriken übernahm ein Verwalter/Spravce die Führung. Einbrüche, Morde und Vergewaltigungen fanden statt. In der deutschen Bevölkerung mehrten sich die Suizide. Am Zwangsunterricht in der tschechischen Schule nahm ich kaum teil und schwänzte ihn meist. Mein Vater wurde von den Tschechen in ein Zwangsarbeitslager verschleppt.
AIs 1946 die Vertreibung der deutschen Bevölkerung begann, mußten meine Mutter, meine Schwester und ich in das Sammellager Karlsbad–Meierhöfen mit nur 20 Kilogramm Gepäck für Erwachsene und zehn Kilogramm für Kinder unter Zurücklassung der gesamten Habe einrücken. Dort wurden wir mit Gummiknüppel- und Gewehrkolbenhieben in Viehwagen verladen.
Über Bayern ging die Fahrt nach Lauterbach im hessischen Landkreis Gießen in eine Turnhalle, wohin ohne unsere Kenntnis auch Gretel, die Tochter meiner Tante mütterlicherseits, vertrieben wurde. So wurden wir vier tags darauf einem Bauern in Zell zugeteilt, vor dessen Haus wir von in der Frühe bis zum Abend warteten, bevor wir ein Zimmer fiir vier Personen erhielten. Auch waren wir Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse in einem Raum.
Über das Rote Kreuz fand mein Vater nach seiner Entlassung zu uns. Er mußte im Wald Bäume harzen, damit wir an Lebensmittelkarten kamen.
Durch die Vermittlung der Schwester meiner Mutter bekamen wir in der Folgezeit die Möglichkeit, in Roßtal von der dortigen Familie Haas die Gastwirtschaft „Grüner Baum“ zu pachten, was 1949 auch zustande kam. Vater bekam für seine Arbeit im Wald von der Gemeinde zwar kein Geld, jedoch 20 cbm Buchenholz, das wir samt Hab und Gut per Bahn nach Roßtal transportierten, wo ich gleich in die 4. Klasse eingeschult wurde.“
Außerdem beglückwünschen wir noch zum 91. Geburtstag am 08. Schneider/Kachler, Renate (Mattonistr. 83), 65396 Walluf und zum 88. am 05. Daniel/ Palme, Ingeborg, Fontanestr. 8, 65187 Wiesbaden. Alles Gute! Erwin Zwerschina
Gemeindebetreuer Rudi Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de
Wir gratulieren zum Geburtstag im März zum: – 89. am 9. Hetzinger, Emma in 86161 Augsburg; – 88. am 27. Bayer, Brigitte geb. Ott in 95213 Münchberg; – 72. am 22. Wild, Rita in 84347 Pfarrkichen. Wir wünschen Ihr
und den hier nicht genannten, alles erdenklich Gute, vor allem aber Gesundheit und Gottes Segen. Den Kranken wünschen wir gute Besserung.
Liebe Landsleute, folgenden Brief an die k.k. Bezirkshauptmannschaft Karlsbad habe ich gefunden. Der Text lautet: „Bei der Wahl des Gemeindeausschusses der Ortsgemeinde Espenthor am 26. Februar 1910 sind im dritten Wahlkörper zu Ausschußmitgliedern gewählt worden: Wenzel Eckl, Karl Schellen, Anton Hauer, Josef Klier und zu Ersatzmännern Johann Watzka und Josef Herget.“ Rudi Baier
Im Landkreis: Altrohlau
Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Tel. (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf.Preis@t-online.de
Die besten Wünsche zu ihrem Geburtstag, alles Gute und Gesundheit senden wir zum: – 94. am 01. Dutz/Bösemer, Marie, 95676 Wiesau, Mühlenhofstr. 4; – 91. am 18. Dr. Roth, Walter, 40699 Erkrath, MaxLiebermannStr. 1; – 87. am 09. Jakob, Elisabeth, 30163 Hannover, Gibraltarweg 6; – 79. am 25. Neukirchner, Manfred, 81925 München, Effnerstr. 85a.
Todesfall: Elisabeth Zettl/Fischer, geboren am 15. November 1933 in Altrohlau, zuletzt wohnhaft in Feldkirchen, verstarb am 15. Dezember 2022 nach kurzem Aufenthalt im Seniorenheim.
Diese traurige und überraschende Nachricht teilte mir die Tochter von Elisabeth Zettl in einem Telefongespräch mit. Ich lernte die liebenswerte Zettl und
ihren bereits verstorbenen Mann Robert bei vielen Altrohlautreffen kennen und schätzen und bekunde den Hinterbliebenen die zutiefst empfundene Anteilnahme aller Altrohlauer.
Spende: Ganz herzlich bedanke ich mich bei Ramona Bittner für ihre großzügige Spende in die Porto- und Auslagenkasse.
In der 12. Folge der Altrohlauer Chronik erwähnte ich bereits die Anstrengungen hinsichtlich der Wasserversorgung Altrohlaus, mithilfe eines Windmotors die Zwietra-Quelle anzuzapfen. Dazu fand ich einen Bericht im Altrohlauer Heimatbrief von 1950: „Der Windmotor von Altrohlau“.
Diese Chronik berichtet an mehreren Stellen von den Sorgen der Altrohlauer Stadtväter, die Fabriken und Bewohner des Ortes mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Im Jahr 1892 kam es daher zum Bau des Wasserbassins am „Schirmbühl“ an der Neudeker Straße. Die Versorgung im Ort erfolgte vorher ausschließlich durch Brunnen. Die Gemeindevertretung ließ folglich zwei Quellen „in der Klinge“ fassen und das Wasser in das erbaute Wasserbassin leiten. Die Quellen erwiesen sich jedoch nur in niederschlagsreichen Monaten als ergiebig.
Zur Abhilfe versuchte man, das Wasser der Zwietra-Quellen (in der Senke zwischen Schneiderberg und Hutberg) der Wasserversorgung dienlich zu machen, indem man mithilfe eines Windmotors dieses Quellwasser in das Wasserbassin pumpen wollte (elektrischen Strom zum Antrieb der Pumpe hatte man noch nicht).
Nun beginnt die eigentliche Geschichte: Eine kleine Schar Männer stieg hinauf über den Katzberg und wandte sich dann dort, wo das Wasserbassin am „Schirmbühl“ steht, von der Straße nach rechts hinein in die Wiesen. Dies war die Gemeindevertretung von Altrohlau. Auch ein Ingenieur der Windmotorenfabrik war dabei und trug eine Aktentasche unter dem Arm. An der Spitze marschierte der Bürger-
meister A. Plass, der damals noch „Vorsteher“ hieß.
„Also, hier ist die Quelle“, sagte der Ingenieur, „dann muß der Motor dort hinauf auf die Anhöhe! Wenn alle Vorbereitungen bis zum Herbst fertig sind und sonst keine weiteren Schwierigkeiten auftauchen, dann – darauf verpfände ich mein Wort –kann die Wasserleitung zum Bassin noch vor Weihnachten der Öffentlichkeit übergeben werden“.
Und so war es auch. Die Leitung funktionierte wie ein Uhrwerk. Der Jubel war groß, viele Brunnen im Ort wurden zugedeckt oder gar eingeebnet. Aber wenige Wochen später ging die Not wieder los. Dazu kam noch, daß der Ort von Tag zu Tag weiterwuchs, die Bevölkerung ständig zunahm. Wenn aber windstille Tage eintraten, gab es nur Fingerhüte voll Wasser.
Die Bewohner lachten erst – und schimpften danach. Der Naudla Bauer (J. Schunk aus der Merangasse 46 und 82) posaunte wohl hunderte Male mit lauter Stimme hinaus: „Ich ho`s ja glei gsoagt, der Motor taugt an Dreeck! Ich bin neat füa dös neia Zeich. Wenn dau koa Wind gäiht, koa da neinmal gscheita Gmoirat blausn!“ „Nein mein lieber Herr Schunk“, sagte dann der Vorsteher immer, „das verstehen Sie nicht. Die Wissenschaft ist heute schon weit fortgeschritten, doch der Wind läßt sich eben nicht befehlen!“
Nur von begrenzter Dauer war also das Leben dieser Wasserleitung und des Windmotors, denn gerade in den Sommermonaten herrschte allgemein Windstille. Und dabei war es so schön gewesen, wenn man am Abend bei Sonnenuntergang von Karlsbad oder Zettlitz her seinen Weg hatte und hinter den qualmenden Brandfüchsen der Fabriken das Windrad auf der Höhe sich drehen sah.
Einen sonnigen Vorfrühling sowie den Kranken eine nachhaltige Besserung wünscht der gesamten Leserschaft, Rudi Preis
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail Rudolf.Kreisl @gmx.de Zum 98. Geburtstag am 09. des Monats gratulieren wir herzlich: Lawitschka/ Korb, Gertrud, 85757 Karlsfeld, Caritas Altenheim Sankt Josef Zimmer 214.
März – der letzte Monat des ersten Vierteljahres 2023 beginnt. Weihnachten, SilvesterNeujahr, die Raunächte, der Heilige-Drei-Königstag, Lichtmeß, Fasching – alles liegt bereits hinter uns. Bis man es sich recht versieht, sind wir mitten in der Fastenzeit angekommen. Ende des Monats, am 26. März, beginnt schon wieder die Sommerzeit. Daheim in Grasengrün und den umliegenden Dörfern war in der Zeit zwischen Lichtmeß und der Faschingszeit bei den Bauern überall das Federnschleißen im Gange. Nachbarn und Bekannte halfen sich gegenseitig dabei, so daß oft 15 bis 20 Personen zusammenkamen. Die Stiele von den Gänsefedern, manchmal auch den Entenfedern, wurden entfernt, damit die Betten weich und geschmeidig wurden. Bei uns gab es viele Gänse und Bitte umblättern
Karlsbad hat die meisten Unternehmen pro Einwohner, die höchste Anzahl an Ladesäulen für Elektroautos und investiert überdurchschnittlich viel
❯ Studie „Unternehmerfreundliche Stadt“ untersucht die Wirtschaftsfreundlichkeit der einzelnen Kommunen
205 Städte und alle Stadtbezirke von Prag werden jedes Jahr im Rahmen der Studie „Unternehmerfreundliche Stadt“ (Město pro byznys) auf ihre Wirtschaftsfreundlichkeit analysiert. Dabei werden 29 Kriterien aus den Bereichen Geschäftsumfeld und Zugang zur öffentlichen Verwaltung unter die Lupe genommen.
In der Region Karlsbad ist die Stadt Falkenau die wirtschaftsfreundlichste Kommune, gefolgt von Eger und Karlsbad. Auf den weiteren Plätzen folgen Marienbad, Schlackenwerth (Ostrov), Graslitz und Asch.

Ziel der Studie sei es, die Unterstützung der Kommunen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen zu ermitteln und erfolgversprechende Lösungsansätze mit den anderen Kommunen zu teilen, erklären die Organisatoren.
In der Region Karlsbad hat Falkenau den Titel „Unternehmerfreundlichste Stadt des Jahres 2022“ gewonnen. Die Experten begründeten ihr Urteil unter anderem damit, daß Falkenaus öffentliche Verwaltung selbst gut wirtschafte: „Der Gewinner Falkenau hat in der Region Karlsbad den höchsten Anteil an Subventionen im Verhältnis zu den gesamten kommunalen Einnahmen, und auch die Kosten für den Schuldendienst sind sehr niedrig, was auf ein gutes Management des Rathauses schließen läßt.“ Zudem sprachen die Macher der Studie der Stadt „für ihre überdurchschnittlichen Ausgaben für die Sozialfürsorge, aber auch für den Wohnungsbau“ Lob aus.


„Was den Arbeitsmarkt betrifft, so können Unternehmer, die sich in der Region niederlassen wollen, von der durchschnittlichen Zahl der Arbeitssuchenden im Alter zwischen 15 und 65 Jahren pro Kopf der Bevölkerung profitieren. Der Altersindex, dies heißt das Verhältnis der Personen im Alter von 15 Jahren und jünger zur Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und älter, ist in der Region Karlsbad durchschnittlich, was ein Versprechen für die künftige Unternehmensentwicklung darstellt“, heißt es in der Studie. Zudem biete die Stadt über ihre Webseite den Unternehmen alle relevanten Informationen, die sie für den Umgang mit der öffentlichen Verwaltung benötigen.
Jan Picka, stellvertretender Bürgermeister von Falkenau, erklärte, wie man in seiner Stadt auf die Unternehmen zugehe: „Seit vielen Jahren treffen wir uns re-
Platz
Eger punktet mit dem höchsten Anteil an Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und überdurchschnittlich viel freiem Wohnraum.
gelmäßig mit den großen Arbeitgebern zum Gedankenaustausch. Außerdem versuchen wir, die Kontakte zu den kleineren Unternehmen zu verbessern. Da viele Firmen Flächen angemietet haben, die der Stadt gehören, haben wir einen kurzen Draht.
Und es wird hoffentlich positiv zur Kenntnis genommen, daß wir die Mieten bereits seit längerem nicht erhöht haben, um die Unternehmen gerade in der aktuellen, nicht einfachen Zeit zu entlasten.“
Ein weiterer Vorteil von Falkenau sei die Kontinuität in den politischen Entscheidungsprozessen. Jeder neu gewählte Stadtrat baue auf der Arbeit seiner Vorgänger auf, sagt Picka und fügt an: „Wir haben auch viele Geschäftsleute in unseren beratenden Gremien, die uns sagen, was sie in Falkenau stört und was wir als Kommune verbessern können.“
Wie erfolgreich diese unternehmerfreundliche Politik ist, zeigt sich exemplarisch an einem Großprojekt, der Umwandlung einer Tagebau-Brache in eine hochmodernes Testzentrum, das BMW im Sommer offiziell eröffnet (Sudetendeutsche
❯ „Unternehmerfreundliche Stadt“

Die vergleichende Studie „Unternehmerfreundliche Stadt“ wurde bereits zum 16. Mal durchgeführt, um das Wachstumspotential der Städte und Gemeinden in der Tschechischen Republik zu bewerten.
Die Analysen wurden von der tschechischen Datenagentur Datank durchgeführt. Dabei wurden die Bewertungen in zwei Hauptkategorien untergliedert, und zwar in das Unternehmensumfeld und in die Aktivitäten der öffentlichen Verwaltung.
Die Studie faßt dabei alle relevanten Informationen und statistischen Daten zusammen, um die wirtschaftliche Entwicklung in der Tschechischen Republik auch auf lokaler Ebene sichtbar zu machen und voranzubringen. Das Ranking wird sowohl für einzelne Regionen als auch für das gesamte Land erstellt.
Die Studie wird von der Wochenzeitung Ekonom herausgegeben. Partner sind der Baukonzern Vinci Construction CS und der Verband der Städte und Gemeinden der Tschechischen Republik.
Zeitung berichtete). 300 Millionen Euro haben die Münchner Autobauer dafür investiert, um insbesondere das autonome Fahren mit Praxistest weiterzuentwickeln.
Daß die unternehmerfreundliche Stadtpolitik bei der Standortentscheidung eine Rolle gespielt hat, bestätigt man bei BMW sogar offiziell. „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Grundstückseigentümer Sokolovská uhelná sowie allen politischen Vertretern, bestätigt uns in unserem Entschluß für den neuen Standort”, sagt Robert Thurner, der Leiter des BMW-Immobilienmanagements für Europa und den Nahen Osten. Falkenau biete, so der BMW-Manager, „ideale Bedingungen und die geeigneten Flächen für den Ausbau unserer Erprobungsstandorte“.
Auf den zweiten Platz in der Region Karlsbad schaffte es Eger. Ein Grund, so die Macher der Studie, sei „der höchste Anteil von Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Unternehmen sowie die überdurchschnittlichen Zahl an fertiggestellten Wohnungen im Verhältnis zur Veränderung der Einwohnerzahl.
„Eger gibt ausreichend Mittel für die Kultur und den öffentlichen Verkehr aus. Der Anteil der Investitionsausgaben an den Gesamtausgaben der Gemeinde liegt weit über dem Durchschnitt in der Region“, heißt es weiter in der Studie.
Gelobt werden auch die Fortschritte in der Digitalisierung:
„Das Egerer Rathaus erzielt das beste Ergebnis im Test der elektronischen Kommunikation, bei dem die Schnelligkeit und Qualität der Beantwortung fiktiver Geschäftsanfragen überprüft wird“, urteilen die Studien-Macher.
Den dritten Platz belegt Karlsbad, das den höchsten Zuwachs an Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr vorweisen kann. Außerdem hat Karlsbad pro Einwohner die meisten Unternehmen. Positiv ist, daß auch in Karlsbad in die Zukunft investiert wird. So verfügt die Stadt über die größte Anzahl von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und stellt überdurchschnittlich viel Geld für Verkehr und Sport bereit.
„In jeder tschechischen Region haben die preisgekrönten Städte neue Ideen und Projekte umgesetzt, die das Leben der Menschen verbessern“, sagt František Lukl, Vorsitzender des Verbandes der Städte und Gemeinden der Tschechischen Republik, und rät vor allem den neu gewählten Stadträten die Ergebnisse der Studie zu nutzen, die bisherige Wirtschaftspolitik der eigenen Stadt mit der der benachbarten Städten oder Gemeinden zu vergleichen.
Torsten Fricke