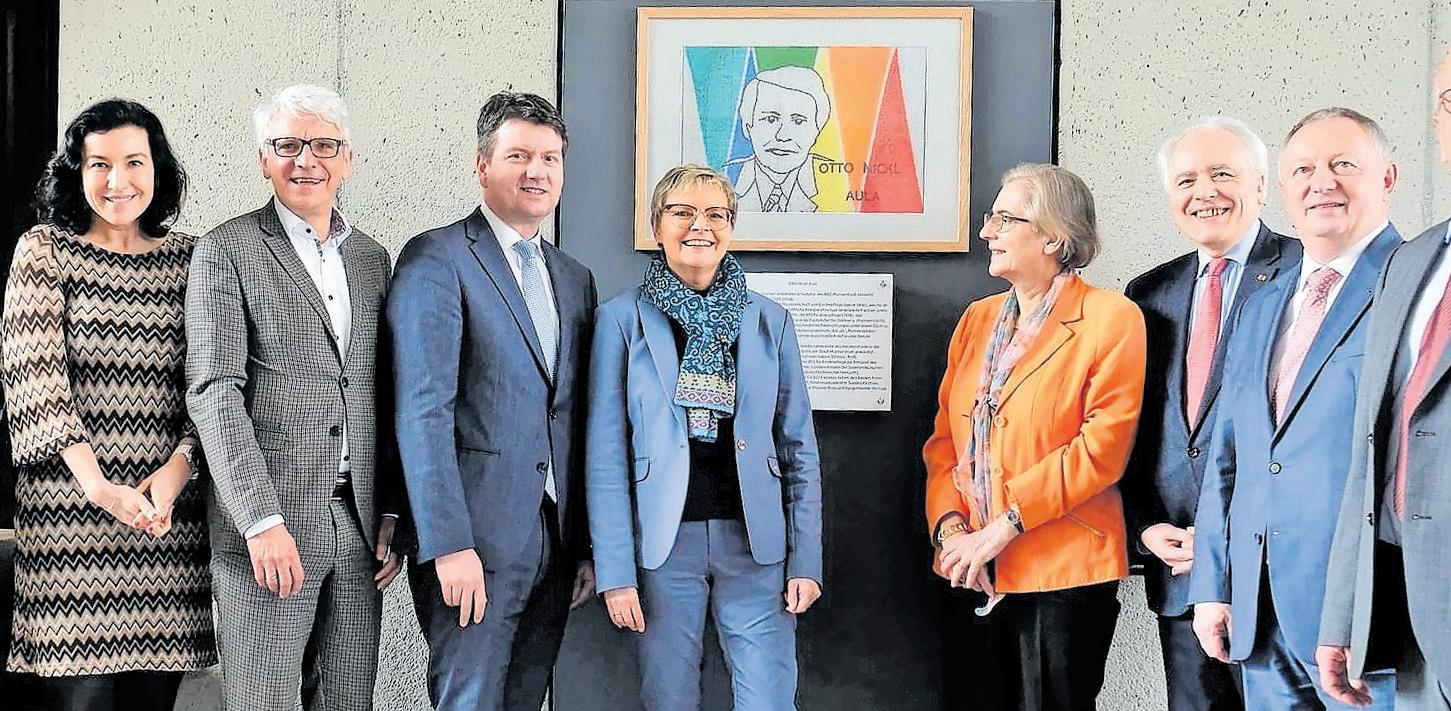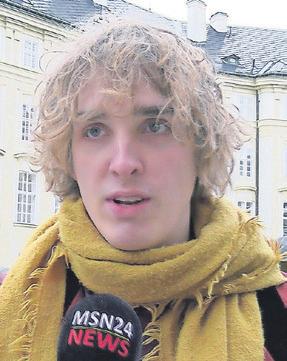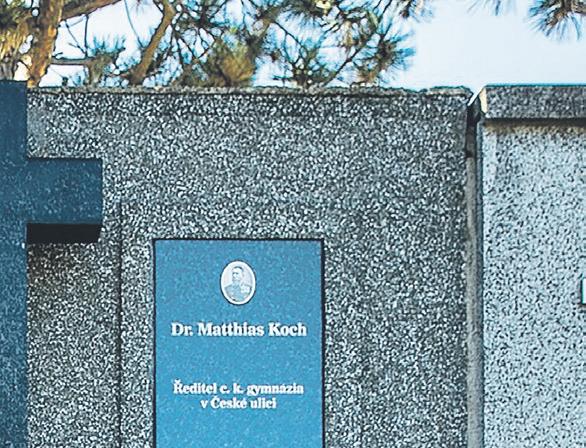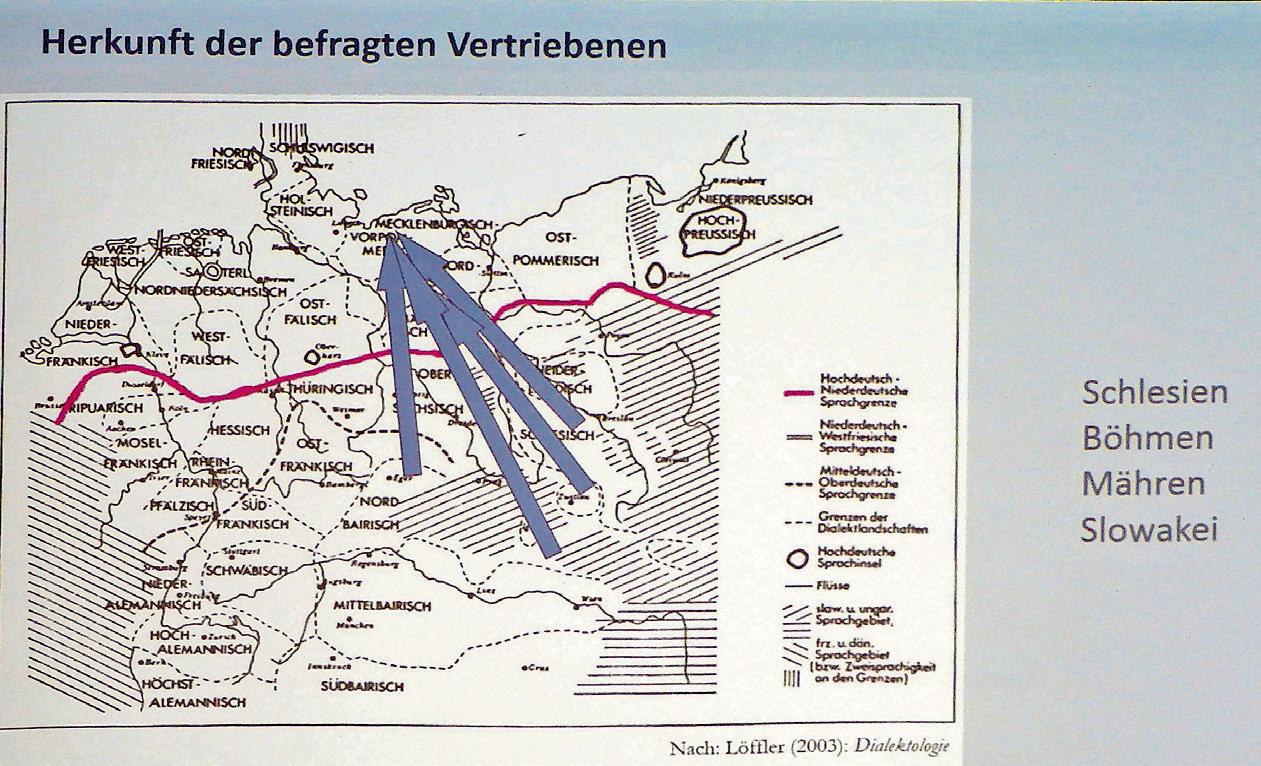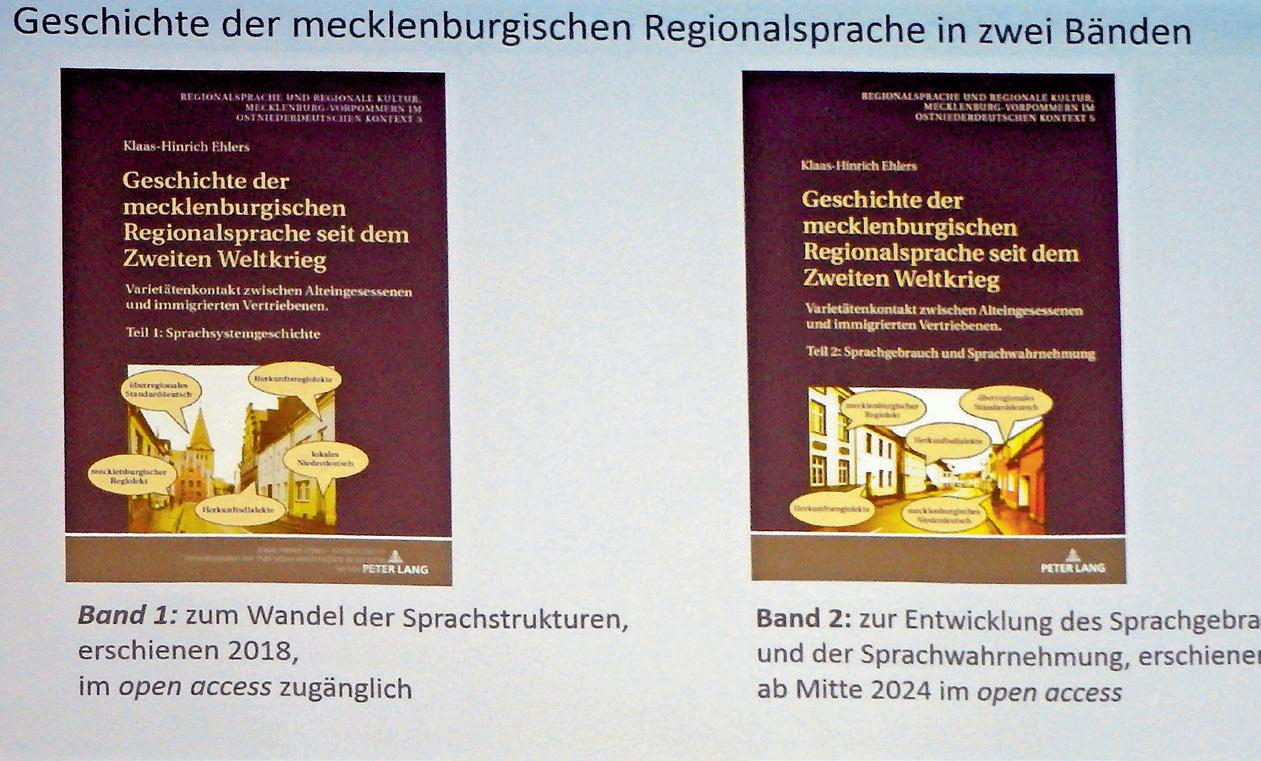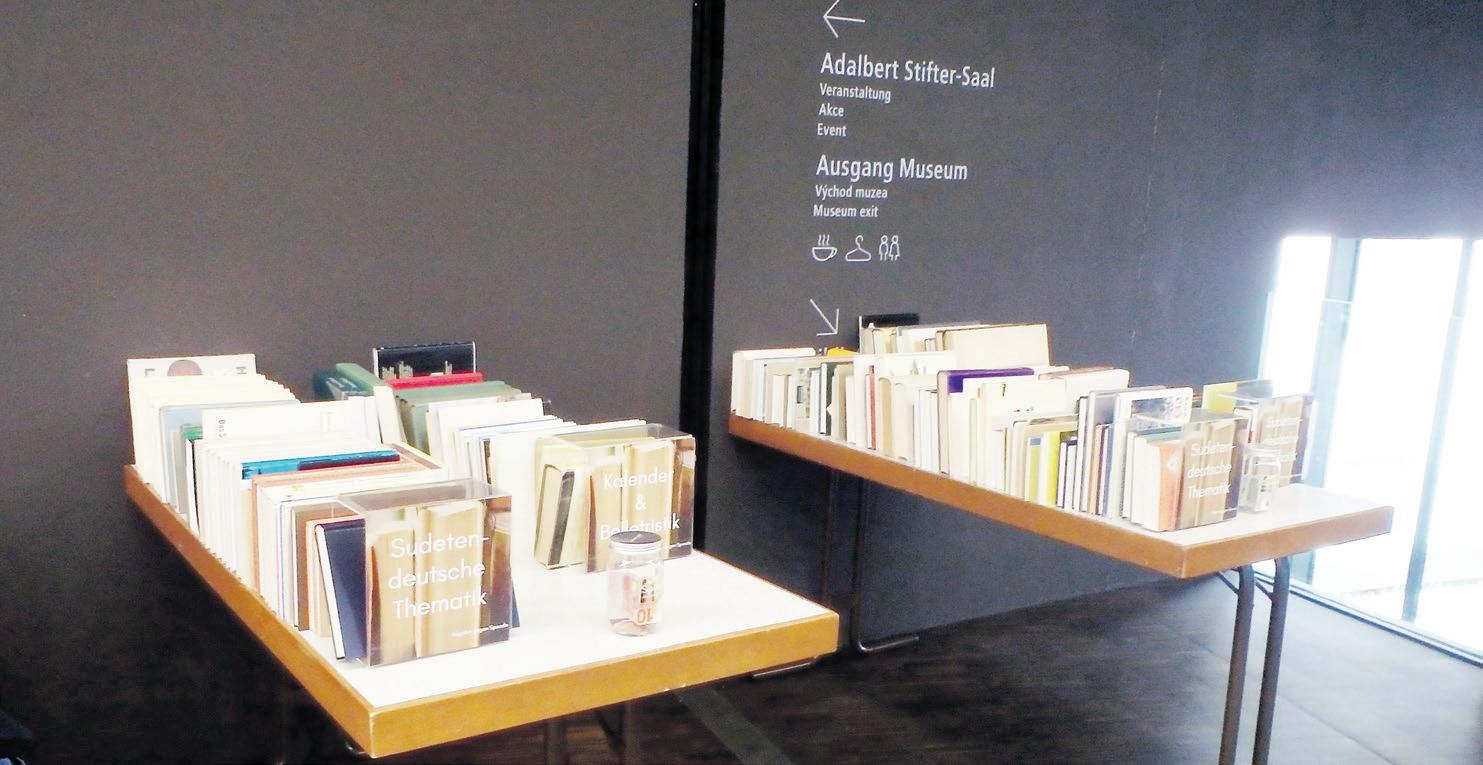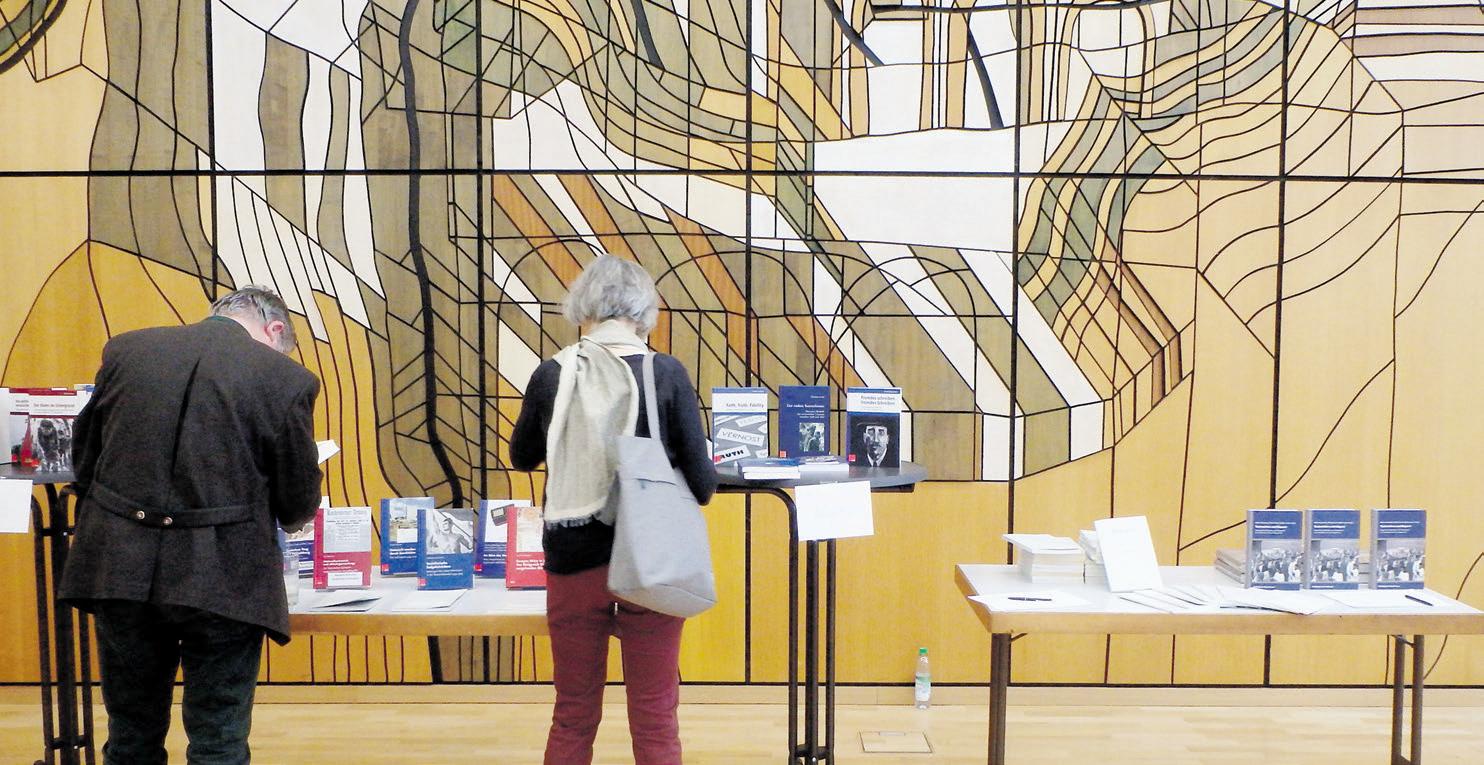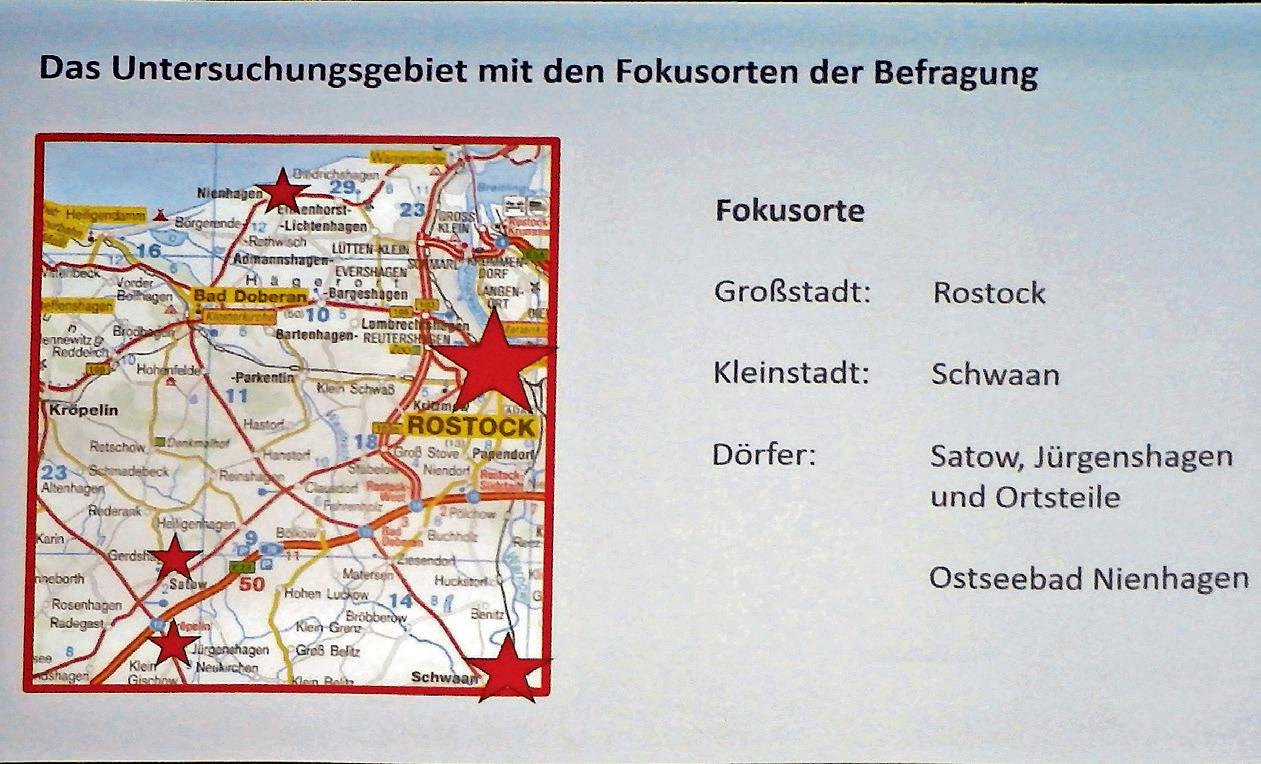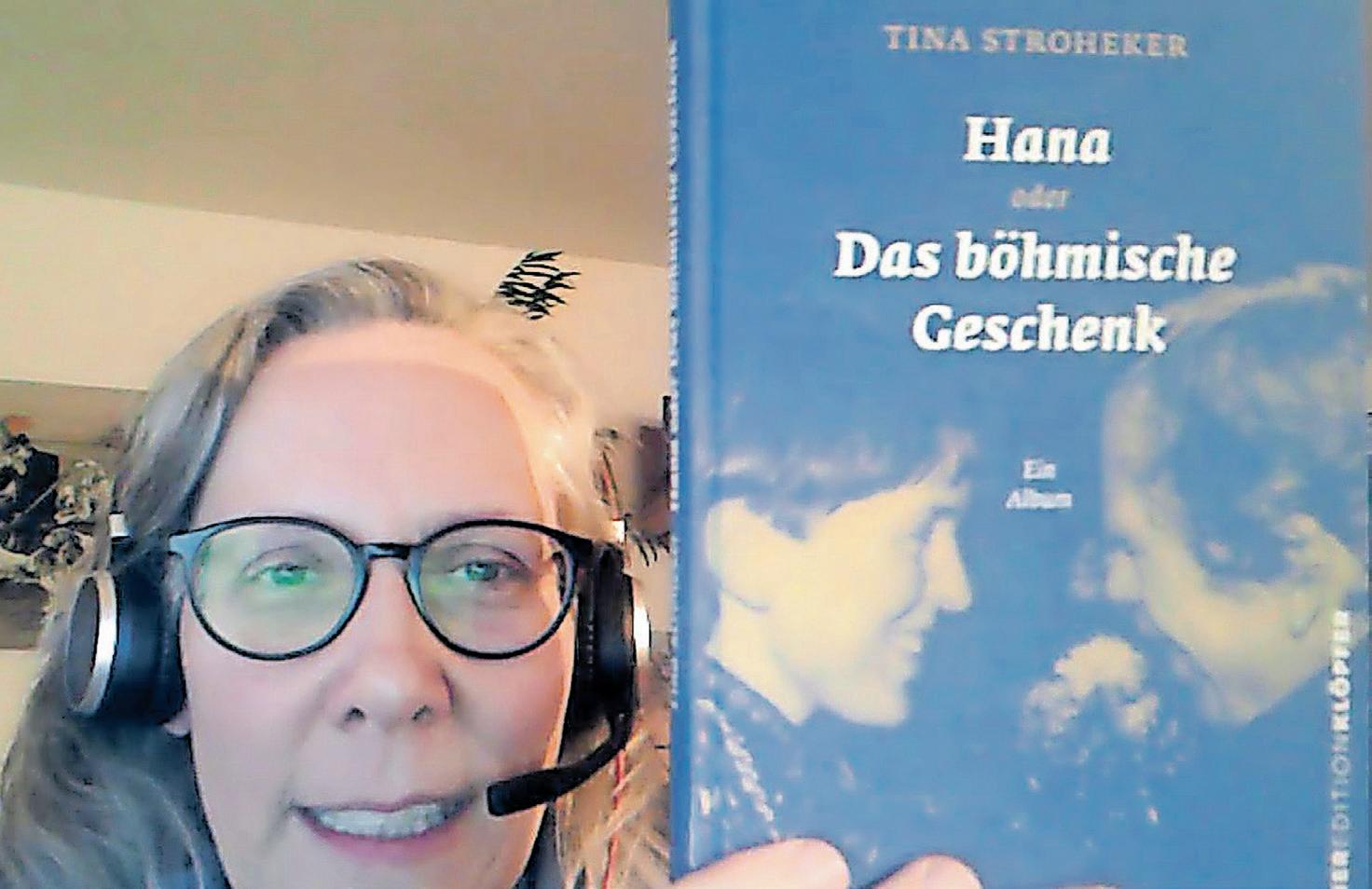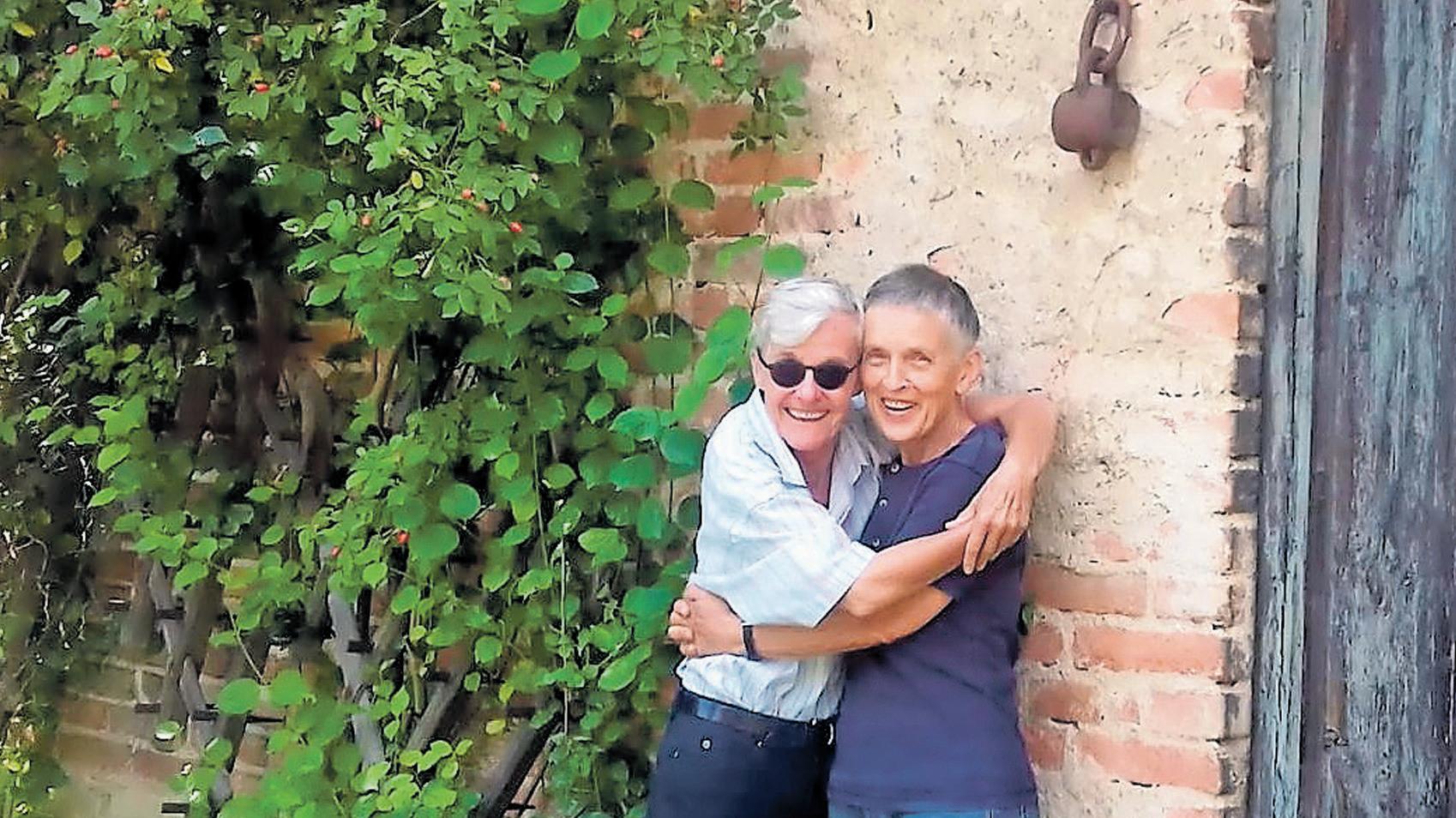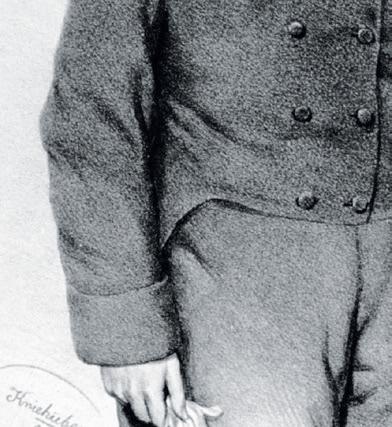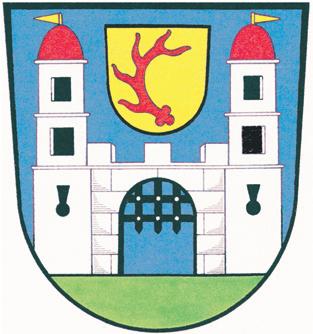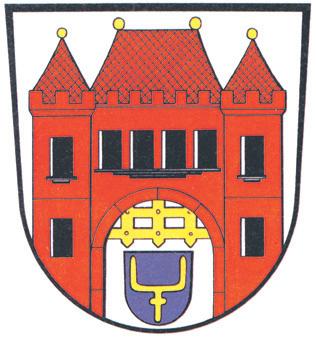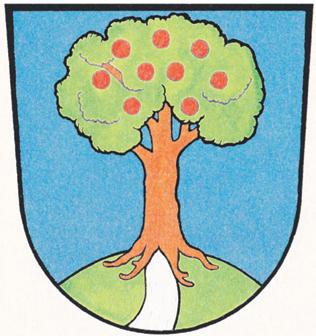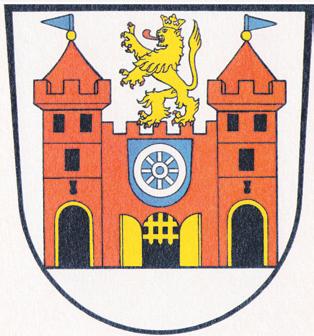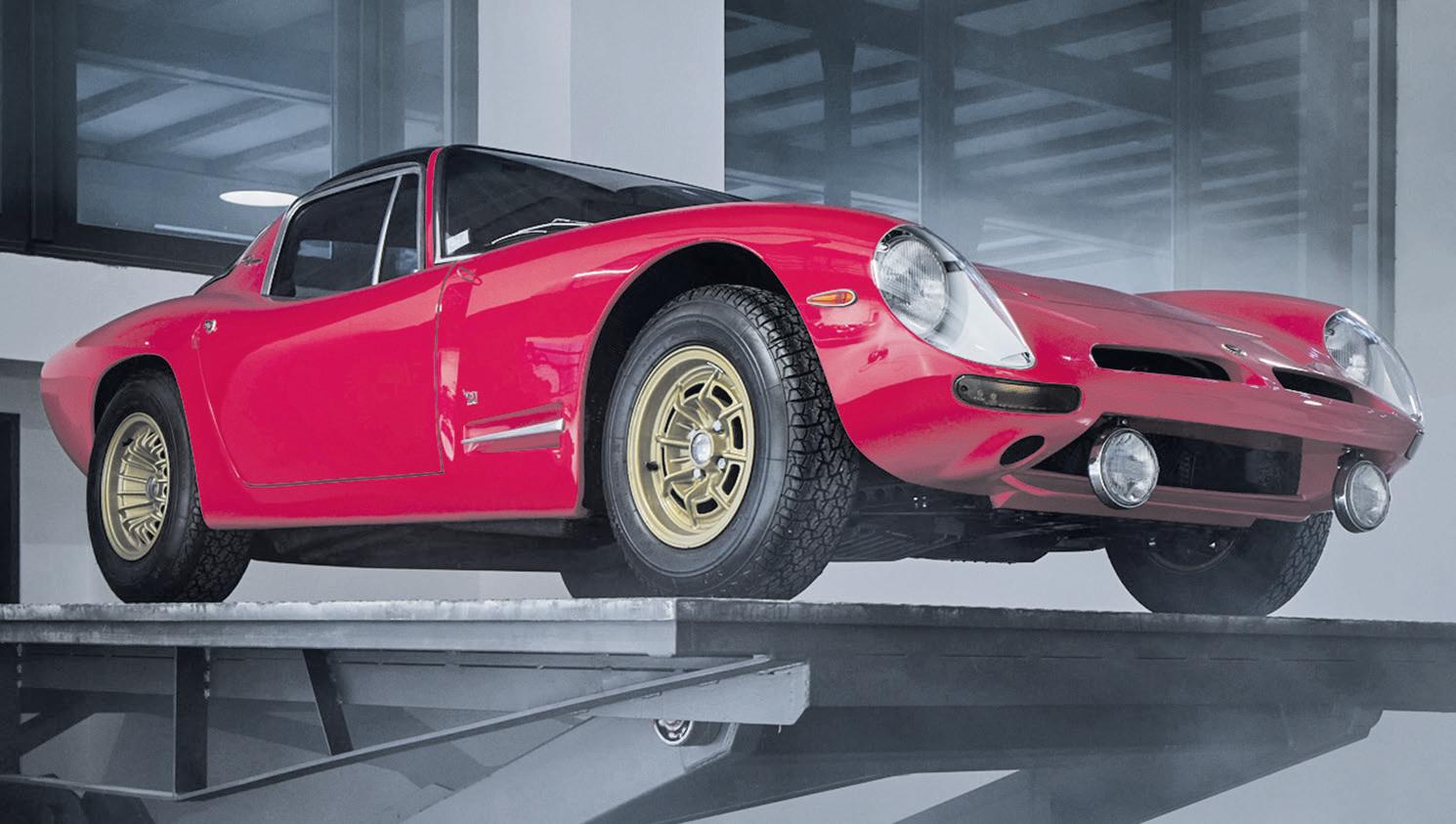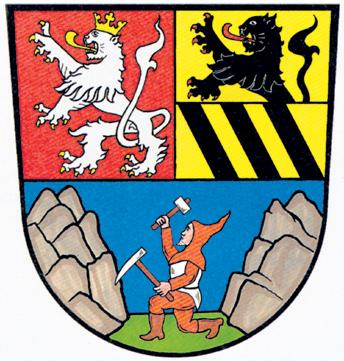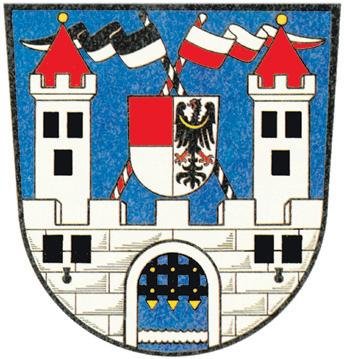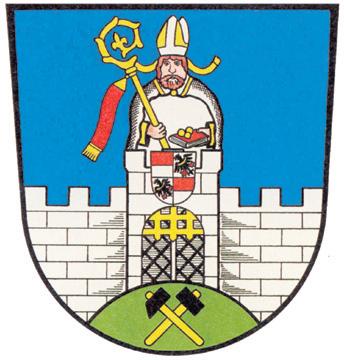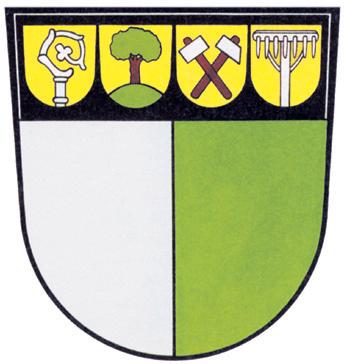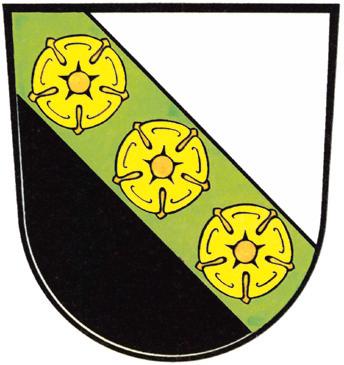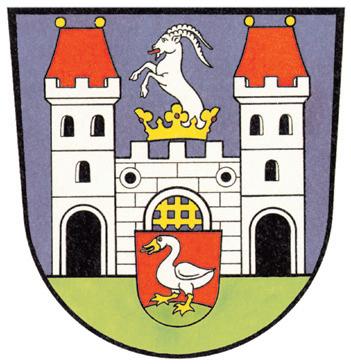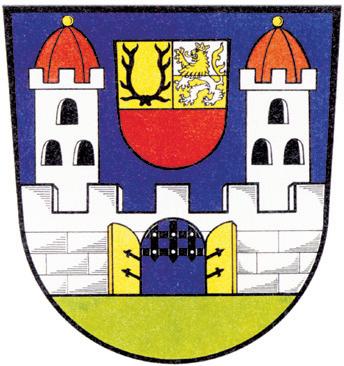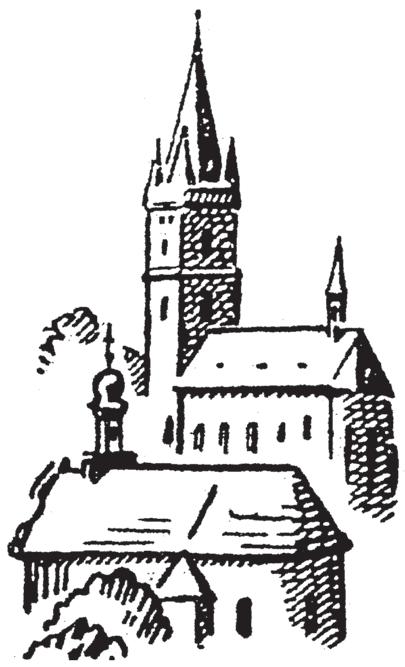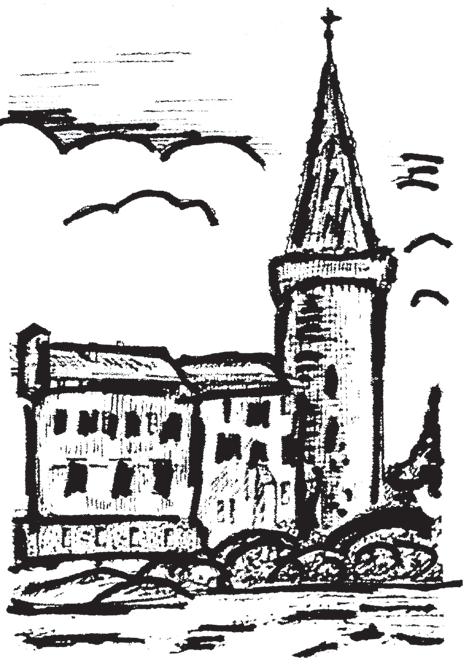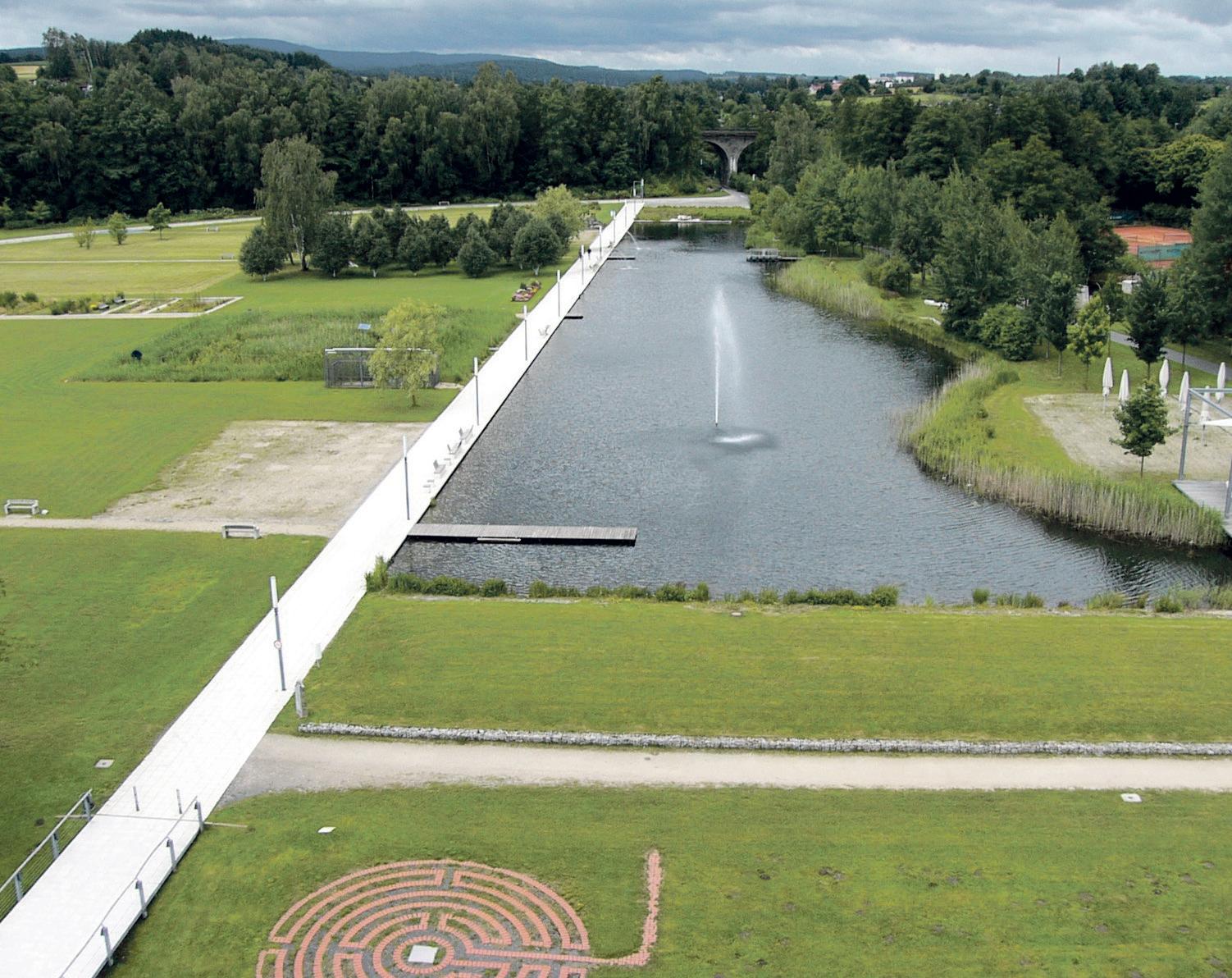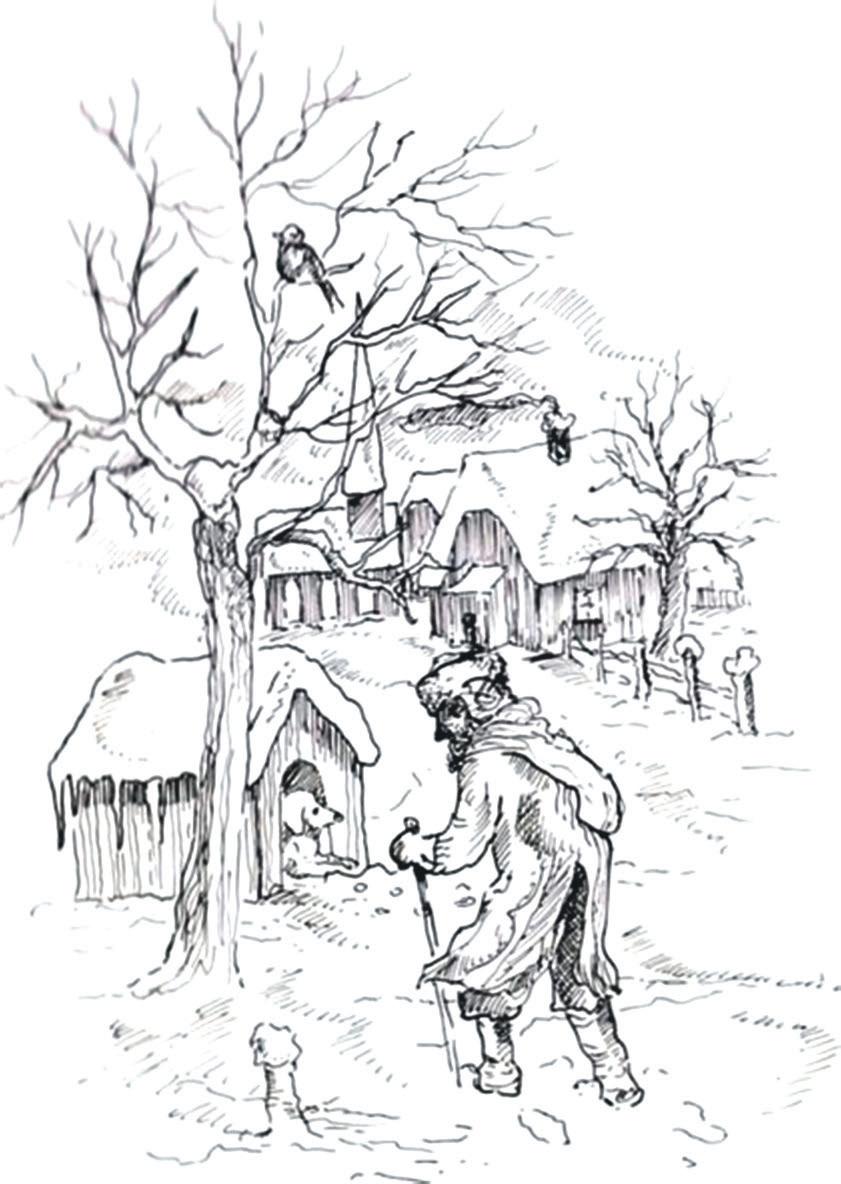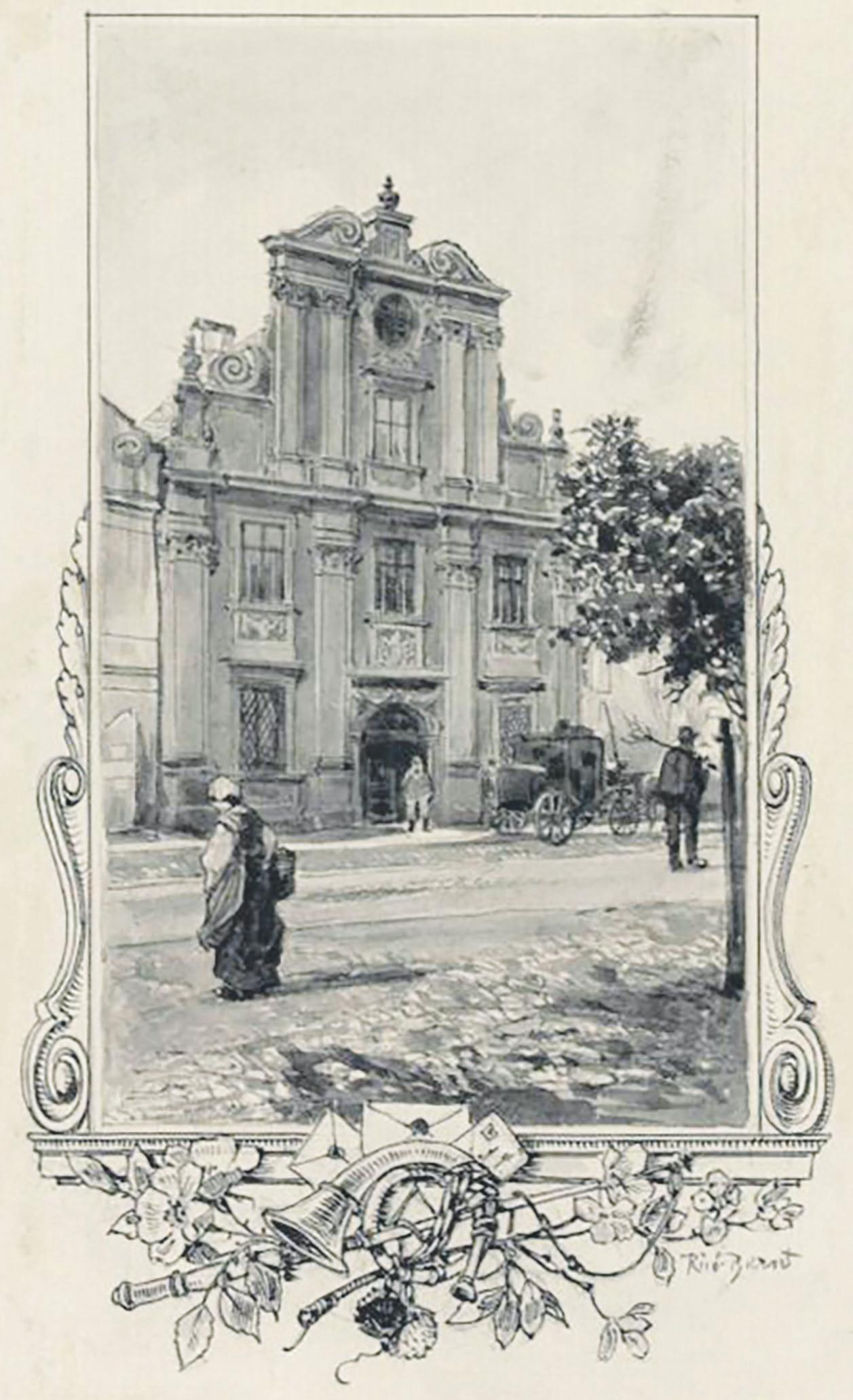AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Der Botschafter des Königreichs Norwegen, Victor Conrad Rønneberg, hat das Prager Sudetendeutsche Büro besucht, um sich bei SL-Büroleiter Peter Barton über das (sudeten) deutsch-tschechische Verständigungsverhältnis der letzten Jahre zu informieren.
Barton konnte ihm anhand zahlreicher Beispiele darlegen, daß dieser Prozeß in den vergangenen Jahren eine ausgesprochen positive Entwicklung genommen hat.
Im Sudetendeutschen Büro waren bereits einige norwegische Botschafter zu Gast. Und die
freundschaftlichen Beziehungen mit mehreren in der Tschechischen Republik akkreditierten Diplomaten bestätigen diese Tendenz, so auch der Besuch Rønnebergs. Der neue Botschafter konnte sein Amt nach dem Besuch bei Staatspräsident Miloš Zeman am 21. September vorigen Jahres o ziell antreten.

Barton freute sich, daß die sudetendeutsche Problematik nicht nur bei Vertretern direkt betro ener Staaten Interesse ndet. Norwegen ist zudem ein Land, dem die Menschenrechte in den einzelnen Staaten der Welt ein ausgesprochen großes Anliegen sind.
❯ Nach der Vertreibung wirkte der Sudetendeutsche über drei Jahrzehnte als Schulleiter am Berufsbildungszentrum
Münnerstadt ehrt Otto Nickl

Fiala verweigert Amnestie für Mynář
Miloš Zeman hat kurz vor dem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt Premierminister Petr Fiala um dessen Unterschrift für eine Generalamnestie seiner Mitarbeiter gebeten, hat die Tageszeitung Deník N berichtet. In einem Punkt habe es sich um einen möglichen Subventionsbetrug des bisherigen Leiters der Präsidialkanzlei, Vratislav Mynář, gehandelt. Fiala habe seine Unterschrift verweigert, heißt es in dem Medienbericht. Der Premierminister selbst kommentierte diese Informationen nicht. Gegen Mynář laufen seit Frühjahr 2021 Ermittlungen wegen des Verdachts auf Veruntreuung von EU-Subventionen. Dabei geht es um sechs Millionen Euro für den Bau einer Pension im ostmährischen Bezirk Ungarisch Hradisch, die Mynářs Firma Clever Management erhalten hatte.
Ukraine-Flüchtlinge bleiben länger
mit Einwohnern des post-sowjetischen Rußland geführt hat.
Ano
kämpft gegen Rentengesetz
Vertreter der Oppositionspartei Ano haben am Mittwoch bei einem Treffen mit Staatspräsident Petr Pavel gegen den Regierungsentwurf zu einer verringerten Rentenanpassung protestiert und das vom Unterhaus bereits gebilligte Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Der stellvertretende Ano-Vorsitzende, Karel Havlíček, sagte, Tschechien drohe eine Blamage, falls Pavel das Gesetz unterschreibe und das Verfassungsgericht es dann später einkassiere.
Trauer um Musiker
Marek Kopelent

Erinnerten an Otto Nickl und 70 Jahre Berufsbildungszentrum (von links): MdB Dorothee Bär, stellvertretender SL-Bundesvorsitzender Klaus Homann, Innenstaatssekretär Sandro Kirchner, Sabine Dittmar, Staatssekretärin beim Bundesgesundheitsminister, Otto Nickls Tochter Margret Wol mit Ehemann Pierre Wol , Landrat Thomas Bold und Schulleiter Georg Grißler. Rechts: Otto Nickl (rechts) bei der Schlüsselübergabe. Fotos: BBZ





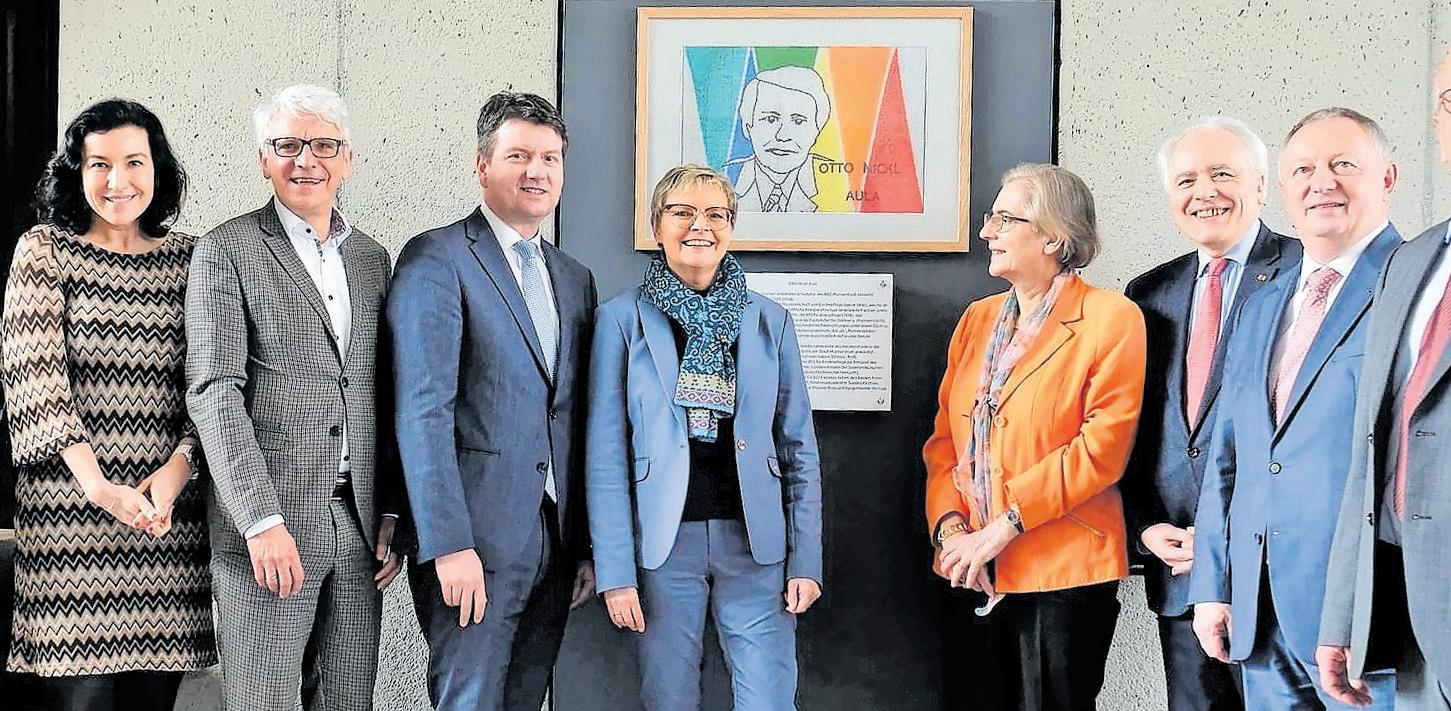
Die Lebensgeschichte von Otto Nickl stehe „exemplarisch für die Opfer der Entrechtung und Vertreibung“, dennoch habe er „wie viele sudetendeutsche Heimatvertriebene angepackt und zum Wohl seiner neuen Heimat gewirkt“, hat Klaus Hoffmann, stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Leben und Werk des langjährigen Leiters des Berufsbildungszentrums Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen gewürdigt. Beim Festakt am Sonntag zum 70-jährigen Bestehen der Bildungsinstitution wurde die Aula nach dem Sudetendeutschen benannt.
Otto Nickl wurde in 1921 in Klein Hermigsdorf geboren, einem Dorf in der deutschen Sprachinsel Schönhengstgau. Die Eltern führten dort einen Hof, der seit 1761 im Familienbesitz war, und Otto Nickl machte zunächst eine landwirtschaftliche Ausbildung. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, mußte
auch Nickl an die Front. Nach der Kriegsgefangenschaft in Schwerin verschlug es den Mitzwanziger nach Bayern. Zunächst arbeitete Nickl als Gutsverwalter in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb in Niederbayern und absolvierte anschließend an der Höheren Landbauschule in Michelstadt eine Ingenieurausbildung. Seinen pädagogischen Neigungen folgend ließ er sich am Berufspädagogischen Institut in München zum landwirtschaftlichen Berufsschullehrer ausbilden. Im Jahre 1951 nach der Einstellungsprüfung trat er seinen Dienst im Landkreis Bad Kissingen an. Bereits 1954 wurde ihm die Schulleitung der landwirtschaftlichen Berufsschulen im Landkreis Bad Kissingen übertragen. Seine weitere Karriere wurde 1961 durch die Ernennung zum Berufsschuldirektor und schließlich 1981 zum Oberstudiendirektor gekrönt. 1984 trat er in den Ruhestand. 2004 verstarb
Otto Nickl. Persönliche Erinnerungen hat

Sabine Dittmar, die am BBZ zur Kinderkrankenpflegerin ausgebildet wurde, später Medizin studierte und den Facharzt für Allgemeinmedizin absolvierte und jetzt Staatssekretärin beim Bundesgesundheitsminister ist. Die SPD-Politikerin nach der Veranstaltung: „Es war eine große Ehre für mich, daß ich beim Doppeljubiläum des BBZ in Münnerstadt als Taufpatin für die Otto-NicklAula fungieren und an den Schulgründer und langjährigen Schulleiter erinnern durfte, den ich als Schülerin auch noch selbst erlebt habe und der einst auch meine Mutter unterrichtet hatte. Otto Nickl ist nicht nur Gründer, er hat seine Schule auch geprägt. Seine Idee von Wertschätzung
und einem Miteinander ist auch heute, nach 70 Jahren, noch immer fester Bestandteil der Schulphilosophie und auch einer der Gründe, warum ich auch mehr als 40 Jahre nach meiner Ausbildung zur Kinderpflegerin immer wieder gerne ins BBZ zurückkehre.“
In seiner Würdigung auf Otto Nickl hatte Klaus Hoffmann auch aus dessen Erinnerungen an die Vertreibung zitiert: „Heimat zu verlieren, all das Geschaffene, die Menschen, ein unerhört brutales Geschehen. Schmerzlich alles zurückzulassen, das Lebenswerk, das eigene und das der Vorfahren. Eine Wunde, die nicht heilen konnte.“
Torsten Fricke
❯ Der aufrechte Journalist wurde vor 90 Jahren ins Polizeipräsidium verschleppt und später im KZ Dachau ermordet
Gedenken an Nazi-Opfer Fritz Gerlich
Vor 90 Jahren, am 9. März 1933, hat Adolf Hitler Bayern gleichgeschaltet, den späteren Massenmörder Heinrich Himmler zum Münchner Polizeipräsidenten befördert und die SA eingesetzt, um Nazi-Gegner mundtot zu machen.
Eines der ersten Opfer war Fritz Gerlich, Chefredakteur der Wochenzeitschrift Der Gerade Weg und einer der bekanntesten Journalisten in Deutschland. Der vehemente Kämpfer gegen den Nationalsozialismus wurde zusammengeschlagen und im Polizeipräsidium in der Ettstraße inhaftiert, bis er 16 Monate später
Insgesamt 271 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben bislang eine Verlängerung ihres Schutzaufenthalts in Tschechien beantragt, hat Innenminister Vít Rakušan (Stan) gesagt und erklärt, die Ukrainer könnten vorerst bis Ende März kommenden Jahres bleiben. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat Tschechien knapp eine halbe Million Visa an Geflüchtete ausgestellt. Wie viele dieser Ukrainer sich noch hierzulande aufhalten, ist nicht bekannt. Schätzungen sprechen von rund 300 000 Menschen.
Dejvice-Theater ausgezeichnet
Zum Theater des Jahres 2022 in Tschechien ist das Prager Dejvice-Theater gekürt worden. Als Inszenierung des Jahres wurde „Konec rudého člověka“ (Das Ende des roten Menschen) von Daniel Majling ausgezeichnet. Dies wurde im Prager Divadlo v Dlouhé (Theater in der Langen Straße) von einem slowakischen Ensemble aufgeführt. Es basiert auf einem Buch der Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, die dafür zahlreiche Gespräche
Im Alter von 90 Jahren ist am Sonntag der Komponist, Pianist, Publizist und Pädagoge Marek Kopelent gestorben. Kopelent war eine der wichtigsten Akteure der tschechischen experimentellen Musikszene der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ein Pionier der sogenannten Neuen Musik. Zu seinem Werk gehören mehrere Oratorien sowie vokale und instrumentale Kammerstücke. Er war zudem Mitbegründer und Vorsitzender von Ateliér 90, einem Zusammenschluß von Komponisten, Interpreten und Musikwissenschaftlern. Seit 1991 lehrte er als Professor für Komposition an der Prager Musikakademie.
Proteste gegen Fiala-Regierung
Unter dem Motto „Česko proti bídě“ (Tschechien gegen das Elend) haben am Samstag mehrere Tausend Teilnehmer auf dem Wenzelsplatz in Prag gegen die Regierung von Premierminister Petr Fiala demonstriert. Sprechchöre und Transparente forderten den Rücktritt der Regierung von Petr Fiala, ein Ende des Krieges in der Ukraine und die Auflösung der Nato. Aufgerufen zur Demonstration hatte die Rechtsaußen-Partei „Právo Respekt Odbornost“ (Recht, Respekt, Expertentum/PRO), die im vergangenen Jahr gegründet worden ist.


Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
ins KZ Dachau verschleppt und dort ermordert wurde.
Zur Erinnerung an Fritz Gerlich veranstaltete die PaneuropaUnion Deutschland vor dem Polizeipräsidium einen Gedenkakt. Bereits im Vorfeld war eine Paneuropa-Delegation mit Präsident Bernd Posselt an der Spitze in Gerlichs Geburtsstadt Stettin gereist, um an seinen 140. Geburtstag im Februar zu erinnern. Posselt nannte es als Ziel, Gerlich auch in Polen bekannter zu machen: „Damit wird er lange nach seinem gewaltsamen Tod eine wichtige Rolle bei der deutschpolnischen Verständigung und Versöhnung spielen.“

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023 2
SPITZEN
PRAGER
Legten Blumen vor dem Münchner Polizeipräsidium nieder, wo Fritz Gerlich bis zu seiner Ermordung in Dachau inhaftiert war (von links): Prinz Erich von Lobkowicz, Dr. Johannes Modesto, Prinzessin Ludmilla von Lobkowicz, Grä n Stephanie von Waldburg-Zeil, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, MdL Ludwig Spaenle, Freifrau Walburga von Lerchenfeld, Anastasia Dick, Michael Dibowski und Sadija Klepo. Foto: Johannes Kijas
Direkt nach der Vereidigung als neues Staatsoberhaupt der Tschechischen Republik hat Petr Pavel auf der Prager Burg seine Antrittsrede gehalten, die die Sudetendeutsche Zeitung im Wortlaut dokumentiert.
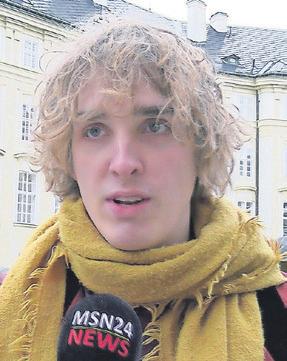

Sehr geehrte Vertreter der Verfassung, liebe Vorgänger im Präsidentenamt, liebe Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger.
Es ist sechs Monate her, daß ich Sie an der Písecká brána (Anm. d. Red.: Pisek-Tor) um Ihr Vertrauen bei den bevorstehenden Wahlen gebeten habe. Ich habe meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten dank des Vertrauens und der Unterstützung all derer, die mich umgeben, begonnen. Zu Beginn bestand unser Team nur aus einer kleinen Gruppe. Nach und nach vergrößerte sich unser Team mit einer wachsenden Zahl von Unterstützern in allen Regionen der Tschechischen Republik sowie im Ausland, bis ich im Januar dieses Jahres vor vollen böhmischen und mährischen Plätzen stand.


Sie sind in die Wahllokale gegangen, um dem Chaos die Stirn zu bieten und den Willen zu zeigen, gemeinsam einen Weg zu Lösungen zu finden. Sie waren es, die es uns ermöglicht haben, zur Rückkehr einer wertebasierten Politik beizutragen.
Die Wahrheit hat wieder gesiegt, dank Ihnen!
Nach den Wahlen ist die Arbeit des Wahlteams beendet. Auf das neue Team wartet jedoch eine kompliziertere und langwierigere Aufgabe. Und dieses Team sind wir alle.
Es besteht aus den Menschen, die mir ihre Stimme gegeben haben, aber auch aus denen, die nicht für mich gestimmt haben oder gar nicht zur Wahl gegangen sind. Gemeinsam stehen wir vor denselben Problemen, und wir können sie nur gemeinsam erfolgreich angehen.
Ich habe versprochen, Würde, Respekt, Anstand und andere Werte in das Amt zurückzuholen, die in den letzten Jahren an Bedeutung verloren haben. Es ist, als hätten wir darauf verzichtet, weil der Hauptaspekt für die Beurteilung des Wertes unserer Taten und Persönlichkeiten der Erfolg geworden ist, unabhängig davon, welcher Preis dafür gezahlt wurde und auf wessen Kosten er erreicht wurde. Leider haben auch die höchsten Staatsvertreter oft darauf Wert gelegt.
So haben Populisten, die ihren eigenen Erfolg und Einfluß auf Lügen, Manipulation und den Mißbrauch von Angst gründen, ihre Chance bekommen. Mein Team und ich haben dieses Spiel nie gespielt. Ich freue mich, daß die rekordverdächtige Wahlbeteiligung bewiesen hat, daß auch Ihnen Wahrheit und Anstand wichtiger sind als böswillige Angriffe und Realitätsverzerrung.
Wenn Politiker ihr Amt antreten, sprechen sie oft von einer hunderttägigen Schutzfrist, um gelegentlicher Kritik für einen lauwarmen Start zu entgehen. Das liegt nicht in meiner Natur. Viel lieber möchte ich für einen zu aktiven Start kritisiert werden.
Deshalb werde ich in Kürze einen Plan mit den konkreten Zielen für meine ersten 100 Tage im Amt veröffentlichen. Sie können mich dann anhand meiner Ergebnisse und nicht nur anhand von Worten beurteilen.
Genauso stark wie mein Mandat, in direkter Wahl gewählt worden zu sein, sind die Schwere Ihrer Erwartungen und die Verantwortung für deren Erfüllung.
Die Rolle des Präsidenten ist genau an dem Punkt am schwierigsten, an dem der Umfang seiner Befugnisse an seine Grenzen stößt. Es ist fair, gleich zu Beginn zu sagen, daß ich gerade deshalb viele Probleme nicht allein lösen kann. Dennoch werde ich aktiv nach Möglichkeiten suchen, sie in Zusammenarbeit mit denjenigen zu lösen, die zu solchen
� Antrittsrede des neuen tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel
„Wir sehnen uns nach Sicherheit, wir schätzen Freiheit und Demokratie“
müssen wir aus unserer Komfortzone herausgehen und das Ziel verfolgen, auch wenn die Chancen auf Erfolg gering sind. Wenn ein Mensch in seinem Herzen spürt, daß etwas richtig ist, oder wenn seine Vernunft ihm dazu rät, wird sein Plan vielleicht einoder zweimal auf ein Hindernis stoßen, aber schließlich wird er erfolgreich sein.
Wir sind ein mittelgroßes Land mit einer einzigartigen Lage in der Mitte Europas, wodurch wir oft einen nüchterneren Blick auf die Welt haben als die Länder mit Machtambitionen. Deshalb können wir zu einem wichtigen Akteur werden, der Partner aus ähnlichen Gebieten und mit ähnlichen Überlegungen zusammenbringt. Es gibt eine Mehrheit solcher Länder in Europa. Lassen Sie uns lernen, die Position zu entwickeln.
Lösungen beitragen können. Ich bin bereit, alle Schritte, die ich unternehmen werde, zu erläutern und mitzuteilen.
Ich habe betont, daß ich hauptsächlich außerhalb des Schloßes arbeiten werde. Ich werde weiterhin Regionen besuchen, um persönlich zu sehen und zu erfahren, was Sie am meisten beunruhigt, um denjenigen Gehör zu verschaffen, die sich manchmal zu Recht nicht gehört fühlen. Und ich werde versuchen, in Zusammenarbeit mit Experten, der Regierung und dem Parlament eine Lösung zu finden.
Ich werde Maßnahmen ergreifen, um die Prager Burg für die Öffentlichkeit, für Kultur-, Festund Bildungsveranstaltungen zu öffnen, und ich werde zu einer klaren, transparenten und regelmäßigen Kommunikation zurückkehren.
In aller Ernsthaftigkeit verstehe ich die derzeitigen Sorgen über die wirtschaftliche und soziale Unsicherheit. Wenn wir langfristig Wohlstand genießen wollen, muß die Wirtschaft unbedingt wieder auf eine solide Grundlage gestellt und ins Gleichgewicht gebracht werden, indem die Inflation eingedämmt und das öffentliche Defizit radikal abgebaut wird. Ich werde Experten konsultieren und Maßnahmen unterstützen, die dies ermöglichen, auch wenn sie zuweilen schmerzhaft sein werden. Solidarität ist ein Kennzeichen eines entwickelten Landes, und ich halte die Tschechische Republik für ein solches. Damit meine ich externe und interne Solidarität. Wir müssen entschlossen und fähig sein, denjenigen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Bei der Beseitigung systemischer Probleme, wie der Unhaltbarkeit des derzeitigen Steuersystems oder des Rentensystems, auf das wir objektiv nicht verzichten können, ist es unerläßlich, keine Pauschalabgaben zu erheben, sondern die Schwächsten zu unterstützen.
Um langfristigen Wohlstand zu erreichen, müssen wir Innovationen und Investitionen in neue Technologien fördern und dadurch Fortschritte auf dem Weg zu einer modernen Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung machen, die zu höheren Löhnen und einem höheren Lebensstandard führen wird. Allerdings fehlt uns seit geraumer Zeit eine Vision, wie wir diese guten Absichten mit konkreten Schritten unterstützen können. Und die Wirtschaft ist nicht die einzige Sorge.
In den letzten Monaten haben Sie eine Welle der Hoffnung und Energie ausgelöst. Ich möchte, daß wir diese nutzen, um ei-
� Umfrage vor der Prager Burg
„Wie bewerten Sie die zu Ende gegangene Präsidentschaft von Miloš Zeman? Was erwarten Sie sich vom neuen Staatsoberhaupt Petr Pavel?“, hat die Sudetendeutsche Zeitung acht Bürger gefragt, die vor der Prager Burg die Inauguration verfolgt haben.
Martin
Pastýř: „Die Amtszeit von Zeman bewerte ich besser nicht. Die Antwort wäre zu lang und nur negativ. Ich hoffe, daß der neue Präsident die Verfassung ehrt und die Hoffnungen erfüllt. Wir erwarten wieder Anstand.“
Jan Kolba: „Zemans Präsidentschaft war nicht besonders ruhmreich. Ich hoffe, daß der neue Staatspräsident das gesellschaftliche Klima verbessert und das Volk eint. Und daß er sich für die demokratischen Prinzipien sowie Werte, wie Freiheit und Menschenrechte, einsetzt.“

Martina
Janků: „Von den vergangenen zehn Jahren unter Zeman war ich nicht begeistert. Ich hoffe, daß mit dem neuen Präsidenten eine neue Ära beginn. Petr Pavel wirkt anständig. Er macht auf mich, den Eindruck eines gebildeten, klugen Menschen, und ich glaube, daß er unser Land im Ausland gut vertritt.“
Blanka Pézlová: „Zeman als Präsident war schrecklich, mehr als schrecklich. Wie jeder normale Mensch in Tschechien bin ich froh, daß diese Ära zu Ende ist. Von unserem neuen Präsidenten erwarte ich vor allem Anstand. Außerdem die Fähigkeit zu kommunizieren und unser Land wieder zu vereinen.“


Oldřich Tristan Florian: „Zeman hat immer wieder versucht, die Verfassung zu brechen. Von unserem neuen Präsidenten erwarte ich, daß er die parlamentarische Demokratie respektiert. Reale Politik ist die Sache der Regierung und des Parlaments.“
David Čapek: „Zemans Präsidentschaft war eine Zeit der Dunkelheit. Der neue Präsident soll die tschechische Gesellschaft einen und keine extremen oder überzogenen Standpunkte vertreten. Wichtig ist mir vor allem, daß auf der Prager Burg wieder politischer Anstand einkehrt.“
Lucie Novobilská: „Was ich zu Zeman sage? Schande, Schande, Schande! Und vor allem seine Kumpanen auf der Prager Burg, wie Mynář und Nejedlý, waren schrecklich! Der ganzen Nation war deshalb spei übel. Jetzt habe ich die große Hoffnung, daß wieder Anstand, Demut und Werte auf der Burg herrschen.“
Martin Štěpanovský: „Zeman war eine Fehlbesetzung und hat auch seine Wähler enttäuscht. An den neuen Präsidenten habe ich keine großen Erwartungen. Ich hoffe nur, daß unser neues Staatsoberhaupt, anders als Zeman, Werte vertritt. Und daß wieder alles gut wird.“
Umfrage: Pavel Novotny

ne gemeinsame Vision für die Tschechische Republik zu entwerfen. Ich würde diesen Prozeß sehr gerne während meiner Präsidentschaft in Gang setzen.
Unsere Reaktionen auf die Krise der letzten Jahre und auch auf die Präsidentschaftswahlen selbst haben mich davon überzeugt, daß wir zusammenkommen können, um ein Ziel zu verfolgen, auch wenn wir verschiedene Wege sehen, um es zu erreichen. Wir brauchen nur den Funken der Entschlossenheit, daß es Sinn hat.
Es ist nicht wahr, daß unsere Gesellschaft zu gespalten ist, um dieses Ziel zu verfolgen. Wir haben uns nur daran gewöhnt, über das zu sprechen, was sie trennt. Wir stoßen auf scharfe Kanten und heben Probleme hervor, was einen Keil zwischen uns treibt. Es wäre viel besser, wenn wir mehr über das sprechen würden, was uns eint.
Wir alle sorgen uns um dasselbe Land, wir sprechen dieselbe Sprache. Wir sehnen uns nach Sicherheit, wir schätzen Freiheit und Demokratie. Das gilt von Krásná bis Bukovec, von Lobendava bis Vyšší Brod. Wir sind alle Bürger dieses schönen Landes.
In jeder unserer Regionen gibt es viele Menschen, die eine klare Vorstellung davon haben, wie unser Land vorangebracht werden kann. Doch irgendetwas hindert sie daran – Vorurteile, mangelnder Mut oder unaufhörliche Bürokratie. Manche behaupten, wir seien zu klein, als daß die Welt unsere Stimme hören könnte. Oder zu schwach, um die Meinung unserer stärkeren Partner zu ändern. Dieses Gefühl mag daher rühren, daß die Geschichte nicht immer gnädig mit uns war.
Ich wünsche uns, daß wir aus diesem Schatten heraustreten können. Machen wir die einfachen Dinge nicht kompliziert, schaffen wir keine Hindernisse, verlieren wir keine Zeit mit der Suche nach der Idealität, damit wir nicht am Ende nichts tun. Wir haben schon so oft bewiesen, wozu wir fähig sind. Ein jüngstes Beispiel ist die erfolgreiche Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Seien wir aktiv und wenden wir dies auch auf andere Bereiche an, zum Beispiel innerhalb der Nato oder der Uno.
Warten wir nicht darauf, daß die großen Staaten ihre Lösungen einbringen. Wo steht denn, daß die Größten auch immer klüger und geschickter sind?
Ich halte es für einen Erfolg, wenn während meiner Präsidentschaft die Zahl der Menschen steigt, die sich von Unsicherheit nicht abschrecken lassen. Wenn wir an etwas glauben,
Wir müssen nicht weit gehen, um uns inspirieren zu lassen. Die Ukraine hat unseren Partnern und uns gezeigt, daß unnachgiebige Entschlossenheit mehr bedeutet als die Überlegenheit und Macht eines Aggressors. Es ist die einheitliche mitteleuropäische Stimme, die wichtig sein wird, wenn wir der Ukraine zum Sieg verhelfen wollen. Und unsere historische Erfahrung sollte nicht der einzige Grund für die Aufrechterhaltung unserer Unterstützung sein. Damit helfen wir auch uns selbst.
Ich möchte, daß Tschechien als aktiver und zuverlässiger Partner mit einer Meinung wahrgenommen wird, als jemand, der die Dinge zum Besseren verändern kann. Als Präsident der Tschechischen Republik werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Ansehen unseres Landes auf ein neues Niveau zu heben. Und auch, um die Art und Weise zu ändern, wie wir uns selbst wahrnehmen. Es sind die Menschen, die aufstehen und immer wieder einen neuen Versuch wagen, die den Unterschied ausmachen. Ändern wir unsere Einstellung zu uns selbst und zu anderen. Schauen wir uns erfolgreiche Menschen an und lassen wir uns von ihren guten Beispielen inspirieren. Unterstützen wir unsere Mitarbeiter in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung. Geben wir ihnen die Möglichkeit, kreativ zu sein, sich zu entwickeln, Projekte umzusetzen und die Verantwortung dafür zu tragen, auch auf die Gefahr hin, gelegentlich zu scheitern. Solche Erfahrungen können uns Schritt für Schritt voranbringen.
Dieses Ziel ist bei weitem nicht nur meins. Wir sind ein Team, und wir müssen gemeinsam beginnen.
Als Präsident werde ich diese Denkweise fördern. Ich werde jeden, der den Mut hat, einen solchen Schritt nach vorne zu machen, gerne in den Vordergrund stellen. Ich werde unter meiner Schirmherrschaft Projekte durchführen, die ein Beispiel für gute Praktiken darstellen, um uns und der ganzen Welt zu zeigen, daß wir eine Nation mit einer eigenen Meinung sind, die sich auf solide Argumente stützt und die sie vertreten kann. Wir sollten bescheiden bleiben, was nicht bedeutet, daß wir keinen Mut, keine Ideen und keine Visionen haben können. Das ist ein Zeichen, das ich bei uns sehen möchte, und ich möchte, daß es auch in der Welt sichtbar wird. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.
Übersetzung: Pavel Novotny

3 AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023
„Wir erwarten wieder Anstand“
Präsident Petr Pavel und seine Frau Eva Pavlová bedanken sich vom Balkon der Prager Burg aus bei den Bürgern. Foto: Kancelář prezidenta republiky
■ Noch bis 14. April, BdV Hessen: „Wer bin ich? Wer sind wir? Zu Idenditäten der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Wanderausstellung des Hauses des Deutschen Ostens. Haus der Heimat, Friedrichstraße 35, Wiesbaden.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 19. März, 10.00 bis 17.00 Uhr, Bayerischer Landesverein für Heimatpflege: Liederlust im Vierklangrausch. Gesungen werden Lieder aus Bayern und dem Sudetenland. Mitveranstalter ist die Sudetendeutsche Heimatpflege. Teilnahmegebühr: 25 Euro. Anmeldung über die Webseite www.heimatbayern.de Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Samstag, 25. bis Sonntag, 26. März:, Paneuropa-Union Deutschland: 59. Andechser Europatag. Anmeldung und Programm: www.paneuropa.org
■ Sonntag, 26. März, 9.00 bis 16.00 Uhr: Landesfrühjahrstagung „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“ . Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.
■ Sonntag, 26. März, 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Auf a Melange im Café Central“. Konzeption im Auftrag des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg mit Anna-Sophia Krauss (Violine), Christoph Weber (Klavier), Carsten Eichenberger in der Rolle des Kellners Leopold und Iris Marie Kotzian (Sopran). Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und
zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11)
86 32 58.
■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr, Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg: „Traumata nach Krieg, Flucht und Vertreibung: Wenn Verschwiegenes zur Sprache kommt“. Lesung und Gespräch mit Susanne Benda („Dein Schweigen, Vater“) und Susanne Fritz („Wie kommt der Krieg ins Kind“). Evangelisches Bildungszentrum Hospitalhof, Büchsenstraße 33, Stuttgart.
■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Buchpräsentation mit Dr. Eva Habel, Direktorin der Regionalcaritas Schluckenau: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“ (siehe rechts). Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 , München.
■ Freitag, 31. März bis Donnerstag, 6. April, Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk: 66. Fritz-Jeßler-Ostersingwoche mit Chorgesang, Volkstanz, Instrumentalmusik und Kindergruppe. Musikalische Leitung: Astrid Jeßler-Wernz, Karlshuld. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen Weitere Informationen unter www.heiligenhof.de
■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsche Heimatpflege: BöhmischMährisch-Schlesischer Ostermarkt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 17.00 Uhr: „Offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien zum Ostermarkt der Heimatpflegerin“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Montag, 3. April, 14.00 Uhr: Altvater-Runde Stuttgart: Kaffee-
nachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Dienstag, 4. April, 14.00 Uhr: Deutscher Böhmerwaldbund Heimatgruppe Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Mittwoch, 5. April, 18.00 Uhr, Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg: „Kinder unter Deck“. Filmvorführung und Gespräch mit Regisseurin Bettina Henkel. Kino Atelier am Bollwerk, Hohe Straße 26, Stuttgart.
■ Dienstag, 11. bis Donnerstag, 13. April, Haus des Deutschen Ostens: „Was uns anzieht: Trachten der Deutschen aus dem östlichen Europa zwischen Ästhetik, Politik und Mode“. Seminar im Bildungszentrum Kloster Banz in Bad Staffelstein. Anmeldung beim HDO telefonisch unter (0 89) 4 49 99 30 oder per eMail an poststelle@hdo.bayern. de Die Seminargebühr beträgt mit zwei Übernachtungen und Vollpension 130 Euro.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
■ Dienstag, 18. April, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Heimaterinnerungen. Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren mit Autorin Gunda Achterhold. Weitere Termine am 2., 16. und 30. Mai sowie 13. Juni. Teilnahmegebühr pro Termin: 15 Euro. Anmeldung erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
■ Dienstag, 18. April, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, Ausstellungseröffnung: „Roland Helmer und Christian Thanhäuser: Konkret-Konstruktiv & Abstrakt –Ein Werkdialog“. Anmeldung erbeten unter Telefon (0 89) 48 00 03 48 oder per eMail an
sudak@mailbox.org Die Ausstellung ist anschließend bis zum 21. Mai montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Sudetendeutsches Haus, Alfred-KubinGalerie, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Sonntag, 23. April, 10.00 bis 17.00 Uhr, Walther-HenselGesellschaft: Sonntagssingen. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Donnerstag, 27. April, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Bairisches Frühlingssingen mit Dr. Erich Sepp“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 28. April, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Deutsch-Tschechischer Dialog in der jungen Generation“. Vortrag und Gespräch mit Julia Schäffer. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Das diesjährige Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien.“ Programm folgt.
■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Sonntag, 14. Mai, 13.00 bis 19.00 Uhr: Egerländer Gmoi Stuttgart: Gmoinachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Donnerstag, 18. Mai, 11.00 Uhr, Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgs-Verein: Himmelfahrtstreffen und Hahnschlagen. Altvaterbaude des MSSGV bei Schopfloch, Stockert 2, Lenningen.
■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr: Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: Themenführung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00 Uhr: Familienführungen mit Nadja Schwarzenegger. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
14.00 bis 15.00 Uhr: „Götz Fehr: Tu Austria felix“ – eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45 Uhr sowie 18.00 bis 18.30 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“. 16.00 bis 17.00 Uhr: Themenführung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Eva Haupt.
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Verleihung der Kulturpreise, die Verleihung des Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.
Das Banat und andere imaginäre Räume der Dichtung

■ Freitag, 14. bis Sonntag, 16. April, Literaturseminar „Das Banat und andere imaginäre Räume der Dichtung“ der Akademie Mitteleuropa auf dem Heiligenhof.
Das Seminar, das die Akademie Mitteleuropa in Zusammenarbeit mit dem Kulturwerk der Banater Schwaben veranstaltet, will einen Spannungsraum literarisch ausloten und mithin sichtbar, erlebbar und nachvollziehbar machen. Dabei ist das Banat, sei es durch die biographische Herkunft der mitwirkenden Autoren, sei es durch thematische Anspielungen oder Anknüpfungen, ein Bezugspunkt, die sich darüber wölbende fiktionsgeleitete Deutung und literarische Verarbeitung und Imagination der andere. Zwischen diesen Polen werden sich die bei dem Seminar gelesenen literarischen Texte oszillierend bewegen. Es handelt sich um ein Seminar mit vor allem aus dem Banat und aus Siebenbürgen stammenden Schriftstellern, namentlich Albert Bohn, Katharina Eismann, Ilse Hehn, Werner Kremm, Johann Lippet, Traian Pop Traian, Horst Samson, Hellmut Seiler, Anton Sterbling, Astrid Ziegler und Dr. Thomas Ziegler. Eingeleitet und moderiert werden die Lesungen von den bekannten Literaturwissenschaftlern und Literaturkennern Dr. Markus Bauer, Prof. Dr. Wolfgang Dahmen, Dr. Walter Engel und Dr. Anneli Ute Gabanyi. Es stehen Plätze für 40 interessierte Teilnehmende zur Verfügung.
Der Tagungsbeitrag beträgt 80 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe pro Person (inklusiv Programm, Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage), beziehungsweise 100 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe im Einzelzimmer. Die Reisekosten müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Anmeldungen sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefax (09 71) 71 47 47 oder per Mail an info@ heiligenhof.de. Kennwort: Banater Literatur.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
❯ Buchpräsentation mit Verköstigung
„Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“

■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“. Buchpräsentation mit Verköstigung in Kooperation mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein. Veranstaltungsort: Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Die Schluckenauer Roma wurden nach 1945 in der kommunistischen Tschechoslowakei in diese Grenzregion umgesiedelt und kamen ursprünglich aus verschiedenen Teilen der einstigen Donaumonarchie. Von überall her brachten sie auch ihre Rezepte mit, wobei viele davon einem Sudetendeutschen ebenfalls vertraut sind.
So entstand ein hochinteressantes Buch mit vielen Kochanleitungen für Süßes und Herzhaftes. Dazwischen finden sich Erinnerungen und Bilder aus dem althergebrachten Leben der Schluckenauer Roma. Somit führt das Buch nicht nur in ihre Küche, sondern auch in ihre Lebenswelt ein. Indem es in den Lebensgeschichten der Roma die Wechselwirkungen mit der Mehrheitsgesellschaft reflektiert, schließt es eine gro-
ße Wissenslücke über diese Minderheit. Das Kochbuch „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“ wurde vom DeutschTschechischen Zukunftsfonds, dem Bundesjustizministerium, dem Regierungsamt der Tschechischen Republik, Renovabis und dem Bistum Eichstätt gefördert. Es ist auf Tschechisch, Deutsch und Romanes erschienen.
Über die Autorin und Referentin des Abends: Dr. Eva Habel ist Direktorin der Regionalcaritas Schluckenau. Von 1999 bis 2008 war sie Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Seit 2008 ist sie als Pastoralreferentin der Caritas für die Roma-Minderheit in Schlukkenau tätig. Sie kümmert sich vor allem um Roma-Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben. Mit Hilfe des Leitmeritzer Bischofs Jan Baxant gründete sie eine Gebietsdirektion.
Eintritt: 20 Euro (inklusive Drei-Gänge-Menü, ohne Getränke). Anmeldung per eMail an poststelle@ hdo.bayern.de

Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023 4 TERMINE
VERANSTALTUNGSKALENDER
Anzeige
❯ Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine, informiert den Sudetendeutschen Heimatrat
Konzept für Gräbersanierungen
soll im Herbst verabschiedet werden














Sudetendeutsche Gräber sind in vielen Städten und Gemeinden der Tschechischen Republik oft die einzigen baulichen Zeugnisse der langen Geschichte der Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Sie sind Orte des kollektiven Gedenkens und Erinnerns wie auch der individuellen Trauer. Diese Gräber zu sanieren und zu erhalten, ist deshalb ein wichtiges Anliegen des Sudetendeutschen Heimatrates.
Das ist ein Thema, das uns seit Jahren, ja Jahrzehnten beschäftigt“, stellte Franz Longin, der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates, bei der jüngsten Online-Konferenz in seiner Begrüßung fest.
Anschließend informierte Martin Dzingel, der Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, über den aktuellen Stand. „Das derzeit laufende Gräber- und Friedhofsprojekt in Tschechien wird nun erst im August abgeschlossen, so daß konkrete Ergebnisse dann im September vorliegen“, erklärte Dzingel.
Damit werde die am 28. April federführend vom Tschechischen Außenministerium in Prag organisierte Konferenz ohne diese Daten stattfinden. Dennoch sollen natürlich bei dieser Tagung wichtige Punkte und Aspekte überlegt, diskutiert und festgelegt werden, die einen Sachstand über den Zustand der deutschen Gräber vermitteln können. „Ein Team wird einen Vorschlag unterbreiten, der in die Diskussion kommt“, konkretisierte Dzingel.

Mit einbezogen sind dabei die deutsche Minderheit, die Sudetendeutsche Landsmannschaft sowie der Tschechische Staat mit mehreren Ministerien, wobei das Ministerium für Regionalentwicklung die Hauptarbeit leisten wird.
„Bei der Konferenz geht es darum zu überlegen, was realistisch beziehungsweise gewünscht ist. Was können die einzelnen Beteiligten einbringen und bieten“, skizzierte Dzingel die Aufgaben bei dem Treffen, wobei es in erster Linie um inhaltliche Aspekte gehen soll, um das seit 2015 laufende Projekt abzuschließen.
Eine Fragestellung könnte beispiels-
Ein positives Beispiel aus Brünn: Der Gründungsdirektor des Deutschen Gymnasiums, Dr. Matthias Koch, war 1926 auf dem Sankt-Ottilien-Friedhof beigesetzt worden, worauf jahrzehntelang nicht einmal eine Grabplatte hinwies. Im

weise sein, wie ein Modellfriedhof aussehen soll, ob alle Gräber bestehen bleiben sollen, wer sich um die Sanierung und Pflege eines Grabes kümmert. Dzingel erklärte, daß viele Gemeinden bereits heute in ihrem Friedhof einen historischen Teil, ein großes Kreuz oder eine zentrale Pietätsstelle für Deutsche haben. Wichtig für Dzingel ist, daß die Delegation der heimatvertriebenen und der in Tschechien verbliebenen Deutschen einheitlich auftrete und am Ende dann ein für alle annehmbarer Vorschlag herauskomme.



Nach der Präsentation der Ergebnisse des Gräber- und Friedhofsprojekts im Herbst soll eine Kommission mit den Hauptvertretern der April-Tagung einberufen werden, um miteinander den endgültigen Vorschlag festzuzurren und schließlich dem Gremium der tschechischen Regierung zu unterbreiten. Heimatratsvorsitzender Longin empfahl, so früh wie möglich die Projektdaten zu analysieren, um sich ein Meinungsbild zu erarbeiten.
Martin Dzingel verwies darauf, daß man mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft im ständigen Austausch sei: „Wir können uns gegenseitig ergänzen. Aber die tschechische Regierung kann nicht 200 000 Gräber sanieren. Wir werden selbst unseren Vorschlag – solide und realistisch – ausarbeiten und unterbreiten. Am Ende wird dann ein Kompromiß stehen“, machte Dzingel zum Abschluß seiner Ausführungen deutlich. Beispiele und Erfahrungen mit Friedhofsanierungen und den dafür nötigen
Gesprächen mit Repräsentanten von Kirche und Kommune aus seiner Heimatregion im südmährischen Leipertitz sowie aus Brüx schilderte Reinfried Vogler. Auf viele Fälle, wo Tschechen die Pflege der deutschen Gräber übernommen haben, machte Edmund Schiefer aufmerksam und schlug vor, diese Bürger zu unterstützen. SL-Kulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann fragte nach Details zu den angedachten Vorschlägen und nahm insbesondere die tschechische Regierung in die Pflicht, da aufgrund der Vertreibung der Deutschen und während der Zeit des Eisernen Vorhangs Besuche und Pflege der Gräber jahrzehntelang nicht möglich waren. Dietmar Heller erinnerte an einige vor der Corona-Pandemie erfolgte Friedhofsrenovierungen in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Verband Omnium. Wegen der zeitweiligen Grenzschließungen und Kontaktbeschränkungen sei diese Kooperation aber während der Pandemie oft zum Erliegen gekommen.
Die Erarbeitung von Vorschlägen durch die Heimatkreise sowie Landschafts- und Ortsbetreuer schlug Günther Wytopil vor, mehrere Modelle „vom Riesenfriedhof bis zum Kleinfriedhof“ favorisierte Dr. Pia Eschbaumer, die Heimatkreisbetreuerin des Heimatkreises Karlsbad.


Warum es wichtig ist, Friedhöfe zu sanieren und Gräber nicht verfallen zu lassen, faßte Martin Dzingel zusammen: „Es geht in erster Linie um das kulturelle Erbe und Gedächtnis sowie um die Pietät gegenüber den Verstorbenen. Das sind die Fakten, die wir sagen können und müssen.“
Den Vertretern des Heimatrates gab Dzingel als Aufgabe, eine Arbeitsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu gründen, die bei der Tagung Ende April in Prag mit dabei ist und dann die Endphase des Projektes begleitet. Markus Bauer
❯ Ehrensache Ehrenamt: Erika Weinert bastelt außergewöhnlichen Osterschmuck, fertigt Trachten und gibt Bastel- und Nähkurse




Die Arbeit mit Perlen ist ihre Spezialität
Wer in diesen Tagen das Sudetendeutsche Haus in München besucht, findet im ersten Stock eine Vitrine mit filigran gearbeitetem Osterschmuck vor: mit Stoff bespannte Eier, auf die wahlweise das Christusmonogramm, das Osterlamm oder Kelch und Hostie eingestickt sind, aus Perlen und Draht geformte Blumen und Eier sowie die berühmten Kratzeier, gefärbte Eier, in die Muster und ganze Texte mit einer Messerspitze eingeritzt worden sind. Zusammengestellt haben den Schmuck zwei Frauen vom Böhmerwaldbund: Waltraud Valentin und Erika Weinert, die die Sudetendeutsche Zeitung in dieser Ausgabe im Rahmen der Serie „Ehrensache Ehrenamt“ vorstellt.
Erika Weinerts Spezialität ist die Arbeit mit Perlen. Aus ihnen macht sie – je nach Jahreszeit – Christbaumschmuck, verzierte Ostereier, Blumen und vieles mehr. Dazu verwendet sie verschiedene Techniken: So fädelt sie zum Beispiel Perlen auf Draht auf, den sie dann anschließend zu Figuren formt. Auf diese Weise entsteht etwa ein Strauß aus Perlenblumen. Oder Erika Weinert stickt sorgsam Perle für Perle auf ein mit Stoff bezogenes Osterei, sodaß darauf ein Gänseblümchen entsteht. Andere Perlen klebt sie zu einem Muster zusammen. Anregungen für ihre Arbeiten holte sie sich früher aus Handarbeitsheftchen, heute auch aus dem Internet.

Gelernt hat sie den Umgang mit Perlen vor circa 35 Jahren in Aalen bei den Böhmerwäldlern. Der Böhmerwald war reich an Glas und damit auch an Glasperlen, die unter anderem für Kleider, Körper- und Kirchenschmuck verwendet wurden. In der Gegend wurde die
heute 80jährige geboren. 1945 wurde sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester vertrieben – der Vater war im Krieg gefallen. Im Bayerischen Wald fand die Familie eine neue Heimat. Als 16jährige ging Erika Weinert nach München, wo sie eine Stelle als Kontoristin antrat. „Heute würde man kaufmännische Angestellte sagen“, fügt sie erklärend hinzu. Die für
ihre Arbeit notwendigen Kenntnisse in der Buchhaltung hat sie sich selbst angeeignet. Auch ihre Cousine lebte damals in München. Sie hat Erika zu den Böhmerwäldlern mitgenommen, bei denen sie bis heute geblieben ist. Zunächst war sie in der Sing- und Volkstanzgruppe dabei. Viele Auslandsfahrten hat sie in den

Am 19. März ist das Fest des heiligen Josef. Da der Mann an der Seite der Jungfrau Maria zu den wichtigsten Heiligen gehört, wird dieses Fest kirchlich als ein Hochfest gefeiert. Allerdings ergibt sich heuer eine Verschiebung im Kirchenkalender. Der Josefstag fällt auf den vierten Fastensonntag. Aus diesem Grund wird er in den Gottesdiensten nicht am 19. März begangen, sondern am Tag danach, also am 20. März. So gesehen kann, wer Josef, Josefa oder Josefine heißt, diesmal zwei Tage lang Namenstag feiern, was in der Fastenzeit natürlich verlockende Möglichkeiten eröffnen würde.
Mich freut, daß der Name Josef in unserer Zeit wieder häufiger an Kinder als Vorname vergeben wird. In den letzten Jahrzehnten schien er fast ganz aus der Mode gekommen zu sein.
Jetzt aber feiere ich immer wieder einmal Taufen von kleinen Josefs oder Josefinas. Dieser Trend bereitet mir nicht nur deshalb Freude, weil so eine jahrhundertealte Tradition wieder auflebt, sondern vor allem auch, weil ich den heiligen Josef als ein wertvolles Vorbild erachte. Wenn also sein Name häufig vorkommt, so hoffe ich, daß dieses Vorbild nicht in Vergessenheit gerät.

Warum ist der heilige Josef so vorbildhaft? Zunächst: Josef war ein Mensch wie wir alle. Fast könnte man sagen: ein Durchschnittsmensch. Als gelernter Zimmermann war er ein Mann des Alltags. Er ging seinem Beruf in Treue nach, mühte sich ab und tat mit seiner Arbeit Gutes für andere, stach aber nicht durch Besonderheiten hervor. Der heilige Josef steht also für die Normalität unseres menschlichen Lebens. Vielleicht hat er das Gewöhnliche außergewöhnlich gut gemacht, aber auch dadurch fiel er eigentlich nicht sonderlich auf.
1970er und 1980er Jahren mit der Böhmerwaldgruppe unternommen: in die USA, nach Schweden, Großbritannien und Brasilien. „Das war sehr schön“, erinnert sich Erika Weinert: „Wenn man in einem Verein ist, wird einem schon viel ermöglicht.“ Neben den Auftritten hatte Erika Weinert noch eine spezielle Aufgabe: Sie kontrollierte vorab, ob die Trachten in Ordnung waren. Denn auch im Umgang mit Stoff ist sie versiert. Ihre Mutter nähte nach dem Krieg aus alten Kleidungsstücken neue – eine Methode, die sich heute unter dem Namen Upcycling aufgrund ihrer Nachhaltigkeit wachsender Beliebtheit erfreut. Erika Weinert pflegt sie noch heute. „Aus alter Bettwäsche mache ich Taschen“, sagt sie und zeigt ein geblümtes und geräumiges Modell. Das Nähen hat sie bereits als Kind angefangen, mit Schürzen und Nachthemden in der Schule. Als Erwachsene nähte sie Kleider für ihre Nichten und dann auch für sich selbst. Das Nähen von Trachten hat sie in einem Kurs erlernt. Inzwischen unterrichtet sie solche Trachtennähkurse selbst. Auch das Basteln gehört fest zu ihrem Terminplan. Jeweils eine Woche vor dem Ostermarkt und dem Adventsmarkt, den die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen veranstaltet, bietet sie zusammen mit dem Böhmerwaldbund Bastelkurse für Frauen an.
Wer Osterschmuck aus dem Böhmerwald – und anderen sudetendeutschen Gebieten – bestaunen und käuflich erwerben möchte, hat dazu übrigens am 1. April beim böhmisch-schlesisch-mährischen Ostermarkt im Sudetendeutschen Haus Gelegenheit – oder jederzeit im ersten Stock des Sudetendeutschen Hauses. Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

Menschen wie Josef machen nicht viel Wind um sich selbst, sie wollen nicht glänzen und strahlen, sie sehnen sich nicht danach, groß herauszukommen. Menschen wie Josef lieben vielmehr das einfache und bescheidene Leben. Sie sind anständige Leute mit lauterer Gesinnung und Verantwortungsbewußtsein. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere betrifft ihr Verhältnis zu Gott. Mir kommt vor: Menschen wie Josef sind deswegen so, wie sie sind, weil sie ein tiefes Bewußtsein davon haben, Kinder Gottes zu sein. Sie wissen, daß ihr Leben Gabe und Aufgabe zugleich ist. Alles, was sie tun und schaffen, geschieht im größeren Horizont einer vom Glauben, von der Hoffnung und von der Liebe geprägten Lebenskultur.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden dem heiligen Josef viele Ehrentitel und Aufgaben zugeteilt. Der Bräutigam der Jungfrau Mariens und Nährvater Jesu ist Patron der Kirche und Fürsprecher für eine gute Sterbestunde. Er ist Patron für Eheleute und Familien sowie für Handwerker und Arbeiter. Zu seinen Aufgaben zählt weiter die Hilfe in der Regelung materieller Angelegenheit und der Schutz vor Verzweiflung. Eine Bauernregel sagt: „Ist‘s am Josefstage schön, kann es nur gut weitergeh‘n.“ Ich will das so deuten: Mit der Hilfe des heiligen Josef ist gut leben. Mit Menschen wie Josef auch.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

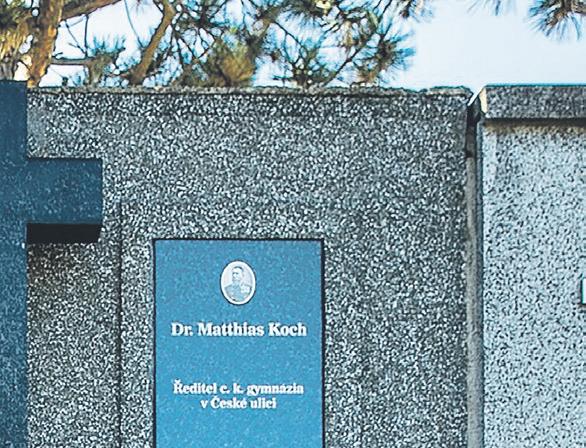

❯ Mut tut gut Menschen wie Josef AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17.03.2023 5
Erika Weinert vom Böhmwaldbund präsentiert auf dem böhmisch-schlesisch-mährischen Ostermarkt ihre Kunstwerke. Foto: Sadja Schmitzer
Rahmen eines tschechischen Schülerprojektes wurde die letzte Ruhestätte jetzt saniert. Fotos: Petr Lundák
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:


Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
eMail
Geburtsdatum, Heimatkreis



Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de



Stellvertretend für Volksgruppensprecher Bernd Posselt war Rudolf D. Fischer, Obmann der SL-Landesgruppe Berlin, zum diesjährigen Gedenken an die Opfer des 4. März 1919 und zum Tag des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf dem Friedhof im nordböhmischen Kaaden gekommen. Fischer berichtet.
An der Gedenkstätte auf dem Stadtfriedhof in Kaaden hatten sich rund 40 Teilnehmer versammelt. Am 25. September 2009, am Fest des heiligen Wenzels, des Schutzpatrons Böhmens, unterzeichneten die ehemaligen und heutigen Bewohner Kaadens eine Versöhnungsurkunde. In dieser Urkunde ist festgeschrieben, daß am 25. September auch der am 4. März 1919 zu Tode gekommenen Menschen gedacht werde. Dieser Festschreibung fühlen wir Sudetendeutschen uns auch an jedem 4. März verpflichtet.

Im Auftrag des Bundesverbandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft legte ich einen Gedenkkranz für die Opfer des 4. März 1919 nieder. Als offizieller Vertreter der Stadt Kaaden legte Stadtrat Michal Voltr gleichfalls einen Gedenkkranz nieder und hielt eine eindrucksvolle Rede.
Lothar Grund vertrat den Heimatkreis Kaaden-Duppau. Seinem Einsatz und seiner Regsamkeit verdanken wir, daß dieses Gedenken auch heuer würdevoll gestaltet wurde. Außerdem
„Pozdrav panbuh“, tschechisch für Grüß Gott.
Unschätzbar wertvoll war für uns die Dolmetscherin Veronika Klimová, die uns geduldig half, unsere tschechischen Freunde zu verstehen und unsere deutschen Reden ins Tschechische zu übersetzen.
In meiner Gedenkrede sagte ich, daß wir heute die Geschichte nicht mehr verändern könnten. Das verpflichte uns jedoch um so mehr, aus unserer über Jahr-
nern, um dann besser und ohne Vorbehalte aufeinander zugehen zu können. Dabei gelte der Grundsatz: verzeihen ja, vergessen nein. Abschließend stellte ich die Frage, wie es denn um das Selbstbestimmungsrecht der Völker in unseren Tagen bestellt sei. Vor dem Hintergrund des unbeschreiblichen Leids, mit dem die Zivilbevölkerung der Ukraine sich täglich konfrontiert sehe, wo Kinder, Frauen und alte Menschen Opfer seien, wo Flucht und Vertreibung erneut eine schreckliche Aktualität erführen – vor diesem Hintergrund seien wir betroffen, ratlos und aufgewühlt.
11/2023
waren der örtliche Dechant Josef Čermák und Bayerns Stellvertretende SL-Landesobfrau Margaretha Michel gekommen. Michel begrüßte ihrerseits die Gedenkenden mit einem herzlichen
� SL-Landesgruppe Baden-Württemberg
hunderte dauernden, gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zu lernen. Es sei wichtig, sich an solchen Gedenktagen wie dem 4. März zu treffen, an vergangene Ereignisse zu erin-
„Frieden hingegen bedeutet frei sein von Angst und Unterdrückung, das bedeutet Rechtsstaatlichkeit und die Gültigkeit des Völkerrechts. Daraus resultiert die zwingende Verpflichtung für uns alle konsequent, stets und überall für diese fundamentalen und existenziellen Werte einzutreten.
Aus Unrecht entsteht Versöhnung
Den 104. Jahrestag des 4. März 1919 beging die SL-Landesgruppe Baden-Württemberg mit einer Feierstunde im Haus der Heimat in Stuttgart und erinnerte an das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Landesobmann Klaus Hoffmann begrüßte Gedenkredner und Ex-Minister Guido Wolf, Konrad Epple MdL, Andreas Kenner MdL, den Karlsruher Bürgermeister Albert Käuflein, Stadträtin Rose von Stein, die Bezirksvorsteherin von StuttgartNord, Sabine Mezger, Ex-Regionalrat Hans-Werner Carlhoff, die Stuttgarter Alt-Stadträtin Bärbel Häring, Ex-Ministerialrätin Christiane Meis, den Vorsitzenden des Sudetendeutschen Heimatrates und Ehrenvorsitzenden des Südmährerbundes Franz Longin, BdV-Landesvorsitzenden Hartmut Liebscher und BdV-Landesgeschäftsführer Richard Jäger sowie die Mitglieder der Sudetendeutschen Bundesversammlung Peter Sliwka und Waltraud Illner. Die Familie Preisenhammer begleitete die Feierstunde musikalisch.


Klaus Hoffmann rief in seinen Eingangsworten die Ereignisse des 4. März 1919 noch einmal in Erinnerung. Dann blickte Guido Wolf auf die Historie des 4. März 1919 zurück und würdigte die Leistung der Sudetendeutschen.
Wolf, seit 2006 im Landtag und 2016 bis 2021 Justizminister, sagte, daß er sich mit der SL sehr verbunden fühle und großen Respekt vor der Lebensleistung der Vertriebenen habe. Deshalb sei ihm wichtig, mit dieser Gedenkfeier an das 1919 den Sudetendeutschen vorenthaltene Selbstbestimmungsrecht zu erinnern.
Im Frühjahr 1919 seien neue Staaten entstanden und Grenzen bestehender Staaten neu gezogen worden. So seien auch die Sudetendeutschen über Nacht Teil der neuen Tschechoslowakei geworden. Sie hätten sich der Republik Deutschösterreich zugehörig gefühlt, aber an den Wahlen zur ersten deutschösterreichischen Nationalversammlung im Februar 1919 nicht teilnehmen dürfen. Deshalb seien sie am 4. März 1919 auf die Straße gegangen. Tschechisches Militär habe die Demonstrationen blutig niedergeschlagen. Das Ergebnis seien 54 Tote und 200 Verletzte gewesen.
Das Ziel der Sudetendeutschen, ihre kulturelle Identität in einem demokratischen Staatswesen zu erhalten, habe sich erst
nach dem Zweiten Weltkrieg und ihrer Vertreibung erfüllt. Allerdings in der jungen Bundesrepublik Deutschland und nicht in ihrer sudetendeutschen Heimat. „Doch die Sudetendeutschen waren ein Glücksfall für Deutschland und für unser Land Baden-Württemberg.“
Auch wenn die neuen Mitbürger aus dem Sudetenland anfangs nicht überall mit offenen Armen empfangen worden seien, so könne das Zusammenwachsen von Einheimischen und Vertriebenen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Vertriebenen hätten maßgeblich zum Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland beigetragen. Ohne ihre Tatkraft wäre der damit verbundene wirtschaftliche Aufschwung bescheidener ausgefallen. Neben dem wirtschaftlichen Beitrag nannte Wolf vor allem das Engagement der Sudetendeutschen zur Versöhnung und Verständigung mit dem tschechischen Nachbarn.
In diesem Zusammenhang zog er Parallelen zwischen den Ereignissen des März 1919 und der Gegenwart in Europa, wo
auch heute in der Ukraine wieder Menschen für ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre Identität kämpften. „Sie kämpfen darum, in einem demokratischen Staatswesen zu leben, und viele von ihnen haben bereits mit ihrem Leben dafür bezahlt. Und wie damals den Herren in Prag das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen egal war, so egal ist dieses Recht der Ukrainer dem Mann im Kreml heute.“ Doch wie es schon seit vielen Jahren eine kontinuierliche Versöhnungsarbeit zwischen Sudetendeutschen und Tschechen gebe, so müsse es dereinst zu einer solchen Versöhnung zwischen jungen Ukrainern und Russen kommen, was man sich allerdings heute angesichts des schrecklichen Krieges von Wladimir Putin gegen die Ukraine kaum vorstellen könne. Die Geschichte der Sudetendeutschen zeige jedoch, daß noch aus der brutalsten Gewalt und dem größten Unrecht eines Tages Verständigung und Versöhnung entstehen können.
Außerdem hielt Franz Longin am Mahnmal für die deutschen Heimatvertriebenen in Stuttgart eine Gedenkrede. In dieser erinnerte er an die Opfer des 4. März 1919, an das Selbstbestimmungsrecht der Völker und legte einen Kranz nieder. Helmut Heisig

FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 6 � Sudetendeutsche Landsmannschaft
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 BIS28MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Verzeihen ja, vergessen nein
Kreisobfrau Waltraud Illner, Sabine Mezger, Rose von Stein, Hans-Werner Carlhoff, Franz Longin, Dr. Dieter Bruder, Vorsitzender des Vereins Alte Heimat–heimattreuer Kuhländler, Vizelandesobmann Christoph Zalder, Bürgermeister Dr. Albert Käuflein, Bärbel Häring, Guido Wolf MdL, Landesobmann Klaus Hoffmann, Konrad Epple MdL, Herbert Preisenhammer von der AG Sing-, Tanz- und Spielkreise in Baden-Württemberg, Andreas Kenner MdL und BdV-Landesvorsitzender Hartmut Liebscher. Bilder: Helmut Heisig
Michal Voltr, Dr. Veronika Klimová, Lothar Grund, Rudolf D. Fischer, Margaretha Michel und Dechant Josef Čermák.
� SL-Kreisgruppe Hof/Oberfanken
Möge der Schmerz schwinden
Wie alljährlich gedachte die oberfränkische SL-Kreisgruppe Hof der Opfer des 4. März 1919 mit Kranzniederlegungen an den Mahnmalen für die Toten der Heimat in Schwarzenbach und Bad Steben statt mit zentraler Gedenkfeier in Bad Steben.
Kreisobmann Adalbert Schiller begrüßte alle Gottesdienstbesucher und Landsleute, insbesondere den Zelebranten Pfarrvikar Sebastian Schiller, SL-Bezirksobfrau Margaretha Michel, Klaus Adelt MdL und Bürgermeister Bert Horn mit seinem Stellvertreter Maximilian Stöckl sowie Schillers Stellvertreter Jürgen Nowakowitz und Bannerträgerin Eva-Maria Herrmann.


Der katholische Kirchenchor und Ellen von Kieseritzky an der Orgel begleiteten den Gedenkgottesdienst. Sie boten Stücke wie „Herr, deine Güte reicht so weit“ von Joseph Haydn, „Alle meine Quellen entspringen in dir“ von Hans-Jürgen Lommatzsch, aus der Anna-Messe von Max Hohnerlein, ein Offertorium von Jean-Francois Dan-
re feste Nahrung seien die Menschen zu sehr geschwächt gewesen. Bei den Friedensschlüssen in Paris von 1919 sei über die Köpfe der Beteiligten entschieden worden. Österreich-Ungarn und die Türkei seien zerlegt worden, mit Folgen, unter denen wir heute noch litten. Auch der Westteil der Ukraine – damals Galizien genannt – habe bis 1919 zu Österreich gehört. USAPräsident Woodrow Wilson habe weitab von den betroffenen Orten vom Selbstbestimmungsrecht der Völker gesprochen. Das habe aber nur für die Sieger gegolten. Mit der neuen Tschechoslowakei habe man wieder einen Vielvölkerstaat geschaffen, ohne die Minderheiten richtig einzubinden. Michel erinnerte an die sudetendeutsche Demonstration am 4. März 1919 in Kaaden. Der demonstrierenden Menschenmenge habe eine kleine Einheit von Tschechen gegenübergestanden, jung, unerfahren und unsicher. „Es fielen Schüsse, und es starben Menschen. Der tschechische Pfarrer von Kaaden wies darauf hin, daß Kleinkinder, Heranwachsende, Frauen und alte Männer getroffen worden seien. Meist waren es Querschläger, die das Unglück anrichteten.“
Vizekreisobmann Jürgen Nowakowitz, Bezirksobfrau Margaretha Michel, Kreisobmann Adalbert Schiller, Anni Zaha und ihre Tochter, Bannerträgerin Eva-Maria Herrmann, in Schwarzenbach.


drieu oder während des Auszugs zum Mahnmal ein Maestoso von Heinrich Christian Rinck.
Margaretha Michel begann ihre Ansprache mit dem Hinweis, sie sei am Vortag beim Gedenken in Kaaden gewesen (Ý Seite 6). Michel begrüßte Pfarrvikar Sebastian Schiller genauso wie am Vortag den Pfarrer von Kaaden mit „Pozdrav panbuh“, tschechisch für Grüß Gott.
So hätten sich mehr als 800 Jahre lang Deutsche und Tschechen in der Heimat begrüßt. Deutsche, Tschechen und Juden hätten über Jahrhunderte meist friedlich zusammengelebt.
Vor einigen Jahren habe ein australischer Historiker darauf hingewiesen, Europa sei gleichsam mit einem Schlafwagen 1914 in den Krieg gerauscht. Bald sei bekannt gewesen, daß die Mittelmächte nicht in der Lage gewesen seien, den Krieg zu gewinnen. Aber man habe lieber Stellungskrieg gespielt. Millionen Menschen seien im Feld und noch mehr an der Spanischen Grippe gestorben. Und für die erkrankten Menschen habe es zuletzt nur noch den Rübenwinter gegeben. Ohne Brot und ande-
Nun schilderte Michel die Folgen, die Diskriminierung der Deutschen, den wachsenden Einfluß des Deutschen Reichs, den Einmarsch in das Sudetenland, die Besetzung der sogenannten Resttschechei und die Vertreibung.
„Mögen mehr als 100 Jahre nach 1919 und 78 Jahre nach Kriegsende die Bitternis und der Schmerz aus den Herzen verschwinden. Gleichzeitig ist es notwendig, daß das noch bestehende Unrecht in wissenschaftlichen Diskursen aufgearbeitet wird. In dem Sinne gedenken wir aller Menschen, die zum Opfer geworden sind und gelitten haben und hoffen auf einen künftigen Frieden“, schloß Margaretha Michel ihre zu Herzen gehende Rede.
Nach dem Gottesdienst zog man unter den bereits genannten Orgelklängen zum Mahnmal der Toten der Heimat. Dort legten Landtagsabgeordneter Klaus Adelt und die beiden Bürgermeister mit den SL-Obleuten einen Kranz nieder. Anschließend fuhr man nach Schwarzenbach und legte auch dort ein Blumengebinde nieder. Pfarrsekretär Bernhard Kuhn sprach an beiden Gedenkstätten ein Gebet für die Toten des 4. März sowie für alle Kriegsopfer. dn
Die Südmährer Thomas und Dr. Bruno M. Kaukal, Claus Hieke mit Wurzeln im Elbetal und im Egerland, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Bundvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Stadtrat Thomas Schmid, Erich Plischke, Vorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier (LdO) in München, sein Stellvertreter Norbert Gröner, Ehrenvorsitzende Gertrud Müller, die Beisitzer Johann Plischke und Josef Fürguth sowie Susanne Häussler von der SLKreisgruppe München.


Klaus Adelt MdL, SL-Kreisobmann Adalbert Schiller, sein Vize Jürgen Nowakowitz, Anni Zaha, dahinter Bannerträgerin Eva-Maria Herrmann, Bezirksobfrau Margaretha Michel, Bürgermeister Bert Horn und Dritter Bürgermeister Maximilian Stöckl in Bad Steben. Bilder: Bernhard Kuhn


Renate Ruchty, Vorsitzende der Böhmerwaldgruppe München, Harfenistin Laura Fischnaller, Birgit Unfug, Betreuerin der Heimatlandschaft ErzgebirgeSaazer Land, Siegfried Lange, Bezirksvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien, Dr. Michael Henker vom Sudetendeutschen Museum, Damian Schwider, Vorsitzender der LdO-Landesgruppe Bayern, Dr. Gotthard Schneider, Landesvorsitzender der Landsmannschaft Schlesien, Paul Hansel, Vorsitzender des BdV-Bezirksverbands Oberbayern und Ministerialdirigent a. D., Andreas Lorenz MdL, die Kuhländlerin Christl Rösch und Professor Dr. Ulf Broßmann, SL-Bundeskulturreferent und Betreuer der Heimatlandschaft Kuhländchen. Bilder: Nadira Hurnaus

Erbe des Ersten Weltkriegs
Heuer beging die SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land den Tag des Selbstbestimmungsrechts der Völker mit der Landsmannschaft Oberschlesien sowie dem BdV-Kreisverband München und BdV-Bezirksverband Oberbayern im Sudetendeutschen Haus in München.
G
astgeber und Kreisobmann Johann Slawik kommentierte den Einzug der Fahnenabordnungen, den Horst Pelger auf dem Akkordeon begleitete, und begrüßte die Gäste. Birgit Unfug gedachte der Toten, Stadtrat Thomas Schmid überbrachte die Grüße von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Andreas Lorenz MdL die der Landesregierung.
Ortfried Kotzian, Gedenkredner und Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, widmete sich dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das sei bei den politischen Auseinandersetzungen zwischen Tschechen und Sudetendeutschen am 4. März 1919 und zwischen Polen und Oberschlesiern am 20. März 1921 verletzt worden. Bei diesen Erbschaften des Ersten Weltkriegs sei es um Machtsicherung, Machtgewinnung, um Landnahme und um Manipulation von Volksgruppen oder ethnischen Gruppen im Sinne der beteiligten Nationalstaaten gegangen.

Der 4. März 1919 sei die Geburtsstunde der Sudetendeutschen als Volksgruppe oder ethnische Minderheit in einem andersnationalen Staat. Deutschböhmen, Deutschmährer und Sudetenschlesier seien in einem gemeinsamen Territorium, der Tschechoslowakei, vereint, was in der Donaumonarchie Österreich-Ungarn nicht der Fall gewesen sei. Dort hätten die österreichischen Kronländer Böhmen, Mähren und Schlesien existiert. Deren Sprache habe nur eine untergeordnete Rolle gespielt, unabhängig davon seien sie Bürger ihres Kronlandes gewesen.
Nach 1918 habe es eine Staatssprache, das Tschechische und Slowakische oder damals als Konstrukt das Tschechoslowakische gegeben, und eine Minderheitensprache, das Deutsche und einige andere. Der 4. März 1919 habe der Welt beweisen sollen, daß die Sudetendeutschen mit ihrer erzwungenen Eingliederung in den tschechoslowakischen Nationalstaat nicht einverstanden gewesen seien.
Alle Deutschen der ehemaligen Kronländer Böhmen, Mähren und Schlesien hätten sich an
diesen Protesten beteiligt: „Die Sudetendeutschen also!“ Dieser Begriff sei bei der Entstehung des tschechoslowakischen Nationalstaates mitgegründet worden. Das weitere Schicksal der Sudetendeutschen wie der Anschluß an das Dritte Reich oder die Vertreibung aus den Sudetenländern sei nur vor dem Hintergrund dieser Geburtsstunde zu begreifen.
Jahrhundertealt seien die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen. Dabei handele es sich um die schwierige Geschichte von Nachbarvölkern, die unter dem Schicksal einer Mittel-
gewesen. So auch in Oberschlesien und einem kleinen Teil Niederschlesiens. Zuvor sei es zu mehreren polnischen Aufständen in Oberschlesien gekommen.
Die Urbevölkerung in diesen Abstimmungsgebieten sei immer zwischen Deutschen, Polen und Tschechen, also zwischen den großen Nationen gestanden. Das sei jene meist slawische Bevölkerung, die weder von Deutschen noch von Polen habe assimiliert werden können wie Kaschuben, Schlonsaken, Masuren, Hultschiner, Teschener Schlesier oder Wasserpolen. Jedes der
Nach dem 11. September 2001 sei die Kriegserklärung gegen den internationalen Terrorismus gekommen und damit die Möglichkeit zum Unterlaufen des Völkerrechts und der Menschenrechte. „Ich nenne nur Guantanamo auf Kuba, den Einmarsch in Afghanistan oder jenen der ,Koalition der Willigen‘ im Irak.“ Rußland habe dies hingenommen. Im Frühjahr 2014 habe Wladimir Putin die politischen Fehler des Westens für seine machtpolitischen Ziele erkannt und auf der Krim Fakten geschaffen. Rußland habe ein bisher autonomes Gebilde in der Ukraine zunächst aus historischen sowie machtpolitischen und strategischen Gründen beansprucht, dann nach dem Prinzip des Selbstbestimmungsrechtes der Völker aus ethnischen Gründen zur Rückkehr ins Russische Reich veranlaßt.
Die Sudetendeutschen hätten 1919 nur demonstrieren können. Sie seien weder an der Gründung der Tschechoslowakei noch am Anschluß 1938 beteiligt worden. Damals wie heute werde das Geschehen mit der friedensstiftenden Kraft des Selbstbestimmungsrechtes der Völker begründet.
lage in Europa gelitten und dieses Schicksal in der Epoche der Nationswerdungen mit machtpolitischen Mitteln auf Kosten der Nachbarn zu bewältigen versucht hätten. Aus diesem Grunde sei das Verhältnis der beiden Nachbarvölker belastet.
Die Leidtragenden seien vor allem die Angehörigen der beiden Völker, die jeweils im Sprach- oder Staatsgebiet des anderen Volkes gelebt hätten: die Polen in Deutschland und die Deutschen in Polen. Mit der Gründung des modernen polnischen Staates Anfang des 20. Jahrhunderts sei der Grundstein für eine bedeutende deutsche Minderheit gelegt worden. Die Volksabstimmung für Oberschlesien am 20. März 1921 habe dazu beigetragen.
Auch die erste polnische Republik habe in dem Nationalitäten- und Vielvölkerstaat Polen eigentlich einen polnischen Nationalstaat gesehen, die Minderheiten seien Fremdkörper gewesen. Mit dem Versailler Friedensvertrag 1919 hätten Gebiete, insbesondere im Osten des Reiches, ohne Volksabstimmung an Polen abgetreten werden müssen. In anderen Gebieten seien zur Festlegung der Grenze zwischen Deutschland und Polen Volksabstimmungen vorgesehen
umliegenden großen Völker habe die Gruppe für sich reklamiert, sie im nationalen Sinne eingliedern wollen, und bei jeder Grenzverschiebung seien sie „befreit“ worden.
Bei der Abstimmung in Oberschlesien hätten 59,6 Prozent für einen Verbleib bei Deutschland und 40,4 Prozent für eine Abtretung an Polen gestimmt. Die Pariser Botschafterkonferenz habe daher beschlossen, Oberschlesien entlang der Sforza-Linie zu teilen. Damit sei der größte Teil des Industriereviers unter polnische Herrschaft gekommen.
Die Geschehnisse auf dem Balkan in den 1990er Jahren oder jetzt in der Ukraine und in Rußland erinnerten fatal an Geschehnisse in der Mitte Europas vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Ironisch schilderte Kotzian, in welch trügerischer Sicherheit sich die Menschen des „Westens“ im Nachwende-Europa gewiegt hätten, geglaubt hätten, daß keine Kriege mehr geführt würden, sich die Demokratie durchgesetzt habe, nur die USA eine Supermacht und die VR China noch nicht so weit und in den Handel mit der freien Welt so eingebunden sei, daß keine Gefahr bestehe. Jugoslawienkriege seien als regionale Konflikte herunter geschrieben worden.
Das Selbstbestimmungsrecht enthalte ein Versprechen, das nicht eingelöst werden könne. Eine Welt, in der jedes Volk einen eigenen Staat nicht bilden müsse, aber bilden dürfe und in dem jeder Mensch dem Volk seiner Wahl angehören könne, lasse sich denken, aber nicht verwirklichen. Selbstbestimmungsrecht könne ohne Volksgruppenoder Minderheitenrecht nur ein machtpolitisches Instrument der Nationalstaaten sein, sei aber keine Lösung für ethnische Konflikte.
Zum Schluß sprach Paul Hansel, Vorsitzender des BdV-Bezirksverbandes Oberbayern und Ministerialdirigent a. D., ebenfalls das Minderheitenrecht an. Er beklagte, daß Polen Gelder für den Deutschunterricht der deutschen Minderheit gestrichen habe. Außerdem wies er angesichts des drei Tage zuvor begangenen Frauentages darauf hin, daß unter den 54 Märztoten 20 Frauen und Mädchen gewesen seien. Das beweise, wie stark sich bereits damals Frauen engagiert hätten. Eine weitere Frau, Laura Fischnaller, hatte das Gedenken auf ihrer Volksharfe von dem Kitzbühler Harfenbauer Peter Mürnseer begleitet. Es endete mit der Bayern- und der Deutschlandhymne.
AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 7
Nadira Hurnaus
� SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land/Oberbayern
Renate Slawik, Dr. Ortfried Kotzian, Gedenkredner und Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, sowie Johann Slawik, Obmann der SLKreisgruppe München-Stadt und -Land.
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Collegium Carolinum und Adalbert-Stifter-Verein referierte der Linguist Klaas Hinrich Ehlers über die sprachliche Integration der Vertriebenen nach 1945. In seinem Vortrag „Ankommen im Dialekt“ ging es speziell um die schnelle Aneignung des Plattdeutschen der Vertriebenen aus den böhmischen Ländern, Schlesien und der Slowakei in MecklenburgVorpommern, die er erforscht hatte.


Unter den vielen deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Norddeutschland angesiedelt wurden, war auch eine große Zahl von Menschen aus den böhmischen Ländern, aus Schlesien und aus der Slowakei“, erläuterte Klaas Hinrich Ehlers. Der Forscher untersuchte in einer Umfrage, wie sich diese Menschen aus mittel- und oberdeutschen Herkunftsgebieten sprachlich in ihrem neuen Lebensumfeld orientierten, das damals noch stark vom Niederdeutschen oder Plattdeutschen geprägt war. Die allgemein übliche Meinung zu dieser Frage sei, daß die immigrierten Vertriebenen ebenso wie die alteingesessenen Menschen vom Gebrauch ihrer Dialekte rasch Abstand genommen und sich sprachlich im überregionalen Hochdeutschen getroffen hätten.
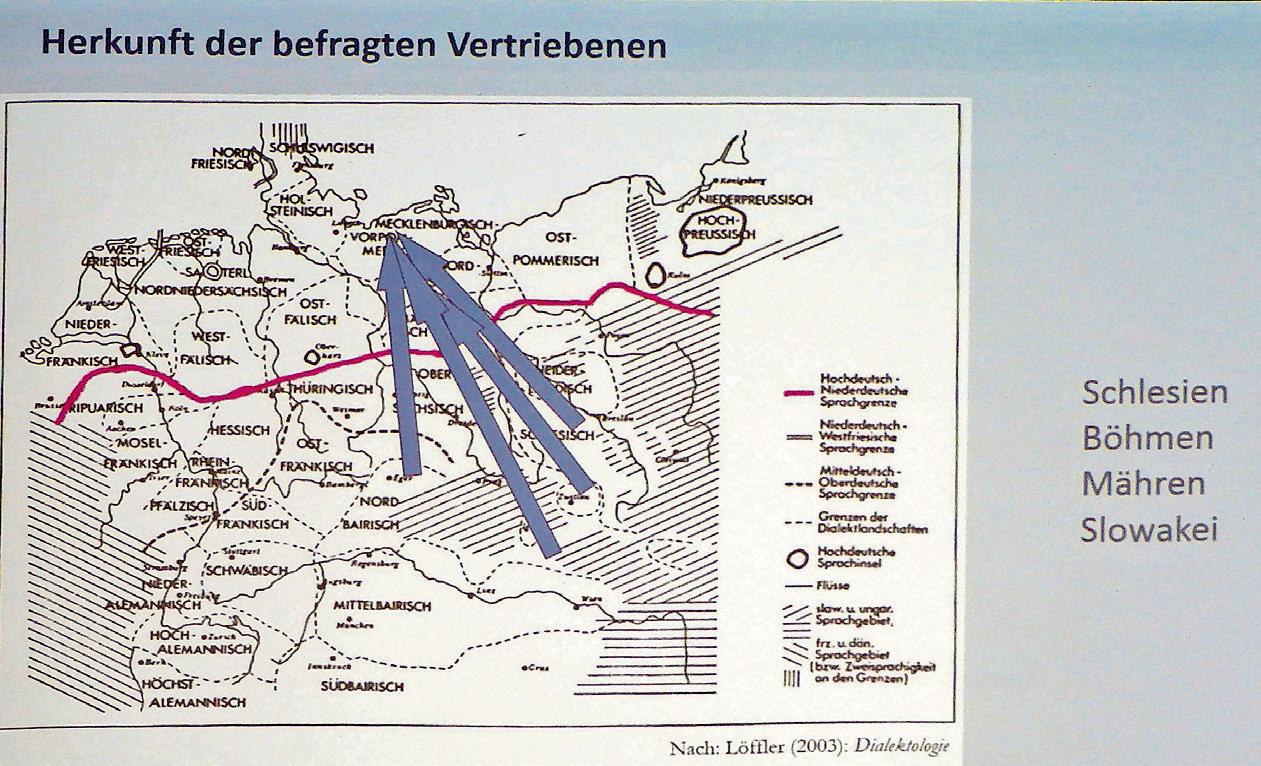
Umfangreiche Zeitzeugenbefragungen in der Umgebung der 5200 Seelen zählenden Kleinstadt Schwaan im Kreis Rostock
� Vortrag im Sudetendeutschen Haus
Man wullt ouck so räden
te erreicht, um durchgeführt werden zu können. Deren dialektale Sprachkompetenz sei in ihrer Selbsteinschätzung und durch einen objektiven „Übersetzungstest“ vom Hochdeutschen in das Plattdeutsche festgestellt worden. „Die meisten vertriebenen Gewährsleute hatten bis 1950 gut Niederdeutsch gelernt.“ Die Erwerbskontexte seien etwa der Kommunikationsbedarf im Schulunterricht oder bei Einheirat in Einheimischenfamilien gewesen. Speziell in der damaligen „SBZ/DDR“ sei den Vertriebenen Gruppenbildung verboten gewesen, was für größere Kontakte mit den Einheimischen gesorgt habe. Auch hätten die Einheimischen besonders auf dem Land oft gar nicht Hochdeutsch sprechen können, was die Zuzügler dazu gezwungen habe, den niederdeutschen Dialekt zu erlernen, auch um so leichter die Versorgung mit Resourcen sicherzustellen. Auch eine gewünschte Gruppenzugehörigkeit habe zu den Motiven gezählt, so Ehlers, der eine Gewährsperson zitiert: „Man wullt äben ouk so räden wi hei räden deit dort, ne?“
in Mecklenburg-Vorpommern zeigten dagegen ein anderes Bild. Viele der Zuwanderer hätten sich schnell sprachlich an ihr neues Sprachumfeld angepaßt, indem sie das mecklenburgische Niederdeutsch erlernt und gesprochen hätten. Ehlers untersuchte den Umfang des Niederdeutsch-Erwerbs bei Vertriebenen und beleuchte-
te die Rahmenbedingungen und Motive für das Erlernen des niederdeutschen Dialekts. „Grundlage der Untersuchung sind 90 Zeitzeugeninterviews und Sprachtests, die 2010 bis 2015 durchgeführt wurden.“ Seine Ergebnisse seien inzwischen auch neben anderen Themen in der gerade erschienenen zweibändigen Geschichte der mecklen-
burgischen Regionalsprache seit dem Zweiten Weltkrieg ausgewertet worden. Sein Forschungsprojekt „Sprachwandel in den Zuwanderungsgebieten von Flucht und Vertreibung. Sprachgebrauch und Sprachwahrnehmung bei Alteingesessenen und immigrierten Vertriebenen in Mecklenburg seit 1945“ bearbeitete
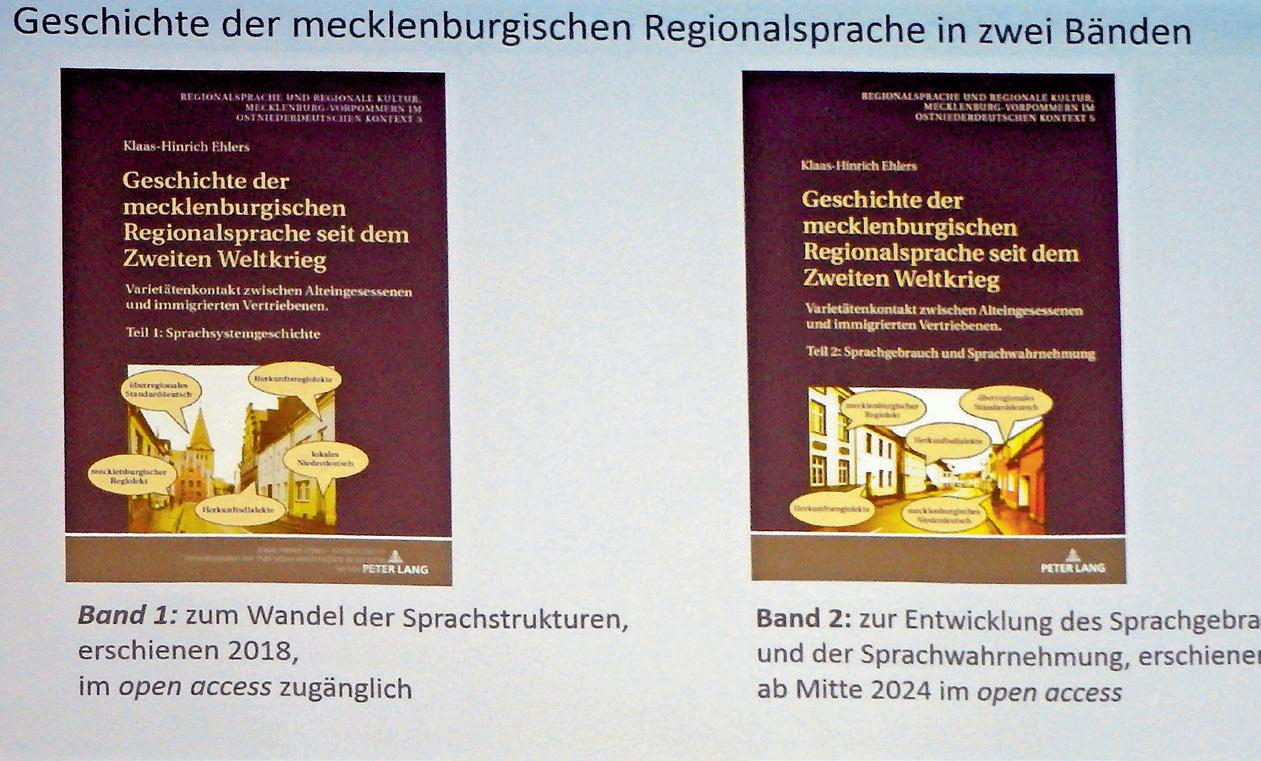
Ehlers von 2020 bis 2022 am Collegium Carolinum. Die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderte Untersuchung schließt thematisch an zwei frühere Projekte an, die ebenfalls am Collegium Carolinum angesiedelt waren.
Das Projekt hatte damals noch genug ältere Gewährsleu-
Ehlers reümierte: „Das Niederdeutsche war wegen seiner sozialsymbolischen und pragmatischen Funktionen für die Immigranten eine attraktive Zielsprache!“ Eine lebendige Diskussion mit den Zuhörern schloß sich an. Einige wiesen darauf hin, daß ähnliche Dialektübernahmen auch in anderen ländlichen Regionen Deutschlands stattgefunden hätten. Susanne Habel
Das 27. Bohemistentreffen des Collegiums Carolinum (CC) konnte wieder analog im Sudetendeutschen Haus stattfinden. Die jährliche Informationsbörse richtet sich an alle, die ein fachliches Interesse an böhmischmährischen oder tschechischen und sudetendeutschen sowie slowakischen Forschungen haben.
Ich freue mich, alle zur Eröffnung des Bohemistentreffens beegrüßen zu können“, strahlte Martin Schulze-Wessel. Der Vorsitzende des Collegiums Carolinum (CC) war auch erfreut über das rege Interesse der Teilnehmer an Forschung und Gedankenaustausch an den böhmischen und slowakischen Ländern und begrüßte die meist jungen Teilnehmer und Wissenschaftler.
In der ersten Themenrunde mit Moderatiorin Marion Dotter ging es um „Adlige, Philantropinnen, Künstlerinnen“. Dazu referierte Constanze Köhn über „Adelige Mentoren von Oratiorenaufführungen in Wien 1780–1810“. Im Zentrum stand die „Gesellschaft der associierten Cavaliers“, in der sich überwiegend hohe Aristokraten um den Staatsbeamten Gottfried Freiherr van Swieten (1733–1803) sammelten, die sich der Oratorienpflege widmete. Magdalena Eriksröd-Buerger behandelte im Vortrag über „Akteurinnen im Prager Kunstbetrieb 1918–1938“ diesen wichtigen Aspekt der neueren feministischen Kunstgeschichte.
Die Vorstellung von neuen Institutionen oder Internet-Portalen moderierte CC-Mitarbeiterin Christiane Brenner. Vojtěch Kessler und Veronika Krišková aus Prag stellten ihre neue „Datenbank für Alltagsgeschichte“ vor. Ziel des Projekts ist, eine systematische dokumentarische Sammlung von alten Memoiren, Familienchroniken,
Künstlerinnen und Buchhändler
Tagebüchern und anderen biographischen Erinnerungen in tschechischer und deutscher Sprache zu erstellen, die sich auf die Geschichte der böhmischen Länder beziehen sowie diese Daten online zur Verfügung zu stellen und so Historikern bei ihrer Arbeit an der zeitgenössischen und modernen Geschichte zu helfen.
Danach folgte die Kurzvorstellung der 28 eingereichten Forschungs-Exposés, die im Internet zugänglich sind und heruntergeladen werden können: www.collegium-carolinum.de/ veranstaltungen/bohemisten-treffen/ 27-bohemisten-treffen#c3508.
Besonderes Interesse verdiente dabei sicher auch die im kommenden Oktober in Reichenberg/Liberec geplante Tagung über Otfried Preußler, die vom Adalbert-Stifter-Verein in München
und der Akademie der Wissenschaften in Prag veranstaltet werden wird. Nach der Mittagspause ging es als zweiten Themenschwerpunkt mit Moderatorin Martina Niedhammer um Handel mit Waren wie Büchern und gefangenen Menschen. Der Vortrag von Mona Garloff (Innsbruck) beschäftigte sich mit dem „Prager Buchhandel zwischen obrigkeitlicher Regulierung und inoffiziellen Vertriebswegen 1680–1750). Damals seien die Lizenzen zum Buchvertrieb stark abhängig von der Konfessionszugehörigkeit gewesen. Eine herausragende Verlegerpersönlichkeit war zum Beispiel von Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738).
Neben der Schließung der Privatdrukkerei des Reichsgrafen aus Böhmen seien mehrmals dessen Bibliotheksbestände konfisziert worden. Erhalte-
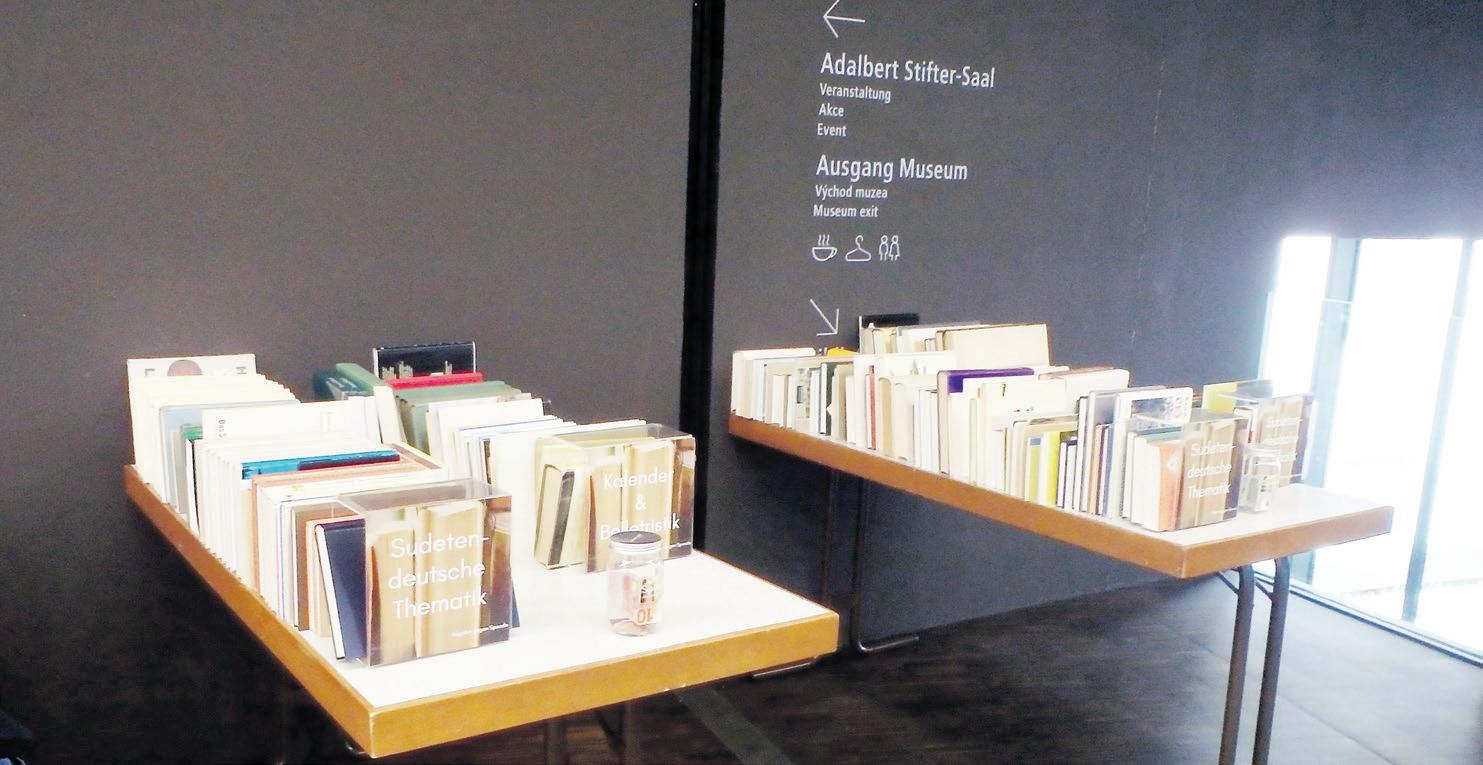
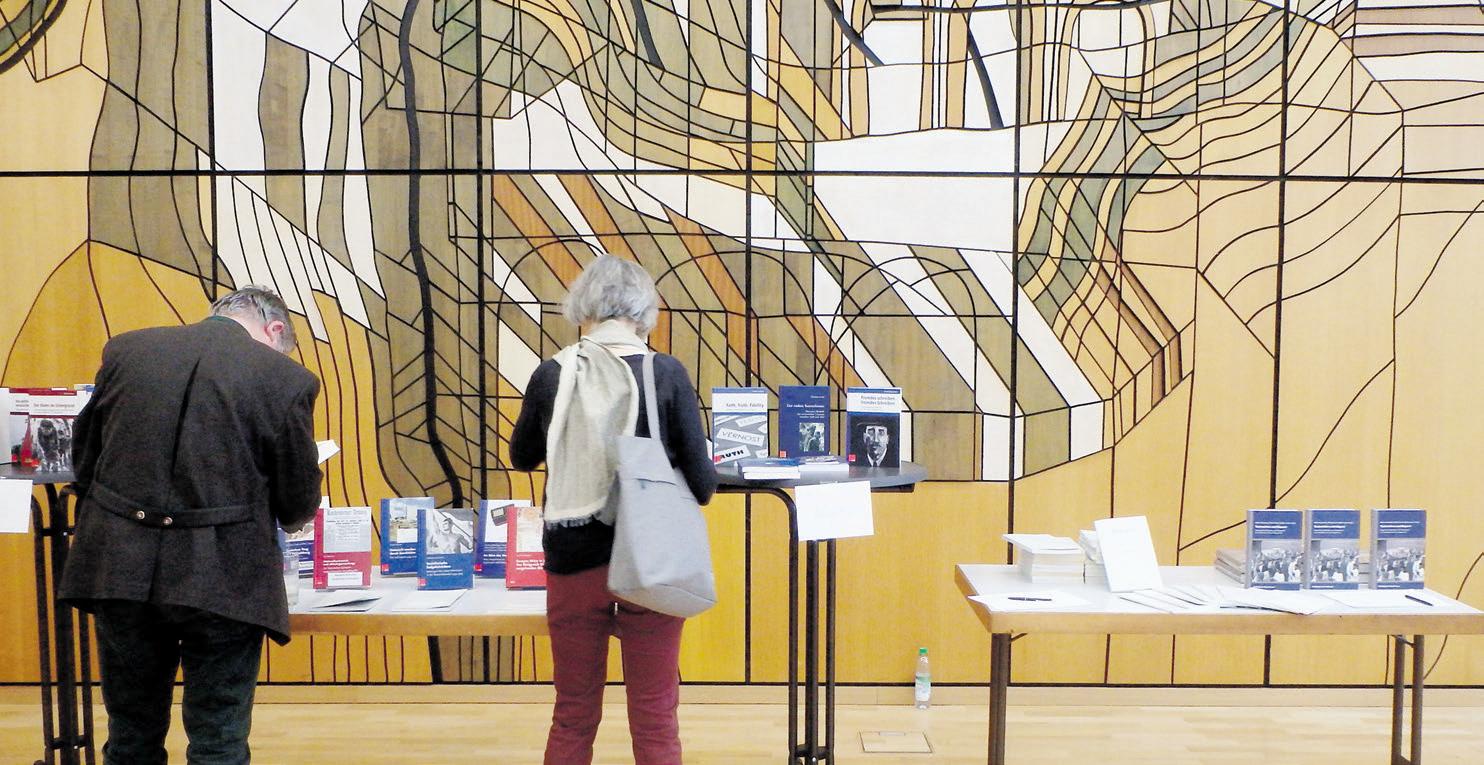
ne Zensurlisten würden gut Aufschluß über den Buchbesitz und Wissenshorizont Sporcks geben.
Der Vortrag von Štefan Szalma (Preßburg) über „Prisoner Trade in the Hungarian-Ottoman Borderland (17th century)“ mußte leider entfallen wie schon zuvor der Vortrag von Michaela Žáková (Prag) über „Philanthropinnen mit blauem Blut“ über die adeligen Wohltäterinnen in der Habsburgermonarchie.
Der dritte Themenschwerpunkt, bei dem Johannes Gleixner moderierte, betraf „Gewalt, Nation und Status“. Dabei sprach David Smrček (Prag/Wien)
über „Street Politics and Collective Violence in Cisleithania in 1897“ über die „Badeni-Krawalle“ nach der „Badenischen Wahlrechtsreform und der Badenischen Sprachenverordnung“ in
der Habsburgermonarchie, die im Jahr 1897 veröffentlicht wurde.
Claire Morelon (Florenz) referierte über „Backlash against Democratization: Social Order and Public Space in the Bohemian Lands 1890–1914“. Diese Zeit sei in den Böhmischen Ländern geprägt gewesen von zunehmenden nationalen Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen sowie zahllosen Demonstrationen der Sozialdemokraten und heftigen Streiks.
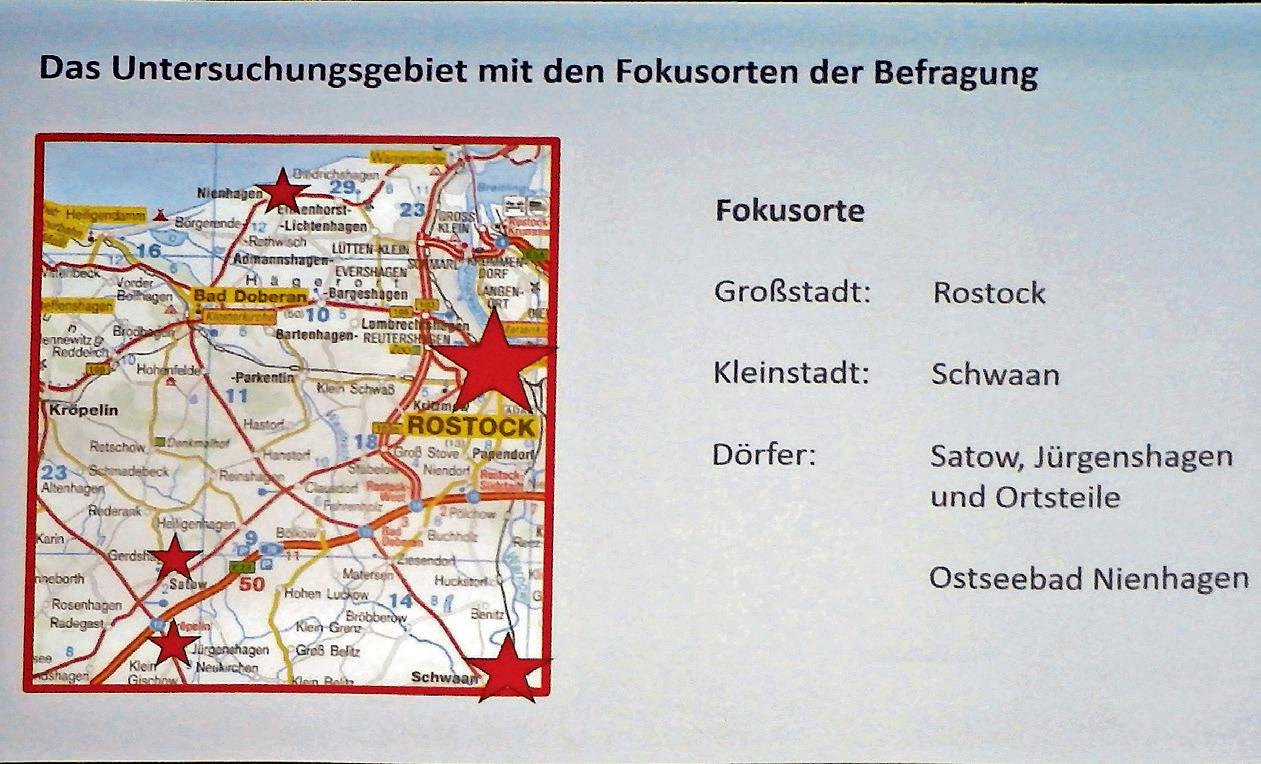
Jesse Siegel (New Brunswick in New Jersey, USA) hielt einen Vortrag über „German-Czechoslovak Businessmen in the European Market 1918–1948“. Seine Forschungen betrafen das „Deutschtum“ der Zwischenkriegszeit.
Besonders durch die internationalen Referenten wurde wieder anschaulich klar, wie weltweit breit gestreut das große Interesse am jährlichen Bohemistentreffen des Collegiums Carolinum in München ist.
Nach dem Ende der Veranstaltung traf man sich wie immer zum Ausklang in einem Münchener Bräuhaus.
Susanne Habel
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 8
Privatdozent Dr. Klaas Hinrich Ehlers zeigt Grafiken zu seinem Vortrag.
Privatdozent Dr. Klaas Hinrich Ehlers. Rechts: Professor Dr. Martin Schulze Wessel (mit Mikrofon) fragt aus dem Publikum nach Details zum Vortrag. Bilder: (2) Susanne Habel
� 27. Bohemistentreffen in München
Neuerscheinungen des CC im Adalbert-Stifter-Saal und Dubletten der Wissenschaftlichen Bibliothek
Mitnehmen
Spenden im Foyer. Bilder: Susanne Habel
zum
gegen
Ein besonderes Frauenporträt stand am Vorabend des Weltfrauentages beim Kulturzoom der Ackermann-Gemeinde im Mittelpunkt. Tina Stroheker, die im baden-württembergischen
Eislingen seit 1983 beheimatete Schriftstellerin, Herausgeberin und Initiatorin literarischer Projekte, las Passagen aus ihrem Buch „Hana oder Das böhmische Geschenk“ bei dem Kluturzoom, zu dem 56 PCs zugeschaltet waren.
In dem Buch geht es um die im Jahr 2019 mit 67 Jahren verstorbene Hana Jüptnerová aus Hohenelbe/Vrchlabí, eine in der Tschechischen Republik hochgeachtete Dissidentin, Deutschlehrerin, engagierte Christin und Brückenbauerin zwischen Deutschen und Tschechen.

Daten und Fakten über die Referentin des Kulturzooms lieferte Moderatorin Sandra Uhlich. Die Verständigung mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa sei ein zentrales Anliegen der Schriftstellerin. So sei Stroheker auch Gastschreiberin im polnischen Lodz gewesen und bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden – unter anderem 2017 mit dem AndreasGryphius-Preis und 2022 mit dem Heinrich-Schickhardt-Kulturpreis der Stadt Göppingen. Das Buch „Hana oder Das böhmische Geschenk“ nannte Uhlich ein poetisches Porträt einer stillen Heldin. Stroheker hatte Jüptnerová 2015 kennengelernt
� Kulturzoom der Ackermann-Gemeinde über die tschechische Dissidentin Hana Jüptnerová
„Hana war ein wirkliches Geschenk“
und bis zu deren Krebstod vier Jahre später begleitet. „Hana Jüptnerová hat auch im Kommunismus nie ihre Werte aufgegeben“, leitete Uhlich zur Autorin über. „Ohne die Fotos wäre das Buch nicht entstanden“, bekannte Stroheker. Die Bilder stammten sowohl von ihr als auch von Hana Jüptnerová selbst und bildeten schließlich die Aufmacher für die einzelnen Kapitel. Angeregt zum Buchprojekt wurde Stroheker von einer kleinen Ausstellung mit Bildern nach Jüptnerovás Beerdigung. Im Corona-Lockdown 2020 konkretisierte sich das Vorhaben. „Das Buch ist im Prinzip chronologisch aufgebaut von der kleinen Hana bis zum Tod, aber vom Wissen durchdrungen, daß Hana nicht mehr lebt“, erläuterte die Schriftstellerin.
Aktivitäten als Dissidentin
Im ersten Themenkomplex widmete sich Stroheker der Heimat Hanas und ihrer Aktivität als Dissidentin. Hohenelbe wird als eine Stadt mit verschwiegener Vergangenheit beschrieben, kurze Informationen gibt es zum Kinderfoto „Mädelchen“, zur Fa-
milie und zum Studium in Brünn. Im Bild „Gebunden“ ist Hana Jüptnerová bereits als junge alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen zu sehen. Ihr Mann, ein Deutscher, dessen Familie das Land nicht verlassen durfte, hatte sie zu dem Zeitpunkt bereits verlassen. Die Mühen des Alltags in der kommunistischen Tschechoslowakei, die Schatten der Staatssicherheit werden deutlich.
„Nur die Kinder haben sie gebunden“, kommentierte Stroheker die Abbildung.
Im Bild „Laut sprechen“ ist der Trauerzug bei der Beerdigung des aus ihrer Heimatstadt stammenden Dissidenten Pavel Wonka zu sehen, der am 26. April 1988 in der Haft starb. Besonders die Tatsache, daß Jüptnerová stark unter Beobachtung stand, betonte die Autorin. „Festtag“ heißt dagegen das Bild, das Hana Jüptnerová mit Staatspräsident Václav Havel zeigt – nach der Samtenen Revolution bei einem Redeauftritt Havels in Traute-
nauim Januar 1990. „Eine strahlende junge Frau, es gab nur Freude“, kommentierte Stroheker diese Aufnahme und verwies zugleich auf Veränderungen im
Privatleben Jüptnerovás. Sie wandte sich verstärkt der Familie, dem Glauben sowie der Versöhnung von Deutschen und Tschechen zu. Mit dem Bild „Licht“, das den Blick auf eine renovierte Kirche im Riesengebirge zeigt, beschrieb die Autorin die Bereitschaft Hana Jüptnerovás, „sich von etwas Größerem ergreifen zu lassen“.
Den zweiten großen Themenkomplex umschrieb die Schriftstellerin mit „Abenteuer“, was für Hana Jüptnerová vor allem die Vergrößerung der Familie mit drei Pflegekindern war. Diese Aufgabe war mit damals 45 Jahren natürlich überaus fordernd, anstrengend und ermüdend – sehr deutlich im Foto „Küchenchefin“ zu erkennen.
Schließlich nahm die deutsch-tschechische Versöhnung einen immer größeren Stellenwert in ihrem Leben ein. Das ist der dritte große Themenbereich, auch vor dem Hintergrund und der Geschichte ihrer Heimatstadt. Der Satz „Kde
domov můj?“/„Wo ist meine Heimat?“ aus der tschechischen Nationalhymne, steht unter einem Bild Richtung Riesengebirge. Und Tina Stroheker läßt ihre Freundin Hana Jüptnerová auch über die Deutschen meditieren. Konkret wird dies exemplarisch an dem Bild „Und alles war einst Hackelsdorf“. Jüptnerová betätigte sich nun unter anderem als Dolmetscherin und Organisatorin von Reisen, unterstützte Renovierungen von Gebäuden und positionierte sich eindeutig zur Vertreibung der Deutschen. „Ich spreche nicht von der deutschen Schuld, auf mir liegt die Schuld meines Volkes“, zitierte Stroheker ihre Freundin. Der letzte Themenkomplex widmete sich dem „Leben und Sterben“. Zunächst kamen noch einige Fotos aus dem Alltagsleben wie „In die Hagebutten“, das das Pflücken und Aufbereiten von Nüssen und Früchten zeigt. „Erster Advent“: die erste Adventskranzkerze humorvoll in Form der Flammen eines der vier Platten des Gasherds. Oder die Teilnahme an der LGBT-Pride-Parade in Prag im Jahr 2018, wo sie sich im Nachklang für die Ehe für alle einsetzte. Im Januar 2019 kam die Diagnose einer aggressiven Krebserkrankung, an der sie am 7. Oktober 2019 starb. Auch diese Monate des Leidens finden sich mit mehreren Bildern und Gedanken dazu in Strohekers Buch.
Moderatorin Uhlich würdigte zusammenfassend Hana Jüptnerová als Vorbild sowie als Ideen- und Ratgeberin. „Hana war ein wirkliches Geschenk“, faßte Autorin Stroheker zusammen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Markus Bauer
Tina Stroheker: „Hana oder Das böhmische Geschenk“. Kröner Verlag, Stuttgart 2021; 160 Seiten, 67 Abbildungen, 24 Euro. (ISBN 978-3-520-75901-6)
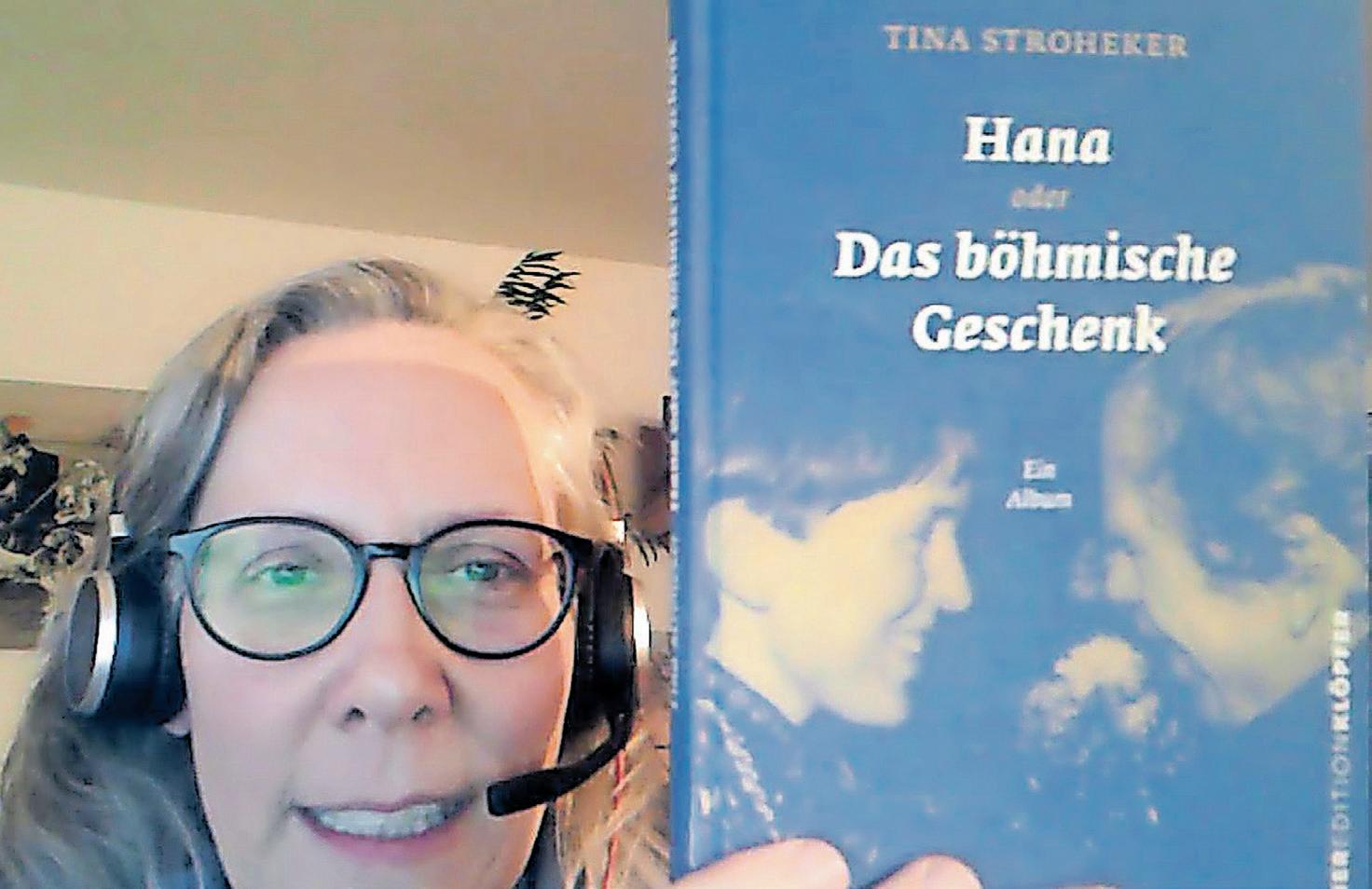
Demnächst tritt das deutschböhmische Kammermusikduo
„Duo Connessione“ aus Carina Kaltenbach-Schonhardt an der Violine und SL-Musikpreisträger Tomáš Spurný am Klavier bei einem Konzert in Heidelberg auf. Das Duo bietet von Joseph Haydn „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ (Hob XX:2) in der Fassung für Violine und Klavier. Dazu liest Sonja Hofmann Texte von Angelus Silesius.

Bei der musikalischen Passionsandacht kommt das Werk
„Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn zur Aufführung: Haydn hatte den Zyklus 1786 als reines Orchesterwerk komponiert. Der Auftrag war aus Spanien gekommen, von einem Domherrn aus Cádiz, der bei dem seinerzeit berühmtesten Sinfoniker Europas eine Meditationsmusik für die Passions-Exerzitien in der Kapelle Santa Cueva bestellt hatte. Die einzelnen Sätze sollten gleichsam als Kommentare der von der Kanzel verlesenen Bibelworte dienen. Für diesen Zweck hatte Haydn eine Folge von beinahe ausschließlich langsamen Sätzen geliefert. „Die Aufgabe“, so Haydn später, „sieben Adagios, wovon jedes gegen zehn Minuten dauern sollte, aufeinander folgen zu lassen, ohne den Zuhörer zu ermüden, war keine von den leichtesten.“
So entstand eine der außergewöhnlichsten Instrumentalkompositionen des gesamten 18. Jahrhunderts, und sie entwickelte sich sehr bald zu einem
Die sieben letzten Worte des Erlösers
der bekanntesten Werken von Haydn (Druckausgaben in London, Paris, Wien). Später folgten Bearbeitungen von Haydn für Streichquartett, für Hammerflügel und schließlich eine Fassung für Orchester, Soli und Chor. Mit der Entwicklung des Klavierinstrumentes folgten bald weitere Klavierbearbeitungen von Carl Czerny gegen 1800 und Louis Köhler. Beide Bearbeiter fühlten, daß die Klavierfassung von Haydn den Instrumenten seiner Zeit entspricht, aber nicht der wachsenden Nachfrage nach dem größeren Klang. Es ist reiner Zufall, daß es keine anderen zeitgenössischen Bearbeitungen gibt. Die Musik des Werkes ist so multiinstrumental und zutiefst ausdrucksvoll, daß sie sich auch für andere Instrumentalbesetzungen gut bearbeiten läßt. „Unsere Bearbeitung reflektiert die Entwicklung der Violinsonaten im 18. Jahrhundert wie bei Wolfgang Amadeus Mozart oder Ludwig van Beethoven und basiert auf dem eingehenden Studium aller Fassungen und aller Notenquellen aus der Haydns Zeit“ erläutert Spurný die Interpretation des Duos.
Umrahmt wird die Musik mit Texten Angelus Silesius‘ – eigentlich Johannes Scheffer (1624–1677) –, des bedeutenden schlesischen Lyrikers, Theo-
logen und Arzt. Seine tiefreligiösen, der Mystik nahestehenden Epigramme passen sehr gut zur geistlichen Musik.
Die musikalische Andacht in der Kirche ist ein Teil der Kon-
zertreise des Kammermusikduos „Duo Connessione“. Das deutsch-böhmische Kammermusikduo entstand 2019, nachdem beiden Solisten schon seit 2016 musikalisch zusammenge-
arbeitet hatten. Das Duo konzentriert sich auf Musik des 18. und 19. Jahrhunderts. Außer den berühmten klassischen und romantischen europäischen Komponisten widmet es sich der Wiederentdeckung der vergessenen Komponisten der Klassik und Romantik, sowohl bei Konzerten, als auch bei CD-Editionen.
Besondere Aufmerksamkeit widmet das Duo der böhmischen und deutschen Musik. Die Konzerte und CD-Aufnahmen werden auf modernen sowie auf historischen Musikinstrumenten gespielt. Neben den großen Werke der klassischen Musik bietet das Duo zu besonderen Anlässen auch Salonmusik des 19. Jahrhunderts und Unterhaltungsmusik anderer Genres, wie Klezmer, Tango, Ragtime, Foxtrott, Blues und Irish Folk.
Der Pianist und Musikwissenschaftler Tomáš Spurný wurde 1965 im mittelböhmischen Beraun geboren und wuchs in Strakonitz im Böhmerwald auf. Er studierte Klavier am Prager Konservatorium und Musikwissenschaften an der Karls-Universität in Prag. Nach seiner Spezialisierung auf das Fach Alte Musik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und einem Kirchenmusikstudium trat er bei Festivals und Konzerten im Inund Ausland auf sowie bei vie-
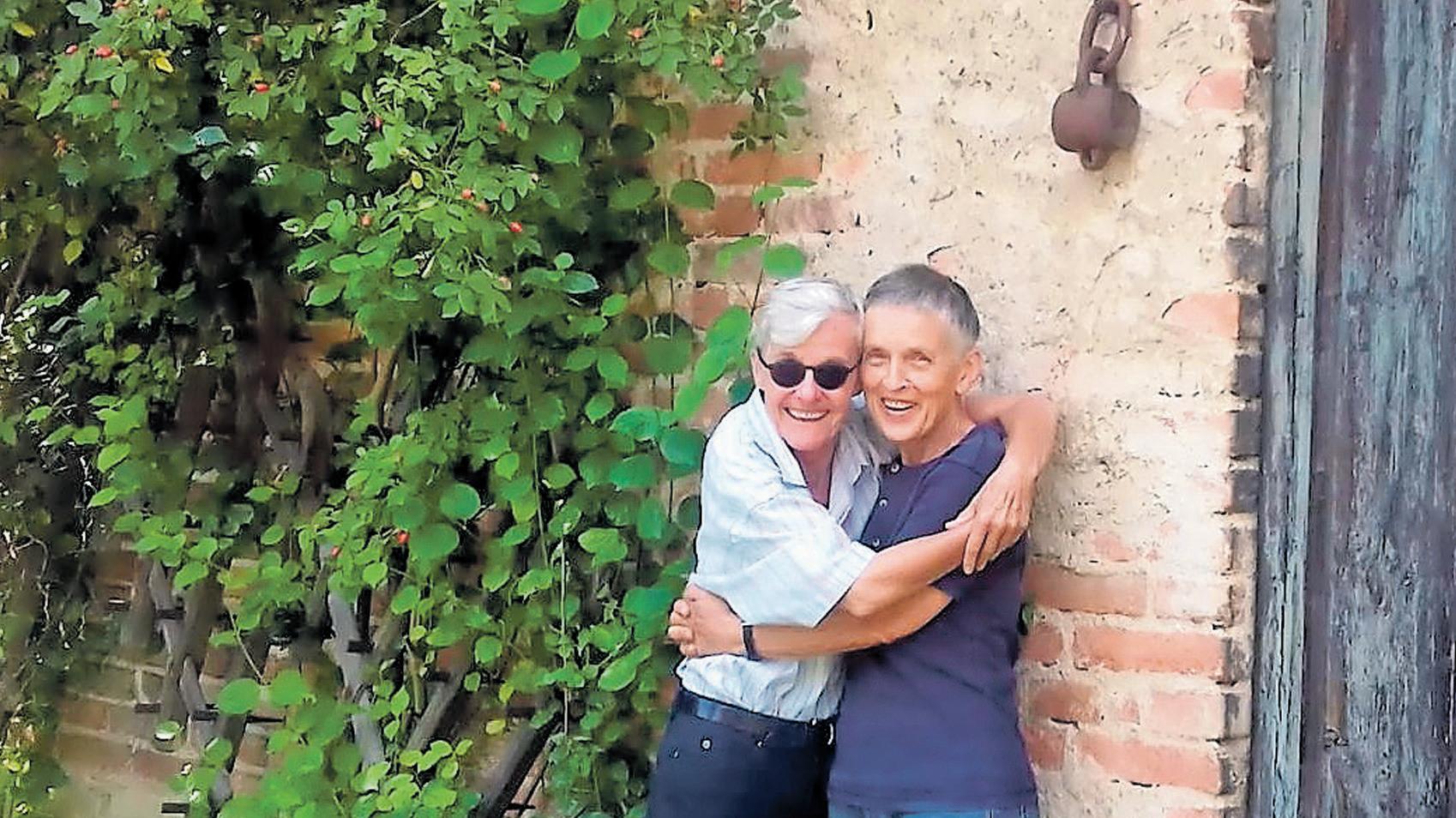
len landsmannschaftlichen Veranstaltungen. 2014 wurde er mit dem SL-Kulturpreis für Musik geehrt. Der Musiker ist in Klassik und Volksmusik zu Hause. Er spielt Klavier und Dudelsack, singt und komponiert und tritt bei vielen Veranstaltungen auf. So erfreute er die Gäste beim Sudetendeutschen Tag 2022 in Hof. Seit 2016 arbeitet er künstlerisch mit der in Freiburg geborenen Geigerin Carina KaltenbachSchonhardt als Kammermusikduo zusammen.
Gemeinsame Auftritte schon seit 2016 Sie absolvierte ein Violinstudium an der Musikhochschule Karlsruhe bei Nachum Erlich, später bei Ulf Hoelscher, welches sie mit dem Konzertexamen abschloß. Später entdeckte sie ihre Begeisterung für die Barockvioline. Sie spielte in den Orchestern des Nationaltheaters Mannheim, der Philharmonie Baden-Baden, der Internationalen Bachakademie Stuttgart und des Karlsruher Barockorchesters. Sie konzertiert in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen und unterrichtet als freischaffende Musikerin in Waldkirch.
Susanne Habel
Samstag, 25. März, 18.00 Uhr: Konzert des Duo Connessione „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“. In Heidelberg-Pfaffengrund, Evangelische Auferstehungskirche, Emmausgemeinde Pfaffengrund, Obere Rödt 11 . Eintritt frei; Spenden erwünscht.
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 9
Konzert zur Passionszeit
Connessione
Carina Kaltenbach-Schonhardt und Tomáš Spurný.
�
mit dem Duo
Moderatorin Sandra Uhlich zeigt das von Tina Stroheker verfaßte Buch. Schriftstellerin Tina Stroheker und Hana Jüptnerová im Jahr 2019.
Tina Stroheker
� BdV-Ortsverein Kleinlinden/Leihgestern/Hessen
März-Gedenken und Wörterbücher
Ganz im Zeichen der Ereignisse am 4. März 1919 stand die Gedenkfeier des hessischen BdV-Ortsvereins Kleinlinden/Leihgestern im Evangelischen Gemeindehaus Kleinlinden.
Monika Schreiter ging auf die Vorgeschichte des 4. März ein. Am 11. November 1918 habe der Erste Weltkrieg geendet, am 28. Juni 1919 sei unter Federführung von Frankreich, Großbritannien und den USA in Versailles der Friedensvertrag geschlossen worden. Das Habsburger Kaiserreich, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn sei auch mit der Abtrennung von Böhmen, Mähren und der Slowakei und einem Teil von Schlesien zerfallen. Das habe die Gründung der ersten Tschechoslowakischen Republik als eigenständigen Staat ermöglicht. Dieser sei ein Vielvölkerstaat mit vielen Nationalitäten wie Tschechen, Slowaken, Deutschen, Ungarn, Polen, Russen und anderen kleinen Gruppen gewesen.
In den mehrheitlich deutsch besiedelten Gebieten, den Randgebieten von Sudetenschlesien im Osten bis ins Egerland und in den Böhmerwald im Westen und den Sprachinseln habe man eine autonome Daseinsform gewollt. Man habe sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen, das USA-Präsident Woodow Wilson als Grundprinzip der Friedensregelung proklamiert habe.
Am 4. März 1919 hätten an mehreren Orten friedliche Demonstrationen für die Zugehörigkeit Deutschböhmens zu Deutschösterreich stattgefunden. Doch tschechisches Militär habe in die Menge geschossen. Am schlimmsten habe es Kaaden getroffen. Insgesamt seien 54 Tote zu beklagen gewesen. Die Opfer des 4. März 1919 hätten keine Entschädigung erhalten, die Täter seien nicht bestraft worden. Mit der Vertreibung nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg hätten die 1000 Jahre Nachbarschaft von Österreichern, Tschechen und Sudetendeutschen geendet.
Vorsitzender Roland Jankofsky sagte, man könne Bücher darüber schreiben, was man sich nicht alles merken könne. „Und so befassen wir uns heute mit einem ganz besonderen Buch, dem ,Sudetendeutschen Wörterbuch‘.“
Eine ideale Überleitung zum Vortrag von Isabelle Hardt. Die Dialektologin an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) stellte die Arbeit an diesem bereits in den 1980er Jahren begonnenen Wörterbuch vor.
� SL-Kreisgruppe und BdV-Kreisverband Groß-Gerau/Hessen
Der heimtückische Nachbar Rußland
Die hessische SL-Kreisgruppe und der BdV-Kreisverband Groß-Gerau begingen Anfang März den Tag des Selbstbestimmungsrechtes im Wallfahrtsort Maria Einsiedel.
Inna Kurlischuk lebte in Luhansk, als Rußland die Krim annektierte und einen Krieg im Osten der Ukraine begann. „Ich konnte nicht glauben, daß im 21. Jahrhundert Panzer aus einem fremden Land durch die Straßen meiner Heimatstadt fahren und Militärflugzeuge am Himmel fliegen.“ Die Stadt mit rund 500 000 Einwohnern beherbergte fünf Universitäten. „Aber nichts hat Putin davon abgehalten, den Krieg zu beginnen.“ Erschütterndes berichtete die Ukrainerin bei der Gedenkfeier.
meister Peter Burger hatte wegen einer Erkrankung nicht kommen können. Er hatte über das formale Recht auf Selbstbestimmung sprechen wollen. Aus Biebesheim war Bürgermeister Thomas Schell gekommen.
Inna Kurlischuk sprach in bewegenden Worten über die Unterdrückung des Rechts auf Selbstbestimmung im ukrainischen Donbaß. Rund sieben Millionen Menschen hätten die Region vor dem Krieg bevölkert.

Sie, Hardt, arbeite an der JLU gemeinsam mit Bettina Hofmann-Käs an diesem von Professor Thomas Gloning herausgegebenen Werk, welches von der Arbeitsstelle Collegium Carolinum München finanziert werde. Bereits seit 1959 stelle die JLU diesem Projekt kostenlos ihre Räume zur Verfügung, während der Freistaat Bayern seit 1985 über das Collegium Carolinum, dem Forschungsinstitut für die böhmischen Länder in München, die Finanzierung gewährleiste.
1988 sei der Band „A“ mit etwa 10 000 Stichwörtern veröffentlicht worden. Von acht geplanten Bänden seien mittlerweile fünf Bände erschienen, der letzte 2018 mit den Buchstaben H, I und J. Jährlich müsse eine 80 Seiten umfassende Lieferung erstellt werden, welche als Nachtrag erscheine. Im vergangenen Jahr sei eine zweite Lieferung zum Band VI von Karbid bis Kauf erschienen.
„In Deutschland gibt es für jede Dialektregion ein Wörterbuch. Manche sind schon lange fertig wie das schwäbische, beim badischen wird gerade der letzte Band erstellt. Die bearbeiten jedoch alle nur einen Grunddialekt. Allen, die keinen sudetendeutschen Ursprung haben, sei gesagt, es gibt nicht den einen sudetendeutschen Dialekt. Die Herausforderung besteht bei diesem Wörterbuch darin, fünf verschiedene Grundmundarten unterzubringen. Bei diesen handelt es sich um Mittelbairisch, Nordbairisch, Ostfränkisch, Obersächsisch und Schlesisch“, gab Hardt einen Einblick in ihre Arbeit.
Angelegt als wissenschaftliches Dialektwörterbuch würden in diesem Berufs- und Gaunersprachen, Pflanzennamen wie auch deutsch-slawische Lehnwortaustausche und Austriazismen aufgenommen, während Flur-, Familienund Hausnamen wie auch ausführliche Erläuterungen über volkskundliche Aspekte keine
Aufnahme fänden. Der „Katze“ sei der bisher längste Wörterbuchartikel gewidmet.
Zur Arbeit hinzugezogen würden bei Wörtern im Hochdeutschen der Duden, manchmal auch das Grimmsche Wörterbuch. Ein großes Problem für die wissenschaftliche Dokumentation sei die Rechtschreibreform in den 1990er Jahren gewesen. Was nun aktuell mit einhergehe mit der Erstellung von Band VI sei die Digitalisierung der bereits erschienenen Bände. Zwischen acht bis zehn Jahre dauere die Arbeit an einem Band. In diesem Jahr solle im Netz eine PDF-Version der ersten fünf Bände eingestellt werden.
Den Hintergrund des Gedenkens erläuterte Hans-Josef Becker in seiner Begrüßung. Er schilderte die Ursachen, die GEschehnisse und die Folgen des 4. März 1919. Wie Becker weiter ausführte, sei das kein nur in die Vergangenheit reichendes Gedenken. Viele Male sei seither das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit Füßen getreten worden. Millionen von Menschen seien unter größten Opfern aus ihrer Heimat vertrieben worden oder hätten fliehen müssen. „Aktuell betrifft dies in besonderer Weise die Menschen aus der Ukraine, die Opfer eines verbrecherischen russischen Massenmörders und seiner Helfershelfer sind.“
Hans-Josef Becker dankte der katholischen Pfarrgemeinde für die Möglichkeit, das Gedenken am Wallfahrtsort zu gestalten. Dieses hatte mit einem Gottesdienst mit Kaplan Maximilian Eichler begonnen. Die musikalische Begleitung besorgten die Violinistinnen Clara Fiedler und Matilda MikowskiBosworth sowie die Musik- und Gesangsgruppe des BdV. Bürger-
Aber: „Meine Heimat hat einen heimtückischen Nachbarn: Rußland.“ Der Donbaß und Rußland seien viele Jahre Freunde gewesen. „Die Ukrainer und Russen hatten gemeinsame Familien und zogen Kinder auf.“ Viele Menschen hätten geglaubt, daß Russen und Ukrainer brüderliche
Die Mutter zweier Töchter berichtete von einer Nacht mit schwerem Beschuß. Da habe ihre elfjährige Tochter sie zu trösten versucht: „Mama, mach dir keine Sorgen, wenn wir schlafen, werde ich immer die Hand meiner kleinen Schwester festhalten. Du mußt wissen, wenn wir im Himmel sind, wirst du uns leicht finden.“ Die Schwester war damals vier Jahre alt. Inna Kurlischuk konnte ihre Töchter retten. „Aber viele Menschen konnten Luhansk nicht mehr verlassen, sie waren Geiseln.“
Kurlischuk berichtete von einem Landsmann im Donbaß, wie er und andere überlebten: „Keine Medizin, kein Licht, kein Wasser, ständiger Beschuß. Wir haben Essen auf dem Feuer ge-
habe ähnliche Zeiten in seiner Geschichte erlebt.
Der Donbaß leide seit 2014 an wirtschaftlichem Ruin, hoher Arbeitslosigkeit und an einer vom Krieg massiv beschädigten Infrastruktur. „Aber das größte Unglück war das gebrochene Schicksal von Tausenden einfacher Menschen. Menschen wie ich und Menschen wie ihr.“ Massive russische Propaganda spreche über die Bedrohung durch die „Faschisten“ aus Kiew, durch die „Faschisten“ aus der NATO, den westlichen Ländern und den USA. „Doch die Bedrohung ging damals wie heute von Rußland aus.“
Die Entscheidung der Ukraine für die Europäische Union sei nicht nach dem Geschmack Rußlands. „Rußlands Ziel ist, die Integration der Ukraine in die Familie der freien Nationen zu verhindern.“ Die gesamte Geschichte der Zivilisation sei jedoch ein Weg zur globalen Einheit zum Wohle der Integrität der Welt. „Länder, Nationen, Völker, Religionen – sie alle haben sich um der Entwicklung und des Fortschritts willen zusammengeschlossen.“
Als ein Prozeß der Komplementarität und der gemeinsamen Entwicklung mache die Integration jedes einzelne Land stärker. „Zu diesem Ziel hat sich mein Land die Werte der Europäischen Gemeinschaft zum Vorbild genommen.“
Kranzniederlegung am Vertriebenenkreuz, einem alten Friedhofskreuz aus Nordböhmen, mit einer Abordnung der Egerländer Gmoi z‘ Kelsterbach und Markus Decker, dem Heimatlandschaftsbetreuer für das Riesengebirge.

Völker seien, daß diese Völker eine Geschichte hätten und eine gemeinsame Zukunft bauten. „Wir haben dieselbe Sprache gesprochen, aber 2014 hat sich gezeigt, daß wir uns nicht verstanden haben.“
� SL-Ortsgruppe Zwiesel/Niederbayern
kocht und Tauben mit der Hand gefangen, um eine Brühe für die Kinder zu kochen.“ Weil Rußland den Donbaß besetzt habe, sei ihre Heimat geteilt. Deutschland verstehe diesen Schmerz mehr als jedes andere Land. Es
Inna Kurlischuk dankte für die Gelegenheit, über ihr Leben und den Schmerz der Ukrainer zu sprechen. „Ich lerne nun seit zehn Monaten Deutsch und kann viele Wörter noch nicht richtig aussprechen. Aber ich weiß, daß Sie mich mit Ihrem Herzen verstehen. Denn in diesem Jahr haben nicht nur die Ukrainer, sondern die ganze Welt erfahren, was für ein großes Herz das deutsche Volk hat.“
Ehrungen und Geschenke
Im Rahmen der Hauptversammlung der niederbayerischen SLOrtsgruppe Zwiesel gedachte die SL-Kreisgruppe RegenViechtach der Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes am
4. März 1919.
Christian Weber, in Personalunion Orts-, Kreis- und Bezirksobmann, konnte zahlreiche Mitglieder der Ortsgruppe begrüßen. Besonders freute er sich, daß die Ortsobmänner Arnulf Illing von Viechtach, Michael Fremuth von Ruhmannsfelden und Fritz Pfaffl von Regen zur Versammlung gekommen waren. Nach der Begrüßung gedachte Weber der Toten. Man gedachte der verstorbenen Sudetendeutschen und derjenigen, die im Zuge der Vertreibung ihr Leben verloren.
In einer kurzen Ansprache wies Weber darauf hin, daß natürlich die Vertreibung der drei Millionen Sudetendeutschen aus der Heimat ein einschneidendes schmerzhaftes Erlebnis gewesen sei. Viele hätten Mißhandlungen erlebt, nicht wenige seien ermordet worden. Man sei sehr dankbar, daß viele Sudetendeutsche in Bayern dank der einheimischen Bevölkerung ein neues Zuhause hätten finden dürfen. Stolz seien sie aber auch auf die kulturellen Leistungen ihrer Vorfahren in der Heimat. Im 12. und 13. Jahrhundert seien ihre Vorfahren von böhmi-
schen Herzögen und Königen als Bauern, Bergleute, Handwerker, Kaufleute und Künstler ins Land gerufen worden, um vor allem die bis dahin nur sehr dünn besiedelten Randgebiete von ihnen erschließen und kultivieren zu lassen. Wenn man heute durch die Heimat fahre, könne man das von ihren Vorfahren Geleistete bewundern. Als Beispiele seien
rin Pfaffl und Manfred Schwarz für 40 Jahre Treue. Nach dem Tätigkeitsbericht des Ortsobmanns berichtete Schriftführerin Karin Pfaffl von den Aktivitäten der Ortsgruppe. Kassiererin Rosemarie Wolf wurde nach ihrem Bericht von den Kassenprüfern Karin und Fritz Pfaffl einwandfreie Arbeit bescheinigt. Weber, der seit nun 19 Jahren die Orts-
benendenkmal gespendet und das ganze Jahr über Kerzen angezündet würden. Es erging ein herzliches Dankeschön an Jürgen Steyer aus Rabenstein und Rudolf Gadamer aus Zwiesel. Anne Marie Rimpler ließ dem Ortsobmann Weber einen Bierkrug von den deutschen Gesangsvereinen aus dem 19. Jahrhundert zukommen. Damit soll Webers Arbeit für die Heimat gewürdigt werden. Vom Ehepaar Barysch erhielt Weber ein Schnupftabakglas mit der Abbildung von Andreas Hartauer, dem Schöpfer des Böhmerwaldliedes. Weber freute sich sehr über die Geschenke und dankte der Familie Rimpler und dem Ehepaar Barysch.
stellvertretend die wunderbaren Städte Reichenberg, Karlsbad und Krummau genannt. Auch heute geschähen wieder Flucht und Vertreibung. Viele Flüchtlinge kämen heute aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan. Flucht und Vertreibung seien auch heute noch aktuell.
Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. Hans Buchinger und Christine Neubert für 25, Katharina Bauernfeind, Franz Weishäupl und Martha Kagerbauer für 30, Ka-
gruppe Zwiesel leitet, dankte allen Mitgliedern des Vorstandes.
Diese sind Vize-Ortsobmann
Fritz Pfaffl, Schriftführerin Karin Pfaffl, ihr Stellvertreter Fritz Pfaffl, Vermögensverwalterin Rosemarie Wolf, ihr Stellvertreter Horst Wolf, die Kassenprüfer Karin und Fritz Pfaffl sowie die Ausschußmitglieder Karl Fleißner, Agathe Rademacher, Harald Steiner und Anne Weber.


In der Aussprache wurde darauf hingewiesen, daß regelmäßig Blumengestecke für das Vertrie-
Nach einer kurzen Pause wurde das traditionelle Gedenken an den 4. März 1919, der sich dieses Jahr zum 104. Mal jährte, gemeinsam durch die Ortsvorsitzenden Arnulf Illing, Fritz Pfaffl und Christian Weber abgehalten. Gedacht wurde der 54 sudetendeutschen Opfer, die sich nach dem Ersten Weltkrieg für das Selbstbestimmungsrecht eingesetzt und dabei ihr Leben gelassen hatten.
Im Rahmen der Veranstaltung kam traditionell das Musikalische nicht zu kurz. Gemeinsam sang man die Lieder „Die Gedanken sind frei“, „Kein schöner Land“ und „Tief drin im Böhmerwald“, die Anne Weber auf ihrer Flöte begleitete. nr
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 10
Inna Kurlischuk
Ortsvorsitzender Roland Jankofsky, Monika Schreiter, Isabelle Hardt und der Vorsitzende des BdV-Kreisverband Wetzlar, Kuno Kutz. Bild: Thomas Wißner
Arnulf Illing, Karin Pfaff, Dr. Christian Weber, Hans Buchinger, Fritz Pfaffl und Hubert Buchinger.
� SL-KG Nürnberg
Auf der Suche nach dem Sohn
Anfang März gedachte die mittelfränkische SL-Kreisgruppe Nürnberg am VertriebenenDenkmal auf dem Nürnberger Hallplatz der Ereignisse des 4. März 1919 im Sudetenland. Gedenkredner war Bezirksobmann Eberhard Heiser.
Erich Ameseder, Ursula Schüller-Voitl und Peter Schlegel von der SL-Kreisgruppe Nürnberg hatten das Gedenken organisiert. Ameseder, Hoffnungsträger für das Amt des zukünftigen Kreisobmannes von Nürnberg, begrüßte die Gäste, darunter die Stadträte Andreas Krieglstein, der Oberbürgermeister Markus König vertrat, und Gerhard Groh sowie die Stadträtinnen Andrea Friedel und Natalie Keller. Krieglstein sprach auch im Namen der anderen Volksvertreter ein wohlwollendes Grußwort. Zunächst erinnerte Eberhard Heiser an die den Landsleuten bekannten Ereignisse in Kaaden, Sternberg, Karlsbad, Arnau, Eger, Mies und Aussig. Dann berichtete er über eine themenbezogene, verwandtschaftliche Begebenheit. Heisers Onkel, seinerzeit Student an der Lehrerbildungsanstalt Eger, habe als 19jähriger an der Kundgebung für das Selbstbestimmungsrecht seiner Volksgruppe in Eger teilgenommen. Bei der Schießerei der tschechoslowakischen Miliz habe ihn ein Streifschuß am Arm verletzt. Er sei aus Furcht vor einer Verhaftungswelle mit einem Kommilitonen ins Erzgebirge geflohen.
Nachdem der Leichtverletzte einige Tage nach den schrecklichen Ereignissen nicht zu Hause erschienen sei, hätten seine Eltern alle umliegenden Krankenhäuser abgeklappert – erfolglos. Sie hätten befürchtet, ihr Sohn sei ums Leben gekommen, die Zahl der Todesopfer sei noch nicht genau ermittelt worden. Die noch lebende, 90jährige Tochter habe berichtet, daß die besorgten Eltern ihres Vaters das Schlimmste befürchtet und prophylaktisch eine Todesanzeige aufgesetzt hätten. Doch dann sei ihr Sohn glücklicherweise mit leichter Blessur nach Hause gekommen.
Heiser berichtete auch über die falschen Angaben Edvard Benešs vor dem Komitee der sogenannten Friedensverhandlungen in Saint Germain. Beneš habe eine Million weniger Sudetendeutsche im Hoheitsgebiet der Tschechoslowakei angegeben, behauptet, es gebe kaum geschlossene, zusammenhängende deutsche Siedlungsgebiete in den Sudetengebieten, und versprochen, nach dem Schweizer Vorbild einen Staat zu gründen, in dem alle Minderheiten gleiche Rechte und eine gewisse Autonomie erhielten.
Laut Reglement der Friedenskonferenz hätten alle Nationalitäten der zerschlagenen Donaumonarchie über die Gründung eines eigenen Staates oder alternativ, sich einem ihnen genehmen Staat anzuschließen, selbst zu entscheiden.
Zu den Worten im Gedenken an die Märzopfer und die Schrekken in der Ukraine blies ein Trompeter „Der gute Kamerad“. Nach der Kranzniederlegung am Denkmal endete die Veranstaltung mit den Worten: „Wir grüßen unsere verlorene, sudetendeutsche Heimat.“ dr
Mitden Stellvertretenden Aichacher Bürgermeistern Josef Dussmann und Brigitte Neumeier, Altbürgermeister Hans-Dieter Kandler aus Mering, Stadtrat Raimund Aigner und Obmann der SL-Kreisgruppe Aichach-Friedberg, Ernst Wollrab, gedachte die bayerisch-schwäbische SL-Ortsgruppe Aichach am Gedenkkreuz der Heimatvertriebenen auf dem Alten Friedhof der Opfer des 4. März 1919. Auf Bitten von SL-Ortsobmann Gert-Peter Schwank würdigte Altlandrat Christian Knauer die 54 Opfer, die bei ihren friedlichen Protesten gegen die Eingliederung ihrer Gebiete in die neue Tschechoslowakei und für den Verbleib bei Österreich von tschechischem Militär erschossen worden waren. Das Erinnern an die Opfer sei erneute Motivation zum engagierten Einsatz für Recht und Freiheit aller Menschen und Völker. Ein Trompetenduett bot den musikalischen Rahmen. Als äußeres Zeichen der Verbundenheit wurde eine Blumenschale niedergelegt. Text und Bild: Susanne Marb

� SL-Kreisgruppe Fulda/Hessen
Die Rolle von Archibald Cary Coolidge
Die hessische SL-Kreisgruppe Fulda gedachte Anfang März in der Frauenberganlage der Opfer des 4. März 1919 im Sudetenland.
Man gedenke der 54 Toten, sagte Fuldas SL-Kreisobmann Rudolf Bauer bei der Eröffnung und erinnerte an die geschichtlichen Hintergründe. Gedenkredner Reinfried Vogler war lange Jahre Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung. Er ging ebenfalls auf die geschichtlichen Zusammenhänge der Ereignisse des 4. März 1919 ein, unter anderem wies er darauf hin, daß die neu ausgerufene Tschechoslowakische Republik bereits die sudetendeutschen Gebiete militärisch

besetzt habe, lange bevor vom Friedensvertrag von Saint Germain festgelegt worden sei, ob
� SL-Ortsgruppe Rückersdorf/Mittelfranken
Spaziergang durch den Frühling
Anfang März traf sich die mittelfränkische SL-Ortsgruppe Rückersdorf im Schmidtbauernhof.

Gedenkredner Reinfried Vogler


dieses Gebiet überhaupt zu diesem neuen Staat gehören solle. Die Sudetendeutschen, die zu den von allen sudetendeutschen Parteien ausgerufenen Demonstrationen gekommen seien, hätten damit deutlich machen wollen, daß sie im Vertrauen auf das von USA-Präsident Woodrow
Rechts BdV-Kreis- und -Landesvorsitzender Siegbert Ortmann.
� BdV-Kreisverband Lauterbach/Hessen
Mißachtung
Am 4. März veranstaltete der hessische BdV-Kreisverband Lauterbach auf dem Friedhof in Lauterbach eine Gedenkveranstaltung anläßlich des Tages der Selbstbestimmung.


An diesem Tag im Jahre 1919 wurden bei friedlichen Demonstrationen im Sudetenland 54 Menschen von tschechischem Militär getötet und über 100 Personen schwer verletzt. Anlaß für die Demonstrationen war die am 4. März 1919 stattfindende Eröffnungssitzung der konstituierenden Nationalversammlung Deutsch-Österreichs in Wien, an der die deutschen Vertreter aus Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien auf tschechoslowakische Anordnung nicht teilnehmen durften. Nach dem Zusammenbruch der Habsburger Donaumonarchie nach dem Ersten Weltkrieg forderten nämlich die Sudetendeutschen eine Angliederung an die Republik Deutsch-Österreich.
Nach dem Willen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs wurde das Sudetenland jedoch gegen den Willen der Bevölkerung der damals neu entstandenen Tschechoslowakischen Republik zugeschlagen. Damit wurde das von USA-Präsident Woodrow Wilson zuvor proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker grob mißachtet. Und so kam es am 4. März 1919 zu einem Generalstreik, verbunden mit friedlichen Demonstrationen im Sudetenland, was mit Waffengewalt beendet wurde. Für die Sudetendeutschen wurde dieser Tag zum Tag des Selbstbestimmungsrechts. Siegbert Ortmann
Wilson in dessen 14 Punkten proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker ihre Abgeordneten in die Nationalversammlung der Republik Deutschösterreich hätten senden wollen, was von der Tschechoslowakischen Republik unterbunden worden sei. Vogler ging auch noch auf die Rolle von Professor Archibald Cary Coolidge als Mitglied der USADelegation bei den Friedensverhandlungen ein. Ebenso zeigte er, daß Edvard Beneš die Verhandlungspartner bei den Pariser Vorortverträgen über wesentliche Fakten, zum Beispiel über den Umfang der deutsch besiedelten Gebiete in Böhmen und Mähren, täuschte.
� SL-Altkreis Schlüchtern/Hessen
Rebellen
Zum Gedenken an die Märzgefallenen von 1919 legte eine Abordnung der hessischen SL-Kreisgruppe Schlüchtern am Vertriebenenkreuz oberhalb von Elm ein Gebinde nieder.
Alt-Kreisobmann Walter Weber sprach in Vertretung des erkrankten Roland Dworschak ehrende Worte. Die Delegation beendete das kurze Gedenken mit einem Vaterunser und dem Feierabendlied von Anton Günther. Anschließend trafen sich etwa 30 SL-Mitglieder im Hotel Stadt Schlüchtern, wo Gernot Strunz im Beisein von Landesobmann Markus Harzer die Gedenkansprache hielt.
Am 4. März 1919, so Strunz, habe tschechisches Militär in mehreren Städten des Sudetenlandes in die friedlich für ihr Selbstbestimmungsrecht demonstrierende Menge geschossen. 54 Tote seien zu beklagen. Die Schützen seien nie ermittelt worden.
Strunz wies darauf hin, daß schon am 3. November 1918 tschechische Truppen das deutsch besiedelte Gebiet in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien besetzt hätten. Damals habe der Chauvinismus Raum gegriffen, beispielsweise als eine Delegation der Deutschböhmen in Prag vom tschechischen Finanzminister Alois Rasin mit den Worten empfangen worden sei: „Mit Rebellen verhandeln wir nicht.“ Strunz kam zum Ergebnis, daß sowohl die Vertreibung als auch das Münchener Abkommen nur möglich gewesen seien aufgrund der Ereignisse von 1918 und 1919.
Letztlich sei es auch zu kurz gegriffen, die Vertreibung lediglich als Ergebnis der Vorgänge des Dritten Reiches zu betrachten. Der Referent sparte dabei nicht mit Kritik an manchen Historikern, was von den Anwesenden mit vollstem Verständnis aufgenommen wurde.
Weber dankte Strunz herzlich und plädierte dafür, das Gedenken an diesen Tag nicht in Vergessenheit treten zu lassen. Die Veranstaltung ging dann in einen gemütlichen Teil über, bei dem viele Geschichten ausgetauscht wurden. sr
Bereits zum dritten Mal konnte Obfrau Bärbel Anclam heuer Mitglieder und Gäste begrüßen. Kräuterpädagogin Birgit Lehmeier referierte über „Ein Spaziergang durch den Frühling“. Zunächst wurde das Kuchenbuffet gestürmt und Kaffee oder Tee dazu gereicht. Für Kuchenverächter gab es einige herzhafte Schnittchen zu kosten. Wie der Name Kräuterpädagogin schon verheißt, spannte Birgit Lehmeier einen Bogen über die Frühlingsmonate und fragte, was man in der Natur im Wald, auf den Wiesen und Feldern und im eigenen Garten schon entdecken könne. Obwohl die Felder noch gräulich dalägen, trieben einige Pflänzchen schon kräftig frisches Blattgrün aus oder blühten auch schon. Hierzu gehörten die Buschwindröschen oder Anemonen, die Christrosen, das Leberblümchen, Winterlinge, Schneeglöckchen, Brombeerranken und die Brennnessel. Ein Großteil der Pflanzen sei als Heilkräuter bekannt. Man könne sie zu Tee verarbeiten, dabei habe jede Pflanze ihren ganz persönlichen Wirkstoff zum Beispiel für die Leber, für den Magen, gegen Fieber oder mit viel Vitamin C. Man könne Marmeladen einkochen oder Blüten zum Verzieren der Speisen verwenden.
Dann blühten die Weiden und Haselnußsträucher mit ihren Kätzchen, was bereits Bienen anlocke. Und auch die Cornelkirsche mit ihren gelben Blüten gehöre dazu. Die Liste der Heilkräuter ließe sich beliebig fortsetzen. Dazu gehörten der Huflattich, das
Märzenblümchen, das Duftveilchen und der Gundermann ebenso wie das Stiefmütterchen, der Löwenzahn, die Taubnessel und die Pestwurz, um nur eine Auswahl zu nennen. Auf einem Quadratmeter Wiese könnten bis zu 100 Kräuter gedeihen. Aber zum Frühling, so Lehmeier, gehörten auch bunt bemalte Ostereier, Osterbrunnen, Osterhasen und natürlich das Osterfeuer. Außerdem lasse sich im Frühling wunderbar in der Sonne Vitamin D tanken. Der anregende und unterhaltsame Vortrag wurde von den Zuhörern mit viel Applaus bedacht. Es gab noch einige Schnäpsle zum Probieren, und aus mehreren Körben konnte man verschiedene Essige, Schnäpse und Marmeladen kaufen.
Obfrau Bärbel Anclam dankte Lehmeier für den schönen und aufschlußreichen Vortrag. Danach wies sie noch auf zwei kommende Veranstaltungen hin und wünschte allen einen guten Nachhauseweg. Nicht zu vergessen ist der Dank an alle Helfer und Helferinnen.
Am Dienstag, 4. April findet die Hauptversammlung der SL-Ortsgruppe statt. Höhepunkt danach ist ein Film von Edwin Heger, der über 20 Jahre alt ist und die „Fahrt nach Karlsbad und Prag und die sächsische Schweiz“ zeigt. Hierzu sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Es gibt Kaffee, Tee, kalte Getränke und Kuchen nach böhmischer Art. Am Donnerstag, 4. Mai wird Kräuterpadagogin Birgit Lehmeier über „So grün ist der Mai“ referieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldung: Telefon (09 11) 57 63 76, Mobilfunk (01 74) 1 67 50 96, eMail otmar.anclam@gmx.de Gabi Waade
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 11
Die Rückersdorfer im Schmidtbauernhof. Bild: Gabi Waade
Eberhard Heiser
Gernot Strunz
Das riesige ehemalige staatliche zentrale Ämterhaus in Reichenberg steht seit 16 Jahren leer. Obwohl das Haus von außen gut erhalten aussieht, ist eine vollständige Rekonstruktion erforderlich, die mehrere hundert Millionen Kronen kosten würde.
Das Gebäude der Firma Glasexport in Reichenberg, das seit Jahren nicht mehr benutzt wird, wurde auch bei der dritten Versteigerung nicht verkauft. Um an dieser dritten Versteigerungsrunde teilzunehmen, die das tschechische Amt für staatliche Vertretung in Vermögensangelegenheiten für Dienstag, 31. Januar und Mittwoch, 1. Februar anberaumt hatte, sollten die potentiellen Interessenten an dem leeren Gebäude eine obligatorische Kaution von 5,7 Millionen Kronen bis spätestens 30. Januar 24.00 Uhr auf dem Konto des Versteigerers gutgeschrieben haben.
Der Preis des Gebäudes war von dem Amt um weitere zehn Millionen Kronen auf 57,01 Millionen Kronen gesenkt worden. Die Stadt Reichenberg wird auch diesmal nicht unter den Bietern sein. Der Grund dafür ist, daß das Rathaus kein Mandat des Stadtrats hat, und der Preis, zu dem der Staat das Gebäude anbietet, ist für die Stadt Reichenberg immer noch zu hoch. Der Landkreis Reichenberg beteiligte sich ebenfalls nicht an der Auktion.
Der Entwurf für das Gebäude stammt von dem tschechischen Architekten František Vahala (* 3. Juli 1881, † 24. März 1942) aus Prag. Gebaut wurde es in den Jahren 1928 bis 1930 an der Ecke von Zittauer Straße und Bahnhofstraße für die Steuerund Zollverwaltung.

Dieses Gebäude mit zwei unterirdischen und fünf oberirdischen Stockwerken diente einst der Unterbringung sämtlicher Staatsämter in Reichenberg. Johann Ozbut, Direktor der Finanzbezirksdirektion, Ministerialrat in Reichenberg und nach Vollendung des Baues dessen Hausverwalter, hatte angeregt, die bisher in verschiedenen Räumlichkeiten sehr ungünstig untergebrachten staatlichen Ämter in einem modernen, ausgedehnten Ämterhaus zu vereinigen und damit den Parteienverkehr angenehmer zu gestalten. Zu diesem Zweck kaufte der Staat im Jahr 1925 die an die Zittauer Straße und Bahnhofsstraße grenzende Parzelle in einem Ausmaß von 2848 Quadratmetern von der Firma Johann Liebieg & Co. Die Lagerräume dieser Firma befanden sich auch in dem neu gebauten Gebäude. Die Arbeiten wurden bereits im Herbst des Jahres 1927 vergeben, und zwar paritätisch an die zwei deutschen Baufirmen von Josef Bayer & Co. sowie von Karl Hocke und an die zwei tschechischen Baufirmen von Otakar Pavlů sowie von František Zejdl. Das Gebäude beherbergte damals 16 Staatsämter, für die 150 Räume neben 16 Wohnungen für Staatsbeamte zur Verfügung gestellt wurden.

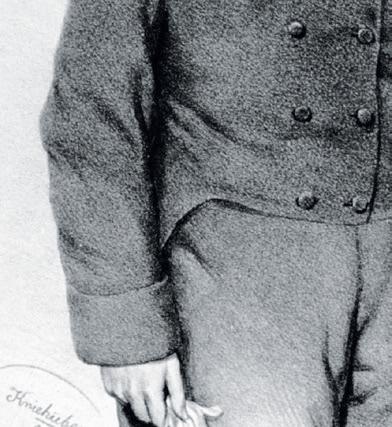

Die Finanzbehörde teilte mit, daß am 1. Oktober 1930 die Über-
Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Ehemaliges Ämterhaus in Reichenberg
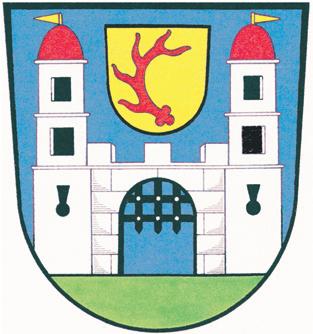
Vergebliche Versteigerungen
zen Komplex den Charakter eines amerikanischen Bürogebäudes verliehen. Der berühmte Exporteur von tschechischem Glas, die Gesellschaft Glasexport, tschechisch Skloexport, kaufte das Gebäude während der Regierung des kommunistischen Regimes, doch das Unternehmen ging in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre pleite. Der Staat übernahm das Gebäude im Jahr 2001, die letzten Mieter zogen acht Jahre später aus.
Ursprünglich war geplant, daß dort die Mitarbeiter des Finanzamtes, des Arbeitsamtes und der tschechischen Sozialversicherungsanstalt einziehen sollten. Seit 2008 versucht der Staat vergeblich, den 9357 Quadratmeter großen Komplex zu verkaufen. Schätzungen zufolge sind Renovierungsarbeiten im Wert von mehr als einer halben Milliarde Kronen erforderlich. Das Gebäude, das jahrelang der Generaldirektion für Finanzen gehört hatte, wurde erstmals im August 2008 zum Kauf angeboten, als ein Gerichtssachverständiger den Mindestpreis auf 84,6 Millionen Kronen festsetzte, doch es fand sich kein Interessent.
siedlung der staatlichen Ämter in das neue Staatsämterhaus beim Bahnhof durchgeführt werde. Im ersten Stockwerk befand sich die Politische Bezirksverwaltung, im zweiten Stockwerk war die Finanzbezirksdirektion und im dritten und vierten Stockwerk befanden sich das Steueramt und die Steuerverwaltung.
Außerdem

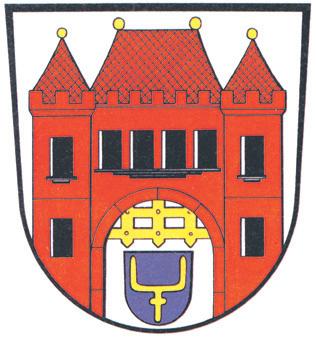
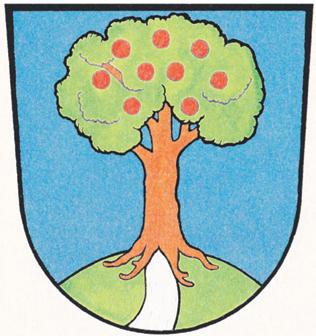
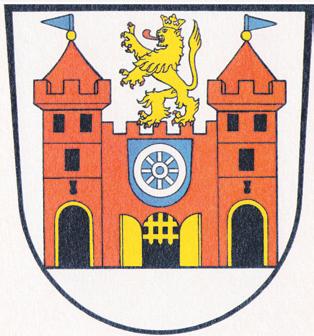
residierten das Hauptzollamt, die Grundsteuerevidenz, die Staatliche Baubezirksleitung, das Gewerbe- und Schulinspektorat, die Grenzfinanzwache und die Forst- und Kellereiinspektion in dem Gebäude.
Die Reichenberger deutsche Musikschule, die zuvor in
der Christianstädter Schule war, übersiedelte im Oktober 1930 in die Räume des städtischen Hauses in der Wiener Straße 45. Dieses war nämlich durch den Umzug der Finanzbezirksdirektion in das neue Ämterhaus frei geworden.


Die Wohnungen waren für je einen Vorstand und weitere Angestellte der einzelnen Abteilungen vorgesehen. Im Erdgeschoß und Zwischengeschoß auf der zur Bahnhofstraße gelegenen Seite befanden sich Geschäftsräume. Unter anderem befand sich
dort die repräsentative Niederlassung der Firma Johann Liebieg & Co. Der Bau, der ohne Einrichtungsgegenstände neun Millionen Kronen kostete, wurde im Jahr 1928 vollendet. Dadurch wurden verschiedene private, städtische und Staatsgebäude, in denen bisher die oben angeführten Ämter untergebracht waren, für Wohnungszwecke frei, so daß der Neubau in diesem Sinne auch zur Linderung der Wohnungsnot beitrug. Der Neubau präsentierte sich als ein Werk der modernen Architektur mit einer glatten Fassade und einem flachen Dach, die dem gan-



Auch in den folgenden Jahren war es nicht möglich, das Gebäude zu verkaufen, selbst nachdem der Preis schrittweise auf 45 Millionen Kronen gesenkt worden war. Im Mai 2020 wurde das Gebäude von dem tschechischen Amt für die staatliche Vertretung in Vermögensangelegenheiten übernommen. Da keine staatliche Institution Interesse an dem Gebäude zeigte, sucht die Behörde im Rahmen einer transparenten elektronischen Auktion nach einem neuen Eigentümer.
Das Amt versuchte dieses bedeutende Gebäude, das sich in der besten Lage vor dem Reichenberger Bahnhof befindet, zum ersten Mal am 15. und 16. November mit einem Startpreis von mehr als 79 Millionen Kronen zu versteigern. Ein Bieter hinterlegte die Anzahlung, bot aber nicht mit, und das Gebäude wurde nicht verkauft. Die zweite Runde der Versteigerung am 20. und 21. Dezember verlief ähnlich, obwohl der Preis auf 67 Millionen Kronen gesenkt worden war. Die dritte Runde der Auktion begann wie bereits erwähnt am Dienstag, 31. Januar um 10.00 Uhr und endete einen Tag später zur gleichen Zeit. Das seit Jahren ungenutzte Gebäude wurde auch beim dritten Mal nicht verkauft. Das Gebäude ist zu einem Vorzeigeobjekt geworden, das niemand will. Der Startpreis war erneut um weitere zehn Millionen auf 57,01 Millionen Kronen gesenkt worden, aber niemand machte ein Angebot, und die Auktion endete auch diesmal ohne Erfolg. Das tschechische Amt für die staatliche Vertretung in Vermögensangelegenheiten muß nun erneut den Preis senken, wenn sie das Gebäude verkaufen will. Um wie viel, ist bisher noch nicht mitgeteilt worden. Danach könnte ein Käufer gefunden werden. In dem ehemaligen historischen Gebäude würden dann neue Wohnungen und Büros entstehen. Stanislav Beran
Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 12
Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel Kreis Friedland Kreis Gablonz
Johann Liebieg (1802–1870), ab 1868
Johann Freiherr von Liebieg, ist der Gründer der Reichenberger Textilfirma Johann Liebieg & Co.
Der Architekt František Vahala (1881–1942) widmet sich in seinen späteren Jahren vor allem öffentlichen Bauten.
Das ehemalige Ämterhaus Anfang März.
Bild: Stanislav Beran
Diese Skizze des Staatlichen Zentral-Ämterhauses veröffentlichte die „Reichenberger Zeitung“ am 8. April 1928.
Das Staatliche Zentral-Ämterhaus in den 1930er Jahren.
� Wiesenthal/Kreis Gablonz

Neues Museum in alter Fabrik
In die ehemalige Glasfabrik Breit in Wiesenthal im früheren Kreis Gablonz kehrt das Leben zurück. Allerdings werden dort keine Perlen mehr hergestellt. In dem Industriegebäude entsteht ein Museum, das bald ganze Familien begeistern möchte.


Der Verein Automoto-Museum aus Gablonz verwandelt die seit Jahrzehnten verlassene Perlenfabrik an der Hauptstraße von Gablonz nach Harrachsdorf in ein modernes Museum für Autos und Motorräder. Es soll bis Ende des Jahres eröffnet werden. Schon jetzt kann man dort eine Rastpause machen und einen guten Kaffee trinken.
Die Renovierung begann vor fünf Jahren. Doch Corona und die Inflation verzögerten sie. „Insgesamt hat uns die Sanierung bereits umgerechnet 3,2 Millionen Euro gekostet“, verriet die Vorsitzende des Vereins, Klára Bártlová.
An die ursprüngliche Glasproduktion wird nur eine kleinere Ausstellung von historischem Glas erinnern“, fügte sie hinzu. Das Museum wird vor allem Youngtimer und Fahrzeuge zeigen, die bei der Rallye Paris–Dakar mitfuhren.
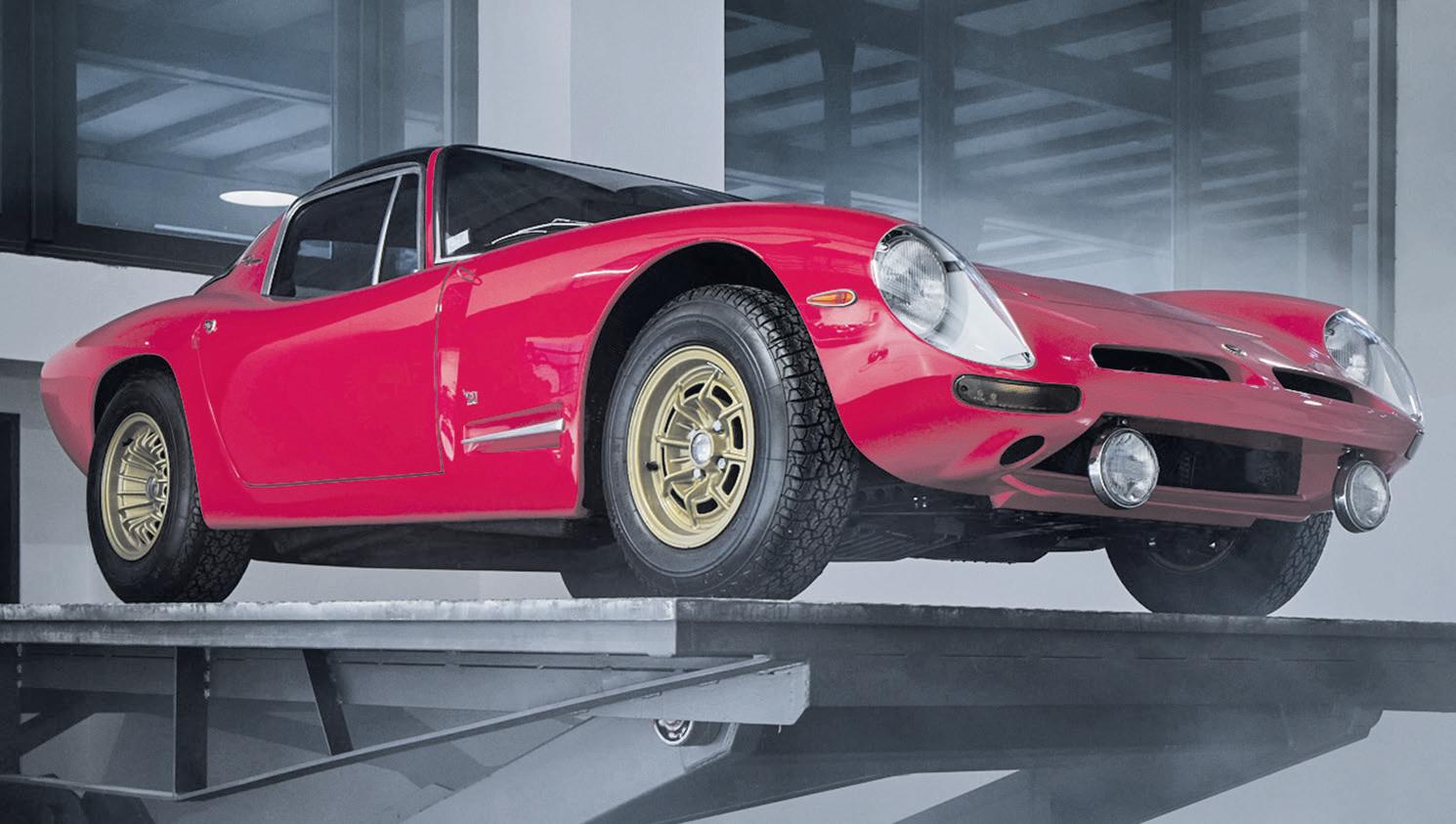
Für Palatschinken bekannt
Petr Kakrda, der Bruder des Rennfahrers Josef Kakrda, der mehrmals an der Afrika-Rallye
Seit 200 Jahren
Das Isergebirge, tschechisch Jizerské hory, polnisch Góry Izerskie, ist ein Teil der Sudeten und die Verbindung zwischen dem in Deutschland gelegenen Zittauer Gebirge/Lausitzer Gebirge und dem tschechisch/polnischen Riesengebirge. Das Isergebirge liegt auf tschechischem und polnischem Boden und ist Quellgebiet von Iser, Queis und Lausitzer Neiße.
Im Mittelteil des Gebirges treten vulkanische Gesteine wie Basalte oder Olivin- und Nephelin-Vulkanite hervor. Besonders markant ist der kegelförmige Buchberg. Weiterhin bedeutend sind die Basaltberge in der Nähe von Friedland.
teilgenommen hatte, übernahm den Betrieb des Cafés. Er ist der Richtige, denn seit mehr als 20 Jahren nennen ihn seine Freunde nur noch Kavárna, das tschechische Wort für Café. „Das ist sein Spitzname“, verrät Renata Röslerová, eine Besucherin des Lokals.

Das helle in Gelbtönen strahlende Café Unterwegs ist mit großformatigen Aquarellen des Autodesigners Jan Tučeks ausgeschmückt. Schnell bekannt wurde das Lokal für seine feinen superdünnen Palatschinken. Die herzhaften sind mit Champions oder Gorgonzola gefüllt und die süßen mit Hüttenkäse und Obst.
Zu jedem Kaffee gibt es ein kleiner Pfefferküchlein in Form eines Autos. „Die meisten Kuchen und Torten machen wir da selber. Wir wollen, daß die Leute bei uns et-
was Besonders bekommen, was nicht an jeder Ecke zu haben ist“, erklärt Kakrda. Kakrdas Großmutter führte lange das berühmte Restaurant Pyramide in Klein Iser und hat-
Hotel für ein- und zweispurige Fahrzeuge sein“, fügt Bártlová hinzu.
Neue Geschichte der Glasfabrik
Der Glasunternehmer Ludwig Breit (1845–1913) gründete die Glasknopffabrik in Wiesenthal 1868. In den Jahren 1886 bis 1888 wurde eine Perlenfabrikation aufgebaut, die erstmals in Europa 16 Glassprengmaschinen zur Aufteilung von Stengelglas einsetzte. Die Modernisierung führte 1890 zum großen Glassprengeraufstand. Dessen ungeachtet wurde die Rationalisierung mit der Einführung von Rondiertrommeln zur Glättung der Rohperlen weiter betrieben.
te später im dortigen Museum einen Lebensmittelladen. „Schon als Kind hat es mir Spaß gemacht, dort zu helfen, ich liebte den Geruch von frisch gemahlenem Kaffee“, erinnert er sich. Schon morgens herrscht reger Verkehr im Unterwegs. „Viele Leute kommen zum Frühstück und zu Geschäftstreffen.
Beliebt ist es hier auch bei Müttern mit Kindern, die stärkste Besuchergruppe sind vor allem am Wochenende die Touristen, die auf dem Weg ins Riesengebirge sind“, erklärt Kakrda. Bei dem neuem Museumscafé läßt sich gut parken.
Hotel für Youngtimer
Das Gebäude der ehemaligen Glasperlenfabrik stammt aus dem Jahr 1868. Es steht zwar
nicht unter Denkmalschutz, aber die Historiker betrachten es als ein Industriedenkmal. Heute ist das Objekt im Besitz von Radek Dvořák von der Youngtimer Bohemia GmbH, die auch den Umbau finanziert.
Youngtimer ist eine Bezeichnung für ältere Kraftfahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen und Motorräder, die als Liebhaberfahrzeuge genutzt werden, aber meist noch nicht als Oldtimer angesehen werden. Beide Begriffe sind Scheinanglizismen, die vergleichbaren englischen Begriffe sind „classic car“ und „modern classic“. Das Wort Youngtimer ist in der englischen Sprache unbekannt, „old-timer“ wird dort als Bezeichnung für Veteranen und ältere Menschen verwendet.
An dem Projekt beteiligen sich auch mehrere Auto- und Motorradsammler, die schon bald im Museum voll ausgestattete spezialisierte Auto- und Motorwerkstätten für die Reparatur und Renovierung ihrer historischen Maschinen und Depositar finden werden. „Eigentlich wird es ein
In der zweiten Inhabergeneration erreichte 1913 die Belegschaftsstärke 400 Mitarbeiter, die in der Röhrenherstellung und Perlenproduktion beschäftigt waren. Von 1933 bis 1938 war die Hütte Bestandteil des Stangenglaskartells. Seit 1938 wurden nur noch technische Preßgläser hergestellt. 1945 wurde das Unternehmen aufgrund der Beneš-Dekrete enteignet. Ludwig Breit junior (* 1899 in Wiesentahl, † 1992 in Schwäbisch Gmünd) baute zwischen 1946 und 1953 in Schwäbisch Gmünd im Osten Baden-Württembergs die familieneigene Wiesenthalhütte neu auf, produzierte wieder für die Schmuckindustrie und erlebte in der neuen Heimat eine neue Blütezeit. Die Wiesenthaler Glasfabrik wurde nach dem Krieg zu einem Betrieb der Gablonzer Glasfabriken. Der letzte Schlag für das Unternehmen war die Wirtschaftskrise 2008. Danach wurde die Produktion vollständig eingestellt und das Gebäude verlassen und dem Verfall preisgegeben.
Petra Laurin
S
eit dem 19. Jahrhundert wird das Gebirge Isergebirge genannt; Namensgeber ist der Fluß Iser, tschechisch Jizera, polnisch Izera. Bis dahin zählte man die Berge zum Riesengebirge. Der höchste Berg ist der in Polen gelegene 1126 Meter hohe Hinterberg, bekannter ist jedoch die von einem Aussichtsturm gekrönte 1124 Meter hohe Tafelfichte an der polnisch-tschechischen Grenze, deren Gipfel in Tschechien liegt. Gegen Norden schließt sich das Isergebirgsvorland an.
Der 1072 Meter hohe Tafelstein am Nordhang der Tafelfichte markierte die Grenzen der Herrschaften der Grafen Gallas in Friedland, der Herren von Gersdorff auf Meffersdorf im oberlausitzschen Queiskreis und der Grafen Schaffgotsch in Schreiberhau in Schlesien. Zwischen 1742 und 1815 wurde er zum Dreiländereck Sachsen-Böhmen-Preußen.
Die Tafel steht in Bad Liebwerda, weist das Isergebirge als Landschaftsschutzgebiet aus und trägt das Große Wappen der Tschechischen Republik mit den Wappen der Länder der böhmischen Krone, wobei das Kernland Böhmen doppelt vorkommt. Heraldisch rechts oben und links unten wird ein steigender silberner doppelschwänziger Löwe mit goldener Blätterkrone auf Rot für Böhmen gezeigt.
Das Isergebirge ist in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vielen Bergsteigern und Wanderern, aber auch Oppositionellen der DDR und der ČSSR durch das Misthaus ein Begriff geworden. Dieses gehörte Gustav Ginzel (1932–2008), der Geologe, Bergsteiger, Bergführer, Skiläufer, Höhlenforscher, Naturschützer, Buchautor, skurriler Lebenskünstler und Naturfotograf war.
Das typische Gestein des Isergebirges ist der porphyr-biotitische Granodiorit oder Isergebirgsgranit. Auffällig ist seine Grobkörnigkeit mit markanten Kristallen von rötlichem Feldspat. Er entstand vor gut 250 Millionen Jahren. Besonders sichtbar ist er in den bizarren Felsen am Nordhang des Gebirges, aber auch verbaut in einigen Stationen der Prager U-Bahn, in älteren Gebäuden von Reichenberg oder Gablonz, bei Aussichtstürmen auf Bergen des Gebirges und bei den Hafenanlagen der Stadt Kiel.
Beeindruckende Granitblöcke befinden sich auch auf den Gipfeln von Taubenhaus, Vogelkuppen, Raubschützenfelsen oder Klein Iser. In die Sandablagerungen der Bergbäche gelangten Kristalle verschiedener Minerale wie beispielsweise Rubine oder Saphire. Sie entstammen Gesteinsgängen im Granit. Die sogenannten Isergebirssaphire gehören zu den schönsten Europas und wurden bereits seit dem Mittelalter in den Ablagerungen des Safierbachs oder in der Kleinen Iser gesammelt.
Im südwestlichen Teil des Gebirges nahe Neustadt an der Tafelfichte sind Glimmerschiefer und Phyllite zu entdecken, das sind Gesteine aus dem ältesten Erdaltertum. Der Charakter des Gebirges unterscheidet sich hier von dessen übrigen Teilen. Südlich von Neustadt fand man Buntmetallerze, vor allem das Zinnerz Kassiterit. Eine Reihe aufgelassener Bergwerke und die schachbrettartige Anlage der Stadt zeugen vom einst blühenden Bergbau. Im Gebirge sind außerdem Felsgebilde aus Quarz anzutreffen. Der Quarzabbau begann schon im 13. Jahrhundert. Eine Variante des Titaneisens Ilmenit ist das tiefschwarze Iserin, das erstmals in Form von losen, abgerollten Körnern auf der Iserwiese nahe der Gemeinde Klein Iser gefunden wurde. Dort fanden sich auch Edelsteine wie Saphir, Topas, Zirkon, Smaragd und Rubin. Die Vielzahl von Wasserläufen, Quellen, Talsperren und Moortümpeln weist auf den Wasserreichtum des Isergebirges hin. Schätzungen ergaben, daß das dort gespeicherte Wasser rund einem Zehntel des Gesamtverbrauchs an Trinkwasser in der Tschechischen Republik entspricht. Über das Gebirge verläuft die Wasserscheide zwischen Ost- und Nordsee. Während die Flüsse der südöstlichen Gebirgsseite wie Iser, Desse und Kamnitz in die Nordsee fließen, suchen Lausitzer Neiße, Wittig und Queis auf der West- und Nordseite ihren Weg in die Ostsee. Besonders Typisch für dieses Gebiet sind aufgrund der Granitfelsen die mehrstufigen Wasserkaskaden mit Stromschnellen und Wasserfällen.
Bedeutend für das Aussehen des Isergebiges sind seine Moore, die seit dem Ende der Eiszeit vor 10 000 Jahren entstanden. Sie stehen bis auf Ausnahmen allesamt unter Naturschutz. Früher dienten sie zum Torfabbau. Das höchstgelegene Moor ist etwa sechs Meter mächtig.
Typisch für das Isergebirge ist sein rauhes Klima. Nebeltage und Nieselregen sind keine Seltenheit. Die Berge sind teilweise bis zu 160 Tage mit Schnee bedeckt. Die Sommer sind kurz und mäßig kühl, so daß bisweilen die Temperatur in den Gipfelzonen unter den Gefrierpunkt fällt. Lange und hartnäckige Winter charakterisieren das Gebiet. Die durchschnittlichen Temperaturen hängen stark von der Meereshöhe ab, so daß Unterschiede um bis zu zwei Grad auf einen Höhenunterschied von 100 Metern als absolut normal gelten.
REICHENBERGER ZEITUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 13
Petr Kakrda im Café Unterwegs.
Bild: Petra Laurin
Ein Youngtimer im Wiesenthaler Museum.
Isergebirge
selbständig
Die verfallende ehemalige Glasperlenfabrik vor der Renovierung.
�
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau

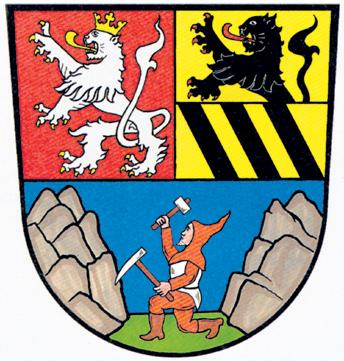
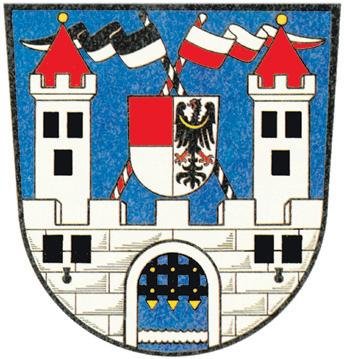

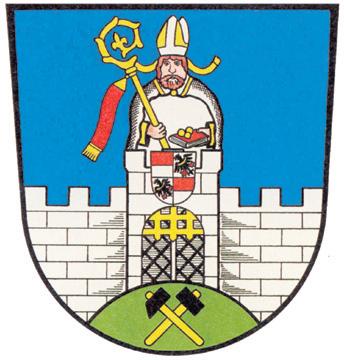
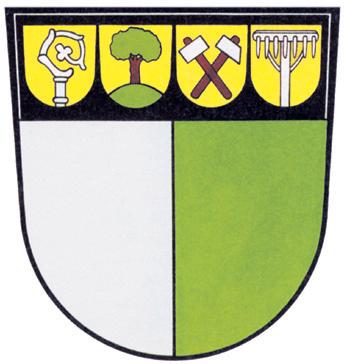

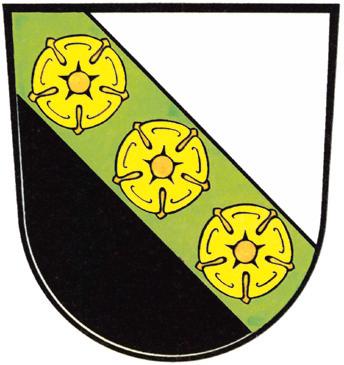

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt

Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


Die Brauerei schmiegt sich im Westen an das Schloß. Bilder: Urbex by Rychy
Eichwald liegt vier Kilometer nördlich von Teplitz-Schönau und ist nicht zuletzt für seine Imitation des Meißner Zwiebelmusters bekannt.
Die Porzellanstadt liegt am Südhang des Osterzgebirges auf einer Höhe zwischen 300 und 870 Metern. Hier kreuzt die von Altenberg nach Teplitz führende Staatsstraße I/8, eine Verlängerung der deutschen B 170, mit der südlich parallel des Erzgebirgskamms verlaufenden Staatsstraße I/27 oder II/253 von Graupen nach Klostergrab beziehungsweise Oberleutensdorf. Ihre Ortsteile sind Pihanken, Wistritz, Böhmisch Zinnwald, Dreihunken, Eichwald, Tischau und Zuckmantel. Auf dem Gemeindegebiet liegt außerdem der aufgelassene Ort Vorderzinnwald. Eichwald wurde an einer Furt im hier von Eichen dominierten Wald des Erzgebirges gegründet. Durch diese Furt führte ein alter Handelsweg der Kelten zwischen Dux und Aussig. Nahe dieses Handelsweges befanden sich die drei befestigten Siedlungen Dux und Doxan in Böhmen sowie Dohna in Sachsen. Sie waren Handelszentren und Münzstätten, die sogenannte Wegefahrten miteinander verbanden. Von Dux aus führten zwei Wege nach Osten: die große Wegefahrt (Langujest) über Teplitz, Modlan nach Aussig, die kleine Wegefahrt (Kleinujest) über Haan, Klostergrab, Eichwald, Jüdendorf, Hohnstein im Eulaugrund nach Tetschen. Diese kleine Wegefahrt führte unmittelbar am Fuße des Erzgebirges entlang und furtete im Eichenwald den Seegrundbach.
Porzellanplastiken in Eichwald: Ein Kaffeeservice und ein Brunnen mit Zwiebelmuster.

Unsere Korrespondentin Jutta Benešová nahm Kontakt mit einem Urban Explorer (Urbexer) auf, nennen wir ihn Lukas, um etwas über den Zustand der alten Lobkowicz-Brauerei in Bilin zu erfahren. Lukas hatte die Stadt Bilin um Erlaubnis gebeten, die verfallene Brauerei besuchen zu dürfen, da er
Im Jahr 1916 wurden ein neuer Kesselraum und ein hoher Schornstein gebaut. Er steht noch heute. Auch nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte eine Modernisierung, und die Brauerei überstand auch den Zweiten Weltkrieg. Aber dann kam das Jahr 1948, das Jahr der Verstaatlichung der Brauerei. Das war der Anfang vom Ende, wie bei vielen anderen Betrieben, die ihren rechtmäßigen Besitzern vom kommunistischen Regime konfisziert wurden. Der Name Max Lobkowicz – so wurde die Brauerei genannt – wurde sofort geändert, da es sich um ein volkseigenes Unternehmen handelte und der Staat nicht


erfahren hatte, daß die Stadt eine Rekonstruktion plant. Ausgerüstet mit Fotoapparat und Drohne für Außenaufnahmen begab er sich im August auf diese interessante Besichtigung. Mit seinem Einverständnis veröffentlicht der Heimatruf seinen von Benšova übersetzten Bericht in Fortsetzungen.

an die wahren Eigentümer erinnern wollte. 1948 bis 1959 hieß es Erzgebirgsbrauerei und 1960 bis 1977 Nordböhmische Brauerei. Der Staat ließ die Brauerei verrotten, und in den letzten Betriebsjahren diente sie nur als Mälzerei für die neue Brauerei in Sedlitz bei Brüx. 1972 wurde die Brauerei in Bilin endgültig geschlossen und auf Beschluß der damaligen kommunistischen Regierung der Tschechoslowakei aufgegeben. Die Schloßbrauerei war einst weithin bekannt, das begehrte Biliner Bier Perla wurde hier mehrere hundert Jahre lang gebraut. Nun aber wurde die gesamte Produktion eingestellt.


Dann kam das Jahr 1990. Nach 42 langen Jahren wurde die Schloßbraue-

rei in einem desolaten Zustand der Familie Lobkowicz zurückgegeben. Diese verpachtete das Areal für mehrere Jahre und verkaufte es schließlich 1996 an die Stadt. Seitdem sucht Bilin nach einer neuen Nutzung des Gebäudes und nach Mitteln für den Wiederaufbau.
Nach dem erfolglosen Versuch eines neuen Besitzers 2016, die Gebäude zu erneuern, kaufte die Stadt Bilin 2022 das Brauereigelände. Das Ressort für Immobilien und Investitionen genehmigte daraufhin eine Erhöhung des Budgets aus dem Verwaltungsüberschuß in Höhe von 30 Millionen Kronen, umgerechnet 1,3 Millionen Euro, zur Finanzierung der ersten Phase des Wiederaufbaus der Brauerei. Fortsetzung folgt







Damals betrug ein Tagesmarsch rund 25 Kilometer, und so lange dauerte der Weg von Dux zur Furt im Eichenwald. Deshalb entstanden an der Furt Hütten und Lagerschuppen, um die Rastenden und ihre Waren aufzunehmen. Erst mit der Zunahme des Handels und dem Aufblühen des Bergbaues im 14. und 15. Jahrhundert siedelten die Grundherren Kolonisten an.
Die erste urkundliche Erwähnung fällt in das Jahr 1494, als Graupener Bergleute bei der Furt ein Schmelzwerk für Zinn erbauten. Denn auch im Tal des Seegrundbaches (Flößbach) wurden Zinngraupen gefunden. Später wurde Holz für die Turner Schmelzhütten auf dem aufgestauten Flößbach nach Turn geflößt. Weiterer Bergbau auf Zinn wurde vor allem am Glantzberg und am Bornhauberg betrieben, wo noch heute Reste von Mundlöchern zu finden sind.

Eichwald gelangte im 16. Jahrhundert zur Herrschaft Teplitz, nachdem
es Gegenstand von dauernden Streitigkeiten zwischen der Klosterherrschaft Ossegg und der Herrschaft Graupen wegen großer Erzlagerstätten war. Dank seiner Lage in einem Kerbtal des Erzgebirges schützt der Kamm des Gebirges Eichwald vor Nordwinden. Wegen seines angenehmen Gebirgsklimas, der reinen Luft und der schönen waldreichen Umgebung wurde Eichwald zum gern besuchten Kurort. Um 1860 errichtete der Fabrikant Anton Tschinkel eine Wasserheilanstalt. Den Anstoß hatte ihm der Balneologe Josef von Löschner gegeben. Durch Zukauf weiterer Grundstücke erweiterte Tschinkel den Kurbereich, aus dem sich später das Theresienbad entwickelte. Dieses war eines der bekanntesten Heilbäder Mitteleuropas. Ab 14. Oktober 1895 hatte eine Linie der Teplitzer Straßenbahn ihre Endstation am Kurbad. Die zwischen 1897 und 1906 im Stil der italienischen Gotik errichtete Kirche der Unbefleckten Empfängnis war eine Filialkirche der Pfarrkirche Weißkirchlitz, die die Fürsten Clary und Aldringen errichteten. Sie ist ein Nachbau der Kirche Madonna dell‘ Orto in Venedig. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 wurde der größte Teil der deutschböhmischen Bevölkerung enteignet und des Landes verwiesen. Die Straßenbahnlinie wurde 1959 eingestellt und von Bussen ersetzt. In den 1980er Jahren gab es Planungen für einen großräumigen Abriß des südlichen Teils der Gemeinde zugunsten eines geplanten Braunkohletagebaues. Viele Bewohner wurden in jener Zeit in neue Großwohnsiedlungen in Teplitz-Schönau umgesiedelt. Diese Pläne wurden nach der Samtenen Revolution aufgegeben.
Heute ist die Stadt vor allem für einen Betrieb der Porzellan- und Majolikaherstellung mit Imitationen des Meißener Zwiebelmusters bekannt. Außerdem werden Farb- und Tafelglas sowie Isolierstoffe in Eichwald produziert.
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg
14 Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 �
in
–
30 Millionen Kronen
Die Lobkowicz-Brauerei
Bilin
Teil II
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 BIS28MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
� Kreis Teplitz-Schönau
Eichwalder Zwiebelmuster
n Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: Heimattreffen in Teplitz-Schönau. Das Programm erscheint im Mai. TERMINE
Die Eichwalder Kirche der Unbefleckten Empfängnis.
HEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ



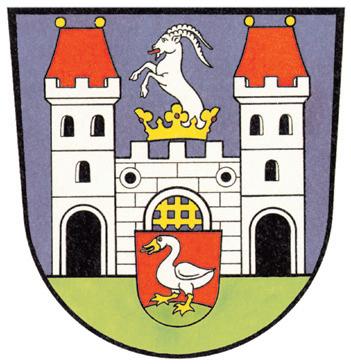
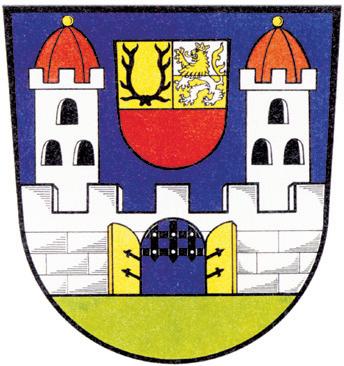
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Hostaus Pfarrer – Teil XVI
Pfarrer
Peter Steinbach
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der dritte Teil über Pfarrer Peter Steinbach (1843–1917).
Auf den Spuren der Fürsten Trauttmansdorff
Das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanzierte grenzüberschreitende zweisprachige Projekt „Hindle“ des Vereins Chodsko žije! – Das Chodenland lebt! – erfreut sich wachsender Beliebtheit. Kürzlich führte eine Fahrt nach Bischofteinitz zu einer Schloßführung und einem Spaziergang durch die Stadt. Die Stadt wird auch Böhmisches Krumau des Westens genannt. Karl Reitmeier berichtet.
Hindle bedeutet im chodischen Dialekt der Ort zwischen hier und dort. Hindle ist die Region zwischen Pilsen und Regensburg, in der es nicht darauf ankommt, in welcher Sprache man spricht, sondern was zählt, ist das gegenseitige Verstehen. Um das gegenseitige Verstehen ging es auch den 50 Teilnehmer von beiden Seiten der Grenze, worüber sich die Historikerin und engagierte Hindle-Projektleiterin Kristýna Pinkrová und ihre Mitstreiterin Anna Kolářová freuten. Wegen der großen Zahl mußten die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt werden, wobei die eine Gruppe zunächst das Schloß besuchte und nach dem Mittagessen im Schloß-Restaurant am Stadtplatz die Stadt besichtigte. Besonders begehrt waren im Schloßrestaurant die böhmischen Spezialitäten wie Lendenbraten oder Palatschinken.
Durch das Schloß führte Kateřina Maštalířová. Sie erzählte, daß die Erzbischöfe von Prag Bischofteinitz und die zugehörigen Dörfer mehrere Jahrhunderte lang ununterbrochen besessen hätten. 1539 bis 1620 habe die Familie Lobkowitz von Hassenstein Herrschaft und Stadt Bischofteinitz in Erbuntertänigkeit beses-

■ Freitag, 24. März, 18.00

Uhr, Taus: Zweisprachiger Vortrag über die Fastentracht der Region Niederes Chodenland mit Martina Pincová und Lída
Kašová und Beispiele für einzelne Trachten im Hindle-Zentrum.
Auskunft: Hindle-Zentrum, náměstí Míru 122, CZ-344 01
Domažlice, Ansprechpartner für Deutsche ist Anna Kolářová, Telefon (0 04 20) 7 21 73 78 94, Ansprechpartner für Tschechen ist Kristýna Pinkrová, Tele-








TERMINE
fon (0 04 20) 7 78 49 31 01, eMail centrum.hindle@gmail.com
■ Samstag, 1. April, Eschlkam: 8.45 Uhr Treffpunkt Gasthof zur Post, Waldschmidtstraße 14, Busfahrt nach Tanaberk, 9.30 Uhr dort Vortrag „Veränderungen von Tanaberk. Vom Wallfahrtsort im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart“ mit Zdeněk Procházka; anschließend Zwölf-Kilometer-Wanderung auf dem Jakobsweg nach Eschlkam mit Einkehr in der Jakobskapel-
sen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg sei der Großgrundbesitz bis zur Enteignung 1945 an die Grafen Trauttmansdorff gegangen.
Für das Schloß, das inzwischen dem Staat gehört, werden mehrere Führungen angeboten. Die Teilnehmer am „Hindle“-Projekt konnten die neueröffnete Abteilung „Schloßküche und Lagerräume“ sowie die Ausstellung des Nachlasses von Mitsuko Gräfin Coudenhove-Kalergi besichtigen.
Die Japanerin Mitsuko Maria Thekla Coudenhove-Kalergi (* 7. Juli 1874 in Tokio, † 27. August 1941 in Mödling in Niederösterreich) war die Ehefrau des österreichisch-ungarischen Diplomaten Heinrich Graf von CoudenhoveKalergi, 1893 bis 1906 Herr auf Schloß Ronsperg. Ihr noch in Tokio geborener Sohn Richard Nikolaus von CoudenhoveKalergi war der Gründer der Paneuropa-Bewegung. Ihre auf Schloß Ronsperg geborene Tochter Ida Friederike Görres war eine Schriftstellerin und katholische Intellektuelle.
Die Führung durch die Stadt leitete Luděk Thomayer, der auch ein Buch über Bischofteinitz geschrieben hatte, das mit historischen, aber auch aktuellen interessanten Fotos versehen ist. Er führte die Besucher zunächst zur Kirche der Heiligen Peter und Paul, von wo auch ein schöner Blick auf die alten Bürgerhäuser am Stadtplatz geboten war, die er ebenfalls erklärte. Weitere Stationen waren unter anderem das Rathaus und das Kapuziner-Kloster. Schwerstarbeit hatte an diesem Tag einmal mehr die Dolmetscherin Marcela Řezníčková zu leisten.
Weitere Hindle-Veranstaltungen ➝ Termine.
Pfarrer Peter Steinbach kritisiert lediglich, daß die Mitglieder des Kirchenverschönerungsvereins sehr nachlässig im Bezahlen der monatlichen Beiträge seien. Daher verkündet er von der Kanzel, daß künftig die Beträge allmonatlich durch Schulmädchen in den einzelnen Häusern eingesammelt würden. Die erzielte Ordnung und Regelmäßigkeit besänftigt Steinbach wieder.
Ende des Jahres 1888 bittet Steinbach erneut um Spenden. Dieses Mal zur Erneuerung des Altars in der Hostauer Friedhofskapelle, da der alte wurmstichig und unästhetisch sei. Wieder wird der Maler Amerling aus Taus mit den Malereiarbeiten beauftragt. Die Bildhauerarbeit geht an den taubstummen Bildhauer Johann Franz in Taus. Insgesamt betragen die Kosten 218 Gulden 80 Kreuzer. Im Mai und Juni 1890 wird der neue Altar aufgestellt. Die Tischlerarbeiten leistet der Hostauer Johann Andreas Egerer. Am 8. September 1890 erfolgt die Altarweihe. Eine Prozession zum Friedhof wird abgehalten und dort neben der Altarweihe auch eine Andacht für den 1656 in Hostau verstorbenen Stifter der Friedhofskapelle, Johann Kleinschmidt. Kleinschmidt verfügte, daß für ihn jährlich sechs Messen für seine Seelenruhe gefeiert würden.
Die vorbenannte Fürstin Anna beauftragt 1888 Maler Amerling, die Statue des heiligen Johannes von Nepomuk auf der Brückenmauer des Schlosses für 18 Gulden zu restaurieren.
Im Mai 1888 weigern sich die Lehrer, die Schulkinder an Sonnund Feiertagen zur Kirche zu führen und dort zu beaufsichtigen. Nach Diskursen zwischen Steinbach und Oberlehrer Johann Dorschner einigt man sich, die Angelegenheit dem Oberschulrat in Bischofteinitz vorzulegen. Dieser entscheidet aber zu Gunsten der Lehrer. Steinbach bemerkt nur, daß Friede herrsche zwischen Oberlehrer und Dechant.
Im Jahr 1889 werden Reparaturen für 91 Gulden 10 Kreuzer an der Dechanteikirche und für 242 Gulden 40 Kreuzer an den anderen Dechanteigebäuden durchgeführt. Um die Anbetung des Allerheiligsten auch jenen zu ermöglichen, die wegen der Schließung der Kirche während des Tages gehindert sind, wird im inneren Eingangsbereich eine vergitterte Glastür aus massiven Brettern und gewundenen Eisengittern angebracht. Die Tür kostet insgesamt 50 Gulden und wird von Tischlermeister Johann Andreas Egerer und Schlossermeister Karl Hiltwein angefertigt. Beide Hostauer berechnen nur die Auslagen für das Material. Steinbach bemerkt noch, daß durch diese Tür das Lüften der Kirche besser ermöglicht werde. Im Herbst wird unter die Sitzbänke der Kinderreihen ein hölzerner Fußboden gelegt, da einige Eltern beklagt hatten, ihre Kinder würden sich auf den kalten Steinfliesen erkälten. Steinbach schreibt hier von verweichlichten Eltern. Für die Bretter müssen 20 Gulden 40 Kreuzer und für die Zimmermannsarbeiten vier Gulden 68 Kreuzer ausgegeben werden.
Im Winter 1889/1890 leiden viele Erwachsene an Influenza. Viele Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren sterben.
Auch die beiden Seelsorger, Dechant und Kaplan, müssen längere Zeit das Krankenbett hüten.
Am 15. August 1890 findet nach dem Pfarrgottesdienst auf dem Stadtplatz vor der Dreifaltigkeitssäule die Segnung der neuen Feuerwehrspritze der örtlichen Feuerwehr statt. Sogar Feuerwehrvereine aus Pernartitz, Ronsperg, Muttersdorf, Plöß, Mönchsdorf, Bischofteinitz, Haid und Neustadtl wohnen der Feier in Hostau bei.
le in Seugenhof, 15.30 Uhr Vortrag „Geschichte der Pilgerwege und Eschlkam“ mit Josef Altmann; anschließend Möglichkeit das Waldschmidt-Museum zu besuchen. Mitveranstalter ist das Centrum Bavaria Bohemia. Auskunft: Hindle-Zentrum, náměstí Míru 122, CZ-344 01 Domažlice, Ansprechpartner für Deutsche ist Anna Kolářová, Telefon (0 04 20) 7 21 73 78 94, Ansprechpartner für Tschechen ist Kristýna Pinkrová, Telefon (0 04 20) 7 78 49 31 01,

eMail centrum.hindle@gmail. com
■ Sonntag, 2. April, Taus: Osterrutenflechten und Ostereierbemalen im Zentrum Hindle. Auskunft: Hindle-Zentrum, náměstí Míru 122, CZ-344 01 Domažlice, Ansprechpartner für Deutsche ist Anna Kolářová, Telefon (0 04 20) 7 21 73 78 94, Ansprechpartner für Tschechen ist Kristýna Pinkrová, Telefon (0 04 20) 7 78 49 31 01, eMail centrum.hindle@gmail.com


Am 27. Januar 1899 erhält jedoch Steinbach vom k. k. Landesschulamt in Prag eine Anfrage, ob die Schulkinder gemäß Erlaß der allgemeinen Schulordnung vom 14. November 1871 dieSonntagsmesse besuchten. Diese leitet Steinbach sofort an den Bezirksschulrat nach Bischofteinitz. Dort wird am 23. Februar verfügt, daß künftig die Schulkinder bei den Gottesdiensten an Sonnund Feiertagen durch die Lehrer zu beaufsichtigen seien. Steinbach hebt noch hervor, daß während der Austragung dieser Angelegenheit zwischen Schulleitung und Dechant ein friedliches Einvernehmen geherrscht habe.

Klara Watzel, geborene Liebermann, Tante des Hostauer Mesners, spendet der Dechanteikirche am 1. Mai 1890 einen Betrag von 400 Gulden mit der Auflage, dafür ein neues großes Wandkruzifix sowie eine neue Monstranz anzuschaffen. So bestellt Steinbach bei Bildhauer Ferdinand Stufflesser aus Sankt Ulrich in Gröden in Südtirol ein Kreuz für 100 Gulden, das an der Südseite der Kirche aufgestellt wird und dessen Segnung Steinbach am 31. August 1890 mit bischöflicher Erlaubnis vornimmt. Die neue Monstranz wird von einer Kunstanstalt in Wien angefertigt. Die aus reinem Silber gegossene, 54 Zentimeter hohe Monstranz trägt den Namen der Stifterin, wiegt 1550 Gramm und kostet 300 Gulden 70 Kreuzer. Die Lunula der neuen Monstranz segnet Bischof Martin Josef Říha in Budweis persönlich am 27. Dezember 1890.
Bei seiner Seelsorge ist es Steinbach ein großes Anliegen, die Renovierung des Armenspitals voranzutreiben. Am 31. August 1890 fordert er in seiner Predigt, die Armen zu unterstützen. Fortsetzung folgt
Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 15
❯ Bischofteinitz
Blick in den Innenhof des Schlosses.
Blick in die Schloßküche.
Blick auf den Nachlaß der Ronsperger Gräfin Mitsuko Coudenhove-Kalergi.
Die Besuchergruppe vor dem Bischofteinitzer Schloß.
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 . BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Bilder: Karl Reitmeier
Heimatbote für
den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

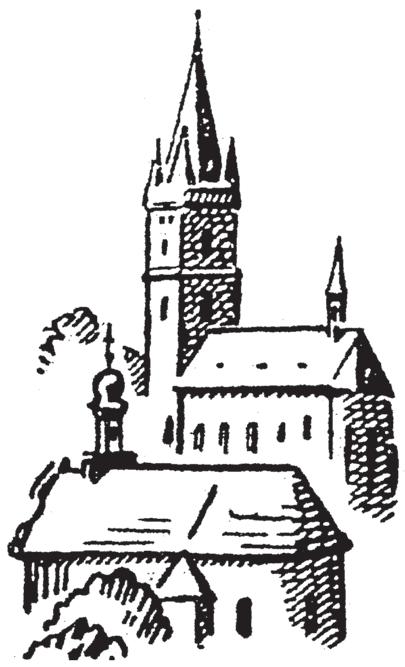
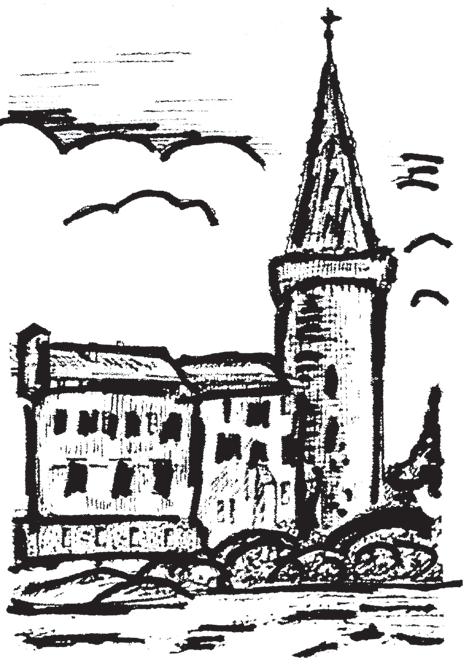
WIR BETRAUERN


■ Haid. Am 19. Feber starb Marianne Egerer/Höfner in Erlangen. Sie war am 3. August 1932 in Haid zur Welt gekommen und wohnte in der Schloßstraße Nr. 374. Nach der Vertreibung kam sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Aufenthalten in verschiedenen Lagern nach Franken, wo sie in Erlangen Walter Egerer kennenlernte. 1956 hei-
rateten sie, und ein Sohn wurde geboren. Die Trauer war groß, als dieser bei einem Verkehrsunfall mit 23 Jahren 1978 starb. Da Walter Egerer schon am 16. Jänner 2007 starb, war die Einsamkeit groß. Sie ertrug sie mit stiller Geduld. Der Nichte Bettina Kirschner gilt unsere herzliche Anteilnahme.
Wolf-Dieter Hamperl Heimatkreisbetreuer
Heimatliche Sagen
Der Wassermann im Blauteich


Die bayerische Landesgartenschau 2006 in Marktredwitz fand erstmals grenzüberschreitend mit der tschechischen Stadt Eger statt. In Eger wurde das Gelände unterhalb der Stadtburg entlang der Bastionsmauern revitalisiert. Dort hatten sich zuvor Schutthalden befunden, und das Gelände war in viele kleine Parzellen, darunter Schrebergärten, zerteilt. Der Umbau machte das Gelände wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und wird seitdem als Naherholungsgebiet, als touristische Attraktion im Rahmen der historischen Altstadt und der Burg und auch als Veranstaltungsort genutzt. Grenzübergreifender

Aspekt ist die Neuanlage eines beide Städte verbindenden Fahrradweges.
❯ Ehrenpreis der Stadt Eger für Wunsiedeler Landschaftsarchitekten
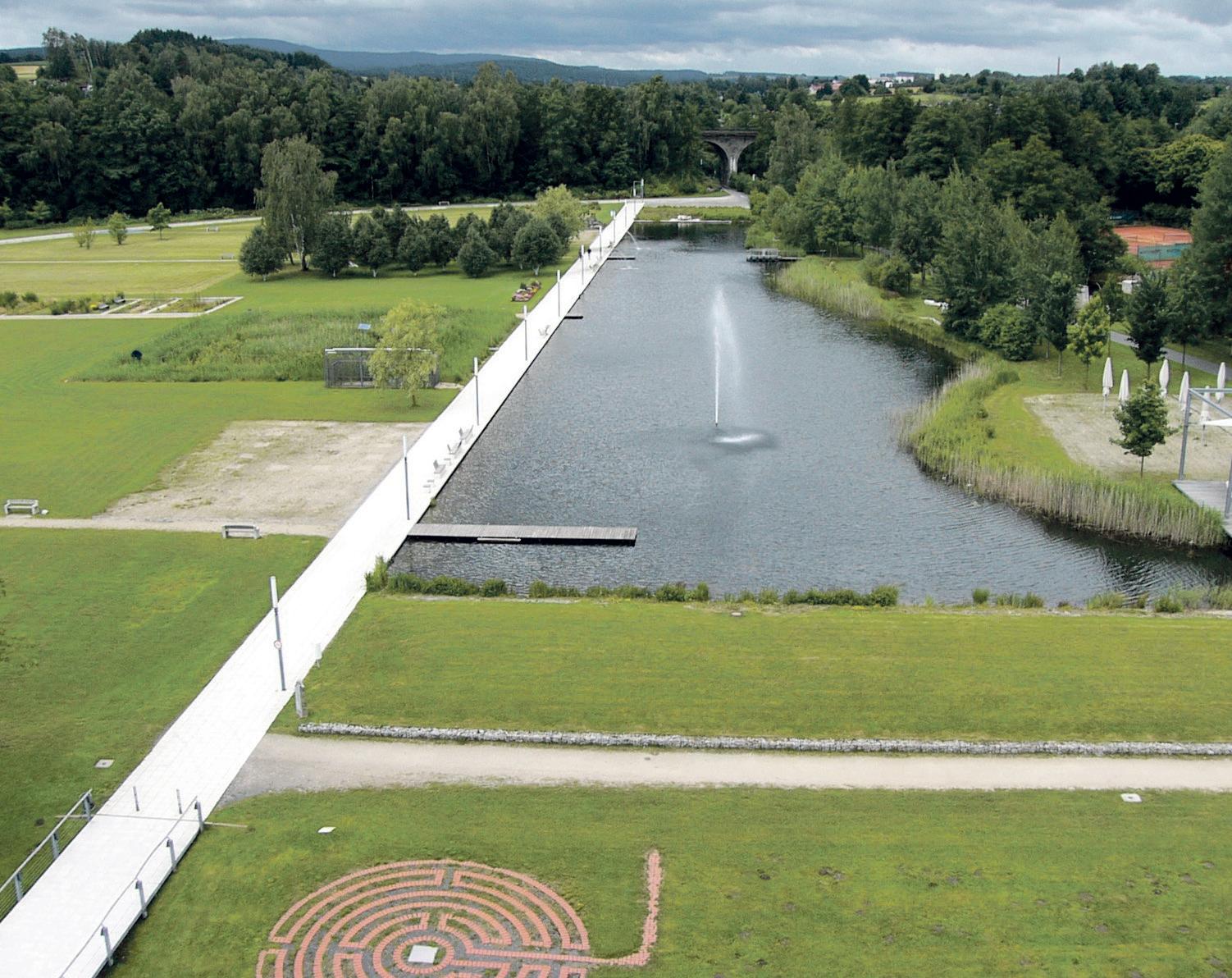
Raimund Böhringer
Beim Neujahrsempfang der Stadt Eger im Kulturzentrum Svoboda zeichnete der Egerer Oberbürgermeister Jan Vrba den Landschaftsarchitekten Raimund Böhringer aus dem nahen oberfränkischen Wunsiedel im Beisein von zahlreichen Politikern und Honoratioren aus Eger sowie einer ganzen Reihe Bürgermeister aus der benachbarten Oberpfalz mit dem Ehrenpreis der Stadt aus.

triebene Waldsassener Unternehmer und Ehrenbürger von Eger. Mit diesem habe Böhringer bei der Vorbereitung und Umsetzung des Meditationsparks am Wallfahrtsort Maria Loreto 2002 eng zusammengearbeitet.

Jan Vrba
G






rund für die Auszeichnung ist Raimund Böhringers grenzüberschreitender Einsatz seit der Samtenen Revolution und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Zunächst erinnerte Egers Oberbürgermeister Jan Vrba an Böhringers Großvater väterlicherseits, der 1919 zwei Buchhandlungen in Eger und Karlsbad gegründet habe, sein Vater sei Buchhändler in Wunsiedel und Marktredwitz gewesen, doch der junge Raimund sei einen anderen Weg gegangen.
Tatsächlich studierte er Landschaftsarchitektur in Berlin, kam nach Wunsiedel zurück und gründete zunächst in Bad Alexandersbad ein Büro. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs läßt Böhringer die Nachbarschaft nicht mehr los. „Ich will einfach meinen Beitrag zu einem guten Miteinander leisten“, sagte er der „Frankenpost“. Daß dies heute wichtiger sei denn je, zeige der Krieg in der Ukraine. Der Einmarsch russischer Truppen ruft in der Tschechischen Republik ungute Erinnerungen an den von der Sowjetarmee gewaltsam beendeten Prager Frühling 1966 wach.
„Böhringer ist heute Mitglied der Bayerischen Architektenkammer, verheiratet und Vater von drei Kindern“, sagte Vrba. Seit 1990 sei Böhringer auf allen möglichen Ebenen an der Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb der Euregio Egrensis beteiligt. Erwähnenswert seien zum Beispiel die touristische Zusammenarbeit im Rahmen des Kurprojektes Fichtelgebirge und Westböhmen oder die aktive Teilnahme an Verhandlungen über den Eisenbahnverkehr. Fruchtbar sei auch seine Zusammenarbeit mit Anton Hart senior gewesen, dem aus Neukinsberg ver-
Böhringers nachhaltigste Unternehmung war die Bayerische Landesgartenschau 2006, die in Marktredwitz und Eger stattfand. Beide Städte profitieren noch heute von den damals angelegten Parkanlagen. Während in Marktredwitz eine Industriebrache in ein neues Stadtviertel mit dem Auenpark verwandelt wurde, entstand in Eger aus einem häßlichen Hinterhofviertel ein Naherholungsgebiet nahe der berühmten Burg. „Gartenkunst und Landschaftsgestaltung sowie Gar-
tenschauen haben in Deutschland eine lange Tradition, aber auf tschechischer Seite war es die erste Schau dieser Art überhaupt. Es gelang, ein großes Gebiet entlang des Flusses Eger mit einer Fläche von 26 Hektar zu rekultivieren. Die Besucherzahlen auf der Messe selbst waren sehr hoch. Und mit diesem Projekt begann die Umwandlung beider Ufer der Eger in das heutige Naturschutzgebiet. Diese erste gemeinsame Gartenschau in der Tschechischen Republik im Jahr 2006 wird für immer ein Symbol für die guten Beziehungen zwischen den Städten und den Menschen auf beiden Seiten der Grenze sein“, schloß Oberbürgermeister Jan Vrba seine Lobrede auf Raimund Böhinger. Später sagte Böhinger zur „Frankenpost“: „Es war eine überwältigende Veranstaltung. Ich war regelrecht gerührt von all den Leuten, die mir auf die Schulter klopften.“
Den Blauteich verbindet eine Sage mit dem Georgsmühlteich. Der Wassermann im Blauteich hatte einen Sohn, den er auf Wanderschaft schickte. Dieser junge Wassermann trieb sich in den Tissaer Teichen herum, die er aber eines Tages verlassen mußte, weil sie während eines trockenen Sommers zu seicht geworden waren. Er übersiedelte also in den Georgsweiher bei Kleingropitzreith. Seine Beschäftigung bestand hier darin, daß er, auf dem Antenhübl sitzend, Körbchen aus Binsen flocht, die er dann ins Wasser warf. Wehe, wenn ein Kind an das Ufer eilte, um ein solches Körbchen herauszufischen: Der Wassermann zog es unbarmherzig in die Tiefe.
Einmal traf ein Fuhrmann aus Tachau den Wassermann beim Flicken seiner Strümpfe an. Als er ihm seine hohen Stiefel anbot, kamen dem Wassermann die Tränen, und er war so ergriffen, daß er versprach, nie mehr Menschen in die Tiefe zu ziehen. Von dieser Stunde an war er auch nicht mehr zu sehen.
Wie die Kreuzäcker zu ihrem Namen kamen
renden Weiher des Fürsten Windisch-Grätz abgefischt. Für die Tachauer und auch die Kleingropitzreither Buben war das immer ein besonderes Erlebnis, wenn der Georgsmühlteich abgefischt wurde. Die Stunden in der Schule vergingen viel zu langsam, denn man wollte ja gerne dabei sein.
So trug es sich zu, daß ein Junge einen nicht gerade kleinen Fisch im Schlamm des abgelassenen Teiches um sich schlagen sah. Kurz entschlossen watete er darauf zu, zog ihn heraus und ließ ihn unter seiner Joppe verschwinden. Direktor Schandera von der Tachauer Herrschaftskanzlei kontrollierte immer das Abfischen und hatte diesen Vorgang beobachtet. Zu gerne wollte er dem Jungen den Fisch wieder abknöpfen und rief ihm deshalb zu: „Hallo! Kleiner, komm‘ einmal her zu mir!“
Der Bub überhörte den Ruf absichtlich und stapfte weiter. Da rief Direktor Schandera abermals: „Komm‘ halt einmal her zu mir. Ich muß dir etwas sagen!“ Doch der Junge antwortete schlagfertig: „Set Boum, wöi ich bin, möin niat niat åll‘s wissn!“
Das besondere an der Landesgartenschau Marktredwitz war, daß eine Industriebrache umgenutzt und mit Ufer- und Auenbereichen zu einem Naherholungsraum und Areal für Veranstaltungen verbunden wurde.
Und: ,,Wer sich in Eger umsieht, der merkt schnell, daß heute eine ganz andere Generation heranwächst. Immer mehr junge Leute nehmen das Ruder in die Hand, überall herrscht eine Aufbruchsstimmung.“
Eine Sage berichtet davon, daß zwei Frauen, die in der Nähe der Lehmgrube grasten, der Grenze wegen in so heftigen Streit gerieten, daß sie sich mit ihren Sicheln gegenseitig die Köpfe abschnitten. Eine von ihnen konnte sich noch ein Stück Weges weiterschleppen, brach dann aber auch tot zusammen.
Zwei massive Steinkreuze, die in unmittelbarer Nähe des Lehmweihers stehen, bezeugen die Bluttat. Die in der Nähe liegenden Felder erhielten aus diesem Anlaß den Namen Kreuzäcker.
Alte Erinnerungen an das Weiher schen
In der Herbstzeit, besonders um Kirchweih, wurden die Dorfweiher und die zu den herrschaftlichen Besitzungen gehö-
Unter dem lauten Gelächter der Zuschauer und dem verschmitzten Lächeln des Herrschaftsdirektors, der sich von dem Kleinen überlistet sah, erreichte dieser das Ufer und konnte seinen Fisch nun unbehelligt nach Hause bringen.
Der verschollene Bergmann

Um 1830 wurde in der Nähe der Au-Ziegelhütte nach Roteisenstein gegraben. Da sich jedoch der Ertrag nach Jahren verringerte, wurde der Abbau wieder eingestellt.
Ein Bergmann aus Kleingropitzreith, der dort beschäftigt war, hatte am letzten Tag im Schacht seine Kette vergessen. Um sie zu holen, fuhr er nochmals ein, kam aber nicht mehr ans Tageslicht, da der Stollen einstürzte. An dieser Stelle blieb es immer sumpfig. Grubenlöcher und Hügel waren dort bis in die jüngste Zeit zu sehen.
Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 16
❯ Kreis Tachau
GEMEINSCHAFT EUROPA 26 . BIS28MAI 20 2 3 IN REGENSBURG
3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Egers Oberbürgermeister
und der preisgekrönte Landschaftsarchitekt Raimund Böhringer.
SCHICKSALS-
7
Heimatkundliches Mitteilungsblatt für die Vertriebenen aus dem Isergebirge/Organ des Gablonzer Heimatkreises e.V.
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, eMail isergebirge@zeitung.de – Betre : Isergebirgs-Rundschau
TERMINE
■ Heimatkreis Gablonz. Von Mittwoch, 30. August bis Sonntag, 3. September findet wieder unsere alljähliche Busfahrt nach Gablonz und ins Isergebirge statt. Auskunft und Anmeldung: Thomas Schönhoff, Glasstraße 6b, 87600 Neugablonz; Telefon: (0 83 41) 6 54 86, eMail archiv@isergebirgs-museum.de
❯ Noch bis 19. März im Isergebirgs-Museum

Sonderausstellung „Schicksale“
Was geschah nach der Vertreibung der Deutschen aus dem nordböhmischen Isergebirge? Wie erging es den Menschen, die 1945/46 gehen mußten und denen, die bleiben konnten?
Blick von der Terrasse des Jeschken ins Tal. Vom Gipfel aus sieht man das Riesengebirge, das Lausitzer Gebirge, das Böhmische Mittelgebirge, das Isergebirge, Böhmisches Paradies (Český ráj – Mittelgebirgslandschaft im Nordosten Tschechiens), das Zittauer Gebirge, das Oberlausitzer Bergland und in die Oberlausitz.

Foto: Dieter Schaurich
❯ Gablonz
Unse Rejsn ei de Hejmicht
Heuer warn mr su Gout will zunn 22. Moule minn Busse nouch Gablunz und ei s Isrgeborge fohrn. Ogefang honn mr drmitte 2001.
Dou kom salt de Frau Dochtr Zosche und dr ZeitungsRössler, wos a Juhrzahnte lang jo de Isergebirgs-Rundschau machn tote zu mir und totn miech battln, iech selle doch amoul ann Bus fr anne Fohrt nouch Gablunz zommstelln.
No jo, gutt und schiene, iech sohte noche: „Alsdann ejmoul mach iech dos halt!“ Mr worn doumouls ock su a 25 Leute und dou sein mr mit ann klenn Busse gefohrn.
Dos hotte siech drnou rimmgeredt und su honn mr halt 2002 wieder anne Rejse gemacht und s wurn immr mejr Leute, su dos iech moichmoul gor ne olle ei ann 50er Bus neibrochte.
Leidr sein halt itze sehr ville weggestorbn odr sein zu aalt, dos se noch mitfohrn kenn, moiche worn jo zahn- odr gor zwelfmoul mitte, su wie dos Ehe-
poor Preissler vu Zorneding bei Minchn odr de Scheuer Brigitte vu Neugablunz.
Mr honn ei olle dan Juhrn ou vill ogesahn bei unsn Ausflügn, mr worn ei Leitmeritz, ei Biehmsch Leipa, bei Hockewanzl ei Politz, ann Riesngeborge, ei Trautenau, Rumburg, Haindorf und Liebwerda und ei Schlesien ei Bod Flinsberg und ou amoul om Schlosse ei Münchngrätz, wu dr Wallenstein begrobn is. Itze sein mr halt inzwischn wiedr ock a klejnes Hoffl, obr mr gahn ne uf. Ou trotz dan ganzn Corona-Wahn, dan se uns dou ständich eigebläut honn, sein mr immr gefohrn, und nie is wos possiert.
S wäre schiene, wenn mr heuer wiedr anne Gruppe zommbrächtn, amende kricht dr ejne odr andre dar dos lasn tutt nu Lust, ou amoul dabei zu sein.
Tutt siech ock bei mr meldn, wenn dr erne Intresse hott.
Es grißt euch olle ei alr Vrbundnhejt, Thomas Schönhoff Ortsbetreuer von Gablonz und Kukan
WIR BETRAUERN
■ Johannesberg: Bereits am 30. Mai 2021 verstarb Resi Herzig/Wünsch in Aichwald im Alter von 91 Jahren. Leider wurde ihr Ableben nicht gemeldet und erst jetzt bekannt.
■ Tannwald. Grete Pohl/ Lippmann verstarb am 2. Januar im Alter von 102 Jahren in Kaufbeuren.
■ Karlsberg. Am 26. Januar verstarb kurz vor seinem 88. Geburtstag in Westendorf bei Kaufbeuren Wolfgang Seibt aus Karlsberg 52. Um ihn trauern seine Gattin Karola, geborene Posselt und der Sohn Christian.
■ Gablonz. In Neugablonz verstarb am 17. November 2022 Walter Reichl im Alter von 87 Jahren, betrauert von seiner Gat-
Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Ausstellung „Schicksale. Die Deutschen im Isergebirge nach 1945“. Sie ist Teil eines auf vier Jahre angelegten Gemeinschaftsprojektes des „Kulturverbandes der Deutschen und Freunden der deutschen Kultur“ unter Leitung von Irene Novák und des „Hauses der deutsch-tschechischen Verständigung“ in Reinowitz, das von Petra Laurin geführt wird. Projektpartner auf deutscher Seite ist das Isergebirgs-Museum Neugablonz. Fachliche Unterstützung leistete Dr. Raimund Paleczek vom Sudetendeutschen Institut.
Petra Laurin und Irene Novák entwickelten und gestalteten die Ausstellung gemeinsam mit der heimatverbliebenen Gablonzerin Christa Petrásková. Sie sichteten Tausende von Karteikarten im Bezirksarchiv Gablonz und stellten daraus exemplarische Biografien von Deutschen zusammen. Die individuellen Schicksalsberichte werden ergänzt durch historische Hintergrundinformationen zur Vorgeschichte der Deutschen in Böhmen, die

Ereignisse kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sowie das Leben danach, sei es als Heimatvertriebener oder als heimat-
verbliebener Deutscher in der Tschechoslowakei.
Besonders ausführlich werden die regionalen Sammel-, Vertrei-
bungs-, Arbeits- und Internierungslager von Albrechtsdorf bis Reichenberg beschrieben. In der Ausstellung werden die letzten zwei Etappen des Projektes präsentiert. Teil drei wird die Schicksale der verbliebenen Deutschen während des sogenannten „realen Sozialismus/ Totalitarismus“ vorstellen. Die Kuratorinnen wollen sich hier vor allem auf Entstehen des ersten Vereines der Deutschen, des Kulturverbandes, im Jahre 1969 konzentrieren und konkrete Lebensgeschichten der verbliebenen und vertriebenen Deutschen aus einer Region vergleichen. Die letzte Etappe widmet sich der Zeit nach 1989 und der Gründung der weiteren Verbände der Deutschen bis heute. Die Ausstellung wird und wurde an weiteren Orten in Tschechien, Deutschland und Österreich gezeigt, wo Sudetendeutsche aus dem Isergebirge heute leben. Ein Katalog über das Gesamtprojekt ist entstanden. Das Projekt wurde durch den Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds und das Bundesministerium des Innern und für Heimat gefördert. Ute Hultsch Isergebirgs-Museum Neugablonz, Bürgerplatz 1 (Gablonzer Haus), 87600 Kaufbeuren-Neugablonz. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 13.00–17.00 Uhr.
Weitere Ausstellungen in der Großen Galerie
❯ Ab 1. April: „Was ist schön? Weibliche Schönheit im Wandel“ – eine Ausstellung von Dr. Alice Selinger.
❯ Ab 15. September: „Ein bewegtes Leben in einer bewegten Zeit. Franz Wurtingers Jugendjahre“ – eine Ausstellung von Felictas Freuding und des Isergebirgs-Museums Neugablonz.
tin Erika und den Schwestern Traudl Simm und Friedl Hartwich.
■ Reichenau. Am 10. November 2022 verstarb in Neugablonz im Alter von 98 Jahren Ilse Schuster/Wabersich (früher Drogerie Schuster in Neugablonz), betrauert von ihren Angehörigen.
■ Puletschnei. In Neugablonz verschied am 21. November 2022 Edith Hoffmann/Wabersich im Alter von fast 93 Jahren. Ihr Gatte Erich war lange Jahre als Ortsbetreuer von Reichenau-Puletschnei tätig.
■ Seidenschwanz. In Kaufbeuren verstarb am 22. Oktober 2022, betrauert von ihrer Familie, Gerlinde Peschel/Menzel im Alter von 87 Jahren.
Die Kuratorinnen der Ausstellung, Irene Novák und Petra Laurin, zu Besuch in der Ausstellung.
Im März gratulieren wir nachträglich herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
■ Dalleschitz. Zum 91. am 16. Heinz Kovar in Ersingen (Baden) und zum 85. am 23. Sigrid Hujer in Kaufbeuren-Neugablonz.
Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Schumburg-Gistei, Unterschwarzbrunn. Zum 88. am 1. Erich Streit in Karlsruhe. Hans Theileis Ortsbetreuer
Im April gratulieren wir nachträglich herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
■ Dalleschitz. Zum 81. am 10. Hannelore Pavlata/Kovar in Pforzheim. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Labau-Pintschau. Zum 93. am 5. Heinz Heidrich in Bad Reichenhall; zum 91. am 7. Cäcilia Piwernetz/Baumann in Linsengericht;

❯ Ab 1. Dezember: „Ein bißchen Magier bin ich schon… Otfried Preusslers Erzählwelten“ – eine Gemeinschaftsausstellung des Sudetendeutschen Museums, des Adalbert Stifter Vereins und des Isergebirgs-Museums Neugablonz.
WIR GRATULIEREN
zum 90. am 15. Marga Strinzel/Könnecke in Sargstedt; zum 88. am 2. Ewald Bernt in Weidenberg;
zum 85. am 4. Hans Lau in Smrzovka;
zum 84. am 9. Christa Schulz/ Dubsky in Möglingen;
zum 83. am 29. Rudolf Kretschmer in Mosbach;

zum 80. am 11. Klemens Posselt in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 78. am 23. Hertwig Simm in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 76. am 23. Christiane Delese/Hübner in Texarkana (Arkansas/USA);
zum 75. am 13. Hans-Peter Bernt in Ebenhofen;
zum 73. am 22. Helmut Fabian-Krause in Kaufbeuren;
zum 63. am 23. Thomas Theileis in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 49. am 18. Cornelia Pinkert in Bonn. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Gablonz. Zum 87. am 4. Dr. Horst Zappe (Hirtengasse 44) in Weidenberg;
zum 92. am 2. Giselheid Staffa/Lahmer (Glasschleiferstraße 27) in Neugablonz;
zum 80. am 28. Werner Schmidt (Lerchenfeldstraße 55) in Kaufbeuren;
zum 81. am 5. Walter Simm (Wiener Straße 100) in Mauerstetten;
zum 81. am 23. Karin Reich/ Wagner (Liliengasse 21) in Bad Salzungen;
zum 87. am 30. Helmut Müller (Große Luftgasse 9) in Mutlangen.
Allen Gablonzer Jubilaren herzliche Glückwünsche ! Thomas Schönhoff Ortsbetreuer
■ Gränzendorf. Zum 84. am 4. Edeltraud Popp/Klamt in Teneriffa;
zum 83. am 27. Sieglinde Klamt in Kaufbeuren;
zum 88. am 19. Hedwig Larisch/Linke in Steyr-Gleink.
■ Johannesberg. Zum 87. am 30. Magda Rössler/Jäger (Grafendorf) in Neugablonz;

zum 86. am 1. Brigitte Hesche/ Posselt in Ballenstedt;
zum 83. am 4. Gertrud Rohmann/Lammel in Schnepfenthal; am 24. Ingrid Lebisch/Pluhar in

Schwäbisch Gmünd; zum 80. am 19. Manfred Schier in Deiningen.
■ Karlsberg. Zum 90. am 19. Anneliese Ranzinger/Dressler in Steinholz.
■ Kukan. Zum 89. am 7. Erich Rössler in Lauchheim; zum 85. am 22. Gudrun Kreutzberg/Filip; zum 78. am 23. Hertwig Simm in Neugablonz; zum 77. am 27. Dieter Kittel in Wendelstein
■ Maxdorf. Zum 91. am 4. Margit Dillian/Zimmermann in Zellerberg; zum 88. am 5. Hilde Mayer/ Bönsch in Mauerstetten; zum 67. am 21. Gerhard Mitlehner in Linsengericht. Thomas Schönhoff Ortsbetreuer
■ Schumburg-Gistei, Unterschwarzbrunn. Zum 83. am 8. Selma Reckziegel/Reckziegel in Kaufbeuren-Neugablonz.
Hans Theileis Ortsbetreuer
17 Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023
Marie Ullrich mit ihrer Enkelin Herma.
Foto: August Prade
Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen)
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Hoffmann, eMail isergebirge@zeitung.de – Betreff: Sternberger Heimat-Post
� Die Landwirtschaft des Mährisch Neustädter Ländchens
Regen, Sonne und Können
Franz Kunz, der Direktor der landwirtschaftlichen Landesfachschule, beschrieb bereits 1923 in der Zeitschrift „Mährisch Neustädter Ländchen“ die Bedeutung von Temperatur, Niederschlag und Wissen um Landwirtschaftstechnik.

Wer von Sternberg gegen Mährisch Neustadt wandert, erblickt gegen Norden ein geschlossenes, von Bergen umrahmtes, flaches Gebiet, dem die Merkmale der typischen Kultursteppe aufgeprägt sind. Fassen wir den Begriff Neustädter Ländchen weiter, so müssen wir auch die bergigen Randgebiete betrachten, vielfach steile, von tiefen Talfurchen durchschnittene Flächen, welche die von den Hochflächen, vom Heidstein und Bradelstein kommenden Gewässer ins flache Land ausmünden lassen. Damit ist die Entstehung des Bodens des Neustädter Ländchens angedeutet: In der Mitte ein mächtiger, durch die Gewässer der Eiszeit und der Jetztzeit zum Absatz gebrachter Schwemmlandboden, an den Rändern und auf den Höhen ein Verwitterungsboden von sehr verschiedener Güte und meist geringer Tiefe. [...] Mehrere mächtige Lösriegel, die in den Zwischeneiszeiten durch Wind angeweht worden sind, überqueren das Ländchen und geben vorzüglichen Ackerboden, der dem Hannaboden in Fruchtbarkeit nicht sehr nachsteht. Echten Hannaboden, das heißt Schwarzerde, besitzt Neustadt nicht. Einen Anhaltspunkt für die Fruchtbarkeit des Bodens gibt der Gehalt an feinsten, abschwemmbaren Bestandteilen [...]. Die eigentümliche Oberflächenform der bergigen Teile bringt es mit sich, daß auf den Hängen und Rücken die abtragenden Kräfte von Wasser und Wind energischer tätig sind und die Entstehung eines guten Ackerbodens unmöglich machen. In chemischer Hinsicht sind unsere Akkerböden fast durchwegs kalkarm[...].
Diese Verschiedenartigkeit in der Beschaffenheit der Ackerböden bedingt große Unterschiede in der Organisation der Landwirtschaft und bleibt nicht ohne Einfluß auf den Reinertrag. Dazu gesellt sich noch der Einfluß des Klimas. Das Neustädter Ländchen liegt im Gebiet des Übergangsklimas und gehört als Teil der oberen Marchebene zu den wärmsten und trockensten Teilen des Landes. Mährisch Neustadt liegt außerdem noch im meteorologischen Schatten des Bradelsteins. Die mittlere Jahrestemperatur von 19 Grad Celsius genügt nicht zur Charakterisierung der Wärmeverhältnisse. Für die Landwirtschaft ist die Verteilung der Wärme- und Niederschlagsmengen auf die einzelnen Abschnitte der Vegetationszeit von Wichtigkeit. Die mittleren Temperaturen betragen für den Winter -22 Grad Celsius, für den Frühling 7,9 Grad, für den Sommer 17,7 Grad und für den Herbst 8,3 Grad Celsius. [...] Das Neustädter Ländchen stimmt in Bezug auf die Temperatur mit den übrigen Gegenden des oberen Marchbeckens vollständig überein. In den übrigen Teilen des Gebietes steht es allerdings nicht so günstig: Die Temperatur nimmt bei 100 Meter Erhebung um ungefähr 0,6 Grad ab, demzufolge die Gefahr des Auswinters der Winterhalmfrüchte mit zunehmender Höhe größer wird. Infolge der verschiedenartigen Höhenlage des Geländes sind die Niederschlagshöhen sehr verschieden. Der südlich an der Linie Meedl–Schröffelsdorf gelege-
ne Teil des Ländchens erhält weniger als 500 mm Regen, jenseits dieser Linie steigt die Niederschlagshöhe und erreicht am Gebirgsrand und am Bradelstein etwa 800 mm. Die größten Niederschlagsmengen fallen im Juli, die kleinsten im Februar. Auf die Jahreszeiten verteilt, erhalten wir im Winter 15,4 Prozent, im Frühling 23,5 Prozent, im Sommer 38,6 Prozent und im Herbst 22,3 Prozent. [...] Diese Verschiedenartigkeit des Klimas und des Bodens bedingt [...] große Unterschiede in der Organisation der Landwirtschaft. Neben diesen natürlichen [...] Grundlagen für unsere Landwirtschaft mußte [...] auch die geschichtliche Entwicklung berücksichtigt werden, weil sich auch heute noch in unserem Wirtschaftsleben die Einwirkung längst vergangener Einflüsse geltend macht. Ich muß in dieser Hinsicht auf die vorzüglichen und erschöpfenden Darlegungen des Dr. Kux in der Geschichte der königlichen Stadt Mährisch Neustadt verweisen. Die älteste Wirtschaftsform war die Dreifelderwirtschaft, eine Art Körnerwirtschaft, nicht für den Einzelbetrieb geeignet, sondern zum gemeinsamen Betrieb einer Bauerngemeinde bestimmt. Sie befriedigte die Hauptbedürfnisse früherer wirtschaftlicher Entwicklungsstufen, und es ist staunenswert, daß sich dieses Wirtschaftssystem fast zwei Jahrtausende zurückverfolgen läßt. Unsere heutigen Fruchtfolgen sind nichts anderes als verschieden gestaltete, verbesserte Dreifelderwirtschaften. Diese Umwandlung hat sich in den letzten 80 Jahren vollzogen.
Früher wurden Roggen und Hafer und etwas Weizen gebaut, wogegen heute die Zuckerrübe als wichtigste Feldfrucht angesehen werden muß. Daneben werden Gerste und Weizen in vorzüglicher Beschaffenheit hervorgebracht. Da unser Gebiet mit Weizen etwas stiefmütterlich bedacht ist, nimmt der Feldfutterbau eine hervorragende Stelle ein. Die Kartoffel ist in den ebenen Teilen des Ländchens, dem „Land“, nur von untergeordneter Bedeutung, in den bergigen Lagen tritt sie vielfach an die Stelle der Zuckerrübe.
Der Zuckerrübenanbau im Neustädter Ländchen geht bis auf das Jahr 1858 zurück, wo erstmals von der neu errichteten Zuckerfabrik in Mährisch Neustadt die Rede ist. Die deutschen Landwirte des Ländchens [...] besitzen rund 10 000 Hektar oder 50 000 Metzen Kulturland; hiervon sind allerdings nur 6 000–8 000 Metzen alljährlich mit Rübe bestellt und geben einen Ertrag von bis zu 400 000 Zentner Zuckerrübe. Was diese Zahl
für die Landwirtschaft des Ländchens bedeutet, darüber zerbricht man sich gewöhnlich nicht den Kopf. Bedenken wir aber, daß die Zuckerrübe im Vergleich zum Getreide oder zu Wiesen [...] aus den Verbindungen des Bodens und der Atmosphäre doppelt bis dreimal soviel organische Stoffe zu erzeugen vermag als Getreide, so leuchtet uns die ungeheure Überlegenheit der Zuckerrübe ein.
WIR GRATULIEREN
n Mährisch Neustadt Im April gratulieren wir zum Geburtstag. Am
2. Hans-Jürgen Bunde (Olmützer Gasse) zum 78. in Kassel; Robert Heger (Obere Alleegasse) zum 85. in Wenden;
Die im Gebiet erzeugte Zuckerrübe wird fast ausschließlich in der Mährisch Neustädter Zuckerfabrik verarbeitet, wo durchschnittlich 450 000 Zentner Zuckerrüben in der Kampagne verarbeitet werden. Heute wird in diesem Unternehmen, das seit 1870 Aktiengesellschaft ist, nur Weißzucker (Verbrauchszucker) hergestellt. Wenn dieser Betrieb auch nicht zu den größten dieser Art zu zählen ist, so stellt er doch einen sehr wichtigen volkswirtschaftlichen Faktor dar.
3. Theresia Woller/Meixner (Wallgasse) zum 87. in Freiberg;
4. Margit Ruhland/Hoplitschek (Sternberger Gasse) zum 90. in Rüsselsheim;
5. Heinz Anderlitschka (Sternberger Gasse) zum 80. in Weilmünster; Mansuet Heidenreich (Olmützer Gasse) zum 87. in Taunusstein;
6. Marie Luncoy (Feldgasse) zum 91. in Brett da noux (Frankreich);
8. Margarete Pschierer/Wenzlitschke (Stadtplatz) zum 88. in Rodenbach;
10. Manfred Brixel (Lange Gasse) zum 87. in Dillenburg;
11. Liesbeth Vetter/Höchsmann (Sternberger Gasse) zum 84. in Süsel; Marta Urban/Volkmer (Sternberger Gasse) zum 93. in Bad Camberg;
Wenn bei der Erwähnung der klimatischen Verhältnisse betont wurde, daß die Verteilung des Regens im Lauf der Wachstumsperiode von besonderer Wichtigkeit ist, so gilt dies insbesondere bei der Rübe. In der Jugend braucht sie nicht viel Feuchtigkeit, erst wenn die Blätter sich gehörig entwickelt haben, verbraucht sie große Mengen Wasser. Regenmenge und Zuckerrübenertrag laufen, wenn wir von extremen Jahren absehen, parallel. Da die Rübe etwa 600 Millionen Niederschlag beansprucht [...], muß der Landwirt alles aufbieten, um die Bodenfeuchtigkeit zu schonen. Es stellt demnach der Zuckerrübenbau an den Wachstumsfaktor Mensch höhere Anforderungen als andere Kulturgewächse, und da sei hervorgehoben, daß unser Ländchen über einen Bauernschlag verfügt, der hinsichtlich der Landwirtschaftstechnik zu den höchststehenden in Mähren zählt. Wir haben nicht nur tüchtige Arbeiter unter ihnen, sondern auch solche, die mit der Wissenschaft ständig in Fühlung sind und deren Ergebnisse ungesäumt prüfen und nachher in die Praxis umsetzen.
Neben 45 000 Zentner Verbrauchszukker werden 8 000–9 000 Zentner Melasse, 32 000 Zentner Schlammkalk und 300 000 Zentner Rübenschnitte erzeugt; die Melasse wird zu Spiritus und zu Presshefe verarbeitet, die übrigen Abfallerzeugnisse kehren in die landwirtschaftlichen Betriebe zurück. Der Spiritus wird in neuester Zeit zu Dynalkol verarbeitet. Die Fabrik beschäftigt während der Kampagne 600 Arbeiter. Der Zuckerrübe folgt, was Bedeutung anbelangt, die Gerste, die ein wichtiges Ausfuhrgut darstellt. Die heimische Gerste, die dem Landgerstentypus angehört, wird meist vermälzt und ausgeführt. Das Mährisch Neustädter Bräuhaus erzeugt jährlich 5 000 Zentner Malz und 8 000 Hektoliter Bier. Weizen und Roggen werden als Winterungen in vorzüglicher Beschaffenheit gebaut; es darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch sehr verheißungsvolle Anfänge mit der Getreide-, besonders Roggenzüchtung gemacht worden sind. Allmählich bürgert sich auch die Wintergerste ein. Der Saatgutzubereitung wird eine ganz besondere Sorgfalt zugewendet. Der Bezirk verfügt über mehrere Saatgut-Reinigungsstationen. Mustergültig ist die Anlage in Hliwitz, wo auch eine Beizmaschine ausgestellt ist. Der Hafer wird, da er ein großer Wasserverschwender ist, nur im geringeren Umfang angebaut [...]. Hingewiesen wurde auch darauf, daß der Bezirk mit Wiesen nicht allzu reich bedacht ist, und da von den vorhandenen große Teile unter Nässe leiden, muß dem Feldfutterbau viel Aufmerksamkeit zugewendet werden. Als wichtigste Feldfutterpflanze gilt auch heute noch trotz mancher Mißjahre der Rotklee in reinen Beständen oder als Kleegras, mit italienischem Reygras gemischt. Allmählich bürgert sich die Luzerne ein. In den letzten Jahren wurden große Flecken mit bedeutendem Aufwand entwässert, insbesondere auf dem Gelände der Gemeinden Dittersdorf und Einoth. Diese Gebiete hatten unter stauender Nässe sehr zu leiden, da ein natürlicher Abfluß wegen Mangel an Gefälle nicht zu erzielen war.
12. Brunhilde Spies/Brixel (Herrengasse) zum 82. in Illerkirchberg; Manfred Roland (Große Neustadt) zum 83. in Wehrheim;


13. Margot Müller/Kaulich (Sternberger Gasse) zum 84. in Puchheim; Edith Wagner/Seuchter (Stadtplatz) zum 86. in Kassel;
14. Robert Breitenbach/Wepil (Siedlung) zum 90. in Bad Camberg;
16. Karl-Heinz Wontka (Untere Alleegasse) zum 78. in Heusenstamm; Gerhard Hampel (Olmützer Gasse) zum 82. in Hünstetten-Bechtheim; Gerhard Richter (Wallgasse) zum 87. in Bad Vöslau (Österreich); Anni Demme/Frömel zum 90. in ON.L6X 2 A4 (Kanada);
17. Gerlinde Weinforth/Schubert zum 93. in Erlangen;
18. Elisabeth Lenz/Rabenseifner (Lange Gasse) zum 88. in 3733 Monrovia (Kalifornien, USA);
19. Inge Morgenstern/Fritsch (Schönberger Gasse) zum 85. in Eppstein; Rotraud Fassl/Pustina (Müglitzer Gasse) zum 88. in Eppstein;
20. Marlies Fahlke/Wagner (Kl. Neustift) zum 78. in Gernsheim;
22. Günther Maneth (Schönberger Gasse) zum 80. in Lohmar; Dietmar Grätzer (Siedlung, Gartenstraße) zum 82. in Kahl;
23. Anneliese Hirsch/Höbling (Olmützer Gasse) zum 85. in Meißner-Abterode;
24. Ingeborg Bergemann/Selinger (Euglgasse) zum 83. in Dortmund; Horst Klement (Untere Alleegasse) zum 83. in Weinbach; Rudolf Brixel (Herrengasse) zum 92. in Wernau;
25. Magda Speet/Falz (Wallgasse) zum 78. in Diepholz;
27. Helga Harzenetter/Parsch (Mittelgasse) zum 93. in Lindenberg;
28. Renate Prokscha/Gans (Theoderichstraße) zum 79. in Ettlingen;
30. Monika Meister/Riedel (Stadtplatz) zum 83. in Villmar. Sigrid Lichtenthäler Ortsbetreuerin
WIR BETRAUERN
n Oskau. Von seiner Tochter erhielt ich die traurige Nachricht, daß Norbert Langer am 6. Februar im Pflegeheim gestorben ist, nachdem er krankheits- und altersbedingt trotz guter Fürsorge durch seine Tochter alleine nicht mehr zurecht gekommen war. Meine Gedanken schweiften zurück nach Oskau, das ich als Eineinhalbjährige mit meiner Oma, meiner Mutter und vier Geschwistern verlassen mußte. Gerne hätte ich mehr von meinem Geburtsort erfahren. Bei einem Treffen am Sudetendeutschen Tag in Augsburg wurde ich an einem Treffpunkt der ehemaligen Bürger aus dem Altvatergebirge auf Norbert Langer aufmerksam gemacht, der lange Zeit Ortsbetreuer von Oskau war. So rief ich ihn einige Zeit später an, und als ich mich vorstellte, rief er verwundert und hocherfreut:
„Da sind Sie ja die Tochter von der Mieli!“ Welch ein Glücksfall, er kannte meine Eltern noch aus der Heimat. Nun konnte ich in häufigen Telefongesprächen und zweimaligen persönlichen Treffen viel Interessantes über Oskau, seine Bewohner und die Umgebung erfahren. Er machte mich auch auf Heimatvertriebene aus dem Kreis Sternberg aufmerksam, die von Hessen aus ab und zu mit einem Kleinbus die Heimat besuchten und denen ich mich anschloß. Im Bus lernte ich Lotti kennen, die bis zur Vertreibung in Oskau wohnte, damals 17 Jahre alt war und viel vom Ort und seiner reizenden Umgebung wußte. Dies alles habe ich Norbert Langer zu verdanken. Ich werde die langen, aufschlußreichen Telefongespräche sehr vermissen und ihn in bester Erinnerung behalten. Eveline Weinländer/Pomm
Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 18
Eindrücke von der bäuerlichen Landwirtschaft in Mährisch Neustadt.
In der Ausgabe 7/2023 dieser Zeitung machten wir einen Spaziergang unter der Führung von Walter Nimmerrichter durch das schöne Mährisch Neustadt. Er schrieb seine Erinnerungen vor über 30 Jahren. Aber etliche Gebäude und Geschichten des schönen Städtchens werden wir natürlich weiter in Erinnerung rufen.
Südseite des Stadtplatzes
Nr. 12: Theodor Schweda, Lebensmittelgeschäft. Karl Schweda jun. ist gestorben. Seine Witwe, geborene Lewin, lebt in der Bundesrepublik. Die Kinder sind in den USA, Dora Schweda lebt in Österreich. Wir überqueren nun die Goeblgasse, die einstige Litauer Gasse.
Nr. 11: Neubau von 1923 des Rudolf Pelzl und seiner Frau Marie, geborene Schweda. Der Sohn, Studienrat Dr. Erich Pelzl, verheiratet mit Erna Kleibl, lebt in der Bundesrepublik, ist regelmäßiger Teilnehmer des Wachsstockfestes und verfaßte die „Besiedlungsgeschichte des Gerichtsbezirks Mährisch Neustadt auf Grund der Flurnamen“, die in der Festschrift zum Wachsstockfest 1973 erschienen ist.
Nr. 10: Wir sind nun vor jenem Hause, in dem sich viele Kranke (oder die sich einbildeten, krank zu sein) in der Hoffnung auf Genesung ihre Pülverchen, Tränklein und Salben besorgten, der Apotheke Alois Rottleuthner. Vor einhundert Jahren (1876) war in diesem Hause das Gasthaus „Zum wackeren Österreicher“. Trug es auch zur Genesung bei? Heinz Rottleuthner lebt in der Bundesrepublik, das Schicksal seiner geschiedenen Frau Hertha, geborene Lewin, ist unbekannt.
Nr. 9: Haus der Camilla Fleischmann/Popp. Im Erdgeschoß befand sich das Konfektionsgeschäft Opatril. Später hatte hier Otto Schötta seinen Laden. Die Witwe Frieda, geborene Höchsmann aus Strelitz, lebt in der Bundesrepublik.
Nr. 8: Der stattliche Neubau von 1911 gehörte Franz und Viktoria Meier. An diesem zentralen Kreuzungspunkt der Schulwege zum Gymnasium und zur Mädchen-Bürgerschule hatte die Buch- und Papierhandlung
Meier einen überaus günstigen Standort. Vorher waren hier an der Ecke zur Fronfestgasse die Bürgerlichen Fleischbänke. Die letzten Besitzer (1910) waren: Bank eins rechts Josef Hoditschke, links Josef Heidenreich; Bank zwei rechts Franz Wenzlitschke, links Ignaz Klein; Bank drei rechts Fleischergenossenschaft, links Franz Müller; Bank vier rechts Franz Urbaschek, links Anton Künschner; Bank fünf rechts Johann Hamp, links Anton Künschner; Bank sechs rechts Jo-




� Ein Spaziergang durch Mährisch Neustadt – Folge II
Unverändert schön
machers und Juweliers Adam Gorny. Später diente dieses Schaufenster freilich prosaischeren Dingen: leckeren Würsten, geräucherten Schinken und vielem mehr, denn nach dem Tode von Gorny kaufte dieses Haus der Fleischer Hans Pfeifer. Im Obergeschoß wohnte Lehrer Anton Illek, dessen Aquarelle immer wieder Käufer fanden. Seine Frau Olga, geborene Rudolf, hatte hier ihren Hutsalon, doch sie war auch als eifrige Sängerin und vor allem als Theaterspielerin allgemein bekannt. Ihr Glanzstück war wohl die Hauptrolle in der Operette „Alt-Heidelberg“. Es war eine sonderbare Laune des Schicksals, das sie nach der Austreibung ausgerechnet nach Heidelberg verschlug. Sie bekleidet das ehrenvolle Amt als Präsidentin des Wachsstockfraueninstituts. Sie ist leider in letzter Zeit gehbehindert, wird aber von der Tochter Sylvia, Kindergärtnerin, liebevoll betreut. Die zweite Wohnung im Obergeschoß bewohnte ich nach 1928 mit meiner Familie, doch nach meinem Wegzug bezog sie Hermine Swobo-da. Nr. 4: Hier befand sich nach 1876 die Apotheke des Ferdinand Daubrawa, der sich damals als Bürgermeister (1867–1883) große Verdienste erwarb. Zu unserer Zeit zeigte die Auslage Wollsachen und Wäschestücke der Firma Babutzkys Erben. Dieses Geschäft übernahm später Bernkopf, dann seine Witwe, geborene Baier. Anni Babutzky lebt verheiratet in Wien. Im Obergeschoß dieses Hauses hatte der Rechtsanwalt Dr. Hans Petzny seine Amtsräume. Er ist bereits gestorben. Seine Sekretärin war Hermine Swoboda (Sie wurde bereits oben erwähnt), die später in der Zukkerfabrik tätig war. Sie lebt in 3547 Wolfhagen (Landkreis Kassel/Hessen), und ist allen Lesern der Sternberger Heimat-Post durch ihre feinfühligen Betrachtungen und Erinnerungen an Neustadt gut bekannt. Es ist begreiflich, daß sie bei jedem Wachsstockfest anzutreffen ist.
hann Rottal, links Johann Federle; Bank sieben rechts Johann Kowarz, links Josef Klein; Bank acht rechts Karl Aschl, links Johann Kowarz. Die Wohnung im zweiten Stockwerk hatten die Lehrerin Nekarda und die Handarbeitslehrerin Knirsch. Nr. 7: Dieses Haus kann auf eine lange geschichtliche Vergangenheit zurückblicken, denn hier stand einst (vielleicht bereits bei der Gründung der Stadt 1223) die Vogtei, das „Herrenhaus“. Ab 1749 diente das Gebäude, das hier einst stand, als Kaserne. 1911 erfolgte der Neubau des heute so stattlichen Gebäudes durch Primär Emil Miller. 1923 gehörte es Therese Miller/ Fleischmann. Im Erdgeschoß war

die Städtische Sparkasse untergebracht, Leiter Ferdinand Heidenreich („Kassa-Nanti“), später Hans Rössler. Hier wirkte auch Cilli Knirsch/Kovarsch. Sie lebt als Witwe in 8069 Hög in Oberbayern und ist Wachsstockfrau.
Nr. 6: In diesem Haus befand sich die Konditorei und Zuckerbäckerei Edmund Willert. Anni Willert, verehelichte Skerle, und Pepperl Willert leben in Österreich. Im oberen Stockwerk wohnte die überaus fleißige, gewissenhafte und gutmütige Lehrerin Emilie Smekal.
Nr. 5: In dem großen Schaufenster gab es glänzende Geschmeide, funkelnde Ringe und Broschen sowie goldene Uhren. Es war das Schaufenster des Uhr-
Nr. 3: Marie Linhart und Antonia Stonner/Koberstein. Im Erdgeschoß befand sich der Gasthof „Zum weißen Kreuz“ von Hans Pfeifer. Ingenieur Koberstein verstarb im Vorjahr. Die Sternberger Heimat-Post brachte einen ausführlichen Nachruf. Nr. 2: Rosa Just. Im Erdgeschoß war die Tabaktrafik Dolleschel. Im ersten Stock hatte die Familie des Fachlehrers August Lohwasser bis zu ihrem Umzug ihre Wohnung. Er ist wohl allen ehemaligen Bürgerschülern als tüchtiger Lehrer und allen Musikfreunden als guter Musiker gut bekannt. Die Töchter waren Friedel und Ingrid.
Wir überschreiten nun die Herrengasse und kommen an die Ostfront des Stadtplatzes. Der Spaziergang endet mit der nächsten Zeitungsausgabe.
19 STERNBERGER HEIMAT-POST Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023
Der Stadtplatz im Jahr 1945 und aus derselben Perspektive im Jahr 2008.
Nr. 7
Nr. 10
Nr. 9
Lebensmittelgeschäft „Schweda“. Bilder: Archiv Mährisch Neustadt
Auch hier sieht man die Südseite des Stadtplatzes mit der Sparkasse und dem Haus Nr. 9, in dem nun der Laden von Friedrich Schötta ist. Davor der Poseidonbrunnen.
Ums
Eck von der Weinstube Götlicher befand sich das
Auf dem Stadtplatz vor der Sparkasse steht dieser Poseidonbrunnen. Im Hintergrund kann man die Weinstube Göttlicher erkennen.
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, eMail isergebirge@zeitung.de – Betre : Zuckmantler Heimatbrief




Das dürre Blatt
Wie ein längst vergess‘ner Traum hängt ein Blatt am kahlen Baum, verwelkt, verdorrt, ganz ohne Leben, hängt es so rum und darin eben erkannte ich den wahren Sinn. Es nahm sein Schicksal nicht so hin. Es fiel nicht ab, es wehrte sich, es gab nicht auf, belehrte mich durch seine Art so rumzuhängen. Es ließ sich auch durch nichts bedrängen, den Platz am Aste abzugeben, verdorrt wollte es weiterleben.
Der Perpendikel
A Segermacher ei am Städtel –
Itz is a tudt, und a vergleicht sich
Zu anner stiehn geblieb‘nen Uhre, Die ei der Ewigkeit vu neuem
Ei Gang gebrucht und ufgezoin wird –Wie der amoal su arbt eim Stübel, Do kimmt a Mutterle vum Durfe
Und brengt a‘n Perpendikel, brengt se,

A sol da Dingrich repperieren.
Der Meester Völkel scheubt de Prille, De gruße Prille uf die Sterne
Und sitt su fluschelnd uf de Ale
Und spricht: „Ja, Mutter, hiert ock, hoatt‘r a Seger ni miet reigebrucht?“

„A Seger?“, frät ünse Mutterle und külstert, „Der Seger, Meester Völkel, gieht schun, Ock der verdammte Perpendikel, Der faule Nickel, tutt ni giehn!“
Wilhelm Menzel
Aus: „Mundart und Mundartdichtung in Schlesien“.
❯ Wenn die Gedanken in die Heimat wandern
Winter
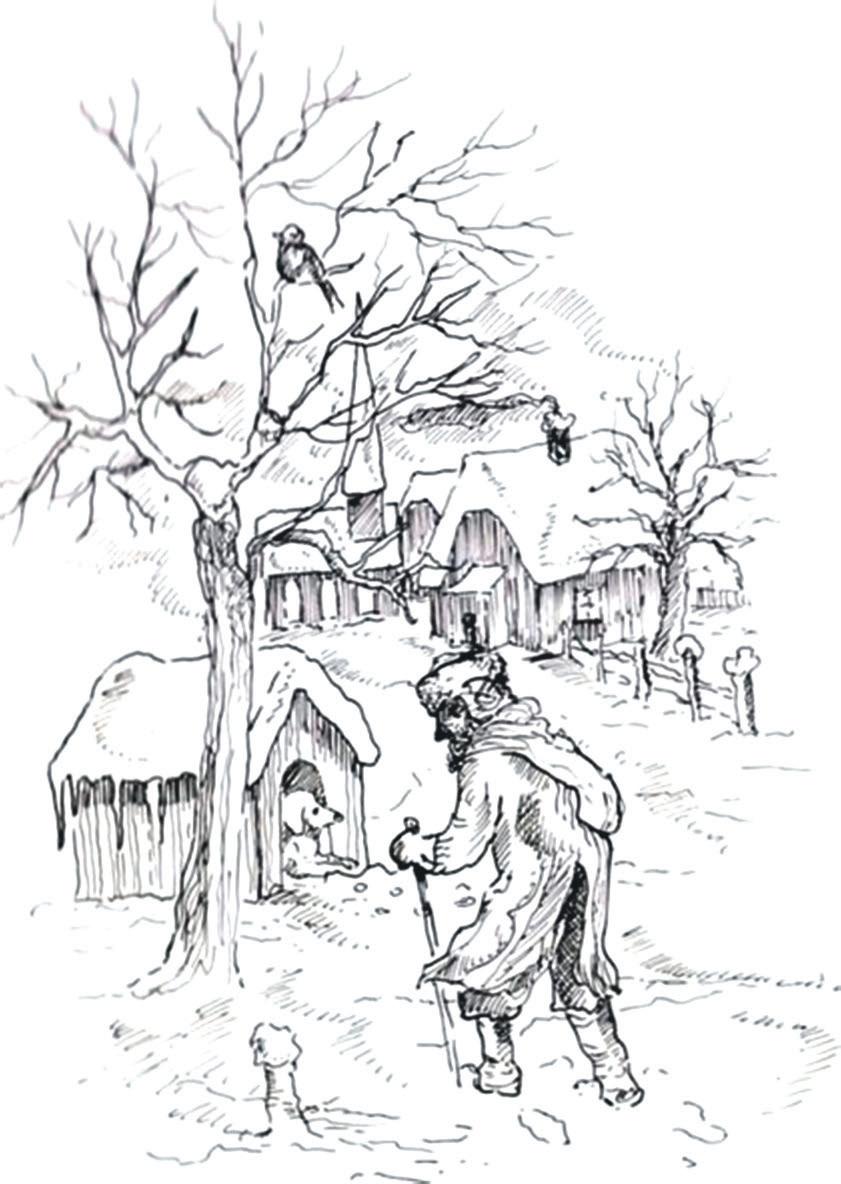
Kaltl is drauß‘n, ‚s ies a rechtigcr Graus, ma kriegt de Hände aus’n Toasch‘n nie raus.
Ei oull’n Gliedern tut ma‘s spier‘n, de Lelle will goar oa der Gusche gefrier’n.
Ei der Bache kracht ‚s Eis bis zende nonder, bei dar Kälde, do ies doas goar kä Wonder.
Die Hunde glutz‘n aus der Hütte raus, nie amol zun Frass’n giehn se naus. Der Wend heilt, s‘is werklich zun God derboarmen, die Vögla sein goar die Ärmsten der Oarmen, kän Pfardedreck find‘n se ond kä Körnla, käne Vogelbeer‘n ond kä Wärmla.
Die Fische eim Woasser mid‘n Schwänzla zoappan, vor Kälde tun se mid‘n Zähn‘ goar kloappan.
Trett ma noch asu langsam ond leise ei‘n Schnie, fängt a oan ze quietsch‘n, ‚s tut‘n halt wieh. De Kälde ies goarschtich fier Mensch ond fier Tier. Oabcr war koan‘s ändarn? Ich koan nie derfier.
Fritz Bernert
Auf der Bischofskoppe

Röngsrem ei a schles’scha Barga is’s doach nörgends a su schien oals wie off d’r Bischofskoppe. War’s nie gloabt, dar gieh oach hin. Nuff! Doas kost groad nie viel Miehe, doas d’rmacht schier jeder Loapsch, hot a hoalbwegs eim Stoarsäckla oach a beßla Worzelschnoaps. Werd a trotzdem moatt ond müde, is a anoch nie verlurn, denn do hoats ju oalle korzlang Bänke, wu ma ausruhn koan. Is ma off d’r Koppe druba, gieht ma vur ei’s „Rudolfsheim“, denn do kriegt ma ale Quärge, Potterbrud, Worscht, Bier und Wein. Ond noch lauter gude Sacha, wu äm’s Hatz eim Laibe lacht. Ond ma frät sech, onderhält sech, bis die Zeit a Ende macht.
Hot ma nu eim Rudolfsheime quietschvergniegt sech oagewoampt, steigt ma off a Aussechtstorm nuff, wenns hübsch kloar – sonst ies’s geploampt. Trefft ma oaber gudes Water, sitt ma weit eis „Preische“ nei ond eis „Glötsche“ nuff ond nonder, goar bis ei de Polakai.
Ond de ganza schles’scha Barge wärma sich eim Sunnaschein. –Warn nu do nie’s Hatze ufgieht, dar muß „triebetömplich“ sein.
Bruno König
Aus: „Vom Teschkerier‘n, Derzehl‘n“. „Glötsche“ bezieht sich auf die Grafschaft Glatz.
Erennerung oan Zeckmantel
‚S wad Eich wuhld oallen asu giehn: Seit br do ai dr Fremde sein, wandern die Gedanken goar oft off hämzu, ai enser schienes Altvoatergebärge. Bei mir giehn se halt oam liebsten noach Zeckmantel!
Es ies etz schunt ieber fuffzich Juhre har, doaß ich doas schiene Schtaadtla zum erschtenmol gesahn hoa. Dozumol hoatte mich enne schwere Krankhät goar oarg hargenumm, unt iech sollte dringend off Loftveränderung ais Gebärge. Wu hätt ich mich denn besser drhulen könn wie ai Voatersch schlesischer Hämet, ru do machte ich abens mit menner Grußla die weite Rase vo Senftlawe (Senftleben, Bez. Neutitschein/Nordmähren) noach Zeckmantel, wu Verwandte vom Vater a hibsches Haisla hoaten.
Onderwags poaßte ich gutt uf, doaß iech och ja woas vo Salisfeld soach, wu mei Voater off de Welt kumm ies unt amohl oals „Salisfelder Franzla“ die ganze Gegend mit sänn Schtreichcn unsecher machte. Har torsch oabr nie wessen, doaß iech Eich doas verroten hoa, har behaupt nämlich immer, har war doas bravste Jengla weit unt brät gewast, se hätten‘an doch a immer doas „gude“ Franzla gehäßen!
Wu enser Ziegla dann ain Boahnhof vo Zeckmantel neiroatterte, schtund datt ä Moan ai galen Hosen unt mit änner bloen Schärze. Har plätzte oan änner Pfeife unt soach sich oalle Leite oan. Endlich koam har off ens zu unt freete:„Seid Ihr vo Senftleb’n?“ Inne jechichnä, doas woar jo dr Onkel Willem! Har noahm mich glei bei dr Hand unt führte ens ain Mieserich zu sänner Villa! Nä, woarsch Eich datt schien! Doas Haus schtund metten ai äm grußen Goarten unt drnaben woar schunt dr Pusch. Aim Hause woarte die Tant Berta off ens unt säte: „Inne jechichnä, seit’r doch glecklich oankumm vo Senftleben!“ Br mußten glei assen unt drnochdarn doas Haus vom Boden bis ain Kaller oansahn. Aim

Das Postgebäude in Zuckmantel (Zlaté Hory). Aquarell in Grau und Federzeichnung in Schwarz (Rahmung) von Rudolf Bernt, signiert. Vorzeichnung zum „Kronprinzenwerk“ (Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Wien 1886–1902), Band „Mähren und Schlesien“, 1897, Seite 639.
Kaller woar änne salbergebaute Pumpe, die de off dr ganzen Welt beschtemmt kä zweetes Mol vierkemmt!
Wu iech oam andern Tage ai dr Frieh drwachen toat, do hoa iech ai mich neigehickert, denn do soach ich ’n Onkel Willem ai änner ruten Tärkenmetze mit äm schien ruten Peschel druffe, wie ha Feier machen toat. Die Ziegen hoatt har schunt gemolken, dann toat’r noch die Entlan und Hinner fittern. Die Tant Berta oamtierte derweil aim Sanatorium vom Dr. Schweinburg oals Boademästeren.
Noach’m Friehschtecke noahm mich dr Onkel Willem mit ai de Schtoadt, wu har jeden Morgen „die Müch“, wie har immer off wienerisch sän toat, aim Hotel Thamm oablieferte. Ich woar ganz paff ieber oalles, woas iech do soach - die bräte saubere Schtroaße mit dan großen Bämm rechts unt lenks, die schien’n Heiser, die Kärche mit dam lieblichen Muttergootesbelde, die kläne Rochuskopalle oam Barge drüben unt die Bischofskoppe, die asu majestätisch off doas oalles ronderguckte.
Wu br wieder hämkoamen, wollt ich mich ang mid’m Poppla schpieln. Do lachte dr Onkel unt säte: „Do satt amol doas Gezeikla oan, du warscht doch nie amende goar noch mit acht Juhrn mid’m Poppla schpieln?“ Oals iech später mit dr Gruhßla vo äm Schpoazierwage zerekke koam, do drschroak iech. Woas denkt Ihr? Hung doas Poppla ärschlich oam Gitterbette, die Grageln nuffgerackt – ’s woar zum Roatzen! – unt mid’m Poppla schpieln woarsch aus!
Zumettich hoatt br änne Soppe, die woar asu decke, doaß ma druff tanzen könnt, oabr doas ganze Ass’n schmackte sihr gutt. Noch’m Mettichass’n mußt ich mich haußen vir dr Veranda änne ganze Schtonde hienlän. Doas woar fir mich änne hoarte Buße, ich toat viel lieber mid’m Hendla schpiel’n, Bliemlan pflock’n, oabr
aim Posche remhatsch’n. Mai Trost woar bluß, doaß ma dorch änne Lecke aim Zaum off de Schtrohße sahn könnt, wenn groad war off Mariahilf giehn toat. A poarmol woar iech a salber mit dr Gruhßla ai dam schien Wollfoahrtskärchla, unt ich färchte, iech hoa mai Hatze verlurn datt drub’n! Oalle Wochen zweemol sei br off Neisse gefoahrn zu äm Uhrndokter. Do mußt br ai Ziegenhoals immer ai die vierte Klasse emschteigen, weil aim Preiß’schen bei dr Boahne die drette Klasse jo nie fir die gewehnlichen Schterblichen woar. Ämol woar br a zu Fusse ai Enderschdorf, unt ich konnt datt zusahn, wie mai Kusine Frieda Hantschken nähn toat.
Die grißte Fräde hoatt ich immer, wenn die Tant Rese vo Nekkelsdruff wieder amol off Besuch koam. Se woar schunt hoalb taab unt ma mußt se tichtich oanschrein, doaß se woas verschtiehn toat. Weil sie drfoahrn hoatte, doaß iech a ang schwerhörig bien, pröllte se mich a oan. Doas woar mir oabr ang zu tomp unt ich gorgelte ihr su laut ich konnte ais Uhr: „Tant Rese, Du brauchst nie asu Schrein mit mir, iech bien nie asu taab wie Du!“ Die gude Tant Rese ärgerte sich nie amol drieber, sie lachte bluß drzune.
Sechs Wochen tauerte doas schiene Laben, unt vo dar gesonden Loft beim Posche unt dar guden Pfläge ho ich sechs Pfond zugenumm. Etz huß’s, wieder oalles vierscherrn zur Hämfoahrt. Dann mußt br Oabschied nahm vo dam schien Landla, wu mrsch asu gutt gefoall’n hoatte, unt dan guden Laiten; roaznich grätscht br zur Boahne unt fuhrn mit dar Kaffemihle ahäm.
Ai dr Schule ho ich drnochdarn zum Oandenken än Ufsoatz ieber die Summerfresche ai Zeckmantel geschrieben unt ’n Onkel Willem drzunegemolt ai dan galen Hosen, mit dar bloen Schärze, dr Tärkenmetze unt dr Pfeife, unt doas Hendla dmaben. Dar Ufsoatz unt doas Beld sein schunt weg, oaber ai mem Hatze vergieht se nie – die Erennerung oan doas schiene Zeckmantel! Rudolf Heider
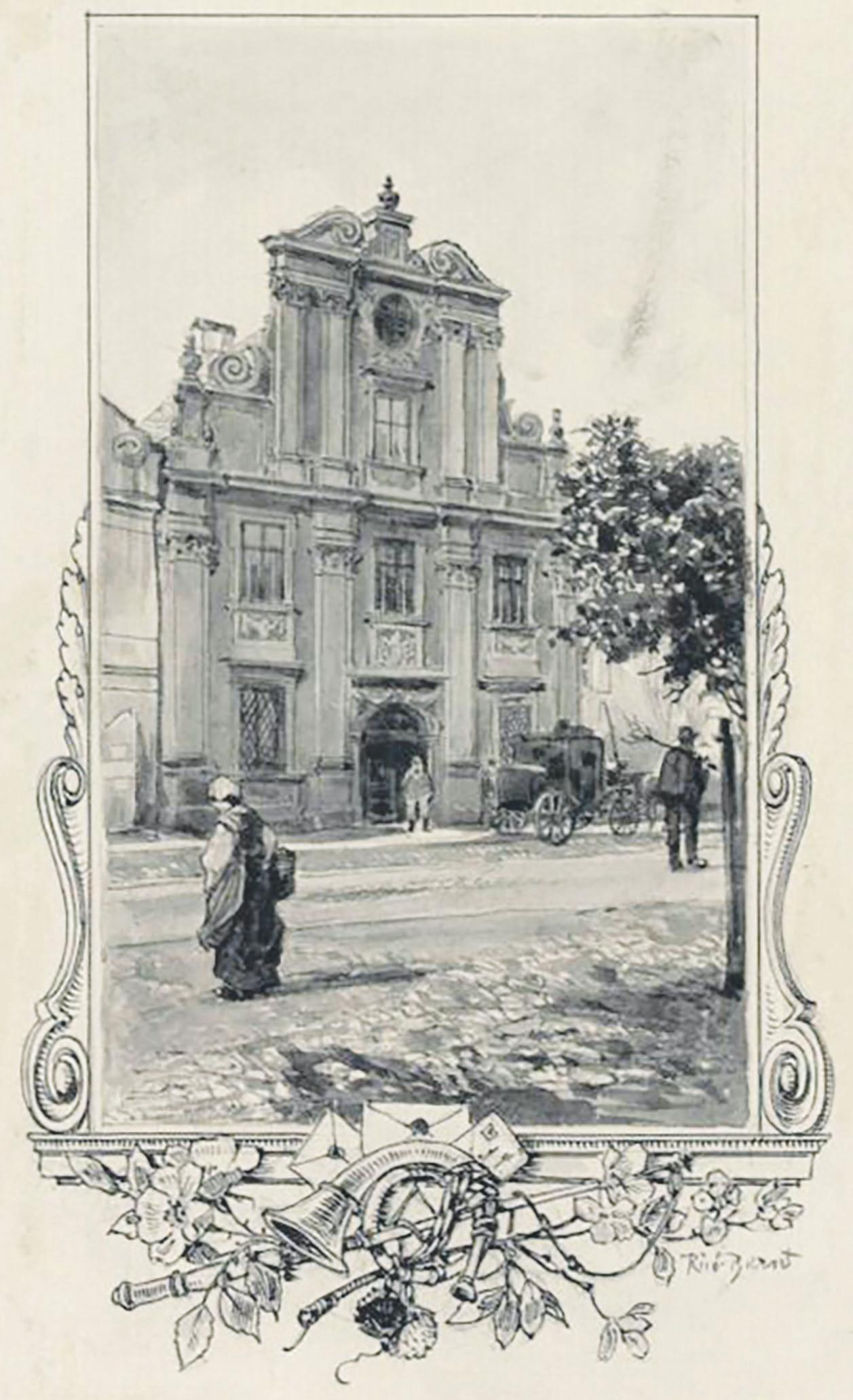
Sudetendeutsche Zeitung Folge 11 | 17. 3. 2023 20
Gertrude Junta Track