Sudetendeutsche Zeitung

FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit





Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland


In eigener Sache! Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,




so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt

gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen
aber








Heimatzeitung am




Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG






Zum ersten Mal hat mit Petr Fiala ein tschechischer Premierminister – begleitet von seinem Kulturminister Martin Baxa –am Dienstag in Regensburg an einer Sitzung des bayerischen Ministerrates teilgenommen.




























„Das ist ein historischer Moment in den bayerisch-tschechischen Beziehungen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder, der das Verhältnis zwischen München und Prag als „ziemlich beste Freunde“ beschrieb.




„Die Zahl der illegalen Flüchtlinge ist nicht so hoch, daß die Einführung von Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums notwendig wäre“, hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala die Forderungen insbesondere aus Sachsen und Brandenburg nach festen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen abgelehnt. Auch Bayern, so Ministerpräsident Markus Söder, ist gegen feste Grenzkontrollen.




Wir müssen möglichst viel tun, um einen der größten Vorteile der Europäischen Union nicht einzubüßen – die Freizügigkeit für Waren und Personen”, sagte Fiala in Regensburg und forderte, die Rückführungspolitik zu verschärfen, die Kontrollen zu verbessern und „uns auf eine Anpassung der Visabestimmungen in Drittländern zu einigen, aus denen illegale Migranten zu uns kommen“.






Bayern, das eine eigene Grenzpolizei betreibt und diese zur Schleierfahndung im grenznahen Raum heranzieht, hält eigene Kontrollen an der Grenze zu Tschechien wie an der österreichischen Grenze derzeit ebenfalls für nicht notwendig, erklärte Ministerpräsident Markus Söder.





In der Pressekonferenz würdigte Söder dabei ausdrücklich die Sudetendeutschen als Brückenbauer, und Fiala gab bekannt, daß ein Mitglied seiner Regierung als offizieller Vertreter am Sudetendeutschen Tag an Pfingsten in Regensburg teilnehmen werde. Dem vorausgegangen waren intensive Bemühungen über unterschiedliche Kanäle von Volksgruppensprecher Bernd Posselt, der ebenfalls in Regensburg war.




In den vergangenen Jahren habe das Verhältnis zwischen Tschechen und Sudetendeutschen „eine neue positive Dimension erreicht“, erklärte Fiala und führte auf die Frage der Sudetendeutschen Zeitung nach dem sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis aus: „Die Beziehungen, das gegenseitige Verständnis füreinander, haben sich wesentlich verbessert. Wir sind daran interessiert, gute Beziehungen zu haben, deshalb wird ein Repräsentant der tschechischen Regierung am Sudetendeutschen Tag teilnehmen. Damit wollen wir zum Ausdruck bringen, daß wir auch bei dieser Frage in die Zukunft denken und nicht darüber, was wir uns in der Vergangenheit nicht vermocht haben zu sagen.“
Offizieller Anlaß des Staatsbesuchs war die Eröffnung der Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ (siehe Seite 3) im Dom, die bis zum 3. Oktober in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte und anschließend vom 8. Dezember bis 8. Mai in Prag im Nationalmuseum gezeigt wird. Die beiden Regierungschefs nutzten das Treffen aber auch,
Bayern und Böhmen verbindet auch das gute Essen, sagte Ministerpräsident Markus Söder beim Besuch der Regensburger Wurstkuchl mit Premierminister Petr Fiala. Fotos: Torsten Fricke





Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf begrüßt Petr Fiala vor dem Beginn der Kabinettssitzung.









um eine Vielzahl von gemeinsamen Projekten voranzubringen. So unterzeichneten Söder und Fiala eine Gemeinsame Absichtserklärung für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Luft- und Raumfahrtbereich. Im Hochschulbereich soll außerdem das Programm „Joint Call Bayern-Tschechien“, das unter anderem Stipendien für Studienaufenthalte im Nachbarland und gemeinsame Forschungsprojekte beinhaltet, ausgebaut werden. Und im Schulbereich soll es mehr Initiativen geben, um die jeweils andere Sprache zu lernen.



Auch bei der Infrastruktur wollen München und Prag gemeinsam Druck machen. „Wir treiben das bayerisch-tschechische Gemeinschaftsprojekt 5G-Korri-




In der Ausstellung:











dor München-Prag weiter voran“, so Ministerpräsident Söder. Dringend notwendig sei auch eine Verbesserung des Schienenverkehrs. Vor allem die „Wieder-


einführung von Fernverkehrszügen zwischen Prag und den beiden bayerischen Metropolen München und Nürnberg“ sei, so Söder, dringend notwendig.

Bereits in wenigen Tagen wird Bayerns Ministerpräsident den nächsten hohen Gast aus dem Nachbarland begrüßen: Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel, den Söder bereits im Frühjahr bei der Sicherheitskonferenz in München getroffen hat, kommt nach Selb, um dort die BayerischTschechischen Freundschaftswochen zu eröffnen. Und zu Petr Fiala, mit dem sich Söder während des Spaziergangs durch die Regensburger Altstadt und beim Mittagessen in der historischen Wurstkuchl intensiv ausgetauscht hat, hat er ohnehin ab sofort einen kurzen Draht: Die beiden haben, wie Söder in der Pressekonferenz erzählte, ihre Handynummern ausgetauscht. Torsten Fricke





AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Beim Gasthaus „Na staré faře“ (Alte Pfarrei) im Prager Stadtviertel Dejwitz (Dejvická) handelt es sich um ein einfaches Lokal.

Die Nähe zu der kleinen, aber populären Matthäus-Kirche und der entsprechenden Bushaltestelle genügt, um zu prosperieren oder zumindest wirtschaftlich zu überleben.
Bayerns
Bei der Hausrenovierung wurde dort die alte deutsche Gasthausbezeichnung „Alte Pfarrei“ entdeckt. Die meisten Neubesitzer reagieren oft auf eine radikale Weise, indem sie an der Fassade alles verdecken, was an die deutsche Vergangenheit erinnert.


Bei diesem Haus hier war es aber anders, und so kann jeder Besucher dieses uralten Stadtteils am Ran-
de der Hauptstadt erfahren, daß in diesem Gasthaus einst guter Ka ee serviert wurde.
Außerdem weiß so gut wie jeder alte Prager, daß die Matthäus-Kirche dem bis heute beliebten Volksfest „Matějská pouť“ (das ursprüngliche Kirchweihfest) seinen Namen gab. Dieses ursprüngliche Kirchweihfest ndet heute allerdings ganz woanders statt.
Europa-Bekenntnis des neuen Ministers
Jegliche Versuche, die Einheit der Europäischen Union zu untergraben, würden dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände spielen, hat der neue tschechische Europaminister, Martin Dvořák, in einem Radiointerview gesagt. Als eines seiner Ziele nannte der Minister daher, den Blick auf die EU in Tschechien zum Positiven zu verändern. Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts NMS Market Research unterstützen derzeit 49 Prozent der Tschechen die EUMitgliedschaft ihres Landes, 38 Prozent halten sie aber für problematisch. Laut Dvořák beruht die EU-Skepsis auf dem Einfluß des früheren Präsidenten Václav Klaus und einer allgemeinen Politikverdrossenheit.
Vorratspflicht für Pharmafirmen
Staatsorden „Za zásluhy“. Zuletzt sang Soňa Červená aus Anlaß der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft im September vergangenen Jahres in der Lateranbasilika in Rom.
Personalnot am Prager Flughafen
Vor dem Beginn der Hauptreisezeit klagt der VáclavHavel-Flughafen über Personalmangel. Man habe wärend der Corona-Pandemie wohl zu viele Leute entlassen, nun sei es schwierig, entsprechenden Ersatz zu finden, sagte der Chef des Flughafens, Jiří Pos, am Sonntag der Presseagentur ČTK. Derzeit sind beim größten tschechischen Flughafen rund 2500 Menschen beschäftigt. Das sind 300 weniger als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019.
Sparta Prag will neues Stadion bauen

lud zum „Mitteleuropa-Tag“ in den Bayerischen Landtag ein
Vertriebene als Brückenbauer
für ein gemeinsames Europa
„Unsere Zukunft liegt im Herzen Europas“, lautet das Fazit von Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, zum „Mitteleuropa-Tag“ im Bayerischen Landtag, der konsularische Vertreter der Länder Ostmittel- und Südosteuropas, Mitglieder der Landsmannschaften und Jugendverbände der Aussiedler und Vertriebenen, Studenten sowie Repräsentanten aus Wissenschaft und Kultur in einem Fachforum zusammengeführt hatte.

Bei dieser Konferenz habe sich bestätigt, so Stierstorfer, „wie eng sich gerade die Vertriebenen und Aussiedler und ihre Nachkommen ihrer alten Heimat in unseren östlichen Nachbarländern verpflichtet fühlen, und wie sehr sie als Brückenbauer die Verständigung und das Zusammenwachsen in einem Mitteleuropa, das über Geschichte und Kultur seit Jahrhunderten eng miteinander verbunden ist, befördern können“.
Rund einhundert Gäste hatten am 4. Mai im Bayerischen Landtag über „Mitteleuropa“ diskutiert. Einen ersten Impuls gab Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, indem er über „Die Deutschen im östlichen Europa in Geschichte und Gegenwart“ berichtete. Dr. Florian Kühler-Wielach vom Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Südosteuropa an der Ludwig-Maximilians-Universität in München stellte die Frage, ob „nach Wende und EU-Osterweiterung“ wirklich von der „Wiedergeburt Mitteleuropas“ die Rede sein könne, ehe Prof. Dr. Ulf Brunnbauer vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg erste Ergebnisse des dort im vergangenen Jahr eingerichteten und mit Mitteln des Freistaats geförderten Forschungsprojekts „Die Vertriebenen als integraler Bestandteil Bayerns“ präsentierte.
Zwischen den Fachvorträgen verliehen zwei von der ARD-
Journalistin Dr. Susanne Glass moderierte Podiumsdiskussionen der Debatte wertvolle Impulse. Zunächst sprachen die in München akkreditierten Vertreter Tschechiens, der Slowakei und Ungarns, die Generalkonsuln Dr. Ivana Cervenková, Jozef Korcek und Gábor Tordai-Lejkó, über „Die Bedeutung des historischen Erbes und die Vertriebenen als Brückenbauer“, bevor dann die junge Generation an der Reihe war.
Nelli Geger von der jungen Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland, Julia Schäffer, Bundessprecherin der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde, und Klaus Weber von der Deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppe stellten sich in einer angeregten Diskussion der Frage „Was bedeuten Mitteleuropa und die alte Heimat für mich heute?“.
Wie wichtig das Thema „Mitteleuropa“ gerade in der aktuellen geopolitischen Situation in Europa ist, kam aber auch dadurch zum Ausdruck, daß sowohl
❯ Beim Staatsbesuch in Kiew




die Bayerische Staatsregierung als auch der Bayerische Landtag hochrangige Vertreter entsandt hatten. So ließ Europaministerin Melanie Huml das Publikum ebenso Anteil an ihren „Gedanken zu Mitteleuropa“ haben, wie Landtagsvizepräsident Karl Freller in seinen Grüßen seitens des Parlaments die Relevanz des Themas würdigte. Gastgeberin Sylvia Stierstorfer war nach der vierstündigen Veranstaltung begeistert: „Wir haben nicht nur viel Neues gelernt und erfahren, sondern auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen Bayern und seinen östlichen Nachbarn erlebt. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, die durch Kultur und Geschichte längst nicht mehr getrennt, sondern eng miteinander verbunden ist. Dazu haben gerade auch die Vertriebenen und Aussiedler und ihr Wille zur Verständigung beigetragen. Früher als andere haben sie erkannt, daß unsere Zukunft im Herzen Europas liegt. Dafür bin ich sehr dankbar“.
Eine Pistole als Gastgeschenk
Früher dürfte ein tschechisches Staatsoberhaupt als Gastgeschenk ein paar Flaschen Becherovka im Gepäck gehabt haben. Anders unter Präsident Petr Pavel, der sich bei seinem Besuch in der Ukraine für ein politisch unkorrektes, aber in Kriegszeiten durchaus praktisches Präsent entschieden hat – eine Neun-Millimeter-Pistole.

Der russische Angriff sei im Februar 2022 auf den erbitterten Widerstand der Ukrainer gestoßen, twitterte Tschechiens Präsident Petr Pavel und schrieb:
„Von Anfang an haben tschechische Waffen die Ukraine im Kampf unterstützt.“
Als „Zeichen des Respekts für dieses Heldentum“ habe er seinem ukrainischen Amtskollegen
Eine geplante Novelle des Arzneimittelgesetzes soll Pharmaunternehmen künftig dazu verpflichten, pro Medikament einen Vorrat für zwei Monate anzulegen. Gesundheitsminister Vlastimil Válek (Top 09) erklärte, er wolle, daß diese Regelung bereits vor der Erkältungszeit im Oktober in Kraft trete. Außerdem soll die Liste der zuzahlungsfreien Medikamente erweitert werden, um die Bürger zu entlasten.
Trauer um
Soňa Červená
Im Alter von 97 Jahren ist Opernsängerin Soňa Červená am Sonntag in Prag gestorben. Nach ihrer Emigration aus der Tschechoslowakei im Jahr 1962 trat die Diva in den besten Opernhäusern der Welt auf. Ihr Mezzosopran erklang etwa unter der Leitung von Herbert von Karajan. 1989 beendete sie ihre Opernkarriere und war danach am Thalia-Theater in Hamburg beschäftigt. Später kehrte Soňa Červená in ihre tschechische Heimat zurück. Nach der politischen Wende von 1989 erhielt sie in Tschechien zahlreiche Auszeichnungen – so 2011 die Verdienstmedaille des tschechischen Kulturministeriums, Artis Bohemiae Amicis, und 2015 den
Tschechiens Fußballrekordmeister Sparta Prag plant, ein neues Stadion zu bauen. Vereinsvorstand Tomáš Křivda sagte, der derzeitige Standort am Sommerberg, dem heutigen Stadtteil Letná, biete keinen Raum für eine Modernisierung und Vergrößerung des Stadions. Die gegenwärtig bevorzugte Variante sei ein Neubau auf dem Strahov, wo ein Nationalstadion für Tschechien mit über 30 000 Plätzen entstehen könnte. Der Verein Sparta Prag, der 1893 gegründet wurde, hat seinen Sitz seit 1917 am Rand des Letná-Parks.
Marathon-Sieg mit neuer Rekordzeit
Der Kenianer Alexander Mutiso hat am Sonntag den Prager Marathon mit 2:05:09 Stunden in einer neuen Rekordzeit gewonnen. Damit knackte Mutiso die 13 Jahre alte Bestzeit um 30 Sekunden. Bei den Frauen siegte Worknesh Edesa aus Äthiopien in 2:20:42 Stunden. Bester tschechischer Läufer und damit Landesmeister wurde Vít Pavlišta in 2:19:14 Stunden. Den tschechischen Titel bei den Frauen holte Moira Stewart. Auf die 42,195 Kilometer lange Strecke durch große Teile der Prager Innenstadt hatten sich rund 10 000 Läufer begeben.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Wolodymyr Selenskyi „die legendäre ČZ 75 mit der Seriennummer 22 überreicht“, so Pavel.
Die halbautomatische Selbstladepistole im Kaliber 9 mal 19 Millimeter wurde 1975 von der tschechischen Waffenschmiede Česká zbrojovka für Armee und Polizei entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Sitz im südostmährischen Ungarisch Brod, wo die Nazis 1936 eine Waffenfabrik aus dem Boden gestampft hatten. Im Februar 2021 übernahm das tschechische Unternehmen den traditionsreichen US-amerikanischen Waffenhersteller Colt und verfügt heute über Produktionsstätten in Tschechien, USA, Kanada und Deutschland. Die Mitarbeiterzahl wird mit über 2000 angegeben.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Das Schi der Kirche, Jacob Gerritsz Loef (zugeschrieben), 1640–1649, Öl auf Leinwand. Allegorisches Gemälde zum Kampf der Konfessionen im Barock: Die als mächtiges Seeschi dargestellte katholische Kirche mit dem gekreuzigten Christus am Mast und mit einer rechtgläubigen Besatzung samt Ordensvertretern und Papst triumphiert über die im Wasser treibenden Ketzer, darunter die Reformatoren Jan Hus, Martin Luther und Johannes Calvin. Foto: Museum Catharijneconvent, Utrecht
Tumbadeckel in Form eines realistisch gestalteten Skeletts, Plastik, Marmor, 1624. Das liegende Skelett stammt vom Sebastiansfriedhof in Salzburg und stand viele Jahrzehnte in der dortigen Beinhauskapelle. Bis 1685 diente die Skulptur als Tumbadeckel einer Gruft, in der verschiedenen Quellen zufolge zwischen 1618 und 1622 Valentin Helmegg beigesetzt wurde. Das manieristische Skelett besticht dabei durch seine überrealistische und lebendige Au assung des Todes. Foto: Salzburg Museum


Kopf der Marienstatue von der zerstörten Mariensäule auf dem Altstädter Ring, die nach Münchner Vorbild 1650 in Prag errichtet worden war. Die Sandsteinskulptur hat Jan Jiří Bendl erschaffen.

Foto: Nationalmuseum Prag
❯ Im Regensburger Haus der Bayerischen Geschichte wird bis 3. Oktober die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ gezeigt
Damenschuhe aus Leder, Seide und Metall, 1. Hälfte 18. Jahrhundert. Diese mit grüner Seide überzogenen und Stickereien verzierten Barockschuhe stammten aus der Krypta einer westböhmischen Kirche.

Foto: Nationalmuseum Prag
„Eine Anhäufung absoluter Spitzenexponate“
Bis zum 3. Oktober ist in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte die BayerischTschechische Landesausstellung 2023/2024 „Barock! Bayern und Böhmen“ zu besichtigen. Die erste derartige Ausstellung





übrigens, wie Direktor Richard Loibl betont, die gemeinsam von seinem Haus und dem Nationalmuseum Prag konzipiert wurde. In Prag wird die Ausstellung dann vom 8. Dezember bis zum 8. Mai 2024 präsentiert.
Ein Jubiläum ist Anlaß, die Ausstellung in diesem Jahr und in Regensburg zu verorten: Vor 400 Jahren, im Jahr 1623, wurde der bayerische Herzog Maximilian I. (1573–1651, siehe auch Seite 14) in der Donaustadt in den Kurfürstenstand erhoben, verbunden mit der dauerhaften Standeserhöhung auch für seine Nachfolger. Andererseits wurden in eben jenem Jahr in Prag führende Protestanten hingerichtet, was zu einem Exodus aus Böhmen wie auch zur Gründung neuer katholischer Klöster führte. Und seit fünf Jahren wütete der Dreißigjährige Krieg, der bekanntlich in Böhmen – in Prag – seinen Ausgang nahm. Diese Jahrzehnte waren eine „Zeit der Zerstörungen und der Wiederherstellung unter dem Marshallplan des Barock“, charakterisiert Loibl diese Epoche. Besonders hob er dabei die Schlacht am Weißen Berg (1620) hervor, die zur Rekatholisierung in Böhmen führte, wo das Hussitentum dominierend war.

Die Barockzeit war also eine „Zeit zwischen Himmel und Hölle“ mit Pracht und Herrlichkeit, aber auch Dunkelheit und Tod – letzteres durch den Krieg und Epidemien. Der Beginn des Barocks ist etwa 1620 anzusetzen, als erste Baumeister aus Italien ins nördliche Nachbarland kamen und ihren neuen Baustil ver-
breiteten. Und mit einem Vorurteil räumt die Ausstellung auf: Barock ist nicht mit der katholischen Konfession gleichzusetzen. Auch im Protestantis-


Beispiel als Skelett in Menschengröße. Aber auch vielerorts der „barocke Himmel“ mit allerlei Putti –in der Ausstellung finden sich unter





rem vier aus dem Kloster Aldersbach, welche die vier letzten Dinge darstellen: Tod, Gericht, Himmel, Hölle.
Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 setzte der Neu- und Wiederaufbau ein, der richtige Start des Barocks. Die Baumeister schufen zur Bewerbung für die von ihnen zu erbauenden Gebäude Modelle – einige finden sich in der Ausstellung, wie das der Benediktinerabtei Michaelbeuren. Doch nicht nur für die Bauwerke gab es Modelle, auch für Kuppeln oder Dekkengemälde. Stadtkirchen wurden neu gebaut, zum Beispiel auf Beschluß des Regensburger Stadtrates die Dreieinigkeitskirche. An vielen Orten änderte sich so das Stadtbild.

Die Künstler und Baumeister mußten für ihre Arbeit bezahlt werden. Auch darüber klärt die Ausstellung anhand einiger Bilder auf. Vor allem landwirtschaftliche Erträge und Einkünfte der Brauereien trugen zur Finanzierung bei.
bunzlau in Böhmen. Ein nicht alltägliches Exponat, eine hölzerne Monstranz aus dem ehemaligen Zisterzienserkloster Plaß (nördlich von Pilsen), fällt sofort in die Augen.
Schließlich war der Barock auch eine Zeit, in der Musik und Theater an Bedeutung gewannen – vor allem zur Umrahmung von Festen und Feiern. So im Jahr 1723 zur Krönung Kaiser Karls VI. in Prag zum böhmischen König, was mit entsprechendem Pomp inszeniert wurde: mit einer Oper in einem Halbamphitheater, von dem ein Modell zu sehen ist. Kunst sollte auch die politische Macht sichtbar machen. Auch der adelige Lebensstil drückte sich in barocken Formen aus: Commedia dell’arte – Spielen einer Rolle, barocke Theaterkostüme (zum Teil mit historischen Bezügen) oder ein Hund aus Holz, der als Abschußvorrichtung für Feuerwerkskörper diente.


zahlreiche barokke Zeugnisse, viele Beispiele etwa aus der Architektur verdeutlichen dies. Im Judentum fand der Barock ebenso Eingang, Thoraschilder und -aufsätze belegen dies – jedoch stärker in Böhmen als in Bayern. Darüber hinaus setzte sich der Stil auch im bürgerlichen Bereich durch.



Beispiele sind Exponate aus dem böhmischen Wallfahrtsort Altbunzlau beziehungsweise der Dreieinigkeitskirche in Regensburg. Viele Künstler und Baumeister arbeiteten übrigens für beide Konfessionen. Und in vielen der
Künstler- und Baumeisterfamilien waren auch Frauen tätig. Krieg und Pest rückten zu der Zeit auch die Verehrung der Nothelfer in den Vordergrund. So finden sich etwa Darstellungen des Heiligen Rochus mit seinem Symboltier, dem Hund, in Darstellungen sowohl in Bayern wie in Böhmen. Und auch der Tod findet oft Niederschlag in künstlerischen Darstellungen – zum
Modell des Klosters Michaelbeuern, Holz; Franz Alois Mayr, 1768. Baumeister Franz Alois Mayr erhielt von Abt Anton Moser den Auftrag, ein Holzmodell zu erstellen. Es zeigt einen Entwurf für die barocke Umgestaltung des im 8. Jahrhundert gegründeten und noch heute aktiven Benediktinerstiftes Michaelbeuern im Salzburger Land 30 Kilometer nördlich von Salzburg. Umgesetzt wurde der Entwurf in dieser Form allerdings nie.
Foto: Benediktinerabtei Michaelbeuern
Empfang der dreißig israelitischen Helden durch König David. Dieser plastische Entwurf, der vor 1770 gefertig wurde, zeigt das geplante Kuppelfresko für die Filialkirche Lauterbach der Benediktinerabtei Michaelbeuern, die durch den bayerischen Kirchenbaumeister Franz Alois Mayr barockisiert wurde. Das Modell diente dabei nicht nur zur einmaligen Demonstration für den Bauherrn, sondern konnte zudem vom ausführenden Maler in der Kirche auf Grund seiner Handlichkeit als direkte Arbeitsvorlage genutzt werden. Foto: Abtei Michaelbeuern

Ein besonderer Ausdruck für den barocken Geist sind die Dekkengemälde, vor allem in Bibliotheken. Hier wird überdeutlich, daß der Barock die letzte Phase einer universellen Vorstellung der Welt war. Als Beispiel dient hier das Clementinum (Jesuitenkolleg) in Prag. Eine fränkische Besonderheit aus dem Barock betrifft das verarbeitete Material.

Denn hier gibt es unterschiedliche Kalksteine, die entsprechend verarbeitet wurden. Ein Tisch aus der Residenz Ansbach weist viele Farben, die mittels Kalkmarmor möglich sind, auf.
Ende des 17., zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat der Barock dann Bayern und Böhmen durchdrungen, überall wurden die künstlerischen und religiösen

Aspekte deutlich. Auch in Wallfahrten und Prozessionen, ob zur Wieskirche in Bayern oder in Alt-
Auch wenn der Dreißigjährige Krieg überwunden war, die Barockzeit blieb eine Zeit des Krieges, wie die Türkenkriege belegen. Daher sind einerseits auch Gemälde von Schlachten ausgestellt, andererseits Darstellungen vom fremden Türken. Sozusagen mit den beiden Landespatronen, der Gottesmutter Maria (Bayern) und Johannes Nepomuk (Böhmen), endet die Ausstellung.
„Wir haben hier eine Anhäufung von absoluten Spitzenexponaten. Tschechische Museen haben ihre Schatztruhen geöffnet“, so Direktor Loibl. Das gilt ebenso für zahlreiche Einrichtungen aus ganz Bayern. 170 Exponate erwarten die Besucher, die über einzelne Themen auch mittels Medienstationen vertieft informiert werden. Zu der Ausstellung ist auch ein Katalog erschienen, der 272 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen umfaßt. Markus Bauer
❯ Erö nungswoche der Landesausstellung
Freier Eintritt bis 14. Mai
Noch bis Sonntag, 14. Mai, ist der Eintritt in das Museum und die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ frei.
Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr. In der Eröffnungswoche der Landesaustellung wer-
den außerdem kostenfreie Führungen um 10.00 Uhr, 11.30 Uhr, 13.00 Uhr und 15.30 Uhr angeboten. Am Samstag, 13. Mai, ist die Ausstellung bis 20.00 Uhr geöffnet. Hier finden zusätzliche Führungen um 16.00 und 18.00 Uhr statt. Adresse: Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg.
❯ Veranstaltung in der Tschechischen Botschaft in Berlin
Pardubitzer Studenten treffen
Überlebende der Vertreibung
Zu einer außergewöhnlichen
Begegnung hatte die Tschechische Botschaft in Berlin eingeladen. Studenten der Universität Pardubitz bekamen die Gelegenheit, mit Zeitzeugen über die Vertreibung zu sprechen.
Sieben Sudetendeutsche, die zwischen 1932 und 1943 im Gebiet der heutigen Tschechischen Republik geboren wurden und jetzt in Berlin leben, berichteten, wie sie nach Kriegsende mit ihren Familien gewaltsam aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben wurden.
Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka sagte in seiner Begrüßung, der schwierige Umgang mit der gemeinsamen Geschichte könne nur über Gespräche aufgearbeitet werden. Die jungen Tschechen, die von ihrem Professor Detlef Gwosc begleitet wurden, studieren an der Sigmund-Freud-Universität Medien und Digitaljournalismus und wollen die Gespräche in einer Videodokumentation aufarbeiten
In den Interviews befragten die Studenten die Zeitzeugen nach deren Kindheitserlebnissen sowie nach Erinnerungen an Vertreibung oder Flucht. In den Gesprächen kamen auch der Werdegang in Deutschland, die ersten Besuche in der alten Heimat und der Kontakt zu den neuen Bewohnern zur Sprache.
Unter den Zeitzeugen befand sich auch Professor Erich John, Jahrgang 1932 und Schöpfer der Weltzeituhr auf dem Alexander-
■ Bis Freitag, 19. Mai, Ausstellung „Nikolaus Hipp: Bilderwelten. Ölbilder, Aquarelle und Lithographien“. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10.00 bis 20.00 Uhr. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Bis Dienstag, 3. Oktober: Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ (siehe Seite 3). Öffnungszeiten (bis 14. Mai Eintritt frei): Dienstags bis sonntags 9.00 bis 18.00 Uhr. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg.
■ Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Mai, Paneuropa-Union Deutschland: 49. Paneuropa-Tage in Stettin und Greifswald unter dem Motto „Paneuropa – Gemeinsam für den Ostseeraum“. Anmeldung und Informationen unter eMail paneuropa-union@t-online.de oder per Telefax an (0 89)
99 95 49 14.
■ Samstag, 13. Mai, 14.00
Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Mutter- und Vatertagsfeier. Fischerheim, In der Aue 2, Wehringen.
■ Samstag, 13. Mai, 15.00
Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Muttertagsfeier. Gasthaus Lohgarten, Hilpoltsteiner Straße 28, Roth.
■ Samstag, 13. Mai, 15.00
Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 13. Mai, 17.00
Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Maiandacht am Vogelbeerbaum. Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Sonntag, 14. Mai, 13.00 bis 19.00 Uhr: Egerländer Gmoi Stuttgart: Gmoinachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
Israel – das Heilige Land und seine Dauerkrise
■ Dienstag, 23. Mai, 19.00 bis 21.00 Uhr, Online-Seminar: „Israel –das Heilige Land und seine Dauerkrise“. Gespräch mit dem Analysten, Orientalisten und Historiker Matthias Hofmann.
Der Vortrag will versuchen, die jüngsten Geschehnisse im Nahen Osten zu erklären. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung nach 1918, dem Ende des Osmanischen Reichs, beleuchtet. Was ist aus dem Land geworden, in dem Milch und Honig fließen, wie es im Alten Testament heißt? Wie wichtig sind Religionen im Nahen Osten? Wie entstand der Staat Israel? Wer sind die Palästinenser? Was ist die Hamas? Welche Nationen verfolgten und verfolgen welche Interessen im Nahen Osten? Kann es einen dauerhaften Frieden in dieser Region geben?
Der Link zur Registrierung wird Anfang Mai auf der Homepage www.heiligenhof.de freigeschaltet.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
platz in Berlin, der bereits 2012 ein Erinnerungsbuch über seine Vertreibung aus Kartitz an der Elbe verfaßt hat („Ikarusflüge“).
Ebenfalls Rede und Antwort standen der gleichaltrige Professor Otto Weiss, der neben vielen anderen Aktivitäten auch ein zweibändiges Werk über seinen Geburtsort Arnau an der Elbe im Riesengebirge geschrieben hat, sowie die 1935 in Neutitschein geborene Edith Kiesewetter-Giese, die neben vielen anderen Publikationen ihre „Erinnerungen an Mähren von Neutitschein nach Berlin“ 2012 herausgegeben hat.
Die Zeitzeugin hatte auch ihr weißes N-Textilschild dabei, das

sie als 10jährige tragen mußte, als sie mit ihrer Familie die Elbe entlang zur Grenze getrieben wurde. Neben der Schilderung von schrecklichen Verbrechen während der Vertreibung wurde auch die vielfache Verbundenheit von Sudetendeutschen mit Tschechen thematisiert. Ebenso die erstaunlichen Lebenswege, die viele trotz Schulausfall über Jahre, trotz ärmlicher Verhältnisse und schwieriger Lebensumstände in der neuen Heimat, meist in der SBZ/DDR machen konnten.
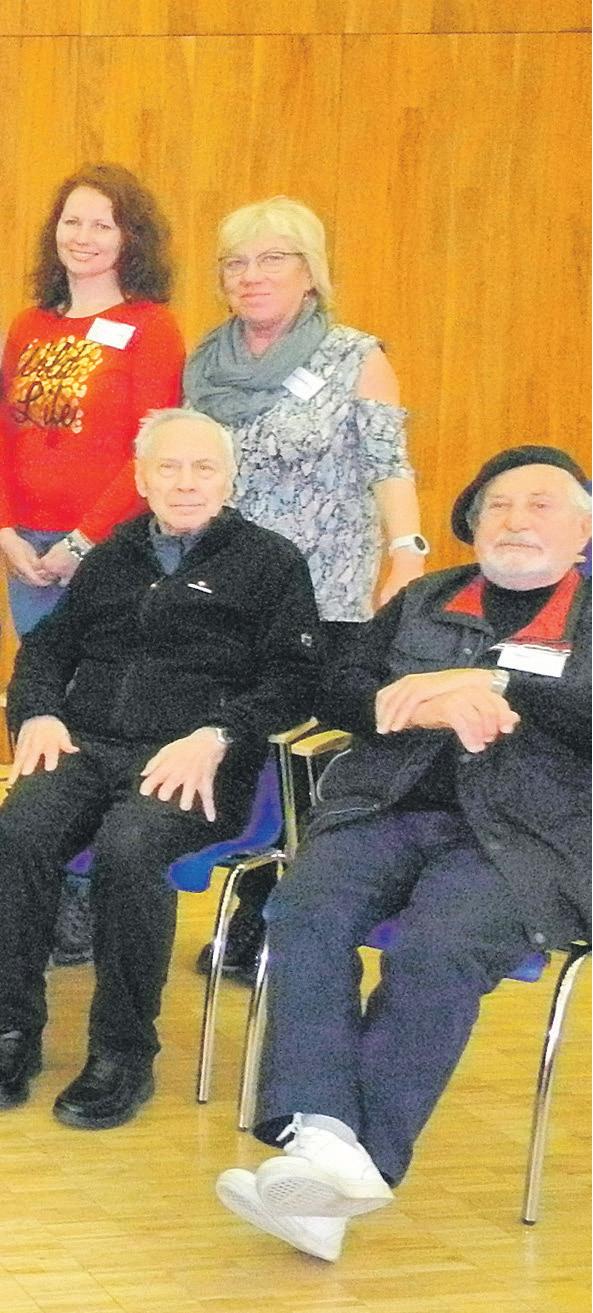
So wurde der 1942 in Johannesberg bei Gablonz geborene Heinrich Klammt sogar DiplomDolmetscher für Russisch und
VERANSTALTUNGSKALENDER

■ Dienstag, 16. Mai, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Dienstag, 16. Mai, 17.00 Uhr, VLÖ: Eröffnung der Ausstellung „Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“. Die Ausstellung wird bis zum 4. Juli gezeigt. Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr, freitags bis 12.00 Uhr. Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.
■ Dienstag, 16. Mai, 17.00
Uhr, Ackermann-Gemeinde
München und Freising: Nepomukfeier-Gottesdienst mit der tschechischen katholischen Gemeinde München. Asamkirche, Sendlinger Straße 32, München.
■ Donnerstag, 18. Mai, 11.00
Uhr, Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgs-Verein: Himmelfahrtstreffen und Hahnschlagen. Altvaterbaude des MSSGV bei Schopfloch, Stockert 2, Lenningen.
■ Freitag, 19. Mai bis Sonntag, 6. August: BayerischTschechiche Freundschaftswochen in Selb und Asch. Detailliertes Programm unter www. freundschaftswochen2023.eu
■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr: Sudetendeutsches
Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: Themenführung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00 Uhr: Familienführungen mit Nadja Schwarzenegger. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
14.00 bis 15.00 Uhr: „Götz Fehr:
haltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45 Uhr sowie 18.00 bis 18.30 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“. 16.00 bis 17.00 Uhr: Themenführung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Eva Haupt.
■ Sonntag, 21. Mai, 14.00 Uhr, SL-Heimatkreis Braunau: Eröffnung der Ausstellung „Domov/Heimat – Adalbert Meier – Fotografien“. Anläßlich des Internationalen Museumstags werden Abzüge von historischen Glasnegativen aus Wekelsdorf gezeigt. Braunauer Heimatmuseum, Paradeplatz 2, Forchheim.
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Dienstag, 30. Mai, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Dienstag, 30. Mai, 17.30 Uhr: Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch. Pfarrer i. R. Franz Pitzal erinnert an das grausame Geschehen. Glockenspiel bei der Mediathek, Jahnstraße, Renningen.
■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadt-
Tschechisch und war einige Jahre als Botschaftsdolmetscher in Prag tätig. Andere Vertreibungsopfer weigerten sich dagegen Tschechisch zu sprechen, obwohl ihre Vorfahren, Mütter und Väter, die Großeltern die Sprache noch beherrschten.
Die in Troppau geborene Professorin Ingrid Hudabiunigg hat mit ihren Kontakten, die sie vor allem durch die Sudetendeutsche Gesellschaft in Berlin zu den Zeitzeugen herstellte, ein interessantes letztes Zeugnis der Vertreibung durch tschechische Germanistik-Studenten aufnehmen lassen. Die Tschechische Botschaft war dafür ein guter Ort. Ulrich Miksch

pfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.
■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr. Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken.
Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com
■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.
■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teil-
❯ Buchvorstellung
Temeswar – Europas
Kulturhauptstadt 2023
■ Dienstag, 16. Mai, 19.00

Uhr: Buchvorstellung „Temeswar/Timișoara: Kleine Stadtgeschichte“ im Rahmen der Programmreihe: „Temeswar 2023: Die Kulturhauptstadt kommt nach München“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Referenten: Prof. Dr. Konrad Gündisch und PD Dr. Tobias
Weger. Seit Jahrhunderten lebten Menschen unterschiedlicher Sprachen und Religionen in Temeswar zusammen, vor allem Deutsche, Ungarn, Rumänen, Serben und Juden, muslimische Türken und Angehörige anderer Ethnien. Im Mittelalter diente die Stadt zeitweilig als königliche Residenz. Von 1552 bis 1718 gehörte die Stadt zum Osmanischen Reich, bis Prinz Eugen sie dem Habsburgerreich eingliederte. Im 18. Jahrhundert wurde Temeswar zu einer Festung mit mehreren Vorstädten, die später zusammenwuchsen. In der seit dem Ende des Ersten Weltkriegs rumänischen Stadt begann im Dezember 1989 das Aufbegehren der Bevölkerung gegen das Ceaușescu-Regime.
Dieser Band erzählt die facettenreiche Geschichte des wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkts des Temescher Banats – anschaulich,
nahme am Versöhnungsmarsch.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.
■ Samstag, 1. Juli, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn. (Achtung, verschoben von ursprünglich 10. Juni auf jetzt 1. Juli.)
■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen unter anderem von OB Dr. Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz (Gera). Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Samstag, 8. bis Sonntag 9.
kurzweilig und kenntnisreich.
Professor Dr. Konrad Gündisch (geboren 1948) studierte Geschichte an der BabeșBolyai-Universität Klausenburg/Cluj-Napoca und war dort anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Nach seiner Aussiedlung in die Bundesrepublik folgten Berufsstationen im Marburg, Tübingen, Stuttgart und Gundelsheim. Er ist mehrfacher Buchautor.
PD Dr. Tobias Weger (geboren 1968 in München) ist Historiker und Übersetzer. Nach Tätigkeiten unter anderem am Schlesischen Museum zu Görlitz wurde er 2005 mit der Arbeit „,Volkstumskampf‘ ohne Ende? Sudentendeutsche Organisationen, 1945 – 1955“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg promoviert. Als Angestellter am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) in Oldenburg legte er 2016 seine Habilitationsschrift „Großschlesisch? Großfriesisch? Großdeutsch! Ethnoregionalismus in Schlesien und Friesland, 1918 –1945“ vor. Seit 2018 ist Tobias Weger wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der LMU.
Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net

■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
❯ Frühjahrsseminar in Bad Alexandersbad
Seliger-Gemeinde: Auf den Spuren aufrechter Sozialdemokraten
„Geschichte von Demokratinnen und Demokraten erzählen – Perspektiven und Chancen“ hat das diesjährige Motto des Frühjahrsseminars der SeligerGemeinde in Bad Alexandersbad gelautet.

Höhepunkt war eine Exkursion ins Egerland nach Asch, Eger und Hohenberg. Vor 160 Jahren waren in Asch Arbeiter dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein beigetreten, den Ferdinand Lassalle am 23. Mai 1863 in Leipzig gegründet hatte. Der Ort des Geschehens, das Arbeiterheim, wurde um 1980 abgerissen.
Es folgte eine Lesung vor dem Ascher Rathaus von Passagen des Buches von Andreas Amstätter „Tomslake – die Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie in Kanada“, die die dramatischen Tage im Herbst 1938 in Asch und den anderen Städten im Egerland beschreiben. Amstätter war damals DSAP-Funktionär und erlebte, wie Wochen vor dem Münchner Abkommen aufgestachelte Henlein-Anhänger am 12. September 1938 versuchten, das Egerer Volkshaus zu stürmen, das aber von sudetendeutschen Sozialdemokraten verteidigt werden konnte. Dieser Ereignisse vor 85 Jahren in Eger gedachten dann deutsche und tschechische Sozialdemokraten. Die SG-Vorsitzende Helena Päßler erinnerte an Franz Lippert (1905–2001), der bei der Verteidigung dabei war und nach der Emigration nach Eger zurückkehrte. Weitere Redner waren der stellvertretende Landesvorsitzende der SPD in Bayern, Matthias Dornhuber, und die stellvertretende Vorsitzende der ČSSD, Daniela Ostrá. Direktor der demokratischen Masaryk-Akademie, Patrik Eichler, erin-

nerte an Siegfried Taub, den stellvertretenden Parlamentspräsidenten, der als Gesundheitspolitiker in der ersten Republik eine wichtige Rolle gespielt hatte und später in New York im Exil verstarb. Eichler schlug damit die Brücke zu den sich anschließenden Gesprächen zwischen deutschen und tschechischen Sozialdemokraten, wo es um aktuelle politische Fragen, gemeinsame Projekte und Strategien ging. Mit dabei waren Libor Rouček, Vladimír Špidla, Lubomír Zaorálek, Tomáš Petříček, Alžběta Kalalová von den jungen Sozialdemokraten Tschechiens, Jörg Nürnberger (MdB) und Oto Novotný, der ehemalige Berater des tschechischen Premierministers Bohuslav Sobotka. Eingerahmt wurde das Frühjahrsseminar durch ein Erzähl-Café am Freitagabend, bei dem Erika Kalkofen-Frahne aus Dortmund ihre über Jahre gemachten Recherchen zum Widerstand ihres Großvaters in Nordböhmen präsentierte. Der kommunistisch engagierte Großvater Franz Frank und seine Familie zahlten einen hohen Preis, so KalkofenFrahne. Frank überlebt nur knapp das KZ, seine Frau verstarb 1944 in Aussig. Am Sonntag schlossen sich zwei aktuelle Vorträge im Veranstaltungssaal des Hotels Alexandersbad an. Die Ukrainerin Tetiana Pastushenko, die als Historikerin am Institut des Zweiten Weltkrieges an der ukrainischen Akademie der Wissenschaften tätig ist, berichtete über die Zerstörung, aber auch die Rettung ukrainischer Archive und Museen im aktuellen Krieg in der Ukraine. Und außerdem informierte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Naturfreunde Deutschlands, Tilmann Schwenke, über „Klima retten, Politik machen“.
Ulrich Miksch Die Zeichnung zeigt, wo das Arbeiterheim einst stand.
❯ Ehrensache Ehrenamt: Die Zwillinge Stefanie und Elisabeth Januschko musizieren für ihr Leben gern
„Kultur ist Teil unserer Persönlichkeit“


Sie sind sowohl einzeln als auch im Doppelpack im sudetendeutschen Vereins- und Kulturleben unterwegs: die Schwestern Stefanie und Elisabeth Januschko. Bereits im zarten Alter von einem Jahr waren die Zwillingsschwestern erstmals bei einem Sudetendeutschen Tag und ab da Jahr für Jahr wieder. „Mit der Spendendose haben wir Geld für die Jugendarbeit der Sudetendeutschen Jugend gesammelt“, erinnert sich Stefanie Januschko.
Auch bei anderen sudetendeutschen Aktivitäten waren sie von klein auf mit dabei: Als Kinder sangen, tanzten und spielten sie zehn Jahre lang in der Böhmerwaldgruppe in München. Mit elf Jahren traten sie in die Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler in Ellwangen ein, mit der sie noch heute regelmäßig an der „Europeade“ teilnehmen, einer Veranstaltung, bei der sich alljährlich regionale Musik- und Tanzgruppen aus ganz Europa versammeln.
Neben dem Interesse für Kultur und Traditionen des Böhmerwalds ist beiden Schwestern nämlich auch ein großes musikalisches Talent in die Wiege gelegt worden: Beide lernten als Grundschülerinnen Instrumente zu spielen: Elisabeth die Zupfinstrumente Gitarre, Mandola und Mandoline, Stefanie das Akkordeon. Mit zehn Jahren kamen noch die Trompete und das Saxofon hinzu, doch das Akkordeon sollte Stefanies Hauptinstrument bleiben. Beide Schwestern brachten es auf ihren Instrumenten zur Meisterschaft und wurden entsprechend mehrfach mit Preisen – etwa bei „Jugend musiziert“ – ausgezeichnet.
Auch mit dem kulturellen Förderpreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft sind die beiden geehrt worden.
Zahlreiche sudetendeutsche Veranstaltungen haben die beiden Schwestern mit ihrem musikalischen Talent bereits bereichert: Advents- und Weihnachtsfeiern ebenso wie die Bundestreffen der Böhmerwäldler, überregionale Treffen und Feierstunden und auch den Sudetendeutschen Tag. Darüber hinaus spielen sie unter dem Namen „ZWOlinge“ Konzerte in ihrer Heimatregion, bei denen sie neben alpenländischen Kompositionen auch eigene Stücke vortragen.
Auch auf ihrer CD mit dem Titel Skippo, die die ZWOlinge vergangenes Jahr aufgenommen haben, kann man diese Stücke nachhören. Es verwundert nicht, daß die beiden bei soviel Talent die Musik zu ihrem Beruf gemacht haben: Elisabeth studierte musik- und bewegungsorientierte

Soziale Arbeit und absolvierte nach ihrem Bachelor ein Jahr an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Inzwischen unterrichtet sie selbst Schüler an der Gitarre und der Mandoline und ist außerdem als Dozentin beim Bayerischen Landesjugend-Zupforchester tätig. Stefanie studierte in Frankfurt am Main Musik und Mathematik auf Lehramt, das Studium schloß sie 2022 ab. Auch wenn sie nun im Berufsleben stehen, bleibt ihnen das Ehrenamt wichtig: „Wir sind mit dem Vereinsleben aufgewachsen, und die Kultur stellt ein Teil unserer Persönlichkeit dar“, sagt Stefa-

nie Januschko. Und Elisabeth Januschko ergänzt: „Wir hoffen, daß wir durch unser Engagement insbesondere junge Menschen für die Kultur und Identität der Sudetendeutschen interessieren und begeistern können.“
Beide sind in Jugendgruppen aktiv: Elisabeth vertritt als Delegierte die Sudetendeutsche Jugend (SdJ) in der Sudetendeutschen Bundesversammlung. Sie ist außerdem seit 2018 Bundesjugendleiterin der Böhmerwaldjugend.
Als solche hält sie den Kontakt zu allen Spielscharen und Böhmerwaldgruppen, koordiniert Termine und Auftritte und organisiert Lehrgänge und Treffen.
Stefanie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der SdJ. Zudem verantwortet sie das Mitteilungsblatt, das „Powidltascherl“, das viermal jährlich erscheint.

Ihr Engagement haben die beiden Schwestern von ihren Eltern und Großeltern geerbt: Bereits ihre Großeltern waren in der Böhmerwaldjugend aktiv, und
Kürzlich begegnete mir der Spruch: „Der Mai ist nicht die Erfüllung, aber er ist eine große Verheißung.“ Diese Worte umschreiben schön, warum so viele Menschen diesen Monat besonders gern haben. Im Mai kommt der Frühling zu seiner vollen Entfaltung. Das können selbst die Tage der sogenannten Eisheiligen mit ihren Kälteeinbrüchen nicht verhindern.
Daß die Natur vom zarten in ein kräftiges Grün wechselt, daß Bäume und Sträucher blühen, daß Vögel fröhlich zwitschern und Bienen emsig summen, daß die Sonne allmählich ihre ganze Kraft entfaltet, all das tut unserer Seele gut. Der Mai ist aber nur die Verheißung. Erfüllen wird sich das Jahr erst, wenn Früchte heranreifen und die Ernte eingebracht wird.
Als Monat der Verheißung steht der Mai für einen wichtigen Aspekt unseres Lebens, den wir immer wieder erfahren und uns darüber wie an einem ganz besonderen Geschenk erfreuen. Es ist die Erfahrung des sich entfaltenden Seins. Nichts auf dieser Welt ist von allem Anfang an so, wie es einmal sein soll. Nichts ist von Anfang an fertig. Alles muß langsam wachsen und zur Reife gelangen.
auch die Eltern pflegen das Vereinsleben intensiv. Dazu gehörten und gehören auch Auftritte beim Sudetendeutschen Tag. Dort musiziert und tanzt die gesamte Familie Januschko, Mutter Sabine leitet als Tanzmeisterin die Volkstänze am Samstagabend nach dem großen HEIMAT!abend an. Dieser Abend gehört seit jeher zu den Höhepunkten des Sudetendeutschen Tags: Unter der Ägide der Heimatpflegerin der Sudetendeutsche präsentieren internationale Gruppen Musik und Tänze aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien.
Auch die beiden JanuschkoSchwestern haben hier schon musiziert. Dennoch wird der diesjährige HEIMAT!abend etwas Besonderes für die beiden sein: Denn in diesem Jahr werden sie diesen Abend erstmals moderieren. Damit sind viel Verantwortung und Arbeit verbunden, schließlich gilt es bereits im Vorfeld, in Absprache mit den verschiedenen Tanz- und Musikgruppen ein attraktives Programm zusammenzustellen.
„Bei der Moderation wird es dann wichtig sein, die Programmpunkte sinnvoll miteinander zu verknüpfen und dabei das Publikum zu unterhalten. Wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe“, sagt Stefanie Januschko. Wie bei vielen Auftritten wird auch hier eines nicht ausbleiben: „Lampenfieber gehört immer dazu“, sagt Elisabeth Januschko. „Dabei ist es uns wichtig, daß die Freude am Musizieren an erster Stelle steht.“ Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
Jeder Mensch hat eine Kindheit und Jugend als Frühling seines Lebens. Manches von seiner späteren Existenz deutet sich darin schon an. Eigenschaften, Begabungen und Talente werden sichtbar, ohne schon voll entwickelt zu sein. Alles drängt zum Wachsen und zum Werden. Es braucht Vertrauen von anderen und Vertrauen in sich selbst, damit sich alles gut entwickeln kann.
Dieses Vertrauen ist wie die Sonne, ohne welche der Frühling nicht sein kann. So gelangt die Verheißung allmählich zur Erfüllung. Selbst Kälteeinbrüche können dann nicht hinderlich sein. Sie kommen und vergehen auch wieder. Auch daran muß man sich im Laufe eines Lebens gewöhnen: daß es Hindernisse gibt, Kräfte, die das Wachsen und Werden verhindern oder hemmen wollen. Sollen wir ihnen erlauben, Macht über uns zu haben? Ich finde nein!
Das Schöne sowohl an der Verheißung wie auch an der Erfüllung ist: Beides hat ein Mensch nicht aus sich selbst. Beides ist ein Geschehen, das sich wie von selbst vollzieht. Es ist wie mit dem Leben insgesamt: eine große Gabe, ein großes Geschenk. Und noch etwas haben Verheißung und Erfüllung gemeinsam: Sie lassen den Menschen staunen und sich freuen. Ist es nicht wirklich jeden Tag neu ein Wunder, daß sich das Leben verheißungsvoll entfaltet und auf Erfüllung hindrängt?
Aus gläubiger Sicht habe ich die Überzeugung: Alles, was mich staunen läßt, alles worüber ich mich aus tiefem Herzen freue, stammt von Gott. Er läßt alles werden, sich entfalten, blühen, heranreifen und zur Erfüllung gelangen. Aus der Fülle seines Seins empfangen wir unser Sein. Immer wieder schenkt er uns verheißungsvolle Anfänge, die uns das Vertrauen in das Leben ermöglichen und erleichtern. Das gilt auch dann noch, wenn die Blüte der Jugend längst schon vorbei ist. Möge uns der Mai wie eine Einladung sein, uns darauf zu besinnen!
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon eMail
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
� Sudetendeutscher Rat eröffnet Ausstellung in Fleißen/Plesná im ehemaligen Kreis Eger
Deutsch-tschechische Geschichte in ehemaliger Textilfabrik
Am vergangenen Freitagabend eröffnete Generalsekretärin Christa Naaß im Hotel Nové Lázně die Marienbader Gespräche des Sudetendeutschen
Rates (Þ nächste Ausgabe der SdZ). Wenige Stunden zuvor war sie im nahen Fleißen/Plesná im ehemaligen Kreis Eger gewesen. In Fleißens neuem Museum eröffnete sie die Ausstellung „So geht Verständigung – dorozumění“ des Sudetendeutschen Rates (SR) auf heimatlichem Boden.
Christa Naaß dankte Bürgermeister Petr Schaller für die Möglichkeit, diese Ausstellung im Rahmen der BayerischTschechischen Freundschaftswochen in Fleißen zu zeigen. „Plesná ist nach der Bayerischen Repräsentanz in Prag der zweite Einsatzort der dreisprachigen Ausstellung auf tschechischem Boden“, hob die Generalsekretärin hervor. „Unsere Ausstellung ist eine hervorragende Ergänzung zur Dauerausstellung über das Schicksal der tschechischen und deutschen Bewohner in dieser Region bis zum Fall des Eisernen Vorhangs.“ Sie dankte außerdem Pablo Schindelmann, dem Geschäftsführer der gemeinnützigen Ge
sellschaft zur Förderung und Durchführung der BayerischTschechischen Freundschaftswochen, für die Vermittlung. Darüber hinaus freute sie sich über das Kommen Christian Knauers, des Vorsitzenden des BdVLandesverbandes Bayern.
Aus der 2000SeelenGemeinde Fleißen, in der bis ins Jahr 1945 mehrheitlich Deutsche gelebt hatten, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg fast alle Deut
meinsamen geologischen Vergangenheit“ war in der ehemaligen größten Fleißener Textilfabrik, die Johann Lehrmann gehört hatte, ein Museum entstanden. Neben dem DeutschTschechischen Zukunftsfonds hatte auch das Sudetendeutsche Museum in München das neue Museum in Fleißen mit einigen Leihstücken unterstützt.
In ihrer Eröffnungsrede erläuterte Christa Naaß die Entstehung und Aufgaben des Sudetendeutschen Rates. Der Rat habe die Aufgabe, die Völkerver
mehrstufigen Vertiefungsmöglichkeiten auch neue Zielgruppen ansprechen soll“, sagte die Generalsekretärin. „Dabei werden die Themen Vermitteln, Vertreibung, Versöhnung, Verständigung und Verbinden erarbeitet und beschrieben.“ Thematisiert würden:
19/2023
SR-Ausstellung im Museum in Fleißen: Bürgermeister Petr Schaller und Generalsekretärin Christa Naaß, Dolmetscherin Gudrun Heißig, Freundschaftswochenchef Pablo Schindelmann und Bayerns BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer.



schen vertrieben und die bis dato starke Textilindustrie in den darauffolgenden Jahren zerstört. Rund 3000 Menschen waren seiner zeit in den dortigen Textilfabriken beschäftigt. Im Rahmen des Projektes „Bayerischböhmische Ausstellungen zur Kriegs und Nachkriegsgeschichte und zur ge
ständigung voranzubringen, insbesondere die Versöhnung und Verständigung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen, sowie die Heimatpflege und Heimatkunde zu fördern.
„Dazu dient neben dem Forum Marienbader Gespräche unsere Ausstellung, die mit ihrer Dreisprachigkeit, mit ihren interaktiven Elementen und mit ihren

PERSONALIEN
l das jahrhundertelange friedliche Zusammenleben von Tschechen und Deutschen im Herzen Europas, l die Auseinanderentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, l der Anschluß des Sudetenlandes, l die nationalsozialistische Besetzung des tschechischen Reststaates, l das Leid der tschechischen Bevölkerung, l die Vertreibung der deutschen Bevölkerung, l die Organisation der Heimatvertriebenen, l die aktive Beteiligung der Vertriebenen am Wiederaufbau in ihren Aufnahmegebieten, l die tätige Förderung des Verständigungsprozesses durch die Sudetendeutschen und die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen.
Die Ausstellung zeige, daß das Verbindende zwischen Tschechen und Deutschen das Trennende überwinden solle. „Hier wird deutlich“, schloß Generalsekretärin Christa Naaß eindringlich, „Menschenrechte sind unteilbar!“
� Präses für die Seelsorge der Sudetendeutschen mit mährischen Wurzeln im Altvatergebiet und im Kuhländchen
Monsignore Dieter Olbrich 75
Am heutigen 12. Mai feiert Monsignore Dieter Olbrich, Präses für die Seelsorge der Sudetendeutschen mit mährischen Wurzeln, 75. Geburtstag
Zur Welt kam Dieter Olbrich
1948 in Frankfurt am Main. Sein Vater stammte aus Fulnek im Kuhländchen, seine Mutter aus Mährisch Schönberg im Altvatergebiet. Nach der Vertreibung hatten die Eltern in Hessen ein neues Zuhause gefunden.
Schon während der Gymnasialzeit reifte in ihm der Wunsch, Priester zu werden. Nach dem Abitur studierte er Theologie unter anderem in Königstein im Taunus, über Jahrzehnte ein geistiges Zentrum der deutschen Heimatvertriebenen. Am 14. Dezember 1974 wurde er im nordrheinwestfälischen Paderborn zum Priester geweiht.

Die erste Kaplanstelle führte ihn nach Bad Arolsen in Hessen.
1979 bis 1981 folgten zwei weitere Kaplansjahre im oberbayerischen Gauting. Nachdem er Pfarrer geworden war, übertrug man ihm die Aufgabe des Militärpfarrers, ein Amt, das er zunächst in Ingolstadt und dann in Fürstenfeldbruck bis 1990 innehatte.
1990 wurde er zum Direktor des Albertinums in München berufen, einer Wittelsbacher Stif
tung, die bereits seit 1574 existiert und Kindern und Jugendlichen zu einem erfolgreichen Schulabschluß verhilft. 23 Jahre lang bekleidete er diese Funktion, wirkte am angegliederten Ludwigsgymnasium als Seminarlehrer für katholische Religionslehre und „quälte“ dort, wie er gerne humorvoll erzählt, angehende Studienreferendare und Schüler. Gerne blickt er auf diese Zeit zurück: „Diese Stelle muß sich der liebe Gott für mich ausgedacht haben.“
Die Arbeit mit jungen Leuten war ihm immer ein Herzensanliegen. Und ob Schüler oder ihre Eltern, „sie alle haben mich in meinen Eigenarten ertragen (müssen?) und mir stets das Gefühl geschenkt, daß ich jeden Tag gerne ins ‚Albi‘ gehe“. So fiel ihm im August 2013 der Abschied schwer.
Seit 1997 ist er Seelsorgehelfer am Liebfrauendom zu München, wo er bis heute mit seinen prägnanten und anregenden Predigten viel Wertschätzung erntet. 1999 erhielt er den päpstlichen Ehrentitel Monsignore.
2009 lebte der Kontakt zur AkkermannGemeinde wieder auf. Das Wirken und die Ziele dieser
Gemeinschaft lagen ihm, dem Vertriebenenkind, wohl im Blut, so daß die Kontakte zu diesem Verband enger und enger wurden. 2010 wurde er zum Vorsitzenden des Sozialwerks der AkkermannGemeinde gewählt und bekleidet dieses Amt bis heute. Die Kontaktpflege mit den vertriebenen Landsleuten, dem Sudetendeutschen Priesterwerk und der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die von größtem Vertrauen und guter Zusammenarbeit geprägt ist, mündete 2012 in die Bestellung zum Visitator für die Seelsorge an den Sudeten und Karpatendeutschen. 2013 kam ein neues Amt hinzu: Olbrich wurde nun auch Geistlicher Beirat der AckermannGemeinde und 2016 in diesem Amt bestätigt.
Als die Visitatorenämter 2016 ausliefen, übertrug man ihm, nachdem die Seelsorge an den Vertriebenen von den Verbänden selbst geschultert werden mußte, das allen Vertriebenenverbänden übergeordnete Amt des Präses für die Seelsorge an den Sudetendeutschen. Sein Büro hat er seither in den Räumen der AkkermannGemeinde, die er regelmäßig aufsucht, um anstehen
de Aufgaben zu bearbeiten oder Gottesdienste für die Heimatverbände, die er besucht, vorzubereiten.
Optimistisch wie er ist, hat er für sich nur einen Wunsch: gesund bleiben. Den ihm anvertrauten Seelen wünscht er: „Oremus pro invicem!“ – Beten wir füreinander!
Der Sprecher der Sudetendeutschen, Bernd Posselt, bringt dem obersten Geistlichen der Volksgruppe große Wertschätzung entgegen: „Monsignore Olbrich ist ein hochgebildeter Mann der leisen Töne und des hintergründigen Humors. Seine Predigten sind inhaltsschwer und dennoch so leicht formuliert, daß sie alle Generationen und Schichten erreichen. Er kann die verschiedenen Kräfte und Strömungen der Volksgruppe zusammenführen und ist der geborene Seelsorger, der die Menschen in ihrer Verschiedenheit annimmt und im Glauben stärkt. Deshalb ist er auch in der Tschechischen Republik sehr beliebt und gehört zu den wichtigsten Brückenbauern in unserer grenzüberschreitenden Arbeit. Ich danke ihm für seinen intensiven Einsatz und wünsche ihm zum Geburtstag von ganzem Herzen viel Glück, Gesundheit, Erfolg und Gottes reichen Segen.“ md
Der Sudetendeutsche Tag findet wieder in Regensburg statt. Neben all ihren anderen kulturhistorischen Schätzen hat die Donaustadt ein besonderes Kleinod: das Pernsteiner, eine Konditorei mit Café aus einer südböhmischen Familiendynastie.
Böhmische Kolatschen und Powidltascherl gibt es bis heute im Pernsteiner in der Vonder-Tann-Straße in Regensburg. Denn die Ursprünge und Wurzeln des Cafés beziehungsweise der Konditorei und Confiserie liegen in Friedberg im südböhmischen Kreis Kaplitz. Dort gründete die Konditoren-Familie Anna und Josef Pernsteiner am 1. August 1901 ihre erste eigene Konditorei. Jetzt, nach der Vertreibung der Familie und in dritter Generation, führt Konditormeister Johannes Pernsteiner (* 1960) den Betrieb mit 15 Beschäftigten.
Herstellung wie in der Heimat
Zwar sind aktuell hinsichtlich böhmischer Spezialitäten nur die beiden genannten Speisen im Pernsteiner-Angebot. Aber Johannes Pernsteiner relativiert. In vielen weiteren Produkten befinden sich Elemente böhmischer Herkunft, das heißt, Grundrezepturen wie etwa Massen (Teige) beruhen auf den Vorgaben des Großvaters – eben wie er dieses damals in seiner Heimat hergestellt hat. „Die Umsetzung hat sich dem Zeitgeschmack der Kunden von heute angeglichen.
Die Wurzeln sind nicht sofort zu sehen oder zu schmecken. Doch wenn man von den Rezepturen weiß, dann merkt man es auch beim Essen“, klärt der mehrfach prämierte Konditor auf.
Daher bilden auch Leute, die mit böhmischen Aspekten gute Erinnerungen verbinden, einen guten Teil der Kundschaft. Seit etwa zwölf Jahren gibt es im Pernsteiner neben Süßem auch Pikantes, das heißt frische, leichte und auch vegetarisch Küche für Berufstätige in der Umgebung und Gäste, die hier kurz zu Mittag essen oder sonst eine kleine Brotzeit einnehmen wollen.

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das AlbrechtAltdorfer-Gymnasium. Da kann es schon vorkommen, daß eine Unterrichtsstunde in einem der Café-Räume stattfindet. „Es ist ein schönes Miteinander mit dem Gymnasium“, freut sich Pernsteiner. Er und sein Café tragen auch in besonderer Weise dazu bei, denn jeder Schüler oder jede Schülerin mit einem Einser im Jahreszeugnis bekommt eine Kugel Eis geschenkt. „Das ist ein Spaß, den
wir uns jedes Jahr am letzten Schultag leisten“, erzählt er. Speiseeis hat es zu Gründungszeiten wohl noch nicht gegeben. Denn von 1901 bis 1923 erfolgte zunächst der Auf- und Ausbau der Zuckerbäckerei/Cukarna Josef Pernsteiner zu einem regionalen Spezialitätenbetrieb.
� Mit böhmischen Wurzeln in Regensburg
Dritte Generation
Ludwig Pernsteiner die Chance, am Brückenbasar nahe der Steinernen Brücke den Konditoreibetrieb wiederaufzunehmen.
Im Jahr 1924 starb der Firmengründer, die Gattin Anna führte bis auf Weiteres die Geschäfte weiter. Trotz der schwierigen Zeit der Weltwirtschaftskrise entschied sich im Jahr 1931 der zweite Sohn Ludwig, in die Fußstapfen des Vaters zu treten und Konditor zu werden. Zur Lehre als Zuckerbäcker ging Ludwig Pernsteiner in das damals mondäne und weltbekannte Kurbad Karlsbad bei der Konditorei Glötzl. Nach dem Tod Anna Pernsteiners im Jahr 1938 übernahm Sohn Ludwig den Betrieb, wobei er tatkräftig von seinen Familienmitgliedern unterstützt wurde. Kurze Zeit später, mit Einmarsch der Deutschen ins Sudetenland und ein knappes Jahr danach mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde Ludwig Pernsteiner in die Deutsche Wehrmacht einberufen. Kriegsbedingt war bis 1945 der Konditoreibetrieb nur unter größter Mühe weiterzuführen, vor allem geschultert von den beiden Schwestern Anna und Maria Pernsteiner.
Nach dem Ende des Krieges erfolgte zunächst der Versuch eines Neustarts in Friedberg, doch die Umsetzung der Beneš-Dekrete traf auch die Familie und den Betrieb Pernsteiner: Enteignung und schließlich Vertreibung aus der angestammten Heimat. Über Linz in Oberösterreich verschlug es die Familie zunächst in verschiedene Teile Bayerns, ehe dann im Jahr 1948 die Zusammenführung der Familie gelang und sich Regensburg als neuer Sitz der Familie ergab.
In Stadtamhof, das am 1. April 1924 nach Regensburg eingemeindet worden war, bot sich nach der Währungsreform für
Bereits drei Jahre später, im Jahr 1951, konnte am Haidplatz, also im Stadtzentrum, eine Filiale eröffnet werden, die bis Ende der sechziger Jahre bestand. Privat wohnte die Familie bis zum Jahr 1957 in einer der Behelfsbaracken, die für Flüchtlinge und Vertriebene errichtet worden waren. In eben jenem Jahr erfolgte
Jahren wurde es weniger, da die Erlebnisgeneration allmählich abtrat.
Bis heute jedoch ist die Ackermann-Gemeinde im Bistum Regensburg hier regelmäßig vertreten mit ihrem monatlichen Literarischen Café oder ihren Besprechungen und Sitzungen. Einmal im Monat findet darüber hinaus in einem der Café-Räume die von der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Regensburg initiierte Veranstaltungsreihe „Bibel im Café“ statt. Und während der Corona-Pandemie war vor allem der Garten des Cafés ein idealer Ort für das bekannte Regensburger Kabarett „Statt-Theater“ sowie für Musiker beziehungsweise Musikgruppen.
Vertriebenen-Treff
dieser etwas teurer als herkömmlicher Kakao ist. „Die Rohstoffe sind gut, die Herkunft und Anbaubedingungen sind ethisch vertretbar“, erklärt der Konditor seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Übrigens ist seit 1995 die Zusammenarbeit mit Kunden, die hochwertige Pernsteiner-Konditoreiprodukte weiterverkaufen, zu einem weiteren Standbein des Unternehmens geworden.
Die in der österreich-ungarischen Monarchie entstandene und auch in Städten und Kurorten Böhmens verbreitete Kaffeehauskultur hat der Inhaber ebenfalls ab 1999 wieder eingeführt. So stehen regionale und auch überregionale Zeitungen und Zeitschriften zur Lektüre zur Verfügung, natürlich sind verschiedene Kaffeesorten zu genießen, und im großen Café-Raum oder – bei entsprechendem
Wetter – im Garten gibt es kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Und immer wieder sind auch Nachkommen sudetendeutscher
sechs geringfügig Beschäftigte und Aushilfen. Stark bewegt hat ihn im Jahr 2015 die Flüchtlingswelle. „Ich habe das Drama meiner Eltern neu gesehen“, zieht er eine Parallele. Daher sieht er eine positive Integration von Flüchtlingen als wichtige Aufgabe –einen bei ihm tätigen Auszubildenden aus Äthiopien nennt er als gelungenes Beispiel. Mit Anfang 60 gilt es langsam, sich über die Zukunft des Cafés und die Nachfolge Gedanken zu machen. Da es keine eigenen Kinder gibt, hat Johannes Pernsteiner eine junge Dame aus dem Umkreis der Familie für diese Aufgabe im Blick. Aber es ist noch Zeit – und die wird der Café-Inhaber neben seiner Arbeit zum Radfahren, Reisen und für Sport nutzen, um körperlich und geistig fit zu bleiben und sich Inspirationen für die eigenen Kreationen zu holen.
somit der Umzug in das neu erworbene Haus, das kurz darauf zum Stammhaus wurde – mit Café und Konditorei. In dieser Zeit heiratete Ludwig Pernsteiners seine aus Schlesien stammende Charlotte. In den Pernsteiner-Cafés trafen sich natürlich Vereine, Verbände und Gruppen aus dem böhmischen und sudetendeutschen Bereich. „Ob nun der Böhmerwaldbund oder die Egerländer – bis auf den letzten Platz waren die Räume des Cafés gefüllt“, erinnert sich Johannes Pernsteiner. In den neunziger
In den sechziger und siebziger Jahren waren die Café-Räume bereits erweitert und die Einrichtung des Cafés modernisiert worden. Zukunftsweisend war im Jahr 1977 zudem der Entschluß von Johannes Pernsteiner, die berufliche Tradition der Familie fortzusetzen und den Beruf des Konditors zu erlernen. Die Lehre absolvierte er bei Konditormeister Karl Eisenrieder in München, danach folgten Wander- und Gesellenjahre mit Tätigkeit in verschiedenen Konditoreibetrieben und schließlich die Meisterprüfung 1982 bei der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz.

Von 1982 bis 1989 arbeiteten zwei Pernsteiner-Generationen im Café und in der Konditorei, 1989 ging Ludwig Pernsteiner in den Ruhestand und übergab das Unternehmen an Sohn Johannes. Dieser begann 1991 damit, das Konditorei-Angebot und auch das Ambiente grundlegend zu modernisieren – Neugestaltung des Verkaufsraumes und Renovierung der Café-Räume.
Zu den süßen Produkten gehören vielerlei Torten, vor allem Hochzeitstorten, Kuchen und Desserts sowie Schokoladen, Trüffel und Pralinen. Als Chocolatier beziehungsweise Konditor legt Johannes Pernsteiner Wert auf gute und tolle Lebensmittel, wobei ihm auch die Herkunft der Rohstoffe wichtig ist. Daher arbeitet er mit Kakao, der von kleinen Kooperativen in Peru stammt, auch wenn


Heimatvertriebener unter den Gästen, deren Eltern oder Großeltern von den böhmischen Wurzeln der Familie Pernsteiner und dem böhmisch angehauchten Charakter des Cafés erzählt haben. Nach Friedberg/Frymburk nad Vltavou, in die Heimatstadt der Vorfahren, fährt Johannes Pernsteiner inzwischen einbis zweimal im Jahr. Erst im Jahr 1992 ist sein Vater erstmals dorthin gefahren, Sohn Johannes hat ihn natürlich begleitet. „In der Zeit des Sozialismus beziehungsweise Kommunismus war er nie dort“, so der Sohn. „Da hatte er einen gewissen Groll und Ärger über das erlittene Unglück. Durch den Besuch 1992 hat er mit dem Ganzen Frieden gefunden. Er hat jahrzehntelang die Geschichte mit sich herumgetragen. Danach hat er anders gesprochen, danach war es erledigt. Er hat auch den damaligen Besitzer unseres Hauses getroffen und ihm die Hand gereicht“, schildert Johannes Pernsteiner dieses einschneidende Erlebnis seines Vaters. Der damals schlechte Zustand des Hauses mag Ludwig Pernsteiner zusätzlich zu dieser Einschätzung motiviert haben. Auch Johannes Pernsteiner ist von der Lage Friedbergs im „landschaftlich wunderschönen Moldautal“ sehr angetan. Das Café Pernsteiner hat –über die einzelnen Räume verteilt – etwa 90 Sitzplätze, dazu kommen etwa genauso viele im Garten. Johannes Pernsteiner beschäftigt 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: drei Konditoren, eine Köchin, drei Verkäuferinnen, zwei Lehrlinge sowie
Denn diese werden immer wieder auch bei Wettbewerben gewürdigt. Wie zum Beispiel 2007 die Trüffelschokolade Criollo Crunch, die beim Award des Monatsmagazins „Living at home“ von Gruner & Jahr als bestes Produkt im Segment Genießen bewertet wurde. Einen persönlichen Eindruck von all diesen süßen Versuchungen kann man sich bei einem Besuch im Café Pernsteiner verschaffen. Als Beatles-Fan empfiehlt der Autor natürlich die Trüffel-Schokolade Scotch Whisky–Mull of Kintyre. Er empfiehlt sie in Würdigung des Kaps, deutsch für Mull, der schottischen Halbinsel Kintyre westlich von Glasgow und in Würdigung des Top-Hits von Ex-Beatle Paul McCartney Ende 1977. Markus Bauer
Café Pernsteiner, Von-derTann-Straße 40, 93047 Regensburg, Dienstag bis Freitag 7.30 –18.00 Uhr, Samstag und Sonntag 9.00 – 18.00 Uhr. Telefon (09 41) 79 54 89, Internet www. pernsteiner.net, eMail johannes@ pernsteiner.net

Im Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München stellte Eva Habel ihr Koch- und Erinnerungsbuch „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“ vor. Veranstalter waren neben dem HDO die Heimatpflege der Sudetendeutschen und der Kulturreferent für die Böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein (ASV).


Rezepte und Erinnerungen
Der Schluckenauer Zipfel ist eine Region im äußersten Norden Böhmens rund um die drei Städte Schluckenau/Šluknov, Rumburg/Rumburk) und Warnsdorf/Varnsdorf. Durch die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg auch aus dieser Region stand Wohnraum leer, und es wurden dringend Arbeiter gesucht. Die tschechoslowakische Regierung siedelte daraufhin Romafamilien aus verschiedenen Teilen der einstigen Donaumonarchie in diese Grenzregion um. Bis heute gibt es im Schluckenauer Zipfel einen hohen Anteil Roma an der Bevölkerung, es ziehen auch Roma aus anderen Landesteilen dorthin. Die frühere Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Eva
Eva Habel: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau“. Schluckenau/Šluknov, Caritas Schlukkenau/Oblastní charita Šluknov, 2022; 22,00 Euro. T. G. Masarykova 611, CZ40777 Šluknov.
In Waldkraiburg/Kreis Mühldorf am Inn ist die Ausstellung „Der Räuber Hotzenplotz und Otfried Preußler“ eröffnet worden. Das Stadtmuseum Waldkraiburg bietet eine lebendige und informative Ausstellung für die ganze Familie. Gleichzeitig ehrt sie damit auch einen umtriebigen Autor, der 1923 im nordböhmischen Reichenberg geboren wurde und in diesem Jahr seinen 100 Geburtstag gefeiert hätte. Vor zahlreichen Gästen eröffneten Kulturreferentin Lydia Partsch und Museumsleiterin Elke Keiper die Schau.
Nach dem Krieg und fünf Jahren in sowjetischer Gefangenschaft kam Otfried Preußler 1949 nach Oberbayern. Bevor er sich ganz der Schriftstellerei zuwandte, arbeitete er als Lehrer an einer Volksschule. „Der kleine Wassermann“, sein erstes Kinderbuch, wurde 1956 veröffentlicht. Otfried Preußler schrieb über 35 Bücher, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden und für die er viele Auszeichnungen erhielt.
Den Räuber Hotzenplotz schrieb Preußler
Habel, gründete 2011 im Auftrag des Bischofs von Leitmeritz, Jan Baxant, eine Regionalcaritas in Schluckenau, um sich für die dort lebenden Roma einzusetzen. Aus ihrer Arbeit entstand das Buch „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“.

Ende März präsentierte Habel auf Einladung der derzeitigen Heimatpflegerin Christina Meinusch, dem Kulturreferenten für die Böhmischen Länder, Wolfgang Schwarz, und dem Haus des Deutschen Ostens die Publikation in der HDO-Gaststätte
� Neue Ausstellung über Otfried Preußler
Hotzenplotz
1962. Ein „erzähltes Kasperltheater zwischen zwei Buchdeckeln“, wie er es selbst nannte.
Schwerpunkt der Waldkraiburger Ausstellung sind die fröhlichen Abenteuer von Kasperl, Seppel und Wachtmeister Dimpfelmoser, die dem Räuber Hotzenplotz Omas geraubte Kaffee-
maschine wieder abjagen wollen. Neben vielen internationalen Originalausgaben des berühmten Buchs wird die Ausstellung vor allem durch die wunderbaren Illustrationen von Franz Josef Tripp sprechend. Er hat dem Räuber seine markante große
Zum Alten Bezirksamt. Das dreisprachige Buch (Tschechisch, Deutsch, Romanes) versammelt 40 Rezepte und berührende Geschichten und Erinnerungen der Roma.

Die Rezepte reichen von Fladenbrot über Piroggen und Haluschky bis hin zu Fleisch- und Kartoffelgerichten. Eine Besonderheit sind die sogenannten Goja, nämlich Würste ohne Fleisch, die stattdessen mit Kartoffeln oder Mehl gefüllt sind. Die Dreisprachigkeit des Buchs ist besonders bemerkenswert, da Romanes eigentlich nur eine münd-
Nase und sein typisches Outfit verpaßt. Und für die jungen Leseratten führt ein lustiges Museumsspiel durch die Ausstellungen und macht Laune auf mehr. Wer seinen Fragebogen abgibt, kann ein schönes Räuber-Bastelbuch gewinnen.
Darüber hinaus sind auch viele andere Figuren von Otfried Preußler zu sehen wie die kleine Hexe, der kleine Wassermann oder das kleine Gespenst. Zusammen mit einer Auswahl von persönlichen Gegenständen bringt sie uns den Autor und vor allem seine Geschichten lebendig vor Augen.
Die Ausstellung im Stadtmuseum Waldkraiburg entstand in Kooperation mit dem Thienemann-Esslinger Verlag und wird von einem attraktiven Begleitprogramm für Kinder und jung gebliebene Erwachsene begleitet.
Bis Sonntag, 2. Juli: „Der Räuber Hotzenplotz und Otfried Preußler“ in Waldkraiburg, Stadtmuseum im Haus der Kultur, Donnerstag bis Sonntag 14.00 –17.00 Uhr, Feiertage geschlossen, Eintritt frei.

der- und Jugendarbeit sowie einer Kleiderkammer eines der Angebote der Einrichtung sei. In der Arbeit für das Gemeindewesen spielten neben Essen und Trinken auch kulturelle Darbietungen mit Tanz und Musik eine große Rolle. Von beiden Aspekten konnten sich auch die Besucherinnen und Besucher des Abends im Alten Bezirksamt überzeugen.
Den kulinarischen Teil übernahm Wirtin Annerose Kloos mit ihrem Team. Auf dem Menü standen Pilzsuppe, Hühnerpaprikasch mit Haluschken und als süßer Abschluß Schmalzgebäck – alles nachgekocht aus dem präsentierten Kochbuch. Die Haluschken brachten die Roma aus der Slowakei mit, wo sie als Nationalgericht gelten und in vielen Varianten zu finden sind. Die Mehrheit der Roma im Ort Schluckenau stammen aus der Slowakei oder haben dort Vorfahren.


liche Sprache ist, die zudem in vielen unterschiedlichen Dialekten gesprochen wird.
Eva Habel schreibt in ihrem Vorwort, daß deswegen auch nicht versucht worden sei, eine einheitliche Rechtschreibung oder Grammatik im Buch zu verfolgen. Finanziell unterstützt wurde die Produktion des Buches von der Sudetendeutschen Heimatpflege und dem DeutschTschechischen Zukunftsfonds. Wie Habel berichtete, sei das Buch aus der Gemeindearbeit der Regionalcaritas in Schluckenau entstanden, die neben Kin-
Der Abend wurde kurzweilig gestaltet mit Tanz- und Musikdarbietungen, vorbereitet durch Jan Cína und Roxana Kovačová, die mit Eva Habel aus Schluckenau angereist waren und ebenfalls einen großen Anteil am Entstehen des Kochbuchs hatten. So erhielten die Besucher auch einen Einblick in die Lieder der Roma und konnten den Klang ihrer Sprache erfahren. Nach Abschluß der voll ausgebuchten Veranstaltung verließen alle wohlgesättigt das HDO. Der Nachmittag führte vielleicht zu einem größeren Verständnis für das Leben und die Kultur der Roma im Schluckenauer Zipfel. Patricia Erkenberg.
� Lesung von Peter Becher in Regensburg
Im Böhmerwald
Direkt vor Pfingsten, am 25. Mai um 18.30 Uhr, liest Peter Becher im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg aus seinem neuen Buch „Unter dem Steinernen Meer“.
Der Roman spielt zwischen Steiermark und München, zwischen Böhmerwald und Budweis und führt zurück in die Vergangenheit. Im Sommer 1990 begegnen sich zwei Budweiser Jugendfreunde, der Deutsche Karl Tomaschek und der Tscheche Jan Hadrava, in einem südböhmischen Gasthaus. Ihr Treffen führt zur Wiederentdeckung und Aufarbeitung verdrängter Erinnungen. Monate später findet man Tomaschek tot auf der Terrasse einer steirischen Almwirtschaft – er hat seinen Frieden gefunden. Auch seine beiden sehr unterschiedlichen Söhne begeben sich auf eine Reise in die Vergangenheit des Vaters, als sie beim Begräbnis die Erinnerung an ihre Jugend einholt.
In diesem Roman schildert Peter Becher, wie die Nachkommen
der Vertreibungsopfer oft Traumata ihrer Eltern- und Großelterngeneration übernommen haben und zu bewältigen lernen können. Susanne Habel
Peter Becher: „Unter dem Steinernen Meer“. Vitalis Verlag, Prag 2022; 200 Seiten, 19,90 Euro. (ISBN 978-389919-646-7)
� SL-KG Augsburg-Land
Bayern ehrt Trautner

Carolina Trautner MdL, ehemalige Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen, wurde dieser Tage geehrt.
Kurt Aue, Obmann der SLKreisgruppe Augsburg-Land und Vorstandsmitglied der SLLandesgruppe Bayern, überreichte Carolina Trautner MdL im Auftrag des Landesvorstandes die SL-Silbermünze mit Urkunde für ihre Verdienste zum Wohle der Sudetendeutschen. Die Auszeichnung fand bei der Kreishauptversammlung der Senioren-Union des CSU-Kreisverbandes Augsburg-Land im Königsbrunner Hotel Krone statt, an der Trautner als CSU-Kreisvorsitzende und Manfred Salz, Obermeitingens Zweiter Bürgermeister, als Kreisvorsitzender der Senioren-Union teilnahmen.

� SL-Ortsgruppe Aichach/Bayerisch-Schwaben
Die Deutschen aus Rußland
Für Ende April hatte die bayerisch-schwäbische SL-Ortsgruppe Aichach zum Vortrag „Geschichte der Rußlanddeutschen“ geladen.
Über 40 Gäste ließen sich im Gasthaus Specht von Viktor Krieger, dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Rußland, informieren. Unter den Besuchern waren zahlreiche junge Aussiedler, die das Angebot als wertvolle Geschichtsstunde über das Leben ihrer Vorfahren nutzten. In Vertretung des erkrankten Ortsobmanns GertPeter Schwank freuten sich dessen Stellvertreter Johann Hoetschel und Schatzmeister
Jonny Michl über den guten Besuch.
Eingangs betonte Krieger, daß es im Russischen Reich seit jeher Gruppen von Deutschen gegeben habe. Diese seien historisch, rechtlich, ständisch und soziokulturell unterschiedlich gewesen und hätten kaum Kontakt zueinander gehabt. Bereits seit dem Spätmittelalter hätten Deutsche vorwiegend aus adliger Oberschicht im Baltikum gelebt. Sie hätten wie ihre Landsleute in Sankt Petersburg oder Moskau als Fachleute in Militärwesen, Staatsapparat, Wissenschaft, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Literatur und Kunst eine herausragende Rolle gespielt. Dazu kämen die Deutschen im Königreich Polen, die dort seit dem Mittelalter gelebt hätten und seit 1815 russische Untertanen gewesen seien. Die größte deutsche Gruppe im Zarenreich seien ab 1760 die Siedler-Kolonisten gewesen, die zur Erschließung von russischen Steppengebieten angeworben worden seien. Aus ihren Nachkommen bestehe die überwältigende Mehrheit der Aussiedler. Die Urbarmachung und Besiedelung der weitgehend unbewohnten Territorien sei für den russischen Staat jahrhundertelang ei-
� BdV-Kreisverband Limburg-Weilburg/Hessen
Vorstand bestätigt
Der hessische BdV-Kreisverband Limburg-Weilburg veranstaltete Ende April in Löhnberg seinen 75. Kreisverbandstag.
Als Gast und Referenten begrüßte der BdV-Kreisvorsitzende Josef Plahl Andreas Hofmeister MdL, Vorsitzender des Landtags-Unterausschusses für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung.
Hofmeister und Plahl begrüßten die Entscheidung der Landesregierung, eine Stelle an der Universität Gießen in Zusammenarbeit mit dem Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung einzurichten, um Vertreibung und Flucht der Deutschen im vorigen Jahrhundert wissenschaftlich aufzuarbeiten und deren Probleme für die Nachwelt aufzuzeigen.
ne andauernde Herausforderung gewesen. Erlasse, die in Europa verbreitet worden seien, hätten den Neusiedlern zahlreiche Rechte und Vergünstigungen zugesichert. Bis 1774 seien bereits 30 623 Einwanderer gekommen. Um Saratow seien beiderseits der Wolga 66 evangelische und 38 katholische Mutterkolonien entstanden. Der Anwerbung ab 1789 für die Gebiete am Schwarzen Meer seien über 50 000 Deutsche gefolgt. Erst nach Jahrzehnten habe sich bei den Siedlern ein nationales Selbstverständnis heraus-
Unter welchen Druck die Siedler im Ersten Weltkrieg geraten seien, zeige die Umbenennung ihrer Ortschaften. Die Oktoberrevolution, die folgende Enteignung und Zwangskollektivierung hätten zur Hungersnot 1921 und 1922 geführt, bei denen allein die Wolgadeutschen 100 000 Opfer beklagt hätten. Die Ausrufung der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen habe den Zugang zu höherer Bildung, berufliche Mobilität oder muttersprachlichen Unterricht erleichtert.
Nach dem deutschen Angriff
� Heimatkreis Prachatitz/Böhmerwald
Generationen und Grenzen überschritten
gebildet, das zunächst starke regionale Züge aufgewiesen habe. Man habe sich Wolga-, Schwarzmeer-, Bessarabien-, Wolhynien- oder Kaukasusdeutsche genannt. Erst nach der totalen Entrechtung und Deportation 1941 sei eine übergreifende Schicksalsgemeinschaft namens Rußlanddeutsche entstanden.
Vor dem Ersten Weltkrieg hätten 2,5 Millionen Deutsche in Rußland gelebt und ihr Landbesitz acht Millionen Hektar betragen. Rasch seien sie die wichtigsten Getreideproduzenten geworden und hätten fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte im Schwarzmeergebiet produziert. Die Führungsschicht habe ihre Zarentreue als systemstabilisierend betrachtet. Europas aufkommender Nationalismus habe auch in Rußland antideutsche Kampagnen und Restriktionen gezeitigt.
auf die UdSSR sei im August 1941 die umfassende Entrechtung der Deutschen erfolgt. Die Liquidierung der Wolgarepublik und die Verbannung ihrer Menschen nach Kasachstan und Sibirien habe die Diskriminierung der Volksgruppe eingeleitet. Mindestens 150 000 Menschen hätten die Deportation und das Lagerleben nicht überlebt. Erst Anfang 1956 seien die Deutschen den übrigen sowjetischen Menschen formalrechtlich gleichgestellt worden, aber die staatliche Diskriminierung habe kein Ende gefunden. Zerstreuung, Verfolgung und Diskriminierung hätten zum Kulturverlust und zum niedrigsten Bildungsstand unter den sowjetischen Völkern geführt. Der deutsche Angriffskrieg und die Kriegsverbrechen hätten antideutsche Ressentiments verursacht, wobei die Deutschen als zuverlässig und tüchtig geschätzt worden seien. Da spätere Versuche für Gleichberechtigung territorialer Autonomie gescheitert seien, habe man ausreisen wollen. Heute lebten 2,5 Millionen Rußlanddeutsche in Deutschland. Daß ihre Eingliederung weitgehend gelungen sei, zeige sich darin, so Krieger, daß sich die zweite Generation kaum von den Einheimischen unterscheide. Gegenwärtig lebten noch etwa 600 000 Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion.
� SL-Ortsgruppe Naila/Oberfranken
Maibaum errichtet
Ende April richtete die oberfränkische SL-Ortsgruppe Naila wieder ihren Maibaum im Pfarrhof der katholischen Kirche auf, heuer zum 39. Mal.

Wie Bezirksvize- und Ortsobmann Adolf Markus in seinem Grußwort erwähnte, solle mit der alljährlichen Errichtung des Maibaums eine Tradition aus der Heimat in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, die 1972 in Naila von der Sudetendeutschen Landsmannschaft eingeführt worden sei, gepflegt werden.
An dem sudetendeutschen Maibaum mit seinem rot-schwar-
Hofmeister sagte, er habe noch einen Bezug zum Sudetenland, der Heimat seiner Eltern. Die Arbeit des BdV und der Landsmannschaften sei wichtig. Er verwies auf § 96 des Bundesvertriebenengesetzes, nach dem Bund und Länder verpflichtet seien, das Kulturgut der Vertriebenen sicherzustellen.
Plahl nannte die Tage der Heimat als Höhepunkte der Verbandsarbeit. So finde heuer der Tag der Heimat wieder in Weilmünster statt. Außerdem wurde
Josef Harbich für 30 Jahre Mitgliedschaft in der SL geehrt. Die Wahlen der Kreisvorstände von BdV und SL brachten folgende Ergebnisse: Josef Plahl wurde wieder BdV-Kreisvorsitzender und SL-Kreisobmann. Sein Stellvertreter wurde Albrecht Kauschat, Robert Bandt wurde Schatzmeister. fl


zem Anstrich, den Farben des Sudetenlandes, seien zehn Wappenschilder von größeren Städten des Sudetenlandes aus verschiedenen Heimatbezirken wie Aussig, Brünn, Eger, Freiwaldau, Grulich, Krummau, Mährisch Trübau, Reichenberg, Troppau und Znaim angebracht.
Obmann Adolf Markus dankte den Akteuren der SL, den tatkräftigen Helfern aus dem „Vertriebenendorf“ zwischen Kirche und Kettelerhaus und der Pfarrgemeinde. Sein Dank galt darüber hinaus dem Nailaer Stadtpfarrer Dekan Andreas Seliger für die Erlaubnis, den Pfarrhof nutzen zu dürfen. fs

Neue Impulse setzte das 71. Heimatkreistreffen der Böhmerwäldler aus dem Heimatkreis Prachatitz Ende April in der Patenstadt Ingolstadt.
Bei der Mitgliederversammlung wurden die Übernahme der Agenden des Heimatkreises Bergreichenstein und eine neue Satzung verabschiedet. Nach der Übernahme der Heimatsammlung Bergreichenstein in das Heimatmuseum von Niemes und Prachatitz wurde die Zusammenarbeit beider Heimatkreise vereinsrechtlich verankert. Das Museum arbeitet an der Neugestaltung. Es schaffte neue Vitrinen und Ausstellungstafeln an, richtete einen weiteren Archivraum ein und installierte einen Großbildschirm. Seit April läuft eine Sonderausstellung über bedeutende Persönlichkeiten im Böhmerwald und im Bayerischen Wald.
Edmund Koch, dessen Vorfahren aus dem bei Böhmisch Krummau gelegenen Ort Ottau stammen, kümmert sich seit Monaten umsichtig um Betrieb und Ausbau der Sammlung. Die noch offenen Archivierungsarbeiten werden vom Stellvertretenden Vereinsobmann Luděk Němec im Sommer fortgesetzt. Als weiterer Schwerpunkt steht die Zeitschrift „Der Böhmerwald“ im Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Namhafte Autoren konnten gewonnen werden, der Themenschwerpunkt „Burgen und Schlösser“ erfreut sich großer Beliebtheit, und das Verkaufsgebiet wurde ausgeweitet. Die ehrenamtliche Arbeit der Redaktion, die Rudolf Hartauer leitet, kann nicht genug geschätzt werden. Der Verkauf in zahlreichen Geschäften im östlichen Bayern zeitigte viele neue Abonnenten und vermittelt Geschichte und Kultur des Böhmerwalds und seiner ehemaligen Bewohner nun einem wesentlich größeren Leserkreis.
Außerdem gelang, eine Schulpartnerschaft zwischen dem Prachatitzer Gymnasium und dem Katharinengymnasium Ingolstadt zu vermitteln. Die Schulleiter Jana Dejmková und Matthias Schickel ermöglichten diese Zusammenarbeit, die die historischen Verbindungen der aus Prachatitz und Umgebung vertriebenen Böhmerwäldler und ihrer Patenstadt fortsetzen und an eine neue Generation vermitteln. Den engagierten Lehrern verdanken wir, daß die Jugendlichen die

Projekttage begeistert aufnahmen.
Bereits zum dritten Mal trafen sich die Schüler beider Schulen, nach zwei Zusammenkünften im vergangenen Sommer und im Winter im Bayerischen Wald war dieses Mal Ingolstadt an der Reihe.
Auf der Agenda des mehrtätigen Aufenthalts standen eine Begrüßung durch die zweite Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll, eine Führung im Audi-Museum und eine Fahrt nach München, aber auch Zeitzeugeninterviews mit Mitgliedern der Ortsgruppe Ingolstadt des Deutschen Böhmerwaldbundes (DBB), dessen Vorsitzendem Werner Meisinger und mit Konrad Pfeifer, der als Vertreter des Heimatkreises Bergreichenstein eigens aus Hannover angereist war. Bei einer Stadtführung lernten selbst die Ingolstädter Jugendlichen viel Neues über ihre Heimatstadt.
Als Zeichen der neuen Verbindung wurde der traditionelle Empfang der Stadt Ingolstadt von den Schülern gestaltet. Bürgermeisterin Deneke-Stoll und Gernot Peter vom Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz begrüßten die vielen Teilnehmer im übervollen Festsaal des Alten Rathauses und lauschten gespannt den Erfahrungsberichten der jungen Ingolstädter und Prachatitzer. Die Vorträge wurden auf Deutsch und Tschechisch gehalten, untereinander läuft

die Verständigung problemlos auf Englisch. Schon zuvor hatten die Schülergruppen am Gottesdienst in der Sebastianskirche, an der Gedenkfeier beim Bischof-Johann-Nepomuk-Neumann-Denkmal und am gemeinsamen Mittagessen teilgenommen. Besonderer Dank galt den Lehrern sowie Edmund Koch, der diese zukunftsweisenden Projekttage mit Rat und Tat unterstützt hatte. Viele Freundschaften wurden geschlossen, und private Treffen abseits der organisierten Zusammenkünfte fanden bereits statt. Beeindruckt von diesem besonderen Treffen waren jung und alt. Die Verbindung zwischen den Generationen und über Grenzen hinweg gelang in Ingolstadt und Prachatitz. tr

� Teplitz-Schönau







für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau



Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
MitWürde durch alle Regime

Der Verein Teplitz und die Mitarbeiter der „Erzgebirgs-Zeitung“ engagieren sich vor allem in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Sachsen. Dazu gehört auch der Geschichtsunterricht im Pirnaer FriedrichSchiller-Gymnasium.
Bereits vor einigen Monaten hatte sich eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Gymnasien im böhmischen TeplitzSchönau und im sächsischen Pirna angebahnt. Zum einen ist der Weg zwischen den Schulen kurz, und zum anderen ist das SchillerGymnasium deutschlandweit das einzige deutschtschechische Gymnasium. Von seinen rund 850 Schülern nehmen etwa 100 tschechische Schüler vorwiegend aus Nordböhmen ab der 7. Klasse am Unterricht bis zum Abitur teil. Das bedeutet, daß auch die tschechische Sprache als Wahlfach für die deutschen Schüler angeboten wird und dazu mehrere Tschechen am Gymnasium unterrichten. Petr Fišer von der „ErzgebirgsZeitung“ hatte bereits Anfang des Jahres dem Teplitzer Gymnasium den interessanten Dokumentarfilm „Mit Würde durch alle Regime“ angeboten. Er schildert das Leben der TeplitzSchönauer Ehrenbürgerin Hana Truncová/John (1924–2022). Die Halbjüdin war mit ihrer Familie den Repressalien nach dem Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich 1938 ausgesetzt und erlebte die Kristallnacht in TeplitzSchönau. Dennoch ver

urteilte sie die Vertreibung der deutschen Bevölkerung und wollte sich der kommunistischen Willkür nach 1948 nicht beugen. Dafür wurde sie mit mehr als
zehn Jahren Gefängnis bestraft und erfuhr auch danach viel Leid. Sie erlebte den Einmarsch der Sowjetarmee 1968 und die nachfolgende sogenannte Normalisierung. In ihren Erzählungen läßt sie diese bedeutenden Ereignisse des 20. Jahrhunderts in Böhmen eindringlich, aber mit ungebrochenem Optimismus aufleben: ein ungewöhnlicher Geschichtsunterricht. Da der Dokumentarfilm ebenfalls in deutscher Sprache vorliegt, war es naheliegend, ihn auch im FriedrichSchillerGymnasium vorzustellen. Diese Gelegenheit bot sich Ende April. Gemeinsam fuhren Petr Fišer, Redaktionsrat der „ErzgebirgsZeitung“, und die Mitglieder des Teplitzer Vereins Vlasta Mládková, Jan Setvák, ich als Mitglied des Teplitzer Vereins sowie des Vereins TeplitzSchönauer Freundeskreis und der Regisseur des Dokumentarfilms, Martin Stu
decký von MSproduction, nach Pirna. Studecký hatte vor etwa fünf Jahren die ersten Kontakte mit Truncová aufgenommen und sie gebeten, über ihre Erlebnisse als Kind im Erzgebirge zu berichten. Daraus wurde ein mehrstündiges Zeitzeugnis der damals etwa 93jährigen. Aus den bedeutendsten Passagen stellte Studecký seine Dokumentation zusammen. Zunächst begrüßte uns Schuldirektor Kristian Raum, dann zeigte uns sein tschechischer Kollege Jan Kvapíl die Räume des Gymnasiums. Das ehrwürdige Gebäude von 1876 ist nicht nur mit der Zeit seiner Gründung dem Te
schließend wurde in der 11. Klasse mit erweitertem TschechischUnterricht der Film vorgeführt, den die Schüler aufmerksam und mit sichtlicher Anteilnahme verfolgten. In der folgenden Diskussion war aber zu erkennen, daß die geschichtlichen Ereignisse in der Tschechoslowakei den deutschen Schülern wenig bekannt waren. Kristian Raum, der im Gymnasium Geschichte lehrt, begrüßte deshalb den Film als interessante Erweiterung und Belebung des zukünftigen Geschichtsunterrichts.

Schuldirektor Kristian Raum und Teplitz-Schönaus Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek. Bilder:
plitzer Gymnasium nahe, auch die Anzahl der Schüler ist etwa gleich. Erst 2022 kam ein Anbau hinzu, der weitere Lehrräume und Aufenthaltsräume für die Schüler bereitstellt. Zum Gymnasium gehören auch eine Außensportanlage und ein sehr hübscher Park.

Das gemeinsame Mittagessen in der Mensa weckte Erinnerungen an die eigene Schulzeit. An

Nachmittags lief er im Internat des Gymnasiums, um ihn weiteren Schülern und Lehrkräften zu zeigen. Das Internat liegt im Zentrum der Stadt und wurde in den 1990er Jahren aus einem Block kleinerer, damals verfallener historischer Gebäude errichtet. Es bezaubert heute durch seine Kombination alter Architektur mit modernen Bauelementen, wobei der historische Charakter erhalten blieb. Hier waren wir nun ganz in einem tschechisch geprägten Milieu, Informationstafeln mit Hinweisen auf aktuelle Veranstaltungen überwiegend in Tschechisch, denn diese Schüler können hier die Woche über wohnen, fahren nur übers Wochenende heim. Aktuell kamen im letzten Jahr noch eine 7. und 8. Klasse für ukrainische Kinder hinzu, während es im Gymnasium selbst dann eine weitere Klasse mit höheren Jahrgängen für Ukrainer gibt. In einem Gemeinschaftssaal im Internat fand die erneute Aufführung des Dokumentarfilms statt, woran auch der in Pirna wohnende Erhard Spacek, der Vorsitzende des Vereins TeplitzSchönau Freundeskreis, teilnahm. Die anschließende Diskussion war wieder ein schönes Beispiel dafür, wie beide Länder immer mehr zusammenwachsen.
Jutta Benešová
Die Gläubigen nach der Andacht vor der
� Unter dem Mückentürmchen
Tschechisch-deutsche Nachbarschaftstreffen, deutsch-tschechischer Schüleraustausch oder gemeinsames Beten fördern Versöhnung und Freundschaft. Jutta Benešová berichtet über die ökumenische Andacht für Frieden und Versöhnung in der Sankt-Wolfgang-Kapelle in Graupen unter dem Mückentürmchen bei herrlichstem Sonnenschein am 1. Mai.
Die von Pater Benno Beneš (1938–2020) im Jahr 2000 eingeführte Tradition drohte nach seinem Tod und Corona verloren zu gehen. Die Initiative ergriff im vergangenen Jahr der evangelische Pfarrer David Keller aus dem sächsischen Altenberg und sprach auf deutscher und tschechischer Seite evangelische und katholische Pfarrer an, um die ökumenische Andacht mit dem Gebet für Frieden und Versöhnung am 1. Mai zu erhalten.
Nach der Andacht trafen sich wieder Nachbarn von diesseits und jenseits der Grenze in gemeinsamen Gesprächen vor der Kapelle, für einen kleinen Imbiß waren sie dankbar. Die diesjährige Kollekte war für die Replik des berühmten Gnadenaltars in der Fürstenauer Kirche bestimmt. Sie war bereits zum Kirmesfest im September geweiht worden, aber die Kommunikation zwischen den Ländern hatte leider nicht geklappt. Wie mir der Geisinger Pfarrer Markus Schuffenhauer erzählte, der auch in Fürstenau predigt, sei das Aufstellen der Replik relativ eilig erfolgt, um den Termin einzuhalten, so daß keine Zeit gewesen sei, die Freunde jenseits der Grenze einzuladen.
1887 war der Fürstenauer Gnadenaltar aus Sachsen in das böhmische Vorderzinnwald in eine
und in der 11.
An diesem Maifeiertag waren außer Pfarrer Keller die katholischen Geistlichen Gerald Kluge aus Dippoldiswalde und Pater Christopher Cantzen aus Maria Radschitz sowie Pastor Marek Janovský von der apostolischen Kirche ohne Grenzen in Teplitz gekommen. Die zahlreiche Gemeinde fand in der kleinen Kapelle kaum Platz. Abwechselnd wurden Stellen aus dem Evangelium in Deutsch und Tschechisch verlesen, in warmen Worten wurde auch der vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine gedacht. Im vergangenen Jahr hatte eine junge Ukrainerin von ihren erschütternden Erlebnissen und der Trennung von ihrem Mann gesprochen – niemand hatte wohl im Mai 2022 geahnt, daß dieses Morden ein Jahr später noch immer kein Ende hat.


eigens dafür errichtete kleine Kapelle überführt worden, die nach 1945 abgerissen wurde. Der Gnadenaltar konnte gerettet werden und befindet sich nun nach einem langjährigen Zwischenaufenthalt in der MariäHimmelfahrtsKirche in Böhmisch Zinnwald im Teplitzer Schloßmuseum. Warum nun die Fürstenauer für ihre Kirche gern eine Replik des Altars haben wollten und wie diese gestaltet ist, versuchen wir demnächst vom Teplitzer Verein bei einem Besuch in Fürstenau herauszufinden. Wir werden berichten.
 Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ HEIMATBOTE
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Der zweite Teil der Serie über die Schulen in Ronsperg befaßt sich mit der Volksschule für Mädchen, der Vereinigung der Volksschulen, dem Bürgerschulunterricht vor dem Ersten Weltkrieg und der Bürgerschule.
Im Jahr 1866 rief Franz Karl Reichsgraf von Coudenhove Schwestern aus dem Orden des heiligen Borromäus vom Mutterhaus in Prag nach Stockau. Bald übernahmen sie in Ronsperg auch den Unterricht für die Mädchen, und zwar in dem Gebäude der ehemaligen Spiritusbrennerei.
1873 bestanden dort bereits zwei Klassen einer Volks- und Industrialschule für Mädchen.
Die Unterhaltungskosten dieser Schule trug Graf Coudenhove. Am 7. Januar 1876 erhielt die Anstalt das Öffentlichkeitsrecht. 1879 wurde sie dreiklassig. 1891 besuchten 234 Mädchen diese Schule. 1894 erhielt sie bei einer Schülerinnenzahl von 248 eine vierte Klasse dazu.
1903 wurde unter Oberin M. Alfreda und der Leiterin der Schule M. Leontia das neue Klostergebäude, das Karl-Borromäus-Heim, erbaut. Neben dem eigentlichen Kloster beherbergte das Haus die Mädchenvolksschule und eine private Bürgerschule mit Pensionat.

Lehrerinnen der vierklassigen öffentlichen Privat-MädchenVolksschule sind
1913 Schulleiterin Schwester Leontia Lengert, Schwester Pulcheria Streček, Schwester Edelreda Debač und Schwester Reineldis Satinsky. Aushilfslehrerinnen waren Anna Wiesner und Hermine Bauer.
Vereinigung der Volksschulen
Am 1. September 1940 wurden beide Schulen, die Volksschule für Knaben und die für Mädchen, zu einer siebenklassigen gemischten Schule vereinigt. Wegen der großen Anzahl von evakuierten Kindern kam bald eine achte Klasse hinzu. Oberlehrer Heinrich Cenefels, der aus Althütten hierher versetzt wurde, erhielt die Schulleiterstelle, die nun zu einer Rektorenstelle erhoben wurde.
Groß war der Lehrermangel, da die jungen Lehrer im Feld standen. Um die Lücken zu füllen, taten die Pensionisten Karl Brunner, Franz Osterer und Susanne Steiner wieder Dienst. Ferner unterrichteten an der Volksschule Anna Landkammer, Marie Liebisch, Andreas Rieß, Anna Weidner, Martha Hubatschek, Luise Kaiser, Martha Schwarzbach, Gertrud Leberl, Hilde Riederer, Erna Oschowitzer, Hedwig Schlick, Gertrud Jaklin und später auch noch für kurze Zeit Leh-
❯ Die Geschichte der Schulen in Ronsperg – Teil II
Unerträgliche





Raumnot
rer aus Schlesien, die als Flüchtlinge nach Ronsperg gekommen waren. Handarbeitslehrerin war Frieda Tragl. Da die Schule nicht für die vielen Klassen gebaut war, mußten zwei Klassen im Klostergebäude bleiben. Als das Kloster zum Kreisaltersheim umgewandelt wurde, wurde die Raumnot unerträglich. Deshalb wurde mitten im Krieg umgebaut. Da Rektor Cenefels die Dienstwohnung nicht in Anspruch nahm und auch auf das große Konferenzzimmer verzichtet wurde, konnten durch den Umbau sieben Klassen in dem Haus Platz finden. Da man auch die Räume mit besserem Licht ausstattete, wurden freundliche Unterrichtsräume gewonnen. Als man wegen der vielen Flüchtlingskinder aus Ungarn und Schlesien noch eine neunte Klasse errichten mußte, kam man aber trotzdem nicht ohne Schichtunterricht aus.
Gegen Ende des Krieges aber litt der Unterricht nicht nur unter dem Lehrermangel, auch die zeitweilige Einquartierung von Flüchtlingstransporten und Militär störten den Schulbetrieb. Da die Schule über keine ausreichenden Luftschutzräume verfügte und die Luftalarme sich mehrten, wurde im April 1945 die Schule geschlossen. Und sie öffnete für die deutschen Kinder, so lange sie noch in Ronsperg waren, ihre Tore nicht mehr. Für die Deutschen gab es keinen Unterricht mehr.
Franz BauerBürgerschulunterricht vor dem Ersten Weltkrieg
Das Ronsperger Geschäftsleben war früher vornehmlich nach Taus ausgerichtet. Die Kaufleute in Ronsperg bezogen ihre Waren von dort. Bevor die Eisenbahnstrecke zwischen Taus und Tachau 1910 in Betrieb genommen wurde, besorgte mein Onkel, der Spediteur Wenzel Pechtl aus den Strohhäusln, die Frachtfuhren. Ich durfte öfter mal mit nach Taus fahren, die leichteren Pakete nach der Rückkehr den Kaufleuten zustellen und bekam dafür von diesen Zuckerstangerln und andere Süßigkeiten.
Auf diese Geschäftslage ist es wohl zurückzuführen, daß sowohl mein Vater Franz Pechtl als auch mein Onkel die tschechische Bürgerschule in Taus besuchten. Ich besaß bis zur Vertreibung noch Zeichnungen, Schulhefte, einige Lehrbücher und Zeugnisse von ihnen. Es dürften aber auch noch andere Ronsperger seinerzeit die Tauser Bürgerschule besucht haben.
Erst mit der Eröffnung der Bahnlinie zwischen Stankau und Ronsperg ab 1900 wurde auch der Besuch der Bürgerschule in Bischofteinitz möglich, wurde aber wenig genützt. Dafür erteilte Lehrer Karl Pauli vor dem Ersten Weltkrieg und bis 1915 Privatunterricht in den Bürgerschulfächern für Knaben. In seiner Wohnung im Hause Stadik neben Fleischhauer Landshut am
Unteren Ringplatz hatte er einen mit allen Erfordernissen wie Wandtafeln und Zeichentischen gut ausgestatteten Unterrichtsraum eingerichtet. Zu meiner Zeit 1912 bis 1915 erteilte er dort zwölf bis 16 Schülern Bürgerschulunterricht. Von Montag bis Mittwoch sowie Freitag und Samstag vormittags – nach Schluß des Unterrichts an der Knabenvolksschule – und am schulfreien Donnerstag von acht bis zwölf Uhr – im Sommer auch schon ab sechs Uhr früh – gingen wir zu Lehrer Pauli und lernten dort die Bürgerschulfächer. Im Juli, kurz vor Schluß des Schuljahres, mußten wir die Prüfung in allen Fächern an der Bürgerschule in Bischofteinitz ablegen (➝ unten).

Karl Pauli war ein guter Lehrer und in unserem Heimatort geachtet. Er war auch auf dem Gebiet der Elektrotechnik (Schwachstrom) praktisch tätig, und wir konnten damals interessanten Experimenten beiwohnen, galvanische Batterien basteln, Licht- und Klingelleitungen legen und so weiter. Lehrer Pauli hatte damals schon ein Haustelefon von seinem Wohnzimmer zum Unterrichtsraum hinauf und den ersten elektrisch beleuchteten Christbaum. Außerdem installierte er die Klingelanlage im damals neuen Sparkassengebäude am Ringplatz. Leider starb er schon 1916 im 40. Lebensjahr.

Franz Pechtl
Die Bürgerschule

Mit dem Reichsvolksschulgesetz vom 14. Mai 1869 wurde die Bürgerschule als Oberstufe der achtjährigen Pflichtschule begründet. Sie sollte eine über das Lehrziel der allgemeinen Volksschule hinausreichende Bildung mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden und Landwirte gewähren. In Bischofteinitz öffnete eine Knabenbürgerschule am 1. November 1878 ihre Tore. 1904 erhielt die Kreisstadt auch eine Mädchenbürgerschule. Als die Borromäerinnen 1903 in Ronsperg ihr neues Klostergebäude errichteten, eröffneten sie auch eine Mädchenbürgerschule mit einem Pensionat. Sie hatte aber nur privaten Charakter. Die Abschlußprüfungen mußten in Bischofteinitz abgelegt werden. Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg bemühte sich Ronsperg intensiv um eine eigene öffentliche Bürgerschule. Die klösterliche Schule erhielt zwar das Öffentlichkeitsrecht, doch es fehlte ein entsprechendes Gebäude. Dechant Šanda war einer der Männer, die sich unermüdlich für die Bürgerschule einsetzten. Fortsetzung folgt
Bürgerschulprüfung in Bischofteinitz
Zeitig früh ging es am Prüfungstag unter Führung von Lehrer Karl Pauli mit Zeichenmappen unterm Arm zum Bahnhof und per Eisenbahn nach Bischofteinitz.
Die Prüfungen begannen
gleich nach der Ankunft des Zuges gegen acht Uhr. Direktor Gustav Gruber prüfte Naturlehre Seite für Seite vom Anfang bis zum Ende des Lehrbuches. Katechet Ferdinand Feyrer machte es leichter, und Fachlehrer Georg Draxel fragte
❯ Hostaus Pfarrer – Teil XXII




Pfarrer Peter Steinbach
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der neunte Teil über den Dechanten Peter Steinbach (1843–1917).
Am Stadteingang heißen der Bürgermeister und die Stadträte zusammen mit allen Vereinen der Stadt den Budweiser Bischof Josef Řiha in einer eigens dafür errichteten Ehrenpforte aus grünem Reisig zu der kanonischen Generalvisitation willkommen. Der Gast wird anschließend zur Dechantei geleitet. Von allen Häusern des Stadtplatzes wehen schwarzgelbe und schwarzrotgelbe Fahnen. Die weißgelbe Papstfahne und die fürstlich-trauttmansdorff‘sche rotweiße Fahne sind auf dem Kirchturm angebracht. Der Eingang zum Pfarrhaus ist mit drei großen Wappenbildern geschmückt: in der Mitte das bischöfliche Wappen, links das trauttmansdorff‘sche Wappen und rechts das Stadtwappen Hostaus.
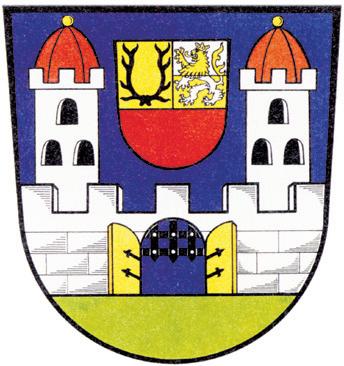
Aus Anlaß der Visitation wird das Presbyterium der Hostauer Dechanteikirche vom Maler Amerling mit einer neuen Malerei für 57 Gulden versehen. Auch die Malerei in der Friedhofskapelle wird restauriert. Über dem Bogen des Portals zum Hostauer Friedhof wird die Aufschrift „Resurrecturis“ angebracht.
In der Dechanteikirche wird die versperrte Muttergottes mit einem neuen Kleid für 25 Gulden ausstaffiert. Auch die Nische des Seitenaltars zur Schmerzhaften Muttergottes wird neu ausgemalt. Die Wandmalerei über der Eingangstür zeigt, wie die Gottesmutter Maria den heiligen Dominikus zum Gebet des Rosenkranzes ermuntert. An der Wand gegenüber der Tür befindet sich das Gemälde „In aller Trübsal und Not steh uns bei, o seligste Jungfrau Maria“. Vis á vis vom Gnadenbild ist die Geschichte von der Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten dargestellt, die vom Räuber Dismas vor dem Überfall anderer Räuber beschützt wird. All jene Malerarbeiten führt Amerling aus, wofür der Kirchenverschönerungsverein 132 Gulden bezahlt.
Österreich (* 1837 in München), wird am 10. September in Genf von dem Anarchisten Luigi Luccheni ermordet. Am 19. September 1898 bestätigt Kaiser Franz Josef I. die Kongruagesetze, die die Einkommensbezüge der Geistlichen festsetzen. Anläßlich des 50jährigen Regentschaftsjubiläums von Kaiser Franz Josef I. gestattet der Papst allen Katholiken Österreich-Ungarns am Freitag, 2. Dezember, Fleisch zu genießen. Und am 30. Juli stirbt der pensionierte deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck, der nach Steinbachs Meinung im sogenannten Kulturkampf zu unrecht die katholische Kirche in Preußen bekämpfte.

uns wahllos, aber zielsicher in seinen Lehrfächern. Fachlehrer Josef Werner, damals Neuling, mißtraute unserer Zeichenkunst, wollte von den mitgebrachten schönen Zeichnungen wenig wissen und klassifizierte unser Können nach den innerhalb einer schwachen Stunde mit Pinsel, Farben und Zeichenstiften angefertigten Malereien und Skizzen. Als Vorlage dienten herbstlich gefärbte Blätter von verschiedenen Bäumen, Schmetterlinge und ausgestopfte Tiere.
Im Quadrieren und Kubieren sowie im Wurzelziehen dieser Potenzen hatte uns Lehrer Pauli unter anderem auch verkürzte Verfahren gelehrt. Fachlehrer Werner staunte über die Schnelligkeit, mit der wir die Resultate an die Wandtafel brachten, schüttelte den Kopf und ließ uns die Rechenvorgänge nach der alten ausführlichen Methode wiederholen. Da die Ergebnisse übereinstimmten, gab es die Noten „Vorzüglich“.
Gegen ein Uhr mittags erhielten wir die Zeugnisse. An-
schließend erholten wir uns bis zur Rückfahrt vom Prüfungsschrecken in der Konditorei Jung vor der Radbusa-Brücke.
Zu Hause konnten wir mit unseren guten Zeugnissen auch noch Lob beziehungsweise Anerkennung in klingender Münze oder anderen Vorteilen und Auszeichnungen ernten. Die ehemaligen Schüler des Lehrers Karl Pauli erinnern sich gewiß gerne an die Bürgerschulstunden und an die Aufregungen vor den Prüfungen.
Franz PechtlFür das Pontifikalamt am 6. Mai, bei dem auch das Sakrament der Firmung gespendet wird, wird ein neues rotes Meßgewand von der Firma Josef Neschkudla in Gabel an der Adler für 70 Gulden angeschafft. Der verwendete Kelch wird zuvor vom Hostauer Josef Hofmann für 19 Gulden vergoldet. Am 7. Mai führt Bischof Řiha in den Schulklassen noch Religionsprüfungen durch, bevor er mit seinem Gefolge am Vormittag des 8. Mai Hostau wieder verläßt.
Wieder sind es einige Ereignisse außerhalb Hostaus, die Dechant Steinbach im Memorabilienbuch für das Jahr 1898 festhält. Kaiserin Elisabeth von
An Lokalereignissen führt Steinbach auf, daß am 15. Juli 1898 ein Brand die Hälfte der Häuser in Muttersdorf zerstörte und er für die Geschädigten elf Gulden 35 Kreuzer in Hostau sammelt. Die Stadtverwaltung von Hostau bittet Steinbach, den hinter der Dechantei gelegenen Forasonitzer Acker der Stadt als Viehmarktplatz abzutreten. Steinbach verständigt daraufhin die Bezirkshauptmannschaft in Bischofteinitz und läßt den Fürst fragen, ob nicht die Wiese hinter dem fürstlichen Meierhof in Hostau als Viehmarkt genützt werden könne. Seine Eintragungen schweigen sich aber über das Ergebnis aus. Am 9. Oktober weiht Steinbach ein neues Feldkreuz an der Straße bei Zwirschen ein, das Josef und Maria Rothmeier aus Zwirschen errichteten. Während der Weihnachtsfeiertage werden bei den Gottesdiensten in der Dechanteikirche 33 Gulden 95 Kreuzer für die katholischen Missionen gesammelt. Im Dezember wird die Figur der Bernadette für die Hostauer LourdesGrotte bei dem genannten Ferdinand Stufflesser in Südtirol in Auftrag gegeben, die Ausgaben dafür von 33 Gulden spendet der Hostauer Bürger Josef Bauriedl. Am 15. März erlassen das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht und die Prager k. k. Statthalterei eine Schrift, die die zunehmende Verrohung und Verwahrlosung der Schuljugend beklagt. Der Erlaß fordert Lehrer, Seelsorger und Freunde der Schule auf, diese Auswüchse aufzuhalten. Steinbach kann hier nicht mit seinem Spott zurückhalten: „Wer hätte wohl einen solchen Jammerschrei der liberalen Schulbehörden erwarten können.“ Im Gleichgang bereitet das k. k. Ministerium des Inneren ein Gesetz vor, das den Verkauf von Tabak, Zigarren und Zigaretten an Jugendliche unter 16 Jahren und ebenso den Alkoholgenuß für Kinder verbietet. Ferner kündigt Papst Leo XIII. ein allgemeines Jubiläum für die Jahrhundertwende an. Der Budweiser Bischof verfügt daher, daß das Jubiläum am dritten Adventssonntag beginnt. Die Bedingungen für den Jubiläumsablaß sind Beichte und Kommunion sowie eine würdige Verrichtung von guten Werken und Gebeten. Fortsetzung folgt
Heimatbote
für den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86

Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Chronik der Vollksschule Godrusch 1935 bis 1944 – Teil II
Gedenkstunde für Slawenapostel
Der zweite Teil der Chronik befaßt sich mit dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 1935/36 und dem Beginn des Schuljahres 1936/37.
Anläßlich des 86. Geburtstages des Präsidenten und Befreiers Tomáš G. Masaryk fand in den ersten Vormittagsstunden des 7. März eine würdige Schulfeier statt, zu der auch die Mitglieder des Ortsschulrates und der beiden Gemeindevertretungen eingeladen wurden. Das Bild des Herrn Altpräsidenten war mit Tannenreiser und Fähnchen geschmückt. Auf dem Schulgebäude wehte die Staatsfahne. Anschließend hörte die Schülerschaft die außerordentliche Schulfunksendung.
Anschaffung des Ortsschulrates
Vom Ortsschulrat Godrusch wurde für die Lehrerbibliothek das Büchlein „Stoffsammlung für den Zeichenunterricht an Volksschulen“ von Josef Mayer zum Preise von zwölf Kronen angeschafft.
Osterfriede
Das Techoslowakische Rote Kreuz veranstaltete heuer seine üblichen Osterfeiern unter dem Wahlspruch „Die Gesunden den Kranken“. In Durchführung dieser Feier wurde an der hiesigen Schule in der Woche vom 30. März bis 4. April eine „Reinlichkeitswoche“ durchgeführt. Außerdem wurden den Kindern neuerlich Zweck und Bedeutung des Osterfriedens des Roten Kreuzes sowie die große Friedensidee des Tchechoslowakischen Roten Kreuzes vor Augen geführt.
Osterferien
Die Osterferien begannen diesjährig am Dienstag, 7. April, mittags um 12.00 Uhr und enden am Dienstag, 14. April. Der regelmäßige Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, 15. April.
Spende
Das Ministerium für Schulwesen und Volkskultur in Prag spendete der hiesigen Schule das Werk „Dr. Edvard Benešs Rede an die Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik“. Das Buch wurde sofort in die Lehrerbibliothek eingegliedert.
n Sonntag, 21. Mai, 15.00
Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Generalvikar Petr Hruška aus Pilsen, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Petr Hruška spricht deutsch, Telefon (0 04 20) 6 08 65 65 57, eMail hruska@bip.cz
n Samstag, 10. Juni, 18.00
Uhr, Haid: Eröffnung des Musiksommers in der Dekanalkirche Sankt Nikolaus mit einem großen Chor- und Orchesterkonzert.
Personales
Mit 1. Mai wurde die Haushaltungslehrerin Hermine Nestler ihres Dienstes enthoben und die Haushaltungslehrerin Margarete Korn mit gleichem Datum zur Dienstleistung hierorts zugeteilt.
Schulfeier am 28. Mai
Am 28. Mai 1936 feierte der Präsident unserer Republik seinen 52. Geburtstag erstmals als
die innigsten Glückwünsche. Anschließend hielt der Schulleiter den Vortrag „Unser Präsident“. Dann hielten die Schüler die Vorträge „Aus der Jugendzeit unseres Staatsoberhauptes“. Mit der Staatshymne fand die gelungene Schulfeier ihren Abschluß.
Pfingstferien
Die Pfingstferien beginnen diesjährig am Freitag, 29. Mai, 12.00 Uhr mittags und enden am
zu übermitteln und sie auch über die günstigen Beziehungsbedingungen zu unterrichten.
Gedenkstunde
Anläßlich des 1050. Jahrestages des Todes des heiligen Method wurde eine Gedenkfeier abgehalten. In dieser Gedenkfeier wurde der kulturellen Bedeutung des Werkes der heiligen Glaubensboten Kyrill und Method gedacht.
in 2,8 Prozent des Unterrichts fehlten Schüler entschuldigt, in 0,04 Prozent fehlten Schüler unentschuldigt.





Einschreibungen
Die Einschreibungen für das Schuljahr 1936/37 fanden am 27. Juni statt. Eingeschrieben wurden 40 Kinder, davon 14 Knaben und 26 Mädchen. Sechs Kinder, fünf Knaben und ein Mädchen, traten neu ein.
Verfaßt und gefertigt
Ludwig Sporer, Oberlehrer, Godrusch, am 3. Juli 1936.
Schuljahr 1936/37
Das Schuljahr 1936/37 begann am Dienstag, 1. September 1936. Die Schülereinschreibungen wurden schon am Endes des Schuljahres 1935/36 durchgeführt und ergaben, da ein Schüler das deutsche Staatsgymnasium in Mies besucht, folgendes Bild: In der Abteilung 1 waren mit fünf Knaben und einem Mädchen sechs Kinder; in der Abteilung 2 mit einem Knaben und sechs Mädchen sieben Kinder; in der Abteilung 3 mit zwei Knaben und acht Mädchen zehn Kinder; in der Abteilung 4 mit sechs Knaben und elf Mädchen 17 Kinder. Insgesamt gingen mit 14 Knaben und 26 Mädchen 40 Kinder in die Volksschule.

Personales
Mit Schulbeginn unterrichten an der hiesigen Schule noch folgende Lehrkräfte: als Religionslehrer H. Wenzel Zwerenz, Kaplan in Neustadtl, und als Haushaltungslehrerin Elsa Seitz.
Schulfeier
Staatspräsident. Anläßlich dieser Begebenheit fand in der Vormittagsstunde des genannten Tages eine eindrucksvolle Schulfeier statt, zu der auch die Mitglieder des Ortsschulrates und die Gemeindevertreter von Godrusch und Kleinmaierhöfen eingeladen waren. Auf dem Schulgebäude wehte die Staatsfahne, das neue Bild des Herrn Staatspräsidenten Edvard Beneš war mit blühendem Flieder geschmückt, und kleine Fähnchen in den Staatsfarben umrahmten es.
Das Programm bestand aus einer Schulfunksendung und einer Klassenfeier. Sichtlich ergriffen lauschten alle der großen ausgestrahlten Präsidentenfeier.
Bei der Klassenfeier übermittelten die Schulkinder in einem Sprechchor ihrem Präsidenten
n Sonntag, 18. Juni, 15.00
Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail
st.valentinus@web.de

n Sonntag, 16. Juli, 15.00
Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Gras-
Dienstag, 2. Juni. Der regelmäßige Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, 3. Juni.
Anschaffung des Ortsschulrates
Für die Lehrerbibliothek wurde aus den Mitteln des Ortsschulrates das Büchlein „Zeichnen im Dienste der Erziehung zur Wehrhaftigkeit“ angeschafft und dem Schulinventar einverleibt.
Wehranleihe
In der Stunde für Bürgerkunde wurde den Schülern Zweck und Bedeutung der staatlichen Wehranleihe klargemacht. Unter die Kinder wurden diesbezügliche Flugblätter verteilt mit der Aufforderung, diese ihren Eltern
litz, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Peter Fořt spricht deutsch, Telefon (0 04 20) 7 24 20 47 02.
n Sonntag, 20. August, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg
Schulschluß
Das Schuljahr 1935/36 endete am Samstag, 27. Juni 1936. An diesem Tage wurden auch die Schulnachrichten und Entlassungszeugnisse verteilt.
Entlassungen

Aus der Schule entlassen wurden folgende vier Mädchen und drei Knaben Barbara Brix, Theresia Reichl, Theresia Schöppl, Theresia Wartha, Josef Wenzel Höra, Franz Schober und Josef Watzka.
Schulbesuch
Die Schüler besuchten im Schuljahr 1935/36 97,16 Prozent des gesamten Schulunterrichts,
Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, SanktVitus-Straße 20, 92533 WernbergKöblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@ gmail.com n Freitag, 1. bis
Überprüfung der Blitzableiter
Am 3. Juli wurde die Blitzableiteranlage der hiesigen Schule von der Firma Preissler, Elektrounternehmen in Haid überprüft und für äußerst mangelhaft befunden. Nach sofort vorgenommener Reparatur, bei der auch der Eisendraht der Anlage durch vorschriftsmäßigen Kupferdraht ersetzt wurde, ergab das abermalige Prüfungsergebnis folgendes einwandfreies Resultat: Widerstand der Erdplatte I beim Eingang 60 Ohm, der Erdplatte II im Garten 22 Ohm, der Luftleitung zwei Ohm.
Die Wiederinstandsetzung der Blitzableiteranlage verursachte einen Kostenaufwand von 318 Kronen.
Sonntag, 3. September: 33. Heimatkreistreffen in Weiden in der Oberpfalz. Programm folgt in Kürze.




n Samstag, 9. September, Haider Loretofest: 11.00 Uhr Fußwallfahrt ab Waidhauser Pfarrkirche Sankt Emmeram;
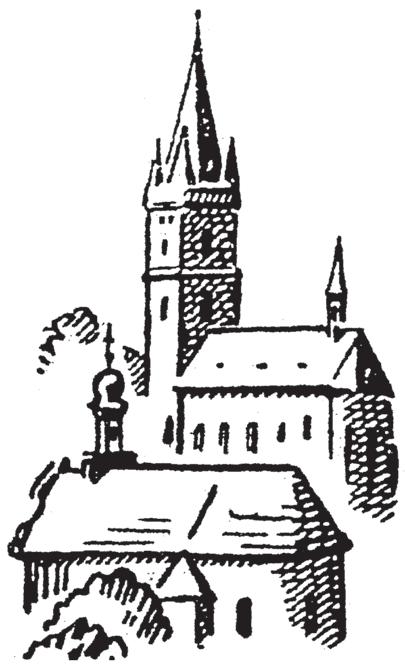

17.00 Uhr Rucksackverpflegung in Haid; 19.00 Uhr deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft:
Anläßlich des Geburtstages Seiner Majestät Peters II., des Königs von Jugoslawien, fand in den Vormittagsstunden des 5. Septembers eine Schulfeier statt, in der auf die innige Freundschaft, die unsere Republik mit Jugoslawien sowie ihren Repräsentanten verbindet, hingewiesen wurde und Peter II. als Muster eines Schülers, Vorbild des Fleißes und Pflichtbewußtseins den Schülern dargestellt wurde. Möge der junge König dereinst großer Führer seines Volkes und wie sein, auf so tragische Weise ums Leben gekommener Vater, Förderer und Träger der großen Friedensidee in Europa sein.
Spende
Von unserem Bezirksschulamt in Tachau erhielt die Schule zwei Büchlein:
l „Der Trotz“ von Franz Knauschner für die Bücherei der Elternvereinigung, l „Rübezahl“ von Hans Regina Nack für die Schülerbücherei. Fortsetzung folgt
Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com n Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA
Bund der Eghalanda Gmoin e. V., Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, Telefon (0 92 31) 6 612 51, Telefax (0 92 31) 66 12 52, eMail bundesvorstand@egerlaender.de Bundesvüarstäiha (Bundesvorsitzender): Volker Jobst. Spendenkonto: Bund der Egerländer Gmoin e.V., Brunnenkonto, IBAN: DE28 7805 0000 0810 5621 57 Egerland-Museum Marktredwitz , Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, www.egerlandmuseum.de, eMail egerlandmuseum@egerlaender.de Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.

❯ Johannes von Tepl Vorschläge
für den Egerländer Kulturpreis
Der Egerländer Kulturpreis Johannes von Tepl und der dazugehörige Anerkennungspreis werden seit 1995 vom Bund der Egerländer Gmoin e. V. (BdEG), der Arbeitsgemeinschaft Egerländer Kulturschaffender e. V. (AEK) und dem Landschaftsrat Egerland in der Sudetendeutschen Landsmannschaft als Vertreter der Egerländer Heimatvereine gemeinsam ausgeschrieben.
Die genannten Institutionen
stifteten den Preis in Erinnerung an den aus dem Egerland stammenden Johannes von Tepl, der um 1400 mit dem „Akkermann aus Böhmen“ die älteste und bedeutendste Prosadichtung der neuhochdeutschen Literatur geschaffen hat.
Der Egerländer Kulturpreis besteht aus einem Haupt- und einem Anerkennungspreis.
Der Hauptpreis ist mit 2000 Euro, der Anerkennungspreis mit 1000 Euro dotiert.
Die Preissummen werden durch Spenden aufgebracht.
Der Hauptpreis wird an lebende Personen verliehen, die sich durch herausragende kulturelle Leistungen um das Egerland und die Egerländer verdient gemacht haben. Der Anerkennungspreis wird an Personen verliehen, die nicht älter als 35 Jahre sind.
Auch Gruppen können für beide Preise berücksichtigt werden.
Vorschläge für die Preisträger können von Personen eingebracht werden, die Mitglieder der oben genannten Institutionen sind. Die Preisvorschläge müssen bis zum 21. Mai an untenstehende Adresse in schriftlicher Form mit einer ausführlichen Begründung und dem Lebenslauf des oder der Vorgeschlagenen eingereicht werden.
Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury aus Vertretern des BdEG, AEK, der Landschaft Egerland (Egerländer Heimatvereine) und einer Person der freien Spender am Sudetendeutschen Tag 2023 in Regensburg ausgewählt.


❯ Klausurtagung der Bundesjugendführung
Generation Teamgeist plant die Zukunft
Ein ganzes Wochenende hat sich die Bundesjugendführung der Egerland-Jugend Zeit genommen, um im Rahmen einer Klausurtagung aktuelle und künftige Themen der EgerlandJugend zu diskutieren.
Zwölf Vorstandsmitglieder aus Bayern, Hessen und Baden-Württemberg trafen sich dafür im unterfränkischen Aidhausen, wo man zwischen den Sitzungen den Teamgeist mit gemeinsames Kochen, Diskussionen am Kaminofen sowie bei Gesellschaftsspielen gestärkt hat.



Bei den intensiven Sitzungen wurden die nächsten Bundestreffen der Egerland-Jugend, der Bundesjugendtag im November und die Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Regensburg geplant.
Außerdem standen der Buchbestand und die Pflege des EJ-
❯ Das Kulturdenkmal in der Welterbestadt wurde vor dem Verfall gerettet und wird seit 2019 aufwändig saniert
Wiedereröffnung: Karlsbad feiert das alte-neue Kaiserbad
Spätestens seit dem JamesBond-Film „Casino Royale“ aus dem Jahr 2006 ist das Kaiserbad in Karlsbad weltberühmt. Doch hinter der Fassade drohte jahrelang der Verfall. Jetzt bekommt die Welterbestadt das Kulturdenkmal zurück.
Das berühmte Wiener Architekten-Duo Ferdinand Fellner und Hermann Helmer hatte auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Brauhauses das zweistöckige Pseudorenaissance-Gebäude realisiert. Die feierliche Eröffnung fand am 5. Mai 1895 statt.
Lagerraums auf der Agenda. Als willkommene Abwechslung wanderten die Teilnehmer außerdem gemeinsam zum Nassacher See. Lena Jobst
❯ Die nächsten Termine
Egerländer Kalender
■ Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Mai: 73. Sudetendeutscher Tag unter dem Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“. Veranstaltungsort: Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.
■ Samstag, 3. Juni: Großer Brauchtums-Nachmittag im Rahmen des Hessentags in Pfungstadt.
■ Sonntag, 11. Juni: Festzug zum Hessentag in Pfungstadt mit Beteiligung von Trachtenträgern des BdEG-LV Hessen.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli: Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend mit Verleihung des Johannes-von-Tepl-Preises 2023 in der Stadthalle Marktredwitz. Veranstalter: BdEG-Bundesverband und Bundesführung der Egerland-Jugend.
Vorschläge an: Dr. Ralf Heimrath, Sommerstraße 18, 93138 Lappersdorf, eMail: Heimrath@ egerlaender.de
Bisherige Johannes-vonTepl-Preisträger sind (Hauptpreis, Auswahl): 1995: Wolf-Dieter Hamperl, Mediziner und Publizist. 1996: Hermann Braun, Volkskundler. 1999: Seff Heil, Heimatforscher und Autor. 2000: Lorenz Schreiner, Mediziner und Publizist. 2001: Hans Heimrath, Pädagoge, Lehrbuchautor und -gutachter. 2004: Helmut Helmessen, Maler und Zeichner. 2005: Hermine „Mimi“ Herold, Sängerin. 2007: Gertrud Fussenegger, Schriftstellerin. 2008: Hans-Achaz Freiherr von Lindenfels, Jurist und Kommunalpolitiker. 2009: Trautl Irgang, Schriftstellerin und Mundartdichterin. 2010: Helmut Preußler, Verleger. 2013: Armin Rosin, Musikwissenschaftler, Dirigent und Musiker. 2017: Wilfried Heller, Geograph und Migrationsforscher.
Die ungewöhnlich komfortabel ausgestatteten Innenräume des Kaiserbades strotzten von modernsten Errungenschaften jener Zeit. So war zum Beispiel der Zander-Saal mit mechanischen Übungsgeräten für die schwedische Heilgymnastik nach der Methode von Dr. Zander ausgestattet. Das Kurhaus war durch einen unterirdischen Gang mit einem BadetorfPavillon verbunden, der zur Vorbereitung des Badetorfs für die Moorbäder diente. Und neben 25 Moorbädern gab es noch 22 Mineral- und vier Kohlensäurebäder sowie Dampf- und Heißlufteinrichtungen, schwedische Bäder, Sitzbäder sowie Räume für die Elektrotherapie.
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.

Das Kaiserbad, seit 1918 mit dem Ende der Habsburger Monarchie Bad I genannt, diente bis zum Ende der 1980er Jahre zu balneologischen Zwecken. Anschließend wurde im ZanderSaal ein Kasino betrieben. 1994 wurde das Gebäude geschlossen und verfiel langsam. 2008 übernahm die Region Karlsbad unentgeltlich die Immobilie und plante eine Neunutzung als Kulturzentrum.
2019 begannen dann die mit über 30 Millionen Euro veran-
schlagten Sanierungsarbeiten, die jetzt im Juni abgeschlossen werden.
Künftig wird das Kaiserbad eine Ausstellung beherbergen, die die Geschichte des Karlsbader Kurbetriebs und anderer europäischer Bäder dokumentiert. Außerdem gibt es einen großen Kultursaal, in dem nicht nur Konzerte aufgeführt und andere Kulturveranstaltungen sowie Konferenzen stattfi nden werden, sondern der auch als Kino dient, zumal Karlsbad eine lange Filmgeschichte hat.
Bereits 1896 fand hier die erste Filmproduktion statt. Bis heute diente die Stadt in über hundert tschechischen und internationalen Filmen als Kulisse und
Drehort. In Casino Royale war der Hauptdrehtort neben dem Kaiserbad das Grandhotel Pupp, wo James Bond mit Vesper Lynd die Nacht verbrachte.
Im neuen Kaiserbad wird auch ein Balneozentrum eingerichtet. Im Mittelpunkt steht dabei eine Bibliothek mit einzigartigen und wertvollen Bücher, die bis zu 300 Jahren alt sind. Die meisten der in Tschechisch, Deutsch oder Latein geschriebenen Bücher sind bereits digitalisiert und stehen Wissenschaftlern und Experten für deren Recherchen zur Verfügung.
Eindrucksvoll im Inneren des Gebäudes sind vor allem die beiden monumentalen Gemälde des Karlsbader Malers Wil-

helm Schneider, der 1914 berühmte Kurgäste auf der Leinwand festgehalten hatte. In dem Gemälde, das in der Herrenstube hängt, bilden Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth den Mittelpunkt. Umgeben wird das Herrscherpaar von 67 Persönlichkeiten, darunter sind der Komponist Beethoven, der Dichter Goethe, Kanzler Metternich und Papst Leo XII. Das zweite Gemälde hängt in der ehemaligen Damentoilette.
Es stellt berühmte Karlsbader Besucher bis 1791 dar und zeigt insgesamt 46 Figuren, wie Herzog Albrecht von Wallenstein und den Renaissance-Gelehrten Bohuslav Hasištejnský von Lobkowitz. Torsten Fricke
■ Samstag, 8. Juli, 15.00 Uhr: Hutzennachmittag im Emil-Renk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach. Kontakt unter eMail: iris. plank@egerlaender-offenbach.de
■ Samstag, 22. Juli, bis Sonntag, 23. Juli: 71. Vinzenzifest und 48. Egerländer Treffen des BdEG-LV Baden-Württemberg in Wendlingen/Neckar.
■ Sonntag, 30. Juli: 70 Jahre St.-Anna-Fest in Mähring. Veranstalter: Heimatkreis Plan-Weseritz
■ Samstag, 5. August: Hutzennachmittag im Emil-RenkHeim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach. Kontakt unter eMail: iris.plank@egerlaenderoffenbach.de
■ Samstag, 9. bis Sonntag, 10. September: Heimattage Baden-Württemberg in Biberach.

■ Sonntag, 17. September,
14.00 bis 19.00 Uhr: 70 Jahre Egerländer Gmoi Offenbach und 65 Jahre Egerland-Jugend Offenbach. Willy-Brandt-Halle, Dietesheimer Straße, Mühlheim. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach.
FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN
Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de
Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de

Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de

Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46
In eigener Sache!
Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
❯ Heimatverband
❯ Hans Valkenauer und sein unvollendetes Projekt im Auftrag von Kaiser Maximilian I.
November/Dezember 2022 Nr. 6
73. Jahrgang
Herzlichen
Glückwunsch
Der Heimatverband der Falkenauer gratuliert herzlich den im Mai geborenen Landsleuten zum Geburtstag.
101. Geburtstag: Gellings, Anna, geb. Mannert (Kloben), 13.05.1922.
100.: Schröder, Barbara, geb. Russ (Annadorf), 20.05.1923.
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Stammte der bedeutendste Bildhauer der Spätgotik ursprünglich aus Falkenau?
In eigener Sache!
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaft liches Arbeiten unmöglich machen würden.
97.: Kleck, Elsa, geb. Frank (Falkenau), 27.05.1926.
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler
93.: Rach, Gretl, geb. Peter (Maria-Kulm), 03.05.1930.
93. : Fujan, Gerhard (Falkenau),16.05.1930.
Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 mehr möglich ist

93. : Dürrschmidt, Willi (Liebenau), 25.05.1930.
Wenn er sein Werk hätte vollenden können, wäre der weltberühmte Dom zu Speyer um ein einzigartiges Kunstwerk reicher: Hans Valkenauer, der bedeutendste Bildhauer der Spätgotik, hatte von Kaiser Maximilian I. den Auftrag bekommen, für die im Dom zu Grabe getragenen römisch-deutschen Herrscher ein monumentales Kaiserdenkmal zu errichten. Doch noch vor der Vollendung des Werkes starb sein Auftraggeber.


Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.
Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber)
93.: Bauer, Margaretha, geb. Hohberger (Werth), 26.05.1934.
90.: Fenkl, Eduard (Falkenau), 17.05.1930.
89.: Meinl, Rudolf (Liebenau), 02.05.1930.
89.: Terl, Anna, geb. Dotzauer (Thein), 04.05.1934.
89.: Prof. Dr. Dotzauer, Winfried (Falkenau), 28.05.1934.
88.: Gromes, Elisabeth, geb. Knobl (Wudingrün), 04.05.1934.
88.: Pecher, Maria, geb. Hammerschmidt (Prösau), 06.05.1934.
86.: Schüssler, Gertrud geb. Bachmann (Königsberg), 06.05.1935.




86.: Dietl, Gerhard (Falkenau), 15.05.1935.
85.: Willomitzer, Dietmar (Bleistadt), 04.05.1938.
85.: Christl, Oswald (LanzThein), 28.05.1938.
84.: Knobl, Edda, geb. Gabriel (Falkenau), 13.05.1939.
84.: Weiner, Elfriede, geb. Siegert (Ebmeth), 17.05.1939.
83.: Rauer, Christa, geb. Hierath (Prösau), 09.05.1940.
83.: Maier, Erich (Zwodau), 20.05.1940.
83.: Gierl, Theresia, geb. Haberer (Steinbach), 28.05.1940.
81.: Richter, Heribert (Littmitz), 26.05.1940.
76.: Püchner, Bruno (Wudingrün), 22.05.1947.
72.: Dietrich-Kryst, Maria geb. Dietrich (Frankfurt a.M.), 24.05.1951.
Hans Valkenauer soll um 1448 geboren worden sein. Wo, ist unklar. Einige Quellen geben die Gegend um Salzburg an, andere Quellen sprechen davon, daß Hans Valkenauer aus einer Regensburger Bildhauerfamilie stammte. Doch möglicherweise führt die Spur weder nach Salzburg noch nach Regensburg, sondern nach Falkenau an die Eger... Belegt ist, daß ihm 1479 in Salzburg das „Stadtrecht“ zuerkannt wurde.
Hans Valkenauer schuf zahlreiche Werke. Wer nach Salzburg kommt und die Festung besucht, findet dort das Grabdenkmal des Fürsterzbischofs Leonhard von Keutschach, einem seiner wichtigsten Förderer.
Seinen wohl größten Auftrag erhielt Hans Valkenauer aber von Kaiser Maximilian für ein Denkmal zu Ehren der römischendeutschen Kaiser, die im Dom zu Speyer ihre letzte Ruhe gefunden hatten. An diesem Werk soll der Künstler ab 1514 gearbeitet haben, doch am 12. Januar 1519 verstarb sein Auftraggeber Kaiser Maximilian I. Unter dem Titel „Das von Kaiser Maximilian I. für den Dom zu Speyer geplante Kaiserdenkmal“ erschien dazu 1930 eine wissenschaftliche Abhandlung, in der das Drama zusammengefaßt wird: „Am 12. Jänner 1519 sank der Kaiser ins Grab, und wenige Monde danach - am 8. Junischloß auch Erzbischof Leonhard von Keutschach (Anm. d. Red.: von 1495 bis 1519 Erzbischof von Salzburg) die Augen. Hans Valkenauer mußte in ihnen die Besteller seiner bedeutendsten Werke und seine wärmsten Gönner betrauern. Ihm selbst mögen angesichts des doppelt schweren Verlustes Hammer und Meißel aus den altersmüden Händen gefallen sein, zumal Mißgunst im Gange war, ihm die Aufgabe zu

❯ Auszüge aus der Egerer Zeitung vom 27. Mai 1933
entreißen. In Trümmern blieb das Werk liegen. Was aus ihm hätte werden können, wenn ein günstigerer Stern über ihm gewaltet hätte, das müssen wir heute an dem ermessen, was Valkenauer sonst gewirkt und geschaffen hat. Daß Valkenauers Kunst das Vertrauen seines kaiserlichen Auftraggebers gerechtfertigt hätte, steht danach außer Zweifel. Um so schmerzlicher müssen wir empfinden, daß des Kaisers hoher Plan in nichts zerfloß wie ein schöner Traum.“
Fünf Säulen des unvollendeten Grabmals befinden sich im Besitz des Salzburg-Museums, das drei nach Speyer und zwei nach Innsbruck ausgeliehen hat. Entdeckt hatte man diese Kunstschätze erst im vorigen Jahrhundert in Salzburg.
Auf Grund der unterschiedlichen Schreibweise ist in der Vergangenheit ein Zusammenhang von Hans Valkenau und Falkenau an der Eger nicht thematisiert worden, aber der Originaltext des Auftrags von
Kaiser Maximilian I. ist ein Indiz: „Item kais. Maj. Hat mit maister Hannsen Valckenawer dingen lassen ain grab zu Speyr zu machen von ainem hubschn rottem marbl dem besten...“. Valkenawe ist die damalige Schreibweise von Falkenau an der Eger. Genauso wie Hans und Peter von Prachatiz, Baumeister des Wiener Stephansdoms, aus Prachatiz stammten, liegt also die Vermutung nahe, daß der berühmte Bildhauer weder aus Regensburg noch aus Salzburg stammen könnte, sondern aus Falkenau an der Eger.
Gerhard Hampl
Was vor 90 Jahren in Falkenau geschah

Heimatkreisbetreuer Gerhard Hampl hat in der Egerer Zeitung vom 27. Mai 1933 geblättert.
P
olizeibericht: In einer Nacht wurden drei Ruhestörer in die Polizeikanzlei mitgenommen, von denen einer den Sühnebeitrag von 5 Kc erlegte, der zwei-
te weigerte sich und erklärte, sein Geld für Bier zu benötigen. Er wurde zur Anzeige gebracht. Der dritte, ein Falkenauer, machte sich einer Wachebeleidigung schuldig, weshalb die Anzeige an das Bezirksgericht erstattet wurde. Einmaliger Opern- und Ope-
rettenabend: Dienstag, den 30. Mai, abends 9 Uhr, findet im Alfa-Kino, Falkenau, ein einmaliger Opern- und Operettenabend der Koloratursängerin Lilly Kolar statt. Zum Vortrag kommen Lieder und Arien aus Operetten von Lehár, Strauß und aus Opern von Puccini, Leoncavallo und Verdi.
Fremdes Eigentum: Der Geschäftsreisende Franz Lugner wurde zur Anzeige gebracht, weil er eine der Landwirtin Berta Dörfler in Dorf Lauterbach gehörige Glastafel, auf die er die Grabschrift gravieren sollte, für eine Schuld von 100 Kc bei einem Egerer Gastwirt verpfändet
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA BUNDESZEITING vereinigt mit
Egerer Landtag e. V., Geschäftsstelle in 92224 Amberg, Paradeplatz 11;
Vorsitzender: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de Stellvertretende
Vorsitzende: Helmut Reich und Dr. Ursula Schüller Für die Egerer Zeitung zuständig: Prof. Dr.-Ing. Alfred Neudörfer, eMail A.Neudoerfer@gmx.de – Kassenführung: Ute Mignon, eMail ute.mignon@online.de


Co. KG
JAHRGANG 72
Spenden an: Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN: DE73 7525 0000 0240 1051 22 – BIC: BYLADEM 1 ABG
Verantwortlich vonseiten des Egerer Landtag e. V.: Dr. Wolf-Dieter Hamperl – Redaktion: Lexa Wessel, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Über den Egerer Wandervogel
Johannes Stauda und der „Wandervogel“
Josef Müller erzählt vom „Egerer Wandervogel“:
Im historischen Egerland gab es zwei Wandervogel-Gemeinden, eine ältere in Eger und eine jüngere in Fleißen.
Der Egerer Wandervogel war mit der Person des Professors Johannes Stauda aufs innigste verbunden. Als Student war er im Reich mit einer neuen Jugendbewegung bekannt geworden, welche von Schülern des Berlin-Steglitzer Gymnasiums ausging. Bald führte sie den Namen „Wandervogel“ im Schild: im blauen Schild mit einem silbernen Greifvogel.
ten. Das alles galt als unanständig, erinnert sich Franz Jahnel, welcher eine führende Rolle im verbotenen Verein gespielt hatte.
Die „Olympier“ trafen sich heimlich vor der Stadt in ihrem Stadion hinter dem Eisenbahndamm an der Straße nach Mühlbach. Dort übten sie sich in volkstümlichen Wettkämpfen im Freien, das heißt im Laufen, Springen und Werfen, was ein Protest gegen den Geräteturn-Betrieb in den Turnhallen war. Mit einbrechender Dunkelheit schlichen sie in ihre Stadtwohnungen zurück.
zu Beginn des Krieges für Spitalzwecke geräumt werden mußte.
Am 8. Juni 1913, schreibt Stauda, machten dann Egerer Mittelschüler keinen „Ausflug“ mehr, sondern eine „Fahrt“, „zu fünft“. Sie ging zum Buchbrunnen hinter den Grünberg.
Ramona (Rott) Friesens Mutter, Alfrede Josefine Trapp (links), wurde 1935 in Stockholm, Schweden, geboren. Als sie drei Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie nach Kassel, Hessen. Jahre später haben sich ihre Mutter und ihr Vater in Gudensberg, Hessen, getroffen. Sie heirateten im Oktober 1956 und wanderten am 14. Januar 1957 nach Kanada aus. Rechts oben: Luise Rott. Rechts unten: Anton Rott.



� Personensuche
Vorfahren und Nachkommen aus Eger
Ramona Friesen, geborene Rott, aus Kanada sucht nach dem Verbleib ihrer aus Eger stammenden Vorfahren beziehungsweise deren Nachkommen:
Personensuche:
Anton Rott und Luise Rott, geborene Schmid, beide 1881 in Eger geboren. Zuletzt wohnhaft in Eger, Karl-Stilp-Straße Nummer 18.
Am 16. April 1946 wurden
Anton und Luise zusammen mit ihrer 1917 in Eger geborenen
Tochter Therese mit einem Vertreibungstransport aus Eger vertrieben.
Ferner nach dem Verbleib der 1915 in Eger geborenen Johanna Nappert, geborene Rott, beziehungsweise ihrer 1943 geborenen Tochter Hannelore Rott. Sie
Der Begründer Karl Fischer war mit seinen Freunden in der Art der fahrenden Schüler des Mittelalters um 1900 zum ersten Mal „auf Fahrt“ gegangen, und zwar „in die böhmischen Wälder“. Unter den Teilnehmern war Hans Breuer, der dann 1910 den „Zupfgeigenhansl“ herausgab, das Liederbuch der Wandervögel.
Die „Olympia“ ging dann 1913 im „Wandervogel“ auf, welchen Stauda, damals Supplent am Egerer Gymnasium, gegründet hatte.
Im ersten Jahr waren es dann 40 Mitglieder, die ihren Führer wählten und in Horden auf Fahrt gingen, zunächst zum unbekannten Egerland. In die Nacht hinein saß man singend um das Lagerfeuer im Wald herum. Das Feuer, die „heilige Flamme“, mehr noch ein Symbol, gehörte zum Jugendstil.
Bis Ende 1914 zählte man 100 Fahrten, auch größere, etwa zwei nach Thüringen, je eine an den Rhein, sowie ins Frankenland. Die Fahrten an den Bodensee und nach Italien mußten wegen des Kriegsbeginns abgebrochen werden.
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
wurden am 1. Juni 1946 mit einem Transport aus Eger vertrieben.
Personen, die hierüber Auskunft geben können, mögen sich bitte direkt wenden an:
Ramona (Rott) Friesen, eMail:
mavkayla58@gmail.com oder an:
Gerhard Hampl

Von-Bezzel-Straße 2
91054 Erlangen
Telefon: (01 70) 1 82 41 24 eMail: geha2@t-online.de
Zur Steglitzer Gruppe gehörte auch Wolf Meyen aus Hagen in Westfalen, welcher in einer plötzlichen Eingebung das Wort „Wandervogel“ in die Runde seiner Schul- und Wanderfreunde warf. Das Wort blieb haften und erreichte bald alle Orte im Reich.
Dies war keine Wortneuschöpfung. Das Zauberwort „Wandervogel“, poetisch für das umgangssprachliche „Zugvogel“, war schon in Gedichten Joseph von Eichendorffs und Otto Roquettes dabei („Ihr Wandervögel in der Luft, in Ätherglanz, im Sonnenduft, Euch grüß‘ ich als Gesellen“).
Ein alter Grabstein (Anlaß für Gedicht Meyens) für eine 26jährige verstorbene HelmholtzTochter auf dem Berlin-Dahlemer Friedhof trägt die Inschrift: „Wer hat Euch Wandervögeln Die Wissenschaft geschenkt, Daß Ihr auf Land und Meeren Nie falsch den Flügel lenkt?
Daß Ihr die alte Palme im Süden wieder wählt, daß Ihr die alten Linden im Norden nicht verfehlt.“
Hier tauchte zum ersten Mal ein neues Daseinsgefühl auf, eine neue Art „zurück zur Natur“, zum einfachen Leben, zum Volk und zu gesunder Körperlichkeit. Von Anfang an, und dann immer entschiedener, wurde den Zivilisationsschäden der Kampf angesagt, insbesondere den Rauschgiften.
Das waren die Gedanken, welche in der Luft zu liegen schienen. In Eger wurde 1908 der abstinente Schüler-Sportverein „Olympia“ gegründet – heute würde man das eine Untergrundbewegung nennen, welche durch die Disziplinarvorschriften der Schulen gehemmt nur heimlich agieren konnte.
Den Mittelschülern, wie es bei uns hieß, also den Gymnasiasten und Oberrealschülern, war zum Beispiel das Laufen auf der Straße, ohne Stehkragen in die Schule zu kommen, sowie Faust- oder sogar Fußball zu spielen, verbo-
Stauda war vorher in Prag mit der „Akademischen Abstinentenschaft Freiland“, gegründet 1908/1909, in Berührung gekommen, die allerlei lebensreformerischen Gedanken anhing. Er nahm an ihren Wanderungen teil und wurde bald eine führende Persönlichkeit im „Prager Frühling“ des Wandervogels von 1911, der bald in fast alle deutschböhmischen Mittelschulstädte ausstrahlte: Reichenberg 1911, Leitmeritz 1912, Böhmisch Leipa 1912, Eger, Karlsbad, Gablonz, Pilsen, Aussig, Komotau, Braunau, Saaz, Prachatitz 1913, Rumburg 1914, Tetschen 1914, Asch 1915 und Fleißen 1919.
Die Bewegung manifestierte sich in der Zeitschrift „Burschen heraus“, dem Gaublatt der deutsch-böhmischen Wandervögel. Die Zeitschrift wurde 1912 in Leitmeritz gegründet. Im Jahr 1913 war Stauda dessen ehrenamtlicher Schriftleiter. Stauda war dann ab 1914 unter anderem auch stellvertretender Gauwart in Böhmen und Leiter der Geschäftsstelle in Leitmeritz.
Zugunsten jüngerer Führer trat er am 1. April 1918 von den Ehrenämtern zurück. Er baute in Eger den „Böhmerlandverlag“ auf, welcher eine bedeutende Rolle im kulturellen und politischen Leben der Deutschen in Böhmen spielte.
In der Zeitschrift „Unser Egerland“ berichtete Stauda zum ersten Mal „Vom Wandervogel in Eger“ (XIX. Jg., 1915). Dies war ein Versuch, den Gedanken der neuen Jugendbewegung im provinziellen Hinterland in das rechte Licht zu rücken, die verunsicherten Schulbehörden zu beschwichtigen, sowie die mißtrauischen Erzieher aufzuklären.
Die gründende Versammlung des Egerer Wandervogels hatte am 2. Juli 1913 stattgefunden. Vorarbeiten dazu hatte auch und besonders Professor Josef Zettl geleistet. In einem glänzenden Vortrag hatte Professor Vinzenz Brehm auf die Grundlagen der Jugendbewegung hingewiesen. Der Erste Vorsitzende des vereinsrechtlich geforderten „Eltern- und Freundesrates zum Egerer Wandervogel“ wurde Alois John, der große Heimatforscher.
Die Stadt stellte ein Heim zur Verfügung, ein Nest, das dann
Auf dem Gautag der deutschböhmischen Wandervögel in Duppau, Pfingsten 1914, wo sich 16 Wandervogel-Gemeinden mit 325 Teilnehmern trafen, waren die Egerer mit 37 Teilnehmern besonders stark vertreten. Fünf Horden zogen mit ihren Wimpeln auf. Der Krieg unterbrach die geradlinige Entwicklung des Wandervogels in Böhmen. Viele Wandervögel meldeten sich als Kriegsfreiwillige, viele kamen nicht mehr zurück. Daheimgebliebene halfen den Bauern bei der Erntearbeit. Nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie, nach der Besetzung Egers durch die Tschechen, demonstrierten die Deutschen für das Selbstbestimmungsrecht. Tschechische Soldaten schossen am 4. März 1919 in die Menge. Unter ihnen fiel auch der Wandervogel Josef Christl, ein Lehramtszögling. Hans Watzlik widmete „Dem Jüngling von Eger“ ein Gedicht: „Trauerwilden Auges, Knabe, nahst du Gott“ (Auszug) . Anders als im Reich, wo der „Wandervogel e. V.“ sehr gesellschaftliche Ziele verfolgte, war der Wandervogel in Böhmen aus guten Gründen völkisch bestimmt. Sein Wesen war Volksverbundenheit (Wilhelm Kotzde). Das schlug sich nieder in Grenzlandfahrten und in Fahrten zu den deutschen Sprachinseln in Siebenbürgen und in der Zips. Noch 1923 hatten Egerer Gruppen, eine Schillsche unter Walter Kasseckert, sowie die Lützower unter Wilhelm Hauptmann, bedeutende Grenzlanderlebnisse. Am Fuß der Gerlsdorfer Spitze wurde letztere auf polnischem Gebiet vorübergehend verhaftet und dann abgeschoben. Es blieb nicht aus, daß sich auch aggressive, ideologische und völkische Elemente ins Spiel mischten. Otto Kletzl zum Beispiel, einer der bedeutendsten Führer im Gau und später Herausgeber der verdienstvollen „Böhmerland-Jahrbücher“, wollte den Ausschluß aller jüdischen, slawischen und mongolischen Bitte umblättern
Johannes Stauda und der „Wandervogel“
Blutfremdlinge. In der Gablonzer Ortsgruppe rumorte der Arierparagraph. Heinz Rutha aus Nordböhmen, der in seiner Zeitschrift „Blätter vom frischen Laben“ Führertum und Rasse propagierte, gründete mit seinen blonden Knaben die „Sudetendeutsche Jungenschaft“. Diese führte dann nach verschiedenen Wandlungen zum „Kameradschaftsbund“ und wurde weiter zur „Sudetendeutschen Heimatfront“. Beide sind in der politischen Geschichte der Sudetendeutschen hinlänglich bekannt.
Nichts davon in Eger, wo Johannes Stauda die überspitzten Forderungen nach „rein deutschem Blut“ kategorisch ablehnte. Als zum Beispiel Rutha mit seinen Schönlingen 1922 am Gautag in Mies auftauchte, bedachte er die Bleichgesichter mit der bösen Formel „blau, blond und blöd“.


Ein gesunder, kritischer, auch zu Spott aufgelegter Zug hielt die Egerer Wandervogelgemeinde zusammen. Auf dem Kreistag zu Seberg im Jahr 1919 hatte sich die jüngere Generation dargestellt, geführt von dem musischen Josef Frank (Frankseff), der ein großer Lautenspieler war. Freiluftaufführungen im alten Schloßhof, Preissingen der Jungen- und Mädchengruppen und Wettkämpfe der Leichtathleten wurden veranstaltet. Zum ersten Mal tauchten dort die Fleißener Wandervögel auf, Bürgerschüler, die wie selbstverständlich integriert wurden. Besonders Ernst Leibl aus Graslitz, der das „Böhmerlandlied“ gedichtet hatte, welches von Walther Hensel vertont wurde, nahm sich ihrer anfänglichen Unsicherheit geradezu rührend an.
Nach Frank übernahm Walter Fieger, der seines Witzes wegen nur „der Doktor“ genannt wurde, die Leitung des Egerer Wandervogels. Unterstützt wurde er von prächtigen Burschen wie dem „Astro“ (Gustav Sternkopf), dem Musikus Urban (Wallisch), dem damals idealistischen Ortwin Nüßl, dem stilleren „Nachti“ (Erich Nachtmann) und dem Praktiker Walter Kasseckert.
Dann gab es ein gewisses kulturelles Gefälle unter den Gruppierungen, was in der Folge zu zwei nebeneinander bestehenden Haufen führte, ohne besondere Rivalität. Beide Gruppen benannten sich nach alten Freiheitskämpfern.
Die Gruppe „Schill“ unter Fieger (Erkennungspfiff „Schill ist tot, er gab sein Leben“) wahrte mehr den Zusammenhang mit geistigen Dingen. Die „Lützower“ unter Fritz Tauscher beschränkten sich mehr auf das Freiluftleben. Beide hielten wie Pech und Schwefel zusammen, als 1912 das Wandervogelheim im Park auf dem Anbühl über der Stadt gebaut wurde.
Das geschah unter den Auspizien des Eltern- und Freundesrates, dem damals der Direktor des Lyzeums Josef Zettl vorstand. Die
Ausführung lag in den Händen des städtischen Oberbaurates Pascher, dessen Sohn ein Lützower war. Pascher, der nach dem verlorenen Krieg und den Depressionen dieser Jahre sich Gedanken über billige Bauweisen machte, schlug vor, einen Lehmstampfbau zu errichten. Hans Kirschneck erinnert sich: „Um die Finanzierung, Eigentumsregelung und Materialbeschaffung kümmerten wir Jüngeren uns damals wenig. Wir veranstalteten zwar Singabende und Lichtbildervorträge in der Volksbücherei, unter anderem auch dreimal mit Walther Hensel, aber die Einnahmen waren nicht so groß, daß sie wesentlich zur Finanzierung beitragen konnten. Da halfen die Spenden unserer Eltern, des Egerer Baustoffhandels und einiger Baufirmen schon mehr. Ganz besonders aber half Oberbaurat Pascher. Er übernahm die Bauleitung und die Überbrückung aller Hindernisse, die sich im Laufe der Bauausführung in den Weg stellten. Es kam zum ersten Spatenstich. Die Abtragung des Humus und der Erdaushub für Keller und Fundamente erfolgten mit großem Eifer von Hand durch unsere Wandervogelgruppen. Es gab einen Terminplan, der, unter der Berücksichtigung der Lehmtrocknungszeit, Fettlehmlagerung und Abschnittsleistungsverpflichtung, tägliche Mindestleistungen im Hinblick auf die Schalungsfristen verlangte. Ein vom städtischen Hochbauamt abgestellter Polier und ein Maurer waren die Seele des Unternehmens. Sie dirigierten uns in den städtischen Steinbruch an der Eger zum Aufladen der schweren Bruchsteine für den Keller und die Fundamente auf Pferdefuhrwerke, in die Ziegelei an der Pograther Straße zum Aufladen von Lehm und Ziegelbrocken, und schließlich zum Wasserholen vom Brunnen am Beginn des Goldbergs bei der Abzweigung nach Kammerdorf. Das war immer die unbeliebteste Tätigkeit, die auch den meisten Schweiß kostete. Je nach Verbrauch mußte mit einem oben offenen schweren Kalkwagen, der selbst schon etwa 300 Kilogramm wog und eiserne Speichenräder hatte, ein Kubikmeter Wasser den steilen Goldberg hinauf und dann rechts den unwegsamen Hohlweg bis zur Baustelle transportiert werden. Bis zu 15 und 16 Mann hingen wir oft am Wagen und mußten im Hohlweg dann noch um Verstärkung rufen. Viel lustiger ging es beim Lehmstampfen zu. Die Sockelgleiche des Bruchsteinmauerwerks, bei dem wir nur Handlangerdienste leisten mußten, war durch Polier und Mauerer bald erreicht. Betondielen wurden als Kellerdecke verlegt, und schließlich wurde unter alle aufsteigenden Wände Isolierpappe verlegt. Darauf schalten dann jeden Vormittag der Polier mit seinem Maurer ein 40 Zentimeter hohes Teilstück mit starken Bohlen ein,
und am Nachmittag kamen dann wir von der Schule, heute die von Schill, morgen die Lützower, genau nach Absprache. Von 14.00 bis 17.00 Uhr waren dann die Schüler und Studenten am Werk, von 17.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit die Lehrlinge und Angestellten. Nur samstags wurde gemeinsam gearbeitet. Der Polier lehrte uns, wie man auf großen Blechen die richtige Konsistenz von Lehm, Wasser und Sand herstellt und dann in zehn Zentimeter starken Schichten in die Schalung einbringt. Das darauffolgende Verdichten wurde im gesungenen Taktrhythmus ausgeführt. Ein besonderes Kapitel waren die Stampfgeräte aus Eisen und Holz – wehe, wenn sich einer an dem falschen Stampfer vergriff! Die Stampfer waren wie ,Leibeigene‘. Jeder Stampfer hatte einen bestimmten Namen, einen speziellen Stiel und entsprach der Größe und Kraft des Eigentümers. So stampfte unser kleinster und schwächster Schüler tagsüber mit dem leichten Stampfer ,Jakob‘ genau so eifríg wie dann am Abend nach Geschäftsschluß der starke Pep mit dem ,Ramses‘.
Das Haus, Häuschen acht mal acht Meter, wurde also in die Höhe gestampft, bekam einen festen weißen Kalkverputz, ein ziegelrotes Mansarden-Pyramidendach und grüne Fensterläden. Im Erdgeschoß befand sich das große ,Ritterzimmer‘ oder der ,Saal‘. Baurat Pascher hatte Paneele, Gestühl, einen schweren Eichentisch nach dem Inventar einer Tiroler Burg kopieren lassen. Daneben ein kleinerer Raum, der als Küche fungierte, in einer Ecke das Plumpsklo. Im Keller standen irdene Wasserspeicher und Waschgelegenheiten. Unter dem Dach waren der Herbergsraum mit dem Matratzenlager, vielleicht die erste Jugendherberge im Land, und ein Erkerstübchen für den Heimwart. Als solcher zog schließlich der Lehramtszögling Josef Müller ein, Gründer des Fleißener Wandervogels. Er hütete bis zur Matura 1924 das Heim und verteidigte es gegen das Gesindel, das sich im Park herumtrieb.“
Die Egerer Wandervögel hatten also ihr Heim, ihr „Nest“, das ganz anders war als das triste Schulzimmer in der Schillerparkschule, das die Stadt zur Verfügung gestellt hatte. Das Landheim in Konradsgrün verlor an Bedeutung. Auch die Zeltlager im Kaiserwald und die Winterlager im Erzgebirge spielten fortan eine geringere Rolle.
Neues Gemeindeleben
Die Schillschen und die Lützlower, die Mädchengruppe, die es seit langem gab (gegründet 1913 von der Lehrerin Irene Nachtmann, die auch Beraterin im Mädchengau war) teilten sich die Benutzung der Räumlichkeiten. Es gab nun regelmäßige Nestabende der einzelnen Gruppen,
an denen frisch, fromm, fröhlich, frei palavert, gespielt, gesungen, vorgelesen werden konnte. Pläne für Großfahrten und für Beteiligungen an Kreis- und Gautagen wurden geschmiedet. Die Jugend war unter sich und frei von jeder Bevormundung durch Obere und Schulbehörden, wie Stauda es immer gefordert hatte: „Der Wandervogel ist eine Mittelschülerbewegung. Das Ausdehnen des Wandervogels über die Mittelschule hinaus ist zersetzend und tötend.“ Dies galt auch im Hinblick auf die alten „Herrschaften himmelblauer Färbung“, die hängengeblieben waren in den Gemeinden, ewige Wandervögel, die sich an alten Stimmungen und Ritualen aufwärmten.
Die Eigenständigkeit der Jungen lebte indessen im besten Einvernehmen mit den Alten in der Stadt. Die Honorationen wurden eingeladen, wenn etwa die Gruppe Schill im Rittersaal einen Märchen-, Lieder- oder Balladenabend gab, Hans Sachs spielte oder Szenen aus dem Florian Geyer aufführte. Bei solchen Gelegenheiten fanden sich Professoren der Mittelschulen ein. Der Wandervogel war kein Bürgerschreck mehr. Er war stabilisiert und strahlte auf andere Jugendbünde aus. Diese übernahmen, was der Wandervogel auf die Beine gestellt hatte. Dabei wurden oft nur Äußerlichkeiten nachgeahmt: die Wanderkluft, das Landsknechtlied, der rußige Kessel am Rucksack und das Lagerfeuer. Vom Wandervogelstil waren schon seit langem beeinflußt: die „Fahrenden Gesellen“ des deutschnationalen Handlungsgehilfenverbands, die englischen Pfadfinder sowie die katholischen „Quikborner“, die Turnerjugend und die jüdische Wanderjugend „Blau-weiß“. Als 1924 der Jugendring gegründet wurde, der alle Jugendgruppen der Stadt vereinen sollte, kam der Wandervogel in den Sog der allgemeinen Organisiertheit, auch in politisches Fahrwasser, und verlor seine Ekken und Kanten. Die Fahrten gingen weiter, aber an den Heimabenden dominierte immer öfter die politische Schulung. Die Turnerjugend kam ins Heim und beanspruchte wegen höherer Zahlenstärke größere Bedeutung. Das Wandervogelheim selbst, von den Mädchen der Ortsgruppe immer sorgfältig in Ordnung gehalten, verlor an Glanz, wurde zur allgemeinen Begegnungsstätte und büßte seine besondere Eigenart ein. Im Jahr 1938 wurde es ein Stützpunkt der Hitlerjugend, in der alle Jugendgruppen aufzugehen hatten.
Fleißener Wandervogel
Der Fleißener Wandervogel war ein Novum in der Geschichte des Wandervogels insofern, daß dort zum ersten Mal Bürgerschüler in einer Bewegung auftraten, zu der bisher ausschließlich
Mittelschüler gehörten. Der Soldatenspiele im Weltkrieg müde geworden, gründete der Hauptmann des Regiments einen Verein, den er patriotisch „Wandervogel Hofer“ nannte. Rätselhaft, wie auch der Name Wandervogel ins Dorf gekommen war. Er war da und beflügelte die Fantasie. Dabei gab es noch keinerlei Verbindung mit der Bewegung in der Stadt oder im Land. Wanderungen, geradezu Gewaltmärsche mit eisenbeschwerten Rucksäcken, wurden unternommen. Einmal ging es an einem Tag über die Glatzen im Kaiserwald bis nach Marienbad.
Im Jahr 1918, in der dritten Bürgerschulklasse, kam die Französischlehrerin Maria Wosmik nach Fleißen. Sie staunte über das, was sie unter ihren Schülern antraf, und erzählte ihnen vom Wandervogel in Eger, im Land und im Reich. Sie brachte Broschüren und Bildbände, welche die Wandervögel in Aktion zeigten. Daraufhin schnitten die meisten Jungen ihre Hose über den Knien ab und trugen Schillerhemden. Die Lehrerin erzählte über das Wesen des Wandervogels, vom Aufbruch einer neuen Jugend, von allerlei Lebensreformerischem, wobei die Abstinenzfrage die größte Rolle spielte. Die Buben nahmen alles gierig auf. Wosmik berichtete ihren Freunden in der Stadt, was sich in diesem Dorf tat, fernab jeder Verbindung mit zeitgenössischen Vorgängen. Bald darauf kam ein Sendbote der Egerer Wandervögel, der überlange „Wagner-Girch“, zu den staunenden Bürgerschülern.
Diese sahen zum ersten Mal einen richtigen Wandervogel in Fleisch und Blut, tipp-topp ausgerüstet, Christus-Sandalen, kurze Hose, Windjacke und Rucksack. Er schenkte den Buben einen „Zupfgeigenhansl“, ging mit den rasch zusammengetrommelten Häuflein in den Wald. Auf einer Blöße übte er mit den Neophyten, die Geige und Gitarre mitgebracht hatten – fortan werden die Instrumente Fiedel und Klampfe heißen – das erste Lied aus dem Liederbuch der Wandervögel: „Ich bin ein jung Soldat, von 21 Jahren“ (Auszug) –das war traurig-schön. Danach „Kommando Pimperle, Kommando Halt!“ auf die Grasnarbe getrommelt. Im Wandervogel gab es also auch Frohsinn.
Die Gruppe blühte auf und wählte ihren „Führer“: Josef Müller, den der Gauwart der deutsch-böhmischen Wandervögel in Reichenberg, Theo Keil, umgehend bestätigte.
Die frisch gebackenen Wandervögel brauchten auch ein Nest. Sie fanden im benachbarten Dorf Schnecken eine Stube, die bisher leer stand, verrucht war, weil in ihr der Teufel gehaust haben soll. Sie richteten sie ein, zimmerten Rundumbänke und einen Schragentisch, hingen Bilder aus der Schülerzeitschrift „Österreichs deutsche Jugend“ an die Wand, einen ganzen Fries
– und wurden ausgelacht, als einmal eine Egerer Horde einfiel, die längst über den Kitsch solcher „Kunst“ hinaus war. Beschämung. Der „Führer“ hatte zu lernen – und wie er dazulernte: aus den vielen neuen Zeitschriften, die im Reich aus dem Boden schossen, wie „Der Vortrupp“, „Junge Menschen“ oder „Guttemplerisches“, aus damals avantgardistischen Büchern, wie „Helmut Harrings“ von Poppert (damals Pflichtlektüre), aus dem Umgang mit anderen Führern, wie Ernst Tscherne aus Graslitz und dem Wagner-Girch aus Eger, der in die Stadt einlud und in das Nest in der Schillerparkschule einführte.
Später kam Professor Stauda nach Fleißen. Nun gründete er den Eltern- und Freundesrat. Großen Eindruck hatte der Kreisrat in Seeberg 1919 gemacht.
Doch es kam nie dazu, daß man an den Preissingen teilnehmen konnte. Denn die Förderung fehlte, welche die Egerer Wandervögel durch Walther Hensel genossen, der öfter in der Stadt war. Singen fiel weg, aber im Sport konnte man sich sehen lassen.
Auf dem Kreistag in Hartenberg 1921 holte sich dann der „Führer“ den ersten Preis im klassischen Pentathlon. Vorübergehend gab es auch eine Mädchengruppe. Einige gemeinsame Nestabende, eine gemeinsame Fahrt in den Rauner Grund, dann löste sich das auf.
Später überschattete ein tragisches Ereignis das Leben der Fleißener Wandervogelgemeinde. Ein apollinisch schöner Jüngling hatte den Freitod gesucht. Es gab nur Mutmaßungen.
Es lief dann noch einige Jahre. Der „Führer“ war in die Stadt Eger gekommen und dirigierte von dort aus noch eine Weile die Vorgänge in der Gruppe, die sich dann langsam selbständig im Fahrten- und Nestbetrieb machte. Die Bindungen lockerten sich, und allmählich wurden die meisten der Gruppe wieder vereinnahmt von der Gesellschaft, in der sie lebten. Und einige trieben ab in eine Richtung, die mit dem Geist des Wandervogels nichts mehr zu tun hatte.
Quellen:
Johannes Stauda: Vom Egerer Wandervogel, in: Egerland, Jg. XIX, 1915.
Johannes Stauda: Der Wandervogel in Böhmen 1911–1920, Hrsg. Kurt Oberdorfer, Reutlingen 1975.
Josef Müller: Elegie auf das Wandervogelheim in Eger, Manuskript, 1978.
Walter K. B. Holz: Wandervogel. Der Hagener Wolf Meyen gab der ganzen deutschen Jugendbewegung den Namen, Sonderdruck aus dem Hagner Heimatkalender, 18. Jg., 1977.
Hans Kirchneck: Rund um das Egerer Wandervogelheim, persönliche Mitteilung, 1978.
Franz Jahnel: Sudetendeutscher Wandervogel, in Egerland, Jg. XI,
� Über den Egerer Wandervogel – Fortsetzung von Seite 15Ein Bild des Oberen Marktplatzes, Eger, in früheren Zeiten. Bild: Josef Haberzettl. Ein farbenfrohes Bild des Egerer Marktplatzes.
Liebe Landsleute und Heimatfreunde!
A
n erster Stelle, wie das Tradition ist, die Glückwünsche an einige Geburtstagskinder, die sich als Gemeindebetreuer um den Zusammenhalt der Landsleute verdient gemacht haben. Wir gratulieren zum: –94. Geburtstag am 31. Mai Walter
Heinl (Janessen), 85276 Pfaffenhofen an der Ilm; –91. am 19. Edith Nübler/Meinelt (Dallwitz-Hohendorf-Schobrowitz), 92421 Schwandorf; –80. am 20.


Wolfgang Müller (Funkenstein), 93053 Regensburg.
Glück und Segen auf allen Euren Wegen!
In der letzten Ausgabe habe ich kurz eine Veranstaltung des Heimatrates angesprochen, in der Martin Dzingel über das große Projekt einer Bestandsaufnahme aller Friedhöfe in sudetendeutschen Gemeinden berichtete. Dazu ist auch ein längerer Bericht in der Sudetendeutschen
Heimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e.
Heimatkreis Karlsbad, Heimatkreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollak, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22. Spendenkonto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparkasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KS –Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
66. JAHRGANG Jänner 2016 FOLGE 1
72. JAHRGANG Dezember 2022 FOLGE 11
Den Erhalt der Friedhöfe sicherstellen
Zeitung (Folge 11, 17. März) erschienen. Die von mir dort erwähnte Konferenz in Prag hat nun am 28. April stattgefunden – sie ist gerade noch rechtzeitig zu Ende gegangen, um Ihnen hier kurz davon zu berichten. Einige Vertreter der Sudetendeutschen – an der Spitze Bernd Posselt – sind persönlich angereist und haben dort auch Referate gehalten. Aber es war auch möglich, per Video teilzunehmen, wofür ich mich entschieden habe – alles wurde simultan übersetzt. Geleitet wurde die Konferenz wieder von Dzingel, dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Regierungsrates für Nationale Minderheiten und Präsidenten der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik. Die Sudetendeutsche Zeitung hat darüber bereits ausführlich (Folge 18, 5. Mai 2023, Seite 1) berichtet. Hier da Wichtigste in aller Kürze.
Die tschechische Regierung hat eine Bestandsaufnahme der
Friedhöfe aller Minderheiten in Auftrag gegeben, die demnächst abgeschlossen sein wird. Danach wird ein Programm mit finanzieller Ausstattung erarbeitet, um den Erhalt dieser Friedhöfe und Grabstätten sicherzustellen.
Soweit ich den Vorträgen entnehmen konnte, begreift der tschechische Staat diese Friedhöfe als historische Zeugnisse, die, soweit es nur möglich ist, als wichtige Dokumente erhalten werden sollen – ein, wie ich finde, ermutigender Schritt, endlich die lange Geschichte der Deutschböhmen zu würdigen.
Wie immer, ist es auch eine finanzielle Frage, inwieweit das machbar wäre – alles wird man wohl nicht konservieren oder restaurieren können. Man muß eine Auswahl treffen. Wir als Nachkommen der vertriebenen deutschsprachigen Bevölkerung sind nun, zusammen mit der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik, gefordert, bei diesem Projekt unsere
� Der Gastwirt aus Roßtal – Teil II und Ende Adolf
Gellen
Kenntnisse, Vorstellungen und Wünsche einzubringen, damit es ein Erfolg wird. Wir bitten daher alle Gemeindebetreuer des Kreises Karlsbad und alle Landsleute, die sich bereits um den Erhalt von Gräbern kümmern oder Kontakt mit ihrer Heimatgemeinde halten, uns ihr Wissen zu übermitteln. Hatte Ihre Gemeinde einen eigenen Friedhof oder war eine Nachbargemeinde zuständig? Existiert dieser Friedhof noch, und in welchem Zustand?
Danke für Ihre Mitarbeit – jede noch so kleine Information ist hilfreich.
In dieser Ausgabe setzen wir außerdem den spannenden Lebensbericht unseres Landsmanns Adolf Gellen aus Drahowitz fort.
Die nächste Ausgabe ist für den 9. Juni vorgesehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Mai, frohe Pfingstund sonstige Feiertage. Denken Sie an den Sudetendeutschen Tag in Regensburg! Pia
EschbaumerKarlsbad vor 100 Jahren
n 1. Mai 1923: Die Verstaatlichung der städtischen Sicherheitswache wird durchgeführt. Die tschechischen Polizisten verstehen sehr schlecht oder gar nicht deutsch. Außerdem besitzen sie fast keine Ortskenntnisse. Von den deutschen Polizisten ließen sich nur wenige in den Staatsdienst übernehmen.
Um 10.00 Uhr vormittags kommunistischer Mai-Aufzug. 300 Personen. Um 2.00 Uhr nachmittags sozialdemokratischer Umzug.
Brunnenweihe erfolgt in einfacher Weise.
Das 1908 in Karlsbad errichtete amerikanische Konsulat wird aufgelassen.
An zahlreichen Gebäuden in der Stadt werden Umbenennungen vorgenommen.
n 2. Mai 1923: Die Stadtpolizei macht zum ersten Mal Dienst.
n 3. Mai 1923: Die deutsche Mark stürzt immer tiefer. 1 Krone = 1.185 Mark
n 4. Mai 1923: Über Auftrag der Regierung mußte die Egerer Stadtvertretung das Kaiser-Josef-Denkmal abtragen.
Um Unruhen zu vermeiden, geschah dies in der Nacht zwischen
2.30 Uhr und 3.00 Uhr bei Glokkengeläut.
n 7. Mai 1923: Der Kurbesuch läuft gut an.
n 8. Mai 1923: Med.
Dr. Fockschaner begeht Selbstmord durch Vergiftung mit Morphium, wegen einer gegen ihn anhängigen Untersuchung infolge verbotener Eingriffe. Seine
Von Rudi Baier

Kollegen setzten ein Kesseltreiben gegen ihn ein.
Dieser Selbstmord bildet das Tagesgespräch von Karlsbad.
Dr. Fockschaner wird wegen seiner Beliebtheit sehr betrauert.
n 11. Mai 1923: Das
Paßwesen wird in die Verwaltung der Staatspolizei übernommen.
Das Bettelunwesen nimmt in Karlsbad überhand.
Die Radio-Station am Buschtiehrader Bahnhof und das Stadttheater werden eröffnet.
Ottilie Franieck, Mitbesitzerin der Franieckschen Buchdrukkerei, stirbt im Alter von 68 Jahren. Sie war Ehrenmitglied des Vereins „Kinderfreund“ und als Wohltäterin bekannt.
Die Promenadenaufseher, die „G´heimer“ oder „Steckenpolizei“, werden abgeschafft.
Das Wandervogel-Haus („Nest“) oberhalb der Panoramastraße, beim sogenannten Pöhlenhof, wird feierlich eröffnet.
Charley Masaryk (Charlotte Garrigue-Masaryk), Gattin des Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk der damaligen Tschechoslowakei, ist gestorben.
n 14. Mai 1923: Beim Morgenkonzert der Mühlbrunnkolonnade fordert ein tschechischer Oberst von dem Dirigenten die Einstellung der Musik. Er wird mit seinem Verlangen abgewiesen. Ein englischer Kurgast macht ihn aufmerksam, daß Karlsbad ein internationaler Kurort und die Tschechoslowakei eine Republik ist. n 15. Mai 1923: Franz
Strobl wird zum Ersten Konzertmeister des Kurorchesters ernannt.
Beim Marktbrunn fragt eine Schwedin, warum die schwarzen Fahnen bei der Zivno-Bank heraushängen. Antwort: „Weil Frau Masaryk gestorben ist“. Schwedin: „Wer war denn die Frau?“ Antwort: „Ich weiß es nicht.“
n 18. Mai 1923: 40 holländische, schwedische und dänische Ärzte treffen zum Studium der kurörtlichen Einrichtungen in Karlsbad ein.
n 19.–21. Mai 1923: In Karlsbad findet der deutsche Juristentag statt.
n 19. Mai 1923: Im Hotel Imperial findet das Zweite Internationale Schachturnier statt. Es werden Preise im Wert von 36.200 Kc zur Verteilung gebracht.
n 20. Mai 1923: Pfingstsonntag: Promenadenkonzert der Standschützenkapelle.
n 22. Mai 1923: Der jüdische Glasfabrikant Leo Moser schenkt Papst Pius XI. ein Kristall-Service, bestehend aus 218 Stücken, und wird von ihm persönlich empfangen.
In Eger verstirbt der langjährige Schwimmschulpächter Friedrich Wilhelm Keitsch im Alter von 67 Jahren. Er war ehemaliger Turnwart des Karlsbader Turnvereins 1860.
Der Schuldiener der ersten Volksschule, August Hüttner, stirbt im Alter von 71 Jahren. Er war Herausgeber des Buches „Unsere heimischen Schmetterlinge“ und Ehrenmitglied der
Im zweiten Teil der Geschichte (erster Teil erschien im April) schildert Adolf Gellen (85 Jahre) aus Drahowitz seinen Werdegang als erfolgreicher Gastwirt in der Gemeinde Roßtal:
Am 1. Oktober 1949 eröffneten wir den „Grünen Baum“ in Roßtal, wobei nach der Währungsreform – Ende der Reichsmark, Geburt der Deutschen Mark (DM) –die Leute, nach erstem Erhalt der 40 DM Kopfgeld, knapp bei Kasse waren. So geschah es nicht selten, daß man Eiern, Speck oder Getreide gegen Bier tauschte. Unsere Eröffnungspreise waren zum Beispiel 46 Pfennige (Pf.) für einen halben Liter (l) Bier (Festpreis in Bayern), 91 Pf. für die Maß, eine Semmel fünf Pf. und ein Kilogramm (kg) Brot 90–110 Pf. Das Menü belief sich je nach Aufwand zwischen 1,80 DM und 2,20 DM.
Da ich durch die Vertreibung zwei Jahre älter als meine Mitschüler war, wurde mir das achte Schuljahr erlassen. Somit konnte ich von 1953 bis 1956 meine Metzgerlehre bei Vertriebenen – Landsmann Adolf Löw, Metzgerei und Viehhandel in Forchheim/Hagenau – absolvieren, um gleich danach im elterlichen Betrieb Aufnahme zu bekommen.
Feuerwehr.

n 23. Mai 1923: Pharmazeut Wilhelm Markert eröffnet eine Apotheke in der Bahnhofstraße „Egerländer Apotheke“.
n 24. Mai 1923: Siegfried Goldberger, Stadtverordneter, wird das Mandat aberkannt, da er ein Ausländer ist. Bringt Rekurs dagegen ein.
Ernst Reinl, Hausbesitzer „3 Lämmer“ und ehemaliger Stadtrat, stirbt im Alter von 77 Jahren.
Der Militärbadehauskommandant Oberstleutnant Emanuel Ambros wird zum KommandantStellvertreter des Infanterie-Regiments 48 in Beraun ernannt und dorthin versetzt. An seiner Stelle kommt Oberst Franz Mach als Stationskommandant nach Karlsbad.
n 25. Mai 1923: Witterung sehr kühl und feucht.
n 26. Mai 1923: Es wird bekannt, daß der Vereinsanwalt des Wohlfahrtsverbandes Union Karlsbad, Arthur Feldmann, verstorben ist. Zudem wird Bad I (Kaiserbad) eröffnet.
Die Stadtverordnetenkammer beschließt, die Aufnahme einer Anleihe von 2,5 Millionen Dollar von der Firma Farson.
n 30. Mai 1923: Die drei Kreuze der abgetragenen Kuppe des Dreikreuzberges werden auf einem ewas erhöhten Platz hinter der Aussichtsstraße aufgestellt, die Arbeiten werden bei Nacht durchgeführt.
n 31. Mai 1923: Die deutsche Mark sinkt unaufhaltsam. 100 Kronen = 210.000 Mark.
Als 1954 der Pachtvertrag des „Grünen Baumes“ nicht verlängert wurde, war es eine Fügung des Schicksals, daß uns Stammgast Andreas Miederer (†) das Grundstück mit Scheune gegenüber dem ,,Grünen Baum“ verkaufte. Daraus entstand später der „Gasthof Kappelhof“. Nach dem Bau der Jahnturnhalle in den 1950er Jahren erhielten wir die dortige Schankerlaubnis über 30 Jahre für alle Veranstaltungen bis zum Ableben meiner Eltern. Mit dem Ende des Pachtvertrages erlosch auch unsere gewerbliche Schankerlaubnis, welche über die Jahre hinweg bei vielen Veranstaltungen mit oft aufreibendem Arbeitsaufwand verbunden war.
Im Jahr 1957 konnten wir den Rest der Scheune erwerben und den „Kappellhof“ um einen Saal erweitern, wobei mir die Zuständigkeit für Umbau und Erweiterung übertragen wurde.
So erfolgten 1960 der Dachgeschoßausbau über dem Saal, Zentralheizungsinstallation bei Umstellung von Koks auf Öl und 20.000 Liter-Tank mit benachbartem Hallenbad, vom Saal erreichbar, sowie fünf Garagen, wobei ich täglich der Erste und der Letzte auf der Baustelle war.
Am 27. August 1964 heiratete ich meine Erna, geborene Ott, nachdem 1963 meine Schwester Christl ihren Fritz Stahl geehelicht hatte.
Im Jahr 1965 nahmen mich meine Eltem als Teilhaber in den Betrieb auf, und am Heiligen Abend kam unsere Tochter Silvia auf die Welt. Dieser folgte
1968 ihre Schwester Margit. Mit Übergabevertrag vom 1. Januar 1970 übernahmen meine Frau und ich den „Kappelhof“, stockten die Garagen für den Bau von sechs Fremdenzimmern auf. Am 29. August 1973 kam unser Sohn Josef zur Welt, der erhoffte Kronprinz. Gewohnt haben wir drei Ehepaare in dieser Zeit im ausgebauten Dachgeschoß, bis wir später für die Eltern ein Haus kauften und renovierten. In diesem Jahr kauften wir von der Patrizierbrauerei das Gasthaus „Grüner Baum“ zur Vergrößerung unseres Fremdenzimmerpotentials. Das Objekt wurde unter Denkmalschutz gestellt, doch erwirkte ein kompetenter Jurist, bei gleichzeitigem Verzicht der Gemeinde auf ihr Vorkaufsrecht, die Realisierung unseres Bauvorhabens: insgesamt 24 Betten in neun Zimmern, alle mit Dusche und WC. In diese Zeit fiel auch der Erwerb des an mein Grundstück grenzenden Saales von „Spielwaren – Seidel“, vormals Haas. Dies ermöglichte die Errichtung einer überdachten Terrasse für 100 Personen, Nebenzimmer für 60 Personen, sowie die Vergrößerung der Küche um Spülküche und Kühlraum. Auch konnte ich das Haus Amon kaufen und baute es in „Gästehaus Erna“ um, wie auch das Anwesen Feldner, das ich „Gästehaus Adolf“ taufte.
Durch ein Versehen bei der Reklame- und Werbeaktion mit der Patrizierbrauerei wurden alle Schilder, statt mit „Kappelhof“, mit „Kapellenhof“ bedruckt. Seitdem blieb es bei dem Namen.
Tochter Silvia wurde Steuerfachkraft, Margit war im Betrieb integriert. Beiden Töchtern wurde zu Lebzeiten ihr Pflichtanteil erstattet. Josef absolvierte die erforderliche Kochausbildung. Mit ihm wurde ein Pachtvertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Doch nach zwei Jahren kündigte er ihn wieder.
2013 erlebte ich das Schlimmste in meinem bisherigen Leben: Meine Krankenhausaufenthalte schwersten Ursprungs, und am 8. März desselben Jahres den Suizid unseres Sohnes Josef.
Tochter Silvia und ihr Mann mußten nun einspringen, doch nach zwei Jahren gaben sie den Betrieb wegen nervlicher Überlastung wieder zurück. Nun war ich gezwungen, einen Weg zur Weiterführung des „Kapellenhofes“ in meinem Sinne zu finden. Unbewußt folgte ich dabei dem Wahlspruch unseres unvergessenen Ernst A. Klier: „Niat noulua zrvingt alls.“
So konnte ich am 1. Oktober 2014 mit der Familie Lienerth aus Dasing tatkräftige Nachfolger aus dem Gastronomiebereich begrüßen. Diese sind auch heute noch für die Roßtaler, aber auch für den „Heimatverband der Karlsbader“, sowie für die seit dem 6. Oktober 1974 jährlich tagenden „Karlsbad-Drahowitzer“ in zufriedenstellender Weise da.
Zu Altrohlau: Ein Bild einer alten Mitgliedskarte der Freiwilligen Feuerwehr in Altrohlau.
❯ Mai 2023
Nachrichten aus den Gemeinden
Karlsbad Stadt
Gemeindebetreuerin Pia
Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de
Liebe
Landsleute, der Mai ist gekommen, und damit auch die sogenannte Saisoneröffnung in Karlsbad –bei uns besser bekannt als Brunnenweihe. Einen ausführlichen Bericht von A.E. Rudolf zu Hintergrund und Geschichte konnten Sie vor einem Jahr in der Karlsbader Zeitung lesen.
Das Element „Weihe“ zeigt deutlich an, daß der religiöse Aspekt urspünglich eine ganz wichtige Rolle spielte: Prozessionen durch die Stadt, Gebete, Segnungen. Die gesamte Bevölkerung, Behörden, Vereine, sowie Kurgäste, nahmen teil – es war wohl eines der bedeutendsten Feste im ehemaligen Karlsbad.
Heute ist das eine weniger feierliche, aber fröhliche Veranstaltung, mit einem Umzug durch die Stadt, bei der Kaiser Karl IV. zu Pferde nicht fehlen darf. Heuer fand sie vom 5. bis 7. Mai statt – vielleicht merken Sie sich diesen Termin schon einmal für das nächste Jahr vor!
Für die sportlichen Leser habe ich einen Tipp: Nehmen Sie doch einmal am Mattoni-Halbmarathon in Karlsbad teil! Das muß ein wunderbares Erlebnis sein in dieser herrlichen Kulisse – auch für die Zuschauer. Oder Sie laufen eine kürzere Strecke. Vielleicht entscheiden Sie sich auch spontan: Der Termin ist am 20. Mai; Infos dazu finden Sie im Internet leicht unter visitczechrepublic.com
Wie schön ist Karlsbad im Mai, wenn die Buchenwälder sich mit frischem Grün schmükken! Mein allererster Besuch im Jahr 1988 fiel in diesen Monat, das war noch in kommunistischer Zeit – seither sind 35 Jahre vergangen, in denen sich so viel zum Guten verändert hat.

Aber vergessen wir unsere Geburtstagskinder nicht: Herzliche Glückwünsche, Gesundheit und Wohlergehen allen, die im Wonnemonat Mai und Anfang Juni das Licht der Welt erblickt haben.

Besonders gratulieren wir außerdem zum: –99. Geburtstag am 16. Mai Luise Rank/Liebl (Teufelsinsel), 64732 Bad König; –86. am 23. Herbert Kummer (Villa Luise), IRL Delgany; –78. am 7. Heinz Hilbert (Kirchenplatz 11), 96120 Bischberg. Pia Eschbaumer
Im Stadtkreis: Aich
Gemeindebetreuer Peter Böhme, Roßdorfer Straße 31, 60385 Frankfurt, Telefon/Telefax (0 69)
43 55 09, eMail: boehme62677@ aol.com
Herzlichen
Glückwunsch zum Geburtstag allen, die im Mai geboren sind, auch den hier nicht erwähnten Landsleuten, besonders aber zum 93. Geburtstag am 30. Mai Ernst Nowak, 35614 Aßlar. Leider muß ich einen Todesfall bekannt geben: Am 12. April ist Edeltraud Sedlak/Marterer im Alter von 97 Jahren in Biebesheim verstorben.
Ihren Angehörigen gelten unsere herzliche Anteilnahme und unser Mitgefühl.

Verehrte Aicher Landsleute, lassen Sie mir bitte Informationen zukommen, die veröffentlicht werden können, auch Todesfälle und Adreßänderungen. Ihr Peter Böhme
Im Stadtkreis: Espenthor
Gemeindebetreuer Rudolf Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Telefax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de Wir gratulieren zum 89. Geburtstag am 20. Mai Gertrud Beierl, geborene Grünes, in 63303 Dreieich-Sprendlingen. Wir wünschen ihr und den hier nicht genannten alles erdenklich Gute, vor allem aber Gesundheit. Den Kranken wünschen wir gute Besserung.




Im Alter von 94 Jahren verstarb am 28. Januar Lizzi Rabus, geborene Pfeiffer, zuletzt wohnhaft in 87700 Memmingen. Die Verstorbene wohnte früher am Krach, Hausnummer 69. Am 17. März verstarb in Memmingen Emma Hetzinger, geborene Leitner, im Alter von 89 Jahren. Den Angehörigen unser Beileid und unsere Anteilnahme. Liebe Landsleute, mit Schreiben vom 15. Februar 1934 teilte der Stadtrat Karlsbad der Bezirksbehörde Karlsbad mit, daß die Stadt in „Erfüllung der ihr obliegenden Verpflichtung, für obdachlose Personen Vorsorge zu treffen, die ihr gehörige Liegenschaft Nummer 10 in Espenthor
(sogenannter Tierschhof) zu einem Obdachlosenasyl umgebaut hat. In der Sitzung vom 19. Januar 1934 hat die Stadtvertretung beschlossen, diejenigen Räume der Liegenschaft, welche dem öffentlich-rechtlichen Zweck der Unterbringung obdachloser Personen dienen, dauernd, ausschließlich und unentgeltlich zu diesem Zweck zu widmen.“ Es handelte sich um das Stadtgemeinde-Gemeinschaftshaus „ban Läim“ in Espenthor. Das Gebäude war früher einmal ein Bauernhof. Wer kann dazu Näheres berichten?
Erinnern möchte ich an den Sudetendeutschen Tag, der vom 26. bis 28. Mai in Regensburg stattfindet. Das Leitwort lautet „Schicksalsgemeinschaft Europa“. Das genaue Programm finden Sie an anderer Stelle in der Sudetendeutschen Zeitung
Ihr Gemeindebetreuer Rudi Baier
Kohlhau
Gemeindebetreuer Albin Häring, Clemens-Brentano-Straße 22, 35043 Marburg/L.-Cappel, Telefon/Telefax (0 64 21) 4 53 02.

Im Monat Mai wünschen wir den Geburtstagskindern herzliche Geburtstagsgrüße und alle guten Wünsche für das neue Lebensjahr zum: –92. Geburtstag am 4. Mai Sieglinde Nietner/Mayer, Josefstr. 7, 95444 Bayreuth; –90. am 27. Getrud Schloßbauer, Keltenstr. 12, 85586 Poing; –83. am
4. Erhard Winkelbauer (Sohn von Frieda Winkelbauer, gebore-

ne Putz), Goethestraße 20, 35447 Reiskirchen; –77. am 23. Heinz Falb, Kulmbacher Straße 64, 95213 Münchberg.
In der Ausgabe vom 31. März hatte ich aus der Kohlhauer Ortschronik eine Kurzbiographie von Oberlehrer August Gärtner zitiert. Nicht erst seit 1919, sondern, wie es aus der Chronik hervorgeht, bereits ab 1. März 1912 – bis 1938 – wirkte er in Kohlhau, zuvor zwei Jahre im Nachbarort Schneidmühl. Im Nachgang dazu hier ein Foto aus dem Jahre 1936 mit 40 Schülerinnen und Schülern der Volksschule Kohlhau und ihrem Lehrer August Gärtner.
Albin Häring
Im Landkreis:
Altrohlau
Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Telefon (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf.Preis@t-online.de 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Altrohlau: Am 1. Mai feierte die Altrohlauer Freiwillige Feuerwehr ihr 150jähriges Gründungs-Jubiläum. Aus diesem Anlaß hat mir Antonin Foglar wichtige Details zu folgendem Bericht und einige Bilder zugesandt. Die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altrohlau fand am 1. Mai 1873 im Gasthaus Kohlert (Neuer Gemeindeplatz Nummer 123) statt. 66 Gründungsmitglieder wählten Rudolf Kohlert zum Ersten Kommandanten.
Zu Altrohlau: Plakat der Firma Hans Flader für Flader-Motorspritzen: 1929 erwarb die Feuerwehr in Altrohlau eine moderne Motorspritze der Firma Hans Flader.

Zu Altrohlau: Stempel der Freiwilligen Feuerwehr in Altrohlau.

Ihm folgten, chronologisch gesehen, ab 1891 Karl Rohm, 1894 Anton Siegl, 1896 Johann Katz, 1897 Karl Lorenz, 1899 Karl Ruß, 1907 Anton Kohlert, 1919 Josef Leipold, 1938 Josef Ruß, 1940 Franz Lochschmidt und 1943 Rudolf Klarner. Die Zahl der akti-
ven Mitglieder lag 1914 bei etwa 80 Mann, bis 1938 bei 105 Mann. Für den Kauf der Grundausrüstung spendete die Gemeinde 250 Fl, außerdem wurde die Feuerwehr mit Spenden der Porzellanfabriken, der Sparkasse und von Privatleuten aus Altrohlau und benachbarten Gemeinden finanziell unterstützt. Dank dieser zahlreichen Zuflüsse galt die Altrohlauer Feuerwehr als eine der am besten ausgerüsteten Wehren im Bezirk.

Schon bald nach der Gründung mußte sich die Feuerwehr am 20. Juli 1873 bei dem Brand der Mühle in der Merangasse Nummer 13 bewähren.
Im Jahr 1880 wurde eine leistungsfähigere Spritze gekauft, 1883 folgte der Kauf einer Feuerleiter. Im Jahr 1891 wurde ein neues Feuerwehrhaus in der Merangasse Nummer 38 errichtet, 1892 bekamen die Feuerwehrmänner neue Uniformen mit den Initialen F.A. Im Dorf wurden drei Hydranten für Löschwasser aufgestellt, und 1894 wurde die Ausrüstung komplettiert. Beim großen Brand am 26. November 1926 im Heizungsraum der Porzellanfabrik Epiag zeigte sich, daß die bestehende AusFortsetzung nächste Seite
Zu Pullwitz: Eine Erinnerungskarte (links) an den Sudetendeutschen Tag an Pfingsten 1961 in Frankfurt/Main mit entsprechendem Sonderstempel. Rechts: Zu Altrohlau: Parade beim Feuerwehrfest im Jahr 1973.

� Mai 2023 – Fortsetzung von Seite 18
Nachrichten aus den Gemeinden
... rüstung nicht auf dem notwendigen Stand war. Deshalb wurde am 6. Oktober 1929 eine moderne Motorspritze der Firma Hans Flader erworben, die 90 000 Tschechische Kronen kostete. Aus diesem Anlaß veranstaltete die Wehr ein großes Fest, an dem sich die gesamte Ortschaft beteiligte.
Im Jahr 1973 wurde das 100jährige Jubiläum mit einem Umzug gefeiert. Die heutige Feuerwehr umfaßt 35 Feuerwehrleute. Das moderne Feuerwehrhaus steht, wie das alte, in der Merangasse 38 und verfügt, neben einer modernen Ausrüstung, über drei Feuerwehrautos.
Am 24. Oktober 2004 wurde in der Altrohlauer Christi-Himmelfahrts-Kirche die neu erstandene Vereinsfahne feierlich eingeweiht. Ein Jahr später hat die Feuerwehr ihrer Partnerstadt Bernkastel-Kues einen Besuch abgestattet, der 2007 erwidert wurde.
Die offizielle Jubiläumsfeier findet am 13. Mai 2023 mit einem Gottesdienst in der Altrohlauer Kirche und einem anschließenden Fest mit Schauübung für die ganze Bevölkerung statt.
Spende: Ganz herzlich bedanke ich mich bei Frau Maria Roth für die großzügige Spende in die Porto- und Auslagenkasse.
Da die nächste Ausgabe der Karlsbader Zeitung erst am 9. Juni erscheint, hier schon die Geburtstage vom Anfang des nächsten Monats. Wir gratulieren herzlich zum: –95. Geburtstag am 8. Juni Anton Sacher, 87474 Buchenberg; –94. am 8. Lina Krassa/Lieberknecht, 69488 Birkenau; –75. am 3. Gerhard Fuchs, 36103 Flieden.
Trauerfall: Pia Eschbaumer teilte mir mit, daß Manfred Neukirchner bereits am 28. Dezember 2022 im Alter von 78 Jahren verstorben ist (geboren 25. März 1944; in der März-Ausgabe wurde noch sein 79. Geburtstag gemeldet). Seiner Frau, Cornelia Wulkopf, bekunde ich die tiefe Anteilnahme aller Altrohlauer. In einer der nächsten Ausgaben
wird Petra Eschbaumer sein Leben und langes Wirken als Hornist im Bayerischen Staatsorchester würdigen.
Neben dem 1. Mai und einigen religiösen Feiertagen gedenken wir jedes Jahr auch unserer Mütter und danken ihnen für die jahrelange Geduld und Liebe.
Dazu eine Anekdote, wie sie sich in Altrohlau zutrug:
„Die ewig Junge“
In Altrohlau lebte eine alte Bauersfrau. Trotz ihrer mehr als 70 Jahre waltete sie im Bauernhof immer noch als Bäuerin und Hausfrau. Eine Herde Kinder hatte sie schon großgezogen und zu braven und tüchtigen Menschen erzogen. Obwohl schon wieder fast ein Dutzend Enkelkinder herumsprangen, war sie immer noch rüstig, munter und guter Dinge. Als eines Tages der Dechant Richter am Hof vorbeiging, sah er, wie sie humpelnd einen großen Pack Holz ins Haus schleppte. Anteilnehmend fragte der Pfarrer: „Sicher wird Ihnen bei Ihrem Rheuma das Wetter doch sehr zu schaffen machen, weil Sie gar so schlecht laufen können?“
„Åch naa“, sagte darauf die Bäuerin, „ich wår gestern ban Maitanz. U ba dean vüln Polkan u Landlern, döi wos i sua gern tånz, san ma heint d‘Flachsn a wenig oag‘schwolln, daß i bål neat hatschn koa!“
In diesem Sinne wünscht Rudi Preis der gesamten Leserschaft einen heiteren und sonnigen Mai.
Grasengrün
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de
Der Frühling hat uns heuer mit seinem Einzug sehr lange warten lassen. Aber jetzt ist er schon lange mit seinen wohlriechenden Blumen eingekehrt und erfüllt die Luft mit ihrem angenehmen Geruch. Weithin ist auch der liebliche Mai mit seinem Blüten-
duft eingezogen. Wir feiern Muttertag und Pfingsten und verabschieden zur Monatsmitte die Eisheiligen. Mit einem Gedicht von Otto Zerlik will ich Euch auf das bevorstehende Pfingstfest einstimmen:
„Oan jedern Eck, oan jedern End, blöiht hellaf, wos no blöiha koan. Sua månchers Kinnerl håut sein Händ voll Bläimla, wos daschleppm koan.
Es stolpert låchat månchern Schriet; sein Äugla blöihn grod schöia mit.
In jedra Staudn, in jedan Baam is Lebm, åls war a Håuchzatstogh, am Stodlfirst, am Gartnzaam, am Giewlsims, in Taubmschlogh.
Du toust koin unbesungna Schriet, låuß d‘Surgn dahoim, sing mit, sing mit. Låch mit! Zan Gåmmern is koan Zeit.
Dös Blöiha håut da Herrgott bstöllt.
Gib åcht, dass niat va latta Freud, a Kinnerl diar za Föißn föllt.
U sing! U singst aa no gånz stüll; an jedan gült dös Glück, döi Freud!
Dös is, wos in da Fröihlingszeit da Herrgott jedern schenkn wüll.“
Unser Sudetendeutsches Pfingsttreffen, der Sudetendeutsche Tag, findet dieses Jahr wieder in der Donau-Arena, Walhalla Allee 24 in 93059 Regensburg statt. Ich werde am Pfingstsonntag nicht in Regensburg anwesend sein, da dieses Jahr zu Pfingsten eine schon lange geplante Familienzusammenkunft stattfindet.
Allen „Grosngräiner‘n“ wünsche ich einen sonnigen Maifeiertag, den Müttern einen schönen Muttertag, den Vätern einen von Gewittern freien Himmelfahrtstag, insgesamt einen schönen Maimonat. Kommt gut durch diese immer noch schwierige Zeit.
Es grüßt Euch alle recht schön Rudi Kreisl
Lichtenstadt
Zu Altrohlau: Das heutige Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr.

Gemeindebetreuerin Magdalena Geißler, Karlsbader Straße 8, 91083 Baiersdorf-Hagenau, Telefon (0 91 33) 33 24 Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag zum: –88. Geburts-
tag am 3. Mai Kurt Kriwan, 83416 Surheim; –81. am 31. Edeltraud Stützlein, geborene Schmidt, 90556 Seukendorf; –80. am 15. Gerlinde Obermillacher, geborene Schmidt, 91522 Ansbach; –am 28. Daniel Kranholdt, 96146 Altendorf.

Allen Müttern, Schwiegermüttern, Großmüttern und Urgroßmüttern wünschen wir einen wunderschönen Muttertag.


Elegante und stilsichere Frauen gibt es in allen Jahrhunderten. Ihre Ausstrahlung und Schönheit gehen dabei oft einher mit einer inneren Stärke. Sie sind schlagfertig, amüsant, klug und selbstironisch. Sie sind Schauspielerinnen, Designerinnen, Künstlerinnen, Hausfrauen und vieles mehr. Sie äußern sich über Mode und Männer, Erfolge und Enttäuschungen, Charme und Talent. Ihre Worte inspirieren uns jeden Tag aufs Neue und machen uns Mut, an uns selbst zu glauben und unseren eigenen Stil zu leben.
Magdalena Geißler und Christina
Am 3. Mai wärst Du, lieber Papa, Schwiegervater, Opa und Uropa, 90 Jahre alt geworden. Leider können wir nicht mehr mit Dir feiern. Aber wir werden am 3. Mai feiern und mit unserem ganzen Herzen und unserer Sehnsucht an Dich denken. Du fehlst uns jeden Tag.
Leider hast Du nicht mehr alle deine Urenkel kennengelernt.
Lukas, Selina und Sophia kanntest Du bereits und warst sehr stolz auf sie. Aber dann kamen noch Ludwig, Konrad und die kleine Ida dazu. Du hättest bestimmt sehr viel Freude mit diesen großen und kleinen Urenkeln. Aber Du schaust bestimmt von deiner weißen Wolke aus zu.
Danke, daß es Dich gab. Und: Wir passen gut auf deine Leni auf!
Christina und Daniel, Herbert und Sonja, Sebastian und Conny, Kathrin und Jörg, Sabrina und Milan
Pullwitz
Gemeindebetreuer Wolfram
Schmidt, Am Buchberg 24a, 91413, Neustadt/Aisch, Telefon (0 91 61) 72 00.
Liebe Pullwitzer, ein herzliches Grüß Gott.
Am 18. Mai 2023 kann Helmut Hederer seinen 82. Geburtstag
feiern; für das neue Lebensjahr wünschen wir alles erdenklich Gute, viel Glück, vor allem jedoch Gesundheit und Zufriedenheit.
An Pfingsten 2023 findet der nächste „Sudetendeutsche Tag“, diesmal wieder in Regensburg, statt. Bestimmt waren einige von Euch bereits vor 61 Jahren in Frankfurt bei dem „Sudetendeutschen Tag“ dabei.
Es grüßt Euch recht herzlich, Euer Wolfram Schmidt


Rodisfort
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de
Alles Gute den Geburtstagskindern im Mai und Anfang Juni. Wir gratulieren zum: –82. Geburtstag am 19. Mai Bruno Dürbeck, 86899 Landsberg am Lech; –55. am 5. Juni Karin Kreisl, 85238 Petershausen; –88. am 9. Marianne Wirth, 64658 Fürth/Odenwald.
Der Mai ist gekommen, und mit ihm beginnt die warme Jahreszeit. Nun kommen Monate, in denen nicht nur die Jungen gerne zum Baden gegangen sind. Die gedeckte Holzbrücke über die Eger sowie die Insel dort, mitten in der Eger, waren die Ziele aller Erfrischungssuchenden.
Der Maifeiertag mit seinem Tanz in den Mai beziehungsweise um den Maibaum, Muttertag, das Pfingstfest, Christi Himmelfahrt, was heute bei den meisten nur noch als Vatertag bekannt ist – der Mai bietet viele Gelegenheiten zum Feiern.
Nicht zu vergessen, wird an Pfingsten, vom 26. bis 28. Mai, unser Sudetendeutscher Tag in Regensburg veranstaltet. Er findet dieses Jahr wieder in der Donau-Arena, Walhalla Allee 24, in Regensburg statt. Ich werde am Pfingstsonntag nicht in Regensburg anwesend sein, da dieses Jahr zu Pfingsten eine schon lange geplante Familienzusammenkunft stattfindet.

Von unserer Heimatdichterin
Margareta Pschorn gibt es nun für Sie alle ein Gedicht zum Muttertag:
„Åch wos a Mutta weart is, dös läßt sich jå neat sogn –u wöißt a Mutta irrgäihst, dös läßt sich a neat klogn.
Koan ånnersch von dein Leutn koan diar döi Löib nuch gebm, wos d‘Mutta füar dich hobm wiard u ghått håut in dein Lebm. Drüm tou af d‘Mutta schaua, tous b’höitn af Schritt u Tritt; da Bests död tou füar d’Mutta: füar d’Mutta bet u bitt!“
Nun wünsche ich noch all meinen Rodisfortern einen schönen, warmen, sonnigen Mai, bis zur nächsten Ausgabe im Juni. „Bleibt‘s ma g‘sund.“ Es grüßt Euch alle recht schön, Rudi Kreisl Schneidmühl Gemeindebetreuer Rudolf Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de Im Mai gratulieren wir herzlich zum: –80. Geburtstag am 4. Mai Karl Weps, 97980 Bad Mergentheim; –77. am 28. Franz Neuerer, 63741 Aschaffenburg. Wir wünschen ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Den Kranken wünschen wir baldige Genesung.
Verstorben ist bereits am 13. September 2022 in Ebermannstadt Erich Klement im Alter von 88 Jahren. Der Verstorbene wohnte in Schneidmühl Hausnummer 3 und war der Sohn der Eheleute Johann Klement und Berta, geborene Kugler.
Am 21. September 1946 mußte er mit seiner Mutter und Schwester im Waggon 30 mit Transport 33453 seine Heimat verlassen. Er erlernte das Schlosserhandwerk, betrieb zeitweise eine Wirtschaft und arbeitete zuletzt bei der Post.
Im Jahr 1955 heiratete er Helene, geborene Maul. Aus der Ehe stammt eine Tochter. Unser Beileid und unsere Anteilnahme gelten seiner Tochter mit den beiden Kindern samt Familien.
Liebe Schneidmühler, ich lade Euch ein zur Teilnahme am Sudetendeutschen Tag, der vom 26. bis 28. Mai in Regensburg stattfindet. Das genaue Programm für den diesjährigen Sudetendeutschen Tag ist an anderer Stelle in der Bitte umblättern
Nachrichten aus den Gemeinden
Sudetendeutschen Zeitung zu finden.
Euer Gemeindebetreuer
Rudi Baier
Sodau–Halmgrün–Großenteich
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de
Wir gratulieren herzlich allen, die bis zum Erscheinen der nächsten Karlsbader Zeitung ihren
Geburtstag feiern können, besonders zum 91. Geburtstag am 5. Juni Elfriede Lorenz/Rippl, 64331 Weiterstadt.
Nun ist der Mai da, und mit ihm beginnt die warme Jahreszeit. Der Maimonat ist auch ein
Monat der Feiertage: Es beginnt mit dem 1. Mai (Maifeiertag), geht weiter mit dem Muttertag, dem Christi-Himmelfahrts-Tag (Vatertag), und dann noch Pfingsten.
Zum Pfingstfest treffen sich viele von uns vom 26. bis 28. Mai auf dem Sudetendeutschen Tag. Unser großes Pfingsttreffen findet dieses Jahr wieder in der Donau-Arena, Walhalla Allee 24, in Regensburg statt. Ich werde am Pfingstsonntag nicht in Regensburg anwesend sein, da dieses Jahr zu Pfingsten eine schon lange geplante Familienzusammenkunft stattfindet.
Da bei uns im Egerland schließlich gerne die Wallfahrer unterwegs waren, habe ich dazu für Euch ein Gedicht von Robert Lindenbaum herausgesucht:
„Pfingsten zu Kulm“ „Schaubuden stehen im Geviert mit großen Vögeln, Hund und Bär, ein Mann ruft wie der gute Hirt‘ die Menschenherde zu sich her.
� Verdiente Karlsbader und ihre Grabstätten
Ihm strömt die Welt aus Aug‘ und Mund. Doch manchmal hält er still und kniet, wenn mit der Herde, bänderbunt, Maria durch die Gassen zieht. Wallfahrer kommen und sind müd‘; nur ihr ekstatischer Gesang geht wie ein altes Kirchenlied inbrünstig durch den Kreuzweggang.
Die Sonne ruht am Hochaltar und flicht Maria einen Kranz. Gott aber reicht uns jubelnd dar die ganze Erde als Monstranz.“
Allen Landsleuten aus Soda-Halmgrün und Großenteich wünsche ich einen warmen Maimonat, den Müttern einen schönen Muttertag, den Vätern einen sonnenreichen Himmelfahrtstag und allen ein schönes Pfingstfest. Bleibt gesund bis nächstes Mal. Es grüßt Euch alle recht schön, Rudi Kreisl
� Meldungen der Ortsbetreuer
Glückwünsche zum Geburtstag
Der Heimatverband und die jeweiligen Ortsbetreuer wünschen auch allen Jubilaren aus den zuvor nicht aufgeführten Gemeinden, besonders aber den nun namentlich genannten treuen Abonnenten der Karlsbader Zeitung alles Gute zu ihrem Geburtstag, ein erfülltes und gesundes neues Lebensjahr!
Dallwitz
19. Mai: Edith Nübler/Meinelt-Brücher, 92421 Schwandorf, 91. Geburtstag.
Drahowitz
11. Mai: Anni Hein/Knössl (Gewerbegasse 7), 35792 Löhnberg, 89. Geburtstag.
28. Mai: Hilde Schöniger/Loh (Pestalozzistraße 138), 35578 Wetzlar, 94. Geburtstag.
28. Mai: Sven Ottmann, 91126 Schwabach, 47. Geburtstag.

31. Mai: Robert Pangratz (Neuern), 90556 Cadolzburg, 91. Geburtstag.
5. Juni: Hermann Veitenhansl
(Oststraße 94, Köhler Tischler), 65385 Rüdesheim, 94. Geburtstag.
Haid–Ellm–Lessau
17. Mai: Friedrich Schiller, 85757 Karlsfeld, 92. Geburtstag.
27. Mai: Jlse Ruzickova/Bärreiter, CZ 36001 Karlsbad/Karlovy Vary, 84. Geburtstag.
7. Juni: Alfred Reinl, 86559 Adelzhausen, 83. Geburtstag.
8. Juni: Rudolf Tilp, 74670 Forchtenberg, 91. Geburtstag.
Hartmannsgrün
8. Juni: Gerti Viertl, 91801 Mkt. Berolzheim, 91. Geburtstag.
Meierhöfen
15. Mai: Willibald Schlagbaum, 35630 Ehringhausen, 67. Geburtstag.
Sachsengrün–
Ranzengrün–
Oberlomitz
1. Juni: Elfriede Grimm, 86675
Buchdorf, 84. Geburtstag Satteles
3. Juni: Elisabeth Jordan/Liewald, 90768 Fürth, 87. Geburtstag.
Schlackenwerth
13. Mai: Marianne Birkenstock, 36323 Grebenau, 88. Geburtstag.
26. Mai: Gudrun Telto, 29471 Gartow, 86. Geburtstag.
29. Mai: Walter Eismann, 61440 Oberursel, 75. Geburtstag.
Tüppelsgrün
20. Mai: Rudolf Kettner, 71691 Freiberg, 94. Geburtstag.
31. Mai: Alois Raab, 89073 Ulm, 91. Geburtstag. Welchau
1. Juni: Christel Neumann (Frau von Alfred Schneider), 73. Geburtstag.
9. Juni: Adolf Raim, 90489 Nürnberg, 84. Geburtstag.
Tondichter und Direktor des Kurorchesters –August Labitzky und seine letzte Ruhestätte
Im vierten Teil der Reihe „Verdiente Karlsbader und ihre Grabstätten“, geschrieben von Rudi Baier, geht es um den Karlsbader Komponisten und bedeutenden Kurorchesterdirektor Karl August Labitzky:
August Labitzky gehörte als Tondichter und Direktor des Karlsbader Kurorchesters von 1868 bis 1903 zweifellos zu den bedeutendsten Karlsbader Bürgern seiner Zeit. Er ist im Jahr 1832 in Petschau geboren worden.
Sein Vater Josef schickte ihn 1845, im Alter von 13 Jahren, zur weiteren musikalischen Ausbildung an das Prager Konservatorium. Dort erhielt sein Bruder Wilhelm bereits seit zwei Jahren eine Ausbildung. Beide blieben dort bis zum Jahr 1848. Dann traten sie als Solisten in das von ihrem Vater geführte Kurorchester in Karlsbad ein.
Im Jahr 1850 begannen sie eigene Konzerte zu geben. 1852 hatten sie ihr erstes eigenes Orchester zusammengestellt. Mit diesem gingen sie auf Auslandstournee.
In den folgenden Jahren festigte Labitzky sein Ansehen als Musiker in Karlsbad, führte aber auch weitere Konzertreisen durch. Im Jahr 1868 übernahm er die Leitung des Karlsbader Kurorchesters von seinem Vater.
Am 12. Oktober 1863 heiratete er Marie Bernhart, eine in Franzensbad geborene Gutsbesitzerstochter.
Labitzky richtete seine Schwerpunkte in der Darbietung auch auf weitere Musikrichtungen aus. Er brachte einen neuen Stil in das Orchester ein und bereitete es auf die Aufführung symphonischer Werke vor. Labitzky vergrößerte das Orchester. Neben seinen Auftritten im Kurorchester übernahm er außerdem auch die musikalische Leitung am Karlsbader Stadttheater.
Labitzky ist der Komponist von insgesamt 93 Orchesterwerken, Tanzkompositionen oder Märschen. Er wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Orden geehrt.
Im Jahr 1903 verstarb Labitzky schließlich in Bad Reichenhall.
Das Grab von Labitzky liegt etwa in der Mitte des Mittelgangs auf dem Karlsbader Friedhof. Auf einem einfach gestalteten Sokkel erhebt sich eine Art Portikus (Säulenhalle beziehungsweise Säulengang), bestehend aus zwei Pfeilern und einem Dreiecksgiebel. Auf diesem ist ein Kreuz aufgesetzt.


Auf der dunklen eingesetzten Tafel stehen die Namen der in der Grabstätte beerdigten Personen:
August Labitzky, Musikdirektor, geboren am 23. Oktober 1832, gestorben am 28. August 1903;
Marie Labitzky, geborene Bernhart, geboren am 5. April 1843, gestorben am 5. Mai 1921;
Cornelia Lampel, geboren am 27. Oktober 1885, gestorben am 20. Mai 1888;
Ladislaus Lempel, Sparkassendirektor, geboren am 1. Januar/Jänner 1850, gestorben am 7. Januar 1923.

„Hoch Labitzky und seine Künstla!“ (A Lobsprüchl as‘n Wandererclub)
„Diarts wißt‘s: Labitzky August‘s Alter, dös woar a Teuflßakrawollt, dian heint nuch jedra Musichhålta vül tausend Dånk u Achtüng zollt.
,Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme!‘ dös trifft dåu zou, as Grund u Buadn, drüm is san August sua a stråmma
a furchtbar brava Kampl wuan!
San Lob klingt niat alloin germanisch, in jedra Språuch, denn dös is gwiß, daß d Musich kosmopolitanisch, dös håißt: niat deutsch u bäihmisch is.
U am Programm vaträgt sich jedra: ,Maschkani, Wagner, Schmettana, Labitzky, Dworschak, List u Schröder, jå, selwa Hannes Bülaff aa!‘
Da ålta Hanslick-Notnreita sticht månchan Musikantn tåud, doch üwa unsra u iahrn Leita, dåu schmiart ear d Buta dick af´s Bråut!
Drüm wolln mar unsra Künstla äihern, va heint oan bis am Immatogh, u‘s Glos af´s letzta Tröppl läihern: Labitzky u san Musich. Hoch! Hurra, Hoch!“
Dieses Lobgedicht über Labitzky wurde eigens in der „Franieckschen Buchdruckerei Carlsbad“ gedruckt. Das Stück dürfte Josef Hofmann zum Verfasser haben.
Dieses Gedicht wurde uns, wie auch manch anderes über Josef Labitzky und seinen Sohn, von August Lampel zur Verfügung gestellt (aus „Karlsbader Badeblatt“, Jahrgang 1961, Seite 262).
Abbildung des Kopfes eines Symphonie-Konzert-Programms unter der Leitung des Karlsbaders August Labitzky: „Etablissement Posthof. Freitag, den 20. Juli 1894. Zwölftes Symphonie-Konzert der Kurkapelle, unter Leitung des Musikdirektors A. Labitzky.“ Bild: Commons.wikimedia

