Bericht über die Marienbader Gespräche (Seite 7)
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung






Jahrgang 75 | Folge 20 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 19. Mai 2023








❯ Aufruf des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt
Auf geht´s nach Regensburg
Liebe Landsleute, unser sudetendeutsches Pfingsttreffen von 26. bis 28. Mai in Regensburg, einer der schönsten Städte Europas, wird wohl wieder ein ganz besonderes Ereignis (Programm siehe auf den Seiten 21 bis 24).


Christian Schmidt, und den langjährigen Vizepräsidenten des Europäischen Parlamentes Libor Rouček.
Art, wie ich reagiert hatte, war die einzige Erklärung für mich, daß mich ein gepflegter Herr in Zivil ansprach und sich nach meinem Schule sein müßte und bot mir an, hier zu bleiben. Ich fragte ihn, was er denn sei, worauf er sich als Kreisschulrat vorstellte. Er versprach mir kostenlose Teilnahme an einem Lehrerausbildungswie die größeren Nazis, als ich einer war, in Bonn zu guten Demokraten gereift waren (Zitat von Herrn Kohl während einer Talk Show in Holland). In diesem Lager kamen wir mit Heimkehrern aus westlichen GeIch hielt es für schmutzige Propaganda, die Amis hätten vor hungernden, angetretenden Landsern hochwertige
Schwester als Transportführer vor. Die Schwester hieß wie ich und rief sogleich eine Ambulanz an. Mitteilungsblatt für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge ❯ Ministerin Ulrike Scharf




Schublade ihres Schreibtisches und übergab mir einen verschlossenen Briefumschlag. 150 Mark waren darin! Ich wollte das Geld nicht annehmen, sie versicherte mir aber, dies sei eine Kollekte, die man ihr mit der Auflage gegeben hätte, sie einem würdigen ab. Diese Sammlung und 100,– DM sind alles, war ich für die Knochenarbeit von der Bundesrepublik erhalten habe. In meiner bescheidenen Meinung hätte man diesen kleinen Betrag als Versuchriger der Waffen-SS automatisch zum Verbrecher gestempelt, meiner Würde beraubt wurde, zählen können. Hier bedanke ich mich bei meinen ehemaligen SS-Kameraden, die als gute Christdemokraten in Bonn Volksvertreter spielen. Verzeibrachte uns in das, was vom Reich übrig geblieben war. Ich vergaß den Namen des Ortes, wo wir in ein Quarantänelager mußten. Vor der Entlausung mußte ich aufpassen, daß auch jeder hineinging! Ein deutsches Fräulein kam mit einem Iwan am Arm daher. Ich

Jugend gemeinsam für Europa
Die Zahlen sind beeindruckend:
15 000 junge Menschen aus Bayern und Tschechien haben sich mit 600 Vorschlägen und 170 000 Stimmabgaben am Digital-Projekt „Jugend gemeinsam für Europa“ beteiligt, das das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) gefördert hat.
Das Feedback der jungen Menschen sei großartig, freute sich Bayerns Jugendministerin Ulrike Scharf auf der Abschlußveranstaltung in München und sagte. „Die Jugend muß Gehör finden – sie ist unsere Zukunft. Ihre Ideen von einem stärkeren und nachhaltigeren Europa bereichern unsere politische Arbeit. Gerade jetzt, wenn Spaltungstendenzen unseren Zusammenhalt gefährden, wenn versucht wird, Gräben zu vertiefen und nicht weit weg Krieg herrscht, ist es wichtig, sich auf gemeinsame Werte und Gemeinschaft zu besinnen. Ich setze mich für eine aktive Kultur der Jugendbeteiligung ein.“
Im Rahmen des bayerischtschechischen Projekts konnten drei Monate lang junge Menschen aus Bayern und der Tschechischen Republik darstellen, wie sie sich ein nachhaltigeres und stärkeres Europa vorstellen und welche Rolle grenzüberschreitende Projekte bei der Stärkung Europas spielen.
Das Ergebnis: Die Jugend diskutierte dabei vielfältige Themen und brachte etliche konstruktive Vorschläge ein, wie zum Beispiel Schulaustauschprogramme aufstocken, mehr gemeinsame Kulturprojekte fördern, Mobilität verbessern, Technologie und digitale Infrastruktur ausbauen.
Die Bürgerbeteiligung fand im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend 2022 statt. Es ist Teil des umfangreichen Bayerischen Aktionsplans „Jugend“ des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Realisiert wurde das Projekt von dem Verein Initiative Offene Gesellschaft gemeinsam mit den Kooperationspartnern Make.org und eKairos.

Einer der Höhepunkte ist der Heimatabend. Foto: Torsten Fricke
Am Freitag Nachmittag diskutiert ein internationales Forum brisante Fragen wie die Gefährdung des Weltfriedens durch das russische und das chinesische Dominanzstreben. Am Samstag verleihen wir unseren Europäischen Karls-Preis an zwei Persönlichkeiten, die an der Spitze des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums stehen und dort eine sehr wichtige Arbeit für uns leisten: Den Hohen Beauftragten für Bosnien-Herzegowina, Bundesminister a. D.

❯ Heimatmuseum Freudenthal/Altvater in Memmingen eröffnet











Bei der Hauptkundgebung am Sonntag werden unser Schirmherr, Ministerpräsident Markus Söder, und ich über die neuesten Entwicklungen im deutschtschechischen und sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis berichten, in dem gerade in diesen Tagen sehr vieles in Bewegung kommt. Außerdem hat die Tschechische Regierung entschieden, daß sie wieder mit einem hochrangigen Politiker vertreten sein wird.
An allen drei Tagen glänzen wir zudem mit K.u.K.: unserer einzigartigen Küche und unserer bunten, äußerst vielfältigen Kultur. Kein Sudetendeutscher
sollte sich dieses Ereignis entgehen lassen, aber auch alle anderen Menschen guten Willens und die breite Öffentlichkeit sind herzlich willkommen. Kommen Sie zum Sudetendeutschen Tag und setzten Sie dadurch ein sichtbares Zeichen für eine gute mitteleuropäische und gesamteuropäische Zukunft! Der Sudetendeutsche Tag freut sich auf viele Gäste aller Volksgruppen und Generationen. Mit den herzlichsten Grüßen Dr. h.c. Bernd Posselt MdEP a. D. Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Neues Museum erinnert an Vertreibung

Bayerns Museumslandschaft ist um eine wichtige Institution reicher. In Memmingen ist jetzt das Heimatmuseum Freudenthal/Altvater eröffnet worden.
Memmingen und das Allgäu haben in der Geschichte der Sudetendeutschen nach 1945 eine besondere Bedeutung. Hier war in den Jahren der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg Endstation für die Güterzüge mit Zehntausenden Vertriebenen aus dem Sudetenland, hauptsächlich aus dem Altvatergebiet, aus Freudenthal, Jägerndorf und Römerstadt an Bord. Selbst für die Nachkommen „d‘Flichtlinge“ – wie sie von den Einheimischen geschmäht wurden – sind viele Fragen zum „Warum“ und „Wie“ der Vertreibung und der Integration in Schwaben noch offen. Antworten gibt das neue Heimatmuseum Freudenthal/Altvater im Memminger Stadtmuseum. Das als klassische Informations-Ausstellung neu konzipierte Museum ist umso bedeutungsvoller, so Kuratorin Ursula Winkler, als Heimatstuben oder Museumsabteilungen, die sich mit der Vertreibungsgeschichte aus dem deutschen Osten beschäftigen, andernorts reihenweise schließen müssen. Die Erlebnisgeneration, die diese Heimatstuben bisher betrieben hat, ist nicht mehr da, Nachfolger gibt es nicht.
An die Geschichte der Flucht der Heimatvertriebenen und ihr Seßhaftwerden in der neuen Heimat erinnerte bereits das 1956 im Stadtmuseum auf 27 Quadratmeter, als Heimatstube eingerichtete Heimatmuseum Freudenthal/Altvater. In jenem Jahr
übernahm die Stadt Memmingen auch die Patenschaft für die Heimatvertriebenen aus Stadt und Kreis Freudenthal. Erwin Weiser, Leiter des gut geführten und beliebten Städtischen
Museums in Freudenthal, baute das Heimatmuseum in Memmingen ehrenamtlich, mit viel Fachverstand und guten Kontakten auf. Nach Erweiterungen in den Jahren 1986 und 1997 wurde
das Museum in den vergangenen drei Jahren auf 200 Quadratmetern mit Filmen, Fotos und 200 Exponaten aus dem Fluchtgepäck komplett neu aufgestellt.
Anfang Mai wurde das neue Museum an alter Stelle – in einer ehemaligen großen Wohnung im zweiten Stock des „Hermansbaus“, einem barocken Stadtpalais – eröffnet. Von den Gesamtkosten des Projekts (rund 285 000 Euro) übernahm das Haus des Deutschen Ostens ein Drittel. Private Spender steuerten knapp 20 000 Euro bei, den größten Anteil an der Finanzierung aber leistete die Stiftung Heimatkreis Freudenthal/Altvater e. V. Memmingen sei nach der Vertreibung, so Kuratorin Ursula Winkler, „ein Zentrum der Erinnerung.“ So hatten sich bereits ein Jahr vor dem ersten of-



Kuratorin Ursula Winkler (links) erklärt, wie stark Memmingen zerstört und wie groß die Wohnungsnot für die Vertriebenen war. Das Heimatmuseum Freudenthal/Altvater be ndet sich im Stadtmuseum Memmingen (www. stadtmuseum-memmingen.de) in der Zangmeisterstraße 8 und ist täglich außer montags von11.00 bis 17.00 Uhr geö net. Fotos: Klaus D. Treude

fiziellen Sudetendeutschen Tag, der 1950 in Kempten stattfand, an Pfingsten 1949 rund 20 000 Landsleute in Memmingen versammelt.

Früher, so Winkler, habe sich das Museum eher an die Erlebnisgeneration gewandt. Künftig wolle man – vor allem für die Bekenntnisgeneration, die Kinder, Enkel und die gesamte Bevölkerung – verstärkt Antworten auf offene Fragen geben. In vielen Familien seien viele Geschehnisse tabuisiert worden. Winkler: „Traumata vererben sich.“
Der Weg durch die Ausstellung beginnt mit einem Stimmungsbild Memmingens im Jahre 1945. Bedrückend ist ein in den Boden montiertes Luftbild, das die Zerstörung durch die alliierten Bombardierungen zeigt.
In diese zerstörte, eher ländliche Welt kamen die Vertriebenen in langen Zügen mit jeweils rund 1200 Menschen aus ihrer industriell hoch entwickelten Hei-
mat. Sie machten damals fast die Hälfte der Memminger Bevölkerung aus. Zwei Welten prallten aufeinander.

Die Heimatvertriebenen hatten eine andere Bildung, waren – im Gegensatz zur überwiegend evangelischen Memminger Bevölkerung – katholisch, sprachen mitunter „eine andere Sprache“, die Frauen waren sehr emanzipiert, hatten eine qualifizierte Berufsausbildung. Ein Kulturschock, der, so Winkler, zu großen Auseinandersetzungen führte.

Unter den Zeitzeugen, deren Erinnerungen in Filmen festgehalten wurden, sind Menschen der Erlebnis-Generation, die die Vertreibung als Erwachsene erlebt haben, aber auch damalige Kinder, denen der Neustart in Schwaben wie ein großes Abenteuer vorkam.
Dr. Ortfried Kotzian, der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, kam als eines
dieser ehemaligen, in Fellheim bei Memmingen geborenen Kinder, zu Wort. Die älteste Zeitzeugin (Jahrgang 1921) berichtet von ihrer österreichischen Prägung und dem Leben im Lager. Andere erinnern sich an die Bombardierungen, wieder andere an die Einquartierungen. Das neue Heimatmuseum versteht sich auch als Forschungseinrichtung. So können Interessierte in den sorgfältig geführten Güterzug-Transportlisten nachlesen, wer mit welchem Zug und in welchem Waggon aus dem Altvaterland Richtung Memmingen transportiert wurde. Die Listen können auch –wie Tausende weitere Objekte – über die Homepage des Heimatkreises (www.heimatkreisfreudenthal.de) in einem virtuellen Depot eingesehen werden. Wertvolle Elemente der bisherigen Ausstellung wurden in das neue Museum übernommen und neu in Szene gesetzt. Großen Wert legten die Verantwortlichen auf das nachhaltige Konzept der Ausstellung. Vitrinen und Infoträger wurden up- und recycled. Für die an Auto-Rückspiegel erinnernden Objektboxen zur Präsentation kleinerer Gegenstände – etwa Habseligkeiten aus der alten Heimat –wendete man erstmals in einem Museum überhaupt den 3DDruck an. Die Haupttexte sind dreisprachig in Deutsch, Tschechisch und Englisch verfaßt. Damit unterstreicht das Heimatmuseum einmal mehr seinen Anspruch, ein Museum im europäischen Dialog zu sein.
Das neue Heimatmuseum solle, so Dr. Hans-Wolfgang Bayer, Kulturamtsleiter der Stadt Memmingen, „nicht nur Erinnerungsort sein, sondern auch ein Ort zum Bewußtwerden, was Integration und Miteinander ausmachen kann“.
Memmingens zweite Bürgermeisterin, Margareta Böckh, sieht in der Neueröffnung des Heimatmuseums einen Meilenstein in dessen Geschichte. „Aber noch lange nicht das Ende.“ Klaus D. Treude

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Im Rahmen des letzten Besuchs von Bernd Posselt in Prag, traf sich der Sprecher der Sudetendeutschen dort mit mehreren tschechischen Politikern. Zu ihnen gehörte auch die langjährige Freundin der Sudetendeutschen Terezie Radoměřská. Die frühere Generalsekretärin von Schwarzenbergs Partei TOP 09 wechselte vor einigen Jahren in die Kommunalpolitik und wurde voriges Jahr in das Amt der Bürgermeisterin von Prag 1 gewählt. In diesem Stadtviertel be nden sich die meisten Re-
gierungs- und Parlamentsinstitutionen der Tschechischen Republik, sowie zahlreiche Botschaften, die Bayerische Repräsentanz und auch das Prager Sudetendeutsche Büro. Dorthin hatte Büroleiter Peter Barton Radoměřská zum Gespräch eingeladen. Für Posselt persönlich ist dieser historische Teil Prags mit aktuell etwa 30 000Einwohnern nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der wichtigsten Teile Europas. Radoměřská repräsentierte in der Vergangenheit an mehreren Sudetendeutschen Tagen ihre Partei, und ihr einmaliges Engagement


im deutsch-tschechischen Verständigungsprozess gehört zu den Konstanten ihres Berufslebens. Wir wünschen ihr weiterhin Erfolg in ih-
rer politischen Laufbahn und ihrer Arbeit für ein glückliches Miteinander zwischen den beiden Völkern und Volksgruppen.
Novitny

Bernd Posselt über deutsche Arroganz und Pavels Chancen

Unter dem Titel „Europa ist endlich erwachsen geworden“ hat Tschechiens renommierteste Tageszeitung Lidové Noviny ein großes Interview mit dem Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, im Vorfeld des Sudetendeutschen Tags veröffentlicht. Die Sudetendeutsche Zeitung dokumentiert das Gespräch in Auszügen.

Lidové Noviny: Europa befindet sich seit einem Jahr im Bann des Ukraine-Krieges. Welche Note würden Sie den Europäern dafür geben, wie sie sich damit auseinandersetzen?
Bernd Posselt: Ich würde hier zwischen der Reaktion der Nationalstaaten und der Reaktion von Europa als Ganzem unterscheiden. Ich muß sagen, daß die meisten Nationalstaaten vor allem am Anfang versagt haben. Als die russische Armee bereits an der ukrainischen Grenze stand, ignorierten sie immer noch die Warnungen vor der drohenden Invasion. Der Wendepunkt, und das will ich wirklich betonen, kam erst mit der Reise des tschechischen Premierministers Petr Fiala und zwei seiner Amtskollegen nach Kiew. Sie haben damals die Ehre Europas gerettet. Was die europäische Ebene angeht, ist es gelungen, die ganze Zeit ihre Einheit zu halten. Leider mit der unrühmlichen Ausnahme meines ehemaligen Freundes Viktor Orbán, der zu einem Handlanger Putins geworden ist.
Viele Europäer haben das Gefühl, daß der Ukraine mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als ihnen selbst. Was kann man tun?
Posselt: Ich würde sagen, daß die meisten EU-Bürger eine überraschende und deutliche Solidarität mit den Ukrainern zeigen.

Ich muß wiederholt die Tschechen erwähnen, die mehr Ukrainer aufgenommen haben als das gesamte Deutschland. Und nach Bayern kamen mehr Ukrainer als nach Frankreich. Es geht also um eine ziemlich ungleichmäßig verteilte Solidarität. Ich höre manchmal Kritik, aber es ist kein Mehrheitsphänomen. Putin wollte die Europäer spalten, aber das ist ihm auch nach einem Jahr nicht gelungen. Sogar vor kurzem, als es ein Problem mit dem billigen ukrainischen Getreide gab, wurde die Solidarität nicht gefährdet. Das Thema wurde schließlich auf europäischer Ebene gelöst, nicht auf der nationalen Ebene, wo jeder Staat eine eigene Gegenmaßnahme ohne Rücksicht auf die anderen ergriffen hätte.
Wie hat der Krieg Deutschland verändert?
Posselt: Der Krieg hat klar gezeigt, daß wir nicht in einer Welt leben, in der wir uns alles beliebig auswählen können: Daß wir von den Amerikanern verteidigt werden, an die Chinesen verkaufen und billiges Gas aus Rußland haben, ohne uns für die breite-
Fiala-Regierung ohne Mehrheit
ren Zusammenhänge zu interessieren. Diese Zeit ist vorbei. Europa als Ganzes, würde ich sagen, hat den Prozeß des Erwachsenwerdens erreicht, wofür es höchste Zeit war.
Hat sich der berühmte deutsche Pazifismus aufgelöst?
Posselt: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, daß mir ein deutscher Pazifismus lieber ist als ein deutscher Militarismus. Aber ich würde hier zwei Sachen unterscheiden: Einerseits gibt es einen Pazifismus, der naiv ist und daran glaubt, daß die anderen die Situation nicht ausnutzen, wenn man selbst einseitig abrüstet. Und andererseits gibt es einen realistischen Pazifismus, der davon ausgeht, daß es die einzige Garantie für den Frieden ist, wenn man selbst stärker ist als der potenzielle Aggressor, worum wir uns jetzt bemühen. Wir brauchen dringend eine europäische Verteidigungsunion, wir brauchen eine europäische Armee. Nicht als Ersatz für die nationalen Armeen, sondern als deren Ergänzung. Droht die Gefahr, daß Europa und Deutschland in Bezug auf China die gleichen Fehler wiederholen, die sie im Falle von Rußland begangen haben?
Posselt: Die deutsche Regierung arbeitet aktuell an einer speziellen Strategie. Aber ehrlich gesagt brauchen wir doch keine deutsche Strategie, sondern eine europäische. Ich glaube, daß die Strategie Chinas darin besteht, zumindest den östlichen Teil Rußlands an sich zu reißen, wenn nicht das ganze Land. Ich bin überzeugt, daß die chinesische Unterstützung Rußlands darauf abzielt, eine Abhängigkeit Rußlands zu erreichen. Aus langfristiger Sicht kommt meiner Meinung nach die größte Gefahr für Rußland aus China, nicht aus Europa, wie Putin es glaubt. Die EU widmet sich aktuell stark „grünen Themen“, was vor
allem in Mittel- und Osteuropa Kritik hervorgerufen hat. Wie ist Ihre Position zu diesen Fragen?
Posselt: Alle Mitgliedstaaten sowie die EU als Institution haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Das heißt, daß sie verpflichtet sind, ihre Emissionen zu reduzieren. Selbstverständlich ist keine Lösung problemlos. Man kann nicht sagen: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß.“ Aus meiner Sicht ist maßgeblich, daß der Emissionshandel jetzt beschlossen wurde. Statt Verbote werden wir hier also eine Marktlösung haben, was ich begrüße. Persönlich halte ich außerdem für sehr positiv, daß wir darüber diskutieren, wie wir unsere Technologieoffenheit behalten können. Man muß der Industrie und Forschung freie Hand lassen, damit sie sich selbst entscheiden. Die Grünen wollen dies einfach durch Verbote und Regulierung erreichen. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil es bei den Menschen Widerstand hervorruft.
Das Thema Migration macht Europa zu schaffen. Sollten Ihrer Meinung nach EU-Gelder verwendet werden, um Grenzmauern oder Zäune zu bauen? Die Kommission lehnt es bisher ab.
Posselt: Es ist kein Thema für die Kommission, sondern für das Europäische Parlament, das als einziges Gremium über die Haushaltsbefugnisse verfügt. Der Schutz der Außengrenzen darf nicht nur denjenigen Staaten überlassen werden, die unter dem größten Migrationsdruck stehen. Zäune sind mit starken Emotionen verbunden, sie schaffen Raum für dramatische Situationen. Aber für den Grenzschutz sind zum Beispiel auch Thermokameras und die Möglichkeit der Luftüberwachung der Grenze wichtig. Wir müssen illegale Grenzübertritte beschränken und gleichzeitig legale Migration erleichtern. Die Vorstellung,
daß Europa eine Festung sein kann, ist illusorisch. Als Europäer sind wir zwar reich, aber die Bevölkerungszahlen gehen zurück. Wir haben mehr alte als junge Bürger, wir brauchen überall qualifizierte Fachkräfte, insbesondere im sozialen Bereich. Die Sudetendeutschen haben eine entscheidende Rolle in der positiven Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen gespielt. Sind diese Beziehungen bereits so weit entwickelt, daß sie auch ohne ihren Beitrag auskommen würden?
Posselt: Wieso können die Sudetendeutschen so viel für die deutsch-tschechische Verständigung tun und warum tun sie das auch? Aus einem einzigen Grund. Weil sie sich für das Land ihrer Vorfahren interessieren. Es geht nicht nur um die Vergangenheit, um die gemeinsame Geschichte, sondern um die Zukunft. Das Problem ist, daß sich der normale Deutsche nicht sonderlich für die böhmischen Länder interessiert. Dies konnten wir auch neulich beim Besuch des Präsidenten Petr Pavel in Berlin sehen. Er hat zum Beispiel eine fantastische Geste gemacht, indem er der Opfer der Berliner Mauer gedachte, aber in der deutschen Presse habe ich keine Erwähnung davon gefunden. In der Vergangenheit war es auch keine Ausnahme, daß ein tschechischer Politiker nach Berlin kam, aber dort von niemandem auf entsprechender Ebene empfangen wurde, weil sich einfach niemand die Zeit dafür genommen hat. Das ist falsch, das ist ein Zeichen von Arroganz. Sie haben schon erwähnt, daß Sie den Besuch von Petr Pavel in Berlin für einen Erfolg halten. Wie bewerten Sie seine ersten Monate im Amt?
Posselt: Ich hoffe, daß Herr Präsident – auch angesichts seiner Herkunft aus Plan – deutlich mehr Aufmerksamkeit der Situation im Grenzgebiet schenken wird. Letztendlich war er seit seiner Wahl schon mehrmals da. Daher bin ich zuversichtlich, daß er auch einer Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit positiv gegenüberstehen wird. Eine vernünftige Entwicklung dieser Regionen ist nur in Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen auf der anderen Seite der Grenze möglich.
Der Sparkurs der Regierung von Premierminister Petr Fiala sorgt für wachsenden Unmut in der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Meinungsumfrage kommt die Regierungskoalition nur noch auf 43 Prozent der Stimmen, hätte also derzeit keine Mehrheit mehr. Das zur Koalition gehörende Bündnis Spolu aus ODS, KDU-ČSL und Top 09 erhält dabei nur 25 Prozent, wobei KDU-ČSL und Top 09 mit derzeit jeweils fünf Prozent um den Einzug ins Parlament fürchten müssen. Stan und Piraten, die ebenfalls zur Fünfer-Koalition gehören, kommen auf 6,0 beziehungsweise 11,0 Prozent. Deutlich in Führung ist mit 30,5 Prozent die Partei Ano des ehemaligen Premierministers Andrej Babiš, die im Vergleich zum Vormonat einen Prozentpunkt hinzugewonnen hat. Die rechtsradiale SPD kommt auf neun Prozent und die sozialdemokratische ČSSD wäre mit 5,5 Prozent wieder im Parlament vertreten. „Mehr als die Hälfte der neuen Ano-Wähler hat zuvor eine der Regierungsparteien bevorzugten. Grund für den Wechsel ist die große Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung“, so die Autoren der Meinungsumfrage.

Fiala hält am Sparpaket fest
Es gibt keinen Spielraum für eine Aufweichung des Sparpaketes, hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala am Wochenende erneut bekräftigt. Das Konsolidierungspaket, das die Regierung in der vergangenen Woche vorgestellt hat, beinhaltet allein für dieses Jahr Einsparungen in Höhe von 94 Milliarden Kronen (3,95 Milliarden Euro).
Diese sollen durch die Streichung von nicht-investiven Subventionen, Steuererhöhungen und Personalabbau im Staatsapparat erreicht werden. Außerdem sollen, wie mehrfach berichtet, die Renten weniger stark steigen als bislang im Gesetz festgelegt.
Inflation höher als erwartet
Das Nicht-Euro-Land Tschechien leidet immer stärker
unter einer hohen Inflation. Statt – wie ursprünglich prognostiziert – 9,3 Prozent wird die Preissteigerung laut einer Schätzung der EU in diesem Jahr auf 11,9 Prozent ansteigen. Beim Bruttoinlandsprodukt erwarten die EUWirtschaftsexperten ein leichtes Plus von 0,2 Prozent, was jedoch deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 2,6 Prozent liegt.
Gedenken an ermordete Roma

Nach Václav Havel hat Präsident Petr Pavel als erst zweites Staatsoberhaupt am Wochenende am Gedenken an die von den Nazis im KZ Lety ermordeten Roma teilgenommen. Von August 1942 bis Mai 1943 waren hier insgesamt 1308 Roma inhaftiert. 327 davon starben in Lety, mehr als 500 Personen wurden nach Auschwitz verschleppt. Im kommenden Jahr soll eine Gedenkstätte für die Roma und Sinti in Lety eröffnet werden. Rundfunk feiert 100. Jubiläum
Am Donnerstag hat der Tschechische Rundfunk sein 100. Gründungsjubiläum mit einem mehrstündigen Open-Air-Konzert im Rieger Park gefeiert und an den 18. Mai 1923 erinnert, als um 20.15 Uhr die erste regelmäßige Radiosendung, ein einstündiges Konzert, auf Langwelle ausgestrahlt worden ist. Die Tschechoslowakei war damals nach Großbritannien das zweite Land in Europa, das regelmäßig Rundfunksendungen übertrug. Bereits am 28. Oktober 1919 wurde anläßlich des ersten Jahrestages der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik die erste Rundfunksendung übertragen.
Kursaison offiziell eröffnet
Mit der Segnung der Quellen ist am Samstag in Marienbad die Kursaison offiziell eröffnet worden. Die Feier ist eine der größten Veranstaltungen in der Stadt und blickt auf eine mehr als zweihundertjährige Tradition zurück. Es handelt sich allerdings um ein symbolisches Ereignis, da die Kurzeit in Marienbad das ganze Jahr über andauert.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Europa als Leuchtturm der Freiheit


Die grenzüberschreitenden Paneuropa-Tage im polnischen Stettin und im zu Mecklenburg-Vorpommern gehörenden Greifswald, die die Paneuropa-Union Deutschland gemeinsam mit der Paneuropa-Union Polen veranstaltet hat, sind im Zeichen einer künftigen europäischen Sicherheitsarchitektur, der geostrategischen Lage im Ostseeraum und der regionalen Kooperation gestanden.

Die Gäste kamen nicht nur aus Deutschland und Polen, sondern auch aus der Ukraine, Frankreich, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Rumänien, Slowenien, Spanien, Litauen und der Tschechischen Republik. Sie wurden bei der Eröffnung im Stettiner Radisson Blu Hotel von Damian Greś, dem Direktor für Regionale Zusammenarbeit in der Woiwodschaft Westpommern, willkommen geheißen. Die Themen Freiheit und Sicherheit in Europa seien, so Greś, aktueller denn je, „und die Geschichte unserer Region ist eine geeignete Grundlage dafür.“
Daran knüpfte der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Knut Abraham, Präsidiumsmitglied der Paneuropa-Union Deutschland und Mitglied des Sudetendeutschen Rates, in seiner Festrede an: „Deutsche und Polen verbinden, aber trennen auch tausend Jahre Nachbarschaft. Die Spuren davon sind überall zu sehen – die ganz furchtbaren, aber auch die, die zeigen, daß unsere Völker viele Jahrhunderte lang eng miteinander verknüpft waren und es heute wieder sind.“

Der langjährige deutsche Gesandte in Warschau betonte: „Politik in Europa setzt Wissen um Geographie und Geschichte voraus.“ Das Wissen in Deutschland über Polen sei aber katastrophal unterentwickelt, was sich auch auf das Wissen über Mitteleuropa insgesamt ausdehnen lasse. Abraham sprach sich dafür aus, gemeinsam Fragen zu stellen und daraus sowohl Definitionen als auch Visionen zu folgenden Themen zu entwickeln: „Was bedeutet Föderalismus in der EU? Welche Rolle hat zukünftig der Nationalstaat?“
Auch diejenigen, die die Nation und den Nationalstaat als zentral betrachteten, sollten dabei auf ein Zusammenwirken in der EU abzielen: „Europa ist kein Platz für Gladiatorenkämpfe der Staaten, bei denen es um Dominanz, Unterliegen und Tricks geht.“ Volksgruppen und Minderheiten dürften nicht als Fünfte Kolonnen diffamiert werden, an ihrer Lage sehe man es aber oft zuerst, wenn der Nationalismus in tiefe Krisen führe.
Der Abgeordnete kritisierte, daß die Kinder der deutschen Minderheit in Polen nur eine Schulstunde pro Woche in ihrer Muttersprache hätten, forderte aber auch mehr Polnisch-Unterricht in Deutschland, vor allem in den Nachbarregionen.
Der internationale Präsident der Paneuropa-Union, Alain Terrenoire aus Paris, drückte Polen seine „Dankbarkeit für sein menschliches, politisches, militärisches und finanzielles Engagement in Sachen Ukraine“ aus.

Putin sei „geblendet von seinem revanchistischen Stalinismus und hat daher nicht nur den Mut der Ukrainer, sondern auch die Entschlossenheit der Europäer, sie zu verteidigen, unterschätzt“.
Es sei „unsere Aufgabe, auch Moldau und Georgien, wenn sie darum bitten, bei der Befreiung ihrer von Rußland besetzten Gebiete zu unterstützen“. Der französische Europapolitiker forderte deshalb mehr sicherheitspolitisches Engagement: „Wir müssen uns endlich mehr um unsere ei-
gene Verteidigung kümmern und unsere externen Abhängigkeiten unbedingt überprüfen.“
Als größte Handelsmacht der Welt könne sich die EU nicht länger vor ihrer weltpolitischen Verantwortung drücken: „Es ist die Zeit gekommen, die der Gründer der Paneuropa-Union, Richard Coudenhove-Kalergi, bereits vor 100 Jahren verkündete, in der es gilt, sich zu versammeln, zu vereinen und zu schützen. Erst dann können wir das mächtige, unabhängige, souveräne und solidarische Europa aufbauen, von dem unser Überleben abhängt.“
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt, erinnerte an einen seiner Vorgänger, den Adenauer-Minister Hans Joachim von Merkatz, der gebürtiger Pommer gewesen ist und die übernationale Funktion seiner alten Heimat immer wieder hervorgehoben hat. Nach dem Sturz des Kommunismus 1989 habe der Paneuropäer Alfred Gomolka als erster demokratisch gewählter Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern die deutsch-polnische Euregio Pomerania ins Leben gerufen. „Dabei fand er auf der polnischen Seite sensible, mutige und aufgeschlossene Partner.“ Der gebürtige Breslauer sei später als Vizepräsident der PaneuropaUnion Deutschland und Mitglied des Europäischen Parlamentes zu einem Motor des EU-Beitritts sowohl der Baltischen Staaten als auch Polens geworden. Posselt zeigte Parallelen zwischen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Polen und mit der Tschechischen Republik auf. Er kritisierte die „überfallartigen Grenzschließungen“ in der Corona-Zeit als „staatliches Macho-Gehabe, nur um zu demonstrieren, daß man wer ist und alles im Griff hat“. Die Menschen beidseits der Grenze hätten darauf mit Transparenten reagiert, auf denen stand: „Wir brauchen Euch!“ Dies müsse zur Devise Europas werden, „denn wir brauchen alle einander“.

Als Positivbeispiel deutschpolnischer Versöhnung erwähnte Posselt das von dem anwesenden Ernst Schröder organisierte Treffen der heimatvertriebenen
Kolberger in dieser heute polnischen Stadt, die dabei freundschaftliche Unterstützung leistete. Er rief zudem dazu auf, sich Polens Initiative anzuschließen und „die alte ostpreußische Hauptstadt künftig nicht mehr nach einem stalinistischen Massenmörder ‚Kaliningrad’ zu nennen, sondern wieder die aus dem Mittelalter stammende Bezeich-
nung ‚Königsberg’ zu nutzen, die auf den böhmischen König Přemysl Otokar II. zurückgeht“.
Der Festakt war von der Präsidentin der Paneuropa-Union Polen, Ewa Maria Goliszek, eröffnet worden. Sie begrüßte, daß der deutsch-polnische Kongreß in zwei Partnerstädten stattfinde, nämlich Stettin und Greifswald.
Dafür gebe es außer der Schönheit dieser Orte drei Hauptgründe: Die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Entwicklung der Metropolregion Stettin für die Schaffung effektiver polnisch-deutscher Kooperationsnetze im politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich sowie in der Raumplanung; die Notwendigkeit, gemeinsam die Zukunft der Euroregion Pomerania zu gestalten, die durch eine nachhaltige Entwicklung des Grenzlandes zur Festigung der EU führen solle, sowie die Bedeutung des einzigartigen Vertragsmodells der Euroregion als Wegweiser für eine gute Zusammenarbeit, die neben der politischen und wirtschaftlichen auch die soziale und die kulturelle Sphäre stärke und „Werte wie Frieden, Freiheit und Sicherheit fördert, die in der heutigen Welt so wichtig sind“.
Ewa Maria Goliszek mahnte zudem, „die Abwesenden bei diesem Kongreß nicht zu vergessen“, insbesondere den Präsidenten der Paneuropa-Union Ukraine, Prof. Ihor Zhaloba, „der derzeit an vorderster Front steht und die Unabhängigkeit der Ukraine sowie den Frieden von uns allen verteidigt“.
Der politische Teil der Paneuropa-Tage mündete in ein internationales Symposion in der historischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald, das Bernd Posselt mit einem Impulsreferat eröffnete. Darin rief Posselt dazu auf, endlich eine echte Europäische Armee zu begründen, die die nationalen Armeen zwar nicht ersetze, aber wesentlich ergänze. Sie müsse über alle drei Waffengattungen – Heer, Luftwaffe und Marine – verfügen und als multinationale Truppe zur Friedenssicherung für den Dienst jedes EU-Bürgers offenstehen. Darüber hinaus sollte, so Posselt, jeder Europäer „das Recht haben, in jedem EU-Land seinen Wehrdienst abzuleisten beziehungsweise als Zeit- oder Berufssoldat zu dienen.“



Zur Förderung des europäischen Bewußtseins schlug der Paneuropa-Präsident vor, eine gemeinsame europäische Militäruniform zu schaffen. Viel wichtiger sei aber eine gemeinschaftliche Produktion und Beschaffung von Rüstungsmaterial, „das
Europa auch auf diesem Gebiet endlich unabhängig und eigenständig macht“. Die Nato sei nach wie vor unverzichtbar, müsse aber künftig aus zwei Säulen bestehen, „den Vereinigten Staaten von Amerika und den Vereinigten Staaten von Europa, die es auch in der Außen- und Verteidigungspolitik dringend aufzubauen gilt“. Sobald es ein Europäisches Marinekommando gebe, solle man überlegen, dieses in Stettin und einer entsprechenden Küstenstadt von Mecklenburg-Vorpommern einzurichten. Ein zweites Impulsreferat hielt die junge Paneuropa-Vorsitzende der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Anastasija Hazenko. Die Europäische Union sei ein Leuchtturm der Freiheit, der Sicherheit und der Rechtsstaatlichkeit: „Für uns bleibt die Einigung Europas von der Ostsee über das Schwarze Meer bis zum Mittelmeer nicht nur ein Ziel, das wir erreichen wollen, sondern ein Traum, den wir ins Leben umsetzen müssen.“ Die Ukraine sei ein europäisches Land, das in den letzten Jahren erhebliche Erfolge bei der Reform der Wirtschaft und der Modernisierung der Infrastruktur erzielt habe. Die Paneuropa-Union spiele eine wichtige Rolle „auf dem Weg zu Freiheit und Stabilität. Krieg bringt Armut und Ungerechtigkeit.“
Zu Beginn des Podiums, das Michael Gahler, Ukraine-Berichterstatter des Europäischen Parlaments und Vizepräsident der Paneuropa-Union Deutschland mit Reichenberger Wurzeln, gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden der PaneuropaJugend Deutschland, Christian Hoferer, leitete, sprach der erste demokratisch gewählte Landtagspräsident von MecklenburgVorpommern, Rainer Prachtl. Der gläubige Christ und Nachkomme einer Olmützer Familie bekannte: „Mein politisches Herz hat noch nie so geblutet wie in diesem Krieg, in dem Ukrainer, aber auch junge Russen aus der Armee des Aggressors sterben.“ Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäkker habe gemeint, daß der geistige Bereich in Deutschland der am meisten vernachlässigte sei, „und ich füge hinzu: in Europa auch“. Gegen diese Fehlentwicklung kämpfe die Paneuropa-Bewegung seit Jahrzehnten konsequent und energisch an. Es gebe aber noch viel zu tun: „Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich zusammengezählt weniger Menschen in demokratischen Parteien als in einer Stadt wie Augsburg, und in meinem Heimatort gibt es nur noch neun Prozent Christen. Wir brauchen
aber die Zehn Gebote und die Bergpredigt, ebenso die Arbeiterbewegung.“ Die vielfach herrschende gefährliche Leere lasse sich nur mit begeistertem Einsatz überwinden. Václav Havel habe mit Recht gesagt: „Wir müssen diesem Europa Kathedralen bauen.“
Der Erste Sekretär der Litauischen Botschaft in Berlin, Giedrus Lingė, begrüßte die Nato-Erweiterung im Ostseeraum, wobei dem Beitritt Finnlands noch die bisher von der Türkei blockierte Mitgliedschaft Schwedens folgen müsse. Stockholm habe außerdem derzeit die EU-Ratspräsidentschaft und bemühe sich sehr, die Sicherheit im baltischskandinavischen Raum zu festigen. Die Baltischen Länder hätten früher als andere gewußt, was aus Rußland auf die Europäer zukommen werde: „Wir haben keine Wahl, als gegenüber der Aggression gegen die Ukraine zusammenzustehen.“
Der stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Europaparlament, Niclas Herbst aus Ratzeburg, vertrat die These, daß die Europapolitik trittsicher den schmalen Grat zwischen Beseeltheit und Entrücktheit gehen müsse. Es sei zwar wahr, daß die Verantwortlichen im EU-Maschinenraum manchmal die europäischen Visionen nicht ausreichend im Blick behielten; auf der anderen Seite vergäßen die Verfechter von Visionen zuweilen, daß diese auch umgesetzt werden müßten. Es sei ein Erfolg des Europaparlamentes, daß im Ringen mit dem Rat die Kürzung der Interreg-Mittel verhindert werden konnte. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Subsidiarität müßten auch durch ausreichende finanzielle Mittel abgesichert werden. Davon profitiere die Euroregion Pomerania ganz erheblich.

Der ehemalige Bundestagsund Europaabgeordnete Milan Horáček, mährischer Paneuropäer und Mitbegründer der Grünen in Deutschland, betonte, daß er sich immer für inneren und äußeren Frieden eingesetzt habe, aber seit dem sowjetischen Einmarsch in seiner Ursprungsheimat in der Tschechoslowakei 1968 niemals dem in gewissen Kreisen verbreiteten sektiererischen Pazifismus verfallen sei. Dies mache schon der Einsatz für die Menschenrechte notwendig, und wenn internationales Recht gebrochen werde, dann müsse man die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Ein von ihm 2005 verfaßter Gastkommentar in der FAZ sei dementsprechend unter dem Titel „Gleiches Recht für die Ukraine“ erschienen. Damals habe er sich
mit Gerhard Schröder und Joschka Fischer auseinandersetzen müssen, die zwar die Türkei in die EU aufnehmen wollten, aber nicht die Ukraine. Fehlhaltungen im Westen und das russische Dominanzstreben hätten zum freiheitlich-europäischen Aufbruch auf dem Maidan in Kiew geführt, gegen den jetzt Rußland seinen Krieg entfesselt habe. Trotz aller Schwierigkeiten sei ganz klar: „Wir müssen alles machen, damit die Ukraine so rasch wie möglich Teil der EU wird!“ Der Präsident der UkrainischDeutschen Gesellschaft, Nestor Aksiuk, hob hervor, daß seine Heimat immer ein europäisches Land gewesen sei und zur europäischen Familie zähle. „Aber Europa hat sich der Ukraine als Bollwerk gegen Rußland bedient, ohne dafür entsprechende Verpflichtungen zu übernehmen.“ Der Angriff Rußlands sei kein Krieg, „sondern ein Genozid. Die russische Armee kämpft nicht gegen eine andere Armee, sondern gegen Zivilisten, gegen Kinder und Frauen, und zerstört systematisch Kirchen und ukrainisches Kulturgut.“
Prof. Pavo Barišić, internationaler Generalsekretär der Paneuropa-Union und ehemaliger Wissenschaftsminister von Kroatien, bezeichnete seine Fahrt mit seinem aus Bosnien-Herzegowina stammenden Stellvertreter Vanja Gavran nach Stettin und Greifswald als „eine historische Reise“. Zum ersten Mal habe es auf dem Weg von Zagreb an die Ostsee keine Paßkontrollen mehr gegeben, weil seine Heimat endlich Teil des Schengen-Raumes geworden sei. Diesen Erfolg gilt es zu bewahren.“ Von Kroatien an der Adria und Spanien am Eingang des Mittelmeeres bis hin nach Polen und zu den Baltischen Staaten wehe die Flagge der Europäischen Union: „Gerade so hat es vor genau 100 Jahren unser Gründer Coudenhove-Kalergi vorhergesagt.“
Der Generalsekretär der Paneuropa-Union Spanien, Prof. Carlos Uriarte Sánchez, skizzierte die Ziele und Vorhaben der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes im zweiten Halbjahr 2023. Diese werde von sich radikal verändernden geopolitischen Rahmenbedingungen geprägt sein, „an die wir Europäer uns ständig anpassen müssen, wenn wir relevant sein wollen“.

Die EU werde global mit „unreguliertem, geschlossenem Wettbewerb und harter Macht“ konfrontiert. Darauf müsse man sich vorbereiten „durch strategische Autonomie sowie eine realistische Außen- und Sicherheitspolitik“. Spanien stehe zum ukrainischen Bemühen, „die von Rußland besetzten Territorien zu befreien“. Madrid werde die EUErweiterung auf dem Westbalkan weiterhin unterstützen, die Mittelmeer-Union wiederbeleben und einen Schwerpunkt auf die Beziehungen mit Lateinamerika und Afrika legen.
Die beiden Podiumsleiter, Michael Gahler und der Bundesvorsitzende der Paneuropa-Jugend Deutschland, Christian Hoferer, setzten ebenfalls wesentliche Akzente. Michael Gahler unterstrich, daß die EU die Ukraine nicht nur unterstützen müsse, sondern von der Zusammenarbeit mit diesem großen europäischen Land und dessen Beitritt auch stark profitieren werde. Christian Hoferer, der ebenfalls sudetendeutscher Herkunft ist, mahnte einen strategischen Dialog über den Vorschlag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an, den französischen Atomschirm auf die EU auszudehnen: „Wie das Ergebnis aussieht, kann heute niemand sagen, aber einfach nur totschweigen ist keine Antwort.“

■ Bis Dienstag, 3. Oktober: Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Dienstags bis sonntags 9.00 bis 18.00 Uhr. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg.
■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr:
Sudetendeutsches
Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: The-

menführung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00
Uhr: Familienführungen. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
14.00 bis 15.00 Uhr: „Götz Fehr:
Tu Austria felix“ – eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45
Uhr sowie 18.00 bis 18.30 Uhr:
Tanzperformance „Fremde
Freunde“. 16.00 bis 17.00 Uhr:
Themenführung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Eva Haupt.
■ Sonntag, 21. Mai, 14.00
Uhr, SL-Heimatkreis Braunau: Eröffnung der Ausstellung „Domov/Heimat – Adalbert Meier – Fotografien“. Anläßlich des Internationalen Museumstags werden Abzüge von historischen Glasnegativen aus Wekelsdorf gezeigt. Braunauer Heimatmuseum, Paradeplatz 2, Forchheim.
■ Mittwoch, 24. Mai, 18.30
Uhr, Sudetendeutsches Museum: Vortrag von Gastrosoph
Dr. Peter Peter über „Die Böhmische Köchin“. Eintritt frei. Sudetendeutschen Museum, Hochstraße 10, München. Im Anschluß (kostenpflichtig): Restaurant Bohemia, Grünwalder Straße 71, München. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de
oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg. Siehe Seiten 21 bs 24.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Sonntag, 28. Mai, SL-Bezirk Oberfranken: Busfahrt zum
VERANSTALTUNGSKALENDER

Sudetendeutschen Tag. Für
Raum Bayreuth: Abfahrt Warmensteinach Freizeithaus 5.15
Uhr, Weidenberg Bahnhof 5.30
Uhr, Bayreuth Bahnhof 6.00 Uhr, Creußen Diska 6.10, Pegnitz
Wiesweiher 6. 30 Uhr. Für Raum
Bamberg: Bamberg Bahnhof 5.30
Uhr, Forchheim Altenheim (Bayreuther Straße15) 6.00 Uhr. Rück-
fahrt: Abfahrt um 16.00 Uhr. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54, bei Helmut Hempel unter Telefon (0 92 77) 16 40 oder beim jeweiligen Kreisvorsitzenden.
■ Dienstag, 30. Mai, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin
Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Dienstag, 30. Mai, 17.30

Uhr: Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch. Pfarrer i. R. Franz Pitzal erinnert an das grausame Geschehen. Glockenspiel bei der Mediathek, Jahnstraße, Renningen.
■ Samstag, 3. Juni, 15.00
Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Eröffnung der Ausstellung „verloren, vermisst, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Die Ausstellung wird bis zum 30. Juni gezeigt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung zur Eröffnung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.
■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr.
Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com
■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.

■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.
■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Donnerstag, 15. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz) und Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg: Vortrag von Thomas Kabisch über „Musik und Philosophie zwischen West und Ost. Vladimir Jankélévitch in Prag“. Weinschenkvilla, Hoppestraße 6, Regensburg. Eintritt frei.
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.
■ Dienstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Ringveranstaltung mit Vortrag von Dr. Michael Hen-
ker über „Die Entwicklung der Museumslandschaft in Bayern“ und anschließendem Empfang. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 48.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.
■ Samstag, 1. Juli, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn. (Achtung, verschoben von ursprünglich 10. Juni auf jetzt 1. Juli.)
■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen von OB Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz. Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Samstag, 8. bis Sonntag 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net
■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: Feierstunde Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.
❯ Ausstellung zu Flucht, Vertreibung und Integration
Ungehört – die Geschichte der Frauen
■ Donnerstag, 15. Juni, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung und Integration“ mit Schirmherrin Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Vertriebene und Aussiedler. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten Millionen von Deutschen ihre Heimat im östlichen Europa verlassen. Es waren vor allem Frauen, die sich auf den beschwerlichen Weg machten.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs Zeitzeu-
ginnen, die aus unterschiedlichen Regionen des östlichen Europas stammen. Ihre Wege durch die Nachkriegsgeschichte weisen Gemeinsamkeiten auf – und sind dennoch jeder für sich ganz besonders. Ria Schneider aus der Batschka, Emma Weis und Friederike Niesner aus Mähren, Gertrud Müller aus Oberschlesien, Rosemarie Becker aus Pommern und Edith Gleisl aus Ostpreußen.
Als Kinder mußten die Zeitzeuginnen schnell erwachsen werden und Verantwortung für sich und andere übernehmen. Die engste Bezugsperson war oft die Mutter.
Israel – das Heilige Land und seine Dauerkrise
■ Dienstag, 23. Mai, 19.00 bis 21.00 Uhr, Online-Seminar: „Israel –das Heilige Land und seine Dauerkrise“. Gespräch mit dem Analysten, Orientalisten und Historiker Matthias Hofmann.
Der Vortrag will versuchen, die jüngsten Geschehnisse im Nahen Osten zu erklären. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung nach 1918, dem Ende des Osmanischen Reichs, beleuchtet. Was ist aus dem Land geworden, in dem Milch und Honig fließen, wie es im Alten Testament heißt? Wie wichtig sind Religionen im Nahen Osten? Wie entstand der Staat Israel? Wer sind die Palästinenser? Was ist die Hamas? Welche Nationen verfolgten und verfolgen welche Interessen im Nahen Osten? Kann es einen dauerhaften Frieden in dieser Region geben?
Link zur Registrierung auf der Homepage www.heiligenhof.de Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
❯ Mit Urkunde beim Award „Europas Museum des Jahres“ geehrt

Sudetendeutsches Museum
präsentiert sich in Europa
Allein die Nominierung für den Award „Europas Museum des Jahres 2023“ war ein Erfolg. Bei der Preisverleihung in Barcelona hat sich das Sudetendeutsche Museum als eines von nur drei Einrichtungen in Deutschland auf der europäischen Bühne präsentiert.

Es war eine Freude, inmitten hochkarätiger und inspirierender Museen gewesen zu sein und neue, internationale Freundschaften zu schließen“, zog Dr. Stefan Planker, Direktor des Sudetendeutschen Museums, Bilanz.
Bei der Präsentation hatte das Sudetendeutsche Museum vor dem internationalen Fachpublikum gezeigt, daß es nicht nur eine Lücke in der Münchner, sondern auch der europäischen Museumslandschaft schließt.

Die Münchner Einrichtung ist das erste Museum, das der vielfältigen Völkergruppe aus den böhmischen Ländern gewidmet ist und sowohl ihre Glanzmomente als auch Tiefpunkte aufzeigt.
Hierbei werden im Sudetendeutschen Museum die europäischen Werte von Menschenrecht und Demokratie unterstrichen. Heimat, Nationalismus, Vertreibung und Neuanfang – von den zentralen Themen des Sudetendeutschen Museums und der multimedialen Aufbereitung in Deutsch, Englisch und Tschechisch waren auch die Mitglieder der Jury beeindruckt.
Unter den 33 Museen, die sich auf der Jahrestagung des Europäischen Museumsforums in Barcelona präsentierten, waren neben dem Sudetendeutschen Museum nur zwei weitere Häuser

aus Deutschland – das Deutsche Museum in Nürnberg und das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhung in Berlin. Am Ende verlieh die Jury den Titel „Europas Museum des Jahres 2023“ an das 1983 eröffnete Museum für Ethnologie in Valencia. TF

❯ Ehrensache Ehrenamt: Professor Stefan Samerski, Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaft und Künste
Alles begann mit einem Kalenderfoto
Über einen Kalender begann das Interesse von Professor Stefan Samerski für die böhmischen Länder. Heute forscht und lehrt er unter anderem zu diesen Gebieten. Samerski ist Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, gefragter Vortragsredner im Sudetendeutschen Haus, Professor mit Lehraufträgen unter anderem im internationalen Priesterseminar Redemptoris Mater in Berlin und an der Ludwig-MaximiliansUniversität München.
Was jedoch wenige wissen, ist, wie der Theologe und Historiker sein Interesse für die böhmischen Länder entdeckt hat, nämlich auf der heimischen Küchenbank in seiner Geburtsstadt Köln. „Ich sehe ihn noch heute daliegen“, sagt er und meint den Sudetendeutschen Kalender, den eine Nachbarin seiner Mutter geschenkt hatte. Auch sie war eine Vertriebene: Die Nachbarin stammte aus den böhmischen Ländern, die Eltern von Samerski aus Danzig. Und aus dieser Verbundenheit heraus gelangte nun der Kalender in die Hände von Stefan Samerski, damals noch Student.


Er war sofort angetan von einem Bild von Karlsbad: „Da müssen wir hin“, teilte er seiner Mutter sofort mit. Und tatsächlich fuhren sie – noch Ende der 1980er Jahre und vor dem Fall des Eisernen Vorhangs – gemeinsam in den weltberühmten böhmischen Kurort und von da an immer wieder. „Aus gesundheitlichen und historischen Gründen“, sagt Samerski mit einem Lachen und ergänzt: „Damals wurde mein Interesse für die kulturellen Ereignisse geweckt, die mit dem Bäderdreieck zusammenhängen.“
Die Familie Samerski begann, auch andere Personen aus ihrem Umfeld für die Fahrten nach Karlsbad zu begeistern. Beides ist Stefan Samerski bis heute geblieben: seine Leidenschaft für die böhmischen Länder und seine Freude daran, Wissen über diese Region und ihre Kultur und Geschichte an andere Menschen weiterzugeben. Dabei richtet er sich bewußt an verschiedene Adressatenkreise: an die wissenschaftliche Fachwelt ebenso wie an ein breites Publikum. „Mir machen Vorträge vor einem interessierten Publikum am meisten Spaß“, sagt er, „egal, ob wissenschaftlich oder
einer Sitzung der Sudetendeutschen Bundesversammlung
allgemein.“ Ebenso viel Freude bereitet ihm die Arbeit in Archiven, um aus dem Studium von zum Teil bisher nicht erforschten Quellen und Akten neue Erkenntnisse zu gewinnen. Daß an diesen historischen Fakten ein allgemeines Interesse besteht, erlebe er immer wieder. Darum streue er auch gerne neue Erkenntnisse öffentlich. „Für mich gehören Forschung und Lehre zusammen“, sagt er. Bereits seit 2010 hält er Jahr für Jahr einen Vortragszyklus im Sudetendeutschen Haus. Zunächst umfaßte ein Zyklus sechs Vorträge im Jahr, mittlerweile sind es vier. An Themen herrscht kein Mangel. Aktuell stehen Kultur und Geschichte der böhmischen Schlösser im Fokus. In den Jahren zuvor hat Samerski über „Geschenke der Natur Böhmens“ ebenso refe-

riert wie über böhmische Religions- und Frömmigkeitsgeschichte, über Schicksalsjahre der böhmischen Geschichte, über Nationalsymbole und über bekanntere und bis lang unbekanntere Persönlichkeiten der böhmischen Historie. Wissenschaftlich hat Samerski in den 1990er Jahren begonnen, sich mit den böhmischen Ländern zu befassen, die er religionshistorisch sehr faszinierend findet: „Die Reformationsgeschichte fängt mit Jan Hus in Böhmen an. In den Ländern der Wenzelskrone überlebten Denominationen, die es andernorts nicht in dieser Form gab.“ In seiner Habilitationsschrift untersuchte er Selig- und Heiligsprechungsprozesse in der katholischen Kirche und in diesem Kontext auch böhmische Heiligen wie etwa Johannes (Jan) Sarkan-
Seit einigen Wochen ist mein Italienisch-Wortschatz um einen Begriff reicher. Gelernt habe ich ihn von Papst Franziskus. Während seines Besuchs in Budapest am letzten Aprilwochenende traf er seine ungarischen Mitbrüder aus dem Jesuitenorden. Im Gespräch, das schriftlich dokumentiert vorliegt, wurde er nach seiner Meinung über die alte Form der Meßfeier in lateinischer Sprache gefragt. Franziskus nützte die Antwort zur grundsätzlichen Kritik an der Einstellung mancher Katholiken, frühere Formen des kirchlichen Lebens zu verklären und gegenwärtige Formen zu ignorieren oder abzulehnen.


Dabei fiel der mir bislang unbekannte Begriff „Indietrismo“. Er leitet sich vom italienischen Adverb „indietro“ ab, was „zurück“ oder „rückwärts“ heißt. Vor diesem Hintergrund könnte man das Wort mit „Rückwärtsgewandtheit“ übersetzen. Das Übersetzungsprogramm meines Computers schlägt mir die Variante „Rückständigkeit“ vor. Ich halte sie für nicht passend, denn dem Papst scheint es mit dem besagten Begriff um eine Haltung zu gehen, die man frei wählen kann. „Rückständigkeit“ ist dagegen eher ein Zustand, und Zustände sind im Leben nicht immer frei wählbar.

der. Später beschäftigte er sich am Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas (GWZO) mit der Konfessionalisierung im Bistum Olmütz. Diese Forschungen stärkten seinen Kontakt mit der Ackermann-Gemeinde, mit der gemeinsam er mehrere Bücher publiziert hat: die Sammelbände „Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultur“ (2018) und „Die Landespatrone der böhmischen Länder“ (2009), sowie eine Studie über „Alt-Bunzlau/ Stará Boleslav. Ein wiederentdeckter Wallfahrtsort“ (2014). Auch andere sudetendeutsch geprägte Institutionen lernte er im Zuge seiner Forschungen näher kennen, beispielsweise die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Seliger-Gemeinde, in deren Archiv er zu sudetendeutschen Sozialdemokraten in Schweden forschte.



2015 wurde er als Mitglied der Geisteswissenschaftlichen Klasse der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste berufen. Von 2017 bis 2021 engagierte er sich als Sekretar der Klasse, und seit 2019 ist er ihr Vizepräsident. Die Sudetendeutsche Akademie ist als ein Forum des akademischen Austauschs gedacht und versammelt Wissenschaftler mit einem Bezug zu den böhmischen Ländern. Dieser Bezug können familiäre Wurzeln ebenso sein wie Forschungsarbeiten zu der Region.
Die Akademie gliedert sich in drei Klassen, die geisteswissenschaftliche, die naturwissenschaftliche und die künstlerische. Jede ist alle drei Jahre verantwortlich für die Publikation eines Sammelbands in der Reihe Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Der Band des Jahres 2022 oblag der Geisteswissenschaftlichen Klasse, für die Professor Samerski einen Sammelband zum Thema „Akademie und Universität – Aus der Perspektive der Eigenidentität und der historischen Erinnerung“ ediert hat.
Wenn es um die Sudetendeutsche Akademie geht, liegt Samerski vor allem deren Brückenfunktion am Herzen –zwischen den Nationen und den Generationen: „Wir haben gute Verbindungen nach Tschechien und in die Slowakei“, sagt er. „Diese sollten wir weiter ausbauen.“ Zugleich könne die wissenschaftliche Vernetzung dazu dienen, neue Generationen anzusprechen.
Dr. Kathrin Krogner-KornalikDoch genug der sprachlichen Erwägungen über ein Wort aus päpstlichem Munde. Wichtiger ist, was Franziskus von der Rückwärtsgewandtheit hält. Es handle sich, so wird er zitiert, um „eine Reaktion gegen die Moderne“ und um „eine nostalgische Krankheit“. Das Zweite Vatikanische Konzil befinde sich nach Meinung des Papstes immer noch in der Umsetzung, und es gebe in der Kirche einen „schrecklichen“ Widerstand gegen die Konzilsdekrete.
Manch einer wird sich jetzt denken: „Soweit, so gut. Ich bin von der päpstlichen Kritik nicht betroffen. Sie zielt auf eine Gruppe, zu der ich nicht gehöre.“ Tatsächlich: In unseren kirchlichen Breiten sind die Dekrete des Zweiten Vatikanischen Konzils letztlich doch mehrheitsfähig. Sie prägen und bestimmen das kirchliche Leben in den Diözesen, Gemeinden, Verbänden und Ordensgemeinschaften. Doch läßt sich damit die päpstliche Kritik getrost ad acta legen? Oder findet sich in der Stellungnahme von Papst Franziskus nicht auch ein Hinweis auf eine Versuchung, von welcher die Kirche, aber auch die Gesellschaft weit mehr angekränkelt ist, als wir uns manchmal eingestehen wollen?
Es geht um die Versuchung zur Nostalgie. In den sich stark verändernden Zeiten, in denen wir leben, sehnen wir uns nach Sicherheit. Und manchmal meinen wir, diese Sicherheit vor allem im Rückgriff auf die Vergangenheit zu finden. „Früher war alles besser“, sind wir dann versucht zu sagen. Doch war früher tatsächlich alles besser? Sicher ist: Es war anders, ob es deswegen gleich schon besser war? Jesus sagte einmal: „Keiner, der die Hand an den Pflug legt, und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.“ Ich meine, daß gerade die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten eine gute Möglichkeit darstellt, nach vorne, anstatt zurückzuschauen. So werden wir auch das stets neue Wirken des göttlichen Geistes besser wahrnehmen können.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München

❯ Redemptorist aus dem Braunauer Ländchen
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
90jähriger Professor promoviert


Erfolgreich verteidigte der aus dem Kreis Braunau stammende Redemptorist und Philosoph Augustin Schmied vorige Woche seine Dissertation in der Universität Innsbruck. Nadira Hurnaus berichtet.
Pater Augustin Schmied lernte ich auf dem Rücksitz eines SUV kennen. Das war 2015 auf dem Weg vom Sudetendeutschen Haus in München nach Marienbad zu den gleichnamigen Gesprächen des Sudetendeutschen Rates (SR). Der Pater wollte die Gespräche geistlich und ich journalistisch begleiten. Wir hatten das Mitfahrangebot Richard Kratschmars, des aus Brünn stammenden damaligen SR-Geschäftsführers, gerne angenommen.
Pater Augustin war aus dem Redemptoristenkloster im oberbayerischen Gars gekommen. Das hatte Herzog Tassilo III. von Bayern 768 gegründet. Eine andere Tassilo-Gründung war 782 das Kloster Frauenchiemsee, in dem ich drei Jahre lang Internatsschülerin war. Eine gute Grundlage für Marienbader Vorgespräche.
Er sei, erzählte Pater Augustin, 1932 in Deutsch Wernersdorf an der Grenze zu Niederschlesien zur Welt gekommen. 1945 hätten die Tschechen ihn mit seiner Familie wild nach Polen vertrieben. Die Polen hätten mit den Sudetendeutschen nichts anzufangen gewußt und sie nach Breslau durchgewunken. Auch dort seien sie nicht willkommen gewesen und dank eines verwandten Geistlichen wieder in die Heimat im Braunauer Ländchen gekommen. Doch es habe nicht lange gedauert, bis die Tschechen sie schließlich „geordnet“ vertrieben hätten.
„Augustin Schmied trat nach der Vertreibung in die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen ein und widmete sich Zeit seines Lebens neben seiner seelsorgli-
Marienbad 2015: Pater Augustin spricht vor dem Sudetendeutschen Rat und besucht den Jüdischen Friedhof. Bilder (3): Nadira Hurnaus
stitut für Lehrerfortbildung in Gars unterbrachen das. Sein Dissertationsprojekt führte er über Jahrzehnte als Buchmanuskript weiter. Die „Fidesimplicita-Theorie“ bildete lange Zeit eine Kontroverse zwischen katholischer und evangelischer Theologie. Im Vorlauf von Rahners „Anonymen Christen“ geht es im Kern darum, ob es für den Glauben ein explizites Bekenntnis braucht oder ob man zum Beispiel auch durch sein Handeln unbewußt Christ sein kann.
Der Rahnerexperte und seit 2022 emeritierte Professor Roman Siebenrock hatte Schmieds Arbeit betreut und erstbegutachtet. Das Nachrichtenportal der Redemptoristenprovinz WienMünchen berichtet über die Defensio in Innsbruck:
Bad Kissingen 2017: Heimatkreismitglied Pater Augustin zelebriert mit Pfarrer Martin Lanži aus Braunau die Messe bei den 33. Braunauer Heimattagen. Bild: Pavel Trojan

chen Tätigkeit der theologischen Lehre. Viele Jahre lang unterrichte er als Professor an den Ordenshochschulen im oberbayerischen Gars am Inn und im rheinländischen Geistingen. Lange war er auch Schriftleiter der Zeitschrift ,Theologie der Gegenwart‘ und verfaßte Artikel und Bücher über wichtige Themen des christlichen Glaubens und des kirchlichen Lebens. 2008 zeichnete ihn die Universität Erfurt für sein Gesamtwerk mit der theologischen Ehrendoktorwürde aus“, schrieb Pater Martin Leitgöb im Jahr 2014 in dieser Zeitung.
Pater Martin ist ebenfalls Redemptorist und war damals Seelsorger der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Prag.

Ein Jahr nach Pater Augustin begleitete er die Marienbader Gespräche mit seinem geistlichen Beistand. Mittlerweile ist er Kolumnist der Sudetendeutschen Zeitung und Provinzial der Redemptoristenprovinz Wien-München. In dieser Eigenschaft war er in dem Gremium, vor dem Pater Augustin seine Dissertation verteidigte.
Pater Augustin verteidigt seine Dissertation. Bilder (2): Rendika Nugraha
1957 hatte die Leitung der Provinz Mün-
❯ Jägerndorfer Urgestein
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
20/2023
Am 17. Mai feierte der langjährige und überaus kundige Heimatkreisbetreuer Kurt Schmidt, Vorsitzender des Heimatkreisvereins Jägerndorf und Herausgeber der Halbjahresschrift „Neue Jägerndorfer Nachrichten“, Initiator sowie über viele Jahre Organisator des Deutschtschechisch-polnischen Kulturwoche, 95. Geburtstag.
Kurt Schmidt kam in Vorwitz bei Hermannstadt im Kreis Freiwaldau im Altvatergebiet zur Welt und verbrachte seine Jugend am Burgberg, dem Marienfeld von Jägerndorf, wo seine Eltern die Gastwirtschaft Der Alte vom Berge betrieben. Die Volksschule besuchte er in Jägerndorf, anschließend die Oberschule, deren Unterricht das Kriegsende und der Einmarsch der Roten Armee beendeten. Er wurde Zeuge von Raub und Vergewaltigungen. Und er mußte Zwangsarbeit

Marienbad 2016: Pater Martin aus Prag feiert mit dem Sudetendeutschen Rat eine Andacht.
chen Pater Augustin freigestellt, um an der Universität Innsbruck ein Doktoratsstudium zu beginnen. Sein Doktorvater war der Jesuit Karl Rahner (1904–1984). Der vor zwei Jahren verstorbene Schweizer Theologe Hans Küng nannte Rahner den Protagonisten der Freiheit in der Theologie. Der junge Doktorand Schmied sollte über die Theorie der „Fides implicita“ dissertieren. Doch seine genannten Professuren und Veröffentlichungen sowie seine Tätigkeiten als Berater des in Würzburg angesiedelten Studienprogramms „Theologie im Fernkurs“ und als Dozent am In-


„Pater Schmied erwies sich sowohl in seinem Vortrag wie auch in der anschließenden Diskussion mit den Professoren als ein brillanter Theologe. Er überzeugte mit einer umfangreichen und tiefen Sachkenntnis ebenso wie mit seiner Fähigkeit, das Thema klar und verständlich vorzustellen. Zugleich bewies er aber auch Humor, zum Beispiel als er in der Einleitung seines Vortrags bemerkte: ,Mit meiner langen Studienzeit bin ich vielleicht nicht unbedingt ein Vorbild für heutige Studierende.‘ Die Professoren sahen das anders und bewerteten seine Doktorarbeit mit der Bestnote.“
Professor em. Roman Siebenrock
2015 hielt der so intellektuelle wie fröhliche Philosoph und Pater Augustin Schmied in Marienbad eine wunderbare Andacht. Anschließend begleitete er die Landsleute interessiert und kenntnisreich bei dem vom Kirchenhistoriker Rudolf Grulich geführten Besuch des Jüdischen Friedhofs.
Nach der Defensio die Professoren, in der Mitte der frisch gekürte Doktor Augustin Schmied CSsR und rechts Provinzial Dr. Martin Leitgöb CSsR.



PERSONALIEN
Kurt Schmidt 95
in Ostrau und Auschwitz, aus der er 1946 entlassen wurde, leisten.
Im Oktober 1946 wurde er nach Bayern vertrieben, wo er in Augsburg seine Reifeprüfung ablegte. Unter kargen finanziellen Verhältnissen ermöglichte ihm, der später promovierte, eine kirchliche Zuwendung die Aufnahme des Studiums der Theologie, der klassischen Philologie und Geschichte in Erlangen.
Seine Lehrtätigkeit begann er 1952 in Gräfenberg im oberfränkischen Kreis Forchheim, und 1955 legte er die Lehramtsprüfung in Niedersachsen ab. Das anschließende Referendariat absolvierte er in Oldenburg und Wilhelmshaven, wo er bis zu seiner Pensionierung 1993 tätig war.
Neben seinem Beruf als Lehrer leitete er als Vorsitzender den

Philologenverband, den Lehrerverband in Niedersachsen und den Beamtenbund. Schon vor seiner Pensionierung wurde Kurt Schmidt zum Heimatkreisbetreuer von Jägerndorf gewählt und übte dieses Amt bis 2014 aus. Dabei unterstützte ihn tatkräftig seine Frau Irma, geborene Heider aus Petersdorf im Kreis Jägerndorf, die 2014 starb.
Als Heimatkreisbetreuer organisierte er seit 1995 jährliche Kulturfahrten in die Heimatstadt sowie Wanderfahrten in das Altvatergebirge, sorgte für die verbliebene deutsche Minderheit unter anderem durch die 2002 erfolgte Fertigstellung des Hauses Europa, das ein Anlaufpunkt für Landsleute bei einem Besuch in Jägerndorf ist. Die Pflege und Erneuerung vieler deutscher Denkmale ist auf sei-
nen Einsatz zurückzuführen. Bei seinen Aktivitäten half ihm die Beherrschung der tschechischen Sprache, die er im fortgeschrittenen Alter erlernte.
Vor fünf Jahren wurde auf seine Initiative eine Gedenktafel für die von den Kommunisten zerstörten zwei Kirchen von Hillersdorf in der katholischen Kirche angebracht. Ein Anliegen war ihm darüber hinaus die Errichtung eines Denkmals für die Opfer des Hungermarsches nach dem Zweiten Weltkrieg nach Grulich, was 2017 geschah. Bei dem Versöhnungsmarsch zu dem Denkmal war er im vergangenen Juni in vorderster Front mitmarschiert. In seinem Beitrag „Abschied und Wiederkehr“ (➝ Seite 12) erinnert er sich an seine Heimat und an seine Heimatarbeit. Daß er noch lange für unsere Sache marschiere, wünschen die Landsleute von Herzem ihm und sich. Meinhard Schütterle/nh
Die Marienbader Gespräche des Sudetendeutschen Rates (SR) widmeten sich am ersten Maiwochenende „Tschechen und Sudetendeutschen sowie europäischen Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien“. Nadira Hurnaus berichtet.
SR-Generalsekretärin Christa

Naaß erzählte zunächst von der wenige Stunden zuvor eröffneten SR-Ausstellung „So geht Verständigung – dorozumění“ im nahen Fleißen/Plesná (Ý SdZ 19/2023). 2023, sagte sie weiter, sei ein Jahr, in dem man des Hitlerputsches vor 100, des Ermächtigungsgesetzes vor 90, des Münchener Abkommens vor 85, der Hinrichtung der Mitglieder der Weißen Rose vor 80 und des Inkrafttretens des Bundesvertriebenengesetzes vor 70 Jahren gedenke.
„Gegenwärtig herrscht zwischen uns und den Tschechen, das beste Verhältnis, das wir je hatten.“ Mit den Worten eröffnete Andreas Künne, der Deutsche Botschafter in Prag, den Referentenreigen. Er berichtete von einer Besucherdichte wie nie zuvor: Wirtschaftsminister Robert Habeck sei bereits drei-, Außenministerin Annalena Baerbock zweimal in Prag gewesen. Mit der Verunglimpfung der Sudetendeutschen, so wie es Miloš Zeman im Präsidentschaftswahlkampf 2013 mit Fürst Karl von Schwarzenberg getan habe, könne man heute keine Wahl mehr gewinnen. Künnes Fazit: „Beste Beziehungen – in zehn Jahren werden sie noch besser sein.“
Nachdem sich Florian Winzen, der neue Leiter der Bayerischen Repräsentanz in Prag vorgestellt hatte, sprach Marlehn Thieme, seit 2016 Vorsitzende des ZDFFernsehrates. Eingangs räumte sie ein, daß das ZDF zwar in der ganzen Welt, jedoch nicht in der Tschechischen Republik vertreten sei. Sie erklärte die Funktion und Arbeitsweise des Fernsehrates, sie warb für publizistische Vielfalt und einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ZDF sei für alle da und brauche eine digitale Verjüngung, um in der Breite an Akzeptanz zu gewinnen. Im Gegensatz zu Wirtschafts- und Rechnungsprüfern des ZDF rege der Fernsehrat an, die Auslandsbüros zu vermehren und die Auslandsberichterstattung zu erweitern. Peter Barton, der Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, erzählte von den schweren Anfängen. Das Büro in der Thomasgasse habe er im Mai 2002 bezogen, offiziell sei es ein Jahr später eröffnet worden. Das sei fast schon zu spät gewesen , da die Einflußsphären bereits abgesteckt gewesen seien. Dennoch habe sich das Büro bewährt, und könne häufig schnell und unbürokratisch helfen. Das habe sich herumgesprochen. Vor allem baue er Kontakte auf und pflege sie und leiste humanitäre Hilfe. „Das Menschliche muß siegen“, schloß Barton seinen Bericht aus Prag.
Die Schwestern Ellen und Janna Kaufmann studieren am Institut für Museologie der Universität Würzburg. Sie stellten

� Marienbader Gespräche
Das Geheimnis des Gelingens
„verloren, vermißt, verewigt –Heimatbilder der Sudetendeutschen“ vor. Diesen Titel trägt ihr Ausstellungsprojekt, an dem sie gegenwärtig mit der Sudetendeutschen Heimatpflege arbeiten. Zunächst schilderten sie ihre völlige Ahnungslosigkeit hinsichtlich des Sudetenlandes und der Vertreibung der Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie hätten sich mit den Begriffen Heimat, Staat, Hymne und Tracht auseinandergesetzt. Sie hätten Zeitzeugen befragt. Außerdem hätten sie sich bei Elisabeth Fendel, Volkskundlerin und eine Zeitlang Gründungsbeauftragte für das Sudetendeutsche Museum, Wigbert Baumann, Vorsitzender des Riesengebirgler Heimatkreisvereins Trautenau, Ingrid Sauer, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv zuständig für das Sudetendeutsche Archiv, Stefan Planker, Leiter des Sudetendeutschen Museums, dessen Mitarbeiterin Eva Haupt und Kathrin Krogner-Kornalik, Mitarbeitern der SL-Öffentlichkeitsarbeit, informiert. Die Ausstellung sei eine Wanderausstellung, die die bildliche Präsenz der alten in der neuen Heimat dokumentiere. Damit wolle sie an die Heimat erinnern und das Interesse an Heimatstuben wecken. Sie werde am 3. Ju-
ni um 15.00 Uhr in der AlfredKubin-Galerie im Sudetendeutschen Haus in München eröffnet.
Nach dieser Ankündigung erklommen die zwei Studentinnen das Podium, das sie sich für eine von Peter Becher moderierte Diskussion mit Volkmar Halb-
Heimat war nur ein Teil der Leiden. Und der Heimatverlust ist einem erst in den fünfziger Jahren bewußt geworden, nachdem man das Überleben gemeistert hatte.“ Heimat und Nation seien nicht identisch. Bei Heimat könne jeder mitmachen.
rücksichtigen.“ Außerdem wies er darauf hin, daß vor allem die Vertriebenen den Dissidenten geholfen hätten.
Eva Habel, ehemalige Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, ging 2008 nach Nordböhmen, wo sie den Caritasverband Schluckenau gründete und aufbaute, um mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der RomaMinderheit zu arbeiten. Seit 2011 ist sie Direktorin des Schluckenauer Caritasverbandes. 2019 erhielt sie für ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz.
tomatisch in Sonderschulen gesteckt worden. Das sei auch nach der Samtenen Revolution so gehandhabt worden. Erst seit 2010 habe sich das allmählich geändert.
Bis 2005 seien alle Fabriken abgewickelt, das Inventar verkauft und der Rest dem Verfall preisgegeben worden. Von der drastisch steigenden Arbeitslosigkeit seien vor allem die Roma betroffen gewesen. Von 1250 Roma seien drei Hochschulabsolventen. 2011 habe die Polizei die Roma vor rassistischen Unruhen schützen müssen. 2018 seien zwei Brandanschläge verübt worden. Die Roma-Siedlung aus 18 Plattenbauten sei vor 15 Jahren verkauft worden. 14 Bauten gehörten einem einzigen Eigentümer. Das produziere Probleme. Die Mietverträge liefen nur einen bis drei Monate, wer aufmucke, werde rausgeschmissen. Heizung und heißes Wasser gebe es je nach Laune des Vermieters. Weihnachten habe eine alte Frau darüber einem Reporter des Tschechischen Fernsehens Auskunft gegeben. Sie flog sofort aus der Wohnung.
Das Verhältnis von Tschechen und Roma habe jahrelang 5600 zu 700 betragen. Nach Corona sei die Zahl der Tschechen unverändert gewesen, die der Roma auf 12500 gestiegen. Es herrsche ein ständiges Kommen und Gehen bei den Roma. Seit dem ersten Lockdown explodiere die Zahl der Drogensüchtigen. „Die Kinder haben Angst, erwachsen zu werden, weil sie dann Drogen nehmen müssen.“ Mit Hilfe aus Deutschland habe sie ein erstes Haus kaufen können. 2017 sei ein zweites Haus dazugekommen, das noch renoviert werden müsse. Sie habe 20 Mitarbeiter, von denen zehn Roma seien. Ein Problem sei die Ausbildung. Wer studiere, komme nicht zurück. „Deshalb bilden wir uns unsere Leute selber aus.“
leib, Bernhard Pohl, Terezie Radoměřská und Josef Zellmeier teilten. Peter Becher ist Schriftsteller, Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins und hat väterliche Wurzeln in Karlsbad.








Volkmar Halbleib MdL ist Vertriebenenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Bayern-SPD. Seine Mutter stammt aus Tachau im Egerland. Er wies darauf hin, daß es Vertreibung schon vor 1945 gegeben habe, zum Beispiel von Sozialdemokraten und Juden. Die Vertreibung habe die Landsleute zu Brükkenbauern gemacht. Ihr Wissen sei das Geheimnis der Gelingens. Aus der Kenntnis der Geschichte erwachse Interesse, aus der Erinnerung werde Zukunft gestaltet.
Bernhard Pohl MdL ist Sprecher für Vertriebenenfragen der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Bayern, hat Wurzeln im Adlergebirge und lebt in der Vertriebenenstadt Neugablonz. Pohl: „Der Verlust der
Heimat schließe nicht aus. Heimat bedeute ein gutes Miteinander und gegenseitige Anerkennung.
Terezie Radoměřská ist Mitglied von TOP 09, Bürgermeisterin von Prag 1, tschechische Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Deutschen. Sie meinte, Heimatverlust sei unmenschlich. Elementar für die demokratische Familie sei, die Vertreiber beim Namen zu nennen. Und: „Leute wie Peter Barton sind wichtig.“
Josef Zellmeier MdL ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe Vertriebene, Aussiedler, Partnerschaftsbeziehungen der CSU-Landtagsfraktion und Vorsitzender des Landesverbandes Bayern der Karpatendeutschen aus der Slowakei.
Auch Zellmeier betonte, daß Heimatverlust schmerzhaft sei. „Die einen wollten zurück, die anderen nicht. Manche hatten Nazis in den eigenen Reihen. Da muß man den Perspektivwechsel be-
Schluckenau, eine Stadt im Böhmischen Niederland und die nördlichste Stadt in Böhmen, liege 90 Kilometer von Prag, 60 Kilometer von Dresden und drei Kilometer von der Oberlausitz entfernt. Sie sei seit dem Mittelalter deutsch besiedelt gewesen.
Ab dem
19. Jahrhundert habe sie vor allem von der Textilindustrie gelebt. Nach der Vertreibung der Deutschen habe Leere geherrscht. Deshalb seien dort Slowaken angesiedelt worden, seit 1950 seien vor allem Roma aus der Ostslowakei gekommen. Die Roma seien in großen Familienverbänden gekommen, um in der Textilindustrie und in den Kolchosen zu arbeiten. Doch sie hätten so gut wie keine Ausbildung gehabt. Die Kinder seien wegen ihrer Sprachprobleme au-
Die materielle Hilfe sei ein Kleiderbasar, der in den Europäischen Hilfsfonds FEAD eingebunden sei. Der Klub Ambrela für sechs- bis zwölfjährige biete Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Kochen und – als christliches Element – Krippenbauen. Themen seien Soziale Medien, Schikane, Drogen, Darts und Wettbewerbe.
Zum Bary Ambrela für elf- bis 26jährige kämen vor allem Jungen. Im Rahmen dieses sozialen Dienstes werde Halloween gefeiert und ins Schwimmbad gegangen und würden Schwammerl gesucht. Ein dritter Sozialdienst helfe Familien mit Kindern. Meist seien die Väter drogen-, alkohol- oder spielsüchtig.
Ziel der Gemeinwesenarbeit sei die Selbstermächtigung, auch wenn die Unterstützung manchmal vergeblich sei. Mit Hilfe des Welt-Roma-Tages an jedem 8. April versuche man gemeinsam die Tradition zu bewahren.
Zum Schluß warb Caritasdirektorin Eva Habel noch einmal für ihr Koch- und Erinnerungsbuch „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“ (Ý SdZ 19/2023). Fortsetzung folgt
Im großen gläsernen Saal der Tschechischen Botschaft in Berlin diskutierten Peter Becher, Vorstandsvorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins (Holzkirchen), der Journalist Petr Brod, der sich aus Prag schriftlich äußerte, ORF-Journalist Johannes Jetschgo (Linz) und Zuzana Schreiberová (Prag) unter Moderation von ASV-Geschäftsführerin Zuzana Jürgens über das Thema „War Kafka ein Sudetendeutscher?“ Bei dem Podiumsgespräch der Botschaft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Adalbert-StifterVerein ging es auch um die Frage „Was bedeutet ,deutsch‘ im östlichen Europa?“
Tanja Krombach vom Deutschen Kulturforum östliches Europa sagte eingangs, daß die Veranstaltung und ihre plakative Frage, ob Kafka ein Sudetendeutscher gewesen sei, zurückgehe auf die Präsentation der beiden Museen über die Deutschen in den böhmischen Ländern, nämlich dem Sudetendeutschen Museum in München und der Ausstellung „Unsere Deutschen“ in Aussig. Vor eineinhalb Jahren sei, kurz nach der Eröffnung der Ausstellung in Aussig, in der Tschechischen Botschaft in Berlin über dieses Thema gesprochen worden. In beiden Museen werde Franz Kafka, dessen 140. Geburtstag wir in diesem Jahr feierten, thematisiert. Kann man Kafka als jüdischen Prager Schriftsteller deutscher Zunge auch als sudeten-

Im Haus des Deutschen Ostens in München (HDO) ist das Begleitbuch zur Ausstellung „Wer bin Ich? Wer sind Wir?“ vorgestellt worden.
Ein Buch über das schwer zu greifende Thema der Identität!“, begann Andreas Otto Weber seine Einführung. Das neue Buch gehe hervor aus der gleichnamigen Ausstellung, die das HDO 2020 aus Anlaß seines 50jährigen Bestehens eröffnet habe, so der Direktor des HDO. „Eine Ausstellung, die über die regional vielfältigen Identitäten von Deutschen aus dem östlichen Europa informieren soll.“
In der Ausstellung – und jetzt im Buch – geschieht dies auf den Gebieten von Sprache, Kultur, Essen, Literatur, Brauchtum, Sport und Religion. Die Neuerscheinung „Wer bin Ich? Wer sind Wir?“ spürt der Identität der
mit Musik in Berlin
Kafka – ein Sudetendeutscher?
deutschen Autoren bezeichnen?
Dazu und zu anderen Einschätzungen der Rolle des Deutschen in Literatur und Gesellschaft in den böhmischen Ländern diskutierten Zuzana Schreiberová vom Multikulturellen Zentrum in Prag, Peter Becher, der Vorstandsvorsitzende des Adalbert Stifter-Vereins, und Johannes Jetschgo, ORF-Journalist und Autor aus Linz unter Moderation von Zuzana Jürgens.


Deutsche Einflüsse
Klaus Harer vom Kulturforum erläuterte die musikalischen Intermezzi der kroatischen Pianistin Maja Matijanec, die wenig aufgeführte Werke von Fridrich Smetana (1824–1884) und Erwin Schulhoff (1894–1942) zu Gehör brachte. Harer schilderte die deutschen Einschläge beider Komponisten: Schulhoff entstammte einer jüdischen Prager Familie und war ein Wunderkind, das auf Empfehlung Antonín Dvořáks als Siebenjähriger in das Prager Konservatorium aufgenommen wurde. Als erfolgreicher Komponist war er auch Kommunist und wurde im Juni 1941 sowjetischer Staatsbürger, als der er dann in Wülzburg in Bayern eingesperrt wurde, wo

�
er an Tuberkulose bereits 1942 starb. Sein Werk war lange vergessen. Smetana hatte auch deutsche Bezüge. Er wuchs deutschsprachig auf. Seine frühen Tagebücher und viele Briefe sind in deutscher Sprache verfaßt und werden gerade ediert. Erst später änderte Smetana seinen Vornamen Friedrich in die tschechische Version Bedřich.
Ihre eigenen persönlichen Bezüge zum Thema enthüllten die Podiumsteilnehmer kurz. Zuzana Schreiberová berichtete von ihrer jüdischen Pardubitzer Familie, deren Großeltern HolocaustÜberlebende gewesen seien und durch die sie Deutsch habe lernen und sprechen sollen. In ihrer Familie spreche man erst seit drei Generationen tschechisch, die Generationen davor seien deutschsprachig gewesen.

Peter Becher berichtete von der väterlichen Familie, die aus Karlsbad stammte. Die pflege
ein „Märchen“ in der Erinnerung, das Märchen von dem verlorenen Paradies, aus dem man vertrieben worden sei. Dann habe er aber erfahren, daß die beiden wichtigsten Sudetendeutschen, während der dreißiger und vierziger Jahre Konrad Henlein und Karl Hermann Frank geheißen hätten. Und so habe sich sein idealisiertes Bild verschattete. Und doch hätten in der Großvätergeneration auch Sozialdemokraten existiert, die wiederum das Sudetendeutsche für sich in Anspruch genommen hätten.
Johannes Jetschgo betonte trotz slawischen Namens keinerlei familiäre Bezüge zu den Sudetendeutschen zu haben. Er sei nur auf professioneller Grundlage mit den tschechischen Nachbarn und einigen sudetendeutschen Bezügen konfrontiert worden.

Jetschgo war es dann, der zur Charakteristik der sudetendeut-
schen Identität die Beschreibung einbrachte, alle Identitäten immer prozessual zu begreifen. Becher nahm diese Art der Herangehensweise dankend auf und verwies auf drei interessante Beispiele der Verwendung des Begriffs Sudetendeutsche. Erstens habe Franz Spina, Slawistik-Professor in Prag und späterer deutscher Minister in den Tschechoslowakischen Regierungen ab 1926, im Jahr 1914 eine Abkehr von der kronländischen Eigenbrötelei als Deutschböhmen, Deutschmähren und Deutschschlesien und ein Eintreten für eine sudetendeutsche Nationalund Kulturpolitik gefordert.
Weiter habe der Schriftsteller Johannes Urzidil 1930 in einer Debatte um die Einordnung der Prager Literatur diese eindeutig in den Kontext der sudetendeutschen Literatur gestellt. Und schließlich Egon Erwin Kisch, der 1937 den deutsch-jüdischen Prager Schriftsteller F. C. Weißkopf als größte Begabung des sudetendeutschen Schrifttums bezeichnet habe. Hier zeigten sich prozessuale Verschiebungen, die später unter der Okkupation Nazideutschlands und der Rolle der Henlein-Bewegung dabei, durch die genannten Personen wieder verändert worden seien.
Die Frage nach der Identität
Die Moderatorin Jürgens zählte dann eine Reihe von Persönlichkeiten auf und ihre unterschiedliche Zuordnung in deutschen, österreichischen und tschechischen Internetdarstellungen. Ein Beispiel: Erwin Schulhoff werde auf der deutschen Wikipedia-Seite als deutsch-böhmischer, auf der tschechischen als tschechoslowakischer Komponist dargestellt.
Der leider wegen Krankheit nicht anwesende, aber angekündigte Petr Brod, Journalist aus Prag, hatte einige Fragen von Zuzana Jürgens schriftlich beantwortet, was sie vortrug. Er antwortete zur Bedeutung Franz Kafkas, für ihn stehe fest, daß Kafka ein Bestandteil der deutschen Literatur und der Weltliteratur sei.
Kafkas Werk Weltliteratur

Durch Kafkas Wirkung sei er auch Teil der tschechischen Hoch- und Populärkultur, und es sei für Brod unverständlich, daß dies in der permanenten Ausstellung des Literaturmuseums in Prag nicht zum Ausdruck komme.
Zuzana Jürgens hatte jedoch am Schluß noch eine erfreuliche Ankündigung zu machen. Seit mehr als 20 Jahren gebe es eine tschechische Buchedition, die sich den tschechischen Klassikern widme. In diesem Rahmen werde demnächst eine Reihe für die deutschsprachigen Autoren der böhmischen Länder in tschechischer Übersetzung begründet. Ulrich Miksch
Deutschen im und aus dem östlichen Europa nach und zeigt deren Vielfalt – aber auch, wie sie durch den Wandel der Zeit geprägt und verändert wurde. „Das Buch zeigt, deutsche Identitäten in Ostmittel- und Südosteuropa sind weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart als Einheit zu begreifen“, faßte Weber zusammen.

„Die Deutschen in diesen Regionen hatten ihren jeweils eigenen Begriff von ,Heimat‘“. Anschließend stellte HDO-Öffentlichkeitsreferentin Lilia Antipow das Thema „Architektur und Identität“ im Buch vor. HDOKulturreferentin Patricia Erkenberg ergänzte mit einem Bericht über „Sport und Identität“. Das Schlußwort hatte der Verleger Michael Volk, der das Begleitbuch in den Kontext seines Verlagsprogramms einordnete.
Susanne Habel
Im oberbayerischen Schliersee wurde zu Ostern das neue Buch „Taiwankatze“ von Susanne Hornfeck vorgestellt. Im Literaturcafé, das der regionale Verein KulturVision veranstaltet, unterhielt sich Susanne Hornfeck mit SL-Literaturpreisträger Bernhard Setzwein. Unter der Moderation von Peter Becher, einem weiteren SL-Literaturpreisträger, erzählte die Schlierseer Sinologin, Übersetzerin und Schriftstellerin aus ihrem Leben, das sie auch längere Zeit nach Taiwan geführt hatte. Hier berichtet Monika Ziegler, die zum Vorstand von KulturVision gehört. KulturVision ist ein Verein zur Förderung des kulturellen Lebens und der Bildung im Landkreis Miesbach.
Welch zauberhaftes Buch! Ich habe „Taiwankatze“ von Susanne Hornfeck in einem Ritt durchgelesen. Als Katzenfreundin und als Interessierte an anderen Kulturen, am Fremdsein und Angekommensein ist es ein Genuß zu lesen und soll Freude und Inspiration bescheren.
Beim letzten Literaturcafé in Schliersee stellte Susanne Hornfeck ihr neuestes Buch vor. Unter der Moderation von Peter Becher erzählte die Schlierseer Sinologin, Übersetzerin und Schriftstellerin aus ihrem Leben, das eine enge Verbindung zu China und Taiwan hat. Sie erzählte unter anderem von ihrem fünfjährigen Aufenthalt in Taipeh, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann lebte und an der Nationalen Universität Taiwan in Taipeh Deutsch lehrte. Dort traf sie auch eine Chinesin, die akzentfrei Deutsch sprach. Auf Basis von deren bewegtem Leben entstand ihr Hornfecks erster Roman „Ina aus China“.

Jetzt empfand Susanne Hornfeck die über 30 Jahre zurückliegende Zeit in Taipeh und ihre Rückkehr nach Schliersee in dem Buch „Taiwankatze“ nach. „Eine Grenzüberschreitung“ heißt es auf dem Cover. Diese Grenz-
überschreitung betrifft die Grenze der Länder, der Kulturen, der Sprache, der Menschen, aber auch der Grenze zwischen Mensch und Katze. Die Schriftstellerin beschreibt in „Taiwankatze“ ihr Leben in Taipeh in engem Zusammenhang mit der Katze Shaobai. Das bedeutet „wenig Weiß“ und ist auf den weißen Kinnfleck der Katze zurückzuführen. Shaobai wird der deutschen Dozentin von chinesischen Freunden überlassen, um die in ihrem Haus rumorenden Ratten zu vertreiben. Die einheimische Katze wird in den kommenden fünf Jahren in der fremden Stadt zu einer Begleiterin, einem Familienmitglied, ja, zu einer Freundin. Susanne Hornfeck verfällt aber keineswegs in den Fehler, die Katze zu vermenschlichen. So etwas würde Shaobai auch gar nicht zulassen, denn sie ist eine eigenwillige Katzenpersönlichkeit mit eigenem Willen. Dies äußert sie durchaus auch mit ausgefahrenen Krallen. Humorvoll beschreibt die Autorin das Zusammenleben der zwei Deutschen mit der Katze. So wartet Shaobai abends, wenn sie von der Universität kommt, bereits auf sie, darf aber nicht sofort begrüßt werden, sondern erst, wenn sie auf „ihren“ Baum im Park geklettert ist und von dort bewundert werden kann. Sie erkennt, wenn Hornfecks Ehemann, im Buch G. genannt, Ischias hat und legt sich heilend an die Seite des Künstlers aus
❯ Buchvorstellung mit zwei Sudetendeutschen Kulturpreisträgern
Grenzüberschreitung
Deutschland. Und Shaobai weiß ganz genau, wann ihre Hausgenossen von ihrem Sommerurlaub am Schliersee zurück nach Taipeh kommen. Sobald sie telefonisch ihre Ankunft ankündigen, rast sie wie eine Wilde durch das Haus. „Es ist schön, erwartet zu werden. Ein bißchen wie Heimkommen“, schreibt Susanne Hornfeck.
Was Shaobai aber gar nicht behagt, das ist, wenn sie in ihren Vorrichtungen gestört wird, dann kann sie auch gewalttätig werden, ebenso, wenn ihr eine Besuchskatze vor die Nase gestellt wird. Shaobai entscheidet, wer ins Haus kommt und wer nicht.
Die Autorin beschreibt ebenso einfühlsam das eigene Fremdsein in Taipeh, obwohl sie die Sprache profimäßig gut spricht. Die Kultur aber, das Klima, das ganze Leben ist fremd: Wenn Susanne Hornfeck im Deutschunterricht Goethes „Osterspaziergang“ rezitiert, stößt sie auf Unverständnis, denn solch ein Frühlingserwachen kennen die Chinesen nicht.

Als die fünf Jahre herum sind, beschließt das Ehepaar, die Katze mit an den Schliersee zu nehmen. Ein freundlicher taiwanesischer Zollbeamter ermöglicht, daß sie Shaobai mit in die Flugzeugkabine nehmen dürfen. Die Katze hält es 20 Stunden in ihrer Transportbox aus, ohne daß es drinnen „naß“ wird. In Schliersee angekommen, rast sie in das nächste Beet. Jetzt ist die Katze fremd, bewältigt aber das Le-



ben als Immigrantin offenbar mühelos. Susanne Hornfeck indes muß sich neu orientieren und schreibt, daß auch jetzt die Katze dabei helfe, wieder Routine in den Alltag zu bekommen. Sie beschließt, ihren ersten Jugendroman „Ina aus China“ zu schreiben.
In vielen Episoden des Zusammenlebens beweist sich die enge Zusammengehörigkeit von Mensch und Tier ebenso wie das Überwinden von Fremdsein. Die Autorin schreibt in schnörkelloser Sprache und beschreibt die Freundschaft mit Shaobai, ohne daß es eine rührselige Katzenstory wird. Zudem erfährt der Leser eine Menge über das Leben in Taipeh, etwa, daß Taiwaner Angst vor den Geistern auf dem Friedhof haben oder daß Fengshui Tag und Ort eines Begräbnisses festlegt und nicht die Anordnung von Möbeln.
„Taiwankatze“ inspiriert dazu, wieder aufmerksam durch das Leben zu gehen und das Verhalten von Tieren zu beobachten. So kann man sich Inspiration holen, wie es denn funktionieren kann, das Fremdsein, das Ankommen und das Anpassen.
In Robert Seethalers neuem Roman dreht sich alles um ein kleines Wiener Kaffeehaus. Wie schon zuvor in seinen Bestsellern „Der Trafikant“ (2012), „Ein ganzes Leben“ (2014) und „Der letzte Satz“ (2020) über Gustav Mahler sind auch in „Das Café ohne Namen“ die vielen Beziehungen Seethalers zu Böhmen zu spüren. Von dort waren seine Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg als Vertriebene nach Wien gekommen.
Nach Wien, also in die Stadt, in der Robert Seethaler 1966 zur Welt kam und wo er im zehnten Wiener Gemeindebezirk Favoriten aufwuchs, kehrt er zurück in „Das Café ohne Namen“. Der Roman des Bestsellerautors, der heute zwischen Berlin und Wien pendelt, beginnt in Seethalers Geburtsjahr und spielt im Wiener Karmeliterviertel, das

❯ Buchvorstellung auf der Leipziger Buchmesse
Café ohne Namen“
ihm viel bedeutet. „Ich habe ganz besondere Erinnerungen an das Karmeliterviertel, weil da meine Großeltern und meine Eltern her sind“, erläuterte Seethaler auf der Leipziger Buchmesse mit Schwerpunkt „Österreich“, bei der das druckfrische Buch vorgestellt wurde.

„Meine Großeltern sind damals nach dem Krieg als Vertriebene aus Böhmen da angekommen. Die Großmutter hat als Tellerwäscherin in einer Großküche gearbeitet, der Großvater als Asphaltierer an der Straße. Mein Vater war Schlosser, die Mutter Sekretärin“, erzählte der Schrift-
steller. „Auch ich trage diese Herkunft immer noch in meinem Herzen.“ Seethaler fing nach dem Besuch der Schauspielschule am Wiener Volkstheater als Darsteller auf der Bühne und im Fernsehen an und schrieb später viel Erzählprosa, vor allem Drehbücher und Romane. Sein „Held“ in „Das Café ohne Namen“ ist der ungelernte Robert Simon, der als Waisenkind in Wien aufwuchs. Er verdient sein Brot als Tagelöhner auf dem Karmelitermarkt und wohnt bei der Witwe Martha Pohl. Er ist zufrieden mit seinem Leben, aber nun, 20 Jahre nach Kriegsen-
Susanne Hornfeck: „Taiwankatze. Eine Grenzüberschreitung“. Drachenhaus Verlag, Esslingen 2023; 100 Seiten, 22,00 Euro. (ISBN 978-3943314-72-4


de, läßt auch Simon sich mitreißen vom Aufschwung. Er pachtet eine heruntergekommene Wirtschaft am Karmelitermarkt und eröffnet darin sein eigenes Café.
Das Angebot ist klein. Es gibt Schmalzbrot, Kaffee, Wein und Bier. Doch die Menschen aus dem Viertel kommen und bringen ihre Geschichten mit. So landet auch die arbeitslose Hilfsnäherin Mila Szabica bei ihm, nachdem sie bei ihrer erfolglosen Stellensuche vor Hunger am Markt einen Schwächeanfall erlitt. Sie wird bei Simon freundlich aufgenommen und seine Kellnerin. Man lernt eine Reihe von Zeitgenossen kennen, die – ähnlich wie zuvor in Seethalers „Das Feld“ (2018) – ein Gruppenbild ergeben: ein Kaleidoskop von Schicksalen, die oft überraschen und tief berühren.
Habel

„DasRobert Seethaler: „Das Café ohne Namen“. Roman. Claassen-UllsteinVerlag, Berlin 2023; 288 Seiten, 24 Euro. (ISBN 9783546100328) Robert Seethaler auf der Leipziger Buchmesse. Bild: Wikipedia
❯ SL-Landesgruppe Bayern und SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach
Unterwegs an Elbe und Moldau
Anfang Mai unternahm Volker Bauer, der für den Stimmkreis Roth im Bayerischen Landtag sitzt, mit Vertretern der mittelfränkischen SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach und Steffen Hörtler, Obmann der SL-Landesgruppe Bayern und Stellvertretender SL-Bundesvorsitzender, sowie Kommunalpolitikern seine bereits dritte Erinnerungsfahrt nach Böhmen.

Comic der Graphic Dokumentary als Ausstellungstafel.
❯ Ackermann-Gemeinde
Comics über einen seligen Pallotiner
An 47 Rechnern in Deutschland und Tschechien verfolgten Menschen am ersten Dienstag im Mai den Kultur-Zoom der Ackermann-Gemeinde. Diesmal ging es um die einige Tage später, am 5. Mai, in Prag eröffnete Ausstellung „Und wenn die Wahrheit mich vernichtet …“, die dem im KZ Dachau verstorbenen und 2019 selig gesprochenen Pater Richard Henkes gewidmet ist. Die Initiatoren der Ausstellung und der damit verbundenen Graphic Documentary, Andreas Thelen-Eiselen, Referent für Religionspädagogik im Bistum Limburg, und Martin W. Ramb, Schulamtsdirektor im Kirchendienst, Leitung der Abteilung Religionspädagogik, Medien und Kultur im Bischöflichen Ordinariat Limburg, gaben darüber Auskunft.
M

oderatorin Sandra Uhlich wies in ihrer Einführung darauf hin, daß der Pallottiner-Pater Richard Henkes auch in der Wanderausstellung der Ackermann-Gemeinde „Zeugen für Menschlichkeit“ gewürdigt werde. Mit der neuartigen Aufarbeitung des Lebensweges liege eine Beschreibung der Vita Henkes für Jugendliche und für den Religionsunterricht vor.
Über die rund 120 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Tschechien, die zu der Ausstellung in Prag angemeldet waren, freute sich Andreas Thelen-Eiselen. Er zeichnete kurz das Leben und Wirken des aus dem Westerwald stammenden Richard Henkes (1900–1945) nach, dessen Eltern einen Krämerladen und eine Landwirtschaft betrieben hätten. Schon früh habe er Interesse an der Mission gezeigt, 1912 habe er erste Kontakte nach Vallendar, dem Zentrum der Pallottiner, aufgenommen, doch von Juni bis November
1918 habe der junge Richard
Henkes als Soldat in den Krieg gemußt – ein halbes Jahr, das ihn stark geprägt habe. Sein Interesse habe besonders den Soldaten-Sodalen gegolten. „Er wurde in der Infanterie geläutert, zum Schluß hatte er keine Begeisterung mehr für Krieg. Ein Bruder war verletzt, Freunde waren tot“, erläuterte Thelen-Eiselen.
Henkes sei 1919 Novize der Pallottiner geworden, habe das Studium der Philosophie und Theologie begonnen und sei am 6. Juni 1925 zum Priester geweiht worden. Nach einer Seelenoder Berufungskrise habe er seinen Dienst als Lehrer, Prediger und Exerzitienmeister begonnen. Nach einer TBC-Erkrankung, längerer Behandlung und der Genesung 1927/28 sowie vor dem Hintergrund des Kontaktes zu einer jungen Frau in Ahrweiler sei Henkes nach Oberschlesien versetzt worden. Dort sei er als Lehrer und Prediger sehr beliebt gewesen. Da er aber kein Blatt vor den Mund genommen habe, sei er bald ins Blickfeld der Nationalsozialisten geraten. Seine Vorgesetzten hätten ihn vom Schuldienst und schließlich aus Schlesien abgezogen. 1941 sei Henkes als Pfarrverwalter nach Strandorf ins Hultschiner Ländchen gekommen. Auch hier habe er offensiv Stellung zur antichristlichen Propaganda der Nazis bezogen. Zuvor habe ihn das Amnestiegesetz noch vor einer Verhaftung geschützt, nun, am 8. April 1943, sei er in Schutzhaft und schließlich ins KZ nach Dachau gekommen.

Hier habe Pater Henkes den späteren Prager Erzbischof und Kardinal Josef Beran kennengelernt, sei mit ihm befreundet gewesen und habe heimlich Tschechisch gelernt, weil er fest daran geglaubt habe, nach seiner Zeit im KZ Dachau in seine alte Pfarrei zurückkehren zu können. In Dachau sei er zum Zeugen der Nächstenliebe und Kämpfer für die Menschenwürde geworden. „Die Grausamkeiten kann man nur erahnen. Tiefes Gottvertrauen hat ihn durch die Zeit im KZ getragen“, charakterisierte der Referent diese Zeit. Henkes habe tschechische Mithäftlinge gepflegt, bis er selbst an Typhus erkrankt und am 22. Februar 1945 gestorben sei. Am 15. September 2019 sei Pater Henkes als Märtyrer der Nächstenliebe im Limburger Dom seliggesprochen worden.
Martin W. Ramb erläuterte die Darstellungsformen Graphic Novel und Graphic Documentary.

„Diese Form schafft das, was reine Literatur nicht schafft. Das zusätzliche Bild vermittelt Tiefe, Unmittelbarkeit“, erklärte Ramb. Und genau das sei ein geeignetes Instrument für Schule und Jugendarbeit. Unabdingbar sei jedoch ein guter Zeichner oder Grafiker, der auch noch die entsprechende Geschichte entwikkele oder sich dem vorgegebenen Thema öffne, sich in dieses einarbeite. Und da sei der Trickfilmzeichner Volker Schlecht alias Drushba Pankow ins Spiel gekommen, der das Leben Henkes in eine Graphic Documentary umgesetzt habe. „Die Resonanz war sehr positiv“, sagte Ramb. So sei die Idee entstanden, eine Auswahl der Comics großformatig als Basis für eine Ausstellung zu verwenden. Und irgendwann habe es nahe gelegen, die Ausstellung auch in Tschechien zu zeigen und ins Tschechische zu übersetzen. Im Oktober sei sie in Rom gelaufen, nun laufe sie in Prag.
Letztlich solle es folgende Elemente geben: Grafic Documentary, Ausstellung, Audio-Video-Guide sowie eine erweiterte Schülerausgabe mit Lehrerhandreichungen und eine fächerübergreifende Homepage mit vielen Audio- und Videoelementen. Mittelfristig sei auch an eine englische Version gedacht.
Von der Teilnahme mehrerer deutscher Schulklassen erhoffen sich Ramb und Thelen-Eiselen Schulpartnerschaften. Die Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde war übrigens bei der Organisation der Stadtrallye mit im Boot. Die Ausstellung kann auch ausgeliehen werden.
Markus BauerDer mittelfränkische CSU-Landtagsabgeordnete Volker Bauer traf sich während seiner Reise in der Tschechischen Republik mit dem dortigen Umweltminister Petr Hladík. Ursprünglich sollte es zu dem Treffen nur im engen Kreis bei einem mittäglichen Arbeitsessen kommen. Da aber die Kabinettssitzung an diesem Tag länger dauerte, mußte Minister Hladík absagen. Um so erfreuter waren Bauer und Steffen Hörtler, daß sich der Minister dann zwei Stunden Zeit nahm, um die Delegation bei ihrer abendlichen MoldauFahrt zu begleiten. Bei dieser Schiffahrt lud Bauer den tschechischen Politiker in den Bayerischen Landtag ein, um einen konstruktiven Dialog über einen Energieaustausch zwischen den Ländern in beide Richtungen einzuleiten. Schließ-
Gäste von Steffen Hörtler, Obmann der SL-Landesgruppe Bayern und Stellvertretender SL-Bundesvorsitzender. Dabei traf die Gruppe im Prager Parlament den Abgeordneten Pavel Bělobrádek. Der ehemalige Vorsitzende der KDU-ČSL, der Schwesterpartei der CSU in der Tschechischen Republik, gilt als einer der wenigen hochrangigen Politiker im Nachbarland, der das Unrecht der Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg offen als solches anspricht. „Hier muß die Wahrheit siegen und es dürfen keine Lügen verbreitet werden“, sagte Bělobradek.

lich habe Bayern bei entsprechenden Wetterlagen häufig einen Überschuß an regenerativ erzeugtem Strom, so Bauer. Länderübergreifende Projekte zum Gewässerschutz und zur Biodiversität waren weitere Themen des Gesprächs. Als Präsident des mittelfränkischen Jagdverbands würdigte Bauer insbesondere die Leistungen der tschechischen Landwirte. „Ihre Arbeit hat eine gut strukturierte Landschaft entwickelt, die ausgezeichnete Lebensbedingungen für das Wild und gute Voraussetzungen für den Erhalt der Artenvielfalt geschaffen hat“, sagte Bauer. Petr Hladík, der aus Brünn stammt, ist den Sudetendeutschen schon länger freundschaftlich verbunden. So hat er erst letztes Jahr, damals war er noch nicht Minister, die gesamte Wegstrecke des Brünner Versöhnungsmarsches mit zurückgelegt.
Das Treffen mit dem Mitglied der Tschechischen Regierung war Teil einer Erinnerungsfahrt mit knapp 50 Kommunalpolitikern und Sudetendeutschen aus dem Landkreis Roth nach Aussig und Prag. Begleitet wurden Bauer und seine

Bělobradek werde innertschechisch schon mal als Faschist bezeichnet, weil er ein Freund der Sudetendeutschen sei, ergänzte Steffen Hörtler. „Als Christ muß man bereit sein, Lehren aus der Geschichte und eigenen Fehlern zu ziehen“, so der Abgeordnete, „sonst kann man sich nicht der Zukunft zuwenden“. Steffen Hörtler betonte in diesem Zusammenhang, den Nachkommen der Sudetendeutschen in der Bundesrepublik gehe es dabei vor allem um ein ideelles Zeichen der Tschechischen Republik.
Eine weitere Station der Reisegruppe war die Deutsche Botschaft. Dort erhielt jener Balkon die größte Aufmerksamkeit, von dem aus der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1989 jenen 4000 DDR-Bürgern, die in der Botschaft Zuflucht gesucht hatten, die Zustimmung der DDR-Führung zu ihrer Ausreise mitgeteilt hatte.
Ferner stand ein Abstecher in die Bayerische Repräsentanz in Prag auf dem Programm. Sie war 2014 eingerichtet worden. Ihr Zweck ist, die Beziehungen zwischen dem Freistaat und der Tschechischen Republik auf allen Feldern zu vertiefen. Dazu werden Fach- und Kultur-Veranstaltungen, Ausstellungen, Innovationskongresse und Experten-Vernetzungen organisiert. Jährlich reisen etwa fünf Mitglieder des bayerischen Kabinetts zu hochrangigen politischen Gesprächen nach Prag. Das Gespräch mit dem Stadtteil-Bürgermeister Jan Čižinský sowie ein Vortrag von Radek Novák, dem Vorsitzenden der liberalen jüdischen Gemeinde in
❯ SL-Ortsgruppe Passau/Niederbayern
Prag und Chef des Kulturverbands der Deutschen in der Tschechischen Republik, komplettierten das dreitägige Programm. Am ersten Tag der Reise war die Gruppe in Aussig gewesen. Dort hatte sie zunächst die Ausstellung „Unsere Deutschen“ im Stadtmuseum besucht. Anschließend gedachte sie an der Gedenktafel auf der Beneš-Brücke mit einer Kranzniederlegung der Opfer des Massakers vom August 1945. Rund drei Millionen Sudetendeutsche in der Tschechoslowakei waren nach Ende des Zweiten Weltkriegs enteignet und nach Bayern, Sachsen und Österreich vertrieben worden, bevor sich in den Jahren danach der Eiserne Vorhang immer dichter schloß. Die Vertreibung begann schon vor der organisierten Ausweisung der Deutschen ab Januar 1946 und war Berichten zufolge oft von Rache, Willkür und Gewalt begleitet. Allein in Bayern fand etwa eine Million Menschen ein neues Zuhause. Fortan galten die Sudetendeutschen als Vierter Stamm Bayerns, der sich beim Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg enorme Verdienste erwarb.
Bauer erklärte bei seiner zwischenzeitlich dritten Erinnerungsfahrt ins Nachbarland mit Angehörigen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, „die Ereignisse damals sollten Tschechen und Deutschen heutiger und künftiger Generationen Mahnung zu einer immer intensiveren Partnerschaft innerhalb der Europäischen Union sein“.
Volker Bauer bedankte sich am Ende der dreitägigen Erinnerungsfahrt bei der SL-Landesgruppe Bayern, namentlich bei Landesobmann Steffen Hörtler, bei dessen Stellvertreterin Hannelore Heller aus Roth und bei dem Landesgeschäftsstellenmitarbeiter Andreas Schmalcz für die umfangreiche Vorbereitung und Durchführung der Fahrt, die viele interessante Termine geboten habe, die sich nicht jeder Gruppe böten. Ein Dank ging an auch Peter Barton, den Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag. Steffen Hörtler zeigte sich auch darüber erfreut, daß Milan Horáček, ehemaliger MdB und MdEP und langjähriger Freund der Volksgruppe, in das Programm mit eingebunden war.
 Robert Schmitt
Robert Schmitt
Wunschkonzert und Neuzugang
Ende April traf sich die im April vor 75 Jahren gegründete niederbayerische SL-Ortsgruppe Passau im Café Aschenberger zu einem Wunschkonzert.


Eingeladen hatte Obfrau Helga Heller, die am 2. September 1927 in Böhmisch Leipa zur Welt gekommen war. „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“, „Kein schöner Land“, „Und in dem Schneegebirge“ sangen die Landsleute. Die junge Eva Renner begleitete die alten Volkslieder auf dem Akkordeon. Sie und das Vocalduo Katharina Dietz und
Anna Hofreiter gehören zu den Mitgliedern der SL-Ortsgruppe Ruhstorf, die ebenfalls zum Wunschkonzert gekommen waren. Nicht zuletzt erfreute man Heller, die sich den mehrstimmigen heimatlichen Klang der „Glocken von Böhmen“ gewünscht hatte. Die nach wie vor äußerst engagierte Obfrau hatte zu einer der letztjährigen Zusammenkünfte Tomáš Cidlina, einen jungen tschechischen Historiker vom Museum ihrer Heimatstadt Leipa, als Referenten geladen. Ihr sei es, so Heller, in diesen Zeiten wichtiger denn je, wieder jüngere,
pazifistisch engagierte Menschen wie Tomáš Cidlina für die Bereitschaft zur Versöhnung auf beiden Seiten zu gewinnen. Sie wünsche, daß sich die heutige junge Generation nicht mehr schwer tun möge mit dem Terminus „sudetendeutsch“, den man nicht mehr mit Rückwärtsgewandtsein assoziieren dürfe. Das Anerkennen von Unrecht und der Wille, in Frieden miteinander zu leben, seien unabdingbar. Tomáš Cidlina, der in seiner tschechischen Heimat schon zahlreiche Initiativen im Kontext mit den Sudetendeutschen ins Leben gerufen habe, habe sein Kommen zum Sudetendeutschen Tag an Pfingsten in Regensburg zugesagt.
Zudem freue sie sich über das neue 1986 geborene Mitglied Eva Zormaier. Ursache für den Beitritt der Passauer Lehrerin sei ihre geliebte Großmutter aus Neudek gewesen, bei der sie aufgewachsen sei. Marita Pletter
� Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen
Glaube und Kirche in der Heimatlosigkeit
Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen veranstaltete Ende April mit dem Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien und dem Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa die internationale Tagung „Glaube und Kirche als Heimatort in der erzwungenen Heimatlosigkeit und als geschützter Identitätsraum in der Heimat“ im hessischen Fulda.
Grußworte des Fuldaer Weihbischofs Karlheinz Diez, der Bischöfin Beate Hofmann von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, von Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, und von Ernst Gierlich, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung, eröffneten die Tagung. Außerdem wurden stellvertretend für die zahlreichen eingesandten Grußworte die Grüße von Alterzbischof Alfons Nossol und Bischof Andrzej Czaja aus dem Bistum Oppeln und von Domherr André Schmeier aus Allenstein im Erzbistum Ermland vorgelesen.


Anschließend hielt Rainer Bendel von der Universität Tübingen einen Einführungsvortrag über Maximilian Kaller als erstem päpstlichen Sonderbeauftragten für die Heimatvertriebenen von 1945 bis 1947 und die Hilfsmaßnahmen der katholischen Kirche für die Heimatvertriebenen in den ersten Nachkriegsjahren. Über die Rolle der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der materiellen Unterstützung der vertriebenen Ostdeutschen sprach Dorothea Wendebourg von der Humboldt-Universität in Berlin. Sie beschäftigte sich ebenfalls mit der geistigen Bewältigung des Vertreibungsschicksals durch die EKD. Der erste Themenblock beleuchtete Schwerpunktthemen, die in der gesamtdeutschen Perspektive von enormer Bedeutung für die katholische und evangelische Vertriebenenseelsorge waren und zugleich einen starken hessischen Bezug aufwiesen. Der Block begann mit grundlegenden Ausführungen vom Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke, dem Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge.
Die mittelfränkische SL-Ortsgruppe Rückersdorf hatte für Anfang Mai zu dem Vortrag „So grün ist der Mai“ von Kräuterpädagogin Birgit Lehmeier eingeladen.

Obfrau Bärbel Anclam begrüßte Mitglieder und Gäste im Schmidtbauernhof. Passend zum Thema hatten Helferinnen und Helfer zuvor Brote mit Pestos und bunten Beilagen kreiert. Und Birgit Lehmeier hatte einen Kräuterkuchen zum Ausprobieren mitgebracht.
Wie der Name Kräuterpädagogin verheißt, ging es Lehmeier vor allem um Kräuter, die im Mai bereits geerntet werden können und in der heimischen Küche eine gute Verwendung finden. Besonders herauszuheben ist momentan der Bärlauch, den man vor allem im Wald entdecken und ernten kann. Diese Pflanze ist gesund, enthält viele Vitamine, und man kann sie jeden Tag essen. Sie hat ein starkes Knoblaucharoma.
Da es in seltenen Fällen Verwechslungen mit dem Aronstab, der Herbstzeitlosen oder
Anschließend referierte Bendel über die Königsteiner Anstalten als ein Zentrum der katholischen Vertriebenenseelsorge in Deutschland. Michael Hirschfeld von der Universität Vechta sprach über das Konzept der Kapellenwagen und der Glaubensburgen an der Zonengrenze, das Pater Werenfried van Straaten entwickelt hatte. Patrick Strosche, Pastoralreferent aus Rüsselsheim am Main, widmete sich der Situation im Bistum Mainz in der Nachkriegszeit und berichtete vom Streit über die Kirchenlieder der Vertriebenen.
Pastor Dietmar Neß aus Groß Särchen in der Lausitz sprach

Spätaussiedlern im vereinigten Deutschland nach 1990 und das offizielle Ende der Vertriebenenseelsorge durch die Abschaffung der Visitatoren als Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz“.
In den 1980er Jahren spielte die Volksfrömmigkeit der oberschlesischen Aussiedler eine entscheidende Rolle bei deren Integration in die Bundesrepublik.
Evelyne A. Adenauer untersuchte diesen Aspekt in ihrem Vortrag. Das letzte Referat des Themenblocks behandelte die freikirchlichen Aussiedler und Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion und deren Integration mit Hilfe des Glaubens.
Die Themenblöcke drei und vier widmeten sich der Bewahrung der kulturellen und sprachlichen Identität in den sozialistischen Staaten Osteuropas nach 1945 und der Rolle der Kirchen für die Bewahrung der christlichen Identität in Osteuropa nach dem Mauerfall. Der dritte Themenblock untersuchte die Rolle der Kirchen für deutsche Minderheiten und Aussiedler. Piotr Tarlinski, Bischofsvikar und Minderheiten-Diözesanseelsorger in der Diözese Oppeln, sprach über die Rolle des Glaubens für die deutsche Minderheit im kommunistischen Polen nach 1945. Anschließend wurde der Vortrag von Rudolf Grulich, Kirchenhistoriker und Wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, über die Rolle der Kirche in der Tschechoslowakei für die deutschen Minderheiten und für die Aussöhnung mit Deutschland vorgelesen. Olga Litzenberger, Leiterin des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Rußland in Nürnberg, analysierte die Rolle von Religion für die Rußlanddeutschen nach ihrer Deportation. Maria Werthan, Präsidentin des BdV-Frauenverbands, thematisierte die Rolle der Kirche für die deutschen Minderheiten in Rumänien unter dem Regime Ceaușescu.
� SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld/Sachsen-Anhalt
Eine Gala für die Mütter
Anfang Mai fand im Musikhotel Goldener Spatz in Jeßnitz die Muttertagsfeier der sachsenanhaltinischen SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld statt.
Wieder waren viele Landsmänninen gekommen, die sich diesen Höhepunkt im Verbandsleben nicht entgehen lassen wollten. Unterstützt wurden sie von einer Minderheit von Landsmännern, die auch gern an dieser Veranstaltung seit Jahren teilnehmen. Sie wurden auch entsprechend von Kreisobfrau Anni Wischner begrüßt. Dann erläuterte sie die Situation in der Kreisgruppe, welche Maßnahmen bisher unternommen wurden und welche geplant sind. Damit gab es wieder genügend Gesprächsstoff für alle.
la Novotny die Muttertagsgala. Wieder bot sie ein buntes Programm. Das reichte von Soloauftritten der Künstler über Gesangduetts von Mutter und Sohn und Tanzeinlagen von Franziska und Florian bis zu anderen lustigen Darbietungen. Mit viel Beifall bedacht wurde auch der Auftritt von Adealina, einem aus der Ukraine geflüchteten Mädchen, das im Goldenen Spatz eine Bleibe fand.
über das Landesflüchtlingspfarramt der Evangelischen Kirche von Westfalen 1955 bis 1973. Robert Pech von der Technischen Universität Chemnitz erläuterte die Bedeutung der politischen Arbeit der beiden Amtskirchen für die Integration der Heimatvertriebenen, insbesondere deren Gremien und politische Vernetzung. Manfred Kittel von der Universität Regensburg beleuchtete die Rolle der beiden großen Kirchen beim Lastenausgleich. Hierzu wurden Ausführungen des erkrankten und emeritierten Vertriebenen- sowie emeritierten Limburger Weihbischofs Gerhard Pieschl vorgelesen. Sie trugen den Titel „Katholische Seelsorge an Aussiedlern und
Der Referent Johannes Dyck ist Leiter des Instituts für Theologie und Geschichte am Bibelseminar Bonn.
Torsten W. Müller, Direktor des Museumsdorfes Cloppenburg, widmete sich der katholischen Kirche und den Heimatvertriebenen in der SBZ und der DDR. Er sprach von der Zuzugskirche, die mit der Zeit zur Ortskirche geworden sei. Zum Schluß des Themenblocks behandelte der evangelische Theologe Tilman A. Fischer von der Berliner Humboldt-Universität „Heimatverlust und Religiosität als einen praktisch-theologischen Impuls zur Beschäftigung mit heimatvertriebenen Christen in der SBZ/DDR“.

� SL-Ortsgruppe Rückersdorf/Mittelfranken
So grün ist der Mai
dem Maiglöckchen geben kann, empfiehlt es sich, das Augenmerk nicht nur auf den Geruch zu richten, sondern auch darauf zu achten, daß der Stiel immer durch das ganze Blatt geht und beim Umbiegen eines Blattes ein Knackgeräusch entsteht.
Wenn der Bärlauch blüht, sollte man ihn nicht mehr essen. Die
Blüte dient der Regeneration. Das Aufzählen der unzähligen Wildkräuter würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, daher nur noch ein kleiner Auszug von weiteren Kräutern, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienen oder sich zum Verzieren von Kuchen oder zum Aufpeppen eines Salates eignen.
Themenblock vier beschäftigte sich mit deutschen Minderheiten im östlichen Europa nach der Wende und der Rolle der Kirchen bei der Bewahrung ihrer christlichen und nationalen Identität. Dmytro Tsolin von der Katholischen Universität Lemberg sprach über die Kirche als Anker des Zusammenhalts in Zeiten des Krieges. An der abschließenden Podiumsdiskussion über die Rolle des Glaubens für deutsche Minderheiten im östlichen Europa nahmen Piotr Tarlinski, Johannes Dyck, André Schmeier und Alexander Gross, evangelischer Pfarrer in Odessa, teil.
Die Tagung bot eine Gelegenheit, sich über Kirche und Glauben bei der Integration oder der Identitätserhaltung von Heimatvertriebenen in Deutschland und den deutschen Minderheiten im östlichen Europa zu informieren. Sie ist auf dem YouTube-Kanal der Kulturstiftung aufrufbar: https://bit.ly/3LWuOjB
Bei einem blühenden Schlehenstrauch oder Stiefmütterchen kann man die Blüten essen, vorausgesetzt, sie sind nicht gespritzt. Labkraut wurde früher zur Käseherstellung genutzt. Der Spitzwegerich wirkt gegen Husten und antiseptisch bei Insektenstichen. Mit Gundermann kann man Pudding aromatisieren. Die weiße Taubnessel hilft bei Blasenentzündungen. Gänseblümchen sind eßbar und lassen sich gut zu Dekorationen verwenden.
Daneben gibt es natürlich noch bekannte Gewächse wie den Holunderstrauch, den Meerrettich, den Rhabarber oder die Minze. Lehmeier gab zum Abschluß ihres Vortrages allen den guten Rat, in die Natur zu gehen, sie zu schmekken und selber Kräutlein zu zupfen. Anschließend an den Vortrag gab es für alle von ihr mitgebrachte und selbst hergestellte alkoholfreie Maibowle zu verkosten. Der unterhaltsame Nachmittag hatte den Besuchern wieder viel neues und auch noch unbekanntes Wissen vermittelt. Gabi Waade
Bei Kaffee und Kuchen gratulierte die Kreisobfrau einigen Landsleuten mit einem kleinen Präsent zum Geburtstag. Danach eröffnete die Gastgeberin Ange-
Angela Novotny und ihre Mitarbeiter hatten ein wunderbares musikalisches Programm geboten. Von leisen Liedern über bekannte Weisen zum Mitsingen bis zu herrlichen Tänzen war alles dabei und für die Teilnehmer wieder ein besonderes Erlebnis. Am Ende dankte Kreisobfrau Anni Wischner den Künstlern mit kleinen Geschenken. Damit ging wieder ein schöner Nachmittag zu Ende. Dank gebührt unserer Anni Wischner, die diese Feier organisiert hatte. Klaus Arendt
� SL-Ortsgruppe Bayreuth/Oberfranken
Vertreibung im Museum
Seit Jahren versucht die oberfränkische SL-Ortsgruppe Bayreuth im dortigen Historischen Museum eine Dauerausstellung über Heimatvertriebene in Bayreuth einzurichten. Nun ist der erste Schritt getan.

Diese Dauerausstellung soll die Aufnahme, die Herkunft, das Schicksal und die Eingliederung der mehr als 39 000 Sudetendeutschen und weiteren Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler in Stadt und Landkreis Bayreuth dokumentieren. Die Ausstellung sollte auch zeigen, welche enormen Leistungen die einheimische Bevölkerung dabei erbrachte. Wir wollten weiter darstellen, welchen Beitrag zum Wiederaufbau die geschundenen Vertriebenen und Flüchtlinge für die Stadt leisteten. Das Historische Museum Bayreuth, ursprünglich eine alte Lateinschule, öffnete nach dreijähriger Schließung und gekonnter Renovierung mit einem neuen Farbkonzept seine Pforten wieder. Im Rahmen der Dauerausstellung über die Geschichte der Stadt Bayreuth bekamen auch die Heimatvertriebenen mit einer großen Glasvitrine und einer Stellwand eine dauerhafte zweite Heimat für ihre Erinnerungsstükke. Wir sind noch nicht ganz zufrieden, aber es ist hoffentlich ein
ausbaufähiger erster Schritt.
An Exponaten übergaben wir einen Flüchtlingskoffer, eine Wäschetruhe, ein Flügelhorn, Mieder und Rock, Hausrat, eine Tabakschneidemaschine, eine Grubenlampe und weitere Kleinteile. Eine komplette Egerländer Tracht und ein mittelgroßer Leiterwagen einer zwölfköpfigen Flüchtlingsfamilie warten noch auf Einlaß.

Im Begleittext des Museums steht: „In Bayreuth trafen 1946 zwischen Februar und Oktober fast 40 000 Männer, Frauen und Kinder aus den Sudetengebieten ein. Von hier aus wurden sie unter anderem nach Kulmbach, Pegnitz, Creußen, Lichtenfels und Kronach weitergeleitet. Viele blieben aber in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden, wo sie nach anfänglichen Schwierigkeiten wie Wohnungsnot und Mißtrauen der Einheimischen eine neue Heimat fanden und im Lauf der Zeit integriert wurden.“

Leider verließen uns bereits zahlreiche Zeitzeugen für immer. Das macht die wirkungsvolle Darstellung der Geschichte der hier gestrandeten Vertriebenen immer schwieriger. Deshalb ist die Einbindung in die Dauerausstellung der Stadt Bayreuth im Historischen Museum besonders wichtig. Manfred Kees

Vor wenigen Tagen feierte Kurt Schmidt seinen 95. Geburtstag (Þ Seite 6). Hier blickt er auf sein Leben zurück.

Bund der Deutschen in Böhmen


Weißwurst muß man zuzeln
Das Goethe-Institut veranstaltete mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) Ende April/Anfang Mai in München ein Seminar für die Medien- und Pressevertreter der Deutschen Minderheiten in Mittel-Ost-Europa und Zentralasien. Richard Šulko, Vorsitzender des Bundes der Deutschen in Böhmen, berichtet.
Das Thema war Rundfunkarbeit. Wir zehn Teilnehmer aus Lettland, Kasachstan, Polen, Serbien, Rumänien, Ungarn Ukraine und Tschechien erlebten eine konzentrierte und praxisorientierte Arbeitswoche. Diese begann mit einem Stadtspaziergang durch die Auer Dult.
Rudolf de Baey, Referent für Minderheiten beim Goethe-Institut, holte uns vom Hotel ab. In schnellem Tempo ging es an der Heilig-Kreuz-Kirche in Giesing vorbei zur Auer Dult auf dem Mariahilfplatz.
Dort erlebten wir echte Münchener Tradition. Die erste Erfahrung mit den Profi-Verkäufern machte Milica Stankić aus Serbien an einem Stand mit Düften:



„Erst wenn sie verschiedene, aber in sich abgestimmte Düfte zusammensetzen, kommt die richtige Atmosphäre.“ Zu Abend aßen wir im Wirtshaus auf dem Nockherberg. Wir erinnerten uns sofort an das traditionsreiche Starkbierfest, insbesondere an die alljährliche Starkbierprobe mit dem Politiker-Derblecken. Der Montag begann mit der Vorstellung der Teilnehmer und des Teams, das das Programm vorbereitet hatte. Neben Rudolf de Baey stellten sich BR-Mitarbeiterin Elke Dillmann und Medientechnikberater Rupert Jaud vor. Nach der Vorstellung, die Dillmann moderiert hatte, wurde es ernst.
Jaud erklärte lebendig die Aufnahmtechnik wie Laustärke, Ton, Schallwellen, Amplitude, Herz, Frequenz, Muskel im Ohr, Schallgeschwindigkeit, Distanzwahrnehmung, Wahl der richtigen Akustik für den jeweiligen Ort und immer mit Kopfhörer. Jaud zum Schluß: „Nehmt bitte genug ,Atmo‘ (Atmosphäre) auf, etwa zwei Minuten, damit sie genug für die Bearbeitung beim Schneiden haben.“ Dillmann erklärte Radioformate wie Umfrage, Interview, Reportage oder Hörspiel. Dann wurden die Teams für Reportagen und Interviews am nächsten Tag gewählt. Themen waren Seilbahn, Schifffahrt, Museum und Alm.

Am Dienstag fuhren wir mit dem Zug nach Schliersee. Bei Regen ging es steil bergauf bis zur Talstation der Seilbahn und mit ihr rauf auf die Schliersbergalm. Dort erwarteten uns Weißwurst mit Brezen und Weißbier. Imola Munteanu aus Rumänien stellte sich der schweren Aufgabe, eine Reportage über das richtige Verzehren einer Weißwurst zu ma-
chen. Rupert Jaud machte es vor und sagte: „Eine Weißwurst muß man zuzeln. Man nimmt sie in die Hand, tunkt sie in den süßen Senf und saugt sie aus. Vornehmer, aber nicht korrekter ist, sie längs aufzuschneiden und dann mit Messer und Gabel zu verspeisen.“ Das war an diesem Tag das Hauptthema, denn mit der dikken Haut hatte jeder zu kämpfen. Nach dem Frühstück fuhren wir mit der Seilbahn wieder ins Tal zum Schifffahren. Mit der jüngsten Kapitänin Deutschlands, Jasmin Lauber, ging es über den See nach Neuhaus am Schliersee zu Markus Wasmeiers Freilichtmuseum.
schön. Im Dom erlebten wir auch ein kleines Orgelkonzert.
Beim Bummel zum Odeonsplatz sahen wir einen Protest-
Irene Weber führte spannend und begeistert durch das Museum. Eine toxische Information war, daß man das Hahnenfußgewächs Eisenhut aus dem Kräutergarten auch für den „freiwilligen“ Tod eines schwerverletzten Bauern genutzt habe, als er mit Wundbrand im Wald gelegen sei. Für mich am interessantesten waren ein alter Bauernhof und eine Brauerei, die bis heute ihr eigenes Bier mit den ursprünglichen Geräten braut. Nachdem wir Likör gekauft hatten, fuhren wir wieder nach München, wo wir im Hotel tot umfielen.


Mittwoch schnitten und mischten wir die Beiträge. Nach vier Stunden hatte man etwa fünf Minuten Sendung. Ein harter
Job! Dann führte uns Dillmann durch die Innenstadt. Die schönste Kirche war die Asam-Kirche in der Sendlinger Straße, die dem heiligen Johannes von Nepomuk geweiht ist. Aber auch die neue Synagoge und der Dom zu Unserer Lieben Frau sind wunder-
zug durch die Straße ziehen. Auf Transparenten stand „Frieden schaffen ist das oberste Ziel,“ „Keine Waffen in Krisengebiete,“ „Wirtschaftskrieg ist nur eine andere Art von Krieg“. Die Demonstranten skandierten ihre Forderungen gerade in dem Augenblick lautstark, in dem wir mit den Ukrainerinnen Svitlana Velbytska und Kabatsii Vitaliia vorbeigingen. Sie waren entsetzt und zeigten das deutlich. Sofort kam einer der Organisatoren, und es entflammte eine heiße Diskussion. Die Demonstranten wollten nicht verstehen, daß man mit Aggressoren nicht verhandeln kann. Neben den Ar-
gumenten der Ukrainerinnen nannte ich das Jahr 1968, als die Russen unser Land überfielen. Menschen mit solchen Überzeugungen sind mir auch in Tschechien bekannt. Dahinter stecken Menschen oder Staaten, die die Einheit Europas zerstören wollen. Ihnen kann man ihren Glauben auch mit Argumenten nicht nehmen, selbst wenn sie die Kriegsopfer vor sich sehen.
Bei Bier und Obadzdem im Englischen Garten hellte sich die von den Demonstranten ver-
dorbene Laune wieder auf. Weil es aber schon spät und kalt war, konnte ich nur eine Maß genießen. Drei Seminarkolleginnen und ich gingen deshalb in den Münchener Ratskeller, wo wir den Biergenuß nachholten Donnerstagvormittag besprachen und bewerteten wir die einzelnen Sendungen. Isabella Schmid, Leiterin der Medienkompetenzprojekte im BR, händigte uns mit Rupert Jaud und Elke Dillmann die Zertifikate aus. Für den Abend hatte Dillmann ein Schmankerl vorbereitet: ein Konzert des BR-Symphonie-Orchesters im Herkulessaal der Münchener Residenz. Dirigent Antonello Manacorda und Pianist Kirill Gerstein spielten Werke von Franz Schubert und Maurice Ravel. Wunderschön! Auch wegen der Umbauten an der Münchner U-Bahn kamen wir erst um Mitternacht ins Hotel. Das kulturelle Erlebnis war jedoch so stark, daß wir noch lang bei Mojito oder Bier diskutierten. Am Freitagvormittag ging für mich ein Traum in Erfüllung. Ich begegnete Evi Strehl von der Sendung „BR Heimat“. Strehl ist Oberpfälzerin. Bevor sie zum Radio kam, war sie Kreisheimatpflegerin der Jugend in Amberg-Sulzbach. Ihr Großvater prägte sie musikalisch. In Sulzbach-Rosenberg lernte sie Seff Heil (1929–2000) kennen, Bundesvüarstäiha des Bundes der Eghalanda Gmoin. Damit wurde auch das Egerländer Kulturgut in ihrer Sendung präsent. Zwar war ich über meine zwei CDs mit Strehl geistig verbunden, aber sie persönlich zu treffen und mit ihr eghalandrisch za riadn ist halt ganz was anderes. Auch ein tolles Erlebnis war zuzusehen, wie eine Sendung live gemacht wird. Deshalb besuchten wir die Redakteurin Hermine Kaiser im Studio bei ihrer Sendung „Habe die Ehre!“, in der sie mit der Historikerin Marita Krauss über Franz von Bayern sprach. Der letzte Programmpunkt war das Mitwirken bei der Serie „iam.justmyself“ des trimedialen BR-Jungendsenders Puls Radio. Diese Live-Serie auf Snapchat und Instagram zeigt das Leben der 19jährigen Lotte, ein Leben, wie es heute die jungen Leute verbringen. Der Teil, bei dem wir dabei waren, war eine Gerichtsszene, in der Lottes Anzünden einer Scheune verhandelt wurde. Ich spielte den Kläger „Herrn Gruber“. Die verantwortliche Redakteurin ist Silke Struhkamp. Großer Dank gilt den Organisatoren. Das Seminar war intensiv, sofort in die Praxis umsetzbar und mit offenem Herzen und Freude vorbereitet. Wir freuen uns schon auf die Folgeseminare.
Zwei Abschiede von heimatlicher Erde hatte ich hinnehmen müssen. Einmal von meinem Elternhaus am Burgberg in Jägerndorf, von wo die Familie im Juni 1945 vertrieben wurde. Zu diesem Zeitpunkt war mein Vater schon nicht mehr am Leben, erschossen in einem Prager Lazarett. Ich wurde im Juli 1945 aus dem Jägerndorfer Lager an der Troppauer Straße zur Zwangsarbeit nach Ostrau gebracht, Mutter und Tante unmittelbar darauf im Rahmen der wilden Vertreibung nach Sachsen. Der zweite Abschied erfolgte im Oktober 1946 von meinem Geburtshaus in Hermannstadt im damaligen Kreis Freiwaldau. Beide Orte des damaligen Ostsudetenlandes symbolisierten also Abschied und Rückkehr, was sich in diesem Bericht niederschlägt.
Nicht allzu oft wird es vorgekommen sein, daß Sudetendeutsche regelmäßig in ihrem durch die Vertreibung einst verlorenen Geburtshaus willkommen geheißen wurden oder sogar dort wieder herrliche Tage verbringen durften. Genau diese Entwicklung bahnte sich an, als ich 2004 sinnend vor meinem Geburtshaus am Vorwitz in Hermannstadt stand, in Gedanken bei meinen dort in den dreißiger Jahren verbrachten Ferienzeiten bei Tante und Großmutter. Diese Erinnerung wurde jäh unterbrochen.
Denn plötzlich sprang ein kleiner Hund, freudig bellend, auf mich zu, gefolgt von zwei kleineren Jungen, zwei größeren Mädchen und deren Mutter, der jetzigen Eigentümerin des ehemals großen Landgasthauses meiner Tante Olga. Ihr erklärte ich die Ursache meiner Betrachtung. Als Antwort erhielt ich eine freundliche Einladung zu Kaffee und frisch gebackenen Kolatschen. Diesem ersten Kontakt folgten viele weitere Besuche, auf die sich neben der Elternfamilie vor allem die Kinder freuen sollten.
Die Familie betrieb jetzt eine ausgedehnte Viehwirtschaft, interessierte sich aber angesichts damals noch bestehender Schwierigkeiten vor allem für die Lebensumstände vor der Vertreibung, für das frühere Aussehen dieser Gaststätte meiner Tante und für die Art der Wasserversorgung dieses Gebirgsortes. Ich informierte die Familie über gerettete Fotos. Dadurch verstärkten sich die Beziehungen zu dieser sehr kirchentreuen Familie.
Schließlich lud sie mich mit Heimatkreisbetreuer Meinhard Schütterle zu einer mehrtägigen Sommerfrische ein. Bilder meiner Schulferien schienen sich zu wiederholen. Zur Steigerung dieses Glücksgefühls fehlten nur Tante, Großmutter sowie alle unsere früheren deutschen Nachbarn vom Vorwitz. Nach der Geburt ihres fünften Kindes bat mich die Familie 2019 um ein Foto, weil ich mit 90 Jahren mit dem Neugeborenen eines gemeinsam hatte, nämlich das Geburtshaus. Neben der Familie verbanden mich schon seit 1995 freundschaftliche Verbindungen zur katholischen Geistlichkeit, besonders aber zum Pfarrer von Mariahilf (Panna Maria Pomocná).
Zudem hatte ich, ebenfalls bereits Jahre vorher, anläßlich einer ähnlichen Begegnung vor meinem Geburtshaus, den Bürgermeister von Hermannstadt kennengelernt. An den Heidelbeerkuchen seiner Frau und an sein Loreto, das der tief gläubige Mann im Garten nachgebildet hatte, erinnere ich mich heute noch sehr gern. Tragischerweise endete diese Verbindung nach nur drei Jahren. Seine fortschreitende Demenz nahm ich kurz vor seinem Tod bei einer letzten Begegnung in der Kirche zu Mariahilf betrübt zur Kenntnis. Solche Kontakte konnten sich nur entwickeln, weil es gelungen war, nach regelmäßigen privaten Besuchen vor der Wende immer in meinen Herbstferien ab 1995 jährliche Fahrten des Heimatkreises in die Wege zu leiten. Bei der christlich geprägten Einstellung der meisten unserer mitfahrenden Landsleute wurde es zur Selbstverständlichkeit, neben den Gemeinden des ehemaligen Kreises Jägerndorf Jahr für Jahr auch Mariahilf in unser Programm einzubeziehen. Die Fahrten begannen mit der ersten Kulturfahrt des Heimatkreises Jägerndorf schon im Jah-
re 1995, als wir mit einem Teil der ersten deutschen Besuchergruppe die Wiedereinweihung der 1974 zerstörten, aber nach der Wende wieder aufgebauten Kirche miterleben durften. Ihren Segen in drei Sprachen erteilten damals Bischöfe aus Polen, der Tschechischen Republik und Deutschland. Damit begann die von dem Ansbacher Busunternehmen Wellhöfer durchgeführte und auf eine Woche begrenzte offizielle Phase einer Rückkehr in die Heimat, bedingt durch die Mitwirkung kommunaler Verwaltungen.
Denn die entsprechenden Vorplanungen dieser Kulturwochen erforderten, in Jägerndorf und anderen Orten des ehemaligen Kreises unsere Vorhaben und Pläne wie Denkmals- oder Kirchenerneuerungen mit den jeweiligen Pfarrern oder Ortsbürgermeistern abzusprechen. Hierbei erreichten wir auf dem Lande meist raschere Ergebnisse als in der Stadt Jägerndorf/Krnov. Im Jahr 2006 kam es schließlich auch dort zu einer Art Frontverschiebung.
Diese begann damit, daß es in jenem Jahr bei einer Diskussionsveranstaltung in Jägerndorf zu einer scharfen Antwort der aus einer deutschen Familie stammenden Sekretärin des Bürgermeisters von Hermannstadt gekommen war, vorgetragen als Ablehnung vorheriger Anwürfe kommunistischer Mandatsträger. In der Folge unterblieben zwar weitere
und Wiederkehr von und nach Jägerndorf
Kurt Schmidts Elternhaus am Burgberg in Jägerndorf. Das Gebäude samt Auto gehörte der Familie von 1924 bis 1945 und liegt an der höchsten Stelle der Stadt Jägerndorf. Für Schmidt war es wegen des Überblicks über das Altvatergebirge der schönste Platz seiner Jugend. Das Gebäude wurde während der Kämpfe 1945 von russischen Fliegerbomben und Granaten beschädigt.


öffentlichen Aktionen dieser Gruppe gegen uns, verlagerten sich aber in den Ratssaal, wo sie sich nun besonders gegen Renáta Ramazanová (ODS), die neu gewählte Bürgermeisterin, richteten. Ihr Zweiter Stellvertreter war Bedřich Marek, dem wir bereits 1995 als damals erstem demokratisch gewählten Bürgermeister von Jägerndorf die Anfänge unserer Verständigungsarbeit zu verdanken hatten.
Damit begann die Zeit einer immer engeren Zusammenarbeit, die sich gelegentlich zu persönlicher Freundschaft steigerte. Deutlichen Ausdruck fand dies 2008 anläßlich meines 80. Geburtstages, als mir die Bürgermeisterin und ihre beiden Stellvertreter in einem Hotel im Fichtelgebirge gratulierten. Unser kulturelles Wirken in der Heimat hatte Anerkennung auch bei unseren tschechischen Partnern gefunden. Damit zurück zum Geburtshaus am Vorwitz.
Dort waren im Juni 1945 zwei russische Soldaten eingedrungen und vergewaltigten meine Tante Olga Beier. Später stellte sich heraus, daß der Vergewaltiger ebenso alt war wie ihr Sohn. Ihr Mann war gezwungen worden, diese Untat mit anzusehen. Doch das Verantwortungsbewußtsein und die Resolutheit meiner Tante blieben ungebrochen. Über die örtliche Gendarmerie suchte sie meine Entlassung aus tschechischer Internierung zum Zweck der „Aussiedlung“ zu erreichen. Sie hatte Erfolg: Im August 1946 wurde ich nach Hermannstadt entlassen. Dort arbeitete ich noch bei der Einbringung der Ernte mit. Hierbei empfand ich plötzlich im Anblick von Urlich, Altvater, Querberg und Bischofskoppe einen eigenartigen, damals völlig abwegig erscheinenden Gedanken, wonach ich nach 20 Jahren meine Bergheimat wiedersehen sollte. Diese Ahnung wurde 1966 zur Tatsache.
Zunächst aber galt es, 1946 die Trauer über den bevorstehenden Heimatverlust in Jägerndorf und Hermannstadt zu bewältigen. Ende Oktober 1946 wurde die Bevölkerung vom Vorwitz erst ins Lager Niklasdorf im Kreis Freiwaldau gebracht, um nach einer Woche Lageraufenthalt nach Bayern vertrieben zu werden. Der Abschied von den heimatlichen Bergen, von Jägerndorf und dem Burgberg erschien trostlos und unverrückbar, die Erwartung einer möglichen schulischen Weiterbildung in Bayern vage und der Gedanke an eine Rückkehr schien ausgeschlossen.

Studium und Berufszeit vergingen, das Interesse an der Heimat blieb. Dafür stieg der Unmut über das zunehmende Desinteresse der deutschen Öffentlichkeit und Presse am Schicksal der Vertriebenen. Die Überzeugung wuchs, entsprechend meinen Möglichkeiten wenigstens für die Landsleute des Kreises Jägerndorf etwas tun zu müssen, und zwar nicht nur verbal. Vorerst aber blieb mein Interesse, von Norddeutschland her gesehen, wo ich mich für die Westpreußen engagiert hatte, zunächst auf die Sudetendeutschen Tage, die Jägerndorfer Treffen oder auf die jährliche Herbstreise nach Jägerndorf beschränkt. Andererseits nutzte ich die Möglichkeit, das Interesse angehender Abiturienten für östliche Länder zu erwecken. Das Ergebnis waren Studienreisen in die Sowjetunion, vor allem aber in die nähere und benachbarte Tschechoslowakei.
Diese als Verpflichtung gesehene Aufgabe sollte sich unmittelbar nach meiner Pensionierung 1993 durch meine schon vorher erfolgte Wahl zum Heimatkreisbetreuer als steigerungsfähig erweisen.
Schon ab 1995 ging es mit Gruppen meiner Landsleute ins Altvatergebirge zur Wanderwoche und nach Jägerndorf zur Kulturwoche. Dort war inzwischen der SchlesischDeutsche Verband unter Franz Strohalm und Horst Westphal entstanden.
Die Zusammenarbeit mit unseren heimatverbliebenen Landsleuten gipfelte 2002 in unserer auf Mietbasis beruhenden Übernahme des neu erbauten Hauses der tschechisch-deutschen Verständigung – Haus Europa am Rathausplatz, also im Zentrum unserer Heimatstadt. Dies
konnte nur geschehen infolge der tätigen Mithilfe Jägerndorfer Landsleute, die sich bereits 1997 zur Gründung des Heimatkreisvereins Jägerndorf entschlossen hatten. Somit war nach meinem leidgeprüften, zweimaligen Abschied 1945/46 eine zwar jeweils zeitlich begrenzte Rückkehr, aber auch ein ständiges Zentrum für die deutsche Minderheit 2002 Wirklichkeit geworden.
Das Haus wird vom Schlesisch-Deutschen Verband unter Horst Westphal verwaltet und wird finanziell getragen von Heimatkreis und Verein, also ohne Mithilfe von Landsmannschaft oder gar deutschen Regierungsorganen. Die deutsche Botschaft
Schmidts Geburtshaus in Hermannstadt, das ein Verwandter vor seiner von Arbeislosigkeit erzwungenen Abreise nach Wilhelmshaven 1935 malte. Von hier wurde er im Oktober 1946 vertrieben. Das Haus wurde zeitweise wieder Gasthaus, so daß er dort mit einer Gruppe Wanderfahrer und bereits mit tschechischen Bürgermeistern seinen 75. Geburtstag feierte. Heute gehört es der Familie Hridžak.
heraus, der sich über die Aktivitäten unserer heutigen Ehrenmitglieder herausgebildet hatte und neben anderen Themen die Details der Kulturwochen bespricht. Diese Form der Rückkehr ist in der Regel mit gegenseitigen Einladungen und Geschenken verbunden. Aber damit zurück in die graue Vergangenheit vor 1989.
Meine ersten inoffiziellen Besuche galten in ortsüblicher Verkleidung dem zerstörten und abgesperrten Mariahilf, dem für Ausländer ebenfalls unzugänglichen Gymnazium Krnov und der Universität von Olmütz, natürlich immer in Begleitung tschechischer Unterstützer. Hier-
Als hilfreich erwiesen sich auch positive Beiträge in den beiden wichtigsten Presseorganen der Stadt.
25-Jahr-Feier der Jägerndorfer Kulturfahrt 2019 im Jägerndorfer Schützenhaus mit 90 tschechischen und deutschen Gästen, darunter Jägerndorfs Bürgermeister Tomáš Hradil, Heimatkreisbetreuer Meinhard Schütterle, Pfarrer Zachrlas Sekretärin Daniela Bolková, Kurt Schmidt und Pfarrer Pavel Zachrla aus Hillersdorf/Dolni Holcovice.
in Prag trug bis zum letzten Jahr wenigstens die Vergütungen für die Lehrkräfte, welche deutsche Sprachkurse im Haus abhielten.
Alle weitergehenden politischen Forderungen lagen nicht mehr im Wirkungsbereich des unabhängigen Vereins oder den Möglichkeiten der Stadt Jägerndorf. Aber es bildete sich ein deutsch-tschechischer Freundeskreis aus Presse, Geistlichkeit und freiwilligen Mitarbeitern
zu zählten vor 1989 furchtlose Einzelpersonen, nach 1989 bald auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche, ja sogar Vertreter der jüdischen Gemeinde. Besonders Ludmila Čajanová, die am Gymnasium unter anderem Deutsch und Latein lehrte und im Stadtrat als Vertreterin der KDU-ČSL wirkte, förderte durch Vermitteln und Dolmetschen unseren Weg zu Ausgleich und Anerkennung.

Bald kam es darauf an, Landsleute über ihre persönlichen Interessen hinaus auch für den Ausbau beziehungsweise die Absicherung dieser offiziellen Kontakte sowie für die Sorge um Erhaltung noch vorhandenen Kulturguts zu gewinnen. Hierfür waren aber auch Unabhängigkeit und ein gewisser finanzieller Fundus erforderlich. Beides gelang 1997 durch die Gründung des Heimatkreisvereins Jägerndorf. Die Gründung kam spät, aber gerade noch rechtzeitig. Nachdem die erste offizielle Gruppenreise nach Jägerndorf mit mehr als 100 Teilnehmern aus Österreich und Deutschland geglückt war, befürchtete ich, der erste Kontakt könnte auch schon der letzte sein. Doch dieser Pessimismus erwies sich bald als weitgehend unbegründet. Denn meine zunächst unausgesprochene Zielvorstellung eines offiziell anerkannten Ausgleichs hatte über den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zu Rekonstruktionen deutschen Kulturgutes wie Friedhof, Burgberg beziehungsweise zur Errichtung des Bauer-Denkmals in Jägerndorf geführt, was wiederum deutsche und tschechische Beteiligungen an der Finanzierung voraussetzte. Für den Verein bedurfte es deshalb meist einer Mitgliederentscheidung über die Verwendung der begrenzten Mittel.
Dies alles führte über viele Verhandlungsrunden, aber auch zu den bereits erwähnten positiven Presseberichten und zu weiterer Annäherung im gegenseitigen Verständnis. Zudem: Nach
der Übernahme des Hauses Europa schien der Gedanke einer begrenzten Rückkehr auch dadurch näher zu rücken, weil einige Mitarbeiter ihren ständigen Wohnsitz nach Jägerndorf verlegten. Horst Kaller als damaliger Kulturreferent bezog beispielsweise eine Wohnung im Schulhaberhaus und wurde dadurch unmittelbarer Nachbar von Bürgermeisterin Renáta Ramazanová.
Die Zahl der Teilnehmer an den seit 1995 jährlichen Kulturwochen nahm im Gegensatz zu den Wanderwochen im Juni zwar ab, bedingt durch Alter oder Tod der sie unterstützenden Landsleute. Die Kontakte zu tschechischen Organisationen geistlicher und weltlicher Art, auch zur jüdischen Kultusgemeinde und privaten Unterstützern legten hingegen zu. Der Prozeß hält bis heute an. Beredtes Zeugnis legten die von den Mitgliedern unseres bundesdeutschen Vereins gewählten deutschen und tschechischen Ehrenmitglieder aus Jägerndorf ab: Horst Westphal als wirtschaftlicher Leiter im Haus und Vorsitzender des Schlesisch-Deutschen Verbandes Jägerndorf, Ludmila Čajanová als Gymnasiallehrerin und Ratsherrin, Květoslava Kukelková von der Pädagogischen Schule Jägerndorf und Kulturschaffende in Jägerndorf. Die beiden Damen haben zwar ihr pädagogisches Wirken inzwischen beendet, nicht aber ihren Einsatz für die deutsch-tschechische Verständigung in der Stadt und im ehemaligen Kreis Jägerndorf. Unsere Form der Rückkehr in die schlesische Heimat blieb zwar immer auf wenige Wochen im Jahr beschränkt, reichte aber aus. Gesellschaftlichen Niederschlag fand dies auch in öffentlichen Ehrungen. So wurde ich 2005 zum Ehrenmitglied des Kirchenchors gewählt; 2012 überreichte mir im Konzertsaal – ehemalige Heiliggeistkirche – Alena Krušinová als damalige Bürgermeisterin ein Diplom der Stadt „für den Aufbau von Vertrauen zwischen der deutschen Vorkriegsbevölkerung Jägerndorfs und der Anknüpfung von Verständigung mit der jetzigen Bevölkerung“.
Skizze des Lagers für politische Gefangene an der Troppauer Straße. Hier, besonders aber im innen noch einmal abgesperrten Teil (Ý roter Kreis), geschahen besonders niederträchtige Untaten. Hier war Kurt Schmidt mit gerade einmal 17 Jahren zeitweise das jüngste Opfer besonders des Lagerkommandanten. Dieser trug den Sowjetstern an der Mütze und ließ seinen Haß prügelnd an wehrlosen Deutschen aus. Heute liegt er in einem Doppelgrab ohne Namensangabe auf dem Friedhof von Jägerndorf/Krnov bestattet. Rechts Ansicht des Aussiedlungslagers des Kreises Jägerndorf am Burgberg. Von hier aus wurden rund 37 000 Deutsche „ausgesiedelt“ beziehungsweise vertrieben. Das Lager wurde gleich nach dem Anschluß 1938 errichtet und diente dem sogenannten Reichsarbeitsdienst.
Soweit der kleine, aber vielleicht beispielhafte Beitrag des Heimatkreises Jägerndorf zu nationalem Ausgleich und zu europäischer Verständigung. Er zeigt, wie in Krnov/ Jägerndorf aus erzwungenem Abschied eine ungezwungene, zur Selbstverständlichkeit gewordene Wiederkehr entwickelt wurde.

für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau








Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Richard Wagner und Teplitz – Teil I
Töplitz – das Schönste, was ich kenne
Unsere Teplitz-Schönauer Korrespondentin Jutta Benešová widmet sich intensiv der Beziehung Richard Wagners zu ihrer Stadt.
Ach, dieses Töplitz mit seiner weitesten Umgebung ist wohl das Schönste, was ich kenne.“ Diese Begeisterung, die Richard Wagner 1842 in einem Brief an seine Schwester Cäcilie äußerte, ist ein so kostbares und einmaliges Zeugnis von Wagners ungewöhnlich inniger Beziehung zu Teplitz, das für ihn in jener Zeit sehr viel bedeutete, sowohl für sein persönliches Leben als auch für sein künstlerisches Schaffen.
Heuer erinnern wir uns am 22. Mai an den 210. Geburtstag eines unserer bedeutendsten und auch umstrittensten deutschen Komponisten. In der umfangreichen Literatur, die über Richard Wagners Leben und sein Werk in Deutschland erschien, wird diese Epoche seines Lebens, seine jugendliche Sturmund Drangzeit, die er so oft in Böhmen verbrachte, kaum erwähnt. Dabei bringen seine ausführliche Autobiographie „Mein Leben“ und seine Korrespondenz eine Reihe von Zeugnissen über seine engen Beziehungen zu Böhmen, zum Böhmischen Mittelgebirge und zum Elbtal, zu Prag und nicht zuletzt zu Teplitz.
und müde und überarbeitet in die Teplitzer Bäder reiste. An den hiesigen Quellen suchte er Genesung für seine nicht sonderlich stabile Gesundheit.
Richard Wagner kam am 22. Mai 1813 im Haus Zum weißen und roten Löwen in Leipzig als neuntes Kind der Familie des Polizeibeamten Friedrich Wagner zur Welt. Es war das stürmische
nach einer recht abenteuerlichen Reise im Bad ankam.
Doch das Kriegsgeschehen griff auch auf Böhmen über. Am 10. August 1813 wurde der Kriegszustand ausgerufen. Für den Kurort bedeutete es das unerbittliche Ende der Kursaison und für Napoleon kurz darauf eine bittere Niederlage in der Schlacht bei Kulm.

meine Phantasie einen unauslöschlichen Eindruck“.
Das Richard-Wagner-Prortrait des mittlerweile erfolgreichen Komponisten schuf Guiseppe Tivoli 1883.



Jahr der Napoleonischen Kriege, also eine wenig geeignete Zeit für freudige Familienereignisse. Wer konnte, verließ die gefährliche Region. Aus Leipzig und Dresden fuhren die Menschen nach Böhmen, weil sie hofften, hinter dem unzugänglichen Wall des Erzgebirges in Sicherheit zu sein.
Wagners Lieblingsschwester Rosalie Marbach/Wagner (1803–1837).
Reich ist Wagners Korrespondenz mit seinen Prager Freunden, die unter Erschwernissen, aber unermüdlich sein unkonventionelles Werk propagierten und aufführten. Dieses hatte nicht nur Bewunderer, sondern vor allem zu Beginn auch harte Gegner in den Reihen der musikalischen Konservativen und auch im Publikum.
Wagners Beziehung zu Nordböhmen war anderer Art. Hierher kam der Komponist, um neue Kräfte zu schöpfen und Ruhe und Inspiration für sein Schaffen zu finden. Hierher kam er schließlich in Zeiten, als er Kapellmeister der Dresdener Hofoper war
■ Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: 9. Kreistreffen in der Heimat. Donnerstag eigene Anreise nach Teplitz-Schönau, Hotel Prince de Ligne (Zámecké náměstí 136); 19.00 Uhr dort Abendessen; anschließend zwei Dokumentarfilme über die Zeitzeugen Pater Benno Beneš SDB (1938–

Viele von ihnen begaben sich nach Bad Teplitz, wo sie größere Chancen für eine Unterkunft erwarteten. So auch Johanna Wagner, die mit ihrem zwei Monate alten Söhnchen Richard in Teplitz Zuflucht suchte und im Haus zu den drei Fasanen am Schloßplatz Quartier fand. Vater Friedrich Wagner mußte als Polizeibeamter die Ordnung in Leipzig hüten.
In Teplitz hielt sich bereits die Leipziger Seconda-Theatergesellschaft auf, zu der auch Ludwig Geyer gehörte, ein naher Freund der Familie Wagner. Böse Zungen behaupteten, daß er sogar ein intimer Freund sei. Es war deshalb nur natürlich, daß Geyer sich bereitwillig Johanna Wagners annahm, als diese am 21. Juli

2020) und Hana Truncová/John (1924–2022). Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Saubernitz (Zubrnice) im Böhmischen Mittelgebirge; dort Besichtigung des Freilichtmuseums; anschließend Mittagessen in der Dorfgaststätte und Weiterfahrt nach Leitmeritz; von dort Schiffahrt auf der Elbe mit Kaffee und Ku-
Wilhelmine „Minna“ Wagner/Planer (1809–1866) war Schauspielerin und Wagners erste Ehefrau. Sie waren 30 Jahre lang verheiratet.

Nach der großen Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 verbreitete sich in der Stadt eine verheerende Epidemie, der auch Friedrich Wagner erlag. Er starb im November, als sein Sohn ein halbes Jahr alt war. Johanna Wagner, die mit ihren neun Kindern zurückblieb, vermählte sich einige Monate später mit Ludwig Geyer, der ihr hilfreich zu Seite stand und den Kindern ein guter Vater war.
1826 erhielt Richards älteste Schwester Rosalie (1803–1837) ein Engagement als Schauspielerin am Ständetheater in Prag, wo Richard sie während der Wintermonate besuchte. Wie er später in seinen Erinnerungen niederschrieb, hinterließ diese „altertümliche Pracht und Schönheit der unvergeßlichen Stadt auf

Gleich im darauf folgenden Jahr 1827 begab sich Wagner erneut aus Dresden nach Prag, und diesmal auf eine Weise, zu der er sich nur unter dem Einfluß einer romantischen Abenteuerlust entschließen konnte. Gemeinsam mit seinem Kameraden Rudolf Böhme brach er zu Fuß nach Prag auf. Das Wetter war herrlich, der Lenz meldete sich in seiner ganzen Pracht, aber auch unter diesen günstigen Bedingungen begriffen die Knaben bald, daß sie ihre Kräfte bei weitem überschätzt hatten. Kaum gelangten sie mit schmerzenden Füßen bis nach Teplitz, um hier zu übernachten. Am anderen Tag mieteten sie sich ein Fuhrwerk, das sie bis nach Lobositz brachte. Von dort aus setzten sie ihren Weg bei schrecklicher Hitze zu Fuß nach Prag fort, denn ihr nicht allzu großer Geldbetrag war schon bald ausgeschöpft. Sie gingen querfeldein, mit dem sorgenfreien Gemüt ihrer Jugend und im Glauben, daß alles nur gut ausgehen könne. Ihr Bemühen wurde mit den herrlichsten Erlebnissen belohnt. „Meine Freude“, erinnerte sich Wagner, „als ich endlich von einer Anhöhe etwa eine Stunde von der Stadt entfernt Prag erblickte, war unbeschreiblich.“
1832 zog Wagner aus, um Wien mit seinen ersten Kompositionen zu erobern, eine Stadt, die vom Geist der großen Klassiker Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven geprägt war. In Wien erwartete ihn jedoch eine arge Enttäuschung. Er fand hier
nicht eine solche Stadt vor, wie er erhofft hatte, gedanklich jung und progressiv. Fünf Wochen später kehrte er also nach Prag zurück, wo er Kontakt mit einigen führenden Vertretern des Musiklebens anknüpfte, mit dem Komponisten Wenzel Johann Tomaschek, mit dem Direktor des Konservatoriums Friedrich Dionys Weber, mit dem hoffnungsvollen Komponisten Johann Friedrich Kittl und weiteren Künstlern, mit denen er auch später in engem Kontakt stand.
Seine erste Oper „Die Hochzeit“, erfüllt von jugendlichem Überschwang, redete ihm seine Schwester Rosalie aus. Es dauerte jedoch nicht lange, und Böhmen inspirierte Wagner zu einem weiteren Bühnenwerk, als er erneut im Jahre 1834 das Land besuchte, nun schon als Theaterkapellmeister. Diesmal reiste er in Gesellschaft seines Leipziger Freundes, des Dichters Theodor Apel, nach Teplitz. Sie quartierten sich im führenden Hotel Zum König von Preußen gegenüber dem Kaiserbad ein, in einem Zimmer mit Balkon in der ersten Etage. In die Kur-Liste trugen sich die jungen Gäste am 17. Juni als Wilhelm Richard Wagner, Tonkünstler, und Guido Theodor Apel, Bürger aus Leipzig, ein. Sie waren dank Apels gefüllter Brieftasche in einer eleganten Kutsche angereist und lebten „wie die jungen Götter“.
Das einstige Hotel Zum König von Preußem war später das Hauptpostamt und stand 2013, als dies Bild entstand, leer.

TERMINE
chen nach Aussig; Rückfahrt zum Abendessen in der Teplitzer Brauereigaststätte Monopol. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt in die Königstadt Kaaden; dort Besichtigung des Franziskanerklosters mit Mittagessen in der Klostergaststätte und Rundgang durch den Klostergarten; anschließend Kranzniederlegung
auf dem Friedhof am Denkmal für die Opfer des 4. März 1919; 19.00 Uhr festliches Konzert in der Schönauer Elisabethkirche; anschließend Abendessen im Wirtshaus. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienstmöglichkeit in der Dekanatskirche Johannes der Täufer am Schloßplatz und eigene Heimreise. Änderungen vor-
Täglich begaben sie sich im eigenen Wagen auf längere Ausfahrten in die Teplitzer Umgebung. Im Restaurant
behalten. Kostenbeitrag inklusive drei Übernachtungen, Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, allen Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen, Schiff und Konzert pro Person im Doppelzimmer 435 Euro, im Einzelzimmer 520 Euro. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Verbindliche Anmeldung
auf der Wilhelmshöhe oberhalb von Graupen, von wo aus sich ein weiter und herrlicher Ausblick in das Teplitzer Tal bietet, speisten sie mit Appetit gebratene Forellen und tranken dazu Wein aus Tschernosek und Biliner Wasser. Sie besuchten die beliebte Tuppelburg mit dem Gehege in Tischau und verschliefen nach einem ausgiebigen abendlichen Gelage den Sonnenaufgang auf dem Milleschauer. Der Teplitzer Aufenthalt wurde jedoch auch ernsten Dingen gewidmet. Während Apel die Heilbäder aus wirklich notwendigen Gründen nahm, ging Wagner „eher zum Vergnügen“ ins Bad. Nach den Tagen ungebundener Vergnügungen und Zerstreuungen fühlte er nun das Verlangen, die Feder zur Hand zu nehmen und sich wenigstens für eine Weile darauf zu konzentrieren, was er als Ziel seines Lebens gewählt hatte. „An einigen schönen Morgen“, erinnerte sich Wagner nach Jahren, „stahl ich mich aus meiner Umgebung fort, um mein Frühstück einsam auf der Schlakkenburg zu nehmen (ein beliebtes Ziel der Teplitzer Kurgäste auf der Königshöhe), und bei dieser Gelegenheit den Entwurf zu einem neuen Operngedicht in mein Taschenbuch aufzuzeichnen. Ich verwendete zu diesem Vorhaben den Text von Shakespeares Schauspiel ,Maß für Maß‘, den ich im Geiste meiner augenblicklichen Laune sehr frei als Libretto für eine Oper umarbeitete, der ich den Titel ‚Das Liebesverbot‘ gab.“ Fortsetzung folgt
bis Sonntag, 30. Juni, durch Überweisung des Reisepreises auf das Konto Erhard Spacek – IBAN: DE35 7008 0000 0670 5509 19, BIC: DRESDEFF700. Bitte Anschrift und Namen der Reiseteilnehmer angeben, sonst Mitteilung mit diesen Angaben an eMail spacek@teplitz-schoenau -freunde.org
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergFÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ HEIMATBOTE
 Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Die Geschichte der Schulen in Ronsperg – Teil III


und modern

Der dritte Teil der Serie über die Schulen in Ronsperg befaßt sich weiter mit der Bürgerschule.
Schließlich stimmte das Mutterhaus der Borromäerinnen in Prag einem Neubau der Bürgerschule zu. Johannes Graf Coudenhove-Kalergi stellte den Baugrund zur Verfügung. Der Bau selbst soll auf zwei Millionen Kronen gekommen sein. 1937 konnte das neue Schulgebäude, eines der schönsten und modernsten in Westböhmen, eingeweiht werden. Von der Straße her kam der Bau nicht voll zur Geltung, doch vom Stadtweiher aus betrachtet, bot die Ronsperger Bürgerschule ein imposantes Bild.

Nach dem Anschluß 1938 wurden jedoch den Schwestern die Leitung der Schule sowie der Unterricht entzogen. Zunächst wurde die Bürgerschule kommissarisch Direktor Josef Drachsler von der Bürgerschule Bischofteinitz unterstellt, bis im Mai 1939 Bürgerschullehrer Karl Hannakam die Schulleitung übertragen wurde. Die Schule hatte damals vier Klassen für Knaben und vier
für Mädchen, für kurze Zeit sogar einmal eine fünfte Klasse, die sie aber wieder an die Kreisstadt verlor.
Zum Lehrkörper der Ronsperger Bürgerschule gehörten zu Beginn des Schuljahres 1939/40 außer dem Direktor Hannakam folgende Fachlehrer beziehungsweise Fachlehrerinnen: Josef Leibl, Ernst Luft, Ludwig Mulz, Josef Rubey, Josef Steiner und Frieda Strecker. Da die Schule aber elf Planstellen besaß, mußten noch Aushilfslehrkräfte beschäftigt werden. Neben dem bereits pensionierten Oberlehrer Karl Reimer waren es vor allem Lehrkräfte der Ronsperger Volksschule, die hier eingesetzt wurden. In der Zeit des Krieges waren an der Bürgerschule kürzere oder längere Zeit Franz Baier, Anton Guldan, Georg Guldan, Gertrud Leberl, Erich Pöhnl, Rudolf Sankowitsch, Martha Schwarzbach, Maria Stich/Pintrowitsch, Luise Rippl
und Peter Rautschka angestellt. Anfang der vierziger Jahre erhielt die Schule den neuen Namen Hauptschule. Die Leitung der Anstalt hatten kommissarisch zeitweilig Peter Rautschka und Anton Guldan. Gegen Ende des Krieges wurde die Schule größtenteils als Reservelazarett verwendet. Im April 1945 wurde wegen Gefährdung der auswärtigen Schüler durch feindliche Tiefflieger der Unterricht eingestellt. Heinrich Cenefels
Grundsteinlegung der neuen Bürgerschule
Sonntag, den 3. Mai 1936, wurde nach dem Hauptgottesdienste die Weihe des Gedenksteines zu der neuen, im Bau befindlichen Privat-Bürgerschule in Ronsperg vorgenommen. Entgegen der ursprünglichen Absicht, diese Zeremonie in aller Stille durchzuführen, gestaltete sich dieselbe durch die
spontane Mitwirkung der hiesigen „Böhmerwald-Harmonie“ unter persönlicher Leitung ihres Begründers, des hochverdienten Oberlehrers Karl Reimer, sowie durch die massenhafte Beteiligung der Bevölkerung zu einer überaus eindrucksvollen und weihevollen Veranstaltung.


Um elf Uhr vormittags versammelten sich auf dem Bauplatze der neuen Bürgerschule die Festgäste: der hochedle Protektor der Schule Majoratsherr Hans Graf Coudenhove-Kalergi zu Ronspergheim, der Hochwürdige Herr Vikär Dominik Šanda, die Geistlichen Obern der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Karl Borromäus in Prag sowie der Konvent der hiesigen Filiale dieser Kongregation, die Herren Oberlehrer Johann Osterer, Josef Brunner und Holl, der gesamte Lehrkörper und eine stattliche Menschenmenge.
In der Hauskapelle des Karolusheims fand unter Beisein des Hochwürdigen Herrn Prälaten Wenzel Feierfeil und der Herren Baumeister Anton Streinz, Peter Janda und Ingenieur Josef Svoboda die Segnung des Gedenksteines durch den Hochwürdigen Herrn Vikär Dominik Šanda statt. Unter den Klängen des Chorals „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ wurde der Stein an seinen Bestimmungsort getragen, worauf Prälat Feierfeil eine fulminante Festrede hielt. Die Musikkapelle brachte sodann die Staatshymne und anschließend das ,Deutsche Lied‘ zum Vortrag, indes seitens aller Festgäste unter sinnigen Segenssprüchen die usuellen drei Hammerschläge geführt wurden.
Möge dieses großzügige Jugendhilfswerk, der prächtige Schulneubau, ebenso zur höheren Ehre Gottes, wie zum Wohle der Jugend als der Zukunft des Staates dienen! Aus der Pfarrchronik von Ronsperg
Am 3. Februar starb Gottfried Leibl, Ehrenkreisrat und bis zu seinem Tod Ortsbetreuer von Plöß, mit 86 Jahren im oberpfälzischen Schwandorf-Freihöls.

Am 9. Februar nahmen wir, der Heimatkreis Bischofteinitz, auf dem Friedhof in SchwandorfFronberg für immer Abschied von unserem Leibl Gottfried. Ebenfalls Abschied nahmen Vertreter des Heimatvereins Plöß, der SL, der Freiwilligen Feuerwehr Freihöls, des Jägervereins Sankt Hubertus Schwandorf mit seiner Bläsergruppe, der Schützengilde Kleeblatt Frotzersricht, der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft
Tell Schwandorf, der Kreisjägergruppen Burglengenfeld, Schwandorf und Oberviechtach mit den Jagdhornbläsern und des CSU-Ortsverbandes Schwandorf, bei all denen er aktives Mitglied war.



Gottfried Leibl trat stets für die deutschtschechische Aussöhnung ein. Er gründete den Heimatverein Plöß, seine Heimatgemeinde, dessen Vorsitzender er 27 Jahre lang war. Mit verschiedenen Publikationen, der Wiederherstellung des Friedhofs in Plöß und dem Wachhalten der Erinnerung mahnte er zum Frieden für heranwachsende Generationen. Er trug in vorbildlicher Weise dazu bei, daß deutschtschechische Kontakte gepflegt wurden und aus Nachbarländern Partnerländer wurden.
Er war jahrzehntelang Mitglied des Kreisrates des Heimatkreises Bischofteinitz und bis 2001 Kassenprüfer. Von da an hatte er das Amt des Kassiers inne, bis er 2013 dieses Amt aus gesundheitlichen Gründen übergab. 2013 wurde er zum Ehrenkreisrat ernannt und nahm, so lange es seine Gesundheit zuließ, an den Kreisratssitzungen teil. Für sein Lebenswerk wurde er 2009 mit der Landkreisverdienstmedaille des Landkreises Schwandorf besonders gewürdigt.
7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA




26 . BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG
Gottfried Leibl kam als erstes Kind der Eheleute Johann und Maria Leibl am 10. Januar 1937 in Plöß zur Welt. Hier wuchs er mit seiner Schwester Margarete bis zur Vertreibung auf. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch vor der sich abzeichnenden Vertreibung aus dem Sudetenland brachte Friedl, wie ihn alle nannten, in vielen nächtlichen Gängen Hab und Gut aus dem Elternhaus zu Verwandten nach Bayern. Hierbei verließ er sich sehr auf seinen Hund Flocki, der ihn bei Gefahr warnte.
1946 wurde die Familie, der Vater war seit dem Rußlandfeldzug vermißt, vertrieben und über Furth im Wald nach Bayern deportiert. Eine der ersten Stationen in der neuen Heimat war Mitterlangau im Landkreis Schwandorf. Hier kam die Familie bei der Tante unter. 1951 begann er bei der Deutschen Bundesbahn in Schwandorf eine Lehre als Schlosser, machte die Ausbildung zum Dampflokführer und legte die Meisterprü-
fung ab. In den fünziger Jahren siedelte die kleine Familie nach Schwandorf über. Hier heiratete Gottfried Leibl am 17. Januar 1959 die Annemie genannte Anna Maria Teplitzky, die er in Mitterlangau kennengelernt hatte. Im August des selben Jahres kam Sohn Peter zur Welt. Der Familie wurden noch weitere Kinder geschenkt: Karl starb mit eineinviertel Jahren, Gerhard, Martin und als Nesthäkchen Annemarie. Im Laufe der Jahre konnte er sich über neun Enkel und vier Urenkel freuen. 1968 fand er bei der Bundeswehr sein neues Betätigungsfeld. Seine Stationen bis zur Pensionierung waren die Panzerbataillone in Neunburg vorm Wald und in Pfreimd sowie das Materialprüfkommando in Mannheim. Krankheitsbedingt beendete er im Jahr 2002 seine Laufbahn als Berufssoldat. Friedl war sehr naturverbunden. Neben dem Angeln war die Jagd seine Leidenschaft. Er brachte sich in der Jägerausbildung ein und blies das Jagdhorn. So war er bei den Kreisjagdgruppen Schwandorf und Oberviechtach, den Tellschützen in Schwandorf und bei den Kleeblattschützen in Schwarzenfeld jahrzehntelang Mitglied. Außerdem führte er mit seiner Frau mehr als 40 Jahre lang ein Waffengeschäft, zunächst in der Innenstadt von Schwandorf und später im eigenen Anwesen. Die Familie bezog 1978 ihr Haus im Schwandorfer Ortsteil Freihöls. Die Mitgliedschaft bei der dortigen Freiwilligen Feuerwehr war selbstverständlich. So war es für Gottfried eine Ehre, den Verein im Jahr 2000 als Festleiter beim 100jährigen Jubiläum tatkräftig zu unterstützen. Schon immer war er mit seiner Heimat hinter dem Eisernen Vorhang verbunden. Nach dessen Fall kehrte er 1989 zu seiner Geburtsstätte nach Plöß zurück. Mit Schwester, Cousins, weiteren Verwandten und ehemaligen Bewohnern seines Heimatortes gründete er den Verein Heimatgemeinde Plöß, dessen Vorsitzender er 27 Jahre lang war. In vielen Arbeitsstunden renovierte er mit den Vereinsmitgliedern den Friedhof in Plöß. Auch die lange Mitgliedschaft und sein Engagement in der SL spiegelten seine Verbundenheit zu Plöß.
Die Faszination Dampflok, Friedl war seit jungen Jahren Dampflokführer, ließ ihn nicht los. Beim Bayerischen Lokalbahnverein und bei den Eisenbahnfreunden Neunburg vorm Wald fand er Gleichgesinnte und brachte sich tatkräftig ein.


Seit sechs Jahren machte ihm seine Gesundheit zu schaffen; langsam verließen ihn seine Kräfte. Die geliebte Jagd und das Beisammensein mit Freunden litten darunter. Am 3. Februar erlosch sein Lebenslicht. Seine Ehefrau, die Kinder mit Familien, Freunde und Bekannte trauern um ihn, ihnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. Der Herr lasse ihn in Frieden ruhen. Regina Hildwein

Die neue Bürgerschule ist schön
Heimatbote
für den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


� Heimatkreis Tachau

Ein ehemals marianisches Land
Der ehemalige Tachauer Bezirk war ein marianisches Land, nicht nur wegen der Wallfahrt zur Schwarzen Muttergottes in der Loreto-Anlage in Haid, sondern auch wegen der vielen Altäre, die der Mutter Gottes geweiht waren. Wir finden in unseren Kirchen zahlreiche Mariendarstellung, von denen Heimatkreisbetreuer Wolf-Dieter Hamperl einige zeigen und beschreiben möchte.
Die Erzdekanalkirche in Tachau war und ist Mariä Himmelfahrt geweiht. Eine schöne Marienstatue steht an einem der gotischen Wandpfeiler im nördlichen Kirchenschiff. Die Statue wurde bei der Restaurierung um 1906 angeschafft. Maria hält mit der Linken den Jesusknaben, der dem Betrachter weit seine Arme entgegenstreckt.


Auch Maria wendet sich mit der rechten Hand dem Beter zu.
In der Pfarrkirche Sankt Ulrich und Prokop in Altzedlisch stand auf dem Hochaltar ebenfalls eine feine gotische Marienfigur. Der rechte Seitenaltar war ein Marienaltar, der im Monat Mai mit Blumen reich geschmückt war. Auch die Kerzen waren mit Bändern umwunden. Hier wurden die beliebten Maiandachten abgehalten. Im linken hinteren Teil der Kirche zeigt die Fahne der Tuchmacher ein schönes Ölbild der Muttergottes von dem Tirschenreuther Kirchenmaler Maurus Fuchs.

Unweit der Pfarrkirche in Altzedlisch im Ort Uschau war die Marienkirche abgerissen worden. Das Ehepaar Seitz ließ an der Straße eine neue Marienkapelle bauen, die der Versöhnung und dem Frieden geweiht ist. Am 7. Juli 2001 wurde sie feierlich eingeweiht.
In der ehemalige Pfarrkirche des heiligen Wenzel in Neustadtl trägt der rechte Seitenaltar eine Darstellung der Madonna, die einer Iko-


Die Mariendarstellung am rechten Seitenaltar in der Pfarrkirche in Neustadtl wurde der Ikone in Santa Maria Maggiore in Rom nachempfunden. Bilder: Archiv Wolf-Dieter Hamperl
ne nachempfunden wurde. So vielfältig waren die Mariendarstellungen in unserer Heimat. Eine Besonderheit war die „Waldandacht“ in Neulosimthal. Karl Dobner hatte sie nach der Grenzöffnung im Dickicht des Grenzwaldes wiedergefunden. Die Dobners und ihr Kreis haben das Marienheiligtum wieder instandgesetzt. Das Ölbild und die Schrifttafeln wurden von Hans Schiffmann aus Tirschenreuth erneuert. So konnte das kleine Heiligtum nahe der Grenze im Oktober 1995 von Pfarrer Heinrich Grillmeier aus Miesbrunn wieder geweiht werden.
Etwas besonderes im Kirchenjahr sind die Maiandachten. Ich erinnere mich an die schönen Maiandachten in Waidhaus. Wir durften alleine um 19.00 Uhr in diese Andachten gehen und mußten erst um 20.00 Uhr wieder daheim sein. Es wurden von den Frauen und Kindern die so schönen Marienlieder gesungen, die sich uns sehr eingeprägt haben. Auch wenn man die Texte der Strophen nicht mehr alle kann, vergißt man aber die Melodien nicht. Übrigens waren auch bei den Evangelischen diese Andachten beliebt.
Die Mutter unseres Architekten in Weiden stammte aus Breslau, ihr anderer Sohn war Pastor in der DDR. Sie besuchte regelmäßig die Maiandachten in Sankt Johannes in Weiden, weil ihr die gefühlvollen Marienlieder so gefielen. Sie bedauerte, daß die evangelische Kirche die Mutter Gottes nicht so verehre. Besonders festlich begangen wurden die Maiandachten in Sankt Peter im Zentrum von München. Prälat Max Zistl hielt sie persönlich. Er sorgte für festliche Musik, und nicht selten trug eine Sängerin von der nahen Oper Marienlieder vor. Die große Kirche war jedes Mal bis auf den letzten Platz gefüllt.
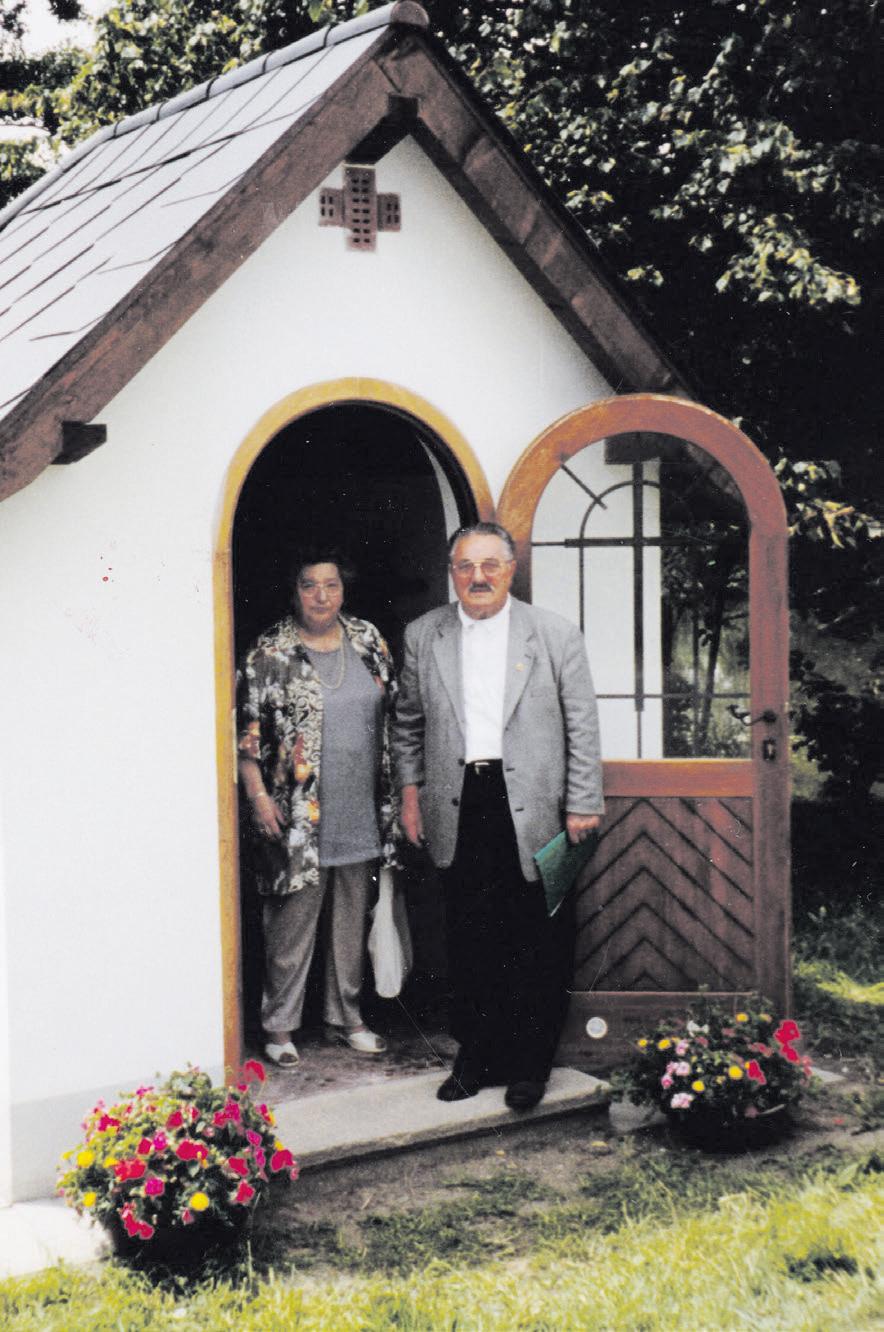
n Sonntag, 21. Mai, 15.00
Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Generalvikar Petr Hruška aus Pilsen, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Petr Hruška spricht deutsch, Telefon (0 04 20) 6 08 65 65 57, eMail hruska@bip.cz
n Samstag, 10. Juni, 18.00
Uhr, Haid: Eröffnung des Musiksommers in der Dekanalkirche Sankt Nikolaus mit einem großen Chor- und Orchesterkonzert.
n Sonntag, 18. Juni, 15.00
Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
n Sonntag, 16. Juli, 15.00
Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee in der
Sakristei. Auskunft: Peter Fořt spricht deutsch, Telefon (0 04 20) 7 24 20 47 02.
n Sonntag, 20. August, 15.00
Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com
n Freitag, 1. bis Sonntag, 3. September: 33. Heimatkreistreffen in Weiden in der Oberpfalz. Programm folgt in Kürze.
n Samstag, 9. September, Haider Loretofest: 11.00 Uhr Fußwallfahrt ab Waidhauser Pfarrkirche Sankt Emmeram; 17.00 Uhr Rucksackverpflegung in Haid; 19.00 Uhr deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com
n Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de

Heimatkundliches Mitteilungsblatt für die Vertriebenen aus dem Isergebirge/Organ des Gablonzer Heimatkreises e.V.
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail isergebirge@sudeten.de
❯ Aus der Polauner Heimatchronik – Wurzelsdorf im Mai 1945

Die Russen kommen
Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (ganz links) bei der Hauptversammlung der Ortsgemeinschaft Labau-Pintschei: Ehrenmitglied Gerhard Bernt (Beisitzer), Renate Domin (Beisitzerin), Karl-Heinz Wenzel (Zweiter Vorsitzender), Hans Theileis (Vorsitzender), Peter Theileis (Beisitzer), Ingeborg Rohner (Kassenprüferin), Thomas Miller (Kassenprüfer), Michael Theileis (Schriftführer), Thomas Theileis (Kassier), Dr. Hans-Joachim Hübner (Beisitzer). Foto: Traudl Theileis
❯ Kontinuität bei den Labauern
Ende Februar hielt die Ortsgemeinschaft Labau-Pintschei mit zweijähriger Verspätung wegen der Corona- Pandemie ihre Jahreshauptversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft ab. Gegründet wurde die Ortsgemeinschaft im Jahr 1954. 2003 wurde sie auf Initiative des damaligen Ortsbetreuers Ernst Tomesch in einen eingetragenen Verein umgewandelt. Seither entwickelte sie sich zur aktivsten Ortsgruppe innerhalb des Gablonzer Heimatkreises.
2011 schlossen sich die Landsleute aus Schumburg-Gistei, Unter-Schwarzbrunn, Marschowitz und Dalleschitz den Labauern an. Erster Vorsitzender und Ortsbetreuer Hans Theileis dankte in seinem Bericht seinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit. Nach mehr als zweijähriger Corona-Unterbrechung konnten ab Mai 2022 die monatlich in Neugablonz stattfindenden Treffen wieder aufgenommen werden. Die Zeit bleibt allerdings auch bei den Labauern nicht stehen. Die Verluste durch den Tod konnten durch die Aufnahme neuer Mitglieder nicht ausgeglichen werden. Die Mitgliederzahl des Vereins sank seit Februar 2020 von 101 auf aktuell 87.
Eine solide Finanzlage konnte Kassier Thomas Theileis vorlegen. Der Verein finanziert sich hauptsächlich durch Beitragseinnahmen und Spenden. Ausgegeben wird das Geld für die Pflege der 1997 auf dem Labauer Friedhof errichteten Gedenkstätte, für Veranstaltungen, Grabschmuck und für das vierteljährlich er-
scheinende Informationsblatt.
Gerhard Bernt erstellt seit vielen Jahren das Rundschreiben, das vor allem von den auswärtigen Heimatfreunden gern gelesen wird. Kürzlich wurde er für diese Arbeit zum Ehrenmitglied ernannt. Die Neuwahl der Vorstandschaft brachte keine Veränderungen. Hans Theileis wurde für weitere vier Jahre als Erster Vorsitzender gewählt, sein Stellvertreter ist wie bisher Karl-Heinz Wenzel. Die Familie Theileis ist auch künftig fest in die Vorstandsarbeit eingebunden. Hans Theileis‘ Bruder Thomas macht als Kassier weiter, sein Sohn Michael als Schriftführer. Seine Frau Traudl und sein anderer Bruder Peter stehen bereit, wenn Hilfe gebraucht wird. Nach Abschluß der Regularien zeigte Beisitzer Hans-Joachim Hübner alte Bilder von Labau. Im Jahr 1823 wurde Labau zur selbständigen Gemeinde, vorher gehöte es zu Marschowitz. 1923, anläßlich des 100jährigen Jubiläums, fand in Labau ein Heimatfest mit einem aufwendigen Festumzug statt, von dem mehrere Aufnahmen existieren. Am Ort der 1558 von Johann Schürer errichteten Glashütte wurde eine Gedenktafel enthüllt. Sie ist erhalten geblieben und befindet sich jetzt im Isergebirgs-Museum Neugablonz. Als Zeichen der Wertschätzung für die Labauer stattete Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse trotz seines vollen Terminkalenders den Labauern einen kurzen Besuch ab. smr
WIR BETRAUERN
■ Gablonz. Am 9. April verstarb kurz nach seinem 92. Geburtstag unser lieber Heimatfreund Guido Hübner aus der Schlager Gasse 15 in Kaufbeuren-Oberbeuren. Seiner Familie herzliche Anteilnahme.

Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb schon vor längerer Zeit Werner Funke aus der Langegasse 88 in Seybothenreuth.
Schönhoff
Thomas■ Morchenstern. In Neugablonz verstarb im 94. Lebensjahr
Rudolf Klamt betrauert von seiner Familie. Thomas Schönhoff
Am 1. Mai 1945 hielt vor der Schule ein Auto mit russischen Soldaten, sie suchten nach versprenten deutschen Soldaten. In der Schule war noch ein S.S. Mann, ein Estländer, der den Anschluß an seine Kameraden verpaßt hatte. Er war bewaffnet. Als ihn die Russen entwaffnen wollten, schoß er mit seiner Maschinenpistole auf die Soldaten. Er traf einen russischen Offizier in den Bauch, und seine Flucht gelang. Man hat von ihm nichts mehr gehört. Der schwer verwundete Offizier ist gestorben und auf den Ober-Polauner Friedhof im Russengrab beerdigt worden. Nun kam großes Leid auch über die Einwohner von Wurzelsdorf. Gewalttaten und Plünderungen waren an der Tagesordnung. Viele Tränen sind geflossen, und manches Gebet ist nicht erhört worden. Deutsche traf das Unheil am meisten.
Am 14. Mai 1945 mußten sich alle Männer bis 65 beim Gasthaus Bartel in Schenkenhahn einfinden. Während sie auf ihren Abtransport in das Ungewisse warteten, zogen Fllüchtlinge, Ausgeraubte mit ihren Pferdegespannen, an ihnen vorüber. Es kam ein Wagen, den Frauen und Mädchen zogen. Kinder und Männer halfen dabei. Nun geschah ein Wunder. Ein russischer Soldat ging auf den Wagen zu, legte seine Hand auf die Schulter der einen Frau, die den Wagen mitzog, und nahm die armen Menschen – man sah die große
Wir gratulieren nachträglich allen Landsleuten, die im Mai Geburtstag feiern konnten, und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
■ Schumburg-Gistei.
Zum 98. am 26. Margit Wetschernik/ Schubert in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 80. am 16. Waltraud Witte/Pfeifer in Eschborn.
Hans Theileis
Angst in ihren Gesichtern – aus dem langen Zug der Wagen heraus. Alle dachten nichts Gutes, der Russe, ein Offizier, schickte einen anderen fort.
Auf der Wiese weideten Pferde, denen die Vorderbeine mit einem Strick zusammengebunden waren, so daß sie nur ganz kur-
sich hier eingefunden hatten, zusammengestellt und unter berittener Bewachung (die russischen Soldaten ohne Sattel auf den Pferden, das Maschinengewehr über den Beinen) in das Sammellager nach Tannwald gebracht. Hier wurden sie von den Russen ausgeraubt. Von hier ging es
wurden sie wieder ohne etwas zu essen gefangen gehalten. Die anderen marschierten gegen Gablonz. Aus Wurzelsdorf sind alle nach einigen Tagen wieder heim gekommen. Die Russen gingen, und die tschechischen Partisanen kamen.
■ Johannesberg. In Jennersdorf (Burgenland) verstarb am 1. Mai Elsa Schöler/Leubner aus Klein-Semmering im Alter von 90 Jahren.
■ Labau-Pintschei. Ilse Pauline Hübner/Munk, geboren am 18. November 1923, starb am 12. Februar mit 99 Jahren in der Bachstraße 48, 67577 Alsheim.
■ Marschowitz. Gretl Renner/Ulbrich, geboren am 8. August 1938, starb am 30. Juli 2022 in der Ramschwagstraße 5, 89312 Günzburg. Hans Theileis
■ LabauPintschei. Zum 98. am 26. Margit Wetschernik/Schubert in KaufbeurenNeugablonz;
zum 96. am 11. Ingeborg Fischer/Kraus in KaufbeurenNeugablonz;
zum 86. am 17. Helga Straub/ Domesle in Tambach-Dietharz;

zum 85. am 22. Konrad Peukert in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 82. am 22. Gerda-Brigitte Zedlitz/Simm in KaufbeurenNeugablonz; zum 81. am 6. Annemarie Vorbachova/Jirak in Reichenberg (Tschechien); am 17. Horst Blob in Kaufbeuren-Neugablonz; am 25. Günter Faltis in Fellbach; zum 80. am 22. Barbara Wolf/
Werner Pfeifer, der Vater des Polauner Ortsbetreuers Hans Pfeifer, malte dieses Bild.
ze Schritte machen konnten. Der Soldat fing zwei von den Pferden ein und brachte sie zu dem Wagen. Man traute seinen Augen kaum: Die Pferde wurden vor den Wagen gespannt, und nun konnten die Flüchtlinge wieder, ohne Belästigung vonseiten der Russen, ihren Weg mit den anderen fortsetzen. Der Flüchtlingstreck nahm kein Ende. Nun wurden die Männer, die
noch am selben Tag nach OberTannwald, wo alle in der PribschFabrik untergebracht wurden. Hier wechselten sogar die Taschenmesser ihren Besitzer.
Am andern Tage ging es nach Morchenstern auf die Wiese bei der Kirche. Hier wurden aus allen Ortsteilen die Männer gesammelt. Einen Tag darauf konnten die Invaliden heimgehen. In der Fabrik in Ober-Tannwald
WIR GRATULIEREN
Palme in Kaufbeuren-Neugablonz;
zum 77. am 9. Irene Geiger/ Weiss in Aichach; zum 75. am 2. Monika Jeschke in Dresden; am 12. Camill Wittiger in Biessenhofen; zum 70. am 18. Anita Zhorzel/ Prade in Kaufbeuren-Neugablonz; zum 69. am 3. Birgit Huber/ Havlik in Höchstädt; zum 67. am 29. Lucia Schmid/Haug in Pforzen; zum 55. am 21. Petra Lutz/Theileis in Rohrdorf. Hans Theileis Ortsbetreuer
Im Juni gratulieren wir herzlich und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
■ Gablonz. Zum 96. am 4. Hilde Endler/Rösler (Josef-PfeifferStraße 6) in Kaufbeuren; zum 91. am 23. Rita Roscher/ Tomasch (Schmirgelfelsgasse 31) in Ballenstedt; zum 95. am 30. Günter Skopan in Neugablonz; zum 81. am 30. Erich Peukert in Harsuben.
Unseren Jubilaren herzliche Glückwünsche. Thomas Schönhoff
■ Gränzendorf. Zum 81. am 19. Brigitta Klier/Klamt in Neugablonz;

zum 91. am 5. Gerlinde Hüttmann/Tschöp in München.
■ Johannesberg. Zum 87. am 1. Herta Renner/Bergmann in Ingolstadt;

zum 84. am 22. Dr. Gunter Seibt in Berlin;
zum 82. am 26. Gerlinde Günther/Hintner (Grafendorf) in Nossen;

zum 81. am 4. Joachim Krause in Pfarrkirchen.
■ Kukan. Zum 88. am 9. Johann Hoffmann;
zum 90. am 11. Hedwig Kusterer/Neumann in Donauwörth.
■ Morchenstern. Zum 88. am 29. Hannelore Oswald/Ikrath in Kaufbeuren; zum 85. am 4. Ursula Oppenheimer/Hollmann.
■ Maxdorf. Zum 87. am 18. Erika Stumpe/Geischberg in Neugablonz; zum 87. am 23. Ruth Wolf/ Schöler.
Am 22. Mai 1945 kamen die Partisanen auch nach Wurzelsdorf. Zum Glück hatten die Tschechen die politschen Leiter der Partei schon nach Tannwald geschafft, es war wieder ein Deutscher, ein kleiner unscheinbarer Mann, der erst vor kuzem nach Wurzelsdorf gekommen war und hier die Stelle eines Schuldieners betreute und gleichzeitig eine Schuhmacherwerkstätte übernommen hatte. Dieser Mann, dem es noch nie so gut gegangen war, erschien mit einem Partisanen beim Ortsleiter Preussler, um denselben nach Grüntal zu holen. Von da kam keiner mehr lebend zurück. Preussler war aber unterdessen schon nach Reichenberg ins Gefängnis gebracht worden.
Die Frauen und Männer, die zuerst in tschechische Hände fielen, haben sehr viel an Leib und Seele durchgemacht. Die Frauen, die ihre Männer in Reichenberg hatten, mußten, wenn sie ihnen was zu essen bringen wollten, den Marsch nach Reichenberg hin und zurück zu Fuß antreten. Verfasser unbekannt Ein unveränderter kurzer Bericht.
■ Radl. Zum 83. am 19. Ewald Patzak in Eckenthal.

■ Reinowitz. Zum 90. am 23. Alfreda Fritz/Fleischmann in Hitzhofen. Thomas Schönhoff
■ Dalleschitz. Zum 86. am 12. Wolfgang Wabersich in Kaufbeuren-Neugablonz. Hans Theileis
■ Labau-Pintschei. Zum 94. am 26. Maria Tomesch/Dworatschek in München; zum 81. am 17. Rolf Seiboth in Nürnberg; zum 80. am 8. Barry H. Lockton in Clovis/CA (USA); am 18. Erich Robert Lang in Herrhof; zum 77. am 4. Franz Seiboth in München; zum 73. am 2. Leonhard Rampp in Pforzen; zum 49. am 13. Hermann Heiß in Pforzen; zum 47. am 23. Michael Theileis in Lamerdingen. Hans Theileis
■ Polaun. Wir gratulieren allen Polaunern, die im Mai geboren sind, auf das Allerherzlichste zum Geburtstag. Hans Pfeifer Ortsbetreuer Schwabenstraße 11 87668 Rieden Telefon (0 83 46) 98 23 69
TERMINE
■ Heimatkreis Gablonz. Mittwoch, 30. August bis Sonntag, 3. September Busfahrt nach Gablonz und ins Isergebirge. Auskunft und Anmeldung: Thomas Schönhoff, Glasstraße 6b, 87600 Neugablonz; Telefon (0 83 41) 6 54 86, eMail archiv@isergebirgs-museum.de
Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen)
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Hoffmann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail sternberg@sudeten.de
� Erinnerungen an die Schulzeit im Kommunal-Realgymnasium Mährisch Neustadt
Späte Liebeserklärung
Lieselotte Klopp-Salinger schrieb über unser RealGymnasium, das sie von 1929 bis 1937 besuchte, folgenden Artikel und nannte ihn „Späte Liebeserklärung“. Leider verstarb sie vor Jahren, aber da sie unsere Heimattreffen in Limburg oft besuchte, kann ich ein Bild von ihr zur lieben Erinnerung beifügen.

Mag sein, daß die Erinnerung vergoldet. Aber das ist es nicht allein. Die Erfahrungen eines Lebens haben mich erkennen lassen, daß sich eine Abneigung, ein lästiger Zwang in eine tiefe Liebe und hohe Achtung wandeln kann. Eine tüchtige Prise Stolz und ein Rübenfuhrwerk voller Dank lassen mich in Erinnerung versinken und von dem Haus erzählen, das mich beladen mit den „Schätzen des Geistes“ am 4. Juni 1937 in die Welt geschickt hat: unser gutes altes Gymnasium in Mährisch Neustadt.
Es stand als verblassende Schönheit hinter der Pfarrkirche, das fröhliche Kaisergelb seiner Stuckkassetten verwaschen von Regen und Zeit. Wer sollte es wohl auffrischen in den armseligen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts? Dabei war es eigentlich noch ein junges Gebäude, aufgebaut im k. u. k. Charme der altösterreichischen Monarchie. Die Annalen der Stadt nennen den seit dem 15. November 1867 amtierenden Bürgermeister Dr. Ferdinand Daubawa (1825–1883) als den Erbauer des großartigen Gebäudes. Er war ein hochgebildeter Mann, hatte Chemie und Pharmazie studiert und sich mit geologischen Studien der Marchebene und des Gesenkes befaßt.
Das mächtige Bauwerk beherbergte anfangs nur das Untergymnasium. Wie ich im Tagebuch meines Großonkels Dr. Johann Kux lesen konnte, mußte dieser zum weiteren Studium auf das Olmützer Gymnasium übersiedeln und bekam das hochnäsige Herabschauen auf den Bauernbuben gleich bei der Anmeldung zu spüren. Den anderen wird es nicht besser gegangen sein.
So war der Entschluß der Neustädter Stadtväter sehr zu begrüßen, die „Ausgestaltung des Gymnasiums zur vollständigen Schule“ für die Jahrhundertwende in Angriff zu nehmen. Am 9. März 1894 wurde der denkwürdige Beschluß gefaßt und am 25. April 1894 umgehend vom Unterrichtsministerium bewilligt.
Unter dem Direktor Ottokar Novotny fand die Metamorphose statt. Das Neue Landesund KommunalObergymnasium war geschaffen. 1898 konnte man die erste Matura feierlich begehen. Die Schülerzahl stieg von 120 auf 277.



Unter Direktor Adolf Daumann (Amtszeit 1896 bis 1908) wurde das Gymnasium unter „Wahrung des Eigentumsrechtes der Stadtgemeinde auf das Gebäude“ als k. und k. Staatsgymnasium übernom
men. Diese kurze Blütezeit fand 1918 mit dem Untergang der eine weite Fläche Europas umfassenden k. und k. Monarchie ÖsterreichUngarn ein jähes Ende. Die Herren des neuen tschechoslowakischen Nationalitätenstaates, auf dem „deutschen“ Auge völlig blind, mach ten das Gymnasi um wieder klein. Sie setzten das Museum und zwei Volksschulklassen ins Parterre des Gebäudes und nannten den Torso das KommunalRealgymnasium. Sie erzwangen einen stetigen Abbau der Klas senzahl, bis im Sommer 1930 noch vier übrigblieben. Ich erinnere mich genau, denn ab 1931 gab es nur noch in den ungeraden Jahren eine Matura. Das änderte sich erst nach dem Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich. Während der acht Jahre, vom Herbst 1929 bis Sommer 1937, da ich als Schülerin dieses ehrwürdige Haus besuchte, war das Gymnasium klein und arm. Wer weiß, wie viele Sammlungen des Deutschen Kulturverbandes, getätigt an allen Festen im Jahreslauf, Krone um Krone wahrlich geopfert für die Ausbildung der Jugend, dem dafür gedachten Fonds treulich übergeben worden waren! Was ich aber im XVII. Jahresbericht des Gymnasiums über das Schuljahr 1936/37 (mein Maturajahr) genau nachlesen konnte, rührte mich zutiefst. Trotz des schweren Existenzkampfes der Bevölkerung spendeten die Bürger für den Erhalt dieser Schule. War es der StudentenUnterstützungsverein, gegründet 1870, jährlicher Mindestbeitrag 4 Kronen, die Stiftungen, die aus dem Wenigen Winziges ausschütteten, oder die Freitische und Verköstigungsgelder, durch die den bedürftigen Schülern das tägliche warme Mittagessen gewährleistet war – die Bereitschaft allein ist vieler Dankesworte wert. Was von staatlicher Seite als Wasserabgrabung gedacht war, floß so aus lauteren, wenn auch dünnen Quellen und bewahrte das kulturelle Erbe unserer Minderheit.
Wenn ich in späteren Jahren die Genialität eines Gymnasiums erklären mußte, welches auf vier Klassen beschränkt seine Schüler dennoch zur Matura führen konnte, erntete ich ungläubiges Erstaunen. Es gab also in den ungeraden Jahren eine Prima, Tertia, Quinta, Septima und in den geraden eine Sekunda, Quarta, Sexta, Oktava. Man
durfte nur nicht sitzenbleiben, denn das war dann leider eine „doppelte“ Ehrenrunde und warf den Betroffenen zwei Klassen zurück. Daß diese vier Klassen auch nur die Hälfte aller finanziellen Ausgaben benötigten, begriff ich in meinem jugendlichen Unverstand noch gar nicht. Auch solcher Vorteil war einfach genial und half der Institution über die mageren Jahre. Als mich, die zehnjährige Primanerin, die Meedler Bäuerin vom Hofe Nr. 71 fragte, was ich wohl werden möchte, da sagte ich spontan: „A Weib mit viel Kinda.“ Denn ich hatte immer schon eine Vorliebe für Haus und Nadelarbeiten und scharte die Kinder der Nachbarschaft im großelterlichen Bauernhofe fantasiereich um mich herum. Die Schule war mir, genau besehen, lästig, ich nahm sie hin als nötiges Übel und freute mich auf das Leben als „Weib mit viel Kinda“. Letztere bekam ich in solchen Hundertschaften, daß ich sie heute nicht zu zählen vermag. Und die Schule, dieses „nötige Übel“‚ hielt mich mehr als ein halbes Jahrhundert fest und gehört heute, in der Rückschau gesehen, zur Erfüllung meines Lebens.
Meine 40 Dienstjahre waren es schließlich, die mir die Lehrjahre in unserem Gymnasium bei unseren Meistern dann so oft in Erinnerung brachten und mir über manche Klippen hinweghalfen. Viele Male schöpfte ich aus dem Gelernten, das sich hinter der krausen Stirn eines nichtsnutzigen Backfisches dennoch verankert hatte, so daß ich gar oft dankbar des „Sämannes“ gedachte, der doch nicht „so viele Körner auf steinigen Boden hatte fallen gelassen“.
Es waren noch keine zehn Jahre nach der Matura vergangen, als mich zum ersten Male die Erkenntnis von der Gediegenheit unserer Ausbildung wie ein Sternenhagel traf. Es mußte erst das Chaos kommen, der harte Lebenskampf, um mir das zu verinnerlichen. Das bittere Kriegsende hatte mich aus der festgefügten Ordnung der Mährisch Rothwasserer Hauptschule in kaum zu fassender Unmenschlichkeit wie Strandgut an ein fernes Ufer geworfen. Dieses ferne Ufer war eine Volksschule am Niederrhein. Der Ort schwer angeschlagen, die geschundene Bevölkerung tapfer bemüht, das normale Leben wieder in Gang zu bringen. Das Schulgebäude, das fast zwei Jahre Lazarett, Lager, Zuflucht gewesen war, in desolatem Zustand, die Schulbücher aus verhaßter Zeit als Heizmaterial verbrannt.
Ich trat am 1. März 1946 meinen Dienst an und bekam in der ersten Konferenz ein 5. Schuljahr mit 48 Kindern zugewiesen und nach kurzen Überlegungen des Rektors mit dem einheimischen Kol

legium Fachunterricht Raumlehre in der Oberklasse Jungen. Es gab kein Lehrbuch, es gab keine Utensilien zum Konstruieren, es gab niemanden, den ich fragen konnte. Es gab nur mich, jung und fremd – und 35 Jungen im Flegelalter, seit Jahren eines geregelten Schulbesuches entwöhnt und übernächtigt von den verbotenen Jagden auf die Brikettzüge, die zu finsteren Stunden mit ihrer kostbaren Fracht nach Westen rollten, vorbei an der frierenden Bevölkerung.
Welchen der 14 Nothelfer ich da wohl angerufen habe, weiß ich nicht mehr. Ich sah nur auf einmal das runde freundliche Gesicht meines MatheProfessors vor mir, den wir liebevoll „Papa“ genannt hatten. Ich hörte förmlich das Stakkato der Kreide, wenn er mit einem Trick die gestrichelten Hilfslinien über die Tafel zog. Da wußte ich, es konnte mir gar nichts mehr passieren. Ich stöberte irgendwo einen abgebrochenen Zirkel und einen Winkelmesser ohne Griff auf. Ein Schülervater reparierte, mehr noch, er schreinerte ein Lineal und eine Reißschiene dazu. Daß das Unternehmen „Raumlehre“ dann wundersam gedieh, sah ich aus den kleinen, klammheimlich überreichten Brikettgaben, welche die nächtlichen Eroberer vom mütterlichen Heizvorrat abgezweigt hatten.
Das war der Anfang einer Kette von liebevollen Dankeschöns an meine Professoren. Aus Lehrern waren „Kollegen“ geworden, an denen ich mich zu messen versuchte, die ich nachahmte und denen ich manches abschaute. Waren es die flotten Rechenmethoden, das interessante Kopfrechnen, die Präzision im Aufbau des Unterrichts, der Wert der Wiederholung, die Humanität in der Menschenführung, die uns vor allem unser Klassenvorstand zuteil werden ließ –scheinbar Vergessenes tauchte zu passenden Gelegenheiten auf und ließ mich immer mehr die Qualität der Allgemeinbildung erkennen, die uns unser Professorenteam vermittelt hatte, ehe es uns aus dem „alten Haus“ in die Welt entließ.
Das Haus steht noch, dort hinter der Pfarrkirche. Nicht mehr verwaschen von Regen und Zeit. Prächtig erstrahlt es in Sonnengelb, breit geworden durch Anbau und Veränderungen. Aber es ist nicht mehr unser Gymnasium, unsere Schule. Im heißen Sommer 1991 stand ich vor seiner imposanten Front. Die vielen Fensteraugen schauten mich an, vertraut wie an allen Morgen jener Jahre, wenn ich beim letzten Glokkenschlag vom Meedler Tor her um die Kirche geradelt kam. Ich schaute zurück in die den Himmel widerspiegelnden Scheiben. Traurig, denn ich wußte, daß dahinter nichts mehr war – so wie damals.
■ Mährisch Neustadt. Im Juni gratulieren wir zum Geburtstag. Am
1. Elfriede Flunkert/Heger (Obere Alleegasse) zum 92. Geburtstag in Lünen; Helma Hamm/Mauler (Untere Alleegasse) zum 85. Geburtstag in Waiblingen; Adolf Katzer (Wallgasse) zum 82. Geburtstag in Mindelheim;

2. Herta Scholler/Scholler (Kirchenplatz) zum 85. Geburtstag in Frankfurt am Main;
4. Josef Winter (Grumberg) zum 96. Geburtstag in München;
5. Elisabeth Kronschnabel/Selinger (Euglgasse) zum 87. Geburtstag in Ottobeuren; Ursula Kutscher/Raschendorfer (Herrengasse) zum 80. Geburtstag in Ühlingen-Birkendorf; Hans Nawratil (Schönberger Gasse) zum 91. Geburtstag in Winnenden; Doris Over/Münster (Fronfestgasse) zum 82. Geburtstag in Bergheim/Erft; Alfred Schneider (Goeblgasse) zum 86. Geburtstag in Idstein;
6. Werner Heindl (Müglitzer Gasse) zum 82. Geburtstag in Burgau;
8. Edith Groß (Stadtplatz) zum 92. Geburtstag in Wiesbaden; Werner Klimesch (Kudlichplatz) zum 82. Geburtstag in Sidney/Australien;


9. Herbert Weigel (Müglitzer Gasse) zum 83. Geburtstag in Rüsselsheim;
11. Helga Kröller/Gabriel (Flurgasse) zum 87. Geburtstag in Aull; Manfred Popp (Goeblgasse) zum 79. Geburtstag in Erfurt;
14. Erwin Libecait (Goeblgasse) zum 90. Geburtstag in Neu-Ulm;
15. Werner Jacoby zum 80. Geburtstag in Nersingen;
18. Ingrid Schreitter/Rabenseifner zum 80. Geburtstag in Kempten;
19. Dr. Ingrid G. Noske (Theoderichstraße) zum 82. Geburtstag in München;
20. Luitgard Richter/Smekal (Herrengasse) zum 89. Geburtstag in Neu-Ulm;
21. Ulrike Olesch/Ullrich (Schönberger Gasse) zum 83. Geburtstag in Bad Schwalbach; Johannes Georg Prokop (Müglitzer Gasse) zum 87. Geburtstag in Frankfurt am Main;
22. Helga Ulrike Falk/Schrimpl (Schönberger Gasse) zum 82. Geburtstag in Offenbach;
23. Kurt Knobloch (Salzgasse) zum 82. Geburtstag in Krailling;
26. Walter Knobloch (Salzgasse) zum 84. Geburtstag in Hünfelden;
29. Ilsemarie Kunz/Kaulich (Sternberger Gasse) zum 81. Geburtstag in Elbtal-Elbgrund. Sigrid Lichtenthäler Ortsbetreuerin
❯ Die Landwirtschaft des Mährisch Neustädter Ländchens
Sinnbild der Erneuerung
In der letzten Ausgabe der Zeitung lasen wir über die Landwirtschaft im Neustädter Ländchen, heute folgen Tierzucht und Obstbau. Die Angaben sind aus der Zeitschrift „Mährisch-Neustädter Ländchen“ von 1923, geschrieben von Franz Kunz, Direktor der Landesfachschule Mährisch Neustadt.
Auf dem Gebiete der Tierzucht hat das Neustädter Ländchen nach manchen schüchternen Schritten ein rasches Tempo eingeschlagen und dürfte heute zu den höchst stehenden Zuchtgebieten Mährens zählen. Der Mährisch Neustädter Rinderschlag ist durch Kreuzung des alten einheimischen Schlages mit Bernern, Simmentalern, Kuhländlern und anderen entstanden und bildet einen Ast des „Mährischen Fleckviehes“. Dieser Schlag weist heute gute Formen auf. Die Leistung wird geprüft.

Die alten Herdebuchvereine und Viehzuchtgenossenschaften waren ihrer Aufgabe nicht gewachsen. An ihrer Stelle traten in der Nachkriegszeit die Züchtervereinigungen, die sich zu einem Bezirksverband zusammengeschlossen haben. Ihre Aufgabe ist keine andere als die, mit dem alten Schlendrian in der Zucht aufzuräumen, durch Einführung der Leistungskontrolle die Rilligsten Tiere herauszusuchen und die Stierkörung und Stierhaltung in geregelte Bahnen zu bringen. Der Kopf dieser Bestrebungen ist Hliwitz, wo alle Vorbedingungen gegeben sind. Damit ist die Viehzucht des Bezirkes in moderne Bahnen gelenkt worden. Es werden nun folgen: Ausmerzung der nicht leistungsfähigen und kranken Tiere und richtige Aufzucht der jungen Geschlechter neben ständiger Prüfung der Leistung.
Da das Neustädter Gebiet einen ariden Einschlag hat, werden die Züchter noch eine harte Nuß zu knacken haben. Das ist die Begründung von Jungviehweiden, was nur in den niederschlagsreicheren Teilen des Ländchens möglich sein wird. Das flache Land ist hierfür nicht geeignet. Der Rinderbestand des Ländchens zählt an 20 000 Stück. Die Milch wird von mehreren Molkerei-
❯ Konditorei Adamek
en, darunter die Genossenschaftsmolkerei in Mährisch Neustadt, verarbeitet. Die Pferdezucht erlitt im Kriege große Einbuße. Die vorjährige Pferdeschau hat aber gezeigt, daß auch dieser Zweig der Tierzucht in guten Händen ist. Gezüchtet wird ein warmblütiger Arbeitsschlag. Für das schwerere kaltblütige Pferd ist das Ländchen im Hinblick auf die klimatischen Verhältnisse kein geeignetes Gebiet. Die Schweinezucht erfreute sich seit jeher eines sehr guten Rufes. Berühmt waren die Gemeinden Pinke, Hliwitz und Meedl wegen ihres guten Ferkelmaterials. Heute besteht eine Schweinezuchtstation in Hliwitz, wo mit Ebern des deutschen Edelschweines gezüchtet wird. Als Zuchtziel gilt, in der kürzesten Zeit mit den billigsten Mitteln Schlachtreife zu erzielen. Die Zuchtschweine werden Sommer und Winter im Freien gehalten. Die Ernährung vollzieht sich größtenteils auf der Weide. Die Hliwitzer Schweinezüchtereien sind lehrreich und sehenswert.
Die Ziegenzucht beschränkt sich auf die Gebirgsgemeinden. Die Schafzucht ist heute bereits bedeutungslos.
Der Geflügelzucht fehlt zwar noch die höhere Weihe. Nichtsdestoweniger wird die Hühner- und Gänsezucht fast in jeder Gemeinde in großem Umfange betrieben.
Von den landwirtschaftlichen Nebenbetrieben verdient der Gemüseanbau besondere Hervorhebung. Mährisch Neustadt versorgt das Gebiet mit Frühgemüse. Tausende Schock Saat werden alljährlich in die benachbarten Gebirgsbezirke ausgeführt. Auch der Obstbau hat Bedeutung. Sämtliche Straßen bis tief hinein in die Gebirgseinschnitte sind mit Obstbäumen eingesäumt. In Langendorf und Passek wird der Walnußbaum kultiviert. Die Hausgärten enthalten manche köstliche Sorte. Sache der Zukunft wird es sein, in die Obstsorten eine gewisse Einheitlichkeit zu bringen, wie dies bereits im Elbtal und in den rheinischen Obstbaugebieten geschehen ist, und die Schädlingsbekämpfung

zu organisieren. Die Obstverwertung macht gute Fortschritte. Obstkonserven und Haustrunke werden fast in jedem Haus zubereitet. Zu den Nebenbetrieben der Tierzucht wären noch die Fischzucht und die Bienenzucht zu besprechen. Die erstere ist seit der Auflassung des Schönwälder Teiches zur Sportfischerei geworden. Für die Bienenzucht ist die Kultursteppe nicht das geeignete Feld. Trotzdem sind im Bezirk Mährisch Neustadt 1910 1 156 Bienenstöcke gezählt worden. Wenn wir das Gesagte überblikken, können wir stolz behaupten, daß die Landwirtschaft des Mährisch Neustädter Ländchens zu den meist betriebenen des Landes gehört und daß sie diesen Vorzug nicht allein den günstigen klimatischen und Bodenverhältnissen, sondern auch dem Umstand verdankt, daß sie zu jeder Zeit Persönlichkeiten und Organisationen an der Spitze hatte, die der Förderung des Bauernstandes Umsicht, Tatkraft und umfassende Bildung widmeten. Seit 1864 wirkt in diesem Sinne der land- und forstwirtschaftliche Verein. Viel hat zur Hebung des Bildungsniveaus der Bauernschaft das gut ausgebaute Schulwesen der Stadt beigetragen, vor allem das Gymnasium, die Bürgerschule und seit fast 25 Jahren die landwirtschaftliche Fachschule. Wenn auch die Poesie alter Arbeitsmethoden längst geschwunden ist, wenn heute der melodische Klang der Sense immer seltener ertönt, um dem Surren der Maschine zu weichen, so schließt die Wissenschaft dem denkenden Bauer neue Tiefen auf, gestaltet jede Tätigkeit reizvoll und macht seinen Beruf zu den erhabensten, wenn auch schwersten, nicht nur wegen der schweren körperlichen Arbeit, sondern auch deshalb, weil Enttäuschungen unserem Landwirt nicht erspart bleiben und weil er von anderen Berufsständen manch bittere Tropfen zu verkosten bekommt. Der säende Bauer ist nicht nur das Sinnbild der Erneuerung, er ist der Urquell der Kraft, der unser gesamtes wirtschaftliches und nationales Leben mit Energie versorgt. Möge er sich auch weiterhin dieser Aufgabe bewußt bleiben!
Verlorenes Paradies der Kindheit



it ockerfarbener Fassade lag an der Ostseite des Stadtplatzes ein würdiges Haus: die Konditorei Adamek. Man betrat das Heiligtum über zwei hölzerne Stufen, wovon die erstere unverhältnismäßig hoch war. Das Lokal atmete wienerische Atmosphäre mit weißen, runden Marmortischen und geschwungenen Kaffeehausstühlen. An diesem Ort erfüllte sich der Wochenwunsch. Kleine und auch größere Lekkereien am Vormittage nach dem Kirchgang waren schon zur Tradition geworden. Und viele, sehr viele Mitbürger hielten fest an diesem Brauch. Zwar schimpfte der Großvater über diese Unsitte, so kurz vor dem Mittagessen sich den Magen mit Süßigkeiten und Naschwerk vollzuschlagen. Kein Wunder, wenn dann der Appetit fehlt und niemand richtig bei Tisch speist.
M
mußte der Meister all jenes vollbringen, was eben nicht alle Sonntage vorkommt.
Alles, was die Hochkultur an Gaumenfreuden in der Wiener und der Böhmischen Backkunst je hervorzubringen vermochte – hier nahm es Gestalt an. Adamek war einer der wenigen Tschechen in der Stadt. Er bekannte sich zum Deutschen Reich, und sein Sohn diente später im Heer. Die Meisterin war eine große Dame voll Hoheit und Würde. Sie war eine gebürtige Breslauerin. Ihre Kleidung unterschied sie von allen anderen Frauen der Stadt. Sie trug zu jeder Jahreszeit bodenlange Kleider. Viel später erst erfuhr ich, daß sie an Krampfadern und offenen Beinen zu leiden hatte.
Nun soll der Meister jener Herrlichkeiten vorgestellt werden. Eines vorneweg: Er war ein Künstler seines Faches, und seine Werke waren Kunst. Nicht nur Zunge und Gaumen, sondern auch Auge und Geruchssinn wurden auf das Höchste beglückt. Ein langer Ladentisch mit gewölkter weißer Marmorplatte trug in zwei Stufen angeordnet nur Erlesenes. In vielen Platten, Aufsätzen und Schalen häuften sich die Spezialitäten. Hierzulande hatte noch jede Hausfrau den Ehrgeiz, im Backen perfekt zu sein. Folglich
Der Genuß begann schon beim Eintritt in diese Räume. Der Duft, der helle Halbschatten, die Sonnenflecken, die gußeisernen Säulen und Lisenen (Mauerblende, Anmerkung der Redaktion), der viele weiße geschliffene Marmor und die Fülle des Angebotes bewirkten, daß sogar das Märchen vom Schlaraffenlande verblaßte und ebenso selbiges vom Töpfchen mit dem süßen Brei. Zumeist wurde sommers eine Portion Gefrorenes bestellt und etwas dazu. Nun muß man aber wissen, daß dies nicht nur ein Quan-
tum von Speiseeis war, nein, auf silbernem Tablett brachte man die Leckerei daher. Sie lag in Kelchen, ein schaufelförmiger Löffel dabei und ein hohes Glas mit aromatisiertem Eiswasser und ein Stapel an Waffeln wurden stets mitgeliefert. Das Angebot war so reichhaltig, daß die Wahl oft schwer fiel. Man schritt die lange Theke ab und genoß die Vorfreude. Ob man nun eine Mokka-Schnitte, eine Spitze, Schaumrolle, Baumstamm, einen Magischen Würfel, eine Cremeschnitte oder irgendein Tortenstück wählte – immer war es ein doppelter Genuß. Da wäre noch das Nebenzimmer zu erwähnen. Vom Lokal aus ging eine hohe verglaste Flügeltüre in jenes Kabinett. Spitzenvorhänge in besonderem Faltenwurf verwehrten die Sicht. Einige Male war es mir gestattet, jenen Raum
zu betreten. Es war ein schmales, langgestrecktes Zimmer mit einigen Tischen. An der Längsseite zog sich eine rotsamtene gepolsterte Bank dahin, und auch die Sessel und Bordüren waren in diesem tiefroten Samt gehalten. Alles andere war weißer Lack. Hier standen ein Piano und ein elektrisches Klavier. Meines Wissens nach das einzige in unserer Stadt. Auch ein Grammophon mit vielen Platten war vorhanden. In dieser Räumlichkeit kamen Freundeskreise, Gruppen, Kameradschaften, Zirkel, Vereine, Jahrgangsgemeinschaften und Cliquen zusammen, um Likörstunden, Kränzchen, Kommers, Heimabende, Jubiläen oder sonst irgendwelche geselligen Zusammenkünfte abzuhalten. Man fände kein Ende, wenn man das Thema vom Genuß und dem Genießen bis zum Grunde ausschöpfen wollte. Zur Adventszeit stand alljährlich die Figur eines Knecht Ruprechts im Schaufenster. Er stand auf einer mechanischen Drehscheibe. Ein Federwerk bewirkte, daß er sich unregelmäßig um sich selbst drehte. Die Rotation erfolgte ganz allmählich, wurde gehemmt, um dann mit einem Ruck wieder zu beginnen. Einen blanken Messingstab trug er in Händen, an dem an einer metallenen Kette eine massive
Kugel baumelte. Jedes Mal bei der ruckartigen Drehung schlug die Kugel klickend an die Scheibe der Auslage. Den guten Knecht Ruprecht hatte man da zu einem Werbeobjekt und Blickfang mißbräuchlich degradiert. Und wir Kinder standen davor und staunten die süße Pracht hinter der Scheibe an. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Befreiung herrschte an diesem Ort Hochbetrieb. Adamek und seine Gattin konnten gar nicht so viel Köstlichkeiten hervorbringen, als der allbekannte preußische Hunger voll der Gier verschlang. Der Umsatz stieg ins Unwahrscheinliche, das Geschäft lief und lief heiß. Diese Konjunktur währte jedoch nur knapp ein Jahr. Als dann im September 1939 der Polenfeldzug begann und zum Zweiten Weltkriege sich ausweitete, trat alsbald die große Ebbe ein. Alle Köstlichkeiten wurden rar, da alle Dinge verwaltet und bewirtschaftet waren. Es war so wie ein Lied verklingt. Zunächst lagen nur noch Attrappen in der Auslage, hohle Verpackungen, deren bunte Aufmachung allmählich verblaßte und bleichte. Eine feine Staubschicht füllte den Schaufensterraum, die niemand mehr beseitigte. Eines Tages verhüllte der Rolladen die einstige süße Wunderwelt. Hinter der geschlossenen Tür lag das verlorene Paradies der Kindheit. Sie tat sich nie mehr wieder auf.
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail zuckmantel@sudeten.de



❯ Erinnerungen an die jüdische Schriftstellerin Ilse Weber
Ilse Herlinger wird am 11. Januar 1903 in Witkowitz/ Vítkovice (Mährisch Ostrau) geboren. Zum Alltag der deutschsprachigen Familie gehören Besuche des örtlichen Tempels ebenso wie die jüdischen Feiertage. Das gesellschaftliche Umfeld Herlingers setzt sich aus einer Vielzahl kultureller und religiöser Gruppen zusammen, sie spricht deutsch und tschechisch gleichermaßen gut.

Schon im Alter von 14 Jahren schrieb Ilse Herlinger jüdische und andere Kindermärchen, kleine Theaterstücke für Kinder und Gedichte, die sie auch vertonte. Sie wurden in deutschen, tschechischen, österreichischen und Schweizer Zeitungen und Zeitschriften, in Büchern und auch im Radio veröffentlicht. 1930 heiratete sie Willi Weber und wohnte mit ihm in Witkowitz. An Neujahr 1931 wurde ihr Sohn Hanuš geboren und sein Bruder Tomáš, genannt Tommy, im März 1934.
Als das Leben in Mährisch Ostrau für Juden immer schwerer wurde, zog die Familie 1939 nach Prag. Im Mai 1939 wurde Hanuš Weber mit einem der vom Briten Nicholas Winton in Prag organisierten Kindertransporte nach England und von dort weiter nach Schweden verschickt, wo er von einer langjährigen Brieffreundin Ilse Webers, Lilian von Löwenadler, als Pflegekind großgezogen wurde. Er entkam so der Vernichtung. Am 6. Februar 1942 wurde die restliche Familie Weber von Prag in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort arbeitete Ilse als Krankenschwester in der Kinderkrankenstube.

Im Lager entstanden weitere Gedichte. Berühmt durch zahlreiche Interpretationen wurden das von ihr komponierte Schlaflied „Wiegala“ und „Ich wand-
Auch Bedřich Fritta kam 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ums Leben. Wie Ilse Weber in Worten, hielt er den Alltag dort in Zeichnungen fest. Mit seinen Werken ist der Band „Wann wohl das Leid ein Ende hat“ illustriert. Bild: https://www.jmberlin.de/fritta/de/todesmetaphern.php


„Ich bin Hanuš“
Herlingers Mutter Therese (1866–1942) ist prägend für die musische und religiöse Erziehung ihrer Tochter. Märchen und Geschichten werden der erst zehnjährigen Ilse nach dem Tod ihres Vaters zum Trost. Erste eigene Gedichte und Geschichten veröffentlicht Herlinger als Dreizehnjährige in der Mädchenzeitschrift Das Kränzchen. Rundfunkbeiträge, Hörspiele,

re durch Theresienstadt“. Dieses Gedicht hat Ilse Weber für ihren Sohn Hanuš geschrieben, „den sie vor Ausbruch des Krieges in Prag in einen Zug gesetzt hatte, in der Hoffnung, ihn eines Tages wiederzusehen“.
Als die Kinderkrankenstube zur Deportation nach Auschwitz bestimmt wurde, meldete sich Ilse Weber freiwillig, um die kranken Kinder zu begleiten. Sie, ihr Sohn Tomáš und die anderen Kinder wurden gleich nach ihrer Ankunft am 6. Oktober 1944 im KZ Auschwitz ermordet.
Ein Häftling vom Leichenträgerkommando, der Ilse Weber von Theresienstadt her kannte, war direkt nach deren Ankunft zu den Wartenden gegangen. Er erzählte später: „‚Stimmt es, daß wir duschen dürfen nach der Reise?‘, fragte sie. Ich wollte nicht lügen, und so antwortete ich: ‚Nein, das hier ist kein Duschraum, es ist eine Gaskammer, und ich gebe dir jetzt einen Rat. Ich habe euch oft singen hören in der Krankenstube. Geh so schnell wie möglich in die Kammer. Setz dich mit den Kindern auf den Boden und fangt an zu singen. Sing, was du immer mit ihnen gesungen hast. So atmet ihr das Gas schneller ein. Sonst werdet ihr von den andern zu Tode getreten, wenn Panik ausbricht.‘ Ilses Reaktion war seltsam. Sie lachte irgendwie abwesend, umarmte eines der Kinder
und sagte: ‚Also werden wir nicht duschen –‘.“
Willi Weber hatte sich bereits im September 1944 freiwillig nach Auschwitz deportieren lassen, weil den Transportteilnehmern versprochen worden war, daß die Familienangehörigen in Theresienstadt bleiben und Briefkontakt halten dürften. Da er wenige Tage später als Zwangsarbeiter in das KZ Gleiwitz verlegt wurde, überlebte er den Holocaust.
Daß die Gedichte von Ilse Weber der Vernichtung entgangen sind, ist maßgeblich auch das Verdienst ihres Mannes. Er hat einen Großteil davon 1944, unmittelbar vor seinem Abtransport nach Polen, in einem Erdloch vergraben und nach dem Krieg unter widrigsten Umständen wieder an sich bringen können. Die Manuskripte blieben auf diese Weise erhalten und konnten veröffentlicht werden.
Ilse Herlinger versuchte mit ihrem literarischen Werk, das Selbstbewußtsein jüdischer Kinder angesichts des zunehmenden politischen und kulturellen Antisemitismus zu fördern und so religiöser Entfremdung entgegenzuwirken. Durch die Lektüre dieser fantasievollen Geschichten, die bewußt in einer jüdischen Lebenswelt angesiedelt sind, wurden junge Leser mit den zugehörigen Werten vertraut gemacht und zugleich in Religi-
kleine Theaterstücke und Märchen für Kinder folgen, die in deutschen, tschechischen und österreichischen Zeitungen und Zeitschriften gedruckt werden. 1928 erscheint mit „Jüdische Kindermärchen“ ihr erstes Buch. Sie widmet es ihrer Mutter. Am 6. Oktober 1944 stirbt Ilse Weber in der Gaskammer von AuschwitzBirkenau.

von Ilse Herlinger, gestaltet von Gre (Grete) Edelstein (1883–1954). Im Juni 2023 erscheinen die Einzelwerke „Jüdische Kindermärchen“, „Die Geschichten um Mendel Rosenbusch“ und „Das Trittrollerwettrennen“ von Wolfgang Rathert in einem Band zusammengefaßt und ergänzt um eine biographische Einleitung. „Wann wohl das Leid ein Ende hat. Briefe und Gedichte aus

on und Tradition unterrichtet: Feiertage wie Pessach, Simchat Tora oder Sukkot sind Teil der Handlung. Kinder sind in Herlingers Werk die Hauptakteure. Ihr Leben ist weder leicht noch unbeschwert, denn die Verhältnisse, unter denen sie aufwachsen, sind von Sorgen und Ausgrenzung bestimmt. Dieser Realität werden, mit den Mitteln des Märchens, familiäre Geborgenheit und tief empfundene Religiosität als Orientierung und Schutz im Alltag gegenübergestellt. Zahlreiche Kommentare und positive Rezensionen in der jüdischen, aber auch der nichtjüdischen Presse begrüßten und lobten die „nachhaltig wirkende[n] Erziehungskunststücke“ der Autorin, die den „Geist jüdischer Nächstenliebe“ und die „Schönheit des Familienlebens“ beschreiben.
Wir dürfen, umgeben von Tod und von Grauen, den Glauben an uns nicht verlieren. Wir müssen der Freude Altäre bauen in den düsteren Massenquartieren.
Kleines Wiegenlied
Abendlied
Goldner Mond und goldne Sterne stehen über der Kaserne. Von der ganzen großen Welt blieb uns nur das Himmelszelt.
Goldner Mond und goldne Sterne. Die ich liebte, sie sind ferne. Wenn die Sehnsucht mich befällt, ist zu klein das Himmelszelt.
Die Nacht schleicht durchs Ghetto so schwarz und stumm. Schlaf, Kind, vergiß alles ringsherum. Schmieg fest dein Köpfchen in meinen Arm. Bei Mutter ist es gut und warm. Schlaf, über Nacht kann vieles geschehn. Über Nacht kann aller Kummer vergehn... Mein Kind, du sollst sehn: einst, wenn du erwacht, ist der Friede gekommen – über Nacht.
geben wollte, war darunter ein Gedicht mit dem Titel „Brief an mein Kind“. Migdal hatte die Verse im Archiv von Yad Vashem in Jerusalem gefunden – ohne einen Hinweis auf die Autorin. Sie veröffentlichte das Gedicht als Text einer anonymen Verfasserin – und bekam im darauffolgenden Frühjahr Post aus Stockholm: „Die Autorin des Gedichts ‚Brief an mein Kind‘ ist meine in Auschwitz ermordete Mutter, Ilse Weber. Und ich bin Hanuš, das Kind, von dem dieser Brief spricht.“
Als Ulrike Migdal 1986 eine Sammlung von Chansons und Satiren aus dem Konzentrationslager Theresienstadt heraus-

Weitere zwei Jahrzehnte mußte Migdal recherchieren, bevor sie 2006 „Wann wohl das Leid ein Ende hat“ herausgeben konn-
te. Der Band versammelt 76 Gedichte Ilse Webers und sämtliche ihrer erhaltenen Briefe aus dem Zeitraum zwischen 1933 und 1944. Damit lag das lyrische Werk der Hörspiel- und Kinderbuchautorin erstmals umfassend vor, das Tausenden Häftlingen in Theresienstadt Trost und Hoffnung gespendet hatte. Hanuš Weber lebte nach dem Krieg mit seinem Vater in Prag und arbeitete später für den Tschechischen Rundfunk. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings kehrte er nach Schweden zurück, wo er 2021 starb. Willi Weber starb 1974 bei einer Reise in Kopenhagen.

 Rudolf Heider/KH
Rudolf Heider/KH
Theresienstadt“ wurde herausgegeben von Ulrike Migdal. Das Buch mit Zeichnungen von Bedřich Fritta erschien auch auf Italienisch. „In deinen Mauern wohnt das Leid. Gedichte aus dem KZ Theresienstadt“ erschien bereits 1991 im Bleicher-Verlag. In dem lebensechten Familienroman „Kinder



� Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe
Dr. Markus Söder


Der Ort ist gut gewählt. Regensburg ist Tor zu unseren östlichen Nachbarn mit vielen historischen Verbindungen nach Böhmen. Hier wird Europa in seiner ganzen kulturellen Kraft und Vielfalt spürbar, als Wertegemeinschaft und einzigartiges historisches Friedensprojekt.

Das Motto des Sudetendeutschen Tages lautet: „Schicksalsgemeinschaft Europa“. Sie steht angesichts des Angriffskrieges, den Rußland gegen die Ukraine führt, vor einer Bewährungsprobe.
Die Erfahrungen der Sudetendeutschen sind in dieser Situation von besonderem
Wert. Nie wieder Krieg, nie wieder Vertreibung, das waren die Lehren, die sie aus ihrem Schicksal zogen. Das ist Mahnung zu Frieden und Verständigung, aber auch zur
Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Völkerrecht. Die Sudetendeutschen geben ein ermutigendes Beispiel für die Gestaltung der Zukunft. Sie haben erlittenes Leid überwunden, engagiert und erfolgreich am Wiederaufbau unseres Landes mitgewirkt und die friedliche Zusammenarbeit in Europa mitgestaltet. Das bleibt unvergessen! Den Sudetendeutschen ein gelungenes Pfingstwochenende in Regensburg und alles Gute für die Zukunft!
Dr. Markus Söder MdL Bayerischer Ministerpräsident



� Grußwort der Oberbürgermeisterin unserer Patenstadt

� Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Dr. h. c. Bernd Posselt
Liebe Landsleute, liebe Gäste, Europa gehört zusammen. Das zeigt sich in der Geschichte und in der Gegenwart, und es zeigt sich anhand von Städten wie Regensburg. Hier in Regensburg ließen sich im Jahr 845 14 böhmische Fürsten taufen, von Regensburg aus wurde das Bistum Prag gegründete. Die Donau, die durch Regensburg fließt, verbindet mit Deutschland, Österreich, Ungarn, der Slowakei, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, der Re-

publik Moldau und der Ukraine zehn europäische Länder. Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft, das hat der Paneuropa-Gründer Richard Coudenhove-Kalergi schon vor 100 Jahren erkannt. Uns in Europa geht es besser, wenn wir zusammenhalten. Das lehrt uns auch die Geschichte unserer Volksgruppe: Zeiten, in denen Tschechen und (Sudeten-)Deutsche zusammengehalten haben, waren Zeiten kultureller Blüte und Zeiten des Friedens. Und so wünschen wir uns, daß auch dieser 73. Sudetendeutsche Tag europaweit ausstrahlt, wenn wir in unserer Patenstadt Regensburg zusammenkommen und mit Freunden aus
der Tschechischen Republik und aus ganz Europa einen offenen und herzlichen Dialog pflegen, gemeinsam für ein sich einigendes Europa einstehen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fortsetzen.
Kommen also auch Sie in großer Zahl zu Pfingsten nach Regensburg und bringen Sie viele Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen Volksgruppe mit, insbesondere solche, die noch nie bei uns waren. In herzlicher landsmannschaftlicher Verbundenheit Ihr Dr. h. c. Bernd Posselt MdEP a. D. Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Herzlich willkommen in Regensburg
Liebe Gäste des Sudetendeutschen Tages aus nah und fern, seit 73 Jahren findet der Sudetendeutsche Tag statt, und ich freue mich, daß Regensburg nach 2019 zum zweiten Mal als Tagungsort gewählt wurde. Denn mit unserer Patenschaft für die Sudetendeutsche Volksgruppe haben wir uns 1951 verpflichtet, die kulturelle Erinnerung zu pflegen. Dieser Verantwortung kommen wir bis heute bewußt und gerne nach. Das diesjährige Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“ verweist auf die Erinnerung an die Vertreibung und würdigt zu-
gleich den großen Beitrag, den die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau geleistet haben. Wie sehr die sudetendeutsche Gemeinde dabei auch das kulturelle Leben mitgeprägt und bereichert hat, zeigen in Regensburg Einrichtungen wie die Ostdeutsche Galerie und das Sudetendeutsche Musikinstitut, die heute aus unserer Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken sind. „Schicksalsgemeinschaft Europa“ deutet aber natürlich auch auf unsere Gegenwart. Wir müssen in diesen Zeiten, in denen un-
sere demokratischen Werte gefährdet sind, Zusammenhalt beweisen. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, ein freies und demokratisches Europa zu bewahren. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft steht für diesen Zusammenhalt. Nach der schrecklichen Erfahrung von Flucht und Vertreibung haben sich Ihre Mitglieder eine neue Heimat aufgebaut und solidarisch an der Entwicklung unserer heutigen Gesellschaft mitgearbeitet. Daß Sie dabei auch Ihr kulturelles Erbe nicht vergessen, dafür ist der jährliche Sudetendeutsche Tag der beste Beweis.
Hier werden Traditionen gepflegt, für die nächste Generation erfahrbar gemacht und die Grundlage dafür gelegt, künftige Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Ich wünsche dem Sudetendeutschen Tag 2023 viel Erfolg und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen schönen Aufenthalt in Regensburg!
Ihre
Gertrud Maltz-Schwarzfischer Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg

Zwischen Krieg und Frieden
Der Angriffskrieg Rußlands gegen die Ukraine kann noch lange dauern. Der Einsatz für Frieden und Freiheit, Volksgruppen- und Menschenrechte einschließlich eines Vertreibungsverbotes ist nötiger denn je. Ein starkes und geeintes Europa auf der Basis der Völkerverständigung hat vor diesem Hintergrund höchste Priori-
tät und erfordert unser Engagement. Deshalb lädt Dr. h. c. Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland am Freitag, 26. Mai, 14.00 Uhr international hochrangige Gäste zu einer Diskussion ins Stadttheater Regensburg (Bismarckplatz 7) über die gegenwärtigen weltpolitischen Herausforderungen ein. Unter anderem diskutiert er mit Nestor Aksiuk, Vorsitzender der DeutschUkrainischen Gesellschaft Ulm, Dr. Iantsing Joseph Dieu, Leiter der Vertretung der Republik Taiwan in Bayern und Dr. Libor Rouček über „Europa – Schicksalsgemeinschaft zwischen Krieg und Frieden“.
Vorbildliche Europäer
Bereits seit 1958 verleiht die Sudetendeutsche Landsmannschaft den nach Kaiser Karl IV. benannten Europäischen Karls-Preis. Erster Preisträger war Lev Prchala, General der tschechoslowakischen Armee, der sich für die Aussöhnung von Tschechen und Deutschen einsetzte. Mit Barbara Stamm, der damaligen stellvertretenden Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern, erhielt 2000 erstmals eine Frau die Medaille, die dem Majestätssiegel Kaiser Karls IV. an der Goldenen Bulle nachempfunden ist.
Dieses Jahr erhalten die beiden Co-Vorsitzenden des offiziellen, von beiden Regierungen ernannten Deutsch-Tschechischen Ge-
sprächsforums, Bundesminister a. D Christian Schmidt (CSU) und der tschechische Sozialdemokrat Dr. Libor Rouček den Europäischen Karls-Preis. Der ehemalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Libor Rouček, beschäftigte sich bereits im Rahmen seiner Promotion im Fachbereich Politikwissenschaften und Soziologie in Wien mit Internationalen Beziehungen. Auch im beruflichen und später politischen Wirken legte er seinen Schwerpunkt stets auf Europa und Auswärtige Angelegenheiten. In Christian Schmidt fand er einen gleichgesinnten Co-Vorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums. Der ehemalige Bundesminister engagierte sich im Arbeitskreis Auswärtiges, Verteidigung, Europa der CSU-Landesgruppe und war unter anderem
Mitglied der deutsch-baltischen, deutsch-kroatischen, deutsch-israelischen und deutsch-tschechischen Parlamentariergruppen. 1997 wurde er ins DeutschTschechische Gesprächsforum berufen.
Die 1997 in der DeutschTschechischen Erklärung verankerte Plattform dient regelmäßigen Treffen von Deutschen und Tschechen und der Diskussion aktueller gesellschaftlicher Themen. Ihr Ziel ist es, den Dialog und die Einbeziehung unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen zu unterstützen, die sich für eine enge und gut funktionierende Partnerschaft beider Länder einsetzen. Der Sprecher, also oberste politische Repräsentant, der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, nannte die beiden Preisträger „herausragende Brückenbauer zwischen den Völkern, die seit Jahrzehnten mit viel Fingerspitzengefühl, Mut und Nachhaltigkeit den Dialog zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik unter führender Einbeziehung der Sudetendeutschen vorangetrieben haben“.
Außerdem seien Schmidt als Hoher Beauftragter der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina und Rouček als ehemaliger Vizepräsident des Europäischen Parlamentes „vorbildliche Europäer in einer Zeit, in der vielfach die Wiederkehr des Nationalismus droht“. KH
73. Sudetendeutscher Tag: Das komplette Festprogramm
Freitag, 26. Mai 2023
n 10.00 Uhr: Pressekonferenz. Presseclub Regensburg, Ludwigstraße 6.
n 13.30 Uhr: Europäischer Auftakt mit musikalischen Darbietungen. Bismarckplatz.
n 14.00 Uhr: Europäisches Forum „Europa – Schicksalsgemeinschaft zwischen Krieg und Frieden“. Stadttheater Regensburg, Bismarckplatz 7.
Podiumsleitung: Dr. h. c. Bernd Posselt MdEP a. D.
Podium: Nestor Aksiuk, Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft (Ulm); Dr. Ian-tsing Joseph Dieu, Leiter der Vertretung der Republik Taiwan in Bayern; Dr. Libor Rouček MdEP a. D.
n 17.00 Uhr: Kranzniederlegung. Bismarckplatz.
n 19.00 Uhr: Festlicher Abend der Sudetendeutschen Stiftung und der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit Verleihung der Sudetendeutschen Kulturpreise 2023 sowie des Sudetendeutschen Volkstumspreises 2023 (gesonderte Einladung).
Moderation: Iris Kotzian. Stadttheater Regensburg, Bismarckplatz 7.
Samstag, 27. Mai 2023
n 9.30 Uhr: Eröffnung der Aktionshalle mit Steffen Hörtler, Landesobmann der SL Bayern. Aktionshalle.
n 10.30 Uhr: Festveranstaltung „Schicksalsgemeinschaft Europa“ in der Haupthalle.
Eröffnung: Steffen Hörtler, Landesobmann der SL Bayern.
Grußworte: Gertrud MaltzSchwarzfischer, Oberbürgermeisterin der Patenstadt Regensburg; Ulrike Scharf MdL, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Schirmherrschaftsministerin; Rita Schwarzelühr-Sutter MdB, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat.
Verleihung der Karls-Preise 2023 der Sudetendeutschen Landsmannschaft durch Dr. h. c. Bernd Posselt MdEP a. D., Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, an
Christian Schmidt MdB a. D., Bundesminister a. D., Hoher Repräsentant der Staatengemeinschaft für Bosnien-Herzegowina, Deutscher Vorsitzender des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, und Dr. Libor Rouček MdEP a. D., ehemaliger Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Tschechischer Vorsitzender des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums.
Dankesworte.
Musikalische Umrahmung: Formation des Westböhmischen
Symphonieorchesters Marienbad.
n 14.30 Uhr: Der Heiligenhof – Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk/Akademie Mitteleuropa/ Arbeitskreis Sudetendeutscher
Akademiker: Genozide und Vertreibung verhüten: Sudetendeutsch-ukrainische Perspektiven für eine europäische Erinnerungskultur. Raum VI.
Referent: Prof. Dr. Manfred Kittel, Regensburg/Berlin.
n 14.30 Uhr: Seliger-Gemeinde: Die Kräfte der Freiheit unterstützen – Volkmar Gabert (1923
2003) und die heutigen deutsch-tschechischen Beziehungen. Raum I.
Podiumsleitung: Christa Naaß
MdL a. D.
Podium: Volkmar Halbleib
MdL, Dr. Libor Rouček MdEP
a. D. und Markus Rinderspacher
MdL. n 14.30 Uhr: Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz): Komponistenportrait: Walther Prokop führt in sein Werk ein. Raum V. n 14.30 Uhr: Ackermann-Gemeinde/Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein/Tschechisches Zentrum München/Sudetendeutsches Priesterwerk: Entschieden für Verständigung. Junge Tschechen und die eigene Geschichte. Raum IV.
Referentin: Christa Naaß MdL
a. D.
n 16.30 Uhr: Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau-Riesengebirge e. V.: Bezirkskarten im Gebiet der heutigen Tschechischen Republik 1850 – 2002. Raum IV.
Referent: Günter Fiedler.
n 16.30 Uhr: Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher e. V.: Familienforschung im Herzen Europas – Sudetendeutsche Familienforschung in Böhmen, Mähren und Schlesien. Raum III.
Referent: Dr. Michael Popović.
Gottesdienst. Raum VI.
n 10.30 Uhr: Einzug der Fahnenabordnungen und Trachtengruppen zur Hauptkundgebung.
n 11.00 Uhr: Hauptkundgebung. Haupthalle.
Begrüßung: Steffen Hörtler, Landesobmann der SL Bayern.
Totengedenken: Roland Hammerschmied.
Erklärung der Sudetendeutschen Jugend: Mario Hierhager, Bundesvorsitzender.
Internationale Grußbotschaft.
Ansprachen: Dr. h. c. Bernd
in Musik und Tanz
Für viele gehört er zu den Höhepunkten eines jeden Sudetendeutschen Tags: der HEIMAT!abend am Samstag. In diesem Jahr werden ihn erstmals Elisabeth und Stefanie Januschko moderieren
Aufstellung zum Fahneneinzug zur Hauptkundgebung.
Podiumsleitung: Blanka
Navrátová (Tschechisches Zentrum München)

Podium: Petr Kalousek (Meeting Brno) und Veronika Kupková (Antikomplex).
n 14.30 Uhr: Sudetendeutsche Landsmannschaft: Unsere Familienwurzeln in Archiven Tschechiens finden – mit Tipps anhand des Beispiels Percy Schmeiser (kanadischer Landwirt, alternativer Nobelpreis 2007). Raum III.
Referent: Werner Honal (Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher VSFF).
n 14.30 Uhr: Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Buchpräsentation: Die vertriebenen Kinder. Raum IX.
Referent und anschließendes
Gespräch mit Zeitzeugen: Jan
Blažek.
n 14.30 Uhr: Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Die Rolle der Darm-Mikrobiota bei Erhalt der Gesundheit und bei verschiedenen Krankheiten. Raum II.
Referent: o. Univ. Prof. Dr. Günter J. Krejs (Präsident).
n 14.30 Uhr: Heimatkreis Jägerndorf: Zurück in die Heimatstadt – Bericht über den Versöhnungsmarsch nach dem Vorbild Brünns sowie über die neue Jägendorfer Heimatstube. Raum
VIII.
Referenten: Lorenz Loserth, Meinhard Schütterle.
n 16.00 Uhr: Mauke – Die Band: Gablonzer Mundartkabarett. Haupthalle. n 16.30 Uhr: Sudetendeutscher Heimatrat: Gegenwart und Zukunft – Aufgaben und Ergebnisse. Raum VI. Ansprechpartner: Franz Longin (Vorsitzender).
n 16.30 Uhr: Adalbert Stifter Verein e. V.: Literatur im Café: Otfried Preußler zum 100. Geburtstag – Stationen seines Lebens und wichtige Werke, vorgestellt von Anna Knechtel. Raum I.
n 16.30 Uhr: Bundesfrauenarbeitskreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft: Mit den Frauen in die Zukunft – Frauenrechte sind Menschenrechte. Raum V.
n 16.30 Uhr: Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz e. V./Böhmerwaldmuseum Wien: Johann Peter – Der Rosegger des Böhmerwaldes. Raum IX.
Referent: Dr. Gernot Peter.
n 16.30 Uhr: SdJ – Jugend für Mitteleuropa e. V.: Die Erben der Vertreibung – Eine (kritische) Bilanz. Raum II.
Referent: Ralf Pasch.
n 16.30 Uhr: BdEG – Bund der Egerländer: Jurysitzung für den Johannes-von-Tepl-Preis 2023. Raum VIII.
Ansprechpartner: Dr. Ralf Heimrath.
n 18.00 Uhr: Kulturreferat der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz): Sudetendeutsches Schatzkästlein. Raum VI.
Lesung: Tina Stroheker.
Musikalische Umrahmung: Formation des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad.
n 19.00 Uhr: HEIMAT!abend: Tracht – Musik – Tanz. Haupthalle.




Regie und Moderation: Elisabeth und Stefanie Januschko.

Grußwort: Sylvia Stierstorfer MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.
n 21.00 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanzfest. Tanz und Geselligkeit mit Musik aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Haupthalle.
Tanzleitung: Sabine Januschko.
Pfingstsonntag, 28. Mai 2023
n 9.00 Uhr: Römisch-katholisches Pontifikalamt. Haupthalle.
Es zelebrieren unter anderem: Vertriebenenbischof Dr. Reinhard Hauke, Monsignore Adolf Pintíř (Vertreter der Tschechischen Bischofskonferenz(, Monsignore Dieter Olbrich (Präses der sudetendeutschen Katholiken), Holger Kruschina (Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks) und weitere Heimatpriester.
n 9.00 Uhr: Evangelischer
Posselt MdEP a. D., Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und Dr. Markus Söder MdL, Bayerischer Ministerpräsident, Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe.
Musikalische Umrahmung: Gartenberger Bunkerblasmusik unter Leitung von Roland Hammerschmied.
Anschließend: Lasershow. Das Sudetendeutsche Museum präsentiert: Die Sudetendeutschen – eine Reise durch die Zeit.
n ab 11.00 Uhr: Sudetendeutsche Heimatpflege: Mundartlesungen. Raum V.
n 13.00 Uhr: Sudetendeutsche Landsmannschaft: Unsere Familienwurzeln in Archiven Tschechiens finden – mit Tipps anhand des Beispiels Julius Patzak (Kammersänger). Raum VI.
Referent: Werner Honal (VSFF).
n 13.00 Uhr: Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau-Riesengebirge e. V.: Deutsch-Tschechische Verständigung, Best Practice aus dem Riesengebirge. Raum I.
Referentin: Štěpánka Šichová.
n 13.00 Uhr: Seliger-Gemeinde: Deutsch-tschechisches Dokumentarfilmprojekt: Über unsere Schwellen hinaus. Erste Schritte. Raum IV.
Diskussionsleitung: Helena Päßler, Co-Bundesvorsitzende der Seliger-Gemeinde.
Diskussion: Wolfgang Spielvogel (Filmemacher), Rainer Brumme (Filmemacher) und Markus Harzer (Lehrer).
n 13.00 Uhr: Förderverein der Stadt Saaz | Žatec e. V./ STRIKE
Television s.r.o. Prag: Dokumentarfilm: Postelberg 1945 –Die Vergeltung der Tschechen. Raum III.
Ansprechpartner: Otokar Löbl.
n 13.00 Uhr: Heimatkreis
Kaplitz: Sitzung. Raum II.
Ansprechpartner: Hermann
Proksch.
n 13.00 Uhr: Heimatverein Luditz: Sitzung. Raum VIII.
Ansprechpartner: Dr. Horst Spitschka.
n Ab 15.00 Uhr: Autoren lesen ihre Werke. Raum IV.
In diesem Jahr ist der HEIMAT!abend (bisher als Volkstumsabend bekannt) unter dem Motto „Hoamaterd“ der kulturellen Heimat auf der Spur. Verschiedene Gruppen aus dem In- und Ausland singen, tanzen und musizieren auf der Bühne in der Haupthalle. Die Moderation und die Regie übernehmen in diesem Jahr erstmals Elisabeth und Stefanie Januschko, die als Musikerinnen schon selbst oft beim Sudetendeutschen Tag auf der Bühne gestanden haben. Sie freuen sich sehr über diese neue Aufgabe, bei der sie mit den verschiedenen Kulturgruppen in
Kontakt treten und gemeinsam ein buntes Programm mit Musik, Liedern und Tänzen zusammenstellen. Organisiert haben sie den Abend gemeinsam mit Heimatpflegerin Christina Meinusch. Auftreten werden unter anderem die Böhmerwaldjugend, die Egerländer Familinemusik Hess, die Gartenberger Bunkerblasmusik, der Iglauer Singkreis, die Kuhländler Trachten- und Tanzgruppe, Moravia Cantat, die Schönhengster Volkstanzgruppe, die Tanzgruppe Javorník und die Wischauer Tanzgruppe. Wer selbst Lust zu tanzen bekommen hat, kommt anschließend beim Sudetendeutschen Volkstanzfest ab 21 Uhr in der Haupthalle auf seine Kosten. Unter fachkundiger Anleitung von Sabine Januschko werden Volkstänze aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien nachgetanzt.
� Hier kommt jeder auf seine Kosten HeimatEgerländer Familienmusik Hess. Moravia Cantat. Bilder: Santifaller (3), Torsten Fricke (1) Die Tanzgruppe Javorník marschiert auch beim Trachteneinzug mit.
❯ Tre en Sie Landsleute aus Ihrer Heimatlandschaft
Wiedersehen

Der Sudetendeutsche Tag ist ein großes Familienfest, auf dem die Besucher bekannte Gesichter wiedersehen und
die einzelnen Heimatlandschaften ausgezeichnet sein, also fürs Egerland, Erzgebirge-Saazerland, Mittelgebirge, Polzen-Neiße-Niederland, Riesengebirge, Adlergebirge, Altvatergebirge, Schönhengstgau, Kuhländchen, Beskiden, Südmähren, Böhmerwald und für die Sprachinseln. Je nach Bedarf können die Heimatorts- und Heimatkreisbetreuer die der Heimatlandschaft zugewiesenen Plätze noch nach Heimatkreisen und Heimatorten aufteilen.
Eifrig wird im Odessa-Haus in Regensburg mit einer professionellen Gesangslehrerin für den Auftritt beim Sudetendeutschen Tag geprobt.
❯ Musik und Mundart mit Mauke – Die Band Ausgezeichnet!
neue Bekanntschaften schließen können. Wer Kontakte aus seiner Heimatlandschaft bzw. aus der Herkunftsregion seiner Vorfahren sucht, hat dazu nach der Hauptkundgebung in der Haupthalle Gelegenheit:
Dann werden wieder Tische für
Ganz im Zeichen der Heimatlandschaften stehen übrigens auch die neuen Taschen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die beim Sudetendeutschen Tag kostenlos ausgegeben werden: Mit ihren langen Henkeln erweisen sie sich nicht nur als praktische Helfer bei Einkäufen und anderen alltäglichen Erledigungen, sondern machen auch optisch mit den 14 Bildmarken aller 14 Heimatlandschaften etwas her.

❯ Schon ab 19. Mai im Donau-Einkaufszentrum

Im Vorfeld des Sudetendeutschen Tages wird im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg (DEZ) die Ausstellung „Die Sudetendeutschen – Unsere Geschichte. Unsere Kultur. Unser Leben.“ gezeigt. Sie wird am 19. Mai um 11.00 Uhr von der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer MdL, unter Beisein der regionalen Presse sowie von Zeitzeugen der Vertreibung eröffnet werden und bis zum 27. Mai zu sehen sein.

Ausstellungen
Vielfalt im Bild

Sie bieten Kunst, Kultur und Informationen: die Ausstellungen auf dem Sudetendeutschen Tag.
■ Das Egerlandmuseum Marktredwitz informiert in der Aktionshalle über 50 Jahre Egerland-Kulturhaus (Stand A14).
■ Im Foyer im ersten Stock präsentieren Dr. Tamara Novátková und Olga Hájková Befestigte Landschaft – Menschen im östlichen Riesengebirge. In den 1930er Jahren wurden in Dörfern im östlichen Riesengebirge, einer militärstrategisch wichtigen Region, Festungsanlagen errichtet. Die Ausstellung fragt danach, wie die Menschen sowohl in diesem Gebiet als auch im gesamten deutschsprachigen Grenzraum die entstehenden Festungsanlagen und die damit verbundene Infrastruktur wahrgenommen haben. Die Ausstellung wurde vom Institut für Geschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Mathematik und Physik der Karls-Universität Prag vorbereitet und war zunächst in der Tschechischen Republik zu sehen. Auf dem Sudetendeutschen Tag wird sie erstmals in deutscher Übersetzung gezeigt.
■ Die Seliger-Gemeinde hat mit Böhmen liegt nicht am Meer eine zweisprachige Ausstellung konzipiert, die Lebenswege sudetendeutscher Sozialdemokraten vorstellt. Zu sehen ist sie in der Aktionshalle am Stand D02.
■ Im Foyer im ersten Stock zeigen der Förderverein der Stadt Saaz | Žatec e. V. und die Ackermann-Gemeinde Hessen e. V. die Ausstellung Der Akkermann und der Tod – Humanismus in Böhmen – Johannes von Saaz und seine Zeit. Johannes von Tepl (auch Johan-
nes von Saaz bzw. Jan ze Žatce) schrieb mit „Der Ackermann und der Tod“, auch bekannt als „Der Ackermann aus Böhmen“, um 1400 eine der ersten neuhochdeutschen Prosadichtungen, die auch noch 600 Jahre später eine Faszination ausübt, schließlich geht es um zeitlose Themen wie Tod, Trauer, Sterben und Schmerz.

■ In der Aktionshalle an den Ständen A12 und A13 zeigt der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. Erinnerungsstücke aus der Fluchtkiste.
■ Gustav Zindl ist die Ausstellung des Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender in der Aktionshalle an Stand A10 gewidmet.
■ Den Botaniker Hugo Iltis (1882–1952) stellt der Deutsche Kulturverein Region Brünn in der Aktionshalle an Stand B01 vor.
■ Im Durchgang zwischen Haupt- und Aktionshalle (nahe Stand A14) präsentiert der Fotograf und Kulturpreisträger 2017 Sebastian Weise sein Grabsteinprojekt Schluckenauer Zipfel.
■ Das Centrum Bavaria Bohemia zeigt im Foyer im ersten Stock den Paneuropa-Gründer Richard Coudenhove-Kalergi und seine Vision der europäischen Einigung.
■ Im Stadtmuseum von Aussig (Ustí nad Labem) ist seit 2021 die Dauerausstellung Unsere Deutschen zu sehen – über sie informiert das Collegium Bohemicum an Stand H09 in der Aktionshalle.
■ Auf eine Spurensuche begeben sich die künstlerischen Bilder der Fotografin Yvonne Most im Durchgang zwischen Haupt- und Aktionshalle, nahe Stand A14.
❯ Europäischer Auftakt zum Sudetendeutschen Tag
Unter freiem Himmel
Was wäre der Sudetendeutsche Tag ohne Musik? Und was wäre der Bismarckplatz in Regensburg ohne das zu Pfingsten erwartbare gute Wetter? Die Musik als eine der Kernkompetenzen der Sudetendeutschen und die einstmals weise Wahl des Pfingstwochenendes als fester Termin für den Sudetendeutschen Tag werden am Freitag, 26. Mai ab 13.30 Uhr auf dem Bismarckplatz mit dem Auftritt zahlreicher internationaler Musikgruppen unter freiem Himmel mustergültig ausgespielt. Rund um die erfrischenden Wasserspiele, die der Platz zu bieten hat, wird bewirtet werden. Auftreten werden sowohl ein hochkarätiges tschechisches Ak-
kordeontrio als auch die ŠvejkBand, die Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München und die Tanngrindler Musikanten, welche mit ihrer Spielweise den Liebhabern traditioneller, jedoch entstaubter Volksmusik insbesondere in der Oberpfalz seit langem ein Begriff sind. Den Höhepunkt des Nachmittags bildet eine Szenario-Aufführung ukrainischer Künstler, präsentiert vom Internationalen Freundeskreis Odessa-Haus in Regensburg. Auf diese Weise repräsentiert diese Auftaktveranstaltung das europäische Musikantentum in seiner Vielfalt und bildet damit einen würdigen, im Wortsinn zu verstehenden Auftakt des Sudetendeutschen Tages.
Bild: Odessa-Haus in Regensburg ❯ Novum am P
ach der Hauptkundgebung lädt das Sudetendeutsche Museum in der Haupthalle zu einer Lasershow ein. Farbige Laserstrahlen visualisieren Schlaglichter aus der sudetendeutschen Geschichte, Exponate des Sudetendeutschen Museums sowie das Bekenntnis zum internationalen Dialog in einem geeinten Europa.
Seit mehr als 17 Jahren begeistert Mauke – die Band ihr Publikum, vor allem in Bayern und Tschechien. Bei ihren Auftritten spielen sie allgemein bekannte Lieder, deren Texte sie humoristisch abändern und in ihren Dialekt, das Paurische, übertragen. Auch die Kabaretteinlagen sind auf Paurisch gehalten. Der Dialekt stammt aus der Stadt Gablonz sowie dem Isergebirge. Nach 1945 brachten die Vertriebenen ihn mit – unter anderem nach Kaufbeuren, wo sich im Stadtteil Neugablonz viele Vertriebene aus Gablonz niederließen. Diesen Dialekt zu erhalten, ist der Band Mauke ein wichtiges Anliegen. Der Begriff Mauke bezeichnet im Paurischen Brei und damit eine Vermischung von Dingen und beschreibt damit den Anspruch der Band, verschiedene Dinge zu kombinieren: Kabarett, Musik, Mundart.

In ihrer jetzigen Formation besteht Mauke – die Band aus Frontmann und Multiinstrumen-

talist Wolfgang Klemm, Mundartdichter Michael O. Siegmund, Gitarrist Herbert Stumpe, Sven Siegmund am Piano, Björn Siegmund zur stimmlichen Begleitung, Dieter Schaurich am Bass und Schlagzeuger Gregor Zasche. 2013 wurde sie mit dem Kunstund Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren ausgezeichnet, 2019 wurde ihr der Dialektpreis Bayern verliehen. In diesem Jahr kommt eine weitere Auszeichnung hinzu: der Sudetendeutsche Kulturpreis für Volkstumspflege der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des Freistaats Bayern. Verliehen wird dieser Preis am Vorabend der Eröffnung des Sudetendeutschen Tages. Auf dem Sudetendeutschen Tag haben die Besucher die Gelegenheit, sich selbst vom Können der Gruppe zu überzeugen: Am Samstag, 27. Mai spielt Mauke – die Band um 16.00 Uhr in der Haupthalle, auf dem Böhmischen Dorffest.
Lyrik und Musik
Der Sudetendeutsche Kulturpreis für Literatur und Publizistik geht an die Schriftstellerin Tina Stroheker. Beim Schatzkästlein am Samstagabend stellt sie ihr Werk vor.
Mut und Liebe, diese beiden: 2015 lernte Tina Stroheker die tschechische Germanistin Hana Jüptnerová kennen. Hana, im Riesengebirge lebend, war Deutschlehrerin, Übersetzerin, Dissidentin und stand in persönlichem Austausch mit Václav Havel. 1982 ließ sie sich taufen, in der atheistischkommunistischen Tschechoslowakei ein mutiger Schritt. Nach der Wende wurde Schwerpunkt ihres Engagements die Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen. Hana hatte zwei Söhne und war Pflegemutter dreier RomaMädchen aus einem Heim. Sie mischte sich zeitlebens ein.
Tina Stroheker hat ihr, inspiriert von zahlreichen hinterlassenen Fotografien, nach ihrem Tod 67 Albumblätter gewidmet, eine poetische Hommage an eine eigenwillige, ganz besondere Frau. Und über das individuelle Porträt hinaus entsteht das Bild eines bewegend einfachen tschechischen Frauenlebens von der Zeit des Kalten Krieges bis in unsere Gegenwart.

Die freie Autorin, Herausgeberin und Initiatorin literarischer Projekte Tina Stroheker, 1948 in Ulm geboren, lebt in Eislingen und erhielt neben zahlreichen Stipendien und Preisen im Jahr 2017 den Andreas-Gryphius-Preis der Künstlergilde (Sitz Esslingen). Sie ist Mitglied u. a. im PEN-Zentrum Deutschland. Mehr als zwanzig Jahre lang erschienen Tina Strohekers Arbeiten bei Klöpfer & Meyer. Neben
ihrer Lyrik haben sowohl ihre Bücher über Polen als auch ihr mutiges Werk „Luftpost für eine Stelzengängerin. Notate vom Lieben“ (2013) große Zustimmung bekommen. Zuletzt erschien ihre hoch gelobte Sammlung „Inventarium. Späte Huldigungen“. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft und der Freistaat Bayern verleihen Tina Stroheker im Rahmen des Festlichen Abends am Freitag, 26. Mai um 19.00 Uhr im Stadttheater Regensburg den Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur und Publizistik. Im Sudetendeutschen Schatzkästlein am Samstag, 27. Mai um 18.00 Uhr in Raum VI der Donau-Arena liest die Preisträgerin außerdem aus dem aktuellen, mehrfach ausgezeichneten Buch. Die Lesung wird dabei von einer Formation des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad musikalisch umrahmt.
Das Westböhmische Symphonieorchester Marienbad (Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně) existiert seit dem 19. Jahrhundert und hatte viele berühmte Dirigenten und Solisten zu Gast. Es zählt zu den bekanntesten Klangkörpern der Tschechischen Republik und konzertiert in zunehmendem Maße auch im Ausland.
Seit vielen Jahren sorgt eine Formation des Orchesters für die musikalische Umrahmung verschiedener Veranstaltungen des Sudetendeutschen Tages. Dazu zählt in diesem Jahr neben dem Schatzkästlein auch die Festveranstaltung „Schicksalsgemeinschaft Europa“ mit der Verleihung des Karls-Preises am Samstag, 27. Mai, um 10.30 Uhr in der Haupthalle der Donau-Arena.
❯ Vom Hauptbahnhof zur Donau-Arena
Shuttle-Service
Um die Anbindung der DonauArena noch zu steigern, hat die Sudetendeutsche Landsmannschaft einen Shuttle-Service eingerichtet. Somit gibt es zwei Angebote, welche Besucher des Sudetendeutschen Tages für die letzte Meile bis hin zum Festgelände in Anspruch nehmen können.
Zweitens fährt der kostenlos nutzbare Shuttle-Service am Samstag halbstündig zwischen

❯ Für Briefmarkensammler und Postfreunde Schmankerl


E


rstens die öffentliche Linie 5 in Richtung Donaustauf/ Sulzbach/Wörth, welche im Rahmen des gewöhnlichen ÖPNVBetriebs genutzt werden kann. Sie fährt am Samstag alle zwanzig Minuten und am Pfingstsonntag halbstündig über diverse Halte in der Innenstadt bis zur Haltestelle Regensburg-Schwabelweis Baseball-Stadion, von wo aus ein kurzer, für den Sudetendeutschen Tag extra ausgeschilderter Fußweg zur Donau-Arena führt.
❯ Bayerischer Rundfunk



8.30 und 10.00 Uhr sowie zwischen 17.00 und 18.30 Uhr vom Hauptbahnhof über die Haltestellen Dachauplatz, Haus der Bayerischen Geschichte, Wöhrdstraße und Weichs/DEZ direkt bis vor die Donau-Arena. Die Haltestelle Wöhrdstraße wird angefahren, um den großen Pendlerparkplatz auf der Wöhrdinsel zu bedienen; die Haltestelle Weichs/DEZ wird angefahren, um das Donau-Einkaufs-Zentrum anzubinden, in welchem im Vorfeld des Sudetendeutschen Tages die Ausstellung
„Die Sudetendeutschen – Unsere Geschichte. Unsere Kultur. Unser Leben.“ zu sehen ist. Zurück geht es dann über dieselben Haltepunkte in umgekehrter Reihenfolge von 21.15 bis 23.15 Uhr.
Am Pfingstsonntag steht der beschriebene Service hinwärts zwischen 7.15 und 10.45 Uhr (jeweils Abfahrt ab Hauptbahnhof) sowie rückwärts zwischen 16.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung. Die Fahrtzeit beträgt in etwa eine Viertelstunde. Für Gäste, die am Hauptbahnhof Regensburg ankommen, gilt zu beachten, daß sie sich in Richtung Innenstadt in das alte Bahnhofsgebäude begeben müssen, um schließlich den Vorplatz des Bahnhofs zu betreten und in gerader Richtung der mittig vom Bahnhof weg verlaufenden Maximiliansstraße folgend den Bussteig C6 aufzusuchen. Von Hauptbahnhof (C6) fahren nämlich sowohl der Shuttle-Service als auch die Linie 5. Außerdem werden am Hauptbahnhof zwei Mitarbeiter der Sudetendeutschen Landsmannschaft bei der Wegfindung behilflich sein.
❯ Vergünstigter Eintritt in Landesausstellung
Barock!
In einer Sondersendung berichtet das Bayerische Fernsehen am Pfingstsonntag zwischen 23.00 und 23.15 Uhr über den Sudetendeutschen Tag aus Regensburg. Für die Redaktion zuständig ist Jürgen Schleifer. Der Beitrag wird anschließend auch in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks abrufbar sein.

Seit dem 10. Mai ist im Regensburger Haus der Bayerischen Geschichte die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ zu sehen. In über 150 Exponate vorwiegend aus Bayern und Tschechien zeigt die Ausstellung Vielfalt und Reichtum einer Epoche, die von Krise und Neubeginn gekennzeichnet war.
Nach Ende des Dreißigjährigen Kriegs wurden sowohl in Bayern als auch in Böhmen Klöster, Kirchen, Adelsresidenzen und Profangebäude im barocken Stil erneuert. Wie die Ausstel-
lung zeigt, hielt der Barock Einzug in nahezu alle Lebensbereiche – über konfessionelle, regionale und ständische Grenzen hinweg.
Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 3. Oktober im Donausaal des Hauses der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1 in Regensburg. Anschließend wird sie ab dem 8. Dezember bis zum 8. Mai 2024 im Nationalmuseum in Prag zu sehen sein. Mit dem Festabzeichen erhalten Sie vom 26. bis zum 28. Mai einen ermäßigten Eintritt von 6 (statt 12) Euro.
Wer an seine Lieben postalische Grüße vom 73. Sudetendeutschen Tag verschicken möchte, kann sich über zwei besondere Angebote freuen: Auch

in diesem Jahr gibt es wieder auf Initiative der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) einen Sonderstempel. Am Infostand der SL im Foyer erhalten Sie außerdem eine dazu passende Postkarte, die Sie direkt versehen mit dem Sonderstempel verschicken können. Auch nach dem Sudetendeutschen Tag besteht noch die Möglich-

❯ Deutsch-Tschechische Stadtführung
keit, den Sonderstempelabdruck zu erhalten. Schicken Sie dazu bis einschließlich 24. Juni 2023 eine einfache Vorlage (mindestens eine 10-Cent-Briefmarke auf einem Blatt Papier) oder einen frankierten Briefumschlag bzw. eine frankierte Postkarte an folgende Adresse: Deutsche Post AG Niederlassung Privatkunden/ Filialen Sonderstempelstelle Franz-Zebisch-Straße 15 92637 Weiden
Auf böhmischen Spuren

Zwischen Regensburg und den böhmischen Ländern bestehen zahlreiche Verbindungen. Eine kostenlose Stadtführung begibt sich mit den Gästen des Sudetendeutschen Tags „Auf böhmische Spuren in Regensburg“ und klärt Fragen wie: Ist die Steinerne Brücke mit der Prager Karlsbrücke verwandt? Was verbirgt sich hinter der Aufschrift „Aufenthalt von Konstantin“ in Regensburg? Wo findet man den Liebesbeweis von Prinzessin Ludmilla von Böhmen in Regensburg?

Beginn der Stadtführung ist am Alten Rathaus. Es stehen zwei Termine zur Auswahl:
Freitag, 18.00–19.30 Uhr
Sonntag, 16.00–17.30 Uhr
Eine Anmeldung ist erforderlich per eMail an anmeldung @sudeten.de




