Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung

Sudetendeutschen Landsmannschaft
HEIMATBOTE
Sudetendeutsche Zeitung
Neudeker Heimatbrief
VOLKSBOTE
Zeitung





HEIMATBOTE
Neudeker HeimatbriefZeitung

VOLKSBOTE
Heimatbrief










HEIMATBOTE
VOLKSBOTE
Sudetendeutsche Zeitung
HEIMATBOTE




VOLKSBOTE
Neudeker Heimatbrief
VOLKSBOTE


❯ Feierliche Eröffnung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen in Selb Präsident Petr Pavel:

Bildungsminister Mikuláš Bek.




❯ Sudetendeutscher Tag
Minister Bek


kommt nach Regensburg
Foto: Vlada CZ „Viele Probleme lassen sich nur lösen, wenn wir mit den Partnern jenseits der Grenze zusammenarbeiten“, hat Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel in seiner Festrede anläßlich der Eröffnung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen in Selb erklärt und dabei erneut deutlich gemacht, daß ein Ziel seiner Amtszeit die Förderung der strukturschwachen Grenzregion ist.













Bildungsminister Mikuláš Bek wird als offizieller Vertreter der tschechischen Regierung am Sudetendeutschen Tag teilnehmen, hat Ministeriumssprecherin Aneta Lednová mitgeteilt.


Bei seinem Staatsbesuch in Regensburg hatte Tschechiens Premierminister Petr Fiala in der Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder bereits bekanntgegeben, daß ein offizieller Regierungsvertreter am Sudetendeutschen Tag teilnehmen wird (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). Dem vorausgegangen waren intensive Bemühungen über unterschiedliche Kanäle von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Gastgeber des Sudetendeutschen Tages.



Posselt begrüßt Beks Teilnahme am Sudetendeutschen Tag als „wichtigen und positiven Schritt hin zu einer gemeinsamen Zukunft im Herzen Europas“. Bek habe schon vor Jahren als Rektor der Universität Brünn die bayerisch-tschechische Konferenz der Universitätspräsidenten begründet und als Europaminister die wegweisende tschechische EU-Ratspräsidentschaft im letzten Jahr gestaltet: „Er ist ein herausragender Brückenbauer, und wir danken dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala dafür, daß er ihn wie am 9. Mai mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und der Spitze der Sudetendeutschen Volksgruppe erörtert, beauftragt hat.“
Seine erste Dienstreise als Staatsoberhaupt hatte Pavel im Februar, direkt nach seiner Vereidigung, in die Region Karlsbad geführt. Mit der Grenzstadt Selb als Ziel seines ersten Staatsbesuchs in Bayern setzte Pavel erneut ein Zeichen. „Die gegenwärtige Situation in Europa zeigt uns, wie wichtig gute Nachbarschaft ist“, sagte Pavel in seiner Festrede mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: „Es ist wichtig, daß wir in dieser Situation zusammenhalten. Wir müssen uns unserer Werte bewußt sein, die die gesamte europäische Demokratie auszeichnen. Die Ukrainer kämpfen nicht nur für ihre Unabhängigkeit, sondern auch für unsere Werte. Würde die Ukraine diesen Kampf verlieren, würden wir alle verlieren.“



Er sei, so Pavel, „der bayerischen Regierung für das Niveau der Zusammenarbeit dankbar, für die Offenheit und das Entgegenkommen bei der Lösung von Problemen“.


In Bayern leben mehr tschechische Staatsbürger als in den anderen Bundesländern zusammengerechnet. Deshalb, so Pavel, sei es besonders wichtig, gute Beziehungen zu haben. „Wir leben seit über tausend Jahre zusammen. Man kann sich schwer die tschechische Geschichte ohne deutsche Landsleute und Mitbürger vorstellen“, sagte Pavel und räumte ein, daß es in dieser Geschichte auch viel Leid



Ministerpräsident Markus Söder begrüßt First Lady Eva Pavlová und Präsident Petr Pavel. Volksgruppensprecher Bernd Posselt im Interview mit dem tschechischen Fernsehen. Pavel auf seiner BMW HP R1250 GS


Begrüßung vor dem Theater in Selb (von links): Umweltminister Thorsten Glauber, First Lady Eva Pavlová, Präsident Petr Pavel, Selbs OB Ulrich Pötzsch, Ministerpräsident Markus Söder, Europaministerin Melanie Huml und Peter Berek, Landrat von Wunsiedel.










gegeben hat. „Ich bin sehr froh, daß diese dunkle Zeit hinter uns liegt“, sagte das Staatsoberhaupt und mahnte, aus der Geschichte zu lernen. „In diesem Kontext freut es mich auch sehr, wie in den vergangenen Jahren die Entwicklung in der Sudetendeutschen Landsmannschaft verlaufen ist. Dafür möchte ich


Fotos: Torsten Fricke (5), Pražský hrad






Wichtig sei, so Pavel, auch der Schüler- und Studentenaustausch zwischen Bayern und Tschechien. Die jungen Menschen seien bei der Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte von „unschätzbarem Wert“, aber auch bei der Gestaltung der gemeinsamen Zukunft. Pavel: „Ich schätze es sehr, daß die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen gerade den Kontakt zwischen den jungen Leuten soviel Bedeutung beimessen.“ Ein großes Potenzial für die grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sehe er auch in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Innovationen und lobte das Memorandum im Bereich Luft- und Raumfahrt, daß Bayern und Tschechien beim Staatsbesuch von Premierminister Petr Fiala in Regensburg unterzeichnet hatten. „Wir sehen auch gute Chancen für den Ausbau der Zusammenarbeit beim Thema Wasserstoff und bei der Nutzung bestehender Gaspipelines für den Transport von Wasserstoff sowie beim Ausbau der Verkehrsnetze auf Straße und auf Schiene, um die Regionen miteinander näherzubringen.“








Präsident Petr Pavel beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Selb (links). Als Ehrengäste in Selb dabei (oben, von links): Milan Horáček (BdV), Birgit Seelbinder (AltOberbürgermeisterin von Marktredwitz), Landesobmann Ste en Hörtler, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Ingrid und Albrecht Schläger (Seliger-Gemeinde) sowie Martin Panten (Ackermann-Gemeinde).
mich persönlich bei Bernd Posselt bedanken, denn ich weiß das sehr zu schätzen“, sagte Pavel, der beim Betreten des Saales ein paar persönliche Worte mit dem Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe gewechselt hat.
Pavel sagte, er begrüße es, daß in Bayern und in Tschechien die jeweils andere Sprache in Schu-

len gelernt werden könne. Wie die Sudetendeutsche Zeitung berichtete, hatte es in Tschechien Bestrebungen gegeben, die zweite Fremdsprache aus dem Lehrplan zu streichen, was de facto das Aus für den Deutsch-Unterricht bedeutet hätte. Diese Streichung konnte in letzter Sekunde verhindert werden.
Pavels Fazit: „Das Wort Freundschaft im Namen der Veranstaltungsreihe, die wir heute eröffnen, ist die Grundvoraussetzung einer echten Partnerschaft. Ich hoffe, daß die BayerischTschechischen Freundschaftswochen nicht nur Freude bringen, sondern auch lehrreich sind. Ich bin überzeugt, daß diese Veranstaltungsreihe zur Vertiefung und Belebung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien beiträgt. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das es wohl auch im Deutschen gibt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Lassen Sie uns gemeinsam an der guten Zukunft arbeiten, damit die dunklen Zeiten ein für allemal vorbei sind.“ Fortsetzung Seite 3. Torsten Fricke
„Ich möchte mich persönlich bei Bernd Posselt bedanken“
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Radek Novák (Foto: links) ist nicht nur Vorsitzender der ältesten Organisation der Deutschen, dem Kulturverband, dem es seit seiner Gründung 1968 als Kind des Prager Frühlings gelungen ist, sich seine Selbstständigkeit und Freiheit über all die Jahre zu bewahren.

Radek Novák ist auch aktives
Mitglied der Liberalen Synagoge in der Prager Heinrichsgasse. Dorthin führten er und SL-Büroleiter Peter Barton den CSULandtagsabgeordneten Volker Bauer (Foto: Mitte) mit seiner Delegation von Kommunalpolitikern und sudetendeutschen Landsleuten.


Novák erinnerte in seiner Re-


de an die historischen Wurzeln des Prager und des böhmischen Judentums, Barton sprach über die hervorragende Verbindung deutscher Kultur und Sprache mit dem liberalen Judentum vor dem Holocaust. Novák kann mit seinem Engagement an diese Tradition anknüpfen. Unvergessen ist, daß es in der Ersten Tschechoslowakischen Republik gerade die wohlhabenden Juden waren, die die ehrwürdigen Institutionen wie das Neue Deutsche Theater oder das Deutsche Casino massiv unterstützten und so vor dem sicheren Ruin retteten. Bauer erinnerte in seiner Rede an die Verp ichtung der deutschen Nation und des Volkes, das jüdische Erbe zu bewahren und wenn möglich,
auch weiter zu entwickeln. Das Prager Sudetendeutsche Büro arbeitet seit seiner Entstehung vor 20 Jahren gerne mit jüdischen Partnern und Organisationen zusammen, und die

❯ Schirmherrin Sylvia Stierstorfer bei der Erö nung im Donau-Einkaufszentrum


Arbeit des Kulturverbands-Vorsitzenden Radek Novák für diese beiden Gruppen der Gesellschaft ist eine wunderbare Fügung des Schicksals.
Ausstellung in Regensburg
klärt über Sudetendeutsche auf
Eine Woche vor dem Start des 73. Sudetendeutschen Tages, der vom 26. bis 28. Mai in der Donau-Arena stattfindet, ist im Donau-Einkaufszentrum (DEZ) die Ausstellung „Die Sudetendeutschen. Unsere Geschichte – Unsere Kultur – Unser Erbe“ eröffnet worden, die bis zum 27. Mai zu sehen ist.
Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, MdL Sylvia Stierstorfer, hat erneut – wie bereits 2019 – die Präsentationsmöglichkeit vermittelt und die Schirmherrschaft übernommen. Vor allem Mitglieder der nahen Ortsverbände der Sudetendeutschen Landsmannschaft, wie Regenstauf und Neutraubling, waren zur Ausstellungseröffnung gekommen. Aber auch DEZ-Kunden lauschten aufmerksam und studierten die 18 Aufsteller über Geschichte, Kultur und Brauchtum der Sudetendeutschen.

SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch wies in seiner Begrüßung auf die neue Tafel zum Thema www.Sudeten.net hin, womit die Vernetzung auf verschiedenen Ebenen – zwischen den Generationen, zwischen den

Prinz Edward in Tschechien
Nach seinem Besuch in Deutschland ist Prinz Edward, der Bruder des britischen Königs Charles III., am Dienstag per Zug nach Prag weiter gereist. Anlaß der Reise war der Duke of Edinburgh International Award, mit dem Initiativen ausgezeichnet werden, die Jugendliche fördern. Außerdem standen der Besuch eines Kinder- und Jugendheims in Prag und ein Gedenken der Helden der Heydrich-Ausschaltung an der Kyrill-und-Method-Kirche auf dem Programm.
Spolu-Kandidatur noch offen
sident. Traditionell nehmen an der Gedenkveranstaltung Vertreter all jener Länder teil, deren Bürger in den Konzentrationslagern Theresienstadt und Leitmeritz ermordet oder gefangen gehalten wurden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Diplomaten aus Rußland und Weißrußland nicht mehr eingeladen. Deutschland wurde durch Botschafter Andreas Künne vertreten.
Applaus für deutsche Philharmoniker
SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch und die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, MdL Sylvia Stierstorfer, erö neten die Ausstellung im Donau-Einkaufszentrum.

Verbänden, Gruppierungen und Einrichtungen – über das Internet vertieft werden soll. Mit einem herzlichen Dank an Stierstorfer für ihre Unterstützung übergab er das Wort an die Landtagsabgeordnete. Die historischen Fakten der
Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg rief Stierstorfer in Erinnerung: 15 Millionen Menschen, von denen fast zwei Millionen nach Bayern kamen, davon zwei Drittel Sudetendeutsche. Auch sie selbst hat väterlicherseits sudetendeutsche
❯ Premierminister warnt eindringlich vor der Schuldenfalle und kündigt Steuererhöhungen an
Wurzeln in Blattnitz (Kreis Mies), weshalb sie über das Schicksal und die Geschichte der Heimatvertriebenen gut Bescheid weiß. Eine Willkommenskultur sei damals nur wenig ausgeprägt gewesen, die Heimatvertriebenen seien weitgehend ohne Besitz in die neue Heimat gekommen. „Dennoch überwogen das Engagement und der Wille, hier neu anzufangen“, erklärte die Landtagsabgeordnete.
Erfolgsgeschichten wie die der heutigen Vertriebenenstadt Neutraubling würden zeigen, daß diese eng mit Sudetendeutschen verknüpft ist. Weiter verwies Stierstorfer auf den Aspekt der Bildung, weshalb sie viel in Schulen ist und Kontakt mit der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen aufgenommen hat – auch um das Thema Vertreibung im Unterricht zu verstärken. Zuletzt erwähnte die Landtagsabgeordnete die in Regensburg seit Sommer vergangenen Jahres tätige Forschungsstelle „Kultur und Erinnerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern 1945–2020“ und die demnächst im Haus des Deutschen Ostens in München präsentierte Ausstellung Frauen und Kinder. Markus Bauer
Petr Fiala kämpft um sein Sparpaket
„Das Tempo der Neuverschuldung in Tschechien ist bedrohlich. Es ist das fatale Erbe der vorangegangenen populistischsozialistischen Regierungen.
Wenn wir es nicht jetzt schaffen, auf die Bremse zu treten, könnte uns die Situation schon in einigen wenigen Jahren aus den Händen entgleiten“, wirbt Premierminister Petr Fiala eindringlich für das umstrittene Sparpaket seiner Regierung.
Unter dem Titel „Česko ve formě“ (Tschechien in Form) will die Regierung in den kommenden beiden Jahren rund 150 Milliarden Kronen (über sechs Milliarden Euro) einsparen. „70 Prozent der Einsparungen werden durch die Streichung von staatlichen Subventionen für Unternehmen, bei denen es sich nicht um Investitionen handelt, realisiert“, sagt Finanzminister Zbyněk Stanjura (ODS).

Strittigster Punkt ist eine Reihe von Steuererhöhungen, die Fialas ODS bislang immer abgelehnt hatte. So soll die Körperschaftssteuer von 19 auf 21 Prozent steigen. Außerdem werden die Abgaben für die Krankenversicherung erhöht, was auch Arbeitnehmer belastet. Und die
Grenze für den höheren Einkommenssteuersatz werden abgesenkt sowie 22 Steuervergünstigungen gestrichen.
Zudem werde die Regierung, so Fiala, „Alkohol, Tabak und andere Produkte, die unser Gesundheitssystem belasten und langfristige Kosten verursachen, stärker besteuern“.
Bei der Mehrwertsteuer werden die beiden niedrigen Steuersätze von zehn und 15 Prozent zu zwölf Prozent zusammengefaßt, was, so Finanzminister Stan-

jura, eine Entlastung für die Bürger bedeute, da damit die Mehrsteuer auf Lebensmittel, Mieten sowie Medikamente und Gesundheitsprodukte um drei Prozentpunkte sinke.
Dennoch hagelt es Kritik. Der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Karel Havlíček (Ano) sprach von einem „schwarzen Tag für Unternehmer“, „da nicht nur die Abgaben für Selbständige steigen, sondern auch nach langer Zeit die Körperschaftssteuer. Zudem erhöht sich die Immobiliensteuer“.
Gewerkschaftsboß Josef Středula beklagte unter anderem die Streichung von Steuervergünstigungen, für die man lange gekämpft habe. Außerdem hält er die Mehrwertsteuersenkungen in ausgewählten Bereichen für wirkungslos. „Wir haben kein
Bis spätestens Ende September will die KDU-ČSL entscheiden, ob sie im nächsten Jahr allein oder in der Spolu-Koalition mit ODS und Top 09 für das Europäische Parlament kandidiert, hat Marian Jurečka, Parteivorsitzender und stellvertretender Ministerpräsident, am Rande der Nominierungskonferenz seiner Partei erklärt. Die Frage sei auf dem Parteitag kein Thema gewesen, so Jurečka.
Tschechien kündigt
Vertrag mit Rußland
Prag will Moskau zur Kasse bitten: In der vergangenen Woche hat die tschechische Regierung Verträge aus den 1970er und 1980er Jahren gekündigt, die der damaligen Sowjetunion und heutigen Russischen Föderation für eine Reihe von Liegenschaften in Tschechien die kostenlose Nutzung für diplomatische Zwecke garantierten. Außenminister Jan Lipavský (Piraten) sagte, Tschechien werde auch entgangene Mieteinnahmen der vergangenen drei Jahre fordern, da Rußland die Liegenschaften nicht für diplomatische Zwecke genutzt, sondern zum Teil sogar untervermietet habe.
Staatspräsident bei KZ-Gedenken
In der KZ-Gedenkstätte Theresienstadt ist am Sonntag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. Zum ersten Mal seit 2015 sprach mit Petr Pavel der amtierende Staatsprä-
Im vollbesetzten Prager Rudolfinum sind am Freitagabend die Essener Philharmoniker mit dem Violinisten Frank Peter Zimmermann vom Publikum gefeiert worden. Das Orchester aus Deutschland trat mit seinem tschechischen Chefdirigenten Tomáš Netopil im Rahmen des Festivals „Pražské járo“ (Prager Frühling) auf und spielte zwei romantische Werke. Zu Beginn erklang das Konzert für Violine und Orchester des englischen Komponisten Edward Elgar und anschließend die 5. Sinfonie von Antonín Dvořák. Bei beiden Programmteilen applaudierte das Publikum so lange, bis eine Zugabe gespielt wurde. Es war das erste Mal, daß Netopil mit den Essener Philharmonikern beim „Prager Frühling“ auftrat.
Solidarität mit den Helden von Mariopol
Eine lebendige Installation mit Namen „Azovstal: rok v zajetí“ (Azovstal: ein Jahr in Gefangenschaft) hat am Samstag auf der Prager Karlsbrücke an jene Menschen erinnert, die vor einem Jahr das Eisen- und Stahlwerk Azovstal im ukrainischen Mariopol gegen den Angriff der russischen Truppen verteidigt haben und bis heute in Rußland inhaftiert sind. Veranstaltet wurde die Aktion von der Organisation Hlas Ukrajiny (Stimme der Ukraine). Eine Kette schwarz gekleideter und gefesselter Menschen sowie Plakate verwiesen auf Folterungen und die schweren Haftbedingungen der betroffenen Soldaten. Nach Angaben der Angehörigenorganisation „Frauen aus Stahl“ sind noch etwa 2000 Verteidiger von Mariopol in Haft.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
einziges Wort darüber gehört, wie die Regierung die Inflation absenken will. Die Sparvorschläge erhöhen hingegen den Preisdruck“, so Středula.
Lob bekam die Regierung dagegen von Wirtschaftsexperten.
So sagte David Marek, Chefökonom der Unternehmensberatung Deloitte, gegenüber dem Tschechischen Rundfunk, Fialas Sparpaket sei „ein guter Kompromiß“. „Im Staatshaushalt müssen allerdings insgesamt 250 Milliarden Kronen (10,6 Milliarden Euro) eingespart werden. Der jetzige Vorschlag der Regierung ist zwar ein guter Beginn, aber er reicht noch nicht“, so der Wirtschaftsexperte, der Staatspräsident Petr Pavel, der das Sparpaket unterschreiben muß, in Wirtschaftsfragen berät.

Daß ein Sparpaket samt Steuererhöhungen bei den Bürgern auf wenig Begeisterung stößt, räumte Fiala bei der Vorstellung selbst ein: „Wir erwarten heute keine lobenden Worte, und wir erwarten auch nicht, daß wir zunächst auf großes Verständnis stoßen. Aber wir sind bereit zu einer rationalen Debatte, und wir sind bereit, alles im Detail zu erklären und alle Entscheidungen zu verteidigen.“ Torsten Fricke


Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

❯
sich bei Tschechiens Präsident Petr Pavel für die Erwähnung der Sudetendeutschen


„Ein starkes Zeichen, ein wichtiges Signal“



„Herr Präsident, es ehrt Sie sehr, daß Sie die Sudetendeutschen und Bernd Posselt erwähnt haben. Auch Steffen Hörtler ist da. Und auch einige weitere Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft“, hat Ministerpräsident Markus Söder auf die Rede von Tschechiens Staatsoberhaupt Petr Pavel in seiner Festrede zur Eröffnung der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen reagiert.


Er, so erzählte Söder, könne sich noch gut an die Zeiten erinnern, als Sudetendeutsche Tage in der Bundesregierung skeptisch beobachtet wurden und in Tschechien heftige Reaktionen auslösten. Heute sei das anders. Es sei ein starkes Signal von Premierminister Petr Fiala, einen Minister zum Sudetendeutschen Tag nach Regensburg zu entsenden, lobte Söder. Dem vorausgegangen sei die Geste der Sudetendeutschen beim Sudetendeutschen Tag 2022 in Hof, auch die tschechische Nationalhymne zu spielen, erklärte der Ministerpräsident und würdigte „die vielen großen und kleinen Schritte des Brückenbauens in den vergangenen Jahren – und das bei dieser gemeinsamen Geschichte.“ Söder: „Danke an die Sudetendeutschen. Und Danke an Sie persönlich, Herr Präsident, für die Erwähnung. Das ist ein starkes Zeichen, ein wichtiges Signal. Ein herzliches Vergelt‘s Gott.“
Zu Beginn seiner Rede hatte Söder Bezug auf das jahrhundertelange friedliche Zusammenleben von tschechischen und deutschen Landsleuten in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien genommen, das nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Aufkommen der Nationalstaaten und des Nationalismus sein schreckliches Ende fand: „Der Nationalismus hat vieles gegeneinander gebracht, zu Hetze und Haß geführt und am Ende einen Krieg mit den extremen Greueltaten des Nationalsozialismus heraufbeschworen. Es gab viel Leid auf allen Seiten. Auch die Vertreibung hat schweres Leid verursacht. Deswegen ist es ein ganz besonderes Ereignis, daß wir heute freundschaftlich zusammenkommen. Nach dieser Geschichte soviel Versöhnung, soviel Miteinander – das ist ein unglaublich schönes Signal und gibt Hoffnung in diesen schweren Zeiten.“
Für Söder und Pavel war es bereits das zweite Treffen in Bayern. Direkt nach der Wahl zum Präsidenten, aber noch vor der Vereidigung hatte der General a. D. und ehemalige Vorsitzende des Nato-Militärausschusses im Februar an der Sicherheitskonferenz in München teilgenom-


In einem gemeinsamen Statement vor den TV-Kameras haben Staatspräsident Petr Pavel und Ministerpräsident Markus Söder die bayerisch-tschechische Freundschaft gewürdigt und die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unterstrichen.
men und dort auch den Bayerischen Ministerpräsidenten zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). Damals vereinbarten die beiden, sich in Selb wieder zu treffen, um die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen gemeinsam zu eröffnen. Der Eiserne Vorhang, so Söder, habe eine grüne Narbe hinterlassen. Die einstigen Industrieregionen beiderseits der Grenze hätten es nicht leicht.















Bereits als Heimatminister sei er, so erinnerte Söder in seiner Festrede, das Problem der strukturschwachen Grenzregionen angegangen. Stück für Stück habe sich insbesondere Oberfranken – was andere als Sorgenkind eingestuft hätten – mittlerweile zu einer innovativen Region entwickelt. Dies gelte auch für die Oberpfalz und Niederbayern. „Damals gab es nur einen Schwachpunkt, nämlich die Frage: Wie entwickeln wir

den gesamten Grenzraum?“, so Söder. Das Signal der tschechischen Regierung und des tschechischen Präsidenten, die Grenzregionen zu fördern, wertete Söder deshalb als „grundlegende Bereitschaft für das Zusammenwachsen in Europa“. Ein gemeinsames, grenzüberschreitendes Engagement eröffne völlig neue Möglichkeiten.
Respekt zollte Söder den Tschechen auch für die Unterstützung der Ukraine. Mit
❯ Bayerisch-Tschechische Freundschaftwochen
Begleitete ihren obersten Chef nach Selb: Dr. Ivana Červenková, tschechische Generalkonsulin München.

450 000 Flüchtlingen habe Tschechien in Relation zur Einwohnerzahl die meisten Ukrainer in Europa aufgenommen. „Wir stehen zu unseren gemeinsamen Werten. Und wir stehen dazu, diese Werte gemeinsam zu verteidigen“, so Söder.
Die Freundschaft zwischen Tschechien und Bayern sehe man im Freistaat auch als Auftrag, sich in Berlin für bessere Beziehungen mit Prag einzusetzen, erklärte Söder und versprach: „Wir

stehen da gerne parat.“ Auch die Wirtschaftsbeziehungen seien hervorragend, so Söder: „Tschechien ist Bayerns drittgrößter Handelspartner weltweit. Über 3000 bayerische Unternehmen haben Geschäftsbeziehungen mit Tschechien, 350 Firmen sind in Tschechien mit einer eigenen Niederlassung vertreten, 160 Unternehmen haben dort sogar eigene Produktionsstätten. Hinzu kommen 22 000 Pendler.“
Torsten Fricke

SL-Kulturpreisträgerin verzaubert zum Auftakt

„Gemeinsam.Chancen.Gestalten“– unter diesem Motto finden zwölf Wochen lang, bis zum 6. August, die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen in Selb und Asch statt. Ein Höhepunkt zum Auftakt ist die Licht- und Laser-Illumination der SL-Kulturpreisträgerin Brigitt Hadlich, am Freitag, 26. Mai in Selb und am Samstag, 27. Mai in Asch.
Die Konzeptkünstlerin verwandelt Gegenstände des Alltags in Kunstwerke, wie in diesem Fall eine Brücke und Bäume im Park. „Ich bin eine Strukturensammlerin“, erklärt Brigitt Hadlich, die 2019 von der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem Kulturpreis für Bilden-
de Kunst und Architektur ausgezeichnet worden ist.
„Meine Eltern stammten aus Gablonz und Umgebung. Ich lebe noch heute in Weidenberg, in einer ehemaligen Vertriebenensiedlung“, erzählt die Künstlerin.
Die beiden Illuminationen sind unterschiedlich. In Selb würden die Freiheit und die Freundschaft gefeiert, in Asch sei die Kunst eher mystisch und erinnere an die einstige Bedeutung der Stadt als Produktionsort für Handschuhe, woran die vier bunten Finger erinnern, die an der Parkbrücke leuchten werden.
Am Freitag, 2. Juni, wird es dann sportlich, wenn Jogger und Nordic-Walker von Selb ins 7,5 Kilometer entfernte Asch laufen und dort gemeinsam zu feiern.

Am Wochenende, 3. und 4. Juni, steigt dann in Selb im RosenthalPark das Mitmach-Wochenende „Sport ohne Grenzen“.
Einen musikalischen Höhepunkt setzen die Bamberger Symphoniker, die unter dem Titel „Böhmische Klangbilder“ am Freitag, 21. Juli, ein Freundschaftskonzert im RosenthalTheater in Selb geben.

„Wir organisieren unsere Veranstaltungen nicht nebeneinander, sondern im Miteinander – so schaffen wir in der Region neue und stärkere Verbindungen“, erklärt Pablo Schindelmann, Geschäftsführer der Selb 2023 gGmbH, das Konzept der Freundschaftswochen. Mehr über das Programm unter www. freundschaftswochen2023

Ministerpräsident Markus Söder bedanktTschechiens Präsident Petr Pavel. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Milan Horáček und Martin Dzingel. Tomáš Linda und Luis Andreas Hart. Tschechiens First Lady Eva Pavlová gratulierte Libor Rouček zum Karls-Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Eva Pavlová mit Jörg Nürnberger, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Sudetendeutschen Rates. Fotos: Torsten Fricke Europaministerin Melanie Huml, Moderator Mischa Salzmann und Umweltminister Thorsten Glauber.
❯ Prof. Dr. Stefan Samerski im Sudetendeutschen Haus
Vortragsreihe über „Böhmische
Ein besonderes Merkmal von Böhmen und Mähren sind die Burgen und Schlösser. Viele alte Sitze der Könige, Bischöfe und des Adels sind heute immer noch zu besichtigen und dokumentieren den kulturellen und historischen Reichtum der Region. Ihnen ist der Vortragszyklus „Böhmische Schlösser – Kultur und Geschichte“ von Prof. Dr. Stefan Samerski gewidmet.
Die Vorträge finden im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8 in München statt. Veranstalter sind die Sudetendeutsche
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher
Tag in Regensburg. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Sonntag, 28. Mai, SL-Bezirk Oberfranken: Busfahrt zum
Sudetendeutschen Tag. Für
Raum Bayreuth: Abfahrt Warmensteinach Freizeithaus 5.15
Uhr, Weidenberg Bahnhof 5.30
Uhr, Bayreuth Bahnhof 6.00 Uhr, Creußen Diska 6.10 Uhr, Pegnitz
Wiesweiher 6.30 Uhr. Für Raum
Bamberg: Bamberg Bahnhof 5.30
Uhr, Forchheim Altenheim (Bayreuther Straße15) 6.00 Uhr. Rück-
fahrt: Abfahrt um 16.00 Uhr. An-
meldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54, bei Helmut Hempel unter Telefon (0 92 77) 16 40 oder beim jeweiligen Kreisvorsitzenden.
■ Dienstag, 30. Mai, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Dienstag, 30. Mai, 17.30
Uhr: Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch. Pfarrer i. R. Franz Pitzal erinnert an das grausame Geschehen. Glockenspiel bei der Mediathek, Jahnstraße, Renningen.
■ Samstag, 3. Juni, 15.00
Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Eröffnung der Ausstellung „verloren, vermisst, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Die Ausstellung wird bis zum

Anzeige
Schlösser“
Landsmannschaft Bundesverband, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, die Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese München und Freising und die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste.
Die nächsten Termine:

■ Montag, 12. Juni, 19.00
Uhr: „Böhmische Schlösser –Teil 2: Königswart“.
■ Montag, 9. Oktober, 19.00
Uhr: „Böhmische Schlösser –Teil 3: Schloß Troja in Prag“
■ Montag, 20. November,
19.00 Uhr: „Böhmische Schlösser – Teil 4: Melnik“.
❯ Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg Barock!

Bayern und Böhmen
Während des Sudetendeutschen Tages bietet sich auch ein Besuch der BayerischTschechichen Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ an.
Das Museum der Bayerischen Geschichte befindet sich am Donaumarkt 1 in der Regensburger Altstadt und ist dienstags bis sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Ausstellung wird bis zum 3. Oktober gezeigt und ist anschließend in Prag zu sehen.
Foto: Torsten Fricke
VERANSTALTUNGSKALENDER
30. Juni gezeigt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung zur Eröffnung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.
■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr.
Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com
■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Ex-
❯ Versöhnungsmarsch Fahrt nach Brünn
Auch in diesem Jahr organisieren die SL Bayern und die SL Baden-Württemberg eine mehrtägige Busfahrt mit Teilnahme am Brünner Versöhnungmarsch.
Die Fahrt geht von Freitag, 23. bis Montag, 26. Juni. Erstmals findet nach dem Brünner Versöhnungsmarsch am 24. Juni am Sonntag, 25. Juni ein Gedenken im Kaunitz-Wohnheim statt, wo die Nazis Hunderte von Widerstandskämpfern ermordet hatten und das später auch im Zuge der Vertreibung von den Kommunisten genutzt wurde.
erzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.
■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Donnerstag, 15. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz) und Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg: Vortrag von Thomas Kabisch über „Musik und Philosophie zwischen West und Ost. Vladimir Jankélévitch in Prag“. Weinschenkvilla, Hoppestraße 6, Regensburg. Eintritt frei.
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.

■ Dienstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Ringveranstaltung mit Vortrag von Dr. Michael Henker über „Die Entwicklung der Museumslandschaft in Bayern“ und anschließendem Empfang. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 48.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.
■ Samstag, 1. Juli, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn. (Achtung, verschoben von ursprünglich 10. Juni auf jetzt 1. Juli.)
■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Be-
60 Jahre Liedpatenschaft der Stadt Wetzlar
Um das Liedgut der einst deutschen Siedlungsgebiete in Osteuropa nach der Vertreibung vor der Vergessenheit zu bewahren, hat die Stadt Wetzlar im Jahre 1962 eine„Patenschaft für das Ostdeutsche Lied“übernommen, die nunmehr 60 Jahre besteht und die weiter gepflegt wird. Informationen über den gebietlichen Umfang der Patenschaft, über dieAktivitäten und die Dienstleistungen der Patenschaftsstelle und die herausgegebenen Liederbücher können angefordert werden bei

Patenschaft der Stadt Wetzlar für das Ostdeutsche Lied Hauser Gasse 17, 35578 Wetzlar Telefon:06441 99-1031, Fax: 99-1034 E-Mail:ostdeutscheslied@wetzlar.de
Die Patenschaft umfasst folgende Gebiete
Baltikum
Banater Schwaben
Batschka
Berlin-Mark Brandenburg
Bessarabien
Buchenland
Dobrudscha

Galizien
Gottschee
Jugoslawien
Karpaten
Litauen
Masuren
Niederschlesien

Oberschlesien
Ostpreußen
Pommern
Sathmar
Siebenbürgen
Slawonien
Slowakei
Sudetenland
Syrmien
Ungarn
Westpreußen
Wolhynien
Zips
gegnung“. Ansprachen von OB Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz. Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Samstag, 8. bis Sonntag 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net
■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Feierstunde zur Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.
■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
❯ Ausstellung zu Flucht, Vertreibung und Integration

Ungehört – die Geschichte der Frauen
■ Donnerstag, 15. Juni, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung und Integration“ mit Schirmherrin Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Vertriebene und Aussiedler. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten Millionen von Deutschen ihre Heimat im östlichen Europa verlassen. Es waren vor allem Frauen, die sich auf den beschwerlichen
Weg machten. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs Zeitzeuginnen, die aus unterschiedlichen Regionen des östlichen Europas stammen. Ihre Wege durch die Nachkriegsgeschichte weisen Gemeinsamkeiten auf – und sind dennoch jeder für sich ganz besonders. Ria Schneider aus der Batschka, Emma Weis und Friederike Niesner aus Mähren, Gertrud Müller aus Oberschlesien, Rosemarie Becker aus Pommern und Edith Gleisl aus Ostpreußen.
Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit
■ Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 6. August: Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. 2. Veranstaltung der Akademie Mitteleuropa für Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik.
Über 100 Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und Weltsicht. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
Die Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft grüßt ganz herzlich alle Landsleute zum 73 Sudetendeutschen Tag in Regensburg Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein gesegnetes Pfingstfest und schöne Stunden im Kreise unserer stolzen Volksgruppe in der Patenstadt aller Sudetendeutschen.
Steffen Hörtler
Landesobmann
Margaretha Michel Eberhard Heiser Hannelore Heller Dr. Sigrid Ullwer-Paul Bernhard Moder Stellvertretende Landesobleute
Andreas Schmalcz
Landesgeschäftsstelle
❯ Ausstellung im Mährischen Landesmuseum in Brünn würdigte den Bürgerrechtler und Brückenbauer Jaroslav Šabata

Ein Kämpfer für die Demokratie
Im Dietrichstein-Palais des Mährischen Landesmuseums in Brünn war eine Ausstellung dem Leben des prominenten Bürgerrechtler und Brückenbauers Jaroslav Šabata gewidmet.
Die Teilnehmer des diesjährigen Brünner Symposiums (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) hatten Gelegenheit, die in tschechischer Sprache gestaltete Darstellung durch die Übersetzung der einführenden Worte des Mitautors der Ausstellung, Patrik Eichler, Journalist, politischer Kommentator, Redakteur der Zeitschrift Listy und Direktor der Demokratischen Masaryk-Akademie, und durch eine Handreichung der Ausstellungstexte in deutscher Sprache den Werdegang Šabatas nachzuvollziehen. Für die Bernhard Bolzano Gesellschaft, deren Mitgründer Šabata war, und für das Brünner Symposium in Gänze bleibt Jaroslav Šabata die prägende Persönlichkeit, die schließlich 2007 auch den Umzug von Iglau (Iglauer Gespräche) nach Brünn (Brünner Symposium) anregte.



Der 1927 in Tullnitz bei Znaim in eine tschechisch-deutsche Bauernfamilie geborene Jaroslav Šabata war das älteste von sieben Kindern. In der Familie sprach auf Wunsch des Vaters Rudolf auch die deutsche Mutter Rosa (geborene Gusserle) mit den Kindern ausschließlich Tschechisch.
Nach der Volkszählung von 1930 hatte Tullnitz 383 Einwohner, 285 deutsche und 98 tschechische. Etwa ein Viertel dieser tschechischen Bewohner stellte die Familie Šabata. Die verwandtschaftliche Verflechtung mit deutschen Teilen der Familie hatte zur Folge, daß mit der Vertreibung alle Deutschen der Familie nach Westdeutschland kamen.
Jaroslavs Šabatas Enkel Michal Uhl begab sich 2010 auf die Suche nach den aus Südmähren stammen-
den deutschen Verwandten. Bei einer Zusammenkunft mit den Tullnitzern erweckte die Information, daß er „Jaras Enkel“ sei, allgemeine Heiterkeit. „Hier bekomme ich sofort das komplette Verzeichnis von Namen und Geburtsjahren aller Geschwister meines Großvaters. ,Hela, Rudy, Eva, Hana‘ deklamieren alle fast einstimmig. Gemeinsam zeichnen wir einen Plan von Dolenice/ Tullnitz und zeigen, wo wer wohnte“ schreibt darüber Michal Uhl in der Zeitschrift Respekt
In seinen Einführungsworten erwähnt der Kurator Patrik Eichler, daß Jaroslav Šabata fließend Deutsch, aber auch Englisch sprach, und daß er bereits im Zweiten Weltkrieg nach Brünn zum Gymnasium ging, dort später auch studierte und eigentlich bis auf seine Gefängnisaufenthalte aus politischen Gründen vor allem in den 1970er Jahren bis zu seinem Tode immer in Brünn gelebt habe.
Zunächst sei er Hochschulpädagoge, dann kommunistischer Funktionär in der Brünner Kreisparteileitung gewesen. In Brünn gehörte er damit ab 1958 zur politischen Szene, die Anfang der 1960er Jahre ökonomische und politische Reformen einforderte. Er setzte sich unverzüglich für per-
sonelle Veränderungen in der Kommunistischen Partei ein und gehörte zu den lautesten Befürwortern einer Einberufung des außerordentlichen 14. Parteitags. Hiervon versprach er sich eine Bestätigung für die reformistische Neuorientierung der Partei.
Nach der Militärinvasion im August 1968 bestand er auf der Rechtsgültigkeit des außerordentlichen Parteitags und nutzte die öffentliche Unterstützung zur Fortsetzung der Reformpolitik. In den Dissidentenkreisen waren die Brünner mit Šabata mehr um moralische Dimensionen bemüht, entgegen den Pragern, die mehr politisch agiert hätten.
Was Šabata, als Philosoph und Psychologe geschult, immer umtrieb, war die Frage, wie könnten die Dinge gestaltet sein, wenn die existierenden Verhältnisse sich veränderten.
Drei Auszeichnungen erhielt Jaroslav Šabata, berichtete Kurator Eichler, zwei zu Lebzeiten, eine postum. Zuerst im Jahre 1988 erhielt er den FrantišekKriegel-Preis der Charta 77, deren Sprecher er 1978 und 1981 war. Diesen bekam er für den Prager Aufruf, den er 1985 mit Václav Havel verfaßte, und der zu Gorbatschows Antritt als KPdSU-Generalsekretär in der Sowjetunion erschien. Der Prager Aufruf formulierte erstmals die Notwendigkeit der demokratischen Wiedervereinigung Deutschlands als Bedingung für ein vereintes demokratisches Europa. Eichler verwies in diesem Zusammenhang auf den Begriff Šabatas von der „Ketzerischen Geopolitik“. Der demokratische Frieden in Europa – im Gegensatz zum Friedenspatt des Kalten Krieges – fordere eine vollständige demokratische Umwandlung Europas. Und zu diesem Ziele sollten westliche Friedensbewegungen mit den Menschenrechtsbewegungen in Mittel- und Osteuropa zusammenarbeiten. Die Grenzen der Blöcke im Kalten Krieg sollten durchbrochen werden.

Dann bekam Jaroslav Šabata den Jiri-PelikánPreis 2008, eine Statue von dem 1971 in Rom gegründe-
ten Zweimonatsblatt Listy ( Blätter), das nach der Samtenen Revolution nach Olmütz übersiedelte, verliehen als Held des „Prager Frühlings“, nicht als Opfer. Šabata sei laut Kurator Eichler damals die sichtbarste Figur des „Prager Frühlings“ gewesen, der nach dem 21. August, dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten unter Führung der Sowjetischen Armee und dem Moskauer Abkommen, jegliche Kapitulation vor den Sowjets ablehnte. Er sagte damals, neun Zehntel der Bevölkerung ständen gegen eine Regierung der Kollaborateure. Man müsse mit Moskau auf Augenhöhe verhandeln. 40 Jahre nach dem „Prager Frühling“ würdigte die Jury des Preises einen Menschen, der „kämpfen wollte und wußte, daß dies ohne schwere Wunden nicht gehen würde.“


In diesem Zusammenhang würdigte Eichler die Zeitschrift Index, die 1968 und 1969 in Brünn nur zwei Jahre erschien, aber die die politische Plattform Šabatas war und später in Vergessenheit geriet.
Zuletzt wurde Šabata am 23. Juni 2012, sechs Tage nach seinem Tod, vom damaligen polnischen Präsidenten Bronisław Komorowski mit dem Großkreuz des Verdienstordens mit Stern der Republik Polen geehrt. Überreicht wurde der Orden durch den polnischen Botschafter an die Familie. Posthum wurden damit Šabatas bedeutsame mitteleuropäische Aktvitäten für die Zusammenarbeit polnischer mit tschechoslowakischen Dissidenten gewürdigt. Es waren diese Treffen im Riesengebirge oder an der Grenze zwischen Polen und der Tschechoslowakei, die die Auszeichnung begründeten.
Zum Ende der Führung ging Kurator Eichler noch auf die letzte Idee Šabatas ein, die der „neudemokratischen Revolution“, die wohl an Masaryks Vorstellung einer weltweiten demokratischen Revolution anknüpfte, im Konkreten aber die Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten, denen er 1996 beitrat, und den Christdemokraten vorbereitete, weil beide Strömungen ein gemeinsames Ziel, nämlich die Emanzipation des Menschen, hätten. In der Regierung von Vladimír Špidla (2002) und dann wieder unter Bohuslav Sobotka (2016–2020) sei diese Zusammenarbeit realisiert worden.
Eine Vitrine mit Teilen seiner Bibliothek, die viel Deutschsprachiges enthält, ein Filminterview-Porträt mit Jaroslav Šabata, das zu seinem 80. Geburtstag erschien und auch seine Tochter Anna Šabatová, die tschechische Ombudsfrau 2014–2020, die selbst 1971 wie ihre beiden Brüder inhaftiert war, zu Wort kommen läßt. Oder eine Vitrine über seine Frau Anna Šabatová (geborene Landová), die für die Familie ihre Ambitionen zurückstellte, dennoch die Familie nicht zusammenhalten konnte. All diese Zeugnisse einer Brünner Persönlichkeit und ihrer politisch aktiven Familie konnte man besichtigen, die in vielen Netzwerken noch heute fortlebt und nicht zuletzt im Brünner Symposium, dem Gespräch zwischen Deutschen und Tschechen in der „Mitte Europas“, ihren alljährlichen Auftritt hat. Ulrich Miksch
Pfingsten liegt dieses Jahr datumsmäßig wieder so, wie ich es eigentlich am Schönsten finde, nämlich Ende Mai. Fünfzig Tage nach Ostern, dem Fest der Auferstehung Jesu, feiern wir eine Wirklichkeit, von der ich überzeugt bin, daß sie für uns alle bedeutungsvoll ist: den Geist von oben, die göttliche Kraft in unserem Leben, das Einheitselement, welches Gott und Mensch und die Menschen untereinander verbindet. Jesus kündigte diesen Geist vor seinem Tod den Jüngern als „Beistand“ an. Das griechische Wort dafür ist nach dem Johannesevangelium „Paraklet“. Das Wort läßt sich noch mit anderen Bergriffen übersetzen wie Tröster, Anwalt, Vermittler, Fürsprecher.
Noch einmal: Es geht um eine Wirklichkeit, die für uns alle bedeutungsvoll ist. Der Geist von oben ist eine unverzichtbare Voraussetzung für unser aller Leben. Ich meine, daß dies selbst Menschen spüren, die sich sonst für kaum religiös halten. Warum? Weil wir immer wieder erfahren, daß wir nicht alles aus uns selbst haben. Woher kommen die glückseligen Momente unseres Seins? Woher kommen die guten Gedanken? Woher die gelungenen Gespräche? Woher der Friede, wenn er wider Erwarten erfahrbar wird? Woher kommt die Kraft zur Versöhnung? Woher kommt Heilung? Woher kommt letztlich alles Gelingen in unserem Leben? Allein an unseren Fähigkeiten, an unserer eigenen Kraft kann es nicht liegen.



Das Pfingstfest will uns also über uns hinausführen. Es ist ein Fest, das uns vor Selbstüberschätzung, aber auch vor Selbstüberforderung bewahrt, weil es uns eben daran erinnert, daß wir von Voraussetzungen leben, die wir nicht selbst bestimmen und garantieren können. Wir feiern an Pfingsten, daß wir in vielfacher Weise begabte Menschen sind. Das heißt: Unserem Menschsein ist etwas gegeben, wir haben Gaben, und diese Gaben verweisen auf einen Geber, den Geist von oben, den man in religiöser Sprache auch als den „Spender aller guten Gaben“ bezeichnet. Daß jede Gabe natürlich auch eine Aufgabe ist, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Doch habe ich noch nicht erklärt, warum ich es so schön finde, daß Pfingsten Ende Mai gefeiert wird. Nun, einfach deswegen, weil der Mai ja auch als Wonnemonat gilt, und Ende Mai ist die Wonne, wie ich finde, auf einem Höhepunkt. Johann Wolfgang von Goethe hat Pfingsten einmal als „das liebliche Fest“ bezeichnet und es in Verbindung mit dem prallen Frühling gebracht. Die frühlingshafte Fülle, der wir Ende Mai in der Natur begegnen, eröffnet uns tatsächlich noch einmal von einer anderen Seite her einen Zugang zu diesem Fest. Der Geist von oben ist ein Geist der Fülle. Er will uns zur Fülle der Liebe führen und zur Fülle der Freude.
Was wir an prachtvollem Wachstum in der Natur wahrnehmen, möge auch in unserem Leben spürbar werden. Und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und in der Gesellschaft. Und in der Kirche. Und daß ich es nur nicht vergesse bei den vielen Begegnungen am Sudetendeutschen Tag. Auch dort wirkt der Geist von oben. Da bin ich mir sicher!
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de 21/2023
der SL-Landesgruppe Bayern im Bad Reichenhaller Alten Rathaus.
❯ SL-Landesgruppe Bayern und SL-Kreisgruppe Berchtesgadener Land
Die erste gemeinsame Tagung
Unter der Schirmherrschaft der oberbayerischen Stadt Bad Reichenhall tagte Mitte Mai der Vorstand der SL-Landesgruppe Bayern erstmals mit der SLKreisgruppe Berchtesgadener Land und der SL-Ortsgruppe Bad Reichenhall im Alten Rathaus in Bad Reichenhall.
Oberbürgermeister Christoph Lung betonte in seinem Grußwort, daß Bad Reichenhall 1945 und 1946 bei damals 12 000 Einwohnern zusätzlich 6000 Geflüchtete aufgenommen habe. Das sei heute, auch angesichts der zuvor erfolgten Bombardierung der Stadt, eine kaum vorzustellende Leistung. In vielen Zimmern hätten drei und mehr Personen Platz finden müssen. „Rückblikkend ein gelungenes Beispiel für Integration, haben sich doch die Stadtbevölkerung und die Geflüchteten gemeinsam am Aufbauwerk beteiligt und durch viele Vereins-, Kulturstättenund Firmengründungen, die auf sudetendeutsche Initiativen zurückzuführen sind, die Stadt dazu gemacht, was sie heute ist –ein attraktives Bad Reichenhall.“ Kreisobmann Bernhard Lerner freute sich in seiner Begrüßung, daß die Stadt sich sofort bereit erklärt habe, das Treffen zu unterstützen, und dankte Lung für die Gastfreundschaft. Die SL-Landesgruppe Bayern, unter Landesobmann Steffen Hörtler eine eigenständige Gliederung in der SL, war unter anderem vertreten durch die Landeskulturreferentin Margaretha Michel, Dorith Müller, Kurt Aue von der Bezirksgruppe Schwaben, Bernhard Moder von der Bezirksgruppe Oberpfalz, Gabriele und Leonhard Schleich, Kriemhild und Dietmar Heller, Gustav Stifter, einem Nachfahren Adalbert Stifters, sowie Geschäftsstellenmit-
Am 13. Mai starb Jana Outratová, die Ehefrau des früheren Vizepräsidenten des tschechischen Senats, Edvard Outrata, nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren in Prag. Peter Barton, der Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, erinnert sich ihrer.


Zum ersten Mal begegnete ich ihr am 20. November 2005, als eine tschechische Delegation von Senatoren der oberen Kammer des tschechischen Parlaments das Sudetendeutsche Haus in München besuchte. Es war der erste offizielle Besuch tschechischer Politiker in dieser Einrichtung,




arbeiter Andreas Schmalcz. Neben seinem gesamten Kreisvorstand durfte Lerner mit Ingelore Kienzler auch eine Vertreterin des Schlesiervereins begrüßen.
Steffen Hörtler, der auch Stellvertretender Bundesvorsitzender, Stiftungsdirektor der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk und Leiter der sudetendeutschen Bildungsund Begegnungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen ist, betonte in seinem heimatpolitischen Bericht die Notwendigkeit, die Gesprächsfäden in Politik, Gesellschaft und in die tschechische Republik nicht abreißen zu las-
Sudetendeutschen Tag, der an Pfingsten in Regensburg stattfinde, mit Bildungsminister Mikuláš Bek, zuvor Europaminister, auch ein Vertreter der tschechischen Regierung kommen. Seit einigen Jahren finde der TschechischDeutsche Versöhnungsmarsch in Brünn statt, heuer vom 23. bis 26. Juni.

sen. Das sei oft schwierig, gelte es doch die sudetendeutschen Interessen so zu vertreten, daß diese im Ergebnis zufriedenstellend berücksichtigt würden. Seine Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala, dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und seine Gremienarbeit, unter anderem im Rundfunkrat, hätten dies wieder sehr und teilweise auch schmerzlich verdeutlicht. Gerade weil auch die SL eine heterogene Gemeinschaft bilde, sei ein hohes Maß an Empathie notwendig. Von der Ackermann- und Seliger-Gemeinde über die Heimatgliederungen bis zu den Gebietsgliederungen seien alle politischen und gesellschaftlichen Strömungen auch bei der SL zu finden.
Kleine Erfolge gäben diesem Vorgehen Recht, so werde zum
„Wir gehen auf dem Weg, auf dem mehr als 20 000 Brünner vor 77 Jahren zur österreichischen Grenze getrieben wurden. Während arbeitsfähige Männer Zwangsarbeit leisten mußten, wurden Frauen, Kinder und Alte in diesem langen Fußmarsch vertrieben. Mindestens 1700 von ihnen erlagen den Qualen des Marsches. Wie in Brünn wird auch anderswo festgestellt, daß sich immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Tschechischen Republik der deutschen Bevölkerung erinnern und oft gemeinsam mit den Sudetendeutschen vor Ort die Gedenkund Grabstätten, die Friedhöfe und Gebäude wieder herrichten.“
Abschließend sagte Hörtler, daß die Landesdelegiertenversammlung mit der Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf dieses Jahr in Erding stattfinden werde. Dort werde man sich am 21. Juli um 10.00 Uhr am Infostand in der Innenstadt treffen.
Nach der Sitzung wurde an der Gedenktafel am Rathausplatz ein Kranz niedergelegt. „Wir erinnern damit an alle Menschen, die durch Flucht und Vertreibung ihr Leben verloren haben und auch heute noch verlieren – und das auch mitten in Europa“, sagte Landesobmann Steffen Hörtler. Der Kranz wurde später zum Vertriebenendenkmal auf dem Friedhof Sankt Zeno gebracht und kann dort noch einige Zeit betrachtet werden. dr
PERSONALIEN
❯ Freundin der Sudetendeutschen
Jana Outratová †
und ich hatte ihn gemeinsam mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Bayerischen Staatskanzlei organisiert. Der Leiter dieser Delegation, Senator Outrata, ließ sich dabei von seiner Frau Jana begleiten. Ihr großes Interesse an der sudetendeutschen Zentrale inmitten Münchens war schon damals spürbar, und sie konnte ihre Begeisterung kaum verbergen, als sie die Bibliothek des Sudetendeutschen Hau-
Tradition ist, daß der BdV-Frauenverband jährlich in ein ehemals deutsch besiedeltes Gebiet fährt, um sich mit dessen Geschichte, Kultur und Schicksal zu befassen. Heuer ging die Reise Anfang März nach Wudersch/Budaörs nahe Budapest. SL-Bundesfrauenreferentin Gerda Ott fuhr als einzige Vertreterin der SL-Frauen sowie als Beisitzerin im Vorstand des BdV-Frauenverbands mit. Sie berichtet.
Auf dem abwechslungsreichen Programm standen Vorträge, die Besichtigung und Führung durch das örtliche Jakob-BleyerHeimatmusem mit der ungarndeutschen Direktorin Kathi Gajdos-Frank, der Besuch des ungarischen Parlamentsgebäudes, des Schlosses Gödöllo, einst beliebter Aufenthaltsort Elisabeths, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, und die Teilnahme an einem katholischen, deutschsprachigen Gottesdienst in Maan/Many sowie daran anschließend eine Begegnung mit Gesprächen im Haus Leimen mit Mitgliedern der ungarndeutschen Selbstverwaltung.
Von diesem Ort Budaörs begannen am 19. Jänner 1946 die ersten Vertreibungen. Wie die Sudetendeutschen durften die Ungarndeutschen 50 Kilogramm Gepäck mitnehmen und wurden in Viehwaggons gen Westen transportiert. Viele kamen nach Baden-Württemberg. In Bretzfeld bei Heilbronn haben die Wuderscher ihr Heimatmuseum.
Ich bin froh, an dieser Fahrt teilgenommen zu haben. Dabei erfuhr ich viel über das Schicksal der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und entdeckte Parallelen zu uns Sudetendeutschen.
ses sah. Danach wurde sie zu einer überzeugten Unterstützerin des Sudetendeutschen Büros in Prag und zu einer persönlichen Freundin.
Sie fehlte an keinem Sudetendeutschen Tag, und ihr Engagement hat mit Sicherheit dazu beigetragen, daß auch ihr Ehemann ein großer Freund der Sudetendeutschen Botschaft an der Moldau
wurde. Vor etwa einem Monat begegnete ich Jana in der Stadt, sie war unterwegs zu einer Ausstellung, eine ihrer Leidenschaften. Dank ihres langen Aufenthalts in Kanada nach der Zerschlagung des Prager Frühlings gewann sie eine weltoffene Einstellung zum öffentlichen Leben und der ganzen Welt. Sie half mir auch mit der Vermittlung persönlicher Kontakte zu den meisten Botschaften in Prag. Am 23. Mai nahmen wir in der Kapelle der Borromäerinnen in Prag-Řepy Abschied von ihr. Jana Outratová wird uns allen sehr fehlen.
Die Marienbader Gespräche des Sudetendeutschen Rates (SR) widmeten sich Anfang Mai „Tschechen und Sudetendeutschen sowie europäischen Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien“. Hier der zweite Teil des Berichts von Nadira Hurnaus.
Jakub Štědroň ist seit zwölf Jahren Direktor des seit 2007 existierenden Hauses der nationalen Minderheiten nahe des Prager Wenzelsplatzes. Neben einer Bibliothek, deren Bücher zur Hälfte deutsche Bücher sind, einem großen Saal, einer Galerie und mehreren Lehrsälen gewährt es jeder der 14 anerkannten Minderheiten zwei Büros und bietet ein multikulturelles Programm. In dem Haus, so Štědroň, seien 30 Organisationen tätig. Dazu zählten die Landesversammlung der deutschen Vereine in der ČR und der Kulturverband. Diese seien das Herz des deutschen Lebens in Prag. Heute bekennten sich 400 000 Menschen oder 0,6 Prozent zur deutschen Minderheit.

Zu den großen Minderheiten gehörten Russen und Ukrainer. Die Russen seien putinkritisch, ihre Vorfahren seien vor den Bolschewiki in die Tschechoslowakei geflohen. Bewegt berichtete Štědroň von der spontanen und andauernden Hilfe des Hauses für die Kriegopfer in der Ukraine und die geflohenen Urkainer. Das Haus sei zu einem Zentrum für humanitäre Hilfe geworden, die zahlreichen Freiwilligen seien froh, helfen zu können. Natürlich habe man Probleme, aber: „Das Leben ist nicht einfach, aber wunderbar.“
Unser Berlin-Korrespondent
Ulrich Miksch sprach mit Tomáš Lindner, Redakteur der tschechischen Wochenzeitung „Respekt“, mit Robert Schuster von der konservativen tschechischen Tageszeitung „Lidové noviny“ und mit Thomas Scharnagl, Leiter „Newsdesk“ von „Frankenpost“, „Nordbayerischer Kurier“ und „Neue Presse“, über Tschechen und Sudetendeutsche im Spiegel der Medien.


Am vertrautesten mit der Materie war Lindner, der in einer deutschsprachigen Familie in Bärringen im Böhmischen Erzgebirge aufgewachsen war und 2016 den Johnny-Klein-Preis für deutsch-tschechische Verständigung erhalten hatte. Er konstatierte, daß Deutschland für die Tschechen vor allem eine große Autobahn zu schönen Zielen sei. Kürzlich habe er eine Reportage über Kebab in Berlin gemacht, um den Landsleuten den Nachbarn näherzubringen.
Schuster, der das wunderbare Prager Deutsch spricht, hatte wenige Tage zuvor ein Interview mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt geführt. Die Jungen, so Schuster, fragten sich, warum man überhaupt erwähnen müsse, daß Posselt Sudetendeutscher sei. Seit dem EU-Beitritt
❯
Im Anfang war das Wort
und der Deutsch-Tschechischen Erklärung schwänden die sudetendeutsch-tschechischen Probleme, damit verschwinde aber auch die Berichterstattung über die kleinen Dinge wie über die Wallfahrten.
Scharnagel räumte ein, daß nur bei Großereignissen wie Wahlen oder über die Energiepolitik berichtet werde. Nach dem Mauerfall sei das Interesse zwar groß gewesen. Auch er sei damals regelmäßig und neugierig ins Nachbarland geradelt. Er sei
schen Vereine in der Tschechischen Republik, informierte über die Geschichte der deutschen Minderheit. Sie habe nach dem Prager Frühling mit der Gründung des Kulturverbandes begonnen. Nach der Samtenen Revolution habe Horst Löffler, Obmann der SL-Landesgruppe Baden-Württemberg und engagierter Böhmerwäldler, den Verbliebenen geholfen, einen Verband aufzubauen.
1994 bis 2004 sei die deutsche „Prager Volkszeitung“ und nach
ke/Most-Stiftung. Studiert hatte er unter anderem Politikwissenschaft in Brünn beim jetzigen tschechischen Premier Petr Fiala. Er sprach über „Zwischen Abwicklung und Zeitenwende. Mittel- und Osteuropa in der politischen Bildung“.
Die „Imperiale Ideologie“ habe im 18. Jahrhundert mit der großen Öffnung nach Westen unter Peter dem Großen begonnen. Parallel dazu sei Rußland die Hegemonialmacht in Ostund Mitteleuropa einschließlich der Inkorporierung der Ukraine geworden. Das Zusammenspiel von Berlin und Rußland habe sehr geholfen. Das Menetekel für die Aufklärung sei die Teilung Polens gewesen.
in Mähring aufgewachen. Dort habe er als Kind die einst großen Heimattreffen der Plan-Weseritzer erlebt. Da der Ort keine Hotels gehabt habe, seien die Kinderzimmer geräumt und vermietet worden. Mittlerweile sei das Treffen sogar grenzüberschreitend, aber die Teilnehmerschar recht überschaubar. Ebenso überschaubar sei die grenzüberschreitende Berichterstattung.
Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der deut-







Gründung der Landesversammlung der „Landesanzeiger“ als Teil der „Prager Volkszeitung“ erschienen. Das aktuelle Organ sei das „Landesecho“. Die Landesversammlung habe gegenwärtig 8500, der Kulturverbandes 1500 Mitglieder. Ziele seien die Pflege der Muttersprache und des deutschen Kulturgutes. Die Landesversammlung sei Träger der Grundschule für deutschtschechische Verständigung und des Thomas-Mann-Gymnasiums in Prag.
Gegenwärtig bereite man die Konferenz „Identität und ihre Bedeutung für die Nationalitäten“ mit in- und ausländischen Gästen aus Politik und Wissenschaft unter der Schirmherrschaft des tschechischen Außenministeriums vor.
Im September würden die konkreten Ergebnisse vorgestellt.
Und am 27. November werde wieder der Johnny-Klein-Preis in Mährisch Schönberg verliehen. Außerdem sei der von ihm, Dzingel, vor 25 Jahren gegründete Jugendverband JUKON nach zwei Coronajahren wiederbelebt worden.
Daniel Kraft ist Leiter der Stabsstelle Kommunikation der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) in Bonn. Zuvor war er bei der Brük-
Als das 1957 gegründete Ostkolleg der BpB 2004 aufgelöst worden sei, so Kraft, sei Osteuropa zu einem weißen Fleck geworden. Erst im Mai 2022, nachdem Rußland die Ukraine angegriffen habe, habe die BpB die Projektgruppe Mittel-, Ost- und Südosteuropa (PG MOE) mit fünf Referenten eingerichtet. MOE sei digital erfahrbar bei einer Politikstunde auf YouTube und einem Videoglossar über die Ukraine. „Go East“ seien virtuelle BpB-Studienreisen wie von Hamburg nach Charkiw. Analoge Studiereisen führten seit 2001 nach Mittel-OstEuropa. Die Bundeszentrale sei 1952 gegründet worden und habe heute mehr als 300 Mitarbeiter. Ihren Präsidenten unterstützten ein zwölfköpfiger wissenschaftlicher Beirat und ein Kuratorium aus 22 Bundestagsabgeordneten. Bei der Busreise durch Deutschland anläßlich ihres 70. Geburtstages habe man auch den Heiligenhof besucht. Dieser gehöre nämlich zu den 105 Bildungsträgern, die die BpB fördere.
Die sechsjährige Natalie Pawlik wurde 1998 mit ihrer Familie als Rußlanddeutsche aus dem Ural ausgesiedelt. 2021 zog sie in den Bundestag ein, und 2022 wurde sie Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Deshalb war ein Schwerpunkt ihrer Rede die russische Desinformation. „Sie versuchen uns zu spalten, damit wir uns nicht gegen sie verbünden.“ Rußland säe Zweifel, schüre Ängste und habe nicht zuletzt die Aussiedler im Visier. Deshalb wolle sie auch deren Widerstandsfähigkeit stärken. Die Medien sollten aber ebenfalls die Verbliebenen gut darstellen, gleichzeitig sollten diese selber Öffentlichkeitsarbeit leisten. Das Bundesinnenministerium unterstütze dies, Beispiele seien das „Wochenblatt“ in Polen und das „Landesecho“ in der Tschechischen Republik. In Serbien unterstütze man das Videoprojekt „In der
Küche unserer Omis“ der Donauschwaben und im historischen Egerland die Marienbader Gespräche der Sudetendeutschen. Die seien ein Paradebeispiel für Völkerverständigung. „Danke für dieses außerordentliche Engagement.“
„Nicht alle haben sich in Putin getäuscht“, begann der Historiker Martin Schulze Wessel seinen Vortrag „Putins Medienkrieg gegen die eigene Bevölkerung“. Doch viele hätten tagespolitisch gedacht und Putin Motive unterstellt, die er nicht gehabt habe. Selbst das Militär sei überrascht gewesen, überrascht von den genozidalen Absichten Rußlands und dem Verteidigungswillen der Ukraine. Das gehe über Putin und Selenskyj hinaus, sei aber ohne Putins missionarischen Eifer und Selenskyjs Charisma nicht möglich.
Wolodymyr Selenskyj stütze seine Politik auf die Gesellschaft, auf demokratische Ideen. Er habe trotz ruchloser machthungiger Politiker eine relative Pressefreiheit durchgesetzt. In Rußland

Im 19. Jahrhundert hätten sich die Gegensätze Demokratie und Nationalismus entwickelt. In Rußland seien Orthodoxie, Autokratie und Nationalismus in eine Sackgasse gemündet. Rußland habe die Ukraine und Polen als die größte Gefahr empfunden. Dieses Gefühl herrsche heute wieder. Ein russischer Minister habe gesagt: „Ukraine und Polen handeln als verlängerter Arm des Westens.“ „Die russische Politik denkt geopolitisch“, schloß Schulze Wessel. Volksgruppensprecher Bernd Posselt war der letzte Referent und legte seinen Schwerpunkt auf das letzte Wort des Seminarthemas. Und das lautete „Medien“. Medien seien Kommunikationsmittel. Und das älteste Kommunikationsmittel sei die Sprache. „Im Anfang war das Wort“, beginne das Evangelium von Johannes, das die Bedeutung der Sprache manifestiere. Vorbild für das Neuhochdeutsche sei das von Johannes von Neumarkt in der Kanzlei Karls IV. verwendete Deutsch gewesen. Kaiser Karl habe Latein, Deutsch, Tschechisch, Französisch und Italienisch gesprochen. Sein Reich sei ein Vielvölkerstaat gewesen, in dem Sprache wichtig gewesen sei. Und dann – endlich –erzählte Posselt eine Anekdote des Prager Journalisten und jüdischen Sprachakrobaten Anton Kuh [1890–1941]: „Ein Schmock kommt mit klirrenden Sporen an den Hosenbeinen seiner feschen Uniform ins Kaffeehaus. Kuh: ,Ich hab‘ auch kein Pferd, aber so kein Pferd wie der hab‘ ich nicht.‘“ Der aus dem nordostböhmischen Jitschin stammende Wiener Karl Kraus habe „Nicht Lügen“ und „Gutes Deutsch“ als Prinzipien für Journalisten postuliert. Kraus habe auch gesagt: „Nichts unterscheidet Deutsche und Österreicher so wie die Muttersprache.“ Begriffe veränderten mit der Zeit ihre Bedeutung. Heimat sei eine Zeitlang in die Rubrik „Blut und Boden“ eingeordnet worden. Das habe sich mittlerweile verändert. „Wir wollen kein supranationales Europa“, sagte Posselt, sondern die vom tschechischen Dichterpräsidenten Václav Havel geforderte „Heimat der Heimaten“.
habe das Unterdrücken von Konflikten den Präsidenten gestärkt. Das Land leide am beginnenden Fluch des Imperiums.
Zu allerguterletzt charmierte Christa Naaß, SR-Generalsekretärin, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung und Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, mit einem Schlußwort und verkündete: „Die SR-Plenarsitzung 2024 findet am Samstag, 13. Januar, und die Marienbader Gespräche von Freitag, 11. Oktober bis Sonntag, 13. Oktober 2024 statt.

Direkt vor dem Sudetendeutschen Tag liest Peter Becher im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg aus seinem neuen Roman „Unter dem Steinernen Meer“. Hier stellt der Historiker Otfrid Pustejovsky das Buch vor.
Peter Bechers Buch „Unter dem Steinernen Meer“ ist ein politischer Familien- und Gesellschaftsroman und doch gleichzeitig auch ein Heimatroman der ganz anderen Art: Blick in die engumgrenzte Böhmerwaldlandschaft zwischen den Grenzen und Sicht auf die „große Welt“ – Elemente Adalbert Stifterscher Landschaftsbeschreibung und Streitpunkte altneuen Nationalismus vor und nach der Zeit des Eisernen Vorhangs, der weltpolitischen Trennungslinie eines halben Jahrhunderts und nochmals weiter zurück in die Nationalismen der Zwischenkiegszeit 1918 bis 1933 und deren Erblast aus dem 19. Jahrhundert.

Peter Becher (* 1952) ist deutsches und tschechisches

PEN-Mitglied und Angehöriger der zweiten Nach-Weltkriegsgeneration.
Politischer Familienroman
Konfrontiert mit dem ambivalenten Vater-Erbe unaufgearbeiteter persönlicher Lebenserfahrungen im Pendelschlag zwischen unterstellter Geschichtslosigkeit und bewußter politischer Eigenentscheidung der Nach-Vertriebenen-Jugend – also Sudetendeutschtum und deutscher Internationalität –, schrieb Becher einen Roman mit „Grenzerfahrungen“, die dem Österreicher, dem ehemaligen Sudetendeutschen und dem Tschechen verständlicher sein können als etwa einem Hannoveraner, Kieler oder vielleicht auch Saarländer.
Mit schwungvoll-leichter Feder führt der Autor, intimer Kenner (sudeten-)deutsch-tschechisch-österreichischer Ambivalenzen und geschichtsbewußter Zeitbeobachter, durch die Untiefen und über die Höhenrücken sozialer, generationsbestimmter nationaler Urteile, Fehlurteile, Vorurteile eines durch die Jahr-
Vor 100 Jahren fand die erste Singwoche von Walther Hensel in Falkenstein bei Mährisch Trübau im Schönhengstgau statt.

Genau vor einhundert Jahren hatten Walther Hensel und seine Frau Olga die Idee, eine ganze Woche dem Singen von Volksliedern zu widmen.
Walther Hensel war 1887 als Julius Janiczek in Mährisch Trübau zur Welt gekommen. Sein
Vater Josef Janiczek entstammte einem deutschen Bauerngeschlecht in Weißstätten an der Thaya in Südmähren. Die Mutter
Theresia Hlawatsch stammte aus dem Dorf Langenlutsch bei Mährisch Trübau im Schönhengstgau.
� Blick hinter die Kulissen österreichisch-tschechisch-(sudeten)deutscher Irrungen und Verwirrungen
Unter dem steinernen Meer
hunderte geschichtlich gewachsenen Raumes, der jedoch im 20. Jahrhundert innerhalb dreier
der Andreas zwischen München und Weiz zu, um dann wieder im „Mai 1991“ nach einer lan-
Im literarischen Gewand des Diskurses läßt Becher die Komplexitäten tschechisch(sudeten-)deutscher Vorstellungen und politischer Realität Revue passieren. So wird der politisch unvoreingenommene, literarisch interessierte Leser nolens volens in die Unaufgearbeitetheiten im Herzen Europa hineingezogen.
Rückblende in die Vergangenheit: Sudetendeutsche Jungen haben den Tschechen deren Turnerbund-Identifikationsfahne geklaut, denn die „hatten ihr Zelt unbewacht zurückgelassen ... Tschechen halt“. Doch diese holen dann im Gegenzug die deutsche Turnerfahne. Und: „So war das damals, im Spätsommer 1935.“
jüdischen Freunde? „Die Juden waren gesichtslos geworden Sollte jetzt auch Budweis eine judenfreie Stadt werden?... Wen soll ich retten?... Und was kann ich da machen?“
dergibt.
Immer wieder geschickt auch das tschechische Idiom fehlerfrei einsetzend, durchsetzt der Autor in zahlreichen Dialogszenarien die politische Irrationalität der vorherigen Generationen: „Die Erinnerungen?... Sie lassen uns nicht in Ruhe.“
Generationen mehrfach zwangsgeteilt worden ist und immer wieder aus Heimatverbundenen Heimat-„Lose“ werden ließ und damit gleichsam zum Paradigma des „geworfenen Menschen“ wurde, der stets Heimat suchte, doch sich als Fremdling wiederfand.
Es ist auch ein Roman, der nach 1990 europaweit möglich gewordenen Wiederbegegnung zweier ehemaliger Freunde aus der Zwischenkriegszeit, des (sudeten-)deutschen Arztes Karl Tomaschek und des tschechischen Ingenieurs Jan Hadrava, und ihrer eine Nacht langen dialogischen Auseinandersetzung mit der eigenen und des anderen Jugend, mit Schuld und Un-Schuld, mit Glaube und Ideologie, Erinnerung und Vergessen, Verdrängen und Wiederbesinnen.
Alles beginnt im Mai 1991 mit dem Tod eines Bergwanderers, des alten Arztes Karl Tomaschek, in der Nacht zum 1. Mai 1991 im steirischen Gebirgsland, setzt sich fort im „Juli 1990“ – so heißen die Kapitel – mit dem einst im Streit von daheim geschiedenen Sohn Thomas in Wien, wendet sich sodann dem Bru-

gen „Wanderung in die Vergangenheit“ zwischen den zufällig wieder aufeinander getroffenen Freund-Feind-Freunden ab dem „Juli 1990“ weit zurück ins (sudeten-)deutsch-tschechisch-österreichische Mit-, Neben- und Gegeneinander auf- und durchzubrechen, doch schließlich in der Beerdigung des alten Tomaschek zu enden.
Altbinnendeutsches Denken wird hier konfrontiert mit den Ambivalenzen der so vielfältigen Erfahrungen, Denkkategorien und Lebenswirklichkeiten jenseits der doch nicht erst seit 1815 schwankenden „Grenzen“.
Im weit ausholenden Kapitel „Juli 1990“ läßt Becher in sechs literarisch begrenzten Abschnitten alte Freund-Feinschaften innerhalb national eingegrenzter Jugendgruppierungen und deren Protagonisten und transnationaler Ausbrüche aufscheinen; Verdächtigungen, Unterstellungen, Anfeindungen, Versöhnungsgesten bestimmen lange Reflexions-Zwie-Diskurse von verbaler bis physischer Gewalt, Glauben und Ideologie, Befreiungsphantasien bis Zwangsrealitäten.

� Jubliäum mit Feier auf dem Heiligenhof
Dann der Krieg: „Der Apotheker eingezogen…, 1940 in Frankreich gefallen…, Czerny war 1945 in Prag ums Leben gekommen…, Ossi aber, der den Budweiser HJ-Bann übernommen und schließlich zur SA gegangen war, der immer höher und höher gestiegen und während des ganzen Krieges unabkömmlich war, hatte sich rechtzeitig vor Kriegsende zu den Amerikanern abgesetzt.“
Aus der Generation der Nachgeborenen
Autor Becher verwendet immer wieder Vornamen der seinerzeitigen Jugendlichen, die durchaus Assoziationen an manche Funktionäre der Sudetendeutschen Landsmannschaft nach 1950 wecken. Dann wiederum der Retroblick auf die Olympiade 1936: „Gustl Berauer ein Sudetendeutscher! ... unsere Läufer natürlich, Cyril Musil, der beste von allen, rief Jan. Tschechoslowaken, alle beide.“
Doch weiter: Namen als ethnische Identifizierung: „Czerny, der sich jetzt Schwarzmann nannte …“, ein vielfach anzutreffendes Faktum bei den verschiedenen Vertreibungsgruppen. Und die
Becher läßt eigentlich kein Problem der so zahlreichen deutsch-tschechischen jahrzehntelang tabuisierten oder wie auch immer ideologisch bis nationalistisch aufgeladenen Streitpunkte aus. Immer wieder flicht er geschickt und passend Teile tschechischer Wortwendungen und Volkslieder im Original mit folgender deutscher Version ein –einschließlich der notwendigen Háčeks, der diakritischen Zeichen, die zum Beispiel aus einem s mit š ein deutsches sch machen und aus einem c dann ein č, das wiederum dem deutschen tsch entspricht.
Dies ist ein Roman, der nicht von der theoretischen Imagination des heimischen Schreibtisches bestimmt ist, sondern vielmehr den Atem des Böhmerwaldes und der jungen Moldau atmet und mit vermittelnder Überzeugung die Großartigkeit des Budweiser Ringplatzes wie-
Im tschechisch-deutschen Wortwechsel wird das geradezu uralte Leben in Böhmen in seiner schriftlichen Wiedergabe zu neuem Leben erweckt: „Ihr habt ja keine Ahnung, nemáte tušení, keine Ahnung vom Krieg! Nevíte nic! Já jsem kapitán, krumlovský kapitán! Ich hab gekämpft, geschossen, überlebt, bojoval, střílel a přežil jsem.“ Und dann wieder der Blick in die örtliche Wirklichkeit der Zeit von 1990 und 1991: „Hatte womöglich auch er, obwohl er die nostalgischen Erinnerungen seiner Landsleute ablehnte, hatte auch er in seinem Gedächtnis eine Vergangengeit restauriert? ... Was, wenn der Eiserne Vorhang die alte Lebenswelt nicht nur abgetrennt und unzugänglich gemacht, sondern auch die Erinnerung an sie geschützt und abgeschirmt hatte?... Die Grausamkeiten, die bis zur Gegenwart ungesühnt blieben?... der verletzte Rechtsfrieden?“ Doch Erinnerung an „damals, im Sommer 1939,... in dem alles aus den Fugen geraten war...“.
Manche Nostalgien der „Gestrigen“, die Widerständigkeiten der Nachgeborenen, die Vergangenheitsträumer und Zukunftsplaner, die Familienzerrissenheiten zwischen Traum und Wirklichkeit, „Heim ins Reich“ neben Böhmerlandheimat: Peter Becher hat sie hier in den Mantel des Romans gehüllt, die Zerrissenheit der Menschen durch die Figuren der Tomascheks und Hadravas aus dem so komplexen mitteleuropäischen Raum Tschechoslowakei, Sudetenland und Böhmische Länder aufs Neue gezeigt und ins ungewohnte gesellschaftliche Bewußtsein gerückt – schmerzhaft und befreiend zugleich. Solch einen Roman zu schreiben, vermag nur die Generation der Nachgeborenen, doch mit dem erworbenen, soliden Wissen von Geschichte, Menschen, Orten, Brüchen, Geschehnissen. Das ist Peter Becher gelungen.
100 Jahre Finkensteiner Singen
Walther Hensel studierte in Prag und Wien alte Sprachen, Französisch, Germanistik und Musik, vor allem Gregorianik. 1911 wurde er an der Universität Freiburg in der Schweiz zum Dr. phil. mit der Dissertation „Der Vokalismus der Mundarten in der Schönhengster Sprachinsel“ promoviert. Nach Prag zurückgekehrt, wirkte er als Lehrer für neuere Sprachen an der dortigen Deutschen Handelsakademie.
Das entscheidende Erlebnis der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg war der „Zupfgeigenhansl“ von Hans Breuer. Das Liederbuch leitete nach Johann Gottfried Herders (1744–1803) und der Romantiker literarischer Volksliedentdeckung und nach Ludwig Uhlands wissenschaftlicher Volksliedforschung die dritte Volkslied-Renaissance ein: die Wiedergeburt des Volksliedsingens als leben- und gemeinschaftsformendes Tun.
Nach der Gründung der Tschechoslowakei 1919 wurde es für die deutsche Bevölkerung
zunehmend schwieriger, ihr angestammtes und über Jahrhunderte gewachsenes Brauchtum zu leben. In dieser Zeit wurde also in der kleinen Waldsiedlung Finkenstein bei Mährisch Trübau zur Singwoche eingeladen. Mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer folgten dem Ruf, vor allem aus dem Kreis der Wandervogelbewegung.
Nach dieser Singwoche folgten hunderte von ähnlichen Wochen in ganz Deutschland und im europäischen Ausland. Ein Teilnehmer der ersten Singwo-
che war Karl Vötterle. Er hatte zusammen mit Walther Hensel die Idee, ein monatlich erscheinendes Liedblatt herauszugeben, damit auch die unzähligen Singgemeinden, die gegründet wurden, Singstoff für ihre Übungsabende hatten. So wurde mit den „Finkensteiner Blättern“ der Grundstein gelegt für die Gründung des Bärenreiter-Verlags von Karl Vötterle. Insgesamt zehn Jahrgänge von 1923 bis 1933 umfaßt das Finkensteiner Liederbuch.
Fünf Jahre nach Hensels Tod am 5. September 1956 in München wurde 1961 die Walther-HenselGesellschaft gegründet, die sich das Ziel setzte, die Singarbeit fortzuführen. So wurden seither mit großem Erfolg mehr als 150 Singwochen durchgeführt.
Diese Wochen fanden vor allem in Süddeutschland, aber auch
als Singfahrten in ehemals deutsche Siedlungsgebiete oder als Almsingwochen in Österreich mit Hermann Derschmidt oder in Brandenburg statt, allein nahezu 50 davon auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Natürlich wurde neben dem Singen von zumeist deutschen Volksliedern auch gewandert, gebastelt und in verschiedenen Gruppen musiziert. Der Volkstanz spielte und spielt dabei eine wichtige Rolle.
Herbert Preisenhammer Sonntag, 30. Juli bis Sonntag, 6. August: Gedenksingwoche auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Anmeldung per eMail post@ walther-hensel-gesellschaft.de oder Info über Internet https:// walther-hensel-gesellschaft.de.
� SL-KG Königsbrunn
Der Tag der Mütter
Die Muttertagsfeier der bayerisch-schwäbischen SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld fand im Wehringer Fischerheim statt.

Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger lobte die Aktivitäten der SL in Wehringen und Königsbrunn. Kurt Aue, Vorstandsmitglied der SL-Landesgruppe Bayern, Obmann der SL-Kreisgruppe Augsburg-Land und Obmann der SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Lechfeld ging auf das Leid ein, das vor allem die Mütter bei Flucht und Vertreibung bei allen Kriegen der Welt erleiden.

Mit Mundartgedichten aus der Heimat erfreute Mundartdichter Leo Schön die zahlreichen Besucher. Diese freuten sich auch über Uli Egger, Musiker und Ehrenbürger von Wehringen, der mit Liederbüchlein alle zum Volksliedersingen animierte. Aue dankte Helga Aue sowie den Stellvertretenden
Ortsobfrauen Kriemhilde Bergmann und Christa Eichler fürs Backen der guten Kuchen und den guten Service. Untermeitingens Zweiter Bürgermeister Manfred Salz lobte die Gäste.



� BdV-KV Odenwald Andacht
auf dem Engelberg
Anfang Mai feierte der hessische BdV-Kreisverband Odenwald mit dem unterfränkischen BdV-Kreisverband MiltenbergObernburg eine fränkisch-sudetendeutsch-schlesische Maiandacht in der Wallfahrtskirche auf dem Engelberg im unterfränkischen Großheubach.
Nach längerer Corona-Pause konnten wir heuer wieder eine Maiandacht mit Franziskanerpater Dietmar Brüggemann feiern. Pater Dietmar ist seit einem guten halben Jahr Guardian im Kloster Engelberg. Beim anschließenden musikalisch-poetischen Ausklang sang der Amorbacher Dreigesang Lieder aus Oberbayern, der Steiermark und Südböhmen sowie zwei Weisen von Anton Günther, dem sudetendeutschen Volksdichter und Sänger des Erzgebirges.
Norbert Kurek sorgte an der Orgel mit Alfred Kipplinger am Akkordeon für die instrumentale Umrahmung. Nach einem gemeinsamen Schlußlied fand der Ausklang im Biergarten der Klosterschänke statt.
� SL-Altkreisgruppe Nordvorpommern/Mecklenburg-Vorpommern

Gebirgler an der See
Mitte April traf sich die mecklenburg-vorpommersche SL-Altkreisgruppe Nordvorpommern im neuen BGZ Ehrenamt in Ribnitz-Damgarten.
In dem dortigen Kaffe erwartete uns eine ansprechende Kaffeetafel mit selbst gebackener Torte. Und wieder gingen unsere Gedanken von der Ostsee, wo wir eine neue Existenz gefunden hatten, zurück in die Heimat. Dabei zeigte sich für einige Riesengebirgler auch eine gewisse Übereinstimmung: zu Hause waren es die Wintersportler, hier sind es nun die Badegäste. Heute sind sie in modernen Hotels oder Ferienwohnungen untergebracht, zu DDR-Zeiten anfangs oft in privaten Wohnoder Schlafzimmern, die Vermie-
ter hausten im Sommer in umgewidmeten Abstellkammern. Natürlich gab es später auch moderne Ferienheime des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds (FDGB). Doch diese Plätze waren in den großen Kombinaten nur beschränkt verfügbar und wurden nach „gesellschaftlichen“ Gesichtspunkten vergeben. Aber es gab auch private Stammgäste wie Riesengebirgler aus Thüringen oder Sachsen bei Riesengebirglern an der Ostseeküste. Natürlich sprachen wir auch über den seit einem Jahr währenden und von Wladimir Putin entfachten Ukraine-Krieg. Erinne-
� SL-Ortsgruppe Warmensteinach/Oberfranken
rungen wurden wach. Zwar war unsere engere Heimat von den eigentlichen Kriegsgeschehnisse verschont geblieben. Doch was nach Kriegsende folgte, war ebenso erschreckend und ist hinlänglich bekannt
Und natürlich waren auch das Ende der „Riesengebirgsheimat“ sowie anderer Heimatzeitungen beim Preußler-Verlag in der jahrzehntelang gewohnten Form und deren neue Gestaltung in der SdZ sowie die neue Redaktion der „Riesengebirgsheimat“ ein Thema. Aber auch die andere neue Variante in gewohnter Gestaltung mit dem Mantel „Böhmische Heimat“ und jeweils zwei Heimatzeitungen aus Kaaden und Erzgebirge oder Komotau und Graslitz im Innern wurden diskutiert.
Peter BarthVorstand hat neues Mitglied



Mitte Mai traf sich der Vorstand der oberfränkischen SLOrtsgruppe Warmensteinach zu einer außerordentlichen Sitzung bei Familie Hempel. Einziger Programmpunkt war die Nachwahl des Stellvertretenden Ortsobmannes.
Da seit dem Tod der Stellvertretenden Ortsobfrau Maria Seidel vor zwei Jahren dieses Amt verwaist war, war es das Bestreben des Obmannes Helmut Hempel, diesen Posten wieder neu zu besetzen. Albrecht Schweingel zog 2015 nach Warmensteinach, 2018 wurde er Mitglied der SL-Ortsgruppe, nimmt regelmäßig an ihren Zusammenkünften teil und stellt sich auch als unentgeltlicher Taxifahrer
immer wieder zur Verfügung. Schweingel ist in Creußen geboren, hat aber Egerländer Wurzeln und ist ein Urgestein der SdJ-Bezirksgruppe Oberfranken. Nachdem sie schon öfters gemeinsame Veranstaltungen be-
� DBB-Heimatgruppe Ellwangen
sucht hatten, sah Obmann Hempel in ihm die geeignete Person für den Posten als Stellvertretender Ortsobman. Auf Befragen der teilnehmenden Vorstandsmitglieder nahm Schweingel die Wahl an. Damit ist der Vorstand der SL-Ortsgruppe Warmensteinach wieder komplett.

Als Zeichen der Ortszugehörigkeit zu Warmensteinach überreichte Hempel noch die von Vorstandsmitglied Hansjörg Nigrin gespendete Gedenkmünze „600 Jahre Warmensteinach“ mit Wappen der Gemeinde.
Im Anschluß wurde noch über die Busfahrt zum Sudetendeutschen Tag nach Regensburg am Pfingstsonntag gesprochen, die die SL-Kreisgruppe Bayreuth organisiert. tl

Vorstand erkundet Museum
Um sich ein Bild vom Sudetendeutschen Museum zu machen, besuchte Claudia Beikircher, Erste Vorsitzende der Heimatgruppe Ellwangen des Deutschen Böhmerwaldbundes (DBB), mit ihrem Vorstand Mitte April das Museum in München.
Auch dabei war Franz Josef Grill, Stadtrat und Zweiter Vorsitzender der DBB-Heimatgruppe Ellwangen. Im Herbst möchte der Vorstand allen Mitgliedern der Heimatgruppe sowie allen Ellwangern eine gemeinsame Fahrt zum Museum

anbieten. Nach einer aufschlußreichen Führung und Pause konnte jeder noch einmal für sich das Museum in Augenschein nehmen.
Die Information über den Brauch der Totenbretter war für viele neu. Die Toten wurden zu Hause auf einem Brett aufgebahrt, bevor sie beerdigt wurden. Zur Erinnerung an den Verstorbenen wurden die Bretter dann am Wegrand aufgestellt. Dieser Brauch war im 19. Jahrhundert im gesamten bairischen und alemannischen Raum verbreitet.
In der Kronacher Sankt-Johannes-der-Täufer-Kirche mit Diakon KarlWerner Goldhammer und Bezirksobfrau Margaretha Michel.
� SL-Orts- und -Kreisgruppe Bayreuth/Oberfranken
Maiandacht und Autorenlesung



Mitte Mai besuchte die oberfränkische SL-Kreisgruppe Bayreuth mit ihrer Ortsgruppe Bayreuth die Heimatstube von Podersam und Jechnitz in Kronach und feierte in der dortigen katholischen Stadtpfarrkirche Sankt Johannes der Täufer eine Maiandacht. Wenige Tage später veranstaltete die oberfränkische SL-Ortsgruppe Bayreuth die Tina-Stroheker-Lesung „Hana oder das Böhmische Geschenk. Ein Album“.

Die interessante und kurzweilig Busfahrt in die Lucas-Cranach-Stadt Kronach hatte Oberfrankens SL-Bezirksobfrau und Bayreuths SLKreisofrau Margaretha Michel vorbereitet. Die Patenstadt Kronach stellt den einstigen Bewohnern des westböhmischen Landkreises Podersam, der in die Gerichtsbezirke Podersam und Jechnitz gegliedert war, drei Räume für eine Heimatstube zur Verfügung. Das Fiedlerhaus, ein aus dem 17. Jahrhundert stammendes Gebäude in der Oberen Stadt, wurde 1986 restauriert und den Heimatvertriebenen zur Nutzung übergeben.
teil des Kirchenjahres. Dies drückt sich in zahlreichen Marienliedern aus. So erklangen auch bei dieser Maienandacht die Lieder „Segne du, Maria“, „Meerstern, ich dich grüße“, „Maria, Maienkönigin“, „Milde Königin, gedenke“ und „Leise sinkt der Abend nieder“.
Auch in Bayreuth ist Tina Stroheker angekommen. Auf Einladung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft in Bayreuth las sie aus ihrem neuen Buch „Hana oder Das böhmische Geschenk. Ein Album“.
Caroline Hasenberger, mit Grill gleichberechtigte Zweite Vorsitzende, war begeistert von der technischen Ausgestaltung wie dem Ortslexikon oder dem interaktiven Heimatatlas. Auf einem großen Bildschirm könne man mit Berühren ganz einfach weitere Informationen über die Heimatlandschaften aufrufen.
Beim abendlichen Ausklang in einer Münchener Gaststätte wurden die persönlichen Eindrücke ausgetauscht und die zukünftige Fahrt geplant.
Martin JanuschkoDer Besuch in Kronach war ein gelungener Gang in die Geschichte von Podersam und Jechnitz, einer Nachbargemeinde von Saaz im weltweit bedeutenden Hopfenanbaugebiet von Böhmen. Schier unerschöpflich ist der Fundus an persönlichen Erinnerungsstücken und macht die Vergangenheit lebendig und erfahrbar. Urkunden, Landkarten, Bilder, sakrale Gegenstände, bäuerliches Handwerkszeug, Nachbildungen von Kulturdenkmalen, Trachten, Wäsche, Münzen und Archivalien sowie vieles andere mehr.
Eine Fundgrube für Erinnerungen. Kaum Platz für weitere Ergänzungen. Uta Bräuer baute die Heimatstube mit auf und verwaltet sie als Betreuerin mit hohem Sachverstand. Unermüdlich hält sie sie in Schwung. Ein breites Netzwerk an Verbindungen hüben und drüben hilft ihr dabei.
Nach dem Mittagessen hielt Diakon KarlWerner Goldhammer eine feierliche Maiandacht in der Stadtpfarrkirche Johannes der Täufer in Kronach. Maria, die Mutter Gottes, verehrt die Katholische Kirche im Monat Mai in besonderer Weise. Aus dem farbenfrohen Aufblühen der Natur in dieser Zeit ergibt sich die Mariensymbolik des Monats Mai. Auch im Sudetenland war die Marienverehrung fester Bestand-

Die Protagonistin des Buches, Hana Jüptnerová, starb 2019 mit 67 Jahren. Sie lebte im Riesengebirge und war eine ungewöhnliche Frau. Sie war Germanistin, eine mutige Dissidentin, Weggefährtin von Václav Havel, engagierte Christin und Brükkenbauerin zwischen Tschechen und Deutschen. Tina Stroheker und Hana Jüptnerová lernten sich 2015 bei einer Konferenz in der Riesengebirgsstadt Trautenau über den deutschböhmischen Schriftsteller Josef Mühlberger kennen und waren befreundet. Initialzündung war eine Kiste voller Bilder – eine Kiste voll von „Hana“. Warum die Bilder nicht zu einer Erzählung verdichten?

Mit großer Beobachtungsgabe, mit präziser Sprache und großem Einfühlungsvermögen zeichnet Tina Stroheker Hannas Leben nach und setzt ihr so ein literarisches Denkmal.
Tina Stroheker gehört zu den anerkannten deutschen Autorinnen der älteren Generation. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen und ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. Beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Regensburg wird die Sudetendeutsche Landsmannschaft sie für dieses Buch mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur und Publizistik auszeichnen.
� SL-Kreisgruppe Nürnberger Land/Mittelfranken
Novemberfeier in der Wenzelburg
Ende März fand die Jahreshauptversammlung der mittelfränkischen SL-Kreisgruppe Nürnberger Land statt.
Kreisobmann Helmut Reich begrüßte Obleute, Delegierte und interessierte Mitglieder. Erika Kunstmanns Niederschrift von der letzten Versammlung im September 2021 lag zur Einsicht auf. Otmar Anclam von der Ortsgruppe Rückersdorf gedachte der verstorbenen Mitglieder.

In seinem umfassenden Bericht betonte der Kreisobmann, daß die SL vor allem altersbedingt in einer Zeit der Veränderung stehe. Nach der Aussage des Volksgruppensprechers Bernd Posselt ist die Sudetendeutsche Landsmannschaft eine geschichtsbewußte und als Vierter Stamm Bayerns eine handlungsfähige Volksgruppe. Mit dem Sudetendeutschen Museum in München, dessen Eröffnung im Oktober 2020 erfolgt sei, sei ein kultureller Kristallisationspunkt geschaffen worden, der die kulturhistorischen Besonderheiten der Volksgruppe im Zusammenhang internationaler geschichtlicher Entwicklungen repräsentiere. Das Museum sei neben weiteren 31 Museen vom Europäischen Museumsforum als Museum des Jahres nominiert worden. Reich bedankte sich für die Treue, die Mit- und Zusammenarbeit auch im Namen des Präsidiums der Bundesversammlung.
In seinem Rückblick erinnerte Reich an die Märzgefallenen-Gedenkfeier am 4. März in Nürnberg. In der letzten ordentlichen Hauptversammlung habe eine Buchvorstellung von Professorin Christa Olbrich ,,Von der Kuhmagd zur Professorin“ im Mittelpunkt gestanden. Da die beiden Kassenprüferinnen Helga Dörre und Helga Gradl nicht mehr zur Verfügung gestanden seien, seien Annemarie Völlmer und Karin Walz für diese Ämter nachgewählt worden.
Der Kreisobmann berichtete auch von der Auflösung der Ortsgruppen Neunkirchen mit Ottensoos sowie Schnaittach. Die nötigen Amtswalterposten hätten alters- und krankheitsbedingt nicht mehr besetzt werden können. Die Kreisgruppe bestehe nur noch aus den vier Ortsgruppen Lauf-Heuchling, Rückersdorf, Röthenbach und dem Volkstanzkreis.
Reich berichtete auch von vielen Aktivitäten der Kreisgruppe. Dazu hätten eine von der Bezirksgruppe organisierte Großeltern-Enkel-Fahrt
nach München zum Sudetendeutschen Museum gehört sowie eine ebenfalls von der Bezirksgruppe angebotene Nordböhmenfahrt nach Aussig. Der Sudetendeutsche Tag 2021 habe wegen Corona im Gasteig, im Sudetendeutschen Haus und im neuen Mu-
seum in München stattgefunden. Den Sudetendeutschen Tag im vergangenen Jahr mit dem Motto „Dialog überwindet Grenzen“ in Hof hätten viele Landsleute mit dem Zug oder mit dem Auto angesteuert. Nennenswert seien auch der Tag der deutsch-tschechischen Begegnung in der Wenzelburg in Lauf sowie die Gedenkfeier anläßlich 100 Jahre Egerländer Gmoi Nürnberg mit Gottesdienst und Festakt gewesen. Hervorzuheben sei der Sudetendeutsche Volkstanzkreis Lauf-Eckental, der das ganze Jahr über punktuell öffentlichkeitswirksam in Erscheinung trete. Ein großes Anliegen der Kreisgruppe sei der Erhalt von Vertriebenen-Denkmalen im Landkreis wie auf den Friedhöfen in Lauf-Heuchling, Neunkirchen und Schnaittach sowie in Grünanlagen in Hersbruck und Neuhaus. Geplant sei eine Rundfahrt zur Begutachtung.
Die Vermögensverwalterin Edith Würth berichtete über eine geordnete Kassenlage, welche die Rechnungsprüferinnen Karin Walz und Annemarie Völlmer überprüft hatten. Walz bestätigte die vorschriftsmäßige Kassenführung. Einstimmig erfolgte die Entlastung der Vermögensverwalterin und des Vorstands. Otmar Anclam leitete die Neuwahlen. Alle Wahlvorschläge wurden angenommen. Helmut Reich ist Kreisobmann, Christl Hanisch-Gerstner und Barbara Anclam sind seine Stellvertreterinnen. Erika Kunstmann ist Schriftführerin und Auguste Arndt ihr Ersatz. Edith Würth ist Vermögensverwalterin und Rüdiger Hein ihr Stellvertreter. Rüdiger Hein kümmert sich um die Organisation, Edith Würth um EDV und Internet. Pressearbeit machen Judith Will und Auguste Arndt. Kassenprüferinnen sind Karin Walz und Annemarie Völlmer, ihr Ersatz ist Irmtraut Wiemer. Delegierte sind Helmut Reich, Rüdiger Hein und Edith Würth, Ersatz ist Josef Lodes.
Christl Hanisch-Gerstner verteilte den reich bebilderten Jahresbericht des Sudetendeutschen Volkstanzkreises und der SdJ. Sie erinnerte an viele Aktivitäten und informierte über das 50jährige Bestehen, das im November in der Wenzelburg gewürdigt werde. Rüdiger Hein unterrichtete vorab über geplante Tagesfahrten nach Thüringen und in die Rhön. Am Ende der Versammlung dankte Kreisobmann Reich den verdienstvollen ausgeschiedenen Obmännern der aufgelösten Ortsgruppen Josef Rau und Willi Gartner für ihre lange Amtswaltertätigkeit mit einem Präsent. In Abwesenheit der ehemaligen Kassenprüferinnen Helga Dörre und Helga Gradl sprach Helmut Reich ebenfalls seinen Dank aus und übergab ein Geschenk zur Weiterleitung. hl
� KV Graslitz
Ein weißer Fleck auf der Landkarte
Anfang April besuchte der KV Graslitz die tschechische Hauptstadt Prag. Ulrich Möckel war dabei und berichtet.
Reisen bildet: Mit dieser Einsicht starteten die Mitglieder des Kulturverbandes Graslitz zu ihrer ersten diesjährigen Exkursion. Diese führte nach Prag. Als erstes stand der Besuch des Goethe-Instituts auf dem Plan. Das Institut fördert die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland, pflegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit und vermittelt ein umfassendes, aktuelles Deutschlandbild. 158 Goethe-Institute in 98 Ländern bilden mit zahlreichen Partnereinrichtungen ein globales Netzwerk. Somit gibt es viele Schnittpunkte bei den Aufgaben und Zielen des Kulturverbandes der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik mit denen des GoetheInstituts.
Einführend wurden das Institut und seine Aktivitäten auf Tschechisch vorgestellt. Denn obwohl die Mitglieder des Kulturverbandes meist von Deutschböhmen abstammen, sind nicht alle der deutschen Sprache mächtig. Nicht umsonst bietet der KV Graslitz seinen Mitgliedern deutsche Sprachkurse an, die rege genutzt werden.
Das Angebot des Goethe-Institutes in Prag ist mit seinen Partnereinrichtungen in Tschechien nahezu flächendeckend, jedoch gibt es eine Auffälligkeit. Der nordwestböhmische Raum ist ein weißer Fleck auf der Landkarte und das, obwohl Johann Wolfgang von Goethe in der Bäderregion sehr oft weilte. Woran dies liege, so die Referentin Teresa Weiser, wisse man auch nicht, aber sie nehme die Anregung auf, auch dieses Gebiet in die Arbeit einzubeziehen.
Dann besichtigten die Graslitzer die umfangreiche deutsche Bibliothek des Instituts mit ihren Büchern, Zeitschriften, Filmund Tonträgern. Neben der Ausleihe stehen dort freundliche, helle Arbeitsplätze zur Verfügung. Den Vorraum schmückt eine Sonderausstellung, die dem Kinderbuchautor Otfried Preußler gewidmet ist. Er kam 1923 im nordböhmischen Reichenberg
zur Welt und starb 2013 im oberbayerischen Prien am Chiemsee. Sein Werk besteht aus mehr als 40 Kinder-, Jugend- und Bilderbüchern, die bekanntesten sind „Der kleine Wassermann“, „Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“, „Das kleine Gespenst“ und „Krabat“. Preußlers Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und haben eine Auflage von 50 Millionen Exemplaren. Das Jugendstilgebäude, das das Goethe-Institut in Prag be-
den Filmen und erfuhren hier, mit welchen Tricks sie entstanden waren. Das war eine Reise in die Vergangenheit mit vielen heiteren Momenten.
Am Nachmittag besichtigten wir die Sankt-Nikolaus-Kirche in der Mitte des Kleinseitener Rings. Dieses monumentale Gebäude zählt zu den bedeutendsten barocken Kirchenbauten Europas. Der Grundstein zu der an das Jesuitenkolleg angrenzenden Nikolauskirche wurde 1673 gelegt, mit dem Bau begannen die Jesuiten aber erst 30 Jahre später. Die Errichtung ermöglichte vor allem Václav Libštejnský aus dem Adelsgeschlecht der Grafen von Kolowrat, der sein ganzes Vermögen für den Bau der Kirche gestiftet hatte, bevor er in den Orden eintrat.

hat den höchsten Innenraum eines Gebäudes in Prag.

Nach dem Auflösen des Jesuitenordens 1775 wurde die Nikolauskirche zur katholischen Pfarrkirche der Kleinseite. Sie wurde 1984 bis 1989 umfassend restauriert. Neben den regelmäßig stattfindenden Gottesdiensten wird die Kirche häufig auch für Konzerte genutzt. Der Glockenturm diente bis 1891 als Wachturm, von dem aus die Wächter Brände oder sich nähernde Feinde meldeten. 1950 bis 1989 nutzten Agenten des kommunistischen Geheimdienstes den Turm für die Überwachung von umliegenden Botschaften westlicher Länder.
herbergt, gehört zum UNESCOWelterbe Historisches Zentrum von Prag. Es wurde 1905 als Hauptsitz der Ersten böhmischen Rückversicherungsbank gebaut, von 1949 bis 1990 befand sich die DDR-Botschaft darin. Heute gehört es dem Staat. Eine Straßenbahnstation weiter steht die legendäre Karlsbrücke. Vom Ende der Karlsbrücke auf der Kleinseite gingen wir nur einige wenige Schritte zum Karel-ZemanMuseum.
Zeman (1910–1989) zählt mit Hermína Týrlová und Jiří Trnka zu den Begründern des tschechischen animierten Films. Die einzigartige und spielerische Ausstellung spricht sowohl Kinder als auch Erwachsene an. Die Räume sind wie Filmstudios mit kleinen Bühnen eingerichtet, in denen die Besucher selbst Aufnahmen machen können.

Das Museum dokumentiert Zemans Leben und Werk von seinen ersten Animationen und Puppenfilmen der 1940er Jahre bis zu seinem Tod 1989. Ein großer Teil des Museums wurde den Filmen „Reise in die Urzeit“, „Die Erfindung des Verderbens“ und „Baron Münchhausen“ gewidmet. Viele Teilnehmer erinnerten sich an die Szenen aus
Unter der Federführung von Christoph Dietzenhofer entstanden 1703 bis 1711 das Westportal, das Gewölbe des Hauptschiffes und die seitlichen Kapellen der Heiligen Barbara und Anna. Sein Sohn Kilian Ignaz Dientzenhofer schuf 1737 bis 1752 das Presbyterium und beendete kurz vor seinem Tod sein Meisterwerk, die
Das Interieur ist barocke Kunst in ihrer Vollendung und versinnbildlicht die Macht der katholischen Kirche. Viele namhafte Künstler waren an der Ausgestaltung beteiligt. Das riesige Deckenfresko „Die Verherrlichung des heiligen Nikolaus“ von Johann Lucas Kracker gehört mit fast 1500 Quadratmetern zu den größten Gemälden Europas. Die Kuppel schmückt das Fresko „Die Heilige Dreifaltigkeit“, ein Werk von Franz Xaver Palko, darunter ragen Monumentalstatuen der vier Kirchenlehrer von Ignaz Franz Platzer in die Höhe.

Der Hauptaltar mit der vergoldeten Statue des heiligen Nikolaus ist der größte Barokkaltar in Prag. Die Statue, wie auch die meisten anderen Altarstatuen in der Kirche, sind das Werk von Ignaz Franz Platzer. Von ihm stammen auch die überlebensgroßen Statuen der Heiligen an den Pfeilern des Kirchenschiffs. Die Kanzel ist mit künstlichem Marmor verkleidet. Darstellungen von Glaube, Liebe und Hoffnung schmücken sie.
70 Meter hohe Kuppel. Den Bau vollendete Anselmo Lurago 1751 bis 1755 mit der Errichtung des Glockenturms. Die Kirche wurde zwar 1752 geweiht, aber bis in die 1760er Jahre noch an ihrer Ausschmückung gearbeitet.
Der Monumentalbau hat eine Grundfläche von 40 mal 60 Metern. Kuppel und Glockenturm sind beide 79 Meter hoch. Die massive kupferbedeckte Kuppel hat einen äußeren Durchmesser von 20 Metern. Sie ist innen 50 und außen 70 Meter hoch und
Die barocke Orgel wird derzeit generalüberholt. Thomas Schwarz baute sie 1745 bis 1747. Sie hat über 4000 Pfeifen mit einer Länge bis zu sechs Metern.
Auf dieser Orgel spielte Wolfgang Amadeus Mozart während seines Prag-Aufenthaltes 1787.
Mit diesen überwältigenden Eindrücken ging es wieder heimwärts. Alle danken sehr herzlich der Organisatorin Jitka Marešová für diese interessante Exkursion ins Zentrum der tschechischen
Neudek Abertham

Neudeker Heimatbrief
für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Folge 645 · 5/2023
Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft, Stadtsparkasse München – IBAN: DE69 7015 0000 0906 2126 00, BIC: SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge 646 (6/2023): Mittwoch, 21. Juni.


❯ 75 Jahre Neudeker Heimatbrief




Von der Wachsmatritze zum World Wide Web
Zeitgleich mit dem 73. Sudetendeutschen Tag in Regensburg feiert der Neudeker Heimatbrief (NHB) 75jähriges Bestehen. Die Aktiven der Gründerjahre sind längst gestorben, aber die folgenden Generationen führten den Heimatbrief bis heute weiter, und die Jubiläumsausgabe ist mittlerweile die 645. Folge der Monatsschrift. Josef Grimm berichtet.
Alles begann am 8. Mai 1948. An jenem Tag fand in Nürnberg das erste Neudeker Treffen nach der Vertreibung aus der Heimat statt. Trotz der damals schwierigen Verkehrsverhältnisse reisten 300 Landsleute auf Einladung des Landsmannes Franz Träger an. Träger hatte mit vielen Mühen ein Adressenverzeichnis der ihm bekannten Landsleute in der neuen Heimat aus der Stadt und dem Landkreis Neudek angelegt.
Der Neudeker Adolf Moder, den es nach Artelshofen bei Nürnberg verschlagen hatte, hatte schon längst mit einer Heimatzeitschrift die Verbindung der in alle Richtungen Deutschlands und Österreichs verstreuten Landleute schaffen und aufrecht erhalten wollen. Die Papierknappheit hatte dies direkt nach dem Kriegsende verhindert. Auf diesem ersten Heimattreffen stellte Moder nun sein Vorhaben vor und fand breite Zustimmung.
Inzwischen waren auf dem Schwarzmarkt Wachsmatritzen, Altpapier und von Hand betriebene Hektographierapparate verfügbar. Eine alte Schreibmaschine fand sich im Bekanntenkreis, und so tippte Adolf Moder auf nur vier Seiten den ersten Neudeker Heimatbrief und versandte ihn Anfang Juni 1948 an die ihm bekannten Adressen mit folgendem Geleitwort:
„So soll nun der 1. Neudeker Heimatbrief hinausziehen in alle Gaue Deutschlands mit dem Wunsche, allen lieben Heimatbrüdern und -schwestern eine Stunde heimatlichen Besinnens zu sein. Möge er seinen Zweck erfüllen, uns näherzubringen und uns die Heimat nur ein ganz klein wenig zu ersetzen! Ich bitte Euch nochmals um freundliche Unterstützung durch Mitteilung aller unsere Landsleute betreffenden Ereignisse.
Nur Liebe zur Heimat zwingt mir mein heutiges Beginnen auf!“
Am 20. Juni 1948 trat dann in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands die Währungsreform in Kraft. Und über Nacht waren die Regale mit Waren voll, und auch Papier war plötzlich verfügbar. Noch zwei weitere Folgen des Heimatbriefes erschienen im händischen Hektographierverfahren, die Ausgabe vom Juli 1948 jedoch schon mit acht Seiten, die Ausgabe vom Oktober 1948 mit zwölf Seiten Umfang.
Um Papier zu sparen, wurde jede Seite so voll wie möglich be-
schrieben, so daß der Satzspiegel bis weit in den Kopfsteg, Fußsteg, Außensteg und Bundsteg hineingeschrieben wurde. Diese Sparmaßnahme wurde auch bei den späteren gedruckten Ausgaben beibehalten. Das bringt den Nachteil mit sich, daß die inzwischen zu dicken Bänden gebun-
uns, die dann im Neudeker Heimatbrief veröffentlicht wurden.
Ein eigenes Bild vom Zustand der verlorenen Heimat konnte man sich etwa ab 1965 machen. Damals öffnete die ČSSR die Grenzen für Besucher aus dem Westen. Da noch keine diplomatischen Beziehungen zwischen
In der Folge 161 vom 15. Juni 1968 feierte der Neudeker Heimatbrief sein 20jähriges Bestehen. Der Graslitzer Alfred Riedl aus Amberg sang ein Loblied auf den immer noch mit gleichem Elan tätigen Herausgeber Adolf Moder, befürchtete aber, daß das dritte Jahrzehnt das letz-
Ab der Samtenen Revolution mischten sich unter Erinnerungen und Berichte über Besuche der Heimat schon Andeutungen von aufkeimender Zusammenarbeit mit kooperationsbereiten tschechischen Initiativen. Zudem erforderte eine Organisationsänderung innerhalb der SL ein En-
sichtlich die Folge einer bedauerlichen Abwerbeaktion einiger Hetzer war.
Der erste NHB ist tatsächlich ein Brief.
denen Hefte nur schwer auf einem Kopierapparat oder Scanner kopiert werden können. Wir besitzen im Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg sämtliche Ausgaben des Neudeker Heimatbriefes, und oft werden wir um Kopien früherer Ausgaben gebeten.
Die vierte Folge vom Dezember 1948 wurde noch mit der Schreibmaschine geschrieben, jedoch schon im Buchdruckverfahren hergestellt. Die erste im Schriftsetzverfahren hergestellte Folge vom Februar 1949 trug nun schon als Logogramm den Neudeker Turm mit hinterlegten Sonnenstrahlen auf der Titelseite.
Bilder waren noch selten, denn sie konnten nur mit den damals kostspieligen Klischees gedruckt werden. Den Zusammenhalt der Leser förderten Familiennachrichten wie Geburten, Hochzeiten und leider auch Todesanzeigen. Die Mehrzahl der Berichte bezog sich auf Erinnerungen an den schmerzlichen Verlust der Heimat. Da die Grenzen zur nunmehr Sozialistischen Tschechoslowakischen Republik (ČSSR) hermetisch dicht waren, fehlten Berichte über das Leben der wenigen Heimatverbliebenen und über die Heimat unter kommunistischer Herrschaft. In der Ausgabe 28 vom 31. Oktober
1951 trat mein Vater Pepp Grimm zum ersten Mal als Autor in Erscheinung mit einem Gedicht über Allerseelen.

In der Ausgabe 48 vom 1. April 1954 führte mein Vater die Rubrik „Aus dr Hutznstub“ ein, in der er bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1961 über Ernstes und Heiteres aus dem oberen Erzgebirge berichtete. Gelegentlich drangen Nachrichten von heimatverbliebenen Landsleuten über den Verfall der Heimat zu

Der erste gedruckte NHB.
Der erste NHB im Schriftsetzverfahren.
Der Grenzgänger



Die neue Rubrik „Aus dr Hutznstub!“.
Krušnohorský Herzgebirge Luft


Der Kopf ab 1975.

te des Neudeker Heimatbriefes sein würde. Doch hier irrte der Laudator, der Neudeker Heimatbrief lebte weiter.
Der Kopf von 2004 bis 2011.
der Bundesrepublik Deutschland und der ČSSR existierten, wurden die Besuchervisa von der Tschechoslowakischen Militärmission bei den Westalliierten in der Podbielskiallee 54 in Westberlin ausgestellt. Nach wochenlangem bangen Warten erhielt man das Dokument.

Bei der Vertreibung war ich dreieinhalb Jahre alt und hatte somit keine Erinnerungen an die Heimat. Ich erinnere mich an das Pfingstfest im Juni 1966, als ich zum ersten Mal seit meiner Geburt wieder in die Heimat kam.
Nach stundenlanger schikanöser Abfertigung an der Grenze bei Schirnding/Mühlbach (Pomezí nad Ohří) folgte die Fahrt über Eger in das Erzgebirge. Dort folgte die Ernüchterung: Die von den Eltern als schön und groß beschriebene Bergstadt Abertham zeigte sich als graues, verfallendes Nest. Von da an beschrieben viele die Heimat besuchenden Vertriebenen ihre traurigen Eindrücke im Neudeker Heimatbrief
Im Lauf der Jahre änderte er mehrfach den Kopf auf der Titelseite, ab der Folge 214 vom Februar 1975 stehen die Wappen der Städte im Kreis Neudek und der Patenstadt Augsburg obenan. Das kleine Format DIN A4 und der schwarzweiß-Druck wurden noch bis Ende 2011 beibehalten. Die Zahl der Autoren schmolz im Lauf der Jahre, und so ergab es sich, daß sich der jeweilige Vorsitzende der Heimatgruppe „Glück auf“ und zugleich der Heimatkreisbetreuer für Neudek seitens der SL für den Inhalt des Heimatbriefes zuständig fühlten. Besonders lange wirkte mein Vorgänger Dieter Thurnwald für den Heimatbrief Da er keinen Zugriff zu Fotos im Internet und zu tschechischen Quellen hatte, füllte er die Seiten mit zahlreichen Jugenderinnerungen.

de des kleinformatigen Heftes und eine Eingliederung des Neudeker Heimatbriefes in die Sudetendeutsche Zeitung (SdZ). Beides fand nicht bei allen Lesern Zustimmung.

Zur darauf folgenden Entwicklung möchte ich nun Stellung nehmen. Gegen Ende des Jahres 2011 besuchte der damalige SdZ-Chefredakteur Herbert Fischer die Heimatgruppe „Glück auf“ in Augsburg und warb für die Eingliederung des Neudeker Heimatbriefes in die SdZ

Dieter Thurnwald hatte kurz zuvor nicht mehr für den Vorsitz in der Heimatgruppe „Glück auf“ kandidiert. Ich schloß mich sofort dem Wunsch Herbert Fischers an und kümmerte mich ab der Folge 508 vom 1. Januar 2012 um den Inhalt des Neudeker Heimatbriefes als monatliche Beilage der SdZ im Farbdruck. Leider büßte die neue Form des Heimatbriefes eine erhebliche Zahl von Abonnenten ein, was offen-
Mir war auch klar, daß für ein stabiles Weiterbestehen des Neudeker Heimatbriefes eine Vielzahl von Quellen in Form von vielen Autoren mit breitem Zugriff auf Archive und beides auch aus der Tschechischen Republik erforderlich machte. Ich selbst lernte zu diesem Zweck an der Volkshochschule Augsburg Tschechisch, im Alter kein leichtes Unterfangen. Eine günstige Gelegenheit zu einer persönlichen Kontaktaufnahme war eine Vernissage unserer tschechischen Freunde des Vereins „Jde o Nejdek (JoN) – Es geht um Neudek“ am 7. Dezember 2013 in der Neudeker Bibliothek. JoN hatte die Jugenderinnerungen des Neudekers Franz Achtner „Wie’s daheim einst war“ ins Tschechische übersetzt und stellte das Buch „Jaké to bylo kdysi doma v Nejdku“ der tschechischen Öffentlichkeit vor. Die Heimatgruppe „Glück auf“ war zur Teilnahme eingeladen. Nach der Veranstaltung traf ich mich mit Jiří Kupilík, dem Herausgeber der tschechischen Zeitschrift „Krušnohorský Herzgebirge Luft“ und mit Ulrich Mökkel, dem Herausgeber der Internetzeitschrift „Der Grenzgänger“ im Neudeker Hotel Anna. Dort trafen wir die kollegiale Vereinbarung, daß wir zukünftig – ohne jedes Mal um Erlaubnis bitten zu müssen – Artikel aus den anderen Zeitschriften unter Angabe der Quelle übernehmen dürfen.
Unser Motto war und ist: „Freundschaft und Zusammenarbeit sind besser als Haß –Přátelství a spolupráce jsou lepší než nenávist“. Seitdem arbeiten der Neudeker Heimatbrief und die beiden genannten Zeitschriften zum Wohl ihrer Leser zusammen. Für mich sind es nun schon elfeinhalb Jahre, die ich mich um den Neudeker Heimatbrief kümmere, ausgestattet mit Internet, Kameras, PC, Bildbearbeitungsprogrammen und TschechischKenntnissen. Trotz einer ernsten Herzerkrankung und Corona mußte ich bisher keine einzige Ausgabe des Neudeker Heimatbriefes ausfallen lassen. Ich hoffe, das bleibt so. Momentan habe ich noch Stoff bis zum Jahresende. Berichte anderer Autoren sind immer herzlich willkommen, damit der Neudeker Heimatbrief auch über sein 75. Jubiläum hinaus weiterbesteht.
HeimatkreisSchie wår‘s en dr åltn Hamit, aber ich will wieder ham nooch Deitschlånd

Am 9. Dezember wurde Josef Grimm 80 Jahre alt (Þ NHB 50/2022). Das feierte er im April mit seiner Familie mit einer Geburtstagsfahrt in die Heimat. Er berichtet.
Achtzig Jahre alt wird man nur einmal, und so lud ich aus diesem Anlaß meine Familie von Ostermontag bis Donnerstag in meine Geburtsheimat im böhmischen Erzgebirge ein. Meine Enkelinnen Franziska (9) und Charlotte (7) sahen zum ersten Mal, wo der Opa auf die Welt gekommen war und die ersten dreieinhalb Jahre seines Lebens verbracht hatte. Ein geliehener Opel-Kleinbus bot Platz für meine Frau Ingrid, unseren Sohn Roland mit Frau Irina und deren beiden Kindern und unsere Tochter Claudia. Bei Waldsassen überquerten wir die Grenze, wo bereits die erste Überraschung auf uns wartete.
In der Wechselstube in der Grenz-Gastwirtschaft auf der tschechischen Seite betrug der Wechselkurs 21,50 Kronen für einen Euro. In Karlsbad war er mit 23 Kronen geringfügig besser. Die tschechische Krone hat im Verhältnis zum Euro im Lauf der Jahre erheblich an Wert gewonnen, ich kenne noch Zeiten, in denen man 33 Kronen für einen Euro bekam. Die Speisen und Getränke in Gaststätten und die Lebensmittel in den Geschäften kosteten früher dreimal weniger als bei uns, dann die Hälfte, und jetzt sind sie ziemlich gleich. Man fragt sich, wie die Tschechen damit zurechtkommen,
denn ihr Lohn ist deutlich niedriger als unserer.
Als Quartier für den viertägigen Aufenthalt hatte ich das Hotel Imperial in Karlsbad gewählt.

Man sagt, es sei nach dem Pupp das zweitbeste am Ort. Es erwies sich als sehr gut, wenngleich die Preise der Lage des Hotels, der Ausstattung und dem guten Namen angepaßt sind. Ein Doppelzimmer kostet mit Büffet zum Frühstück und Abendessen umgerechnet 200 Euro pro Tag, ein Familienappartement mit Elternzimmer und Kinderzimmer 400. Doch was soll‘s, auf meine letzte Reise kann ich eines Tages nichts mitnehmen. Die Fahrt mit der Standseilbahn vom Imperial hinunter in die Stadt und die anschließende Pferdekutschenfahrt durch die Kurzone waren besonders für die Kinder ein Erlebnis. Am nächsten Tag fuhren wir in die ehemalige Kreisstadt Neudek. Dort aßen wir im bewährten Hotel Anna zu Mittag. Die Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg bezieht in diesem gemütlichen Altstadthotel bei ihrer jährlichen Fahrt in die Heimat Quartier. Anschließend ging es vom 560 Meter über dem Meer im geschützten Rohlautal gelegenen Neudek hinauf nach Abertham ins Erzgebirge. Die Stadt liegt zwischen 850 und 950 Meter über dem Meer. Ein altes Sprichwort lautet: „In Abertham herrscht acht Monate Winter, die restlichen vier Monate ist es kalt.“ Bei unserem Eintreffen in Abertham machte das Wet-
ter diesem Sprichwort alle Ehre: Ein Schneesturm fegte am 11. April über Abertham, so daß wir kaum aus dem Auto aussteigen konnten. Rasch ein paar Fotos mit Blick auf die Kirche und auf das Rathaus, dann ging es zu „unserem“ Haus in der Vítězná 20, früher Eva-Buchholz-Stra-
men und uns wie Bettler fortgejagt hätten.
Obwohl ich nur dreieinhalb Jahre darin wohnte und als Kleinkind Abertham nicht bewußt als meine Heimat erlebte, beschleicht mich jedes Mal ein seltsames Gefühl, wenn ich vor dem Haus stehe. Mein Stamm-
Haus. Ich habe alles gesehen, das Wohnzimmer, mein Geburtszimmer, die ehemalige Werkstätte und den Verkaufsraum. Seitdem kann und will ich das Haus nicht mehr betreten. Es sperrt sich etwas in mir. Soll der jetzige Besitzer damit glücklich werden, für mich ist die Sache abgeschlossen.

ße 20. Mein Vater hat es 1924 als Geschäftshaus für Schuhwaren, Papier- und Galanteriewaren, Schuhreparaturwerkstätte und Wohnhaus für seine Familie gebaut. Das Haus ist nach so vielen Jahren in einem tadellosen Zustand. Ich zeigte meinen Enkelinnen das Fenster im ersten Stock, in dem dahinter liegenden Zimmer ich auf die Welt kam, und erklärte ihnen, daß es uns im Jahr 1945 die Tschechen weggenom-

baum väterlicherseits reicht lükkenlos bis zum Jahr 1535 zurück, und meine Vorfahren lebten seitdem immer in Abertham. Der heutige Besitzer heißt Josef Hraško, der darin eine Autowerkstätte betreibt. Sooft ich in Abertham bisher war, habe ich die Werkstätte noch nie geöffnet gesehen.
1966 war ich zum ersten Mal nach der Vertreibung wieder in Abertham und in unserem
Unten am Eck Perninská/ Vítězná (Bärringer Straße/EvaBuchholzstraße) verschandelte jahrzehntelang die häßliche Ruine des ehemaligen Hotels Uran das Ortszentrum von Abertham. Nun kaufte eine tschechische Investorgesellschaft das Objekt und baute es zu einem Apartementhaus mit kleinen Eigentumswohnungen um. Bei unserem Besuch in Abertham war es fast fertig. Im Internet waren bisher die Wohnungen zum Kauf angeboten. Jetzt wird im Internet nur noch ein Objekt darin angeboten, eine kleine Wohnung mit 58 Quadratmetern Grundfläche zum stolzen Preis von umgerechnet 259 000 Euro. Wohlgemerkt in Abertham mit etwa 950 Einwohnern auf fast 1000 Metern Höhe, mit nur zwei kleinen privaten Lebensmittelläden, keiner Schule, keinem Unterhaltungsangebot, und nicht etwa in Augsburg oder München. Aber offenbar haben sich für fast alle Wohnungen Käufer gefunden. Jedenfalls ist nun der HotelUran-Schandfleck beseitigt.

Ich erfuhr, daß die Kirchturmuhr, die der verstobene Ehrenfried Zenker bei der Renovierung der Kirche in den Jahren 1993 bis 2006 reparieren ließ, nun wie-
der defekt sei. Vom Geld, das Ehrenfried Zenker von deutschen Spendern für den Erhalt der Kirche gesammelt hatte, ist nach seinem Tod im Dezember 2016 noch etwas übrig, das ich in Verwahrung habe. Ich lege Wert darauf, daß „unsere“ Kirchturmuhr in Abertham wieder die Zeit angibt. Daher soll die Uhr erneut repariert werden. Nach einem Cafébesuch in Oberwiesenthal fuhren wir über Sankt Joachimsthal wieder zurück nach Karlsbad. In Sankt Joachimsthal unten am Kreisverkehr gegenüber dem Kurhotel Curie wollte ich in der Apotheke Tabletten kaufen. Da stand an der Eingangstür die Mitteilung: „Ab 1. April 2023 dauerhaft geschlossen.“ Ich kam auch ohne Tabletten aus, aber was machen dort und in den ganzen Erzgebirgsgemeinden die alten Leute? Die nächstgelegenen Apotheken sind in Schlackenwerth und Karlsbad. Am nächsten Tag besuchten wir das hübsche Städtchen Elbogen und besichtigten die dortige Burg. Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen im Grandhotel Pupp in Karlsbad. Am Donnerstag fuhren wir wieder nach Augsburg heim. Meine Eltern hatten nach der Vertreibung oft wehmütig gesagt: „Mir woll’n wieder ham nooch Åberthåm.“ Ich sagte zum wiederholten Mal: „Schie wår‘s en dr åltn Hamit, aber ich will wieder ham nooch Deitschlånd.“ Die Familie war sich einig, daß die Reise in meine Geburtsheimat eine würdige Nachfeier meines Geburtstages gewesen sei.
Heimatgruppe „Glück auf“ und JoN haben wieder einen gemeinsamen Stand
Wir zählen nicht mehr mit, wie oft die Heimatgruppe „Glück auf“ – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg und der tschechische Verein „Jde o Nejdek (JoN) – Es geht um Neudek“ bei den Sudetendeutschen Tagen mit einem gemeinsamen Stand auftraten. So auch an diesem Pfingstwochenende in Regensburg.
Unsere tschechischen Freunde vom Verein „Jde o Nejdek“, die sich insbesondere um den Erhalt deutscher Kulturgüter in und um Neudek kümmern, zeigen ihre Veröffentlichungen und werben mit vielfältigem Prospektmaterial für den Besuch der

Stadt Neudek und ihrer Umgebung, insbesondere für eine Wanderung auf dem Kreuzweg. Die Heimatgruppe „Glück auf“ – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg präsentiert auf einem Videomoni-
tor ihre Internetseite www.heimatgruppeglueckauf.de, stellt das Heimatmuseum in Augsburg-Göggingen vor, gibt Einblick in die Transportlisten der Vertreibung von 1946 aus der kreisfreien Stadt Eger und den Landkreisen Eger, Elbogen, Falkenau, Graslitz, Karlsbad und Neudek und wirbt für den Besuch des Heimatmuseums, die Mitgliedschaft in der Heimatgruppe und den Bezug des Neudeker
Heimatbriefs, der 75. Geburtstag feiert (Ý Seite 11) Als Besonderheit präsentiert sie einige wertvolle Trachtenkleider, die sie aus einem Nachlaß erhalten hat. Es handelt sich um Einzelanfertigungen, keine industriell gefertigte Massenware. Die Konfektionsgröße ist etwa 38/40. Da im Heimatmuseum leider kein Platz mehr ist, bieten wir die Kleider auf unserem Ausstellungsstand gegen eine namhafte Spende für das Heimatmuseum zum Verkauf an. Der Verein JoN und die Heimatgruppe „Glück auf“ freuen sich auf zahlreiche Besucher ihres gemeinsamen Infostandes A 11 in der Aktionshalle. Josef Grimm
Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail rz@sudeten.de
� Die Geschichte der nordböhmischen Stadt Deutsch Gabel – Teil VIII
Die Bauern wehren sich
Als die schlechte Behandlung, welche den Abgesandten der Bauern in Prag zuteil geworden war, in den Herrschaften Lämberg, Wartenberg, Gabel, Grafenstein, Friedland und Reichenberg bekannt wurde, entstand bei den Untertanen eine große Erregung. Sie verweigerten der herrschaftlichen Obrigkeit alle Abgaben und andere Pflichten. Ihrem Unmut machten sie durch Schmähreden auf den Grafen Breda Luft. Wer von den Untertanen nicht mitmachen wollte, dem wurde mit Brand und Totschlag gedroht.
Um den Streit zu schlichten, begaben sich der Kreishauptmann von Jungbunzlau und der General Aneas Sylvius Piccolomini als Kommissare nach Wartenberg. In ihre Hände legten die Untertanen einen Revers, in dem sie sich verpflichteten, alle Dienste und Zahlungen solange zu leisten, bis ihnen der Kaiser auf ihre Klageschrift Antwort erteilt haben würde. Diese Klageschrift aus zehn Punkten verfaßte ein Advokat in Prag, sie lautete:
l Erstens haben sie im Jahre 1679 30 Steuern und 1680 abermals zwölf Steuern erlegen müssen.
l Zweitens müßten nebstdem, daß aus der Familie eines jeden Untertanen immer ein Kind im Dienste der Obrigkeit stehen muß, die andern Kinder, ob sie nun zu Hause oder anderwärts im Dienste stünden, für eine bestimmte Geldsumme auslösen.
l Drittens müssen die Untertanen von der Obrigkeit Obst, Fleisch, Kälber, Käse während der Fastenzeit um einen hohen Preis abnehmen und verlieren beim Verkauf ein Bedeutendes.
l Viertens mußte ehedem jeder Bauer jährlich drei Zaspeln spinnen. Seit zwei Jahren aber jedes Jahr 15, wozu sie nicht einmal hinreichend Flachs bekommen. Auch muß jeder Bauer der Obrigkeit eine Gans halten, diese vier mal berupfen und die Federn abliefern. Wenn die Gans verendet, muß er sie ersetzen.
l Fünftens muß jeder Bauer über die bestimmten Ackertage noch einen Biertag tun und wenn die Ackertage nicht verbraucht werden, für jeden Tag einen Florin (Gulden) bezahlen.
l Sechsten müssen jetzt die Untertanen auf dem Schlosse und auf den Höfen Wache halten und unentgeltlich Boten laufen.

l Siebtens mußten sie durch zwölf Jahre zu den verschiedenen Baulichkeiten des Grafen umsonst alle Dienste leisten.
l Achtens werden nach Taufen und Hochzeiten die Leute gezwungen, in die Wirtshäuser zu ziehen, dort weidlich zu trinken, damit nur recht viel Bier konsumiert werde.
l Neuntens sagt man ihnen niemals, wofür und auf wessen Befehl sie die Steuern zu entrichten hätten. Und als im vorigen Jahre eine kaiserliche Kommission zur Revision da war, da habe der Graf den Häuslern und Hausleuten zu sagen verboten, daß sie auch Steuern bezahlen.
l Zehntens müssen die Mädchen und Weiber auf Befehl der Obrigkeit ihr Haar abschnei-
den lassen, wofür ihnen ein paar Kreuzer zugeworfen werden. Obzwar die Bauern einen Revers ausgestellt hatten und auch die in Prag verhafteten sechs Abgesandten freigelassen worden waren, beharrten sie doch auf ihrer Weigerung, irgendwelche Dienste zu leisten. Sie kamen auch noch zu Beratungen zusammen und wurden in ihren Forderungen immer hartnäckiger. Der Kaiser befahl daher den Kriegshauptleuten, sich nochmals an Ort und Stelle zu begeben, um beide Parteien zu verhören.
Graf Breda bevollmächtigte seinen Amtsschreiber als Vertreter. Am 16. März begannen die Einvernahmen. Sie fielen zu Ungunsten der Bauern aus. Der Amtsschreiber vertrat die Sache seines Herrn mit solcher Zungenfertigkeit, so daß ihm die Bauern mit ihrer unbeholfenen Sprache nicht gewachsen waren. Außerdem verteidigte der Schulmeister von Ringelshain, Sebastian Finke, die Rechte der Herrschaft, so daß ihn die Bauern beinahe erschlagen hätten. Am 27. März 1680 erstattete der Kreishauptmann Bericht an den Kaiser. Die-
fielen Kurfürst Karl Albrecht von Bayern (1726–1745), König Friedrich II. von Preußen (1740–1786), Friedrich August von Sachsen (1733–1763), dann Sardinien, Spanien und Frankreich über das Erbe der 23jährigen Kaisertochter Maria Theresia her, um es ihr streitig zu machen.
Der Krieg begann mit einem Landfriedensbruch am 31. Juli 1741. An diesem Tag überrumpelten die Bayern die Bischofsstadt Passau, das Tor zu Österreich. Der kunstliebende, schwache, unentschlossene Kurfürst wollte sich der böhmischen Kurstimme versichern. Im Herbst 1741 fiel sein Heer in Böhmen ein. Prag wurde am 26. November im Handstreich genommen. Dort ließ sich Karl Albrecht am 8. Dezember 1741 zum König von Böhmen krönen. So war es möglich, daß Karl Albrecht am 25. Januar 1742 zum deutschen Kaiser gewählt wurde. Zwei Tage später zogen die Österreicher in München ein. Karl VII. war ein Kaiser ohne Land. Ganz Südbayern war in den Händen der Österreicher. König Friedrich II. von Preußen
hen. Das Kloster gab ihnen das Geld.
Das erste kaiserliche Militär, welches in unserer Gegend erschien, waren 1756 zwei Kompanien Kroaten. Bei sehr kaltem Nordsturmwetter marschierten sie durch Brins nach Gabel. Wegen ihres Aussehens – sie trugen verschnürte Röcke, rote Mäntel und Schuhe aus geflochtenem Schilf – und wegen ihres kriegerischen Auftretens erregten sie anfangs bei den Bewohnern Furcht. Doch mit ihrer Freundlichkeit und Treuherzigkeit erwarben sie sich sehr bald die Sympathien der Bevölkerung.
Nicht so die ungarischen Husaren; diese waren und blieben fürchterlich. Nach ihnen kamen verschiedene deutsche Regimenter, das Palavicinische nach Brins, Grünau, Luh und Neuland, das schwarze Kroatenregiment nach Gabel. Nun spürte auch die hiesige Gegend die drückende Kriegslast. Die Einquartierungen waren sehr lästig. Unentgeltlich mußten die Bewohner an der Grenze Schanzen und Verhaue bauen. Nicht einmal das Futter für die Zugtiere wurde bezahlt.
Friedland Kreis Gablonz


ser ließ den Aufstand mit Waffengewalt niederwerfen. Viele Bauern wurden eingesperrt und die, die geflohen waren, verfolgt.
Am 7. Mai 1680 starb Reichsgraf Christoph Rudolf von Breda. Die Verwaltung der Güter trat die Witwe Benedikta von Breda an. Viele der eingekerkerten Untertanen wandten sich mit der Bitte um Freilassung an sie. Alle ihre Bitten wurden zurückgewiesen. Erst später, und zwar auf die Fürbitten der jungen Herrschaften bei ihrer Mutter, öffneten sich die Kerker nach Erlegung von Kautionen und Reversen. Anton
Taubmann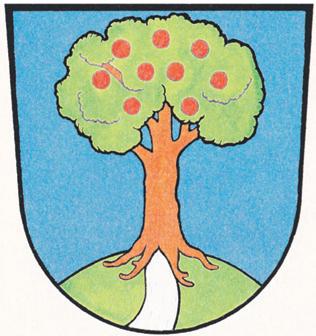
Der Siebenjährige Krieg
In der pragmatischen Sanktion, welche Kaiser Karl VI. (1711–1740) am 19. April 1713 erlassen hatte, wurde festgesetzt, daß im Falle des Aussterbens der Habsburger im Mannesstamme die Töchter Karls VI. erben sollten. Dieses Staatsgrundgesetz wurde sowohl von allen Ständen des Reiches als auch von den auswärtigen Mächtigen angenommen und gebilligt. Nachdem jedoch Kaiser Karl VI. am 20. Oktober 1740 gestorben war,
erhob Ansprüche auf Schlesien. Maria Theresia wies diese Forderungen als unbegründet zurück. Während der bayerische Widerstand zusammenbrach, drang Friedrich II. in Mähren ein. Doch bald sah er sich gezwungen, Mähren wieder zu verlassen. Am 11. Juni 1742 einigte er sich mit Maria Theresia. Aber schon im Sommer 1744 drangen 80 000 Preußen in Böhmen ein. Doch bald wurde Friedrich II. wieder aus Böhmen hinausmanövriert.
Im Österreichischen Erbfolgekrieg (1741–1748) mit dem Ersten und Zweiten Schlesischen Krieg war die Stadt Gabel von Militär verschont geblieben. Das änderte sich im Siebenjährigen Krieg (1756–1763). Nach der Schlacht bei Lobositz am 1. Oktober 1756 kamen am 10. Oktober 40 preußische Husaren nach Gabel und forderten von der Obrigkeit und der Stadt Lebensmittel und Geld für ihre Armee bei Zittau. Ohne auf das Geforderte zu warten, zogen sie wieder ab. Am 23. Oktober kamen sie wieder. Sie verlangten vom Prior des Klosters, Pater Longinus Albrecht, 30 Dukaten, oder er sollte mit ihnen nach Zittau ge-
Im April 1757 fielen drei feindliche Armeen in Böhmen ein, der Feldherr Schwerin aus Schlesien, König Friedrich II. über Tetschen und Prinz von Bewern von Zittau aus. Alle kaiserlichen Regimenter, die in der Umgebung von Gabel Quartiere bezogen hatten, bekamen den Befehl, sofort nach Gabel zu marschieren. Ein Grenadier des Regimentes Palavicini, der seine Einheit erst in Gabel einholte, mußte seine Verspätung mit 100 Stockschlägen büßen, unter denen er beim Stadttor starb. Zwei andere Soldaten wollten sich die Ruinen am Roll ansehen. Auf dem Wege dorthin hörten sie die Trommel zum Abmarsch schlagen. Sie liefen zurück, verirrten sich aber im Wald. Der eine kam noch rechtzeitig an, der andere holte sein Regiment erst in Gabel ein.
In der Schlacht bei Kolin siegte am 18. Juni 1757 Feldmarschall Daun über König Friedrich II. Ein Teil der flüchtenden Preußen zog über Leipa und Gabel in die Oberlausitz, um die großen Mehlvorräte – 900 vierspännige Wagen – in Zittau zu decken.
Am 14. Juli kam ein kaiserlicher Heerhaufen über Seifersdorf in die Nähe der Stadt. Die Kaiserlichen besetzten die Höhen bei Markersdorf und Lämberg, um den Preußen den Rückzug nach Sachsen abzuschneiden. Von Hennersdorf kamen 200 Mann k. k. Husaren, von Niemes ebensoviele Dragoner, welche sich bei Böhmischdorf auf dem Katzenberg postierten. In Gabel befanden sich unter dem preußischen General Puttkammer 4000 Mann Fußvolk und 500 Husaren. Die große k. k. Armee kam am 15. Juni nach Gabel. Die Stadt wurde von vier Seiten beschossen. Der südliche Torturm sank schon am 15. Juli gegen 10 Uhr zusammen. Aber durch das Tor konnte man nicht eindringen. Fortsetzung folgt
Dierömisch-katholische Pfarrei Haindorf lädt zur traditionellen Wallfahrt am Sonntag, 2. Juli um 9.00 Uhr in die Basilika Mariä Himmelfahrt ein. Hauptzelebrant wird Dr. Martin Leitgöb ČSsR, Provinzial der Redemptoristenprovinz Wien-München und Kolumnist der Sudetendeutschen Zeitung, sein.


� Gablonz
Böser Unfall endet gut
Einen glücklichen Ausgang nahm ein schrecklich aussehender Unfall, der sich am Mittwochmorgen, dem 3. Mai, in Gablonz ereignete.
An der Stelle, an der sich das Unglück ereignete, baut die Gemeinde Gablonz gegenwärtig eine neue Fußgängerbrükke über Bahngleise. Ein Bagger stürzte auf die sechs Meter tiefer liegenden Gleise. Der Fahrer des Baggers erlitt nur leichte Verletzungen und mußte nach Angaben des Sprechers des Rettungsdienstes der Region Reichenberg nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Baufirma entlud den Bagger von einem Lastkraftwagen, den der Fahrer zu nahe an den Rand des Eisenbahnkorridors gefahren hatte. Beim Abladen rutschte der Bagger mit dem Fahrer von der Ladefläche des Lasters und stürzte auf das Gleis. Glücklicherweise ist der Bahnverkehr seit dem 2. Mai im Zusammenhang mit der Reparatur der Brücke gesperrt. Bei dem Unfall wurde nur der Baggerfahrer verletzt, lediglich der Lastwagen und der Bagger wurden schwer beschädigt.

Die ursprüngliche Fußgängerbrücke über die Gleise mußte im vergangenen Jahr im März wegen ihres schlechten Zustands geschlossen und anschließend abgebaut werden. Der Sturz des Baggers beschädigte die Schalung und zerstörte die vorbereitete Holzbewehrung der Stahlbetonschwelle, auf der das Unternehmen mit der Herstellung des Betonfundaments für die neue Fußgängerbrücke beginnen sollte. Die Schalung muß wiederhergestellt werden. Man hofft, daß der Bauzeitplan dadurch nicht gefährdet wird. Stanislav Beran

für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau







Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt
Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Richard Wagner und Teplitz – Teil II und Schluß

Die liebe Töplitzer Geborgenheit
Unsere Teplitz-Schönauer Korrespondentin Jutta Benešová widmet sich intensiv der Beziehung Richard Wagners zu ihrer Stadt. Hier der zweite und letzte Teil.
Richard Wagners zweite, vollendete Oper „Das Liebesverbot“ war zwar vom Geist des Jungen Deutschland getragen, aber musikalisch und formal noch den großen Vorbildern und Konventionen des damaligen Opernschaffens verpflichtet.
„Aus dem abstrakten Mystizismus war ich herausgewachsen, und ich lernte nun, die Materie zu lieben“, sagte er. Damit verriet er, daß er Witz und Geist der französischen und italienischen Opern bewunderte, die er als Kapellmeister selbst dirigierte. Sie waren seiner heiteren Neigung zu einem ergötzlichen Leben nahe, und in jener Zeit war er auch einer gewissen Frivolität nicht abgeneigt. „Die Frucht aller dieser Eindrücke und Launen war meine Oper ,Das Liebesverbot‘.“
Ende Juni, nach Beendigung der Bäderkur, verabschiedeten sich Wagner und Apel von der Stadt Teplitz „bei einem guten Turner Bier“ im Restaurant Neptun. Am 30. Juni fuhren sie nach Prag, neuen, doch nicht minder verlockenden Erlebnissen entgegen. Noch im Juli 1834 kehrte Wagner nach Leipzig zurück, um sich auf den Antritt seiner Musikdirektorenstelle bei der Bethmann-Operngesellschaft in Magdeburg vorzubereiten. „Mit der Rückkehr endete für immer die fröhliche Zeit meines Lebens. Auch wenn ich mich vorher keinen ernsthafteren Verirrungen und leidenschaftlichen Erregungen entzogen hatte, so traten nun endgültig in mein Leben wirklich Sorgen.“
Der neue Beruf brachte ihm nicht nur nützliche Erkenntnisse der Theaterpraxis, sondern auch viele dienstliche Pflichten und persönliche Probleme. So fuhr er zwar 1835 wieder in das Land der Harfenspieler und Straßensänger –wie er Böhmen in seiner Novelle „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ nennt, aber diesmal nach Marienbad, um hier gesangliche Verstärkung für das Magdeburger Singspiel zu gewinnen. In einem Brief an Apel erinnerte er sich da-
n Sonntag, 18. Juni, 14.00

Uhr: Hauptversammlung des Heimatkreisvereins Dux, Duxer Heimathaus, Duxer Straße 10, 63897 Miltenberg. Auskunft: Klaus Püchler, eMail klauspuechler@web.de

n Donnerstag, 31. August bis
Sonntag, 3. September: 9. Teplitz-Schönauer Kreistreffen in der Heimat. Donnerstag eige-

bei inmitten von Streß und Sorgen an ihren gemeinsamen Aufenthalt in Teplitz, „erfüllt von glücklichen Augenblicken des süßen Nichtstuns“. Über weitere, oft sorgenvolle Stationen seines Lebens in Königsberg, Riga, mit Umwegen über London bis nach Paris, der Stadt der Musik, können wir uns in den zahlreichen Wag-
Und hier schrieb Wagner den Brief an seine jüngste Schwester Cäcilie mit der eingangs erwähnten Liebeserklärung an „Töplitz“. Der Sommer 1842 trug alle Anzeichen einer gelungenen Saison. Ein bemerkenswertes Familienereignis war das persönliche Treffen von Wagners Gattin Minna mit seiner Mutter, die sich ebenfalls wie so oft in Teplitz zur Kur aufhielt. In Teplitz sahen sie sich nämlich zum ersten Mal, und zu Wagners großer Erleichterung war es endlich gelungen – nach sechs Ehejahren – die Mauer zwischen ihnen zu beseitigen und die Mutter mit der Schwiegertochter zu versöhnen, gegen die sie aus vielerlei Gründen voreingenommen war.
nen und Vorhaben, und deshalb quartierte er sich mit Freude „in einem kleinen Zimmer des Gasthofs ein, wo mir über Nacht ein Bett gerichtet wurde“.
Er ergab sich völlig seiner entflammten Fantasie, und eines Nachts im Mondenschein, eingehüllt in ein Leintuch, begab er sich zur Burgruine, um dort persönlich die fehlende Spukgestalt zu ersetzen. Dabei spielte er mit der Vorstellung, daß ihn vielleicht jemand mit Schaudern beobachten könnte. „Bereichert mit diesen Erlebnissen“ erinnerte sich Wagner, „kehrte ich in ausgezeichneter Stimmung und bester Gesundheit nach Teplitz zurück.“ Dort erwartete ihn eine wichtige Nachricht, die die Premiere seines „Rienzi“ betraf.
Die Partitur war im April 1845 fertig, und Wagner war in einem furchterregenden Gesundheitszustand. Anfang Juli begab er sich deshalb mit seiner Gemahlin, die ebenfalls dringend eine Bäderkur benötigte, nach Marienbad. „Wieder stand ich auf dem vulkanischen Boden dieses beachtenswerten und für mich stets anregenden böhmischen Landes“, erinnerte sich Wagner nach Jahren mit dem Gefühl angenehmer Erlebnisse. Marienbad wirkte auf Wagners Zustand sehr wohltuend.

de ebenfalls in den Strudel der Ereignisse hineingezogen. Seine Sympathie war eindeutig auf der Seite derjenigen, die das Heil einer besseren Zukunft proklamierten.
ner-Biographien informieren. Nach nicht ganz drei Jahren verließ er das ungastliche Paris ohne Ruhm, ohne Geld, in großer Enttäuschung. Auch in seinen Briefen aus Paris erinnerte er sich an die idyllischen Augenblicke „in der lieben Töplitzer Geborgenheit“. Im März 1842, als sich schon der Tag seiner Rückkehr in die Heimat näherte, schrieb er, daß er es in Paris nicht mehr aushalte, und „außerdem erlegt mir der Gesundheitszustand meiner Frau auf, mich in diesem Jahr in die Töplitzer Bäder zu begeben, die allseits empfohlen werden“. Ende 1836 hatte er sich mit der Sängerin Minna Planer, die er in Magdeburg kennengelernt hatte, vermählt.
Diesmal kam er als armer Musikant mit seiner Frau Minna erneut nach Teplitz, und am 9. Juni 1942 fanden sie ganz am Rande von Schönau ein bescheidenes Quartier in der Eiche. Wagner wohnte mit seiner Gemahlin ohne besondere Bequemlichkeit, und dennoch fühlte er sich zufrieden, und nach den erlebten Mühen der vergangenen Jahre war er in der „anmutigen Töplitzer Einsiedelei“ sehr glücklich.

ne Anreise nach Teplitz-Schönau, Hotel Prince de Ligne (Zámecké náměstí 136); 19.00 Uhr dort Abendessen; anschließend zwei Dokumentarfilme über die Zeitzeugen Pater Benno Beneš SDB (1938–2020) und Hana Truncová/John (1924–2022).
Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Saubernitz (Zubrnice) im Böhmischen Mittelgebirge; dort Be-
Das bedeutete für Wagner aber vor allem, daß er sich allein und frei bewegen konnte, während sich seine Mutter mit Minna den täglichen Kurbädern widmete. Er trug in sich nämlich den Plan zu einem neuen Opernwerk und suchte eine Weile Konzentration und Inspiration in den tiefen Tälern der Berge und in der unendlichen Weisheit der Natur. Seine Gedanken kreisten um die Geschichte des Tannhäuser. Er kannte das Lied vom Tannhäuser aus dem 13. Jahrhundert und auch das Volkslied aus dem 16. Jahrhundert.
Der Tannhäuser wurde in dieser Zeit zu Wagners Leidenschaft und Fluch. „Es war eine verzehrende Erregung, die mir Blut und Nerven in fieberhafter Hitze hielt, als ich an der Skizze und den Kompositionen zum Tannhäuser arbeitete.“ Die Geschichte des Tannhäuser war in seinem Inneren schon früher gereift, als ihn eines Maientages ein längerer Ausflug aus Teplitz bis zum Ufer der Elbe führte.
Die Ruine der Burg Schrekkenstein auf einer schroffen Felsklippe fesselte ihn sofort, und seine weiteren Schritte führten ihn bis zu den Mauern der zerfallenen Burg. Hier blieb er in Gedanken tief versunken vor dem ergreifenden Ausblick auf den Fluß stehen, der ruhig in seinem breiten Flußbett dahin floß, umgeben von blühenden Hängen. Auf einer Anhöhe sang ein Hirte. Dieses Liedchen erweckt in dem Komponisten die Vorstellung von Pilgern, die im Tal vorüberziehen. Die romantische Lage der Burgruine mit ihrer geheimnisvollen Atmosphäre entsprach voll und ganz seinen schöpferischen Inspiratio-

sichtigung des Freilichtmuseums; anschließend Mittagessen in der Dorfgaststätte und Weiterfahrt nach Leitmeritz; von dort Schiffahrt auf der Elbe mit Kaffee und Kuchen nach Aussig; Rückfahrt zum Abendessen in der Teplitzer Brauereigaststätte Monopol. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt in die Königstadt Kaaden; dort Besichtigung des Franzikanerklo-
Am 18. Juli, voller Ungeduld nach Dresden getrieben, verließ Wagner Teplitz, „den Ort der ersten berauschenden Ausflüge meiner Jugend“. Er war überzeugt, daß die reine Luft und die Kurbehandlungen dazu beitrügen, die zerrüttete Gesundheit von Minna zu bessern, die er in Gesellschaft seiner Mutter in Teplitz zurückließ.
Wagner kehrte zu seinen Kapellmeisterpflichten nach Dresden zurück. Sobald es ihm die Zeit erlaubte, setzte er die Arbeit an seinem Tannhäuser fort. Es kam nur langsam voran, und so erhielt der Tannhäuser erst im Sommer 1844 in der ungestörten
Hier fand er ideale Bedingungen zum Ausruhen, und seinen Entschluß, sich diesmal den Kurbehandlungen ernsthaft zu unterziehen, meinte er ehrlich. Allerdings erwachte mit der Erholung auch sein Tatendrang. Die Arbeit an den „Meistersingern von Nürnberg“ ging ihm leicht von der Hand. Während weniger Tage war er mit dem Entwurf des Librettos fertig, das zum Abschluß die Bemerkung trug: „Marienbad, 16. Juli 1845“. Er verließ Marienbad am 9. August mit dem Gefühl
„Ja, wir erkennen es, die alte Welt, sie geht in Trümmer“, schrieb er im April 1849. Nach der Niederschlagung des Aufstands floh Wagner in eine lange Emigration in die Schweiz. Mit dem Abschied in die Emigration waren nun die Fäden seiner vertrauensvollen Beziehungen zu Böhmen zerrissen, die später in seinen Erinnerungen nur noch die Umrisse eines „gelobten Landes seiner romantischen Jugend“ enthielten. Nach Jahren fand seine Musik auch Anerkennung. Als berühmter Meister, mit einigen Gastkonzerten auch in Prag, vollendete er sein größtes Werk in Bayreuth, wo er sich 1872 niedergelassen hatte. Er sehnte sich danach, diese Wege im gelobten Land seiner romantischen Jugend noch einmal zu gehen, und wählte den sonnigen, noch warmen Herbstbeginn 1875. Am 14. September kam er von Karlsbad nach Teplitz. Ihn begleitet seine zweite Frau Cosima, die nun die Gegend und das Land kennenlernte, worüber sie so viel gehört hatte, und führte auch ihre Kinder mit.
Umgebung auf dem Lande seine musikalische Gestalt. Die Oper beendete er unter völliger Erschöpfung: „Ich hatte in die Arbeit mein ganzes Sein auf solch verzehrende Art gelegt, daß, je weiter ich mich dem Ende näherte, mich desto mehr die Befürchtungen überwältigten, es könne mich der nahe Tod daran hindern, das Werk zu vollenden. Bei den letzten Noten hatte ich das freudige Gefühl, als würde ich mich aus einer tödlichen Gefahr befreien.“
sters mit Mittagessen in der Klostergaststätte und Rundgang; anschließend Kranzniederlegung auf dem Friedhof am Denkmal für die Opfer des 4. März 1919; 19.00 Uhr festliches Konzert in der Schönauer Elisabethkirche; anschließend Abendessen im Wirtshaus. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienstmöglichkeit in der Dekanatskirche Johannes der
als habe er Flügel. Über Karlsbad und Teplitz fuhr er nach Aussig, wo er auf ein Schiff umstieg und so seinen Weg nach Dresden fortsetzte.
Die weiteren Jahre nach der Rückkehr aus den böhmischen Bädern waren von der Kapellmeistertätigkeit und Wagners eigener schöpferischer Arbeit erfüllt.
Die revolutionären Gedanken des Jahres 1848 beherrschten die deutschen Städte und machten auch keinen Bogen um die sächsische Metropole. Wagner wur-
Täufer am Schloßplatz und eigene Heimreise. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag inklusive drei Übernachtungen, Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, allen Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen, Schiff und Konzert pro Person im Doppelzimmer 435 Euro, im Einzelzimmer 520 Euro. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rech-
In Teplitz stiegen sie im Hotel Zum König von Preußen ab, wo Wagner sorglose und heitere Zeiten mit seinem Freund Apel verbracht hatte. Wie bescheiden kam ihm nun das einstmals so vornehme Kurhotel vor. Praktische Erwägungen mußten der Sentimentalität weichen, und Wagner zog aus dem unzulänglichen Preußischen König in das gegenüber liegende Kaiserbad, das erst kürzlich errichtet worden war. Es folgten noch einige Tage in Prag.
Sein letzter Weg nach Karlsbad, Teplitz und Prag im Jahre 1875 beschloß das Kapitel von Wagners persönlichen Beziehungen zum böhmischen Land, Beziehungen mit reichen Erlebnissen und Anregungen. Und das ist wohl nicht wenig. Am 13. Februar war Richard Wagners 140. Todestag.
nung. Verbindliche Anmeldung bis Sonntag, 30. Juni, durch Überweisung des Reisepreises auf das Konto Erhard Spacek – IBAN: DE35 7008 0000 0670 5509 19, BIC: DRESDEFF700. Bitte Anschrift und Namen der Reiseteilnehmer angeben, sonst Mitteilung mit diesen Angaben an eMail spacek@teplitz-schoenaufreunde.org
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergHEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ
 Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Hostaus Pfarrer – Teil XXIII





Pfarrer Peter Steinbach
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der zehnte Teil über den Dechanten Peter Steinbach (1843 –1917).
❯ Die Geschichte der Schulen in Ronsperg – Teil IV
Appetithäppchen
auf dem Boden des Kosterhofs
Der vierte Teil der Serie über die Schulen in Ronsperg befaßt sich weiter mit der Bürgerschule.
Einweihung der neuen Bürgerschule
Die neue Klosterbürgerschule in Ronsperg sollte im Herbst 1937 eingeweiht werden. Ich war damals Zögling im Kloster Ronsperg; so konnte ich aus nächster Nähe den Aufbau der Schule erleben. Die eigentlichen „Bauherrn“ der neuen Schule waren unsere Ordensfrauen Schwester Oberin Leokadia und Schwester Direktorin Febronia. Dank deren intensiven Bemühens kam es zum Bau dieses herrlichen Schulgebäudes, das damals einmalig im ganzen Landkreis, ja in Westböhmen war.


Gut konnte man beobachten, wie sehr diese Schwestern unermüdlich den Bau vorantrieben. Da kamen die Architekten, und unsere Ordensfrauen planten und schufen mit an diesem Werk zum Wohle der Bevölkerung Ronspergs und der ganzen Umgebung. Endlich war es so weit.

Die sonst so beschauliche Ruhe im Kloster war schon Tage vorher unterbrochen. Aufgeregt harrte man des großen Tages der Einweihung. Mit unserer Erzieherin Schwester Annunziata, einer Handarbeitslehrerin, sammelten wir Tage vor dem Fest in Kleinseimlowitz bei den Bauern Eier, Rahm und Milch; denn zum Einweihungsfest sollten die Schmierkuchen nicht fehlen. Die Semlowitzer Bauern gaben recht gern, und im Kloster wurde gebacken und alles für den großen Tag vorbereitet.

Am Vorabend kamen die hohen Ordensfrauen, Schwester Generaloberin aus Prag und eben alles, was Rang und Namen hatte. Auch staatliche und geistliche Würdenträger waren geladen. Es war ein sonniger Sonntag. Unzählige Menschen waren anwesend. Vor dem Kloster wurden das Hochamt zelebriert und festliche Reden gehalten. Wir Klosterschülerinnen trugen am Festtag weiße Schürzen und Häub-
chen und boten am Festplatz vor dem Kloster Appetitbrötchen an.
Heiß brannte die Sonne vom Himmel, dicht standen die Menschen im Klosterhof und auf der Straße bis zum Schloßaufgang. Mit meinem Tablett ging ich durch die Menge und – o Schreck – von irgend einer Seite wurde ich gedrückt und gestoßen, und da ich keine geübte Servierkraft war, fiel das Tablett mit den gemischten Salat- und Wurstbrötchen auf den Boden. Diesen Schrecken werde ich nie vergessen! Schwester Annunziata war unser gestrenger Feldwebel, wie wir sie nannten, und inmitten der Feststimmung bekam ich es mit der Angst zu tun. Aber sie hatte Verständnis. Und so blieb mir dieser Tag doch in guter Erinnerung.
Anni Kuhn-Fünffinger
Berufsschulen

Die Gewerbliche Fortbildungsschule wurde um 1900 ge-




gründet. Der Unterricht wurde an verschiedenen Abenden und am Sonntagvormittag erteilt, und zwar von Handwerksmeistern und Volksschullehrern, die sich in Fortbildungskursen die Kenntnisse für diesen berufskundlichen Unterricht erworben hatten.
1913 lehrten hier Oberlehrer Franz Leberl als Leiter der Schule und die Lehrer Wilhelm Kurt und Karl Pauli. Den Schulausschuß

sperg die Kreisberufsschule errichtet. Leiter war von 1939 bis 1942 der Diplomingenieur Fritz Hell und nach dessen Einberufung zum Kriegsdienst Zimmermeister Beck.
Die landwirtschaftliche Berufsschule
Nach 1938 wurde auch eine Landwirtschaftliche Berufsschule errichtet. Sie unterstand zunächst dem Rektor der Volksschule, bis 1942 Johann Gröbner die Leitung übernahm. Die Knaben, zwei Klassen, hatten Unterricht in der Volksschule, die Mädchen, meist zwei, einmal sogar drei Klassen, wurden in den Räumen der neuen Bürgerschule unterrichtet. Einzugsgebiet der Schule war der Gerichtsbezirk Ronsperg, nur die Ortschaften in der Nähe von Waier gingen dort zum Unterricht.
Spitzenklöppelschule
der Gewerblichen Fortbildungsschule bildeten damals Bürgermeister Franz Reitmeier, Vorsitzender; Ignaz Heidl, k. k. Notar, Vertreter der Stadt; Friedrich Till, Forstmeister, Vertreter des Landesausschusses; Josef Reitmeier, Vertreter der Handelskammer; Josef Roth, Vertreter der Genossenschaft.
Wegen der zentralen Lage und weil in der freigewordenen tschechischen Schule in Bahnhofsnähe auch ein entsprechendes Gebäude zur Verfügung stand, wurde nach 1935 in Ron-
Segensreich war auch das Wirken der Spitzenklöppelschule. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Ronsperg einen königlich kaiserlichen Spitzenkurs, den Stanislava Javourek leitete. Zuletzt wurden in drei Klassen Mädchen jeden Alters in die Kunst des Spitzenklöppelns eingeweiht. Die Unterrichtsräume lagen in der ehemaligen Filzschuhfabrik und im Hause von Franz Reitmeier neben der Fawa-Bruck. Als langjährige Lehrerinnen sind noch bekannt Hedwig Modritsch, geborene Fleischmann und verwitwete Gröger, Rosa Kolitsch und Fräulein Baumgärtl.
Kindergarten
Bereits um die Jahrhundertwende betreuten die Barmherzigen Schwestern neben der Volksschule für Mädchen eine Kinderbewahranstalt, wie damals der Kindergarten hieß. Nach dem Bau der neuen Bürgerschule hatte der Kindergarten auch hier schöne, sonnige Räume mit einem separaten Eingang erhalten.
 Franz Bauer Heinrich Cenefels
Franz Bauer Heinrich Cenefels
7 3.
Der Budweiser Bischof Josef Řiha bestimmt weiter, daß in Kirchen mit mehreren Priestern um Mitternacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar nur eine heilige Messe gefeiert werden darf. Im Jahr 1900 findet sich nur ein Eintrag im Memorabilienbuch. Es werden im November Reparaturen am Altar der Schmerzhaften Muttergottes für 98 Gulden 40 Kreuzer vorgenommen.

SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA



26 BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG
Jedoch ist ein allgemeiner, in lateinischer Sprache abgefaßter Brief Steinbachs vom 15. Oktober 1900 im Pfarrarchiv erhalten geblieben. Gleich zu Beginn erklärt er seine Absicht. Er will das Nachfolgende für die Nachwelt bewahren, da es sonst keine anderen schriftlichen Quellen gibt. So beschreibt er, auf wessen Patrozinium die Kirche geweiht ist, wie viele Katholiken die Seelsorger zu betreuen haben, welches Personal zur damaligen Zeit in der Dechantei tätig
ist, und er berichtet von den baulichen Veränderungen seit dem Neubau der Kirche nach dem großen Brand. Er bestätigt ferner, daß die ihm anvertraute Herde in Hostau keinen Grund zur Klage gibt, und verweist auf die erfolgreiche Volksmission von 1894. Dann beschreibt er noch den großen Brand und bittet abschließend seine Leser um deren Hilfe, seiner bei der Meßfeier und in Gebeten zu gedenken. Für die Dechanteikirche werden im Jahr 1901 vier vernickelte Leuchter für 37 Gulden ein Kreuzer bei der Hanauschen Eisengießerei in Komotau angeschafft. Im August werden zwei Doppelarmleuchter, von denen jeder sieben Öllampen enthält, bei Schlossermeister Karl Hiltwein für 16 Gulden bestellt. Diese Leuchter werden bei der Anbetung des Allerheiligsten am Hochaltar und zur Beleuchtung der Lourdes-Grotte bei den Maiandachten verwendet. Am 17. September 1901 werden die beiden Beichtstühle von Tischlermeister Adam Wohlrab für fünf Gulden neu angestrichen. Am 1. Juli 1901 kommt es zu starken Gewittern mit heftigem Regen, die sich am Abend entladen. Fortsetzung folgt
TERMINE
■ Freitag, 9. Juni, Heiligenkreuz: 14.00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Pfarrer Klaus Oehrlein von der Rosenmühle in Rosendorf; anschließend Begegnung „Unterm Dach“ im Pfarrgarten bei Schmierkuchen und Getränken. Auskunft: Peter Gaag, Fridinger Straße 8, 70619 Stutt-

JOHANNES von Schüttwa (von Tepl, von Saaz)
gart, Telefon (07 11) 4 76 07 22, Telefax (07 11) 4 76 07 26, eMail heiligenkreuz@t-online.de ■ Samstag, 3. Juni, Schüttwa: 14.00 Uhr 775-Jahr-Feier im Dorfpark, Programm ➝ unten. Auskunft: Ivo Dubsky vom Nikolausverein, eMail i.dubsky@ volny.cz




3. 6. 2023


Šitboř (Schüttwa)

Heimatbote für
den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


❯ Chronik der Volksschule Godrusch 1935 bis 1944 – Teil III
Blühender Flieder ziert Benešs Portrait

Der dritte Teil der Chronik befaßt sich weiter mit dem Schuljahr 1936/37.
Schulfeier zum 28. Oktober
Die Schulfeier anläßlich des Staatsfeiertages fand bereits in den Vormittagsstunden des 27. Oktobers statt. Um 12.00 Uhr mittags schloß sodann der Unterricht. Auf dem Schulgebäude wehte ab 10.00 Uhr vormittags die Staatsfahne, und das Klassenzimmer hatte zur Feier Festschmuck angelegt.
Das Programm bestand aus einem Lied, der Festansprache „Zum Geburtstage unseres Staates“ des Klassenlehrers, der Huldigung des Staates, dem Rezitieren von Gedichten und der Staatshymne. Anschließend hörten die Kinder den deutschen Schulrundfunk in Prag zum Staatsfeiertag mit Fanfaren, Ansprache des Ministers Franz Spina, der sinfonischen Dichtung „Moldau“ von Friedrich Smetana, der Schilderung „Der 28. Oktober 1918 in Prag“, der Huldigung der Staatsflagge und der Staatshymne.
Jugendfürsorge
Die Ortssammlung für Kinderschutz und Jugendfürsorge im Monate Oktober ergab einen Betrag von 16,50 Kronen. Er wurde der Bezirksjugendfürsorge überwiesen.
Weltspartag
Anläßlich des Weltspartages am 31. Oktober wurden die Schüler in der Stunde für Bürgerkunde über den Wert des Sparens und die Bedeutung dieses Tages eingehend aufgeklärt.
Gedenkfeier
Der 100. Todestag des Dichters Karel Hynek Mácha wurde im Rahmen einer Gedenkfeier den Schülern in Erinnerung gebracht. Bei dieser Gelegenheit wurden sie mit dem Lebenslaufe des Dichters und seinen wichtigsten Werken vertraut gemacht.
Weltfriedenstag
Der deutsche Schulrundfunk in Prag brachte anläßlich des Weltfriedenstages die Sendung „Zum Weltfriedenstag“, in welcher der Außenminister unseres Staates, Kamil Krofta, zu den Schulkindern sprach und ihnen die Bedeutung des Friedens für Menschheit und Zivilisation darlegte. Die Ansprache des Ministers gab in der anschließenden Nachbesprechung Gelegenheit, die Friedensidee in allen Kinderherzen zu fördern und zu vertiefen.
Inspektion
Die Inspizierung der hiesigen Schule durch Bezirksschulinspektor Franz Präger fand am 17. November vormittags statt.
Er äußerte sich über den Gesamteindruck der Schule wieder sehr lobend.
Weihnachtsferien
Die Weihnachtsferien begannen am Dienstag, den 22. Dezember um 12.00 Uhr mittags und endeten am 3. Jänner 1937. Der regelmäßige Unterricht beginnt wieder Montag, den 4. Jänner 1937.
Schulfeier zum 7. März
diesjährige Wahlspruch eingehend erklärt und erläutert.
■ Samstag, 10. Juni, 18.00 Uhr, Haid: Eröffnung des Musiksommers in der Dekanalkirche Sankt Nikolaus mit einem großen Chor- und Orchesterkonzert.
Franz Spina kam am 5. Oktober 1868 in Markt Türnau im Schönhengstgau zur Welt und war einer der vier deutschen Minister in der Ersten Tschechoslowakischen Republik.
Franz Spina beherrschte bereits als Kind neben seiner deutschen Muttersprache die tschechische Sprache. Er besuchte die utraquistische Volksschule in seinem Heimatort und wechselte 1879 über in das Piaristengymnasium in Mährisch Trübau, welches er 1887 mit der Matura abschloß. In Wien studierte er zunächst Germanistik, Altphilologie und Philosophie. 1888 immatrikulierte er sich an der KarlFerdinands-Universität mit dem Berufsziel Mittelschulprofessor. Zugleich wurde er 1889 Mitglied der Burschenschaft Constantia, die in der Münchener Burschenschaft Sudetia aufgehen sollte. Er legte 1892 die Lehramtsprüfung in Deutsch, Latein und Griechisch ab. 1901 wurde er zum Dr. phil. promoviert. Er hatte Anstellungen in Braunau im Riesengebirge und Mährisch Neustadt, von 1901 bis 1905 war er Gymnasialprofessor in Mährisch Trübau. 1906 erfolgte die Berufung zum Lektor für die tschechische Sprache an der Deutschen Universität in Prag. Es folgte 1909 die Habilitation für die tschechische Spra-
Semesterferien
In der letzten Vormittagsstunde des 30. Januar 1937 ging das erste Halbjahr zu Ende. Die Schulnachrichten wurden mit diesem Tage datiert und verteilt.
Gedenkfeier
Im Sinne des Landesschulratserlasses vom 27. Januar 1937 wurde am Mittwoch, den 10. Februar 1937 in der letzten Vormittagsstunde eine Gedenkfeier anläßlich des 100. Todestages des russischen Dichters Alexander Sergejewitsch Puschkin [* 6. Juni 1799 in Moskau, † 10. Februar 1837 in Sankt Petersburg] abgehalten. Die Kinder der Oberstufe wurden mit seinem Lebenslauf und einigen seiner bedeutenden Werke bekannt gemacht.
Die im Rahmen der Osterfeiern durchzuführende Reinlichkeitswoche fand an der hiesigen Schule vom 14. bis 20. März statt.
Tag des Buches
Franz Spina und Emil Franke
che. Spina verfaßte zahlreiche Publikationen über die Kulturgeschichte Böhmens. Von 1929 bis 1938 war er Redakteur der Slawischen Rundschau.
In der Ersten Tschechoslowakischen Republik wurde er 1920 als Abgeordneter vom Bund der Landwirte (Tschechoslowakei) (BdL) in das tschechoslowakische Parlament gewählt. 1926 wurde er zum Minister für öffentliche Arbeiten berufen. 1936 erfolgte eine erneute Berufung zum Minister ohne Geschäftsbereich. Er starb am † 17. September 1938 in Prag.
Emil Franke kam am 3. April 1880 in Großpriesen bei Aussig zur Welt und war Minister in verschiedenen Regierungen der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit.
Emil Franke studierte Jura und Philosophie mit Promotion in Prag, Wien und Berlin. Ab 1917 engagierte er sich in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Partei, vormals Tschechische Volkssozialistische Partei, in der er sich auch an der Ausarbeitung des Parteiprogramms beteiligte und 1918 bis 1939 Stellvertretender Vorsitzender war.

Von 1918 bis 1939 war er Abgeordneter für die Sozialistische beziehungsweise später Volkssoziale Partei in mehreren Vertretungen: 1918 in der Revolutionären Nationalversammlung, 1920 in der neu gewählten regulären Nationalversammlung der Tschechoslowakei. Sein Man-
Anläßlich des 87. Geburtstages des Präsident-Befreiers Tomáš G. Masaryk fand in den Vormittagsstunden des 6. März eine würdige Schulfeier statt. Auf dem Schulgebäude wehte ab 8.00 Uhr früh die Staatsfahne, und das Klassenzimmer hatte Festschmuck angelegt. Den Schülern wurde Gelegenheit geboten, die außerordentliche Rundfunksendung mit der Festrede des Ministers Franz Spina anzuhören. Anschließend fand die Schulfeier statt, in der der Klassenlehrer den Lebenslauf unseres Alt-Präsidenten schilderte. Im Chorsprechen brachten sodann die Schüler ihre Glückwünsche dar. Mit dem Absingen der Staatshymne fand die Schulfeier ihr Ende. Der Unterricht wurde um 12.00 Uhr mittags geschlossen.

Osterfrieden
des Roten Kreuzes
Das Tschechoslowakische Rote Kreuz veranstaltet heuer seine üblichen Friedens-Osterfeiern unter dem Motto „Im Frieden Wachsamkeit“. Den Kindern wurde neuerdings Zweck und Bedeutung des Tschechoslowakischen Roten Kreuzes vor Augen geführt und besonders der
● „Wegweiser für Lehrer, Schulleiter und Ortsschulräte“ von A. Felbinger, A. Sladek und A. Stepan.
P ngstferien
Die Pfingstferien begannen diesjährig am Freitag, den 14. Mai 1937, mittags um 12.00 Uhr und endeten am Dienstag, den 18. Mai. Der regelmäßige Unterricht begann wieder am Mittwoch, den 19. Mai.
Schulfeier zum 28. Mai
■ Sonntag, 18. Juni, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
■ Samstag, 1. Juli, 10.00 Uhr, Altzedlisch: 33. Heimatgottesdienst des Kirchsprengels, anschließend Treffen im Pfarrhaus.
dat behielt er auch nach den Parlamentswahlen 1925, 1929 und 1935 bis zur Auflösung des Parlaments 1939.
Von September 1919 bis Mai 1920 war er kommissarischer Eisenbahnminister in der Regierung Vlastimil Tusar I.
Von Oktober 1922 bis Dezember 1925 war er Minister für die Versorgung, von Februar 1924 bis Dezember 1925 Postminister und von Juli 1925 bis Dezember 1925 Minister für Soziales in der Regierung Antonín Švehla I.

Von Dezember 1929 bis Oktober 1932 war er Postminister in der Regierung František Udržal II.
Von Oktober 1932 bis November 1935 war er Postminister in den Regierungen Jan Malypetr I, II und III.
Von November 1935 bis Januar 1936 war er Postminister in den Regierungen Milan Hodža I und II. Von Januar 1936 bis Juli 1937 war er Schul- und Bildungsminister, von März 1936 bis Juli 1937 kommissarischer Finanzminister in der Regierung Hodža II. Von Juli 1937 bis September 1938 war er Schul- und Bildungsminister und von Juli bis Oktober kommissarischer Finanzminister in der Regierung Milan Hodža III.
Emil Franke starb am 1. Dezember 1939 mit 59 Jahren in Prag.
Am 22. März fand der Tag des Buches an der hiesigen Schule seine verdiente Würdigung. Die Aufklärung, die Schuljugend und Elternschaft umfaßte, erstreckte sich auf gute Jugendlektüre, richtiges Lesen und richtige Verwertung des Lesegutes sowie den Kampf gegen schlechte und schädliche Einflüsse der schlechten Jugendliteratur.
Osterferien
Die Osterferien beginnen dieses Jahr am Dienstag, den 23. März, mittags um 12.00 Uhr und enden am Dienstag, den 30. März. Der regelmäßige Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, den 31. März.
Anscha ungen
Aus den Mitteln des Ortsschulrates wurden für die Lehrerbibliothek angeschafft:
● „Schule und Völkerversöhnung“ von Josef Hudl,
Anläßlich des 53. Geburtstages des Staatspräsidenten Edvard Beneš fand in den Vormittagsstunden des 28. Mai eine eindrucksvolle Schulfeier statt. Das Schulgebäude war mit der Staatsfahne geschmückt, und im Klassenzimmer war das Bild des Präsidenten von blühendem Flieder umrahmt. Der Klassenlehrer schilderte in einem Vortrag die großen Verdienste, die sich Präsident Edvard Beneš während seiner Amtszeit sowohl für Staat als auch für sein Volk erworben hat.
Anschließend übermittelten hierauf die Schüler in einem Sprechchor die innigsten Glückwünsche ihrem Staatsoberhaupt. Das Absingen der Staatshymne beschloß die Feier. In der letzten Vormittagsstunde wurde dann den Schülern Gelegenheit geboten, die außerordentliche Schulfunksendung zu hören, in der unser Schulminister Emil Franke die Persönlichkeit des Präsidenten der Republik würdigte.
Schulschluß
Das Schuljahr 1936/37 endete am Samstag, den 26. Juni 1937. An diesem Tage wurden auch die Schulnachrichten und Entlassungszeugnisse verteilt.
Entlassungen

Mit Ende des Schuljahres wurden drei Knaben und zwei Mädchen aus der Schule entlassen: Franz Leyerer aus Kleinmaierhöfen, Johann Marka aus Godrusch, Josef Wenisch aus Kleinmaierhöfen, Anna Reisser aus Kleinmaierhöfen und Marie Wartha aus Kleinmaierhöfen.
Einschreibungen
Die Schülereinschreibungen für das Schuljahr 1937/38 fanden am 28. und 30. Juni statt. Eingeschrieben wurden 36 Kinder, zwölf Knaben und 24 Mädchen. Neueintretende sind ein Knabe und ein Mädchen.
Schulbesuch
Die Schüler besuchten im Schuljahr 1936/37 96,32 Prozent des gesamten Schulunterrichts, in 3,68 Prozent des Unterrichts fehlten Schüler entschuldigt, in 0 Prozent fehlten Schüler unentschuldigt. Geschlossen und gefertigt: Ludwig Sporer, Oberlehrer.
Auskunft: Sieglinde Wolf, Wettersteinstraße 51, 90471 Nürnberg, Telefon (09 11) 81 68 68 88, eMail si.wolf@web.de
■ Sonntag, 16. Juli, 15.00 Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Peter Fořt spricht deutsch, Telefon (0 04 20)
7 24 20 47 02.
■ Sonntag, 20. August, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com
■ Freitag, 1. bis Sonntag, 3. September: 33. Heimatkreistreffen in Weiden in der Oberpfalz. Programm folgt in Kürze.
■ Samstag, 9. September, Haider Loretofest: 11.00 Uhr Fußwallfahrt ab Waidhauser Pfarrkirche Sankt Emmeram; 17.00 Uhr Rucksackverpflegung in Haid; 19.00 Uhr deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com ■ Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
■ Tachau. Am 14. Mai starb Margareta Axmann mit 96 Jahren im bayerisch-schwäbischen Türkheim. Sie war am 2. Juli 1926 in Tachau zur Welt gekommen. Im Zuge der Vertreibung strandete sie schließlich in Türkheim. Hier war sie lange Jahre Rektorin der Grundschule. 1975 gründete sie den Förderkreis Türkheim für mehr Kunst, Kultur, Natur und Bildung. 1978 bis 1990 war die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande Zweite Bürgermeisterin. Ihrem Cousin Wilhelm Glasauer und ihrer Nichte Renate Glasauer gilt unser Beileid.

Heimatblatt für die Kreise Hohenelbe und Trautenau
Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. – 1. Vorsitzende: Verena Schindler, Telefon 0391 5565987, eMail: info@hohenelbe.de, www.hohenelbe.de – Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. – 1. Vorsitzender Wigbert Baumann, Telefon 0931 32090657 – Geschäftsstelle Riesengebirgsstube (Museum-Bibliothek-Archiv), Neubaustr. 12, 97070 Würzburg, Telefon 0931 12141, eMail: riesengebirge-trautenau@freenet.de – www.trautenau.de – Redaktion: Karin WendeFuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Telefon 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: Riesengebirgsheimat@t-online.de – Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Erscheinungsmonats.
� Spindelmühle
Vom 10.04. - 15.04.2023 besuchten wir wieder einmal Spindelmühle im Riesengebirge. Vom Wetter her war es eine sehr durchwachsene Woche – Sonnenschein, Sturm, Schneefall –typisches Riesengebirgeswetter eben. Auf Grund der Nebensaison war es sehr ruhig in Spindelmühle, kaum Touristen, viele Gasthäuser hatten geschlossen.

Das Geheimnis der Versöhnung ist die Erinnerung
mindestens 36 Toten. Auch mein Großvater, Schuhmachermeister Gustav Exner, war unter den Opfern. Hier stellten wir ein Lichtlein auf und beteten ein stilles Vaterunser im Gedenken an die Toten.
� Heimatkreis Hohenelbe


Das 61. Bundestreffen und das 29. Wiedersehensfest der Riesengebirgler aus Arnau und Umgebung findet am 16. und 17. September 2023 in Bensheim an der Bergstraße statt.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Patenstadt und bitten alle Landsleute und Heimatfreunde, sich diesen wichtigen Termin vorzumerken.
Stellvertretend für den Vorstand: Verena Schindler, 1. Vorsitzende
Wir ließen uns aber vom Wetter nicht abhalten und unternahmen Wanderungen zur neuen Peterbaude, besuchten Hohenelbe und Starkenbach und selbstverständlich auch das Denkmal für die im Mai und Ju-

� 73. Sudetendeutscher Tag
Die „Heimatlandschaft Riesengebirge“ mit ihren Heimatkreisen Braunau, Hohenelbe und Trautenau nimmt wieder gemeinsam mit dem Begegnungszentrum
Trautenau (Centrum setkávání Trutnov) am Sudetendeutschen Tag in Regensburg teil.
Der große Erfolg im letzten Jahr, als wir von der Nachwuchsgeneration unserer Heimatkreise zum ersten Mal einen Informationsstand auf die Beine stellten, und sogar mit einem der größten Stände vertreten waren, bestärkt uns, auch heuer wieder mit viel Optimismus und Vorfreude zu organisieren und anzupacken. Gemeinsam mit dem Team des Begegnungszentrums Trautenau rund um seine engagierte Geschäftsführerin
Štěpánka Šichová werden wir wie 2022 das Riesengebirge wieder
� Zur Nachahmung empfohlen!
ni 1945 bei der Vertreibung von der Partisanengruppe Nikolaj ermordeten Männer. Der Granitstein mit der Aufschrift „Ruht in Frieden“ wurde 2015 am Veraweg aufgestellt, vermutlich an der Stelle des Massengrabes mit
Das Riesengebirge präsentiert sich wieder auf dem Sudetendeutschen Tag
72. Sudetendeutscher Tag 2022. Mit Zylinder Erik Buchholz, 1. Vorsitzender Braunau. Vierte von links Kirsten Langenwalder (Pressereferentin HK Hohenelbe), rechts daneben Štepánka Šichová (Geschäftsführerin BGZ Trutnov), dahinter Wigbert Baumann (1. Vorsitzender HK Trautenau).
Stammtisch-Treffen für alle Interessierten im Großraum München

Anfang 2023 entstand die Idee, Anfang März fand er bereits statt: Ein Stammtisch für alle Interessierten rund ums Sudetenland, organsiert von Kirsten Langenwalder aus der Nachwuchsgeneration des Heimatkreises Hohenelbe.
Nun fand das Treffen am 2. Mai bereits zum dritten Mal statt, diesmal wieder im „Brünner Eck“ in München-Neuhausen, wo sich elf Nachkommen aus dem Adlergebirge, Altvatergebirge, Egerland, Elbetal, Erzgebirge, Kuhländchen und Rie-
sengebirge einfanden. Es ergaben sich wieder interessante Gespräche rund um die verlorene Heimat der jeweiligen Vorfahren. Der Stammtisch, der einmal im Monat stattfindet, bietet die Gelegenheit, sich im realen Leben zu vernetzen. Jeder ist herzlich dazu eingeladen – aus jedem Heimatbezirk, in jeder Altersgruppe! Gerne darf auch jemand mitgebracht werden.

Informationen zu Ort und Zeit sind über den Heimatkreis Hohenelbe zu erfragen: Tel. 08342 95545 (ggf. Anruf-
Auch oben in Krausbauden waren wir. Am Wegekreuz und am Glockenturm dachten wir dankbar an den Einsatz der vielen Menschen in Krausebauden und Spindelmühle, die an der Wiederherstellung dieser beiden Objekte mitgewirkt haben. Natürlich erinnerten wir uns auch an die schönen Heimattreffen vergangener Jahre. Schweren Herzens und mit dem Riesengebirgslied im Radio fuhren wir am Samstag wieder heim, mit der Gewißheit, bald wieder dort zu sein – im schönen Riesengebirge.
Dirk und Carmen Schulze HOB Spindelmühle-Friedrichstalmit einem großen Informationsstand präsentieren.
Mit Štěpánka sind wir freundschaftlich verbunden und sehr froh, daß sie uns bei vielen grenzübergreifenden Anfragen und Problemen hilft.
Die Besucher erwartet viel Informatives, Mundartliches und Humorvolles aus Rübezahls Reich; auch wer sich für Familienforschung interessiert, wird an unserem Stand fündig.
Wir freuen uns auf regen Besuch, viele interessante Gespräche und zahlreiche Begegnungen – generationsübergreifend!
Treffpunkt:
73. Sudetendeutscher Tag, 26.28.05.2023, Regensburg, DonauArena, Aktionshalle, Standnummern F01, F03, F05 und F07.
Kirsten Langenwalder Rochlitz - München
� Der Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. gratuliert Zum 80. Geburtstag von Vorstandsmitglied Gudrun Bönisch
Am 17. Mai feierte unser langjähriges Mitglied Gudrun Bönisch, Heimatortsbetreuerin von Kottwitz und Kassenprüferin im Vorstand, ihren 80. Geburtstag. Gudrun stammt aus dem Allgäu. Ihren Beruf als Lehrerin hat sie mit Begeisterung ausgeübt. Sie war bei der Lehrer- und Schülerschaft sehr beliebt und hat noch im Ruhestand Deutschunterricht erteilt.

Im Jahr 2009 hat Gudrun nach dem plötzlichen Tod ihres lieben Mannes Leopold Bönisch, gebürtig aus Kottwitz, die Ortsbetreuung von Kottwitz und das Amt der Kassenprüfung im Heimatkreis übernommen und beide Ehrenämter nahtlos weitergeführt. Das beliebte Gemeindetreffen in Weimar-Possendorf sowie das Kirchenfest St. Peter und Paul in Kottwitz wurden unter ihrer Regie ebenfalls zu einem Erfolgserlebnis für die Alteinwohner und Heimatfreunde. Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort engagierte sie sich zudem für die traditionsreiche Brünnl-Wall-
� Arnau
beantworter-Ansage beachten) oder info@hohenelbe.de Berichte unter www.hohenelbe.de/ „Die Nachwuchsecke“.
Kirsten Langenwalder, Rochlitz - München
Pressereferentin HK Hohenelbe
Foto: Peter Stächelin
fahrt in Ketzelsdorf. Auch in diesem Jahr steht der Besuch des Gottesdienstes am 1. Juli in der Kirche Maria Brünnl mit auf dem Programm des Heimattreffens in Kottwitz. Der Heimatkreis und sein Vorstand danken der Jubilarin für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr großartiges Engagement. Wir wünschen Gudrun noch viele schöne Jahre bei guter Gesundheit und weiterhin viel Schaffenskraft und Freude an der Heimatarbeit. Verena Schindler
1. Vorsitzende Bärbel Hamatschek
3. Vorsitzende und Sprecherin der Heimatortsbetreuer
Nachruf auf Gert Matzer
Am 18.03.2023 verstarb in Bensheim Herr Gert Matzer, geb. am 29.10.1942 in Mittellangenau.
Gert Matzer gehörte viele Jahre lang dem Arbeitskreis Arnau an und war auch Mitglied im Deutsch-Tschechischen Freundschaftskreis. Er hatte für die Anliegen der Arnauer stets ein offenes Ohr und hat sie nach seinen Möglichkeiten unterstützt. Er besuchte auch einige Male Arnau
� Ochsengraben HOB gesucht!
Wir bedanken uns bei Helmut Pittermann für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit als HOB vom Ochsengraben. Wir bedauern sehr, daß er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen muß und wünschen ihm alles Gute! Gleichzeitig suchen wir dringend einen Nachfolger. Bitte meldet Euch bei mir!
Bärbel Hamatschek
Sprecherin der HOB, 3. Vorsitzende des HKH Meisenweg 16, 35066 Frankenberg, Tel. 06451 9134.
(Hostinné) und hat die Gründung der Partnerschaft zwischen Bensheim und Arnau befördert. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Roswitha und den Angehörigen.
Verena Schindler
1. Vorsitzende Christian Eichmann
Ehrenvorsitzender und Sprecher AK Arnau
TERMINE
Niederhof 01.07.2023: Weihe Statue Hl. Joseph und Gemeindetreffen
Kottwitz 02.07.2023: Kottwitzer Treffen
Heimatkreis Hohenelbe 16./ 17.09.2023: Bundestreffen des Heimatkreises Hohenelbe

In diesem Jahr feiert die Gemeinde Radowenz, heute Radvanice, sein 1000-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlaß wünschen wir dem Bürgermeister T. Nemec viel Erfolg für die Zukunft!
Die „Trautenauer BezirksKunde“ von 1901 besagt, daß Radowenz im Jahr 1023 gegründet wurde. Einer Legende nach soll der Name Radowenz von einem Radmacher namens Wenzel abgeleitet sein. Auf dem Ortswappen befinden sich eine Fichte und ein Rad.
Tausend Jahre Radowenz
gefördert wurden. Nach der Vertreibung 1946 wurde die „Důl Kateřina“ verstaatlicht, 1952 erhielt sie den Namen „Důl Stachanov“ und wurde unter die Verwaltung der Joachimsthaler Uranbergwerke gestellt.
Nach der Wende erwies sich der Steinkohlebergbau im Schatzlarer Revier nicht mehr konkurrenzfähig. Die letzte Steinkohle wurde 1994 gefördert. Insgesamt konnten der Grube 13 Mio. Tonnen Steinkohle entnommen werden.

� Heimatkreis Trautenau
78. Heimatkreistreffen:
Samstag, 15. Juli 2023 und Sonntag, 16. Juli 2023
Der Samstag mit der Mitgliederversammlung wird wie im letzten Jahr rund um die „Riesengebirgsstube“ in Würzburg, Neubaustr. 12, stattfinden. Für den Sonntag ab 12:00 Uhr ist der Nebenraum von Schusters „Zur Zeller Au“ wie beim letzten Mal gebucht.
Wigbert Baumann 1. Vorsitzender Heimatkreis Trautenau
� Bernsdorf -Berggraben
Autobahnbau
Günter Fiedler teilte mir Mitte März mit, daß die Trasse der zukünftigen Autobahn von der polnischen Grenze über Königshan, Bernsdorf und Goldenöls zurzeit ausgepflockt und die Bäume und Sträucher gerodet werden (Anmerkung: = Teil der Autobahnverbindung von Königgrätz nach Breslau https:// de.wikipedia.org/wiki/Europastraße_67)). Mit etwas Zeitvorsprung werden die ersten drei
� Großaupa I, II, III - Petzer
Kolorierte Ansichtskarte
Das Dorf liegt im Tal des Baches Jibka (Jívka) an der von Trautenau über Petersdorf, Qualisch nach Ober Wernersdorf führenden Straße und grenzt an den Bezirk Braunau (heute Nachoder Bezirk). Höchster Berg im Umkreis ist der Hexenstein (738 m) mit seinen zwei Gipfeln, der sich im Habichtsgebirge erhebt. Seit 2020 ermöglicht der neue
Geschichte: Die erste urkundliche Erwähnung von Radowenz stammt aus dem Jahr 1607. 1790 bestand der Ort aus 61 Häusern. 1834 befanden sich dort bereits 123 Häuser mit 814 Einwohnern. Im Ort gab es eine Schule, ein Jägerhaus, drei Leinwandbleichen, zwei Schänken, zwei Mühlen und eine Brettsäge. Auf der Anhöhe stand eine Ritterburg, das Alte Schloß.
24 Meter hohe Aussichtsturm einen fantastischen Rundblick. Der kleine Ortsbach mündet in der Mitte des Dorfes in die Jibka, die durch das Niederdorf gegen Jibka (Jívka) und weiter nach Starstadt (Stárkov) fließt.
Zum Glück gibt es heute noch Menschen, die sich für die Heimat ihrer Vorfahren aktiv einsetzen. Christa Lang ist das beste Beispiel dafür. Sie fragt nicht lang, sie packt an. Über die Ahnenforschung kam sie der Region ihrer Eltern näher. Ihr Vater stammte aus Petzer, ihre Mutter aus dem Glockenhaus in Großaupa, sie selbst ist in Krumbach geboren.
Im Jahr 2015 übernahm Christa Lang von Josef Adolf die Aufgabe, als HOB von Großaupa III - Petzer der „Riesengebirgsheimat“ die monatlichen Geburtstagsmeldungen und Berichte zukommen zu lassen. Mit demselben Ehrgeiz, der sie bei ihren Radtouren zu Höchstleistungen anspornt, und der Verantwortung, die sie als Vorstand des Frauenchors Bubesheim hat, warf

Pfarrort war Ober Wernersdorf (Horní Vernéřovice). Zum Pfarrsprengel gehörten Radowenz (Radvanice), Brenden (Paseka) und Schönborn (Studénka). Die Kapelle zum Hl. Johannes der Täufer wurde 1899 erbaut. Gründer des Friedhofs war Johann Rzehak, der 1901 verstarb. 1939 lebten in Radowenz 704 Personen in 155 Häusern. Die Bewohner waren durchwegs Deutsche. In neun Bauernhöfen wurde Ackerbau betrieben – Getreide, Rüben, Kartoffeln und Flachs. In den 1960er Jahren wurden neue Häuser für die Bergarbeiter gebaut. So entstand ein neuer Teil von Radowenz, der sich in Richtung Schönborn erstreckte.

Vereine: Es gab einen landwirtschaftlichen Verein, einen Veteranenverein und die Freiwillige Feuerwehr. Später kam ein Turnverein dazu.
� Großaupa I, II, III - Petzer
Schulen: Die ersten Spuren eines Schulunterrichts finden sich im Jahr 1728 durch den Studenten Franz Seidel. Die erste dreiklassige Schule wird im Jahr 1876 erwähnt. 1788 wurde das Häuschen Nr. 31 zur Schule, bis 1792 das neue Schulgebäude Nr. 105 fertiggestellt war. Seit den 1960er Jahren befindet sich eine neue Schule im Neubaugebiet, die auch von Schülern der Nachbargemeinden besucht wird.
Bergbau: Das Radowenzer Tal gehört zur Lagerstätte des Schatzlarer Steinkohlenbeckens. Seit den 1830er Jahren wurde in verschiedenen Gruben Steinkohle gefördert. Einige mußten zum Ende des 19. Jahrhunderts wegen Unrentabilität wieder stillgelegt werden. 1922 bis 1930 wurden der Grube „Katharina“ sämtliche anderen Radowenzer Gruben zugeschlagen. Bis 1937 konnten hier jährlich bis zu 70.000 t Steinkohle gefördert werden. Dank der Kohle überstand die Region selbst die Weltwirtschaftskrise ohne Einschränkungen. Bis 1942 wurden alle Gruben der Region der Sudetenländischen Bergbau AG angeschlossen. Für die Rüstungsindustrie wurde viel Kohle benötigt, so daß in der Grube „Katharina“ 1943 und 1944 97.000 t Kohle
Christa Lang übernimmt!
sie sich in die neue Arbeit und erfüllt die Aufgabe bis heute mit Bravour.
Als Ernst Kirchschlager beim Aupataltreffen 2022 verkündete, daß er als HOB von Groß-Aupa I und II – mit heute fast 87 Jahren – aus Altersgründen drin-
Ernst Kirchschlager.

gend einen Nachfolger sucht, wartete Christa erst einmal ab, ob sich nicht ein Jüngerer findet. Ab sofort wird sie nun doch zumindest die Geburtstagsmeldungen übernehmen und bittet die Heimatfreunde, ihr bei der Aktualisierung der Listen zu hel-
Die letzten Zeitzeugen wissen, daß wir unsere Heimat erst in den Jahren 1966-1967 verlassen konnten, da die neue Grubenleitung die Bergleute brauchte, um beispielsweise das nahe Parschnitzer E-Werk und die Papierfabrik mit Kohle zu versorgen. So blieben die Bergleute von der Vertreibung verschont.
Aber auch der Bergbau forderte Todesopfer. So kam mein Onkel im Februar 1946 in der Grube ums Leben. Meine Tante wurde im August 1946 mit zwei Kindern vertrieben.
In Radowenz liegt heute alles brach. Es gibt keine Landwirtschaft mehr, kein Stück Vieh, keine Wiesen. Der Wald rückt immer näher an den Ort, auch die ehemalige Bahnstrecke ist überwuchert. Sagners Berg, auf dem bis 1945 Getreide angebaut wurde, die Felder meines Onkels Franz Thorik, ebenso Josef Seidels Felder sind einem hohen Wald gewichen. Auch von dem ehemaligen Bergwerk steht nichts mehr. Die Halde ist schön saniert worden. Das Beamtenhaus (Hungerturm genannt) steht nicht mehr. Etwas darunter wurde ein kleiner See angelegt. 1945 war der letzte deutsche Ortsvorsteher von Radowenz der Kaufmann Josef Umlauf. HOB W. Thole
fen, indem Verstorbene zeitnah gemeldet werden. Auch die Organisation des diesjährigen Aupataltreffens vom 9. bis 10. September liegt in ihren Händen und wir wünschen ihr dafür viel Erfolg! Hoffentlich findet eine große Zahl von Heimatfreunden den Weg nach Wernigerode.
Herzlichen Dank an Ernst Kirchschlager, der im Juli 2008 die Heimatortsbetreuung von Ludwig Bönsch übernommen hat und diese bis heute ausführte.
Sein langjähriger Einsatz ist nicht hoch genug zu schätzen. Beim letzten Aupataltreffen im August 2022 war die Familie Kirchschlager mit sechs Personen, einschließlich Sohn, Enkel und Bruder am stärksten vertreten.

Lieber Ernst, wir wünschen Dir alles Gute und Gesundheit! kw
Quelle: Christa Lang
Kilometer von der polnischen Grenze bis zum Königshaner Hof gebaut und fertiggestellt, damit die großen LKWs nicht mehr durch Königshan und Liebau fahren müssen. Und auf der sogenannten Kohlstraße von Königshan in Richtung Schatzlar, gleich hinter den letzten Häusern von Königshan, wird es eine Auf- und Abfahrt von der Autobahn auf die Kohlstraße geben.
HOB Peter StächelinEinladung zum
31. Aupataltreffen, Samstag 9.9. und Sonntag 10.9.2023.
Liebe Heimatfreunde, wir treffen uns wieder am 9.9. und 10.9.2023 in Wernigerode im Hotel „Am Schloßberg“, Tel. 03943 5532340.
Wer bereits am Freitag, 8.9.23 anreist, kann vorab ein Abendessen bestellen. Die Kosten für Halbpension betragen 69,00 €. Bitte meldet Euch
so bald wie möglich an. Es würde mich freuen, wenn viele von dem Angebot Gebrauch machen würden – und denkt daran, vielleicht ist es ja das letzte Mal, daß wir uns im schönen Harz in diesem Kreise treffen können.
Eure HOB Christa Lang Handy: 0170 6523260
Aupataltreffen 2022. Wir hoffen auch 2023 auf viele Teilnehmer!
� Mundart – Paurisch
Wie mir frieho gegasso honn
Noch do Votreibung gings ons assameessig un iebohaupt gohr nee a su gutt. Unn monchmohl hotta mir rechtich Hongo. Gescherr hotta mir natierlich ah kejs. Bajm Friehsteck hott a jedo vo ons sechs Geschwestan sei eichenes Teppla un dos wurd voteidicht bis zom Letzta. Unn Hauptsache, ma hott a gruusses Teppla. Wenn die Schniete, die mir kriechta, schunn a bessla eldo wohr, do honnse meine zwee Briedo aja Kaffee gebrockt. Dos wohr eh kej Bunnkaffee, sondern „Bliemlakaffee“. Ah späto hotta mir immo noch Caro, sullt wie Kaffee schmecka, wohr odou ejne ganz schiene Julle ¹). Es hotte ah a Lebensmettl, Kunsthonich. Dos wohr a gruusso Werfel aj Poppe ajgepackt. Und ua wohr dos Beld vo emm Gebäude –do schiefe Torm von Kitzingen. Eigentlich hotte mir die ganze Zeit Fastenzeit unn wohrn ah olle schien schlank. Die Leite, die decko wohrn, kunnta vielleicht
Heimatkreis Trautenau
16.-18.06.2023:
30. Heimatorttreffen in Sontra
Ketzelsdorf
01.07.2023: Brünnlfest
heimlich a Schweinla fettfittan. Unn wemma do dorwescht wurde, is ma ajgesperrt wuhrn. Wenn iewohaupt, kriechta mir sonntichs enn Schweinebroota mit Sisskraut un Hundeschnippalan 2). Wos iewrich wohr hommo om Montich wiedo gekriecht. Dann wohr kej Flejsch mehr, dos Kraut wohr dann mit a Kellan vermischt unn a bessla uufgebroota. Aj do Woche hotts vollecht amohl enn Worschtgulasch mit viel Paprikapolvo, oudo enn Kiewlsauo mit salwer gesommlta Pelza gebn. Mietwochs goubs oft Apana unn Quork. Dos muchta mir ju gerne. Nee gern muchta mir Apana mit Telltonke oudo Reisfelsl. Wemmos ah nee muchta, hommos doch gegassa, weilmer wossten, dossmer eh nischt anders kriechta.
HOB Harald Richter (gekürzt)
Glossar:
1) mieses Getränk
2) kleine Knödel.
Soor
24.06.2023: Johannesfest nicht 04.07.2023!
Heimatkreis Trautenau
15./16.07.2023: 78. Heimatkreistreffen in Würzburg
