Heimatpflegerin Christina Meinusch über den HEIMAT!abend
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutsche Zeitung
VOLKSBOTE







� Stiftung Zentrum


Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung
Sudetendeutschen Landsmannschaft
Zeitung
HEIMATBOTE



Sudetendeutsche Zeitung
Neudeker Heimatbrief
was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen
Vor 70 Jahren, am 5. Juni 1953, ist das Bundesvertriebenengesetz (BVFG) in Kraft getreten. Es gilt als Abschluß der westdeutschen Vertriebenengesetzgebung nach dem Zweiten Weltkrieg und als wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zu sozialer und wirtschaftlicher Gleichstellung.
Die Vertriebenengesetzgebung insgesamt, aber insbesondere das Bundesvertriebenengesetz ist die konsequente politische Umsetzung dessen, was bereits in der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950 als Forderungen der Vertriebenen und Flüchtlinge zu ihrer Eingliederung in die Nachkriegsgesellschaft enthalten ist“, erklärt der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius.
Große Weitsicht sei damals mit der Aufnahme des sogenannten Kulturparagrafen 96 bewiesen worden. Dessen Aufträge laut Gesetzestext sind der Kulturerhalt „im Bewußtsein des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes“, die wissenschaftliche Erforschung sowie die „Weiterentwicklung der Kulturleistungen der Vertriebenen und Flüchtlinge“ und haben im Laufe der Jahrzehnte immer größere Relevanz erhalten.
Insgesamt sei die Geschichte des Bundesvertriebenengesetzes auch deswegen eine Erfolgsgeschichte, weil der Gesetzgeber es – oft auf Ratschlag des BdV und seiner Mitglieder hin – immer wieder wechselnden Gegebenheiten angepaßt habe.
gegen Vertreibungen Menschenrechtspreis für Klaus Iohannis
Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen hat den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis am Sonntag bei einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

Nach dem Europäischen KarlsPreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft und dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ist Iohannis damit erneut für seinen Einsatz für Menschen- und Minderheitenrechte gewürdigt worden.
In seiner Laudatio sagte JeanClaude Juncker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission: „Als Staatspräsident Rumäniens und früherer Bürgermeister von Hermannstadt spielt Klaus Iohannis in Europa eine führende Rolle, wenn es um essentielle demokratische Anlie-


� Tomáš Kafka würdigt in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Durchbruch in den Beziehungen
„Es geschehen noch Wunder“ – unter dieser Überschrift hat der Tschechische Botschafter in Berlin, Tomáš Kafka, einen Namensartikel verfaßt, der von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter der Rubrik Briefe an die Herausgeber veröffentlicht worden ist. In seinem Beitrag würdigt Kafka ausführlich den historischen 73. Sudetendeutschen Tag, an dem mit Mikuláš Bek erstmals ein tschechischer Minister im offiziellen Auftrag der Regierung sprach. Die Sudetendeutsche Zeitung dokumentiert Kafkas Beitrag im Wortlaut.
Von Tomáš Kafka, Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin
Eines der am meisten frequentierten und damit wohl auch beliebtesten Worte seit dem Ausbruch des russischen Krieges gegen die Ukraine ist der Begriff „Zeitenwende“. Alles, was neu gemacht oder gedacht werden muß, kann seitdem nicht anders heißen. Zeitenwende mag und deckt scheinbar alles. Eine Beschränkung ist dennoch dabei, und die geht auf das Konto Putins und seines Krieges: Der Grund für die namensgebende Zeitenwende ist negativ, denn von Putins Krieg kontaminiert. Diese Einschränkung macht es möglich, daß man für etwas Neues und diesmal uneingeschränkt Positives immer noch den Begriff Wunder benutzen kann. Zumal, wenn diese Neuigkeiten ausgerechnet an Pfingsten passieren, das mit seiner Tendenz zum Wundersamen bekannt ist. Doch manchmal mußte man
Ein besonderer Moment auf dem Sudetendeutschen Tag: Volksgruppensprecher Bernd Posselt bedankt sich bei Tschechiens Bildungsminister Mikuláš Bek für seine große Versöhnungsrede.

auf diese Wunder lange warten. Doch zumindest in zwei Kategorien ist diese Wartezeit nun vorbei. Es geht um zwei einstige Sorgenkinder: die sudetendeutschtschechische Versöhnung und die deutsche Eishockeygeschichte.
In den sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen kam das Wunder nicht ganz unerwartet. An seinem Anfang stand die deutsch-tschechische Erklärung aus dem Jahre 1997, als Prag und Bonn einsahen, daß sie außerstande waren, ihre historischen
Differenzen juristisch zu lösen, und beschlossen, lieber einen Kontext zu schaffen, der sie nicht an der friedlichen Zukunftsgestaltung hindern wird. Der Weg zum jüngsten Wunder war aber noch nicht geebnet, es verlangte, noch viel Vertrauen – vor allem unter den Sudetendeutschen und Tschechen – zu bilden. Das tat man vor allem mittels der Hilfe des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
Dieser Fonds – gemeinsam mit dem Gesprächsforum – ermöglichte den Bürgern beider
gen geht – dazu gehören auch Schutzrechte für Minderheiten. Iohannis gehört für mich zu jenen aus Mitteleuropa kommenden Staatsmännern, die über ihre Zeit hinauswirken werden.“
Unter den 500 Gästen waren der ehemalige Europaabgeordnete Milan Horáček, der Ehrenvorsitzende der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Reinfried Vogler, und Hessens Justizminister Prof. Dr. Roman Poseck.
Länder, sich gegenseitig kennenzulernen und dabei auch festzustellen, wie nah man sich mental ist, wenn man endlich die ideologischen Brillen wegzulegen vermag. Diese Mühe hat sich gelohnt! Das Schönste dabei ist, daß man nun, mit dem diesjährigen Wunder im Rücken, wo beide Seiten gegenseitig ihre Schuld bekannt und sich die Hand zur Versöhnung und zur Bildung eines friedenvollen Europas gereicht haben, sich ebenfalls eingestehen darf, daß die sudetendeutsch-tschechische
Versöhnung vielen individuelle Katharsis gebracht, aber auch vielen Menschen Spaß gemacht hat. Doch nicht nur von den Versöhnungen leben die diesjährigen Pfingstwunder! Die deutsche Eishockeygeschichte gehört zweifelsohne dazu, auch wenn es in Tampere „nur“ zum Gewinn der silbernen Medaille gereicht hat. Doch als Vertreter der Tschechischen Republik, also eines Staates, wo Eishockey eine Art alternative Religion darstellt, kann ich hoffentlich den Erfolg der deutschen Eishockeymannschaft gebührend einordnen.
Zunächst will ich sagen, daß von Kanada im Finalspiel besiegt worden zu sein, keine Schande ist. Es ist eher wie für die Fans von Karl May, von Old Shatterhand geschlagen zu sein. Also: eine Ehre! Außerdem darf ich bezeugen, daß seit dem Gewinn der silbernen Medaille nun das deutsche Eishockey von den tschechischen Nachbarn endlich ernst genommen wird, was wiederum für die Tschechen der Anerkennung für den tschechischen Fußball seitens der deutschen Fans gleichkäme. Tampere, auf jeden Fall, kann nun nicht nur für deutsche Sportfans ähnlich wie Bern im Jahr 1954 ein Ort sein, wo man am Pfingstsonntag 2023 (fast) Weltmeister geworden ist. In unseren tschechischen Augen haben die deutschen Eishockeyfans jedes Recht dazu!
Nun ist aber das diesjährige Pfingsten vorbei. Es gilt zwar auch hier, daß nach Pfingsten vor Pfingsten ist, man kann dennoch keine Wunder planen. Bis neue Wunder geschehen, fürchte ich, wird man noch eine ganze Menge Zeitenwenden bewerkstelligen müssen. Doch die gute Nachricht ist, daß es Gott sei
gibt!
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Petra Dachtler ist in der Deutschen Botschaft in Prag für die politische Abteilung zuständig. Kurz nach der Übernahme dieser wichtigen diplomatischen Aufgabe besuchte sie das Prager Sudetendeutsche Büro, um sich mit dessen Leiter Peter Barton über die aktuelle Entwicklung der (sudeten) deutsch-tschechischen Beziehungen auszutauschen. Beide Gesprächspartner waren sich einig, daß sich der Stand der deutsch-tschechischen Nach-
barschaft stetig weiter entwickelt. Somit können auch Fragen der Verständigung und Versöhnung zwischen den früheren und heutigen Bewohnern der sudetendeutschen Gebiete in der Tschechischen Republik eine neue und zukunftsorientierte Dimension bekommen. Die Zusammenarbeit des Prager SL-Büros und der Deutschen Botschaft hat, wie auch dieses Tre en unterstreicht, 21 Jahre seit dem Bestehen des sudetendeutschen Sitzes an der Moldau nichts an Aktivität verloren.
❯ Kritik an den geplanten Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen der Regierung von Premierminister Petr Fiala wächst Gewerkschaftsverband
droht mit nationalem Generalstreik
Gegen die geplanten Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen verstärken die Gewerkschaften in Tschechien ihren Druck auf die Regierung von Premierminister Petr Fiala. Der wichtige Gewerkschaftsdachverband ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů) hat mittlerweile einen nationalen Streikausschuß eingerichtet und Proteste für die letzte Juni-Woche angekündigt. Sogar mit einem Generalstreik, der das ganze Land lahm legen soll, wird mittlerweile gedroht.
Nachdem die Regierung in der ersten Maihälfte ihren Plan zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und zur Änderung des Rentensystems vorgelegt hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), hat der Gewerkschaftsdachverband ČMKOS zunächst die Streikbereitschaft ausgerufen. Nun wurde auch ein Streikausschuß eingerichtet.
Laut Josef Středula, dem Vorsitzenden des Gewerkschaftsdachverbandes, münden diese Schritte zwar nicht zwangsläufig in einen Generalstreik. Aber niemand werde ihn sagen hören, daß die Gewerkschaften dieses Instrument von vornherein ausschließen wollten, so Středula.
Die Gewerkschaften fordern von der Regierung, eine außerordentliche Sitzung der Sozialpartner einzuberufen, und zwar noch im Juni, also noch bevor das Abgeordnetenhaus mit den Beratungen über das Konsolidierungspaket beginnt.
In der Kritik stehen die geplanten Änderungen bei der Mehrwertsteuer, die insbesondere Alkohol und Nikotin verteuern, und die Abschaffung von Steuererleichterungen bei Sachleistungen für Arbeitnehmer.
„Wir sind bereit zu diskutieren und Punkte nachzubessern, in denen wir Fehler gemacht haben. Wir sind aber nicht bereit, dem Druck nachzugeben“, erklärte Premierminister Petr Fiala. Und auch sein Arbeits- und
Premierminister Petr Fiala und Oppositionsführer Andrej Babiš im TV-Duell. Foto: CNN Prima News


❯ Erste Live-Debatte zwischen Premierminister Petr Fiala und Vorgänger Andrej Babiš
Schlagabtausch live im TV
Zum ersten Mal seit der Wahl der neuen Regierung haben sich Premierminister Petr Fiala und sein Vorgänger sowie Gegenkandidat Andrej Babiš einem TV-Duell gestellt, das der Sender CNN Prima News am Sonntagabend ausgestrahlt hat.
Hauptthemen waren das geplante Sparpaket der Regierung, um den hochverschuldeten Staatshaushalt zu konsolidieren, und die Inflation, die vor allem Rentner und Familien mit geringem Einkommen immer stärker belastet. Der Vorwurf von Fiala,
Sozialminister Marian Jurečka zeigte wenig Kompromißbereitschaft. „Tschechien hat die niedrigste Arbeitslosenquote innerhalb der EU. Im ersten Quartal wurden die Löhne dieses Jahres erhöht, die Versicherungsabgaben sind um 10,5 Prozent gestiegen. Und die Firmen kündigen klar an, sie wollen weiter Arbeitnehmer einstellen. Wer ge-
❯ O zielle Zahlen des Tschechischen Statistikamtes
seine Regierung habe Staatsverschuldung und Inflation von der Vorgängerregierung unter Andrej Babiš geerbt, löste ein hitziges Wortgefecht aus.

„Das ist eine Amateurregierung“, lederte Babiš gegen Fiala und forderte seinen Widersacher öffentlich zum Rücktritt auf: „Der Premierminister sollte die Leitung der Regierung an Gouverneur Kuba übergeben und selbst anstelle von Jourová EU-Kommissar werden.“
„Senken Sie die Lebensmittelpreise, senken Sie Ihre Marge“, konterte Fiala mit Blick auf
sund ist und Arbeit finden will, wird diese auch finden.“ Wie berichtet, hatte die Regierung Mitte Mai ihr Sparpaket vorgestellt, mit dem das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr um 94 Milliarden Kronen (knapp vier Milliarden Euro) verringert werden soll.
PRAGER SPITZEN

Präsident ernennt Verfassungsrichter
Präsident Petr Pavel hat am Montag zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im März neue Mitglieder des Verfassungsgerichts ernannt. Es handelt sich um den ehemaligen Vorsitzenden des Obersten Verwaltungsgerichts, Josef Baxa, den Verfassungsrechtsprofessor Jan Wintr und die ehemalige Vorsitzende der Richtervereinigung, Daniela Zemanová. Die Ernennung dieser drei Verfassungsrichter wurde vom Senat in der vergangenen Woche gebilligt. Sie werden Richter ersetzen, deren zehnjährige Amtszeit am 3. Mai geendet hat.
Wenig Interesse
an Ferienjobs
Das Angebot ist groß, das Interesse gering. Viele Ferienjobs werden demnach unbesetzt bleiben, hat eine Umfrage der Presseagentur ČTK unter Personalagenturen ergeben. Der Grund: Viele potentielle Arbeitnehmer suchen eine Tätigkeit in einem Büro. Mit Muskelkraft will dagegen kaum noch jemand arbeiten – trotz leicht gestiegener Gehälter. So kommt ein Saisonarbeiter in einem Lager in Prag derzeit auf einen Stundenlohn von 160 Kronen (6,77 Euro).
Deutlich mehr Autos verkauft
Der Absatz neuer Autos ist in Tschechien gestiegen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden über 95 000 Kraftfahrzeuge verkauft. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg von mehr als 18 Prozent, meldet der Verband der Autoimporteure. Nach Angaben des Verbandes stiegen die Autoverkäufe in allen Kategorien, außer bei Bussen. Bei den Pkws verzeichnete die Marke Škoda den höchsten Absatz. Es folgten die Automarken Hyundai, Volkswagen und Toyota.
Solidarität mit Alexei Nawalny
Dutzende Menschen haben am Sonntag auf dem Altstädter Ring in Prag für die Freilassung des russischen Regime-
ISSN 0491-4546
nicht zum Bereich Investitionen gehören, und bei Gehältern. Zudem sind einige Steuererhöhungen geplant. So sollen unter anderem die unteren beiden Sätze der Mehrwertsteuer von 10 und 15 Prozent zu einem einzigen Satz von 12 Prozent zusammengeführt werden, der obere Satz von 21 Prozent bleibt bestehen. Torsten Fricke
Reallöhne sinken um 6,7 Prozent
Der monatliche Durchschnittslohn in Tschechien ist im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Prozent auf 41 265 Kronen (1746 Euro) gestiegen. Unter Berück-
sichtigung der Inflation sanken die realen Einkommen der Arbeitnehmer allerdings um 6,7 Prozent. Die Inflation der Verbraucherpreise erreichte im ersten Quartal dieses Jahres in Tschechien 16,4 Prozent und damit den zweithöchsten Wert in diesem Jahrhundert. Die Reallöhne gingen das sechste Quartal in Folge zurück. Die mit dem Durchschnittslohn verbundene Kaufkraft wies im ersten Quartal – wie im Vorjahreszeitraum auch – eine sinkende Tendenz auf. Laut Pavel Sobíšek, dem Ana-
lysten der UniCredit Bank, ist Tschechien im internationalen Vergleich das EU-Land mit dem stärksten Kaufkraftverlust der Löhne gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019.
Die Reallöhne würden in diesem Jahr weiter sinken, schätzt zudem Jakub Seidler, Wirtschaftswissenschaftler beim tschechischen Bankenverband, gegenüber der Presseagentur ČTK ein. Er erwarte aber ein moderates Tempo von etwa zwei Prozent im Gegensatz zu dem deutlichen Rückgang von 8,5 Prozent im vergangenen Jahr.
Die Löhne in Tschechien entwickeln sich laut ČSÚ je nach Sektor unterschiedlich. Nur im Energiesektor übertraf der Lohnzuwachs im ersten Quartal die Inflation: Die Löhne stiegen hier um durchschnittlich 23,1 Prozent auf 79 221 Kronen (3362 Euro). In anderen Sektoren waren die Reallöhne rückläufig. Der stärkste Rückgang im Vergleich zum Vorjahr wurde im Bildungswesen verzeichnet, in dem die Kaufkraft um 10,7 Prozent sank. Die Durchschnittslöhne im Geldund Versicherungssektor fielen real um zehn Prozent.
kritikers Alexei Nawalny demonstriert. Zu sehen war dabei auch eine Replik der Zelle, ein sogenannter Strafisolator, in den Nawalny im russischen Gefängnis mitunter eingesperrt wird. Den Organisatoren zufolge wollte man damit auf die unmenschlichen Bedingungen aufmerksam machen, unter denen Nawalny in der Haft leidet. Ähnliche Aktionen fanden am Sonntag, dem Geburtstag des Regimekritikers, in mehreren Städten auf der ganzen Welt statt.
Alle Tschechen aus dem Sudan gerettet
Mit Hilfe der Türkei wurden die letzten zwei Tschechen im Sudan in Sicherheit gebracht, hat Tschechiens Außenminister Jan Lipavský (Piraten) via Twitter erklärt. Bereits im April waren drei Tschechen aus dem Bürgerkriegsland von der deutschen Bundeswehr evakuiert worden.
Briefmarke unter dem Hammer
Für 1,9 Millionen Kronen (80 300 Euro) ist am Samstag in Preßburg eine grüne Vier-Kronen-Marke versteigert worden. Es ist die dritthöchste Summe, die jemals für ein Postwertzeichen aus der Tschechoslowakei erzielt wurde. Bei der Marke handelt es sich eigentlich um ein Exemplar der österreichischungarischen Post. Nach Gründung der Tschechoslowakei wurde sie jedoch mit dem schwarzen Aufdruck „Pošta Československá 1919“ versehen und weitergenutzt.
Tschechen vertrauen ihrem Präsidenten
Das Vertrauen der Tschechen in ihren Staatspräsidenten ist seit der Amtsübernahme durch Petr Pavel deutlich gestiegen. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor. Demnach würden derzeit fast drei Fünftel der Bürger dem Präsidenten vertrauen. Als Miloš Zeman aus dem Amt geschieden ist, habe dieser Anteil bei unter zwei Fünfteln gelegen. Am niedrigsten sei das Vertrauen für Miloš Zeman Mitte 2022 gewesen, als der Wert unter 30 Prozent fiel.
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Heimat ist nicht exklusiv, sondern auch emotional
Der traditionelle Heimatabend ist das Herz eines jeden Sudetendeutschen Tages. In diesem Jahr übernahmen die „ZWOlingen“ Elisabeth und Stefanie Januschko Regie und Moderation. Welche wichtige Bedeutung der Heimatabend für die Sudetendeutschen auch über den Veranstaltungstag hinaus hat, erklärt die Heimatpflegerin der Sudendeutschen, Christina Meinusch, im Interview
In diesem Jahr wurde der Volkstumsabend als HEIMAT!abend tituliert, also Heimat groß geschrieben und mit einem Ausrufezeichen verstärkt. Was bedeutet der Begriff Heimat für Sie als Heimatpflegerin?
Meinusch: Im engen Sinn wird Heimat definiert als Ort, an dem man geboren und aufgewachsen ist. Für die rund drei Millionen Sudetendeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Tschechoslowakei verlassen mußten,
würde dies bedeuten, daß sie ihre Heimat endgültig verloren haben. Für die Sudetendeutsche Heimatpflege ist Heimat deshalb ein viel weiter gefaßter Begriff. Heimat ist für die Heimatpflege definiert durch Landschaft, Bauwerke, Denkmäler und Tracht als materielle Bestandteile, aber auch durch immaterielle Kulturtraditionen wie Dialekt, Tanz, Musik, Kulinarik und Bräuche. Auch Menschen und Gemeinschaften können Heimat sein
und bieten. Diese Heimat ist keine exklusive Heimat für die aktuellen oder ehemaligen Bewohner eines Ortes, sondern auch emotionale Heimat der nachkommenden Generationen, die sich mit der Heimat ihrer Vorfahren verbunden fühlen. Genau hierfür steht der HEIMAT!abend wie keine andere Veranstaltung der Heimatpflege. Neben der Heimat sind Tanz und Musik weitere Säulen des Heimatabends. Was macht die
Tänze so besonders?


Meinusch: Daß Volkstänze wichtiges Kulturerbe sind, zeigt die Aufnahme der „Kuhländler Tänze“ in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung kulturellen Erbes gehört untrennbar auch die kulturelle Praxis. Durch Dokumentation von Tänzen, durch grenzüberschreitende Vernet-
zung deutscher und tschechischer Tanz- und Musikgruppen und regelmäßige Auftrittsmöglichkeiten für sudetendeutsche Sing- und Spielscharen, zum Beispiel beim HEIMATabend! des Sudetendeutschen Tages, unterstützt die Sudetendeutsche Heimatpflege den Erhalt dieser Kulturform. Beim diesjährigen HEIMAT!abend war eine Mitarbeiterin des Forschungsprojekts

F

rau Meinusch, welche Bedeutung hat der traditionelle Heimatabend auf dem Sudetendeutschen Tag für Sie als Heimatpflegerin?
Christina Meinusch: Tanz, Musik und Tracht, Mundart und grenzüberschreitende Kulturpflege sind wichtige Themen für die Heimatpflege. Keine Veranstaltung im Jahr vereint so viele Kernpunkte unserer Arbeit miteinander. In diesem Jahr tanzten erstmals gleich drei Tanzgruppen aus Deutschland und der Tschechischen Republik mit Tänzern aus drei Generationen gemeinsam. Auch das Publikum wird über die Jahre zunehmend „grenzüberschreitend“, das heißt der Anteil tschechischer Besucher steigt stetig. Meiner Meinung nach steigt vor allem durch diesen Charakter der Verständigung auf kultureller Ebene die Anzahl jüngerer Interessierter und Teilnehmer auf der Bühne in den letzten Jahren.



In der 1995 gegründeten Schönhengster Volkstanzgruppe aus Mährisch Trübau tanzen junge Deutsche und Tschechen gemeinsam.
„Immaterielles Kulturerbe Bayern II (UNESCO)“ am Institut für Volkskunde der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Sie hat sich vor Ort von diesem Kulturerbe überzeugt und arbeitet aktuell an einer virtuellen Ausstellung hierzu.

Und wie beurteilen Sie die Bedeutung der Musik?
Meinusch: Gleiches gilt für die Volksmusik. Auch sie zählt zum immateriellen Kulturerbe der Sudetendeutschen, und auch sie kann nur über kulturelle Praxis erhalten und weitergegeben werden. Durch die „Offenen Singen“ mit verschiedenen Kooperationspartnern leistet die Sudetendeutsche Heimatpflege einen Beitrag zum Erhalt dieses kulturellen Schatzes. Weiter unterstützt die Heimatpflege sudetendeutsche Volksmusikgruppen durch die Schaffung von Auftrittsmöglichkeiten bei ihren vielfältigen eigenen Veranstaltungen. Welche Funktion hat für Sie die Tracht als vierte Säule des Heimatabends?


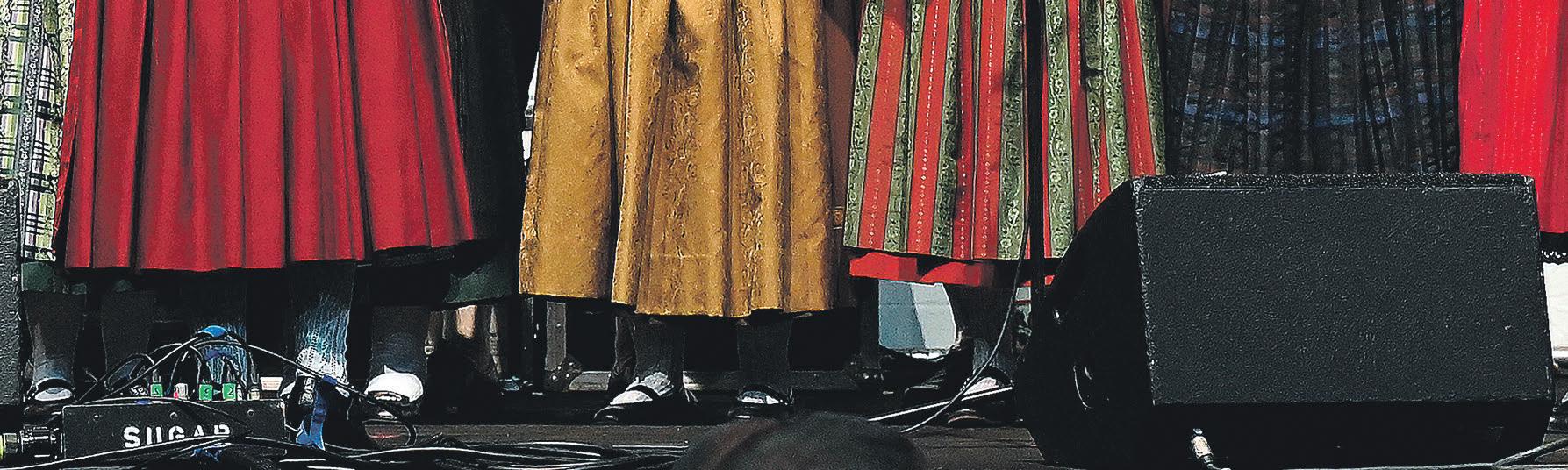



Meinusch: Tracht ist mehr als Kleidung. Sie schmückt, zeigt, was der Träger hat und kann, und identifiziert die Tracht tragende Person gleichzeitig als zu einer Gruppe zugehörig. Die sudetendeutschen Trachten sind so vielfältig und reich an Unterschieden wie die Heimatlandschaften, aus denen sie stammen: aus den Bergen des Riesengebirges, der Weite des Elbetals oder dem Weinanbaugebiet in Südmähren, um nur einige Beispiele zu nennen. Selbst innerhalb einer sudetendeutschen Heimatlandschaft finden sich unterschiedliche Trachtenformen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Egerland, dessen Tracht im Jahr 2022 vom Deutschen Trachtenverband zur Tracht des Jahres gekürt wurde: Allein acht Trachtenformen nur für die Frauen sind in dieser Region bekannt und waren mit der Gartenberger Bunkerblasmusik auch auf der Bühne vertreten. Tracht ist bei allen auftretenden Gruppen fester Bestandteil des Auftritts. TF

❯ Für eine Ausstellung soll die Geschichte ab 1938 erforscht werden
Herzig-Mautner-Fabrik
in Grünwald: Zeitzeugen und Dokumente gesucht
Die Geschichte der ehemaligen Herzig-Mautner-Fabrik in Grünwald, dem heutigen Mšeno, reicht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zurück. In der 1917 erschienenen Heimatkunde von Fidelio Finke ist zu lesen, daß die älteste hiesige Bebauung – eine Fabrik zum Bedrukken von Baumwollstoffen – hier 1798 gegründet wurde. Heute beherbergt das Haus in der Janovská-Straße das Perlenmuseum und die neu eingerichtete Kunstgalerie Nisa Factory.
Neben der Sanierung und dem Wiederaufbau des Areales befaßt sich das Team der heutigen Eigentümerin Zuzana Slámová auch mit der Rekonstruktion der lokalen Geschichte.
Im turbulenten 19. Jahrhundert erfuhr das Gebäude zahlreiche Veränderungen, Umbauten und Besitzerwechsel. Nach und nach wurde die alte Glasschleiferei in eine Weberei und Baumwollspinnerei umgewandelt, die mit Dampfmaschinen und menschlicher Arbeitskraft betrieben wurde. Ab 1880 wurde das Gebäude Teil des riesi-
■ Bis Freitag, 30. Juni, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Ausstellung „verloren, vermisst, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Bis Freitag, 30. Juni, Ausstellung „Die vertriebenen Kinder“. Öffnungszeiten montags bis freitags 10.00 bis 16.00 Uhr. An Feiertagen ist die Ausstellung nicht geöffnet. Sudetendeutsches Haus, 1. Stock, Hochstraße 8, München.
■ Bis Dienstag, 3. Oktober, Bayerisch-Tschechiche Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr.
■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr. Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com
■ Freitag, 9. Juni, 19.00 Uhr: Autor Marek Toman präsentiert im Rahmen des Comic Festivals München das Buch „Die vertriebenen Kinder“. Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, München.
■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Samstag, 10. Juni, 15.00
Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Monatsversammlung. Niederrheinischer Hof, Hülserstraße 398, Krefeld.
■ Montag, 12. Juni, 19.00
Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 2: Königswart“ von Prof. Dr. Stefan Samerski
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@
gen Geschäftsimperiums der Firma Mautner und Oesterreicher, die auch mehrere Textilfabriken in der Slowakei betrieb. In den 1930er Jahren wurde in Grünwald Kunstseide hergestellt und als Material für klassische Kleidung – Damenblusen und -kleider – verwendet.
Die im Archiv in Brüx aufbe-
wahrten Stoffmuster ermöglichen eine Rekonstruktion von Stoffen mit kleinen bunten Blumen und großflächigen, ausgeprägten Blumenmustern. Für die Zeit zwischen 1938 und 1945 haben sich kaum Informationen erhalten. In der Zeit zwischen 1946 und 2000 wurden hier Metallkomponenten
VERANSTALTUNGSKALENDER
sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089)
48 00 03 37.
■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00
Uhr, Ackermann-Gemeinde
Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.
■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Donnerstag, 15. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz) und Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg: Vortrag von Thomas Kabisch über „Musik und Philosophie zwischen West und Ost. Vladimir Jankélévitch in Prag“. Weinschenkvilla, Hoppestraße 6, Regensburg. Eintritt frei.
■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.
■ Samstag, 17. Juni, 19.30
Uhr, Deutsches Kulturforum


östliches Europa: Lesung und Gespräch mit Reiner Stach:

„Die Schwelle des Glücks. Kafkas Sommer mit Dora Diamant“. Haus des Gastes Graal-Müritz, Rostocker Straße 3, Ostseeheilbad Graal-Müritz.
■ Mittwoch, 21. Juni, 14.30
Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Frauentreff. Pfarrheim der katholischen Kirche Heiliger Schutzengel, Hauptstraße 18, Krefeld.
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.
■ Dienstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Ringveranstaltung mit Vortrag von Dr. Michael Henker über „Die Entwicklung der Museumslandschaft in Bayern“
für Gablonzer Bijouterie hergestellt, der Name wechselte zu Silka. Während dieses langen Zeitraums konzentrierte sich hier die Produktion von Aluminiumund Gußschmuck, emailliertem Schmuck und Abzeichen. Nicht nur die Geschichte vor 1945, sondern auch die nach 1945 ist nicht aufgearbeitet. Mit einem öffentlichen Aufruf will Kunsthistorikerin Anna Habánová diese Wissenslücke schließen: „Für eine kommende Ausstellung suchen wir Material, das uns hilft, die baulichen Veränderungen des Areals zu rekonstruieren, also zum Beispiel alte Postkarten oder Fotos, die spätere Veränderungen zeigen, Aufnahmen der im Areal befindlichen Straßenbahnhaltestelle, Bilder von den Innenräumen oder der Fabrikausstattung, aber auch Stoffe aus der Zwischenkriegszeit oder Musterbücher und Produkte aus der Nachkriegszeit.“ Außerdem sei man auch sehr an persönlichen Geschichten interessiert, erklärt Habánová, die über die eMail-Adresse anna. habanova@centrum.cz erreichbar ist.
❯ Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband Kandidaten für die Förderpreise gesucht
Seit 1979 verleiht die Sudetendeutsche Landsmannschaft jeweils im Frühjahr die Sudetendeutschen Förderpreise. Vorschläge für die Ehrung im Jahr 2024 können bereits jetzt eingereicht werden.
Mit den Förderpreisen werden junge Menschen geehrt und unterstützt, die sich im Bereich der Kultur verdient gemacht haben. Vergeben wird der Preis in verschiedenen Kategorien: darstellende und ausübende Kunst, Wissenschaft, Literatur
und Publizistik, Musik, bildende Kunst und Architektur sowie Volkstumspflege. Für die Preisverleihung im Frühjahr 2024 bittet die Sudetendeutsche Landsmannschaft um Vorschläge an die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bundesverband e. V., Hochstraße 8, 81669 München, oder per eMail an info@sudeten.de Die Kandiaten sollten jünger als 35 Jahre sein, sudetendeutsche Vorfahren haben oder einen Beitrag mit sudetendeutschem Bezug geleistet haben.

und anschließendem Empfang. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 48.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.
■ Samstag, 1. Juli, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn. (Achtung, verschoben von ursprünglich 10. Juni auf jetzt 1. Juli.).
■ Sonntag, 2. Juli, 9.00 Uhr: Wallfahrt Haindorf zum Fest Mariä Heimsuchung. Die Heilige Messe feiert Pater Dr. Martin Leitgröb CSsR, Provinzial der Redemptoristenprovinz WienMünchen.
■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen von OB Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz. Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net
■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Juli: Deutscher Böhmerwaldbund: 31. Bundestreffen in der Patenstadt Passau. Auszug aus
dem Programm: Samstag, 10.00 Uhr: Kulturpreisverleihung im Rathaus mit Oberbürgermeister Jürgen Dupper. Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst im Passauer Dom. 11.00 Uhr: Kundgebung im Großen Redoutensaal mit Sylvia Stierstorfer, MdL, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.
■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Feierstunde zur Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.
■ Sonntag, 13. August, 11.00 Uhr: Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche Maria Kulm (Kreis Falkenau/Sokolov).
■ Dienstag, 15. August. Die Böhmerwaldjugend singt und tanzt auf der Landesgartenschau. Auftritte von 13.15 bis 14.15 Uhr sowie von 17.00 bis 18.00 Uhr. Landesgartenschau. Zuppinger Straße, Freyung.
■ Mittwoch, 6. September, SL-Kreisgruppe Krefeld: Fahrt in die Eifel zur Burg Vogelsang. Abfahrt 10.00 Uhr ab Zooparkplatz, Uerdingerstraße 377, Krefeld.
■ Montag, 9. Oktober, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 3: Schloß Troja in Prag“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Montag, 20. November, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 4: Melnik“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 17. bis Pfingstsonntag, 19. Mai 2024: 74. Sudetendeutscher Tag in Augsburg. Zu den festen Programmpunkten zählen wieder die Kulturpreisverleihung am Freitagabend, die Verleihung des Europäischen Karls-Preises am Samstagvormittag und der HEIMAT!abend am Samstagabend sowie die Hauptkundgebung am Pfingstsonntag.
❯ Ausstellung zu Flucht, Vertreibung und Integration
Ungehört – die Geschichte der Frauen
■ Donnerstag, 15. Juni, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung und Integration“ mit Schirmherrin Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten Millionen von Deutschen ihre Heimat im östlichen Europa verlassen. Es waren vor allem Frauen, die sich auf den beschwerlichen
Weg machten. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs Zeitzeuginnen, die aus unterschiedlichen Regionen des östlichen Europas stammen. Ihre Wege durch die Nachkriegsgeschichte weisen Gemeinsamkeiten auf – und sind dennoch jeder für sich ganz besonders.
Ria Schneider aus der Batschka, Emma Weis und Friederike Niesner aus Mähren, Gertrud Müller aus Oberschlesien, Rosemarie Becker aus Pommern und Edith Gleisl aus Ostpreußen.

Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit
■ Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 6. August: Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. 2. Veranstaltung der Akademie Mitteleuropa für Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik.
Über 100 Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und Weltsicht. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen
Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
❯ Vortrag von Dr. Gernot Peter auf dem Sudetendeutschen Tag
Johann Peter –Der Rosegger des Böhmerwaldes
Den Schriftsteller Johann Peter (1858–1935) hat beim Sudetendeutschen Tag im Rahmen einer Vortragsveranstaltung Dr. Gernot Peter, Betreuer des Böhmerwaldheimatkreises Prachatitz und des Böhmerwaldmuseums Wien, in den Mittelpunkt gestellt. Unter dem Titel „Johann Peter – der Rosegger des Böhmerwaldes“ würdigte der Referent, ein Nachkomme des im Vortrag vorgestellten Autors, dessen Leben, Wirken und Schaffen.
Über die Familienforschung sei er zu dem Thema gekommen. „Ich habe zu Hause Bücher von Johann Peter gefunden und dann gesammelt“, blickte Gernot Peter einleitend zurück.
Zunächst beschrieb der Referent sozusagen die Rahmenaspekte: den erst im Jahr 1774 gegründeten Geburtsort Buchwald/Bučina – übrigens mit 1180 Metern der höchstgelegene Ort im Böhmerwald – mit seinen rauen klimatischen Bedingungen samt Sicht bis in die Alpen und seiner Struktur als Straßendorf. Nicht eindeutig gesichert ist, ob der Ort von Abkömmlingen künischer Freibauern gegründet wurde. Jedenfalls erfolgte im Jahr 1956 die Zerstörung des Ortes, lediglich die Dorfkapelle und das Hotel wurden wiedererrichtet.

Wie für die Ortsgründung ist auch bei Familie Peter die Herkunft von künischen Freibauern unklar. Gesichert ist aber das von den Vorfahren mehrere Generationen lang ausgeübte Amt des Dorfrichters, weshalb die Familie auch im „Richterhaus“ wohnte. Diese Stätte, aber auch die Tätigkeit des Großvaters von Johann Peter als Händler von Resonanzholz, das vor allem für den Bau von Musikinstrumenten bis nach Wien und Linz geliefert wurde, fanden in Erzählungen Niederschlag.
Der am 23. Februar 1858 als neuntes von zwölf Kindern der Eheleute Franz und Katharina Peter (geb. Pribil) geborene Johann Peter besuchte zunächst die Volksschule. Später schickten ihn die Eltern in eine höhere Schule, die Realschule in Bergreichenstein.
Wie damals häufig üblich, war eine geistliche Laufbahn, also der Prie-

sterberuf, für ihn vorgesehen. Dies scheiterte später jedoch an den mangelnden Kenntnissen in der tschechischen Sprache. Die Entscheidung fiel nun für den Lehrerberuf mit einer Ausbildung in der Lehrerbildungsanstalt in Budweis von 1874 bis 1878. Neben den genannten Orten war er als Lehrer in Großmeiseldorf (Weinviertel in Österreich), Prachatitz, Haida, Böhmisch Leipa und schließlich in Winterberg tätig, wo er am 14. Februar 1935 starb.
„Die Luftlinie zwischen Geburts- und Sterbeort beträgt 25 Kilometer, der Lebensweg zirka 900 Kilometer“, verriet Gernot Peter. In Prachatitz zerbrach auch Johann Peters erste Ehe mit Leontine Schánel, das war auch der Grund zur Übersiedlung nach Haida. In Prachatitz begründete er außerdem die Monatszeitschrift „Der Böhmerwald“, gefördert vom Verleger Johann Steinbrener. Erwähnt sei schließlich das musikalische Talent. Johann Peter spielte Klavier, Flöte und Geige sowie Orgel. Es ist sogar eine Komposition von ihm für vier Streichinstrumente mit dem Titel „Heitere Stunden“ erhalten.
Die ersten schriftstellerischen Versuche stammen aus der Zeit in Budweis, wo er Artikel für Zeitungen und Zeitschriften schrieb. An Peter Rosegger schickte er 1884 ein Feuilleton für dessen Zeitschrift „Heimgarten“. Zwei Jahre später erschien Johann Peters erstes Buch „Charakter- und Sittenbilder aus dem Böhmerwald“, gefördert von Rosegger. Bis 1898 folgten weitere Bücher, fast jedes Jahr eines. Neben dem Böhmerwald beschrieb er auch das Weinviertel in Österreich. Auch ein pädagogisches Fachbuch stammt aus seiner Feder – „Unscheinbare Hilfsmittel und Wege der Erziehung“. Und auch Ge-
dichte gehörten zu seinem Schaffen, so etwa im Buch „Der Poet im Dorfschulhause“ von 1894. In seiner Prachatitzer Zeit erschien 1914 sein Hauptwerk „Der Richterbub. Ein Heimatbuch aus eigener Jugend“. Vom Ersten Weltkrieg geprägt und beeinflußt waren dann die folgenden Bücher „Volksedelinge. Ein Heldenbuch für die deutsche Jugend“ und „Helden aus dem Volke. Kriegsgeschichten aus der österreichischen Armee“, beide von 1916. Insgesamt 23 Bücher hat er veröffentlicht, dazu zahl-

❯ Parteivorsitzende besuchte Eger und Prag
reiche Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften, wobei ihm unter anderem der Dialekt sehr wichtig war.
Natürlich hat Johann Peter viele Ehrungen erhalten, neben persönlichen Auszeichnungen auch Gedenktafeln und eine Büste. Drei Tage nach seinem Tod wurde er am 17. Februar 1935 am Friedhof in Winterberg beigesetzt.
Die Beiträge und Bücher Johann Peters charakterisieren und beschreiben zahlreiche Stätten seines Lebens und Wirkens, beginnend mit dem Richterhaus und dem Blumengarten seiner Mutter über Leben, Kultur und Brauchtum im niederösterreichischen Weinland bis hin zu Lyrik- und Gedichtbänden oder dem erwähnten PädagogikBuch.
Abschließend erläuterte Gernot Peter seinen persönlichen Weg zu seinem Vorfahren und die seither entfalteten Aktivitäten in Form von intensiver Forschung und Organisation von Veranstaltungen. Markus Bauer


Saskia Esken auf den Spuren ihrer Mutter und der SPD
Im Gedenken an das Exil des deutschen SPD-Vorstandes während des Nationalsozialismus, der sogenannten SoPaDe, hat die Ko-Bundesvorsitzende der SPD, Saskia Esken, Prag besucht.
Auf dem Weg in die tschechische Hauptstadt legte Esken in Eger einen Zwischenstopp ein. Hier ist ihre Mutter aufgewachsen. „Meine Mutter ist nach dem Krieg als Kind aus dem Egerland vertrieben worden – wie viele weitere Deutsche“, erinnert sich Esken und sagt: „Die Vertreibung ist ein Erlebnis gewesen, das meine Mutter sehr nachhaltig beeinflußt hat.“
Ihre Mutter sei dann in ihrer neuen Heimat Baden-Württemberg eine leidenschaftliche Sozialdemokratin und überzeugte Anhängerin von Willy Brandt geworden. „Das hat mich auch dazu motiviert, zur Sozialdemokratin zu werden“, erzählt die Ko-Bundesvorsitzende der SPD.

In Prag traf Esken dann hochrangige Mitglieder der tschechischen Schwesterpartei ČSSD, darunter auch den diesjährigen Träger des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, den ehemaligen Vi-
zepräsidenten des EU-Parlaments Libor Rouček.
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der tschechischen Sozialdemokraten, Michal Šmarda, gedachte Esken außerdem an dem Gebäude, wo der Exilvorstand der deutschen Sozialdemokraten in den Jahren von 1933 bis 1938 Unterschlupf gefunden hatte. Hier legte sie an der Gedenktafel, die Willy Brandt am 14. Mai 1990 eingeweiht hatte, Blumen nieder.
In einem Interview mit Radio Prag unterstrich Esken die historische Bedeutung: „Zur 160-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland gehört, daß sie immer wieder auch Verbot, Verfolgung und Unterdrückung erfahren hat. 1933 eben, nach der Machtübernahme durch Hitler und die NSDAP, war die Sozialdemokratische Partei verfolgt, verboten, und ihre Mitglieder mußten sich in Sicherheit bringen. Dabei war es nötig, dafür zu sorgen, daß diejenigen, die Schutz suchen, diesen auch finden. Dazu brauchte es Organisationen, aber es mußte ebenso die Sozialdemokratie als Organisation aufrechterhalten werden. Und das war nur im Exil möglich. Wir sind auch heute noch sehr dank-
bar, daß die tschechischen Sozialdemokraten damals die entsprechende Unterstützung gegeben haben.“
Diese grenzüberschreitenden Kontakte seien heute immer noch von hoher Bedeutung, so Esken: „Es ist für uns als sozialdemokratische Parteienfamilie in Europa sehr wichtig, regelmäßig in Kontakt zu sein, uns auszutauschen über die aktuelle Situation, die historisch bedingt und auch regional vielleicht Unterschiede aufweisen mag, aber ebenso Parallelitäten.“
Man sei, so die SPD-Chefin, geschockt vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und von den Folgen, die auch in der Europäischen Union spürbar seien.
Esken: „Unsere Gesellschaften ächzen unter der Inflation, und die Unternehmen ächzen unter den Lieferkettenproblemen. Insofern die Wirtschaft in Schwierigkeiten, ins Trudeln gerät – und in Teilen steht in Deutschland ja eine sogenannte technische Rezession an –, haben wir durchaus gemeinsame Themen, die wir besprechen können und über die wir uns auch austauschen. Das ist ganz besonders wichtig.“
Miksch
Die Buchstaben K und I sind derzeit in vieler Menschen Munde. In den Zeitungen wird über KI geschrieben. Im Radio und Fernsehen wird über die Chancen und Risiken von KI diskutiert. An Schulen und Universitäten wird KI im Unterricht thematisiert. In Parlamenten wird über KI debattiert. Vor allem aber: Forschungsinstitute auf der ganzen Welt beschäftigen sich intensiv mit der Entwicklung von KI und werden von Großkonzernen mit viel Geld gefördert – nicht ohne Eigeninteresse, versteht sich.
Die Abkürzung KI steht für den Begriff „Künstliche Intelligenz“. Verstanden wird darunter die Fähigkeit von Computerprogrammen, logisch zu denken, selbständig Wissen zu speichern und Lösungen zu finden, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, Wahrnehmungen zu registrieren und zu verarbeiten. Insgesamt scheint es sich dabei, so behaupte ich als Laie, um die Fortsetzung und Verfeinerung eines technologischen Trends zu handeln, mit dem wir es nicht erst seit gestern zu tun haben. Seit Jahren „googeln“ wir, wenn wir im Alltag an die Grenzen unseres Wissens stoßen. Ebenfalls lassen wir uns seit Jahren die Fahrtrouten im Auto von Navigationsgeräten berechnen.
So gesehen fürchte ich mich nicht vor der Künstlichen Intelligenz. Die Computertechnik ist ja längst zu einem wertvollen Hilfsmittel zur Bewältigung praktischer und theoretischer Herausforderungen unseres Lebens geworden. Um noch ein anderes Beispiel zu nennen: Wenn es mir von einem Übersetzungsprogramm ermöglicht wird, einen fremdsprachigen Text in meine eigene Sprache zu bringen, dann sehe ich darin eine große Erleichterung, vor allem eine Zeiteinsparung.


Zugleich weiß ich aber auch: Kein Computer dieser Welt wird mir jemals die Aufgabe ersparen, einem tschechisch-, italienischoder englischsprachigen Freund etwas von meinen Gefühlen zu offenbaren. Dazu brauche ich ja letztlich nicht nur Worte und Sätze, sondern meinen Tonfall, meine Augen, meine Hände und vor allem mein Herz. Auch zu staunen, mich zu freuen, zu hoffen, mutig zu sein, liebevoll mit meinen Mitmenschen umzugehen, mir Sorgen zu machen, traurig zu sein, zu klagen, zu beten – in alledem werde ich niemals von einem Computer ersetzt werden können.
Die wirklich wichtigen Herausforderungen ebenso wie die großen Fragen werden bleiben, mit oder ohne Künstliche Intelligenz. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Worin besteht der Sinn meines Lebens? Was ist meine Lebensaufgabe, meine Berufung? Warum müssen Menschen leiden? Wie gelingt Liebe?
Alle Technik ist letztlich nur ein Werkzeug, und Werkzeuge werden geschaffen und benützt, seitdem es das Menschengeschlecht gibt. Viel hängt davon ab, wie wir Werkzeuge einsetzen. Sie können Fluch oder Segen sein. Ich bin überzeugt: Der Mensch mit seiner Herzensbildung, seinem Gewissen und der Fähigkeit zu unterscheiden und zu gestalten wird auch im Umgang mit KI eine zentrale Rolle spielen.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München


Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
Am gestrigen 8. Juni feierte Hermann Sehr 85. Geburtstag. Seine Herkunft hängt aufs engste mit der wechselvollen Geschichte des Egerlandes zusammen.
Die Querelen der Tschechen und die Stimmen der Sudetendeutschen, die in seinem Geburtsjahr 1938 „Heim ins Reich“ riefen, wurden immer lauter. Außerdem spitzte sich die politische Lage im Heimatort seiner Eltern, in Altalbenreuth im Kreis Eger, zu. Deshalb wurde er nicht im Wohnort seiner Eltern, sondern im Geburtsort seiner Mutter Barbara Sehr/Dietrich in Pernatitz im Kreis Tachau geboren. Damals wies noch nichts auf die böse Wendung nach dem Zweiten Weltkrieg hin. Der Vertreibung in die SBZ kam seine Mutter mit den Kindern am 8. August 1946 durch die Flucht nach Neualbenreuth in der Oberpfalz zuvor.
Nach der Volksschule kam Hermann in die Lehre nach Bubenreuth, in die „klingende“ Musikstadt in Mittelfranken, wo er das Bogenmacherhandwerk und als erstes Musikinstrument
Am 14. Juni feiert Ulf Broßmann, SL-Bundeskulturreferent, Vize-Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates und Landschaftsbetreuer für das Kuhländchen, in München 80. Geburtstag.
Ulf Broßmann kam in Mankendorf im Kreis Neutitschein im Kuhländchen zur Welt.
Als Anfang 1945 der Kanonendonner immer näher kam, der Vater war in der Wehrmacht, floh die Mutter mit den drei Kindern über Mährisch Schönberg zu Verwandten ins Riesengebirge.
Nach dem Zusammenbruch landeten sie in einem verwanzten Lager in Ober Altstadt bei Trautenau. Die Mutter und die beiden älteren Geschwister mußten Zwangsarbeit leisten.
1946 entkamen sie dieser Drangsal durch Vertreibung in den Westen. Über das Lager Dachau gelangten sie nach Grünwald in eine Gartenlaube mit defektem Dach. Doch endlich waren sie allein. Der Vater wurde 1947 aus USA-Gefangenschaft entlassen und durfte nach Grünwald. So wuchs Broßmann in der wieder vereinten Familie dort und später in Freising auf.
Nach einem Maschinenbaustudium promovierte er, war am Max-Planck-Institut tätig und
Am 1. Juni feierte Dietmar Gräf, aus Marienbad stammender Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises für Musik 2001, mit Freunden am Lago Maggiore 80. Geburtstag

PERSONALIEN
� Vollblutmusiker aus dem Egerland
Hermann Sehr 85
die Geige erlernte. In der Gesellenzeit spielte er als Posaunist in der Bubenreuther Geigenbauerkapelle. Der blieb er auch treu, nachdem er 1957 in die Bundeswehr eingetreten war. Dort kam er zur Luftwaffe und dank seines musikalischen Talents zum Luftwaffen-Musikkorps I. Im Selbststudium brachte er sich auch Tubaspielen bei und trat als Tubasolist auf.
Außerhalb der Bundeswehr leitete er verschiedene Musikkapellen und verstärkte in den sudetendeutschen Festgottesdiensten immer wieder das Hornensemble des sudetendeutschen Kammermusikers Manfred Neukirchner.
In seiner 30jährigen Dienstzeit erhielt er viele Ehrungen. Der Stabsfeldwebel wurde als erster Musiker in der Geschichte der Bundeswehr 1992 mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeich-
net. Die SL zeichnete ihn für seine großen Verdienste mit ihrem Großen Ehrenzeichen und der Adalbert-Stifter-Medaille aus.
Schon in jungen Jahren setzte er sich für die Belange der Heimatvertriebenen ein. Als 13jähriger trat er der DJO bei. Später wechselte er zum Bund der Eghalanda Gmoin. Er ist langjähriges Mitglied des Egerer Landtages und der SL. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher Artikel für das „Gmoi-Bladl“, die „Egerer Zeitung“ und die Sudetendeutsche Zeitung Seine Interessengebiete liegen in der Musikforschung, in der Genealogie und in der Brauchtumspflege. Für die jüngeren sudetendeutschen Volksmusiker ist er Mentor und unangefochtene Fachautorität. Bereits
� SL-Bundeskulturreferent aus dem Kuhländchen
Ulf Broßmann 80

wurde als Professor an die Hochschule für angewandte Wissenschaften München berufen.
Die Liebe zur verlorenen Heimat erwachte 1991 beim Besuch seines Geburtsortes. 1994 drehte er einen Film über den Ort und veröffentlichte 2001 die Chronik „Spuren von Mankendorf“. Nach seiner Emeritierung 2013 intensivierte er seine Heimatarbeit und wurde 2015 Landschaftsbetreuer für das Kuhländchen.
Wichtig sind ihm Verständigung und Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen sowie Sanierung und Erhaltung der Denkmale in seiner Heimat. Er stellt sich auch als Partner und Gutachter für Zuschüsse zur Restaurierung von Kulturgütern beim DTZF zur Verfügung. Sein besonderes Interesse gilt der Reformation, insbesondere den Mährischen Brüdern, sowie den heimatlichen Krippen. Er ist ein begehrter Referent und Autor.
In den 1990er Jahren lernte er die Neutitscheiner Volkstanzgruppe Javorník kennen und schätzen, sie brachte ihm sogar
1980 initiierte er das erste Familientreffen der Sehrs/Köstlers in Neualbenreuth und gab viel von seinem Wissen und Können an die folgenden Generationen weiter. Vor fünf Jahren organisierte er das 37. große Familientreffen in Neualbenreuth. Seine drei Enkeltöchter sind immer dabei. Sie fühlen sich dem Volksstamm der Sudetendeutschen zugehörig. Als eine Enkelin das Thema Jugendstil in der Schule hatte, machte Sehr für sie und ihre Schwestern eine Jugendstilführung durch Karlsbad. Mittlerweile hat er drei Urenkel. Er ist der glücklichste Urgroßvater und seit 59 Jahren mit seiner wunderbaren Frau Christa das Zentrum der Familie Sehr. Aus dem Musikerberuf zog er sich zurück, aber er ist für seine Freunde und Landsleute nach wie vor ein Egerländer, der viel kulturelles Wissen und Können teilt. Möge Hermann Sehr die Landsleute noch lange damit beglücken. Zuzana Finger
23/2023
Der Vater des Komponisten, Organisten, Dirigenten und Musikwissenschaftlers war der Kapellmeister, Solotrompeter und Geiger Dolf Gräf. Nach der Vertreibung lebte Dietmar Gräf in Bayreuth. Er studierte Kirchenmusik, Schulmusik für Gymnasien, Tonsatz und die Konzertfächer Klavier und Dirigieren in Regensburg, Würzburg, München und Wien. An der LudwigMaximilians-Universität in München promovierte er in Musikwissenschaft, Didaktik der Musik und Pädagogik. Er war Lehrer der Regensburger Domspatzen, Domkapellmeister in Eichstätt und Gymnasiallehrer in Mindelheim im Unterallgäu, Bamberg und München sowie Dozent für Musikpädagogik an der Universität München. Gräf gründete den Förderkreis für Symphonie- und Kammerkonzerte sowie den „Musica-SacraChor“ Bad Wörishofen und war fünf Jahre lang Intendant und
am Sudetendeutschen Tag ein Ständchen (Ý Seite 10). Er förderte ihre Zusammenarbeit mit der Kuhländler Trachten- und Tanzgruppe. 2019 wurden die Kuhländler Tänze als „Vermittlung historischer Tanzkultur und transnationaler Zusammenarbeit“ in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes eingetragen. An der tschechisch-deutschen Dokumentation der Tänze auf DVD beteiligte er sich beratend und über den Landschaftsrat auch finanziell. Am Tag des Immateriellen Kulturerbes im Mai, veranstaltet vom Bayerischen Heimatministerium, stellte er die Kuhländler Tänze in Videosequenzen im Freilandmuseum in Bad Windsheim vor.
2019 verlieh ihm sein Geburtsort die Ehrenbürgerschaft für besondere Verdienste um den Ort und die Versöhnung beider Völker. Das spornte ihn an, sich weiter für die Denkmale und die Kultur in Mankendorf einzusetzen. In der SL übernahm er 2016 das Amt des Vize-Vorsitzenden des Sudetendeutschen Heimatrates. Nach zwei Jahren als Schriftführer im Ausschuß für Kultur und Volkstumspflege der Sudeten-
� Kulturpreisträger 2001 aus Marienbad
Dietmar Gräf 80

Musikalischer Leiter des KneippMusik-Festivals in Bad Wörishofen. Er gab über 2000 Konzerte, komponierte über 500 Werke, unternahm zahlreiche Tourneen und ist Gastdirigent namhafter Sinfonieorchester, vornehmlich aus der Tschechischen Republik. Seine Spezialität sind Aufführungen von Werken sudetendeutscher Komponisten wie Widmar Hader, Heinrich Simbriger, Oskar Sigmund, Armin Rosin, Andreas Willscher und Roland Leistner-Mayer.
Seit Dezember 2004 ist Gräf ordentliches Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste in der Klasse der Künste und Kunstwissenschaften. Bei der Künstlergilde Esslingen ist er seit 1999 Mitglied, seit 2014 Fachgruppenleiter für Musik und Vizevorsitzender seit 2016. Gräf verfaßte Bücher über Musikerziehung und Gregoria-
nischen Choral und arbeitete an der Schulbuchreihe „Spielpläne Musik“ mit. Seine Kompositionen umfassen fast alle gängigen Besetzungen, darunter Werke für Chor, Orgel, Orchester, Klavier, Ensemble und Lieder.
Natürlich erhielt Gräf für seine Leistungen wie Auftritte, Meisterkurse, Tourneen oder Kompositionen viele Auszeichnungen. Dazu gehören 2001 der Sudetendeutsche Kulturpreis für Musik, 2003 die Goldene Verdienstmedaille der Stadt Bad Wörishofen, 2004 das Bundesverdienstkreuz am Band, 2009 eine Goldmedaille vom damaligen Papst Benedikt XVI. bei Gräfs drittem Auftritt als Dirigent und Organist im Petersdom zu Rom und 2010 den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis sowie 2013 die Pro-Arte-Medaille der Künstlergilde Esslingen. Der Marienbader tritt immer wieder bei Ver-
deutschen Bundesversammlung wählte ihn der SL-Bundesvorstand 2020 zum Bundeskulturreferenten. Er wurde damit in den Vorstand kooptiert und Mitglied der Bundesversammlung sowie des Sudetendeutschen Stiftungsrates. Er ist Vorsitzender der Jury zur Vergabe der Sudetendeutschen Förder- und Kulturpreise, Laudator und Moderator des von ihm geliebten Sudetendeutschen Schatzkästleins, einem Glanzstück in Bild, Musik und Dichtung. Gerne organisiert er Kulturfahrten in die Heimat und Jubiläen von sudetendeutschen Persönlichkeiten. Seit Mai 2023 ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Friedhöfe beim Heimatrat. Die Arbeitsgruppe war im April bei einer diesbezüglichen Konferenz im tschechischen Außenministerium in Prag (Ý SdZ 22/2023). Eine Lösung des Friedhofproblems scheint Broßmann zum Greifen nahe. Außerdem ist er Mitglied der Ackermann-Gemeinde, des Adalbert-Stifter-Vereins, des BDV, der Sudetendeutschen Krippenfreunde, des Klubs rodáků a přátel města Nový Jičín und der Heimatgruppe Kuhländchen München, deren Obmann und Trachtenträger er ist. Wo Ulf Broßmann ist, ist‘s kuhländlerisch, aber nie langweilig. Dafür danken die Landsleute – und erwarten noch viel von ihm. dn/as
anstaltungen der Sudetendeutschen Akademie oder anderer Institutionen auf, und dies in vielen Varianten: mal an Klavier oder Orgel, mal mit verschiedenen Blas- oder Schlaginstrumenten. In seinem Heim in Bad Wörishofen hat er eine Sammlung von mehr als 100 Musikinstrumenten, teilweise aus fernen Ländern. Oft läßt der Musiker dazu auch seine wohlklingende Stimme ertönen, so bei Werken seines mittlerweile verstorbenen Freundes Widmar Hader, der selbst mit dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis ausgezeichnet wurde.
Trotz seiner zahlreichen Aufgaben bei der Künstlergilde und dem Engagement in der Sudetendeutschen Akademie ist das musikalische Allround-Genie ständig unterwegs, zum Beispiel an seinem Geburtstag in Italien. Offiziell feiert er am morgigen 10. Juni in Bad Wörrishofen mit Stadtpfarrer Andreas Hartmann, Bürgermeister Stefan Welzel und seinem Freund Klaus Holetschek. Bayerns Gesundheitsminister war lange Bürgermeister von Bad Wörishofen, seine Mutter stammt ebenfalls aus Marienbad. Susanne Habel
Auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg veranstaltete der AdalbertStifter-Verein (ASV) eine neue Folge seiner Reihe „Literatur im Café“. Bei dem Vortrag „Otfried Preußler zum 100. Geburtstag“ stellten Anna Knechtel und der Historiker Raimund Paleczek Stationen von Preußlers Leben und einige wichtige Werke vor. Moderatorin waren ASV-Geschäftsführerin Zuzana Jürgens.
Mit der Veranstaltungsreihe ,Literatur im Café‘ möchte ich an Vertreter der deutschen Literatur aus den böhmischen Ländern erinnern“, leitete Anna Knechtel ein. „An Schriftsteller, deren Namen noch bekannt sind wie Max Brod und Marie von Ebner-Eschenbach, aber auch solche, die weniger bekannt sind“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin des ASV.
„Der heutige Abend ist einem Schriftsteller gewidmet, der keineswegs vergessen ist“, kündigte Knechtel an. „Anläßlich seines 100. Geburtstages geht es jetzt um Otfried Preußler, der vermutlich auch fast alle von uns mit seinen Kinderbüchern begeistert hat.“
Zur Orientierung bot die Referentin Einzelheiten aus dem Leben des Jubilars. Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 als Otfried Syrowatka in Reichenberg geboren, wo er 1942 Abitur machte. Im selben Jahr kam er zur Wehrmacht. Zu seinen schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend gehörten Gedichte für seine Tanzstundenpartnerin und spätere Verlobte Annelies Kind und der Roman „Erntelager Geyer“ (1944).

❯ Veranstaltung des Adalbert-Stifter-Vereins: „Literatur im Café“

Erdäpfel und Erdbeeren
1944 geriet er an der Ostfront in sowjetische Gefangenschaft. Er kam erst Ende 1949 frei. Wegen der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei konnte er nicht in seine Heimat zurück. So zog er in das oberbayerische Rosenheim zu Annelies, die 1949 seine Frau wurde und ihm drei Töchter schenkte. Nun studierte Preußler Lehramt und unterrichtete bis 1970 in der Volksschule in Stephanskirchen. Daneben schrieb er Artikel und Theaterstücke für Laien und
❯ Am Stand der Hausner-Stiftung beim Sudetendeutschen Tag
hatte 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit „Der kleine Wassermann“, basierend auf Sagen seiner böhmischen Heimatregion, wofür er den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. 1957 folgte „Die kleine Hexe“, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte „Räuber Hotzenplotz“. Zwei weitere Teile kamen 1969 und 1973 heraus. 1960 erhielt er den SL-Kulturpreis für Schrifttum.
Eine sorbische Sage verarbeitete der Autor in seinem Buch über den Zauberlehrling „Krabat“, für das er erneut den
Preisverleihung posthum
Am diesjährigen Sudetendeutschen Tag in Regensburg war die Hausner-Stiftung mit einem eigenen Stand vertreten und informierte mit Flugblättern und in persönlichen Gesprächen über Zweck und Aufgaben der Stiftung. Zweck der HausnerStiftung ist, die kulturelle Identität der deutschen Vertriebenen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien zu erhalten und das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen in diesen Gebieten und Deutschland zu fördern. Die Stiftung wurde 2002 gegründet.
Höhepunkt des Geschehens beim Sudetendeutschen Tag war am Pfingstsonntagdie Verleihung des Hausner-Preises posthum an das Ehepaar Inge und Max Hefele, die Preisträger des Jahres 2022. Pandemiebedingt kam es erst dieses Jahr zur Preisverleihung, und hier bot sich der Sudetendeutsche Tag als beliebter Treffpunkt an. Der Kuratoriumsvorsitzende Siegfried Dolleisch und Vorstandsvorsitzender Harald von Herget eröffneten die Preisverleihung. In der bewegenden Laudatio wurden freundlichst die verstorbenen Preisträger und ihre Leistungen gewürdigt.
Inge Hefele, aus dem Kuhländchen gebürtig, war mindestens seit 1958 in der SL-Ortsgruppe Gundelfingenaktiv. Sie machte sich beim Aufbau und der Betreuung des Sudetendeut-
chen Heimatmuseums in Gundelfingenunentbehrlich. Seit 1970 trat ihr Mann Max Hefele an ihre Seite und brachte sich ebenfalls in den Aufbau, die Instandhaltung und die Besucherbetreuung des Museums ein. Die Tätigkeiten von Inge Hefele im Einzelnen aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, es sei aber noch vermerkt, daß sie ab 1990 auch das Sekretariat der SLOrtsgruppe Gundelfingenübernahm und hierbei Großes leistete wie die Herausgabe der eigenen Heimatzeitung.
Beide Töchter der Hefeles ließen es sich nicht nehmen, den Preis für ihre Eltern in Regens-
burg in Empfang zu nehmen. Der Preis bestand aus einer Urkunde, der Karl-Hausner-Medaille und einem Preisgeld, was von Dolleisch und von von Herget an die beiden Hefele-Töchter überreicht wurde. dh
Die nächste Festveranstaltung der Hausner-Stiftung mit Preisverleihung findetam 9. Dezember im Sudetendeutschen Haus in München im Adalbert-StifterSaal statt.
Kontakt: Kuratoriumsvorsitzender Siegfried Dolleisch, Göllstraße 18, 83404 Ainring. Telefon (0 86 54) 48 51 16, eMail dolleisch@hausnerstiftung.de

Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Weitere bekannte Bücher sind „Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil“ (1978), „Der Engel mit der Pudelmütze. Sieben Weihnachtsgeschichten“ (1985), „Zwölfe hatʼs geschlagen“ (1988), „Das Eselchen und der kleine Engel“ (1993) sowie „Mein Rübezahlbuch“ (1993). Über Preußlers Leben las Anna Knechtel ihre schöne Zusammenfassung. Zwischen den biographischen Blöcken las der Historiker Raimund Paleczek Aus-
❯ Komponistenportrait von Walther Prokop
züge aus einigen Werken. Die Gäste von „Literatur im Café“ hörten gebannt zu, zunächst den Passagen aus „Der kleine Wassermann“. Der Titelheld entdeckt überrascht, daß Menschen gebratene „Steine“ zu essen scheinen, die sich als Erdäpfel entpuppen. Darüber klärt ihn sein Vater, der Wassermann mit der Harfe, auf, wie einst Otfried Preußlers Vater Josef seinem Sohn die Welt erklärt hatte. „Der Vater war als Lehrer an einer Sonderschule angestellt, darüber hinaus aber jahrelang Leiter des Reichenberger Heimatmuseums, Volkskundler und Heimatforscher“, erläuterte Knechtel. Weitere Lesungen boten Episoden aus „Das kleine Gespenst“, Kriegserlebnisse aus „Erntelager Geyer“ und Warnungen vor der unheilvollen Macht des Zauberbuchs in „Krabat“. „Preußler wollte die Verführbarkeit durch allesbeherrschende böse Mächte begreiflich machen“, kommentierte Knechtel klug. „Und wohl auch davor warnen –wußte er doch selbst, wie man einer solchen Versuchung erliegt.“ Dies bezieht sich auf die Verführbarkeit des jungen Preußler, der mit 17 „Erntelager Geyer“ verfaßt hatte, einen typischen Hitlerjugend-Roman, der jugendlichen Lesern zur Beschreibung des Jungenlagers und der Arbeit auf Bauernhöfen nationalsozialistische Propaganda vermittelte.
Zum Schauplatz der Weihnachtsgeschichte habe Preußler seine nordböhmische Heimat gemacht, so Knechtel. Und Raimund Paleczek las einfühlsam die Szene aus „Flucht nach Ägypten“, in der die Muttergottes für einen todkranken Jungen mitten im Winter Erdbeeren sprießen läßt. Susanne Habel
Dichtung und Musik
Auf dem Sudetendeutschen Tag bot das Sudetendeutsche Musikinstitut (SMI) in Regensburg ein Musikerportrait. Der Komponist Walther Prokop, der 2018 mit dem SL-Kulturpreis für Musik geehrte wurde, führte mit zahlreichen Tonbeispielen in sein Werk ein.
Walther Prokop war schon einmal gefeierter Gast beim Sudetendeutschen Tag. 2018 war er im Goldenen Rathaus in Augsburg mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Musik ausgezeichnet worden. Sein Vater, der Maler und Graphiker Karl Prokop, stammte aus Zwickau in Böhmen. Prokop selbst wurde 1946 im oberbayerischen Rosenheim geboren. Von 1968 bis 1972 studierte er Schulmusik und Komposition an der Münchener Musikhochschule. Er arbeitete 1974 bis 2011 als Musikerzieher und Schulchorleiter am Gymnasium von Gars am Inn in Oberbayern. Von 1986 bis 2004 war Prokop Erster Vorsitzender des Tonkünstlerverbands SüdostBayern und erhielt Auszeichnungen für seine Kompositionen, etwa 1981 den Förderpreis der Stadt Rosenheim. Er hat vier Kinder, die ebenfalls musizieren.
Über die Einladung von Andreas Wehrmeyer, dem Direktor des SMI, freute sich der Musiker sehr: „Das ist selten, daß mal ein lebender Komponist vorgestellt wird.“ Prokop erzählte heiter und oft ironisch über seine Entwicklung als Musiker. „Als Komponist stand ich anfangs unter dem Einflußder Zweiten Wiener Schule wie Anton von Webern, orientierte mich jedoch bald an der französischen ,Groupe des Six‘ wie etwa Francis Poulenc. Die Franzosen haben mich durch ihre Farbigkeit, durch ihr Licht fasziniert.“
Er habe geistliche und weltliche Chormusik geschaffen, oft inspiriert von Texten. „Ich habe bald aus dem Bauch heraus komponiert – ich mache nicht No-
ten, sondern Töne.“ Auch habe er Liederzyklen nach Werken der Dichtung – von Goethe bis Ringelnatz – und auch Sologesänge mit Orgel und Instrumentalmusik komponiert. Prokop führte einige Titel als Beispiele an.
„Seit ich im Ruhestand bin, haben sich meine Kompositionen vermehrt“, schmunzelte er. Damals sei er auch aus Gars nach Rosenheim gezogen, was zu einer Veränderung seiner Arbeit geführt habe. „Ich bin dort in der
gessenen“ nach Gedichten von Theodor Kramer für Bariton und Klavier (2001). „Der jüdischböhmischstämmige Kramer kam 1897 in Niederhollabrunn in Österreich-Ungarn zur Welt und arbeitete in der Zwischenkriegszeit zeitweise als Buchhändler. Er mußte 1939 emigrieren, kam jedoch 1957 nach Wien zurück, wo er 1958 auf dem Zentralfriedhof beerdigt wurde.“ Dieser Dichter habe skurrile Verse geschrieben, die ihn inspiriert hätten.
der Pfarrei Sankt Hedwig auf einen fantastischen Organisten gestoßen, für den ich Kirchenmusik komponiere, etwa die Vertonung des ,Hohelieds‘“. Um die Aufzählung seiner Musikstücke zu veranschaulichen, gab er Hörbeispiele von seinen Werken, die er auf CDs mitgebracht hatte: Zunächst erklangen „Scherzo“ und „Rondo. Finale“ aus dem „Divertimento für Flöte, Klarinette und Fagott“ (1981).
Darauf folgte die „Sommerfrische“ (2001) aus „Die Schnupftabaksdose. Vier gemischte Chöre“ nach Joachim Ringelnatz .
Nach diesen heiteren Stükken, bei denen die Sänger mit ihrer Artikulation brillierten, kamen „Heute summen noch die Bienen“ und „Die alten Geliebten“ aus „Gesänge einer Ver-
Da er in dem Kirchenmusiker und Organisten Herbert Weß an Sankt Hedwig einen kongenialen Partner gefunden habe, so Prokop, komponiere er auch öfter für die Orgel, sei dennoch immer wieder von Texten fasziniert. Dazu spielte er das „Te Deum laudamus“ für Sopran, Tenor und Orgel (2021). Dessen Uraufführung fand 2022 mit Veronika Burger (Sopran), Herbert Gruber (Tenor) und Herbert Weß (Orgel) in Rosenheim statt, und das Werk klang auch als CD-Aufnahme beeindruckend und schön. Die lebhafte Fragerunde im Anschluß machte deutlich, daß es sehr sinnvoll und gut ist, sich mit dem weiteren Schicksal von früheren Kultur- und Förderpreisträgern zu beschäftigen.

Susanne Habel

Im Sudetendeutschen Haus in München eröffnete HeimatpflegerinChristina Meinusch die neue Ausstellung „verloren, vermißt, verewigt. Heimatbilder der Sudetendeutschen“.
Die Ausstellung ist als studentisches Projekt des Studiengangs Museologie und materielle Kultur der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Kooperation mit der Heimatpflegerinder Sudetendeutschen entstanden. Gefördert wird das Projekt vom Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München und vom Kulturreferenten für die Böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein. Zur großen Eröffnungsveranstaltung waren rund 100 Gäste gekommen.
Was ist Heimat, und was bedeutet es, diese zu verlieren? Dies war die theoretische Frage, die der neuen Ausstellung zugrunde liegt. Rund drei Millionen Sudetendeutsche hätten nach dem Zweiten Weltkrieg die Tschechoslowakei verlassen müssen, so die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen im Vorfeld der Eröffung am vergangenen Samstag.
„Was vielen Vertriebenen von ihrer Heimat blieb, waren Bilder. Sie schmück(t)en oftmals private Wohn-, aber auch gemeinschaftliche Versammlungsräume“, erinnerte Christina Meinusch. Genau diesen Heimatbildern widme sich die Ausstellung „verloren, vermißt, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Doch es gehe nicht nur um die materiellen, sondern auch um die immateriellen Bilder von der verlorenen Heimat, die in Form von Vorstellungen und Erinnerungen überdauert hätten.
Die Ausstellung war als studentisches Projekt des Studiengangs Museologie und materi-

im Sudetendeutschen Haus in München
„verloren, vermißt, verewigt“
chel und Marie Rieker, die die Rede der Studentinnen und Studenten hielten. Für die großartige Unterstützung beim Blockseminar mit den Studierenden hier in München und beim Aufbau der Ausstellung gelte ihr herzlicher Dank dem Team des Sudetendeutschen Museums, sagte Meinusch.

Auch die Studenten erklärten ihre Erlebnisse bei der Gestaltung: Zunächst schilderten sie ihre völlige Ahnungslosigkeit hinsichtlich des Sudetenlandes und der Vertreibung der Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie hätten sich für das Projekt mit den Begriffen Heimat, Staat, Hymne und Tracht auseinandergesetzt. Sie hätten Zeitzeugen befragt, viele Wissenschaftler interviewt und Quellen recherchiert. Das Ergebnis sei eine neue Art von Heimatbetrachtung und Aufarbeitung.
Volksgruppensprecher Bernd Posselt lobte die jungen Menschen, die dem Vergessen ein starkes Zeichen entgegensetzen würden.
„Diese Ausstellung läßt eine professionelle Handschrift erkennen“, so Lilia Antipow. „Sie bietet der – auch nichtsudetendeutschen – Öffentlichkeit einen neuen Blick auf das Thema und verbindet Dreifaches: einen theoretisch und methodisch innovativen Zugang, historische Sachkenntnis und emotionale Wirkung“, lobte die HDO-Pressereferentin beim anschließenden, festlichen Empfang im Ottovon-Habsburg-Foyer mit einem feinen Buffet. sh
elle Kultur der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Kooperation mit der Heimatpfl -


gerin der Sudetendeutschen entstanden. Gefördert wird das Projekt vom Haus des Deutschen
Ostens (HDO). Daher wollte Christina Meinusch besonders die 24 Studenten begrüßen, die
an diesem Ausstellungsprojekt mitgearbeitet hatten, namentlich Alexander Diehl, Paula Mi-

Bis Freitag, 30. Juni: „Verloren, vermißt, verewigt“ in München, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8. Montag bis Freitag 9.00–17.00 Uhr.
wie Heimatscheine oder Aussiedlungsbefehle
Auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg nahm Ralf Pasch, der Autor von „Die Erben der Vertreibung“, die Neuauflage seines Buches über die Enkelgeneration der Vertreibung zum Anlaß, über die Situation zehn Jahre später mit Vertretern der Sudetendeutschen Jugend (SdJ) und einem – auch älteren – Publikum zu diskutieren.
Vor zehn Jahren entstand das Titelfoto mit dem Hinterkopf von Antonia Goldhammer, die damals sehr aktiv in der SdJ war, und dem Schriftzug „Meta-*heimat“ auf ihrem T-Shirt auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg. Gemacht hatte das Foto Mario Hierhager, der gegenwärtige SdJ-Vorsitzende. In den Jahren danach sammelte Pasch 15 Portraits der Enkelgeneration in Deutschland und in der Tschechischen Republik.

❯ Podiumsdiskussion der SdJ beim 73. Sudetendeutschen Tag
Die Erben der Vertreibung – eine Bilanz
Vier der im Buch behandelten Enkel stellte er noch einmal
vor: Antonia Goldhammer, Sebastian Benedikt, Urenkel des Schriftstellers Hugo Scholz, Petr Joza (* 1969), Archivar auf Schloß Tetschen, und die Organisation Brontosaurus aus dem Altvatergebirge. Mit ihnen habe er Fragen bearbeitet, die er sich selbst gestellt habe.
Sein Großvater Alois Pasch (1913–2001) aus dem Riesengebirgskreis Trautenau habe ihm seine Erinnerungen „Ein Leben für die Technik und mit der Technik“ vermacht: 900 Seiten maschinengeschrieben. Die Großmutter Marie Pasch (1916–1999)
sei in Tetschen-Bodenbach zur Welt gekommen. Die Erlebnisse mit den Großeltern wie Heimatreisen und Heimaterzählungen einschließlich der niedergeschriebenen Erinnerungen hätten ihn vor die Frage gestellt: „Was mache ich damit?“
„Hat man eine Aufgabe, wenn man solche Wurzeln geerbt hat? Was heißt in diesem Zusammenhang Versöhnung? Hat das Erbe etwas mit Versöhnung zu tun?“ Diese Fragen habe er sich und seinen Porträtierten gestellt. Aber wie sehe es heute damit aus? „Wir sind nicht Opfer der Vertreibung, wir sind nur die Erben einer faszinierenden und leidvollen Vergangenheit“, habe 2013 Peter Paul Polierer, der damalige SdJ-Vorsitzende, der auch im Publikum saß, gesagt. Die Podiumsteilnehmer waren Alexander Stegmeier, Tomáš Matějka und Mario Hierhager. Alexander Stegmaier (* 1995), seit 2017 EJBundesjugendführer, war in Egerländer Tracht gekommen. Der Pilsener Tomáš Matějka
ist Mitglied der 1996 gegründeten tschechischen SdJ-Partnerorganisation Sojka. Er war als
gen im Gaisthal und erfuhr erst Jahre später von seiner Mutter, daß sein Großvater Sudetendeutscher war.
Ralf Pasch: „Die Erben der Vertreibung: Sudetendeutsche und Tschechen heute“. Mitteldeutscher Verlag, Halle an der Saale 2022 zweite Auflage;232 Seiten, 18 Euro. (ISBN 978-3-95462236-8)

18jähriger vor zehn Jahren erstmals in ein Sommer-Zeltlager ins Gaisthal mitgefahren, hatte das gut gefunden und sich erst allmählich gefragt: „Wieso sind wir Deutsche und Tschechen hier im Gaisthal und machen hier etwas zusammen? Wer ist die SdJ?“ Später wurde er zum Sudetendeutschen Tag eingeladen, freute sich auf eine tolle Veranstaltung mit seinen deutschen Freunden, wußte aber nichts über dieses jährliche Treffen.
Und Mario Hierhager, der mittlerweile 35jährige Vorsitzende der SdJ, rutschte in die deutschtschechische Jugendbegegnun-

Stegmeier berichtete vom jüngsten, dem 50. EJ-Bundestreffen im oberfränkischen Marktredwitz. 2022 seien sie erstmals zum samstäglichen Volkstumsabend in die Eghalandrische Heimat gefahren. Zwei Reisebusse voller Trachtenträger seien nach Elbogen gefahren, die EJ habe auf dem Marktplatz getanzt, und die Einheimischen hätten interessiert zugesehen. Anschließend hätten sie im Kulturzentrum Dvorana ihren Volkstumsabend mit viel tschechischer Prominenz gefeiert. Trotz einiger Widerstände und der Corona-Regeln sei alles beeindruckend gut gelungen.
Tomáš Matějka erzählte von den Sommer-Zeltlagern, zu denen immer etwa 30 tschechische Jugendliche mit etwa zehn Betreuern kämen.
Für viele tschechische Familien sei es attraktiv, ihre Kinder nach Deutschland zu schikken, immerhin lernten sie bei
den Sommerlagern auch etwas deutsch.
Mario Hierhager berichtete auf Anfrage, daß die SdJ noch mehrere Tausend Mitglieder habe. Die SdJ werde auch in zehn Jahren noch existieren, da sie einen unbeschwerten Zugang zur schwierigen sudetendeutschtschechischen Geschichte pflege. Viel problematischer seien zwei Jahre Corona gewesen. Corona habe viel Vereinsarbeit auch im Jugendbereich gerade im ländlichen Raum zerstört. Alle Vereine täten sich momentan schwer.
Für die Zweite Auflageseines Buches schrieb das Ralf Pasch ein bilanzierendes neues Vorwort. Noch sind die Enkel der Vertreibung mit deutsch-tschechischen Themen, vor allem mit Begegnungen beschäftigt. Bald werden dies wohl die Urenkel tun.
Ulrich Miksch

Im Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) in Regensburg wird derzeit die Ausstellung „Emil Orlik an Max Lehrs“ gezeigt. Sie präsentiert Briefe und Postkarten, die der 1870 in Prag geborene Künstler Orlik an seinen Freund, den Kunsthistoriker Max Lehrs, schickte.
Über 440 Briefe und Postkarten
sandte Emil Orlik (* 1870 in Prag, † 1932 in Berlin) zwischen 1898 und 1930 an seinen Freund, den Kunsthistoriker Max Lehrs. In seinen Schreiben berichtet der bekannte Grafikerund gefragte Portraitist über seine Reisen und

KOG ergibt sich ein faszinierender Einblick in das Leben des Künstlers und seine vielfältigen künstlerischen Projekte. Emil Orliks erster erhaltener Brief an Max Lehrs datiert vom 20. Juni 1898. Orlik schrieb ihn während seiner ersten großen Europareise. Der knapp 28jährige hatte sich damals als freischaffender Künstler in seiner Geburtsstadt Prag niedergelassen, wohin er nach seinem Studium in München zurückgehrt war. Der fünfzehn Jahre ältere Kunsthistoriker Lehrs lebte zu der Zeit in Dresden. Seit 1896 leitete er dort das Königliche Kupferstich-Ka-


❯ Ausstellung in Regensburg
Orliks Post
Orliks aus. Der Künstler unterstützte wiederum Lehrs, als dieser 1911 eine Ausstellung mit Zeichnungen des Malers Ferdinand Hodler vorbereitete.
künstlerischen Projekte. Die Texte begleitet Orlik mit einer Vielzahl an Zeichnungen, manchmal findensich auch kleine Druckgrafiken.Die einzigartige Sammlung befindetsich im Kunstforum Ostdeutsche Galerie.
Prag und Dresden
Mit der Ausstellung „Emil Orlik an Max Lehrs. Künstlerpost aus aller Welt“ stellt das Regensburger Museum diesen Schatz erstmals ausführlich der Öffentlichkeit vor. In der Zusammenschau mit Zeichnungen, Aquarellen, Radierungen, Holzschnitten und Lithografienaus dem umfangreichen Orlik-Bestand der GrafischenSammlung des
Viel Zeit verbrachte Emil Orlik auf Reisen. Ob er sich auf einer großen Studienreise befand oder lediglich Freunde und Kollegen besuchte oder sich bei einem Kuraufenthalt erholte –immer war Orlik mit Stift oder Feder unterwegs und auf Motiv-Suche. So sind nicht nur seine Skizzenbücher voller Zeichnungen, auch in den Karten und Briefen an Max Lehrs fiden sich oft verwandte Darstellungen.
Neben Sehenswürdigkeiten sind es lokale Trachten und Landschaftsmotive, aber auch alltägliche Begebenheiten, die er meisterhaft – oft mit wenigen Strichen – zu Papier brachte. In vielen Fällen gehen seine druckgrafischenArbeiten auf solche Studien zurück. Den Be-
binett. Sehr wahrscheinlich war es sein professionelles Interesse, das ihn mit dem jungen Grafiker zusammenführte. Ihr mal mehr, mal weniger intensiver Briefwechsel sollte die beiden Männer von nun an über 30 Jahre begleiten. Bis 1930 erhielt Lehrs über 440 Briefe und Postkarten von Orlik, die er sorgfältig aufbewahrte und in drei Alben binden ließ.
Die Korrespondenz umfaßt somit die gesamte produktive Zeit von Emil Orlik. „Fast jedes Schreiben ergänzt Orlik mit Zeichnungen. Oft sind es humorvolle Kommentare zum Geschriebenen oder Eindrücke von seinen Reisen. Manchmal sendete er Lehrs auch Proben sei-
❯ Quer durch die Welt
ner druckgrafischenArbeiten,“ berichtet Sebastian Schmidt, der Kurator der Ausstellung und Leiter der GrafischenSammlung am KGO. „Somit sind die Schriftstükke nicht nur als historische Dokumente zu betrachten. Es handelt sich zugleich auch um kleine Kunstwerke,“ hebt er hervor. Orliks Post bietet Einblick in sein Leben und gibt Auskunft über seine vielen Reisen quer durch Europa sowie nach Asien und Amerika. Die Berichte über seine künstlerischen Vorhaben und Aufträge ergeben ein Bild über den Werdegang des gefragten Portraitisten. Die Briefe und Karten, die während seiner Japanbesuche in den Jahren 1900 bis 1901 und 1912 entstanden, lassen seine Auseinandersetzung mit der japanischen Kunst, insbesondere dem Farbholzschnitt, nachvollziehen. Vor Ort in dieser Technik ausgebildet, trug Orlik zur Verbreitung dieser für den Jugendstil charakteristischen Technik in Mitteleuropa bei.
Heute befindetsich Lehrs‘ einzigartige Sammlung an Künstlerpost im Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Angekauft hat sie im Jahr 1967 der Adalbert-StifterVerein (ASV) mithilfe von Bundesmitteln für die im Vorjahr gegründete Stiftung Ostdeutsche Galerie. Die erste wissenschaftliche Auswertung erfolgte im ASV, der 1981 eine Auswahl des Materials unter dem Titel „Malergrüße“ veröffentlichte. Die Ausstellung „Emil Orlik an Max Lehrs. Künstlerpost aus aller Welt“ präsentiert die nun komplett dokumentierte Korrespondenz zum ersten Mal in der Gesamtheit.
Auch wenn Emil Orlik und Max Lehrs ihre ersten Briefe
wahrscheinlich bereits zuvor ausgetauscht hatten, kann man ihre Begegnung in den Niederlanden im September 1898 als Beginn ihrer freundschaftlichen Beziehung ausmachen. Für Orlik war es eine Station auf seiner ersten großen Europareise. Lehrs – in diesen Tagen ebenfalls auf Reisen – traf ihn in Amsterdam.
In Max Lehrs fand Orlik den richtigen Gesprächspartner, mit dem er sich über seine aktuellen künstlerischen Projekte austauschen konnte. Der Kunsthistoriker gilt als Entdecker Orliks. Als Direktor des Dresdner Kupferstich-Kabinetts (1896–1904 und 1908–1923) sowie zeitweise des Kupferstichkabinetts in Berlin (1904–1908) erwarb Lehrs Orliks Werke. Doch auch „dem Privatmann!!“ (18. Oktober 1899) schickte Orlik gelegentlich Proben aktueller Arbeiten als Geschenk.
Die beiden Freunde profitieten auch gegenseitig von ihren Kontakten in Kollegenkreisen. So vermittelte Lehrs Orlik beispielsweise an Julius Leisching, den Direktor des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn.
Im Jahr 1900 richtete das Museum die erste umfangreiche Einzelausstellung von Werken Emil
Ein Künstler auf Reisen
richten an Max Lehrs zufolge bearbeitete Orlik seine Druckplatten bisweilen sogar unterwegs und ließ diese in verschiedenen Werkstätten seines Vertrauens drucken. Oft verband er seine Reisen mit Portraitaufträgen.
Wegweisend war für Emil Orlik insbesondere seine erste Japanreise in den Jahren 1900 und 1901. Einen der ersten Briefe an Lehrs schrieb er am 15. Mai 1900. Dort stellte er fest: „Lernt man aber den scheußlichen modernen Firnis, mit dem hier lei-

der schon so vieles überzogen ist, abzunehmen, so findetman doch, daß die Dinge hier noch über Erwarten schön sind. Ich wandere ganze Tage herum: in Kuriositäten-Läden, zu Holzschneidern, Farbenholzschnittdruckern (schönes Wort!).“
Am 26. Juli 1900 schrieb er: „Mir gefällt es hier immer besser! Ich spreche schon zum Dienstgebrauch genügend japanisch und kann famos Holzschnitte drucken.“ Bei seiner zweiten Reise Richtung Japan im Jahr 1912, die ihn auch nach
Das Herzstück der Präsentation stellen die mehr als 440 Originale von Orliks Briefen und Karten dar. Die jeweils aufgeschlagenen Seiten der drei Alben wechseln regelmäßig, damit die Besucher bis zum Ende der Laufzeit der Ausstellung am 18. Juni möglichst viele von Orliks virtuosen Zeichnungen im Original betrachten können.
Einladung ins Kaffeehau
Sämtliche Schriftstücke wurden im Rahmen der Vorbereitungen zu dem Ausstellungspro-
Die gesamte Korrespondenz ist zudem im Katalog abgebildet, der außerdem die Transkriptionen der Texte enthält. Ausgewählte Zitate aus dem Schriftwechsel bilden den Leitfaden der Präsentation. Ausgestellt sind neben dem Briefwechsel 125 Kunstwerke aus der über 2500 Werke umfassenden Orlik-Sammlung des KOG: Zeichnungen aus Skizzenbüchern, die der Künstler auf seinen Reisen erstellte, aber auch beispielsweise Portraits und Exlibris, die im Zusammenhang mit seiner Korrespondenz stehen, sowie auch einige Gemälde.
Die Ausstellung bietet eine spezielle Attraktion: eine Kaffeehaus-Ecke, die mit Möbelstükken aus dem Fundus des Theaters Regensburg wie zu Emil Orliks Zeiten eingerichtet wurde. Das Orlik-Café lädt dazu ein, bei Kaffee und Kuchen den Kartengruß wieder aufleben zu lassen. Zur Auswahl gibt es neben Postkarten mit Orliks Motiven auch Blanko-Karten zum Selbstgestalten. Um die Post direkt auf den Weg bringen zu können, gibt es im Café Briefmarken und die Replik eines Briefkastens von 1865 aus dem Freilandmuseum Oberpfalz.
Ägypten, Nubien, Ceylon, China und Korea führte, standen statt technischen Fertigkeiten zunehmend exotische Motive im Mittelpunkt. Orlik hatte bereits 1901 überlegt, auf dem Rückweg von Japan nach Amerika zu fahren. Doch er entschied sich damals dagegen. Eine gute Gelegenheit, doch noch in die USA zu reisen, ergab sich 1924. Die Kosten für die Reise und den zweimonatigen Aufenthalt übernahm ein Auftraggeber, der ein Porträt bei Orlik bestellte.
jekt hochauflösendeingescannt.
Mit allen Vorder- und Rückseiten sowie den meist ebenfalls noch vorhandenen Umschlägen sind rund 1200 Digitalisate angefertigt worden. In der Ausstellung kann man anhand der Scans auf einem großen Bildschirm jedes einzelne Schriftstück im Detail betrachten.
Seine Eindrücke von New York brachte Orlik in einem Brief vom 20. Januar 1924 an Lehrs

auf den Punkt:
„Die Stadt ist unvorstellbar großartig 1000 künstlerische Eindrücke. Aber die Einstellung zum Leben ist für uns schwer. Alles nach Dollar-Wert gemessen.“ In zahlreichen Skizzen hielt er immer wieder die Skyline der Metropole fest. Als Hommage an die Stadt erstellte Orlik 1928 eines
Bis Sonntag, 18. Juni: „Emil Orlik an Max Lehrs. Künstlerpost aus aller Welt“ in Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Straße 5, Dienstag bis Sonntag 10.00–17.00, Donnerstag 10.00–20.00 Uhr, Feiertage 10.00–17.00 Uhr, Internet www.kunstforum. net
seiner beeindruckendsten Blätter, die große Radierung „Bau eines Hochhauses in New York“.
� Wischauer Sprachinsel
Ein Koreaner zu Gast
Unter den Besuchern am Stand der Wischauer war am Pfingstsonntag in Regensburg auch Su Hyun Bea vom koreanischen BdV. Er hatte in Berlin in einer Ausstellung Wischauer Trachtenstikkereien gesehen, unter denen der Name Rosina Reim stand. Nun wollte er die Stickereien und den Menschen in Natura sehen.


Das war auch für mich ein tolles Erlebnis, als mich der junge Mann persönlich suchte, weil er in Berlin unsere Wischauer
Objekte gefunden und meinen Namen gelesen hatte“, sagte Rosina Reim, die langjährige Landschaftsbetreuerin der Wischauer Sprachinsel. „Er war sehr angetan. Ich habe ihm meine ‚Wischauer Glückstropfen‘ mitgegeben. Er meinte, er werde dieses Geschenk seinen Eltern mitbringen. Das sei etwas Besonderes. So oft wie Herr Bea hat sich noch kein Mann vor mir verbeugt. Das tut gut, solche Menschen zu treffen, die uns als Außenstehende schätzen.“
Mit diesem Handyfoto zeigt Su Hyun Bea, wo er zum ersten Mal auf die Wischauer stieß.
1948 fanden im Süden Koreas Wahlen statt, die die Demokraten gewannen. Der sowjetisch kontrollierte Norden beantwortete dies im selben Jahr mit der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea. 1950 griff Nordkorea im Glauben auf einen schnellen Sieg den Süden an. Der Krieg zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea sowie der mit ihr im Verlauf verbündeten Volksrepublik China auf der einen Seite und der Republik Korea sowie Truppen der Vereinten Nationen unter Führung der USA auf der anderen Seite dauerte bis 1953.
Neben dem Krieg in Afghanistan von 1978 bis 1989 und dem Vietnamkrieg war dies der größte Stellvertreterkrieg im Kalten Krieg. Korea ist gegenwärtig das einzige geteilte Land der Welt.
Hanzelková überreicht Broßmann die Broschüre „Völkerverbindende Begegnungen“, Miroslav Hanzelka hat Geburtagskichlen dabei, und Ondřej Syrovátka, Zweiter Bürgermeister von Neutitschein, überbringt die Geschenke der Mankendorfer Bürgermeisterin Martina Blažková. Zum Schluß erhält Broßmann einen witzigen USBStick mit Heimatbildern und daten, der sich in der Silhouette von Neutitschein verbirgt.
� Kuhländchen
Heimatständchen für Ehrenbürger
Weil Ulf Broßmann, Landschaftsbetreuer für das Kuhländchen, in wenigen Tagen 80 Jahre alt wird (Þ Seite 6), brachte ihm die Neutitscheiner Volkstanzgruppe Javorník ein Ständchen und Geschenke von guten Freunden aus der Heimat.

Am frühen Nachmittag des Pfingssamstags saß Ulf Broßmann völlig entspannt mitten im Böhmischen Dorffest und verdaute bei einem Heimattipple
Kaffee die Verleihung des Europäischen Karlspreises an Christian Schmidt und Libor Rouček. Überraschend bat ihn Eva Hanzelková, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Volkstanzgruppe Javorník, ihr zu folgen. Baß erstaunt folgte ihr Broßmann an eine freie Stelle der Halle. Geschwind formierten sich die Javorníks und sangen ein Geburtstagsständchen.
Dann las Hanzelková die Geburtstagswünsche der Manken-
� Brünn, Jägerndorf und Mährisch Schönberg
dorfer Bürgermeisterin Martina Blažková vor, in der diese dem Mankendorfer Ehrenbürger Broßmann nicht nur gratulierte und alles Gute wünschte.
„Wir danken Ihnen für Ihre Bescheidenheit, Freundschaft und Liebe zu Mankendorf. Wir wissen es sehr zu schätzen, daß Sie trotz des Schmerzes, den Ihre Familie ertragen mußte, uns Ihre Zuneigung schenken. Danke, daß Sie Ihr Heimatdorf nie vergessen haben und immer ger-
ne zurückkommen. Dies ist der Ort, in dem Sie zur Welt kamen und immer Freunde finden werden. Danke für Ihr Vertrauen und stete Zusammenarbeit, die nicht nur uns, sondern alle Mankendorfer, ob deutsch- oder tschechischsprachig, verbindet. Nur in Freundschaft und Liebe können wir gemeinsam Hindernisse überwinden und große Ziele erreichen.“
Anschließend prasselte es Geschenke. Nadira Hurnaus
Heimatstände zum Kennenlernen
Und Monika Ofner-Reim, Tochter von Rosina Reim und deren Amtsnachfolgerin, sagte: „Wir sind immer wieder überrascht, wo überall Spuren unserer kleinen Wischauer Sprachinsel zu finden sind.“
Su Hyun Bea studierte an der Koreanischen Universität und der Humboldt-Universität zu Berlin. Jetzt ist er Mitarbeiter des Donghwa-Instituts und Vertreter der Föderation der Nordprovinzen Koreas. Er ist deren Verbindungsmann zu den deutschen Vertriebenenverbänden.
Ähnlich wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Korea im Koreakrieg massenhaft Flucht und Vertreibung. Zwischen 1945 und dem Ende des Koreakrieges verloren zwei Millionen Menschen im Nordteil der koreanischen Halbinsel ihre Heimat, flohen nach Südkorea und mußten sich jenseits der innerkoreanischen Grenze eine neue Zukunft aufbauen.
Seine Großeltern, erzählt Su Hyun Bae, hätten im Norden gelebt. Sie hätten eine Fabrik besessen und seien Christen gewesen. Die Kommunisten hätten sie nach dem Koreakrieg enteignet und vertrieben. Sie hätten mit zwei Koffern in Südkorea neu angefangen. Nadira Hurnaus

Die verbliebene Brünnerin Lotte Proásková am Stand des Deutschen Kulturvereines Regio Brünn – Begegnungszentrum.




Die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland präsentiert den „Johnny“KleinPreis für deutschtschechische Verständigung, der zum Andenken an den aus Mährisch Schönberg stammenden Journalisten, Diplomaten und Politiker heuer zum 4. Mal in seiner Heimatstadt verliehen wird.
Wischauer und Wischauerinnen mit Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf. Bilder: Nadira Hurnaus



und Sohn von Ingeborg Cäsar. Bilder: Nadira Hurnaus


� SL-OG Weilimdorf
Unmut
über Titel
Die baden-württembergische SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf mit Zuffenhausen, Stammheim, Rot, Zazenhausen, Freiberg und Mönchsfeld traf sich Ende Mai zu ihrem letzten Monatsnachmittag vor der Sommerpause im Haus der Begegnung in Stuttgart-Giebel.

Ortsobfrau Waltraud Illner


nutzte das Treffen, um die Ortsgruppe über das Programm des Sudetendeutschen Tages in Regensburg zu informieren, das Neueste aus der Verbandsarbeit zu verkünden und die wichtigsten Termine, die in die Zeit des Sommers fallen, bekanntzugeben. Sie machte dabei keinen Hehl über ihren Unmut über den Titel einer Ausstellung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, die im Haus der Heimat in Stuttgart ab 3. Juni läuft und mit „Migration und Wohnungsbau. Lebensgeschichten aus Stuttgart-Rot“ tituliert ist.
„Vertriebene sind keine Migranten, die freiwillig einen Wohnortwechsel vornahmen, sondern Menschen, die gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen und im Viehwagon in Deutschland ankamen“, sagte die Ortsobfrau. Nach ihrer Vorstellung hätte man die Ausstellung besser „Vertriebene, Migration und Wohnungsbau. Lebensgeschichten aus Stuttgart-Rot“ genannt, dies wäre der Historie gerecht geworden. In diesem Zusammenhang erwähnte Illner auch, daß die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch, den Wunsch geäußert habe, die Wanderausstellung „verloren, vermißt, verewigt –Heimatbilder der Sudetendeutschen“ in Stuttgart zu zeigen.
Bei den Sommerterminen wies Illner auf den 17. Juni hin, an dem im Stuttgarter Haus der Heimat das 75jährige Jubiläum der Kreisgruppe Stuttgart sowie der Ortsgruppen Weilimdorf und Bad Cannstatt gefeiert werden sollten. Ehrengast sei die berühmte ehemalige Primaballerina des Stuttgarter Balletts, Professor Birgit Keil, die in einem Festvortrag über ihr Leben und Wirken erzählen werde.

Für die Brünn-Fahrt vom 23. bis 26. Juni gebe es noch freie Plätze. Und auch die Charta-Feier am 5. August auf dem Stuttgarter Schloßplatz mit dem Vorsitzenden der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag, Christoph de Vries MdB, erwähnte Illner. Der erste Monatsnachmittag der SL in Stuttgart-Giebel nach der Sommerpause werde am 9. September stattfinden. Helmut Heisig
� Kulturverband Graslitz


Handykurse und Polonaise
Mitte Mai feierte der Kulturverband der Deutschen in Graslitz Muttertag.
Die Sonne scheint, und in Graslitz merkt man nichts von dem harten Klima des Erzgebirges. Die Bäume sind ausgetrieben, das Gras steht hoch. In der Stadt wurden weitere Häuser renoviert. Samstagnachmittag ist im Ort alles lebendig, und der Saal im Kulturhaus ist für den Muttertag geschmückt.
Die Feier beginnt mit der Begrüßung der Gäste durch die Vorsitzenden
Petr Rojík und Jitka Marešová in Deutsch und Tschechisch.
Dann übernehmen die Moderatoren Regina Gerberová und Horst Gerber –Tochter und Vater – und gratulieren allen Müttern zum Muttertag, ebenfalls zweisprachig. Eine beeindruckende Szene. Seit einem Jahr ist Jan Šimek Bürgermeister von Graslitz. Er ist Mitglied in unserem Verein. Für uns bedeutet es ein große Freude, daß er seine kurze Ansprache ebenfalls in beiden Sprachen an die Anwesenden richtet. Er erinnert an die Bedeutung des Muttertags und sagt, ein Ort funktioniere nur dank des Einsatzes der Mütter, ob jung oder alt.
Die Kinder des Graslitzer Kindergartens bereichern mit Gedichten, Liedern und Tänzchen die Feier. Etwa 15 Minuten dauert ihr Auftritt, und immer wieder kann man das Wort Mama hören. Alle sind begeistert. Unser Bürgermeister hat das ganze Programm aufgezeichnet, und hier darf man verraten, ein Kind unseres Bürgermeister gehört zur Kindergartengruppe, und seine Frau ist eine der betreuenden Kindergärtnerinnen.
Monika Hrádková, Bürgermeisterin im nahen Schwaderbach, gibt uns ebenfalls die Ehre. Auch Josef Štícha, der Bürgermeister von Zbiroh, das nahe der Autobahn zwischen Pilsen
und Prag liegt, war gekommen. Wie immer begrüßte er die Besucher mit einem Glas Sekt im Foyer. Wie schon in den vergangenen Jahren sorgt er für die Bewirtung: Krapfen, Schaumrollen und belegte Semmeln. Neben Kaffee gibt es kalte Getränke. Nach der Pause werden auch Bier und Wein ausgeschenkt.
Der Kulturverband bietet seinen tschechischen Mitgliedern Deutschkurse. Gerda Hazuchová hat gerade sehr erfolgreich einen Kurs durchgeführt. Für die Muttertagsfeier haben die Kursteilnehmer vier deutsche Lieder eingeübt und aufgezeichnet. Das Video wird im Saal vorgeführt. Die Liedtexte liegen dazu aus, so daß alle mitsingen können. Gerda wird den Kurs weiterführen, da ihre Schüler sich dies wünschen. Hervorzuheben ist, daß sie dies ehrenamtlich tut.
Uns erscheint es auch wichtig, den Anwesenden mitzuteilen, daß für Mitglieder Computerund Handykurse angeboten wurden. Jeder Schüler der 8. Klasse betreute eines unserer Mitglie-
der und brachte ihm einfache Arbeiten an diesen Geräten bei. An erster Stelle stand das Schreiben von eMails. Schulleiter Zdeněk Pečenka unterrichtete persönlich den Handykurs.
Wie bereits im Herbst singt Kristina Kůtkova aus Eger. Sie ist seit Herbst Studentin in Prag. Kristina trägt ein umfangreiches Paket von internationalen Liedern flott und gekonnt vor und erhält viel Applaus. Ebenso begeistert der Gesangsauftritt von Petra de Dios, Lehrerin an der Musikschule in Falkenau. Sie muß sich selbst begleiten, da der Partner am Klavier erkrankt ist. Vor dem Auftritt von de Dios wurden den ältesten Mitgliedern noch Blumen überreicht, die die Sträußchen gerne entgegennahmen. Schon im Feber hatte Marcela Propenková einen Malwettbewerb für den Muttertag ausgelobt. Das schönste Motiv wird in der Pause der Muttertagsfeier ausgezeichnet. Als Siegerin erhält Ivana Žižlavská den Preis ausgehändigt. Und dann beginnt das große Aufspielen von František Stůj, Martina Ventenglová und Josef Levý. Und schon stürmen die Zuhörer die freien Flächen, um zu tanzen. Dann geht mal eine Polonaise durch den Saal, dann kreisen wiederum Paare, begleitet von Musik der 1950er bis 1990er Jahre. So kommt der Saal zur Hälfte in Bewegung. Andere wieder klopfen und summen die Melodien mit. Ja, mit Musik fühlt man sich immer besser. Sie ist gleichsam ein Jungbrunnen. Und aufgetankt mit Musik fährt man gerne wieder nach Hause. Dies ist alles dank unserer Sponsoren möglich, der Karlsbader Bezirk, die Städte Graslitz und Rothau unterstützten uns tatkräftig. Zum Schluß ergeht noch an alle Organisatoren und Helfer der Muttertagsfeier in Graslitz ein herzliches Dankeschön für einen wundervollen Nachmittag.
� SL-Ortsgruppe Rückersdorf
Trachtenschau im Schmidtbauernhof
Mitte Mai fand im Schmidtbauernhof Rückersdorf der Tag der Vereine statt. Auch die mittelfränkische SL-Ortsgruppe mit Obfrau Bärbel Anclam stellte sich hier vor.
Einige Mitglieder der Ortsgruppe bewirteten die Gäste mit Kaffee und böhmischen Kuchenspezialitäten. Wir erzählten ihnen von den monatlichen verschiedenen Veranstaltungen und hoffen dadurch, neue Mitglieder zu werben. Unsere nächste achttägige Reise in die Masuren, die von Bärbel und Otmar Anclam schon in Vorbereitung ist, erweckte bei einigen Interesse.
Bärbel Anclam hatte für diesen Tag den Sudetendeutschen Volkstanzkreis aus Lauf eingeladen, um Trachten aus früheren Zeiten zu zeigen. Leider konnte nur ein kleiner Teil des Volkstanzkreises kommen, da die anderen anderweitig engagiert waren. Die Leiterin der Volks-
tanzgruppe, Christel HanischGerstner, erläuterte dem aufmerksamen Publikum die Unterschiede der Trachten. Die Männer tragen eine Egerländer Tracht, während die Trachten der Frauen variieren können je nach dem Herkunftsgebiet. Zwei der anwesenden Frauen führten jeweils eine Tracht aus Karlsbad im Egerland vor. Eine weitere Frau trug eine Tracht aus dem Riesengebirge in Nordböhmen. Der Volkstanzkreis ist auch immer auf dem Kunigundenfest in Lauf zu erleben. Nach den interessanten Erläuterungen verabschiedete sich die Leiterin und wünschte noch einen schönen Tag. Obfrau Bärbel Anclam dankte ihr für ihr Kommen und stand bei Interesse der Besucher an der Sudetendeutschen Landsmannschaft den ganzen Tag über zur Verfügung. Wir freuten uns auch, daß Mitglieder der Laufer und Röthenbacher SL-Ortsgruppe zu uns gekommen waren. Gabi Waade
� SL-Landesgruppe Baden-Württemberg Neuer Gedenkstein

Ende Mai enthüllte die SL-Landesgruppe Baden-Württemberg in Renningen am Glockenspielturm einen Gedenkstein, der an den Brünner Todesmarsch erinnert.
Zu einem der schrecklichsten Ereignisse der Nachkriegszeit im Sudetenland gehört der Brünner Todesmarsch. Bei diesem Marsch mußten 30 000 Deutsche Brünn, die Hauptstadt Mährens, binnen einer Stunde verlassen und auf einem 35 Kilometer langen, quälenden Weg nach Österreich gehen.

An dieses Ereignis erinnerte Pfarrer Franz Pitzal beim Glokkenspiel in Renningen. Er selbst war am 21. Februar 1936 in Iglau zur Welt gekommen und hat Angehörige, welche den Todesmarsch erlebten. Die Stellvertretende Landesobfrau Waltraud Illner und weitere Vertreter des Landesvorstands der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie ihren Heimatgliederungen waren nach Renningen gekommen und nahmen an der Gedenkfeier teil.
rad Epple MdL für seine Teilnahme sowie einer Vertreterin der Stadt Renningen. Für den Bund der Vertriebenen erinnerte der sudetendeutsche Vertreter im Landesvorstand, Jürgen Ginzel, an dieses schreckliche Ereignis. Der Bruna-Vorsitzende Peter Kotacka hatte dieses Schicksal selbst erlebt und berichtete über seine Erlebnisse. Schließlich sprachen Angehörige der Familie Hotzny, die den Gedenkstein in Erinnerung an den Brünner Todesmarsch initiiert hatten. Später wird der Gedenkstein am Weltkulturpfad in Renningen einen dauernden Aufstellungsplatz finden. Am Schluß der Veranstaltung enthüllte die Familie Hotzny den Gedenkstein, der alle Generationen an dieses schreckliche Geschehen erinnern wird. In wenigen Wochen fahren die beiden SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg wieder zum Brünner Friedensmarsch, der seit einigen Jahren in Brünn an die Greueltaten erinnert und ein Baustein der Versöhnungsarbeit zwischen Sudetendeutschen und Tschechen ist.
Marc Biadacz MdB sprach ein Grußwort und dankte auch Kon-Reicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Stadt und Kreis Reichenberg Kreis Deutsch Gabel Kreis Friedland Kreis Gablonz




Im Siebenjährigen Krieg dient das Deutsch Gabeler Dominikanerkloster dem Militär als Spital und Winterquartier.
Seine Klosterkirche Sankt Laurentius errichtete Franz Anton Berka von Duba (1635–1706) in den Jahren 1699 bis 1722 nach einem Entwurf von Johann Lucas von Hildebrandt nach dem Vorbild der Wiener Peterskirche. In einer Gruft befinden sich in einem Totenschrein die Gebeine der heiligen Zdislava.
� Die Geschichte der nordböhmischen Stadt Deutsch Gabel – Teil VIII
In der Schlacht bei Hochkirch überfällt die Kaiserliche österreichische Armee unter dem Kommando von Feldmarschall Leopold Joseph Graf Daun am 14. Oktober 1758 in einem Nachtgefecht das preußische Heerlager. Das Gemälde schuf der französische Schlachten- und Vedutenmaler Hyacinth de La Pegna (* 1706 in Brüssel, † 1772 in Rom) um 1760.

Kriege, Krankheiten und Ausbeutung
Der Angriff wurde von der Nordseite unternommen. Mit Kanonenschüssen wurde das Tor gesprengt. Durch die Bresche drangen die Kaiserlichen in die Stadt ein, wurden aber von rechts und links mit Kartätschen empfangen. Viele blieben auf dem Kampfplatz. Die übrigen gelangten über die Leichen ins Innere der Stadt, wo ein heftiger Straßenkampf entstand. Bei einbrechender Dunkelheit mußten sich die Kaiserlichen zurückziehen. Am nächsten Tag, dem 16. Juli 1757, griffen sie unter der Führung des Hauptmanns Poniatowski um so energischer an. Die Preußen hatten sich im festen Kloster verschanzt. Als sie aber sahen, daß von Leipa aus keine Hilfe kam, hißten sie die weiße Friedensfahne. Die Österreicher hatten drei Offiziere und 486 Mann verloren. Ihnen wurde an der Straße von Zittau nach Reichenberg eine Gedenksäule errichtet. Hauptmann Poniatowski wurde schwer verwundet. Für seine Waffentat bei Gabel wurde er zum Ritter des Maria-TheresiaOrdens und später in den böhmischen Fürstenstand erhoben. Die Bewohner von Gabel hatten großen Schaden erlitten, da die Häuser schwer beschädigt worden waren. Auch die Kuppel der Kirche hatte bedenkliche Risse.
Während des Siebenjährigen Krieges, besonders nach der Schlacht bei Hochkirch bei Bautzen am 14. Oktober 1758, waren die Schlösser Lämberg, Neufalkenburg, Walten und Wartenberg als Militärspitäler eingerichtet. Die Versorgung und Betreuung der Verwundeten war ungenügend. Sie lagen in den großen Zimmern der Schlösser auf feuchtem Stroh, in Schmutz und Ungeziefer aller Art. Jammer und Wehklagen erfüllten die Räume Tag und Nacht. Diese Zustände dauerten bis zum 22. November. Die Soldaten, welche in Lämberg starben, wurden im nahen Wald begraben. In diesem Massengrab sollen 1000 Soldaten

liegen. Ein ebener Platz mit einem Totenkreuz im Wald macht es kenntlich. Als Feldmarschall Leopold Joseph Graf von Daun mit seiner Armee in der Gabler Gegend Winterquartiere beziehen wollte, mußten die Spitäler in das Innere des Landes verlegt
den von Teschen am 13. Mai 1779 erhielt Österreich nur das bayerische Innviertel. Durch den Einfall Friedrichs II. in Böhmen wurde auch Gabel in die Kriegsereignisse einbezogen. Schon im Juni 1778 wurde die Grenze mit kroatischen Soldaten besetzt

Von Gabel verlangten die Feinde am 11. August 30 000 Taler. Da die Bürger diese hohe Summe nicht aufbringen konnten, wurden viele von ihnen als Geiseln nach Niemes gebracht. Am 15. August kamen preußische und sächsische Jäger nach Gabel. Diese verübten in der ganzen Gegend unbeschreibliche Grausamkeiten, Walten wurde am 20. und Postrum am 21. August geplündert. Der Prior, der Subprior und einige Gabler Bürger wurden am 7. September nach Niemes und über Leitmeritz nach Dresden verschleppt; von dort wurden sie erst am 7. Januar 1779 entlassen. Die Feinde verließen am 12. September 1778 Gabel und zogen nach Zittau ab.
Bauernaufstand
te mehr und mehr. Die Jahre des Mißwachses von 1769 bis 1770 brachten Teuerung und Hungersnot. Auch das angrenzende Sachsen wurde davon heimgesucht. Die Leute ernährten sich, um ihren Hunger zu stillen, von Abfällen, Kraut und Kleie. Man mischte die Spreu der Flachsknoten (Knotenspreu) unter die Nahrung und kochte Gras und Laub. Sogar das Aas überließ man nicht mehr den Hunden, sondern verzehrte es selbst. Aus dieser Ernährung entstanden Krankheiten, an denen viele starben.
werden. Wie der Herbst jede Stube zu einem Soldatenhospital gemacht hatte, so wurde im Winter jedes Haus ein Lazarett für seine eigenen Bewohner. Viele Menschen starben an Fieber, Blattern und anderen Krankheiten, besonders jene älteren Leute, die sich der Verwundeten angenommen hatten.
Bayerischer Erbfolgekrieg (1778–1779)
Dieser Krieg wurde vom Preußenkönig Friedrich II. und von den Sachsen gegen Kaiser Joseph II. (1765–1790) geführt. Nach dem Aussterben der bayerischen Linie der Wittelsbacher 1777 suchte Kaiser Joseph die Stellung Österreichs im Reich durch die Gewinnung von Niederbayern und der Oberpfalz zu stärken. Friedrich II. verhinderte dies durch die Demonstration eines kurzen Feldzuges in Böhmen ohne einen Schlachtentscheid. Die Russen und die Franzosen suchten zu vermitteln. Im Frie-



Am 6. Juli 1778 kam der in vielen Schlachten siegreiche, energische General Graf Laudon nach Gabel. Am 21. Juli wurden einige Abteilungen nach Zittau geschickt und verlangten von der Stadt 150 000 Taler, weil die Preußen in ähnlicher Weise in Böh-men vorgegangen waren. Sie erhielten aber nur einige 20 000. In der Nähe von Böhmischdorf gab es am 1. August ein Gefecht mit den Preußen. Am tapfersten waren die Kroaten. Feindliche Husaren drangen am 2. August in Gabel ein. Mit gezückten Säbeln gingen sie auf die Bewohner los, um von ihnen Geld zu erpressen. Vom Kloster verlangten sie 100 Dukaten, erhielten aber nur elf. Am 3. August brachten die Preußen 300 Gefangene nach Gabel. Die meisten waren Kroaten, die sie in den Bergen an der Grenze gefangengenommen hatten. Sie wurden in der Kirche und im Pfarrhaus untergebracht und am 5. August nach Zittau abgeführt.
Nordböhmen konnte sich nach dem Siebenjährigen Krieg nicht mehr so recht erholen. Die vielen Truppendurchzüge und Militäreinquartierungen hatten dem Volk schwere Leidenszeiten gebracht, 1760 raffte eine Seuche den größten Teil des Viehbestandes hinweg. Die Bauern waren durch häufige und große Kontributionen völlig verschuldet. Als der Krieg zu Ende war, mußten sie der Obrigkeit noch die Robottage nachleisten, welche sie wegen der Transportfuhren während des Krieges versäumt hatten. Das Volk verarm-
Die Ursachen des Bauernaufstandes von 1775 lagen in den Untertanenverhältnissen, in denen sich die recht- und schutzlosen Bauern den mächtigen Grundherren gegenüber befanden. Der Bauer durfte seinen Wohnort nicht ohne einen Losbrief oder Weglaßzettel seines Herrn verlassen. Fast unerträgliche Robotleistungen waren den verachteten Leibeigenen von ihrer gnädigen Obrigkeit in widerrechtlicher Weise aufgebürdet worden.
Das Kind eines Bauern mußte drei Jahre, eines Häuslers, der Felder hatte, zwei Jahre und eines jeden anderen Häuslers ein Jahr auf einem herrschaftlichen Meierhof dienen. Der Bauer war gezwungen, in einer von der Herrschaft bestimmten Mühle mahlen zu lassen, wobei er nicht selten durch den Müller in schändlicher Weise betrogen wurde. Gewissenlose Beamte drangen oft darauf, daß
die Untertanen erkranktes Vieh, schlechtes Getreide und ähnliche Dinge der Herrschaft um einen hohen Preis abkauften. Der Bauer konnte nicht mehr früh genug auf die herrschaftlichen Felder aufbrechen und dieselben nicht spät genug verlassen. Ganz besonders rechtswidrig ging es auf der Herrschaft Wartenberg zu, nachdem Ludwig Josef Graf Hartig diese 1715 gekauft hatte. Zu dieser Herrschaft gehörte auch Hennersdorf. Er verlangte von den Un-tertanen „die nötige Robot, die er immer brauche“ und hielt sich nicht an die im Urbarium festgelegten Leistungen. Die Bauern beschwerten sich beim Kreisamt in Jungbunzlau. Doch der Bauer durfte kein Recht haben. Das Kreisamt entschied im Sinne des Gutsherrn. Der Bürgermeister wurde abgesetzt und obendrein noch wegen seiner Klage von der Obrigkeit mit 100 Gulden bestraft.
Bald darauf ließ sich der Graf vom Bürgermeister Lehmann das Urbarium bringen, unter dem trügerischen Vorwand, er wolle es sehen und verbessern. Dieses Urbarium erhielt die Gemeinde trotz Bitten und Beschwerden nicht mehr zurück. Jetzt, da die Bauern keinen schriftlichen Beweis für ihre Pflichtleistungen und Gerechtigkeiten in den Händen hatten, ging der „ehrenfeste“ Graf daran, das Urbarium nach seiner Weise zu seinem Nutzen zu „verbessern“. Bei Geldstrafe verbot er den Untertanen, sich mit ihren Beschwerden irgendwohin zu wenden.
Kaiserin Maria Theresia (1740–1780) hatte angeordnet, daß die Handrobot um die Hälfte der Tage gekürzt werde. Der Zugrobot sollte unverändert bleiben. Als dieses Patent veröffentlicht wurde, war das Volk der Meinung, daß dieses keineswegs das echte Robotpatent sei. Es müsse vielmehr ein anderes vorhanden sein, das größere Freiheiten enthalte. Man glaubte allgemein, daß es von der Grundobrigkeit zurückbehalten werde und man könne es nicht anders erhalten, als daß man mit Gewalt auftrete. Fortsetzung folgt
Nordböhmen in Regensburg
Irene Novak vom Kulturverein im „Mauke“-TShirt mit Herbert Stump von der am Vortag mit dem SL-Kulturpreis für Volkstumspflege gekrönten Neugablonzer Mundartband „Mauke“ (Ý SdZ 21/2023) von hinten und rechts von vorne.

� Nixdorf/Kreis Schluckenau
Glocken für Frieden und Versöhnung
Die heutigen Bewohner von Nixdorf im ehemaligen Kreis Schluckenau kümmern sich um das Erhalten der alten deutschen Traditionen. Nun kehren die Kirchenglocken zurück, die zukünftig für Versöhnung und Frieden läuten werden.
Wenn sich Roman Klinger, Vorstandsmitglied des Vereins der Deutschen in Nordböhmen mit Sitz in Reichenberg und Träger des SL-Förderpreises für Volkstumspflege 2019, etwas in den Kopf setzt, dann setzt er das auch durch. Nun hat er mit dem Verein Nixdorf neue Glocken für die Ortskirche beschafft. „Das war eine Herzensangelegenheit.


1751 festlich eingeweihte Kirche wurde in den letzten Jahren mit Spenden und Fördermitteln teilweise renoviert. Ebenso die Orgel mit 2166 Pfeifen und 36 Registern. Klinger kümmert sich liebevoll um die Kirche und verstärkt mit seiner schönen Stimme den Kirchenchor. Er wohnt in Nixdorf, ist Lehrer und unterrichtet jenseits der Grenze deutsche Kinder. Die deutschen Traditionen zu erhalten, ist eines seiner wichtigsten Anliegen. Eine weitere Leidenschaft sind die Kirchenkrippen, die er sammelt und renoviert. Als er vor zwölf Jahren das Osterreiten wiederbelebte, das seine Vorfahren vor Zeiten auch organisiert hatten, kamen 120 Sudeten-
in Reinowitz. Daneben die 96jährige aus Böhmisch Leipa stammende Helga Heller, Obfrau der niederbayerischen SL-Ortsgruppe Passau, mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt.

� Reichenberg
Neues Kunstwerk vor dem Rathaus
Am 15. Juli werden sie eingeweiht. Die Glocken sind die Stimme unseres Kirchturms, der 1942 für Kriegszwecke fast vollständig zum Schweigen gebracht wurde. Heute hängt nur noch eine Glokke, die Sankt Anna, im Kirchturm“, erklärt er.
Die neuen Glocken für Nixdorf sind bereits in Prag, sie wurden von der tschechischen Glockengießerei Manoušek im niederländischen Asten gegossen. Sie kosten mehr als eine Million Kronen, der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds zahlt ein Viertel.
„Genau so viel Spenden haben wir gesammelt“, ergänzt Klinger, ein stolzer Bewohner Nixdorfs. Er hofft auf weitere Unterstützung via Spendenkonto oder Klingelbeutel in der Kirche. „Wenn es nicht genügt, muß der Rest über die Eigenmittel des Vereins beigesteuert werden.“
In Nixdorf werden bald zwei Glocken für Versöhnung der Nationen und Frieden auf der Welt läuten. Die große Nikolausglokke wiegt 350 und die kleinere Jungfrau-Maria-Glocke 120 Kilogramm. Seine Urgroßeltern, so Klinger, hätten bereits 1920 versucht, neue Kirchenglocken gießen zu lassen. Das sei ihnen nicht gelungen. Als Urenkel habe er sich jetzt dafür fest eingesetzt. Die nach einem Umbau

Kinder helfen bei der Enthüllung des „Vulpes Gott“.
Seit Mitte Mai steht ein neues Kunstwerk vor dem Reichenberger Rathaus.
Die Enthüllung der neuen Statue auf dem Reichenberger Marktplatz vor dem Rathaus, die einen Hund symbolisiert, zog Dutzende von Menschen an.
Die Statue „Vulpes Gott“ von František Skála reiste aus Dresden, wo sie seit letztem Herbst im Rahmen des Kunstfestivals

„Tschechische Saison in Dres-
� Reichenberg
den“ aufgestellt war, in die Stadt unter dem Jeschken.
Die Enthüllung des außergewöhnlichen Kunstwerks, für dessen Anfertigung 350 Kilometer vezinkter Draht verbraucht wurde, wurde von Kindern begleitet und mit Musik untermalt. „Dies ist ein Denkmal, das den gesellschaftlich vergessenen und übersehenen Wesen gewidmet ist, die um ihre Existenz kämpfen. Auch kleine Mischlinge verdienen Respekt. Ich wünsche, daß ihr ,Vul-
Wer kennt die Gastro?
Der sächsische Verlag Tschirner und Kosova arbeitet an einem Rezept- und Kochbuch über die Reichenberger Küche.
Für ein Kapitel des Buches suchen wir Informationen über die Reichenberger Gastronomie vor 1945 und wären für Hinweise und Fotos sehr dankbar. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, ein komplettes Kapi-
tel „Geschichte der Reichenberger Gastronomie“ gegen Honorar zu schreiben, bitten wir um Kontaktaufnahme entweder via Telefon oder via eMail.
Jürgen TschirnerVerlag Tschirner & Kosova, Zum Harfenacker 13, 04179 Leipzig, Mobilfunk (01 76) 20 74 99 08, eMail info@tschirner-kosova.de, www.tschirner-kosova.de
pes Gott‘ liebt“, sagte František Skála bei der Enthüllung. Das Kunstwerk wiegt vier Tonnen und hat die Maße 320 mal 730 mal 370 Zentimeter. Skála hatte sich von dem Hund aus dem Bild „Pieta“ des tschechischen Grafikers Max Švabinský (1873–1962) aus dem Jahr 1906 inspirieren lassen. Darin nähert sich die winzige Figur eines kleinen Hundes den zentralen Figuren der Jungfrau Maria und Christus.
František Skála kam am 7. Februar 1965 in Prag zur Welt. Er gehört zu den bedeutendsten tschechischen zeitgenössischen Künstlern und stellt seine Kunstwerke weltweit aus. Der Bildhauer, Maler, Kinderbuchillustrator, Musiker und Tänzer ist auch Mitglied des Sklep-Theaters in Prag und Autor der ersten Comics, die 1987 erschienen. Er besitzt auf dem Drewitsch bei Prag einen denkmalgeschützten Meierhof. Stanislav Beran
deutsche. Heuer waren es schon ein paarmal so viel. Er sorgt sich auch um die Sanierung der Gedenkkreuze, oft ganz ohne Fördermittel, nur mit ehrenamtlicher Arbeit und Begeisterung. „Sie sind ein Stück der Geschichte. Auch das Kreuz zwischen Einsiedel und Lobendau haben wir nicht vergessen. Wir versuchen jeden Teil der Vergangenheit zu retten. Zum letzten Mal zum Beispiel eine Haustür von einem Umgebindehaus. Sie wäre sicher im Ofen gelandet.“ Petra Laurin
Spendenkonto: IBAN CZ11 0100 0001 2397 4208 0207.
Heimatkreis und Gemeindebetreuer gratulieren allen treuen RZ-Abonnenten aus dem Kreis Deutsch Gabel, die im Juni Geburtstag, Hochzeitstag, ein Jubiläum oder sonst ein Ereignis begehen. Heimatkreis und Gemeindebetreuer wünschen alles Gute, Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit sowie den Kranken unter uns baldige Genesung.
n Heimatkreis – Geburtstag. Am 25. feiert Rosl Machtolf,
Ansichten der Nikolauskirche in Nixdorf auf einer Postkarte von Bernhard Kittel. Im Zentrum steht die neue Orgel von 1901. Sie stammt von der Firma der Gebrüder Jägerndorf in Österreichisch-Schlesien im Altvaterland. Sie hat 36 Register mit 2166 Pfeifen.

KREIS DEUTSCH GABEL
Ortsbetreuerin von Hennersdorf (Haus-Nr. 198), Hirschgasse 21, 71397 Leutenbach, ihren 88. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr alles Gute, vor allem aber Gesundheit und Gottes überreichen Segen. Gleichzeitig hoffen wir, daß die Leser der Reichenberger Zeitung noch viele Jahre von ihrem unerschöpflichen Wissen profitieren können. Ihre fundierten Geschichten aus der Heimat „vn dr heme“ sind einzigartig. Bei dieser Gelegenheit dankt der Heimatkreis
auch für die bisherige Unterstützung ganz herzlich.
Othmar Zinner
n Deutsch Gabel – Geburtstage. Am 20. Ida Thum (Witwe von Ernst Thum, Haus-Nr. 64), Richard-Wagner-Straße 41, 82538 Geretsried, 73 Jahre.
Othmar Zinner
Helga Hecht
n Zwickau – Geburtstage. Am 7. Reinfried Prokop, KarlMarx-Straße 57, 15366 Hop-
pegarten, 84 Jahre, und am 17. Siegfried Herrmann, Bergweg 13, 55595 Hargesheim, 98 Jahre.
Othmar Zinner
n Kriesdorf – Geburtstag. Am 19. Kurt Elstner (Ndf. 22, Landwirt), Alter Markt 4, 06526 Sangerhausen, 91 Jahre.
Christian Schwarz
n Kunnersdorf – Geburtstag. Gerhard Stohl (Haus-Nr. 377), Hasenheide 17, 47918 Tönisvorst, 87 Jahre. Steffi Runge
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau
 Dux Ossegg
Dux Ossegg
Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Teplitz-SchönauBöhmisches Mittelgebirge in Regensburg
� Teplitz-Schönau





Seltener Fund in alter Fabrik

Immer wieder finden sich in alten Firmengebäuden Zeugen der Vergangenheit, die auf die Tätigkeit und den Fleiß der deutsch-böhmischen Unternehmer in Teplitz hinweisen. So berichtet auch Jitka Bažantová, Kuratorin der Sammlungen angewandter Kunst unseres Teplitzer Schloßmuseums, über einen seltenen Fund, der uns auf die ehemalige Steingut-Fabrik Reinhold Borsdorf aufmerksam macht.
Jitka Bažantová gab unserer Korrespondentin Jutta Benešová ihr Einverständnis zur Übersetzung des Berichts ins Deutsche und stellte auch die Fotos zur Verfügung.
men von Teilzeitkräften in die unteren Stockwerke des Gebäudes tragen und kontaktierte das Teplitzer Museum, um den Fund begutachten zu lassen.

Borsdorf-Keramikvase mit Kristallglasur.



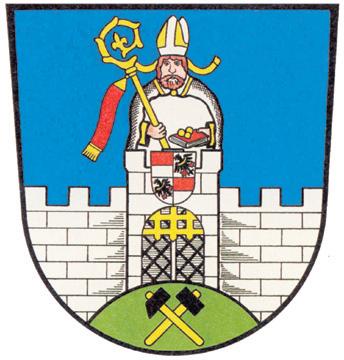
Auf einen historisch außergewöhnlichen Fund stieß Marek Kratochvíl, Miteigentümer der jetzigen Teplitzer Firma Palivos, im April in Teplitz. Bei der geplanten baulichen Rekonstruktion seiner Firma auf dem Gelände der ehemaligen Steingutfabrik Reinhold Borsdorf in der Nähe des Hauptbahnhofs in der ehemaligen Werkstraße 6 entdeckte er im ausgebauten
Dachboden die originalen Borsdorf-Gipsformen. Er ließ die For-
Aus Sicht des Museums handelt es sich um einen Fund von außerordentlichem kunsthistorischen Wert, da die untergegangenen Keramikfabriken ihre ursprünglichen Formen grundsätzlich nicht erhalten hatten und nach dem Ende der Produktion in der Regel liquidierten. Die entdeckten Formen erhöhen den Bekanntheitsgrad der Produktionsleistung dieser Firma erheblich, da noch keine Produktionsoder Angebotskataloge bekannt sind, die das Keramiksortiment der Fabrik Borsdorf genau definieren.
Das Teplitzer Museum dokumentiert seit langem systematisch die Geschichte der Keramikproduktion in Teplitz-Schönau. Derzeit verfügt das Museum über fünf Kunstvasen der ehemaligen Firma Borsdorf, die dem Museum 1904 geschenkt wurden, sowie über einen Satz von vier kleinen Skulpturen, die 1994 in einem Teplitzer Antiquitätengeschäft erworben wurden. Dank


der Entdeckung von Marek Kratochvíl wächst nun die Sammlung des Museums um etwa 100 Gipsformen der Firma Borsdorf an, was nur eine kleine Auswahl aus der Gesamtzahl der entdeckten Formen darstellt.
Aus der Geschichte der Firma Reinhold Borsdorf
Die Entwicklung der keramischen Industrie in der nordböhmischen Region wurde durch das Vorhandensein reicher Kohlevorkommen und lokaler Rohstoffquellen, insbesondere keramischer Tone, bestimmt. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert arbeiteten mehr als 30 Keramikfabriken direkt in Teplitz-Schönau oder in der Umgebung. In vielen kleinen und großen Werkstätten, Manufakturen und Fabriken wurde eine breite Palette von Steingut hergestellt, angefangen von Ofenkacheln über verschiedene Gebrauchsgegenstände aus Weich- oder Hartsteinzeug bis hin zum luxuriösesten Porzellan.
Eines dieser Unternehmen war die 1880 gegründete Fabrik von Reinhold Borsdorf. Sie wurde zwei Jahre später, am 14. Juli 1882, in das Handelsregister eingetragen. Die Fabrik spezialisierte sich auf die Herstellung von
Kochtöpfen mit bleifreier Glasur, wofür sie auf den Ausstellungen in Berlin 1880 und in Triest 1882 den ersten Preis erhielt. Im Jahr 1884 präsentierte das Unternehmen auf einer Industrieausstellung in Teplitz braunes Geschirr im sächsischen Stil.
Nach dem Tod von Reinhold Borsdorf im Jahr 1900 übernahm sein Sohn Walter die Leitung des Unternehmens, der neben Töpfen auch Luxusprodukte mit den damals modisch verfließenden Kristallglasuren in das Produk-
TERMINE
stellungen zeitgenössischer angewandter Kunst. Im Jahr 1934 beschäftigte die Fabrik 40 Arbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von 100 000 Mark.
Nach 1945 wurde das Unternehmen unter staatliche Verwaltung gestellt. Die Leitung der Fabrik wurde dem Nationalverwalter und Keramiker Jaroslav Záhoř übertragen. Das Unternehmen mußte die dekorative Keramik komplett aus der Produktion streichen und konzentrierte sich ausschließlich auf die Herstellung von Gebrauchs- und feuerfestem Geschirr wie Formen zum Backen von Gugelhupf und Osterlamm, verschiedene Backformen, Krapfenformen, Krüge, Blumentöpfe, Töpfe, Becher oder Wasserkocher.
tionsprogramm einführte, wofür das Unternehmen 1903 auf einer Ausstellung in Aussig eine Goldmedaille gewann. In den 1930er Jahren entwarf Walters Tochter Ilse Borsdorf, Absolventin der Fachschule für Keramik in Teplitz-Schönau, künstlerische Keramik für das Unternehmen und präsentierte sich auch auf Aus-
1946 wurde der Betrieb Vereinigte Keramikwerke Teplice als Nationalverwalter eingesetzt. Unter seiner Leitung war das Unternehmen bis 1952 tätig, dann wurde die Steingut-Produktion endgültig eingestellt. Die Angestellten brachten die Gipsformen mit dem Lastenaufzug auf den Dachboden, wo sie in der Hoffnung auf eine spätere Wiederaufnahme der Produktion gelagert wurden, was jedoch nicht der Fall war. So überlebten die Gußformen weitere 70 Jahre in relativ gutem Zustand, bevor sie wiederentdeckt wurden.
n Sonntag, 18. Juni, 14.00 Uhr: Hauptversammlung des Heimatkreisvereins Dux, Duxer Heimathaus, Duxer Straße 10, 63897 Miltenberg. Auskunft: Klaus Püchler, eMail klauspuechler@web.de n Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: 9. Teplitz-Schönauer Kreistreffen in der Heimat. Donnerstag eigene Anreise nach Teplitz-Schönau, Hotel Prince de Ligne (Zámecké náměstí 136); 19.00 Uhr dort Abendessen; anschließend zwei Dokumentarfilme über die Zeitzeugen Pater Benno Beneš SDB (1938–2020) und Hana Truncová/John (1924–2022). Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Saubernitz (Zubrnice) im Böhmischen Mittelgebirge; dort Besichtigung des Freilichtmuseums; anschließend Mittagessen in der Dorfgaststätte und Weiterfahrt nach Leitmeritz; von dort Schiffahrt auf der Elbe mit Kaffee und Kuchen nach Aussig; Rückfahrt zum Abendessen in der Teplitzer Brauereigaststätte Monopol. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt in die Königstadt Kaaden; dort Besichtigung des Franziskanerklosters mit Mittagessen in der Klostergaststätte und Rundgang; anschließend Kranzniederlegung auf dem Friedhof am Denkmal für die Opfer des 4. März 1919; 19.00 Uhr festliches Konzert in der Schönauer Elisabethkirche; anschließend Abendessen im Wirtshaus. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienstmöglichkeit in der Dekanatskirche Johannes der Täufer am Schloßplatz und eigene Heimreise. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag inklusive drei Übernachtungen, Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, allen Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen, Schiff und Konzert pro Person im Doppelzimmer 435 Euro, im Einzelzimmer 520 Euro. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Verbindliche Anmeldung bis Sonntag, 30. Juni, durch Überweisung des Reisepreises auf das Konto Erhard Spacek – IBAN: DE35 7008 0000 0670 5509 19, BIC: DRESDEFF700. Bitte Anschrift und Namen der Reiseteilnehmer angeben, sonst Mitteilung mit diesen Angaben an eMail spacek@teplitz-schoenaufreunde.org
 Ladowitz Klostergrab
Bilin
Graupen Niklasberg
Ladowitz Klostergrab
Bilin
Graupen Niklasberg
HEIMATBOTE
FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ



Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Hostaus Pfarrer – Teil XXIV

Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der elfte Teil über den Dechanten Peter Steinbach (1843 –1917).
❯ Ronsperg
Schloßsanierung beginnt
Die Wiege von Europa steht in Ronsperg, denn im dortigen Schloß wuchs der Begründer der Paneuropa-Union, Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi auf. Das Gebäude befindet sich seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand, und in der Vergan-
Das oberpfälzische Waldmünchen und das böhmische Ronsperg sind gerade einmal 22 Kilometer voneinander entfernt, eigentlich ein Katzensprung. Was liegt da näher, als eine Zusammenarbeit anzustreben. So sahen sich kürzlich auf Einladung der SchloßKommission Bürgermeister des Aktionsbündnisses Čerchov plus in Ronsperg um. Gekommen waren Markus Ackermann, Waldmünchens Bürgermeister und Vorsitzender des Aktionsbündnisses, die Bürgermeister Sandro Bauer aus Furth im Wald, Stefan Spindler aus Rötz und Helmut Heumann aus Treffelstein sowie die Leiterin des Europe-Direct-Büros in Furth im Wald, Karin Stelzer, Bettina Scheck vom Vorzimmer des Waldmünchener Stadtchefs, Ronspergs Vizebürgermeister Jakub Jansa. Zuzana Langpaulová, die tschechische Projektleiterin des Gemeindeverbundes Domažlicko, dolmetschte.
Bei dem Gang durch das Schloß informierte Eva Vondrašová über dessen Geschichte. Das Schloß sei anfangs eine Festung mit einem Wassergraben gewesen. Im 17. Jahrhundert hätten sich verschiedene Besitzer abgewechselt. Die grundlegenden Veränderungen habe Matyáš von Wunschwitz zwischen 1682 und 1696 vorgenommen. Aus der ursprünglich gotischen Burg sei ein komfortables Barockschloß geworden. Der letzte Besitzer sei die Familie Coudenhove-Kalergi gewesen.
Heinrich Graf Coudenhove-Kalergi sei Diplomat in Tokio gewesen. Dort habe er die Japanerin Mitsuko geheiratet, die eine der er-
genheit gab es immer wieder Bemühungen, das Schloß zu renovieren. Richtig Schwung kam in diese Bestrebungen aber erst mit der Schloß-Kommission unter der Leitung von Eva Vondrašová. Sie bemüht sich nun schon seit Jahren darum, diesem geschichtsträch-
sten Asiatinnen in Europa gewesen sei. Sie hätten sieben Kinder gehabt, darunter Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi, der Begründer der Paneuropa-
tigen Ort wieder Leben einzuhauchen. Die Schloß-Kommission erfährt dabei großartige Unterstützung von Bürgermeister Martin Kopecký. Im Herbst begann seine zweite Amtszeit, die vier Jahre dauern wird. Karl Reitmeier berichtet.
Nach der interessanten Schloß-Führung gab es noch ein Treffen bei Bürgermeister Martin Kopecký. Dort erfuhr die Delegation aus dem benachbarten

Union. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei das Schloß verstaatlicht worden und 1989 in den Besitz der Gemeinde Ronsperg übergegangen.
Inzwischen geht die Renovierung des Schlosses weiter. Laut Vondrašová werden heuer noch einige Bauarbeiten durchgeführt. Die Reparatur der Schloßtreppe soll bis Ende Juni abgeschlossen sein. Ferner erfolgen der Austausch von zehn Fenstern und die Reparatur der Steinverkleidung. Instandgesetzt wird der Giebel über dem Haupteingang, die Reparaturen von Mauer und Dach werden fortgesetzt. Die Region Pilsen, das Ministerium für Kultur und der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums finanzieren die Arbeiten.
bayerischen Grenzraum, daß die Finanzierung der Renovierungsarbeiten nicht so einfach sei. Alleine die Sanierung des Treppenaufgangs koste umgerechnet 88 000 Euro. Bürgermeister Akkermann war sich sicher, daß das Schloß ein Juwel werde, wenn einmal alles renoviert sei. Kopecký sagte, daß das Interesse an Schloßbesuchen groß sei, doch diese wegen der großen Unfallgefahr noch nicht möglich seien. Wenn die ersten Arbeiten abgeschlossen seien, womit er im September oder Oktober rechne, seien Besichtigungen möglich.
Der junge Bürgermeister hat noch eine hervorragende Idee, für die ihm der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds einen Zuschuß zugesagte. Er möchte auf dem Friedhof ein Denkmal für
die ehemaligen deutschen Bewohner errichten lassen. Den deutschen Friedhof hatte ein kommunistischer Bürgermeister dem Erdboden gleichmachen lassen. Geblieben sind nur ein paar Gräber am Rande des Areals und Totentafeln an den Friedhofswänden. Kopecký ist nun auf der Suche nach den Namen der einst hier beerdigten Deutschen, möglichst mit Geburtsund Sterbetag. Er hofft auf die Unterstützung der Nachkommen in Deutschland. Diese können sich per eMail wenden an info @zamekpobezovice.cz
Kopecký wies darauf hin, daß die Historikerin Kristýna Pinkrová ein zweisprachiges Buch über Ronsperg vorbereite, das im Herbst erscheinen werde. Diskutiert wurde eine tschechische Übersetzung des Romans „Der böhmische Samurai“ von Bernhard Setzwein, und erwähnt wurde die Publikation von Masumi Böttcher-Muraki über Mitsuko Coudenhove-Kalergi.

Martin Kopecký sah es als notwendig an, die Leute immer wieder über die Paneuropa-Ideen Coudenhove-Kalergis zu informieren, denn sie seien friedensstiftend. Markus Ackermann vertrat die Ansicht, daß es alle versäumt hätten, die Werte der EU besser herauszustellen. Das Bild der EU müsse dringend verbessert werden. Der Bürgermeister Kopecký sah die Lage sarkastisch. Früher sei in der Tschechoslowakei im Kommunismus alles reguliert gewesen, und niemand habe sich beschwert. Nunmehr werde aber – auch von den Kommunisten – zu viel Regulierung in der EU angeprangert.
Am 1. Juli 1901 kommt es zu starken Gewittern mit heftigem Regen, die sich am Abend entladen. Um 19.15 Uhr schlägt der Blitz in den Futterboden des herrschaftlichen Meierhofs ein. Als Folge ist der Hof der Dechantei mit erstickendem Qualm gefüllt. Es besteht die Gefahr, daß auch die ganze Dechantei ein Raub der Flammen wird. Die Mannschaften des Hostauer Feuerwehrvereins sind die ganze Nacht im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf die Dechantei zu verhindern. Glücklicherweise regnet es die ganze Nacht hindurch, denn die Wasservorräte des Dechanteibrunnens und des Meierhofs reichen nicht aus.
Die kostbaren Kirchenkelche nimmt der Bezirksvikar Franz Masanz in Verwahrung. Die Pfarrmatrikeln und Paramente sowie andere Kostbarkeiten werden in die Keller der Dechantei gebracht. Der Obmann des Feuerwehrvereins, Josef Dietz, überwacht selbst die Eingänge zu den Kellern. Steinbach ist es ein Anliegen, von den vielen, die die Dechantei vor der Vernichtung gerettet haben, einige namentlich zu erwähnen: Johann Schmidt (Nr. 17), Johann Dietz (Nr. 20), Johann Bäuml, Josef Liebermann, Anton Christi und Bürgermeister Anton Binhack.

Auch kommt es in diesem Jahr wieder zu Streitigkeiten zwischen dem Hostauer Ortsschulrat und Dechant Steinbach wegen des Gartenteils der Dechantei, der als Turnplatz der Schule benützt wird. Einige Mitglieder

des Schulrates beanspruchen die Überschreibung des Gartenteils, angeblich weil nie der jährliche Pachtzins von zehn Gulden erhöht wurde. Steinbach wendet sich an das Patronatsamt in Bischofteinitz. Domänendirektor Franz Jost ordnet an, daß ein schriftlicher Pachtvertrag geschlossen wird, da sonst der Schule die Benützung des Gartenteils nicht mehr gewährt werden kann. So wird am 21. Juni 1901 ein Pachtvertrag für sechs Jahre eingegangen. Darin wird festgehalten, daß dem Dechant und seinen Dienstboten jederzeit ungehindert der Zugang zu diesem Gartenteil gewährt werden muß. Ebenso verbleiben die dortigen Obstbäume im Eigentum der Dechantei. Ferner wird festgelegt, daß der jährliche Pachtzins 25 Gulden beträgt. Steinbach ist äußerst zufrieden mit dem Ergebnis, das für ihn mit ziemlich viel Sorge, Geduld, Verhandlungen und materiellen Opfern verbunden war. Seine Entwürfe eines Pachtvertrags in den Jahren 1886, 1887 und 1892 wurden jedes Mal vom Ortsschulrat abgelehnt. Er bittet daher seine Nachfolger im Amt des Dechanten, ihm seine Mühen gelegentlich in Form einer Meßfeier zu vergelten.
Die „Westböhmische Rundschau“ berichtet in ihrer Ausgabe vom 27. Juli 1901, daß in Hostau eine Besprechung zu den im Herbst 1901 angekündigten Landtagswahlen stattgefunden hat. Bei der Versammlung wird Wenzl Stahl, Landwirt in Polschitz (Polžice), als Kandidat der Alldeutschen Partei nominiert. Ein erklärtes Ziel der Alldeutschen Partei ist, die Liberale und die Fortschritts-Partei zu bekämpfen, da es dieser immer nur um das Kapital und den Profit gehe. Fortsetzung folgt
TERMINE
■ Freitag, 9. Juni, Heiligenkreuz: 14.00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Pfarrer Klaus Öhrlein von der Rosenmühle in Rosendorf; anschließend Begegnung „Unterm Dach“ im Pfarrgar-

ten bei Schmierkuchen und Getränken. Auskunft: Peter Gaag, Fridinger Straße 8, 70619 Stuttgart, Telefon (07 11) 4 76 07 22, Telefax (07 11) 4 76 07 26, eMail heiligenkreuz@t-online.de
WIR GRATULIEREN
Im Juni gratulieren wir herzlich folgendem treuen Abonnenten des Bischofteinitzer Heimatboten und wünschen Gottes Segen.
■ Heiligenkreuz, Haselberg. Am 18. Alois Vogl (Voglwirt), 86 Jahre. Peter Gaag Ortsbetreuer
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im Juni Alfred Piwonka, ehemaliger Ortsbetreuer von Semeschitz, am 9. zum 72. Geburtstag; Josef Friedrich, Ortsbetreuer von Zetschowitz, am 17. zum 95. Geburtstag; Hans Laubmeier, ehemaliger Ortsbetreuer von Grafenried, Seeg, Anger und Haselberg, am 20. zum 82. Geburtstag und Franz
Drachsler, ehemaliger Ortsbetreuer von Plöß/Wenzelsdorf, am 22. zum 99. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter Pawlik Heimatkreisbetreuer
Heimatbote für

den Kreis Ta<au
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de



� 73. Sudetendeutscher Tag
Egerland in Regensburg
n Samstag, 10. Juni, 18.00 Uhr, Haid: Eröffnung des Musiksommers in der Dekanalkirche Sankt Nikolaus mit einem großen Chor- und Orchesterkonzert.

n Sonntag, 18. Juni, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web. de
n Samstag, 1. Juli, 10.00 Uhr, Altzedlisch: 33. Heimatgottesdienst des Kirchsprengels, anschließend Treffen im Pfarrhaus. Auskunft: Sieglinde Wolf, Wettersteinstraße 51, 90471 Nürnberg, Telefon (09 11) 81 68 68 88, eMail si.wolf@ web.de
TERMINE
Ludmilla Himmel, Ortsbetreuerin von Schönbrunn und Schriftführerin im Kreisrat, Waltraud Hamperl und Heimatkreisbetreuer Dr. Wolf-Dieter Hamperl. Bild: Nadira Hurnaus

� Chronik der Volksschule Godrusch 1935 bis 1944 – Teil IV
n Sonntag, 16. Juli, 15.00 Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee. Auskunft: Peter Fořt spricht deutsch, Telefon (0 04 20) 7 24 20 47 02.
n Sonntag, 20. August, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon

(0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com n Freitag, 1. bis Sonntag, 3. September: 33. Heimatkreistreffen in Weiden in der Oberpfalz. Das Festprogramm werden wir zeitnah an dieser Stelle veröffentlichen. n Samstag, 9. September, Haider Loretofest: 11.00 Uhr Fußwallfahrt ab Waidhauser Pfarrkirche Sankt Emmeram; 17.00 Uhr Rucksackverpflegung in Haid; 19.00 Uhr deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-VitusStraße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com n Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@ web.de
Bösartiger Hautausschlag zwingt Kinder in die Isolation
Der vierte Teil der Chronik befaßt sich mit dem 1. Halbjahr des Schuljahres 1937/38.
Schuljahr 1937/38.
Das Schuljahr 1937/38 begann am Mittwoch, den 1. September 1937. Die Schülereinschreibungen, die schon Ende des Schuljahres 1936/37 durchgeführt worden waren, ergaben, da ein Schüler mit 1. September neu aufgenommen wurde, folgendes Bild:
In der Abteilung 1 waren mit einem Knaben und einem Mädchen zwei Kinder; in der Abteilung 2 mit sieben Knaben und vier Mädchen elf Kinder; in der Abteilung 3 mit keinem Knaben und sieben Mädchen sieben Kinder; in der Abteilung 4 mit fünf Knaben und zwölf Mädchen 17 Kinder. Insgesamt gingen mit 13 Knaben und 24 Mädchen 37 Kinder in die Volksschule.
Personales
Mit Schulbeginn unterrichten an der hiesigen Schule noch Karel Merth, Kaplan in Neustadtl, als Religionslehrer und Elsa Seitz als Haushaltungslehrerin.
Turngeräte

Mit Schulbeginn wurden auf dem der Schule zugewiesenen Turn- und Spielplatz die neuen Turngeräte aufgestellt. Diese neuen Turngeräte bestanden aus einer Leiter, zwei Kletterstangen, einer eisernen Reckstange und einem Schwebebalken. Die Turngeräte erforderten einen Kostenaufwand von 300 Kronen.
Kochunterricht
Mit Beginn des Schuljahres wurde der Kochunterricht eingeführt. Zwecks Durchführung desselben beschaffte der Ortsschulrat einen Petroleum-Ofen mit Bratröhre zum Preis von 350 Kronen und weiteres Kochgeschirr um 28 Kronen 50 Heller. Lieferant genannter Lehrmittel war die Firma M. Löbl in Tachau.
Personales
Kaplan Karel Merth, der bisher den Religionsunterricht an der hiesigen Schule versah, wur-
de mit 19. Oktober nach Schlaggenwald versetzt. Mit selbem Datum übernahm der aus Schlaggenwald kommende Kaplan Karel Brabec den Religionsunterricht an der hiesigen Schule.
Schulfeier
zum 28. Oktober
Die Schulfeier anläßlich des Staatsfeiertages fand bereits in den Vormittagsstunden des 27. Oktobers statt. Im festlich geschmückten Schulzimmer wurde den Kindern die Entstehung der Republik vor Augen geführt und jener Männer gedacht, de-
ren Idealismus und Liebe zum Volke die Grundlagen zur Schaffung des Staates bildeten. Hierauf wurde die Deklaration von Sankt Martin von Tours erörtert.
Im Anschluß an die interne Schulfeier hörten die Kinder die ganzstaatliche Schulfunksendung des Prager Rundfunks. In dieser Rundfunksendung hielt der Unterrichtsminister Emil Franke die Festansprache an die deutschen Schulkinder.
Mit dem Absingen der Staatshymne endete die Schulfeier. Das Schulgebäude war ab 10.00 Uhr vormittags mit der Staatsfah-
ne geschmückt. Um 12.00 Uhr schloß der Unterricht.
Weltspartag
Anläßlich des Weltspartages am 31. Oktober wurden die Schüler in der Stunde für Bürgerkunde über den Wert des Sparens und die Bedeutung dieses Tages eingehend aufgeklärt. Die LBVKassa in Tachau schenkte der Schule 37 Sparfaltschachteln.
Gesundheitszustand der Kinder
In der ersten Dezemberhälfte ließ der Gesundheitszustand der Schulkinder sehr zu wünschen übrig. Ein bösartiger Hautausschlag, der sich rasch verbreitete, zwang die Schulleitung zu Isolierungsmaßnahmen gegen die Erkrankten und deren Geschwister. Die Erkrankten standen teilweise in ärztlicher Behandlung. Der Schulbesuch im Monat Dezember sank dadurch zwangsläufig auf 90,68 Prozent.
Beurlaubung des Religionslehrers
Der der hiesigen Schule zugeteilte Religionslehrer Karel Brabec trat mit 1. Dezember einen zweimonatigen Krankenurlaub an. Mit selbem Datum übernahm Dechant Karl Rosin den Religionsunterricht an der hiesigen Schule.
Weihnachtsferien
Die Weihnachtsferien begannen am Mittwoch, 22. Dezember 1937, um 12.00 Uhr mittags und endeten am Sonntag, 2. Jänner 1938. Der regel-
mäßige Unterricht begann wieder am Montag, 3. Jänner 1938. Schluß des 1. Halbjahres
Am 29. Jänner 1938 schloß das 1. Halbjahr. Die Schulnachrichten wurden in der letzten Vormittagsstunde verteilt.
Schulbesuch im 1. Halbjahr
Die Schüler besuchten 93,85 Prozent des Unterrichtes. Sie versäumten 6,15 Prozent entschuldigt und null Prozent unentschuldigt.
Semesterferien
Im Schuljahre 1937/38 wurden ausnahmsweise und versuchsweise die Halbjahresferien wieder um den 4. und 5. Feber verlängert. Aus diesem Grund schloß der Unterricht am 29. Januar 1938 um 12.00 Uhr mittags, und die Ferien dauerten bis einschließlich 6. Feber. Am 7. Feber begann wieder der normale Unterricht.
7. März
Anläßlich des 88. Geburtstages des ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik wurde an der hiesigen Schule eine Gedächtnisfeier abgehalten, in welcher der große Staatsmann und Mensch Tomaš Garrigue Masaryk gewürdigt wurde. Fortsetzung folgt
Bund der Eghalanda Gmoin e. V., Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, Telefon (0 92 31) 6 612 51, Telefax (0 92 31) 66 12
� Die nächsten Termine
Egerländer
Kalender
n Sonntag, 11. Juni: Festzug zum Hessentag in Pfungstadt mit Beteiligung von Trachtenträgern des BdEG-LV Hessen.

n Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli: Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend mit Verleihung des Johannes-von-Tepl-Preises 2023 in der Stadthalle Marktredwitz. Veranstalter: BdEG-Bundesverband und Bundesführung der Egerland-Jugend (mehr über das Programm siehe rechts).
n Samstag, 8. Juli, 15.00
Uhr: Hutzennachmittag im Emil-Renk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach. Kontakt unter eMail: iris. plank@egerlaender-offenbach.de
n Samstag, 22. Juli, bis Sonntag, 23. Juli: 71. Vinzenzifest und 48. Egerländer Treffen des BdEG-LV Baden-Württemberg in Wendlingen/Neckar. Ausführliches Programm in der nächsten Ausgabe.
n Sonntag, 30. Juli: 70 Jahre St.-Anna-Fest in Mähring. Veranstalter: Heimatkreis Plan-Weseritz.
n Samstag, 5. August: Hutzennachmittag im Emil-RenkHeim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach. Kontakt unter eMail: iris.plank@egerlaenderoffenbach.de
n Freitag, 11. August: Gäuboden-Festzug in Straubing. Anmeldung beim Landesvüarstäiha Helmut Kindl unter eMail helmut.kindl@t-online.de



n Sonntag, 13. August: Egerländer Gebetstag in Maria Kulm.
n Samstag, 9. bis Sonntag, 10. September: Heimattage Baden-Württemberg in Biberach.
n Sonntag, 17. September, 14.00 bis 19.00 Uhr: 70 Jahre Egerländer Gmoi Offenbach und 65 Jahre Egerland-Jugend Offenbach. Willy-Brandt-Halle, Dietesheimer Straße, Mühlheim. n Sonntag, 1. Oktober: Erntedank-Festzug zur Fürther Kärwa. Anmeldung bei Ingrid Deistler von der Gmoi Nürnberg unter eMail deistler@egerlaender.de
n Dienstag, 3. Oktober: Landeshauptversammlung des BdEG-LV Hessen.

n Samstag, 14. Oktober, 15.00
Immer wieder, wie hier auf dem Gredinger Trachtenmarkt im vergangenen Jahr, ist die Egerländer Tracht ein Blickfang.
� Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend vom 30. Juni bis 2. Juli in Marktredwitz
Musik, Tanz und Gesang –die Sprache der Heimat
Von Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli finden in Marktredwitz der Egerlandtag und das 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend statt.
Das Festprogramm der drei Tage im Überblick.
n Freitag, 30. Juni
18.00 Uhr: Eintreffen der Egerland-Jugend in der Schule Marktredwitz (Bauerstraße).
n Samstag, 1. Juli
10.00 Uhr: Workshops und Proben der Egerland-Jugend
� Oberbürgermeister Oliver Weigel
Die Egerlandtage zählen seit vielen Jahrzehnten zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Stadt Marktredwitz.
für den Volkstumsabend in der Grundschule Marktredwitz.
14.30 Uhr: Eröffnung des Egerlandtages und Verleihung des Egerländer Kulturpreises „Johannes von Tepl“ im Egerland-Kulturhaus. Festredner: Peter Berek, Landrat des Kreises Wunsiedel. Musikalisch umrahmt von der Egerländer Familienmusik Hess unter der Leitung von Alexander Hess.
16.00 Uhr: Besichtigung des Egerlandmuseums und der Ausstellung „allerley kunststück –
� Landrat Peter Berek
Reliefintarsien aus Eger“.
18.00 Uhr: Abendessen für die Egerland-Jugend und die Gäste in der Stadthalle Marktredwitz.
19.30 Uhr: Volkstumsabend „Egerländer Notenbüchl“ der Egerland-Jugend in der Stadthalle mit der Gartenberger Bunkerblasmusik unter der Leitung von Roland Hammerschmied.
n Sonntag, 2. Juli
9.15 Uhr: Totenehrung auf dem Friedhof in Marktredwitz.
10.00 Uhr: Festgottesdienst in der katholischen Kirche Herz Je-
� Bundesversammlung Christa Naaß
su mit Pater John Kuncherakkattu und Monsignore Karl Wuchterl. Musikalische Gestaltung: Egerland-Jugend unter Leitung von Roland Hammerschmied. Im Anschluß: Offenes Tanzen und Singen der Egerland-Jugend vor der Kirche. Anschließend Mittagessen in der Stadthalle.
13.30 Uhr: Festakt zum Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Festrednerin: Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung.

� Egerland-Jugend Alexander Stegmaier
� Bundesvüarstäiha Volker

Uhr: Hutzennachmittag. EmilRenk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach.
n Samstag, 28. und Sonntag, 29. Oktober, Kulturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoin in Marktredwitz.
Denke ich ans Egerland, so denke ich an Menschen, die ihre Heimat verlassen mußten. Dieses Thema ist aktueller denn je – denn auch den Flüchtlingen in der heutigen Zeit geht es nicht anders. Umso wichtiger ist es dann, kulturelle Anker zu finden, die die Erinnerung an die Heimat lebendig halten.
Der EghalandaGmoi gelingt es, ihre kulturellen Wurzeln zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Brauchtum, Tracht, Mundart, Literatur und Musik sind lebendig und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben und zur Entwicklung des Kulturraumes im Herzen Europas. Die Egerländer Kultur belegt in eindrucksvoller Weise, daß ein Europa der Regionen nicht an Grenzen gebunden ist.
er Egerlandtag findet erneut im Schatten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine statt. Das Thema Flucht und Vertreibung ist derzeit leider Gottes auch deshalb so aktuell wie lange nicht. Alle Menschen, die vertrieben werden und flüchten müssen haben eines gemeinsam: unermeßliches Leid, den Verlust der Heimat, die Sorge um die Angehörigen – und die Hoffnung wieder zurückkehren zu können.
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
ZDum vierten Mal werden die wichtigsten Treffen der Egerland-Jugend und dem Bund der Eghalanda Gmoin zusammen ausgetragen. Dieses Jahr unter dem Motto: „Musik, Tanz und Gesang – die Sprache der Heimat“. Niemand verkörpert die Sprache unserer Heimat besser als die Egerland-Jugend. Durch das Tragen der Tracht, der Pflege der Mundart, das Singen und Tanzen füllen wir die Traditionen der Heimat mit Leben.
Der diesjährige Egerlandtag steht unter dem Motto „Musik, Tanz und Gesang – die Sprache der Heimat“. Dieses Motto wird vor allem die EgerlandJugend mit ihren Darbietungen und ihren Veranstaltungspunkten zeigen. Ich freue mich auch, daß erneut die Egerland-Jugend ihr Bundestreffen zusammen mit dem Egerlandtag begeht. Der Bund der Eghalanda Gmoin e. V. ist sehr stolz darauf, daß wir im 116. Jahr nach der Gründung des Bundes und 72 Jahre nach dem ersten Egerlandtag in Regensburg noch immer Egerlandtage abhalten. Natürlich kleiner, aber entgegen zurückliegenden Mutmaßungen, gibt es uns Egerländer noch! Freuen wir uns auf einen Egerlandtag und ein Bundestreffen der Egerland-Jugend, welches ein Treffen der Begegnungen von Landsleuten, Freunden der Egerländer, alter Freunde und Weggefährten sein wird. Bedanken möchte ich mich bei all jenen, die durch ihr Engagement und ihre eingesetzte Zeit dieses Festwochenende möglich machen.
Der Dank des Bundesvorstandes geht an dieser Stelle auch an das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Soziales für die finanzielle Förderung des Egerlandtages und des 51. Bundestreffens der Egerland-Jugend.
� Bundeshauptversammlung im Egerland-Kulturhaus mit Neuwahlen und Ehrungen sowie einem großen Projekt für 2024 Konzertwochenende mit vier Blasmusik-Kapellen
Mitglieder und Delegierte aus den 42 Egerländer Gmoin des Bundes der Eghalanda haben sich auf Einladung von Bundesvüarstäiha Volker Jobst zur Bundeshauptversammlung im Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz getroffen.
Zu der Versammlung sprachen Oberbürgermeister Oliver Weigel und der Vorsitzende vom Bund der Deutschen in Böhmen, Richard Šulko, der lobend sagte:
„Man kann sehen, daß das Egerland lebt, daß die Öffentlichkeit sogar über die Grenzen hinweg an unserem Kulturgut interessiert ist und daß wir gemeinsam in den verschiedensten Fassetten unserer Arbeit doch ein wichtiger Teil des europäischen Kulturgutes sind“. Würdevoll gestalteten Lena Jobst und Erich Wetzka das Totengedenken zu Beginn der Versammlung. Der Bundesvüarstäiha fuhr dann mit den Versammlungsre-
gularien fort und präsentierte seinen Bericht über den Berichtszeitraum. Tätigkeitsberichte legten auch die Bundestrachtenwartin, der Bundesjugendführer, der Kassier, die Bundeskulturwartin und die Landesvüarstäiha ab. Der Abend wurde bei zünftiger böhmischer Blasmusik gestaltet. Hierzu konnte die Blasmusik rund um Thomas Mort aus der Oberpfalz im Egerland-Kulturhaus begrüßt werden. Der zweite Tag der Bundes-
hauptversammlung begann mit der Ehrung für Vorstandsmitglied Sibylle Jordan. Sie wurde mit der Bundesehrennadel des Bundes der Egerländer Gmoin ausgezeichnet. Die Vorstandswahlen leitete dann der bayerische Landesvüarstäiha Helmut Kindl. Die Ergebnisse: Volker Jobst (Bundesvüarstäiha), Günther Wohlrab (stv. Bundesvüarstäiha), Gerlinde Kegel (stv. Bundesvüarstäihare), Helmut Hahn (Kassier),
Heike Stegmaier (Schreiberin), Ingrid Hammerschmied (Bundestrachtenwartin), Wolfgang Jordan (Bundesorganisationsleiter) und Christina Diederichs (Bundeskulturwartin). Der aus dem Bundesvorstand ausgeschiedene Alfred Baumgartner wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Anschließend stellte Jobst ein interessantes Vorhabens des Bundes vor, welches für den 3. bis 5. Mai 2024 geplant ist: Ein Konzertwochenende mit Blas-
musik aus dem Egerland und Böhmen in Radolfzell am Bodensee. Dabei werden die Egerländer Kapellen „Gartenberger Bunkerblasmusik“, „Egerländer Blaskapelle Waldkraiburg“ und die „Egerländer Geigenbauerkapelle Bubenreuth“ sowie die „Schloßbergmusikanten“ aus Radolfzell für mehrere Konzerte dabei sein. Die Egerland-Jugend wird einige Musikstücke mit Egerländer Volkstänzen bereichern.
FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN
Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de

Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de
Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de

Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46
In eigener Sache!
Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Torsten Fricke. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
❯ Sonntag, 3. September

❯ Tschechiens größtes künstliches Gewässer liegt bei Falkenau
November/Dezember 2022 Nr. 6
73. Jahrgang
Bundestreffen in Schwandorf
Das Programm folgt noch, aber der Termin steht bereits fest:




Das 36. Bundestreffen der Falkenauer findet am Sonntag, 3. September in Schwandorf statt.

Veranstaltungsort wird– wie im Vorjahr – die Oberpfalzhalle sein. Geöffnet ist dann auch die Falkenauer Heimatstube in der Brauhausgasse beim Stadtmuseum.
❯
Heimatverband
Vom Tagebau zum Naherholungsgebiet:
In eigener Sache!
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaft liches Arbeiten unmöglich machen würden.
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist
Herzlichen
Glückwunsch

Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 mehr möglich ist
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden.
Der Heimatverband der Falkenauer gratuliert herzlich den im Juni geborenen Landsleuten zum Geburtstag.

Mittlerweile ist es beim Kulturverband Graslitz und dem Deutsch-Tschechischen Kulturverein Potok aus Schneeberg zu einer guten Tradition geworden, daß der Mai mit einer Exkursion beginnt. In diesem Jahr war das Braunkohlegebiet um Falkenau das Ziel, denn hier wird einerseits noch der Rohstoff Braunkohle gefördert, aber gleichzeitig gibt es umfangreiche Erfahrungen mit der Rekultivierung eines stillgelegten Tagebaues.
Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber)
Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
101. Geburtstag: Hörrlein, Maria, geb. Lenk (LauterbachDorf), 21.06.22
98.: Glaubitz, Marianne, geb. Knobl (Falkenau), 11.06.25
97.: Dörfler, Hertha (Königswerth), 26.06.26
94. : Fischer, Leopold (Theussau), 9.06.29
93.: Lenhardt, Theresia, geb. Müller (Zieditz), 7.06.30




91.: Köstler, Hans (Bleistadt), 14.06.32


91.: Hammer, Otto (Falkenau), 22.06.32
90.: Hölldobler, Betti, geb. Werner (Katzengrün), 10.06.33
90.: Ehrend, Hildegard, geb. Prexler (Haberspirk), 19.06.33

90.: Geigenfeind, Gerda, geb. Bauernfeind (Lanz), 30.06.33

88.: Götzl, Gerlinde, geb. Fritsche (Karlsbad), 16.06.35
87.: Theisinger, Rosina, geb. Barth (Prösau-Falkenau), 7.06.36
87.: Neumann, Willi (Lauterbach-Dorf), 11.06.36
86.: Kijewski, Wolfgang (Berlin), 12.06.37
84.: Schmax, Franz-Josef (Königswerth), 28.06.39
82.: Gottfried, Roland (Theussau), 20.06.41




80.: Vankova, Marianne, geb. Reinhold (Unterreichenau), 30.06.43
74.: Schober, Ernst (Schwandorf), 14.06.49
Tagebaue sind zwar flächenmäßig groß, jedoch ist es schwierig, einen guten Blick auf das Geschehen darin zu bekommen. Exkursionsführer Dr. Petr Rojík, der als Geologe viele Jahre in diesem Unternehmen tätig war, führte die Gruppe zu einer schönen Stelle bei Lanz, von der aus man einen guten Blick auf das Geschehen im aktiven Tagebau Jiří hat.





Auch wenn das Treiben im Tagebau mit den riesigen Baggern und den kilometerlangen Förderbändern imposant aussieht, so sind seine Tage aus politischen Gründen gezählt. 2030 soll die Förderung von Braunkohle eingestellt werden, und damit endet in dieser Region eine lange Ära des Bergbaues.

Das Braunkohleflöz hat eine Mächtigkeit von 30 bis 40 Metern. Der darüberliegende Abraum wird über Förderstrecken hinter das ausgekohlte Gebiet gebracht und dort wieder verfüllt. Insgesamt wurden hier bisher etwa 360 Millionen Tonnen Kohle von 1949 an abgebaut. Um einen solch großen Bergbaubetrieb aufrechtzuerhalten, ist ein Umfeld aus Werkstätten erforderlich, welche auch die Segmente der Bandförderanlagen bauen und warten. Ausfallzeiten sollten möglichst kurz sein.
Nach Beendigung der Förderung ist eine Renaturierung der Flächen vorgesehen, wofür es in unmittelbarer Nachbarschaft ein gutes Beispiel gibt, welches an-
schließend das Ziel der Exkursionsteilnehmer war: Der See Medard, westlich von Falkenau gelegen, ist Tschechiens größter künstlicher See.

Dieser entstand im Rahmen eines umfangreichen Projekts zur Rekultivierung des vom Kohleabbau betroffenen Gebiets der ehemaligen Tagebaue Medard und Libík, die später zu einer einzigen Grube Medard-Libík zusammengelegt wurden. Der Bergbau in diesem Gebiet wurde am 31. März 2000 eingestellt.
Mit der Auffüllung des Sees wurde nach umfangreichen Erdarbeiten im Jahre 2008 begonnen. Der geplante Pegelstand wurde 2016 erreicht. Auf dem

Gebiet des Medard-Libík-Geländes gab es früher fünf Dörfer oder Siedlungen. Diese Siedlungen verschwanden während des Tagebaus. Die Umstrukturierung der tschechischen Wirtschaft nach 1990 führte zu einem Rückgang des Anteils an festen Brennstoffen. Dieser wurde eingeleitet, ohne daß die Lagerstätten vollständig ausgebeutet wurden. Ein Grund für die vorzeitige Stilllegung war die Abschreibung des Flözes Josef wegen zu hohen Schwefelgehalts.
Der See Medard hat eine OstWest-Ausdehnung von vier Kilometern. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 1,5 Kilometer. Hier sind nun 120 Millionen Kubik-

❯ Heimatkreisbetreuer Gerhard Hampl erinnert sich an eine Geschichte, die seine Mutter öfter erzählt hat
meter Wasser gespeichert, die zum größten Teil der Eger kontrolliert entnommen wurden. Die Wasserfläche beträgt 493,44 Hektar, und diese befindet sich exakt auf 400 Metern über dem Meeresspiegel. Derzeit sind nur Freizeitaktivitäten rund um den See möglich, denn der See ist nicht zum Baden freigegeben. Im östlichen Bereich hofft man auf Investoren, welche den See touristisch weiter aufwerten.
Auf der Südseite hat man von einem aufgeschütteten Hügel aus einen guten Blick über das gesamte Areal. Da die Uferzonen in weiten Bereichen bewaldet wurden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Bäume die Sicht



Der Ukrainer Vasil auf Maierhöfen Nummer 5
Gerhard Hampl, Heimatkreisbetreuer des Heimatkreises Falkenau, erinnert sich an eine Geschichte, die seine Mutter öfter erzählt hat, und die er jetzt aufgeschrieben hat.
Oft hatte unsere Mutter von einem jungen Burschen mit Namen Vasil erzählt. Diesen brachte unser Vater eines Tages von irgendwo her mit auf unseren Hof in Maierhöfen Nr. 5. Er könne sich dort nützlich machen und etwas arbeiten. Er sollte separat verpflegt werden und nicht gemeinsam mit am Tisch sitzen, daran habe man sich aber nicht







gehalten. Was sollte es, jemanden, der am Hof mitarbeitet, in einer Ecke sitzen zu lasssen, das kam gar nicht in Frage. Er muß ein kluger Kerl gewesen sein, er sprach sogar etwas deutsch, das er im Laufe der Zeit weiter verbessert haben soll. Er soll eine Art Ausweis besessen haben, mit dem er sich frei bewegen und auch ins Kino gehen konnte. Einige von unserer Mutter erzählte Geschichten blieben mir noch in Erinnerung. So habe er einmal gefragt, was die vielen schwarz gekleideten Leute auf der Straße sollten. Unsere Mutter erklärte ihm, sie
begleiteten einen verstorbenen Dorfbewohner auf dem Weg zum Friedhof.
Er solle daraufhin geantwortet haben: „Bei uns macht man nicht so viel Aufwand um einen Toten, man gräbt ein Loch, leg´t den Leichnam hinein, schaufelt das Loch wieder zu und das war es gewesen.“ Er habe nie von seinem Vater gesprochen, nur von seiner Mutter. Er soll gesagt haben: „Einmal noch nach Hause meine Mutter sehen, dann wieder nach Deutschland.“
Dann gab es noch die andere Sache mit Hitler und Stalin. Seine Worte sollen gewesen sein:
„Hitler Schwein, Stalin noch größeres Schwein“ oder „Stalin und Hitler, große Verbrecher“.
Unsere Mutter soll ihm dann geantwortet haben, er solle nur aufpassen, hier in der Stube könne er das unter uns sagen, aber ja nicht draußen.
Heute wissen wir, der durch Stalin verursachte als „Holodomor“ bezeichnete Hungertod in der Ukraine war in den 1940er Jahren bei jungen Menschen wie Vasil noch stark in deren Gedächtnis verankert. Mit Kriegsende verschwand Vasil, keiner weiß, wohin. Nach dem Ende des Kal-
ten Krieges habe ich einmal gefragt, wie Vasil denn mit Nachnamen hieß. Keiner hatte es gewußt. Niemand hatte gewußt wie er hieß, woher er kam und wohin er ging. Sollte er noch leben, so müßte er heute ein alter Mann mit 90 oder mehr Jahren sein, der Ukrainer Vasil auf Maierhöfen Nummer 5. Gesetzt, er wäre irgendwann noch einmal zurückgekehrt, er hätte niemanden mehr vorgefunden. Die Höfe leer und verwaist, oder zerstört in einem Kohlenloch verschwunden, die Menschen vertrieben. War Vasil ein Zwangsarbeiter?
versperren. Der künstliche See Medard ist eine ökologische Bereicherung, und auch der Erholungswert der Region um Falkenau wird damit gesteigert, auch wenn die Erreichbarkeit dieses Areals derzeit noch schwierig ist.

Für die Teilnehmer dieser Exkursion war die Gegenüberstellung einer aktiven und einer renaturierten Kohlegrube sehr interessant, zumal mit Dr. Petr Rojík, der in seinem Berufsleben sowohl im Braunkohlebergbau selbst als auch bei der Renaturierung maßgeblich mitgearbeitet hat, ein hoch kompetenter Experte die Gruppe führte.
Ulrich Möckel

❯ Energiewende Tschechiens







Mega-Akku
Auch Tschechien investiert in die Energiewende. Der landesweit größte Batteriespeicher wurde bei Falkenau installiert.
Da Wind- und Solarenergie nicht gleichmäßig zur Verfügung stehen, sind Mega-Akkus zur Stabilisierung des Stromnetzes von entscheidender Bedeutung. Auf dem Gelände des Umspannwerkes Marie ging jetzt Tschechiens größter Batteriespeicher ans Netz. Die Kapazität beträgt 7,45 MWh. Zum
Vergleich: Der weltgrößte Akku steht in Kalifornien und

über 1600 MWh.

Die Eger hat den Medard-See geflutetverfügt Exkursionsführer Dr. Petr Rojík (unten, rechts) erläutert den rekultivierten Tagebau Medard mit dem großen See. Hier befanden sich früher mehrere Ortschaften, die dem Tagebau weichen mußten. Kleines Foto oben: Der Tagebau Jiří gibt einen Eindruck, wie das Gelände ausgesehen hat. Fotos: Ulrich Möckel
Egerer Landtag e. V., Geschäftsstelle in 92224 Amberg, Paradeplatz 11;
Vorsitzender: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de Stellvertretende
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA BUNDESZEITING vereinigt mit H. Preußler Druck und Versand

Vorsitzende: Helmut Reich und Dr. Ursula Schüller
Für die Egerer Zeitung zuständig: Prof. Dr.-Ing. Alfred Neudörfer, eMail A.Neudoerfer@gmx.de – Kassenführung: Ute Mignon, eMail ute.mignon@online.de Spenden an: Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN: DE73 7525 0000 0240 1051 22 – BIC: BYLADEM 1 ABG
Die Geschichte des Gebietes „Egerer Stadtwald“ steht in Zusammenhang mit der Gründung der gleichnamigen Stiftung und dem Gewerbe des Musikinstrumentenbaus:

Die Stadt Eger/Cheb verkauft mit beachtlichem Gewinn hochwertiges Tonholz aus ihrem Waldbesitz auf der deutschen Seite der Staatsgrenze.“ Liest ein unvoreingenommener Leser solch eine Schlagzeile im Internet, kommt wahrscheinlich bei ihm die Frage auf: „Wie geht das denn?“ Dabei hilft erst einmal ein kurzer Blick in die Geschichte: Im 16. Jahrhundert erwarb die Stadt Eger den später sogenannten Egerer Stadtwald auf dem Sprengelt des Klosters Waldsassen. Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Stadt, die Nachkriegsgeschichte mit der Trennung Europas und dem Eisernen Vorhang führten dazu, daß der in Bayern in der nordöstlichen Oberpfalz gelegene Egerer Stadtwald (634 Hektar) unter die Treuhandschaft der Bundesrepublik Deutschland gestellt wurde.
Nach der europäischen Wende der Jahre 1989/1990 und der Samtenen Revolution in der Tschechischen Republik gab es langandauernde juristische Bemühungen, die Treuhandschaft der Bundesrepublik Deutschland abzulösen. Nach dem Einvernehmen zur Auflösung der Treuhandschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt Eger wurde auf der Basis eines zwischenstaatlichen Vertrages der Wald in den Besitz der Stadt übertragen.
Die Stadt Eger erhielt den Egerer Stadtwald mit vollen Eigentumsrechten zurück und bewirtschaftet jetzt die Waldfläche mit eigenem Forstpersonal. Gleichzeitig wurde aber die binationale
JAHRGANG 72
Verantwortlich vonseiten des Egerer Landtag e. V.: Dr. Wolf-Dieter Hamperl – Redaktion: Lexa Wessel, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Landeskunde
Zuschnitte aus Tonholz.
Der Egerer Stadtwald
Stiftung „Egerer Stadtwald“ gegründet. Sie hat die Aufgabe, die Bürger der heutigen Stadt Eger mit den ehemaligen Bürgern der Stadt Eger und deren Nachkommen zusammenzuführen im Bewußtsein, Kultur und Geschichte der Stadt Eger und des historischen Egerlandes grenzüberschreitend gemeinsam zu bewahren und weiter zu entwikkeln. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Ein Teil des erwirtschafteten Gewinns aus der forstwirtschaftlichen Nutzung steht bis jetzt dieser Stiftung zur Verfügung, um die Finanzierung und Förderung von Projekten in der Stadt Eger und im Egerland auf beiden Seiten der Grenze zu bezuschussen. Diese Projekte beziehen sich auf die kulturellen Traditionen, Geschichte und Projekte, welche die Zusammenarbeit der Bewohner dies- und jenseits der Grenze fördern, die sich zu der Stadt Eger und der Region Egerland ohne Rücksicht auf die Nationalität bekennen. Über die Unterstützungsmodalitäten entscheiden jährliche Sitzungen, an denen Vertreter von beiden Seiten der Grenze teilnehmen. Nun zum Tonholz aus dem Egerer Stadtwald: Das nördliche Gebiet des Egerlandes, vornehmlich die Stadt Schönbach/Luby, war für ihren Musikinstrumentenbau bekannt und
berühmt. Für die klangliche Qualität jedes Instrumentes spielen die Schwingungs- und Resonanzeigenschaften des verbauten Holzes eine entscheidende Rolle – des Ahornholzes für den Boden, des Fichtenholzes für die Decke mit ihren Löchern.
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
Einer der ersten Schritte in der Entstehungsgeschichte eines Instrumentes ist das „Anklopfen“ des Holzes. Dabei klemmt der Geigenbaumeister den besonders ausgeführten Zuschnitt (dessen Holz eine bestimmte Struktur aufweisen und über mehrere Jahre, noch besser Jahrzehnte, in der Luft getrocknet sein muß) in einem bestimmten Punkt zwischen die Finger einer Hand und läßt ihn frei hängen. Mit dem gekrümmten Zeigefinger der anderen Hand klopft er unterhalb des Haltepunktes mehrmals auf das Holz, welches mit einem bestimmten Ton antwortet, sprich resoniert. Je nach Klang des Holzes entscheidet er über die zukünftige Verwendung des Zuschnittes.



In den bayerischen Wäldern, in denen die Stadt Eger heute Forstwirtschaft betreibt, wächst solch ein Holz von bester Qualität. Dieses ist geeignet für Musikinstrumente und auch für zukünftige Rücklagen der Stadt.
Josef Kubát, Geschäftsführer des städtischen Unternehmens „Lesy města Che-
� Verwaltungs- und Aufsichtsrat der Stiftung Egerer Stadtwald
Egerer Stadtwald fördert Projekte

Die erste diesjährige Sitzung des Verwaltungs- und Aufsichtsrates der Stiftung Egerer Stadtwald fand am Donnerstag, den 25. Mai 2023, in Wiesau/ Bayern statt.
Die Sitzung fand traditionell in einer außergewöhnlich freundschaftlichen Atmosphäre statt, es wurden viele interessante Vorschläge unterbreitet und wichtige Beschlüsse gefaßt. Auf der Tagesordnung stand die Wahl des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, wobei diese Posten laut Stiftungssatzung alle
zwei Jahre zwischen Vertretern der tschechischen und der deutschen Seite wechseln. Roland Grillmeier, Landrat des Landkreises Tirschenreuth, wurde mit allen Stimmen zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Jiří Černý zum stellvertretenden Vorsitzenden für die tschechische Seite gewählt. Bacc. Ondřej Behina wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Das Hauptthema war, wie immer, die Diskussion über die eingegangenen Projektanträge, wobei insgesamt sieben vorgelegt wurden. Der Verwaltungsrat
stimmte einstimmig dafür, alle Anträge zu unterstützen, und es wurden insgesamt 31 940,00 Euro verteilt. Die Stiftung Egerer Stadtwald fördert die Tätigkeit der sechsten Grundschule Eger im Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Partnerschulen auf der deutschen Seite und des intensiven Deutschunterrichts. Ein Zuschuß geht auch an die eingetragene Einrichtung Post Bellum. Das Hauptprojekt der Organisation mit dem Titel „Paměť národa“ (Gedächtnis der Nation) ist eine Sammlung von Erinnerungen bestimmter Persönlichkei-
ten, Fotografien, Tagebüchern und verschiedenen Archivunterlagen aus der totalitären Zeit des 20. Jahrhunderts. Außerdem wurde auch das Kurmittelhaus Sibyllenbad mit dem Projekt der Errichtung einer Aussichtsplattform mit Blick auf das Gebiet der Fraisch und den Tillenberg unterstützt. Weitere Zuschüsse gingen an: Petr Jaška, den Egerer Landtag, den Verein Život na Dyleň, sowie an den Bund der Eghalanda Gmoin – Bund der Egerländer e.V. Die nächste Sitzung des Verwaltungs- und Aufsichtsrates der Stiftung Egerer Stadtwald ist für Herbst geplant.
bu“ (Wälder der Stadt Cheb), erklärt: „Auf dem Gebiet des Egerer Waldes in den südwestlichen und südlichen Ausläufern des Tillenberges wachsen hauptsächlich Fichten. Hier herrschen für sie optimale Bedingungen. Die Stämme sind kerzengerade und wirklich zylindrisch, deren Jahresringe sind regelmäßig, ihre Abstände sind sehr gering. Es besteht bereits ein großer Mangel an solchem Holz, weshalb es sich sehr gut verkaufen läßt. Wir verkaufen unser wertvolles oberpfälzer Holz an ein spezialisiertes Sägewerk in Chlumetz an der Cidlina/Chlumec nad Cidlinou in der Nähe von Königgrätz. So gelangt Holz aus Bayern nach Mittelböhmen, was eigentlich für den Holzhandel ungewöhnlich ist. Das Material aus dem Egerer Wald wird dort zum Herstellen spezieller Doppel-Zuschnitte für das Herstellen von Musikinstrumenten verarbeitet.“
Gleichzeitig empfiehlt er, im Wald nicht zu viel abzuholzen und weist darauf hin, daß ein so hochwertiger Bestand, den die Stadt als historisches Eigentum wiedererworben hat, eine einzigartige Rücklage bedeutet:
„Der Zustand der Baumbestände ist mehr als zufriedenstellend, und meiner Erfahrung nach wird es zu einem Zuwachs der Holzmasse kommen. Es besteht daher keine Notwendigkeit, zu viel abzuholzen. Das bewahrt uns vor Umweltkatastrophen, und das ist gut so. Der Egerer Wald könnte so einen Beitrag zur künftigen wirtschaftlichen Absicherung der Stadt leisten.“
Zudem könnte der Egerer Wald auch nach Jahrzehnten noch den wirtschaftlichen Kreislauf des bedrohten (und hoffentlich sich noch rechtzeitig erholenden) Gewerbes des Musikinstrumentenbaus des Egerlandes unterstützen. Nd
❯ Egerländer Mundart von Etta Engelmann
S Kaffeedipfl
A dumpfs Grumpl , Gschepper u Klirrn reißt uus in da Nåcht zan Oustasunnta imma hålwa draa as’n Schlouf. A Erdbe’m!? Des houts va uus dou in Basel scho efta geb’m, da s‘ G’schiir in da Kredenz klåppert hout. Kirzagrood sitz ma in Bett, ma Tochta Marie, ihra Moa, ma Mutta u iich. –
Uis hout endle an Läichtschålta g’funna u dou sean ma des Malheur: In da Kuchl liegts Gwirzrechal miit ålln wos draaf woa in Scherwan aaf’m Stoabuan, vadålt unter ålln Mewln. Mia kinna kuin Schriit in d‘ Kichn ei’måchn. Borfass wäi ma woan, häin ma uus in dean Scherwan d‘ Fäis z’schniin u in Essa u Öll warn ma aasgrutscht. Wårt ma läiwa bis s‘ höll wiad min zommrama. Nou da Oustafräimettn mäin ma uus ower denner im unner Kuchl kimmern: Däi siat ba Läicht läisa aas åls in da Nåcht. Esser, Öll, Pfeffer u Solz humm Zeit g’hott zan Zommlaffn, die schänsst Solåtsoßn schwimmt
unter da Kredenz u untern Uafn. Dou entdeckt ma Tochter ihrer läibsts Kaffeedipfl z‘brochn untern Diisch.
„Ma eghalanda Dipfl“ , grei(n) t se lous. „Iich ho sua gern draas drunkn!“ u d‘ Zah laffn ara scho iiwer d‘ Båckn oi.
Ma Schwiechasuh(n) moit: „Dees Rechal mou iiwern Fålln nu aaf d‘ Diischkonntn aafg’schlogn sa(n), wou des Dipfl nu van Omd her g’stondn hout.“
Es woa owa a wirkle as schännsta wos ma g’hott humm: a kluina Fouß, draaf ebba väia
Santimeder in d‘ Häich senkrecht
Rülln wo zar an Bauch aasanonnagänger, åffa wiida 6 Santimeda Verenging biis zan asseworts buargan Rondstickla, wou ma d‘ Untalippn bequem ei(n)legn koa, da uin koa Tropfn oilafft iiwern Drinken. Da Hengl iis väiareggert, darn zwäi Finga ei(n) påssn u an Dama koa ma uam affeleg’n, wou a kloina Muldn iis, dar er neat oorutscht. Dazou däi bunta Målerei: Da Fouß u d‘ Rülln gräi(n), as Mittelstickl im-
mandim miit ara Rousnburtn rosa u rout miit gräin Blaalern dekeriert, da aasgstülpt Rond assn vergoldt. U aa däi Rousnburtn iis uam u untn va zwoia dinnern Goldrandlern aa(n)g’fosst . Sechta Dipfla brauchn koa Diischdekeration, sie sanns sölwa.
A d‘ Untertassn koa ma sporn, wal jo nex oilafft. Grouß soot sann se a, ma mou neat völlafurt nouschenkn, es båssn zwou normal Dassnburtionan ei.
Ich ho däi Trauer va meiner Tochter gut vastondn u häit beinåh miitgreint.
„Da Großvotter hout draas drunkn u iich bin schuld, wal e se neat weggrammt ho“, weamert d‘ Marie weiter.
Dou schålt se ma Mama a(n): „Äiza louts ower amål s’ Kirwl in Durf, dirts zwou, u häierts aaf miit enkern Gehäi(n). Da Votter hout mäin an gonzn Huaf dahamm loua u dirts weamerts im a ra Dipfl! Rammts läiwa zomm! Da Schronk iis jå scho uinagruckt! Amend koa ma d`Scherm nu bichn.“
❯ Historisches Dokument wurde auf einem Flohmarkt in Frankfurt entdeckt
Verschollene Stadtchronik von Eger aufgetaucht

Eines Tages mitten in der Corona-Zeit erreichte das Informationszentrum in Eger eine kurze E-Mail. Ihre Absenderin aus Deutschland schrieb, sie besitze ein altes Buch über Eger, und fragte, ob die Stadt daran interessiert sei. So begann 2020 der Weg der verschollenen „Chronik der Stadt Eger“ zurück an ihren Herkunftsort.
Der Historiker Miloš Říha, ehemaliger Kastellan der Burg Königswart, wurde von Vertretern der Stadt Eger gebeten, die Echtheit des angebotenen Buches zu beurteilten.
Anhand einiger Fotos des Manuskripts, die die Besitzerin ihm schickte, stellte er fest, daß es sich um eine Chronik aus dem Jahr 1743 handelte, die zwar in der Liste der historischen Chroniken aufgeführt war, aber als verloren galt. Daraufhin wurde er von der Stiftung Historisches Eger mit einem entsprechenden Geldbetrag nach Deutschland geschickt und beauftragt, das Buch zu kaufen.
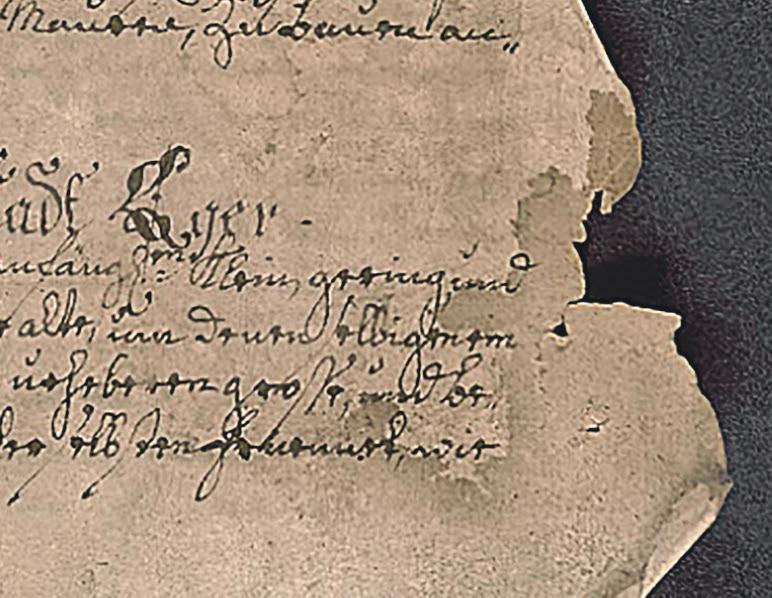


Am 8. November 2020, einen Tag vor der Schließung der Grenze zu Deutschland wegen der Corona-Pandemie, traf Říha im Spessart ein und erwarb nach einem kurzen Treffen mit der Besitzerin das Manuskript. In einem Gespräch mit ihr erfuhr er, daß ihre Mutter das Buch in den 1970er Jahren zusammen mit zwei antiken Töpfen auf einem Flohmarkt in Frankfurt am Main gekauft hatte.
Ein Textauszug: „In dem jahre 1428 antstunde ein geschreÿ, als wann die Hussiten auch heraus in das Egerlande zu kommen gesinnet wären, die Stadt sich zwar gleich in anfang dieses krieges in einen gutten vertheÿdigungsstande gesetzet, und bies 10000 R verbauet. Damit sie sich aber noch besser währen könte, hat sie in allen um die Stadt herinnliegenden gärten ihre schöne, und fruchtbahre bäume abgehauen, so geschehen an dem sonnabendt vor Ostern. Endlich in dem nemliche jahre an dem freytag der heiligen Apostlen Simonis und Judae kamen die Hussiten von Schlaggenwerth in das Egrische und streiffen in solchem mit 75 pferden herum. Als solches in der Stadt kundtbahr worden, schieckten die von Eger ihre schietzen hinaus, denen also

bald noch 50 söldner mit ihren pferden folgen musten, diese fiengen 24 Hussiten sambt 42 pferden, die übrigen wurden getödtet, und darbeÿ noch 27 armbrüst, und 2 pantzer erbeüttet, Wilhelm Raittenbach ihr anführer aber ist gefallen, und hat den halß an einem stahlenen kragen angestossen, worauf er gestorben ist.“
Die Chronik der Stadt Eger wurde 1743 vom Bürgermeister Johann Thomas Funk verfaßt. Sie beschreibt die Geschichte der Stadt von den Anfängen bis 1743 und stützt sich dabei auf ältere Chroniken. Bei den Ereignissen, die er selbst miterlebt hat, vor allem der Belagerung der Stadt durch die Franzosen 1742, legt Funk den Bericht als Augenzeuge vor.

Dem 15 dito ist wiederum ein Frantzösischer Hauptmann Le Duc von dem regiment Piemont in der Kirche zu St. Anna begraben worden, der vor Eger sein leben hat lassen müssen. Dem 16
dito haben die Frantzosen in der nacht wiederum eine scharffe attaque auf die St. Wentzl-burg gewaget, aber mehrmahlen nichts gewunnen, unserer seitts ist ein granadier und zwar der schon oben angeregter Platterscheck (der beÿ mir in quartier gelegen) durch den hinteren theil des halses mit einer musqueten-kugel geschossen worden, welcher sich aber selbst unterdessen mit seinem schnupftuch verbunden, und die gantze nacht also daraussen ausgehalten hat, fruhe morgens kame er herein in das Lazareth, so da ware beÿ dem Juden Oppenheim in seinem unteren zimmer, allwo ich ihn alsogleich besuchte, und eine pfeiffen taback rauchend antraffe, es ware so gefährlich mit ihme (scilicet) das er beÿ dem auszuge der guarnison aus Eger schon in seinem gliede mit sack und pack ausmarchirte, nebst ihme traffe in diesem Lazareth an einen alten Invaliten, den eine stuck-kugl das pein bies von
S. v. dem hinderen hinweggerissen, und einen Constabler, deme ein zersprungener doppelhaken (welchen er selbst geladen, und überladen hat) einen armb hinweggerissen, und ansonsten noch elendiglich plesoiret hat. So ist auch annoch diesem abend gegen 7 uhr von dem Thürlein deren Clarisserinnen das Kreütz mit einer stuck-kugl hinweg geschossen worden. Dem 17 aprilis hat der feinde durch die gantze nacht theils mit feüer-kuglen, theils mit steinen die Stadt auf das erschröcklichste zugesetzet, und sollen in dieser nacht 345 stuckkugel von dem feinde in die Stadt hereingeschossen worden seÿn, wovon 4 in unser Franciscaner40 aber in deren RR. PP. Dominicaner-Kloster gefallen sind doch ohne merklichen schaden.“ Das Buch umfaßt etwa 900 Manuskriptseiten. Der gesamte Einband fehlt, ebenso wie die Titelei und einige weitere Seiten des Textes. Říha hat die alte Kurrentschrift transkribiert und anschließend ins Tschechische übersetzt. Die Übersetzung wurde auf der Website der Stiftung Historisches Eger veröffentlicht. Der deutsche OriginalBand wurde digitalisiert und ist heute als Faksimile im Internet zugänglich (https://www. manuscriptorium.com)
„Eben in diesen 1561 jahr fiel eine traurige begebenheit vor. Am mitwoch vor Maria Magdalena, ware in der nacht gegen tag ein grosses ungewitter, zu welcher zeit der alte Erhart Gabler ein leck und bürger in Eger, seinen weib (weil er sie sorg hatte) mit einen brod-messer das herz durchstochen, beÿ den Usch (oder wasser abfall) neben der prediger kirchen, das ist anjetzo hinter der Kirchen, am Peter Fuhrmans eck haus. Den Montag darnach ist auf den Marckt beÿ den Fisch häüslein an intern röhrkasten beÿ der fleisch-banck, ein brücklein von holtz aufgerichtet worden, und weil derjenige alters halben nicht knieen kunte band ihm der scharffrichter euf einen sessel, und schlug ihm den kopf ab. Dieß war die folge, vielleicht einer nur eingebildeten eÿfer sucht, und dieß ist auch eine lehre noch für jene, die an diesen fieber leiden.“
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e.

Heimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.
Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Heimatcreis Karlsbad, Heimatcreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Electrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollac, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22. Spendenconto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparcasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KS –Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaction: Lexa Wessel. Redactionsschluß: 20. des Vormonats.
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
66. JAHRGANG Jänner 2016 FOLGE 1
72. JAHRGANG Dezember 2022
In Regensburg fand der Sudetendeutsche Tag statt
Liebe Freunde der schönen Kurstadt Karlsbad und seiner bezaubernden Umgebung!

Wann wird es endlich Frühling – das habe ich mich in den letzten Wochen oft gefragt. Man hat länger Freude an der Fülle der Blüten gehabt, weil sie bei der kühlen Witterung nicht so schnell verwelkten; meine Vernunft hat mir auch gesagt, daß ich mich über den vielen Regen freuen sollte: Er war bitter nötig, um die Speicher zu füllen – aber es war oft schon arg trist, und ein bisschen mehr Wärme hätte es schon sein dürfen. Hoffen wir, daß der Sommer nun nicht mit krachender Hitze über uns hereinbricht.
Laue Frühsommertage wünsche ich uns allen, besonders aber denjenigen, die im Juni ihren Geburtstag feiern können. Wir gratulieren herzlich unseren (ehemaligen) Gemeindebetreuern zum: –88. Geburtstag am 14. Juni Marianne Bachmann/ Grund (Hartmannsgrün), 91781 Weißenburg; –91. am 17. Erwin Zwerschina (Drahowitz), 92237 Sulzbach-Rosenberg; –98. am 29. Willi Peter (Taschwitz), 73433 Aalen. Glück, Gesundheit und Segen auf all euren Wegen!
Todesmeldung: Leider muß ich mitteilen, daß unser lieber Landsmann Gerhard Fritsch nicht mehr unter uns weilt. Er verstarb am 19. Mai, versehen mit den Sterbesakramenten, begleitet von seiner Gattin und im Kreise der engsten Angehörigen. Geboren am 4. März 1930 blieb ihm zwar die Kriegsteilnahme erspart, jedoch nicht die Vertreibung. Aber die Heimat war in seinem Herzen fest verankert, er blieb ihr stets eng verbunden. Und so diente er auch seit 1974 als Betreuer seiner Gemeinde Putschirn, bis er das Amt aus Altersgründen im Jahr 2020 schweren Herzens aufgeben mußte. Wir gedenken seiner in Dankbarkeit. Den Angehörigen sprechen wir unsere tiefempfundene
Anteilnahme aus und wünschen besonders seiner Frau viel Kraft für eine Zukunft ohne den Mann, mit dem sie viele Jahrzehnte des Lebens geteilt hat. Nun noch ein paar Eindrücce vom 73. Sudetendeutschen
Pfingsttreffen in Regensburg: Wer ein Gesamt-Abonnement der Sudetendeutschen Zeitung hat, konnte über den Sudetendeutschen Tag schon ausführlich letzte Woche lesen – ich werde mich hier kurz fassen. Das Motto lautete diesmal: „Schicksalsgemeinschaft Europa“, wozu übrigens auch gut das Thema der gerade laufenden Landesausstellung im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg paßt: „Barock! Bayern und Böhmen“, deren Besuch ich allen empfehle. Die Völker in Mitteleuropa sind eng miteinander verbunden: durch eine, oft leidvolle, Geschichte, durch gemeinsame Kultur und, teils mühsam erworben, durch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gerade angesichts des Krieges, der am östlichen Rand Mitteleuropas erneut Verwüstung, Vertreibung, Leid und Tod über ein Volk bringt, müssen wir uns weiter bemühen, die Schranken zu überwinden, die immer noch zwischen uns stehen. Das ist ein mühsamer Prozeß. Wir müssen allen dankbar sein, die sich hier einbringen, wie beispielsweise die Mitglieder des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums. Dessen beide Vorsitzende wurden daher zu Recht mit dem diesjährigen Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet, nämlich der Deutsche Christian Schmidt (selbst kein Sudetendeutscher, aber dennoch höchst engagiert) sowie der Tscheche Libor Rouček. Besonders dessen Dankesrede hat nicht nur mich tief beeindruckt – unser Sprecher Bernd Posselt nannte sie „historisch“. Offen miteinander reden, zuhören, das Leid und die Verletzungen der anderen Seite anerkennen – so kommen wir weiter.
Neben all den Gesprächskreisen, dem Heimatabend und dem Volkstanzfest stand das gesellige Zusammensein mit den Landsleuten im Mittelpunkt, besonders am Pfingstsonntag nach der Hauptkundgebung. Aus den Ortschaften des Karlsbader Kreises hatten sich knapp 20 Personen eingefunden, fünf von ihnen aus der Ortsgruppe Karlsbad waren gemeinsam angereist. Hier ein paar Impressionen (die Fotos hat alle Pavel Padua aus Schlakkenwerth beigesteuert). Unter anderem war eine kleine fröhliche Gruppe beim Sudetendeutschen Tag zu sehen: Albin Häring aus Kohlhau (der von seinen Enkeln begleitet wurde), Werner Kraus und Irene Kašáková aus der Karlsbader Ortsgruppe, sowie Pia Eschbaumer.
Die Kiste (Bild) spielte lange Zeit eine wichtige Rolle: Sie
enthält nämlich Schilder für alle rund 50 Gemeinden aus dem Karlsbader Kreis, die früher über mehrere Tische verteilt wurden, damit jeder „seinen“ Ort schnell finden konnte. Heutzutage reichen uns zwei kleine Tische, auf denen die Schilder gar nicht alle Platz hätten. Und so wird die schwere Kiste künftig nicht mehr die Reise zu den Pfingsttreffen antreten. Unser Zeugwart Rudi Klier hat sie lange Zeit treu verwahrt, nun übernimmt sie Rudi Baier. Wir werden uns stattdessen mit dem hölzernen Schild des Karlsbader Stammtisches in München begnügen.
Mein Vorgänger als Kreisbetreuer, Erwin Zwerschina, kümmert sich nach wie vor um die Dokumentation: In das Buch tragen sich nicht nur alle Teilnehmenden seiner Drahowitzer Treffen ein, sondern auch die der
vor 100 Jahren
Von Rudi Baier

Pfingsttreffen. Unsere nächste Karlsbader Zeitung wird am 14. Juli erscheinen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit! Ihre Pia Eschbaumer
n 1. Juni 1923: Die Staatspolizei übernimmt den städtischen Polizeidirektor, den städtischen Polizeioberkommissär und 28 Mann nicht in den Staatsdienst. Da die obigen in definitiven Dienstverhältnissen stehen, muß die Stadt anderweitig für sie sorgen.
n 4. Juni 1923: Am Buschtierader Bahnhof wird die errichtete Radiostation der Benutzung übergeben.
n 6. Juni 1923: Im Haus „Hispania“ stürzt eine Wohnungseinschleicherin, die 26jährige Verkäuferin Helene Leonhard aus Prag, Mitglied einer Einbrecherbande, als sie sich in einer Dachkammer des vierten Stockwerkes entdeckt sah und durch das Kammerfenster auf das Dach fliehen wollte, in den Hofraum hinab, wo sie mit schweren Verletzungen liegen blieb.
n 10. Juni 1923: Eine Deputation (Abordnung) unter Führung von Branddirektor Mattoni nimmt am 25jährigen Gründungsfeste der freiwilligen Feuerwehr Hartmannsgrün teil.

n 11. Juni 1923: Nuntius Marcia von Prag trifft zum Besuch hier ein.
unionen mit vielen Besuchern statt.
n 16. Juni 1923: Schreitter-Schwarzenfeld erhält von 25 Bewerbern die Stelle eines Konzeptsbeamten bei der Bezirksverwaltungskommission.
n 19. Juni 1923: Feuerwehr: Rohrführer Johann Rippl wird zu Grabe getragen. Heinrich Teschner begeht das 60jährige Jubiläum im Dienst der Buchdruckerei Franieck.

n 21. Juni 1923: Die Sonnwendfeier wird auf den Schindlerfeldern abgehalten.
n 22. Juni 1923: KaiserFranz-Joseph-Denkmal beseitigt. Es wurde am 19. Juni abgetragen. Der Sockel bleibt stehen. Die überlebensgroße Statue wird im städtischen Materialhof aufbewahrt.
n 23. Juni 1923: Das Stadtverordnetenkollegium beschließt die provisorische Aufnahme eines Darlehens von eineinhalb Millionen Kronen. Musikdirektor Robert Manzer wird zum Generalmusikdirektor ernannt.
Eine kleine fröhliche Gruppe beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg/ Bayern: Albin Häring aus Kohlhau (der von seinen Enkeln begleitet wurde), Werner Kraus und Irene Kašáková aus der Karlsbader Ortsgruppe und Pia Eschbaumer.

n 12. Juni 1923: Feuerwehr: Kommandositzung: Die „Epiag“, erste böhmische Porzellanindustrie AG, spendet 600 Kronen und Familie Ernst Reinl 1000 Kronen. Anton Puffeld wird zum Kompagniehornisten ernannt.
Ein argentinischer Kurgast wird beim hiesigen Postamt aufgefordert, tschechisch zu sprechen, da der Beamte nur schlecht deutsch könne.
n 13. Juni 1923: Med. Oskar Kraus, griechischer Konsul in Karlsbad, stirbt im Alter von 60 Jahren.

n 14. Juni 1923: Das spanische Konsulat befindet sich bis zum 15. September im Haus des Kaisers Karl IV. am Schloßberg. Ab dem 15. September befindet es sich bei Peter Chocholaty Pupps Parkhotel. Die Vorbereitungen für die Gemeinschaftswahlen nehmen ihren Anfang.
n 15. Juni 1923: Im Kurhaus finden samstags Tanzre-

Die politische Bezirksverwaltung gibt Richtlinie heraus und trifft Sicherheitsmaßnahmen für das am 1. Juli geplante erste Autorennen.
Der regelmäßige Bäderflugverkehr ist geplant Karl Ludwig, Stadtarchivar, wird wegen seiner Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied des „Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen“ ernannt.
Tschechische Opern-Gastspiele während der Saison im Karlsbader Stadttheater geplant. Die Stadtgemeinde verwahrt sich dagegen.
n 25. Juni 1923: Mit Beschluß des Ortsschulrates werden die Leitungen der Karlsbader Volks- und Bürgerschulen ermächtigt, allfällig notwendig werdende Verschiebungen im Schulsprengel kurzwegig im gegenseitigen Einvernehmen durchzuführen.
Hugo Kaun, Komponist, wohnt der Aufführung seiner Symphonie durch das Kurorchester, bei. Er stellt dasselbe mit den größten Orchestern der Welt gleich.
Karlsbad Stadt
Gemeindebetreuerin Pia
Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Liebe
Landsleute, wir senden herzliche Glückwünsche an alle Geburtstagskinder des Monats Juni (und vorausblikkend Anfang Juli), besonders zum: –95. Geburtstag am 19. Juni Dauber/ Pichl, Ida, 65812 Bad Soden; –95. am 29. Becker/Syba, Anna (Dr.-de-Carro-Str.), 42113 Wuppertal; –89. am 01. Juli Zaha/Pech, Anna (Röhreng. 9), 95131 Schwarzenbach am Wald (Tochter: Evi Herrmann. Telefon 0 92 89 68 35).
In der letzten Ausgabe habe ich etwas zur Eröffnung der Bädersaison geschrieben, allerdings konnte ich keine aktuellen Bilder bringen. Diese finden Sie nun im Bericht unserer Geschäftsführerin Susanne Pollak – und sie machen doch Lust, im nächsten Jahr dabei zu sein!
Bald steht ein anderes Event bevor, das in jedem Jahr Filmschaffende und Publikum von weither anlockt: das „Internationale Filmfest Karlovy Vary“ findet heuer vom 30. Juni bis 08. Juli statt. Mit Spannung wird erwartet, welche berühmten Schauspieler und Regisseure sich die Ehre geben, was für Filme präsentiert werden. Allerdings kann sich dieses Filmfest nicht mit denen von Cannes, Venedig oder Berlin messen, aber es muß sich auch nicht verstekken. Hier ein Zitat dazu von der Website visitczechrepublic.com:
„Das Filmfestival in Karlsbad/Karlovy Vary ist die prestigeträchtigste Filmschau in Mitteleuropa und hat eine unverwechselbare Atmosphäre. 1946 fand es zum ersten Mal in Marienbad/Mariánské Lázně statt, ein Jahr später ist es nach Karlsbad gezogen, und seitdem findet es regelmäßig in der ersten Julihälfte statt. Das Festival führt alljährlich Premieren von mehr als 200 neuen Filmen aus aller Welt auf, der beste von ihnen wird bei der Abschlußzeremonie traditionsgemäß mit dem Hauptpreis, dem Kristallglobus, ausgezeichnet. Zum Festival gehören neben der Anwesenheit von zahlreicher Film- und Gesellschaftsprominenz und tausenden Filmfans die verschiedenen Konzerte, Zeremonien, Parties, Pressekonferenzen und dutzende Begleitveranstaltungen. Das Zentrum des Festivals ist das Hotel Thermal, die Filmvorführungen finden jedoch
Nachrichten aus den Gemeinden
fast in der ganzen Stadt statt.“ Wahrscheinlich sind heuer schon alle Hotels ausgebucht (und ich bin in dieser Zeit zu einer Wanderwoche am Rheinsteig verabredet), aber mit rechtzeitiger Planung könnte es doch im nächsten Jahr klappen? Ich mache mir jedenfalls schon einmal eine Notiz in den Kalender. Hoffentlich ist zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni nicht nur endlich ein Frühling eingezogen, der den Namen verdient, sondern es zeigt sich auch der Sommer – der dann aber gerne nicht allzu heiß werden muß.
Herzliche Grüße, Ihre Pia Eschbaumer

Im Stadtkreis:
Drahowitz
Gemeindebetreuer Erwin
Zwerschina, Am Lohgraben 21, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Telefon (0 96 61) 31 52, Fax (0 96 61)

8 13 78 37
Im Juni gratulieren wir unseren Jubilaren herzlich zum: –100. Geburtstag am 23. Juni Landa/Neubauer, Hermine (Tachau), 63457 Hanau; –97. am 17. Pöpperl, Alois, 36355 Grebenhain; –96. am 25. Gerlach/Richter, Emmy (Pestalozzistr. 146), 70188 Stuttgart;
–95. am 19. Dauber/Pichl, Ida (Fröbelpl. 108), 65812 Bad
Soden; –94. am 05. Veitnhansl, Hermann (Oststr. 94), 65385 Rüdesheim; –91. am 17. Zwerschina, Erwin (Bachstr. 8), 92237 Sulzbach-Rosenberg; –90. am 17. Prof. Bartl, Hans (Pestalozzistr. 24), 61350 Bad Homburg; –90. am 21. Konheisner/ Steidl, Marie (Fröbelpl. 7), 90471 Nürnberg; –88. am 25. Gallenmüller/Weinmann, Edith (Gießhüblerstr. 207), 89415 Lauingen; –85. am 09. Wotruba, Reinhard (Bachstr. 400), 61462 Königstein. Zum 08. Mai 2023 begrüßen wir herzlich unser neues Mitglied im „Heimatverband der Karlsbader e.V.“ Harald von Herget, mit Drahowitzer Wurzeln, geboren am 04. Februar/Feber 1963 in München, jetzt in 82319 Starnberg. Er ist der Sohn unserer am 22. Januar 2021 verstorbenen Herta Duck. Daheim wohnte die Familie in der Gartenstraße, zuletzt Danziger Straße, Ecke Schellingstraße CNr. 377, Villa „Sankt Leonhard“.
Auf zahlreiches Wiedersehen beim Drahowitzer Treffen in Roßtal am Sonntag, dem 10. September 2023, freut sich, Ihr Erwin Zwerschina
Im Stadtkreis: Espenthor
Gemeindebetreuer Rudolf Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de






Wir gratulieren zum: –95. Geburtstag am 17. Juni Scheurer, Elisabeth, geborene Schneider, in 76185 Karlsruhe; –91. am 09. Geier, Eduard in 85567 Grafing. Wir wünschen ihnen und den hier nicht genannten alles erdenklich Gute, vor allem aber Gesundheit und Gottes Segen. Den Kranken wünschen wir gute Besserung.
Ihr Gemeindebetreuer Rudi Baier
Kohlhau
Gemeindebetreuer Albin Häring, Clemens-Brentano-Str. 22, 35043 Marburg/L.-Cappel, Telefon/Fax (0 64 21) 4 53 02 Kohlhau gehörte bekanntlich zum Kirchsprengel Donawitz, und die Donawitzer Kirche war somit auch die Pfarrkirche der Kohlhauer.
Ein Bild zeigt eine Fronleichnamsprozession in Donawitz. Dies dürfte Anfang der 1930er Jahre gewesen sein. Sicherlich waren auch Kohlhauer Teilnehmer darunter. Vorne ist zunächst meine Mutter zu erkennen, die damals unverheiratet noch in Donawitz lebte, dahinter ihre Schwester Berta Schloßbauer und daneben Marianne König. Der „Himmel“, unter dem der Pfarrer mit der Monstranz schritt, wurde von Feuerwehrmännern getragen. Das Fachwerkhaus dahinter gehörte dem Meßner Anton Christl.
Zum 84. Geburtstag am 20. Juni möchte ich herzlich gratulieren: Neubauer/Schloßbauer, Hildegard, 73734 EsslingenBerkheim. Albin Häring
Im Landkreis:
Altrohlau
Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Telefon (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf.Preis@t-online.de Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im Juni! Wir gratulieren zum: –97. Geburtstag am 21. Juni Steinmüller, Ernst, 70174 Stuttgart; –95. am 08. Sacher,
Anton, 87474 Buchenberg; –94. am 08. Krassa/Lieberknecht, Lina, 69488 Birkenau; –75. am 03. Fuchs, Gerhard, 36103 Flieden; –74. am 28. Neukirchner/ Wulkopf, Cornelia, Effnerstr. 85a, 81925 München.
Altrohlau-Chronik von Alois Tröber
13. Teil
■ 1893: Der Verdienst in den Fabriken ist gut. Man sucht nach getaner Arbeit an den Wochenenden Geselligkeit und Zerstreuung. Diese findet man fast ausschließlich in den Wirtshäusern des Ortes. In den kleinen, einfachen Gaststuben oder Gärten, zum Beispiel „Ban Peiter Seffn“, Hauptstraße 95, beim „Weidermann“ (später „Zum Bahnhof“), Hauptstraße 6, oder in der „Allianz“ (Allianzgasse 130), spielt man Karten oder schiebt Kegel, wie auch im „Hotel Siegl“, Hauptstraße 1, oder am „Schwanzröima“, Neudeker Straße 126. Dies macht man meistens so ausgiebig, daß der Sonntag nicht ausreicht und man am Montag „blaumachen“ muß. Bei den Malern und insbesondere bei den Drehern gehört der „blaue Montag“ zur Woche wie das Amen in der Kirche.
Bei schönem Wetter geht man auch auswärts, zum Beispiel nach Neurohlau „Zum Bärenwirt“, nach Sittmesgrün zum „Siegl“ oder „Schneider“ oder auch auf die „Rudolfshäich“. Wandern oder Sport in der heutigen Form sind noch nicht modern, Kino und Radio gibt es noch nicht.
An Wirtshäusern besteht in Altrohlau wahrlich kein Mangel. Zu den beiden ältesten Wirtshäusern „Ban Keck`n“ Nummer 30 und „Ban Kohlert“ Nummer 123 (als Nachfolge des alten Wirtshauses Nummer 11) gesellen sich im Laufe der Jahre noch viele hinzu. Ihre Anzahl übersteigt meistens die Zahl 20 um einiges, wobei andererseits auch ältere Wirtshäuser geöffnet bleiben. Schon bald haben sich Gleichgesinnte gefunden, denen das Trinken von gutem böhmischem Bier und Kartenspielen allein nicht die rechte Befriedigung bringt. Im Besonderen hat der Turngedanke schon sehr früh Fuß gefaßt. Im gleichen Maße kam die Pflege des Gesangs dazu. Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgte bereits 1873, ebenso des „Vereins gedienter Soldaten“ im Jahr 1878.
■ 1894: Kostenlose Schutzimpfung der armen Schulkinder auf Veranlassung des Fabrikbesitzers Karl Ritter Freiherr von Zdekauer.
■ 1895: Das vielfältig gestaltete Vereinsleben zeigt sich in weiteren Vereinsgründungen.
Die Gesangssektion der Porzellanarbeiter wird ins Leben gerufen. Gründung des Gesangsvereins „Freundschaft“, der Musikvereine „Harmonie“ und „Lyra“. Beim Gesangsverein „Freundschaft“ ist Franz Schuster, geboren 1869 in Schönfeld, von 1895 bis 1929 Chormeister und Ehrenmitglied des Musikvereins „Harmonie“.
Die Pflege der Musik steht bei den Altrohlauern hoch im Kurs. Viele Altrohlauer Fabrikarbeiter haben an den Abenden oder an den Wochenenden in Ausflugsorten oder selbst über den Sommer in Karlsbad als Musiker lohnende Nebenverdienste gefunden. In fast allen Musikkapellen spielen zu dieser Zeit Altrohlauer Musikanten mit.
Ebenfalls erfolgt die Grün-
dung des Deutschen Schulvereins, woraus später der „Deutsche Kulturverein“ entsteht. Auch viele Tischgesellschaften und Stammtische, wie zum Beispiel „Gemütlichkeit“, „Ulk“, „Hötzendorfer Ecke“ und „7-Mann-stark“, werden gegründet. Die Vereinsvielfalt prägt sich später noch weiter aus und bleibt zum größten Teil bis in die 30er Jahre erhalten.
■ 1896: Am 13. Mai stirbt Karl Ritter Freiherr von Zdekauer im Alter von 49 Jahren in Grieß bei Bozen.

Das Übergreifen eines Zimmerbrandes in der Neuen Fabrik am 18. Oktober wird durch die Freiwillige Feuerwehr verhindert.
■ 1897: Die Mädchenvolksschule wird in dem umgebauten und erweiterten Gebäude der Volksschule mit zehn Klassen eingerichtet. Erster Oberlehrer wird Johann Alboth; von dem Leben des fast vergessenen Lyrikers Johann Alboth werde ich in einer der nächsten Ausgaben noch ausführlich berichten. Bereits 1949 schrieb Robert Lenhart im Altrohlauer Heimatbrief: „Johann Alboth`s dichterisches Schaffen zu würdigen, wäre schon längst Pflicht unserer Heimatstadt gewesen. Dies ist leider nicht geschehen. Und Johann Alboth war nur als Oberlehrer bekannt, von dem in der Karlsbader Tageszeitung gelegentlich ein Gedicht erschien.“ Zum Beispiel die Heidelieder, von denen Robert Lenhart nur noch eine Strophe in Erinnerung blieb: „Und selbst der Herr am Wege dort legt still die Dornenkrone fort und schmückt sein Haupt mit Blüten.“
Einen wunderschönen, blütenreichen Juni wünscht der gesamten Leserschaft, Rudi Preis
Grasengrün–Rodisfort–Sodau–Halmgrün–Großenteich
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de
Ich hoffe, Sie haben die Pfingstfeiertage gut verbracht, und vielleicht war der eine oder andere, mit Frau, Kindern oder Enkelkindern, in Regensburg, um sich in der DonauArena auf dem Sudetendeutschen Tag umzusehen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, dort mit dabei zu sein. Ich wurde dieses Jahr anderweitig in Anspruch genommen und fehlte deshalb in Regensburg.
Mittlerweile sind wir im Jahr 77 nach der Vertreibung, und politisch treten wir, meiner Meinung nach, nach wie vor auf der Stelle. Wenn sich in der Politik nur die Hälfte dessen bewegt hätte, was sich in privaten Kontakten und Begegnungen getan hat und tut, wären wir schon wesentlich weiter.
Es ist ein trauriges Kapitel. Meine Eltern und Großeltern sprachen immer von ihrer Heimat. Die erste Heimat war immer das Egerland beziehungsweise das Sudentenland. Als junger Mensch habe ich das nie verstanden. Jetzt da ich älter bin und mich damit beschäftige, kann ich nachfühlen, was das für ein Schmerz gewesen sein muß, der immer, bis zu ihrem Tod, in ihrem Leben war. Leider müssen immer die kleinen Leute für das
büßen, was die großen anrichten. Was war das für ein Leid damals. Und dann liest man in den Geschichtsbüchern und auch in manchen Museen: „Und sie fanden ihre neue Heimat“!
Die meisten Vertriebenen fanden eine neue „Bleibe“, aber sie fanden nie wieder die Heimat. Meine Oma und meine Mutter sagten immer: „No jåa, dåu san ma åakumma, ower dahoim bin i in da Hoimat.“
So richtig fällt es einem im Münchner Sudetendeutschen Museum auf. Stockwerke und unzählige Räume sind voll mit Geschichte, Wirtschaft, Kultur und Kartenmaterial – was sehr gut gemacht und vor allem sehenswert und lehrreich ist. Und dann im unteren Stock, kurz vor dem Ende der Ausstellung, findet man es auf ein paar wenigen Quadratmetern: das Thema Flucht und Vertreibung.
Meine Frau und ich waren sehr enttäuscht, weil man dort auf das Nötigste reduziert hatte – ganz anders als in den bisher gesehenen oberen Stockwerken und Bereichen. Fast die gleiche Wahrnehmung hatten auch Besucher, mit denen wir spontan ins Gespräch kamen. Das Personal des Museums war sehr nett, viele sprachen gebrochenes deutsch, blieben uns aber bei genauerem Nachfragen die Antworten schuldig.
Daß aber in einem Sudetendeutschen Museum (wie der Name alleine schon sagt) das Thema „Flucht und Vertreibung“ so kurz abgehandelt wird, ist schwer zu verstehen. Denn es wird all den Menschen und ihrem ergangenen Leid in keinster Weise gerecht. Gerade dort finde ich das traurig, denn wo hätte ich mir sonst mehr erwarten können?
Heimat kann nicht ersetzt werden, auch nicht durch noch so gut gemachte Filmbeiträge und schon gar nicht, indem man dieses Kapitel „verschönt“, wie auch mit dem immer wieder zu hörenden Satz: „Sie fanden ihre neue Heimat.“ Es wissen nur noch die wenigsten, es wird auch nicht propagiert, und man bekommt den Eindruck, es sollte einfach vergessen werden – aber nicht von den Opfern und ihren Nachfahren.
Ich weiß, viele sind der Meinung, daß man auch in der Sudetendeutschen Landsmannschaft nun endlich Ruhe geben sollte. Das mache ich aber nicht, solange ein Unterschied zwischen Deutschen und Opfern anderer Nationalitäten gemacht wird. Wir mußten und müßen uns, zum Beispiel im ehemaligen Konzentrationslager, die Gräueltaten der Deutschen im Weltkrieg ansehen – und das auch mit Recht.
So aber sollen bitte andere Nationen ansehen und dazu stehen, was damals an den Deutschen verbrochen wurde – und zwar nach dem Krieg. SelbstverBitte umblättern
� Juni 2023 – Fortsetzung zu Seite 25
Nachrichten aus den Gemeinden
ständlich stehe ich für ein gemeinsames, friedliches und vorwurfsfreies Europa – aber wahre Geschichte zu „verschönern“ beziehungsweise der Versuch sie „schönzureden“ ist nicht zielführend – für alle Beteiligten des grausamen Krieges und dessen Nachkriegszeit.
Solange ich mit meinen zwei Beinen noch im Leben stehe, bin ich meinen Vorfahren diese Mahnung an zukünftige Generationen schuldig.
Ihnen allen wünsche ich endlich schöne warme Frühsommertage und einen guten Start in den bevorstehenden Sommer.
Bleiben Sie gesund, wünscht von Herzen, Ihr Rudi Kreisl
Lichtenstadt
Gemeindebetreuerin Magdalena Geißler, Karlsbader Straße 8, 91083 Baiersdorf-Hagenau, Telefon (0 91 33)33 24
Heimatstube in 90513 Zirndorf, Fürther Straße 8; betreut von Christina Rösch-Kranholdt, Egloffsteiner Ring 6, 96146 Altendorf, Telefon (0 95 45) 35 98 13
Wir gratulieren zum Geburtstag im Juni zum: –90. Geburtstag am 07. Juni
Zimmermann, Christl, ge-
borene Pflegler, 35232 Buchenau; –84. am 03. Gläser, Walter, 36325 Köddingen; –81. am 17. Bärreiter, Friedrich, 69517 Gorxheimertal;
� Meldungen der Ortsbetreuer
Der Heimatverband und die jeweiligen Ortsbetreuer wünschen auch allen Jubilaren aus den zuvor nicht aufgeführten Gemeinden, besonders aber den nun namentlich genannten treuen Abonnenten der Karlsbader Zeitung alles Gute zu ihrem Geburtstag, ein erfülltes und gesundes neues Lebensjahr!
Aich
24. Juni: Edith Schmidt/ Schimmer, 65474 Bischofsheim, 95. Geburtstag.
Engelhaus
18. Juni: Peter Haase, 36160 Dipperz, 80. Geburtstag.
24. Juni: Hannelore Heller/ Neudert (Tochter von Kraus Elsa), 91154 Roth, 69. Geburtstag.
Hartmannsgrün
14. Juni: Marianne Bachmann/Grund, 91781 Weißenburg, 88. Geburtstag.
Lessau
15. Juni: Maria Vögele/Hüttl, 81673 München, 84. Geburtstag.
–80. am 11. Lauber, Edeltraud, 89431 Bächingen.
Wie wir erst jetzt erfahren haben, verstarb schon am 21. Januar 2023 im Alter von 95 Jahren Ilse Ruhnau, geborene Richter. Sie lebte bis zum Schluß in einem Seniorenheim in Nürnberg. Es trauert ihre Familie.
Danke für Spenden von Familie Reim und Familie Berger; für Porto Ursula Schwenda; Kuchenspende Magdalena Geißler und Christina.
„Wir werden nicht älter mit den Jahren. Wir werden neuer jeden Tag.“
(Emily Dickinson)
Magdalena Geißler
Schneidmühl
Gemeindebetreuer Rudolf
Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de Im Juni gratulieren wir herzlich zum: –97. Geburtstag am 04. Juni Kröpfl, Helene, geborene Kugler, 86150 Augsburg; –90. am
08. Reimer, Ernestine, geborene Prachensky, 86633 Neuburg/Donau; –82. am
13. Weidner, Horst, 71229 Leonberg-Ramtel. Wir wünschen alles Gute und Wohlergehen, und den Kranken baldige Genesung.
Ihr Gemeindebetreuer
Rudi Baier

� Mitteilungen des Heimatverbandes – weiter auf Seite 24
Liebe Heimatfreunde, liebe Leser der Karlsbader Zeitung!
Am ersten Maiwochenende begann die neue Kursaison in Karlsbad. Vom 5. bis 7. Mai 2023 feierte die ganze Stadt dieses bedeutende Fest. Kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen wurden geboten.


Pirkenhammer
19. Juni: Josefine Gäßler, 89233 Neu-Ulm, 92. Geburtstag. Rodisfort

24. Juni: Marianne Neuhauser/Hartl, 91284 Neuhaus/Pegnitz, 85. Geburtstag. Sachsengrün–

Ranzengrün–Oberlomitz
01. Juni: Elfriede Grimm (Oberlomitz Hausnummer 4), 86675 Buchdorf, 84. Geburtstag.
19. Juni: Christa Martinis/ Hacker (Sachsengrün Hausnummer 58), 92442 Wackersdorf, 85. Geburtstag.
Tüppelsgrün
20. Juni: Marianne Rauscher/ Deimer (fr. Kammersgrün), 07548 Gera, 98. Geburtstag.
Unterlomitz mit Gießhübl–
Sauerbrunn
25. Juni: Liselotte Heumann, 91325 Adelsdorf, 87. Geburtstag.
Am Samstag, den 6. Mai, begann die Saison mit der Segnung der Quellen durch den päpstlichen Nuntius und mit einer feierlichen Heiligen Messe. Dann folgte der Umzug des Gefolges von Karl IV., dem Stadtgründer, durch die Stadt. Vom Schloßturm erklang eine festliche Fanfare. Gleichzeitig bot die Stadt Karlsbad ein reichhaltiges Kulturprogramm, unter anderem in der Becher-Villa, in der Kunstgalerie und im Stadtmuseum.

Liebe Landsleute, wenn Sie jetzt eine Reise nach Karlsbad planen sollten, dann besuchen Sie doch bitte die Familie Werner Kraus im Egerländer Hof: Telefon +42 03 53 22 93 32, Website: www.egerlanderhof.eu eMail wkraus@seznam.cz
Spenden: Spenden sind bei uns eingegangen, für die wir uns herzlich bedanken: –50,00 Euro von Gerlinde Lochner, München; –50,00 Euro von Dr. Pia Eschbaumer, München; –30,00 Euro von Albin Häring, Marburg; –30,00 Euro von Gerhard Schneider, Bad Homburg; –25,00 Euro von Peter Krebs, Egerländer Gmoi Donauwörth; –58,00 Euro erhielten wir durch den Verkauf von Büchern.
Wenn Sie uns weiterhin gewogen sind und uns Ihre Spendenbereitschaft zeigen wollen, finden Sie nachfolgend die Bankverbindung: –Empfänger: Heimatverband der Karlsbader e.V.; –Bank: Kreissparkasse München; –IBAN:
DE31 7025 0150 0070 5523 44;
–BIC: BY LADE M1KS; Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt oder wollen Sie ungenannt bleiben, dann rufen Sie bitte an bei Pollak, Telefon (0 81 42) 1 23 03.
Mitgliedschaft im Heimatverband der Karlsbader e.V.: Werden auch Sie Mitglied in unserer Gemeinschaft. Der am 21. August 1949 von Hans Ritter von Stein in Forchheim gegründete Heimatverband ist der freiwil-
lige Zusammenschluß der 1945 und 1946 aus der Stadt- und dem Landkreis Karlsbad vertriebenen Deutschen. In den ersten Jahren nach der Gründung standen Nachforschungen nach dem Verbleib und dem Schicksal der Landsleute, die Beratung in sozialen Angelegenheiten im Vordergrund seiner Tätigkeit. Später sah es der Heimatverband als seine vornehmste Aufgabe an, das reiche und vielfältige kulturelle Erbe seiner Heimatstadt und ihres Umlandes zu sammeln, zu bewahren und weiterzugeben.
Ein Beitrittsformular sende ich Ihnen gerne zu, bitte anrufen bei Pollak, Telefon (0 81 42) 1 23 03. Als neues Mitglied begrüßen wir Harald von Herget!
Karlsbader Museum und Archiv in Wiesbaden Oranienstraße 3: Jeden ersten Samstag im Monat von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr ist das Museum für Besucher geöffnet. Am Samstag, den 3. Juni 2023, erwarten Sie unser Museumsbeauftragter Horst Engel und seine Frau Christa und führen Sie gerne durch die Räume mit den seltenen Ausstellungsgegenständen. Mit der Buslinie 16 ab HauptBitte umblättern

Auch in Karlsbad und Umgebung klingt langsam der Sommer an. � Mitteilungen des Heimatverbandes – Fortsetzung zu Seite 26
Informationen für alle Heimatfreunde
bahnhof ist das Museum zu erreichen, bis zur Haltestelle „Landesbibliothek“. Wir erwarten gerne Ihren Besuch! Dr. Engel Telefon (06 41) 4 24 22. Bund der Deutschen – Landschaft Egerland – Ortsgruppe
Karlsbad: Am 1. Juni 2023, um 15.00 Uhr, war schon die nächste Vorstandssitzung mit Kaffeeklatsch im Egerländer Hof – Juli und August ist Urlaubszeit, und

daher gibt es keine Treffen. Von Pavel Padua bekam ich die schöne Aufnahme vom Kaffeeklatsch am 4. Mai zugesandt: eine fröhliche Runde und so viele Teilnehmer – da kann ich fast neidisch werden. In München gibt es schon viele Jahre keinen Stammtisch mehr, was ich sehr bedauere. Darum freue ich mich über diese Treffen und den Zusammenhalt in Eurer Gruppe mit

Irene Kasakova. Geburtstage: Herzliche Gratulation allen, die im Mai und Juni geboren sind. Wir wünschen gute Gesundheit und viel Glück im neuen Lebensjahr zum: –85. Geburtstag am 9. Mai Milos Gebhart; –78. am 16. Franz Alscher (München); –53. am 19. Marus Klyeisenova; –79. am 1. Juni Anna Kucova; –79. am 1. Renata Pastelakova; –70. am 9. Bri-
gita Prochazkova; –83. am 24. Edith Novakova; –79. am 30. Eva Endalova; –79. am 30. Truda Sapouskova. Unsere Bücherecke:
n Einwohnerverzeichnis der Kurstadt Karlsbad, der Stadt Fischern und der Marktgemeinde Drahowitz. Es handelt sich um die 324 Seiten des äußerst seltenen Adreßbuches von 1938/1939 mit dem Redaktionsstand von
1937. Preis: 29,00 Euro.
n Karlsbader Historische Schriften Band 2. Eine kenntnisreiche Betrachtung über Karlsbad als Kur- und Genesungsstadt. Preis: 19,80 Euro.
n Karlsbader Schicksalstage
1939 bis 1946. Von Prof. Dr. Rudolf Schönbach. Preis: 4,50 Euro.
n Zwischen Grenzen und Zeiten. Egerländer Landsleute erzählen, zusammengestellt von
Hans Bohn. Preis: 6,00 Euro. Alle Preise inklusive Porto und Verpackung.
Kontaktdaten: Susanne Pollak, Estinger Straße 15, 82140 Olching, Telefon (0 81 42) 1 23 03, eMail heimatverband@carlsbad. de Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, und vor allem wünsche ich Ihnen viel Gesundheit!
Ihre Susanne Pollak � Verdiente Karlsbader
Heinz Schubert

In diesem Teil der Reihe „Verdiente Karlsbader“ berichtet Rudi Baier über den Karlsbader
Heinz Schubert:
Heinz Schubert war Erster Vorsitzender des Heimatverbandes der Karlsbader, geboren in Karlsbad am 7. September 1911, Sohn des Dipl. Ing. Oberbaurat Carl Schubert und seiner Frau Odilia, geborene Steinberger. Er besuchte die Volksschule und das Gymnasium in Karlsbad. Anschließend studierte er von 1930 bis 1936 an der Deutschen Universität in Prag Medizin, Rechtsund Staatswissenschaften sowie Volkswirtschaft.
Im Jahr 1939 arbeitete er in der Rechtsabteilung bei der „Georg Schicht AG“, Aussig, und später in der Rechtsabteilung der „Riune Adriatica di sicurta“ in der Landesdirektion Reichenberg. In den Jahren 1945 bis 1948 war er bei der „Deutschen Barytindus-
trie“ und Mitglied der Geschäftsführung im Zweigwerk Sontra/ Hessen. 1947 nahm Schubert an der Gründung des Arbeitgeberverbandes des Hessischen Bergbaus in Marburg teil. Und dort war er bis 1948 Vorstandsmitglied.
1948 war seine Berufung als Hauptgeschäftsführer der „Bergbau Versorgungszentrale“ des Landes in Wiesbaden. 1949 bis 1960 war er Hauptgeschäftsführer der „Gesellschaft zur Förderung von Bergbausiedlungen“ in Hessen. Im Jahr 1960 wurde er Leiter der Verkaufsabteilung III der „Buderus´schen Eisenwerke Wetzlar“. 1963 übernahm er kurzzeitig die leitende Position bei der deutsch-italienischen „Bong Mining Company“ in Liberia. 1964 wurde er zum Direktor der „Portland Zementwerke Heidelberg AG“, Verkaufsbüro in München. Er war Präsident des „Rotary International Club“,
In Erinnerung an Bertha von Suttner

Zum Gedenken erinnern wir an Bertha von Suttner, geboren am 9. Juni 1843, gestorben am 21. Juni 1914.

Eine böhmische Adelige tritt ins Rampenlicht der europäischen Öffentlichkeit: Bertha von Suttner, geborene Gräfin Kinsky, im Jahr 1905 erste weibliche Trä-
gerin des seit 1901 verliehenen Friedensnobelpreises.
Diese einzigartige Frau wurde die erste Kämpferin für das größte Anliegen der Menschheit: Für den Frieden!
Im Jahr 1889 erschien ihr Buch „Die Waffen nieder!“, in Massenauflage gedruckt und in fünf Sprachen übersetzt.

Ein Höhepunkt ihres Lebens war ihre Mitwirkung bei der ersten Haager Friedenskonferenz
1889. Die Staaten der Welt waren sich einig, im Fall eines Streites nicht die Waffen sondern die guten Dienste der Vermittlung in Anspruch zu nehmen.
Doch alles ging unter im Waffenlärm des Ersten und Zweiten Weltkrieges.
Eine Woche nach dem Tod von Bertha von Suttner fielen die Schüsse von Sarajevo und es begann der Erste Weltkrieg.
Susanne Pollak
Starnberg. Schubert gehörte zu den Vorstandsmitgliedern im Heimatverband der Karlsbader seit der Gründung des Verbandes. Und von 1963 bis 1988 war er dessen Erster Vorsitzender. Schubert war zudem Herausgeber des heimat- und kulturgeschichtlich bedeutenden Werkes „Karlsbad, ein Weltbad im Spiegel der Zeit“.

Im Jahr 1987 wurde Schubert zum Ehrenvorsitzenden des Heimatverbandes ernannt. 1971 wurde ihm als Zeichen des Dankes die „Karlsbad-Plakette“ verliehen und 1982 eine Hohe Auszeichnung durch den Rotary-Club. 1985 wurde ihm die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft hat ihm in Anerkennung seiner Leistung für Volk und Heimat die Dr.-von-Lodgmann-Medaille verliehen.
Schubert ist am 24. Mai 1990 verstorben und wurde in Krailling beerdigt.
� Gedenken und Mahnung Sehenswürdigkeiten in Karlsbad. Dr. jur. Heinz Schubert, geboren am 7. September 1911, gestorben am 24. Mai 1990. Das Buchcover von „Karlsbad, ein Weltbad im Spiegel der Zeit“ von Heinz Schubert. Das Buchcover von „Die Waffen nieder!“ von Bertha von Suttner. Bertha von Suttner.