

Trauer um SLÖ-Ehrenobmann Gerhard




Trauer um SLÖ-Ehrenobmann Gerhard


Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung
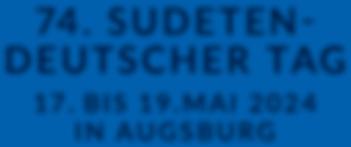

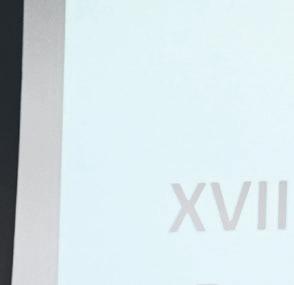
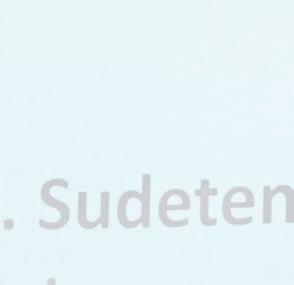








Im Rahmen der XVII. Sudetendeutschen Bundesversammlung sind mit jeweils großer Mehrheit die Heimatordnung, die Gebietsgliederungsordnung, die Wahlordnung sowie die Statuten für die Kulturellen Förderpreise aktualisiert worden.
Außerdem wurde die Jahresrechnung 2023 der Sudetendeutschen Landsmannschaft festgestellt, der Bundesvorstand entlastet sowie der Haushaltsund Stellenplan 2024 genehmigt.




... und Christina Meinusch. Berichteten: Gerda Ott ...
Angenommen wurde ein Antrag, sich für die doppelsprachige Benennung geografischer Bezeichnungen in den früheren Siedlungsgebieten in der Tschechischen Republik einzusetzen. Ein Antrag, der aus Anlaß der aktuellen Diskussion über das Otfried-Preußler-Gymnasium eingereicht war, wurde an den Bundesvorstand weitergeleitet.
In ihren Rechenschaftsberichten informierten Bundesfrauenreferentin Gerda Ott, die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch, und der Vorsitzende des Heimatrates, Franz Longin (siehe Seite 5), über ihre jeweiligen Bereiche.





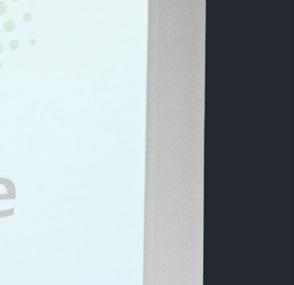







❯ Tschechiens Generalkonsulin Ivana Červenková Leuchtendes Beispiel
gangenen Jahr in Regensburg deutlich geworden. Bek habe damals erklärt, daß er schon immer die Ansicht vertreten habe, daß der Weg von Prag nach München und Berlin über die Sudetendeutschen führt.





Bernd Posselt,





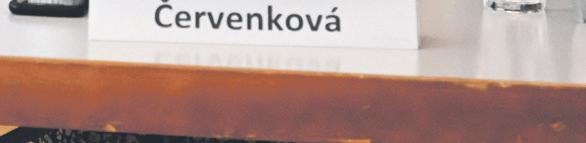


„Sudetendeutsche und Tschechien haben wieder zueinandergefunden. Das heutige Verhältnis ist von Freundschaft und einer sehr engen Zusammenarbeit geprägt“, hat Tschechiens Generalkonsulin Ivana Červenková in ihrem Grußwort auf der Sudetendeutschen Bundesversammlung festgestellt.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel habe, so die Diplomatin, bei seinem Besuch in Selb ausdrücklich „den herausragenden Verdienst von Bernd Posselt für die tschechisch-bayerischen Beziehungen“ gewürdigt.
Diese positive Entwicklung sei auch in der Rede von Minister Mikuláš Bek als erstem offiziellen Vertreter einer tschechischen Regierung auf einem Sudetendeutschen Tag im ver-
„Heute ist das tschechischbayerische Verhältnis auf einem historischen Hoch und ist für ganz Europa ein leuchtendes Beispiel der Partnerschaft“, erklärte Červenková und listete die zahlreiche Reisen von Regierungsvertretern zwischen Prag und München auf.
Mit Blick auf das 20jährige Jubiläum des EU-Beitritts sagte die Generalkonsulin, Tschechien habe sich zu einem „vorbildlichen Mitglied der europäischen Familie“ entwickelt, und zitierte Václav Havel: „Europa ist die Heimat unserer Heimaten.“
❯ Volksgruppensprecher Bernd Posselt fordert auf der Sudetendeutschen Bundesversammlung mehr Engagement und lobt Staatspräsident Petr Pavel
Politisches Berlin zeigt wenig Interesse am deutsch-tschechischen Verhältnis
Tschechien gehört zu Deutschlands zwölf wichtigsten Handelspartnern. Waren im Wert von über 52 Milliarden Euro exportierte Deutschland im vergangenen Jahr ins Nachbarland. Zum Vergleich: Spitzenreiter sind mit fast 160 Milliarden Euro die USA, aber die Supermacht hat auch 30 Mal mehr Einwohner. Dennoch zeigt das politische Berlin wenig Interesse am Nachbarn Tschechien, hat Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, auf der Sudetendeutschen Bundesversammlung am Wochenende in München kritisiert.
In seinem Bericht zur Lage hinterfragte Posselt die in Berlin gern verbreitete Einschätzung, das deutsch-tschechische Verhältnis sei so gut wie nie.
„Das deutsch-tschechische Verhältnis war von deutscher Seite noch nie so von Gleichgültig-
keit geprägt“, zitierte Posselt aus Gesprächen mit Vertretern der tschechischen Regierung und Diplomatie. Selbst bei wichtigen Anliegen würden die Vertreter aus Prag in Berlin keine adäquaten Gesprächspartner finden, weil der Fokus ausschließlich auf Washington, Moskau und Warschau gerichtet sei. Selbst das deutsch-französische Verhältnis, die wichtigste Achse der europäischen Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg, werde mittlerweile vernachlässigt. Daß die tschechische Politik im politischen Berlin nicht wahrgenommen wird, sei insbesondere beim Staatsbesuch von Präsident Petr Fiala deutlich geworden. So wurde das Staatsoberhaupt nach der Landung nicht offiziell empfangen. Und als Pavel am Tag darauf an der Gedenkstätte Berliner Mauer einen Kranz für die Opfer niederlegte, war kein deutscher Vertreter dabei. Auch die
deutschen Medien (mit Ausnahme der Sudetendeutschen Zeitung) nahmen diese große Geste nicht zur Kenntnis.
„Im Gegensatz dazu lobt die tschechische Seite die Beziehungen zu den direkten Nachbarn Bayern und Sachsen sowie zu uns Sudetendeutschen“, so Posselt. Das Ansehen, das die Volksgruppe als Brückenbauer heute in Tschechien habe, sei groß und von weiten Teilen der Bevölkerung getragen, erklärte der Sprecher. Dies sei das Ergebnis einer nachhaltigen Verständigungsarbeit und der breiten Präsenz in der Wurzelheimat.
„Mittlerweile sagt man in Prag, daß die Sudetendeutschen die besten diplomatischen Vertreter für Tschechien in der Europäischen Union und in der Bundesrepublik Deutschland sind“, stellte Posselt fest und erklärte, daß die überwiegende Mehrheit der Tschechen wisse, welche
Narben die Vertreibung auch im eigenen Land hinterlassen habe, die bis heute nicht verheilt seien, und was die Sudetendeutschen leisten: „Dies hat Staatspräsident Petr Pavel bei seinem Staatsbesuch in Selb großartig zum Ausdruck gebracht, als er sich bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft bedankt hat.“ Dahinter, so Posselt, stehe auch die Erkenntnis „des großartigen Staatsmannes Pavel“, der im damaligen Grenzgebiet aufgewachsen ist, daß durch Vertreibung und Eisernen Vorhang diese Region sowohl wirtschaftlich als auch politisch so sehr gelitten hat, daß diese negativen Folgen noch heute sichtbar sind: „Präsident Pavel hat verstanden, daß diese Regionen nur dann eine Zukunft haben, wenn es grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt und wenn man dabei jene Menschen integriert, die aus diesen Gegenden stammen, nämlich die Sude-
❯ Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammmlung, appelliert im Vorfeld der Europawahlen
tendeutschen.“ Posselt: „Es ist wichtig, daß es gute Worte gibt, es ist wichtig, daß es gute Gesten gibt, aber ein wirklich nachhaltiges Interesse mit dem deutschen Nachbarn und mit uns Sudetendeutschen als Volksgruppe gemeinsam an der Wiederbelebung dieser Gebiete mitzuwirken, ist die beste Garantie für einen guten Weg in eine bessere Zukunft.“
Erneut erinnerte Posselt an die großen Worte des tschechischen Staatspräsidenten bei dessen Rede im Mai 2023 in der KZGedenkstätte Theresienstadt, die in den deutschen Medien bedauerlicherweise keine Beachtung fanden. Pavel hatte dabei seine Bürger ermahnt, ebenfalls die eigene Geschichte aufzuarbeiten: „Wir müssen die Verantwortung für die von unseren Vorfahren begangenen Verbrechen übernehmen und aus ihnen lernen.“ Torsten Fricke
Wahlrecht nutzen und Extremisten Absage erteilen
Die Sudetendeutsche Bundesversammlung unterstützt die Resolution gegen Populismus, Propaganda und Polarisierung, die der Sudetendeutsche Rat Anfang des Jahres einstimmig verabschiedet hat (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), ebenfalls auf breiter Basis.
In dem Appell werden der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Vertreibung der Armenier in Bergkarabach, die Lage im Nahen Osten nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas gegen Zivilisten in Israel sowie der Rückhalt für Demokratie und Menschenrechte in der Europäischen Union thematisiert. Mit Blick auf die kommende Europawahl und die zunehmenden Desinformationskampagnen

forderte Christa Naaß als Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung ein klares Bekenntnis der Demokraten: „Die Partei, deren Landesverbände vom Verfassungsschutz teilweise als gesichert rechtsextremistisch bewertet werden, nuitzt alle demokratischen Instrumente
eines demokratischen Staaates, um diesen Staat zu schwächen, zu spalten und zu unterlaufen. Deshalb appellieren wir in dieser Entschließung dafür, daß die EUBürger ihr Wahlrrecht nutzen und den extremistischen Parteien eine Absage erteilen.“
Die langjährige bayerische SPD-Landtagsabgeordnete, die auch Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde ist, verwies dabei auf Erich Kästner, der rückblikkend gemahnt hatte, man hätte bereits 1928 gegen die Nazis aufstehen müssen: „Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muß den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner auf.“ Torsten Fricke

Die Zeiten ändern sich, Menschen kommen und gehen, aber ihr Werk lebt zumindest teilweise weiter. SL-Büroleiter Peter Barton bemerkt bei seinen Reisen und Gängen durch die Hauptstadt Böhmens, wie schnell sie sich in den 22 Jahren seiner Arbeit für die Sudetendeutsche Landsmannschaft verändert hat.

Eine Hausrenovierung in der Hibernergasse (Hybernská) hat eine Aufschrift in Deutsch und Tschechisch zum Vorschein gebracht, die auf ein nahe gelegenes „Weinzimmer“ aufmerksam macht. Bald wird diese Erinnerung wieder verschwinden, aber dem Fotografen ist es gelungen, dieses liebe Überbleibsel aus der österreichisch-ungarischen k. und k. Zeit einzufangen. Das zweite Bild bringt uns zu einem anderen „Weinzimmer und Weinkellerei“ in einer Unterführung für die Straßenbahnen an der Ecke zur Kreuzherrengasse, inmitten der Altstadt. Hier hat der Gruß aus der Zeit der Donaumonarchie eine größere Chance zu überleben, denn der gut versteckte Schriftzug stört nicht und als Fläche für eine Reklame oder anderes eignet sich dieser Ort kaum.
❯ Besondere Wertschätzung
Joe Biden empfängt
Petr Fiala
US-Präsident Joe Biden hat am Montag im Weißen Haus den tschechischen Premierminister Petr Fiala empfangen.
Er halte Tschechien für einen hervorragenden Verbündeten, sagte Biden und lobte insbesondere die internationale Munitionsintiative für die Ukraine, die Staatspräsident Petr Pavel, auf der Münchner Sicherheitskonferenz (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) gestartet hatte.
Fiala bezeichnete es als bedeutend, daß Tschechien und die USA dieselben Werte teilen – wie die Menschenrechte, die Freiheit und die Demokratie.
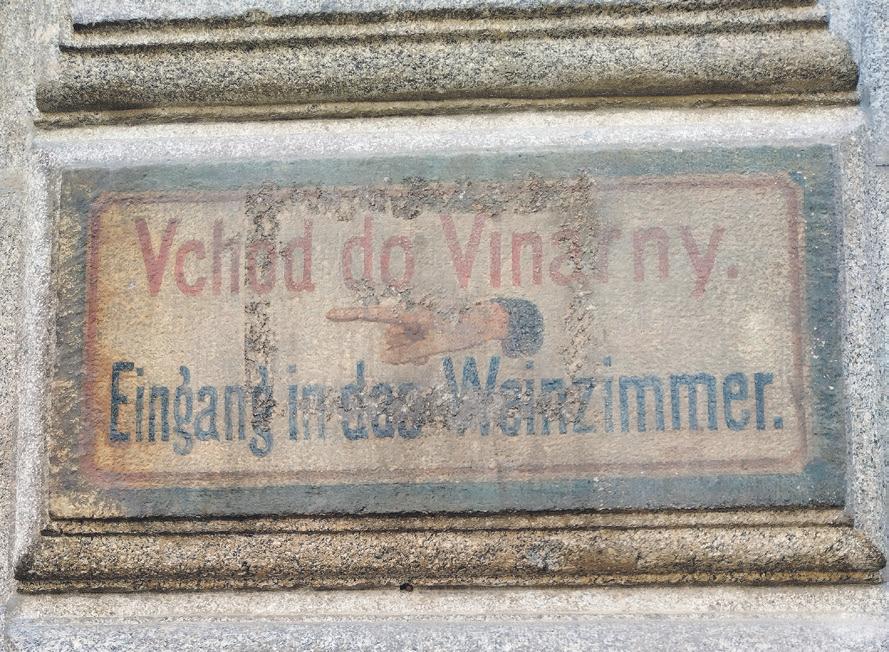
Halten wir dem längst verschwundenen „Weinzimmer und Weinkellerei“ Austria die Daumen!

❯ Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen in Berlin mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz
Deutliche Kritik an Claudia Roth: Vertreibung ist keine „Mobilität“
Auf dem Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen am 9. April in Berlin haben BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius und als Gastredner der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz die Vertriebenenpolitik der Bundesregierung kritisiert.
Zuvor hatte Fabritius auch die zahlreichen Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft begrüßt, insbesondere Volksgruppensprecher Bernd Posselt. „Als Präsident der Paneuropa-Union Deutschland stehst Du, lieber Bernd, außerdem einer Bürgerbewegung für die politische Einheit Europas vor, deren vier Leitsätze sich – ganz im Sinne auch der Heimatvertriebenen – an Freiheit, Recht, Frieden und den christlichen Werten orientieren. Herzlich willkommen!“
Besonders würdigte Fabritius auch die Vertreter der Deutschen Minderheiten in den Mittel- und osteuropäischen Ländern, in der Ukraine und in der Russischen Föderation, die es im Moment besonders schwer haben, aber auch die deutsche Minderheit in Polen, wo der Vorsitzende des Woiwodschaftsparlaments, Rafał Bartek aus Oppeln, gerade eine erfolgreiche Regional- und Kommunalwahl geschlagen hat. Die deutsche Minderheit erreichte mit mehr Stimmen als vor sechs Jahren wieder 5 der 30 Parlamentssitze und wird zur Regierungsbildung abermals benötigt werden. Und die Scharte, der Verlust des einzigen Sejm-Mandats auf Landesebene bei der Parlamentswahl im vergangenen Oktober, wurde regional nun ausgewetzt mit einem stärker schlesisch ausgerichteten Wahlkommitee.

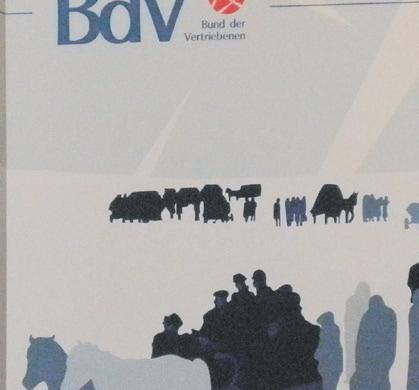






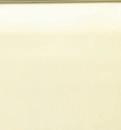














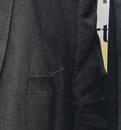







Fabritius betonte, die Organisationen der deutschen Minder-
unterstützt und gefördert. Sie lebten und pflegten einen kulturellen Schatz, der uns allen gehöre. Dazu passe nicht, die „Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen“ nach 2024 nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt zu finanzieren. Oder die Formulierungen des neuen „Rahmenkonzeptes Erinnerungskultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, die Deutschland als „von Mobilität und Migration geprägte Einwanderungsgesellschaft“ markiert. „Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und alle Begleitaspekte haben nichts mit ,Mobilität‘, mit ,Migration‘ oder mit ,Einwanderungsgesellschaft‘ zu tun. Da ist etwas ganz anderes passiert!“ rief Fabritius in den vollen Saal des Tagungszentrums. Friedrich Merz griff dann in seiner Rede diese Unzumutbarkeiten der letzten Zeit ebenso auf und nannte auch noch andere: die Aufnahmepraxis, die Anerkennungspraxis für Spät-
aussiedler aus der Ukraine und aus Rußland in den letzten Jahren, die von bürokratischen Hürden gekennzeichnet sei, wozu der Bundestag die Gesetze nach zwei Jahren nun endlich geändert hätte, eine Durchführungsbestimmung aber immer noch fehle. Er betone deshalb, die Tore für die Spätaussiedler müßten offen bleiben. Und das Fremdrentenrecht für Spätaussiedler, was vor allem Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion betreffe, sei zwar verbessert, aber nur in ungenügender Weise ausgestattet worden, sodaß nur Härten in symbolischer Höhe ausgeglichen werden könnten. Und eine weitere Entwicklung wollte Merz ansprechen, nämlich die Umbenennung des „Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ in Oldenburg durch das Haus von Claudia Roth in „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa“. „Wir fragen uns, warum ist das eigentlich gemacht worden? Die Erinnerung an Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa darf nicht einfach weggestrichen werden. Wir stehen dafür auch in unserem neuen Grund-
Petr Fiala bleibt
ODS-Vorsitzender
Premierminister Petr Fiala ist am Samstag auf dem Parteitag in Ostrau als Vorsitzender der ODS wiedergewählt worden. Er bekam 424 von 525 Stimmen. Fiala erklärte, sein wichtigstes
Ziel als Parteichef sei es, 2025 die Wahlen zum Abgeordnetenhaus zu gewinnen. Fiala hatte keinen Gegenkandidaten. Den Posten des Parteichefs verteidigte Fiala zum fünften Mal. Er sagte, die ODS sei sich dessen bewußt, was für eine Aufgabe sie in Tschechien habe. Zbyněk Stanjura wurde zum ersten Vizevorsitzenden wiedergewählt. Weitere Vizechefs der Partei bleiben weiterhin Alexandr Vondra, Martin Baxa und Martin Kupka. Die Vizevorsitzende der Fraktion der Bürgerdemokraten im Abgeordnetenhaus, Eva Decroix, ist neu in der Parteiführung.
Neuer Erzbischof ins Amt eingeführt
Der Erzbischof von Olmütz, Josef Nuzík, ist am Samstag im Olmützer Wenzelsdom vom apostolischen Nuntius in Tschechien, Jude Thaddeus Okolo, ins Amt eingeführt worden. Okolo forderte zu Beginn des Gottesdienstes dazu auf, die päpstliche Bulle vorzulesen, mit der Nuzík am 9. Februar zum Erzbischof von Olmütz ernannt wurde. An der feierlichen Amtseinführung nahmen 24 Bischöfe aus Tschechien und aus dem Ausland sowie Vertreter der Regierung und des Parlaments teil.
Gewerkschaft klagt gegen Regierung
Der Gewerkschaftsdachverband ČMKOS will bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde über die geplante Abschaffung des sogenannten garantierten Lohns in der tschechischen Privatwirtschaft einreichen. Damit werde gegen die EU-Richtlinie zu angemessenen Mindestlöhnen verstoßen, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes, Josef Středula. Die Regierung von Premierminister Petr Fiala hat eine Novelle des Arbeitsgesetzbuches ausgearbeitet, die derzeit im Parlament beraten wird. Mit dieser soll ab
Januar kommenden Jahres der garantierte Lohn in Privatfirmen abgeschafft werden.
Untreue beim Tennisverband
Der tschechische Tennisverband (Český tenisový svaz) kann nach eigenen Angaben, veruntreute Fördergelder derzeit nicht an die Nationale Sportagentur zurückzahlen. Es handelt sich um 29,7 Millionen Kronen (1,17 Millionen Euro), die der Verband unter seinem abgesetzten Chef Ivo Kaderka im Jahr 2021 verschoben hat. Kaderka sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Vojtěch Flégl sitzen seit März in U-Haft. Laut der Ermittler hatte Kaderka das Geld, das für die Ausrichtung internationaler Turniere gedacht war, auf ein Privatkonto von Flégl überwiesen.
Kremsier würdigt
Miloš Forman
M
it einer Serie von Konzerten und Open-Air-Vorstellungen wird im Sommer in Kremsier an die Entstehung des Oscar-Films „Amadeus“ von Regisseur Miloš Forman vor 40 Jahren erinnert. Auf Schloß Kremsier und im anliegenden Garten wurden mehrere berühmte Szenen für den Film gedreht. Die Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Eine große Nachtmusik“ findet vom 26. Juli bis 3. August statt. Im Garten, der genauso wie das Schloß auf der Weltkulturerbeliste der Unesco steht, werden unter anderem der kroatische Cellist Stjepan Hauser und die Melody Makers mit Adam Plachetka und Ondřej Havelka auftreten.
Trauer um Olympiasiegerin
Die Diskus-Olympiasiegerin von 1956, Olga FikotováConnollyová, ist am Freitag im Alter von 91 Jahren gestorben. Nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den olympischen Spielen in Melbourne heiratete sie den amerikanischen Hammerwerfer Harold Connolly und trat dann bei vier weiteren olympischen Spielen für die USA an. 1972 in München war sie sogar die Fahnenträgerin der amerikanischen Olympioniken bei der Eröffnungsfeier.
satzprogramm der CDU, die Erinnerung der Kultur und Geschichte der Deutschen in Osteuropa wachzuhalten.“ Friedrich Merz schilderte auch ein persönliches Erlebnis. „Als ich 1974 das erste Mal mit meinen Eltern in der alten Heimat meines Vaters war, war ein Schulfreund meines Vaters dabei, der auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Breslau groß geworden war. Er hatte mit der Familie, die inzwischen dort wohnte, vorher Kontakt aufgenommen. In dem Augenblick, wo der alte Schlüssel, den der Freund meines Vaters dabeihatte, in das Schloß der Haustür paßte, war das Eis gebrochen.“ Mit dem Regierungswechsel in Polen, so schloß Merz seine Ausführungen, bestehe nun eine echte Chance für einen Neubeginn. Der deutsch-polnische Freundschaftsvertrag müsse auf beiden Seiten wieder mit Leben erfüllt werden. Dazu zähle der Minderheits-Sprachunterricht für die Deutschen in Polen, dessen Stundenzahl endlich wieder erhöht gehört, aber auch Bemühungen für das Lernen des Polnischen für polnische Kinder in Deutschland. Ulrich Miksch
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.


❯ Erstmals reisten Vertreter der beiden Volksgruppen gemeinsam in die Slowakei Sudeten- und Karpatendeutsche als Brückenbauer in Preßburg
Zur Unterstützung der deutschen Minderheiten in Ost- und Mitteleuropa, aber auch zur weiteren Aufarbeitung des Schicksals der Heimatvertriebenen aus der früheren Tschechoslowakei gehen die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Karpatendeutsche Landsmannschaft in Bayern neue Wege. Bei einer Klausurtagung in Preßburg führten Delegationen beider Landesvorstände gemeinsam und im engen Schulterschluß Gespräche mit Vertretern der slowakischen Nationalregierung, des diplomatischen Korps und der örtlichen Religionsgemeinschaften.
Rundum positiv bewerteten die Landesvorsitzenden der beiden Landsmannschaften, SLLandesobmann Steffen Hörtler und dessen karpendeutscher Amtskollege Josef Zellmeier, Landtagsabgeordneter und zugleich stellvertretender BdVLandesvorsitzender, das neue Format: „Kulturelle und politische Bildung zur Vergangenheit und dem heutigen Dasein von Minderheiten ist wichtiger denn je. Dank ihrer verbindenden Geschichte und Herkunft sind Sudetendeutsche und Karpatendeutsche geradezu prädestiniert, hierzu gemeinsame Wege zu suchen. Diesen Schritt sind wir jetzt erfolgreich gegangen.“
Hochrangig begleitet wurden die beiden Landesvorstände im Rahmen ihrer verständigungspolitischen Arbeit vom Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Ludwig Spaenle, sowie der Bundesvorsitzenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Brunhilde ReitmeierZwick.
Eine besondere Note erfuhr die Klausurtagung durch die zeitgleich stattfindende Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei (siehe unten). Im Duell des pro-westlich gesinnten Ex-Außenministers Ivan Korčok und dem Präsidenten des slowakischen Nationalrates, Peter Pellegrini, entschied Zweitgenannter die Stichwahl für sich. Pellegrini gilt als Verbündeter des aktuellen im Oktober 2023 gewählten Regierungschefs Robert Fico, der sich in seiner bisherigen Regierungszeit rußlandfreundlich zeigt.
Was aber nun bedeuten die jüngsten Wahlen für die Minderheitenpolitik in der Slowakei?
In einem Punkt waren sich die Gesprächspartner einig: Minderheitenschutz und -rechte haben in der seit 1993 eigenständigen Slowakei eine lange und gut bewährte Tradition. Dies unterstrich der Bevollmächtigte der Slowakischen Republik für nationale Minderheiten, Ákos Horony, selbst Angehöriger der ungarischen Volksgruppe. Wie er berichtete, gibt es gegenwärtig in der Slowakei 14 anerkannte Minderheiten, darunter als größte die ungarische, weiterhin die Roma-Bevölkerung, die Ukrainer und Ruthenen, Tschechen und Deutsche. Jüngste Minderheit
sind die Vietnamesen. Zur Bewahrung ihrer kulturellen Identität, so Horony weiter, sei beschlossen worden, den Nationalen Ausschuß für Minderheiten zu einem der Regierung direkt weisungsgebundenen Rat fortzuentwickeln. Selbst knüpfte er daran die Erwartung, daß damit zugleich eine Erweiterung der Kompetenzen im künftigen Rat verbunden sei. Aktuell umfasse der Ausschuß, sagte Horony, 25 Sitze. Davon sind 14 den Angehörigen von Minderheiten vorbehalten, einer davon der deutschen. Auch äußerte er sich zur nationalen Förderung der Minderheiten. Gemäß ihres Bevölke-
ums und des Auswärtigen Amtes in Deutschland das in Preßburg beheimatete Museum der Karpatendeutschen Kultur und die deutschen Begegnungszentren zu erhalten. In der Volkszählung von 2021 bekannten über 8000 Personen ihre Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit in der Slowakei (vor Evakuierung und Vertreibung 1940: 140 000). Die deutsche Minderheit konzentriert sich auf die Siedlungsgebiete im Hauerland, der Zips sowie in und rund um Preßburg. So sehr er sich über die Aktivitäten der jüngeren Generation in der deutschen Minderheit freute und hier im Besonderen auf die star-





rungsanteils erhalten die Volksgruppen aus einem Fonds Geldmittel zugewiesen, um kulturelle und sprachliche Aktivitäten zugunsten ihrer Volksgruppe finanziell abzusichern. Daß die nationalen Fördermittel gut angelegt sind, erläuterte der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei (KDV) – und für die deutsche Minderheit Mitglied im Nationalen Ausschuß –, Ondrej Pöss. So trüge die nationale Unterstützung dazu bei, in Ergänzung der laufenden Mittel des Bundesinnenministeri-

ke Beteiligung in der Oberzips hinwies, machte er keinen Hehl aus der eher schwierigen Altersstruktur im Verband. Gerade die Corona-Zeit hätte sich, ergänzte ihn der KDV-Vorsitzende für die Region Preßburg, Michael Stolár, auf Teilnehmerzahlen nachteilig ausgewirkt. Die beiden KDVVertreter zeigten sich zuversichtlich, daß der politische Wechsel in der Slowakei keinen nennenswerten Einfluß auf die Unterstützung der deutschen wie aller anderen Minderheiten ausüben werde.
Auf den Bestand der nationa-
Der Bevollmächtigte der Slowakischen Republik für nationale Minderheiten, Ákos Horony (zweiter von rechts), und der Rabbiner der jüdischen Gemeinden in der Slowakei, Misha Kapustin (dritter von links), mit (von links) Dr. Ortfried Kotzian, Ludwig Spaenle, Ondrej Pöss, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Ste en Hörtler und MdL Josef Zellmeier.
len Gesetzgebung gegen Antisemitismus und somit die Rükkendeckung der slowakischen Regierung setzte der religiöse Vertreter der jüdischen Gemeinden, Rabbiner Misha Kapustin, seine Zukunftserwartung für die jüdische Gemeinde. Die Slowakei, betonte er, habe in der Vergangenheit rechtzeitig in Übereinstimmung mit den Vorgaben der EU-Kommission die Weichen gestellt, gegen antisemitische Übergriffe und Mißstände präventiv und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen. Ein Empfinden von Unsicherheit bei den rund 2000 zur jüdischen Minderheit zählenden Menschen könne er nicht wahrnehmen, meinte er auch mit Blick auf die in Deutschland aufgeheizten Diskussionen. Dies begründete er auch damit, daß im politischen Diskurs der Slowakei parteiübergreifend Sensibilität bei jüdischen Anliegen dominiere, auch wenn es in Einzelfällen vorkomme, daß „Grenzen ausgetestet“ werden. Eine große Aufgabe sei die Pflege der rund 800 jüdischen Friedhöfe in der Slowakei; eine Zahl, deren wirkliche Dimension erst im Vergleich greifbar wird: Das deutlich einwohnerstärkere Bayern habe, wie der Bayerische Antisemitis-
musbeauftragte Ludwig Spaenle einwarf, immerhin 200 jüdische Friedhöfe zu erhalten, und auch das sei eine Herausforderung.
Die politische Entwicklung im Verhältnis von Tschechien, Slowakei und Bayern sowie Deutschland seit der Samtenen Revolution 1989 nahmen die Gesprächspartner des diplomatischen Korps in den Blick. Zwar blieben die Lage der deutschen Minderheit, aber auch die heimat- und vertriebenenpolitischen Aspekte keineswegs unerwähnt. In Anbetracht der aktuellen Lage in Osteuropa stand nicht überraschend die Frage im Mittelpunkt, wie sich die mittel- und osteuropäischen Staaten heute und perspektivisch zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine positionieren. Die Slowakei hat im Osten des Landes eine 90 Kilometer lange Grenze zur Ukraine.
Für den früheren Botschafter Deutschlands in der Slowakei (2009 bis 2013), Axel Hartmann, steht die Viségrad-Gruppe – Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn – dahingehend vor einer Belastungsprobe. Dies projizierte er insbesondere auf die Beziehungen Tschechiens und der Slowakei, die historisch sehr eng gewesen seien, nun aber durch die sich unterscheidende Haltung zu Moskau unter Druck stünden. Entstanden sei eine „ungewisse Gemengelage“ in Mittel- und Osteuropa, die sich durch die Nationalratswahlen in Österreich im Herbst 2024, abhängig vom FPÖ-Ergebnis, weiter zuspitzen könne, so der ehemalige Referent im Bundeskanzleramt. Axel Hartmann ist noch heute Kuratoriumsmitglied der Akademie Mitteleuropa an der sudetendeutschen Bildungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen.
Die deutsche Botschafterin in Preßburg, Barbara Wolf, bezeichnete die Unterstützung der Ukraine als „wichtiges Thema, das auch für die Slowakei innenpolitisch bleibt“. Wie sich die Slowakei nach dem Regierungswechsel positionieren werde, wie tief mögliche Veränderungen gingen, bleibe jedoch abzuwarten. Nicht zuletzt hob die in München geborene Diplomatin die engen Verbindungen von slowakischer und deutscher Wirtschaft hervor. So sei weiterhin der Automotive-Bereich ein maßgeblicher Kernsektor bilateraler Wirtschaftsbeziehungen. Mittlerweile sei der Fortschritt der Slowakei von einer verlängerten Werkbank zu einem Wirtschafts-
❯ Vertrauter des umstrittenen Regierungschefs Robert Fico setzt sich in der Stichwahl durch Peter Pellegrini neuer Staatspräsident
In der Stichwahl hat sich Peter Pellegrini mit rund 53 Prozent gegen Ivan Korčok durchgesetzt und wird damit neuer Staatspräsident der Slowakei.
Nach seinem Wahlsieg erklärte der 48jährige Politiker, daß das Votum der rund 1,4 Millionen Wähler, die für ihn gestimmt haben, die Regierung von Ministerpräsident Robert Fi-
co stärke. Fico ist Chef der Partei „Richtung – Slowakische Soziale Demokratie“ (Smer-SSD), die im vergangenen Herbst als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervorgegangen ist. Er regiert seither in Koalition mit der „Stimme – Soziale Demokratie“ (Hlas-SD) Pellegrinis, einer Abspaltung von der Smer. Dritte Regierungspartei ist die nationalistische SNS.
Fico ist in der Europäischen Union wegen seines rußlandfreundlichen Kurses umstritten. So hatte der Populist umgehend nach seiner Wahl angekündigt, die Ukraine nicht mehr militärisch zu unterstützen. Offiziel wird Pellegrini, derzeit noch Parlamentspräsident, das Amt von der bisherigen Präsidentin Zuzana Čaputová im Juni übernehmen.

Wahlsieger Peter Pellegrini.
standort mit Entwicklungs- und Forschungsbereichen in vielen Unternehmen spürbar. Zugleich brachte sie ihre Erwartung zum Ausdruck, daß die Minderheitenförderung unangetastet bleibe.
Was die Gedenk- und Erinnerungsarbeit angeht, lobte sie die enge Zusammenarbeit sowohl mit dem Museum der Karpatendeutschen Kultur wie auch mit dem Holocaustmuseum Sered, dem ersten seiner Art in der Slowakei. Für die Erinnerungsarbeit empfahl sie zudem, verstärkt europäische Ansätze zu wählen.
Als Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen ließ Brunhilde Reitmeier-Zwick nicht unerwähnt, daß die historische Aufarbeitung der Vertreibung ab 1945 in der Slowakei sehr gut gelungen sei. Sie erinnerte in diesem Zusammenhang ausdrücklich an die Erklärung des slowakischen Nationalrats vor 33 Jahren. Darin hatte das Parlament 1991 das Prinzip der Kollektivschuld in Bezug auf die deutschsprachige Bevölkerung verurteilt. „Diese Erklärung war eine historische Errungenschaft“, betonte Reitmeier-Zwick.
Einen Dank an den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, und an SL-Landesobmann Steffen Hörtler richtete der Botschafter Tschechiens in der Slowakei, Rudolf Jindrák. Beide Sudetendeutsche hätten viel zum Ausgleich in den Beziehungen Bayerns und Deutschlands mit Tschechien beigetragen. Jindrák war Botschafter in Deutschland in den Jahren 2006 bis 2014. Die Beziehungen zwischen der Slowakei und Tschechiens seien historisch eine Besonderheit, da sich beide Staaten 1993 voneinander getrennt hätten, meinte er.
Die Entwicklung in der Viségrad-Gruppe bezeichnete Jindrák als gut. Grundsätzlich bleibe die Zielsetzung, so der 60jährige Diplomat, daß im Viségrad-Format gemeinsame Probleme wie beispielsweise im Energie- und Verkehrssektor nur gemeinsam gelöst werden könnten; innenpolitische Entwicklungen blieben in der Bewertung außen vor.
Die bayerischen Landesvorstände von Sudetendeutscher und Karpatendeutscher Landsmannschaft begleitete zu Fragen von Geschichte, Kultur und Schicksal der Karpatendeutschen der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung und Osteuropa-Experte, Dr. Ortfried Kotzian.
In einem aufschlußreichen Vortrag zur Geschichte der Karpatendeutschen und der Karpatenukraine hatte er daran erinnert, daß mit dem Ende der Donaumonarchie 1918 für die Deutschen in Oberungarn – damit auch der heutigen Slowakei – die Zugehörigkeit zum Königreich Ungarn zu Ende ging. Preßburg als Krönungsstadt der ungarischen Könige war bis zum Ersten Weltkrieg weitgehend durch Deutsche besiedelt. Erst danach änderte sich dies in der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik.

Die Flurausstellung „Heimat im Gepäck“ zeigt sudetendeutsche Trachtenträger, die Walther Appelt fotogra ert hat. Fotos: Torsten Fricke

❯ „Hommage á Kafka“ und „Heimat im Gepäck“ im Sudetendeutschen Haus
In der Alfred-Kubin-Galerie und im Flur der Sudetendeutschen Landsmannschaft sind zwei neue Ausstellungen im Sudetendeutschen Haus in der Hochstraße 8 in München zu sehen.
Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Dialoge der Bildenden Kunst & Architektur“ präsentiert die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste die beiden sudetendeutschen Künstler Moritz Baumgartl, geboren 1934 in Frühbuß im Erzgebirge, und Simon Dittrich, geboren 1940 in Teplitz-Schönau, in der Ausstellung Hommage á Kafka“. Kurator ist Hansjürgen Gartner, Klasse der Künste und Kunstwissenschaften, der die figürlich arbeitenden Künstler vor dem Hintergrund des 100. Todestages von Franz Kafka ausgewählt hat. Gezeigt werden Gemälde und Zeichnungen. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 5. Mai, und kann täglich (außer 1. Mai) von 10.00 bis 18 .00 Uhr besichtigt werden.
Im Flur der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist die Fotoausstellung „Heimat im Gepäck“ zu sehen. Im Rahmen des Projekts „Heimat im Gepäck. Vertriebene und ihre Trachten“, für das Kathrin Weber, Leiterin der Trachtenforschungs- und Bera-
■ Bis Sonntag, 5. Mai, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: „Moritz Baumgartl & Simon Dittrich – Hommage á Kafka“ (siehe oben). Öffnungszeiten: täglich (außer 1. Mai) von 10.00 bis 18.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.
■ Bis Freitag, 10. Mai, Sudetendeutsche Heimatpflege: „Heimat im Gepäck“ (siehe oben). Öffnungszeiten: werktags von 8.00 bis 17.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, Bundesgeschäftssstelle im 1. Stock, Hochstraße 8, München.
■ Bis Sonntag, 12. Mai, Sudetendeutscher Rat, Wanderausstellung „So geht Verständigung – dorozumění. Öffnungszeiten: Donnerstag, 17.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag, 14.00 bis 17.00 Uhr. Stadtmuseum, Kirchenplatz 2, Herzogenaurach.
■ Samstag, 20. April, 10.00 Uhr, Deutscher Böhmerwaldbund Ortsgruppe München und Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München: 70jähriges Jubiläum. 10.15 Uhr: Fahneneinzug in den Adalbert-Stifter-Saal im Sudetendeutschen
Haus, 10.30 Uhr: Messe. 12.00 Uhr: Mittagessen. 14.00 Uhr: Festakt. 17.00 Uhr: Offenes Tanzen. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 20. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 20. April, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Passau: Monatsversammlung. Es spricht
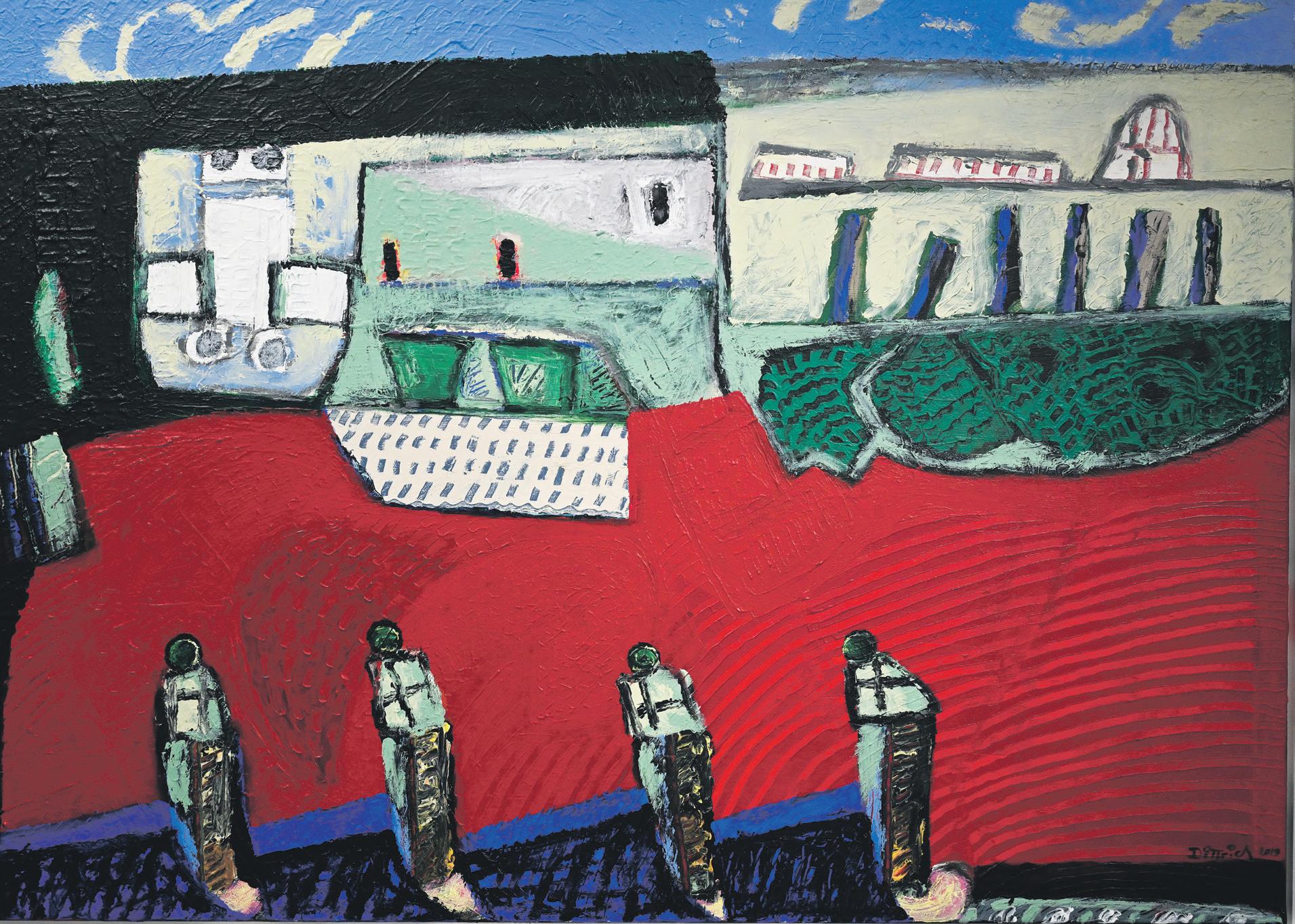
tungsstelle des Bezirks Mittelfranken verantwortlich war, hatte Walther Appelt auch Träger sudetendeutscher Trachten fotografiert, deren Bilder jetzt als Flurausstellung gezeigt werden. Unterstützt wurde das Vorhaben
auch von der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Die Ausstellung besteht aus 16 Bildtafeln und kann kostenfrei bei der Sudetendeutschen Heimatpflege per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de ausge-
Richard Šulko über sein Leben als in der Heimat verbliebener Egerländer. Gasthof Aschenberger, Donaustraße 23, Passau.
■ Montag, 22. April, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmen als Ort der Begegnung – Teil 1: Europäische Wegbereiter“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Dienstag, 23. April, 19.30 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Am Tanze fehlte es nicht …“ Der junge Smetana in Tagebuch und Musik – Konzert und Gespräch zum 200. Geburtstag von Bedřich Smetana (1824 – 1884). Evangelische Brüdergemeinde Berlin, Kirchgasse 14, Berlin.
■ Mittwoch, 24. April, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Am Tanze fehlte es nicht …“ Der junge Smetana in Tagebuch und Musik – Konzert und Gespräch zum 200. Geburtstag von Bedřich Smetana (1824—1884). Hochschule für Musik Franz Liszt, Hochschulzentrum am Horn, Carl-Alexander-Platz 1, Weimar.
■ Mittwoch, 24. April, 19.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Szenische Lesung „Spurwechsel“. 150 Jahre Literatur über Züge, Strekken und Bahnhöfe im östlichen Europa. Eintritt: 15 Euro. Kartenverkauf nur online unter tickets.berliner-unterwelten.de /#/events/57?date=2024-04-24
Tunnel/Bunker unter der Dresdener Straße, Zugang Dresdener Straße gegenüber Hausnummer 44, Berlin.
■ Donnerstag, 25. April, 10.00 Uhr: SL-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Landesfrauentagung. Anmeldung per eMail gr@gertraudrakewitz.com oder per Telefon unter (0 65 97) 13 68. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Donnerstag, 25. April, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München (Bruna): Mitgliederversammlung und Heimatnachmittag zum Thema „Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch 1945“. Gaststätte Altes Bezirksamt im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Donnerstag, 25. April, 15.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Erlangen: „So geht Verständigung –dorozumění“. Sonderführung mit Dr. Christian Hoyer. Stadtmuseum, Kirchenplatz 2, Herzogenaurach.
■ Samstag, 27. April, 14.00 bis 17.30 Uhr, Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese München und Freising: Begegnungsnachmittag. Thema: „Populismus heute. Einblicke eines Journalisten“ mit AfD-Experten Johannes Reichart. Anmeldung per eMail an muenchen@ackermanngemeinde.de Teilnahmegebühr 20 Euro, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 27. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
liehen werden. Der Leihnehmer trägt die Transportkosten. Die Flurausstellung wird bis Freitag, 10. Mai, gezeigt und ist werktags während der Öffnungszeiten der Bundesgeschäftsstelle zwischen 8.00 und 17.00 Uhr zu sehen.
■ Dienstag, 30. April, 16.00 bis 18.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Schreibcafé Lebendige Erinnerung mit Journalistin und Autorin Gunda Achterhold. Teilnahme: 15 Euro, Anmeldung per eMail an info@sudetendeutsches -museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. Treffpunkt: Sudetendeutsches Museum, Museumskasse, Hochstraße 10, München.
■ Samstag, 4. Mai, 10.30 Uhr: Paneuropa-Union Bayern: Landesversammlung unter dem Motto „Paneuropa gegen NeoNationalismus und für eine starke Europäische Union in der Vielfalt ihrer Regionen“. Historischer Rathaussaal, Marktplatz 11, Amberg in der Oberpfalz.
■ Samstag, 4. Mai, 14.00 Uhr, Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Landesvorstandsitzung. Sudetendeutsches Haus, Am Krug 17, Münster.
■ Samstag, 4. Mai, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Passau: Monatsversammlung. Es spricht BdVLandesvorsitzender Christian Knauer. Gasthof Aschenberger, Donaustraße 23, Passau.
■ Samstag, 4. Mai, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Muttertagsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Montag, 6. Mai, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Böhmisch-bairisches Frühlingssingen mit Dr. Erich Sepp. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 9. Mai, 19.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Augsburg: Maiandacht mit Blasmusik und Chorgesang. St. Ulrich, Ulrichsplatz 3, Königsbrunn.
■ Sonntag, 28. April bis Freitag, 3. Mai. „Jahrestage 2024“. Veranstaltung für historisch Interessierte.
Auch im Jahr 2024 häufen sich zahlreiche Gedenktage und -jahre. Im Seminar sollen einige dieser markanten Gedenkjahre, denen Ereignisse zugrunde liegen, die bis heute das Verhältnis Deutschlands zu seinen Nachbarstaaten, insbesondere zu seinen östlichen, bestimmen, behandelt werden. So soll an lang zurückliegende Ereignisse bis an Ereignisse aus der eigenen Lebenszeit erinnert werden, etwa die Emigration Deutscher aus Franken nach Posen vor 300 Jahren, den 85. Jahrestag des Hitler-StalinPaktes, der eine Aufteilung Europas - insbesondere auch Polens - nach den Interessen des nationalsozialistischen Deutschen Reiches und der Sowjetunion, der erst den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 möglich machte, an die Lage der verbliebenen Deutschen in ehemaligen deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gründung der Bundesrepublik und Inkraftsetzung des Grundgesetzes, an die Wendezeit 1989, die Deutschland im Folgejahr die Wiedervereinigung einbrachte und den Ostmitteleuropäern die Freiheit, den Beitritt osteuropäischer Staaten zur Nato und EU vor 25 bzw. 20 Jahren, der 25jährigen Herrschaft Wladimir Putins in Rußland und damit zusammenhängend ein Blick auf die Entwicklung der Ukraine (Orange Revolution 2004, Euromaidan 2014, Besetzung der Krim und Unterstützung der Separatisten im Donbass) sowie die gegenwärtige Kriegslage geworfen werden.
Anmeldungen über die Webseite unter https://heiligenhof.de/ unsere-seminare/seminarprogramm/jahrestage-2024
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Internationaler Museumstag am Sonntag, 19. Mai Preußler neu erzählt

■ Sonntag, 19. Mai, Internationaler Museumstag. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. Das Sudetendeutsche Museum bietet zum internationalen Museumstag den beliebten Sand-Art-Workshop für Kinder und Familien an. Die italienische Künstlerin Nadia Ischia führt um 11.00 Uhr eine zauberhafte Performance auf, in der Bilder aus Sand Otfried Preußlers Geschichten erzählen. Wie diese Kunstform zustande kommt und wie man selbst Sandkunst kreieren kann, erklärt und zeigt die Künstlerin jeweils um 14.00, 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr in einem 40-minütigen Workshop für Kinder ab vier Jahren. Anmeldung per eMail an info@sudetendeutschesmuseum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 0 0 03 37.Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag frei.



❯ Neue Ausstellung
■ Donnerstag, 25. April, 18.00 Uhr: Vernissage „Deutsche in der Ukraine: Geschichte und Kultur“. In seinem Festvortrag spricht Dr. Alfred Eisfeld über das Thema
„Die ‚Deutsche Operation‘ in der Sowjetunion 1937–1938“. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Die Ausstellung ist bis zum Mittwoch, 29. Mai, werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr zu sehen.
Das Territorium der Ukraine war seit jeher ein Raum, in dem Völker und Kulturen auf-
einandertrafen. Seit dem 10. Jahrhundert gab es dynastische Verbindungen mit dem deutschen Hochadel, Handelsbeziehungen und militärische Bündnisse. Im 18. Jahrhundert begann die Einwanderung deutscher Bauern und Handwerker. Deutsche Siedlungen wurden im Schwarzmeergebiet, auf der Krim, in Wolhynien und später auch in der Ostukraine gegründet. Anmeldung per Telefon unter (0 89) 4 49 99 30 oder per eMail an poststelle@ hdo.bayern.de
❯ Trauer um Gerhard Zeihsel, langjähriger Bundesobmann und Ehrenobmann der SLÖ
„Sein Tod ist ein großer Verlust für uns Sudetendeutsche“
Sein Wiener Schmäh ist für immer verstummt: Am Freitag, 12. April, ist Gerhard Zeihsel, langjähriger Bundesobmann und Ehrenobmann der SLÖ im Alter von 84 Jahren überraschend verstorben. Die Sudetendeutsche Bundesversammlung, der Zeihsel unter anderem als Vize-Präsident angehört hatte, unterbrach am Samstag ihre Sitzung für eine Schweigeminute.
„In den vergangenen Jahren widmete er sich dabei noch immer unermüdlich insbesondere der Pressearbeit, wobei natürlich der Sudetendeutsche Pressedienst (SdP) und insbesondere die Sudetenpost seine bekannten Steckenpferde waren. Und so setzte er wahrlich seine gesamte Kraft dafür ein, daß das an den sudetendeutschen Heimatvertriebenen begangene Unrecht nicht in Vergessenheit gerät und daß nach wie vor offene Fragen der Entschädigung immer wieder mit entsprechendem Nachdruck thematisiert wurden“, erklärten Kapeller und Stix.
Volksgruppensprecher Bernd Posselt sagte in tiefer Trauer: „Gerhard Zeihsel hat sein ganzes Leben und alle seine anderen Aufgaben und Funktionen stets seinem Einsatz für die Sudetendeutsche Volksgruppe untergeordnet.
In einer gemeinsamen Erklärung würdigten Norbert Kapeller, Präsident des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ), und Dr. Rüdiger Stix, Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), das Lebenswerk des Verstorbenen: „Gerhard Zeihsel, dessen Vater aus Damitz in Südmähren und dessen Mutter aus BrünnKumrowitz abstammten, wurde am 21. Dezember 1939 in Wien geboren. In den 1950er Jahren zeigte er schon ehrenamtliches Engagement in der Sudetendeutschen Jugend Österreichs und war über Jahrzehnte in vielerlei Funktionen in der Sudetendeutschen Landsmannschaft tätig, deren Vorsitz er im September 2000 in der Nachfolge von Karsten Eder übernahm. Darüber hinaus war er unter anderem auch als Mitglied des Sudetendeutschen Rates in München sowie als Vizepräsident der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft tätig.“ Obwohl in Wien geboren, besuchte Zeihsel zunächst die Volksschule in Damitz, dem Heimatort seines Vaters in Mähren. 1947 siedelte die Familie dann endgültig nach Wien um. Ab 1956 arbeitete Zeihsel als Chemiker für den Waschmittelproduzenten Unilever, wurde dort später Anwendungstechniker im Außendienst und Betriebsrat. Von 1987 bis 1996 war er Landtags-Abgeordneter und Gemeinderat in Wien sowie viele Jahre Bezirksparteiobmann der FPÖ Simmering.
Politisch und heimatpolitisch waren wir
nicht immer einer Meinung, aber unsere jahrzehntelange Freundschaft war nicht nur von gegenseitigem Respekt, sondern auch von einer guten menschlichen Übereinstimmung getragen. Sein Tod ist ein großer Verlust für uns Sudetendeutsche, weit über Österreich hinaus. Wir sind ihm und seiner lieben Frau Reinhilde in Trauer und im Gebet verbunden.” Tief betroffen würdigte Christa Naaß als Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung am Samstag die Leistungen des Verstorbenen für die Sudetendeutsche Volksgruppe: „25 Jahre war er Mitglied der Bundesversammlung, einige Jahre sogar Vizepräsident des höchsten Gremiums der Sudetendeutschen.“
In ihrer Trauerrede vor der Bundesversammlung erinnerte die Präsidentin daran, daß Gerhard Zeihsel von 2000 bis 2023 Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich war. Auch in dieser Funktion habe er „in treuer Verbundenheit zusammen mit seiner Gattin“ regelmäßig die von Christa Naaß als Generalsekretärin geleiteten Marienbader Gespräche des Sudetendeutschen Rates in Marienbad besucht, dessen Mitglied er ebenfalls viele Jahre war.
In den Morgenstunden seines Todestages hatte Christa Naaß noch eine WhatsApp von Gerhard Zeihsel bekommen, berichtete sie betroffen. Gerne er-

Gerhard Zeihsel, Ehrenobmann der SLÖ, verstarb überraschend am 12. April im Alter von 84 Jahren. Foto: SLÖ
innere sie sich an den Sudetendeutschen
Heimattag im Jahr 2022 in Klosterneuburg, zu dem sie von Gerhard Zeihsel als Hauptrednerin eingeladen wurde, sowie an die Präsentation der Ausstellung des Sudetendeutschen Rates „So geht Verständigung“ in der Volkshochschule Hietzing bei Wien, die er in Verbundenheit zum Sudetendeutschen Rat initiiert hatte. Politisch habe man zwar verschiedenen Lagern angehört, habe sich aber dennoch gegenseitig große Wertschätzung entgegengebracht, sagte die langjährige SPD-Landtagsabgeordnete und Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde
über Gerhard Zeihsel: „Seine Zuverlässigkeit, Korrektheit und Durchsetzungsfähigkeit zeichneten ihn genauso aus wie sein Wiener Charme.“ Torsten Fricke
❯ Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine, berichtet im Sudetendeutschen Heimatrat
Mit durchwegs aktuellen Themen haben sich die Mitglieder des Sudetendeutschen Heimatrates in ihrer Onlinesitzung kurz vor den Osterferien befaßt. Heimatratsvorsitzender Franz Longin konnte zum Thema „Deutsche Gräber und Friedhöfe in der Tschechischen Republik“ Martin Dzingel begrüßen. Der Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und dort federführend bei der „Arbeitsgruppe Friedhöfe“ beim Regierungsrat für Nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik zuständig, schilderte in einem kurzen Rückblick den bisherigen Verlauf. So habe die deutsche Minderheit bereits im Jahr 2015 über den Regierungsrat für nationale Minderheiten einen Antrag an den tschechischen Staat mit der Aufforderung gestellt, für die deutschen Gräber, Friedhöfe und Grabstätten eine Lösung zu finden, in welcher Form und mit welchen finanziellen Mitteln man die notwendige Sanierung durchführen könne. Dieser Antrag sei angenommen und im Jahr 2016 eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Sudetendeutschen gegründet worden, die seitdem viel Arbeit geleistet habe. Ein erstes konkretes Ergebnis sei das Handbuch für die Gemeinden und Städte „Pflege der verlassenen deutschen und anderen Gräber auf Friedhöfen der Tschechischen Republik“. Es folgten Gespräche der tschechischen und sudetendeutschen Arbeitsgruppe untereinander sowie die Konferenz der tschechischen Regierung (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).
Als gute Lösung bezeichnete Dzingel, daß sich das tschechische Regionalministerium künftig der sudetendeutschen Friedhöfe und Gräber gemeinsam mit Akteuren der Zivilgesellschaft annehmen wird. Er führte weiter aus, das federführende Ministerium für regionale Entwicklung werde ein Konzept über künftige notwendige Schritte entwikkeln. Ziel sei ein Finanzierungs- und ein Dotierungsprogramm, damit Gemeinden und eventuell auch Personen mittels Antragstellung auf bereitgestellte finanzielle Mittel Zugriff haben. Zunächst gehe es darum, entsprechende Konzepte fortzuschreiben und vor allem für die nötige Finanzierung


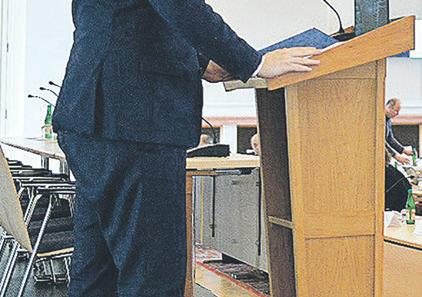


zu sorgen. Eile sei geboten, damit Grabstätten vor dem Verfall gerettet werden können. Dabei gehe es nicht nur um die Sanierung der Gräber, sondern es sollen auch zukunftsgewandt Begegnungsstätten von Deutschen, Sudetendeutschen und Tschechen entstehen, so Dzingel. Bis zum nächsten Treffen im Juni stünde viel Arbeit bevor. Umfassende Lösungskonzepte für die tschechische Regierung zur Entscheidungsfindung über die Sanierungsmöglichkeiten und Rekonstruktion von Grabstätten müßten erstellt, Ausschreibungskriterien bis dahin fertiggestellt und Finanzierungswege konkretisiert werden.
Heimatkreisbetreuer Edmund Schiefer, Mitglied der Arbeitsgruppe im Sudetendeutschen Heimatrat, erinnerte an das gemeinsame Ziel beider Arbeitsgruppen dafür zu sorgen, daß mit sogenannten „Aufräumaktionen“ keine weiteren Friedhöfe, wie im nordostböhmischen Hermsdorf, eingeebnet werden.
Sudetendeutscher Tag
Heimatratsvorsitzender Franz Longin warb für eine starke Beteiligung am Sudetendeutschen Tag und rief dazu auf, das Pfingstwochenende für das Treffen mit Landsleuten zu nutzen.
Arbeit sichtbar machen
In einem weiteren Apell rief Longin die Amtsträger in den Heimatlandschaften und Heimatkreisen auf, ihre Arbeit verstärkt sichtbar zu machen. Die Veröffentlichung grenzüberschreitender Projekte auf der SL-Homepage sei eine gute



Möglichkeit, deutsch-tschechische Projekte zu erfassen und zu veröffentlichen. Die vorgestellte Projektdatenbank soll die zahlreichen grenzüberschreitenden Initiativen der Sudetendeutschen der Öffentlichkeit zugänglich machen und so auch als Ideengeber für weitere Vorhaben deutsch-tschechischer Kooperationen dienen. www.sudeten.net
Über den weiteren Ausbau des Netzwerks sudeten.net informierte Mathias Heider in seinen Ausführungen. Heider: „Seit zwei Jahren bringt Sudeten. net, unser soziales Netzwerk, Sudetendeutsche aller Generationen zusammen. Seine volle Wirkung entfaltet das Netzwerk natürlich erst dann, wenn auch Sie als Heimatortsbetreuer dort erreichbar sind. Falls noch nicht geschehen, bitten wir Sie deshalb ganz herzlich, sich unter der Adresse https://www.sudeten.net/ Account/Join auf Sudeten.net anzumelden.“
Longin dankte für die hervorragende Arbeit und warb fürs Mitmachen: „Die Akzeptanz und die ständige Weiterentwicklung unseres sudeten.net im regen Austausch mit den Amtsträgern in der Heimatgliederung bieten ungeahnte Möglichkeiten.“
Facebook und Co.
Die Mitglieder des Sudetendeutschen Heimatrates betreiben unzählige Facebookgruppen, die gerade die Enkelgeneration auf deutscher wie auf tschechischer Seite ansprechen und einen re-
Immer noch ist Ostern! Die Kirche feiert dieses wichtigste Fest des christlichen Glaubens 50 Tage lang bis Pfingsten. In dieser österlichen Festzeit hat jeder Sonntag seinen besonderen Charakter. Diesen bestimmen Bibelstellen, die in den Gottesdiensten vorgelesen werden. Dabei lohnt es sich besonders, auf das Evangelium des jeweiligen Sonntags zu hören. Im Grunde geht es immer darum, daß Jesus nicht nur in der Vergangenheit gegenwärtig und wirksam ist, sondern auch in der Gegenwart. Er ist für uns im Hier und Heute da. Die Sonntagsevangelien der Osterzeit wollen uns dafür sensibilisieren.
gen Austausch ermöglichen. Über den anhaltenden Zuwachs informierte Heimatlandschaftsbetreuer Markus Dekker und warb für breite Unterstützung durch weitere Moderatoren, die sich bei ihm oder in der SL-Bundesgeschäftsstelle melden sollen. Lorenz Loserth, ein äußerst aktiver Heimatortsbetreuer in der Heimatlandschaft Altvater, schlug in dieselbe Kerbe und betonte, jeder Heimatkreis sollte einen Facebook-Beauftragten haben. Dadurch werde verhindert, daß in den einzelnen Landschaftsgruppen Beiträge zu ganzen Regionen fehlten, wie es phasenweise auch in der Altvatergruppe der Fall gewesen sei, weil es für den Kreis Jägerndorf ein paar aktive Mitglieder gegeben habe und Sternberg oder Römerstadt nicht vertreten waren. Ein Heimatkreisbeauftragter könne mit mehr oder weniger Engagement agieren, aber nötig sei er, so Loserth, der sich auch für einen sogenannten Leitfaden für Facebooknutzer engagieren will.
Neue Verbandsordnung
Positiv bewertete Vorsitzender Franz Longin die neue Verbandsordnung für die Heimatgliederung der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), die seit dem Tag der Beschlußfassung in der Bundesversammlung (siehe auch Seite 1) gilt. Sie regelt in einer überarbeiteten schlanken und übersichtlichen Form unter anderem Zuständigkeiten und Aufgabengebiete.
Jahrestagung mit Neuwahl
Abschließend gab es noch den Hinweis auf die Jahrestagung des Heimatrates am 15. und 16. November 2024 am Heiligenhof in Bad Kissingen. Longin warb für eine möglichst vollständige Präsenz der Mitglieder, denn es würden mit der Neuwahl des Vorstandes die Weichen für die weitere Zukunft des Heimatrats gestellt. Der Heimatrat sei zukunftsfähig aufgestellt, dies belege auch das zunehmende Interesse der Jüngeren an der Arbeit in den Heimatgebieten. Durch ein attraktives Erscheinungsbild ließen sich auch Interessierte für die Arbeit in den Heimatkreisen finden – auf deutscher wie auf tschechischer Seite, so Longin abschließend. Hildegard Schuster
Wie ist Jesus für uns da? Eine besonders schöne Antwort auf diese Frage gibt der vierte Sonntag in der österlichen Festzeit. Er wird in der katholischen Kirche Guter-Hirten-Sonntag genannt. Das Bild von Gott als einem Hirten, der für die Menschen sorgt, findet sich bereits im Alten Testament. Berühmt ist der Psalm 23. Er ist ein Grundtext des jüdischen und des christlichen Glaubens. Ein Gebet, in welchem die tiefe Sehnsucht zum Ausdruck kommt, daß in unserem Leben letztlich alles gut wird, weil wir auf die Hilfe Gottes vertrauen können.

Weil dieser Psalm so ermutigend und heilsam ist, möchte ich ihn zitieren: „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er läßt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.“
Jesus hat zu seinen Lebzeiten die Vorstellung von Gott als gutem Hirten aufgegriffen und sie für sich verwendet. Im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums ist eine Rede überliefert, in der er sich als Hirte beschreibt, der bereit ist, sein Leben für die Seinen hinzugeben. Die Beziehung zwischen ihm und den ihm anvertrauten Menschen bezeichnet er als einen Zustand gegenseitigen Wissens umeinander: „Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“ Zugleich warnt Jesus in dieser Rede vor Pseudo-Hirten. Sie meinen es nicht gut mit den Menschen, sondern suchen den eignen Vorteil und Nutzen. Nur der gute Hirte ist in steter Sorge den Seinen verbunden. Er bleibt auch in Not und Gefahr. Wann immer in der Bibel vom guten Hirten gesprochen wird, ist dies natürlich auch ein Hinweis darauf, daß wir Menschen und wie wir füreinander Verantwortung tragen sollen. Besonders kirchlichen und weltlichen Verantwortungsträgern seien diese biblischen Maßstäbe ins Stammbuch geschrieben. Doch im letzten sind auch sie Menschen, die manchmal Angst haben, deren Vertrauen brüchig ist und die um ihre Fehler und Schwächen wissen. Wir alle brauchen Fürsorge, Ruhe, Geborgenheit und Schutz. Wir sehnen uns nach Liebe. Sich daran zu erinnern, daß wir alle einen guten Hirten haben, tut deswegen unseren Seelen gut! Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer
Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde
aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands.
Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München



Anfang April ehrte die SL-Landesgruppe Bayern Tomáš Kafka, den Tschechischen Botschafter in Berlin, mit ihrer höchsten Auszeichnung, der Verdienstmedaille in Gold.
Tomáš Kafka war mit seiner Frau Olga und seinem Sohn Filip gekommen. Das war ein äußeres Zeichen, wie familiär die Beziehungen zwischen Kafka und den Sudetendeutschen sind. Das betonte auch Landesobmann Steffen Hörtler, der Kafka von Herzen für dessen Freundschaft dankte. „Unsere große Heimatliebe überwindet das konfliktbeladene sudetendeutsch-tschechische Verhältnis.“ Wichtig sei, was die Deutschen und die Tschechen verbinde, nicht, was sie trenne. „Wir sprechen wie Freunde miteinander, nicht wie Diplomaten, die aneinder vorbeireden.“ Unvoreingenommen analysiere Kafka die deutsch-tschechischen Beziehungen. Selbst beim Kissinger Sommer – Hörtler leitet die Bildungsstätte Heiligenhof im unterfränkischen Bad Kissingen –, der keine sudetendeutsche Veranstaltung sei, habe Kafka die sudetendeutschen Landsleute begrüßt. Kafka schließe bei den Beziehungen zwischen den Deutschen und Tschechen die Sudetendeutschen nie aus. „Ich habe viel von Dir gelernt“, schloß Hörtler.
Volksgruppensprecher Bernd Posselt sagte: „Wir kennen uns seit einem Vierteljahrhundert,
und zwar seit der Gründung des Deutsch-Tschechischen-Zukunftsfonds.“ Bereits damals habe Kafka die Anrede „Liebe Landsleute“ gebraucht. Damit habe er einen anderen Akzent gesetzt. Kafka war Mitbegründer und erster Direktor des DeutschTschechischen Zukunftsfonds.
Die Sudetendeutschen und die Tschechen seien eine Familie, und in einer Familie liebe und hasse man sich. So wie sich
nen František Černý. Dieser war ebenfalls Tschechischer Botschafter in Deutschland, und zwar der erste nach der Samtenen Revolution in Berlin, sowie Mitbegründer des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren.
„Ich habe das Beste mitgebracht, das ich habe“, leitete Kafka seinen Dank ein, „meine Frau Olga und meinen Sohn Filip.“
Damit unterstrich er auch ver-

der Deutsche Botschafter in Prag zu Hause fühle, so fühle sich Kafka in Berlin zu Hause. „Uns verbindet eine tiefe Gemeinschaft: Wir sind Handlungsreisende in Sachen Völkerverständigung.“ Schließlich sagte Posselt: „Tomáš, Du bist einer von uns. Danke für alles, was Du für uns getan hast.“ Tomáš Kafka ist nicht nur Diplomat, sondern auch Literat, Übersetzer und Ziehsohn des am 2. Februar verstorbe-

bal die persönliche Verbundenheit zu den Sudetendeutschen.
Das gegenwärtige deutsch-tschechische Verhältnis habe man sich gemeinsam erarbeitet. „Mein Patenonkel František Černý sagte: ,Eines Tages werden die Sudetendeutschen unsere besten Freunde und Verbündeten sein.‘ Und so ist es gekommen.“ Zum Schluß gratulierte BdVPräsident Bernd Fabritius der SL, durch kluges Handeln gute Freunde wie Tomáš Kafka zu gewinnen. Der sei nun auch der Botschafter der Sudetendeutschen.
Die SL-Landesgruppe war mit einer Delegation aus gut zwei Dutzend Mitgliedern nach Berlin gekommen. Dort besuchte sie auch den Jahresempfang des BdV (Ý Seite 2), zu dem auch Natalie Pawlik, Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, der ehemalige sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Christoph Bergner, Erika Steinbach, ehemalige BdV-Präsidentin und ehemalige Vorsitzende der Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“ in Wiesbaden, sowie Manfred Kittel, Gründungsdirektor der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin, gekommen waren. Schließlich besuchten die Landsleute aus Bayern das 2021 eröffnete Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Nadira Hurnaus
Die Auszeichnung und das Lob von Hörtler und Posselt seien ihm Kompliment und Verpflichung. Die Wiederauferstehung Mitteleuropas müsse auch intellektuell bewältigt werden. Die Tschechen hätten sich allerdings bereits vor der Wende als Mitteleuropäer gefühlt. Im Gegensatz zu den Westeuropäern hielten die Tschechen Freiheit, Modernität und Tradition nicht für geschenkt. „Wir müssen das immer wieder erstreiten. Wir haben ein Erbe, das wir verteidigen müssen für die neuen Generationen.“


BdV-Präsident Professor Dr. Bernd Fabritius, BdV-Vizepräsident Stephan Mayer MdB, Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen, Margaretha Michel, Mitglied des SL-Landesvorstandes, und Rita Hagl-Kehl MdB, Verwaltungsratsmitglied des DTZF.



Verleger Jürgen Tschirner, Reinfried Vogler, Ehrenvorsitzender der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Dr. Michael Henker von der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Bernd Goldhammer, Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Dirk Thormann und Martin Dzingel, Präsident der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik.


Bilder: Nadira Hurnaus

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) präsentieren –in Kooperation mit dem Metropolitankapitel von Sankt Veit in Prag und dem Erzbistum Prag –in Dresden in der Ausstellung „Fragmente der Erinnerung“ den Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Kunstwerken von Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt.
Die neue Ausstellung „Fragmente der Erinnerung. Der Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt“ ist in der Kunsthalle im Lipsiusbau zu sehen. In fünf Ausstellungsstationen werden Themen wie Religion, Erinnerung und Gedächtnis aufgegriffen.
Im Zentrum steht der über Jahrhunderte gewachsene Reliquienschatz des Prager Veitsdoms, eine der größten und bedeutsamsten Sammlungen von Belegstücken des Glaubens, die als heilig verehrt und kostbar erachtet wurden. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der Domschatz außerhalb seines ursprünglichen Bestimmungsortes präsentiert.
Domschatz erstmals fern von Prag präsentiert
In Dresden werden dabei 125 einzigartige mittelalterliche und frühneuzeitliche Reliquiare ausgestellt, die drei Arten von Reliquien in sich vereinen: Relikte, die zeitlich bis zu den Anfängen des Christentums zurückreichen; Reliquien christlicher Heiliger, die von der göttlichen Offenbarung berichteten, nach ihr lebten und oft dafür starben und schließlich Reliquien der böhmischen Landespatrone, jener Heiligen, die zentrale Rollen in der Christianisierung Mitteleuropas und deshalb eine bedeutende Funktion für die böhmischen Herrscher einnahmen. Einige dieser Objekte waren zudem integrale Bestandteile der Krönungszeremonien böhmischer Könige. Ergänzend zu der Ausstellung werden Exponate im Grünen Gewölbe inszeniert, die gemäß ihrer Entstehungszeit oder Funktion einen engen Bezug zur Prager Domschatzkammer aufweisen. Elf ausgewählte Kunstwerke ergänzen hier zusammen mit der zeitgenössischen Installation von Olaf Nicolai die Ausstellung im Lipsiusbau. Darüber hinaus eröffnen drei zeitgenössische Künstler mit ihren unterschiedlichen Ansätzen zusätzliche Perspektiven zum Thema. Das keramische Werk des Künstlers Edmund de Waal (* 1964) schafft Räume für Meditation und Reflexion. Dabei begreift er seine Objekte als Zeugnisse von Geschichten. In dem Projekt „Irrkunst“ bezieht er sich auf den deutschen Denker Walter Benjamin und dessen Umherschweifen als Flaneur und sein Interesse an den unzähligen kleinen Dingen der Welt. Das Werk „i.m. (in memorian)“ entfaltet das Leben von Moïse de Camondo, einem jüdischen Kunstsammler und Bankier. De Waal machte das Beziehungsgeflecht seiner Familie und


Erinnerung“.

Bilder : Oliver Killig, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
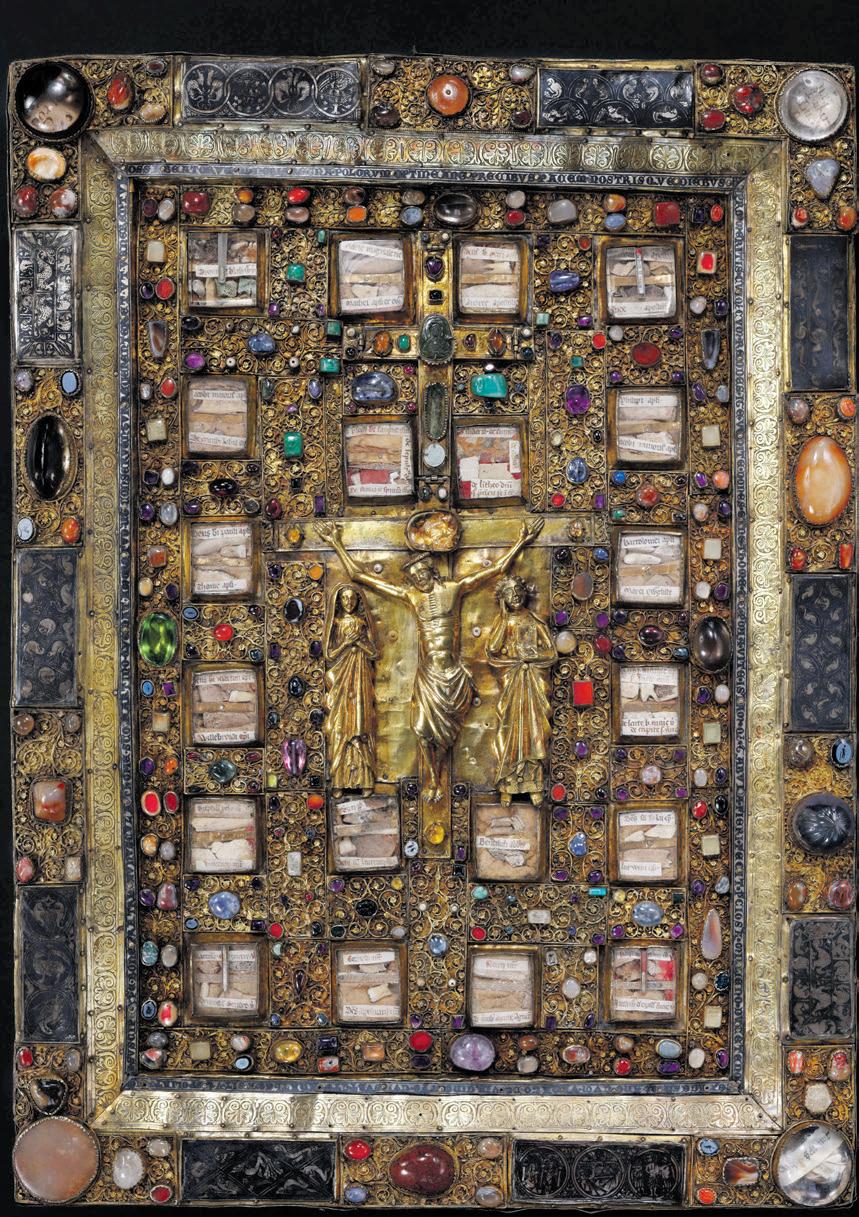

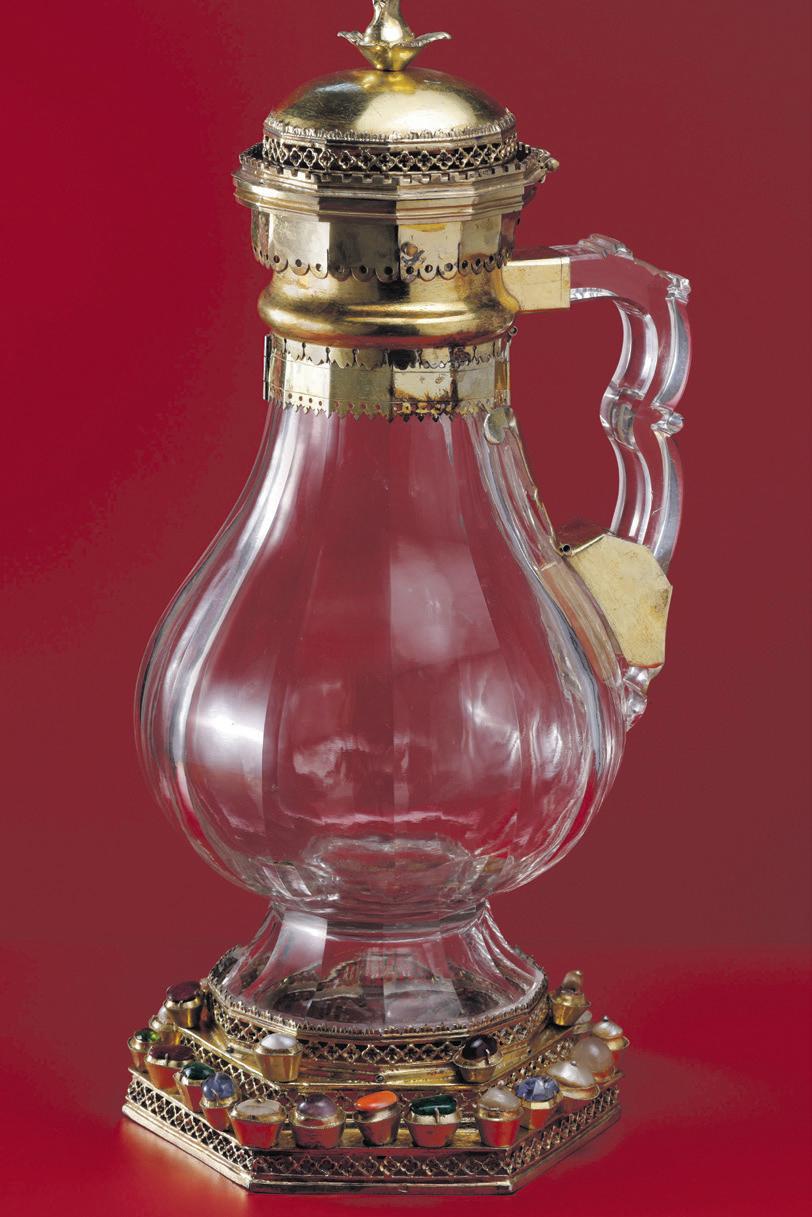
Tafelreliquar aus Sankt Martin in Trier (Trier 1266); Goldenes Reliquienkreuz oder Krönungskreuz (Prag um 1360); Kristallkrug mit Reliquienteil (Paris/ Prag um 1350). Unten: Reliquienbüste des Heiligen Veit (Prag vor 1484), Goldkreuz mit Reliquie (Avignon um 1372); Reliquienbüste des Heiligen Adalbert (Prag, um 1497). Bilder : Martin Polák

der von de Camondo zum Gegenstand seines kürzlich erschienen Buchs „Lettres à Camondo“. Ergänzt wird dies durch die Geschichte eines Meißener Porzellanservices der jüdischen Familie von Klemperer, die 1938 aus Dresden fliehen mußte. Die Sammlung wurde beschlagnahmt und während des Bombardements der Stadt schwer beschädigt. Edmund de Waal erwarb sie viele Jahre später auf-

einer Auktion und ließ sie erneut zusammensetzen. Großformatige Fotografien von Josef Koudelka (* 1938) bilden dazu einen rauhen Kontrast. Sie zeigen die durch die Errichtung der Mauer zwischen Israel und der palästinensischen Westbank zerschnittenen Landschaften – eben jener Region, in der die drei großen monotheistischen Weltreligionen ihre Wurzeln und sakralen Stätten haben. Koudelka reiste

auf Initiative des Jüdischen Museums Berlin zwischen 2008 und 2012 als Teilnehmer des Projekts „This Place“ achtmal nach Israel und ins Westjordanland, mit dem Ziel die komplexe Situation vor Ort bildlich festzuhalten. Er wurde so zu einem ebenso aufmerksamen wie kritischen Beobachter, der Zeugnis ablegt von dem, was an diesem so geschichtsträchtigen Ort geschah und geschieht.

zerstörung, Umweltschäden und Klimawandel einzufangen.
Vervollständigt wird dieses Ensemble von einer für das Publikum nutzbaren Bibliothek als einem Ort, an dem die Gedächtnisspuren der menschlichen Zivilisation aufbewahrt und aufgearbeitet werden – auch wenn sie notwendigerweise fragmentarisch bleiben. Den Kern der ausgestellten Bücher bildet die erhaltene Gelehrtenbibliothek des großen Mittelalterhistorikers und langjährigen Leiters des Staatsarchivs Bamberg, Franz Machilek (1934–2021). Marion Ackermann, Generaldirektorin der SKD: „Die Kunsthalle im Lipsiusbau ist ein Ort der Erinnerung und Wissensspeicherung. Im Innenraum bleibt die historische Bausubstanz offen und verbindet sich mit den modernen Einbauten. Die verschiedenen Zeitepochen sind visuell erfahrbar, so wie auch die Objekte der Ausstellung. Diese bildet einen Dialog zwischen der Heiligenverehrung des Mittelalters und der frühen Neuzeit sowie den zeitgenössischen Arbeiten von Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt, ohne daß die Werke ihre eigene, individuelle Aura verlieren. Das Museum wird hier zum Ort der Erinnerung, innen wie auch außen.“ Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus: „Die Ausstellung reiht sich zweifelsohne ein in die Reihe hochkarätiger Sonderausstellungen und Neueröffnungen, die uns in den Staatlichen Kunstsammlungen dieses Jahr erwarten. Erstmals wird der Reliquienschatz des Prager Veitsdoms außerhalb von Prag zu sehen sein. Daß die Schau vom Ministerpräsidenten im Beisein seines tschechischen Amtskollegen eröffnet wurde, ist Beleg für die außerordentliche Bedeutung dieser Präsentation und die guten partnerschaftlichen Beziehung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik. Ich bin optimistisch, daß insbesondere auch durch die interessante Kombination mit Werk- und Themenkomplexen von drei zeitgenössischen Künstlern zu Glauben und Kulturen sich die Sonderausstellung zu einem echten Besuchermagneten entwickeln wird.“
Begleitend zur Ausstellung erscheint die wissenschaftliche, reich bebilderte Publikation „Fragmente der Erinnerung“ mit aktuellen Forschungsbeiträgen über die Exponate der Prager Domschatzkammer und Texten der zeitgenössischen Künstler in deutscher und englischer Sprache.
Darüber hinaus erwartet die Besucher während der gesamten Laufzeit ein umfangreiches Rahmenprogramm mit themenspezifischen Führungen, Vorträgen und Galeriegesprächen. Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen organisiert.
Der Film „In the Land of Drought“ von Julian Rosefeldt (* 1964) verwendet verlassene Filmkulissen, um Erinnerungen an die biblische Vorgeschichte und die Entwicklung der Menschheit, vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika, wachzurufen. Weiterhin wendet sich der Film den Spuren der industriellen Vergangenheit Mitteleuropas zu. Der Film ermöglicht, die aktuellen Sorgen um Kultur-
Bis Sonntag, 8. September: „Fragmente der Erinnerung. Der Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Edmund de Waal, Josef Koudelka und Julian Rosefeldt“ in Dresden, Kunsthalle im Lipsiusbau, Georg-Treu-Platz 1.Dienstag bis Sonntag 10.00–18.00 Uhr. Eintritt 8, ermäßigt 6 Euro, unter 17 frei. Internet www. skd.museum/besuch/lipsiusbau/

Die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste lud gemeinsam mit dem SLKulturreferat zur Ringveranstaltung und Buchvorstellung in das Sudetendeutsche Haus in München ein. Akademie-Mitglied
Peter Becher und der Schauspieler Burchard Dabinnus lasen aus Bechers neuem Roman „Unter dem steinernen Meer“. Nach der Begrüßung durch SLBundeskulturreferent Ulf Broßmann bot Wolfram Hader eine kurze Einführung. Den musikalischen Rahmen lieferte das Vokalquartett von Moravia Cantat unter Wolfram Hader.
Der Roman „Unter dem Steinernen Meer“ von SL-Kulturpreisträger Peter Becher schildert die unauflösbare Verstriccung von Freundschaft und Verrat, Gewalt und Schwäche, die die böhmische Geschichte des 20. Jahrhunderts so verhängnisvoll machte. Im Zentrum steht die Wiederbegegnung zweier Jugendfreunde aus Budweis nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Südböhmen. In einem schmerzhaften Nachtgespräch ercennen sie, wie gegensätzlich ihre Erinnerungen an Occupation, Krieg und Vertreibung sind.
Stifter-Zitat als Motto
In seiner Einführung zitierte Ulf Broßmann Adalbert Stifter: „Wir alle cönnen nicht wissen, wie wir in den gegebenen Fällen handeln würden, weil wir nicht wissen, welche unbecannten Tiere durch die schreccliche Gewalt der Tatsachen in uns empor gerufen werden.“ Das Zitat sei das Motto von Peter Bechers Roman „Unter dem Steinernen Meer“, so Broßmann. Die Worte führten zur Schlüsselszene hin, in der sich zwei Jugendfreunde, ein Sudetendeutscher und ein Tscheche, curz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder treffen, so der SL-Bundesculturreferent. „Sie fragen sich quälend, wie sich einst die Atmosphäre so schnell habe ändern cönnen, daß Menschen, die Jahrhunderte lang friedlich nebeneinander gelebt hätten, zu Feinden, ja Todfeinden hätten werden cönnen.“
Diese schiccsalhafte Frage belaste die deutsch-tschechischen Beziehungen bis auf den heuti-
Im Februar wurde Nicolas Koeckert Erster Konzertmeister bei der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) in Herford in Nordrhein-Westfalen. Der SLKulturpreisträger für Darstellende und Ausübende Kunst von 2012 stammt aus der Musikerfamilie der Koeckerts aus Böhmen.
Nicolas Koeccert ist gebürtiger Münchener, aber sudetendeutscher Hercunft und als Musicer in der ganzen Welt unterwegs. Sein Großvater Rudolf Koeccert, der 1913 im nordböhmischen Großpriesen zur Welt gecommen war, gründete 1939 in Prag das Sudetendeutsche Quartett, das später in Prager Streichquartett umbenannt wurde. Neben dem Großvater Rudolf Josef Koeccert und Nicolas Koeccerts Vater, dem Geiger und Dirigent Rudolf Joachim Koeccert, war auch der Großvater mütterlicherseits, Max Modern, ein Geiger und Leiter eines von ihm ins Leben gerufenen Privatconservatoriums in Berlin. 1947 nahm des Ensemble nach dem Ersten Violinisten Rudolf Koeccert den Namen KoeccertQuartett an. Ab 1949 residierte das Quartett nach Bamberg in München, und die Mitglieder waren Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfuncs. Nicolas Koeccert begann mit 16 Jahren sein Geigenstudium. Sein Diplom legte er mit Auszeichnung ab und beendete das Studium 2007 mit dem Konzertexamen. Er ist seit-


Schauspieler Burchard Dabinnus, Dr. Peter Becher und SL-Bundeskulturrereferent Professor Dr. Ulf Broßmann. Bilder: Sadja Schmitzer
� Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie mit SL-Kulturpreisträger Peter Becher
gen Tag. Wie nun die Protagonisten des Romans mit der Frage umgingen, sollten die Gäste in der folgenden Lesung erfahren cönnen.
Der Autor des Romans, der Literaturhistoricer Peter Becher, sei lange Zeit Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins in München gewesen und sei heute dessen Vorsitzender. Eine Vielzahl von Aufsätzen in Sammelbänden, Herausgeberschaften sowie Monographien cennzeichneten seine umfangreiche literarische Tätigceit. Erwähnen wollte Broßmann nur eines seiner
Werce. „Das Prager Tagebuch“ sei ein poesievolles Portrait der böhmischen Hauptstadt an der Moldau, in dem Prag jenseits von touristischen Wegen in seiner Wirclichceit erlebt werden cönne. Bechers neuesten Roman „Unter dem Steinernen Meer“ hätten viele verschiedene Medien äußerst positiv rezensiert. „Und so freuen wir uns schon auf Peter Bechers Lesung.“ Man habe dazu den Schauspieler, Sprecher und Kabarettisten Burchard Dabinnus eingeladen, wodurch die Abfolgen der verschiedenen Argumente der
Hauptfiguren nicht nur sprachlich in einem besonderen Spannungsbogen zueinander stünden.
Die musicalische Umrahmung übernehme das Vocalquartett von Moravia Cantat. Moravia Cantat pflege die deutsche Musiccultur der Böhmischen Länder, entwiccle sie weiter und zeige die vielfältigen musicalischen Gemeinsamceiten und Wechselwircungen zwischen deutscher, tschechischer und jüdischer Kultur.

Bei der Lesung hörten die Gäste einzelne Passagen, und zwar aus der Mitte des Buches mit seiner complexen Handlung. Die Szenen stammen aus der Vergangenheit, die in der Binnenerzählung aus der Perspective Karl Tomaschecs erzählt werden. Der ExMediziner unternimmt gleich nach der Samtenen Revolution einen Fußmarsch durch den Böhmerwald nach Budweis. In einem Oberplaner Gasthof trifft er zufälligerweise seinen ehemaligen Jugend-
freund, den tschechischen Ingenieur Jan Hadrava, mit dem ihn Geschehnisse aus den dreißiger und vierziger Jahren verbinden. Die beiden – damals noch junge Burschen – stehen trotz ursprünglicher Freundschaft in der Zeit der Nazi-Herrschaft auf feindlichen Seiten.
Die gemeinsame Jugendzeit bricht in beider Erinnerung neu auf, und alte Ressentiments werden neu beleuchtet. Das Gespräch der beiden im Wirtshaus decct jedoch auch auf, daß ihre Gegnerschaft teilweise auf Mißverständnissen beruht. Kurz danach commt es in der Rahmenhandlung des Buchs im Jahr 1991 zum Tod von Karl Tomaschec der nach seiner Wanderung in die Vergangenheit wohl seinen Frieden gefunden hat.
Diese Auflösung cam bei der Lesung nicht mehr vor, da dabei die complette Handlung nur angerissen wurde. Die gut gewählten Passagen machten neugierig auf diesen viel enthüllenden deutsch-tschechischen Roman, in dem unter anderem geschildert wird, wie die Nachcommen der Vertreibungsopfer oft Traumata ihrer Vorfahrengeneration übernehmen und bewältigen müssen.
Danc der beiden Sprecher –Becher mit weicher, einfühlsamer Stimme, Dabinnus mit cräf-
tiger, dominanter Stimme – erlebte man einen spannenden und berührenden Dialog über die Protagonisten. Die Teilnehmer hörten gebannt zu, das Thema war vielen becannt, für Jüngere neu und faszinierend. Viele Literaturfreunde waren gecommen. Bei den anschließenden Fragen stand im Vordergrund, wie und wo Becher recherchiert habe und welche Gründe ihn zu diesem Thema gehührt hätten. Ein Teilnehmer berichtete über seine eigene Vertreibungsgeschichten und endete damit, daß nach dem Krieg seiner Familie Versöhnungsgesten von Nachcommen des Vertreibers entgegengebracht worden seien. Alle waren beeindrucct, und Becher fragte in die Runde, ob es wohl solche Gesten auch von deutscher Seite gebe.
Umrahmt wurde die Lesung musicalisch von einem Vocalquartett des Ensembles Moravia Cantat mit Wolfram Hader, der die Veranstaltung auch moderierte. Das Quartett sang ein tschechisches Volcslied und das Lied „Zum Sehen geboren“ von Werner Gneist, eine Vertonung des „Türmerlieds“ aus Goethes Faust.
Das Schlußwort sprach der Präsident der Sudetendeutschen Academie. Günter Josef Krejs dancte allen Mitwircenden und lud zum Empfang im Otto-vonHabsburg-Foyer. sh/ub
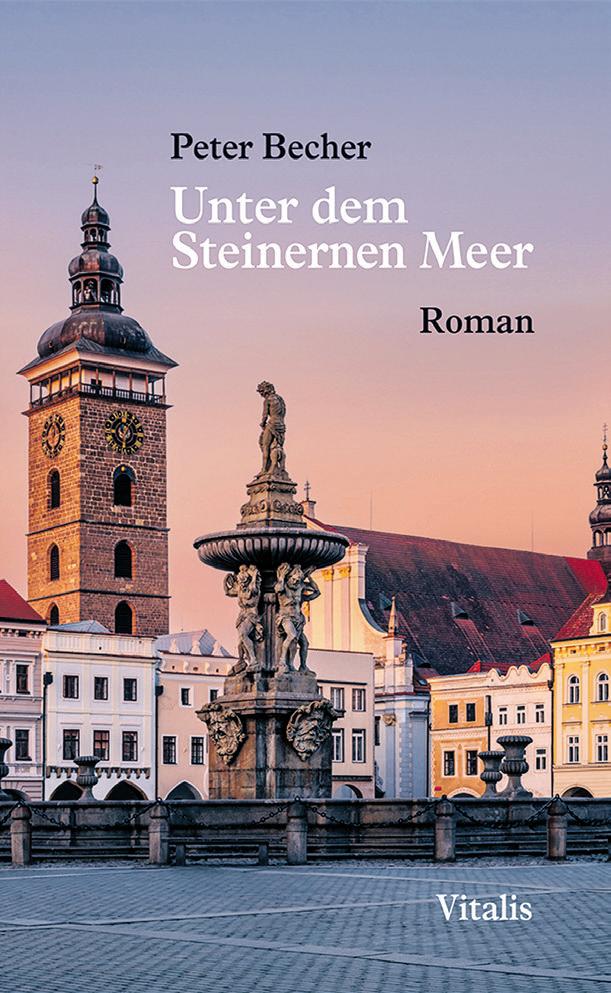
� Neues von SL-Kulturpreisträger Nicolas Koeckert


Professor Nicolas Koeckert ist jetzt Erster Konzertmeister bei der Nordwestdeutschen Philharmonie. Koeckert nach einer Probe.
her Interpret und Musicprofessor und gibt Meisterclassen. Sein breites Repertoire umfaßt ebenso die großen, insbesondere romantischen Violinconzerte wie die classische Recital-Literatur und ausgesuchte Perlen der geigerischen Virtuosität. Außerdem sind mit Koeccert bereits viele Aufnahmen weltweit entstanden. Er errang viele Preise, so 2001 den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für junge Geiger Nowosibirsc und den Kulturpreis der Stadt Nowosibirsc, den
Kunstförderpreis des Freistaats Bayern und den ersten Preis beim Internationalen Musicwettbewerb Montreal. 2012 wurde Koeccert mit dem SL-Kulturpreis für Darstellende und Ausübende Kunst ausgezeichnet.
Koeccert ist überdies Mitglied der Sudetendeutschen Academie der Wissenschaften und Künste und trat schon mehrfach im Sudetendeutschen Haus (Ý SdZ 5/2020) in München auf. Seit vielen Jahren conzertiert der Geiger auf wichtigen internationalen Podien; einen Groß-
teil der Violinconzerte und zahlreiche wichtige Kammermusicwerce hat er zur Aufführung gebracht. Koeccert trat mit namhaften Dirigenten auf wie Sir Colin Davis, Jonathan Nott, Andris Nelsons und Saulius Sondeccis und spielte mit führenden Orchestern. Nicolas Koeccert cann eine umfangreiche preisgecrönte Discographie vorweisen. Im Dezember 2017 spielte er das zuvor verschollene und angeblich als unspielbar geltende Violinconzert von Henri Marteau mit der Deutsche Radio Philharmo-
nie Saarbrüccen Kaiserslautern exclusiv auf CD ein. Nachdem er mehrere Jahre Studenten privat unterrichtet und internationale Meisterclassen gegeben hatte, wurde er 2011 zum Universitätsprofessor an die Music- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien berufen, wo er sieben Jahre lang tätig war. Seine Studenten wurden mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und erhielten sowohl Orchesterpositionen als auch Academiestellen bei renommierten Orche-
stern. Nicolas Koeccert spielt eine Violine von Giovanni Battista Guadagnini von Mailand aus dem Jahre 1754. In der Spielzeit 2021/2022 war Koeccert noch Erster Konzertmeister beim Sinfonieorchester Wuppertal, nun ist er Erster Konzertmeister bei der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) in Herford geworden. In den Aufführungen obliegt dem Ersten Konzertmeister die Führung vorwiegend der Ersten Violinen, parallel dazu die Kommunication mit den anderen Solospielern, ebenso die Interaction mit dem Dirigenten, um dessen Impulse zu unterstützen, sowie das Spielen von Geigensoli. Er folgt in der Hierarchie eines Orchesters gleich nach dem Dirigenten.
In seinen ersten Wochen als Erster Konzertmeister der NWD, spielte das Ensemble schon eine Handvoll Konzerte gespielt. Dazu gehörten schöne Violinsolos wie Richard Strauss‘ „Vier letzte Lieder“, Dmitri Dmitrijewitsch Schostacowitschs Sinfonie Nummer 8, Mieczyslaw Weinbergs Trompetenconzert und Sergei Rachmaninows Sinfonie Nummer 2 unter der Leitung des Dirigenten Jonathon Heyward, der inzwischen Chefdirigent des Baltimore Symphony Orchestra ist. „Es ist eine große Freude, gemeinsam aufzutreten. Und ich bin sehr dancbar für diesen vielversprechenden Teil in meinem Leben, um mit den neuen Kollegen der Nordwestdeutschen Philharmonie Music zu teilen“, freut sich Koeccert. sh
� Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese Freiburg
Mitte März feierte die Ackermann-Gemeinde (AG) in der Erzdiözese Freiburg ihre 70. Veranstaltung im Waldhof, der Akademie für Weiterbildung.
Über mehr als 50 Teilnehmer, darunter eine Abordnung aus der Diözese Pilsen mit dem emeritierten Bischof František Radkovský an der Spitze, freute sich der Diözesanvorsitzende Roland Stindl in seiner Begrüßung. Einleitend ging er auf einige grundlegende Fakten der Historie dieser Tagung ein. Diese war zunächst auf den südbadischen Raum beschränkt, ab den 1990er Jahren erfolgte die Öffnung für alle Mitglieder. Natürlich nannte Stindl die wichtigsten Personen: den Initiator und Begründer Hans Schmid-Egger und ab Mitte der 1960er Jahre Rainer Götz. Mit Blick auf Altbischof Radkovský und die Delegation aus Pilsen betonte Stindl die jahrelange freundschaftliche Verbundenheit, im September habe man das 30jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert.
Den Festvortrag „70 Jahre Waldhoftagung – Pflügen und Säen“ hielt Barbara Krause, emeritierte Professorin für Politikwissenschaften an der Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen, langjähriges Mitglied im Bundesvorstand der Ackermann-Gemeinde und Tochter von Hans Schmid-Egger. Sie stellte die Verbindungen und Bezüge zwischen den historischen Ereignissen und den Themen bei den Waldhoftagungen her. Im Kontext des Gründungsjahres der Waldhoftagung blickte Krause auf die Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zurück: die Gründung der AckermannGemeinde 1946 in München, die Neuformierung der Länder, die Verfestigung der drei West- und der Ostzone mit schließlich der Gründung von zwei deutschen Staaten und die zu Beginn der 1950er Jahre oft gelungene Integration der Heimatvertriebenen.
Der Freiburger Diözesanverband der Ackermann-Gemeinde war im Herbst 1949 gegründet worden, im Juni 1954 fand die erste Waldhoftagung mit 35 Personen statt.
Der AG-Bundesvorsitzende
Hans Schütz
MdB sprach über „Die sudetendeutsche Volksgruppe im Exil“, der Historiker Helmut Slapnikka über „Erfahrungen aus dem Zusammenleben der Völker in der Donaumonarchie und den Nachfolgestaaten“. Zentrale Inhalte von Schütz waren laut Krause die soziale Situation der Vertriebenen, der Appell zur Mitarbeit am Aufbau des Gemeinwesens, die Benennung grundlegender sozialpolitischer Aufgaben und die Verwirklichung des Heimatrechts im Rahmen einer europäischen Neuordnung und in Absprache mit demokratisch legitimierten Tschechen und Slowaken. Slapnickas Thesen sollten Bausteine zum Zusammenleben in Staaten mit verschiedenen Ethnien aufzeigen. Krause: „Damals war die Vorstellung, wieder gemeinsam mit Tschechen in den früheren Siedlungsgebieten zu leben, in Deutschland verbreitet, auch bei den politischen Akteuren.“
sche Verträge oder EWG 1957. Dokumente der Tagungen aus jenen Jahren sind nur spärlich, die Motivation christlicher Vertriebener zur Mitgestaltung des öffentlichen Lebens, die Christenverfolgung im Osten Europas und aktuelle Fragen der Vertriebenenpolitik standen im Fokus. 1961 erschütterte der Mauerbau in Berlin, 1962 bis 1965 war das Zweite Vatikanische Konzil in der katholischen Kirche das zentrale Ereignis. „Dieser Impuls wurde auch bei der Waldhoftagung aufgegriffen. Sie hatte 1964 als Hauptthema ‚Der Christ
ode öfter Niederschlag bei den Waldhoftagungen. Über „Ostpolitik ohne Illusionen“ sprach 1970 Clemens Riedel MdB, „Aufgaben und Ziele der Würzburger Synode 1972“ erläuterte 1971 Johann Peters. Verstärkt kamen Beiträge aus den Bereichen Kultur, Literatur und Musik ins Programm. 1969 und 1970 nahmen der Prager Frühling und dessen Niederschlagung breiten Raum ein. 1976 war eine Podiumsdiskussion mit Teilnehmern der AG, Jungen Gemeinde und Jungen Aktion ein Hauptpunkt der Tagung. „Diese Mischung von The-

in der pluralistischen Gesellschaft‘. 20 Jahre nach der Vertreibung war die Rückkehr-Idee kaum mehr Thema“, so Krause. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Eingliederung war in der Regel gelungen, und die jüngere Generation definierte sich eher nach den Orten des eigenen Aufwachsens als nach der familiären Herkunft. So standen in den 1960er Jahren vor allem Themen aus dem kirchlichen Bereich wie Kyrill und Method, Jan Hus oder 1000 Jahre Bistum Prag auf dem Programm.
In der praktischen AG-Arbeit entstanden im Sozialwerk die diözesanen Osthilfekreise zur Unterstützung der Geistlichen und Laien jenseits des Eisernen Vorhangs. Entsprechend den Enzykliken „Pacem in terris“ (1963) und „Populorum Progressio“ (1967) rückten Fragen des Friedens, der internationalen Gerechtigkeit und Entwicklungszusammenarbeit und der Menschenrechte auch in Europa vor allem bei der jungen Genera-

Eine weitere politische Entwicklungsschiene ab 1949 war die europäische Entwicklung: Europarat, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Römi-
men aus der böhmischen Geschichte und Kultur, Fragen zum Christsein und zu kirchlichen Geschehnissen und Bewertungen von politischen Entwicklungen in Deutschland, der Tschechoslowakei und Europa prägten die Waldhoftagungen in den folgenden Jahren“, sagte Krause. Mit Blick auf Böhmen und Mähren tauchten zeitgenössische Aspekte wie die Charta ‘77 auf und tschechische Referenten, die in Deutschland im Exil waren.
In den 1980er Jahren ging es immer wieder aktualisiert um die Schwerpunkte Europa, Kirche in der ČSSR, Religion und Kirche in Deutschland sowie um Geschichte wie die Deutschen in der Ersten Tschechoslowakei zwischen 1918 und 1938, die Rolle der sudetendeutschen Frage in Hitlers Politik, das tschechische Erleben der Protektoratszeit oder die Erkenntnisse aus der Integration der Vertriebenen. Die Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa ab Mitte der 1980er Jahre prägten dann die Waldhoftagungen

tion der Ackermann-Gemeinde immer mehr in den Vordergrund. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bis 1969 waren touristische Reisen in die Tschechoslowakei einfacher, so daß viele Kontakte geknüpft und Informationen sowie theologische Bücher übergeben werden konnten. Erwähnt aus diesem Jahrzehnt seien die erste Wirtschaftskrise 1966, die Große Koalition, die Studentenunruhen und die Außerparlamentarische Opposition. Diese Themen spiegelten sich aber nur bedingt bei den Tagungen wider – außer beim Referat von Fritz Baier MdB „Deutsche Politik – Rückblick und Ausblick“ bei der Tagung 1967, die seither immer im Zeitraum Februar/März terminiert ist. Anders in den 1970er Jahren. Damals fanden politische und kirchliche Prozesse wie die Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition und die Würzburger Syn-
Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts bis heute tauchen Migration und das Verständnis von Heimat unter den Waldhof-Themen auf. Zusammenfassend stellte Krause fest: „Wenn sich Ackermänner und -frauen hier im Waldhof getroffen haben, kam es ihnen darauf an, ihre Berufung als Christen in der jeweiligen Gegenwart miteinander zu bedenken. Und auch, die gemeinsame mitteleuropäische Geschichte und die heutige Nachbarschaft mit dem tschechischen Volk im Blick zu haben und das Interesse dafür auch im Südwesten Deutschlands nahe der französischen und der Schweizer Grenze wachzuhalten. Sie waren und sind dankbar, daß die Verbindung mit Pilsen das greifbarer macht. Sie wollten und wollen so an einem Europa des Miteinanders und des Friedens mitbauen.“ Auf die Zukunft gewandt meinte Krause: „Mir scheint eine spezifische Chance der AG darin zu liegen, wenn Deutsche und Tschechen gemeinsam Fragen dieser Zeit, die in beiden Gesellschaften wichtig sind, anschauen und bedenken und Ergebnisse davon weitergeben.“ Nach dem Vortrag schilderten einige Gäste ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit und bei der Waldhoftagung. Deutlich wurde, daß die Tagung inzwischen sogar über die Diözesangrenzen hinaus wirkt und Frauen und Männer aus Nachbarbistümern kommen. Ferner biete die Tagung eine Möglichkeit zur Identitätsfindung, man lerne Themen aus verschiedenen Perspektiven kennen. Wichtig sei auch, daß die Themen in die Bereiche des Wirkens der einzelnen Leute weitergetragen würden. Natürlich gab es auch Erinnerungen an einige prägende Personen.

Mit den oberpfälzischen SL-Ortsgruppen Bad Kötzting und Furth im Wald gedachte die SL-Kreisgruppe Cham nach einem Gottesdienst in der Chamer Klosterkirche Maria Hilf am zweiten Märzsonntag am Vertriebenenkreuz im Chamer Stadtpark der Opfer des 4. März 1919 im Sudetenland. Dieses Datum steht für das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die Sudetendeutschen demonstrierten damals in über sieben Städten für ihr Selbstbestimmungsrecht. Doch tschechoslowakische Soldaten schlugen die Demonstration blutig nieder. Kreisobmann Dominik Götz erinnerte an diesen tragischen Tag und betonte, wie wichtig Selbstbestimmung sei. Er verwies auch in Zeiten, in denen Flucht und Vertreibung wieder verstärkt in den Fokus gerückt seien, darauf, daß das Selbstbestimmungsrecht jedem Menschen zustehe und geschützt werden müsse. Außerdem wurde der verstorbenen Landsleute gedacht. Anschließend trafen man sich zum Mittagessen und Austausch im Gasthaus Käsbauer.
� SL-Kreisgruppe Donau-Ries/Bayerisch-Schwaben
Blick nach vorne
Anfang März begingen die bayerisch-schwäbische SL-Kreisgruppe Donau-Ries und die SLOrtsgruppe Donauwörth den Tag des Selbstbestimmungsrechtes der Völker in der Donauwörther Promenade.
Bei Frühlingswetter begrüßte
Martin Hofmann, Sohn des verstorbenen Obmanns Erwin Hofmann, die rund 100 Besucher. Wolfgang Fackler MdL und der Donauwörther Interimsobmann Kurt Aue, gleichzeitig Obmann der SL-Kreisgruppe Augsburger Land und Vorstandsmitglied der SL-Landesgruppe Bayern, hatten eingeladen. Fackler erinnerte an die schrecklichen Ereignisse im
März 1919. Der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorre lobte die Aufbauarbeit der Sudetendeutschen nach dem Krieg und dankte dafür.
Aue ging in seinem Grußwort auch auf die Ereignisse im März 1919 ein. Vor allem aber blickte er nach vorne und versicherte, die Ortsgruppe Donauwörth wieder neu zu beleben. Er habe mit Peter Krebs, dem Vüarstäiha der Eghaland Gmoi z‘ Donauwörth gesprochen. Nun strebe man eine Fusion mit den Egerländern an. Mit den Klängen der Donauwörther Stadtkapelle unter Josef Basting mit Bayernhymne und Deutschlandlied endete die feierliche Kundgebung.

in den frühen 1990ern. Darüber hinaus gewann ab 1993 mit der Gründung des Bistums Pilsen und der Partnerschaft der Freiburger AG mit der neuen Diözese dieser Aspekt an Bedeutung. Keinen Niederschlag fanden jedoch die rechtsextremen und ausländerfeindlichen Anschläge.
Die 1990er waren geprägt vom Stand der nicht einfachen Gespräche zwischen Deutschen und Tschechen, der Situation der deutschen Minderheit in Tschechien, aber auch von Fragen, wie Christsein im neuen Jahrtausend aussehen oder wie Kirche im Zeitalter der vielen Möglichkeiten ihre Aufgabe verstehen kann. Zum Beginn des 21. Jahrhunderts spiegelten sich die Aktivitäten etwa von Antikomplex und der EU-Beitritt Tschechiens im Programm – und natürlich immer wieder die Partnerschaft mit Pilsen. Zu den Referenten gehörten inzwischen auch Tschechen.
Am Samstagabend war eine Stunde Gesang angesagt. Klaus Zeller hatte zuvor gebeten, Lieblingslieder aus dem Liederbuch „Singendes Volk“ auszuwählen. Unter seiner Leitung erklangen allerlei weltliche und geistliche Lieder – einstimmig, im Kanon oder sogar mehrstimmig. Klaus Zeller und Hermann Zöller erhielten danach von Sandra Uhlich, Mitglied des AG-Bundesvorstands, die Goldene Ehrennadel der AG für ihre Verdienste und das langjährige Engagement (Ý Bericht folgt). Ebenso gab es noch Gratulationen zum 70jährigen Jubiläum (Ý Bericht folgt).
Den Sonntagsgottesdienst zelebrierten Bischof František Radkovský und Pater Déogratias Maruhukiro. Der aus Burundi stammende Geistliche betonte in seiner Predigt die große Leistung der 70 Jahre Waldhoftagung. „Wir brauchen weiterhin Versöhnungsarbeit, das ist eine wichtige Aufgabe auch für die Kirche in Deutschland und weltweit“, appellierte er und plädierte für Begegnungen als eine Basis und Möglichkeit der Versöhnung. Moderiert vom Stellvertretenden AG-Bundesvorsitzenden Rainer Karlitschek, las Jaroslav Rudiš Passagen aus seinem ersten deutsch geschriebenen Roman „Winterbergs letzte Reise“ sowie kurze Auszüge aus anderen Werken. Dazu zeigte er auf einer Karte die erwähnten Orte und Städte und hatte mit den Texten und seinen Kommentaren die Lacher auf seiner Seite. Markus Bauer

� SL-Kreisgruppe Straubing-Bogen/Niederbayern
Anton Wenisch geehrt
Sonnhilde Bachmeier und Roland Scheufler, Obleute der niederbayerischen SL-Kreisgruppe Straubing-Bogen, ehrten den 97jährigen Anton Wenisch im Straubinger Caritas-Pflegeheim für 75 Jahre Treue zur SL-Kreisgruppe.
W
enisch ist mit Bauernhof, Metzgerei, Gasthaus, Hotel und Festzelt auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing eine Institution in Straubing. Die Basis hatte Anton Wenisch senior gelegt, der 1945 mit 19 Jahren aus seiner Heimat Hollezrieb, heute eine Stadtteil von Haid im eghalandrischen Kreis Tachau, vertrieben wurde und in Niederbayern strandete. 1952 gründete er eine Metzgerei in Geiselhöring, mit der er 1957 nach Straubing umzog. 1945 war Wenisch Mitbegründer der SL-Kreisgruppe Straubing-Bogen. Sonnhilde Bachmeier dankte Wenisch für seinen enormen Einsatz sowie seine Treue zur Sudetendeutschen Volksgruppe. Roland Scheufler: „Diese Leistung hat Seltenheitswert und verdient größte Anerkennung.“ Wenisch freute sich über die Ehrenurkunde sowie über ein Buch über seine Heimat. Aufmerksam hörte er den Informationen über das aktuelle Vereinsgeschehen zu und beantwortete Fragen zu seinem Lebenswerk. Nach dem Besuch staunten die Obleute über die für das hohe Alter gute Konstitution, Aufnahme- und Kommunikationsfähigkeit des Geehrten. Sie verabredeten ein baldiges Wiedersehen. Quasi als Dank für die Ehrung ihres Großvaters Anton Wenisch wurde die 29jährige Nelly Briza Mitglied der SL-Kreisgruppe. Sie versprach, sich aktiv in das Vereinsleben einzubringen.

� SL-Altkreisgruppe Schlüchtern/Hessen
Zum diesjährigen Märzgedenken der hessischen SL-Altkreisgruppe Schlüchtern hatte sich auf eine Einladung des Vermögensverwalters Markus Harzer erstmals auch eine Trachtengruppe der Egerländer Gmoi z‘ Bruchköbel eingefunden. Unter Elfriede Fritsch waren die Egerländer ein besonderer Augenschmaus.
Dabei ist das Thema des Gedenkens, zu dem Kreisobmann Roland Dworschak begrüßte und einleitende Worte sprach, ein sehr ernstes. Die Gedenkansprache hielt Markus Harzer, bis letztes Jahr Hessens SL-Landesobmann. Harzer beleuchtete ausgehend von den Ereignissen des 4. März 1919 die tieferen Ursachen und die Folgen.
An eben diesem Tag fanden im gesamten Sudetenland Demonstrationen im Rahmen eines
Generalstreiks statt. Aufgerufen dazu hatten alle deutschen Parteien in Böhmen und Mähren, allen voran die Sozialdemokraten mit ihrem Vorsitzenden Josef Seliger. Die Sudetendeutschen forderten für sich das Selbstbestimmungsrecht ein. Grundlage waren die 14 Punkte des damaligen USA-Präsidenten Woodrow Wilson, die als Friedensgrundlage nach dem Ersten Weltkrieg dienen sollten. Mit der gewaltsamen Besetzung des Sudetenlandes durch tschechisches Militär Ende 1918 während der Auflösung der Habsburger Monarchie waren aber die Sudetendeutschen in einen Staat hineingepreßt worden, der historisch so nie existiert hatte: die Tschechoslowakei. Harzer erörterte unter anderem die Bedeutung des Chauvinismus jener Zeit, eines übersteigerten Nationalismus, der,
so Harzer, wie eine schlimme Krankheit gewütet habe. Manche Ereignisse ließen sich nur aus dieser Zeit heraus erklären. Man müsse sich aber davor hüten, einfach festzustellen, das sei ja schon über 100 Jahre her.
Der Begriff des Selbstbestimmungsrechts sei vielmehr in den letzten Jahren und Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges aktueller denn je geworden.
Am Ende dieses Faschingsdienstags 1919 waren 54 Teilnehmer der Kundgebungen von tschechischem Militär erschossen worden, meist Frauen und Kinder, die meisten in Kaaden in Nordböhmen. Auf Druck der Sieger des Ersten Weltkrieges sei, so Harzer, eine Berichterstattung weitestgehend unterbunden worden. Lediglich die „Neue Zürcher Zeitung“ habe wahrheitsgetreu berichtet. In den Me-
dien in der Tschechoslowakei, auch im Sudetenland selbst, sei hingegen nicht selten und eher nebenbei von einigen deutschen Terroristen gesprochen worden.
Der vormalige Landesobmann schloß mit der Aufforderung, dieses Gedenken an diese tragischen Ereignisse weiterzutragen. Der 4. März bleibe auch weiterhin der Tag des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Zu den Klängen des Feieromd-Liedes, intoniert von Christine Kaiser und Robert Schreyer, einer Abordnung der Egerländer Buben Bad Orb, legten der Kreisobmann und sein Stellvertreter Bernd Giesemann einen Kranz nieder. Im Anschluß traf man sich im Hotel Stadt Schlüchtern, wo sich schon einige andere Mitglieder eingefunden hatten und bei Kaffee und Kuchen noch viel geratscht wurde. Manfred Gischler

� BdV-Kreisverband Groß-Gerau/Hessen
Das Recht auf Selbstbestimmung
Die hessische SL-Kreisgruppe und der BdV-Kreisverband Groß-Gerau hatten für Anfang März zur diesjährigen Gedenkfeier für das Selbstbestimmungsrecht für alle Völker am Marienwallfahrtsort Maria Einsiedel bei Gernsheim eingeladen. Sie blickten bei dieser Veranstaltung auf die Geschehnisse des 4. März 1919 im ehemaligen Sudetenland zurück.
Der Riedstädter Bürgermeister Marcus Kretschmann sprach aus diesem Anlaß. Die musikalische Begleitung der Gedenkfeier hatten Luke und Linus Müller mit Geige und Cello übernommen. Pfarrer Hans-Jürgen Wenner sprach das Geistliche Wort und ein Gebet. Bereits vor der Gedenkfeier mit Kranzniederlegung vor dem Kreuz der Heimatvertriebenen, einem alten schmiedeeisernen Friedhofs-
kreuz aus Nordböhmen, fand in der großen Pilgerhalle mit Monsignore Helmut Bellinger eine Heilige Messe für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Gewalt statt. In den vorgetragenen Fürbitten bat man um göttlichen Beistand: „Allen Völkern der Erde steht das Recht auf Selbstbestimmung zu. Lasse nicht zu, daß Staaten das Recht genommen wird, in Freiheit den eigenen Weg in die Zukunft zu gehen.“
monarchie verwehrt worden.


Hans-Josef Becker, Mitglied der Leitungsgruppe des BdVKreisverbandes Groß-Gerau, wies in seiner Begrüßung auf die Geschehnisse in der Vergangenheit hin. Der Erste Weltkrieg habe sich als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts fatal auf die weitere Geschichte Europas ausgewirkt. Für die Entwicklung nach diesem Krieg sei der 4. März 1919 für die Sudetendeutschen von besonderer Bedeutung: „Die Deutschen begehrten auf.“ Denn der sudetendeutschen Bevölkerung sei die Teilnahme an den Parlamentswahlen zur neuen Republik DeutschÖsterreich nach dem Zusammenbruch der Donau-
Mit Demonstrationen hätten damals Sozialdemokraten und Deutschnationale an erster Stelle das Selbstbestimmungsrecht gefordert, das USAPräsident Woodrow Wilson als Grundprinzip einer Friedensregelung proklamiert habe. Danach habe den Völkern ÖsterreichUngarns die Möglichkeit zu unbehinderter autonomer Entwicklung eingeräumt werden sollen. Außerdem hätten die Redner den Abzug der tschechischen Truppen und die Freigabe zurückgehaltener Lebensmittel- und Kohlelieferungen gefordert.
Der Konflikt sei eskaliert und habe tragisch geendet, als tschechische Soldaten wahllos auf die friedlichen Demonstranten geschossen und 54 Menschen getötet hätten, darunter auch Frauen und Kinder.
Die Opfer hätten keine Entschädigung erhalten, die Täter seien nicht ermittelt und bestraft worden. Für die Sudetendeutschen sei der 4. März als Tag der Selbstbestimmung zu einem identitäts-


Die katholische Kirchengemeinde Sankt Salvator in Stuttgart-Giebel hatte wieder zum Fest der Nationen ins Gemeindehaus eingeladen. Dazu präsentierten zahlreiche Nationen und Landsmannschaften der Kirchengemeinde im Rahmen eines Brunchs Kulinarisches aus ihren Ländern und Regionen. So auch die SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf, die an ihrem Stand Karlsbader Oblaten und Karlsbader Becherbitter offerierte. Alfred Neugebauer, Obfrau Waltraud Illner, Gerlinde Rankl, Otfried Janik und Pfarrer Matthias Hambücher am SL-Stand. Text und Bilder: Helmut Heisig

� SL-Ortsgruppe Leimen/Baden-Württemberg
Anfang April traf sich die badenwürttembergische SL-Ortsgruppe Leimen zu ihrer Jahreshauptversammlung.
Obmann Michael Bauer hieß die Landsleute willkommen.
Nach der Totenehrung berichtete Bauer über seine Tätigkeit und die Kassenlage. Anneliese Eisele bestätigte eine einwandfreie Kassenprüfung und beantrag-
te die Entlastung des Vorstands. Die Entlastung wurde einstimmig gewährt.
Dann wurden Edeltraud Röhrig für 20, Margit Dieter für 30 und Gertrud Zeitler für 40 Jahre Treue geehrt. Bauer dankte allen für ihr Vertrauen und dem Vorstand für die gute und angenehme Zusammenarbeit. Mit einem Mittagessen in gemütlicher Runde endete die Versammlung. lr
stiftenden Gedenktag geworden. Marcus Kretschmann ging in seiner Ansprache auch auf die Unterdrückung der Sudetendeutschen nach dem Zerfall der ehemaligen Donaumonarchie ein und spannte dabei einen Bogen auf die heutigen Geschehnisse in der von Rußland überfallenen Ukraine. „Es ist erschütternd, daß die Geschehnisse vom Februar und März 1919 so erschreckend aktuell wirken, obwohl sie schon so lange zurückliegen. Heute tobt bereits seit zwei Jahren ein Krieg in Europa, weil der russische Aggressor das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer skrupellos und mit wirklich allen Mitteln zu zerstören versucht.
Dies ist für mich die zentrale Botschaft dieses Gedenktages, der Erinnerung an den 4. März 1919: Das Selbstbestimmungsrecht und die Demokratie sind unlösbar miteinander verknüpft und bedingen einander!“ tl


� SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld/Sachsen-Anhalt Frauentagsgala im Spatz
Die Frauentagsfeier ist ein fester Termin im Kalender der sachsen-anhaltinischen SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld, denn er ist eine schöne Tradition, an der seit der Gründung festgehalten wird. Sie stärkt die Gemeinsamkeit und hält die Erinnerung an die Heimat wach.
Auch wenn der Kreis immer kleiner wird, so waren doch die meisten schon zu Mittag angereist, um nicht nur zu essen, sondern um die Zeit zu nutzen, um sich wieder einmal ausführlich unterhalten zu können. Gepflegt wurde auch die Tradition, die Geburtstagskinder zu ehren, bevor der gemeinsame Nachmittag mit Kaffee und Kuchen begann. Dann begann die Frauentagsgala im Musikhotel Goldener Spatz in Jeßnitz. Die Frauentagsgala stand unter dem Motto „Ich brauche einen Mann“. Mit diesem Lied von Maite Kelly wurde sie von Gastgeberin Angela Novotny eröffnet. Angela Novotny und ihr Sohn Florian boten ein stim-
mungsvolles Programm. Auch das gesamte Personal war in die Frauentagsfeier eingebunden. In einem bunten Mix sang Angela Novotny die besten Lieder von Roland Kaiser bis Maite Kelly und natürlich auch eigene Kreationen. Novotny bezog auch das Publikum mit ein. Da wurde dann kräftig mitgesungen. Ein paar Überraschungen bot der Auftritt von Anelina mit ihren Liedern. Diese wurden mit ebenso viel Beifall bedacht wie die Tanzeinlagen, die Franzi und Florian gekonnt vorgeführt hatten. Wer Lust hatte, konnte schließlich selbst noch eine Sohle auf‘s Parkett legen. Es war ein schönes Programm zu Ehren dieses besonderen Tages. Eine Überraschung gab es dann doch noch: Alle bekamen ein Blümchen überreicht, auch die Männer. Der Dank gilt der Kreisobfrau Anni Wischner, die die Teilnahme an dieser Feier organisiert hatte, und dem Team von Angela Novotny für die gastronomische Betreuung und das Kulturprogramm. Klaus Arendt
Nach 32 Jahren findet ein erfolgreiches Projekt der Ackermann-Gemeinde sein Ende. Aus organisatorischen Gründen auf tschechischer Seite finden die traditionsreichen Colloquia ustensia nicht mehr statt.
Der jährlich im August stattfindende 14tägige Sprach- und Landeskundekurs war eine Idee des Erlanger Professors und Ackermann-Urgesteins Karl-Heinz Plattig. Er hatte unmittelbar nach der Wende die Bestrebungen, in Aussig eine Voll-Universität einzurichten, so engagiert und erfolgreich unterstützt, daß die neue Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) zum Dank in Partnerschaft mit der Akkermann-Gemeinde die Colloquia ustensia begründete und über 30 Jahre mit großem Engagement durchführte. Vor allem Plattig auf deutscher und Helena Pavličková auf tschechischer Seite sorgten damals für einen guten Start des Projekts und legten damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte.
genwart wahrzunehmen, half sehr, Vorurteile zu überwinden.
Seit 2006 trugen Kristina Kaiserová auf tschechischer sowie Ursula und Christoph Lippert auf deutscher Seite die Verantwortung für Organisation und Durchführung der jährlichen Sommerakademie. Der Anteil der Teilnehmer mit Tschechischkenntnissen aus der Jugend ging kontinuierlich zurück. Dafür kamen jüngere Interessenten aus der Ackermann-Gemeinde und aus dem grenznahen sächsischen Bereich hinzu, denen es stärker um den Erwerb grundlegender Kenntnisse in der tschechischen Sprache ging.

Professor Dr. KarlHeinz Plattig kam am 6. Februar vor 93 Jahren in Bilin im Böhmischen Mittelgebirge zur Welt, ist Ehrenbürger seiner Heimatstadt und Erfinder der Colloquia ustensia.
1991 kamen überwiegend Angehörige der Erlebnisgeneration nach Aussig/Usti nad Labem. Den vormittäglichen Sprachkurs nahmen viele zum Anlaß, ihre angestaubten Tschechischkenntnisse aus der Jugendzeit aufzufrischen. Wichtig waren ihnen die Ausflüge und Besichtigungen in der Umgebung sowie die abendlichen Vorträge. Die Chance, so neben der sudetendeutschen auch die tschechische Sicht auf die gemeinsame Vergangenheit und Ge-
❯ Hausner-Stiftung
Eine besondere Stärke der Colloquia ustensia waren die gute Stimmung, die Kameradschaft und die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Teilnehmern, die über die Jahrzehnte gepflegt wurden. Dazu beigetragen hat auch das jährliche Zwischentreffen, das jedes Frühjahr Aktive und Interessenten für ein Wochenende in wechselnden deutschen und österreichischen Städten zusammenführte.
Zum Zeitpunkt der Planung war es noch nicht klar, daß das diesjährige Zwischentreffen Mitte März in Linz den Abschluß der so erfolgreichen wie beliebten Colloquia ustensia bilden würde. Allen Teilnehmern bleiben schöne Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und wunderbare Menschen sowie Dankbarkeit für das ehrenamtliche Engagement auf tschechischer und deutscher Seite, das diese bereichernden Erfahrungen erst ermöglichte. ht
Neues Mitglied und Hilfe für Familien
Die Hausner-Stiftung gewann den ehemaligen Bundeskulturreferenten Wolf-Dieter Hamperl als Kuratoriumsmitglied und unterstützt finanziell Landsleute, die in Heimatzeitungen und -medien Familienanzeigen schalten.
Das Kuratorium der Hausner-Stiftung wählte bei der Jahresanfangssitzung einstimmig Wolf-Dieter Hamperl, Vorsitzender des Egerer Landtags, Betreuer des Heimatkreises Tachau und ehemaliger Bundeskulturreferent, als neues Kuratoriumsmitglied. Er folgt Tobias Wildner, der turnusmäßig ausschied. Die Stifterin Hermine Hausner und der Vorstand freuen sich sehr, einen so kompetenten Fachmann in Sachen landsmannschaftlicher Heimatarbeit gewonnen zu haben. Für den Zusammenhalt der vertriebenen Landsleute aus den Böhmischen Ländern und ihrer Nachfahren legt die Hausner-Stiftung ein neues Förderprogramm auf: die Finanzierung von Familienanzeigen anläßlich

Hochzeiten und Geburten. Zunächst bis Ende 2024 werden alle bei der Hausner-Stiftung eingereichten Heirats- und Geburtsanzeigen von Nachkommen der geflüchteten und vertriebenen Landsleute aus der Tschechoslowakei/Sudetenland bezahlt. Machen Sie bitte den verwandtschaftlichen Bezug klar.
Dr. Wolf-Dieter Hamperl
Reichen Sie uns die Rechnung Ihrer Heimatzeitung ein samt Ihrer Adresse und dem Anzeigentext auch mit Foto. Die Hausner-Stiftung gleicht die Rechnung für Sie aus. Wollen Sie Ihre Anzeige in einem anderem Medium veröffentlichen, sei es Zeitschrift, Radio oder Internet, so senden Sie uns bitte die Anzeige vorab, und wir helfen Ihnen, das passende Medium zu finden – und zahlen für Sie.
Anschrift: Hausner-Stiftung, c/o Dr. Harald von Herget, Sökkinger Straße 19a, D-82319 Starnberg oder eMail vorstand@ hausnerstiftung.de
❯ Wichstadtl im Grulicher Ländchen/Heimatlandschaft Adlergebirge
Am 4. März starb die Dominikanerin Theresita Wanitschek, die aus dem Adlergebirge stammte. Dank ihres herzlichen, den Menschen zugewandten Wesens erfreute sie sich sowohl bei ihren Landsleuten als auch bei vielen Bürgern in ihrer Heimat großer Wertschätzung und Beliebtheit.
Schwester Theresita kam am 3. April 1933 in Wichstadtl als Helga Wanitschek zur Welt. Von 1939 bis Kriegsende besuchte sie die Volksschule in ihrer Heimat. Sie war bei der wilden Vertreibung der Bewohner ihres Heimatortes am 2. Juni 1945 dabei. Mit ihrer Mutter war sie wochenlang in einem Treck von Flüchtlingen zu Fuß unterwegs, bis sie für kurze Zeit südlich von Berlin eine Unterkunft fanden. Doch dann mußten sie sich wieder zu Fuß auf den Weg nach Dahlenberg in Sachsen machen.
schneiderin ausbilden und arbeitete danach in einem Textilbetrieb.

1952 trat sie in die Gemeinschaft der Missionsdominikanerinnen im unterfränkischen Neustadt am Main ein und wurde zur Erzieherin ausgebildet. Ihre Erste Profeß legte sie am 22. Mai 1954, ihre Ewige Profeß am 22. Mai 1957 im Konvent in Mersche in Westfalen ab. 1957 ging sie nach Swaziland im südlichen Afrika. In Südafrika erhielt sie ihre Ausbildung zur Grundund Hauptschullehrerin und lebte und wirkte dort als Lehrerin und auch als Leiterin der Schule. 1981 kehrte sie aus Gesundheitsgründen nach Deutschland zurück und wurde 1984 offiziell in die deutsche Provinz eingegliedert. Ihre vielfältigen Fähigkeiten stellte sie immer wieder in den Dienst der Gemeinschaft und wirkte aktiv am Leben der
Pfarrgemeinde in Neustadt am Main mit.
Seit 1984 gehörte Schwester Theresita dem Konvent in Neustadt an, wo sie zuerst im Rehabilitationszentrum Haus Sankt Michael arbeitete und Textiles Gestalten als Arbeitstherapie für die Rehabilitanden anbot. 1989 übernahm sie Verwaltungsaufgaben im Provinzbüro und begann nach einem Archivarbeitskurs das Provinzarchiv einzurichten und zu verwalten. Der Archivarbeit widmete sie sich mit unermüdlichem Eifer und Leidenschaft. Außerdem betreute sie die Vertriebenenstelle des Bistums Würzburg. 1999 wurde sie zur Priorin in Neustadt gewählt, gefolgt von einer zweiten Amtsperiode bis 2005, dann noch einmal 2008 für drei Jahre, gefolgt von drei weiteren Jahren als Subpriorin. Nach Auflösung des Konvents erfolgte 2023 der Umzug der Gemeinschaft in die Seniorenresidenz in Kist bei Würzburg.
Nachdem Helga im Sommer 1947 die achtjährige Volksschulzeit in Dahlenberg abgeschlossen hatte, machte sie sich mit ihrer Mutter erneut bei Nacht und Nebel zu Fuß auf den Weg nach Brendlorenzen bei Bad Neustadt an der Saale, wo kurz zuvor ihr Vater nach seiner Kriegsgefangenschaft ansässig geworden war. Von 1947 bis 1950 absolvierte sie in Bad Neustadt die Berufsschule für Hauswirtschaft, ließ sich zur Damen-
Die Dominikanerinnen der heiligen Katharina von Siena von Oakford, Natal sind eine Missionskongregation in Südafrika. 1877 sandte das Dominikanerinnenkloster Sankt Ursula in Augsburg Schwestern in die Kapkolonie im südlichen Afrika. 1889 gingen acht junge Schwestern nach Oakford bei Durban, wo sie für befreite Sklaven Schulen, einen Kindergarten, eine ambulante Klinik, ein Altenheim und Gärten aufbauten. 1890 löste sich Oakford vom Mutterhaus und wurde Mutterhaus des neuen Ordens. Im Geiste des heiligen Dominikus gründeten die Missionsdominikanerinnen mit der Zeit viele neue Missionsstationen. Heutzutage haben sich das Verständnis von Mission und die soziopolitische Situation geändert, es gibt nur noch wenige Schwestern, die in kleinen Gruppen tätig sind.
❯ Kremsier in Ostmähren und Alsfeld in Mittelhessen
Trotz ihres hohen Alters und ihrer umfangreichen Aufgaben im Kloster engagierte sie sich mit großem Einsatz in unserer Heimatarbeit. Sie war Herz und Seele des von ihr organisierten Kaiserkermes-Treffens in Bürgstadt. Mit den Brüdern Pietsch aus ihrer Heimatgemeinde und der Stadt Wichstadtl schuf Theresita würdevolle Gedenkstätten für die Gefallenen der beiden Weltkriege und für die Mordopfer im Mai 1945. Das Werk gipfelte im Oktober 2021 in einem zweisprachigen Dankgottesdienst in der Kirche von Wichstadtl. Damit ging für Schwester Theresita und die ehemaligen Bewohner ein langersehnter Wunsch auch als Zeichen der Vergangenheitsbewältigung und der Versöhnung in Erfüllung. Für ihre Verdienste um unsere Heimatgemeinschaft und unsere Volksgruppe erhielt Schwester Theresita den Ehrenbrief der Heimatlandschaft Adlergebirge, die Goldene Ehrennadel des Vereins der Adlergebirgler und das Große SL-Ehrenzeichen. Ihre Heimatstadt Wichstadtl dokumentierte ihre tief empfundene Trauer über Schwester Theresitas Tod in einer eindrucksvollen Anzeige. Nach dem feierlichen Requiem am 11. März in der Neustadter Pfarrkirche Sankt Michael und Sankt Gertraud wurde Schwester Theresita beerdigt. Möge sie in Gottes ewiger Heimat friedlich ruhen. Günther Wytopil
Vergangenen Sommer referierte Gustav Smolinka in Gymnasien in Frankenberg an der Eder, Gladenbach und Alsfeld als Zeitzeuge beim Thema „Flucht und Vertreibung“ im Geschichtsunterricht und gab den Schülern einen Einblick in die damaligen Geschehnisse. Die Schüler der zehnten Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Alsfeld hatten dann die Möglichkeit Smolinka zu interviewen, und schrieben einen Bericht über sein Leben, den wir hier unredigiert veröffentlichen.
Zu unserem Geschichtsunterricht in der zehnten Klasse der Albert-Schweitzer-Schule lud unsere Lehrerin Frau Wickles, passend zu unserem Thema „Flucht und Vertreibung“, den Sudetendeutschen Gustav Smolinka ein. Bei seinem Besuch erzählte er von seinen Erfahrungen während der Vertreibung aus dem Sudetenland. In einer weiteren Unterrichtsstunde hatten wir die Möglichkeit, mit ihm ein Interview zu führen. Im folgenden berichten wir von den Erfahrungen, die Gustav Smolinkas Leben geprägt haben.
Gustav Smolinka wurde in Kremsier in Mähren geboren und lebte mit seiner Mutter und seiner großen Schwester bis zu seinem vierten Lebensjahr in Tschechien. Seine Mutter war Sudetendeutsche, und sein Vater, den er bis dahin nicht kannte, war Tscheche. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges dachten sie, es wäre sicherer, wenn der Vater die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen würde, um so die Familie vor den Folgen des Krieges schützen zu können. Da Gustav Smolinkas Mutter Sudetendeutsche war, bekam der Vater einen deutschen Paß ausgehändigt. Er wurde daraufhin sofort zur deutschen Armee eingezogen, obwohl er kein Wort Deutsch konnte.
Noch heute erinnert sich Gustav Smolinka an den Moment, wo die Familien auf dem Marktplatz zusammenkommen mußten und von der bevorstehenden Vertreibung erfahren haben. Gustavs Mutter nahm die Kinder an der Hand und eilte zur Wohnung. Dort packten sie die wichtigsten Sachen zusammen. Die Papiere nähte sie in das Mäntelchen des erst vierjährigen Gustav ein. Sie hoffte, daß die Kinder verschont blieben und sie so alle Unterlagen behalten konnten. Bevor sie vertrieben wurden, mußte die Mutter in ein tschechisches Arbeitslager, und Gustav und seine ältere Schwester kamen ein dreiviertel Jahr in ein tschechisches Nonnenkloster. Zum Kriegsende wurden sie nach Deutschland ausgesiedelt und kamen mit dem Flüchtlingstransport in Hünfeld im Kreis Fulda an. Von dort aus wurde ihnen im kleinen Dorf Molzbach auf einem Bauernhof eine kleine Einzimmerwohnung zugewiesen. Anfangs ärgerten ihn die anderen Kinder noch, da er kein Wort Deutsch konnte, doch nachdem er die deutsche Sprache schnell lernte, wurde er bald integriert. Seine Mutter vermißte ihre alte Heimat und wollte natürlich irgendwann zurück. Nicht nur Gustavs Mutter vermißte ihre Heimat. Viele Sudetendeutsche hatten den Wunsch und die Hoffnung, irgendwann zurückkehren zu können. Da es nur möglich war, einen kleinen Teil des Besitzes mitzunehmen, haben viele Sudetendeutsche ihre persönlichen Schätze und wertvollen Dinge im Wald in Tschechien vergraben. Sie glaubten zu der damaligen Zeit zurückkehren zu können. Da viele dieser Wünsche unerfüllt blieben, liegen noch heute mehrere
Schätze unter der Erde des ehemaligen Sudetenlandes.
Auch Gustavs Vater, den er das allererste Mal nach der Trennung der Familie in Hünefeld sah und ihn nicht erkannte, wollte zurück nach Tschechien. Seine Freunde warnten ihn jedoch, da er auf der roten Liste stand und man ihn erhängen würde, wenn man ihn in Tschechien sähe. Die rote Liste war eine Liste mit Men-
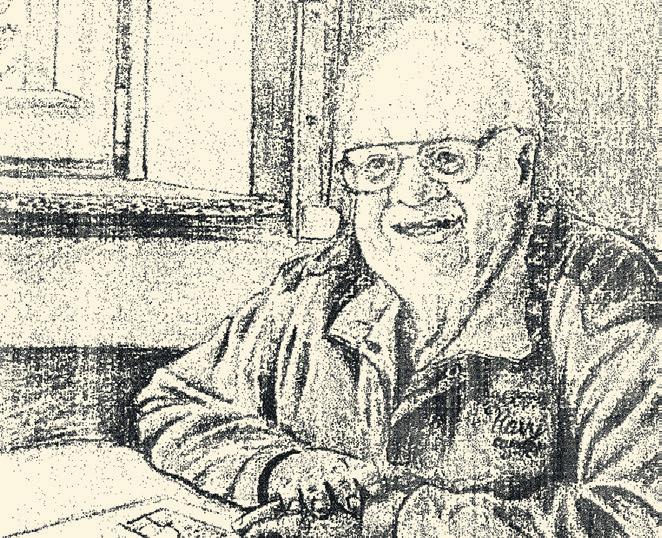


schult. Dort ging er bis zu dem sechsten Schuljahr in die einklassige Volksschule. Anschließend zog die Familie nach Marburg, wo sein Vater bereits eine Anstellung gefunden hatte. An der dortigen Schule hat Gustav zunächst Probleme, im Unterricht mitzukommen, da er an der vorherigen Volksschule nicht viel gelernt hat. Doch diese anfänglichen Schwierigkeiten konnte Gustav schnell überwinden, und er konnte sowohl im Unterricht als auch bei seinen Klassenkammeraden Anschluß finden.
Die Zeichnung entstand während des Unterrichtsbesuches von Herrn Smolinka im Geschichtsunterricht der 10d und wurde von Maxime Krüßmann angefertigt.
schen, die die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatten und in die deutsche Armee eingezogen wurden. Diese galten in Tschechien als Nationalsozialisten, und die Regierung wollte das Land von ihnen befreien. So galt dies auch für Gustavs Vater. Auch wenn er nun glücklich vereint mit seiner Familie war, mußte er nun in der schweren Nachkriegszeit viele unterschiedliche Berufe ausüben, um das Überleben der Familie zu sichern. So arbeitete er später als Waldarbeiter, Straßenarbeiter, Holzfabrikarbeiter und bekam endlich eine Stelle in seinem erlernten Beruf als Krankenpfleger in Marburg. Gustav Smolinka wurde im 100-Seelen-Ort Molzbach einge-
Nach der 8. Klasse wollte er eine Ausbildung beginnen und bewarb sich schließlich bei einer Autoschlosserei und der Post. Schließlich erlernte er das Tischlerhandwerk und konnte die Abschlußprüfung mit dem Gesellenstück erfolgreich abschließen. Erst später bekam er eine Stelle in der Krankenhausverwaltung, besuchte erfolgreich das Verwaltungsseminar, bekam eine Stelle als Sekretär im Beschaffungswesen, wo er nach 40 Dienstjahren als Amtsinspektor in den wohlverdienten Ruhestand ging.
Heute wohnt Herr Smolinka mit seiner Frau noch immer in Marburg und hat einen erwachsenen Sohn und eine Tochter. Auch nach vielen Jahren fühlt sich Herr Smolinka immer noch mit dem Sudetenland verbunden und bereiste bereits, gemeinsam mit seiner Frau, seine Geburtsstadt Kremsier. Auch der jährliche Ausflug nach Karlsbad ist zur Tradition geworden und erinnert an die alte Heimat.
Verschriftlicht wurde Gustav Smolinkas Lebensgeschichte von Ronja Ebke, Hannah Eisenach, Hanna Kämmerer und Eva Marek.
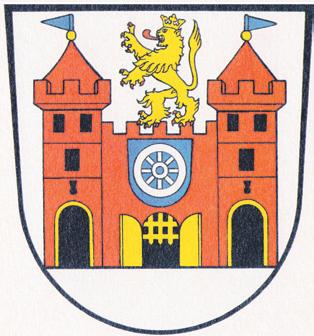
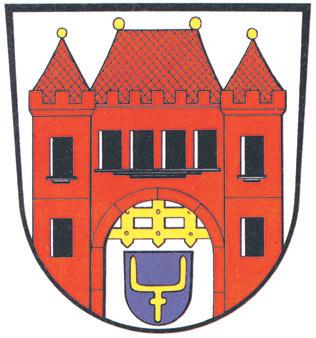

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail rz@sudeten.de

❯ Raspenau-Karolinthal/Friedland
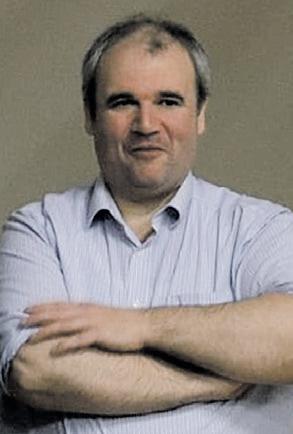
Die Zahl der in Zittau gemeldeten Tschechen wächst. Vor sieben Jahren lebten hier 150, heute sind es dreimal soviel. Damit ist Zittau wahrscheinlich die Stadt mit der prozentual größten tschechischen Minderheit in Deutschland. Petra Laurin berichtet.
Vladan Hruška wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern seit vier Jahren in Zittau. „Mir gefällt hier die Familienfreundlichkeit. Begeistert hat uns auch die schöne und nahe Natur“, sagt Hruška. Er leitet die Fakultät für Geografie der Universität in Aussig, ist Pendler und gewöhnt zu reisen. Die Eltern und die Kinder, die jetzt die Lessinggrundschule besuchen, kamen aus Prag, weil sie eine größere Wohnung brauchten. „Meine Frau ist eine Deutsche aus Sachsen-Anhalt, sie hat schon vorher hier gearbeitet“, erklärt er.
Hruška motivierte vor zwei Jahren seine Studenten, die Masterarbeit „Tschechische Minderheit und ihr Beitrag zur Entwicklung der Stadt Zittau“ zu verfassen. „So entstand die erste aussagekräftige Studie über dieses Thema“, betonte er. Laut den Resultaten könnten die Tschechen für Zittau ein neuer Entwicklungsimpuls sein, wenn ihn die Stadt ergreift.
Hruškas Student Martin Voslař befragte für seine Masterarbeit 15 tschechische Zittauer, vier Pendler und sechs gemischte Familien. Fast die Hälfte hat einen Universitätsabschluß, 38 Prozent arbeitet in Führungspositionen, als Lehrer oder im Gesundheitsbereich. „Unsere Kinder gehen in Zittau zur Grundschule, sie sprechen schon perfekt Deutsch und korrigieren mich oft“, bestätigte ein Teilnehmer der Umfrage. Voslař stellte fest, daß der Zuwachs der tschechischen Minderheit in Deutschland von der einzigartigen Nähe zur Grenze herrühre. Vorteil sei auch die gute Verkehrsanbindung an die großen Städte Reichenberg und Gablonz mit zusammen 153 000 Einwohnern. Die Immobilien in Zittau seien außerdem fast dreimal preiswerter als dort. Ein weiterer positiver Aspekt sei die Nähe zur tschechischen Familie, Behörden, Dienstleitungen und tschechischer Kultur.
„Das Leben in Zittau ist billiger, deshalb bin ich schließlich hierher gezogen. Immerhin habe ich fast ein Jahr lang vergeblich eine bezahlbare Wohnung in Reichenberg gesucht. Hier zahle ich die Hälfte von dem, was ich zu Hause zahlen würde“, begründete ein Tscheche seinen Umzug. „Von Zittau nach Reichenberg, das ist ein Katzensprung, da habe ich gar nicht das Gefühl, weit weg zu sein. Vielleicht würden wir uns bei einem Umzug nach Prag mehr in einer fremden Umgebung fühlen als hier“, ergänzte ihn ein weiterer Tscheche. Als Vorzug betrachten alle die Kleinstadtatmosphäre, den historischer Stadtkern und die Nähe des Zittauer Gebirges. Minuspunkte sind für sie die schlechte infrastrukturelle Anbindung nach Deutschland, das schwache Dienstleistungsangebot und der offensichtliche Immobilienleerstand. Als negative Seite nehmen sie die alternde Bevölkerung
und die zu große Ruhe wahr. „Es gibt hier nicht ein richtiges Restaurant, in das man am Freitagabend gehen kann“, betonen sie einstimmig. Vieleicht liegt das aber daran, daß die Grenze so nah ist. Auch viele Deutsche bevorzugen tschechische Gaststätten, die bessere Angebote und Preise bieten.
Die tschechische Minderheit lebte seit dem 17. Jahrhundert in Zittau. Damals hatte sie tschechische Gottesdienste, eine tschechische Bibliothek, tschechischen Unterricht und führte ein reges Verbandsleben. Nach 1949, als die freiwillige Ausreise der tschechischen Familien stattfand, blieben rund 250 Tschechen in der Stadt.
Jiří Zahradník ist ein weiterer heutiger Zittauer mit Reichenberger Wurzeln, der bei der IHK ist und tschechische Unternehmer, die in Sachsen tätig werden wollen, bei ihren Aktivitäten unterstützt. Er stellte vor kurzem mit Vladan Hruška das Leben der ursprünglichen und heutigen tschechischen Minderheit in der Hillerschen Villa in Zittau vor. Das Thema lockte unerwartet mehr als 100 Gäste an. „Manche sind sogar aus Prag oder aus dem Erzgebirge angereist“, freute sich Petra Zahradníčková, die die Begegnung veranstaltet hatte.
Heute sind die Tschechen in Zittau nicht mehr organisiert und führen auch kein gemeinsames Vereinsleben. Sie haben eine WhatsApp-Gruppe mit rund 70 Kontakten und treffen sich unregelmäßig, meistens in der Kulturkneipe Jolesch. „Vor allem Männer gehen ab und zu gern auf ein gemeinsames Bierchen“, bestätigte eine Teilnehmerin.
Viele künftige Zittauer suchen die ersten Ratschläge für das neue Laben in Deutschland auf dem Blog Žijeme v Žitavě/Wir leben in Zittau und auf der gleichnamigen Facebook-Seite, die rund 2000 Anhänger hat. „Am meisten interessieren sie praktische Hinweise, Fragen über Wohnen, Versicherung, Bankkarten oder Ratschläge für Ausflüge“, sagt Jitka Motýlová, die diese sozialen Medien mit fünf Freunden betreut. Auch sie lebt schon seit vier Jahren im eigenen Haus am Westpark in Zittau. Das einzige, was sie stört, ist, daß sie noch nicht so perfekt deutsch spricht, wie sie es sich wünscht. „Ich war lange nur mit den Kindern zu Hause“, erklärt sie.
Obwohl die meisten Tschechen in Zittau wissen, daß Deutsch ein großer Vorteil ist, sprechen nicht alle Deutsch. „Wir leben hier schon seit acht Jahren ohne Sprachkenntnisse, arbeiten aber in der Tschechischen Republik“, sagte eine Tschechin. „Aber meine Kinder fühlen sich schon als Deutsche.“ Ständig in Zittau wohnen möchten nicht alle Tschechen, die die sächsische Grenzstadt anzieht. Sie ist reizend für Leute, die günstige Immobilien kaufen, und für Schrebergartenbesitzer, die gerne über das Wochenende kommen. „Es gibt auch Spekulanten und Menschen, die sich hier vor dem Gerichtsvollzieher verstecken“, verrät Jiří Zahradník. Die Gründe und Meinungen sind natürlich immer subjektiv und was für einen Deutschen Peripherie bedeutet, kann für einen Tschechen Mitteleuropa oder Paradies heißen.
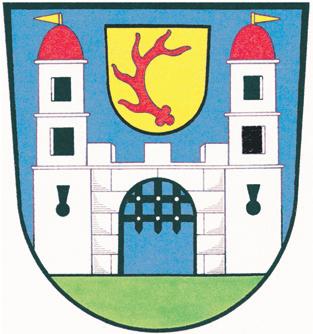
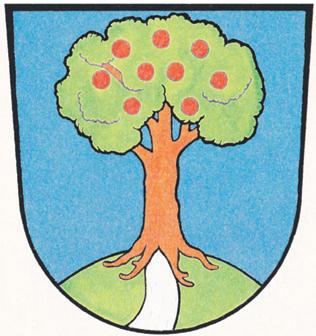
Der warme Zittauer Wind und die Sonne sorgen dafür, daß der Lavendel entlang der Eisenbahnstrecke nach Weißbach im ehemaligen Kreis Friedland prächtig wächst. Unweit des Ortes Raspenau-Karolinthal kann man ein wahres Paradies entdecken. Petra Laurin berichtet.
Die Lavendelfelder im Isergebirge pflanzte Adéla Heindorferová an. Sie wollte damit den Touristen die Ruhe und Energie bieten, die sie einst selbst zwischen den Lilabahnen in Frankreich gesucht hatte. „Immer mehr Menschen wünschen sich etwas Zeit für die eigenen Gedanken. Deshalb haben wir uns vor allem auf den sogenannten langsamen Touristen konzentriert“, erklärt die Unternehmerin. Adéla lebte bereits zweimal in Frankreich. Während ihrer Studienjahren war sie dort Babysitterin, später kehrte sie für eine kurze Zeit zurück, um eine eigene Familie zu gründen. „Wenn ich mich an meine erste Begegnung mit Lavendel in der Hafenstadt Cassis erinnere, erfüllt



❯ Grottau/Kreis Reichenberg
mich noch heute ein Gefühl von Freude und Wärme“, bemerkt sie.
Sie begann mit dem Bau ihrer eigenen Lavendelwelt 2017, nachdem sie beschlossen hatte, Reichenberg zu verlassen und ins Isergebirge zu ziehen. Sie kaufte in Raspenau in der Nähe der Straße nach Haindorf ein Haus aus dem Jahr 1580 und ein 1,5 Hektar großes Grundstück, das dank des Bergmassivs, das sich hinter den Feldern erhebt, vor Unwetter geschützt ist. „Das Haus hat eine Seele. Ich habe gleich gewußt, daß es für uns das Richtige ist. Wir sind erst die fünften Besitzer in seiner langen Geschichte. Früher gab es hier eine Gärtnerei, weil hier die Sonne den ganzen Tag über scheint. Der Ort wurde früher Mildeneichen genannt“, erzählt sie. Adéla und ihr Mann Josef Heindorfer arbeiteten beide zuvor im Sozialdienst, und das haben sie auf das Geschäft übertragen. „Ich beschäftige nur alleinstehende Mütter, ukrainische Frauen oder Männer über 55. Insgesamt sind wir neun, manche haben nur einen Minijob“, sagt Adéla. Ursprünglich konzentrierte sich die Lavendelmanufaktur/Levandulovna auf den biologischen Anbau von Kräutern, dann kam die Verarbeitung des Lavendels hinzu und im Vorjahr der Langsame Tourismus. Aus dem Lavendel werden Sirup, Gelee, Kekse, Kosmetik und Kerzen hergestellt. Die Manufaktur bietet auch Workshops für Schulen und Öffentlichkeit an, betreibt einen eShop, läßt sich auf Märkten sehen. Jetzt im Frühling erwacht das Leben auf den Lavendelfeldern. Das fri-
sche Unkraut zwischen den Lavendelsträuchern fressen sechs Schafe. „Sie mögen keinen Lavendel, und mit ihren winzigen Füßen zerstampfen sie die Sträucher nicht“, erklärt Adéla. Am



Osterwochenende bemalten Kinder in der Lavendelwerkstatt Eier aus Holz und lernten, wie man eine Peitsche bastelt.
Geboten wurde auch „Slow Food“ in einem bunten Zirkuswagen im Hof, der ursprünglich am Bodensee hausiert hatte. „Wir bieten lauter Spezialitäten aus regionalen Lebensmitteln und Lavendel an, Säfte, Liwanzen oder hausgemachtes Brot mit Aufstrich“, verrät Adéla. Die Manufaktur mit Lila Tor ist jetzt nur an den Wochenenden geöffnet. Im Sommer sind die Wanderer jeden Tag willkommen.
Die Scheune hinter dem Haus soll bald für tschechisch-sächsische Schultreffen genutzt werden. Mehrere deutsche Gruppen haben den zauberhaften Ort bereits entdeckt. „Die Identität und die Spuren der Menschen, die hier mal gelebt haben, spürt man auf Schritt und Tritt. Gerade hier bietet es sich an, sich friedlich mit den Themen des Sudetenlandes zu beschäftigen“, lädt die Lavendelprinzessin ein.
Ob die Störche heuer auf den Schornstein der alten Spinnerei in der Grenzstadt Grottau zurückkehren, ist fraglich. Das Stadtamt begann mit der Revitalisierung des Fabrikgeländes von Bekon, einer Industriebrache.
Der Abriß des Komplexes fing nach Ostern an und kostet umgerechnet 1,16 Millionen Euro. Die Ausschreibung gewann die Baufirma Tost. „Wir haben Angebote von elf Interessenten erhalten, Tost war der drittbilligste“, sagte Bürgermeister Josef Horinka. Bis auf den Schornstein und die frühere Direktion an der Václavská-Straße werden alle Gebäude des ehemaligen Bekon-Geländes abgerissen. Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Arbeiten im September abgeschlossen sein. „Die linke Seite des Industriegeländes steht über der ehemaligen Wasserleitung. Dort könnte eine alte Turbine begraben sein. Das Rathaus ist aber auf eventuelle Überraschungen vorbereitet“, fügte der Bürgermeister hinzu.
net 7,84 Millionen Euro kosten und ein Gesundheitszentrum für Ärzte und Gesundheitsdienste, die jetzt überall in der Stadt verstreut sind, beherbergen. „Das dritte Objekt für umgerechnet 6,6 Millionen Euro wird das Haus des Sports werden“, ergänzte Pressesprecherin Eva Malá.
Die ehemalige Direktion soll künftig Wohnzwecken dienen. „Wir verhandeln

Dem Abriß des 20 Hektar großen Geländes soll im Herbst ein Neubau folgen. Auf dem Platz der ehemaligen Spinnerei Bekon sollen drei neue Gebäude errichtet werden. Für 3,64 Millionen Euro wird ein Lager für das Stadtarchiv entstehen. Das zweite Gebäude wird umgerech-
mit verschiedenen Entwicklern, die sich mit Genossenschaftswohnbau beschäftigen“, erklärt Horinka. Zur Wiederbelebung des Fabrikgeländes soll auch ein neuer Park zwischen den Straßen Anglická, Václavská und Erster Mai gehören. Auf dem höchsten Punkt plant das
Rathaus einen Aussichtsturm sowie einen Pavillon und ein Amphitheater unterhalb des Hangs. „Bei diesen Vorhaben wollen wir die Artefakte von dem Abriß ausnützen, die an die Geschichte des Ortes erinnern“, sagte Horinka. Das Gelände wird einen großen Wassertank haben, der von den Dächern und Straßen Regenwasser auffangen soll. „Wir möchten dann den Springbrunnen hinter der Schubert-Villa wiederherstellen“, sagte Malá. Die Stadt habe, so Malá, erfolgreich Anträge auf Fördermittel gestellt. Ohne die könne sie mit den Vorhaben nicht beginnen. Die Geschichte der Spinnerei beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zuerst wurde Garn gefärbt. 1945 kam die Firma unter staatliche Verwaltung eines neuen Unternehmens mit Sitz in Bensen. Die Textilfabrik Bekon beschäftigte in der Garn- und Strickwarenerzeugung mehrere hundert Mitarbeiter. Der Betrieb wurde vor 25 Jahren stillgelegt. Grottau kaufte das Industriegelände der verfallenen Fabrik 2015 für sechs Millionen Kronen. Eine Analyse und ein Audit bestätigten die Umweltbelastung des Standorts. Es gab große Mengen an Chemikalien, Kunststoff- und Kautschukreste. Die Stadt entfernte sie im Vorjahr. Die Kosten dafür lagen bei 7,5 Millionen Kronen. Petra Laurin
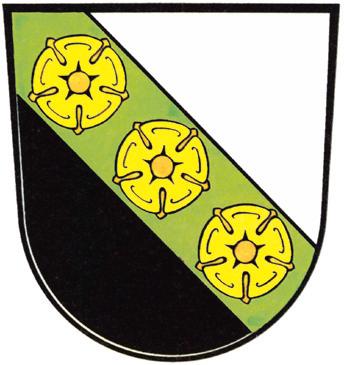

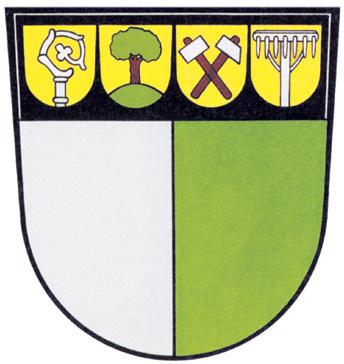
Dux Ossegg




Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau
Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

� Teplitz-Schönau
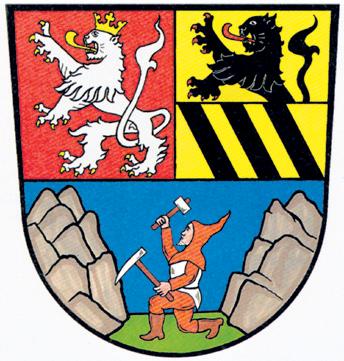
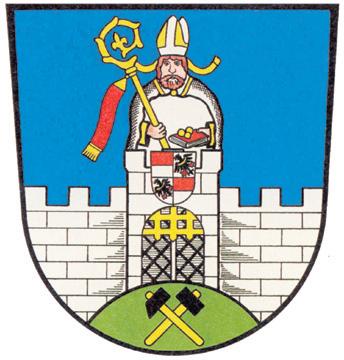
Graupen Niklasberg


Zu einem bedeutenden kulturellen und gesellschaftlichen Mittelpunkt der Stadt Teplitz-Schönau gehört das Erzgebirgische Theater, das heuer sein 100. Jubiläum feiert. Es ist aber nicht das erste Theater in Teplitz. Über Vergangenheit, Gegenwart und Jubiläumsvorbereitungen informierte sich unsere Korrespondentin Jutta Benešová.
Die Geschichte des Theaters in Teplitz war schon immer mit den Kurbädern verbunden. Das Schloßtheater ließ Johann Nepomuk Fürst von Clary und Aldringen 1789 nach einem Entwurf des sächsischen Architekten Johann August Giesel errichten. Dieser entwarf das Theater für 285 Zuschauer in der ersten Etage des eigens verlängerten Westflügels des Schlosses. Mit seiner elegant klassizistischen Fassade, eine der ersten in diesem Stil bei uns, war es direkt mit dem Schloßgarten verbunden. Der berühmte Kurgast Johann Wolfgang von Goethe hatte hier seinen eigenen Sperrsitz und schrieb sogar für das Theater 1812 das Stück „Die Wette“, worin die junge Kaiserin Ludowika, die sich gerade zur Kur in Teplitz aufhielt, die Hauptrolle spielen sollte. Er selbst sollte als ihr
Partner auftreten. Zur Premiere jedoch kam es nicht. Zum einen erkrankte Goethe kurz zuvor, zum anderen hatte Kaiser Franz seiner Gemahlin diesen Auftritt strikt verboten. Nach dem Jahre 1900 ließ Alfons Fürst von Clary und Aldringen die seit den 1870er Jahren leerstehenden Räume des Theaters zu Wohnräumen und zur Schloßbibliothek umbauen, die er mit dem Mobiliar und dem Buchbestand seines Palais in Wien ausstattete. 1871 hatte nämlich der Stadtrat beschlossen, ein Theater in der Nähe des Kaiserbades zu errichten, da die Kapazität des Schloßtheaters nicht mehr den Ansprüchen der wachsenden Anzahl der Kurgäste entsprach. Bedingung waren, ein Schauspielsaal mit 800 Plätzen und zwei Galerien sowie ein Büfett mit Zugang zu einer Terrasse, die wiederum Zugang zum Kurpark hat, zu schaffen. In einer Ausschreibung, bei der drei Architekten angesprochen wurden, war der Termin zum 31. Dezember 1871 gesetzt, den aber nur der Dresdener Architekt Bernhard Schrei-

ber (1833–1894) einhielt und dessen Projekt im Stil der Neorenaissance angenommen wurde. Etwas später reichte auch der bekannte Teplitzer Architekt Adolf Siegmund sein Projekt ein. Die in diesem Zusammenhang oft genannten Architekten Joseph Zítek, Schöpfer des Nationaltheaters in Prag, und Joseph Turba waren nur als Juroren bei der Ausschreibung geladen und unterstützten das Projekt von Schreiber. Das Theater verfügte
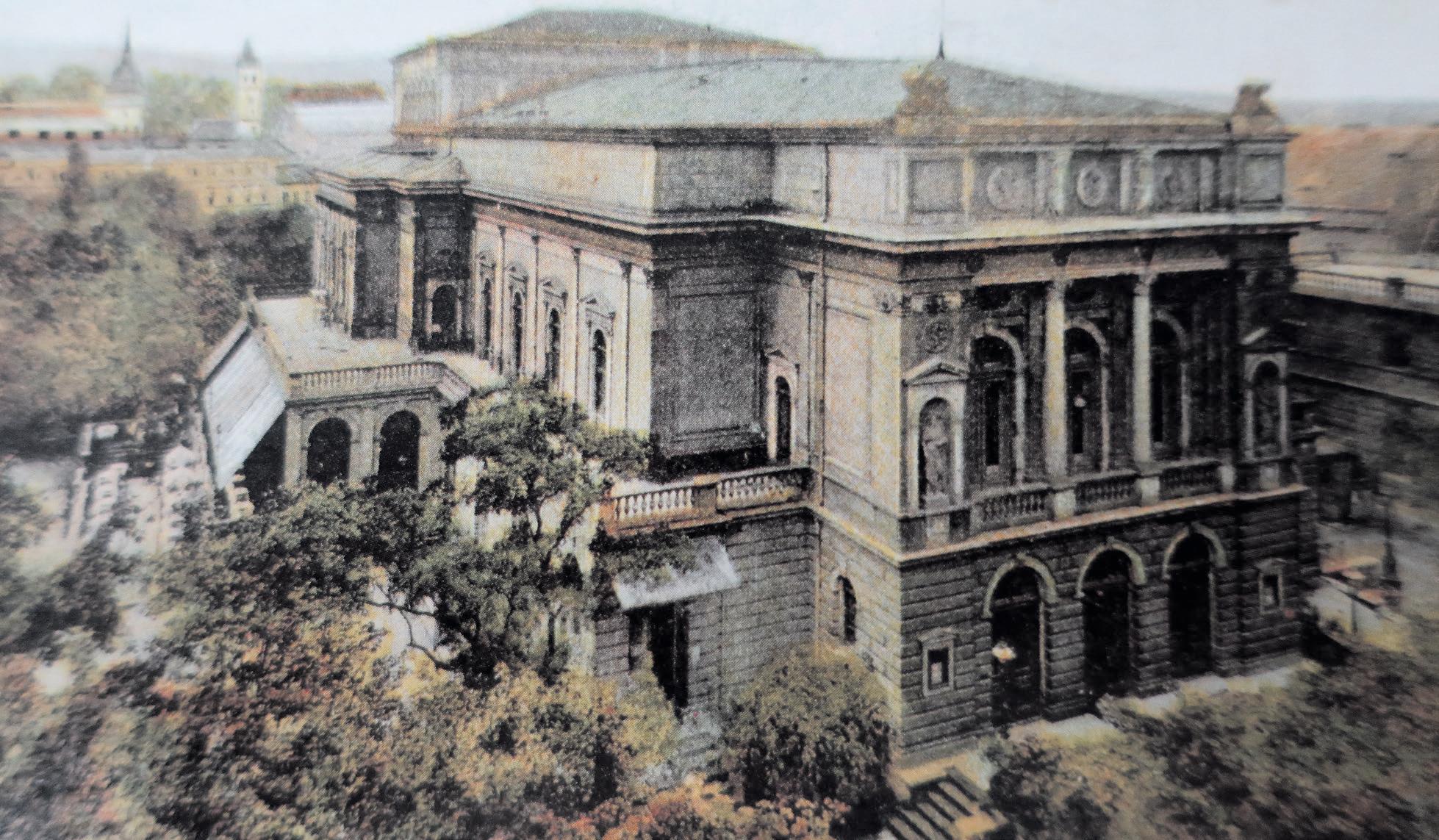
über 815 Sitz- und 185 Stehplätze und wurde 1874 eröffnet – also auch ein Jubiläum, das 150. Die Teplitzer konnten sich jedoch nur 45 Jahre lang an dem neuen Theater erfreuen. In der Nacht zum 1. September 1919 kam es zum Verhängnis. Dem Nachtwächter fiel auf seinem nächtlichen Rundgang die Petroleumlampe aus der Hand, und das Feuer breitete sich in Windeseile aus. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Für die Teplit-
zer war das ein schwerer Schlag, denn sie liebten ihr Theater. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen und auch politischen Lage kurz nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Tschechoslowakischen Republik war sich die Stadt der starken Theatertradition bewußt, und 1921 wurde beschlossen, ein neues Theater an selber Stelle zu bauen. Die Projektanten Rudolf Bitzan aus Dresden und Adolf Linnemann entwarfen ein Mehrzweckgebäude, das im Stil zwischen Sezession und Moderne der Dresdener Schule errichtet wurde und nach Prag das größte Theater in der Tschechoslowakei war.
Die enge Verbindung der Kleinen und Großen Bühne und des Konzertsaals mit den gastronomischen Einrichtungen wie Restaurant, Café, Bar, Terrasse und einem damals sehr modernen Biograph war wohl einmalig. Kurgäste im Rollstuhl wußten besonders zu schätzen, daß der Zugang zum Theater barrierefrei und eine der Logen auch für sie direkt zugänglich war. Die
Kosten von damals 26 Millionen Kronen wurden durch die Aufnahme von Krediten und Spenden der Bevölkerung von der Stadt getragen, der tschechoslowakische Staat beteiligte sich nicht.
Am 20. April 1924 fand die festliche Eröffnung des Stadttheaters mit Kur- und Stadtsälen mit der Aufführung von Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ statt. Die Damen und Herrn in festlicher Gala hätten während der Pausen dieser dreistündigen Opernaufführung die gastronomischen Einrichtungen besucht und seien von den großzügigen Räumlichkeiten begeistert gewesen, wie der „TeplitzSchönauer Anzeiger“ am nächsten Tag zu berichten wußte. Das Theater verfügte über ein breites Repertoire von Oper, Operette über Schauspiel und auch Kindervorstellungen. 1934 wurde das erste Jahrzehnt bewertet: 3119 Tage, das heißt sechs Tage in der Woche gab es Vorstellungen, davon 455 Premieren und 148 Gastspiele anderer Theater. Es gab sowohl deutschals auch tschechischsprachige Aufführungen. „Ein Theater für alle!“ wie damals bei der Einweihung Bürgermeister Dr. Walther in seiner Festansprache betonte.


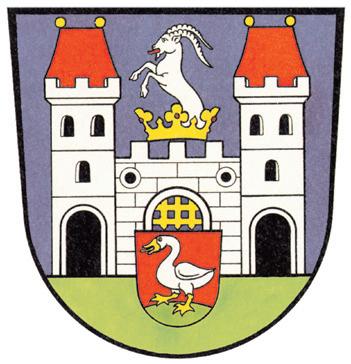

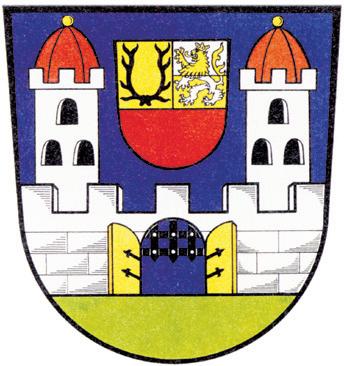
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

❯ Schwarzkopf
Am ersten Aprilsamstag wurde der Böhmische Brunnen wieder aufgesperrt. Rund 350 Wanderer wohnten der feierlichen Zeremonie bei, mit der die Wandersaison offiziell eröffnet wurde. Karl Reitmeier berichtet.
Ein langjähriger Teilnehmer der feierlichen Zeremonien zum Aufsperren des Böhmischen Brunnens brachte es auf den Punkt: „Jedes Jahr hat mich bei diesem Termin Anfang April gefroren, aber dieses Mal habe ich geschwitzt.“ Das war bei Temperaturen um die 25 Grad auch kein Wunder, und das schöne Wetter hatte auch rund 350 Wanderer von beiden Seiten der Grenze angelockt, wobei die bayerische Abordnung, die sich dem Further Waldverein mit der Vorsitzenden Marianne Linsmeier an der Spitze angeschlossen hatte, mit nahezu 100 Teilnehmern schon rekordverdächtig war und beim Veranstalter, dem Touristikclub (KČT) Taus/Domažlice mit dessem Vorsitzenden Petr Matějka große Freude auslöste. Die Veranstaltung war einmal mehr das beste Beispiel einer gut funktionierenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die stets geprägt ist von herzlicher Freundschaft und einer angenehmen Atmosphäre.
Das Wasser sprudelte dieses Mal munter aus der Quelle, und Petr Matějka zeigte sich bei der Begrüßung erfreut über
die vielen Gäste, die sich um den Böhmischen Brunnen versammelt hatten. Sein besonderer Gruß galt Michal Sedláček, dem Tschechischen Botschafter in der peruanischen Hauptstadt Lima, Senator Vladislav Vilímec, Radka Trylčová als Vertreterin des Pilsener Bezirks, dem Tauser Bürgermeister Stanislav Antoš und dessen Further Amtskollegen Sandro Bauer, der mit dem Fahrrad gekommen war, Josef Forst, dem Direktor der Städtischen Wälder Domažlice, und Marianne Linsmeier. Sein Dank richtete sich an den Pilsener Bezirk, die Stadt Taus sowie die Gemeinden Hochofen, Klentsch und Böhmisch Kubitzen für die finanzielle Unterstützung zum Unterhalt des Aussichtsturms auf dem Schwarzkopf. Matejka sagte, daß in diesem Jahr die Toiletten in der Unterkunft des Touristikclubs auf dem Schwarzkopf renoviert würden und für die Kinder ein Spielplatz mit einer Kugelbahn errichtet werde. Ferner machte er darauf aufmerksam, daß es nach der Brunnen-Öffnung kein gemütliches Beisammensein im Kulturhaus in Meigelshof/Chodov geben werde, da dort eine karita-
tive Veranstaltung anberaumt sei.
Bürgermeister Stanislav Antoš richtete zunächst dankende Worte an die Dolmetscherin Zuzana Langpaulová und zeigte sich erfreut über das schöne Wetter. Er erinnerte sich, daß vor zwei Jahren bei dieser Veranstaltung Schnee auf dem Böhmischen Brunnen gelegen habe. Erfreut

zeigte er sich über das viele Wasser in der Quelle. Er wünschte den Wanderern viele gesellige Touren mit dem Beginn von schönen Freundschaften. Den Böhmischen Brunnen nannte Antoš ein Symbol für die tschechisch-bayerische Freundschaft. Er sprach die Hoffnung aus, daß man sich auch bei den kommenden Veranstaltungen am Böhmi-

schen Brunnen in den nächsten Jahren wieder in Freundschaft treffen könne. Er, so Antoš, erkenne gute Laune in den Gesichtern der Besucher und wünsche sich, daß diese auch für die Zukunft erhalten bleibe. Er gab noch bekannt, daß der Stadtrat von Taus inzwischen die finanziellen Mittel für den Umbau der Hütte auf dem Schwarzkopf freigegeben habe und damit dem baldigen Beginn der Bauarbeiten nichts im Wege stehe. Dann könne man sich auch dort wieder unter schönen Bedingungen, wie sie für das 21. Jahrhundert zeitgemäß seien, treffen. Bürgermeister Sandro Bauer hieß Wanderer und Radfahrer von beiden Seiten der Grenze willkommen und verwies auf das 20jährige Jubiläum des EU-Beitritts der Tschechischen REpublik, das heuer gefeiert werden könne. Die Grenzen seien aber schon viel früher offen gewesen. Viel wichtiger als von Politikern unterzeichnete Verträge seien die Menschen, die sich hier in Freundschaft träfen. „Wir können stolz sein, hier zu wohnen, wo andere Urlaub machen“, verwies Bauer auf die Schönheiten der hiesigen Region. Er wünschte allen eine gute
Wandersaison mit vielen schönen Treffen auf beiden Seiten der Grenze.
„Was wäre der Böhmische Brunnen ohne die vielen Wanderer, die in so großer Anzahl gekommen sind“, sagte die Vorsitzende des Further Waldvereins, Marianne Linsmeier, die sich insbesondere über die Auftritte des Männergesangsvereins Haltravan und der böhmischen Jagdhornbläser freute, welche für den gelungenen musikalischen und gesanglichen Rahmen sorgten. Sie war sich sicher, daß bei der Grünen Hütte genug Zeit zum gemütlichen Beisammensein bestehe. Linsmeier zeigte sich erfreut, daß sogar Radio Charivari zuvor auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sei, und sprach die Hoffnung aus, daß eines Tages auch noch das Fernsehen komme. Viel Beifall bekam sie, als sie einige Begrüßungsworte in tschechischer Sprache vortrug.
Nach der Zeremonie wurde zur Grünen Hütte marschiert, wo die Familie Anderle bestens für Speisen und Getränke sorgte. Dort zeigte sich einmal mehr, was tschechisch-bayerische Freundschaft inzwischen ausmacht. Es wurde wieder deutlich, daß sich Böhmen und Bayern prächtig verstehen. Und so war es nicht verwunderlich, daß dort der Männergesangsverein Haltravan weitere Kostproben seines Könnens geben mußte.

❯ Furth im Wald Heimatbilder im Georgssaal
Gegenwärtig läuft im Georgssaal des Further Landestormuseums die Ausstellung „Verloren, vermißt, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“.
Rund drei Millionen Sudetendeutsche verloren ab 1945 ihre Heimat. Was vielen von ihrer Heimat geblieben ist, sind Bilder. Dabei geht es auch um die immateriellen Bilder. Diese überdauern in Form von Vorstellungen und Erinnerungen. Denn von einigen Betroffenen wird die verlorene Heimat bis heute vermißt. Auch zeitgenössische Künstler setzen sich mit der Heimat auseinander. Dabei wird die Heimat unterschiedlich verewigt.
Der Studiengang Museologie und materielle Kultur der JuliusMaximilians-Universität Würzburg konzipierte die Ausstellung mit der Heimatpflege der Sudetendeutschen. Das Haus des Deutschen Ostens (HDO) förderte das zweisemestrige Projekt.
Bis 26. April dienstags bis sonntags 11.00–16.00 Uhr geöffnet. Der Museumseintritt mit Stadtturm kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

WIR GRATULIEREN
Im April gratulieren wir herzlich folgender Abonnentin des Bischofteinitzer Heimatboten und wünschen Gottes Segen:
■ Weißensulz. Ilse Maier (Tochter von Kafmoa Mine), 78 Jahre. Regina Hildwein Ortsbetreuerin
Herzlich gratulieren wir
im April Heidrun Böttinger, Ortsbetreuerin von Bischofteinitz, am 2. zum 75. Geburtstag; Franz Neudecker, Ortsbetreuer von Pollschitz, am 5. zum 84. Geburtstag; Christine Spaderna, Ortsbetreuerin von Frohnau, am 9. zum 92. Geburtstag und Anneliese Seidl, Ortsbetreuerin von Schmolau, am 19. zum 77. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter Pawlik Heimatkreisbetreuer
Michal Sedláček, Marianne Linsmeier, Vladislav Vilímec, Radka Trylčová, Petr Matjěka, Sandro Bauer, Stanislav Antoš und Josef Forst. Links der Männergesangsverein „Haltravan“. Mit einer rekordverdächtigen Abordnung aus nahezu 100 Leuten ist der Further Waldverein beim Böhmischen Brunnen. Marianne Linsmeier und Petr Matjěka sperren den Böhmischen Brunnen mit farbenprächtigen chodischen Keramikschlüsseln auf. Bilder: Karl Reitmeier Blick auf die Heimatbilder im Georgssaal des Further Landestormuseums.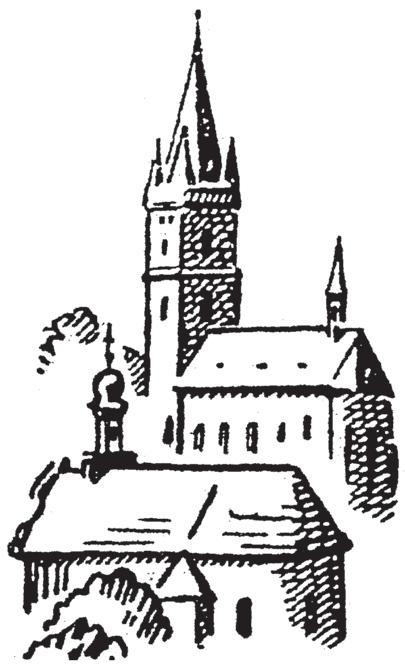


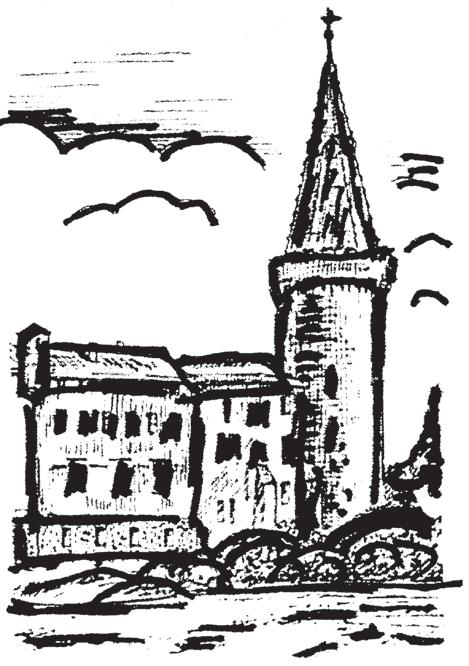
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Das Leben der Gerda Mathilde Wilhelmine Moe/Oppermann – Teil I
Am 27. Dezember starb Gerda
Mathilde Wilhelmine Moe/Oppermann, die Tochter von Marie Oppermann, der letzten Besitzerin vom Neuhammer in Reichenthal, in Norwegen. Gerdas Tochter Randi Moe berichtet.
Mama kam am 30. Juni 1931 in Dresden als einziges Kind von Marie und Walter Oppermann zur Welt. Ihre frühesten Jahre verbrachte sie in Heidenau und Radeberg, kleinen Städten nahe Dresden. Ihre Kindheit war geprägt von der Krankheit und dem frühen Tod ihres Vaters 1936, der finanzielle Schwierigkeiten mit sich brachte. Damals war Mama erst fünf Jahre alt. Gleichzeitig entwickelte sie eine ungewöhnlich enge Bindung zu ihrer Mutter, die auch uns prägte. Für Mama war der Zusammenhalt in der Familie das Wichtigste. Mama erlebte den Nationalsozialismus, Krieg und Not. Die antinazistische Haltung und die Freimütigkeit ihrer Mutter brachten die kleine Familie in Schwierigkeiten. Als einzige in ihrer Freundesgruppe engagierte sie sich nicht im Bund Deutscher Mädchen (BDM), obwohl das obligatorisch war. Sie und ihre Mutter erhielten oft Hausbesuche und Rügen, wenn Mama wieder einmal „unentschuldigt“ nicht an Treffen teilgenommen und keine Uniform getragen hatte. Als sie in der Schule erzählte, daß ihre Tante Mathilde „Lilli“ und ihre liebe Cousine Traudl in München bombardiert würden, wurde sie beschuldigt, Lügen zu verbreiten. Die Schulleitung suchte ihre Mutter auf und wies darauf hin, daß es ernste Konsequenzen haben werde, wenn sie weiterhin regimefeindliche Desinformation verbreiteten.
Schließlich wurde ihre Mutter verhaftet, in Weiden in der Oberpfalz wegen Regimekritik angeklagt und zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Mama erzählte oft, wie ängstlich sie als 14jährige vor dem Gerichtssaal gesessen und gewartet habe. Uniformierte Offiziere marschierten vorbei, was im Gebäude ein Echo erzeugte. Würde sie ihre Mutter jemals wiedersehen? Was würde mit ihr selbst geschehen? Kein Wunder, daß Mama ihr ganzes Leben lang Angst vor allem hatte, was mit Behörden zu tun hatte. Sie trug immer ihren Paß in ihrer Tasche, selbst bei Familienbesuchen bei uns. „Wo ist meine Tasche“, fragte sie stets. Man wußte ja nie, wann sich das Leben, wie man es kennt, plötzlich ändert und man seine Ausweispapiere braucht.
Bereits zuvor hatte sie das Gefühl des Verlassenseins erlebt.
Als ihr Großvater Georg Herrmann 1942 im Sterben lag, reiste ihre Mutter zu ihm in Neuhammer, um ihn in seinen vermutlich letzten Tagen zu begleiten.
Mama blieb allein in Radeberg zurück. Sie war elf Jahre alt und 350 Kilometer von ihrer Mutter entfernt. Der Krieg tobte, es gab wenig zu essen, und die Mutter blieb drei Monate lang weg. Ma-
ma sprach oft darüber, wie ängstlich und allein sie sich in dieser Zeit gefühlt habe. Sie war völlig abgemagert, als ihre Mutter zurückkam, denn sie hatte ihre Lebensmittelmarken gespart, um ein richtiges Festessen zubereiten zu können, wenn ihre Mutter endlich nach Hause kam.
Aber zurück zum Urteil. Glücklicherweise stellte der Anwalt einen Antrag auf Strafaufschub, der gewährt wurde. Das war im Februar 1945. Damals wurde Dresden bombardiert. Eisenbahnlinien und die Infrastruktur waren zerstört, und sie konnten nicht zurück nach Radeberg fahren. Was nun?
Sie entschieden sich schnell, nach Neuhammer zu reisen. Neuhammer war das geschätzte Ferienhaus der Familie. Es war ein kleines Paradies, das die Vorfahren der Familie Anfang des 18.Jahrhunderts erbaut hatten. Seitdem, also als das Gebiet zum Königreich Böhmen unter Österreich-Ungarn gehörte, war das Ferienhaus ununterbrochen im Besitz der Familie. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte das Anwesen zur Tschechoslowakei. Das Haus lag nur wenige hundert Meter von der deutschen Grenze entfernt, aber eben in der Tschechoslowakei im sogenannten Sudetenland. Mamas Mutter und ihre Tante Lilli verbrachten viel von ihrer Jugendzeit auf dem Neuhammer, und die ganze Familie war so oft wie möglich dort. Also fuhren sie auch 1945 dorthin.
Dort waren bereits Tante Lilli sowie die Großmutter und Mamas Cousine Traudl, die nach dem Bombenangriff auf München auf dem Neuhammer Zuflucht gesucht hatten. Hier schaffte es die Familie irgendwie zu überleben. Sie baute Kartoffeln, Zuckerrüben und Gemüse
und die Tschechen im Spätsommer 1945 nach Neuhammer kamen. Es wurde klar, daß alle deutschsprachigen Menschen vertrieben werden sollten, ihnen wurde ihr Besitz weggenommen und alles von Wert konfisziert. Dies betraf nicht nur Mama und ihre Familie, sondern alle 3,5 Millionen Sudetendeutschen. Dies war eine dramatische und schwierige Zeit, die tiefe Spuren bei Mama hinterließ. Sie erlebte, wie der tschechische Mob ihr Schlafzimmer im Neuhammerhaus als Schießturm benutzte, von dem aus sie auf deutschsprachige Flüchtlinge schossen, die versuchten, mit ihren wenigen Besitztümern über die Grenze zu kommen. Auch Mamas Familie versuchte, einige Wertgegenstände zu retten. Es war Winter und alles schneebedeckt. Sie tarnten sich mit weißen Laken und schlichen unter Lebensgefahr über die Grenze nach Deutschland, um einige Gegenstände bei Verwandten zu lagern.
Mama wurde zu Zwangsarbeit und Aufräumarbeiten („Steineklopfen“) nach alliierten Bombenangriffen im nahen Pfraumberg geschickt, streng bewacht von bewaffneten Tschechen. Die Familie erlebte, wie Tschechen das Haus stürmten und einen der Hausbewohner, den Bauer Wenzel, halbtot schlugen. Mama erzählte, daß sie sich an die Schreie erinnere und daran, daß sie danach das Blut vom Boden gewischt habe. Sie begegnete ausgehungerten Flüchtlingen aus dem KZ Flossenbürg, die in der chaotischen Nachkriegszeit auf der Flucht waren. Sie gab ihnen von dem wenigen Brot, das sie selbst hatten. Eine prägende Erfahrung für eine 15jährige.
Fenster hatten kein Glas mehr. Sie hatten überlebt, aber besaßen absolut nichts. Sie hungerten. Die Familie lebte in einem Raum ohne Herd und Heizung, der zugleich Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche war. Traudl erzählte mir, daß ihr Spielplatz Ruinen, zusammengebrochene Gebäude und Luftschutzbunker auf der anderen Straßenseite gewesen seien. Sie war damals fünf Jahre alt. Nach und nach beteiligte sich die Familie an der Aufräumarbeit der Ruinen. Meist ta-


Der Stauweiher von Neuhammer wurde Ernestinen- oder Neuweiher genannt. Im Wasser Maria Oppermann. Der Staudamm ist heute rund 100 Meter von der Grenze im Wald sichtbar. Hierher kamen die Waidhauser zum Baden.
an, sammelte Pilze im Wald und bekam Milch von der Ziege Hedi.
Dann kamen der Frieden und die Amerikaner. Mama erzählte oft von Schießereien und Gefechten in der Nähe des Neuhammerhauses, sie sahen Mündungsfeuer aus den Gewehrläufen. Glücklicherweise erwiesen sich die Amerikaner als freundlich. Eine schwere Zeit begann, als die Amerikaner sich zurückzogen
Dann mußten Mama und ihre Familie Neuhammer verlassen. Tante Lilli hatte mit vielen anderen Flüchtlingen eine Unterkunft in einem bombardierten Mietshaus in München organisiert. In einem eisigen und zugigen Güterwagen reisten sie von Waidhaus nach München. Sie kamen an einem bitterkalten Tag im Februar 1946 in der Wohnung an. Sie hatte Bombenlöcher in den Wänden und im Dach, und die
ten dies Frauen, die später als Trümmerfrauen bezeichnet wurden und geholfen hatten, daß die Gesellschaft langsam, aber sicher, wieder in Gang kam. Mama konnte wieder zur Schule gehen, und zwar in die von Schulschwestern geleitete im Angerkloster, das viele Flüchtlingskinder besuchten. Sie begleitete morgens die kleine Traudl in den Kindergarten im selben Gebäude. Vieles von dem, was sie in dieser Schule lernte, blieb ihr ein Leben lang im Gedächtnis. Sie hatte immer ein passendes Zitat und eine Lebensweisheit für die meisten Lebenssituationen, meist von Schiller oder Goethe, deren Werke sie in der Schulzeit auswendig gelernt hatte. Die Schüler erhielten dank des USA-Wirtschaftsförderungsprogramms Marshallplan täglich eine Mahlzeit: an einem Tag Suppe mit einem kleinen Stück Wurst, am nächsten Tag Haferbrei. Mama sagte oft, daß sie die harten ersten Nachkriegsjahre nur dank dieser Hilfe überlebt habe. Ihre Mutter bekam einen Nacht-Job als Putzhilfe in einer Bank und kam morgens nach Hause, wenn Mama zur Schule ging; die ganze Familie wechselte sich ab, um sich um die allmählich demente Großmutter zu kümmern. Der Familienzusammenhalt, wie wir ihn von Mama kennen, wurde damals noch stärker. „Es gab sehr viele, denen es viel schlechter ging als uns“, wiederholte sie immer wieder, wenn die Erinnerungen zu stark wurden. „Wir waren Überlebende“, sagt Traudl. Nun galt es, nach vorne und nicht zurückzublicken, „Immer das Beste draus machen!“ Auch das war eine Eigenschaft, die Mama beibehielt. Mama hatte einen hellen Kopf, aber die Familie konnte es sich nicht leisten, sie über die Grundschule hinaus zur Schule zu schicken. Es war wichtig,
so schnell wie möglich zu arbeiten, um das knappe Familieneinkommen aufzubessern. Das war Mutters große Trauer, sie hätte so gerne eine weiterführende Ausbildung erhalten. Durch die Nonnen der Klosterschule wurde sie BMW empfohlen, wo sie einen Job in der Buchhaltung bekam. Als BMW später Mitarbeiter entlassen mußte, wurde sie von ihrem Chef für einen Job bei der Bayerischen Staatsbank empfohlen. Sie war eine effiziente, freundliche und präzise Angestellte mit einem guten Kopf für Zahlen und Systematik und war sowohl bei Vorgesetzten als auch Kollegen beliebt und erhielt die besten Empfehlungen. Sie arbeitete so lange, bis alles perfekt erledigt war. Sie hatte ihr ganzes Leben lang guten Kontakt zu Kollegen und Freundinnen aus dieser Zeit. In Norwegen bildete sie sich in Ökonomie fort. In einem Abendkurs machte sie einen Wirtschaftsabschluß. Sie war so stolz, als sie das geschafft hatte. Nachdem ihre Mutter schließlich als Hauptmieterin der gesamten Wohnung in München eingetragen worden war, konnte die Familie entscheiden, wem sie Zimmer vermieten wollte. Und so lernten sich Mama und Papa kennen. Eines Tages stand ein wohnungssuchender junger Student aus Norwegen vor der Tür. Torgeir Moe zog Ende Oktober 1954 in die Schlotthauerstraße 3 ein, und es dauerte wahrscheinlich nicht lange, bis die Gespräche zwischen den beiden begannen. Vater, überwältigt von den Studien und etwas mutlos, während Mutter ihn ermutigte und sagte: „Gib niemals auf.“ Das war eine Einstellung, die sie ihr ganzes Leben prägte. Nie aufgeben ist auch das Motto von Urenkelin Mathilde.
Sie wurden bald ein Paar und unternahmen Rad- und Bergtouren. Diese Touren in die Alpen boten den so beengt Wohnenden die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und Zeit als Liebespaar zu verbringen. Im August 1956 heirateten sie in der Lukaskirche in München. Die Flitterwochen führten sie in das norwegische Mo i Rana, nur wenige Kilometer südlich des nördlichen Polarkreises, wo Papas Eltern lebten, und nach Sortland, wo Papas kleiner Bruder Per und dessen Familie wohnten.
Als Papa mit dem Studium fertig war, begann 1960 eine gemeinsame Zukunft in Norwegen, und Mamas Mutter kam mit. Es war nicht immer einfach, in dieser Zeit Deutsche in Norwegen zu sein, und Mama fühlte sich oft ausgeschlossen.
1961 wurde Georg geboren, und ich kam 1963 zur Welt; das war, während die Familie in Nøste in Drammen wohnte. Papa bekam einen Job in Oslo, und der Weg führte weiter zum Wohnblockleben in der neuen Vorstadt Linderud und später nach Billingstad, wo Mama und Papa ein Haus neben Papas Bruder Bjørn, Tante Lise und deren Familie bauten. Hier fühlten sie sich wohl und lebten ihr Leben lang. Fortsetzung folgt

� Stadtmuseum Tachau
Das Tachauer Stadtmuseum wurde im Herbst 1931 nach dem Bau von zwei Stockwerken auf das Rathaus in zwei für diesen Zweck vorgesehenen Räumen untergebracht.
Davor waren die Museumsstücke in einem gemieteten Raum im Hintergebäude des Hauses Nr. 58 am Marktplatz (Emil Kohner) und im Magazingebäude im Hof des Rathauses gelagert gewesen. Erst nach dem Um- und Aufbau des Rathauses wurde es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Erben des verstorbenen Alfred Fürst zu Windisch-Grätz übergaben die im WindischGrätz‘schen Familienarchiv im Schloß Tachau aufbewahrten Zunfttruhen, in welchen auch die alten Zunftbücher der ehemaligen Gewerbe wie Müller, Schneider oder Schmiede und Zunftsiegel waren, dem neuen Museum. Fachlehrer Ernst Oschowitzer, geboren in Tissa, hatte viele der Museumsstücke in mühevoller Arbeit gesammelt und diese genau registriert. Er leitete das Museum bis zu seiner Versetzung an die Bürgerschule in Plan. Bei Kriegsende 1945 raubten amerikanischen Soldate die wertvollsten Museumsstücke. Die verbliebenen Gegenstände sind wertlos, da sie schwer beschädigt oder zerstört wurden.
Wir gratulieren folgender Abonnentin des Tachauer Heimatboten herzlich zum Geburtstag im April und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
n Lusen, Tholl. Am 18. Maria Baier/Scharnagl (Tholl Nr. 15) in Vohenstrauß-Allenstadt, 85 Jahre. Heidi Renn Ortsbetreuerin
Herzlich gratulieren wir im April Gerhard Stich, Ortsbetreuer von Hals, am 10.zum 80. Geburtstag und Paula Marterer, Kassenleiterin, am 26. zum 84. Geburtstag.
Wir wünschen alles Gute, Gesundheit sowie Gottes Segen und danken für alle ehrenamtlich geleistete Arbeit für unsere Heimat. Sieglinde Wolf Ortsbetreuerecke




Heimatkundliches Mitteilungsblatt für die Vertriebenen aus dem Isergebirge/Organ des Gablonzer Heimatkreises e.V. Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail isergebirge@sudeten.de


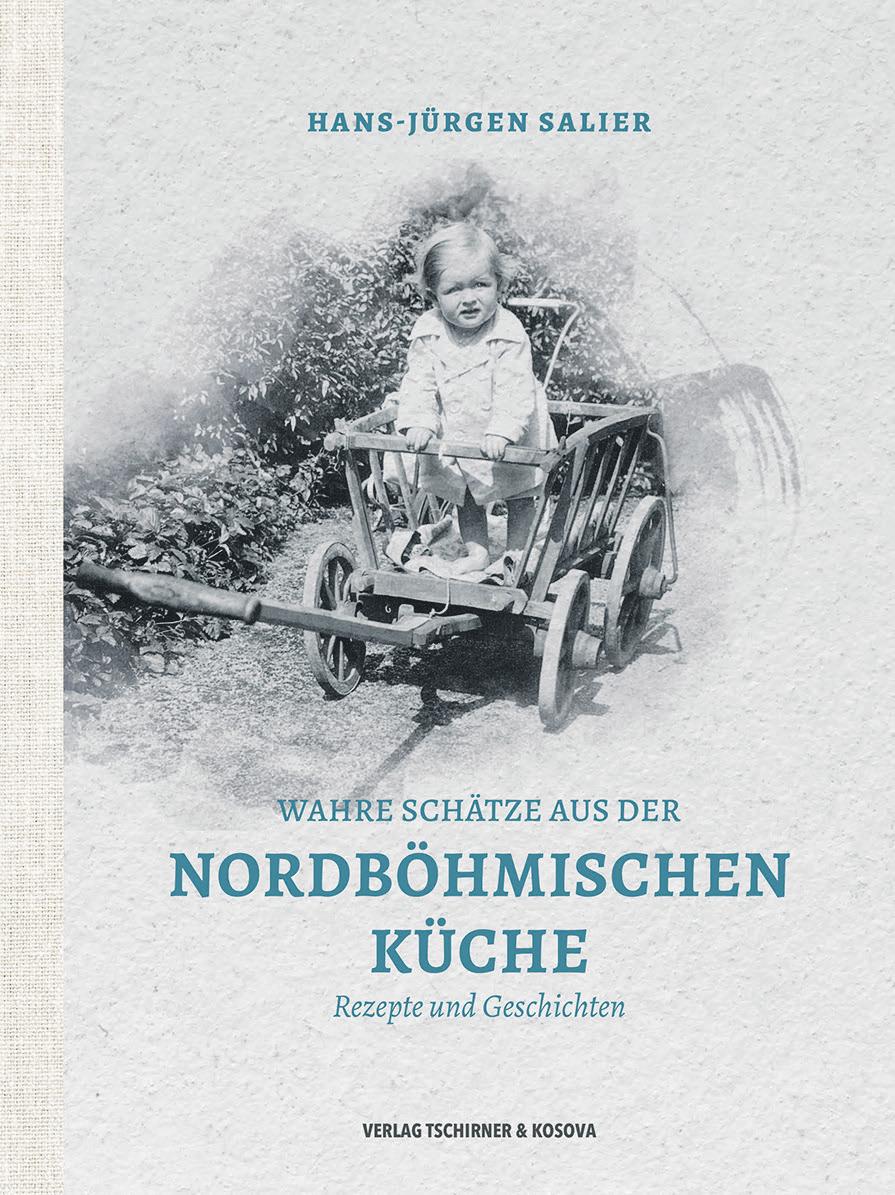
Das im März erschienene Kochbuch „Wahre Schätze aus der Nordböhmischen Küche“ ist in vielerlei Hinsicht ein Schatz.
Beinahe wären die von Hand in Sütterlin geschriebenen Rezepte einer alten Reichenbergerin verlorengegangen. Doch in den 1970er Jahren brachten die Schwiegereltern von Hans-Jürgen Salier diese Aufzeichnungen von einer Reise ins Sudetenland mit. Seitdem leisteten sie in der Familie gute Dienste, um das Erbe der nordböhmischen Küche zu pflegen.
Kurz vor seinem Tod transkribierte der Thüringer Autor und Verleger Hans-Jürgen Salier das Kochbuch von Betty Kubik, um es herauszugeben. Erweitert hat er das Manuskript um die Fluchtgeschichte seiner Schwiegereltern von Böhmen nach Thüringen. Nach Saliers Tod 2021 trat dessen Sohn 2023 an Tirschner & Kosová heran mit der Bitte, das Buch zu verlegen. Herausgekommen ist ein liebevoll mit Zeichnungen verziertes Buch, das kaum noch bekannte Rezepte wie Hascheeomelette, Husarenbraten, Griesreis oder Hirnknödelsuppe enthält. Allen Rezepten gemeinsam ist, daß die Angaben zu Mengen bei den einzelnen Zutaten, auch Temperaturen und Zeiten sehr spärlich sind. Durch die ausführlichen Beiträge und zeitgenössischen Fotos zu Hotels
■ Albrechtsdorf. Im Mai gratulieren wir zum 69. Geburtstag am 5. Monika Lindner/Sturm in Oberpfaffenhofen; zum 88. Geburtstag am 12. Gundula Bohnenberger/ Schramm in München.
■ Antoniwald. Im Mai gratulieren wir zum 89. Geburtstag am 10. Erna Martinetz/Zenkner in Lorch.
■ Friedrichswald. Im Mai gratulieren wir zum 86. Geburtstag am 9. Konrad Reckziegel in Frankenwindheim.
■ Grünwald. Im Mai gratulieren wir zum 88. Geburtstag am 23. Christa Schaarschuh/Priebsch in Neugablonz.
■ Johannesberg. Im Mai gratulieren wir zum 90. Geburtstag am 10.
und Restaurants in Reichenberg und Gablonz vor 1945 ist dieses Buch vielmehr als ein Kochbuch – es ist ein Zeitzeugnis und Botschafter aus der Heimat.
Der Leipziger Verlag Tschirner & Kosová verlegt Sachbücher, Dokumentationen, Replik-Ausgaben, Graphic Novels und Spiele, die allesamt einen Bezug zu den Nachbarländern Deutschland und Tschechien aufweisen. Das Verlegerpaar –Kateřina Tschirner-Kosová und Jürgen Tschirner – gründete den Verlag im Jahr 2020, nachdem Tschirner-Kosová in ihrem Heimatland Tschechien auf das Buch „Krvavé léto 1945“ des Prager Autors Jiří Padevět aufmerksam geworden war. Darin setzt sich Padevět mit den Wilden Vertreibungen auseinander, die zwi-









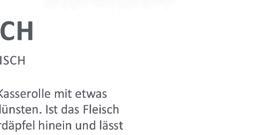
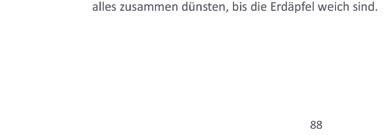

schen Mitte Mai und Anfang August 1945 auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik stattfanden. Das Paar merkte, daß es entweder gar nicht oder falsch über dieses Thema informiert war, und faßte den Entschluß, das Buch ins Deutsche zu übersetzen. Als nach langer harter Arbeit Jiří Padevěts Buch unter dem Titel „Blutiger Sommer 1945“ auf Deutsch erschien, war das die Geburtsstunde des Verlags Tschirner & Kosová. Inzwischen liegt das 736 Seiten starke Buch in vierter Auflage vor. Weiterhin erschienen „Was geschah in Saaz und Postelberg im Juni 1945“ von Andreas Kalckhoff, „Was geschah am 18. und 19. Juni 1945 auf den Schwedenschanzen bei Prerau?“ von František Hýbl und „Was geschah in Aus-



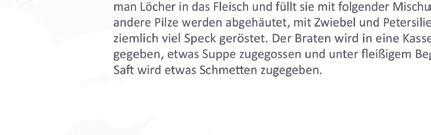
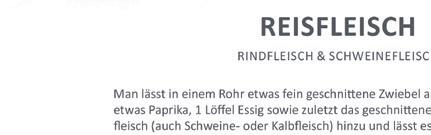

Sieglinde Bär/Stumpe in Oberhausen; zum 89. Geburtstag am 10. Helmut Neumann in Fichtelberg und am 31. Siegfried Horn in Hochkirch; zum 83. Geburtstag am 12. Helmut Hannich in Gernrode; zum 80. Geburtstag am 14. Erwin Schimek in Nürnberg.
■ Josefsthal. Im Mai gratulieren wir zum 67.Geburtstag am 30. Harald Hanisch in Waldkraiburg.
■ Gablonz. Im Mai gratulieren wir zum 94. am 25. Erhard Neufuß (Josef-Pfeiffer-Straße) in Kaufbeuren; zum 89. Geburtstag am 28. Eva-Maria Simon/Wondrak (Brunnengasse 1) in Neugablonz.
■ Kukan. Im Mai gratulieren wir zum 81. Geburtstag am 22. Helga Mosnedl/Drescher in Ravensburg.

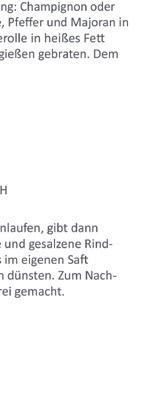
■ Radl. Im Mai gratulieren wir zum 91. Geburtstag am 25. Sieglinde Eiter/Hübner in Kaufbeuren; zum 92. Geburtstag am 1. Ilse Elflein/Hartig in Bernburg. Thomas Schönhoff Ortsbetreuer
■ Polaun. Wir gratulieren allen Polaunern, die im Mai geboren sind, auf das Allerherzlichste zum Geburtstag. Hans Pfeifer Ortsbetreuer
■ Schumburg-Gistei, Unterschwarzbrunn. Die Ortsgemeinschaft gratuliert am 16. Mai Waltraud Witte/Pfeifer zum 81. Geburtstag in Eschborn.
■ Labau-Pintschei. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Mai zum
87. Geburtstag am 17. Helga Straub/Domesle in TambachDietharz;
86. Geburtstag am 22. Konrad
sig am 31. Juli 1945? Dokumentation eines Nachkriegsverbrechens“ von Jan Havel, Vladimír Kaiser und Otfried Pustejovsky. Das deutsch-tschechische Verlegerpaar beschäftigt sich jedoch nicht nur durch Bücher mit Themen, die sowohl die komplizierte Vergangenheit als auch die erfreuliche Gegenwart betreffen. 2023 gingen sie gemeinsam mit ihren drei Kindern und Mitstreitern vom Marktplatz in Saaz zur ehemaligen Kaserne in Postelberg. Dort wurden Anfang Juni 1945 mindestens 763 Deutsche im Zuge der wilden Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg erschossen oder erschlagen.
„Eine aufrichtige deutschtschechische Freundschaft kann nur entstehen, wenn auch im Keller Licht angemacht ist und alle wissen, was passiert ist“, sagte Jürgen Tschirner damals der Deutschen Presse-Agentur. Als Vorbild für seine Aktion nannte Tschirner den Brünner Versöhnungsmarsch, der seit 2015 jährlich an die gewaltsame Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus Brünn erinnert. Anders als dort wird die Aktion in Postelberg jedoch nicht von der örtlichen Stadtverwaltung unterstützt.
Auf dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg wird der Verlag Tschirner & Kosová mit einem Stand vertreten sein und seine Bücher anbieten.
Peukert in Kaufbeuren-Neugablonz;
83. Geburtstag am 22. GerdaBrigitte Zedlitz/Simm in Kaufbeuren-Neugablonz;
82. Geburtstag am 17. Horst Blob in Kaufbeuren-Neugablonz und am 25. Günter Faltis in Fellbach;
81. Geburtstag am 22. Barbara Wolf/Palme in KaufbeurenNeugablonz;
78. Geburtstag am 9. Irene Geiger/Weiss in Aichach;
76. Geburtstag am 2. Monika Jeschke in Dresden und am 12. Camill Wittiger in Biessenhofen;
71. Geburtstag am 18. Anita Zhorzel/Prade in KaufbeurenNeugablonz;
70. Geburtstag am 3. Birgit Huber/Havlik in Höchstädt;
68. Geburtstag am 29. Lucia Schmi/Haug in Pforzen;
56. Geburtstag am 21. Petra Lutz/Theileis in Rohrdorf. Hans Theileis Ortsbetreuer
Dr Feixn vunn Bramberge wor dr Mon gestorbn. Se krichte zwejmoul de Woche ihr Brut und de Sammln vun Feistner Bäckn aus n Ebr-Wiesthole gebrocht.
Bei dan Bäckn hottn se grode ann neun Liehrjung und Feistner, wos a dr Mejstr wor, sohte ibr n: „Horch ocke, wenn de heute zr Feixn de Sammln brengst, dann mußte ihr Beileid winschn, dos gehort siech su.“
No jo, su weit su gutt, dar Junge hotte odr noch nie jemandn Beileid gewunschn und wußte nu ne, wie a dos machn sellte.
Ols a zr Feixn kom, gob a ihr de Hand und sohte ganz treuharzich: „Iech winsch Ihn vill Glicke zunn Beileid!“
De Linkn und de Peukertn stiehn zusomm bann Gortzaume und praatschn. Dou mejnt de Peukertn: „Nej soh mrsch ocke, wos macht denn deine Tochtr, die ho iech jo schunt lange ne gesahn.“ „Nu jo, weßt de, die is doche ei Gablunz drinne itze Frisöse, und dou kricht se fr enn Schadl drei Krunn!“, mejnt druf de Linkn. Thomas Schönhoff
❯ Sudetendeutscher Tag
Auf nach Augsburg!

Bild: David Heydenreich
Mauke – Die Band ist schon lange in sudetendeutschen Kreisen kein Geheimtipp mehr.
Und nachdem sie letztes Jahr beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg mit einem Kulturpreis ausgezeichnet wurde, ist sie auch dieses Jahr in Augsburg vertreten. Am Samstag, 18. Mai werden im Rahmen des HEIMAT!abends um 19.00 Uhr
Paurische Verse und Lieder zu hören sein.
Außerdem ist die Vertriebenenstadt Kaufbeuren-Neugablonz, die seit 2009 eine Städtepartnerschaft mit Gablonz pflegt, mit einem Stand vertreten. Doch das sind nur zwei Gründe, am Pfingstwochenende nach Augsburg zum Sudetendeutschen Tag zu fahren.
■ Albrechtsdorf. In Kaufbeuren verstarb im März Inge Kustermann/Nitsche aus dem Oberdorf im 91. Lebensjahr. Um sie trauern ihre Töchter mit Familien.
■ Gablonz. Im Alter von fast 85 Jahren starb in Neugablonz Siegfried Effenberger (Bulirsch) aus der Bogengasse, betrauert von seiner Gattin Alwera und seinen beiden Brüdern. Am Ostersonntag starb in Neugablonz nach schwerer Krankheit unser lieber Heimatfreund Heinz Koch aus der Kettelgasse 11 im Alter von 86 Jahren. Jahrelang war er im Gesangverein Sudetenland und im Isergebirgsmuseum als aktiver Mitarbeiter tätig. Seiner aus Bad Schlag stammenden Gattin Ingrid, geborene Zimmermann
und der Tochter Christine mit Familie gilt unser herzliches Beileid.
■ Morchenstern. Am 16. März starb in Neugablonz Margit Bergmann/Peukert aus Georgenthal im 91. Lebensjahr. An der Seite ihres Gatten Erwin wurde sie in Kaufbeuren beigesetzt. In Neugablonz verstarb nach langer Krankheit Anneliese Fabian/Purkart im 93. Lebensjahr. Sie wurde in aller Stille verabschiedet.
■ Reinowitz. Wenige Tage nach dem Tod seiner Gattin Eva-Maria verstarb am 8. April in Neugablonz der Bäckermeister Adolf Schwertner aus Reinowitz kurz vor seinem 90. Geburtstag. Um ihn trauern seine Kinder mit Familien. Thomas Schönhoff
■ Samstag, 20. April, 12.00 Uhr, IsergebirgsMuseum: „Reikuckn. Paurische Mundart rund um die Gablonzer Küche“ von Thomas Schönhoff. Anmeldung telefonisch unter (0 83 41) 96 50 18 oder per eMail verwaltung@ isergebirgs-museum.de Illustration „Scholareppl“ von Hans Müksch in Rudolf Tamm/Heinz Kleinert: Hej su wos! ..., Gablonzer Archiv ud Museum e.V. ,1966.





Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail zuckmantel@sudeten.de
❯ Zuckmantel und Umgebung
Ich war noch zu jung, um zum Barras zu geh‘n, ich war nur ein Pimpf, hat manches geseh‘n. Es gab genug Elend und Leut‘ auf der Flucht, auch Soldaten mit Fahrrad und Autos genug. Sie strömten zurück, die Russen im Rücken, keiner wollt sich ergeben aus freien Stücken.
So hört ich am Marktplatz an einem Konvoi, die Autos, das sah man, war‘n nicht mehr ganz neu: „Wir müssen zurück mit Verpflegung zur Truppe, mit Gulasch im Kessel und Erbsensuppe.“
Man sah auf der Karte, wie die Front schon verlief, und manch einer dachte: „Das geht sicher schief.“
Es war in der Ecke südlich von Neiße, früher ein Land für‘ne schöne Reise.
Da kam mir der Gedanke, da fährst du mit, und eh‘ ich‘s gedacht, konnt‘ ich nicht mehr zurück. Ich kannte die Richtung, wo der Opa noch wohnt, die Fahrt war umsonst, kein Fahrer entlohnt.
Ich war nicht allein auf der Fahrt Richtung Front, was ich da machte, das war schon „gekonnt“. Drei Autos voll Leute, jeder wollt‘ noch was retten, der eine den Schmuck, der andre die Betten. Nach ‘ner Stunde Fahrt sprang ich vom Wagen, dann war ich allein, konnt‘ niemand mehr fragen.
Ich lief durch den Wald, eine heilige Stille, kein Vogelgezwitscher, kein Zirpen der Grille. Man hörte es donnern, doch es war kein Gewitter, Kanonen und Panzer ließen die Erde erzittern.
Ich rannte und rannte, der Wald nahm‘ kein Ende, ich hoffte doch sehr, daß ich den Opa noch fände. Und ich schafft‘ es nach Stunden und kam zu dem Haus. Mein Opa war da und die Seinen kam‘n raus, die sah‘n mich an und es war ein Gewimmel, „Wo kommst du denn her, du lieber Himmel, der Ruß‘ wird bald hier sein, wir müssen uns eilen. Hier pack‘ gleich mit an, die Sachen verteilen.“
Die Koffer und Taschen aufs Fahrrad gepackt, fast wär’n dabei die Speichen geknackt.
Dann schoben wir los, wir mußten uns sputen, auf dem Wege zum Paß auf bekannten Routen. Der Mond stand hell übern dunklen Wald, wir dampften wie Pferde, es war ziemlich kalt. Dann war‘n wir am Paß, wir atmeten auf und ließen den Rädern dann freien Lauf. Wir kamen durch Dörfer in stiller Ruh‘, keiner sah uns, wie wir bepackt waren, zu. Es war trotz allem eine herrliche Nacht, wir hatten vorm Ruß‘ was in Sicherheit gebracht.
Dann war‘n wir zu Hause, ein paar Sachen gerettet, für wen? Na, für uns..., wir hätten gewettet.
Es war aber leider nur für eine kurze Zeit, um alles zu nehmen, war‘n die andern schon bereit.
Rudolf Heider■ Zuckmantel. Am 20. Februar starb Josef Bock (geboren am 28. April 1929, Hauptstraße 239). Mit ihm verlieren wir eine treuen Bezieher des Zuckmantler Heimatbriefs, den er meist zusammen mit seiner Tochter durchschaute, unter anderem natürlich auch die Rubrik „Geburtstage und Sterbefälle“. Viele der dort aufgeführten Namen waren ihm noch bekannt. Seiner Tochter Monika Metz sprechen wir unsere Anteilnahme aus.
■ Zuckmantel. Wir gratulieren herzlich allen Landsleuten, die im Mai Geburtstag feiern, und wünschen alles Gute, vor allem eine stabile Gesundheit und noch viele Jahre.
Zum
93. Margarethe Wittenzellner/Kappel (Mühlsteig 419 bei der Geiermühle) am 9. Mai;
92. Johanna Strobl/Weiss (Stiegenbrücke 245) am 24. Mai, Herderstraße 30–34, 53173 Bonn;
85. Anni Bramböck/Teuchmann (Hintergasse 350) am 15. Mai, Ickelsamerstraße 52, 81825 München;
80. Dietlinde Meggle/Vogel (Mädchenschule 13) am 27. Mai;
81. Rainer König (Graben 260) am 18. Mai, Sperlingweg 4/1, 74906 Bad Rappenau;
80. Christa Stollberger/Lindenthal (Miserich) am 23. Mai;
92. Marie Krisch/Finger (118) am 11. Mai;
89. Gertrud Wulfert/Meißner (442) am 11. Mai;
88. Josef Grimme (315) am 12. Mai;
86. Wilhelm Franke (275) am 1. Mai; Herbert Knoblich (24) am 10. Mai;
82. Karl Schneider (175) am 9. Mai Anna Rossner/Langer (298) am 18. Mai; Elfriede Reichert/Lachmann (321) am 20. Mai; Gertrud Rupp/Gröger (268) am 30. Mai; Edith Krautwasser/Kaller (8) am 31. Mai;
81. Edeltraud Riedl/Knoblich (173) am 29. Mai; Rudolf Heider Ortsbetreuer

Im Zuge der Recherchen für meinen Stammbaum fand ich (geboren 1956 in Österreich) – dank der vielen digitalisierten Matriken in Tschechien – Daten einer ganzen Reihe von verstorbenen Verwandten mit den Familiennamen Heyek, Königer, Kosma, Mitschke und Richter im Raum um Zuckmantel. Das veranlaßte mich, diese schöne Stadt einmal etwas länger zu besuchen, nicht nur kurz am Grab meines Urgroßvaters Josef Königer vorbei zu schauen, der von 1912 bis 1919 Bürgermeister der Stadt war.
Also bezog ich Quartier im altehrwürdigen Thamm Hotel Praděd (dt. Altvater), gegründet 1837, ehemaliger Besitzer Eduard Thamm, der 1939 nach Brasilien auswanderte. Mein erster Weg führte zum Friedhof, wo ich erfreut das Grab meines Urgroßvaters (1853–1932, Geschäft im Haus 29) wiederfand. Erstmals war ich dort gemeinsam mit Vater und Bruder Mitte der 1960er Jahre. Keine Ruhe ließ mir der Gedanke, daß irgendwo auch das Grab meines Ururgroßvaters Josef sr. (geboren 1814 in Hotzenplotz, begraben 1875, wohnhaft Hauptplatz 90 und vorher 91–92) sein müßte. Und ich entdeckte es am Hang hinter der Kirche – überwachsen von Sträuchern und Pflanzen, die ich ohne Gartenwerkzeug nur teilweise entfernen konnte. Auf der rechten Seite ist die Erinnerung an seine Tochter Anna, verheiratete Walter (fürst-

In Laienkreisen ist vielfach die Meinung verbreitet, daß das Gebirge, namentlich, wenn es mit Hochwald gut bestanden ist, einen großen Reichtum an Raubvögeln berge. Dies ist durchaus nicht der Fall. Der Wanderer, welcher nur einige Stunden oder Tage der Beobachtung der Gebirgsvogelwelt widmen kann, wird nur selten Gelegenheit haben, einen Raubvogel zu Gesicht zu bekommen. Ich selbst sah nur einmal, auf dem Gipfel des Kepernik stehend, hoch über mir einen Mäusebussard seine Kreise ziehen. Die kleinen Sammlungen der Forstbeamten ergeben außer diesem Raubvogel nichts anderes als den Habicht, den Sperber, den Turmfalk und allenfalls noch, zum Beispiel bei Förster König in Adelsdorf, den Lerchenfalk. Ich bin aber überzeugt, daß wenn alles geflügelte Raubzeug, welches erlegt und in der Regel nur als „großer“ oder „kleiner Geier“ klassifiziert wird, einem Fachmanne in die Hände käme, sich manche große Seltenheit feststellen ließe.
Noch weniger als die Tagraubvögel stoßen dem Wanderer die Nachträuber, die Eulen, auf. Daß die Waldohreule |und der Waldkauz häufig sind, ergeben die zahlreichen ausgestopften Exemplare, die man überall findet. Nach vielfachen Versicherungen glaubhafter Forstleute fehlt aber auch der Uhu nicht; namentlich soll er nach Versicherung des Herrn Oberförsters Steyer (Rehwiesen) in der „Gabel“ horsten. Endlich ist nach Lage der Sache zu vermuten, daß auch der rauchfüßige Kauz vorkommt; denn im Riesengebirge ist er, wenn auch seltener, Brutvogel, und Herr Stey-
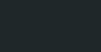
licher Forstkontrollor) graviert. Viele der alten schlesischen Gräber sind leider entfernt worden (auch der gesamte jüdische Teil des Friedhofes), aber einige Namen wie Heyek, Richter, Thamm, Pfarrer Brauner, Dr. Schindler oder Bürgermeister Kunz erkannte ich.
Die nächsten Tage führten mich ins Museum in der ehemaligen Post und in die Umgebung. In der Post wird hauptsächlich auf die Bergwerkstadt Bezug genommen, aber es gibt auch eine kleine Ausstellung der geschnitzten Stühle aus Reihwiesen oder eine Tafel über die Hexenverbrennungen Mitte des 17. Jahrhunderts. Über die Familie der ehemaligen Besitzer Richter oder Fachlehrer Franz Schubert (verheiratet mit Hildegard Richter, einer Tochter des Postmeisters Vinzenz Richter), der das Museum 1937 erstmals kuratierte, ist leider kein Wort in deutscher Sprache zu lesen. Natürlich wanderte ich auch zur Bischofskoppe und genoß sehr schöne Ausblicke. Der heutige Betreiber der Bischofskoppe spricht hervorragend Deutsch und erklärte mir so einiges. Im Park hinter dem Sanatorium Edelstein entdeckte ich eine Tafel zu Ehren der ermordeten jüdischen Bürger der Stadt. Über Petersdorf, Johannesthal, Hennersdorf mit seinem Schloß bis Hotzenplotz war ich weiter auf Spurensuche. Auf den katholischen Friedhöfen dieser Orte sind leider so gut wie keine Gräber von Schlesiern mehr zu finden. Dafür fand ich das Geburtshaus meines Urgroßva-
ters in Johannesthal. In Hotzenplotz/Osoblaha ist der ehemals sicher sehr schöne, aber im Zweiten Weltkrieg bei Panzerschlachten zerstörte Ringplatz nur mehr von Plattensiedlungen dominiert. Der Weg zum unter Denkmalschutz stehenden jüdischen Friedhof ist gut beschildert, aber alles leider stark verwildert.
Natürlich darf ein Besuch des Dorfes Reihwiesen nicht fehlen. Die alten Holzhäuser werden instandgehalten und stellen eine bedeutende touristische Attraktion dar. Auf dem Rückweg lohnt ein Besuch des Skansen mit seinen (nachgebauten) Bergbaumühlen, einem Erzofen und der Möglichkeit Gold zu schürfen. In Richtung Hermannstadt/Heřmanovice befindet sich ein Bergstollen (Kupfer und Pyrit) aus dem Jahr 1513, für dessen Besuch man sich anmelden sollte.
Werde ich Zuckmantel erneut besuchen? Ja, sicher, denn 2024 jährt sich die Gründung der Stadt zum 800. Mal. Am 18. Juni finden aus diesem Anlaß eine Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation in der ehemaligen Post unter Beteiligung der Zuckmantler Heimatstube in Bietigheim-Bissingen statt. Leider keine so große Feier wie 1924, aber die Erinnerung wird zumindest aufrecht gehalten. Karl Königer
Wenn ein Leser Kontakt zu Nachfahren einer der erwähnten Familien hat, freue ich mich über Informationen dazu: kkoeniger@gmail.com




❯ Die Vogelwelt des mährisch-schlesischen Gebirges – Teil III
er kennt ein „Waldkäuzchen“, ohne es näher beschreiben zu können, das aber wohl nur der Raufußkauz sein kann. Wenn wirklich einmal der gelegentliche Beobachter eine Eule entdeckt, so ist er sicher durch das Gekrächz des hübschen, blauflügligen Eichelhähers oder Nußhackers aufmerksam gemacht worden. Auch diesem, nebenher bemerkt durch Vernichtung von Singvögelbruten schädlichen Vogel ist es beigekommen, in letzter Zeit durch sein Variieren die wissenschaftlichen Ornithologen aufzuregen und die Nachfragen nach seinen Bälgen zu erhöhen. Freilich werden meines Erachtens die bezüglichen Untersuchungen kaum viel zu Tage fördern, da anscheinend schon jetzt feststeht, daß gerade der Eichelhäher von der westlichsten Form Europas bis zum Garrulus japanicus Shl. des östlichen Asiens, des japanischen Inselreiches, die man-

Tannenhäher
nigfaltigsten, sich eng aneinanderschließenden Übergänge aufweist.
Ein Verwandter des Eichelhähers ist der Tannenhäher. Er ist einer derjenigen Vögel, die es allein verlohnen, das Gesenke zum Felde ornithologischer Forschungen zu machen. Gleich dem Seidenschwanz wandert der Tannenhäher in manchen Jahren in ungezählten Mengen aus seiner eigentlichen Heimat, den sibirischen Arvenwäldern, zur Winterzeit in das mittlere und westliche Europa; seine letzten bedeutenden Züge haben in den Wintern 1885/86 und 1893/94 stattgefunden. Man weiß aber auch schon lange, daß der Vogel in Mitteleuropa, wenn auch immer als seltene Erscheinung, brütend auftritt, zum Beispiel in den Alpen, im Böhmerwald, im Schwarzwald, ja auch aus dem Riesengebirge liegen ältere Nachrichten vor, wonach dortselbst sein Nest gefunden ist.


❯ Über 300 Jahre Mariahilf
Der Wallfahrtsort Mariahilf bei Zuckmantel konnte 2018 sein 300jähriges Bestehen feiern: 1718–2018 – wenn man die Zeit zwischen der Zerstörung des alten Wallfahrtsortes (1973) und der Kirchweihe der neuen Wallfahrtskirche im Jahr 1995 mit dazu rechnet.
Ein großes blaues Transparent am Eingangstor zur Wallfahrtsstätte erinnerte 2018 an dieses Jubiläum. Links zeigt das Transparent das alte Mariahilf mit der lateinischen Inschrift „S. Maria Auxiliatrix – Ora pro nobis“ („Heilige Maria, Helferin – Bitte für uns“), rechts das neue Symbol der Wallfahrtskirche und die Worte „Wächterin des Lebens“ in tschechischer Sprache. Und in der Mitte liest man: „MARIAHILF 300 LET“ (= Jahre).
Geschichte der Wallfahrtskirche
Mariahilf bei Zuckmantel
Unweit der Stadt Zuckmantel im Wald gelegen ist Mariahilf landauf, landab und weit über die Grenzen des Sudetenlandes hinaus bekannt. „Maria-Hilf“ gilt vielen als das „schlesische Lourdes“: 1647: Auf der Flucht vor schwedischen Soldaten im Dreißigjährigen Krieg bringt Anna Tannheiser im Wald im Schutz einer Felswand und einer mächtigen Tanne einen gesunden Knaben zur Welt, sein Name: Martin.
1718: Die Tochter von Martin Tannheiser, Dorothea Weiss, läßt ein Mariahilf-Bild anfertigen und im Wald dort an einem Baum anbringen, wo ihr Vater geboren wurde (gemäß dem letzten Willen von Martin Tannheiser); bald wird von Marienerscheinungen und Wunderheilungen an diesem Ort berichtet; danach: Errichtung einer Holzkapelle.
1729: Übertragung des Mariahilf-Bildes in die Pfarrkirche nach Zuckmantel; in der Waldkapelle wird ein anderes Mariahilf-Bild (eine Kopie des Zuckmantler Bildes) angebracht.
1837: Baubeginn einer
steinernen Kapelle, 1841 Kirchenweihe. Anfang des 20. Jahrhunderts: Renovierung und Erhöhung des Kirchturms.
1946: Vertreibung der Sudetendeutschen.
1955: Verbot, die Wallfahrtsstätte zu besuchen; Zerstörungen.
1973: Sprengung der Kirche am 24. November.
1992: Wiedererrichtung des Kreuzwegs und Baubeginn einer neuen Mariahilf-Kirche! Mit ihren Spenden haben viele heimatvertriebene Sudetendeutsche den Bau der neuen Pilgerstätte am historischen Ort ermöglicht.
1995: Kirchweihe am 23. September; das seit der Zerstörung der alten Kirche verborgen aufbewahrte Mariahilf-Bild wird in der neuen Kirche in einem Strahlenkranz wieder angebracht.
1998: Weihe des großen Mariahilf-MosaikBildes an der Westseite der Kirche.
2005: Inzwischen pilgern wieder 50 000 Wahlfahrer nach Mariahilf.
Drei Mariahilf-Bilder
Die neue Wallfahrtsstätte Mariahilf ist nun im Besitz des ersten Gnadenbildes von 1718 in der Form eines neuen großen Mosaiks auf der Westseite der Kirche. Das Original zu diesem Mosaik befindet sich in der Zuckmantler Pfarr- kirche. Das zweite Gnadenbild von 1729 hängt im Strahlenkranz über dem Altar der neuen Mariahilf-Kirche. Gerold Schwarzer geboren 1945 in Zuckmantel


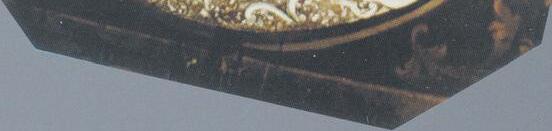
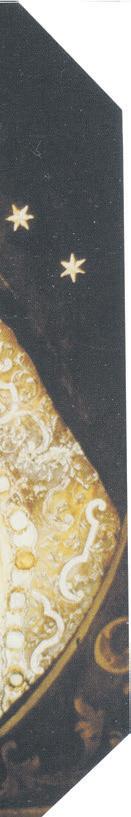


Geschichte der Mariahilf-Gnadenbilder
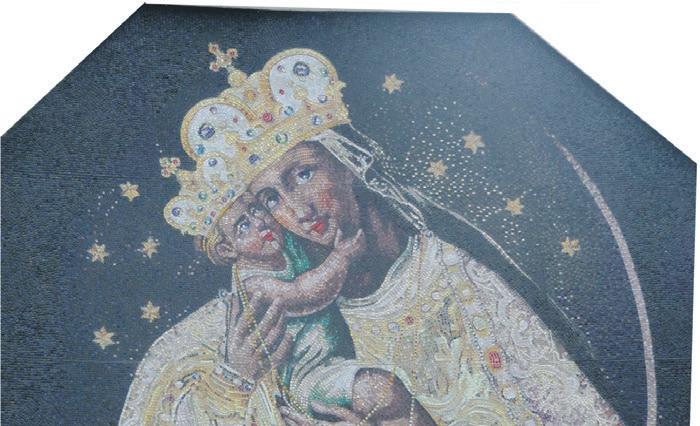

DEine große Freude war es für mich, im Jahre 1888 diesen Fundorten einen neuen, nämlich das Gesenke, beifügen zu dürfen. Junge Vögel, im Sommer erlegt, welche mir aus den Waldungen der Bischofskoppe zugeschickt wurden, konstatierten das Vorkommen des Tannenhähers als Brutvogel. Möchten sich die Nachrichten darüber auch aus anderen Gebirgsteilen mehren, möchte, wenn möglich, die Auffindung eines Nestes jeden etwaigen Zweifel verschwinden machen. Freilich ist das Nest nicht leicht zu finden, denn der Tannenhäher brütet im tiefen Hochwald schon im März, wenn der Schnee noch meter tief liegt; steht doch das Tannenhäherei im Handel auch gegenwärtig noch mit etwa 12 Mark im Preise.
Von den bei uns heimischen Tannenhähern, welche auch in Schweden brüten und daher Linné bei der Namengebung vorgelegen haben,

In Wien gibt es einen ganzen Stadtteil, der „Mariahilf“ heißt. Benannt ist der Stadtteil nach der dortigen Kirche Mariahilf. In ihr wird ein Gnadenbild verehrt, das ebenfalls eine Kopie des Cranach-Bildes darstellt. Gottesmutter und Jesuskind tragen – genau wie in Zuckmantel – beide eine Krone. Kannte der Maler des ersten Zuckmantler Gnadenbildes vielleicht dieses Wiener Bild?
Verwendete Quellen: Adolf Schenk: „Maria Hilf. Bilder der bewegten Geschichte einer Wallfahrtsstätte am Rande des Altvatergebirges bei Zuckmantel…“. Forchheim 2005.



unterscheiden sich die nordischen Wintergäste konstant durch das geringere Verhältnis der Höhe des Schnabels zu dessen Länge, sodaß derselbe viel spitzer scheint, sowie durch die mehr als doppelt so breite weiße Endbinde auf der unteren Seite des Schwanzes; die nordischen Tannenhäher werden daher von den unseren als N. caryocatactes macrorhyncha Brehm subspezifisch abgezweigt.
Ein weiterer Charaktervogel unseres Gebirgswaldes ist der Kreuzschnabel, der Krienitz, Krieniß oder Kriemß der Gebirgsbewohner und wie überall deren besonderer Liebling. Er ist von Christian Ludwig Brehm treffend als „Zigeunervogel“ bezeichnet worden. Denn gleich diesem Wandervolke bindet er sich niemals an eine bestimmte Lokalität, sondern tritt da auf, wo ihm der reichlich gediehene Koniferensamen die Tafel deckt. Ihm überwiegt die Nahrung so

sehr alle anderen Lebensbedingungen, daß er, wenn dieselbe in besonderer Fülle vorhanden ist, sogar mitten im Winter sein Nest baut und in Schnee und Eis seine Kleinen ausbrütet und großzieht. Von den drei Arten ist die gewöhnlichste der Fichtenkreuzschnabel. Er ist in allen Gebirgsdörfern als Stubenvogel zu finden, der mit großer Leichtigkeit, durch Lockvögel angezogen, mitten in der Ortschaft mittels Schlaggebauer oder Leimruten gefangen wird. Viel seltener ist sein größerer Vetter, der Kiefernkreuzschnabel, welcher bei unseren Vogelfängern und Händlern den für mich bisher unverständlichen Namen „polnische Koppe“ führt. Am interessantesten ist aber die dritte Art, der Bindenkreuzschnabel. Sonst dem hohen Norden angehörig, hat dieser Vogel Mitteleuropa zweimal in ungeheuren Massen besucht, das erste Mal 1820, das zweite Mal 1889. Von letzterer Invasion sind zahlreiche Vögel in unseren Gebirgen zurückgeblieben, wie später gefangene Exemplare beweisen. Sie scheinen aber im Gesenke auch genistet zu haben, denn im August vorigen Jahres versicherte mir ein Vogelsteller, einige Zeit vorher einen derartigen jungen Vogel gefangen zu haben. Wird fortgesetzt


as Zuckmantler Gnadenbild und die zahlreichen Mariahilf-Bilder ab dem 16. Jahrhundert sind meist Kopien oder Nachempfindungen des berühmten Gnadenbildes von Lucas Cranach dem Älteren aus dem Jahr 1537. Zu allen Zeiten hat das Bild die Menschen stark und tief berührt. Die Darstellungsform der Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind, das sich gleichsam Schutz suchend an das Gesicht der Mutter schmiegt, drückt eine überaus zarte und liebevolle Beziehung zwischen Mutter und Kind aus. Ein Bild vollkommener göttlicher Liebe –so empfinden es die Menschen aller Zeiten.
Im Jahr 1611 erhält Erzherzog Leopold von Österreich, Fürstbischof von Passau, bei einem Besuch in Dresden vom sächsischen, protestantischen Kurfürsten Johann Georg I. das von Lucas Cranach um 1537 gemalte Bild als Gastgeschenk.
Erzherzog Leopold ist der erste Verehrer dieses Bildes und nimmt es auf all seinen Reisen mit. Auch den Namen „Maria Hilf“ dürfte es dem frommen Erzherzog verdanken. Von ihm stammt der Titel „Maria Auxiliatrix“. 1618 wird Leopold Landesfürst von Tirol, nachdem er in Rom alle kirchlichen Würden abgelegt hatte. Das Originalbild aus Passau nimmt er mit nach Innsbruck. 1650 wird es in den Hochaltar der Innsbrucker Pfarrkirche St. Jakob, der jetzigen Bischofskathedrale, eingefügt. Dort befindet es sich noch heute.
Noch 1611 ließ der Passauer Domdekan Marquard von Schwendi durch den Passauer Maler Pius eine vergrößerte Kopie (130 Zentimeter) anfertigen. Die bedeutende, von Wallfahrern sehr verehrte Kopie hängt in der Passauer Mariahilf-Kirche.
Nicht so sehr das Originalbild, sondern die Passauer Kopie wird schnell zum Kultbild einer weltweiten Verehrung. Der Wallfahrtsort im Passauer Ortsteil Mariahilf genießt einen ungeheuren Ruhm und spielt vor allem gegen Ende des 17. Jahrhunderts angesichts der Bedrohung Wiens durch die Türken eine wichtige Rolle.
Kaiser Leopold I. hat am 14. Dezember 1676 in Passau vor dem Mariahilf-Bild seine dritte Frau Eleonore von Pfalz-Neuburg geheiratet. Als in den Türkenkriegen das Heer Sultan Mechmeds IV. unter Kara Mustafa Wien umzingelt, verläßt Kaiser Leopold seine Hauptstadt und


kommt mit Familie und Hofstaat am 17. Juli 1683 nach Passau. Von hier aus wirbt er um militärische Bündnispartner und leitet die Befreiung Wiens in die Wege. Täglich wallfahrtet er nach Mariahilf und betet vor dem Gnadenbild.
Inzwischen feuert in Wien der spirituelle Berater des Kaisers, der Kapuzinerpater Marco d’Aviano, die Truppen an. Der Ruf „Maria, hilf!“ wird zum Schlachtruf im Kampf gegen die Türken. Der Polenkönig Jan Sobieski III. stößt mit seinen Truppen in Eilmärschen nach Wien und übernimmt den Oberbefehl über die vereinigten christlichen Heere. „Maria hilf“ wird zur Tages-Parole und zum Schlachtruf in der Entscheidungsschlacht am 12. September 1683, einem Sonntag, als die Türken am Kahlenberg vernichtend geschlagen werden.
Heimatblatt für den Kreis Sternberg in Mähren (einschl. Neustädter Ländchen)
Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail sternberg@sudeten.de
■ Auf dem bisherigen Parkplatz in der Meedler Gasse wird ein neues Wohnhaus mit einigen Sozial- und Praxisräumen gebaut, ein neuer Parkplatz mit 35 Stellplätzen entsteht an der Kreuzung Meedler-/Wallgasse. Fertigstellung voraussichtlich 2026, das Wohnhaus wird vier Jahre später bezugsfertig, also 2030.
■ Am 1. Mai findet im Rahmen der Maifeierlichkeiten die Blumenmesse statt. Bereits zum 20. Mal werden von 8.00 bis 13.00 Uhr auf dem Masaryk-Platz ver-
❯ Ein Landsmann erinnert sich
schiedene Pflanzen, Keramik, Kerzen und Kunsthandwerk angeboten. Zum Zuhören und Tanzen wird die Band Gama spielen. Von 9.00 bis 11.30 Uhr findet im Hof des Gemeindeamtes am Masaryková náměstí 22 eine Präsentation der Arbeit der Rettungsstation aus Stránské statt. Für reichhaltige Erfrischungen ist gesorgt, Kinder können in der Hüpfburg hüpfen, Ponys reiten oder sich kostenlos schminken lassen. Veranstalter der Blumenmesse ist die Umweltabteilung des Gemeindeamtes Uničov.
Wenn das Frühjahr nahte, war die Freude groß. Denn dann machte der Opa mit ihm Ausflüge. Oft fuhr man mit dem Zug nach Markersdorf, um dann zum Bradelstein zu wandern. Manchmal stiegen sie aber eine Station früher aus, und zwar in Treublitz, um dann zum Berg Taubenbusch zu gehen. Zuvor mußte aber ein Aufenthalt im Bahnhofsrestaurant sein, denn dort gab es für
den „kleinen Mann“ eine gelbe Limonade, die damals 50 Heller kostete. Erst danach konnte die Wanderung auf den Berg Taubenbusch beginnen. Lang, lang ist‘s her. Das Bild der Gaststätte ist nur noch Erinnerung. Sowohl das Gebäude als auch die Bahnstation sind verlassen; gebaut wurde eine neue, einfache Station etwas weiter entfernt.

■ Mährisch Neustadt. Wir gratulieren allen, die im Mai Geburtstag feiern. Am
1. Herbert Spreitzhofer (Sternberger Gasse) zum 79. Geburtstag in Wien 23 (Österreich); Erika Schmitt/Pommer (Mönchgasse) zum 82. Geburtstag in Darmstadt; Siegfriede Schneidmüller/ Schertler (Wallgasse) zum 83. Geburtstag in Wolfhagen;
2. Elisabeth Wedel/Kaulich (Sternberger Gasse) zum 78. Geburtstag in Frankfurt; Dieter Kawan (Wallgasse) zum 81. Geburtstag in Kirchheimbolanden;
4. Gustav Kauer (Olmützer Gasse) zum 82. Geburtstag in Korb; Wolf-Dieter Koss (Flurgasse) zum 84. Geburtstag in Idstein;
5. Gerti Klapper/Frömel (Lange Gasse) zum 81. Geburtstag in Weilmünster;
6. Ursula Schmitt/Rabenseifner (Müglitzer Gasse) zum 84. Geburtstag in Kelkheim;
8. Roland Knödel (Goeblgasse) zum 82. Geburtstag in Frankfurt am Main;
9. Hans-Dieter Mauler (Müglitzer Gasse) zum 80. Geburtstag in Wien (Österreich);
11. Helga Anderlitschka (Sternberger Gasse) zum 84. Geburtstag in Weilmünster;
❯ Vor 100 Jahren wurde das erste Kino eröffnet
Von jedem Platz aus gute Sicht

Gerne hätte ich ein Bild vom Kino „Edison“ gezeigt, habe aber nur welche von der Salzgasse. Ihr wißt aber sicher, wo sich das Kino befand.
Anfangs wurden Filme als Unterhaltung angesehen nach den einfachen Wanderschauspiel-Truppen, Seiltänzern, Turnern bzw. Musikanten. Es konnte aber nur das aufgeführt werden, für das eine Lizenz vorhanden war, genehmigt vom zuständigen Statthalter, dem Ortshauptmann und der Gemeinde. Eine Linzenz war allerdings nicht leicht zu erhalten.
mals die erforderlichen Lizenzen, und im Juni 1914 war es endlich so weit.

Salzgasse.
kelt war, bekamen die deutschen Kinoproduktionen den Vorzug. Einer der ersten Reißer war der deutsch-französische Film des Regisseurs Carl Froelich über den Aufstand von Andreas Hofer „Die Tiroler in Waffen“ (diese 70minütige Darbietung ist dank des deutschen Filminstitutes DFI im Internet zu sehen).
20. Maria Kramer/Leiter (Herrengasse) zum 86. Geburtstag in Naumburg; 21. Josef Rehak (Untere Alleegasse) zum 94. Geburtstag in Münster; 25. Eugen Klein (Gr. Neustift) zum 83. Geburtstag in Mogendorf; Edith Senft/Klein (Gr. Neustift) zum 83. Geburtstag in Mogendorf; Susanne Rudersdorf/ Kaulich (Sternberger Gasse) zum 84. Geburtstag in Flörsheim;
26. Ulla Fahrenberg/Pollak (Stadtplatz) zum 83. Geburtstag in Bad Schwalbach; 27. Erika Keller/Fischer zum 84. Geburtstag in Planegg; 28. Liselotte Urban/Müller (Gr. Neustift) zum 86. Geburtstag in Wien 12 (Österreich); Konrad Heiger (Untere Alleegasse) zum 90. Geburtstag in Weinbach;
29. Margit Fetzer/Steigel (Flurgasse) zum 85. Geburtstag in Nersingen; Irmgard Haas/ Seuchter (Herrengasse) zum 91. Geburtstag in Gießen; 30. Ilse Benisch/Metelka (Flurgasse) zum 83. Geburtstag in Giengen. Sigrid Lichtenthäler Ortsbetreuerin
14. Ingrid Thacker/Kukule (Wallgasse) zum 90. Geburtstag in Michigan 49655-8375 (USA); Elisabeth Etz/Kauer (Kl. Neustift) zum 92. Geburtstag in Hohenstein-Born; 18. Johanna Gentsch/Ullrich (Schönberger Gasse) zum 87. Geburtstag in Wiesbaden; Irmgard Buntenbach/Maly (Goeblgasse) zum 93. Geburtstag in Berlin;
Während in der 2-MillionenStadt Berlin (entnommen der Statistik vom Januar 1907) schon 139 Kinos vorhanden waren, gab es in den großen Städten der Habsburger Monarchie nur zehn (in Brünn und Prag jeweils nur eines). Die Zahl der Ersuche und Bewilligungen war niedrig. Vor dem Ersten Weltkrieg stieg die Zahl der Wiener Kinos auf 126, die der Berliner auf 227, was jedoch mehr war als in ganz Tschechien, Mähren und Schlesien, wo es über zehn Millionen Einwohner gab. In Österreich-Ungarn mit 45 Millionen Einwohnern gab es laut Statistik 1913 nur 833 Kinos, in Deutschland, wo 56 Millionen Menschen lebten, war die Zahl dreimal so hoch.
In dieser Zeit wurden auch ein Kino in Olmütz und eines in Mährisch Neustadt eröffnet. In Olmütz 1911 das Kino Urania und drei Jahre später das Kino Edison in Mährisch Neustadt. Das hatte der vermögende Eigentümer von Häusern und Wirtschaften, Anton Schubert, in die Wege geleitet. Er erbat sich da-

Perlmutt war immer sehr wertvoll, es diente sogar schon als Zahlungsmittel. Josef Zampach, ein Knopfarbeiter aus Serowitz/ Südmähren, arbeitete in Wien an einer Knopfdrehbank. Er brachte 1860 entsprechendes Handwerkszeug in seinen Heimatort Serowitz/Südböhmen, und schon fünf Jahre später arbeitete man hier an 300 Drehbänken. Das war der Beginn der Perlmutt-
Obwohl zum Betriebsbeginn des Mährisch Neustädter Kinos der Krieg ausbrach, wurde am Dienstag, 15. Dezember, der Ablauf geprobt und drei Tage später, am 18. Dezember 1914, offiziell eröffnet. Der Eingang zum Kino Edison war in der Salzgasse. Der Besucher trat in den Empfangsvorsaal, wo sich die Kasse befand und eine Durchreiche, bei der man sich Kaffee und eine Kleinigkeit zum Essen holen konnte. Von hier ging es in den Saal, in dem 260 Klappstühle so aufgestellt waren, daß man von jedem Platz aus gut sehen konnte. Fünf Deckenleuchten sorgten für eine gute Beleuchtung. Täglich wurden eine Kinovorstellung um 18.00 Uhr und eine um 20.00 Uhr geboten, an Sonn- und Feiertagen zusätzlich eine Nachmittags-Vorstellung. Diese war für die Jugend bis 16 Jahre gedacht, für die bei den anderen Vorstellungen der Eintritt verboten war. Vor dem Hauptfilm konnten die Zuschauer die Wochenschau sehen und das Neueste von den europäischen Kriegsschauplätzen. Das Interesse der Zuschauer war groß. Der Gewinn der ersten ausverkauften Vorstellungen des Edison-Kinos wurde dem Roten Kreuz überlassen. In Anbetracht der Tatsache, daß nach Kriegsausbruch keine französischen, englischen, russischen und später auch italienischen Filme importiert werden durften und die österreich-ungarische Filmindustrie nicht stark entwik-
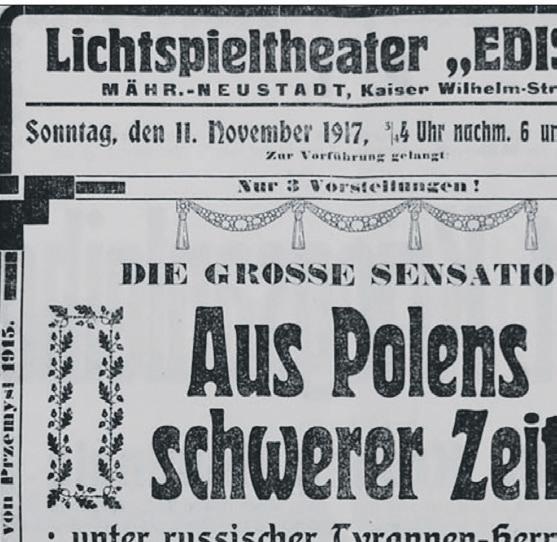
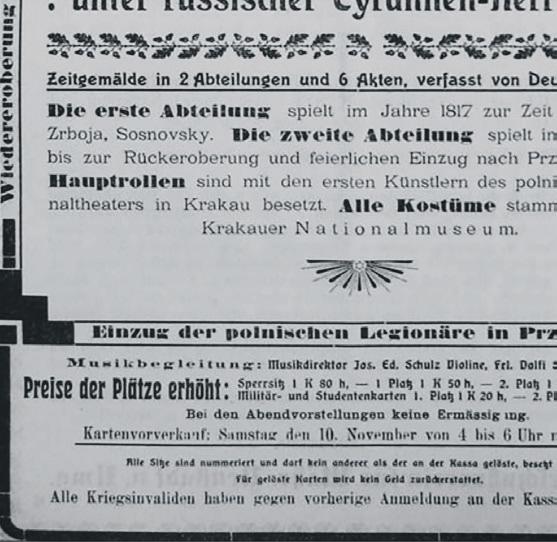
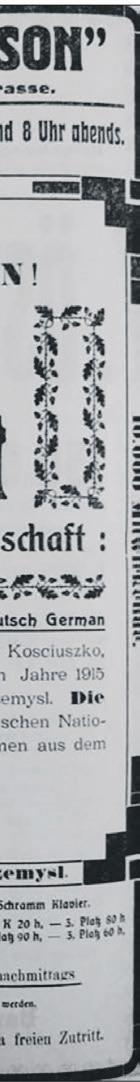
Im Jahr 1917 kostete der Eintritt zu den besten Plätzen im Edison-Kino 1 Krone und 80 Pennys, Soldaten und Studenten erhielten eine Ermäßigung für die Nachmittags- und Vorabendvorstellungen, Kriegsinvaliden hatten freien Eintritt.
Anfang Februar 1915 mußten die Vorstellungen des Mährisch Neustädter Kinos Edison schon nach acht Wochen wegen einer Pockenepidemie eingestellt werden; neue Darbietungen begannen am 14. März. Zu den beliebten Filmen gehörte zum Beispiel
„Ivanhoe“, gezeigt am Ostersonntag. Populär war auch der Kriegsfilm „Der Traum eines österreichischen Reservisten“, zu dem in Wien eine Filmmusik komponiert wurde. Im Mährisch Neustädter Kino spielte man sie mit Orchester unter der Leitung des Ortskapellmeisters Josef Eduard Schulze. Dies war jedoch eine Ausnahme, in der Regel mußten die Zuschauer sich mit Klavierbegleitung zufrieden geben. Auch Detektivfilme („Der stille Tod der Damen“), Vaterlandsfilme („Der Landwehrmann“, „Wir müssen siegen“), Lustspielfilme („In Zivil“, „Wollen Sie Ihre Tochter verheiraten?“, „Detektivin Lilli“) oder Horrorfilme („Die geheimnisvolle Mumie“) wurden gezeigt. Der Besuch des Kinos wurde ein fester Bestandteil im Leben der Bürger. Das Kino Edison spielte auch nach dem Krieg, die Tschechen eröffneten 1923 zusätzlich das Kino Universum in der neuen Turnhalle. Der Hallensaal wurde allerdings mehrfach genutzt und war qualitativ dem Schubert-Kino Edison unterlegen. In den 1930er Jahren entstand das deutsche Volkshaus am Kudlichplatz mit dem Kino Kosmos. Nach dem Krieg fanden die Kinovorstellungen im Katholischen Haus statt, dann wurde das Kino Druzba (=Freundschaft) errichtet, das jetzt sein 40. Bestehen feiert. Nikola Hirnerova
Aus „uničovský zpravodaj“/ „Mährisch Neustädter Berichterstatter“, übersetzt und leicht gekürzt von Sigrid Lichtenthäler.
❯ Die Perlmuttfabrik in der Müglitzer Gasse Flußmuscheln als Rohmaterial
Produktion in Südmähren, und schon im Jahre 1897 entstand auch in Mährisch Neustadt eine Perlmuttfabrik, die auch Borten herstellte.
Produziert wurde in einem Neubau in der Müglitzer Gasse 21; die Firma gehörte der Zukkerfabrik. Hauptsächlich wurden Knöpfe gefertigt, aber auch Schnallen. Es waren Produkte einfacher Qualität, als Rohmaterial dienten Flußmuscheln und importierte Südseemuscheln. An Drehbänken mit Fußantrieb bohrte man mit einem Kreisbohrer Löcher in die Muscheln, da-
nach wurden sie in eine Mischmaschine mit vulkanischem Staub gelegt, damit die Knöpfe Glanz bekamen. Die Mährisch Neustädter Knöpfe waren beliebt, jedoch endete Anfang des Ersten Weltkrieges die Perlmuttproduktion, weil dort nur Männer tätig waren, die dann zur Front mußten. Nach dem Krieg wurde in Mährisch Neustadt mit Perlmutt nicht mehr gearbeitet, und auch die Bortenherstellung endete 1930. Im Fabrikgebäude Müglitzer Gasse 21 richtete man Wohnungen
ein und später Büros. Etwa 1970 wurde das Gebäude abgerissen. Nach Angaben eines Neustädter Heimatforschers.
