





Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

❯ Ministerin Ulrike Scharf


„Diese Herzlichkeit, diese Begeisterung, dieses Miteinander sind ansteckend. Es ist deshalb eine große Freude für mich, am Sudetendeutschen Tag teilzunehmen“, sagt Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf. Im Sudetendeutschen Gespräch erklärt die Staatsministerin außerdem, warum es wichtig ist, weiter an die Vertreibung zu erinnern, und welche politischen Themen sie im Vorfeld der Europawahl umtreiben. Seite 3 ❯ 74. Sudetendeutscher Tag von Freitag, 17. bis P ngstsonntag, 19. Mai in Augsburg







Jede Region innerhalb der historischen Länder Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien ist geprägt von einer reichen Kultur, unverwechselbaren Traditionen und Bräuchen, die von Sudetendeutschen bis heute liebevoll gepflegt, in den Formen der Zeit fortentwickelt und an kommende Generationen weitergegeben werden.






D74. SUDETENDEUTSCHER TAG 17. BIS 19.MAI 2024 IN AUGSBURG Sudetendeutsche und Tschechen –miteinander für Europa
iese Vielfalt der sudetendeutschen Heimat zwischen Böhmerwald und Altvater kommt am Sudetendeutschen Tag besonders deutlich durch die rund hundert Informations-
stände zum Ausdruck, an denen sich verschiedene Organisationen und Städte mit ihren tschechischen Partnern präsentieren. Am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag haben die Besucher zwischen 8.00 und 18.00 Uhr auf der Messe Augsburg in den Hallen 6 und 7 sowie im Foyer Gelegenheit, die einzigartigen Angebote zu entdecken, von der Ahnenforschung über die Lokalgeschichte bis hin zu handwerklichen Präsentationen. Das große Programm zum 74. Sudetendeutschen Tag lesen Sie in dieser Ausgabe auf den Seiten 6 bis 9.


Die Informationsstände sind jedes Jahr auf dem Sudetendeutschen
einer der Besuchermagneten.
„Einer der glücklichsten Tage in der europäischen Geschichte“
Montag, der 3. Mai 2004 war einer der glücklichsten Tage in der europäischen Geschichte und einer der schönsten in meinem Leben. Wir standen auf dem Vorhof des Europäischen Parlamentes in Straßburg, unweit des Friedensnobelpreisträgers und ehemaligen polnischen Staatspräsidenten Lech Wałęsa.

Die von ihm gegründete und auch von der Paneuropa-Union jahrelang unterstützte Freiheitsbewegung „Solidarność“ hatte maßgeblich dazu beigetragen, die kommunistische Gewaltherrschaft im ehemaligen Ostblock sowie dann im zerfallenden Zwangsstaat Jugoslawien zu Fall zu bringen – gemeinsam mit den mutigen Bürgerrechtlern und Volksmassen in den jahrzehntelang unterdrückten Ländern, mit Papst Johannes Paul II und mit Ronald Reagan. Auch wir hatten mit dem Paneuropa-Picknick vom 19. August 1989 an der österreichisch-ungarischen Grenze – das diesen Sommer 35 Jahre her ist – unseren Anteil daran.
15 Jahre später trat die EUMitgliedschaft der drei baltischen Staaten, Polens, der Tschechischen und der Slowakischen Republik, Ungarns und Sloweniens in Kraft, hinzu kamen Zypern und Malta, die zwar niemals ein kommunistisches Regime erleiden mußten, aber dennoch ein schweres Schicksal.
Bei der Straßburger Feier 2004 waren alle, die dabei sein durften, zutiefst ergriffen. Die Parlamentspräsidenten der neuen Mitgliedstaaten übergaben ihre jeweilige Nationalflagge dem Freiheitshelden Wałęsa. Er reichte sie an die in Straßburg stationierte erste echte europäische Militäreinheit, das multinationale Eurokorps, weiter, welches sie dann auf Masten hißte, die in der ehemaligen Danziger Lenin-
Werft, in der Wałęsa als junger Elektriker den Aufstand gegen die Sowjetherrschaft begonnen hatte, gefertigt worden waren. Auch die Europafahne wehte, und die Europahymne erklang.
Tschechischer Vertreter bei der Zeremonie war übrigens der Senatspräsident und frühere Bürgerrechtler Petr Pithart, der gemeinsam mit zwei anderen Regime-Gegnern in der kommunistischen Zeit unter dem Pseudonym „František Jedermann“ eindrucksvoll und verbotenerweise den Verfall der Kulturlandschaft in den sudetendeutschen Vertreibungsgebieten beschrieben hatte.
Pithart und mir – wir sind bis heute gute Freunde – war durchaus bewußt, daß der dringend erforderliche und uns alle begeisternde Prozeß der EUOsterweiterung durchaus auch eine gewisse Doppelbödigkeit besaß. Etliche von uns hatten bei der Abstimmung über den tschechischen Beitritt ein kritisches Votum abgegeben – auch ich, obwohl ich viele Jahre lang darauf hingearbeitet hatte, daß das Land meiner Vorfahren Teil der Gemeinschaft freier Völker werden sollte. Wir wollten aber darauf hinweisen, daß noch einiges geschehen mußte, um einen echten Dialog zwischen Tschechen und Sudetendeutschen herbeizuführen.
Heute ist er Gott sei Dank in vollem Gange, und auch die EUErweiterung insgesamt, die später noch um Rumänien, Bulgarien und Kroatien ergänzt wurde, ist ein einzigartiger Erfolg. Man stelle sich vor, die Putin‘sche Gewaltherrschaft würde bis an den Böhmerwald reichen! Tschechen, Sudetendeutsche und unser Schirmland Bayern bilden heute das Herz des freien Europa, das in seiner Einheit und Freiheit wieder gefährlich bedroht ist.

Premierminister Petr Fiala auf der Konferenz „20 Jahre Tschechische Republik in der EU: Eine Vision für ein erweitertes Europa“ in Prag, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede hielt. Foto: Vlada ČZ
❯ Tschechiens Premierminister Petr Fiala zu 20 Jahren EU-Mitgliedschaft
„Wir sind ein viel reicheres Land“
Mit der Konferenz „20 Jahre Tschechische Republik in der EU: Eine Vision für ein erweitertes Europa“ hat das politische Prag das Jubiläum gewürdigt. Unter den Festrednern war neben Staatspräsident Petr Pavel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) auch Tschechiens Premierminister Petr Fiala, der nicht nur Bilanz zog, sondern auch seine Zukunftsvision skizzierte.
Jahrestage seien in der Regel ein Anlaß zur Rückbesinnung. Dies habe auch in diesem Fall durchaus seine Berechtigung, denn die EU habe die Tschechische Republik erheblich verändert, sagte Fiala und stellte fest: „Die EU-Mitgliedschaft hat dazu beigetragen, daß wir heute ein
viel reicheres Land sind. Die Mitgliedschaft gibt uns auch Sicherheitsgarantien und verankert uns fest im Westen, wo wir historisch gesehen immer hingehört haben.“ Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mache unter anderem deutlich, daß die Energiesicherheit von entscheidender Bedeutung sei, so Fiala: „Die europäischen Länder reagieren darauf mit der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, aber auch mit Investitionen in die Kernenergie und in die Entwicklung der Kerntechnik. Dies ist eine Priorität für die Tschechische Republik. Und wir wollen auch unsere Bemühungen verstärken, wirtschaftlich erschwingliche kleine Kernreaktoren zu entwickeln.“
Ein weiteres Element der europäischen Sicherheit sei die Un-
abhängigkeit in kritischen Sektoren, wie bei Arzneimitteln, und bei strategischen Rohstoffen und Technologien, wie Mikrochips. Fiala: „Eine weitere Sicherheitsdimension, die wir nicht unterschätzen dürfen, ist das Problem der illegalen Migration, das seit zehn Jahren ganz Europa unter Druck setzt. Dieses Problem wird nicht von alleine verschwinden, und es ist gut, daß die Mitgliedstaaten nach einer vernünftigen Lösung suchen.“ Der Migrationspakt sei ein „erster wichtiger Schritt“, sagte der Regierungschef und stellte klar: „Wir sind jedoch erst auf halbem Wege, und das wird nicht ausreichen. Eine gemeinsame europäische Lösung für die illegale Migration ist notwendig, aber sie muß mutiger sein und tiefer gehen.“ Torsten Fricke
Unterwegs in der Tschechischen Republik stand SL-Büroleiter Peter Barton neulich am Bahnsteig des Bahnhofs von Teschen (Český Těšín), der am östlichsten gelegenen Stadt Tschechiens. In den letzten zehn Jahren sank der Anteil der ethnischen Polen in dieser Stadt zwar von 16 auf weniger als 14 Prozent, dank des intensiven Engagements der Vertreter der polnischen Minderheit gelang es dennoch, am Teschener Bahnhof eine Tafel mit polnischen Ortsnamen anzu-
bringen. Dagegen regte sich in der Vergangenheit bei der Bevölkerung einiger Gemeinden anfangs Widerstand, so wurden etwa manche der polnischen Ortstafeln beschädigt. Der Streit hatte sich nach einiger Zeit glücklicherweise gelegt, zumindest fand Barton im Internet keine weiteren Nachrichten mit diesem Inhalt. Die durch die Grenze zu Polen getrennte Stadt Teschen ist inzwischen zum Zentrum der polnischen Minderheit in der ČR geworden, deren sinkender Anteil in der Bevölkerungszahl konnte jedoch nicht gestoppt werden.

❯ Botschafter Tomáš Kafka im Gespräch mit Prof. Dr. Bernhard Schlink über das deutsch-tschechische Verhältnis
„Die
In der Bayerischen Landesvertretung in Berlin haben die deutschen Freunde der Olga-HavelStiftung einen Dialog zwischen dem tschechischen Botschafter in Deutschland, Tomáš Kafka, und dem Schriftsteller und Universitätsprofessor Dr. Bernhard Schlink veranstaltet.
Rund 100 Interessierte fanden sich am 16. April zu diesem Gespräch zwischen dem Erfolgsautor Schlink und seinem Übersetzer in die tschechische Sprache, Tomáš Kafka, ein. Beide verbindet gemeinsame literarische Arbeit auch an einem noch nicht publizierten Theaterstück über Mitteleuropa.
Kafka umschrieb das Thema des Abends mit „Die Zeitenwende und unsere Zeitenwenden“. Es war also ein Abend über die Zeitläufe und ihre Interpretation durch die beiden Diskutanten sowie über das deutsch-tschechische Verhältnis.
Kafka erinnerte an die erste Zeitenwende, die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, die Schlink schon in den 1980er Jahren, aber auch im „Vorleser“ (1995) zum Ausgangspunkt von fiktionalen Geschichten machte, die die Fragen des Umgangs mit den Verbrechen der Nazizeit in Generationenkonflikten aufgriffen.
„Die Zeitenwende von 1989 habe ich nicht nur damals als Befreiung erlebt, sondern ich sehe sie immer noch so. Und die deutsche Einigung ist eines der großen schönen Ereignisse meines Lebens“, beschrieb Schlink die nächste wichtige Zeitenwende seines Lebens. „Und jetzt noch, wenn ich mit dem Fahrrad durch das Brandenburger Tor fahren kann. Immer wieder denke ich, toll, daß das möglich geworden ist. Ich habe immer an die Wiedervereinigung geglaubt. Und 1989/90 war für mich die Erfüllung dieser Hoffnung, dieses Traumes, den ich immer hatte. Und das war unter den vielen kommenden Zeitenwenden in meinem Leben seit 1989 die unbestreitbar beglückendste, befreiendste und schönste.“
Dann kam Kafka auf den Er-



PRAGER SPITZEN
Arbeitslosenquote nur bei 2,9 Prozent
Mit 2,9 Prozent haben Tschechien und Polen die niedrigste Arbeitslosenraten innerhalb der EU, hat die EU-Statistikbehörde Eurostat für März errechnet. Europaweit betrug die Arbeitslosenrate durchschnittlich 6,0 Prozent. Die höchsten Werte hatten Spanien mit 11,7 Prozent und Griechenland mit 10,7 Prozent.
Gewerkschaften gehen auf die Straße
Die tschechischen Gewerkschaften wollen am 21. Mai gegen die von der Regierung geplanten Änderungen im Arbeitsrecht und gegen die Rentenreform demonstrieren. Zu dem Protest hat der größte hiesige Dachverband, die Böhmisch-Mährische Konföderation der Gewerkschaftsverbände (ČMKOS) mit 270 000 Mitgliedern, aufgerufen. Unter anderem wenden sich die Arbeitnehmervertreter damit gegen die Möglichkeit von Entlassungen ohne Angabe von Gründen und gegen die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters.
Überraschung beim Prag-Marathon
Zwei Außenseiter haben am Sonntag den Marathon in Prag dominiert. Bei den Männern siegte Lemi Berhanu Hayle aus Äthiopien, der nach 2:08:41 Stunden ins Ziel kam. Bei den Frauen gewann die Äthiopierin
betonte der Senatsvorsitzende Miloš Vystrčil (ODS) in seiner Rede zum 79. Jahrestag des Aufstandes. „Unser Volk und unsere Soldaten zeigten damals, daß sie das Münchner Abkommen und die Kapitulation zu keinem Moment akzeptiert hatten“, so Vystrčil weiter. Auch die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), betonte das Heldentum der damaligen Aufständischen. Zudem schlug die Politikerin in ihrer Ansprache die Brücke zum heutigen tschechischen Engagement für die Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression: „79 Jahre nach dem Prager Aufstand beweisen wir Tschechen der freien Welt mit unserer Initiative zum Kauf von Munition, daß wir Führung ergreifen und andere mit eigenen positiven Beispielen inspirieren können.“
Daniel Raiskin wird Chefdirigent



folgsroman von Schlink zu sprechen. „Der Vorleser“ 1995 schlug auch in Tschechien enorm ein. Kafka hatte den Roman selbst gelesen, schrieb einen Essay in einer tschechischen Wochenzeitung. Und innerhalb einer Woche meldete sich ein Herausgeber, der den Roman unbedingt veröffentlichen wollte. So kam Kafka unter enormen Druck, das Buch schnell zu übersetzen. Und in dem Interesse zeigte sich auch in Tschechien die Konstellation des Romans als eine sehr attraktive. Man urteilte, die ganze Wahrnehmung des 20. Jahrhunderts lasse sich auch anders deuten. Das Private ist mindestens genauso wichtig wie das gesamtpolitische. Davor hatten sich vor 1989 sehr viele Menschen auch in Tschechien gefürchtet. Man
mußte damals Partei ergreifen, schwarz oder weiß. Doch die grauen Geschichten seien doch das interessante.
Dann streifte das Gespräch die folgenden Zeitenwenden. Besonders intensiv widmete sich Schlink den Terroranschlägen vom 11. September 2001, die Amerika, wo Schlink einen Teil des Jahres auch lebt, im Mark getroffen haben. Dies habe, so Schlink, bis heute auch starke Auswirkungen auf Europa, denn das Interesse an Europa sei in Amerika auf dem Rückzug.
Den 22. Februar 2022 charakterisierte Kafka als ein Ergebnis, daß der russische Präsident Wladimir Putin in der Kompromißkultur des Westens eine Schwäche sah. Putin habe sich dadurch ermutig gefühlt, die Welt nach
Vor rund hundert Gästen diskutierten Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka und Prof. Dr. Bernhard Schlink über die Zeitenwenden und das deutsch-tschechische Verhältnis. Fotos: Ulrich Miksch
seinem Gusto zu gestalten, analysierte Kafka und sagte: „Das ist nun aber nicht nur ein politischer Konflikt, sondern eine politische Katastrophe. Und was das Schlimmste ist: Diese Katastrophe multipliziert sich.“
Auf die Frage aus dem Publikum, warum die tschechische Regierung nicht schon 2014 interveniert habe, als Rußland völkerrechtswidrig die Krim annektierte, antwortete Kafka, man sei damals zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen: „Ein Jahr nach der Präsidentenwahl, die zugunsten Miloš Zeman ausging, waren wir zu defensiv aufgestellt. Das hat sich grundlegend geändert.“
Die Veranstaltung, die immer mit einem Spendenaufruf für die Projekte der Olga-Havel-Stiftung in Tschechien verbunden ist, unterstützte diesmal das Projekt „Feriencamps für junge Roma“, wo begabte Roma, die die Ober- und Hochschulen besuchen, vielfältig unterstützt werden. Ulrich Miksch
❯ SLÖ-Ehrenobmann und VLÖ-Vizepräsident ist am 12. April im Alter von 84 Jahren verstorben Abschied von Gerhard Zeihsel


Die Landsleute verneigen sich vor Gerhard Zeihsel: Der am 12. April verstorbene SLÖ-Ehrenobmann und VLÖ-Vizepräsident ist am vergangenen Freitag auf dem Wiener Zentralfriedhof zu Grabe getragen worden.
Nach der Eröffnung der Trauerfeier in der großen Halle des Wiener Zentralfriedhofs durch hinführende Worte von Prälat Karl Rühringer, ehemaliger Domdekan zu Sankt Ste-
phan, und Fürbitten für den Verstorbenen durch den VLÖ-Vorstand würdigten unter anderem VLÖ-Präsident Norbert Kapeller, SLÖ-Bundesobmann Dr. Rüdiger Stix, Bayerns SL-Landesobmann Steffen Hörtler und Dr. Reinfried Vogler, Ehrenpräsident der SL-Bundesversammlung, in persönlichen Worten das große Engagement des Verstorbenen und sprachen Witwe Reinhilde sowie der ganzen Familie ihr Beileid aus.
Bedatu Hirpa Badane in 2:23:41 Stunden das Rennen über 42,195 Kilometer. Insgesamt hatten sich über 8000 Läufer aus knapp einhundert Ländern zum Start gemeldet. Das Rennen war für die Profis die letzte Möglichkeit, sich noch für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.
Erinnerung an den Prager Aufstand
In Tschechien ist am Sonntag an den Beginn des Prager Aufstandes gegen die deutsche Besatzung am 5. Mai 1945 erinnert worden. Die Kämpfe auf den Prager Barrikaden im Mai 1945 seien ein grundlegendes Ereignis der tschechischen Geschichte,
Die Janáček-Philharmonie in Ostrau erhält zur Saison 2026/27 einen neuen Chefdirigenten. Den Posten übernimmt der aus Rußland stammende Daniel Raiskin, der derzeit musikalischer Leiter des Symphonieorchesters im kanadischen Winnipeg ist. Er ersetzt den scheidenden Chefdirigenten Wassili Sinaiski. Raiskin stammt aus St. Petersburg und ist vor 23 Jahren aus Rußland ausgewandert. Er halte die Invasion in die Ukraine für barbarisch, hatte der 54jährige schon vor einiger Zeit gesagt. Daniel Raiskin hat unter anderem in Freiburg studiert und leitete von 2005 bis 2016 als Chefdirigent die Rheinische Philharmonie Koblenz. Mittelalterliche Gräber entdeckt
Archäologen haben im Garten der Jan-Hus-Kirche in Ungarisch Brod mittelalterliche Gräber entdeckt. Laut den Experten vom Slowakischen Museum befand sich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit rund um die Kirche ein weitläufiger Friedhof. Während der jetzigen Untersuchungen habe man bisher nur die jüngsten Gräber geöffnet, sagte Tomáš Chrástek, der die Abteilung Archäologie des Museums leitet.
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Zum dritten Mal nach 2022 und 2023 wird Ulrike Scharf als Schirmherrschaftsministerin am Sudetendeutschen Tag teilnehmen. Im Sudetendeutschen Gespräch erklärt die Staatsministerin, warum ihr dieser Termin an Pfingsten so wichtig ist, wie der Freistaat Bayern die Vertriebenen auch in Zukunft unterstützt und welche Themen sie derzeit umtreiben.
Frau Ministerin, beginnen wir mit der Bundespolitik. Die Bundesregierung hat das „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ in „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa“ umbenannt. Welche Folgen befürchten Sie durch die Streichung des Begriffs „der Deutschen“?
Ulrike Scharf: Die Bundesregierung hat mal wieder für große Irritation gesorgt. Wenn man diese wesentliche Begrifflichkeit aus dem Namen streicht, ist zu befürchten, daß mittelfristig auch die finanziellen Mittel für diese wichtige und völkerverbindende Kulturarbeit gekürzt werden. Das werden wir als Freistaat Bayern nicht hinnehmen. Wir haben deshalb eine Bundesratsinitiative gestartet. Und ich bin überzeugt, daß die anderen Bundesländer unsere Einschätzung teilen.
Seit Ende des Zweiten Weltkrieges und der Vertreibung von weit über zehn Millionen Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa sind fast acht Jahrzehnte vergangen. Was entgegnen Sie Stimmen in Berlin, den Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes, in dem die Vertriebenenpolitik und Kulturförderung fest verankert sind, zu ändern oder gar abzuschaffen?
Scharf: Der Paragraph 96 ist weitaus mehr als eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Er ist zum einen eine moralische Verpflichtung gegenüber allen Opfern von Flucht und Vertreibung und deren Nachkommen. Unsere Gesellschaft hat den Vertriebenen viel zu verdanken. Es waren Vertriebene, die maßgeblich am Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Deutschland beigetragen haben. Diesen Respekt gegenüber den Vertriebenen zeigt die Staatsregierung seit Jahrzehnten, was bereits 1954 unser damaliger Ministerpräsident Hans Ehard mit der Übernahme der Schirmherrschaft über die Sudetendeutschen deutlich gemacht hat. Die Sudetendeutschen sind der Vierte Stamm Bayerns. Diese enge Partnerschaft mündet seitdem in vielen langfristig angelegten Projekten, wie dem Sudetendeutschen Museum in München als einem Leuchtturmprojekt bayerischer Kulturpolitik. Ich bin deshalb auch sehr froh, daß wir diese enge Verbindung in unserem aktuellen Koalitionsvertrag in Bayern fortschreiben. Zum anderem ist diese Kulturarbeit eine Chance, Brücken für ein friedliches, geeintes Europa zu bauen und zu erhalten – insbesondere über die Sudetendeutschen zwischen Bayern und Tschechien. Das bayerischtschechische Verhältnis ist voller Leben! Das kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis intensiver Kontaktpflege und des Willens auf beiden Seiten zur Verständigung. Ich war kurz nach meinem Amtsantritt gemeinsam mit Bernd Posselt in Tschechien und habe selbst erlebt, wieviele Türen er mit den Sudetendeutschen geöffnet hat. Sie waren auch die erste Ministerin, die an den Marienbader Gesprächen des Sudetendeutschen Rates teilgenommen hat. Scharf: Das war eine bewußte Entscheidung. Unser Ziel ist es, dieses friedliche Miteinander, die gute Nachbarschaft, durch persönliche Kontakte und den politischen Austausch auf den unterschiedlichsten Ebenen immer wieder zu unterstreichen und zu fördern.
� Interview mit Ulrike Scharf, Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen Volksgruppe

� Zur Person: Ulrike Scharf
� Geboren am 16. Dezember 1967 in Erding, ein Sohn
� Ausbildung zur Bankkauffrau und Studium der Betriebswirtschaftslehre zur Diplom-Kauffrau (FH)
� 1992 bis 2014: selbstständig im familieneigenen, mittelständischen Unternehmen
� Seit 2002: Mitglied im Erdinger Kreistag
� 2006 bis 2008: Mitglied des Bayerischen Landtags
� Seit 2011: Mitglied im CSU-Parteivorstand
� Seit 2013: Mitglied des Bayerischen Landtags
� 2014 bis 2018: Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz
� Seit 2019: Landesvorsitzende der Frauen-Union Bayern
� Seit 23. Februar 2022: Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales
� Seit 8. November 2023: weitere stellvertretende Ministerpräsidentin
Vor wenigen Tagen, beim Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Prag, hat der tschechische Präsident Petr Pavel erneut appelliert, Deutschland und Tschechien sollten gemeinsam die Grenzregionen stärken.
Scharf: Der bayerisch-tschechische Grenzraum liegt im Herzen Europas. Und für Bayern ist Tschechien ein sehr wichtiger Partner. Die Staatsregierung hat deshalb mehrere Projekte gestartet. Das Miteinander in der Region ist ganz entscheidend für den Erfolg und die Verständigung. Ich möchte hier auch den Nationalpark Bayerischer Wald und Šumava auf tschechischer Seitehervorheben. Wie wichtig ist es, die Sprachkompetenz zu verbessern?
Scharf: Wir waren alarmiert, als es in Tschechien Überlegungen gab, den Deutschunterricht an den Schulen zu streichen. Gott sei Dank konnte dies verhindert werden. Überall, wo es Sprachbarrieren gibt, gibt es auch Verständigungsprobleme. Sprache verbindet uns. Wir müssen deshalb die Sprachkompetenz auf beiden Seiten fördern. Als Schirmherrschaftsministerin sind Sie an Pfingsten zum dritten Mal Ehrengast auf dem Sudetendeutschen Tag. Mit welcher Erwartung fahren Sie nach Augsburg? Scharf: Diese Herzlichkeit, diese Begeisterung, dieses Miteinander sind ansteckend. Es ist deshalb eine große Freude für mich, am Sudetendeutschen Tag teilzunehmen – auch wegen der wunderschönen Trachten, aber vor allem wegen der vielen persönlichen Begegnungen. Mit der Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend, dem Sudetendeutschen Karls-Preis und dem Heimatabend am Samstag sowie der Festveranstaltung am Sonntag, an der auch unser Ministerpräsident teilnehmen wird, ist
diese Wochenende geprägt von Höhepunkten. Mich bewegt zutiefst, daß auf dem Sudetendeutschen Tag Menschen der Erlebnisgeneration dabei sind, die damals über Nacht ihre Heimat mit allem Hab und Gut verloren und nur ein paar Jahre später in der Charta der Heimatvertriebenen Rache und Haß abgeschworen haben und jetzt mit vielen Tschechen gemeinsam Pfingsten verbringen.
Politik fordert immer den ganzen Menschen. Gerade als Ministerin sind Sie ständig unterwegs und haben kaum Zeit für sich selbst. Was hat Sie bewogen, von der freien Wirtschaft in die Politik zu wechseln?
Scharf: Die Wurzeln liegen wohl in meiner Schulzeit. Ich war Klassen- und Schulsprecherin. Diese Motivation, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, ist also bei mir früh angelegt. Die Landespolitik ermöglicht es, aktiv mitzugestalten. Ich möchte das Leben für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern besser machen. Das treibt mich an. Sie sind Frauenbeauftragte in der Staatsregierung und Landesvorsitzende der Frauen-Union, der mit rund 22 000 Mitgliedern größten Arbeitsgemeinschaft der CSU. Wie steht es um die Gleichberechtigung in der Politik?
Scharf: Wir sind immer noch zu wenig Frauen in der politischen Verantwortung, obwohl wir die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Das geht von der kommunalen Ebene über die Landespolitik bis in die Bundespolitik. Zur CSU: Wir sind nur dann eine Volkspartei, wenn auch wir Frauen entsprechend mitentscheiden. Als Frauen-Union ist es deshalb unser primäres Ziel, die gleichberechtigte Teilhabe zu fördern.
Woran liegt es, daß es zu wenig Frauen in der Politik gibt? Sind es die Männer, die blockieren? Oder haben viele Frauen eine andere
Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf auf dem Sudetendeutschen Tag 2022 in Hof mit den Wischauern Rosina Reim, Monika Ofner-Reim, Gernot Ofner und Burgl Schmiedt. Foto: Torsten Fricke
Lebensplanung?
Scharf: Hier kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen ist die CSU historisch gewachsen eine Männer-Partei. Und es dauert, bis sich alte Sichtweisen auf allen Ebenen ändern. Zum anderen trauen es sich viele Frauen auch oft weniger zu oder haben Zweifel, ob sie Familie und Politik miteinander vereinbaren können. Wir haben deshalb ein Mentoring-Programm gestartet. Ein Jahr lang begleiten und unterstützen wir Neueinsteigerinnen. Ich kann mich noch gut an meine Anfangszeit im Kreistag erinnern. Kein Mensch hat mir damals gezeigt, wie man einen Antrag schreibt.
Apropos Schreiben: Wie stehen Sie zum Gendern?
Scharf: Ich lege großen Wert darauf, daß in einer Rede beide Geschlechter begrüßt werden. Überhaupt nicht ausstehen kann ich es, wenn sich im Landtagsplenum ein Abgeordneter als gewählter Vertreter der Bürgerinnen und Bürger ans Rednerpult stellt und in der Begrüßung nur die „Kollegen“ anspricht. Das stört mich wahnsinnig, weil wir Kolleginnen auch da sind. Im Schriftdeutsch halte ich allerdings das Gendern mit Sternchen, dem große I oder anderen Zeichen für kontraproduktiv, weil der Text damit nicht barrierefrei ist. Gerade für mein Ministerium ist es ein großes Ziel, daß alle Menschen teilhaben und die Texte verstehen können. Wir haben deshalb auch eine Webseite unter dem Namen einfach-finden. bayern.de gestartet, über die alle Inhalte der Staatsregierung in einfacher Sprache sowie in Gebärdensprache abrufbar sind. Politik zu machen bedeutet immer, auch mit Konflikten und Niederlagen umgehen zu müssen. Sie waren ab 2014 eine hochgeschätzte Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz, bis Ministerpräsident Markus Söder 2018 als Nachfolger von Horst Seehofer Sie überraschend nicht für sein erstes Kabinett nominiert hat. Wie groß war die Enttäuschung? Scharf: Natürlich war das ein sehr bitterer Moment. Aufgefangen haben mich damals meine Familie und meine Freunde. Als Abgeordnete habe ich aber weiterhin eine große Verantwortung gegenüber meinen Wählerinnen
Scharf: Fluch und Pflicht. Es ist aber eine tolle Möglichkeit der politischen Kommunikation mit Menschen, die man sonst nicht erreicht. Auf der anderen Seite sehen wir gerade im Digitalen eine Verrohung über die Sprache. Wir erleben Haßkommentare, die oft keine Grenzen mehr kennen. Besonders erschreckend ist der zunehmende Antisemitismus. So hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS), die von Ihrem Ministerium gefördert wird, vor ein paar Tagen im Jahresbericht gemeldet, man habe 2023 in Bayern so viele antisemitische Vorfälle dokumentiert wie noch nie zuvor. Woran liegt das?
und Wählern im Stimmkreis. Ich habe mich deshalb voll auf meine Arbeit als Abgeordnete konzentriert. Selbstverständlich ist es eine große Freude und Ehre seit Februar 2022 als Staatsministerin und seit November 2023 zudem als weitere stellvertretende Ministerpräsidentin erneut Verantwortung in der Bayerischen Staatsregierung übernehmen zu dürfen.
In einem Interview haben Sie einmal gesagt, daß neben einem guten Rückhalt in der Familie vor allem eiserne Disziplin und unglaublicher Fleiß notwendig seien, um erfolgreich zu sein. Wie diszipliniert und fleißig sind Sie?
Scharf: Zur notwendigen Disziplin gehört, Aufgaben zeitnah zu erledigen. Wenn ich einen Koffer voller Akten mit nach Hause bekomme, muß ich mir abends die Zeit nehmen, die Unterlagen durchzusehen. Und ich mag es nicht, in Termine unvorbereitet zu gehen. Auch das bedarf einer gewissen Vorarbeit. Diesen Anspruch habe ich an mich selbst.
Bei allem Verantwortungsbewußtsein hat man auch eine Verantwortung gegenüber sich selbst. Wie halten Sie sich fit?
Scharf: Früher habe ich es geschafft, regelmäßig in der Früh zu joggen. Das geht heute oft nicht mehr. Aber ich versuche, Sport und Bewegung in den Alltag einzubauen sowie mich einigermaßen gesund zu ernähren. Sie haben sogar mehrere Marathons erfolgreich absolviert. Ihre nächsten Ziele?
Scharf: Ich schwimme regelmäßig. Ich würde auch gerne wieder einen Marathon laufen, aber dafür bedarf es einer intensiven Vorbereitung. Und dafür fehlt die Zeit... .. zumal Sie auch in einer neuen Rolle gefordert werden. Sie sind vor neun Monaten Oma geworden.
Scharf: Es ist einfach wunderbar! Jedes Mal, wenn ich meinen Enkel sehe, geht mir das Herz auf. Oma zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Diese bedingungslose Liebe, die man einem Enkelkind entgegen bringt, ist einzigartig. Sie sind auch auf Social Media aktiv. Allein auf Facebook haben Sie über 12 000 Follower. Fluch oder Segen?
Scharf: Mit dem 7. Oktober, als die Hamas Israel überfallen hat, sind die Zahlen erschrekkend nach oben gegangen. Der jetzt offen gezeigte Antisemitismus erstreckt sich über alle Schichten und ist sehr viel verbreiteter als wir bisher angenommen haben. Für mich ist der RIAS-Bericht ein klarer Auftrag an die Politik: Wir müssen uns noch stärker in der Prävention engagieren. Mein Ministerium macht dies auf vielfältige und niederschwellige Art und Weise. So veranstalten wir am ersten Juni-Wochenende in Regensburg im Haus der Bayerischen Geschichte unser großes „Fest der Demokratie“. Damit wollen wir vor allem jungen Menschen ansprechen. Neben der Prävention ist aber natürlich auch der Rechtsstaat gefordert. Wir müssen Straftaten auch im Internet konsequent verfolgen. Ein Lackmustest für die Demokratie ist die Europawahl. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, daß rechtsradikale und rechtsextreme Parteien zu den Wahlsiegern gehören werden? Scharf: Wenn man sich die jüngsten Wahlergebnisse in Europa ansieht, macht mir diese Entwicklung große Sorgen. Was mich zutiefst erschüttert: Wir wissen aus Umfragen, daß gerade junge Menschen stark zu den rechtsradikalen oder rechtsextremen Parteien tendieren. Ich hoffe, daß wir diese Menschen erreichen und ihnen klar machen können, was zum Beispiel die AfD für ein Frauenbild vertritt oder daß diese Partei die Europäische Union abschaffen will. Frage an Sie als Arbeits- und Jugendministerin: Die Bild-Zeitung hat unlängst getitelt, in Deutschland sei Fleiß keine Tugend mehr. Im Gegenteil: die Deutschen würden immer fauler. Stimmt das?
Scharf: Wir haben viele Studien zu diesem Thema, und ich erlebe die jungen Menschen tagtäglich, zum Beispiel bei unseren Formaten wie „Jugend im Gespräch mit…“, bei denen wir in direktem Austausch mit den jungen Leuten sind, aber auch bei Freisprechungsfeiern oder bei der Übergabe von Meisterbriefen. Die jungen Menschen sind engagiert und leistungsbereit, aber sie haben eine andere Vorstellung von ihrem Leben, insbesondere was die Verbindung von Arbeit und Privatem anbelangt. Eine entscheidende Stellschraube ist dabei die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Das Arbeitszeitgesetz muß sich endlich an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren. Fakt ist, daß sich die Arbeitskultur auch durch die Digitalisierung grundlegend verändert hat. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist gerade für Sie eine besondere Herausforderung. Ihr Partner lebt in Südtirol. Wie schaffen Sie das?
Scharf: Wir haben keinen festen Rhythmus, da wir beide beruflich stark engagiert sind. Im Sommer nutze ich ein freies Wochenende, um nach Südtirol zu fahren, und er kommt im Winter, wenn er mehr Zeit hat, oft nach Bayern. Wir leben das seit zehn Jahren. Es funktioniert! Torsten Fricke
❯ Sudetendeutsches Institut
Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv hat wieder die Vorstellung und Übergabe neuer Findmittel der Bestände des Sudetendeutschen Archivs an den Trägerverein des Archivs, das Sudetendeutsche Institut, stattgefunden. Mit 1860 Archiveinheiten konnte seit der letzten Übergabe im Oktober 2022 erneut eine eindrucksvolle Erschließungsbilanz vorgelegt werden.
Aus den nunmehr für den Forscher gut zugänglichen Beständen ragt sowohl an Umfang als auch an Bedeutung der Sudetendeutsche Wandervogel heraus. Das Schriftgut des Sudetendeutsche Archives umfaßt derzeit insgesamt 2200 laufende Meter und ist das größte Vertriebenenarchiv. Erstmals nahmen an der Übernahme der neue Direktor des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, Christoph Bachmann (seit 1. April 2023), und die Leiterin der für die Bestände des Sudetendeutschen Archivs zuständigen Fachabteilung V, Archivdirektorin Elisabeth Weinberger (seit 1. März 2023), teil. Im Gespräch über die getane und noch bevorstehende Arbeit wurde erneut die besondere Bedeutung des Bestandes des Sudetendeutschen Archivs als einziger Bestand des Bayerischen Hauptstaatsarchivs mit einer bundesweit und in weitere Länder reichenden Provenienz betont.
■ Bis Sonntag, 12. Mai, Sudetendeutscher Rat, Wanderausstellung „So geht Verständigung – dorozumění.“ Öffnungszeiten: Donnerstag, 17.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag, 14.00 bis 17.00 Uhr. Stadtmuseum, Kirchenplatz 2, Herzogenaurach.
■ Freitag, 10. bis Sonntag, 12. Mai, Egerland-Jugend: 52. Bundestreffen. Aalen-Fachsenfeld.
■ Samstag, 11. Mai, 14.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Augsburg: Wir feiern die Mütter und Väter. Fischerheim, In der Aue 2, Wehringen.
■ Samstag, 11. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Passau: Sudetendeutsche Maiandacht. Nikolakloster, Passau.
■ Samstag, 11. Mai, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Muttertags-Feier. Anmeldung bei Gerda Nilges per Telefon unter (0 21 58) 25 73 oder per eMail an werner.appl@ sudeten-kr.de Niederrheinischer Hof, Hülser Straße 398, Krefeld.
■ Samstag, 11. Mai, 16.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Maiandacht. Vogelbeerbaum, OttoSchrimpff-Straße, Roth.
■ Samstag, 11. Mai, 17.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Muttertagsfeier. Schützenhaus, Otto-Schrimpff-Straße 15, Roth.
■ Donnerstag, 16. Mai, 14.30 Uhr: SL-Ortgruppen Fichtelberg, Warmensteinach und Weidenberg. Muttertags-Feier mit Musikbegleitung der Fichtelgebirgs- SL. Gasthof zum Fichtelgebirge, Familie Böhner, Sophienthal 22, Weidenberg.
■ Donnerstag, 16. Mai, 17.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde: Nepomukfeier. Asamkirche, Sendlingerstraße 32, München.
■ Freitag, 17. bis Pfingstsonntag, 19. Mai: 74. Sudetendeutscher Tag in Augsburg. Ausführliches Programm siehe Seite 6 bis 9.
■ Sonntag, 19. Mai, Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 11.00 bis 11.30 Uhr: „Otfried Preußlers Erzählwelten“ – Sand-Art-Show mit der Künstlerin Nadia Ischia im Adalbert-Stifter-Saal. 14.00, 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr: „Eine Prise Sand“ – Sand-ArtWorkshop für Kinder und Fami-

Bei der Übergabe neuer Findmittel (von links): Dr. Christoph Bachmann, Christine Kobler, Anna Bu er, Ingrid Sauer, Dr. Elisabeth Weinberger und Dr. Raimund Paleczek. Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Der Vorsitzende des Sudetendeutschen Instituts e. V., Raimund Paleczek, dankte besonders den beiden Sachbearbeiterinnen Ingrid Sauer und Christine Kobler für die geleistete Arbeit sowie Elisabeth Weinberger und Christoph Bachmann für die Wertschätzung und Unterstützung.
Die neu erschlossenen Bestände im Einzelnen mit den jeweiligen Archiveinheiten (AE): Sammlungen Materialsammlung Preußler Verlag (33 AE, sechs Kartons)
Graslitzer Heimatstube, Heimatgeschichtliche Sammlung (24 AE, drei Kartons)
Böhmerwäldler Ahnenkartei (Günther Burkon, kursorisch erschlossen)
Diverse Neuzugänge persönlicher Dokumente, Heimatberichte, Vertreibungsberichte, Heimatblätter
Verbandsschriftgut
Sudetendeutscher Wandervogel (835 AE, 55 Kartons)
Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste e. V. (175 AE, 34 Kartons)
Seliger Gemeinde (80 AE,
lien mit der Künstlerin Nadia Ischia in der Museumspädagogik. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. 13.00 bis 17.00 Uhr,:„En plein air!“ Urban Sketching rund um das Sudetendeutsche Museum. 13.00 bis 14.00 Uhr, 14.30 bis 15.30 Uhr und 16.00 bis 17.00 Uhr: Skizzenhefte, Zeichenmaterialien und Tipps rund ums Urban Sketching mit Informations- und Materialstand und Einführung in Zeichentechniken im Adalbert-Stifter-Saal. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. ■ Sonntag, 19. Mai, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fahrt zum Sudetendeutschen Tag nach Augsburg. Abfahrt: Weilimdorf-Giebel, Ecke Giebelstraße/Krötenweg 6.00 Uhr. Zustieg: Bahnhof Stuttgart-Feuerbach 6.15 Uhr. Anmeldung bei Waltraud Illner unter Telefon (07 11) 86 32 58 oder per eMail an illner@sudeten-bw.de
■ Freitag, 24. Mai, 18.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach: Maiandacht am Vertriebenengedenkstein. Im Vogelherd, Schwabach.
■ Samstag, 25. Mai, 11.30 Uhr, BdV-Landesverband Hessen: Kulturfest „Unsere Heimat Hessen“. 13.30 Uhr: Festrede Ministerpräsident Boris Rhein. 14.00 Uhr: Trachtenschau unter anderem mit dem Egerländer Volkstanzkreis. Stadthalle, Kasseler Straße, Fritzlar. ■ Freitag, 31. Mai bis Sonntag, 2. Juni, Paneuropa-Union Deutschland: „Paneuropa: Wir sind Freiheit“. 50. Paneuropa-Tage in Kempten und Zeil. ■ Freitag, 31. Mai bis Samstag, 1. Juni: 73. Deutschhauser Heimattreffen in Lichtenfels. Anmeldung bei Heimatortsbetreuerin Gerda Ott unter Telefon (07 11) 59 22 85. ■ Sonntag, 2. Juni, 11.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz): Kammerkonzert-Matinee mit dem Geigenduo Joshua Epstein/ Thomas Kaes und der Pianistin Heather Epstein. Auf dem Programm stehen Werke von Ge-
org Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Suk (anläßlich seines 150. Geburtstags) und Bohuslav Martinů. Eintritt 15,00 Euro. Vorverkauf unter www.okticket.de Festsaal des Bezirks Oberpfalz, Ludwig-ThomaStraße 14, Regensburg.
■ Donnerstag, 6. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Oskar Schindler – Lebemann und Lebensretter“. Eröffnung der Ausstellung im Adalbert-Stifter-Saal. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. Die Sonderausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie läuft bis Sonntag, 27. Oktober. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Samstag, 8. Juni, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen. Anmeldung unter Telefon (0 21 51) 3 26 99 70 oder per eMail an werner.appl@ sudeten-kr.de Niederrheinischer Hof, Hülser Straße 398, Krefeld.
■ Samstag, 8. Juni, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Falkenauer Heimatstube in Schwandorf“. Vortrag von Gerhard Hampl. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 8. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Die Retterin Valeria Valentin“. Filmvorführung im Adalbert-Stifter-Saal in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Italienischen Republik München und dem Italienischen Kulturinstitut. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum. de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Montag, 10. Juni, 19.00 bis 20.30 Uhr, Südosteuropa-Gesellschaft: „Verhältnis auf dem Prüfstand – Ungarns EU-Ratspräsidentschaft 2024“. Podiumsdiskussion mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Dr. Sonja Priebus von der Europa-Universität Viadrina, Zoltán Kiszelly vom Center for Political Analysis und Prof. Dr. Gabor Polyák
sechs Kartons)
Sudetendeutsche Jugend (421 AE, 64 Kartons)
Sudetendeutscher Sängerbund (12 AE, ein Karton)
Nachlässe „Loseblattsammlung“ Kleinstnachlässe: 50 AE neu, insgesamt 779 AE
Nachlaß Walter Doskočil (116 AE, 16 Kartons)
Nachlaß Heinrich Pleticha (73 AE, acht Kartons)
Nachlaß Leopold Pfitzner (23 AE, vier Kartons)
Familienarchiv Stütz aus Gablonz (18 AE, zwei Kartons)
von der Eötvös Loránd Universität Budapest.
■ Donnerstag, 13. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München: Heimatnachmittag. Gaststätte Zum alten Bezirksamt im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Samstag, 15. Juni, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag mit Thomas Schembera vom Polizeirevier 8 zum Thema Enkeltrick und Telefonbetrug. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Montag, 17. Juni, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmen als Ort der Begegnung – Teil 2: Der Frieden kommt aus Böhmen“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 21. bis Montag, 24. Juni, „Meeting Brno“ in Brünn mit dem Brünner Versöhnungsmarsch am Samstag, 22. Juni. Die SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Busfahrt. Anmeldung per Telefax an (0 89) 48 00 03 96, per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by. de, oder per Post an SL Bayern, Hochstraße 8, 81669 München.
■ Sonntag, 7. Juli, 10.00 Uhr, Heimatkreis Kaaden-Duppau: Marien-Wallfahrt mit zweisprachigem Festgottesdienst. Kapellenberg, Winteritz (Vintířov).
■ Sonntag, 1. September, 10.30 Uhr, Monsignore Herbert Hautmann, Vertriebenenseelsorger der Erzdiözese Bamberg: Vertriebenenwallfahrt. Hauptzelebrant ist Regionaldekan Holger Kruschina aus Nittenau, der 1. Vorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerkes. Wallfahrtsbasilika Heilige Dreifaltigkeit, Gößweinstein.
■ Freitag, 13. bis Sonntag, 15. September, Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband: Sudetendeutscher Kongreß. Kloster Haindorf, č.p. 1, Hejnice, Tschechien.
■ Freitag, 18. Oktober, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München: Heimatnachmittag. Gaststätte Zum alten Bezirksamt im HDO, Am Lilienberg 5, München.
■ Donnerstag, 18. Juli bis Freitag, 2. August: Kultursommercamp24 – Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. Veranstaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre aus Deutschland und Tschechien Über 100 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und ihr Wissen. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden. Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de



❯ Neue Ausstellung
■ Bis Mittwoch, 29. Mai: Ausstellung „Deutsche in der Ukraine: Geschichte und Kultur“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Öffnungszeiten: werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr.
Das Territorium der Ukraine war seit alters her ein Raum, in dem unterschiedliche Völker und Kulturen aufeinandertrafen. Seit dem 10. Jahrhundert gab es wiederholt dynastische Verbindungen mit dem deutschen Hochadel, Handelsbeziehungen und militärische Bündnisse. Im 18. Jahrhundert begann die Einwanderung deutscher Bauern und Handwerker. Bäuerliche Siedlungen (Kolonien) wurden im Schwarzmeergebiet, auf der Krim, in Wolhynien, später auch in der Ostukraine gegründet. Im 20. Jahrhundert wurde das friedliche Miteinander der Völker und Ethnien durch die beiden Weltkriege, die kommunistische „Oktoberrevolution“ und die sozialistischen Umwälzungen empfindlich gestört.

❯ Stand auf dem Sudetendeutschen Tag

■ Das Sudetendeutsche Museum ist auf dem Sudetendeutschen Tag am Samstag, 18. und Sonntag, 19. Mai, in der Messe Augsburg mit einem eigenen Stand vertreten. Am Samstag wird hier von 12.00 bis 16.00 Uhr ein Kinderprogramm angeboten. Die jungen Besucher des Sudetendeutschen Tages erfahren, welche Objekte im Sudetendeutschen Museum ausgestellt werden und warum. Die Kinder können außerdem ein Lieblingsobjekt aus-
wählen und danach ein eigenes Kunstwerk gestalten. Ob Musikinstrument oder Möbelstück, Gartenzwerg oder Glitzermaus – mit Ölkreiden, Filzstiften und Collagematerial, die Museumspädagogik unterstützt bei der Umsetzung. Nach dem großen Erfolg auf dem Ostermarkt im Sudetendeutschen Haus können Kinder und Enkel an einem weiteren Stand unter fachkundiger Anleitung lernen, wie Osterratschen gebastelt werden.





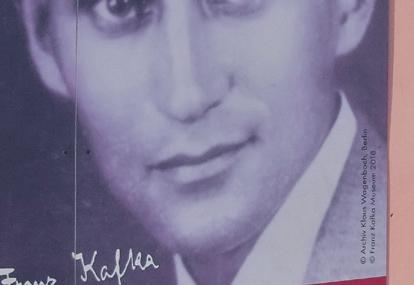





Auf der Kleinseite be ndet sich das Kafka-Museum. Es ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geö net. Im Museumsshop ist ein Stadtplan mit den wichtigsten Kafka-Orten erhältlich.

Künstler David Černý hat diesen zehn Meter hohen Kafka-Kopf gescha en, dessen Metallplatten sich bewegen. Das Kunstwerk steht vor dem Quadrio-Einkaufszentrum.
❯ Vor hundert Jahren starb der weltberühmte Vertreter der Prager deutschen Literatur
„Hier war mein Gymnasium, dort in dem Gebäude, das herübersieht, die Universität und ein Stückchen weiter links hin mein Büro. In diesen kleinen Kreis – ist mein ganzes Leben eingeschlossen.“ Franz Kafka
Vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924, verstarb Franz Kafka, der bedeutendste Vertreter der Prager deutschen Literatur. Der Sohn einer bürglich-jüdischen Kaufmannsfamlie wurde nur 40 Jahre alt, aber seine Wirkmacht ist nach wie vor ungebrochen. In seiner Geburtssstadt Prag finden sich insbesondere im Umkreis des Altstädter Rings zahlreiche Orte, die an Kafka erinnern. Eine Spurensuche.
Per Hausgeburt kam Kafka am 3. Juli 1883 in der ehemaligen Prälatur der Sankt-Niklas-Kirche zur Welt. Er ist das erste Kind von Hermann Kafka (18521931) und seiner Frau Julie, geb. Löwy (1856-1934). Die jüdischen Eltern führen ein Geschäft mit Galanteriewaren. In der Familie wird deutsch gesprochen, mit Bediensteten aber zumeist tschechisch. Im Mai 1885 zieht die Familie um. Es ist der erste von zahlreichen Wohnungswechseln. Vom Geburtshaus ist heute nur das Portal erhalten, nachdem 1897 ein Brand das Gebäude zerstört hat. Von 1889 bis 1893 besuchte Kafka die Deutsche Knabenschule am Fleischmarkt, anschließend das deutschsprachige humanistische Staatsgymnasium im Palais Goltz-Kinsky. Nach dem Abitur studierte Kafka an der Deutschen Universität zunächst Chemie, bevor er zu Jura wechselt und in diesem Fach auch promovierte.







Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, zogen sich die Apostel mit Maria neun Tage lang zurück, um zu beten. Der Ort dieser intensiven Gebetszeit wird in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments als das Obergemach in Jerusalem bezeichnet. Was damit genau gemeint ist, läßt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Es könnte aber sein, daß mit dem Obergemach derselbe Raum gemeint ist, in welchem Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte.


Berliner Staatsbibliothek Das Fotoalbum der Familie Kafka
Zum 100. Todestag von Franz Kafka präsentiert das Stabi Kulturwerk (Unter den Linden 8, Berlin) noch bis zum 2. Juni eine umfangreiche Ausstellung mit rund 130 Originalfotogra en der Familie Kafka, viele davon bislang unverö entlicht und erstmals in dieser Zusammenstellung zu sehen. Die Aufnahmen zeigen einen Schriftsteller der Weltliteratur im Kreis seiner Verwandtschaft. Ö nungszeiten: dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr, donnerstags bis 20.00 Uhr. Fotos: Archiv Klaus Wagenbach, Stabi Berlin











Dlážděná 6/Hybernská 16: Das Café Arco war der Tre punkt des Prager Kreises.



Im Goldenen Gäßchen 22 schrieb Kafka den Erzählband „Der Landarzt“.









Während eines Aufenthalts im Sanatorium Hoffmann in Kierling bei Klosterneuburg verstarb Kafka am 2. Juni 1924. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in Prag. Pavel Novotny/Torsten Fricke
Über den Schriftsteller und Kritiker Max Brod wurde Franz Kafka in die junge Dichterszene eingeführt. Ab 1908 wurde deren wichtigster Treffpunkt das Café Arco. Eine bedeutende Rolle spielte für Kafka zeitlebens der Sport. Er schwamm regelmäßig in der Moldau, ruderte ausgiebig, absolvierte täglich ein strenges Gymnastikprogramm und unternahm stundenlange Fußmärsche in die Umgebung Prags – auch um mit dieser körperlichen Betätigung seine Leiden, wie Stimmungsschwankungen, Depressionen, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit, zu mildern. 1917 diagnostizierten die Ärzte bei Kafka eine unheilbare Lungentuberkulose. In der Folgezeit verschlechterte sich Kafkas Gesundheitszustand von Jahr zu Jahr.









Ring/Staroměstské náměstí 934/5: Im Oppelthaus lebte Franz Kafka ab 1913 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Fotos: Mediaservice Novotny

Kühl und hart
Kühl und hart ist der heutige Tag. Die Wolken erstarren. Die Winde sind zerrende Taue. Die Menschen erstarren. Die Schritte klingen metallen Auf erzenen Steinen, Und die Augen schauen Weite weiße Seen.
In dem alten Städtchen stehn Kleine helle Weihnachtshäuschen, Ihre bunte Scheiben sehn

Auf das schneeverwehte Plätzchen. Auf dem Mondlichtplatze geht
Still ein Mann im Schnee fürbaß, Seinen großen Schatten weht

Der Wind die Häuschen hinauf. Menschen, die über dunkle Brücken gehn, vorüber an Heiligen mit matten Lichtlein. Wolken, die über grauen Himmel ziehn aaavorüber an Kirchen aaamit verdämmernden Türmen. Einer, der an der Quaderbrüstung lehnt und in das Abendwasser schaut die Hände auf alten Steinen.
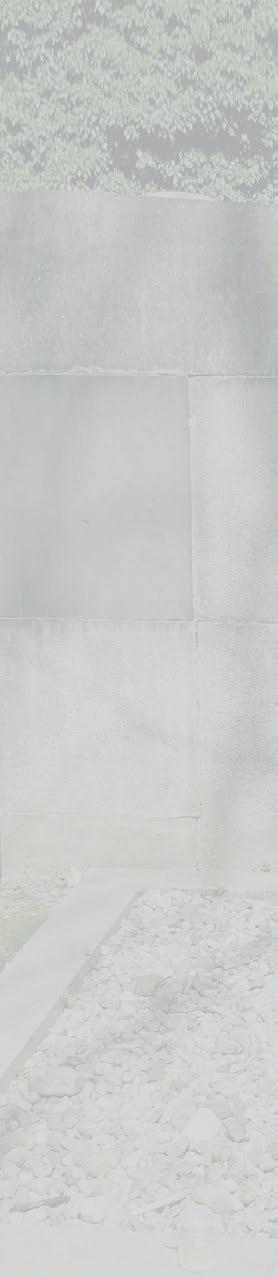


Die Beschreibung seiner Heimatstadt Prag ist das älteste lyrische Bruchstück, das sich in einem Brief vom 9. November 1903 erhalten hat. Franz Kafka schrieb damals an seinen Schulfreund Oskar Pollak von „einigen Versen“, die er „in guten Stunden lesen“ möge.



Nach dieser Gebetszeit fand in Jerusalem das jüdische Wochenfest statt, auf Hebräisch Schawuot. Zu diesem Fest strömten Pilger von überall her in die Heilige Stadt. 50 Tage nach der Auferstehung Jesu erfuhren dabei die Apostel und mit ihnen all jene, die sonst noch in Jerusalem waren, das Herabkommen des Heiligen Geistes. Die Apostelgeschichte erzählt von Sturm und Feuerszungen, aber auch davon, daß die versammelten Menschen in Sprachen zu reden begannen, die nicht ihre eigenen waren. Bevor die Kirche bis heute jedes Jahr an Pfingsten dieses machtvollen Ereignisses gedenkt, erinnert sie sich immer daran, daß die Apostel mit Maria im Obergemacht tagelang beteten. Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten treffen sich viele Christen in Gruppen rund um den Globus, um das neuerliche Kommen des Heiligen Geistes zu erbitten. Sie wissen dabei ebenfalls Maria, die Mutter Jesu, in ihrer Mitte. Der Marienmonat Mai trägt das seine zu dieser besonderen Gebetsatmosphäre bei. Wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Wir können diese Frage letztlich nicht beantworten, ohne selbst Erfahrungen der Geistkraft Gottes gemacht zu haben. Als Menschen können wir manches mit eigener Kraft, mit eigenem Verstand und vor allem aus eigenem Willen bewirken. Wohlgemerkt manches, aber nicht alles! Immer wieder gibt es Situationen, in denen wir uns um einen Durchbruch zu einer neuen Freude, zu größerer Freiheit und zu innigerer Liebe zwar bemühen, aber wir schaffen es nicht, weder alleine, noch mit anderen.

Doch haben wir wohl alle schon die Erfahrung gemacht, daß es quasi wie von selbst zu einem solchen Durchbruch kam. Das kann im persönlichen Leben genauso passieren wie in der Gesellschaft oder in der Kirche. Plötzlich ist etwas anders geworden. Nicht nur anders, sondern vor allem besser. Überall, wo wir solches erlebten, können wir nach christlichem Verständnis sagen: Wir haben das Wirken des Heiligen Geistes erfahren. Er schafft Bewegung hin zum Positiven. Er erneuert die Herzen der Menschen. Er hilft uns, daran zu glauben, daß unser Leben Sinn hat. In der neuntägigen Gebetszeit vor Pfingsten bitten wir also intensiv um das Kommen des Gottesgeistes, den wir schon so oft erfahren haben. Wir bitten auch darum, daß wir offen sind für die vielen Durchbrüche, die er in unserem Leben und in unserer Welt bewirken will. Mögen wir unsere Augen, unsere Ohren, vor allem aber unser Herz nicht davor verschließen. Und nicht zuletzt: Mögen wir bereit sein, Mitarbeiter des Heiligen Geistes zu sein. Er will keine bloßen Zuschauer, sondern Akteure. Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München
❯ Grußwort des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. Markus Söder „Es





Ministerpräsident Markus Söder beim Sudetendeutschen Tag.
Bayern ist das Land, in dem Europa Gestalt annimmt! Dazu leisten die Sudetendeutschen einen hervorragenden Beitrag. Dank und Anerkennung verdient der Einsatz von Bayerns viertem Stamm für die Zukunft. Sie soll im Zeichen des Miteinanders stehen. Deshalb ist das Motto der Veranstaltung gut gewählt: Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa!
Die Bayerische Staatsregierung hat sich die Pflege der



guten Beziehungen zu unseren tschechischen Nachbarn zur besonderen Aufgabe gemacht. Dabei setzen wir auf den engen Kontakt zu den Partnern in Prag. Auch sie sind überzeugte Europäer, auch sie treten mit ganzer Kraft für Freundschaft und Zusammenarbeit ein. Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung in Regensburg und Prag ist ein glänzender Beweis des guten Miteinanders. Es war ein historischer Moment, als beim Sudetendeutschen Tag des vergangenen Jah-
res der tschechische Bildungsminister Professor Dr. Bek davon sprach, daß das Versöhnungswerk zwischen Tschechen und Deutschen im Grunde schon vollbracht sei. Die Sudetendeutschen haben den Boden für diese Versöhnung bereitet. Unter der Schirmherrschaft des Freistaats Bayern haben sie eine Brücke gebaut, die unsere Völker verbindet, im Wissen um die Geschichte und im Vertrauen auf die Zukunft.
Dr. Markus Söder, MdL Bayerischer Ministerpräsident

Volksgruppensprecher Bernd Posselt dankt Tschechiens Bildungsminister Mikuláš Bek für dessen historische Rede.

Bewegender Moment beim Einzug im vergangenen Jahr: Sylvia Stierstorfer, Ministerpräsident Markus Söder, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und Regensburgs Zweite Bürgermeisterin Astrid Freudenstein beklatschen die Wischauer Abordnung.
❯ Freitag, 17. bis P ngstsonntag, 19. Mai in Augsburg
„Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa“ ist das Motto des diesjährigen 74. Sudetendeutschen Tages, der von Freitag, 17. bis Pfingstsonntag, 19. Mai in Augsburg stattfindet. Hauptveranstaltungsort ist das Messegelände.
H
Liebe Sudetendeutsche, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, Sie ganz herzlich in Augsburg zum 74. Sudetendeutschen Tag willkommen heißen zu dürfen.
❯ Oberbürgermeisterin Eva Weber Das Motto hat Signalwirkung
DIn einer Sondersendung berichtet das Bayerische Fernsehen am Pfingstsonntag von 23.15 Uhr bis 23.30 Uhr über den Sudetendeutschen Tag.
Für die Redaktion zuständig ist Jürgen Schleifer. Der Beitrag wird auch in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks abrufbar sein.


öhepunkte sind der Festabend für die Sudetendeutschen Kulturpreiseträger am Freitag, die Verleihungen des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen an den ehemaligen Präsidenten der EUKommission, Jean-Claude Junkker, sowie des Menschenrechtspreises an die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten und der traditionelle Heimatabend am Samstag sowie die Hauptveranstaltung am Sonntag mit den Festreden von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.
❯ Volksgruppensprecher Bernd Posselt diskutiert mit Politikern und Experten
Als „Europäischer Auftakt“ startet der 74. Sudetendeutsche Tag am Freitag ab 14.00 Uhr mit einer hochrangig besetzten Podiumsdiskussion im Augustanahaus (Im Annahof 4).
Unter der Leitung von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, werden Markus Rinderspacher, Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Dr. Pavel Svoboda, MdEP a. D. und ehemaliger tschechischer Justizminister, der Europa- und Verfassungsrechtler Dr. Dirk Hermann Voß sowie Prof. Ihor Zhaloba, Präsident der Paneuropa-Union
iese traditionsreiche Veranstaltung steht heuer unter einem ebenso bemerkenswerten wie aussagekräftigen Leitsatz: Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa. Das Motto hat Signalwirkung. Es spricht von Versöhnung, Annäherung, Verständigung und Frieden. Sie als Sudetendeutsche sind mit Ihrem unermüdlichen Einsatz für ein friedliches Zusammenleben in Europa ein Symbol für die Völkerverständigung.
Zwischen Augsburgerinnen, Augsburgern und Su-
detendeutschen besteht eine intensive Beziehung und ein gutes Miteinander. Dieses friedliche Miteinander, das wir hier in Augsburg erleben und darüber hinaus unter anderem auch mit den langjährigen Städtepartner- und -patenschaften zu Ihnen pflegen, gilt es zu bewahren – in jeder Hinsicht. Es ist das höchste Gut, ganz besonders mit Blick auf unsere Tradition als Friedensstadt. Dafür wollen wir uns mit Menschlichkeit, Empathie und Respekt begegnen und das Bewußtsein für gegenseitige Akzeptanz und Solidarität stärken. Ganz in diesem Sinne bietet der Sudetendeutsche Tag hervorragende Möglichkeiten zur

Oberbürgermeisterin Eva Weber. Foto: Stadt Augsburg Höhepunkt am Samstagabend ist der HEIMAT!abend mit viel Musik und Tanz. Fotos: Torsten Fricke (4), Paneuropa-Union (2), SPD, Wikipedia
Begegnung, zum Kennenlernen und Austausch. Die persönlichen Gespräche fördern eine wertschätzende Haltung, die gemeinsamen Erlebnisse bereichern uns. Deshalb danke ich von Herzen allen, die sich genau dafür engagieren, und wünsche dem 74. Sudetendeutschen Tag einen großen Erfolg. Eva Weber Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg

Ukraine, über das Thema „Herausforderung für Europa: Desinformation und Subversion“ sprechen. Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat Rußland auch seine hybride Kriegsführung massiv ausgeweitet. Hierzu gehören Cyberangriffe, wie unlängst der der Cybergruppe APT28, der dem russischen Militärgeheimdienst GRU zugeordnet wird, auf die SPD und zahlreiche Regierungsstellen sowie Rüstungs- und Logistikunternehmen in Deutschland, und Desinformationskampagnen, die aktuell im Vorfeld der Europawahlen an Intensität zunehmen.
Gleichzeitig versucht Rußland sei Jahren, insbesondere auf dem Balkan, Demokratien zu destabilisieren. Zudem verdichten sich die Beweise, daß Rußland das Brexit-Referendum in Großbritannien beeinflußt hat und rechtspopulistische Bewegungen sowie Parteien in der EU massiv unterstützt.

Festabzeichen gilt auch für den ÖPNV
Das Festabzeichen zum Preis von 10,00 Euro (Schüler und Studenten 5,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei) berechtigt zum Eintritt in alle Veranstaltungen des Sudetendeutschen Tages am Pfingstwochenende. Außerdem kann damit der Augsburger Verkehrsverbund AVV (außer Nachtbusverkehr) in der Zone 10 und 20 kostenlos genutzt werden. Übrigens: Enkel und Urenkel erhalten freien Eintritt, wenn sie ihre Groß- oder Urgroßeltern zum Sudetendeutschen Tag begleiten.
Böhmisches Dorffest
Es gehört zum Sudetendeutschen Tag wie der Powidl zu den Mehlspeisen: Das Böhmische Dorffest ist seit Jahrzehnten den ganzen Pfingstsamstag und Pfingstsonntag über zentraler Anlaufpunkt für alle, die das Kulturerbe der Sudetendeutschen durch Musik, Tanz und Kulinarik sinnlich erfahren möchten. Als Speis und Tank werden Spezialitäten wie Liwanzen und Kolatschen sowie österreichische Weine und böhmisches Bier angeboten. Für Tanz und Musik sorgen die Egerländer Familienmusik Hess, die Egerland-Jugend, Kurt Pascher und seine Original Böhmerwälder Musikanten, die Schönhengster Sing- und Spielschar und die Schönhengster Tanzgruppe Mährisch Trübau.
Bischof Meier zelebriert Messe


Dem religiösen Charakter von Pfingsten tragen zwei Gottesdienste Rechnung: Am Pfingstsonntag zelebriert ab 9.00 Uhr in Halle 5 der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier das Pontifikalamt. Den evangelischen Gottesdienst feiert Pfarrerin Erna Meiser aus Niederbayern ebenfalls ab 9.00 Uhr mit den Gläubigen im Tagungscenter.
Sonderstempel der Deutschen Post
Die Deutsche Post drückt dem Sudetendeutschen Tag den Stempel auf: Im Foyer des Tagungscenters ist das Briefmarken-Team der Post mit einem Stand vertreten. Philatelisten können sich Briefe und Postkarten mit einem Sonderstempel, den der Bundesverband initiierte hat, versehen lassen.

Kolping-Blasorchester Göggingen auf dem Königsplatz Musikalischer
Böhmen gilt als Hochburg der Musik – doch auch Augsburg muß sich musikalisch nicht verstecken. Maßgeblichen Anteil daran hat das Kolping-Blasorchester Göggingen, das seit 1921 in der Kulturszene Schwabens eine Konstante darstellt.
Göggingen, bis 1972 eine eigene Stadt und seitdem Teil Augsburgs, verfügt durch die Pa-
❯ Staatsministerin Ulrike Scharf und Volksgruppensprecher Bernd Posselt verleihen die Sudetendeutschen Kulturpreise
Seit 1955 verleiht die Sudetendeutsche Landsmannschaft die Sudetendeutschen Kulturpreise. Auch in diesem Jahr werden Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und Volksgruppensprecher Bernd Posselt die Auszeichnungen überreichen.
Der Festakt ist traditionell der erste Höhepunkt des Sudetendeutschen Tages und findet in diesem Jahr am Freitag, 17. Mai, ab 19.00 Uhr im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt. Durch den Abend führt Iris Marie Kotzian, Sängerin und Trägerin des Sudetendeutschen Förderpreises. Die Begrüßung der geladenen Gäste übernimmt Dr. Ortfried Kotzian, Vorsitzender des Vorstandes der Sudetendeutschen Stiftung. Für die Stadt Augsburg spricht Jürgen Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport. Mit dem Großen Kulturpreis wird in diesem Jahr Dr. Gertrude Krombholz geehrt. Die aus Tetschen stammende Pädagogin war Chefhosteß für die Eröffnungsund Schlußfeiern der Olympischen Spiele von 1972, 1976 und 1980 und entwickelte 1973 die Idee für den Rollstuhltanz. Außerdem rekonstruierte sie anhand historischer Quellen 1976 den mittelalterlichen Moriskentanz und gründete die Münchner Moriskentänzer.
Nach dem Eintritt in den Ruhestand stiftete die promovierte Historikerin den nach ihr benannten und erstmals 1998 verliehenen Preis der TUM für die besten wissenschaftlichen Arbeiten in der angewandten Sportwissenschaft. Für ihre beeindrukkende Lebensleistung wurde Dr. Gertrude Krombholz mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Bayerischen Verdienstorden.
Der Sudetendeutsche Kulturpreis für Darstellende Kunst und


tenschaft für Neudek und Umgebung über ein enges freundschaftliches Verhältnis zu den Sudetendeutschen. Unter der Leitung von Alexander Körner gibt das Blasorchester eine musikalische Einstimmung auf den 74. Sudetendeutschen Tag, und zwar am Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr mitten in Augsburg auf dem Königsplatz. Foto: Kolping-Blasorchester






























Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und Volksgruppensprecher Bernd Posselt werden die Sudetendeutschen Kulturpreise im Goldenen Saal an (von links) Dr. Gertrude Krombholz, Eva Herrmann, Wolftraud de Concini und Roland Hammerschmied verleihen. Fotos: Torsten Fricke, privat (3)
Musik geht an Eva Herrmann. Seit den späten 1980er Jahren bringt sich die Pianistin mit sudetendeutschen Wurzeln vielfältig in die Musikkulturpflege der Sudetendeutschen ein, zum Beispiel über enge Kooperationen mit dem Sudetendeutschen Musikinstitut, der Künstlergilde Esslingen und dem Adalbert-StifterVerein.
Mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur und Publizistik wird Wolftraud de Concini geehrt. Die Publizistin und Fotografin wurde 1940 in Trautenau im böhmischen Riesengebirge geboren und war unter ande-
rem 2015 Stadtschreiberin des Deutschen Kulturzentrums Östliches Europa in Pilsen. Seit 1964 lebt de Concini in Italien.
Ein fester Bestandteil des Sudetendeutschen Kulturlebens ist der 1967 in Falkenau geborene Roland Hammerschmied. Der leidenschaftliche Musiker pflegt Mundart, Lieder und Volkstänze, die teilweise nur mündlich überliefert wurden.
Für sein nachhaltiges Engagement wird Roland Hammerschmied mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Heimat- und Volkstumspflege ausgzeichnet.
❯ Samstag, 18.00 Uhr, Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1 Schatzkästlein
Das Sudetendeutsche Musikinstitut unter der Leitung von Dr. Andreas Wehrmeyer und Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann präsentieren das Sudetendeutsche Schatzkästlein am Samstag, 18.00 Uhr, im Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.
Kulturpreisträgerin Wolftraud de Concini liest aus ihrem Buch „Böhmen hin und zurück“. In knappen, scheinbar leichten Texten geht sie heikle, schwerwiegende Themen an: Vertreibung, Heimatverlust und Entwurzelung, das Flüchtlingsleben und das lebenslange Anderssein sowie ihre Rückkehr nach Böhmen. Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Kulturpreisträgerin Eva Herrmann.
DIE SUDETENDEUTSCHE ZEITUNG - IN AUGSBURG GEDRUCKT!
PRESSE-DRUCK REALISIERT IHR KONZEPT. VON DER DATEI BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT – QUALIFIZIERTES KNOW-HOW UNTER DEM DACH EINES VERLÄSSLICHEN PARTNERS. UNSERE EXPERTEN SIND GERNE FÜR SIE DA!

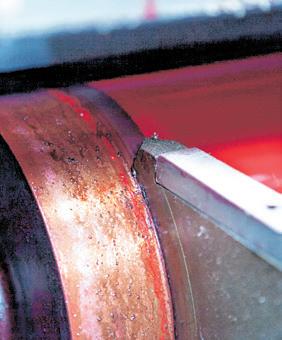





Ihr Partner für Firmenbroschüren, Mitarbeiterzeitungen und Kunden magazine mit den Vorteilen des Zeitungsdrucks. www.wir-drucken-deine-zeitung.de


Freitag, 17. Mai
■ 11.00 Uhr: Pressekonferenz. Im Annahof 4, Augsburg.
■ 14.00 Uhr: Europäischer Auftakt. Augustanahaus, Im Annahof 4, Augsburg.
■ 16.00 Uhr: Musikalischer Auftakt. Königsplatz. Konzert des Kolping Blasorchesters Göggingen.
■ 17.00 Uhr: Kranzniederlegung. Rathausplatz.
■ 19.00 Uhr: Festlicher Abend mit Verleihung der Sudetendeutschen Kulturpreise. Goldener Saal des Augsburger Rathauses (gesonderte Einladung).
P ngstsamstag
■ 9.30 Uhr: Eröffnung der Aktionshalle. Steffen Hörtler, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Landesobmann der SL Bayern. Halle 7.
■ 10.30 Uhr: Festveranstaltung „Sudetendeutsche und Tschechen – miteinander für Europa“. Halle 5. Eröffnung: Steffen Hörtler, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Landesobmann der SL Bayern. Grußworte:
Bernd Kränzle, 3. Bürgermeister der Stadt Augsburg.
Ulrike Scharf MdL, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales sowie Schirmherrschaftsministerin.
Natalie Pawlik, MdB und Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bundesministerium des Innern und für Heimat.
Verleihung des Karls-Preises 2024 der Sudetendeutschen Landsmannschaft durch Dr. h. c.
Bernd Posselt MdEP a. D., Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe an JeanClaude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission a. D.
Verleihung des Menschenrechtspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft an die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN).
Dankesworte. Musikalische Umrahmung: Stadtkapelle Gersthofen unter Leitung von Gerhard Kratzer.
■ 14.30 Uhr: Ausstellungsprojekt Tradition in Bildern/Tradice v obrazech. Anfertigung von Trachtenfotos im Stil der Ausstellung. Fotoshooting. Leitung: Václav Šilha. Auskunft am Stand D12 in Halle 7.
■ 14.30 Uhr: Deutscher Kulturverband Region Brünn – Begegnungszentrum Brünn. Hermann Ungar: „Die Ermordung des Hauptmanns Hanika. Tragödie einer Ehe“ (1925). Buchpräsentation. Referent: Dr. Milan Neužil. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.13.
den Autoren: Werner Sonne und Thomas Kreutzmann. Moderation: Hartmut Koschyk. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.
■ 14.30 Uhr: Sudetendeutsche Jugend (SdJ) – Jugend für Mitteleuropa e. V. Heimweh und Heimreise der Sudetendeutschen und ihrer Nachkommen: Forschung und erlebnisorientierte Diskussion. Vortrag: Dr. Soňa Mikulová. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.9. ■ 14.30 Uhr: Sudetendeutsches Musikinstitut. Musikalische Vorstellung des böhmischen Komponisten Wenzel Johann Tomaschek. Vortrag: Dr. Andreas Wehrmeyer. Mitwirken-
Veronika Kupková. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.
■ 16.00 Uhr: Bund der Eghalanda Gmoin e. V. (BdEG). Jurysitzung für den Johannes-vonTepl-Preis 2024 (geschlossene Veranstaltung). Ansprechpartner: Dr. Ralf Heimrath. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.9.
■ 16.00 Uhr: Bundesfrauenarbeitskreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Frauenforum: Engagierte Frauen im Bereich der deutschen Minderheiten und der deutschsprachigen Gemeinschaften in aller
publik und Jugend- und Kulturorganisation der deutschen Minderheit (JUKON). Deutsche Friedhöfe in Tschechien: Spaziergänge durch Westböhmen und JUKON-Fotowettbewerb. Vortrag: Sven Müller und Ilyas Zivana. Halle 6.
■ 16.30 Uhr: WaltherHensel-Gesellschaft e. V. und Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Offenes Singen mit Herbert Preisenhammer. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A.
■ 17.30 Uhr: Gruppe Sude-
digung Trautenau–Riesengebirge e. V. – Begegnungszentrum Trautenau. Streifzug durch sudetendeutsche Städte auf alten Stadtplänen. Vortrag: Günter Fiedler. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.
■ 18.00 Uhr: Sudetendeutsches Schatzkästlein. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.
■ 19.00 Uhr: HEIMAT!abend. Halle 5.
■ 21.00 Uhr: Sudetendeutsches Volkstanzfest. Halle 5.
P ngstsonntag
■ 9.00 Uhr: Römisch-katholisches Pontifikalamt. Es zelebrie-

Hauptveranstaltungsort des 74. Sudetendeutschen Tages ist die Messe Augsburg, die sowohl per Bahn als auch per Auto bequem zu erreichen ist.
❯ Via Zug: Am Hauptbahnhof Augsburg angekommen, nehmen Sie den Zug und fahren bis zur Station Augsburg Messe. Die Fahrzeit beträgt circa fünf Minuten. Von dort sind es zehn Gehminuten zum Messegelände. Hinweis: Im Reiseplaner der Deutschen Bahn muß als Ziel „Messe DB, Augsburg“ eingestellt sein.
de: Wolfgang Antesberger (Tenor) und Eva Herrmann (Pianistin). Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.
❯ So kommen Sie zur Messe Augsburg Anreise mit Bahn oder Auto
❯ Via ÖPNV: Nehmen Sie die Tram-Linie 3 (über Königsplatz) in Richtung Haunstetten West P+R und steigen Sie an der Haltestelle Bukowina Institut/PCI aus. Die Fahrtzeit beträgt zwölf Minuten. Von dort können Sie entweder in sieben Minuten zu Fuß zum Messegelände gehen oder in den Bus
Welt. Vortrag: Hartmut Koschyk. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.
einsteigen und eine Haltestelle weiter fahren. Der Bus bringt Sie in beiden Richtungen zum Messegelände – entweder zur Haltestelle Messe Süd oder zum Messezentrum. Alternative: Nehmen Sie die Tram-Linie 3 in Richtung Haunstetten West P+R und steigen Sie an der Haltestelle Königs-
platz aus. Von dort steigen Sie in den Bus Nr. 41 in Richtung Maria Stern beziehungsweise Bergstraße. Steigen Sie an der Haltestelle Messezentrum aus. Die gesamte Fahrzeit beträgt circa 15 Minuten. ❯ Via Auto: Fahren Sie die Autobahn A 8 München–Stuttgart bis zur Anschlußstelle Augsburg West. Dort wechseln Sie auf die B17 Richtung Landsberg am Lech und verlassen die Bundesstraße an der Ausfahrt Augsburg-Messe. Folgen Sie der weiteren Beschilderung. Foto: Messe Augsburg
■ 11.00 Uhr: Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und Freundeskreis Sudetendeutscher Mundarten. Mundartlesungen. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A.
■ 13.00 Uhr: Ackermann-Gemeinde e. V. und Antikomplex –hnutí proti xenofobii. „Generation ‚N: Deutschböhme“ (2016). Präsentation des Films von Veronika Kupková und Olga Komarevtseva-Burkhart. Vortrag: Veronika Kupková. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.
■ 13.00 Uhr: Ausstellungsprojekt Tradition in Bildern/Tradice v obrazech. Anfertigung von Trachtenfotos im Stil der Ausstellung. Fotoshooting. Auskunft am Stand D12 in Halle 7.
■ 13.00 Uhr: Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e. V. und Verein für deutschtschechische Verständigung Trautenau–Riesengebirge e. V. – Begegnungszentrum Trautenau. Stand der Pflege deutscher Gräber in der Tschechischen Republik. Vortrag: Štěpánka Šichová. Halle 6. ■ 13.00 Uhr: Seliger-Gemeinde e. V. – Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten. Deutsche vs. Tschechen – Eine Veranstaltung zur Fußball-EM 2024. Podiumsdiskussion mit: Dr. Filip Bláha und Markus Rinderspacher. Moderation: Helena Päßler. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 A.
■ 13.00 Uhr: Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband – e. V. Unsere Familienwurzeln in Archiven Tschechiens finden – allgemein und am Beispiel von Percy Schmeiser (kanadischer Landwirt, Right Livelihood Award 2007). Vortrag: Werner Honal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher (VSFF). Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B. ■ 13.00 Uhr: Vitalis-Verlag, Prag. „Unter dem Steinernen Meer“. Lesung mit dem Autor: Dr. Peter Becher. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.
■ 14.00 Uhr: Heimatkreis Kaplitz. Jahreshauptversammlung. Ansprechpartner: Hermann Proksch. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.9.


■ 14.30 Uhr: Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk mit der Bildungsstätte Der Heiligenhof, Akademie Mitteleuropa und Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker e. V. Der Böhmische Raum und sein Friedenspotential – Ereignisse und Ideen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Vortrag: Prof. Dr. Stefan Samerski. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.
■ 14.30 Uhr: Sudetendeutscher Heimatrat: Deutsche und Tschechen – kommunale Partnerschaften. Podiumsdiskussion mit Bürgermeistern/Vertretern der Vertriebenengemeinden/ -städte. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B.
■ 16.00 Uhr: Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein und Adalbert Stifter Verein – Kulturinstitut für die böhmischen Länder: „Über unsere Schwellen hinaus. Teil II. Wagen nach Wien“ (2023). Präsentation des Films von Rainer Brumme und Wolfgang Spielvogel über den Umgang mit der Vertreibung. Referent: Dr. Wolfgang Schwarz. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B.
ten in der Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins e. V. Sudetendeutscher Alpinismus. Traditionsreiche Vereine –moderne Hütten. Vortrag: Klaus Svojanovsky. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.13.
■ 17.30 Uhr: Lehrstuhl für Geographie der Jan-Evangelista-PurkyněUniversität in Aussig. Adam Kraft – Verleger und Künstler aus Karlsbad und Augsburg. Vortrag: Dr. Jiří Riezner. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B.
ren unter anderem: Dr. Bertram Meier, Bischof von Augsburg, Monsignore Adolf Pintíř, Vertreter der Tschechischen Bischofskonferenz, Monsignore Dieter Olbrich, Präses der sudetendeutschen Katholiken, Holger Kruschina, Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks, Siegfried Weber, Kanoniker in Budweis und Militärdekan sowie weitere Heimatpriester. Halle 5.
■ 16.00 Uhr: Heimatkreis Braunau. Im Tal der Träume: Die letzten vier Generationen der Familie Faltis von Jamny im Schloß Weckelsdorf. Die Enkeltochter erzählt! Vortrag: Beate Baron. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.13.
■ 16.30 Uhr: Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Re-





■ 14.30 Uhr: Fara Semněvice, Gemeinde Hochsemlowitz/ Semněvice, Antikomplex –hnutí proti xenofobii. Geschichte und Gegenwart des Pfarrhauses Semlowitz. Vorstellung der bürgerschaftlichen Initiative Fara Semněvice. Referenten: Antonín Kolář und Milada Kolářová. Halle 6. ■ 14.30 Uhr: Seliger-Gemeinde e. V. – Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten. Was wird aus unserem Miteinander in Europa? Podiumsdiskussion mit: Ronja Endres, Hannes Heide MdEP, Libor Rouček MdEP a. D. und Dr. Reinhard Schaupp. Moderation: Christa Naaß. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A. ■ 14.30 Uhr: Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland. „Schuld und Leid. Das Trauma von Flucht und Vertreibung 1945–2022“. Lesung mit
■ 16.00 Uhr: Ackermann-Gemeinde e. V. „... und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“. Der Umgang mit der eigenen Schuld als Grundlage für einen Dialog aus christlichem Ursprung. Podiumsdiskussion mit: Dr. Günter Reichert, Dr. Peter Becher, Dr. Otfried Pustejovsky und Richard Neugebauer. Moderation: Christoph Lippert. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1. ■ 16.00 Uhr: Antikomplex –hnutí proti xenofobii und Heimatkreis Braunau. Mitten am Rande – Gespräche mit Menschen, die dem Sudetenland ein neues Gesicht geben. Podiumsdiskussion mit: Erik Buchholz, Michal Bureš, Antonín Kolář und Milada Kolářová. Moderation:



■ 17.30 Uhr: Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband – e. V. Unsere Familienwurzeln in Archiven Tschechiens finden – allgemein und am Beispiel von Julius Patzak (Kammersänger). Vortrag: Werner Honal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher (VSFF). Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B.
■ 17.30 Uhr: Verein für deutsch-tschechische Verstän-
❯ In Deutsch und Tschechisch Festführer


Zum 74. Sudetendeutschen Tag ist ein Festführer erschienen, der auf 48 Seiten über das gesamte Programm informiert. Der deutsche Festführer wird am Veranstaltungsort ausgegeben. Ab sofort steht der Festführer in
und







■ 9.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst. Erna Meiser, Pfarrerin i. R. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1.
■ 10.00 Uhr: Aufstellung der Fahnenabordnungen und Trachtengruppen. Vor Halle 6.
■ 10.30 Uhr: Einzug der Fahnenabordnungen und Trachtengruppen zur Hauptkundgebung. Moderation: Robert Wild
■ 11.00 Uhr: Hauptkundgebung. Halle 5. Begrüßung: Steffen Hörtler, Landesobmann der SL Bayern.
Totengedenken: Robert Wild.
Erklärung der Sudetendeutschen Jugend (SdJ) – Jugend für Mitteleuropa e. V.: Mario Hierhager, Vorsitzender.
Grußbotschaft aus Böhmen.
Reden:
Dr. h. c. Bernd Posselt MdEP a. D., Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Dr. Markus Söder MdL, Bayerischer Ministerpräsident und Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe. Musikalische Umrahmung: Kurt Pascher und seine Original Böhmerwälder Musikanten.
■ 14.30 Uhr: Ackermann-Gemeinde e. V. und Sudetendeutsches Priesterwerk e. V. Ulrich – ein europäischer Heiliger. Gespräch mit: Domkapitular Dr. Thomas Groll. Moderation: Mathias Kotonski. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.1. ■ 14.30 Uhr: AutorenNetzwerk Ortenau-Elsaß. „was bleibt“ – Kindheitserinnerungen 1939–1952. Lesung mit dem Autor: Helmut Hannig. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.13. ■ 14.30 Uhr: Filmstudio Sirius und Kulturverband/Spolek Němců a přátel německé kultury, Ortsgruppe Graslitz/Kraslice. „Das Erzgebirge – Grenzgeschichten von Deutschen und Tschechen“ (2019). Präsentation des Films von Jörg-Peter Schilling. Mitwirkende: Dr. Petr Rojík, Dr. Pavel Andrš, Anita Donderer und Ulrich Möckel. Referent: JörgPeter Schilling. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 B. ■ 14.30 Uhr: Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Haus des Deutschen Ostens und Volk Verlag. „Tracht(en)Kunst. Die Anatomie der Wischauer Tracht“, „Heimat im Gepäck. Vertriebene und ihre Trachten“ und; „Wer bin ich? Wer sind wir?“. Buchpräsentationen. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.11 B. ■ 14.30 Uhr: Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e. V. Die Sprachencharta und die Stellung des Deutschen als Minderheitensprache in der Tschechischen Republik. Vortrag: Štěpánka Šichová. Halle 6. ■ 16.00 Uhr: Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Sudetendeutsches MundartMemory. Projektvorstellung: Lorenz Loserth. Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A.







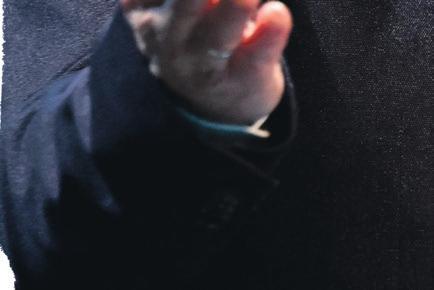






❯ HEIMAT!abend und Sudetendeutsches Volkstanzfest am P ngstsamstag


Aus Böhmen kommt die Musik, und auf dem HEIMAT!abend am Sudetendeutschen Tag kommt ihre völkerverbindende Kraft zur Entfaltung.




Mauke-Frontmann Wolfgang Klemm und seine Bandkollegen präsentieren eine einzigartige Mischung aus paurischen Texten und Kabarett.

In Halle 5 der Messe Augsburg zelebrieren am Pfingstsamstag um 19.00 Uhr Gruppen deutscher und tschechischer Muttersprache die gemeinsame Kultur der Böhmischen Länder im Herzen Europas durch



virtuose musikalisch-tänzerische Darbietungen unter der Regie von Roland Hammerschmied. Einen besonderen Höhepunkt bildet der Auftritt der Neugablonzer Mundartkabarettgruppe „Mauke – Die Band“, die 2023 für ihre Verdienste um den Erhalt der Gablonzer Lebensart mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Volkstumspflege ausgezeichnet wurde. Bereits 2013 erhielten die Musiker den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Kaufbeu-

ren und 2019 den Dialektpreis Bayern. Die Band um Frontmann Wolfgang Klemm bietet eine einzigartige Mischung aus Musik, paurischen Texten und Kabarett. Botschafter des Böhmerwaldes in Augsburg und Umland sind seit Jahrzehnten Kurt Pascher und seine Original Böhmerwälder Musikanten, die auch heuer den böhmischen Zauber in die Messe Augsburg tragen. Gleichermaßen dürfen sich die Gäste über den Auftritt der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, des Prachiner Ensembles Strakonitz/ Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice sowie der Egerländer Familienmusik Hess freuen. Für alle, die mit dem HEIMAT!abend selbst auf den Geschmack gekommen sind, ist im Anschluß das Sudetendeutsche Volkstanzfest genau das richtige. Ab 21.00 Uhr wird in der Halle 5 der Augsburger Messe getanzt. Für die fachkundiger Anleitung sorgt Tanzmeisterin: Sabine Januschko.
Moderiert von Ingrid Deistler und Rudolf Klieber finden am Pfingstsonntag von 11.00 bis 16.00 Uhr im Tagungscenter, Ebene 1, Raum 2.24 A, die traditionellen Mundartlesungen statt.
Der Ablauf: 11.00–11.15 Uhr: Günter Fiedler, Riesengebirge, Paurisch. 11.20–11.35 Uhr: Bernhard Geier, Sudetenschlesien, Altvater. 11.40–11.55 Uhr: Margit Bartošová, Riesengebirge, Paurisch. 12.00–12.15 Uhr: Thomas Englberger, Schönhengstgau, Triebendorf. 12.20–12.35 Uhr: Friedrich Höpp, Kuhländchen. 12.40–12.55 Uhr: Renata Smutná, Riesengebirge, Paurisch. 13.00–13.15 Uhr: Erhard Peter, Kuhländchen. 13.20–13.35 Uhr: Rosina Reim, Wischauer Sprachinsel. 13.40–13.55 Uhr: Etta Engelmann, Egerland, Falkenau. 14.00–14.15 Uhr: Harald Höfer, Iglau. 14.20–14.35 Uhr: Gustav Reinert, Jeschken-Lausitzer Gebirge. 14.40–14.55 Uhr: Rudolf Klieber, Egerland, Mokrau. 15.00–15.15 Uhr: Richard Šulko, Egerland, Netschetin. 15.20–15.35 Uhr: Inge Eflerová, Riesengebirge, Paurisch. 15.40–15.55 Uhr: Leo Schön, Braunau. 16.00 Uhr: Nach den Lesungen findet ein offenes Treffen der sudetendeutschen Mundartfreunde statt. Auch online sind zahlreiche Mundart-Aufnahmen über den YouTube-Kanal der Sudetendeutschen Landsmannschaft unter www.youtube.com/sudeten abrufbar. Die Videos sind Teil des Projekts „Heimat im Ohr –Mundart im Netz“ der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.
Anzeige






















Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung Gras itzer Heimatzeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München
E-Mail svg@sudeten.de
�
„Ich
Die von der Ackermann-Gemeinde im Bistum Regensburg initiierte Veranstaltungsreihe „Quo vadis, Grenzland“ widmete sich heuer Ende April als Zoom-Veranstaltung der Frage „,Nichts wie hin! Oder: Nichts wie weg?‘ – Lebensqualität im Grenzland beiderseits der bayerisch-tschechischen Grenze“. Mitveranstalter waren das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und die Katholische Erwachsenenbildung in Regensburg, Förderung kam vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
Martin Sarnezki, Moderator und Vorstandsmitglied der Ackermann-Gemeinde im Bistum Regensburg, gab einen Überblick über das Programm. Der Vorsitzende Bernhard Dick würdigte das mannigfaltige Programm. CeBB-Leiterin Veronika Hofinger sprach über „Lebensqualität im Grenzland“. Grundsätzlich, so Hofinger, habe jeder Mensch einen in alle Richtungen orientierten Aktionsradius, der bisweilen an der Grenze beschnitten werde. Die Aufgabe des CeBB und weiterer Institutionen sei, für die Menschen in der Grenzregion den Aktionsradius auf beiden Seiten der Grenze zu erweitern – bei oft unterschiedlichen Kulturräumen. Insbesondere durch soziale Kontakte oder unterhaltsame Veranstaltungen könnten die Lebensqualität gesteigert und eine konstruktive Grundhaltung zum Nachbarland erreicht werden. Hofinger verwies auf die besonderen Aspekte des europäischen Grünen Bandes, des früheren Grenzstreifens, der Europa vier Jahrzehnte getrennt habe. Anhand von Begriffen beschrieb Hofinger Lebensqualität und machte deutlich, daß diese aufgrund subjektiven Empfindens schwer meß- oder steuerbar sei. So nenne der Bericht der Bundesregierung über Lebensqualität zwölf Dimensionen mit 46 Indikatoren, das Regierungsamt der Tschechischen Regierung weise in einer ähnlichen Studie elf Indikatoren oder Dimensionen auf. Im Vergleich der zwei Länder fehle auf tschechischer Seite der Aspekt „In globaler Verantwortung handeln und Frieden sichern“, ansonsten tauchten in beiden Ländern die gleichen Inhalte auf.
Beim Ranking der Lebensqualität rangiere Deutschland auf Platz 16 und die Tschechische Republik auf Platz 18, relativ schwache Werte seien jedoch im Vergleich zum Binnenland oder zu Ballungsgebieten in anderen Untersuchungen für die Grenzregionen ermittelt worden. Andererseits seien erst jüngst die Städte Eger, Karlsbad und Krummau als Aufsteiger gekürt worden. „Es ist schwierig, bestimmte Fakten zu verallgemeinern. In dieser Region ist viel Bewegung, vieles hat sich verbessert. Es ist zwar nicht alles ideal, aber vieles in positiver Entwicklung“, schloß Hofinger.
„Erfolgsrezepte jenseits der Grenze“ waren das Thema von Václav Chroust, Zweiter Bürgermeister von Klattau und Direktor der dortigen Katakomben. Er widmete sich den Entwicklungen in den mehr als 30 Jahren seit dem Mauerfall. Dieser und der EU-Beitritt Tschechiens seien wichtige Etappen gewesen. Deutsche und Tschechen hätten viele Gemeinsamkeiten wie Kultur, Essen und Trinken oder Humor. Sie trenne nur die Sprache. „Von Bedeutung ist auch, den Weg zu ebnen mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist ein Weg, der in die Zukunft führt“, nannte er die Grundlagen. Verbunden damit sei-
en die weiterzugebenden Werte. Auch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse brachte der 1963 Geborene ein. Er erinnerte an die Jahrzehnte, in denen Fahrten von Klattau nach Regensburg nicht möglich gewesen seien; an Spaziergänge im Böhmerwald nur bis zur Grenze, ohne den Osser oder Lusen erreichen zu können. Chroust: „Der Fall des Eisernen Vorhangs war die wichtigste Sache, die ich in meinem Leben erfahren durfte.“ Heute freue er sich über das Leben in einer demokratischen Welt mit offenen Grenzen und der Tatsache, daß Tschechien Bestandteil des Westens sei, auch wenn dieser Aspekt im Westen oft anders eingeschätzt werde. Mit Bedauern blicke er auf die Grenzschließung während Corona zurück.
„Wir müssen Freundschaft und Freiheit leben“, sagte er und schilderte die langjährigen und guten Kontakte zwischen seiner Stadt und der AckermannGemeinde Regensburg – auch über die offiziellen Treffen hinaus. Er plädierte für „echte Beziehungen zwischen normalen Menschen unabhängig von der Politik“, die eine tiefere Qualität brächten. Als Erfolgsrezept nannte er die Aspekte Treffen, Freunde, Zusammenarbeit mit Empathie, miteinander reden. Und: „Den Blick auf die Zu kunft richten als Tschechen, Deutsche und Europäer.“
„Erfolgsrezepte diesseits der Grenze“ beschrieb Bernd Som mer, Erster Bür germeister von Waldsassen. Einleitend skizzierte er die Unterschiede bei den Verwaltungsebenen in beiden Ländern, was bisweilen Arbeit und Abstimmungen erschwere. Durch die Einstufung als Oberzentrum und die Zusammenarbeit mit mehreren Kommunen beiderseits der Grenze habe seine Region jedoch eine zentrale Bedeutung erlangt. Die Einwohnerzahl sei stabil, die finanzielle Situation angespannt. Im Rückblick auf 1989 nannte Sommer die Schließung der letzten Porzellanbetriebe, Ängste im Zuge der Grenzöffnung und die ungewisse Zukunft des Zisterzienserinnenklosters. Aber: „Die Ängste waren unbegründet, die Ressentiments wurden abgebaut, der Bau der gemeinsamen Zukunft begann.“ 2010 sei von der Grenze nichts mehr zu spüren gewesen. Wo Menschen zusammenkämen, spielten Grenzen und Sprache keine Rolle mehr. 1990 bis 2020 sei eine starke Aufwärtstendenz spürbar gewesen, ein Erstarken der Wirtschaft in den Kommunen und Städten, auch im Landkreis Tirschenreuth. „Ohne die Grenzöffnung wäre das nicht möglich gewesen. Die Menschen wollen in der Region bleiben, der Drang in die Großstädte ließ nach.“ Dazu beigetragen habe der Ausbau des Verkehrsnetzes, auch wenn bei der Bahn noch Defizite bestünden und das eine oder andere ÖPNV-Projekt unsicher sei.
sei 2022 die grenzüberschreitende Arbeit gefeiert worden, unter anderem mit der Verleihung des Europäischen Kulturerbe-Siegels für die zisterziensische Klosterlandschaft Waldsassen. Aktuell sehe er, so Sommer, Aufgaben in den Bereichen Bildung, Sprache, Gesundheitswesen, Kultur, Sport, Verkehr, Rad- und Wanderwege sowie Tourismus. In der grenzüberschreitenden Arbeit seien gegenseitiges Vertrauen und Respekt sowie das Aufeinanderzugehen die Basis. „Unser Grenzland ist lebenswert, es fehlt uns fast an nichts. Wir haben geringe Lebenshaltungskosten und eine hohe Lebensqualität. Wir sind bereit für weitere Zuzüge“, endete Sommer.

Ivo Dubský ist Vorsitzender des 2010 gegründeten Vereins für den Wiederaufbau der SanktNikolaus-Kirche in Schüttwa. „Das Projekt hat eine positive Wirkung auf die soziale und gesellschaftliche Entwicklung und den Zusammenhalt“, sagte er. Er erinnerte daran, daß um 1350 Johannes von Schüttwa, Tepl oder Saaz hier zur Welt gekommen sei. Mit Fotos erläuterte Dubský den schrecklichen Zustand der Kirche sowie die Sanierung und Neugestaltung des Umfeldes. Wichtig sei gewesen, das Andenken an Johannes von Schüttwa einzubeziehen. Inzwischen fänden in der Kirche und auf dem Gelände viele Kulturveranstaltungen statt. Die Kirche sei von Bayern und Tschechen gemeinsam saniert worden, doch Politiker auf tschechischer Landesebene vergäßen häufig das Sudetenland. Um so mehr zolle er den Leuten vor Ort und in der Region Anerkennung für ihr Engagement. „Wenn wir das Grenzgebiet aufwecken wollen, muß die Gemeinde selbst etwas tun. Wir machen einfach weiter, die Menschen sind sehr aktiv und bringen sich ein“, schloß Dubský. „Lebensqualität aus der Sicht von Bürgern der Grenzregion“ beleuchteten Deutsche und Tschechen, die in der Grenzregion tätig waren, sind oder werden. So plant Maximilian Bolch, Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin, eine spätere Praxis als Hausarzt in Waldsassen mit Wohnort Eger. Er habe Tschechien als ein spannendes Land empfunden und sofort das Sprachzertifikat Bohemicum an der Universität Regensburg angestrebt. Er wolle Landarzt in Waldsassen sein und in Eger leben.
Grenzpendler Miloslav Sláma aus Klattau arbeitet bei der Personalservice-Firma Aaquila in Regen. Aktuell, so Sláma, pendelten rund 33 000 Tschechen zur Arbeit nach Deutschland, etwa ein Viertel in die GrenzlandLandkreise Cham (4750), Regen (1680) und Freyung-Grafenau (1370). Ein Hauptgrund sei der Mindestlohn, der 2023 in Tschechien rund 4,30 und in Deutschland zwölf Euro betragen habe.
den Deutschen, Tschechisch zu lernen. Inzwischen sei Englisch die gemeinsame Sprache. 2018 verbrachte Marcus Reinert, heute Grundschullehrer in Kelheim, sechs Monate in Pilsen. Seine zweite Ausbildung als Theaterpädagoge brachte er damals als Kulturmanager im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet bei Čojč, dem grenzübergreifenden Theaternetzwerk, ein. Und er lernte Tschechisch. Er organisierte und leitete Jugendbegegnungen vom Fichtelgebirge bis zum Dreiländereck und lernte Land und Leute beiderseits der Grenze kennen. Das faszinierte ihn und weckte den Wunsch, hier dauerhaft zu leben. Als er ein Arbeitsangebot aus dem Landkreis Cham erhielt, zog er in die frühere Kreisstadt. „Land, Leute, der Zauber der Natur – viele Erwartungen haben sich bestätigt“, war Reinerts erster Eindruck.
Freundschaften seien entstanden, tschechische und deutsche Jugendliche nutzten den neuen Skater-Park in Eger. Ein beklemmendes Gefühl habe bei ihm die Grenzsperrung 2020 ausgelöst. Andererseits habe Corona einen Schub bei der Digitalisierung bewirkt. Mit einigen Ereignissen
Die tschechischen Pendler fänden in Deutschland eine stabile Arbeit, darüber hinaus entstünden oft auf der Berufs- und Arbeitsebene freundschaftliche Beziehungen. Im privaten Bereich sei die Sprache ein Hindernis. Als Deutschlehrer motiviere er seine Landsleute, Deutsch zu lernen. Natürlich empfahl er auch
Doch bald wurden auch die infrastrukturellen Nachteile wie die langen Wege nach Cham und Taus oder Regensburg und Pilsen deutlich. „Ich kann mir vorstellen, später wieder ins Grenzland zu ziehen. Denn es gibt hier viele Attraktionen, die ich schätze und von denen ich schwärme. Der Böhmerwald und die angrenzenden Orte sind eine reizvolle Region. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die ursprünglich aus Prag oder großstädtischen Regionen stammten“, faßte Reinert zusammen. Die Verkehrsanbindungen sind auch für Zuzana Verešová, die an der Ostbayerischen Technischen Hochschule AmbergWeiden arbeitet und zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Geschichtspark BärnauTachau tätig war, die Hauptherausforderung. Denn die aus Pilsen stammende Frau wohnt mit ihrer Familie in Flossenbürg. „Trotz Covid wurden wir im ländlichen Raum gut angenommen, die Integration verlief schrittweise. Aber mindestens ein Auto –meistens sogar mehr – ist nötig“, schilderte sie. Ob Einkäufe oder Arztbesuche – ohne fahrbaren Untersatz gehe es nicht. Andererseits sei die Einbindung in die örtlichen Strukturen sehr schnell gegangen, prägend sei die überregional bekannte KZGedenkstätte. „Gut, daß diese Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten“, stellte Verešová fest, die 400 Meter von dieser Einrichtung entfernt wohnt. Ein Urgestein in Sachen bayerisch-tschechischer Unternehmungen ist der frühere DBFahrdienstleiter und heutige Wanderführer Rudi Simeth aus Eschlkam-Stachesried. Er erzählte: „Mit der Grenze bin ich schon als Vorschulkind in Verbindung gekommen. Der Großonkel nahm uns zur Grenze mit und ermahnte uns: ‚Ja keinen Schritt über die Grenze!‘ Ich erlebte alle Höhen und Tiefen mit. Uns ging nichts ab, weil wir nichts anderes kannten.“ Seit dem Mauerfall biete er grenzüberschreitende Wanderungen an. Dabei beziehe er oft die verlassenen Orte ein, die in den 1950er Jahren dem Erdboden gleichgemacht worden seien. Besonders entlang des Grünen Bandes gebe es wunderbare, unberührte Landschaften. In der Diskussion sagte Magdalena Becher, Leiterin für das Bayerisch-Tschechische Gastschulprojekt bei der Euregio Egrensis, bei ihrer früheren Tätigkeit im Tschechischen Zentrum Düsseldorf sei ihr klar geworden, sie müsse näher an die Grenze. Über das CeBB sei sie zur Euregio Egrensis mit Dienstsitz in Marktredwitz gekommen. Becher: „Ich bin ein absoluter Fan vom Grenzgebiet.“ Markus Bauer
Wilfried Heller hat einen neuen Band herausgegeben. Der SLKulturpreisträger dokumentiert darin die Beiträge einer Tagung in Wildstein im Kreis Eger und wertet die Aussagen zu Vertreibung und Integration von 14 Betroffenen aus.
Über die Integration der rund zwölf Millionen deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es ein Fülle von Veröffentlichungen. Sie reichen von kurzen Erlebnisberichten bis zu großen wissenschaftlichen Untersuchungen. Eine Forschungslücke ist, daß die Darstellungen von Vertriebenen, ihren Nachkommen und anderen betroffenen Gruppen bisher kaum ausgewertet worden sind, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Erfahrungen mit der Vertreibung und der Integration herauszuarbeiten.
Vierzehn Stimmen
Wie unterscheiden sich die Erlebnisse der selbst Vertriebenen von denen ihrer Kinder und Enkel? Wie haben Aussiedler die Integration erlebt, und was ist die Perspektive der in der Heimat verbliebenen Deutschen?
Bei letzteren stellt sich zwar nicht die Frage der Eingliederung an einem neuen Wohnort, doch mußte diese oft übersehene Gruppe bald nach 1945 in einem völlig veränderten sozialen Umfeld zurechtkommen, was ganz ähnliche Fragen aufwirft. Auch die Ergebnisse der relativ jungen Traumaforschung wurden bisher wenig auf die deutschen Vertriebenen bezogen, obwohl hier unzählige Traumatisierungen geschehen sind.
Der Geograph Wilfried Heller, im Alter von vier Jahren selbst mit seiner Familie aus dem Egerland vertrieben, führte über diese Fragen eine Tagung durch, deren Ergebnisse hier dokumen-
tiert werden. Die Tagung fand nach den langen Corona-Wirren im Oktober 2023 im westböhmischen Ort Wildstein/Skalná (bis 1950 Vildštejn) statt. Bei dem Treffen sprachen 14 Referenten. Darunter waren Vertriebene wie der Künstler und Architekt Hatto Zeidler oder der ehemalige SL-Bundeskulturreferent Wolf-Dieter Hamperl, außerdem Mitglieder der Nachkommen dieser Erlebnisgeneration, also deren Kinder, wie der Germanist Ralf Heimrath und die darauffolgenden Enkel wie SL-Kulturpreisträger Alexander
Bräutigam. Ferner referierten drei später emigriere Aussiedler wie Erich Wetzka und eine heimatverbliebene Egerländerin. Alle Beiträge sind spannend und ergreifend. Interessant ist, wie differenziert und tiefgründig auch die Stimmen der Jüngeren über Vertreibung und deren Folgen sind. Beispielhaft dafür ist der Beitrag von Gudrun Scharr, die 1967 in der Oberpfalz geboren und deren Mutter 1946 aus Littmitz im Kreis Elbogen vertrieben wurde. Die Leiterin der Bayerischen Justizakademie in Pegnitz in Oberfranken sinniert
unter anderem darüber, warum Vertriebene, die eigene Kinder bekommen hätten, sich weniger mit der Vertreibung und den Folgen beschäftigt hätten als Kinderlose? Vielleicht weil „die Vertriebenen mit eigenen Kindern selbstverständlich und unweigerlich in eine andere Zeit gewachsen wären“? Die Kinderlosen dagegen hätten auch „mehr Zeit und Einsamkeit gehabt, um sich ihren Gedanken an die Heimat zu widmen“. Die Vertreibung werde in den Berichten der verschiedenen Generationen nur wenig unter-

schiedlich hinsichtlich des Ablaufs und der Probleme, die dabei einträten, beschrieben, faßt Herausgeber Heller zusammen. „Die Eingliederung in Deutschland kann nach allen Darstellungen als gelungen bezeichnet werden, auch wenn in fast allen Erlebnisberichten die Heimatvertriebenen von manchen Einheimischen als ,Flüchtlinge‘ herabgesetzt und als nicht als gleichwertig eingeschätzt wurden.“
Förderlich für die Integration seien die Verwendung des Standarddeutschen („Hochdeutsch“) anstelle des Dialekts und vor allem das Einheiraten in einheimische Familien gewesen, auch wenn manche Einheimische die eingeheirateten Vetriebenen zuweilen etwas von oben herab betrachtet hätten, so Heller. Ein ganz wesentlicher Faktor, der den Heimatvertriebenen Anerkennung und Ansehen ermöglicht habe, seien Leistungen im Beruf und in sozialen Einrichtungen oder das Engagement in Ehrenämtern oder für Musikaufführungen gewesen. Andererseits würden das Vertreibungsgeschehen und die Probleme der Eingliederung von den älteren Referenten intensiver behandelt als von den anderen. „In manchen Berichten der jüngeren Generation wird die Herkunft der Vertriebenen sogar teilweise fast nostalgisch verklärt“, beobachtet Heller, auch wenn das Unrecht und die Grausamkeiten der Vertreibung unbestritten blieben. „Befunde der Traumaforschung zeigen, daß Traumata, wie solche, die infolge der Vertreibung auftreten, bei Vertriebe-
nen noch lange wirken, vielleicht sogar nie verschwinden, sondern nur verdrängt werden können.“
In den Beiträgen des Bandes würden von den jüngeren Autoren Traumata nicht explizit angesprochen, abgesehen von Hinweisen auf Bemerkungen mancher Einheimischer, daß Vertriebene und ihre Nachkommen doch nicht ganz zur Gemeinde des Zuzugsgebietes gehörten. Wilfried Heller, der am 8. Mai 1942 in Littmitz/Kreis Elbogen zur Welt kam, ist ein deutscher Geograph und emeritierter Professor für Sozial- und Kulturgeographie. Schwerpunkte seiner Lehr- und Forschungstätigkeit sind Raumstrukturwandel und Migrationsforschung in Deutschland und Südosteuropa. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt Heller 2013 den Sudetendeutschen Kulturpreis für Wissenschaft und 2017 den Egerländer Kulturpreis „Johannes-vonTepl“ für Wissenschaft. Susanne Habel

Wilfried Heller (Hrsg.): „Aus der Sicht verschiedener Generationen ‒ Vertreibung aus dem Egerland und Eingliederung in Deutschland“. Verlag Inspiration Unlimited, Berlin 2024; 83 Seiten, 14,80 Euro. (ISBN 978-3-94512749-0)



Eine musikalische Reminiszenz zum 25. Todestag von Ernst Mosch bot die Egerländer Geigenbauerkapelle Mitte April im mittelfränkischen Bubenreuth. Das Ensemble hat eine Geschichte, die schon mit der Vertreibung begann. Als Ende des Jahres 1950 die ersten Neubürger, also die Vertriebenen aus dem Egerland, in der Geigenbauersiedlung Bubenreuth einzogen, waren unter ihnen auch einige Musiker aus Schönbach/ Luby und Umgebung. Das Orchester der Geigenbauer wurde ins Leben gerufen. Es kann als Nachfolger verschiedener Schönbacher Kapellen verstanden werden.
Einen überaus unterhaltsamen Abend mit traditioneller, aber auch neuartiger böhmischer Musik erlebten die Besucher des Blasmusikabends der Egerländer Geigenbauerkapelle in der bis auf den letzten Platz

besetzten Bubenreuther Mehrzweckhalle. Kaum eine Blasmusik ist so bekannt und beliebt wie die böhmische. Herz und Gemüt werden von den schwungvollen Melodien gleichzeitig angesprochen, unverwechselbar ist deren Klang. Die Egerländer Geigenbauerkapelle hat sich ganz diesem Genre verschrieben – und das kam sehr gut an. Gleich beim ersten Stück, dem Marsch „Start frei“, ging man musikalisch in die Vollen und gab einen Vorgeschmack darauf, wie schmissig und impulsiv der Abend verlaufen sollte. Kapellenvorstand Werner Hehn begrüßte eine ganze Reihe von Gä-
sten und Ehrengästen. Ansonsten begnügte er sich mit dem Satz: „Ich mache es kurz, wir sind nicht zum Reden gekommen, sondern zum Musizieren.“ Moderator Andreas Schaufler führte unterhaltsam und humorvoll durch das Programm. Er ging auf die Programmpunkte ein und verstand es hervorragend, die Stimmung noch weiter zu heben. Die Polkas standen dann auch im Mittelpunkt des Programmes. So erklangen die „Brauhaus-Polka“, „Goldener Oktober“ und ein besonderes „Danke schön“ widmete die Kapelle ihrem Notenarchivar mit der „Archivi-







sten-Polka“. Aufgelockert wurden die Zweivierteltakt-Stücke durch schwungvolle Walzer. Dabei fungierten der Dirigent Alexander Stadler und seine Klarinette spielende Ehefrau Isabella als Gesangssolisten und setzten dem Ganzen ein i-Tüpfelchen auf.
Bei der „Kridlovka-Polka“ von Kurt Pascher hatten die Flügelhornsolisten Alois Schmid und sein Sohn Christian einen Solopart zu meistern, der es in sich hatte. Sie erhielten tobenden Applaus. Mit viel spielerischer Finesse folgten die „Weinkeller-“, „Stephans-“ und „BlütenprachtPolka“, bevor es mit dem Marsch „Domi Adventus“ in die Pause ging. Den zweiten Teil widmete die Egerländer Geigenbauerkapelle ihrem Idol, dem Egerländer Ernst Mosch zu dessen 25. Todestag. Mit dem „Falkenauer-Marsch“ erinnerte die Kapelle an seinen Geburtsort Zwodau bei Falkenau. Danach folgten seine ersten beiden Titel „Fuchsgraben“ und „Rauschende Birken“, wobei das Publikum diesen Ohrwurm mitsummte. Danach ging es mit beschwingten Melodien und viel Gesang von Ernst Mosch flott weiter. Ein Höhepunkt war die
achtjährige Tochter des Dirigenten: Sophie Stadler sang das Lied zum Mosch-Walzer „Wenn Opa
Beim Blasmusikabend der Egerländer Geigenbauerkapelle wurden auch Ehrungen vorgenommen.
So wurden Alexander Stadler für 25 Jahre als Dirigent der renommierten Kapelle zwei Ehrungen zuteil. Der Kreisehrungsbeauftragte des Nordbayerischen Musikbundes, Steffen Schmidt, überreichte in dankbarer Anerkennung für die Verdienste um die deutsche Blasmusik die Ehrennadel in Gold des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) für 25 Jahre aktive Dirigententätigkeit. Die dazugehörende Urkunde hatte der Präsidenten des NBMB, Manfred Ländner, unterschrieben.
Auch Bubenreuths Bürgermeister Norbert Stumpf blickte auf gemeinsame Jahre zurück, hob das ehrenamtliche Engagement hervor und wünschte dem Dirigenten weiterhin viel Erfolg.

erzählt von Zuhaus“. Ihre beiden Opas Reinhold und Sepp dürften hier aufmerksam zugehört haben.
Bevor Moderator Schaufler die letzten Stücke ankündigte, bedankten sich der Erste Vorstand Werner Hehn und Dirigent Stadler für den überwältigenden
Besuch. Nach dem „Walzer für Dich“ und der „Böhmischen Liebe“ war noch lange nicht Schluß, denn die Kapelle hatte sich natürlich für die vehement geforderten Zugaben mit einigen Potpourris vorbereitet. Beinahe frenetischer Applaus war der Lohn für vier Stunden Melodien aus der „alten“ Heimat, mit der die Musiker auf unterhaltsame Art dafür sorgten, daß die Egerländer Tradition in Bubenreuth nicht verlorengeht. Heinz Reiß
Kontakt: Werner Hehn, Egerländer Geigenbauerkapelle Bubenreuth, David-MorgensternWeg 17, 91056 Erlangen, Telefon (0 91 31) 4 52 72, eMail vorstand@ geigenbauerkapelle.de
Die Egerländer Geigenbauerkapelle, so der Bürgermeister, sei ein Aushängeschild der Gemeinde. Sie dokumentiere für den Geigenbauerort die Themen Musik und Integration. Als Anerkennung der Gemeinde Bubenreuth überreichte Stumpf die Ehrenurkunde zum
25jährigen Jubiläum und ein Geschenk. Gerührt dankte Stadler all seinen Musikern, die ihm 25 Jahre die Treue gehalten hätten, und seiner Frau Isabella, die ihm bei seinen Einsätzen immer den Rücken freigehalten habe und ihn noch dazu musikalisch unterstütze. Heinz Reiß




Im Rahmen eines festlichen Ehrenabends in der Münchener Traditionsgaststätte Paulaner am Nockherberg zeichnete Christian Knauer, Vorsitzender des BdV-Landesverbandes Bayern, Ende April die beiden ehemaligen CSU-Landtagsabgeordneten Sylvia Stierstorfer und Peter Winter mit der Goldenen Ehrennadel des BdV aus.
BDie baden-württembergische SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf mit Zuffenhausen, Stammheim, Rot, Zazenhausen, Freiberg und Mönchsfeld traf sich Ende April zur Jahreshauptversammlung.
Ortsobfrau Waltraud Illner blickte in ihrem Rechenschaftsbericht auf 2023 zurück. Sie erwähnte die zahlreichen Vortragsveranstaltungen bei den Monatsnachmittagen in Stuttgart-Giebel, bei denen sie Gäste wie Maximilian Mörseburg MdB oder das Weilimdorfer Original Aline Groß begrüßt habe. Der Höhepunkt sei die Feier zum 75jährigen Bestehen der Ortsgruppe gewesen. Zu der seien der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper und die ehemalige Primaballerina des Stuttgarter Balletts, Professor Birgit Keil, ins Haus der Heimat in Stuttgart gekommen. Neben den Veranstaltungen in der Ortsgruppe fanden wieder die 4.-März-Feier und der Ostdeutsche Ostermarkt im Haus der Heimat sowie ein Tagesausflug zum Schönenberg in Ellwangen statt. In ihrem Ausblick auf 2024 wies Illner auf den Monatsnachmittag am 15. Juni hin, bei dem über „Enkeltrick und Telefonbetrug“ aufgeklärt werde, und auf den Tagesausflug am 11. Juli an den Brombachsee. Sie freue sich, daß im September der neue Weilimdorfer Bezirksvorsteher Julian Schahl zum Monatsnachmittag nach Giebel kommen werde. Neben den vielen Worten, den Zahlen aus dem Kassenbericht und dem Bericht von Kassenprüfer Otfried Janik wurden Mitglieder geehrt. Klaus Weis wurde für 75, Otfried Janik für 60, Hannelore Threimer und Rainer Pelka wurden für 45, Waltraud Illner, Annemarie Klemsche-Haberhauer und Bruno Klemsche für 40, Inge Aigelsreiter, Edith Seidenspinner, Heike Titz und Helmut Heisig für 35, Sabine Mezger, Agnes Peukert, Maria Wieland und Thomas Wanek für 20 und Evelyn Weis und Hans Heger für zehn Jahre Treue mit Nadel und Urkunde ausgezeichnet. tg
eide ehemaligen Politiker waren während ihrer politischen Tätigkeiten auf unterschiedliche Weise sehr mit den Heimatvertriebenen, den Aussiedlern und den Spätaussiedlern sowie ihren Landsmannschaften verbunden. Als Dank für deren fortwährende Unterstützung bei der Umsetzung der vom BdV angestoßenen Initiativen hatten sich die Mitglieder des BdV-Landesvorstandes, die Vorsitzenden der Landsmannschaften und die Vertriebenenpolitischen Sprecher von SPD, Freien Wählern und Bündnis 90/Die Grünen zusammengefunden, um beiden Persönlichkeiten Respekt und Anerkennung zu zollen. Die aus Pfatter in der Oberpfalz stammende Sylvia Stierstorfer, hatte 2018 die Funktion einer Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene übernommen, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Innerhalb weniger Monate sei es ihr gelungen, die Herzen der Mitglieder in unseren Verbänden für sich zu gewinnen, sagte Knauer in seiner Laudatio. Stierstorfer habe dem Bayerischen Landtag von 2003 bis 2023 angehört. In ihrer neuen Funktion sei sie eine vorbildliche, über die Fraktionsgrenzen hinweg anerkannte Ansprechpartnerin für die in Bayern lebenden Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler sowie deren Nachkommen gewesen. Diese hätten sich jederzeit mit ihren Anliegen, Fragen und Eingaben an sie wenden können. Den BdV-Landesverband Bayern und die Landsmannschaften im Freistaat habe sie mit vorbildlichem Engagement, beispielsweise in Fragen der Pflege des kulturellen Erbes, bei politischen Themen wie der fortdauernden Gültigkeit der Beneš-Dekrete oder der Lage der deutschen Minderheit, unterstützt. Eine zentrale Aufgabe habe sie darin gesehen, die bayerische Öffentlichkeit über das Schicksal, die Geschichte und die Kultur der Heimatvertriebenen und Aussiedler zu informieren und sie für deren Anliegen zu sensibilisieren. Entsprechend habe sie großen Wert auf eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit gelegt.
Um die Bande zu den östlichen Nachbarn zu festigen, habe sie sich – in engem Austausch mit der 2021 gegründeten Stiftung Internationaler Jugendaustausch Bayern – für einen Ausbau der Begegnungen zwischen Schülern und Jugendlichen aus Ost und West eingesetzt. Initiiert habe sie auch ein 100 000-EuroProgramm, mit dem das Haus der Bayerischen Geschichte Lehrmaterialien und digitale Angebote für Schülerinnen und Schüler zum Themenkomplex „Vertriebene und Aussiedler“ habe entwickeln können. Das ebenfalls von ihr angestoßene Forschungsprojekt „Vertriebene als integraler Bestandteil Bayerns“ fördere am Leibniz-Institut für Südostund Osteuropaforschung seit 2022 neue Erkenntnisse darüber, wie die Vertriebenen als Brükke und Kulturvermittler im Herzen Europas gewirkt und welchen Einfluß sie auf die kulturelle Identität Bayerns ausgeübt hätten.
„Als besonderen Freund der deutschen Minderheit in Oberschlesien“ würdigte der BdVLandesvorsitzende den früheren Haushaltsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Peter Winter aus Waldaschaff. Winter ha-
mangelnden Unterstützung durch die polnischen Behörden entgegenzuwirken und für potentielle Schüler Fahrgelegenheiten zu schaffen, habe er über seine Kontakte zur Stadt Aschaffenburg den ersten Schulbus für die vom Verein Pro Liberis Silesiae in Raschau bei Oppeln gegründete deutsche Schule organisiert. Eine Vielzahl von ihm organisierter Transporte mit Schul- und Kindergartenmöbeln sowie weiteren Einrichtungsgegenständen und die Überlassung weiterer drei Schulbusse seien gefolgt.



Ausstellungseröffnung im Böhmerwaldmuseum in Wien.


be von 2003 bis 2018 dem Bayerischen Landtag angehört. Schon seit Beginn seiner Parlamentsarbeit sei er – obwohl er keinen Vertriebenenhintergrund habe – Mitglied der Arbeitsgruppe Vertriebene, Aussiedler, Partnerschaftsbeziehungen der CSULandtagsfraktion gewesen. Mit ihr habe er 2009/2010 die deutsche Minderheit in Oberschlesien besucht. Bei einem abendlichen Gespräch habe der frühere Sejm-Abgeordnete Bruno Kosak geklagt, daß schon viele bundesdeutsche Besucher Versprechungen gemacht hätten, passiert sei allerdings wenig. Dieser Satz sei ausschlaggebend für ein fortan völlig ungewöhnliches Engagement des CSU-Politikers gewesen.
Die prekäre Situation der Minderheit beim Aufbau ihrer Schulen habe ihn zu konkreten Hilfsmaßnahmen veranlaßt. Um der
Da der Sejm vor einigen Jahren eine Volksschulreform beschlossen habe, die eine Ausweitung der Jahrgänge und ein höheres Raumprogramm beinhaltet habe, habe die Schließung der Schule gedroht. Unter Mithilfe seines Kollegen Walter Nussel habe Winter sechs Schulcontainer organsiert und so, auch mit Unterstützung des Bayerischen Sozialministeriums, einen wichtigen, ja essentiellen Beitrag für den Erhalt der Einrichtung leisten können. Für den Aus- und Umbau der Schule sei ihm zudem gelungen, unter Mithilfe seiner Bundestagskollegin Andrea Lindholz rund 300 000 Euro aus Bundesmitteln zu beschaffen. Mittlerweile sei neben den Schulen in Raschau und Guttentag in Oppeln/Malina ein richtiges Schulzentrum mit Kleinkinderbetreuung, Schule, Mittagsbetreuung, Turnhalle und so weiter entstanden. Bei seiner ersten Reise nach Schlesien habe er den damaligen polnischen Dolmetscher im Deutschen Generalkonsulat in Breslau kennengelernt. Ihm habe er bei der Ausbildung seiner Kinder in Deutschland geholfen und an dessen Heimatort Großpeterwitz die Ortsfeuerwehr durch Beschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeugs und etlicher Ladungen mit Feuerwehrzubehör unterstützt. Diese habe er buchstäblich bei den Freiwilligen Feuerwehren in seinem Landkreis erbettelt. Im Herbst plane er, weitere Gerätschaften, unter anderem einen Spreizer, nach Großpeterwitz zu bringen.
Peter Winter habe zudem in seiner Funktion als Haushaltsvorsitzender stets für die Anliegen der Heimatvertriebenen ein offenes Ohr gehabt und die Landsmannschaften und den BdV tatkräftig unterstützt. Er gehöre mit seinem Engagement für unsere Anliegen und für jene der deutschen Minderheit wohl zu den herausragenden und vorbildlichsten Beispielen ehrenamtlichen Engagements, das er ohne großes Aufsehen fortwährend leiste, schloß Christian Knauer.


Ausstellungseröffnung im Südmährerhof mit

Mitte April ging die heurige Eröffnung des Südmährerhofs im Museumsdorf Niedersulz im Weinviertel in Niederösterreich bei prächtigem Besuch und frühlingshaften Temperaturen über die Bühne.
Wenige Tage zuvor war bereits die Sonderausstellung „Bedeutende Persönlichkeiten im Bayerischen Wald und im Böhmerwald“ im Böhmerwaldmuseum in Wien eröffnet worden. Grußworte entboten Botschaftsrat Vojtěch Joza von der politischen Abteilung der Tschechischen Botschaft in Wien, SLÖBundesobmann Rüdiger Stix, Landesobmann Erich Lorenz und die Hausherren Gernot Peter und Franz Kreuss.

Auf dem Südmährerhof erläuterte Brigitta Appel die von ihr konzipierte Ausstellung „Denkmäler entlang der Grenze“, wozu sich alle Generationen gesellten. Der Obmann des Kulturverbandes der Südmährer, Hans-Günter Grech, konnte zusammen mit seiner Frau Christa Gudrun die in Anwesenheit der Nationalratsabgeordneten Angela Baumgartner, Bürgermeisterin von Sulz, zahlreich erschienene lokale Prominenz begrüßen. Die beiden Musikvereine der Gemeinde Sulz im Weinviertel, die Ortsmusikkapelle (OMK) Obersulz-Blumenthal und die OMK Niedersulz, unterhielten beim Festakt weit mehr als 100 Leute bei einem Platzkonzert mit schöner mährischer Musik.
Die Eghalanda Gmoi z‘ Waldsassen in der Oberpfalz führte kürzlich ihre Jahresversammlung durch.
Nach der Begrüßung durch den Gmoivüarstaiha Josef Heinz wurde der Verstorbenen gedacht, wie es in einer Mitteilung heißt. Trotz schwindender Mitgliederzahlen habe Heinz einen sehr umfangreichen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2023 vorlegen können. So erinnerte er unter anderem an den Neujahrsempfang der Stadt Weiden mit Markus Söder, die Bundeshauptversammlung im Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz, den Sudetendeutschen Tag in Regensburg, den Egerlandtag in Marktredwitz, das Laurentiusfest in Chodau, die Bundeskulturtagung in Marktredwitz und die Landeshauptversammlung Bayern in Ingolstadt.
Aktiv gewesen sei auch die Egerländer Singgruppe unter der Leitung von Alois Fischer. So habe sie unter anderem die Messe in Maria Loreto zum Gedenken an verstorbene Mitglieder, den Gottesdienst in Bad Neualbenreuth zur Fußwallfahrt von Sankt Quirin nach Maria Kulm und eine Heilige Messe in der Herz-Je-
su-Kirche in Marktredwitz gestaltet.
Im weiteren Verlauf der Jahresversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt: Rudolf Hannawald für 60 sowie Marianne Bauer und Gerlinde Bauer für 40 Jahre Treue. Bei den Neuwahlen konnten alle Posten wieder besetzt werden. Den Vorstand hat weiterhin Josef Heinz inne. Sein Stellvertreter ist Heinz Pleier, Schriftführerin ist Elfriede Hannawald-Fastner, ihre Stellvertreterin ist Marianne Bauer. Kassierer ist zukünftig Wolfgang Sommer, Stellvertreterin ist Elfriede Hannawald-Fastner, Kassenprüfer sind Edmund Bittner und Annelies Pleier. Rudi Hannawald wird – solange es ihm möglich ist – das Amt des Kulturwarts ausüben.
Zum Schluß wies Ludwig Schicker auf die Veranstaltungen des deutsch-tschechischen Stammtisches hin, an dem jeder, der daran Interesse habe, teilnehmen könne. So werde am 16. Mai das Museum „Flucht. Vertreibung. Ankommen" in Erbendorf besichtigt. In seinem Grußwort dankte Stadtrat Bernhard Lux für die Arbeit der Gmoi, insbesondere der Singgruppe, die viele Veranstaltungen bereichere.






Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

Marktplatz mit Pestsäule auf einer Postkarte des Kunstverlags Brück & Sohn von 1912.
Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Tockczaw stammt aus dem Jahr 1240. Später wurde der zur Riesenburg gehörige Ort Duchczow und Dux genannt.
� Dux
In der Mitte des 14. Jahrhunderts besiedelten zunehmend Deutsche die bisher von Tschechen bewohnte Stadt. Bereits 1389 stellte die deutsche Bevölkerung die Mehrheit der Bürger. Daneben gab es eine starke jüdische Gemeinde. 1390 wurde die erste Schule eröffnet, die Meister Jakob leitete. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch schon einen Bürgermeister und ein Altengericht. Neben der romanischen Sankt-Georgs-Kirche errichtete nach 1318 Agatha von Schumburg ein Dominikanerkloster, das während der Hussitenkriege aufgelöst wurde. Bis 1398 gehörte Dux den Herren von Riesenburg, danach kaufte es Wilhelm von Wettin dem völlig überschuldeten Borso VI. ab. Da der Handel ohne königliche Zustimmung erfolgte, war er Gegenstand eines jahrzehntelangen Streits. 1412 ging die Stadt an den böhmischen König Wenzel IV. über. In einem Friedensvertrag zwischen den Markgrafen von Meißen und der böhmischen Krone wurde die Stadt 1417 wieder an die Mark Meißen übereignet. Während der Hussitenkriege wurde die Stadt niedergebrannt. Erst danach kam es zum Wiederaufbau. Gleichzeitig gingen die Streitigkeiten zwischen der böhmischen Krone und den Markgrafen von Meißen weiter, bis die Stadt 1459 durch den Vertrag von Eger endgültig Böhmen angeschlossen wurde. 1460 wurden die Stadtprivilegien bestätigt, die Stadt erhielt vom böhmischen König Georg von Podiebrad Stadtwappen und Siegel sowie das Braurecht. Die Verwaltung wurde Zbynko Zajíc von Hasenburg und danach Prokop von Rabstein übertragen. Der Nachfolger Prokops, Heinrich von Rabstein, bedrohte die Besitztümer der Herzöge von Sachsen, die daraufhin Strafzüge nach Böhmen unternahmen. Nach der Schlichtung siedelten die Herren von Sulewitz auf der Riesenburg. Paul Fürst Kaplirz de Sulewicz verlegte 1491 seinen Sitz auf die Feste Dux und überließ die Burg dem Verfall. 1512 bauten die neuen Herren ein Renaissance-Rathaus. 1527 wurde die Herrschaft Dux an Depolt Popel von Lobkowitz verkauft. Sohn Wenzel baute die Stadtfeste weiter zum Schloß aus.


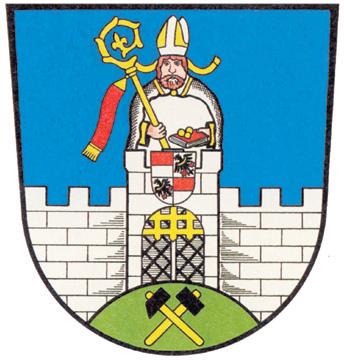

Die Teplitzer Straße auf einer Postkarte des Kunstverlags Brück & Sohn von 1911.
Während des Dreißigjährigen Krieges brannten schwedische Truppen 1634 einen Großteil der Stadt nieder. Nachdem der letzte in Dux herrschende Lobkowitzer Franz Josef kinderlos gestorben war, übernahm die Witwe Polyxena Marie von Lobkowicz die Stadt. 1642 heiratete sie den Grafen Maximilian von Waldstein. Sein Nachfolger, der Königgrätzer Bischof Johann Friedrich von

Waldstein, ließ 1671 eine Brauerei erbauen und milderte nach seiner Ernennung zum Prager Erzbischof seinen Untertanen die Leibeigenschaft. Die Einnahmen aus Frondiensten und sonstige Finanzabgaben gehörten von nun an der Stadt. 1675 wurde die erste Brauerei erbaut, 1675 bis 1695 das Schloß gänzlich renoviert. 1680 erhob Johann Friedrich von Waldstein die Herrschaften Dux und Oberleutensdorf zum Familienfideikommiß, dabei erteilte er der bis dato untertänigen Stadt Dux die Freiheit. Nach Johann Friedrichs Tod übernahm sein Bruder Ernst Josef die Herrschaft. Dessen Neffe Johann Josef wurde 1707 Universalerbe. Zwei Jahre nach dem Beginn seiner Regentschaft brannte ein Großteil der Stadt einschließlich des alten Rathauses ab. Gleichzeitig erlebte die Stadt unter dem neuen Eigner ihren größten Aufschwung. Das Schloß wurde um zwei Seitenflügel verbreitert, 1721 wurde die Marienkirche fertiggestellt und 1722 vom Leitmeritzer Bischof Johann Adam Wratislaw von Mitrowitz eingeweiht. 1723 wurde der Bau
der Sankt-Barbara-Kirche und 1728 des Schloßhospitals mit der Kirche Mariä Himmelfahrt beendet. 1713 gründete Johann Josef von Waldstein eine Manufaktur zur Herstellung von Waffen. Im Schloß eröffnete er die Waldstein-Galerie. Nach seinem Tod 1731 übernahm sein Neffe Franz Josef von Waldstein das Erbe. Dieser bereicherte Dux um zahlreiche künstlerische Werke, unter anderem mit Statuen aus der Werkstatt von Matthias Bernhard Braun. Nach dem Ausbruch der Pest, an der auch seine Frau Josefa starb, ließ er die Pestsäule der Heiligen Dreifaltigkeit errichten.
Im Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763 wurde die Stadt, in der inzwischen Graf Emanuel Filibert von Waldstein herrschte, vom preußischen Heer völlig ausgeraubt. Nach dem Krieg errichtete der Graf in Dux eine Strumpfmanufaktur. 1763 wurde der erste Braunkohleschacht in Betrieb genommen.
Der gebildete Josef Karl Emanuel von Waldstein trat 1774 die Nachfolge an. Er umgab sich gerne mit Künstlern und Wissenschaftlern. 1785 brachte er den Schriftsteller, Weltenbummler und Abenteurer Giacomo Casanova auf das Schloß. Dieser verbrachte als Schloßbibliothekar bis zu seinem Tod 1798 13 Jahre in Dux. Aus dieser Zeit stammt auch der Großteil seiner Veröffentlichungen. Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven und der russische Zar Alexander I. zählten ebenso zu seinen Gästen. Nach dem Tod von Josef Karl Emanuel von Waldstein 1814 übernahm dessen Bruder Adam, ein bedeutender Botaniker, die Herrschaft. Er baute das Schloß im klassizistischen Stil um, legte den englischen Park im Schloßgarten an und errichtete ein Schloßmuseum. Anschließend kam es wegen früher Todesfälle zum raschen Wechsel in der Herrschaft. 1818 wurde das städtische Bürgerspital errichtet, dafür hatte der in Dux gebürtige kursächsische Beichtvater Joseph Preyßler der Stadt 1514 Gulden und 15 Kreuzer gespendet. 1831 bestand die Stadt Dux aus 170 Häusern mit 1030 deutschsprachigen Einwohnern. Die freie Schutzstadt Dux umfaßte 157 Häuser mit 887 Einwoh-
nern, das Schloß einschließlich zwölf Häusern mit 143 Einwohnern bildete den herrschaftlichen Anteil. Unter herrschaftlichem Patronat standen die Dechanteikirche Mariä Verkündigung und die mit drei Lehrern besetzte Schule. Der freie Anteil wurde von einem Magistrat mit einem Bürgermeister und einem geprüften Rat verwaltet. Die Stadtgemeinde besaß eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 806 Joch 279 Quadratklafter. 142 Personen waren gewerblich tätig, darunter waren 65 Meister und Gewerbsherren. Die Stadt besaß das Privileg für vier Jahrmärkte, zudem wurde mittwochs ein Wochenmarkt abgehalten. Im obrigkeitlichen Anteil befanden sich ein Meierhof, ein Förster- und ein Gärtnerhaus, ein Bräuhaus und eine Branntweinbrennerei. Außerhalb der Stadt lag das herrschaftliche Hospital. Dux war Pfarrort für Liptiz und Ladowitz; die Filialkirchen in Liptitz und Sobrusan waren dem Dekanat Dux untergeordnet.
Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften war Dux ab 1850 eine Stadtgemeinde im Leitmeritzer Kreis und wurde Sitz eines Gerichtsbezirkes. Unter Anton von Waldstein besuchten der Schriftsteller František Palacký und Frédéric Chopin das Schloß. Auch die Stadt änderte und vergrößerte sich. Die alten Tore wurden abgerissen und neue Unternehmen entstanden, darunter 1849 eine Zuckerfabrik und eine Glasfabrik. 1853 kam eine Porzellanmanufaktur des Inhabers Eduard Eichler hinzu. Im Preußisch-Österreichischen Krieg 1866 brachten die durchziehenden Heere die Cholera nach Dux. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Eisenbahn gebaut und im Mai 1867 eröffnet. Dux wurde zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt.
Dux wurde dank Kohleförderung, Ziegeleien, Kalkwerken, Gießereien, Keramikfabriken und später Glasereien zur wichtigen Industriestadt. Der Bergbau führte immer mehr Menschen nach Dux, und das war fast auch sein Untergang. Durch den Abbau und die Unterhöhlung mußten immer wieder Teile der Stadt abgerissen werden. Der industrielle Aufschwung wirkte sich auch auf die Bevölkerungszahl
aus. Hatte Dux zu Beginn des 19. Jahrhunderts 772 Einwohner, waren es 1900 bereits 11 921. Die Tschechen waren eine Minderheit. Die Industrie benötigte gut ausgebildete Facharbeiter. 1872 wurde deshalb eine Bergfachschule eingerichtet. Das Gebäude der Privat-Bergschule für das nordwestliche Böhmen befand sich in der Brüxer Straße. Bei Bergunglücken 1879, 1893, 1900 und dem größten 1934 kamen mehr als 240 Bergarbeiter ums Leben. Beim Thermalwassereinbruch 1879 auf der Grube Döllinger starben 23 Bergleute. Dadurch gingen mehrere Gruben des Reviers unter; der Wasserentzug der Heilquellen von Töplitz und Loosch stellte die Bäder vor die Existenzfrage. 1881 wurde Dux an das Telefonnetz angeschlossen, 1892 die elektrische Beleuchtung in Betrieb genommen und 1893 ein Postamt eröffnet. 1896 wurde das städtische Museum eröffnet, im selben Jahre wurde Dux Sitz einer Bezirkshauptmannschaft. 1902 wurde die evangelische Kirche geweiht, die Pläne stammten von den Dresdner Architekten Schilling & Graebner. 1911 kam das Bezirkskrankenhaus dazu und 1914 das Gebäude des Gymnasiums. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Dux von einer Wirtschaftsflaute heimgesucht.
Nach der Gründung der Tschechoslowakei 1920 zählte die Stadt 12 513 Einwohner, davon 5965 Tschechen, und 1930 waren es 13 040 Einwohner. 1927 wurde das tschechische ReformRealgymnasium eröffnet. Dux schloß sich vor dem Zweiten Weltkrieg nicht mehrheitlich der
Sudetendeutschen Partei Konrad Henleins an. 1933 stand an der Spitze der deutsche Antifaschist und Sozialdemokrat Karl Schlein, der kurz vor der Okkupation der Stadt durch deutsche Truppen am 9. Oktober 1938 ins Exil nach Schweden floh. Nach der Besetzung wurde ein großer Teil der tschechischen Bevölkerung in das Landesinnere vertrieben. Dadurch sank die Einwohnerzahl bis Mai 1939 auf 9646. Bis 1945 war die Stadt Sitz des deutschen Landkreises Dux im Regierungsbezirk Aussig im Reichsgau Sudetenland.
Am 8. Mai 1945 übernahm der Tschechoslowakische Nationalausschuß unter Josef Skalník die Geschicke der Stadt. Durch Beschuß der sowjetischen Armee brannte am 10. Mai die Kirche Mariä Verkündung aus. Aufgrund der Beneš-Dekrete wurde der Hauptteil der deutschen Bevölkerung enteignet und vertrieben. Ausgenommen waren nur Einwohner, die sich gegen die Besetzung der Tschechoslowakei durch das Deutsche Reich am 15. März 1939 gewandt hatten. 1947 hatte Dux 8229 Bewohner. Erst nach und nach kam es zur Nachbesiedlung mit Tschechen. 1961 wurde der Kreis Dux aufgehoben und die Stadt dem Kreis Teplitz zugeordnet. Der größte Teil des Schloßparks, das Hospital und die Kirche Mariä Himmelfahrt mußten dem Bergbau weichen. Verkehrswege wurden abgerissen und nur teilweise wieder aufgebaut. Im Zuge der Verwüstung der Gemeinde Herrlich wurde 1975 das Kataster von Herrlich-Neudorf der Stadt Dux zugeschlagen, das Kataster von Herrlich-Neuhof fiel der Stadt Ossegg zu. In Herrlich kam der Maler, Cartoonist, Illustrator und Kinderbuchautor Hans Johann Georg Traxler am 21. Mai vor 95 Jahren zur Welt. Doch darüber nächste Woche mehr.
WIR GRATULIEREN
Folgenden treuen HeimatrufAbonnenten gratulieren wir zum Geburtstag im Mai und wünschen von ganzem Herzen Glück, Gesundheit und Gottes Segen.
n Klostergrab, JaneggKrinsdorf, Janegg-Wernsdorf/Kreis Dux, Grundmühlen/Kreis Teplitz-Schönau. Horst Wiedemann, JohannSebastian-Bach-Straße 16, 85540 Haar, 17. Mai 1934.
n Ladowitz/Kreis Dux. Rosemarie Junge, Goethestraße 21, 93138 Lappersdorf, 10. Mai 1930.
n Ullersdorf/Kreis Dux. Gudrun Fuchsenberger, Bussardweg 34, 63741 Aschaffenburg, 8. Mai 1942.
n Teplitz-Schönau. Erhard Spacek (Heimatkreisbetreuer), Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, 29. Mai 1942.
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg


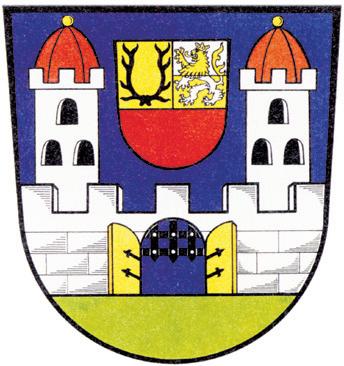
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


Jedes Jahr treffen sich Menschen aus den unterschiedlichsten Richtungen, aus Deutschland und aus der Tschechischen Republik in der Sankt-GeorgsKirche in Grafenried, um Zeugnis für den Glauben abzulegen, aber auch um Zeugen eines gemeinsamen Europas zu sein.
Im Frühjahr 1946 mußten die deutschsprachigen Grafenrieder ihre Häuser im Sudetenland an der Grenze zur Oberpfalz verlassen. Grafenried wurde zerstört, den Menschen wurde ihre Heimat genommen. Lange Zeit war der Ort Synonym für Flucht und Vertreibung. Heute ist das verschwundene Dorf Grafenried ein Ort der Begegnung, der Mahnung und des Miteinanders. Jedes Jahr treffen sich ehemalige Bewohner der Ortschaften Grafenried, Seeg, Anger und Haselberg in den Grundfesten der freigelegten Kirche Sankt Georg, um ihrer Heimat zu gedenken. Um für ein paar Stunden mit ehemaligen Nachbarn und Freunden oder deren Nachkommen vereint zu sein, nehmen viele eine weite Anreise auf sich. Waldmünchens Stadtpfarrer Wolfgang Häupl sagte zu Beginn des Gottesdienstes, den er mit dem Geistlichen aus Klentsch, Ivan Pavlíček, und Klaus Oehrlein von der Ackermann-Gemeinde aus Würzburg zelebrier-
Grafenried wurde 1282 im Urbarium von Niederbayern erstmals erwähnt. Seine Gründung geht auf die Zeit um 950 zurück. Es gehörte zum Pflegamt Waldmünchen. Es lag auf der Grenze zwischen Böhmen und Bayern und litt seit seiner Gründung unter den Kämpfen um diese Grenze.
Der Grafenrieder Pfleger Hans von Lampach berichtet 1567 von 60 Herdstätten und großer Armut. Pfleger Wolf Pelkhofer berichtet 1631 über einen Georg Thomas von Schönlündt, der 1541 nach Grafenried kam, um eine Glashütte aufzubauen. Des-
te, daß viele Menschen einen langen Weg auf sich genommen hätten, um sich in ihrer Heimat zu treffen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern und sich auszutauschen. Für viele Anwesende sei Grafenried Heimat. „Mit dem Besuch zeigen Sie, daß Sie Ihre Vorfahren von Grafenried nicht vergessen haben“, meinte der Geistliche. Diese Mauern hier in Grafenried seien ein ganz besonderer Ort. Manche der hier Anwesenden seien hier getauft worden, hätten hier Gottesdienste gefeiert und ihre Angehörigen im naheliegenden Friedhof bestattet. Mit dem alljährlichen Treffen zeige man, daß man die Vorfahren und die eigenen Wurzeln nicht vergessen habe. Zu glauben, dazu lade Jesus ein, auch damals und hier in den Mauern der Sankt-
Georgs-Kirche. Man sei aufgerufen, an Gott zu glauben, so wie die beiden Kirchenpatrone Adalbert und Georg es getan hätten.
rückkommen, sondern viele zeigten ihr Interesse an der Geschichte Grafenrieds und wertschätzten auch die archäologische Arbeit, die in den vergange-






Der Waldmünchener Stadtpfarrer Wolfgang Häupl zelebrierte den Gottesdienst in den Ruinen der ehemaligen Pfarrkirche Sankt Georg. Bild: Christa Bucher
Ortsbetreuer Thomas Schrödl freute sich, die Besucher in den Ruinen der ehemaligen Pfarrkirche Sankt Georg begrüßen zu können. Die Anwesenden würden nicht nur in ihre Heimat zu-
nen Jahren geleistet worden sei. Grafenried sei zu einem Ort der Versöhnung und Völkerverbindung geworden. Deutsche und Tschechen reichten einander hier die Hand und zeigten Wertschät-
zung und Achtung vor dem anderen. Gerade in einer Zeit, wo Extremismus und Fanatismus herrschten, seien dieser Ort und dieses Treffen Vorbild für ein grenzüberschreitendes gutes Miteinander. Eine gemeinsame Erinnerungskultur zeichne diesen Ort aus, der Mahnmal der Vereinigung geworden sei. Als sensationelle Entdeckung bezeichnete Schrödl den Fund der Grafenrieder Orgel, die 1789 gebaut worden sei und mehr als 150 Jahre lang in Gottesdiensten in der Pfarrkirche Grafenried erklungen sei. Daß der damalige Geistliche die Orgel vor der Sprengung der Kirche abgebaut habe, grenze an ein Wunder. Auch daß diese durch Zufall gefunden worden sei und die Zeit vergleichsweise gut überstan-
den habe, sei ein kleines Wunder. Nun werde diese in einer Orgelwerkstatt originalgetreu restauriert. Nach der Restaurierung werde diese im Musikkonservatorium in Brünn Studenten zur Verfügung stehen. Nach Brünn komme die Orgel, weil die Grafenrieder Kirche nicht mehr existiere, sich in der Umgebung aber kein passender Ort befinde. Da von staatlicher Seite die Zuschüsse für die Restaurierung nur spärlich vorhanden seien, habe man eine grenzüberschreitende Spendenaktion gestartet. Sämtliche Spenden, versicherte Schrödl, seien ausschließlich für die Restaurierung der Orgel bestimmt. Zum Schluß galt Schrödls Dank all denen, die den historischen Ort in mühevoller Arbeit freigelegt und seinen Erhalt gesichert hätten. Stellvertretend nannte er Hans Laubmeier, Helmut Roith, Alois Rötzer, Zdeněk Procházka und vor allem Zuzana Langpaulová. Ihrem Einsatz sei es zu verdanken, daß viele Überreste des alten Grafenried wieder zum Vorschein gekommen und in einem Freilichtmuseum erhalten geblieben seien. Gemeinsam sangen alle mit dem Aster Kirchenchor das Grafenrieder Lied. Im Anschluß kamen sie im Gasthaus Zum Deutschen Eck in Steinlohe zum Heimattreffen zusammen. wbf
Grafenried – Teil I
sen Kinder verkauften die Glashütte 1580 an Georg Pelkhofer von Mooswang. Dieser vergrößerte den Besitz und übergab 1613 einen Teil seinem Sohn Wolf Eytl für 5000 Gulden. Zwei Glashütten und mehrere Wie-

sen und Felder behielt er. Infolge der Gegenreformation mußte der kalvinische Wolf Eytl Pelkhofer von Mooswang seinen Besitz verlassen. Als er 1634 mit den Schweden zurückkehrte, plünderten die-
se Grafenried total aus. Nach seinem Tod 1635 wurde seine Witwe Anna Margaretha Besitzerin von Grafenried. 1637 verkaufte sie den Ort an den Glashüttenmeister Georg Gerl von Sankt Katharina. Georg Gerl siedelte Untertanen in Grafenried an und baute das Brauhaus wieder auf. Seine Tochter Maria und ihr Mann Georg Werner, Glashüttenmeister von Schönau, übernahmen 1667 den Besitz. Nach dem Tod ihres Mannes 1677 übergab Maria den Besitz 1680 ihrem dritten Sohn Hanuß Thomas Werner. 1688 gab es in Grafenried eine Kapelle. Fortsetzung folgt
Herzlich gratulieren wir im Mai Marta Klement, Ortsbetreuerin von Sirb und Rouden, am 7. zum 93. Geburtstag; Anna Bayerl, ehemalige Ortsbetreuerin von Wottawa, am 10. zum 103. Geburtstag; Günter Gröbner, ehemaliger Kreisrat, am 13. zum 81. Geburtstag; Josef Willard, ehemaliger Mitarbeiter von Schüttwa, am 20. zum 92. Geburtstag; Josef Urban, Ortsbetreuer von Münchsdorf, am 22. zum
93. Geburtstag; Peter Pawlik, Heimatkreisbetreuer, am 27. zum 67. Geburtstag und Franz Vogl, Ortsbetreuer von Sichrowa, Pscheß, Garassen und Holubschen, am 31. zum 91. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem Herzen noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für die tatkräftige Mitarbeit. Peter Gaag Stellvertretender Heimatkreisbetreuer Ortsbetreuerecke




Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Wer die Stiftsbasilika im oberpfälzischen Waldsassen besucht, findet am rechten Chorpfeiler rechts vom freistehenden Altartisch die verstümmelte Christusfigur. Sie wird als besonderes Heiligtum verehrt. Fast immer brennen dort Kerzen. Wie kam es zu dieser Wallfahrt in Waldsassen?
Folgenden Text schrieb Walter Strunz vom Kapplhof in Schönlind 1982 zum Gedenken an den letzten Pfarrherrn der Wieser Kirche Pfarrer Josef Roth.
„Das Kirchdorf Wies lag fünf Kilo meter südlich von Eger an der über Waldsassen führenden Reichsstraße inmitten des Heiligenkreuzer Reviers. Ringsum von Wald umgeben war es allen Egerländern und Stiftländern, besonders den Egerer und Waldsassener Bürgern, als Ausflugsort bekannt.
In den beiden Gast stätten Fischer und Krämling traf man sich beim guten böhmischen Bier bei der Kuba oder beim Roßbacher. Wies entstand als Wallfahrtsort.
� Wies
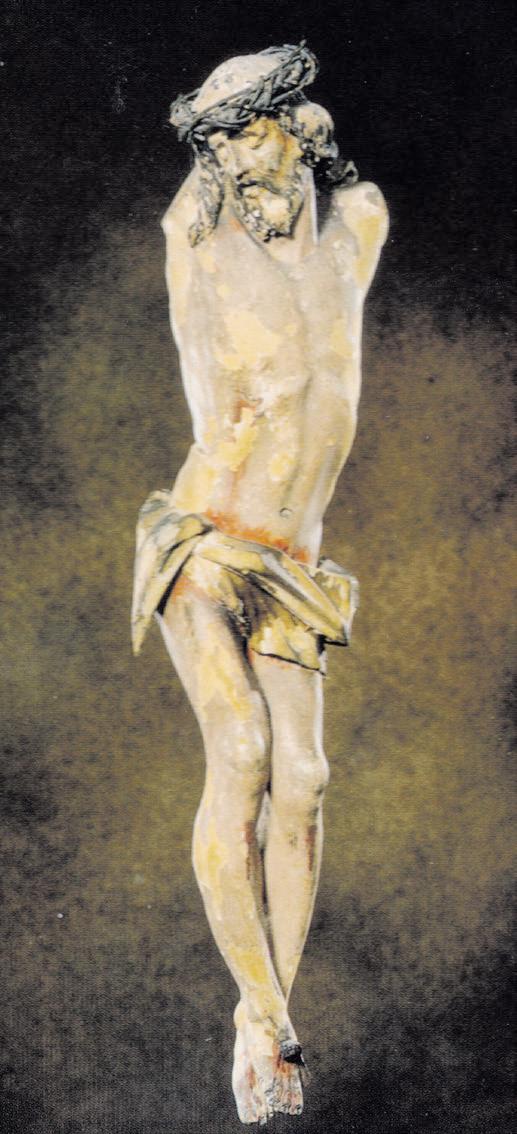
Die geschändete Christusfigur in der Stiftsbasilika in Waldsassen.
Im Jahre 1748 ließ die Egerer Bürgersfrau Barbara Stötzer das Bildnis des gegeißelten Heilands dort an einem Fichtenstamm anbringen. Viele Gläubige, besonders auch aus Bayern, pilgerten zu diesem Bild. Die Opfergaben flossen reichlich, und jeder Pilger nahm sich einige Splitter dieser Fichte mit, denen man Wunderkraft zumaß. Schon nach zwei Jahren waren die Mittel vorhanden, eine Kapelle um den Fichtenstamm mit dem Gnadenbild, der inzwischen zu einem Stumpf geworden war und mit Blech eingefaßt werden mußte, zu bauen.
Am 3. März 1750 weihte der Pfarrer von Oberlohma, Thomas Kolb, die Kapelle. Der Magistrat von Eger ließ im selben Jahr ein Wohnhaus für den Geistlichen erbauen und suchte beim Regensburger Konsistorium um die Bestellung eines Priesters nach,
der auch bald eingesetzt wurde. Der Magistrat behielt sich das Patronatsrecht vor, übertrug aber Barbara Stötzer, die 1772 nach Ungarn ziehen sollte, die Aufsicht über die Kirche. Im Jahre 1751 wurde die Kirche durch Zubauten vergrößert. Die Wieskirche war ein markantes Egerländer Gotteshaus. Dieser aus dem 18. Jahrhundert stammende barocke Fachwerkbau mit Mansardendach bestand genau 200 Jahre lang. Das Fachwerk reichte hier bis zur Grundmauer und war in einer Grundschwelle verzapft. Die barocke Fenstergestaltung war sehr gut in die Fachwerkfassade eingearbeitet. Im Inneren zeigte die Kirche eine ausgezeichnete vielfältige räumliche Gliederung. Sie war reichhaltig mit Wandmalerei, Figuren, einem Hauptaltar, einer Kanzel und vier Nebenaltären geschmückt. Die Kirche war als Ganzes ein einmaliges Prachtstück barocker Baukunst. 1949 wurde das Pfarrhaus niedergerissen und die Kirche geplündert. Oft hörte man Schlagermusik aus dem Gotteshaus. Im darauffolgenden Sommer 1950 wurde der Kirchenbau niedergerissen und angezündet. Ein tschechischer Soldat zog sich hierbei eine Blutvergiftung zu, der er im Egerer Krankenhaus erlag. Gleichzeitig machte man den ganzen Ort dem Erdboden gleich.
Am 6. Februar 1951 fanden deutsche Zöllner an der Grenzsperre bei Wies eine armlose Christusfigur mit einem Strick um den Hals in offensichtlich frevelhafter Absicht aufgehängt. Die deutschen Grenzbe-
amten nahmen die Christusfigur ab und übergaben sie dem damaligen Stadtpfarrer von Waldsassen. Dort wird sie jetzt wie ein Gnadenbild in sühnender Liebe verehrt. Dieser geschändete Christus-Korpus stammte vom Vortragkreuz, welches bei den jährlichen Prozessionen mitgeführt wurde, aus der Kirche ,vo da Wies‘.“
Das Mirakelbuch
Von dieser Wallfahrt hat sich ein Mirakelbuch erhalten, in dem handschriftlich 125 Wunder verzeichnet sind. Drei werden hier im Orginal aufgeführt:
l Nummer 3. „Thomas Kahla, bürglich Glaser in Eger, bekam sein Kind auf einem Aug eine Plattern und auf dem anderen ein Fließlein und eine zeitlang blind Lage. Weilen keine Mittl zu finden, verlobten die Eltern das Kind zu dem gegeißelten Heyland, … es dahin verrichtete ihr Opfer und gebet, so bald erblühet das Kind … und die Platter und Flüsel verlohren sich von Tag zu Tag, wird ebenfalls aydlich bestärckt.“
l Nummer 8. „Item den Sebastian Adler, Bauern zu Heilig Creutz, ist früh morgens, die felder zu düngen, mit einem Fuder Dung auf das Feld gefahren. Un-
einen Groschen Gelds zu einem Opfer ist der Ochs wieder aufgestanden und frisch und gesund nach Hauß gebracht worden.“
l Nummer 11. „Item ein Flaschenmeister zu Eger mit Nahmen Joseph Pflantz hat in einer Suppen eine Nadl oder Spitzblech mit eingegessen, welche nicht mehr herauszubringen war. Nach diesem aber durch überflüssiges Blutauswerffen ruffte in seiner großen noth umb Hülff zu den gegeißelten Heyland und versprach, ein Opfer zu überbringen. Es bald solches geschehen, hat sich die Nadl in den Leib gegeben, und ist mit ihm besser worden, welches er aydlich behaupten will.“
Diese drei Heilungen zeigen schon, wie breit gestreut die Nöte und Leiden der damaligen Menschen unserer Heimat waren. Die genauere Analyse der 125 Erhörungen und Heilungen spiegelt folgenden Sachverhalt: Wie auch in anderen Gnadenstätten verlobte man sich häufig bei Unfällen, wegen Knochenbrüchen, Geschwüren an den Beinen, wegen schwerer Infektionskrankheiten wie Brand, Rotlauf und Plattern, be-
den sich unter den breit gestreuten Krankheitsbildern drei gehäuft. An erster Stelle standen die Augenleiden, so wie in Maria Kulm der Hörschaden. Blindheit wird allein neunmal genannt; weiters „Plattern auf den Augen“, „Fell im rechten Aug“, „Spitzholz im Auge“ oder „Kuhhornstoß ins Auge“. Diese Häufung war nicht zufällig, stand

Ein Votivbild, das oberste einer Bildersäule, zeigt den Wanderer Martin Groß aus Schönlind, der wegen eines Knochenbruchs ein Gelübde zum Wiesheiland macht.

ter der Fahrt ist ihm ein Ochs auf dem Feld umgefallen und würcklich todt dagelegen. Nach Verlobung aber zu dem gegeißelten Jesu mit einer heiligen Meß und
sonders natürlich bei Kleinkindern und lange bestehendem Krankheitsverlauf. Doch hat die Wallfahrt in der Wies auch ihre besonderen Erhörungen. So fan-
doch an der Straße zur Kapelle ein Brunnen, dessen Wasser eine heilende Kraft bei Augenkrankheiten zugesprochen wurde. Auch bei Bruchleiden, besonders bei Kindern und Säuglingen, wurde der Jesus auf der Wies um Hilfe gebeten. Genauso oft, nämlich acht Mal, führten verschluckte Gegenstände, auch meist bei Kindern, zu einem „ex voto“: „Brot im Hals“, „Semmel verschluckt“, „Nadel verschluckt“ oder „Nagel in der Nase“. Letzterer wurde als Votivgabe ausgestellt. Seltenere Anlässe zu einem Gelübde waren Zahnund Kopfschmerzen, Gicht, Nervenleiden wie „Kind kontract worden“ oder in „Kindsnöthen“, aber auch Depressionen und Epilepsie wie „Fraiß“. All diese Leiden betrafen den Menschen, nur in acht Fällen verlobte man sich wegen der Tiere hierher, dreimal weil die Ochsen umgefallen waren, je einmal war das Pferd „fußkrumb“, das Euter
der Kuh entzündet und einmal war „das Vieh durch gottlose Leuth verzaubert worden“. Und was gelobte man bei Rettung aus der Not, bei Heilung von der Krankheit? Besonders häufig wird die Kombination eines Opfers, meist Geld, aber auch Schmuck mit einem Gebet oder einer Andacht erwähnt. Weit entfernt Wohnende gelobten eine Wallfahrt zum Beispiel mit dem vom Fieber befreiten Kind nebst einer Andacht. Besonders beliebt war das Zahlen von Messen, was den Expositus der Wieskirche und den Egerer Stadtpfarrer ganz schön in Schwierigkeiten brachte. Denn 1760 berichtet er von 3000 vorrätigen Votivmessen, weshalb vier Priester zum Messelesen nicht ausgereicht hätten. Die Wallfahrt prosperierte derart, daß man 1761 3585 Gulden an Einnahmen verzeichnete. 26 dieser Wundertaten wurden auf gut gemalten Votivbildern festgehalten. Sie sind auf vier länglichen Tafeln aufgereiht. Jeweils sechs oder sieben Tafeln sind aufgereiht und mit einem Rahmen versehen. Alois John fand sie 1906 gleich beim Eingang in die Kirche. Er berichtete jedoch von sechs langen Holztafeln mit je sechs Bildern, also von insgesamt 36 Bildern. Diese oben genannten vier Tafeln fand ich um 1986 im Treppenhaus des Stadtmuseums Franzensbad, das damals noch nahe dem Kurtheater beheimatet war. Die Bilder sind keine einfachen Bauernmalereien, sondern zweifelsohne bessere Bilder. Wahrscheinlich wurden sie als Ganzes bei einem gut ausgebildeten Maler in Auftrag gegeben. Dafür sprechen das einheitliche Format und der entsprechende Malstil, die Raumaufteilung der Bilder und der immer wieder in eine wunderschöne hügelige Landschaft führende Blick. Sie sind sicherlich ein Werk eines der Egerer Maler. Leider sind sie nicht signiert.
Die Votivbilder im Franzensbader Stadtmuseum und der geschändete Jesus in Waldsassen sind die einzigen Überreste des einst blühenden Wallfahrtsortes Wies. Wolf-Dieter Hamperl



Bund der Eghalanda Gmoin e. V., Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, Telefon (0 92 31) 6 612 51, Telefax (0 92 31) 66 12 52, eMail bundesvorstand@egerlaender.de Bundesvüarstäiha (Bundesvorsitzender): Volker Jobst. Spendenkonto: Bund der Egerländer Gmoin e.V., Brunnenkonto, IBAN: DE28 7805 0000 0810 5621 57 Egerland-Museum Marktredwitz , Fikentscherstraße 24, 95615 Marktredwitz, www.egerlandmuseum.de, eMail egerlandmuseum@egerlaender.de Redaktion: Lexa Wessel, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Trauermeldung
Gmoi Mörlenbach trauert um Josef Zoubek:
Über 20 Jahre lang leitete und prägte Josef Zoubek die Egerländer Gmoi in Mörlenbach. Plötzlich und unerwartet ist er am 2. April 2024 verstorben. Der langjährige stellvertretende Landesvüarstäiha (Landesvorsitzender) in Hessen wurde 77 Jahre alt.
In seine Amtszeit als Vüarstäiha fallen die gut durchgeführten Veranstaltungen, Landestreffen (2010) und Bundesjugendtreffen (2014) in Mörlenbach. Veranstaltungen, wie Kaiser-Kirwa, Mai-
� Spendeneingänge
Andacht, sowie Vertriebenentreffen auf der Tromm, aber auch der Bau des Egerlandbrunnens, zeigten seine große Einsatzbereitschaft, wovon auch die Arbeitsgemeinschaft Süd mit ihren Treffen profitieren konnte. Im Landesverband Hessen der Egerländer wurde er 2009 stellvertretender Vorsitzender. Bereits 2003 hat er die Arbeitsgemeinschaft Süd übernommen, deren Leiter er viele Jahre bis zur Auflösung der Vereinigung war. Für seinen Einsatz wurde er 2014 mit dem Bundesehrenzeichen der Egerländer ausgezeichnet. In 2023 erfolgte die Ernen-

nung zum Landes-Ehrenmitglied in Hessen.
Das Ortsgeschehen in Mörlenbach hat er in vielfältiger Weise mitgeprägt. Pfarrer Torsten Geiß stellte die Verdienste in der Trauerfeier dar, bevor Vertreter mehrerer Vereinigungen das Wort ergriffen.
Insgesamt 17 Jahre lang bereicherte Zoubek mit seinem tiefen Baß die Auftritte des Kirchenchors Cäcilie. Für die Kirchengemeinde war der „Pepe-Mobil-Fahrer“ ein perfekter „Hintergrund-Schaffer“ für Veranstaltungen, Reparaturen und diverse weitere Probleme.
Weitere wichtige Lebensstationen sind: 60 Jahre Mitglied in der Kolping-Familie, über 15 Jahre im Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde, und große Aktivität in der Ökumene. Nicht zuletzt ist der Fußballverein zu nennen. Dort übernahm er nach seiner aktiven Zeit über 20 Jahre die Aufgaben des Jugendleiters und Betreuers. Nicht nur den Egerländern sondern auch vielen Vereinen und Vereinigungen wird Zoubek mit seiner zugreifenden und problemlösenden Art sehr fehlen. Wir trauern mit seiner Familie. Hans-Jürgen Ramisch
Wir bedanken uns herzlich für alle eingegangenen Spenden für den Egerlandbrunnen:
–Zustiftung Egerlandmuseum (Krauß-Stiftung): 2000 Euro.
–Jobst, Lena: 100 Euro.
–Gmoi Herborn: 500 Euro
–Hlawatsch, Henny: 30 Euro.
–Böhm, Johann: 100 Euro.
–Gmoi Forchheim: 100 Euro.
–Gmoi Donauwörth: 80 Euro
–Häring, Mechthild: 30 Euro.
–Wurstverkauf von Gerlinde Hofmann bei der BHV: 85 Euro. –Bender, Hermine: 50 Euro. –Heinl, Irmgard: 50 Euro. –Seidel, Gretl: 50 Euro. –Fenkl, Eduard: 150 Euro. –Sparkasse Hochfranken: 500 Euro. –Heintsch, Rautgunde: 50 Euro. –Gmoi Zorneding: 100 Euro. –Stiftung Egerer Stadtwald: 3500 Euro.
–Hirsch, Erich: 100 Euro. –Jobst, Volker: 100 Euro. –Wallner, Helmut: 100 Euro.
Im Namen des Bundes der Eghalanda Gmoin e.V. bedanke ich mich bei allen Spendern für die Zuwendungen. Zu den genannten Spendern kommen noch manche kleine und große Spenden hinzu, die ausdrücklich nicht genannt werden wollen. Bitte beachten Sie für künftige
� Werner Pöllmann – Dreiländereck am Buchbrunnen – Teil III und Ende – weiter auf Seite 15
Spenden, daß auf dem Überweisungsträger der Spendername vollständig zu erkennen ist. Ich versichere Ihnen, daß alle Spenden für den Egerlandbrunnen, sowie für den Erhalt, die Pflege und den Unterhalt dieses Brunnens, eingesetzt werden. Die verantwortlichen Personen des Bundes setzen seit 2005 großes persönliches Engagement daran, den schönen Egerlandbrunnen zu erhalten. Anfal-
lende Kosten sind aber zu erstatten, und in die Brunnentechnik muß auch regelmäßig investiert werden.
Spendenkonto: –Empfänger: Bund der Egerländer Gmoin e.V. –Brunnenkonto: IBAN: DE28 7805 0000 0810 5621 57; Ihr Volker Jobst Bundesvüarstäiha
� Die nächsten Termine
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit den kommenden Terminen des Egerländer Kalenders. Alle sind herzlich eingeladen: 2024:
n Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai: 52. Bundestreffen der BdEGEgerland-Jugend in Wendlingen.
n Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai: 74. Sudetendeutscher Tag in Augsburg.
n Sonntag, 2. Juni: Hessentag in Fritzlar.
n Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni: Deutsches Trachtenfest, Wangen/Allgäu.
n Sonntag, 9. Juni: 70 Jahre Eghalanda Gmoi Zorneding.
n Sonntag, 16. Juni: 75. Gmoijubiläum Herborn.
n Sonntag, 23. Juni, bis Montag, 24. Juni: Nordgautag in Grafenwöhr. n Sonntag, 30. Juni: Landestreffen und 70 Jahre Eghalanda Gmoi Ingolstadt.

Grenzzeichen im Lagerstein.
Trotzdem ernannte Napoleon Sachsens Kurfürst am 20. Dezember 1806 zum König, um ihn als Verbündeten zu gewinnen. Preußen verlor im Frieden von Tilsit 1807 unter anderem das Bayreuther Gebiet staatsrechtlich an Frankreich.
Napoleon, der den Kaiser in Wien dazu brachte, die Reichskrone 1806 niederzulegen und
Aber Königsberg in Preußen heißt nicht deshalb so, weil es die Krönungsstadt der Hohenzollern war, sondern weil es 1255 der böhmische König Ottokar II. Přemysl gegründet hat. Die Kronländer der Wettiner und Hohenzollern lagen aber nicht innerhalb des damaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wo es nach wie vor nur das Königreich Böhmen gab, dessen Herrschern schon 1198 (bestätigt 1212) von den Staufern die erbliche Königswürde verliehen worden war. Im Dreißigjährigen Krieg büßte der Kaiser seine Macht im Reich ein und baute deshalb seine Stellung als König von Böhmen und Ungarn aus. Dadurch verlor auch Eger nach und nach seinen Sonderstatus. 1721 mußte der Egerer Landtag die Einheit des absolutistischen Habsburger Staates anerkennen und sich auflösen. Karl VI. steckte das Egerland einfach von seiner kaiserlichen in seine königliche „Hosentasche“, bevor er 1723 die Wenzelskrone empfing. Dieser kluge Schachzug war nötig, weil er keine Söhne hatte und unklar war, wer nach ihm die Reichskrone tragen würde. Damit sank die einst Freie Reichsstadt Eger in den Rang einer Königlich-böhmischen Stadt herab. Mit Aufhebung der böhmischen Hofkanzlei im Jahr 1762 wurde das Königreich de facto zum Kronland degradiert und verwaltungstechnisch an Österreich angegliedert, also nicht mehr von Prag, sondern von Wien regiert, wo man 1804 das österreichische Kaisertum kreierte. 1775 folgte die Incorporation (Mediatisierung) des Ascher Ländchens. Das Reichspfand erlosch de jure jedoch erst 1806 mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation selbst. Erst am 2. November 1807 wechselte das (1564–1628 lutherische) Egerland kirchlich vom Bistum Regensburg zum Erzbistum Prag. Da die Rekatholisierung von Prag ausgegangen war, hatte sich die Erzdiözese de facto schon 1628 das Umland von Eger einverleibt. Als 1769 die Bayreuther Linie der Hohenzollern ausgestorben war, übernahm das Gebiet der Ansbacher Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander (1736–1806). Er heiratete in zweiter Ehe eine verwitwete Gräfin, trat am 2. Dezember 1791 zurück und lebte dann als Pferdezüchter in England. Der fränkische Besitz fiel am 5. Januar 1792 an das Berliner Haupthaus zurück und wurde Teil des Königreichs Preußen. Die Hohenzollern hatten im 18. Jahrhundert den Namen Preußen und ihre Königswürde von der Region Königsberg (nun Ostpreußen genannt) auf ihren gesamten Besitz im Reich ausgedehnt und in verschiedenen Friedensverträgen anerkennen lassen. Damit war die Landesgrenze vom Dreiländereck Franken–Sachsen–Böhmen bis zum Dreiländereck Franken–Bayern–Böhmen am Buchbrunnen zur Trennlinie zweier Königreiche geworden.
1804 ein österreichisches Kaisertum zu erfinden, veränderte die politische Landkarte Mitteleuropas radikal. Im Reichsdeputationshauptschluß wurden 1803 100 Territorien kleinerer Landesherren ihren größeren Nachbarn zugeschlagen (zum Beispiel das Hochstift Passau). Am 1. Januar 1806 ernannte Frankreichs Kaiser den Herzog (ab 1803 Kurfürst) von Württemberg und den Kurfürsten von Bayern zu Königen. Von nun an trafen am Buchbrunnen drei Königreiche (Böhmen, Preußen und Bayern) aufeinander. Doch die Zeit dieser Drei-Königreichs-Ekke dauerte nur wenige Tage. Am 7. Januar 1806 annektierte Frankreich das preußische Bayreuther Gebiet. Der König von Preußen und der Kurfürst von Sachsen stellten sich Napoleons Expansion in den Weg. Ihre Truppen wurden am 14. Oktober 1806 bei Jena und Auerstedt geschlagen.
1795 hatte Preußen mit Frankreich den Frieden zu Basel geschlossen. Das Königreich isolierte sich damit im Reich und verhielt sich neutral zu Napoleon. Im Frieden von Schönbrunn vom 15. Dezember 1805 gab Preußen Ansbach freiwillig ab und bekam dafür am 15. Februar 1806 (für wenige Monate) das erheblich größere Kurfürstentum Hannover. Ansbach wurde am 1. Januar 1806 königlich-bayerisch, und Bayreuth wurde sieben Tage später als Napoleons „pays réservé“ von Frankreich besetzt. Mit dem Pariser Vertrag vom 28. Februar 1810 kaufte das Königreich Bayern für 15 Millionen Francs dieses Territorium und nahm es am 7. April 1810 in Besitz. Damit war das Dreiländereck mit Sachsen und Böhmen bis 1918 zu einer Drei-KönigreichsEcke geworden. Bayreuth war jetzt Verwaltungszentrum des Obermainkreises, zu dem unter anderem das 1803 säkularisierte
Hochstift Bamberg und das einstige Waldsassener Stiftland gehörten. 1838 setzte sich aber die alte Trennlinie des Buchbrunnens westwärts wieder durch, wo die katholische Oberpfalz auf den evangelischen Teil Oberfrankens trifft. Bayerns Kreise tragen nach einer reichsweiten
NS-Verwaltungsreform von 1939 (wie alle deutschen Mittelbehörden) den Namen Regierungsbezirk, den es seit 1808 in der AdministrationPreußensgab. Grenzen führten nach Möglichkeit oft über weite Strekken an Fließgewässern entlang. Wo das nicht möglich war, markierte man größere Bäume und (falls vorhanden) Felsen, errichtete Steinwälle oder hob Raingräben aus. Grenzsteine sind an Böhmens Außengrenzen seit 1544nachweisbar.Zwischendem Ameisenbühl bei Schirnding und dem Buchbrunnen sollen sieben Steine gestanden haben, die neben dem Brandenburger und dem Egerer Wappen die Jahreszahl 1562 trugen. Zwischen Asch und Selb gibt es bis heute sieben Wappensteine aus dem 18.Jahrhundert beziehungsweise Bruchstücke davon. Nur selten waren Landesgrenzenvordem19.Jahrhundert auf voller Länge mit Steinenvermarkt,esseidenn,ihr Verlaufwarunklaroderstrittig. Die lückenlose Markierung der drei Landesgrenzen, die am Buchbrunnen zusammentreffen,begannnichtetwamitderzu Böhmen, sondern mit der preußisch-bayerischen Grenze zwischen dem heutigen Oberfranken und der Oberpfalz. Das Königreich Preußen schloß mit dem KurfürstentumBayernam30.Juni 1803 einen Grenzvertrag, in dessen Folge wuchtige Grenzsteine vom Buchbrunnen bis in die Nähe von Marktredwitz gesetzt wurden. Viele von ihnen haben bis heute überdauert. Weiter auf Seite 19
n Sonntag, 7. Juli: 70.Gmoijubiläum Limburg.
n Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli: 19. Vinzenzifest und 49. Egerländer Landestreffen Ba-Wü in Wendlingen.
n Samstag, 20. Juli: 5. Egerländer Brunnenfest in Marktredwitz von 11–17 Uhr.
n Freitag, 9. August: Gäuboden-Festauszug in Straubing, Anmeldung beim Vüarstäiha LV Bayern H. Kindl.
n Samstag, 31. August, bis Sonntag, 1. September: Trachtenmarkt in Greding mit Beteiligung der Egerländer.
n Sonntag, 8. September: 35. Landestreffen des BdEGLV Hessen und 70. Gmoijubiläum Bruchköbel.
n Sonntag,22. September: Oktoberfestumzug,München.
n Samstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober: AEK-Begegnung im EgerlandKulturhaus Marktredwitz.
n Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober: Bundeskulturtagung im Egerland-Kulturhaus Marktredwitz.
n Dienstag, 5. November: Landesarbeitstagung des Landesverbands Hessen in GießenAllendorf.
Termine: www.egerlaender.de


Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46 Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Egon Brückner aus Elbogen teilt seine früheren Erinnerungen über seinen Weg nach Rußland an die Front (Von Weiden aus bis in die Ukraine):
Am 1. März wurden wir nach Weiden in der Oberpfalz verlegt, dort kamen noch andere Einheiten von anderen Garnisonen dazu. Dies waren fast nur 18 bis 19jährige. Dort wurden wir eingekleidet und marschbereit gemacht. Da ich schon vorher meinen Eltern schrieb, daß ich am 1. und 2. März in Weiden sei, besuchten sie mich noch einmal. Das war ein weiter Weg für sie, bei den damaligen schlechten Zugverbindungen. Ich hatte auch nicht viel Zeit für sie, denn ständig mußten wir etwas anderes holen. Nach dem Einkleiden schnell eine halbe Stunde zu den Eltern vor die Kaserne, dann war Essenszeit. So standen die alten Leute vor der Kaserne und warteten den ganzen Tag, bis ich ab und zu ein paar Minuten Zeit für sie hatte. Dabei bemerkte ich gar nicht, wie bedrückt sie waren. Erst auf der langen Fahrt nach Rußland kam mir zu Bewußtsein, wie es für sie war, nun auch den jüngsten Sohn ins Ungewisse fahren zu sehen, wo sie doch schon einen Sohn und einen Schwiegersohn verloren hatten.
Ich sehe sie heute noch in Weiden am Bürgersteig stehen, als wir am Abend kompanieweise zum Bahnhof marschierten. Ich winkte ihnen noch einmal zu, sah, daß meine Mutter weinte, Vater winkte mir auch ganz verlegen zu, dann waren wir an ihnen vorbei.
Zum Güterbahnhof durften sie nicht, denn dort herrschte jetzt reges Leben. Lange Züge standen bereit, es waren Güterwaggons mit einer Lage Stroh am Boden. Bevor wir einsteigen durften, hieß es noch einmal stillgestanden, und mit Nachdruck wurde uns gesagt, daß wir größtes Augenmerk auf unser Marschgepäck zu legen hätten, es drohten strenge Strafen, falls etwas abhanden käme. Darüber Nachdenken konnte sowieso keiner, denn bei der guten Organisation, die man anerkennen mußte, waren wir in kürzester Zeit in den fahrbaren Untersätzen und die Lokomotiven pfiffen zur Abfahrt. Nun ging es in Richtung Rußland. Keiner von uns unerfahrenen Jungen konnte sich vorstellen, was auf uns wirklich zukam. In unserer kurzen Ausbildung hörten wir nur, daß der Krieg gewonnen werden müsse. Und sollte der eine oder andere tatsächlich Pech haben, dann sei es immerhin noch eine große Ehre, für Führer und Vaterland zu sterben. Daher waren viele von uns so begeistert, daß sie sich schon jetzt mit Auszeichnungen an der Brust sahen.
Ich selbst war nicht sehr bgeistert, konnte ich mir doch schon aus den Schilderungen meiner Brüder und meines Schwagers ein klein wenig vorstellen, wie es dort zuging – und trotzdem war dann die Wirklichkeit noch ganz anders. Dazu kam noch, daß ich kein so guter Soldat war. Mir hing der ganze Kram zum Hals heraus, wo doch daheim so viel vernünftige Arbeit wartete.
� Egon Brückner – Teil I
Dabei ging es nicht auf direktem Weg unserem Ziel zu, denn durch die ständigen Bombardierungen der Amerikaner und Engländer wurden viele Bahnstrekken getroffen, denen wir jetzt auf Umwegen ausweichen mußten. Wir wußten nie, in welchen Frontabschnitten wir eingesetzt werden sollten, denn einmal fuhr der Zug nach Norden, dann wieder nach Süden, bis wir erfuhren, daß es die Umleitungen sind, die wir fahren mußten. Ein völlig anderes Bild bot sich uns, als wir die deutsche Grenze hinter uns hatten und in Polen waren. Dort schienen überwiegend kleine Landwirte zu sein, die nie in Eile waren. Im Vorbeifahren sahen wir, wie sie vor ihren kleinen Häuschen, wo auch Stall und Scheune unter einem Dach waren, saßen. Neben der Haustür war auf zwei in den Boden gerammten Pfählen ein Brett, das als Bank diente. Dort saß der Pan, und eine Pfeife rauchend sah er den Hühnern, Gänsen, meist waren auch zwei Schweine dabei, zu, wie sie sich vor dem Haus mit Scharren, Wühlen und Schnattern beschäftigten. Etwas weiter graste eine Kuh mit Kalb, manchmal sogar zwei Kühe und ein kleines Pferd. Mir ging nicht durch den Kopf, daß Menschen so lange untätig vor dem Haus sitzen können. Aber ihnen reichte es scheinbar, wenn sie nur zu essen hatten. Die Felder waren nur schmale Streifen, zehn bis 15 Meter breit: Auf einem war Roggen, am anderen Hafer, Rüben, manchmal Kartoffeln, manchmal auch einer mit Weizen, sogar von guter Qualität. Mehr brauchten und mehr wollten sie scheinbar auch nicht. In der kleinen Scheune wäre für mehr auch gar kein Platz gewesen.
Heute weiß ich, daß diese Leute ärmer und primitiver lebten als andere, aber vom eigentlichen Leben mehr hatten. Denn Eile, oder wie es heute heißt Streß, war für diese Menschen ein Fremdwort. Unser Zug fuhr unaufhaltsam weiter. Für mich war dieses fremde Land, und alles was ich dort sah, ein großes Erlebnis. Vor dem aufgezogenen Schiebetor des Güterwaggons saß ich im Stroh und nahm alles auf. Dies ließ mich den Krieg vergessen, denn inzwischen waren wir schon auf russischem Boden. Jeden Tag hielt der Zug einmal an einer Bahnstation. Dort gab es von einer Feldküche einen tüchtigen Schlag Eintopf, auf den sich unsere jungen hungrigen Mägen schon freuten. Die Feldflasche wurde mit Kaffee (Mukkefuck) gefüllt, dazu ein viertel Kommißbrot, etwas Käse und Margarine. Die Letzten saßen noch auf der Latrine, was wir alle schnell vornahmen, denn im Waggon gab es nur einen Eimer, was bei dem ratternden Zug und vor den Augen aller nicht jedermanns Sache war. Da pfiff auch die Lokomotive schon wieder zum Aufbruch. Denn in disem unermeßlich gro-
ßen Rußland wurde Kanonenfutter gebraucht, so sagte man damals. Aber wir jungen Dachse hatten zu dieser Zeit noch keine Ahnung davon. Und wenn wirklich einmal einem schwer ums Herz wurde, waren so viele Frohnaturen da, die aufheiterten und das Schwere vergessen ließen. Sobald der Tag zu grauen begann, saß ich vor der Schiebetür und konnte mich nicht sattsehen, denn jetzt fuhren wir schon in der Ukraine – sie würde mir unvergessen bleiben. Denn noch nirgends hatte ich so schönen schwarzen, fruchtbaren Boden gesehen, den ich am liebsten in die Hände genommen hätte. Aber der Zug hielt schließlich nicht dort, wo ich gerne einmal ausgestiegen wäre.
Die Bauern dort hatten meist drei kleine Pferde vor einem Einscharpflug gespannt und ackerten die Stoppelfelder vom vorigen Jahr. Ich dachte an daheim, wie schön es doch war, wenn im Frühjahr die felder bestellt wurden. Aber eine schnelle Ernüchterung erfuhr ich, als ich in die Ferne sah.
Wir fuhren schon tagelang in diesem Land ohne daß sich an der Gegend etwas änderte: flaches weites Land, soweit das Auge sah. Ein Unbehagen beschlich mich, faßt Angst kam in mir auf, wie verloren man sich vorkam. In meiner Heimat konnte man von einem Dorf zum anderen sehen, aber hier waren es mehr als eine Tagesreise von der einen zur anderen Ansiedlung. So fruchtbar der Boden dort auch war, er wurde schlecht genutzt. Ab und zu nur waren kleine, aus Lehm gebaute Kaden, meist ohne Fenster, oder nur ein kleines, dafür stand die niedrige Tür immer offen. Das hatte seinen Grund, denn in diesen kleinen Häusern waren nicht nur die menschlichen Bewohner, auch die Hühner, Gänse, manchmal auch Ziegen, hatten dort ihre Unterkunft. Damit diese hinein und auch wieder hinaus konnten, stand die Tür offen. Obwohl es mich brennend interessierte, einmal einen Blick in das Innere so eines Häuschens zu werfen, kam ich nie dazu, denn immer waren wir in Eile an die Front zu kommen, aber bis jetzt wußte noch keiner von uns, wo dies sein würde. Noch waren wir in der Ukraine, wenn auch schon sehr südlich.
Die Bewohner dort müssen sich ausschließlich von Mais (Kukurutz) und Sonnenblumen ernährt haben, denn ich sah nur kleine Felder, wo im Vorjahr Kartoffeln angepflanzt waren. Dagegen war Mais überall, sogar das Stroh war für sie lebenswichtig. Die Dächer wurden damit gedeckt, es wurde ein riesengroßer Haufen (Schober) geschichtet, der immer einen großen Hohlraum hatte. Dies war der Stall für das Vieh, damit es die Tiere im Winter schön warm hatten. Diese einfachen Menschen – vielleicht konnten sie nicht einmal schreiben – waren aber im Stapeln dieser Schober Meister. Ich
habe mich oft gefragt, wie sie das wohl machten, denn das Vieh muß sich doch bis zum Frühjahr regelrecht durchgefressen haben.
Nach innen war nur ein kleiner Stollen als Zugang. Dieser wurde beim Verlassen des Stollens gleich wieder zugeschlichtet wegen der Kälte im Winter und wahrscheinlich auch wegen der wilden Tiere. Da es weit und breit keinen Wald gab, wurden die Kuhfladen und die Stengel der Sonnenblumen getrocknet und als Brennmaterial verwendet.
Dort waren Menschen, die von der übrigen Welt nichts oder nur ganz wenig sahen. Wahrscheinlich kam in normalen Zeiten nur einmal im Jahr ein Staatsdiener vorbei, um Steuern zu erheben. Aber trotzdem sah man keine traurigen oder bekümmerten Gesichter. Im Gegenteil: Spät Abends saßen sie beisammen, und wir hörten ihre Lieder, die sie sangen, bis in unseren Zug. Welch glückliche Menschen sie doch waren. Sie hatten sich mit der Einsamkeit und dieser Weite abgefunden, vor der mir schauerte. So rollte unser Zug durch die Ebene, die nicht enden wollte. Eines Morgens, es dämmerte gerade und war noch erbärmlich kalt – denn so heiß es auch am Tag war, so kalt waren die Nächte –, da hielt plötzlich unser Zug an. Durch das eintönige Rattern des Zuges wurden die meisten gleichgültig und dösten vor sich hin oder schliefen. Aber sobald der Zug hielt, waren alle hellwach. Wir sahen etwa vier Kilometer entfernt eine Stadt. Wir waren in der Ukraine schon durch einige Städte gekommen – aber warum hielten wir hier so weit entfernt davon? Gleich gingen tolle Gerüchte herum, und eine Nervosität war in der ganzen Zugbesatzung zu spüren, jetzt war zu merken, wie nervenaufreibend dieses tagelange Fahren ins Ungewisse war. Um keine Unruhe aufkommen zu lassen, sagte man uns, diese Stadt sei Cherson, aber wir dürften nicht einfahren. Die Erleichterung war förmlich zu spüren, denn Cherson lag fast am Schwarzen Meer. Das heißt es konnte also nicht Stalingrad sein, wo wir hinfuhren. Denn das war seit Tagen unsere Befürchtung gewesen, daß wir in diesen menschenfressenden Schlund sollten. In Stalingrad selbst war vor kurzem die sechste Armee mit Mann und Maus aufgerieben worden. Aber aus strategischen Gründen sollte die Front etwas zurück trotzdem gehalten werden. Wir wußten schließlich nicht, daß es dort, wo wir hinkommen sollten, noch schlechter sein sollte.
Doch erstmal waren wir alle erleichtert, denn in den letzten Tagen sahen wir schon ab und zu Spuren des Kampfes. Wenn auch die meisten davon schon älteren Datums waren, war es doch die Wirklichkeit, der wir begegneten. Und die Helden unter uns, die sich die siegreichen Kämpfe schon ausmalten, wurden stiller, als sie die russischen Panzer, die wie ausgebrannte Blechkisten herumlagen, oder die abgeschossenen Flugzeugtrümmer sahen. Fortsetzung folgt
� Falkenau
Die Straße, die parallel zur Frontseite des Bergarbeiterheims in Falkenau verlief, wurde ursprünglich nach dem Generalsekretär der Union der Bergarbeiter in der CSR „Adolf Pohl Straße“ benannt. Nach dem Anschluß 1938 wurde diese Straße in „Konrad Henlein Straße“ umbenannt.
Der in Neuhammer bei Neudeck am 11. März 1875 geborene Adolf Pohl war laut „Egerländer Biografischem Lexikon“ (Band 2, Seite 65) 1903 zum Vorstandsmitglied der gesamtöstereichischen „Union der Bergarbeiter“ berufen. Seine Verdienste waren sehr vielfältig – diese alle aufzuführen würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Er erreichte Kollektivverträge, die 46-Stunden-Woche, bezahlte Erholungsurlaube, das Bruderladengesetz und vieles mehr. Sein am 28. Mai 1902 in Münchhof bei Elbogen gebore-

ner Sohn Alfred Pohl wurde 1938 verhaftet und ins KZ-Dachau gebracht. Dieser ist am 14. März 1964 in Regensburg verstorben. Einer seiner Urenkel, der uns zusammen mit seiner Frau im Herbst vergangenen Jahres in unserer Heimatstube in Schwandorf besucht hatte, hat ein Buch über seinen Urgroßvater und Großvater geschrieben, das bald in den Druck geht. Gerhard Hampl

� Falkenau
Wir wünschen allen Geburtstagskindern im Mai alles Gute, Gesundheit und viel Glück im neuen Lebensjahr! Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag zum:
–102. Geburtstag Gellings, Anna, geb. Mannert, (Kloben), 13.05.1922.
–98. Kleck, Elsa, geb., Frank, (Falkenau), 27.05.1926. –94. Rach, Gretl, geb., Peter, (Maria-Kulm), 03.05.1930. –94. Fujan, Gerhard, (Falkenau), 16.05.1930. –94. Dürrschmidt, Willi, (Liebenau), 25.05.1930. –94. Bauer, Margaretha, geb. Hohberger, (Werth), 26.05.1934. –91. Fenkl, Eduard, (Falkenau), 17.05.1930. –90. Meinl, Rudolf, (Liebenau), 02.05.1930. –90. Terl, Anna, geb. Dotzauer, (Thein), 04.05.1934. –90. Prof. Dr. Dotzauer, Winfried, (Falkenau), 28.05.1934. –89. Gromes, Elisabeth, geb. Knobl, (Wudingrün), 04.05.1934. –89. Pecher, Maria, geb. Hammerschmidt, (Prösau), 06.05.1934. –87. Schüssler, Gertrud, geb. Bachmann, (Königsberg), 06.05.1935. –87. Dietl, Gerhard, (Falkenau), 15.05.1935. –86. Willomitzer, Dietmar, (Bleistadt), 04.05.1938. –86. Christl, Oswald, (Lanz-Thein), 28.05.1938. –85. Knobl, Edda, geb. Gabriel, (Falkenau), 13.05.1939. –85. Weiner, Elfriede, geb. Siegert, (Ebmeth), 17.05.1939. –84. Rauer, Christa, geb. Hierath, (Prösau), 09.05.1940. –84. Maier, Erich, (Zwodau), 20.05.1940. –84. Gierl, Theresia, geb. Haberer, (Steinbach), 28.05.1940. –82. Richter, Heribert, (Littmitz) , 26.05.1940. –77. Püchner, Bruno, (Wudingrün), 22.05.1947. –73. Dietrich-Kryst, Maria, geb. Dietrich, (Frankfurt a.M.), 24.05.1951.

Egerer Landtag e. V., Geschäftsstelle in 92224 Amberg, Paradeplatz 11;
Vorsitzender: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de Stellvertretende Vorsitzende: Helmut Reich und Dr. Ursula Schüller Für die Egerer Zeitung zuständig: Prof. Dr.-Ing. Alfred Neudörfer, eMail A.Neudoerfer@gmx.de – Kassenführung: Ute Mignon, eMail ute.mignon@online.de
Spenden an: Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN: DE73 7525 0000 0240 1051 22 – BIC: BYLADEM 1 ABG
Verantwortlich vonseiten des Egerer Landtag e. V.: Dr. Wolf-Dieter Hamperl – Redaktion: Lexa Wessel, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Egerer Landtag e.V.
Am 5. April traf sich der Vorstand des Egerer Landtag e.V. in Amberg/Oberpfalz zur traditionellen April-Vorstandssitzung:
Vermutlich zum letzten Mal tagte der Vorstand in seiner Geschäftsstelle in Amberg, Paradeplatz 11. Wie alle sahen, sind die Regale leer, die Bücherei befindet sich im Bezirksarchiv Eger, die Archivalien im Staatsarchiv Amberg und das Fotoarchiv bei der Digitalisierung.
Dabei ist geplant, den Mietvertrag zum nächstmöglichen Termin zu kündigen. Dieser wurde am 26. Dezember 1996 von Professor Lorenz Schreiner unterschrieben; es war nicht einfach, die jetzigen Vermieter ausfindig zu machen.
Neu in unserem Kreis konnte Petr Schaller begrüßt werden. Er stammt aus einer deutschen Familie und ist Bürgermeister in Plesná/Fleißen. Er hat ein großartiges Museum in den Gebäuden der ehemaligen LohmannFabrik aufgebaut. Er wird uns über die Geschehnisse in der Tschechischen Republik berichten.
Wichtige Punkte des Programms waren der Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, ein Bericht über unsere „Egerer Zeitung“, Informationen zur finanziellen Lage des Vereins (Ute Mignon) und zur Abrechnung des dritten Projekts (Helga Burkhardt). Die Finanzen des Vereins sind geordnet.
Für die Zukunft ist ein Buch mit dem Titel „Eger vor 100 Jahren“ geplant. Darin sollen viele der wunderschönen Postkarten und Fotographien unserer Fotosammlung zur Darstellung kommen.
Ein Schwerpunkt der Versammlung waren die schon lange fälligen Ehrungen: Der Vorsitzende ehrte Helga Burkhardt, selbst noch in Eger geboren, für ihre herausragenden Verdienste mit der Balthasar-Neumann-Medaille. Burkhardt besorgte gewissenhaft und erfolgreich die Abrechnungen der drei Projekte,


Dr. Wolf-Dieter Hamperl zeichnete Vereinsmitglied Helmut Reich aus.
welche die Inventarisierung und Archivierung unserer Archivalien ermöglichten. Auch Bruni und Wilhelm Rubick wurden für ihre große und immerwährende Hilfe bei den Räumaktionen in der Geschäftsstelle mit der Balthasar-Neumann-Medaille ausgezeichnet. Den früheren stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Helmut Reich, ehrte Wolf-Dieter Hamperl mit der Ehrenmitgliedschaft. Er war seit vielen Jahrzehnten erfolgreich im Vorstand des Vereins tätig und hat sich große Verdienste in den schweren Jahren der Vereinsführung erworben.
Am 4. April 2024 wurde Hamperl vom Amberger Oberbürgermeister Michael Cerny zu einem Gespräch empfangen. Grund war das 70jährige Jubiläum der
Patenschaft Amberg über die vertriebenen Bürger von Stadt und Land Eger. Dort wurde vereinbart, daß am Sonntag, den 29. September, im historischen Rathaus ein Festakt zu diesem Jubiläum stattfinden wird.
Ich würde mich sehr freuen, wenn zahlreiche Mitglieder unseres Vereins daran teilnehmen würden. Ich bitte Sie, sich bei mir zu melden, damit Sie offiziell von der Stadt Amberg eingeladen werden können. Am 24. April übergebe ich die restlichen Archivalien (darunter 93 Grafiken, Holzschnitte, Stadtpläne, Landkarten, künstlerische Darstellungen, das Konvolut „Wandervogel“) an Dr. Eva Rita Sagstetter zur Ergänzung unseres Archivbestands im Bayerischen Staatsarchiv in Amberg. Dr. Wolf-Dieter Hamperl

� Egerer Landtag e.V.
im Monat Mai können wir einem Mitglied des Egerer Landtag e.V. zum hohen Geburtstag gratulieren: Geboren am 22. Mai 1944: Gerhard Schaller, Buchhaldestraße 13, 87761 Lauben.
Spendeneingänge: –100 Euro wurden gespendet von Aloisia Münzel.
� Dreiländereck am Buchbrunnen – Teil III und Ende – Fortsetzung von Seite 17
Sie tragen auf der Nordseite die Initialen „Pr.“ (Preußen) und auf der Südseite „P.B.“ (Pfalz-Bayern) sowie eine fortlaufende Nummerierung, die mit der „2“ beginnt, weil direkt am Dreiländerpunkt seit 1912 das Brunnenhaus des Buchbrunnens steht.
1844 wurde auch die 358 Kilometer lange bayerisch-böhmische Grenze neu vermarkt. Beide Länder gehörten 1815–1866 zum Deutschen Bund, dem Nachfolger des Heiligen Römischen Reiches. Man setzte 402 große Hauptgrenzsteine, die mit „K. BAYERN“ oder „K. BÖHMEN“ einer fortlaufenden Nummer und der Jahreszahl 1844 beschriftet waren. Sie standen im Abstand von etwa 900 Metern und dazwischen alle 50 Meter ein kleiner Laufergrenzstein. Die „Läufer“ trugen auf beiden Seiten ein Kreuz und eine arabische Zahl, die aber nicht in die arabische Zählung der Hauptgrenzsteine einbezogen war. In jeder der zehn Grenzsectionen begannen beide Zählungen wieder von vorne. Wo es Felsen direkt in der Grenzlinie gab, sparte man sich die Steine und schlug die Grenzzeichen gleich ins anstehende Gestein. Auch vorhandene Grenzsteine aus dem 18. Jahrhundert (meist mit Wappen) bezog man in das neue System ein. Die Section I begann an der Drei-Königreichs-Ecke Bayern–Böhmen–Sachsen und endete am Buchbrunnen. Sie hatte 67 Haupt- und 320 Laufersteine. Die Section II führte mit 33 Hauptund 94 Laufersteinen östlich um das einstige Stiftland herum vom Buchbrunnen bis zum Baderbrunnen, wobei das Fraischgebiet zwischen beiden Staaten aufgeteilt wurde. Auf böhmischer Seite lag in den Sectionen I bis III der Elbogener Kreis. Mit einem bayerisch-österreichischen Staatsvertrag wurde am 24. Juni 1862 in Wien der neuvermarkte Verlauf von Böhmens Westgrenze besiegelt. Um Hauptsteine von Läufern in kartographischen Darstellungen zu unterscheiden, bekamen erstere oft römische Zahlen, was aber nicht der Realität entsprach. Eine Besonderheit stellt das „Maria-TheresianischeKleeblatt“ dar, ein Kreuz mit runden Enden, während die Enden sonst meist rechtwinklig waren. Initialen trugen die kleinen Steine aber nicht.
Am Buchbrunnen stand seit 1803 der preußisch-bayerische Grenzstein auf dem Dreiländerpunkt. Er bekam 1844 auch die Funktion des Laufersteins 1 der Section II. Hier hätte eigentlich der Hauptstein 1, mit dem die Section I endete und die Section II begann, stehen müssen. Da der Platz aber schon belegt war, setzte man kurz vorher den Hauptstein 67 und 50 Meter weiter den Hauptstein 1, auf den dann der Lauferstein 2 folgte. Der Hauptstein 67 wurde 1930 ersetzt durch den Zwischenstein 4/19 und der Hauptstein 1 blieb als neuer „HS 5“ bis heute erhalten. Der Lauferstein 1 (ab 1930: 4/20) wurde 1912 durch das Brunnenhaus überbaut. Möglicherweise sind im Gebäude Grenzzeichen angebracht, die den Dreiländerpunkt
markieren. 1930 setzte man noch den Zwischenstein 4/21. Am 22. Oktober 1937 trat der deutsch-tschechoslowakische Vertrag über Grenzwasserläufe auf der sächsischen und bayerischen Strecke der Grenze sowie über Gebietsaustausch an der Grenze vom 3. Dezember 1935 in Kraft. Schon um 1930 waren die Grenzsteine von 1844 umfrisiert, also durch Behauen schlanker gemacht und neu beschriftet. Viele Hauptsteine setzte man um. Alle Steine bekamen nun die Initialen „DB“ (Deutschland–Bayern) und „ČS“ (ČeskoSlovensko) und neue Nummern (Hauptsteine ohne, und Zwischensteine mit Bruchstrich). Die Jahreszahl 1844 blieb meist erhalten. Aus zehn Sectionen wurden zwölf römisch nummerierte Abschnitte. Und die Anzahl der Zwischensteine hat man so erhöht, daß sie nun in Sichtweite voneinander stehen. Alte Steine von 1844 haben einen runden Kopf und neue von 1930 einen geraden Kopf. Abschnitt I beginnt am Dreiländereck Bayern–Böhmen–Sachsen und endet am Grenzübergang Asch–Selb, Abschnitt II endet am Grenzübergang Schirnding–Mühlbach, und Abschnitt III am Grenzübergang Neualbenreuth.
In den 1990er Jahren erfolgte eine neue Beschriftung. Aus „ČS“ wurde „C“ (Czech republic), und aus „DB“ machte man „D“, allerdings nur mit schwarzer Farbe, so daß die eingemeißelten Initialen von 1930 noch sichtbar sind, wenn auch weiß übermalt.
In Oberfranken grenzt der Kohlwald (mittlerweile Teil der Gemarkung des Marktes Schirnding, Name von früheren Köhlerein) des staatlichen Arzberger Forstes an den Buchbrunnen. Von oberpfälzer Seite ist es die Gemeinde Münchenreuth mit ihrem Wald, und auf böhmischer Seite ist es der Buchwald/ Bučina in der Unterkunreuther Flur. Unterkunreuth wurde 1844 zusammen mit Liebeneck zum Dorf Kreuzenstein gezählt, ist aber seit 1850 ein Ortsteil von Mühlbach an der Eger (Pomezí nad Ohří). Mit dem 3,5 Kilometer entfernten 637 Meter hohen Grünberg (Bismarckturm von 1909 seit 1993 wieder zugänglich) läuft der Naturraum Fichtelgebirge dort aus, wo bis 1967 die Wallfahrtskirche Sankt Anna auf Eger herabblickte. Zuständig für den Buchbrunnen ist nach der Forstverwaltungsreform vom 1. Juli 2005 der Forstbetrieb Waldsassen. 1912 erwarb die Stadt Eger das Areal der benachbarten vier Zintelwiesenquellen auf bayerischer Seite, wo nahe des Buchbrunnens noch Grenzsteine mit der Aufschrift „W.E.1912“ zu finden sind, und errichtete auf dem Dreiländerpunkt das kleine Haus, das mit der Bezeichnung Buchbrunn, dem königlich-bayerischen Wappen und dem Wappen der Stadt Eger versehen ist. Es gibt dort bis heute einen zugänglichen Trinkwasserhahn. Bayerns Forstverwaltung hatte diesen Bau gefordert. In ihm kommt eine Wasserleitung an, die im Krebsbacheinzugsgebiet (zwischen Münchenreuth und Seedorf)
sechs Quellen (Männer-, Ploß-, Schmidthauquelle, Heiligenund Bäumelbrunnen) anzapft. Eger konnte diese Quellen als Tauschwasser erwerben. Der Topographie nach bekamen Waldsassen und Tirschenreuth schon länger Trinkwasser von der böhmischen Seite des Tillenbergs. Beiden Seiten reichte das natürliche Gefälle, und man brauchte keine Pumpstationen. Da die Stadt Eger von 1890 bis 1910 um 8480 Einwohner (30 Prozent) angewachsen war, erschloß man noch Quellen in Oberfranken (Silberbruch-, Pfalzhau-, Brandelwiesenquelle), die man schon 1698 angekauft hatte, sowie den Kuhstallbrunnen in Oberkunreuther Flur. Insgesamt sind es rund 15 Quellen auf neun Quadratkilometern. Die Leitungen aus Oberfranken und Oberkunreuth münden unterhalb der Entsäuerungsanlage (Entzug von Eisenoxid aus dem Wasser) in den Hauptsammler in 531 Metern Seehöhe. Dieser führt mit 30 Zentimetern starken Gußrohren durch Unterkunnreuth, um den Grünberg zum Hochbehälter (1500 Kubikmeter) im Kulmwald (nordöstlich der Sankt-Anna-Kirche) in 521 Metern Höhe. Ingenieur Karl Kreutzinger projektierte den Bau auf böhmischer Seite, den die Teplitzer Firma Niklas für 600 000 Kronen ab Herbst 1910 ausführte. Die Baugenehmigung für den bayerischen Teil (ausgeführt von Eger in Eigenleistung) erteilte das Königliche Bezirksamt Tirschenreuth am 8. Juli 1911. Im Mai 1912 ging die 14 Kilometer lange Anlage in Betrieb. Kommunalwahlen und der Unterkunreuther Schwalbenmüller hatten den Baustart 1910 verzögert. Für die Schwalbenmühle mußte man erst zwölf Stunden Wasser anstauen, damit man zwölf Stunden mahlen konnte. Doch schon in der Planungsphase des Wasserleitungsbaus hatte sich der Müller 1908 mit dem Neubau eines Gasthauses ein zweites Standbein geschaffen. Es wurde so gut angenommen, daß man es 1932/1933 erweitern mußte. Die Mahlgänge liefen dann elektrisch. Auch dem Krebsbach, der in die Freisnitz mündet (und diese bei Arzberg in die Röslau) werden beträchtliche Wassermengen entzogen. Dadurch bekamen sechs Mühlen an der Freisnitz Probleme. Sie erhielten von der Stadt Eger wegen des Verlusts von acht Sekundenlitern Wasser Abfindungen von 530 bis 1510 Mark. Grundeigentümern, die im Fischereirecht oder bei der Wiesenbewässerung Nachteile erlitten haben, zahlte man zwischen 20 und 150 Mark. Das gesammelte Wasser fließt nun schon über 110 Jahre von Bayern nach Eger, davon 45 (1946–1990) durch den Eisernen Vorhang. Werner Pöllmann
Quellen: Kurt Zeidler: Erweiterung der Egerer Wasserleitung, im: Egerer Zeitung, Amberg Heft 2/1992, Seite 24–26.
Dieter Hermann: Der Buchbrunnen im Dreiländereck, in: www.bayern-fichtelgebirge.de/ ostrand
Heimatkreis Graslitz – Patenstadt: Aschaffenburg
Ansprechpartnerin Heimatzeitung, Graslitzer Stube und Öffentlichkeitsarbeit: Christine Uschek, Hörsteiner Straße 24, 63791 Karlstein Telefon (0 61 88) 52 61, eMail: Uschek@t-online.de






Ansprechpartnerin Heimatkreis: Gisela Forster, Niederscheyerer Straße 109, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm, Tel. (0 84 41)7 25 10, eMail: GiselaForster@t-online.de Facebook: Graslitz – die klingende Stadt – Public Group/Facebook. Redaktion: Kathrin Hoffmann. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.

Damit dies auch jeder Bewohner von Graslitz/Kraslice und Umgebung mitbekommt, organisiert die Stadtverwaltung alljährlich die Frühjahrsausstellung im Kulturhaus. Kindergärten und Schulen werden eingeladen, zum Thema passende Motivtafeln zu erstellen, und die Bastler und Handwerker der Region können ihre unterschiedlichen Produkte zeigen und verkaufen. Da dies eine Woche vor Ostern stattfand, waren viele Osterartikel im Angebot. Aber auch Klöppelwaren und verschiedenste Strick- und Häkelerzeugnisse wurden gezeigt, bis hin zu Holzspielwaren.
Es ist eine Schau der bastlerischen und handwerklichen Talente. Mit der Einbeziehung der Kinder- und Jugendeinrichtungen wird der Bogen zwischen den meist älteren Menschen, die sich damit ihre Rente etwas aufbessern, und der Jugend geschlagen. So wird es den Kindern ermöglicht, während des Unterrichtes diese Ausstellung zu besuchen. Der Kontakt zwischen Jung und Alt ist wichtig, um Traditionen fortzuführen und Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzugeben. Vielleicht entdeckt auch der eine oder andere dadurch seine kreativen Fähigkeiten und kommt zu einem neuen, erfüllenden Hobby. Ulrich Möckel

Mai
Aufgrund des begrenzten Platzes einer Zeitungsseite hat die Redaktion entschieden, in dieser Ausgabe auf die umfangreichen Geburtstagsmeldungen zu verzichten.
Wir wünschen allen Jubilaren aus Stadt und Kreis Graslitz alles Gute, stabile Gesundheit und Lebensfreude im neuen Lebensjahr! Christine Uschek
Telefon (0 61 88) 52 61
Telefax (0 61 88) 4 48 72 61
eMail: uschek@t-online.de
❯ Gitarrenbauer und Musiker Roger Rossmeisl nach Bubenreuth überführt



Mehrfach kreuzten sich die Wege vieler Bubenreuther mit Roger Rossmeisl. Nun fand der bereits 1979 in Berlin verstorbene legendäre Gitarrenbauer auf Wunsch seiner Familie seine letzte Ruhe in der GeigenbauerGemeinde.
Roger Raymond Rossmeisl (1927–1979) hatte viele Bubenreuther Instrumentenmacher schon in deren „alter Heimat“ kennengelernt, in der Musikstadt Schönbach im Egerland. Dorthin nämlich, ins damalige Eldorado des Streich- und Zupfinstrumentenbaus, hatten der Berliner Tanz- und Varieté-Musiker Wenzel Rossmeisl (1902–1975) und seine Frau, die Vortragskünstlerin Elisabeth Rossmeisl, ihren Sohn Roger Raymond 1941 in die Lehre geschickt. Rossmeisl junior sollte in der Heimat seiner Vorfahren ebenfalls den Instrumentenbau erlernen. Anders als sein Großvater Franz Rossmeisl sollten es aber nicht Blechblasinstrumente sein, die Enkel Roger bauen sollte, sondern Gitarren, vor allem moderne Gitarren, die damals sehr gefragt waren. Das hing aufs Engste damit zusammen, daß Vater Wenzel Rossmeisl im Berlin der 1920er und 1930er Jahre zu einem der angesehensten Banjospieler und Gitarristen avanciert war. Die Tanzorchester- und Jazz-Szene war sein Zuhause, er spielte unter anderem mit Paul Abraham, Ben Berlin oder Peter Kreuder. Wenzel Rossmeisl erkannte frühzeitig den Bedarf an modernen Jazz-Instrumenten. Daher begann er zusammen mit Schönbacher Gitarrenbauern eigene Gitarrenmodelle zu entwickeln und zu bauen, die an die großen US-amerikanischen Vorbilder angelehnt waren. Er konnte sich so ein zweites Standbein und einen renommierten Markennamen aufbauen. Denn sehr viele seiner Profikollegen und auch zahlreiche Laienmusiker vertrauten fortan auf die Gitarren mit dem Schriftzug „Roger“ auf der Kopfplatte, die also denselben Namen trugen wie sein Sohn. In Schönbach war es vor allem der Zupfinstrumentenmachermeister Franz Hirsch (1879–1964), der Rossmeisl dabei unterstützte und ab Mitte der 1930er Jahre den Bau von hochwertigen Archtop-Gitarren vorantrieb. Fast vier Jahre lang ging Sohn Roger ab 1941 bei Meister Hirsch in die Lehre und absolvierte berufsbegleitend die staatliche Fachschule für Musikinstrumentenbau. Zahlreiche Freundschaften zu Schönbachern konnte Roger Rossmeisl in diesen Jahren schließen. Doch nach Kriegsende 1945 hielt den jungen Berliner nichts mehr in Schönbach, das nun von der Tschechoslowa-
kischen Republik beansprucht wurde. Die Vertreibung der Sudetendeutschen und damit die Vertreibung seines Lehrmeisters und der anderen Schönbacher war bereits beschlossene Sache und stand kurz bevor. In seiner Heimat Berlin sah Roger Rossmeisl nun die Chance seines Lebens gekommen. Hier konnte er zusammen mit seinem Vater für amerikanische GIs musizieren, zum Beispiel in der gerade gegründeten American Forces Network Band (AFN Band), und hier konnte er zudem für die wiederentstehende Jazz-Szene der Hauptstadt die angesagten Archtop-Gitarren bauen, etwa eine für Coco Schumann.
Die erste Gitarre mit Tonabnehmer aus deutscher Nachkriegsproduktion verließ die Rossmeisl-Werktstatt noch 1945, wie der ehemalige „Ghetto-Swinger“ Schumann in seiner Autobiographie berichtet. Doch auch US-Musikgrößen waren es, die den beiden MusikerGitarrenbauern ihr Vertrauen schenkten.
verkennbar Rossmeisls Handschrift trugen. Als Chef-Designer zeichnete Rossmeisl für sämtliche Modelle der Jahre 1954 bis 1962 verantwortlich und begründete den Ruf Rickenbackers als renommierte Gitarrenbaufirma. Von Rossmeisl designte Schallöcher etwa wurden zum Markenzeichen der Hollowbody-Rickenbackers. Der von beiden Rossmeisls in der Nachkriegszeit entwickelte signifikante Baustil des „German Carve“ ist aufs Engste mit den legendären Solidbody-Modellen Combo 800 und 600 verbunden.
Internationale Bekanntheit erlangte die kalifornische Gitarrenschmiede in den 1960er Jahren durch John Lennon, Mitglied
search & Development und konnte sich im nagelneuen Werksgebäude nach seinen Wünschen einrichten. Sein damaliger Assistant Phil Kubicki erinnerte sich, daß dort eine traumhaft schöne Ideal-Werkstatt zur Holzbearbeitung mit allen erforderlichen Maschinen für die Herstellung von Gitarren entstanden war. Es habe sogar zwei große, aus Deutschland importierte Werkbänke gegeben. Rossmeisls erste Aufgabe war es, eine FenderJazzgitarre zu bauen. Wenig später präsentierte man in Fullerton stolz die Gitarre „Fender Limited“. Der Beweis, daß man in Kalifornien in der Lage war, hochwertige handgemachte Jazzgitarren herzustellen, war damit erbracht.

In Absprache mit der Familie brachten die Filmemacher Luc Quelin (Mitte) und Kaspar Glarner (rechts) den alten Berliner Grabstein des Gitarrenbauers Roger Rossmeisl von Berlin ins Depot des Bubenreuther Museumsvereins, vertreten durch Christian Hoyer (links) vom Bubenreutheum. Rechts die Platte des Urnengrabs in Bubenreuth. Bild: Luc Quelin
Barney Kessel wäre hier stellvertretend zu nennen, der eine Roger Super No. 1000 spielte. Im Kiez, in dem Roger aufgewachsen war, konnte die Roger-Gitarrenbau-Werkstatt so in den ersten Nachkriegsjahren erfolgreich wiederaufgebaut werden.
Bald schon war in Roger Rossmeisl allerdings der Wunsch gereift, ins Heimatland der Archtop-Guitar zu gehen. Kurzerhand verfaßte Rossmeisl 1952 ein Bewerbungsschreiben an den legendären Gibson-Präsidenten Ted McCarty, der ihn 1953 tatsächlich einstellte. Der Sehnsuchtsort Kalamazoo entpuppte sich aber als nicht so rosarot wie erhofft, Rossmeisl konnte sich und seine Ideen nicht verwirklichen. Schon wenige Monate später kündigte er. Francis Hall, der 1953 die Firma Rickenbacker gekauft hatte, engagierte den Fachmann aus Deutschland und betraute ihn mit dem Aufbau neuer Gitarrenlinien, die nun un-
Nach vielen weiteren Projekten im R&D-Department (wie die Coronado- und Wildwood-Serien, die Telecaster Thinline etc.) kehrte Rossmeisl in den 1970er Jahren nach Deutschland zurück, wo er, gebeutelt von finanziellen und gesundheitlichen Problemen, im Jahr 1979 in Berlin verstarb. In den USA bleibt er eine Gitarrenbauer-Legende, deren Andenken hochgehalten wird.
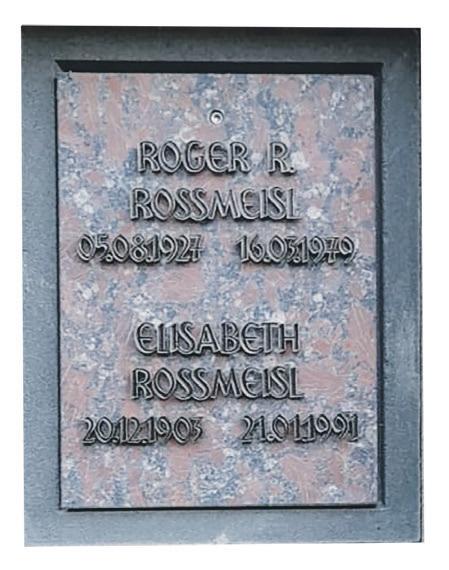
der englischen Popund Rockband The Beatles. Lennon benutzte das RickenbackerModell 325 in der ersten Hälfte der 1960er Jahre als eines seiner Haupt-Musikinstrumente. Dank seiner Tätigkeit bei Rikkenbacker konnte sich Rossmeisl in den USA einen erstklassigen Ruf als genialer Konstrukteur erarbeiten. Sein Wechsel zum größten Gitarrenbauer der USA 1962 verwundert daher nicht.
Der bisher für seine „Bretter“ (Massivholzgitarren) bekannte Hersteller Fender wollte aus Prestigegründen im Bereich der traditionell gearbeiteten „Acoustics“ gleichziehen. Dafür bedurfte es eines Kalibers wie Rossmeisl, der von Leo Fender persönlich damit beauftragt wurde, eine komplett neue Akustik-Gitarren-Produktion ins Leben zu rufen. 1966 avancierte Rossmeisl zum Leiter der Abteilung Re-
Auch in Bubenreuth, wo er viele Freundschaften und Geschäftsbeziehungen pflegte, wird die Erinnerung an ihn bewahrt. Über die Jahre im fernen Amerika hielt Rossmeisl Verbindung zu seinem Lehrmeister Franz Hirsch, der in der Geigenbauersiedlung ein neues Zuhause gefunden hatte. Zu vielen Musikinstrumenten- und Bestandteilherstellern in Bubenreuth unterhielt er als Vertreter von US-Firmen Kontakte und besuchte Bubenreuth oft im Nachgang zur Frankfurter Musikmesse. Fasziniert von der Vita Rossmeisls widmeten der Schweizer Kaspar Glarner und der Franzose Luc Quelin dem Gitarrenbauer Roger Rossmeisl 2018 einen Dokumentarfilm, dem Bruno Ganz seine Stimme lieh: „Who the f... is Roger Rossmeisl“. George Vjestica, der Gitarrist von Nick Cave and the Bad Seeds, hat die Originalmusik komponiert und eingespielt, alles auf Rossmeisl-Gitarren. 2023 ist der weltweit anerkannte Gitarrenbauer auf Veranlassung seines Sohnes auf den Friedhof der Geigenbauer-Gemeinde überführt worden. Sein Berliner Grabstein wurde dem Museumsverein Bubenreutheum als Exponat übergeben. Christian Hoyer
Die jungen Birken stehen so beleuchtet da am Wegesrand, als hätte eine helle Hand viel Licht geholt von irgendwo und alles ihnen zugewandt.
Dann kommt der Wind, leise wie noch nie und greift in ihren grünen Kreis, als wären sie zuinnerst heiß von einer Frühlingsmelodie.
Josef Moder (Graslitz/Würzburg)
■ Samstag, 25. Mai, 14.00 Uhr, Kirchberg: Maiandacht in der Kirche St. Aegidius.
■ Sonntag, 26. Mai, 11.00 Uhr, Schönwerth: Wallfahrt zur heiligen Dreifaltigkeit, Kapelle Heilige Dreifaltigkeit.
■ Sonntag, 2. Juni, 10.30 Uhr, Graslitz: Gemeinsame Messe zu Fronleichnam, Kirche Corpus Christi.
■ Samstag, 8. Juni, 11.30 Uhr, Silberbach: Gottesdienst zu Kirchweih, Kirche Heiliges Herz Jesu.
■ Freitag, 21. Juni, 17.00 Uhr, Heinrichsgrün: Heilige Messe zu Ehren des heiligen Alois, Kirche St. Martin.
■ Sonntag, 28. Juli, 11.00 Uhr, Schönau: Fest zu Ehren des heiligen Jakobus, Kirche St. Jakobi.
■ Sonntag, 4. August, 11.00 Uhr, Frankenhammer: Kirchweihfest, Kirche Heilige Dreifaltigkeit.
■ Sonntag, 30. Juni, 16.00 Uhr, Rothau: Wallfahrt zu Sankt Peter und Paul, gemeinsame Messe, Kirche St. Peter und Paul.
■ Sonntag, 1. September, 11.30 Uhr, Kirchberg: Egidi-Fest in der Kirche St. Aegidius
■ Sonntag, 10. November, 15.00 Uhr, Heinrichsgrün: Wallfahrt zu Sankt Martin mit gemeinsamer Messe, Kirche St. Martin.
■ Samstag, 17. August, 11.30 Uhr, Schwaderbach: Wallfahrt Mariä Himmelfahrt, Kirche Mariä Himmelfahrt.



Heimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.
Heimatkreis Karlsbad, Heimatkreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollak, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22. Spendenkonto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparkasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KS –Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Bericht von Kreisbetreuerin Dr. Pia Eschbaumer
Liebe Landsleute,
Soeben habe ich erfahren, daß unsere liebe Gerti Weis, bis vor kurzem Gemeindebetreuerin von Haid–Elm–Lessau, frühmorgens am Samstag, den 20. April, im Krankenhaus verstorben ist, wenige Tage vor ihrem 79. Geburtstag. Ihre gesundheitlichen Einschränkungen hat sie lange Zeit ohne Jammern ertragen, und bei der letzten Mitgliederversammlung des Heimatverbands im Herbst 2023 freute ich mich sehr, sie augenscheinlich munter und aktiv zu erleben. Umso erschrockener war ich, als ich vor Kurzem hören mußte, daß sie im Krankenhaus auf der Intensivstation lag. Eine engagierte Heimatfreundin ist von uns gegangen – all ihre Freunde trauern um sie.
Neben all den Feiertagen im Mai – „Tag der Arbeit“, 79. Jahrestag Ende des Weltkrieges, Christi Himmelfahrt, Muttertag, Pfingsten, Fronleichnam – steht für uns auch der „Sudetendeutsche Tag“ an Pfingsten in Augsburg im Mittelpunkt. Das Treffen beginnt am Freitag, den 17. Mai, wenn in einer abendlichen Festveranstaltung die Sudetendeutschen Kulturpreise verliehen werden. Am Samstag sind hervorzuheben: vormittags die feierliche Verleihung des Karls-Preises und abends der Heimatabend sowie das Sudetendeutsche Volkstanzfest.
Wie gewohnt findet am Pfingstsonntag nach katholischem und evangelischem Gottesdienst die Hauptkundgebung statt, eingeleitet durch den Einzug der Fahnenabordnungen und Trachtengruppen. Und dann gilt es, in dem Trubel die Tische mit den Landsleuten aus den Herkunftsgemeinden zu finden, von denen hoffentlich viele den Weg nach Augsburg finden werden! Motivieren Sie bitte
Ihre Kinder und Enkel, mit Ihnen zu kommen! Denn es gibt so viel zu entdecken: Büchertische, Kunsthandwerk, Informationen zur Ahnen- und Herkunftsforschung, und Leckereien aller Art. Ein detailliertes Programm finden Sie im Internet unter www.sudeten.de und auch hier in der Sudetendeutschen Zeitung Zu ihren Geburtstagen im Mai wollen wir zwei Landsleuten, die sich um ihre Herkunftsgemeinden kümmern, herzlich gratulieren zum: –81. Geburtstag am 20. Mai Wolfgang Müller, (Funkenstein), 93053 Regensburg; –65. am 05. Eva Fleming/Konheisner (Donawitz). Alles Gute für ein glückliches und gesundes neues Lebensjahr! Zwei andere, im letzten Jahr noch genannte, durften einen nächsten Geburtstag leider nicht mehr erleben: Edith Nübler/ Meinelt (Dallwitz-HohendorfSchobrowitz), und Walter Heinl (Janessen), sind inzwischen verstorben, wie von mir gemeldet wurde. Auch den Tod von Gerhard Fritsch (Putschirn) hatte ich schon im Juni letzten Jahres bekannt gegeben, trotzdem habe ich ihn bedauerlicherweise im März erneut unter den Geburtstagen aufgeführt, was mir sehr leid tut.
Anbei ein paar Impressionen aus dem österlich geschmückten Karlsbad, die eine heutige Karlsbaderin an unsere Geschäftsführerin Susanne Pollak geschickt hat.
Unsere nächste Ausgabe wird am 14. Juni erscheinen; der Redaktionsschluß am 20. Mai wird es mir gerade noch erlauben, dafür einen Bericht über das Pfingsttreffen zu verfassen. Ich hoffe aber, daß möglichst viele von Ihnen dort anwesend sein werden und sich selbst ein Bild davon machen können! Herzliche Grüße, Pia Eschbaumer

� Meldungen der O rtsbetreuer
Der Heimatverband und die Ortsbetreuer wünschen auch allen Jubilaren aus den sonst nicht aufgeführten Gemeinden, aber besonders den nun namentlich genannten treuen Abonnenten der Karlsbader Zeitung, alles Gute zu ihrem Geburtstag, ein erfülltes und gesundes neues Lebensjahr!
Aich
30. Mai: Ernst Nowak, 35614 Aßlar, 94. Geburtstag.
Espenthor
25. Mai: Gertrud Beierl/Grünes, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 90. Geburtstag.
Haid – Ellm – Lessau
4. Mai: Josef Rau, 91220 Schnaittach, 86. Geburtstag.
17. Mai: Friedrich Schiller, 85757 Karlsfeld, 93. Geburtstag.
27. Mai: Jlse Ruzickova/Bärreiter, CZ 36001 Karlovy Vary. 85. Geburtstag.
� Mai 2024 – weiter auf nächster Seite
Hartmannsgrün
3. Mai: Margarete Götz, 85059 Denkendorf, 84. Geburtstag.
16. Mai: Josef Götz, 85095 Denkendorf, 89. Geburtstag.
Schulgemeinde
Dallwitz
–Hohendorf
2. Mai: Margaretha Laiacker, 80686 München, 97. Geburtstag.
Kohlhau
4. Mai: Sieglinde Nietner/Mayer, 95444 Bayreuth, 93. Geburtstag.
4. Mai: Erhard Winkelbauer (Sohn von Frieda geb. Putz), 35447 Reiskirchen, 84. Geburtstag.
23. Mai: Heinz Falb, 95213 Münchberg, 78. Geburtstag.
Meierhöfen
15. Mai: Willibald Schlagbaum, 35630 Ehringhausen, 68. Geburtstag.
Rodisfort
19. Mai: Bruno Dürbeck, 86899 Landsberg am Lech, 83. Geburtstag.
Sattles
7. Mai: Walter Hübner, 93449 Waldmünchen, 96. Geburtstag.
Schönfeld
5. Mai: Hartmut Rauscher, 65396 Walluf, 80. Geburtstag.
Tüppelsgrün
6. Mai: Leo Stutzig, 23611 Bad Schwartau, 91. Geburtstag. 20. Mai: Rudolf Kettner, 71691 Freiberg, 95. Geburtstag.
31. Mai: Alois Raab, 89073 Ulm/Donau, 92. Geburtstag.
Nachrichten
Karlsbad Stadt
Gemeindebetreuerin Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail: kreisbetreuung @carlsbad.de

Liebe Karlsbader, allen, die im wunderschönen Monat Mai Geburtstag haben, wünschen wir Gesundheit und Wohlergehen!
Besonders herzlich gratulieren wir zum: –100. Geburtstag am 16. Mai Luise Rank/Liebl (Teufelsinsel) in 64732 Bad König; –87. am 23. Herbert Kummer (Villa Luise), IRL Delgany; –83. am 08. Christine Stich/ Ritter (Rittersheim), 71555 Sulzbach; –79. am 14. Dr. Wolfgang Tischler, 65812 Bad Soden. Der Letztgenannte hat mir vor einigen Wochen zu meinem Geburtstag eine Karte (mit Blick vom Hirschensprung zum Hotel Imperial) aus seiner Geburtsstadt Karlsbad geschickt, wo er einen Kur-Urlaub im Hotel Imperial verbracht hatte. Die Aufnahme erinnert mich an zweierlei: zum einen an das Haus meiner Familie (ein wenig links unterhalb vom Imperial), zum anderen an meine grenzenlose Verwunderung beim ersten Besuch in Karlsbad, dort anstelle eines Hirsches eine Gemse anzutreffen! Ehrlich gesagt: ich staune immer noch, obwohl das nun schon Jahrzehnte zurückliegt und ich mich nach etlichen weiteren Aufenthalten eigentlich an den Anblick hätte gewöhnen können. Damals, im Mai 1988, hat niemand der Mitreisenden meine Irritation verstanden – kein
Wunder: Das waren alles ehemalige Karlsbader, für die das alpine Tier an dieser Stelle ein ganz vertrauter Anblick war. Mehr Anrecht auf ein Denkmal hätte eigentlich sogar ein Hund, denn die älteste Überlieferung der Sage aus dem Jahr 1571 spricht von einem Jagdhund Kaiser Karls IV., der bei der Verfolgung von Wild in die heiße Quelle stürzte. Die gängige Erzählung vom Hirschen, der auf der Flucht vor den hetzenden Hunden mit einem weiten Satz hinunter zur Quelle sprang, hat sich aber dann durchgesetzt und wurde vielfach auch im Bild festgehalten. Sicher gehört so ein Riesensprung ins Reich der Legenden – selbst für eine Gemse!
Stifter der Skulptur war der aus dem mecklenburgischen Schwerin stammende Baron von Lützow. Er hatte sich im Jahr 1846 in Karlsbad angesiedelt, machte sich mit Spenden und Stiftungen um die Stadt verdient und wurde 1853 zum Ehrenbürger ernannt. Er ließ sich hoch über der Altstadt eine Villa im Empire-Stil bauen, in deren Garten unter anderem auch die lebensgroße Statue eines Hirsches aus Gußeisen aufgestellt war, die heute hinter dem Parkhotel Richmond zu finden ist. Warum er nicht diese Skulptur auf dem Felsen aufstellen ließ? Angeblich war er überzeugt, daß ein Hirsch niemals solch einen Sprung wagen würde, wohl aber eine Gemse. Und wenn wir auch heute wohl alle überzeugt sind, daß Gemsen nur in den Alpen vorkommen, so stimmt das nicht ganz: Sie waren einst auch in manchen Mittelgebirgen beiheimatet.
Trotzdem: Ich kann mich mit dem Tier dort oben nicht wirklich anfreunden. Auf einer benachbarten Felsnadel war bereits im
Jahr 1804 durch einen reichen, aus Karlsbad stammenden Wiener Kaufmann ein hölzerner Aussichtspavillon errichtet worden: die nach diesem benannte Mayer-Gloriette. Und vom höchsten Punkt grüßt, wie man auf alten Stadtansichten sehen kann, schon seit viel längerer Zeit ein großes Kreuz. Der Mai beschenkt uns heuer großzügig mit mehreren Fei-
ertagen: am 1. Mai der „Tag der Arbeit“, 9. Mai Christi Himmelfahrt, 19./20. Mai Pfingsten, 30. Mai Fronleichnam, nicht zu vergessen den Muttertag am 12. Mai. Ich hoffe, viele von Ihnen am Pfingstwochenende in Augsburg beim Sudetendeutschen Tag zu treffen! Bis dahin herzliche Grüße, Ihre Pia Eschbaumer Bitte umblättern

Im Stadtkreis: Drahowitz
Gemeindebetreuer Erwin Zwerschina, Am Lohgraben 21, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Telefon (0 96 61) 31 52, Fax (0 96 61) 8 13 78 37

Wir beglückwünschen unsere Mai-Geborenen herzlich: zum: –95. Geburtstag am 28. Mai Hilde Schöniger/ Loh, (Pestalozzi Straße 138), 35578 Wetzlar; –48. am 28. Ottmann Sven, 91126 Schwabach. Der stets um die Bewahrung unseres Eghalanda Dialekts bemühte ehemalige Mitbetreuer unseres Karlsbader Museums in Wiesbaden, Anton Ascherl, entdeckte in seinem Heimatnachlaß die Niederschrift des unvergessenen Josef Hofmann (Hofmann Bepp) „Wöi a Üachalanda Pfarra predinga mou“, deren Verinnerlichung gewiß auch den älteren Eghalandern von uns einige Mühe abverlangen wird. Vielen Dank dafür, lieber Tone! Bei Gelegenheit wollen wir diesen Text abdrucken.
Das Pfingsterlebnis beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg kann ich zum Zeitpunkt dieser Niederschrift noch nicht kommentieren, weise aber vorsorglich immer wieder auf unser erstes Drahowitzer Treffen hin: am Sonntag, den 15. September 2024, in 90453 Nürnberg-Katzwang, Ellwanger Straße 7, Gaststätte ,,Zum Rednitzgrund“, wo ich wieder per Zug oder S-Bahn Anreisende abhole. Erwin Zwerschina
Im Landkreis: Altrohlau
Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Telefon (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf.Preis@t-online.de Vom 4. bis zum 31. Januar 2024 fand in Meierhöfen eine Ausstellung über die Geschichte der Porzellanfabrik Gießhübel statt. Vielleicht werden Sie sich fragen, welchen Bezug diese Vernissage zu Altrohlau hat: Der Kurator dieser Ausstellung war Antonín Foglar aus Altrohlau, der mich seit Jahren mit seinem umfangreichen Archiv über Altrohlau mit Fotos Zeitungsausschnitten und dergleichen unterstützt. Deshalb danke ich ihm mit diesem Bericht für seine jahrelange Tätigkeit im Sinne vieler Altrohlauer.
Unter dem Motto „Malá ale Naše“ (klein aber unser) erhielt die Eröffnung viel Beifall von den zahlreichen Besuchern. Es begeisterten die Schönheit und Eleganz des Porzellans, ebenso wie die Farbenpracht des Dekors in kräftigem Kobaltblau, Purpur, Karmin und Gold.
Bei der Begrüßung der Gäste zur Eröffnung wies Kurator Foglar darauf hin, daß die 1803 gegründete Porzellanfabrik, nach Schlaggenwald (1792) und Klösterle (1794), die drittälteste Porzellanfabrik Böhmens war. Ebenfalls 1803 wurde die Porzellanfabrik in Pirkenhammer gegründet. Viele der Porzellanfabriken mußten ihren Betrieb wegen der übermächtigen Konkurrenz einstellen, 2013 auch die Fabrik in Gießhübel, die 194 Jahre lang Generationen von Arbeitern und Angestellten beschäftigt hatte. Die Porzellanfabrik hatte sich zu einem echten Familienunternehmen entwickelt, das unter dem Motto „klein, aber unser“ firmierte. Das Gebäude wurde noch 2013 abgerissen. Nur der leere Platz erinnert an all die Men-

schen und Mitarbeiter, die dort einst ihr Auskommen hatten. Der Mai bringt uns viele Feiertage, wobei das Christi Himmelfahrtsfest an die Altrohlauer Kirchenweihe erinnert und den Altrohlauern das weithin bekannte bürgerliche „Altrohlauer Fest“ bescherte. Die damals 14jährige Edith Meier vom Richterberg läßt uns im Altrohlauer Heimatbrief vom Mai 1949 an ihren Erinnerungen teilhaben:
„Das Altrohlauer Fest, wie schön und unvergeßlich war es, nach der Schule auf den Festplatz zu laufen und dem Aufbau der Ringelspiele und Schiffschaukeln zuzusehen. Auch das Aufstellen der Marktstände in den Straßen weckte das Interesse aller Kinder, bis die Fabriken um 17 Uhr mit lautem Getön das Ende des Arbeitstages ankündigten und wir schnell heim rannten, um vor den Eltern zu Hause zu sein. Endlich kam der ersehnte Tag. Ich war total aufgeregt. In der Kirche war es vorbei mit einem andächtigen Gebet; in meinem Kopf schwirrte nur ein Gedanke: Heute ist das große Fest! Nach dem Gottesdienst ging es sofort hinaus auf die Straße. Schon beim Frank-Konditor fingen die ersten Stände an, die sich bis zum Lenhart hinauf und hinunter bis zum Bergmann zogen. Was gab es da alles zu sehen! Rasierklingen und Messer, Krawatten und die vielen Spielsachen, Luftballons, Pfeiferl und vieles mehr. Magisch zogen mich die vielen Zuckerlstände an; da wurden die Elbogener Pumpernikkel, der türkische Honig angeboten. Der Eiswagen quälte sich durch die Menschenmenge, die Würstchenbuden roch ich schon von weitem. Wäsche, Kunstblumen, Gablonzer Schmuck, Porzellangeschirr wurden ebenso lauthals angeboten wie Rosenkränze und Weihwasserkessel.
Dann ging es auf den Festplatz, wo sich der Trubel und Lärm mit den Melodien aus den Leierkästen vermischte. Von den Schaubuden herab erklangen laut die Trompeten und Tschinellen, bei den Schaukeln und Ringelspielen herrschte riesiges Gedränge, Zauberer, Clowns und Tänzerinnen luden lauthals zu ihren Darbietungen in die Buden und Zelte ein. Auf einmal großes Gelächter und Auflauf bei der Sesserl-Reitschule, denn der Schankauer Wenz saß drauf und sang! An so einem Tag ging es dem Unikum immer gut, bekam er doch viel Kuchen und Krapfen geschenkt.
Auch an den Schießbuden ging es hoch her, denn jeder wollte seiner Liebsten eine Rose schießen. In den Wirtshäusern spielte überall die Musik zum Tanz auf, und beim „Kempf“ standen vor dem Haus lange Reihen Tische und Bänke, wo nur selten ein Plätzchen zu ergattern war. So habe ich mein „Altrohlauer Fest“ noch gut in Erinnerung und wünschte, es könnte bald wieder so sein.“
Wir gratulieren herzlich allen Geburtstagskindern des Monats Mai, auch zum: 77. Geburtstag am 4. Mai Renate Nieberle/Hakker, 86807 Buchloe. Einen wunderschönen Mai mit all seinen Facetten, Feiertagen und Festlichkeiten wünscht der gesamten Leserschaft, Rudi Preis
Grasengrün
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Stra-

ße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf.Kreisl@gmx.de Nach einem warmen März bescherte uns das Wetter Anfang April gleich sommerliche Temperaturen. Der Frühling kam heuer mit Macht und hat uns mit seinem Einzug nicht lange warten lassen. Weithin ist jetzt auch der liebliche Mai mit seinem Blütenduft eingezogen. Wir feiern Muttertag und Pfingsten und verabschieden zur Monatsmitte die Eisheiligen. Vergessen wir auch nicht die Kirchenfeste Christi Himmelfahrt und Fronleichnam; der Mai –ein Monat mit vielen Feiertagen. Gleich zu Beginn der 1. Mai: Maifeiertag, der in unserem Dorf „Rund um den Maibaum“ gefeiert wurde. Mit Erlaubnis eines Bauern durfte aus seinem Wald eine Fichte als Stiftung gefällt werden. Diesem gewiß fuhren vier oder fünf Burschen mit Einspänner hinaus und fanden im Staatswald einen schöneren, größeren und schlankeren Baum, der eben dann im Bauernwald gefällt, ausgeastet und in Eile auf den auseinandergezogenen Wagen aufgeladen wurde. Ein buschiger Giebel mußte auch noch dazu gesucht werden, dann ging’s aber eiligst je nach Fundstelle aus dem Kestel, Gronich, Tennisberg oder Stockholz in Richtung Anger, wo schon andere Burschen warteten, um den Baum zu schälen.
Am nächsten Abend haben die Plozmoidla den Giebel mit den von ihnen gestifteten Kopftüchern geschmückt, und einen Kranz gebunden. Unterdessen haben die Burschen auf einem Leiterwagen die Spreizen verstärkt, Stangen zu Scheren gebunden und ein Loch gegraben. Der Baum wurde auf den Wagen gehoben, der Giebel und der Kranz daran befestigt.
Die Scheren wurden nun stufenweise angesetzt am Baum, und auf Kommando mit einem „Hau-Ruck“ kam er Zug um Zug in die senkrechte Stellung. Das war ein hartes, nicht ungefährliches Stück Arbeit, bis der Baum Bitte umblättern



im Loch verkeilt war und wieder frei stehen konnte.
Gerne kamen aus den Nachbardörfern Gäste zur Tanzmusik, welche am folgenden Sonntag darauf schon um drei Uhr begann. Lose wurden verkauft, mit denen man Teile des Baumes oder ein Kopftuch gewinnen konnte. Gegen Abend gingen alle mit Musik auf den Anger, wo sich schon Jung und Alt versammelt hatten. Die Plozmoidla und Plozknecht durften den Baum umtanzen, dann kamen die Holzmacher. Das waren zwei oder drei maskierte Burschen, die je nach ihren Einfällen auf einem Ackergerät mit Ochsengespann, Kutsche oder auch zu Fuß aus einer Ecke auftauchten und mit ihrem selbst erdachten, humorvollen Spiel begannen.
Dazwischen kam das Essentragweibl, hinter deren Maske auch ein Bursche steckte, und brachte im Buckel- oder Handkorb das Essen für die Schwerarbeiter, das aber erst mit Überraschungen, zum Beispiel einem lebenden Hahn, Ziegelsteinen, Stirnblatt oder Nachttopf, gespickt war. Ein Schuß kündigte den Förster an, welcher die Holzmacher als Holzdiebe erkannte und sie vertreiben wollte. In diesem Handgemenge wurde der Förster an den Baum gefesselt und erst nach seiner Einwilligung, daß der Baum den Holzmachern gehöre, wieder befreit. Mit frisch geölter Säge und scharf gedengelter Hacke wurde das Spiel ernsthaft beendet. Der rauschende Giebel neigte sich der Erde zu, der Stamm machte beim Aufprall noch einen „Schnelzer“ wie ein Fisch, der sich im Backrohr noch einmal bewegt, und dann wird es still um ihn herum.
Mit einem Ehrentanz wurde von den Plozmoidlan und Plozknechtn, dem Förster, Holzmachern und Essentragweibl der Tanz im Saal fortgesetzt. So ähnlich wiederholte sich das Jahr um Jahr. Unser Sudetendeutsches
Pfingsttreffen, der Sudetendeutsche Tag 2024, findet dieses Jahr wieder in Augsburg statt. Ich werde am Pfingstsonntag anwesend sein, in der Hoffnung jemanden aus den von mir betreuten Orten begrüßen zu dürfen, um die eine oder andere Person auch einmal persönlich kennenzulernen.
All meinen Grasengrünern wünsche ich einen sonnigen Maifeiertag, den Müttern einen schönen Muttertag, den Vätern einen von Gewittern freien Himmelfahrtstag, und insgesamt einen schönen Maimonat: „Vergeßt ma ned auf die Eisheiligen und bleibt’s ma g’sund.“
Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
Lichtenstadt
Gemeindebetreuerin Magdalena Geißler, Karlsbader Str. 8, 91083 Baiersdorf-Hagenau, Telefon (0 91 33) 33 24

Heimatstube in 90513 Zirndorf, Fürther Straße 8; betreut von Christina Rösch-Kranholdt, Egloffsteiner Ring 6, 96146 Altendorf, Telefon (0 95 45) 35 98 13 Wir gratulieren den Geburtstagskindern im Monat Mai ganz herzlich zum Geburtstag zum: –86. Geburtstag am 3. Mai Kurt Kriwan, 83416 Surheim; –82. am 31. Edeltraud Stützlein, geb. Schmidt, (Sekretär), 90556 Seukendorf; –81. am 15.Gerlinde Obermillacher, geb. Schmidt, 91552 Ansbach; –66. am 28. Herbert Geißler; –50. am 28.Daniel Kranholdt, 96146 Al-
tendorf. Magdalena Geißler
Gedicht „Im Mai“: „Jeder Morgen: Nagelneu
Jede Blüte: Einmalig
Jede Wolke: Einzigartig Und auch du: Ein Unikat
Ich wünsche dir, daß du das Staunen niemals verlernst. Daß du dich täglich dem Leben öffnest –und das Leben sich dir.“ (Tina Willms)
Vielen Dank für die Geldspende an Familie Gellen, für den Kuchen an Familie Reim; Kaffee, Tee und anderes kommt von mir. Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Wonnemonat Mai. Grillen, in den Biergarten gehen oder einfach nur im Garten oder auf dem Balkon sitzen und sich am Leben erfreuen.
In eigener Sache: Ich bin schon etwas enttäuscht – haben Sie kein Interesse mehr an der Heimatstube? Warum kommen so wenige? Ab sofort sind wir wieder jeden Monat vor Ort mit tollem Gebäck, Kaffee und Tee! Im Mai ist es der 5. Mai. Wir öffnen von 14 bis 16 Uhr. Kommt doch einfach mal vorbei, wenn ihr Lust auf eine nette Unterhaltung habt. Wir würden uns sehr freuen. Meine Telefonnummer: (0 95 45) 35 98 13. Ihre Christina Rösch-Kranholdt
Pullwitz
Gemeindebetreuer Wolfram Schmidt, Am Buchberg 24a, 91413 Neustadt/A., Telefon (0 91 61) 72 00

Liebe Pullwitzer, ein herzliches Grüß Gott. Am 18. Mai kann Helmut Hederer seinen 83. Geburtstag feiern. Für das neue Lebensjahr wünschen wir alles erdenklich Gute, viel Glück, vor allem jedoch Gesundheit und Zufriedenheit. Es grüßt recht herzlich, Ihr Wolfram Schmidt
Rodisfort

Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf.Kreisl@gmx.de Der Mai beschert uns dieses Jahr allerhand Feiertage. Es beginnt mit dem 1. Mai und dem Tanz in den Mai beziehungsweise um den Maibaum, Muttertag, das Pfingstfest, Fronleichnam, Christi Himmelfahrt, heute bei den meisten nur noch als Vatertag bekannt; der Mai bietet zum Feiern viele Gelegenheiten. Nicht zu vergessen an Pfingsten vom 17. bis zum 19. Mai unser Sudetendeutscher Tag in Augsburg. Ich werde am Pfingstsonntag in Augsburg anwesend sein, vielleicht sieht man sich einmal dort. Der Himmelfahrtstag und der Dreifaltigkeitstag galten in Rodisfort als Gewittertage. Der Himmel war meist schwarz und es gingen an diesen Tagen schwere Gewitter nieder, oft von Hagel-
körnern begleitet. Die Familien blieben um ein Kerzenlicht geschart und beteten, daß der Herr Haus und Hof vor Blitzeinschlag verschonen möge. An diesen Tagen sollte man auch das Baden in der Eger unterlassen. Manche Leute gingen in dieser Zeit auf Wallfahrt nach Engelhaus zur Dreifaltigkeitskirche.
Nun wünsche ich noch all meinen Rodisfortern einen schönen, warmen, sonnigen Mai, sowie ein frohes Pfingstfest! Bis zur nächsten Ausgabe im Juni. Bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
Schlackenwerth
Gemeindebetreuer Horst Hippmann, Schloßstraße 9, 74357 Bönnigheim, Telefon/ Fax (0 71 43) 2 29 49, eMail: horst_hippmann@web.de

Ehrung für den langjährigen Vorsitzenden des Heimatverbands Schlackenwerth:
Mitte Februar/Feber wurde Horst Hippmann mit der Bürgermedaille seiner jetzigen Heimatstadt Bönnigheim ausgezeichnet.
Im Jahr 1941 in Schlackenwerth geboren kam der Geehrte als kleiner Junge zunächst ins schwäbische Bayern, von dort aus dann ins benachbarte BadenWürttemberg, wo er ab 1963 in Bönnigheim ansässig wurde und eine Familie gründete.
Dort engagierte er sich vielfältig, unter anderem auch als Obmann der Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft, aber auch in verschiedenen Vereinen der Gemeinde. Ich zitiere aus der Laudatio des Bürgermeisters: „Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Gemeinderats und der Bönnigheimer Bürgerschaft für diesen selbstlosen Einsatz in einer Treue und Beständigkeit wie sie heutzutage nur noch selten anzutreffen sind.“
Besonders hervorzuheben ist aus unserer Sicht sein unermüdlicher Einsatz für den in Rastatt ansässigen Heimatverband Schlakkenwerth, als dessen Vorsitzender er in Nachfolge von Josef Hubatschek viele Jahre lang amtierte. Dieser hatte im Jahr 1969 den Bürgermeister von Rastatt dafür gewinnen können, die Patenschaft für den Heimatverband Schlackenwerth zu übernehmen. Daraus ergab sich auch eine Städtepartnerschaft mit Ostrov, dem früheren Schlackenwerth.
Dazu nochmals die Worte des Bürgermeisters: „Sie und Ihre Frau Elfriede engagierten sich jahraus jahrein, damit das kulturelle Erbe Ihrer angestammten Heimatstadt bewahrt bleibt. Nach intensiver Kleinarbeit weihte die Stadt Rastatt im Juli 2019 in der Kulturstätte Rossi-Haus das SchlackenwerthZimmer ein.“ Dieses besteht weiterhin, obwohl sich nun bedauerlicherweise der Heimatverband zum Ende des Jahres 2023 aufgelöst hat (siehe Karlsbader Zeitung vom Januar/Jänner, Nummer 1+2 vom 12. Januar der Sudetendeutschen Zeitung).
Auch die Bürgermeisterin von Rastatt übermittelte Glückwünsche: „Es freut mich außerordentlich, daß Ihr Engagement für die Schlackenwerther Heimatvertriebenen nun zu dieser Auszeichung geführt hat.“
Lieber Herr Hippmann, wir schließen uns diesen Glückwünschen an und gratulieren herzlich! Danke für Ihren Einsatz unter unserem Motto „Laß Dir die Fremde zur Heimat, aber die
Heimat nie zur Fremde werden“ –das haben Sie vorbildlich erfüllt! Pia Eschbaumer Herzliche Glückwünsche für ein gesundes und frohes neues Lebensjahr entrichten wir zum Geburtstag zum: –89. Geburtstag am 13. Mai Birkenstock, Marianne, 36323 Grebenau; –87. am 26. Telto, Gudrun, 29471 Gartow; –76. am 29. Eismann, Walter, 61440 Oberursel.
Schneidmühl

Gemeindebetreuer Rudi Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail: baier_rudolf@hotmail.de Wir gratulieren im Mai herzlich allen Geburtstagskindern zum: –81. Geburtstag am 4. Mai Karl Weps in 97980 Bad Mergentheim; –78. am 28. Franz Neuerer in 63741 Aschaffenburg. Wir wünschen ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Den Kranken wünschen wir baldige Genesung. Verstorben ist im Alter von 87 Jahren am 23. Februar 2024 Manfred Nagel, Ehemann unserer lieben Schneidmühlerin Hannelore Nagel, geb. Schöniger, (Hausnr. 15). Ihr und den Angehörigen gilt unser Beileid und aufrichtige Anteilnahme. Ihre Schwester Emmi ist vor Kurzem aus Altersgründen ins betreute Wohnen in ein Seniorenheim in Wiesbaden verzogen. Wir wünschen ihr in ihrem neuen Zuhause alles Gute und eine glückliche Zeit. Erinnern möchte ich an den Sudetendeutschen Tag, der am Pfingstsonntag in Augsburg stattfindet. Das Motto lautet „Sudetendeutsche und Tschechen –Miteinander für Europa“. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in Augsburg begrüßen könnte. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Ortsbetreuer Rudi Baier
Sodau–Halmgrün–
Großenteich

Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf.Kreisl@gmx.de Nun ist der Mai da, und mit ihm beginnt die warme Jahreszeit. Der Maimonat ist auch ein Monat, der „überlastet“ ist mit Feiertagen: Es beginnt mit dem 1. Mai (Maifeiertag), geht weiter mit dem Muttertag, dem Himmelfahrtstag (Vatertag), und dann noch Pfingsten. Zum Pfingstfest treffen sich auch heuer wieder viele von uns vom 17. bis zum 19. Mai auf dem Sudetendeutschen Tag, der dieses Jahr wieder in der Messe Augsburg stattfindet. Ich werde am Pfingstsonntag anwesend sein und freue mich auf meine Landsleute. Ende Mai feiern wir dann auch noch Fronleichnam. Die Bedeutsamkeit der eigenen Person wurde durch den Gang zur Kommunionbank am Weißen Sonntag erstmals in den kindlichen Herzen wachgerufen. Bewußt fühlten sich die Erstkommunikanten als Mittelpunkt der Familie. Der Kommuniontag ging als Ereignis jedoch
zu schnell vorüber und der Glanz im Kinderherz verbleicht rasch wieder. Das weiße Kleidchen mit dem Kränzchen und der dunkle Anzug mit der Schärpe wurden sorgsam im Schrank aufbewahrt. Einmal sollte noch im gleichen Jahr etwas von der Erstkommunionherrlichkeit in die Kinderseele zurückkehren, und zwar am Fronleichnamstag. Darauf freute man sich besonders. Fronleichnam bekam mit dem Prozessionszug durch das Dorf sein besonderes Gepräge, denn im Gegensatz zu anderen Kirchenfesten spielte sich hier ein großer Teil der Feierlichkeiten im Freien ab. Mit Vereinsaufmärschen, Fahnenschwenken, Musik, Gesang und rituellen Regeln wurde dem Kultbedürfnis der Menschen Genüge getan. Weihrauchgeruch zog durch die Straßen, und fast den ganzen Vormittag läuteten in Abständen die Kirchenglocken. Gleichgestellt mit Vereinen und Körperschaften nahmen auch die Kommunionkinder geschlossen am Umzug teil. Schon rein äußerlich unterschieden sie sich gegenüber den anderen Schulklassen durch ihre festliche einheitliche Kleidung. Somit spielten die Kinder Jahr für Jahr eine wichtige Rolle in der Prozession, sie gehörten einfach dazu, genau wie die behelmte Dorffeuerwehr und die Veteranen mit dem Federhut. Gewöhnlich herrschte am Fronleichnamstag schon vormittags eine drückende Schwüle. Während des Umzugs ging mancher besorgte Blick von Bauersleuten zum Himmel. Sie sahen nach Gewitterwolken hinter der gleißenden Sonne aus. Die Heuernte hatte bereits begonnen, auf den Wiesen trocknete das Futter. Ein Gewitterregen konn-
te alles verderben. Die Prozessionswege waren staubig, die Luft flimmerte, die Kehlen der Sänger trockneten aus. Die Musikanten wischten immer häufiger den Schweiß von der Stirn. Veteranen und Feuerwehrmänner öffneten den obersten Haken an ihren Uniformröcken. Ganz ungehörig sehnte sich mancher Umzugsteilnehmer nach einer kühlen Halben oder freute sich zumindest jetzt schon auf den anschließenden Gang in das Dorfwirtshaus.
Inzwischen zeigte die Kirchenuhr auch schon die Mittagszeit an. Die Kolonnen der Vereine formierten sich nochmals, die Musik spielte einen flotten Marsch, zügig ging es jetzt voraus, dem nahen Gasthaus zu. Dort legte der Wirt gerade frisches Eis auf das neu angezapfte Faß Bier. Allen Landsleuten aus Sodau–Halmgrün und Großenteich wünsche ich einen schönen warmen Maimonat, den Müttern einen schönen Muttertag, nicht nur den Vätern einen sonnenreichen Himmelfahrtstag, und allen ein schönes Pfingstfest. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
Im Umkreis:
Sachsengrün–
Ranzengrün–
Oberlomitz
Gemeindebetreuer
Gerhard
Hacker, Am Hang 32, 92442 Wakkersdorf, Telefon (0 94 31) 5 11 63, Fax (0 94 31) 79 91 91 Zu seinem 80. Geburtstag am 25. April gratulieren wir Bitte umblättern

n 1. Mai 1924: Die Stadt errichtet an Stelle des verstaatlichten Polizeiamtes eine städtische Erhebungsstelle, die jene Agenden zu versehen hat, die vom Staat nicht übernommen worden sind.
Die Überwachungsorgane (sogenannte G'heimer) werden für die Parkanlagen und Wälder wieder eingestellt.
Die Brunnenweihe wird in einfacher Weise gefeiert. Einweihung des Sprudels und feierliches Hochamt in der Dekanalkirche.
Es finden sozialdemokratische und kommunistische Mai-Feiern statt. Aufzug durch die Stadt zum Becherplatz, wo Ansprachen gehalten werden.
Der Tschechisierungsverein „Narodni Severoceska“ veranstaltet ein Militärkonzert im „Café Park Brunn“, früher „Café Schönbrunn“, und lockt deutsche Besucher an durch deutschgedruckte Plakate, auf denen die
� Reihe " Verdiente Karlsbader"
Veranstalter verheimlicht werden.
Baumeister Srb und Ingenieur Grimm planen die Errichtung eines großen Ladenprojekts bei der Egerbrücke neben dem städtischen Waaghäuschen.
n 3. Mai 1924: Das Stadttheater wird eröffnet.
Erstes Posthofkonzert: Zum ersten Mal erscheinen die Programme mit viersprachigem Titel und tschechischem Druck der tschechischen Vortragsstücke.
Die Kurliste erscheint zum ersten Mal mit viersprachigem Titel. Die Namen der tschechischen Kurgäste in tschechischer Sprache.
In Deutschland finden Reichstagswahlen statt. Die Sozialdemokraten erleiden große Verluste, die Nationalen und Kommunisten gewinnen viele Stimmen.
n 5. Mai 1924: Im Alter von 74 Jahren verstirbt der städtische Oberförster Thomas Nitzl.
Von Rudi Baiern 11. Mai 1924: Es tritt endlich Frühlingswetter ein.
Am Marien-Altar in der katholischen Kirche gerät ein Kranz in Brand während Weihbischof Glasauer gerade bei großem Besuch der Kirche das Pontifikalamt hält. Der Brand wird schnell gelöscht. Nur mit großer Mühe wird eine Panik verhindert.
Der Aufbau des Militärbadehauses wirkt nach Gutachten von Fachleuten unschön und nicht in den Rahmen der Umgebung passend.
n 15. Mai 1924: Im städtischen Lesesaal werden die Besuchsgebühren herabgesetzt: Tageskarte 1 Kč, Wochenkarte 5 Kč und Monatskarte 15 Kč.
n 17. Mai 1924: In der Vorstandsitzung des Wohlfahrtsvereins UNION findet die Neuwahl der stellvertretenden Vereinsfunktionäre statt. Beschlossen wird, daß die Versicherungsgebühr von 240 Kč wieder von den auszuzahlenden Wohl-
fahrtsbeträgen in Abzug zu bringen ist.
n 18. Mai 1924: Im „Sanssouci“ wird eine Kunstausstellung eröffnet. Die Freibäder werden alle aufgehoben.
Die Bahnhofsrestauration wird an einen tschechischen Legionär verpachtet.
n 19. Mai 1924: Heinrich Pötzl, Hausbesitzer, verstirbt im 84. Lebensjahr. Er war in den 70er und 80er Jahren die Seele aller größeren Veranstaltungen in Karlsbad.
n 21. Mai 1924: Der Theaterbeginn wird versuchsweise auf 19.30 Uhr herabgesetzt. Der Kurbesuch zeigt gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 2445 Personen.
Am Bahnhof wird einer Dame die Handtasche mit 5000 Kč Bargeld und Schmuck im Wert von 25 000 Kč geraubt.
n 27. Mai 1924: Die Stadtvertretung bewilligt der
Baugenossenschaft Eigenheim eine Subvention von einer Million Kč.
Das Stadtverordneten-Kollegium beschließt zahlreiche Anstellungen von Ärzten im Krankenhaus.
Die Stadtvertretung beschließt, den Brückenbau vom Salzsudhaus zum Oberen Bahnhof auf eigene Regie durchzuführen.
Die Stadt kauft von den Bradaczekschen Erben das Haus „Jäger“ am Schloßplatz für 225 000 Kronen.
Im Gaswerk wird ein moderner Vertikal-Kammerofen an Stelle der alten Horizontalretortenöfen aufgestellt. Die Kosten per drei Millionen Kč werden von der Stadtvertretung bewilligt.
Die Sauerbrunnbäder beim Dorotheensäuerling werden niedergelegt.
Für das städtische Zentralkino wird als Geschäftsleiter Ernst Hollmann junior bestellt; der-
selbe hat einen pauschalierten Reinertrag von 100 000 Kc pro Jahr auf die Dauer von sechs Jahren zu entrichten. n 28. Mai 1924: Das neue tschechische Wochenblatt „Karlovarske Listy“ wird herausgegeben.
n 31. Mai 1924: Die Tanzreunionen im Kurhaus beginnen.
In Deutschland wird eine Ausreisetaxe von 500 Goldmark eingeführt; Schaden für Karlsbad. Alle öffentlichen Aufschriften müssen an erster Stelle in tschechischer und an zweiter in deutscher Sprache angebracht werden. Der Staat erwähnt Karlsbad in einer Werbeschrift mit kaum drei Zeilen. Marienbad dagegen wird lobend hervorgehoben. Die Ursache ist, daß sich Karlsbad nicht so leicht tschechisieren läßt. Die Witterung im Mai war günstig. Die Durchschnittstemperatur betrug 19,6 Grad.
In dieser Ausgabe der Reihe geht es um den verdienten Karlsbader Paul Klemm:
Am 18. August 1848 in Jokes im Bezirk Joachimsthal geboren absolvierte Klemm die dreiklassige Unterrealschule in Joachimsthal und Kaaden und die Lehrerbildungsanstalt in Leitmeritz. Er diente anschließend als Unterlehrer in Platten, erhielt das Lehrbefähigungszeugnis für Volksschullehrer am 23. Oktober 1869. Daraufhin diente er als Lehrer in Webhau, er machte die Lehrbefähigungsprüfung über die sprachlich historische Gruppe in Bürgerschulen (Lehrbefähigungszeugnis in Leitmeritz am 23. Mai 1874). Er war im Schuljahr 1874/1875 und 1875/1876 Lehrer an der Bürgerschule in Falkenau und wurde mit Dekret des hohen k.k. Landesschulrats in Prag am 26. Juni 1876 zum Lehrer an der Bürgerschule Karlsbad bestellt. Ab 1877 lehrte Klemm an der II. Mädchenklasse Unterrichtssprache, Geografie und Geschichte, in der I. Mädchenklas-

se Geometrie, und in allen sechs Klassen Gesang. Im September 1880 gründete Klemm einen kaufmännischen Fortbildungskurs als Sonntagsschule. Am 12. Februar 1881 heiratete er in der Pfarrkirche zu Sollmus Karoline Benisch aus Gießhübel. Das Ehepaar hatte mehrere Kinder. Am 16. September 1889 eröffnete Klemm eine Privat-Mädchenfortbildungsschule im Lehrerzimmer der II. Volksschule in Karlsbad mit 20 Mädchen.
� Reihe " K arlsbader Geschichten"
In der neuen Serie "Karlsbader Geschichten" erscheinen künftig Geschichten, Anekdoten und Interessantes aus der Stadt Karlsbad und Umgebung. Die erste Geschichte trägt den Titel "Eine Jagd im Schloßpark zu Schlackenwerth":
� Fortsetzung von Seite 23
nachträglich recht herzlich unserem Ernst Stengl in 90619 Trautskirchen (Sachsengrün, Hausnummer 31). Er ist aus unseren drei Ortschaften das letzte Kind, dessen Geburt am 25. April 1944 in die standesamtlichen und kirchlichen Bücher einzutragen war.
Im August 1946 ging es dann zusammen mit seiner Mutter und
Prinz Isenburg von Toscana weilte seit vielen Jahren bereits im Schloß Schlackenwerth. Isenburg war ein sehr jovialer Mensch. Er hatte die Tochter des dortigen Arztes MUDr. Rohrer geheiratet, suchte aber dennoch bei passender Gelegen-
Im November 1890 legte er vor der Prüfungskommission in Prag die Lehrbefähigungsprüfung für die englische Sprache mit Erfolg ab. Am 10. September 1895 wurde er als Direktor der Bürgerschule angestellt und leistete darauf am 25. September 1895 in der Bezirkshauptmannschaft den Diensteid. Klemm wirkte insgesamt 55 Jahre lang als Pädagoge, davon 43 Jahre lang an der Bürgerschule. Nach Trennung der Schule in eine Knaben- und eine Mädchenschule wirkte er zuletzt durch drei Jahre als Direktor der Mädchenabteilung bis zu seinem Rücktritt Ende des Schuljahres 1918/1919. Am 24. April 1924 verstarb er im Alter von 76 Jahren in Karlsbad. Rudi Baier

heit auch Anschluß an fürstliche Kreise. Da kam ihm auch der Schah von Persien willkommen. Er lud den Schah samt Gefolge zu einer Jagd ein, welche aber für den exotischen Fürsten nicht anstrengend sein durfte. Er wußte Rat. Er ließ hunderte
Gänse, junge und alte, durch das Schloß- und Forstpersonal in den benachbarten Dörfern einkaufen, von den noch gelben Vögeln bis zu den ältesten ausstoßbaren Gänserichen, und die Qualität war Nebensache. Diese Tiere wurden im geschlossenen Park, welchen der Bach durchfließt, ausgelassen. Als der Schah mit seinen Leuten erschien, begann ein lustiges Knallen der Gewehre auf das Wild. Reiche Jagdbeute und reicher Ordensregen bis zum Portier und den jüngsten gelade-
nen Nimroden war der fröhliche Schluß dieser genial durchgeführten anstrengungslosen Jagd. Abends kehrten fast 50 Wägen, meist Landauer, mit den Jagdgästen nach Karlsbad zurück. Das Wild wurde verschenkt. Rudi Baier

den vier Geschwistern im zweiten Transport fort aus der Heimat. Der Vater war in russischer Gefangenschaft. Daß er, der Zweijährige, von allem, was nach
Kriegsende im Ort passierte, nichts mitbekommen hat, wird man nicht annehmen dürfen. Zu groß war die Angst bei den Erwachsenen vor der Willkür der meisten Russen und Tschechen und der Neusiedler. Es gab kein
Eigentum mehr: Inventar, Wohnraum, Arbeitskraft, und sogar ein ausreichendes Essen konnten abgepreßt werden.
Der Transport war nach Thüringen gegangen. Doch keiner wollte dort die Mutter mit ihren fünf Kindern aufnehmen. Im Jahr 1948 gingen sie über die innerdeutsche Grenze nach Bayern. Als nach dem Jahr 2000 die Tschechische Republik in vorbildhafter Weise anfing, unsere Matrikelbücher zugänglich zu machen, begann Stengl un-
ermüdlich mit der Ahnenforschung väterlicherseits. Bis zum Jahr 1560 hat er den Stamm zurückverfolgt. 1788 hat ein Jakob Stengl aus Weidmesgrün, Kreis Schlackenwerth, nach Sachsengrün geheiratet: eine Susanna Siegl aus Hausnummer 23. Er hat von Josef Kilches das Anwesen Hausnummer 31 gekauft. Dieser war ein Büchsenmacher, und so
blieb ihm bis zuletzt der Hausname „Büchsenmacher“. Liebe Heimatleute, jetzt wissen wir allerhand über unser besonderes Geburtstagskind, und wir wünschen ihm auch noch gute Gesundheit und Gottes Segen. Ich grüße Sie alle recht herzlich, bleiben Sie gesund! Ihr Gerhard Hacker