






Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung
Sudetendeutschen Landsmannschaft Zeitung
HEIMATBOTE
HEIMATBOTE

Heimatbrief


VOLKSBOTE

❯ Volksgruppensprecher Besserer
Schutz für Minderheiten
In einer Erklärung zum Vertriebenengedenktag (siehe Seite 3) hat der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, betont, daß mit 120 Millionen Menschen derzeit so viele Vertriebene dieses schwere Schicksal erleiden müßten, wie nie zuvor in der Geschichte.



Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.
Der langjährige Europaabgeordnete appellierte an die derzeit in Bildung befindliche neue EU-Kommission, eine weltweite Initiative für ein internationales kodifiziertes und strafbewährtes Vertreibungsverbot zu starten. Die derzeitigen völkerrechtlichen Instrumente seien unzureichend. Es gebe sehr unterschiedliche Ursachen für Flucht und Vertreibung, der Hauptgrund sei aber oft, daß eine Gruppe Merkmale aufweise, die autoritären und nationalistischen Machthabern mißfallen, wie etwa Sprache oder Religion. Deshalb sei es höchste Zeit, daß die EU-Kommission dem Beschluß des Europaparlamentes und des Bundestages folge, das erfolgreiche Bürgerbegehren für einen verbesserten Volksgruppen- und Minderheitenschutz umzusetzen, statt es wie bisher vom Tisch zu wischen. Der Sprecher der Volksgruppe kündigte an, dieses Anliegen in die Debatte um eine Wiederwahl von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission und um das Programm der künftigen EU-Kommission einzubringen.
Wichtig, so Posselt, wäre auch, einen EU-Kommissar zu berufen, der sich ressortmäßig um Minderheitenfragen und Maßnahmen gegen Flucht und Vertreibung kümmert.



Rinshofer, Luis Nowak, Projektleiter Cornelius Von der Heyden, Paul Aschauer und Hannah Renner. Foto: Torsten Fricke
„Jeder vierte Bayer hat einen Vertriebenenhintergrund. Ein Schulprojekt dem wichtigen Thema Vertreibung zu widmen, ist deshalb großartig. Ich danke den Lehrern und Schülern am Gymnasium in Bad Tölz für dieses Engagement“, sagt Steffen Hörtler, SL-Landesobmann und Vize-Präsident des Bundes der Vertriebenen.
Im Rahmen des Projektseminars Geographie hatte eine 15köpfige Schülergruppe im März das Sudetendeutsche Museum, das Haus des Deutschen Ostens und den Bund der Vertriebenen besucht und unter anderem mit Dr. Raimund Paleczek, Leiter der Abteilung Historische Forschung und Archiv, und dem BdV-Landesvorsitzenden Christian Knau-
er über diesen Teil der deutschen Geschichte gesprochen.
„Gerade die junge Generation mit den Wurzeln der Vorfahren aus den deutschen Ostgebieten in Berührung zu bringen und dazu anzuregen, sich selbst auf Spurensuche zu begeben, ist ein wichtiger Auftrag – vor allem gegen das Vergessen“, so deren Lehrer Cornelius Von der Heyden, der das Schulprojekt geleitet und selbst sudetendeutsche Wurzeln hat. Als besondere Wertschätzung für das Interesse wurden die Schüler und Lehrer auf Initiative von BdV-Landeschef Knauer von der Staatskanzlei zum Gedenkakt für die Opfer von Flucht und Vertreibung am Samstag in das Prinz-Carl-Palais eingeladen. Bericht siehe Seite 3
❯ Nach der Auszeichnung durch das Centrum Bavaria Bohemia reiste der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung nach Israel Brückenbauer
Seine beiden Lebensthemen liegen keine 24 Stunden auseinander: Am vergangenen Freitag ist Dr. Ludwig Spaenle für sein jahrzehntelanges deutschtschechisches Engagement mit dem Brückenbauerpreis des Centrums Bavaria Bohemia auszeichnet worden. Am Samstag flog der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe erneut nach Israel.
Für die böhmisch-bayerische Verständigung wünscht sich Spaenle, daß „das Wunder der Normalität weitergeht“. 2010 war der damalige Staatsminister für Unterricht und Kultus gemeinsam mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt nach Tschechien gereist. Die beiden hatten damit den Weg bereitet für den ersten offiziellen Besuch eines bayerischen Ministerpräsidenten in Prag, mit dem Landeschef Horst Seehofer Monate später – in Begleitung von Posselt – ein neues Kapitel in den nachbarschaftlichen Beziehungen aufschlug. Spaenle und Posselt besuchten 2010 die Opferorte Kyrillund-Method-Kirche, Theresienstadt, Lidice und Aussig. Insbesondere das Gedenken in Lidice (siehe auch Seite 2) wurde von der tschechischen Öffentlichkeit besonders wahrgenommen. Man verneige sich vor den im Jahr 1942 von den Nationalsozialisten ermordeten Mitbürgern und bitte um Vergebung für „jenen Teil der Schuld, den wir zu tragen haben“, sagte Posselt damals. Gleichzeitig erinnerte der Volksgruppensprecher auch an das Schicksal der nach dem Krieg gewaltsam aus der Tschechoslowakei vertriebenen Sudetendeutschen. Man müsse alles dafür tun, daß Verbrechen wie jenes von Lidice „nie mehr im Namen Deutschlands“ geschähen, und man wolle sich dafür einsetzen, daß „die nachbarschaftlichen Beziehungen und die Freundschaft zwischen dem tschechischen und dem bayerischen Volk so eng wie möglich“ seien, erklärte Spaenle damals und lobt jetzt den Verständigungswillen auf beiden Seiten: „Dieses Händereichen über alles hinweg ist ein Wunder,



„Das, was ich dort gesehen habe, werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagte Dr. Ludwig Spaenle nach dem Besuch des Festivalgeländes, wo die Hamas 364 zum größten Teil junge Menschen ermordet hat. Fotos: Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung
das eigentlich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet gehört.“ Die beiden Reisen der bayerischen Spitzenpolitiker waren der Startschuß für weitere konkrete Schritte, wie die beiden Abkommen über Kultur und Wissenschaft, die Spaenle abschloß. Wichtig ist dem CSUPolitiker heute, den Jugendaustausch weiter voranzubringen. „Persönliche Begegnungen und das Überwinden von Sprachgrenzen sind das Ein und Alles. Wir müssen den jungen Menschen vermitteln, daß es das gemeinsame Haus Europa braucht.“
Zum zweiten Mal nach dem Terroranschlag der palästinensischen Hamas am 7. Oktober 2023 auf israelische Zivilisten flog Spaenle am vergangenen Samstag nach Tel Aviv. Beim ersten
Besuch im Dezember war Spaenle Mitglied der Delegation des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gewesen.
Bei der jetzigen Arbeitsreise standen unter anderem ein Besuch des Leo-Baeck-Instituts in Jerusalem, das sich mit der Geschichte des deutschsprachigen Judentums beschäftigt, und ein Treffen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem auf der Tagesordnung, um das Kooperationsabkommen, das Ministerpräsident Söder unterzeichnet hat, weiter umzusetzen.
„Wir wollen insbesondere Lehrer weiterbilden, um die Erinnerung an das Menscheitsverbrechen Holocaust aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig ist es wichtig, daß wir als deutsche Zivilgesellschaft Verantwortung im Kampf gegen den Antisemitismus übernehmen“, so Spaenle.
In der Bayerischen Vertretung hat Spaenle außerdem im Auftrag der Landeshauptstadt Mün-
chen Familien von Nazi-Opfern Wertgegenstände zurückgegeben, die Hitlers Schergen vor über 80 Jahren geraubt hatten. Tief bewegt hat den Beauftragten der Besuch des Festivalgeländes am Kibbuz Re´im, wo die Hamas 364 Menschen ermordet hat. „Wir haben mit einem Betroffenen gesprochen, der 700 Kinder gerettet hat und jetzt so schwer traumatisiert ist, daß er nur noch zittert und nicht mehr schlafen kann. Das, was ich dort gesehen habe, werde ich mein Leben lang nicht vergessen.“ Mit seiner Israel-Reise will Spaenle deshalb auch eine klare Botschaft aussenden: „Die Verantwortung für die aktuelle Lage in Nahost trägt allein die Hamas, die mit ihrem brutalen Terroranschlag auf Zivilisten mehr als 1200 meist junge Menschen ermordet hat.“
Selbstverständlich dürfe man auch in Deutschland die israelische Politik und die massive Militärintervention kritisieren, aber hierzulande habe diese öffentliche Debatte längst einen Kipppunkt überschritten. „Israel wird ungeprüft und unwidersprochen als das Böse dargestellt. Die Leiden der palästinensischen Bevölkerung werden dabei als Instrument genutzt, um in Deutschland Haß und Antisemitismus zu verbreiten. Wir dürfen nicht vergessen, daß Israel die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist.“ Daß jüdische Studenten und Wissenschaftler an deutschen Universitäten wieder gejagt und angegriffen werden, sei widerwärtig, so Spaenle. Hinzu komme, daß es sich bei den Opfern in der Regel auch noch um deutsche Staatsbürger handle, die mit der israelischen Regierungspolitik schon deshalb nichts zu tun hätten. Spaenle: „Diese Lage ist brandgefährlich. Hier ist der Rubikon überschritten.“
Eine Einladung der österreichischen Botschafterin Dr. Bettina Kirnbauer hat es SL-Büroleiter Peter Barton ermöglicht, die Präsidentin des Bundesrates, Margit Göll, in der Prager Botschaftsresidenz zu treffen. Die gebürtige Gmünderin schilderte Barton, wie sehr sie die Anliegen der Sudetendeutschen in ihrer Heimat interessieren, wo sie in ihrer niederösterreichischen Stadt zusammenkommen und zum festen Bestandteil der Region gehören. Daraufhin erzählte ihr Barton über seine Arbeit für Versöhnung und Verständigung zwischen Su-
detendeutschen und Tschechen, die er seit nunmehr 22 Jahren in der historischen Hauptstadt Böhmens und der Tschechischen Republik leisten darf. Das Prager Sudetendeutsche Büro versucht, die Arbeit der Landsleute aus Deutschland und Österreich in der Tschechischen Republik zu präsentieren, und Barton betont, daß die Sudetendeutschen, egal in welchem Land sie heute leben, nur eine einzige Heimat besitzen. Aus diesem Grund entwickelt sich die Zusammenarbeit des Prager Büros mit der Österreichischen Botschaft in Prag und dem SLÖ-Bundesvorsitzenden Rüdiger Stix sehr gut.
Margit Göll war von 2016 bis 2023 Abgeordnete im Landtag von Niederösterreich und wurde anschließend in den Bundesrat entsandt und hier für das erste Halbjahr 2024 zur Präsidentin gewählt. Die ÖVP-Politikerin ist verheiratet und hat einen Sohn.

❯ Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel bei der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz
Ziel ist „ein echter, gerechter und nachhaltiger Frieden“
Man müsse ein Stadium erreichen, „in dem auch Vertreter Rußlands am Verhandlungstisch sitzen“, hat Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel nach dem Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz erklärt, der am Wochenende ohne Beteiligung Moskaus stattgefunden hat.
Über 100 Länder und internationale Organisationen hatten bei der Ukraine-Konferenz Grundlinien für mögliche Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau diskutiert. Die große Mehrheit der Teilnehmer forderte die Beteiligung „aller Parteien“ an einem Friedensprozeß und betonte zugleich die Bedeutung der Souveränität der Ukraine und die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen. Die Abschlußerklärung wurde allerdings von mehreren BRICS-Staaten, wie Indien und Brasilien, nicht unterstützt. Und China, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates und Unterstützer Rußlands, war der Konferenz ferngeblieben.
An dem Treffen hatte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilgenommen, zu dem Petr Pavel eine besondere Beziehung hat. Als Staatsoberhaupt war Pavel nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs nicht nur nach Kiew, sondern auch an die Front im Osten der Ukraine gereist. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Pavel, der vor seiner politischen Karriere von 2015 bis 2018 Vorsitzender des Nato-Militärausschusses war, eine internationale Munitionsinitiative gestartet und aus nicht genannten Ländern rund eine halbe Million Schuß im Kaliber 155 Millimeter und 300 000 Schuß im Kaliber 122 Millimeter organisiert.
Die Beteiligung Rußlands an künftigen Friedensgesprächen

Reichenberg will Fernsehturm kaufen
Der 100 Meter hohe Fernseh- und Hotelturm auf dem Jeschken ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Region um Reichenberg. Der 1973 eröffnete Bau wurde von dem Architekten Karl Hubáček geplant und gehört dem Telekommunikationsanbieter České Radiokomunikace. Um Fördergelder für eine dringend notwendige Sanierung zu generieren, soll die Immobilie im Laufe des Jahres an die Stadt Reichenberg verkauft werden. Eine entsprechende Vorvereinbarung unterzeichneten beide Seiten am Montag.
IStGH: Tschechien rudert zurück
Daß der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) einen Haftbefehl gegen Israels demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beantragt hat, weil Israel die Hamas-Terroristen auch im Gaza-Streifen konsequent verfolgt, wurde unter anderem von Tschechiens Premierminister Petr Fiala scharf kritisiert. Jetzt kam die Rolle rückwärts. Die Tschechische Republik hat sich einer Initiative von mehr als 90 Ländern angeschlossen und in einer gemeinsamen Erklärung die „unerschütterliche Unterstützung“ für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag bekräftigt. Das tschechische Außenministerium teilte am Samstag mit, daß Tschechien von der Unabhängigkeit der Entscheidungen des Gerichtshofs überzeugt sei und ihn als eine wichtige internationale Institution betrachte.
nen Euro dotiert. Das Preisgeld ist für die Finanzierung der ersten fünf Jahre in Deutschland gedacht. Im Rahmen seiner Forschung auf dem Gebiet der diskreten Mathematik hatte Kráľ eine Vermutung von Michael D. Plummer und László Lovász aus den 1970er Jahren bewiesen, wonach jeder brückenfreie kubische Graph eine exponentielle Anzahl perfekter Matchings hat. Eishockey-Verband bestätigt Hadamczik
Der tschechische Eishockeyverband (ČSLH) wird auch in den nächsten vier Jahren von Alois Hadamczik geführt. Bei der Hauptversammlung am Samstag in Prag stimmten 59 der 61 Delegierten für den 71jährigen ehemalige Nationaltrainer, der seit 2022 Verbandschef ist. Von 2006 bis 2008 und von 2010 bis 2014 coachte Hadamczik die Nationalmannschaft und gewann mit ihr 2006 Olympia-Bronze sowie drei WM-Medaillen. Hadamcziks bislang größter Erfolg als Verbandschef ist der WM-Titel, den die tschechische Nationalmannschaft vor ein paar Wochen bei der Heim-WM geholt hat.
Ein Toter bei Militärübung


könne aber, so Pavel, „nicht unter Bedingungen geschehen, die für das angegriffene Land inakzeptabel“ seien. „Die UN-Charta und insbesondere das Recht auf Selbstverteidigung, Souveränität und territoriale Integrität müssen respektiert werden“, stellte das Staatsoberhaupt klar. Es dürfe keinen Scheinfrieden geben, der den völkerrechtswidrigen Angriff im Nachhinein rechtfertigt, sondern das Ziel sei „ein echter, gerechter und nach-
haltiger Frieden“, so Pavel: „Vor uns liegt noch ein schwieriger Weg, aber wir können nicht mit gefalteten Händen warten.“
In der Abschlußerklärung stellten die Staaten klar, daß die UN-Charta, das Völkerrecht und damit die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine die Basis für den Friedenprozeß bilden.
Darüber hinaus konnte man sich auf eine gemeinsame Sichtweise zu den diskutierten The-
❯ Botschafter Andreas Künne beim Gedenken an das deutsche Massaker in Lidice
Am Jahrestag des deutschen Massakers an den Bewohnern des Dorfes Lidice hat auch der Deutsche Botschafter in Prag, Andreas Künne, an der Gedenkveranstaltung teilgenommen und einen Kranz niedergelegt. Nach der erfolgreichen und mutigen Kommandoaktion auf den Nazi-Verbrecher Reinhard Heydrich hatten Gestapo und SS aus Rache am 10. Juni 1942 eines der schlimmsten Kriegsverbrechen verübt. Alle 173 männlichen Bürger von Lidice, die älter als 15 Jahre waren, wurden erschossen. Dabei wurde der Bürgermeister František Hejma von den Nazis gezwungen, die Todeskandidaten zu iden-


tifizieren, bevor er als einer der letzten Opfer ebenfalls ermordet wurde. Die 195 Frauen wurden zunächst in das KZ Ravensbrück deportiert. Nur wenige Op-
fer überlebten des Kriegsende. Die Kinder wurden entweder zwangsgermanisiert oder in einem SS-Wagen vergast. Das perverse Ziel der Nazis, Lidice ein für alle mal auszulöschen ge-
men einigen: Ukrainische Kernkraftwerke wie Saporischschja müssen gesichert und geschützt werden. Sie sollten zudem der souveränen Kontrolle der Ukraine sowie der Aufsicht der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) unterstehen. Die freie und sichere Handelsschiffahrt muß gewährleistet werden. Dieser Punkt ist insbesondere für die Länder des globalen Südens wichtig, weil sie auf ukrainische Getreideausfuhren angewiesen sind. Alle Kriegsgefangenen müssen ausgetauscht werden. Zudem müssen alle unrechtmäßig vertriebenen ukrainischen Kinder sowie sämtliche willkürlich inhaftierten Zivilisten in die Ukraine zurückgebracht werden. Torsten Fricke
PAuszeichnung für
Mathe-Professor
rof. Dr. Daniel Kráľ von der Masaryk-Universität in Brünn ist der erste tschechische Forscher, dem eine Alexandervon-Humboldt-Professur verliehen wird. Mit Berufung nach Leipzig will die Universität ihre Kompetenz auf dem Gebiet der sogenannten Diskreten Mathematik ausbauen. Die HumboldtProfessur ist die renommierteste Forschungs-Auszeichnung in Deutschland und mit 3,5 Millio-
Auf dem Truppenübungsplatz bei Olmütz ist am Montag bei einer Munitionsexplosion ein tschechischer Soldat ums Leben gekommen. Weitere acht Personen wurden verletzt. Verteidigungsministerin Jana Černochová reiste umgehend zur Unfallstelle und besuchte die Verletzten im Krankenhaus. Die Ministerin: „Nach ersten Erkenntnissen kann ausgeschlossen werden, daß die Explosion durch Sabotage oder andere Aktivitäten einer ausländischen Macht verursacht wurde.“
Vorchristliche Gräber entdeckt
Beim Bau der Autobahn D 35 haben Archäologen in der Nähe von Königgrätz das vermutlich längste Hügelgrab Europas entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen ist die Anlage rund 190 Meter lang. Die Grabanlage soll aus dem vierten Jahrhundert vor Christus stammen.
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
lang nicht. Das Dorf wurde samt Gedenkstätte wieder aufgebaut, und auf der ganzen Welt nannten sich mehrere Kommunen in Lidice um. Botschafter Künne twitterte auf Tschechisch: „Lidice. Eine der schlimmsten Greueltaten, die die Deutschen je begangen haben. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, daß künftige Generationen in Frieden leben können. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um sicherzustellen, daß keine Macht es wagt, die Menschenrechte zu verletzen, Unschuldige brutal zu ermorden und den Menschen ihre Freiheit zu nehmen. Wir werden nicht vergessen. Nezapomeneme.“ Torsten Fricke
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird
des
für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
❯ Bundesweiter Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung
Als erstes Bundesland würdigt der Freistaat Bayern seit 2014 die Opfer von Flucht und Vertreibung mit einem eigenen Ge-
denktag, der am zweiten Sonntag im September begangen wird. Im Vorfeld des bundesweiten Gedenktags, der seit 2015

Celina (Grüne) und Volkmar Halbleib (SPD), Staatsministerin Ulrike Scharf und Bayerns BdV-Vorsitzender Christian Knauer.
zeitgleich mit dem Weltflüchtlingstag am 20. Juni stattfindet, en, wird in Bayern ebenfalls an die Opfer erinnert.
Für Samstag hatte Ministerpräsident Markus Söder die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern angeordnet.
An der Gedenktafel in der Staatskanzlei gedachten Bayerns weitere stellvertretende Ministerpräsidentin Ulrike Scharf, Abgeordnete des Landtages und Christian Knauer, Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen, mit Vertretern der Landsmannschaften der Opfer.
Auf der 1999 in der Staatskanzlei angebrachten Gedenktafel heißt es: „Den deutschen Vertriebenen zur Erinnerung an Deportation, Flucht und Vertreibung / Zum Gedenken an ihre Heimat und an ihre Toten / Zum Dank für ihren Einsatz beim Wiederaufbau in Bayern.“
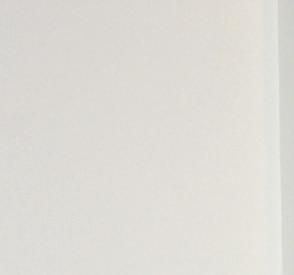










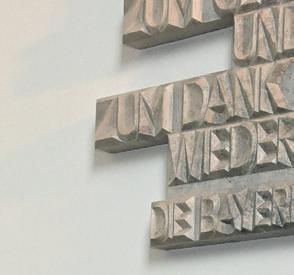






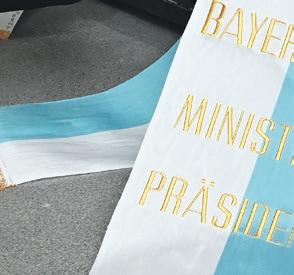

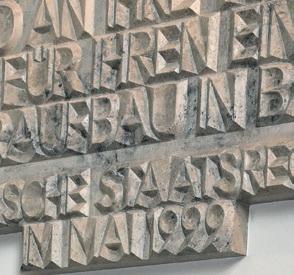












Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales sowie weitere stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern und Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen
❯ Staatsministerin Ulrike Scharf kritisiert in ihrer Festrede die aktuelle Politik gegen Vertriebene und Aussiedler
„Frau Roth hat aus der Geschichte nichts verstanden“
„Immer wieder versuchen Despoten, Tradition, Kultur und Identität ganzer Völker auszulöschen“, hat Ulrike Scharf, weitere stellvertretende Ministerpräsidentin, in ihrer Festansprache am Samstag zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung gewarnt. So seien 2023 weltweit 113 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen.
Scharf warnte davor, über die aktuellen Katastrophen das eigene Schicksal zu vergessen: „Zu oft gerät dabei die Geschichte deutscher Vertriebener, Aussiedler und Spätaussiedler in den Hintergrund. Die Menschen wurden damals vertrieben, weil sie Deutsche waren. Ein Stigma, eine Kollektivschuld, die viel zu oft vergessen wurden.“



Sudetendeutsche beim Gedenktag (von links): Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann mit Renate Ruchty von der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe und Bundesversammlungsmitglied Birgit Unfug, Landesobmann Ste en Hörtler mit Beauftragter Dr. Petra Loibl und Schatzmeister Toni Dutz mit Ehefrau Evi.

Besonderer Ehrengast: Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, mit Bayerns Staatsministerin Ulrike Scharf und dem Landtagsabgeordneten Peter Wähler.
Roth die eigentlich im Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes garantierte Kulturförderung weiter sabotiert.
Diese Friedensbotschaft ist heute ist aktueller denn je. Wir bauen die Zukunft auf Ihren historischen Erfahrungen. Zukunft braucht Herkunft.“

Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb eine Bundesratsinitiative gestartet, zum einen, um die Namensstreichung rückgängig zu machen, und zum anderen um zu verhindern, daß
In dieses negative Bild passe auch das Handeln der Staatsministerin beim Bundeskanzler sowie Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, die das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa umbenannt (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) und „der Deutschen“ gestrichen hat, so Scharf: „,Der Deutschen‘ ist gelöscht, getilgt, von der ideologischen Sprachpolizei eliminiert. Bei der Documenta und den Berliner Filmfestspielen läßt man antisemitische Hetze durchgehen, aber Kultur und Geschichte der Deutschen streicht diese Bundesregierung weg. Frau Roth hat aus der Geschichte nichts verstanden.“ Roth solle sich ein Beispiel nehmen an den Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern, die in Europa Brücken bauen und sich seit Jahrzehnten für Versöhnung einsetzen.
❯ Christian Knauer, Landesvorsitzender des BdV „Fremdrentengesetz ist eine Verhöhnung“
Als „schreiende Ungerechtigkeit“ hat Christian Knauer, Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen, in seiner Ansprache die aktuelle Regelung beim Fremdrentengesetz kritisiert.
Der Ärger unter den Spätaussiedlern und Aussiedlern sei groß, zumal, so Knauer, „offenkundig für so vieles auf der Welt bei uns Geld vorhanden scheint“. „Die Härtefallregelung, wie sie in den letzten Monaten vom Bund praktiziert wurde, ist nichts anderes als eine Verhöhnung dieser Menschen, die vielfach ihr Leben lang fleißig gearbeitet haben“, kritisierte der bayerische BdV-Chef mit deutlichen Worten und warnte vor Altersarmut bei den Betroffenen.
„Auch hier dürfen die Menschen nicht aus Verzweiflung in

die Arme der Parteien am ganz rechten oder linken Parteienspektrum getrieben werden“, warnte Knauer eindringlich.
„Wir kämpfen dafür, daß die Bundesregierung Sie nicht im Stich läßt“, unterstrich Ministerin Scharf in ihrer Festrede und sagte: „Ich verneige mich vor Ihrer Lebensleistung, vor Ihrer Friedensleistung. Sie sind Versöhner und Brückenbauer ohne Wenn und Aber. In der Charta der deutschen Heimatvertriebenen haben Sie sich schon früh zu einem geeinten Europa bekannt. Sie wollten von Anfang an und mit aller Kraft die Spirale von Krieg, Gewalt und Leid beenden.
In ihrer Eigenschaft als auch für Jugend zuständige Staatsministerin hatte Ulrike Scharf am Ende ihrer Rede noch eine persönliche Bitte an die Vertriebenen: „Bleiben Sie die Pioniere für Versöhnung und Freundschaft gerade in diesen Zeiten der Spaltung. Bleiben Sie die Kraft der Zukunft aus dem Wissen der Geschichte. Damit auch bei der jungen Generation die historische Saat Europas für Frieden und Freiheit aufgeht.“ Torsten Fricke
❯ Dr. Petra Loibl, Beauftragte der Staatsregierung
„Beeindruckende Botschaft“
Ein Viertel der bayerischen Bevölkerung kommt aus einer Familie mit Vertriebenenhintergrund, hat Dr. Petra Loibl, Beauftragte der Staatsregierung, in ihrer Rede festgestellt.
Das Schicksal der Vertriebenen sei „Teil unseres historischen Erbes und der Identität der Menschen in Bayern“ und dürfe nicht vergessen werden. Loibl: „Heute haben wir eine beeindruckende Botschaft des Zusammenhalts erlebt.“

Auf dem Podium sprach Bayerns BdV-Vorsitzender Christian Knauer mit den Zeitzeugen Johann Michl (links), Ria Schneider und Helmut Erwert über ihr erlebtes Vertreibungsschicksal.


❯ Mitgliederversammlung wählt Prof. Dr. Matthias Stickler zum neuen Vorsitzenden
Die Akademie Mitteleuropa hat einen neuen Vorstand. Nachdem der bisherige
Vorsitzende Dr. Raimund Paleczek und der Geschäftsführende
Vorsitzende Dr. Günter Reichert ihre Positionen abgegeben hatten, wählte die Mitgliederversammlung auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, den Würzburger Historiker Prof. Dr. Matthias Stickler, zum neuen Vorsitzenden.
Neuer stellvertretender Vorsitzender ist der Stuttgarter Politologe Carsten Eichenberger. Die beiden Vorstandsmitglieder sind mit der Arbeit der Akademie seit langem verbunden –Prof. Stickler neben seiner Tätigkeit im Vorstand als Referent und Carsten Eichenberger als ehemaliger Studienleiter des Heiligenhofs. Neuer Geschäftsführender Vorsitzender ist Hans Knapek. Schatzmeisterin bleibt Utta Ott. Der scheidende Vorstand und der Studienleiter der Akademie, Gustav Binder, berichteten von der erfreulichen Wiederaufnahme der Bildungsarbeit nach der Corona-Krise. Die vielfältigen Kontakte zu Universitäten und Einrichtungen der Zivilgesellschaft in den Ländern Ost- und Mitteleuropas erwiesen sich als tragfähig und ermöglichen weiterhin die Bildungs- und Begegnungsarbeit mit Studenten und weiteren Interessierten aus die-
■ Bis Sonntag, 27. Oktober, Sudetendeutsches Museum: „Oskar Schindler – Lebemann und Lebensretter“. Sonderausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie. Eintritt frei. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 22. Juni, 16.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Holunderblüten – Die Prager Autorinnen Ossip Schubin, Marie Holzer und Hermine Hanel“. Eintritt frei. Anmeldung per eMail an reservierung@mendelssohnremise.de Mendelssohn-Remise Berlin, Jägerstraße 51, Berlin.
■ Montag, 24. Juni, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und Egerländer Gmoi z‘Nürnberg: Vernissage „Verloren, vermisst, verewigt –Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Die Ausstellung wird bis zum 12. Juli gezeigt. Anmeldung per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Bankgasse 9, Nürnberg.
■ Montag, 24. Juni, 18.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung: „Böhmen liegt nicht am Meer“. Repräsentanz des Freistaats Bayern in der Tschechischen Republik, Michalská 12, Prag.
■ Montag, 24. Juni, 19.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Wenzel Jaksch (1896–1966) – Biographische Schlaglichter auf einen Sozialdemokraten aus Mitteleuropa“. Buchvorstellung mit Prof. Dr. Michael Schwartz. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Dienstag, 25. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: „Höhepunkte des deutschen Theaterlebens in Prag vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“. Ringveranstaltung mit Prof. Dr. Herbert Zeman und Dr. Herbert Schrittesser. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48. Sudetendeut-

Prof. Dr. Matthias Stickler überreicht Dr. Günter Reichert zum Abschied ein wissenschaftliches Werk über die Habsburger Monarchie.
sen Ländern. Auch ukrainische Teilnehmer kommen wieder zum Heiligenhof. Große Sorgen bereitet den Verantwortlichen allerdings die nahezu zum Erliegen gekommene Projektförderung durch die Bundesregierung. So hat die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Staatsministerin Claudia Roth, entgegen ihren Ankündigungen bisher auch für 2024 die Förderung nicht wieder aufgenommen. Auch aus dem Bundesministerium des Innern und für Heimat kommen mittlerweile alarmierende Zeichen. Die für den Rest des Kalenderjahres benötigten Projektmittel sind bisher noch nicht genehmigt. Der Weg-

Der neue Vorstand der Akademie Mitteleuropa (von links): Hans Knapek, Utta Ott, Carsten Eichenberger und Vorsitzender Prof. Dr. Matthias Stickler.
fall dieser Förderungen würde die Seminararbeit der Akademie existenziell bedrohen.
Der neue Vorsitzende Prof. Stickler dankte Raimund Paleczek und Günter Reichert für deren Tätigkeit und langjähriges Engagement. Insbesondere Reichert habe die erfolgreiche Entwicklung der Akademie entscheidend geprägt, nachdem er 2008 das Amt des Geschäftsführenden Vorsitzenden von seinem Vorgänger, Staatssekretär Wolfgang Egerter, übernommen hatte. Mit der Wahl von Knapek zum neuen Geschäftsführenden Vorsitzenden soll auch die Verbindung zur Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk verstärkt werden, deren
VERANSTALTUNGSKALENDER
sches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 29. Juni, 14.00 Uhr, Heimatkreis Freudenthal/ Altvater: 3. Erinnerungscafé. Stadtmuseum, Zangmeisterstraße 8, Memmingen.
■ Samstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, BdV-Landesverband
Hessen: Kulturtagung „Von Heimat(en) und Identität(en) –(Spät-) Aussiedler aus den postsowjetischen Staaten, aus Polen und aus Rumänien“. Eintritt 8 Euro. Theater im Pariser Hof. Spiegelgasse 9, Wiesbaden.
■ Dienstag, 2. Juli, 16.00 bis 18.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Lebendige Erinnerung“. Schreibcafé mit Journalistin und Autorin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Anmeldung per eMail an info@sudetendeutsches-museum. de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37, Sudetendeutsches Museum, Treffpunkt Museumskasse, Hochstraße 10, München. ■ Donnerstag, 4. Juli, 10.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Hilfe für Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus“. Fortbildung für Lehrer, Studenten und Museumsmitarbeiter. Anmeldung über die Bayerische Museumsakademie. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. ■ Freitag, 5. Juli, 15.30 Uhr, Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau, Eröffnung der Ausstellung: „(Nicht) gekommen, um zu bleiben“ – Vertreibung, Patenschaft, Partnerschaft. Die Ausstellung wird bis zum 31. Juli gezeigt. Eintritt frei. Foyer, Rathaus Würzburg.
■ Samstag, 6. Juli, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.
■ Samstag, 6. Juli, 15.00 Uhr: Graslitzer Stammtisch Geretsried. Gasthof Geiger, Tattenkofener Straße 1, Geretsried.
■ Sonntag, 7. Juli, 10.00 Uhr, Heimatkreis Kaaden-Duppau: Marien-Wallfahrt mit zweisprachigem Festgottesdienst. Kapel-
lenberg, Winteritz (Vintířov).
■ Samstag, 13. Juli, 13.00 Uhr, Heimatkreis Komotau und Förderverein Mittleres Erzgebirge – Komotauer Land: Gedenkstunde an der „Gedenkstätte 9. Juni 1945“. Deutschneudorf.
■ Sonntag, 14. Juli, 9.30 bis 23.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: EM-Fußballfinale im Museum. 9.30 bis 14.00 Uhr: Böhmischer Frühschoppen.15.00 bis 18.00 Uhr: Tischkicker-Turnier.18.50 bis 19.00 Uhr: Dokumentarfilm „DFC Prag – die Legende kehrt zurück“ im Adalbert-Stifter-Saal. 19.00 bis 20.00 Uhr: Finale des Kickerturniers. 20.00 bis 23.00 Uhr: Public Viewing des EM-Finales im AdalbertStifter-Saal. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 17. Juli, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.
■ Samstag, 20. Juli, 10.00 bis 14.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Mutig und menschlich: Ein Workshop zur Förderung von Zivilcourage“. Anmeldung per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37 oder per eMail an anmeldung@sudetendeutschesmuseum.de
■ Samstag, 27. Juli, 10.00 Uhr, Bund der Deutschen in Böhmen: Heimatmesse anläßlich des Sankt-Anna-Festes mit den vertriebenen Deutschen und dortigen Tschechen. Laurentiuskirche in Luck bei Luditz.
■ Samstag, 3. August, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.
■ Sonntag, 4. August, 19.00 Uhr, Musikakademie der Studienstiftung des Deutschen Volkes: „Gustav Mahler: Das klagende Lied“. Konzert in der Isarphilharmonie. Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, München.
■ Mittwoch, 14. August, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.



Vorstandsvorsitzender der Diplom-Kaufmann ist. Die Akademie Mitteleuropa wurde 2002 von den Verantwortlichen des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe ist es, das Bildungs- und Begegnungsprogramm des Heiligenhofs auf die Länder Mittel- und Osteuropas auszuweiten. Die Akademie hat sich in dieser Zeit hohe Anerkennung verschafft. Ihre Arbeit wird begleitet durch ein mit hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft besetztes Kuratorium. Diesem steht der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Peter Michael Huber, vor.
■ Sonntag, 18. August, 11.00 Uhr, Förderverein Wallfahrtskirche Maria Kulm: 25. Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche, Maria Kulm.
■ Donnerstag, 29. bis Freitag, 30. August, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Demokratie erwandern – ein Spaziergang durch die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Teilnehmerbeitrag: 140 Euro pro Person (inklusive Übernachtung und Essen). Anmeldung per eMail an kultur@hausschlesien.de oder per Telefon unter (0 22 44) 88 62 31. Haus Schlesien, Dollendorfer Landstraße 412, Königswinter.
■ Sonntag, 1. September, 10.30 Uhr, Monsignore Herbert Hautmann, Vertriebenenseelsorger der Erzdiözese Bamberg: Vertriebenenwallfahrt. Hauptzelebrant ist Regionaldekan Holger Kruschina aus Nittenau, der 1. Vorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerkes. Wallfahrtsbasilika Heilige Dreifaltigkeit, Gößweinstein.
■ Samstag, 7. September, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.
■ Freitag, 13. bis Sonntag, 15. September, Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband: Sudetendeutscher Kongreß. Kloster Haindorf, č.p. 1, Hejnice, Tschechien.
■ Montag, 16. September, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Brücken die verbinden“. Teil 3 der Vortragsreihe mit Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 10, München.
■ Mittwoch, 19. September, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.
■ Samstag, 19. bis Montag, 30. September: Sandauer Heimattreffen in Arzberg und Sandau. Auszug aus dem Programm: Samstag, 16.00 Uhr: Treffen in der Sandauer Heimatstube. Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst und Patronatsfest in der Pfarrkirche St. Michael. Montag, 10.00 Uhr: Feierliches Hochamt.
■ Bis Mittwoch, 31. Juli: Ausstellung „Vertreibung 1939“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Öffnungszeiten: werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr. Die Ausstellung „Vertriebene 1939“ veranschaulicht anhand von 400 Fotografien, Plakaten und Dokumenten die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen Zivilbevölkerung, die während des Zweiten Weltkriegs aus den Teilen Polens deportiert wurde, die an das „Dritte Reich“ angegliedert wurden. Die gewaltsamen Zwangsaussiedlungen, Inhaftierungen und Ermordungen von insgesamt 1,5 Millionen polnischer und jüdischer Bürger waren zugleich Teil der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik, die in der Errichtung von KZs und im Holocaust mündete.
An ihrer Stelle wurden „Volksdeutsche“ aus Ost- und Südosteuropa angesiedelt, denn das Ziel der Besatzer war die völlige Germanisierung der Territorien. So sollte in einem Distrikt namens „Warthegau“ eine „blonde Provinz“ als „ein Laboratorium zur Züchtung des germanischen Herrenmenschen“ entstehen.

■ Donnerstag, 18. Juli bis Freitag, 2. August: Kultursommercamp24 – Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. Veranstaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre aus Deutschland und Tschechien. Über 100 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und ihr Wissen. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden. Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯
■ Donnerstag, 4. Juli, 10.00 bis 16.30 Uhr: „Hilfe für Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus. Das Beispiel Oskar Schindler“. Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte weiterführender Schularten, Mitarbeiter von Museen und zeitgeschichtlichen Einrichtungen sowie Studenten. Die Gedenkstätte Yad Vashem nennt sie „Gerechte unter den Völkern“ – Menschen, die während des Nationalsozialismus Juden halfen. In einem Fachvortrag erläutert die Historikerin Prof. Dr. Susanna
Schrafstetter zunächst die dafür notwendigen Bedingungen und Faktoren. Anschließend präsentiert Dr. Raimund Paleczek, Forschungsleiter des Sudetendeutschen Museums, in der Sonderausstellung den Lebensweg Oskar Schindlers als ein herausragendes Beispiel. Am Nachmittag diskutieren die Teilnehmer in Workshops die Vermittlung des Themas in Schule und am außerschulischen Lernort. Anmeldung über die Bayerische Museumsakademie (www.bayerischemuseumsakademie.de).

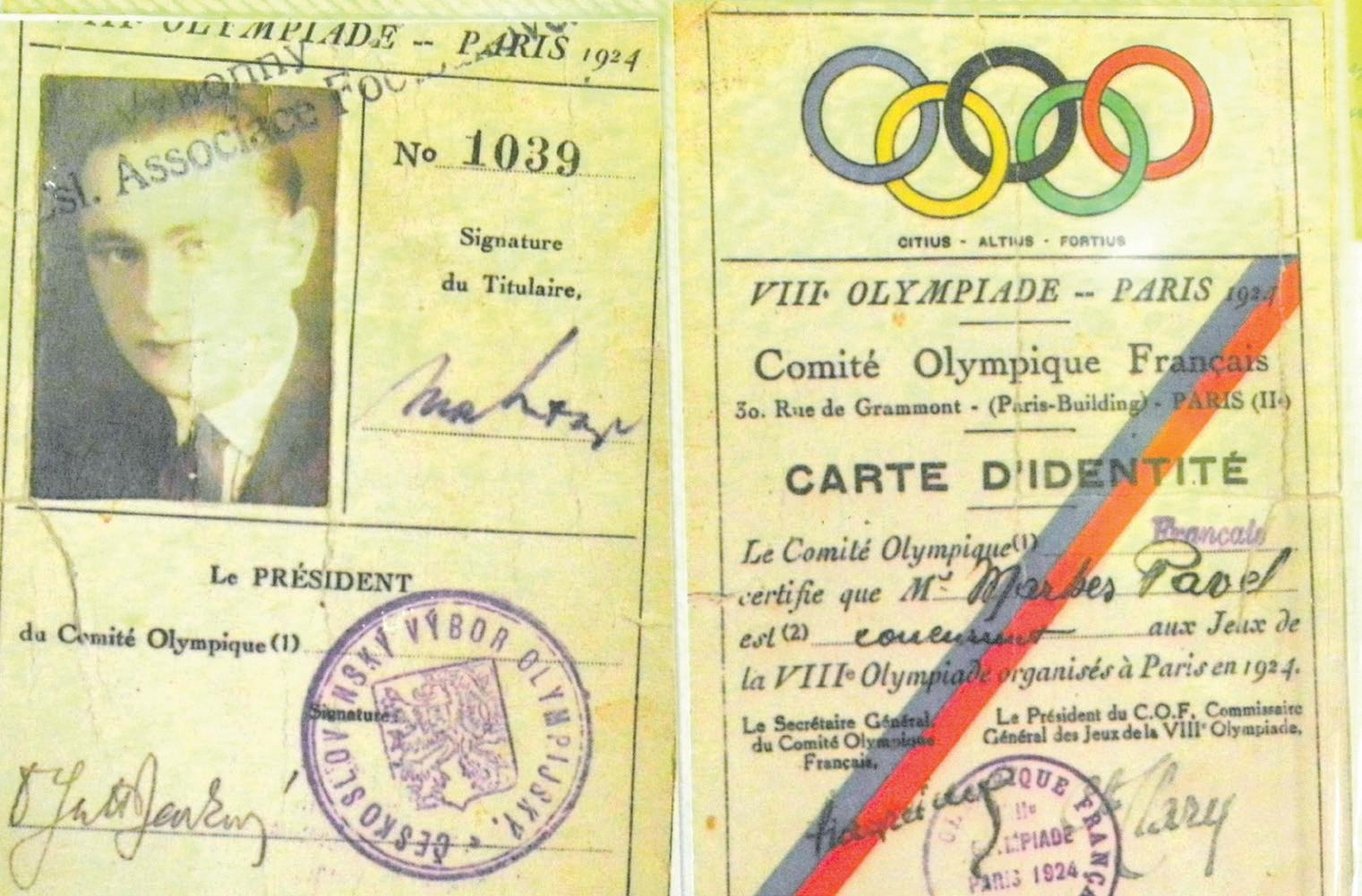
Paul Mahrer gehörte zur tschechoslowakischen Nationalmannschaft, die bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris erst im Achtel nale gegen die Schweiz scheiterte. Ein historisches Dokument: Die Akkreditierung von Paul Mahrer für die Olympischen Spiele vor hundert Jahren in Paris mit der Nummer 1039.
❯ Nachfahren auf den Spuren des jüdischen Sportlers in Prag, Teplitz-Schönau und Berlin
Es war nicht der erste Besuch in Prag, Theresienstadt und Berlin für die Enkel und Urenkel des berühmten Fußballers der ersten tschechoslowakischen Republik Paul Mahrer. Aber zur Europameisterschaft in Deutschland, zu der sich auch Tschechien qualifiziert hat, und vor den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer, gab es viele Gründe aus Los Angeles und New York nach Europa zu reisen.
In Prag empfingen Vertreter des nationalen Fußballverbands, darunter auch ein Funktionär des FK Teplice aus der Heimatstadt des 1900 in Teplitz-Schönau geborenen Paul Mahrer, die Nachkommen. Im Nationalmuseum in Prag überreichten sie das in der Familie erhalten gebliebene Trikot Mahrers in der tschechoslowakischen Olympiamannschaft von 1924 als Leihgabe.
Dann gab es am 3. Juni ein Spiel des Deutschen Fußball Clubs (DFC) Prag gegen die Europeada-Mannschaft der Deutschen Minderheit in Tschechien. In die Mannschaft DFC reihten sich vier Spieler der Nachfahren Paul Mahrers, der 1923 vom Teplitzer Fußball Klub 03 in diesen Club gewechselt hatte, ein: die Enkel Thomas und Alec, sowie die Urenkelin Dani und der Urenkel Zev. Thomas Oellermann, der auch mitspielte und den fußballerischen Kontakt zu den Amerikanern schon einige Jahre pflegt, jubelte: „Das erste Mal seit 90 Jahren führt ein Mahrer unseren DFC als Kapitän aufs Feld!“ Leider verlor der DFC das denkwürdige Spiel mit 2 zu 25. Vielleicht aber ein gutes Omen für die Mannschaft der deutschen Minderheit bei der Europeada. Dann besuchten die Mahrers Theresienstadt, wohin Paul als Jude 1943 ins Ghetto deportiert wurde, und das er mit viel Glück überlebte – im Gegensatz zu seinen Brüdern Kurt und Otto, die im KZ Auschwitz ermordet wurden – wohl auch weil er als Spielertrainer im Team der Fleischer, die den Pokalwettbewerb gewannen, tätig sein konnte. Ein Abstecher nach Aussig führte die Mahrers zur dortigen Ausstellung „Unsere Deutschen“ und erstmals nach Teplitz-Schönau zum Haus, in dem Paul Mahrer aufwuchs. In Berlin besuchten sie den Deutschen Bundestag, wo sie auf den begeisterten


von
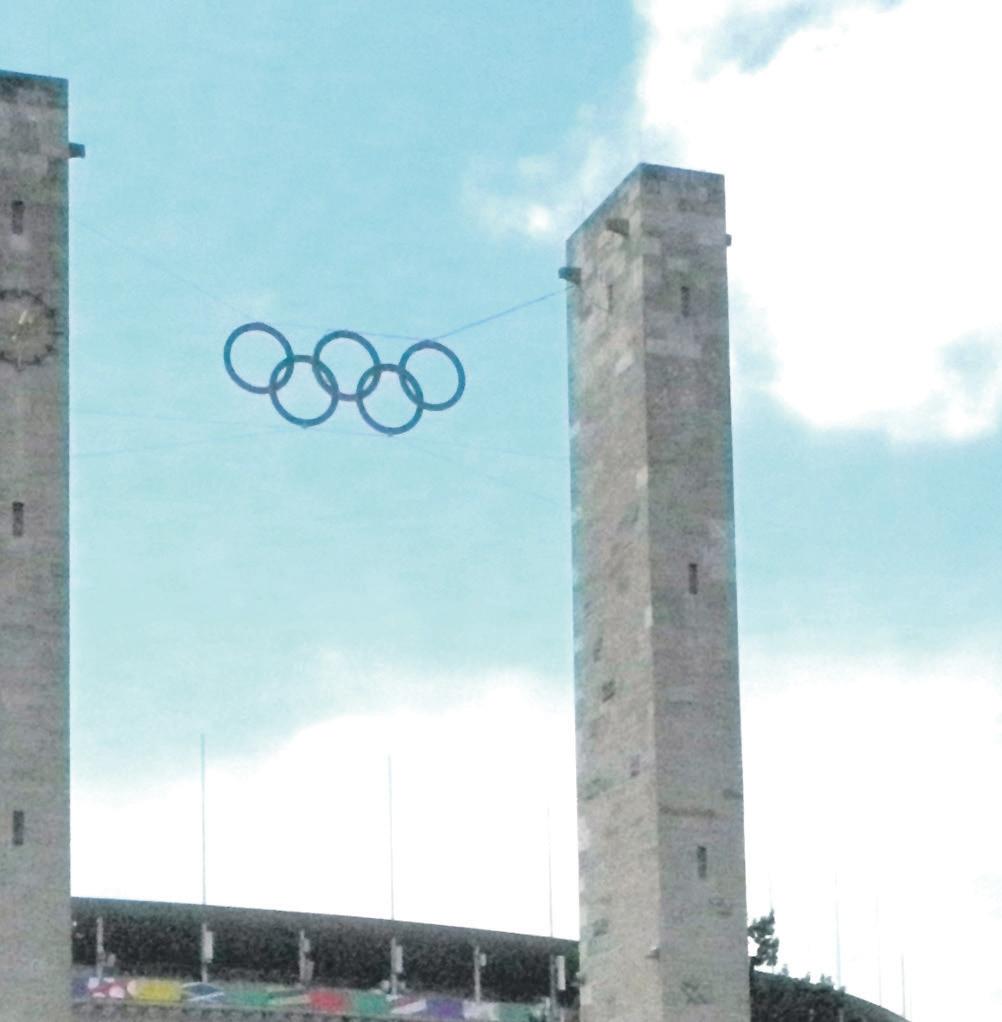
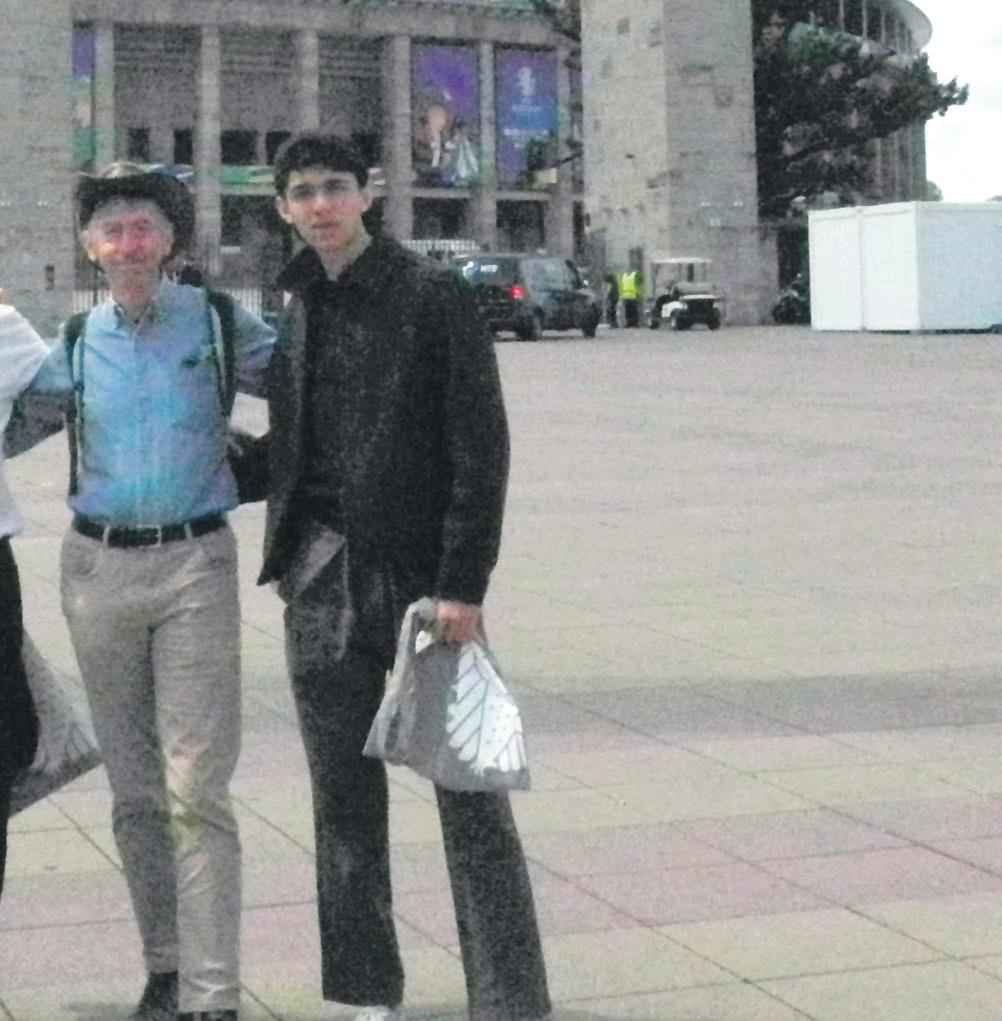
dem
Fußballer Jörg Nürnberger trafen, der auch einige Wurzeln in Prag geschlagen hat, und sie gingen zum Olympiapark, wo gerade die Ausstellung „Sport. Masse. Macht. – Fußball im Nationalsozialismus“ zu sehen ist und Hertha BSC auch seinen Vereinssitz hat. Dort wurden die Mahrers vom Interimspräsidenten Fabian Drescher und dem Geschäftsführer Thomas E. Herrich empfangen, weil auch Hertha eine Geschichte mit Paul Mahrer verbindet. 1933 spielte der DFC bei Hertha, wegen des Einflusses der Nationalsozialisten schon damals, durften die jüdischen Spieler, darunter Paul Mahrer, nicht antreten.
Das Gespräch mit der sportlichen Familie danach, wobei nur die Urenkelin Dani eine richtige Fußballerin geworden ist, kein Wunder bei der hohen Wertschätzung des Frauenfußballs in den Vereinigten Staaten, drehte sich viel
Olympiastadion.
kischen Mannschaft 1924 in Paris ein. Mahrer spielte in jener Zeit sechs Mal für die Auswahl seines Landes. Ein enger Freund wurde dabei wohl der Prager František Plánička (1904–1996), der Torwart der tschechoslowakischen Nationalmannschaft zwischen 1926 und 1938, den er ab 1966 immer wieder besuchte. Aber auch die Rückkehr in die USA, wo Paul Mahrer zwischen 1926 und 1932 bereits als Spieler gelebt hatte und wo sein zweiter Sohn Jerry geboren wurde, findet seinen Niederschlag mit Fotos von 1947, wo er in einer jüdischen Altherren-Mannschaft noch einmal mit Spielerfreunden auftritt.
Thomas Mahrer, der in Los Angeles
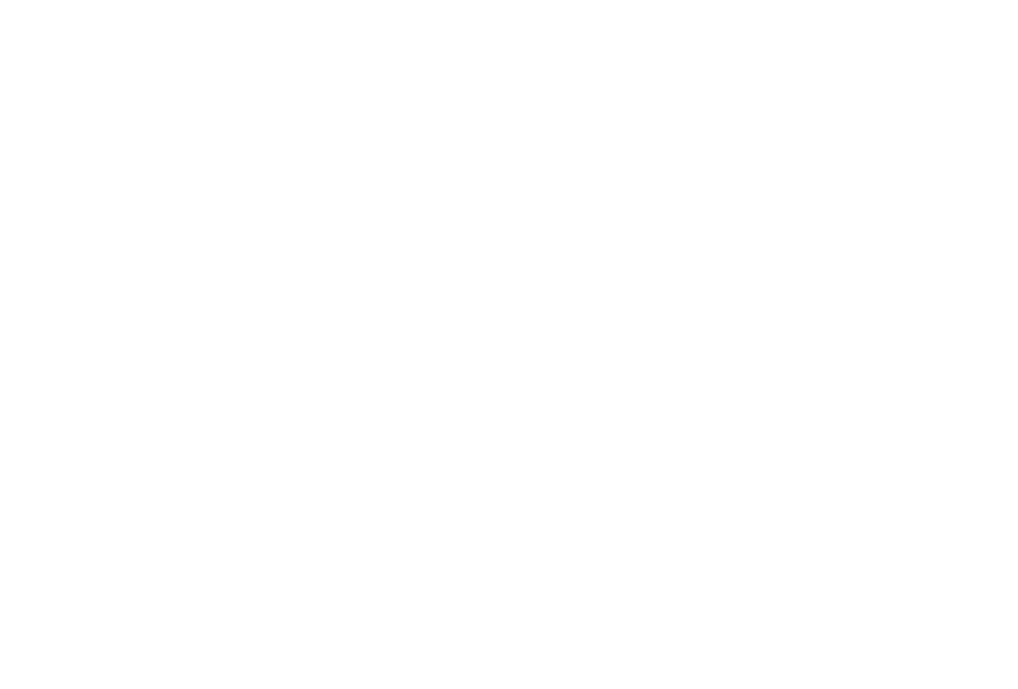
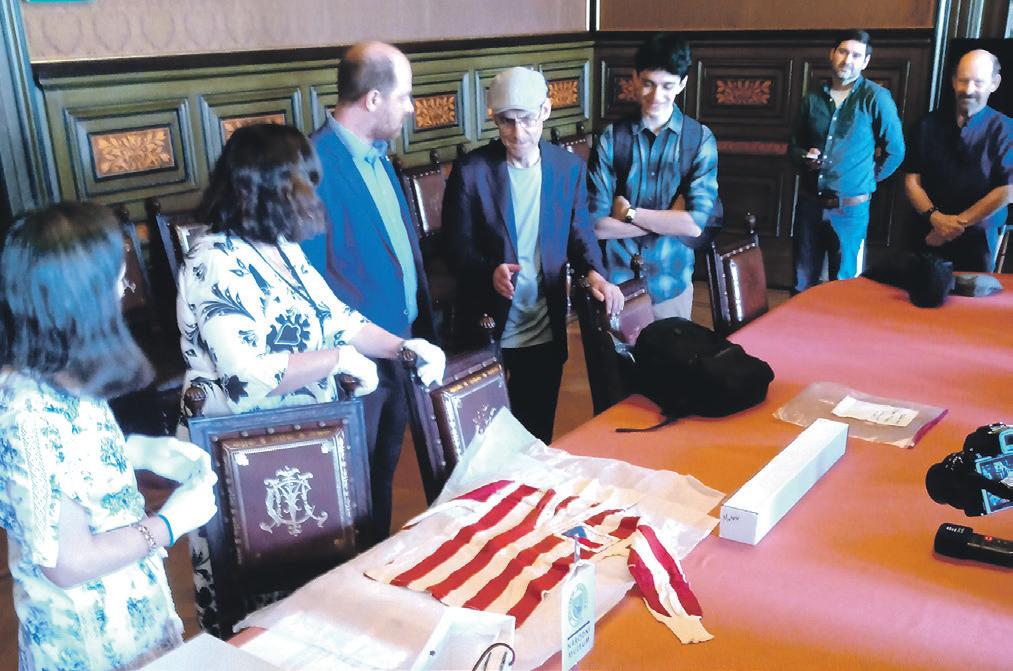
der
um die familiäre Präsenz von Paul Mahrer und die Reisen, die die Familie eigentlich seit 1966 immer wieder in die Tschechoslowakei, vor allem nach Prag und Theresienstadt, führte. Auch die böhmische Küche war in der Familie, vor allem in New York sehr präsent und geliebt und in Tschechien immer wieder gerne probiert.
Das von Alec aus New York mitgeführte Familienalbum seines Großvaters enthielt dann wahre Schätze. Die Teplitzer Anfänge im TFK 03 wurden sichtbar, und die große und erfolgreiche Südamerikareise 1922 mit Spielen in Rio de Janeiro und Buenos Aires wird darin vielfach dokumentiert mit touristisch anmutenden Fotos, aber auch mit Original-Zeitungsausschnitten der argentinischen Presse.
Einen besonderen Raum nimmt die Olympiateilnahme der tschechoslowa-
lebt und der Vater der Fußballverrückten Dani ist, erzählt dann noch von der Stärke seiner Großmutter Betty, geborene Guttmann, die es geschafft hat, sich und ihre beiden Söhne, auch wegen der amerikanischen Staatsbürgerschaft ihres zweiten Sohnes, in Nazideutschland überleben zu lassen. Sie waren in verschiedenen Lagern interniert und kamen durch einen durch das IRK organisierten Gefangenenaustausch im Februar 1944 über die Schweiz in die USA. Und er erzählt von den ersten Besuchen in Israel Ende der 1960er Jahre, wo Paul Mahrer offiziell empfangen wurde und mit vielen jüdischen Fußballern aus der Tschechoslowakei zusammentraf. Am Ende, kurz vor ihrem Rückflug in die USA, blieb als Resümee: Wohin hat es die Anfang des 20. Jahrhunderts geborenen Teplitzer, Deutsche und Juden, aber ja auch einige Tschechen verschlagen? Ganz schön weit in die Welt, wenn sie die schrecklichen Zeitläufte überleben konnten. Ulrich Miksch
❯ Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, MdL Dr. Petra Loibl, besuchte das Sudetendeutsche Museum
„Hier gibt es immer wieder Neues zu entdecken“
Der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian (links), und der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Hans Knapek (rechts), zeigten der Beauftragten MdL Dr. Petra Loibl das Sudetendeutsche Museum.
Foto: Aussiedler- und Vertriebenenbeauftragte Bayern




Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, MdL Dr. Petra Loibl, hat am vergangenen Montag das Sudetendeutsche Museum in München besucht.
Die CSU-Politikerin wurde dabei von Dr. Ortfried Kotzian (Sudetendeutsche Stiftung) und Hans Knapek (Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk) durch die Dauerausstellung geführt.
Dr. Petra Loibl: „Es ist für mich keine Überraschung, daß das Sudetendeut-
sche Museum das beliebteste Museum in ganz München ist. Es ist eine wahre Schatzgrube. Man kann hier durch die Jahrhunderte reisen, sich sehr gut in die jeweilige Zeit einfügen, und lernt auch viel über die große kulturelle wie sprachliche Vielfalt der verschiedenen Regionen des Sudetenlandes.“
Die Beauftragte sagte zudem, sie werde das Museum weiterempfehlen und habe fest vor, sobald als möglich wiederzukommen, „denn hier gibt es, gleich wie oft man zu Besuch kommt, immer wieder Neues zu entdecken“.
Vor zwei Wochen besuchte ich das Dorf Zürau, das in der böhmischen Hopfenregion um Saaz liegt. Ein Dorf, in dem ich vor einigen Jahren schon einmal war. Bei meinem ersten Besuch war mir der völlig ruinöse Zustand der Dorfkirche aufgefallen. Jetzt nahm ich wahr, daß man eifrig dabei ist, das kleine sakrale Juwel wieder herzurichten. Außen erstrahlt es bereits in neuem Glanz. Innen ist noch einiges zu tun. Ob die Kirche allerdings wieder zu einem lebendigen Zentrum des Dorfes werden wird? Zu hoffen wäre es. Die religiöse Situation in Nordwestböhmen läßt allerdings zweifeln. Immerhin ist die Sanierung der Kirche eine Erinnerung an das früher blühende Glaubensleben in der Region. Nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Zürau wurden Wolhynien-Tschechen im Dorf angesiedelt, die sich wie andernorts mit der Geschichte und Tradition ihrer neuen Umgebung kaum identifizieren konnten. Außerdem ist das Dorf, was die Bevölkerungszahl betrifft, deutlich geschrumpft. Während 1930 noch 380 Bewohner hier lebten, waren es 2021 nur mehr 68, so verrät die Internetenzyklopädie Wikipädia. Man merkt dem Ort eine gewisse Leere an. Auf der anderen Seite ist da aber auch noch immer ein Rest von Idylle. Malerisch inmitten von Hopfenfeldern gelegen, ist es ein Ruhe- und Kraftort. So habe ich Zürau nun schon zweimal erlebt, und so wird es mir im Gedächtnis bleiben. Als Ruhe- und Kraftort empfand das kleine böhmische Dorf auch einer der ganz Großen der deutschen Literaturgeschichte, Franz Kafka, dessen 100. Todestag dieses Jahr begangen wurde. Er war der Anlaß, warum ich im Rahmen eines Ausflugs mit Freunden abermals Zürau besuchen wollte. Der Schriftsteller hatte im August 1917 einen Blutsturz erlitten, nach dem seine Tuberkuloseerkrankung diagnostiziert wurde, an der er schließlich auch sterben sollte. Zur Erholung zog er sich bis Ende April 1918 nach Zürau zurück, wo seine Schwester Ottla einen Bauernhof bewirtschaftete. Im Rückblick empfand Kafka seinen Aufenthalt in der Provinz als einen der besten Abschnitte seines Lebens.

An literarischen Zeugnissen sind aus dieser Zeit die sogenannten „Zürauer Aphorismen“ erhalten, die später Max Brod – wie fast alles andere von Kafka – herausgab. Es handelt sich um kurze versonnene und manchmal auch versponnene Gedanken, die Einblick in das Geistes- und Gefühlsleben des Schriftstellers geben. Der letzte der insgesamt 109 Aphorismen beginnt folgendermaßen: „Daß es uns an Glauben fehle, kann man nicht sagen. Allein die einfache Tatsache unseres Lebens ist an Glaubenswert gar nicht auszuschöpfen.“ Der Aphorismus geht danach noch ein wenig weiter. Aber diese zwei Sätze reichen schon zum Nach- und Weiterdenken.
Die Worte des todeskranken Franz Kafka ebenso wie das heutige Dörfchen Zürau in seiner ganzen Ambivalenz zwischen Leere und Kraft stellen mir Fragen: „Worin besteht der Sinn deines Lebens?“, „Schätzt du dein Leben?“, „Ist dir das Leben, wie es ist, nämlich in seiner Ambivalenz, in seiner Leere ebenso wie in seiner Fülle ein Impuls zu sagen: ,Ja, ich glaube‘?“. Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung Gras itzer Heimatzeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München
E-Mail svg@sudeten.de 25/2024
Am 24. Juni feiert Hannelore Heller/Neudert, eine bekennende Egerländerin und versierte Bankerin, im mittelfränkischen Roth ihren 70. Geburtstag.
Z
� Ein Kind der SL-Basis mit Wurzeln im Egerland
ur Welt kam Hannelore Heller 1954 in Osterdorf bei Pappenheim im Kreis Weißenburg in Oberfranken als drittes Kind des Metzgermeisters Josef Neudert und der Damenschneiderin Elisabeth Neudert/Kraus. Der Vater stammte aus Langgrün bei Buchau im ehemaligen Kreis Luditz, die Mutter aus Engelhaus im ehemaligen Kreis Karlsbad. Bruder Alois kam 1945 noch in Engelhaus zur Welt, Bruder Reinhold 1948 in Pappenheim und Schwester Brigitte 1960 in Weißenburg.
Ihre ersten elf Lebensjahre verbrachte sie in KimratshofenOberhofen in Bayerisch-Schwaben bei Anton und Anna Kraus, den Eltern ihrer Mutter. 1965 zog sie nach Weißenburg, wo sie 1970 Mittlere Reife und bei der Stadtsparkasse eine Banklehre machte. Bereits vor dem Ende ihrer Lehrzeit war das Finanzgenie in die Kreditabteilung gekommen und blieb Zeit ihres Berufslebens dem Kreditwesen treu. 1972 wurde sie Kreditsachbearbeiterin, später Stellvertretende Referatsleiterin der Kreditabteilung. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre machte sie an der Bayerischen Verwaltungsschule in München den Sparkassenbetriebswirt, sie machte die Ausbil-
Am 11. Juni starb Rudolf Hüttl, langjähriger Obmann der SLKreisgruppe Bamberg, mit 87 Jahren in Bamberg.
Am 1. Januar 1937 kam Rudolf Hüttner in Mies zur Welt. Der Vater betrieb eine Drogerie. Anfang Juli 1945 holten Amerikaner aus Schweinfurt das beim Geschäft gelagerte Fotopapier ab. Man hätte mitfahren können, aber man wartete. Und so kam Rudolf Hüttner mit seiner Familie in das Lager Vlašim bei Prag. Hunger begleitete die Familie, und der Junge mußte Massengräber schaufeln. Dann ging es auf einen tschechischen Bauernhof, wo Rudolf als Knecht arbeiten mußte. Der Vater war schwer krank und konnte nur liegend transportiert werden. Schließlich folgte die Vertreibung.
Am 6. März starb Hans-Karl Fischer, Mitglied des Vorstands der Heimatgruppe Kuhländchen-München mit 66 Jahren in München.
Hans-Karl Fischer kam am 31. August 1957 in Passau zur Welt und wuchs im nahen Seestetten auf. In München studierte er Philosophie sowie Literaturgeschichte. Anschließend war er bis 1981 Herausgeber der Passauer Anthologie „Handzeichen“. Zu seiner lesenswerten Erzählung „Der Friedhof von Gstöding“ stellte die „Passauer Neue Presse“ die sprachliche und inhaltliche Komplexität des jungen Autors heraus. Die „Oberpfälzer Nachrichten“ bestätigten ihm eine Begabung für Satire, die er amüsant und volksschwankähnlich mit Esprit komponiere. Über den Gewinn des Werkstattpreises in Lyrik 2001 schreibt der „Münchner Merkur“, daß Fischer mit markigen Versen, die wach machten, und konkreten Sprachbildern und Rhythmik die Zuhörer, die ihn gewählt hätten, beeindruckt habe. Bald erschienen weitere Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, und so wurde er 2003 leitender Redakteur des Buches „schöne böse kindheit“ des Münchner Literaturbüros. Jahrelang berichtete er über die Abende des Lyrik-Preises München und arbeitete bis
dereignungsprüfung und beendete ein Abendstudium als Betriebswirtin.
1980 bis 1983 wurde sie Personalratsvorsitzende der Hauptniederlassung Roth. 1981 trat sie in die SL-Ortsgruppe Roth ein und übernahm recht bald Ehrenämter wie Schriftführerin und Vermögensverwalterin. 1983 wurde sie Gruppenleiterin der Abteilung Kredit und Stellvertretende Leiterin der Abteilung Kredit der Vereinigten Sparkassen Roth-Schwabach, 1987 Leiterin der Abteilung Firmenkunden der Hauptniederlassung Roth mit Hilpoltstein, Roth und Spalt. In den 1980er Jahren hatte die Sparkasse einen gemischten Chor, Heller war die Altstimme. Und in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre gab sie AzubiUnterricht für das Personalkreditgeschäft.
1996 bis 2000 war sie Gruppenleiterin Kreditrevision und Stellvertretende Leiterin Revision der Sparkasse Roth-Schwabach, bis 2012 wieder Kreditsachbearbeiterin, nun durch Fusion bei der Sparkasse Mittelfranken-Süd.
Hannelore Heller: „Die Sparkasse war meine Zweitfamilie.“ Und die SL, bei der auch die Stieftöchter mitmachen, ist ihre Erstfamilie. Heller: Ich bin ein Kind der SL-Basis.“

1989 heiratete sie Dieter Heller, der in Sandau im nordböhmischen Kreis Böhmisch Leipa zur Welt gekommen war und dort noch die erste Volksschulklasse besucht hatte. Mit der Heirat bekam sie die Stieftöchter Elke Thumm und Erika Grasser, mittlerewile hat sie vier Stiefenkel und einen Stiefurenkel.
� Verdienstvoller Egerländer
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft erkannte schnell den Wert der unaufgeregten, analytischen und zurückhaltenden, aber dennoch durchsetzungsstarken Landsmännin. Aufzuzählen, was sie nicht war und ist, wäre leichter, als ihre Ämter aufzulisten. Sie war Mitglied des Vorstandes der Bezirksgruppe Mittelfranken, des Präsidiums, des Ältestenrates und Vizepräsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung sowie Mitglied des Stiftungsrates der Sudetendeutschen Stiftung. Sie ist Finanzverwalterin und Stellvertretende Obfrau der SLLandesgruppe Bayern, Mitglied der Bundesversammlung und Mitglied von 19 landsmannschaftlichen, kulturellen, politi-
Rudolf Hüttner †
Über ein Lager landete die Familie in Wonfurt bei Haßfurt in Unterfranken, zuerst mißtrauisch beobachtet, dann allmählich angenommen. Man hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten und der Produktion von Schuhweiß und Exobrausepulver über Wasser. 1951 kam die Familie nach Bamberg. Der Abschied von Wonfurt war tränenreich. 1957 konnte der Vater in Bamberg-Gartenstadt eine Drogerie eröffnen. Rudolf besuchte das Gymnasium in Bamberg bis zur 4. Klasse und trat 1954 eine Drogistenlehre an. Der Abschluß erfolgte in Schweinfurt. Er arbeitete bei seinem Vater, übernahm 1974 die Firma und betrieb sie bis 2000. In Bamberg hatte sich Rudolf Hüttners Vater intensiv für die Landsmannschaft eingesetzt. Rudolf trat 1986 in die SL ein. Er übernahm 1988 das Amt des Obmanns der SL-Ortsgruppe Bamberg-Gartenstadt und wurde 2004 Obmann der SL-Kreisgruppe Bamberg. Etwas später wurde er auch Stellvertretender Obmann
� Kuhländchen

zu seinem Tod bei den „Literaturseiten München“ mit. Dort veröffentlichte er als Redakteur der „Lyrischen Kostproben“ Aphorismen, Gedichte, Kurzgeschichten, Feuilletons, Dialektgedichte und Essays. Er veranstaltete Abende und Führungen in der Glyptothek, wo er den Teilnehmern die griechische Mythologie näherbrachte. Und er fertigte künstlerische Scherenschnitt-Portraits und -Masken an.
Eine besondere Ehrung erhält Hans-Karl Fischer posthum. Im heurigen Kafkajahr wird sein Gedicht „In den Kittel eines / Käfers getunkt“ aus seinem Gedichtband „Diebstahl“ (2002) in der Kulturzeitschrift „Literatur in Bayern“ unter der Rubrik „Bayerische Kleinode“ abgedruckt. In ihrer Besprechung weist Pia-Elisabeth Leuschner darauf hin, daß Fischer in seinem Gedicht souverän Anspielungen auf gleich drei Werke Kafkas verwebe und diese überbiete, es handele sich um „Die Verwandlung“, „Eine kaiserliche Botschaft“ sowie „Das
schen, Natur- und Sportvereinen. Und natürlich war und ist sie maßgeblich an den von ihrem Mann Dieter initiierten Projekten und Veranstaltungen beteiligt. Dazu gehören die Publikationen „Erinnerung an Flucht und Vertreibung vor 60 Jahren“ der heimatkundlichen Schriftenreihe des Landkreises Roth und „Arbeitshilfen für den Amtswalter“ der SL Bayern, die deutsche Ausgabe des tschechischen Buches „Verschwundene Orte des Duppauer Gebirges von A bis Z“ der Historikerin Zdena Binterová, das Buch „Das Flüchtlingslager Vogelherd/Schwabach, Station auf dem Weg der Vertreibung“ und die Liste der Mahn- und Gedenkstätten der Heimatvertriebenen in Bayern. Ihre Auszeichnungen reichen vom kleinen Ehrenzeichen bis zur Rudolf-Lodgman-Plakette der SL, von der Bayerischen Ehrenamtskarte in Gold bis zum Bundesverdienstkreuz am Bande. Steffen Hörtler, Stellvertretender SL-Bundesvorsitzender und Obmann der SL-Landesgruppe Bayern: „Hannelore Heller ist der liebenswürdigste und freundlichste Mensch, den ich kenne. Ihre unglaubliche Kompetenz und ihr brillianter Sachverstand sind ein Glücksfall für die SL-Landesgruppe Bayern.“ Die Landsleute danken und gratulieren Hannelore Heller aus übervollem Herzen und wünschen ihr das Beste und Gottes reichen Segen. Nadira Hurnaus
der SL-Bezirksgruppe Oberfranken. Im Heimatkreis unterstützte er die Wallfahrt zur Muttergottes von Mies, die seine Schwester Maria Hüttner mitbelebt hatte. Für seinen Einsatz zeichnete ihn die SL-Landesgruppe Bayern mit ihrer Verdienstmedaille in Bronze aus. Möge er in Frieden ruhen. Margaretha Michel
Montag, 1. Juli, 14.00 Uhr Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Bamberg in der großen Aussegnungshalle. Statt Kränze und Blumen bitte eine Spende für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt Bamberg, Spendenkonto: Hospizverein Bamberg e. V., IBAN: DE13 7705 0000 0000 0851 00, Verwendungszweck: Spende für Kinderhospiz Rudolf Hüttner.

Schloß“. Nicht nur damit ist Fischer Teil der Münchener Literaturlandschaft. Der Nachlaß seines gleichnamigen Vaters führte ihn zur Ahnenforschung nach Neutitschein ins Kuhländchen. Sein Vater war ein Neffe des Schriftstellers und Arztes Hans Carossa (1878–1956). Dessen erste Frau Valerie Endlicher stammte aus Neutitschein. Sie arbeitete in einem Passauer Bekleidungshaus. Hans Carossa lernte sie dort kennen und heiratete sie 1907. Die Familie von Valerie Endlicher war weitverzweigt, zu ihr zählten viele bekannte Persönlichkeiten und Künstler wie der Beskiden-Maler Hugo Baar, der in München starb, und Friedrich Kubiena, der Sammler der Kuhländler Tänze, die nun zum Immateriellen Kulturerbe in Bayern gehören. Fischer kontaktierte interessiert die Archive im Kuhländchen, was ihn zu einem Kenner Neutitscheiner Persönlichkeiten machte. Darüber referierte er auch vor der Heimatgruppe Kuhländchen-München. Eben-
so referierte er im Münchner Literaturbüro über „Kubiena, Goethe, Carossa“. Mehrmals berichtete er in der Sudetendeutschen Zeitung über Berühmtheiten um Valerie Carossa. Für 2024 hatte er Vorträge über Joseph Ullrich, den Heimatforscher des Kuhländchens, angekündigt. Er machte sich mit seinen Recherchen über bekannte Personen Neutitscheins besonders verdient und entriß sie literarisch der Vergessenheit. Mit seinem kulturhistorischen Engagement und seinem Einsatz für Verständigung und Aussöhnung erhielt er künftigen Generationen das Andenken an die verlorene Heimat. Der Landschaftsrat Kuhländchen und alle Mitglieder der Kuhländler Heimatgruppe-München danken ihm für seine großen Verdienste über den Tod hinaus von Herzen. Hans-Karl Fischer hinterläßt eine schmerzliche Lücke in unserem Münchener Kuhländler Freundeskreis. Wie sehr hätten wir ihn noch gebraucht! Doch er behält mit seiner freundlichen, bescheidenen, hilfsbereiten Art, und mit seinem heiteren Wesen einen festen Platz in unserer geistigen Mitte. Nach all den vielen Mühen und Arbeiten im Leben für andere wünschen wir ihm nun seine Ruhe in Frieden. Ulf Broßmann
In diesem Jahr jährt sich die Böhmerwäldler Trachtennähwoche zum 30. Mal. Traditionell fand sie wieder nach Pfingsten und dem Sudetendeutschen Tag statt. Dazu fanden sich 24 Näherinnen, drei Referentinnen und fünf Gäste ein im Haus der Böhmerwäldler in Lackenhäuser, einem Gemeindeteil von Neureichenau im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. Unter der bewährten Leitung von Erika Weinert und Ursula Kisslinger konnten die Arbeiten im Tagungsraum, der zum Nähsaal umfunktioniert wurde, beginnen.
Seit 1994 fand die Nähwoche in Folge zunächst auf der Hofstelle Seereit in Gangkofen, dann im Haus Sankt Johann in Brannenburg, das dem Sudetendeutschen Priesterwerk gehörte, und seither im Haus der Böhmerwäldler in Lackenhäuser statt. Schon im Jahr 1974 wurde bei einer Sitzung des Böhmerwaldbundes beschlossen, eine Böhmerwäldler Trachtenfibel zu erarbeiten. Der Schwerpunkt in der Frauenarbeitspflege der Böhmerwäldler war in den folgenden Jahren eine Erweiterung der Fibel unter Berücksichtigung der neuen Erkenntnisse und Ergebnisse der Näharbeiten und dem erweiterten Wissen über das Zubehör. Die Teilnehmerinnen der Kurse haben in den letzten Jahren neben der „Erneuerten Tracht“ die speziellen Trachten aus ihren Heimatgemeinden anhand von Fotografien und Trachtenteilen nachgearbeitet. So konnten unter anderen die Tracht der Budweiser Sprachinsel, die Tracht aus Rothenbaum bei Neuern im nördlichen Böhmerwald, die Krumauer Tracht, die Wallerer Arbeitstracht und Goldhaubenkleider zur Tracht aus Rosenberg nachgearbeitet





Die
❯ 30 Jahre Böhmerwäldler Trachtennähwoche














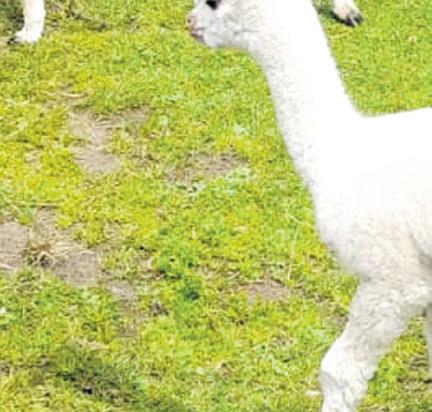
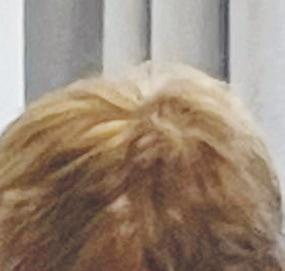



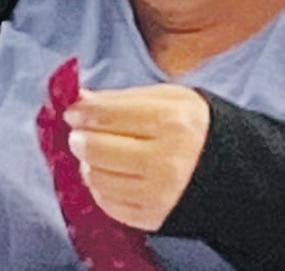






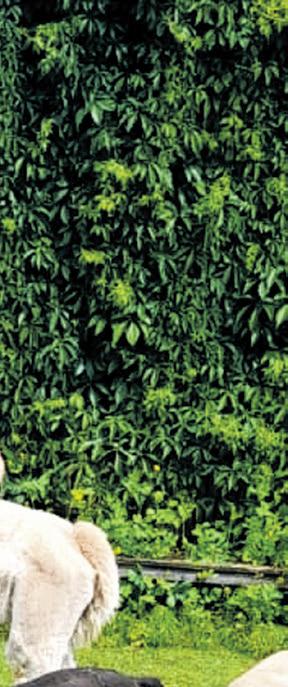
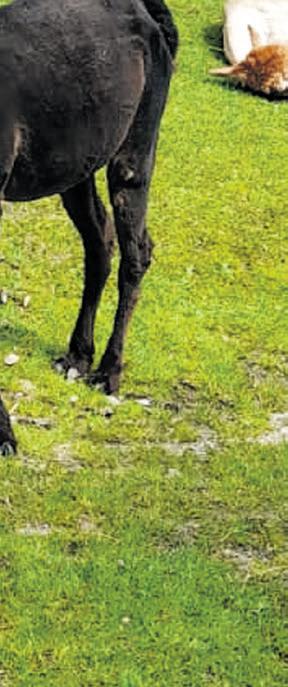












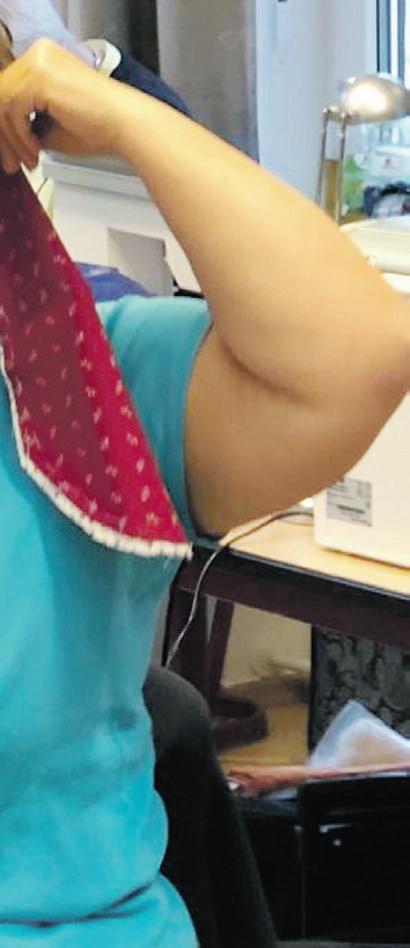

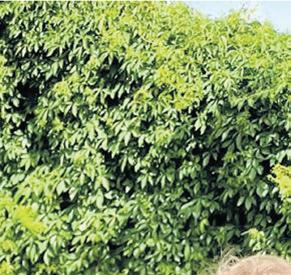








werden. Die Vielfalt der Trachtenlandschaft aus dem Böhmerwald wurde so im Laufe der Jahre wieder revitalisiert und wird aktiv bei Treffen, Auftritten oder beim Sudetendeutschen Tag getragen. Bei abendlichen Vorträgen über die „Trachtenentwicklung und Trachtenforschung im Böhmerwald“ erfuhren die Tagungsteilnehmerinnen interessante Informationen zum Thema Tracht. Bei einem Diskussionsabend sprachen die Teilnehmerinnen angeregt über ihre Erfahrungen und tauschten sich aus. Der Ausflug am Mittwoch führte uns dieses Jahr zum Alpakahof Schreiber in Schaufling im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Die Geschichte des Hofes reicht weit zurück. Bereits um 1510 gibt es erste urkundliche Erwähnungen im Zusammenhang mit der Sickinger Mühle. Das Wohnhaus mit seinen eindrucksvollen Gewölben ist in der Zeit des Spätbarock entstanden. Das Anwesen mit den seinerzeit meisten Ländereien in Sicking war damals Eigentum der Abtei Niederaltaich.
Begrüßt wurde die kleine Ausflugsgruppe mit einem Gläschen Beerenprosecco. Anschließend begann die Hofführung mit dem Besuch bei den Alpakas. Mit ihren großen Augen, dem weichen Fell und dem ruhigen, friedlichen Charakter eroberten die Tiere sofort alle Herzen. Besonders das erst vier Tage alte Alapakafohlen, das vorwitzig und neugierig zwischen den erwachsenen Tieren umhersprang, war sofort der Liebling von allen Besuchern. Die Gruppe erfuhr allerlei Wissenswertes über die Nutztiere aus den Anden, über die wertvolle hochwertige Alpakawolle und ihre Verwendung und Verarbeitung in der Textilindustrie. In der Wollstube konnten Teile aus der umfangreichen Kollektion käuflich erworben werden. Mit Kaffee und leckerem Kuchen –von der „Hauswirtin“ selbst hergestellt – im Hof-Café Establo wurde der gelungene Nachmittag abgerundet. Leider ging diese schöne und harmonische Woche wieder viel zu schnell zu Ende. Am Freitag wurden beim obligatorischen Fototermin die neugenähten Trachten – leider dieses Mal wegen des Regens unter dem schützenden Dach – vorgeführt.
Die Organisation der schönen Trachtennähwoche lag wieder in den bewährten Händen von Erika Weinert und Renate Slawik. Dank gebührt der Leitung des Webinger-Hauses und der guten Betreuung durch Renate Wögerbauer und ihren fleißigen Helferinnen.
Teilnehmerin Brigitte Kneissl und Kursleiterin Erika Weinert. Mitte und rechts: Besuch und „Raubtierfütterung“ im Alpakahof.
Nach Uwe Wittstocks Bestseller „Februar 1933“ über die Flucht jüdischer Schriftsteller aus Deutschland geht es in seinem neuen Buch um die große Flucht deutscher Literaten von 1940 bis 1942 aus Europa.
Am 14. Mai 1941 verhaftete die Gesapo allein in Paris mehr als 3500 Juden und brachte sie in Auschwitz um. Ab 1942 wurden in einer Kooperation von SS, französischer Polizei und der Regierung in Vichy 75 000 französische und ausländische Juden an die Nazis ausgeliefert und ermordet.
Viele der im Februar 1933 Hals über Kopf aus Berlin nach Frankreich geflohenen deutschen jüdischen Schriftsteller und Hitlergegner hatten das vorausgesehen. So setzte ab Sommer 1940 nach der deutschen Besetzung eines Teils von Frankreich erneut eine große Fluchtwelle, diesmal nach Marseille, ein. Dort – so
glaubte man irrtümlich – würden noch Schiffe nach Übersee fahren. So blieb nur die weitere Flucht nach Spanien und Portugal in der Hoffnung, dort auf ein Schiff nach Amerika zu kommen. Dazu brauchte man ein französisches Ausreisevisum und Transitvisa für Madrid und Lissabon. Teils in den 120 französischen Internierungslagern oder in Dachzimmerchen in Marseille sitzen unter Tausenden von Emigranten Hannah Arendt, Heinrich und Golo Mann, Walter Benjamin, Anton Kantorowicz, Anna Seghers mit zwei Kindern, Walter Mehring, Alfred Döblin, Eugen Feuchtwanger und Franz Werfel mit Alma Mahler fest. Sie alle haben ein Ziel: Möglichst schnell heraus aus Frankreich, aus Europa. Einer ihrer Helfer ist der amerikanische Journalist Varian Frey, der auch mit Unterstützung von Eleonore Roosevelt, der Frau des USA-Präsidenten, und dem Emergency Rescue Committe
❯ Neuer Bestseller
mindestens 200 Gefährdete illegal ins sichere Ausland rettet. Über die dramatischen Versuche und Erfolge gegen den Widerstand selbst amerikanischer Behörden schreibt Wittstock in kurzen, ebenso bedrückenden wie hinreißenden Kapiteln. Wohl die meisten über das ganze Buch verteilten Berichte gelten dem Prager Franz Werfel (1890–1945) und seiner Frau Alma Mahler-Werfel (1879–1964). Er ist Jude, geht in keine Synagoge, sucht aber Halt im Religiösen. Sein Buch über den Genozid an den Armeniern „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ hat ihn berühmt und reich gemacht. Ob er auch ein politisches Gespür hat oder
nur Opportunist ist? Wie Wittstock schreibt, kann Werfel 1933 nicht schnell genug ein schriftliches Bekenntnis zu Hitler abgeben, wird aber nur acht Wochen danach aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen. In Österreich schreibt er eine Laudatio auf Kanzler Kurt Schuschnigg, mit dessen durch einen Autounfall getöteter Frau Alma er befreundet war. Schuschnigg verliebt sich in Almas Tochter Anna und folgt ihr sogar auf einer Reise nach Italien. Wittstock verdammt Schuschnigg in Grund und Boden: „Er regierte mit diktatorischer Machtfülle, stellte Parlament und Verfassungsgericht kalt und führte die
Todesstrafe ein. Nur um seine eigene Machtfülle zu verteidigen, versuchte er Österreich gegen die Begehrlichkeiten Hitlers zu verteidigen.“
Der panische Versuch, den vorrückenden Deutschen zu entkommen, wird für das Ehepaar Werfel zur Odyssee, die auch nach Lourdes führt. Werfel kauft alle Traktate über Bernadette. Täglich gehen Alma und er zur Grotte, wo Maria um Hilfe gebeten wird. Bei der wirren Flucht ohne Passierschein, auf den sie lange warten müssen, werden sie zu Gefangenen der Bürokratie. Fry persönlich bringt eine kleine Gruppe mit Werfels, Hein-
Ebenfalls ein großes Dankeschön geht an die Sudetendeutsche Stiftung, die die Trachtennähwoche der Böhmerwäldler auch in diesem Jahr wieder unterstützt hat. Brigitta Schweigl-Braun
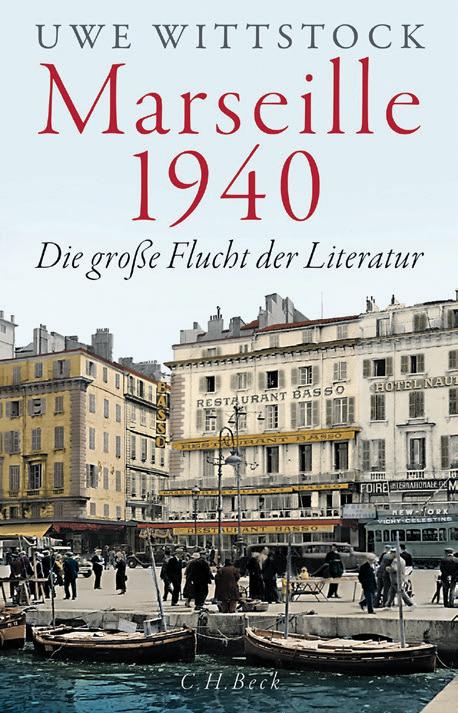
rich und Golo Mann am 12. September 1940 mit dem Zug an die spanische Grenze. Von dort geht es acht Kilometer zu Fuß über die Pyrenäen. Der herzkranke, übergewichtige Werfel wird von Alma angetrieben. Schließlich hängt quer über der Straße eine Eisenkette, die Frankreich von Spanien teilt. Die Flüchtlinge klettern darüber. Von Lissabon aus geht es im Oktober 1940 mit dem griechischen Dampfer Nea Hellas nach New York. Mit nur 54 Jahren stirbt Werfel in Kalifornien an einem Herzinfarkt. Anna Mahler-Werfel bleibt in Amerika als Mittelpunkt kultureller Gesellschaften. Norbert Matern


Zu einer Neuauflage brachte es der Roman einer Krummauerin. „Das falsche Bild“ von Gerti Brabetz kam erstmals vor 20 Jahren heraus. Der historische Roman war schnell vergriffen und wurde 2007 von einem anderen Verlag wieder veröffentlicht. Nun hat – rechtzeitig zum 85. Geburtstag der Verfasserin – ein weiterer Verleger das Buch entdeckt und neu publiziert.
Ein historischer Roman von Gerti Brabetz ist „Das falsche Bild“ in doppelter Hinsicht: Das Buch spielt kurz nach der „Samtenen Revolution“ im Jahr 1990, als die Protagonistin Vera Jakobi ihren Geburtsort Krummau in Südböhmen besucht. Die Galeristin aus Heidelberg möchte dort ein paar nostalgische Urlaubstage verbringen. Sie hofft, in der Stadt ein verlorengegangenes Portrait ihrer Mutter als Kind wiederzufinden. Bei ihrem Aufenthalt in Krummau werden schnell Erinnerungen wach, einerseits an die Vertreibung der Familie Krasna, der sie entstammt, andererseits an die Kinder- und Jugendzeit der Mutter am Anfang des 19. Jahrhunderts. Mutter Martha hat ihre zwiepältigen Reminiszenzen in Erzählungen und auf Audiocassetten lebendig gehalten. So springt die Autorin gekonnt zwischen den Zeitebenen hin und her und läßt den Leser gleichzeitig in Veras inneren Monologen an deren Erlebnissen und Gefühlen teilhaben. Neben dieser Nostalgiegeschichte ist das Buch jedoch ein Kriminalroman: Die Suche nach dem Kinderbildnis entwickelt sich zu einer komplexen und raffinierten Spurensuche, bei der die Heldin in der Lokalgeschichte Krummaus recherchiert. Wie soll sie das Bild finden, das nach den Wirren von Nachkriegszeit und Vertreibung für immer verschollen scheint?

Vera enthüllt sorgsam gehütete Geheimnisse. Sie entdeckt pikante Verwicklungen ihrer eigenen Tanten mit dem berühmten Maler Ludwig Welke, der die jungen Frauen auf indiskrete Weise dargestellt hat. Welke war vor Jahrzehnten wegen seiner Bilder und seines lockeren Lebenswandels aus Krummau verjagt worden.
Skandal um Egon Schiele

Dem Leser wird schon bei der Beschreibung der damals skandalösen Bilder von jungen Mädchen und Kindfrauen schnell klar, daß es dabei um Egon Schiele geht. Der Schauplatz der Bildersuche, das Hotel Fürstlicher Klosterhof, wo Vera logiert, ist überdies unschwer als das Hotel Rose in Krummau zu erkennen, das später eine Zeitlang durch die Aufstellung einer BenešBüste neben dem Eingang Schlagzeilen machte. Die Enteignung- und Vertreibungs-Dekrete vom ehemaligen Präsidenten Edvard Beneš werden mehrfach im Buch erwähnt, wenn Vera sich als Sudetendeutsche zu erkennen gibt oder an den Wohnstätten ihrer Kindheit auftaucht. Im Häuschen der Großel-
tern leben inzwischen Roma aus der Slowakei, die sehr hilfsbereit sind. Im einstigen Elternhaus jedoch sieht es anders aus. Die Authentizität der Szenerie sowie die Beschreibung von Straßen, Schloß und Umgebung Krummaus machen die kriminalistisische Suche noch spannender und verlocken dazu, Karten oder alte, deutschsprachige Stadtpläne zur Hilfe zu nehmen.
So werden bei Veras Besuch vergessene Familientragödien wieder wach, aufgedeckt in Gesprächen mit heimatverbliebenen Verwandten, oder provoziert durch Begegnungen mit Zeitgenossen, die oft etwas zu verbergen haben. Dabei erfährt die Erzählerin, wie schwer für sie selbst Vergeben und Vergessen sind, und daß die Frage nach Schuld und Sühne sich für sie immer noch stellt.
Bemerkenswert ist dabei, wie objektiv und genau die Autorin
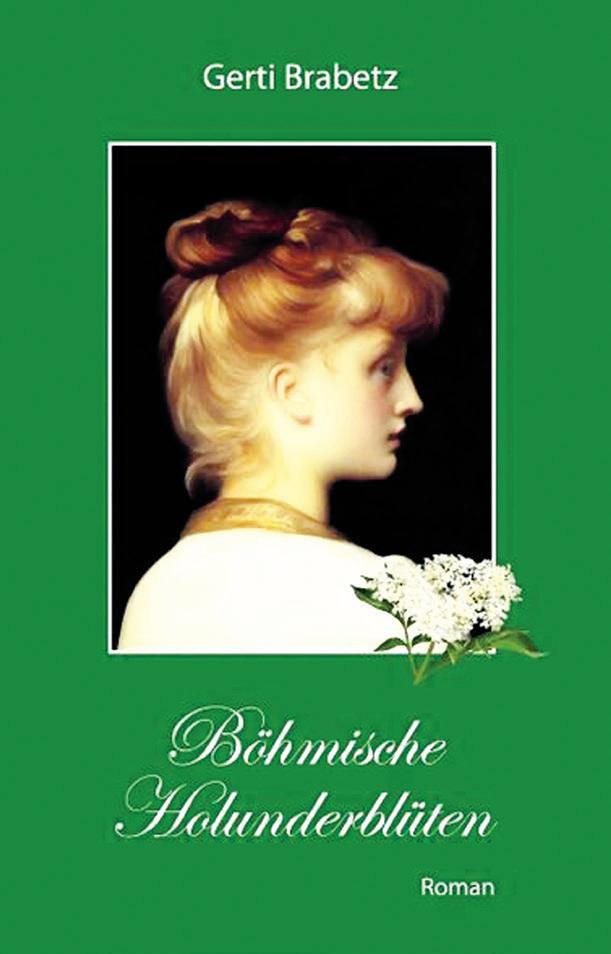
alle Personen schildert: Ob einen zufällig in einem Dorf entdeckten tschechischen Bildhauer, der im Verborgenen fantastische Skulpturen schöpft, oder eine allein im Sperrgebiet lebende, greise Tante, die bis zuletzt von tschechischen Grenzsoldaten geradezu familiär betreut wird, ist gleich. Eine der Hauptstärken des Kriminalhistorienromans liegt in der psychologisch stimmigen, messerscharfen Beobachtungsgabe, mit der hier Menschen dargestellt werden.
Messerscharf beobachtet
Das geschieht oft auf ganz indirekte Weise, mit wenigen, perfekt gewählten Worten: Eine kleine Körperbewegung wird gezeigt, ein spontaner Ausspruch – oft auch auf Tschechisch – zitiert, die Berührung einer Hand nachfühlbar gemacht. So werden alle Akteure lebendig, steigen

aus dem doppelten historischen Rahmen und erhalten ihr eigenes, zeitgenössisches Portrait. Und so gelingt dem Buch auch noch der Absprung in eine andere, zusätzliche Gattung: Denn „Das falsche Bild“ ist auch und vor allem ein echter und echt guter Liebesroman. Denn die über 50jährige Sudetendeutsche Vera trifft Milan. Der etwas jüngere tschechische Glaskünstler verliebt sich in sie, und sie erliegt seinem spröden, verletzlichen Charme. Beide sind verheiratet, wenn auch innerlich auf Distanz zum Ehepartner. Eine Affäre beginnt, die unglaublich sensibel, feinfühlig und ehrlich beschrieben wird.
Alte Tante an der Grenze Veras Schwierigkeiten dabei – etwa ihre Rivalität mit Milans alkoholsüchtiger, haßerfüllter Stiefschwester oder ihre eigenen Bindungen an ihren untreue) Ehemann und ihre gesicherte Existenz in Deutschland –leuchten ein. Und werden doch vom gemeinsamen Erleben, von der bereitwilligen Hinwendung zum anderen aufgefangen.
Voraussetzung und Folge zugleich ist die seelische Öffnung der Protagonistin. Sie reißt alte Wunden auf, um sie endgültig heilen lassen zu können. Die wenigen Tage und das Treffen mit Milan setzen einen Veränderungsprozeß in Gang, der durch einen Hilfsappell von Veras Familie in Deutschland unterbrochen wird. Veras Mutter Martha erkrankt schwer. Dieses eine Mal muß Vera noch einmal auf die Stimme aus der Vergangenheit hören und nach Deutschland zurückkehren.
Das Trauma der Vertreibung weicht einer inneren Befreiung von der Vergangenheit, obsessives Erinnern macht der Suche nach einer Zukunft Platz. Ob in Krummau, in Heidelberg oder in Kanada, ob gemeinsam mit Milan oder ganz frei – die Heldin findet ein neues Bild von den anderen, von sich selbst und von der Liebe. Sie hat wohl lange Zeit das „falsche Bild“ gesucht.
Susanne Habel
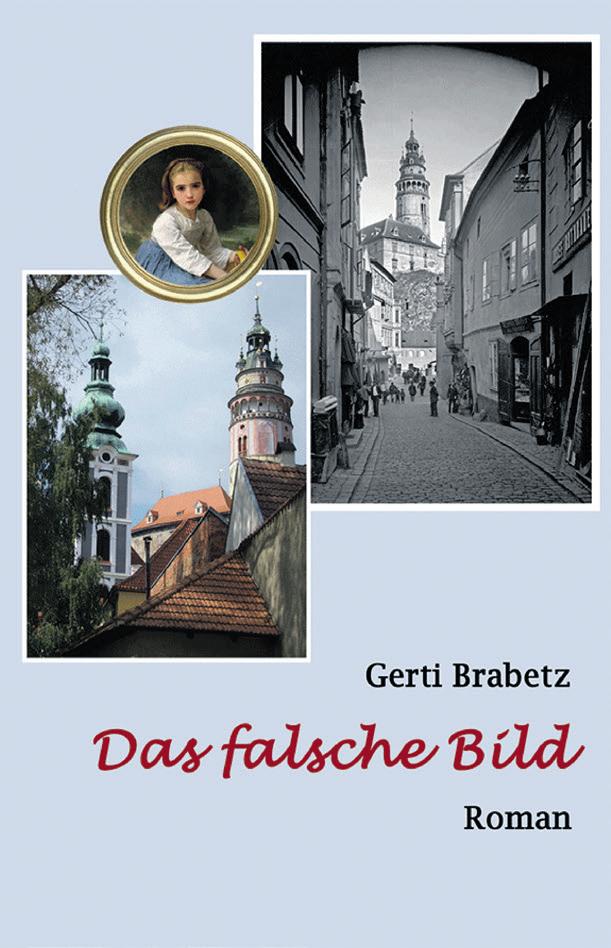
Gerti Brabetz wurde am 19. Juni 1939 in Krummau an der Moldau in Südböhmen geboren. Im Mai 1946 wurde ihre fünfköpfige Familie in einem Viehwaggon nach Hessen vertrieben. In Kassel machte sie am Gymnasium Engelsburg das Abitur. Sie trat bei den Henschel-Werken eine Stelle als Fremdsprachensekretärin an. 1965 heiratete sie ihre Jugendliebe Jürgen Radloff und bekam zwei Kinder. Die Familie lebt seitdem in Marburg an der Lahn mit seiner alten Universität, die die Arbeitsstätte des Paares bis zur Rente war. Mehrere Jahre war sie

Schriftführerin der dortigen SL-Ortsgruppe.
Ihre musikbegeisterten Eltern hatten die Begabungen ihrer drei Kinder im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten gefördert. Gerti kam auch früh mit Literatur in Berührung und dachte sich Geschichten aus. Im Rentenalter füllte sie die gewonnene Freizeit mit intensivem Schreiben. Aus ihren eigenen Erinnerungen und Impressionen von Reisen nach Krummau entstand 2002 ihr erster erfolgreicher Roman „Das falsche Bild“.
Die Heimat wurde zum Hauptthema, so in „Almas Hut“ und zuletzt in „Böhmische Holunderblüten“. Sie absolvierte viele Lesungen, die sie auch nach Krummau und zweimal nach Oberplan führten. Darüber hinaus verfaßte Gerti Brabetz zwei Romane über Frauen in einer Grenzsituation. Als fünffache Großmutter schrieb sie auch zwei Jugendbücher. Schwere Erkrankungen schränkten ihren schriftstellerischen Elan in den letzten Jahren leider etwas ein.
Die Bedeutung von Erinnerung als Erbe und Auftrag für die heutige Generation stand im Mittelpunkt des Diözesan- oder Begegnungstages der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Regensburg. Im Kolpinghaus nahmen gut 30 Mitglieder, zum Teil auch Interessenten, daran teil.
Mit einer vom Vorstandsmitglied Florian Würsch gestalteten und musikalisch von Harfenistin Veronika Wabra begleiteten Laudes zur geistlichen Einstimmung startete der nach mehreren Jahren Coronapause nun wieder durchgeführte Diözesantag. Über sechs neue Mitglieder – mit Ingrid Ecker aus Kollnburg war eines auch anwesend – freute sich der Diözesanvorsitzende Bernhard Dick in seiner Begrüßung. Sigmund Bonk verwies als Direktor des Akademischen Forums Albertus Magnus in seinem Grußwort auf die bewährte gute Kooperation mit der Ackermann-Gemeinde. Diese betonte auch Roland Preußl, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Regensburg. Persönlich habe er durch seine aus der Slowakei stammende Ehefrau einen besonderen Bezug zum Arbeitsfeld der Ackermann-Gemeinde. In seinem Amt als Geschäftsführender Vorsitzender der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Regensburg lobte er die in der AckermannGemeinde geleistete Erinnerungsarbeit, das „Gedenken an eine gelingende Versöhnung“. Bei der Erinnerungskultur im jüdischen Bereich stehe hingegen meist die Tätersicht im Zentrum, während etwa die Leistungen des Judentums nicht berücksichtigt würden. Daher plädierte er dafür, beim Erinnern und Gedenken auch das Wertvolle und Schöne einzubeziehen – und natürlich die Würde des Menschen. Er verwies auf Oskar Schindlers Frau Emilie Schindler und darauf, daß das Ehepaar Schindler 1947 bis 1949 in Regensburg gelebt habe. Über die Struktur und die Aufgaben des 1955 gegründeten Sudetendeutschen Archivs, das seit 2007 im Bayerischen Hauptstaatsarchiv angesiedelt ist, informierte Archivarin Ingrid Sauer in ihrem Vortrag „Die Schatzkammer der Erinnerung – das Sudetendeutsche Archiv“. Seit 20 Jahren ist
Sauer im Hauptstaatsarchiv tätig, seit 17 Jahren für das Sudetendeutsche Archiv. „Die Sudetendeutsche Volksgruppe hat als einzige der Heimatvertriebenen ein eigenes Archiv“, sagte sie stolz. Nach der Übernahme der Schirmherrschaft des Freistaates Bayern über die Sudetendeutsche Volksgruppe 1954 sei ein Jahr später das Archiv als Ge-


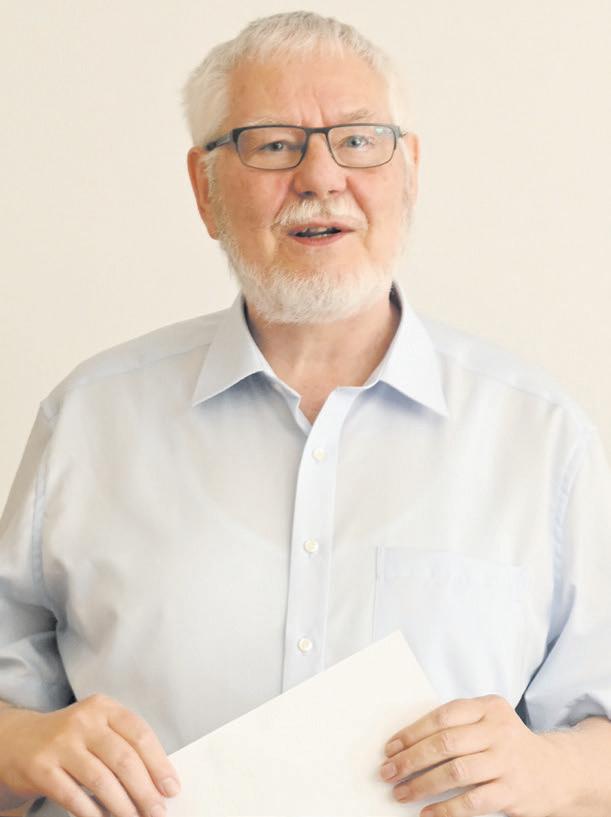
dächtnis der Volksgruppe gegründet worden – mit drei Bereichen: Führen einer Zentralkartei über Veröffentlichungen, Auswertung der Presse (Sammlungstätigkeit), Pressestelle der Landsmannschaft (Veröffentlichungen, Ausstellungen). „Damals war es eine reine Dokumentationseinrichtung“, blickte Sauer zurück und sprach von 1000 laufenden Regalmetern. Mit dem Umzug ins Bayerische Hauptstaatsarchiv 2007 habe dann die Sortierung und Strukturierung der Dokumente mit folgenden drei Schwerpunkten richtig begonnen: Verbandsschriften von Landsmannschaft und Heimatkreisen, Nachlässe und Sammlungen von Bildern, Plakaten, und so weiter. Diese könnten nach Anfrage genutzt werden, auch über Bayern hinaus.
Anhand ausgewählter Beispiele zeigte Sauer die Vielfalt und die Bedeutung dieser Dokumente auf. Ob nun ein Fahrtenbuch mit persönlichen Notizen und Erinnerungen, ein Gästebuch von einer Kindererholungsverschikkung, Nachlässe von Priestern oder Politikern: Oft könne man sich erst dadurch – etwa durch Tagebucheinträge – ein genaues Bild über einzelne Personen


oder Ereignisse machen. Inzwischen würden auch viele Studierende aus dem Ausland, vor allem aus Tschechien, das Archiv auch wegen der Bandbreite nutzen. „20 Prozent der Nachlässe im Verzeichnis des Hauptstaatsarchivs sind sudetendeutsche“, sagte Sauer. Einen großen Teil des Bestandes machten die Sammlungen aus, zumal hier ganz unterschiedliche Kategorien Platz fänden: Erlebnis- und Vertreibungsberichte, Texte über die Ankunft der Vertriebenenzüge im Jahr 1946, Schreibwettbewerb „Zeitreise“ des Katholischen Deutschen Frauenbundes zusammen mit der SL Bayern 2009, Lebenserinnerungen, Materialien aufgelöster Heimatstuben und so weiter. „Wir nehmen noch gerne Quellen an.“ Abschließend nannte Sauer die zentralen heutigen Tätigkeiten: Erschließen und Verzeichnen der Dokumente, konservatorische Behandlung, Beratung und Betreuung von Forschern. „Wir haben jährlich über 450 Anfragen.“
Mit vielen Zitaten garniert, war der Vortrag von Katrin Boeckh, die am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg die Forschungsstelle „Kultur und Er-
innerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“ leitet. „Vertreibung und Flucht: tradierte Erfahrung der dritten Generation“ lautete ihr Thema. „Bis vor zehn Jahren gab es viele Veröffentlichungen über die erste und zweite Generation, die dritte war noch nicht so präsent“, stellte Boeckh fest. Sie verwies auf das kulturwissenschaftliche Konzept des kollektiven Gedächtnisses, das aber durch das kommunikativ-kulturelle Gedächtnis ergänzt werden müsse.
Dazu gehöre auch die mündliche Weitergabe von Erfahrungen, die soziale Interaktion und Alltagskommunikation der Generationen. Beim Thema „Vertreibung“ komme bei der Erfahrungsverarbeitung primär die Familie zur Geltung, also das Generationengedächtnis von Flucht und Vertreibung. Es gehe darum, die Empfindungen der dritten Generation zusammenzustellen und zu beschreiben. Mit den Änderungen der Rahmenbedingungen ab 1989/90 wie Möglichkeiten zum Reisen oder freie Historiografie in den Herkunftsländern sei außerdem eine weniger verkrampfte Beschäftigung mit dem Thema festzustellen, eine neue Dimension in der Herangehensweise für die Familiengeschichte möglich geworden.
Meistens würden bei den Enkeln die Erinnerungen ungefähr im achten oder neunten Lebensjahr mit der Teilnahme an sudetendeutschen Veranstaltungen und so weiter beginnen, auch wenn Erstkontakte früher, aber im Unbewußten seien. Höchst unterschiedlich gestalte sich bei der Generation der Enkel die Rezeption der Flucht- und Vertreibungsschilderungen der Großeltern: von unterhaltsam und spannend über Bewunderung für den Mut der Flüchtlinge und Schmerz über Verluste bis hin zu Empathie über den Verlust von Verwandten oder die Unfähigkeit, Familiengeschichte zu verstehen und zu verarbeiten.
Aber auch Distanzierung wie genervt sein von den ständigen Schilderungen der Familienereignisse bis hin zur „Spätberufung“ – etwa durch äußere Auslöser oder Soziale Medien – und dem Wunsch nach Bewahrung mit Weitergabe von Werten und Einstellungen. „Es gibt ein reges Interesse in der dritten Generation – nicht nur passiv, sondern sich selbst in die Vergangenheit hineinzubegeben, damit umzugehen.“ Mit dem Plädoyer, die Vertreibungsgeschichte stärker in die Lehrpläne von Schule und Studium zu platzieren, schloß Boeckh.
Musikalisch umrahmte die Veranstaltung Veronika Wabra mit mehreren Stücken – auch aus Böhmen – auf der Harfe. Markus Bauer

❯
Bei der Mitgliederversammlung der Ackermann-Gemeinde (AG) in der Diözese Regensburg im Kolpinghaus sprach Vize-Bundesvorsitzender Martin Panten über „Die Zukunft der Ackermann-Gemeinde“.
Wegen Corona lag die letzte Mitgliederversammlung einige Jahre zurück, in denen sich Veränderungen und Neuerungen ergaben. Darüber berichtete der im Dezember neu gewählte Diözesanvorsitzende Bernhard Dick. Er stellte auch das neue Leitungsteam vor und ging auf den bereits 2021 gegründeten Trägerverein ein. Dieser sei ins Leben gerufen worden, um den Finanzen einen rechtlich klaren Rahmen zu geben. Dick gab einen Rückblick auf die traditionellen Veranstaltungen wie Literarisches Café, Adventsfeier, Grenzenlose Wanderung oder Kulturreisen und die neuen Angebote wie die Symposien „Setkávání – Encounters – Begegnungen“, die Reihe „Quo vadis, Grenzland?“, die Nepomukfeier oder die Treffen mit Pfadfindern aus Pilsen. Von vielen positiven Entwicklungen sprach Martin Panten mit Blick auf die Bundes- und Diözesanebene. Als Bürgermeister von Parkstetten bei Straubing gehöre er auch dem Regensburger Diözesanverband an. Positiv wirke sich aus, daß mit Luise Olbert und Sebastian Panten zwei Stellvertretende Bundessprecher der Jungen Aktion der AG in Regensburg studierten. Daraus sei die neue Reihe der intergenerativen Treffen entstanden, bei der zum ersten Mal zwei parallele, aber unterschiedlich konzipierte Stadtführungen in Regensburg erfolgreich durchgeführt worden seien. Generationsübergreifende Veranstaltungen seien auch die Ostertage in Eglofs oder das Rohrer Forum um den 1. Mai mit über 100 Teilnehmern.
„Die Ackermann-Gemeinde genießt ein hohes Ansehen in der Kirche“, machte Panten auch anhand der Präsenz im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken deutlich. Hier sei oft der Satz „Ihr seid die Stimme für Europa.“ zu
hören, die AG werde als ein europäisch orientierter Verband, der sich für Versöhnung und Zusammenarbeit einsetze, wahrgenommen. Europa gehöre seit der Verbandsgründung zu den zentralen Inhalten. Daher habe die AG auch vor der Europawahl die Aktion „Ich geh‘ zur Wahl“, an der sehr viele Mitglieder und Freunde sowie beim Endspurt auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil teilgenommen habe. Die Arbeit oder die Veranstaltungen sollten intergenerativ, offen, ehrlich und deutlich in der Positionierung sein. Mit Blick auf die künftige Arbeit stellte er Europa in den Mittelpunkt. Kein anderer katholischer Verband beackere dies so intensiv. Es gehe um eine friedliche, respektvolle und tolerante europäische Integration, um ein zukunftsfähiges Zusammenleben aus der Vergangenheit heraus möglich zu machen, schloß Panten. Das neue intergenerative Format nannte Florian Würsch, der dieses seitens des Leitungsteams betreut, eine Chance, auf Ebene verschiedener Projekte institutionell zusammenzuarbeiten. Verschiedene Personen- und Altersgruppen könnten sich hier kennenlernen. Die nächste Veranstaltung der Reihe sei die Fahrt mit einem nachgebauten Römerschiff in Mariaort bei der Mündung der Naab in die Donau. Künftig solle es pro Jahr drei derartige Veranstaltungen geben. Ein Nebeneffekt sei der Gewinn neuer Mitglieder. Sechs neue schlugen, so Martin Panten, in den letzten Wochen zu Buche, darunter auch Leute seines Heimatortes, die am ersten intergenerativen Treffen teilgenommen hätten. Anders war es bei Ingrid Ecker. Sie ist im Zuge der Familienforschung – eine ihrer Omas stammt aus dem Böhmerwald –auf die AG gestoßen. „Wir hoffen auf einige weitere Mitglieder“, meinte Jean Ritzke Rutherford, die im Leitungsteam für den Schriftverkehr und die organisatorischen Belange zuständig ist und für das Team weitere Mitarbeiter sucht. Aber die Zwischenbilanzen sind durchaus erfreulich. Markus Bauer
Ende März fand im Paul-LöbeHaus des Deutschen Bundestags in Berlin die erste Sitzung des neuen Kuratoriums mit Stiftungsrat und Stiftungsvorstand der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland statt.
Die Stiftung freut sich, Cristina Arheit-Zapp, Stefan Frühbeißer MdL, Magdalena Lemańczyk und Markus Zanner gewonnen zu haben. Sie wollen sich für die Anliegen deutscher Minderheiten und deutschsprachiger Gemeinschaften weltweit einsetzen.
Arheit-Zapp kam 1978 in Buenos Aires zur Welt. Sie studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Buenos Aires und Metallurgie in Aachen. Seit 2004 arbeitet sie im Familienunternehmen Sin Par S.A. Sie gehört verschiedenen Organisationen an wie dem Verein Deutscher Ingenieure und der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer. Sie engagiert sich beim MariaLuisen-Kinderheim und im Deutschen Klub in Buenos Aires. Sie ist seit 2023 im Vorstand des Verbandes Deutsch-Argentinischer Vereinigungen. Stefan Frühbeißer, geboren 1969 in Ebermannstadt, begann nach Abitur und Wehrdienst als Verwaltungs-
Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland

fachwirt bei der Stadt Pottenstein. 1998 bis 2002 arbeitete er für den Bezirk Oberfranken, 2002 bis 2023 war er Pottensteins Erster Bürgermeister. Seit 2023 ist er Mitglied des Bayerischen Landtags. 2021 erhielt er die Kommunale Verdienstmedaille.

Die in Polen geborene Soziologin Magdalena Lemańczyk ist auf deutsch-polnische Beziehungen sowie nationale und ethnische Fragen spezialisiert. Seit 2019 ist sie Assistenzprofessorin am Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der

Wissenschaften. Sie ist Chefredakteurin der wissenschaftlichen Zeitschrift „Language, Discourse & Society“ und befaßt sich mit sozial-demografischen Fragen und sozialen Innovationen in Polen und Deutschland. Zu ihren Publikationen gehören „Children of German-Polish Relationships. Identity and Nationality“ (2024) und „Die deutsche Minderheit als (Mehr-)Wert“ (2021). Markus Zanner kam 1967 in Wei-

den in der Oberpfalz zur Welt. Nach dem Studium der Geschichte, Religionswissenschaft und Romanistik in Regensburg studierte er Geschichte und Anthropologie an der Universidad Nacional de Misiones in Argentinien. 2011 bis 2020 war er Kanzler der Universität Bayreuth und maßgeblich am Aufbau des neuen Campus in Kulmbach beteiligt. Davor bekleidete er mehr als zehn Jahre lang verschiedene Positionen im Wissenschaftsmanagement der TU München. Seit 2021 ist er Kanzler der TU Nürnberg.

Während des Musicals stellen die Kinder die Notenmännlein vor. Bilder: Heinz Reiß
� Bubenreuth/Mittelfranken
Der Musikkindergarten im mittelfränkischen Bubenreuth feierte 70. Geburtstag.
Schon immer wollten die Schönbacher Geigenbauer nicht nur Musikinstrumente bauen, sondern auch auf ihnen spielen. 1954, fünf Jahre nach ihrer Ansiedlung in Bubenreuth, gründete der in Waltersgrün in der Nähe der Musikstadt Schönbach geborene Unternehmer Fred Wilfer (FRAMUS) einen Werkskindergarten. Der wurde über die Grenzen hinaus für seine musikalische Früherziehung bekannt und berühmt. Zwei Argumente hatte der Egerländer Fred Wilfer dabei vor Augen. Er wollte in den Nachkriegsjahren die Möglichkeit schaffen, daß Mann und Frau arbeiten gehen können, und er wollte den Kindern von drei bis sechs Jahren etwas „Spielerisches“ mit auf den Weg geben. Die Erzieherin Gertrud Fischer, genannt Tante Gertrud, übernahm die Leitung des Kindergartens, und in der musikalischen Geigenbauersiedlung machte sie die Erfahrung, daß sie mit Musik bei Kindern sehr weit kam. Unter ihrer Anleitung begann sie die Kinder spielerisch an das Flötenspiel heranzuführen. Problem war hier die traditionelle Notenschrift. Gelöst hat sie es zum damaligen Zeitpunkt durch eine geniale Notensetzung für Kinder. Die junge Kindergärtnerin erfand die bunten „Notenmännlein“. Sie ersetzte die Notation durch eine bunte Männleinschar, die auf den richtigen fünf Notenlinien sich bewegten. Für die acht Töne einer Blockflöte bekamen die Männlein einen farbigen Bauch, das Männlein mit dem gelben Bauch entsprach dem Ton „a“, und für den Ton „h“ hüpfte ein roter Bauch über die Linien. Um sich die Farben und den dazu gehörenden Ton schneller merken zu können, gab es das Notenbuch auch zum Ausmalen. Für die Tondauer hatte

Bürgermeister Norbert Stumpf mit Bollerwagen.
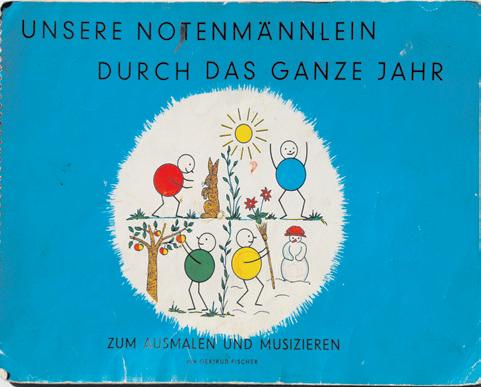
Das erste Notenbüchlein von Gertrud Fischer
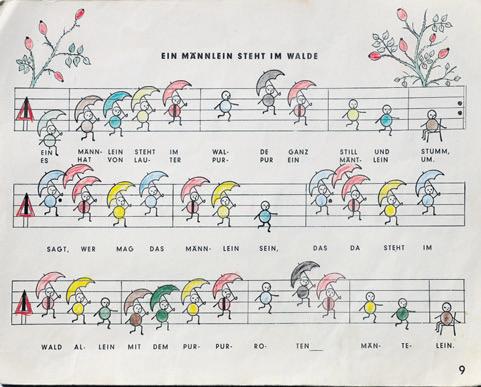
Fischer ebenfalls eine kindgerechte Lösung. Für eine halbe Note ließ sie das Männlein auf einem Stuhl sitzen, ein gehendes Männlein entsprach einer Viertelnote und für eine ganze Note hat sie das Männlein ins Bett gelegt. Daß die Männlein auf den Linien tanzten, kam bei dem musikalischen Nachwuchs gut an, erst am Ende des zweiten Heftes mit etwas schwierigeren Liedern ging Fischer Schritt für Schritt zum normalen Notensystem über, so daß die Kinder, als sie in die Schule kamen, die normale Notenschrift bereits lustig erlernt hatten. Die tanzenden Notenmännlein waren ein voller Erfolg, nach den Blockflöten folgten ein Heft für Klavier- und Gitarrenunterricht und Übersetzungen in verschiedene Sprachen. Am Samstag feierte der Musikkindergarten mit Musik, Showeinlagen und einer Tombola seinen 70. Geburtstag. Derzeit hat er 25 und im angeschlossenen Waldkindergarten 22 Kinder. Petrus ließ die Sonne scheinen, so daß die zahlreichen jungen und älteren Gäste aus nah und fern begeistert den kleinen Stars bei der Uraufführung des Musicals „70 Jahre Musikkindergarten“ folgen konnten. Das Musical war eigens für das Jubiläum geschaffen worden. Kindergartenleiterin Christiane Bayer-Fischer führte durch die Geschichte von der Gründung über die Notenmännchen bis zum Waldkindergarten. Das Musical endete mit dem von Andreas Haensel komponierten und arrangierten „Bubenreuth-Lied“.
Erster Gratulant war Bürgermeister Norbert Stumpf. Mit seinem Geschenk, einem Bollerwagen, erfüllte er gleich den Wunsch der Kinder. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen, selbstgebrautes Bier und Bratwürste. Den Nachmittag lockerten noch ein Märchenerzähler und viele Spielstationen auf. Heinz Reiß
� Schönenberg/Baden Württemberg
Flüchtlinge und Heimatvertriebene sowie deren Nachkommen pilgerten Anfang Juni zum 74. Mal zur Wallfahrtskirche auf den Schönenberg bei Ellwangen. Das Motto lautete heuer: „Begegnung mit Ostmittelund Südosteuropa“. Veranstalter war die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Vertriebenenorganisationen (AKVO) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit ihrem Geschäftsführer Rainer Bendel.
Am Portal der Wallfahrtskirche Zu Unserer Lieben Frau, einem Juwel barocker Baukunst, begrüßte der Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher die Gäste, darunter Trachten- und Fahnenträger aus dem Sudetenland. Fast ein ganzes Menschenalter sei vergangen, seit die Deutschen im Osten brutal vertrieben und entwurzelt worden seien. Anfangs hätten sie noch geglaubt, eines Tages in die Heimat zurückzukehren. Doch habe sich diese Hoffnung nie erfüllt. Die, die nach Ellwangen gekommen seien, hätten nicht nach Vergeltung getrachtet, sondern gebetet und beteten auch heute für das friedliche Zusammenleben der Völker. Was das kleinmütig gewordene Europa dringend brauche, hätten die Vertriebenen vorgelebt, indem sie nicht verzweifelt seien, sondern eine schwierige Situation zu einer Erfolgsgeschichte gewendet hätten. Dafür gebühre ihnen Dank, Anerkennung und Respekt der folgenden Generation. Dambacher dankte den Redemptoristen, die seit mehr als 100 Jahren die Wallfahrten auf den Schönenberg betreuten und jährlich mehr als 200 000 Besucher empfingen, sowie dem Musikverein Rattstadt, der im Freien aufspielte.
Dekan Matthias Koschar, Geistlicher Beirat der Ackermann-Gemeinde und Bischöflicher Beauftragter für die Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge aus Tuttlingen, dankte für den warmen Empfang auf dem Schönenberg, einem Ort der Gottesbegegnung und einem Leuchtturm des Glaubens. Die Nachfolgegeneration solle für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität beten und alles dafür tun, daß Menschen in ihrer Heimat leben könnten. Auch wenn die Pilger weniger würden, seien doch diese großen Anliegen geblieben.
In seiner Predigt verteidigte Koschar die scheinbar frauenfeindliche biblische Erzählung von Adam und Eva im 1. Buch Mose. Die Bibel sei keine Gebrauchsanweisung und erläutere keine Wirklichkeit, sondern wolle eine Wahrheit vermitteln. Deswegen gehe es in dieser Erzählung nicht vordergründig um die Rolle der Geschlechter, sondern darum, was dem Menschen an Erkenntnis zusteht.
Der Philosoph Ernst Bloch habe sogar biblische Texte gegen die Theologie in Stellung gebracht und die These vertreten, daß der Homo sapiens die Schaffung paradiesischer Zustände in die eigene Hand nehmen müsse. Jedoch zeigten die Ergebnisse von menschlichen Heilsversprechen wie der Französischen Revolution, des Nationalsozia-
des Bischöflichen Gymnasiums Brünn mit seiner Leiterin Elen Turbová, einer Schülerin aus dessen Oberstufe. Am Vorabend hatte der Chor in der Salvatorkirche Aalen ein Begegnungskonzert mit dem Kammerchor des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen gegeben. Das Konzert sollte der Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen dienen und gehörte zu einer Veranstaltungsreihe der Ackermann-Gemeinde. Koschar dankte der Pfarrei, den Redemptoristen, der Fahnenabordnung, den Ministranten, den Lektorinnen, dem 88jährigen Konzelebranten Franz Pitzal sowie Rainer Bendel. Zum Gedenken an die Opfer von Gewalt, Flucht und Vertreibung gestern und heute trugen Frauen in

Menschenwürde werde nicht vom Staat verliehen, sondern komme aus der Hand Gottes. Sie gelte daher für alle Menschen, so verschieden sie seien. Europa sei ein vielfältiger Kontinent. Alles Uniforme sei uneuropäisch. Allerdings sei bisher die kulturelle Frage hinter wirtschaftlichen und finanzpolitischen Notwendigkeiten zurückgeblieben. Ohne kulturelle Intention bleibe aber das europäische Einigungswerk unvollendet.
Auf dem Schönenberg habe nach dem Krieg nicht nur der Ellwanger Kreis getagt, um ein neues Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten, sondern Ellwangen sei auch eine zentrale Stätte, wo der heilige Methodius verehrt werde, der lange Zeit Bi-


lismus, Marxismus und Putins Angriffskrieg, daß Schreckliches geschehe, wo immer der Mensch Gott spiele.
Dagegen seien Demut und Erdung notwendig, die Einsicht in die menschlichen Grenzen, die Achtung vor dem Geheimnis des Lebens. Unser irdisches Zelt sei vorläufig. Die Bosheit der Welt fange bei uns selbst an und in dem, was wir tun. Auch jeder Einzelne von uns gestalte die Welt. Um die Entzweiung und Konkurrenz unter den Menschen zu überwinden, sei es angebracht, die jesuanische Sendung und den christlichen Glauben neu zu ergreifen. Das Reich Gottes werde in der Grundsolidarität der christlichen Familie erfahrbar. Eine innere Heiterkeit des Daseins ergreife uns, wenn wir in Christus mit Gott versöhnt und in ihm geborgen seien. „Gott liebt uns, trau es ihm doch zu“, schloß Koschar. Dann dankte er den Mitwirkenden, allen voran dem Chor
� SL-Altkreisgruppe Schlüchtern/Hessen
Tracht brennende Kerzen zum Altar: für die Ackermann-Gemeinde, für den Hilfsbund karpatendeutscher Katholiken, für die Eichendorff-Gilde, für die Ermland-Familie, für das SanktGerhards-Werk und für das Bistum Rottenburg-Stuttgart. In der folgenden Glaubenskundgebung sang Winfried Mack MdL eine Lobeshymne auf die Heimatvertriebenen als maßgebliche Gründer des modernen Europa. Sie hätten bereits fünf Jahre nach dem Krieg in ihrer 1950 in Stuttgart verkündeten Charta Weitsicht, Klarheit und Größe bewiesen. Sie sei ein großes Versprechen und ein Aufbruch in eine neue Zukunft gewesen. Die Nachgeborenen könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Jede Generation sei – stets bedroht vom Bösen – in ihre Zeit gestellt und müsse immer neu für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte kämpfen.
schof von Mähren gewesen sei – eine schöne Koinzidenz mit der Anwesenheit des Chors aus Brünn. Die Brüder Kyrill und Method hätten versucht, die Bibel durch die Erfindung des kyrillischen Alphabets den Slawen verständlich zu machen. Sie seien Verbindungsbrücken zwischen der westlichen und der östlichen Tradition und Fürsprecher für die ökumenischen Anstrengungen der Schwesterkirchen. Papst Johannes Paul II. habe sie 1980 zu Schutzpatronen Europas ernannt. Entsprechend dem Motto der Wallfahrt stehe Ellwangen für das Band zwischen dem östlichen und westlichen Europa, zwischen seinen beiden Lungenflügeln. Europa bedeutet Frieden und Freiheit, schloß Mack. Die Marienandacht am Nachmittag zelebrierte wieder Dekan Matthias Koschar. Wie schon am Morgen oblag die musikalische Gestaltung den Brünner Gymnasiasten. Stefan P. Teppert
Bekenntnisgeneration am Ruder
Bei der Jahreshauptversammlung der hessischen SL-Altkreisgruppe Schlüchtern Ende Mai übernahm die Bekenntnisgeneration im Wesentlichen das Ruder.
Roland Dworschak dankte zunächst herzlich für die Unterstützung, die er als Kreisobmann erfahren hatte, um zügig zur Vorstandswahl überzuleiten. Gernot Strunz hatte sich bereit erklärt,
die Wahl durchzuführen, an seiner Seite Manuela Ziegler als Schriftführerin. Am Ende stand der neue Vorstand fest. Markus Harzer, zuvor lange Landesobmann, ist jetzt zum Kreisobmann gewählt worden. Seine Wurzeln liegen in Neudek. Sein Stellvertreter bleibt Bernd Giesemann mit Wurzeln im Adlergebirge. Auch sonst gab es verjüngende Veränderungen. Einige Vorgespräche waren
diesmal nötig, um den Mitgliedern entsprechende Personalvorschläge unterbreiten zu können. Roland Dworschak, mittlerweile Ehrenmitglied, übernimmt zunächst von Harzer das Amt des Vermögensverwalters, bis auch hier eine andere Lösung gefunden werden wird. Gesine Weber rückt wieder zur Schriftführerin auf. Tabea Ziegler, die sich um die Zeitung kümmert, gehört jetzt dem erweiterten Vorstan-

dan. Neu im Team ist auch der Macher der Musikgruppe „Egerländer Buben Bad Orb“ Robert Anton Schreyer als Kulturreferent. Natürlich haben alle die Wahl angenommen. Harzer sagte, daß bewährte Konzepte weitergeführt würden. Dazu gehörten ein Sommerfest im Restaurant Rabenhorst, der Tag der Heimat in Herolz, ein Vorweihnachtstreffen und in absehbarer Zeit auch wieder ein böhmisches Schmankerlessen. Essen, Trinken, Musik und Spaß seien eben die schönsten Veranstaltungen, betonte der neue Kreisobmann. Dazu könnten weitere Angebote gemacht werden, die auch die Geschichte einschlössen, was sowieso Teil der Arbeit der SL sei. Darüber hinaus werde man wieder mit einem hiesigen Busunternehmen eine Fahrt ins Egerland unternehmen. „Und nicht zuletzt wollen wir in zwei Jahren unser 20jähriges Jubiläum feiern“, schloß Harzer. Manfred Gischler
Mitte Mai 2024 fand das traditionelle Totengedenken auf dem Görkauer/Jirkover Friedhof statt. Das war gleichzeitig der 20. Jahrestag der Einweihung des Gedenksteins. Diesen hatte der Görkauer Freundeskreis (GFK) mit der Görkauer Stadtverwaltung und der sächsischen Partnerstadt Brand-Erbisdorf am Eingang des Friedhofs errichtet und den Teilnehmern des achten GFK-Jahrestreffens im Mai 2004 bei der ersten gemeinsamen Gedenkstunde präsentiert. Die zweisprachige Inschrift des Steines lautet: „Zum Gedenken an alle Görkauer, die in der Heimat oder Fremde ruhen. Görkauer Freundeskreis 2004“. Der Gedenkstein wurde im Oktober 2021 restauriert. Die Kosten trug dankenswerterweise Brand-Erbisdorf.
Die Errichtung dieser Gedenkstätte gewinnt zunehmend an Bedeutung, denn sie wird auch in künftigen Zeiten an die Existenz der deutschen Bevölkerung in unserer Heimatstadt erinnern. Wir ehren unsere Toten und setzen damit gleichzeitig ein Zeichen für die junge Generation, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, die leider allzu oft verfälscht wiedergegeben wird. Jährlich werden das Areal des Gedenksteins und das Ehrengrab von Anna Haubner, die als erste Tote auf dem 1904 neu angelegten Friedhof an der Sadschitzer Straße beerdigt wurde, gepflegt und im Mai ein Totengedenken gehalten. So auch in diesem Jahr. Bereits am Vormittag trafen sich Thomas Mielenz, Frank Brendler, Elena Ziemey und Cornelius Wittig aus Brand-Erbisdorf, um das Gelände um den Gedenkstein und das Ehrengrab zu säubern. Anschließend fand auf Schloß Rothenhaus ein Mittagessen statt, zu dem Bürgermeisterin Dana Havlátková Jurštaková eingeladen hatte. Bei strahlendem Sonnenschein begann danach die Gedenkstunde auf dem Heimatfriedhof.
Auch eine Gruppe vom Komotauer Begegnungszentrum mit Leiterin Emma Laubrová war gekommen. Darüber hinaus hatten sich einige Tschechen vor dem Gedenkstein versammelt. Ein Trompeterquartett der Kunst- und Musikschule Jirkov umrahmte das Gedenken. Während der Kranzniederlegungen durch die Partnerstädte Brand-Erbisdorf und Görkau/Jirkov wurden die deutsche und tschechische Nationalhymne gespielt. Die Europahymne begleitete die Kranzniederlegung des GFK. Der Brand-Erbisdorfer Oberbürgermeister Martin Antonow überbrachte die Grüße seines Stadtrates mit einem herzlichen „Glück Auf“. Am Ende des Zweiten Weltkrieges seien mehr als zwölf Millionen Menschen aus
Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet der Mährisch-Schlesische Sudetengebirgsverein (MSSGV) im bayerisch-schwäbischen Memmingen mit der dortigen SL und der Grundschule Memmingerberg das Lichterschwimmen Mitte Mai zu Ehren des Brückenheiligen Johannes von Nepomuk.
In verschiedenen Unterrichtsfächern werden die Schüler der 3. Klasse auf das Fest vorbereitet. Im Religionsunterricht wird über die Bedeutung des heiligen Johannes von Nepomuk berichtet, im Werkunterricht werden die Schiffe gebaut und im Deutschunterricht wird das schöne Gedicht von
dem ehemals deutschen Osten heimatlos geworden. Über zwei Millionen Zivilisten hätten die Vertreibung nicht überlebt. Auch wenn damals nicht alle Leiden gleich vorbei gewesen seien, so sei das offizielle Kriegsende der hoffnungsvolle Anfang eines besseren Europa gewesen. „Vor 74 Jahren begann unser Frieden, ein Frieden in Europa, der elementar und für die jüngeren Menschen normal ist. Das wirklich Faszinierende war dabei: Den Deutschen mit all ihrer Schuld wurde von unseren Nachbarn viel Vertrauen und manche Vergebung geschenkt. Viele Menschen kamen damals in einer neuen Umgebung an, welche sich mittlerweile zumindest als zweite Heimat anfühlen mag.“ Heimat sei etwas sehr persönliches. Heimat mache stark, und zugleich sentimental. Hier in Görkau/Jirkov lebten nun neue Generationen. Und es lebe die hoffentlich dankbare Erinnerung. Für Sachsen, auch in BrandErbisdorf, sei es auch jetzt wieder eine große Herausforderung, daß fremde Menschen in unserer Heimat leben wollten. Das Wissen um wirklich schlechte Zeiten sollte den Deutschen nun auch die Kraft geben, den sozialen Frieden nicht weiter mit Fremdenhaß und Ausländerfeindlichkeit zu gefährden. Dabei hätten wir gerade mit Tschechien gute und zuverlässige Nachbarn. Es brauche weiter Verständnis und Respekt, Geduld und Freundschaft im Kleinen und über politische Grenzen hinweg. Antonows Dank galt der Partnerstadt Jirkov, dem GFK und
auf kulturellen und historischen Wurzeln basiert und den Völkern fast des ganzen Kontinents gemeinsam ist. Wir betrachten das menschliche Leben, Freiheit, To-
se Aufgabe hatte in den letzten Jahren Freund Thomas Mielenz übernommen, wofür wir ihm dankbar sind. Ich möchte Ihnen zuerst ganz

leranz, Ruhe und Frieden in unseren Häusern als das Wertvollste. Diese Werte brächten eine Behaglichkeit mit sich, an die man sich schnell gewöhnt habe. Aber die Werte seien nicht selbstverständlich. Und heute würden wieder nicht weit entfernt Menschenleben im Krieg ausgelöscht.
Während des letzten Weltkriegs seien viele Görkauer auf den heutigen Schlachtfeldern Osteuropas gestorben. Das sei ein kostspieliges Opfer für Selbstherrlichkeit und Erweiterungssucht gewesen. „Unser heutiges Treffen symbolisiert nicht nur Demut, sondern auch gegenseitiges Verständnis, Anerkennung und Respekt. Erinnern wir uns an alle Görkauer, die in ihrer Heimat nicht ruhen können. Und so laßt uns die Opfer des Krieges ehren und so handeln, daß sich seine Schrekken nie wiederholen.“
Zum Abschluß gedachte ich als GFK-Vertreterin aller Landsleute, die sich um diesen Gedenkstein verdient gemacht hatten, und aller Verstorbener, denen wir über den Tod hinaus verbunden sind. Dann sagte ich: „Mein Name ist Ute Müller. Meine Mutter stammte aus Rothen-

den Menschen, die sich rührig um die Kontakte bereits im 23. Jahr der Städtepartnerschaft kümmerten.
Görkaus Bürgermeisterin sagte, sie betrachte die Feier als einen symbolischen Händedruck über die Grenzen hinweg. Die neue Ära habe eine neue Friedensordnung für Europa gebracht. „Seien wir dankbar für die europäische Zivilisation, die
haus. Ich bin also eine Nachgeborene und gehöre nicht mehr zur Erlebnisgeneration. Zum ersten Mal habe ich 2007, also vor 17 Jahren, an einem GFK-Treffen teilgenommen und war damals auch zum ersten Mal auf diesem Friedhof und an diesem Gedenkstein.
Im Namen des GFK darf ich nun die Worte der Ehrung und des Dankes aussprechen. Die-

herzliche Grüße von Rudi Jansche ausrichten. Er, Jürgen Schmidt und Otto Macak können aus gesundheitlichen Gründen heute nicht dabei sein. Daß sich im Laufe der Jahre die Anzahl der Teilnehmer an diesem traditionellen Totengedenken verringert hat, ist nicht zu übersehen. Ein Sprichwort sagt: ,Die Zeit ist eine geräuschlose Feile.‘ Sie feilt leise und unermüdlich an uns Menschen und an all dem, was unser Leben ausmacht. Aber zum Beweis, daß die Zeit nicht alles auslöschen kann, dafür haben wir uns heute und hier an diesem Ort versammelt.
waltung am Görkauer Friedhof, um über die Aufstellung eines Gedenksteins zu entscheiden. Die Landsleute wurden positiv überrascht. Die Stadt bot nicht irgendeinen Platz auf dem Friedhof an, sondern einen bereits vorhandenen Stein an zentraler Stelle direkt im Eingangsbereich. Eine Woche später faxte Jansche den abgestimmten Text der Stadtverwaltung, so wie er heute auf dem Gedenkstein steht. Der Spruch wurde auf eine Glasplatte geschrieben und auf den Stein aufmontiert. Diese vorläufige Fassung wurde einen Monat später den Teilnehmern des Jahrestreffens präsentiert – vor genau 20 Jahren. Wie war das so schnell möglich? Es war eine beispiellose Aktion. Soldaten der Bundeswehr
semble den Treppenaufgang und bot ein Flötenkonzert als Willkommensgruß. Mit vier Bussen waren 160 Personen ins Böhmische gefahren. Die Busfahrer hatten ein Problem. Sie wollten die älteren nicht mehr so mobilen Landsleute direkt zur Andacht in die Kirche fahren. Aber auf dem Marktplatz herrschte Parkverbot. Ohne viele Umstände eskortierte die Polizei die Busse auf den Marktplatz. Heute, nach 20 Jahren, sind wir weniger als 160 Leute. Aber wir sind hier. Die gute Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Görkau und BrandErbisdorf und dem GFK besteht weiter. Wir haben den Weg der Freundschaft und Versöhnung eingeschlagen, und wir wollen ihn weitergehen.

Während der alljährlichen GFK-Treffen entstand der Wunsch, den deutschen Görkauern ein Denkmal zu setzen, einen zentralen Ort des Gedenkens für unsere in der Heimat und fern der Heimat Verstorbenen zu finden. Auch für die, die irgendwo verscharrt wurden. Es sollte ein Gedenkstein gesetzt werden, der auch unsere in den Weltkriegen Gefallenen und die grausam vor und bei der Vertreibung ermordeten Deutschen einbezieht. Der geeignete Ort war der Friedhof in Görkau.
Die GFK-Hauptakteure hätten sich Vorstand oder Präsidium nennen können. Aber sie fanden für sich den passenderen Namen Aktiver Kern. Er nahm 2003 Kontakt zur Görkauer Stadtverwaltung auf. Als Vermittler sei Hauptmann Thomas Mielenz gedankt. Nicht klar war, ob dieses Anliegen auf Verständnis stoßen würde. Aber, und das war nicht selbstverständlicht, sie reichten uns die Hand, und wir nahmen sie. So funktioniert Völkerverständigung. Die Verhandlungen verliefen von Anfang an erfolgreich. 2004 trafen sich Karl Schröter, Rudolf Jansche und Emil Siegert erneut mit Vertretern der Stadtver-
und der tschechischen Armee sowie Arbeiter des Görkauer Bauhofs mit ihren Baugeräten richteten innerhalb von drei Tagen das Areal um den Gedenkstein her. Sie kampierten während dieser Zeit in einer Hütte in Rübenau. Kontakte wurden geknüpft, neue Freundschaften entstanden. So funktioniert Völkerverständigung!
Das GFK-Treffen vor 20 Jahren gehört wohl zu den bedeutendsten und ergreifendsten Erlebnissen der Landsleute. Für viele war es die erste Begegnung mit der Heimat seit der Vertreibung. Viele sahen sich damals zum ersten Mal wieder und lagen sich weinend in den Armen. Es gab auch ein Wiedersehen mit Prinzessin Pimpinella Hohenlohe-Langenburg, die mit ihrem Enkel Sandro aus Spanien gekommen war.
Besonders überwältigt aber waren die Landsleute davon, wie sie in ihrer Heimatstadt willkommen geheißen wurden und wie auch die Stadt sich auf dieses Heimattreffen vorbereitet hatte. Unvergessen bleibt der Empfang in der ehemaligen Bürgerschule, der heutigen Kunst- und Musikschule. In weinroten Gewändern säumte ein Blockflöten-En-
Die vertriebenen Bewohner lieben ihre Heimat, da diese in ihren Erinnerungen einen festen Platz hat und mit persönlichen Erlebnissen verbunden ist. Aber langsam gehen uns diese alten Deutschböhmen aus, die sich für die Erhaltung ihres Kulturgutes engagieren. Darum bedeuten uns dieser Gedenkstein und die Tradition der Gedenkstunde so viel. Denn was ist Tradition? Tradition heißt nicht, Asche verwahren, sondern eine Flamme am Brennen halten. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen und wir können das Geschehene nicht rückgängig machen. Aber wir können und müssen daraus unsere Lehren ziehen. Die Geschichte und die Wahrheit mit all ihren Hintergründen müssen erhalten bleiben für die künftigen Generationen und als Mahnung und in der Hoffnung, daß nur der Frieden ihr Leben und ihre Zukunft bestimmen werden. Vor meinen Augen habe ich ein Bild. Es ist ein Bild an dieser Stelle von 2016, dem letzten Jahrestreffen des GFK. Hand in Hand stehen Franz Löschner und Rudi Jansche vor dem Gedenkstein und verneigen sich. Heute verneigen wir uns für jeden dieser großartigen Menschen, die seither von uns gegangen sind. Für alle, die nicht mehr unter uns sind. Sie bleiben unvergessen. Der GFK dankt allen Helfern und Unterstützern, die dieses Gedenken ermöglicht haben, und allen Anwesenden für ihr Kommen.“
Die Gedenkfeier fand auch heuer in einem würdigen Rahmen statt. In der Hoffnung, daß wir uns auch künftig an diesem Ort des Friedens treffen werden, verabschiedeten sich die Landsleute voneinander. Ute Müller
Goethe „Sankt Nepomuks Vorabend“, das er bei einem Kurauf-
enthalt in Karlsbad und der Teilnahme am Lichtschwimmer verfaßte, durchgenommen.

„Lichtlein schwimmen auf dem Strome, / Kinder singen auf der Brücken, / Glocke, Glöckchen fügt vom Dome / Sich der Andacht, dem Entzücken. / Lichtlein schwinden, Sterne schwinden, / Also löste sich die Seele / Unsres Heil‘gen, nicht verkünden / Durft er anvertraute Fehle. / Lichtlein, schwimmet! Spielt, ihr Kinder! / Kinderchor, o singe, singe! /
Und verkündigt nicht minder, / Was den Stern zum Sterne bringe.“ Als ich vor mehr als 30 Jahren dieses Fest initiierte, hätte ich nie gedacht, daß es auch 17 Jahre nach meiner Pensionierung mit einer Selbstverständlichkeit von der Schule weiter tradiert wird. Wenn
ich als Organisator die Schulleiterin jedes Jahr frage, ob die Schule das Fest wieder organisiert, kommt die beruhigende und freudige Antwort: „Natürlich machen wir das wieder. Es ist fest in unserem Schuljahresablauf vorgesehen, und die Kinder freuen sich schon darauf“. Einen schöneren Dank und Bestätigung für diese Tradition kann es doch nicht geben. Gerhard Pohl

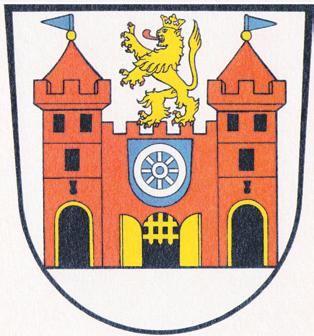
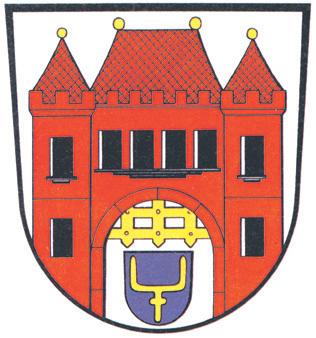
Voller Sehnsucht, aber vergebens hatten die Vertriebenen aus dem Sudetenland anfangs auf die Rückkehr in die Heimat gewartet. Sie sammelten und pflegten Erinnerungen, Erinnerungsstücke, Chroniken und Zeitzeugenberichte in Archiven und Heimatstuben. Interesse an und Geld für diese Sammlungen und ihre Verwalter werden weniger. Ratlosigkeit herrscht. Was tun mit all den Kostbarkeiten?
Anfang Juni feierte die oberbayerische Vertriebenenstadt Waldkraiburg mit ihren neuen tschechischen Freunden aus Nordböhmen im Kulturhaus die Übergabe ihres Heimatarchivs von Böhmisch Leipa, Haida und Dauba an das Heimatkundliche Museum mit Galerie in Böhmisch Leipa.

Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
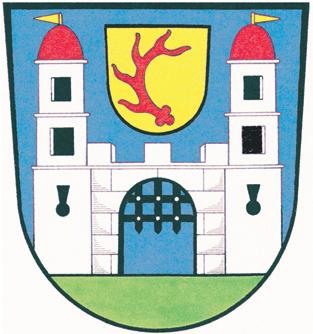
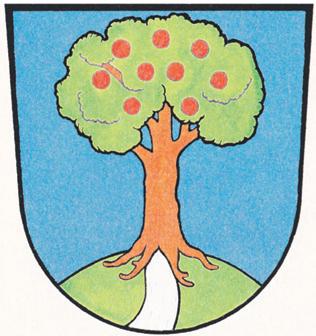

� Waldkraiburg, Böhmisch Leipa, Haida und Dauba
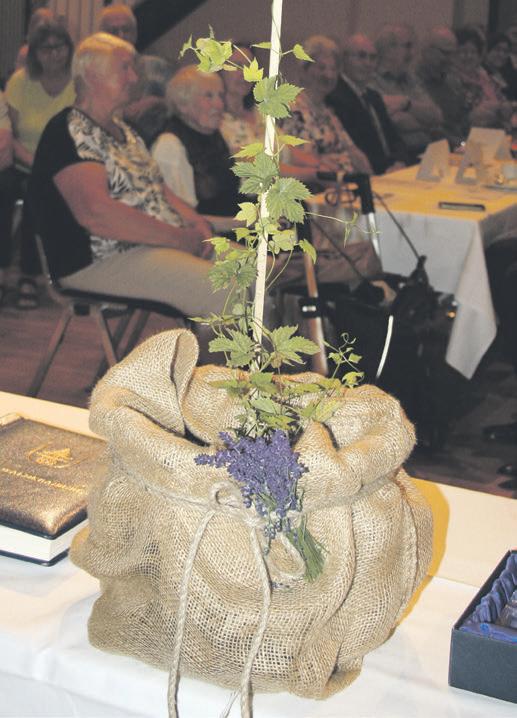
Der Festakt begann mit einem Stück von Johann Sebastian Bach, den das Streichertrio der Musikschule Waldkraiburg unter Beatrix Bene-Godany spielte. Anschließend begrüßte Waldkraiburgs Zweiter Bürgermeister Anton Kindermann die tschechische Delegation, die deutschen Honoratioren und die Landsleute. Kindermanns Wurzeln liegen ebenfalls in Nordböhmen, und zwar in Ehrenberg im einstigen Kreis Rumburg. „Das Heimatarchiv und seine Geschichte“ schilderte Konrad Kern, seit 1990 Stadtarchivar. Zunächst skizzierte er die Anfänge der Stadt, dann konzentrierte er sich auf die Entwicklung des Archivs. Mitte der 1970er habe Maria Bürger/Gürtler aus Böhmisch Leipa begonnen, ein Archiv anzulegen. 1981 habe Erika Rahnsch/Nittel aus Falkenau-Kittlitz bei Haida die Arbeit übernommen. 1988 sei der „Verein zur Sammlung und Bewahrung des Kulturgutes der Vertriebenen in Waldkraiburg“ entstanden und Rahnsch sei bis 2018 dessen Kassenverwalterin gewesen. Das Heimatarchiv sei letztlich ihr Werk gewesen. 1998 habe die Stadt das Archiv übernommen, womit öffentliche Gelder zur Verfügung gestanden hätten. Erika Rahnsch und Erika Thoß hätten von 1999 bis 2002 das Archiv inventarisiert und drei Findbücher erstellt. Interessiert und wohlwollend habe Rahnsch verfolgt, wie das Archiv des Heimatkreises Tetschen-Bodenbach in Stuttgart 2016 nach Tetschen überführt worden sei. Sie habe sich auch für ihr Archiv eine Rückkehr in die Heimat vorstellen können. Vor drei Jahren sei sie überraschend gestorben. Vergangenes Jahr habe er sich über eine Schenkung in die Heimat umfassend informiert und Kontakt zu Michal Rádl, Kreisarchivar von Böhmisch Leipa, und Tomáš Cidlina, Historiker beim Heimatkundlichen Museum von Böhmisch Leipa, aufgenommen. Mittlerweile seien bereits 50 Bananenkartons sowie andere Schachteln und Mappen im Heimatkundlichen Museum.
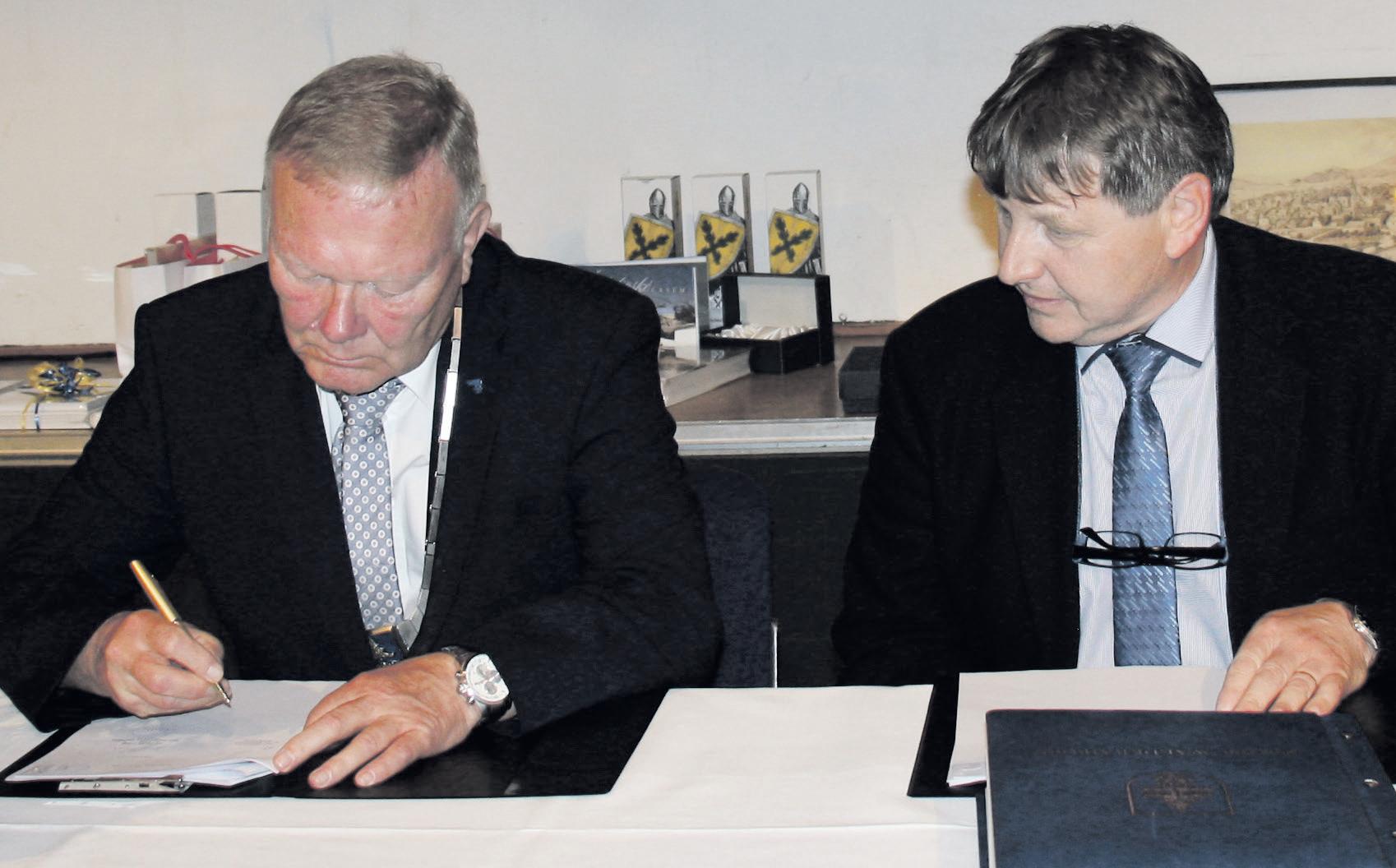
Zweiter Bürgermeister Anton Kindermann und Museumsdirektor Zdeněk Vitáček unterschreiben den Schenkungsvertrag.

ration warten müssen, die ohne den Haß auf alles Deutsche sei. Zur Aufklärung mache er Ausstellungen und erinnere an die deutschen Mitbürger. Mittlerweile wachse die dritte und vierte Nachkriegsgeneration heran. „Wir haben die Gräben schon etwas zugeschüttet.“ Und: „Ich verspreche, unser gemeinsames Erbe gut zu pflegen.“ Bayerns Landesobmann Steffen Hörtler zitierte die Böhmisch Leipaerin Helga Helms, die gesagt habe, wir könnten doch Heimat zusammen haben. Dann schilderte er die Vertreibung seines Vaters Otto aus Blottendorf im Kreis Böhmisch Leipa vor 78 Jahren und verband damit seine Freude über die Schenkung. Hörtler schloß mit dem Satz: „Wir sind keine Freunde, wir sind Brüder.“

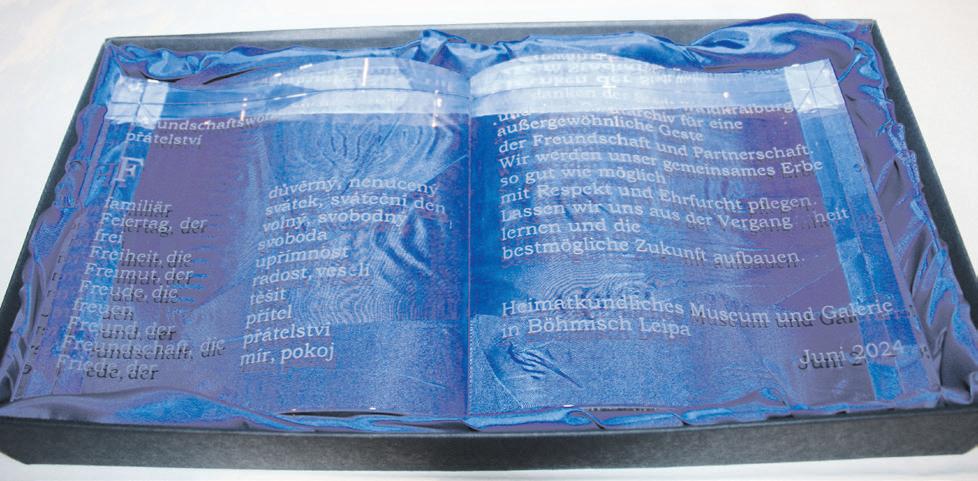

„Wir danken der Stadt Waldkraiburg und dem Stadtarchiv für eine außergewöhnliche Geste der Freundschaft und Partnerschaft. Wir werden unser gemeinsames Erbe so gut wie möglich mit Respekt und Ehrfurcht pflegen. Lassen wir uns aus der Vergangenheit lernen und die bestmögliche Zukunft aufbauen“, steht auf dem Glasbuch, das das Museum in Böhmisch Leipa Waldkraiburg schenkte. Der Hopfen links ist ein Geschenk aus Dauba. Ein Stück Wald, ein Stück Wiese, einen Katalog ihres Glasmuseums sowie die Replik eines Biedermeierpokals brachten die Haidaer mit. Bild (1): Elke Keiper
Bewegt dankte Cidlina für die Schenkung: „Das kann als Beispiel für Europa dienen.“ Und er erklärte, warum das Archiv so wichtig sei. 1945 habe zwar der Krieg geendet, nicht aber die Ungerechtigkeit. Die Vertreibung habe tiefe Gräben gerissen. Die zugezogenen Menschen im Grenzgebiet hätten keine neue tschechische Identität finden können, das Deutsche stecke viel zu tief in dieser Gegend. Schließlich seien die Deutschen zurückgekommen, um sich in ihren Heimatdörfern zu treffen. Das habe auch Haß geschürt. man habe auf die neue Gene-
Nachdem Vizebürgermeister Kindermann und Zdeněk Vitáček, Direktor des Heimatkundlichen Museums in Böhmisch Leipa, den Übergabevertrag unterzeichnet hatten, trugen sich zum erstenmal Tschechen im Goldenen Buch Waldkraiburgs ein: Böhmisch Leipas Zweiter Bürgermeister Jakub Mencl, Květa Vinklátová, Kulturbeauftragte des Bezirks Reichenberg, Zdeněk Vitáček und Irena Žalovičová, Bürgermeisterin von Dauba.
Schließlich wurden Geschenke ausgetauscht und tschechische Gruß- und Dankesworte gesprochen. Cidlina und Kern fielen sich in die Arme. Und das Streichtrio spielte die Tschechische, die Deutsche und die Europa-Hymne.
Vor dem Festakt mit vielen großen Worten hatte Kern die tschechische Delegation am Grab von Erika Rahnsch mit deren Söhnen Wolfgang und Gerhard zu einem stillen Gedenken empfangen. Mencl und Vitáček legten Blumen nieder, und Cidlina verstreute Heimaterde. Ebenso gedachte man des ersten Waldkraiburger Bürgermeisters Hubert Rösler, der aus Hirschberg am See im damaligen Landkreis Dauba vertrieben worden war, an dessen Grab mit Blumen. Zum Schluß legte Květa Vinklátová am Gedenkplatz für die Toten der Heimat Blumen nieder, und Cidlina verstreute auch hier Heimaterde. Nadira Hurnaus

trägt sich in das Goldene Buch ein.

Tomáš Cidlina und Konrad Kern freuen sich.





❯ Neue Ausstellung in Rumburg
Harald Skala aus dem sächsischen Obercunnersdorf widmet sich der Militärgeschichte der k. k. Monarchie und der Genealogie. Im Depot des Museums in Tetschen entdeckte er fast vergessene Portraits der kaiserlichen Familie, von sächsischen Kurfürsten und Offizieren. Nun stellt das Museum in Rumburg diese Bilder aus.
In der Ausstellung sind 14 Portraits von Offizieren des k. k. Infanterie Regimentes Nr. 17 und 18 Portraits aus der Ahnengalerie von Leopold Anton Altgraf Salm-Reifferscheidt-Hainspach aus dem Schloß Hainspach“, sagt Skala. Nach der Verstaatlichung des Schlosses 1946 landeten die Gemälde im Depot. Der Name des Malers der Offiziersportraits ist nicht bekannt, die Bilder entstanden um das Jahr 1726. „Die Namen der Offiziere stehen auf der Rückseite der Portraits, oft jedoch nicht richtig geschrieben.“ Das Regiment kämpfte zum Beispiel bis 1734 in Ungarn und Siebenbürgen gegen die Türken. Nach dem Krieg wurde es in Belgrad stationiert. Aus der Hainspacher Ahnengalerie sind insgesamt 53 Portraits erhalten geblieben, die in Tetschen aufbewahrt wurden. „Die Ahnengalerie wurde von Leopold Anton Altgraf SalmReifferscheidt-Hainspach gegründet, die ältesten Bilder hingen wohl schon in dem Wiener Palast der Familie Salm-Reifferscheidt“, ergänzt Skala. Bis auf
❯ Isergebirge
einige wenige war der Zustand der Bilder ganz gut, sie waren allerdings ohne Rahmen, und für die Ausstellung mußten sie restauriert und neu gerahmt werden.
Skala konnte bei der Bearbeitung der Dokumentation einige der bis heute unbekannten Personen auf den Portraits identifizieren oder falsch beschriftete Bilder korrigieren. „Über die Offiziersportraits war bis jetzt überhaupt nichts bekannt“, betonte er. Die Ausstellung begleiten zweisprachige Tafeln, die die Verhältnisse der Altgrafen SalmReifferscheidt-Hainspach und die Geschichte des Infanterie Regimentes darstellen.
Harald Skala, geboren am 3. Juli 1935 in Schatzlar/Žacléř im
Riesengebirge, stammt aus einer Mischehe. Sein Vater war ein Tscheche, seine Mutter eine Sudetendeutsche. Nach August 1968 und der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Warschauer-Pakt-Truppen flüchtete er mit einem kurzen Zwischenaufenthalt in Belgien nach Deutschland. Bis zu seiner Pensionierung war er in Hessen bei Siemens beschäftigt. Seit 2010 wohnt er in einem Umgebindehaus in Obercunnersdorf.
Petra Laurin
„Vergessene Bilder aus dem Schloß Hainspach“ im Museum Rumburg bis Mai 2025 Dienstag bis Mittwoch 10.00–15.00, Donnerstag bis Samstag 10.00–17.00 Uhr.
Petra Laurin, unsere Korrespondentin im Isergebirge, wurde für ihre literarischen Verdienste um die deutsche Vergangenheit geehrt.
Bereits zum siebten Mal veranstaltete die Region Reichenberg den Wettbewerb „Buch des Jahres“ und zeichnete herausragende regionale Literatur aus. Eine siebenköpfige Jury wählte aus 45 Publikationen aus dem Jahr 2023 die besten aus. „In diesem Jahr waren wir uns einig, daß in jeder Kategorie die Anzahl hochwertiger Bücher sehr hoch war. Nicht nur in Bezug auf den Inhalt, sondern auch in Bezug auf die Gestaltung“, sagte Květa Vinklátová, Stellvertretende Landeshauptfrau für Kultur, Denkmalpflege und Tourismus der Region Reichenberg, Ende Mai bei der Preisverleihung in der Wissenschaftlichen Regionalbibliothek in Reichenberg. Petra Laurin, Journalistin, Autorin, Leiterin des Hauses der deutsch-tschechischen Verständigung in Gablonz-Reinowitz und Vizepräsidentin der deutschen Vereine in der Tschechi-
Heuer gab der Verlag Tschirner und Kosova „Wahre Schätze der Nordböhmischen Küche. Rezepte und Geschichten“ heraus (➞ SdZ 11/2024). In loser Folge stellt die Reichenberger Zeitung einige Rezepte vor.
Kraftbrühe für Kranke
Eine alte Taube oder eine alte Henne wird im Mörser zerstampft. Dann gibt man sie in einen Kochtopf und gießt etwa anderthalb Liter leicht gesalzene, entfettete kräftige Rindssuppe kalt darüber und läßt sie gut zugedeckt anderthalb bis zwei Stunden langsam kochen. Dann filtert man die Suppe, welche bis zur Hälfte eingekocht ist,
schen Republik, erhielt die Ehrung für ihre Bemühungen, die deutsche Geschichte der Reichenberger Region bekannt zu machen und für die Nachwelt zu bewahren.
„Wir arbeiten seit fast zehn Jahren an Buchprojekten. Es begann mit Büchern über die Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge. Da wir immer neue Nachfragen bekommen, arbeiten wir an einer neuen erweiterten Auflage“, so Laurin. Im vergangenen Jahr gab das Haus der deutschtschechischen Verständigung außerdem „Haindorf – Die Legende des Wallfahrtsortes“ über die Geschichte des Klosters Haindorf mit Illustrationen von Monika Hanika heraus. Das Buch erschien in Deutsch, Tschechisch und Paurisch. Vor Weihnachten erschien posthum „Erinnerungen an ein stilles Iserge-
birge“ des Gablonzer Fotografen und Autors Siegfried Weiss. Zu den weiteren Projekten des Hauses gehörte das zweisprachige deutsch-tschechische Buch „Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isergebirge“, das auch als Hörbuch erschien.




Für die Bewahrung der deutschen Geschichte der Region Reichenberg erhält Petra Laurin eine Sonderauszeichnung.
Daneben gaben Petra Laurin und das Haus der deutsch-tschechischen Verständigung viele Publikationen heraus, die mit dem Isergebirge und seiner ehemaligen deutschen Bevölkerung verbunden sind. Vor allem eine Buchreihe über Gustav Ginzel, den bekannten Globetrotter und Bewohner des Misthauses von Klein Iser, stieß auf großes Interesse.
„Was mir persönlich Freude macht, ist, daß es mir gelang, ein Team von Journalisten, Übersetzern, Korrektoren und Graphikern zu finden, die ähnlich ein-
Wahre Schätze aus der Nordböhmischen Küche
gestellt sind“, sagt Laurin. „Wir arbeiten gemeinsam an neuen Projekten, und das macht Spaß. Heuer wollen wir ein deutschtschechisches Buch über Rübezahl herausgeben. Der AdalbertStifter-Verein wird unser Partner sein.“ Außerdem sei eine Bücherreihe über das Isergebirge geplant, in der Texte deutscher Autoren aus der Region vorgestellt und ins Tschechische übersetzt werden sollen.
Vor zwei Jahren erhielt Laurin bereits den Sonderpreis der Reichenberger Jury für „Humor der Deutschen“ und voriges Jahr den Hauptpreis für „Märchen und Sagen der Deutschen aus dem Isergebirge“ in der Kategorie „Bücher für Kinder und Jugendliche“. Laurin: „Schön und wichtig für mich ist auch, daß die Region Reichenberg mit dem Preis ausdrückt, daß die deutsche Geschichte für die heutigen Bewohner dieser Landschaft wichtig ist.“ Bei der Ehrung wurde auch betont, daß sich im Isergebirge niemand mit der deutschen Vergangenheit so systematisch befasse wie Laurin.
Am 15. Juni feierte Herta Linke aus Hennersdorf bei Gablonz im oberfränkischen Weidenberg 95. Geburtstag. Margaretha Michel berichtet.
Bei den Treffen der Sudetendeutschen erscheint Herta eher unauffällig. Aber am Telefon überraschte sie mit ihrer festen und deutlichen Stimme und ihrem Wissen. Beim Besuch vor einigen Tagen empfing sie mich so: „Ich wollte eigentlich in den Garten, die Schnecken ablesen. Ich muß immer etwas arbeiten, und wenn ich mich ausruhe, lese ich. Meine Nichten versorgen mich mit Lektüre. Ich habe gerne böhmische Texte.“ Auf dem Tisch liegt aufgeschlagen ein Roman über Angela Merkel. Sie spricht weiter: „Die Vertreibung hät‘s ni gebraucht. Wir wußten ja nicht mal im Orte, wer Deutscher oder Tscheche war. Wir haben alle friedlich zusammengelebt und gearbeitet. Ich bin nur dankbar, daß wir mit den vielen kleinen Kindern bis zur Aussiedlung im Haus bleiben konnten. Eigentlich hatte ich eine Lehrstelle für Schneiderin in Gablonz, aber aus der Lehre wurde nichts.

Herta Linke und die Madonna aus Albersdorf.
Der Kommissar hat mir glei‘ nach Kriegsende eine Liste vorgelegt mit den Namen der Einwohner. Ich sollte sagen: Wer sollte abgeschoben werden. Darauf antwortete ich: ,Entweder alle oder keiner.‘ Er hat mich gelobt. Ja, es gab schon Leute, die andere angeschwärzt haben. Wie es halt immer ist.“
„Bei allem Pech, ich ho immer Glicke gehoobt! Mein wertvollstes Stück von daheeme werde ich ihnen zeigen.“ Sie holt eine Muttergottes aus dem Schrank und hält sie liebevoll in der Hand. „Meine Mutter Gertrude Hollmann und ihre Eltern stammen aus Spindlermühle im Riesengebirge. Dort herrschte immer wieder Hungersnot. Deshalb begab sich der Großvater Richtung Schlesien. Im Wallfahrtsort Albersdorf kaufte er sich diese Madonna und brachte sie nach Hause. Bei der Aussiedlung trug er sie wie ein kleines Kind auf den Armen, und die Madonna wurde ihm nicht abgenommen.
Als meine Mutter vier Jahre alt war, zogen ihre Eltern nach Wiesenthal, das ganz nahe bei Hennersdorf liegt. Dort übernahmen sie eine Landwirtschaft. Die Familie meines Vaters Franz Linke (1898–1968) war schon seit längerem in Hennersdorf ansässig. Großvater und Urgroßvater waren sogar Bürgermeister vor Ort. Mein Vater hatte Schlosser gelernt, arbeitete dann aber im eigenen Betrieb als Glasdruk-
ker. Man stellte vor allem Material für Luster her. Meine Mutter Gertrude (1900–1987) half zu Hause und erzog die fünf Kinder. Die Schule in Hennersdorf war zweiklassig. Später mußten die jüngeren Schwestern dort in die tschechische Schule gehen. Bei der Aussiedlung hatten wir auch Glück. Wir kamen in den Westen. Der Aufnahmeort war allerdings das völlig zerstörte Frankfurt am Main. Und dann hatten wir wieder Glück. Der Vater kam 1946 aus der Gefangenschaft nach Hause. Zuerst war er in der SBZ, konnte aber durch eine Zuzugsgenehmigung zu uns. Sein Schwager war damals schon in Bischofsgrün tätig, und so ging er dorthin und wir kamen Ende 1946 nach. Und wir arbeiteten wieder für den Export. Wir sammelten Kiefernzapfen, trockneten sie am Ofen und besprühten und beklebten sie mit Glitzer. Das war das erste Produkt für den Verkauf. So wurde ich keine Schneiderin, sondern eine Industriearbeiterin. Sechs Jahre waren wir in Bischofsgrün, und dann bekamen wir bei der Werksiedlung in Weidenberg die Möglichkeit, uns niederzulassen. In den letzten Jahren vor der Rente verfiel auch die Weidenberger Industrie. Für einige Jahre war ich noch in einer Weberei beschäftigt, und dann ging ich in Rente. Noch zur Werksiedlung: Mein Vater gehörte zu den Begründern. Wir bauten 1951/52 dort ein Haus und ebenso eine Druckerhütte. Wir stellten zuerst Glasknöpfe her und später dazu auch Lusterbehang. Neben dem Vater arbeiteten meine Schwester, ich und angestellte Arbeiter. Mein Bruder hatte Kaufmann gelernt, übernahm aber den Betrieb nach Vaters Tod. Das dauerte jedoch nur noch einige Jahre. Unsere Produkte, die Glasknöpfe und Lusterbehang, wurden nach 1970 nicht mehr gekauft. Deshalb mußten die Betriebe schließen.“ Herta Linke war seit 1995 mit der Obfrau Herta Mann und mit Herta Keller im Führungstrio der SL-Ortsgruppe Weidenberg. Sie übte das Amt lange aus, wofür sie großen Dank verdient. Zu ihrem Leben heute merkt sie noch an: „Meine Nichten unterstützen mich sehr. Ich war schon mehrmals in der Heimat. Die Nichten waren erst vor kurzem mit mir dort. Wir haben noch entfernte Verwandte daheim. Was hat die Vertreibung der Deutschen den Tschechen gebracht? Ich kann nur sagen, das hätte es nicht gebraucht! Wären wir geblieben, wäre es auch den Tschechen besser gegangen.“
Oblate mit der Schokolade bestrichen, eine zweite Oblate wird daraufgelegt und bestrichen. Das wiederholt man noch dreimal. Dann werden die Ränder bestrichen. Zuletzt gießt man die Schokoladen oben drauf.
durch ein Tuch. Die Suppe ist überaus wohlschmeckend und kräftig.
Heringssalat
Der Hering wird fünf Stunden in Wasser gelegt. Dann wird er abgehäutet, entgrätet und in kleine Streifen geschnitten. Man kocht einige Eier hart, wiegt Eiweiß, Eidotter, Brunnenkresse und Rote Rüben getrennt. Dann werden die Heringsstreifen gitterförmig auf eine flache Schüssel gelegt. In jedes dieser Gitter
gibt man etwas von dem Gehackten, so daß es farbig aussieht, trägt den Salat so zu Tisch und mischt ihn erst dann mit Pfeffer, Essig und Öl. Man kann auch den halben Teil der gehackten Speisen mit der Brühe der Roten Rüben übergießen. So wird das Begossene rosenrot.
Husarenbraten
Lungenbraten salzen und mit Schinken und Paprika belgen, mit Speck zusammenrollen und binden. Man läßt ihn in fein ge-
schnittenem Speck und Zwiebeln anbraten, Wasser oder Brühe angießen. Ist der Braten weich, läßt man Kornbrotbrösel mit Paprika in Fett anlaufen und gießt mit Schmetten und Suppe auf.
Holzknechtknödel
Speck schneiden, am Feuer glasig werden lassen und darin gewürfelte Semmeln und gehackte Zwiebeln gelb rösten. Inzwischen wird aus Mehl, Milch und Salz ein Teig abgeschlagen. Die erkalteten Semmelwür-
fel und gehackte Petersillie kommen hinzu. Dann Knödel formen und kochen.
Karlsbader-Oblaten-Torte
Man gibt 140 Gramm geriebene Schokolade und sechs Eßlöffel lauwarme Milch in einen Topf und erwärmt dies langsam. Man verquirlt zwei Dotter und rüht zwei Gramm Vanillezucker und 140 Gramm Butter in die Schokolade. Das alles läßt man heiß werden und rüht so lange, bis die Masse glatt wird. Dann wird eine
Heidelbeersaft
Heidelbeeren kochen und sieben. Den Saft mit Zucker und etwas Wasser kochen. Auf zwei Liter Saft kommt ein halbes Kilogramm Zucker.

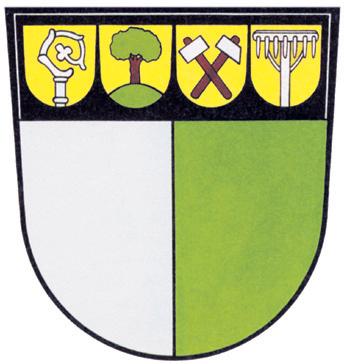



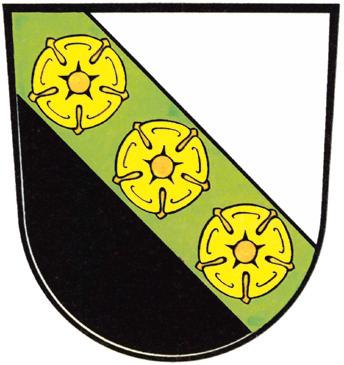

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
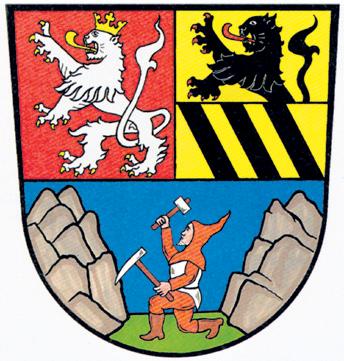
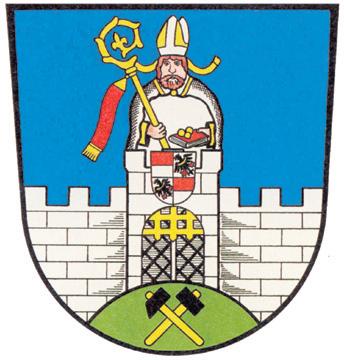

Der erste Tagungsabend im Hotel der Brauerei Monopol in Teplitz-Schönau.
Unsere Korrespondentin Jutta Benešová nahm an der deutschtschechisch-polnischen Wissenschaftlichen Tagung „Vertriebene, (Heimweh-)Touristen und ‚Neusiedler‘ in den Grenzgebieten der DDR, der Tschechoslowakei und der Volksrepublik Polen“ Anfang Juni im Hotel der Brauerei Monopol in TeplitzSchönau teil. Sie berichtet über ihre Eindrücke.
Als mich der sächsische Journalist Steffen Neumann fragte, ob ich Interesse an dieser Konferenz hätte, sagte ich natürlich zu. Welch interessantes Thema! Die Tagung hatte der Verein Deutsche Gesellschaft (DG) in Kooperation und mit Unterstützung der Euroregion Elbe-Labe organisiert. Am ersten Abend sprach nach einer Begrüßung durch die Hauptorganisatoren Steffen Neumann von der Euroregion Elbe-Labe und Vincent Regente, Historiker und Leiter der DG-Abteilung EU & Europa, Kristina Kaiserová, Historikerin an der Purkyně-Universität inAussig, über den DDR-Entertainer Lutz Jahoda. Aus meiner Jugendzeit in der DDR kannte ich Jahoda, über sein Leben wußte ich aber nur wenig. Ein anschließender Film, den Sat 1 ausgestrahlt hatte und der für die Konferenz gekürzt worden war, berichtete über die Vertreibung und das Schicksal einiger Zeitzeugen in den Nach-
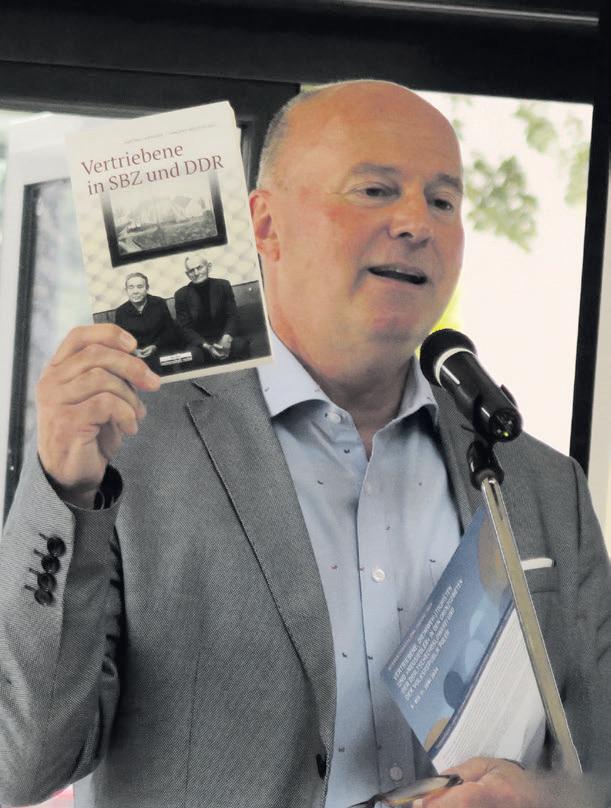
kriegsjahren. Das war schon ernstere Kost nach Jahodas Wienerliedern und gab eine Einstimmung auf die nachfolgenden beiden Konferenztage. Da ich weder Sudetendeutsche noch Politikwissenschaftlerin bin, kann ich über diese Konferenz nur meine persönlichen Eindrücke schreiben. Nach über 40 Jahren Anpassung an ein Leben in der Fremde kann ich aber beim Thema „Heimweh“ mitreden. Als Korrespondentin des Heimatrufs in der Sudetendeutschen Zeitung sind mir auch die zahlreichen deutschen Organisationen, Heimatkreise und Vereine mit ihren grenzüberschreitenden Bemühungen um Versöhnung und Verständigung bekannt. Gleichzeitig erkannte ich dank zahlreicher privater und offizieller Kontakte mit tschechischen Freunden in den langen Jahren, daß es für die Kriegsereignisse des 20. Jahrhunderts nicht immer nur eine Wahrheit gibt. Diese von der DG organisierte Tagung in Teplitz war eindeutig eine deutsche Veranstaltung, die auch den deutschen Minderheiten in der Tschechischen Republik und Polen gewidmet war. Dazu gehörten auch Beiträge von tschechischen und polnischen Wissenschaftlern, die ihre Tätigkeit auf die genannten Themen der Tagung richten und ihre Studien oft auch aus deutschen Quellen schöpfen. Über-
rascht hat mich an diesem ersten Tag im kleineren Kreis die Herzlichkeit der Menschen, die spontanen Gespräche und Begrüßungen. Erhard Spacek, Heimatkreisbetreuer von Teplitz-Schönau und Vorsitzender des TeplitzSchönau Freundeskreises, dem auch ich als Mitglied angehöre, machte mich mit einigen Personen bekannt, die ich nur dem Namen nach kannte wie
ich bei der Begrüßung am nächsten Morgen von Hartmut Koschyk MdB a. D., DG-Vizevorsitzender und ehemaliger Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Er berichtete von einer ähnliche Tagung 2019 in Leipzig und stellte die entsprechende Publikation dazu vor. So hoffe ich, daß auch von dieser Tagung eine Zusammenfassung erscheint, um noch einmal in Ruhe die einzel-

Dr. Vincent Regente von der Deutschen Gesellschaft und Steffen Neumann begrüßen die Tagungsteilnehmer, und Dr. Andreas Wiedemann spricht über Remigration. ❯ Deutsch-tschechisch-polnische Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft in Teplitz-Schönau
■ Donnerstag, 29. August bis Sonntag, 1. September: 10. Teplitz-Schönauer Heimattreffen. Donnerstag bis 16.00 Uhr Einchecken im Hotel Prince de Ligne am Schloßplatz, dort Abendessen; 19.00 Uhr Abfahrt nach Eichwald zum Festkonzert in der Kirche Santa Maria del‘ Orto.
Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Soborten, dort Besichtigung des alten Jüdischen Friedhofs; Weiterfahrt nach Mariaschein, dort Besichtigung der Wallfahrtskirche der Schmerzhaften Mutter Gottes, Mittagessen im Schützenhaus; Weiterfahrt nach Ossegg, Kranzniederlegung am Denkmal




Dr. Kristina Kaiserová spricht über den aus Brünn stammenden mittlerweile 97jährigen DDR-Entertainer Lutz Jahoda, und Professor Dr. Ira Spieker referiert über „Flüchtling – Umsiedler – Neubürger?“.
Christoph Lippert, ehemaliger SL-Bundesgeschäftsführer sowie sehr reges Mitglied der Akkermann-Gemeinde und der SL, und Margarethe Michel, Kulturreferentin und Stellvertretende Obfrau der SL-Landesgruppe Bayern. Daß diese wissenschaftliche Tagung nicht die erste ist, erfuhr

nen Beiträge durchlesen zu können. Vielleicht wird mir dann auch der Vortrag „Komm mit uns das Grenzland aufbauen! Wiederbesiedelung und neue Strukturen in den Grenzgebieten der böhmischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg“ von Andreas Wiedemann klarer, einem deutschen Historiker aus Prag.
Warum wunderte er sich über die starke sogenannte Remigration 1946 ins Grenzland aus der Prager Region, schließlich hatten nach dem Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich gemäß des Münchener Abkommens zahlreiche tschechische Familien die deutsch besetzten Gebiete verlassen müssen. Offizielle Quellen sprechen hier von rund 140 000 Tschechen. Das erwähnte er in seinem Vortrag nicht. Dazu gehörten vor allem zahlreiche Beamte, die nach der Gründung der Tschechoslowakei 1918 in den überwiegend von Deutschen bewohnten und verwalteten Gebieten eingesetzt wurden, aber auch eine große Zahl von deutschen Sozialdemokraten, die durch ihre antifaschistische Einstellung Repressalien befürchten mußten. Ganz davon abgesehen, daß die jüdische Bevölkerung nach der Anwendung der Nürnberger Gesetze versuchte, sich im tschechischen Inland in Sicherheit zu bringen. Die Juden konnten dann aber, wie bekannt, nach 1945 keine große Rolle mehr bei der Remigration spielen. Dieser gewaltige, erzwungene Bevölkerungsaustausch durch die Vertreibung und Neubesiedelung der Grenzgebiete ist in der Geschichte einmalig, und die oft negativen Auswirkungen einer Ansiedlung von Menschen ohne Bindung an Kultur und Landschaft der „neuen“ Heimat sind noch heute zu spü-

ren und durchaus einer Diskussion wert. Sehr interessant war für mich auch der anschließende Vortrag von Ira Spieker vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden mit dem Titel „Flüchtlinge – Umsiedler – Neubürger? Verortungen zwischen staatlich forcierten Integrationsmaßnahmen und individuellen Adaptionsstrategien“, eine sehr gute Beschreibung der Situation, als bei der Vertreibung der deutschen Bevölkerung eine große Welle von Vertriebenen als erstes in das vom Krieg stark zerstörte Sachsen gelangte. Eine ähnliche Situation entstand damals auch in Thüringen, woher ich stamme, denn auch wir hatten damals unsere Wohnung mit einer „Flüchtlings“-Familie teilen müssen, obwohl unser Mietshaus durch eine Bombe 1944 teilweise zerstört war. Außerdem habe ich die trostlosen Menschentransporte in Erinnerung, die durch die zerstörten Straßenzüge unserer Stadt zogen und vergeblich nach einer Bleibe suchten. Als Kind waren das für mich Bilder, die sich für immer einprägten. Meine Mutter sprach damals von Flüchtlingen aus Böhmen und Schlesien. Im Nebenhaus wurde eine Familie mit fünf Kindern einquartiert –ein sechstes war unterwegs, mit der mich später eine langjährige Freundschaft verbinden sollte. Fortsetzung folgt

des Grubenunglücks vom 3. Januar 1934; Rückfahrt nach Eichwald, Eröffnugskonzert in der Kirche Santa Maria del‘ Orto anläßlich des Eichwalder Stadtfestes, Abendessen und Rückfahrt ins Hotel. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt zum Teplitzer Stadtteil Settenz, Besichtigung der Glashütte Mühlig; Spanferkelessen in der Tuppelburg im Wildgehege Tischau; in Teplitz Besichtigung der Ausstellung „Die sieben Hügel von Teplitz“ in der Schloßgalerie; 19.00 Uhr Abendessen im Stadttheater. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche, anschließend Heimfahrt. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag für drei Übernachtungen mit Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, Mahlzeiten, Besichtigungen Führungen, Konzert im Einzelzimmer 550 Euro pro Person, im Zweibettzimmer 480 Euro pro Person. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Verbindliche Anmeldung durch Überweisung des Reisepreises auf das
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
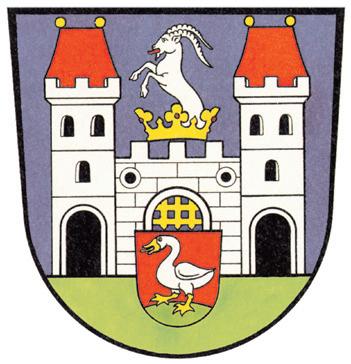

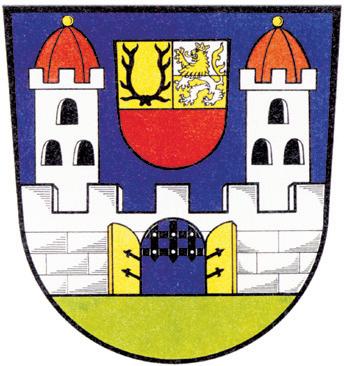
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de





Kellermeister Ottomar Dörrer, Bürgermeister Thomas Ludwig, Bürgermeister Martin Kopecký, Ortsbetreuer Franz Metschl, Oberbürgermeister Dr. Markus Naser mit Gattin Karin, Erster Vorsitzender Ivo
Jelínek und Ehrenbürger Ekkehard Brand mit Birgit.
Es war im Jahr 2013, als die Schüttwaer in ihrer Patengemeinde Seckach in BadenWürttemberg zu ihrem mutmaßlich letzten Heimattreffen zusammenkamen. Mittlerweile lebten nur noch wenige Angehörige der Erlebnisgeneration, und der trostlose Anblick des früheren Heimatortes im Böhmerwald löste auch bei den Nachkommen keine große Begeisterung für ein Weitermachen aus.
Als sich dann zwei Jahre später ein gewisser Ivo Dubský als Erster Vorsitzender des Heimatvereins Spolek Mikuláš bei Ortsbetreuer Franz Metschl meldete und von seinen Plänen berichtete, war man zunächst skeptisch. Zu lange hatte der Dornröschenschlaf schon angedauert, und warum sollten sich Tschechen für den Wiederaufbau einer ehemaligen deutschen Kirche samt Friedhof einsetzen? Doch sie taten dies.
Zuallererst räumten sie den Gottesacker auf, beseitigten das Gestrüpp und stellten die Grabsteine wieder auf. Sodann begannen die jahrelangen Sanierungsarbeiten an der Kirche, von welcher nur noch die Seitenmauern und der untere Teil des Turmes standen. Mit viel Verhandlungsgeschick gelang es Ivo Dubský, das Vertrauen der Verantwortlichen bei der Stadt Ronsperg/ Poběžovice, zu der Schüttwa heute gehört, der Bezirksregierung in Pilsen sowie des DeutschTschechischen Zukunftsfonds in Prag zu gewinnen, um von dort Zuschüsse zu erhalten.
Aber auch die alten Schüttwaer, die 1945 und 1946 ihre geliebte Heimat hatten verlassen müssen, zeigten sich zusehends angetan von diesem außergewöhnlichen Engagement und unterstützen die Maßnahmen in Schüttwa seither nicht nur ideell, sondern auch finanziell. In dieser Einmütigkeit schritten die Baumaßnahmen Schritt für Schritt voran, äußerlich vor allem daran erkennbar, daß der Kirchturm neu verputzt wurde und in der Zwischenzeit auch seine Zwiebel und seine Uhr zurückerhielt. Parallel dazu ging der Heimatverein Spolek Mikuláš sein zweites Ziel an: die Würdigung von Johannes von Schüttwa (1350–1414). Er war einer der wichtigsten deutschsprachigen Prosadichter des späten Mittelalters. Sein um 1401 verfaßtes Werk „Der Ackermann aus Böhmen“ oder „Der Ackermann und der Tod“ berührt auch den heutigen Leser und erschien in mehreren Fassungen als Reclam-Heftchen. Wer heute nach Schüttwa kommt, entdeckt dort nicht nur
Bischofteinitz Ronsperg Hostau ❯ Schüttwa
Schon seit knapp einem Jahrzehnt tut sich in dem kleinen Böhmerwalddorf Schüttwa Außergewöhnliches. Der im Jahr 2015 gegründete Heimatverein Spolek Mikuláš/Sankt-Nikolaus-Verein hatte sich damals zum Ziel gesetzt, binnen einer
Dekade die nur noch als Ruine dastehende Ortskirche samt ihrem Umfeld, dem Friedhof, zu sanieren und der Erinnerung an den bedeutendsten Heimatsohn Johannes von Schüttwa ein würdiges Antlitz zu geben. Heute kann mit Bewunderung und Dankbarkeit festgestellt werden, daß diese Versprechen in die Tat umgesetzt wurden und die umfangreichen Arbeiten auf die Zielgerade einbiegen. Das „Wunder von Schüttwa“ verdient seinen Namen aber auch deshalb, weil es ein Zeichen ge-
lebter Völkerverständigung, ja Versöhnung, im wiedervereinten Europa ist. Wo über Jahrzehnte Kriege, Haß und Feindschaft tobten, werden zwischen Tschechen und Deutschen ein gedeihliches Miteinander und echte Freundschaft gepflegt.



das im Jahre 2018 eingeweihte Denkmal für Johannes von Schüttwa, sondern auch fünf zweisprachige Informationstafeln sowie zwölf Kunstwerke aus Sandstein, die im Jahr 2019 im Rahmen eines Bildhauersymposiums entstanden und sich mit dem Hauptwerk von Johannes von Schüttwa beschäftigen. Außerdem brachten junge tschechische Literatur- und Geschichtswissenschaftler ein ebenfalls zweisprachiges Buch heraus, das sich umfassend mit dem Leben, dem Wirken und den Nachwirkungen des Johannes von Schüttwa beschäftigt. Waren schon die seither durchgeführten Baumaßnahmen und Projekte sehr umfangreich und kostspielig, so stellt nunmehr die Dacheindeckung der Sankt-Nikolaus-Kirche einen letzten großen Brocken dar. Dem enormen Verhandlungsgeschick des von Ivo Dubský so-
wie der äußerst tatkräftigen Mitwirkung von Ortsbetreuer Franz Metschl ist es zu verdanken, daß die zuständigen Stellen den vorbildlichen Aktivitäten in Schüttwa auch weiterhin aufgeschlossen gegenüberstehen. Allerdings waren die zur Verfügung stehenden Mittel des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds Ende 2023 nahezu ausgeschöpft, weshalb man sich Gedanken machen mußte, von welcher Seite weitere Gelder kommen könnten. Diese Perspektive ist nun real geworden, denn der Vorstand der Sudetendeutschen Stiftung in München hat kürzlich einen positiven Grundsatzbeschluß gefaßt. Es ist sehr erfreulich, daß damit auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft den Pioniercharakter der Projekte in Schüttwa anerkennt.
Den alten Schüttwaern mit ihren Ortsräten und Ortsbetreuer Franz Metschl sowie der Pa-

tengemeinde Seckach mit Bürgermeister Thomas Ludwig war es schon seit einiger Zeit ein Anliegen, dem herausragenden Engagement der für diese so positive Entwicklung Verantwortlichen auf tschechischer Seite eine passende Würdigung zukommen zu lassen. Die Lösung fand sich in der ehemals Freien Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken, schon seit Jahrzehnten Franz Metschls neue Heimat.
Gelegen an der alten Heeres-, Handels- und Pilgerstraße von Prag und Nürnberg nach Speyer und Metz, hießen die einstigen Vorgänger des dortigen Oberbürgermeisters Markus Naser schon im Mittelalter viele böhmische Fürsten in ihren Mauern willkommen, darunter Kaiser Karl IV. und König Wenzel. Als Historiker mit der Thematik bestens vertraut, ließ es sich Naser nicht nehmen, zu sonntag-
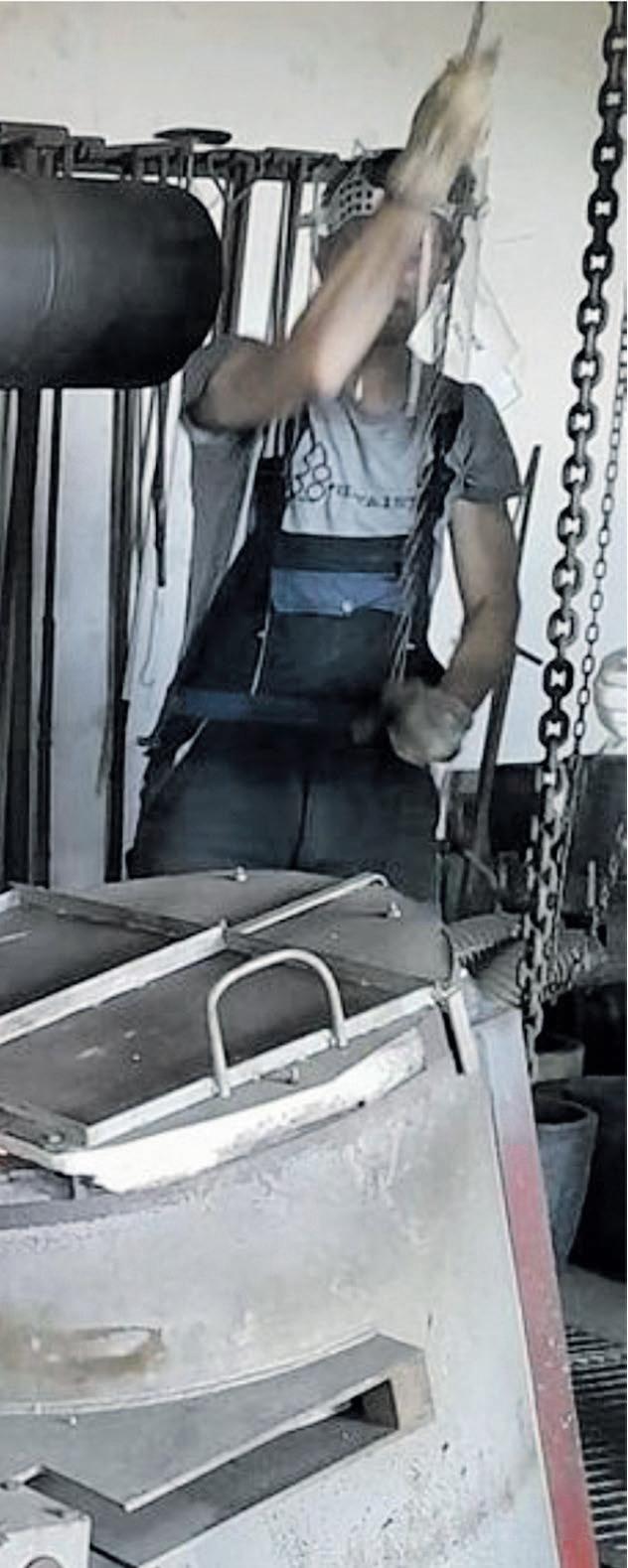
mittäglicher Stunde in seinem historischen Rathaus als Ausrichter dieser besonderen Zeremonie zu fungieren. Zusammen mit seinem Bürgermeisterkollegen Thomas Ludwig aus Seckach und Ortsbetreuer Franz Metschl galt sein besonderer Willkommensgruß dem Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Tomáš Jelínek, dem Bürgermeister der Stadt Ronsperg, Martin Kopecký, dem Ersten Vorsitzenden des Heimatvereins Spolek Mikuláš, Ivo Dubský, sowie dem Ehrenbürger und Bürgermeister i. R. Ekkehard Brand, in dessen Amtszeit die Patenschaft zwischen Seckach und Schüttwa im Jahre 1988 begründet worden war.
In seiner Laudatio bezeichnete es Bürgermeister Thomas Ludwig als „Friedensarbeit per Excellence“, daß sich in Schüttwa unter Führung des weitsichtigen und nimmermüden Ivo Dubský

Geschäftsführer
eine Gruppe von Menschen zusammengefunden habe, die dem Dorf neues Leben einhauchen wolle, und dies ganz bewußt unter Einbeziehung der jahrhundertelang von Deutschen geprägten Ortsgeschichte. Die Mitwirkung und Unterstützung der Kommune sei dafür eine der elementaren Grundvoraussetzungen, weshalb auch dem Bürgermeister von Ronsperg, Martin Kopecký, und dem dortigen Stadtrat aufrichtige Dankesworte gälten. Dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sei es wichtig, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen zu gestalten. Deshalb unterstütze er Ideen, die die deutsch-tschechische Nachbarschaft stärkten und lebendig machten. Die in Schüttwa in den letzten knapp zehn Jahren realisierten Maßnahmen verkörperten diese Ziele mustergültig, weshalb alle Beteiligten dem Fonds für seine maßgebliche Förderung sehr dankbar seien. Kleine Präsente unterstrichen die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung, während Kellermeister Ottomar Dörrer bereits mit dem berühmten Meistertrunk auf die internationalen Gäste wartete. Der Sage nach bewahrte der damalige Altbürgermeister Georg Nusch die Stadt Rothenburg im Jahre 1630 vor der Zerstörung durch die Kaiserliche Armee, indem er einen drei Liter fassenden Humpen Wein auf einen Zug leertrank und damit den obersten Heerführer Feldmarschall Tilly milde stimmte. Dem gemeinsamen Mittagessen schloß sich eine kleine Stadtführung an, bei welcher die gotische Stadtpfarrkirche Sankt Jakob mit ihrem berühmten Heiligblut-Altar von Tilmann Riemenschneider im Mittelpunkt stand. Das „Wunder von Schüttwa“ ging weiter, denn Ende Mai wurde in der Nähe von Tábor in Südböhmen eine neue Glocke für die Sankt-Nikolaus-Kirche gegossen. Sie erhielt eine Inschrift sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch. Die Glockenweihe findet Ende September in Schüttwa statt, wozu der Heimatverein Spolek Mikuláš schon heute recht herzlich einlädt. Interessenten können sich bei Ortsbetreuer Franz Metschl oder der Gemeinde Seckach anmelden; es ist beabsichtigt, Fahrgemeinschaften zu bilden.
Auskunft: Franz Metschl, Kaiserweg 12, 91541 Rothenburg ob der Tauber, Telefon (0 98 61) 39 08, eMail gretl.franz@gmx.net
Impression aus der Glockengießerei kurz vor dem Anstich. Die Masse hat in diesem Moment eine Temperatur von rund 1100 Grad Celsius. Nach drei Tagen ist sie abgekühlt, und dann beginnt die Feinarbeit. Bild: Franz Metschl Dubský, Tomáš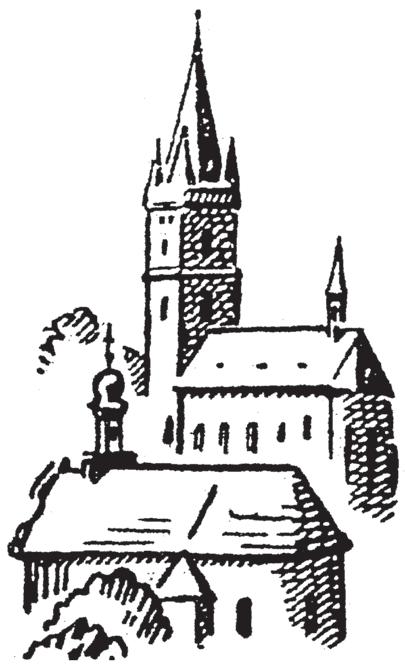


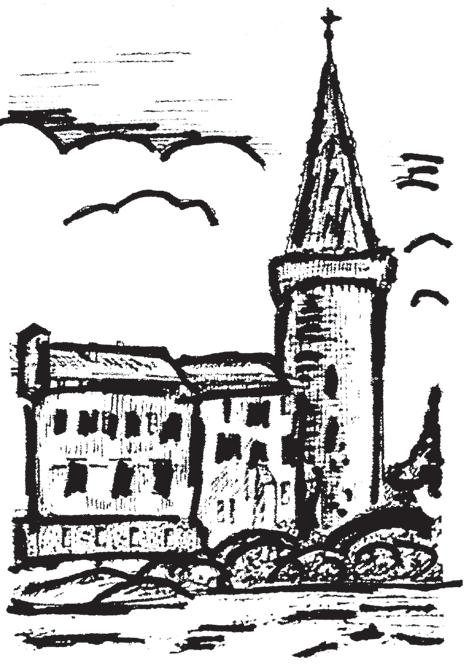
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Am Pfingstsonntag begann die diesjährige Saison der deutschen Gottesdienste in der Haider Loreto einmal im Monat zwischen Mai und Oktober.
Georg Hartl, der Hauptzelebrant und frühere Pfarrer von Waidhaus, freute sich über die 30 Besucher, darunter viele Bekannte, aber auch Neulinge. Die musikalische Begleitung an Gitarre und Harmonium bot diesmal der zweite Zelebrant Peter Fořt aus Graslitz. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines tschechischen Vaters ist er in beiden Sprachen zu Hause und ein wahrhaft lustiger Zeitgenosse. Zum Abschluß zogen alle in einer Sakramentsprozession und gesungener Litanei durch den Umgang ins „Heilige Haus“ zum Schlußsegen. Danach traf man sich in
geselliger Runde zum Austausch bei Kaffee und Kuchen, den das Mesner-Ehepaar Moravec wieder zubereitet hatte. Dank dieses Loreto-Heiligtums mit seiner Wallfahrt besaß die relativ kleine Stadt Haid bereits in der Barockzeit eine überörtliche Bekanntheit – selbst im Ausland. Dies bezeugt eine Serie mit Spielkarten, die geographische Motive zeigen und ab 1765 in Paris in einer Größe von 8,5 mal sechs Zentimeter erschienen. Nicolas de Poilly (1712–1780) hatte sie entworfen und Jean-Baptiste Mitoire (1707–1780) gedruckt. Auf einer dieser Spielkarten erscheint nun als kleinste Stadt auch Haid mit acht größeren Städten in Westböhmen wie Mies, Klattau, Pilsen, Plan oder Taus. Die Karten enthalten ne-
ben den Ortsnamen die Bezeichnung der Flüsse, an denen sie liegen. Wenn deren Name unbekannt war, dann heißt es Ruisseau, französisch für Bach, so auch bei Haid. Angegeben sind die Entfernungen in lieue zur jeweiligen Hauptstadt, für das Königreich Böhmen ist das Wien. Das alte französiche Längenmaß beträgt vier Kilometer. Böhmen hat neun Wert-Karten von zwei bis zehn und anstatt As, König, Dame, Bube jeweils viermal Informationen über die drei Städte Budweis, Eger und Prag sowie allgemein über das Land. Da heißt es auf Französisch: „Böhmen produziert viel Weizen, Safran und sehr wenig Wein, aber dort wird gutes Bier hergestellt, es gibt eine Reihe von Teichen und Flüssen voller Fische, viele Wälder voller Wild, in den

Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz mit Birett, Gitarre und Pfarrer Georg Hartl. Bilder (2): Klaus Oehrlein
Der „Konastoch“, der 24. Juni, war in Ujest ein besonderer Tag. Da war Kirchweih, denn die Dorfkapelle war Johannes dem Täufer geweiht. An diesem Tag feierte der Pfraumberger Pfarrer in der Kapelle einen feierlichen Gottesdienst. Die Dorfbewohner hatten um 1870 diese Kapelle errichtet. Über das Baujahr ist man sich nicht einig, war es 1868, 1869 oder 1875.

Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Ujest 1946 führte zur Verwahrlosung, schließlich zum Verfall und Sturz des Dachreiters auf den maroden Bau. Nach 1990 kamen immer mehr ehemalige Ujester ins Dorf und sahen den Trümmerhaufen. Der Berufsschullehrer Josef Knödl konnte das nicht ertragen und hatte mit wenigen anderen eine Vision: Neubau der Dorfkapelle. Schon Vater Wenzl Knödl hatte als Maurer und Zimmermann am Neubau der Schule in den 1930er Jahren gearbeitet. Am 18. November 1992 gründete man einen Kapellenbauverein. Gründungsmitglieder waren Josef Knödl, Edith und Alfred Meier, Roland Pintzka, Elisabeth Wein, Annemarie Zapke und Thomas Fink. Im selben Jahr wurden die Grundstücksverhältnisse geregelt und die Bodenplatte betoniert. Die Grundsteinlegung erfolgte am 27. März 1993, wie man einer Steinplatte am Sockel der Kapelle entnehmen kann. Josef Knödl hatte als Berufsschullehrer eine völkerverständigende Idee: Schüler und Lehrlinge beider Staaten sollten den Bau gemeinsam errichten. So arbeiteten Lehrlinge des SOU-Betriebes in Heiligen bei Tachau und Königsberg an der Eger, Lehrlinge der Firma Ribecky aus Mies und der Firma Hubasek aus Hollezrieb mit Schülern der Berufsschule Gunzenhausen aus dem Bereich Bautechnik und Holztechnik unter ihren Lehrern Knödl, Schäble, Lutz, Lohnert und Magg für das gemeinsame Projekt. Die tschechischen Schüler mauerten und verputzten den Bau außen und innen, die Gunzenhausener bauten den Dachstuhl mit eingebautem Glokkenturm, den die Tachauer
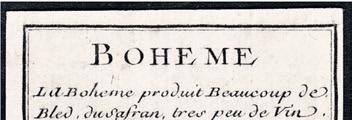


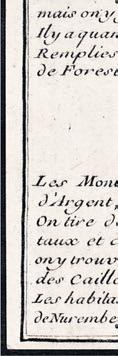
verblechten. Die Glocke spendete der Kapellenbauverein Steudach bei Erlangen. Die Fenster und die Kapellentüre wurden wieder in Gunzenhausen gefertigt und schließlich in die Kapelle eingebaut. Das jeweilige Baumaterial finanzierten Gönner, ehemalige Ujester. Immer wieder wurde in den Reden von einem Zeichen der Hoffnung für eine gute Nachbarschaft sowie von Versöhnung zwischen Sudetendeutschen und Tschechen gesprochen. Pfarrer Vladimír Born (1938–2016) sagte: „Immer wurde von wenigen Verantwortlichen vieles zerstört, was aber viele immer wieder aufgebaut haben. Erst dann ist ein
Bergen gibt es Silber-, Kupferund Bleiminen. Aus diesem Königreich werden Kristalle und bewundernswertes Glas gewonnen, es werden auch Topase und sehr schöne Kieselsteine gefunden, die Einwohner beziehen ihre Waren aus Nürnberg und von den Messen in Leipzig.“

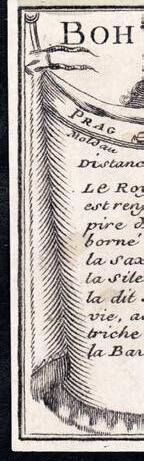




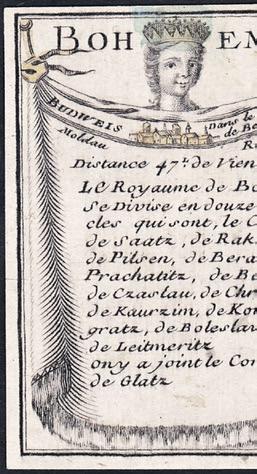
In der Mitte prangt der böhmische Löwe. Bei Prag werden die Länder, die um Böhmen herum liegen, genannt und erklärt, daß es die Hauptstadt des Königreichs Böh-


Ende damit, wenn man es selber will. Gott ist immer da!“
Die Decke der Kapelle bauten die Königsberger ein, ebenso fertigten sie den Altartisch und die Stühle sowie die Kirchenbänke. Das bunte Fenster wurde von einem Prager Glaser gefertigt, das große Kreuz an der linken Wand schnitzte ein Künstler aus Muhr am See, dem Wohnort von Josef Knödl. Die aus Ujest stammende und in Schwarzenfeld ansässige Keramikerin Valerie Schwandner stiftete die drei Reliefs „Taufe Jesu im Jordan“, „Vertreibung“ und „Schutzmantelmuttergottes“. Die alten Fahnen der Kapelle fanden sich in Tachau, wurden restauriert und hängen wieder

■ Samstag, 22. Juni, 10.00 Uhr, Ujest: Festgottesdienst anläßlich 30jähriges Jubiläum der Errichtung der Kapelle Johannes der Täufer. Andreas Knödl, Sohn des Erbauers, lädt alle Ujester, Labanter und Pfraumberger herzlich ein. Auskunft: WolfDieter Hamperl (Kontaktdaten ➝ Impressum oben).

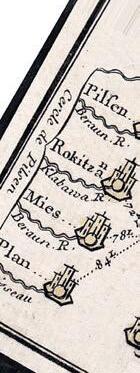
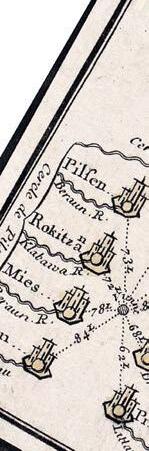


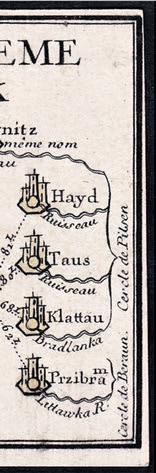

men ist, an der Moldau und 68 lieue von Wien entfernt liegt. Bei Eger heißt es, daß es im Pilsner Kreis am Fluß Eger in 92 lieue Entfernung zu Wien liegt. Weitere größere und kleinere Flüsse des Landes werden genannt. Über Budweis erfährt man, daß es im Bechiner Kreis an der Moldau und 47 lieue von Wien entfernt liegt. Außerdem werden die zwölf historischen Kreise Böhmens aufgelistet sowie die bis 1763 zu Böhmen gehörige Grafschaft Glatz. Mit diesen Karten wurde vermutlich die gesamte bekannte Welt beschrieben, allerdings in sehr unterschiedlicher Detaillierung: Frankreich am ausführlichsten, Europa ziemlich genau, der Rest der Welt sehr pauschal. Bekannt sind mindestens 22 Regionen von Frankreich, 46 europäische Länder und vier Kontinente. Und unter all diesen findet sich – vor 250 Jahren – bereits auch das kleine Haid. Klaus Oehrlein
in der Kapelle. Hinten links steht auf dem Boden die alte große Glocke, die in Pfraumberg in einem Baum hing. Sie ist aus Eisen, Georg Hamperl aus Nr. 46 hatte sie 1918 gestiftet. Die kleine Glocke von „Stör“ ist verschwunden.
Am 25. Juni 1994 weihten Monsignore Vladimír Born und Pfarrer Josef Kern die fertige neue Johannes-Kapelle feierlich ein. 400 Personen nahmen an dieser denkwürdigen Feier teil. Drei Kinder aus Ujest wurden nach dem Gottesdienst getauft, die ersten Christen im Ort. Am 30. Mai 1997 heiratete Christine, die Tochter von Edith Meier, ihren fränkischen Mann hier. Edith Meier, die die Kapelle seit ihrer Weihe wie eine Mesnerin betreut, sagt, daß die einheimische Bevölkerung die Kapelle immer

■ Samstag, 6. Juli, 10.00 Uhr, Altzedlisch: 34. Heimatgottesdienst des Kirchsprengels, anschließend Treffen im Pfarrhaus. Auskunft: Sieglinde Wolf, Wettersteinstraße 51, 90471 Nürnberg, Telefon (09 11) 81 68 68 88.
■ Sonntag, 21. Juli, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
■ Freitag, 26. Juli, 14.30 Uhr, Bruck am Hammer: Festgottesdienst zum 34. Jakobifest nach der Wende mit Pfarrer Dr. Jiří Majkov aus Plan und dem Brukker Bürgermeister Eric Mara. Anschließend Friedhofsgang und Begegnung im Gasthaus. Anmeldung: Ingrid Leser, 95671 Bärnau, Am Galgen 1, Telefon (0 96 35) 3 29, eMail leser. baernau@t-online.de

mehr als ihre Kapelle bezeichnet. Ein gutes Zeichen, denn wir Egerländer werden weniger. Der Bau der Johannes-Kapelle in Ujest sprengte damals die Ortsgemeinschaft. Ortsbetreuer Anton Roppert (Lenkerer), Josef Frank (Pfraumberger Nachtwächter) und Josef Knödl konnten sich nicht einigen. Josef Knödl hatte aber die Zeichen der Zeit erkannt und in die Zukunft gearbeitet. Wenn wir uns am 22. Juni wieder am Konasfest in Ujest treffen, dann widerlegt das den Satz von Edvard Beneš: „Laßt drei Generationen vergehen, und niemand wird sich an die ehemaligen Bewohner erinnern.“ Daß ich diesen Artikel schreiben konnte, verdanke ich einem Besuch von Andreas Knödl, Sohn des 2011 verstorbenen Josef Knödl. Er brachte Vereinsmaterial und Fotos, und wir hatten schöne Gespräche. Danke! Wolf-Dieter Hamperl





Heimatkundliches Mitteilungsblatt für die Vertriebenen aus dem Isergebirge/Organ des Gablonzer Heimatkreises e.V. Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail isergebirge@sudeten.de


Bilder: Torsten Fricke
Auch beim HEIMAT!abend des Sudetendeutschen Tages am P ngstsamstag begeisterte Mauke – Die Band. Der italienische Bademeister, dem die Blicke der Frauen gelten, und der Renteneintritt eines Bäckers wurden genauso besungen wie die letzten verbliebenen 66 Haare auf dem Kopf – meisterhaft gedichtet auf Roland Kaisers „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ Wer den Auftritt nacherleben möchte, ndet ihn auf dem Youtube-Kanal der Sudetendeutschen Landsmannschaft: https://www.youtube. com/@Sudeten
❯ Geschichtsstunde bei der Jungen Generation in Schwabach
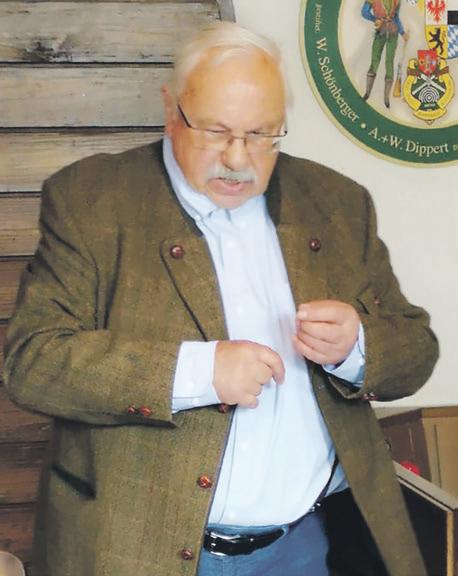

Der Nachkomme einer böhmischen Glasschmuckfabrikantenfamilie, Dr. Dieter Piwernetz, referierte in Schwabach bei der SL-Ortsgruppe Junge Generation über das böhmische florierende Glas- und Schmuckwarenindustriegewerbe. Aus seinem angekündigten einstündigen Referat wurden kurzweilige gute zwei Stunden.
Im vollbesetzten Nebenraum des Schießhaus-Gasthauses in Schwabach folgten 30 Interessierte seiner spannungsvoll aufgebauten Geschichtsstunde.
Beginnend bei natürlichen Glasperlenfunden über die Beherrschung von künstlicher Glasherstellung und Weiterverarbeitung bis zur Vollendung von beachtenswertem Modeschmuck wurde ein großer Bogen aufgespannt. Der Referent zeigte die Vielfalt der mit der Glasherstellung, Glasverarbeitung und Glasveredelung befaßten Handwerker, wie zum Beispiel die Glasdrucker, Glas- und Glasteinschleifer, Glas-Maler und Versilberer sowie die Bandbreite der Bijouterie-Industrie. Dazu die notwendigen Berufe der Graveure, Formenschlosser, Werkzeugmacher und Gürtler.
Schwerpunkt dieser Handwerkskunst in Böhmen war Gablonz im Isergebirge. Es war die mit großer Perfektion hergestellte Imitation von Edelsteinen aus gefärbten und geschliffenen Glasrohlingen, die zu großem Exporterfolg geführt hat. Dr. Dieter Piwernetz schilderte anhand einer großen schweren geschliffenen Glasschale die Kunst der Hohlglaserzeugung und die Kunst des Glasschleifens gewölbter und fassetierter Flächen. Die mittelständischen Familien und mittelständischen Betriebe arbeiteten gut zusammen. Große Gewinne erzielten jedoch der Handel und die Exporteure der Waren in die Welt, vor allem nach Indien, Afrika und
De Posseltn kimmt ei ann Blumlodn und soht, dos se a Blumsteckl fr ann Gebortstag brauchn täte. De Vrkejfrn zeigt r su ollrhand odr dr Possltn tutt nischt ne gefolln. Drnou sitt se ei ar Ecke a poor siche Bonsai-Bejml stiehn, wie se de Japanr ei Moude honn. Se mejnt: „Nej, die sein odr hibsch … wos is denn dos?“ Dou soht de Vrkejfrn: „Ja, wissen Sie, das sind Bonsai-Bäumchen, die können bis zu 200 Jahre alt werden.“
„Wie hejßn die? Ponsei? Kenn iech ne, obr hibsch sein se. Und die warn 200 Juhre aalt? No alsdann dou nahm iech itze amoul ejs, und drnou warn mr schunt sahn!“ Thomas Schönhoff
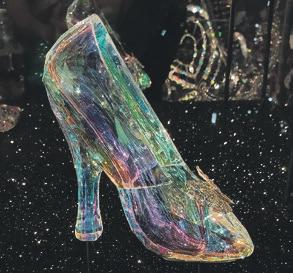
Auch heute noch ist Gablonzer Glas weltbekannt: Dieser Kristallschuh aus der Werkstatt Swarovski wurde für Walt Disneys Cinderella gescha en.
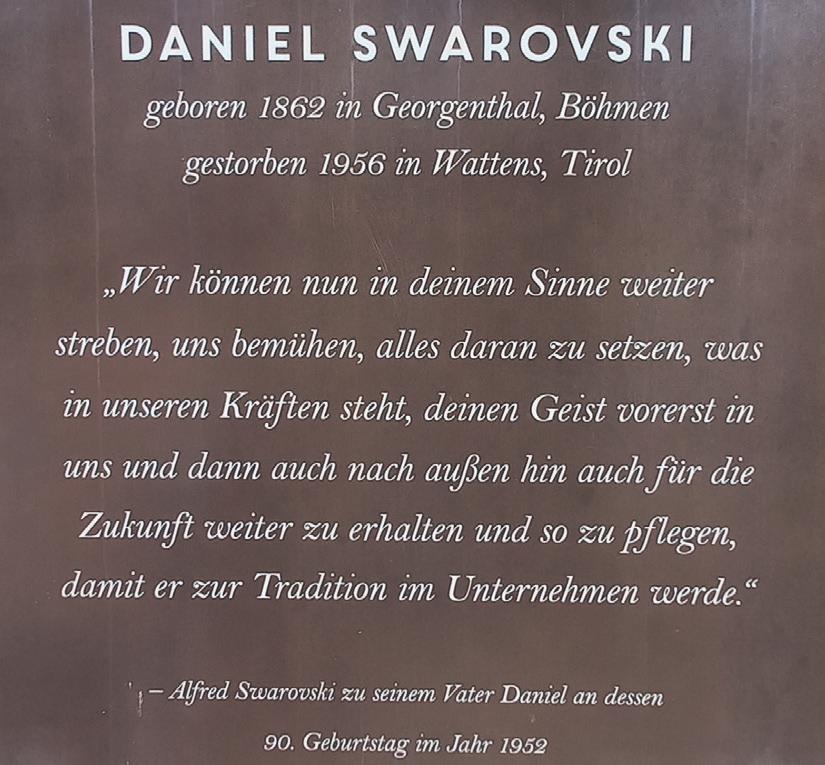
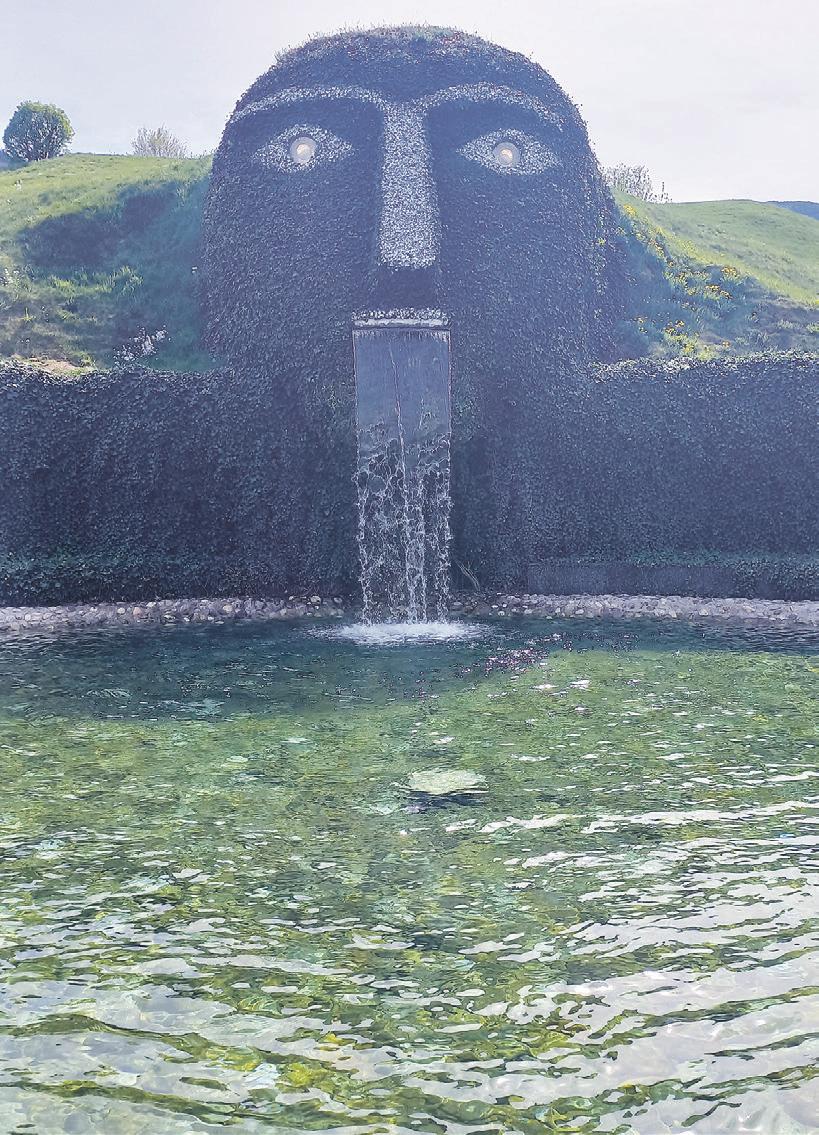
Südamerika, die dem kleinen Handwerker oftmals die Lieferpreise vorgegeben haben.
Ende der dreißiger Jahre lebten immerhin etwa 90 000 Menschen von der Gablonzer Glas- und Schmuckwarenindustrie mit allen beteiligten Gewerben. Der Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich und der folgende Zweite Weltkrieg mit den massiven Exportbeschränkungen brachten die weitgehende exportorientierte Gablonzer Glaswarenindustrie fast gänzlich zum Erliegen. Nach der Vertreibung 1945/ 1946 kamen viele Menschen aus der Glasregion um Gablonz überwiegend nach Bayern und begannen mit dem Wiederaufbau einer neuen Glas- und Schmuckwarenindustrie vor allem in Neugablonz und im Raum Bayreuth in Weidenberg, Warmensteinach und Fichtelberg. Dabei fanden sie Unterstützung von weitsichtigen Politikern der Bayerischen Staatsregierung.
Es war nicht leicht, geeignete Gewerbegelände mit passender Infrastruktur und Wohnungsbaugebiete zu finden. Doch bereits 1951 konnten in Weidenberg 53 Betriebe mit der Produktion von Modeschmuck und GlasGebrauchsgegenständen neu anfangen.
Der Export mußte mühsam wieder aufgebaut werden, die Vorkriegserfolge konnten jedoch nicht mehr erreicht werden. Ende der 1960er Jahre wurde der arbeitsintensive Glasschmuck allmählich von den viel billigeren Kunststoffprodukten verdrängt.
Der großartige Anteil der heimatvertriebenen Sudetendeutschen am Wiederaufbau der Industrie in Bayern und die Schaffung von Arbeitsplätzen in einem bis dahin in Bayern unbekannten Industriebereich bleiben unvergessen.
■ Polaun. Wir gratulieren allen Polaunern, die im Juli geboren sind, auf das Allerherzlichste zum Geburtstag. Hans Pfeifer Ortsbetreuer
■ Labau-Pintschei. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 94. am 20. Helga Donth/Bachmann in Roth; 92. am 14. Helmut Swarovsky in Tanne-Harz; 89. am 29. Oskar Hübner in Kaufbeuren-Neugablonz; 88. am 2. Edith Schimpelsberger/Priebsch in Kremsmünster (Österreich); 85. am 21. Ingeborg Fischer/ Schröder in Kaufbeuren-Neugablonz; 83. am 1. Dagmar Seliger/Kutscher in Heilbronn und am 27. Walter Tomesch in Schwäbisch Gmünd; 80. am 14. Christa Hirschner/ Tomesch in Korb-Remstal und am 17. Monika Bernt/Hannich in Ottobrunn; 77. am 14. Peter Seidel in Kaufbeuren-Neugablonz; 73. am 2. Franz Zhorzel in Kaufbeuren-Neugablonz; 61. am 27. Andrea Tomesch in Fürth; 57. am 18. Heike Dietrich/ Rohner in Kaufbeuren; 50. am 22. Nicole Castro-Hübner/Hübner in KaufbeurenNeugablonz; 13. am 29. Dominik Theileis in Lamerdingen. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Dalleschitz. Die Ortsgemeinschaft gratuliert am 16. Juli Heinz Lejsek in Langenhain zum 85. Geburtstag. Hans Theileis
■ Marschowitz. Die Ortsgemeinschaft gratuliert zum 91. am 25. Edeltraud Hübel/ Hübner in Kiefersfelden; 89. am 31. Edeltraud Bittner/ Weiss in Schwäbisch-Gmünd. Hans Theileis Ortsbetreuer
■ Gablonz. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 87. am 17. Dr. Gerhard Mewald in Schwäbisch Gmünd; 84. am 14. Felicitas Gürtler/ Hübner (Talstraße 39) in Mannheim; 78. am 24. Erich Kiesewetter (Wiener Straße 93) in Neu-Ulm; 92. am 4. Heinz Müller (Rollgasse 6) in Kaufbeuren; 55. am 6. Ortsbetreuer Thomas Schönhoff (Wiener Straße 56) in Neugablonz.
■ Johannesberg. Die Ortsgemeinschaft gratuliert am 15. Juli Rudi Kettner in Neugablonz zum 66. Geburtstag.
■ Kukan. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 83. am 11. Edith Voigt/Bernhauser in Augsburg und am 27. Helga Dieter/Hoffmann in Kaufbeuren; 94. am 15. Anneliese Pilz/Triola in Berlin.
■ Neudorf. Die Ortsgemeinschaft gratuliert am 11. Juli Kurt Kiesewetter in Thale zum 84. Geburtstag.
■ Maxdorf. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 84. am 21. Christl Zimmermann; 85. am 21. Gerda Stumpe/ Bönsch in Westendorf und am 29. Gerda Miksch/Posselt; 90. am 6. Selma Prediger/Görner in Schwandorf.
■ Radl. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 86. am 7. Peter Brosche (Kohlstatt) in Augsburg; 90. am 10. Karl-Heinz Schreiber.
■ Reichenau. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 74. am 24. Linda Kindermann/ Effner; 95. am 30. Ilse Umlauf/Lorenz.

In den Kristallwelten im Tiroler Wattens kann man die ganze Kunst der aus dem Isergebirge stammenden Glasmacher bestaunen. Bilder: Kathrin Ho mann
■ Bad Schlag. In Neugablonz verstarb im Mai Karl Leininger im 96. Lebensjahr. Er war der Ehemann von Traudl Leininger/ Richter aus Bad Schlag, an deren Seite er im Neugablonzer Friedhof beerdigt wurde. Um ihn trauern seine Töchter Hannelore und Elke mit Familien.
■ Reichenau. In Kaufbeuren verstarb am 11. Mai Erika Mang/Schlenz aus Reichenau im 95. Lebensjahr betrauert von ihrem Sohn Walter mit Familie. Thomas Schönhoff Ortsbetreuer
Bitte teilen Sie Sterbefälle Ihren Ortsbetreuern mit, damit diese hier darüber berichten können.
Die erfolgreiche Gablonzer Glas- und Schmuckwarenindustrie mit ihrer langen Tradition im Isergebirge ging zu Ende. Die Erinnerung an diesen Industriezweig sollte nicht nur in Museen wachgehalten werden.
Die aufmerksamen Zuhörer spendeten großen Beifall, und Ortsobmann Manfred Baumgartl bedankte sich für diesen professionalen freien Vortrag auf das herzlichste.
■ Bis Sonntag, 8. September, Isergebirgsmuseum Neugablonz: NEUgablonz24 –Mensch, Leben, Heimat. Ausstellung mit Fotografien und Geschichten von Erika Fischer und Kees van Surksum.
■ Isergebirgsmuseum
Neugablonz – Angebote für Kinder:
Mittwoch, 31. Juli: Schmuckbasteln mit Perlen aus Neugablonz.
Mittwoch, 7. August: Holzperlendekoration. Mittwoch, 14. August: Windspiel.
Mittwoch, 21. August: Schmuckbasteln mit Perlen aus Neugablonz.
Mittwoch, 28. August: „Die
kleine Hexe“ von Otfried Preußler, Lesung mit Bastelangebot. Jeweils 10.00–11.30 Uhr, Materialkosten: 3 Euro. Isergebirgsmuseum Neugablonz, Bürgerplatz 1, Kaufbeuren-Neugablonz. Anmeldung erforderlich per eMail verwaltung@ isergebirgs-museum.de oder telefonisch Dienstag bis Sonntag ab 12.30 Uhr unter (0 83 41) 96 50 18. ■ Sonntag, 4. bis Donnerstag, 8. August, Gablonz: Busfahrt nach Gablonz und ins Isergebirge. Unterkunft in Gablonz, Ausflüge nach Kloster Ostritz (Bild) und Oybin. Abfahrt: Neugablonz, Zustiege an der Strecke möglich. Auskunft: Thomas Schönhoff, Telefon (0 83 41) 6 54 86, eMail tomgablonz69@gmail.com
■ Albrechtsdorf. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 88. am 7. Hannelore Nehrkorn/Jäger in Thale-Westerhausen; 83. am 26. Karin Hladik in Neugablonz.
■ Antoniwald. Die Ortsgemeinschaft gratuliert am 13. Juli Norbert Fischer in Steyr (Österreich) zum 81. Geburtstag.
■ Friedrichswald. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 80. am 17. Monika Bernt in Ottobrunn; 84. am 21. Christa Bamberg/ Streit; 90. am 9. Inge Gernrot/Streit und am 1. Hilda Haubner/Krause in Neugablonz; 72. am 20. Renate Renger/Usler.
■ Reinowitz. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 93. am 17. Lotte Dornacher/ Fuchs in Neugablonz; 83. am 9. Renate Hübner/Jäger in Neugablonz; 79. am 13. Helga Wabersich/ Schwertner in Germaringen.
■ Bad Schlag. Die Ortsgemeinschaft gratuliert am 7. Juli Ingrid Koch/Zimmermann in Kaufbeuren-Neugablonz zum 85. Geburtstag.
■ Seidenschwanz. Die Ortsgemeinschaft gratuliert im Juli zum 83. am 9. Meta Bergmann/ Brückner in Neugablonz; 86. am 2. Helga Winterhoff/ Zemann; 81. am 18. Gerlinde Schrott/ Hartig; 79. am 5. Renate Hubrik/Posselt. Thomas Schönhoff Ortsbetreuer

Bild: https://www.jonsdorf.de/service/region/kloster-st-marienthal-in-ostritz/

Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail sternberg@sudeten.de
Passend zum Artikel über die Bedachung des „Museums am Wassertor“ nochmals zur Auffrischung die fünf Neustädter Stadttore, wobei ein Teil des Pförtl-Stadttores das heutige Stadtmuseum beherbergt.
Das Schönwälder Stadttor an der Nordseite der Ringmauer war wohl das prachtvollste Stadttor und bestand aus drei Türmen, dem höheren Innenturm (zwischen Schönberger Gasse Nr. 28, Dr. Otto Langer, und Nr. 26, Navratil), dem mittleren (bei Haus Nr. 30/31, Federle/Fehr) und dem äußeren Turm (bei Haus Nr. 39, Schischma). Der höhere Innenturm war in der Ringmauer eingebunden und hatte oben einen durchlaufenden Balkon, ein Satteldach und vier Spitztürmchen als Statussymbol für die „königliche Stadt“. Der mittlere kleinere Torturm und der gleichhohe äußere standen zu beiden Seiten des Wallgrabens, dessen Ufer durch eine Zugbrücke verbunden war. Zum Stadttor gehörten das ehemalige Wachthaus zum mittleren Turm (Haus Nr. 27, Schischma), das ehemalige Wachthaus zum äußeren Turm (Haus Nr. 29, Thöndel) und das ehemalige Gemeinde-Konsumhäusl (Haus Nr. 35, Schischma). Das Ende des Schönwälder Stadttors kam 1863, als am 6. Mai ein Blitzschlag im Wohnzimmer oberhalb der Torwölbung des Innenturms das Brautpaar Johann Kauer und Therese Türck tötete.
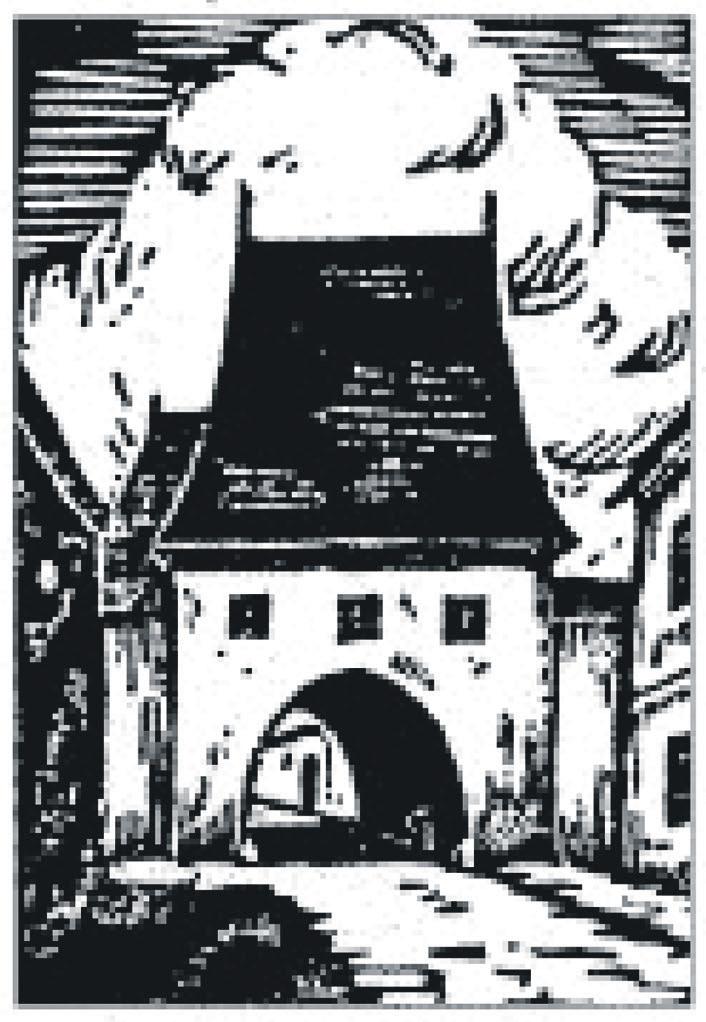
NEUIGKEITEN
Wie ihr wißt, konnten wir ab 1970 im Limburger Schloß zwei Räume als Heimatstube nutzen, was für uns seelisch sehr wichtig war. Wegen eines Wasserschadens Anfang 2010 kamen unsere Exponate ins Limburger Stadtarchiv, wo sie bis heute lagerten. Nach langer kritischer Prüfung, also keiner Spontanentscheidung, sind sie jetzt an ihren Ursprungsort nach Mährisch Neustadt (heute Uničov) zurückgekehrt. Die Zeit war meines Erachtens reif dafür. Im Museum von Mährisch Neustadt werden sie einen liebevollen und würdigen Platz bekommen, und die Stadt Uničov wird damit die Erinnerung an die deutsche Vergangenheit wachhalten. Jetzt haben nicht nur, aber vor allem, die Sudetendeutschen und ihre Nachkommen die Möglichkeit, an Ort und Stelle die Wurzeln ihrer Vorfahren zu spüren. Sigrid Lichtenthäler
Einen ausführlichen Bericht bringen wir in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung.


Das einzige erhaltene Stadteingangstor ist das Meedler Tor. Links der Blick durch das Tor auf das Rathaus auf einer historischen Postkarte, rechts derselbe Blick im Jahr 2009. Bild: https://historie.smoula.net/unicov07.html
Daraufhin verkauften die Torbesitzer Anton Scholler, Kürschner, und Ferdinand Roßbrei, Schlossermeister, den Turm an die Stadtgemeinde, die das schadhafte Gebäude noch 1863 zur Verbreiterung der Schönberger Gasse abreißen ließ. Das Meedler Stadttor an der Westseite der Ringmauer wurde 1498 im gotischen Stil aus Steinquadern als Doppeltor erbaut. Der innere Torturm (Müglitzer Gasse Nr. 10, Havran) ist als letzter Überrest der Neustädter Stadtbefestigung heute noch erhalten. In der Torhalle ist das zum ehemaligen Zwinger führende Pförtl noch erkennbar. Der äußere Torturm (bei Müglitzer
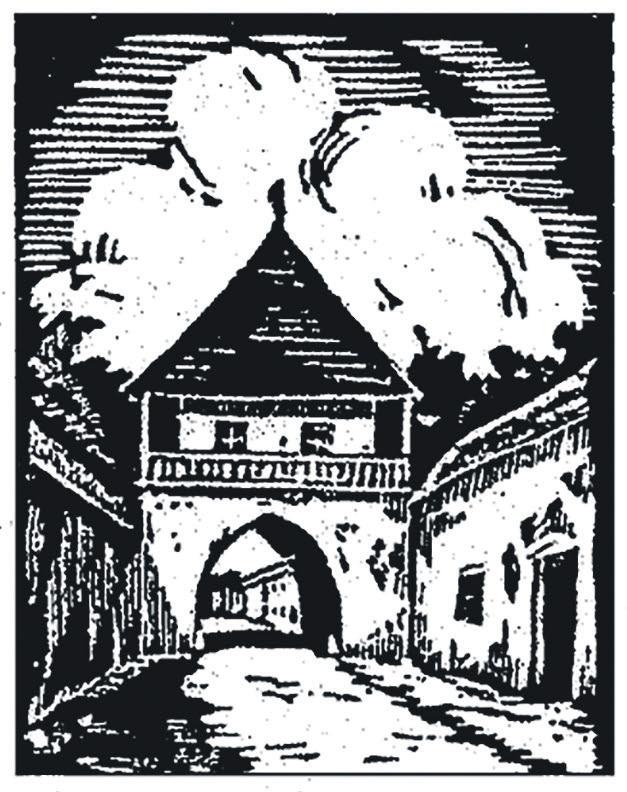
Ehemaliger äußerer Torturm des Meedler Stadttores von 1860, als der Wallgraben längst mit Erde aufgefüllt und die Zugbrücke entfernt war.
Gasse Nr. 17, hinter Jakubeks Tabaktrafik) stand am diesseitigen Ufer des Wallgrabens, der mit einer hochgezogenen Zugbrükke unüberwindbar gemacht wurde. Zum äußeren Torturm gehörte ein Wachthaus (Haus Nr. 16, Tabakfabrik der Jakubin), an das heute noch zwei Gedenksteine erinnern. Außerdem stand noch das ehemalige Gemein-Konsumhäusl (Müglitzergasse 18, Kober, Kauer) davor. Der äußere Torturm des Meedler Tores wurde 1863 im Zuge der allgemeinen Straßenverbesserung wegen Baufälligkeit demoliert. Das Pförtl-Stadttor an der Ostseite der Ringmauer in der Olmützer Gasse in der Nähe des Oskawaflusses gelegen, bestand aus drei gewaltigen Turmgebäuden, dem Pförtl-Turm, dem Kaiser- oder Schwedentrutz-Turm und dem äußeren Wasserturm. Der Pförtl-Turm (Bei Haus Nr. 23, Schlosserei Knefel) hatte seinen Namen von dem Türl neben dem Beobachtungsturm, das den Fußgängern einen Ausgang aus der ehemaligen Klostergasse zur
Ledermühle und nach Zielchowitz sowie den letzten Eingang am Abend nach dem Schließen der Stadttore ermöglichte. Durch den Pförtl-Turm führte damals ein Fußweg, der „Pförtlsteig“. Die heutige Olmützer Gasse als befahrbare Straße entstand erst 1860 nach Abbruch des Stadttores. Der Kaiser- oder Schwedentrutz-Turm (bei Olmützer Gasse 27, Kauer) leitet seinen Namen wohl von dem tapferen Widerstand ab, den die Neustädter 1642 den Schwedenhorden entgegensetzten, und diente als Zeughaus zur Aufbewahrung der Waffen, als Pulverturm zur Unterbringung von Schießpulver und als Wohnung für den Pförtner. Bei Nachforschungen in den zwanziger Jahren wurde hier ein mit dem Stadtwappen und dem
Das Meedler Tor, ehemals inneres Stadttor, erbaut 1498 und heute noch erhalten.
Ehemaliger Pförtl-Turm mit dem Ausgangstürl zur Ledermühle und Oskawa.
In Mährisch Neustadt tut sich was


In der Oberen Alleegasse, nicht weit von der Kreuzung zur Olmützer Gasse, entstand ein neues Haus.
sem Jahr ausnahmsweise einen Monat länger ist, wird der Fliesenbelag komplett erneuert und das Bad einen neuen Anstrich erhalten. Schwerpunkt des Anstrichs wird das künftige Logo des Schwimmbads sein – der auffällige Clown.
Baujahr 1575/1585 verzierter Steinrahmen gefunden. Vom äußeren Wasserturm, der zum Schillerplatz (bei Haus Nr. 2, Tschamler) hin gelegen haben muß, ist wenig bekannt. Überreste der alten Zwingmauer konnte man noch in der ehemaligen Gastwirtschaft Heidenreich, Olmützer Gasse 13, sehen. Das Littauer Stadttor an der Südseite der Ringmauer in der Goeblgasse wurde als Doppeltor ausgebaut, und zwar mit einem inneren (bei Nr. 17, Krist und Nr. 18, Doleschal) und einem äußeren Torturm (Haus Nr. 21, Hubral-Schuster) nebst einer Torwächterwohnung. Vor dem äußeren Torturm stand das ehemalige Gemein-Konsumhäusl (bei Haus Nr. 21, Zohner, Dobisch). Nach dem Abbruch des Littauer Stadttores um 1860 wurde das nach Westen anschließende Teilstück des Wallgrabens mit privaten Fabrikgebäuden überbaut, die zuerst von Vinzenz Nebesky für eine Schafwollwaren-Erzeugung, dann von 1871 bis 1919 vom ehemaligen Bürgermeister Josef Goebl für eine Seidenfabrikation und seit 1919 von der Holzindustrie- und Wagenbau-GmbH, der „Howag“, für die Herstellung von Fahrzeugen genutzt wurde. Die Fabrikgebäude standen in der Olmützer Gasse Nr. 22. Das Pirniker Stadttor an der Nordostseite der Ringmauer, in der Pirniker Gasse gelegen, war das jüngste und unbedeutendste Stadttor; es soll sogar im Dreißigjährigen Krieg zugemauert gewesen sein. Seine erste urkundliche Belegung datiert aus dem Jahre 1587. Das Pirniker Stadttor bestand aus einem einfachen, schwach befestigten Torturm (bei Pirniker Gasse 5, Zemsly) und mußte um 1860 der Straßenverbreiterung Platz machen. Erich Mandel

Ehemaliger Kaiser- oder Schwedentrutz-Turm.
In Mährisch Neustadt entsteht neuer Wohnraum, und die bestehende Infrastruktur wird den Veränderungen angepaßt.
Das Hallenbad in Mährisch Neustadt wird einer Verjüngungskur unterzogen. Während der Sommerpause, die in die-
„Wir werden alles tun, um Anfang September die ersten Schwimmer im modernisierten Bad begrüßen zu können“, so Schwimmbadleiter Jiří Páleník. Aus Sicht der Besucher wird dies die größte Modernisierung des Hallenbades in den fast 19 Jahren seines Betriebs sein. Die Sportanlage wurde im Dezember 2005 der Öffentlichkeit übergeben. Seitdem werden jeden Sommer in der Schwimmhalle verschiedene kleinere Reparaturen oder technische Verbesserungen vorgenommen.


Im Gebiet vor dem ehemaligen Fischteich zwischen der Olmützergasse und Flurgasse werden Familienhäuser gebaut. ❯ Die fünf Neustädter Stadttore
■ Mährisch Neustadt. Wir gratulieren herzlich allen Landsleuten, die im Juli Geburtstag feiern können. Am 1. Emilie Havranek/Leither (Siedlung) zum 86. Geburtstag in Limburg; 3. Martha Schoblocher/Mück (Kirchenplatz) zum 98. Geburtstag in Mosbach; 6. Renate Bauer-Mehren/ Schrimpl (Schönberger Gasse) zum 79. Geburtstag in München; 7. Edeltraud Krumm/Falz (Sternberger Gasse) zum 95. Geburtstag in Freiberg und Edith Wölfli/Niemann (Goeblgasse) zum 83. Geburtstag in Senden; 9. Ursula Marcus/Wepil (Siedlung) zum 79. Geburtstag in Lommel/Belgien; 11. Ordlind Klimesch (Kudlichplatz 1) zum 88. Geburtstag in Schlüchtern-Nied und Franz Steigel (Siedlung) zum 85. Geburtstag in Hohenstein; 14. Elisabeth Zengler/Fork (Olmützer Gasse) zum 89. Geburtstag in Aarbergen; Werner Borsig (Müglitzer Gasse) zum 80. Geburtstag in München und Wolfgang Czerny zum 80. Geburtstag in Schauenburg; 15. Gerlinde Weissleder/Niesner (Untere Alleegasse) zum 86. Geburtstag in Wolfhagen; 17. Alice Pauly/Brandweiner (Olmützer Gasse) zum 88. Geburtstag in Frankfurt und Erwin Wepil (Siedlung) zum 86. Geburtstag in Hünstetten; 21. Eugenie Schwetz zum 95. Geburtstag in Bad Hersfeld; 23. Anni Rustler/Demel (Obere Alleegasse) zum 94. Geburtstag in Raunheim; 24. Sigrid Heck/Zerhau (Flurgasse) zum 80. Geburtstag in Senden und Doris Maier/Heindl (Müglitzer Gasse) zum 80. Geburtstag in Burgau; 25. Dietmar Künschner (Wallgasse) zum 81. Geburtstag in Frankfurt; 27. Helga Seidl/Znaniewitz (Mönchgasse) zum 87. Geburtstag in Affalterbach; Ingrid Ehlig/ Schneider (Feldgasse) zum 82. Geburtstag in Wiesbaden und Ursula Steudter/Mendel (Siedlung) zum 82. Geburtstag in Nersingen; 28. Manfred Schertler (Kirchenplatz) zum 88. Geburtstag in Weinheim; 29. Edith Kandzia/Petzner (Olmützer Gasse) zum 83. Geburtstag in Wiesbaden; 30. Erika Clark/Mück (Siedlung) zum 95. Geburtstag in Oroville/C.A. (USA); 31. Edith Biller/Skacel zum 88. Geburtstag in Mörfelden-Walldorf. Sigrid Lichtenthäler Ortsbetreuerin
■ Deutschhause. Im Juli gehen unsere herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag an folgende Landsleute: am 16. Juli Karl Pluschke zum 83. Geburtstag; am 18. Juli Gerhard Pluschke zum 83. Geburtstag; am 19. Juli Elsbeth Pluschke zum 85. Geburtstag; am 26. Juli Christine Schwarz und Willi Weixler zum 83. Geburtstag; am 27. Juli Alfred Hubel zum 81. Geburtstag. Frank Pluschke Wenn Personen, denen hier zum Geburtstag gratuliert wird, bereits verstorben sind, teilen Sie uns das bitte per eMail mit an sternberg@sudeten.de
Sudetendeutsche
❯ Neues Dach für das Museum am Wassertor
Am Dach des Stadtmuseums (unser früheres Wasserschlößchen) nagte der Zahn der Zeit, und im Frühjahr 2023 begann es stark anzuschwellen. Damit es nicht zu Beschädigungen der Exponate kam, wurde die komplette Ausstellung ins Heimatmuseum von Olmütz ausgelagert. Die Dachreparatur begann gleich nach Ostern und dauert bis Mitte Mai. Weil das Haus ein Kulturdenkmal ist und unter besonderen Auflagen steht, konnte mit der Reparatur nicht sofort begonnen werden. Die benötigten Dachschindeln stellen nur einige Handwerksbetriebe in Tschechien her und – was das Besondere ist – die Schindeln werden für jedes Dach einzeln gefertigt, was nur im Winter möglich ist. Jetzt sind die Schindeln fertig, und man wartet auf stabiles Wetter, damit die Bedachung ausgetauscht oder zum Teil ergänzt werden kann. Auch das Heimatmuseum in Olmütz, das jetzt die Sammlung
des Mährisch Neustädter Museums verwaltet, rechnet mit der Rückgabe der Gegenstände noch vor den großen Ferien. Die deponierten Exponate kommen wegen ihres Zustandes mit nur einigen kleinen Änderungen wieder zurück und werden sogar um einige neue Teile ergänzt. Im Depot fand sich nämlich ein Album mit bisher nicht veröffentlichten Fotos und Arbeiten ehemaliger Museen und mit Scheiden von Schwertern, die momentan zur Reparatur in der Werkstatt sind. Das alles wird dann zusammen mit einer Schwertausstellung gezeigt.
Schindeln sind eine traditionsreiche Bedachung, genutzt seit

Jahrhunderten. Auf eine Holzplatte kommt eine Form, die nur von einer Seite mit Nuten versehen ist. Bis ins 19. Jahrhundert besaßen Schindeldächer meist nur Schlösser, Burgen und Kirchen. Wegen Brandschutzvorschriften wurden sie von Schiefer, später Eternit, verdrängt. Die sogenannten gespaltenen Schindeln werden heute in Handarbeit hergestellt. Ihre Qualität ist sehr gut, und sie sind in etwa so anzusehen wie die aus Holz mit dichten Jahresringen. Man kann die Rundung der Schindel nach Bedarf schneiden. Ein Großstück wird in Viertel geteilt – und die spaltet man weiter in kleinere Teile per Hand oder mit einer speziellen Kneifzange. Danach bearbeitet man die Plättchen in einem Schreinerschraubstock; hier werden sie gespannt und mittels eines Schabeisens mit Rillen versehen. All die Arbeiten müssen mit sauberen Fingern oder einer Kneifzange gemacht werden.

Das „Museum am Wassertor“ gehörte früher zur Stadtbefestigung; die Stadtmauer entstand bald nach Gründung der Stadt und wurde zum ersten Mal in einer Urkunde des Königs Johannes von Luxemburg aus dem Jahre 1327 erwähnt. Das Gebäude des heutigen Museums ist ein Renaissancebollwerk, errichtet in den Jahren 1575 bis 1585. Es diente als städtische Waffenkammer und war als Wassertor Teil der Stadtgrenze. Der untere Teil ist aus Stein, der obere, in dem der Wärter des Wassertors wohnte, aus ungebrannten Ziegeln.
Weil ab 1845 eine Stadtsicherung nicht mehr nötig war, verkaufte die Stadt die Stadtmauer-Steine für den Bau von Häusern. Um das Gebäude der früheren Waffenkammer kümmerte sich lange Zeit niemand. Die Restaurierung begann in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, und 1993 wurde das Gebäude als Stadtmuseum genutzt. Marek Juráň Aus „uničovský zpravodaj“ (Mährisch Neustädter Berichterstatter), März 2024, übersetzt und leicht gekürzt von Sigrid Lichtenthäler.

Abseits vom Verkehr, in einer stillen Gasse, steht sie da, die Minoritenkirche, jetzt Klosterkirche. Die Minoriten, ein Zweig des Franziskanerordens, wirkten im Schul- und Missionswesen und betreuten von Mährisch Neustadt aus auch manche Gemeinde der Umgebung seelsorgerisch.
Das Presbyterium der Kirche stammt von 1330 und ist spätgotisch. Bei einem großen Brand 1505 wurde die Kirche arg beschädigt, verlor das Gewölbe und erhielt stattdessen ein niedriges flaches, dreijochiges, dessen Einfügung die großen spitzbogigen Fenster zum Opfer fielen. Heute vermauert, zeigen sie größtenteils dennoch ihr schönes mit Steinen zugelegtes Mauerwerk.
Ein weiterer Brand 1595 beschädigte Kloster und Kirche wieder, worauf das Kloster von den Ordensmännern verlassen wurde. Im Jahre 1616 zogen, auf Aufforderung des Stadtrates, reformierte Franziskaner wieder ein, und der Mährisch Neustädter Pfarrer wurde aufgefordert, die neue Ansiedlung nach Möglichkeit zu fördern. Aber die Franziskaner verließen den Ort schon nach einem Jahr, und der Stadtrat übergab das marode Kloster 1620 samt Kirche dem aus Polen eingewanderten Minoritenpriester Georg Galanius, der einige Ordensmänner aus Mähren und Österreich herbeiholte, in der Pfarrseelsorge aushalf und seit etwa 1645 auch die Pfarrei versah. Leider wurde er von den Schweden schwer mißhandelt, sodaß er an den Folgen 1650 verstarb. Sein Nachfolger sowie

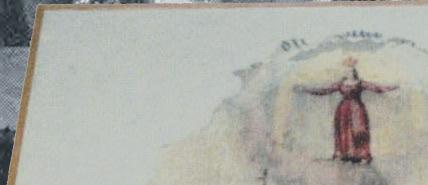

die Ordensmänner unterstützten den Mährisch Neustädter Pfarrer bis 1760 in der Seelsorge, obwohl ihnen dies seit Mai 1662 vom Konsistorium auf strengste verboten war. Der letzte Priester, der bis August 1816 zugleich Stadtkaplan war, wurde zur Minoriten-Stadtpfarre nach Brünn berufen.
Noch 1784 betrug die Zahl der hier lebenden Brüder 25, aber bis zum Jahre 1812 verminderte sie sich auf zwei. Das Kloster wurde 1815 geschlossen – auf Verlangen der Minoritenbrüder, die Mangel an Nachwuchs hatten. In den Jahren 1700 bis 1767, während der Barockzeit, entstanden Keller und Gewölbe im Erdgeschoß, und das ganze Areal wurde um ein zweites Stockwerk erhöht. In zwei Etappen errichtete man dann im Klassizismus den östlichen Hoftrakt und die klassizistische Treppe im westlichen Flügel. Die dem Heiligen Kreuz geweihte Kirche übernahm jetzt der Religionsfonds und ließ sie 1822 mit Schindeln eindecken. Im April 1844 überließ man die Kirche, deren Äußeres seit 1725 nahezu unverändert geblieben war, der Bürgerschaft, die sie zum Gottesdienst der Schuljugend nutzte. Zu diesem Zweck restaurierte man das Gotteshaus mit hohem Kostenaufwand, versah es mit einer Chorstiege und neuer Orgel. Der weiß-gelbe Anstrich und die schönen Seitenaltäre wurden durch Spenden von Wohltätern erneuert. An der Außenseite stellte man ein Kreuz aus Gußeisen auf einem Steinpostament auf. 1831 ging die Kirche an das k. k. Militärknaben-Erziehungsinstitut über, und später wurde sie für die in Mährisch
Neustadt gegründete Unter-Realschule hergerichtet.
Im Juli 1902 sperrte man die Klosterkirche wegen Baufälligkeit, und sie blieb zehn Jahre ungenutzt. Im Jahre 1912 wurde sie nach einer Renovierung wiedereröffnet und diente viele Jahre als Schulkirche der Volks- und Bürgerschulen. Bis 1944 waren im ehemaligen Klostergebäude das Gemeindeamt, das Stadtarchiv und das Heimatmuseum untergebracht.
Von besonderem Interesse ist die an die Südseite des Presbyteriums angefügte Sakristei wegen ihrer gut erhaltenen Fresken. Im großen Deckengewölbe kann man die Fußwaschung bewun-

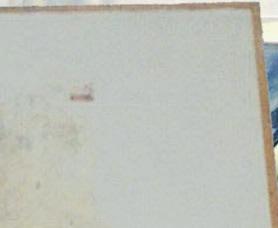
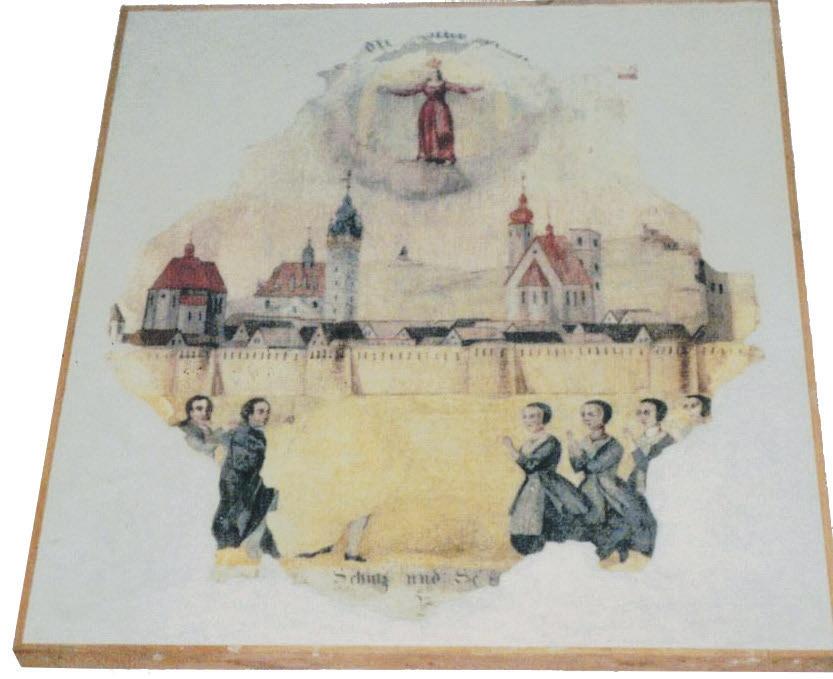
Oben die Klosterkirche mit Kloster, das später als Bürgerschule diente. Links das Mirakelbild, das an einer der Seitenwände hängt.




dern. Die beiden Hauptfiguren, Christus und Apostel, in hervorragender Ausführung, werden dem MährischNeustädter Maler Oderlitzky zugeschrieben. Die kleinen Nebenbilder stehen in künstlerischer Hinsicht dem Großgemälde nach. Die kirchliche Einrichtung ist einfach, doch sind die intarsierten Kirchenbänke, Chorstühle und die Kanzel vorzügliche Arbeiten. Seit 1983 dient die frühere Klosterkirche als Konzertsaal. Der Altar und die Apsis wurden entfernt, das große Altarbild steht jetzt im Altarraum der Pfarrkirche. Die Orgel wurde im Altarraum installiert. Der Raum unter der Empore wurde zu einem Foyer umgestaltet und dient heute als Ausstellungsraum oder Empfangshalle und kann durch Vorhänge vom Hauptraum abgetrennt werden. Die beiden restaurierten Seitenaltäre und die Kanzel blieben erhalten. Die hervorragende Akustik des früheren Sakralraumes wird nunmehr für Konzerte und musikalische Darbietungen von Solisten und Chören genutzt. In der alten Sakristei, die heute als Umkleide- und Requisitenraum dient, sind die schönen Stuckarbeiten und Dekkenfresken frisch restauriert und für Besucher zugänglich. Eine erhöhte Tribüne zwischen dem Kirchenschiff und dem jetzigen Orgelraum rückt die Künstler optisch in den Mittelpunkt. Der Fußboden wurde mit quadratischen und rechtekkigen Steinplatten in einer passenden Maserung ausgelegt. Die ständige Bestuhlung für etwa 130 Personen ist modern gehalten. Das dunkle Holz der Stühle und deren beige Bezüge bilden einen sehr guten Kontrast zu der hell gestrichenen, lichtdurchfluteten ehemaligen Klosterkirche. Sigrid Lichtenthäler
Die Informationen zu dem Artikel stammen von Rudolf Pahler aus der Zeitschrift „Das Neustädter Ländchen“ vom April 1944 und von Aufzeichnungen des Ehepaares Ertl.




Redaktionsschluß: Jeweils der 5. des Erscheinungsmonats. Redaktion: Kathrin Ho mann, Telefon (0 81 04) 88 80 10, eMail zuckmantel@sudeten.de

■ Zuckmantel. Wir gratulieren herzlich allen Landsleuten, die im Juli Geburtstag feiern, und wünschen alles Gute. Zum 98. Rosa Müller/Titze (Niedervorstadt 429) am 31. Juli, Stettiner Straße 9, 74226 Nordheim; 97. Adolf Konrad (FerdinandSeidel- Straße 288) am 30. Juli; 95. Margaretha Prem/Sperlich (Franz-Schubert-Straße 194) am 18. Juli; 94. Hildegard Kunze (Arnoldsdorfer Straße 587) am 25. und Maria Schnaubelt/Grüttner (aus Dürrkunzendorf, Gattin von Alfred Schnaubelt, Miserich 509) am 29. Juli;
93. Ingeborg Schmidt/Förster (Villenstraße 308) am 1. Juli, Köthnerberg 1a, 30989 Gehrden; 92. Margarete Zensch/Lakomy (Bahnhofstaße 304) am 20. Juli , Algatan 7, S-26332 Höganäs (Schweden);
88. Anna Hanke/Schönfelder (Kolonie 430) am 15. Juli, Sommerstraße 5b, 85253 Erdweg, und Elisabeth Braun/Mattner (Gaswerkgasse 318) am 21. Juli, Rubensweg 4, 70736 Fellbach;
87. Dr. phys. Horst Neumann am 7. Juli;
86. Adolf Seidel (Lerchenfeld 17) am 14. Juli;
85. Dr. Robert Thürmer (HansKnirsch-Straße 679) am 15. Juli;
84. Helga Fink/Heisig (Miserich 518) am 1. und Margareta Rathgeber/Härtl (Bahnhofstraße 543) am 1. Juli; Sieglinde Di Risio/König (Geiermühle) am 20. Juli, Karlstraße 114, 76137 Karlsruhe, und Walter Luley (Mutter Emma Luley/Kunert) am 29. Juli;
83. Dr. Eveline Ziesenitz/ Krause (648) am 9. und Georg Doleczik (Lerchenfeld 6) am 26. Juli;
81. Herbert Fläschner (Bahnhofstraße 313) am 31. Juli;
80. Heidelinde Michel/Haage (Obervorstadt 530) am 2. Juli;
78. Kurt Schneeweis (Niedervorstadt 494) am 30. Juli. Rudolf Heider Ortsbetreuer
❯ Goldwaschen heute
Weltmeister werden

Die diesjährige Weltmeisterschaft im Goldwaschen findet vom 19. bis 24. August im Goldgräbermuseum und auf der Rennbahn Zuckmantel statt.
Bereits ab Samstag, 17. August ist die Registrierung als Teilnehmer möglich, am Montag um 17.00 Uhr beginnt das Programm dann mit einer Eröffnungsparade. Neben den Wettbewerben stehen auch Live-Musik, eine Goldgräberhochzeit und ein Spanischer Abend auf dem Programm. Informationen: https:// krajpokladu.cz/wgpch-2024/
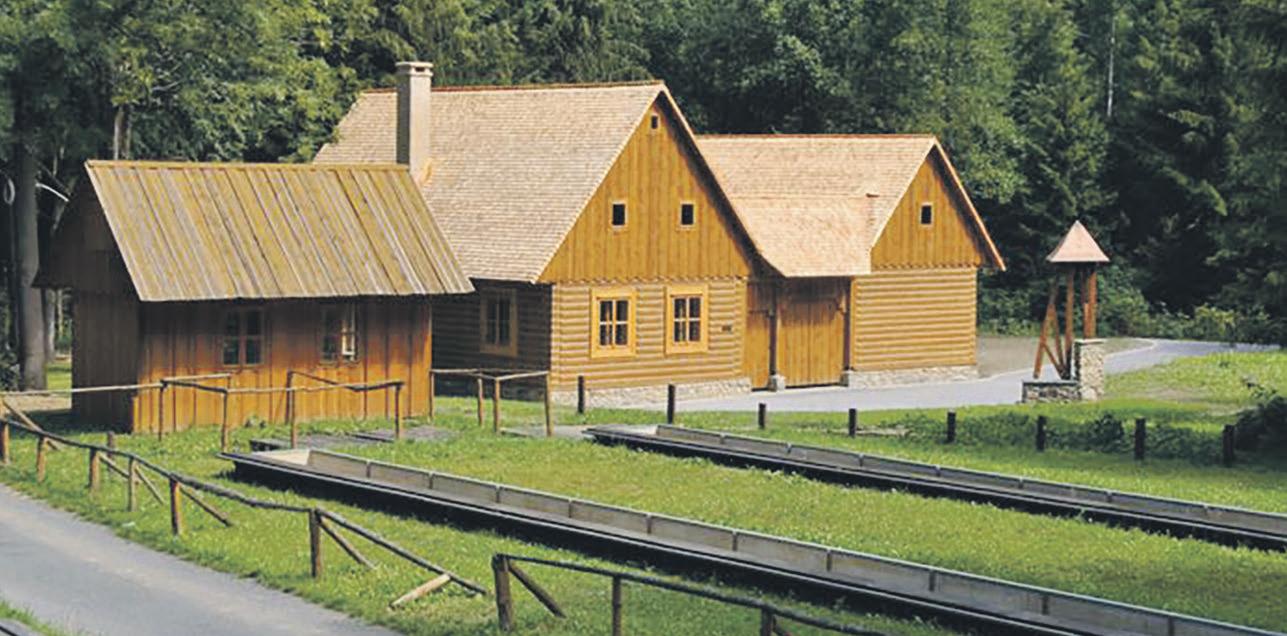
Im Bergbaufreilichtmuseum nden sich getreue und funktionstüchtige Repliken einer mittelalterlichen Goldmühle und eines Pochwerks.
❯ Der Goldbergbau in Zuckmantel und Umgebung
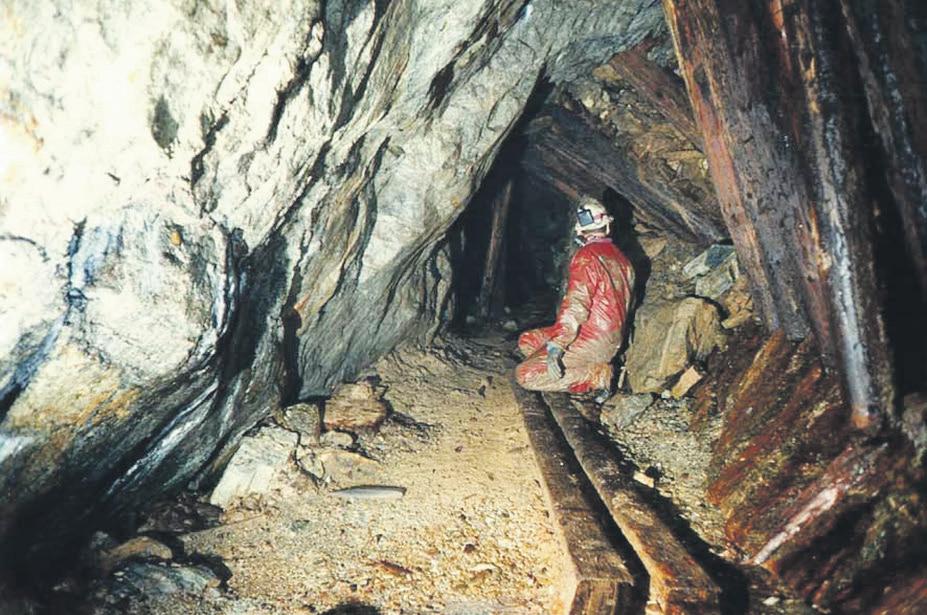
In solchen Stollengängen wurden teils recht große Golderzklumpen gefunden.




Das neue Logo von Zuckmantel, das wir in der letzten Ausgabe vorgestellt haben, berücksichtigt stark die Bergbauvergangenheit Zuckmantels und die Goldvorkommen in der Umgebung. Aus diesem Grund gehen wir in dieser und in der nächsten Ausgabe auf die Geschichte des Goldbergbaus in Zuckmantel und Umgebung ein. Rudolf Heider sandte den Artikel ein.
Die Hussitenkriege trafen Schlesien sehr hart. 1428 wurden die Gmeinden Ottmachau, Ziegenhals, Weidenau, Zuckmantel mit dem Goldbergbau gänzlich geplündert. Gewerbe und Handel lagen völlig danieder.
Das Treiben und Rauben des Rittertums war nicht minder störend für den Bergbau. Denn die mächtige Veste Edelstein thronte am Hackelsberg über Zuckmantel; sie war lange das Exil verurteilter Ritter, und dies war Ursache, daß die Umgebung von unzähligen Fehden heimgesucht wurde, bis im Jahr 1460 der Breslauer Bischof Johann von Rosenberg durch List in Besitz des Schlosses kommen konnte. Er befreite die Gefangenen, führte viele hier gefundene Schätze weg, schleifte das Schloß und setzte sich in den Besitz von Zuckmantel und den Goldgruben des Althackelsberges.
Seinem Nachfolger Bischof Rudolf wurde 1474 der unrechtmäßige Besitz von Zuckmantel mit all seinen Allodien, Waldungen und Bergwerken bestätigt, und dieser erhielt auch durch Abtretung anderer Einkünfte neben einer Summe Geldes vertragsmäßig den Goldbergbau. Von jener Zeit blieb Zuckmantel bis auf den heutigen Tag den Bischöfen von Breslau, und sie wandten alle ihr Hauptaugenmerk auf den Bergbau.
Jedoch mag um diese Zeit der Bergbau eine neuerliche Niederlage erlitten haben, welche aber nicht bekannt ist, denn die Geschichte weist nach, daß der Fürstbischof Johannes V. Thurzo viel Sorgfalt auf die Verbesserung der bischöflichen Güter verwendete. Er ließ die verlassenen Bergwerke wieder bebauen und dies mit gutem Erfolg und erhielt dafür von Kaiser Maximilian 1505 das Recht, Goldmünzen zu prägen unter der Bedingung, neben dem Bildnis Johannes des Täufers auch die Beischrift „Munus Caesaris Maximiliani“ zu setzen. Er starb als Freund der Wahrheit und der Wissenschaften, bedauert 1520. Sein Nachfolger Jakob von Salza erhielt nach dem Tode des
Herzogs von Münsterberg die Oberhauptmannschaft in Schlesien, welche Würde die folgenden Bischöfe zum Nutzen des Fürstentums Neisse bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts beibehielten. Unbekümmert um die Fortschritte, welche die Reformation in Schlesien damals machte, sorgte Bischof Jakob für die Vermehrung des Ertrages der bischöflichen Güter und unterstützte zu diesem Zweck vor allem den Bergbau. Am meisten tat
heiten waren auch auf die übrigen Bergwerke des Fürstentums ausgedehnt und hatten den erwünschten Erfolg. Es zogen aus Mähren und Schlesien immer mehr Menschen hierher, vergrößerten durch Anbau die schon vorhandenen Dörfer oder legten den Grund zu neuen. Mit der Vermehrung der Bevölkerung vervielfältigte sich auch der Bergbau, und von AltHackelsberg bis Ziegenhals wurden die Schächte und Stollen
Martin Gerstmann (Bischof 1574–1585) vermehrte die bischöflichen Einkünfte in der Bergstadt Freiwaldau und den dazu gehörigen Ortschaften dadurch, daß er die von den Herren von Fugger gepachteten Bergwerke, wodurch sich diese große Reichtümer erwarben, 1580 übernahm. Unter seinem Nachfolger Andreas Jerin (Bischof 1585–1596) war der Zuckmantler Obergrümder am blühendsten. Er brachte

dies aber Balthasar III. von Promnitz, welcher nach Jakob von Salza 1539 Bischof geworden war. Er wünschte den Berggegenden mehr Menschen. Da diese aber nur dorthin gingen, wo sie mehr Gewinn erwarten, sollte der Bergbau eine Erwerbsquelle werden. Der Althackelsberg – alter Hackelsberg (schon diese Benennung deutet auf ein hohes Alter des Grümderbergwerks, in dem sie wahrscheinlich von den vorgefundenen Halden des alten Bergwerks hergenommen ist) bei Hermanstadt versprach ihm die meiste Beute; deswegen eröffnete er hier neue Gruben, baute Pochwerke und Schmelzhütten, machte kostspielige Wasserleitungen, wovon noch Spuren zu sehen sind, und erteilte den gegenwärtigen und künftigen Gewerkschaften eine Befreiung und Privilegien 1541. Aufgrund dessen erhielt jedes Gewerke das Recht, sich auf den bischöflichen Gründen niederzulassen, in den Waldungen das zum Bergbau nötige Holz zu fällen, die Märkte des Fürstentums frei zu beziehen und den Gewinn gegen mäßige Abgaben zu benützen. Die Frei-
gegraben, wovon heute noch Spuren zu sehen sind. Die ergiebigsten darunter waren: die alte Grube, der blaue Stollen am Wege nach Hermanstadt, die Schindlerschächte und Kupferzeche und der Dreifaltigkeits-Blei und Erbstollen, welcher letzterer auch Obenweichen genannt, an Gold reiche Beute ergab. Übrigens führte Bischof Balthasar unter dem Neissischen Adel eine neue Lehens- und Landesordnung ein und starb allgemein gesegnet im Jahre 1562. Seine Nachfolger setzten das von ihm begonnene Gut fort und strebten um die Wette, den Ertrag ihrer Güter zu vergrößern, die Verfassung des Landes zu verbessern und den Bergbau zu vermehren. So schuf Kaspar von Logau (Bischof 1562–1574) auf Ansuchen der Städte eine neue Erbfolgeordnung, weil die von Bischof Wenzeslaus vorgeschriebene Gemeinschaft der Güter und die Erbfolge in die Hälfte zwischen Eheleuten dem Bürgerwohl nachteilig empfunden wurde. Auch diese Einrichtungen wirkten nachteilig auf das Bergwerkgseigentum.
Eisen, Blei, Vitriol, und der Erbstollen am Hackelsberge reichliche Spenden an Gold. Zu dieser Zeit wurde unter vielen Stücken gediegenen Goldes ein Stück von sieben Pfund schwer in einem weißen Quarz gefunden. Man fand ferner am 4. August 1590 ein Stück gediegen Gold von dreieinhalb Pfund Breslauer Gewicht und an Wert 355½ fl ungarisch, oder 675 fl 27kc rheinisch, am 20. Mai 1591 ein Stück von 9 Pfd, so auf 456 ¾ fl ungarisch oder 847 fl 47 kc rheinisch geschätzt worden – welche dieser Bischof dem Kaiser Rudolf nach Wien als eine Seltenheit übersandte; und die Gewerkschaft begnügte sich mit einer Abbildung derselben in natürlicher Größe, welche mit dieser Beschreibung heute noch im Zuckmantler Stadtarchiv aufbewahrt wird.
Die Sage, daß auf der Goldkoppe bei Freiwaldau, auf dem Friedeberger Ulrichsberge am Überschar und an anderen Orten auch Gold geraben und gewaschen wurde, machen die Namen der Berge und Bäche, noch mehr aber die vielen verfallenen Gruben, von deren Innerem
die Überbleibsel auf den Halden zeigen, glaubwürdig; daß aber auch um Freiwaldau beträchtliche Eisengruben und Eisenhämmer bestanden haben, wird von den vielen noch vorhandenen Schlackenhalden und mehreren im Freiwaldauer Grundbuch vorhandenen Kaufkontrakten zur Gewißheit erhoben.
So blühte der Bergbau wieder, und das Fürstentum genoß Ruhe und Wohlstand bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Damals war Erzherzog Carl von Österreich Bischof von Breslau. Er versagt dem zum böhmischen König gewählten Friedrich von der Pfalz seine Huldigung; deshalb floh er – verfolgt von den Protestanten – zum König von Polen und bewog ihn zur Verbindung mit Österreich. Daraufhin überzogen polnische Truppen verheerend Schlesien. Voll Zorn darüber fiel Johann Georg von Jägerndorf in das bischöfliche Gebiet ein und brandschatzte in demselben 1619. Dieses wiederholte er nach der Schlacht am Weißen Berg, wo er des Fürstentums Jägerndorf beraubt und 1621 geächtet wurde. Daß diese Kriegszüge für den Bergbau störend wirkten, ist verständlich.
Nach Johann Georgs Tod genoß zwar das Fürstentum Ruhe, aber nur bis zum Jahr 1626. Da ward es unter dem von dem Herzog von Weimar in Schlesien einfallenden Schweden und Sachsen hart heimgesucht. Mehrere Städte und Döfer erlitten Plünderungen und Brand. Noch vorhandene Überbleibsel von Schwedenschanzen zeugen von mehreren hier vorgefallenen Treffen. Als aber nach dem Siege von Nördlingen durch den Erzherzog Ferdinand 1634 Schlesien wieder in die Hände der Kaiserlichen gekommen war, nahm sich Ferdinand I. mit Vorliebe des Fürstentums Neisse an. Er gab den Gegenden, wo sich der Goldbergbau befand, der Bergstadt Zuckmantel und den Dörfern Hermanstadt, Ober- und Niedergrund 1635 eine Salva Guardia, welche sie vor Raub, Einquartierungen, Fuhren und anderen Kriegslasten schützen sollte. Indessen war doch wegen der langen Kriege das Land durch drükkende Abgaben, Durchmärsche und Plünderungen verarmt, und durch Hunger, Pest und Auswanderungen teilweise entvölkert. Es stand daher jedes Gewerbe still. Der Bergbau, die reichste Quelle des Landes verlassen, und die Hüttenwerke waren durch Nachlässigkeit und Veruntreuung der Beamten eingegangen. Wird fortgesetzt