

Sudetendeutsche Zeitung






Sudetendeutsche Zeitung




Neudeker Heimatbrief

Zeitung
VOLKSBOTE

Neudeker Heimatbrief

















Botschafter Tomáš Kafka beim Sudetendeutschen Tag. Foto: T. Fricke
❯ Botschafter in Berlin Tomáš Kafka wechselt nach Prag
Turnusmäßiger Amtswechsel in Berlin: Im Oktober folgt Jiří Čistecký auf Tomáš Kafka als Botschafter der Tschechischen Republik, hat das Prager Außenministerium mitgeteilt.
Seit 2023 bis zum April dieses Jahres war Čistecký Chargé d‘Affaires (Geschäftsträger) in der tschechischen Botschaft in Moskau. Der Diplomat, der seit 1994 in Diensten des Außenministeriums steht, leitete unter anderem die Sektion für Mitteleuropa und war unter anderem an der tschechischen Botschaft in Wien tätig. Von 2019 bis 2023 leitete er das tschechische Generalkonsulat in Istanbul. Der auch in Deutschland hochgeschätzte Tomáš Kafka wechselt nach vier Jahren als Botschafter in Berlin nach Prag ins Außenministerium. Kafka wurde 1998 tschechischer Co-Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in Prag. 2005 wurde er Direktor der Abteilung für Mitteleuropa im Außenministerium und wechselte 2008 als tschechischer Botschafter nach Irland. Dieses Amt versah er bis 2013. Von 2014 bis 2020 war er wiederum Direktor der MitteleuropaAbteilung, zugleich von 2017 bis 2020 auch stellvertretender Vizeminister für Europäische Angelegenheiten. 2001 wurde der Brückenbauer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2006 erhielt Kafka den Kunstpreis zur deutschtschechischen Verständigung. Und 2024 würdigte die SL-Landesgruppe Bayern den Diplomaten mit ihrer höchsten Auszeichnung, der Verdienstmedaille in Gold. Auf dem Sudetendeutschen Tag 2024 sprach Kafka als offizieller Vertreter der Tschechischen Republik und überbrachte die herzlichen Grüße von Staatspräsident Petr Pavel.


















des






Ein tschechischer Minister, zwei Bundestagsabgeordnete, ein bayerischer Landtagsabgeordneter, der mittelfränkische Bezirkstagspräsident, der Deutsche Botschafter, der Gouverneur der Region Brünn und mehrere Bürgermeister – mit dem zehnten Versöhnungsmarsch von Pohrlitz nach Brünn ist das Brückenbauerprojekt in der deutsch-tschechischen Politik angekommen.
Um an die Vertreibung der 20 000 Brünner Deutschen zu erinnern, ist Initiator Jaroslav Ostrčilík erstmals 2007 mit Studienfreunden von Brünn die 30 Kilometer bis zum Massengrab bei Pohrlitz gegangen. Als Geste der Versöhnung und als Zeichen, daß Brünn seine ehemaligen Mitbürger willkommen heißt, führt seit 2015 die Strecke von Pohrlitz wieder zurück nach Brünn ins Augustinerkloster. Für den Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries war die Reise nach Brünn gleich mehrfach eine Premiere. „Ich bin zum ersten Mal in Tschechien und habe auf der Hinreise Kunewald besucht, den Heimatort meiner Mutter in Neu Titschein. Das war sehr bewegend, erstmals vor dem Haus meiner Großeltern zu stehen. Die Vertreibung hat meine Familie sehr geprägt.“
Der gebürtige Hamburger mit mährischen Wurzeln ist Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten in der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion und wurde begleitet von MdB Stephan Mayer. Der Erste Stellvertretende Vorsitzende der Gruppe hat ebenfalls mährische Wurzeln und ist unter anderem Vizepräsi-





dent des Bundes der Vertriebenen und Präsidiumsmitglied des Sudetendeutschen Rates.
Beim Thema Versöhnung mit Tschechien gäbe es „noch Luft nach oben“, so de Vries: „Es geht heute nicht mehr um irgendwelche Regreßansprüche, sondern darum, Unrecht anzuerkennen und Unrecht auch nicht mehr zu rechtfertigen. Das ist ein wichtiges Thema für uns“, sagte der Bundestagsabgeordnete mit Blick auf die tschechische Politik.

Für den Regierungsbezirk Mittelfranken, der 2023 eine Partnerschaft mit Südmähren geschlossen hat, sagte Bezirkstagspräsident Peter Daniel Forster: „Die gemeinsame Teilnahme von Deutschen und Tschechen am Versöhnungsmarsch ist ein starkes Zeichen der Vergangenheitsbewältigung zwischen beiden Völkern.“
Weitere Berichte über den Versöhnungsmarsch lesen Sie auf Seite 3 Torsten Fricke

Der Chor
Königin-Olga-Stift-Gymnasiums unter Leitung von Paulina Klundt-Wiatrowski sang Michael Jacksons „Earth Song“.
Begrüßte die Sudetendeutschen: Bildungsminister Mikuláš Bek.
Die MdB Christoph de Vries und Stephan Mayer legten einen Kranz nieder. Links: Petr Kalousek (Meeting Brno) und SL-Landesobmann Ste en Hörtler.
Kerzen zum Gedenken der Vertreibungs-Opfer (von links): Bayerns Landesobmann Ste en Hörtler, MdL Jürgen Mistol, Botschafter Andreas Künne sowie die MdB Christoph de Vries und Stephan Mayer.
Peter Barton, Leiter des Prager SL-Büros, mit dem japanischen Gesandten Ikuo Shoji und Daniel Herman.
Karls-Preisträger Milan Horáček und Christa Naaß, Präsidentin der SL-Bundesversammlung.
Miroslav Novák, Bürgermeister von Pohrlitz.
Peter Daniel Forster, Bezirkstagspräsident von Mittelfranken.
Zum zehnten Mal marschierten Tschechen und Sudetendeutsche beim Versöhnungsmarsch gemeinsam zurück nach Brünn. Fotos: Torsten Fricke
Nicht nur der Egerer Bahnhof, dieses eher häßliche Gebäude aus der Zeit des „realen Sozialismus“, wie man diese geschichtliche Epoche in der Zeit des tschechoslowakischen Kommunismus offiziell nennen mußte, soll bald renoviert werden. Umfangreichere Veränderungen werden auch in unmittelbarer Nähe des großen Bahnhofs erwartet.
Der Leiter des Prager Sudetendeutschen Büros, Peter Barton, wollte die neue Fußgängerbrücke östlich des Bahnhofs besichtigen, wobei ihm die einheimischen Egerer verrieten, daß sie wohl eher weniger genutzt werden wird.
❯ Preis des Präsidenten
Karlsbader
Filmfest ehrt
Daniel Brühl
Der deutsch-spanische Schauspieler und Regisseur Daniel Brühl wird auf dem Karlsbader Filmfest mit dem Preis des Präsidenten ausgezeichnet.
Das renommierte Festvial wird am heutigen Freitag eröffnet und läuft bis zum 6. Juli. Brühl wird sein Regiedebüt „Nebenan“ aus dem Jahr 2021 persönlich in der Weltkulturerbestadt vorstellen.
Unter dieser Brücke kann man zwischen den zahlreichen Bahngleisen eine „Insel“ von sehr alten Gebäuden entdecken. Auch diese sollen angeblich bald verschwinden, denn hinter dem Bahnhof wird eine neue Station zur Wartung moderner Zugwagen entstehen. In den fast achtzig Jahren seit der Vertreibung der Sudetendeutschen, die voll von geschichtlichen Umwälzungen sind, hat sich niemand um den Zustand der alten Häuser gekümmert, und so kann man vorne noch klar die deutsche Aufschrift „Zoll“ lesen. Es ist schon erstaunlich, wie so manches Erbe der Vergangenheit

weiterbesteht, bis es dann endgültig verschwindet. Deshalb wollte Peter Barton dieses Überbleibsel

aus alten Zeiten mit einem Foto für die nächste Generation bewahren.

Weitere Preisträger sind Hollywood-Star und Regisseur Viggo Mortensen (weltbekannt als Aragorn in der „Der Herr der Ringe“) sowie der Brite Clive Owen. Daniel Brühl spielte in „Nebenan“ einen Schauspieler, der mit Enthüllungen konfrontiert wird.
❯ Zentrale Veranstaltung mit dem Welt üchtlingstag in Berlin
Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung
Nach einer Initiative des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck findet seit zehn Jahren in Berlin ein Nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung statt, der mit dem Weltflüchtlingstag begangen wird. Nach der Corona-Pandemie bildete der Kleine Saal des Konzerthauses Berlin als Veranstaltungsort jetzt zum zweiten Mal einen würdigen Rahmen.
Mittlerweile wird ins Zentrum dieses Gedenkens immer eine Klammer gesetzt zwischen den Opfern von Flucht und Vertreibung nach 1945, die wesentlich auch Deutsche betraf, und der gerade in diesem Jahr wieder gestiegenen Zahl von Opfern von Flucht und Vertreibung weltweit von 110 bis 120 Millionen betroffenen Menschen. Wobei es dabei vor allem, um die Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen in Deutschland zu gehen scheint. Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, begrüßte die Gäste der Feierstunde, dann sprach die stellvertretende Generaldirektorin der Internationalen Organisation für Migration (IOM) Irena Vojáčková-Sollorano, die ihre eigene Aufnahmegeschichte als tschechoslowakisches Flüchtlingskind thematisierte. Eine sudetendeutsche Lehrerin, die vertrieben wurde, nur weil sie eine Deutsche war und die nach vielen Wirren ihren Beruf in Nordhessen wieder aufnehmen konnte, hat 1968 ein tschechisches Flüchtlingskind mit viel Zuneigung die deutsche Sprache gelehrt. Das sei sie gewesen. Mittlerweile sei sie seit 40 Jahren deutsche Staatsbürgerin und seit 35 Jahren in internationalen Organisationen aktiv, um Menschenrechte zu vertreten und für

Der Vertriebene Oswald Wöhl (Mitte) mit Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka, Milan Horáček und Ste en Hörtler. Foto: Ulrich Miksch
sie zu kämpfen. Und sie danke Deutschland für die Hilfe, die es vielen Schwachen in der Welt gewähre, so wie es schon vor 1750 Jahren vor Christus im ältesten erhaltenen Gesetzestext der König von Babylon im Codex Hammurapi forderte. Die Starken sollten nicht die Schwachen unterdrücken. Die IOM helfe weltweit, den momentan Schwachen zu helfen. In einem dann folgenden Podiumsgespräch kamen unter der Moderation von Jörn Thießen, dem Leiter der Abteilung Heimat, Zusammenhalt und Demokratie im BMI, ein Sudetendeutscher aus Neustadt an der Tafelfichte und heute wohnhaft in Potsdam und ein syrischer Flüchtling aus einem kleinen Ort bei Damaskus, der 2015 vor dem IS floh und über die Balkanroute nach Deutschland kam. Während der Flüchtling, der seit kurzem deutscher Staatsbürger geworden ist und mittlerweile als Journalist arbeitet, die besonderen Vorzüge des Grundgesetzes
pries, ja sogar seine Liebe zum Grundgesetz erklärte, schilderte Oswald Wöhl, Jahrgang 1941 seine präzisen Erinnerungen über die Vertreibung der Sudetendeutschen aus Neustadt an der Tafelfichte, seine schwierigen Erfahrungen in Deutschland bis weit in die 1950er Jahre hinein, aber auch seine Verbundenheit mit seiner Heimat in Nordböhmen, seine Erfahrung mit der neuen Besitzerin des Hauses seiner Familie, die ihn herzlich empfing und mit der er bald eine lebenslange Freundschaft knüpfen konnte.
Das Schlußwort sprach der BdV-Präsident Bernd Fabritius. Er erinnerte an die Opfer von Nemmersdorf vor bald 80 Jahren in Ostpreußen, die Opfer der Roten Armee wurden, die aber zu Propagandazwecken von deutscher, wie von sowjetischer Seite benutzt wurden, deren Legenden noch heute von deutschen wie von russischen Bürgern geglaubt werden. Nemmersdorf war der Auftakt für viele die Flucht vor
Argentinischer
Präsident in Prag
Der argentinische Präsident Javier Milei hat sechs Monate nach seiner Wahl Tschechien besucht und ist am Montagabend von Staatspräsident Petr Pavel auf der Prager Burg empfangen worden. Argentinien ist für Tschechien das viertwichtigste Exportland in Lateinamerika. Themen des Gesprächs zwischen Pavel und Milei waren die gegenseitigen Beziehungen sowie die globale Sicherheitslage. Zuvor hatte Milei im Žofín-Palais in Prag einen Vortrag mit dem Titel „Was tun mit einer ineffektiven Regierung?“ gehalten. Milei ist als Verfechter des Anarchokapitalismus international umstritten.
Kaufhaus Máj wiedereröffnet
Nach einer etwa zweijährigen Sanierungspause ist das Kaufhaus Máj in der Prager Neustadt am Montag wiedereröffnet worden. Die Sanierung hat insgesamt 4,5 Milliarden Kronen (180 Millionen Euro) gekostet. Noch vor der Wiedereröffnung hatte im Mai die Installation zweier Skulpturen des Künstlers David Černý an der Außenfassade für Kontroversen gesorgt. Sie stellen riesige Schmetterlinge dar, deren Körper aus Spitfire-Flugzeugen bestehen.
Sicherung der Lieferketten
sem Jahr den Goldenen Eishokkeyschläger als bester tschechischer Spieler der aktuellen Saison gewonnen. Der 28jährige, der beim NHL-Team der Boston Bruins unter Vertrag ist, hatte in der gerade zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Tschechien das entscheidende Tor gegen die Schweiz geschossen. Pastrňák ist bereits zum siebten Mal zum Sieger gekürt worden. Seit 2017 belegte er, mit nur einer Unterbrechung 2022, immer den ersten Platz. Beim aktuellen 56. Jahrgang wurde Nationaltorwart Lukáš Dostál Zweiter und Angriffsspieler Martin Nečas Dritter.
Erste Lieferung an die Ukraine
Die erste Munitionslieferung, die dank der tschechischen Initiative auf dem Weltmarkt besorgt wurde, wird der Ukraine bis Ende Juni ausgehändigt, hat Verteidigungsministerin Jana Černochová (ODS) erklärt. Insgesamt hätten sich 18 Länder an der Initiative, die Staatspräsident Petr Pavel auf der Sicherheitskonferenz in München gestartet hatte, beteiligt, so die Verteidigungsministerin.
Tschechische Weine ausgezeichnet
der Front zu ergreifen. Und was sich daran an Vertreibungen, ethnischen Säuberungen, Deportationen anschloß, kostete mehr als zwei Millionen Deutsche das Leben.
Fabritius erinnerte daran, daß die Ereignisse nach dem Zweiten Weltkrieg ein entscheidender Moment für die 1951 verabschiedete Genfer Flüchtlingskonvention waren und daß diese auch bei dem Beschluß der Bundesregierung 2014 den Weltflüchtlingstag, der seit 2001 begangen wird, zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung zu machen, eine Rolle spielten. „Gerade wir, meine Damen und Herren, wissen und wollen niemals vergessen, daß jeder Krieg, jede Vertreibung, jede ethnische Säuberung – gleichgültig wo, wann und mit welcher Begründung – immer Verbrechen sind. Sie zerstören Existenzen und schädigen ganze Gesellschaften.“
Das Gedenken endete mit dem Singen der Nationalhymne, unterstützt von Stipendiaten der Stiftung Kurt-Sanderling-Akademie des Konzerthausorchesters Berlin, die als musikalische Begleitung vorher Werke des ukrainischen Komponisten Jefim Golyscheff (1897–1970) und des in Preßburg geborenen Ernst von Dohnanyi (Dohnányi Ernö) (1877–1960) zu Gehör brachten.
Der anwesende tschechische Botschafter Tomáš Kafka eilte am Ende der Veranstaltung zum Zeitzeugen Oswald Wöhl und dankte ihm im Beisein von Steffen Hörtler, stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, und Milan Horáček, Träger des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen Volksgruppe, für sein Zeugnis, aber auch für seine Versöhnungsarbeit.
Ulrich Miksch
Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Verschlechterung des internationalen Umfeldes muß Tschechien seine ökonomischen Interessen neu bewerten, hat Außenminister Jan Lipavský (Piraten) am Montag zum Auftakt der Beratungen der tschechischen Wirtschaftsdiplomaten im Czernin-Palais in Prag gewarnt. Es müßten, der Chefdiplomat, die Lieferketten für wichtige Produkte und Rohstoffe gesichert werden, damit Tschechien in dieser Hinsicht nicht erpreßbar sei.
David Pastrňák wieder bester Spieler
Der WM-Erfolgsstürmer David Pastrňák hat auch in die-
Winzer aus Tschechien haben beim Decanter World Wine Award in London 105 Medaillen gewonnen, darunter drei Gold-, 28 Silber- und 74 Bronzemedaillen. Beim größten Weinwettbewerb der Welt wurden 18 143 Weine aus 57 Ländern getestet. Briefwahlgesetz verabschiedet
Im Ausland lebende tschechische Bürger werden schon bei den nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus die Möglichkeit der Briefwahl nutzen können. Bisher mußten sie persönlich in einer diplomatischen Vertretung wählen. Das Abgeordnetenhaus verabschiedete am Freitag die entsprechende Gesetzesnovelle über die Briefwahl. Die Oppositionspartei Ano scheiterte mit ihrem Vorschlag, das Gesetz erneut in zweiter Lesung zu erörtern. Das Gesetz wird demnächst dem Senat vorgelegt.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Foto: Reiner Bajo

❯ Samstag, 31. Mai 2025 Versöhnungsmarsch
Der Brünner Versöhnungsmarsch 2025 findet am Samstag, 31. Mai statt – zum 80. Jahrestag des Brünner Todesmarsches und eine Woche vor dem 75. Sudetendeutschen Tag in Regensburg. Die Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg werden rechtzeitig über eine gemeinsame Busreise informieren.
„Sehr beeindruckt hat mich, daß der Versöhnungsmarsch auf die Initiative der Brünner Zivilgesellschaft zurückgeht“, sagt Jürgen Mistol, der als erster deutscher Parlamentarier die gesamte Strecke von Pohrlitz bis zum Augustinerkloster in die mährische Stadt mitgegangen ist.
Der 59jährige Regensburger ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, gehört dem Bayerischen Landtag seit 2013 an und ist einer der beiden Koordinatoren für die Zusammenarbeit zwischen dem Landtag und der tschechischen Abgeordnetenkammer.
2015 hatte der Brünner Stadtrat in einer Resolution um Vergebung gebeten: „Die Stadt Brünn bedauert aufrichtig die Ereignisse des 30. Mai 1945 und der darauffolgenden Tage, als Tausende von Menschen aufgrund des Prinzips der Kollektivschuld oder der verwendeten Sprache gezwungen wurden, die Stadt zu verlassen. Wir sind uns der menschlichen Tragödien und der kulturellen und sozialen Verluste bewußt, die damals entstanden sind.“
„Nur wenn man die Vergangenheit kennt und daraus die richtigen Schlüsse zieht, kann man die Zukunft positiv gestalten“, erklärt dazu Mistol, der einräumt, daß die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg kein Kernthema der Grünen ist. „Aber ich selbst habe schlesische Wurzeln und bin mit dem Thema Flucht und Vertreibung aufgewachsen.“ Auch viele Grüne hätten das gleiche Familienschicksal, wie die frühere Landtagsvizepräsidentin Christine Stahl sowie deren Nachfolgerin und spätere Berliner Senatorin Ulrike Gote, die beide ebenfalls schlesische Wurzeln haben.
Außerdem gehörten, so der Koordinator, „zu einem guten bayerisch-tschechischen Verhältnis auch immer die Sudetendeutschen“. Er habe deshalb dieses Pfingsten erstmals an einem Sudetendeutschen Tag teilgenommen und sei positiv überrascht worden. Daß die tschechischen Gäste die Sudetendeutsche mit Landsleute ansprechen und umgekehrt die tschechische Hymne gespielt wird, seien starke Zeichen der Verständigung.
„Mit Bernd Posselt hat die Sudetendeutsche Landsmannschaft jemanden an der Spitze, der die europäische Idee wirklich lebt








Brünns VizeBürgermeisterin Karin Podivinská, Botschafter Andreas Künne mit Janine Bassenge, Bezirkstagspräsident Peter Daniel Forster, Bürgermeister Hans Henninger und Gouverneur Jan Grolich.












❯ Kranzniederlegung im Kaunitz-Studentenwohnheim „Eine Mahnung zur Versöhnung“
„Wie kaum ein anderer Ort in Brünn steht das Kaunitz-Studentenwohnheim für Haß und Gewalt zwischen den beiden Volksgruppen. Unser gemeinsames Gedenken ist deshalb eine Mahnung zur Versöhnung“, sagt Steffen Hörtler, stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bayerns Landesobmann.
Zum dritten Mal nach 2022 legten anläßlich des Brünner Versöhnungsmarsches Tschechen und Sudetendeutsche Krän-




















ze am Mahnmal nieder und erinnerten an die Opfer von Mord und Folter. Die Gestapo hatte das Studetenwohnheim von 1939 bis 1945 als Internierungslager mißbraucht. Im Innenhof, wo heute das Mahnmal steht, wurden mindestens 800 Menschen durch Erhängen oder Erschießen ermordert. Zehntausende Tschechen, meist aus dem politischen Widerstand, durchliefen das Gestapo-Gefängnis, bevor sie in ein Konzentrationslager deportiert wurden.
Nach dem Einmarsch der Roten Armee am 26. April 1945 in Brünn nutzten die tschechoslowakischen Kommunisten als neue Machthaber bis Juni 1945 die Gebäude, um hier sudetendeutsche Bürger zu inhaftieren und zu foltern.
Der tschechische Historiker Tomáš Staněk geht davon aus, daß in dieser Nachkriegszeit mindestens 300 Brünner Deutsche ermordet wurden. Heute gehören die Gebäude zur Veterinärmedizinischen und Pharmazeutischen Universität.










































































Das Kaunitz-Studentenwohnheim wurde zunächst von der Gestapo, später von den tschechoslowakischen Kommunisten als Gefängnis genutzt.


Mistol,







❯ Der grüne Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol absolvierte den gesamten Brünner Versöhnungsmarsch
Schritt für Schritt gemeinsam in eine bessere Zukunft

Angeführt von der Europafahne marschieren mehrere hundert Tschechen, Deutsche und Österreicher auf der Landstraße von Pohrlitz in Richtung Brünn.

Der grüne Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol im Gespräch mit Ulrike Sendelbach auf dem Weg durch Pohrlitz. Fotos: Torsten Fricke
und auch klare Worte findet, wie die Feststellung, daß der Nationalismus das Grundübel ist“, so Mistol. Die Idee, am Versöhnungsmarsch teilzunehmen, sei Zufall gewesen. Auf einem Empfang des tschechischen Generalkonsulats zum zwanzigjährigen Jubiläum des EU-Beitritts sei er mit Bayerns Landesobmann Steffen Hörtler ins Gespräch gekommen, der ihm vom Versöhnungsmarsch berichtet hatte. „Ich habe dann spontan entschieden, nach
Brünn zu reisen“, erzählt Mistol der Sudetendeutschen Zeitung „Dieser Versöhnungsmarsch symbolisiert wie keine andere Veranstaltung die deutsch-tschechische Verständigung und zeigt, wie weit wir auf dem Weg zur deutsch-tschechischen Versöhnung sind“, sagte Andreas Künne auf der Abschlußkundgebung im Klostergarten. Der Deutscher Botschafter war zum dritten Mal dabei und dankte den Veranstaltern von Meeting Brno, daß die Opfer nicht vergessen werden.



























Der Versöhnungsmarsch sei mittlerweile zu einem Markenzeichen und Vorbild für andere Gedenkveranstaltungen geworden sei. So hatte Künne erst Wochen zuvor gemeinsam mit Vertretern von Meeting Brno am Versöhnungsmarch von Postelberg nach Saaz teilgenommen. „Wer vergißt, tötet zum zweiten Mal“, zitierte Künne aus dem Talmud und sagte: „Wenn wir uns der Geschichte nicht stellen, begehen wir alte Fehler in neuem Gewand.“ Die Deutschen sei-
en Schuld am Menschheitsverbrechen, der Shoa, stellte Künne klar: „Wir stellen uns unserer Verantwortung für Greueltaten, wie in Lidice, für Unmenschliches wie Terezin. Wir erinnern uns an die etwa 345 000 in der Tschechoslowakei ermordeten Menschen, darunter 260 000 Jüdinnen und Juden. Wir bekennen uns zur Schuld unserer Vorväter, zu dem im deutschen Namen von Deutschen begangenen Verbrechen. Wir entschädigen Opfer und Verbliebene. Wir hal-
ten die Erinnerung wach. Das ist unsere historische Verantwortung.“ Der Botschafter warnte vor gefährlichen Tendenzen in Europa mit einem Erstarken des Rechtsextremismus und eines gefährlichen Nationalismus: „Wir wissen aus der Vergangenheit, wohin Haß, Ausländerfeindlichkeit und Ausgrenzung führen.“ Sein Appell richtete sich aber auch an die Tschechen, die eigene Geschichte anzunehmen: „Man muß ehrlich in den Spiegel sehen, um nicht alte Feindbilder und Irrtümer wiederzubeleben.“ Der Versöhnungsmarsch erinnere an Verbrechen, „die immer noch viel zu oft vergessen werden“, und zwar „ausschließlich deswegen, weil diese Menschen Deutsche waren“, so Künne. Bildungsminister Mikuláš Bek sagte auf der Abschlußkundgebung: „Ich bin sehr glücklich, was uns in den vergangenen Jahren gelungen ist und welche Fortschritte wir erzielt haben. Ich möchte mich bei allen, die dazu beigetragen haben, für den Mut bedanken.“ Es sei für ihn ein Höhepunkt gewesen, „daß ich im vergangenen Jahr als Vertreter der tschechischen Regierung am Sudetendeutschen Tag teilnehmen konnte“.
„Dieses Festival sendet ein starkes Signal auch an die Menschen in anderen Ländern und Regionen, die den Weg der Versöhnung noch vor sich haben“, unterstrich Jan Grolich, Gouverneur der Region Südmähren. Diesen Worten waren zuvor Taten gefolgt. Die im vergangenen Jahr geschlossene Partnerschaft zwischen Südmähren und Mittelfranken, die maßgeblich von Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung und damals Bezirkstagsvizepräsidentin, vorangetrieben wurde, hat bereits Früchte getragen, wie Bezirkstagspräsident Peter Daniel Forster erklärte: „Wir konnten heute in Brünn an der Unterzeichnung der ersten Gemeindepartnerschaft zwischen dem mittelfränkischen Markt Arberg und dem südmährischen Dolní Dunajovice teilnehmen. Ein Fundament dieser Partnerschaft ist das gegenseitige Kennenlernen. Es geht aber auch um das Erinnern an unsere gemeinsame Geschichte. An das Unrecht des von Deutschland ausgegangenen Zweiten Weltkriegs. Und an das Unrecht von Flucht und Vertreibung.“ Torsten Fricke
Jürgen
Ste en Hörtler, Christa Naaß, Klaus Ho mann und Christoph Zalder bei der Kranzniederlegung.
In Brünn: Christoph de Vries, Sven Oole, Ste en Hörtler, Peter Daniel Forster, Stephan Mayer, Andreas Künne, Jürgen Mistol und Janine Bassenge.
Beauftragte Petra Loibl zu Gast im Sudetendeutschen Haus
Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, MdL Dr. Petra Loibl, hat das Sudetendeutschen Haus besucht und dabei mit drei Institutionen gesprochen.
Zunächst wurde die CSULandtagsabgeordnete von Institutsleiter Prof. Dr. Martin Schulze Wessel und Geschäftsführer Dr. Martin Zückert im Collegium Carolinum begrüßt. Dabei betonte die Beauftragte, wie wichtig ihr der Austausch gerade mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit der Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa und der Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und deren erfolgreicher Eingliederung in Bayern befassen, ist.
Auch in ihrer alltäglichen Arbeit profitiere sie sehr von der Expertise und dem Rat des Collegiums Carolinum, dessen Schwerpunkt in historischen, aber auch sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlichen Studien zu den Böhmischen Ländern und der Slowakei liegt.
Dr. Loibl dankte Prof. Dr. Schulze Wessels ausdrücklich für die großartige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Abgeschlossen wurde die Begegnung durch eine Führung durch die Bibliothek, bei der Dr. Zückert der Beauftragten einen Überblick über die zahlreichen Publikationen des Instituts im Wandel der Zeiten gab.
Anschließend traf Loibl mit dem Vorsitzenden des AdalbertStifter-Vereins, Dr. Peter Becher, Geschäftsführerin Dr. Zuzana Jürgens, und Dr. Wolfgang Schwarz, dem Kulturreferenten
■ Bis Mittwoch, 21. August, Seliger-Gemeinde: „Böhmen liegt nicht am Meer“. Ausstellung in der Repräsentanz des Freistaats Bayern in der Tschechischen Republik, Michalská 12, Prag.
■ Bis Sonntag, 27. Oktober, Sudetendeutsches Museum: „Oskar Schindler – Lebemann und Lebensretter“. Sonderausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie. Eintritt frei. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 29. Juni, 14.00 Uhr, Heimatkreis Freudenthal/ Altvater: 3. Erinnerungscafé. Stadtmuseum, Zangmeisterstraße 8, Memmingen.
■ Samstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, BdV-Landesverband Hessen: Kulturtagung „Von Heimat(en) und Identität(en) –(Spät-) Aussiedler aus den postsowjetischen Staaten, aus Polen und aus Rumänien“. Eintritt 8 Euro. Theater im Pariser Hof. Spiegelgasse 9, Wiesbaden.
■ Dienstag, 2. Juli, 16.00 bis 18.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Lebendige Erinnerung“. Schreibcafé mit Journalistin und Autorin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Anmeldung per eMail an info@sudetendeutsches-museum. de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37, Sudetendeutsches Museum, Treffpunkt Museumskasse, Hochstraße 10, München.
■ Donnerstag, 4. Juli, 10.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Hilfe für Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus“. Fortbildung für Lehrer, Studenten und Museumsmitarbeiter. Anmeldung über die Bayerische Museumsakademie. Sudetendeutsches

Beauftragte Dr. Petra Loibl (Mitte) mit der Heimatp egerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch, und dem Bundesgeschäftsführer der Landsmannschaft, Andreas Miksch. Foto: Hildegard Schuster
der Böhmischen Länder, zusammen. Nachdem Dr. Becher zunächst einen Überblick über die Geschichte des bereits 1947 von Wissenschaftlern, Künstlern und Schriftstellern gegründeten Verbands gegeben hatte, entspann sich eine rege Unterredung darüber, wie sich das kulturelle Erbe der Deutschen aus den böhmischen Ländern sowohl in Tschechien wie in Bayern lebendig erhalten und gerade auch jüngeren Generationen am besten vermitteln lasse.
Wesentliche Hindernisse stellen die geringen Sprachkenntnisse gerade auf deutscher Seite, aber auch die schwindende
Bedeutung des Deutschen als Fremdsprache an tschechischen Schulen dar. Erfreut zeigte sich die Runde dagegen am wachsenden Interesse vieler junger Tschechen an der deutschen Vergangenheit ihrer Heimat.
Weiter berichtete Dr. Becher über die vom Adalbert-StifterVerein alljährlich vergebenen Stipendien an tschechische und deutsche Schriftsteller und die wissenschaftliche Forschungsarbeit des Verbandes, wohingegen Dr. Schwarz den Schwerpunkt seiner Tätigkeit als Kulturreferent eher auf die kulturelle Breitenarbeit legt.
Abgeschlossen wurde der Besuch im Sudetendeutschen Haus
VERANSTALTUNGSKALENDER
Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 5. Juli, 15.30 Uhr, Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau, Eröffnung der Ausstellung: „(Nicht) gekommen, um zu bleiben“ – Vertreibung, Patenschaft, Partnerschaft. Die Ausstellung wird bis zum 31. Juli gezeigt. Eintritt frei. Foyer, Rathaus Würzburg.
■ Samstag, 6. Juli, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.
■ Samstag, 6. Juli, 15.00 Uhr: Graslitzer Stammtisch Geretsried. Gasthof Geiger, Tattenkofe-

ner Straße 1, Geretsried.
■ Sonntag, 7. Juli, 10.00 Uhr, Heimatkreis Kaaden-Duppau: Marien-Wallfahrt mit zweisprachigem Festgottesdienst. Kapellenberg, Winteritz (Vintířov).
■ Samstag, 13. Juli, 13.00 Uhr, Heimatkreis Komotau und Förderverein Mittleres Erzgebirge – Komotauer Land: Gedenkstunde an der „Gedenkstätte 9. Juni 1945“. Deutschneudorf.
■ Sonntag, 14. Juli, 9.30 bis 23.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: EM-Fußballfinale im Museum. 9.30 bis 14.00 Uhr: Böhmischer Frühschoppen.15.00



durch ein Treffen mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch und dem Bundesgeschäftsführer der Landsmannschaft, Andreas Miksch.
Dr. Loibl dankte der sudetendeutschen Heimatpflege für ihre hervorragenden Leistungen bei der Dokumentation, Bewahrung und Förderung der kulturellen Überlieferungen der Sudetendeutschen. Ob es um Heimat- und Familienforschung, Zeitzeugenprojekte, Mundart, Volksmusik und -tanz, Trachten, Krippen oder Alltagskultur und Kunstprojekte gehe – in all diesen Bereichen zeitigt die Arbeit der Heimatpflege herausragende Ergebnisse.
Zuletzt berichtete Christina Meinusch von einem durchaus bewegenden Projekt, das sie mit Studenten der Europäischen Ethnologie in Bamberg auf den Weg gebracht habe, und dessen Ziel es sei, die Vertriebenenherkunft Verstorbener auf Grabsteinen fränkischer Friedhöfe zu rekonstruieren.
In dieser Arbeit sieht Dr. Loibl wertvolle Berührungspunkte zu einem bereits in der letzten Legislaturperiode angestoßenen Projekt des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, das die Erfassung und Bewahrung von Vertriebenendenkmalen zum Ziel hat.
Zum Ende ihres Besuchs kündigte die Beauftragte, die erst eine Woche zuvor das Sudetendeutsche Museum besichtigt hatte, weitere Besuche im Sudetendeutschen Haus an. Dr. Petra Loibl: „Die Sudetendeutschen sind wie eine große Familie, und ich fühle mich seit meinem ersten Tag als Beauftragte sehr wohl bei ihnen.“
bis 18.00 Uhr: Tischkicker-Turnier.18.50 bis 19.00 Uhr: Dokumentarfilm „DFC Prag – die Legende kehrt zurück“ im Adalbert-Stifter-Saal. 19.00 bis 20.00 Uhr: Finale des Kickerturniers. 20.00 bis 23.00 Uhr: Public Viewing des EM-Finales im AdalbertStifter-Saal. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 17. Juli, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.

Am Montag ist die Ausstellung „verloren, vermisst, verewigt. Heimatbilder der Sudetendeutschen“ im Heimatministeriums von der Sudetendeutschen Heimatp ege in Kooperation mit der Egerländer G´moi z‘ Nürnberg erö net worden. Nach einer Einführung in die Ausstellung und Begrüßung durch Christina Meinusch (links) folgten Grußworte von Bernd Posselt und Dr. Simon Naczinsky, rechts neben Referatsleiterin Annette Friedrich, für das Heimatministerium, Dienstsitz Nürnberg. Einen Kurzvortrag zum Thema Heimat hielt Dr. Daniela Sandner (Mitte) vom Bayerischen Landesverein für Heimatp ege. Die musikalische Umrahmung übernahm die Egerländer G´moi z‘ Nürnberg. Die Ausstellung ist noch bis zum 12. Juli im Heimatministerium in Nürnberg, Bankgasse 9 zu sehen. Foto: Tatjana Slesarevá
Europäische Perspektiven
■ Sonntag, 4. bis Donnerstag, 8. August: „Europäische Perspektiven. Deutschland und seine östlichen Nachbarn“. Seminar für historisch-politisch Interessierte aus Deutschland und Osteuropa. Nach mancherorts schwieriger Transformationsphase wurden die meisten ostmittel- und südosteuropäischen Staaten kurz vor und nach der Jahrtausendwende in die Nato beziehungsweise in die Europäische Union aufgenommen, und der wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierungsprozeß nahm Fahrt auf. Es flossen EU-Fördermittel zur Modernisierung von Infrastruktur, Bildung, Justizwesen und Umwelt. Der EU-Beitritt dieser Staaten ist eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen – einerseits. Jedoch zeigten sich nach einem weiteren Jahrzehnt Bruchlinien zwischen alten und neuen EU-Mitgliedern, zunächst in der Migrationskrise 2015, seit 2022 in der Positionierung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. In Ungarn, Polen sowie zuletzt in der Slowakei kamen zeitweise europaskeptische Parteien an die Macht. Außen- und verteidigungspolitisch orientierten sich die Polen eher an den USA, die Ungarn unter Viktor Orbán kooperieren in Wirtschafts- und Energiefragen mit dem autoritären und – gegenüber dem gesamten Westen – aggressiven Rußland und beteiligen sich nicht an direkter Militärhilfe für die Ukraine. Die Perspektiven auf eine engere und bessere europäische Zusammenarbeit sind skeptisch oder negativ. Neben den aktuellen politischen Ereignissen werden aber auch historische und kulturelle Verbindungen zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarvölkern in Vorträgen und Filmen aufgezeigt. Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Erinnerungen lebendig machen und erhalten Schreibcafé
■ Dienstag, 2. Juli, 16.00 bis 18.30 Uhr: „Erinnerungen werden lebendig – Schreibcafé im Museum“. Weitere Termine am 6. August, 3. September, 1. Oktober und 5. November. Museumspädagogik, Hochstraße 10, München. Im Schreibcafé des Sudetendeutschen Museums lassen die Teilnehmer mit Journalistin und Autorin Gunda Achterhold an insgesamt fünf Nachmittagen Erinnerungen lebendig werden – schreibend, und im Austausch miteinander.
Thematische Anregungen holen sich die Teilnehmer den bei einem kurzen Rund-
im Museum
gang durch eine der fünf Ebenen der Dauerausstellung im Sudetendeutschen Museum. Kleine Übungen und Methoden aus dem Kreativen Schreiben regen anschließend dazu an, eigene Erfahrungen oder Erlebnisse zu erinnern und handschriftlich festzuhalten. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der Treffpunkt ist an der Museumskasse. Der Preis pro Termin beträgt 15 Euro; die 5er Karte mit allen fünf Terminen kostet ermäßigt 60 Euro Anmeldung per eMail an anmeldung@sudetendeutschesmuseum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.



■ Samstag, 20. Juli, 10.00 bis 14.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Mutig und menschlich: Ein Workshop zur Förderung von Zivilcourage“. Anmeldung per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37 oder per eMail an anmeldung@sudetendeutschesmuseum.de
■ Samstag, 27. Juli, 10.00 Uhr, Bund der Deutschen in Böhmen: Heimatmesse anläßlich des Sankt-Anna-Festes mit den vertriebenen Deutschen und dortigen Tschechen. Laurentiuskirche in Luck bei Luditz.
■ Samstag, 3. August, 11.30 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Pizzeria Rosa Mystica, Erlanger Straße 13, Fürth.
■ Sonntag, 4. August, 19.00 Uhr, Musikakademie der Studienstiftung des Deutschen Volkes: „Gustav Mahler: Das klagende Lied“. Konzert in der Isarphilharmonie. Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, München.
■ Mittwoch, 14. August, 14.00 Uhr: Monatstreffen der Graslitzer. Café Alte Villa, Erlanger Straße 50, Fürth.
■ Sonntag, 18. August, 11.00 Uhr, Förderverein Wallfahrtskirche Maria Kulm: 25. Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche, Maria Kulm.
Neue Ausstellung
Vertriebene 1939
■ Bis Mittwoch, 31. Juli: Ausstellung „Vertreibung 1939“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Öffnungszeiten: werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr. Die Ausstellung „Vertriebene 1939“ veranschaulicht anhand von 400 Fotografien, Plakaten und Dokumenten die traumatischen Erlebnisse und rend des Zweiten Weltkriegs aus den Teilen Polens deportiert wurde, die an das „Dritte Reich“ angegliedert wurden. Die gewaltsamen Zwangsaussiedlungen, Inhaftierungen und Ermordungen von insgesamt 1,5 Millionen polnischer und jüdischer Bürger waren zugleich Teil der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik, die in der Errich-


❯ Analyse von Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender des SSBW
Wie lautet die


Sudetendeutsche Frage heute?


















Unter dem Titel „‚Wie lautet die Sudetendeutsche Frage heute“ hat sich Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozialund Bildungswerk (SSBW), mit einem elementaren Thema der Aufarbeitung der Vertreibung auseinandergesetzt. Die Sudetendeutsche Zeitung dokumentiert die Analyse, die im Literaturspiegel erschienen ist, in Auszügen: Im August 2023 kommentierte der Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Baden-Württemberg und stellvertretende Bundesvorsitzende der SL, Klaus Hoffmann, in den „Nachrichten der Sudetendeutschen aus Baden-Württemberg“ sehr anerkennend den gemeinsamen Weg von Sudetendeutschen und Tschechen in den vergangenen 30 Jahren und insbesondere das Auftreten des tschechischen Bildungsministers Mikuláš Bek auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg. Er kommt dann zu dem Schluß: „Damit ist die Sudetendeutsche Frage jedoch noch nicht beantwortet“. ... Es war der Ausdruck von der Sudetendeutschen Frage, der mich aufmerken ließ. Diesen Ausdruck hatte ich schon lange nicht mehr gehört und auch selbst nur noch selten benutzt. Dabei war er jahrzehntelang ein Schlüsselbegriff, um die Geschichte und das Schicksal der Sudetendeutschen Volksgruppe zu beschreiben. ...
Die Sudetendeutsche Frage war in erster Linie eine Rechtsfrage. In dem grundlegenden Dokument für alle deutschen Heimatvertriebenen, der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“, haben diese im August 1950 in beeindruckender Weise wenige Jahre nach der Vertreibung auf Rache und Vergeltung verzichtet. ... Was sie verlangten, war, daß das Recht auf die Heimat anerkannt und verwirklicht wird. ... Die große Hoffnung auf eine Realisierung dieses Rechts setzten sie dabei stets in eine „europäische Lösung“ zu einer Zeit, in der das tschechische Volk seine Freiheit wiedergewonnen haben würde und mit ihnen über eine „echte Partnerschaft“ sprechen werde.
Zu diesen Gesprächen kam es jedoch nach der überraschenden Wende von 1989/90 nicht. Präsident Havels moralisch höchst anerkennenswerte Äußerungen, daß er persönlich die Vertreibung als „zutiefst unmoralische Tat“ und kollektive Rache verurteilt, wurden von der tschechischen Öffentlichkeit nicht geteilt und blieben folgenlos. Die neuen tschechoslowakischen und ab 1993 tschechischen Regierungen lehnten Gespräche mit den Sudetendeutschen als Nicht-Regierungsorganisation ab und verteidigten die umstrittenen „Beneš-Dekrete“. Die Bundesregierung setzte sich in keiner Weise für ein wie immer geartetes Heimatrecht der Sudetendeutschen ein. .... Eine womöglich letzte Hoffnung darauf, daß mithilfe von
Rechtsmitteln das Vertreibungsunrecht thematisiert und in welcher Weise auch immer korrigiert wird, war mit der Aufnahme der Tschechischen Republik in die Europäische Union 2004 verbunden. Mit Rechtsgutachten ausgestattet plädierte die Führung der Volksgruppe dafür, daß die Tschechische Republik vor einem Beitritt ... die Vertreibungsdekrete und das Straffreiheitsgesetz aufheben müsse. Die europäischen Staaten und das Europaparlament sahen dies anders. Die demonstrativen zehn Gegenstimmen der CSU-Abgeordneten blieben ohne Wirkung. Die samtene Revolution in der damaligen ČSSR und der Wegfall des Eisernen Vorhangs in Europa waren jedoch eine echte Zeitenwende. ... Sie ermöglichte die Wiederbegegnung von Tschechen und Sudetendeutschen auf breiter Front. Bald machte das Wort von der Volksdiplomatie (Richard von Weizsäkker) die Runde. In den vergangenen 30 Jahren entdeckten sich Sudetendeutsche und Tschechen wieder neu. Sie entdeckten ihren gemeinsamen Heimatraum, entdeckten, daß die Zeit nicht stehen geblieben war, ja daß sie sogar heilen kann und daß es eine Zukunft gibt, die nicht in der Restauration von Vergangenem besteht. Die Zwischenbilanz ... kann sich sehen lassen. Insbesondere auf lokaler Ebene, zwischen den heutigen tschechischen Dörfern und Städten und den Heimatortsgemeinden der ehemaligen deutschen Bewohner kam es zu einer Vielzahl von Begegnungen und gemeinsamen Projekten. Instandgesetzte Kirchen, Denkmale und Friedhöfe zeugen von einem respektvollen Umgang mit der Vergangenheit. ... Es sind vielfach Sudetendeutsche, die Partnerschaften initiieren und ihre Kenntnisse über Land und Leute in die Politik, die Wirtschaft und Wissenschaft einbringen. So wuchsen Verständnis und Vertrauen und häufig die Erkenntnis, daß auch nach Jahrzehnten der Trennung und der unterschiedlichen Lebenswelten die gemeinsame Herkunft aus Böhmen, Mähren oder Sudetenschlesien weiterhin verbindet. ... Gibt es also noch eine Sudetendeutsche Frage, nachdem sich niemand gefunden hatte, der Recht
gesprochen hätte, und nachdem sich alle Beteiligten ehrlich freuen, daß das deutsch-tschechische Verhältnis unter entscheidender Mithilfe der Sudetendeutschen noch nie so gut war wie heute? Ich meine ja! Ich halte die Sudetendeutsche Frage heute nicht mehr für eine Rechtsfrage im eigentlichen Sinn, sondern für die Frage, wie die Tschechische Republik mit „ihren Deutschen“ umgeht. Durch die verdienstvolle Ausstellung in Aussig wurde dieser treffende Begriff geprägt. ... Nahezu 80 Jahre nach der Vertreibung sind die vertriebenen Deutschen erfolgreich in die Bundesrepublik Deutschland oder andere Aufnahmeländer integriert und haben sich in der Regel einigen Wohlstand erarbeitet. Dies und die klaren Fronten des Kalten Krieges haben anfangs vorhandene Hoffnungen auf Rückkehr und Besitzansprüche verblassen lassen. Für die nachgewachsene Generation spielen diese keine Rolle mehr. Die von einigen Hardlinern angezettelte Debatte über die Satzungsänderung der Sudetendeutschen

Am Mahnmal im Kaunitz-Wohnheim in Brünn gedachte Hans Knapek (zweiter von links) gemeinsam mit Martin Körner, (Stadt Stuttgart), Dr. Ortfried Kotzian und Milan Horáček der tschechischen Opfer, die von den Nazis gefoltert und ermordet wurden.
Landsmannschaft und den Vorwurf, daß diese nun „auf die Heimat verzichte“, war eine Fake-Debatte...
Was Integration und Wohlstand jedoch nicht überstrahlt haben, ist das verletzte Rechtsempfinden vieler Sudetendeutscher und das Interesse an ihrer Herkunftsheimat. Dies empfinden heute auch viele Nachgeborene noch so.
Den Tschechen stand für eine ähnliche Entwicklung nur eine wesentlich kürzere Zeit zur Verfügung. Während des Kommunismus war es weder möglich, sich Wohlstand zu erwerben noch über die Geschehnisse offen zu reflektieren. Die Haltung der Bevölkerung zur Vertreibung auch des dann demokratischen Tschechien blieb daher noch lange Zeit unverändert. Ängste überwogen und wurden geschürt und konzentrierten sich auf ein Thema, das durch eine ungelenke sudetendeutsche Politik befördert wurde, einen regelrechten Kampf um die Abschaffung der BenešDekrete. Die tschechische Seite, die sich angeprangert und herausgefordert fühlte, schaffte sie nicht ab und baute ein etwas unverständliches böhmisches Dorf um sie herum auf, von dem man nicht
wissen soll, ob es existiert oder nicht. Aber auch darüber ging die Zeit hinweg. Die Umfragewerte, die die Zustimmung der Tschechen zur Vertreibung wiedergeben, sinken deutlich. Die oben erwähnte Volksdiplomatie trägt Früchte, Ängste sind gewichen und vielfach bestehen gerade zwischen Tschechen und Sudetendeutschen freundschaftliche Verhältnisse. Die Frage, wie Tschechien mit den Sudetendeutschen umgeht, hängt allerdings weiterhin noch von den politischen Machtverhältnissen und den Verantwortungsträgern ab. Die derzeitige europafreundliche Regierung unter Premierminister Petr Fiala und der international erfahrene Staatspräsident Petr Pavel scheinen erkannt zu haben, daß die Sudetendeutschen auch für ihr Land eine Rolle spielen können. Warum? Weil ein richtiger Umgang mit „ihren Deutschen“ es den Tschechen ermöglichen wird, in der Wahrheit zu leben. Bereits im Oktober 1989 schrieb Václav Havel in einem Brief an Bundespräsident Richard von Weizsäcker: „Ich persönlich – ebenso wie viele meiner Freunde – verurteile die Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg. Sie erschien mir immer als eine zutiefst unmoralische Tat, die nicht nur den Deutschen, sondern vielleicht in noch größerem Maße den Tschechen selbst Schaden zugefügt hat.“ Der kürzlich verstorbene tschechische Staatsmann Karl von Schwarzenberg ... erklärte bereits zehn Jahre früher: „Ich bin der Überzeugung, daß ein Verbrechen noch lange kein weiteres Verbrechen rechtfertigt. Wir Tschechen haben eben nicht von Masaryk gelernt und uns anders verhalten. Wir haben das leider nicht geschafft, und darin liegt für mich die Tragödie. Die Vertreibung ist für mich deshalb kein Problem der Sudetendeutschen. Sie ist kein deutsches oder österreichisches Problem. Sie ist ein Problem der Tschechen, meiner Nation. Wir müssen irgendwie damit klarkommen, daß auch wir in unserer Geschichte nicht immer die Unschuldslämmer waren.“ Und schließlich Staatspräsident Petr Pavel, als er im Mai 2023 in Theresienstadt (!) der Opfer des Nationalsozialismus gedachte: „…darüber dürfen wir die Verbrechen unserer Vorfahren nicht vergessen und müssen aus ihnen lernen“. Dies sind nur einige prominente Aussagen, die unterstreichen, daß die „Sudetendeutsche Frage“ zuvörderst eine Frage der Tschechen geworden ist. Ihre Klärung führt nicht zu einer Rückkehr der Sudetendeutschen, sondern zur Wahrheit für das tschechische Volk. ... Die Sudetendeutsche Frage ist weiterhin eine Frage, an deren Beantwortung zu arbeiten sich lohnt. Für alle Beteiligten und für ein dauerhaft befriedetes Europa. Sie zu beantworten heißt in der heutigen Zeit nicht mehr Recht zu sprechen, sondern Zeichen zu setzen. Das aufkommende Gedenkjahr 2025 böte dafür eine gute Gelegenheit.
Am heutigen 28. Juni steht im Heiligenkalender der katholischen Kirche ein Name, der in unseren Breiten nicht allzu bekannt ist: Irenäus von Lyon. Der Theologe und Bischof kam um 140 nach Christi Geburt in der damaligen Handelsmetropole Smyrna in Kleinasien – heute Izmir in der Türkei – zur Welt. Er war Schüler des dortigen Bischofs Polykarp, der seinerseits wahrscheinlich ein Schüler des Apostels und Evangelisten Johannes gewesen war. Mit Irenäus von Lyon begegnen wir also einer Gestalt des frühen Christentums. Jene Zeit war für Christen im Römischen Reich von Verfolgungen geprägt. Das Blatt sollte sich erst mit der „Konstantinischen Wende“ 313 wenden, als dem Christentum der Status einer erlaubten Religion zuerkannt wurde. Irenäus von Lyon starb wie sein Lehrer Polykarp und viele, viele andere Christen seiner Epoche den Märtyrertod. Aus diesem Grund wird an seinem Gedenktag die liturgische Farbe rot verwendet. Das Martyrium verbindet ihn übrigens mit den beiden Aposteln Petrus und Paulus, die ihm am 29. Juni folgen. Wie kommt es, daß der heilige Irenäus mit der französischen Stadt Lyon verbunden ist, obwohl er aus Kleinasien stammt? Auch das hat mit der Verfolgungs des Christentums zu tun. Im Jahr 177 war der Bischof der Stadt Lugdunum in Gallien, heute Lyon, hingerichtet worden. Unser Protagonist war zu dieser Zeit gerade in Rom und dort als Nachfolger des ums Leben gekommenen gallischen Bischofs berufen worden. Bewundernswürdig ist, wie flexibel viele damalige kirchliche Amtsträger waren. Um ihres Glaubens willen waren sie bereit, ihr Leben dort zur Verfügung zu stellen, wo sie gebraucht wurden, noch dazu unter Lebensgefahr.

Doch nicht nur aufgrund seiner Verfügbarkeit und seiner Bereitschaft zum Martyrium gelangte Irenäus in den Heiligenkalender. Er war auch ein anregender Theologe. So beschäftigte er sich mit der Frage, wie viel Einheit und wie viel Vielfalt es in der Kirche geben solle. Das ist bis heute eine wichtige Frage, die Anlaß für viele Diskussionen gibt. Übrigens ist dieses Thema nicht nur in der Kirche bedeutsam. Es bewegt uns ebenso in der Gesellschaft. Überall haben wir es mit dem Spannungsfeld Einheit und Vielfalt zu tun. In der Zeit des heiligen Irenäus stritt man sich in der Kirche heftig um den richtigen Ostertermin. Der Papst wollte jene Christen aus der Kirche ausschließen, die Ostern nicht am selben Termin wie in Rom feierten. Irenäus brachte dagegen ein wichtiges Argument in Stellung. Was den Glauben nicht in seinem Kern in Frage stelle, solle jede Ortskirche für sich selbst entscheiden dürfen. Jahrhunderte später wurde dieser Grundsatz so formuliert: Im Notwendigen herrsche Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. Wieviel Zwietracht und Mißgunst könnten wir uns in der Kirche und in der Gesellschaft ersparen, wenn man weniger hitzköpfig wäre im Durchsetzen der eigenen Meinung. Irenäus heißt „der Friedliche“. Sein Name war Programm. Vielleicht ist die bevorstehende Urlaubs- und Ferienzeit eine Möglichkeit, uns dieses Programm etwas besser zu eigen zu machen.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München
Die Kreuze dokumentieren das Massengrab bei Pohrlitz, wo 890 deutsche Opfer der wilden Vertreibung liegen.
Fotos: Torsten Fricke
PERSONALIEN
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung Gras itzer Heimatzeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München
E-Mail svg@sudeten.de 26/2024
Am 29. Juni feiert Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozialund Bildungswerk (SSBW) mit Wurzeln im Schönhengstgau und im Erzgebirge, im oberbayerischen Otterfing 65. Geburtstag.
In Otterfing lebt Hans Knapek mit seiner Frau Karen, geborene Pilz, und ihren drei Kindern. Karen Knapek ist ebenfalls bekennende Sudetendeutsche und seit langen Jahren überaus aktiv bei den Sudetendeutschen Akademikern. Hans Knapeks Mutter Amalia stammt aus Oberbrand im ehemaligen Kreis Sankt Joachimsthal und sein Vater Josef aus Rudelsdorf im ehemaligen Kreis Landskron. Er wuchs im oberpfälzischen Neutraubling auf, in einer der fünf Vertriebenenstädte Bayerns. Mit elf Jahren, also Anfang 1975, ging er zur SdJ und wurde wenige Jahre später Jugendgruppenführer. Die Arbeit in der SdJ und ihrem Dachverband Deutsche Jugend des Ostens (DJO) ließ ihn bis zum Eintritt ins Berufsleben nicht mehr los. In diesen Jahren übernahm er zahlreiche Ämter auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Zunächst baute er eine starke und erfolgreiche Jugendgruppe in Neutraubling auf. Er war Bezirksgruppenführer in Niederbayern/ Oberpfalz und trieb die Wiedererrichtung des SdJ-Traditionszeltplatzes in Gaisthal maßgeblich voran. Ihm gelang, dafür eine Million Mark einzutreiben. Als Mitglied in den Landesvorständen von SdJ und DJO Bayern und in der Bundesgruppenführung der SdJ war vor allem die heimatpolitische Arbeit sein Aufgabenfeld. So ist die Idee eines deutsch-tschechisch-slowakischen Jugendwerkes maßgeblich von ihm, ebenso die damaligen großen Flugblatt- und
Am 29. Juni feiert Kurt Aue, Obmann der SL-Kreisgruppe und Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes Augsburg-Land sowie Vorstandsmitglied der SL-Landesgruppe Bayern aus dem Altvaterland, in Augsburg-Haunstetten seinen 80. Geburtstag.
Man kennt Kurt Aue weit über die Stadtgrenzen von Augsburg und Königsbrunn hinaus als langjährigen Fußballspitzenschiedsrichter, als Selbsthilfegruppenleiter des Restless-LegsSyndroms, als Mitbegründer des Königsbrunner Blasorchesters und vor allem als aktiven Sudetendeutschen.
Er war sechs Jahre alt, als er seine Eltern, mit denen er damals in Bäumenheim bei Donauwörth lebte, fragte, warum öfters ein Tscheche zu Besuch sei. Seine Mutter erzählte ihm, daß er bei der Vertreibung im Gedränge am Bahnhof in Freiwaldau beim Einstieg in die bereitgestellten Viehwaggons, mit denen die Vertriebenen wie ein Stück Vieh hätten abtransportiert werden sollen, verloren gegangen sei.
Seine Mutter erzählte, sie habe ihn nach ihrer Ankunft in Bayern monatelang über das Rote Kreuz gesucht. Plötzlich sei Ende 1946 überraschend ein Tscheche gekommen, der den damals zweijährigen Kurt am Bahndamm bei Freiwaldau gefunden
Hans Knapek 65
Plakataktionen zum 17. Juni sowie eine „Abrißgenehmigung“ für die Berliner Mauer. Dank der Jugendarbeit wurde er früh mit den Einrichtungen des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks (SSBW) vertraut. Er verbrachte unzählige Wochenenden auf Seminaren, Tagungen und in Jugendfreizeiten auf dem Heiligenhof und der Burg Hohenberg, leitete dort Zeltlager und veranstaltete Jugendleiterlehrgänge. Bereits vor 50 Jahren war er zum ersten Mal auf dem Heiligenhof.
Knapek studierte Betriebswirtschaft in Regensburg. Anschließend war er in drei Unternehmen Personalreferent und Personalleiter. 14 Jahre lang war er bei Dow Chemical, einem der großen US-amerikanischen Chemieunternehmen an mehreren Standorten in Deutschland und in Frankreich tätig. Acht Jahre lang verantwortete er die Personalarbeit für American Express in Zentraleuropa. Seine letzten elf Berufsjahre führte er als Mitglied der Geschäftsleitung den Unternehmensbereich Personal beim deutschen Elektronikkonzern Rohde & Schwarz in München. 2022 begann sein Ruhestand.
standsvorsitzenden. Damit verbunden ist auch die Mitgliedschaft im SL-Bundesvorstand.

Bereits 2007 bat ihn Wolfgang Egerter, in den Stiftungsrat der neugegründeten Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk einzutreten. 2009 übernahm er das Amt des Vorsitzenden des Stiftungsrats von Günter Reichert, und 2021 folgte er Reichert in der Rolle des Vor-
Knapek: „Ich sehe mich in einer Generationenfolge, in der es jetzt an meiner Generation liegt, das, was in 70 Jahren geschaffen wurde, in eine gute Zukunft zu führen. Ich freue mich, daß mit Christian Leber und Robert Wild zwei weitere Vertreter dieser Generation mit mir Verantwortung dafür übernehmen. In einer Zeit, in der es wieder verstärkt gilt, Lehren aus Flucht und Vertreibung zu ziehen, und in der es entscheidend darauf ankommen wird, die Sudetendeutsche Volksgruppe und ihr Erbe für die Zukunft zu bewahren, hat der Heiligenhof mit seiner Bildungs- und Begegnungsarbeit eine entscheidende Aufgabe.“ 2002, also vor 22 Jahren, war Hans Knapek Gründungsmitglied der Akademie Mitteleuropa auf dem Heiligenhof. „Die Akademie will in ihren Informations- und Bildungsveranstaltungen die Kenntnis von Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Politik und Alltagsleben der Bundesrepublik Deutschland und ihrer europäischen Nachbarstaaten –insbesondere der ostmitteleuropäischen Staaten – fördern; die grundlegenden Elemente des Völkerrechts – vor allem der Menschenrechte – vermitteln; bürgerschaftliches Engagement in der Bundesrepublik Deutschland und den ostmitteleuropäischen Nachbarstaaten unterstützen“, lesen wir über die Akademie auf ihrer Internetseite.
� Verdienstvoller Landsmann aus dem Altvaterland
habe und über die Rotkreuznummer, die jeder Vertriebene angeheftet bekommen habe, den Aufenthaltsort der Mutter habe ausfindig machen können und den Findling unter Einsatz seines Lebens über die deutsch-tschechische Grenze nach Bäumenheim zu seinen Eltern gebracht habe.

Die Mutter erzählte auch die Geschichte der Vertreibung. Am Tag zuvor seien Militär und Polizei vor der Haustür gestanden und hätten gesagt, daß sie in der nächsten Frühe das Haus zu verlassen hätten und nur 40 Kilogramm Gepäck mitnehmen dürften. Am nächsten Morgen seien russische Soldaten gekommen und hätten die Vertriebenen zum Bahnhof nach Freiwaldau gepeitscht. Auf dem Weg dorthin sei die Oma des damals zweijährigen Kurt vergewaltigt und ermordet worden. Der Vater habe zwangsweise zum tschechischen Militär gemußt und ausgerechnet den Zug zusammenstellen müssen, mit dem Sohn und Frau hätten abtransportiert werden sollen.
Kurt Aue freute sich sehr über den Tschechen, der bis zu seinem Tode jede Ostern nach Bäumenheim kam. Seine Jugendzeit bis zum Erwachsenenalter verbrachte Kurt in der Industriegemeinde Bäumenheim, wo damals das weltbekannte Dreschmaschinen Werk Dechentreiter beheimatet war, in dem der Vater, der in der Heimat in Jägerndorf Schlachter war, nach seiner Kriegsgefangenschaft arbeitete. Man lebte zunächst in Baracken des Außenlagers Dachau, in denen zuvor Zwangsarbeiter gewohnt hatten. In der Schule und auf dem Sportplatz wurde man als „Du-Hurra-Flüchtling“ beschimpft. Aber die Kinder waren schneller integriert als die Erwachsenen. Die Eltern bauten in Bäumenheim ein Haus. Von der damals gegründeten Sudetendeutschen Landsmannschaft wollten sie nie etwas wissen. Auch der aufwachsende Kurt fühlte sich immer mehr als echter bayerischer Schwabe. Nach seiner Lehre zum Buchdrucker heiratete er in Bäumen-
Mitglied der Bundesversammlung war Hans Knapek über drei Perioden als SdJ-Vertreter und dann wieder seit dem Jahr 2009. Das Wichtigste ist ihm jedoch gegenwärtig die Arbeit für die Stiftung SSBW: „Ich weiß, daß man vorangehen muß, aber auch, daß man alleine wenig erreicht.“ Auch Volksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert diesem vielfachen Weggefährten von Herzen: „Ich kenne Hans Knapek seit fast einem halben Jahrhundert. Unter den damaligen Führungspersönlichkeiten der Sudetendeutschen Jugend ragte er von Anfang an heraus. Immer wieder raunten die Älteren: ,Das ist eines unserer ganz großen Talente.‘ Obwohl er viele Jahre lang seinen Schwerpunkt auf Familie und Beruf legte und zeitweise fern von München lebte, geriet er niemals auch nur an den Rand des inneren Kerns unserer Volksgruppe, sondern blieb fest in deren Mitte verwurzelt. Seine Qualifikation auf vielen Gebieten und seine internationale Erfahrung waren und sind unverzichtbar. Er ist Theoretiker und Praktiker in einem. Besonders freute mich, daß er sich nach seiner Rückkehr nach Bayern bereit erklärte, wieder für die Bundesversammlung zu kandidieren und Führungsämter zu übernehmen – sowohl im Bundesverband der Landsmannschaft als auch in den Einrichtungen, die den Heiligenhof tragen, allen voran das Sudetendeutsche Bildungswerk. Er ist ein sudetendeutscher Intellektueller mit einer geschliffenen Sprache in Wort und Schrift. Gleichzeitig sieht man ihm die Freude an, mit der er und seine liebe Frau Karen Tracht tragen und auf den Bühnen der Volksgruppe tanzen. Ich wünsche Hans und seiner ganzen Familie von Herzen alles Gute, weiterhin viel Erfolg, Glück, Gesundheit und Gottes Segen.“
heim eine Einheimische und zog zunächst einmal nach Königsbrunn. Dort wurde er bald zum Stadtrat und Kreisrat gewählt. Im Vereinsleben spielte er eine große Rolle und war 43 Jahre lang als Fußball-Schiedrichter tätig. Auch als freier Mitarbeiter der „Augsburger Allgemeinen“ und der Stadtzeitung machte er sich einen Namen. Der damalige legendäre Bürgermeister Fritz Wohlfarth und der Metzgermeister Otto Treutler holten den inzwischen 35jährigen in die SL.
Dort tat er sich sehr schwer, weil die Mitglieder über die Tschechen schimpften, die sie vertrieben haben. Kurt Aue, dem ein Tscheche das Leben gerettet hatte, sah das aber anders und ist seither auf Versöhnung mit den Tschechen aus. So reist er mit seinen SL-Vorstandsmitgliedern öfters in seine Heimat, um den Tschechen die Hand zu reichen. Nun freut er sich über das Geburtstagsständchen, das ihm das Blasorchester Königsbrunn bereiten wird. Und er freut sich über die Geburtstagsfeier mit seiner Frau, seinen drei erwachsenen Kindern, seinen sechs Enkeln und seinen zwei Urenkeln. Die Landsleute wünschen von Herzen alles Gue, Gesundheit und Gottes Segen. te
Tomáš Kafka, der Tschechische Botschafter in Berlin, ist Diplomat, Übersetzer, wie sein Namensvetter Franz Literat und Fußballfan. Er versäumt kein Spiel seiner Nationalmannschaft. Die EM inspirierte ihn zu „Zeitenwende des Fußballs“.
Man verdankt der Bundesliga Nicht nur deutsche Fußballsieger. Sie war auch die Modequelle Für Schnauzer mit der Dauerwelle.

Doch Schnauzer kamen dann zum Ende, Auch hier grassiert die Zeitenwende. Zu den Trikots, die sind nun lila, Paßt nicht mehr der Vokuhila.
Tja, ohne Beckham schwer zu sagen, Welchen Haarschnitt soll man tragen?
Doch damit das Spiel nicht abschmiert, Wer‘s ernst meint, ist nun tätowiert!

Der für Böhmen bedeutsame Fluß Eger entspringt südwestlich von Weißenstadt am See und durchquert auf seinem Weg den nördlichen Teil Tschechiens bis zur Vereinigung mit der Elbe, wobei das Wasser dann mit dieser zurück durch Deutschland in die Nordsee fließt. Ein ganzer Landstrich wurde nach ihm benannt: das Egerland.
Es hat eine lange Geschichte mit reichen Bräuchen und dem besonderen Dialekt. Man kann symbolisch die Eger als einen Arm betrachten, der sich um die Schulter Tschechiens legt und andeutet, laßt uns ab jetzt freundschaftlich verbunden gemeinsam die nächste Wegstrekke beschreiten.
Die EU-Osterweiterung am 1. Mai 2004 bedeutete die Aufnahme weiterer zehn Staaten Mittel- und Osteuropas in das Gefüge der Europäischen Union, darunter auch Tschechiens. Für die nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen und die in der Heimat verbliebenen Egerländer
Die Eger verbindet
war schon vor zwanzig Jahren die Egerquelle ein passender symbolischer Ort für eine gemeinsame Feier. In dieser Tradition trafen sich auch vor zehn Jahren und in diesem Jahr die Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberfranken, des Graslitzer Kulturverbandes und des Vereins Potok aus Schneeberg an der Egerquelle zu einer gemeinsamen zweisprachigen heiligen Messe. Diese zelebrierte Monsignore Peter Fořt. Bernd Posselt, Bundesvorsitzender und Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der von 1994 bis 2014 dem Europäischen Parlament angehörte und dieses denkwürdige Ereignis vor zwanzig Jahren als ein Akteur mitgestaltete, ließ es sich nicht nehmen, der Einladung von Margaretha Michel, Bezirksvor-
sitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberfranken, zu folgen. Dabei plauderte er in seiner Ansprache etwas aus dem Nähkästchen der Geschichte und ging auf die enormen politischen Herausforderungen dieser Aufnahme von zehn weiteren Ländern, darunter Tschechiens, ein. Aber es war auch eine große Chance, wie die vergangenen zwanzig Jahre uns heute deutlich zeigen. Während seiner Rede trug Bernd Posselt einen „Floderer“, den Trachtenhut der Egerländer, den Monsignore Fořt extra dafür mitgebracht hatte. Es wurde nicht versäumt all jenen zu gedenken, die an den Treffen der letzten beiden Jahrzehnte teilgenommen hatten und heute nicht mehr unter uns weilen. Der Beitritt Tschechiens zur EU vor zwanzig Jahren war ein


bedeutender Grundstein unseres heutigen Zusammenlebens, das durch den Beitritt zum Schengenraum am 21. Dezember 2007 weitere spürbare Erleichterungen für die Bürger unserer beiden Länder brachte. Das kann man nicht hoch genug würdigen.
Im Anschluß ging es nach Weißenstadt, wo auf dem Marktplatz das Maifest mit dem Aufstellen des Maibaumes stattfand. Dazu wurde unsere Gruppe offiziell vom Bürgermeister begrüßt. Gesättigt fuhren die Teilnehmer mit beiden Reisebussen weiter zum knapp dreißig Kilometer entfernten Ort Marienweiher, um sich dort bei Kaffee und Kuchen für die folgende Besichtigung der Basilika und der Marienandacht zu stärken.
Der Legende nach geht dieser Wallfahrtsort auf einen sächsi-
schen Fuhrmann zurück. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts sei er im Straßenwirtshaus am Vordersee, so die alte Ortsbezeichnung, eingekehrt. In der Nacht sei das Wirtshaus von Räubern überfallen worden. Der Fuhrmann befand sich in Lebensgefahr und wandte sich in seiner Not an die Mutter Gottes mit der Bitte, ihn zu erretten. Er überlebte. Daraufhin hat der Fuhrmann ein Marienbild in einer hölzernen Kapelle aufgehängt, welches in der Folgezeit von immer mehr Pilgern besucht wurde. Die Wirren der Jahrhunderte mit ihren Kriegen und Zerstörungen sind heute in dieser prunkvoll ausgestatteten Wallfahrtsbasilika nicht mehr erkennbar. Im hinteren Teil wird die Egerer Wallfahrtsfahne aufbewahrt. Diese stammt aus dem Jahr 1865 und ist somit das Bin-
deglied zwischen Marienweiher und den Egerländern. Nach der Vertreibung der Deutschböhmen kamen vielen Egerländer in diese Region und die Wallfahrtskirche gab ihnen Halt in ihrer inneren Zerrissenheit. Anfänglich war es ja unmöglich, zu ihren angestammten Wallfahrtsorten zu pilgern. Diese Maifahrt zur Egerquelle und zum Wallfahrtsort Marienweiher war für alle Teilnehmer eine Rückbesinnung auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Dankbarkeit und Respekt vor den erbrachten Leistungen aller Menschen der Region über Ländergrenzen hinweg. Ein herzlicher Dank gilt Frau Margaretha Michel und dem Team der Bezirksgruppe Oberfranken der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie Jitka Marešová vom Kulturverband Graslitz für die hervorragende Organisation und Monsignore Peter Fořt für die heilige Messe an der Egerquelle und die Maiandacht in der Wallfahrtsbasilika Marienweiher. Ulrich Möckel

� Kandidatenvorschläge können ab sofort eingereicht werden
Im Sudetendeutschen Kalender startet das neue Jahr immer mit der festlichen Vergabe der Förderpreise. Und an Pfingsten bildet die Verleihung der Kulturpreise den festlichen Auftakt des Sudetendeutschen Tags.
Ab sofort können Kandidatenvorschläge sowohl für die Förder- als auch für die Kulturpreise eingereicht werden. Um das jahrhundertealte kulturelle Erbe zu wahren und zu fördern, vergibt die Sudetendeutsche Landsmannschaft jedes Jahr die Sudetendeutschen Kultur- und Förderpreise in den Kategorien Darstellende und Ausübende Kunst, Wissenschaft, Literatur und Publizistik, Musik, Bildende Kunst und Architektur sowie Volkstumspflege. Bei den Vorschlägen für die Sudetendeutschen Förderpreise ist Folgendes zu beachten: Die Kandidaten sollten nicht älter als 35 Jahre sein, der Sudetendeutschen Volksgruppe entstammen oder einen Beitrag mit sudetendeutschem Bezug geleistet haben. Entsprechende Vorschläge sind mit einer kurzen Begründung und den jeweiligen Kontaktdaten zu richten an: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Bundesverband e. V., Hochstraße 8, 81669 München, oder per eMail an info@sudeten.de
Segnung der Egerquelle durch Monsignore Peter Fořt
Fotos: Ulrich Möckel
Dr. Gertrude Krombholz wurde auf dem Sudetendeutschen Tag mit dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis ausgezeichnet. Foto: Torsten Fricke
� Heilige Messe an der Quelle
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, bei seiner Ansprache.
Margaretha Michel und Monsignore Fořt bei der Messe.


Im Haus des Deutschen Ostens in München (HDO) eröffnete die Ausstellung „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten“. Jacek Kubiak aus Posen hatte die Ausstellung konzipiert. Der Journalist und Dokumentarfilmer hielt die Festrede bei der Eröffnung. Nach der Begrüßung durch HDO Direktor Andreas Otto Weber folgten Grußworte der Münchener Stadträtin Gudrun Lux, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Petra Loibl MdL, und des Vizepräsidenten der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN), Bernard Gaida.
Die Wanderausstellung „Vertriebene 1939“ veranschaulicht anhand von gut 400 Fotografien, Plakaten und Dokumenten die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen und jüdischen Zivilbevölkerung, die während des Zweiten Weltkriegs aus denjenigen Teilen Polens deportiert wurde, die an das „Dritte Reich“ angegliedert wurden. Die gewaltsamen Zwangsaussiedlungen, Inhaftierungen und Ermordungen von insgesamt 1,5 Millionen polnischen und jüdischen Bürgern waren Teil der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik. An ihrer Stelle wurden „Volksdeutsche“ aus Ostund Südosteuropa angesiedelt. „Vertreibungen haben das 20. Jahrhundert gezeichnet“, sagte Petra Loibl in ihrem Grußwort, das per Video übermittelt wurde. Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene erinnerte daran, daß viele Ethnien davon betroffen gewesen seien. In Osteuropa hätten die Nationalsozialisten Millionen Menschen – besonders Juden – vertrieben, bevor dieses Schicksal auch Millionen Deutsche erlitten hätten. „Der Rassenwahn verschob sie alle wie Schachfiguren“, beklagte Loibl das damalige Geschehen.
„In der Schule habe ich über die Nazi-Vertreibung der Polen 1939 aus Großpolen gelernt“, sagte Bernard Gaida zum Thema. Über die Deportation der Polen aus Ostpolen nach Kasachstan und die Umsiedlung der Deutschen aus der Sowjetunion in den Warthegau dagegen nichts, so der FUEN-Vizepräsident und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM). Gaida lobte die Gestaltung der Ausstellung. In „Vertriebene 1939“ gelinge es, die tragischen Schicksa-
Verschoben wie Schachfiguren

Professor Dr. Bernard Gaida, Dr. Jacek Kubiak, Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende des Bessarabiendeutschen Vereins, Kerstin Celina, Vertriebenenpolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Bayerischen Landtag, Professor Dr. Andreas Otto Weber, Dr. Lilia Antipow und Paul Hansel vom Vorstand des BdV-Landesverbands Bayern. Bilder: Lilia Antipow, HDO
le von Menschen zum Vorschein zu bringen, die durch Krieg, Diktatur oder Ideologie ihre angestammte Heimat verloren hätten. Er betonte, daß das Recht auf Heimat ein Menschenrecht sei und jede Vertreibung unabhängig von der Volkszugehörigkeit offen dargestellt werden müsse. Noch immer versuche man, spätere Vertreibungen mit früheren zu rechtfertigen. „Deswegen soll jede Vertreibung – unabhängig von der Volkszugehörigkeit der Opfer und der Täter – zum Vor-

schein gebracht und mit der ganzen Grausamkeit dargestellt werden.“ Dank der Ausstellung könne man besser verstehen, daß Rache keine Lösung sei und daß die Vielfalt Europas geschützt werden müsse, so Gaida. Jacek Kubiak ging bei seiner Vorstellung des Projekts auch auf die bevorstehende Erweiterung der Präsentation ein, die die Perspektive der deutschen „Umsiedler“ im „Warthegau“ miteinbeziehen soll. Der Kurator zeigte den Besuchern der Vernissage Auszüge aus der Videoaufzeichnung des Interviews mit den Geschwistern Harry und Reinholdt Haegelen, zweier Deutscher aus der Ukraine. Er führte durch die Ausstellung, die als Wanderausstellung hoffentlich noch an vielen Orten zu sehen sein wird.
Außer den Personen, die Grußworte sprachen, waren auch Kerstin Celina, die vertriebenenpolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Bayerischen Landtag, sowie Brigitte Bornemann, Bundesvorsitzende des Bessarabiendeutschen Vereins, unter den Ehrengästen.
„Herzlich begrüße ich alle zur Ausstellung ,Vertriebene 1939‘, die thematisch direkt an unsere letzte Ausstellung ,Deutsche in der Ukraine‘ anschließt!“, hatte Andreas Otto Weber bei seiner Begrüßung gesagt. „Die nationalsozialistische Rassenideologie und Hitlers Idee vom ,Lebensraum im Osten‘ zielten darauf ab, Osteuropa durch eine Ger-
manisierung und eine Verdrängung des Slawentums umzugestalten.“ Nach dem Angriff auf Polen 1939 und der Errichtung des „Generalgouvernements Polen“ sei es zu Massenvertreibungen von Polen und Juden gekommen, die den „Volksdeutschen“ hätten weichen müssen: „Ziel der Besatzer war die völlige Germanisierung“, so Weber. Im sogenannten Warthegau habe eine „blonde Provinz“ als Laboratorium zur Züchtung des germanischen Herrenmenschen entstehen sollen. „Zu den betroffenen Gebieten gehörten die Provinz Posen, ein Teil des Lodzer Gebiets, Pommern, das nördliche
Masowien und Schlesien“, faßte der HDO-Direktor zusammen. Weber stellte auch den Kurator vor. Kubiak sei polnischer Dokumentarfilmemacher. Bereits als Student habe er sich der Oppositionsbewegung angeschlossen und sei 1980 Mitglied der Solidarność geworden, weshalb er 1981 verhaftet worden sei. 1988 bis1995 habe er Karriere als Journalist gemacht und 1993 die Firma Telenowa gegründet, die über 500 Film- und Fernsehproduktionen herausgebracht habe. „Kubiaks Filme setzen sich mit geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Themen auseinander einschließlich der gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichte“, so Weber. Schon 2020 habe man im HDO Kubiaks Film „Die blonde Provinz – Polen und der deutsche Rassenwahn“ von 2009 gezeigt. Kubiak habe dieses Projekt weiterführen können. Er habe dafür Interviews mit deutschen Opfern dieser Zwangsumsiedlungen in den „Warthgau“ aufgezeichnet. „Eines dieser Videos und den Film ,Die blonde Provinz‘ können Sie in der Ausstellung ansehen“, bot Weber an, was viele Gäste gleich nach der Eröffnung taten. Susanne Habel Bis Mittwoch, 31. Juli: „Vertriebene 1939“ in München-Au, Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5. Montag bis Freitag 10.00–18.00 Uhr.

Blick in die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Institut für Nationales Gedenken in Warschau, dem Polnischen Städteverband in Posen/Poznań und dem Unabhängigkeits-Museum in Warschau entstand. Ein wichtiger Partner war außerdem das Außenministerium der Republik Polen.
Der Kurator Dr. Jacek Kubiak erläutert Details der Ausstellung.
Schicksal einer Familie in der Schau.
� Neue Vortragsreihe von Stefan Samerski: Böhmen als Ort der Begegnung Teil II
Der Frieden kam aus Böhmen
In der zweiten Folge der diesjährigen Vortragsreihe über „Böhmen als Ort der Begegnung“ sprach Stefan Samerski nach der Begrüßung durch Andreas Miksch, den Bundesgeschäftsführer der Sudetendeutschen Landsmannschaft, über Böhmen als Schauplatz wichtiger politischer Friedenstreffen im 19. Jahrhundert. Die Reihe im Sudetendeutschen Haus wird wieder veranstaltet vom SL-Bundesverband, der Sudetendeutschen Heimatpflege, der AckermannGemeinde in der Erzdiözese München und Freising sowie der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste und gefördert von der Sudetendeutschen Stiftung.
Das Zusammenleben von Völkern und Ethnien war immer von einem Auf und Ab geprägt“, begann Samerski seinen Vortrag. Dies treffe auch auf die böhmischen Länder zu, so der Kirchenhistoriker. Der Zweite Weltkrieg sei ein Urereignis für die Landsleute gewesen mit der Mahnung, man solle Schwierigkeiten durch Kommunikation lösen. Durch ihre historischen Erfahrungen mit ethnischen Konflikten seien die Sudetendeutschen geradezu prädestiniert für den Dialog. „Frieden stiften oder fördern gehört zur DNA, die die Sudetendeutschen mitbringen.“
Die Antike und das Römische Reich deutscher Nation seien vielfach von Krieg geprägt gewesen, so der Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. „Das galt bis zur Aufklärung!“ Samerski nannte als einen der Fixpunkte Immanuel Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ von 1795. Freilich habe es auch in der Bibel derartiges Gedankengut gegeben wie die „Friedenstaube mit Ölzweig“ als Angebot von Gott nach der Sintflut oder die Forderung „Schwerter zu Pflugscharen“. „Der Auftrag Jesu Christi galt der Nächstenliebe.“
Friedliche Lösungen
Ab der Aufklärung habe man Konflikte auch friedlich klären wollen, so Samerski. Diese These wollte er mit einigen Schlaglichtern aus Böhmen im 19. Jahrhundert beleuchten. Schon zu Anfang jenes Jahrhunderts seien einige Probleme in Böhmen gut gelöst worden. Samerski nannte die Allianzverträge von Teplitz, die im September 1813 zwischen Rußland, Österreich und Preußen gegen Napoleon abgeschlossen wurden. Am 3. Oktober 1813 habe Österreich in Teplitz auch einen Vertrag mit Großbritannien geschlossen. „Damit entstand ein breites Bündnis gegen Frankreich.“ Und dieses Treffen habe eben in Böhmen stattgefunden, wo seit dem Mittelalter schon ein wirtschaftliches Zentrum mitten zwischen den euro-

päischen Mächten gelegen habe. Auch seien die Mächtigen gerne in Badeorten wie Teplitz zusammengekommen, um sich eher unauffällig unter dem Vorwand von Kuraufenthalten treffen und verhandeln zu können.
Nach der Niederschlagung Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig sei es dann 1814/1815 zum Wiener Kongreß gekommen, der unter dem österreichischen Staatskanzler Clemens von Metternich stattgefunden und der böhmische Wurzeln gehabt habe, so Samerski. Alle seien damals an einen Tisch gekommen, auch der Verlierer Frankreich. Man habe damals auch auf allerhöchster Ebene regelmäßige Zusammenkünfte vereinbart.
Unter Metternichs Leitung seien auf dem Wiener Kongreß nicht die Verhältnisse von vor 1789 wiederhergestellt, sondern ein europäisches Mächtegleichgewicht geschaffen worden, das möglichst alle Interessen der Sieger und sogar der Besiegten berücksichtigt habe.
Direkt nach dem Wiener Kongreß sei im September 1815 mit der Heiligen Allianz von Rußland, Preußen, Österreich – und 1818 Frankreich – ein Bündnis gegründet worden, das „im Namen der Heiligen Dreieinigkeit“ der Sicherung eines „Ewigen Friedens“ habe dienen sollen. Die Idee dazu habe Zar Alexander I. gehabt, ein „religiöser Schwärmer“. Das verbindende Element der Herrscher sei das Christentum gewesen. „Dabei war der russische Zar orthodox, Kaiser Franz I. von Österreich römisch-katholisch und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen evangelisch.“

Alle Staaten des Kontinents seien beigetreten bis auf den Kirchenstaat, der das überkonfessionelle Engagement abgelehnt habe, und Großbritannien. „Zwar erklärte der englische Prinzregent Georg IV. persönlich seine Zustimmung und trat in seiner Eigenschaft als König von Han-
nover auch bei, Großbritannien blieb jedoch fern.“
Als gemeinsame Maßnahme gegen aktuell herrschende politische Unruhen und antisemitische Ausschreitungen hätten die Mächte die Karlsbader Beschlüsse von 1819 gefaßt – wieder mal in einem böhmischen Badeort

Anton Paterno (Verleger), „Franz I: Alexander I: Fried: Wilhelm III: / in Wien“ (Allegorie auf die Heilige Allianz: Kaiser Franz. I., Zar Alexander I. und König Friedrich Wilhelm III. reichen sich die Hände, im Hintergrund eine Gesamtansicht Wiens), 1815. Bild: Wien Museum, Inventar-Nummer 250526

und unter dem österreichischen Außenminister und späteren Staatskanzler Clemens von Metternich. „Das Schreckgespenst im 19. Jahrhundert war die Revolution“, erläuterte Samerski die Hintergründe.
Die Beschlüsse hätten aus vier Gesetzen bestanden: aus der Exekutionsordnung, dem Universitätsgesetz, dem Preßgesetz (Pressegesetz) und dem Untersuchungsgesetz. Sie hätten das Verbot der öffentlichen schriftlichen Meinungsfreiheit und der Burschenschaften bewirkt, die Überwachung der Universitäten, die Schließung der Turnplätze (Turnsperre von 1820 bis 1842), die Zensur der Presse sowie die Entlassung und das Berufsverbot
für liberal und national gesinnte Professoren, die ihre Einstellung ihren Schülern vermittelt hätten. Aufgrund der Beschlüsse habe beispielsweise August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der Verfasser des Deutschlandliedes, 1842 seine Professorenstelle in Breslau und ein Jahr später seine preußische Staatsbürgerschaft verloren und emigrieren müssen. 1820 habe der Troppauer Fürstenkongreß auf Schloß Grätz in Sudetenschlesien stattgefunden, zu dem Metternich Teilnehmer von den fünf Großmächten zu Beratungen über das weitere politische Vorgehen eingeladen habe. Metternich habe versucht, eine Lösung für die Aufstände in Spanien und Portugal zu finden, wo nach den napoleonischen Kriegen republikanische Ideen den Fortbestand der Monarchien in Frage stellten. Der Beschluß, Truppen aufzustellen, habe gereicht, um die Aufstände zu beenden und die staatliche Ordnung wiederherzustellen.
Treffen in Böhmen
Mit der Julirevolution von 1830 und dem Sturz der Bourbonen in Frankreich habe die Heilige Allianz ihren gesamteuropäischen Charakter und Einfluß verloren. „Im Herbst 1833 reaktivierten Rußland, Österreich und Preußen in der Konferenz von Münchengrätz noch einmal kurz die Heilige Allianz.“ Dies sei ein letztes Treffen zur Sicherung des monarchischen Systems gewesen. Dafür habe es auf Schloß Münchengrätz beim Grafen Christian von Waldstein und seiner Frau Maria, geborene ThunHohenstein, auch ein gewaltiges kulturelles Rahmenprogramm gegeben: „Ein Theater wurde angebaut, Feuerwerke und Jagden veranstaltet.“
Das Ende der Allianz habe als tiefere Ursache die „Orientalischen Frage“ gehabt. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches hätten alle europäischen Mächte um Teile davon gestritten, schloß der Referent seinen Vortrag. Die von ihm zuvor geschilderten Treffen und Kongresse waren deutliche Bespiele dafür, wie durch Aktionen in Böhmen damals der Frieden erhalten wurde.
Der Referent stand danach beim Empfang im Otto-vonHabsburg-Foyer noch für Fragen der großen Gästeschar bereit. Susanne Habel
Die Schriftstellerin Ulrike Draesner (Þ SdZ 12/2024) erhielt den Literaturpreis der Konrad-AdenauerStiftung (KAS). Die Auszeichnung wurde letzten Sonntag im Weimarer Musikgymnasium Schloß Belvedere vergeben.
U
lrike Draesners Werke halten – mit hochentwickeltem Sprachbewußtsein – literarische Signale politischer Vorgänge in Zeitenwenden fest. Sie bezeugen dadurch die verwandelnde Kraft der Literatur“, sagte der KAS-Vorsitzende Norbert Lammert in Berlin.
Die unabhängige Jury würdigte Ulrike Draesners außerordentlich vielfältiges literarisches Werk. Die Romane und Erzählungen, Essays und Reiseberichte, Lyrik und multimedialen Projekte der schlesischbayerischen Schriftstellerin reflektieren auf nachhaltige Weise aktuelle gesellschaftliche Diskurse: das Gedächtnis von Gewalt und Exil; die Frage nach Identität und Geschlecht; die Rolle von Sprache und Liebe im Anthropozän; die Auseinandersetzung mit Reproduktionstechniken und mit dem Menschenbild der Naturwissenschaften. Herausragend sei ihre

Romantrilogie über die europäische Gewaltgeschichte („Sieben Sprünge vom Rand der Welt“ von 2014, „Schwitters“ von 2020, „Die Verwandelten“ von 2023), die Vertreibungs- und Verwandlungsgeschichten aus dem 20. Jahrhundert erzähle. In ästhetischer Virtuosität, durch intensive Recherche und Gestaltung vor allem weiblicher Lebensläufe und mit enormer poetischer Imagination zeuge ihr Schreiben von der Freiheit der Kunst. Der KAS-Literaturpreis wird seit 1993 an Autoren vergeben, die der Freiheit das Wort geben. Er ist mit 20 000 Euro dotiert. Ulrike Draesner ist 31. Trägerin des Literaturpreises. Zu den bisherigen Preisträgern zählen etwa Sarah Kirsch, Walter Kempowski, Günter de Bruyn, Thomas Hürlimann, Norbert Gstrein, Adam Zagajewski, Herta Müller, Daniel Kehlmann, Petra Morsbach, Uwe Tellkamp, Arno Geiger, Tuvia Rübner, Martin Mosebach, Rüdiger Safranski, Marica Bodrožić, Michael Kleeberg, Michael Köhlmeier, Hans Pleschinski, Barbara Honigmann und Lutz Seiler.
Medaille anläßlich der Allianzverträge von Teplitz (Breslau 1813). Bilder: Karl Lesser, Rijksmuseum Amsterdam, Schenking van mevrouw J. M. van Gelder-Nijhoff
Ulrike Draesner. Bild Susanne Habel
SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch, Professor Dr. Stefan Samerski, Sadja Schmitzer ,Leiterin der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, und David Heydenreich, Mitarbeiter der SL-Öffentlichkeitsarbeit. Bild: Susanne Habel
� Heimatvertriebene und Aussiedler im Erzbistum Freiburg

� SL-Ortsgruppe Zwiesel/Niederbayern
Wahlen, Buch, Film und Gesang
Anfang Juni fand die Hauptversammlung der niederbayerischen SL-Ortsgruppe Zwiesel im Hotel zur Waldbahn statt.
rts- und Bezirksobmann
OChristian Weber begrüßte Arnulf Illing, Obmann der SL-Ortsgruppe Viechtach, Michael Fremuth und das neue Mitglied Wilhelm Weinberger. Weber betonte, daß das Schicksal der Sudetendeutschen eng mit Flucht und Vertreibung verbunden sei. Die heutige Akzeptanz auf offizieller tschechischer Seite gegenüber den immer noch existierenden BenešDekreten und dem Freistellungsgesetz könne man nicht akzeptieren.
Detailliert informierte er über den Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Augsburg. Und er berichtete über die posthume Ehrung Otfried Preußlers, mit der ihn der Stadtrat seiner Heimatstadt Reichenberg ausgezeichnet habe (Ý RZ in SdZ 23/2024). Laut Weber können die Sudetendeutschen stolz auf Preußler sein, und die Ortsgruppe Zwiesel und die Bezirksgruppe Niederbayern-Oberpfalz der SL gratulieren der Familie Preußler zur verdienten Ehrung ihres Vaters.
ter ist Horst Wolf. Kassenprüfer sind Karin und Fritz Pfaffl. Beisitzer sind Karl Fleißner, Agathe Rademacher und Anne Weber. Delegierte sind Christian Weber, Anne Weber, Harald Steiner und Wilhelm Weinberger. Obmann Christian Weber freute sich, wieder ein motiviertes und kompetentes Team an seiner Seite zu haben.

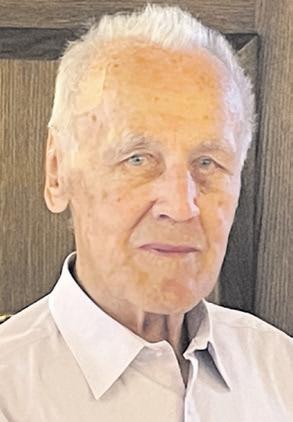
Beim Totengedenken gedachte man besonders der seit der letzten Hauptversammlung verstorbenen Mitglieder Emmerich Bauer und Edit Fürst sowie der Anfang Juni verstorbenen Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek, die aus Komotau in Nordböhmen stammte. Anschließend ehrte man Georg Rudolf Stadler für zehn, Hubert Buchinger für 30 sowie Harald Steiner und Horst Wolf für 35 Jahre Treue. Nach Webers Tätigkeitsbericht schilderte Schriftführerin Karin Pfaffl die Aktivitäten der Ortsgruppe. Kassiererin Rosemarie Wolf wurde nach ihrem Bericht von den Kassenprüfern Karin und Fritz Pfaffl einwandfreie Arbeit bescheinigt. Weber, der seit 20 Jahren die Ortsgruppe leitet, dankte dem Vorstand für seine ehrenamtliche Arbeit. Er würdigte besonders die Zusammenarbeit mit den Ortsobmännern Arnulf Illing und Fritz Pfaffl aus Regen.
Die Neuwahlen leitete Illing. Weber blieb Ortsobmann, seine Stellvertreter sind Harald Steiner und Fritz Pfaffl. Schriftführerin ist Karin Pfaffl, ihr Stellvertreter ist Fritz Pfaffl. Vermögensverwalterin ist Rosemarie Wolf, ihr Stellvertre-
Anschließend stellte Fritz Pfaffl sein neuestes Buch „Die Spiegelglasfabrikation im Mittleren Böhmerwald“ vor, welches heuer im Ohetaler Verlag erschien. In seiner Buchvorstellung bot Pfaffl zuerst einen Überblick der Spiegelglasfabriken im Mittleren Böhmerwald. Beispielsweise befand sich direkt an der Landesgrenze bei Bayerisch Eisenstein auf böhmischer Seite in Elisenthal die Zieglerhütte, die Peter Ziegler im 19. Jahrhundert gegründet hatte. Pfaffl beschrieb den Vorgang des Versilberns von Gläsern. Alternativ gab es die Verwendung von Quecksilber oder Silber zur Spiegelherstellung, wobei sich Silber durchsetzte, da Quecksilber gesundheitsschädlich ist. Aus einer Silberlösung setzte sich mit Hilfe eines Reduktionsmittels elementares Silber auf die Glasoberfläche ab. Pfaffls Vorfahren arbeiteten in den Spiegelglaswerken des Böhmerwaldes sowie auf bayerischer Seite in Frauenau. Abschließend schilderte Pfaffl Biografien bekannter Spiegelmacherfamilien wie Abele und Hafenbrädl.
Der folgende Film dokumentierte die Vertreibung und die Integration der Sudetendeutschen in Bayern. Thematisiert wurde der Brünner Todesmarsch. Seit einigen Jahren veranstaltet Brünn im Rahmen des Festivals „Meeting Brno“ einen Versöhnungsmarsch. Heuer sind auch die SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg wieder dabei (Ý Seite 1ff).
Gemeinsam sang man „Kein schöner Land“ und „Tief drin im Böhmerwald“, unterstützt von Anne Weber mit der Flöte. Weber dankte abschließend allen Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz und appellierte an alle mit sudetendeutscher Herkunft und Abstammung, sich für die Heimat ihrer Vorfahren zu interessieren und Veranstaltungen der Landsmannschaft zu besuchen. Es sei wichtig, daß die kulturellen Leistungen der Vorfahren nicht in Vergessenheit gerieten.
78. Wallfahrt nach Walldürn
Unter dem Leitmotiv „Als Glaubende gehen wir unseren Weg“ stand die 78. Wallfahrt der Heimatvertriebenen und Aussiedler zur Wallfahrtsbasilika Sankt Georg oder zum Heiligen Blut im nordbadischen Walldürn Mitte Juni.
Das Pontifikalamt zelebrierte der aus Klattau stammende Emmeram Kränkl OSB, Altabt der Benediktinerabtei Sankt Stephan in Augsburg, der seinen Ruhestand in der Benediktinerabtei Schäftlarn verbringt. Eingangs hatte Stadtpfarrer, Wallfahrtsleiter und Franziskanerpater Josef Bregula die Vertreter der Akkermann-Gemeinde (AG), der Stadt Walldürn, die Stadt-, Kreis- und Pfarrgemeinderäte sowie die Wallfahrer begrüßt. Das Motto interpretierte er als „Zusage für das ewige Leben und die Heimat bei Gott“. Das Leitmotiv nahm auch Kränkl in seiner Predigt auf. Er schilderte die Unterschiede der Erfahrungen und Eindrücke eines Touristen und eines Wallfahrers. Beim Touristen bleibe viel nur an der Oberfläche, die Reise befriedige vor allem die Neugier. Dagegen habe der Pilger ein Ziel. Er nehme Strapazen auf sich, verzichte auf Komfort, wolle nur mit dem Notwendigsten, möglichst wenig Ballast auskommen. Das Ziel sei der Zweck seiner Pilgerschaft, ein Ziel, das ihn auch seiner eigentlichen Bestimmung, seinem Lebenssinn näherbringe. Darum sei eine Pilgerreise oft mit innerer Einkehr, nicht selten auch Umkehr, also Lebensänderung verbunden.
Kränkl charakterisierte das Leben eines modernen säkularen Menschen als das eines Touristen, dem es um Abwechslung, Wellness und Genuß gehe. „Das Leben eines Christen gleicht dagegen nach Paulus einer Pilgerreise. Hier auf Erden leben wir gleichsam in Zelten, die jederzeit abgebrochen werden können, die uns also keine endgültige Heimat bieten können. Wir leben sozusagen in der Fremde,

mat.“ Daraus ergäben sich Folgen für das Leben. Alles sei vergänglich, keine übertriebene Sorge um das irdische Leben und die Zukunft sei nötig. „Unsere erste Sorge sollen die Anliegen Gottes in dieser Welt sein. Wenn wir uns um Gottes Anliegen sorgen, dann wird auch er für uns sorgen.“ Mit einem Gedanken des heiligen Alfons von Orozco schloß Kränkl seine Predigt: „Unser christliches Leben ist ein Weg zum Himmel. Der Pilger, der mit Bedacht un-

denn wir haben hier auf Erden kein festes Zuhause. Dabei gehen wir unseren Weg zum endgültigen Ziel nicht als Schauende, sondern als Glaubende. Wir glauben, daß das Ziel unseres Lebens Gott ist, aber wir können ihn mit unseren Sinnen weder sehen noch hören noch tasten noch mit unserem Verstand erfassen.“
Das Zweite Vatikanum habe daher auch die Kirche als pilgerndes Gottesvolk neu gedeutet. An die Heimatvertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler gewandt, meinte er: „Wir haben alle die Erfahrung gemacht, daß unsere irdische Heimat nichts Festes, Sicheres und Endgültiges ist. Wir mußten oder wollten sie verlassen, aus welchen Gründen auch immer. So fällt es uns leichter, den Status zu begreifen, den wir Christen eigentlich haben: daß wir Pilger sind, unterwegs zu einer anderen endgültigen Hei-
� SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf
Die Polizei rät
Gast des Monatsnachmittags der SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf, zu dem Ortsobfrau Waltraud Illner ins Haus der Begegnung in Giebel eingeladen hatte, war Polizeihauptkommissar Thomas Schembera.
Beim Einbruchschutz müsse man auf gesicherte Türen und Fenster achten, seine Wertgegenstände auflisten und gute Nachbarschaft pflegen. Und Fremde Personen dürfe man nicht in die Wohnung lassen. Thomas Schembera warnte vor Tricks wie das Vortäuschen einer Notlage oder eine Amtsperson, ein Firmenvertreter oder ein Handwerker zu sein. Das seien Versuche, um in die Wohnung zu kommen und zu stehlen oder unseriöse Geschäfte abzuschließen.
„Rufen Sie immer die Polizei, sei es bei verdächtigen Beobachtungen oder wenn Sie selbst Opfer eines Betruges wurden.“ Das gelte besonders für die Gefahren am Telefon oder im Internet. Bei Anrufen, bei denen Betrüger mit dem Enkeltrick oder schockierenden Nachrichten an das Geld der Opfer kommen wollten, gelte es, Ruhe zu bewahren, aufzulegen und sofort die Polizei anzurufen. „Doch achten Sie darauf, daß die Leitung unterbrochen wurde, bevor Sie die 110 wählen, sonst melden sich die Betrüger erneut, weil sie in der Leitung geblieben sind und sich weiter als Polizisten ausgeben.“
Aber auch vor falschen Microsoft-Mitarbeitern, die sich über Telefonanrufe den Zugang zu Computern erschleichen wollten, warnte der Polizist, der im Polizeirevier 8 in Stuttgart-Feuerbach Dienst tut. Im Internet müsse man neben Fake-Shops, die sich mit gefälschten Webseiten die Zugangs- und Bankdaten verschaffen wollten, neuerdings auch auf den Enkeltrick 2.0 auf WhatsApp achten, mit dem der Zugang auf das Handy ergaunert werden solle. Auch vor dem Öffnen von Anhängen, die mit Schadsoftware infiziert sein könnten, warnte der Referent. Thomas Schembera sprach auch die Gefahren, die unterwegs im Alltag lauern, an. Er gab schließlich wertvolle Hinweise, wie man sich am besten vor Handtaschenraub und Taschenund Trickdiebstahl schützen könne. Helmut Heisig

terwegs ist, hält sich nicht dabei auf, nutzlos Neues zu hören und die Antiquitäten und Türme von Städten und andere Kuriositäten zu betrachten; denn er weiß, daß dabei die Zeit verloren geht und es keine Frucht bringt, sich dabei aufzuhalten.“
Lesungen und Fürbitten trugen Gabi Stanzel, Vizevorsitzende der Ackermann-Gemeinde im Erzbistum Freiburg, und Irmgard Michalek vor.
Beim Empfang im Pfarrzentrum hieß Rainer Kreis im Namen des Pfarrgemeinderates die Gäste willkommen. Aus ihm überlieferten Erzählungen schilderte er, daß nach dem Zweiten Weltkrieg die Heimatvertriebenen lediglich mit ihrem Leben und ei-
nem Koffer angekommen seien. „Wir müssen das Andenken hochhalten. Denn gerade heute sehen wir, was Krieg und Vertreibung mit sich bringen.“ Helmut Hotzy, langjähriger AG-Beauftragter für diese Wallfahrt, zeichnete die Vita Kränkls und dessen Bezüge zur AG nach. Emmeram Kränkls Vater Georg sei viele Jahre Diözesanvorsitzender der AG im Bistum Regensburg, Emmeram Kränkl Protektor beim AG-Sozialwerk gewesen. Ebenso erinnerte Hotzy an die erste Vertriebenenwallfahrt in Walldürn 1946 und die anschließenden früheren politischen Kundgebungen. „Die Zeit hat sich geändert, die Erlebnisgeneration ist weitgehend ausgestorben. Aber die Arbeit der AG ist noch nicht beendet, Brückenbauer werden noch lange gebraucht“, resümierte er. Zum Schluß gedachte man des im November verstorbenen langjährigen Geistlichen Beirats der AG Freiburg, Ludwig Weiß. Roland Stindl, AG-Diözesanvorsitzender im Erzbistum Freiburg, stellte die Arbeit seines Verbandes vor wie die seit 1993 bestehende Partnerschaft mit dem Bistum Pilsen. Ebenso wies er auf die 120 Millionen Flüchtlinge weltweit hin. „Flucht und Vertreibung sind also stets ein Thema, dem man sich widmen muß“, so Stindl. Dieses Thema nahm auch der Stellvertretende Walldürner Bürgermeister Jürgen Mellinger in seinem Grußwort auf. Viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge hätten in Walldürn eine neue Heimat gefunden. „Das soll auch künftig funktionieren.“ Markus Bauer

� SL-Altkreisgruppe Nordvorpommern Neue Heimstatt
Jüngst traf sich die mecklenburg-vorpommersche SL-Altkreisgruppe in Zingst.
Bei unserem letzten Heimattreffen in Zingst mußten wir uns leider vom Martha-Müller-Grählert-Club wegen Aufgabe durch die Volkssolidarität verabschieden. Dieser hatte uns 25 Jahre lang als Heimstatt gedient, wo wir uns recht wohl fühlten und stets willkommen waren. Sehr schwierig erwies sich die Suche nach einem neuen, möglichst mietfreien, zentral gelegenen Treffpunkt. Und wieder half uns Birte Meier, die Sekretärin des Bürgermeisters, die uns bereits seit Jahren unterstützend begleitet. Die Lösung fand sich schließlich im Speisesaal der Schule direkt neben der zentralen Bushaltestelle. Auch hier wurden wir wieder sofort willkommen geheißen.
Natürlich schweiften beim ersten Treffen die Gedanken an unsere Schulzeit kurz nach unserer
„erzwungenen Ankunft" 1946 in Zingst zurück. Und das nach längerer Unterbrechung des Schulbesuches, da wir Deutschen in unserer Heimat nach Kriegsende keine Schule besuchen durften. Kein Vergleich dieses modernen Gebäudes mit den damaligen drei Schulstandorten. Die kleinste hatte einen Klassenraum und die Lehrerwohnung. Ganz zu schweigen von den sanitären Anlagen über den Hof. Aber immerhin gab es schon gemischte Klassen. Der damalige Rektor Pauscher war auch ein Vertriebener, doch das war damals tabu. Wir hatten keine moderne Turnhalle, der Sport fand einfach in der freien Natur statt. Leider läuft die Zeit gegen uns. Auch unsere Gruppe wird immer kleiner. Aber solange es geht, machen wir weiter. Bald treffen wir uns in Ribnitz-Damgarten. Auch hier mußten wir wegen Aufgabe durch die Volkssolidarität einen neuen Treffpunkt finden. Peter Barth
Harald Steiner und Hubert Buchinger werden geehrt
Im Speisesaal der Zingster Schule. Bild: Robert Arnold
Dr. Christian Weber, Fritz und Karin Pfaffl, Rosemarie Wolf, Harald Steiner, Wilhelm Weinberger, Dr. Karl Fleißner, Michael Fremuth, Arnulf Illing und Dr. Anne Weber. Bild: Horst Wolf (1), Anne Weber (2)
Diakon Tobias Eckert, Abt em. Dr. Emmeram Kränkl, Diakon Friedhelm Bundschuh und Pater Josef Bregula feiern Eucharistie. Rechts signiert Kränkl das Goldene Buch der Stadt, hinter ihm stehen Jürgen Mellinger, Rainer Kreis, Roland Stindl und Helmut Hotzy. Bilder: Markus Bauer
Thomas Schembera und Waltraud Illner. Bild: Helmut Heisig

Kinderchöre und
Ende Juni begannen das Bistum Regensburg und das Bistum Pilsen mit einer Wallfahrt nach Neukirchen beim Heiligen Blut das Festjahr „1100 Jahre heiliger Wolfgang“ und eröffneten die diesjährige Wolfgangswoche.
Schon im Bus von Regensburg zur Wallfahrtskirche Mariä Geburt zum Heiligen Blut hatte Domvikar Andreas Albert, der Leiter der Pilgerstelle der Diözese Regensburg, den Pilgern nach dem von ihm gespendeten Reisesegen das Leben und Wirken des heiligen Wolfgang erläutert. Besonders ging er auf Wolfgangs für das Bistum Regensburg entscheidende Fakten ein: die Trennung des Bischofsamtes und des Amtes des Abtes von Sankt Emmeram, die Zustimmung zur Abspaltung des böhmischen Teils des Bistums Regensburg, das die Gründung des Bistums Prag ermöglichte, und die Gründung einer Domschule mit Chor, aus der die heutigen Regensburger Domspatzen hervorgingen. Bei angenehmen Sommertemperaturen konnten sich die Pilger – ob zu Fuß, mit Fahrrad, Auto oder Bus – im Klostergarten stärken und ins Gespräch kommen. Auch mit den Bischöfen aus Regensburg und Pilsen –Rudolf Voderholzer und Weihbischof Josef Graf sowie Altbischof František Radkovský und Bischof Tomáš Holub – waren „Small-Talk“ und „Selfies“ möglich. Für den Markt Neukirchen beim Heiligen Blut hieß Bürgermeister Markus Müller die Wallfahrer willkommen, für die Pfarrei und das Franziskanerkloster tat dies Pater Augustinus Kozdra. Aus Regensburg war eigens der Wolfgangsschrein nach Neukirchen gebracht worden. Am Marktplatz, wo sich Vereinsabordnungen, die Kommunalpolitiker und die Pilger bereits zahlreich versammelt hatten, segnete Voderholzer den Schrein. Mit Musik zog die Prozession zur Wallfahrtskirche, vier Männer der Freiwilligen Feuerwehr trugen den Wolfgangsschrein.

Fahnenabordnungen bereichern die Wallfahrt.
Patron für die Völker Europas
Als Dekan für die Region Cham begrüßte am Anfang des Gottesdienstes Pfarrer Holger Kruschina, gleichzeitig Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks, die Pilger. „Die Saat, die der heilige Wolfgang gelegt hat, ist aufgegangen“, erklärte er und verwies auf den Brückenschlag – auch bei dieser Gelegenheit – zwischen den Bistümern Regensburg und Pilsen. Letzteres war 1993 wiederum vom Bistum Prag abgespalten worden. Der „Uropa“ dieser Bistümer, der heilige Wolfgang, habe durch sein Wirken ein klares Zeugnis für Christus abgelegt. Als Glaubensbote und Glaubenszeuge seiner Zeit würdigte auch Hausherr Pater Augustinus den heiligen Wolfgang, an dessen Schrein elf Kerzen – für jedes Jahrhundert eine – brannten. „Er steht gleichermaßen für die Kirche von Regensburg und als Patron der Völker Europas.“ Daher sei es auch kein Zufall, daß dieser Festgottesdienst mit dem Wolfgangsschrein an der Grenze von Bayern und Böhmen stattfinde. Aber auch die grenzüberschreitende Marienwallfahrt nach Neukirchen trage seit sechs Jahrhunderten zur Völkerverbindung bei. Mit Freude hieß
er die tschechischen und deutschen Wallfahrer aus Klattau und Taus, Waldmünchen und Furth im Wald, die der Ackermann-Gemeinde und der Marianischen Männerkongregation willkommen. An die völkerverbindende Wallfahrt vor zehn Jahren beim Katholikentag ebenfalls hierher erinnerte Bischof Voderholzer in seiner Begrüßung. Der am Seitenaltar aufgestellte Wolfgangsschrein sei „kein Sarg, sondern
zum Erzbistum aufgestiegen sei und 2023 das 1050jährige Jubiläum habe feiern können. Die rhetorische Frage, ob Bischof Wolfgang mit dieser Entscheidung eine Brücke gebaut oder eine Grenze gezogen habe, beantwortete Bischof Voderholzer postwendend: „Wolfgang trug den geografischen und kulturellen Gegebenheiten Rechnung. Er errichtete keine neue Grenze, sondern erkannte die bestehende Eigenständigkeit an.
sichts unterschiedlicher Sichtweisen beim aktuellen Prozeß in der deutschen katholischen Kirche – bedeutet, erläuterte Voderholzer: Partizipation, Mission und die Gemeinschaft des im Herbst in Rom stattfindenden zweiten Teils der Bischofssynode.
„All das hat der heilige Wolfgang, ohne den Begriff der Synodalität dafür zu verwenden, aber durch seinen Hirtendienst bewirkt. Er zeigt uns zugleich das wahre Wesen der Synodalität. Denn sie darf nicht verwechselt werden mit einer Demokratisierung der Kirche im politischen Sinn. Der heilige Wolfgang ist ein Lehrer der recht verstandenen Synodalität.“ Dies vertiefte Voderholzer mit der damals vollzogenen Trennung der Ämter des Abtes und des Bischofs, wodurch den Mönchen eine stärkere Teilhabe am kirchlichen Leben ermöglicht worden sei.

eine Wiege, der sich die Kirche immer als einen Jungbrunnen vergewissert“.
In seiner Predigt, die sein Pilsener Amtsbruder Holub abschnittsweise ins Tschechische übersetzte, erinnerte Voderholzer an das Motto „Mit Christus Brücken bauen“ des Katholikentages 2014 und an die damalige Wallfahrt. Als wichtigen Schritt Bischof Wolfgangs, der bis heute die Menschen in beiden Ländern betreffe, nannte Wolfgangs jetziger Nachfolger Voderholzer den Verzicht auf die zum Bistum Regensburg gehörenden Regionen östlich des Bayerischen beziehungsweise des Böhmerwaldes schon ein Jahr nach dem Amtsantritt – also 973. Somit sei die Gründung des Bistums Prag möglich geworden, das später
Sein Tun war ein pastorales, seelsorgliches, missionarisches.“
Voderholzer zitierte den Heiligen: „Wir sehen im Boden jenes Landes eine kostbare Perle verborgen, die wir nicht, ohne unsere Schätze zu opfern, gewinnen können. Gern opfere ich mich selbst und das Meinige auf, damit dort die Kirche erstarke und das Haus des Herrn festen Boden gewinne.“ Aus diesen Sätzen werde Wolfgangs Charakter als geistlicher Schatzsucher sowie Förderer der Charismen und Gnadengaben deutlich.
Einen weiteren Gedanken brachte der Regensburger Bischof damit in Verbindung, nämlich Papst Franziskus‘ Auftrag, gerade heute das Moment der Synodalität in der Kirche zu stärken. Was das für ihn – ange-
„Und er selber konnte als Bischof seinen Hirtendienst der Verkündigung des Evangeliums mit einem stärkeren Profil versehen. Auch die Reform des Klerus und der anderen Klöster war ihm ein Herzensanliegen. Sie sollten auf diese Weise wieder stärker die Kraft von Glaube, Hoffnung und Liebe ausstrahlen. Durch die Freigabe der böhmischen Gebiete hat Wolfgang die Partizipation vieler kostbarer Perlen für das Erstarken der kirchlichen Sendung im künftigen Bistum Prag ermöglicht.“ In diesem Kontext nannte der Bischof die Heiligen Wenzel, Johannes von Nepomuk, Ludmilla, Adalbert und Johannes Nepomuk Neumann sowie „viele nicht namentlich bekannte Heilige des Alltags“.
Zum Schluß ging Bischof Voderholzer auf die mit dem heiligen Wolfgang verbundene Bildung ein. Partizipation und Sen-
dung in der Kirche bräuchten Vorbereiter, um viele Menschen teilhaben zu lassen. In der von Wolfgang begründeten Domschule seien der spätere Kaiser Heinrich II., der Heilige, und die spätere ungarische Königin, die heilige Gisela, unterrichtet worden.
„Heute baut der heilige Wolfgang eine Brücke zwischen unseren Bistümern, indem wir uns auf den Weg gemacht und um seinen Schrein versammelt haben und mit ihm den dreifaltigen Gott preisen. Synodalität heißt wörtlich ,Miteinander auf dem Weg sein‘. Aus allen Himmelsrichtungen sind wir gekommen, aus Bayern und Böhmen, aus dem Bistum Regensburg und dem Bistum Pilsen. Uns verbindet der gemeinsame Glaube, den einst der heilige Wolfgang verkündet hat. Der heilige Wolfgang ist somit auch ein Patron Europas, dessen kulturelle Vielfalt in den Regionen lebt und das durch seine christlichen Wurzeln geeint ist.“ Mit dem Dank an die vielen Pilger, die auch Zeuge des gemeinsamen Glaubens seien, der eine Brücke bilde, und den Worten „Diese Brücke hält, sie hält uns zusammen, weil Gott uns zusammenführt und zusammenhält.“ schloß Bischof Rudolf Voderholzer. Der Gottesdienst war zum Teil zweisprachig. Die Lesung wurde in tschechischer, das Evangelium in deutscher Sprache vorgetragen, die Fürbitten abwechselnd in Deutsch und Tschechisch. Am Ende der Eucharistiefeier segnete der Bischof die Wolfgangsmedaillen, welche die Pilger am Ausgang überreicht bekamen. Musikalisch umrahmten den Pontifikalgottesdienst 65 Kinder aus den Bistümern Pilsen und Regensburg. Das waren die Špačci sv. Bartoloměje oder Bartholomäus-Spatzen, der verstärkte Kinderchor des Doms zu Pilsen unter Blanka Nosková und Mitglieder von sechs Kinderchören des Regensburger Diözesanverbands Pueri Cantores unter Julia Glas. Nach dem Gottesdienst sangen die Mädchen und Buben im Klostergarten zwei deutsche Lieder und ein tschechisches Lied. Markus Bauer
Inzwischen ist es ein guter Brauch, daß Mitglieder der Akkermann-Gemeinde in der Erzdiözese Freiburg am Tag vor der traditionellen Wallfahrt der Heimatvertriebenen und Aussiedler zum Heiligen Blut im nordbadischen Walldürn (Þ Seite 10) ein interessantes Objekt in der Nähe besichtigen. Heuer stand die von Heinrich Hennig initiierte und erbaute Waldkapelle Sankt Maria im Walldürner Ortsteil Glashofen-Neusaß auf dem Programm.
Urgestein, Macher, Visionär, Kämpfernatur – mit diesen und vielen weiteren Attributen wird der mittlerweile 83jährige Heinrich Hennig beschrieben, der 2018 das Bundesverdienstkreuz erhielt. Von seinen zahlreichen Verdiensten seien nur einige wenige genannt: 52 Jahre Kommunalpolitik als langjähriger Ortsvorsteher von Glashofen, Vorstandsvorsitzender der Milchzentrale Nordbaden, Betreuung drogenabhängiger Jugendlicher ab 1984, Initiator des Golfclubs und Golfplatzes in seinem Ortsteil sowie des Energieparks Neusaß mit Spatenstich für das neue Agro-Solar-Projekt am kommenden 1. Juli und Unterstützung des Odenwald-Hospiz. Sein jüngstes Projekt, die im September eingeweihte Waldkapelle Sankt Maria am Neusaßer Mühlweg, präsentierte er nun den Mitgliedern der Freiburger Ackermann-Gemeinde. „Es war schon immer mein Wille, eine Kapelle zu bauen“, erklärte der tief gläubige frühere Landwirtschaftsmeister. Er erzählte, daß 1945/1946 die aus dem Jahr 1717 stammende Glokke der Hofkapelle für die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen geläutet worden sei. „In Glashofen-Neusaß waren etwa 250 Flüchtlinge und Heimatvertriebene vor allem bei den Bauern untergebracht und hatten so Arbeit und Verpflegung.“
Die Wiese, auf der die Kapelle gebaut wurde, hat Hennig extra gekauft, der Bau startete vor zirka zwei Jahren. Die MarienWidmung der Kapelle rührt von
der Glocke auf seinem Hof, die ebenfalls der Gottesmutter gewidmet ist. Das Gebäude ist als Lehmbau und in Fachwerkstruktur – wie es auch früher üblich war – errichtet worden, für die künstlerische Gestaltung sorgte der Akademische Bildhauer Rainer Englert aus dem nahen Walldürn-Ziegelhütte. So ist der Altar aus weißem und roten Sandstein, die Bilder mit den Motiven Mariä Geburt und Maria Verkündigung sind von außen und von innen klar zu sehen. „Bis 22 Uhr werden die Bilder mit gespeicherter Solarenergie angestrahlt“, betonte der Kapelleninitiator. Außerdem ist die Mari-

enkapelle Tag und Nacht geöffnet. Die Glocke, deren Ton mit der auf dem Hof abgestimmt ist, kann mit einem kleinen Schalter zum Erklingen gebracht werden. Die Kirchenbänke stammen von anderen Kapellen, insgesamt finden 30 Leute in der Kapelle Platz. Alle Personen, die mehr als 14 Tage beim Bau der Kapelle mitgeholfen und mitgearbeitet haben, sind in einem Glasbild verewigt. Außerdem waren am Bau vor allem Firmen aus der Region Walldürn tätig. Natürlich gehört auch ein entsprechendes Umfeld mit frisch gepflanzten Bäumen und Rosen zur Kapelle. Immer wenn er an der Kapelle vorbeifährt, nimmt sich Heinrich Hennig eine Viertelstunde Zeit zum Meditieren und zur Lektüre der Einträge im ausgelegten Pilgerbuch. Faszinierend findet er auch die Verknüpfung von zum Teil sehr alten und ganz neuen Elementen. Noch in Arbeit ist eine Christusfigur, die entsprechend des in Brasilien verbreiteten Auferstehungschristus gestaltet wird. Da die Kapelle am Neusaßer Mühlweg liegt, statten ihr gerne Wanderer und Radfahrer einen Besuch ab. Auch Pilgergruppen im Rahmen der Walldürner Wallfahrt zum Heiligen Blut machten hier kurz Station. Zum einjährigen Jubiläum der Einweihung beziehungsweise zum Festtag Mariä Geburt am 8. September oder Mariä Namen am 12. September wird Heinrich Hennig sicher den Schalter betätigen und mit dem Glokkengeläut zum Gebet einladen. Markus
Altbischof František Radkovský, Bischof Dr. Tomáš Holub, Bischof Professor Dr. Rudolf Voderholzer, Weihbischof Dr. Josef Graf und Domprobst Prälat Dr. Franz Frühmorgen.
Brigitte Schmidegger, Gabi Stanzel, Marianne Stindl, Heinrich Hennig, Diözesanvorsitzender Roland Stindl, Irmgard Michalek und Helmut Hotzy in der neuen Marienkapelle. Bild: Markus Bauer


Neudek Abertham

Bärringen

Neudeker Heimatbrief
für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Folge 658 · 6/2024



Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft, Stadtsparkasse München – IBAN: DE69 7015 0000 0906 2126 00, BIC: SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge 659 (7/2024): Mittwoch, 17. Juli.
In der Folge 655 des Neudeker Heimatbriefes kündigten wir bereits Ende März das Jubiläum 70 Jahre Patenschaft Göggingen/Augsburg – Stadt und Landkreis Neudek“ an. Da nun die Einzelheiten des Ablaufes der Festveranstaltung am 27. Juli feststehen, erinnern wir unsere Leser nochmals an die Jubelfeier. Außerdem berichten wir, wie es zur Ansiedlung der Neudeker in Augsburg und Umgebung kam und wie Göggingen und später Augsburg Pate der Vertriebenen aus Neudek und Umgebung wurde.
Das Fest beginnt am Samstag, 27. Juli mit einer Feierstunde am Neudeker Mahnmal vor dem Gögginger Friedhof. Das Mahnmal errichtete die Heimatgruppe „Glück auf“ im Jahr 1954. Es besteht aus drei Gedenksteinen. Der linke Stein trägt in Reliefform die Bilder der beiden Erzgebirgsdichter Anton Günther und Hans Soph. Den mittleren Stein schmücken ein Bild des Neudeker Turmfelsens mit dem Turm der ehemaligen Burg und das Wappen der Stadt Neudek. Auf dem rechten Stein stehen die Namen aller Ortschaften des ehemaligen Landkreises Neudek. Nach der Feier werden die Landsleute auf Kosten der Heimatgruppe „Glück auf“ in Bussen zum Augsburger Rathaus gebracht. Dort findet um 13.00 Uhr im Fürstenzimmer der Empfang durch die Stadt Augsburg statt. Wir freuen uns, daß Eva Weber, die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, ihr Kommen zugesagt hat. Aus Neudek/ Nejdek kommt ein Bus mit Vertretern der Stadtverwaltung, an ihrer Spitze Bürgermeisterin Ludmila Vocelková, und tschechischen sowie heimatverbliebenen deutschen Bürgern. Wegen des begrenzten Platzes im Fürstenzimmer bitten wir um Anmeldung bei Anita Donderer, Telefon (08 21) 66 57 24, eMail anitadonderer@ gmx.de oder Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimmaugsburg@t-online.de Wie kam es zur Ansiedlung der Einwohner von Stadt und Landkreis Neudek im bayerischschwäbischen Raum Augsburg nach der Vertreibung von 1945/46? Neudek war ebenso wie Augsburg eine Stadt der Textil-, Eisen- und Papierindustrie. Als die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus dem Sudetenland von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges beschlossene Sache war, machten sich aus Neudek einige mutige Männer unter Gefahren auf den Weg nach Bayern, um Städte zu erkunden, in denen die erfahrenen Industriearbeiter Neudeks gebraucht würden. Sie knüpften Kontakte zur amerikanischen Besatzungsmacht und zur sich entwickelnden neuen bayerischen Staatsverwaltung. Im Verlauf des Jahres 1946 gelang, sechs Eisenbahnzüge mit 7200 vorwiegend aus Neudek stammenden Heimatvertriebenen nach Augsburg zu lenken. Da die Stadt fast vollständig zerbombt war, wurden die Neudeker in die umliegenden Gemeinden





❯ Göggingen, Augsburg und die Neudeker feiern
70 Jahre Patenschaft



Stadtwappen von Neudek …
Göggingen, Haunstetten, Gersthofen und in die Städte Friedberg und Aichach weitergeleitet. Der damalige Markt Göggingen nahm eine besonders große Zahl von Heimatvertriebenen auf. Die Mehrzahl der Vertriebenen aus den Ortschaften des Landkreises Neudek kam in die schwäbischen Gemeinden Offingen, Ichenhausen, Burgau und Günzburg. Göggingen wurde zum Zentrum der Vereinsaktivität der Neudeker, allen voran der Heimatgruppe „Glück auf“, die im März 1952 gegründet worden war.
Die Neudeker Vertriebenen wurden nach anfänglicher Ablehnung rasch geschätzte Bürger
in Augsburg und ganz BayerischSchwaben. Recht schnell integrierten sie sich kulturell und kommunalpolitisch. Und schon ab 1948 stellten sie in Göggingen drei Gemeinderäte. Von 1966 bis 1972 waren es sogar fünf, darunter der bereits verstorbene Erich Sandner, der zugleich Zweiter Bürgermeister gewesen war, und der ebenfalls bereits verstorbene Herbert Götz, der spätere Zweite Vorsitzende der Heimatgruppe „Glück auf“.





In Würdigung der Integrationsbereitschaft und der Aufbauleistung der Neubürger aus Neudek faßte der Gögginger Ge-

meinderat 1953 den Beschluß, Pate der Stadt Neudek zu werden. Die Urkunde wurde am 1. August 1954 ausgestellt. 1969 wurde Göggingen zur Stadt erhoben und kurz darauf in die Stadt Augsburg eingemeindet. Die Handschrift der Neudeker im Gögginger Stadtrat ist deutlich erkennbar im Vertrag zur Eingliederung der Stadt Göggingen in die Stadt Augsburg vom 29. Juni 1972. Dort ist den Neudekern folgender Paragraph gewidmet: „§ 18 Patenschaft Göggingen/ Neudek. Die Stadt Augsburg verpflichtet sich zur Fortführung
der bisherigen Patenschaft für die Stadt Neudek (Sudetenland) und unterstützt die Heimatgruppe „Glück auf“ Landkreis Neudek bei ihren turnusmäßigen Heimattreffen in der bisher üblichen Weise. Die Stadt Augsburg wird das Neudeker Ehrenmal betreuen und die Neudeker Heimatstube erhalten.“





und

Die Patenschaftsurkunde Augsburgs wurde am 1. September 1975 ausgestellt und vom damaligen Oberbürgermeister Hans Breuer, einem gebürtigen Troppauer, unterschrieben. Augsburg versprach, den Heimatvertriebenen aus der Stadt und dem Landkreis Neudek eine zweite Heimat zu geben. Die Stadt Augsburg kommt ihren zugesagten Verpflichtungen bis heute nach, wofür wir sehr dankbar sind. Der Kontakt der Heimatgruppe zur Stadt Augsburg und ihren jeweiligen Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterin ist ausgezeichnet. Das Ziel der Patenschaft ist erreicht. Längst sind wir Augsburger, Offinger, Burgauer oder Günzburger. Nach der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei weiteten Anita Donderer und Herbert Götz als die „Kinder von damals“ die Patenschaft auf das heutige Nejdek aus. Seit 2013 beteiligt sich daran auch die Heimatgruppe „Glück auf“. Andere Heimatgruppierungen knüpften Kontakte zu den Gemeinden Abertham und Hochofen-Trinksaifen. Die Kontakte bestehen auf Bürgerebene mit den jeweiligen Stadtverwaltungen. Ein sichtbares Zeichen waren und sind die Besuche der Augsburger Oberbürgermeister Peter Menacher, Paul Wengert, Kurt Gribl, der jetzigen zweiten Bürgermeisterin Martina Wild sowie des Altoberbürgermeisters Hans Breuer und des Altbürgermeisters Theo Gandenheimer in Neudek und das zugesagte Kommen von Oberbürgermeisterin Eva Weber zum Patenschaftsjubiläum. Von Neudeker Seite waren die Bürgermeister Jiří Bydžovský, Vladimír Benda und Lubomír Vítek nach Augsburg gekommen. Die jetzige Neudeker Bürgermeisterin Ludmila Vocelková hat ihr Kommen zum Patenschaftsjubiläum zugesagt. Auch die Kontakte auf Bürgerebene sind vielfältig, zum Bespiel durch den seit über zehn Jahren traditionellen deutschtschechischen Gemeinschaftsstand der Heimatgruppe „Glück auf“ und des tschechischen Bürgervereins „Jde o Nejdek (JoN)“ auf den Sudetendeutschen Tagen. Mit Pavel Andrš, dem langjährigen Ersten Vorsitzenden von JoN, verbindet uns eine besonders innige Freundschaft. Ich erinnere ferner an die Fußballspiele der Datschiburger Kikkers, organisiert von Anita Donderer und dem Fußballclub Nejdek, und an die von Anita Donderer und Herbert Götz organisierten jährlichen Busfahrten der Heimatgruppe „Glück auf“ nach Neudek und Umgebung. Seit dem Tod von Herbert Götz organisiert Anita Donderer die Fahrten allein. Ferner fanden regelmäßige Heimattreffen in Abertham/ Abertamy statt und finden weiterhin in Hochofen-Trinksaifen/ Vysoká Pec-Rudné statt. Verfallende Kirchen wurden von Heimatvertriebenen renoviert und deutsche Friedhöfe wurden in der alten Heimat gepflegt. Die Vertreibung aus der Heimat war ein großes Unrecht, aber die Wunden sind verheilt. Wir hoffen auf eine ständig wachsende Verständigung mit unseren tschechischen Nachbarn, denn Freundschaft und Versöhnung sind besser als Haß: Protože přátelství a usmíření jsou lepší než nenávist. Josef Grimm
… von Göggingen …
…
von Augsburg.

Impressionen vom Neudeker Stand
Über die großen Veranstaltungen des 74. Sudetendeutschen Tages wurde schon ausführlich in der Sudetendeutschen Zeitung und im „Der Grenzgänger“ berichtet. Daher schildern wir hier nur einige Impressionen vom traditionellen deutsch-tschechischen Gemeinschaftsstand der Heimatgruppe „Glück auf“ und des tschechischen Bürgervereins „Jde o Nejdek (JoN) – Es geht um Neudek“.
Zum Standaufbau am Freitag Nachmittag ab zwei Uhr trafen trotz widriger Verkehrsverhältnisse aus Neudek Pavel Andrš, Sonja Bourová und Hans Kemr ein. Von unserer Seite waren Anita Donderer, Helmut Günther und ich zugegen.
Ein großes Schriftband am Stand kündigte das Jubiläum „70 Jahre Patenschaft Göggingen/Augsburg – Neudek/Nejdek“ an. Nachdem wir bei früheren Sudetendeutschen Tagen des öfteren eine schlechte Lage unseres Standes hatten beklagen müssen, hatten wir diesmal Glück: Unser Stand lag in der Halle 7 an einem der Hauptdurchgänge zum Gastronomie- und Unterhaltungsbereich. Die Ausstellungsgegenstände waren rasch auf dem Ausstellungstisch ausgelegt, und zum Ausschmücken der Wände unseres Standes hatten unsere Neudeker Freunde Bildtafeln mitgebracht. Ulrich Möckel, der Herausgeber der Internetzeitschrift „Der Grenzgänger“, beschreibt in der aktuellen Ausgabe 126 der Zeitschrift seine Eindrücke vom Besucheraufkommen am Samstag und Sonntag: „Der Samstag war für die Standbetreiber ein gemütlicher Tag ohne viele Besucher, und so wurden langjährige Kontakte gepflegt und sich über manches Problem ausgetauscht. Die älter werdende Erlebnisgeneration und das häufig fehlende Engagement der nachgeborenen Gene-
n Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Juni, 26. Beerbreifest in Hochofen-Trinksaifen/Vysoká Pec u Nejdku-Rudné: Samstag 10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Thaddäus Posielek, Organist Peter Rojík und Sopranistin Věra Smrzová in der Kirche Mariä Heimsuchung in Trinksaifen; 12.00 Uhr Mittagessen in Hochofen mit Bürgermeister Václav Malý; 14.00 Uhr Fahrt nach Seifen/Ryžovna mit Besuch des Anton-Günther-Grabs und der
� Wappenlexikon
Fünf Neudeker Stadtwappen
Das Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg besitzt das „Sudetendeutsche Wappenlexikon“, das Aleš Zelenka und Tony Javora 1985 im Verlag Passavia in Passau herausgaben. Es zeigt die Wappen der sudetendeutschen Städte und schildert ihre Geschichte.
eisen; der gekrönte Schild wird von zwei silbernen Löwen gehalten. Der tschechische Historiker August Sedlaček (1843–1926) spricht von einem Berggezäh mit natürlichen Stielen, nach dem die Krone fünfzackig und mit Edelsteinen geschmückt ist; die Werkzeuge sieht man manchmal auch in vertauschter Stellung. Das gleiche Wappen führten auch Schmiedeberg, Johannesthal oder Böhmisch Wiesenthal und andere Bergwerksorte, bevor ihnen ein anderes Wap-

Das historische Stadtwappen.
interessanten Vorträgen, Filmpräsentationen und Diskussionsrunden sowie Vereinsversammlungen begleitet dieses Treffen. Dabei ist auffällig, daß immer


ration bereiten vielen Standbetreibern Sorge. So war nicht selten zu vernehmen, daß es wohl das letzte Jahr für manchen Stand auf dem Sudetendeutschen Tag gewesen sein könnte. Am Sonntag entsprach die Besucherresonanz den Erwartungen der meisten Standbetreiber. So traf man sich im gastronomischen Bereich oder an den Ausstellungsständen der Regionen und Vereine. Es war schön zu sehen, wie sich Kinder und Enkel um ihre Eltern und Großeltern kümmerten, damit sie die für sie wichtige Veranstaltung besuchen konnten. Nicht nur die Großveranstaltungen bestimmten den Sudetendeutschen Tag. Eine Vielzahl von

mehr dieser Veranstaltungen von jungen Tschechen geleitet werden, die sich mit dem Thema der Vertreibung zum Teil auch aus wissenschaftlicher Sicht beschäftigen. Publikationen in tschechischer Sprache darüber waren vor 30 Jahren noch Ausnahmen und sind heute Normalität. Es waren interessante und erlebnisreiche Tage in Augsburg, dennoch waren sie mit etwas Wehmut verbunden. Etliche Stände waren aus Altersgründen aus dem Hallenbild ver-
schwunden. Auch fehlten manche netten Menschen, die man in der Vergangenheit einmal im Jahr zu dieser Veranstaltung traf und worauf man sich schon freute. Aber das Leben geht weiter, und neue, interessante Bekanntschaften wurden geschlossen. Der Sudetendeutsche Tag ähnelt einem großen Familienfest unter Gleichgesinnten.“ So weit Ulrich Mökkels Eindrücke.
An unserem Stand fanden sich zur Kontaktpflege Vereinsmitglieder ein, aber auch interessierte Passanten beider Sprachen, um sich über die bevorstehende Festveranstaltung zum 70jährigen Patenschaftsjubiläum und über Reisen nach Neudek und Umgebung und über dortige Sehenswürdigkeiten zu informieren.
Besonders erfreut waren wir natürlich über den Besuch etlicher prominenter Besucher, darunter Ulrike Scharf, bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Eva Weber, Oberbürgermeisterin von Augsburg, Petra Loibl, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Andreas Jäckel, Abgeordneter im Bayerischen Landtag und Stadtrat von Augsburg, Max Weinkamm, Stadtrat von Augsburg, Heinrich Bachmann, Altstadtrat von Augsburg, und Volker Ullrich MdB. Es war der mindestens zwölfte gemeinsame Auftritt der Heimatgruppe „Glück auf“ und des tschechischen Vereins „Jde o Nejdek“ auf den Sudetendeutschen Tagen. Während früher noch manche Besucher die Nase über diese deutsch-tschechische Zusammenarbeit rümpften („Wer mit de Tschechn paktiert, dem ghörn Händ und Fais abghackt“), ist unser gemeinsamer Ausstellungsstand längst Normalität geworden. Wir werden nächstes Jahr beim 75. Sudetendeutschen Tag in Regensburg sicher wieder dabei sein. Josef Grimm
TERMINE
Kirche in Gottesgab/Boží Dar; anschließend Besuch des Gedächtnissteins und Einkehr im Restaurant der Brauerei in Seifen; 17.00 Uhr Rückfahrt nach Hochofen, Abendessen und kleiner deutsch-tschechischer Heimatabend mit Helmut Zettl und Franz Severa. Sonntag 10.00 Uhr Wanderung mit Roman Kloc, Václav Malý und Schwarzbeersuche ab Penzion Na Vysoká Peci, früher Justinsklause, zum Fuchswinkel/Rabenberg; 12.00 Uhr
Mittagessen und Ende des Treffens. Unterkunft Hotel Malamut, früher Schwarz, Nové Hamry 18, CZ-36221 Nové Hamry, Telefon (0 04 20)7 31 47 89 10, eMail hotelmalamut@gmail.com; Hotel Seifert, früher Rohm, Nové Hamry 13, CZ-36221 Nové Hamry, Telefon (0 04 20) 7 24 08 82 10, eMail info@ horskyhotelseifert.cz; Hotel Anna, Naměstí Karla IV. 486, CZ36221 Nejdek, Telefon (0 04 20) 3 53 82 47 56, eMail info@
wellnesshotelanna.cz. Auskunft: Adolf Hochmuth, Am Schloßberg 28, 91757 Treuchtlingen, Telefon (0 91 42) 36 04, eMail adolf-hochmuth@t-online. de n Samstag, 27. Juli, 70 Jahre Neudeker Mahnmal und 40 Jahre Heimatmuseum in Augsburg: 11.00 Uhr Feierstunde am Neudeker Mahnmal vor dem Gögginger Friedhof mit Grußworten, Festredner Heinz Münzenrieder, Totengedenken und der Kolping-
Im ehemaligen Landkreis Neudek sind dies Abertham, Bärringen, Frühbuß, Neudek und Platten. Beim Abdruck aus einer Veröffentlichung braucht man eine Abdruckgenehmigung. Nach unseren Ermittlungen ist der Verlag Passavia Passau vor 30 Jahren erloschen. Es gelang auch nicht, Kontakt mit den Autoren aufzunehmen. Die Sudetendeutsche Stiftung unterstützte jedoch damals die Herausgabe des Buches finanziell, was aus dem Geleitwort des damaligen Volksgruppensprechers Franz Neubauer hervorgeht. Die Wappen der fünf Städte im Landkreis Neudek und das Wappen der Patenstadt Augsburg zieren seit 2012 das Impressum des Neudeker Heimatbriefes. Wir wollen den Lesern die Beschreibung der Wappen nicht vorenthalten und nennen das „Sudetendeutsche Wappenlexikon“ ausdrücklich als Quelle. Das Buch ist vergriffen, vereinzelt werden gebrauchte Exemplare in Antiquariaten für 22,00 bis 185,00 Euro angeboten. Josef Grimm
Abertham

Aktuelles Wappen.
Abertham wurde 1529 bei reichhaltigen Silber- und Zinnerzlagern an dem Bache Wistritz gegründet. 1534 wurde dort die Kirche der Vierzehn Nothelfer erbaut, die 1736 einer barocken Kirche weichen mußte. Nachdem der natürliche Reichtum erschöpft war, entwickelte sich Abertham zum Hauptort der erzgebirgischen Handschuhindustrie.
Zum Bergstädtchen wurde es wahrscheinlich noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von Ferdinand I. erhoben, worauf offensichtlich auch das geführte Wappen zurückzuführen ist: in Rot gekreuzte schwarze, goldbestielte Schlegel und Berg-
pen verliehen wurde. Damit stellt sich die Frage, ob dieses Bergmannssymbol zur damaligen Zeit als wirkliches Wappen angesehen wurde; auf manchen Siegeln dieser Orte begleitete das Symbol im oder ohne Schildchen das eigentliche Ortswappen. Bei Abertham wurde die Grenze des Allgemeinen jedoch durch die –vielleicht spätere – Hinzufügung der Schildhalter überschritten. Nach der Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung im Jahr 1946 verlor Abertham die Stadtrechte und wurde zur Obec Abertamy zurückgestuft. Am 22. Juni 2007 erhielt Abertamy vom tschechischen Staat erneut die Stadtrechte verliehen.

WIR GRATULIEREN
Wir gratulieren folgenden treuen Beziehern des Neudeker Heimatbriefs zum Geburtstag im Juni und wünschen von Herzen alles Schöne und Gute sowie viele schöne Jahre in Gesundheit und Zufriedenheit.
n Neuhammer. Johanna Spahr/Meindl (Ober Neuhammer 141), Am Rain 6, 86517 Wehringen, 29. Juni 1946.
n Sauersack. Elfriede Fastner, Turmstraße 13, 95698 Neualbenreuth, 28. Juni 1939.
n Eibenberg. Hans Hermann Lauber (Nr. 30), Sattlerbad 8, 38855 Wernigerode, 14. Juni 1939.
Blaskapelle; 13.00 Uhr Empfang der Stadt Augsburg im Fürstenzimmer des Rathauses. Auskunft: Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail heimatgruppe -glueckauf@t-online.de oder grimm-augsburg@t-online.de n Freitag, 30. August bis Sonntag, 1. September, SL-Altkreisgruppe Schlüchtern: Freitag Fahrt nach Neudek über Eger mit Stadtführung und Mittagessen. Samstag Rundfahrt im Norden auf den Spuren des
verschwundenen Sudetenlandes. Sonntag Rückfahrt über die Burg Seeberg und Franzensbad. Fahrtpreis pro Person voraussichtlich 200 Euro. Auskunft: Markus Harzer, eMail markusharzer@web.de n Freitag, 6. bis Sonntag, 8. September, Heimatkreis Neudek: Busfahrt von Augsburg nach Neudek/Nejdek mit Besichtigung von Karlsbad. Auskunft: eMail heimatgruppeglueckau@t-online.de
Josef Grimm, Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf, Dr. Pavel Andrš und Anita Donderer.
Anita Donderer mit Dr. Petra Loibl MdL, Landesbeauftragte für Aussiedler und Vertriebene, sowie Sonja Bourová, die Wolfgang und Eva Zormaier über Neudek informiert. Bilder: Josef Grimm (2), Ingrid Grimm (2)
Dr. Pavel Andrš, Sonja Bourová, Hans Kemr, Josef Grimm, Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, Anita Donderer, Stadtrat Andreas Jäckel MdL und Altstadtrat Heinrich Bachmann.



für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau


Bilin Teplitz-Schönau


Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de




� Deutsch-tschechisch-polnische Wissenschaftliche Tagung der Deutschen Gesellschaft in Teplitz-Schönau – Teil II und Schluß
Vertriebene, Heimwehtouristen und Neusiedler
Hier der zweite und letzte Bericht unserer Korrespondentin Jutta Benešová über die deutsch-tschechisch-polnische Wissenschaftliche Tagung „Vertriebene, (Heimweh-)Touristen und ‚Neusiedler‘ in den Grenzgebieten der DDR, der Tschechoslowakei und der Volksrepublik Polen“ der Deutschen Gesellschaft (DG) Anfang Juni in Teplitz-Schönau
Der Aussiger Archivar Petr Karlíček sprach über „Kleiner Eiserner Vorhang – die tschechisch-sächsische Staatsgrenze 1945 bis 1966“. Er berichtete über das Verbarrikadieren der Grenzen von Polen und der Tschechoslowakei nach 1945 mit Stacheldraht aus Angst, die Deutschen könnten wiederkommen. Während die Grenzen zu Bayern und Österreich – dem gehaßten imperialistischen Westen – bis 1989 geschlossen geblieben seien, sei die Grenze zur SBZ mit der Zeit durchlässiger geworden. Aber noch 1966 habe es einer persönlichen Einladung oder wirtschaftlicher Interessen dieser drei Länder bedurft, um aus der DDR nach Polen oder in die Tschechoslowakei zu gelangen. Die alten einfachen Zollstationen zwischen Böhmen und Sachsen hätten nun Wachstationen der bewaffneten Staatspolizei ersetzt. Grenzregionen seien durch Rodung und Abrisse von Orten zu bewachten Grenzgebie-
ten geworden, zu denen der Zutritt verboten gewesen sei. Die anschließende Podiumsdiskussion über die ersten drei Vorträge war überaus anregend.
„Grenzen der Freundschaft. Tourismus zwischen der DDR, ČSSR und Polen“, ein Vortrag von Mark KeckSzajbel vom Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien an der Europäischen Universität Frankfurt an der Oder, betraf die Zeit nach 1970 und die Bildung der spezifischen Beziehungen der drei „sozialistischen Brudervölker“ Polen, Tschechoslowakei und DDR. Eine Entwicklung, die weitere fast 30 Jahre andauerte und wohl auch die zahlreichen Mißverständnisse zwischen den Deutschen nach der Wiedervereinigung Deutschlands verursachte. Der Referent betonte, wie in der DDR versucht worden sei, das Problem Vertreibung zu „normalisieren“. Bereits um 1972 sei eine reise-, keine grenzfreie Zone der drei Länder entstanden, wobei es den Vertriebenen in der DDR möglich gewesen sei, bereits zeitig die Heimat und die Gräber ihrer Vorfahren in Form von Urlaubs- und Freundschaftsreisen in Böhmen und Schlesien aufzusuchen, ihren Kindern zu zeigen und Kontakte mit ehemaligen Nachbarn zu knüpfen.

Diese Möglichkeiten seien den Vertriebenen hinter dem Eisernen Vorhang, die in der Bundesrepublik gestrandet seien, genommen gewesen, und die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat sei viel tiefer verwurzelt

Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek und Martin Rak, Deutschlehrer am Teplitzer Gymnasium.
gewesen. Dank der Vertriebenenverbände und ähnlicher Organisationen hätten im Gegensatz zur DDR alte Traditionen bewahrt und gepflegt werden können, aber die Erinnerungen an unerreichbar Vergangenes sei viel schmerzlicher gewesen und oft idealisiert worden. Daß es dadurch zwangsläufig auch zu großen Enttäuschungen kam, als sie schließlich oft in hohem Alter die durch Jahrzehnte kommunistischer Politik verkommenen ehemaligen Heim-

stätten aufsuchen durften, davon handelte der Vortrag „Heimat als Reiseziel zur Zeit des Kalten Krieges. Nostalgietourismus der Vertriebenen aus der Tschechoslowakei nach 1945“ von Sandra Kreisslová von der Karls-Universität in Prag. Die vor allem sehr interessante psychologische Seite des Tourismus der Vertriebenen an die ehemaligen Orte ihrer Kindheit behandelten die Vorträge „Die Sudetendeutschen in der Bundesrepublik und der DDR“ von Soňa Mikulová, seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Geschichte der Emotionen am Max-Planck-Institut in Berlin, und „Heimwehtouristen aus der DDR in Polen“ von Mateusz Hartwich, einem Historiker aus Berlin.
Die diesem Thema gewidmete Podiumsdiskussion „Nostalgietourismus aus der DDR und der Bundesrepublik – Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ brachte interessante Beiträge aus den Reihen der rund 40 Teilnehmer. Dabei gefiel mir besonders der Beitrag von Margaretha Michel, der Kulturreferentin und Vizeobfrau der SL-Landesgruppe Bayern.
Sie sagte, der Begriff „Heimwehtourismus“ entspreche nicht mehr den heutigen Vorstellun-

gen. Der Zweck der Besuche in die Heimat sei vor allem, Abschied zu nehmen und Aussöhnung mit der Vergangenheit zu finden. Beweggründe, die ich auch während meiner Tätigkeit als Delegatin eines deutschen Reisebüros in unseren Teplitzer Bädern bemerkte. Zu den deutschen Kurgästen gehörten oft Vertriebene aus Ost und West, die während ihres Kuraufenthalts Stätten ihrer Kindheit und Gräber ihrer Vorfahren aufsuchten oder zu finden versuchten und oft auch eine Art Fazit zogen, daß nach den vielen Jahren doch das Leben weitergehe und sie endlich auch inneren Frieden gefunden hätten.
An den letzten Tagungs-Vorträgen, die der Verständigungspraxis der tschechischen Antikomplex-Bewegung und der deutschen Ackermann-Gemeinde gewidmet waren, konnte ich leider nicht teilnehmen. Der Besuch von Steffen Hörtler an diesem Tag, sei es auch nur kurzzeitig gewesen, vermittelte eine gewisse Symbolik, da er sich gemeinsam mit Erhard Spacek sehr um eine Städtepartnerschaft zwischen Bad Kissingen und TeplitzSchönau bemüht – der beste Beweis, daß sich die Beziehungen zwischen unseren Ländern ständig vertiefen. Damit können wir auch bei dem Thema des Podiums „Neue Ideen für die Verständigung?“ mit Martin H. Dzingel, dem Präsidenten der Landesversammlung der deutschen Verei-
ne in der Tschechischen Republik, Steffen Hörtler als Stiftungsdirektor des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks, und Terezie Vávrová-Stiborová vom Verwaltungsrat von Antikomplex eigentlich das Fragezeichen durch ein starkes Ausrufezeichen ersetzen! Zum Schluß noch bemerkt, daß im Hintergrund des Konferenzsaales ständig zwei Simultandolmetscherinnen bereit waren, die sowohl in Deutsch als auch in Tschechisch gehaltenen Vorträge und Diskussionsbeiträge zu übersetzen, so daß jeder der Teilnehmer die Möglichkeit hatte, sich zu beteiligen. Das Restaurant der Brauerei Monopol sorgte vorbildlich für die Pausenversorgung der Teilnehmer mit Speis und Trank, wobei es gerade in den Pausen zu spontanen Begegnungen der Teilnehmer beider Länder kam – eigentlich das Wichtigste bei solchen Konferenzen.
Solche wissenschaftlichen Tagungen sind Meilensteine für neue Ideen der Verständigung, und ich scheue mich auch nicht vorzuschlagen, daß das Thema Vertreibung auch aus tschechischer Sicht ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit wäre. Die Ausstellung „Vertreibung 1939“ im Haus des Deutschen Ostens in München über die Deportation der polnischen Zivilbevölkerung (Ý SdZ 24/2024) ist ein gutes Beispiel.

DG-Vizevorsitzender Hartmut Koschyk, Richard Neugebauer, Vizepräsident der Landesversammlung, Dr. Mark Keck-Szajbel, Dr. Mateusz Hartwich, Dr. Sandra Kreisslová, Dr. Soňa
TERMINE

n Donnerstag, 29. August bis Sonntag, 1. September: 10. Teplitz-Schönauer Heimattreffen. Donnerstag bis 16.00 Uhr Einchecken im Hotel Prince de Ligne am Schloßplatz, dort Abendessen; 19.00 Uhr Abfahrt nach Eichwald zum Festkonzert in der Kirche Santa Maria del‘ Orto.
Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Soborten, dort Besichtigung des alten Jüdischen Friedhofs; Weiterfahrt nach Mariaschein, dort Besichtigung der Wallfahrtskirche der Schmerzhaften Mutter Gottes, Mittagessen im Schützenhaus; Weiterfahrt nach Ossegg, Kranzniederlegung am Denkmal
des Grubenunglücks vom 3. Januar 1934; Rückfahrt nach Eichwald, Eröffnungskonzert in der Kirche Santa Maria del‘ Orto anläßlich des Eichwalder Stadtfestes, Abendessen und Rückfahrt ins Hotel. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt zum Teplitzer Stadtteil Settenz, Besichtigung der Glashütte Mühlig; Spanferkelessen in der Tuppelburg im Wildgehege Tischau; in Teplitz Besichtigung der Ausstellung „Die sieben Hügel von Teplitz“ in der Schloßgalerie; 19.00 Uhr Abendessen im Stadttheater. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche, anschließend Heimfahrt. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag für drei Übernachtungen mit Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen, Konzert im Einzelzimmer 550 Euro pro Person, im Zweibettzimmer 480 Euro pro Person. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Verbindliche Anmeldung durch Überweisung
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Graupen Niklasberg
Mikulová, Ulrich Miksch von der Seliger-Gemeinde.
Petr Karliček, Professor Dr. Ira Spieker und Tagungsleiter Steffen Neumann. Martin H. Dzingel, Christoph Lippert von der Ackermann-Gemeinde, Manuel Rommel vom „Landesecho“ und Steffen Hörtler.


HEIMATBOTE

FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ

Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

Unser Bayerischer-und-Böhmerwald-Korrespondent Karl Reitmeier berichtet von einer interessanten Fahrt in die MoldauMetropole.
Der Verein Gäste- und Kulturführer Bayerwald wartet immer wieder mit Reise-Schmankerln auf. Dieses Mal hatte der Vorsitzende Josef Altmann unter dem Titel „Mit dem Rucksack auf den Spuren der Hussiten“ eine Zwei-Tages-Fahrt mit dem Zug nach Prag zusammengestellt, um sich, ausgestattet nur mit einem Rucksack, auf die Spuren des böhmischen Theologen, Predigers und Reformators Jan Hus zu begeben. Dabei war es Altmann gelungen, Christoph Mauerer aus Neukirchen beim Heiligen Blut mit ins Boot zu holen.
Mauerer unterrichtet an der Westböhmischen Universität Pilsen Germanistik und gibt in Prag Sprachkurse für Firmen. Längst ist ihm Prag zur zweiten Heimat geworden, und er ist nicht nur vorzüglicher Kenner des Nachbarlandes, sondern präsentierte sich bei der zweitägigen Reiseleitung auch als wandelndes Geschichtslexikon. Er führte uns zu vielen Stätten, die mit Jan Hus in Verbindung stehen, und konnte über Hus auch sehr viel Interessantes erzählen. Bei der Geschichte über Jan Hus und die Hussiten verwies
Mauerer auch auf den Bezug zu Ostbayern, wie er sich beim Drachenstich in Furth im Wald oder bei den Neunburger Burgfestspielen „Vom Hussenkrieg“ manifestiert. Die Hinfahrt der auf 25 Leute begrenzten Teilnehmerzahl ging mit dem Zug von Furth im Wald nach Prag. Nach der Ankunft in der JugendstilEmpfangshalle des Prager Hauptbahnhofs führte der Weg vorbei am Denkmal für den Engländer Nicholas Winton. Der Sohn deutscher Einwanderer hatte kurz vor dem
Bischofteinitz Ronsperg Hostau ❯ Oberpfälzer in Prag

Auf den Spuren von Jan Hus
Beginn des Zweiten Weltkrieges die Rettung von 669 jüdischen Kindern vor den Nationalsozialisten aus der Tschechoslowakei nach England organisiert. Vorbei am Denkmal für den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill ging es zum Restaurant „Zum Marienbild“ in der Nähe des Prager Fernsehturms zum Mittagessen. Gut gestärkt gingen wir am Jüdischen Friedhof vorbei auf den 271 Meter hohen Veitsberg/Vítkov im Stadtteil Zischkaberg/Žižkovt. Historische Bedeutung hatte der Hügel durch die Schlacht am Veitsberg 1420 erlangt. Damals besiegte das hussitische Heer, angeführt von Jan Žižka, die kaiserlich-katholischen Truppen. Von 1929 bis 1933 wurde auf dem Hügel ein monumentales Nationaldenkmal errichtet. 1950 wurde zudem das 16,5 Tonnen schwere Denkmal für den Hussitenführer Jan Žižka aufgestellt. Dieses neun Meter hohe Reiter-Standbild wird als die größte Bronzestatute der Welt betrachtet. Vom Veits-

berg bot sich ein wunderbarer Ausblick auf die Goldene Stadt, den alle genossen. Nach dieser Exkursion gingen wir zu unserem Basislager Hotel Ariston, wo sich die meisten etwas ausruhten. Dort schaute dann auch Václav Bernard, der Stellvertretende tschechische Verkehrsminister, vorbei. Eigentlich hätten wir mit ihm im BierLokal Ostrý (Osser) von Lukáš Beneš zu Abend essen sollen. Er mußte aber kurzfristig am nächsten Tag schon sehr früh zu einer Besprechung nach Wien reisen und sagte deshalb bei Josef Altmann und mir ab. Wir übermittelten dann aber im Ostrý die Grüße von Bernard. In diesem gemütlichen Bierlokal herrschte gleich von Anfang an gute Stimmung. Die steigerte sich allerdings noch, nachdem Christoph Mauerer einen Geigenspieler engagiert hatte. Mit dem sangen wir die von Mauerer verfaßte deutsche Fassung des bekannten Liedes „Žádnej neví, co sou Domažlice“ „Koana woaß des, wo is Domaschlitze“. Dabei war auch Václav Bernard eine Strophe gewidmet. Zum Abendessen wurden Wurstplatten serviert, und die Überraschung vieler Ausflügler war groß, als sie erfuhren, daß

die sich um die deutsch-tschechische Freundschaft bemühen: Josef Altmann und Christoph Mauerer.
die Wurst von der Metzgerei Fellner aus Furth im Wald stammte. Eingeweihte, die bereits im vergangenen Jahr schon einmal dort gewesen waren, wußten dies allerdings. Sogar bayerisches Bier schenkte der Wirt aus, aber die meisten genossen tschechischen Gerstensaft. Nachdem die Tour am ersten Tag mit rund zehn Kilometern doch recht anstengend gewesen war, versuchte sich danach niemand mehr als Nachtschwärmer, sondern wir legten uns lieber schlafen, war doch am nächsten Tag wieder ein umfangreiches Programm zu absolvieren. Erneut war eine Wanderung durch die Stadt angesagt, dieses Mal rund zwölf Kilometer, die unter anderem zum Wenzelsplatz, zum Karolinum – dem historischen Gebäude der Karls-Universität, an der der Theologe Jan Hus wirkte – und zum Altstädter Ring führte, wo unter anderem das Jan-HusDenkmal bestaunt wurde. Dort wurde auch die Sankt-Nikolaus-Kirche, eine tschechische hussitische Kirche, besichtigt, die zu den ältesten Kirchen der Prager Altstadt gehört, denn sie wurde bereits 1273 erstmals urkundlich erwähnt.
Immer wieder führte Christoph Mauerer uns zu Plätzen und Gebäuden, die mit Jan Hus in Verbindung gebracht werden, und berichtete überall ausführlich über die Geschichte. Nach einem kurzen Abstecher zur Karlsbrücke, wo das Leben auch an einem Werktag pulsiert, statteten wir noch der Bethlehemskapelle mit der Dauerausstellung über das Wirken von Jan Hus, der in Tschechien als ein Nationalheiliger verehrt wird, einen Besuch ab. In dieser Kapelle hatte Jan Hus ab 1402 gepredigt und dort auch das gemeinsame Singen während des Gottesdienstes in der tschechischen Landessprache eingeführt. Wir erfuhren, daß Hus dort jährlich rund 200 Predigten mit zum Teil 3000 Besuchern auf Tschechisch abgehalten und damit auch das tschechische Nationalbewußtsein gefördert hatte.
Hus forderte in seinen Predigten eine strenge und tugendhaf-
te Lebensweise und wandte sich gegen Zeitgeist und Mode. Er kritisierte zudem den weltlichen Besitz der Kirche, die Habsucht des Klerus und dessen Lasterleben. Das gefiel den Kirchenoberen natürlich nicht. Deshalb ließen sie ihn schließlich anläßlich des Konzils in Konstanz, für das ihm eigentlich freies Geleit zugesichert worden war, auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Alle zeigten sich tief beeindruckt von der Bethlehemskapelle mit den Wandmalereien, die das Schicksal von Jan Hus sehr anschaulich zum Ausdruck brachten. Auch die Dauerausstellung hinterließ nachhaltige Eindrücke. Von dort ging es über den Platz Husova mit einer Kurzbeschreibung auf einer weiteren Tafel über Jan Hus vorbei an dem Gebäude des Österreichischen Kulturforums Prag, vor dem das Denkmal für Josef Jungmann steht. Jungmann war ein tschechischer Sprachwissenschaftlicher und eine führende Persönlichkeit der tschechische Nationalen Wiedergeburt im 19. Jahrhundert.

Von dort ging es zurück zum Wenzelsplatz mit dem Nationalmuseum im Hintergrund, wo die frei zur Verfügung stehende Zeit noch zum Besuch der einladenden Cafés genutzt wurde. Anschließend marschierten wir zurück zum Hauptbahnhof und traten mit dem Alex die Heimreise an. Dabei erfuhren wir, daß für Ende Oktober nochmals eine Zugfahrt nach Prag geplant sei, wobei anläßlich des tschechischen Nationalfeiertages auf dem Veitsberg eine Militärparade mit Staatspräsident Petr Pavel stattfinde, die bei dieser Gelegenheit besucht werde. Auf der Rückfahrt waren wir uns einig, zwei erlebnisreiche Tage in der Goldenen Stadt verbracht zu haben. Ein Dank galt insbesondere Christoph Mauerer für seine hervorragende Begleitung.
In der Bethlehemskapelle zeigt eine Wandmalerei Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz.
Das Denkmal für den Engländer Nicholas Winton in der Bahnsteighalle des Prager Hauptbahnhofs.
Jan-Žižka-Denkmal auf dem Veitsberg.
Zwei,
Vor dem Denkmal für Jan Hus und der Sankt-Nikolaus-Kirche auf dem Altstädter Ring.
Bilder: Karl Reitmeier


Heimatbote für den Kreis Ta<au


Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
� Purschau, Langendörflas, Altenstadt bei Vohenstrauß und Weiden – Teil I
Die jüdische Familie Kohner
Unter dem Titel „Zwei Stolpersteine der Versöhnug“ (Þ HB 24/2024) berichtete Nadira Hurnaus über eine Schüleraktion in Altenstadt bei Vohenstrauß, die die Geschichte der jüdischen Familie Kohner recherchierte, deren Wurzeln in Purschau und Langendörflas lagen. Die meisten Familienmitglieder kamen in Konzentrationslagern der Nationalsozialisten um. Der Historiker Sebastian Schott, der auch das Tachauer Heimatmuseum in Weiden in der Oberpfalz betreut, ist ein Kenner der jüdischen Geschichte in der Region. Der Heimatbote veröffentlicht nun seine detaillierten Forschungsergebnisse bezüglich der Familie Kohner in mehreren Folgen.
Ernestine Kohner war die Tochter des jüdischen Handelsmannes Joachim Kohner, der am 30. August 1833 in Purschau das Licht der Welt erblickt hatte. Seine Ehefrau Anna, geborene Neubauer, war am 19. Januar 1844 in Langendörflas zur Welt gekommen. Das Ehepaar hatte fünf Kinder, von denen die beiden ältesten Töchter Sabine am 16. Januar 1870 und Ernestine am 22. Mai 1872 ebenfalls noch in Langendörflas geboren wurden. Zwischen 1872 und 1874 wanderte die Familie nach Bayern aus, ihre erste Station diesseits der Grenze war das Dorf Altenstadt bei Vohenstrauß, wo am 4. Juli 1874 die Tochter Rosa, am 20. September 1875 der Sohn Karl und am 24. Januar 1878 die Tochter Hermine auf die Welt kamen. Seit 1882 schließlich wohnten Joachim und Anna Kohner mit ihren Kindern in Weiden. Purschau, der Geburtsort Joachim Kohners, war ein Dorf sieben Kilometer südwestlich von Tachau. Jüdische Menschen lebten dort wohl schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die letzte jüdische Familie verließ den Ort 1937 und zog nach Tachau. Um 1860 hatte Purschau 95 jüdische Einwoh
Gegenwärtig läuft in der Reithalle in Tachau-Heiligen die zweisprachige Wanderausstellung „900 Jahre Klöster Zwiefalten und Kladruby/Kladrau – 1115 bis 2015“. Zur Ausstellungseröffnung in der nach Wien zweitgrößten Reithalle Europas waren Anfang Juni rund 60 Deutsche und Tschechen gekommen.
Die Feierstunde im restaurierten Baudenkmal Tschechiens des Jahres 2023 umrahmte musikalisch anmutig die Sopranistin Karina Assfalg aus Zwiefalten in der Schwäbischen Alb auch mit Beiträgen tschechischer Komponisten. In Deutschland absolviert sie jedes Jahr etliche Konzerte mit glänzenden Kritiken. Sie war vier Jahre Mitglied im ExtraChor des Ulmer Theaters sowie Mitglied des ExtraChores am Staatstheater in Stuttgart und dem Philharmonia Chor Stuttgart. Seit Anfang 2024 ist Karina Assfalg festes Mitglied
ner, bis 1880 hatte sich die Zahl der Juden auf 41 Personen mehr als halbiert, was aber immer noch 5,5 Prozent aller Bewohner des Ortes entsprach. Ihren Lebensunterhalt verdienten die meisten Purschauer Juden, wie wohl auch die Kohners, mit Handel, vor allem mit Hausierhandel. Ähnlich war die Situation in Langendörflas, das drei Kilometer südlich von Tachau liegt. Auch hier sind jüdische Einwoh
derlassung ausländischer Juden in Bayern ausdrücklich verboten worden. Erst das „Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt“ vom 16. April 1868 brachte auch in diesem Bereich eine Gleichstellung von Juden und Nichtjuden. Durch sein Inkrafttreten zum 1. September 1869 erloschen alle Ausnahmebestimmungen in Bezug auf die Einwanderung von Juden. Für das im Grenzgebiet zu

die größte Bedeutung zukam, braucht nicht näher begründet zu werden.
Zwölf Jahre nachdem er nach Weiden gekommen war, stellte der böhmische Handelsmann
Joachim Kohner einen Antrag auf Erwerb des Heimatrechts an seinem nunmehrigen Wohnsitz. Denn dies war die Voraussetzung für die Verleihung der bayerischen Staatsangehörigkeit beziehungsweise des Rechtstitels auf

Der jüdische Friedhof in Purschau und in Langendörflas.
ner bereits seit der Mitte des 17. Jahrhunderts belegt. Etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nahm die Anzahl der jüdischen Familien ständig zu, so daß die Juden einen bedeutenden Anteil der Bevölkerung bildeten. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging ihre Zahl durch Wegzug in größere Städte jedoch rapide zurück. Um 1870 lebten in Langendörflas noch 18 jüdische Familien, das waren rund 100 Personen, die zwölf Prozent aller Einwohner des Dorfes ausmachten. 43 Jahre später verließ der letzte jüdische Bürger den Ort. Auch für die Juden aus Langendörflas war die häufigste Quelle des Lebensunterhaltes der Hausierhandel.
In Paragraph 11 des „Edikts über die Verhältnisse der jüdischen Glaubensgenossen im Königreiche Baiern“ von 1813 war die Einwanderung und Nie
Böhmen gelegene Weiden bedeutete es im Besonderen, daß nun auch Angehörige der auf der anderen Seite der Grenze liegenden jüdischen Landgemeinden – mit ihren stark eingeschränkten Möglichkeiten, ein berufliches Auskommen zu finden –verstärkt in die aufstrebende Industriestadt ziehen konnten. Ohne Zweifel hat dies wesentlich zum raschen Aufstieg der jüdischen Gemeinde Weiden beigetragen.
Trotz der unbestrittenen Rolle von Floß als Muttergemeinde für die Juden in Weiden stellten um 1894/95 – also gute 25 Jahre nach Aufhebung des Einwanderungsverbotes für Juden nach Bayern – Juden aus Böhmen mit zehn Familienoberhäuptern nur eines weniger als die Marktgemeinde im Oberpfälzer Wald. Daß dabei dem Weiden am nächsten gelegenen Bezirk Tachau
� Wanderausstellung über Kloster Kladrau eröffnet
die Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen oder Indigenat. Mit Beschluß des Magistrats und des Gemeindekollegiums erhielt der jüdische Kaufmann im Juli 1895 gegen die Bezahlung einer Gebühr von 240 Mark das Heimatrecht in der Stadt Weiden, und noch im selben Monat wurde ihm zudem von der Regierung der Oberpfalz in Regensburg die Naturalisationsurkunde für sich, seine Ehefrau Anna und seine Kinder Ernestine, Rosa, Karl und Hermine zugeschickt. Die Untertanen des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. besaßen nun die Staatsangehörigkeit im Königreich Bayern und die Bundeszugehörigkeit im Deutschen Reich.
Joachim Kohners älteste Tochter Sabine war von der Annahme der bayerischen Staatsbürgerschaft nicht betroffen, da sie sich 1894 bereits „seit längerer Zeit in
Gründung vor 909 Jahren
des JohannStraussFestivalEnsembles unter PaulFriedrich Deppe. Die Begrüßung übernahm Tachaus Bürgermeister Petr Vrána. HubertusJörg Riedlinger, Vorsitzender des Zwiefaltener Geschichtsvereins und Altbürgermeister, dankte dem Gastgeber. Mit Hilfe des Dolmetschers Rudi Tomšu führten die Redner in das Thema ein. Anton Fürst zu WindischGraetz, ein Nachkomme des ReithallenErbau
ers Fürst Alfred I. zu WindischGraetz, hatte wegen Unwetters nicht kommen können. Die Ausstellung hatten Pavel Voltr vom Tachauer Tourismusamt, der Verein Via Carolina –Goldene Straße und der Ge

schichtsverein Zwiefalten erarbeitet. Es geht dabei um die Suche nach den Spuren des christlichbenediktinischen Erbes im vereinten Europa. Weitere Ausstellungstafeln zeigen Schülerarbeiten aus Zwiefalten, Burglengenfeld, Altenstadt an der Waldnaab und Kladrau. InfoTafeln berichten über den tschechischen Exilpfarrer Monsignore Jaroslav Kubevec, der den Kommunisten ein Dorn im Auge war und der nach sei
Amerika“ aufhielt. Auch die 1874 geborene Rosa versuchte ihr Glück in Übersee und wanderte in die USA nach Libertyville im Bundesstaat Illinois aus. 1913 besuchte sie jedoch noch einmal ihre Familie in Weiden und wohnte während dieser Zeit bei ihrer Schwester Ernestine in der Bahnhofstraße 19 ¼, heute Nummer 7. Während die jüngste Tochter Hermine nach ihrer Heirat mit dem Kaufmann Gustav Karl aus Walsdorf in Oberfranken im Juli 1900 Weiden verließ, blieben die Kinder Karl und Ernestine in der nördlichen Oberpfalz. Nach elf Jahren in der Bahnhofstraße zog die ledige Ernestine, die ein finanziell abgesichertes Leben als Privatière führte, 1922 in die Johannisstraße 17, wo sie sich mit ihrer Nachbarin Maria Reindl, der Ehefrau des ReichsbahnSchmieds Johann Reindl, anfreundete. Karl Kohner wandte sich wie sein Vater dem Kaufmannsberuf zu und verbrachte mehrere Jahre in Schwandorf, wo er die 1880 in Wallerstein im Bezirksamt Nördlingen geborene Verkäuferin Rosa Lisberger kennenlernte. Sie heirateten im August 1906 in Weiden, wohnten in der Sedanstraße 8 und hatten zusammen die drei Söhne Willi, geboren am 10. Mai 1907, Siegfried, geboren am 4. Januar 1909, und Justin, geboren am 11. August 1912. Bis zum Novemberpogrom 1938 führte Karl Kohner eine Schnittwarenhandlung am Unteren Markt 7 und war mit seinem Geschäft allen Anfeindungen der nationalsozialistischen Boykotthetze gegen jüdische Unternehmen in Weiden seit 1933 ausgesetzt. Noch im Sommer 1938 wurde er mit seiner Firma in eine „Warnkarte“ der Kreisleitung der NSDAP aufgenommen: „Wo handeln in Weiden Juden“. Sie sollte auch noch die letzten nichtjüdischen Käufer abschrekken, ein jüdisches Geschäft zu betreten: „Deutscher, Vorsicht beim Einkauf! Werde kein Volksverräter.“ Fortsetzung folgt
ner Flucht 1950 in die Gegend von Zwiefalten kam. Der Priester überlebte in den 1950er Jahren zwei von seinem kommunistischen Vaterland beauftragte Mordversuche. Er regte vor seinem Tode an, die Kontakte der beiden Klöster im Falle einer Grenzöffnung neu zu beleben. Das versprach ihm der damalige Bürgermeister HubertusJörg Riedlinger. Mit Hilfe von Rainer Christoph, dem damaligen Vorsitzenden des Vereins Goldene Straße, gelang es unter schwierigen Umständen, den Wunsch umzusetzen. Daß dieses Projekt gelang, war der zufälligen Begegnung eines Altenstädter Schülervaters mit einer Frau aus Zwiefalten bei einer Kur in Bad Kötzting zu verdanken. Über das damals erstellte deutschtschechische Sagenbuch über die Goldene Straße kam schließlich der Kontakt zwischen Zwiefalten und dem Verein Goldene Straße zustande.
TERMINE
n Bis Sonntag, 14. Juli, Bärnau: Fotoausstellung „Paulusbrunn früher und heute“ im Knopfmuseum.
n Bis Donnerstag, 31. Oktober, Tachau-Heiligen: Ausstellung „900 Jahre Klöster Zwiefalten und Kladruby/Kladrau – 1115 bis 2015“ in der Reithalle Mittwoch bis Sonntag 10.00–17.00 Uhr. n Samstag, 6. Juli, 10.00 Uhr, Altzedlisch: 34. Heimatgottesdienst des Kirchsprengels, anschließend Treffen im Pfarrhaus. Auskunft: Sieglinde Wolf, Wettersteinstraße 51, 90471 Nürnberg, Telefon (09 11) 81 68 68 88. n Sonntag, 14. Juli, Bärnau: Bergfest an der Steinbergkirche. 8.00 Uhr Votivprozession vom Marktplatz zum Steinberg, 9.00 Uhr Festgottesdienst am Freialtar hinter der Steinbergkirche, anschließend Zug zum Schützenhaus mit Standkonzert und Frühschoppen; 14.00 Uhr Kreuzweg in der Steinbergallee; anschließend Kaffee und Kuchen im Schützenhaus.
n Sonntag, 21. Juli, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
n Freitag 26. Juli, 14.30 Uhr, Bruck am Hammer: Festgottesdienst zum 34. Jakobifest nach der Wende mit Pfarrer Dr. Jiří Majkov aus Plan und dem Brukker Bürgermeister Eric Mara. Anschließend Friedhofsgang und Begegnung im Gast

haus. Anmeldung: Ingrid Leser, 95671 Bärnau, Am Galgen 1, Telefon (0 96 35) 3 29, eMail leser. baernau@t-online.de
n Sonntag, 18. August, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
n Sonntag, 7. September, 19.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
n Samstag, 14. September, 18.00 Uhr, Bruck am Hammer: Barockkonzert des Ensembles Alcinelle in der Sankt Jakobuskirche.
n Sonntag, 20. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Weihbischof em. Ulrich Boom aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
Petr Vrána und Hubertus-Jörg Riedlinger.
Die Brucker Jakobuskirche.


Heimatblatt für die Kreise Hohenelbe und Trautenau

Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. – 1. Vorsitzende: Verena Schindler, Telefon 0391 5565987, eMail: info@hohenelbe.de www.hohenelbe.de – Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. – 1. Vorsitzender Wigbert Baumann, Telefon 0931 32090657 – Geschäftsstelle Riesengebirgsstube (Museum-Bibliothek-Archiv), Neubaustr. 12, 97070 Würzburg, Telefon 0931 12141, eMail: riesengebirge-trautenau@freenet.de – www.trautenau.de – Redaktion: Heike Thiele, Eulengasse 16, 50189 Elsdorf, Telefon 02271 805630, eMail: riesengebirgsheimat@gmx.de – Redaktionsschluss: jeweils der 1. des Erscheinungsmonats.
� Sudetendeutscher Tag 2024
� Nachrufe/ Vorstand Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge
Rückblick Sudetendeutscher Tag 2024



Ein großes Leben hat sich erfüllt. er Heimatkreis Hohenelbe/ Riesengebirge hat seinen langjährigen, ehemaligen Kulturreferenten Prof. Dr. Hans Pichler, gebürtig aus Oberhohenelbe im Riesengebirge, am 14. Mai 2024
Fotos: Kirsten Langenwalder
(V. l. n. r.:) In Riesengebirgstracht: Die kleine Personengruppe, die sich zum Einzug der Trachten einfand. Ein kleiner Eindruck vom Hohenelber Teil des Gemeinschaftsstandes. Der große Gemeinschaftsstand war stets gut besucht.
Der Heimatkreis Hohenelbe ist beim Sudetendeutschen Tag zum bereits dritten Mal ein Teil des großen Gemeinschaftsstandes der Heimatlandschaft Riesengebirge gewesen.
Zum ersten Sudetendeutschen Tag in Regensburg, der im Jahr 2019 stattfand, erlebten einige Riesengebirgsnachkommen eine Enttäuschung. Nicht wenige Nachkommen besuchten den Sudetendeutschen Tag mit der Vorstellung, daß es möglich ist, auf dem Sudetendeutschen Tag einen Informationsstand von der Heimatlandschaft ihrer Vorfahren – dem Riesengebirge –vorzufinden. Leider mußte festgestellt werden, daß man einen Stand zum Riesengebirge vergeblich suchte. Aus dieser Enttäuschung entstand Energie. Man fand sich, überwiegend bei Facebook, zusammen und beschloß: „Das muß anders werden, wir bringen das Riesengebirge wieder auf den Sudetendeutschen Tag und wir präsentieren die Heimat unserer Vorfahren an einem großen Gemeinschaftsstand“. Die
Premiere sollte bereits 2020 stattfinden, fiel jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer. So präsentierte sich die Heimatlandschaft Riesengebirge erstmals im Jahr 2022 in Hof mit einem großen deutsch-tschechischen Informationsstand und ist seitdem fester Bestandteil des Sudetendeutschen Tages. Neben denjenigen, die alljährlich vorbeischauen, kommen auch immer wieder neue Gesichter. 2024 war zudem zu beobachten, daß sich einige junge Nachkommen auf den Weg zum Sudetendeutschen Tag machten. Teilweise ließen sie sich von der ebenfalls anwesenden Erlebnisgeneration die Ortschaften zeigen, aus denen sie stammen, und sich viele Dinge rund um die verlorene Heimat erzählen. Der große, grenzübergreifende Gemeinschaftsstand wurde von den Heimatkreisen der Heimatlandschaft Riesengebirge – dies sind die Heimatkreise Braunau, Hohenelbe und Trautenau – sowie dem Begegnungszentrum Trautenau gestaltet und er wurde ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Der Teil des
Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e. V. wurde 2024 wie in den Vorjahren von seiner Pressereferentin übernommen, dankenswerterweise durch Unterstützung aus dem Riesengebirgsfreundeskreis, denn dieses Mal mußte sie beim Aufbau und am Sonntag auf die Hilfe ihrer Freundin verzichten, welche die zwei Male zuvor ein tolle Unterstützung gewesen war. Am Pfingstsonntag war wie im Vorjahr die 1. Vorsitzende des Heimatkreises, Verena Schindler, zeitweise am Stand anwesend. Nach einigen Jahren, in denen das Riesengebirge auch beim
� Termine
Trachteneinzug fehlte, ergab es sich in Augsburg, daß sich eine kleine Gruppe zusammenfand und in Riesengebirgstrachten zur Hauptkundgebung mit einzog.
Auch wenn es immer wieder mit viel Aufwand verbunden ist, wir von Seiten des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e. V. machen weiter. Wir werden auch 2024 in Regensburg wieder mit am Start sein – in bewährter Gemeinschaft unserer „Mitstreiter“ aus den beiden Heimatkreisen und dem Begegnungszentrum. Kirsten Langenwalder Pressereferentin HKH
Termin 62. Bundestreffen
Bitte dieses Datum vormerken.
Das 62. Bundestreffen des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge findet am 14. und 15. September 2024 in Marktoberdorf statt. Wir bitten, unser Bundestreffen fest einzuplanen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Landsleute, die unseren Heimatkreis beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg vertreten haben. Für den den Vorstand: Verena Schindler 1. Vorsitzende

Die neue Heimatortsbetreuerin von Arnau
wohnt habe. Meine Eltern Ferdinand und Charlotte Waengler, geb. Reil, stammten aus Harta, meine Großeltern aus Harta, Komotau, Mittel- und Niederlangenau. Mein Vater war während des Krieges nur zweimal kurz auf Urlaub. In Arnau wohnten wir bei einer tschechischen Familie im ersten Stock oberhalb des Schwimmbads. Auf dem Foto anno 1944 ist mein Vater das zweite Mal auf Fronturlaub, im Hintergrund ist die Dekanalkirche von Arnau zu sehen.
hat nun ebenfalls den Ort Arnau übernommen.
Mir tat es leid, daß Arnau schon längere Zeit ohne Heimatortsbetreuer(in) war. Als im März bei unserer Vorstandssitzung in Marktoberdorf in die Runde gefragt wurde, wer die Betreuung übernehmen könnte, meldete ich mich. Diese Arbeit übernehme ich sehr gern, da ich meine ersten 51 1/2 Lebensjahre zusammen mit meiner Mutter und ab Januar 1945 mit meinem Bruder in Arnau ge-

Vor dem Krieg war mein Vater in der Bürgerlichen Brauerei als Chemiker für die Limonadenherstellung von Mirelli zuständig. Im Juni 1945 waren wir schon im Lager in Arnau, bereit zum Abtransport in offenen Güterwagen an die tschechisch-sächsische Grenze. Mein fünf Monate alter Bruder erkrankte im Lager jedoch sehr stark an Durchfall. Die tschechische Lagerärztin befürchtete Ruhr, sah eine hohe Ansteckungsgefahr für die anderen Menschen im Lager und entschied sehr verantwortungsvoll, uns zu entlassen. Mit Zustimmung des Bürgermeisters von Harta durften wir nach Harta zu Großmutter Olga und Tante Ada Waengler ziehen. Gott sei Dank war mein Bruder bald wieder gesund. Mit dem dritten Transport im Rahmen der sogenannten „geordneten Vertreibung“ mußten wir dann am zehnten April 1946 ab Hohenelbe unsere Riesengebirgsheimat endgültig verlassen. Berchtesgaden war unsere erste Bleibe in Deutschland bzw. in Bayern. Nach den Stationen Neutraubling/Regensburg (Schulzeit und Jugend) und München
(die ersten Ehejahre) lebe ich nun seit mehr als 50 Jahre mit meinem Mann Alf Mainert in Karben, einer Stadt etwa 20 km nördlich von Frankfurt/Main. Kinder und Enkel wohnen zum großen Teil in der Nähe, im Rhein-Main-Gebiet.
An Arnau habe ich nur noch wenige Erinnerungen, aber an die Zeit 1945/46 in Harta und an die Vertreibung kann ich mich sehr gut erinnern. Meine Eltern haben auch stets sehr viel von „Zuhause“ im Riesengebirge erzählt. Viele Geschichten rankten um Kindheit, Jugend, Schulzeit, Kennenlernzeit und Wanderungen im Gebirge. Meine Familiengeschichte und das Riesengebirge waren mir immer präsent und die Erinnerung daran ein großes Anliegen. Besonders dankbar bin ich, daß ich jetzt im Alter zu Menschen in der alten Riesengebirgsheimat enge Kontake knüpfen konnte. Für mich schließt sich da da ein Kreis.
Die Gruppe der Arnauer ist sehr klein geworden und auf 16 Mitglieder geschrumpft. Das könnte aber auch den Vorteil haben, in dieser kleinen Gruppe engere Kontakte zu pflegen. Über jeden Kontakt von Ihrer Seite würde ich mich sehr freuen. Ingrid Mainert HOB Arnau Tel. 06039 2255, eMail: mainert@t-online.de
Seine mehr als 30 Jahre dauernde Funktion als Verantwortlicher für den Bereich Kultur und Museen hat sehr viele und tiefe Spuren hinterlassen. Es war das Anliegen von Hans Pichler, „die Heimat Riesengebirge“ nicht zu vergessen und sie in der Erinnerung bei heutigen und zukünftigen Generationen zu behalten. Sein großes, geschichtliches Wissen war die Grundlage für die Erstellung von vielem literarischem Material in Form der Ortsbücher des Heimatkreises und weiterer Veröffentlichungen.
Durch seine Initiative konnte der Heimatkreis bei seinen jährlichen Bundestreffen in Bensheim und Marktoberdorf verschiedene Künstler aus dem sudetendeutschen Bereich für Ausstellungen gewinnen.
Professor Hans Pichler besuchte seine alte Heimat Riesengebirge oft und gern, um dort erholsame Momente zu genießen und mit den neuen tschechischen Bewohnern in Kontakt zu kommen. Diese Verbindungen haben sich auf die Arbeit des Heimatkreises fruchtbar ausgewirkt im Sinne
� Auf Reise ins Riesengebirge

guter Völkerverständigung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. Neben seinen vielen Mitgliedschaften in Akademien war es für uns Riesengebirgler bewundernswert, wie Hans auch die umfangreichen Arbeiten im Riesengebirgsmuseum bewältigen konnte. Wer Hans Pichler kannte, wußte, daß er immer mit gut durchdachten Argumenten für Projekte und Ideen auftrat. Diese Ausführungen vermögen nicht den großen Arbeitsradius und die Verdienste von Hans Pichler wiederzugeben. Der Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge wird Prof. Dr. Hans Pichler ein ehrenvolles Andenken bewahren. Christian Eichmann Ehrenvorsitzender Verena Schindler 1. Vorsitzende

Bärbel Hamatschek und Gatte haben eine schöne Wanderung im Riesengebirge erlebt. Schon oft haben wir lange Kammwanderungen gemacht, aber am Reifträger waren wir noch nicht. Als wir wieder einmal mit einer Busgesellschaft im Riesengebirge waren, fuhren wir mit ihnen zur Goldhöhe. Die Gruppe ging nur bis zur Elbequelle, aber wir seilten uns mit Erlaubnis ab und gingen Richtung Reifträger. Es gesellten sich noch zwei Leute mit zu uns. Es war schönes Wetter angesagt, aber hier oben (1.400 m Höhe) ging ein kalter Wind. Wir holten unsere warmen Stirnbänder aus dem Rucksack. Der Wind wurde immer stärker, da zog ich mir noch das Regencape über, das schützte etwas vor dem eisigen Wind (es waren sechs Grad). Es war Nebel aufgekommen, so konnten wir auch nicht in die Ferne sehen. Das Laufen machte uns etwas wärmer und siehe da, der Nebel lichtete sich und wir sahen in weiter Ferne den Reifträger. Ich nannte ihn „kleine Schneekoppe“. Nun begann ein langer, ansteigender Weg, erst einmal bis zu den Quarksteinen, dann waren wir bald an unserem Ziel, dem Reifträger. Hier stärkten wir uns mit einer Rübezahlsuppe mit Steinpilzen. Dann genossen wir den herrlichen Fernblick nach Sachsen und nach Schlesien hinein. Bei unserem Heimweg sahen wir in der Ferne die Veilchenspitze und die Schneegrubenbaude liegen. Bald waren wir wieder an der Elbequelle und an der Elbfallbaude vorbei. Am Pantschefall ging unser Blick nochmals ins Elbetal hinunter. Da waren lauter Wege, die wir schon früher einmal gegangen waren. Nun ging es bis zur Bergstation, wo wir bequem nach Spindelmühle hinunterfuhren. Bärbel Hamatschek HOB Oberlangenau
Prof. Dr. Hans Pichler, * 24.03.1931 in Oberhohenelbe im Riesengebirge, 14.05.2024 in Mössingen. Foto: privat
Bärbel und Günther Hamatschek vor dem Reifträger. Foto: privat
Familiennachrichten
aus dem Heimatkreis Hohenelbe

Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. Sitz Marktoberdorf Geschäftsführung: Gerhard Baumgartl 87616 Marktoberdorf, Richard-Wagner-Str. 2 Tel. 08342 40528, Fax 08342 7054060 www.hohenelbe.de, eMail: info@hohenelbe.de Sparkasse Allgäu, IBAN: DE 41 7335 0000 0380 271262 BIC: BYLADEM1ALG
Der Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. gratuliert zum Geburtstag
19.07. Helga Dommermuth, HOB von Hackelsdorf, zum 94. Bärbel Hamatschek, Sprecherin der HOB, 3. Vorsitzende des HKH
n ANSEITH
30.07. Rudolf Wanka (A18) zum 93. HOB Tanja Fritz Tel. 06222 389787 eMail: meerfritz@gmail.com
n HARRACHSDORF
05.07. Walter Hollmann zum 83.
06.07. Christl Erben zum 90.
09.07. Inge Adolf zum 89.
12.07. Ilse Müller zum 93.
14.07. Erika Kreuzler zum 79.
14.07. Monika Winterhalder zum 79.
17.07. Dr. Adolf Slawisch zum 88.
23.07. Helga Kurth zum 95.
24.07. Hannelore Dlabola zum 85.
31.07. Rudolf Rieger zum 88. HOB Ines und Falk Heinrich Tel. 03586 4085635
n HENNERSDORF
05.07. Miriam Zeller geb. Erben zum 91. 18.07. Angelika Cersovsky zum 68. HOB Ingrid Mainert (Waengler) Tel. 06039 2255
n HERMANNSEIFEN
01.07. Maria Lehmann geb. Hamatschek zum 92.
04.07. Maria Hönig zum 92.
07.07. Ilse Schmidt geb. Knahl zum 92. 07.07. Helena Reichow geb. Pohl zum 97.
09.07. Edeltraut Honc geb. Drescher zum 96.
09.07. Johann Jary zum 92.
13.07. Magdalena Maresch geb. Lorenz zum 91.
21.07. Georg Baudisch zum 88.
23.07. Leonhard Klug zum 89.
24.07. Hannelore Hofmann geb. Stransky zum 83.
27.07. Inge Eckhardt geb. Tippelt zum 91.
27.07. Anni Stober geb. Riedel zum 94.
28.07. Franz Jatsch zum 92. HOB Christina Auerswald Tel. 0341 24707822
n HOHENELBE
04.07. Wolfgang Humpel zum 93.
16.07. Michaela Malbranc zum 58.
27.07. Edeltraud Eisenlohr geb. Fröhnel zum 83.
29.07. Friedrich Lorenz zum 91.
HOB Ingrid Mainert (Waengler) Tel. 06039 2255

n NIEDERHOF 1937 Kurt Hamatschek (Rudolfstal 165) zum 87. 09.07. Roland Kleiner (Hanapetershau 28) zum 86. 1939 Helma Mehrwald geb. Weikert (Rudolfstal 147) zum 85. 10.07. Paul Kleiner (Gansbachtal 43) zum 83. 23.07. Werner Goder (Höhe 37) zum 86. 23.07. Gerd Zinecker (Gansbachtal 48) zum 85. 25.07. Ilse Lange geb. Zirm (Gansbachtal 131) zum 89.
n HUTTENDORF
06.07. Ursula Reimann geb. Poulitschek (Nr. 144) 22.07. Heidelinde Honriol geb. Gernt (Nr. 66) zum 80. 26.07. Kurt Tauchmann (Nr. 88) HOB Siegfried Schorm
n KLEINBOROWITZ
12.07. Sieglinde Gierden (25) zum 84. 12.07. Herta Rothe geb. Kosel (105) zum 85. 25.07. Erich Unger (217) zum 99. 02.07. Otto Bräuer (174) zum 92. HOB Tanja Fritz s. Anseith
n KOTTWITZ
19.07. Anton Schoft (Sohn von Adolf Schoft, Kottwitz 55) zum 79. 22.07. Marie Reppenhagen geb. Paus (Oberdorf 155) zum 95. 23.07. Gisela Baudisch zum 73. 24.07. Anni Langner geb. Exner (Katharinadörfel 2) zum 90. 26.07. Ingrid Lindner geb.Schaar (Kottwitz 141) zum 86. HOB Gudrun Bönisch Tel. 08377 1293
n MASTIG
06.07. Margit Groß geb. Gernert (M6) zum 97. 28.07. Walburga Oberle geb. Tietz (HM7) zum 96. 28.07. Christa Koziolek geb. Gernert (M6) zum 86. HOB Tanja Fritz s. Anseith
n MITTELLANGENAU
03.07. Ehrentraud Brill geb. Wiesner zum 86. 05.07. Anni Hieke geb. Lorenz zum 96. 09.07. Liselotte Biedermann geb. Tauchen zum 87. 11.07. Rudolf Renner zum 97. 14.07. Manfred Zirm zum 86. HOB Verena Schindler Tel. 0391 5565987

Der heutige Schulkomplex von Mittellangenau. Foto: Josef Kalenský
n MOHREN
04.07. Margot Hütscher geb. Schöpel zum 80. 07.07. Rudolf Drescher zum 86. 07.07. Friedrich Lath zum 90. 08.07. Margarete Stegbauer geb. Hoffmann zum 95. 09.07. Helga Krumpholz geb. Wagner zum 84. 11.07. Roland Erben zum 85. 11.07. John Siegbert zum 84. 19.07. Anton Schoft zum 79. 22.07. Konrad Baier zum 80. 25.07. Rudolf Fiedler zum 92. 29.07. Gertrud Wipperbusch geb. Schöbl zum 85. HOB Christina Auerswald Tel. 0341 24707822

Besondere Geburtstage Gratulation an Helma Mehrwald und Gerd Zinnecker zu ihren 85. Geburtstagen.
HOB Erich Kraus Tel. 0351 4718868 eMail: brigitte.und.erich.kraus@ web.de
n NIEDERLANGENAU
07.07. Maria Palzer geb. Kröhn zum 90. 11.07. Roland Renner zum 90. 14.07. Erika Hauke geb. Hanke zum 83. 16.07. Helmut Fleischer zum 85. 17.07. Edith Hins geb. Lorenz zum 85. 19.07. Reinhard Lamer zum 87. 20.07. Erika Heid geb. Ullrich zum 87. 28.07. Herbert Fuhrmann zum 79.
30.07. Herbert Erben zum 85.
31.07. Herbert Renner zum 81.
HOB Verena Schindler Tel. 0391 5565987
n OBERLANGENAU
03.07. Ilse Hornemann geb. Hamatschek zum 85.
08.07. Christa Markel zum 94. 12.07. Uwe Renner zum 79. Herzliche Grüße von Eurer
HOB Bärbel Hamatschek Tel. 06451 9134
n OBERPRAUSNITZ
25.07. Annelies Keller geb. Knauer (47) zum 84. HOB Tanja Fritz s. Anseith
n PELSDORF
06.07. Günter Müller zum 90. 12.07. Elfriede Erben geb. Kudernatsch zum 96.
HOB Anna Schreier Tel. 03695 600862
n POLKENDORF
06.07. Ernestine Zeil geb. Erben (Nr. 33) zum 92. 06.07. Gerlinde Hopkins geb. Schön (Nr. 66) zum 79. 18.07. Horst Sonnabend (Nr. 5) zum 84. 26.07. Anna Ewald geb. Nechanitzky (Nr. 24) zum 85.
Sylvia Colditz
n ROCHLITZ
01.07. Doris Langner (Ober-Rochlitz 7, Oberdorf 17) zum 88. 02.07. Alfred Rieger (Ober-Rochlitz 432) zum 87. 07.07. Renate Stark geb. Veith (Ober-Rochlitz 248) zum 78. 11.07. Helga Kübitz geb. Knappe (Nieder-Rochlitz 214) zum 98. 14.07. Josef Weber (OberRochlitz, Im Han) zum 93. 19.07. Adele Schumacher geb. Biemann (Sahlenbach) zum 82. 20.07. Hans Schier (OberRochlitz 171) zum 96. 25.07. Ilse Böhm geb. Körber (Sahlenbach 163) zum 99.
Rochlitzer Jubilarinnen: 05.07. Wally Tiezel geb. Palme (Nieder-Rochlitz 256, Plötzertampel) zum 95. 16.07. Gudrun Weichhart geb. Hacker (OberRochlitz 508) zum 100.
HOB Kirsten Langenwalder Tel. 089 12018348 (abends u.WE) eMail: presseriesengebirge@ aol.com
n SCHWARZENTAL 01.07. Agnes Fries (Hs 19) zum 93.
01.07. Rudi Berauer (Hs. 15) zum 76. 04.07. Marianne Ritzert geb. Glossauer (Hs. 50) zum 97. 09.07. Mariechen Sauer geb. Bock (Hallerhaus) zum 96. 17.07. Ilse Seidenbecher geb. Renner (Hs. 34) zum 98. 17.07. Andreas Pohl (Hs. 89, Gasthaus) zum 90. 20.07. Mariechen Batz geb. Seidel (Hs. 195) zum 98. 22.07. Waltraud Lath (Hs. 90) zum 79. 24.07. Egon Berauer (Hs. 15) zum 83. 26.07. Hilde Hartlieb geb. Pfleger (Hs. 170, „Bönischbauden“) zum 84. Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!
HOB Vera Kraus‚ Tel. 0173 8853142


n WITKOWITZ

n SPINDELMÜHLEFRIEDRICHSTHAL
02.07. Monika König geb. Eichler (Sp 083-Eichlerbaude) zum 83. 02.07. Horst Scholz geb. Zinecker (Sp 043Milscherloch) zum 84. 06.07. Christel Keil geb. Hollmann (Sp 199St. Peter, Nebenhaus Alpenhotel) zum 94. 09.07. Rudolf Erben (Sp 063 - St. Peter) zum 83. 10.07. Helmut Buchberger (Sp 069 - St. Peter, Lebens mittelgeschäfte) zum 96. 11.07. Renate Zöpf geb. Ullrich (Sp 209 - Haus Ullrich, Bäckerei) zum 81. 15.07. Margit Geist geb. Bradler (Sp 005 - Tannenstein) zum 85. 16.07. Hannelore Kraus geb. Never (F 044Haus Regina) zum 82. 16.07. Rosalinde Klein geb. Erlebach (Sp 061St. Peter) zum 85. 20.07. Ronny Pittermann (Sp 172 - Daftebauden, Haus Spindler) zum 52. 22.07. Hansjörg Böhm (Ober-Rochlitz) zum 86. 25.07. Maria Brankatschek geb. Lauer (Sp 171 - Haus Tannenstein) zum 86. 27.07. Peter Worbs (Sp 089Peterbaude) zum 97. 27.07. Edith Hollmann geb. von Thaden (Sp 084 - Bärengrund-Baude) zum 90. 28.07. Walpurga Seidel geb. Flach (Sp 058 - St.Peter, Haus Drei Berge) zum 84. 30.07. Brunhilde Lindenthal geb. Ebert (Sp 058 - St. Peter, Haus Drei Berge) zum 84. 31.07. Heinz Lauer (Sp 0171, Haus Tannenstein) zum 82.
HOB Dirk Schulze
Tel. 033732 40383
eMail: tischlerei-dirk-schulze@ t-online.de
n STUPNA
06.07. Dr. ret. nat. Franz Jeschek (Hs. 97) zum 78. 16.07. Irma Himsel geb. Jäger (Jäger-Hs. 54) zum 93. HOB Heidrun Vogt
Tel. 036421 22707
n SWITSCHIN
05.07. Johann Staffa (Nr. 36) z. 84. 07.07. Reinhard Unger (Nr. 57) zum 85. 14.07. Irmgard Bischof geb. Staffa (Nr. 3) zum 85. 22.07. Johann Dittrich (Nr. 72) zum 83. 25.07. Annelies Sonnabend geb. Hettfleisch (Nr. 15) zum 84.
HOB Roman C. Scholz
Tel.: 0170 2457875
eMail: r.c.scholz@freenet.de
02.07. Alfred Rücker (Wilfels, Hinterwinkel 77) zum 97. Edeltraud Berndt geb. Fischer (Paulin-Johann, Hinterwinkel 72) zum 91. Heidemarie Löffland (Heidi) geb. Bien (JakobsFrannzl, Mitteldorf 359) zum 84. Else Richter geb. Fischer (Lorzes, Niederdorf 31) zum 97. Frieda Storch (Friedl) geb. Böhm (siehe Linke, Trudi) zum 90. 14.07. Margarethe Loge (geb. Feistauer (Gütelbauer, Mitteldorf 15) zum 90. 20.07. Martha Barth geb. Fischer (Paulin-Franzl, Schwarzental 96) zum 86. 21.07. Kurt Fischer (von Fischer-Arnold, Gasthaus Mitteldorf 206) zum 83. 25.07. Anni Fischer geb. Bien (Jakobs-Seffi, Mitteldorf 23) zum 90. 26.07. Herbert Scharf (Hegerhaus, Simsberg 105) zum 92. 29.07. Werner Hollmann (siehe Hoffmann Helga) zum 80. Hans-Joachim Hönig Tel. 03949 502153
Liebe Leser und Leserinnen, bitte helfen Sie mit, die Listen zu aktualisieren und melden Sie Verstorbene Ihrem/Ihrer HOB. Danke.
Familiennachrichten aus dem Stadt- und Landkreis Trautenau
n MITTELLANGENAU
Martha Erben geb. Erben, Haus Nr. 33, geboren am 04.06.1921, verstorben vor einigen Jahren.
n NIEDERHOF Inge Dietrich geb. Hamatschek (Rudolfstal 165), geb. 19.08.1929, verst. 24.08.2023 mit 94 Jahren.
n NIEDERLANGENAU
Ernst Graf geboren 22.07.1937 in Kleinlangenau Nr. 1 (Paradies), verst. 15.10.2023 mit 86 Jahren. Hartwig Schreier, geboren am 22.07.1939, Haus Nr. 173, verst. 03.08.2021 in Halle mit 82 Jahren.
n OBERHOHENELBE
Der langjährige, ehemalige Kulturreferent des Heimatkreises und der Heimatortsbetreuer von Oberhohenelbe, Prof. Dr. Hans Pichler, geboren am 24.03.1931 in Oberhohenelbe, ist am 13.05.2024 verstorben. Seiner Familie gehört unser tiefes Mitgefühl.
n ROCHLITZ
Rudolf Schmidt (Sichdichfür 12), geboren am 23.08.1931 und verstorben im Dezember 2023 mit 92 Jahren.
n SCHWARZENTAL
Gertrud Rührich geb. Ullrich, geb. 27.02.1923 in Schwarzental, verst. 28.04.2024 in Crailsheim. mit 101 Jahren.

Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V., Sitz Würzburg Geschäftsstelle/Riesengebirgsstube: 97070 Würzburg, Neubaustr. 12 Tel. 0931 12141, Fax 0931 571230 1. Vorsitzender Wigbert Baumann www.trautenau.de, eMail: riesengebirge-trautenau@freenet.de Sparkasse Mainfranken Würzburg IBAN: DE 31 7905 0000 0001 405695 BIC: BYLADEM1SWU
Der Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. gratuliert zum Geburtstag
03.07. Georgine Nitsch HOB von Güntersdorf, Hegerbusch, Ketzelsdorf, Komar, Söberle u. m. zum 60. 07.07. Eberhard Hösel, ehem. HOB von Güntersdorf, Hegerbusch, Ketzelsdorf, Komar, Söberle, zum 81. 15.07. Ernst Kirschschlager, HOB Großaupa I/II, zum 88.
n ALTENBUCH
10.07. Walter Patzelt (S.) zum 92. 16.07. Alfred Fischer (NA 19) zum 91.
17.07. Alfred Zipper (MA 88) zum 91.
18.07. Edith Rhein geb. Schneider (MA 38) zum 91.
27.07. Gerlinde Rudolph geb. Schnabel (MA 105) zum 83. 27.07. Elisabeth Scheller geb. Pauer MA 94 zum 90. HOB Markus Decker Tel. 0170 2120408 (ab 19.00 h)
n ALT-ROGNITZ
07.07. Albert Patzak (AR 82) zum 91. 15.07. Anneliese Gareis geb. Hilbert (AR 69) zum 90. HOB Andreas Hoffmann Tel. 03672 411729 eMail: brunnl@outlook.de
n ALTSEDLOWITZMARKAUSCH
07.07. Manfred Gold zum 84. 12.07. Marta Hola geb. Lautsch zum 87. 13.07. Margarete Boksch geb. Jirouschek zum 89. 21.07. Ingrid Thurik geb. Berger zum 83. HOB Georgine Nitsch Tel. 08638 9822828 eMail: georgine.nitsch @t-online.de
Die Sanierung der Schloßmauer von Hohenelbe. Fotos: Karolína Boková
Die Post in Schwarzental. Foto: Bärbel Hamatschek
Dirk und Carmen Schulze (HOB Spindelmühle) am Wegekreuz in Krausebauden (links) und am Denkmal vom Veraweg (rechts). Fotos: privat
n BAUSNITZ
25.07. Anni Hinz geb. Rücker zum 84. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n BURKERSDORF
04.07. Albert Kreutzinger zum 83. 13.07. Karl Futter zum 87. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n DEUTSCH PRAUSNITZ
03.07. Hubert Weigel (24) zum 92. 09.07. Anna Treschnak (35) geb. Jarausch zum 88. 13.07. Walter Pawel (6) zum 93. 18.07. Irma Stankewitz (88) geb. Skopez zu 98. 21.07. Kurt Seidel (111) zum 94. 30.07. Hildegard Plettenberg (184) geb. Rosenberg zum 90. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n DÖBERLE
03.07. Franz Elstner (66) zum 92. 12.07. Kurt Maier (27) zum 84. 12.07. Herta Hörl geb. Schöbel (25) zum 83. 24.07. Annelies Wiencke geb. Franz (13) zum 89. HOB Dr. Siegfried Erben Tel. 03843 842088 dr.siefriederben@web.de
n DUBENETZ
06.07. Ursula Bistier geb. Mathys (ND 70) zum 81. 12.07. Kurt Munser zum 93. 14.07. Helene Koß geb. Friedel zum 96. 14.07. Siegfried Mach zum 85.
22.07. Josef Mach zum 79.
27.07. Martha Lange geb. Patzak zum 86.
30.07. Juliane Schippers geb. Lindgens zum 64. 31.07. Oswald Sopauschke (27) zum 82.
HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n FREIHEIT
03.07. Mariann Csiky geb. Stephan zum 100. 18.07. Annemarie Marsch zum 82.
20.07. Alfred Erben zum 92. 22.07. Horst Wurbs zum 85. HOB Dr.-Ing. Herbert Gall 03744 2413660
n GLASENDORF
18.07. Franz Seidel (Nr. 13) zum 88. 25.07 Horst Kühnel (Nr. 40) zum 86. HOB Alois Zieris Tel. 03578 314382
n GRADLITZ
04.07. Christa Freudenberg geb. Hauke zum 81. 09.07. Horst Rösel zum 86. 18.07. Ulrike Riemann geb. Stump zum 80. 24.07. Alfred Winter zum 93. 27.07. Heinz Rössel zum 85. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n GROSS-AUPA I und II
01.07. Lieselotte Wulf geb. Hofer (I/145) zum 84. 04.07. Ingeborg Hofer (II/65) zum 80.
09.07. Annelies Probst geb. Tippelt (I/30) zum 81.
15.07. Ernst Kirchschlager (I/29) zum 88. 22.07. Herbert Braun (II/47) zum 81.
25.07. Anni Pries geb. Tippelt (I/143) zum 88.
28.07. Monika Bönsch geb. Otto (II/60) zum 84.
29.07. Christina Bauer (I/90) zum 92.
31.07. Annelies Marcinkowski (I/6) zum 89.
HOB Christa Lang Handy: 0170 6523260
n GÜNTERSDORFKOMAR - HEGERBUSCH
03.07. Ernst Schneider (203) zum 95.
05.07. Gerhard Wanjek (K 50) zum 92.
08.07. Irmgard Erwerth geb. Schenk (64) zum 91. 15.07. Magdalena Kruske geb. Hampel (294) zum 95.
27.07. Dr. Horst Böhnisch zum 85. 30.07. Martha Höckelmann geb. Reis (138) zum 92. HOB Georgine Nitsch s. Dubenetz
n HARTMANNSDORF
06.07. Rudolf Barth (Nr. 23) zum 92. 22.07. Anna Hanika geb. Bensch (Nr. 42) zum 86. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n HERMANITZ, BIELAUN, PRODE und GRABSCHÜTZ
17.07. Edeltraud Gäbler geb. Posner zum 88. 19.07. Margarete Glowacki geb. Voith zum 92. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n JUNGBUCH
10.07. Richard Baier (Nr. 192) zum 85. 15.07. Magdalena Roth geb. Goldmann (FTH) zum 96. 22.07. Waltraud Zabranská geb. Erben zum 91. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n JOHANNESBADSCHWARZENBERG
03.07. Dietmar Tippelt zum 81. 08.07. Heidemarie Frenzel zum 83. 11.07. Leopold Letzel (J) zum 94. 27.07. Renate Kitzmichel zum 94. 31.07. Marianne Peiska geb. Kühnel zum 88. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n KAILE
28.07. Herbert Wlatschiha zum 94. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n KETZELSDORF
16.07. Edeltraut Buschner geb. Fabinger (50) zum 84. 20.07. Franz Fiedler zum 86. 20.07. Christel Kapahnke geb. Illner (56) zum 85. HOB Georgine Nitsch s. Dubenetz
n KLADERN
30.07. Birgitt Schick geb. Posner zum 70. HOB Josef Heina Tel. 03831 280179
n KLEINAUPA
03.07. Rosel Grabiger zum 94. 03.07. Ursula Springer geb. Salwender zum 84. 07.07. Anna Brames geb. Salwender zum 93. 08.07. Gertrud Herbst geb. Bönsch zum 86. 08.07. Margot Wuttke geb. Wimmer zum 84. 09.07. Erika Köppel geb. Kühn zum 70. 10.07. Maria Matthies geb. Patzelt zum 83. 10.07. Edith Dziamski geb. Kirschnek zum 82. 12.07. Gerhard Schmidel zum 86. 16.07. Johanna Wagner geb. Klein zum 90. 17.07. Irmgard Wiesner geb. Kirchner zum 86. 18.07. Peter Tippelt zum 86. 19.07. Maria-Theresia John zum 95. 21.07. Hans Wasse zum 95. 21.07. Hedwig Körmer geb. Richter zum 90. 26.07. Inge Barth geb. Utz zum 72. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n KÖNIGINHOFDEUTSCH PODHART
08.07. Dieter Rubant zum 82. 17.07. Traudel Stolpmann geb. Friebel zum 84. 19.07. Otto Lar zum 93. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n KÖNIGSHAN
04.07. Werner Nowak zum 68. 08.07. Rosalinde Resnischek geb. Börner zum 93. 08.07. Rudolf Maiwald zum 85. 08.07. Wolf-Rüdiger Kallus z. 82. 08.07. Uta-Theresia Mautner geb. Blaschek zum 82. 20.07. Erhard Winter zum 93. 20.07. Franz Anders zum 86. 24.07. Edgar-Georg Ringel zum 85.
25.07. Anni Hinz geb. Rücker zum 84. 26.07. Irmgard Scholz geb. Geyer zum 84. 26.07. Bärbel Kotscharnik geb. Glänz zum 76. 30.07. Gerda Blaschek geb. Arloth zum 85. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n KOKEN
05.07. Dr. Thomas Nedwidek zum 68. 11.07. Irma Fenner geb. Steffan zum 85. HOB Josef Heina Tel. 03831 280179
n KUKUS
02.07. Erich Jaschke (Nr. 38) zum 80. 03.07. Anneliese Hofmann geb. Jaschke (Nr. 38) zum 89. 08.07. Willibald Sturm (Nr. 32) zum 84. 14.07. Karin Kühnel (Nr. 47) zum 83.
HOB Wolfgang Dittrich-Windhüfel Tel. 0761 2025553
eMail: wodw54(at)gmail.com
n LAMPERSDORF
04.07. Angelika Waltereid geb. Vieldorf (16) zum 80. 08.07. Erika Loudová geb. Richter (144) zum 83. 17.07. Werner John (29) zum 81. 23.07. Dietmar Miksch (130) zum 81. 28.07. Elisabeth Schadek geb. Krause (136) zum 77. 29.07. Reinhard Winkler (11) zum 72.
HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz

Trautenau, die Erzdekanalkirche Mariä Geburt. Foto: Karolina Boková
n OBERALTSTADT
03.07. Siegfried Gall zum 86. 14.07. Krista Phillip geb. Haase zum 85. 18.07. Gerhard Kerner zum 89. 24.07. Christa Unterstab geb. Cramer zum 97. 26.07. Annelies Kober geb. Moser zum 95.
HOB Markus Decker s. Altenbuch
n OBER-NIEDERALBENDORF und DÖRRENGRUND
07.07. Sieglinde Schmidt geb. Polz (N. A.) zum 84. 18.07. Josef Reiß (N. A.) zum 84. 21.07. Maria Gössel geb. Patzack (O. A.) zum 82.
HOB Helena Kessler Tel. 09355 1047
n OBER-NIEDERKOLBENDORF
17.07. Wolfgang Pech (N.K.) zum 85. 30.07. Martha Sitte geb. Doleschel (N. K.) zum 86.
HOB Helena Kessler Tel. 09355 1047
n PETZER
03.07. Josef Schröfel zum 91. 11.07. Marie Herkrath zum 96. 17.07. Peter Franz zum 80. 19.07. Helga Felsleitner geb. Bönsch zum 96. 19.07. Edeltraud Knipping geb. Hofer zum 96. 19.07. Günther Mitlöhner zum 84.
27.07. Georg Friedrich zum 82. 27.07. Hans Friedrich zum 82. 30.07. Ernst Hofer zum 90.
HOB Christa Lang Handy: 0170 6523260
n PILNIKAU - PILSDORF
05.07. Gerhard Pauer (Pd I/71) zum 81.
06.07. Maria Hotter geb. Wonka (Pd I/37) zum 87. 06.07. Josef Wonka (Pd I/37) zum 87. 08.07. Heidrun Frank-Perusat geb. Schida (Pi 3) zum 77. 13.07. Alfred Stepan (Pd I/74) zum 85. 14.07. Christina Schilling geb. Hofmann (Pi 17) zum 92. 19.07. Walter Peyerl (Pi 158) zum 93. 22.07. Walter Leppelt (Pi 15) zum 85. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n QUALISCH
01.07. Christine Leis geb. Steiner zum 85. 04.07. Irmgard Neuner geb. Kohl zum 95. 08.07. Helmut Kasper zum 86. 14.07. Helmut Friese zum 92. 14.07. Heinz Urbanetz zum 92. 17.07. Kurt Kasper zum 95. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n RADOWENZ
01.07. Gerda Haselbach geb. Rzehak zum 84. 03.07. Ilse Altmann geb.Thole zum 84. 05.07. Helga Hoyn geb. Föhst zum 86. 06.07. Kurt Schmidt zum 96. 08.07. Sigrid Kopecka geb. Rudolf zum 85. 28.07. Alfred Thurik zum 84. 28.07. Siegfried Pfeifer zum 85. HOB W. Thole Tel. 06196 44836
n SCHATZLAR, STOLLEN, BOBER, BRETTGRUND/ WERNSDORF, REHORN/ QUINTENTAL, SCHWARZWASSER
04.07. Sigrid Kuhnová geb. Bock zum 81. 04.07. Peter Kleiner zum 78. 05.07. Erika Fetzer geb. Wiese zum 74. 06.07. Annelies Illner geb. Meuer zum 88. 07.07. Ralf Schöbel zum 61. 08.07. Wally Engelage geb. Tobias zum 90. 16.07. Lydia Bader geb. Hruby zum 93. 16.07. Bärbel Kotscharnik geb. Glänz zum 76. 21.07. Rudolf Klust zum 87. 22.07. Burkhard Weber zum 76. 24.07. Herta Kammel geb. Fell zum 88. 25.07. Anneliese Huke geb. Schmidt zum 90. 26.07. Annelis Kober geb. Moser zum 94. 26.07. Anna Linder geb. Novak zum 85. 26.07. Margarethe Ehehalt geb. Schatty zum 82. 28.07. Gerlinde Jahn geb. Hofmann zum 85. 29.07. Walter Weiser zum 93. 29.07. Erna Kolar zum 84. 30.07. Irmgard Köhler geb. Tamm zum 87. 31.07. Christa Haas geb. Kollmann zum 85. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n SCHURZ
27.07. Olga Meyer geb. Tschöp zum 97. HOB Josef Heina Tel. 03831 280179
n SIEBOJED
20.07. Herbert Baudisch zum 92.
HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n SILWARLEUT
20.07. Raimund Beck zum 97. 27.07. Olga Mayer zum 97. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n SÖBERLE
02.07. Alfons Anders zum 97. 08.07. Christine Schramm geb. Kodym zum 87. 12.07. Herta Holm geb. Rücker zum 85. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n SOOR
02.07. Johann Patzak (NS/EU) zum 79.
Historische Ansicht von Alt-Rognitz. Zeichnung: Michal Vojtěch

02.07. Marie Zieglgansberger geb. Wippler (NS/EUL 87) zum 87. 03.07. Josef Wippler (NS 33) zum 96. 09.07. Manfred Hanke (OS/EI 44) zum 81. 14.07. Alfred Scholz (NS 97) zum 93. 15.07. Frieda Schelhas geb.Qual (OS) zum 95. 20.07. Günther Mühl (OS 116) zum 96. 23.07. Maria Walke geb. Pusch (OS 13) zum 87. 25.07. Heinz Hoder (OS/EI 83) zum 83. 26.07. Alfred Wippler (NS 53) zum 93. Patronatsfest in Soor Aus Anlaß des Patronatsfestes feiert Pfarrer Pawel Rousek am 25. Juni 2024 um 18.00 Uhr in der Soorer Kirche „St. Johannes der Täufer“ eine Heilige Messe Am 28. Juni 2024 um 18.00 Uhr gibt der örtliche Chor „Na Zdar“ ein Konzert in der Soorer Kirche. Zu beidem wird herzlich eingeladen.
HOB Edith Niepel Tel. 03841 632765
n STAUDENZ
09.07. Josef Dvoratschek zum 85. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz
n TRAUTENAU 03.07. Heidelinde Niemeier geb. Kamradek zum 83. 05.07. Erika Kühn geb. Kubinazum 92. 06.07. Herbert Schoft zum 97. 10.07. Max Sagaster zum 92. 12.07. Karl Heinz Kubesch zum 97. 12.07. Peter Hoberland zum 92. 13.07. Margarethe Ott geb. Illner zum 90. 15.07. Elisabeth Petereit geb. Überla zum 100. 18.07. Sieglinde Debelka geb. Buchta zum 88. 20.07. Hans Joachim Sturm zum 92. 23.07. Annelies Paulus Edeltraud zum 81. 24.07. Norbert Potsch zum 92. 03.07. Monika Klein geb. Erben zum 82. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n TRAUTENAUHOHENBRUCK
17.07. Dirk Schleif (Nr. 10) zum 61. 23.07. Gerlinde Borowski (Schleif Nr. 10) zum 83. 25.07. Anna Alsleben (IllnerAnni Nr. 21) zum 98. 26.07. Josef Tatsch zum 89. 29.07. Erika Weber (Falge Nr. 17) zum 81. 29.07. Hedwig Schmook (Illner-Hedl Nr. 59) 30.07. Irene Bauer (Illner Nr. 59) zum 83. 31.07. Annemarie Funke (Falge Nr. 17) zum 83. HOB Harald Richter Tel. 02224 81437 eMail: UHRichter@t-online.de
n TRAUTENBACH
01.07. Elisabeth (Liesl) Rose (59) zum 90. 04.07. Dr. Manuela Aschauer geb. Lehmert (115) zum 64. 05.07. Bärbel Gohlke geb. Lath (61) zum 83. 07.07. Hermann Baudisch (20) zum 87.
09.07. Ewald Morocz (16) zum 84. 11.07. Ursula Wagner geb. Altmann (131) zum 84. 12.07. Isolde (Ilse) Schön geb. Müller (13) zum 92. 16.07. Dirk Schleif (10) zum 84. 18.07. Ingeburg Hartig geb. Walter (82) zum 87. 26.07. Annelies Steinhauser geb. Thamm (63) zum 82. 26.07. Ursula Diesner geb. Hasebach (43) zum 82. HOB Georgine Nitsch s. Altsedlowitz n WEIGELSDORFKALTENHOF 04.07. Inge Wandrey geb. Seidel (We 16) zum 84. 08.07. Alfons Mann (We 39) zum 92. 11.07. Roland Richter (We 21)zum 83. 13.07. Gertrud Schneider (We 25) zum 89. 18.07. Renate Mehl geb. Demuth (We 74) zum 81. 24.07. Maria Wirth geb. Scharf (Ka 24) zum 90. 26.07. Erika Kalkusarni geb. Staros (Volanov 26) zum 89. 26.07. Christa Czarnetzki geb. Falge (We 71) zum 83. 28.07. Ingeborg Krug geb. Gottwald (We 61) zum 83. 29.07. Kurt Lehmert (Ka 6) zum 84. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n WELHOTTA-BÖSIG 06.07. Erna Hindermann zum 88. 19.07. Annelise Kunze zum 97. 31.07. Susanne Stöber zum 95. HOB Sieglinde Wolf
n WIHNAN
07.07. Maria Fähnrich geb. Aster zum 87. 17.07. Viteslav Groh zum 90. HOB Josef Heina Tel. 03831 280179
n WILDSCHÜTZ
06.07. Josef Reuß zum 92. 20.07. Christina Schößler geb. Thim (141) zum 84. 21.07. Albert Gottwald (Hof) zum 100. 30.07. Anna Moosbauer geb. Rösel (7) zum 99. 30.07. Rosel Taube geb. Fischer, (128) Breslauer zum 87. HOB Markus Decker s. Altenbuch
n WÖLSDORF 15.07. Kurt Ott (Nr. 94) zum 94. 20.07. Olga Becher geb. Kriegler zum 92. HOB Wolfgang Dittrich-Windhüfel s. Kukus
n WOLTA
06.07. Karl Heinz Illner zum 81. 15.07. Maria Schäfer geb. Stechmann zum 93. 15.07. Marianne Spalda zum 96. 21.07. Hildegard Freier zum 85. 24.07. Gerhard Menzel zum 82. 26.07. Erhard Rumler zum 95. 31.07. Kurt Dressler zum 84. HOB Lothar Riemer Tel. 0816 8874937 eMail: lothar@riemeronline.com
n RADOWENZ Am 03.05.2024 verstarb Christel Flemming geb. Hauptfleisch im Alter von 94 Jahren in Berlin. Am 08.05.2024 verstarb Herbert Thole im Alter von 88 Jahren in Boizenburg.



Rübezahl und „sein Enkel“ Wigbert Baumann, Andreas Hoffmann und Wigbert Baumann am Trautenauer Stand, das Wappen von Trautenau. Fotos: Wigbert Baumann und Andreas Hoffmann
� Sudetendeutscher Tag
Pfingsterlebnisse am Trautenauer Stand beim Sudetendeutschen Tag 2024
Andreas Hoffmann berichtet von seinen Eindrücken zum Sudetendeutschen Tag 2024 und wie es am Trautenauer Stand so gewesen ist.

Früher, in meiner Jugendzeit, konnte ich mit langen Haaren und Musik der Rolling Stones provozieren oder für Irritation sorgen. Heute gelingt mir das, zumindest in Thüringen, mit dem Sudetendeutschen Tag. Wenn ich ankündige, über Pfingsten dieses Großereignis zu besuchen, zeigt sich oft Irritation im Gesicht des Gegenübers.
Teilnahme an einem „Lach-Yoga-Kurs“ oder beim „Gothic Treffen“ wären schneller akzeptiert und in Ordnung. Aber Sudetendeutscher Tag! Da haben Klischees und Vorurteile scheinbar das „ewige Leben“. Dabei geht es dort um Verständigung und Versöhnung, daß Tschechen und Deutsche und „Sonstwer“
miteinander ins Gespräch kommen, daß man über alte Heimatlandschaften spricht, sich von Kultur und Tradition der einzel-

nach Vorfahren sucht. Dieses Jahr stellte ich fest, daß unser Trautenauer Stand die meisten Originale zu bieten hat. Einmal unseren Vorsitzenden, Wigbert Baumann, welcher sich Original ‚Rübezahls Enkel‘ nennt. Dazu eine original alte Rübezahl-Holzfigur, originale Pastellzeichnungen und anderes Gezeichnetes. Aber ich höre auf, sonst bekomme ich nachträglich Ärger mit den „Hohenelbern“, den „Braunschen“ und vom Tschechischen Verein Trutnov. Wir standen wieder nebeneinander, jeder an seinem „Marktstand“. Aber statt Obst, Gemüse oder Honig boten wir Faltblätter zur Information, Bücher, viel Kultur und auch Trutnover Bier an. Es war ein
richtig langer Gemeinschafts stand. Auffällig war hier die ge häufte Anwesenheit von Pro minenz. Damit meine ich nicht Herrn Posselt oder Herrn Söder,

und fraß gnadenlos alles

sondern den Herrn der Berge. Heutzutage darf man ihn auch offiziell „Rübezahl“ nennen, ohne daß ein Gewitter aufzieht. In verschiedensten künstlerischen Varianten stand er da oder lief persönlich umher. Und da es Pfingsten war, gab es in Veranstaltungen auch die unterschiedlichsten Dialekte zu hören. Da bekam man die Vielfalt des Sudetenlandes zu spüren und die Verständlichkeit war gut. Es war eben Pfingsten! Diese Vielfalt bot sich auch beim Besuch an den unterschiedlichen Ständen in der Messehalle. In der Pfingstnacht hatte ich einen ungewöhnlichen Traum. Der Trautenauer Lindwurm kam in unsere Würzburger Heimat-
gewaltiger Schreck! Aber der Lindwurm, dieser lockere Bursche, hatte Humor und spuckte alles wieder aus. Zumindest das meiste, denn Überflüssiges blieb verschwunden. Im Traum vermißten wir hinterher nichts. Als ich aufwachte, kam mir dies wie eine Vision für die Zukunft vor. Und ich dachte: Wenn du den ganzen Tag am Trautenauer Stand zubringst, werden deine Träume visionär. Mein Fazit: Der Sudetendeutsche Tag sorgt für gute Gedanken und sinnvolle Veränderungen. Außerdem bin ich, zumindest im Traum, endlich mal dem legendären Trautenauer Lindwurm begegnet.
Andreas Hoffmann HOB Alt-Rognitz und Raatsch
Die gute böhmisch-schlesische Zusammenarbeit hat auch dieses Jahr wieder stattgefunden.
den Europatag 2023 anläßlich
verkauft. Die Bleche waren leer und der ewig hungrige ‚Rübezahls Enkel‘ Wigbert Baumann chen Ränder schmecken lassen. Als Verstärkung kam noch Franz Geißendörfer dazu und hat sich
Wolfgang Dittrich-Windhüfel hat kürzlich mehrere Orte von Günter Henke übernommen.

Wolfgang Dittrich-Windhüfel begann 2017 quasi aus dem Nichts heraus seine eigene, familienbiografisch angelegte Recherche über das Leben im ehemaligen Landkreis Trautenau und speziell die Ortsgemeinde Kukus in Sichtweite des Riesengebirges. Seine Nachforschungen brachten inzwischen erstaunliche Ergebnisse und setzten die Familiengeschichte in ein völlig neues Licht. Dabei halfen ihm nicht nur die im Internet frei zugänglichen Datenbanken und Texte, sondern auch der Einblick in Dokumente deutscher, polnischer und tschechischer Archive sowie die inzwischen zahlreich erschienenen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die gerade die 1930erund 1940er-Jahre im Fokus haben und über Sprachgrenzen hinweg Ergebnisse zu Tage fördern, die so manchen familienbiographischen Hintergrund erhellen. Seine Ursprungsfamilien stammen alle aus dem Bezirk Königinhof an der Elbe. Er ist seit 2024 Mitglied der SL und HOB für Kukus, Schlotten und Wölsdorf. Wolfgang Dittrich-Windhüfel HOB Kukus, Wölsdorf, Schlotten
In Malá Úpa (Kleinaupa) steht eine der höchstgelegenen Kirchen Tschechiens, die Kirche St. Peter und Paul. Nun wird für die Restaurierung gesammelt.
Sie steht hier schon seit 1791 und ist heute wie damals eng mit dem Gemeindeleben verknüpft. In der Vergangenheit brannte die Kirche nach einem Blitzschlag ab, wurde anschließend aber wiedererbaut. Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie renoviert, aber zu einer erneuten Reparatur kam es dann erst 1986 und auch dies nur dank der Freigebigkeit von Alteingesessenen, die heute in Deutschland leben. 2019 ging die Kirche in den Besitz der Gemeinde Malá Upa über, die sofort notwendige Schritte zur Feststellung des Gesamtzustands unternahm. Fachexpertise schätzt die zur Reparatur erforderlichen Kosten auf 5,8 Millionen CZK –
unter anderem zur Festigung der Konstruktion, für ein neues Dach und die Feuchtigkeitsdämmung zum Ausbessern des Innen- und Außenputzes. Die Restaurierungskosten der Orgel werden auf 535.000 CZK geschätzt.
Natürlich bemüht sich die Gemeinde um finanzielle Mittel aus Beihilfen, dennoch möchten wir auf diesem Wege auch all jene ansprechen, die die Kirche mögen und gern einen persönlichen Beitrag zu ihrer Reparatur beisteuern würden.
Zu diesem Zweck wurde ein transparentes Konto der Gemeinde Malá Úpa bei der Tschechischen Sparkasse (Ceská sporitelna) 4691943339/0800 (IBAN CZ67 0800 0000 0046 9194 3339) eingerichtet.
Für Ihre Bereitschaft möchten wir Ihnen schon im Voraus herzlich danken. Gott segne Sie! Die Gemeinde Malá Úpa

von „50 Jahre Europastadt Würz burg“ zusammen mit der Stif tung Kulturwerk Schlesien als Generalprobe mit einem ge meinsamen Infostand am Markt platz bereichert. Es war beschlos sene Sache, daß auch in diesem Jahr am Muttertag unterhalb vom Würzburger Rübezahl das Riesengebirge von böhmischniederschlesischer oder auch tschechisch-polnischer Seite vorgestellt wurde. Auf den Tipp von Michael Fries von der Landsmannschaft der

als Schnapsverkäufer besonders von Becherovka und Sliwovitz
Andrea Huber lud zweimal zu schichten rund um den Herrn der ches Kinderherz mit ihren Er zählungen. Am Pavillion war der Maltisch mit Motiven aus dem Riesengebirge wie jedesmal ohne Pause der „Renner“ für kleine Künstlerinnen und Künstler. Es war ein gelungenes Familienfest mit dem Motto „Wir feiern die

Oberschlesier wurden drei große Bleche Mohnkuchen nach schlesischer Art beim Bäcker bestellt und von Lisa Haberkern, der Geschäftsführerin der Stiftung, auf den Berg gebracht. Die Nachbarn vom „Mwanza e.V.“ hatten tansanischen, fair gehandelten Kaffee im Angebot. Am Ende des schönen Frühlingssonntags waren 120 Stücke Mohnkuchen
� Heimatortsbetreuer Georgine
Georgine Nitsch übernimmt die Aufgaben von Günter Henke.

Vielfalt“, an dem sich die vielen internationalen Gesellschaften und Vereine der Stadt Würzburg, ihre Region und deren Köstlichkeiten vorstellen konnten. Zum ersten Mal war der schlesische Mohnkuchen mit von der Partie. Alle waren zufrieden und auch 2025 werden wir wieder zu Füßen Rübezahls am Festungshang zu finden sein. Wigbert Baumann
Ich habe die große Freude und Ehre, diese Aufgaben ab dem 01.06.2024 übernehmen zu dürfen und hoffe sehr, daß ich seinem „Erbe“ gerecht werde. Ich danke hiermit meinem Freund Günter für die hervorragende Tätigkeit als HOB-Sprecher und HOB-Betreuer diverser Orte sowie der ganzen Vorarbeit, welche er in den vergangenen Jahren erbracht hat. Auch freue ich mich, daß er uns weiterhin in seinen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Ich wünsche Günter und seiner Familie von ganzem Herzen alles Gute! Mit herzlichen Grüßen – Eure Georgine Nitsch HOB-Sprecherin

stube
Weitere Eindrücke des Sudetendeutschen Tages am Trautenauer Stand, den Herrn der Berge Rübezahl eingeschlossen. Fotos: Wigbert Baumann
W. Dittrich-Windhüfel. Foto: privat
Das schöne Wetter sorgte für eine tolle Atmosphäre. Foto: Krakonošuv vnuk
Das schöne Wetter sorgte für eine tolle Atmosphäre. Fotos: Krakonošuv vnuk
