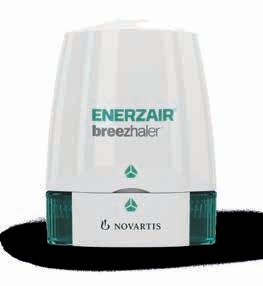6 minute read
Exzellente Sicht auf die Mukosa – eine unabdingbare Voraussetzung für die Darmkrebsvorsorge
In Deutschland erkranken jährlich rund 37.000 Menschen an Kolonkarzinomen, den häufigsten der malignen Darmtumoren [1]. Darmkrebs gehört zu den Krebsarten, die sich häufig und unbemerkt über Jahre hinweg aus benignen Vorstufen (den Adenomen) zu malignen Adenokarzinomen entwickeln. Daher können die Vorstufen im Rahmen einer Untersuchung zur Früherkennung rechtzeitig identifiziert und der Ausprägung des Kolonkarzinoms vorgebeugt werden. Die Darmkrebsvorsorge wird von den gesetzlichen Krankenkassen mit einem umfassenden Screening-Angebot unterstützt. Dieses beinhaltet einen jährlichen Test auf fäkales okkultes Blut ab dem 50. Lebensjahr sowie eine Koloskopie ab 50 Jahren. Sofern der erste Befund unauffällig war, kann die Koloskopie nach 10 Jahren wiederholt werden [2]. Bei Patienten und Patientinnen mit erhöhtem Darmkrebsrisiko wird eine Koloskopie auch in jüngeren Jahren von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen [3]. Für die Darmkrebsvorsorge stehen laut S3-Leitlinie verschiedene Untersuchungen zur Verfügung: Stuhltests, radiologische sowie endoskopische Verfahren. Als Goldstandard gilt die Koloskopie [4]. Dabei wird – anders als bei einer Sigmoidoskopie – nicht nur der letzte Abschnitt des Dickdarms untersucht, sondern auch der Bereich vom Kolon bis zum terminalen Ileum. Vor der Behandlung wird der Darm mithilfe von Darmspülpräparaten gereinigt, sodass Polypen, Adenome oder Karzinome zuverlässig entdeckt werden können.
Darmreinigung: vom Einlauf bis zu modernen Spüllösungen
Advertisement
Für die Darmreinigung sind heute viele verschiedene Präparate und Lösungen verfügbar. Welche Form für die jeweiligen Patienten und Patientinnen am geeignetsten ist, ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem Allgemeinzustand oder der zu erwartenden Therapietreue. Bevorzugt werden aber in der Regel Darmspüllösungen mit einem geringen Trinkvolumen, unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und einer einfachen Zubereitung. Nachdem über lange Zeit vor allem Einläufe in Kombination mit diätetischen Einschränkungen zur Darmreinigung eingesetzt worden waren, etablierten sich in den 1980er Jahren PolyethylenglykolLösungen (PEG), d.h. osmotisch ausgewogene Elektrolytspüllösungen zur oralen Einnahme, die sich schnell zum Goldstandard der Darmreinigung vor Koloskopien entwickelten [5]. Denn die PEGLösungen wirkten sehr effektiv: Das PEG in der Darmspüllösung wird praktisch nicht resorbiert und bindet durch seine osmotische Wirkung Wasser in Form von Wasserstoffbrücken. Das Wasser passiert anschließend den Gastrointestinaltrakt, ohne resorbiert zu werden [6]. Ein Nachteil früherer PEG-Lösungen war jedoch, dass die Patienten 4 Liter der Lösung innerhalb weniger Stunden zu sich nehmen mussten. Neben dem hohen Trinkvolumen erschwerte auch ein salziger Geschmack die Einnahme. Daher wurden die PEG-Lösungen durch den Zusatz von Ascorbinsäure/ Natriumascorbat (ASC) ergänzt, wodurch sich das Trinkvolumen auf 2 Liter reduzieren ließ [7]. Durch die osmotische Wirkung gelangt zusätzlich Wasser in den Darm und induziert einen laxativen Effekt. Ein positiver Nebeneffekt von ASC ist der angenehme Geschmack. Mittlerweile gibt es die PEG+ASC-Lösungen auch mit einem geringeren Trinkvolumen und sie werden außerdem in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten.
Plenvu® schreibt die Innovationen fort
Heute steht mit Plenvu® eine Darmspüllösung zur Verfügung, die in besonderer Weise die Wirkmechanismen von PEG und ASC kombiniert. Dadurch wird es möglich, das Trinkvolumen der Spül-
lösung auf 1 Liter* zu reduzieren. Zusätzlich enthaltene Elektrolyte wie Natrium- und Kaliumchlorid unterstützen durch ihre ebenfalls osmotischen Effekte die Wirkung von PEG und ASC. Die Elektrolyte verhindern, dass klinisch signifikante Konzentrationsänderungen von Natrium, Kalium oder Wasser auftreten – außerdem wird das Dehydrierungsrisiko reduziert [8]. Dieser Effekt wird dadurch unterstützt, dass zu beiden Dosen der Trinklösung zu je 500ml zusätzlich mindestens 500ml klare Flüssigkeit (z. B. Wasser, klarer Apfelsaft) eingenommen werden sollen.
Dosis-Splitting Im Idealfall sollten die Patienten die Trinklösung in 2 Dosen (mit nächtlicher Pause dazwischen) zu sich nehmen. Findet die Koloskopie z.B. am Vormittag statt, wird die Trinklösung am Vorabend und am Morgen des Untersuchungstages getrunken. Durch das Dosis-Splitting verbessert sich nicht nur die Adhärenz der Patienten, sondern es verlängert sich auch der Reinigungsprozess und die Reinigungsleistung erhöht sich um 15–20% im Vergleich zur Einnahme der gesamten Lösung am Vortag [9]. Bei einer Koloskopie am Nachmittag sollte als adäquate Alternative zum Dosis-Splitting die Einnahme beider Dosen am Untersuchungstag – im Abstand von mindestens 1 Stunde – erfolgen. Eine gesplittete Einnahme wird sowohl von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) als auch von der Europäischen Gesellschaft für gastrointestinale Endoskopie (ESGE) empfohlen [10, 11].
* Zusätzlich muss 1 Liter frei wählbare klare Flüssigkeit getrunken werden. Abbildung 1: In der MORA-Studie war Plenvu® der 2-Liter-PEG+ASC-Lösung Moviprep® bei gesplitteter Einnahme hinsichtlich der Reinigung des gesamten Kolons überlegen (mod. nach [6]).
Abbildung 2: Im kritischen Segment des rechten Kolons bewirkte Plenvu® bei doppelt so vielen Patienten eine exzellente und gute Reinigung wie Moviprep® (mod. nach [6]).

Wie die MORA-Studie belegt, ist Plenvu® trotz des niedrigen Trinkvolumens bei der Gesamtreinigung des Darms nicht unterlegen [6]: Mit der Einnahme der 1-Liter-PEG+ASC-Lösung* erzielten 97,3% der Patienten bei zweigeteilter Trinkmenge eine erfolg-
reiche Darmreinigung gegenüber 92,2% nach gesplitteter Einnahme der 2-Liter-PEG+ASC-Lösung Moviprep® (Abb. 1). Auch bei der Reinigung des kritischen rechten Kolons zeigt sich eine signifikante Überlegenheit von Plenvu® (Abb. 2). Durch die die exzellente und gute Reinigungsleistung von Plenvu® bei 31,6% der Patienten musste während der Koloskopie zudem weniger Spülflüssigkeit abgesaugt werden, wodurch sich die Untersuchungszeit verringerte [6]. Fabian Sandner, Nürnberg
Literatur
1 International Agency for Research on
Cancer, 2019. Im Internet: http://gco.iarc. fr/today/data/factsheets/populations/276germany-fact-sheets.pdf 2 Positionspapier Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und
Stoffwechselerkrankungen zur Darmkrebsvorsorge, 2019 Im Internet: www. dgvs.de/wp-content/uploads/2018/03/
Positionspapier_Organisiertes-DK-Screening_M%C3%A4rz 2018_final.pdf 3 Kassenärztliche Bundesvereinigung.
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von
Krebserkrankungen (Krebsfrüherkennungs-Richtlinien). Bundesanzeiger; 2009; 148a 4 Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften.
S3-Leitlinie 021-007OL: Kolorektales
Karzinom, 2017 5 Wexner SD et al. Surg Endosc 2006;20: 1147-1160 6 Bisschops R et al. Endoscopy 2019;51: 60-72 7 Bitoun A et al. Aliment Pharmacol Ther 2006;24:1631-1642 8 Fachinformation Plenvu®; Stand: Oktober 2019 9 Martel M et al. Gastroenterol 2015;179: 79-88 10 Ell C et al. Z Gastroenterol 2007;45: 1191-1198 11 Hassan C et al. Bowel preparation for colonoscopy: ESGE Guideline – Update 2019. Endoscopy 2019;51:775-794 Aktualisierte S3-Leitlinie Rauchen und Tabakabhängigkeit:
Vareniclin erhält höchsten Empfehlungsgrad
Für den Einsatz zur medikamentösen Tabakentwöhnung erhielt der partielle Nikotinrezeptorblocker Vareniclin (Champix®) in der im Januar aktualisierten Leitlinie „Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und Behandlung“ erstmals eine starke Empfehlung. Er hat somit den höchsten Empfehlungsgrad für eine medikamentöse Behandlung von entwöhnungswilligen Rauchern und Raucherinnen. Darüber hinaus wurden zum ersten Mal auch Smartphone-gestützte Entwöhnungsverfahren in die Leitlinie mit aufgenommen.
Effektiver Wirkmechanismus
Gemäß der aktualisierten S3Leitlinie soll Vareniclin eingesetzt werden, wenn eine medikamentöse Behandlung mit einer Nikotinersatztherapie (NET), wie z.B. Nikotinpflaster oder -kaugummi, nicht ausreichend wirksam ist. Grund für die starke Empfehlung von Vareniclin sind die guten Ergebnisse der EAGLES-Studie, die den effektiven dualen Wirkmechanismus von Vareniclin bestätigt. Dabei reduziert Vareniclin das mit dem Nikotinkonsum einhergehende Belohnungs- und Genussgefühl und verringert gleichzeitig die Freisetzung von Dopamin. Dies führt zu einem schwächeren Rauchverlangen und weniger starken Entzugssymptomen. In einer Metaanalyse von insgesamt 27 Studien wurde eine hohe Evidenz für die Wirksamkeit von Vareniclin im Vergleich zu Placebo festgestellt (RR: 2,24, 95%-KI: 2,06–2,43). In weiteren Studien und Auswertungen der Behandlungsarme war Vareniclin auch effektiver als Bupropion (RR: 1,39, 95%-KI: 1,25–1,54; 5 Studien; n>5.800) und als NET (RR: 1,25, 95%-KI: 1,14–1,37; 8 Studien; n>6.200). Zudem konnte bei Vareniclin, im Vergleich zu Placebo, kein erhöhtes Risiko für neuropsychiatrische Nebenwirkungen festgestellt werden.
Neu: Empfehlung für digitale Verfahren zur Tabakentwöhnung
Zusätzlich zu den etablierten Empfehlungen für verhaltenstherapeutische Interventionen plus medikamentöse Unterstützung spielen auch digitale Optionen – online bzw. durch Apps – eine wichtige Rolle. Hierdurch wird der Weg zu breiteren Zielgruppen geöffnet. Gerade die einkommensschwächeren abhängigen Raucher erhalten so Zugang zu niederschwelligen Unterstützungsangeboten. Aufgrund der weiten Verbreitung von Mobiltelefonen stellen diese Entwöhnungsverfahren eine günstige Rauchentwöhnungsoption für weniger motivierte Raucher dar. Zu den Smartphone-gestützten Verfahren zählen auch „Rauchfrei-Apps“. Da mobile Selbsthilfeprogramme, elektronisch oder neuerdings per App, eine sehr viel breitere Gruppe von Rauchern ansprechen, die sich für Gruppenprogramme nicht bereit finden würden oder diese nicht bezahlen können, sollten Ärzte auch diese Entwöhnungsmöglichkeiten in die Therapie integrieren.
E. W.