

Vorwort
Vorwort zum Ziel dieses Buches, zu seiner Gliederung, seiner Gestaltung und zur Quellenlage
Das vorliegende Werk erscheint zur Feier des 200-jährigen Jubiläums der maschinenbetriebenen Schifffahrt in der Schweiz und hat zum Ziel, den interessierten Leser auf eine Reise von West nach Ost (entsprechend etwa der Gliederung des klassischen Kursbuches) mitzunehmen und die Geschichte der Schifffahrt auf den einzelnen Gewässern sowohl fundiert als auch unterhaltend d arzustellen. Abschliessende Kapitel sind als Querschnittsinformationen zu verstehen; sie beleuchten Aspekte, welche alle Gegenden und alle Unternehmungen in etwa gleichermassen betreffen, so etwa hinsichtlich der Baufirmen der Schiffe, der Antriebstechniken, des Marketings oder des juristischen Umfelds.
Es werden im Wesentlichen jene 19 Unternehmungen historisch unter die Lupe genommen, welche heute im Verband der Schweizerischen Schifffahrtsunternehmungen (VSSU) vertreten sind. Daneben existieren weitere Anbieter, welche entweder nur Bedarfsverkehr (mit kantonaler Konzession) vermitteln (so etwa die Firma Bucher in Luzern) oder aber einen öV-Spezialfall darstellen, wie etwa die «Mouettes Genevoises», die beiden Unternehmungen im Jura oder die Schifffahrt auf dem Silsersee/GR. Allen «Outsidern» wird eine summarische Auflistung gewidmet. Diese 19 eidg. konzessionierten Schifffahrtsunternehmungen werden in je einem eigenen Kapitel von ihren Ursprüngen her bis zum heutigen Tage separat beleuchtet. Diese Darstellungen sind, weitgehend unabhängig von der Grösse der betreffenden Un-
ternehmung(en), in sich gliederungsmässig standardisiert, damit die Lesbarkeit und Quervergleiche erleichtert sind.
Die Texte richten sich an ein eher breites Publikum, bei den Schifffahrtsfreunden im engeren Sinne dürften vor allem die frühen historischen Entwicklungen ein paar «Aha-Effekte» auslösen. Selbstverständlich soll eine sorgfältig ausgesuchte, illustrative und teils auch exklusive Bebilderung die Texte ergänzen und erhellen. Es sind in diesem Sinne natürlich längst nicht alle Schiffe bildlich dargestellt; die Auswahl versucht, einigermassen repräsentativ zu sein.
Ausgangslage für die Texte bildet einerseits (vor allem für die ganz frühe Zeit) die Schrift «Pioniere der Dampfschifffahrt» des gleichen Autors, erschienen 2009 als Band 89 der Reihe «Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik» des Vereins für wirtschaftshistorische Studien, Zürich. Als «Grundtenor» und spezifisch zur Illustration der «Belle Époque» ist der 1907 erschienene Band «Schweizerische Dampfschiffahrt» der Kollektion «Die Industrielle und Kommerzielle Schweiz beim Eintritt ins XX. Jahrhundert» aus dem Polygraphischen Institut AG in Zürich nach wie vor ein ausgezeichneter Fundus. Ein weiterer inhaltlicher Ausgangspunkt von Bedeutung ist das Buch «Schiffahrt auf den Schweizer Seen» von Anton Räber, erschienen 1972 im Orell Füssli Verlag. Die Materialien für die ab diesem Zeitpunkt erschienenen diversen Publikationen des Teams Gwerder/Liechti/Meister waren für Präzisierungen und für die Fortschreibung in den letzten 50
Jahren natürlich ebenfalls eine grosse Hilfe. Aus der neueren Zeit bildet die schöne und übersichtliche Broschur «Schweizer Schifffahrt» aus dem Verlag Dampferzeitung (herausgegeben zum 100-jährigen Jubiläum des VVSSU, des Versicherungsverbandes der VSSU) viele Denkanstösse und Anregungen.
Bei der Bebilderung wurde auf möglichst nicht oder nur selten publiziertes Material geachtet, der Aussagewert geht der Bildqualität im Zweifelsfall vor. Die wunderbaren Modelle von Erich Liechti erlaubten es, die ersten Schiffe realitätsnah und plastisch darzustellen.
Der damals zweijährige Buchautor Jürg Meister im Juni 1944 mit seiner Mutter Rosa Meister-Winter in der Schadau beim Ausfluss des Thunersees in die Aare. Im Hintergrund DS Beatus, noch vor dem Umbau des Halbsalons.
 Basel, März 2023
Jürg Meister
Basel, März 2023
Jürg Meister
Dank
Dank nach aussen und innen
Das vorliegende Werk ist in Absprache und Koordination mit dem Verband Schweizerischer S chifffahrtsunternehmungen (VSSU) erarbeitet worden. Der Autor schuldet dem Geschäftsführer dieses nun auch 125 Jahre bestehenden Branchenverbandes, Herrn Stefan Schulthess (SGV), besten Dank für die Ermunterung.
Mit wertvollen Anregungen und wichtigen Hinweisen – und weit darüber hinaus – haben mich d ie Mitstreiter bei den beiden vorangegangenen und schwergewichtigen Werken zum Thuner- und Brienzersee und zum Vierwaldstättersee grossartig unterstützt, nämlich vorab Peter Gondolf und Bruno Schoog. Beide haben nicht nur wertvolles Bildmaterial beigesteuert, sondern auch inhaltlich immer wieder wesentliche Impulse gegeben: Bruno Schoogs stupende verkehrshistorische Kenntnisse haben an manchen Stellen dieses Buches erst so richtig «das Fleisch an den Knochen» gebracht. Peter Gondolf hat es zudem wieder übernommen, sich breit abgestützt um das Lektorat und akribisch um das Korrektorat zu kümmern: eine grosse Beruhigung! Beiden lieben Kollegen gebührt mein bester Dank.
Mit historischen Materialien, mit Bildern aus allen Epochen, mit Plänen und sehr viel Fachwissen haben mich überdies freundlich und grosszügig mit Wort und Tat unterstützt:
– A mstad Heinz, Zug
– Engemann Markus, Chanderbrügg
– Gavazzi Mario, Luzern
– Graf Markus, Prévérenges
– Gwerder Josef, Meggen
– Horlacher Robert, Hausen AG
– Hunziker Kurt, Luzern
– Jau Walter, Bern
K nöpfel Robert, Bonstetten ZH
– Liechti Erich, Wimmis
Mischler Ernst, Einigen
Reimann Lukas, Arth
– Zumstein Beat, Basel
Diesen Herren und allen weiteren Bildlieferanten mein grosser Dank.
Von institutioneller Seite sind ebenfalls mit herzlichem Dank zu erwähnen:
– Dampferzeitung, Luzern
– Schiffsammlung Erich Liechti (Stiftung/Verein), Hilterfingen
– Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, Basel
– Schweiz. Wirtschaftsarchiv, Basel
– Staatsarchiv, Basel
Einen ganz speziellen Dank richte ich an den Weber Verlag AG mit seiner souveränen Unternehmensleiterin Annette Weber, dem in jeder Hinsicht kompetenten und hilfreichen Projektleiter Samuel Krähenbühl und der sehr verständnisvollen Polygrafin Shana Hirschi.
Last but not least danke ich herzlich meiner Gattin Brigitte für ihre Geduld und für das so verständnisvolle wie effiziente Freihalten meines Rückens.
Die Schifffahrt im Binnenland Schweiz
Begründung, Entwicklung, Aufgabe und Bedeutung im Zeitraffer
Unser Land ist das mit vielen grösseren und kleineren Seen ergänzte und bestückte Quellgebiet grosser europäischer Ströme und damit eigentlich das Wasserschloss grosser Teile Europas. So kann es nicht verwundern, dass auf den zahlreichen Seen und den einigermassen schiffbaren Flüssen die Schifffahrt schon im vorindustriellen Zeitalter über Jahrhunderte hinweg eine Selbstverständlichkeit war. Lange bevor gute Strassen und lange bevor Eisenbahnen unser Land durchzogen, waren diese Gewässer geschätzte und auch vielbefahrene Verkehrswege, sei es im lokalen oder regionalen Bereich, sei es im Transitverkehr als Zufahrten etwa zum Gotthard, den Bündner Pässen oder dem Simplon. Am Südrand der Alpen erleichterten der Luganer- und der Langensee den Verkehr mit den cisalpinischen Gegenden, die später zu Italien zusammenwuchsen, und entlang des Jurasüdfusses konnte eine Wasserstrasse beträchtlicher Länge und Reichweite genutzt werden. Kraft zum Rudern oder Wind zum Segeln waren aber allemal gefordert.
Bei dieser etwas zur Nabelschau tendierenden Betrachtungsweise darf nicht vergessen werden, dass der Verkehr auf dem Wasser anderswo noch im vorindustrielen Zeitalter eine mindestens ebenso vitale Rolle spielte – und zwar noch viel mehr als in der politisch kleinteiligen und geographisch kleinräumigen Schweiz. Ein faszinierendes Kanalsystem wie etwa in Frankreich existierte nicht, ebenso wenig waren ganzjährig problemlos befahrbare grosse Ströme – Stichwort etwa Hudson oder Mississippi oder schon nur der Nieder-
rhein – vorhanden. Aber an solchen Gewässersystemen artikulierte sich das Bedürfnis nach einer Effizienzsteigerung zu allererst! Und diese kam – die Industriegeschichte lehrt es exemplarisch – mit der Nutzung der Dampfkraft, diese entdeckt und zur Betriebsreife weiterentwickelt von der damals führenden Industrienation Grossbritannien. Dass das erste brauchbare Dampfschiff überhaupt, das von Robert Fulton konzipierte «North River Boat» (später meist «Clermont» genannt) in Amerika zum Fahren kam, ist dem dort vorhandenen Pionier- oder auch Abenteuergeist zu verdanken.
Diese externen Faktoren waren es, welche die mechanisch betriebene Schifffahrt in die Schweiz hineintrugen; es war keine eigene innere Entwicklung, es war nicht einmal eine Kopie, es war zunächst nichts anderes als eine ausländische Innovation.
Am 18. Juni 1823 umjubelten und bestaunten riesige Menschenmassen um den Genfersee die erste Fahrt des ersten Dampfschiffes in unserem Land, des auf eine amerikanische Initiative und mit privaten Mitteln erbauten «Guillaume Tell».
Dieser machte Furore, Kritiker schwiegen bald und praktisch sofort gab es Nachahmer, in fast allen Fällen mutige und zukunftsgläubige Pionierfiguren und so wurde, hier vorerst summarisch dargestellt, die Dampfschifffahrt im hiesigen Perimeter eingeführt im Jahre
1823 wie erwähnt auf dem Genfersee
1826 auf dem Neuenburger- und Murtensee (mit Auswirkungen auf den Bielersee und die Aare bis Solothurn), aber im Süden auch auf dem Lago Maggiore
1835 auf dem Zürich- und dem Thunersee
1837 auf dem Vierwaldstätter- und dem Walensee
1839 auf dem Brienzersee
1848 auf dem Luganersee
1850 auf dem Untersee und Rhein
1852 auf dem Zugersee
1855 schweizerischerseits auf dem Bodensee
1887 auf dem Bielersee
1888 auf dem Hallwilersee
1890 auf dem Greifensee und dem Ägerisee
1925 auf dem Rhein im Raum Basel (nach Vorläuferaktionen vor dem Ersten Weltkrieg)
1932 als Autofähre auf dem Zürichsee
Das erste Kapitel der Dampfschifffahrt in unserem Lande wird deshalb mit Rücksicht auf die staunenswerten privaten Initiativen mit der Überschrift «Die Pioniere» aufgeschlagen.
Die Aufgabe und damit die volkswirtschaftliche Bedeutung der Schifffahrt auf hiesigen Gewässern machten seit ihrer Einführung in relativ kurzer Zeit grundlegende Wandlungen durch.
War das in der Regel durch interessante, ja abenteuerliche private Initiativen eingeführte Dampfschiff bis zum Erscheinen der Eisenbahn (1847 Zürich–Baden) das einzige wirkliche mechanisierte Massentransportmittel und die wesentlich schnellere Personenbeförderung als die Postkutsche, so fiel dieses (vom meist bald einmal aufgetretenen Konkurrenzdruck abgesehen) rentable Monopol mit dem rasanten Bahnbau ab etwa 1858 in ebenso raschen Schritten dahin – dies mit einem widersprüchlichen Doppeleffekt: ein massi-
ver übergeordneter Bedeutungsverlust und in nicht wenigen Fällen auch eine schiere Existenzbedrohung einerseits, exemplarisch etwa sichtbar am Zusammenbruch der zwischen Yverdon und Solothurn kurzzeitig blühenden Langstrecken-Dampfschifffahrt; auf der anderen Seite aber, etwa in Genf, Thun und Luzern, eine leistungsfähige Verbindung mit der «grossen weiten Welt». Ab diesen Bahnendpunkten kam das internationale Geschäft praktisch von einem Tag auf den anderen erst so richtig in Schwung.
Mit der liberalen Bundesverfassung von 1848 und dem ihr zu Grunde liegenden politisch eminenten Übergang vom Staatenbund zum Bundesstaat traten in vielen wirtschaftlichen Bereichen durchgreifende Änderungen ein. Die Niederlassungsfreiheit schuf schweizweit das, was wir heute Freizügigkeit nennen. Durch die einheitliche Währung des Frankens, durch die Abschaffung der Binnenzölle und die Vereinheitlichung von Massen und Gewichten und nicht zuletzt der Währung entstand erst der einheitliche Wirtschaftsraum Schweiz. Dieser wäre toter Buchstabe geblieben, hätte nicht ein leistungsfähiges Verkehrsnetz für Personen und Waren die Möglichkeiten geschaffen, diese modernen Grundsätze in die Praxis zu überführen. Die neue eidgenössische Post alleine war dazu nicht in der Lage, weil sie viel zu wenig leistungsfähig war. Diese Aufgabe konnten nur die neuen maschinengetriebenen Verkehrsmittel Schiff und Eisenbahn bewältigen. Schon bald kam es zu Verknüpfungen mit entsprechenden Verkehrswegen im Ausland, was bald zu einem fast lückenlosen Verkehrsnetz in Europa führte. Dieses wiederum war die Voraussetzung für den Aufschwung im Tourismus. Immerhin beschränkten sich die Bahnbauten zum Teil vorerst auf die Bedienung der Übergangspunkte zur Schifffahrt (etwa in Genf durch die französische
PLM, in Luzern und Thun durch die damalige Centralbahn), was sofort zu einer massiven Belebung des Schiffsverkehrs führte, zumal sich die Bahnen in jenem Zeitpunkt bereits in ganz Europa zu vernetzen begannen. Dies führte dazu, dass in stark vermehrtem Masse Reisende aus dem ganzen Kontinent und insb. auch aus Grossbritannien den Weg in die Schweiz fanden. Der von den Engländern ganz massiv geprägte erste «Alpinismus-Hype» in Form von Erstbesteigungen war marketingmässig ein weiterer wichtiger Treiber. Eine Reise in die Schweiz wurde für begütertere Kreise «fashionable». Deshalb ist dieses Kapitel mit «Die Eisenbahn kommt: Konkurrenz und erste Touristenströme» überschrieben. In dieser Zeit wurden die nach wie vor eher einfach bis rudimentär ausgestalteten Schiffe (alles nur Glattdecker ohne nennenswerte Aufbauten) vor allem technisch wesentlich besser, sicherer und schneller – der Komfort war aber vorerst noch nicht das zentrale Thema. Immerhin hat schon 1867 mit den Salondampfern «Humboldt» und «Friede» auf dem Mittelrhein eine Bauart Einzug gehalten, welche Signalwirkung haben sollte: Schon 1870 erschien mit DS «Oberland» auf dem Brienzersee der erste Salondampfer unseres Landes.
Nach dem Auf und Ab im Gefolge des DeutschFranzösischen Kriegs (1870/71) setzte zunächst kurzzeitig eine rasante Aufwärtsentwicklung der Schifffahrt ein, die zu vielen Schiffsneubauten führte Es war aber eine schnell vergehende Blase, an die sich eine Rezession anschloss, welche diesen Aufschwung für einige Jahre trübte, in denen so gut wie keine neuen Schiffe in Betrieb gesetzt wurden. Danach begann ein progressiv verlaufender wirtschaftlicher Aufschwung, unterstützt durch ein weiter perfektioniertes Verkehrswesen
auf der Schiene, welches die Mobilität der Menschen mehr und mehr vereinfachte, auch verbilligte und letztlich geradezu befeuerte. Die «Belle Époque» deutete sich an und kam in den letzten etwa 20 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zur vollen Blüte. Die bisher eher kleinen und mit wenig Komfort ausgestatten Schiffe in Glattdeck- oder Halbsalonbauart wichen mehr und mehr den eleganten und bestens, oft auch luxuriös ausgestatten Zweideck-Salondampfern, wie sie glücklicherweise (primär dank idealistischer Anstrengungen) teilweise auch heute noch vorhanden sind. Diese dienten zwar in jener Zeit mit ihrem hohen Anteil an Plätzen erster Klasse hauptsächlich einem stark gewachsenen Fremdenverkehr begüterter Kreise, aber doch auch schon dem einheimischen Bürgertum zum Sonntagsausflug, exemplarisch etwa an den Diensten der Zürcher «Helvetia» abzulesen.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in der Mitte der Sommersaison 1914 fand diese üppige Entwicklung ein jähes Ende – und zwar für lange Zeit. Es waren zunächst die unmittelbaren Folgen des Krieges, welche hin zu einem im Jahre 1918 fast totalen Zusammenbruch der Frequenzen führte, dann aber auch die sich in der Folge einstellenden sozialen Unruhen und wirtschaftlich insgesamt schwachen Zeiten. Einem gewissen Zwischenhoch (die «goldenen Zwanziger») folgte der Börsenkrach von 1929 und eine zehnjährige Krise mit verbreiteter Arbeitslosigkeit … und Aufrüstung links und rechts. Die Besserstellung einfacherer Kreise nach dem Landesstreik von 1919 brachte aber auch einen Lichtblick: Menschen, die zuvor die Mittel für eine Schifffahrt nicht gehabt hatten, waren nun an schönen Sonntagen und den Wochen der Sommerferien nun in der 2. Schiffsklasse zahlreich anzutreffen. Am 1. September 1939 brach aber der Zweite Weltkrieg mit allen seinen Folgen aus.
Das Kapitel über die Zeit von 1914 bis etwa 1946/47 heisst denn auch «Krieg – Krise – und wieder Krieg».
Entgegen düsterer Prognose stellte sich aber schon bald nach dem Krieg (nicht zuletzt befeuert vom sog. Marshall-Plan der Vereinigten Staaten) eine starke und solide Stärkung der Wirtschaft ein, die sozialen Verhältnisse wurden wesentlich besser, die Verdienste nahmen zu, es gab schnelle und massive Fortschritte in praktisch allen Lebensbereichen, das Leben begann – im Vergleich zu früheren Zeiten – auch für breite Bevölkerungskreise wesentlich leichter und bequemer zu werden. Rund 25 Jahre hielt dieser rasante Aufschwung. Ab den späten 1960er Jahren stieg die Teuerung an, was sich durch die zunehmende Dollarschwäche noch weiter akzentuierte. Aber erst der Yom Kippur-Krieg im Herbst 1973, dem die erste Ölkrise folgte (autofreie Sonntage) bremste diesen Boom aus. Diese Epoche wird gemeinhin als «Hochkonjunktur» bezeichnet. In dieser Phase wurden die Schiffe, vor allem an Sonntagen, geradezu gestürmt, es kam zu praktisch nie wieder erreichten Frequenzspitzen. Zum Schluss dieses Zeitabschnitts hatte der Sonntagsverkehr aber den Zenit bereits überschritten: Neue Freizeitgewohnheiten wie das damals immer weiter verbreitete Fernsehen setzten ihm ebenso zu wie der Sonntagsausflug per Individualverkehr.
Der wirtschaftliche Aufschwung jener Jahre ging mit einer starken Verlagerung zum Individualverkehr einher, das Automobil hatte seinen Siegeszug definitiv angetreten. Nur noch Wenige waren auf Schiffsverbindungen wirklich angewiesen, Schiff fahren wurde klar zum Freizeitvergnügen und dabei ist es
geblieben. In besonderem Masse von dieser Entwicklung betroffen wurde die tägliche Winterkursschifffahrt, soweit sie dem Pendlerverkehr diente.
Im Zeichen der herrschenden Fortschrittsgläubigkeit geriet das Dampfschiff in den Ruf, aus der Zeit gefallen zu sein, was für einige Veteranen da und dort durchaus zutreffend war. Von Kriegsende bis und mit 1971 wurden so 30 Dampfer ausser Dienst genommen, vier wurden zu Dieselelektrischen Radschiffen umgebaut. Im Gegenzug erschienen im gleichen Zeitraum rund 50 moderne Motorschiffe verschiedenster Grössenklasse, geliefert oft von der Bodan-Werft in Kressbronn am Bodensee, später auch von der Schiffswerft Linz an der Donau. Am Vierwaldstättersee perfektionierte die DGV/SGV erfolgreich den Schiffsbau in eigener Regie.
Ohne dass es zu eigentlichen Rückschlägen gekommen wäre, verflachte die Entwicklung in den nachfolgenden Jahren. Schiffe wurden nur noch in Einzelfällen ausser Dienst genommen und das Dampfschiff erlebte, ausgehend von den Protesten im Gefolge der Ausserdienststellung des DS «Wilhelm Tell» II auf dem Vierwaldstättersee, im ganzen Land eine mit viel Herzblut und Spendengeld getragene Renaissance. Motorschiffe wurden in bescheidenerem Rhythmus durchaus weitergebaut, wobei damit in vielen Fällen neu entstandenen oder sich aus der allgemeinen Gesellschaftsentwicklung ergebenden Bedürfnissen Rechnung getragen wurde und wird. So hat sich der auf Sparflamme lange vorbestehende und mit eher bescheidenem Aufwand vorgehaltene Wunsch zur Verpflegung auf dem Schiff Quantensprünge erlebt – das Stichwort «Schiffsgastronomie» legt beredtes Zeugnis davon ab. Festlichkeiten auf Schiffen hat es immer etwa wieder gegeben, aber
«Events» sind mehr als nur ein Anglizismus geworden: nämlich ein Geschäftsmodell. Themenfahrten, eine Kombination aus Gastronomie und Event, gibt es praktisch überall. Kursmässige Winterfahrten trugen noch lange das Etikett einer gerade noch für die allerwichtigsten Notwendigkeiten vorgehaltenen und dabei unrentablen Nische –heute sind sie mancherorts sehr beliebt und nicht mehr wegzudenken.
Diese «Wohlfühlschifffahrt» mit dichtem Fahrplan und diversesten Zusatzangeboten auf schönen und teilweise massgeschneiderten Schiffen hat ab 2020 durch die Corona-Pandemie (insb. bei den Gästen aus Übersee) einen herben Rückschlag erlitten. Eine Erholung ist zwar absehbar, aber im besten Fall wird erst das Jubiläumsjahr 2023 wieder einigermassen den Verhältnissen von 2019 entsprechen.
Soweit das Heute. Und das Morgen?
Das Reservoir potentieller Fahrgäste ist im Inland nur schwer und mit viel Marketingaufwand zu ver-
DIE POST hat (auf die Initiative eines engagierten Schifffahrtsfreundes hin) das Jubiläum von 200 Jahren Dampfschifffahrt in der Schweiz einer originellen Sondermarke im Sonderformat würdig befunden – und dies erst noch für die meistverwendete Frankatur.

grössern und im internationalen Sektor erscheinen die Verhältnisse so instabil wie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Diese weltpolitischen Unsicherheiten schlagen sich in den Energiepreisen nieder und gleichzeitig werden die Ansprüche der Bediensteten nicht weniger und nebenbei die Sicherheitsanforderungen immer perfektionierter. Geht die Rechnung auf? Ist die Zahlungsbereitschaft intakt?
Auch bei allenfalls etwas ruhigeren äusseren Bedingungen wird die Frage der Umweltverträglichkeit der Schifffahrt die nächsten Jahre mitprägen. Der gesellschaftliche Druck auf eine Transformation wird zunehmen.
Alles Fragen und Herausforderungen.
Hinweise und Vorbemerkungen zur Gliederung dieses Buches, zu den Illustrationen und Tabellen
Dieses Werk hat vor allem den Anspruch, die Vielseitigkeit und den Facettenreichtum der hiesigen Schifffahrt in den vergangenen 200 Jahren und in der Gegenwart in Wort, Bild und Zahlen im Sinne einer bunten Palette zu zeigen. Mit diesem Ziel verbunden ist aber gleichzeitig das Gebot einer gewissen Stringenz durch eine möglichst repräsentative Auswahl und Gestaltung von Bild-, Text- und Tabellenmaterial, denn eine erschöpfende, katalogartige Darstellung würde den Rahmen dieses Werkes bei weitem sprengen und wohl geradezu enzyklopädische Masse annehmen. Verlag und Autor verweisen deshalb für ergänzende Information gerne auf die spezifische Literatur, auf welche im Quellenverzeichnis hingewiesen wird.
Die Gliederung des Buches folgt im Sinne der klassischen Disposition des angestammten amtlichen Kursbuches von West nach Ost (mit «Seitensprüngen») den aktuellen Mitgliedern des Verbandes Schweizerischer Schifffahrtsunternehmungen. Innerhalb dieser Unternehmungen gilt, wo sinnfällig, eine Standarddarstellung, welche folgende (grosszügig abgegrenzten und praktischen Kriterien geschuldeten) Zeitabschnitte/Epochen umfasst:
– Die Pionierphase (ab 1823 bis etwa 1850)
– Die Eisenbahn kommt: Konkurrenz und erste Touristenströme (ab etwa 1850 bis rund 1890)
– La Belle Époque (ab etwa 1890 bis 1914)
– Krieg – Krise – Krieg (ab Erstem Weltkrieg bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg)
– Hochkonjunktur (ab etwa 1948 bis Ende Jahrhundert)
– Heute und morgen (ab 2000)
Dazu finden Sie je einen Grundtext und eine adäquate Anzahl von Bildern mit ergänzenden Legenden. Als Schluss jeder der 19 Darstellungen mit in der Regel je sechs Unterkapiteln folgt eine Tabelle im Sinne einer Schiffsliste. Bei einigen kleineren Gewässern, wo die Schifffahrt erst relativ spät in Erscheinung trat, ist diese Gliederung sinngemäss verkürzt.
Die Bilder/Illustrationen sind mit dem Anspruch ausgesucht worden, sowohl den jeweiligen «Geist der Zeit» atmen zu lassen, als auch eine repräsentative, Vorstellung der epochetypischen Schiffe mit wenig oder gar nicht bekannten, raren Dokumenten zu vermitteln. Es handelt sich somit um eine bewusste, oft mehr- oder vieldeutige Auswahl. Mit den zugehörigen Legenden wird versucht, den Informationsgehalt zu vertiefen.
Der Autor hat dem Verlag gegenüber das Manuskript als frei von Drittrechten erklärt; sollte sich jemand in seinen Ansprüchen verletzt fühlen, stehe ich persönlich für die Bereinigung zur Verfügung. Der Verlag ist in einem solchen Fall berechtigt, meine E-Mail-Adresse bekannt zu geben. Die tabellarischen Zusammenstellungen sind nach bestem Wissen recherchiert und aktualisiert worden. Sie sind aber im Vergleich zu spezifischeren Publikationen zwar in der Anzahl der Schiffe einigermassen vollständig, vermitteln aber nur die allerwichtigsten Daten und Fakten. Da Schiffe in der Regel langlebig sind und oftmals eine ganze Reihe von Generalrevisionen und Umbauten über sich ergehen lassen durften, ergäbe sich eine ausserordentlich verästelte und schwer lesbare Kompilation.
Im Sinne einer gewissen Stringenz sind die Schiffe deshalb in der Regel mit ihren Daten und Fakten nur im Ursprungs- und/oder Schlusszustand vermerkt. Nur wirklich tiefgreifende zwischenzeitliche Änderungen werden angegeben. Wer Interesse an tiefer dargestelltem Datenmaterial hat, sei erneut auf das Quellenverzeichnis verwiesen. Was an dieser Stelle zum Verständnis dieser vereinfachten Tabellen aber doch noch gesagt werden muss: Gewisse Daten sind schlecht vergleichbar! So wurden bspw. auf dem Genfersee den Schiffen früher im Quervergleich eine recht hohe Tragkraft zugebilligt – wogegen heute die freigegebene Anzahl an Passagieren zufolge insb. französischer Vorschriften (und mit einem Seitenblick auf den Komfort) als Kontrast deutlich tiefer ist als anderswo.
Die Angaben zum Déplacement verweisen meistens auf den End- bzw. den heutigen Zustand.
Bei den Abmessungen ist zu beachten, dass bis etwa 1990 die Schiffe in den einschlägigen Unterlagen (fast) konsequent mit ihrer Länge in der Wasserlinie und der Breite im Hauptstand festge-
Von Schiffen vor der Epoche der Fotografie sind nur künstlerische Erzeugnisse verschiedenster Technik erhalten, etwa Kupferstiche, Radierungen, Aquatinten etc. Sie sind zwar oft in bestimmten Aspekten ausgesprochen detailgetreu, in den Gesamtproportionen jedoch vielfach in irgendeiner Hinsicht unzuverlässig. Recht oft wurden die Schiffe bspw. mit stark verkleinerten Fahrgästen bestückt, um sie so deutlich grösser erscheinen zu lassen. Auf verlässlich überlieferten Daten und Fakten basierende Modelle vermitteln hingegen ein sehr plastisches Bild der damaligen Realitäten.

Modell E. Liechti, Foto L. Däppen
halten wurden. In neuerer Zeit werden fast überall die Länge über alles und die Breite über alles veröffenlicht: Die Schiffe wirken dadurch «grösser», was Marketinggründe haben mag.
Bei der Betriebszeit werden das erste und letzte Betriebsjahr festgehalten, ein Abbruch konnte unter Umständen Jahre später erfolgen.
Zur besseren Lesbarkeit der Tabellen werden diverse Abkürzungen verwendet, siehe Verzeichnis.
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis der Bau- und sonstigen Lieferfirmen
AS Adolph Saurer AG, Arbon
Bodan Bodan-Werft GmbH, Kressbronn (DE)
Brent Daniel Brent & Sons, Rotherhithe (Bereich London, GB)
BS Breuning & Söhne, Hamburg-Wilhelmsburg (DE)
Buss Buss AG, Stahl- und Maschinenbau, Pratteln. Werftgelände in Kaiseraugst.
BW Bodan-Werft GmH, Kressbronn (DE)
Cavé Etablissement Mécanique François Cavé, Paris (Faubourg St-Denis)
CAT Caterpillar Inc. (USA)
CoNaVi Cantiere Conavi, Viareggio
D & M Ditchburn & Mare, Blackwell (Bereich London, GB)
DW Deggendorfer Werft und Eisenbau GmbH
EWZ (auch EWC): Escher Wyss & Cie, Zürich
Fairbairn William Fairbairn & Sons, Manchester (GB)
Fawcett Fawcett, Preston Engineering Co. Ltd., Liverpool (GB)
GHH Gutehoffnungshütte, Walsum (DE)
Herbosch Eugène Herbosch, Antwerpen (B)
HL Schiffswerft J. G. Hitzler, Lauenburg an der Elbe (DE)
Holtz Schlosswerft Holtz, Hamburg-Harburg (DE)
JHH Jacobi, Haniel & Huyssen, Ruhrort (DE)
JP John Penn & Sons, Greenwich (GB)
JSH Janssen & Schmilinsky AG, HamburgSteinwerder (DE)
Linz ÖSWAG, Schiffswerft Linz (AT)
Sulzer Gebrüder Sulzer AG, Winterthur
Lux Lux-Werft, Mondorf (DE)
M & R Miller & Ravenhill, Blackwall (Bereich London, GB)
MSW Meidericher Schiffswerft, Duisburg (DE)
N&M Napier & Miller, Glasgow (GB)
NAM Norddeutsche Automobil- und Motoren AG, Bremen (DE)
ÖSWAG Werft- und Maschinenbau GmbH, Linz (AT)
Penn John Penn & Sons, Greenwich (GB)
R & R Robinson & Russell, London
Roentgen Gerhard Moritz Roentgen, Lekkerland (NL)
Ruthof Christof Ruthof, Schiffswerft, MainzKastel (DE)
SA Gebr. Sachsenberg AG, Rosslau an der Elbe (DE)
Schneider Schneider & Cie, Le Creusot (F)
Sc Scott’s Shipbuilding & Engineering Company, Greenock (GB)
TH Theodor Hitzler, Werftbetrieb, HamburgVeddel (DE)
Th John I. Thornycroft, Southampton und Woolston (GB)
V & G Vogt-Gut AG, Arbon
Abkürzungsverzeichnis zu den Texten und Tabellen
a. D. ausser Dienst
BAV Bundesamt für Verkehr (früher EAV, Eidg. Amt für Verkehr)
BB Backbord (linke Schiffsseite in Fahrrichtung)
BLS Seit 2006 öV-Konzern mit Sitz Bern, vorher Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–Lötschberg–Simplon oder kurz Bern–Lötschberg–Simplon-Bahn
DS Dampfschiff
Hsp Hauptspant (Breite auf Deck in der Schiffsmitte)
kW Kilowatt (Leistungseinheit, heute üblich anstelle von PS)
MS Motorschiff
NOB Schweizerische Nordostbahn
PSi Indizierte Pferdestärke (Zylinderleistung) bei Dampfschiffen
PS nom Nominelle Pferdestärke, früheres Mass, entsprechend rund 4 PSi
SB Steuerbord (rechte Schiffsseite)
SBB Schweizerische Bundesbahnen
SrDS Schraubendampfer
VHS Verkehrshaus der Schweiz, Luzern
VR Verwaltungsrat
WL Wasserlinie
Übersicht



Genfersee Lac Léman

Die Pionierphase
Genf ist im Laufe der Zeit zu einer betont internationalen Stadt geworden. Internationalität hat jedoch bereits in den 1820er Jahren, bei den Anfängen der Dampfschifffahrt auf dem Genfersee, eine Rolle gespielt. DampfschifffahrtPionier war hier nämlich ein in Frankreich für die USA akkreditierter, auf den Azoren geborener Amerikaner, nämlich Edward Church (1769–1847).
Church wurde im Jahre 1769 in Fayal auf den Azoren als Sohn amerikanischer Bürger englischer Abstammung geboren. Im Jahre 1790 ernannte ihn George Washington persönlich zum amerikanischen Honorarkonsul in Bordeaux. Zugleich war Church Geschäftsmann. Aus württembergischen Quellen wissen wir, dass er dabei sehr erfolgreich war, die Dampfschifffahrt auf der Garonne bei Bordeaux zu etablieren. In der Quelle wird dies besonders herausgehoben, weil viele andere Versuche, die Schifffahrt in Frankreich einzuführen, gescheitert waren.
Zeitweise hielt sich Church in Paris auf. Dort machte er auch die Bekanntschaft mit Robert Fulton, dem Dampfschiff-Pionier schlechthin.
Bei seinem Besuch in Genf im Jahre 1822 war Church höchst erstaunt, ja entsetzt, dass auf dem Genfersee noch kein Dampfschiff verkehrte. Am 15. Dezember 1822 liess er die lokalen Zeitungen wissen, dass er mit einem «sentiment de surprise» festgestellt habe, dass hier «par une bizarrerie inconcevable» die Segnungen der Dampfschifffahrt noch nicht Fuss gefasst hätten, «tandis que plus de cinq cents de ces bateaux répandent la grande découverte de Fulton dans toutes les parties du monde».
Gepackt von Ehrgeiz und Pioniergeist beschloss Church, diesem Übelstand auf eigene Verantwortung und eigene Kosten entgegenzutreten. Er war offenbar ein sehr vermögender Mann, der es sich leisten konnte, das Risiko eines so wagemutigen Unternehmens alleine in die Wege zu leiten. Ein Dampfschiff war so teuer, dass es sich nur wenige Einzelpersonen leisten konnten, und ein Erfolg war keineswegs garantiert. Church trat mit der ihm offensichtlich aus den früheren Jahren in Bordeaux bekannten Firma Mauriac
Der Initiant und Investor für das erste Dampfschiff in der Schweiz: Edward Church und seine Familie. Alters- und Familiensituation deuten darauf hin, dass das Gemälde etwas vor seiner Genfer Zeit in Paris entstanden ist. Es befindet sich im Besitz seiner Nachfahren in Atlanta/USA. Sammlung E.
 Liechti
Liechti
Père & Fils in Verbindung und bestellte dort ein hölzernes Schiff. Die Antriebsanlage gab er in England, wahrscheinlich bei Boulton & Watt, in Auftrag. Bis dahin war die Schifffahrt auf dem Genfersee, wie auf allen Alpenrandseen, traditionell von den Zünften geregelt. Es ist zu vermuten, dass hier der Grund dafür liegt, dass das Dampfschiff sich auf den Personentransport beschränkte. So konnten die Ruder- und Segelschiffzünfte ihr Kerngeschäft des Gütertransports behalten und waren von dem Dampfschiff weniger tangiert. Der für
damalige Verhältnisse stark anwachsende Personenverkehr war in diesen Dimensionen neu und damit in der Vergangenheit ohnehin nicht ihr Kerngeschäft gewesen. Die Zeit der Restauration und damit die Abkehr von Errungenschaften der napoleonischen Zeit hatte viele wirtschaftliche Freiheiten nicht mehr zurückdrängen können. Handel und Wandel prägten diese Zeit der frühen Unternehmer. Damit einher ging ein grosses Bedürfnis nach verstärkter Mobilität für Personen, die durch das neue Schiff abgedeckt wurde.
Die Attraktion eines solchen «primeur» liess sich die Regierung nicht entgehen und verfügte nur wenige Auflagen. Um neben den Behörden auch das Publikum für sich zu gewinnen, hatte Edward Church kurz vor Weihnachten 1822 die oben zitierten Überlegungen den lokalen Zeitungen zugehen lassen: eine frühe Form des «Pressecommuniqués». Die ganze Angelegenheit nahm Church so in Anspruch, dass er vom 7. Februar 1823 bis zum 23. August 1824 offiziell Wohnsitz an der Rue des Paquis in Genf nahm.
Die Bauarbeiten auf einem improvisierten Werftplatz in Genf Eaux-Vives (ziemlich genau gegenüber der genannten Rue des Paquis, also am linken Ufer) schritten zügig voran, und auch die Maschinen- und Kessellieferung aus England erfolgte pünktlich. Am 28. Mai 1823 lief das auf den Namen «Guillaume Tell» getaufte Schiff unter grossem Jubel der äusserst zahlreichen Zuschauer von Stapel. Das Echo in der Region war enorm, und auch die sonst gegenüber Ereignissen im Welschland eher zurückhaltende Deutschschweiz nahm staunend und erfreut davon Kenntnis. Das erste Dampfschiff der Schweiz war aus heutiger Sicht mit seinen 75 Fuss (etwa 22 m) Kiellänge ein wirklich sehr kleines Schiff. Die meisten frühen Darstellungen verleiten zu Fehlschlüssen: Die Fahrgäste erscheinen als

Modell des ersten Genferseedampfers «Guillaume Tell» I, dessen Jungfernfahrt genau 200 Jahre vor Erscheinen dieser Publikation stattgefunden hat. Modelle gerade von sehr frühen Schiffen, von denen noch keine Fotografien gemacht werden konnten, geben ein plastischeres und präziseres Bild dieser Schiffe, die man sonst nur von künstlerisch geprägten Kupferstichen, Aquatinten und dergleichen kennt. Ein Charakteristikum des ersten Dampfschiffes auf Schweizer Gewässern waren die flachen Baldachine an Stelle der bald aufkommenden und besser geeigneten Zelte. Modell E. Liechti,
 Foto L. Däppen
Foto L. Däppen
bewusst klein gehaltene Gestalten auf einem grossen Schiff. Wahrscheinlich sollte damit eher die marktmässige Bedeutung der neuen Verkehrsmittel als die wahren Proportionen herausgehoben werden.
Am 18. Juni 1823 erfolgte die rund um den See enthusiastisch gefeierte Jungfernfahrt – im Raum Lausanne war die Begeisterung wahrscheinlich begleitet von einer Prise Neid. Die Maschinenleistung betrug 12 nominelle Pferdestärken oder knapp 50 indizierte PS, von denen nach Abzug aller Nebenantriebe und inneren Verluste noch etwa zwei Drittel an der Welle verblieben. Die einzylindrige Dampfmaschine der «Guillaume Tell» war also verglichen mit späteren Anlagen wenig leistungsfähig und lebte auch stärker vom Vakuumeffekt hinter dem Kolben als von der Dampfexpansion selbst. Einer Höchstgeschwindigkeit des Schiffes von immerhin 13 km/h stand das aber nicht im Weg. Die planmässigen Fahrten der «Guillaume Tell» liefen täglich Ouchy an und kehrten, am Schweizer Ufer entlang, mit Zwischenhalten in Morges, Rolle, Nyon und Coppet nach Genf zurück. Sonntags und montags wurden die Fahrten mit einer Zusatzrunde in den oberen Seeteil ergänzt.
Der Preis für die einfache Fahrt nach Lausanne in der zweiten Klasse, die sich im Bugteil des Bootes befand, entsprach übrigens genau dem Postkutschen-Tarif der «Regie des Postes du Canton de Vaud» für die gleiche Strecke; auch die Fahrt dauerte ähnlich lang. Das Schiff war durchaus in der Lage, die Strecke Genf–Lausanne in Direktfahrt in vier Stunden zurückzulegen. Im täglichen Betrieb mit Zwischenhalten war aber eine Fahrzeit von sechs Stunden die Regel. Nicht nur wenn die Bise steif von Nordosten blies, wie oft am Léman, traten Zeitverluste ein. Die Passagiere wurden –und dies sollte auf allen Schweizer Seen bis etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Regel bleiben – in Beibooten ans Land bzw. zum Einschiffen gerudert.
Trotz der hohen Preise war der Ansturm enorm, und die Gesellschaft florierte, kurzzeitig wenigstens. Die bald einmal auf den Plan tretende Konkurrenz führte
dann rasch zu einem wesentlich tieferen Tarifniveau. Der erste Konkurrent der «Guillaume Tell» war die Entreprise du Winkelried, die sich bereits im August 1823 konstituierte und im Folgejahr mit der «Winkelried» I einen noch grösseren Dampfer in Betrieb setzte.
Im Spätsommer 1824, auf der Höhe des Erfolges seines Schiffes, verkaufte Church sein Unternehmen an eine Gesellschaft mit 17 Teilhabern, die gleich im ersten Geschäftsjahr eine Dividende von sagenhaften 18 % einstrichen. Die Höhe der Dividende ist andererseits aber auch ein Spiegelbild des hohen Risikos, dass die Anteilseigner mit so einem noch weitgehend unerprobten Verkehrsmittel eingingen. Church kehrte zunächst nach Paris zurück. Er befasste sich aber weiter intensiv mit der Dampfschifffahrt: So half er mit, den ersten Bodenseedampfer «Wilhelm» zu realisieren. Gleichzeitig war Church aber auch beim Bau des ersten bayrischen Dampfschiffes, der «Max Joseph», als Berater tätig. Kurz darauf reiste er in den Raum Como, wo er 1826 an der Realisierung der Dampfschiffe «Lario» und «Plinio» mitbeteiligt war. Leider ist das weitere Leben und Wirken von Edward Church nicht gut dokumentiert. Im Jahre 1847 soll er in Kentucky verstorben sein.
Das erste Dampfschiff der Schweiz, letztlich nichts anderes als eine amerikanische Investition, erhielt –im erst 1815 der Eidgenossenschaft beigetretenen Kanton Genf – den Namen «Guillaume Tell»; das zweite Schiff wurde «Winkelried» getauft: Patriotismus «à la Genevoise»!
Die Pionierleistung von Church erfüllte zunächst alle Erwartungen und hat sich technisch bewährt. Im Jahre 1831 – jetzt verkehrten bereits drei Dampfer auf dem Genfersee – diskutierten militärische Stellen auch die Kriegstauglichkeit dieser Schiffe. Ein Ergebnis ihrer Überlegungen war: Die «Guillaume Tell» ist zwar relativ klein und langsam, die Verwendbarkeit als Kriegsschiff steht jedoch ausser Zweifel. Abgesehen von dieser aus heutiger Sicht eher etwas seltsam wirkenden Episode ist die «Guillaume Tell» aber schnell vom Fortschritt und auch von der Konkurrenz eingeholt worden. 1836,
Der ebenfalls noch ganz aus Holz gezimmerte «Winkelried» I war die Antwort der Konkurrenz: Deutlich grösser, etwas schneller, das waren die zugkräftigen Argumente. Die Fahrgäste sind hier nicht, wie sonst in dieser Periode üblich, besonders klein gezeichnet, um das Schiff grösser erscheinen zu lassen. Die Proportionen sind insgesamt recht gut getroffen. Aus: BateauxàVapeurduLéman,Editions de Fontainemore, Paudex; vgl. Quellenverzeichnis
als nur noch eiserne, grössere und viel schnellere Dampfschiffe im Einsatz waren, wurde sie aus dem Verkehr gezogen und abgewrackt. Die von Church initiierte Gesellschaft fusionierte bald einmal mit der Entreprise du Winkelried zur Compagnie genevoise des bateaux à vapeur réunis, die ihrerseits durch eine lange Reihe von weiteren Kooperationen, Zusammenschlüssen, Fusionen und Nachfolgegesellschaften letztlich in die 1873 gegründete und noch heute bestehende Compagnie Générale de Navigation (CGN) mündete.
Die genferische Premiere des Jahres 1823 war im Nachbarkanton Waadt, insbesondere in Lausanne, wohl eher säuerlich-süss aufgenommen worden. Die Rivalität der beiden Kantone und Städte hatte Tradition. Man wollte nicht nur mit Genf gleichziehen – nein, ein Schiff mit dem Heimathafen Ouchy sollte grösser, schneller und komfortabler werden und in jeder Hinsicht dominieren. In Genf war Edward Church als herausragende und finanziell engagierte Persönlichkeit am Werk, während sich die Dinge in Lausanne «demokratischer» abspielten. Eine Gruppe Bürger war fest entschlossen, «es den Genfern zu zeigen» und bildete von Anfang an eine Aktiengesellschaft, wobei Sigis-
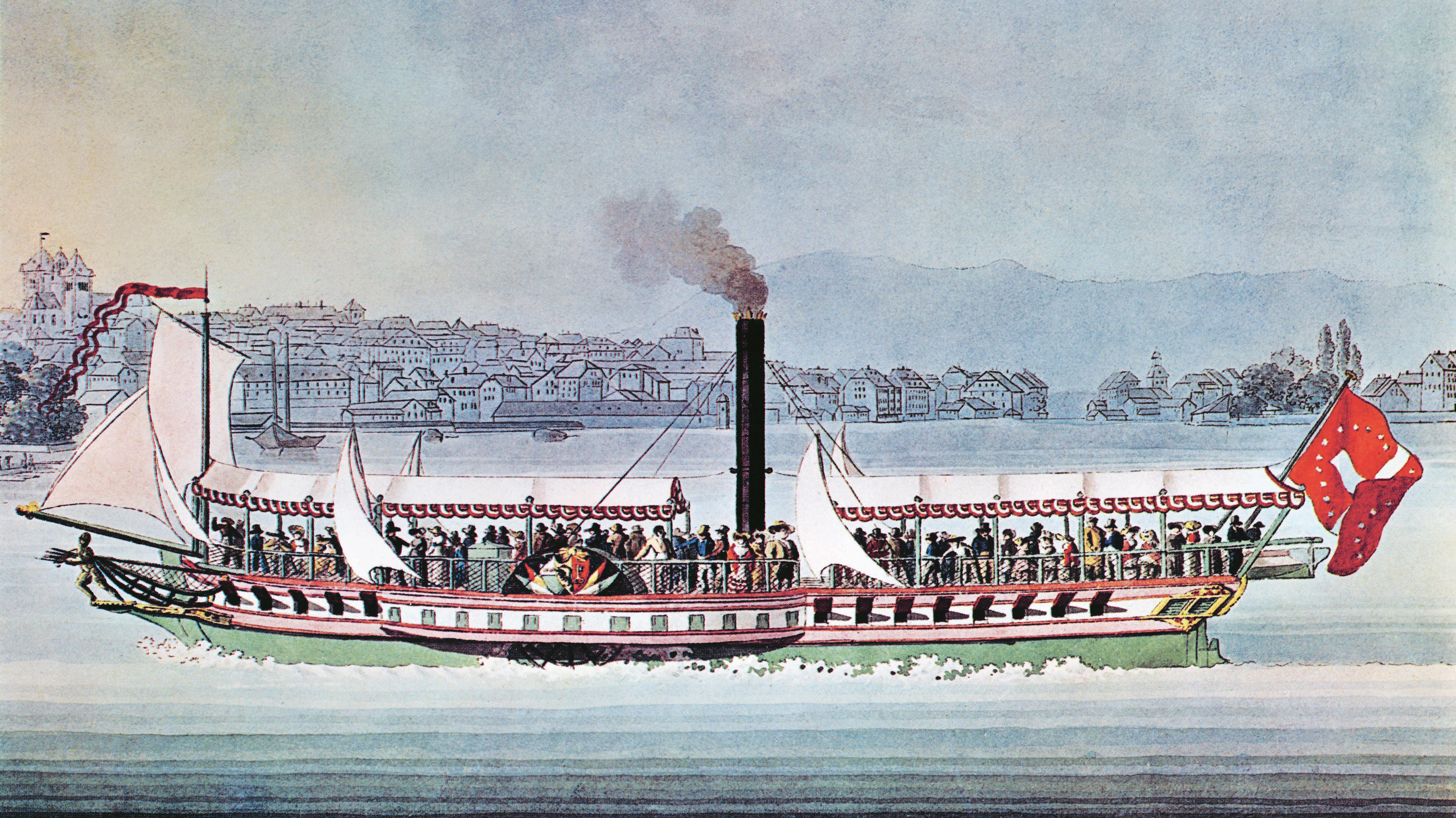
mond de la Harpe als Gründungspräsident die führende Rolle übernahm.
Der Waadtländer de la Harpe (geb. am 25. Mai 1780 in Colombier/VD, gestorben am 17. Mai 1858 in Lausanne) war eine Persönlichkeit, welche nicht nur für die Schifffahrt tätig und wirksam war. Auf Grund seiner Lebensdaten kann mit einiger Sicherheit angenommen werden, dass die Initiative zum Bau eines Dampfschiffes unter der weiss-grünen Flagge im Leben de la Harpes wohl nur eine Episode war. De la Harpe war nämlich vor allem Offizier und Staatsmann. Von 1824 bis 1830 hatte er die Würde eines Abgeordneten an der Eidgenössischen Tagsatzung inne. Während der politischmilitärischen Wirren im Baselbiet um 1832 war de la Harpe Eidgenössischer Kommissär vor Ort.
Zurück zur Schifffahrt: Das im Gründungsprospekt vom 1. November 1824 (also ein gutes Jahr nach der Inbetriebnahme des genferischen Schiffes) mit 120 000 damaligen «Francs de Suisse» vorgesehene Aktienkapital wurde in patriotischem Eifer und im Glauben an den Fortschritt sofort und stark überzeichnet: Es kamen 168 000 Francs zusammen. Damit glaubte man die
Feste Stationen, Schiffländen und Brücken gab es anfänglich nur ganz wenige: Ein- und ausgeschifft wurde über sog. Stationskähne, ein keineswegs ungefährliches Unterfangen. Hier mit DS «Winkelried» I sicherlich künstlerisch etwas überhöht dargestellt, aber ein Vergnügen war das ganz bestimmt nicht immer.
Die «Helvétie» aus dem Hause Ditchburn & Mare in London war das damals (1841) grösste Dampfschiff in der Schweiz. Es war mit einer leistungsfähigen, oszillierenden Niederdruck-Zwillingsmaschine ausgerüstet, damals ein bestauntes Novum. Diese sehr frühe Aufnahme um 1855 zeigt das Schiff in seinem Ursprungszustand. Der in der Folge mehrfach umgebaute und modernisierte Dampfer war trotz seiner Bauart als Glattdecker immer sehr beliebt, seine Stabilität war legendär. Im Verlaufe des Ersten Weltkrieges musste er verschrottet werden.


finanzielle Basis zu haben, die «Guillaume Tell» und auch die nachgefolgte Konkurrenz, die «Winkelried», in jeder Hinsicht deutlich übertrumpfen zu können. Allerdings geriet der Ehrgeiz bald zur Verblendung: Für den Bau des 36,9 m langen, 60 PS starken und 17,5 km/h schnellen hölzernen Dampfers in England mussten zusätzlich zum vorhandenen Aktienkapital Darlehen aufgenommen werden. Wie dem auch sei, das gegenüber der «Guillaume Tell» ganz wesentlich grösser dimensionierte, aber ebenfalls noch hölzerne Schiff war in England, bei der Firma Brent in Rotherhithe (im Osten von London) in Auftrag gegeben worden, die Maschine wurde bei Boulton & Watt in Birmingham hergestellt und der Kessel vermutlich von Maudslay in London.
Das Schiff wurde in Ouchy, südlich des Schlosses, von englischen Facharbeitern zusammengebaut und lief unter grossem Jubel und in lokalpatriotischer Hochstimmung am 15. Juli 1826 als «Léman» I von Stapel. Die mittlerweile drei genferischen Schiffe waren, alle vollbesetzt, Zeugen des spektakulären Vorgangs. Am 27. Juli nahm die «Léman» den regelmässigen Verkehr auf, selbstverständlich von Ouchy nach Genf und zurück.

Die Genfer bestaunten das neue Schiff ausgiebig – es fehlte aber auch nicht an einigen Seitenhieben. Gut zehn Jahre lang sollte dieses Schiff die von den Initianten gewünschte Dominanz auf dem See durchhalten können, bis dann die genferische «Aigle» 1837 das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen liess.
Die Konkurrenz der zwei ursprünglichen Gesellschaften in Genf bekam ihnen letztlich nicht gut. Sie schlossen sich daher 1829 zu einer Betriebsgemeinschaft zusammen und fusionierten. 1837 ersetzten sie die «Guillaume Tell» durch die neue «Aigle», ein Schiffs-
Die Antwort aus Lausanne auf die beiden Genfer Initiativen liess nicht lange auf sich warten: DS «Léman» I präsentiert sich in Genf.
Notre Histoire, Sammlung J. Meister
name, der nun für fast hundert Jahre die Schifffahrt auf dem Léman prägen sollte. Es war das letzte für den Genfersee gebaute Schiff mit Holzschale. Das von der englischen Werft Miller & Ravenhill gebaute Schiff war mit 20 km/h deutlich schneller als die «Guillaume Tell».
Damit geriet der Lausanner «Léman» stark ins Hintertreffen. Unter Verwendung von Teilen dieses Schiffes entstand ein neuer «Léman», das erste Schiff des Sees mit eiserner Schale, das zudem eine Dampfmaschine mit ½ atü Betriebsdruck erhielt, doppelt so stark wie der Vorgänger, und nun ebenfalls mit 20 km/h verkehren konnte.
Am bemerkenswertesten aber war das Schiff der neuen Compagnie de l’Helvétie, welches auch ihren Namen trug und 1841 in Verkehr kam. Dieses ausgezeichnete Schiff war von der englischen Werft Ditchburn & Mare erbaut worden. Es war das erste Schiff der Schweiz mit einem sog. Schottenkessel (vereinfacht: zylindrische Form mit Feuerrohr und rückkehrenden Rauchrohren). Dieser erzeugte genug Dampf für ein Schiff mit der hohen Tragkraft von 1000 Personen als auch für eine Geschwindigkeit von 23 km/h. Es entstand in einer Zeit, in der die Schiffe normalerweise wegen des damals rasanten technischen Fortschritts schnell veralteten. Umso bemerkenswerter ist es, dass dieses Schiff (mehrfach umgebaut) bis 1918 in der Flotte verblieb.
Diese Neuheit wiederum setzte die Betreiber des «Aigle» unter Druck. 1842 trat bei ihm an die Stelle der Holzschale eine Eisenschale und die Geschwindigkeit konnte auf 22 km/h gesteigert werden. Schon 1857 löste die Gesellschaft das Schiff durch eine dritte «Aigle» ab, die nun sogar 23 km/h schnell war und auch bis 1918 erhalten blieb.
Die Eisenbahn kommt
Am 1. Juli 1855 erreichten die Gleise der Compagniedel’Ouestdescheminsdefer
Suissevon Yverdon her (das schon von Norden her per Dampfschiff erschlossen war, siehe unter Lac de Neuchâtel ) Morges am Genfersee. Dort wurden sie provisorisch bis zum See geführt. Hier beim Anschluss an die Eisenbahn entstanden nun auch Werftanlagen, die genützt wurden, bis die CGN 1888 ihre Basis nach Lausanne-Ouchy verlegte.
Drei Jahre lang stiegen die Reisenden in Morges auf das Schiff nach Genf um, bevor am 25. Juni 1858 die Bahnlinie bis in die Rhonestadt verlängert war und den Schiffen den Durchgangsverkehr entzog. Schon ein Jahr später führte eine Strecke der Ligne d’Italie, deren Name Programm war, von Bouveret am oberen Ende des Sees aus das Tal der Rhone hinauf. Die damals dort entstandene Verknüpfung von Bahn und Schiff existiert noch immer. Die Hoffnung der Gesellschaft, damit den Grundstein für eine Hauptbahnlinie von Genf aus dem südlichen Ufer des Léman entlang gelegt zu haben, erfüllte sich jedoch nicht. Die Erweiterung der Eisenbahnverbindungen geschah stattdessen vom schon zuvor durch den Bahnverkehr erschlossenen Lausanne aus entlang des schweizerischen Nordufers ins obere Tal der Rhone. Von 1857 bis 1861 überbrückten die Schiffe das fehlende Teilstück von Lausanne bis Villeneuve. Beide genannten Bahngesellschaften engagieren sich sogleich auch in der Schifffahrt.
Die neuen Bahnlinien stellten im Alltagsbetrieb nun auf den wichtigsten Verbindungen eine den Schiffen überlegene Konkurrenz dar. Aber sie brachten auch einen neuen Kundenkreis an den Léman und Genf hatte über die französische PLM (Paris–Lyon–Méditerranée) ab 1858 einen internationalen Bahnanschluss bis Paris. Es zeigte sich rasch ein doppelter Effekt: Auf der einen Seite wandte die regionale Kundschaft den Schiffen weitestgehend den Rücken zu und wechselte mindestens im Bereich des Zweckverkehrs auf die Bahn, auf der anderen Seite erschien gleichzeitig eine neue, meist relativ kaufkräftige internationale Kundschaft – dies vor allem natürlich eher in der warmen Jahreszeit. Der Genfersee wurde fast über Nacht
Oben: Nach den ersten Pionierschiffen entstanden für die verschiedenen konkurrierenden Gesellschaften stattlichere, nun konsequent eiserne Schiffe – mit unterschiedlichem Erfolg. Die 1842 von Miller & Ravenhill aus England gelieferte «Aigle» II erwies sich als wenig gelungen und wurde im Zeichen des Bahnbaus 1860 an die «Ligne d’Italie» verkauft, welche das Schiff sinngemäss auf «Simplon» I umtaufte. Aber schon bei der Gründung der CGN 1873 erwies sich das Boot als reparaturfällig und überzählig, es wurde 1874 in einen Stationsponton umgebaut.
Sammlung P. Gondolf
Unten: Im Jahre 1871 – die Zeit der Belle Époque war noch nicht gekommen – war der mit zwei Kaminen, vier Kesseln und einer starken oszillierenden Nassdampf-Verbundmaschine ausgerüstete Halbsalondampfer «Winkelried» II eine Sensation – und für wenige Jahre auch das grösste Schiff in der Schweiz. Leider wurde der markante Dampfer im Zuge des Ersten Weltkriegs stillgelegt und anschliessend abgebrochen – die Schrottpreise waren verlockend hoch!
Sammlung P. Gondolf
zu einem recht exklusiven Reiseziel und der sportliche Teil insb. der britischen Reisenden legte auf dem Weg in die verlockenden Alpen einen Zwischenstopp an den milden Gestaden ein und nutzte gerne die Schiffe, auch wenn die Fahrt etwas länger dauerte als mit der Bahn. Neben der Seelandschaft galt es, den Ort von Rousseaus Roman «Julie ou la Nouvelle Héloïse» bei Vevey gesehen zu haben – damals fast ein Pflichtprogramm für jeden Bildungsbürger.
Die zunächst sehr unübersichtlich nebeneinander agierenden Schifffahrtsgesellschaften rückten unter diesen Auspizien näher zusammen und gegen 1870/71 präsentierte sich die Situation wie folgt: Die Lausanner Compagnie de l’Helvétie besass uneingeschränkt die namensgebende «Helvétie» I plus den neuen «Bonivard», die ebenfalls in Lausanne beheimatete Société du bâteau à vapeur le Léman den ebenfalls namensgebenden «Léman» III und die Genfer Société anonyme de bâteau à vapeur l’Aigle war Alleineigentümer des «Aigle» III. Die kleineren Dampfer «Guillaume Tell» II, «Chillon» und
«Rhône», aber auch der imposante «Winkelried» II mit zwei Kaminen standen im Miteigentum der drei vorgenannten Gesellschaften. Es kam unter dem Druck der Verhältnisse bald einmal zu Fusionsverhandlungen und die ersten Statuten der neuen Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (CGN) wurden am 16. Januar 1873 ratifiziert.
Damit war die Schifffahrt auf dem Léman auf eine neue Grundlage gestellt. In der Erkenntnis gegen die schnelleren Bahnlinien dem See entlang nur mit einem qualitativ hochwertigen Schiff bestehen zu können, bestellte sie in diesem Sinne bei Escher Wyss & Cie zuerst ein Salon-Schiff mit luxuriöser Ausstattung: das damals mit aussergewöhnlichen Dimensionen geradezu revolutionär wirkende DS «Mont Blanc» II (1875), ein Schwesterschiff der «Helvetia» auf dem Zürichsee. Dieses Schiff blieb zunächst ein Einzelstück, ein deutlicher Hinweis darauf, dass dem Léman seine grosse Zeit als Reiseziel aus aller Welt noch bevorstand.
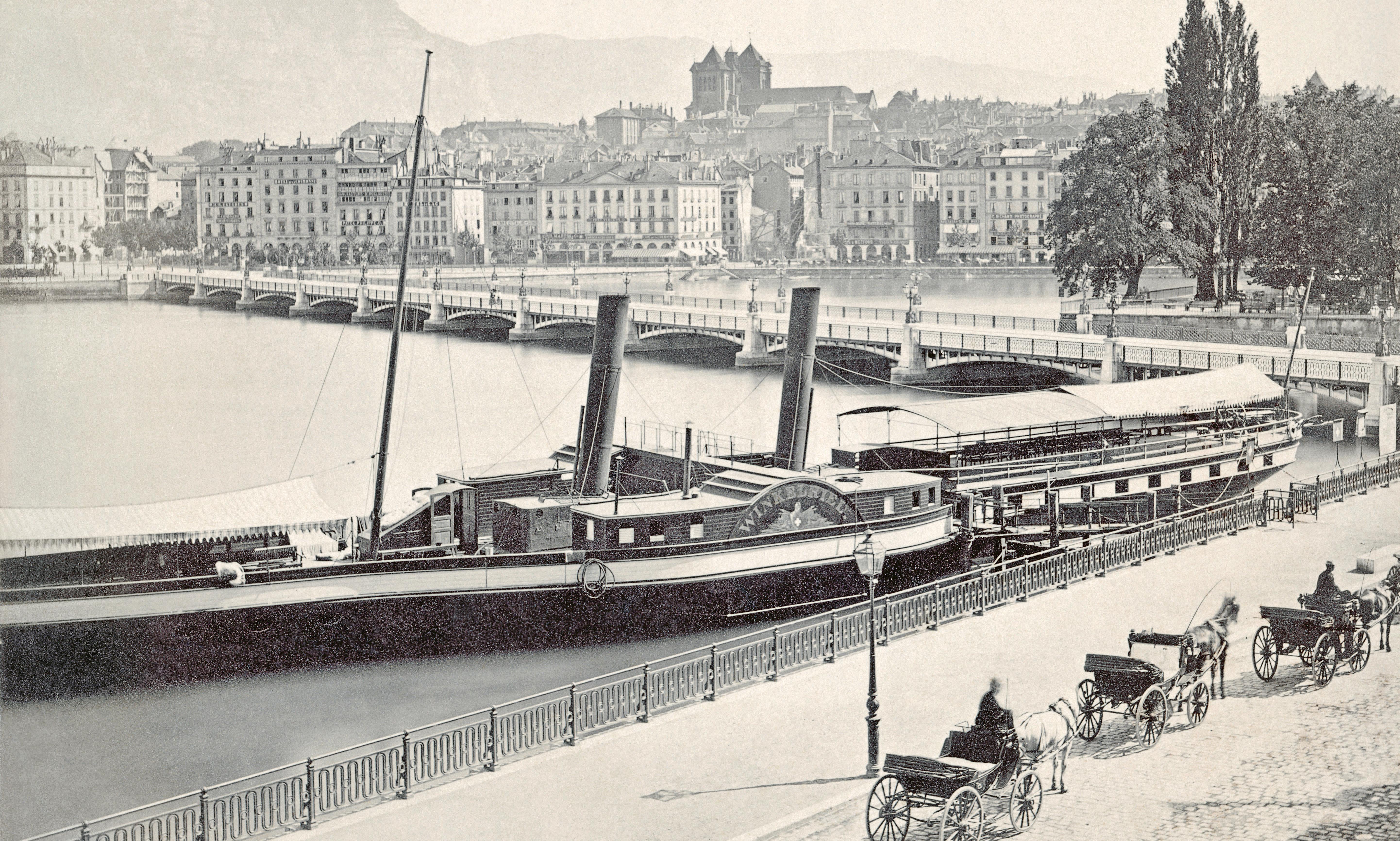


Dieses interessante Bild vermittelt einen herrlichen Einblick in die Atmosphäre des Genfer Hafens um 1860. Im Vordergrund wird gerade eine der klassischen «barques à voile latine» entladen: grosse Steinblöcke, möglicherweise etwa von Meillerie hergebracht. Im Hintergrund grüsst der elegante Dampfer «Aigle» III und im Mittelgrund sehen wir, scharf abgebildet, den erklärtermassen sehr robusten kleineren Dampfer «Guillaume Tell» II von John Penn.

Die Belle Époque
Der «Mont Blanc» folgten mehrere kleinere Einheiten für lokale Dienste und mit der «France» (1886) ein weiteres Schiff mit zwei Decks und erstmals elektrischer Beleuchtung sowie, weiterhin von Escher Wyss & Cie, ein schneller Halbsalondampfer «Major Davel» (1892). Die Probefahrten mit diesen zwei letzten Schiffen verliefen nicht ganz zufriedenstellend und die Gesellschaft traf 1892 das schwerste Schiffsunglück in diesen 200 Jahren Schifffahrt in der Schweiz, nämlich eine Kesseldom-Explosion auf dem Flaggschiff «Mont Blanc» beim Stationieren in Lausanne.

Aus diesen Gründen wandte sich die Gesellschaft einem anderen Lieferanten zu, der Gebrüder Sulzer AG aus Winterthur. Dort wurde ein neues grosses Schiff mit einer Kapazität von 1000 Passagieren bestellt, welches die Gesellschaft anlässlich der Schweizerischen Landesausstellung 1896 in Genf in Betrieb nahm. Diesem Schiff wurde dem Anlass entsprechend der Name «Genève» verliehen und ab diesem Zeitpunkt entstand eine neue, bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen Reeder und Konstrukteur.
Nun, kurz vor der Jahrhundertwende, kam die «Belle Époque», eine wahre Apotheose, was die Fremdenverkehrsströme anbelangt, so richtig in Schwung. In dieser Euphorie profitierte die CGN vom hocherfreulichen Aufschwung und vergrösserte sich in jeder Hinsicht. Das Geld floss in Massen in die Kassen der Schifffahrtsgesellschaft. Adel, Reiche und gekrönte Häup-
Kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieg hat die noch junge CGN den Mut gehabt, aufgrund der zunehmenden Frequenzen ein noch grösseres und luxuriöseres Schiff als den «Winkelried» in Betrieb zu nehmen: den imposanten Salondampfer «Mont Blanc» II , praktisch ein Schwesterschiff der «Helvetia» des Zürichsees. Im Sommer 1892 hat das Schiff zufolge einer Kesseldom-Explosion mit 26 Todesopfern traurige Berühmtheit erlangt und wurde nach Reparatur und Umbau als «La Suisse» I wieder in Betrieb genommen. Nach dem Erscheinen der noch imposanteren «La Suisse» II wurde der Name des Schiffes auf «Évian» geändert, den es bis zum Abbruch 1940 trug.
Sammlung R. Knöpfel