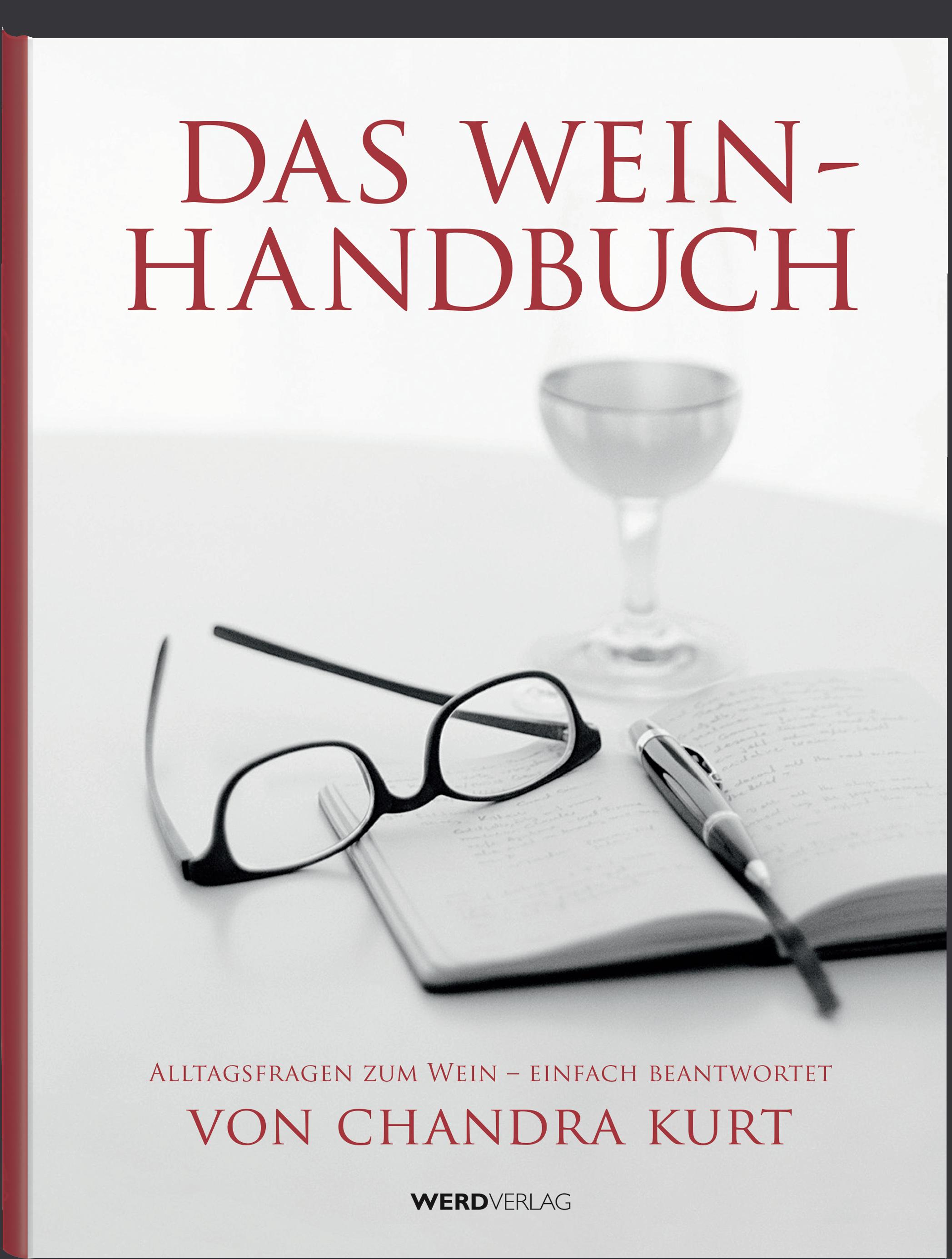
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2013 Werd & Weber Verlag AG, CH-3645 Thun/Gwatt
Idee & Texte
Chandra Kurt www.chandrakurt.com
Foto Umschlag
Patricia von Ah www.patriciavonah.com
Gestaltung
Jan Loosli
Werd & Weber Verlag AG
Satz
Alexandra Marti
Werd & Weber Verlag AG
Lektorat
Linda Malzacher
Werd & Weber Verlag AG
Korrektorat
Madeleine Hadorn
Werd & Weber Verlag AG
ISBN 978-3-85932-711-5
www.werdverlag.ch
www.weberverlag.ch
Einleitung
Dieses Buch habe ich nicht bewusst geplant – es ist das Resultat einer Reise durch Dutzende von anderen Weinbüchern, Weinzeitschriften und Weindiskussionen. Wir Fachleute sind es gewohnt, die Materie Wein mit Fachbegriffen zu umschreiben. Manchmal klingt das Resultat, als ob wir eine Fremdsprache sprechen. Wir übertrumpfen uns gegenseitig mit Wörtern, als ob Weingenuss ein Hochleistungswettbewerb wäre, bei dem es primär darum geht, sein Wissen zu vermitteln. Möglichst abgehoben und manchmal sehr unverständlich. Glauben Sie mir, Weingenuss hat gar nichts damit zu tun. Es geht nicht darum, nach einem Schluck Wein die kuriosesten Worte darüber verlieren zu können. Weingenuss ist vielmehr die Fähigkeit, seine Sinne zu aktivieren, auf sie zu hören, Aromen und Weine zu vergleichen, Feinheiten zu erkennen und sagen zu können, was einem gut gefällt und was nicht. Oder anders ausgedrückt – Weingenuss kann mit Musikgenuss verglichen werden. Traubensorten sind die Instrumente, Weinstile sind Melodien und Winzer sind Musiker oder Interpreten. Erst wenn man dieselbe Musik, von verschiedenen Musikern oder Orchestern interpretiert, miteinander vergleicht, erkennt man die Finessen und Unterschiede. Niemand hat alle Musikrichtungen gern, auch ist man nicht immer in der Stimmung für alle – dasselbe gilt für den Wein. Wunderbar ist, dass Wein ein kreatives Feld ist, das sich ständig entwickelt, neu erfindet und traditionelles und modernes Schaffen Seite an Seite Platz haben.
«Das Weinhandbuch» ist kein Buch über Weinregionen, Traubensorten, Weingeografie, Weinnamen, Winzer oder Jahrgänge. Es ist eine alphabetische Zusammenstellung von Weinbegriffen, die einmal etwas länger und einmal etwas kürzer beschrieben werden. Viele dieser Fachbegriffe werden in keinem anderen Buch erklärt. Zahlreiche davon verwende ich in meinem jährlich erscheinenden Weineinkaufsführer «Weinseller» (siehe Seite 006). Die Zusammenstellung ist nicht vollständig, da sie intuitiv entstanden ist. Dieses Buch wird wachsen – mit Ihrer Hilfe. Senden Sie Weinbegriffe, die Sie nicht verstehen, die absurd klingen, an mich: chandra@chandrakurt.com.
Der «Weinseller»
1998 habe ich mit dem «Weinseller» begonnen. Die Idee war, ein jährlich erscheinendes Buch zu schreiben, das die nicht zu teuren Weine des Detailhandels vorstellt. Weine, die man also in Geschäften kauft, in denen man auch das Essen, die Putzmittel und sonstige Dinge für das tägliche Leben besorgt. Ich erinnere mich, wie ich selber vor den Weinregalen stand und nicht wusste, was ich kaufen soll, da das Angebot so gross und vielfältig war.
Seit der ersten Ausgabe ist der «Weinseller» ein finanziell unabhängiger Einkaufsführer. Die Beiträge sind weder gesponsert noch finanziert. Jahr für Jahr steht es den Schweizer Grossverteilern und Discountern offen, ob sie ihre Weine durch mich verkosten und bewerten lassen wollen oder nicht. Die Degustationen beginnen jeweils im Juni, und jede Woche gehe ich zu einem anderen Anbieter. Entweder verkosten wir in der Zentrale oder in einem Weinkeller. In der Regel degustiere ich zusammen mit dem Weinverantwortlichen des Hauses, der die zu verkostenden Weine auch zusammenstellt. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich weit über 600 Weine verkostet. Dabei kommt es zu spannenden Diskussionen über die Weinphilosophie des Hauses, über Trends in der Weinwelt und über die Zukunft des Weins. Wein hat verschiedene Gesichter und Stimmungen –diese versuche ich in Worte zu fassen. Schlechte Weine kommen im Buch nicht vor.
Ich bin selber immer wieder erstaunt, dass ich jeden Tag etwas Neues dazulerne. Vor 20 Jahren waren beispielsweise die Weine der Neuen Welt kein grosses Thema, Österreich war international noch nicht gefeiert, niemand sprach von der Klimaerwärmung oder von aromatisierten Weinen. Die Weinwelt ist alles andere als statisch, sie entwickelt sich ständig weiter und fordert uns auf, sich mit ihr zu entwickeln.
www.weinseller.com
Zum Gebrauch dieses Buches
Ganz einfach. Aufgebaut ist «Das Weinhandbuch» alphabetisch wie ein Lexikon. In den einzelnen Einträgen gibt es Verweise auf ähnliche oder weitere Begriffe, die zum Thema passen ( Stichwort). Man braucht keine Fachperson zu sein, um die Texte zu verstehen. Primär wollen sie einfach und verständlich die Materie Wein erklären, mit vielen Tipps und Hinweisen aus dem täglichen Leben. Wichtig ist die Verbindung von Wein und Food. Daher spielen Speisen und ihre Kombinationsmöglichkeiten mit Wein eine zentrale Rolle.
Finden Sie einen Begriff nicht, dann senden Sie mir eine E-Mail an chandra@chandrakurt.com und wir nehmen ihn in der nächsten Ausgabe auf. In der ersten Ausgabe stehen rund 250 Begriffe. Man muss nicht bei A beginnen, um Z zu verstehen. Im Gegenteil. Stöbern Sie im Buch und geniessen Sie diese verbale Weinreise – am besten bei einem Glas Wein.
Abgang
Vom Abgang ist immer wieder die Rede, wenn es um die Beurteilung von Weinen geht: Abgang gleich Länge oder Nachhaltigkeit des Weins. Es geht um die Frage, wie nachhaltig der Eindruck ist, den der Wein im Mund (nicht in der Kehle) hinterlässt. Wie lange dauert es, bis die Wirkung der Aromen nachlässt und sich der Speichelfluss normalisiert? Den Abgang kann man in Sekunden messen. Die Spanne reicht von nicht vorhanden bis zu 10 oder gar 20 Sekunden. Je länger, desto bleibender das Erlebnis und umso besser der Wein. Ich habe festgestellt, dass der Abgang auch davon abhängt, was man zuvor getrunken hat. Die besten Ergebnisse betreffend Abgang erzielt man, wenn man Folgendes beachtet:
Leichter Wein vor schwerem Wein.
Weisswein vor Rotwein.
Trockener Wein vor Süsswein.
Einfacher Wein vor komplexem Wein.
Junger Wein vor altem Wein.
Adstringent
Ein adstringierender Wein ist nichts anderes als ein Wein, dessen Geschmack stark vom Tannin ( Gerbstoff ) dominiert wird. In unserem Gaumen ziehen sich die Schleimhäute zusammen, die Zunge fühlt sich pelzig an und der Geschmack ist bitter und streng. Ob ein Wein adstringent ist oder nicht, hat entweder mit seinem Alter oder mit seiner Qualität zu tun. Tannine findet man einerseits in den Traubenkernen und -häuten sowie in den Holzfässern. Ein Topwein hat in der Regel auch viel Tannin oder zumindest die Struktur, um viel Tannin zu vertragen. In seinen jungen Jahren steht das allerdings zu sehr im Vordergrund. Daher muss der Wein gelagert werden, sodass das Tannin seine jugendliche Strenge verliert. Ein qualitativ eher schlechter Wein ist in der Regel auch eher von «grünen» Gerbstoffen markiert. Sie sind ein Zeichen, dass mit nicht optimalen Trauben gearbeitet worden ist. Hier hilft auch die Lagerung nicht. Ein solcher Wein wird nie gut und samtig.
Nicht zu viel einkaufen, denn meist sind Aktionsweine reife Weine, die nicht mehr zu lange gelagert werden sollten.
Darauf achten, dass man den Normalpreis kennt.
Hände weg von Einheitspreisen à la «5 Franken für jede Flasche». Weinaktionen sind wie Lebensmittelaktionen
aoftmals nichts anderes als Promotionen, um Kunden in die Läden zu locken. Und gegen solche Promotionen spricht nichts.
Ist man sich nicht sicher, ob man den Wein mag, ist die Aktion auch eine gute Gelegenheit, den Wein günstiger einzukaufen und ihn anschliessend zu testen.
Nicht jede Traubensorte hat gleich viel Tannin. Zu den bekanntesten unter den kräftigen Sorten gehören Nebbiolo (Barolo, Barbaresco), Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Tannat.
Aktion
Jedes Weingeschäft macht mehrmals pro Jahr Weinaktionen. Das kann verschiedene Gründe haben:
Promotion: Ein neuer Wein wurde in das Sortiment aufgenommen, aber niemand kennt ihn. Um die Aufmerksamkeit der Weinliebhaber auf ihn zu lenken, wird dieser Wein während der Promotionsphase etwas günstiger, also attraktiver angeboten.
Lagerräumung: Bekanntlich kommen Jahr für Jahr neue Jahrgänge auf den Markt. Da ein Lagerplatz auch etwas kostet, sorgen die Weinanbieter dafür, dass sie diesen stets unter Kontrolle haben. Ein- bis zweimal im Jahr findet dann ein sogenannter Lagerverkauf statt, damit der Lagerplatz wieder frei wird. Es wäre falsch zu glauben, dass dort weniger gute Weine verkauft würden. Meist ist es auch so, dass die Weine an solchen Lagerverkäufen kostenlos zur Verkostung bereitstehen. Ideal also, um das eigene Wissen aufzubessern und den Geschmack zu trainieren.
Firmenphilosophie: Praktisch jeder Grossverteiler kalkuliert seine Weine so, dass er sie mehrmals pro Jahr zu Aktionspreisen anbieten kann. Manchmal lohnt es sich gar zu warten, bis der eigene Lieblingswein in der Aktion angeboten wird.
Lockangebot: Manchmal verkauft ein Anbieter den Wein auch unter dem Einstandspreis – das heisst, er verdient zwar nichts daran, kann aber Neukunden ins Geschäft «locken».
Nicht nur günstige Weine können während Aktionen erworben werden, sondern auch solche, die sonst über 50 Franken kosten. Oft macht man sogar das bessere Schnäppchen, wenn man etwas mehr ausgibt ( Verkaufspreis).
Alcopops
Alcopops haben nichts mit Wein zu tun. Es handelt sich dabei vielmehr um süsse gebrannte Wasser mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent, aber weniger als 15 Volumenprozent. Sie enthalten mindestens 50 Gramm Zucker pro Liter (oder einen anderen Süssstoff) und in der Regel weitere Aromaoder Farbstoffe. Alcopops sind konsumfertig gemischte Getränke, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten.
Alkohol
Alkohol entsteht bei der Vergärung des im Traubenmost gelösten Zuckers durch Hefen in Ethylalkohol und Kohlensäure. Die Hefepilze spalten den Zucker in Weingeist (Ethanol) und Kohlensäure auf. Dieser Alkohol ist farblos und von angenehmem Geruch. Je nach Zuckergehalt des Mostes, der Art der Hefen sowie den Temperaturen während der Gärung entsteht ein anderes Alkoholvolumen. Klimawandel, Akzeptanz bei Weingeniessern und Fachpresse sowie moderne Vinifikationsmethoden und Kultivierungen in wärmeren Weinbauregionen führten ab Ende der 90er-Jahre dazu, dass der Alkoholgehalt auch in den einfachsten Alltagsweinen immer höher wurde. 13 bis 15 Volumenprozent sind keine Seltenheit. Inzwischen erleben wir glücklicherweise wieder einen Trend zu leichteren Weinen, deren Alkoholgehalt bei 9 bis 12,5 Volumenprozent liegt. Der natürliche Alkoholgehalt eines Weins ist zwar kein absolut gültiger Massstab für seine Qualität, aber Ausdruck der Traubenreife: Beim Ernten ist die Reife der Trauben und ihre Qualität das wichtigste. Je länger die Trauben am Stock reifen, desto grösser wird die Fruchtkonzentration – und später bei der Vinifikation der Alkoholgehalt.
Noch etwas: Ich habe festgestellt, dass Alkohol nicht gleich Alkohol ist. Zwei Weine können denselben Alkoholwert aufweisen und ich vertrage sie dennoch nicht gleich gut. Bei einem spüre ich den Alkoholeinfluss bereits nach einem Glas, beim anderen auch nach einer halben Flasche noch nicht. Ein Thema, dem ich mich noch mehr widmen werde.
Ein paar Werte: Prosecco 11%, Champagner 12%, Rotweine 10 bis 16%, Weissweine 6 bis 15%.
Ein Wein ist nicht besser, nur weil er einen hohen Alkoholgehalt hat. Wichtig ist die Balance von Gerbstoffen, Säure, Aromen und Alkohol.
Alkohol ist ein Geschmacksträger. Er lässt den Wein (wie die Butter beim Kochen) aromatischer wirken. Alkoholwerte nehmen mit der Reifezeit des Weins nicht ab.
Deutsche Rieslinge werden unter anderem geliebt, weil sie im Schnitt einen Alkoholgehalt von 8 bis 10 Volumenprozent aufweisen.
Alkohol kann auf verschiedene Arten in den Wein gelangen. Man kann ihn bewusst dazugeben ( aufspriten) oder er entsteht, wenn sich der in den Trauben enthaltene Fruchtzucker während der Gärung in Alkohol und Kohlensäure verwandelt. Der Alkohol wird dem Wein durch aufwendige technische Verfahren entzogen. Beim alkoholfreien Wein liegt der Restalkoholgehalt unter 0,5 Volumenprozent.
Alkoholfreie Weine sind trinkbereit und müssen nicht gelagert werden.
aAlkoholfreier Wein schmeckt nicht wirklich wie Wein.
Alkoholfrei
Auch wenn sich mancher ein gutes Essen ohne Wein kaum vorstellen kann, gibt es verschiedene Gründe, warum man zum Essen nicht immer Alkohol trinken kann und will. Man muss noch Auto fahren, an eine Sitzung oder arbeiten. Die Gründe können auch gesundheitlicher Natur sein, zum Beispiel, dass man Alkohol nicht gut verträgt. Ein Thema, das heute vermehrt auch in Fachkreisen diskutiert wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken, die nicht Süssgetränke sind, in naher Zukunft noch zunehmen wird. Persönlich habe ich schon verschiedene alkoholfreie Weine aus Europa oder aus den USA verkostet, habe aber noch keinen wirklichen Favoriten gefunden – im Gegensatz zum alkoholfreien Bier. Allerdings glaube ich, dass es auch gar nicht darum geht, dass der alkoholfreie Wein gleich gut schmeckt wie ein «normaler» Wein. Wichtig ist, dass er keinen Alkohol enthält – oder wenn, dann nur ganz wenig. Alkoholfreier Wein ist nicht mit Traubensaft zu verwechseln. Traubensaft wird durch die Pressung frisch geernteter Weintrauben gewonnen. Wein dagegen ist in Tanks oder Fässern vergorener Traubensaft. Die Basis alkoholfreier Weine sind vollständig vergorene Weine (ca. 10 bis 13 Volumenprozent Alkohol), denen nach der Reifezeit der Alkohol entzogen wird. Alkoholfreier Wein hat dieselben Entwicklungsstadien durchlaufen wie ein normaler Wein. Zusätzlich wurde ihm in einer weiteren Produktionsstufe der Alkohol entzogen. Ein entalkoholisierter Wein darf alkoholfrei genannt werden, wenn der Restalkoholgehalt unter 0,5 Volumenprozent liegt. Geschmacklich unterscheiden sich diese beiden Weintypen stark – besonders, weil Alkohol auch ein Geschmacksträger ist. Je mehr Alkohol ein Wein enthält (man denke zum Beispiel an einen Amarone mit rund 15 Volumenprozent), desto aromatischer und vollmundiger nehmen wir den Wein wahr. Aus gesundheitsfördernder Sicht bin ich gegen Weine mit zu hohem Alkoholgehalt. Leider waren solche Blockbuster-Weine in den letzten Jahren sehr beliebt und überall anzutreffen. Dieser Trend hat glücklicherweise etwas abgenommen und man spricht bereits vom Trend der «Light»-Weine, also von Weinen, deren Alkoholgehalt bei plus/minus 5,5 Volumenprozent liegt.
Alltagswein
Tischwein Alte Welt
Weine aus der Alten Welt sind Weine aus den traditionellen europäischen Weinbauregionen. Dazu gehören Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Bulgarien, Ungarn etc. Weine aus diesen Regionen werden meist nach gesetzlichen Vorschriften produziert ( Weingesetz). Ertrag, Produktionsmethoden sowie erlaubte Traubensorten sind oftmals definiert. Der Vorteil einer solchen Weinpolitik ist, dass die Regionen eine geschmackliche Identität erhalten und man deren Produkte (Weine) einfacher vergleichen kann. Das ermöglicht wiederum, dass man den besten Wein, den besten Produzenten oder das beste Terroir eruieren kann. Natürlich hat dies auch einen Einfluss auf den Geschmack des Weins, denn Weine werden nicht mit dem Ziel vinifiziert, einem bestimmten Konsumentengeschmack zu entsprechen, sondern vielmehr das Terroir und die Traubencharakteristik am schönsten zu zeigen. Natürlich werden nicht alle Weine der Alten Welt nach diesem Konzept vinifiziert – heute schon gar nicht mehr. Aber es ist dennoch die Basis der europäischen Weinkultur.
Nach wie vor kommen die grössten Weine der Welt aus der Alten Welt: Bordeaux, Burgund, Champagne, Piemont, Toskana, Mosel.
Alter
Hätte man vor ein paar Jahren Experten gefragt, welche Weine sie zu einem Festmahl servieren würden, wäre das Ergebnis ganz anders ausgefallen als heute. Während damals Weine mit einem Alter von 10 bis 20 Jahren genannt worden wären, kommen heutzutage auch schon ganz junge Tropfen auf den Tisch. Vorbei ist die Zeit, in der ein Bordeaux erst einmal ein Vierteljahrhundert im Keller schlummern musste oder der Burgunder erst anlässlich seiner bräunlichen Altersfarbe für gut befunden wurde. Die globale Überproduktion – die noch lange nicht gestoppt ist – sorgte dafür, dass auch traditionelle Weinbauregionen wie
Heute muss ein Wein nicht mehr alt werden, um gut zu sein. Nur überdurchschnittlich gute Weine können wirklich alt werden. Auch ein moderner Wein entwickelt sich in der Flasche.
Wie ein Wein reift, hängt auch von seinem Verschluss ab. Immer wieder spannend ist es, verschiedene Jahrgänge desselben Weins miteinander zu vergleichen. Dabei kann man lernen, ab welcher Reifezeit ein Wein wirklich reif oder gar zu reif geworden ist.
Bordeaux oder die Toskana ihre Weine viel trinkbereiter auf den Markt bringen. Generell kommen die Weine viel saftiger, runder und mit weicheren Gerbstoffen in den Handel, als das früher der Fall gewesen ist. Neben den Weinen haben sich jedoch auch die Konsumenten verändert. Die wenigsten sind heutzutage noch bereit, so und so viele Jahre zu warten, bis sie ihren Wein öffnen. Wein wird eingekauft und innert ein bis zwei Jahren getrunken, wenn nicht sogar schon am Kaufabend selbst. Persönlich lege ich allerdings nach wie vor Weine auf die Seite, um ihre geschmackliche Evolution zu verfolgen. Denn ein wirklich reifer Wein zeigt uns ein Aromenspektrum, das er in seiner Jugend noch nicht entwickelt haben kann ( Trinkreife ).
Amabile
Amabile ist die italienische Bezeichnung für halbtrockene Weine mit einem Mindestalkoholgehalt von 10,5 Volumenprozent. Die Restsüsse beginnt bei mindestens 12 Gramm pro Liter und geht bis 45 Gramm pro Liter. Amabile-Weine sind entsprechend lieblich bis süsslich im Geschmack. Der Begriff Amabile ist in der Regel auf dem Etikett vermerkt.
Amarone
Amarone ist keine Traubensorte (genauso wie Rioja oder Chianti keine sind), sondern der Name für eine Weinspezialität, deren Ursprung im italienischen Valpolicella-Gebiet liegt. Amarone wird aus den Rebsorten Corvina, Rondinella und Molinara erzeugt. Diese werden nach der Ernte auf Strohmatten luftgetrocknet (wobei der Trocknungsprozess bei günstigeren AmaroneWeinen mit grossen «Föhnen» beschleunigt wird). Dadurch verlieren die Trauben ein Drittel bis zur Hälfte ihres Gewichts und werden fast als Rosinen gekeltert. Anschliessend reift der Wein je nach Qualität zwei bis sechs Jahre in kleinen Eichenfässern. Mit diesem Verfahren erzeugt man wuchtige, trockene und
alkoholreiche Weine mit 14 bis 15 Volumenprozent, die schwer, aber auch samtig und tiefgründig sind. Amarone ist ein festlicher Wein, den man am besten aus grösseren Gläsern geniesst. Man sollte sich Zeit nehmen für ihn. Er wird auch gerne als Meditationswein bezeichnet. Ein Amarone ist kein günstiger Wein.
Animalisch
Dieser gerne für Rotweine verwendete Fachausdruck beschreibt verschiedene Aromen, die in der Tierwelt zu Hause sind: so etwa Pferd, Frischfleisch, Leder, Stall, Moschus usw. Solche Aromen sind Geschmacksache und treten in der Regel bei alten Rotweinen oder Weinen mit einem Hefefehler ( Brett) auf. Ein animalischer Wein ist ein Wein, bei dem die Fruchtaromen überdeckt sind. Meist haben Männer solche Weintypen lieber als Frauen.
AOC
Die «Appellation d’Origine Contrôlée» (kontrollierte Herkunftsbezeichnung) ist ursprünglich ein Schutzsiegel für französischen Wein (und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse). Es bedeutet, dass der Wein aus einem speziellen Gebiet oder Terroir stammt. Auch können sein Reifegrad, das Mostgewicht sowie der Zucker- und Alkoholgehalt definiert sein. Die Bezeichnung AOC kann auch ein Hinweis auf den Stil sein. Sie ist jedoch kein sicheres Indiz für hohe Qualität. In der Schweiz wurden 1988 erstmals AOC-Regelungen für Weine eingeführt – allerdings hat jede Weinbauregion eigene Gesetzmässigkeiten. In anderen Ländern werden beispielsweise die Gütesiegel DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) oder DAC (Districtus Austriae Controllatus) verwendet. Durch behördliches Dekret ist der Ursprung des Weins klar deklariert. Damit werden die typischen Eigenschaften einer Appellation bewahrt oder neu kreiert.
Mit dem Aperitifwein wird der Gaumen «aviniert» und auf das Mahl vorbereitet.
Wenn zum Apéro ein Champagner serviert wird, dann am besten ein Blanc de Blanc. Er besteht aus 100 Prozent Chardonnay und ist fruchtiger und frischer als einer, der zusätzlich Pinot Noir und Pinot Meunier enthält.
Manche Traubensorten ergeben Weine, die als parfümiert gelten. Nicht etwa, weil sie mit zusätzlichen
aAromastoffen ergänzt worden sind, sondern weil ihre Aromatik besonders auffallend ist. Solche Weine eignen sich besonders gut zum Aperitif (Sauvignon Blanc, Riesling, Riesling x Sylvaner, Muscat …).
Persönlich serviere ich den Apérowein auch gerne zum ersten Gang.
Apéro
Schon der Begriff Apéro lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Apéro ist eine stets willkommene Sache. Er soll einerseits den Gaumen befeuchten und andererseits vom Alltag zum genüsslichen Mahl überleiten. Ein Apéro kann sowohl vor dem Mittag als auch vor dem Abendessen eingenommen werden.
Wird zum Apéro ein zu schwerer, komplexer Wein serviert, sättigt das den Gaumen. Kommt hinzu, dass schwere Weine meist nach Essen verlangen und «nackt» genossen gar nicht so gut schmecken. Ein Schaumwein dagegen, sei es ein Champagner, ein Prosecco, ein Cava oder ein Sekt, ist immer ein perfekter Start. Er belebt Gaumen und Geist und strahlt nicht zuletzt auch etwas Festliches aus. Ideale Apéroweine sollten in der Nase duften. So sind etwa Viognier, Sauvignon Blanc, Muscat, Riesling oder Riesling x Sylvaner typische Traubensorten, deren Weine wunderbar zu einem Apéro passen. Es sind Weine, die weniger mit einem dichten und komplexen Körper aufwarten, sondern vielmehr mit einer verführerischen Duftnote, die sich immer wieder verändert – wie ein Blumenstrauss duften sie je nach Tageszeit anders. Ein trockener Sherry (Fino, Manzanilla) bietet ebenfalls einen idealen Einstieg. Eisgekühlt serviert fliesst er die Kehle besonders schnell hinunter. Doch aufgepasst, Sherry hat etwas mehr Alkohol als ein trockener Weisswein. Rotwein zum Apéro? Warum auch nicht. Doch auch hier sollte darauf geachtet werden, dass der Wein nicht zu schwer ist und vielleicht leicht gekühlt serviert wird. Ein Gamay oder ein leichter Pinot Noir eignen sich gut. Roséwein gehört ebenfalls zu den gern ausgeschenkten Apérogetränken, zumindest im Sommer. Aber Vorsicht: Auch wenn er lieblich daherkommt, hat er meist mehr Alkohol als ein trockener Weisswein. Was zum Aperitif getrunken wird, hängt auch von der Jahreszeit ab. Bei sommerlichen Temperaturen ist der Wunsch nach einem süffigen und spritzigen Wein grösser, als wenns draussen kalt ist und schneit. Es lohnt sich, auf die eigenen Vorlieben zu achten.
Apfelsäure
Hart schmeckender, natürlicher Bestandteil des Weins. Bei frischen Weissweinen wird die Apfelsäure geduldet, bei Weissweinen, die in der Barrique ausgebaut werden, eher nicht. Bei Rotweinen ist sie unerwünscht. Darum wird die Apfelsäure bei der malolaktischen Gärung in die mildere Milchsäure umgewandelt. Oft wird bei Degustationen gefragt, ob ein Wein die malolaktische Gärung durchgemacht hat. Was man damit eigentlich fragen will, ist, ob der Wein eher die frische, kantigere und schnell sauer schmeckende Apfelsäure enthält. Sie kommt bei Weissweinen nur wirklich gut zum Tragen, wenn die Trauben eine optimale Reife erreicht haben und der Wein von Topqualität ist.
Aroma
Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet das Wort Aroma «Würze». Wein enthält einige hundert Aromastoffe, die in unterschiedlichen Konzentrationen vorliegen. Allgemein betrachtet bezieht sich das Aroma eines Weins auf dessen Duft und Geschmack. Die Aromavielfalt wird durch die Rebsorte, den Jahrgang, das Terroir und die Vinifikation beeinflusst. In der Önologie unterscheidet man daher prinzipiell zwischen Primäraromen, die aus der Traube selbst beziehungsweise der Behandlung und Bearbeitung vor der Gärung stammen, den Sekundäraromen, die durch die Gärung entstehen, und den Tertiäraromen, die durch die Reifung im Flaschenkeller dazukommen. Das Aroma eines Weins ist vielfältig und kann auch fehlerhaft sein. Persönlich habe ich am meisten über Weinaromen gelernt, indem ich Weine miteinander verglichen habe. Erst dann wurden mir die Unterschiede so richtig bewusst. Die Geschmackssinneszellen sind beim Menschen als Geschmacksknospen an bestimmten Stellen der Zunge vereinigt. Vier Qualitäten werden bewusst unterschieden: süss, sauer, salzig und bitter. Durch ihre Kombination und hinzukommende Wahrnehmungen des Geruchssinns entsteht eine Vielzahl von Geschmacksnuancen.
Je unreifer die Traube, desto mehr Apfelsäure enthält sie. Ein Wein braucht genügend Säure, um gut zu schmecken. Wichtig ist, dass eine ausgewogene Balance zwischen Säure, Alkohol und Frucht besteht.
Aromatisiert
Was mich am Thema Wein besonders fasziniert, ist unter anderem die Tatsache, dass er sich laufend weiterentwickelt. Es kommen immer neue Jahrgänge auf den Markt, neue Traubensorten, neue Winzer, neue Weinbauzonen und neue Weinstile. Im Verlauf des letzten Jahres ist mir eine Entwicklung besonders aufgefallen: der Trend hin zu aromatisiertem Wein. Das ist nichts anderes als Wein, der mit natürlichen oder naturidentischen Aromastoffen, Aromaextrakten, Gewürzen, Kräutern oder anderen geschmacksgebenden Lebensmitteln aromatisiert wird. Der Alkoholgehalt solcher Weine beträgt mindestens 7 und weniger als 14,5 Volumenprozent. Wenn ich höre, dass dies ein neuer Trend sei, muss ich etwas schmunzeln, denn bereits in der Antike wurde Wein mit Honig, Gewürzen und Rosinen aromatisiert. In alten Texten aus Mesopotamien wurden Rezepte gefunden, in denen dem Wein Myrrhe und auch Drogen beigefügt wurden. Bei den Griechen war es üblich, Wein mit Harz und verschiedenen Gewürzen zu ergänzen, und die Römer liebten den Effekt von Süssholz im Wein. Damals ging es allerdings primär darum, den Wein trinkbarer zu machen oder minderen Wein aufzuwerten.
Heute kommen die Weine qualitativ stabil auf den Markt. Die neue Weingattung der aromatisierten Weine könnte vielmehr ein Weg sein, um einerseits der neuen Generation den Weingenuss näherzubringen und andererseits ein Produkt zu entwickeln, das grundsätzlich zu unseren neuen Ess- und Trinkgewohnheiten passt. Süss ist gefragter denn je. Was sind die Hauptgetränke der Jugend von heute: Süssgetränke wie Coca-Cola, Fruchtsäfte, Red Bull und Rivella. Daher muss auch ein Wein extra-aromatisch sein, wenn er überhaupt wahrgenommen werden will. So habe ich inzwischen Weine mit Schokoladenextrakt oder Bitterorangenaroma verkostet. Natürlich sind diese Mixturen nicht schlecht –im Gegenteil. Der Jahrgang spielt keine Rolle, es geht vielmehr darum, welcher Aromastoff dominant ist. In meinen Augen hat aromatisierter Wein dennoch nichts mehr mit Wein zu tun. Der Wein mutiert vom geografisch beeinflussten Kulturgut zum austauschbaren Getränk, das nur solange auf dem Markt erhältlich ist, wie es sich gut verkauft. Anschliessend wird es durch ein neues trendiges Getränk ersetzt. ➛
Bis jetzt werden in der Schweiz folgende Weintypen unterschieden, wenn man von aromatisiertem Wein spricht:
Wein-Aperitif: Spritz und Co.
Wermut oder Wermutwein: Aromatisierter Wein, dessen charakteristisches Aroma durch die Verwendung dafür geeigneter Stoffe erzielt wurde. Es müssen immer auch Stoffe verwendet werden, die aus Artemisia-Arten gewonnen wurden. Zur Süssung dürfen nur Zucker, karamellisierter Zucker, Traubenmost, konzentrierter Traubenmost oder rektifiziertes Traubenmostkonzentrat verwendet werden.
Bitterer aromatisierter Wein: Aromatisierter Wein mit einem charakteristischen bitteren Aroma. Die Bezeichnung kann mit der Angabe des verwendeten Aromastoffs ergänzt werden, sie kann aber auch durch eine der folgenden Bezeichnungen ersetzt werden:
«Wein mit Chinarinde», wenn für die Aromatisierung im Wesentlichen natürliches Chinarindenaroma verwendet wurde.
«Bitter vino», wenn für die Aromatisierung im Wesentlichen natürliches Enzianaroma verwendet wurde und eine Gelboder Rotfärbung erfolgte.
«Americano», wenn die Aromatisierung von aus Beifuss und Enzian gewonnenen natürlichen Aromen herrührt und eine Gelb- oder Rotfärbung erfolgte.
Artischocken
Artischocken sind eine wahre Herausforderung für jeden Sommelier, da ihre Kombination mit Wein schier unmöglich ist. In der Regel tendieren Artischocken dazu, den Wein süsser zu machen. Daher wählt man idealerweise einen trockenen Weisswein mit genügend Säure, so etwa einen Kerner, einen Sauvignon Blanc oder einen Schaumwein.
Assemblage
Unter einem reinsortigen Wein versteht man einen Wein, der aus einer einzigen Traubensorte vinifiziert worden ist. Eine Assemblage dagegen ist eine Mischung aus verschiedenen Sorten. Es wäre falsch zu sagen, dass eines besser ist als das andere. Beide Arten haben ihre Berechtigung, beide bringen tolle Weine hervor und beide haben eigene Traditionen. Nehmen wir zum Beispiel die Weinbauregionen Burgund und Bordeaux, zwei Klassiker in Frankreich. Im Burgund werden seit jeher reinsortige Weine vinifiziert: Pinot Noir als Rotwein und Chardonnay als Weisswein. In Bordeaux füllen nur ganz wenige Châteaux reinsortigen Wein ab. Die meisten roten Gewächse sind eine Assemblage aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot. Die weissen Weine werden aus Sauvignon Blanc und Sémillon gemischt. Auch wenn diese beiden Regionen jeweils andere Weinstile pflegen, sind beide hoch geschätzt und gelten als die Elite der Weinwelt.
Der Vorteil von reinsortigen Weinen ist ihre Vergleichbarkeit. Man kann nicht nur alle Chardonnays der Welt miteinander vergleichen und herausfinden, welcher einem am besten gefällt, sondern auch erkennen, wie der Boden, die Vinifikationsmethode und das Klima den Wein gekennzeichnet haben. Vorsicht beim Etikettenlesen : Auch wenn nur eine Traubensorte aufgeführt ist, besteht der Wein nicht immer nur aus ihr. Je nachdem, woher er kommt, genügt es, wenn 70 bis 80 Prozent der Sorte für den Wein verwendet wurde.
Ich vergleiche die beiden Weinschulen auch gerne mit «Kür» und «Pflicht». Der reinsortige Wein ist die «Pflicht». Man muss den Gesetzmässigkeiten der Trauben folgen – sie anpflanzen, wo sie am besten wachsen, sie nähren mit dem, was sie brauchen, und den Wein daraus vinifizieren, den sie ergeben. Bei der Assemblage («Kür») kann der Winzer zum Artisten werden. Er muss nicht in jedem Jahrgang dieselbe Assemblage produzieren, sondern er fügt zusammen, was in seinem Gaumen das beste Resultat ergibt. Ganz individuell.
Atmen
Ein Wein atmet. Zumindest reagiert er auf Sauerstoff. Andernfalls könnte man ihn ewig offen stehen lassen, ohne dass er sich dabei verändern würde. Aber wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass eine geöffnete Flasche Wein am nächsten Tag nicht mehr geniessbar oder sogar noch besser geworden ist. Sobald Wein der Luft ausgesetzt ist, beginnt ein Entwicklungsprozess. Je besser die Qualität des Weins, desto länger kann er «atmen». Ist der Wein einfacher und schlechter, ist seine Lebensdauer an der Luft entsprechend kurz. Sehr komplexe und junge Weine brauchen sogar etwas Luft, um ihren Charakter überhaupt erst zeigen zu können. Solche Weine dekantiert man am besten. Vorsicht jedoch bei ganz alten Weinen – Luft wird ihnen in den meisten Fällen nur einen kurzen Moment lang gut tun.
Aufspriten
Diverse sehr bekannte Weine sind das Resultat vom Aufspriten. Dabei wird einem Grundwein Weinbrand oder anderer Alkohol beigefügt. Dies ist zum Beispiel bei Portwein, Madeira, Sherry, Marsala oder Banyuls der Fall. Aufgespritete Weine können sowohl trocken als auch süss sein. In der Regel ist ihr Alkoholgehalt höher als bei «normalem» Wein.
Auftakt
Der Auftakt ist der erste Eindruck, den ein Wein im Gaumen hinterlässt. Idealerweise bleibt der Auftakt in positiver Erinnerung, sodass man richtig Lust hat, weiter von diesem Wein zu trinken. Je nach Weintyp ist der Auftakt fruchtig oder frisch. Reifte ein Wein lange im Holzfass ( Barrique ), kann der Auftakt an Röstaromen erinnern. Und ist ein Wein etwas älter, so zeigt sich das auch daran, dass der Auftakt oxidative Noten offenbart.
Auktionen sind eine ideale Gelegenheit, um sich ein Bild von der Weinelite zu machen. Es genügt schon, den Auktionskatalog durchzulesen. Weinauktionen sind ein guter Spiegel der allgemeinen Wirtschaftslage. Geht es der Wirtschaft gut, steigen die Weinpreise, geht es schlecht, fallen sie. Vorsicht vor dem berühmten Kaufrausch. Auch wenn das Angebot noch so spannend ist, immer vor Augen haben, wie es im eigenen Weinkeller aussieht. Wenn man schriftlich mitbietet, unbedingt angeben, wo der Höchstpreis liegt. Es ist auch möglich, Angebote einzureichen, die unter dem Schätzwert liegen. Die Kaufchancen sind zwar nicht besonders gross, aber manchmal darf der Auktionator unter den Einstandspreis gehen, wenn bei diesem niemand bietet. Nicht vergessen, dass zum Verkaufspreis die Mehrwertsteuer und etwa 10 Prozent für den Auktionator dazukommen.
Auktion
Ich ersteigere regelmässig Wein an Weinauktionen, vor allem sehr alte Weine, die man häufig kaum mehr trinken kann. Dennoch ist es spannend zu beobachten, wie die Evolution eines Weins verläuft. Weinauktionen sind in der Regel ideale Gelegenheiten, um Trouvaillen wie rare Topweine oder gesuchte Jahrgänge zu entdecken, denn was an Weinauktionen verkauft wird, ist zu 80 Prozent nicht mehr im «normalen» Weinhandel zu finden. Beim Studium des Auktionskatalogs findet man nicht nur heraus, dass immer wieder dieselben Namen vorkommen, sondern auch, welches die Topweine der Welt sind. Ganz vorne liegt die Region Bordeaux mit ihren Top-Châteaux, gefolgt von Spitzenburgundern, ein paar Rhône-Weinen und edlen Champagnern. Italien ist mit Weinen aus dem Piemont und der Toskana, Spanien mit Kultweinen wie Pingus oder Vega Sicilia stark vertreten. Riesling-Liebhaber werden auch die eine oder andere deutsche Abfüllung finden. Die Neue Welt ist zwar etwas stärker vertreten als noch vor zehn Jahren, macht aber mit ein paar Kultweinen aus Kalifornien den kleinsten Teil aus. Sehr interessant ist das Angebot an alten Portweinen oder Madeiras. Es kommt vor, dass man über 100-jährige Abfüllungen findet. Je nach Auktionshaus besteht etwa eine Stunde vor Beginn der Versteigerung die Möglichkeit, den einen oder anderen Wein zu verkosten. Das ist ideal, wenn etwa eine grössere Sammlung einer Person verkauft wird und man durch die Verkostung erkennen kann, wie die Weine gelagert wurden. Denn einer der problematischsten Punkte bei Auktionen ist, dass man nicht genau weiss, in welchem Zustand die Weine sind. Und einmal gekauft, können sie nicht zurückgegeben werden. Es wäre falsch zu glauben, dass alle Auktionshäuser genau prüfen, woher die Ware kommt. Je elitärer das Haus, desto mehr wird kontrolliert. In guten Händen ist man beispielsweise bei Sotheby’s in London oder New York oder bei Christie’s. Aber manchmal hat man auch Lust, spontan an einer Weinauktion mitzumachen, die im nahen Umfeld stattfindet. Will man eigene Weine versteigern, schickt man am besten eine Liste dieser Weine an diverse Auktionshäuser und fragt nach, ob sie am Verkauf interessiert wären und zu welchem Preis. Unbedingt angeben, wie die Weine verpackt sind (geschlossene Originalkiste, 6er-Kisten, 12er-Kisten, Einzelflaschen) und welchen Jahrgang sie haben.
Ausbau
Nach der Gärung folgt der Ausbau des Weins. Dazu können einerseits spontane Vorgänge wie die malolaktische Gärung oder das Ausscheiden von Weinstein gehören, aber auch gezielte Massnahmen wie das Auffüllen, der Abstich, das Schwefeln, das Schönen oder das Filtrieren. Im Allgemeinen benötigt der Wein mehrere Monate oder Jahre für seinen Ausbau, je nach Sorte und Qualität. Im Grunde genommen ist der Ausbau die «Erziehung» des Weins, die manchmal etwas länger und manchmal etwas kürzer dauert.
Auslese
Steht der Begriff «Auslese» auf dem Etikett ist das ein Gütezeichen für eine höhere und vor allem spezielle Qualität. In den meisten Fällen sind Auslese-Weine weisse oder rote Topweine aus vollreifen, gesunden und spät geernteten Trauben. Die Trauben können sogar von Botrytis befallen sein, was im Fall von Wein durchaus erwünscht sein kann. Je nachdem, ob der Auslese-Wein aus der Schweiz, Deutschland oder Österreich kommt, ändern sich die genauen Vorschriften punkto Produktion. Ich serviere solche Weine gerne zum Essen und lasse ihnen vorher etwas Zeit, um sich zu entfalten.
Ausnahme
Das Weinwissen ist voller Ausnahmen. Als ich das verstanden und akzeptiert hatte, wurde es für mich viel einfacher, mit dieser grossen und komplexen Materie umzugehen. Wir kennen den Satz «Keine Regel ohne Ausnahme» – beim Wein trifft sie praktisch zu 100 Prozent zu. Wenn ich über einen Wein schreibe, dass er eine Ausnahme ist, so kann sich das auf seinen Geschmack, seinen Preis, seine Machart oder sogar seine Aufmachung beziehen. Auch ein Jahrgang kann ein AusnahmeJahrgang sein – dann war es beispielsweise untypisch heiss oder es regnete viel.
Autochthon
Wenn in Fachkreisen von autochthonen Rebsorten gesprochen wird, so heisst das nichts weiter, als dass es sich um einheimische Traubensorten handelt. Das Wort wird zusammengesetzt aus den altgriechischen Begriffen «autos» = «selbst» und «chthon» = «Erde» und bedeutet «ursprünglich, einheimisch, alteingesessen, an Ort und Stelle entstanden». Autochthone Rebsorten sind also Trauben, die in nahezu nur einem ganz speziellen Gebiet der Erde angebaut und kultiviert werden. Von einer autochthonen Rebsorte spricht man auch dann, wenn die Sorte dort ihren Ursprung hat, wo sie wächst, oder wenn sie in der Region auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken kann. Gründe dafür können sein, dass die Sorte sich nur in diesem Klima oder diesem Terroir wohlfühlt, dass die Sorte historisch in der Region verankert ist oder dass in anderen Gebieten schlicht keine Vermarktungsmöglichkeit für diese Sorte besteht. Autochthone Sorten sind das pure Gegenteil von internationalen Sorten wie Chardonnay, Merlot oder Cabernet Sauvignon. Es sind spannende Unikate, wie beispielsweise im Wallis die weissen Sorten Petite Arvine oder Amigne und die roten Humagne Rouge und Cornalin. Mit einer Walliser Winzerin habe ich eine Weinkollektion ausschliesslich aus autochthonen Schweizer Traubensorten kreiert: www.collectionchandrakurt.com.
Autoklav
Der Autoklav ist ein gasdicht verschliessbarer Druckbehälter, der bei der Schaumweinproduktion verwendet wird – etwa beim Prosecco. Dabei wird der Wein mit Zucker und Hefen in grosse druckdichte Behälter gefüllt. Diese beiden Zutaten produzieren während der zweiten Gärung CO2, also die seidigen Bläschen. Bei dieser sogenannten Prosecco-Methode dauert die zweite Gärung im Autoklav mindestens 30 Tage, während bei der klassischen Methode in der Flasche (z. B. für Champagner, Franciacorta oder Cava) dafür ein Zeitraum von Monaten oder sogar Jahren vorgesehen ist. Beide Methoden basieren auf demselben Prinzip, dass die Umwandlung von Zucker in Kohlensäure dank Einsatz von Hefen erreicht wird.
Bag-in-Box
Bei der Bag-in-Box-Verpackung wird der Wein in ein luftdichtes «Kissen» aus Folie gefüllt, das wiederum in einen Karton (mit Zapfhahn) verpackt wird. Einmal offen, bleibt der Wein einige Wochen lang frisch, da beim Korken keine Luft nachströmen kann und so ein Oxidationsprozess vermieden wird. Diese Verpackungsform ist platzsparend, wird unter Weinliebhabern aber kontrovers diskutiert, da alle Rituale rund um den Genuss aus der Flasche wegfallen. Wenig praktisch ist auch die Tatsache, dass man einen grossen Kühlschrank braucht, um die Box zu kühlen. Zudem sieht man nicht, wie viel Wein man trinkt. Andererseits wird man nie mit einem Korkfehler konfrontiert sein. Es wäre falsch zu glauben, dass nur minderwertige Weine so abgefüllt werden. Im Gegenteil.
Balance
Ein guter Wein hat – egal aus welchem Land er stammt – ein Hauptmerkmal: die Balance. Ob sie existiert oder nicht, merkt man primär im Gaumen. Denn nur wenn Alkohol, Frucht, Gerbstoffe und Säure in Harmonie zueinander stehen, kann man von einem ausbalancierten und in den meisten Fällen auch grossen Wein sprechen. Wie die Balance in einem Wein erreicht wird, ist das Geheimnis eines jeden Weinmachers. Jahr für Jahr wird unterschiedliches Traubengut geerntet und gleichzeitig kommen laufend neue Verarbeitungstechniken im Weinkeller hinzu. Nichtsdestotrotz frage ich jeden Winzer, den ich treffe, wie er es schafft, einen ausgewogenen Wein zu kreieren. Die Antworten darauf sind so vielfältig wie die Weinaromen. Die einen betonen die Arbeit im Keller, andere sehen den Schlüssel in der Wahl des richtigen Terroirs und wieder andere sind überzeugt, Balance durch das gekonnte Mischen verschiedener Trauben zu erreichen. Recht haben sie alle, und obschon es kein eigentliches Rezept für ausbalancierten Wein gibt, steht fest, dass hochstehendes Weinmachen eine ausgewogene Mischung aus kreativer Selbstsicherheit und technischer Erfahrung verlangt.
Barrique
Mit Barrique bezeichnet man heute ein Weinfass mit einem Volumen von 225 Litern. Der Begriff wurde bereits im Mittelalter als ein Bordelaiser Schiffsmass verwendet. Durch das ausgewogene Verhältnis von Holzoberfläche zu Fassvolumen gibt das Holz (in der Regel Eiche) mehr Tannin ab. In der Barrique produzierte Weine besitzen oft eine dezente, typische Vanillenote. Nicht alle Weine werden in der Barrique ausgebaut, besonders geeignet ist der Barrique-Ausbau für kräftige Weiss- und Rotweine. Je nach Qualität des Weins verbringt er mehr oder weniger Zeit im Holzfass. Meist kann man einen Wein länger lagern, wenn er einen Teil seiner Reifezeit in der Barrique verbracht hat. Ein Wein ist jedoch nicht zwingend besser, wenn er in der Barrique reifen konnte. Ob ein Winzer seinen Wein heute im Holzfass lagert oder nicht, hängt einerseits von den gesetzlichen Bestimmungen der Weinbauregion ab ( Weingesetz), und andererseits vom Weinstil, den er produzieren will. Es gibt Produzenten (ganz egal auf welchem Teil der Erde sie sich befinden), die auf das Holz schwören, andere lehnen es komplett ab. Persönlich achte ich immer darauf, dass ein Wein aus dem Holzfass keine allzu heftigen Spuren davon in sich trägt. Wichtig ist die Ausgewogenheit zwischen Aromen, Alkohol, Gerbstoffen und Säure. Siehe auch Fass.
Basiswein
Ich sage immer, dass es die Qualität der Basisweine ist, die uns etwas über die Güte des Weinhauses verrät. Denn einen qualitativ guten und entsprechend teureren Topwein zu vinifizieren ist viel einfacher als die Produktion eines guten Basisweins. Basisweine können einem den Einstieg in die Weinwelt vereinfachen. Sie helfen uns dabei, die Unterschiede in einzelnen Weinen zu erkennen. Um einen Topwein zu verstehen oder im Gaumen zu spüren, warum ein Wein der Topwein eines Weinguts ist, sollte man mit der Degustation des Basisweins beginnen und diesen mit der nächsthöheren Qualitätsstufe vergleichen. Dann erkennt
man die aromatischen Unterschiede, die komplexere Struktur und wie sich der Charakter des Weins mit jeder höheren Stufe weiter entfaltet. Ein Basiswein ist in der Regel kein Lagerwein, sondern sollte in den ersten zwei bis drei Jahren konsumiert werden. Er kann sowohl aus einer einzelnen Traubensorte vinifiziert worden sein oder auch das Resultat einer Assemblage sein. Ein guter Basiswein macht mir immer wieder grosse Freude, denn er ist meist sehr süffig und einfach zu verstehen.
Biodynamisch
Biodynamisch ist nicht mit biologisch oder ökologisch zu verwechseln. Auch wenn die beiden Bezeichnungen ähnlich klingen, unterscheiden sie sich doch voneinander. Biodynamischer Weinbau geht auf den Anthroposophen Rudolf Steiner zurück, der ein gesundes Zusammenspiel zwischen den Menschen, Tieren, Pflanzen, der Erde und anderen Planeten fördern wollte. Demeter ist ein Gütesiegel für biodynamisch erzeugte Produkte wie Wein. Im Zentrum des biodynamischen Weinbaus steht der Boden, wobei seine Revitalisierung oder Aktivierung unter Einbezug kosmischer Kräfte wie der Mondkraft stattfindet. Vorreiter des biodynamischen Weinbaus findet man in Deutschland, im Elsass, im Burgund, in der Loire und auch in der Schweiz. Nicolas Joly (Loire) oder Olivier Humbrecht (Elsass) setzen sich heute unermüdlich für diese Weinbauphilosophie ein. Persönlich kann ich bei einer Blinddegustation aufgrund der Aromen nicht erkennen, ob ein Wein biodynamisch produziert worden ist oder nicht. Bei einigen solchen Weinen ist es aber schon vorgekommen, dass sie meine Sinne ungewöhnlich intensiv in Anspruch genommen haben. Der Wein hat mich fast ein wenig erschöpft – ohne dass ich besonders viel davon genossen hätte.
Biologischer Wein
Biologischer Wein wird weltweit und mit allen Rebsorten produziert. In den 1960er-Jahren begann in der Weinszene die Bewegung «zurück zur Natur», die aber noch nie so erfolgreich und aktuell war wie heute. Biologisch erzeugter Wein schmeckt nicht besser als nicht-biologischer Wein, es wäre aber auch falsch zu glauben, dass biologische Weine weniger gut seien. Oftmals braucht biologisch produzierter Wein etwas mehr Zeit, um sich zu entfalten. Sein Genuss erfordert Geduld, sei es durch längere Lagerung oder durch das Dekantieren und das Ausschenken in grössere Gläser
In den meisten Weinbauregionen wird von Monokultur gesprochen, das heisst, dass auf dem Terroir neben den Rebstöcken keine anderen Pflanzen wachsen. Dies macht die Reben sehr anfällig für Insekten, Pilze und andere Krankheiten, da in ihrer Umgebung kein Ökosystem für natürliche Schützlinge besteht. Aus diesem Grund ist die Basis des biologischen Rebbaus nicht die Monokultur, sondern ein vielfältiger und natürlicher Lebensraum.
Spricht man von biologischem Wein, beinhaltet dies folgende Punkte:
Die Reben sind gentechfrei.
Auf den Parzellen wachsen auch Gräser und Kräuter.
Auf Unkrautvernichtungsmittel wird verzichtet.
Mineralien und organische Substanzen wie kompostierter Mist garantieren eine natürliche Düngung, der Einsatz von Kunstdünger ist verboten.
Nützlinge werden gefördert. Der Einsatz von synthetischen Insektiziden ist nicht erlaubt. Pilzkrankheiten werden nicht mit synthetischen Fungiziden, sondern mit Schwefel und nach Bedarf mit wenig Kupfer oder Tonerde bekämpft.
Die Weine werden durch Umfüllen und durch natürliche Schönungsmittel (z. B. Eiweiss) auf behutsame Art geschönt. Das Konservierungsmittel schweflige Säure wird nur in minimalen Dosen eingesetzt.
Blanc de Blanc
Diesen Begriff kennt man primär aus der Champagne. Dort bedeutet er, dass der Champagner ausschliesslich aus Chardonnay vinifiziert worden ist. Blanc de Blanc ist aber auch der Begriff für einen Weisswein, der nur aus Weissweintrauben produziert wurde. Weissweine können auch mit Rotweintrauben hergestellt werden ( Blanc de Noir), da die Weinfarbe aus der Schale und nicht aus dem Fruchtfleisch stammt. Am besten halbiert man einmal eine rote Weintraube, dann sieht man, wie hell die Frucht innen ist.
Blanc de Noir
Ein Blanc de Noir ist ein aus Rotweintrauben vinifizierter Weisswein. Da die Farbe des Weins von den Schalen der Trauben stammt, bedeutet das im Fall der Blanc-de-Noir-Weine, dass der Traubensaft beim Pressen nur ganz kurz mit den Schalen in Kontakt kam. Je länger dieser Kontakt dauert, desto kräftiger werden die Farbe und die Struktur des Rotweins. Solche Weine findet man in jeder Weinbauregion und aus den verschiedensten Traubensorten. Weisser Merlot beispielsweise ist ein Blanc de Noir, da die Merlot-Traube eine Rotweintraube ist. Auch Federweiss ist ein Blanc de Noir. Interessant sind die Blanc de Noir-Champagner – sie bestehen nur aus den beiden Sorten Pinot Noir und Pinot Meunier.
Blinddegustation
Eine Blinddegustation oder Blindverkostung ist nichts anderes, als wenn man nicht weiss, welche Weine man im Glas hat. In der Regel werden solche Proben organisiert, damit unter einer Anzahl Weinen der beste «herausdegustiert» werden kann – ohne dass die Degustatoren von den Etiketten beeinflusst werden. Solche Degustationen sind auch für mich immer wieder spannend, denn ich frage mich ständig, woran wir denken, wenn wir Wein verkosten. An seinen Preis, was wohl
die anderen am Tisch über ihn sagen werden oder dass sein Etikett bezaubernd aussieht? Vielleicht versuchen wir auch, den Merlot aus einem St-Émilion, die Eukalyptusaromen aus einem roten Chilenen und die staubigen Tannine aus einem Sangiovese herauszuspüren. Was aber würde geschehen, wenn Wein ganz ohne zu denken verkostet würde? Wenn wir für einmal nicht mit dem Gehirn, sondern mit dem Gefühl antworten würden? Wenn wir alle Informationen zur komplexen Materie Wein auf die Seite stellen würden? Es geht nicht darum, dass Unwissende eine Carte blanche bekommen, denn man kann nicht nicht denken, wenn man nicht zuvor viel gedacht hat. Es geht vielmehr darum, dass man das Unterbewusstsein an die Oberfläche kommen lässt – einmal, für einen kurzen Moment, für ein Glas Wein. Frei von der Struktur der Informationen.
Je älter wir werden, desto mehr wissen wir, ob wir etwas mögen oder nicht, ob sich etwas lohnt oder nicht, ob wir etwas vertragen oder nicht. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden. Kommt hinzu, dass wir in einem Ratgeber-Zeitalter leben. Von allen Seiten erfahren wir, wie wir leben sollen, wie etwas zu lösen oder zu verstehen ist. Aus diesem Schema auszubrechen, passiert selten unbewusst und Blindverkostungen tendieren dazu, stressiger als ein Abschlussexamen zu sein: Jeder will herausfinden, ob er den Wein richtig beschrieben hat, ob er die Herkunft erraten hat, ob er die Traube erkannt hat, ob er ihn gleich hoch wie Parker bewertet hat – kurz, ob er recht hat. Eigentlich erstaunlich, denn wenn es eine Materie gibt, die man nicht exakt messen kann, dann ist es Wein. Entstehen grosse Ideen, die verrücktesten Weinbeschreibungen oder die schönsten Erlebnisse nicht, wenn man Informationen, die man sich während Jahren angeeignet hat, bewusst einen Moment ausblendet? Zum Beispiel, indem man ein Glas Wein in die Hand nimmt, einen Schluck davon geniesst und den Wein einfach sprechen lässt. Müssen wir wirklich genau wissen, was wir trinken, damit wir es mögen? Können wir den Inhalt im Glas nicht einfach trinken und beurteilen, ob wir ihn mögen oder nicht? Unser Expertenwissen verlieren wir dadurch ja nicht – es steht uns einfach für einmal nicht im Weg. So paradox das klingen mag: Gesunder Menschenverstand kann von zu viel
Wissen und Denken erstickt werden. Und was mit einem Wein passiert, der keine Luft bekommt, wissen wir. Erfreulicherweise ist Wein nicht nur eine äusserst komplexe Materie, Wein hat auch ein unschlagbar befreiendes Element in sich: Wein ist Genuss, und Genuss ist die beste Ablenkung für zu viel Bewusstsein. Spätestens ab der zweiten Flasche denken wir nicht mehr allein in den gewohnten Mustern mit allen Vorurteilen. Im Gegenteil. Wir sagen Dinge, deren Ursprung mehr im freien Unterbewusstsein zu Hause ist. Was aber machen wir, wenn wir nur ein Glas Wein trinken? Einmal – ohne Gedanken. Ein Versuch ist es wert.
Blockbuster-Wein
Ein Begriff, den ich in den letzten Jahren immer häufiger verwendet habe, um moderne, gehaltvolle, laute und üppige Weine zu beschreiben. Blockbuster-Weine können von überall her kommen. Die Bezeichnung bezieht sich mehr auf den Stil als auf die Herkunft. Meist sind sie (wie Blockbuster-Filme) nicht kompliziert, bieten aber für einen kurzen Moment die totale Unterhaltung. Es braucht keine Vorbildung, um sie zu verstehen. Blockbuster-Weine sind fast immer dunkel in der Farbe und heftig im Geschmack, ohne dass die Gerbstoffe zu kräftig markieren. Aromatisch tauchen Noten von Schokolade, dichten schwarzen Früchten und Kaffee auf. Die meisten BlockbusterWeine reiften in der Barrique und haben einen Alkoholgehalt von über 13,5 Volumenprozent. Beliebte Traubensorten für solche Weine sind Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot, Tempranillo, Malbec, Primitivo, Grenache oder Carménère.
