Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft
Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft

Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft
Standpunkte für Wirtschaft und Gesellschaft
Eine Analyse von Ökonom
David Stadelmann. Seite 8





















Was geschieht mit dem Bahnhof? Architekt Roland Gnaiger im Interview. Seite 12
Politik und Frauen






Agenda Austria-Direktor Franz Schellhorn mahnt Reformen ein. Seite 22


Zur politischen Partizipation von Mädchen und jungen Frauen in ländlichen Räumen. Seite 40
Der Arbeitsforscher Hans Rusinek sagt: „Unser Umgang mit Zeit ist selbst- und weltzerstörerisch.“ Seite 44

Sieben Ideen für eine bessere Zukunft







Ilgs nüchterne Überlegungen
Einen Monat vor den Landtagswahlen 1949 veröffentlichte der damalige Landeshauptmann Ulrich Ilg seine „nüchternen Überlegungen vor den Wahlen“. Was Ilg da festhielt, das hat wohl auch im heurigen Wahljahr noch seine Gültigkeit. Als gutes Beispiel kann folgender, durchaus drastisch formulierte Satz des Politikers dienen: „Wir können nur hoffen, dass die Leute nicht so dumm sind und auf jeden Schmarren und jede Hetzerei hineinfallen.“

Politische Partizipation
Junge Frauen sind an politischen Themen und gesellschaftlichen Veränderungen zwar interessiert, aber selten in politische Strukturen involviert: Warum das so ist und warum traditionelle Geschlechterrollenbilder vor allem in ländlichen Räumen wirken, das erklärt Politikwissenschaftlerin Angelika Atzinger in ihrem Beitrag.
Neue Lösungen
Obwohl wir damit nur suboptimal tippen können, ist die bereits 1867 erfundene Tastaturbelegung – genannt „QWERTZ“ – auch heute noch auf allen Geräten Standard. Es sind solche Pfadabhängigkeiten, die uns am Fortschritt hindern. Denn sogenannte „QWERTZ“-Welten gibt es überall, wie Politologe Markus Rhomberg erklärt.
„Thema Vorarlberg“ jetzt einfach auf Ihrem Tablet oder Smartphone lesen. Mit der kostenlosen App read.it oder auf www.myreadit.com können über 800 Magazine und Zeitungen gelesen werden – auch Vorarlbergs Monatszeitung „Thema Vorarlberg“ ist selbstverständlich im Online-Kiosk erhältlich.


Im digitalen Wandel. Und der Brief des Herausgebers. Kurz & bündig. Aktuelles aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Made in Vorarlberg. Innovation durch Vernetzung.
Marke Vorarlberg. Über Gemeinsamkeit.
Freihandel als Grundsatz. Ökonom David Stadelmann widmet seinen Beitrag dem Freihandel. Und er schreibt dabei, dass mit der Zunahme des weltweiten Handels der Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten gestiegen ist, insbesondere in ärmeren Ländern. Vertreter der Wirtschaft üben indes am geplanten EU-Lieferkettengesetz harsche Kritik. Bregenz und der Bahnhof. Die Bestvariante scheint umgesetzt zu werden. Was sie für Bregenz bedeuten würde, das erklärt Architekt Roland Gnaiger im Interview.
Genug ist genug. Ein Appell. Und Leserbriefe.
Vollkasko gegen die Wand. Überlegungen von Christian Ortner.
Journalismus und Demokratie. Kurt Bereuet analysiert eine aktuelle Umfrage.
Papierkram. Verhaltensökonom Matthias Sutter berichtet aus seiner Forschung.
Im Rückspiegel. Vorarlbergs Wirtschaft im Februar. Sieben Ideen. Franz Schellhorn formuliert, was Österreich gut täte.
KI in Unternehmen. 1000 Besucher bei einer WKV-Veranstaltung.
Vorarlberg in Zahlen. Wissenswertes aus unserem Land.
Der gespaltene Berg. Ein Bild aus dem Jahr 1970.
Kunst.Hubert Lampert.
Nachgedacht. Vorarlbergerinnen kommentieren.
Im Ausland. Die Schriftstellerin Daniela Alge im Porträt.
Tradition. Schuhhaus Vögel, die dritte Generation.
Medizin. Ein Etappensieg im Kampf gegen den Lungenkrebs.
In aller Kürze. Wissenschaftliche Erkenntnisse.
Überwintern. Die Strategien der Schmetterlinge.
Jonathan Meese. Das Enfant terrible der Kunstszene im Gespräch mit Gerald A. Matt.
Sozialversicherung. Ein Rückblick in die Anfänge. Landesarchiv. Über liederliches Zechen.
Vom Aufheben. Achtlos weggeworfen: Eine bemerkenswerte Ausstellung. Die Villa Raczynski. Einst ein Geschenk eines Grafen an seine Gattin. Frauen in der Politik. Eine Analyse.
Frauen und der Krieg. Ein Essay von Stefania Pitscheider Soraperra.
Wenn alte Ideen blockieren. Was es mit Pfadabhängigkeiten auf sich hat. Gedankenhappen. Was andere in anderen Medien berichten.
Gehetzt. Arbeitsforscher Hans Rusinek im Interview.
Ulrich Ilg. Nüchterne Überlegungen. Abgehakt. Eine Hand voll Sprüche. Und Clint Eastwood.
„Spätestens seit Corona ist in Österreich die Gießkanne das meistgenützte politische Instrument“ – das sagt Medienmanager Christian Ortner.
IN DIESER AUSGABE VON
Freihandel als Grundsatz: Unter diesem Titel berichtet der Ökonom David Stadelmann im Schwerpunkt dieser Ausgabe, dass die Stimmen der Globalisierungsgegner mittlerweile leiser geworden seien. „Die Realität hat sie eingeholt“, konstatiert Stadelmann, „und diese Realität gestaltet sich deutlich anderes.“ Dem Professor für Volkswirtschaftslehre zufolge besteht –beispielsweise – die Hauptauswirkung westlicher Investitionen in armen Ländern darin, „die Produktivität und darauffolgend Löhne sowie Arbeitsstandards zu verbessern“. Stadelmann sieht Fortschritte in eine positive Richtung, und das in mehrfacher Hinsicht. Einen Fortschritt soll auch das geplante EU-Lieferkettengesetz bringen. Doch was gut gemeint sein mag, ist für die Wirtschaft nicht überblickbar und auch nicht administrierbar, wie Experte Klaus Friesenbichler im Interview sagt. Der WIFO-Ökonom sagt auch: „Wir haben in Österreich eine wenig rational geführte, emotionalisierte Diskussion.“
Medienmanager Christian Ortner kritisiert in seinem Beitrag indes, dass die Gießkanne in Österreich das meistgenützte politische Instrument geworden ist, während die studierte Politologin Angelika Atzinger erklärt, warum in Vorarlberg Mädchen und Frauen an der Politik zwar interessiert, in selbiger aber kaum involviert sind. Und wie Medienaskese und Wahlverhalten zusammenhängen, das erklärt anschließend Kurt Bereuter; der Publizist stützt sich dabei auf eine aktuelle, durchaus alarmierende Umfrage in Österreich.
Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, formuliert indes sieben Ideen, die unser Land in eine bessere Zukunft brächten. Wobei Schellhorn auf deren Umsetzung drängt: „Österreich braucht Reformen, sonst werden die Probleme immer größer.“ Was aber ist, wenn sich das Bessere gar nicht durchsetzen kann, weil sich das Schlechtere bereits etabliert hat? Politikwissenschaftler Markus Rhomberg berichtet in seinem Beitrag, was es mit sogenannten Pfadabhängigkeiten auf sich hat – und wie sich diese überwinden lassen.
Doch zum Nachdenken braucht man Zeit. Wie aber soll man in unserer hektischen Zeit Abstand gewinnen, um Entscheidungen in Ruhe überdenken zu können? Arbeitsforscher Hans Rusinek setzt im Interview an diesem Punkt an, er sagt dabei: „Wir verwechseln Produktivität mit Gehetztheit, mit diesem rasenden Stillstand, der uns davon abhält, Entscheidendes zu hinterfragen und anders zu machen.“
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen im Namen der gesamten Redaktion …

Andreas Dünser Chefredakteur
IMPRESSUM
Herausgeber und Medieninhaber: Wirtschaftskammer Vorarlberg, Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch Internet: www.themavorarlberg.at
E-Mail: info@themavorarlberg.at Verlagsort: Feldkirch Chefredakteur: Andreas Dünser Redaktion: Herbert Motter (stellvertretender Chefredakteur), Sabine Barbisch, Eva Niedermair, Julia Schmid, Nora Weiß, alle Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch Ständige Autoren: Kurt Bereuter, Klaus Feldkircher, Christian Feurstein, Thomas Feurstein, J. Georg Friebe, Wilfried Hopfner, Christoph Jenny, Edgar Leissing, Andrea Marosi-Kuster, Gerald A. Matt, Peter Melichar, Christina Meusburger, Manuela de Pretis, Martin Rümmele, Angelika Schwarz, David Stadelmann, Matthias Sutter, Andreas Unterberger Gastautoren dieser Ausgabe: Angelika Atzinger, Alfons Dür, Carina Ebenhoch, Silvia Ettl-Huber, Simon Groß, Andrea Huber, Hubert Lampert, Claudia Niedermair, Christian Ortner, Stefania Pitscheider Soraperra, Markus Rhomberg, Franz Schellhorn, Markus Schmidgall, Monika Wagner Fotografen: Markus Gmeiner, Lisa Mathis
Layout/Grafik/Umsetzung: Michael Türtscher Grafisches Konzept/Design: Ralph Manfreda Druck: Russmedia Verlag GmbH
Herstellungsort: Schwarzach. Nachdruck nach Absprache gestattet, Fotos ohne Bildnachweis stammen aus unserem Archiv. Erscheinungsweise: jeden ersten Samstag im Monat, ausgenommen Jänner und August. Leserbriefe an leserbrief@themavorarlberg.at Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. Druckauflage: 61.500 Offenlegung der Eigentumsverhältnisse nach § 25 Mediengesetz: Wirtschaftskammer Vorarlberg, siehe auch http://themavorarlberg.at/offenlegung Grundlegende Richtung: Informationen zu aktuellen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen Anzeigenannahme: Media Team Kommunikationsberatung, 6840 Götzis, Hauptstraße 24, www.media-team.at, markus.steurer@media-team.at, ✆ 05523 52392

Roland Gnaiger
Der Architekt erklärt, welche BahnhofsVariante Bregenz aufblühen ließe.

Jonathan Meese
Das Enfant Terrible der Gegenwartskunst, im Gespräch mit Gerald Matt.

Stefania Pitscheider Soraperra
Im Krieg ist stets von Männern die Rede. Was aber ist mit den Frauen? Ein bemerkenswerter Essay.

Hans Rusinek
Der Arbeitsforscher sagt: „Wir verwechseln Produktivität mit Gehetztheit.“
„THEMA VORARLBERG“
IST EINE PUBLIKATION DER

Unternehmen mit Nutzung fortgeschrittener Informations- und Kommunikationstechnologien in Prozent aller Unternehmen – mit Nutzung von …
Brief des Herausgebers
Das Ziel ist gut, der Weg ist falsch
Es ist unbestritten, dass wir Klima und Menschen bestmöglich schützen müssen, und dass viele Maßnahmen und Schritte zu setzen sind, damit unsere Umwelt höchstmöglich intakt bleibt und die Situation prekärer Arbeitsverhältnisse in vielen Regionen der Welt verbessert wird.
Das Ziel der EU ist es wohl, die hohen ethischen Standards, die bei uns gelten, auch außerhalb der EU zu stärken. Die Frage aber bleibt, ob ein nicht administrierbares Gesetz innerhalb der EU sich positiv auf die Lebenssituation der Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern auswirken kann.
Denn Europa muss bei diesen „weltumspannenden Ideen“ auch darauf achten, dass wir dabei die wirtschaftliche
Entwicklung unseres EU-Lebensraumes nicht übergebührlich strapazieren. Denn der damit verbundene bürokratische Aufwand trifft zuerst unsere Unternehmen und in der Folge uns alle. Und in der Folge besteht die Gefahr, dass der gesamte europäische Wirtschaftsraum weiter an globaler Wettbewerbsfähigkeit verliert. Mit der möglichen Auswirkung, dass auch der hart erarbeitete Wohlstand verloren gehen könnte.
Ob daher der Weg, wieder einmal die Unternehmen dafür in die Pflicht zu nehmen, damit sich anderswo „die Welt verbessert“, der richtige ist, darf schon stark bezweifelt werden. Die EU könnte ja auch versuchen, die offensichtlichen Missstände, welche in manchen Ländern definitiv gegeben sind, auf politischem
Weg zu lösen, anstatt mit einem weiteren immensen bürokratischen Aufwand wiederum die Unternehmen zu belasten. Die Wirtschaft stöhnt jedenfalls jetzt schon unter den vielen Lasten, welche den ökologischen Transformationsprozess begleiten (neben den vielen sonstigen Herausforderungen Rohstoff, Energie, Teuerung, um nur wesentliche zu nennen).
Deshalb ist es schon richtig, wenn die Verhandlungen zu diesem Gesetz noch einmal intensiviert werden. Ich gebe zu, das hätte man auch schon in einer früheren Phase der Konsultationen tun können, man hätte sich damit eine solche Aufregung im letzten Moment erspart. Hoffen wir, dass weitere Konsultationen zum einen eine administrierbare Lösung
Unternehmen mit Aufholbedarf
Das Ausmaß, in dem Unternehmen Künstliche Intelligenz, Data Analytics und fortgeschrittene Cloud Services nutzen, hängt zwar maßgeblich vom Wirtschaftszweig, der Unternehmensgröße und vom Standort ab; aber im Durchschnitt gerechnet, setzt einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria zufolge bisher lediglich eines von zehn österreichischen Unternehmen auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Data Analytics und fortgeschrittene Cloud Services werden von jedem vierten beziehungsweise dritten Unternehmen in Österreich genutzt, auch das sind Durchschnittswerte.
In Summe ist bei 47 Prozent aller österreichischen Unternehmen zumindest eine dieser fortgeschrittenen Technologien im Einsatz, im europaweiten Vergleich ordnet sich Österreich damit allerdings nur im unteren Drittel ein; Finnland (90 Prozent) führt die Tabelle an, vor Dänemark (77 Prozent). Im österreichweiten Vergleich schlagen sich Vorarlbergs Unternehmen übrigens recht gut: 53,6 Prozent der hiesigen Unternehmen setzen eine der erwähnten Technologien ein, das bedeutet Platz zwei in Österreich, Wien liegt mit einem Prozentpunkt voran. 12,2 Prozent der Vorarlberger Unternehmen nutzten der Statistik Austria zufolge Künstliche Intelligenz.
für unsere Wirtschaft bringen und zum anderen zu einer wirklichen Verbesserung der Situation in den Schwellenländern führen können.
Übrigens: Eine wirkungsvolle Abstimmung darüber, woher Güter kommen und auf welche Art und Weise sie produziert werden, können die Konsumenten geben, indem sie bewusst kaufen und auf beispielsweise „made in EU“ achten.

Über Geschichte – und berechtigte Argumente.




1 | Leerstand in Salzburg
Wie die „Salzburger Nachrichten“ jüngst berichteten, kämpft die Salzburger Altstadt zunehmend mit Leerstand und damit mit einer Entwicklung, die nicht nur für die Bausubstanz der Gebäude, sondern auch für den Standort problematisch ist. Auf der Suche nach Lösungen, sprich nach „Rezepten gegen die Leere“, wird in Salzburg nun auch über Hohenems diskutiert. Die zuständige Salzburger Baustadträtin Anna Schiester bezeichnete die Nibelungenstadt jedenfalls als Vorbild: „Dort wurden ganze Häuserzeilen saniert und gezielt durch einen Branchenmix belebt.“ Die Zentralvereinigung der Architekten Österreichs hatte im Vorjahr das Projekt „Wiederbelebung der Altstadt Hohenems“ mit dem Bauherrenpreis ausgezeichnet. Hohenems, das positive Beispiel, wird zunehmend bekannter.
2 | Kabarettist Wagner
Der österreichische Kabarettist Berni Wagner wurde dieser Tage von „Der Welt am Sonntag“ augenzwinkernd gefragt, wie denn ein Deutscher reden müsse, um in Wien nicht negativ aufzufallen. Der gebürtige Linzer antwortete, man solle keinesfalls versuchen, den Wiener Dialekt zu imitieren, da man ansonsten schnell enttarnt werde: „Wenn man partout nicht als Deutscher wahrgenommen werden möchte, sollte man einfach behaupten, dass man aus Vorarlberg stammt.“ Die Vorarlberger hätten einen eigenen Dialekt, den man im Rest von Österreich nicht versteht: „Deshalb bemühen sie sich um ein möglichst sauberes Hochdeutsch und sind von Deutschen kaum zu unterscheiden.“ Man müsse als Deutscher in Wien also nur sagen, dass man „aus Dornbirn“ sei, erklärte Wagner: „Und schon ist man durch.“
3 | Liechtensteins Außenministerin
Liechtensteins Außenministerin, Dominique Hasler, warb dieser Tage in einem von der APA geführten Interview für ein starkes Europa. Auch wenn es „wie in jeder Partnerschaft Höhen und Tiefen“ gebe, führe daran kein Weg vorbei, sagte die 45-Jährige in Wien. Zwar wird im außenpolitischen Bericht der Liechtensteiner Landesverwaltung ein offenbar kritischer Blick auf die aktuelle Befindlichkeit der EU geworfen, dies ändere laut Hasler jedoch nichts daran, dass die EU „auch in schwierigsten Zeiten bewiesen hat, dass sie resilienzfähig ist“. Die Liechtensteinerin lobte zudem „die gute Zusammenarbeit mit den zentralen Partnern Österreich und Deutschland“, sagte jedoch mit Blick auf Vorarlberg: „Im Rheintal, in diesem überregionalen Raum, ist noch viel Potenzial für grenzüberschreitendes Arbeiten gegeben.“
4 | Gerhard Schwarz
Nicht nur die Geschichte ist prägend, sondern auch das, was über die Geschichte gelehrt wird; unter anderem mit diesen Worten schrieb Gerhard Schwarz, der Präsident der Schweizer Progress Foundation, jüngst in der „NZZ“ gegen die „verbreitete Geschichtsvergessenheit“ an. Denn Schwarz zufolge wird Geschichte oft auch nur als politische Geschichte vermittelt, Wirtschaft spiele kaum eine Rolle, und wenn, dann selten eine positive: „Dabei ist unser tägliches Leben mehr durch die Geschichte der Wirtschaft geprägt als durch die der Politik. Wie wir heute wohnen, essen, uns kleiden, fortbewegen, gegen Krankheiten schützen, verdanken wir großteils visionären Unternehmern, die einst Risiken auf sich nahmen, an Ideen glaubten, sie gegen Widerstände durchsetzten.“ Doch indem man das im Geschichtsunterricht zu wenig abbilde, schaffe man subtil einen Nährboden für Wirtschaftsfeindlichkeit. Schwarz schrieb: „Dass das, was vor uns war, nicht einfach Schnee von gestern ist, sondern Gegenwart und Zukunft prägt, scheint aus dem Bewusstsein zu verschwinden.“



5 | Rauch und Moosbrugger
Mit dem Ziel, Tierleid so rasch wie möglich zu beenden, hatte sich der für Tierschutz zuständige Minister Johannes Rauch Ende Jänner dafür ausgesprochen, die Übergangsfrist zur Umsetzung des Verbots von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung bereits 2030 enden zu lassen. Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger, der an dieser „willkürlich festgesetzten Jahreszahl“ prompt harsche Kritik geäußert hatte, legte nun im „Ö1 Journal“ nach. Die Landwirtschaft, sagte der Dornbirner, stehe unter zunehmendem Druck, wie zu produzieren sei: „Aber letztendlich ist der Preis ein ganz zentrales Argument beim Einkauf. Das war gerade in den vergangenen Monaten zu spüren.“ Dieser Spagat zwischen höchsten Anforderungen und geringstem Preis sei in der Produktion aber nicht zu schaffen: „Die Landwirtschaft ist bereit, sich auch in der Haltung weiterzuentwickeln, aber das braucht den Markt, das braucht verlässliche Partnerschaften und das braucht kostendeckende Erlöse für die Landwirtschaft.“ Nun ist Tierwohl wohl vielen ein Anliegen, aber nur wenige Konsumenten sind bereit, auch mehr zu zahlen; ein Ausweg in diesem Abtausch berechtigter Argumente ist nicht in Sicht.

Mit der Innovations- und Technologiebörse #ITB24 bietet Organisatorin Konstanze Vetter einen Rahmen für den Start innovativer Projekte. Am 21. März 2024 finden sich im Festspielhaus Bregenz bei 1zu1-Gesprächen Kooperations- und Forschungspartner, bei Kurzvorträgen die richtigen F&E-Förderungen für die geplanten Vorhaben sowie in Marktatmosphäre potenzielle Lieferanten und Kunden. wisto.at/itb24

Text von MANUELA DE PRETIS WirtschaftsStandort Vorarlberg, Dornbirn
7,3 Millionen für Projekte, die helfen, dem landesweiten Zukunftsbild vom chancenreichen Lebensraum, näher zu kommen.
Von Christina MeusburgerDie Vorarlberger Landesregierung unterstützt die Vision der Marke Vorarlberg seit Beginn dieses Jahres mit elf Schlüsselprojekten. Diese sind in den Bereichen Wohnen und Bildung angesiedelt. Um leistbares und bedarfsgerechtes Wohnen auch in Zukunft zu ermöglichen, sollen mit „Wohnen 550“ insgesamt 300 Wohnungen geschaffen werden, die mit einem Gesamtentgelt von monatlich 550,- Euro gedeckelt sind. Dabei handelt es sich um 2-Zimmer-Wohnungen, die vor allem jungen Paaren oder Familien helfen sollen, sich ein paar Jahre lang etwas ansparen zu können.
Im Bildungsbereich lautet der Schlüssel „gesund aufwachsen“. Dazu zählen vor allem viel Bewegung, gesundes Essen, sozialer Zusammenhalt und Lernhilfen für alle, die es brauchen. Mit der „täglichen Bewegungseinheit“ hat Vorarlberg eine Vorreiterrolle eingenommen. Der Bund hat im letzten Jahr jedem Bundesland eine Pilotregion finanziert. Vorarlberg hat als einziges Bundesland eine zweite Pilotregion dazu finanziert. Gemeinsam mit Bewegungscoaches turnen, spielen und laufen die Kinder täglich eine Stunde. Bewegungscoach Fabrice Bautista von der Sportunion berichtet uns: „Die Arbeit als Bewegungscoach gefällt mir sehr gut. Es wird immer

wichtiger, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, gesund und fit zu bleiben. Die Kinder sollen Freude und Spaß an den Spielen haben und dadurch eine positive Einstellung zum Sport aufbauen. Ultimativ wird das die Freude an Bewegung ankurbeln und einen guten Einfluss auf ihr Leben haben.“ Für dieses Jahr ist in Vorarlberg bereits eine landesweite Ausrollung der „täglichen Bewegungseinheit“ vorgesehen.
Mit „Kinder.Essen.Körig“ kommt ein leistbares, gesundes und regionales Mittagessen an die Schulen und Kindergärten. Das Land nimmt dafür 1,5 Millionen Euro in die Hand. Das Fördermodell kommt nicht nur Kindern und Familien,
an regionalen Produkten ist, desto höher fällt die Förderung aus. Ein Großteil der Gemeinden hat bereits Interesse bekundet.
Lerncafés
Die Caritas Lerncafés sind ein qualitativ hochstehendes Angebot an kostenloser Lernbetreuung bis zur 9. Schulstufe. Sie werden ebenfalls verstärkt gefördert. Aktuell werden an 16 Standorten über 480 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren aus einkommensschwachen und armutsgefährdeten Familien beim Lernen und schulischen Vorankommen unterstützt. Durch die regelmäßige Betreuung in einem fachlich pädagogischen Umfeld verbessert
an drei weiteren Standorten auszubauen, wodurch weitere 70 Lernplätzen für Kinder und Jugendliche angeboten werden können.
Die nächste Veranstaltung der Marke Vorarlberg: 20. März 2024 „Wissen verbindet“, Firma Omicron, Klaus, ab 17 Uhr. Anmeldungen unter www.vorarlbergchancenreich.at/wissenverbindet

Zur Person
CHRISTINA MEUSBURGER Kommunikation
Marke Vorarlberg
Freihandel ist das Pendant zum Protektionismus. Im Gegensatz zu diesem verzichtet der Freihandel auf Handelshemmnisse, um den Handel zwischen den Staaten zu fördern. David Ricardo entwickelte vor über 200 Jahren das, was wir heute die klassische Außenhandelstheorie nennen. Seine Frage: Worin besteht der Vorteil des internationalen Handels? Die Antwort: Jedes Land produziert das, was es am besten kann –und produziert durch den Austausch von Waren in Summe mehr. Das hat sich bis heute bewährt.
Als kleines Land mit knapp neun Millionen Einwohnern ist Österreich auf den Handel mit anderen Ländern angewiesen. Ein möglichst ungehinderter Zugang zu Auslandsmärkten ist für Konsumenten und Unternehmen gleicher-
maßen von entscheidender Bedeutung. Gerade in der jetzigen Situation ist es essenziell, über alle Kanäle Wachstumsimpulse zu erzeugen.
Märkte müssen offengehalten und die Umsetzung von Regeln garantiert werden. Dazu tragen die EU-Handelsabkommen bei, indem sie helfen, den negativen Auswirkungen der Coronakrise entgegenzuwirken, Resilienz aufzubauen und Lieferketten zu diversifizieren und zu sichern.
Handelsabkommen bestimmen die Rahmenbedingungen für die internationalen Wirtschaftsaktivitäten der Unternehmen aus Österreich. Abkommen dienen dem Abbau von Zöllen und der Beseitigung von ungerechtfertigten bürokratischen Hürden im Handel. Um im Außenhandel auch künftig erfolgreich
zu sein und so weiterhin Wohlstand und Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen beziehungsweise zu sichern, benötigen exportorientierte österreichische Unternehmen verbesserte Rahmenbedingungen auf ihren Exportmärkten und keine zusätzliche überbordende Bürokratie.
Dass Freihandel auch mit ökologischen und sozialen Problemen einhergeht, ist unbestritten. Aber gleichzeitig war und ist er das Rückgrat für unseren Wohlstand, wie auch für den beeindruckenden Rückgang der Armut in der Welt.
Es mag sie dennoch geben, die Skeptiker des freien Handels, der bösen Globalisierung. Kritiker greifen immer wieder zur Behauptung, die handelsbedingten Wachstumsvorteile kämen nur den Eliten und nicht den Armen zugute, seien
also unausgewogen. In Indien allerdings hat das Wachstum aufgrund von Reformen, darunter der Handelsliberalisierung, fast 200 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Für China, das noch stärker wächst, wird geschätzt, dass seit dem Beginn der Reformen mehr als 300 Millionen Menschen die Armutsgrenze nach oben überschritten haben.


Die alte Leier der Globalisierungsgegner in den vergangenen Jahrzehnten lautete, Freihandel würde zu Lohndumping führen und Arbeits- sowie Umweltstandards senken. Nur große Unternehmen würden von der Globalisierung profitieren, während der Rest der Gesellschaft – sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern – den Kürzeren ziehe. Mittlerweile sind die Stimmen der Globalisierungsgegner leiser geworden. Die Realität hat sie eingeholt und diese gestaltet sich deutlich anders.
Mythos der Verarmung durch Freihandel
Mit der Zunahme des weltweiten Handels seit 1990 und dessen weiterer Ausdehnung ab dem Jahr 2000 – zusätzlich angefacht durch den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation – ist der Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten gestiegen, insbesondere in ärmeren Ländern. Die Kinderarbeit ist weltweit zurückgegangen, obwohl sie aufgrund des Bewusstseins über die Existenz von Zulieferern in derzeit noch armen Ländern und aufgrund der globalen Vernetzung
für manche vielleicht präsenter erscheint als vor 30 Jahren. Zudem gibt es keine Senkung von Standards im Umweltbereich. Mit zunehmendem Wohlstand schützen Länder ihre Umwelt verstärkt, und der weltweite Handel beschleunigt den Übergang zu neuen, als „grün“ bezeichneten Technologien.
Handel hebt den Wohlstand
Unternehmen und Investoren suchen nicht gezielt die ärmsten Länder der Welt auf, um sie auszubeuten, sondern tätigen ihre Investitionen hauptsächlich in verhältnismäßig wohlhabenden Ländern und Schwellenländern. Wenn sie in besonders arme Länder investieren, sei es durch Direktinvestitionen oder durch Investitionen in ihre Zulieferer, besteht die Hauptauswirkung der Investitionen darin, die Produktivität und darauffolgend Löhne sowie Arbeitsstandards zu verbessern. Auch wenn die Löhne und Standards natürlich noch nicht das hohe Niveau der USA oder vieler EU-Länder erreichen, ist im Vergleich zu vor mehr als 30 Jahren ein Fortschritt in eine positive Richtung erkennbar.

Prof. Dr. David Stadelmann ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth (Deutschland); Fellow bei CREMA – Center for Research in Economics, Management and the Arts; Fellow beim Centre for Behavioural Economics, Society and Technology (BEST); Fellow beim IREF - Institute for Research in Economic and Fiscal Issues; Fellow am Ostrom Workshop (Indiana University); Mitglied des Walter-Eucken-Instituts. david.stadelmann@ uni-bayreuth.de

Nahezu jede Prognose und Warnung der Globalisierungsgegner hat sich als weitestgehend unzutreffend erwiesen. Die Betrachtung globaler Daten offenbart, dass der weltweite Anteil der Beschäftigten, die in extremer Armut leben, zwischen 2000 und 2022 von rund 26,3 Prozent auf 6,4 Prozent gesunken ist. Ohne die teilweise übertriebenen Lockdowns während der Corona-Pandemie wäre die extreme Armut mit hoher Wahrscheinlichkeit noch stärker zurückgegangen.
Ein Indikator für Ausbeutung ist Kinderarbeit. Zwischen 2000 und 2020 verringerte sich der Anteil der Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren, die Arbeiten verrichteten, für die sie gemäß der gängigen Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen zu jung waren oder die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden könnten, von etwa 16 Prozent auf 9,6 Prozent. Es ist bemerkenswert, dass Kinder in ländlichen Gegenden armer Länder etwa dreimal so oft arbeitstätig sind wie in städtischen Gebieten, in denen sich eher Zulieferbetriebe für westliche Unternehmen befinden. Zulieferer bieten vielleicht
Die Stimmen der Globalisierungsgegner sind leiser geworden. Die Realität hat sie eingeholt: Mit der Zunahme des weltweiten Handels ist der Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten gestiegen, insbesondere in ärmeren Ländern. Auch die Kinderarbeit ist zurückgegangen. Es ist vielfach ein Fortschritt in eine positive Richtung erkennbar.
Von David Stadelmann
>> keine großartigen Löhne nach westlichem Verständnis, aber doch oft solche, dass Eltern ihre Kinder nicht zur Arbeit schicken müssen, sondern sie zur Schule gehen lassen können.
Auch im Bereich der Umwelt zeigt sich, dass ein steigender Wohlstand oft mit einer Verbesserung der Umweltqualität einhergeht. Der Environmental Performance Index der Yale University und ihrer Partner versucht, die ökologische Nachhaltigkeit nahezu aller Länder weltweit zu bewerten, wobei Faktoren wie Biodiversität und Luftverschmutzung mitberücksichtigt werden. Demokratische Marktwirtschaften, die aktiv am Freihandel teilnehmen, belegen die oberen Ränge. Autokratien mit geringem Außenhandel belegen hingegen eher die unteren Ränge.
Warum erhöht Freihandel den Wohlstand?
Das Aufkommen globaler Wertschöpfungsketten hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre Zulieferer in anderen Ländern als Bestandteil ihres eigenen Geschäftsmodells betrachten. Technologien und Prozesse, die für eine effizientere Produktion dienlich sind, finden dadurch weltweit Verbreitung. So konnten viele ärmere Länder, wie Indonesien oder Vietnam, sowie mittlerweile wohlhabende Länder wie etwa Polen, mehrere Entwicklungsstufen überspringen und rasches Wachstum realisieren. Sie sind heute ein Teil der globalen Wertschöpfungsketten.
Wenn politische Entscheidungsträger keine Handelshemmnisse schaffen, sondern die Rolle ihrer Länder als Zulieferer und Empfänger von Direktinvestitionen als Chance begreifen, erscheinen auch Infrastrukturinvestitionen sinnvoller. Sobald Straßen, Häfen und Fabriken errichtet sind, um beispielsweise Textilien oder Plastikspielzeug herzustellen und zu


Der weltweite Handel beschleunigt den Übergang zu neuen, als „grün“ bezeichneten Technologien.
transportieren, können diese Infrastrukturen auch teilweise für High-Tech-Industrien genutzt werden. Viele Schwellenländer, insbesondere China, demonstrierten bereits, wie realistisch dieser Weg ist.
All dies ermöglicht es Arbeitnehmern, mit ihrer Arbeit einen höheren Wert zu schaffen. Dann erhalten sie auch eine bessere Vergütung. Tatsächlich bieten exportorientierte Unternehmen in armen Ländern höhere Löhne als Produzenten, die nur für den heimischen Markt produzieren – noch besser zahlen nur direkt ausländisch geführte Unternehmen. Die Arbeit ist bei Zulieferern in ärmeren Ländern attraktiver und die Arbeitsstandards sind höher als in anderen Wirtschaftsbereichen. Die Weltbank empfiehlt beispielsweise zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität in der kambodschanischen Wirtschaft, dass dort einheimische Unternehmen dieselben Arbeitsstandards wie die Bekleidungsfabriken von Zulieferern für den internationalen Markt anwenden sollen.
Nicht alles ist rosig
Die Argumente der Globalisierungskritiker waren stets wenig konsistent und die Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre demonstrieren das Potenzial des Freihandels für die weltweite Steigerung des Wohlstands.
Doch eine konsistente ökonomische Perspektive muss berücksichtigen, dass Freihandel nicht immer ausschließlich positive Auswirkungen hat. Ein Argument in diesem Kontext ist die Schutzbedürftigkeit junger Industrien. Es postuliert, dass neue Branchen möglicherweise vor internationaler Konkurrenz geschützt werden müssen, bis sie ausgereift und wettbewerbsfähig sind. Dieses Argument ist theoretisch stichhaltig. Allerdings berücksichtigt es politökonomische
Anreizstrukturen unzureichend. Wird ein Wirtschaftssektor vor ausländischer Konkurrenz geschützt, ist eine positive Entwicklung nicht garantiert, da es für die Begünstigten oft rentabler ist, sich politisch für dauerhaften Schutz und immer neue Subventionen einzusetzen.
Angesichts des weltweit steigenden CO2-Ausstoßes könnte es sinnvoll sein, den Freihandel durch Klimazölle etwas zu regulieren. In Ländern, die Klimaschutz effizient durch eine CO2-Bepreisung betreiben, sind die Produktionskosten aufgrund der Bepreisung etwas höher. Um diesen Nachteil im internationalen Wettbewerb auszugleichen, wird mitunter vorgeschlagen, einen Ausgleich über Klimazölle zu schaffen. Dadurch würden CO2-intensive Produkte aus Ländern, die keinen oder nur wenig Klimaschutz betreiben, mit einem Zoll belegt, um den Wettbewerb gegenüber jenen, die das Klima schützen, „fairer“ zu gestalten. Wiederum ist dieses Argument theoretisch stichhaltig. Allerdings werden auch hier politökonomische Aspekte vernachlässigt. Klimazölle verursachen einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Zudem besteht die große Gefahr, dass sie für protektionistische Zwecke missbraucht werden. Dies ist sogar wahrscheinlich, da „Klima“ heutzutage eine Rechtfertigung für fast jede beliebige Maßnahme zu sein scheint, die den aktuellen politischen Entscheidungsträgern gerade genehm ist.
Obwohl es theoretisch nachvollziehbare Argumente gegen Globalisierung und Freihandel geben kann, stellt Freihandel angesichts der oft völlig verzerrten Anreize in der Politik eine hervorragende Grundregel dar. Vom Prinzip des Freihandels sollte daher nur in absoluten Ausnahmefällen und dann auch nur für eine im Voraus stark begrenzte Zeitperiode abgewichen werden.
„Eine wenig rational geführte Debatte“
EU-Lieferkettengesetz: Klaus Friesenbichler (44), stellvertretender Direktor des Lieferketteninstituts ASCII und Senior Economist beim Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), sagt im Interview, dass im Interesse aller eine praktikable Lösung gefunden werden müsse.
Von Andreas DünserFreihandel wird von der österreichischen Bevölkerung mehrheitlich skeptisch gesehen, man sieht eher die Nachteile, denn die Vorteile. Wie bewerten denn Sie diese Haltung, Herr Friesenbichler?
Wir haben in Österreich eine wenig rational geführte, emotionalisierte Diskussion über internationale Arbeitsteilung und somit auch über Freihandel. Da wird sehr polarisiert diskutiert. Und dass es da so eine fundamentale Gegnerschaft gibt, das ist für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die österreichische eine befremdliche Situation.
Auch das EU-Lieferkettengesetz wird kontrovers diskutiert.
Auch hier ist beobachtbar, dass die Debatte nicht mehr rational geführt wird. In Österreich, aber auch auf europäischer Ebene, ist das nur noch ein Schlagabtausch plakativer Schlagwörter. Und ich weiß nicht, ob die Regulierung in Brüssel jetzt tatsächlich noch inhaltlich verhandelt wird. Dabei wäre ja eigentlich Ziel, zu einer effektiven Regulierung zu kommen; also zu einer Regulierung, die ministrabel ist, die kosteneffizient ist, also für Unternehmen auch leistbar. Wir hätten ja nichts von einer Regulierung, die zu restriktiv und zu teuer wäre und so scharf umgesetzt würde, dass unternehmerisches
Handeln dann kaum mehr möglich ist.
Der Tenor aus der Wirtschaft, aus der Industrie lautet: Niemand will Kinderarbeit, niemand will die Umwelt zerstören.
Aber die Richtlinie in dieser Form ist nicht überblickbar und nicht administrierbar.
Dass die Administrierbarkeit und Überblickbarkeit
zugehörigkeit Bescheid, und wir können –bei Waren sehr gut, bei Dienstleistungen etwas weniger gut – einschätzen, wie internationale Handelsverflechtungen aussehen. Unser Tool zeigt nun das Firmennetzwerk inklusive Handelsverflechtungen: Es sind 30 Millionen europäischen Firmen in rund 900 Millionen Lieferbeziehungen. Doch trotz der Größe handelt es sich letztlich um ein Small-World-Netzwerk.
Soll heißen?
Geht man zwei, drei, maximal vier Lieferschritte zurück, landet man in einer Gegend, in einem Land, bei einem Lieferanten, der potenziell problematisch ist. Vor allem in den sogenannten Hochrisiko-Sektoren, die ein hohes Risiko aufweisen für Umwelt- und Sozialverstöße. Das sind die Landwirtschaft, die Textilindustrie und der Bergbau. Betrachtet man nun die Lieferketten beispielsweise bei Textilien, dann dürften circa 80 Prozent der textilverarbeitenden europäischen Unternehmen letztlich Güter und Dienstleistungen von „problematischen“ Lieferanten beziehen. Und jetzt stellt sich die Frage: Wie geht man damit um? Wie kann ein entwicklungspolitisches Instrument auch praktikabel umgesetzt werden?

kritisiert werden, ist nachvollziehbar. Man diskutiert letztlich eine Art Globalhaftung, die so gut wie alle Unternehmen trifft. Jetzt kommen wir aber zu einem für Sie als Journalisten und für mich als Forscher wenig ergiebigen Punkt, der leider ganz zentral ist: Diese Regulierungen werden hinter verschlossenen Türen ausverhandelt und bleiben lange Zeit relativ intransparent. Man kennt den aktuellen Stand der Dinge nicht. Man weiß nur, dass man sich in Eckpunkten geeinigt hat; etwa, dass man die Anwendbarkeit erweitert hat, im Vergleich zu den bereits existierenden Lieferkettengesetzen in Frankreich und in Deutschland.
Von welcher Dimension ist da eigentlich die Rede?
Wir haben uns am Lieferketteninstitut ASCII unseren eigenen, sozusagen synthetischen Datensatz konstruiert. Wir wissen, wie viele Firmen es in Europa gibt, wir wissen über die Größenklassen und die Branchen-

„Nicht überblickbar, nicht administrierbar“
Kommt das EU-Lieferkettengesetz in Brüssel nochmals auf die Tagesordnung? Wirtschaftslandesrat Marco Tittler warnt vor gravierenden Folgen für Vorarlbergs Wirtschaft.
Von Andreas DünserÜber das EU-Lieferkettengesetz wird seit Jahren diskutiert. Anfang Februar sollten nun die Mitgliedsstaaten der EU darüber abstimmen. Doch dazu kam es erst gar nicht: Nachdem Deutschland und Österreich bereits im Vorfeld angekündigt hatten, sich der Stimme enthalten zu wollen; und auch Italien, sowie mehrere kleinere Länder Bedenken angemeldet hatte, entschloss sich der EU-Rat, die Abstimmung zu verschieben. In Brüssel heißt es nun, dass das Lieferkettengesetz möglicherweise im März wieder auf die Tagesordnung komme, die EU-Ratspräsidentschaft versuche, vor allem Italien zur Zustimmung zu bewegen, möglicherweise mit Zugeständnissen in anderen Bereichen.
Worum geht es? Mit dem Lieferkettengesetz sollen große europäische Unternehmen verpflichtet werden, auf die Einhaltung von Menschenrechten und von Umweltschutz entlang ihrer gesamten Lieferkette zu achten. Unternehmen müssten demnach ihre –vorgelagerte – Lieferkette auf Verstöße gegen Menschenrechte, Gesundheit und Umweltschutz prüfen. Würden Verstöße festgestellt, müssten die Unternehmen selbst dafür sorgen, dass diese abgestellt würden; andernfalls seien die Geschäftsbeziehungen einzustellen. Unternehmen müssten also ihre Zulieferer strengstens kontrollieren. Bei Verstößen gegen das Lieferkettengesetz drohen Unternehmen im äußersten Fall Geldstrafen von bis zu fünf Prozent ihres weltweiten Nettoumsatzes.
Die „Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit“ soll dabei für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und einem weltweiten Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen Euro gelten, auch für Unternehmen mit hohem Schadenspotenzial, wie Textil- und Landwirtschaft. Dort liegt die Grenze bei mindestens 250 Beschäftigten und 40 Millionen Euro Nettoumsatz.
Was wäre denn der bessere Weg? Was wäre ein praktikabler, administrierbarer Weg?
Wir schlagen ein System vor, in dessen Zentrum Komplexitätsreduktion steht: Von vornherein alle Länder ausnehmen, die ein hinreichend gutes Rechtssystem haben – das träfe beispielsweise die gesamte EU, Nordamerika, Japan und Südkorea. Und für alle anderen Länder sollte ein Versicherungssystem und ein Zertifizierungssystem eingeführt werden: Lieferanten in den betreffenden Ländern werden geprüft, sind sie sauber, bekommen sie einen Stempel, der Versicherer übernimmt das Risiko. In Screenings vor Ort, in die Prüfung der jeweiligen Produktionsbedingungen, könnten auch die NGO eingebunden werden.
Wie lautet Ihr Fazit?
Eine Regulierung ist wünschenswert, sie muss allerdings effektiv und auch kosteneffizient umgesetzt werden. Es wäre in unser aller Interesse, dass wir eine praktikable Lösung finden. Aber die jetzige Diskussion gibt Anlass zur Sorge, es scheint die rationale Diskussion, wie so eine Regulierung ausgestaltet werden soll, leider verloren zu gehen.
Vielen Dank für das Gespräch!
In Österreich wurde die Vertagung unterschiedlich aufgenommen: Während Kritik etwa von der Arbeiterkammer und von verschiedenen NGO kam, zeigten sich Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung erleichtert, vorerst zumindest. „Bei europaweit 900 Millionen Lieferbeziehungen wäre durch die angedachte Einbeziehung auch indirekter Beziehungen praktisch jedes Unternehmen in der Verantwortung“, sagte Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf: „Eine solche Tragweite ist nicht überblickbar, geschweige denn administrierbar und schadet der Wirtschaft.“

Wirtschaftsminister Martin Kocher, der sich für die Stimmenthaltung entschieden hatte, argumentierte, er unterstütze die Ziele der Richtlinie – aber mit dem Gesetz würden Pflichten und Haftungsrisiken auf kleine und mittlere Unternehmen abgewälzt.
Das sagt auch Wirtschaftslandesrat Marco Tittler: „Die eigentlichen Ziele der Richtlinie werden grundsätzlich unterstützt. Gut gemeint ist jedoch häufig das Gegenteil von gut gemacht, das zeigt sich auch bei diesem Vorschlag. Er ist überschießend, führt zu Unsicherheiten, trifft mitunter die falschen Unternehmen und ist in der vorliegenden Form deshalb zur Gänze abzulehnen.“ Vorarlbergs Unternehmen würden international für ihre hohen ethischen und sozialen Standards geschätzt, aber gerade die exportorientierte und zulieferintensive Wirtschaft Vorarlbergs könnte hier besonders betroffen sein, warnt der Landesrat: „Wenn große Konzerne verpflichtet werden, ist es sogar naheliegend, dass diese Unternehmen die Pflichten und Risiken nach Möglichkeit überwälzen oder unsere KMU aus den Lieferketten verdrängt werden.“ Für Vorarlberg ist das von großer Bedeutung: „Unsere Wirtschaft besteht zu mehr als 99 Prozent aus Klein- und Mittelbetrieben, die in der Regel nicht über große Verwaltungsapparate verfügen.“ Die Erfüllung dieser Auflagen würde zudem zu einem beträchtlichen Kostenfaktor werden, der sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken könnte: „Vorarlbergs Unternehmen wollen in erster Linie ihrem Geschäft nachgehen und wir müssen sicherstellen, dass das auch weiterhin möglich ist.“ Es soll nicht verschwiegen werden, dass Befürworter des Gesetzes Gutes wollen. Aber ist der Weg denn der richtige? Ein Kommentar in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ las sich da sehr deutlich. Dort wurde das Lieferkettengesetz als „unselige Richtlinie“ bezeichnet, deren Vorgaben Europas Unternehmen zwingen sollen, „die hohen Wert- und Moralvorstellungen der EU in ihren weltweiten Lieferketten durchzusetzen“. Zitat aus dem Kommentar: „... unter Generalverdacht (gestellt), dringen hiesige Unternehmen mit Gegenargumenten nicht durch. Diese erschöpfen sich nicht in der berechtigten Klage über Bürokratie und Rechtsunsicherheit durch schwammige Regeln, die zum Rückzug aus schwierigen Märkten zwingen könnten, statt zu diversifizieren. Ökonomen weisen auf den Schaden hin, den Lieferkettengesetze in Entwicklungsländern anrichten. Deren Weg zu Wohlstand führt über die Eingliederung in die globale Arbeitsteilung.“


Schon bald nach seiner Fertigstellung im Jahr 1986 wusste man um die Untauglichkeit des Bregenzer Bahnhofs. Doch nach 20 Jahren erfolgloser Planung scheint nun endlich jene Variante vor der Realisierung zu stehen, die laut Architekt Roland Gnaiger (72) Bregenz einen substanziell besseren Stadtteil bringen würde. Der Architektur-Professor sagt im Interview: „Bregenz schickt sich an, zu beweisen, dass wir auch gute, anziehende, lebenswerte Orte schaffen können.“
Herr Professor Gnaiger, das zuständige Bewertungsgremium hat nach Angaben der Stadt Bregenz nun die Bahnhofs-Variante „4a“ zum Siegerprojekt gekürt. Eine gute Entscheidung?
Ja, nach vielen erfolglosen Jahren scheint ein Durchbruch gelungen zu sein. Um das richtig einzuordnen, muss man wissen: Es ging bei diesem Thema um viel mehr als um den Bahnhof. Seit Jahrzehnten gibt es für die Bregenzer Stadtentwicklung keine Entscheidung von vergleichbarer historischer Tragweite. Wie im Leben von Menschen gibt es auch in der Geschichte von Städten große Momente, Momente die über ihr weiteres Schicksal entscheiden. Der 23. Februar war für Bregenz solch ein Moment. Glücklicherweise mit einer Wendung zum Guten.
Wie ist das zu verstehen?
Stellen wir uns einmal vor, unsere Landesregierung hätte nie für die Unverbaubarkeit des österreichischen Bodenseeufers votiert, oder es hätte sich nie jemand dafür eingesetzt, das Aushubmaterial des Arlbergtunnels zum Bodensee zu führen, um damit die unverzichtbaren Seepromenaden zu begründen. Dramatischer noch: Es wäre 1971/72 in den letzten Minuten nicht geglückt, die Autobahn weg von Seeufer und Stadt in den Pfänder zu verlegen, die Stadt und ihr Seezugang wären dauerhaft verdorben. Die den Bahnhof und sein Umfeld betreffende Entscheidung ist vergleichbar folgenschwer. Mit einem Unterschied: Die Vielschichtigkeit dieses Gegenstands ist schwieriger zu vermitteln.
Schwieriger zu vermitteln? Der jetzige Bahnhof, ein Bauwerk von bemerkenswerter Hässlichkeit, zerfällt. Bregenz braucht dringend eine Lösung.
Die Fixierung auf das Errichtungsdatum des Bahnhofs verstellte zu lange den Blick auf das Gesamtfeld. Es galt, eine größere Betrachtungshöhe zu gewinnen. Ohne Rücksicht auf das gesamte Gebiet zwischen Montfort- und Quellenstraße, Casino und Klostergasse würde die größte Bregenzer Entwicklungschance vertan. Im Übrigen: Der Begriff Bahnhof wird den heutigen Anforderungen nicht gerecht. Es geht um eine Mobilitätsdrehscheibe, die auf maximal effiziente, gefahrlose und atmosphärevolle Weise zwischen Bahn, Bus, Pkw, Fahrrad und zu Fuß gehen verbindet und wechseln lässt. Nur wenn wir mit „Bahnhof“ solch einen dynamischen Knoten meinen, können wir bei diesem Begriff bleiben.
Lässt sich da – als Positiv-Beispiel – auch auf die Erweiterung der Fußgängerzone verweisen?
Es ist erlebbar, wie anders sich Bregenz mit der erweiterten Fußgängerzone zeigt, wie das soziale Leben damit aufatmet. Dieser Wandel wird sich Kürze auch an den Umsätzen der Läden und Gastronomie abbilden. Gegen ein solches Stadtleben kann sich doch niemand ernsthaft stellen. Es darf um den Bahnhof gleich einladend und freundlich werden wie am Sparkassenplatz, rund um den Leutbühel oder in der Anton Schneiderstraße.
Als Eingangstor in die Landeshaupt- und Festspielstadt Bregenz müssen der Bahnhof und sein Vorplatz ähnlich wohlwollend willkommen heißen wie der Kornmarktplatz.
Seit Jahrzehnten wird geplant. Was spricht denn gegen die letzte, 2018 noch gültige Planung?
Sie hätte den Keil, den das heutige, öde Bahnhofsumfeld zwischen das alte Zentrum und die bewohnerstarken Bezirke jenseits der Quellenstraße treibt, für immer vertieft. Die derzeitige Landesstraße ist das Grundübel. Unverändert ließe sie vom Verkehr umspülte, inselartige Restflächen übrig. Im Ergebnis wäre alles auf eine filetierte Stadt und letztklassige Wohn- und Arbeitsumfelder hinausgelaufen. Den Fußgängerinnen und Radfahrern würde kein Schutz vor Lärm geboten, kein einladender Platz, keine ruhige Straße, keine Erlebnisqualität. Und ein von manövrierenden Bussen zerschnittener Bus- und Bahnhofsplatz, der noch gefährlicher und unattraktiver wäre, als er heute schon ist. Vorarlberg gilt international als Architekturmusterland. Weder die Landes-, noch die Stadtregierung können sich die bestehende Verkehrswüste rund um den Bahnhof als Visitenkarte für die Landeshaupt- und Festspielstadt Bregenz wünschen.
Sie sagten zuvor, die Landesstraße sei das Grundübel.
Das Grundübel liegt in der Führung der Straße. Diese Straße, deren S-Kurve den quer im Raum stehenden Bahnhof umrundet, ist die Manifestation der autogerechten, gleichzeitig menschenfeindlichen Stadt. In Europas historischen Städten kennen wir derartige, für hohe Geschwindigkeit gebaute Kurvenradien nicht. Während der vergangenen Jahrzehnte haben wir dem motorisierten Verkehr grundsätzlich jeden Vorrang eingeräumt. Damit sind die Städte und ihre Bewohnerinnen unter die Räder gekommen. Heute gilt es, die Städte den Menschen zurück zu geben. Verkehrspolitik ist nicht länger Autolobbying! Ohne Verlegung der Landesstraße an die Bahngleise – wie vor dem Postamt und Kunsthaus – ließe sich kein substanziell besserer Stadtteil errichten.
Es standen sechs Entwurfsvarianten zur Entscheidung an. Die ausgewählte Variante 4a wurde auch von Ihnen favorisiert. Was zeichnet diese aus?
Sie erweitert die Schönheit und den Lebens- und Aufenthaltswert der alten Bregenzer Stadträume in Richtung Zukunft, Klima-Resilienz und Quellenviertel. Zu Fuß gehen und Radfahren werden priorisiert, Bahnhof und Bahnhofsplatz werden einer Landeshauptstadt entsprechend würdig gestaltet. Diese Variante schlägt eine Brücke zwischen historischem Zentrum und den jüngeren Wohngebieten und vermittelt zwischen Stadt, See und Festspielbezirk.
Was sprach gegen Varianten, welche den Bahnhof auf die Fläche des heutigen Parkplatzes – Seestadt – verlegen? Was sagt der Fachmann?
Je näher der Bahnhof an das Stadtzentrum rückt, umso schwerer fällt es, Lebendigkeit und Frequenz im ganzen Entwicklungsgebiet aufrecht zu erhalten. Sein Abrücken von Quellenviertel, Mehrerau und Vorkloster hätten deren Bewohnerinnen zu Recht als abweisende Geste verstanden. Auch würde eine Bahnhofpassage in unmittelbarer Nachbarschaft zur attraktiv neugestalteten Hypopassage als Schildbürgerstreich gesehen. Außerdem ignorierte diese Lage die Bedeutung des Festspielbezirks. Denn hätten das Stadion, das Frei- und Hallenbad, das Casino und erst recht das Festspielhaus nicht heute bereits einen direkten Bahnanschluss, man müsste ihn glatt erfinden!
Pointiert gefragt, provokant gefragt: Waren die Entscheider mit der Komplexität des Themas überfordert?
Politische und finanzielle Motive werden zu selten mit fachlichen Expertisen zur Deckung gebracht. Auf diesen Ort wirken ungemein viele Faktoren und gegensätzliche Interessen ein. Es geht um Besitzverhältnisse und Kostenübernahme zwischen Land, Stadt, Investoren, ÖBB. Es geht angesichts der Vielschichtigkeit aber auch um Vorstellungskraft und Unterscheidungsvermögen. Und es geht um Kooperationsbereitschaft. Ich habe Verständnis dafür, dass Laien von der Vielschichtigkeit gefordert, mitunter überfordert sind. Es gilt festzuhalten: Der gute Wille aller Beteiligten hat zu einer Lösung im Sinne aller geführt.
An einem schönen Platz? Es handelt sich beim heutigen Bahnhofsumfeld um den hochwertigsten Baugrund Vorarlbergs! Wo noch ließe sich so dicht an einem gelungenen Stadtzentrum leben oder arbeiten, unmittelbar angeschlossen an alle Verkehrsmittel? Wo sonst hätte man den See und seine Promenade vor der Haustüre und erreichte im Nu den Festspielbezirk und die seeseitigen Sport- und Freizeitanlagen? Unter idealen Bedingungen können in Bregenz Mitte 4000 bis 5000 Menschen höchstwertig wohnen und/ oder arbeiten. Der schöne, programmatische Name „Bregenz Mitte“ wird infolge des gewählten Projek tes mit Leben gefüllt. Jede andere europäische Stadt schätzte sich glücklich, hätte sie so nahe an ihrem Zentrum ein solch bedeutendes Entwicklungsgebiet wie Bregenz.
gestalteten Empfang. Auch ein Ende der exorbitanten Flächenversiegelung liegt im Landesinteresse. Im ganzen Land kann enorm viel wertvollster Grünraum erhalten bleiben, wenn es gelingt, mehr als 4000 Menschen in Bregenz Mitte anzusiedeln. Mit einer verkehrsberuhigten Hauptstadt und dem in Aussicht gestellten Mobilitätsknoten wird das Land zum Vorreiter einer neuen Verkehrs- und Klimapolitik.
Die Investoren … … müssen nicht in Verkehrsinseln investieren oder ihr Geld in einer schäbigen Peripherie versenken und stehen glaubwürdig für Nachhaltigkeit. Nichts ist so nachhaltig und auch monetär interessant, wie ein nutzungsneutrales Haus im Zentrum einer wunderbar gestalteten, klimaresilienten Stadt. Funktional gelungene und schöne Häuser behalten Wert und Bestand über Jahrhunderte.
Die ÖBB …
… hat in den vergangenen Jahren in ganz Österreich vorbildliche Bahnhöfe gebaut. Eine Mobilitätsdrehscheibe am Stand des Wissens und der Zeit, funktional, schön und anziehend, noch dazu am Ufer des Bodensees und im Dreiländereck, wird auch für die Bundesbahnen ein stolzes Renommierprojekt.
Ist es angemessen, von einer Jahrhundertchance für Bregenz zu sprechen?
Das wäre eine grobe Untertreibung! Wird eine Straße von Bauten mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen gesäumt, dann ist deren Bestand gewissermaßen für ewig in Beton gegossen. Die größere Hoffnung ist die: Dass Demokratie mehr kann als autogerechte Stadt, Speckgürtel, Zersiedlung und Bodenversiegelung. Dafür braucht es neue Aushandlungs- und Qualitätssicherungsformen. Bregenz schickt sich an, zu beweisen, dass wir auch gute, anziehende, lebenswerte Orte schaffen können und unserem baukulturellen Erbe gerecht zu werden in der Lage sind.

Und das Land Vorarlberg … … der See, die Festspiele, das Landhaus und die Landeshauptstadt „gehören“ allen Bürgerinnen und Bürgern Vorarlbergs. Allen garantiert das Siegerprojekt einen freundlichen, sorgfältig
Gestatten Sie mir die Frage: Warum waren – und sind – Sie da derart engagiert?
Bregenz ist meine Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen. Auch wenn ich jahrzehntelang woanders lebte und auf der ganzen Welt herumgekommen bin: Gerade im Vergleich lernte ich diesen Ort zwischen Berg und See richtig schätzen. Ich weiß nicht, ob alle Bregenzerinnen und Bregenzer die Schönheit ihrer Stadt ausreichend würdigen. Ich durfte in den vergangenen Jahren viel über Stadtbaukunst lernen. Diese Expertise bringe ich gerne auch für Bregenz ein.
Vielen Dank für das Gespräch! „E eicheinladend und freund
Der Umgang mit vermeintlichen Plagiaten muss sich ändern. Eine offizielle Kommission sollte Vorwürfe erst prüfen, bevor sie an die mediale Öffentlichkeit gelangen.
Von Silvia Ettl-HuberIch habe Anfang der 1990er-Jahre zeitgleich mit Alexandra Föderl-Schmid und Stefan Weber Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg studiert. Die Journalistin, Vize-Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und frühere STANDARD-Chefredakteurin Föderl-Schmid lernte ich zwar nicht während des Studiums kennen, durfte aber später bei der einen oder anderen Podiumsdiskussion mit ihr diskutieren. Mit Weber drückte ich ab und an die Bank im Seminarraum. Nicht selten waren wir einer gemeinsamen kritischen Meinung. Dass das erwünschte kritische Denken von damals, Jahrzehnte später in Verbindung mit Worten wie Jagd, Plagiatsfragmenten und Verzweiflungstat in den Medien auftaucht, ist menschlich bedrückend.
Als Hochschulprofessorin, die mittlerweile hunderte Masterarbeiten betreut hat, scheint es mir eine Pflicht, endlich auch fachlich Stellung zu beziehen. Viel zu lange haben wir uns an den Universitäten und Hochschulen unkollegial gegenüber den Betreuenden der geschmähten Arbei-
ten weggeduckt, um nicht ins Visier des sogenannten Plagiatsjägers zu geraten.
Keine Betrugsabsicht
Das, was Weber als Plagiat anprangert, ist meist nicht mehr als eine Abweichung von seinen (!) wissenschaftlichen Standards. Absatz für Absatz werden in hundertseitigen Arbeiten Mängel gesucht. Mit neuen digitalen Möglichkeiten wird über fast 30 Jahre alte Arbeiten aus dem Vor-Internet-Zeitalter geurteilt. Das Wort „Plagiat“ sollte dabei den Eindruck schüren, dass das ganze Werk gestohlen und für das eigene ausgegeben wurde, dass es sich bei der Autorin um eine faule und betrügerische Person handle. Dabei besteht das Hauptvergehen dann oft darin, dass in der Einleitung der Arbeit eigener Text formuliert wurde. Etwas, was manche Hochschulen sogar verlangen. In anderen Fällen wurde über mehrere Absätze hinweg nur ein Autor zitiert. Das kann man als geistige Aneignung im Sinne eines Plagiats sehen, aber das Vorgehen liegt weit weg von einer Betrugsabsicht.
Es gibt übrigens auch keine Pflicht zur exzellenten Dissertation. Möglicherweise wurden die von Weber angemerkten Mängel ohnehin in einem Gutachten an gemerkt und sind in die Beurteilung eingeflossen.
Es ist ein bisschen so, als würde eine Volksschullehrerin die Dikta te von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Karl Ne hammer oder Vizekanzler Wer ner Kogler heraussuchen und man stellt fest, dass diese nicht exzellent waren – zumal seitdem ei ne Rechtschreib reform stattge funden hat. Wobei ich

hier der politischen Hierarchie im Land folgend nur drei männliche Beispiele genannt habe. In der Wahl der Personen scheint Weber eher ein spezielles Faible für die Jagd auf von Frauen verfasste Abschlussarbeiten zu haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Mehrköpfige
Kommission
Ein Lösungsansatz? Es ist an der Zeit, eine offiziell ernannte mehrköpfige Plagiatskommission einzurichten, die Vorwürfe im Mehraugenprinzip prüft, bevor Medien involviert werden.
Leserbrief zum Artikel von Josef Moosbrugger „Alpwirtschaft versus Großraubtier“ aus Thema Vorarlberg, Ausgabe Nr. 95, Februar 2024
Als Nachbar von Vorarlberg lese ich neugierig und aufmerksam einzelne Beiträge zum Land. Ich bin oftmals als Biologe in Vorarlberg unterwegs, im Rheintal und im Rheindelta, habe Kontakt zu Vorarlbergern, die sich für den Erhalt und die Förderung der natürlichen Mitwelt einsetzen. Ich habe gestaunt, wie Josef Moosbrugger, der Präsident der Landwirtschaftskammer, sich über den Wolf und die Alpwirtschaft äußert. Da stellt er Behauptungen in den Raum, die sich bei einer sorgfältigen Analyse der Fakten nicht halten lassen. Er behauptet, dass der Wolf die Weidewirtschaft, die Jagdwirtschaft (?),
Tourismus, Kulturland und Biodiversität bedrohen soll. Beim Tourismus bietet der Wolf durchaus Potenzial. In den Abbruzzen liegt Alfadena. Das Ortschild weist den Zusatz „Città del Lupo“ auf. Im Dorf ist ein kleines Wolfsmuseum, das den Wandel der Einstellungen gegenüber dem Wolf aufzeigt. Im Museum sind Angebote für „Exkursionen zu Wolf und Bär“ von ausgebildeten WanderleiterInnen.
Nach Moosbrugger bedroht der Wolf auch die Jagdwirtschaft. Beobachtungen eines bündnerischen Jagdaufsehers seit 2000, den ersten Wölfen im Gebiet, zeigen andere Wirkungen: Die erlegten Hirsche, Rehe und Gämsen waren gesund und kräftig. Es fehlten kranke und schwache Tiere. Förster bemerkten an mehreren Stellen einen Rückgang des Verbisses und das Aufkommen zu Jungtieren.
Moosberger lobt den äußerst problematischen Abschuss von Wolfsrudeln in der Schweiz, behauptet, dass die Herdenschutzmaßnahmen wirkungslos gewesen seien. Die Aussage stimmt so nicht. Die getätigten Wolfsabschüsse wurden aus Rücksichtnahme auf die Landwirtschaftslobby veranlasst. Sie waren größtenteils willkürlich und politisch
Die Haltung und die Forderung von Moosberger ist identisch mit den Forderungen des schweizerischen Bauerverbandes. Sie verhindert ein sachliches Gespräch und verhindert Lösungen bei Problemen, die Wölfe verursachen können. Die Flinte ist die schlechteste Lösung im Natur- und Kulturraum der Alpen.
Aus meiner Sicht hat Moosberger zu wenig nachgedacht, dafür mit Schlagworten polemisiert. Mit freundlichen Grüßen, Josef Zoller, Rorschach
Leserbrief zu Thema Vorarlberg, „Sachkundige Informationen“ Ausgabe Nr. 95, Februar 2024
Sehr geehrter Herr Chefredakteur Dünser. Ihren Gesellschaftsteil von Thema Vorarlberg lese ich immer mit Interesse. Die letzte Ausgabe (Februar 2024) möchte ich aber im Speziellen hervorheben. Kaum irgendwo in Vorarlberger Printmedien finden sich begründet. Eine fachlich fundierte Überwachung des Wolfsbestandes sieht anders aus.
Artikel in gefälliger Aufmachung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen wie in Ihrer Publikation. Neben solchen von regionalem Interesse und den kleinen Kommentaren und Glossen, den belebenden Karikaturen, raschen Sprüchen und Zitaten erscheinen sachkundige Informationen zu diversen Sachgebieten (zum Beispiel Geologie, Medizin, Kulinarik, Botanik), profunde geschichtliche Analysen, kritische, individuelle, philosophische Deutungen zeitnaher Probleme und originelle querdenkerische Ideen zu politischen und ökonomischen Ärgernissen.
Diesmal möchte ich besonders die Artikel von Peter Melichar, Kurt Bereuter, Thomas Feurstein und J. Georg Friebe und den Bericht von Angelika Schwarz erwähnen. Neue Denkweisen und Einsichten sind immer wieder aus den gut geführten Interviews zu gewinnen, diesmal insbesondere aus jenen mit Otfried Höffe und Marie-Luisa Frick.
Obwohl ich die Vorarlberg-Themen mit meinem Zeitungs-Abo regelmäßig bekomme, habe ich jetzt doch von Ihrem Angebot eines Gratis-Abos Gebrauch gemacht. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Walter Simma, Feldkirch
Endlich wurde korrigiert, was zwar erst vor acht Jahren eingeführt wurde, aber dennoch überfällig war. Damals war die Lehrerausbildung von fünf auf sechs Jahre verlängert worden. Nun soll das Studium für die Primarstufe (Volksschule) und die Sekundarstufe (AHS, BHS, Mittelschule) aus drei statt vier Jahren Bachelor- und zwei Jahren Masterausbildung bestehen. Unter anderem damit will Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dem immer größer werdenden Personalmangel entgegenwirken. Ein Schelm, wer dabei denkt, dass man von dieser Entwicklung auch schon vor acht Jahren hätte wissen können.
Es dauert nicht lange, da findet der Minister Post in Form eines offenen Briefes in seinem ministerialen Briefkasten. Absender: eine Gruppe Vorarlberger Lehramtsstudenten. Inhalt: Auch wenn man die Korrektur nach acht Jahren grundsätzlich für die kommenden Jahrgänge begrüße, so sei es dennoch hochgradig ungerecht für ihre „Generation“ und dafür wollen sie vom Steuerzahler entschädigt werden: „Dieses eine zusätzliche Jahr, das wir durchlaufen, muss unserer Meinung nach in irgendeiner Form kompensiert oder abgegolten werden.“ Die längere Studiendauer habe finanzielle und berufliche Nachteile für die betroffenen Jahrgänge, etwa durch den Verlust eines Jahresgehaltes und der fehlenden Pensionsanrechnung. „Garniert“ wird der Brief mit dem Vorwurf zu geringer Wertschätzung für den Beruf und dem Wunsch nach einer Debatte über die gesellschaftliche Anerkennung der Lehrerausbildung in Österreich. Und wenn man schon einmal bei der Zeitung ist, wird der Journalistin noch in den Block diktiert, dass das Bildungssystem derzeit sowieso auf der Intensivstation liege.
Ob der offene Brief zur schnellen Genesung und zur Verlegung in die Normalstation und dem Wunsch nach einer höheren Wertschätzung wirklich hilft? Könnte schwierig werden. Noch nicht zu Ende studiert (in Österreich immer noch praktisch gratis), noch nie im erlernten Beruf gearbeitet, aber bereits die erste Entschädigung vom Staat fordernd und noch vor der ersten gehaltenen Unterrichtsstunde damit hadernd, dass man auf einer Intensivstation arbeiten muss. Findet das wirklich jemand ausserhalb dieser Gruppe gut?

Mit ziemlicher Sicherheit ja. Schon gar nicht ist auszuschliessen, dass die Politik dem Begehr der angehenden Pädagogen Gehör schenken könnte. Spätestens seit Corona ist in Österreich die Gießkanne das meistgenützte politische Instrument. „Darfs ein bisschen mehr sein und das für alle?“ Ein bisschen mehr Covid-Hilfe, ein bisschen mehr Klimabonus, ein bisschen mehr Förderung oder Mehrwertsteuerbefreiung für die PhotovoltaikAnlage, die man vor allem deshalb anschafft, weil sie sich –auch ohne Förderung – schlicht rechnet. Gerne zum Drüberstreuen und ebenfalls zum größten Teil auf Steuerzahlerkosten eine neue Heizung für zu Hause, das Gratis-Klimaticket für Bus und Bahn für alle 18-Jährigen oder – zumindest für die auswärts Studierenden – zur Hälfte von vielen Standortgemeinden finanziert. Das nennt man dann wohl „schlau“, weil damit die Studiosi den Hauptwohnsitz in ihrer Gemeinde belassen, wofür die Kommunen aus einem anderen Fördertopf deutlich mehr Geld erhalten, als sie den Studenten mit auf den Weg geben.
Und zum Drüberstreuen wirft der Kanzler in seiner Rede zur Nation noch einen quasi „Nehammer-Tausender“ unters Volk, weil man in dessen Augen wohl nur dann kein fauler Hund ist, wenn man 100 Prozent arbeitet. Eh schon wurscht bei 33 Milliarden an Förderungen, die der Staat jährlich ausgibt. Damit beträgt Österreichs Förderquote 7,5 Prozent und ist damit längst deutlich höher als im EU-Schnitt (6,7 Prozent).
Und noch etwas wurden wir in den vergangenen Jahren gelehrt. Auch bei der Auswahl der Förderungs-Adressaten ist man nicht zimperlich. Wer reibt sich nicht die Augen, wenn er hört, dass Milliarden-Pleitier René Benko für sein 6-Sterne-Chalet „N“ in Oberlech 1,2 Millionen an Covid-Förderungen erhalten hat, wie auch alle russischen Oligarchen, die sich meist über zypriotische Briefkastenfirmen Hotels – oder sind es doch keine – in den Winter-Hotspots unter den Nagel gerissen haben.
Spätestens seit Corona ist in Österreich die Gießkanne das meistgenützte politische Instrument.
Auch sie sollen in Zukunft, geht es nach dem fürsorglichen Staat, zumindest einmal am Tag warm essen können.
Über den erwähnten „NehammerTausender“ kann sich weder jemand, der neben der Erziehung von Kindern oder der Pflege der Eltern „nur“ 80 Prozent arbeitet als auch ich mich als altmodisch Vollzeit arbeitender Grenzgänger nicht freuen. Den schweizerischen „Karin Keller-Sutter-Tausender“ gibt es nämlich nicht. Die Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements hat derzeit ganz andere Sorgen. Am 3. März, also kurz nach dem Erscheinen dieser Ausgabe, stimmt das Schweizer Volk über eine zusätzliche 13. AHVRente (Alters- und Hinterlassenschaftsversicherung) ab. Die Initianten fordern gleichzeitig, dass sichergestellt werden müsse, dass Menschen, die Ergänzungsleistungen bekommen – also den wirklich Bedürftigen – diese nicht gekürzt werden. Wie gegenfinanziert werden soll, lassen die Initianten offen.
Karin Keller-Sutter von der freisinnigen FDP wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die zusätzliche Rente für 2,6 Millionen Pensionierte, obwohl die AHV bis zumindest 2030 nicht defizitär ist. Das wurde durch verschiedene Reformen, etwa durch die vom Volk 2022 abgesegnete schrittweise Anhebung des Pensionsalters für Frauen auf 65 Jahre, sichergestellt. Die noch bestehende finanzielle Balance sieht Keller-Sutter massiv gefährdet, weil die Umsetzung der Initiative schon im ersten Jahr 8,7 Prozent oder 4,1 Milliarden Franken mehr kosten würde. Ein Szenario, das bei österreichischen Politikern nur ein müdes Lächeln auslöst. Obwohl die Zuschüsse zu den Pensionen inzwischen beinahe ein Viertel des Gesamtbudgets ausmachen, hat man auch hier schnell wieder die Gießkanne ausgepackt. 9,7 Prozent mehr für (fast) alle. Hätte man das „förderungs-verwöhnte“ Volk gefragt, es wäre nichts anderes herausgekommen. Wie die Schweizer am 3. März entscheiden, war – gemäß den jüngsten Umfragen – noch offen.

Zur Person CHRISTIAN ORTNER
* 1971 in Lustenau. Von 2002 bis 2012 war der promovierte Jurist Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten. 2013 bis 2019 bei der NZZ Mediengruppe. Seit 2019 bei CH Media, einem Jointventure von NZZ Regionalmedien und AZ Medien; Chefredakteur von sechs regionalen Newsportalen.

Die Onlineseite vorarlberg.ORF.at verbuchte 2023 über 100 Millionen Seitenaufrufe. Die Social Media-Community ist auf über 86.000 Follower gewachsen. Die Podcasts des ORF Vorarlberg mit sieben Angeboten in neuem Look werden sehr gerne genutzt.
„Vorarlberg heute“ bis zu 86 Prozent Marktanteil
2023 erzielten einzelne Ausgaben des täglichen TV-Magazins „Vorarlberg heute“ über 80 Prozent Marktanteil, der höchste Wert lag bei unschlagbaren 86 Prozent. Damit wurden Bestwerte seit 2020 erreicht, haben doch zu Spitzenzeiten bis zu 94.000 Zuschauerinnen und Zuschauer um 19.00 Uhr in ORF 2 V „Vorarl-
nem durchschnittlichen Jahresmarktanteil von 64 Prozent (Montag bis Sonntag), wochentags sind es sogar 65 Prozent.
Seit 1. Jänner 2024 steht „Vorarlberg heute“ online mit Untertiteln zur Verfügung. Bereits kurz nach Ende ist die TV-Sendung auf der ORFTVthek sowie auf der neuen Seite on.ORF.at mit Untertiteln abrufbar.
ORF Radio Vorarlberg klare Nummer 1 Laut zuletzt veröffentlichtem Radiotest ist ORF Radio Vorarlberg jener Radiosender, den alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ab zehn Jahren am längsten und am meisten hören. Kein anderes Radio in Vorarlberg wird täglich von so vielen Personen eingeschaltet


vorarlberg.ORF.at verzeichnete 2023 über
und so lange gehört. ORF Radio Vorarlberg hat die höchste Reichweite und den größten Marktanteil.
vorarlberg.ORF.at mit neuen Rekorden
Die Onlineseite vorarlberg.ORF.at kam 2023 pro Monat auf 2,4 Millionen Visits, dabei wurden die Seiten monatlich 8,5 Millionen Mal aufgerufen. Die Seitenzugriffe haben damit gegenüber 2022 um 15 Prozent zugenommen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 konnten die Seitenaufrufe sogar mehr als verdoppelt werden. Auch die Visits wurden in diesem Zeitraum mit einem Plus von insgesamt 46 Prozent massiv gesteigert. Auf das gesamte Jahr 2023 aufsummiert kommt vorarlberg.ORF.at auf über 100 Millionen Seitenaufrufe.
Social Media-Community groß und jung
Die Facebook-Seite „ORF Vorarlberg“ und der Instagram-Account „orfvorarlberg“ haben zusammen aktuell über 86.000 Follower und erreichen mit den redaktionellen Inhalten rund 156.000 Personen pro Tag. Die Social MediaCommunity des ORF Vorarlberg ist jung: Das Durchschnittsalter der rund 50.000 Follower auf Instagram liegt bei 32 Jahren, knapp 70 Prozent sind jünger als 35 Jahre.



„Mein Dank gilt unserem großen, treuen Publikum und dem gesamten Team des ORF Vorarlberg für den tollen Einsatz! Mit unseren Medien sind wir da für die Menschen – mit Information, Unterhaltung, Sport und Kultur aus Vorarlberg. Ein ‚ORF Vorarlberg für alle‘ eben!“
Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg

„So viele Menschen täglich zu informieren und zu unterhalten ist eine große Verantwortung, die wir als Redaktionsteam sehr ernst nehmen und eine Aufgabe, der wir jeden Tag mit höchster journalistischer Sorgfalt, großem Einsatz und viel Freude nachkommen.“
Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg

Zur Person KURT BEREUTER * 1963, studierte BWL, Philosophie und Politikwissenschaften. Organisationsberater und -entwickler, freier Journalist und Moderator, betreibt in Alberschwende das Vorholz-Institut für praktische Philosophie.
Einer neuen Umfrage des Gallup-Institutes zufolge gibt es einen Zusammenhang von Mediennutzung und der Beteiligung an Wahlen. Es mag jetzt nicht verwundern, dass jene, die Medien stärker nutzen, sich auch eher an Wahlen beteiligen. Ist Demokratie doch eine Regierungsform, bei der sich eine Gesellschaft darauf geeinigt hat, dass die Lenkung durch die Politik vernunftgeleitet sein soll und es einen Austausch von Argumenten wenigstens geben soll. Demokratie muss also durchschaubar und ihre Entscheidungen in der Entstehung nachvollziehbar sein. Damit vernunftgeleitete Entscheidungen durch die Bürgerschaft möglich und akzeptiert werden, bedarf es also guter Argumente und die setzen wiederum Informiertheit der Wählenden voraus.
Vertrauen in Informationen und politische Akteure
Aber auch bei repräsentativen Demokratien ist es entscheidend, dass Wählende gut informiert sind, die getroffenen Entscheidungen gut akzeptieren und deren demokratisches Entstehen respektieren können. Überspitzt formuliert, könnte man theoretisch behaupten, je besser informiert die Wählenden sind, desto eher werden vernunftgeleitete Entscheidungen zustande kommen, beziehungsweise akzeptiert werden. Dass dem aber so ist, braucht es Vertrauen in die Informationen und Vertrauen in die politischen Akteure. Die einen müssen gut recherchiert, gut aufgearbeitet und gut präsentiert werden und die anderen müssen vernunftgemäß agieren. Deshalb gibt es – zumindest theoretisch – in liberalen Demokratien das freie Mandat, bei dem der oder die politisch Verantwortlichen an ihre Vernunft und ihr Gewissen gebunden sind und gerade nicht an ihre Wählerklientel. Auf die werden sie ein Auge werfen müssen, sofern sie wiedergewählt werden wollen, aber sie sollten gerade nicht „nur“ nach deren Meinung agieren, sonst werden sie zu Populisten. Letztlich müssen sie immer auch „das Große und Ganze“ im Auge behalten und nach reiflichem Überlegen vor ihre Wählerschaft hintreten und ihre Entscheidung vertreten und bestenfalls auch argumentativ erklären.
Die Gallup-Umfrage zu den Nachrichtenmedien Knapp unter 80 Prozent der Befragten informiert sich laut Umfrage mindestens
täglich einmal in den Medien über aktuelle Ereignisse. Aber knapp über 80 Prozent der Befragten halten Nachrichten für sich wichtig. Wobei die Zahl jener, die Nachrichten nicht mehr regelmäßig nutzen, steigt, was auch in früheren Studien schon festgestellt wurde. Interessant und auffällig ist der Zusammenhang von Nachrichtennutzung und der Teilnahme an Wahlen. 85 Prozent der überzeugten Wähler und Wählerinnen geben an, dass sie mindestens einmal täglich Nachrichten nutzen, während es bei den überzeugten Nichtwählern nur 48 Prozent sind, die mindestens einmal täglich Nachrichten nützen. Ähnlich ist es bei den Demokratiezufriedenen und den Demokratieunzufriedenen, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Demokratiezufriedene nutzen Nachrichten häufiger als Demokratieunzufriedene. Dabei sind über 90 Prozent der Befragten der Meinung, dass
An unterster Stelle liegt das Vertrauen in die österreichischen Medien bei Nachrichten aus der Innenpolitik.
unabhängige und kritische Nachrichtenmedien für unsere Demokratie sehr oder eher wichtig sind. Aber nicht einmal 60 Prozent geben an, dass die österreichischen Nachrichtenmedien für unsere Demokratie einen sehr oder eher großen Beitrag leisten. Das größte Vertrauen in eine richtige, faire und objektive Berichterstattung haben die Befragten in die Sportberichterstattung, bei der 79 Prozent sehr hohes oder eher hohes Vertrauen haben. Das geringste Vertrauen allerdings in der Berichterstattung über die Innenpolitik, die österreichische Politik, bei der nur mehr jede/r zweite Befragte/r sehr oder eher hohes Vertrauen in die österreichischen Nachrichtenmedien hat. Bei regionalen und lokalen Themen ist das Vertrauen bei fast Dreivierteln der Befragten zumindest eher hoch und bei der internationalen Berichterstattung ist dieses immerhin noch bei 57 Prozent
mindestens eher hoch. Also an unterster Stelle liegt das Vertrauen in die österreichischen Medien bei Nachrichten aus der Innenpolitik. Dabei wäre den Befragten die Glaubwürdigkeit eines Nachrichtenmediums mit 80 Prozent sehr wichtig, trifft aber laut Umfrage nur auf 16 Prozent sehr zu. Andererseits ist den Nachrichtennutzern die „Aktuelle Nachricht“ nur zu 66 Prozent sehr wichtig und wird auch von 41 Prozent als sehr zutreffend beurteilt. Man könnte also festhalten, dass Aktualität möglicherweise auf Kosten der Glaubwürdigkeit in den Nachrichtenmedien geht: Speed kills?
Das Vertrauen in die österreichischen Parteien
Im Jänner 2024 wurde repräsentativ erhoben, dass den Aussagen der Parteivorsitzenden max. 36 Prozent der Befragten sehr oder eher vertrauen, wobei Andreas Babler diese Liste mit diesem Wert anführt, vor Werner Kogler (34 Prozent), Beate Meinl-Reisinger (34 Prozent), Karl Nehammer (32 Prozent), Dominik Wlazny (32 Prozent), Herbert Kickl (30 Prozent) und Günther Hopfgartner von der KPÖ mit 22 Prozent. Wobei zu beachten gilt, dass in diesem vorgeblich repräsentativen Sample mit 13 Prozent am meisten der Befragten angeben, dass sie der FPÖ sehr positiv gegenüberstehen. So trauen dann auch 35 Prozent der Befragten der FPÖ und der SPÖ sehr und eher zu in Österreich positive Veränderungen herbeizuführen und die Neos (33 Prozent) und die ÖVP (32 Prozent) folgen dahinter. Immerhin 23 Prozent würden sogar der KPÖ das sehr und eher zutrauen.
Der Spiegel des Vertrauens
Jede Demokratie ist so stark, wie das Vertrauen der Bürgerschaft in sie, egal ob bei eher direktdemokratischen oder repräsentativen Demokratiesystemen. Für dieses Vertrauen sind per se alle in einer Demokratie verantwortlich, die politisch aktiven Menschen in besonderem Maße. Dann sind aber schon die Nachrichtenmedien gefordert, dem Vertrauen der Nutzer zu entsprechen und mit diesem Vertrauen verantwortungsvoll umzugehen. Immerhin ist die Einstellung gegenüber Journalisten laut obiger Umfrage im letzten Halbjahr von 62 Prozent auf 68 Prozent „sehr und eher positiv“ gestiegen.
Der heimische Tourismus ist in Bewegung – in Richtung der gemeinsam entwickelten Vorarlberger Tourismusstrategie 2030. Im Zentrum stehen vier Werte: Authentische Gastfreundschaft, weltoffene Regionalität, faire Kooperation und nachhaltige Entwicklung. Diese Werte bringen auf den Punkt, mit welcher Haltung bereits heute viele Gastgeberinnen ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Wir haben bei drei Betrieben nachgefragt, wie sie „Gastgeben auf Vorarlberger Art“ leben.
GVA Tourismusnetzwerk
– eine Initiative von Vorarlberg Tourismus
Das GVA Tourismusnetzwerk unterstützt Betriebe dabei, die Werte der Vorarlberger Tourismusstrategie 2030 umzusetzen und sie Gästen spürbar zu vermitteln.
Kontakt und Informationen: Annemarie Felder, Koordinatorin GVA Tourismusnetzwerk gva@vorarlberg.travel

Der HIRSCHEN DORNBIRN positioniert sich als „boutiquestyle hotel“ und ist nicht zuletzt bekannt für seinen wortwörtlich ausgezeichneten Brunch, den auch externe Gäste genießen. Charlotte Hirt, die den 1743 gegründeten Familienbetrieb im Stadtteil Haselstauden führt, ist es wichtig, „sich auf Augenhöhe wohlwollend zu begegnen. Gastfreundschaft wird sowohl vom Team als auch von unserer Familie gelebt.“
Die Gäste kommen aus der DACH-Region und von noch weiter her. Sie sind an der regionalen Vielfalt bei Produkten und Landschaft, an Kultur und Architektur interessiert. „Urlauber und Geschäftsreisende schätzen unsere Liebe zum Detail, die persönliche Ansprache und natürlich unsere Gastfreundschaft!“ Charlotte Hirt weiß, dass sich die Wünsche von Kund:innen und Mitarbeiter:innen gleichermaßen weiterentwickeln. Ihr geht es darum, Werte zu vermitteln und Individualität zu fördern. Ein weiteres Credo lautet: „Trends erkennen, aber nicht wetteifern!“


„Eine Landpartie mit Tisch und Bett“ – das ist der GASTHOF RÖSSLE in BRAZ auf eine griffige Formel gebracht. Gastgeber Martin Bargehr spricht mit seinen Gästen nicht nur gern über Speis und Trank, sondern interessiert sich für vielfältige Themen. Das wissen sie sehr zu schätzen, ebenso wie Martins Bruder Valentin, der Inhaber und Küchenchef: „Es ist ein großes Glück, neben ihm viele langjährige Mitarbeiter zu haben.“ Auf Kontinuität setzen die Bargehrs auch in den Beziehungen zu ihren regionalen Lieferant:innen. Zehn Zimmer hat der „gewachsene Betrieb“, den er in dritter Generation leitet.
Das Hauptgeschäft ist das À-la-carte-Restaurant. „Als Gast fühlt man sich hier – von der berühmten Fischsuppe an – einfach angekommen. Egal, ob in den historischen Stuben oder im schattigen Gastgarten“, lobte das Fachmagazin Falstaff. Ein Projekt des GVA Tourismusnetzwerks gab den Anstoß für die behutsame Renovierung des Betriebs. „Uns war wichtig, die familiäre Atmosphäre beizubehalten. Ein Vorarlberger Architekturbüro hat uns mit seinem Konzept überzeugt. Umgesetzt haben es Handwerker aus der Region“, erzählt Valentin.
Los Angeles

„Gastgeben auf Vorarlberger Art bedeutet für uns, dass wir den WÄLDERHOF LINGENAU als Fenster zur Natur verstehen. Die Natur liefert uns die Zutaten für die frische Küche ohne Fertigprodukte, für Kosmetika, Textilien und so weiter. Deshalb übernehmen wir für die Natur auch Verantwortung: von der Energie über die Reinigung der Zimmer bis zur Wäsche im eigenen Haus“, sagt Barbara Wild.
Sie ist in dritter Generation Gastgeberin im Wälderhof. Die Frühaufsteherin bringt von ihren Wanderungen immer wieder Kräuter, Beeren oder Pilze mit – und zeigt damit ganz unmittelbar den Gästen die Schönheit ihrer Heimat.
„Auch im Umgang mit unseren Gästen und Mitarbeitenden unseres kleinen Teams sehe ich Wertschätzung als Schlüssel für unseren Erfolg. Letztlich ist das ein Kreislauf, alles hängt mit allem zusammen.“

We are where you are


Wer kennt sie nicht: Die ganzen Berichtspflichten und Checklisten im Berufsalltag, die viel Zeit kosten, deren Nutzen aber häufig begrenzt ist. Bürokratie gibt es nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, sondern auch im privaten Sektor. In beiden Bereichen würde es sich auszahlen, das Dickicht an Papierkram zu hinterfragen und zu lichten.
UTTER geb 1968in

… arbeitet auf dem Gebiet der experimentellen Wirtschaftsforschung und Verhaltensökonomik, ist Direktor am Max Planck Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und lehrt an den Universitäten Köln und Innsbruck.
Abbau von Bürokratie ist eine immer wieder gehörte Forderung, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber auch um das Leben von Bürgern einfacher zu machen. Nicht selten kommt es vor, dass etwa in Formularen mehrmals nach der Adresse der ausfüllenden Person gefragt wird; als ob es nicht genügen würde, diese Information einmal anzugeben. Für Unternehmen kommen praktisch jährlich neue Berichtspflichten dazu. Ein bekanntes aktuelles Beispiel ist die ESG-Berichtspflicht, wonach Unternehmen verpflichtet sind, Informationen über ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken offenzulegen. Man fragt sich, ob neben dem Erstellen aller Berichte – die häufig auch noch ungelesen bleiben – überhaupt noch Zeit bleibt, etwas zu produzieren. Berichtspflichten und unnötige Formularangaben gibt es aber nicht nur aufgrund von oftmals fragwürdigen Bestimmungen politischer Entscheidungsträger, sondern auch unternehmensintern. Darunter ist zum Beispiel zu verstehen, dass Mitarbeiter in Unternehmen angeben müssen, wie und wann sie welche Arbeitsschritte oder Aufgaben erledigen. In der ökonomischen Theorie werden solche Berichtspflichten oft als notwendiges „Monitoring“ bezeichnet, also die Überwachung und Überprüfung, dass Mitarbeiter alles richtig machen (und nicht auf der faulen Haut liegen). Es wird auch argumentiert, dass solche Pflichten – häufig in der Form von Checklisten abzuarbeiten – vermeiden, dass Mitarbeiter Fehler machen, die für ein Unternehmen sehr kostspielig sein könnten. Selten wird in der ökonomischen Theorie darüber diskutiert, ob solche Berichtspflichten wirklich notwendig und nicht etwa kontraproduktiv sind, weil sie Mitarbeiter gängeln und diesen als ein Signal des Misstrauens von Seiten der Unternehmensführung erscheinen. Es erscheint aus diesem Blickwinkel betrachtet gar nicht unplausibel, dass der Nutzen von Berichtspflichten geringer als deren Kosten sein könnte. Nur ist das schwer zu messen.
Matthias Heinz von der Universität zu Köln hat mit mehreren Kollegen kürzlich eine Studie vorgestellt, die untersucht hat, welche Auswirkungen die Reduktion von Berichtspflichten in Unternehmen haben kann. Dazu kooperierte er mit einer großen Bäckereikette in Deutschland, die in 145 Filialen über 2000 Beschäftigte hat. Aufgrund einer eingehenden Erfassung stellten die Autoren fest, dass in jeder Filiale pro Woche bis zu 22 verschiedene Checklisten ausgefüllt werden mussten, viele davon jeden Tag und von jedem Mitarbeiter. Eine frühere Befragung aller Mitarbeiter hatte ergeben, dass solche Checklisten als Zeitverschwendung auf der einen Seite, aber auch als entwürdigend auf der anderen Seite wahrgenommen wurden. Zwei dieser Listen waren besonders unbeliebt. In einer davon musste jeder Mitarbeiter jeden Tag Arbeitsprozesse
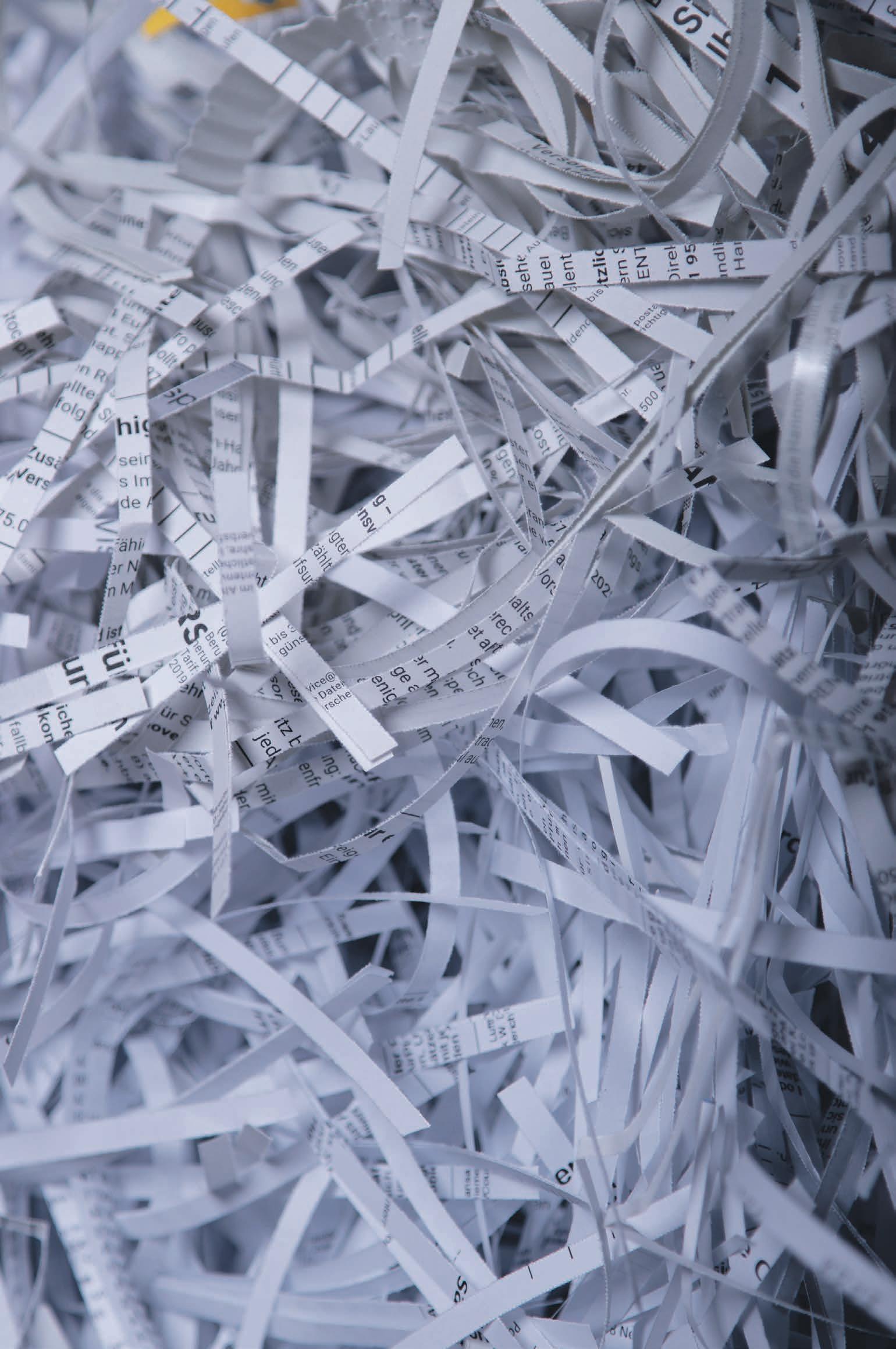
und -abläufe bestätigen, die überaus detailliert waren; beispielsweise, ob man jeden Kunden beim Bedienen angelächelt hat, ob man auf jeden Krapfen den Zucker in der richtigen Form aufgestreut oder ob man eine bestimmte Brotsorte im Ofen immer auf eine ganz bestimmte Seite des Backofens gelegt hat. Für jede Frage musste täglich abgezeichnet werden, dass man es richtig gemacht hatte. Im Schnitt brauchte jeder Mitarbeiter pro Woche über eine halbe Stunde für diese Checkliste. Dazu kam noch eine weitere halbe Stunde pro Woche für das Tagesprotokoll, in dem Vorfälle des Tages zu protokollieren waren.
Diese beiden (besonders unbeliebten und als unnötig erachteten) Checklisten wurden in der Hälfte der Filialen für die Dauer von neun Monaten abgeschafft. Dabei wurde zufällig festgelegt, in welchen Filialen diese Listen entfielen. Dann wurde aufgrund von Verkaufs- und Personaldaten und weiteren Befragungen untersucht, ob die Abschaffung einen Einfluss auf die betreffenden Filialen hatte, jeweils im Vergleich mit der anderen Hälfte der Filialen, in denen das Ausfüllen beider Listen weiter tägliche Pflicht war.
Die Ergebnisse sind eindeutig. Die Abschaffung erhöhte die Umsätze in den betreffenden Filialen um fast drei Prozent, was bei einem Gesamtumsatz der Bäckereikette von rund 100 Millionen Euro ein spürbarer Betrag ist. Die eingesparte Zeit (von über einer Stunde pro Woche und Mitarbeiter) konnte viel sinnvoller für den Verkauf und die Präsentation der Waren beziehungsweise der Verkaufsflächen verwendet werden. Die Abschaffung der beiden Checklisten hatte auch zur Folge, dass die Filialleiter substanziell seltener kündigten, insbesondere weil sie sich von unnötigem Papierkram entlastet fühlten und den Eindruck hatten, sie könnten sich wichtigeren Dingen widmen. Die Abschaffung der beiden Checklisten führte nicht etwa zu schlechterer Qualität der Bäckereiwaren oder einer schlechteren Präsentation der Waren, wie verdeckte Einkäufe bestätigten. Vielmehr führte sie zu einer stärkeren Identifikation mit dem Unternehmen und dem Eindruck, dass das Unternehmen den einzelnen Mitarbeiter stärker vertraute.
Der Effekt der Abschaffung dieser Checklisten war jedoch nicht in jeder Filiale gleich. Bereits vor der Durchführung der Studie wurden Regionalleiter gefragt, bei welchen Filialen sie positive Effekte erwarten würden. Wie sich zeigte, hatten die Regionalleiter ein gutes Gespür dafür, wo die Abschaffung positiv wirken würde, nämlich in jenen Filialen, die sie als „ohne Probleme“ beschrieben. Dort erhöhten die gewonnene Zeit und das gesteigerte Vertrauen die Produktivität. In Filialen, wo Probleme in der Belegschaft wahrgenommen wurden, brachte die Abschaffung der Checklisten hingegen keinen Vorteil. In Summe aber war die Reduktion von Berichtspflichten vorteilhaft für das Unternehmen.

Business English A2/B1 Communication
Inhalt
Nach diesem Kurs kommunizieren Sie leicht und professionell mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern im direkten Kontakt, per E-Mail, Brief oder Telefon. Ihre bestehenden Kenntnisse werden aufgefrischt und ausgebaut. Sie lernen aktuelle Konventionen im Geschäftsalltag und die entsprechenden Redewendungen und Ausdrücke dazu.
Trainerin
Cynthia Pintarelli
Trainingseinheiten: 32
Beitrag: € 449,-
Termin
2. - 25.4.2024
Di + Do 18:00 - 22:00 Uhr
WIFI Dornbirn
Kursnummer: 15550.15
Diplomlehrgang Public Relations Management
Inhalt
Kund:innen, Lieferant:innen oder Medien: Unternehmen müssen den Bedürfnissen zahlreicher Interessensgruppen gerecht werden. Public Relations hat sich in diesem Spannungsfeld schon längst zur Pflichtdisziplin jedes Unternehmens entwickelt - denn die Meinung der Öffentlichkeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Lernen Sie in diesem Diplomlehrgang, wie Sie mit Ihren Kund:innen und der Öffentlichkeit auf Augenhöhe kommunizieren.
Trainer
Mag. Herwig Dämon
Trainingseinheiten: 80
Beitrag: € 1.895,-
Termin
5.4. - 11.5.2024
Termine lt. Stundenplan
WIFI Dornbirn
Kursnummer: 23516.15
Achtsamkeits- und Meditationslehrer:in
Inhalt
Der Fokus dieser Fachausbildung liegt in der persönlichen Bewusstseinsentwicklung und in der Reflexion der eigenen Erfahrungen als Basis für eine professionelle Arbeit. Damit wird die Befähigung angestrebt, sich selbst, Einzelpersonen und Gruppen zum Thema Achtsamkeit und Meditation zu begleiten. Sie lernen unvoreingenommen nach innen zu lauschen und sich auf das Hier und Jetzt einzulassen.
Trainer
Dipl.Soz.päd (FH)
Max Straub
Trainingseinheiten: 160
Beitrag: € 2.850,-
Termin
17.4. - 19.10.2024
Termine lt. Stundenplan
St. Arbogast
Kursnummer: 11521.15

Lehrgang Krisenmanagement
Inhalt
Eine Krise ist eine absolute Stresssituation für die Organisation, unabhängig ob diese von externen oder internen Ursachen ausgelöst wurde. Diese Ausnahmesituation kann mit bestehenden Strukturen und Prozessen nicht zweckmäßig gemanagt werden. Die Vorgehensweise in der Krise entscheidet aber über den Fortbestand der Organisation.
Trainer:innen Diverse Trainer:innen
Trainingseinheiten: 24
Beitrag: € 990,- zzgl. Prüfungsgebühr € 400,-
Termin
25.4. - 10.5.2024
Termine lt. Stundenplan
WIFI Dornbirn
Kursnummer: 64560.15
Verkaufsakademie
Dornbirn, 12.4 - 21.6.2024, Termine lt. Stundenplan, 91 Trainingseinheiten, € 2.350,-; K.Nr. 23550.15
Personalmanagement für KMU
Dornbirn, 24. + 25.4.2024, Mi + Do 9:00 - 17:00 Uhr, 16 Trainingseinheiten, € 445,-; K.Nr. 12572.15
Rhetorik - Freies Sprechen
Dornbirn, 12. - 20.4.2024, Fr + Sa 14:00 - 20:00 Uhr, 28 Trainingseinheiten, € 485,-; K.Nr. 10523.15
Six Sigma Green Belt
Dornbirn, 21.3 - 5.7.2024, Termine lt. Stundenplan, 88 Trainingseinheiten, € 4.160,- zzgl. Prüfungsgebühr € 480.-; K.Nr. 64504.15
Rhetorik und Schlagfertigkeit im Verkauf
Dornbirn, 23. - 24.4.2024, Di + Mi 9:00 - 17:00 Uhr, 16 Trainingseinheiten, € 580,-; K.Nr. 23555.15
IFS Management
Dornbirn, 14.3. - 14.6.2024, Termine lt. Stundenplan, 95 Trainingseinheiten, € 2.730,- zzgl. Prüfungsgebühr € 480,-; K.Nr. 64508.15
Quereinstieger:innen im Reisebüro
Hohenems, 2.4. - 17.5.2024, Termine lt. Stundenplan, 88 Trainingseinheiten, € 1.890,-; K.Nr. 77503.15
WIFI Dornbirn
Bahnhofstraße 24, 6850 Dornbirn, T 05572/3894-425, E info@vlbg.wifi.at WIFI. Wissen Ist Für Immer.
Hämmerle Kaffee investiert rund 1,7 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Produktionsbetriebs. Das Blu descher Unternehmen hat eine eigene Silo- und Mischanlage für die flexible und rasche Produktion von speziellen Instant-Heißgetränken entwickelt. Die se vereinfacht und beschleunigt die Her stellung von kleineren Chargen speziel ler Automaten-Füllprodukte. Zwei neue Verpackungsroboter sorgen zudem für mehr Effizienz, Flexibilität und Sicher heit bei den bestehenden Fertigungsli nien. Die Gesamtinvestition sorgt für ei ne Kapazitätssteigerung von 20 Prozent.
Größere Investitionen sind auch beim Beschlägespezialisten Grass am Stamm sitz in Höchst angekündigt. So wird das Unternehmen bis spätestens 2026 rund 40 Millionen Euro in diverse Baumaß nahmen investieren. Mit dieser anste henden Großinvestition sollen nicht nur regionale Arbeitsplätze langfristig erhal ten bleiben, sondern auch die Automati sierung erhöht und eine wertstromorien tierte Fabriksplanung umgesetzt werden.

Ebenso plant der Seilbahnhersteller Doppelmayr einen Meilenstein zur Stärkung des Standorts Hohe Brücke in Wolfurt. Mit neuen Produktionshallen und einem Hochregallager sollen dringend notwendige Kapazitäten für die steigende internationale Nachfrage geschaffen werden. Investiert werden über 200 Millionen Euro. In den nächsten vier bis fünf Jahren soll hier Raum für 850 hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden. Die geplanten neuen Produktionshallen umfassen eine Fläche von 45.000 Quadratmetern.
Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss dagegen expandiert in den USA. Nach der Gründung neuer Standorte im texanischen Laredo sowie in Miami im vergangenen Jahr wird das USA-Netz nun um einen weiteren Standort erweitert.

HERBERT MOTTER Stellvertretender Chefredakteur Thema Vorarlberg
Generalprobe für die Mars Analog Mission: Österreichisches Weltraum Forum testet bei Gebrüder Weiss in Wien.
erfolgen. Mit der Errichtung des Standortes in China würden sich Zeiten und Wegstrecken in den Lieferketten reduzieren. Damit verbessere sich auch der ökologische Fußabdruck. Collini bekennt sich laut der Wirtschaftspresseagentur aber unverändert zum Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Hier wird der Stammsitz in Hohenems mit zusätzlichen Hallen bis 2024 ausgebaut.
Im Geschäftsjahr 2023 konnte die Wolford AG einen Umsatz in Höhe von 126,9 Millionen Euro erzielen. Dies entspricht einer Steigerung von plus 1 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2022. Die Region AsienPazifik (APAC) verzeichnete ein Wachstum von 32 Prozent, während Nordamerika ein Wachstum von zwei Prozent auf der Basis von konstanten Wechselkursen für 2023 verzeichnete. Die Großhandelsumsätze stiegen um plus zwölf Prozent.
Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) zeichnete erstmals zwei Großprojekte von i+R Wohnbau Lindau mit dem Vorzertifikat in Gold aus. Sowohl das Vierlinden-Quartier in Lindau als auch der Bücklepark
besondere für die Entwicklung ehemaliger Industriebra- chen in hochwertige Wohnquartiere mit Gewinn von Grünflächen, für das Energiekonzept, die Infrastruktur, den Komfort und die hohe Wirtschaftlichkeit.
Der Getriebehersteller Zimm Group hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 29,5 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber 2022. ZIMM ist Marktführer in der Entwicklung und Produktion von Spindelhubgetrieben in verschiedenen Größen in Europa. Im Vorjahr konnte mit den ebenfalls elektromechanisch angetriebenen Industrieaktuatoren eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht werden, die eine gut funktionierende Alternative zu hydraulischen Systemen darstellt.
Auch der Technologiedienstleister Antiloop mit Sitz in Götzis kann auf ein weiteres äußerst erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken. Neben einem Umsatzwachstum auf über 2,1 Millionen Euro hat das Unternehmen die Mitarbeiterzahl verdreifacht auf zuletzt 26 Mitarbeitende. Mit Erweiterung der Führungsriege
steht das Jahr 2024 weiter auf Expansion und Transformation.
Mit 1. März 2024 geht die MEGA Pulverbeschichtungen GmbH aus Schwarzach an die Feuerverzinkerei Karger aus Illertissen in Deutschland über. Die Eigentümer des heimischen Pulverbeschichtungs- und Sandstrahl-Experten regeln damit erfolgreich ihre Nachfolge. Gleichzeitig stellen beide Unternehmen durch die neue Zusammenarbeit die strategischen Weichen für eine gemeinsame Zukunft. Die MEGA Pulverbeschichtungen GmbH ist spezialisiert auf das Sandstrahlen und vor allem die Beschichtung von Großteilen für metallverarbeitende Betriebe in den unterschiedlichsten Farben und Oberflächenstrukturen.
Auf Expansionstour ist auch der zweite Vorarlberger Beschlägespezialist, Julius Blum GmbH. Blum integriert den belgischen Vertreter und Produzenten von Möbelkomponenten Van Hoecke in die eigene Gruppe. Kontinuität als oberste Prämisse – sowohl für die Kunden, die weiterhin den gewohnten Service bekommen, als auch für die 360 Mitarbeitenden von Van Hoecke, die neu zur Blum-Gruppe dazustoßen.
Mondelēz International arbeitet an seinen Fortschritten, den gesamten CO2Fußabdruck zu reduzieren mit dem langfristigen Ziel, bis 2050 ein Netto-NullEmissionsziel (NZ) zu erreichen. Dies soll unter anderem durch die Einführung neuer energieeffizienter Technologien und den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien erreicht werden.
Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg emittiert erfolgreich einen 300 Millionen Euro schweren Pfandbrief am europäischen Anleihenmarkt. Das Interesse heimischer und internationaler Investoren war groß. Der Erlös fließt in die Region zurück.
Ihre Führungsstruktur verstärkt die Sutterlüty Handels GmbH und freut sich, mit Florian Sutterlüty die dritte Generation in die Geschäftsleitung zu berufen. Florian ist ab sofort, neben Jürgen Sutterlüty, als Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb, Strategie und HR zuständig.
Österreich hat kein berauschendes Jahr hinter sich und ein nicht sonderlich vielversprechendes Jahr vor sich: Die Wirtschaft ist in die Rezession abgetaucht, die Lohnstückkosten steigen durch die hohen Lohnabschlüsse schneller als in allen anderen westeuropäischen Industrieländern, und zu allem Überfluss wird auch noch gewählt, was dem ohnehin schwer angeschlagenen Staatshaushalt nicht gut tun wird. Das alles scheint aber niemanden zu beunruhigen. Alles geht seinen gewohnten Gang, dabei bräuchte das Land dringend ein paar Veränderungen:
1 | Die Löhne brutto ausbezahlen. Alle Arbeitnehmer wissen, wie viel sie netto verdienen. Aber die meisten wissen nicht, wie viel sie zum Gelingen des Staatsganzen beitragen und wie viel die staatlichen Leistungen sie tatsächlich kosten. Weil die Steuern und Abgaben der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern an den Staat abgeführt werden. Wir sollten auch hier dem Beispiel der Schweiz folgen und die Löhne brutto auszahlen. Jeder Arbeitnehmer überweist seine Krankenversicherung, seine Pensionsversicherung und seine Lohnsteuer selbst. So wie das bei allen anderen Ausgaben des täglichen Lebens perfekt funktioniert. Alle könnten darüber befinden, ob sie die Kosten der staatlichen Leistungen für angemessen oder überzogen halten. Der Druck auf bessere staatliche Angebote würde deutlich steigen.
2 | Vollzeitarbeit honorieren.
In Österreich wurden seit 1995 netto keine neuen Vollzeitstellen geschaffen. Und das, obwohl heute um 1,2 Millionen Menschen mehr in diesem Land leben als damals. Der gesamte Beschäftigungszuwachs findet Teilzeit statt. Das hat nicht nur mit fehlender ganztätiger Kinderbetreuung zu tun. Sondern insbesondere damit, dass es sich viele Haushalte leisten können, weniger zu arbeiten. Wir haben es hier also mit einem erfreulichen Wohlstandsphänomen zu tun. Zudem ist Mehrarbeit nur noch in Spanien und Belgien unattraktiver als in Österreich. Wer die Arbeitszeit um 50 Prozent erhöht, bekommt in Öserreich nur 32 Prozent mehr netto, in Schweden und Dänemark sind es 44 Prozent. Heimische Regierungen haben in den vergangenen Jahren immer wieder niedrige Einkommen
steuerlich entlastet – weshalb der Netto-Stundenlohn in Teilzeit höher ist als in Vollzeit. Österreichs Bevölkerung überaltert, deshalb braucht der Sozialstaat dringend mehr (Voll)Zahler. Will die Politik verhindern, dass mehr Menschen immer weniger arbeiten, muss sie die Belastung der mittleren und höheren Einkommen senken.
3 | Kinder aus schwachen Haushalten fördern. Österreichs Schüler landen bei internationalen Bildungstests seit Jahren abgeschlagen im Mittelfeld – und das, obwohl in der EU nur Luxemburg noch mehr Geld pro Schüler ausgibt als Österreich. Das schlechte Abschneiden liegt nicht nur an den Schulen, sondern auch an der starken Migration. Respektive daran, dass die Bildungspolitik so tut, als gäbe es sie nicht.
Zur Person
FRANZ SCHELLHORN
* 1969 in Salzburg, ist seit 2013 Direktor der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria und ein ehemaliger Wirtschaftsjournalist. Von 2004 bis 2013 leitete der promovierte Ökonom das Wirtschaftsressort der Tageszeitung „Die Presse“, ab 2011 war er dort auch stellvertretender Chefredakteur. Schellhorn schreibt regelmäßig im Nachrichtenmagazin „Profil“.

4 | Das Investitionsklima verbessern. Österreich wird 2024 die mit Abstand höchsten Lohnkostensteigerungen der EU-15 verzeichnen. Gleichzeitig wächst die Produktivität der Erwerbstätigen pro Stunde kaum noch, ist pro Kopf betrachtet sogar schon länger rückläufig. Um nicht aus vielen Märkten zu fliegen, muss sich das ändern. Dazu braucht es Investitionen. Aber wer investiert schon gerne in einem Land, in dem Unternehmen von der Politik als „Abzocker“ vorgeführt werden? Wer steckt sein Geld in einen Standort, in dem schon bald Vermögen- und Erbschaftsteuern eingeführt werden, die fast ausschließlich Unternehmen treffen? Österreich braucht keine neuen Steuern, Österreich braucht eine grundlegende Modernisierung. Allein das Adressieren von Problemen, die für jedermann sichtbar sind, schafft Vertrauen in den Standort. Wir müssen wieder mehr über das Erwirtschaften des zu Verteilenden reden als über das Verteilen
Die Ausgaben bremsen wie die Schweizer. Die Bundesregierung wird bis 2027 jedes einzelne Jahr mehr Geld ausgeben als in den Corona-Jahren 2020 und 2021. Obwohl die Pandemie zumindest budgettechnisch kein Thema mehr ist. Wie der Ausgabenrausch in den Griff zu kriegen ist, zeigt die Schweiz. Schon vor mehr als 20 Jahren wurde hier eine Schuldenbremse beschlossen. Gebremst werden allerdings nicht Schulden, sondern die Ausgaben: Sie dürfen die prognostizierten Einnahmen nicht überschreiten. Letztere werden um konjunkturelle Schwankungen bereinigt, in Zeiten wirtschaftlicher Hochphasen darf weniger ausgegeben
Was tun gegen Rezession, Bildungsmisere und Budgetdefizite? Österreich braucht Reformen, sonst werden die Probleme immer größer.
Von Franz SchellhornKI – Echte Hilfe oder schlechter Hype? Renommierte Experten referierten auf Einladung der Wirtschaftskammer vor 1000 Besuchern im Montforthaus.
Von Herbert Motter, Eva Niedermair und Daniela Vonbunwerden, in Krisenzeiten ist die Politik aufgefordert, aktiv gegenzusteuern und Geld in die Hand zu nehmen. Einzige Bedingung: Die Mehrausgaben müssen innerhalb einer festgelegten Frist von sechs Jahren wieder hereingespielt werden. Das funktioniert prächtig, ohne dass die Schweizer Straßen brüchig oder die Spitäler heruntergekommen wären.
6 | Die tickende Pensionsbombe entschärfen.
Auch wenn viele es nicht mehr hören wollen: Wir haben ein erdrückendes Pensionsproblem. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Pensionisten bis 2050 um knapp eine Million steigen. Zu diesem Zeitpunkt werden 1,3 Erwerbstätige einen Pensionisten erhalten müssen – ein ziemlich sportliches Unterfangen. Auch die Politik hat keine Antwort auf die Frage, wer dann den Sozialstaat finanzieren soll. Zumal bereits heute jeder vierte Budgeteuro dafür aufgewendet werden muss, das Finanzloch im staatlichen Pensionssystem zu stopfen. Allein in den kommenden fünf Jahren muss der Staat 168 Milliarden Euro zuschießen, um die Finanzierungslücke zu stopfen. Die Lösung: Das Pensionsantrittsalter muss an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Besser gestern als heute. So wie das viele vergleichbare Länder längst gemacht haben.
7 | Den Klimaschutz säkularisieren.
In eine lebenswerte Zukunft werden uns nicht die Apokalyptiker führen, die sich auf die Straßen kleben. Sondern Ingenieure, die innovative Lösungen finden. Es ist nicht lange her, dass die Politik die Emissionsziele festgesetzt hat, während Techniker überlegt haben, wie diese am besten zu erreichen wären. Ökonomen waren derweil damit befasst, klimaschädliches Verhalten so zu bepreisen, dass der Umstieg auf die neuen Technologien möglichst zügig erfolgt, und schmutzige Importe so zu bezollen, dass die Exporteure ebenfalls einen Anreiz für Klimapolitik haben. Zu dieser Aufgabenteilung sollten wir zurückkehren und uns nicht von Politikern vorschreiben lassen, welcher Antrieb der richtige ist und wie wir in Zukunft am besten heizen.
Dieser Text von Franz Schellhorn ist in der „Kleine Zeitung“ am 6. Jänner 2024 erschienen, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Künstliche Intelligenz ist zweifellos eines der faszinierendsten, aber auch kontroversesten Themen unserer Zeit. Die Technologie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten, leben und interagieren, grundlegend zu verändern. Doch zugleich begegnen uns auch viele Fragen und Unsicherheiten. Ist KI eine echte Hilfe für Unternehmen oder nur ein aktueller Hype? Gibt es reale Anwendungen, die Unternehmen einen Mehrwert bieten, oder sind die Versprechungen von KI übertrieben? Wie wird KI unser Zusammenleben und unsere Geschäftsmodelle verändern? Auf Einladung der Wirtschaftskammer Vorarlberg referierten vor kurzem Expertin Alexandra Ebert und Experte Tristan Post vor 1000 Besuchern aus Wirtschaft und Politik im Montforthaus zu diesem Thema.
In Unternehmen
Tristan Post, KI-Experte, freier Berater und Lehrender an der Technischen Universität München, sagte dabei einleitend, dass der Durchbruch von generativer KI und Tools wie ChatGPT, Midjourney und ähnlichen Entwicklungen KI in die breite Masse gebracht hätten: „Wir erleben gerade, wie KI zunehmend zu einem Gebrauchsgegenstand wird; ähnlich der Entwicklung bei Computern in den 1960er- und 1970er-Jahren.“ Viele Unternehmen stünden in ihren entsprechenden Bemühungen, KI im Unternehmen zu verwenden, aber erst am Anfang: „Entscheidend ist aber nicht die Frage, wie man KI in einem Unternehmen integriert, sondern wie man mit KI Mehrwert schafft.“ Post unterstützt Unternehmen zu Beginn ihrer KI-Transformation, und verfolgt dabei das Ziel „mit minimalem Aufwand maximale Wirkung“ zu erzielen. Dem Experten zufolge muss dabei zwischen zwei Arten der Künstlichen Intelligenz unterschieden werden: Zwischen der schwachen und der starken KI. Während die schwache
KI – zu ihr zählt auch ChatGPT – in spezifischen Aufgaben hervorragend ist, etwa beim Sortieren von E-Mails in Spam und Nicht-Spam oder im Erkennen von Krankheiten auf medizinischen Bildern, agiert die starke KI ähnlich wie der Mensch, sie kann ihr Wissen in vielen Bereichen anwenden. Post zufolge stimmt es, dass „viele KI-Algorithmen nicht sehr transparent sind und es oft schwierig ist, zu verstehen, warum die KI zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist“. Deshalb werde zunehmend an der Verbesserung der Transparenz dieser Algorithmen gearbeitet, um sie fairer zu machen. In der Zukunft erwartet er sich signifikante Fortschritte im Bereich der generativen KI. „Diese wird zunehmend autonomer und bietet die Möglichkeit, auf Unternehmensebene autonome Agenten zu entwickeln, die auf dem Wissen, den Daten und Prozessen eines Unternehmens basieren“, erklärt Post. Unternehmen müssen sich Gedanken darüber machen, eigene Verantwortliche oder gar Teams für das Thema KI einzusetzen.
„Responsible AI“
Für die KI-Expertin und Chief Trust Officer bei Mostly AI, Alexandra Ebert, wird es die große Herausforderung sein, eine Vertrauenswürdigkeit für Unternehmen in Bezug auf KI-Standards zu schaffen. Ihr Hauptanliegen ist eine „Responsible AI“, sprich eine verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz. Die wichtigsten Eckpfeiler sind dabei der Datenschutz, die Sicherheit der Systeme, aber auch die
Fairness, Diversität, Inklusion und die Nicht-Diskriminierung. Aus ihrer Sicht gehören Daten demokratisiert und entdiskriminiert. Zu sehr dominiere noch in den Daten das Weltbild des weißen Mannes mittleren Alters. Man müsse entgegensteuern, damit dann nicht Stereotype weiterverbreitet werden.

„Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz geht es letztlich immer darum: Kann ich dadurch produktiver werden? Kann es mir Arbeit abnehmen? Kann ich neue Dinge machen, die bisher nicht denkbar waren?“ KI als Selbstzweck einzusetzen, wäre aus ihrer Sicht falsch. Achtsamkeit sei sehr wichtig. Alexandra Ebert vertritt die Meinung, dass KI eine Grundlagentechnologie wird, ähnlich wie Strom. „Was ich hoffe beziehungsweise wo wir noch Schritte setzen müssen, um das in Österreich und Europa möglich zu machen, ist, dass KI auch gesellschaftlich für den sogenannten ,social impact‘, die Potenziale realisieren kann, die man ja immer wieder damit in Verbindung bringt, gerade in den Bereichen Medizin, Klimawandel.“ Weder Ebert noch Post sehen durch KI übrigens Arbeitsplätze in Gefahr.
Große Chancen
Der Gastgeber des Abends, Wirtschaftskammer-Präsident Wilfried Hopfner, ist davon überzeugt, dass die Integration von KI-Technologien in Unternehmen enorme Chancen bietet, sei es in der Effizienzsteigerung, der Produktinnovation oder der Erschließung neuer Märkte. „Gleichzeitig verstehen wir jedoch auch die Bedenken und Fragen aus ethischer Sicht, welche sich in diesem Zusammenhang ergeben“, sagte der WKV-Präsident. „Was am Arbeitsmarkt passieren wird, hängt wohl davon ab, wie wir dieser neuen Technologie begegnen. Wenn wir die Herausforderung annehmen, dann kann KI eine große Chance für uns sein“, erklärte wiederum Landeshauptmann Markus Wallner.
Von Einbürgerungen, dem Produktionswert der hiesigen Landwirtschaft, einem Rückgang der Impfquote und ertappten Schnellfahrern – Fakten zu Vorarlberg.
Von Herbert Motter
In DOREN eröffnete 1901 die erste Käsereischule Österreichs.
Bunt gemischt
01 02
03
04
05
Mit 677 Einbürgerungen wurde im Vorjahr in Vorarlberg der höchste Wert der vergangenen 15 Jahre erreicht.
Von den österreichweit 1,1 Milliarden Euro des Zukunftsfonds für das Jahr 2024 erhält Vorarlberg einen Anteil von insgesamt rund 49 Millionen Euro.
Insgesamt 168 Vorarlberger Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen sind mit dem Landes-Gütesiegel „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“ prämiert.
130 Millionen Euro gibt das Land Vorarlberg jährlich für die Kinderbetreuung aus.
9313 Haushalte – rund 17.800 Menschen – sind in Vorarlberg im Vorjahr mit der Wohnbeihilfe des Landes unterstützt worden.
Das Klimaticket, ein Erfolg
In Vorarlberg sind im vergangenen Jahr 85.618 Klimatickets verkauft worden. Das bedeutete gegenüber 2022 eine Steigerung um 5,5 Prozent, gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 gar einen Zuwachs von 13,3 Prozent. „Wir haben vieles in Bewegung gebracht“, sagte der zuständige Landesrat Daniel Zadra bei der Präsentation der Bilanz.
SONNTAG liegt auf 888 Metern Höhe.
SILBERTAL hieß bis ins 17. Jahrhundert hinein „Silberberg“.

06 Quelle:
Derzeit gibt es in Vorarlberg 510 landwirtschaftliche Biobetriebe.
Ranking
PRODUKTIONSWERT der Vorarlberger
LANDWIRTSCHAFT 2022
[1] Tierische Erzeugnisse 55%
[2] Tiere 19%
[3] Futterpflanzen 15%
[4] Gemüse & Gartenbau 9%
[5] Obst 1,3%

WETTERRADAR VALLUGA

Das nach einem Blitzeinschlag 2017 stillgelegte Wetterradar Valluga in St. Anton am Arlberg wird mit einem Kostenaufwand von 3,8 Millionen Euro wieder errichtet. Auf 2800 Metern Seehöhe soll das Radar,
POLIZISTEN wurden 2023 im Zuge von Amtshandlungen


SCHNELLER ALS DIE POLIZEI ERLAUBT
Die Verkehrspolizei in Vorarlberg hat im vergangenen Jahr einem ORF-Bericht zufolge mehr als 214.000 Autofahrerinnen und Autofahrer erwischt, die zu schnell gefahren sind. Zudem hieß es, dass die Polizei im Vorjahr 39.930 Alkotests durchgeführt habe, dabei waren rund 1.160 Lenkerinnen und Lenker mit mehr als 0,5 Promille am Steuer ertappt worden.

Wohl kein anderer Punkt in Vorarlberg steht derart symbolhaft für den früheren, zerstörerischen Umgang mit Landschaft und Natur wie der gespaltene Udelberg. Im Bild zu sehen sind Bauarbeiten im Jahr 1970. Aus der Bilddatenbank volare der Vorarlberger Landesbibliothek.
Das Land strebt eine Gesetzesänderung an, die es künftig allen Gemeinden ermöglichen soll, Radaranlagen aufzustellen.
Jener Mann, der im August in Bregenz auf eine Wohnungstür geschossen haben soll, wurde nun in Basel festgenommen. Der 27-Jährige war ein halbes Jahr lang auf der Flucht.
In Vorarlberg gibt es mittlerweile drei bestätigte Masernfälle sowie zwei Verdachtsfälle. Die Behörden erneuern dringend ihre Impf-Empfehlung. Masern können zu schweren Komplikationen führen.
Der Staatsvertrag zwischen Österreich und der Schweiz für das 1,9 Milliarden Euro teure Hochwasserschutzprojekt Rhesi soll im Mai unterschrieben werden.
Österreich und die Schweiz haben bisher nicht über die Variante „Lustenau Süd“ der S18 verhandelt. Diese war von Ministerin Leonore Gewessler im Vorjahr als Alternative zur CP-Variante präsentiert worden.
Von der Skipiste ins Spital: Seit Jänner wurden 141 Patienten mit dem Notarzthubschrauber in die Unfallambulanz des LKH Bludenz gebracht.
Bei Bauarbeiten in der Feldkircher Innenstadt ist eine bereits vor dem 15. Jahrhundert errichtete Mauerstruktur entdeckt worden.
2177 Vorarlberger Paare haben sich im Vorjahr das Ja-Wort vor dem Standesamt gegeben.
Die Landesregierung hat den Umbau der Senderstraße und den Neubau eines Kreisverkehrs beim Güterbahnhof Wolfurt beschlossen. Die Bauarbeiten sind von März bis September 2024 geplant.
Die Polizei warnt aktuell vor Einbrüchen in Wohnhäuser und ebenerdige Wohnungen. Zuletzt waren Unbekannte in Häuser in den Bezirken Dornbirn, Feldkirch und Bludenz eingebrochen, jeweils in den Abendstunden. In all diesen Fällen waren die Bewohner nicht zu Hause.

www.hubertlampert.com
„Chronologie IV“
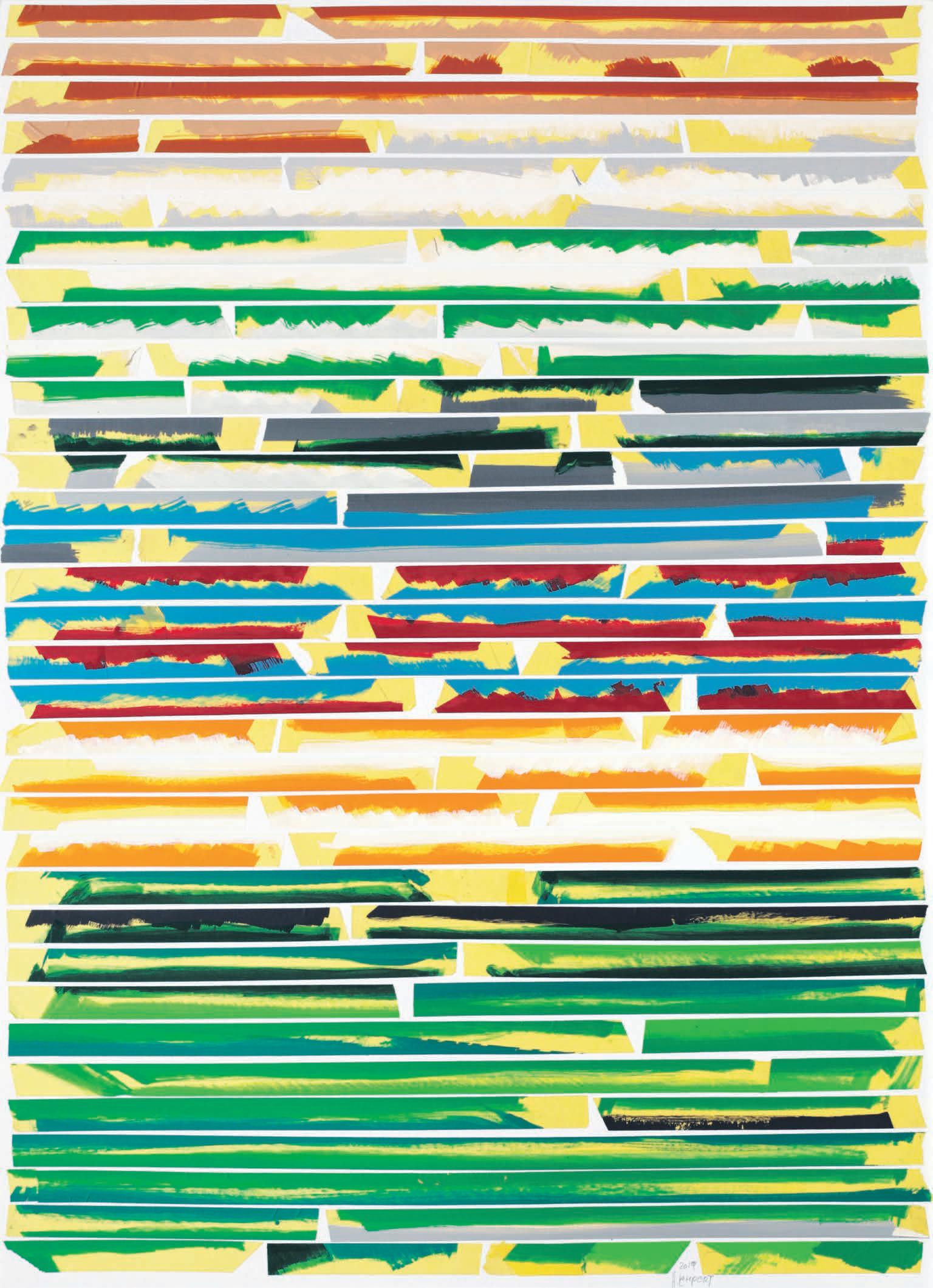

Eine Schule, die gut ist für Kinder mit Behinderungen, ist die bessere Schule für alle.“ Es gibt Sätze, die begleiten ein Leben lang. Aufgetaucht vor circa 35 Jahren, als Eltern von Kindern mit Behinderung mit engagierten Pädagog:innen gemeinsames Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung in Vorarlberg „erkämpften“. Die Elternbewegung war Teil der internationalen Selbstbestimmt-Leben Bewegung von jungen Erwachsenen, die uns die Augen öffneten dafür, dass Menschen mit Behinderung keine besonderen Bedürfnisse haben, sondern dieselben wie alle anderen auch, und keine Sonder-Orte brauchen. Was sie brauchen ist besondere Unterstützung. Lernen miteinander, voneinander, auch nebeneinander, gemeinsam UND individuell, weil ALLE Kinder, unabhängig ob Diagnose oder nicht, mit völlig unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in die Schule kommen. Eine Schule, die Vielfalt ernst nimmt, lässt Kinder im eigenen Lerntempo lernen, berücksichtigt individuelle Lernstile und Interessen – ein unschätzbarer Mehrwert für ALLE – auch für leistungsstarke Kinder, die sich nicht selten in Schulen langweilen. Potenzialentfaltung für ALLE, kein gnädiges Zugeständnis an Kinder mit Behinderungen.
Doch es geht um mehr. Schulen sind die Orte, an denen das gemeinsame Leben ALLER – unabhängig vom familiären Hintergrund, von Leistungsstärke (von Hochbegabungen bis hin zu Beeinträchtigungen), Sprache, Religion, Geschlecht u.a. eingeübt werden kann und auch muss. Wo sonst sollen Kinder als die Erwachsenen der Zukunft Demokratie lernen? Lernen, dass jeder Mensch gleich viel zählt, dass manche Menschen mehr, andere weniger Unterstützung brauchen?
Die Hartnäckigkeit, mit der an aussondernden Lernorten festgehalten wird und die frühe Trennung von Kindern mit 10 Jahren verspielt diese Chancen – für Kinder und die Gesellschaft.
Wieso? Weshalb? Warum?

Was war hier vor 1000 Jahren, warum können Räder fahren, sind Wolken schneller als der Wind, so viele Fragen hat ein Kind.“ 1979 hat Udo Jürgens diese Strophe im Lied „1000 Jahre sind ein Tag“ geschrieben. Eltern und Pädagog:innen kennen das nur zu gut: Unsere Kinder stellen den ganzen Tag Fragen! Für sie ist die Welt ein großes Geheimnis und sie wollen allen Dingen auf den Grund gehen. Wenn wir ehrlich sind, manches von dem, was Kinder fragen, wissen wir selbst auch nicht!
Es gibt zwei Möglichkeiten auf die Fragen unserer Kinder zu reagieren: Entweder „Ach Kind, komm lass die Fragerei, für sowas bist du noch zu klein“, um Udo Jürgens zu zitieren, oder wir versuchen gemeinsam mit dem Kind eine Antwort zu finden. Zweiteres eröffnet uns und den Kindern die Tür zum Ergründen und Verstehen der Welt, indem wir Hypothesen aufstellen und diese prüfen. In unseren Kindergärten beginnen schon die Jüngsten, hinter die Phänomene der Natur zu schauen und Technik zu erleben. In den Volksschulen lässt „Technik und Design“ als neues Schulfach Kinder selbst Hand anlegen und Dinge erschaffen. Angebote wie zum Beispiel die Skills Week führen Jugendliche dann tiefer in die Anwendungen von Naturwissenschaften in der Technik. Angeleitet von ebenso wissbegierigen Erwachsenen entsteht so Begeisterung für die MINTFächer. Diese Neugierde und Freude am Tun ist der Grundstein für den Berufseinstieg und die weitere Entwicklung. Wir Erwachsene reden in diesem Kontext oft von „Skills“, also von Fähigkeiten, die die Kinder erlernen sollen. Die Basis für alle „Skills“ ist die Neugierde, das „ich will wissen, wie das geht, wie das gemacht wird“.
Um mit Udo Jürgens Worten zu schließen: „Ich bitt euch, fragt, solang ihr seid, Ihr seid die Zeit!“ – Stellen wir uns also den Fragen der Kinder!

Die Situation der Gleichstellung von Frauen und Männern bei uns im Ländle gibt nicht unbedingt Anlass, besonders stolz zu sein. Im März kommen die städtischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Österreichs zum Arbeitstreffen nach Bregenz. Ich freue mich darauf, gleichzeitig ist mir schmerzlich bewusst, dass wir im Vergleich mit den anderen Bundesländern beim Thema Gleichstellung oft Schlusslicht sind. Bei der Gehalts- und der Pensionskluft liegen wir in Vorarlberg auf dem beschämenden letzten Platz. Hierzulande erzielen Männer das höchste Jahreseinkommen in Österreich, Frauen das geringste. Unbezahlte Familien- und Sorgearbeit obliegt hauptsächlich den Frauen, während die Entscheidungsmacht in Politik und Wirtschaft vorwiegend in Männerhand ist. Wo bleibt hier die gerechte Aufteilung von Chancen und Herausforderungen zwischen den Geschlechtern? Ist es nicht längst an der Zeit für einen Rollenwandel, zum Wohle aller?
Grund stolz zu sein, habe ich trotzdem: Es ist das erste Mal, dass besagtes Treffen in Vorarlberg stattfindet. Seit 2021 bin ich als Bregenz-Vertreterin Teil dieses wertvollen Austausches zwischen Städten wie Graz, Linz oder Wien. Damals verankerte die Stadt Bregenz das Thema Frauen und Gleichstellung als erste Stadt Vorarlbergs gemeinsam mit dem Thema LGBTIQ+ in der städtischen Verwaltung – mit dem Bekenntnis, sich auf kommunaler Ebene für das gesamtgesellschaftliche Ziel der Gleichstellung stark zu machen. Als Landeshauptstadt ging sie damit als Pionierin in Vorarlberg neue Wege.
Sich als Stadt oder Gemeinde proaktiv für Gleichstellung einzusetzen, mag manchen als vernachlässigbares Randthema erscheinen. Dieser Einsatz führt jedoch Schritt für Schritt zu einer gleichberechtigteren Zukunft – und davon profitieren schlussendlich alle.
Monika Wagner
Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft

Stellen Sie sich vor, Sie gehen über den Kornmarktplatz in Bregenz oder den Marktplatz in Dornbirn und begegnen einem kahlrasierten jungen Mann im Anzug mit weiß getünchtem Kopf. Mit einem Pinsel malt er sich eine dicke schwarze Linie durch die Mitte, sie teilt sein Gesicht und den Kopf in zwei Hälften. Was würde geschehen? Wir würden ihn wahrscheinlich als Spinner abtun und mit betretenem Blick weitergehen. Würden wir es als anstößig empfinden? Wohl eher nicht. Uns vermag ein Szenario wie dieses kaum mehr zu erschrecken. 1965, im Jahr von Günter Brus‘ Aktion Wiener Spaziergang, wurde sein Verhalten noch als widerwärtig und moralisch verwerflich empfunden. Brus wurde von der Polizei abgeführt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Es war nur eine der Aktionen des jungen Künstlers mit dem Ziel, auf politische und gesellschaftliche Missstände hinzuweisen und die Öffentlichkeit aufzurütteln, sie zu provozieren.
Das Kunsthaus Bregenz zeigt derzeit eine umfassende Ausstellung dieses Ausnahmekünstlers, der Zeichner, Maler und Literat zugleich war und wenige Tage vor der Eröffnung in hohem Alter verstorben ist. Fast 800 Menschen sind zur Eröffnung gekommen. Der kühle Beton des Hauses, das Licht, die kathedrale Anmutung des KUB – sie bilden einen beeindruckenden Rahmen für ein faszinierendes Gesamtwerk, das niemanden kalt lässt. Aktueller könnte eine Ausstellung nicht sein. Gräben und schmerzhafte Risse tun sich auf, dicke schwarze Linien, in Europa und auf anderen Kontinenten. Ich stehe vor der Fotografie von Günter Brus mit weißem Kopf und schwarzem Strich und denke über den Zustand unserer Gesellschaft nach. Eine ins Schwanken geratene politische Mitte und eine gefühlte Unerbittlichkeit, mit der wir uns manchmal begegnen. Eine Person neben mir meint: „Für mich hat die Naht auch etwas Verbindendes, das die Hälften zusammenfügt.“ Ein schöner Gedanke. Die Kraft dieses Bildes ist ungebrochen.
Daniela Alge wurde im Bregenzerwald geboren, betreibt mit ihrer Familie einen Bio-Bauernhof im Allgäu und hat sich von einer Pädagogin zur Autorin entwickelt. Ein Gespräch über regionale Krimis und heilsames Schreiben.
veröffentlicht, aktuell beschäftigt sich die Autorin mit Wurzeln im Bregenzerwald mit dem heilsamen und autobiographischen Schreiben. Vier
In Bizau im Bregenzerwald ist Daniela Alge mit ihrer Familie, der Vater Waldaufseher, die Mutter vermietete Ferienzimmer, aufgewachsen. „Während der Woche waren wir immer mit den Nachbarskindern draußen unterwegs, im Winter mit Schulfreundinnen auf dem Hirschberg beim Skifahren und Boarden, im Frühling und Herbst mit der Oma im Vorsäß, an Sommer-Wochenenden mit der Familie in den Bergen“, erinnert sie sich zurück. Nach der Pflichtschule in Bezau entschied sich die junge Frau für eine Ausbildung als Kindergartenpädagogin in Feldkirch. Bis 2002 verantwortete sie die Leitung des Kindergartens in Mellau, die folgenden fünf Jahre war sie Älplerin und Schneesportlehrerin. Vor siebzehn Jahren hat Daniela Alge mit ihrem Mann Christian dann den Hof im Allgäu übernommen, auf dem dessen Großmutter aufgewachsen war. Heute lebt das Paar mit ihren drei Kindern auf dem Bio-Bauernhof im nahen Wangen.
Im Allgäu fühlt sich die gebürtige Bregenzerwälderin wohl: „Die Wälder haben mit den Allgäuern sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als mit den Wienern. Die Grenze zwischen dem Bregenzerwald und dem Allgäu ist nach meinem Gefühl nur auf Papier gezeichnet.“ Außerdem schätzt es die 49-Jährige, ländlich zu wohnen, findet Ausgleich in den Bergen, genießt aber auch die Nähe zur Stadt Wangen. „Dort gibt es noch richtig viele kleine Läden, in denen ich alles bekomme, was ich im Alltag brauche.“
Für die Autorin, Schreibgruppenleiterin und Landwirtin ist klar: „Ich komme ganz wunderbar ohne ein Amazon-Konto klar und würde mir wünschen, dass meine Leserinnen meine Bücher in kleinen Buchhandlungen vor Ort kaufen.“
Im März 2024 wird Daniela Alges neuer Roman „Die Botschaft der Eule“ erscheinen. Die Veröffentlichung findet diesmal im Selbstverlag statt: „Ich bin glücklich über die vielfältigen Möglichkeiten für Autorinnen heutzutage und dass es auf diesem Weg wirklich möglich ist, eigene Schreib-Träume zu leben und zu verwirklichen, ohne sich an einen Markt und die Vorstellung anderer anpassen zu müssen.“
Schreibfreundin, Buchliebhaberin, Landwirtin
Bücher begleiten Daniela Alge seit ihrer Kindheit: „Ich habe immer viel ge-

lesen und mir gewünscht, selbst mal ein Buch zu schreiben.“ Kurz vor ihrem 30. Geburtstag kam sie diesem Ziel auf unkonventionelle Weise näher, wie sie lachend erzählt: „Ich absolvierte einen Fernlehrgang mit dem Titel ‚Schreiben lernen – Autor werden‘ beim HumboldtInstitut, das damals auf der Rückseite vieler Zeitschriften Werbung machte.“ Parallel dazu kam der Trend zu Regionalkrimis bei der Neo-Autorin an: „Und damit auch der Gedanke, dass ich nicht zum Recherchieren nach Schweden oder Irland reisen muss, ein Krimi kann auch im Bregenzerwald spielen“.
Die 49-Jährige ist mittlerweile die Autorin von acht Büchern, davon vier Krimis. Sie hält auch Schreibkurse und be-
Lebenslauf
Daniela Alge wurde am 6. März 1975 in Au geboren und ist in Bizau aufgewachsen. Sie hat die Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Feldkirch absolviert und von 1994 bis 2002 die Kindergartenleitung in Mellau verantwortet. Fünf Jahre als Älplerin und Schneesportlehrerin folgten, bevor sie ab 2007 Landwirtin und Mutter wurde. Seit 2013 ist die 49-Jährige Autorin; sie schreibt Bücher, leitet Schreibgruppen und ist Landwirtin. Daniela Alge lebt mit ihrem Mann Christian und den Kindern Sonja, Maja und Matteo in Wangen im Allgäu.
wirtschaftet mit ihrem Mann den Biohof. Der Alltag ist stark von der Natur geleitet. Im Winter und an Regentagen sind ihre Schreibzeiten länger, im Sommer komme sie oft wochenlang kaum dazu. „Eine Landwirtschaft ist kein Job mit geregelten Arbeitszeiten, du kannst keinen Urlaub planen und oft genug keinen Feierabend. Es gilt, die Pausen zu nützen und dann zu schreiben.“ Aber kein Nachteil ohne Vorteil: „Dafür kann ich aber auch während der Woche mal vormittags auf die Skipiste, wenn andere im Büro sind. Das genieße ich sehr. Ich mag es, meine eigene Chefin zu sein und täglich selbst zu entscheiden, was ich wann und wie mache.“ Die Vielfalt ihrer Arbeiten ist eine wichtige Basis ihres kreativen Schaffens, und sie sagt, ihre besten Ideen entstehen oft dann, „wenn ich stundenlang mit dem Traktor über die Wiesen fahre, um das Heu zu wenden“.
Regionalkrimis als Türöffner Ihren Schreibstil beschreibt sie als realistisch. „In meinen Romanen wird es nie darum gehen, dass eine Frau am Ende glücklich ist, weil sie ihren Traummann gefunden hat. Ich schreibe lieber über Menschen, die ihre Zufriedenheit in sich selbst finden, die sich ihr eigenes Leben gestalten, damit sie sich damit wohlfühlen und sich nicht von anderen
Menschen, von vermeintlicher Schönheit, Fitness oder beruflichen Erfolgen abhängig machen.“
So bezeichnet sie die Regionalkrimis, die sie erfolgreich veröffentlicht als „Türöffner in die Welt der Schriftstellerinnen: Ich hatte 2013 drei Kleinkinder und einen Hof und schlicht keine Zeit für Reisen und Recherchen. Also schrieb ich über das, was ich kannte: Die Menschen im Bregenzerwald.“ Ihr Erstlingswerk entstand folglich „intuitiv und spontan“. Über ihre Hauptfigur, Kommissar Reinhold Waldinger, fand sie rasch einen Verlag, der Erfolg bei den Lesern motivierte sie für drei weitere Krimis mit ihm. Dennoch sagt sie heute: „Man spürt es bei meinen Krimis: Die Ermittlungen, Morde, Action und so weiter sind gar nicht mein Metier. Es ging immer um die Menschen dahinter, wie es dazu kam, dass sie so handelten.“
Heilsames und autobiografisches Schreiben
Das Schreiben ist für die Wahl-Allgäuerin längst über den Beruf der Schriftstellerin hinausgewachsen. „Wenn ich meine Gedanken regelmäßig aufs Papier bringe, fallen mir irgendwann Wiederholungen und Muster auf.“ Wenn ein aktuelles Problem auch schon in älteren Notizen auftauche, komme der Moment, das Thema anzugehen: „Schreiben macht sichtbar, was sonst unbewusst den ganzen Tag in meinem Kopf abläuft, und gibt mir so die Chance, destruktive Muster zu erkennen, zu benennen und Lösungen zu suchen.“
Aus diesem Grund absolviert die Buchliebhaberin aktuell einen Lehrgang zum Thema heilsames Schreiben und beschäftigt sich mit autobiografischem Schreiben. „Diese Art des Schreibens, abseits der Veröffentlichungen und fiktiver Geschichten, hat mir persönlich sehr viel gebracht. Sich regelmäßig zu reflektieren, seine Träume aufzuschreiben und immer wieder den Fokus auf ein Ziel auszurichten bereichert mein Leben sehr. Das möchte ich auch in meinen Schreibangeboten weitergeben.“


Schuhhaus Vögel in der Kaiserstraße – seit drei Generationen eine angesagte Adresse in Bregenz, wenn es um das Thema Schuhe geht. Spricht man allenthalben über den Kampf zwischen stationärem Handel und Online-Shopping, so kommt man nicht an diesem Familienbetrieb vorbei, der – gerade in Zeiten von Corona – seine Flexibilität bewiesen hat.
Von Klaus Feldkircher

Zur Person
KLAUS FELDKIRCHER
* 1967 in Bregenz, hat als Autor, Texter und Konzepter diverse Sachbücher veröffentlicht. Der ausgebildete Germanist und klassische Philologe ist in der Erwachsenenbildung tätig, lehrt(e) an der AHS und an der FH Vorarlberg. Daneben ist er als Agenturpartner in der Kommunikationsbranche tätig.
So war der 16. März 2020 ein einschneidender Tag in der Geschichte des Schuhhauses. „Wie vielen andere war uns beim ersten Lockdown nicht klar, was das für unsere Zukunft bedeuten sollte“, erklärt Geschäftsführer und Inhaber Robert Vögel. Seine Schwester Sabine ergänzt: „Wir saßen zu Hause und überlegten, wie wir weiter vorgehen sollten.“
Ein großes Plus in dieser Zeit sei die Unterstützung durch die vielen Stammkunden gewesen, die die Unternehmerfamilie ermuntert habe, ein neues Businessmodell zu entwickeln. Das Ergebnis: „Wie haben innert kürzester Zeit einen OnlineShop auf die Beine gestellt, in dem unsere Kunden stöbern konnten und tatsächlich auch fleißig geordert haben.“ Die Bestellungen wurden dann vom Team Vögel –Robert, Schwester Sabine und Gattin Elke – sortiert, anschließend wurde eine Route festgelegt, um die Ware zuzustellen. So konnte das Unternehmen im Rahmen der Möglichkeiten Umsätze generieren und die Bindung zu seinen Kunden noch mehr intensivieren. „Ein weiteres Plus war ein Besuch des ORF, der unser Modell publik gemacht hat. Diese Geschichte hat uns einen zusätzlichen Schub gegeben“, erklärt Schwester Sabine Nussbichler.
Familienunternehmen mit Verantwortung
Eine weitere Besonderheit stellt die Personalpolitik des Familienunternehmens dar. Haben die meisten Firmen in Zeiten von Corona Personal abbauen müssen, so ist das Schuhhaus Vögel einen anderen Weg gegangen. „Wir haben vor der Pandemie eine Mitarbeiterin gesucht. Im Zuge dieser Suche fanden wir eine Person, die unseren Vorstellungen entsprochen hat“, erzählt Robert Vögel. So habe er ihr zugesagt. Und obwohl Corona alles verändert hat, habe er sich verpflichtet gefühlt, zu seinem Wort zu stehen. „Heute bin ich froh, dass wir das durchgezogen haben“, so der Geschäftsführer.
Überhaupt ist der Familienbetrieb bekannt für sein gutes Arbeitsklima. Das Schuhhaus Vögel hat zehn Mitarbeitende, von denen alle schon seit vielen Jahren im Unternehmen beschäftigt sind. Fluktuation gebe es praktisch keine, so Elke Vögel. Und das sei schon seit der Gründung so gewesen.
Schuhmacher Joachim Vögel
Ins Leben gerufen wurde das Unternehmen 1928 von Joachim Vögel, Jahr-
gang 1905, aus Doren. Gemeinsam mit Gattin Sophie aus Buch zog es ihn in die Landeshauptstadt, wo er in der Jahnstraße 20 eine Schuhmacherwerkstatt eröffnete. Kurze Zeit später kam eine Filiale in der Klostergasse 12 dazu. 1940 beschäftige Vögel sechs Mitarbeiter. Aufgrund von Platzmangel verlegte er 1941 die Werkstatt in die Mildenbergstraße 9, 1946 übersiedelte er mit dem Betrieb an die heutige Adresse Kaiserstraße 3, die Werkstatt verblieb in der Mildenbergstraße, wo die Maschinen bis zu seinem Tod verblieben. Heute ist das Gebäude das Heim von Enkelin Sabine Nussbichler mit Familie. Joachim Vögel erkannte früh, dass die Zukunft seines Handwerks weniger in der Reparatur als vielmehr im Handel liege. Deshalb verlegte er das Hauptaugenmerks seines Geschäfts mehr und mehr auf den Verkauf. Er besuchte sämtliche Messen in Österreich, um sein Portfolio zusammenzustellen, darüber hinaus ergänzten unter anderem Sandalen aus Italien sein Sortiment. „Das Geschäft war damals viel kleiner als die heutigen Räumlichkeiten“, erzählt Robert Vögel. Auf einer Fläche von gerade einmal 20 Quadratmetern verkauften Joachim Vögel und seine Frau Schuhe an die Bregenzer Bevölkerung.
Ära Erich Vögel Sohn Erich besuchte die Handelsschule, um nach deren Abschluss noch eine Schuhmacherlehre in Feldkirch zu absolvieren. Anschließend war er zehn Monate in Wien in einem Schuhhandel tätig. Die Zeit in der Bundeshauptstadt nutzte der junge Mann nicht nur beruflich, sondern auch, um seiner Leidenschaft, dem Fußball, zu frönen. Erich Vögel war Zeit seines Lebens als Aktiver und dann als Anhänger dem Verein Schwarz Weiß Bregenz verbunden.
1973 übernahm Erich Vögel das Unternehmen in der Kaiserstraße, das er mit viel Umsicht vergrößerte und sanierte. Während der Umbauphase wurden die Waren in den gegenüberliegenden Räumlichkeiten des Hotel Sonne in der Kaiserstraße verkauft, bis am 19. März 1974 das Geschäft unter großer Anteilnahme

der Öffentlichkeit wiedereröffnet wurde. 1987 erfolgte der zweite große Umbau.
Sohn Robert absolvierte in den 80erJahren die Lehre im elterlichen Betrieb und übernahm 1996 das Schuhhaus, das er bis zum heutigen Tag führt. Unter seiner Ägide fand 2007 der bis dato letzte Umbau statt, der durch DI Hermann Boss realisiert wurde.
Engagement für die Stadt
Doch Familie Vögel ist in der Landeshauptstadt nicht nur aufgrund ihrer geschäftlichen Aktivitäten bekannt. Robert setzt sich schon seit vielen Jahren in zahlreichen Vereinigungen für das Prosperieren seiner Stadt ein. So ist er seit Langem Mitglied der WIGEM, wo er unter anderem mitverantwortlich für die Gründung des Bregenzer Stadtmarketings war.
Durch diese Funktion war er auch sehr nahe an der Politik, die ihn vor wenigen Jahren einholte. War er anfangs „nur“ auf der Liste des damaligen Bürgermeisters Markus Linhart, so ist er seit Dezember 2023 als Wirtschaftsstadtrat für „seine“ Stadt tätig. Ob er sich ein Engagement über die aktuelle Amtsperiode vorstellen kann? „Stand jetzt: ja“, antwortet Vögel. Der Einstieg sei für ihn zeitlich in Ordnung gewesen, da er so die Möglichkeit erhalten habe auszuloten, ob diese Funktion vereinbar mit Beruf und Familie sei. Dazu komme der Rückhalt durch seine Frau Elke und Schwester Sabine, die ihm dieses Engagement erst ermögliche. Daneben engagiert sich die Familie im Schiklub, weiters fungiert Robert als Schriftführer im VfBB Bregenz, der sich die Nachwuchsförderung der Vereine für Ballsportarten zur Aufgabe gemacht hat. Nicht zu vergessen ist auch das Engagement der Familie im Faschingsverein Pipelines, wo Robert dem damaligen Prinzen Dietmar Steinhauser als Zeremonienmeister zur Seite stand und den Bregenzer Fasching nach wie vor als ehemaliger „Zere“ unterstützt. Auf die Frage, wie er die Zukunft des Handels sehe, meint Robert Vögel: „Wir haben uns mit der Übernahme des Schuhhauses Gasser in der Schulgasse für die Zukunft gewappnet. Durch diesen Schritt konnten wir unser Portfolio erweitern und neue Kunden gewinnen.“ Neben dem klassischen Geschäft an den beiden Standorten setzt das Team weiterhin auf die Online-Präsenz, um auch in diesem Bereich gerüstet zu sein.


Zur Person
ANGELIKA SCHWARZ
* 1975 in Feldkirch, ist Journalistin, studierte Germanistin und Anglistin, langjährige ORF-Redakteurin und -Moderatorin (Radio und Fernsehen). Angelika Schwarz arbeitet in der Unternehmenskommunikation der Landeskrankenhäuser Vorarlberg.
Wissenschaftler und Ärzte haben im Kampf gegen Lungenkrebs weitere Fortschritte erzielt, die die Behandlungsstrategie bei nicht kleinzelligen und operablen (ohne Fernmetastasen) Lungenkarzinomen verändert haben: Eine Immuntherapie, die bereits vor der Operation zum Einsatz kommt, hat in einer aktuell noch laufenden internationalen Studie statistisch bemerkenswerte Wirksamkeit gezeigt.
Maßgeblich beteiligt an dieser Studie ist ein interdisziplinäres Studienteam der Vorarlberger Landeskrankenhäuser unter Studienkoordinator Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas Winder, PhD. Der Onkologe ist Leiter der Abteilung „Innere Medizin II“ an den LKH Feldkirch und Rankweil. Aufgrund der richtungsweisenden Bedeutung der Studie sind die ersten Forschungsergebnisse Ende 2023 auch im „New England Journal of Medicine“ publiziert worden. „Die medizinische Fachzeitschrift genießt weltweit höchstes Ansehen“, freuen sich die Co-Autoren aus Vorarlberg.
Immuntherapie entlarvt und verdrängt Krebszellen Pro Jahr erhalten zwischen 180 und 200 Menschen in Vorarlberg die Diagnose „Nicht kleinzelliger Lungenkrebs“. Der überwiegende Teil ist zu diesem Zeitpunkt zwischen 60 und 70 Jahre alt. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate ist abhängig vom Stadium der Krebserkrankung. Wird das Lungenkarzinom im frühen Stadium entdeckt, beträgt sie zwischen 50 und 90 Prozent. Generell hält die heutige Schulmedizin im Kampf gegen diese Krebsart mehrere Optionen bereit.
Die Vorgehensweise, sofort zu operieren und danach mit einer Chemotherapie ein neuerliches Auftreten bösartiger Krebszellen zu verhindern, galt dabei bislang als Standard. Das hat sich nun geändert: „Wir haben in unserer Studie erfolgreich untersucht, ob es in den operablen Stadien II bis IIIb noch effektiver wäre, wenn wir schon vorab mit modernen Substanzen medikamentös behandeln. Erstens, um den Tumor zu verkleinern und zweitens, um beobachten zu können, wie der Krebs auf bestimmte Behandlungen anspricht“, erklärt Primar Dr. Thomas Winder die Ausgangslage der Studie.
Die Immuntherapie vor der Operation (neoadjuvante Therapie) wirkt gegen entartete Strukturen in unserem Körper,
im konkreten Fall gegen jene des nicht kleinzelligen Lungenkrebses. Sie entlarvt die Tumorzellen, die sich ansonsten recht gut tarnen können und quasi „undercover“ unterwegs sind. Das menschliche Immunsystem greift in der Regel körpereigene Strukturen ja nicht an – außer etwa bei Autoimmunerkrankungen. Die Krebszellen werden durch die Medikation für das Immunsystem sichtbar und können unschädlich gemacht werden.“ Nach der Operation wird noch eine Zeit lang weiter medikamentös behandelt (adjuvante Therapie). „Wir haben also versucht, mit einer modernen Therapie das Immunsystem so zu aktivieren, dass es den Krebs bekämpfen kann. In unserer Studie haben wir gesehen, dass bei manchen Patienten allein schon nach der Immuntherapie die Krebszellen komplett verschwinden! Im danach herausgeschnittenen Präparat, das sich die Pathologen nach dem Eingriff unter dem Mikroskop angesehen haben, waren teils überhaupt keine Krebszellen mehr vorhanden“, betont der Primar: „Daher waren und sind wir überzeugt davon, dass der neoadjuvante Ansatz Sinn macht.“
15 Patientinnen und Patienten aus Vorarlberg
Beteiligt waren Teams aus Krankenhäusern und Studienzentren weltweit. Diese haben jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Patienten eingeschlossen. „Wir haben als kleines Land überdurchschnittlich viele Menschen in die Studie einschließen können“, sagt Primar Winder in seiner Funktion als Studienleiter für Vorarlberg. „Wir sind sehr dankbar, dass sich 15 unserer Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkrebs eingebracht haben.“ Weltweit sind im Jahr 2022 insgesamt 802 Menschen im Rahmen der Studie rekrutiert worden. In der sogenannten Doppel-Blindstudie sind die Teilnehmer per Zufallsgenerator entweder mit Placebo oder eben mit moderner Immuntherapie vorbehandelt worden.
Die Erforschung der neuen Behandlungsmethode zeichnet sich nicht nur durch eine Länder- und Spitäler-übergreifende Kooperation aus, sondern auch durch interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Einrichtungen. Mit dabei sind vor allem die Bereiche Pulmologie, Thoraxchirurgie und Pathologie sowie die Abteilungen für Radiologie, Nuklearmedizin und besonders auch die
Spitalsapotheke. „Diese sehr enge Kooperation ist essentiell. Es braucht viele Player, um bei so einer Studie erfolgreich mitmachen zu können. Es ist ein Riesenaufwand, aber er lohnt sich“, bringt es der Studienkoordinator auf den Punkt.
Höhere Überlebenschance ohne Rückfall
Denn schon vor Abschluss der Studie verdeutlichen erste Zahlen, dass die Chance, die Krankheit gesund zu überleben, mit dem neuen Therapieansatz signifikant gestiegen ist: „Nach den ersten zwölf Monaten betrug in der Gruppe mit Vorab-Immuntherapie die Rate der Überlebenden ohne Rezidiv 73,4 Prozent im Vergleich zu 64,5 Prozent in der Placebo-Gruppe. Dazu kommt, dass bei 17,2 Prozent der Teilnehmenden mit moderner Therapie überhaupt keine Tumorzelle mehr nachweisbar war, bei der Gruppe mit herkömmlicher Behandlungsstrategie waren es nur 4,3 Prozent.“ Ein weiteres Zwischenergebnis: Jene Patienten, die doch ein Tumorrezidiv bekommen, bekommen es bei moderner Behandlungstherapie deutlich später. „Wir sehen also, die neue Strategie führt zu einem besseren Outcome. Das bedeutet, dass mehr Menschen ihre Krankheit rezidivfrei und damit gesund überleben“, fasst Primar Thomas Winder zusammen. Bereits diese ersten Ergebnisse haben einen neuen Standard in der Behandlung von operablen nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen hervorgebracht.
Entscheidend sind nun die kommenden fünf Jahre, in denen die Teilnehmer der Studie regelmäßig zu Kontrollen eingeladen sind. „Es wird Nachfolgestudien geben, die unter anderem das Ziel haben, individuelle Therapien daraus zu entwickeln. Jeder Mensch,
„Bei manchen Patienten verschwinden allein schon nach der Immuntherapie die Krebszellen komplett!“
Primar Thomas Winder
 FOTOS: ISTOCKPHOTO, KARIN NUSSBAUMER, MATTHIAS WEISSENGRUBER
Die heutige Schulmedizin hält im Kampf gegen diese Krebsart generell mehrere Optionen bereit.
FOTOS: ISTOCKPHOTO, KARIN NUSSBAUMER, MATTHIAS WEISSENGRUBER
Die heutige Schulmedizin hält im Kampf gegen diese Krebsart generell mehrere Optionen bereit.
Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse – kurz zusammengefasst.
Von Sabine Barbisch
Wer am meisten vom Kindergarten profitiert
Im Fachjournal „European Sociological Review“ wurde eine Studie veröffentlicht, die beleuchtet, welche Kinder besonders vom Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung profitieren. Die Untersuchung basiert auf Längsschnittdaten von 992 Kindern im deutschen Nationalen Bildungspanel. Gaia Ghirardi (European University Institute, Italien) zeigt mit ihren Kollegen auf, dass der Besuch einer institutionellen Betreuung soziale Ungleichheiten in den Kompetenzen von Kindern mindern und sozial ausgleichend wirken kann. Co-Autorin Corinna Kleinert (Leibniz-Institut für Bildungsverläufe) formuliert: „Würden alle Kinder ausschließlich durch ihre Eltern betreut, würden sich die sozialen Ungleichheiten in der Entwicklung hingegen verstärken.“ Konkret zeigte sich, dass gerade
Kinder aus sozial schwächeren Familien, die größeren Vorteile im Hinblick auf ihre kognitiven Kompetenzen, beispielsweise im Bereich Mathematik oder beim Wortschatz, aus dem Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ziehen. Unabhängig von ihrer Herkunft gilt für alle Kinder, dass der Besuch
einer Betreuung ihre sozialemotionalen Kompetenzen stärkt.
Was weltweit kleiner wird
D ie Forschungsgruppe „Ungleichheiten in Verwandtschaftsbeziehungen“ arbeitet am Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Im Fachmagazin „PNAS“ hat deren Leiter, Diego Alburez-Gutierrez, gemeinsam mit Ivan Williams (Uni Buenos Aires) und Hal Caswell (Uni Amsterdam) eine Studie zur Zahl der Verwandten, die ein
Mensch hat, veröffentlicht: Demnach schlage in Nordamerika und Europa, wo die Familien schon heute vergleichsweise klein seien, die Veränderungen insgesamt stark durch. In Südamerika und in der Karibik erwarten die Forscher den größten Rückgang an verwandtschaftlichen Netzwerken. Alburez erklärt die Erkenntnisse für Österreich: „Eine 65-Jährige konnte im Jahr 2023 erwarten, durchschnittlich 16,5 lebende Verwandte zu haben. Nach den neuen Berechnungen wird eine ebenso alte Österreicherin im Jahr 2050 nur noch 15,8 und 2095 –statistisch gesehen – nur noch 14,2 Verwandte haben.“ Für die Studie zogen die Wissenschaftler historische und prognostizierte Daten der Ausgabe 2022 der „World Population Prospects“ der UNO heran.
Wer Filme anders sieht
Was gut für das Textverständnis ist Kinder mit und ohne Autismus
Eine Untersuchung der Universität Genf zeigt, dass Kinder mit Autismus bei Filmen einen anderen Fokus haben als Kinder ohne Autismus. Diese Unterschiede nehmen im Laufe der Kindheit zu. Wie im Fachjournal „eLife“ erklärt, ließen die Wissenschaftler 166 Jungen mit Autismus und 51 nicht autistische Buben Zeichentrickfilm-Sequenzen anschauen. Dabei wurde aufgezeichnet, wohin sich die Blicke der Kinder richteten. Die Probanden waren zwischen zwei und sieben Jahre alt und wurden immer wieder getestet. Bei den Kindern ohne Autismus zeigte sich dabei mit
Was die Fettneubildung steigert
Fruktose, jener Zucker, der in Obst und Honig oder in geringerem Maß auch in Gemüse vorkommt, wird gerne als „gute“ Alternative zum Haushaltszucker gesehen. Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten warnt vor dieser Annahme; denn vielmehr gelange Fruktose aus dem Dünndarm direkt in die Leber. Die Folge kann eine Fettleber, die häufigste Lebererkrankung, die zu einer chronischen Entzündung des Organs führen kann, sein. Ali Canbay, Direktor der Medizinischen Klinik am
zunehmendem Alter eine Synchronisation der Blicke: die Kinder richteten ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf die gleichen Elemente einer Szene. Bei den autistischen Kindern fehlte diese Synchronisation, ihr Interesse galt anderen Arten von Reizen. Im Laufe der Zeit entwickelte jedes Kind mit Autismus seine individuellen visuellen Vorlieben. Das Fazit von Studienleiterin Marie Schaer: „Diese Arbeit zeigt, dass autistische Kinder, wenn sie nicht schon früh Interesse an sozialen Interaktionen zeigen, zunehmend desinteressierter werden.“
E
rkenntnisse aus einer Metastudie zum Thema Lesen hat ein Wissenschafts-Trio der spanischen Universität Valencia im Fachblatt „Review of Educational Research“ veröffentlicht: Eine Auswertung von 25 Studien ergab, dass das Textverständnis bei Kindern und Jugendlichen bei gedruckter Lektüre sehr viel besser ist als bei digitalen Texten. Co-Autor Ladislao Salmeron erklärt: „Der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des digitalen Lesens in der Freizeit und der Fähigkeit, Texte zu verstehen, liegt nahe bei null.“ Insgesamt flossen 39 Vergleiche zwischen analoger
Wer seine Gangart verändert
und digitaler Lesepraxis ein, die zwischen den Jahren 2000 und 2022 durchgeführt wurden: Rund 470.000 Teilnehmende aller Altersgruppen waren beteiligt. Christina Vargas, eine der Studienautorinnen, fasst zusammen: „Wenn ein Schüler zehn Stunden damit verbringt, gedruckte Bücher zu lesen, ist sein Verständnis wahrscheinlich sechs- bis achtmal größer, als wenn er die gleiche Zeit auf digitalen Geräten liest.“
Diese Erkenntnis hat auch die Forschenden selbst überrascht. Die Daten zeigen aber auch, dass das insbesondere für jüngere Leser gilt.
Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum, präzisiert: „Alle Zuckerarten finden bei Überkonsum ihren Weg in die Leber und können damit zu einer Fettleber beitragen, doch die Fruktose steigert die Fettneubildung in besonderem Maße – um das 15-fache gegenüber der Glukose.“ Eine gesunde und ausgewogene mediterrane Ernährung könne helfen, die Fetteinlagerungen in der Leber zu bekämpfen, sagen Experten. Als Richtwert empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation 25 Gramm Fruktose pro Mahlzeit nicht zu überschreiten.
Am FH Campus in Wien wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts unter der Leitung von Sebastian Durstberger ein kurioses, aber mittlerweile alltägliches Phänomen untersucht: Beim sogenannten „Textwalken“, dem gleichzeitigen Gehen und Tippen ins Smartphone, passt sich das Gangbild an das Multitasking an. Das Setting für das Experiment: 27 Probanden gingen über ein spezielles Laufband, im Hintergrund gab es eine Leinwand, für ein realistisches Szenario gab es typische Straßengeräusche. Die Teilnehmenden sollten eine Rechen-
aufgabe einmal im Kopf und ein anderes Mal mit dem Smartphone lösen. Dabei wurden die Bewegungen der Teilnehmenden mit Sensoren aufgezeichnet, in 3-D-Modellen dargestellt und analysiert. Im Fachblatt „Heliyon“ erschienen nun die Studienergebnisse: Die Schritte wurden durch das „Textwalken“ kürzer und breiter. Dieser „Cowboygang“ senke das Sturzrisiko. Aber er führe auch zu einer Belastung auf der Außenseite des Kniegelenks, was mit einer leichten X-Stellung einhergehen und Meniskus und Knorpel nachhaltig schädigen könne.

Nachweise über nachhaltiges Wirtschaften beschäftigen Betriebe immer stärker. Manche, weil direkt betroffen von Berichtspflichten. Andere, weil betroffene Kunden oder Banken diese verlangen. Ökoprofit bietet einen praxisnahen, niederschwelligen Einstieg in die Thematik.
Der Green Deal der EU ist mittlerweile auch bei kleineren Betrieben angekommen, wie das Beispiel von Ingo Metzler von „Metzler naturhautnah“ zeigt: „Wir machen Ökoprofit, um für unsere Kunden und Banken einen Nachweis über unsere nachhaltige Unternehmensführung zu erbringen.“ Regelwerke wie CSRD, Taxonomie, Lieferkettengesetze, CO2-Grenzausgleichszölle bringen immer stärkere Verpflichtungen. Es gilt, diese Themen frühzeitig in die Betriebe zu implementieren. Ökoprofit kann dafür eine gute Grundlage sein: Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsthemen werden hier in verschiedenen Modulen praxisnah aufbereitet, Unterstützung bei der Erfassung von relevanten Zahlen und der Planung und Umsetzung von Maßnahmen erbracht.
Anerkennung Ökoprofit als EMAS-Vorstufe Erfreulicherweise wurde das vor über 30 Jahren in Graz gegründete Umweltmanagementsystem Ökoprofit im ver-

gangenen Jahr als Vorstufe des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS von der Europäischen Kommission anerkannt. Dieser wichtige Schritt sollte Ökoprofit zertifizierten Betrieben bei der Akzeptanz des Zertifikats bei Kunden helfen und den Übergang zu ISO und EMAS erleichtern.
Rekordwerte bei Ökoprofit-Zertifizierungen Diese Entwicklungen, aber auch das zunehmende Bewusstsein für Klima-
wandel und Energieabhängigkeiten haben Ökoprofit in den vergangenen Jahren einen starken Zulauf an Betrieben gebracht: über 200 Zertifizierungen waren es 2023, 21 neue Betriebe sind derzeit auf dem Weg zur Erstzertifizierung.
Gemeinsam schwierige Themen meistern und dranbleiben
„Die Begleitung durch erfahrene Berater, der Austausch mit anderen Betrieben verschiedenster Branchen, sowie ein
Ökoprofit: Umwelt- und Klimaprogramm für Betriebe – ein neues Einsteigerprogramm startet im April 2024 –Zertifizierung: € 6.500, Landes- und Gemeindeförderungen: € 2.080 bis € 3.900; Jährliche Re-Zertifizierung: € 400 bis € 1.200.
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten, Mag. Verena Lässer-Kemple T +43 5574 511 26121
verena.laesser-kemple@vorarlberg.at www.vorarlberg.at/oekoprofit

niederschwelliger und praxisorientierter Input von Experten macht dieses Netzwerk attraktiv für uns“, meint Frank Uebelen von der Firma Walter Bösch GmbH. Zertifiziert werden die Implementierung eines Umweltmanagementsystems und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Betriebe steigen da ein, wo sie gerade stehen. Viele langjährige Ökoprofit-Betriebe wurden über die Jahre zu Umwelt-Pionieren, andere steigen bereits auf hohem Niveau ein.

Zur Person
J. GEORG FRIEBE
* 1963 in Mödling, aufgewachsen in Rankweil. Studium der Paläontologie und Geologie in Graz. Seit 1993 Museumskurator an der inatura Erlebnis Naturschau in Dornbirn.
Der Frühling zieht ins Land, und mit ihm kommt nach der beinahe insektenlosen Winterszeit wieder Leben in unsere Wälder, Wiesen und Gärten. Unter dem Kleingetier stehen die Schmetterlinge an erster Stelle auf der Sichtbarkeits- wie auch auf der Beliebtheitsskala. Wir freuen uns, wenn diese bunten Gaukler die Landschaft beleben. Nun sind sie also wieder da, aber wo waren sie eigentlich im Winter?
Schmetterlinge haben je nach Art unterschiedliche Strategien, die kalte Jahreszeit zu überdauern. Tagfalter, die sich –wie der Kleine Fuchs, das Tagpfauenauge oder der Zitronenfalter – im Jahr als erste zeigen, haben als erwachsene, geschlechtsreife Tiere überwintert. Im Herbst haben sie sich in geschützte Winterquartiere zurückgezogen. Dazu gehören auch vom Menschen errichtete Gebäude. So finden die Überwinterer ihre Verstecke oft in Stadeln und Scheunen, aber auch Garagen und Kellerräume werden gerne genutzt. In freiem Gelände kommen alle Strukturen in Frage, wo sie vor Wind und Wetter geschützt sind. Der Frost kann diesen Überwinterern nichts anhaben. Der Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) verfügt mit Glycerin in Kombination mit Sorbit und Proteinen über einen körpereigenen Frostschutz – ein Phänomen, das in der Insektenwelt gar nicht so selten ist. Damit können die Tiere auch stärkeren Frost unbeschadet überstehen.
Eine Tagfalterart, die noch vor wenigen Jahrzehnten in unseren Breiten unmöglich überwintern hätte können, ist der Admiral (Vanessa atalanta). Dieser attraktive Schmetterling zählt zu den klassischen Wanderfaltern. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet liegt am Mittelmeer. Noch in den 1980er-Jahren war die Einwanderung über die Alpen der Regelfall. Die hier geschlüpfte Sommergeneration trat dann im Herbst die Reise in den Süden an. Eine Überwinterung nördlich der Alpen schien ausgeschlossen. Seit einiger Zeit mehren sich die Anzeichen, dass der Admiral den Winter auch hierzulande überdauern kann. Schon 2014 wurde der erste Admiral des Jahres Mitte Februar an einem sonnig-warmen Föhntag in Göfis dokumentiert – ein eindeutiger Überwinterer. Und heuer zeigte sich der erste Vertreter dieser Art bereits am 23. Jänner im inatura-Areal. Den nachfolgenden Kälteeinbruch überstand er problemlos. Aber

nicht alle Tiere der Sommergeneration bleiben hier. Der Rückzug über die Alpen findet weiterhin statt: Vergangenen Oktober zog ein Falter nach dem anderen in Serfaus (Tirol) auf knapp 2400 Metern Seehöhe gegen Südwesten. Das Mittelmeer erreichen diese Wanderer dennoch kaum mehr: Der Südrand der Alpen ist ihnen als Überwinterungsquartier warm genug. Nicht alle Schmetterlinge verbringen den Winter als geschlechtsreife Falter. Viel häufiger ist die Überwinterung als eines der Vorstadien Ei, Raupe oder Puppe. Der Graue Zwergspanner ist ein sehr häufiger Nachtfalter. Als Kulturfolger wird Idaea seriata in Gärten, an Häusern, auf Balkonen und in und um landwirtschaftliche Anwesen bis in die Städte angetroffen. Der Falter fliegt von April bis Oktober in zwei bis drei Generationen. Die Nachkommen der letzten Generation des Jahres überwintern als Raupe. Bei ihrer Nahrung sind sie keinesfalls wählerisch. Wird auch das Gewöhnliche Leimkraut als Hauptnahrungspflanze genannt, so werden selbst Zierpflanzen im Garten und am Balkon nicht verschmäht. Die Raupen sind klein genug, um leicht übersehen zu werden. Gelegentlich gelangen sie im Herbst als „blinde Passagiere“ mit den Topfpflanzen in geschützte Räume. Und weil die Falter vom Licht angezogen werden, verirren sie sich bisweilen auch in den Wohnbereich. Dort können sie ihre Eier an Zimmerpflanzen ablegen. Die Wärme im Keller und besonders im Wohnzimmer sorgt für eine raschere Reifung und frühe Verpuppung. Bereits im Jänner oder Februar schlüpft dann der voll entwickelte Falter – zu einer Zeit, in der er draußen im Freien nicht überlebensfähig wäre. Und im Zimmer fehlt ihm die nötige Nahrung. Einer der schönsten Beweise, dass Nachtfalter nicht immer langweilig grau sein müssen, ist der Achat-Eulenspinner (Habrosyne pyritoides). Seinen Namen verdankt er einem weiß-braunen Schlingenmuster, das diese Art unverwechselbar macht. Gegen den Flügel-Vorderrand treten Orangetöne hinzu, und der vorderste Teil des Flügels ist (von weißen Linien begrenzt) ungezeichnet. Der Falter fliegt ab Mai bis August in lichten Wäldern,
an Waldwegen und -rändern, sowie in Gärten und Parks. Brombeere und Himbeere sind die alleinige Nahrung der Raupen. Sie fressen nachts und sitzen nur selten offen auf der Pflanze. Am Tag verstecken sie sich am Boden meist in trockenem Laub. Durch ihre orangebraune Färbung mit bis zu drei weißen Seitenflecken ist auch die Raupe leicht bestimmbar. Wer sie finden will, sucht sie am besten nachts mit einer Lampe. Um erfolgreich über den Winter zu kommen, errichten die Raupen eine Behausung aus zusammengesponnenen Blättern. Noch im Herbst verpuppen sie sich dort in einem leichten, braunen Gespinst und überwintern. Erst gegen Ende des Frühjahrs schlüpfen die geschlechtsreifen Falter.
So unterschiedlich die Schmetterlinge in Färbung, Größe und Lebensweise sind, so unterschiedlich sind auch ihre Strategien, mit der kalten Jahreszeit zurecht zu kommen. Doch auch hier ist vieles im Wandel. Gerade der Admiral ist ein gutes Beispiel, dass in der Natur nichts „in Stein gemeißelt“ bleibt. Es wäre naheliegend, Verhaltensänderungen allein mit dem Klimawandel erklären zu wollen. Aber wie immer sind die Prozesse in der Natur komplexer, und die zunehmende Erwärmung ist nur ein Faktor von vielen – die wir noch immer viel zu wenig verstehen.
„Wir sind umzingelt von Freiheit, aber wir machen uns selber unfrei“
Von


Jonathan Robin Meese wurde 1970 in Tokio geboren. Er ist einer der vielseitigsten, meist diskutiertesten und auch radikalsten deutschen Künstler seiner Generation. Er malt, modelliert, performt, hält Lesungen, erschafft Bühnenbilder und führt Regie. In Interviews und Manifesten rief er zu einer „Diktatur der Kunst“ auf. Gleichzeitig präsentierte er sich ganz bescheiden als „Ameise der Kunst“. Gerald A. Matt traf ihn anlässlich seiner Performance „KosmischeMiniaturenimWeltenraumDeLarge“im Wiener Volkstheater zu einem Gespräch.
Kosmische Miniaturen im Weltenraum De Large, ein spannender, ironischer und gleichzeitig neugierig machender Titel für Deine Aufführung im Wiener Volkstheater. Erwartet uns ein Gespräch über die Zukunft der Kunst und welche Rolle die Oper in der Kunst spielen wird?
Es geht natürlich um Kunst, und es geht um die Freundschaft zwischen mir und Alexander Kluge. Wir kennen uns seit Jahrzehnten und wahrscheinlich schon vorgeburtlich. Wir sind ja überzeitliche Wesen und wollen einfach, dass die Kunst geliebt wird. Und ich natürlich, dass sie an die Macht kommt. Er gehört wie meine Mutter auch einer älteren Generation an. Und ich liebe diese Leute, weil sie so viel zu sagen haben und ein Rückgrat haben. Und er hat erkannt, ja der Meese, das ist halt auch so ein eigenständiger, hermetischer und ziemlich eigenartiger Typ. Und deshalb verstehen wir uns so gut. Und als ich damals den Parsifal machen sollte in Bayreuth, wo ich rausgeschmissen wurde aus politischen Gründen, da hat er mich sehr unterstützt – und ist, genauso wie ich immer noch, beseelt von Rache. Wir wollen denen die rote Karte zeigen. Bayreuth ist ein alter Hut und hat mit Richard Wagner nichts mehr zu tun, weil Richard Wagner hat was riskiert und hat auch Neues, hat Kunst geschaffen. Bayreuth ist heute nur noch ein Lakai der Politik. Bayreuth ist tote Hose.
Du hast den Parsifal auch in Wien gemacht. Ja, das war faszinierend. Wien liebt halt die Extreme. Hier bin ich willkommen. Und hier rede ich mit Kluge über die Zukunft. Und Richard Wagner spielt da wieder eine Riesenrolle.
Da finden wir neben der Miniatur den Weltraum, neben dem Kleinen das Große, neben der Ferne das Nahe. Ist das die Dialektik, die die Kunst braucht?
Ja, richtig. Wenn man nicht zu Hause Klarschiff macht, kann man auch nicht groß denken und die Kunst schätzen und ohne Zensur leben und die Zukunft aushalten.
Wie kann man sich Euren Auftritt vorstellen? Gespräch und Performance?
Es ist alles sehr spontan. Lass‘ Dich überraschen.
Zur letzten Aufführung hier im Volkstheater. Da war nichts theatralisch Lautes. Das war Meese is(t) back. Mutterzsöhnchen im Kunstglück. Du hast mit Deiner Mutter gesprochen, über ihr Leben, über Euer gemeinsames Leben. Welche Bedeutung hat Deine Mutter auch für die Arbeit? Und wie hat die Arbeit dann Deine Mutter beeinflusst?
Ich zäume das Pferd von hinten auf. Also meine Mutter lebt, weil ich sie in die Kunst einbaue. Deshalb lebt sie noch.
Sie ist 94.
Sie ist 94 und sie wird 150, weil die Kunst jung hält. Und wir müssen die Alten wieder lieben. Meine Mutter hat mich in die Welt gebracht, ohne dass ich sie gewählt habe. Sie ist unwählbare Macht. Bei wählbarer Macht bin ich immer sehr skeptisch. Meine Mutter ist von derselben Generation wie Alexander
Kluge. Die haben uns so viel zu erzählen und die bringen uns besser in die Zukunft, wenn wir sie befragen und wertschätzen.
Das heißt, Muttersöhnchen ist bei Dir jetzt nichts Abwertendes, Negatives.
Das ist Natur. Meine Mutter ist eine Naturgewalt und ohne sie wäre ich ja auch nicht da. Ich war immer gerne Muttersöhnchen und ich möchte auch, dass meine Mutter glücklich ist und stolz ist auf ihren Sohn. Sie hat mir die Kraft gegeben, weiterzukämpfen. Und ich wurde ja bekämpft, zensiert oder man wollte mich unter den Teppich kehren. Ich war auch vor Gericht in der Kunst. Was ich jetzt als Ehre empfinde.
Du wurdest freigesprochen. Da ging es um Hitler und den Hitlergruß.
Ich wurde freigesprochen, natürlich, weil ich der Kunst verpflichtet bin. Ich bin nicht der Realität verpflichtet. Die Realität interessiert mich nur in dem Sinne, dass sie verdrängt werden und durch Kunst ersetzt werden muss. Und da bin ich wieder bei Richard Wagner und Ludwig II. von Bayern und Caligula. Die haben auch die Kunst an erste Stelle gestellt. Das Politisch-Religiöse überlebt halt nicht. Es ist zu schwach. Es ist zeitgebunden. Kunst ist zeitlos und wird uns alle überleben.
Das kommt vielleicht auch im zweiten Begriff dieses Titels zum Ausdruck, nämlich das Kunstglück. Ja, Kunst und Glück. Ist Kunst Dein Glück und ist Deine Kunst unser Glück?
Ja, also Kunst beglückt mich, indem ich sie zum Chef mache. Und ich mich nach ihr richte. Und sie gibt mir die totalste Freiheit. Aber ich muss sie auch aushalten können. Menschen können heutzutage kaum noch Freiheit aushalten. Deshalb wollen sie unfrei werden und im Zwangskollektiv unfrei leben. Und Kunst ist die totale Freiheit. Daher der ständige Versuch, sie zu zensurieren. Wir müssen die politische, religiöse, ideologische, zwangskollektivistische Brille wegschmeißen, um frei zu sein.
Also jetzt aber die Frage: Was brachte Dich zur Kunst? Ab wann wusstest Du, Kunst ist mein Leben?
Ich wollte immer Unabhängigkeit. Das war für mich das Wesentliche in meinem Leben. Und ich wollte zu keiner Seilschaft gehören. Und ich wollte zu keiner Politik gehören, zu keiner Religion gehören, zu keiner Gemeinde gehören. Ich wollte eigenständig in der Sackgasse meines Lebens spielen.
Also Freiheit.
Freiheit in meiner Sackgasse. Ich liebe das Abseits. Damit fühle ich mich sauwohl. Und ich habe in Ahrensburg damals in einem Haus gewohnt, in einer Straße, wo es eine Sackgasse gab. Und in dieser Sackgasse war ein Spielplatz. Und da habe ich gespielt ohne Ende. Und so will ich mein Leben leben, bis zum Ende. Ich will in diesem Abseits, in der Sackgasse spielen. Ich möchte das erledigen, was ich zu erledigen habe, ohne auf Kosten anderer zu leben, ohne Guru zu sein, ohne Mitläufer zu sein. Ich will auch
keine Macht haben. Die Macht gehört der Kunst.
Geht es Dir um eine Einheit von Kunst und Leben oder ist Dir die Kunst mehr Schutzraum, Möglichkeitsraum? Wie siehst Du das Verhältnis von Kunst und Leben?
Ich möchte, dass die Kunst das schreckliche Leben und vor allem Politik und Religion verdrängt. Der Pharao und seine politische Welt hat nicht überlebt. Aber die Pyramide, die Kunst sehr wohl. Die Kunst ist die stärkste Kraft. Sie wird niemals Machtmissbrauch betreiben, weil sie das gar nicht auf der Agenda hat. Und das Universum ist schon ein Gesamtkunstwerk. Da gibt es gar keine Politik. Da gibt es auch keine Parteien und auch keine religiösen Gemeinden. Wir sind umzingelt von Freiheit, aber wir machen uns selber unfrei.
Gibt es so etwas wie ein Signaturwerk, ein Werk, in dem sich Deine Haltung, Deine ganzen Ambitionen sozusagen verdichten?
Ich habe da an den Parsifal gedacht.
Ich habe schon eine Fixierung auf Richard Wagner. Ich halte den bei all seinen Irrwegen für den größten Künstler, der jemals diesen Planeten betreten hat. Er hat etwas so Unfassbares geschaffen, das Gesamtkunstwerk. Er wollte auch, dass die Kunst alles andere ersetzt und dass wir in der Kunst leben. Und auch ein Staat kann ein Gesamtkunstwerk werden, genauso wie die gesamte Welt.
Du hast immer wieder von der Diktatur der Kunst gesprochen, was Dir auch heftige Kritik eintrug. Ein Missverständnis?
Ja, ich hasse und ich lehne MenschenDiktaturen und Diktatoren ab. Die Sonne ist ein Diktator. Die Liebe ist auch ein Diktator. Liebe ist nie demokratisch. Die ist nicht abstimmbar, sondern sie überfällt mich, kommt über mich, nimmt mich mit auf eine Reise in die Zukunft. Und genauso ist es mit der Kunst. Wir haben lange genug die Welt in politisch-religiöse-ideologische Zonen eingeteilt. Und jetzt haben wir den Salat: Grauenhafte Kriege, grauenhafte Konflikte, die alle nur auf Ideologie, Religion und Politik basieren. Und ich sage: Nein, danke.
ist nur ein Zeitphänomen, Kunst steht über den Dingen. Die Kunst überlebt. Kunst ist der Urknall. Kunst hat es vor den Menschen gegeben, wird es nach den Menschen geben. Wir sind nur Gast auf diesem Planeten. Deshalb ist ja auch Caligula so interessant, der hat die Absurdität von Politik verstanden und hat deshalb Pferde zu Senatoren gemacht, um diesen Politikern zu zeigen, sorry, hier ist eure Grenze. Das Glas Wasser vor mir ist schon Kunst in sich, weil es keiner Ideologie angehört. Wir wollen aber immer das Wasser ideologisieren, politisieren, religiösisieren. Das ist aber gegen das Wasser gerichtet und auch gegen uns. Aber man kann doch ein Dorf, eine Stadt, ein Land, einen Wald nicht politisch in irgendein Korsett quetschen. Ein Wald will weder linkspolitisch noch rechtspolitisch sein. Ein Wald will nicht wählen gehen. Der will auch keinen Machthaber, sondern der will sich entwickeln. Der will evolutionär in die Zukunft wachsen. Dazu braucht man keine Parteien, dazu braucht man die Kunst.
„Ich möchte, dass die Kunst das schreckliche Leben und vor allem Politik und Religion verdrängt.“
Alles Kollektive ist Dir suspekt. Ich habe mich nie organisiert. Ich bin in keiner Partei, in keiner Gemeinde, in keiner Gruppe, keiner Organisation. Viele werden jetzt sagen: Ach, der Herr Meese, der ist ja auch nur ein mieser Guru. Nein, ich habe keine Jünger. Ich lehne die ab und würde die immer nach Hause schicken. Ich will keine Anhänger. Ich will Liebende. Aber die sollen das lieben, was sie selber tun und nach Hause gehen. Also mir kann man das nicht vorwerfen. Ich bin viel zu naiv oder viel zu kindisch. Aber auf der anderen Seite auch gefährlich, ungefährlich gefährlich. Bisher hat man mich immer für einen Narren gehalten. Das finde ich ja gut. Und ich bin dafür, dass wir wieder das Einzelne komplett schätzen lernen. Alles, was geil war für das Leben, für andere, ist aus dem Einzelnen entstanden, aus dem Ei. Ist nie aus dem Kollektiv entstanden. Das Kollektiv war immer gegen das Einzelne. Und also dem vertraue ich nicht. Den Massen, dem Herdentrieb traue ich null. Also der Mehrheit traue ich null.
Da fragt es sich, wie es heute um die Kunst steht, wo die Kunst immer mehr politisch, ja politisch korrekt sein soll. Das äußert sich im Wokismus, in der Identitätspolitik. Alles völlig fremd für Dich?
Ja, vollkommen wahnsinnig. Es gibt ganz viele zwangskollektivierte Politaktivisten, die die Kunst durch Politik ersetzen wollen, Aber das ist ja sehr zynisch. Es gibt nur eine identitätsstiftende Kraft auf diesem Planeten. Und das ist Kunst, nicht die Politik, Religion oder Utopie. Nur Kunst gibt uns die Identität, die wir überhaupt aushalten können, die wir uns in die Zukunft führen. Und natürlich gibt es ein Verhältnis von Politik und Kunst. Politik hat sich der Kunst komplett unterzuordnen, Politik
Das ist ein wunderbares Plädoyer für die Freiheit und für Radikalität. Baselitz hat über Dich gesagt: Er ist mir in seinem radikalenDenkensehrnah.Ichglaube,man kanndiesenBerufnurüberleben,künstlerisch,wennmanradikalgegensichselbst auch ist. Inwieweit sind Radikalität und Provokation verbunden?
Man muss sich selbst provozieren. Man muss seine eigene Radikalität aushalten und mit seinem Spiegelbild klären. Das Spiegelbild bin aber nicht ich, sondern das ist jemand anders. Wenn ich denke, dass ich das bin, bin ich schon politisch, religiös gefangen in der Vergangenheit. Ich muss mir darüber klar sein, dass ich nur eine Maske trage.
Vielen Dank für das Gespräch!
Die Anfänge der Sozialversicherung in Österreich.
Von Alfons DürDer Schriftteller Franz Kafka war seit 1908 bei der Allgemeinen Unfallsversicherungsanstalt in Prag tätig. Dort war er für Arbeitsunfälle zuständig. Im Sommer 1909 schrieb er darüber an Max Brod: „Denn, was ich zu tun habe! In meinen vier Bezirkshauptmannschaften fallen […] wie betrunken die Leute von den Gerüsten herunter, in die Maschinen hinein, alle Balken kippen um, alle Böschungen lockern sich, alle Leitern rutschen aus, was man hinauf gibt, das stürzt hinunter, was man herunter gibt, darüber stürzt man selbst. Und man bekommt Kopfschmerzen von diesen jungen Mädchen in den Porzellanfabriken, die unaufhörlich mit Türmen von Geschirr sich auf die Treppen werfen.“
Ähnliches hätte er auch über Vorarlberg schreiben können, denn eine Folge der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer stärker aufkommenden Industrialisierung war eine enorme Zunahme von Arbeitsunfällen. Die Arbeiter-Unfallversicherungs-Anstalt in Salzburg, die für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg zuständig war, schrieb denn auch 1899 im Rechenschaftsbericht über die ersten zehn Jahre ihres Bestandes: „Das Leben der Menschen gleicht einer fortgesetzten Reihe von Unfällen, welche allmählich zu dessen Ende führen.“
Arbeitsunfälle bekamen im Industriezeitalter eine neue Qualität. Lohnausfall und Verlust der Arbeit durch Unfall oder Krankheit wurden zu existenzbedrohenden Risiken. „In allen Ländern wird deshalb“, so heißt es in einem Standardwerk zur Geschichte der Sozialversicherung, „der Arbeitsunfall als ein nicht mehr dem persönlichen Schicksal allein zurechenbares, der individuellen Verantwortung oder gar persönlicher Vorsorge zugängliches Unglück erkannt, sondern als ein der Strukturveränderung der neuen Technologie innewohnendes soziales Risiko“. „Unfallverhütung“ und „Arbeiterschutz“ wurden nun europaweit zu dringlichsten Forderungen. Versorgungsmöglichkeiten, die früher Zünfte und Grundherrschaft boten, waren nicht mehr existent. Nunmehr musste der „sorgende Staat“ diese Lücke schließen. 1883 wurden in Österreich Gewerbeinspektoren geschaffen, die Vorläufer der Arbeitsinspektorate. Die Gewerbenovelle 1885 brachte wichtige Neuerungen: die Bestimmungen über die Sonntagsund Feiertagsruhe wurden verbessert, die

zulässige Arbeitszeit in manchen Bereichen herabgesetzt, die Nachtarbeit von Frauen, Kindern und Jugendlichen beschränkt. Ihren Höhepunkt erreichte die Arbeiterschutzbewegung aber mit der Einführung der obligatorischen Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter. Mit dem Gesetz vom 28. Dezember 1887, „betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter“, RGBl. 1888, Nr.1 (UVG), und dem Gesetz vom 30. März 1888, „betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter“, RGBl. 1888, Nr. 33 (KVG) traten am 1. November 1889 erstmals Pflichtversicherungen für Arbeiter in Kraft, die zumindest für einen kleinen Teil der arbeitenden Bevölkerung eine Absicherung bei Krankheit und Unfall boten. 1894 wurde der Anwendungsbereich dieser Gesetze erweitert. Aber erst in den folgenden Jahrzehnten wurden allmählich alle Arbeitnehmer in diese Pflichtversicherungen einbezogen.
Schon vor der Einführung dieser Pflichtversicherungen hatte es auf der Grundlage gewerbe- und vereinsrechtlicher Bestimmungen Betriebskrankenkassen gegeben. Im Jahr 1890 gab es im Sprengel der AUVA Salzburg insgesamt
Alpe Ifer in Egg, um das Jahr 1890 datiert: Gefährliche, unfallträchtige Arbeiten.
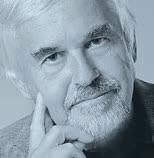
Zur Person ALFONS DÜR *1948 in Lauterach, Studium der Rechtswissenschaften in Wien, Richter, von 1998 bis 2008 Präsident des Landesgerichtes Feldkirch. Forschungen zur NS-Justiz und zu Fragen der Rechts- und Justizgeschichte Vorarlbergs.
426 Krankenkassen, in Vorarlberg waren es mehr als 60. Diese Betriebskrankenkassen gewährten meist auch einen Schutz bei Arbeitsunfällen, doch waren ihre Leistungen zeitlich begrenzt. Die obligatorische Unfallversicherung erfasste nur etwa ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung. Die Versicherung erstreckte sich nämlich nur auf gefährliche Arbeiten. In der Anfangszeit waren im Wesentlichen nur die Fabriksbetriebe, Steinbrüche, das Baugewerbe sowie die unter Verwendung von Kraftmaschinen betriebenen Gewerbe von der Versicherung umfasst. Um 1890 waren im Zuständigkeitsbereich der AUVA Salzburg von 1.821000 Bewohnern nur etwa 150.000, davon mehr als 50.000 nur auf wenige Tage oder Stunden, versichert. Versicherungsschutz bestand nur während der Verrichtung gefährlicher, unfallträchtiger Arbeiten, nicht der gesamten Arbeitszeit. Arbeiter und Taglöhner kamen auf diese Weise oft zu Versicherungszeiten von nur wenigen Tagen und Stunden.
In der Anfangszeit der Unfallsversicherung war die Frage der „Werkstättenversicherung“ höchst umstritten. Dabei ging es um die Frage, ob Tätigkeiten in der Werkstatt in gleicher Weise versichert sein sollten wie jene auf Baustellen. Das Gesetz bot verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Tatsächlich war es so, dass Arbeiter nur bei Unfällen auf einer Baustelle eine Entschädigung erhielten, nicht jedoch an ihrem ständigen Werkplatz. Franz Kafka setzte sich für eine umfassende, auch die Werkstätten einschließende Interpretation des Unfallversicherungsgesetzes ein. Diese Auffassung setzte sich letztlich durch. Für die Berechnung der Versicherungsbeiträge wurden die Unternehmen in über 500 „Berufstitel“ eingereiht, die wiederum – je nach Unfallgefährlichkeit– in zwölf Gefahrenklassen

eingeteilt wurden. Innerhalb der Gefahrenklassen erfolgte eine weitere Einstufung nach Gefahrenprozentsätzen, die statistisch ermittelt wurden. Neben diesem Gefahrenschema waren die Lohnsummen der jeweiligen Betriebe für die Höhe der Versicherungsbeiträge entscheidend. Um falsche Angaben auszuschließen und eine Überprüfung zu ermöglichen, wurden die Unternehmen im Jahr 1909 durch das „Lohnlistenzwangsgesetz“ verpflichtet, „Aufschreibungen“ über die zur Ermittlung der für die Versicherung anrechenbaren Bezüge zu machen und diese fünf Jahre aufzubewahren.
Die Versicherungsbeiträge mussten zu 10 Prozent vom Versicherten und zu 90 Prozent vom Unternehmer aufgebracht und gesamthaft vom Unternehmer an die AUVA abgeführt werden. Je höher die Gefahrenklasse und der Gefahrenprozentsatz waren, desto höher war der zu leistende Versicherungsbeitrag. Gegen die Einstufung konnte Einspruch erhoben werden, was häufig geschah, da die Aufbringung der Versicherungsbeiträge vielen Familien- und Gewerbebetrieben Schwierigkeiten bereitete und die
Berechnung oft auf Widerstand und Ablehnung stieß.
Jacob Zuderell aus Schruns führte beispielsweise 1891 in einer Eingabe an das k.k. Ministerium des Innern aus, die Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt in Salzburg habe ihn für den Betrieb einer einfachen Brettersäge zu einer viel zu hohen Beitragsleistung von 3.34 Gulden verpflichtet und ihn in die Gefahrenklasse 10, Prozentsatz 59, eingereiht. Diese Einreihung sei im Vergleich zu der für den Arbeiter vorhandenen Gefahr viel zu hoch, da seine Säge an der Kurbelscheibe am Wallbaum des Wasserrades angebracht sei und „keine Riemen und Kammräder“ laufen würden. Die „großen Etablissements, wie zum Beispiel Spinnereien, wo Sääle voll Maschinen laufen und jeder unbeachtete Schritt den Arbeitern Schaden bringen kann“, würden viel niedriger eingestuft, obwohl dort die Gefahr viel größer sei.
Zehn Jahre nach Einführung der Unfallversicherung konnte die AUVA Salzburg für ihren Zuständigkeitsbereich stolz Bilanz ziehen: „Mehr als 18.000 Menschen sind während des abgelaufenen Dezenniums bei versicherter Arbeit verunglückt, 627 haben hierbei ihren Tod gefunden, 311 Witwen, 553 Kinder und 32 betagte Eltern beweinten den Verlust ihres Ernährers, mehr als 2700 sind zeitlebens unfähig geworden, durch ihrer Hände Arbeit in gewohnter Weise den Unterhalt zu schaffen; dank diesem Gesetze sind sie vor Not und Elend, vor dem traurigen Schicksale des Bettlers bewahrt.“
Neben der finanziellen Absicherung der Unfallopfer wurden nun Prävention und Unfallverhütung zu wichtigen Zielen staatlichen Handelns. Auch Franz Kafka beschäftigte sich damit. Er verfasste mehrere Beiträge zum Thema Unfallverhütung und nahm 1913 am II. Internationalen Kongress für Rettungswesen und Unfallverhütung in Wien teil.
Auch wenn viele Regelungen der Unfallsversicherung in der Anfangszeit kompliziert und zeitbedingt waren, so veränderten sie nicht nur das Selbstverständnis des Staates, sondern auch die Lebensbedingungen der Menschen. Innert weniger Jahrzehnte bot der „sorgende Staat“ den Menschen eine neue Perspektive sozialer Sicherheit, eine Perspektive, die auch heute zu den notwendigen und unverzichtbaren Gegebenheiten unseres Lebens zählt.
M ARKUS

… ist Archivar und Historiker im Vorarlberger Landesarchiv in Bregenz.
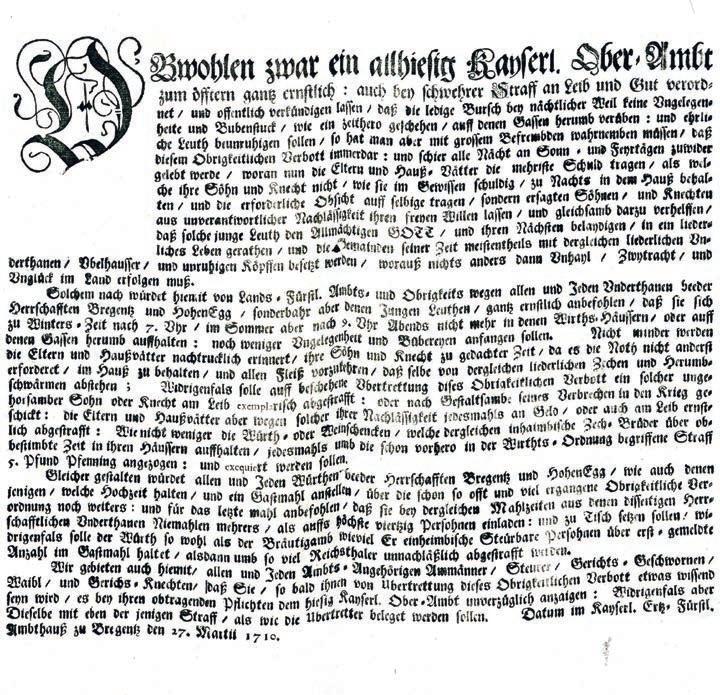
Gedruckte Verordnung des Oberamts Bregenz, 27. März 1710
Nicht erst seit pandemiebedingten Ausgangssperren beziehungsweise zugeschlossenen Gasthäusern schätzen auch wir heute wieder den Wert einer freien Gestaltung unserer Freizeit etwa im Wirtshaus oder auf dem Sportplatz. Nicht selten wurde aber auch schon in früheren Zeiten bei diesen Gelegenheiten über die Stränge geschlagen, was immer wieder die Obrigkeit auf den Plan rief.
Im März 1710 sah sich das Oberamt Bregenz einmal mehr dazu genötigt, mithilfe einer gedruckten und öffentlich angeschlagenen Verordnung auf häufig vorkommende Missstände im Zuge von allzu feierwütigen Nachtschwärmern und Ruhestörern hinzuweisen und bei Zuwiderhandlung mit harten Strafen zu drohen. Die gedruckte Verordnung gibt hierbei einen Eindruck von den damaligen Zuständen auf den Gassen und in den Wirtshäusern in der Herrschaft Bregenz. Neben angeführten Missständen wie Ruhestörung, öffentliches Ärgernis, Trunkenheit, Raufereien, Gotteslästerung und Ähnliches appellierte das Oberamt dann auch an die Erziehungsberechtigen der Missetäter: Nicht minder werden die Eltern […] nachtrucklich erinnert, ihre Söhn und Knecht […], im Haus zu behalten und allen Fleiß vorzukehren, daß selbe von dergleichen liederlichen Zechen und Herumbschwärmen abstehen. Ebenso wurden aber auch die Wirtsleute in die Pflicht genommen. So erinnerte die Verordnung auch daran, dass Hochzeitsgesellschaften mit mehr als 40 Personen laut einer früheren Verordnung verboten waren. Sollte es dennoch zu größeren Gesellschaften und weiteren Zwischenfällen kommen, so seien einzig Bräutigam und Wirt haftbar zu machen.
Genützt haben derlei Verordnungen und Strafandrohungen aber offenbar nur wenig. In den Beständen des Landesarchivs sind ausufernde Hochzeitsgesellschaften oder Wirthausraufereien mit vielerlei Beschreibungen gut dokumentiert.
www.landesarchiv.at

Fundstücke der Landschaftsreinigung haben im vorarlberg museum einen besonderen Platz bekommen – als Exponate eines Problems: Dem achtlosen Wegwerfen von Abfall und Gegenständen. Damit wird dieses Problem nicht nur in verschiedene Kontexte, sondern vor allem „in gut einsehbare Positionen“ gesetzt.

Weggeworfenes, Unrat, Abfall oder einfach Dinge, die nicht in die Natur gehören: Achtloses Wegwerfen – auch als „Littering“ bekannt – bleibt trotz vermeintlich geschärften Umweltbewusstseins ein Problemthema. Ausgewählte Exponate, die im Rahmen der Landschaftsreinigung in Vorarlberger Gemeinden von Ehrenamtlichen gefunden wurden, sind nun aktuell in die Dauerausstellung „buchstäblich vorarlberg“ des vorarlberg museums eingebettet. Teils kuriose Einzelstücke finden sich inmitten dieser interessanten Kostprobe – im insgesamt reichen Gesamtbestand von über 160.000 Objekten im Museumsdepot.
Die Abfallstücke finden hier Platz zwischen bedeutsamen und weniger bedeutsamen Dingen: Inmitten von Heiligenfiguren, Kunstobjekten, Trachtenhauben, archäologischen Funden und weiteren Objekten aus der Geschichte Vorarlbergs. Bewusst und prominent platziert, fordern diese Exponate mehr Aufmerksamkeit für ein Thema ein, das als gesellschaftliche Entwicklung erst seit jüngster Vergangenheit eine eigene Geschichte und damit Bedeutung entwickelt hat.
So ein Müll!
Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der Landschaftsreinigung von 15.000 freiwilligen Helfern insgesamt rund 65 Tonnen Abfall in den Vorarlberger Gemeinden gesammelt. Das ist erschreckend, aber auch eindrucksvoll. Und zwar so eindrucksvoll, dass auch das vorarlberg museum als ideeller Partner und Gastgeber hier große Potenziale erkannt hat – zumal die Institution die wachsende Bedeutung der Themen Abfall und Umwelt auch in den eigenen Strategieprozess einfließen ließ. Das Ausstellen von Abfall in dieser intervenierender Form und Funktion inmitten gängiger Museumsexponate hat somit durchaus plausible Gründe.
Müll im Museum. Das mag kurios erscheinen, aber auch die Auffassungen vieler über die Museumsarbeit sind, man könnte erst recht sagen, antiquiert. Die wichtige Rolle von Museen als Botschafter eben nicht nur historischer Zusammenhänge („Da steht doch nur altes Zeug herum!“), sondern auch gesellschaftlicher Entwicklungen wird oft unterschätzt.
„Eine Ausstellung über Abfall und Unrat hat nicht einfach nur mit ‚Müll‘ zu tun, sondern gibt Anlass zur Reflexion über unser Verhältnis zu den Dingen, zu Vergänglichkeit und Zukunft und zum Umgang mit unserer Umwelt“, erklärt der Vorarlberger Kulturwissenschaftler Bernhard Tschofen: „Müll ist nicht nur ein brennendes Gegenwartsthema, sondern auch eine Herausforderung für das Museum in seiner Rolle als ‚clearing station‘ zwischen Vergangenheit und Zukunft. Dazu gehört nämlich auch der Blick für das Verschwinden der Dinge aus unserer engeren Lebenswelt und ihr Nachleben – gleich ob als Bereicherung oder Belastung.“
Mosaik der Kulturgeschichte

Theresia Anwander vom vorarlberg museum war von Anfang an mit dem Vorarlberger Gemeindeverband bei der gemeinsamen Umsetzung der Idee dabei. Für sie als „Kuratorin“ der Intervention ist es besonders spannend, auch vermeintlichen Abfall als eine Art Schatz zu betrachten, der ge- und aufgehoben werden soll: „Rentiert sich der Aufwand, etwas aufzuheben? Entscheide ich mich für ein Ja, dann folgt die Kopfarbeit. Wie und wo verwahre ich den Schatz? Was ist der Schatz, welche Erinnerungen trägt er mit sich? Genau das ist Sammlungsarbeit im Museum. Entdecken, was zu finden ist, aufbewahren, verwalten, erforschen, vermitteln. Mit offenem Blick begreife ich auch diese Fundstücke aus der Landschaftsreinigung als Mosaiksteine unserer Kulturgeschichte.“
Die Exponate wurden von der Kuratorin gezielt in der bestehenden Ausstellung platziert, teilweise sogar „versteckt“. „Ob und wie sie wahrgenommen, eingeordnet und kontextualisiert werden, entscheiden die Betrachterinnen und Betrachter selbst. Die Möglichkeiten und Betrachtungsweisen sind jedenfalls vielfältig“, sagt die Ethnologin.
Ob ausgestellter Unrat oder pädagogisch wertvolle Exponate mit Zweitleben: Die Verbindung zwischen Landschaftsreinigung und Museum ist eine kreative und durchaus unterhaltsame Möglichkeit, ein weiteres Zeichen gegen Littering zu setzen. Und: Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, diesen Artikel gelesen, hat das Vorhaben sein Ziel wohl kaum verfehlt.

In Bregenz wird eine Luxusimmobilie angeboten, aber es findet sich kein Käufer, der den hohen Preis bezahlen will. So geschehen 1899, als die Villa Raczynski oberhalb von Bregenz mit ihrem prachtvollen Schloss, den zahlreichen Nebengebäuden sowie rund sechs Hektar Grund, trotz mehrerer Versuche, keinen zahlungskräftigen Interessenten fand. Sogar ein ausführliches Exposé wurde gedruckt, um die zahlreichen Vorzüge des Anwesens anzupreisen.
Auf 60 Seiten, in französischer Sprache und reich bebildert, wurden die Gebäude und die Infrastruktur beschrieben. Es beginnt mit der Verkehrslage Vorarlbergs, die sowohl mit dem Schiff als auch mit dem Zug hervorragend sei, und setzt mit der Charakterisierung der ansässigen Bevölkerung fort, die arbeitsam, konservativ und resistent gegen sozialistische Ideen sei. (rebelle aux ideés subversives et aux doctrines socialistes). Die Beschreibung des Anwesens beginnt mit Zahlen und Fakten: 60.674 Quadratmeter Grund, davon 19.000 Quadratmeter Gartenfläche, 29.000 Quadratmeter Rasen und 6000 Quadratmeter Wald. Es folgt die Aufzählung der imposanten Gebäude: die eigentliche Villa mit 34 Metern Länge und 20 Metern Breite, das Haus für die Angestellten von ähnlicher Größe, ein Gewächshaus, Stallungen, ein Pförtnerhaus, ein Eiskeller sowie zwei Kegelbahnen, eine überdachte und eine Freiluftbahn. Das Haupthaus sei im Stile von Louis XV. erbaut und erlaube es neben der Wohnfunktion auch in verschiedenen Salons Empfänge und Feste für zahlreiche Gäste auszurichten. Abschreckend für potenzielle Käufer waren neben dem hohen Kaufpreis sicher auch die erwartbaren Folgekosten, sorgten doch vor dem Verkauf 60 Bedienstete dafür, dass Haus und Hof in Schuss blieben und die Besitzer ein luxuriöses Leben führen konnten.
Die Herrschaften, die die wunderschöne Villa, wahrscheinlich Schloss Linderhof von Ludwig II. nachempfunden,
und den wunderschönen Garten erbauen und gestalten ließen, waren Carl Eduard Graf Nalecz Raczynski und seine Frau Karolina, geboren als Prinzessin von Oettingen-Wallerstein, aus der Nähe von Nördlingen stammend. Anlässlich einer Reise hatte das kinderlose Paar in Lindau übernachtet, wobei die Gräfin vom gegenüberliegenden Ufer des Bodensees so entzückt war, dass sie sich nichts mehr wünschte, als dort sesshaft zu werden.
Der Graf erfüllte seiner Frau zwei Jahre vor der silbernen Hochzeit diesen Wunsch, kaufte am Fuß des Gebhardsbergs landwirtschaftlichen Grund und innerhalb von zwei Jahren wurde eine prachtvolle Villa und eine ganze Reihe weiterer Gebäude errichtet, die er ihr 1876 zum 47. Geburtstag schenkte.
Der Graf stammte aus altem polnischem Adel, verfügte über große Besitzungen in Galizien und galt als steinreich. Die Villa Raczynski entwickelte sich bald zu einem Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Bregenz, da dort immer wieder große Feste ausgerichtet wurden, bei der sich die hohe Beamtenschaft und der Adel der Umgebung trafen. So wurde etwa im September 1879 ein großartiges Feuerwerk zum Geburtstag der Gräfin abgebrannt, das in ganz Bregenz bestaunt werden konnte. Graf und Gräfin nahmen auch aktiv am kulturellen Geschehen in der Stadt teil, so besuchten sie oft das Theater, wo die erste Zuschauerreihe für sie reserviert war. Leider ist nicht bekannt, ob sie auch Beziehungen zur Familie Poellnitz pflegten, die damals das benachbarte Schlösschen Babenwohl, heute Verwaltungsgebäude der Landesbibliothek bewohnte. Vielleicht war doch die konfessionelle Schranke zu hoch, waren die Raczynskis doch sehr katholisch geprägt, während Ernest von Poellnitz den protestantischen Glauben nach Vorarlberg gebracht hatte und sogar für den Bau der benachbarten Heilig-Kreuz-Kirche gesorgt hatte.

Als die Gräfin 1898 nach längerer Krankheit einem Schlaganfall erlag, kehrte auch der Graf Bregenz den Rücken, kehrte in seine polnische Heimat zurück und verstarb schon bald nach ihr 1899. Er vermachte der Stadt Bregenz die enorme Summe von 20.000 Gulden für Verschönerungszwecke, was ihm die Ehre einbrachte, dass ein Aussichtsplatz nahe der heutigen Landesbibliothek nach ihm benannt wurde: Raczynski-Ruhe (auf dem offiziellen Wegweiser steht dort leider komplett falsch geschrieben Racinsky statt Raczynski und ich werde den Artikel zum Anlass nehmen, den Fehler korrigieren zu lassen). Es war nun die Aufgabe eines Neffen, gleichzeitig Erben des Grafen, das Anwesen zu verkaufen, was dann allerdings ganze fünf Jahre dauerte, und das bei einem kontinuierlich sinkenden Preis. Schließlich entschloss sich der Dominikanerinnenorden aus Lauterach an der Versteigerung im Sommer 1904 teilzunehmen, und da der Aufruf der Priorin, etwaige Konkurrenten „wegzubeten“, offensichtlich gefruchtet hatte, wurden die Schwestern stolze Besitzerinnen des

Zur Person THOMAS FEURSTEIN
* 1964 in Bregenz, Studium der Germanistik und Geografie, Bibliothekar und Leiter der Abteilung Vorarlbergensien an der Vorarlberger Landesbibliothek seit 1998.
Anwesens. Sie hatten bis dahin in Lauterach, im heutigen Redemptoristinnenkloster, eine Mädchenschule unterhalten, die noch 1904 samt dem Internat in die Villa verlegt wurde. Die Dominikanerinnen nannten ihre neue Heimat „Marienberg“, da schon zu Zeiten der Grafenfamilie eine Statue der Muttergottes mit Kind ihren festen Platz an der Fassade der Villa hatte.
Kontinuität und Wandel prägen seither Marienberg. Beständigkeit garantieren bis heute die Dominikanerinnen, die viele Jahre auch die Leitung der Schule innehatten. Nur zwischen 1938 und 1945 wurde den Schwestern die Schulen entzogen und verstaatlicht, die Gebäude während des Kriegs als Lazarett genutzt und in der Besatzungszeit als Heim für französische Mütter und Kinder verwendet. Die Schwestern waren es auch, die sich durch den Verkauf zweier Häuser in der Schweiz finanziell in die Lage versetzten, die Villa und die Parkanlage nach den Vorgaben des Denkmalschutzes vorbildlich zu restaurieren. Obwohl sie heute im Schulalltag nicht mehr präsent sind, beeinflussen sie bis heute weltanschaulich die Schulen, bekennt sich doch der diözesane Schulträgerverein öffentlich dazu, auf „Grundlage und Zielsetzungen des katholischen Weltbildes im Geiste des Ordens der Dominikanerinnen“ zu agieren.
In den Schulen Marienbergs kam es zu großen Veränderungen: Über viele Jahre hinweg hatten die Hauswirtschaftlichen Schulen Marienbergs einen festen Platz in der Vorarlberger Schullandschaft, in den vergangenen Jahren kamen dann in rascher Folge auch eine private Volks- sowie Mittelschule hinzu, zu der sich in naher Zukunft auch noch eine gymnasiale Oberstufe gesellen soll. Jedenfalls werden immer mehr der ursprünglichen gräflichen Bauten für Schulzwecke verwendet, so tummeln sich schon heute in der prunkvollen Villa Raczynski die Schüler und Schülerinnen der privaten Volksschule.
Zur politischen Partizipation von Mädchen und jungen Frauen in ländlichen Räumen.
Von Angelika Atzinger
Zur Person
ANGELIKA ATZINGER
* 1986 in Innsbruck, Studium Politikwissenschaft und Translationswissenschaften, seit 2012 in frauen- und mädchenspezifischen Kontexten und in der Erwachsenenbildung tätig, seit 1998 Geschäftsführung im Verein Amazone, der sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt.
Obwohl sich Mädchen und junge Frauen für politische Themen und gesellschaftliche Veränderung interessieren, können sich nur wenige von ihnen vorstellen, politisch aktiv zu sein, etwa ein politisches Amt zu übernehmen. Traditionelle Geschlechterrollenbilder und ungleich gestaltete Zugänge sind Gründe dafür. Sie wirken insbesondere in ländlichen Räumen.
Noch immer sind Frauen in politischen Entscheidungsgremien unterrepräsentiert, vor allem auf kommunaler Ebene und speziell in ländlichen Regionen. Laut Österreichischem Gemeindebund gab es 2023 in Österreich erstmals mehr Bürgermeisterinnen als Bürgermeister mit dem Namen Franz oder Hans. Die Tendenz ist also steigend. Vorarlberg liegt aber deutlich unter dem österreichischen Schnitt von 10,5 Prozent: Hier stehen sieben Bürgermeisterinnen 89 Ortsvorstehern gegenüber.
Mangelndes Interesse und fehlendes Engagement können als Gründe nicht herangezogen werden: Aktuelle Erhebungen, wie von Gallup 2022, zeigen, dass Mädchen und junge Frauen in Österreich sehr wohl an politischen Themen interessiert sind. Laut einer Umfrage von Plan International halten es 96 Prozent von 1000 befragten Mädchen und jungen Frauen zwischen 15 und 24 Jahren für wichtig, sich politisch zu engagieren, 88 Prozent haben sich bereits politisch engagiert.
Während diese Ergebnisse weltweit ähnlich sind, fällt auf, dass die geplante oder umgesetzte aktive Beteiligung in Österreich deutlich niedriger ist. Nur 18 Prozent glauben, dass Politiker und Politikerinnen die Ansichten von jungen Frauen kennen und nur sieben Prozent geben an, dass sie mit den Entscheidungen der Politik zufrieden sind. Nur zwölf Prozent können sich vorstellen, für ein politisches Amt zu kandidieren; allerdings wurde eine von fünf Befragten bereits durch persönliche Erfahrungen entmutigt, sich politisch zu engagieren.
Diese Ergebnisse decken sich mit Erfahrungen, die der Verein Amazone in seiner Arbeit seit vielen Jahren macht: Mädchen und junge Frauen sind interessiert und engagiert, finden aber wenig Möglichkeiten politischer Teilhabe in ihren Alltagswelten vor, denn nach wie vor sind Partizipationsstrukturen, insbesondere in ländlichen Räumen, auf Männer ausgerichtet.
Fehlende Mitgestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsstrukturen für Frauen, vorherrschende Geschlechterklischees und Sexismus sind vielen zivilgesellschaftlich und politisch Agierenden wenig bewusst – dies wirkt sich dahingehend aus, dass Mädchen und junge Frauen weniger Potenzial für sich und ihre Lebenskonzepte entwickeln können. Zudem wirken traditionelle Rollenbilder schon in früher Kindheit und beeinflussen Lebens- und Karrierevorstellungen. Dabei ist die Abwanderung aus ländlichen Regionen gerade von jungen Frauen seit vielen Jahren ein medial stark diskutiertes Thema. Unzureichende Infrastruktur – etwa im Bereich Arbeitsplätze, Kinderbetreuung und Mobilität – ist hier sicherlich ein starkes Motiv, aber auch traditionelle Geschlechter- und Familienbilder sowie unzureichende Entwicklungsmöglichkeiten spielen laut Experten und Expertinnen eine wesentliche Rolle. Handlungsansätze, um politische Partizipation von jungen Frauen zu fördern, müssen vielschichtig und vielfältig sein: Einerseits geht es darum, förderliche strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen, etwa Vereinbarkeitsmodelle für Politikerinnen. Weiters muss es darum gehen, niederschwellige Partizipationsmöglichkeiten bereits im Kinder- und Jugendalter zur Verfügung zu stellen und Politik überall dort zum Thema zu machen, wo sich Mädchen aufhalten. Dabei sind Räume für Austausch, Diskussionen auf Augenhöhe und das Ernstnehmen geschlechtsspezifischer Aspekte wesentlich. Auch entsprechende Vorbilder sind wichtig, denn der Austausch mit ihnen motiviert und inspiriert. Gerade in ländlichen Regionen brauchen Mädchen und junge Frauen Angebote, die sie in ihrer Selbstbestimmung fördern und sie zu individuellen Lebensentwürfen ermutigen.
Im Rahmen des Projekts „Rollen im Wandel“ setzt der Verein Amazone gemeinsam mit femail – FrauenInformationszentrum Vorarlberg, Vorarlberger Familienverband und Regionalentwicklung Vorarlberg Angebote in ländlichen Regionen, die tradierte Geschlechterrollenbilder in Frage stellen und Alternativen eröffnen. Im Rahmen des Projekts werden neben Empowerment-Formaten für Mädchen und junge Frauen auch sensibilisierende Maßnahmen für Menschen aller Altersgruppen umgesetzt. Das braucht es, denn Hindernisse und Hürden, mit denen junge Frauen in ihrem Alltag konfrontiert sind, sind den politischen Entscheidungstragenden nach wie vor wenig bewusst.

Die

Zur Person STEFANIA
PITSCHEIDER
SORAPERRA
leitet seit 2009 das Frauenmuseum Hittisau. Als Mitglied der KünstlerInnengruppe WochenKlausur hat sie zahlreiche Projekte an der Schnittstelle zwischen Kunst und Gesellschaftspolitik realisiert, etwa für den steirischen herbst, die Shedhalle Zürich oder die Biennale von Venedig. Sie hat am Kunsthistorischen Museum Wien, der Kunsthalle Wien, der Shedhalle Sankt Pölten und dem Kulturzentrum Cooperations in Wiltz (Luxemburg) gearbeitet.
Als Ausstellungskuratorin, Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin gilt ihr Interesse gesellschaftspolitischen und feministischen Fragestellungen. Sie wurde in Brixen, Südtirol geboren und ist ladinischer Muttersprache.
Im Zusammenhang mit Krieg ist meist von Männern die Rede – von tapferen Soldaten, kriegstreibenden Generälen, verrückten Diktatoren oder kämpferischen Präsidenten. Aber Krieg ist nicht minder Frauensache. Die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind Frauen und Mädchen. In bewaffneten Konflikten sind sie geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Und diese Gewalt dauert oft auch nach den Kriegshandlungen an. Aber Frauen sind nicht nur Opfer. Oft sind es gerade sie, die in Friedensprozessen eine aktive Rolle einnehmen. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Waffen. In Frieden zu leben, heißt, sicher zu leben, keine Angst vor Gewalt und Menschenrechtsverletzungen zu haben. Frieden ist kein Projekt für Individuen. Er ist ein gemeinschaftlicher Prozess, bei dem Konflikte nicht durch Waffen, sondern durch Verhandlungen, Netzwerke, Gruppen, Allianzen gelöst werden. Frauen zeigen weltweit Widerstandsfähigkeit, Erfinderinnengeist und Mut bei der Bewältigung der Probleme in Kriegs- und Nachkriegszeiten. In allen Teilen dieser Erde spielen sie eine wichtige Rolle als Vermittlerinnen zwischen verfeindeten Gruppierungen. Sie dokumentieren Kriegsverbrechen und suchen nach Lösungen. Sie sind es oft, die die Kraft zum Wiederaufbau ihres eigenen Lebens und jenes ihrer Familien aufbringen. Sie arbeiten mutig und unbeirrt daran, patriarchale Machtstrukturen aufzubrechen, neue Perspektiven zu eröffnen, Wege des Friedens zu zeichnen.
1136 Frauen
In Zeiten des Krieges müssen wir über Frieden sprechen. Das wussten auch jene Frauen, die sich 1915 im niederländischen Den Haag zum Internationalen Frauenfriedenskongress trafen. Mitten im Ersten Weltkrieg organisierten die Juristin Anita Augspurg und ihre Lebensgefährtin, die Frauenrechtlerin Lida Gustava Heymann, gemeinsam mit der niederländischen Ärztin und Pazifistin Aletta Jacobs einen Kongress, an dem 1136 Frauen aus zwölf Nationen teilnahmen. Die Frauen erarbeiteten dabei einen Forderungskatalog an die Nationen der
Welt, der seiner Zeit weit voraus war. Sie forderten einen ständigen Internationalen Gerichtshof und legten damit den Grundstein für jenen Internationalen Gerichtshof, der heute seinen Sitz in Den Haag hat. Sie gründeten ein Gremium, das bis heute existiert und einen Beraterstatus bei den Vereinten Nationen hat: die „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“. Und sie verurteilten aufs Schärfste Massenvergewaltigungen als Mittel der Kriegsführung.
Als 411 vor unserer Zeit Aristophanes sein pazifistisches Theaterstück „Lysistrate“ verfasste, gab es auf dem Peloponnes schon 20 Jahre Krieg zwischen Sparta und Athen. Im Stück geht es um den Kampf einiger Frauen gegen die Männer als Verursacher von Krieg. Als der Ratsherr den Frauen vorwirft, sich in den Krieg einzumischen, obwohl dieser sie als Frauen nichts angehe, antwortet Lysistrate: „Wie? Trifft [der Krieg] nicht doppelt und dreifach uns Frauen? Wir haben die Knaben geboren. Wir haben gewappnet ins Feld sie geschickt. […] Wärt ihr bei Sinnen, so behandeltet ihr die Geschäfte des Staats akkurat wie wir Frauen die Wolle!“ Lysistrate plädiert dafür, Staatsapparate zu entfilzen, die Gesellschaften zu kämmen und zu einem vereinenden wollenen Mantel neu zu weben. Sie spricht also von Frieden, Kooperation, Völkerverständigung.
Ist es naiv, in Zeiten des Krieges über Frieden zu sprechen? Ich denke nicht. Denn wir brauchen andere Lösungen als einen neuen Weltkrieg. Und wir brauchen Frauen und Männer, die sich dafür einsetzen. Für den Frieden zu sein bedeutet nicht, Konflikte zu scheuen. Konflikte können oft der Motor für Veränderung sein – denken wir an Frauenrechte, an Arbeitnehmer:innenrechte, an den Sturz unrechter Regime. In einer Welt, die von Vielfalt und unterschiedlichen Ansichten geprägt ist, sind Konflikte unvermeidlich. Aber anstatt sie zu fürchten, sollten wir sie als Chance sehen, Missverständnisse zu klären, Ungerechtigkeiten anzugehen und echten Wandel herbeizuführen. Konflikte ermöglichen es uns, unsere Standpunkte zu überdenken, neue Perspektiven einzunehmen und Kompromisse
zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Sie fordern uns heraus, über unseren Tellerrand hinauszuschauen und nach Lösungen zu suchen, die über den Moment hinausgehen und langfristigen Frieden fördern. Doch während Konflikte oft unvermeidlich sind, ist es entscheidend, wie wir mit ihnen umgehen. Statt auf Gewalt oder Unterdrückung zu setzen, sollten wir auf Dialog, Empathie und Kompromissbereitschaft setzen. Nur so können wir echte Veränderungen bewirken und langfristigen Frieden aufbauen. Die Frage ist also vielmehr, wie wir eine neue Konfliktkultur etablieren können.
Frauen, Frieden, Freiheit, Demokratie 2025 jähren sich die Bauernkriege zum 500. Mal. Sie waren eine entscheidende Periode des sozialen Aufstands in der europäischen Geschichte, in der unterdrückte Bäuer:innen und Arbeiter:innen gegen feudale Herrscher:innen aufbegehrten. Diese Rebellionen zeigten den Willen der Unterdrückten, für ihre Rechte und Würde zu kämpfen und trugen zur Entwicklung moderner Konzepte von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit bei. Aus diesem Anlass und im Rahmen eines Interreg-Projektes, an dem elf Institutionen in Vorarlberg, Baden-Württemberg und Bayern teilnehmen, widmet sich das FMH Frauenmuseum Hittisau zahlreichen Fragen rund um Freiheit, Frieden und Demokratie im Spiegel von Geschlechtergerechtigkeit.

Delegierte im April 1915 an Bord der MS Noordam, darunter Jane Addams, Annie E. Malloy und Emmeline Pethick-Lawrence.
Es war das Jahr 1867, in dem der Buchdrucker und Journalist Christopher Latham eine primitive Schreibmaschine entwickelte. Seine Erfindung hatte aber zunächst einen Haken: Die Typenhebel, die die Buchstaben auf Papier brachten, blockierten sich immer wechselseitig. Nach sechs langen Jahren und zahllosen Prototypen kam der Erfinder auf eine Lösung: Häufig genutzte Buchstaben platzierte er auf der Tastatur weit entfernt voneinander, um das Blockaderisiko zu minimieren. Heraus kam dadurch die QWERTZ-Folge.
Rund 50 Jahre später patentierte der Psychologe August Dvorak das DSK-Keyboard. Diese Tastatur hatte eine intuitive Tastenfolge und versprach dadurch ein bis zu 40 Prozent schnelleres Tippen. Dvorak kam aber zu spät. Den Siegeszug der QWERTZ-Tastatur konnte er nicht mehr aufhalten.
Auch heute, wo es schon lange keine mechanischen Hebel auf der Tastatur mehr gibt, die verklemmen könnten, ist die QWERTZ-Folge auf allen Geräten Standard. Eine damals aus technischen Gründen logische Entscheidung führte dazu, dass wir heute immer noch 40 Prozent langsamer tippen, als wir das eigentlich könnten. Aus heutiger Sicht hat sich also ein suboptimales System etabliert und konnte von einer eigentlich besseren Erfindung nicht mehr verdrängt werden.
Solche QWERTZ-Welten gibt es überall. „Sie zeigen, dass Entscheidungen für einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zwar logisch sind, aber die Fülle aus Entscheidungen in der Gegenwart reduziert. QWERTZ-Welten sind behäbige und ineffiziente Systeme“, bringt es Benedikt Fechner, Experte für digitale Innovationen, auf den Punkt.
Warum wir heute immer noch suboptimal tippen, erklärt das Konzept der Pfadabhängigkeit. Eine solche führt dazu, dass ein Ereignis oder eine Entwicklung durch vergangene Ereignisse und Entwicklungen geprägt und begrenzt wird. Dadurch wird der Status quo stabilisiert oder gar zementiert. Entscheidungen aus der Vergangenheit bestimmen also die Richtung, in die sich etwas zukünftig bewegen wird.
Und genau an diesem Punkt wird es über die Tastatur hinaus interessant. Denn solche Pfadabhängigkeiten finden wir eben nicht nur bei technischen Entwicklungen, sondern auch in
… oder wie wir neue Lösungen für den gesellschaftlichen Wandel

Organisationen, Unternehmen, Institutionen, Märkten, gesellschaftlichen Bereichen oder der Gesellschaft als Ganzem. Diese Einsicht verdanken wir dem Wirtschaftswissenschaftler Douglass North und er wiederum verdankt dieser Einsicht einen Nobelpreis.
North konnte zeigen, dass Pfadabhängigkeiten den institutionellen und gesellschaftlichen Wandel erschweren können. Anders formuliert es der Soziologie Armin Nassehi: Gesellschaften seien träge und könnten mit der Dynamik der Dinge nicht aktiv umgehen.
Wie aber kommt es überhaupt zu Pfadabhängigkeiten?
Grob gesagt stabilisieren – in einem wertfreien Sinne – vier Mechanismen diese Pfade der Entwicklung. Einerseits bauen funktionalistische Ansätze darauf, dass es in jeder Organisation oder der Gesellschaft als Ganzem unzählige wechselseitige Abhängigkeiten gibt. Veränderungen in einem Bereich schlagen Wellen in andere Bereiche. Und dadurch, dass sich ein solcher Wandel eben nicht einhegen lässt, steigt die Widerstandskraft gegen eine Veränderung.
Wenn dann auch noch Statusgruppen an Macht oder Einfluss verlieren sollten, wird die Veränderungsresistenz noch stärker. Hier geht es wohlgemerkt nicht nur um finanzielle Macht, sondern zum Beispiel auch um soziale Macht, Wissens- oder Kompetenzvorsprünge.
Zwei weitere Mechanismen konzentrieren sich vor allem auf die möglichen Vor- und Nachteile bestehender oder neuer Verfahren. Während eine legitimationsbasierte Herangehensweise an die Überlegenheit des bisherigen Verfahrens glaubt – Vorsicht vor dem Satz

Zur Person MARKUS RHOMBERG
* 1979 in Bregenz, ist Geschäftsführer des Wissenschaftsverbunds Vierländerregion Bodensee, einer internationalen Allianz von 25 Universitäten und Hochschulen.
Literaturtipp!
Metelmann, Jörg & Welzer, Harald (2020): Imagineering: Wie Zukunft gemacht wird. S. Fischer Verlage
„Das war doch immer schon erfolgreich“ – und damit bisherige Verfahrensweisen wiederholt, verstehen utilitaristische Mechanismen Veränderungsprozesse als Kosten-Nutzen-Abwägungen. Das geht dann so: Die Einführung neuer Prozesse, Strukturen oder Handlungsweisen verursacht zunächst Mehrkosten und zwingt Spezialistinnen und Spezialisten dazu, Neues zu lernen. Das erzeugt offensichtlich Widerstand und führt dazu, dass es bequemer ist, bei den alten Lösungen zu bleiben, auch wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind.
Und was bedeutet das für Gesellschaft und Transformation?
Zugegeben, es ist nicht leicht, neue Wege zu beschreiten, um Veränderungen in Organisationen oder der Gesellschaft als Ganzem zu bewirken. Das hat einen einfachen erkenntnistheoretischen Grund: Wir schauen auf die Welt mit den alten, wohl bekannten und scheinbar bewährten Begriffen, Kategorien und Schubladen. Das gibt uns Sicherheit.
Gesellschaftliche Routinen sind träge, Handlungs- und Reaktionsmuster erwartbar, das Verhalten bestimmter Gruppen habitualisiert und gesellschaftliche Konflikte institutionalisiert. Mit dieser Diagnose erklärt Armin Nassehi die fehlende Veränderungsbereitschaft. Aber, und daran möchte ich anschließen, er sagt auch: „Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir uns wechselseitig Trägheit oder Aufbruch vorwerfen. Es geht um die viel weiter reichende Frage, wie sich Pfadabhängigkeiten ändern lassen.“
Die oben genannten Barrieren und die Trägheit sind harte Nüsse. Das gilt sowohl für Organisationen als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Denn zur Haupteigenschaft des Neuen gehört vor allem, dass es nicht so recht in die alten Schablonen passen will.
Also, wie kommen wir da wieder raus?
Wären wir alle auf der sprichwörtlichen grünen Wiese, wäre Neuentwicklung nur kompliziert, in bestehenden Strukturen wird sie allerdings komplex. Wie können wir innerhalb von Routinen unsere Routinen verändern? Wie können wir mit den systemeigenen Mitteln die eigenen Möglichkeiten erweitern? In Organisationen und in der Gesellschaft? Zunächst müssen wir uns wohl trauen, innerhalb des Bekannten Experimente
FOTOS: ANGELA LAMPRECHT, ISTOCKPHOTOerträumen können.
Von Markus Rhomberg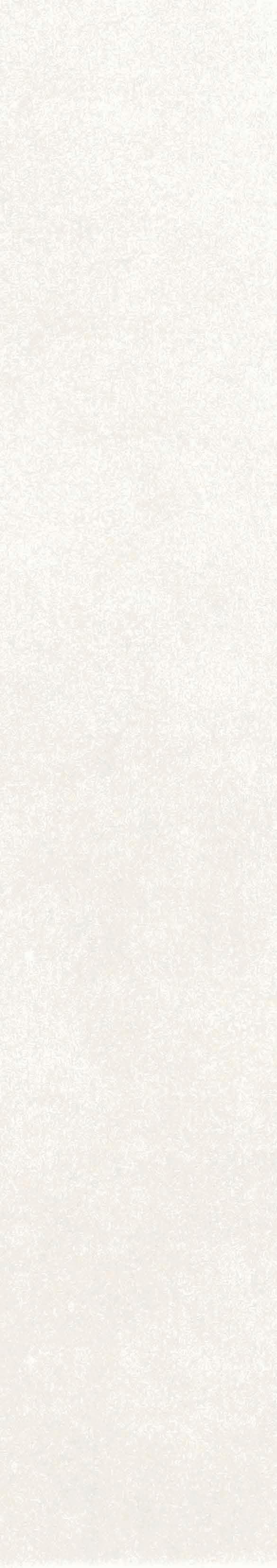
durchzuführen und damit soziale und institutionelle Innovationen genauso zu fördern, wie die Köpfe, die diese Innovationen entwickeln und leben sollen. Dazu gehören einerseits Mut und andererseits das Schaffen von sicheren Räumen, in denen Menschen und Gruppen agieren können. Dabei ist es wichtig, das Grundprinzip von Experimenten „Versuch und Irrtum“ zu stärken, um der Komplexität von gesellschaftlicher Transformation begegnen zu können.
Das geht beispielsweise im Rahmen von Planspielen oder dem Austesten neuer Regeln in einer zeitlichen und/oder räumlichen Dimension. Menschen und Gruppen erhalten so ein Gefühl für die Machbarkeit von sozialen und institutionellen Innovationen.
Wie das funktionieren kann, dazu gibt es eine Vielzahl an Beratungsliteratur und -praxis. Ich möchte den Fokus aber auf ein anderes Konzept setzen, das sich ausdrücklich die Frage stellt, wie das Neue in die Welt kommt und wie wir es schaffen können, Möglichkeitsräume zu öffnen, die uns bisher verschlossen waren, beziehungsweise die wir einfach nicht gesehen haben, und wie wir neue, ganz andere Pfade öffnen können.
Imagineering ist eine solche Methode. Sowohl der Satz „Alles könnte ganz anders sein“ als auch die Feststellung von Jörg Metelmann und Harald Welzer als Proponenten, dass es keinen Masterplan für die Moderne gibt, stehen am Anfang dieses Konzepts: „Wir brauchen daher Zukunftsbilder, die die Lebensqualität in einer nachhaltigen Moderne vorstellbar machen und die Veränderung der gegenwärtigen Praxis attraktiv und nicht abschreckend erscheinen lassen“. Ohne solche Zukunftsbilder lasse sich keine eine gestaltende Politik denken: „Wenn Politik und Zivilgesellschaft wie Kaninchen vor der Schlange ausschließlich auf die Bewahrung eines fragiler werdenden Status quo fixiert sind, verlieren sie die Fähigkeit, sich auf ein anderes Ziel zuzubewegen“.
Imagineering setzt darauf, dass unsere Vorstellungskraft die Zukunft formt. In dieser Vorstellung erschaffen wir systematisch Bilder von wünschenswerten Zukünften. Die Konzentration gilt also dem Ziel und nicht dem Pfad. Und wer den Pfad noch nicht kennt, tappt weniger in die Falle sich auf ausgetrampelten Pfaden wiederzufinden.
Eine Handvoll Meinungen, zitiert aus anderen Medien
W
er Subventionen sät, wird nicht Dankbarkeit, sondern wachsende Ansprüche ernten.
Claudia Wirz, Publizistin, in der „NZZ“.
Unerbittliche Rechthaberei und Ignoranz sind zur inflationären Währung der politischen Kommunikation geworden.
Hans Bachmann, Kommunikationsexperte, in der „Presse“.
Und gerade, weil die Mehrheit vor allem das tut, was die anderen tun, können ein paar wenige Engagierte einen regelrechten Lawineneffekt auslösen.
Sibylle Anderl und Ulrich Schnabel, Wissenschafts-Journalisten, in der „Zeit“.
Wer genau hinschaut, der sieht es gleich: Überall laufen Leute herum, die sich jeden Morgen fürs Geschäft verkleiden, für die Rolle, die sie dort spielen. Wolf Lotter, Kolumnist, im „Profil“.
Heute haben die Menschen so viele Veränderungen erlebt, auch im Privaten, dass sie keine Enthusiasten der Veränderung mehr sein können.
Wilhelm Schmid, Philosoph, im „Spiegel“.
Für Millionen Menschen empfiehlt sich intensives Senffasten, dann haben sie bis zum Fest der Auferstehung des Herrn nichts mehr, was sie auf sozialen Plattformen und in Leserkommentarspalten dazugeben können.
Hans Zippert, Satiriker, in der „Welt“.
I
ch sehe hier einen Mangel in unserer politischen Kultur, dass sich niemand zu sagen traut: Meine Lieben, Ihr seid prinzipiell für Euch selbst verantwortlich.
Udo Kaubek, Unternehmer, in der „Presse am Sonntag“.
Die offene Gesellschaft braucht Menschen, die Freiheit wollen. Aber Staat und Erziehung fördern Konformität.
Giuseppe Gracia, Schriftsteller, in der „NZZ“.

Zur Person
HANS RUSINEK
* 1989 forscht, berät und publiziert zum Wandel der Arbeitswelt. Er forscht an der Universität St. Gallen und ist Fellow im ThinkTank30 des Club of Rome. Bis 2020 war er Associate Strategy Director und erster Mitarbeiter der Purpose-Beratung der Boston Consulting Group, BrightHouse. Seine Essays zu Wirtschaft und Gesellschaft erscheinen etwa in „BrandEins“, „Capital“, „Die Zeit“, oder „Deutschlandfunk“.
Hans Rusinek studierte VWL, Philosophie und Politik an der London School of Economics und in Bayreuth, sowie Design Thinking in Potsdam.

Der Arbeitsforscher Hans Rusinek (34) sagt im Interview, dass unser Umgang mit Zeit selbst- und weltzerstörerisch ist. Dem Berater und Publizisten zufolge sind Umweltkrise und Erschöpfungskrise in der Arbeit miteinander verbunden: „Wir verwechseln Produktivität mit Gehetztheit, mit diesem rasenden Stillstand, der uns davon abhält, Entscheidendes zu hinterfragen und anders zu machen.“
Von Andreas DünserAlles wird hektischer. Und immer mehr Menschen haben das Gefühl, keine Zeit mehr zu haben. Das aber hat Ihnen zufolge, Herr Rusinek, fatale Folgen.
Wir leben in einer Welt, in der wir einiges hinterfragen sollten. Aber diese Gehetztheit hält uns davon ab. Man braucht Raum und Zeit, um Dinge zu hinterfragen. Verantwortung ist eine zeitintensive Praktik. Zeit ist die Voraussetzung für sämtliche Handlungen, die uns in eine enkeltaugliche Zukunft bringen könnten.
Sie schreiben, dass es in dieser komplexen Welt nicht die eine Lösung für die Klimakrise gibt. Aber wenn sie einen Punkt nennen könnten, „von dem aus sich die Welt in tatsächlich bessere Bahnen lenken ließe“, dann wäre das – so sagen Sie – unser Umgang mit Zeit.
Es gibt nichts, an dem man unsere toxische Arbeitskultur und unser umweltschädliches Dogma in der Arbeitswelt so unmittelbar und direkt erkennen kann wie an unserem Umgang mit Zeit. Zeitnot und Gehetze sind selbst- und weltzerstörerisch: In dem Ausmaß, in dem wir Ressourcen abbauen und der Welt keine Möglichkeit mehr zur Regeneration geben, bauen wir auch unsere eigenen körperlichen Ressourcen ab. So sind Umweltkrise und Erschöpfungskrise in der Arbeit miteinander verbunden.
Und doch gilt derjenige als beruflich erfolgreich, der ständig arbeitet und außerhalb der Arbeit kaum Zeit hat.
In unserer Kultur der Gehetztheit gelten Menschen, die nicht gehetzt wirken, als suspekt, während Menschen, die ständig am Limit sind, in bestimmter Art und Weise überlegen wirken. Aber warum ist das so? Warum finden wir einen randvollen Kalender so erstrebenswert?
Wie könnte eine Antwort lauten?
Es ist ein menschliches Bedürfnis, einen Unterschied machen zu wollen. Das Schlimmste, was viele Menschen erleben können, ist offenbar, kein Meeting, keinen Termin zu haben. Denn das heißt wohl: Nicht gefragt zu werden, nicht gebraucht zu werden.
Diese Gehetztheit wird einem aber auch von außen aufgezwungen, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass viele kulturelle Prozesse von innen und von außen ineinandergreifen. Ein Teil wird einem sicherlich von außen aufgetragen, etwa über den Leadership-Mythos, demzufolge ein erfolgreicher CEO bereits in aller Frühe anfängt zu arbeiten. Wäre ich CEO, würde ich in jedem Interview sagen, dass man bereits um vier Uhr aufstehen muss. Damit würde ich dafür sorgen, dass meine Konkurrenz komplett überfordert und übernächtigt ist (lacht). Ernster gesprochen: Gehetztheit in Organisationen führt rein wirtschaftlich zu einer schlechteren Performance. Die Qualität unserer Arbeit leidet unter unserer Gehetztheit. Aber wir meinen, wir bräuchten keine Erholung, wir müssten uns von unserem Körper nichts sagen lassen, könnten rund um die Uhr wie eine Maschine funktionieren. Nur, dass uns das ans Limit bringt.
Ihnen zufolge zeigt sich diese Entgrenzung nicht nur im Umgang des Menschen mit sich selbst, sondern auch im Umgang des Menschen mit der Natur.
Ja. Wir sehen und denken die Wirtschaftswelt als große Maschine, in der Organisationen, Führungskräfte und untergeordnet Mitarbeiter wie Maschinen funktionieren, rund um die Uhr. Aber diese Maschinen-Metaphorik passt nicht. Denn der Mensch ist nicht nur Kulturwesen, er ist eben auch Naturwesen. Das Kulturwesen Mensch beherrscht die komplexe Mathematik, entwickelt die Künstliche Intelligenz, baut Smartphones. Aber das Naturwesen Mensch ist sterblich, verletzlich, braucht Regeneration, braucht Zeit und Gelassenheit. Es ist eine Zweiseitigkeit, eine Zweigesichtigkeit. Dass wir das eine zu sehr verdrängen, das ist das Dilemma. In diesem Maschinenverständnis ist alles entgrenzt. Wir verwechseln Produktivität mit Gehetztheit, mit diesem rasenden Stillstand, der uns davon abhält, Entscheidendes zu hinterfragen und anders zu machen.
Bei all dem Gehetztsein verlieren wir also den Blick auf das Wesentliche?
Der Zweifel ist eine wichtige menschliche Errungenschaft. Doch „gehetzt zweifeln“ ist ein Widerspruch in sich. Wir nehmen uns nicht die Zeit, uns zu fragen, was unser Tun eigentlich tut, wie das der Philosoph Michel Foucault einmal so schön gesagt hat. Und damit können wir keinen Abstand zu diesen Praktiken gewinnen, die uns und unsere Welt an den Rand bringen. Das ist eines der Grundprobleme: Dieser Abstand, der zur Reflexion so notwendig wäre, wird weder von der Arbeitswelt noch in der Politik wertgeschätzt. Wir sehen das doch ständig: Wird ein Politiker oder ein CEO etwas gefragt, dann muss er auf alles eine Antwort haben, und wie aus der Pistole geschossen muss diese Antwort kommen. Würde da jemand sagen, er müsse zuerst nachdenken, würde ihm das sofort als Schwäche ausgelegt. Und so reflexionsarm ist dann eben auch die Politik und die Wirtschaft.
Weil der Ausdruck suggeriert, dass wir ein Privatleben und ein Arbeitsleben haben. Natürlich stimmt das ein Stück weit, aber es lässt vollkommen außer Acht, dass ich zu Hause und am Arbeitsplatz der gleiche Mensch bin. Ich hole mir in der Arbeit mein Einkommen, und in meiner Freizeit alles, was mir Selbstwirksamkeit und Selbstwert gibt? Das ist ein Ablasshandel, der nicht funktioniert. Es lässt sich nicht zwischen dem monetären Einkommen und dem psychologische Einkommen trennen. Man braucht auch Sinn in der Arbeit. Der Mensch, der in der Arbeit keine Anerkennung erfährt, ist davon auch nach Feierabend negativ geprägt. Die Krise der Arbeit und die Krise der Demokratie gehen da Hand in Hand …
Inwiefern?
„Es wird schwer, nach Feierabend ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.“
In der Arbeitswelt, die einen Großteil unserer Lebenswelt füllt, verkümmern unsere demokratischen Fähigkeiten. Axel Honneth, ein Philosoph der Frankfurter Schule, hat das wunderbare Buch „Der arbeitende Souverän“ geschrieben. Honneth zeigt, dass derjenige, dem in der Arbeit nicht der Eindruck vermittelt wird, dass sich der Austausch von Argumenten lohnt, auch kein guter Souverän im demokratischen Sinne ist. Demokratie ist nicht, nur alle paar Jahre zu wählen, Demokratie ist die ständige Teilnahme an öffentlichen Diskursen. Demokratie sollte uns durch die gesamte Gesellschaft begleiten. Man sollte die Politik nicht den Politikern überlassen, so könnte man das auch sagen.
Sie schreiben: „Eine besser funktionierende Arbeitswelt ist zentrale Voraussetzung für ein demokratisches Bewältigen der Klimakrise.“ Wir fragen: warum?
wir nur für das einen Schutzinstinkt, das wir kennen. Das Namenlose ist mit dem Fluch des Vergessenwerdens belegt. Und tragischerweise ist es so, dass an Orten, die am meisten von der Natur entfernt sind, die Entscheidungen mit den größten Folgen für sie getroffen werden.
Sie konstatieren mit Blick auf die gegenwärtigen, multiplen Krisen: „Wir befinden uns gerade nicht in einer großen Enttäuschung, sondern in einer Ent-Täuschung.“
Ich berate viele Organisationen, spreche oft mit Vorständen. Und höre oftmals: „Warum ist denn die Welt auf einmal so in Unordnung geraten?“ Ich sage dann immer: „Wir haben nur zu lange weggeschaut.“ Wir haben uns zu lange eingeredet, dass die Welt der Wirtschaft und die Welt der Arbeit von der Welt der Natur und von der Welt der demokratischen Legitimität komplett zu trennen wären. Wir haben uns zu lange eingeredet, dass Unternehmen isolierte Gewinnmaximierungsmaschinen sind, die sich mit nichts anderem als mit Gewinnmaximierung auseinandersetzen müssen. All diese Krisen befreien uns von dieser Täuschung. Wir sind dem Wortlaut entsprechend ent-täuscht worden. Doch sind Krisen immer auch Lernmöglichkeiten. Das ist das Rationalisierende in Krisen. Noch eines …
Ja, bitte?
Es gibt vom Schauspieler Nicholas Ofczarek den schönen Satz, er gehöre nicht zu denen, die sofort zu allem eine Meinung haben müssen.
Der bringt das wunderbar auf den Punkt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. In dieser Welt, die von sozialen Medien dominiert ist, ist ständig die Rede von Haltung. Haltung soll man zeigen, für dieses, für jenes. Sich manchmal auch einer Haltung zu verweigern, und zuerst nachzudenken, das würde uns ganz gut stehen. Statt von der einen Hysterie gleich wieder in die nächste zu kippen …
Apropos. Sie sagen, dass Sie der Ausdruck der Work-Life-Balance immer schon irritiert habe. Warum?
Die Arbeitswelt ist ein extrem wichtiger Kitt für unsere Gesellschaft. Und die Arbeitswelt ist nun mal die Welt, mit der wir diesen Planeten abarbeiten. Das heißt, wir müssen die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch am Arbeitsplatz reflektieren. Denn es wird schwer, nach Feierabend ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.
Ihr Buch regt an sehr vielen Stellen zum Innehalten, zum Nachdenken an. Etwa, wenn Sie schreiben, dass die meisten Menschen Automarken, sogar Automodelle unterscheiden können, aber im Wald kaum einen Baum kennen. Was sagt uns das? Zum einen ist das autobiografisch und selbsttherapeutisch. Ich kann Automodelle besser unterscheiden als Bäume. Aber da es auch anderen so gehen wird, sagt uns das, dass wir ein Bildungsproblem haben. Wir glauben, wir könnten unserer Verantwortung für die Umwelt mit sehr abstrakten Maßnahmen gerecht werden, etwa mit Klimadiplomatie oder mit CSR-Broschüren. Dabei entwickeln
Große gesellschaftliche Errungenschaften sind immer erst durch Krisen entstanden. Und wir stehen heute endlich vor Irritationen, die groß genug sind für einen Bedeutungswandel, die groß genug sind, um Praktiken des kritischen und produktiven Hinterfragens zu verankern. Irritationen können dazu führen, dass sich die Menschen selbst bessere Fragen stellen und dadurch bessere Antworten bekommen. Die Zukunft der Arbeit wird die Arbeit an der Zukunft. Entscheidend ist, dass man sich Sinnfragen stellt. Etwa, wie man Sinn in seine Arbeit bekommt. Aber Vorsicht: Wir erleben Sinn nur in bestimmten Momenten. Sinn ist ein sehr flüchtiger Gast. Er kommt und geht. Sinnsuchen ist okay, schlimm ist’s nur, wenn man meint, ihn dauerhaft gefunden zu haben.
Sie wollen im Buch irritieren, zum Nachdenken anregen. Ließe sich abschließend eine Frage stellen, über die es sich nachzudenken lohnt?
Ich glaube, dass wir – wenn es um Gehetztheit, aber auch um andere Pathologien geht – zu stark von der Angst geprägt sind, negativ aufzufallen, dass wir deshalb allerhand Unsinn tolerieren und mitmachen. Meine Frage zum Abschluss also: Was würden Sie heute tun, wenn Sie keine Angst hätten?
Vielen Dank für das Gespräch!
Lesetipp!
Hans Rusinek, „Work Survive Balance – Warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist“, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2023




Einen Monat vor den Landtagswahlen im Oktober 1949 veröffentlichte der damalige Landeshauptmann Ulrich Ilg im „Vorarlberger Volksblatt“, der Tageszeitung der Volkspartei, seine „nüchterne Überlegungen vor den Wahlen“. Bereinigt um die damals aktuellen politischen Themen und bereinigt um die Wahlwerbung für seine ÖVP ließen sich Ilgs Worte auch heute noch als Appell an die gesamte Wählerschaft lesen; vor allem angesichts des heurigen „Superwahljahres“ mit EU-Wahl, Nationalratswahl und Landtagswahl. Aber lesen Sie selbst, diese Auszüge aus Ilgs „nüchternen Überlegungen“.
Wir stehen am Beginn eines großen politischen Kräftemessens in ganz Österreich …
Dessen ungeachtet gibt es aber doch einen großen Kreis von politisch Gleichgültigen, Kurzsichtigen oder Verärgerten, die diese Tragweite nicht erfassen, oder denen alles gleichgültig ist, was über ihre tägliche Bedürfnisbefriedigung hinausgeht. An diese Kreise muss diesmal die Wahlwerbung in besonderer Weise herangetragen werden.
Ich höre jetzt schon die Stimmen: „Es muss doch ein einträgliches Geschäft sein, dass die so an ihren Posten kleben, diese Politiker, und dass sie so um die Gunst des Volkes werben.“ Solche und ähnliche Bemerkungen sind am meisten dazu angetan, dass anständige Menschen davor zurückschrecken möchten, für eine politische Tätigkeit sich herzugeben. Gott sei Dank denken nicht alle Leute so.
Es war denn auch alles eher als ein Vergnügen, in den letzten Jahren ein politisches Mandat zu bekleiden …
In Wirklichkeit geht es nicht um persönliche Liebhaberei, sondern um wichtige öffentliche Interessen und es wäre unverantwortlich, der Besetzung öffentlicher Stellen gleichgültig gegenüberzustehen. Das muss besonders jenen gesagt werden, die in Bausch und Bogen alle politischen Funktionäre verurteilen oder pauschal die politischen Parteien, welche bisher Verantwortung getragen haben, als fünftes Rad am Wagen wegwerfend behandeln.
Es ist auch sehr einfach, über politische Parteien abfällig zu urteilen. In Wirklichkeit hat bisher noch niemand den Weg gezeigt, wie man ohne solche in einer Demokratie dem öffentlichen Leben Inhalt geben kann. Auch jene, die das Wort „Parteiwirtschaft“ andauernd im Munde führen, wissen nichts Besseres zu tun, als zu den bisherigen Parteien nur noch eine neue Partei hinzuzufügen. Nach alter Erfahrung wird dadurch das Regieren aber nicht leichter gemacht. Das mögen sich alle politischen Erneuerer deutlich hinter die Ohren schreiben.
Wichtig erscheint allerdings, dass der Auswahl der Posten ein größeres Augenmerk geschenkt wird. Zum Wesen einer erfolgreichen Demokratie gehört objektive, sachliche Zusammenarbeit.
An Lügen, Beschimpfungen und Verleumdungen wird es nicht fehlen. Die unverschämtesten Behauptungen werden in Umlauf gesetzt werden, denen man wehrlos gegenübersteht. Wir können nur hoffen, dass die Leute nicht so dumm sind und auf jeden Schmarren und jede Hetzerei hineinfallen.

Wer tut, was er kann, bleibt das, was er ist.
Alex Tristan, Kabarettist
Auch unerfreulichen Erscheinungen ist ein lichter Moment zuzubilligen.
Heinz Sichrovsky, Kulturjournalist
Es muss auch dumme Menschen geben, die Evolution hat es so gewollt.
Harald Martenstein, Kolumnist
Der Brandbeschleuniger wird unsere Humorlosigkeit gewesen sein.
Franziska Zimmerer, Journalistin
Ich ertrage das Leben zur Not auch mit Wasser.
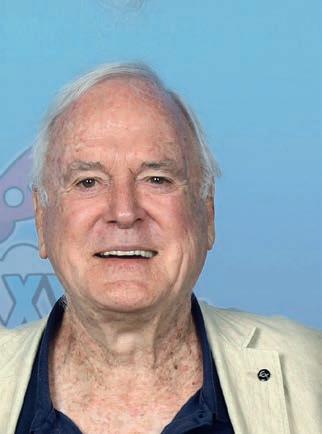
Zeitwohlstand ist nach wie vor eine Utopie.
Ich bin ja nur offiziell die böseste Frau der Schweiz. Hazel Brugger, Satirikerin
Ignoranz ist der Trotz der Dummen.
Sollten humorlose Leute Menschen mit Sinn für Humor vorschreiben dürfen, worüber
John Cleese, Schauspieler, Comedian und Monty Python-Legende
Wir reiten in die Stadt!
Wenn man sich wieder einmal ärgert, dass etwas nicht nach Plan läuft, kann man sich an den österreichischen Publizisten Wolf Lotter halten, der in einem Interview mit dieser Zeitung einmal sagte:

DIE SACHE MIT DER PEST
Der deutsche Medienwissenschaftler Russ-Mohl nennt Desinformation nonchalant eine gesellschaftliche Pest, an folgendem Beispiel hätte der Professor wohl seine beruflich helle Freude. Finanzminister Brunner hatte dieser Tage in einem Interview explizit gesagt: „Kickl als Kanzler schließe ich für mich persönlich aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Republik führen und im Ausland repräsentieren kann.“ Die Frage, ob er Chef seiner Partei werde, ließ der Minister insofern unbeantwortet, als er erklärte, man wolle bei der Wahl gut abschneiden, es sei noch lange nichts entschieden. Aber erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Die SPÖ teilte unter Bezugnahme auf das Interview in einer Aussendung mit: „Brunner schließt eine Koalition mit Kickl explizit nicht aus, sondern redet ihr das Wort.“ Und: „Brunner plant, Nehammer zu stürzen.“ Sapperlot. Jetzt gibt es nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder hat’s die rote Pressestelle nicht so mit sinnerfassendem Lesen. Oder sie missinterpretiert und desinformiert vorsätzlich. Womit wir wieder bei dem eingangs erwähnten deutschen Medienwissenschaftler wären, und der Sache mit der Pest. Der Ausdruck ist herb, aber das ist verweigertes Verstehen auch.

„Der Mensch mag Veränderung nicht, kann aber gut damit umgehen.
Er muss sich nur aufraffen.“
Florence Gaub, Zukunftsforscherin
Eine Botschaft? Aber welche?

„In keiner einzigen Version des wahren Lebens oder der Natur oder der Geistesgeschichte gibt es den Satz: ‚Es lässt sich alles planen und es kommt so, wie ich es heute sage.‘ Also: Mach aus dem, was kommt, das Beste! Gestalte es! Es ist alles drin, da gibt es eine große Bandbreite. Frei nach Clint Eastwood: Wir reiten in die Stadt, der Rest ergibt sich. Es passiert schon was. Schauen wir mal, was geht. Wenn man genug Lebenserfahrung hat, weiß man, dass die Dinge nie so kommen, wie man glaubt. Deshalb ist es wichtig, mit allem zu rechnen, das Neue freundlich anzunehmen und nicht vor allem Angst zu haben, was man nicht kennt. Dann muss man sich halt mit dem Neuen anfreunden! Nestroy sagte, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben – aber was in unserer Gesellschaft halt besonders gerne getan wird, ist, vor lauter Angst gar nichts zu tun.“
