Berlin und Bonn / Februar 2025
www.behoerdenspiegel.de


Berlin und Bonn / Februar 2025
www.behoerdenspiegel.de

Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Öffentlichen Dienstes. Wie stehen die Parteien zu Themen wie Digitalisierung, Personalaufbau und Arbeitsbedingungen im Staatsdienst? Wir haben nachgefragt – die Antworten und Konzepte der Parteien finden Sie auf auf den nachfolgenden Seiten.



Mehr Sicherheit durch zeitgemäßen Polizeidatenaustausch

„Unter Maßgabe der rechtlichen Möglichkeiten könnten auch länderübergreifend Informationen abgerufen werden“, benennt Harmsen einen entscheidenden Hoffnungsschimmer, aber auch die größte Einschränkung von P20: Die unterschiedlichen Rechtsrahmen des
föderalen Staates deuten einmal mehr auf langwierige Prozesse hin, während denen gewisse Lücken im Raster weiterhin bestehen.
(BS/Mirjam Klinger/Christian Brecht) Bereits kurz nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde öffentlich, dass der Täter kein Unbekannter war: Behörden in mindestens sechs Bundesländern beschäftigten sich mit Taleb al-Abdulmohsen. Dieser sei „durchs Raster gefallen“, betonen die Verantwortlichen bezüglich der ungewöhnlichen Radikalisierung des Täters. Ein Umstand, der über den bislang unzureichenden Informationsaustausch zwischen den deutermöglichen soll. Vom Datenhaus werde in Kürze eine minimal funktionierende Version (Minimal Viable Product, kurz MVP) bei ersten teilnehmenden Behörden in den Wirkbetrieb gehen, heißt es aus dem BMI. Davon ausgehend werde man sich auf weitere DHÖS-Funktionen sowie auf die Interims-Vorgangsbearbeitungssysteme (iVBS) fokussieren. Polizeien von Bund und Ländern sollen ihre Vorgangsdaten ins Datenhaus transferieren und die Funktionalitäten der bestehenden VBS dorthin abschichten – bis zum Jahr 2030. Dass es von der Saarbrücker Agenda bis zum jetzigen Stand acht Jahre dauerte, hat laut Lars Harmsen von der BMI-Pressestelle zwei Gründe: Technik und Finanzierung. Einerseits sei es hochkomplex, „eine Vielzahl sehr heterogener Systeme zu harmonisieren und einen zentralen Betrieb zu gewährleisten“. Andererseits sei die „Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung“ für den Aufbau der technischen Struktur unabdingbar. Das Projektbudget brachten Bund und Länder 2020 in Form des Polizei-ITFonds voran.
Prävention durch Digitalisierung Die müßige Frage, ob eine vollfunktionale polizeiliche Datenplattform den Anschlag von Magdeburg hätte verhindern können, wird aus dem BMI nachvollziehbarerweise nicht beantwortet. Ein prall gefülltes Datenhaus, in dem nicht noch viele Türen aufgrund von offenen Rechtsfragen und Datenschutzbestimmungen verschlossen sind, hätte die Wahrscheinlichkeit dafür logischerweise erhöht. Ein funktionales Datenhaus-Ökosystem könne „einen Beitrag dazu leisten, um Zusammenhänge von Einzelsachverhalten und Muster in der Tatbegehung schneller und zuverlässiger zu erkennen“, so Harmsen Verhindern lassen werden sich Gewalttaten nie, erst recht nicht, wenn sich die Täter den üblichen Erkennungsmustern entziehen. Doch der Abbau rechtlicher Hürden, klare inner- und interföderale Zuständigkeiten sowie adäquate IT-Schnittstellen würden Deutschlands wahren Sicherheitsreifegrad überhaupt erst zeigen. Es wären zudem präventive statt ausgrenzende Maßnahmen, die weniger spaltende Wirkung hätten. Engmaschigere polizeiliche Raster hätten fraglos das Potenzial, zukünftig Menschenleben zu retten.

Marode Trainingsstätten
Die Finanzmisere vieler Kommunen strahlt auf den Breitensport aus: Etlichen Schwimmbädern droht die Schließung. Seite 13

Mit einer Steuer gegen den Müll
Die „Tübinger Verpackungssteuer“ ist rechtens. Ob sie das Problem der Vermüllung löst? Die Meinungen gehen auseinander. Seite 22

Herausforderungen der Zukunft angehen
BSI-Chefin Claudia Plattner möchte den Bundes-CISO in ihrem Bundesamt ansiedeln.
Berlin und Bonn / Februar 2025

www.behoerdenspiegel.de
Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Öffentlichen Dienstes. Wie stehen die Parteien zu Themen wie Digitalisierung, Personalaufbau und Arbeitsbedingungen im Staatsdienst? Wir haben nachgefragt – die Antworten und Konzepte der Parteien finden Sie auf auf den nachfolgenden Seiten.



Mehr Sicherheit durch zeitgemäßen Polizeidatenaustausch
(BS/Mirjam Klinger/Christian Brecht) Bereits kurz nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde öffentlich, dass der Täter kein Unbekannter war: Behörden in mindestens sechs Bundesländern beschäftigten sich mit Taleb al-Abdulmohsen. Dieser sei „durchs Raster gefallen“, betonen die Verantwortlichen bezüglich der ungewöhnlichen Radikalisierung des Täters. Ein Umstand, der über den bislang unzureichenden Informationsaustausch zwischen den deutschen Sicherheitsbehörden nicht hinwegtäuschen kann.
Die Ursachenforschung nahm nach dem Attentat unverzüglich den öffentlichen Raum ein. Wo passierten die Fehler und wer hat sie gemacht? Am 30. Dezember tagte der Innenausschuss des Bundestages, um sich über den Ermittlungsstand zu informieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach davon, „jeden Stein“ umdrehen zu wollen: „Alle Hintergründe müssen gründlich und genauestens ermittelt werden.“ Das Kernproblem laut der Bundesinnenministerin: Der Täter von Magdeburg konnte keiner üblichen Gefährderkategorie wie Islamist, Rechts- oder Linksextremist zugeordnet werden.
Strukturelle Probleme
Der 50-jährige Mann war den Behörden dennoch bekannt: In den Jahren vor dem Attentat gab es 14 Ermittlungsverfahren gegen ihn, die meisten wurden eingestellt. Zudem erstattete er selbst 18 Anzeigen – vor allem gegen einen Kölner Flüchtlingshilfeverein. Diese Informationen fanden sich in einer vertraulichen Aufstellung des Bundeskriminalamts (BKA), die dem Innenausschuss vorgelegt wurde. Trotz dieser Vorgeschichte schien bei den beteiligten Behörden niemand gehandelt zu haben – ein Problem, das auch auf Kommunikationsdefizite zurückzuführen ist.
Laut Eycke Körner, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Sachsen-Anhalt, erschweren
vor allem strukturelle und technische Hindernisse den Informationsfluss zwischen Behörden erheblich. „Es braucht einheitliche Kommunikationsstandards und Schnittstellen sowie klare Zuständigkeitsregeln, um in Krisensituationen effizient zu handeln“, sagte Körner gegenüber dem Behörden Spiegel. Ein weiteres Hindernis für die Effizienz in Krisensituationen sei die föderale Struktur Deutschlands. Unterschiedliche gesetzliche Regelungen auf Bundes- und Landesebene behinderten nicht nur die Abstimmung zwischen den Sicherheitsbehörden, sondern könnten auch die Geschwindigkeit und Einheitlichkeit polizeilicher Reaktionen beeinträchtigen. Körner sieht daher die Notwendigkeit, die Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern zu harmonisieren.
Hoffnungsträger Datenhaus Informationsaustausch bedeutet heutzutage digitale Vernetzung. Um diese zu erweitern, initiierte das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) 2016 die Saarbrücker Agenda, welche „die Informationsarchitektur der Polizei“ ans digitale Zeitalter anpassen soll. Das Kernziel des aus der Agenda hervorgegangenen Projekts „Polizei 20/20“ (P20) ist ein zentraler Speicherort für polizeiliche Daten: Das Datenhaus-Ökosystem (DHÖS), das allen Polizistinnen und Polizisten Zugriff auf relevante Informationen
ermöglichen soll. Vom Datenhaus werde in Kürze eine minimal funktionierende Version (Minimal Viable Product, kurz MVP) bei ersten teilnehmenden Behörden in den Wirkbetrieb gehen, heißt es aus dem BMI. Davon ausgehend werde man sich auf weitere DHÖS-Funktionen sowie auf die Interims-Vorgangsbearbeitungssysteme (iVBS) fokussieren. Polizeien von Bund und Ländern sollen ihre Vorgangsdaten ins Datenhaus transferieren und die Funktionalitäten der bestehenden VBS dorthin abschichten – bis zum Jahr 2030.
Dass es von der Saarbrücker Agenda bis zum jetzigen Stand acht Jahre dauerte, hat laut Lars Harmsen von der BMI-Pressestelle zwei Gründe: Technik und Finanzierung. Einerseits sei es hochkomplex, „eine Vielzahl sehr heterogener Systeme zu harmonisieren und einen zentralen Betrieb zu gewährleisten“. Andererseits sei die „Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung“ für den Aufbau der technischen Struktur unabdingbar. Das Projektbudget brachten Bund und Länder 2020 in Form des Polizei-ITFonds voran.
„Unter Maßgabe der rechtlichen Möglichkeiten könnten auch länderübergreifend Informationen abgerufen werden“, benennt Harmsen einen entscheidenden Hoffnungsschimmer, aber auch die größte Einschränkung von P20: Die unterschiedlichen Rechtsrahmen des
föderalen Staates deuten einmal mehr auf langwierige Prozesse hin, während denen gewisse Lücken im Raster weiterhin bestehen.
Prävention durch Digitalisierung
Die müßige Frage, ob eine vollfunktionale polizeiliche Datenplattform den Anschlag von Magdeburg hätte verhindern können, wird aus dem BMI nachvollziehbarerweise nicht beantwortet. Ein prall gefülltes Datenhaus, in dem nicht noch viele Türen aufgrund von offenen Rechtsfragen und Datenschutzbestimmungen verschlossen sind, hätte die Wahrscheinlichkeit dafür logischerweise erhöht. Ein funktionales Datenhaus-Ökosystem könne „einen Beitrag dazu leisten, um Zusammenhänge von Einzelsachverhalten und Muster in der Tatbegehung schneller und zuverlässiger zu erkennen“, so Harmsen Verhindern lassen werden sich Gewalttaten nie, erst recht nicht, wenn sich die Täter den üblichen Erkennungsmustern entziehen. Doch der Abbau rechtlicher Hürden, klare inner- und interföderale Zuständigkeiten sowie adäquate IT-Schnittstellen würden Deutschlands wahren Sicherheitsreifegrad überhaupt erst zeigen. Es wären zudem präventive statt ausgrenzende Maßnahmen, die weniger spaltende Wirkung hätten. Engmaschigere polizeiliche Raster hätten fraglos das Potenzial, zukünftig Menschenleben zu retten.

Marode Trainingsstätten
Die Finanzmisere vieler Kommunen strahlt auf den Breitensport aus: Etlichen Schwimmbädern droht die Schließung. Seite 13

Mit einer Steuer gegen den Müll
Die „Tübinger Verpackungssteuer“ ist rechtens. Ob sie das Problem der Vermüllung löst? Die Meinungen gehen auseinander. Seite 22

Herausforderungen der Zukunft angehen
BSI-Chefin Claudia Plattner möchte den Bundes-CISO in ihrem Bundesamt ansiedeln.

23.04.2025
Abwehr, Lage und Nacharbeitung Magdeburg · Dorint
18 06 2025
„Ist die Pistole echt??“ Polizei – Kinder und Jugendliche Digitaler Polizeitag · Online
27.08.2025
Krisenresilienz der Sicherheitsbehörden Mainz · Hilton
01 10 2025
Innovationen in der Polizeiarbeit: Einsatz fortschrittlicher Technologie zur Bekämpfung von Kriminalität und Erhöhung der Sicherheit Potsdam · Dorint
27.11.2025
Drohnen zur Einsatzunterstützung München · The Westin Grand
www.polizeitage.de

Eine Veranstaltungsreihe des Behörden Spiegel und der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
TECHNOLOGIETAGE POLIZEI
Innovative Entwicklungen und anwendungsorientierte Lösungen zur Verbesserung der polizeilichen Aufgabenerledigung
07.-08 04 2025
Hotel Gude, Kassel
www.fuehrungskraefte-forum.de; Suchwort: Technologie
KLOSTER-KLAUSUR
Die digitale Transformation der Kriminalpolizei
12.-14 05 2025
Kloster Himmelspforten, Würzburg
www.fuehrungskraefte-forum.de; Suchwort: Kloster
KLOSTER-KLAUSUR
Digitale Kriminalistik
08.-10.09.2025
Kloster Drübeck, Ilsenburg im Harz
www.fuehrungskraefte-forum.de; Suchwort: Kloster


Nationale Nervosität
Teure Versprechen

Schwerpunktthema der Ausgabe

Im Vorfeld der Wahl überbieten sich die Parteien gegenseitig mit finanziellen Entlastungsversprechen S. 9
Briefwahl-Krise
Warum die Wahl 2026 in Karlsruhe entschieden wird S. 6
Von der Pike auf gelernt Sind Kommunalpolitiker die besseren Bundestagsabgeordneten?.....................S.14
Hass und Gewalt vor der Wahl
Politikerinnen und Amtsträger wenden sich an die Polizei S. 36
Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „Bundestagswahl 2025“ handelt.


Seite 2: BS/Hoffmann unter Verwendung von christianthiel.net, stock.adobe.com
Impressum
Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH. www.behoerdenspiegel.de Herausgeberin und Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll
Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt
Leiterin der Berliner Redaktion Anne Mareile Walter Leiter der Bonner Redaktion Bennet Biskup-Klawon
Aktuelles Öffentlicher Dienst Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf, Hans-Jürgen Leersch
Kommune Julian Faber, Scarlett Lüsser
Digitaler Staat Christian Brecht, Paul Schubert, Anna Ströbele Sicherheit & Verteidigung Jonas Brandstetter, Thomas Hönig, Mirjam Klinger, Lars Mahnke, Klaus Pokatzky
Sonderkorrespondenten BOS Dr. Barbara Held, Gerd Lehmann
Online-Redaktion Tanja Klement
Parlamentsredaktion Berlin
Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10
Zentraler Kontakt
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57
Tel. 0228/970 97-0
Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41
Tel. 030/55 74 12-0
Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch
Anzeigenleitung Dr. Fabian Rusch Layout Yonca Bilgi, Marvin Hoffmann, Maximilian Spuling Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin & ProGov GmbH, Bonn
Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau
Herausgeber- und Programmbeirat Uwe Proll (Vorsitz)
Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www. ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent
Für Bezugsänderungen:
Kommentare König Fußball nicht allmächtig
(BS) Nach fast zehn Jahren ist eine endgültige Entscheidung getroffen: Der Staat darf die Kosten für einen polizeilichen Mehraufwand beim Veranstalter geltend machen. Der jahrelange Rechtsstreit zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH ist nach einem Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts beendet. Streitsumme war immerhin 425.000 Euro für einen Polizeieinsatz, der der DFL in Rechnung gestellt wurde. Das Spiel war als Risikospiel eingestuft worden. Ausschlaggebend war das Bremische Gebühren- und Beitragsgesetz, das vorsieht, dass „bei Veranstalterinnen und Veranstaltern für den polizeilichen Mehraufwand bei gewinnorientierten, erfahrungsgemäß gewaltgeneigten Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Personen eine Gebühr erhoben wird, welche nach dem Mehraufwand zu berechnen ist, der aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Polizeikräfte entsteht“. Darunter fallen sog. Risikospiele. Das Problem ist nur: Risikospiele sind gesetzlich nicht definiert. Der Veranstalter entscheidet, vereinfacht gesagt, für seinen Verantwortungsbereich, sprich die Spielstätte. Die Polizei stuft das Spiel für ihren Verantwortungsbereich ein. Sie bewertet die Gesamtlage in einer Stadt. Das heißt, es kann zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Nichtsdestotrotz ist es nicht richtig, dass die Allgemeinheit auf den Kosten sitzen bleibt, die solche Spiele mit sich bringen. Natürlich zeigen sich Fanvertreter fassungslos über
das Urteil. Man sei enttäuscht, dass staatliche Aufgaben jetzt plötzlich mit einer privaten Rechnung versehen würden. Es fehle eine Instanz, die sich das Ganze von außen anschaue. Wenn man den Spieß umdreht, kann man fragen: Warum soll der Staat für ein Privatvergnügen Ressourcen bereitstellen? Natürlich sind die organisierten Fananhänger empört, da sie keine Randale machen, und verweisen auf wie auch immer definierte Kommunikationsformate, bei denen alle Beteiligten ihre Sichtweisen darlegen könnten. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Krawalle trotzdem stattfinden.
Auch der Verweis auf Präventionsprogramme hilft nicht, wenn trotzdem Steine, Flaschen oder Böller in Richtung Polizeibeamter fliegen. Der Wandel muss von den Zuschauern kommen. Und wenn nur über die Vereine finanzieller Druck ausgeübt werden kann, dann ist das ein Weg. Zudem ist es anmaßend, ein Mitspracherecht bei polizeilichen Einsatzmaßnahmen zu fordern. Die Polizei ist kein privater Sicherheitsdienstleister, den man nach Gutdünken einsetzen kann, wenn man sich danach fühlt. Außerdem werden die Dienstherren der Polizeibeamten wohl kaum Einsätze anordnen, die nicht nötig sind. Die Beamten werden auch so genügend Überstunden anhäufen und sich bei anderer Gelegenheit mit Flaschen und Böllern beworfen.
(BS) Deutschland braucht auf der Bundesebene ein Digitalministerium! Diese nicht wirklich neue Forderung wird dieser Tage häufiger und lauter denn je vorgetragen.
von Guido Gehrt
Insbesondere Digitalpolitikerinnen und -politiker, aber auch zahlreiche Vertreter der Verwaltungsdigitalisierungsszene sowie der HightechBranchenverband Bitkom haben sich hier klar positioniert. Durch die Bündelung von digitalpolitischen Themen und Kompetenzen sowie die Konzentration budgetärer Mittel soll die „digital governance“ gestärkt werden und der Prozess der digitalen Transformation von Staat und Gesellschaft effizienter und effektiver gestaltet werden. So weit, so gut. Vielleicht kurzfristig sogar das beste Signal, welches man zum Wohle auch und gerade der Ver-
waltungsdigitalisierung hierzulande geben kann – auf der Bundesebene. Doch anders als viele Länder, die international oftmals zum Vergleich herangezogen werden und als Vorbilder in Sachen Digitalisierung gelten, zeichnet sich Deutschland nicht durch zentralstaatliche Strukturen, sondern durch einen starken Föderalismus aus – insbesondere im Bereich der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Komunen. Die „Durchschlagskraft“ eines eigenen Digitalressorts beim Bund ist daher maßgeblich – wie auch der Bitkom in seinem Positionspapier zu erkennen gibt – auf eine Neuregelung der digitalpolitischen Beziehungen der drei Verwaltungsebenen angewiesen. Stichwort: Föderalismusreform III. Sicherlich ein ganz dickes Brett, welches sich aber auch mit Blick auf andere Politikbereiche – etwa die Finanzbeziehungen – in Angriff zu nehmen lohnt.
Die Forderungen der Gewerkschaften seien nicht zu finanzieren, sagte Karin Welge, Präsidentin und Verhandlungsführerin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verwies schon vor Verhandlungsstart auf die angespannte Haushaltslage. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, dass die verschiedenen Parteien am Ende der Verhandlungen eine faire Einigung erzielen werden – für Beschäftigte, Bund und Länder.
Zuschläge für belastende Jobs Verdi und der Beamtenbund DBB fordern eine Lohnsteigerung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. In besonders belastenden Jobs, etwa im Gesundheitsbereich mit Wechselschichten, soll es höhere Zuschläge geben. Vorgesehen sind zudem drei zusätzliche freie Tage sowie ein freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Auch sollen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes Arbeitszeitkonten eingerichtet werden, über die diese eigenständig verfügen können. Allein die Entgeltforderungen und die zusätzlichen freien Tage würden die Kommunen jährlich mit 14,9 Milliarden Euro belasten, rechnete VKA-Präsidentin Welge vor. Für die Tarifbeschäftigten des Bundes würden sich die Mehrkosten durch die Entgeltforderungen auf rund 1,7 Milliarden Euro belaufen, heißt es aus dem Bundesinnenministerium (BMI). Insgesamt wären die Mehrkosten für die Arbeitgeber aber weit höher. Denn die Gewerkschaften fordern eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Allein auf Bundesebene
Gewerkschaften scheitern mit Forderungen im ersten Anlauf
(BS/amw/akh) Die Auftaktrunde im Tarifstreit für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist Ende Januar in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Während die Gewerkschaften sich vom Verhandlungsauftakt enttäuscht zeigen, hält die Arbeitgeberseite die Erwartungen an den neuen Tarifvertrag für unrealistisch.
würden die Entgeltzahlungen damit um weitere 4,4 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Unabhängig von den noch zu vereinbarenden Beträgen ist davon auszugehen, dass dieser Forderung – wie in den vergangenen Jahren üblich – nachgekommen wird.
Der Staat vor dem Kollaps Dass die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde zu keinen Zugeständnissen bereit war, kommentierte der DBB folgendermaßen: Es sei nicht akzeptabel, wenn Bund und Kommunen nun zielführende Verhandlungen mit Blick auf sinkende Inflationsraten oder die maroden Kommunalfinanzen verzögerten. Dadurch werde die Attraktivität des Arbeitgebers Staat beschädigt – in einer Zeit, in der der Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um die besten Köpfe immer schärfer werde.
„Viele Kommunen befinden sich am Rande der Handlungsfähigkeit, die Beschäftigen sind überlastet; wenn nicht gehandelt wird, droht ein Kollaps“, warnte Verdi-Vorsitzender Frank Wernecke. Es reiche nicht aus, Verständnis für die starke Überlastung und die finanzielle Situation der Beschäftigten zu äußern. Wichtiger sei es, Lösungen für die Entlastung herbeizuführen und die Gehälter deutlich anzuheben.
„Wir erwarten in der zweiten Runde deutliche Fortschritte. Das wird nur möglich sein, wenn die Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.“ Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) formulierte ihr
Aufgabenzersplitterung überwinden (BS/akh) Bund, Länder und Kommunen müssen sich klar zu mehr Bündelung bekennen. Das ist ein zentraler Schritt, um lange diskutierte Überlegungen zur Reform der staatlichen Aufgabenorganisation endlich in die Tat umzusetzen.
Eine moderne, leistungsfähige und resiliente Verwaltung braucht eine zeitgemäße Aufgabenverteilung. Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) formuliert in seinem neuen Gutachten „Bündelung im Föderalstaat –zeitgemäße Aufgabenorganisation für eine leistungsfähige und resiliente Verwaltung“ Handlungsempfehlungen, wie diese gelingen kann. „Das Aufgabengeflecht des Staates ist über Jahrzehnte angewachsen und immer zersplitterter geworden – die öffentliche Verwaltung stößt an ihre Belastungs- und Leistungsgrenze“, betont Prof. Dr. Sabine Kuhlmann, stellvertretende NKR-Vorsitzende und Verwaltungswissenschaftlerin an der Universität Potsdam. Das Anfang Februar veröffentlichte Gutachten und der darin beschriebene bündelungsorientierte Reformansatz sollen sowohl bei der Neugestaltung bestehender Leistungen als auch beim Design neuer Leistungen für Entlastung sorgen. „Unsere Vorschläge sind bereits jetzt praktisch umsetzbar, da sie schrittweise angegangen werden können und wir nicht gleich die große Staatsreform fordern“, erläutert Kuhlmann
Ins Handeln kommen
Unverständnis. „Das Verhalten der Arbeitgeber war zwar vorhersehbar, dennoch ist es angesichts der Lage der Beschäftigten nicht angemessen“, erklärte Christian Ehringfeld, für die Tarifpolitik verantwortlicher stellvertretender GdP-Bundesvorsitzender. Der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke kommentierte den Verhandlungsauftakt mit den Worten: „Löhne rauf, Belastung runter: Das ist unsere Ansage. Hoch engagierte Polizeibeschäftigte werden hier einfach so ignoriert.“
Die Macht der Beschäftigten Der Verhandlungsführer des DBB, Volker Geyer, kündigte noch am Tag der gescheiterten Verhandlung Warnstreiks und Protestaktionen an. „Bund und Kommunen lassen uns keine andere Wahl“, sagte er. Schon beim Warnstreik-Auftakt vier Tage später kamen laut DBB rund 1.000 Beschäftigte in Aachen zusammen, um für mehr Geld und mehr freie Tage zu demonstrieren. Dass Proteste der Beschäftigten Wirkung zeigen, wurde bei den letzten Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen deutlich. Im April 2023 hatte es einen Rekord-Abschluss im Öffentlichen Dienst gegeben. Dem gingen besonders zähe
Gespräche voraus – begleitet von vielen Streikaktionen. Erst nach einem Schlichtungsverfahren konnten sich die verhandelnden Parteien in der vierten Tarifrunde auf einen Kompromiss einigen.
Laut Verdi sind von den aktuellen Verhandlungen mehr als 2,5 Millionen Personen direkt oder indirekt betroffen. Das BMI spricht von 2,6 Millionen Beschäftigten bei den kommunalen Arbeitgebern und 132.000 Tarifbeschäftigten des Bundes. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 17. und 18. Februar in Potsdam geplant. Die dritte Runde ist auf den 14. bis 16. März terminiert. Sollte sich bis dahin keine Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite finden, bleibt wieder nur das Schlichtungsverfahren.
EntgeltgruppeErfahrungsstufe 123456
EG15440,32469,11501,23545,08590,18619,86
EG14400,31426,38460,43498,21540,33570,57
EG13370,30398,88431,41466,72508,28530,84
EG12333,63366,51404,93447,57497,60521,34
EG11322,59352,83381,25412,08454,28478,02
EG10311,63335,32362,26391,48424,01434,69
EG9c303,03324,17347,15371,92398,55417,64
EG9b285,35305,16317,60354,39376,19401,45
EG9a275,92292,99309,60346,55354,91376,26
EG8262,52278,93290,29301,64313,82319,67
EG7247,62266,53277,79289,16299,88305,64
EG6243,36258,92269,84280,63291,24296,64
EG5234,32249,41259,61270,40280,44285,62
EG4224,21239,48252,30260,28268,26272,93
EG3221,02237,44241,44250,58257,43263,71
EG2206,57222,74226,77232,53245,17258,40 EG1188,44191,11194,44197,55205,56
Geforderte Steigerung der monatlichen Entgelte für Tarifbeschäftigte der Kommunen um acht Prozent (Angaben in Euro). Die markierten Entgeltgruppen und -stufen profitieren von der Mindesterhöhung. Tabelle: BS/eigene Berechnung unter Verwendung der Entgelttabelle VKA ab März 2024 des DBB
Aktuelles aus dem Arbeitsrecht
Eine Kolumne von Ralph Heiermann
Recht zu bekommen ist nicht immer einfach. Lässt sich ein Streit nicht vermeiden und landet dieser vor Gericht, erhoffen sich beide Seiten eine schnelle Entscheidung und einen günstigen Ausgang. Dieser hängt von der Rechtslage ab. Die Schnelligkeit der Entscheidung hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Nur schnelles Recht ist gutes Recht und sichert die Akzeptanz der Justiz und des Rechtsstaates insgesamt. Kämen gerichtliche Entscheidungen zu spät, müsste man befürchten, das andere, nicht rechtsstaatliche, Wege gesucht würden, um Streitigkeiten zu beenden.
Das vollständige Gutachten kann auf der Homepage des NKR eingesehen werden.
Anhand von drei Verwaltungsleistungen – dem Antrag und der Erteilung einer Fahrerlaubnis, der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und der Einkommensprüfung – zeigt das Gutachten auf, wie einzelne Prozessschritte stärker zusammengefasst werden können. „Für uns ist klar: Es muss überall gebündelt und vereinfacht werden, wo möglich“, fasst NKR-Mitglied Dorothea Störr-Ritter zusammen. Gemeint sind damit sowohl funktionale als auch fachliche und räumliche Bündelungen. Die Vorschläge trügen dazu bei, die kommunale Ebene bei der Bewältigung der Personal-, Leistungs- und Finanzierungsprobleme effektiv zu entlasten und stärkten damit die subsidiäre Aufgabenerfüllung, so die Landrätin a. D. „Unser Ziel ist es, der nächsten Bundesregierung neue, realistische Wege aufzuzeigen, wie sie diese Transformation steuern, organisieren und zeitnah umsetzen kann“, erläutert NKR-Mitglied Malte Spitz Er appelliert daran, endlich aus der Phase der Problem- und Lösungsbeschreibung herauszukommen und notwendige Reformen jetzt anzugehen. Empfehlungen zur technischen, aber auch zur organisatorischen Umsetzung der Reform seien im Gutachten vorhanden. „Wichtig ist ein gemeinsamer Wille aller Ebenen zur Aufgabenbündelung.“
Die Zeit drängt Vor bald 15 Jahren hat der Gesetzgeber durch eine Ergänzung des Gerichtsverfassungsgesetzes für Prozessparteien die Möglichkeit eingeführt, durch eine Verzögerungsrüge das Gericht zur Eile zu mahnen, wenn ein Gerichtsverfahren unangemessen lange dauert. Führt dies nicht zu einer Beschleunigung, kann durch eine Klage erreicht werden, dass die Justiz selbst zur Zahlung einer Entschädigung für eine unangemessene Dauer des Verfahrens verurteilt wird. Die Wirksamkeit von Verzögerungsrüge und Entschädigungsanspruch für die Beschleunigung von Verfahren ist umstritten. So ist schon nicht eindeutig zu bestimmen, wann ein Verfahren unangemessen lange dauert. Allerdings dürfte es keine Richterin und keinen Richter unbeeindruckt lassen, wenn eine Verzögerungsrüge durch eine der Prozessparteien erhoben wird und diese Verzögerungsrüge nicht offensichtlich unbegründet erscheint.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in einem Urteil vom 14. November 2024 (Aktenzeichen 5 C 7.23), zu dem bisher nur die Pressemitteilung vorliegt, mit der Frage befasst, ob auch ein Personalrat in einem personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren einen Anspruch auf Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer geltend machen kann. Die Verfahren, wegen derer der Personalrat Entschädigung verlangte, hatten in der ersten Instanz 39, 37 und 22 Monate gedauert. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch die klageabweisenden Entscheidungen der beiden Vorinstanzen bestätigt und festgestellt, dass der Personalrat als sonstige öffentliche Stelle im Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes anzusehen sei, der kein Entschädigungsanspruch gegen den Staat zustehe. Denn der Personalrat ist rechtlich nicht verselbstständigter Bestandteil der zur öffentlichen Verwaltung gehörenden Dienststelle, bei der er gebildet ist und gehört damit selbst zum staatlichen Bereich. Seine Mitbestimmungsrechte, die durch eine unangemessene Dauer des Verfahrens beeinträchtigt werden könnten, stellen keine Selbstverwaltungsrechte dar. Auch bei der Interessenvertretung der Beschäftigten sind die Personalvertretungen, so das Bundes-




verwaltungsgericht, maßgeblich an der Ausübung staatlicher Hoheitsbefugnisse beteiligt. Dem Staat kann jedoch kein Anspruch gegen sich selbst zustehen.
Die richtigen Mittel
Das Bundesverwaltungsgericht hat eine bisher höchstrichterlich nicht geklärte Frage abschließend entschieden. Für die Personalvertretungen in Bund, Ländern und Kommunen folgt daraus, dass sie zwar in Fällen überlanger Verfahrensdauer die Verzögerung nicht mit der Verzögerungsrüge nach dem Gerichtsverfassungsgesetz angreifen und keine Entschädigung beanspruchen können. Sie können zur Beschleunigung der Beilegung von Streitigkeiten über ihre Beteiligungsrechte aber sehr wohl andere wirksame Mittel nutzen. Insbesondere in Fällen, in denen durch eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse die Rechtsverwirklichung in Gefahr ist, bietet sich die Einleitung von vorläufigen Rechtsschutzverfahren an. Diese können neben dem eigentlichen Beschlussverfahren vor dem Verwaltungsgericht für eine schnelle gerichtliche Klärung sorgen, die sogar im Anschluss die Fortführung des Verfahrens in der Hauptsache überflüssig machen kann. Die Durchführung solcher Eilverfahren sollte deshalb immer erwogen und geprüft werden.




Dr. Ralph Heiermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht und besitzt eine Kanzlei in Hannover. Er berichtet an dieser Stelle regelmäßig über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Verwaltung und die aktuelle Rechtsprechung. Foto: BS/privat
Die Bundestagswahl entscheidet nicht nur über die zukünftige Regierung, sondern auch über die Weichenstellung für den Öffentlichen Dienst. Welche Ansätze verfolgen die Parteien bei der Entbürokratisierung oder soll der Staatsaperat in Zukunft weiter wachsen?
Partei
23. FEBRUAR 2025






Brauchen wir für die Erfüllung staatlicher Aufgaben zukünftig mehr oder weniger Personal?
„Unser Staat hat die Kernaufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen. Dazu leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst täglich einen wichtigen Beitrag. Mit ihrer Expertise, ihrer Erfahrung und ihrem Engagement tragen sie ganz wesentlich dazu bei, dass unser Staat und unsere Verwaltung funktionieren. Die Wirklichkeit zeigt jedoch auch: Viel zu oft ist der Staat mit sich selbst beschäftigt und verheddert sich im Wirrwarr der Regeln, die er selbst erschaffen hat. Unser Ziel ist ein Staat, der wieder handlungsfähiger und schneller wird. Dafür wollen wir langfristig schlankere Strukturen.“

„Die SPD will einen starken Öffentlichen Dienst, modern und digital, der als guter Arbeitgeber beispielhaft vorangeht. Wir möchten den Staat als Arbeitgeber attraktiver gestalten – durch flächendeckendes Homeoffice, Job-Sharing und flexible Teilzeitmodelle im Öffentlichen Dienst. Unser Ziel ist ein Arbeitgeber, der Fachkräfte ausbildet, gewinnt und langfristig bindet sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessert. Lebenslanges Lernen soll die Basis für einen leistungsfähigen Öffentlichen Dienst bilden. Dafür setzen wir auf gezielte Weiterbildung und Qualifizierung, um die Kompetenzen der Fachkräfte weiter auszubauen. Befristete Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst wollen wir deutlich reduzieren. Unbefristete Stellen sollen stattdessen zur Regel werden, um Sicherheit und Perspektiven für die Beschäftigten zu gewährleisten.“


„Die föderale Struktur und Verwaltung in Deutschland hat sich bewährt, aber sie braucht ein Update, das Effizienz und Bürgerfreundlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Eine Generalinventur ist dafür der erste notwendige Schritt. Es müssen alle föderalen Zuständigkeiten und Verwaltungsprozesse einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Zu viele Behörden auf Bundes- und Landesebene sowie in den Kommunen überschneiden sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Generalinventur muss von einem klaren politischen Willen getragen sein, die Effizienz und Handlungsfähigkeit des Staates zu verbessern, und mit einer Föderalismusreform abgeschlossen werden. Für uns haben Reformen im Finanz- und im Bildungsbereich, bei der Inneren Sicherheit, dem Bevölkerungs- und Katstrophenschutz, der Migration und der Digitalisierung Priorität.“

„Durch Modernisierung und Automatisierung, auch durch den Einsatz von KI, kann der Arbeitsaufwand für Verwaltungsprozesse reduziert werden. Dies würde nicht nur die Effizienz unserer Verwaltung steigern, sondern auch dazu beitragen, die Ministerialverwaltung des Bundes zu verkleinern und die Umsetzungsverantwortung der nachgeordneten Bundesbehörden zu stärken. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und unbesetzter Stellen ist es dringend nötig, dass wir unsere Ressourcen effizient einsetzen und unsere Verwaltungsprozesse anpassen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“


„Die vergangenen Jahre haben eindrücklich gezeigt: der Öffentliche Dienst ist nicht krisenresilient, nur mit großem Engagement der Beschäftigten und der Rückkehr von Beschäftigten aus dem Ruhestand konnten große Herausforderungen wie die Krise der Aufnahme schutzsuchender Menschen und die COVID19-Pandemie bewältigt werden. Nötige Investitionen in die öffentliche Infrastruktur können nicht umgesetzt werden, weil überall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, welche die geplanten Maßnahmen umsetzen können. Also ganz klar: wir brauchen wieder mehr Personal im Öffentlichen Dienst.“


Was sollten die zentralen Maßnahmen des Bürokratieabbaus sein?
„Die Bürokratie in unserem Land braucht endlich ein spürbares Stoppschild. Wir wollen damit starten, dass jedes Ministerium sofort eigene Vorschläge für ein jährliches Gesetz zum Bürokratieabbau vorlegt. Das soll jeder Minister bei seiner Amtseinführung als Hausaufgabe mitbekommen. Es geht um Erleichterungen bei Aufbewahrungsfristen, Dokumentations-, Melde- und Statistikpflichten, Erwerbstätigkeit im europäischen Ausland oder der Pflicht zur Bestellung von Betriebsbeauftragten. Zudem stellen wir sämtliche nationale Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes auf den Prüfstand, insbesondere auch bürokratische Pflichten zur Abwärmenutzung sowie für Rechenzentren.“
„Ein effektiver Bürokratieabbau ist nur möglich, wenn diejenigen einbezogen werden, die ihn erleben und für die Bürokratie verantwortlich sind. Deshalb werden wir nach der Regierungsbildung Wirtschaft, Länder und Kommunen zu einem Praxisgipfel einladen, um weitere notwendige Maßnahmen konkret zu erfassen und zu vereinbaren. Zudem führen wir eine Genehmigungsfiktion ein, bei der Anträge automatisch genehmigt werden, wenn die Behörde nicht innerhalb einer festgelegten Frist reagiert. Das sorgt für mehr Planungssicherheit bei Bau- und Investitionsprojekten.“
„Wir Freie Demokraten fordern ein sofortiges dreijähriges Moratorium für Bürokratie: In dieser Zeit dürfen keine neuen Regularien beschlossen werden, die für Unternehmen zu neuen bürokratischen Belastungen führen, es sei denn, sie sind vorher in gleichem Umfang abgebaut worden. Wir wollen ein bürokratiefreies Jahr für Betriebe, in dem sie keine Berichtspflichten erfüllen müssen. Es muss jedes Jahr ein Jahresbürokratieentlastungsgesetz geben, um einen Abbau-Pfad für überflüssige Regelungen zu schaffen. Mit einer Bürokratiebremse im Grundgesetz verankern wir den Bürokratieabbau in unserer Verfassung. Wir wollen sicherstellen, den Erfüllungsaufwand für Betriebe im Saldo um mindestens sechs Milliarden Euro pro Legislaturperiode zu reduzieren.“
"Ein wesentliches Mittel für den Bürokratieabbau ist die Digitalisierung der Verwaltung. Es ist unabdingbar, dass wir die Verwaltung so aufstellen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen mit dem Staat einfach und effizient kommunizieren können. Um dieses Ziel zu erreichen, planen wir gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die Einführung der Deutschland-App. Diese App wird schrittweise alle staatlichen Verwaltungsangebote sicher, barrierefrei und anwendungsfreundlich gebündelt zur Verfügung stellen. Im Hintergrund der App bauen wir eine moderne, modulare und standardisierte IT-Architektur auf, bei der die Verwaltungsdomänen von Bund, Ländern und Kommunen sinnvoll ineinandergreifen. Damit schaffen wir nicht nur eine effiziente Verwaltung, sondern auch eine nutzerfreundliche Oberfläche für die Bürgerinnen und Bürger."
„Die Rückholung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wird eine wichtige Maßnahme sein. Dadurch können Doppelstrukturen der Verwaltung in den Privatunternehmen der Daseinsvorsorge und ihrer Beaufsichtigung und Kontrolle durch die zuständigen Behörden abgebaut werden. Durch die Zusammenführung von Bürgergeld und den Kosten der Unterkunft in eine neue Mindestsicherung entfällt die kommunale Verwaltung der KdU.“
Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.
Behörden Spiegel: Ein großes Projekt des BfJ ist die Übermittlung des Führungszeugnisses. Dieses soll in Zukunft nicht nur digital beantragt, sondern auch digital übermittelt werden können. Wie ist hier der aktuelle Stand?
Veronika Keller-Engels: Das Führungszeugnis wird sehr häufig benötigt. Wir haben hier einen täglichen Output von ungefähr 20.000 Exemplaren. Dieser Vorgang erfolgt überwiegend vollautomatisiert. Bisher ist es so, dass das Führungszeugnis digital beantragt werden kann, aber immer noch auf Papier ausgedruckt wird. Der Grund ist schlicht die Fälschungssicherheit. Wir verwenden spezielles Papier, welches auf Fälschung überprüft werden kann. Es kommt immer wieder vor, dass Arbeitgeber uns Führungszeugnisse schicken, um diese zu überprüfen, denn das Dokument ist ein beliebter Fälschungsgegenstand. Da seitens der Bürgerinnen und Bürger ein großes Interesse daran besteht, das Führungszeugnis digital zu erhalten, haben wir mit dem Bundesministerium der Justiz ein entsprechendes IT-Projekt gestartet, um den kompletten Prozess inklusive der Überprüfbarkeit der Echtheit zu digitalisieren. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Jahres 2026 das digitale Führungszeugnis auf den Markt bringen können.
Behörden Spiegel: Aufgrund der Bundestagswahl ist die Bekämpfung von Hasskriminalität ein hochaktuelles Thema. Wie arbeiten Sie hier mit anderen Behörden zusammen?
Keller-Engels: Unsere Tätigkeit in diesem Bereich hat sich geändert. Ursprünglich hat das BfJ auf der Grundlage des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes Pionierarbeit bei der Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet geleistet. Durch den Digital Services Act der EU kam es hier zu einer Zuständigkeitsverschiebung. So haben wir einen Großteil unserer Aufgaben an die Bundesnetzagentur abgegeben, die als Digital Services Coordinator die Plattformaufsicht übernommen hat. Die Aufsicht über die sehr großen Online-Plattformen hat die EU-Kommission übernommen. Wir stehen immer noch mit der Bundesnetz -
A uf sechs Eckpunkte hatten sich die Verhandlungspartner in Sachen Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz im April 2024 verständigt. Auf deren Grundlage dieser fanden die weiteren Verhandlungen für eine Zusatzvereinbarung statt. Das verfrühte Ende der Ampelregierung gefährdete jedoch das in den Verhandlungen Erreichte. Eine Absichtserklärung, die im Januar dieses Jahres unterzeichnet wurde, sollte verhindern, dass die Gespräche umsonst geführt wurden. Darüber hinaus sind aktuell vier Machbarkeitsstudien zur Prüfung der geplanten Vorhaben in der Bonner Region in Arbeit. All diese Schritte sollen eine schnelle Wiederaufnahme der Verhandlungen nach den Wahlen mit einer neuen Bundesregierung vereinfachen.
Überholte Vorgaben
Es gibt aber auch Kritik. Nach Aussage des Bunds der Steuerzahler (BdSt) wird es der kommenden Bundesregierung auf diese Weise nur umso schwerer gemacht, Abstand von den bisherigen Verhandlungsergebnissen zu nehmen. In den geplanten neuen Ansiedlungen und den damit einhergehenden Investitionen in die Region sieht der BdSt mehr eine überdimensionierte
BfJ-Präsidentin über Digitalisierungsvorhaben und Unterstützung für Opfer
(BS) Das Bundesamt für Justiz (BfJ) ist nach seiner Präsidentin Veronika Keller-Engels der Zentrale Dienstleister der Justiz für Gerichte, Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger. Im Gespräch erklärt sie, wie sich der Aufgabenzuschnitt verändert und der erwartete Ansturm bei den Tilgung von Cannabisstraftaten ausblieb. Die Fragen stellte Dr. Eva-Charlotte Proll.

Das BfJ hat einige neue Aufgaben erhalten, so verwaltet es seit Januar 2025 das Rechtsdienstleistungsregister. Ein Mangel an Aufgaben besteht daher nicht, erklärt BfJ-Präsidentin Veronika Keller-Engels. Foto: BS/Rudolf
agentur in sehr gutem fachlichem Austausch und haben die Aufsicht als Bußgeldbehörde im Hinblick auf den Zustellungsbevollmächtigten bestimmter Sozialer Netzwerke als Aufgabe behalten. Dieses Instrumentarium dient dazu, dass gerichtliche Zustellungen nicht umständlich im Ausland bewirkt werden müssen,
Keller-Engels: Die Härteleistungen sind Haushaltsmittel, die vom Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt werden, um Solidarität mit den Opfern solcher Anschläge zum Ausdruck zu bringen. Im letzten Jahr haben wir Härteleistungen in einer Gesamthöhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro ausgezahlt. Dies
„Kein Mangel an Aufgaben für den Öffentlichen Dienst“
sondern hier im Inland gemacht werden können. Wir können auch Verstöße mit Bußgeldern bis zu 5.000.000 Euro ahnden.
Behörden Spiegel: Das BfJ ist für die Verteilung von Härteleistungen im Zusammenhang mit extremistischen und terroristischen Anschlägen zuständig. Welche Zuwendungen beinhaltet dies?
betrifft nicht nur Großschadensereignisse, sondern auch einzelne Angriffe auf Personen. Die Härteleistungen können über ein online verfügbares Antragsformular bei uns direkt beantragt werden. Diese Leistungen reichen von Soforthilfen bis zu jahrelangen Zahlungen. Wenn jemand durch einen Anschlag schwer verletzt wurde, dann wird auch der Verlauf der gesundheitlichen Genesung
mittels weiterer Leistungen begleitet. Bei den Sofortleistungen handelt es sich beispielsweise um Beerdigungsleistungen und Schmerzensgeld für Angehörige. Wir prüfen das hier im Haus und arbeiten hier sehr eng mit dem Opferbeauftragten des Bundes, Roland Weber, zusammen. Die Auszahlungen der Härteleistungen hat für die Betroffenen den Vorteil, dass wir nicht an strenge Beweisregeln wie Gerichte gebunden sind. Mir ist wichtig, zu betonen, dass wir versuchen, die Leistungen, die wir an die Betroffenen auszahlen, im Regressverfahren bei den Tätern wieder beizutreiben. Im Hinblick auf die Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 kann ich ergänzend anmerken, dass der Deutsche Bundestag finanzielle Hilfen für Betroffene als staatliche Billigkeitsleistung zur Verfügung stellt. Für die Beantragung ist das Bundesamt für Justiz ebenfalls die zuständige Stelle.
Behörden Spiegel: Das BfJ konsolidiert aktuell seine Liegenschaften
Zusatzvereinbarung stoppen oder verankern?
(BS/sr) Während der vergangenen Jahre haben sich Vertreter des Bundes, der Länder Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz sowie Vertreter der Bundesstadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises über eine Zusatzvereinbarung zum Berlin/ Bonn-Gesetz beraten. Mit einer Absichtserklärung haben sie die Fortschritte dieser Gespräche nun gesichert. Doch das wird nicht überall gerne gesehen.
Regionalförderung. Dabei hatte der Bund Bonn bereits in Milliardenhöhe entschädigt, als die Stadt ihren Hauptstadt-Status verloren hatte. Auch auf die Ansiedlungen von namhaften Institutionen seit dem Umzug weist der BdSt hin. BdSt-Präsident Reiner Holznagel erklärte dazu, dass das Berlin/ Bonn-Gesetz längst überholt sei. Schließlich würden die Ministerien die Vorgaben des Gesetzes schon lange ignorieren und einen Großteil ihres Personals mittlerweile in Berlin (73 Prozent) haben, legt der BdSt dar. Daher sprechen sich Holznagel und der BdSt für ein Ende der Zwangsteilung der Verwaltung aus, die teuer, ineffizient und klimaschädlich sei. Wie es der alle zwei Jahre erscheinende Teilungskostenbericht darlegt, verursacht die Teilung jährlich Kosten von 9,1 Mio. Euro. Der BdSt schätzt auf Rückfrage die Kosten jedoch auf bis zu 20 Mio. Euro. Grund für diese höhere
Einschätzung ist unter anderem der Fakt, dass verlorene Arbeitszeit durch das Pendeln zwischen den Standorten nicht erfasst wird.
Notwendige Kostenanalyse In Anbetracht der mangelnden Daten sieht der BdSt eine dringende Notwendigkeit für eine Vollkostenanalyse, für die der Teilungskostenbericht ungeeignet sei. Lediglich ein 2016 einmal veröffentlichter Statusbericht des Umweltministeriums habe tiefgreifendere Einblicke erlaubt. Jedoch bezifferte auch dieser die Teilungskosten nicht. Aber der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die Effizienz unter der Teilungsarbeit leide. So wurden laut dem Bericht jährlich 40.000 teilungsbedingte Videokonferenzen veranstaltet, das sind durchschnittlich 180 am Tag. Der BdSt erklärt weiter: „Unterm Strich zeigt sich immer wieder, dass sowohl Bundesregierung als auch Bundestag an einer echten Analyse nicht interessiert sind – eine grundlegende Kostenbetrachtung ist offenbar nicht gewollt.“ Zwei Zentren für Resilienz Befürworter der Zusatzvereinbarung weisen jedoch auf die Vorteile der zwei Standorte hin. So helfe die Aufteilung auf Bonn und Berlin dabei, Liegenschaften und Grund-
von ursprünglich fünf auf zukünftig zwei. Wie geht es hier voran?
Keller-Engels: Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben für rund 1.400 Beschäftigte bereits eine Konsolidierung auf drei Liegenschaften durchgeführt. Das ist einmal das Haupthaus an der Adenauerallee, dann eine Zweigstelle Ramersdorf/ Oberkassel, die wir noch aufgeben werden, und eine neue Liegenschaft auf der Friedrich-Ebert-Allee. Im Jahr 2027 soll der Neubau an der Adenauerallee bezugsfertig sein. Der Vorteil der Liegenschaftskonsolidierung liegt schon in der jetzigen Form darin, dass die Gebäude nur wenige Straßenbahnhaltestellen auseinanderliegen, sodass Meetings trotzdem persönlich vor Ort stattfinden können und die Beschäftigten zu bestimmten Veranstaltungen, beispielsweise zum Thema Gesundheitsmanagement, zusammenkommen können. Wir haben gemeinsam mit dem Umzug auch Desksharing eingeführt – ein Element der Transformation der Arbeitswelt, das auch in den Behörden angekommen ist.
Behörden Spiegel: Zur Transformation der Arbeitswelt gehört auch das mobile Arbeiten. Wie wird dies im BfJ gehandhabt?
Keller-Engels: Die Beschäftigten haben bei uns die Möglichkeit, zu 80 Prozent ortsflexibel zu arbeiten. Dies ermöglicht viele Freiheiten und erleichtert zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für eine Stärkung des sozialen Zusammenhaltes unter Kollegen haben wir regelmäßige Teamtage, soziale Veranstaltungen wie das Sommerfest, führen aber auch digitale Schulungen – beispielsweise zum Thema Führen auf Distanz – durch. Wir haben verschiedene Programme insbesondere für Führungskräfte auf den Weg gebracht, um für die Besonderheiten des ortsflexiblen Arbeitens zu sensibilisieren. Das sind in meinen Augen wichtige Punkte, um einen Wechsel vom reinen Präsenzbetrieb auf Telearbeit und ortsflexibles Arbeiten zu schaffen. Nach unseren aktuellen Erfahrungen und aufgrund der positiven Rückmeldungen der Beschäftigten gehe ich davon aus, dass wir bei diesem Modell bleiben können.
stücke zu finden und sei ein Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte. Letzteres sei eine Aufgabe die mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Fachkräftemangels noch bedeutender werden kann. Auch in Sachen Resilienz habe sich das zweite bundespolitische Zentrum bereits bewährt, sagt unter anderem Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei: „Gäbe es kein zweites bundespolitisches Zentrum, müsste man es spätestens nach den Erfahrungen von Pandemie, Krieg und Energiekrise erfinden.“
Das Bundessortenamt ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.
Zum 1. August 2025 ist der Dienstposten der Präsidentin bzw. des Präsidenten (w/m/d) am Hauptsitz Hannover zu besetzen. Das vollständige Stellenangebot finden Sie im Internet unter www.bundessortenamt.de
Den
ersten Zweifel lässt bereits die Verordnung der Bundesinnenministerin vom 27. Dezember 2024 aufkommen: Paragraf 52 Abs. 3 Bundeswahlgesetz (BWG) erlaubt ihr im Auflösungsfall die uneingeschränkte Fristverkürzung ohne Zustimmung des Bundesrats. Mit Blick auf die Gegebenheiten in anderen Staaten kann gesagt werden, dass ein solcher manueller Eingriff in ein Fristengefüge durch ein Regierungsmitglied von vornherein als äußerst bedenklich angesehen werden muss. So bedürfte es in Österreich für jegliche Änderungen im seit Jahren unverändert gebliebenen Wahlkalender der Nationalratswahl eines Gesetzesbeschlusses.
Problematische Fristen
Genau die Fristen sind das Problem: Wie jüngst u. a. die Wahlleiter von Dresden, Thüringen und Bayern sagten, seien massive Schwierigkeiten bei der Briefwahl zu erwarten; einige Wahlleiter rufen sogar zur Urnenwahl wegen der bei der Briefwahl zu erwartenden Schwierigkeiten auf.
Sieht man auf die deutschen Fristen, so sind drei Dinge auffällig:
1. Die Kandidatenlisten stehen erst 24 Tage vor der Wahl fest, wenn am 30. Januar 2025 die finalen Entscheidungen der Landes- und Bundeswahlausschüsse über Beschwerden gegen Listen vorliegen. Erst dann können Stimmzettel gedruckt und versandt werden. Das erhöht den Druck auf Druckereien, Versand- und Postdienstleister erheblich, denn diese Wartefrist kostet volle 34 Tage.
2. Mit 16 Werktagen Vorlauf für Druck, Versand und Rücksendung ist faktisch das Wahlrecht der Auslandsdeutschen zumindest sehr erschwert, wenn nicht völlig verunmöglicht. Die Orientierung der Deutschen Post AG über Brieflaufzeiten gibt sechs bis zehn Werktage für die USA an und vier bis acht Werktage für Spanien (Mallorca!). Es steht die Frage im Raum, ob ein Fristengefüge grundgesetzkonform sein kann, wenn hunderttausende Auslandsdeutsche in Übersee de facto von der Teilnahme an der Bundestagswahl ausgeschlossen sind.
3. Die Fristen für Beschwerden gegen Einträge im Wählerverzeichnis und Anträge auf Briefwahl sind faktisch nur von Ortsansässigen einhaltbar. Paragraf 17 BWG gestattet ausschließlich die höchstpersönliche Einsichtnahme ins Wählerverzeichnis bei der Gemeinde am 20. bis 16. Tag vor der Wahl (28. Januar bis 1. Februar) während der allgemeinen Öffnungszeiten. Das ist für Auslandsdeutsche nicht darstellbar

Warum die Wahl 2026 in Karlsruhe entschieden wird
(BS/Robert Müller-Török/Alexander Prosser/Robert Stein*) Der Deutsche Bundestag wird am 23. Februar 2025 neu gewählt und es ist absehbar, dass wesentliche Probleme auf die res publica zukommen, die Zweifel erzeugen könnten, ob diese Wahl den demokratischen Mindeststandards entspricht.

Es wird knapp mit den Briefwahlunterlagen in diesem Jahr. Im schlimmsten Fall könnten tausende Wählerstimmen an verspäteter Zustellung oder zu knappen Fristen scheitern.
und auch für prinzipiell Ortsansässige schwierig, z. B. für Pendler und Erziehende.
Hohe Anteile an Briefwahl Voraussichtlich höchst problematisch wird das Thema Zurückweisung verspätet eingegangener Wahlbriefe. Diese sind nach Paragraf 39 BWG Abs. 4 Z. 1 zurückzuweisen; die Einsender werden nicht als Wähler gezählt. Blickt man auf die Meinungsumfragen betreffend potenzielle um die Fünf-ProzentParteien oder auf die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl, so wird das ein ganz massives demokratiepolitisches Problem. So ging 2021 der Wahlkreis München West/ Mitte mit 137 Stimmen Vorsprung an die CSU vor den Grünen. Derartig knappe Wahlkreise gab und gibt es viele mehr: Steinburg-Dithmarschen – 52 Stimmen Unterschied zwischen CDU und SPD, Emmendingen-Lahr – 90 Stimmen zwischen CDU und SPD und Bonn – 216 Stimmen Unterschied zwischen Grünen und SPD. Aus diesen Gründen, verschärft durch die jüngste Wahlrechtsreform, sind Anfechtungen höchst wahrscheinlich. Insbesondere von Grünen und Union, denn diese könnten zu den
Schon im Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist die Kanalisierung in einen sicheren und regulierten Markt als großes Ziel genannt. Dies soll „[...] durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot [...]" ermöglicht werden, welches „[...] den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen [...]" lenkt und so der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubtem Glücksspiel in Schwarzmärkten entgegenwirkt. Doch dieses Ziel scheint mit dem aktuellen Regulierungsrahmen nicht recht zu gelingen. Mehrere Studien zeigen einen zunehmend wachsenden Schwarzmarkt. Eine umfangreiche Überprüfung und eine damit einhergehende Anpassung der Regulierung ist allerdings noch weit entfernt. Zwar gab es eine Zwischenevaluierung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 und eine vollständige Evaluierung ist für das Jahr 2026 geplant, aber das ist für einige Akteure zu
Hauptgeschädigten gehören, wenn zigtausende Briefwahlunterlagen verspätet eintreffen: 2021 erzielte die Union bei der Briefwahl 3,3 Prozent mehr als an der Urne, die Grünen sogar 3,7 Prozent mehr. Profitieren könnte hingegen die AfD: 6,7 Prozent Stimmanteil per Briefwahl standen dort 13,6 Prozent an der Urne gegenüber.
Die Briefwahlunterlagen
Dieses Problem beginnt bereits beim Druck und Versand der Briefwahlunterlagen. Ingolstadt hatte 2021 an der Urne 68.932 Wähler, aber 118.436 Briefwähler – bei 238.834 Wahlberechtigen. Vernachlässigen wir die beantragten, aber entweder gar nicht abgeschickten oder verspätet eingegangenen Briefwahlunterlagen, so erscheint es höchst zweifelhaft, ob Ingolstadt oder sein Dienstleister 118.436 Wahlbriefe mit Briefwahlunterlagen an einem einzigen Tag drucken, zusammenstellen und versenden kann. Wahrscheinlicher ist eine Versendung über einen längeren Zeitraum. Das verkürzt die Frist selbst für inländische Briefwähler noch weiter.
Noch problematischer wird es, wenn Wähler, welche die Brief-
Foto: BS/ Carola Vahldiek, stock.adobe.com
wahlunterlagen nicht rechtzeitig oder gar nicht erhalten haben, zur Urnenwahl eilen. In diesem aus Berlin von der Wahl im September 2021 wohlbekannten Szenario gehen dann in den Wahllokalen die Stimmzettel aus. Die Abschätzung, wie viele Wahlberechtigte ins Wahllokal kommen, ist bei einer Wahlbeteiligung von 76,6 Prozent und einem Briefwähleranteil von 47,3 Prozent bei der letzten Bundestagswahl äußerst schwierig. Dass die Zulassung „verhinderter Briefwähler“ bundeseinheitlich vorgenommen wird, ist bei der hohen Dezentralisierung unwahrscheinlich: Erwartbar ist, dass in jedem Wahllokal unterschiedlich vorgegangen wird, was dann in Summe gegen den Grundsatz der allgemeinen Wahl massiv verstößt. Auch hier sind Anfechtungen zwangsläufig und wohl als erfolgversprechend einzuschätzen – siehe Berlin 2021. Ein bislang völlig vernachlässigtes Problem mit verspätet eingegangenen Briefwahlstimmen wird deren Aufbewahrung bzw. Vernichtung. Diese enthält aus Datenschutzsicht höchst sensible Daten: Wie z. B. Jürgen Klinsmann (Wohnsitz Kalifornien) gewählt hat, sollte einem Kommunalbeamten, der allein und
Was braucht eine effiziente Glücksspielregulierung?
(BS/sr) Viele Forscher sind sich einig: der Mensch hat einen Spieldrang. Dieses bedingt im Glücksspiel ohne Überwachungsmaßnahmen leider auch schnell die Gefahr, süchtig zu machen. Daher ist es wichtig, dass die Spielerinnen und Spieler in einem sicheren Umfeld spielen. Dafür soll die Regulierung über den Glücksspielstaatsvertrag sorgen. Doch in seiner aktuellen Iteration scheint der Staatsvertrag seine selbst gesetzten Ziele nur bedingt zu erreichen und Anpassungen, beispielsweise für eine effizientere Regulierung, wird es nicht so schnell geben.
spät. Ein Punkt, den es in diesem Rahmen zu beachten gilt, ist, dass bei der praktischen Anwendung der Vorgaben des Staatsvertrages zusätzliche Bürokratie entsteht.
Bürokratischer Spielerschutz Die Umsetzungsgesetze der einzelnen Bundesländer werden zwar vor Verabschiedung auf eine mögliche Verringerung des Erfüllungsaufwandes geprüft, aber sie sind dabei an die Vorgaben des Staatsvertrages gebunden. Ein Umstand, der, wie zuvor erwähnt, zwar zu mehr Bürokratie führen kann, dies aber
unbeobachtet verspätet eingelangte Wahlbriefe vernichtet, nicht einsehbar sein. Darum werden solche Stimmen üblicherweise ausschließlich von Wahlkommissionen in Räumen bzw. Tresoren mit mehreren Schlüsseln aufbewahrt und unter ihrer Aufsicht vernichtet. Sollte der Wahlausschuss des neu gewählten Bundestags – Stichwort Richter in eigener Sache nach Art. 41 Abs. 1 GG – oder das danach angerufene BVerfG diese doch auszählen wollen, ist das durch dezentrale, ungesicherte Aufbewahrung bzw. erfolgte Vernichtung verunmöglicht. Ein Blick nach Österreich in diesem Zusammenhang zeigt, dass zur Stimmabgabe bereits verwendete, aber verspätet eingelangte Wahlkarten – so werden die Briefwahlunterlagen dort bezeichnet –für die österreichischen Behörden „heiße Ware“ sind. Die Vernichtung der ungeöffneten Wahlkarten kann nur vor den Augen einer Wahlkommission erfolgen. Im Jahr 2019 wurden ca. 400.000 Wahlkarten des abgesagten 2. Wahlgangs zur Wiederholungswahl der Bundespräsidentenwahl 2016 vor den Augen von Mitgliedern der obersten Wahlbehörde geschreddert.
Diese Wahl wird wohl 2026 in Karlsruhe entschieden, nachdem der Wahlausschuss des Bundestages nach dem schlechten Vorbild Berlins 2021 nach mindestens einem Jahr in eigener Sache entschieden hat. Dies widerspricht im Übrigen dem Code of Good Practice der Venedig-Kommission des Europarates, der in Punkt 3.3 zwar eine erstinstanzliche Entscheidung über Wahleinsprüche durch das Parlament (in eigener Sache) zulässt, aber festlegt, dass diese erstinstanzliche Entscheidung innerhalb weniger Tage getroffen werden muss.
*Robert Müller-Török, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.
Alexander Prosser, Wirtschaftsuniversität Wien.
Robert Stein, Leiter Wahlabteilung des österreichischen Bundesministeriums für Inneres i.R.

im Sinne der Ziele des Glücksspielstaatsvertrages hinzunehmen sei, wie es aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium heißt. Aufgrund der Prüfung bei Gesetzesbeschluss wird eine regelmäßige Kontrolle jedoch als nicht notwendig erachtet, heißt es auf Rückfrage aus mehreren obersten Aufsichtsbehörden der Länder. Vertreter der Glücksspielindustrie sehen bereits seit Längerem einen Anpassungsbedarf für den Glücksspielstaatsvertrag. Auch auf ihren Wunsch gab es bereits die angesprochene Zwischenevaluierung. Es stellt sich aber die Frage, ist der Aktualisierungsprozess schnell genug? Wenn nein, wie kann der Anpassungsbedarf möglichst gering gehalten werden? Runde Tische zwischen Regulierern, Forschern und der Industrie können eine effiziente Lösung sein. Dennoch bleibt es ein Balanceakt zwischen Spielerschutz und Kanalisierung, der auch mit technologischen Weiterentwicklungen und neuen Forschungsergebnissen wohl nie bewältigt werden wird – denn nach dem Glücksspielstaatsvertrag ist vor dem Glücksspielstaatsvertrag.
Zu der Frage, „Wie Regulierung gelingt“, wird es auch auf dem DAWKongress 2025 am 13. März eine Diskussion mit Vertretern der Politik geben. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Kongress finden Sie unter. https:// www.automatenwirtschaft.de/dawkongress-2025/
% 1.880.500
(BS) Der Öffentliche Dienst ist für beide Geschlechter einer der großen Arbeitgeber in Deutschland. Auch wenn Gleichberechtigung seit Langem das Ziel ist, gibt es nach wie vor Bereiche, in denen die Geschlechter nicht gleich aufgestellt sind. Dabei zeigt si ch auch eine teils klischeehafte Verteilung, z. B. darin, dass der Anteil an Frauen in Führungspositionen im BMFSFJ von allen obersten Bundesbehörden am Höchsten ist.
MÄNNER UND FRAUEN im Öffentlichen Dienst FRAUEN IN ALLGEMEINEN LEITUNGSPOSITIONEN in obersten Bundesbehörden
Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Staatshaushalts und von Investitionen. Wie soll mit der Schuldenbremse weiter verfahren werden und wie wird die Finanzbeziehung zwischen Bund und Ländern weiterentwickelt?
23. FEBRUAR 2025












„Nein. Wir halten an der grundgesetzlichen Schuldenbremse fest. Sie stellt sicher, dass Lasten nicht unseren Kindern und Enkeln aufgebürdet werden. Denn die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Die Schuldenbremse hat zuletzt sowohl in der Krise als auch in konjunkturellen Schwächephasen ihre Funktionsfähigkeit und Flexibilität bewiesen.“


Brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse?Brauchen wir eine Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern?
„Wir sollten die Einnahmeverteilung zwischen Bund und Ländern sowie den Länderfinanzausgleich überprüfen, um weitere Ansätze für effizientes Handeln und nachhaltige Haushaltspolitik zu setzen.“
„Die derzeitige Schuldenregel ist nicht auf die Herausforderungen unserer Zeit und die Zukunft ausgelegt. Daher strebt die SPD eine Reform der Schuldenregel im Grundgesetz an, damit Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und den Wohlstand nicht blockiert werden. Nur so können wir ein gutes Leben für zukünftige Generationen gewährleisten.“
„Wir müssen gezielt in Bildung investieren, den sozial-ökologischen und digitalen Strukturwandel bewältigen sowie die Infrastruktur landesweit modernisieren. Dafür benötigen nicht nur der Bund, sondern auch die Länder (und Kommunen) ausreichend finanzielle Spielräume. Deshalb schlagen wir einen Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen vor. Dieser umfasst die bereits erwähnte Reform der Schuldenregel, um den Ländern zusätzlichen finanziellen Spielraum zu ermöglichen. Zudem möchten wir die höchsten Vermögen in unserem Land stärker in die Verantwortung nehmen, um die Gemeinschaft zu finanzieren. Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögensteuern sollen so die Einnahmen der Länder stärken, denen diese Steueraufkommen zustehen. Außerdem setzen wir uns für eine flexiblere Gestaltung der Defizitregel ein, sodass die Länder im Rahmen der europäischen Fiskalregeln Möglichkeiten zur Kreditaufnahme erhalten.“
„Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen müssen grundsätzlich auf den Prüfstand. Freiheit für künftige Generationen bedeutet auch, ihnen keine Schuldenberge zu hinterlassen. Daher ist für uns Freie Demokraten die Einhaltung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse zentrales Gebot der Generationengerechtigkeit. Sonst haften Kinder für ihre Eltern. Diese gilt auch für die Bundesländer. Nachhaltige und priorisierende Haushalte schaffen Generationengerechtigkeit, weil Lasten nicht auf künftige Generationen übertragen werden. Nur so sichern wir die finanziellen Handlungsspielräume kommender Generationen. Deutschland muss Stabilitätsanker in Europa bleiben und mit gutem Beispiel vorangehen. Wir können es uns nicht erlauben, dass unsere Kreditwürdigkeit in Frage gestellt wird. Ausufernde Staatsschulden wie in Frankreich oder Italien würden die europäische Stabilität ins Wanken bringen. Wir haben in der Vergangenheit für strenge Schuldenregeln gekämpft. Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, wird die Währungsunion scheitern.“
„Deutschland ist von früheren Regierungen jahrelang auf Verschleiß regiert worden. Die Folgen sind im ganzen Land zu spüren: Einsturzgefährdete Brücken, vernachlässigte digitale Infrastrukturen oder überlasteter Schienenverkehr, dabei waren leistungsfähige Infrastrukturen ein deutlicher Standortvorteil Deutschlands. Um unsere Wirtschaft zu stärken müssen wir die öffentlichen Investitionen ausbauen und dafür die Schuldenbremse sinnvoll modernisieren. Es geht dabei nicht darum, die Schuldenbremse abzuschaffen oder die Haushaltsdisziplin aufzugeben, sondern vielmehr darum, eine Balance zwischen notwendigen Investitionen und verantwortungsvoller Finanzpolitik zu finden. Durch eine solche Reform können wir unsere Wirtschaft stärken, die Infrastruktur verbessern und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sicherstellen.“
„Ja. Es muss der öffentlichen Hand möglich sein, für Investitionen in die Infrastruktur Schulden aufzunehmen. Die Beibehaltung der Schuldenbremse führt dazu, dass künftige Generationen weniger Schulden erben – aber auch eine vollkommen marode Infrastruktur. In Krisensituationen muss es auch möglich sein, zur Stützung der sozialen Sicherungssysteme Schulden aufzunehmen.“
„Die derzeitigen Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern sind komplex und oft ungerecht. Um eine faire und nachhaltige Verteilung der Finanzmittel zu gewährleisten, setzen wir uns für eine umfassende Reform ein. Durch eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs, eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und eine bessere Abstimmung von Bundes- und Landesprogrammen können wir gemeinsam daran arbeiten, Deutschland zu einem fairen und gerechten Land zu machen, in dem alle Menschen gleichwertige Lebensverhältnisse haben.“
„Nein. Wir müssen den Ländern wieder eigene Einnahmen verschaffen: mit einer konsequenten steuerlichen Gleichbehandlung von Erbschaften und der Einführung einer Vermögenssteuer.“
Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.
Die deutsche Start Up-Szene kommt nur schwer vom Fleck. Hierzulande finden die meisten Wachstumsunternehmen zwar in der Frühphase Investoren – vor allem Privatpersonen oder mittlere Venture-Capital-Fonds –, die mit ein paar Millionen Euro Startkapital unterstützen. Doch treten die jungen Unternehmen in die nächste Wachstumsphase ein, gestaltet sich das Akquirieren von Wagniskapital-Investoren bereits deutlich schwieriger.
Darin liegt ein entscheidender Unterschied zum Wirtschaftsstandort USA. Eine Studie des Investors Lakestar zeigt, dass Deutschland und die Vereinigten Staaten zwar in puncto Forschung gleichauf liegen, in den USA jedoch achtmal mehr Geld für Wachstumsfinanzierungen ausgegeben wird als hierzulande. Die Differenz zwischen den beiden Nationen machen auch folgende Zahlen deutlich: Bei Finanzierungsrunden von mindestens 100 Millionen Euro, die in Deutschland zwischen 2020 und Mitte 2023 stattfanden, stammten mehr als 46 Prozent der Investments aus den USA. Die Folge: Deutsche Start Ups werden abhängiger von ausländischen Investoren, die wiederum die unternehmerischen Strategien unter Umständen entscheidend mitbestimmen. Um die Start Up-Szene zu stärken und Wagniskapital-Investitionen anzukurbeln, legte die Ampelkoalition eine Reihe von Maßnahmen auf. So präsentierte das Bundesfinanzministerium (BMF) im November vergangenen Jahres die „Initiative für Wachstums- und Innovationskapital (WIN-Initiative)“ – ein Bündnis aus Wirtschaft, Verbänden, Politik und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Ziel des Bündnisses ist es, bis 2030 das deutsche Venture-Capital-Ökosystem mit rund zwölf Milliarden Euro zu bezuschussen. Die Bundesrepublik soll so zu einem führenden Standort für Innovationen und Wachstumskapital ausgebaut
Appell an den Bund Umstellung auf Doppik-Haushalt (BS/amw) Mit einem Aufruf an die kommende Bundesregierung will die Verwaltungsinitiative „Re:form“ die Haushaltsführung des Bundes auf ein neues Fundament stellen.
In dem Schreiben fordert das Bündnis, in der nächsten Legislaturperiode das Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes auf die staatliche Doppik umzustellen. Nahezu alle europäischen Länder hätten bereits ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt, auch hierzulande solle „eine flächendeckende Harmonisierung der Haushaltswirtschaft auf allen öffentlichen Ebenen“ erfolgen, schreiben die Unterzeichner des Papiers. Bundesregierung und Bundestag sollten nicht nur Einnahmenund Ausgaben betrachten, sondern ebenso Abschreibungen und zukünftige Zahlungsverpflichtungen im Blick haben, erklärten diese weiter.
Der anhaltende Investitions- und Sanierungsstau der öffentlichen Infrastruktur sei auch ein Ergebnis der bisherigen Haushaltssteuerung des Bundes, die „nur die aktuellen Zahlungsströme und keine Folgekosten berücksichtigt“. Ein funktionierender Staat müsse aber über ein nachhaltiges Haushaltsund Rechnungswesen verfügen, in dem die staatliche Leistungserbringung transparent dargestellt sei.
Förderung von Wagniskapital-Anlagen
(BS/Anne Mareile Walter) Mit einer Reihe von Maßnahmen hatte die Ampel den Start Up-Standort Deutschland stärken und Wachstumsunternehmen besser bezuschussen wollen. Branchenverbände halten das für nicht ausreichend und fordern von einer neuen Bundesregierung mehr Taten.

Mehr Wagniskapital-Investoren für die Start Up-Szene: Dieses Ziel verfolgt eine Reihe von Maßnahmenpaketen der scheidenden Bundesregierung. Doch deren Wirkungsgrad ist umstritten.
werden, schrieb das BMF in einer entsprechenden Mitteilung.
Deutschland hinkt hinterher Ein ähnliches Ansinnen verfolgt der HGTF-Opportunity-Fonds, der im Juni 2024 von BMF und BMWK mit einem Fondsvolumen von insgesamt 660 Millionen Euro aufgelegt wurde. Im Vorfeld war 2005 der High-Tech-Gründerfonds lanciert worden, der seit Bestehen in mehr als 750 Start Ups aus den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech, Life Sciences und Chemie investierte. Mit dem im vergangenen Jahr neu gestarteten HGTF-Opportunity-Fonds sollen ausgewählte Unternehmen auch in späteren Wachstumsphasen mit hohen Finanzierungssummen unterstützt werden.
Ein drittes, politisch instruiertes Vorhaben: Anfang 2024 erweiterte das BMF den Kapitalzugang für Start Up-Firmen – mit 1,6 Milliarden Euro aus dem Zukunftsfonds sowie
150 Millionen Euro aus dem ERPSondervermögen. Dazu erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: „Zu den 1,75 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln, die wir investieren, kommt mindestens der gleiche Betrag an privaten Mitteln hinzu.“ Wie beurteilen Branchenverbände die von der Politik geschnürten Maßnahmenpakete? Sind sie ein Schritt in die richtige Richtung? Das schon – so der einhellige Tenor, aber ausreichend seien sie bei Weitem nicht. So hält der Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) die WINInitiative und die Verbesserung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung zwar für eine gute Entscheidung, doch die vorzeitige Auflösung der Ampelregierung habe den Effekt gehabt, dass wichtige regulatorische Maßnahmen nicht mehr verabschiedet werden konnten. Nun müsse eine neue Bundesregierung die „Zielmarke an mobilisiertem privatem Kapital deutlich steigern“, sagte
Foto: BS/Mikki Orso, stock.adobe.com
BVK-Vorstandssprecherin Ulrike Hinrichs. Damit Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds zu mehr Investments in die Anlageklasse Venture Capital animiert werden, müssten „unangemessene Einschränkungen“, etwa durch die Anlageverordnung CRR oder Solvency II, abgebaut werden.
Rechtssicherer Rahmen für Investitionen in Infrastruktur Auch der deutsche Fondsverband BVI sieht noch etliche Hemmnisse, die einem verstärkten Investieren in Wagniskapital entgegenstehen. Bestehende Steuervorschriften würden beispielsweise Risiken für Asset-Manager bergen und dafür sorgen, dass deren Einfluss auf die Zielgesellschaft eingeschränkt ist. Einen ersten Lösungsansatz sieht der BVI in dem im Dezember 2024 vorgelegten Gesetzentwurf für ein zweites Zukunftsfinanzierungsgesetz. Die darin vorgesehenen steuerlichen und aufsichtsrechtlichen
Finanzielle Implikationen der Wahlprogramme
Änderungen würden „die Rahmenbedingungen für den Kapitalmarkt und für Wachstumsunternehmen“ verbessern, teilte ein Sprecher des Verbands mit.
Aus Sicht des Startup-Verbands seien HTGF-Opportunity-Fonds, Wachstumsfonds sowie die WIN-Initiative „wichtige Meilensteine“, um Innovationen zu stärken. Dennoch schränkt die Vorstandsvorsitzende des Verbands, Verena Pausder ein: Die Maßnahmen könnten lediglich „Startschuss für eine umfassende Finanzierungsoffensive in der nächsten Legislaturperiode“ sein. Komme es dazu nicht, bestehe die Gefahr der Abhängigkeit von ausländischen Investoren. „Europa muss lernen, selbstständig zu laufen“, so Pausder. „Sonst bauen wir die Rampe, machen Startups groß – und am Ende picken sich andere die Rosinen raus.“
Gründerbranche kommt allmählich aus der Krise
Die aktuelle finanzielle Situation der deutschen Start Ups umreißt auch eine Mitte Januar veröffentlichte Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Diese kommt allerdings zu einem positiven Ergebnis. So schreiben die Autoren, dass sich die Gründerbranche von der Krise, die nach dem Zinsanstieg ausgebrochen war, nun allmählich erhole. Deutsche Wachstumsunternehmen hätten im vergangenen Jahr gut sieben Milliarden Euro an Wagniskapital eingesammelt – knapp eine Milliarde mehr als noch im Jahr 2023.
EY-Partner Dr. Thomas Prüver fasst zusammen: „Hohen Zinsen, zurückhaltenden Investoren und einer schwachen Konjunkturentwicklung zum Trotz hat sich die Start UpSzene in Deutschland nach einer Talsohle in den vergangenen Jahren im Jahr 2024 stabilisiert.“ Der Anstieg bei den Investitionssummen sei auf die Zunahme „großer Deals“ zurückzuführen. Diese Trendwende gilt es weiterzuverfolgen.
(BS/Hans-Jürgen Leersch) Im Vorfeld der Bundestagswahl übertreffen sich die Parteien mit Zusagen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Dabei bietet keine Partei eine vollständige Finanzierungsübersicht.
Im Überbietungswettbewerb, wer die Bürgerinnen und Bürger am meisten entlasten will, liegt die AfD mit 145 Milliarden Euro vorn, dicht gefolgt von der FDP mit 138 Milliarden Euro Entlastungsvolumen. Eine Regierungsbeteiligung der AfD ist ausgeschlossen und bei der FDP ist schon höchst ungewiss, ob sie wieder in den Bundestag einziehen wird. Wahlsieger dürfte nach allen Umfragen die Union werden. Sie verspricht Entlastungen in Höhe von 89 Milliarden Euro, während SPD und Grüne, die als Koalitionspartner der Union in Betracht kommen, mit 30 Milliarden (SPD) und 48 Milliarden Euro (Grüne) bei Weitem nicht so viel in Aussicht stellen.
Schwierige Einigung bei Reform der Einkommenssteuer
Am schnellsten dürfte sich eine Einigung bei den Stromkosten erzielen lassen: Union sowie SPD und Grüne wollen die Belastungen durch Netzentgelte reduzieren. Da die Netzentgelte dem Ausbau der Stromnetze dienen, müssten im Falle einer Reduzierung die anfallenden Kosten folglich aus dem Bundesetat bezahlt werden. Dieses Entlastungsvolumen wurde vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) auf zehn Milliarden Euro berechnet.
Schwieriger wird es mit einer Einigung bei der Reform der Einkommensteuer. Nach IW-Berechnungen strebt die Union eine Entlastung im Umfang von 41 Milliarden Euro an, bei der SPD sind es acht Milliarden und bei den Grünen elf Milliarden. Die CDU/CSU will Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen entlasten. Dazu sollen der Steuertarif spürbar abgeflacht und der Grundfreibetrag erhöht werden. Der Spitzensteuersatz soll später greifen und für Kapitalgesellschaften soll es eine Entlastung um 20 Milliarden Euro geben. Eine Reduzierung des Spitzensteuersatzes ist allerdings für beide potenziellen Koalitionspartner SPD und Grüne ein rotes Tuch. Die SPD verspricht etwa „Steuersenkungen für 95 Prozent
der Steuerzahlenden“, womit klar sein dürfte, dass Großverdiener nicht nur von Senkungen ausgenommen sind, sondern sogar mehr bezahlen sollen.
Steuersenkungsversprechen tragen Länder und Kommunen Als Kompromiss bietet sich eine stärkere Erhöhung des Grundfreibetrages an, was alle potenziellen Koalitionspartner wollen. Außerdem besteht bei der SPD auch die Bereitschaft, Überstunden von der Besteuerung auszunehmen. So gut wie keine Chance dürfte die Union auf Durchsetzung ihrer Forderung nach Abschaffung des Solidaritätszuschlags haben, was zu Steuerausfällen beim Bund in Höhe von 13 Milliarden Euro führen würde. Der „Soli“ wird bei Beziehern höherer Einkommen erhoben sowie bei Sparern und Kapitalanlegern.
Im Bundestag hatte die SPD Unionsanträge auf Abschaffung des „Solis“ regelmäßig abgelehnt. Sie will vielmehr Spitzenverdienende stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen. Auch die Grünen wollen laut Programm die „Gerechtigkeitslücke“ schließen und keine Steuern für besonders Wohlhabende senken.
Die Vorstellungen von SPD und Grünen bezüglich einer höheren

Erbschaftsteuer und der Wiedereinführung der Vermögensteuer werden von der Union nicht mitgetragen, was diese im Bundestag immer wieder deutlich machte. Die Bundesländer würden hier allerdings von Mehreinnahmen profitieren, da ihnen das Aufkommen aus der Erbschaft- und Vermögensteuer allein zusteht. Auch über die SPD-Forderung einer höheren Besteuerung von Kapitaleinkünften will die Union nicht verhandeln. Eine vollständige Finanzierungsübersicht fehlt bei allen Parteien. Marcel Fratzscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), warf den Parteien daher kürzlich vor, dass sie die „Wähler hinters Licht führen wollen“.
Das IW weist außerdem darauf hin, dass die Hälfte der Steuersenkungsversprechen von Ländern und Kommunen zu tragen wäre, was zu großem Widerstand im Bundesrat führen dürfte. Ein Ausweg bietet sich an, vor allem auch zur Finanzierung von dringend notwendigen Investitionen: „Die nächste Bundesregierung, wer immer sie bilden wird, sollte die Schuldenbremse reformieren“, empfiehlt Joachim Nagel, der Präsident der Deutschen Bundesbank. Nagel steht mit seiner Ansicht nicht allein.
AdM 1 –
Büro der Ministerin Leiterin des Büros der Ministerin Koordination, Grundsatzund Sonderaufgaben Ri'n OLG Dr. Wiebke Zimdars -5144
AdM 2 –
Kabinettsund Bundesratsreferat Bundestags-, Bundesrats-, Landtags-, Ministerratsangelegenheiten; Justiz ministerund Amtschefkonferenzen Ri'in AG Lena Geckeis -3683
Pressesprecher Presseund Öffentlichkeitsarbeit, Internet und Intranet, Bürgerbeauftragter
MR Dennis Zahedi -5427 Referat Öffentliches Recht Staatsund Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Rechtsbereinigung, Recht der internationalen Organisationen und der EU (soweit nicht B 2)
MR Frank Leibrock -5479

Foto: BS/MdJ/Jennifer Weyland
Ständiger Vertreter der Ministerin Staatssekretär Dr. Jens Diener
Abteilung D Zivilrecht Landesprüfungsamt für Juristen Präsident des Landesprüfungsamtes LMR Andreas Catrein -5315
Abteilung C Justizund Maßregelvollzug, Soziale Dienste LMR Dr. Jérôme Lange -5407
SAARLAND Ministerium der Justiz Franz-Josef-Röder-Straße 17 66119 Saarbrücken
Referat D 1 Bürgerliches Recht, Zivilgerichtsverfassungsund Zivilverfahrensrecht, Arbeitsund Sozialgerichtsverfahrensrecht, Insolvenzrecht
Telefon: 0681/501-00
Telefax: 0681/501-5855 0681/501-5885 (Amt der Ministerin) 0681/501-5885 (Büro Staatssekretär) 0681/501-5897 (Landesprüfungsamt)
E-Mail: poststelle@justiz.saarland.de Justiz im Internet: www.justiz.saarland.de
Referentin: Ri'n ArbG Caroline von Büren -5445 LMR Andreas Catrein -5315
Referat PA Ausbildungsund Prüfungswesen höherer und gehobener Dienst, Vorbereitung und Durchführung der juristischen Staatsprüfungen
Richter Lars Rojan -5316
Referat C 1 Grundsatzfragen, Personal und Organisation des Strafvollzuges und des KARO
Referent: MR Patrick Schütz -5446 LMR Dr. Jérôme Lange -5407
Frauenbeauftragte
Beratung und Unterstützung der Dienststelle sowie der Bediensteten in allen Fragen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung
-5449
Geschäftsleiter (siehe auch Referat A 4)
Anja Wagner
JOAR'in
MR Jörg Engel -5419
Projektleiter Digitalisierung (siehe auch Referat A 5)
MR Dr. Christoph Lafontaine -5414
Abteilung B Strafrecht, Europarecht, Recht der internationalen Organisationen; Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften
MDgt'in Michèle Bucher-Rixecker -5444
Abteilung A Personal, Haushalt, Organisation, Fortbildung und Informationstechnik LMR'in Michaela Müller -5404
Vorsitzender des Personalrates: JAI Carsten Heyner -5699
Beschwerdestelle § 13 AGG: JOAR'in Susanne Schön -4928
Behördlicher Datenschutzbeauftragter: MR Dr. Thomas Axmann -5406 Sicherheitsbeauftragter: MR Patrick Schütz -5446 Fachkraft für betriebliche Suchtprävention: JOAR Erhard Stoll -5429
Antikorruptionsbeauftragte: MDgt'in Michèle Bucher-Rixecker -5444 Beauftragter des Arbeitgebers nach § 181 SGB IX (Inklusionsbeauftragter): JOAR Joachim Dietrich -5145
Schwerbehindertenvertretung: RBe Birgit Roth (MUKMAV) -4658
IT-Sicherheitsbeauftragter: DVAR Manuel Kastler -5447 Gesamtfrauenbeauftragte: HS'in i. JVD Beatrix Barth -7727
Interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz für den Geschäfts bereich des Ministeriums der Justiz: MR Jörg Engel -5419
Referat A 1
Referat C 2
Justizvollzugsrecht, Sicherheit, Bauangelegenheiten und Liegenschaften des Justizvollzuges
MR Dr. Thomas Axmann -5406
Referat C 3 Ausund Fortbildung der Bediensteten, Behandlungsvollzug, Soziale Dienste RiLG Dr. Alexander Alsfasser -5432
Referat C 4 Maßregelvollzug RiLG Matthias Schneider -5149
Referat B 1 Grundsatzfragen, Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften, Staatsschutz, Immunität, Indemnität, Kriminologie (einschl. KRimZ) MDgt'in Michèle Bucher-Rixecker -5444
Haushalt, Beschaffung, Bau und Liegenschaften Referentin: JOAR'in Anja Wagner -5449 Referent: ROR David Ecke -5442 LMR'in Michaela Müller -5404
Referat B 2 Europarecht (Zivilund Strafrecht)
MR Dennis Zahedi -5427
Referat B 3
Strafgerichtsverfassungsund Strafverfahrensrecht, RiStBV, Ordnungswidrigkeiten, Strafvollstreckung, Eingaben und Fachaufsichtsbeschwerden in Strafsachen Richterin Katrin Schnur -5415
Referat B 4 Materielles Strafrecht und Nebenstrafrecht, JGG StA'in Anja Klein -5158
Referat A 2 Gehobener und mittlerer Dienst (ohne Gerichtsvollzieher), Justiz wachtmeisterdienst, Tarifbeschäftigte der Gerichte und Staatsanwaltschaften, Rechtsreferendare, Beamtenund Tarifrecht, sonstiges Ausbildungsund Prüfungswesen
MR Michael Raber -5417
Referat B 5
Rechtshilfe (Zivilund Strafrecht), Justizmitteilungsrecht in Strafsachen (MiStra) MR Patrick Schütz -5446
Referat A 3
Allgemeine Dienstaufsicht, Statistik und Controlling, Rechtsangelegenheiten im höheren Dienst, Richterrecht, Rechtsanwälte und Notare, Anwaltsund Notarrecht, Personalangelegenheiten der Gerichtsvollzieher und Gerichtsvollzieherwesen, Kostenrecht, Grundsatzangelegenheiten der Abteilung A Ri'in LG Julia Müller-Hermann -3828
Referat A 4
Personal des höheren Dienstes, Organisation, Arbeitsschutz, Sicherheitsangelegenheiten (jeweils der Gerichte und Staatsanwaltschaften), Geheimschutz, Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter und Schiedsleute, Personal, Organisation, Beschaffung und Geschäftsgang des Ministeriums (Geschäftsleitung)
MR Jörg Engel -5419
Referat A 5 IT der Gerichte und Staatsanwaltschaften, Elektronischer Rechtsverkehr
Referentin: StA'in Anja Klein -5158
Referent: RiLG Dr. Matthias Heffinger -7733
MR Dr. Christoph Lafontaine -5414
Referat A 6 Fortbildung
PsychDir'in Dr. Carmen Kühn -4929
► ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
Markterkundung
Beweiskräftige Feststellungen
Infolge der Berufung auf Alleinstellungsmerkmale hatte sich eine Behörde entschieden, ein Vergabemanagementsystem (VMS) ohne einen Ausschreibungswettbewerb zu beschaffen. Der Tatbestand des Paragrafen 14 IV Nr. 2 Buchst. b VgV erlaube dies, weil nur ein einziges System über Merkmale verfüge, welche die ausschreibende Stelle wünsche und für ihre Zwecke benötige. Der Hanseatische Vergabesenat ist von der Rechtmäßigkeit nicht überzeugt. Es mangelt zum einen an der Dokumentation und zum anderen an der Beweiskräftigkeit des Vortrags, dass andere Anbieter nicht gleichermaßen bestimmte gewünschte Merkmale („Features“) in ihre VMS-Lösungen einprogrammieren könnten. Der Senat stellt heraus, dass Paragraf 14 VI VgV (Prüfung von Alternativen, keine künstliche Wettbewerbseinschränkung) ganz zentral eine Aussage über die Grenzen des Bestimmungsrechts eines öffentlichen Auftraggebers enthalte. Insbesondere müsse in zweifelhaften Fällen zwingend eine Markterkundung vorgenommen werden, damit bewiesen sei, dass andere Anbieter die benötigten Merkmale nicht erfüllen können. Genau daran fehle es. Mit dieser Erwägung wird gemäß einer Kommentierung von Rosenkötter in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Vergaberecht (6/24, S. 728, 739 ff.) eine tatsächlich wie auch rechtlich problematische Frage aufgeworfen: Kann und darf man einem Leistungsversprechen eines Konkurrenten, der in seinem VMS derzeit nicht über diese Features verfügt, zutrauen, dass er diese nach einer – unterstellten –Beauftragung herzustellen in der Lage ist? Dies ist eine Frage der technischen Fähigkeit sowie eines in die Zukunft gerichteten Leistungsversprechens. Beweiskraft kann einer solchen Behauptung jedenfalls nicht beigemessen werden.
OL Hamburg, Beschl. v. 06.04.2023 (1 Verg 1/23)
► UNTERNEHMEN AUS DRITTSTAATEN
Keine verbrieften Ansprüche
Entscheidung zur Zulassung
Gelegentlich stellt sich die Frage, ob Unternehmen aus sog. „Drittstaaten“, also Staaten, die weder Mitgliedsstaaten der EU noch mit der EU über ein sog. Beschaffungsabkommen (GPA) verbunden sind, einen Anspruch haben, an öffentlichen Vergabeverfahren beteiligt zu werden. Gleichermaßen ist fraglich, ob sie sich auf EU-Richtlinien berufen dürfen und ggf. auch Rechtsschutzmaßnahmen, gestützt auf zur Verfügung gestellte Bieterrechte, ergreifen dürfen.
Genau diese Frage wird vom Gerichtshof negativ beantwortet. Dies bedeutet, dass Unternehmen aus Drittstaaten wie der Türkei, die weder Mitgliedsland der EU ist noch über ein Beschaffungsabkommen mit der EU verfügt, im Prinzip keine Rechte haben. Sie können die Beteiligung an einem Vergabeverfahren nicht erstreiten, wenn diese, aus welchen Gründen auch immer, abgelehnt wird. Sie besitzen nicht die Befugnis, dass sie diejenigen Rechte in Anspruch nehmen können, wie sie Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten der EU oder mit ihren verbundenen GPA-Staaten zustehen. Unbeschadet dessen können solche Unternehmen durch eine Entscheidung der nationalen Vergabestelle zugelassen werden. Ansprüche auf eine Zulassung besitzen diese Unternehmen jedoch nicht.
Diesbezüglich fällt ins Gewicht, dass der Sinn und Zweck der Mitgliedschaft in der EU bzw. eines GPA-Staates gerade derjenige ist, Unternehmen aus den jeweiligen Staaten mit Rechten auszustatten.
Diesbezüglich muss es einen Unterschied geben zu Unternehmen aus sog. Drittstaaten. Es verbietet sich eine Gleichstellung aus dem Blickwinkel des EU-Rechts.
► DIGITALE ANGEBOTSABGABE Allgemeinverfügbare Mittel Fragliche Software-Installation
In einem Vergabeverfahren, welches sich auf Werbe- und Marketingdienstleistungen bezog, wurde ein Bieter infolge eines nicht formgerechten Angebots ausgeschlossen. Mit dem Nachprüfungsantrag wendet er sich gegen die (vermeintliche) Anforderung einer Installation, welche gemäß seinen – allerdings nicht sehr substanziierten – Kenntnissen Sicherheitsbedenken auslösen. Es geht im Kern um die Verwendung von Java bzw. JavaScript. Er trägt vor, dass nicht wenigen Unternehmen gewisse Installationen auf Arbeitsplatz-Rechnern verboten sind, und zwar aus Sicherheitsgründen. Eine Vollinstallation dieser JavaTools führe zu Sicherheitsrisiken. Er habe deswegen dafür sorgen müssen, dass ein externer Dienstleister die EDV-mäßigen Voraussetzungen herstellt. Darin sieht er eine Rechtsverletzung, weil es sich angeblich nicht um allgemein verfügbare elektronische Mittel im Sinne der Paragrafen 10 und 11 der VgV handelt. Die Vergabekammer sieht dies gegenteilig und betont, dass grundsätzlich Java-Elemente in jedem Browser vorinstalliert werden. JavaScript ist eine Programmiersprache für Webseiten. Sie wird nur in einem Webbrowser ausgeführt und ist nicht für einen Download bestimmt. Schon dadurch sei belegt, dass es sich hier um eine allgemein verfügbare Software bzw. allgemein verfügbare elektronische Mittel im Sinne der Paragrafen 10 und 11 VgV handelt. Wenn Sicherheitsvoraussetzungen in einem Unternehmen so beschaffen seien, dass bestimmte Funktionen von externen Dienstleistern ausgeübt werden müssen, so sei dies nicht unter dem Gesichtspunkt unzulässiger elektronischer Mittel angreifbar.
► SCHLECHTLEISTUNGEN
Umfassende Dokumentation
Indizien können genügen Die öffentliche Auftraggeberin hatte mit einem Bieter hatte mit einem Bieter schlechte Erfahrungen betreffend Innenputzarbeiten gemacht. Im Rahmen der erneut gestarteten Ausschreibung zu dem gleichen Gewerk beteiligte sich erneut derjenige Bieter, welcher durch schlechte Leistungen aufgefallen war. Er wurde von ihr von der weiteren Beteiligung am Vergabeverfahren ausgeschlossen. Die Vergabekammer bestätigt diese Nichtberücksichtigung. Sie betont: Der in Paragraf 124 I Nr. 7 GWB verwendete Begriff der mangelhaften Erfüllung ist umfassend im Sinne einer nicht vertragsgerechten Erfüllung zu verstehen. Erfasst sind vertragliche Haupt- und auch Nebenpflichten. Beide Formen der Pflichtverletzungen können gravierende Folgen auslösen. Vorliegend ist die Antragstellerin wiederholt ihrer Mängelbeseitigungspflicht nicht nachgekommen. Prinzipiell können einigermaßen gewichtige Indiztatsachen und erst recht Beweise einer Schlechterfüllung genügen. Es gab aus dem früheren Auftrag heraus zahlreiche Mängelrügen und Nachfristsetzungen sowie eine ca. 50 Seiten umfassende Fotodokumentation. Aus diesen Unterlagen ergeben sich zahlreiche, im Einzelnen dokumentierte Rissbildungen, Abbröckelungen und Abplatzungen im Innenputz sowie mit Fremdkörpern zugesetzte Dehnungsfugen und schließlich mit Putz verunreinigte Sichtbetonwände. Die Nichtberücksichtigung ist nach alledem nicht ermessenfehlerhaft.
VK RheinlandPfalz, Beschl. v. 29.04.2024 (VK 40/23)
VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschl. v. 15.03.2023 (1 VK 1/23)
Impulse auf dem Hamburger Vergabetag (BS/bk) Die Klagen und Forderungen sind bekannt: Unternehmen ächzen unter der Bürokratie. Besonders bei der Teilnahme an Vergabeverfahren stoßen manche an ihre Grenzen. Doch gerade hier ist der Staat auf Unternehmen angewiesen. In manchen Bereichen gibt es so wenige Bewerber, dass kaum ein echter Wettbewerb zustande kommt.
Die Bürokratie sei zu komplex und schrecke von der Teilnahme an öffentlichen Vergaben ab, kritisiert Axel Kloth, Vizepräsident der Handelskammer Hamburg. Er habe große Hoffnungen in das Vergabetransformationsgesetz gesetzt, doch diese seien nicht erfüllt worden. Der Entwurf sei enttäuschend gewesen. Kloth hat den Eindruck, dass das Gesetz eher Erleichterungen für die Auftraggeber bringe, während die Auftragnehmer kaum profitierten. Dies macht er unter anderem an der geplanten Anhebung der Schwellenwerte für die Direktvergabe fest. Auch das geplante Bundestariftreuegesetz sieht er kritisch, da es zusätzlichen bürokratischen Aufwand verursachen könnte. Die Bundesregierung teilt diese Einschätzung nicht, wie sie kürzlich in einer Antwort (Drucksache 20/14596) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion darlegte. Sie sieht durch den Gesetzentwurf keine neuen bürokratischen Belastungen für Unternehmen. In Hamburg
hingegen findet die Kritik Gehör. Bettina Lentz (SPD), Staatsrätin in der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, appelliert an den Bund: „Es braucht eine Vergabetransformation durch die nächste Bundesregierung.“ Dass nicht alles umsonst war, davon sind Marc Greitens, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Heuking, sowie Dr. Tim Schurig, Leiter Grundsatzangelegenheiten der Vergabe in der Finanzbehörde Hamburgs, überzeugt. Greitens weist darauf hin, dass die EU-Kommission eine Änderung der Richtlinie 2014/24/EU zur öffentlichen Auftragsvergabe plane. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) werde dazu Impulse nach Brüssel liefern. Er ist sich sicher, dass Inhalte aus dem Entwurf des Vergabetransformationsgesetzes genutzt werden. Diese Annahme teilt auch Schurig. Die Inhalte würden die Grundlage für die kommenden Diskussionen schaffen. Doch nicht alles sieht der Hamburger Experte positiv. Besonders die geplante An-
hebung der Schwellenwerte für die Direktvergabe hält er für problematisch. Er befürchtet, dass dies faktisch zu einer Abschaffung regulärer Vergabeverfahren führen könnte –ein Widerspruch zu den Prinzipien von Nachhaltigkeit und Wettbewerb. Auch aus Controlling-Sicht sei die Direktvergabe kritisch zu sehen, da sie schwerer nachzuvollziehen sei.

► TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Euronormen
Zusatz „o. glw.“ zwingend Schon seit der Koordinierungsrichtlinie aus dem Jahre 2014 ist ein Verweis auf eingeführte technische Regelwerke sowie auch auf Gütezeichen und Zertifizierungen im weiteren Sinne ganz offiziell rechtlich zulässig. Zwar schreitet die Europäisierung der Normen und sonstigen technischen Standards weiter voran. Dies gilt speziell auch für den Umweltbereich. Jedoch sind in den EU-Mitgliedsstaaten längst noch nicht alle Zertifizierungen und Standards so weitgehend europäisiert, dass nicht auf eventuelle weitere Standards in den jeweiligen Ländern Rücksicht genommen werden müsste. So kam es, dass die bulgarische Gemeinde Pleven bei der Ausschreibung von Betonbordsteinen und Kabeln auf die europäisierte nationale Norm (EN) Bezug genommen hatte, jedoch ohne den Zusatz „oder gleichwertig“. Der EuGH stellt heraus, dass gemäß Art. 42 III Buchst. b RL 2014/24/ EU der Zusatz „oder gleichwertig“ zwingend hinzuzufügen ist, wann immer technische Spezifikationen durch Bezugnahme auf Normen, einschließlich nationaler Normen zur Umsetzung von EN, in die Leistungsbeschreibung Eingang finden. Ausnahmen bestehen selbst für harmonisierte Normen i. S. v. Art. 2 Nr. 11 VO 305/2011 keineswegs.
Zusammenfassung der Entscheidungen: RA und FA für Vergaberecht Dr. Rainer Noch, München (Oppler Büchner PartGmbB)
Monat im Behörden Spiegel ◄
Ausschreibungen · Submissionen
a24salescloud.de Die wie-für-mich-gemacht Ausschreibung

Früher. Passender. Einfacher. So geht Ausschreibung heute. www.a24salescloud.de


Jetzt Ihre Vorteile entdecken




Ein vertrautes Gespräch mit der Schweizer Botschafterin Livia Leu
(BS/ps) In den Kantonen zwischen Genf und Appenzell, von Bern bis Lugano wird Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch gesprochen und alle verstehen sich: „Unus pro omnibus, omnes pro uno" – „Einer für alle, alle für einen". So steht es in der Kuppel der Eingangshalle des Berner Bundeshauses, dem Sitz von Regierung und Parlament. Nicht nur dieses Bekenntnis – „Wir sind ein Volk, und einig wollen wir handeln" –, wie es Friedrich Schiller in seinem Wilhelm Tell II 2 klassisch formuliert, verbindet uns mit den Nachbarn jenseits des Bodensees, sondern noch viele andere kulturelle, politische, wirtschaftliche und sprachliche Gemeinsamkeiten sowie die über 325.000 Deutschen, die in der friedlichen Alpenrepublik leben. Sie sind, nach den Italienern, die zweitgrößte Ausländergruppe. Umgekehrt leben etwa 99.000 Schweizerinnen und Schweizer in der Bundesrepublik, dem wichtigsten Wirtschaftspartner der Eidgenossen.

Nachdem die Schweizer Botschafterin Livia Leu bereits in Teheran und Paris tätig war, arbeitet sie seit Ende 2023 im Konsulat in Berlin und beschäftigt sich unter anderem mit Handels- und Investitionsbeziehungen beider Länder. Foto: BS/Botschaft der Schweiz
All das basiert auf einem soliden, umfassenden und bewährten
Vertragswerk – einschließlich bester Beziehungen zwischen Berlin und Bern. Dass diese weiter gedeihlich bleiben, darum kümmert sich in der deutschen Hauptstadt Livia Leu als Schweizer Botschafterin und damit Interessenvertreterin, Sympathieträgerin, Brückenbauerin, Kommunikatorin, Analytikerin und Managerin. Nach dem Jurastudium 1989 im diplomatischen Dienst arbeitete sie in Bern, Paris und Genf. Ihre nächsten Etappen sind ab 1994 die Vereinten Nationen in New York und verschiedene Funktionen im Berner Außenministerium. 2009 wird Leu als erste Frau Botschafterin in Teheran, 2018 als erste schweizerische Frau Botschafterin in Paris. Danach ruft Außenminister Ignazio Cassis sie im Herbst 2021 zurück nach Bern und sie wird vom Bundesrat zur Staatssekretärin und Chefunterhändlerin mit der EU ernannt. Im November 2023 tritt sie dann ihre aktuelle Funktion als Botschafterin der Schweiz in Deutschland an. „Gerade auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bringt unsere beiden Länder eng zusammen. Ich sage immer gerne: Es ist eine Grenze, die verbindet. Angesichts der wirtschaftlichen Situation in Deutschland verlangen die Handels- und Investitionsbeziehungen derzeit besondere Aufmerksamkeit, ebenso die Kooperationen im Forschungs- und Innovationsbereich.“ Diskussionsbedarf bestehe überdies bei gemeinsamen Herausforderungen in der Migrationspolitik, dem Klimawandel und der digitalen Transformation, so Leu
Neutral, aber mit klaren Positionen
Seit dem Wiener Kongress 1814–15 ist die Schweiz neutral der Welt gegenüber, aber weder passiv noch gleichgültig. Sie vertritt klare Positionen und orientiert sich dabei stets am internationalen Recht, so etwa als gewähltes Mitglied des UNSicherheitsrats (2023–2024). Die Schweiz hat eine lange humanitäre Tradition, die von der Bevölkerung getragen wird. Nicht zufällig ist sie Geburtsort des Roten Kreuzes und der Genfer Konventionen, die den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten gewährleisten und den Kern des humanitären Völkerrechts bilden.
Die Umkehrung der Schweizer Fahne, ein weißes Kreuz auf rotem Grund – das Schweizerkreuz –, in ein rotes Kreuz auf weißem Grund wird 1864 vom Schweizer Gründer Henry Dunant zum Symbol des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) gewählt und weht seither weltweit auf dessen Flagge. Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine leistet Bern humanitäre Hilfe, nimmt ukrainische Flüchtende unbürokratisch auf, trägt die Sanktionen der EU mit und organisiert schon ab 2022 erste Konferenzen zum Wiederaufbau, zum Frieden und zu Minenräumungen: „Ganz allgemein ist die Schweiz eine solidarische Wertepartnerin in Europa und beteiligt sich z. B. auch an den sogenannten Kohäsionszahlungen an ausgewählte EU-Mitglieder. Weltweit arbeitet sie im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (IZA) mit über 40 prioritären Ländern zusammen und leistet dafür einen Beitrag von knapp 0,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts“, erzählt die Botschafterin. Die Strategie zur internationalen Zusammenarbeit (IZA) für die Jahre 2025 bis 2028 wurde 2024 verabschiedet. Sie definiert die Ziele und Schwerpunkte für die Entwicklungs- und die wirtschaftliche Zusammenarbeit, für die humanitäre Hilfe sowie die Förderung des Friedens und der Menschenrechte.
Mediator und Interessenvertretung
Zudem habe die Friedensförderung eine lange Tradition – als Korrelat zur Neutralität. Ziel der sogenannten „Guten Dienste“ sei es, Differenzen und Konflikte zwischen Staaten auf politischem Weg beizulegen. Dazu zählten die Erleichterung des Dialogs (Fazilitation) oder Vermittlung (Mediation) in Konflikten, die Organisation internationaler Konferenzen oder auch die Wahrnehmung von Schutzmachtmandaten. „Ich hatte persönlich die Gelegenheit, diese Funktion im Rahmen meines Einsatzes als Botschafterin im Iran wahrzunehmen, wo die Schweiz seit nunmehr 45 Jahren die Interessen der USA vertritt“.
Und weil der „Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“, so Schillers Wilhelm Tell hellsichtig zum Feldschützen Stüssi im
4. Akt, sorgen sich die friedfertigen Schweizer sehr wohl über die Rückkehr des Krieges nach Europa. „Er hat unsere Gesellschaften erschüttert und leider das Ende des Prinzips „Sicherheit durch Zusammenarbeit“ in Europa besiegelt“, so Botschafterin Leu. „Die hohe Anzahl an Opfern und das große Leid der Zivilbevölkerung lösen bei unserer Bevölkerung tiefe Betroffenheit aus.“ Leider gebe es weltweit noch weitere gravierende Krisen, etwa im Sudan. Die Schweiz setze sich überall für die friedliche Beilegung von Konflikten sowie nachhaltige, gerechte Lösungen ein, in Nahost für die Zweistaatenlösung.
Besondere Rolle in der europäischen Architektur Als neutralem Staat kommt der Schweiz eine besondere Rolle im europäischen Sicherheitskontext zu. Mit Deutschland wird eng bei einer breiten Palette von Themen zusammengearbeitet, von der Katastrophenhilfe über Cyber-Abwehr und Ausbildung bis hin zur Friedensförderung. „Weiter sei unsere Teilnahme an ausgewählten Projekten der Permanent Structured Cooperation (PESCO) der EU genannt.“ Diese ermögliche es, die Verteidigungsfähigkeit im Einklang mit den Neutralitätspflichten zu stärken. Die Schweiz beteilige sich zudem an der von Deutschland initiierten European Sky Shield Initiative (ESSI), welche eine bessere Koordination bei der bodengestützten Luftverteidigung erlaubt. Seit 1996 nehme die Schweiz an der Partnerschaft für den Frieden (Partnership for Peace) der NATO teil und fördere damit den Erfahrungsaustausch sowie die Fähigkeit zur Interoperabilität, um eine nahtlose Zusammenarbeit verschiedener Systeme und Technologien zu ermöglichen. All dies seien Beispiele des Engagements zu Stabilität und Sicherheit in Europa. Der Krieg gegen die Ukraine hat Europa und die Schweiz sicherheitspolitisch zusammengerückt, auch wenn diese eine etwas andere Rolle spielt als Land außerhalb der EU und der NATO. „Die Schweiz und Deutschland haben seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Bonn im Jahr 1952 ein vertrautes, vielfältiges und gutnachbarliches Verhältnis aufgebaut, basierend auf ähnlichen
gesellschafts-, wirtschafts- und außenpolitischen Zielsetzungen. Man begegnet sich auf Augenhöhe, mit Respekt, Sympathie, einer gemeinsamen Sprache, geteilten Werten und ähnlicher Kultur.“ Die Schweiz werde grundsätzlich als stabiles, zuverlässiges und erfolgreiches Land wahrgenommen. Die Wertschätzung freue sie und das Land arbeite täglich daran, das positive Bild durch gemeinsame Erfolge weiter zu stärken. Seit 35 Jahren ist Livia Leu mittlerweile Schweizer Diplomatin und darf sich, mit Blick zurück, eigentlich entspannt zurücklehnen. Mit wem würde sie vielleicht trotzdem mal für einen Tag den Platz tauschen wollen? „Ich fände es span
Rezept der Botschafterin
Capuns sursilvans
Zutaten:
nend, mal einen Tag lang Intendantin der Berliner Philharmonie zu sein“, antwortet sie. Aber wichtiger ist ihr: „Wir haben noch gar nicht über das Verhältnis der Schweiz zur EU gesprochen, das die Leute in Deutschland interessiert. Derzeit sind wir wieder in Verhandlungen mit der EU über eine Stabilisierung und Weiterentwicklung des bilateralen Weges und machen dabei gute Fortschritte.“ Das freut sie besonders, durfte sie doch in ihrer vorherigen Funktion als Staatssekretärin und Chefunterhändlerin mit der EU die Vorbereitung der Verhandlungen leiten. Leu ist zuversichtlich, dass das nun vorliegende Paket gute Chancen auf Erfolg im gegenseitigen Interesse hat.
150 g Mehl, 0,5 dl Milch, 2 Eier, verquirlt, 1 Prise Salz, 20 g Magerspeck, fein gewürfelt, 20 g Salsiz (luftgetrocknete oder geräucherte Rohwurst), fein gewürfelt, 20 g Bündnerfleisch, fein gewürfelt, 10 g Lauch, fein gewürfelt, 20 g Zwiebeln, fein gehackt, 10g Butter, ein wenig Rosmarin, Petersilie und Basilikum, frisch, fein gehackt, 40 junge Stielmangoldblätter, 1 EL Butter, 2 dl Bouillon, 1 dl Rahm, 20 g Rohschinken
Zubereitung:
Für den Teig Mehl und die Prise Salz (auf keinen Fall mehr, da die übrigen Zutaten recht salzig sind) in eine Schüssel geben. Milch und Eier mischen und nach und nach unter das Mehl rühren. Teig so lange schlagen, bis er Blasen wirft. Teig eine halbe Stunde ruhen lassen. Magerspeck, Salsiz, Bündnerfleisch, Lauch und Zwiebeln in der Butter dünsten.
Kräuter kurz mitdünsten. Mischung unter den Teig rühren. Stielmangoldblätter kurz blanchieren und im kalten Wasser (wenn möglich mit ein paar Eiswürfeln) abkühlen lassen. Blätter auf ein Tuch ausbreiten und trocken tupfen.
Einen Kaffeelöffel Füllung auf jedes Blatt geben. Zu Wickeln einrollen. Krautwickel in Butter kurz anbraten. Mit der Bouillon ablöschen. Rahm beigeben und zirka fünf Minuten köcheln lassen.
Anrichtung: Krautwickel auf dem Teller mit dem gebratenen Rohschinken bestreuen. Zu den Capuns kann geriebener Käse serviert werden.
Der Name dieser heute vor allem dem Vorderrheintal zugeordneten Mehlspeise leitet sich vom Bild des gemästeten, gebratenen und gefüllten Hähnchens ab, im Rätoromanischen mit dem Begriff capun oder chapun bezeichnet. Diese „Kraut-Kapaunen“ werden in den verschiedensten Varianten zubereitet. Als besonders originell seien hier die capuns cun olma (Capuns mit Seele) aus Flond erwähnt, wo man ein Stückchen Butter in die Mitte des Kloßes legt. Die Butter schmilzt anschließend und so entsteht im Innern ein Loch, die olma Dazu passt vorzüglich ein Riesling oder ein Pilsner. Prost. Foto: BS/Schubert, generiert durch Adobe Firefly


„Schwimmen zu können ist so wichtig wie laufen.“ Mit diesem Satz unterstreicht Jan Pommer die Notwendigkeit, ins Handeln zu kommen – und das schnell. Er ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Schwimmverbands (DSV) und bezeichnet die Einsparungen beim Betrieb von öffentlichen Bädern als „einen völlig falschen Schritt“. Dennoch sehen sich derzeit viele Städte und Gemeinden dazu gezwungen.
„Teile des Sportangebots in den Kommunen sind in Gefahr. Es gibt einen großen Investitionsstau.“
Dr. Stefanie Brilon, Kommunalexpertin bei der KfW
Eine Mitte Januar veröffentlichte Studie, die das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durchgeführt hat, kommt dementsprechend zu dem Schluss: 40 Prozent der Kommunen mussten bereits einzelne Sportangebote wegen des baulichen Zustands ihrer Sportanlagen streichen – 36 Prozent befürchten, dass sie ihre Angebote aufgrund bröckelnder Turnhallen und maroder Sportbäder in den kommenden Jahren reduzieren müssen. „Teile des Sportangebots

(BS/Anne Mareile Walter) Viele Kommunen stecken tief in den roten Zahlen, die Finanzmisere strahlt auch auf den Breitensport aus: Jedem siebten Schwimmbad droht ohne Sanierung demnächst die Schließung, andernorts werden Sportangebote drastisch eingekürzt.
in den Kommunen sind in Gefahr. Es gibt einen großen Investitionsstau“, erklärt dazu Dr. Stefanie Brilon, Kommunalexpertin bei der KfW.
Dies untermauert die Difu-Analyse mit folgenden Zahlen: Sofern keine umfassenden Sanierungen vorgenommen werden, wird in den kommenden drei Jahren jedes siebte Schwimmbad schließen müssen. Konkret bedeutet das: 800 Bäder gingen verloren.
Für die Erhebung zur Situation der kommunalen Sportanlagen wurden insgesamt 307 Städte, Gemeinden und Landkreise im Oktober vergangenen Jahres befragt. 59 Prozent bezeichneten dabei den Investitionsrückstand der eigenen Sportanlagen als „gravierend“ oder „nennenswert“, in Bezug auf den Zustand der Hallenbäder sagten das 62 Prozent.
Verzicht auf kleinteilige Förderprogramme
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) spricht von einer „dramatischen Entwicklung“. DStGB-Hauptgeschäftsführer André Berghegger betont: Das sei ein „fatales Signal“ an den Breitensport und den Schwimmunterricht. Er sieht den Bund und die Länder in der Pflicht, Neubauten und Sanierungen in Zukunft finanziell besser zu unterstützen. Auch sei eine groß angelegte Investitionsoffensive für die Sportinfrastruktur unausweichlich. Es solle auf kleinteilige Förderprogramme verzichtet werden, stattdessen müssten Budgets für die Kommunen aufgesetzt werden, so seine Forderung.
Der Deutsche Schwimmverband (DSV) äußert sich ebenfalls besorgt. Mit der jetzigen Infrastruktur werde nicht mehr gewährleistet, dass alle Kinder und Erwachsenen schwim-
men lernen, teilt er mit und weist auf eine Analyse des Schwimmverbandes Nordrhein-Westfalen hin, laut der in dem bevölkerungsreichsten Bundesland mehr als 100 öffentliche Bäder aus Kostengründen nicht mehr von den Kommunen selbst getragen werden. Stattdessen übernehmen die Aufgabe Schwimmvereine sowie Bürgerinnen und Bürger.
Steuerprivilegien für Schwimmbäder erhalten
Der DSV schlägt ein „umfassendes Investitionsprogramm“ vor und schließt sich damit dem Appell des DStGB an. Hierfür müssten Bund und Länder die Fördergrundlagen schaffen.
„Das Bundesprogramm sollte langfristig angelegt und bürokratiearm ausgestaltet werden und die flexible Verwendung der Fördermittel ermöglichen“, erklärt Jan Pommer Eine weitere Forderung des DSV: Der Betrieb von Schwimmbädern solle per Gesetz zur kommunalen Pflichtaufgabe werden. Die Steuerprivilegien und Regelungen zum steuerlichen Querverbund gelte es zu erhalten und zu erweitern. Um die Finanzmisere zu lösen, schlägt der Verband zudem vor, Bäderstandorte gemeinsam zu betreiben sowie mehrere Bäder als ServiceGmbH zu organisieren und so Kommunen zu entlasten.
Indes verweist der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf eine Kurzexpertise aus dem Jahr 2018, die den Sanierungsstau bei den Sportstätten auf 31 Milliarden Euro bezifferte. Durch die seitdem erfolgten Preissteigerungen und notwendigen energetischen Standards sei mittlerweile von einem „deutlich höheren Sanierungsstau“ auszugehen, so der DOSB weiter.
Um der drohenden Schließung von kommunalen Sportstätten mit Alternativen zu begegnen, initiierte der DOSB für Sportvereine ein zwei Jahre dauerndes Projekt, innerhalb dessen mehr Sportangebote ins Freie verlagert werden sollen. Eine Universallösung für den Sanierungsstau sei das aber nicht, erklärt Pressesprecher Björn Jensen: „Ein Ausweichen ins Freie ist nicht bei allen Sportarten und allen Altersklassen möglich.“
„Nicht
bei allen Sportarten und Altersklassen ist ein Ausweichen ins Freie möglich.“
Björn Jensen, Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes
So seien gerade für den Wettkampfsport genormte Sportstätten nötig, es brauche ein breites Spektrum von klassischen Sportstätten bis hin zu Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Eine Verlagerung des Sportangebots hält auch Helmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags (DST), nicht für das Allheilmittel. „Der öffentliche Raum kann klassische Sportanlagen nie komplett ersetzen“, betont er. „Bund und Länder müssen die Finanzsituation der Städte grundlegend verbessern.“
Dass es den Appell umzusetzen gilt, zeigt auch folgendes Ergebnis der Difu-Analyse: Bereits jede fünfte Kommune nahm einzelne Sportstätten aus dem Betrieb. Die Lösungsvorschläge aus den Reihen der Städte und Gemeinden selbst beziehen sich derweil vor allem auf eine bessere finanzielle Grundausstattung – 76 Prozent der befragten Kommunen fordern das. 55 Prozent halten eine Entbürokratisierung von Förderprogrammen für sinnvoll. Für einen geringeren Eigenmittelanteil stimmen 31 Prozent und eine Aufstockung von Förderprogrammen trifft in knapp einer von drei Kommunen auf Zustimmung (29 Prozent).
Ein Viertel der Kommunen errichtete neue Sportanlagen Trotz der finanziellen Widrigkeiten halten Kommunen aber grundsätzlich am Betrieb ihrer Sportstätten fest. Immerhin 94 Prozent von ihnen waren 2024 im Besitz einer Sporthalle, 92 Prozent verfügten über einen Sportplatz. Etwas mehr als die Hälfte hatte ein Freibad, 46 Prozent betrieben Hallenbäder. Zwei Drittel der Befragten gaben zudem an, die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze in den vergangenen zehn Jahren konstant gehalten zu haben und ein Viertel der Kommunen errichtete neue Sportanlagen.
„Schwimmbäder bieten nicht nur Menschen aller Altersgruppen und sozialen Schichten ein Angebot zur Bewegung. Sie sind auch soziale Ankerpunkte und unverzichtbare Stätten der Gemeinschaft sowie ein Ort der gelebten Integration“, sagt Jan Pommer. Damit das so bleibt, müssen Bund und Länder in Zukunft stärker an den finanziellen Verteilungsschrauben drehen.









Foto: BS/Ali-Cemil Sat
ehörden Spiegel: Sie sind bereits seit Jahren in der Münchberger Kommunalpolitik aktiv. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück und was hat Sie dazu bewogen, ihr Engagement auf die Bundesebene zu verlagern?
Ali-Cemil Sat: Die Erfahrungen, die ich in der Kommunalpolitik machen durfte, bedeuten mir sehr viel und begleiten mich tagtäglich. Sie war geprägt von intensiver Arbeit besonders im direkten Austausch mit den Menschen vor Ort. Dabei ging es uns immer darum, konkrete Lösungen für alltägliche Probleme zu finden und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Lebensqualität in unserer Heimatstadt zu verbessern. Vor Ort in den Kommunen erleben wir hautnah, wie sich die politischen Entscheidungen der höheren Ebenen auf das Leben der Menschen auswirken. Besonders in einer Zeit, die von so vielen verschiedenen Herausforderungen geprägt ist, wie in den vergangenen Jahren, lassen sich viele Probleme nicht mehr auf kommunaler, sondern nur noch auf Bundesebene effektiv angehen. Um aktiv Lösungen für die Sorgen und Nöte der Menschen zu finden, muss auch ich mein Engagement deshalb auf die Bundesebene verlagern.
Behörden Spiegel: Welche besonderen Erfahrungen oder Kenntnisse bringt man als Kommunalpolitiker in den Bundestag mit ein, die anderen Kandidierenden fehlen?
Sat: Aus meiner Perspektive heraus kann ich behaupten, dass ich gelernt habe, direkt Verantwortung zu über-
S
eit 2008 hat die Kommunalrichtlinie den Klimaschutz als strategisches Thema in Kommunen etabliert. Viele Gemeinden verfügen heute über Klimaschutzkonzepte und entsprechendes Fachpersonal. Unter dem Eindruck der Klimaproteste ab 2019 haben zahlreiche Kommunen ihre Klimaschutzziele ambitionierter gestaltet und häufig vorgezogen, oft mit früheren Zieljahren als die Bundesregierung, die Klimaneutralität bis 2045 anstrebt.
Kommunale Rollen und Möglichkeiten im Klimaschutz
Das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) hat in mehreren Studien die Rollen und Potenziale von Kommunen im Klimaschutz analysiert. Die aktuelle Studie „Kommunale Klimaschutzambitionen“, die im Auftrag das Umweltbundesamts (UBA) erstellt wurde, befasste sich mit der Frage, welche Klimaschutzziele Kommunen aufsetzen sollten und inwieweit diese durch eigene Aktivitäten erreichbar sind.
Die Studie empfiehlt Kommunen, ihre Klimaschutzziele zu diversifizieren. Kommunen müssen in verschiedenen Bereichen einen Beitrag zur nationalen Zielerreichung leisten. Dieser ist durch die lokale Treibhausgas (THG)-Minderung allein nicht abgebildet. Es wird empfohlen, dass Kommunen zusätzlich Klimaschutzziele in den folgenden drei Handlungsfeldern formulieren und ihre vorhandenen Potenziale maximal ausschöpfen: Reduktion des lokalen Endenergieverbrauchs, Ausbau erneuerbarer Stromerzeu-
Interview mit Ali-Cemil Sat, Direktkandidat des Wahlkreises Kulmbach
Sind Kommunalpolitiker die besseren Bundestagsabgeordneten?
(BS) Wer für den Bundestag kandidiert, muss sich auf eine lange Ochsentour durch die eigene Partei einstellen, doch Erfahrung in der Kommunalpolitik ist keine Grundvoraussetzung. Warum dieses Know-how aber entscheidende Vorteile mit sich bringt, erklärt der Direktkandidat des Wahlkreises Kulmbach, Ali-Cemil Sat. Die Fragen stellte Julian Faber.

nehmen und immer die Bedürfnisse der Menschen im Blick zu haben. Bei uns in der Kommunalpolitik geht es nicht um abstrakte Diskussionen, sondern um konkrete Lösungen, die sich direkt auf das Leben der Menschen vor Ort auswirken. Mit begrenzten Mitteln zu arbeiten, unter Einbezug der Bürger, um am Ende erfolgreich ein Projekt umzusetzen – das ist die Erfahrung, die mir die Kommunalpolitik geschenkt hat und die anderen vielleicht fehlt. Kritikfähigkeit und Selbstreflexion zähle ich auch dazu,
denn das direkte Feedback, das uns die Bürger mitgeben, müssen wir verstehen und in unsere politischen Entscheidungen integrieren. Deshalb bringe ich nicht nur politische Erfahrung, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen vor Ort mit.
Behörden Spiegel: Ihre Hauptthemen sind soziale Ungleichheit sowie der Einsatz für den ländlichen Raum. Wie genau möchten Sie diese Themenfelder im Bundestag bearbeiten?
Sat: Ja, das stimmt. Die Bekämpfung existenzieller Ängste wie sozialer Ungleichheiten, aber auch die Stärkung des ländlichen Raums sind für mich entscheidende Kernthemen. Ich möchte die Schere zwischen Arm und Reich schließen und das vor allem durch eine gerechte Steuerpolitik, die die Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen entlastet. Wir müssen Chancengleichheit schaffen, damit alle Kinder, unabhängig von ihrer Familiengeschichte, die gleichen Möglichkeiten für ein gutes Leben haben. Außerdem müssen wir das Thema Rente angehen, um den Menschen ein sicheres und respektvolles Leben im Alter zu ermöglichen. Für den ländlichen Raum setze ich mich vor allem für eine bessere Infrastruktur ein, besonders in den Bereichen Mobilität und Digitalisierung. Wir brauchen flächendeckend schnelles Internet, um die ländlichen Regionen nicht von den Großstädten abzuhängen.
Gleichzeitig ist es wichtig, dass durch die gezielte Förderung von Arbeitsplätzen und lokalem Unternehmertum, gerade auch in der Gastronomie, die ländlichen Gebiete lebendig bleiben, um sie auch weiterhin als attraktiven Lebens- und Arbeitsort zu erhalten.
Kommunale Handlungsspielräume im Klimaschutz
(BS/Benjamin Gugel) Eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes zeigt, wie Kommunen ihre Klimaschutzziele formulieren sollten, um diese schlussendlich auch umsetzen zu können. Eine lokale Treibhausgas-Minderung allein reicht nicht.
gung sowie Entwicklung und Pflege lokaler CO2-Senken. Dabei verfügen Kommunen über drei wesentliche Hebel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen:
Eigener Handlungsbereich: Umsetzung der THG-Potenziale im eigenen Handlungsbereich, speziell im Bereich der Verwaltungsgebäude, des kommunalen Fuhrparks und der Beschaffung.
Einfluss auf kommunale Unternehmen: Es wurde in verschiedenen Studien deutlich, dass dieser kommunale Einflussbereich eine hohe Relevanz besitzen kann, insbesondere wenn die Wärmeversorgung in der Hand kommunaler Unternehmen (Stadtwerke) liegt. Motivation lokaler Akteure: Durch die Instrumente „Regulierung“, „finanzielle Anreize“, „Versorgung“ und „Information“ können lokale Akteure motiviert werden, THG-mindernde Maßnahmen umzusetzen. Dieser Hebel ist wichtig, da Akteure ohne diese Anreize nur bedingt aktiv werden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Kommunen mit diesen Instrumenten in einem Mehrebenensystem mit EU, Bund und Ländern agieren. Es ist deswegen sinnvoll, die begrenzten kommunalen Mög-
lichkeiten mit den Aktivitäten anderer Ebenen abzugleichen. Priorisierung kommunaler Klimaschutzstrategien Ein solcher Abgleich kommunaler Möglichkeiten erfolgte im Projekt „Instrumente für die kommunale Klimaschutzarbeit (IkKa)“, das vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) durchgeführt wurde. Dort wurde untersucht, in welchen Handlungsfeldern Kommunen prioritär einen Beitrag zum Klimaschutz leisten sollten. Eine pauschale Blaupause für alle Kommunen oder einen Standardmaßnahmenkatalog im Klimaschutz kann es dabei nicht geben. Jede Kommune ist strukturell unterschiedlich. Auch haben Kommunen administrativ und mit ihren kommunalen Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten, auf den Klimaschutz Einfluss zu nehmen.
Für eine objektive Priorisierung von Klimaschutzstrategien werden im IkKa-Projekt zwei gleichwertige Bewertungskriterien vorgeschlagen: mögliche THG-Minderungen in den verschiedenen Strategien sowie die Einflussmöglichkeit einer Kommune innerhalb des Mehrebenensystems in diesen Strategien. Die unterschiedlichen kommunalen Einflussmöglichkeiten wurden
im Projekt erstmals für 31 Klimaschutzstrategien ermittelt und in einem Bericht veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Priorisierung zeigt Kommunen objektiv auf, in welchen Klimaschutzhandlungsfeldern sie prioritär in den nächsten Jahren aktiv werden sollten und unterstützt damit bei der Entwicklung einer spezifischen lokalen Klimaschutzstrategie.
Realistische Einschätzung kommunaler Klimaschutzziele
Die IkkA-Methodik wurde auch in der zuvor beschriebenen UBAStudie genutzt. Anhand von drei Beispielkommunen wird die Erreichbarkeit lokaler Treibhausgasneutralität bis 2030 untersucht.
Die Ergebnisse zeigen, dass selbst bei voller Ausschöpfung aller kommunalen Stellhebel nach IkKa nur etwa 50 Prozent Emissionsminderungen gegenüber 2021 erzielt werden könnten. Hauptursache ist, dass die politischen Rahmenbedingungen, in denen die Kommune agiert (Land, Bund, EU) auf deutlich spätere Zieljahre ausgelegt sind. Kommunen können also vorgezogene Klimaschutzziele nicht allein erreichen.
Behörden Spiegel: Sie sind aktuell der jüngste bekannte Direktkandidat für die Bundestagswahl 2025. Wie könnte man mehr junge Menschen für politisches Engagement begeistern, sei es auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene?

Sat: Für unseren Wahlkreis Kulmbach, Lichtenfels und Bamberg-Land mag das sicherlich wahr sein, aber es gibt noch viele andere, teilweise jüngere Kandidatinnen und Kandidaten im Bundesgebiet. Dadurch sehen wir alleine schon: Die Jugend ist politisch und möchte mitgestalten. Es gibt jedoch eine Menge junger Menschen, die sich weder gehört noch ernst genommen fühlen. In den Parlamenten wird über unsere Zukunft entschieden, doch mit uns geredet wird kaum. Solange wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, werden wir junge Leute auch nicht politisch an uns binden können. Außerdem braucht es dringend mehr Partizipationsmöglichkeiten auch in den Kommunen sowie mehr demokratische Strukturen in den Schulen.
Es wird deswegen empfohlen, vorgezogene kommunale Klimaschutzziele differenziert zu betrachten. Auf strategischer Ebene bedeutet das: Für die Zielstellung dient das vorgezogene Zieljahr weiterhin. Damit wird die Bedeutung des Themas nach außen sichtbar und innerhalb der Verwaltung die Priorität des Klimaschutzes verdeutlicht. Die operative Zielstellung hingegen bedeutet, dass Kommunen bei allen genannten Stellhebeln ihre maximalen Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen. Die Ausschöpfung der eigenen Möglichkeiten im kommunalen Klimaschutz-Monitoring wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Ab 2025 wird mit dem Maßnahmen-Planer ein Online-Instrument zur Verfügung stehen, das die Darstellung dieser Ausschöpfung ermöglicht. Diese differenzierte Betrachtungsweise ermöglicht es Kommunen, ihren Beitrag zur nationalen Treibhausgasneutralität transparent darzustellen und gleichzeitig realistische operative Ziele zu verfolgen.

Benjamin Gugel arbeitet seit 2007 am Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu). Er koordiniert dort das Themenfeld des kommunalen Klimaschutzmonitorings. Ziel ist es, Forschungsergebnisse für Kommunen so aufzubereiten, dass diese in der Klimaschutzpraxis erfolgreich umgesetzt werden können. Gugel leitete das „IkKa-Projekt“ und arbeitete im UBA-Projekt „Kommunale Klimaschutzambitionen“ mit. Foto: BS/privat
Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Öffentlichen Dienstes. Davon sind auch die Kommunen betroffen. So stellt sich die Frage, ob und wie die Parteien die Kommunen bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben unterstützen wollen.
Partei Wie sollte der Bund die Kommunen finanziell besser unterstützen?







„Kommunen brauchen eine langfristig tragfähige finanzielle Ausstattung.
Dazu muss vor allem der Grundsatz der Konnexität eingehalten werden: Wer eine Leistung veranlasst oder ausweitet, muss für ihre Finanzierung aufkommen. Das gilt vor allem für Gesetze des Bundes, die bei den Kommunen zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen führen. Bund und Länder müssen zudem gemeinsam mit den Kommunen Lösungen finden, die Dynamik bei den Sozialausgaben zu stoppen. Darüber hinaus müssen die kommunal relevanten Förderprogramme des Bundes einfacher in der Abwicklung werden, indem sie zusammengefasst und auf einer Online-Plattform gebündelt werden. Fristen sollten realitätsnah gefasst, Antragsverfahren vereinfacht und Nachweispflichten reduziert werden.“
„Wir sehen die Notwendigkeit, den Kommunen mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen, damit sie ihre Aufgaben bewältigen können. Sowohl der Deutschlandfonds als auch die Reform der Schuldenbremse für die Länder bieten hierfür geeignete Ansätze. Ein großer Teil der Investitionen für den Strukturwandel erfolgt auf kommunaler Ebene, doch viele Kommunen stehen finanziell unter Druck. Es bedarf endlich einer Lösung des spezifischen Problems der kommunalen Altschulden. Dabei wollen wir dafür Sorge tragen, dass auch die Situation der ostdeutschen Kommunen berücksichtigt wird, welche ebenfalls durch unverschuldete Altlasten herausgefordert sind. Zudem setzen wir uns für langfristige Finanzierungsvereinbarungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen ein. Die Infrastrukturplanung soll durch größere Kapazitäten und eine vereinfachte Förderung gestärkt werden. Über den Deutschlandfonds wollen wir kommunale Unternehmen mit Eigenkapitalzuschüssen beziehungsweise langfristigen Darlehen unterstützen.“





23. FEBRUAR 2025


Sollen Kommunen in Gesetzgebungsprozesse besser eingebunden werden und wenn ja, wie?
„Die Voraussetzung für ein erfolgreiches Miteinander von Bund, Ländern und Kommunen ist, dass die Kommunen bei der Bund-Länder-Koordinierung frühzeitig eingebunden werden. Für einen besseren Gesetzgebungsprozess muss die kommunale Praxiserfahrung stärker berücksichtigt werden. Es sind die Kommunen, die vielfach die Umsetzung von Maßnahmen verantworten.“
„Wir setzen uns für starke Kommunen ein und fördern die Beteiligung der Menschen vor Ort durch Bürgerforen, digitale Plattformen und Partizipationsprojekte. Dazu gehört auch die Einrichtung kommunaler Entwicklungsbeiräte, in denen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam Empfehlungen für langfristige Entscheidungen erarbeiten können.“
„Die föderale Struktur und Verwaltung in Deutschland hat sich bewährt, aber sie braucht ein Update, das Effizienz und Bürgerfreundlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Ein agiler Staat, der zeigt, dass er sich selbst reformieren kann, beweist seine Handlungsfähigkeit und stärkt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in demokratische Institutionen. Eine Generalinventur ist dafür der erste notwendige Schritt. Es müssen alle föderalen Zuständigkeiten und Verwaltungsprozesse einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Zu viele Behörden auf Bundes- und Landesebene sowie in den Kommunen überschneiden sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Generalinventur muss von einem klaren politischen Willen getragen sein, die Effizienz und Handlungsfähigkeit des Staates zu verbessern und mit einer Föderalismusreform abgeschlossen werden. Für uns haben Reformen im Finanz- und im Bildungsbereich, bei der Inneren Sicherheit, dem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, der Migration und der Digitalisierung Priorität.“
„Die Frage, wie der Bund die Kommunen finanziell besser unterstützen kann, ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Um gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen zu ermöglichen, muss die Verteilung der Steuern zwischen Bund, Ländern und Kommunen den tatsächlichen Aufgaben und Investitionsbedarfen entsprechen.“
„Generell muss das Konnexitätsprinzip konsequenter angewendet werden. Die Linke fordert als Sofortmaßnahme zur Entlastung der Kommunen die Übernahme der Kosten für die Aufnahme Asylsuchender. Kommunen in den Regionen, die vom Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung und dem Umbau der Industrie in Richtung Klimafreundlichkeit besonders betroffen sind, müssen Mittel aus einem neu aufgebauten Klima- und Transformationsfonds erhalten.“
„Es sind die Kommunen, die die Bedürfnisse vor Ort am besten kennen und daher auch entscheiden sollten, wie diese Bedürfnisse am besten erfüllt werden können. Zu oft werden Gesetze und Vorgaben aus den Hauptstädten gemacht, ohne dass die Kommunen ausreichend beteiligt werden. Dies kann dazu führen, dass die Gesetze und Vorgaben nicht den tatsächlichen Bedürfnissen vor Ort entsprechen.
In der vergangenen Legislaturperiode haben wir die Möglichkeiten der Kommunen gestärkt, von Energieprojekten zu profitieren. Wir werden dies in Zukunft noch weiter ausbauen, indem wir Förderprogramme für die Kommunen vereinfachen und nach klaren Regeln gestalten. Konkret werden wir die Förderprogramme weiter vereinfachen, indem wir Bürokratie abbauen, klare Antragsverfahren einführen, die Finanzmittel den Kommunen künftig direkt zur Verfügung stellen und die ungebundenen kommunalen Mittel stärken.“
„Bislang werden die Kommunen in den Gesetzgebungsprozessen des Bundes vor allem durch ihre kommunalen Spitzenverbände vertreten und besitzen im Innenausschuss des Bundestages besondere Rechte (u.a. Entsendung von Sachverständigen in öffentliche Anhörungen). Allerdings wird ihre Expertise zu wenig eigeninitiativ abgefragt.“
Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.
Anstehen, Nummer ziehen, warten. Das ist längst Alltag für die Menschen beim Besuch des Bürgerzentrums in Trier. Relativ neu ist, dass das Aufrufsystem oft schon gegen Mittag eingestellt wird – wenn absehbar ist, dass nachfolgende Bürger nicht mehr bedient werden können. Wer dann noch in der Schlange steht, hat Pech gehabt. Morgen ist auch noch ein Tag.
Katalysator des Investitionsstaus
„Wir haben keinen Fachkräftemangel, sondern einen Kräftemangel,“ stellt Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des DStGB-NRW klar. Nach Angaben der Deutschen Steuer-Gewerkschaft fehlen etwa 572.900 Mitarbeitende im Öffentlichen Dienst, davon 108.500 in der Kommunalverwaltung. Die Personalnot könne „die Daseinsvorsorge an den Rand des Zusammenbruchs bringen“, heißt es vom DStGB-Hauptgeschäftsführer Andre Berghegger. Er warnt vor einem „schleichenden Blackout der Kommunalverwaltung“ innerhalb der nächsten zehn Jahre.
Nach Angabe des Deutschen Städtetages (DST) fehlt es vor allem in den Hoch- und Tiefbauämtern an Mitarbeitenden. Das wirke sich auch auf dringende Bau- und Infrastrukturprojekte aus. Die Notsituation betreffe „einerseits die Gewinnung von eigenem Personal, andererseits können externe Aufträge aufgrund von Kapazitätsengpässen in Planungsbüros nur schwer oder gar nicht vergeben werden“, so der DStGB. Wie viele der Verzögerungen kommunaler Infrastrukturprojekte primär auf Personalmangel zurückzuführen sind, konnten die Landesregierungen in NRW, Bayern und Berlin auf Nachfrage nicht beantworten.
Mehr als nur Fachkräftemangel
In der Fläche betreffe der Notstand die gesamte Bandbreite städtischer Tätigkeitsfelder. Besonders groß seien die Engpässe „in der Kinderbetreuung, im Pflegebereich, in den Hoch- und Tiefbauämtern, bei den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden, in der IT, aber auch bei den
(BS/Julian Faber) Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) warnt vor einem schleichenden Blackout der Kommunalverwaltung. Die Personalnot im kommunalen Öffentlichen Dienst gefährdet zunehmend die Sicherung der Daseinsvorsorge. Der Ruhestand hunderttausender Beschäftigter in den nächsten zehn Jahren verschärft die Lage weiter.

Umwelt- und Bürgerämtern“, berichtet DST-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Und auch außerhalb der Ämter und Behörden sehe es düster aus. Laut Berghegger gehen in den nächsten fünf Jahren beispielsweise mehr als 50.000 Busfahrer in den Ruhestand.
In Hamburg habe sich die Zahl ausgeschriebener Stellen im Öffentlichen Dienst seit 2013 verdreifacht, in rund 35 Prozent reiche eine einmalige Ausschreibung zur Besetzung nicht mehr aus. In
Köln fehle es vor allem an Personal im Außen- und Ordnungsdienst, in andere Kommunen primär an ausgelernten Verwaltungskräften. Gleichzeitig bleiben offene Ausbildungsplätze in der Stadtverwaltung oft unbesetzt. Die Priorisierung von Projekten und Aufgaben sei deshalb längst Standard, heißt es beispielsweise aus Köln. In kleineren Kommunen bleiben selbst Schlüsselpositionen, wie die des Kämmerers, immer öfter auf unbestimmte Zeit vakant. Das führt zu Mehr-
belastungen des bestehenden Verwaltungsapparates. In Teterow in Mecklenburg-Vorpommern wurde beispielsweise der Fachbereich Zentrale Dienste nach mehreren vergeblichen Ausschreibungen auf unbestimmte Zeit eingestellt. Arbeitsmigration unverzichtbar Personalgewinnung im Ausland scheitere vor allem an zu langwierigen Anerkennungsverfahren von Qualifikationen in den deutschen Auslandsvertretungen, so
der DStGB. Dabei sei Arbeitsmigration zur Lösung der Problematik unverzichtbar: „Eine geregelte Zuwanderung von ausländischen Fachkräften kann helfen, gerade die Berufe zu stärken, in denen besonders großer Mangel herrscht“, so Dedy. Die Unterstützung dürfe aber nicht mit der Einwanderung enden: „Den Menschen, die voller Tatkraft zu uns kommen, muss auch der Weg zu einer gesellschaftlichen Integration geebnet werden.“ Ein Baustein könnte der Job-Turbo des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sein. Er soll die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt beschleunigen, steht jedoch als dysfunktionales Bürokratiemonster in der Kritik. Ausgerechnet die Anerkennung ausländischer Qualifikationen beschleunige der Turbo nicht, kritisiert u. a. der Bundesrechnungshof.
Bund und Länder sind gefragt Der DST plädiert für eine stärkere Betonung der Vorteile des Öffentlichen Dienstes: „Die Städte sind moderne Arbeitgeber. Sie werben mit Marketingkampagnen und Jobbörsen intensiv um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie engagieren sich zudem in berufsbegleitenden oder dualen Studiengängen, um Absolventinnen und Absolventen zu gewinnen und langfristig zu binden“, so Dedy Er verweist aber auch auf die Grenzen kommunaler Handlungsmöglichkeiten: „Bund und Länder sind gefragt, das Dienst- und Tarifrecht zu flexibilisieren. Fachkräften, die per Quereinstieg in den Öffentlichen Dienst eintreten, müssen angemessene Eingruppierungen geboten werden können.“ Zudem sollten Fördergelder nicht mehr allein für Infrastrukturmaßnahmen verwendet werden, sondern auch die Planung und Vorbereitung für das dafür nötige Personal mitberücksichtigen. Auch der beschleunigte Ausbau verfügbarer Studienplätze für besonders nachgefragte Tätigkeiten durch Bund und Länder sei unerlässlich – damit es nicht nur im Wartezimmer des Bürgerbüros endlich öfter heißt: „Der nächste bitte!“
… sah ich im ZDF die Sendung „Wiso“. Es ging um den Pflegenotstand in Deutschland. Wer schiebt in 20 Jahren unsere Rollstühle? Ich bin ein Babyboomer. Mein Jahrgang 1964 ist der geburtenreichste der Bundesrepublik. Diese Generation ist heute noch überwiegend erwerbstätig, u. a. auch in der Pflege. Wir werden den absoluten Notstand also erst in 15 – 20 Jahren erreichen.
Applaus zahlt keine Miete Aber Pflege findet nicht nur in großen und organisierten Einrichtungen statt. Ich sehe vor allem die betroffenen Angehörigen, die sich von heute auf morgen um ihre Lieben rund um die Uhr kümmern und sich regelrecht aufopfern müssen. Der Applaus unserer Gesellschaft und der Politik während der Corona-Zeit ist längst verstummt. Unsere Pflegekräfte sind überlastet und zu schlecht bezahlt. Sie werden immer weniger, die zu Pflegenden immer mehr. Viele ausländische Fachkräfte dürfen hier nicht arbeiten, weil die Pflegeausbildung des Herkunftslands nicht anerkannt wird. Darauf zu setzen, dass diese Kräfte in Zukunft umschulen, um in Deutschland arbei-
ten zu dürfen, ist äußerst riskant. Sie werden Länder priorisieren, in denen besser bezahlt wird, der Amtsschimmel weniger wiehert, Menschen mit Migrationshintergrund mehr willkommen sind und die englische Sprache ausreichend ist. Die deutsche Bürokratie scheint sich wenig daran zu stören, dass es fünf vor zwölf ist. Immerhin war Gesundheitsminister Lauterbach im vergangenen Jahr überrascht, dass so viele Pflegebedürftige von so wenigen Pflegekräften gepflegt werden müssen.
Ein migrationspolitisches Armutszeugnis
Einem Gegensteuern durch die noch regierende Ampel maß er wenige Erfolgschancen zu. Auch die Vorgängerregierungen haben diesbezüglich wenig veranlasst. Das ist ein politisches Armutszeugnis. Für mich war es vor allem überraschend, dass unser Gesundheitsminister überrascht war. Aber die Politik hat es auch schwer. Könnte denn diese in der aktuell sehr aufgeheizten Stimmung einen Blumentopf gewinnen, wenn sie den Pflegenotstand und nicht das Migrationsthema in den Vordergrund stellt? Das wäre doch politischer
Selbstmord. Auch mich machen die brutalen Taten in Aschaffenburg, Magdeburg und Solingen wütend und mein subjektives Sicherheitsgefühl schwindet.
Schluss mit den Phantomdebatten Nüchtern betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit, vom Pflegenotstand in den nächsten Jahren betroffen zu sein, um ein Vielfaches höher, als Opfer dieser unsäglichen Straftaten zu werden. Wenn wir in Deutschland bei der Pflege unseren Ansprüchen nicht mehr gerecht werden, bedeutet dies den Tod unserer humanitären Gesellschaft. Die Betroffenen, seien es die Pflegkräfte, seien es die zu Pflegenden oder die Angehörigen, sind heute sehr leise. Politik giert nach lauten Themen. Sie kann eben nur so seriös sein, wie der Wähler es verkraftet.


Die Stadt Greven ist eine lebendige Stadt an der Ems. Wer eine Verwaltung der kurzen Wege schätzt, ist hier richtig. Sie erfüllen die erforderlichen beamtenrechtlichen sowie fachlichen Voraussetzungen und bringen eine ausreichende Erfahrung und Eignung im Sinne des § 71 Abs. 3 GO NRW mit.
Zu Ihrem Geschäftskreis gehören der Fachbereich Steuerung und Service mit den Fachdiensten Organisation, Personal, IT, Steuerung und der Fachbereich Finanzen mit den Fachdiensten Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung und Abgaben, Grundstücks- und Geodatenmanagement. Eine Änderung des Geschäftskreises bleibt ausdrücklich vorbehalten. Als Erste*r Beigeordnete*r werden Sie zur*zum Allgemeinen Vertreter*in des Bürgermeisters nach § 68 GO NRW bestellt.
Je nach persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen ist die Bestellung zur*zum Kämmerer*in möglich.


Rolf Hartmann war von 2004 bis 2020 Bürgermeister der Gemeinde Blankenheim.
Foto: BS/privat

Interessiert? Dann nden Sie unsere ausführliche Stellenbeschreibung in unserem Bewerberportal unter www.greven.net/karriere
Mit einem guten Abfallwirtschaftskonzept und einer guten Kreislaufwirtschaft ist für die Sauberkeit einer Stadt schon viel gewonnen. Doch müssen gerade auch die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden, denn von ihnen hängen sauber getrennte Stoffströme und (nicht) umherliegender Abfall ab. Wie ein Sprecher der Stadtreinigung Hamburg (SRH) erklärt, seien abfallwirtschaftliche Tätigkeiten selbstverständlich im Alltag, dabei müssten Menschen immer wieder intuitiv über die Entsorgung von Abfällen entscheiden. „Im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Menschen mit allen anderen Nachrichten, Werbemaßnahmen, Social Media und Alltagsproblemen“ bleibe manchmal kaum noch Kapazität für die einfachen, aber wichtigen Handgriffe zur Abfalltrennung. Diese seien aber für ein sinnvolles Recycling dringend nötig, so der Sprecher. Zusätzlich könne jede Person durch sauber sortierte Wertstoffe einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Theorie und Praxis bereitstellen
Um den Kampf um die Aufmerksamkeit der Bürger zu gewinnen, hat die Stadt vielfältige Möglichkeiten ersonnen, wobei die Website der Stadtreinigung und die SRH-App eine wichtige Rolle spielen. Auch sei es wichtig, Social-Media-Kanäle zu bespielen, da man über diesen Weg auch Zielgruppen erreiche, die vielleicht nicht gezielt nach Informationen zu diesem Thema suchten. „Aber Mülltrennung kann nicht digital stattfinden, deshalb ist es wichtig, Angebote zu schaffen, die sowohl die Müllvermeidung als auch die richtige Mülltrennung im Alltag vereinfachen.“
Behörden Spiegel: Köln gilt als eine der dreckigsten Städte Deutschlands. Wie bewerten Sie dieses Image und welche Faktoren tragen aus Ihrer Sicht zu dieser Wahrnehmung bei?
Thomas Thalau: Diese pauschale Wahrnehmung ist bedauerlich und spiegelt nicht die Arbeit und Maßnahmen wider, die wir mit hohem Einsatz täglich unternehmen. Sauberkeit ist jedoch nur ein Aspekt einer umfassenden Stadtbildpflege. Verschiedene Faktoren wie Bevölkerungsdichte, Architektur, Gestaltung des öffentlichen Raums, Verkehr, Baustellen, die Sichtbarkeit sozialer Herausforderungen, das Erscheinungsbild von Gebäuden sowie der Zustand der Infrastruktur tragen wie viele weitere Faktoren sicher zu diesem Empfinden bei. Wir arbeiten als AWB kontinuierlich daran, die Reinigungsleistungen bedarfsgerecht mit hoher Qualität zu erbringen und zugleich die Menschen in der Stadt für ein verantwortungsbewusstes Verhalten zu sensibilisieren.
Behörden Spiegel: Einige Orte wie der Brüsseler Platz oder die Uni-Wiese gelten als besonders vermüllt. Wie erklären Sie sich solche Hotspots und welche Maßnahmen setzen Sie dort um?
Thalau: Solche Hotspots entstehen oft durch lokale Anziehungspunkte oder Veranstaltungen bzw. liegen in deren Umfeld mit zum Teil hohen Besucherzahlen und unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten. Wir setzen dort auf regelmäßige und zusätzliche Reinigungen, verstärken Kontrollen oder auch das Entsorgungsangebot durch weitere Behälter. Zudem arbeiten wir eng mit lokalen Initiativen zusammen, um das Bewusstsein für Sauberkeit zu schärfen und gemeinsam mit den Akteuren vor
Hamburg räumt auf
(BS/Scarlett Lüsser) Ob mithilfe der „WasteWatcher+“, der neuen „EcoHHub“-Servicestationen, der „Stilbruch“-Gebrauchtwarenkaufhäuser oder groß angelegter Müllsammelaktionen – Hamburg legt großen Wert auf eine saubere Stadt. Um das zu erreichen, hat die „Perle des Nordens“ viele verschiedene Maßnahmen ergriffen.

Bei „Hamburg räumt auf“ helfen auch die Kleinsten mit. Über die große Beteiligung von Kitas und Schulen freut sich die Stadtreinigung besonders. Foto: BS/Thorge Huter, Stadtreinigung Hamburg
Ein Beispiel hierfür sind „EcoHHub“-Servicestationen, von denen es aktuell zwei gibt. Diese lassen sich rund um die Uhr nutzen und dienen dazu, noch brauchbare Gegenstände wie Bücher und CDs zu tauschen, kostenlose und kostenpflichtige Abfallprodukte wie Gassi-Beutel oder Laubsäcke zu erstehen oder auch seltenere Abfallprodukte wie Speiseöle und kaputte Elektrogeräte zu entsorgen. An der neuesten, komplett solarbetriebenen Station in Altona lassen sich außerdem Gegenstände in gutem Zustand wie Spielzeuge, Mobilgeräte oder Schuhe und Kleidung in Abgabefächer zum Weiterverkauf bei „Stilbruch“ abgeben. Die Ge-
brauchtwarenkaufhäuser seien eine weitere Möglichkeit für Hamburg, viele gut erhaltene Stücke wieder in den Kreislauf zu bringen, erklärt der SHR-Sprecher. Zudem werde jeder neue Haushalt an ein Vier-Tonnen-System angeschlossen und eine freiwillige Laubtonne werde in diesem Jahr neu eingeführt.
Aktiv auf Menschen zugehen Darüber hinaus müsse man die Menschen direkt erreichen, um ein „Bewusstsein für verantwortungsvollen und ressourcensparenden Konsum“ zu schaffen. Hierbei helfen Aktionsformate wie die „CleanSchnacks“, bei denen die Hamburger „WasteWatcher+“
aktiv das Gespräch an öffentlichen Orten – wie Stränden und Parks – suchen, auf achtloses Verhalten aufmerksam machen und nützliche Tipps und Infomaterial zum Thema Sauberkeit und Abfallvermeidung geben. Auch an Schulen und Kitas werden umweltpädagogische Maßnahmen durchgeführt. Und Hamburgerinnen und Hamburger sowie Besuchende können sich bewusst für etwas mehr Umweltbildung entscheiden und den Energieberg Georgswerder besuchen, wo man eine schöne Aussicht auf Hamburg genießen oder sich bei vielfältigen Events und Führungen zu Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz infor-
Wie die Abfallwirtschaftsbetriebe Kölns Image aufpolieren (BS) Kölsch, Klüngel, Karneval – die Domstadt ist für vieles bekannt, aber Sauberkeit gehört meist nicht dazu. Thomas Thalau von den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB) Köln spricht über Herausforderungen, Maßnahmen und die gemeinsame Verantwortung für eine saubere Stadt. Die Fragen stellte Julian Faber.

Über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWB stellen sich mit kölscher Lebensfreude dem täglichen Kampf gegen den Müll. Foto: BS/AWB Köln GmbH
Ort wirksame Lösungen zu finden. Bei besonderen Events wie dem Karneval intensivieren wir gezielt die Öffentlichkeitsarbeit und geben Hinweise, wie Vermüllung vermieden werden kann.
Behörden Spiegel: Die Sauberkeit einer Stadt erfordert auch die Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung, Polizei und Ordnungsämtern. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in Köln?
Sehen Sie Verbesserungspotenzial, beispielsweise bei der Bemessung von Bußgeldern?
Thalau: Die Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung, Polizei und Ordnungsamt ist essenziell und funktioniert in Köln gut. Es gibt regelmäßige Abstimmungen und gemeinsame Aktionen. Dennoch sehen wir insgesamt Verbesserungspotenzial bei der Durchsetzung und Bemessung von Bußgeldern, um klare Zeichen
zu setzen und die Sauberkeit sichtbar und wirksam zu verbessern. Die spezifischen Herausforderungen sind allen Akteuren dabei durchaus bewusst. Es darf jedoch nicht einfach akzeptiert werden, wenn Menschen den öffentlichen Raum vorsätzlich für die Ablagerung ihrer Abfälle missbrauchen, obwohl ausreichend legale und zum Teil kostenfreie Entsorgungsmöglichkeiten bestehen.
Behörden Spiegel: Der Personalmangel hat längst die gesamte Bandbreite der kommunalen Daseinsvorsorge erfasst. Wie ist es um die Personalsituation bei der AWB und die Wertschätzung ihrer Arbeit in der Bevölkerung bestellt?
Thalau: Dieser Trend ist spürbar. Wir versuchen, durch gezielte Maßnahmen wie qualitativ hochwertige Ausbildungsprogramme, attraktive Arbeitsbedingungen und auch
mieren kann. Ein fester Bestandteil des Hamburger Veranstaltungskalenders ist die Aktion „Hamburg räumt auf!“, die es bereits seit 1998 gibt und die fast jedes Jahr durchgeführt wird. 2025 können Einzelpersonen, Schulen, Kitas, Vereine und Betriebe von Ende Februar bis Anfang März an der AufräumAktion teilnehmen und durch das Müllsammeln sogar Preise gewinnen. Laut dem SRH-Sprecher sei im vergangenen Jahr mit mehr als 100.000 Teilnehmenden ein neuer Rekord aufgestellt worden. „Mit „Hamburg räumt auf!“ haben die Menschen die Möglichkeit, sich gemeinsam für ihre Stadt zu engagieren, etwas für die Umwelt zu tun und dazu macht es auch noch Spaß. Sie bringen ihre „Perle“ gemeinsam zum Glänzen.“ Es gehe bei der Aktion auch darum, den bewussten Umgang mit der Umwelt und dem eigenen Müll zu vermitteln und zu zeigen, dass jeder und jede Einzelne einen Unterschied machen könne. Insgesamt zieht die SRH eine positive Bilanz, denn die Maßnahmen machten sich bezahlt. Seit Beginn der 2011 eingeführten Recyclingoffensive habe es eine deutliche Steigerung der getrennt gesammelten Abfälle gegeben. Die regelmäßig durchgeführten unabhängigen und wissenschaftlichen Hausmüllanalysen bestätigten eine verbesserte Qualität der getrennten Stoffströme. „Die Recyclingquoten verbessern sich stetig, im Großstädtevergleich hat Hamburg die rote Laterne längst abgegeben.“ Dennoch müssten mehr Abfälle korrekt getrennt werden, anstatt im Restmüll zu landen. Es ließen sich nämlich „nur saubere Stoffströme gut recyceln“.
der Herausstellung von Vorzügen öffentlicher Arbeitgeber in unsicheren Zeiten gegenzusteuern. Zudem verfolgt die Arbeit in der Daseinsvorsorge einen wertvollen gemeinschaftlichen Nutzen, der für viele Menschen zunehmend attraktiv ist. Die Wertschätzung unserer Arbeit ist sowohl in der Stadtgesellschaft als auch in der Verwaltung und Politik hoch, was uns stets motiviert, weiterhin unser Bestes zu geben. Die Kölnerinnen und Kölner haben ein sehr gutes Gespür für das, was wir tun und dafür, wo die eigentlichen Ursachen liegen. Wir leisten hier gerne unseren Beitrag und freuen uns über die Anerkennung, ruhen uns aber nicht darauf aus.
Behörden Spiegel: Die Verantwortung für eine saubere Stadt liegt nicht allein bei den Entsorgungsbetrieben. Wie könnte man die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger erhöhen, etwa durch Sensibilisierungskampagnen oder andere Initiativen?
Behörden Spiegel: Wie blicken Sie auf die Zukunft? Arbeiten Sie an innovativen Technologien oder Konzepten – und können andere Städte davon lernen?
Thalau: Wir stehen innovativen Technologien und Konzepten mit Neugier und Interesse gegenüber. Dabei verfolgen wir Nachhaltigkeitsziele, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Neue Lösungen müssen funktionieren und unsere Mitarbeitenden bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen. Aktuell testen wir verschiedene alternative Antriebstechnologien im Fuhrpark und beschäftigen uns mit dem Ausbau digitaler Lösungen. Zuletzt haben wir einen BioBot zur richtigen Nutzung der Biotonne veröffentlicht. Wir stehen mit anderen Städten und Verbänden regelmäßig im Austausch, geben unsere Erfahrungen gerne weiter und sind offen für kooperative Zusammenarbeit, um gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.

Thomas Thalau ist Sprecher der Geschäftsführung bei der AWB Köln. Foto: BS/AWB Köln GmbH
Thalau: Diese Einbindung ist absolut relevant. Mit unserem Team der Umweltbildung entwickeln und initiieren wir Sensibilisierungskampagnen, Schulprojekte und Bürgerbeteiligungen, betreiben fachliche Aufklärung und sind bei Mitmachaktionen wie „Kölle putzmunter“ selbst aktiv. Wir wollen das Verantwortungsbewusstsein stärken und die Menschen bewusst in die Sauberhaltung der Stadt einbinden, um gemeinsam eine saubere und lebenswerte Umgebung zu schaffen. Dem frisch entwickelten Masterplan Sauberkeit ging eine breite und intensive Beteiligung relevanter Stakeholder sowie der Bevölkerung voraus, die in vielschichtige Handlungsempfehlungen mündete.

Ihr Schritt in einen richtig grünen Job!

Die Abteilung Grünflächen im Garten- und Tiefbauamt der Stadt Freiburg im Breisgau ist für die städtischen Parks, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze sowie den Baumschutz und die Baumpflege im gesamten Stadtgebiet verantwortlich.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine gestaltungsstarke und souveräne Führungspersönlichkeit als Leiterin der Abteilung Grünflächen (a)
Mit der Position geht auch die ständig stellvertretende Amtsleitung des Gartenund Tiefbauamtes einher. In diesem Rahmen vertreten Sie die Amtsleitung im Bereich Grünflächen - sowie allgemein in deren Abwesenheit gemeinsam mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Tiefbau und Verkehr. Die Bezahlung dieser attraktiven Position erfolgt in Anlehnung an den TVöD außertariflich.
Wir lieben Freiburg weil es ganz schön bunt ist. Auch als Arbeitgeberin. Deshalb freuen wir uns auf Bewerbungen (a)ller, die für ihr Thema brennen und uns und unsere Stadt weiterbringen wollen. Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Alter, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung oder Behinderung sind bei uns willkommen. Vielfalt - dafür stehen wir. Und das (a) im Jobtitel.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie in Kürze auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Yanna Schneider, Annika Lachmann oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
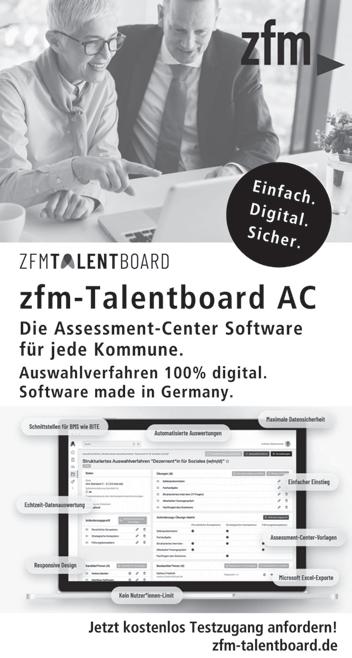
Anz_Abtl-Gruenflaechen_Freiburg_02-2025.indd 1 31.01.25 11:18
Gestalten Sie die Zukunft unserer Stadt aktiv mit.
Die vitale und vielseitige Stadt Reutlingen überzeugt mit ihrer Nähe zur Metropolregion Stuttgart sowie landschaftlich reizvollen Schwäbischen Alb. Das Amt für Stadtentwicklung und Vermessung mit ca. 70 Mitarbeitenden ist in fünf Abteilungen gegliedert und beschäftigt sich mit allen Fragen rund um Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Verkehrsplanung und Vermessung.
Die Aufgaben der Abteilung Stadtentwicklung reichen von innovativer Stadt- und Rahmenplanung über die Leitung wettbewerblicher Verfahren bis hin zu Bauleitplanung, Stadtsanierung und Stadtgestaltung. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine innovative und engagierte Führungspersönlichkeit als
Stellvertretende Amtsleitung (w/m/d) Stadtentwicklung und Vermessung und Abteilungsleitung (w/m/d) Stadtentwicklung
Talentboard.indd 1
Als Interimsmanager*in schaffen Sie in kurzer Zeit einen Mehrwert.
03.02.25 09:30
Vieles ist aktuell in Bewegung. Der demographische Wandel fordert von öffentlichen Verwaltungen und kommunalen Unternehmen neue Herangehensweisen und Lösungsansätze für anstehende Aufgaben.
Für Kundenprojekte in allen Funktionsbereichen des öffentlichen Sektors suchen wir erfahrene und ambitionierte Persönlichkeiten als Interimsmanagerin / Interimsmanager (w/m/d)
Als Interimsmanager*in übernehmen Sie bei unseren Kunden kurzfristig Verantwortung, um dringende Aufgaben und Projekte effizient und erfolgreich umzusetzen.
Was Sie mitbringen sollten:
Erfahrung: Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in verantwortungsvoller Position, idealerweise im öffentlichen Sektor oder in projektnahen Aufgabenstellungen.
Als erfahrene und lösungsorientierte Führungskraft managen Sie die vielfältigen Themen in unserem Sozialamt!

Die Verwaltung des Landkreises Lörrach liegt mitten in der City Lörrachs, eingebettet zwischen Weinbergen, Rhein- und Wiesental sowie in direkter Nachbarschaft zur Schweiz mit Basel und Frankreich mit dem Elsass.
Rund 1.500 Mitarbeitende sorgen für das Gemeinwohl in der Region. Wir verwalten nicht nur – wir gestalten die Region mit unserer Arbeit mit.
Im Rahmen einer Altersnachfolge suchen wir idealerweise zum 01.07.2025 eine kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit als
Diese attraktive Position wird nach A 15 LBesGBW besoldet bzw. nach EG 15 TVöD vergütet.
Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen, sinnstiftenden und zukunftssicheren Job in einem offenen und engagierten Team. Wir bieten Ihnen eine faire Unternehmenskultur und viel Raum für eigene Gestaltung. Zudem sorgen flexible und mobile Arbeitsmöglichkeiten für eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Yanna Schneider, Alexander Wodara oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_FBL-Soziales_LK-Loerrach_01-2025.indd 1 20.12.24
Ihre Visionen für eine nachhaltige Stadtentwicklung!

Die Stadt Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg ist nördlich der Landeshauptstadt Stuttgart gelegen. Ihren rund 19.000 Einwohner*innen bietet sie ein lebendiges und familienfreundliches Umfeld. Eingebettet in eine landschaftlich reizvolle Umgebung überzeugt Sachsenheim durch eine gute Infrastruktur sowie eine gute Verkehrsanbindung.
Als Stadtverwaltung setzen wir uns gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeiter*innen für die vielfältigen Belange unserer Bürger*innen ein. Im Fachbereich Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit stellen wir uns aktiv den kommunalen Herausforderungen wie Stadtentwicklung, Klimaschutz oder Mobilität und arbeiten gemeinsam an einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft unserer Stadt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine gestaltungsorientierte Führungspersönlichkeit als
Fachbereichsleitung
Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit (w/m/d)
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Sanny Groß und Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Besoldung/Vergütung dieser attraktiven Position erfolgt bis zur Besoldungsgruppe A15 bzw. EG 15 TVöD. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar und kann daher sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit (Jobsharing) besetzt werden. Für Tandembewerbungen sind wir offen. Interessiert? Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche
Flexibilität: Bereitschaft, sich schnell in neue Themenfelder und Organisationen einzuarbeiten.
Kompetenz: Fundiertes Wissen in den Bereichen Verwaltung, Prozessoptimierung, Digitalisierung oder strategisches Management.
Persönlichkeit: Ausgeprägte Kommunikations- und Führungskompetenz sowie eine hohe soziale und interkulturelle Sensibilität.
Verfügbarkeit: Offenheit für zeitlich befristete Einsätze mit wechselnden Aufgabenstellungen.
Interessiert?
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen unter der Rufnummer 0178 8894251 zfm-Geschäftsführer Edmund Mastiaux zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
In dieser Funktion berichten Sie direkt an den Bürgermeister. Die attraktive Position wird nach EG 14 TVöD bzw. A 15 LBesGBW vergütet.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Alexander Wodara, Annika Lachmann oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung

Gestalten Sie ein zukunftsfähiges
Personal- und Organisationsmanagement in Osnabrück!

Osnabrück, das heißt: offen, sozial, vielseitig, naturverbunden, überraschend, bodenständig, attraktiv, überschaubar, wachsend – eben Lebensqualität auf den ersten und zweiten Blick! Fast 170.000 Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich hier zu Hause – und als Teil einer Stadt, die glücklich macht. Als Arbeitgeberin setzen wir Schwerpunkte auf Vielfalt und Verlässlichkeit, Kollegialität und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir sagen stolz: »Wir sind bei der Stadt!« – und freuen uns auf Sie als neue Kollegin und neuen Kollegen.
Der Fachbereich Personal und Organisation mit seinen fünf zugeordneten Fachdiensten versteht sich als Querschnittsfunktion für die zentralen Themen der Stadtverwaltung mit insgesamt rund 3.300 Mitarbeitenden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine motivierende Führungspersönlichkeit als Fachbereichsleitung Personal und Organisation (w/m/d)
Diese verantwortungsvolle Position wird nach A 16 NBesG bzw. EG 15 TVöD vergütet.
Die unbefristete Vollzeitstelle kann grundsätzlich bei sich einander ergänzenden Arbeitszeiten in Teilzeit besetzt werden.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Sanny Groß, Elisa Heinen und Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!





















zfm in eigener Sache!



Sie brennen für die Arbeit mit Menschen, haben Erfahrung in der Personalsuche und -auswahl und kennen das kommunale Umfeld? Dann haben wir die perfekte Aufgabe für Sie!
Als eine der führenden Personalberatungen für den ö entlichen Sektor unterstützen wir unsere Kunden seit über 30 Jahren in allen Fragestellungen eines zukunftsorientierten Personalmanagements. Unsere Aufträge sind hierbei so facettenreich wie der ö entliche Sektor selbst: Von der Suche eines/einer CDO (w/m/d) für eine Großstadt über die Auswahl einer Stadtwerkegeschäftsführung bis hin zur Begleitung von Entwicklungsprogrammen für die Führungsnachwuchskräfte einer gesamten Kreisverwaltung. Verstärken Sie unser motiviertes und dynamisches Team in der Personalsuche und -auswahl als erfahrene/erfahrener
Wir können uns unterschiedliche Modelle der vertraglichen Zusammenarbeit vorstellen. Für uns ist es selbstverständlich, dass Sie die Vorteile von Remote-Arbeit in Ihrer Tätigkeit in vollem Ausmaß ausschöpfen können.
Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen unter der Rufnummer 0178 8894251 zfm-Geschäftsführer Edmund Mastiaux zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!



zfm-Personalberater_2025_neu.indd 1
Setzen Sie bauliche Akzente für die Stadt am Fluss.
03.02.25 09:28
Bereit für eine Aufgabe mit Herz und Verstand? – Kommen Sie ins Stadt-Up Frankfurt!
Das Jugend- und Sozialamt gehört mit rund 2.000 Beschäftigten zu den größten Ämtern der Stadtverwaltung Frankfurt am Main. Das Amt ist mit insgesamt 7 Sozialrathäusern und 6 Besonderen Diensten dezentral über das gesamte Stadtgebiet ausgerichtet.
Als ein Besonderer Dienst fungiert das Rathaus für Senioren als zentrale Anlaufstelle zur Beratung und Unterstützung bei allen Lebenslagen und rund um die Themen Älterwerden für die Menschen in unserer Stadt sowie Institutionen und Träger in Frankfurt. Die zugeordneten Bereiche Leitstelle Älterwerden, Zentrale Heimplatzvermittlung und Soziale Hilfen für Heimbewohnende, Betreuungsbehörde und das Versicherungsamt verfolgen das übergeordnete Ziel, positive Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine kommunikationsstarke und empathische Führungspersönlichkeit als
Leitung für das Rathaus für Senioren (w/m/d)
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Gianna Forcella, Raza Hoxhaj oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Diese verantwortungsvolle Position ist nach A14 HBesG bzw. nach EG 14 TVöD bewertet. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung. Interessiert? Die Personalberatung
Anz_Lt-Rathaus-Senioren_Frankfurt_02-2025.indd 1
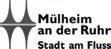
Übernehmen Sie eine Schlüsselrolle in der Stadtentwicklung und gestalten Sie die Zukunft Frechens mit!
09:14 Entwickeln und gestalten Sie als erfahrene Führungskraft den neu gegründeten Fachbereich Wohnen!
Machen Sie Krefeld mit uns l(i)ebenswert! Die Stadtverwaltung Krefeld ist vor Ort eine der größten Arbeitgeberinnen. Im Zusammenwirken mit der Bürgerschaft organisieren und gestalten rund 4.000 Mitarbeitende den Alltag und das tägliche Miteinander in unserer Stadt.
Der Rat der Stadt Krefeld hat die Neugründung des Fachbereiches Wohnen beschlossen, um das Thema „Wohnen“ noch stärker in den Fokus zu rücken. Der Fachbereich umfasst die Abteilungen „Wohnraumsicherung und Obdachlosenhilfe“ sowie „Wohnungsbauförderung und Wohnhilfen“, welche die Wohnungsmarktsituation umfassend und sozialpolitisch analysieren sollen. Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine motivierte Führungspersönlichkeit als Fachbereichsleitung Wohnen (w/m/d)
Die attraktive Position wird für Beamt*innen nach Besoldungsgruppe A 16 LBesG bzw. für Tarifbeschäftigte entsprechend außertariflich vergütet. In dieser bedeutungsvollen Funktion setzen Sie Ihre Expertise in den Themen der Sozialverwaltung gewinnbringend zur Förderung der Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger ein.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Yanna Schneider, Annika Lachmann oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Stadt Mülheim an der Ruhr gehört mit ca. 170.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zur Metropolregion Rhein-Ruhr. Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr ist ein städtischer Fachbereich, der mit rund 250 Beschäftigten etwa 290 Gebäude betreut und den übrigen städtischen Fachbereichen in allen Fragen der Immobilienwirtschaft als Dienstleister zur Verfügung steht.
Im Zuge einer Nachbesetzung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine persönlich wie fachlich überzeugende Führungspersönlichkeit als Technische Leitung (w/m/d) des ImmobilienService
Die Besoldung/Vergütung dieser attraktiven Position erfolgt bis zur Besoldungsgruppe A15 bzw. EG 15 TVöD.
Sie setzen Ihre hohe Eigeninitiative und Fachexpertise gezielt für die Umsetzung anspruchsvoller Projekte ein, darunter die Realisierung des Bildungsentwicklungsplans sowie die Modernisierung städtischer Gebäude.
Gegenüber allen Akteurinnen und Akteuren agieren Sie auf Augenhöhe und behalten dabei stets die übergeordneten Ziele im Blick.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj und Rebecca Engels gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Die Stadt Frechen mit ihren rund 54.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt als attraktives Mittelzentrum in der Region Köln/Bonn und grenzt westlich an die Metropole Köln. Die Stadt ist ein wichtiger Wirtschafts- und attraktiver Wohnstandort in der Region und verfügt über ein breites Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot. In einer wirtschaftsstarken Region mit vielen überregionalen Bildungs-, Forschungsund Kultureinrichtungen bietet Frechen hervorragende Zukunftsperspektiven und eine hohe Lebensqualität. Bei der Stadt Frechen kümmern sich derzeit rund 850 Mitarbeitende um die Belange der Bürger:innen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine überzeugende, engagierte Führungspersönlichkeit (w/m/d) als
(w/m/d)
Die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt nach der Wahl durch den Rat der Stadt Frechen für eine Wahlzeit von acht Jahren.
Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe B 2 LBesO NRW zuzüglich einer Aufwandsentschädigung nach der Eingruppierungsverordnung NRW. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Elisa Heinen, Raza Hoxhaj oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Überörtliche Prüfung in 18 Vergleichskommunen
Exemplarische Zeitplanung eines fristgerechten Jahresabschlusses
Jahresabschlüsse fristgerecht zu erstellen, ist für viele Kommunen eine enorme Herausforderung. Insbesondere kleinere Gemeinden leiden unter Personalmangel, Fluktuation und einer hohen Arbeitsbelastung. Jahresabschlüsse fristgerecht aufzustellen, ist zudem keine isolierte Aufgabe, sondern Teil eines Steuerungskreislaufs, der Haushaltsaufstellung, Haushaltsvollzug und Jahresabschluss umfasst. Verzögerungen in einer Phase wirken sich auf die gesamte Kette aus. Fehlende oder verspätete Abschlüsse erschweren nicht nur die Haushaltsplanung, sondern können auch rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Die Überörtliche Prüfung hat die Problemlagen analysiert und im Wesentlichen zwei wirksame Lösungsansätze vor Ort gefunden.
Gleichmäßigere Verteilung von Aufgaben
Klare Richtlinien sind entscheidend, um die Erstellung von Jahresabschlüssen zu optimieren. Das konnten wir in der 234. Vergleichenden Prüfung (Kommunalbericht 2023, S. 97) nachweisen. In sechs der 18 Vergleichskommunen existierten Richtlinien, um fristgerecht den Jahresabschluss
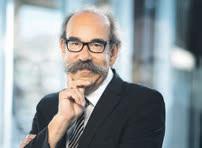
Es ist ein ausgesprochen nebliger Tag, als Vertreterinnen und Vertretern von Städten und Gemeinden im Kongresssaal der NRW.Bank in Düsseldorf zusammenkommen. Wie ein Sinnbild der multiplen Krisen und Unsicherheiten lichtet sich der Dunst erst später am Tage. Tatsächlich wird auch das eigentliche Thema der Veranstaltung von der prekären Wirtschaftslage in Deutschland, dem Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten sowie der vorgezogenen Bundestagswahl überlagert. Verunsicherung aus Übersee Die Sorge vor einer Verschärfung der angespannten Wirtschaftslage in Deutschland durch einen neuen Handelskrieg mit den USA ist auch bei den Kommunen groß. Schon jetzt schränken nachfragebedingte Drosselungen der Industrieproduktion die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik ein. „Zudem ist die Energieproduktion auf einem Tiefstand, den wir seit der Wiedervereinigung nicht gesehen haben“, berichtet Stefan Schilbe, Direktor der HSBC Global Research. Gleichzeitig werden die Kommunen von einer enormen Altschuldenlast erdrückt: Nach offiziellen Zahlen der Bundesregierung summieren sich diese auf 31 Milliarden Euro. Allerdings bezieht sich diese Zahl ausschließlich auf Kassenkredite, die zur kurzfristigen Liquiditätssicherung gedacht sind, von vielen Kommunen aber zur Deckung laufender Kosten genutzt werden. Summiert man hingegen Extrahaushalte und sonstige öffentliche Fonds, den Schuldenstand der Kernhaushalte sowie kommunaler Einrichtungen und Unternehmen,
erstellen zu können. Von diesen sechs Kommunen konnten fünf Kommunen alle Jahresabschlüsse des Prüfungszeitraums prüffähig vorlegen, während von den weiteren zwölf Kommunen lediglich zwei Kommunen alle Jahresabschlüsse des Prüfungszeitraums prüffähig vorlegen konnten. In der 244. Vergleichenden Prüfung (Kommunalbericht 2024, S. 144 ff.) bestätigte sich das Bild. Die Gemeinde Hasselroth konnte nachweisen, wie durch die Einführung von Monatsabschlüssen Aufgaben gleichmäßiger verteilt und Engpässe im Jahresabschluss vermieden werden können. Tätigkeiten wie die Pflege offener Posten, der Abgleich der Anlagenbuchhaltung oder die Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldungen wurden regelmäßig während des Haushaltsjahres erledigt. Dies senkte den Zeitdruck am Jahresende erheblich und führte im Ergebnis zu einer fristgerechten Aufstellung der Abschlüsse in den Jahren 2021 und 2022. Diese „getaktete“ Methode ist nicht nur effizient, sondern schafft auch Transparenz und erleichtert die Identifizierung von Schwachstellen. Gleichzeitig ermöglicht sie es, Arbeitsbelastungen besser zu verteilen und Rückstände zu vermeiden.
Dr. Ulrich Keilmann leitet die Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof in Darmstadt. Foto: BS/privat
Ein weiteres Erfolgsmodell aus der 244. Vergleichenden Prüfung zeigt die Zusammenarbeit der Gemeinden Glashütten, Usingen und Neu-Anspach. Glashütten hatte bis dato mit Personalmangel und Fluktuation im Finanzmanagement zu kämpfen. Jahresabschlüsse wurden bis zu 356 Tage zu spät aufgestellt.
Auf eigene Initiative hin suchte man vor Ort nach Lösungen und fand in benachbarten Kommunen die gleiche Finanzsoftware vor. Ergebnisse: Die Haushaltssatzungen 2021 bis 2023 wurden noch im Jahr vor dem Haushaltsjahr der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 wurden bis September 2020 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2022 konnten fast fristgerecht (maximal drei Tage verspätet) aufgestellt werden.
Interkommunale Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg Glashütten hatte als zweitkleinste Kommune im Vergleich eine unterdurchschnittliche Personalausstattung im Finanzmanagement und schaffte dennoch den „Turnaround“, weil alle Kommunen in der IKZ schon vorher die gleiche Finanzsoftware nutzten und so qualifizierte Mitarbeiter digital vernetzt zusammenarbeiten konnten. Insgesamt gab es hier nicht nur eine sehr gelungene Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen, sondern offensichtlich funktionierte die interkommunale Zusammenarbeit auch über Gemeindegrenzen hinweg. Denn obwohl es sich nicht um unmittelbare Nachbarkommunen handelte, stellten sich sehr schnell Erfolge ein.
Fachbereiche, Berechnung und Buchung Mittelübertragung, Übersicht Haushaltsermächtigung)
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben auswerten und Beschlüsse vorbereiten
Fertigstellung des Jahresabschlusses inklusive Anhang, Anlagen und Rechenschaftsbericht
Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Gemeindevorstand Mitte April FJEnde April FJ Vorlage des aufgestellten prüffähigen JA mit allen Anlagen an das Rechnungsprüfungsamt
FJ Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt
Oktober FJ+1 Beschluss über den geprüften Jahresabschluss und Entlastung Gemeindevorstand Ende Dezember FJ+1 öffentliche Auslegung und Vorlage bei Rechnungsprüfungsamt und Aufsicht Mitte
1) Für die Darstellung dieser Ansicht wurden die Maßnahmen stark verdichtet. Für den realen Einsatz werden eine detailliertere Darstellung der einzelnen Maßnahmen sowie die Definition eines Startdatums empfohlen.
2) FM = Folgemonat, HJ= Haushaltsjahr, FJ = Folgejahr Quelle: BS/Hessischer Rechnungshof; Stand: Juni 2024
Wie der Wahlkampf die Entschuldung verzögert
(BS/Julian Faber) Beim 19. Kommunalen Finanzmarktforum in Düsseldorf standen Altschulden, Investitionsstau und politische Unsicherheiten im Fokus. Expertinnen und Experten mahnten Mut zu fiskalischen Reformen an – doch die Prioritäten der Politik sind andere.

Foto: BS/studio schmidt-dominé/NRW.Bank
so betrug die Verschuldung nach Angabe des Statistischen Bundesamtes Ende 2023 insgesamt 322,9 Milliarden Euro. Dabei haben Städte und Gemeinden einen nie dagewesenen Aufgabenkatalog vor der Brust: Nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaft müssten sie in den nächsten zehn Jahren rund 600 Milliarden Euro in ihre Infrastruktur investieren. Zusätzlich sind jedes Jahr Investitionen von sechs Milliarden Euro nötig, um die Klimaziele bis 2040 zu erreichen. Die schwachen Wirtschafts-
prognosen von 0,3 Prozent im Jahr 2025 versprechen keinerlei Besserung auf der Einnahmenseite. Der auf Bundesebene viel beschworene ausgeglichene Haushalt gilt den Kommunen längst als weltfremde Illusion.
Wahlkampf geht vor Wie auf vielen Veranstaltungen dieser Tage wird auch in Düsseldorf darüber diskutiert, wie zeitgemäß die Schuldenbremse angesichts des enormen Handlungsbedarfes noch ist. An ihren letzten politischen Vorkämpfern lässt das Podium kaum
Mut zur Veränderung
Diese Mitteorientierung spreche allerdings nicht für ein Übermaß an Veränderungsbereitschaft: „Wir wählen das Bekannte, keine Changemaker. Charismatischer Überschwang ist uns verdächtig,“ kritisiert Korte. Angesichts steigender Notwendigkeit von Problemlösungs- und Transformationsfähigkeit brauche es aber mehr Mut zur Veränderung – nicht nur bei den Fragen der Fiskalpolitik.
Immerhin: Der Nebel in Düsseldorf hatte sich zum Ende der Veranstaltung gelichtet. Das politische Nebelgrau wird wohl erst Ende Fe bruar sichtbar aufklaren. Fest steht: Eine nachhaltige Lösung der kommunalen Haushaltslage erfordert nicht nur Geduld, sondern auch Mut und politischen Willen. Nur mit entschlossenem Handeln werden Kommunen ihre Rolle als Träger der öffentlichen Daseinsvorsorge auch künftig wahrnahmen können.
ein gutes Haar: „FDP-Chef Christian Lindner verfolgt mit seinem Wahlkampf offensichtlich das Ziel, pünktlich in die Elternzeit zu kommen“, witzelt Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen. Längst scheint bei den anwesenden Experten die Gewissheit obsiegt zu haben, dass die fiskalpolitischen Herausforderungen nicht durch Einsparungen allein zu bewältigen sind. Das Bundeskabinett plant nun, sich an der Übernahme der Altschulden mit bis zu 50 Prozent zu beteiligen. Voraussetzung dafür ist, dass die Länder ihre Kommunen zuvor von laufenden Liquiditätskrediten entschuldet haben. Eine notwendige Grundgesetzänderung braucht eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, dem entsprechenden Gesetzesentwurf stimmte das Bundeskabinett Ende Januar zu. Auch Daniel Sieveke, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, verspricht Unterstützung für die besonders belasteten Kommunen – nach der Bundestagswahl. Das Verständnis für diesen Zeitplan hält sich bei den anwesenden Kommunalvertretern in Grenzen. Die Botschaft ist angekommen: Die Problemlösung muss warten, der Wahlkampf geht vor. Karl-Rudolf Korte mahnt trotz allem zur Gelassenheit. Auch für die kommende Bundesregierung würden die nächsten Jahre herausfordernd, Anlass zur Panik bestehe aber nicht: „Wir wählen mehrheitlich moderat, mittig, mittelmäßig. Die meisten Wählerinnen und Wähler haben bereits Montag vergessen, welchen Namen sie Sonntag angekreuzt haben. Das ist kein Nachteil unserer Demokratie, das ist ein Luxus.“ Denn das politische System sei stabil genug, eine Machtübernahme durch die Ex tremen stehe nicht zu befürchten. „Die überparteiliche Brandmauer steht. Wir werden stabile Machtverhältnisse bekommen, vermutlich in einer Zweierkoalition“, so Korte.
Das Klimaanpassungsgesetz (KAnG) ist schon seit vergangenem Jahr in Kraft, doch müssen auf ein solches Gesetz auch konkrete Inhalten folgen. Dieser Gesetzesvorgabe ist die Bundesregierung Ende 2024 nachgekommen und hat ihre Anpassungsstrategie verabschiedet, um Deutschland klimafest zu machen. Die Strategie benennt 33 Ziele und über 180 Maßnahmen, um die Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Infrastruktur vor Extremwetterereignissen zu schützen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke äußerte sich dazu: „Die […] beschlossene Klimaanpassungsstrategie ist der vorerst letzte Baustein eines umfassenden Updates der Klimaanpassung in Deutschland. […] Mit den Ländern entwickeln wir eine gemeinsame, dauerhafte Finanzierung von Klimaanpassung für Kommunen.“ Mit dem Gesetz nehme sich die Bundesregierung selbst in die Pflicht zu handeln und sie habe mit der Klimaanpassungsstrategie nun erstmals messbare Ziele und Indikatoren aufgestellt. Damit könne man in Zukunft den Fortschritt im Umgang mit Klimafolgen transparenter machen und besser nachsteuern, so Lemke. „Damit schaffen wir den Einstieg in ein dynamisches Klimaanpassungsmanagement. Jetzt geht es darum, die Strategie entschlossen umzusetzen, damit sie ihre Wirkung für den Schutz der Menschen in Deutschland und unseren wirtschaftlichen Wohlstand entfalten kann.“
Wie das Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) erklärt, sei eines der Ziele, das Klimaanpassungsmanagement zu stärken. Damit bis 2030 80 Prozent der von den Ländern im Rahmen des Klimaanpassungsgesetzes dazu verpflichteten Gemeinden bzw. Landkreise ein Klimaanpassungskonzept vorlegen können, sollen Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Zudem stelle der Bund „umfang-
Der Landkreis Wolfenbüttel arbeitet in Projekten zu diesem Thema eng mit regionalen Akteuren an kreativen Lösungen, die eine nachhaltige Landnutzung zum Ziel haben und ökologische, ökonomische wie auch soziale Aspekte berücksichtigen. Das „Blueing“-Konzept beschreibt den Prozess hin zu wasserhaltefähigen Landschaften und zur Schließung von Wasserund Stoffkreisläufen auf kleinräumiger Ebene.
Dieses Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass Wasser eine zentrale Rolle im Klimaschutz spielt. Es ist nicht nur für die Umwandlung von Sonnenenergie in Lebensstrukturen entscheidend, sondern auch für die Kühlleistung der Landschaft. Landnutzung und Wassermanagement im regionalen Klimawandel finden in jüngster Zeit verstärkt in der Wissenschaft wie auch in der Förderung Beachtung (z. B. im „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ des Bundes).
Agroforstwirtschaft für wasserhaltende Landschaften
Ein zentrales Element von „Blueing“ ist die Erhöhung des Pflanzenanteils, insbesondere von Bäumen und Sträuchern, da Pflanzen als natürliche „Wassermanager“ fungieren. Diese können bei ausreichend Wasserdargebot Oberflächentemperaturen in der Landschaft ausgleichen. Mehr Sonnenenergie wird in Abkühlungsprozesse umgesetzt. Gleichzeitig wird Wasser vor Ort gehalten. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um Extremwetterereignissen wie Starkniederschlägen oder Dürren entgegenzuwirken.
Kommunen rüsten sich gegen Klimawandelfolgen
(BS/Scarlett Lüsser) Wenn etwas draußen geplant ist, schaut man vorher aus dem Fenster oder in die App und zieht sich entsprechend an. Mit dem Klimawandel sollte es genauso gehalten und vorausschauende Maßnahmen ergriffen werden, denn so schnell, wie es Bürgerinnen und Bürger können, lässt sich eine Stadt nicht anpassen. Eine ähnliche Auffassung hat auch der Bund und stellte vor kurzem eine konkrete Strategie auf.

reiche Beratungs-, Informations-, Vernetzungs- und Fortbildungsangebote“ zur Verfügung.
Umsetzung vor Ort
Doch auch wenn der Bund Fördermittel und Unterstützungsangebote stellt, liegt die Planung und Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen zum Großteil bei Ländern und Kommunen. Dabei haben viele natürlich bereits vor dem Gesetzeserlass angefangen, ihre Städte und Kommunen klimasicherer zu gestalten. So hat beispielsweise die Stadt Karlsruhe bereits 2013 eine Klimaanpassungsstrategie beschlossen, welche 2021 fortgeschrieben wurde. Die Karlsruheeigene Klimastrategie enthält über 80 Maßnahmen, wovon Stand 2023 bereits ein Großteil
umgesetzt oder als Daueraufgabe etabliert wurde. Lediglich zwölf Prozent der vorgesehen Maßnahmen sind noch nicht in der konkreten Umsetzungsphase, alle anderen sind bereits geplant, haben begonnen oder sind schon fortgeschritten. Zusätzlich hat die Stadt 2015 einen „Städtebaulichen Rahmenplan Klimaanpassung“ als „sonstige städtebauliche Planung“ beschlossen, der dem im Dezember 2024 beschlossenen Bebauungsplan „Grünordnung und Klimaanpassung in der Innenstadt“ zugrunde liegt. Der Bebauungsplan „enthält weitreichende Analysen zum Stadtklima und Maßnahmenvorschläge nach Stadtstrukturtypen. Für das Stadtgebiet wird die bioklimatische Belastung in Stufen dargestellt und
Hotspot-Gebiete definiert“, erklärt ein Sprecher der Stadt. Mithilfe der Grünordnung sollen Schwammstadtelemente aufgebaut und vermehrt werden. Die dicht bebaute und stark versiegelte Karlsruher Innenstadt soll hierbei als Pilot dienen, denn dort bestehe erheblicher Bedarf an kühlender Grünstruktur, erklärt ein Sprecher der Stadt. Nachdem die Erfahrungen aus dem Pilotverfahren ausgewertet wurden, sollen diese Elemente auch in anderen Stadtteilen umgesetzt und mittelfristig die ganze Stadt entsprechend überplant werden.
Mit Bürgerbeteiligung
Auch die Stadt Dresden entwickelt bereits seit 2008 erste Ideen, wie die Stadt an das sich verändernde
Blueing-Konzept für Wolfenbüttel
(BS/Sven Volkers) Seit Ende 2021 ist der Landkreis Wolfenbüttel auf dem Weg zu einer Pionierregion für wasserhaltende Landschaften. Die Region soll dadurch widerstandsfähiger gegenüber einem sich verändernden Klima werden. Das „Blueing“-Konzept wurde von der Diplom-Ingenieurin Ina Küddelsmann im Rahmen ihrer laufenden Doktorarbeit entwickelt. „Blueing“ ist ein wichtiger Baustein für die Klimaanpassungsstrategie, die der Landkreis derzeit erstellt.
In der Landwirtschaft bedeutet „Blueing“ unter anderem, bodenschonend zu wirtschaften und Böden ganzjährig zu bepflanzen. Dies schließt die Etablierung von Agroforstsystemen sowie die Anlage von Hecken ein. Agroforstsysteme, also Gehölze, die in landwirtschaftliche Flächen integriert werden, bieten zahlreiche ökologische sowie ökonomische Vorteile. Sie stellen eine effiziente Möglichkeit dar, landwirtschaftliche Flächen an sich ändernde Klimabedingungen anzupassen und können zur Ertragsstabilität beitragen. Seit Anfang 2023 hat die Agroforstwirtschaft als nachhaltige Landnutzungsart in Deutschland eine bemerkenswerte Entwicklung erfahren. Im Landkreis Wolfenbüttel wurden in den letzten Jahren bereits von drei landwirtschaftlichen Betrieben Agroforstsysteme umgesetzt.
Neueste Entwicklungen in Modellregion Wolfenbüttel
Seit Anfang 2025 wird Agroforst im Landkreis Wolfenbüttel auch durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse gefördert. Dieses deutschlandweit erste Förderprogramm für das Gebiet eines Landkreises erleichtert landwirtschaftlichen Betrieben, Agroforst ökonomisch und praktisch zu durchdenken und auszuprobieren.
Beratung und Planung werden bis zu 70 Prozent gefördert, die Einrichtung einschließlich Entwicklungspflege sogar bis zu 90 Prozent. Anfang 2025 ist auch das Projekt „Klima-Landschaft mit Agroforst“ gestartet. Die ProjectTogether gGmbH arbeitet zusammen mit dem Aufbauende Landwirtschaft e. V. und dem Deutschen Fachverband für Agroforst e. V. (DeFAF) in Kooperation mit der Landkreisverwaltung daran, den Landkreis Wolfenbüttel als Modellregion für eine klimaangepasste Landnutzung mit Agroforstsystemen zu entwickeln. Der Prozess umfasst die Analyse von Potenzialen, die Identifizierung von Zielbildern sowie die Schulung potenzieller Umsetzer und synergetischer Wertschöpfungsgemeinschaften. Ergebnisse sollen auf Basis von Partizipationsprozessen ein Visionsbild, konkrete Agroforstplanungen sowie Flächenpläne für die Klimalandschaft Wolfenbüttel sein. Ziel sind detaillierte Planungen für Agroforstflächen für und mit den örtlichen Landwirten und Landwirtinnen. Als Mehrwerte für landwirtschaftliche Betriebe werden verbesserte Bodenqualität, reduzierte Erosion, stabilere Erträge und neue Einkommensmöglichkeiten gesehen. Ein erstes Erprobungsvorhaben,
die „Blaue Wabe“, befindet sich aktuell in der abschließenden Prüfung beim Bundesamt für Naturschutz. Schwammstadt-Elemente auch auf dem Dorf Im oberen Wassereinzugsgebiet des Gewässers Wabe im Naturpark Elm-Lappwald sollen neben der Etablierung von Agroforstsystemen auf landwirtschaftlichen Flächen auch Maßnahmen zum Wasserrückhalt im Wald sowie „Schwammstadt“Elemente im Dorf Neuerkerode umgesetzt werden. Partner sind hier der Landschaftspflegeverband Wolfenbüttel e. V., die Niedersächsischen Landesforsten sowie die Stiftung Neuerkerode. Ende 2022 wurde die Verwaltung durch den Kreistag beauftragt, Entwicklungspotenziale in Hinblick auf eine mögliche Revitalisierung des Niedermoores „Großes Bruch“ im Süden des Landkreises zu prüfen und einen Beteiligungsprozess mit Landbesitzenden und -nutzenden und anderen Akteuren zu initiieren. Hierzu wurden 2024 entsprechende Arbeitsgruppen gebildet. Ziel ist es, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Wasserhaltefähigkeit unter Berücksichtigung von Bodenertragsalternativen zu erhöhen. Auch hier ist aktuell ein Förderantrag beim Land in der Prüfung.
Klima angepasst werden kann. Über die Jahre wurden verschiedene Forschungsprojekte und Maßnahmen ergriffen, aber auch Sensoren und Ähnliches in der Stadt verteilt, um Hitzeinseln und grundsätzliche Temperaturschwankungen feststellen zu können. Da sich durch den Klimawandel aber immer extremere Wetterlagen ergeben, hat das Dresdener Umweltamt ein „gesamtstädtisches Klimaanpassungskonzept“ entwickelt, welches nun im Januar fertig gestellt werden konnte. Im Zuge des Konzeptes wurden umfassende Analysen zu Notwendigkeiten und Möglichkeiten in Alt- und Neustadt durchgeführt. Klimabedingte Gefährdungspotenziale und ortskonkrete Defizit- bzw. Betroffenheitsanalysen wurden unter anderem durch externe Fachleute ermittelt bzw. durchgeführt. „Um quartierspezifische Besonderheiten abzubilden, konnten zudem die Dresdnerinnen und Dresdner in Workshops – den „KlimaTischen“ – Vorschläge für Anpassungsmaßnahmen machen.“ Diese Vorschläge reichten von ersten Ideen und allgemeinen Hinweisen zu konkreten Projektvorschlägen zu Schwammstadtelementen, die Hitze verringern und Starkregenfolgen mindern sollten.
Diese aus Analysen und Anregungen zusammengetragenen Maßnahmen sollen nun in verschiedenen Projektphasen umgesetzt werden oder sind zum Teil bereits umgesetzt worden. Dazu werden Fördermöglichkeiten geprüft. Der Leiter des Dresdener Umweltamts, René Herold, hält dies für essenziell: „Klimabedingte Gesundheitsrisiken werden so minimiert, zukunftsfähige Arbeitsplätze gesichert, die Lebensqualität in Dresden gewährleistet und unsere Stadt als attraktiver Tourismusstandort erhalten.“ Die Resilienz einer Stadt werde zu einem bedeutenden Standortfaktor für neue Unternehmensansiedlungen.
Seit Sommer 2022 arbeitet der Landkreis Wolfenbüttel zudem an einem Wasserversorgungskonzept. Aufgrund der klimatischen Entwicklungen haben sich die Fragen zur Grundwasserentnahme verschärft. Da die per Erlass nutzbaren Dargebotsreserven der Grundwasserkörper nur einen geringen Spielraum aufweisen, wurde das Projekt initiiert, um ein zukunftsfähiges Konzept und nachhaltige Strategien zum Umgang mit der Ressource Grundwasser zu entwickeln.

Sven Volkers ist Kreisbaurat im Landkreis Wolfenbüttel und verantwortet die Bereiche Umwelt, Bauen und Wirtschaftsbetriebe. Zudem ist er Geschäftsführer des Naturparks ElmLappwald und leitet die Verwaltung der Stiftung Zukunftsfonds Asse. Foto: BS/privat

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde gegen die in Tübingen eingeführte Verpackungssteuer zurückgewiesen. Die Steuer wird auf Einweggeschirr für Lebensmittel zum Mitnehmen erhoben. Die Beschwerde war von der Betreiberin einer ansässigen McDonald’s-Filiale eingereicht worden. Nachdem dieser in der Vorinstanz stattgegeben wurde, wies sie das Oberverwaltungsgericht in Leipzig ab. Nach der Entscheidung zog die Franchisenehmerin vor das Bundesverfassungsgericht, welches die Beschwerde nun endgültig abwies.
Spitzenverbände freuen sich Der Deutsche Städtetag (DST), der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßen die Entscheidung. „Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur „Tübinger Verpackungssteuer“ ist aus kommunaler Sicht zu begrüßen. Das Gericht hat klargestellt, dass die Erhebung einer kommunalen Verpackungssteuer auf nicht wiederverwendbare Verpackungen und Einweggeschirr im Gastrobereich als örtliche Verbrauchssteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2a GG rechtmäßig ist“, erklärte DStGBHauptgeschäftsführer Dr. André Berghegger. Damit würden im Ergebnis die kommunalen Handlungsspielräume im Kampf gegen die Vermüllung der Innenstädte und der Umwelt durch Einwegverpackungen sinnvoll gestärkt. Städte und Gemeinden gäben jährlich bis zu 700 Millionen Euro für die Sammlung und Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze aus. Helmut Dedy, DST-Hauptgeschäftsführer, betonte: „Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben die Städte mehr Planungssicherheit. Wir rechnen damit, dass jetzt mehr Städte eine Verpackungssteuer lokal einführen werden.“ Er wirbt dafür, eine bundesweite Regelung für eine solche Steuer einzuführen. Ob die Tübinger Verpackungssteuer Schule machen wird, ist derzeit noch ungewiss. So heißt es aus der
Seit
letztem Februar versucht die hessische Polizei in den Innenstädten für mehr Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Unterstützt wird sie dabei vom Hessischen Polizeipräsidium Einsatz. Insgesamt ziehen alle Beteiligten ein positives Fazit. Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Offenbach, Hanau, Gießen, Marburg, Fulda, Rüsselsheim, Bad Homburg und Wetzlar sind seit Beginn an dabei. Im August 2024 schlossen sich auch Bad Hersfeld und Biedenkopf der Innenstadtoffensive an. Damit wirken alle sieben Polizeipräsidien daran mit, den Kontrolldruck in den Innenstädten durch mehr Polizeipräsenz zu erhöhen, um die objektive Sicherheitslage zu steigern und das subjektive Sicherheitsgefühl zu verbessern.
Frankfurter Bahnhofsviertel ist Schwerpunkt Bis Dezember 2024 führten die beteiligten 28.500 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mehr als 50.000 Personenkontrollen durch. Zahlen zu den Ergebnissen der Kontrollen liegen allerdings erst ab Oktober vor. In den in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres wurden 540 Personen festgenommen und etwa 140 Haftbefehle vollstreckt. Das Frankfurter Bahnhofsviertel stellt einen besonderen Schwerpunkt der Innenstadtoffensive dar. Im vergangenen Jahr wurden dort insgesamt 15 Großkontrollen durchgeführt. Ende Januar erfolgte die erste Schwerpunktkontrolle des ak-
Littering als Ordnungsproblem
(BS/bk) Rund 320.000 Einwegbecher für Heißgetränke werden laut Bundesumweltministerium in Deutschland pro Stunde verbraucht. Auch Einwegverpackungen für Speisen treiben in den Kommunen die Kosten der Abfallentsorgung in die Höhe. Tübingen reagiert 2022 mit der Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer: Für Einwegverpackungen gelten 50 Cent, für Einwegbesteck 20 Cent Aufschlag. Damit wolle die Stadt neben der Kostendeckung auch Anreize für das Angebot von Mehrwegverpackungen schaffen. Führt das nicht nur zu einer saubereren, sondern auch zu einer sichereren Stadt?

Viele Städte haben Vermüllung von öffentlichen Plätzen zu kämpfen. Ob eine kommunale Verpackungssteuer Abhilfe schafft, wird sich zeigen. Foto: BS/T, stock.adobe.com
Stadt Freiburg, dass man den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zunächst erst einmal prüfen und bewerten wolle – insbesondere die Argumentation sowie etwaige rechtlich zu berücksichtigende Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts. Es sei aber geplant, bis zur Sommerpause eine Vorlage zur Verpackungssteuer in die politischen Gremien zu bringen.
Die Stadt Heidelberg bereitet die Einführung einer Verpackungssteuer vor. Das Ziel sei es, die Verpackungssteuer in diesem Jahr mit einem Satzungsbeschluss umzusetzen. Da die Stadt Heidelberg eine vergleichsweise junge Stadt sei, finde das Leben häufig – vor allem in den Sommermonaten – im Freien statt. Dies führe zu Vermülllung. Die Verpflichtung der Gastronomie, ein Mehrwegsystem für To-Go-Angebote einzuführen, wirke nur auf
einen Teil der Littering-Abfälle. Im Heidelberger Stadtgebiet seien zudem flächendeckend ausreichend Abfallbehälter aufgestellt, dennoch müssten zentrale und belebte Plätze bei Bedarf teilweise mehrmals täglich gereinigt werden. Ergänzend dazu sehe die Bußgeldstelle Bußgelder für die Verschmutzung im öffentlichen Raum vor.
Neues Werkzeug, neue Probleme Die Stadt Frankfurt am Main plant gegenwärtig keine Einführung einer solchen Steuer. Auch dort habe die Stadt mit erheblicher Vermüllung zu kämpfen. Im Rahmen der Streifengänge stelle die Stadtpolizei des Ordnungsamtes regelmäßig hohe Vermüllungslagen fest. Die meisten Beschwerden und Feststellungen beträfen das Thema „wilder Sperrmüll“. Kleinabfälle fallen vor allem an viel frequentierten Ort an. Doch
sei eine Ahndung schwierig, da die Verursacher meistens nicht ausfindig gemacht werden könnten. Abhilfe habe eine vermehrte Aufstellung von Abfallbehältern geschaffen. Eine Verpackungssteuer wäre aus Umwelt- und Klimaschutzsicht sicherlich sinnvoll, um Littering zu vermeiden, Einwegverpackungen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, so eine Sprecherin der Stadt. Als Begründung gibt die Stadt am Main an, dass es durch die Einwegkunststoffverbotsverordnung (EWKVerbotsV) und das Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) bereits zwei Regelungen gebe, die eine ähnliche Zielrichtung verfolgten. Zwar könnte eine Steuer parallel laufen, doch eine lenkende Wirkung würde dann entstehen, wenn rechtlich vorgeschrieben würde, dass Produkte in Einwegverpa-
Erste Bilanz der hessischen Innenstadtoffensive liegt vor (BS/lm) Die Hessische Landesregierung hat Anfang des Jahres ihre Bilanz zur Innenstadtoffensive gezogen. Die Initiative, die als Teil ihres Sofortprogramms 11+1 im Februar letzten Jahres gestartet war, kann erste Erfolge vorweisen.
tuellen Jahres im Problemviertel, bei der auch die Bundespolizei unterstützend mitwirkte. Insgesamt wurden dabei 190 Personen kontrolliert und in der Folge vier Personen festgenommen sowie 27 Strafverfahren eingeleitet. Weitere Kontrollen sollen in kurzen Abständen folgen, um den Kontrolldruck hoch zu halten. Innenminister Dr. Roman Poseck (CDU) sagte: „Die Stadt Frankfurt hat leider über einen langen Zeitraum die notwendigen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einrichtung von Videoüberwachung und Waffenverboten, verweigert.“ Im letzten Jahr sei aber eine Stabilisierung der Lage gelungen.
Stadtpolizei zusätzlich involviert
In Wiesbaden arbeiten Stadt- und Landespolizei traditionell vertrauensvoll im Rahmen des Programms „Sicheres Wiesbaden“ zusammen, wie ein Sprecher mitteilte. In einzelnen Kontrollbereichen hat sich diese Zusammenarbeit durch die Innenstadtoffensive nach Auskunft der Stadt verstärkt. Dies gilt für den Bereich des illegalen Glücksspiels und die Durchsetzung des Messerverbotes in Waffenverbotszonen. Weitere gemeinsame Einzelmaßnahmen befinden sich in der Ausarbeitung.
Zudem erarbeitet der kommunalePräventionsrat einen Konzeptvorschlag zum Thema Städtebauliche Kriminalprävention. Bei den Kontrollen werde Wert darauf gelegt, in der Kommunikation den präventiven Charakter der Maß-
enger Kooperation von Stadt und Landespolizei eine Waffenverbotszone eingerichtet, die auf Daten der Kriminalitätsstatistik beruht und die Videoüberwachung erweitert und ertüchtigt. Ordnungsdezernent Heiko Lehmkuhl begrüßt die Initia-
„Wir werden die Innenstadtoffensive auch in diesem Jahr mit Hochdruck fortsetzen.“
Dr. Roman Poseck, Hessischer Innenminister
nahmen zu betonen. Dies führe zu einer hohen Akzeptanz der Kontrollen in der Bevölkerung und erhöhe das Sicherheitsgefühl. Die Stadt Kassel hat im Rahmen der Innenstadtoffensive die Zusammenarbeit der Landespolizei mit der Stadtpolizei wie auch mit dem Gewerbeaußendienst intensiviert und gemeinsame, abgestimmte Kontrollen und Aktionen durchgeführt. Im Herbst wurde in der Innenstadt in
ckungen teurer zu verkaufen seien als solche in Mehrwegverpackungen. Eine solche Regelung müsse nach Einschätzung des Magistrats bundeseinheitlich über das Verpackungsgesetz geregelt werden. Zudem würde eine Einführung einen zusätzlichen erheblichen Verwaltungsaufwand darstellen. Im Norden ist man ebenfalls skeptisch, ob eine Verpackungssteuer allein hilft. „Grundsätzlich kann eine solche Steuer Anreize schaffen, Verpackungsmüll zu reduzieren, was sich positiv auf das Stadtbild auswirken könnte“, heißt es aus dem Magistrat der Stadt Bremerhaven. Eine sauberere Umgebung könne wiederum das allgemeine Verhalten beeinflussen. Die Wirkung hänge jedoch von mehreren Faktoren ab, wie die Umsetzung der Steuer und den begleitenden Maßnahmen. Gezielte Kontrollen auf Littering gebe es von Seiten des Bürger- und Ordnungsamtes nicht. Diese fänden lediglich im Rahmen des normalen Streifendienstes statt, so ein Sprecher.
„Sauberkeit als Vorstufe für Sicherheit“ Neben einer sauberen Stadt erhofft man sich beim DST ein Mehr an Sicherheit. Nach einem Positionspapier betrachtet man „Sauberkeit als Vorstufe von Sicherheit“: Indem sich Städte für ein reines und freundliches Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger einsetzten, wirkten sie zugleich der Entstehung kriminovalenter Faktoren entgegen. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Sauberkeit und Sicherheit sei ein wichtiges Element der kommunalen Sicherheitspolitik. Hintergrund der Annahme bildet die sogenannte „Broken windowsTheorie“. Folgt man dieser Theorie, so stehen die Verwahrlosung des städtischen Umfelds und die Entstehung von Kriminalität in einem direkten Zusammenhang. Deshalb müsse man der Verwahrlosung möglichst frühzeitig Einhalt gebieten.
Bereich des Herrngartens. Stadtrat Paul Georg Wandrey begrüßt die gesteigerte Polizeipräsenz sehr.
Weitere Städte willkommen Innenminister Poseck erwog bereits zum Start der Initiative eine Ausweitung auf weitere Städte und ermutigte die Teilnehmenden, die gesamte Bandbreite an Maßnahmen wahrzunehmen: „Insoweit appelliere ich auch an die Kommunen, von den Möglichkeiten der Waffenverbotszonen und der Videoüberwachungen Gebrauch zu machen. Auch eine gute Beleuchtung und regelmäßige Müllbeseitigung können viel bewirken.“ Seit Anfang Februar hat auch Bad Hersfeld eine Waffenverbotszone eingerichtet. Bevor sich die knapp über 30.000 Einwohner zählende Kreisstadt dem Programm anschloss, hatte sie zunächst das Bundesgesetz abgewartet, das die Zuständigkeit für Waffenverbotszonen an die Bundesländer übergab. Die Landesregierung übertrug diese Kompetenz im Dezember per Verordnung auf die Städte und Gemeinden.
tive ausdrücklich: „Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kassel und der Landespolizei konnten wir bereits zahlreiche präventive und repressive Maßnahmen erfolgreich umsetzen.“ Auf diese Weise werde das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt. Derlei Absprachen zwischen Landes- und Stadtpolizei gibt es auch in Darmstadt, so auch beim letztjährigen Weihnachtsmarkt und im
Bürgermeisterin Anke Hoffmann (parteilos) hält die Polizeipräsenz für einen entscheidenden Baustein für die Gewährleistung der Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger. Dies habe oberste Priorität. Überdies seien die Rückmeldungen aus der Bevölkerung durchweg positiv. Sie erhoffe sich, dass die Innenstadtoffensive dabei helfe, Straftaten zu verhindern.
genua ist made in Germany –für Ihre digitale Souveränität.

18. – 19. März 2025 SAVE THE DATE

Arbeiten an jedem Ort. VS-NfD-konform.
Excellence in Digital Security.


Sichern Sie die Integrität und Handlungsfähigkeit Ihrer Behörde durch höchste IT-Sicherheit von genua.


Unsere genusecure Suite ermöglicht VS-NfD-konforme Arbeitsplätze sowie umfassenden Schutz nach strengsten Standards für Ihre behördliche Kommunikation. Mehr erfahren: genua.de/genusecure-suite
Vienna House Andel’s Berlin




Vertrauen Sie auf genua – für sichere und robuste IT-Infrastrukturen.








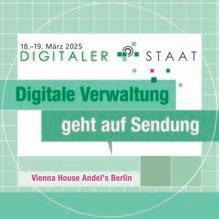





www.dv-rlp.de



Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Februar 2025
(BS/Christian Brecht) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bezeichnet sie als „das größte Digitalisierungsprojekt in der Geschichte Deutschlands“: die elektronische Patientenakte. Die Testphase für das Projekt begann Mitte Januar, der Minister und die BSI-Präsidentin haben keine Zweifel an der Sicherheit der digitalen Akte. Doch ein simulierter Hacker-Angriff kurz vor dem Jahreswechsel nährt neue Zweifel am Datenschutz.
www.behoerdenspiegel.de

Titelgrafik: BS/Hoffmann unter Verwendung von: Saim Art, stock.adobe.com; soyibakter, stock.adobe.com; dunga, stock.adobe.com; Radiographs, stock.adobe.com; peterschreiber.media, stock.adobe.com; Sunday Cat Studio, stock.adobe.com
Seit dem 15. Januar existiert von allen 73 Millionen in Deutschland gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) – sofern dieser durch das sogenannte Opt-out-Verfahren nicht individuell widersprochen wird. In der digitalen Akte werden erstmals alle vorhandenen Gesundheitsdaten einer Patientin oder eines Patienten zusammengefasst. Präzisere Diagnosen und bessere Behandlungen sind das Ziel. Im Rahmen einer ersten Testphase setzen derzeit rund 300 Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Franken die ePA ein. Ein reibungsloserer Start also als etwa die Einführung des elektronischen Rezepts (E-Rezept)? Nur bedingt. Zwei Wochen vor dem Beginn der Testphase bekamen Bedenken hinsichtlich des Gesundheitsdatenschutzes des Projekts neuen Auftrieb.
Zugriff auf jede beliebige Akte „Die Daten sind sicher“, ging Bundesgesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach (SPD) bei einer Präsentation der ePA in Köln auf ebendiese Bedenken ein. Wenn es auch nur „ein Restrisiko für einen großen Hacker-Angriff“ gäbe, würde die ePA nicht online gehen, versicherte er. Lauterbach bezog sich damit auf einen Cyber-Angriff auf die Patientenakte, den die IT-Sicherheitsexpertin Bianca Kastl und ihr Kollege Martin Tschirsich koordiniert, ausgewertet und auf dem 38. Chaos Communication Congress (38C3) Ende 2024 in Hamburg vorgestellt hatten. Ihre Kernaussage: Cyber-Kriminelle könnten „aus der Ferne auf jede beliebige ePA zugreifen“. Sicherheitslücken gebe es beim Ausgabeprozess der Versichertenkarten, bei den Beantragungsportalen der
Praxisausweise sowie dem alltäglichen Umgang mit den Karten. Auf die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ging Gabriela Bogk, CISO bei Stadler und Leiterin des 38C3Programms, via LinkedIn noch mal gesondert ein: Das Passwort zum ePA-Zugang ist Bogk zufolge „auf die elektronische Gesundheitskarte gedruckt“. Der Zugang erfolgt nämlich über die Identifikationsnummer der Karte, die auf deren Rückseite steht. Bogk verglich das mit einer auf der Kreditkarte notierten PIN –was ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen würde.
Blindflug und Stigmatisierung Kastls und Tschirsichs erfolgreiches Hacken der elektronischen Patientenakte rief entsprechende Verunsicherung in der Politik und im Gesundheitswesen hervor. Der Bund sei gefordert, „jetzt schnell zu handeln, auf die Vorwürfe einzugehen und gegebenenfalls Mängel abzustellen“, erklärte Denis Lehmkemper, Landesbeauftragter für den Datenschutz in Niedersachsen.
„Das ePA-Passwort ist auf die Gesundheitskarte gedruckt.“
Gabriela Bogk, Chaos Computer Club
Beim Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten dürften die Bürgerinnen und Bürger „vom Staat höchste Sicherheitsstandards erwarten“, so Lehmkemper Dr. Michael Hubmann, Präsident des
Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte (BVKJ), sprach von einem „Blindflug“, bei dem die Verantwortlichen versuchten, eine „leicht zu überwindende Datenlücke kleinzureden“.
Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), sagte gegenüber dem Ärzteblatt, er würde seinen Patientinnen und Patienten die ePA derzeit nicht empfehlen. Und am Tag des Starts der Testphase äußerte der Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit seine Bedenken in einem offenen Brief. Zu dessen Mitzeichnenden gehört auch der Bundesverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP). Dieser sorgt sich insbesondere um psychiatrische und psychotherapeutische Patientendaten, die von anderen medizinischen Stellen gelesen werden und zu Stigmatisierung führen könnten. Auch sei es psychisch schwer kranken Menschen oft gar nicht möglich, die Opt-out-Option zu ziehen, weshalb sich der BDP – erfolglos – für die Opt-in-Variante (aktive Zustimmung) ausgesprochen hatte.
Datenmissbrauch unwahrscheinlich
Bei vielen Ärztinnen und Ärzten überwiegt indes zunächst die Freude über die Vorteile der ePA, insbesondere in den Hausarztpraxen, die oft viele Patientendaten von unterschiedlichen Stellen zusammentragen und medizinische Leistungen teils doppelt erledigen müssen. Dr. Bahman Afzali etwa, dessen Gemeinschaftspraxis zu den rund 300 Teststellen gehört, fällt jetzt umso mehr auf, „wie sehr die ePA für alle wirklich fehlt“, so der Arzt gegenüber der FAZ. Ständig würden „Befunde und Daten“ fehlen, mit denen er „besser und
schneller“ behandeln könnte, so Afzali. Gesundheitsminister Lauterbach bleibt derweil zuversichtlich, was sein Herzensprojekt angeht, das er unbedingt vor dem Ende der Legislatur – und somit womöglich dem Ende seiner Zeit als Gesundheitsminister – zu einem erfolgreichen Abschluss bringen will. In der Testphase sei ein Datenmissbrauch „völlig ausgeschlossen“ und bis zum bundesweiten Rollout müssten nur noch Kleinigkeiten verbessert werden, so Lauterbach. Der Gesundheitsminister vertraut seinen für die technische Umsetzung der ePA verantwortlichen Stellen: dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Gematik, die Deutsch-
„In der Testphase ist ein Datenmissbrauch ausgeschlossen.“
Dr. Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister
lands Telematikinfrastruktur (TI) regelt. Letztere bedankte sich in einer Stellungnahme beim CCC. Man nehme die Sicherheitshinweise „entsprechend ernst“. Gleichwohl hält die Gematik einen derartigen Cyber-Angriff „in der Realität für nicht sehr wahrscheinlich“, da zu viele Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssten.
BSI-Präsidentin Claudia Plattner hatte die ePA im Sommer 2024 als „so sicher wie nur irgend möglich“ bezeichnet. Infolge der 38C3-Er-
kenntisse habe das BSI „umgehend zusätzliche Schutzmaßnahmen entwickelt und deren Umsetzung veranlasst“, heißt es aus Kreisen von Deutschlands IT-Sicherheitsbehörde. Die Umgebung der Kartenterminals müsse zudem so gewählt sein, dass „unautorisierte physische Zugriffe jederzeit durch das Gesundheitspersonal unterbunden werden können“. Bei allen digitalen Schutzmaßnahmen, deren Wirksamkeit sich in den kommenden Wochen und Monaten erweisen wird, braucht es für eine vollumfängliche Sicherheit der eigenen Gesundheitsdaten gegebenenfalls immer noch menschliches Eingreifen.
Zäher Beginn
Zur Halbzeit des vierwöchigen Testzeitraums bescheinigt Dr. Sibylle Steiner, Vorständin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der elektronischen Patientenakte keinen guten Start. „Wir stehen faktisch noch vor dem Anpfiff“, blieb Steiner während eines Pressegesprächs Ende Januar bei der Sportanalogie. Damit meinte sie, dass nicht mal jede fünfte Praxis in den Modellregionen die ePA bislang überhaupt habe testen können. Der Grund sei, dass diese Praxen wegen fehlender Rechte noch keinen Zugriff auf die ePA ihrer Patientinnen und Patienten hätten.
Ein Drittel der Testpraxen hätten von den Anbietern ihrer Praxisverwaltungssysteme (PVS) zudem noch kein ePA-3.0-Modul erhalten und könnten deshalb nicht testen. In dieser Gemengelage seitens des Bundesgesundheitsministeriums den bundesweiten Rollout im April anzukündigen, hält Steiner für „verfehlt“. Dr. Karl Lauterbach muss wohl noch ein paar Hürden aus dem Weg räumen.
Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft des Öffentlichen Dienstes. Wollen die Parteien ein Digitalministerium schaffen, welches gebündelt die Aufgaben der Digitalisierung vorantreibt und welche Rolle wird Künstliche Inteligenz im Zielbild der zukünftigen Regierung einnehmen.
Partei
23. FEBRUAR 2025






Soll es in der nächsten Legislatur ein eigenständiges Digitalministerium geben? Falls ja, wo lägen dessen konkrete operative Vorteile?
„Ja, wir wollen die Verantwortung zum Beispiel für Infrastruktur, Datenpolitik, KI, Plattformen und digitale Dienste bündeln. Dazu richten wir ein Bundesdigitalministerium ein. Die gesamte Beschaffung von IT im Bund und die einheitlichen Schnittstellen für IT-Systeme im öffentlichen Bereich verankern wir hier. Auch die Digitalressourcen im nachgeordneten Bereich bündeln wir.“

„Die Digitalisierung der deutschen öffentlichen Verwaltung hat für uns höchste Priorität. Seit 2023 besteht ein gesetzlicher Anspruch darauf, dass Bürgerinnen und Bürger jede Verwaltungsleistung digital beantragen können. Um diesen Anspruch schneller und konsequenter umzusetzen, werden wir alle Zuständigkeiten für die Verwaltungsdigitalisierung in einem Ministerium bündeln und es mit den erforderlichen finanziellen Mitteln und Befugnissen ausstatten. Nachgeordnete Stellen und Dienstleister wie ITZBund, Bundesdruckerei, Bundesverwaltungsamt, BSI, Digitalservice und FITKO müssen so organisiert werden und zusammenarbeiten, dass zentrale Projekte der Verwaltungsdigitalisierung endlich zügig und nutzerfreundlich umgesetzt werden können.“



„Wir Freie Demokraten betrachten exzellente Grundlagenforschung als entscheidende Voraussetzung für Innovationen. Deshalb möchten wir den gesamten Forschungsprozess – von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung bis hin zum Transfer in die Privatwirtschaft – stärken. Dazu ist es notwendig, Bürokratie abzubauen, und Deutschland damit wieder zu einem attraktiveren Standort für Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher zu machen – insbesondere durch kürzere Visawartezeiten. Die Kompetenzen für Innovationspolitik wollen wir in einem neu zu schaffenden Digitalministerium bündeln, Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen verstärkt unterstützen, insbesondere auf Basis der Erfahrungen mit DATIpilot und der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND). Private Investitionen möchten wir durch steuerliche Vorteile wie Forschungszulagen unterstützen.“
„Ein Digitalministerium ist eine von mehreren Möglichkeiten, um die Digitalpolitik zu organisieren. Wir sprechen uns für eine stärkere Bündelung von Zuständigkeiten und Budgetverantwortung aus, um die Digitalpolitik effektiver und effizienter zu gestalten. Ein wichtiger Schritt wäre die Einrichtung einer unabhängigen Digitalagentur. Mit einer solchen Agentur schaffen wir eine einheitliche Ansprechpartnerin für Digitalunternehmen und Nutzer, die über geballte Kompetenz verfügt. Dies würde es ermöglichen, die europäischen Digitalgesetze harmonisiert anzuwenden und die Digitalisierungsvorhaben stark umzusetzen. Sie würde in der Lage sein, die verschiedenen Akteure und Interessengruppen zusammenzubringen und eine koordinierte und effektive Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben zu gewährleisten.“


„Für eine erfolgreiche digitale Transformation ist eine zentrale ressortübergreifende Koordinierungstelle aller Digitalisierungsprojekte das zentrale Instrument. Diese Projekte sollten über ein zentrales Digitalbudget gesteuert werden. Als Querschnittsthema sollte Digitalisierung in allen Ministerien präsent sein und eher durch agilere Strukturen als durch ein separates Digitalministerium koordiniert werden.“


Welche Potenziale liegen im Einsatz künstlicher Intelligenz für die öffentliche Verwaltung?
„Hier liegen erhebliche Potenziale, die wir nutzen müssen. Mit dem Einsatz von KI bauen wir in Deutschland eine effiziente, vollständig digitalisierte Verwaltung für Bürger und Unternehmen auf, die rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche niederschwellig und nutzerfreundlich Serviceleistungen erbringen kann. Bei eindeutigen Sachverhalten wollen wir mit KI zu viel schnelleren Bescheiden kommen – wobei für die Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich immer ein Recht auf individuelle Überprüfung besteht.“
„Durch den Einsatz von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz beschleunigen und optimieren wir Verwaltungsprozesse. Damit entlasten wir die Beschäftigten und verbessern den Service für die Bürgerinnen und Bürger. Dies ermöglicht einen zeitgemäßen Zugang zu staatlichen Leistungen.“
„Wir Freie Demokraten wollen einen KI-Bürgerassistenten einführen, der Bürgerinnen und Bürger bei digitalen Behördengängen unterstützt. Der Assistent soll den Zugriff auf Verwaltungsdienstleistungen erleichtern und Zugangshürden abbauen. Wir wollen dadurch alle Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, Verwaltungsdienstleistungen einfach rein digital nutzen zu können. Künstliche Intelligenz kann die Erledigung vieler Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung effizienter machen und so das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit staatlicher Institutionen stärken. Sowohl intern als auch in der Interaktion mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen sorgt KI für mehr Effizienz und Nutzerfreundlichkeit.“
„Die Potenziale von KI für die öffentliche Verwaltung sind vielfältig. Zum Beispiel kann KI bei der Automatisierung von Routineaufgaben eingesetzt werden, um die Effizienz und Effektivität der Verwaltung zu verbessern. KI kann auch bei der Analyse von Daten und der Identifizierung von Mustern helfen, um bessere Entscheidungen zu treffen und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, dass KI im Rahmen unserer gemeinsamen Werte eingesetzt wird. Dies bedeutet, dass KI-Systeme so entwickelt und eingesetzt werden müssen, dass sie diskriminierungsfrei sind und die Menschenrechte schützen. Die Europäische Union (EU) hat mit der KI-Verordnung einen wichtigen Grundstein für die Regulierung von KI gelegt. Diese Verordnung muss nun möglichst unbürokratisch umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass KI-Systeme sicher und verantwortungsvoll eingesetzt werden.“
„KI kann helfen, die Vorgangsbearbeitung in Verwaltungsverfahren und insbesondere Planungsverfahren unter anderem durch automatisierte Datenverarbeitung zu beschleunigen und den Beschäftigten mehr Zeit für die Entscheidungsfindung geben. Kindergeld könnte automatisiert an Beschäftigte ausgezahlt werden, statt in jedem Einzelfall ein Antragsverfahren durchzuführen. So kann KI beim Bürokratieabbau insgesamt helfen.“
Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.
Das DVDV agiert als Türöffner und stellt zunächst sicher, dass die an einem Meldevorgang beteiligten Behörden berechtigt sind, Daten miteinander auszutauschen. Sobald der Authentifizierungsprozess erfolgreich war, gibt das DVDV auch die notwendigen Verbindungsparameter, wie Zertifikate und IT-Schnittstellen der Behörden, für die Datenübertragung frei. Die Kommunikation erfolgt auf Grundlage von DVDV automatisiert zwischen den IT-Fachverfahren der jeweiligen Behörden. Bei entsprechender gesetzlicher Grundlage können so mit nur einem Vorgang auch mehrere Behörden über eine Änderung, wie den neuen Wohnsitz, informiert werden. Die Nachrichten selbst werden auf Grundlage des OSCI-Standards verschlüsselt und übermittelt.
DVDV wurde bereits im Jahr 2007 mit Blick auf das elektronische Melderegister entwickelt. 2019 ging eine vollständig überarbeitete Version des Produkts in Betrieb. Heute sind mehr als 30.000 IT-Fachverfahren und 40.000 Organisationen im DVDV registriert. 2024 erhielt das DVDV rund 500 Millionen Anfragen: „Als zentrale Infrastruktur-
Die digitale Transformation bietet enorme Chancen: effizientere Prozesse, kürzere Bearbeitungszeiten und stärkere Bürgerfreundlichkeit. Dennoch hinken die Erwartungen an den digitalen Staat oft hinterher, wie auch der eGovernment Monitor 2024 zeigt.
Ein neuer Ansatz: Proaktiver Bürgerservice Push-Government kann staatliche Leistungen automatisieren und sie proaktiv anbieten, ohne dass Bürger aktiv Anträge stellen müssen. Leistungen wie Kindergeld oder Wohngeld lassen sich dann direkt anbieten, Fristen einfacher einhalten. Dies entlastet sowohl Bürger als auch Behördenmitarbeitende, die sich auf komplexere Anliegen konzentrieren können. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist dies ein entscheidender Hebel zur Effizienzsteigerung.
Herausforderungen und Lösungen Push-Government steht vor Hürden wie Datenschutzanforderungen, technischer Infrastruktur und föderalen Strukturen. Eine freiwil-
Das Deutsche Verwaltungsdiensteverzeichnis
(BS/FITKO) Jedes Jahr wechseln Millionen Menschen innerhalb von Deutschland ihren Wohnsitz. Wer beispielsweise von Göttingen nach Wetzlar zieht, muss diese Änderung im Wetzlarer Stadtbüro melden oder den entsprechenden Antrag online ausfüllen. Mit der Wohnsitzummeldung wird auch die Stadt Göttingen über den Umzug informiert, die entsprechenden Daten werden automatisiert übermittelt. Eine entscheidende Rolle nimmt hierfür mit DVDV (Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis) ein Produkt des deutschen IT-Planungsrats ein.
komponente von Bund, Ländern und Kommunen ist das Produkt maßgeblich dafür, dass sich ITFachverfahren von Behörden im digitalen Raum finden und erfolgreich miteinander kommunizieren“, erklärt Stephan Bartholmei, Abteilungsleiter Produktmanagement in der FITKO (Föderale IT-Kooperation). Die FITKO steuert das Produkt seit Mitte 2021 im Auftrag des IT-Planungsrats.
Verfügbarkeit und Datenintegrität im Fokus
Entscheidend für den Erfolg des Produkts sind unter anderem die hohen Sicherheitsstandards und die deutschlandweite Verbundstruktur. Zusammen stellen sie die konstante Verfügbarkeit der
richtigen Verbindungsparameter sicher. Hierfür wird der Datenbestand im DVDV auf einem zentralen Server des Bundes gepflegt. Dieser Datenbestand wird bei Änderungen auf die DVDV-Server in den Bundesländern übertragen. Die Landesserver verarbeiten die Anfragen der IT-Fachverfahren, die für die Durchführung von Verwaltungsprozessen benötigt werden.

Hinter den Anfragen stehen immer Organisationen mit hoheitlichen Aufgaben, in der Regel Behörden und öffentliche IT-Dienstleister.
Sollte ein Server ausfallen, wird eine Anfrage automatisch an einen anderen DVDV-Server in den Ländern weitergeleitet. Änderungen am Datenbestand wie die Aufnahme eines neuen Fachverfahrens, aber auch die Verwaltung von Rollen und Rechten erfolgen ausschließlich am Server des Bundes. Verantwortlich hierfür sind autorisierte Stellen aus Bund und Ländern. Sie prüfen auch die Richtigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Über einen Auskunfts-Client können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen oder Fachverfahrensteller bei entsprechender Berechtigung Verbindungsparameter einsehen, jedoch nicht verändern. Dies garantiert die Integrität
der bereitgestellten Informationen. „Für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen oder auch für Sachbearbeitende in der Verwaltung agiert das DVDV unsichtbar im Hintergrund. Das Verzeichnis ist jedoch entscheidend dafür, dass tausende Verwaltungsprozesse und Online-Dienste in Deutschland jeden Tag reibungslos funktionieren“, erklärt Nia Katranouschkova, Projektmanagerin und Expertin für das DVDV im Amt für IT und Digitalisierung der Hamburger Senatskanzlei. Ausführliche Informationen zur Nutzung und Funktionsweise des DVDV stellt die FITKO über das Förderale Entwicklungsportal bereit. Das Portal bietet auf docs.fitko.de die relevanten technischen Dokumentationen für Umsetzungsverantwortliche aus Bund, Ländern und Kommunen zum DVDV und weiteren Produkten des IT-Planungsrats.
Weitere Informationen zum Produkt finden sich unter: docs.fitko.de/dvdv In der März-Ausgabe des Behörden Spiegel wird das Portalverbund Online-Gateway (PVOG) vorgestellt.
rungen basierend auf vorhandenen Daten.
Verwaltungsservices per Klick: Effizient und unkompliziert (BS/Florian Wüchner/Frank Zettler*) Push-Government zielt auf einen Paradigmenwechsel in der öffentlichen Verwaltung ab, indem es von einer reaktiven zu einer proaktiven Dienstleistungserbringung übergeht. Materna und Infora unterstützen diesen Ansatz mit erfahrenen Teams, einem KI-Fahrplan und etablierten KI- und Tech-Ökosystem.
lige Opt-out-Lösung sowie nutzerzentrierte Ansätze können Skepsis abbauen. Ziel ist eine Akzeptanz vergleichbar mit dem Komfort von Online-Shopping.
Von „der Markt zieht“ zu „der Staat schiebt“ Für den Erfolg von Push-Government braucht es acht zentrale Schlüsseldimensionen.
1. Leistungen werden gezielt aus Sicht der Bürgerbedürfnisse ausgewählt und aufgebaut, idealerweise priorisiert nach Fallzahlen.
2. Die Verwaltung muss proaktive Angebote schaffen, indem sie Voraussetzungen und gezielte Ansprache der Zielgruppen automatisch abgleicht.
3. Mit dem Scouting von Diensten und Best Practices im EUKontext lassen sich Quick Wins
Digitale Souveränität sei kein „nice to have“, sondern entscheidend für die Regierbarkeit Deutschlands und Europas und Kernaufgabe der Fachbereiche, verdeutlichte Dr. Markus Richter, CIO Bund auf der Geburtstagsfeier des ZenDiS in Bochum. Dort sei sie jedoch „noch nicht ganz angekommen“. Das ZenDiS beschrieb der Aufsichtsratsvorsitzende als Ankerpunkt für Souveränität, Open Source und Wettbewerb. Letzterer ist Richter wichtig: Er plädierte dafür, einen Markt für „Lock-in-freie“ Lösungen zu schaffen, anstatt Verbote auszusprechen. Der CIO verwies weiterhin auf die Zusammenarbeit des ZenDiS mit Ländern wie Frankreich und den Niederlanden. „Jetzt fängt es erst an Spaß zu machen, weil wir in das Inhaltliche kommen“, beschrieb Richter den Moment ein Jahr nach der Gründung des Zentrums. Die Office- und CollaborationSuite des ZenDiS openDesk verzeichnete seit ihrem Launch im Oktober 2024 über 1.000 Anfragen aus Bund, Ländern, Kommunen, Bildungseinrichtungen und auch Unternehmen. Sie hat 1.700 Pilotnutzende und 35.000 aktive Lizenzen der Enterprise-Edition. Auch openCode wird mit aktuell 5.400 Nutzenden immer beliebter und erlebte kürzlich einen Relaunch. Zurzeit dient die Plattform primär dem Austausch von Software. Andere Anwendungsfälle wie etwa die ebenenübergreifende Kollaboration sollen stärker betont werden, kündigte die ZenDiS-Com-
realisieren, die von Steuererklärungen bis Sozialleistungen reichen.
4. Push-Government setzt hochmoderne Analyse- und KI-Plattformen voraus, um flexible und skalierbare Services aus der souveränen Cloud zukunftssicher zu liefern.
5. Insgesamt müssen die Interaktionen mit der Verwaltung mit „maßgeschneiderten“ Dienstleistungen vereinfacht und beschleunigt werden. Das schafft mehr zufriedene Bürger.
6. Staatliche Leistungen müssen schneller und unkomplizierter bereitgestellt werden und die Bearbeitungszeiten müssen sich verkürzen.
7. Der Abbau von Bürokratie durch Automatisierung fördert die Teilhabe an Leistungen der öffentlichen Hand und stärkt
openDesk hat 1.700 Pilotnutzende
das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürgern.
8. Schließlich ist auch die interne Perspektive der Verwaltung wichtig mit den Themen Regulatorik, Technologie und Datenschutz, Vernetzung von Datenquellen sowie Konzeption und Betrieb.
Einfache Push-Government-Dienste können bereits heute in digitalisierten Fachverfahren ergänzt werden, während komplexere Anforderungen von den Ergebnissen der laufenden Registermodernisierung profitieren (z. B. geregelter Datenaustausch zwischen Behörden).
Drei zentrale Dimensionen von Push-Government » Proaktive Bereitstellung: Bürger erhalten relevante Leistungen automatisch, z. B. Steuererklä-
(BS/ast) Am 15. Januar 2024 nahm das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) offiziell seine Arbeit auf. Ein Jahr später feiert es seinen ersten Geburtstag, zieht eine positive Bilanz und gibt einen Ausblick auf seine weitere Arbeit.
munity-Managerin Janou Feikens an. Ein neues Badge soll künftig auf den ersten Blick Informationen über die verschiedenen Softwares geben. Außerdem werde openCode mit dem BSI zur Basis für eine sichere Software-Lieferkette und zu einem sicheren Bezugsort für Software weiterentwickelt.
Messbare Souveränität Neben seinen Plattformen und Produkten bietet das ZenDiS auch Beratung für die öffentliche Verwaltung an. In diesem Jahr steht ein weiteres Projekt an: „Wir werden die digitale Souveränität messbar machen“, sagte ZenDiS-Geschäftsführerin Jutta Horstmann. Dazu entwickelt das ZenDiS einen „Souveränitäts-Check“, der zu einem „Souveränitäts-Index“ führt. Damit könne in Zukunft ein Lagebild der technologischen (Un-)Abhängigkeit der Verwaltung erstellt werden. Luise Kranich , Referatsleiterin „Rahmenarchitektur, Standardisierung für Plattformsysteme und für Digitale Services“ im Bundesinnenministerium (BMI), bestätigte in der anschließenden Podiumsdiskussion, dass openCode vorher für Nicht-Entwickler kompliziert zu nutzen gewesen sei. Die Plattform sei aber mit dem User-Feedback verbessert worden und helfe dem
» Technologische Nutzung: effektive Nutzung von Daten sowie Technologien wie KI und Big Data ermöglichen personalisierte Interaktionen, etwa bei Lebensereignissen wie Umzug oder Geburt.
» Effizienz und Bürgererfahrung: Weniger Bürokratie, höhere Zufriedenheit und gestärktes Vertrauen.
Fazit
Push-Government schafft eine zukunftsfähige Verwaltung, die durch personalisierte, digitale Dienstleistungen überzeugt. Mit einem etablierten KI- und TechÖkosystem, erfahrenen Teams und einem etablierten KI-Fahrplan mit flexiblen Einstiegsmöglichkeiten ist Materna der ideale Partner für die Umsetzung einer Push-Government-Plattform.
*Florian Wüchner ist Vice President im Ressort Public Sector bei Materna. Frank Zettler ist Senior Consultant beim Tochterunternehmen Infora.
BMI nun dabei, in einer öffentlichen Konsultation zur Architekturrichtlinie die Meinungen von Experten einzusammeln und vorzustrukturieren. Kranich verwies auch auf die „noch viel zu geringe“ Bedeutung von Open Source in der OZG-Umsetzung. Diese begründe sich unter anderem darin, dass proprietäre Software oft kurzfristig günstiger sei. Daher brauche es eine Gesamtkostenbetrachtung, findet die Referatsleiterin.
Ein zweiter KGSt-Bericht zu Open Source in Kommunen beschreibt den Aufbau einer Open-SourceGovernance. „Open Source muss sich als Thema durch alle Steuerungs- und Management-Felder ziehen“, sagte die Autorin des Berichts Anika Krellmann (KGSt). Hier brauche es mehr Kompetenzen. Die pionierhaften Empfehlungen des Berichts „müssen wir jetzt erproben“, schloss Krellmann
Behörden Spiegel: Kommunen stehen zunehmend vor Herausforderungen durch die wachsende Gefahrenlage im Cyber-Raum. Kann die AKDB dabei unterstützen?
Gudrun Aschenbrenner: CyberAttacken werden immer häufiger. Und die Auswirkungen solcher Angriffe beschränken sich nicht nur auf die technische Infrastruktur bei einem echten Hacker-Angriff, sondern haben auch andere Folgen. Beispiele wären Probleme bei Auszahlungen von Sozialhilfe oder die Nichtdurchführbarkeit von

AKDB setzt auf KI-Tool KAI und Open Source
(BS) Die AKDB ist der größte kommunale IT-Dienstleister in Bayern. Anna Ströbele und Paul Schubert sprachen mit Vorstandsmitglied Gudrun Aschenbrenner und dem Vorstandsvorsitzenden Rudolf Schleyer über die DeutschlandID, CyberHilfe für Kommunen und die Visionen zur digitalen Souveränität der Anstalt.
Autozulassungen. Letzteres hat wirtschaftliche Auswirkungen, z. B. dass eben auch Autohäuser, wenn Autos nicht zugelassen werden, in finanzielle Schwierigkeiten geraten können. Deswegen gilt natürlich, sich resilient aufzustellen. Da reden wir von Kosten, die investiert werden müssen. Investitionen in Mindset, in Know-how, Infrastruktur und Technologien sind nötig. Insofern sind zentrale IT-Dienstleister auch in Zukunft gefordert, Kommunen beiseitezustehen. Dies sowohl im Know-howAufbau als auch mit Blick auf den kommenden Fachkräftemangel, damit diese hohen Investitionengar nicht mehr vor Ort in den Kommunen getätigt werden müssen, sondern eben an anderer, zentraler Stelle mit einer besseren Skalierbarkeit.
Unterschiedliche Geschäftsmodelle beim Cyber Crime, die weder wir noch die Kommunen antizipieren können, nehmen immer weiter zu. Um da zu bestehen, müssen wir

Webinar am 11. März 2025
uns in diesem Bereich noch mehr professionalisieren.
Behörden Spiegel: Kommen wir nun zum Thema digitale Identitäten. Welche Bedeutung hat dieses Thema für die AKDB, insbesondere im Zusammenhang mit der DeutschlandID?
Schleyer: Digitale Identitäten sind die Grundlage für Ende-zu-Ende-digitalisierte Prozesse. Nur wenn ich als Verwaltung sicher sein kann, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer „wahren“ Identität einen Antrag gestellt haben, kann ich den Prozess sicher abwickeln. Da ist es wichtig, eine Identitätsprüfung oder eine Art von Identitätsnachweis zwischenzuschalten. Wir reden hier tatsächlich von einer unverzichtbaren Grundlage für die Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Deshalb halten wir digitale Identitäten für essenziell für ein erfolgreiches E-Government und für eine erfolgreiche Komplettdigitalisierung der Verwaltung. Die BundID spielt dabei eine ganz zen-
setzen können. Pro Woche haben wir etwa 100 Nutzende, die KAI erproben und über 10.000 Anfragen stellen. Die Nutzung ist bayernweit verteilt. Dabei sind kleinere, aber auch größere Gemeinden und Landratsämter aktiv.
Behörden Spiegel: Was macht KAI konkret?
Aschenbrenner: Es gibt verschiedene Use Cases. Zum einen bietet er Textzusammenfassungen oder eine Übersetzungsfunktion an. Jenseits von KAI arbeiten wir auch an einem KI-Assistenten, der z. B. den Straßenzustand erfassen kann. Dafür könnte man ein Fahrzeug, was in einem kommunalen Auftrag unterwegs ist, mit Kameras ausstatten, um die Umgebung zu erfassen. Aus diesen Informationen könnte der Assistent Vorschläge unterbreiten, ob eine Straße saniert werden muss, wie viel Zeit das in Anspruch nehwverursacht. In München haben wir z. B. im Sommer häufig das Problem, dass viele Straßen im Sommer gleichzeitig gesperrt werden, weil sie saniert werden müssen. Hier können KI-Tools ansetzen.
Behörden Spiegel: Kommen wir auf das Thema der digitalen Souveränität zu sprechen. Die AKDB ist seit 2021 Mitglied der Open Source Business Alliance. Wie zeigt sich das in Ihrem Organisationsprofil?
Zentrale Sicherheitskonzepte des Active Directory praktisch umsetzen
Das Ebenenmodell und gesicherte Admin-Arbeitsplätze sind zentrale Elemente in jedem Windows-Netzwerk-Sicherheitskonzept.
Obwohl gut dokumentiert, wirft deren praktische Umsetzung, wie die Einrichtung von Privileged Access Workstations (PAWs), oft Fragen auf. Zum Beispiel bezüglich der Anzahl der Ebenen, des Zugriffs im Homeoffice oder der Integration in die Cloud-IT.
Diese und viele weitere Fragen beantwortet unser Webinar.








trale Rolle. Wir als AKDB sind die Software-Lieferanten der BundID, die in Zukunft DeutschlandID heißen wird. Wir sind der Entwicklungspartner des BMI und entwickeln diese Funktionalitäten in enger Abstimmung mit dem Ministerium immer weiter. Wir haben dieses Jahr auch das Zentrale Bürgerpostfach als eigenständige Komponente der BundID weiterentwickelt. Wir haben schon bei der Smart Country Convention vorgeführt, wie die zukünftige EUDI-Wallet eingebunden wird, wie also tatsächlich aus der BundID Dokumente in diese Wallet abgelegt werden können. Wir kommen damit immer mehr in die Lebenswirklichkeit der Menschen, die zunehmend völlig unabhängig von Zeit und Ort Verwaltungsleistungen nutzen wollen. Wir müssen in dieser Hinsicht auch an den Fachkräftemangel denken, der uns in den nächsten vier bis fünf Jahren Probleme bereiten wird. Wir müssen uns vorstellen, dass wir bis ins Jahr 2030 in eine Situation kommen, wo uns nach verschiedenen Prognosen etwa eine Million Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung fehlen werden. Da sind noch keine zusätzlichen Bedarfe hinzugerechnet, der Komplexitätszuwachs fehlt also noch. Insgesamt fehlt uns letztendlich jede fünfte Stelle, die nicht besetzbar sein wird. Wenn wir also nicht in eine solche dauerhafte Mangelsituation kommen wollen, dann bleibt uns nur die vollständige Automatisierung aller Verwaltungsvorgänge, die ohne einen menschlichen Eingriff durchlaufen können. Dafür brauchen wir auch rechtliche Grundlagen. Das wird man sich nicht ersparen können, aber man wird auch die Grundlagen schaffen müssen – mit den entsprechenden, leicht zugänglichen, voll digitalisierten Prozessen zusammen mit den weit verbreiteten digitalen Identitäten. Dann haben wir eine Chance, dass wir auch im Jahr 2030 noch eine funktionierende öffentliche Verwaltung erleben und nicht in die Situation einer echten Demokratiekrise hineingeraten. Denn wenn ein Staat nicht mehr funktioniert, werden die Bürgerinnen und Bürger auch an der Staatsform zweifeln. Das gilt es zu verhindern. Das klingt etwas pathetisch, aber ich glaube, man sieht schon an einigen Beispielen in Deutschland, dass solche Dysfunktionalitäten tatsächlich in problematische politische Situationen münden können.
Behörden Spiegel: Sie haben die Automatisierung als Hilfsmittel erwähnt – oft wird dabei auch Künstliche Intelligenz genannt, die Mitarbeitende entlasten kann. Wie Sie bereits sagten, hat die AKDB im Oktober 2024 einen kommunalen KIAssistenten vorgestellt. Frau Aschenbrenner, welche Funktionen bietet er und welche Kommunen nutzen ihn bereits?
Aschenbrenner: Unser KI-Assistent KAI ist schon seit über einem halben Jahr bei uns in Bayern unterwegs. Durch unser Kommunalforum konnten wir noch mehrere Pilotkunden gewinnen. Aktuell arbeiten wir mit 14 Kunden zusammen, die ihre speziellen Anforderungen mit unserem Produktmanagement erproben, wo wir auch direkt Anforderungen um-

Gudrun Aschenbrenner ist Vorstandsmitglied der AKDB. Foto: BS/AKDB
Schleyer: Wir haben, nachdem wir der Open Source Business Alliance beigetreten sind, begonnen, den Code unserer Online-Dienste im Open-Source-Repository zu veröffentlichen, weil wir schon seit vielen Jahren mit Open Source arbeiten. Gleichzeitig sind wir auch offen gegenüber dem „Public money, public code“-Ansatz, also freie Software als Standard für öffentlich finanzierte Software zu etablieren. Es soll nicht um die Generierung von privaten Gewinnen gehen. Digitale Souveränität im Allgemeinen hat aber auch mehr Aspekte als nur Open Source. Bei der AKDB befassen wir uns mit der Frage, wie unabhängig wir uns z. B. vom Einfluss anderer Staaten machen können. Wir werden allein mit Open Source in dieser Thematik nicht weiterkommen. Wir müssen Alternativen so weit verfügbar machen, dass der notwendige Betrieb aufrechterhalten werden kann. Wir sollten uns aber nicht nur auf die Software konzentrieren, sondern auch auf die Hardware blicken. Da haben wir Komponenten in unseren Mobilfunknetzen oder Rechenzentren, die wir nicht ohne Weiteres ersetzen können. Ich würde mir wünschen, dass wir uns das Gesamtsystem der öffentlichen IT etwas genauer vornehmen und uns intensiv mit der Frage auseinandersetzen: Wie viel Souveränität können wir sicherstellen?
Als Impuls für den Dialog stellte Dr. Dominik Böllhoff, PD, das Strategiepapier „Der Weg zur öffentlichen Hand von morgen“ und die darin enthaltenen Ansätze für eine grundlegende Verwaltungstransformation vor. Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation des Landes zeigten sich im politischen Diskurs zunehmend Forderungen, nicht nur den Bürokratieabbau voranzutreiben, sondern auch – so die neue Initiative des Bundespräsidenten – Staat und Verwaltung grundlegend zu reformieren.
Das Strategiepapier folgt diesem ganzheitlichen Veränderungsansatz. Zentral ist hierbei das Zielbild, an dem sich alle nötigen Veränderungen ausrichten. Dieses umfasst drei Handlungsfelder: Die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit, die Orientierung an Gemeinwohl und Service sowie die Durchsetzung von Effektivität und Effizienz. Vier wesentliche Reformbereiche müssen integriert und adressiert werden. Dies umfasst die Restrukturierung der Verwaltungslandschaft, die Personalentwicklung und -motivation, die Schaffung eines neuen Modus Operandi sowie die Produktivitätssteigerung. Die Umsetzung müsste zum einen in den einzelnen Behörden vorangetrieben werden. Zum anderen müssten hierfür die institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Transformation in den einzelnen Behörden
Katja Wilken, Präsidentin des Bundesverwaltungsamts, führte aus, dass neben Bemühungen für eine größere Verwaltungsstrukturreform, für die ein politischer Konsens notwendig sei, der Blick stärker auf die einzelnen Behörden gerichtet werden sollte. Hier bestünden Potenziale zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit. Relevante Ansatzpunkte seien die in einer Behörde angewandten Steuerungs-
Um die Einstellungen zur E-Akte zu erheben, wurde eine Online-Befragung durchgeführt. Es wurden Informationen zur Person, Einstellung zur Technologie und Erfahrungen mit der E-Akte erhoben. Der Fragebogen wurde über den Behörden Spiegel, das Online-Forum öffentlicher Dienst, ein Online-Forum des IT-Verbunds SchleswigHolstein sowie E-Mails an zufällig ausgewählte Kommunen, Landesund Bundesbehörden beworben.
Einstellung grundsätzlich positiv
Die Befragung wurde von April bis September durchgeführt. Insgesamt haben 169 Personen den Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt (94 weiblich, 67 männlich, Altersdurchschnitt 44.81 Jahre, bis auf zwei alle aus der öffentlichen Verwaltung). Die Affinität zur Technikinteraktion der Befragten ist sehr hoch. Ein Großteil (144) nutzt die E-Akte bereits in unterschiedlichem Ausmaß. Betrachtet man die kognitive und emotionale Bewertung der elektronischen Aktenführung, dann hatten fast alle Befragten eine positive Einstellung zum grundsätzlichen Konzept der E-Akte. Bei der tatsächlichen Erfahrung gibt es einen kleinen Teil, der auf emotionaler Ebene ablehnender ist.
Die tatsächliche Erfahrung mit der E-Akte wurde überwiegend positiv bewertet. Einige Personen äußerten jedoch kritisch, dass ihr Einsatz weder zu mehr Zeit für die Interaktion mit Stakeholdern führe noch Fehler verhindere und dass die Fehlerbehebung aufwändig sei. Weitere
Das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ unseres Staates verbessern
(BS/Marvin Zmiewski*) „Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Staates wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern als nicht mehr gut angesehen.“, erklärte Prof. Dr. Holger Mühlenkamp im Rahmen einer Veranstaltung an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Für Mühl enkamp, dort Professor für Öffentliche Betriebswirtschaftslehre, stehen Steuerbelastung, Bürokratiekosten und Zeitaufwand nicht mehr in angemessener Relation zu den Leistungen der öffentlichen Hand für die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen. Ausdruck dessen seien auch die jüngsten Wahlerfolge von Parteien, die dem etablierten politisch-administrativen System kritisch gegenüberstehen.

mechanismen sowie die Führungsund Organisationskultur. Durch wirkungsorientierte Steuerung und die Einführung eines Portfoliomanagements könnten Ressourcen zielgerichteter und damit wirksamer eingesetzt werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit der bestehenden Lob- und Kritikkultur fördere den Unternehmergeist in der Behörde und ermutige die Mitarbeitenden, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und rechtlichen Rahmenbedingungen bestmöglich
im Sinne des Gemeinwohls auszugestalten. Die notwendige Automatisierung und Digitalisierung werde durch die permanent steigende Zahl von gesetzlichen Einzelfallregelungen und fehlende Investitionsmittel gehemmt.
Zahlreiche Redundanzen auf kommunaler Ebene Zusätzlich sind Restrukturierungsprozesse der Verwaltungslandschaft notwendig. Diese seien, so Dr. Stephan Weinberg, Staats-
sekretär im Finanzministerium Rheinland-Pfalz, oft mit Widerständen verbunden und dadurch nicht leicht umzusetzen. Positive Erfahrungen bestünden beispielsweise durch die Konsolidierung von Standorten der Finanzverwaltung in Rheinland-Pfalz. Wesentlicher Erfolgsfaktor sei hierbei, die Potenziale der Digitalisierung und Automatisierung zu nutzen.
Dorothea Störr-Ritter, Landrätin a. D. und Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats, wies darauf hin,
Wie stehen Sie zur elektronischen Aktenführung?
(BS/Prof. Dr. Moreen Heine/Dr. Daniel Wessel/Florian König*) Eine ordnungsgemäße Aktenführung ist Kernaufgabe in Verwaltungen. Nur so können behördliche Entscheidungen nachvollzogen werden. Die Digitalisierung der Aktenführung in Form der E-Akte-Einführung gilt daher als eine zentrale Aufgabe in der Verwaltungsdigitalisierung. Wie erleben Beschäftigte die Einführung und Nutzung von E-Akte-Systemen? Welche Haltung haben Sie gegenüber der elektronischen Aktenführung? Eine Befragung der Forschungsgruppe E-Government an der Universität zu Lübeck gibt Einblicke und fokussiert auf die Bereiche Veraktung, Geschäftsgänge und Zusammenarbeit.
grundsätzliche Kritikpunkte sind, dass die Verwendung der E-Akte nicht durchgesetzt werde und dass man sich bei der Einführung nicht habe einbringen können. Ein Teil der Befragten vermisst bei der Arbeit mit E-Akten das schnelle Durchblättern, die Übersicht, Haptik und das physische Arbeiten. Außerdem werden Notizen und Markierungen, Ergonomie und Gesundheit, fokussiertes Arbeiten und Konzentration, Verfügbarkeits- und Mobilitätsvorteile, bessere Lesbarkeit sowie Möglichkeiten zur Strukturierung und Anpassung vermisst.
Ein Teil der Befragten vermisst hingegen nichts.
Kommentare sprechen Klartext
In den Freitextantworten zeigten sich einige klare Aussagen. Sie betreffen die teilweise mangelhafte Gebrauchstauglichkeit: „Die Software ist ständig defekt. Es tauchen ständig neue Probleme auf.“ „Das Nutzererlebnis ist katastrophal.“
Vorteile
• Verbesserte Übersichtlichkeit (18)
• Effizienzsteigerung (17)
• Schnellere Dokumentensuche (16)
• Bessere Zusammenarbeit (11)
• Reduzierung von Papierarbeit (10)
• Verfügbarkeit von Akten/Standardisierung (10)
drückt sich häufig in massiver Stimmungsmache aus oder in einer Art Verweigerungshaltung.“ „Unsere Mitarbeiter wurden überhaupt nicht mitgenommen. Die Hausspitze übt aber auch keinen Druck aus, dass die E-Akte gelebt wird. Das heißt, es gibt immer noch jeden Menge Papier.“
Dass es auch anders gehen kann, zeigt folgendes Zitat: „Stetige Wei-
Nachteile bezüglich
• Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität (19)
• Schnittstellen und Integration (18)
• Suchfunktionen (16)
• Performance und Stabilität (13)
• Workflows und Automatisierung (12)
Die Tabelle zeigt die in Freitextfeldern genannten Vor- und Nachteile zu den tatsächlichen Erfahrungen mit der E-Akte mit mindestens zehn Nennungen.
Grafik: BS; Quelle: Forschungsgruppe E-Government der Universität zu Lübeck
Verdeutlicht werden auch Widerstände in der Organisation: „Überall gibt es Kolleginnen und Kollegen, die der Einführung der E-Akte ablehnend gegenüberstehen. Dies
terentwicklung nach Anwenderrückmeldungen hat zu einer hohen Akzeptanz bei den Beschäftigten geführt. Übersicht wurde deutlich verbessert.“
dass insbesondere auf der kommunalen Ebene zahlreiche Redundanzen bestehen.
Die Zentralisierung von BackOffice-Aktivitäten über mehrere Landratsämter sei ein Schlüssel für effizientere Verwaltungsstrukturen. Zudem brauche es dringend eine andere Rechtsetzung. Die hohe Regulierungsdichte belaste die Verwaltung stark. Eine verbesserte Rechtsetzung sollte immer den Vollzug im Blick haben und der Verwaltung stärkere Ermessensspielräume bieten. Wo möglich, sollten aufwendige Einzelfallbewertungen durch pauschale Bewertungsansätze ersetzt werden.
Die richtige Zeit für eine grundlegende Reform ist jetzt In der sich anschließenden PanelDiskussion, moderiert von Prof. em. Dr. Hermann Hill, wurde deutlich: Die öffentliche Verwaltung in Deutschland ist leistungsfähig, wird aber durch zahlreiche Rahmenbedingungen gehemmt. Lösungsvorschläge für eine grundlegende Verwaltungsreform sollten – auf Basis der vielen schon vorhandenen Ansätze und Überlegungen, jetzt angegangen werden. Ein wichtiger Aspekt auf diesem Weg sollte die verstärkte Einführung von Mechanismen zur Wirkungskontrolle sein. Diese helfen den Mitarbeitenden der Verwaltung in der Reflexion ihrer Arbeit. Sie machen außerdem die Arbeit der öffentlichen Verwaltung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern transparenter. Im Nachbarland Österreich wurden gute Erfahrungen mit diesem Instrument gemacht, führte Prof. Sanja Korac von der DUV Speyer aus.
Die Studie „Der Weg zur öffentlichen Hand von morgen – Eine Reformagenda, heute zu beginnen“ ist online abrufbar: www.pd-g.de/ reformagenda
*Marvin Zmiewski ist Senior Consultant bei der PD.
Insgesamt wurden E-Akten positiv bewertet. Allerdings liegt hier sehr wahrscheinlich ein Selektionseffekt vor, da die Befragten über digitale Wege auf die Befragung aufmerksam gemacht wurden und somit eher Personen mit einer positiven Einstellung zu Technologie und EAkte erreicht wurden. Das zeigen auch die Freitextantworten, die Eindrücke zur gesamten Organisation bieten.
Mit Blick auf die Gebrauchstauglichkeit sind die negativen Aspekte der elektronischen Aktenführung sowie die Vorteile von Papier interessant: Ein Teil kann noch besser umgesetzt werden. Dazu gehören leicht zugängliche Funktionen wie digitale Haftnotizen oder Textmarkierung wie auch schnelles Durchblättern durch ein alternatives Layout. Andere Aspekte wie Haptik und weniger Bildschirmarbeit lassen sich jedoch kaum realisieren. Insgesamt lieferte die Befragung wertvolle Einblicke und Hinweise für Verbesserungen. Ein zentraler Erfolgsfaktor sind Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung darunter insbesondere die Einbindung der Nutzenden in den Einführungs- und Weiterentwicklungsprozess. Allerdings sind die Interpretationsmöglichkeiten durch die Selbstselektion eingeschränkt. Eine Vollerhebung in zufällig ausgelosten Abteilungen wäre hilfreich, um diesen Effekt zu reduzieren.
*Prof. Dr. Moreen Heine, Dr. Daniel Wessel und Florian König sind Teil der Forschungsgruppe E-Government der Universität zu Lübeck.
Behörden Spiegel: Was war die Startidee des Sovereign Cloud Stacks und wie hat sich das Projekt letztlich tatsächlich entwickelt?
Kurt Garloff: Europäische Bürger, Unternehmen und Staaten haben eine sehr große Abhängigkeit von digitalen Plattformen von außerhalb Europas: Wir sind digitale Kolonie. Diese Abhängigkeit kann gegen uns verwendet werden. Ohne weitere Maßnahmen neigen Plattformmärkte zu Monopolen – wir beobachten hier ein Oligopol weniger großer amerikanischer (und chinesischer) Technologie-Unternehmen, den sogenannten Hyperscalern. Neben regulatorischen Maßnahmen ist es nach meiner Überzeugung dringend erforderlich, dass in Europa eigene Wertschöpfung und Innovation im Bereich von CloudInfrastruktur stattfindet. Diese Notwendigkeit wurde von der Agentur für Sprunginnovationen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auch gesehen und das Projekt SCS bei der Open Source Business Alliance (OSBA) gefördert. Man darf sich dabei nicht von den vielen Milliarden blenden lassen, die die Hyperscaler gerne anführen, um uneinholbar zu erscheinen. Vieles davon geht in Hardware und Rechenzentren. Und in Plattformdienste, die zwar den Lock-In vergrößern sollen, aber von vielen Nutzern gar nicht benötigt werden. Auch bei Open Source Software (OSS) bedienen sie sich in großem Maßstab.
Letzteres ist der Startpunkt für SCS: Wir schultern die Integration der OSS-Komponenten in eine konsistente offene Lösung gemeinsam, so dass wir sehr viel Effizienz gewinnen und dabei auch Standards definieren können, die einen Betreiberwechsel und eine Föderierung einfach machen. Dafür konnten wir Cloud-Anbieter gewinnen.
Behörden Spiegel: Was waren Ihrer Meinung nach die größten Errungenschaften des Projekts?
Garloff: Wir hatten das große Glück, direkt zu Beginn einen potenten Partner zu gewinnen, der eine eigene Cloud-Plattform aufbauen wollte und damit einen großen Nutzer, der mit unserer Technologie ein kommerzielles Angebot aufgebaut hat. Das Feedback und die Erfahrungen aus dem Produktivbetrieb waren für uns
Sovereign Cloud Stack für flexible IT
(BS) Der Sovereign Cloud Stack (SCS) wurde entwickelt, um eine eigene Cloud-Infrastruktur auf Basis von Open-SourceSoftware zu schaffen. Bis 2024 wurde das Projekt durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Was SCS der Verwaltung bietet, wo es bereits eingesetzt wird und wie seine Zukunft aussieht, erzählt der CTO Kurt Garloff im Interview. Die Fragen stellte Anna Ströbele.
sehr wertvoll. Heute nutzen täglich Hunderttausende Menschen diese Infrastruktur z. B. in der BayernCloud Schule.
„Ohne weitere Maßnahmen neigen Plattformmärkte zu Monopolen.“
Mittlerweile gibt es sechs Anbieter (PlusServer, Wavecon/Noris, RegioCloud, AOV, artcodix, scaleUp Technologies), die die SCS Software erfolgreich für kommerzielle CloudInfrastrukturdienste nutzen. Darüber hinaus gibt es Anbieter, die die Container-Plattform auf nicht-SCS Virtualisierung einsetzen sowie private Clouds und Projekte an Hochschulen.
Behörden Spiegel: Welche Vorteile bietet SCS der öffentlichen Verwaltung, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit?
Garloff: Durch den Preiswettbewerb sind die vorhergesehenen Leistungen bei Ausschreibungen der öffentlichen Verwaltung durchaus kosteneffizient, aber bei den schnellen Innovationszyklen in der IT ist das Vorhersagbare ja immer nur ein Anfang. Wir wollen doch von der Weiterentwicklung im Bereich KI profitieren, auch wenn wir das vor ein paar Jahren nicht mit ausgeschrieben haben! Bei einer erfolgten Vergabe an proprietäre Anbieter ist die Verwaltung aufgrund der hohen Wechselkosten für alles Unvorhergesehene und häufig auch für Folgeausschreibungen aber dem Anbieter ausgeliefert. Solche Abhängigkeiten gibt es bei SCS nicht, denn die Standards sind anbieterübergreifend. Zusätzliche Dienste oder Anschlussverträge

können flexibel an andere, kompatible Anbieter vergeben werden. Das führt zu einem funktionierenden Markt auch nach einer initialen Vergabeentscheidung - Konkurrenz belebt das Geschäft.
Die Architektur von SCS wurde für sehr hohe Sicherheitsansprüche entworfen. Für eine hohe Sicherheit bei der Isolation verschiedener Nutzer wird die Hardware-Virtualisierung genutzt. Der ganze Entwicklungsprozess bei SCS nutzt Reviews und kontinuierliche Tests für das komplette System, so dass jederzeit ein vollständig validierter Entwicklungsstand vorliegt. Im Falle bekanntwerdender Sicherheitslücken ist damit ein kurzfristiges Bereitstellen und Installieren von Fehlerbehebungen realistisch. Dies ist im Laufe des Projekts mehrmals bewiesen worden.
SCS hat seine Hausaufgaben bezüglich der Softwarelieferkette gemacht. Aus Projektmitteln wurden weiterhin Penetration Tester (Hacker, die im Auftrag des Software-
anbieters Sicherheitslücken suchen und melden) bezahlt. Die gefundenen Schwächen wurden adressiert und viele der Angriffe in automatische Tests umgesetzt, so dass ganze Klassen von Lücken in Zukunft nicht unentdeckt bleiben können. Zwei der SCS Anbieter haben erfolgreich eine BSI C5 Sicherheitszertifizierung durchgeführt.
Behörden Spiegel: Welche Rolle spielt der Sovereign Cloud Stack in der Deutschen VerwaltungscloudStrategie (DVC)?
Garloff: Frühere Versionen der DVCDokumente hatten konkrete technische Anforderungen definiert, die von SCS erfüllt wurden und entsprechend SCS auch explizit als eine mögliche Umsetzung der Anforderungen genannt wurde. Mittlerweile gibt es ein höheres Abstraktionsniveau des DVC-Dokuments, so dass SCS hier nicht mehr so prominent erscheint.
In den Initiativen zur konkreten Umsetzung, insbesondere der In-
teressengemeinschaft Betrieb von Containern (IGBvC), hat SCS mitgearbeitet und ist dort als eine mögliche Umsetzung der Anforderungen positioniert. Aus diesem Kontext ist auch das erfolgreiche FITKO Providerwechsel-Projekt zu verstehen. Hieraus sollten im nächsten Schritt konkrete Angebote gebaut werden, z. B. mit der openDesk Lösung des ZenDiS, die wunderbar auf SCS funktioniert.
Behörden Spiegel: Nach Ende der BMWK-Förderung: Wie sehen Sie die Zukunft von SCS?
Garloff: Als gefördertes Projekt hatte SCS die Besonderheit, keine eigenen kommerziellen Interessen zu verfolgen und somit die hohe Expertise auch in diverse Aktivitäten – insbesondere der öffentlichen Hand – neutral einbringen zu können. Diese Arbeit wird auch nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts zum 31.12.2024 fortgesetzt: Initial 14 (mittlerweile 16) Unternehmen haben sich zusammengefunden und das Forum SCS-Standards in der OSBA gegründet. Mit den Mitgliedsgebühren wird ein kleines Team finanziert, das die Weiterentwicklung der SCS-Standards steuert und die Zertifizierungen durchführt.
„Die Architektur von SCS wurde für sehr hohe Sicherheitsansprüche entworfen.“
Daneben gibt es Technologiepartner. Sie nehmen durch Supportund Wartungsdienstleistungen Geld ein und finanzieren durch diese die Weiterentwicklung der freien Software. Dank der existierenden Nutzung von SCS fangen sie auch nicht bei Null an. Ich selbst habe das Unternehmen S7n Cloud Services GmbH gegründet, welches auch mit diesen Partnern übergreifende Entwicklung und Wartung koordinieren kann. Darüber hinaus gibt es ein Ökosystem von Dienstleistern für Beratung, Implementierungsleistungen und Schulungen.





Cloud wird in der öffentlichen Verwaltung seit mittlerweile zehn Jahren thematisiert. Dominierten vor fünf bis zehn Jahren noch eher Vorbehalte der CloudNutzung auf Grund fehlender digitaler Souveränität oder der Compliance-Konformität die Diskussionen, so stehen heute Fragen der technischen Fähigkeiten, schnelleren Bereitstellungen und der wirtschaftlichen Nutzung im Mittelpunkt. Es ist ein breites Angebot entstanden und auch die Nachfrage nach Cloud-Angeboten steigt und wir diskutieren nicht mehr das berühmte „ob“, sondern nunmehr das „wie“. Im ITZBund sind bereits 30 Prozent der Infrastruktur cloudbasiert, Tendenz steigend. Mit der Bundescloud und der Betriebsplattform Bund (BPB) sind private Cloud-Infrastrukturen des Bundes entstanden, die primär für die Umsetzung der IT-Konsolidierung Bund designt wurden. Beide Plattformen werden zukünftig zur Bundescloud 2.0 zusammengeführt.
Das ITZBund hat den Zugang dazu nun allen Kunden des ITZBund grundsätzlich geöffnet. Damit ste-

SONDERVERÖFFENTLICHUNG
Die Cloud vor der zweiten Halbzeit in der öffentlichen Verwaltung?
(BS/Holger Lehmann) Ich bin ein bekennender Fußballfan und der Auffassung, dass die Cloud in der öffentlichen Verwaltung Mitten in der ersten Halbzeit steckt.
hen leistungsfähige Cloud-Infrastrukturen – auch zur Umsetzung der Cloud First-Strategie - innerhalb der sicheren Masterrechenzentren des ITZBund produktiv zur Verfügung. So wird die E-Akte Bund oder die Betriebskonsolidierung in privaten Clouds des Bundes umgesetzt. Bundescloud und BPB werden durch Personal des ITZBund entwickelt und betrieben.
Eine Frage der Kraft
In dem fast zehnjährigen iterativen Entwicklungsprozess von privaten Clouds im ITZBund ist auch deutlich geworden, dass (Weiter) Entwicklung und Betrieb ressourcenintensiv sind. Das gilt für notwendiges Personal aber auch für die Finanzen. Die Situation verschärft sich durch den Fach-
Holger Lehmann ist Leiter des Projektes operative IT-Konsolidierung im ITZBund, Leiter der Stabstelle ProITK und Pressesprecher des ITZBund. Foto: BS/C. Daitche/ITZBund


kräftemangel, eine angespannte Konkurrenzsituation auf dem ITFachkräftemarkt und sicher auch durch die Haushaltslage. Parallel ist zu erkennen, dass im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung der „Hunger“ an IT-Infrastruktur exponentiell steigt und immer mehr Skalierung und Flexibilität in kurzen Zeitfenstern notwendig ist. So hat das ITZBund bei seiner Gründung im Jahr 2016 eine knapp fünfstellige Anzahl an Serversystemen betrieben. Heute sind es fast 80.000.
Das Team muss größer werden Um die beschriebenen Spannungsfelder für die öffentliche IT als Grundlage für die Digitalisierung aufzulösen, bin ich überzeugt, benötigt es eine Neugestaltung der Einbeziehung privatwirtschaftlicher Unternehmen in die Leistungserbringung der öffentlichen IT. Insbesondere im Cloud-Markt sind in den letzten Jahren zahlreiche Angebote – auch neben den Hyperscalern – entstanden. Für das ITZBund ist damit das Verhältnis mit der Wirtschaft neu auszurichten. Nach meiner Vorstellung gilt es zwei Extreme zu harmonisieren. Erstens, die öffentliche IT macht

Standardisierte und kosteneffiziente Public-Cloud-Services sind wichtige Bausteine auf dem Weg zur beschleunigten digitalen Transformation der deutschen Bundesverwaltung. Gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) bietet Bechtle ab sofort über einen Rahmenvertrag mit dem Beschaffungsamt des BMI (BeschA) und in enger Zusammenarbeit mit dem Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) sichere PublicCloud-Services für Bundesbehörden an. Das breite Spektrum der Cloud-Dienste entspricht strengen Compliance-Vorgaben, beschleunigt digitale Innovation und ermöglicht effizientere Bürgerservices. 1:0 für die





alles selbst oder zweitens, die Wirtschaft macht die komplette öffentliche IT. Es ist wichtig auf der einen Seite eine leistungsfähige IT für die öffentliche Verwaltung aufzubauen und auf der anderen Seite die notwendigen eigenen Fähigkeiten und die dabei entstehenden Kosten auch im Kontext digitaler Souveränität und Compliance zu sehen. Das ITZBund hat im Jahr 2024 im Cloudkontext zwei maßgebliche Vergaben abgeschlossen. Dies sind die sogenannte Cloud on Premises und die Public Cloud. Damit stehen den Kunden des ITZBund demnächst neben der Bundescloud 2.0 weitere CloudPlattformen zur Verfügung. Die Cloud on Premises wird hierbei von einem Technologielieferanten (weiter)entwickelt und in den Rechenzentren des ITZBund betrieben. Durch diese Diversifikation des Cloud-Portfolios hat das ITZBund u.a. die Möglichkeit sich mit seinen begrenzten Ressourcen auf die (Weiter)Entwicklung der Bundescloud 2.0 zu fokussieren und gleichzeitig das Angebot zu erweitern. Aus meiner persönlichen Sicht hat das ITZBund damit ein leistungsfähiges Angebot an Cloud-
plattformen generiert. Jede dieser Plattformen kommt mit speziellen Merkmalen und technischen Stärken. Die aktuelle BPB bspw. mit einer ISO27001-Zertifizierung und einer VS-NfD-Freigabe, die Public Cloud mit einem Pay-perUse-Modell.
Die Stärken zeigen Für das ITZBund bedeutet dies, die jeweiligen Stärken der Plattformen seinen Kunden transparent zu machen und in die spezifische Nutzung zu bringen. Hierzu wird u.a. ein technisches und betriebswirtschaftliches Management der einzelnen Plattformen auszubauen sein, um Entscheidungen für Investitionen, Entwicklungsbedarfe, Compliance-Themen im Sinne unserer Kunden treffen zu können.
Ich bin davon überzeugt, dass die Cloud-Nutzung in der öffentlichen Verwaltung sich weiterentwickeln wird. Dementsprechend gilt es aus Managementsicht die Entwicklungen aktiv zu gestalten und an den Herausforderungen der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung auszurichten. Einer meiner Fußballtrainer in meiner Jugend sagt mal zu mir: „Holger, Du musst dort hinlaufen, wo der Ball hinkommt, nicht wo er herkommt!“ Im übertragenen Sinne gilt das meines Erachtens auch für die Cloudnutzung der öffentlichen Verwaltung. Die Nutzung von Cloud ist kein Selbstzweck, kann aber ein großer Gamechanger in den Herausforderungen der Digitalisierung sein!



Aktuell baut govdigital einen verteilten Kubernetes-Cluster auf, der die Rechenzentren von neun öffentlichen IT-Dienstleistern verknüpft: AKDB (Bayern), ekom21 und HZD (Hessen), ITEBO und KDO (Niedersachsen), LDI (Rheinland-Pfalz), Lecos (Sachsen) sowie LVR InfoKom und OWL IT (Nordrhein-Westfalen). Der gd.K8s-Cluster steht als Minimal Viable Product (MVP) bereits zur Verfügung. Das Ziel ist eine gemeinsame Betriebsumgebung, in der Anwendungen der öffentlichen Hand hochverfügbar und resilient betrieben werden können. Dadurch lassen sich sicherer Betrieb und die Flexibilität der Cloud verbinden. Bereitstellung kommunaler Fachverfahren, Umgang mit Kapazitätsengpässen, Vorbereitung auf Ausfälle – die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Cloud-Beratung für Mitglieder und öffentliche Träger
Für die umfassende Cloud-Transformation brauchen öffentliche Einrichtungen Hilfestellungen. Govdigital hat im vergangenen Jahr zwei große Rahmenverträge ausgeschrieben und vergeben. Seit Frühjahr 2024 können Mitglieder und ihre öffentlichen Träger Beratungsleistungen beziehen, ohne selbst Ausschreibungen durchführen zu müssen. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium unter der Leitung von EY mit den Unterauftragnehmern Accenture, Allgeier Public, ARES Consulting, Avanade und ISO Public Service.
Das Angebot der gd.Cloud-Beratung ist breit gefächert: Es umfasst strategische Fragen der Cloud-Transformation kompletter Organisationen, Multi-Cloud-Strategien und Cloud-Security. Angefragt werden können Fachleute wie Cloud-Berater, -Architekten, Trans-
Cloud-Broker, Kubernetes-Cluster und Deutsche Verwaltungscloud
(BS/Victoria Abshagen/Philipp Gärtner*) Die künftige Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung hängt wesentlich davon ab, wie Gebietskörperschaften, Behörden und öffentliche IT-Dienstleister bundesweit zusammenarbeiten. Dank Cloud-Technologie können digitale Leistungen heute behörden-, kommunen- und länderübergreifend einfacher bereitgestellt und schnell skaliert werden. Govdigital als Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister fördert diese Entwicklung aktiv – von einem mitgliederübergreifenden Kubernetes-Cluster über den Zugang zu Public-Cloud-Anbietern bis zum Aufbau der Deutschen Verwaltungscloud (DVC).

formation Manager oder Cloud-Security Specialists.
gd.Cloud-Broker: Cloud-Ressourcen fünf großer Anbieter Schon die ersten Monate haben gezeigt, dass hier ein großer Bedarf besteht. Interessant ist das Angebot nicht nur für Mitglieder der govdigital, sondern auch für deren öffentliche Träger, die nach entspre-
Von VS-NfD bis GEHEIM. Erfahren Sie mehr.
chender Prüfung daraus Leistungen beziehen können. Der gd.Cloud-Broker bietet einen einheitlichen Zugang zu fünf privaten Cloud-Anbietern. Im Auftrag der govdigital wird der Broker von der Firma BTC aus Oldenburg betrieben. Mitglieder und deren Träger haben Zugriff auf die Cloud-Ressourcen der internationalen Anbieter AWS, Azure und Google sowie
der beiden deutschen Anbieter IONOS und STACKIT. Die Buchung von Leistungen ist flexibel, die Abrechnung erfolgt komfortabel auf Basis des Pay-per-Use-Prinzips. Auch hier ermöglicht es das Inhouse-Modell der Genossenschaft, dass weite Teile der öffentlichen Hand über den Broker auf die Leistungen zugreifen können: von der unmittelbaren Verwaltung von Bund und Ländern bis zu mehr als 80 Prozent der Kommunen.
DVC: Angebot öffentlicher ITDienstleister unter einem Dach Das Dach der Cloud-Transformation der deutschen Verwaltung ist die Deutsche Verwaltungscloud (DVC). Die DVC ist ein Projekt – bald Produkt – des IT-Planungsrates, das Verwaltungen in Deutschland den Zugang zu Cloud-Services der öffentlichen IT-Dienstleister ermöglicht. Sie bietet Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene die Möglichkeit, Cloud-Services schnell, sicher und rechtskonform zu beziehen. Ziel ist es, die digitale Souveränität zu stärken, die Leistungsfähigkeit der Verwaltungen zu erhöhen und die föderale IT-Zusammenarbeit zu verbessern. Das Herzstück der DVC bildet das Cloud-Service-Portal, ein zentraler Marktplatz, auf dem Verwaltungen Cloud-Dienste einstellen, bestel-
len und verwalten können. Dieses Portal gewährleistet einen rechtssicheren Zugang zu einer Vielzahl von Services, die bestimmten DVCStandards entsprechen müssen. Öffentliche IT-Dienstleister stehen häufig vor fragmentierten Infrastrukturen und einer dezentralen Verteilung ihrer Angebote. Die DVC bietet die Möglichkeit, ihre Dienste über eine zentrale Plattform zu vermarkten und damit eine wesentlich größere Reichweite zu erzielen. Anstatt individuell Vertriebsstrategien zu entwickeln, können sie sich auf die Entwicklung von Services konzentrieren.
Öffentliche Verwaltungen sollen vor allem von einer standardisierten und transparenten Nutzung der angebotenen Dienste profitieren. Die zentralisierte Plattform ermöglicht Effizienzgewinne, Kosteneinsparungen und schnellere Implementierungen neuer Anwendungen.
Regelbetrieb ab April
Die Umsetzung der DVC erfolgt seit Januar 2024 unter der Gesamtprojektleitung der FITKO in Zusammenarbeit mit der govdigital eG. Ein wesentliches Ziel des Projekts ist der schrittweise Aufbau eines umfangreichen Portfolios von CloudServices, die von IT-Dienstleistern der öffentlichen Hand bereitgestellt werden. Im April 2025 geht die DVC von der derzeitigen Pilot- und Projektphase in den Regelbetrieb über. Anfang 2025 standen schon mehr als 20 Services öffentlicher IT-Dienstleister zur Verfügung, perspektivisch werden auch private Cloud-Angebote angebunden.
*Victoria Abshagen ist Business Development Managerin gd.Cloud. Philipp Gärtner ist Projektmanager für die Deutsche Verwaltungscloud (DVC).
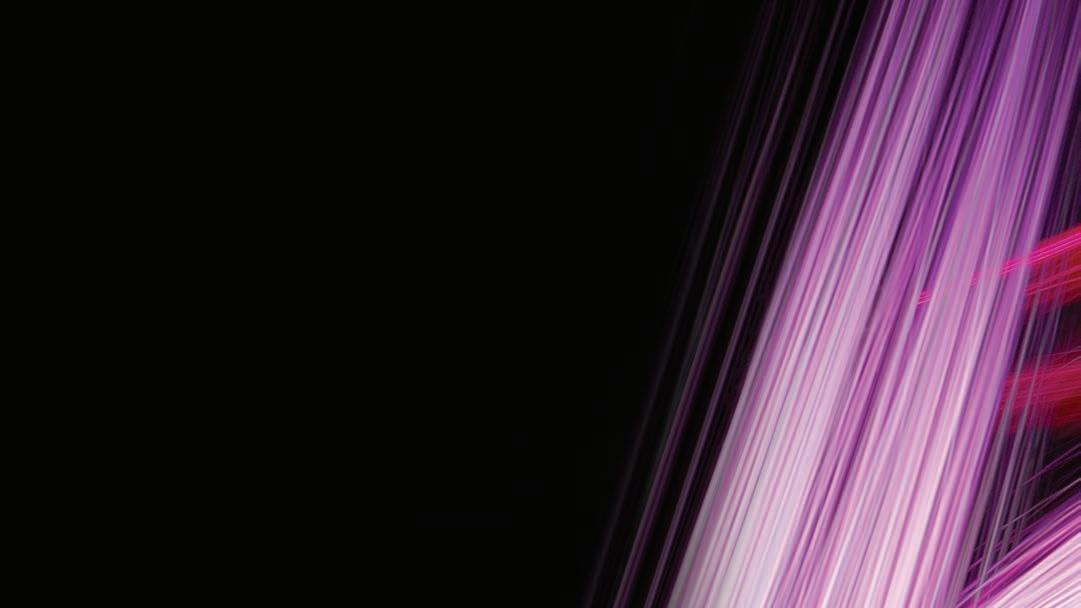
SINA Cloud – Souverän gedacht. Sicher gemacht.
Die SINA Cloud für Verschlusssachen bis GEHEIM. Beliebige Mandanten und Sicherheitslevel auf einer Infrastruktur.
secunet.com protecting digital infrastructures
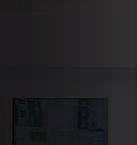










Der Weg zu mehr Unabhängigkeit und Informationssicherheit
Die öffentliche Verwaltung befindet sich bereits seit einigen Jahren auf dem Weg in eine umfangreiche Digitalisierung. Oberstes Gebot ist dabei die digitale Souveränität. Diese ist geprägt von Unabhängigkeit, Datenschutz und der Kontrolle über die eigenen Daten. Die Institutionen der öffentlichen Hand stehen in der Pflicht, hochsensible Daten ihrer Bürger, zu schützen – vor dem Zugriff und der Einflussnahme unbefugter Dritter. Dieser Anspruch auf Datensouveränität stellt den öffentlichen Sektor vor einige Herausforderungen.

Der Begriff Datensouveränität bezieht sich auf den selbstbestimmten Umgang und die volle Hoheit über alle Vorgänge der Erhebung, Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der eigenen Daten. Dabei sind Transparenz und Kontrolle die Grundvoraussetzungen für einen datensouveränen Staat. Nur, wenn klar ist, welche Daten wo, wann und von wem verarbeitet werden, gelingen ein selbstbestimmter Umgang mit den Daten und eine aktive Einflussnahme auf deren Verarbeitung. Datensouveränität ist ein wichtiger Bestandteil digitaler Souveränität. Im Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der digitalen Souveränität findet sich folgende Definition dafür: Sie beinhaltet „[…] die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können“. Die Hoheit über die eigenen Daten spielt dabei eine zentrale Rolle. Das aktuelle Whitepaper „Digitale Souveränität“ der Schwarz Digits beleuchtet das Thema umfassend. Es zeigt Wege auf, die ein souveränes digitales Europa ermöglichen. Damit der öffentliche Sektor in Deutschland digitale Souveränität erreicht, muss er sich zunächst aus der aktuell bestehenden Abhängigkeit von einzelnen Technologie-Anbietern lösen. Die öffentliche Verwaltung aus der Abhängigkeit befreien
Analysen von PwC und Deloitte, die im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) durchgeführt wurden, zeigen, dass sich die öffentliche Verwaltung in einer TechnologieAbhängigkeit von großen US-Softwarekonzernen befindet. Sie setzt für ihre tägliche Arbeit proprietäre Software ein, für die einerseits wiederkehrende Lizenzgebühren anfallen, die andererseits nicht oder kaum den speziellen Bedürfnissen des Sektors entspricht und die außerdem einen Anbieterwechsel erschwert.
Hinzu kommen berechtigte Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der -sicherheit. Selbst wenn Daten auf Servern in Deutschland gespeichert werden, hat der in den USA ansässige Konzern weiterhin Zugriff darauf. Der CLOUD Act bietet die Rechtsgrundlage für einen Zugriff durch unbefugte Dritte. Dabei dürfen US-amerikanische Behörden auf die gewünschten Informationen zugreifen, wenn dieser Zugriff der nationalen Sicherheit dient. Die Bundesregierung will diese


Abhängigkeit auflösen und die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung nachhaltig auf Grundlage der „Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität für die IT der Öffentlichen Verwaltung“ etablieren. Diese priorisiert drei Prämissen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung:
1. Wechselmöglichkeit: Der öffentliche Sektor hat jederzeit die Möglichkeit der freien Wahl und des flexiblen Wechsels zwischen Technologie-Anbietern sowie deren Lösungen und Komponenten. Diese sichern die Unabhängigkeit und Gestaltungsfreiheit.
2. Gestaltungsfähigkeit: Um digitale Souveränität zu gewährleisten und eigene Interessen zu vertreten, müssen die eingesetzten Lösungen (mit-)gestaltet werden können. Es sind die Kompetenzen und Arbeitsstrukturen notwendig, die es ermöglichen, Technologie-Lösungen verstehen und bewerten zu können. Außerdem muss die Expertise vorhanden sein, Lösungen (weiter) zu entwickeln und deren Betrieb sicherzustellen. Je nach Wertschöpfungstiefe ist dies eine Einzelfallentscheidung.
3. Einfluss auf die Anbieter: Dahinter verbirgt sich einerseits die Fähigkeit der öffentlichen Verwaltung, ihre Anforderungen und Bedarfe gegenüber den Technologie-Anbietern zu artikulieren und durchzusetzen. Dies soll durch rechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen sichergestellt werden. Andererseits ist damit auch die Möglichkeit gemeint, Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung von Technologien und Standards zu nehmen, um die eigene digitale Souveränität zu stärken.
Die souveräne Cloud als Problemlöser Aufbauend auf der Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität hat die Bundesregierung die Deutsche Verwaltungscloud-Strategie (DVS) beschlossen. Diese sieht eine Multi-Cloud-Strategie der Bundesregierung vor. Das Ziel der DVS ist die Schaffung gemeinsamer Standards und offener Schnittstellen für Cloud-Lösungen der öffentlichen Verwaltung. Damit soll übergreifend eine interoperable und modulare föderale CloudInfrastruktur für die öffentliche Verwaltung etabliert werden, die die wechselseitige Nutzung von Anwendungen ermöglicht und gleichzeitig die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern reduziert. Die von der öffentlichen Verwaltung genutzten Cloud-Lösungen



im Rahmen dieser Strategie müssen jedoch zwingend datensouverän sein. Nur eine souveräne Cloud gewährleistet die Integrität und Sicherheit des öffentlichen Sektors nachhaltig. Doch hier ergibt sich die nächste Herausforderung: Global agierende Anbieter mit Sitz in Nicht-EU-Ländern erfüllen den Souveränitätsanspruch nur auf dem Papier. Sie dürfen mit Souveränität werben, da der Begriff nicht geschützt ist, können diese aber aufgrund von miteinander in Widerspruch stehenden Rechtsräumen nicht garantieren – auch nicht, wenn deutsche beziehungsweise EU-Server dies suggerieren.
Die Merkmale einer souveränen Cloud Eine souveräne Cloud bietet eine sichere, lokalisierte Umgebung für die Datenspeicherung und -verarbeitung, verringert so das Risiko von Datenschutzverletzungen und schützt vor unbefugtem Zugriff. Mit dem Einsatz einer „echt souveränen“ Cloud kann den hohen Compliance- und Sicherheitsanforderungen im öffentlichen Sektor Rechnung getragen werden, ohne dabei Kompromisse beim enormen Potenzial moderner Lösungen eingehen zu müssen. Anhand spezifischer Souveränitätsmerkmale lässt sich erkennen, ob eine CloudLösung tatsächlich souverän ist:
1. Technische Souveränität: Die Speicherung der Daten erfolgt in zertifizierten Rechenzentren, die den EU-Sicherheitsvorgaben und der DSGVO entsprechen. Nutzer behalten die volle Kontrolle über die Speicherung, Einsicht und Verarbeitung ihrer Daten. Transparenz wird durch Open-Source-Technologien gewährleistet. Daten können jederzeit auf alternative Cloudund On-Premises-Umgebungen migriert werden, um eine Abhängigkeit vom Anbieter – einen Vendor Lock-in – zu vermeiden.
2. Juristische Souveränität: Der Hauptsitz des Cloud-Anbieters und der Ort der Datenspeicherung, -verwaltung sowie -verarbeitung befinden sich ausschließlich in Europa. Dies verhindert Leistungsverweigerung oder -verbote durch außereuropäische Staaten und schützt die Daten vor der Anwendung außereuropäischer Gesetze wie zum Beispiel des bereits erwähnten CLOUD Acts.
3. Zertifizierungen und Testate: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nutzt den Kriterienkatalog C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue), um CloudLösungen auf die Mindestanfor-

derungen an ein sicheres CloudComputing zu überprüfen. Das C5-Testat stellt die höchste Auszeichnung im Bereich Cyber-Sicherheit dar und bietet eine wichtige Orientierung für die Auswahl eines Anbieters. Wie findet man eine souveräne Cloud?
Um den Institutionen der öffentlichen Verwaltung die Suche nach der souveränen Cloud zu erleichtern, hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) zusammen mit ihren beiden Partnern, der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), einen Rahmenvertrag mit dem Multicloud Broker Computacenter geschlossen. Computacenter erhielt den Zuschlag im Rahmen einer Ausschreibung und bietet der öffentlichen Verwaltung einen einheitlichen Zugriff auf Cloud-Leistungen verschiedener Anbieter – darunter auch vier aus Deutschland beziehungsweise Europa. Einer dieser Anbieter ist STACKIT, der Cloud- und Colocation-Provider der Schwarz Gruppe. STACKIT erfüllt mit seiner souveränen Cloud internationale Compliance- und Sicherheitsanforderungen. Eine weitere Digitalisierungsinitiative des öffentlichen Sektors wurde bereits 2021 mit dem GovTech Campus Deutschland e. V. durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) ins Leben gerufen. Das BSI ist dem GovTech Campus in Berlin im vergangenen Jahr beigetreten. Gemeinsam mit anderen Projektpartnern, unter anderem STACKIT, arbeitet das BSI dort im Cloud-Reallabor daran, Public-Cloud-Dienste für die Bundesverwaltung und Betreiber Kritischer Infrastrukturen sicher nutzbar zu machen. Ein Fokus des Cloud-Reallabors liegt auf der Wechselfähigkeit zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern.
Zusätzlich geht eine aktuelle Studie, die in Zusammenarbeit zwischen dem Handelsblatt Research Institute und STACKIT entsteht, unter anderem der Frage nach, welche Cloud-Strategien zu mehr digitaler Souveränität führen.
Die Ergebnisse, die voraussichtlich Ende Mai 2025 veröffentlicht werden, können den öffentlichen Sektor ebenfalls bei seiner Suche nach einer souveränen Cloud-Lösung unterstützen.
Prozesse optimieren und vorhandene Lösungen nutzen
Die Auswahl eines souveränen Cloud-Anbieters ist nur der erste Schritt. Wie gelingt es, die hochkomplexen bürokratischen Vor-
gänge digital abzubilden? Oft wurde versucht, diese eins zu eins in die digitale Welt zu übersetzen, anstatt sie zunächst zu hinterfragen. Die öffentliche Verwaltung muss offen dafür sein, die eigenen Prozesse genau zu beleuchten und zunächst Optimierungspotenzial zu identifizieren, welches sich mithilfe der Technologie ausschöpfen lässt. Auf dem Markt existieren bereits erprobte Lösungen, welche die hohen und komplexen Anforderungen des öffentlichen Sektors erfüllen. Dazu zählen beispielsweise Lösungen für den digitalen Verwaltungsarbeitsplatz wie der KI-Assistent Pharia Government Assistant oder die Büroverwaltungssoftware openDesk. Zudem gibt es mit WIRE on STACKIT eine sichere Kommunikationsplattform, die über eine Freigabeempfehlung für die Kommunikation von Verschlusssachen durch das BSI verfügt. Dies ist mit Blick auf die erhöhte Bedrohungslage durch Cyber-Kriminalität in den Bereichen E-Government, Innere und Äußere Sicherheit sowie der Kritischen Infrastrukturen ein notwendiger Schutzmechanismus. Als Open-Source-Technologien sind diese nicht nur vollständig transparent, sondern zahlen auch auf die in der DVS verankerte Wechselfähigkeit ein.
Die souveräne Cloud bietet volle Freiheit und gewährleistet Sicherheit
Nur eine souveräne Cloud „made in Europe“ gewährleistet die Integrität und Sicherheit der öffentlichen Verwaltung und der Kritischen Infrastrukturen nachhaltig. Mit der Wahl eines echten souveränen Cloud-Anbieters wie STACKIT eröffnet sich der öffentliche Sektor die volle Freiheit, individuelle und sichere Lösungen für seine Digitalisierung zu realisieren.
Weiterführendes Interesse an dem Thema „Datensouveräne Cloud“?
E in Anstieg von mehr als 40 Prozent in fünf Jahren – so entwickelt sich die Cyber-Kriminalität in Niedersachsen. Im Lagebild des vergangenen Jahres wurden 13.200 Fälle registriert und rund 3.400 Tatverdächtige ermittelt, erklärte Baier. Daher forderte er, dass jede Organisationsleitung kritisch hinterfragen solle, welche Prozesse besonders schützenswert sind und wie diese im Falle eines Angriffs wiederhergestellt werden können. Das Management der Informationssicherheit bleibe „Chefinnen- und Chefsache“, betonte er. „Die digitale Sicherheit wird zur entscheidenden Frage unserer Zeit“, so der Landes-CIO weiter. Niedersachsen habe diese Entwicklung vorausgesehen: Bereits 2021 unterzeichnete das Bundesland die bundesweit erste Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Anlass dafür war die erste Auflage des CyberSicherheitstags Niedersachsen. Mit dieser Vereinbarung wurden die rechtlichen Grundlagen für eine enge Zusammenarbeit geschaffen.
Niedersächsische Cybersicherheitsstrategie vorgestellt
Niedersachsens CISO Dr. Franz Schenk erklärte in Hannover, dass dadurch der Austausch verbessert wurde, Penetrationstests durch das BSI für die niedersächsische
„Warum
brauchen wir Informationssicherheit? So interessant sind wir doch gar nicht.“
So eine Reaktion habe der CISO der Niedersächsischen Landesverwaltung, Dr. Frank Schenk, schon öfter gehört, wenn er versuchte, für mehr Cyber-Sicherheit zu werben. Hacker hacken aber nicht nur, um an Informationen gelangen, sondern auch, um daraus Profit zu schlagen – und das sei dank Kryptowährungen und der damit einhergehenden Anonymität heute viele einfacher möglich. Deswegen sei heute jede Organisation potenzielles Opfer, so Schenk. Dazu zählen auch kleine und mittlere Kommunen, von denen Niedersachsen eine Menge hat.
Landes-CIO Dr. Horst Baier findet, die NIS-2-Regulierung von Kommunen sei falsch, da sie einen hohen bürokratischen Aufwand gebracht habe. Doch deswegen sollten sich die Kommunen jetzt nicht entspannen – im Gegenteil. Baier appellierte an die Eigenverantwortung der Städte und Gemeinden. Noch habe die Cyber-Sicherheit nicht überall Priorität. Woran es mangelt, weiß das Land dank der Ergebnisse des ITSicherheitschecks für Kommunen „B-Hard", einem kostenfreien und
Digitale Sicherheit als entscheidende Frage der Zeit
(BS/Paul Schubert) Die Gefahrenlage im Cyber-Raum nimmt zu – das zeigt sich auch in Niedersachsen. Landes-CIO Dr. Horst Baier warnte auf dem Cyber-Sicherheitstag Niedersachsen vor der wachsenden Bedrohung durch Cyber-Kriminalität und stellte die umfassende Cybersicherheitsstrategie des Landes vor.

Landes-CIO Dr. Horst Baier wünscht sich ein Cyber-Sicherheitszentrum für Niedersachsen. Foto: BS/Brecht
Landesregierung ermöglicht und eine „Roadshow“ für Kommunen angeboten werden konnte. Auch die dritte Ausgabe des ITSicherheitskongresses brachte Neuerungen: So nutzte Landes-CIO
Baier die Gelegenheit, die Cybersicherheitsstrategie Niedersachsens einem breiteren Publikum vorzustellen. Diese wurde im September letzten Jahres veröffentlicht und setzt gemeinsam mit einer im Ok-
tober beschlossenen Verwaltungsvorschrift die NIS-2-Anforderungen für die Landesverwaltung um. Der Bund hänge hier noch hinterher: „NIS-2 ist ja gescheitert“, stellte Baier fest. Er hoffe, dass die Po-
Wie sich die Kleinsten besser schützen können
(BS/Anna Ströbele) Ein IT-Sicherheitscheck gibt Einblicke über das aktuelle Schutzniveau von Niedersachsens Kommunen. Während das Land mehr Eigenverantwortung fordert, drängen die Kommunen auf weitere Unterstützung durch das Land. Neben mehr Geld und Personal könnten einheitliche Standards und zentrale Schulungsangebote helfen. Auch Kooperationen zwischen Kommunen sind nicht zu vernachlässigen.
freiwilligen Angebot des Niedersächsischen Innenministeriums.
228 Kommunen haben ihn bereits genutzt. „Für die 62 Prüffragen haben wir Durchschnittswerte für jede einzelne Kommune berechnet“, erklärt Marcel Ernst, IT-Security Con-
Frage betraf Ticketsysteme. Ergebnis des Checks in Niedersachsen: 125 Kommunen (55 Prozent) hätten bereits ein solches implementiert, 101 Kommunen (45 Prozent) nicht. Ernst empfiehlt die Verwendung von solchen, um den IT-Betrieb zu
„Wir hätten eine Grundlage, auf die wir uns alle gemeinsam committen können.“
Moritz Kienzle, ISB des Landkreises Rotenburg (Wümme), über verbindliche IT-Sicherheitsstandards
sultant bei Bechtle, das die Checks durchführte. Daraus habe sich ein Lagebild ergeben, welches zeige, wie die Kommunen in Niedersachsen grundsätzlich aufgestellt sind. Eine

Cyber-Sicherheitstag Niedersachsen stand unter dem Motto: Befähigung, Kooperation und Resilienz.
organisieren und Kennzahlen zu erfassen. Diese Dokumentation im Ticketsystem könnte auch dabei helfen, den eigenen Arbeitsaufwand zu beweisen, um beispielsweise wei-

Aiko Leubner, CISO der KDO, möchte die Kommunen in Niedersachsen effizienter und zukunftssicher aufstellen.
tere Haushaltsmittel zu erhalten. Auch in Nordrhein-Westfalen wurde der Sicherheitscheck durchgeführt. Hier schnitten die Kommunen Ernst zufolge etwas besser ab.
Nur der erste Schritt Dr. Stephan Meyn, Referatsleiter und Pressesprecher beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, erklärte, die Aktion sei ein Erfolg gewesen. Nun sei „schwarz auf weiß“ klar, an welchen Stellen nachgearbeitet werden müsse. Er sprach sich dafür aus, in Zukunft eine Wiederholung durchzuführen, um die Fortschritte zu sehen. Gleichzeitig stellte Meyn klar: „Das kann nur der erste Schritt sein“. Er forderte vom Land eine Eingriffstruppe für Cyber-Notfälle und die finanzielle und personelle Unterstützung der Kommunen über weitere Förderprogramme. Die zentrale Gestaltung von Schulungen wäre Meyn zufol-
litik sich bis zum Herbst auf eine Lösung einige. Die Cybersicherheitsstrategie Niedersachsens enthält keine grundsätzlichen Überraschungen. Sie fordert insbesondere eine engere Vernetzung in den Bereichen Cyber Security, Cyber Crime und Cyber Intelligence sowie eine verbesserte Kommunikation zwischen Kommunen und der Landesverwaltung, insbesondere im Hinblick auf Vorfallsmeldungen. Weitere Handlungsfelder sind unter anderem eine ganzheitliche Lagebilderstellung und die Förderung von öffentlichprivaten Partnerschaften.
Großer Wunsch nach einem CyberSicherheitszentrum Ein besonderes Anliegen war Baier die Errichtung eines Cyber-Sicherheitszentrums in Niedersachsen. Als Vorbilder dienen hier andere Landes-Cybersicherheitsbehörden wie das Hessen3C, die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) und das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) in Bayern. Für ein solches Zentrum bestehe ein „hoher Bedarf“, allerdings sei die Umsetzung derzeit finanziell nicht realisierbar, so der Landes-CIO. Dennoch hatte die niedersächsische Landesregierung aus SPD und Bündnis 90/ Die Grünen die Einrichtung eines solchen Zentrums bereits 2022 im Koalitionsvertrag festgeschrieben.
ge ebenfalls sinnvoll. Nicht jedes Rathaus müsse sich hierzu eigene Gedanken machen oder eigene Videos produzieren. Außerdem lohne sich mehr Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, um nicht allein dazustehen. „Längst nicht alle“ Kommunen seien bei den ITDienstleistern organisiert. Moritz Kienzle, Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) im Landkreis Rotenburg (Wümme), befürwortet ebenfalls die interkommunale Zusammenarbeit, zum Beispiel in Form der gemeinsamen Beschaffung oder der Etablierung von gemeinsamen Standards. Den Kommunen würde es Kienzle zufolge helfen, wenn beispielsweise der ITGrundschutz bundesweit verbindlich wäre. Es brauche Zeit und ein „entsprechendes Investment“, um diesen zu erreichen. „Aber wir hätten eine Grundlage, auf die wir uns alle gemeinsam committen können. Dann könnte man deutlich leichter von links nach rechts schauen und sehen: Wo steht ihr, was machen wir gerade und wo können wir uns gegenseitig helfen?“, so der ISB. Auf die Verbindlichkeit eines IT-Sicherheitsstandards für alle müssten sich die Länder untereinander einigen.

Die Referierenden aus Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung sowie eines Unternehmensverbands und eines Wirtschaftsvertreters diskutierten über ein Cyber-Lagebild in Echtzeit. Fotos: BS/Ströbele
Behörden Spiegel: Wenn wir etwas weiter in die Zukunft blicken, gibt es Herausforderungen durch Quantentechnologien. Wie bereitet sich das BSI schon heute darauf vor?
Claudia Plattner: Das Thema Quantentechnologien treibt uns in der Tat sehr um. Wir müssen davon ausgehen, dass Daten, die heute herkömmlich verschlüsselt wurden, ab etwa 2030 mit Quantencomputern entschlüsselt werden können. Die richtigen Schutzmaßnahmen stehen uns schon zur Verfügung, jetzt ist es wichtig, dass sie auch eingesetzt werden. Dazu müssen bereits gespeicherte Daten auf quantensichere Verschlüsselungsmechanismen migriert werden.
Im Moment machen wir Folgendes: Wir sehen zu, dass die Menschen wissen, dass sie sich schützen und jetzt in die Migration müssen. Mit sehr vielen unserer europäischen Kollegen haben wir ein Paper geschrieben, das vor genau diesem Szenario (store now, decrypt later) warnt. Und wir geben ihnen eine konkrete Hilfestellung an die Hand. Wir machen u. a. technische Richtlinien, die sagen, wie das geht. Und natürlich kümmern wir uns jetzt Stück für Stück darum, die ersten Migrationen herbeizuführen. Wir haben auch die erste quantensichere Smartcard zertifiziert. Der Markt spielt also auch mit.
Behörden Spiegel: Es gibt eine Diskussion um den CISO Bund, ob es ihn braucht und wo er angesiedelt werden soll. Sie plädieren für einen CISO Bund beim BSI. Können Sie die Gründe dafür nennen?
Plattner: Zunächst mal – wir brauchen auf jeden Fall einen CISO Bund. Die Bundesverwaltung braucht Hilfe dabei, das IT-Sicherheitsniveau überall adäquat zu adressieren. Das braucht Struktur, Institutionalisierung und auch ein Mandat. Ich möchte das beim BSI ansiedeln, erstens, weil wir schon eine Menge dieser Befugnissen haben und ich mir Sorgen mache um potenzielle Reibungsverluste. Wenn ein CISO woanders angesiedelt ist, gibt es womöglich Unklarheiten bezüglich der Befugnisse. Das kann dazu führen,
Klassische IT-Sicherheit unterscheidet prinzipiell zwischen „innen“ und „außen“. Verkehr, der von extern in das interne Firmennetz kommt, gilt dabei als verdächtig. Beim sogenannten „Castle-and-Moat“-Konzept („Burg mit Wassergraben“) wird es dem Benutzer schwergemacht, von außerhalb des Netzwerks Zugriff zu erhalten; aber standardmäßig vertraut man jedem, der sich innerhalb des Netzwerks befindet (Beispiel VPNEinwahl). Problematisch bei dieser Vorgehensweise ist, dass ein Angreifer, der einmal den Zugriff auf das Netzwerk erlangt hat, über alles darin frei verfügen kann. Diese Form der Perimeter-Sicherheit verliert jedoch u. a. durch Cloud Computing und verstärktem mobilen Arbeiten seit Corona an Bedeutung. Bereits Mitte der 1990er Jahre entwickelte der Informatik-Student Paul Marsh ein Konzept, das Sicherheit unabhängig vom Perimeter definiert – „ZeroTrust“. Dabei werden alle Zugriffe und Anfragen als prinzipiell verdächtig betrachtet. Anwender und Applikationen müssen sich immer authentifizieren und autorisieren. Populär wurde der Begriff allerdings erst, als es 2010 vom einem Forrester-Research-Analysten aufgegriffen wurde. Die wichtigsten Grundsätze von Zero Trust sind geringste Privi-
BSI will Quantentechnologien und Künstliche Intelligenz verstärkt nutzen
(BS) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) möchte sich für die Zukunft rüsten. Dr. Eva-Charlotte Proll und Anna Ströbele sprechen mit BSI-Präsidentin Claudia Plattner darüber, warum der CISO des Bundes bei ihrer Behörde angesiedelt werden sollte und ob es gelingt, genügend weibliche IT-Fachkräfte zu gewinnen.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner (rechts) erklärte hinsichtlich der Cybernation Deutschland, dass alle mitmachen müssten, da ihr Team nicht aus Helikoptern springe und Systeme sichere. Foto: BS/Wagner
dass diese beiden Stellen gegeneinander ausgespielt werden. Da will ich niemandem etwas Böses unterstellen. Aber es liegt in der Natur der Dinge, dass solche Prozesse auseinanderlaufen, wenn man sie nicht in einer Hand lässt. Das sollten wir nicht tun. Zweitens kümmern wir uns nur um Cyber-Sicherheit. Technisch, fachlich, sachlich.
„Wir eruieren,
mit der Bundesverwaltung umgesetzt werden kann. Aufwandsärmer kriegt das deswegen keiner hin.
Behörden Spiegel: Auf einer Veranstaltung haben Sie einmal gesagt, dass Frauen eine bislang ungenutzte Ressource in der IT-Sicherheit sind. Wie setzt sich das BSI dafür ein, den Anteil von Frauen im eigenen Haus zu erhöhen?
wie wir
KI
einsetzen, um Schwachstellen zu finden und Schutzmaßnahmen weiterzuentwickeln.“
Und drittens, wissen wir, wie es geht. Wir haben die entsprechenden Kompetenzen hier. Wir haben die Leute, die wissen, wie das in der Praxis und
Plattner: Ich bin wirklich zufrieden mit dem, was wir im BSI bisher in dieser Hinsicht erreicht haben. Wir haben Stand jetzt 35 Prozent
Frauen im BSI. Wir haben 25 Prozent in Führungspositionen. Die Quote ist noch nicht perfekt, aber wir sind einen ordentlichen Schritt nach vorne gegangen. Und diese letzte Zahl freut mich eigentlich am meisten: Wir haben inzwischen bei den Bewerbungen 40 Prozent Frauen. Das ist eine Riesenzahl und für mich wichtig. Ich will das wissen. Ich will sehen, was da passiert. Klar, ich selbst stehe natürlich auch für das Thema. Ich versuche, viele Kampagnen zu unterstützen. Wir sind auf vielen Veranstaltungen zum Thema präsent. Wir machen viel auf Social Media. Es gibt so viele IT-affine, talentierte Frauen, und wir wollen durchaus noch ein paar davon für das BSI gewinnen. Aber grundsätzlich geht es auch darum, sie insgesamt für den MINT-Bereich zu motivieren. Es gibt so viele spannende Aufgaben: in naturwissenschaftlichen Bereichen, im Bereich der
Spagat zwischen IT-Sicherheit und Usability (BS/Oliver Wege) Zero Trust, auf Deutsch „Null-Vertrauen“, bezeichnet eine Sicherheitsstrategie, die auf dem Prinzip basiert, dass man niemals automatisch vertraut. Sie geht davon aus, dass Bedrohungen sowohl extern als auch intern auftreten können, und daher sollte keinem Benutzer oder Gerät standardmäßig vertraut werden, egal ob sie sich innerhalb oder außerhalb des Netzwerks befinden.
legierung bzw. minimaler Zugang, Kontrolle des Gerätezugriffs, Mikrosegmentierung und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Dabei wird auch auf Sicherheitstechniken zurückgegriffen, die längst etabliert sind.
ZTNA als Grundpfeiler
ZTNA (Zero Trust Network Access) ist der wichtigste Ansatz im Bereich der Zero Trust-Architektur. Dabei kann man grob in agentenbasierte ZTNA und dienstbasierte ZTNA unterscheiden. Für die agentenbasierte ZTNA muss auf allen Endpunktgeräten eine Softwareanwendung installiert werden. Der dienstbasierte oder cloudbasierte ZTNA ist ein Cloud-Dienst und erfordert keine Verwendung oder Installation eines Agenten. Einrichtungen sollten deshalb vorher überlegen, welche Art von ZTNA-Lösung am besten zu ihren Anforderungen passt. Wenn ein Unternehmen beispielsweise schon eine EDR-Lösung (Endpoint Detection and Response) betreibt, kann eine agentenbasierte ZTNA
eine effektive Option sein. Ggf. können sich beide Lösungen sogar einen Agenten teilen. Wenn sich ein Unternehmen hingegen in erster Linie auf die Cloud konzentriert, kann ein dienstbasiertes Modell relativ zügig eingeführt werden.
ZTNAs lassen sich darüber hinaus meist auch in das breitere Sicherheits-Ökosystem des Herstellers integrieren. Hier zeigt sich aber auch die größte Schwachstelle der ZTNATechnologie, die stark properitär ausgerichtet ist. Offene Standardisierungsansätze existieren quasi nicht, man muss sich deshalb momentan an einen Hersteller binden. Ein anderes Zero Trust-Konzept hat Microsoft vorgestellt und es Zero Trust DNS (ZTDNS) genannt, da es technisch auf dem DNS-Service basiert. Domain-Name-System (DNS) realisiert die Zuordnung der „sprechenden“ Domain-Namen in technisch verwendbare IP-Adressen, die sogenannte Namensauflösung. ZTDNS will nun grundsätzlich jegliche Kommunikation ohne DNS unterbinden und so die
Informatik, im Bereich der CyberSicherheit. Wir stellen fest, wir kriegen sie motiviert. Das macht mich sehr stolz, muss ich sagen.
Behörden Spiegel: In welchen Bereichen setzt das BSI schon Künstliche Intelligenz ein? Und wie sind die Pläne für die nächste Zeit?
Plattner: Wir brauchen definitiv mehr davon. Das ist glaube ich ganz klar. Wir setzen es heute schon in der Lagebeobachtung und -bewertung ein. Anomalie-Erkennung und Intrusion Detection sind Stichworte. Wir eruieren, wie wir KI einsetzen, um Schwachstellen zu finden und Schutzmaßnahmen weiterzuentwickeln. Wenn wir die Schwachstelle per KI gefunden haben, bevor sie der Angreifer per KI gefunden hat, können wir warnen, bevor er oder sie sie ausnutzt. Das ist im Prinzip der Wettlauf, der da passiert. Und das wird Stück für Stück mehr. Und daneben kümmern wir uns auch um die Frage: Wie kann man eigentlich KI-Systeme sicher betreiben? Das Thema hat also verschiedene Facetten für uns. Ich bin da sehr aufgeschlossen und positiv und das kann ich definitiv auch für das Haus sagen. Aber wir haben noch ein paar Risiken zu managen.
Behörden Spiegel: Das BSI kooperiert mit anderen europäischen Cyber-Sicherheitsbehörden. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?
Plattner: Die internationale Zusammenarbeit ist sehr vielfältig und sehr intensiv. Wir arbeiten insgesamt eng und produktiv mit unseren europäischen Partnern zusammen, auch zum Beispiel mit der ENISA. Angriffe enden nicht an der Landesgrenze und Datenströme auch nicht. Daher ist es wichtig, dass die operative Zusammenarbeit auch auf der Fachebene so hervorragend klappt. Ob Gremienarbeit zu Standards und Richtlinien, etwa zur Postquantenkryptografie, oder bei der Abwehr von Cyber-Angriffen im Verbund der europäischen CERTs (Computer Emergency Response Teams), Europa ist gemeinsam stark.
Netzstruktur verschleiern. Microsoft kombiniert dazu den Windows DNS-Client mit der Windows Filtering Platform (WFP), um DNS-basierende Regelwerke implementieren zu können. Die DNS-Server lösen dann ausschließlich zulässige Domänennamen auf.
Keine Whitelist, kein Zugang Für Ausnahmen können Administratoren dem Client eine IP-Whitelist für Ziele ohne Namensauflösung mitgeben. Windows blockiert nun den gesamten ausgehenden IPVerkehr, mit Ausnahme von DHCP zur dynamischen Zuweisung der Client-IP-Adresse, NDP-Verkehr für Netzwerkinformationen und den verschlüsselt geschützten DNS-Verkehr. Möchte ein Client nun auf eine Serverressource zugreifen, befragt er zunächst den geschützten DNS-Server. Falls die dort hinterlegte Richtlinie den Zielserver erlaubt, erhält der Client eine positive DNS-Antwort. Ansonsten wird die Kommunikation durch fehlende Namensauflösung bzw. über die WFP
blockiert. Infolge der standardmäßigen Blockade können einige Dienste systemimmanent nicht korrekt funktionieren. Drucker müssten entweder über IP-Whitelisting erlaubt oder über Microsofts Universal Print angesprochen werden. Auch Kollaborationsplattformen, wie MS Teams, Webex und Zoom, stellen eine ähnliche Herausforderung dar, gleiches gilt für klassische IP-Telefonie. Auf Grund der (noch) vielen Ausnahmen stellt sich die Frage, ob ZTDNS eher ein Over-Engineering darstellt und in einem Placebo-Effekt mündet, da ein Großteil der IP-Adressen in der Whitelist landen. Zusammenfassend: Für Behörden ist der dienstbasierte ZTNAAnsatz wohl kaum anwendbar, da die Cloud-Nutzung von Hyperscalern noch sehr ungebräuchlich ist. Ebenso ist der agentenbasierte Ansatz in Zeiten der „Digitalen Resilienz“ auf Grund fehlender offener Standards problematisch. Überhaupt sollte man zunächst nur in geeigneten Teilbereichen mit einer Realisierung beginnen, denn nicht unterschätzt werden sollte der administrative und regulatorische Aufwand. Zu beachten ist auch die Usability: Zero Trust würde eigentlich auch eine Loginmaske vor dem Intranetwebserver erfordern – wohl eine schlechte Idee, um Usern ITSicherheit zu vermitteln.
Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft im Punkto IT-Sicherheit. Welche Maßnahmen wollen die Parteien ergreifen umd öffentliche Institutionen besser zu schützen?
23. FEBRUAR 2025
Partei Wie gewährleisten und verbessern wir die CyberSicherheit der öffentlichen Institutionen hierzulande?












„Unser Ziel ist es, unser Land noch besser gegen (hybride) Angriffe auf kritische Infrastrukturen sowie gegen Desinformationskampagnen zu schützen. Dazu werden wir die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Ländern, dem Bund, kommunalen Versorgern und Betreibern kritischer Infrastrukturen verbessern. Gleichzeitig werden wir die Vorsorge- und Sicherstellungsgesetze modernisieren und anpassen. Darüber hinaus streben wir eine Erweiterung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden zur Cyber-Abwehr an.“


Durch welche Maßnahmen sollen dabei insbesondere die Kommunen geschützt werden, um deren Handlungsfähigkeit zu sichern?
„Zahl, Komplexität und Schwere von Cyber-Angriffen wachsen beständig. Sie treffen das Nervensystem unseres Landes. Aber wir sind nicht wehrlos. Mit vernetzter Resilienz werden wir unsere Schlagkraft erhöhen. Wir statten unsere Sicherheitsbehörden bei der Cyber-Sicherheit mit den notwendigen Befugnissen, mit Fachpersonal und moderner Infrastruktur aus. Dazu braucht es auch eine konkurrenzfähige Besoldung. Wir handeln nach dem Grundsatz: Was in der analogen Welt verboten ist, muss auch in der digitalen Welt verboten sein. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist weiter zu vertiefen. Deshalb bauen wir das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu einer Zentralstelle für Fragen der Informations- und Cyber-Sicherheit aus. Es soll neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt eine starke dritte Säule der Cyber-Sicherheitsarchitektur unter Führung des Bundesministeriums des Innern bilden. Wir entwickeln unser Nationales Cyber-Abwehrzentrum so weiter, dass es in komplexen Schadenslagen bundesweit eine Abwehr von Gefahren und Angriffen koordinieren kann. Um das große Know-how außerhalb der Bundeswehr zu nutzen, wollen wir die Cyber-Reserve stärken. Gemeinsam mit den Ländern schaffen wir die Voraussetzungen für eine starke aktive Cyber-Abwehr des Bundes. Cyber-Angriffe insbesondere aus dem Ausland müssen wir aufklären und unterbinden können. Wir verzahnen die zivilen und militärischen Fähigkeiten zur Cyber-Abwehr besser. Wir nehmen regelmäßige gemeinsame Cyber-Übungen der Bundes-, der Landes- und der kommunalen Ebene vor.“
„Hierbei ist das KRITIS-Dachgesetz für die Kommunen ein zentraler Schritt, das bundeseinheitliche und sektorenübergreifende Vorgaben für den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) einführt. Dieses Gesetz zielt in erster Linie auf die Resilienz ab, um die Versorgungssicherheit unserer Gesellschaft mit lebenswichtigen Dienstleistungen zu gewährleisten.“
„Wir Freie Demokraten wollen nicht, dass der Staat die Cyber-Sicherheit durch sein Handeln gefährdet. Statt einer unkontrollierten Nutzung von IT-Schwachstellen durch Polizei und Nachrichtendienste braucht es ein geordnetes Schwachstellenmanagement, bei dem eine unabhängige Institution den Nutzen einer Schwachstelle gegen den Schaden für die IT-Sicherheit abwägt. Ohne ein solches Schwachstellenmanagement darf der Staat keine weitreichenden Instrumente wie die Quellen-Telekommunikationsüberwachung oder die Online-Durchsuchung einsetzen. Wenn einer staatlichen Stelle Sicherheitslücken bekannt werden, muss sie diese umgehend dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) melden. Das BSI führt dann eine Schließung der Lücke durch den Hersteller herbei. Wenn dies nicht gelingt, veröffentlicht das BSI die Lücke nach den allgemeinen Grundsätzen der Cyber-Sicherheit. Die Unabhängigkeit des BSI vom Bundesinnenministerium muss daher gesteigert werden. Das heimliche Betreten von Wohnungen, etwa zum Aufspielen von Trojanern, lehnen wir ab.“
„Wir sind uns der Bedrohung durch Hackerangriffe und andere Cyber-Kriminelle Aktivitäten bewusst und wollen daher mit einem Cyber-Sicherheitsstärkungsgesetz unsere IT-Infrastruktur härten und widerstandsfähiger gegen Angriffe machen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Stärkung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das BSI muss eine prominente Rolle beim Schutz digitaler Infrastruktur bekommen und zur Zentralstelle ausgebaut werden. Dies würde die IT-Sicherheit in Deutschland auf ein höheres Niveau heben und die öffentlichen Institutionen besser vor cyberkriminellen Angriffen schützen.“
„Die Sicherheit der digitalen Infrastrukturen von Staat und Wirtschaft muss ihrem Wesen nach zentral gewährleistet werden. Das BSI muss gestärkt und vom Zugriff von Polizei und Geheimdiensten freigehalten werden - ITSicherheit muss immer Vorrang haben. Durch Anwerbung und Weiterqualifikationen muss auf allen staatlichen Ebenen die personelle Ausstattung und das Know-How der Cyber-Sicherheit verbessert werden.“
„Unser Ziel ist es, digitale Netze und Einrichtungen durch hohe IT-Sicherheitsanforderungen robust gegen Hackerangriffe zu machen. Dies kann durch die Implementierung von Sicherheitsstandards, die regelmäßige Aktualisierung von Software und Hardware sowie die Schulung von Fachpersonal erreicht werden. Wir wollen auch sicherstellen, dass die öffentlichen Institutionen in der Lage sind, auf yber-Kriminelle Angriffe schnell und effektiv zu reagieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherung relevanter öffentlicher Datenbanken. Wir wollen mit „digitalen Botschaften“ im europäischen Verbund absichern, um sie auch in Krisenfällen vorzuhalten. Dies wird es ermöglichen, wichtige Daten und Informationen auch in Zeiten von Krisen oder Angriffen sicher zu speichern und zu verwalten.“
„Kommunen müssen selbst für einen verbesserten Schutz ihrer IT-Strukturen sorgen. Das können nicht alle Kommunen aus eigener Kraft, weshalb wir Modellen einer zentralen Infrastruktur von Rechenzentren und digitalen Registern bei Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben offen gegenüberstehen. Die Linke fordert, dass das BSI auch Kommunen und kleine Unternehmen bei der IT-Sicherheit unterstützen können soll.“
Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.
Behörden Spiegel Berlin und Bonn / Februar 2025
(BS/Mirjam Klinger) „Frieden in Freiheit: Sicherheit!“ Mit diesem Gleichnis betreibt die Partei Bündnis 90/Die Grünen aktuell Wahlkampf. Freiheit und Sicherheit sind in den letzten Jahren zu Kampfbegriffen der politischen Diskussionslandschaft geworden. Dabei gleicht es einem Drahtseilakt, beides unter einen Hut zu bringen.
www.behoerdenspiegel.de

Ein polizeibekannter Rechtsextremist wird nach seiner Haftentlassung von der Polizei überwacht. Es soll sichergestellt werden, dass er keine neuen Straftaten begeht oder untertaucht. Bei der Observation gerät auch seine Freundin ins Visier der Sicherheitsbehörden und wird auf Bild- und Videoaufnahmen festgehalten. Sie klagt dagegen. Der Grund: Dies sei einstarker Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht und ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Der Fall landet schließlich vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfGE). Dort bekommt die Klägerin im Januar dieses Jahres recht: Das Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen ist verfassungswidrig. Die Richterinnen und Richter betonen, dass heimliche Observationen nur bei einer konkreten oder zumindest konkretisierten Gefahr erlaubt sind: „Die Polizei darf nicht ohne nähere gesetzliche Vorgaben über die Grenzen der Freiheit der Bürger entscheiden.“ Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts setzt Freiheit und Sicherheit in ein klares Verhältnis – ein Spannungsfeld, das immer wieder gesellschaftliche und politische Debatten prägt. Laut dem Historiker Prof. Dr. Eckart Conze von der Phillips-Universität Marburg rückte das Thema Sicherheit – insbesondere die Spannung zwischen Sicherheit und Freiheit – bereits durch die Corona-Pandemie in den Mittelpunkt gesellschaftlicher und politischer Debatten. So sei in Meinungsumfragen der vergangenen Jahre regelmäßig von einer „Erosion des Sicherheitsgefühls“ die Rede gewesen. Der Wertbegriff Sicherheit hat jedoch schon lange eine zentrale Rolle in Strategiedebatten und Parteiprogrammen. Der Politikwissenschaftler Christopher Daase bezeichnete
die Sicherheit bereits 2010 als den „Goldstandard des Politischen“.
Null-Tolleranz-Politik
Ein markanter Ausdruck der Bedeutung von Sicherheit in der deutschen Politik war die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 24. Februar 2022. „Sicherheit ist das fundamentalste Versprechen, das ein Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern schuldet“, betonte er damals. Auch im aktuellen Wahlkampf nimmt der Schutz der Sicherheit eine zentrale Rolle ein. Der CDU-Bundesvorstand unterstrich dies mit dem Slogan „Nur wer sicher ist, kann in Freiheit leben“. Laut der Union entspricht das subjektive Gefühl der Unsicherheit der gestiegenen Anzahl an Delikten und Verbrechen. Aus diesem Grund setzt die Union auf eine „Null-Toleranz-Politik“: Sicherheitsbehörden sollen gestärkt und Straftäter konsequent abgeschoben werden. „[...] erweiterte Befugnisse stellen für Sicherheitsbehörden keineswegs nur eine Beschränkung von Freiheit dar, sondern sie dienen gerade auch dem Erhalt oder der Stärkung von Freiheit“, machte die Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz (CSU) deutlich. Dies werde jedoch von großen Teilen des politischen Spektrums oft verschwiegen. Ob es neue Regelungen benötige, sei eine Frage der Abwägung. Aus der Sicht von Lindholz sei jedoch „die dabei notwendige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in den letzten Jahren immer stärker in eine Schieflage zulasten der Sicherheit geraten“. Weiter führte die CSU-Politikerin aus: „Wenn unsere im öffentlichen Interesse handelnden Behörden nicht mehr effektiv Straftäter verfolgen oder Gefahren unterbinden können, müssen auch
etablierte Grundsätze hinterfragt und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.“
„Die
Polizei darf nicht ohne nähere gesetzliche Vorgaben über die Grenzen der Freiheit der Bürger entscheiden.“
Auszug aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
Spätestens seit dem Anschlag in Solingen im August 2024 und dem Sicherheitspaket der Ampelkoalition herrscht eine rege Diskussion um erweiterte Befugnisse für die deutschen Sicherheitsbehörden. Das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit ist die Gretchenfrage: Wie weit dürfen die Befugnisse und somit auch die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit gehen?
Vertrauen oder Kontrolle
Für den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, ist diese Frage klar zu beantworten: „Die Politik muss entscheiden, ob sie den Verfechtern eines übertriebenen Grundrechtsschutzes stattgeben möchte oder zeitgemäße, effiziente Polizeiarbeit ermöglicht.“ Gerade für die Verfolgung schwerer Straftaten im Netz seien passende gesetzliche Grundlagen notwendig. „Wir fordern eine europarechtskonforme und grund-
rechtsschonende Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung sowie den gezielten Einsatz moderner Überwachungsmethoden wie der der Quellen-Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)“, so Kopelke. Laut dem GdP-Vorsitzenden sind es nicht die erweiterten Befugnisse oder polizeilichen Möglichkeiten, die eine Problematik für die Freiheit darstellen. Stattdessen hänge es von „harmonisierten rechtlichen Standards“ ab. Kopelkes Einschätzung passt zu den Worten des Schriftstellers Wilhelm von Humboldt. Für von Humboldt sollte die Hauptaufgabe des Staates darin bestehen, die Sicherheit zu gewährleisten, die den individuellen Handlungsspielraum schützt und ermöglicht. Seine Überzeugung fasste er in dem Satz zusammen: „Sicherheit ist […] Gewissheit der gesetzmäßigen Freiheit.“ In eine andere Richtung geht die Argumentation der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen, Bettina Gayk: „Wer Freiheit will, und ich bin froh, in einem freien Land zu leben, muss auch hinnehmen, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann.“ Laut Gayk darf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Polizeigesetz nicht als eine Grenzensetzung betrachtet werden. Stattdessen erinnere das Bundesverfassungsgericht vielmehr die Sicherheitsbehörden daran, „die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger zu respektieren“. Mit dem Anwachsen der Datenmengen in der digitalen Welt steige auch die Gefahr, dass unbeteiligte Personen ins Visier der Sicherheitsbehörden gerieten, nur weil sie bestimmte Muster aufwiesen. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sieht somit vielmehr die Polizei
selbst in der Verantwortung, sicherzustellen, dass sie bei ihrer Arbeit Grundrechte und somit die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger nicht verletzt. „Es hilft meist am besten, wenn sich diejenigen, die überwachen, in die Rolle der Überwachten versetzen und sich in dieser Rolle die Frage beantworten, ob sie die Überwachung für gerechtfertigt hielten“, erklärte Gayk Auch der Grünen-Politiker Marcel Emmerich, Obmann im Ausschuss für Inneres und Heimat, sieht nicht in einem weiteren Eingriff in die Freiheit der Bürger eine zwingende Stärkung der Sicherheit. „Es ist wichtig, zu betonen, dass weder Vorratsdatenspeicherung noch Gesichtserkennung Taten wie in Solingen oder Magdeburg verhindert hätten“, betonte Emmerich gegenüber dem Behörden Spiegel. In Balance gebracht
Die Debatte um die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zeigt, wie sensibel und komplex dieses Thema ist. Die unterschiedlichen Standpunkte verdeutlichen, dass es keine einfachen Antworten gibt. Während Befürworter erweiterter Sicherheitsbefugnisse diese als essenziell für den Schutz der Gesellschaft betrachten, warnen andere vor einem möglichen Missbrauch und den damit verbundenen Eingriffen in die Grundrechte. Klar ist: Eine kluge und ausgewogene Gesetzgebung sowie transparente Kontrollmechanismen sind unverzichtbar, um beiden Aspekten gerecht zu werden. Die Diskussion bleibt damit ein zentraler Bestandteil der politischen und gesellschaftlichen Agenda – und erfordert eine ständige Auseinandersetzung mit den grundlegenden Werten unserer Demokratie.
Mitte Januar dieses Jahres wurden Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der sächsischen Linken in der Landeshauptstadt bedroht. Die Polizeidirektion Dresden teilte mit: Acht junge Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren seien offenbar zielgerichtet auf einen Informationsstand der Linksjugend zugegangen, um die Standbetreiber zu beleidigen und zu bedrohen. Die fünf Personen – eine Frau und vier Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren, die der Linksjugend angehören – blieben laut Polizei unverletzt. Ein Tisch des Standes wurde bei dem Vorfall beschädigt. Dresden ist jedoch bei Weitem nicht der einzige Schauplatz politisch motivierter Straftaten im Wahlkampfkontext. Nach Angaben des Berliner Senats kam es in der Hauptstadt bisher zu insgesamt sechs Übergriffen an Wahlkampfständen. Darunter zwei Körperverletzungen, drei Beleidigungen und eine Bedrohung. Dies teilte der Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses mit. Erkenntnisse zu einer Gefährdung der Bundestagswahl lägen aus Sicht der Polizei bislang keine vor, erklärte Hochgrebe weiter. „Ich gehe fest davon aus, dass das so bleibt.“
Von abgerissenen Plakaten bis hin zu tätlichen Angriffen
So bilden die Angriffe zwar keine konkrete Gefahr für die Wahl an sich. Eine Einschüchterung für die Wahlkämpfenden sind sie dagegen allemal. „Wir erleben in diesem wie auch in vorhergehenden Wahlkämpfen eine Vielzahl an Störaktionen“, erklärte der Pressesprecher des Landesverbands Die Linke Sachsen, William Rambow, gegenüber dem Behörden Spiegel. Konkret handele es sich bei diesen „Störaktionen“ um abgerissene Plakate, zerstörte Großflächen und Hass im Netz, aber auch um tätliche Angriffe. So sei die Linke zwar seit jeher Angriffe und Anfeindungen in Wahlkämpfen gewohnt, jedoch „hat die Qualität und Häufigkeit der Angriffe in den letzten Jahren merklich zugenommen.“ Eine Ausnahme bildet lediglich der Haustürwahl-
Politikerinnen und Amtsträger wenden sich an die Polizei
(BS/Mirjam Klinger/Lars Mahnke) Im Wahlkampf mag das Wort „Kampf“ stecken, die körperliche Unversehrtheit sollte aber eigentlich außer Frage stehen. Leider ist dies jedoch nicht immer der Fall. Kurz vor der Bundestagswahl häufen sich die Meldungen über Angriffe sowohl auf Kandidatinnen und Kandidaten als auch auf Wahlhelfende. Die Polizei steht vor der Herausforderung, Übergriffe zu verhindern, Täter zu ermitteln und die Meinungsfreiheit zu schützen.

kampf. Hier gaben die Parteien an, dass bei dieser Wahlkampf-Form so gut wie keine Angriffe zu erwarten seien. Rambow wies jedoch darauf hin, dass die Mitglieder der Linken grundsätzlich niemals allein, sondern immer im Team an den Haustüren unterwegs seien.
Der Pressesprecher der SPD Berlin, Ralf Höschele, berichtete dem Behörden Spiegel von einem Angriff in Berlin-Lichterfelde, der sich kürzlich ereignete. Dort habe eine mutmaßlich rechtsradikale Grup-


pe SPD-Wahlkämpfende attackiert, „bei denen diese und ein zur Hilfe kommender Polizist Verletzungen davontrugen und im Krankenhaus behandelt werden mussten“. Eine klare Zunahme sieht die SPD Berlin vor allem auf den digitalen Plattformen. „Dort löschen wir viele Kommentare und blockieren die entsprechenden Accounts“, so Höschele
Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren Auch die Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) unterstreichen dies. Rund 5.400 Angriffe auf Amts- und Mandatsträger hat es im Jahr 2023 gegeben, so die letzten offiziellen Angaben des BKA. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um etwa 29 Prozent. Laut dem Chef des BKA, Holger Münch, entspricht das einer Verdreifachung der Angriffe innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Nur in etwa elf Prozent der Fälle folgt darauf Anzeigen, gab das BKA an. Und dies, obwohl bereits das Bemalen oder Beschädigen von Wahlplakaten eine Sachbeschädigung darstellt, die eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren nach sich ziehen kann. Ist es nicht möglich, die Täter bei der Beschädigung der Wahlplakate zu erwischen, verzichten viele Parteien jedoch aufgrund der geringen Chancen auf Aufklärung auf eine Anzeige gegen Unbekannt. Auch wenn sich die Parteien nicht von den steigenden Angriffen und dem Vandalismus in ihrer politischen Arbeit beeinflussen lassen möchten, zeigt die schiere Möglichkeit eines Angriffs Auswirkungen auf die tägliche Wahlkampfarbeit: „Das erhöhte Gefahrenpotenzial stellt dennoch eine organisatorische Herausforderung dar“, erläuterte Rambow. Zum einen, da größere Teams und damit mehr Wahlkämpferinnen und -kämpfer nötig seien. Zum anderen, da insbesondere ältere Mitglieder sich teilweise aus Sorge vor Angriffen dafür eintscheiden würden, an bestimmten Wahlkampf-Aktionen nicht mehr teil-
zunehmen. Alle Parteien berichten davon, die Sicherheitsvorkehrungen inzwischen erhöht zu haben. Außerdem werde die Sicherheit auf Wahlkampfveranstaltungen durch die Polizei gewährleistet. Die Sicherheitsbehörden legen laut Rambow
„Die Qualität und Häufigkeit der Angriffe hat in den letzten Jahren merklich zugenommen.“
William Rambow, Pressesprecher des Landesverbands Die Linke Sachsen
seit den Kommunal- und Europawahlen 2024 einen stärkeren Fokus auf den Wahlkampf. So habe es in der letzten Januarwoche eine Beratung zwischen der sächsischen Polizei, des Landesamts für Verfassungsschutz Sachsen (LfV) und des Sächsischen Innenministeriums mit den antretenden Parteien gegeben. „Zudem folgen wir der Empfehlung der Polizei, indem wir die Behörden nach Möglichkeit vorab über geplante Wahlkampfaktivitäten informieren“, betonte der Linken-Poli-

Seit August 2024 hat die „starke Stelle“ ihre Arbeit aufgenommen. Die bundesweite Ansprechstelle zum Schutz kommunaler Amtsund Mandatsträgerinnen und -träger berät seither Betroffene, die in Ausübung ihres politischen Man-
dats Anfeindungen erleben. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden seit Aufnahme der Beratungstätigkeit über 120 Anfragen bearbeitet. Das Themenspektrum sei groß und die individuellen Anliegen der Ratsuchenden unterschiedlich. Dennoch ließen sich einige Auffälligkeiten erkennen: Häufig meldeten sich die Betroffenen nicht sofort. Daraus resultierten komplexe Sachverhaltsdarstellungen und fortgeschrittene Konfliktkonstellationen. Außerdem handele es sich häufig um verbale oder schriftliche Anfeindungen, Verleumdungen, Beleidigungen oder Bedrohungen. Fälle tätlicher Angriffe seien dagegen bisher nicht geschildert worden. „Unsere bundesweite Ansprechstelle vermittelt konkrete, persönliche und vertrauliche Unterstützung“, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Rahmen eines Besuchs der „starken Stelle“. Vom 24. bis 26. Februar organisiert die Behörden Spiegel Stiftung gemeinsam mit der Thomas-Morus Akademie und dem Präventionsnetzwerk #sicherimDienst in Bensberg die Veranstaltung „Sicher im öffentlichen Raum – Schutz, Prävention und Perspektiven für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst“. Anmeldungen sind online über die Thomas-Morus Akademie möglich.
tiker. Auch ein Sprecher der FDP wies darauf hin, dass gerade bei Parteiveranstaltungen immer wieder mit den Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet werde. „Zum Beispiel bei Wahlkampfkundgebungen oder Parteitage haben wir grundsätzlich – wie bei großen Parteitagen üblich – ein Sicherheitskonzept“, so der FDP-Sprecher. Die Bundesländer und Landespolizeien versuchen, mit Prävention und konkreten Maßnahmen die Sicherheit von Wahlhelferinnen und -helfern zu gewährleisten. So teilte Mitte Januar das Landesinnenministerium Mecklenburg-Vorpommern in einer Pressemeldung mit, dass sich die Landespolizei auf die „heiße Phase“ des Bundestagswahlkampfes vorbereite. Zum Schutz und zur Unterstützung der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer arbeite die Polizei unter anderem mit einer zentralen telefonischen Anlaufstelle – wie bereits zur Kommunal- und Europawahl 2024. Die Anlaufstelle richtet sich laut Innenministerium an alle, die Hinweise auf Straftaten oder andere relevante Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Bundestagswahl melden möchten. Hinsichtlich anstehender Wahlkampfveranstaltungen seien Polizei und Versammlungsbehörden mit den Veranstaltern in engem Austausch. „Dies ermöglicht es der Polizei, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und ein sicheres Umfeld für die Wahlkämpfenden zu schaffen“, versicherte ein Sprecher des Ministeriums. Der Innenminister MecklenburgVorpommerns, Christian Pegel (SPD), mahnte: „Angriffe auf Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und auf diejenigen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich für unsere Gesellschaft engagieren, sind absolut inakzeptabel.“ Solche Taten griffen nicht nur Einzelpersonen an, sondern auch die Werte und Grundpfeiler der deutschen Demokratie.
Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft der Inneren Sicherheit Deutschlands. Wie stehen die Parteien zur Verschärfung des Strafrechts und zur Ausweitung der Befugnisse von Sicherheitsbehörden?
Partei
Brauchen wir härtere gesetzliche Bestimmungen in Deutschland? Wenn ja, wo und in welcher Form konkret?












23. FEBRUAR 2025


Welche Befugnisse benötigen die Polizeien zur effektiven Strafverfolgung und sollten die Regularien sowie Kontrollmechanismen für Nachrichtendienste angepasst werden?
„Wir stärken die Sicherheitsbehörden auch mit den Mitteln des Strafrechts: Angriffe auf diejenigen, die uns schützen, sollen härter bestraft werden. Wir setzen verstärkt auf die elektronische Fußfessel. Gewalttäter gegen Frauen müssen gestoppt werden. Wir setzen mehr Videokameras sowie Systeme zur automatisierten Gesichtserkennung an Brennpunkten und Gefahrenorten ein. Straftäter dürfen nicht einfach so davonkommen. Wir verpflichten die Internetanbieter zur Speicherung der IP-Adressen. Gegen jede Form der Gewalt gegen Kinder gehen wir konsequent vor – auch im Netz. Wir stellen das Unterstützen von Terror-Organisationen konsequenter unter Strafe und greifen durch: Ausweisung, Entzug des Aufenthaltstitels, Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft. Wir geben unseren Sicherheitsbehörden eine möglichst umfassende Befugnis zur elektronischen Gesichtserkennung und erlauben ihnen die Nutzung moderner Software zur Analyse von großen Datenmengen, polizeilichen Datenbanken und sozialen Netzwerken. Wir schaffen digitale Befugnisse wie QuellenTelekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung und automatische Datenanalyse mittels KI für alle Bundessicherheitsbehörden. Die Leistungsfähigkeit unserer Nachrichtendienste ist von entscheidender Bedeutung für unsere Sicherheit in Zeiten international vernetzten Terrors und grenzüberschreitender Kriminalität. Wir müssen die Befugnisse unserer Nachrichtendienste verbessern, damit wir Augenhöhe mit der Leistungsfähigkeit der Nachrichtendienste unserer ausländischen Partner erreichen und nicht länger von deren Hinweisen zu Terrorgefahren abhängig sind. Dazu müssen insbesondere unverhältnismäßige rechtliche Auflagen zurückgeführt werden. Wir werden prüfen, wie wir Erkenntnisse der Dienste und sonstiger Sicherheitsbehörden zum Beispiel in Visaverfahren wirksamer zur Geltung bringen, damit Gefährder gar nicht erst in unser Land kommen.“
„Dank der professionellen Arbeit unserer Sicherheitsbehörden ist Deutschland eines der sichersten Länder der Welt. Die Sicherheitsbehörden müssen in die Lage versetzt werden, frühzeitig Gefahren und Bedrohungen abzuwehren.
Das gilt besonders mit Blick auf die Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie politisch motivierte Kriminalität. Das gilt auch für die Bedrohungen durch Organisierte Kriminalität, Finanzkriminalität und Straftaten im und aus dem Internet (Cybercrime). Dem Nährboden für Terror, Angst und Hass begegnen wir fokussiert und konsequent. Wir kümmern uns um einen soliden Bevölkerungsschutz und schützen unsere kritische Infrastruktur. Wir sorgen für Sicherheit, die schützt und Vertrauen schafft. Dafür schaffen wir ein modernes Bundespolizeigesetz, das der Bundespolizei klare Befugnisse gibt, um den heutigen sicherheitspolitischen Herausforderungen wirksam zu begegnen.“
„Wir Freie Demokraten lehnen symbolische und reflexhafte Verschärfungen des Strafrechts ab. Schließlich ist das Strafrecht keine Allzweckwaffe, sondern die Ultima-Ratio des Rechtsstaats. Wir stehen für eine starke Strafjustiz, die schnelle Entscheidungen über Schuld oder Unschuld herbeiführt. Das Strafrecht gilt es deshalb insgesamt zu evaluieren und im Sinne des Ultima-Ratio-Grundsatzes auf Tatbestände mit entsprechendem Unwertgehalt zu fokussieren. Deswegen wollen wir das Strafgesetzbuch systematisch überprüfen und überholte Straftatbestände anpassen oder streichen. Hierzu gehören etwa Paragraf 142 StGB (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) und Paragraf 265a StGB (Erschleichen von Leistungen); die Beförderungserschleichung, Schwarzfahren, soll als Ordnungswidrigkeit gelten. Wir stehen für eine evidenzbasierte Strafrechtspolitik und wollen daher die Datengrundlage zu Strafprozessen verbessern, insbesondere in den Ländern.“
„Unsere Demokratie wird von innen wie außen massiv bedroht. Die schrecklichen Taten von Solingen und Magdeburg zeugen davon. Auch Angriffe autoritärer Staaten auf unsere Demokratie nehmen stetig zu. Wir setzen uns dafür ein, dass sehr ernstzunehmende sicherheitspolitische Bedrohungen zielgerichtet mit allen rechtsstaatlichen Möglichkeiten bekämpft werden. Dazu gehören gute Rechtsgrundlagen, aber auch dringend notwendige Investitionen in die Innere Sicherheit sowie mehr Prävention.“
„In Fragen der Inneren Sicherheit sehen wir kaum Notwendigkeiten für härtere gesetzliche Bestimmungen. Wir unterstützen solche Forderungen, deren Effekt plausibel und deren Vollzug nicht unverhältnismäßig ist. Beispielsweise sollte die Regelung von Waffenverboten im Einzelfall aus Paragraf 41 Waffengesetz so gestaltet werden, dass diese auch unmittelbar von der Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr und von Staatsanwaltschaften und Gerichten bei Gewaltstraftaten angeordnet werden können.“
„Die SPD setzt sich für gute Arbeitsbedingungen bei der Bundespolizei ein und unterstützt die Polizistinnen und Polizisten in ihrer Arbeit für unsere Sicherheit. Dabei stellen wir moderne Ausrüstung sowie zeitgemäße Befugnisse für Polizei- und Sicherheitsbehörden sicher. Mit der Reform des Bundespolizeigesetzes soll die Bundespolizei mit modernen, rechtssicheren Befugnissen ausgestattet sein und soll so helfen, Bedrohungslagen effizienter zu analysieren. Außerdem soll unsere Polizei automatisierte (KI-basierte) Datenanalysen vornehmen können. Das ermöglicht eine schnellere Kriminalitätsbekämpfung. Besonders im wichtigen Kampf gegen die Organisierte Kriminalität müssen wir sie stärker befähigen, riesige Datenmengen effizient auswerten und Kriminalität gezielt bekämpfen zu können. Wir haben zudem das Strafgesetzbuch verschärft, um Rettungskräfte und Polizei besser vor Angriffen zu schützen. Solchen Attacken treten wir mir null Toleranz entgegnen.“
„Wir fordern eine Generalinventur für die Innere Sicherheit in Deutschland. Bund und Länder müssen die föderale Aufgabenverteilung im Bereich der Inneren Sicherheit neu ordnen und dabei die Zahl der zuständigen Behörden reduzieren. Es braucht eine Föderalismusreform im Bereich der Inneren Sicherheit. Wir fordern leistungsfähige Nachrichtendienste, die als Frühwarnsystem für Gefährdungen einen Beitrag für die Sicherheit unseres Landes leisten. Dazu brauchen alle Dienste auch in ihrer Kooperation mit der Polizei eine klarere eigene Rechtsgrundlage. Gleichzeitig braucht es eine verbesserte Kontrolle der Nachrichtendienste. Diese verhindert nicht die Arbeit der Nachrichtendienste, sondern ist in einem liberalen Rechtsstaat die zwingende Voraussetzung für die Legitimität und das Vertrauen in nachrichtendienstliche Tätigkeit. Wir wollen deshalb die bislang zersplitterte Kontrolllandschaft institutionell, funktional und organisatorisch neu ordnen und dabei Kontrolllücken schließen.“
„Um die Polizeien in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen, müssen wir sicherstellen, dass sie über die notwendigen Ressourcen und rechtsstaatlichen Befugnisse verfügen. Daher wollen wir die gesetzlichen Grundlagen der Polizeien des Bundes wie das Bundespolizeigesetz modernisieren und dabei auch Antworten auf neue Bedrohungen geben. Die Kriminalität verlagert sich zunehmend in den digitalen Raum, und die Polizei muss technisch mithalten können, um effektiv zu sein. Dies wollen wir mit Investitionen in moderne Technologien und Infrastruktur gewährleisten.“
„Die Polizei verfügt im Rahmen der Strafprozessordnung bereits über ausreichende Befugnisse einer effektiven Strafverfolgung in den rechtsstaatlich gesetzten Grenzen. Wenn mit der Anpassung der Kontrollmechanismen für Nachrichtendienste gemeint sein soll, diese Kontrolle zu lockern, widerspricht Die Linke dem eindeutig.“
Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.
Das Bundesverfassungsgericht hält die Erhebung von Gebühren für den polizeilichen Mehraufwand bei Hochrisikospielen der Fußball-Bundesliga in Bremen für mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Stadt Bremen darf somit dem ortsansässigen Bundesligaverein SV Werder Bremen nach Paragraf 4 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes die zusätzlich anfallenden Kosten für sogenannte Hochrisikospiele in Rechnung stellen.
Gerichtspräsident Stephan Harbarth begründete die Entscheidung wie folgt: „Die Verfassung kennt keinen allgemeinen Grundsatz, nach dem die polizeiliche Gefahrenvorsorge durchgängig kostenfrei zur Verfügung gestellt und ausschließlich aus dem Steueraufkommen fi nanziert werden müsste.“ Durch das Urteil würden nun die wirtschaftlichen Nutznießerinnen und Nutznießer an den Kosten der Polizeieinsätze beteiligt und Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geschont. „Das ist ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel“, stellte Harbarth fest.
Signalwirkung für andere Länder In einigen Bundesländern wurde das Urteil ganz genau verfolgt. Die Landesregierungen in RheinlandPfalz und Hamburg hatten bereits vor der Urteilsverkündung ihr Interesse an dem Modell verkündet. Auch in Niedersachsen zeigt man Interesse. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) begrüßte das Urteil und will weitere Schritte prüfen: „Wir werden die Entscheidung des Gerichts nun sehr genau analysieren und die weiteren Schritte für Niedersachsen sorgsam abwägen.“ Sie betonte aber, dass sie die Ausstellung von Gebührenbescheiden nicht als Ideallösung betrachte. Ihr gehe es vor allem um die Eindämmung von Gewalt im Umfeld von Fußballspielen. In Nordrhein-Westfalen, wo die meisten Profivereine beheimatet
Im Zuge weitergehender Betrachtungen der Organisation des LKA MV wurde im Jahr 2020 die Chance genutzt, der Polizeiabteilung im Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern die Zusammenführung von Organisationseinheiten mit Schwerpunkt Informationstechnik, die bislang in verschiedenen Abteilungen sowie dem Stab der Behörde angegliedert waren, vorzuschlagen und dafür erste konzeptionelle Überlegungen darzulegen.
Erste Erfolge feststellbar
Nach einer gedanklichen Vorbereitung im Februar 2021 wurden in einem ersten Schritt im Folgemonat der Stabsbereich 3 – IT-Grundsatz und Verfahrensbetreuung, die Aufgabenbereiche Telekommunikationsüberwachung und Informationstechnische Überwachung (und im Projektverlauf hinzugekommen Automotiv IT) des Dezernates 24 – Besondere Dienste (Abteilung 2 – Ermittlungs- und Einsatzunterstützung) sowie im Gesamtbestand das Cybercrime-Dezernat, inklusive



Muss die DFL bald für Polizeieinsätze zahlen?
(BS/lm) Was bei den Fußball-Bundesligavereinen für einen Schockmoment gesorgt haben dürfte, wurde in Polizeikreisen positiv aufgenommen. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt in seinem Urteil grundsätzlich, dass Polizeikosten bei den Clubs zurückgeholt werden können.

Werden weitere Bundesländer dem Beispiel Bremens folgen und zukünftig Gebühren für die Mehrkosten von Polizeieinsätzen bei sogenannten Hochrisikospielen erheben? Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat den Weg dafür grundsätzlich frei gemacht.
sind, ist in jeder Saison mit einer Vielzahl von Hochrisikospielen zu rechnen. Ein Sprecher des NRWInnenministeriums bestätigte, dass nach Einschätzung der Landesinformationsstelle Sporteinsätze (LIS) „14 Spiele der ersten vier Ligen und des DFB-Pokals in NordrheinWestfalen in der Saison 2023/24 retrograd als jene Spiele betrachtet werden, die für eine Kostenbeteiligung der Vereine grundsätzlich in Betracht gekommen wären bzw.
kommen würden.“ Innenminister Herbert Reul (CDU) freute sich, dass mit dem Urteil Klarheit geschaffen wurde, sagte aber auch: „Trotzdem bleibe ich dabei: Polizeieinsätze dürfen kein Preisschild haben. Ich will keine Preisschlacht führen, wenn es um Polizeieinsätze geht. Für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, ist ein Versprechen des Staates an seine Bürger.“ Er fordert, dass Vereine und Stadionbetreiber sich ihrer Verantwortung
bewusst sein und mehr Geld in die Sicherheit Ihrer Stadien investieren. Die rot-grüne Regierungsfraktion in Hamburg hatte im September in der Hamburgischen Bürgerschaft einen Antrag eingebracht, der eine gerechtere Verteilung der Polizeikosten bei Profifußballspielen vorsieht. Sören Schumacher, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Hamburg, erklärte: "Im besten Fall verstärken DFL und Vereine auch ihre Bemühungen für mehr Sicherheit in Stadion und Fanszene. So können wir Hochrisikospiele […] künftig vermeiden und die Polizeikosten drastisch reduzieren.“
Innensenator Andy Grote (SPD) kommentierte das Urteil: „Damit steht das Thema Stadionsicherheit und polizeilicher Aufwand wieder ganz oben auf der Tagesordnung.“ Er fordert die zügige Etablierung einer zentralen und unabhängigen Stadionverbotskommission. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, Dennis Gladiator , hatte auf dem Hamburger Polizeitag letzten November darauf hingewiesen, dass eine analoge Diskussion um die Kosten von Polizeieinsätzen bei kulturellen Großereignissen wie Konzerten, Hummel- oder Hafenfesten entstehen könne. Diese könnten sich in der Folge womöglich ähnlichen Forderungen nach einer Kostenbeteiligung ausgesetzt sehen. In Bremen sieht man dies nicht so. „Unsere vom Bundesverfassungsgericht kürzlich bestätigten Kriterien schließen aus, dass andere Veranstaltungsarten ähnliche Rechnungen bekommen
Das Digitale Service- und Kompetenzzentrum stellt sich vor (BS/Jörg Bruhn*) Unter Maßgabe einer der zahlreichen Handlungsempfehlungen der Cybercrime-Bekämpfungsstrategie der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wurden im Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern die Zuständigkeiten und Strukturen unter Berücksichtigung der Entwicklungen in den anderen Bundesländern wiederholt geprüft.
der Ansprechstelle Kinderpornografie (Abteilung 4 – Schwere Kriminalität), und das Dezernat 55 - Digitale Forensik (Abteilung 5 – Kriminalwissenschaft und -technik) aus den bisherigen Organisationsstrukturen des LKA MV herausgelöst und als Digitales Service- und Kompetenzzentrum (DiSK) organisatorisch zusammengeführt. Mit dem formellen Projektauftrag des IM MV vom April 2021 wurde dieses Vorhaben bestätigt und mir als Leiter des Cybercrime-Dezernats die Verantwortung übertragen. Die Projektleitung wurde durch die Einrichtung einer Geschäftsstelle sowie im ersten Jahr durch eine Projektassistenz unterstützt.
Zielstellung war, die IT-Kompetenzen des LKA MV zu bündeln, um damit die vorhandenen Ressourcen noch zielgerechter einzusetzen und die Servicequalität zu erhöhen.
Auf Grundlage eines zu fertigenden Evaluationsberichts sollte, sofern die Erfahrungen aus dem Projekt positiv sind, über eine Verstetigung bzw. Überführung des Projekts in die AAO entschieden werden.
könnten“, ließ der Pressesprecher des Senators für Inneres und Sport verlauten.
Gewerkschaften begrüßen Urteil In Berlin bekräftigte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) ihre „Position, dass das Land Berlin keine Kostenbeteiligung für Vereine an Zusatzausgaben bei Polizeieinsätzen im Hinblick auf Hochrisikospiele plant.“ Dies wiederum sorgte für scharfe Kritik seitens der Gewerkschaften. Der dbb berlin und die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Berlin warfen Spranger in einer gemeinsamen Pressemitteilung vor, die Interessen der Steuerzahler zugunsten der Profifußballindustrie zu opfern.
Die DPolG nahm die Entscheidung „mit großem Respekt“ entgegen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der DPolG, Heiko Teggatz, hält die Beteiligung an den Kosten für „richtig und notwendig, damit den Einsatzkräften dieses Geld auch wieder zugutekommen kann.“
Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert, dass die Gelder „tatsächlich für die Polizeihaushalte genutzt werden“. Laut Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der GdP, hat das Urteil weitreichende Bedeutung, da es alle kommerziellen Großveranstaltungen mit Konfliktpotenzial betreffe: „Die Entscheidung wird ein Präzedenzfall für ganz Deutschland sein und wird den Umgang mit der Finanzierung solcher Einsätze grundsätzlich beeinflussen.“
Bei den Fanvertretern kam das Urteil nicht gut an. Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ zeigte sich „fassungslos“ und befürchtet langfristig schweren Schaden für die staatliche Ordnung. Der erste Vorsitzende Jost Peter warnte: „Durch das heutige Urteil verkommt Polizeiarbeit zur simplen Dienstleistung.“ Bei Beibehaltung forderte Sprecher Thomas Kessen eine konsequente Ausweitung des Urteils auch auf andere Großveranstaltungen.






Zusammenarbeit verbessert
Nachdem erste Erfahrungen in den neuen Strukturen gesammelt und Abläufe harmonisiert wurden, waren erste Synergieeffekte, verkürzte
Informationswege und ein Ausgleich von Informationsdefiziten feststellbar. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde auf Antrag des LKA MV der Projektauftrag seitens des IM MV erweitert. In der Folge konnte auch der IT-Administration des Dezernats 12 – Technik und Logistik (Abteilung 1 – Verwaltung, Recht, Technische Dienste) in das DiSK einbezogen werden. Hiervon versprach man sich vor allem eine bessere und engere Zusammenarbeit mit dem IT-Grundsatz, vor allem was die Berücksichtigung und fachliche Bewertung einsatztaktischer Komponenten und Anforderungen an die IT-Infrastruktur des LKA MV angeht. Hierdurch ließen sich weitere Optimierungsansätze zum zielgerichteten Ressourceneinsatz sowie zur Verbesserung der Servicequalität gegenüber den Abteilungen des LKA MV als Bedarfsträger erkennen und können nunmehr für die Behörde ganzheitlich sichergestellt werden. Eine räumliche Zusammenführung des Personals in gemeinsam genutzte Räume, in Verbindung mit der erforderlichen IT-Infrastruktur, wurde innerhalb des Projekts vorgedacht, lässt sich gegenwärtig aber noch nicht umsetzen.
Nach Erstellung des Evaluationsberichts und weitergehender Ab-
stimmung mit dem IM MV zu den dort dokumentierten Erkenntnissen wurde das Projekt im Juni 2024 erfolgreich beendet und das Digitale Service- und Kompetenzzentrum als neue siebte Abteilung des LKA MV eingerichtet. Die neue Abteilung 7 verfügt über folgende Dezernate: Dezernat 71 – Fachkoordination kriminalpolizeiliche Datenverarbeitung (KDV), Dezernat 72 – Kriminalpolizeiliche IT- und Spezialtechnik (KrITuS), Dezernat 73 – Zentralstelle Kommunikationsüberwachung (ZKÜ), Dezernat 74 – Cybercrime (CC), Dezernat 75 - Digitale Forensik (DF).
Das DiSK als Taktgeber
Der Referatsleiter II440 – Kriminalitätsbekämpfung, Internationale polizeiliche Zusammenarbeit, polizeiliche und gesamtgesellschaftliche Prävention, LKD Heiko Tesch führt aus: „Das Digitale Service- und Kompetenzzentrum (DiSK) bildet das Top-Level der IT-Leistungsperformance in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ab. Durch die Bündelung der verschiedenen ITGrundsatz- und Fachbereiche entstehen viele positive Synergieeffekte, welche sich bereits jetzt sowohl nach innen als auch außen widerspiegeln. Mit dem Selbstverständnis eines Dienst- und Service-Leisters
für die gesamte Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern wird das DiSK auch zum Takt- und Impulsgeber im Bereich digitaler Ermittlungen, forensischer Auswertungen und nicht zuletzt Zukunftstechnologien. Die Einrichtung des Digitalen Service- und Kompetenzzentrums (DiSK) im Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern ist daher ein weiterer Meilenstein für eine moderne, effiziente, nachhaltige und leistungsfähige Kriminalitätsbekämpfung“ „Die Internetkriminalität gewinnt in der kriminalpolizeilichen Arbeit zunehmend an Bedeutung. Digitale Spuren als Beweismittel zu sichern sowie die Herausforderungen der Digitalisierung im Allgemeinen erfordern eine zukunftsfähige Bündelung aller verfügbaren Ressourcen“, erklärt Innenminister Christian Pegel diesen Schritt und: „Daher müssen wir neben der Optimierung von Ermittlungsansätzen und -methoden nach einer mehrjährigen Projektphase auch die Organisation der auf diesem Gebiet leistungsfähigen Spezialbereiche innerhalb der Polizei anpassen.“

Polizeidirektor Jörg Bruhn ist seit 1992 Angehöriger der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern und leitete von Oktober 2013 bis Juli 2021 das Cybercrime-Dezernat im LKA MV. Seit März 2021 Projekt- und Abteilungsleiter DiSK Foto: BS7LKA MV
Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages notiert in einer Ausarbeitung über Biowaffen im Jahr 2002, dass schon „im Mittelalter […] Brunnen mit Leichen vergiftet oder Städte durch pestinfizierte Tierkadaver oder Pestopfer verseucht“ wurden.
„Operation Alberich“, bei der Räumung besetzter Teile Nordostfrankreichs durch deutsche Truppen; der russisch-finnische Winterkrieg 1939–1940: die Vergiftung von Brunnen durch Tierkadaver und Kot; Burkina Faso, 2022: die Sabotage von Wasseranlagen und die gezielte Verunreinigung von Wasserstellen; das kanadische Wasserreservoir in Rafah im südlichen Gazastreifen, im Juli 2024 gezielt von den Israelis zerstört.
Ein Beispiel eines Landwirts aus dem Raum Ravensburg aus dem November 2005 zeigt auch hier das Potenzial. Er hatte zwei geöffnete Kanister Pflanzenschutzmittel an der Wasserentnahmestelle im westlichen Bodensee bei Sipplingen versenkt – sein Motiv: „Rache an der Justiz“.
Kunden als Sicherheitsmechanismus
Die mehrstufigen Sicherheitsmechanismen, die von den Wasserversorgungsunternehmen von Flensburg bis Garmisch und von Aachen bis Cottbus eingesetzt werden, sind sicherlich eine geeignete Maßnahme, um dieses Risiko einzuschränken. Wie sehen sie aber im Detail aus?
In der Regel findet die Kontrolle der Trinkwasserqualität nach Einbringung ins Versorgungsnetz in einem meist mehrwöchigen Zyklus statt: An designierten Probeentnahmestellen (bspw. in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Behörden) wird in regelmäßigen Abständen eine Probe gezogen und dem angeschlossenen Labor für eine umfassende Analyse zugestellt. Darüber hinaus setzen Wasserversorger auf ihre aufmerksame, kritische Kundschaft: Sollte das gelieferte Trinkwasser Veränderungen in Farbe, Geruch und bzw.oder Geschmack aufweisen, so melden sich die Verbraucher im Regelfall sehr schnell bei ihrem Wasserversorgungsunternehmen. Hier liegt genau letztlich die Schwachstelle im System, denn wenn es einer (wie auch immer gearteten)
KI ist überall – dieses Mal aber als gewichtiges Marketingargument für angebotene Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen, wie die 26. Intersec in dem Wüstenstaat zeigt. In der „Policing Area“ dominierten Lösungen für elektronische Überwachung und Kontrollen aller Art – für den öffentlicher Raum, in Gebäuden, für Flughäfen, mit Sensoren im Gelände. KI wird nicht nur für Gesichtserkennung implementiert, sondern sorgt auch für die Echtzeit-Analyse der anfallenden Daten. Hinter der auffallenden Betonung von „Surveillance“-Technik steht unter anderem die mit Europa nicht vergleichbare Gesetzeslage in den VAE, die Überwachung im öffentlich zugänglichen Raum nicht nur erlaubt, sondern Unternehmen sogar dazu verpflichtet. Im weitaus größten Ausstellungsbereich präsentierten Feuerwehrund Katastrophenschutzbereich eine Leistungsschau, die vom futuristischen Feuerwehrwagen und Miniaturhubschraubern über KI-gesteuerte Drohnen und Löschgeräte bis hin zu elektronischen EinsatzAccessoires reichte. Mittendrin: der deutsche Pavillon unter dem Logo des Bundesministeriums für Wirt-
Trinkwasserversorgung als Kritische Infrastruktur
(BS/Prof. Frank Reininghaus) In seinem Werk aus dem Jahr 430 v. Chr. berichtete der Grieche Thukydides über den Peloponnesischen Krieg, dass „die Peloponnesier“ verdächtigt worden waren, „Gift in die Zisternen“ geworfen zu haben. Dass es auch heute zu einem Anschlag auf die Trinkwasserversorgung in Deutschland kommen kann, ist nicht ausgeschlossen. Diese Option eines terroristischen (oder auch anderweitig motivierten) Angriffs nicht muss mitgedacht werden

Gruppierung gelingen würde, nach Ausgang aus dem Wasserwerk ein farb-, geschmack- und geruchloses Gift in ausreichender Menge in das Wasserversorgungssystem einzubringen, so könnten die Gemeinde, der Stadtteil, die Region dadurch beeinträchtigt werden, ohne dass dies zeitnah dem Wasserversorger und den Kunden zur Kenntnis gelangen würde.
Mit genug Wissen ist Sabotage möglich
Konkret ist die Sicherheit der Zugänge zu den Wassernetzen sowie die Lagerungsstätten des aufbereiteten Trinkwassers ein Problem. Physische Sicherheit der Trinkwasserbrunnen und der Trinkwasserhochbehälter wird in Deutschland in vielen Fällen durch eine geeignete Palette von Maßnahmen generiert. Hierzu gehören bspw. einfache Zäune, vergitterte Fenster, Zugangskontrollen in Form von Codekarten
oder Schließsystemen, Videoüberwachung, Bewegungsmeldern v. a. Diese Maßnahmen reichen generell aus, da in jedem System genügend Redundanzen in Form weiterer Lagerstätten vorhanden sind. Jedoch wäre mit nur wenigen wasserbau- und -versorgungstechnischen Grundkenntnissen eine Manipulation oder Sabotage durchaus realisierbar; dies könnte eine Unterbrechung oder physische Zerstörung der Anlagen ebenso beinhalten wie die gezielte Einbringung einer kontaminierenden Substanz. Die Folge des Ersteren wäre ein Versorgungsengpass (der jedoch sofort von der Bevölkerung bemerkt werden würde), Zweiteres würde – je nach Substanz – möglicherweise zu einer unbemerkten und schleichenden Kontamination der Verbraucher im betroffenen Gebiet führen.
In den vergangenen Jahren wurden die technischen Möglichkeiten zur permanenten Überwachung
der Wasserqualität breitflächig erforscht und teils zur Serienreife entwickelt. So basiert eines der Systeme, auf dem Vorkoster-Prinzip: Biologische Kleinstlebewesen, die in einem Bypass der Trinkwasserleitung ausgesetzt werden, werden per Kamera überwacht, um signifikante Veränderungen ihrer Fluoreszenz bei toxischer Schädigung zu beobachten.
Tierische Hilfe in Berlin Seit Sommer 2018 kommt ein ähnliches System bei den Berliner Wasserwerken zum Einsatz: Hier werden Bachflohkrebse als „natürliches Frühwarnsystem“ eingesetzt. Die Krebse werden zu einer Kohorte von je acht Krebsen in einem Kammersystem in einen Wasser-Bypass eingesetzt und reagieren, sobald das Wasser in irgendeiner Weise verschmutzt ist. Diese Tiere reagieren bspw. auf Kupfer und Blei, aber auch auf andere Schad- und
Leistungsschau in Dubai
(BS/Dr. Barbara Held) Der Hype ist real. Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt mittlerweile auch die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr. Die Anwendungsmöglichkeiten sind unzählig. Ebenso die Chancen. Ein Blick über den Tellerrand nach Dubai.

Schwebstoffe. Über die installierte Sensorik werden die Veränderungen des Verhaltens der Krebstiere an die Zentrale gemeldet, in der dann die Quelle der Verunreinigung ermittelt und entsprechend vom Netz getrennt wird.
Weitere Systeme für ständige Wasserkontrollen sind bspw. im Wasserwerk in Berlin-Friedrichshagen installiert, wo ein Dutzend Moderlieschen (silberfarbene, bis zu zehn Zentimeter lange Fische) in einem Aquarium leben, oder Coca-Cola in Knetzgau, wo mit Fischen die Qualität des gereinigten Abwassers getestet wird. Es ist das einzige Werk des Getränkeherstellers in Deutschland, das eine eigene Kläranlage betreibt.
Reicht alles aus?
Obwohl es in der Vergangenheit nur sehr wenige Versuche gegeben hat, über die Kontamination des Trinkwassers einen terroristischen Akt oder Sabotageakte durchzuführen, bedeutet dies nicht, dass diese Bedrohung gänzlich negiert werden kann. Kommunen und Wassserversorgungswerke sollten dringend, die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsmechanismen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Bei einem malevolenten Eingriff im Bereich des Rohwassers wird möglicherweise im Bereich der Gewinnung, spätestens jedoch im Wasserwerk selbst die Kontamination festgestellt und es können entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Für einen malevolenten Eingriff nach Austritt aus der Produktionsstätte (dem Wasserwerk), wenn sich das vermeintlich unbelastete Trinkwasser im Verteilungsnetz befindet, lassen sich verschiedene Szenarien kreieren, bei denen dieser Eingriff zum Erfolg führen könnte; dies gilt insbesondere für nur einfach gesicherte, oberirdische Lagerstätten, Pumpstationen etc.

Prof. Frank Reininghaus ist Non-Resident Research Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik sowie Fregattenkapitän d.R. Foto: BS/privat
türlich KI. Dr. Ehab Khalifa, Leiter der Monitoring Technological Developments Unit der VAE, zeigt sich überzeugt: „Grenzen für KI setzt nur die menschliche Vorstellungskraft!“
schaft und Klimaschutz (BMWK). Insgesamt 62 meist mittelständische Firmen unterstützt das Ministerium bei ihrem Auftritt im World Trade Center. Auf diese Weise können dann auch deutsche Besucher lernen, dass deutsche Firmen in der Sicherheitsund Rettungstechnik an der Weltspitze mitspielen. U. a. produzieren sie die besten Brandmeldeanlagen, erzählt Tim Dünnemann vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), der gegenüber dem BMWK als Branchenvertreter die Ausstellerfirmen koordiniert. Als innovatives Beispiel nennt er eine Aufnahmetechnik, mit der Kameras entstehende Brände anhand von Luftströmungen erkennen können, bevor diese für das Auge sichtbar werden. Hochmoderne Brandschutztechnik aus Deutschland wurde deshalb auch in die wiedererstandene Kathedrale von Notre Dame eingebaut. Darin steckt na-
AI Act als Vorbild für Standards Vertreterinnen und Vertreter aus Sicherheitsbehörden, Firmen und Forschung waren sich einig in ihrer Forderung nach einer möglichst internationalen Regulierung von KI, einschließlich der Zertifizierung von Herstellerfirmen. Damit wolle man auch einem künftigen KISchwarzmarkt vorbeugen. Dr. Hatem Aly vom United Nations Office on Drugs and Crime verwies auf die “United Nations Convention against Cybercrime”, die im vergangenen Dezember von der UN-Versammlung verabschiedet wurde und sich im weltweiten Ratifizierungsprozess befindet.
„Wir müssen ethische Standards und regulatorische Rahmen für KI entwickeln“, forderte Carlo Loveri, Leiter des Business Continuity Managements für den Flughafen Abu Dhabi und lobte ausdrücklich den EU Artificial Intelligence Act (EU AI Act) als brauchbaren Ansatz. Aber: „Wir brauchen weltweite Standards“.
Einem War of Attrition könnten wir nicht standhalten, schärfen die Verteidigungspolitischen Richtlinien ein. Die Landes- und Bündnisverteidigung müsse „mit einem nur einmal vorhandenen Kräftedispositiv die gesamte Bandbreite der Aufträge und Aufgaben abdecken“. Wie aber kann es gelingen, von „Masse“ getragene Angriffe abzuwehren? Digitale Einsatzunterstützung durch Luft- und Landdrohnen und durch unbemannte Boden- und Luftsysteme (UGS/UAS) lässt sich quantitativ skalieren und macht Verteidigung auf diese Weise möglich. Vom Zug bis zur Brigade wird der Einsatz von Drohnen zur neuen Normalität. Auch im Zeitalter der Digitalisierung bedeutet Abschreckung, sich durch defensive und offensive Operationen vor allem auf dem Gebiet eines Aggressors verteidigen zu können. Gemäß dem Paradigma der Software Defined Defence (SDD) werden unbemannte Systeme zur Enabling Hardware, die gerade auch dort vernetzt und synchron, reaktionsschnell und präzise operiert. Nur so ist das Bündnis nicht nur „bereit und willens, jeden Zentimeter des verbündeten Territoriums zu verteidigen“, sondern technisch auch dazu in der Lage.
Rüstungsprozesse hinterfragen
Wie sehr sich, angesichts der Bedrohung, auch Rüstungsprozesse dem raschen Taktschlag der Digitalisierung anpassen müssen, beschrieb Generalleutnant Andreas Marlow, Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres, auf dem Technologieforum des Fraunhofer FKIE: „Wir müssen weg von einer plattformzentrierten Rüstung hin zu einer Rüstung, welche die Vernetzung der Systeme in der Dimension Land ganzheitlich betrachtet.“ Schon im Oktober wies er gemeinsam mit dem Amt für
EinWohnungseinbruch irgendwo in Berlin. Die Bewohnerin Frau Wachsam stellt entsetzt nach ihrem Einkauf Beschädigungen an ihrer Wohnungseingangstür fest, sie merkt schnell, die Wohnung ist komplett durchwühlt. Sie ruft sofort die 110. Kurz darauf treffen die alarmierten Einsatzkräfte ein und bestätigen den Verdacht eines vollendeten Einbruchs. Die Dienstkräfte beginnen mit ihrer Arbeit. Während ein Polizist erste Ermittlungen im Wohnhaus durchführt, zückt die Kollegin ihr dienstliches Smartphone und startet die INSITUApp. Stift und Notizblock bleiben in ihrer Schutzweste.
Die Kollegin erfasst die ersten Informationen zum Wohnungseinbruch und übergibt per QR-Code den Vorgang mit den Grunddaten wie Adresse, Tatzeit und Personalien an den gerade eingetroffenen Kriminaldauerdienst. Dieser übernimmt den Vorgang des Wohnungseinbruchs nahtlos, beginnt mit der Spurensicherung und dokumentiert die Wohnung vollumfänglich. Spuren und Asservate sowie die zugehörigen Informationen wie Fotos, Skizzen, Videos und Sprachaufzeichnungen stehen immer in einer Beziehung zueinander und werden miteinander verknüpft – die Dokumentation ist mit INSITU lückenlos nachvollziehbar. Fertig mit der Arbeit vor Ort, werden die erfassten Daten vom Wohnungseinbruch per Knopfdruck an das polizeiliche Informations- und Vorgangsbearbeitungssystem übermittelt.
Zurück auf der Dienststelle sind die Daten für die weitere Sachbearbeitung verfügbar. Die Übertragung der handschriftlichen Notizen entfällt, die Doppelerfassung ist passé – für die Dienstkräfte ein enormer Mehrwert.
Zyklische Integration und vernetztes Operieren
(BS/Prof. Dr. Wolfgang Koch) Wie sehr Drohnen militärische Realitäten dominieren, zeigt der Krieg in der Ukraine. Zwingend braucht das Heer Drohnen und Drohnenabwehr, um Aggressoren abzuschrecken und rasch „kriegstüchtig“ zu werden. Die Experimentalserie Land zeigte den Beitrag von Forschung und Innovation.
Heeresentwicklung gangbare Wege zu einer schnelleren Beschaffung digitalisierter Technologien für landbasierte Operationen. Ein vom Heer entwickeltes taktisches Szenar mit fünf Einzelvignetten, die Sensor-Effektor-Prozesse abbilden, war die Basis der zweiten Experimentalserie Land (ExpS La). Sie bot im Oktober 2024 einen Rahmen für vernetzte Integration von Hardware- und Software-Updates. So konnten Industrie und Forschung gemeinsam mit Soldatinnen und Soldaten im Gefechtsübungszentrum Heer Marktverfügbares sowie neueste Prototypen und Systeme unter realistischen und einsatznahen Bedingungen testen, weiteren Forschungs- und Innovationsbedarf identifizieren und den tatsächlichen Bedarf des Heeres unmittelbar kennenlernen.
„Die Grundlage für die Weiterentwicklung der Waffensysteme ist das Feedback unserer Soldatinnen und Soldaten, aber auch der militärischen Führer, die auf unterschiedlichen Ebenen diese Systeme im Gefecht führen“, unterstrich Marlow. „Sie wissen am besten, was erforderlich ist, was funktioniert und was nicht.“ Die Nutzung unbemannter Systeme und Künstlicher Intelligenz (KI) würde integraler Bestandteil der Landes- und Bündnisverteidigung. Die Teilnahme an der Experimentalserie Land war daher für die wehrtechnische Forschung und Innovation besonders wichtig. Im Hinblick auf „Kriegstüchtigkeit“
bewertete die ExpS La 2024 vorhandenes Material, materielle Zuläufe, vor allem aber auch Forschungsvorhaben und Innovationen szenariobasiert und qualifiziert durch taktisch-operationelle Tests im Systemverbund. Damit ist die Basis für zielgerichtetes Nachsteuern gelegt. Erfahrene Soldatinnen und Soldaten schätzten den militärischen Nutzen im digitalen Systemverbund ein. Durch Vernetzung aller Sensoren und Effektoren optimiert er den Führungsprozess. Dieser Ansatz hat seine Praxistauglichkeit bewiesen. Beim „Ausprobieren“ neuer Technik lernte die Forschung den Einsatzbedarf des Heeres in realitätsnaher Umgebung, aber auch die Sorgen und Nöte der Soldatinnen und Soldaten kennen. Gemeinsam mit den Herstellern gelang Trouble Fixing durch „Operation am offenen Herzen“ der Systeme und die unmittelbare Umsetzung von Ideen. Es zeigte sich aber auch, was in Laborumgebungen, nicht aber unter realen Bedingungen funktioniert. Am meisten daraus gelernt hat die Forschung. Sie sieht aber Wege zur Maturierung, die in der nächsten ExpS La getestet werden. Vor allem wurden neue Forschungsfragen identifiziert, die so nur die Realität stellen kann. Sie konnten bereits mit Soldaten und Soldatinnen, aber auch mit Herstellern noch vor Ort diskutiert werden. Aber auch die Einsatzkräfte lernten den taktischen Wert von Hochtechnologie
und erlebten ihren lebensrettenden Nutzen. Offiziere erfuhren, wie sie für das digitale Gefechtsfeld ausbilden müssen.Das komplexe Rahmenszenar mit anspruchsvollen Vignetten stellte aber auch das Heer vor Herausforderungen, aus denen es für die nächste Experimentalserie Lehren zieht. Die Beiträge des Fraunhofer FKIE orientierten sich an der Idee einer „Sensorglocke“, die durch vernetzte Sensorik und Datenfusion das Lagebild erweitert. Zu erfassen war eine Vielzahl unterschiedlicher Drohnentypen als Baustein für Plattformschutz im bodennahen Raum. Eingebracht wurden EO/IR-Sensorik, RF-Breitbandscanner, innovative Funkpeiler sowie ein Akustikmodul, das bereits einen hohen Reifegrad besitzt. Die Fähigkeit zur Drohnendetektion, -peilung und -klassifikation, aber auch zur Lokalisierung des Steuerungspersonals konnte erfolgreich unter Beweis gestellt werden. Die wissenschaftliche Nachauswertung und Dokumentation steht aufgrund der Datenfülle noch aus. Wertvolle Erfahrungen für die Experimentalserie 2025 wurden gewonnen. Besonders fruchtbar war es für die Forschung, aber auch für die interne Wahrnehmung des Heeres, die Bedeutung der Elektronischen Kampfführung (EloKa) unmittelbar zu erleben. Mit den Fachoffizieren und Firmenvertretern ergaben sich Gespräche mit höchstem Erkenntnisgewinn, vor allem durch Lehren
Wie eine App die Polizei entlastet
(BS/Juliane Joswig) Mit INSITU („in situ“, lateinisch für: in originaler Lage, am Ursprungsort) beginnt für Polizistinnen und Polizisten, die am Einsatzort arbeiten, ein neues Zeitalter: INSITU ist eine App, die eine vollständige Spur- und Sacherfassung am Tatort bzw. Einsatzort ermöglicht. Ziel ist es, jederzeit Antworten auf die zentralen Fragen zu haben: „Was wurde wann, wo, wie, von wem und warum gesichert?“

Mithilfe der INSITU-App können Polizeikräfte die Beweissicherung direkt vor Ort elektronisch erfassen und die erfassten Daten in Echtzeit miteinander verknüpfen.
INSITU geht auf ein Forschungsprojekt des BKA, der TU Darmstadt und weiterer Polizeiorganisationen zurück. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte das Projekt von Juli 2018 bis Juni 2021 mit knapp einer Million Euro.
Von der Forschung in die Praxis Das Ergebnis: Ein Demonstrator mit verschiedenen Funktionalitäten, die Grundlage der INSITU-App und ein Bedarf bei allen deutschen Polizeien kristallisierten sich heraus.
INSITU ist heute ein „Joint Venture“ der Polizei Berlin und des BKA unter der Gesamtleitung von Dr. Steffen Franz und Teil des Programms Polizei 20/20. Das Programm hat das Ziel, die IT-Landschaft der deut-
Foto: BS/Joachim Edler, Polizei Berlin
schen Polizei zu harmonisieren –weg von Eigenentwicklungen hin zu einheitlichen Lösungen. Ob Funkwagen, Kriminaldauerdienst oder sichernde Kriminaltechnik – vor allem Dienstkräfte im „Ersten Angriff“ profitieren von INSITU. Gerade die vielen Vorgänge kleiner und mittlerer Kriminalität und einer wenig komplexen Spurenlage führen zu einem hohen Arbeitsaufwand.
Um die Dokumentation dieser Vorgänge zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, ist INSITU das geeignete Arbeitswerkzeug. Automatisierte Prozesse wie die Erstellung von Asservatenlisten, Lichtbildmappen, Datenzusammenführung und -sortierung sowie die automatisierte Übertragung von Mediendaten in die
aus dem Krieg in der Ukraine. Dort zeigt sich, dass eingesetzte Systeme kontinuierliche Software-Updates benötigen, um nicht ihre Wirksamkeit zu verlieren: SDD ist keine Option, sondern ein Muss. Aufschlussreich ist der Vergleich von Wettbewerben wie dem European Land-Robot Trial (ELROB), der auf eher langfristige Perspektiven zielt, und der ExpS La, in deren Fokus die zyklische Integration und das vernetzte Operieren in taktischen Szenaren stehen, um bereits jetzt kurzfristige Einsatzausbildungsaspekte und notwendige Anpassungen zu identifizieren. Beide Ansätze sind komplementär und sollten voneinander lernen. Zum Abschluss der ExpS La 2024 lud Generalmajor Klaus Frauenhoff, Chef des Amtes für Heeresentwicklung, zu einem Distinguished Visitors Day ein, um die Lessons Learned mit anderen Teilstreitkräften, vor allem aber mit dem Beschaffungswesen der Bundeswehr zu diskutieren. Der Höhepunkt war eine live demonstrierte Verzögerungsoperation, die feindliche Kräfte im Verbund unterschiedlicher Luft- und Landdrohnen zum Stillstand brachte. Sie veranschaulichte, welche Fähigkeiten dem Heer zur Verfügung stehen werden, aber auch die Schwierigkeiten, die auf dem Weg zur Umsetzung in die Fläche überwunden werden müssen. Nach der Experimentalserie ist vor der Experimentalserie!

Prof. Dr. Wolfgang Koch ist Chief Scientist des Fraunhofer-Instituts für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE).
Foto: BS/privat
polizeilichen Systeme erleichtern die Arbeit der Dienstkräfte erheblich.
Gemeinsames Arbeiten auf einer Datengrundlage in Echtzeit Auch größere Einsätze, wie die Bearbeitung umfangreicher Lagen oder Durchsuchungen, stellen aufgrund der strukturierten und standardisierten Erfassung von Spuren und Asservaten mit INSITU kein Problem dar. Die Einsatzkräfte arbeiten zudem auf einer gemeinsamen Datengrundlage. Dank der Echtzeitsynchronisierung können sie gemeinsam an einem Einsatzort oder auch mehreren Einsatzorten zusammenarbeiten und große Spurenlagen erfassen. Das führt zu einer besseren Abstimmung und Zusammenarbeit vor Ort. Auch bei Lagen mit mehreren Polizeibehörden ist INSITU anwendbar – unabhängig davon, ob die Polizei iOS oder Android nutzt. INSITU ist in beiden Welten verfügbar.
Dienstkräfte wirkten aktiv an der App mit Die Herangehensweise von INSITU ist in der Polizei ein Novum. Wichtig war es von Beginn an, die Nutzenden in den Mittelpunkt zu stellen. Mehr als 250 Testpersonen aus allen 20 Polizeiorganisationen haben INSITU mitentwickelt – ganz nach dem Motto von den Dienstkräften für die Dienstkräfte.
Einsatzkräfte aus dem Funkwageneinsatzdienst, dem Kriminal
dauerdienst, der Mordkommission, den Einsatzhundertschaften und der sichernden Kriminaltechnik testeten INSITU in insgesamt zehn Iterationsschleifen auf Herz und Nieren. Fachliche Anforderungen, Verbesserungsvorschläge, Wünsche zur Handhabung und Fehler wurden in der Entwicklung berücksichtigt und umgesetzt.
INSITU geht auf die Straße INSITU hat den Sprung aus den Kinderschuhen geschafft und ist mittlerweile auf den Dienstgeräten der Polizei Berlin installiert. Die Rückmeldungen der Dienstkräfte sind positiv und sie freuen sich, endlich den Notizblock nicht mehr rausholen zu müssen.
Die Polizei Berlin beginnt mit der Pilotierung in ausgewählten Dienststellen. Bewährt sich die App, soll es zu einer flächendeckenden Einführung kommen.
Nach der Einführung in Berlin folgen weitere Polizeibehörden. Das BKA wird INSITU ab Herbst ausrollen, in weiteren Behörden laufen die Vorbereitungen.
Besonders in Zeiten einer angespannten und knappen Ressourcensituation kommt INSITU zu einem richtigen Zeitpunkt. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Standardisierung und Vereinheitlichung – Dienstkräfte werden entlastet, damit Bürgerinnen und Bürger mehr Polizei auf der Straße sehen.

Juliane Joswig ist Projektleiterin INSITU bei der Polizei Berlin.
Foto: BS/privat
Der Ausgang der Wahl beeinflusst auch die Zukunft der Verteidigungsplanung. Wie stehen die Parteien zur militärischen Unterstützung der Ukraine und wie wollen sie eine bedrohungsgerechte Austattung der Bundeswehr gewährleisten?
Partei

Wie kann das Know-how für verteidigungswichtige Schlüsseltechnologien in Deutschland gehalten bzw. auf- und ausgebaut werden?
„Die strategische Sicherheitsforschung ist von existenzieller Bedeutung für Deutschland. Deshalb wollen wir bereits vorhandene Expertise bündeln, Akteure miteinander vernetzen und gezielt fördern. Dafür werden wir ein Kompetenznetzwerk für strategische Sicherheitsforschung entwickeln und Einschränkungen für militärische Forschung aufheben. Sicherheits- und verteidigungsrelevante Forschungskooperationen mit Hochschulen sollen ermöglicht und gestärkt werden. Zivilklauseln müssen abgeschafft werden.“

„Die SPD wird eine Investitionsprämie, den Made in Germany-Bonus, statt bürokratischer Förderprogramme einführen. Die Förderprogramme dauern oft zu lange und schaffen für die Unternehmen jede Menge unnötige Bürokratie. Anstelle von neuen Förderprogrammen wird in Zukunft stärker auf eine unkomplizierte Steuerprämie gesetzt. Im Wachstumschancengesetz war bereits eine Investitionsprämie für den Bereich der Energieeffizienzmaßnahmen angelegt. Mit der neuen Investitionsprämie für bestehende Unternehmen und Neuansiedlungen sollen nun Zukunftsinvestitionen in die Technologien von morgen in der Breite angekurbelt werden: Jede Unternehmensinvestition in Maschinen und Geräte (aus den sogenannten Ausrüstungsinvestitionen) soll mit zehn Prozent der Anschaffungssumme direkt und unkompliziert über eine Steuererstattung gefördert werden. Die erfolgreichen Förderprogramme wie GRW oder GAK für die regionale Wirtschaft werden fortgeführt.“

„Wir Freie Demokraten wissen, dass wir uns auch in der Wissenschaft in einem neuen Systemwettbewerb befinden. Deshalb benötigen wir in Europa und Deutschland eine klare Strategie für Forschung und Innovation, die auf Technologieoffenheit basiert. Wir wollen eine europäische Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) nach amerikanischem Vorbild entwickeln, die sich auf den Technologietransfer zwischen Militär und Wissenschaft sowie auf die Förderung von Forschungsprojekten mit militärischen oder Dual-Use-Anwendungen konzentriert. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns gezeigt, dass wir unsere technologischen Stärken besser zum Schutz der Freiheit weltweit einsetzen müssen. Zudem fordern wir ein konsequentes DeRisking im Forschungsbereich nach kanadischem Vorbild.“

„Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode mit dem KRITIS-Dachgesetz, das konkrete Sicherheitsstandards formuliert, im Kabinett einen wichtigen Grundstein gelegt, um unsere kritischen Infrastrukturen zu schützen. Allerdings ist dies nur ein erster Schritt. Um unser Know-how für verteidigungswichtige Schlüsseltechnologien langfristig zu sichern, benötigen wir eine weitere Stärkung unserer Infrastruktur und zugleich eine resiliente Wirtschaft.“

„Dies wird nur durch ausreichende staatliche Nachfrage möglich sein. Ob bei einer Ausrichtung auf die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr noch alle militärischen Schlüsseltechnologien nachgefragt sein werden, wird sich dann erweisen.“

23. FEBRUAR 2025
Wie soll die militärische Unterstützung der Ukraine in der nächsten Legislaturperiode gestaltet sein?
„Die Ukraine verteidigt auch uns, denn fällt die Ukraine, droht ein russischer Angriff auf weitere europäische Länder. Daher unterstützen wir die Ukraine mit allen erforderlichen diplomatischen, finanziellen und humanitären Mitteln sowie mit Waffenlieferungen. Sie muss ihr Selbstverteidigungsrecht ausüben können. Gemeinsam mit Frankreich, Polen und Großbritannien wollen wir in enger Abstimmung mit den USA eine gemeinsame Strategie entwickeln, um die Ukraine zu unterstützen. Dazu gehört auch die Frage nach glaubhaften Sicherheitsgarantien für die Ukraine und in diesem Zusammenhang die Frage der Rolle der NATO. Unser Ziel ist ein Friedensprozess, der von der Ukraine aus einer Position der Stärke und auf Augenhöhe geführt werden kann. Schließlich wollen wir der Ukraine eine EU-Perspektive aufzeigen. Ihr EU-Beitritt liegt im sicherheits- und geopolitischen Interesse Deutschlands und Europas. Vor einem Beitritt müssen jedoch alle Kriterien vollständig erfüllt sein.“
„Die SPD steht fest zur Ukraine. Wir bekennen uns zur Unterstützung der in ihrem Kampf gegen die russische Aggression – und das so lange wie erforderlich. Die bilaterale Sicherheitsvereinbarung Deutschlands mit der Ukraine wird von uns ausdrücklich unterstützt.
Die Ukraine muss in der Lage sein, mögliche Verhandlungen mit Russland auf Augenhöhe zu führen. Einen russischen Diktatfrieden auf Kosten der Ukraine lehnen wir entschieden ab. Verhandlungen dürfen nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg erfolgen. Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine müssen erhalten bleiben. Die SPD unterstützt die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte sowie die Lieferung von Waffen und Ausrüstung mit Besonnenheit und Maß.
Auch die zivile Unterstützung der Ukraine ist für uns von entscheidender Bedeutung. Denn die Fähigkeit der Ukraine, sich im russischen Angriffskrieg zu behaupten, hängt wesentlich von der Widerstandsfähigkeit ihrer Zivilbevölkerung ab. Friedensinitiativen, wie sie vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj angestoßen wurden, begrüßen wir.“
„Wir wollen die Ukraine in ihrem Freiheits- und Verteidigungskampf gegen Russland mit allen notwendigen Waffen und Munition ohne Verzögerungen und Reichweitenbeschränkung ausstatten. Echten Frieden in Europa wird es nur geben, wenn Putin keinen Erfolg hat. Die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, sich jederzeit gegen russische Angriffe verteidigen zu können. Insbesondere fordern wir die unverzügliche Lieferung und Nachbeschaffung des Marschflugkörpers Taurus. Die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte wollen wir in Deutschland fortsetzen. Wir setzen uns dafür ein, eine gerechte Finanzierung der Unterstützung der Ukraine innerhalb der NATO/ EU/G7-Staaten insbesondere auch durch die Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu erreichen. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Anspruch auf vollständige Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität. Gleichzeitig unterstützen wir die Aufnahme der Ukraine in die NATO und die zügige Fortführung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine.“
„Der russische Präsident Wladimir Putin versucht, territoriale Grenzen zu verschieben und es ist unsere Verantwortung, ihm klar zu machen, dass er nicht erfolgreich sein kann, wenn er versucht, sich dieses Territorium mit vielen Menschenleben zu erkaufen.
In Bezug auf die Ukraine müssen wir unsere Unterstützung für das Land fortsetzen und ausbauen. Dies umfasst die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung, die Ausbildung von ukrainischen Soldaten und die Unterstützung bei der Reform der ukrainischen Streitkräfte.
Unser Ziel ist es, die Souveränität und Integrität der Ukraine zu schützen und die russische Aggression zurückzudrängen. Wir sind bereit, unsere Verantwortung wahrzunehmen und unsere Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur zu stärken. Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern und Alliierten daran arbeiten, eine starke und effektive Verteidigung aufzubauen, um die Sicherheit und Stabilität in Europa zu gewährleisten.“
„Wir müssen raus aus der Kriegs- und Eskalationslogik und Vorschläge unterstützen, die den Weg zu einer friedlichen Lösung ebnen können. Wir fordern eine gemeinsame Initiative der Bundesregierung mit der EU, Brasilien, China und anderen Staaten, um Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen.“
Die Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten keine Antworten zu den gestellten Fragen bis zum Redaktionsschluss zur Verfügung stellen.
Hochpräzise Detektion kleiner und unauffälliger Objekte bis hin zur Ortung von Weltraumobjekten, ohne für andere Radargeräte sichtbar zu sein – so lautet das Zukunftsversprechen des Quantenradars. Die Gegenwart gestaltet sich allerdings anders. „Quantenradare sind eine recht junge und experimentelle Technologie“, machte Dr. Sigurd Huber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) deutlich. Aktuelle Quantenradar-Prototypen fänden sich zumeist in Forschungs- und Laboreinrichtungen. „Diese Systeme sind häufig groß und sperrig, da sie komplexe optische Systeme wie Lasergeneratoren, Kühlsysteme und photonische Detektoren beinhalten“. Auch die Leistungsfähigkeit fälle bisher bescheiden aus. Quantenvorteile gegenüber konventionellen Radaren seien gegenwärtig nur auf geringen Reichweiten zu erzielen. Außerdem blieben mit der zeitgenössischen Quantenradartechnologie konstruierte Radargeräte primitiv. Sie könnten nur die Präsenz oder eben Nicht-Präsenz eines Objektes anzeigen. Anders als konventionelle Radargeräte, die sich die physikalischen Eigenschaften der Radarstrahlung zur Detektion der Entfernung von Objekten zunutze machen, basieren Quantenradare auf der namensgebenden Quantenmechanik. Die technische Grundlage bildet dabei die sogenannte Quantenverschränkung. Die Gesetze der Quantenphysik ermöglichen es, dass mehrere Teilchen oder andere Quantensysteme trotz räumlicher Distanz miteinander verbunden sind. Diesen Umstand des verschränkten Quantenzustandes macht sich die Forschung beim Quantenradar zunutze. „Ein Photon wird am Ort des
Nicht hochentwickelte Jets, sondern Schwärme billiger, intelligenter Drohnen, die in Kombination mit Cyberoperationen, elektronischer Kriegsführung und Raumfahrttechnologien erfolgreich sind, beherrschen den Himmel. Die Zukunft sind Drohnen, die autonom agieren, Daten teilen und dezentrale Entscheidungen treffen. Dennoch ist es nicht einfach, Multi-Domain Operations (MDO) in die Realität zu überführen. MDO erfordern die nahtlose Integration aller Domänen und einen radikalen Wandel in Strategie und Operationsführung. Wenn jedoch die Grenzen zwischen den Disziplinen verschwimmen, ist eine präzise interdisziplinäre Strategie notwendig, die Technologie, menschliche Expertise und organisationale Aspekte berücksichtigt. Lange Zeit standen Land-, Luft- und Seestreitkräfte im Zentrum militärischer Auseinandersetzungen. Doch der Gefechtsraum ist unübersichtlicher geworden. Neue Domänen sind nicht mehr bloße Ergänzungen, sondern Ausdruck nationaler Souveränität. Gleichzeitig geraten bestehende Sicherheitsarchitekturen unter Druck. Dies führt zu einem Umdenken: Militärische Überlegenheit lässt sich nicht mehr durch isolierte High-Tech-Systeme erreichen. Entscheidend ist die Fähigkeit, alle Technologien vernetzt, interoperabel und domänenübergreifend zu nutzen. Dabei zeichnen sich mehrere Herausforderungen ab: Die fehlende Verzahnung ziviler und militärischer Fähigkeiten, die zunehmende Bedeutung der Informationsdominanz, die Anpassung militärischer Ausbildung an technologische Entwicklungen und die Notwendigkeit, Command & Control-Strukturen zu modernisieren. Während SoftwareDefined Defense (SDD) eine flexible,
Wie Quantentechnologie die Detektion revolutionieren könnte
(BS/jb) Die Konzeption des Quantenradars hat großes Potenzial. Noch befindet sich die Technologie aber in der Konzeptund Laborphase. Der Einsatz erster leistungsfähiger Systeme ist nicht abzusehen. Quantentechnologie könnte aber noch auf anderen Wegen die Leistung der Radar-Überwachung signifikant steigern.

Das konventionelle Radar bleibt bedeutend. Foto: BS/Jane Schmidt, Bundeswehr
Radars behalten und das zweite Photon wird in die Umgebung ausgesendet“, erläuterte Huber. Die kombinierte Radardetektion dieser Photonenpaare erlaubt eine verbesserte Erkennung von Objekten. Das praktisch umzusetzen, gestaltet sich allerdings schwierig. Zu den Bedingungen, unter denen Quantenradare einen Vorteil liefern, gehöre eine sehr niedrige Signalstärke, machte Huber deutlich. „Dies führt zu beschränkter Reichweite“. Darüber hinaus sei die Erzeugung und Detektion von quantenmechanisch korrelierten Radarsignalen nur bei Temperaturen im Milli-Kelvin-Bereich möglich. „Außerdem ist die Quantenverschränkung gegen-
über Rauschen und Umwelteinflüssen hoch sensibel“, so Huber Um ein Signal zu detektieren, bedürfe es daher hochempfindlicher Quantendetektoren mit äußerst niedriger Dunkelzählrate, hoher zeitlicher Auflösung und Effizienz. Gegenwärtige Verfahren zur Detektion seien empfindlich und schwer in größerem Maßstab einzusetzen. Zusätzlich erschwert die Tatsache, dass das gespeicherte Photon zu dem Zeitpunkt den Detektor erreichen muss, in dem das entsendete Photon an dem Objekt gestreut wird und zum Detektor zurückkehrt, die Entwicklung. Das macht nicht nur optische Speicher für das verbliebene Photon notwendig. „Im Grunde impliziert es, dass die Entfernung zum Ziel bereits a priori bekannt sein muss“, stellte Huber fest. Wenn es allerdings gelänge Quantenradare für den Einsatz auf große Distanzen zu konstruieren, eröffne sich ein ganzes Spektrum an Anwendungen.
Kein Thema für den roten Teppich Trotz dieser Aussichten sind die Forschungsbemühungen zum Quantenradar noch zurückhaltend. Während Arbeiten zum Quantencomputer von riesigen Investitionssummen profitierten, sei das Interesse am Quantenradar deutlich begrenzter, erläuterte Dr. Oliver Gabel, Fraunhofer-Institut (INT). Große IT-Unternehmen trieben die
Forschung voran, weil die Anwendung der Technologie in zahlreichen Gebieten große Gewinne verspreche. Das Quantenradar könne auf dieser Welle nicht mitreiten. Das Anwendungsspektrum beschränke sich überwiegend auf militärische Überwachung und Verteidigung. Darüber hinaus ginge mit dem militärischen Fokus eine Tendenz zur Geheimhaltung einher, welche die Forschung weiter verlangsame, führte Huber aus. Trotzdem gab es in der Vergangenheit eine Reihe von Forschungsprojekten in Deutschland, die sich mit der Thematik befassten. So zum Beispiel das europäische Projekt Quantum Technology for Defence with Application to Optronics (QUANDO) oder das QuantenradarTeam (QUARATE). Das DLR beteiligte sich an beiden Projekten. Die finanziellen Mittel wurden durch die European Defence Agency (EDA) im Fall von QUANDO und für QUARATE zu 77 Prozent durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereitgestellt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich nicht absehen, wann Quantenradare militärisch zum Einsatz kommen. Quantentechnologie als solche kann allerdings in anderer Form auch auf der mittleren Zeitachse zur Leistungsfähigkeit von Radarsystemen beitragen. Mit dem Projekt QUA-SAR möchte das DLR diese Möglichkeiten ausloten. Dabei
Im Spannungsfeld von Technologie, Menschen und Organisation (BS/Kraus*,Wißmann*,Glauner*) Konflikte werden nicht mehr nur auf dem Boden, in der Luft oder auf dem Meer entschieden. Krieg ist nicht länger, was Clausewitz kannte, und auch nicht das, was wir in den Militärdoktrinen des 20. Jahrhunderts verstanden haben. Multi-Domain Operations (MDO) sind der neue Imperativ.
skalierbare Architektur verspricht, bleibt offen, wie sich Streitkräfte gegen fortgeschrittene Cyber-Angriffe und elektronische Kriegsführung absichern können. Es muss daher eine Balance gefunden werden zwischen dem Vertrauen in automatisierte Systeme und der Notwendigkeit, menschliche Urteilskraft zu fördern. Traditionelle Hierarchien und siloartige Strukturen sind für den notwendigen Austausch und die schnelle Entscheidungsfindung hinderlich. Nicht nur strukturelle Anpassungen, sondern auch ein Mentalitätswandel sind gefragt.
MDO ist in aller Munde Was steckt hinter dem Begriff? Ein Blick in Publikationen zum Thema gibt Aufschluss. Major Ralph Dekker, Frank Gubbels sowie Dr. Alex Kalloniatis vom DSTG Australia verfassten im Rahmen des 29. International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS) 2024 ein Papier zu Multi-Domain Operations aus NATO-Sicht. Sie analysierten die Integration verschiedener Wirkungsdimensionen und die Rolle externer Stakeholder. Ihre Erkenntnis: Moderne militärische Operationen können nicht isoliert betrachtet werden. Physische, virtuelle und kognitive Effekte müssen in einem kohärenten Gesamtansatz orchestriert werden. Besonders bemerkenswert ist die Erkenntnis, dass der digitale Raum nicht nur als eigenständiges Operationsgebiet existiert, sondern als verbindendes Element zwischen
den traditionellen Domänen fungiert. Cyber-Operationen haben die Fähigkeit, sowohl physische als auch kognitive Wirkungen zu erzeugen. Die kognitive Dimension erhält eine zentrale Bedeutung. Bemerkenswert ist auch ihre Sicht auf externe Stakeholder: Industrie und Forschung werden nicht mehr nur als Unterstützer betrachtet, sondern als integrale Bestandteile. Dieser Ansatz reflektiert einen Paradigmenwechsel weg von einer rein militärischen Betrachtung hin zu einem systemischen Verständnis moderner Konfliktführung. Ein anderer Blick stammt aus Indien: Brigadier Rajeev Ohri, vom Centre for Joint Warfare Studies, sieht Informationsdominanz als zentralen Faktor für MDO. Seiner Ansicht nach ist die Informationsdomäne das verbindende Element aller anderen Domänen. Daraus ergeben sich mehrere Konsequenzen: Erstens fordert Ohri eine nationale Informationsstrategie mit einer „National Information Umbrella Organization“ als Schnittstelle zwischen militärischen und zivilen Fähigkeiten. Zweitens verschiebt sich das Verständnis von Souveränität, bei der nicht nur territoriale Kontrolle, sondern auch Informations- und elektromagnetische Souveränität entscheidend sind. Drittens betont er die zentrale Bedeutung des elektromagnetischen Spektrums, da Kommunikation zunehmend auf drahtlose Infrastrukturen umgestellt wird. Schließlich fordert er eine Civil-Military Fusion (CMF). Ohri hebt hervor, dass Indien
nimmt das Projekt unter anderem den effizienten Einsatz von Radarsystemressourcen in den Blick. Konkret geht es um Szenarien, in denen mehrere Radarsensoren zusammenwirken. Aus mathematischer Perspektive handelt es sich dabei um ein Optimierungsproblem in mehreren Variablen. Daraus erwächst ein Problem. Auf der einen Seite muss die Verteilung innerhalb des dynamischen Gefechtsumfeldes in Echtzeit stattfinden. Auf der anderen Seite können konventionelle digitale Computersysteme die Verteilungsaufgabe nur mit zeitlichem Verzug erfüllen. Quantencomputing soll Abhilfe schaffen. Dank der quantenmechanischen Prinzipien der Überlagerung und der Verschränkung sei es derartigen Systemen möglich, den gesamten Lösungsraum für die Optimierung eines Sensornetzwerks in einem Überlagerungszustand darzustellen, erläuterte Huber. QUA-SAR deckt dabei den softwarebezogenen Anteil ab. „Es geht hier also vorrangig um die Entwicklung von Quantenalgorithmen und Quantenberechnungskonzepten“. Anwendung könnte diese Technologie zum Beispiel in einem Multi-Sensorsystem finden. In diesem sind sowohl luftgestützte- als auch bodenbasierte Radare integriert. In einem solchen Szenario könnten alle Daten über störsichere Kommunikationskanäle bei einem Quantencomputer zusammenlaufen. Dessen Algorithmen stellten das bestmögliche Zusammenwirken der Einzelsysteme sicher. Ganz neue Möglichkeiten eröffneten sich wiederum, wenn die Entwicklung den Einsatz von Quantencomputern bei Raumtemperatur ermöglicht. Dann könnten Berechnungen z. B. direkt auf einem Flugzeug erfolgen.
durch die Verbindung seiner starken IT-Industrie mit militärischer Expertise eine einzigartige Chance hat, in der neuen Ära von MDO eine führende Rolle zu übernehmen. Gleichzeitig warnt er vor einer zu starken Technologiefixierung und plädiert für pragmatische, indigene Lösungen. Im Verständnis von MDO lohnt sich nicht nur ein Blick über den geographischen Tellerrand, sondern auch auf andere Industrien. Die Bankenindustrie hat mit Open Banking gezeigt, dass Daten nicht isoliert bleiben müssen. Start Ups und neue Kooperationen haben so innovative Finanzdienstleistungen geschaffen. Ein ähnlicher Wandel zeichnet sich in der Automobilindustrie ab: Hersteller haben sich von der Entwicklung eigener Entertainmentsysteme und Navigationslösungen verabschiedet und stattdessen auf Integration gesetzt. Diese Prinzipien sind übertragbar auf den Verteidigungssektor: Offene, interoperable Systeme können die Wertschöpfung erhöhen und gleichzeitig die Resilienz gegenüber Bedrohungen stärken. Wer in der Zukunft MDO beherrschen will, muss nicht nur militärische Kapazitäten ausbauen, sondern auch die Logik der digitalen Plattformökonomie anwenden.
* Prof. Dr. Rafaela Kraus, Universität der Bundeswehr München
* Stephanie Wißmann, Geschäftsführerin secublox
* Prof. Dr. Patrick Glauner, TH Deggendorf
Menschen treffen bis zu 30.000 Entscheidungen am Tag Künstliche Intelligenz (KI) erlaubt es, menschliches Entscheidungsverhalten zu automatisieren, um sie schneller, günstiger und besser durchzuführen. Heutzutage werden im KI-Umfeld insbesondere Verfahren des maschinellen Lernens genutzt. Diese finden in Datensätzen mit Hilfe von statistischen Methoden Muster, anstatt, dass diese Muster explizit durch Regeln beschrieben werden müssen. Die Verfahren des maschinellen Lernens sind generisch also auf eine Vielzahl von Problemen anwendbar. Im militärischen Kontext stellt KI eine Schlüsselkomponente dar. Deren Anwendungen erstrecken sich ausdrücklich nicht nur auf autonome Waffensysteme, sondern beispielsweise auch auf Analyse von Satellitenbildern, Einkauf oder Personalplanung. Der Einsatz von KI in militärischen Anwendungen und autonomen Waffensystemen (AWS) führt aktuell zu umfangreichen Diskussionen. Diese sind jedoch vielfach durch Ängste vor einem menschlichen Kontrollverlust über vermeintliche „Killer-Roboter“ und einem mangelnden Verständnis von KI geprägt. Der Einsatz von AWS erfolgt jedoch gerade nicht in einem rechtsfreien Raum. Das geltende Völkerrecht gilt auch für neue AWS und hält für deren Einsatz bewährte Grundsätze berei, die von den Vertragsstaaten auch bei der Nutzung von KI zur Verteidigung eingehalten werden müssen. Darüber hinaus gibt es die passende Methodik, um KI-basierte AWS sicher und transparent in Einklang mit dem neuen EU-Produkthaftungsrecht zu entwickeln und einzusetzen.

D r. Troy Meink – das ist der Name des Mannes, den der frisch vereidigte US-amerikanische Präsident Donald Trump für das Amt des Air Force Secretary vorgesehen hat. In Trumps Favoritenliste für hohe Ämter im Verteidigungsministerium der USA (DoD) sticht er heraus. Meink ist kein Quereinsteiger, wie die meisten der von Trump begünstigten Kandidatinnen und Kandidaten. Der promovierte Ingenieur schaut auf eine fast vierzigjährige Karriere bei der U.S. Air Force und im Pentagon zurück. Zurzeit tritt er als stellvertretender Direktor des National Reconnaissance Office (NRO) in Erscheinung. Als solcher zeichnet er für die täglichen Abläufe der Spionagebehörde – sie stellt weltraumgestützte Geheimdienstinformationen für das Militär bereit – verantwortlich. Dieser Umstand verdeutlicht, wo Meinks Expertise verortet ist: in der Raumfahrt.
Sollte er im Amt des Air Force Secretary bestätigt werden, obläge ihm aber die Verantwortung für die Space- und Air Force. Traditionell legt die U.S. Air Force ihr Hauptaugenmerk auf die Dimension Luft. Davon zeugt die Zukunftsvision, die der scheidende Air Force Secretary Frank Kendall unter dem Titel „The Department of the Air Force in 2050“ im Januar veröffentlichen ließ. Darin prognostiziert er, dass der Fähigkeitsschwerpunkt der U.S. Air Force bei bemannten Luftsystemen mit starken autonomen und KI-betriebenen Anteilen liegen wird. Die Dimension Weltraum wird hingegen zur Aufrechterhaltung der Informationsüberlegenheit von zentraler Bedeutung sein.
Der Raumfahrtexperte Meink könnte einen Paradigmenwechsel zugunsten weltraumbezogener Fähigkeiten einläuten. Das erscheint plausibel, weil die Air Force Space Command (AFSPC) der U.S. Air Force am 20. Dezember 2019 durch die erste Trump-Administration zur U.S. Space Force (USSF) und damit zur unabhängigen militärischen Abteilung erhoben wurde.
Die sechste Generation muss warten
Der Führungswechsel fällt in eine Zeit, in der das Pentagon die Weichen für die Zukunft der US-amerikanischen Luftstreitkräfte stellt. Im vergangenen Jahr setzte Kendall das wettbewerbsorientierte Next-Generation-Air-Dominance-(NGAD)-Programm aus. Ziel dieses Programms ist einen Kampfjet der sechsten Generation zu entwickeln. Er soll die Rolle des Luftüberlegenheitsjägers von der F-22 Raptor erben. Diese erfüllt ihre Aufgabe bereits seit zwanzig Jahren. Seit 2011 produzieren die Entwickler Lockheed Martin und
Viele Fragen bezüglich der Kampfjets der Zukunft
(BS/Jonas Brandstetter) Die sechste Kampfjetgeneration soll sich durch autonome Begleitsysteme, digitale Vernetzung sowie Tarn- und Künstliche-Intelligenz-(KI)-Fähigkeiten auszeichnen. Doch rund um den Globus stottern die Entwicklungsbemühungen. Dazu gesellt sich Kritik an der Konzeption.
der bedeutendste Zulieferer Boeing keine neuen Einheiten mehr.
Die Entwicklung des designierten Nachfolgers ist zurzeit jedoch ausgesetzt. Angesichts wachsender Kosten lässt Kendall das Projekt NGAD seit Juni vergangenen Jahres erneut evaluieren. Zur Fertigstellung des Konzepts sind nämlich mindestens 20 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung nötig. Seit 2013 hat der US-Kongress insgesamt rund 4,2 Milliarden Dollar für NGAD freigegeben.
Die Entscheidung, wie und ob die Entwicklung am NGAD fortgesetzt wird, trifft nicht mehr Kendall selbst. Das Schicksal der NGAD legt er in die Hand seines Nachfolgers.
Sollte der Senat also Meink sein Vertrauen aussprechen, steht er vor der Aufgabe, zu entscheiden, ob die kostenintensive Entwicklung eines Luftüberlegenheitsjägers fortgesetzt wird, der: über Tarnkappeneigenschaften verfügt, fernsteuerbar ist und dank Künstlicher Intelligenz (KI) teilautonom agiert,für Luftkämpfe und Bodenangriffe geeignet ist, zur elektronischen Kampfführung (EloKa) befähigt ist, Daten direkt an Satelliten übertragen kann, 360-Grad-Rundumsicht per Helm-Display bietet, über ein adaptives Triebwerk verfügt und optional auch Laserwaffen trägt.
Krisen auch bei der Konkurrenz Mit der geplanten Indienststellung ab 2030 verfolgen die USA das ambitionierteste Kampfjet-Projekt für die sechste Generation. International gibt es aber einige Konkurrenzprojekte, die sich ebenfalls darum bemühen, einen Nachfolger für die Flugzeugmuster der fünften Generation zu entwickeln. Dazu zählt auch die Bundesrepublik. Seit 2017 beteiligt sich Deutschland am zunächst binationalen und seit dem Jahr 2023 trinationalen Entwicklungsprojekt Future Combat Air System (FCAS). Vor acht Jahren stießen die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron das Projekt an. Seit 2023 ist auch Spanien offiziell am Projekt beteiligt. Entwickelt werden soll dabei mehr als ein Kampfjet. Hinter FCAS verbirgt sich ein ganzes Waffensystem, bestehend aus einem zentralen, bemannten New Generation Fighter (NGF), diversen unbemannten Fähigkeitsträgern (Remote
Carrier) sowie einem Informationsund Missionsmanagementsystem (Air Combat Cloud). Das Fähigkeitsprofil sieht vor, dass das System bei Indienststellung über Stealth-Eigenschaften verfügt, zur elektronischen Kampfführung (EloKa) befähigt ist, verschiedene Ziele mit hoher Wirksamkeit bekämpfen kann und Sensordaten vernetzt bearbeitet. „Die Fähigkeit, sich in ein vernetztes System zu integrieren, aus diesem zu agieren und zu kommunizieren, wird die Luftwaffe der Zukunft prägen“, prognostiziert der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz. Airbus und Dassault Aviation teilen sich
Leiter der französischen Generaldirektion für Rüstung, Emmanuel Chiva, vor den Abgeordneten der Nationalversammlung verhaltene Töne an. Ob man den geplanten Zeitplan einhalten könne, wollte er nicht garantieren. Einen Monat zuvor verkündete der französische Verteidigungsminister, Sébastien Lecornu, den Entwicklungsbeginn einer unbemannten Begleitdrohne (UCAV) für das Kampfflugzeug Rafale F5. In der kommenden Dekade soll das Luftfahrzeug für den bemannt-unbemannten Flugverbund zur Verfügung stehen. Damit wäre eine bedeutende FCAS-Fähigkeit, die
„Es gibt viele Möglichkeiten, diese Programme eng miteinander zu verknüpfen, damit wir nicht das ganze Geld zweimal ausgeben müssen.“
V Guillaume Faur, Vorstandsvorsitzende der Airbus SE
jeweils auf deutscher und französischer Seite die Entwicklungsarbeiten. Konkret ist Dassault Aviation für die Entwicklung des NGFs zuständig und der deutsche Partner für KI-gestützte Drohnenschwärme und eine „Gefechts-Cloud“ verantwortlich. Der Projekt-Lead liegt auf französischer Seite.
Die Zusammenarbeit gestaltete sich allerdings von Beginn an schwierig. Bereits bei der Ausgestaltung der Konzeptionsphase 1A und B kam es zu massiven Verwerfungen zwischen den Partnern. Die Unternehmen zankten sich um geistiges Eigentum und Exportrechte. Noch wird an der Phase 1B gearbeitet. Die zweite Phase und damit der Bau des Demonstrators steht aber bevor. Geplant ist, 2028 oder 2029 einen Demonstrator in die Luft zu bringen. Das ist mit weiteren Kosten verbunden und einem entsprechenden Auftrag, der von politischer Seite erfolgen muss. Darüber hinaus traf sowohl die französische als auch die deutsche Regierung Entscheidungen, die Zweifel an der Überzeugung der jeweiligen Verantwortlichen am Projekt aufkommen lassen. Im Herbst vergangenen Jahres stimmte der
Integration eines unbemannten Wing-Man, durch die Rafale vorweggenommen. Dass Deutschland den US-Kampfjet F-35 beschafft, ist ebenfalls kein Vertrauensbeweis in FCAS. Ab 2026 beginnt die Auslieferung von insgesamt 35 Luftfahrzeugen durch den US-Hersteller Lockheed Martin. Ein Jahr später sollen sie auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel die deutsche nukleare Teilhabe gewährleisten.
Harmonie zwischen London, Tokyo und Rom
Während FCAS vom Misstrauen der Entwicklungspartner geprägt ist, bemühen sich die britische und die japanische Regierung um einen weltoffenen, kooperativen Ansatz bei ihrem Kampfjet-Projekt Global Combat Air Programme (GCAP). Das GCAP zeigt sich auch für Interessenten außerhalb Europas offen. Zwar steigt mit der Anzahl der Projektteilhabenden der Organisationsaufwand, allerdings verteilen sich auch die enormen Entwicklungskosten auf mehr Schultern. Während eines Besuches in Bahrain in der vorletzten Januarwoche verkündete die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, dass sie
die Aufnahme Saudi-Arabiens ins GCAP für angezeigt halte. „Wir sind dafür, Saudi-Arabien an der Entwicklung zu beteiligen, aber es ist klar, dass dies nicht unmittelbar erfolgen wird“, erklärte Meloni auf der Arabischen Halbinsel. Weitere Details wolle sie mit den übrigen Gründungsmitgliedern von GCAP erörtern.
Den angemessenen Rahmen, um einen derartigen Diskurs zu führen, schafften die Industriepartner der jeweiligen Länder, BAE Systems, Leonardo und Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd (JAIEC), im Dezember vergangenen Jahres. Sie gründeten ein Joint Venture zur Entwicklung und Produktion des Jets. Alle beteiligten Unternehmen halten daran jeweils ein Drittel. Neben den drei nationalen Entwicklungsteams erfolgen Projektarbeiten im neu gegründeten Hauptquartier im britischen Reading.
Querschläger von verschiedenen Standpunkten
So viel Einigkeit weckt Begehrlichkeiten. In London monierte der Vorstandsvorsitzende der Airbus SE, Guillaume Faury, vergangenen Monat, dass in Europa zwei Entwicklungsbemühungen für einen Kampfjet der sechsten Generation parallel liefen: „Es gibt viele Möglichkeiten, diese Programme eng miteinander zu verknüpfen, damit wir nicht das ganze Geld zweimal ausgeben müssen“, so Faury. Unter den aktuellen Gegebenheiten bezahlten die beteiligten Nationen doppelt für Fähigkeiten, die man einfach hätte teilen können. „Die Regierungen müssen sich zusammensetzen, ihre Anforderungen und den Preisrahmen definieren und gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten ausloten“, forderte er weiter. Dabei sei Eile geboten. Noch seien die Programme in einer frühen Konzeptionsphase. Doch bereits in zwei Jahren seien die Entwicklungen so weit fortgeschritten, dass sie nur noch unabhängig voneinander fortgesetzt werden könnten. Davor, explizit die Zusammenführung von FCAS und GCAP zu fordern, schreckte Faury allerdings zurück. Stattdessen empfahl er, eine gemeinsame Turbine, Sensorik und Cloud-Technologie zu nutzen. Weniger zurückhaltend formulierte der zukünftige Vorsitzende des neu zu gründenden Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, seine Kritik. Im sprachlichen Stil und über das bevorzugte Kommunikationsmittel seines politischen Vorgesetzten holte er zur Radikalkritik aus. Auf dem Kurznachrichtendienst „X“ monierte er, dass „wir Idioten immer noch bemannte Kampfflugzeuge bauen“.













Mit Laptop und Regenjacke






so Schubert, dass man diesen „Naturfrevel nicht einfach in andere Länder auslagern kann“. Naturschutz müsse global gedacht werden. Und „da gehört es dann auch dazu, dass man weniger Fleisch isst. Waldrodung ist ein großes Thema und je weniger intensive Landnutzungsformen wir brauchen, desto mehr schützen wir den Wald.“






(BS/Tanja Klement) Draußen ist es grau und trüb, im Laufe des Tages soll es regnen. Zeit für die Arbeit. Bluse und Jackett kann Lisa Schubert im Schrank lassen. Was heute als Arbeitskleidung gebraucht wird, das entscheidet vor allem das Wetter. Für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim in Oberbayern ist die 35-jährige Revierleiterin ganzjährig zwischen Bäumen und Tümpeln unterwegs.



Als sie sich für ein Studienfach entscheiden sollte, hatte Schubert eine Karriere als Försterin nicht auf dem Schirm, wollte umwelteffizientes Planen und Bauen studieren. In der Kindheit hatte sie von einem Leben als Hubschrauberpilotin geträumt. Heute würde sie ihren Berufsalltag zwischen Schreibtisch und Revierrundgang nicht mehr missen wollen. „Jeder, der gerne draußen ist und die Na-






die Bewirtschaftung für ein zusätzliches Einkommen. Daneben macht Schubert auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Immerhin ist ca. ein Drittel der Fläche Deutschlands bewaldet und die Bewirtschaftung und Pflege entsprechend von öffentlichem Interesse.
Der Wald schafft saubere Luft und sauberes Wasser. Aber er soll auch viele weitere Aufgaben erfüllen. Naturschutz, Artenschutz, Naherho-

tur liebt, der ein bisschen wetterfest ist, dem kann ich diesen Beruf ans Herz legen“, so Schubert Dass sie sich am Ende für den Beruf entschieden hat, das liegt vielleicht an den Professoren, die den Beruf „so gut dargestellt haben“. Auch sei das Studium sehr praxisnah gewesen. „Man ist viel draußen. Und als junger Mensch will man ja doch auch immer gerne was Gutes tun, die Welt verändern. Und da, glaube ich, ist Förster auf alle Fälle ein guter Ansatz.“
Arbeit ohne Alltag Auf die Frage, wie ein typischer Arbeitstag bei ihr aussieht, sucht Schubert seit Jahren eine gute Antwort. Da Försterinnen und Förster in und mit der Natur arbeiteten, gebe es „die eine feste Routine“ nicht. Bei Hochwasser etwa stehen bei Lisa Schubert ganz andere Aufgaben auf dem Plan als bei Schnee im Winter. Der Beruf sei maßgeblich durch die Jahreszeiten geprägt. Regelmäßige Aufgaben hat sie trotzdem. Eine der wichtigsten Aufgaben der Försterin ist die Beratung privater Waldbesitzender. Ihnen hilft sie, auf den Waldflächen die individuellen Ziele umzusetzen – ob Brennholz für den Eigenbedarf, Insektenschutz oder
lungsgebiet und Nutzholz: Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, braucht es eine bunte Mischung an verschieden bewirtschafteten Flächen, die zusammen ein Mosaik ergeben. Dieses ermöglicht bei rund 700.000 Waldbesitzenden in Bayern fast schon nebenbei eine Vielfalt an Lebensräumen, die mit einer einheitlichen Waldnutzung nicht möglich wäre.
Zwischen Klimaanpassung und Umweltschutz
Je nach Zusammensetzung der Forstreviere haben Lisa Schubert und ihre Kollegen neben dem Aus-





tausch mit der Umweltschutzbehörde auch Kontakt zu Artenschutz- und Umweltverbänden. In Alpennähe etwa gebe es besonders viele extrem seltene Pflanzen und Tiere, deren Lebensräume bewahrt werden müssten. Immer wieder gehe es in ihrem Revier dabei um die Gelbbauchunke. Doch auch hier brauche es eine gesunde Mischung. Denn wenn alle Waldflächen etwa zugunsten der Gelbbauchunke vernässt würden, fänden andere Tierund Pflanzenarten keinen für sie geeigneten Lebensraum mehr. Und auch die nachhaltige Produktion von Nutzholz ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mischung – ob für den Möbelbau oder auch die Feststoffheizung. Letztere könnte auch für Nicht-Waldbesitzende eine gute Option sein, so Schubert. Die Ölquelle habe man ja auch nicht selbst im Keller. Die Mutter eines Sohnes sieht das ganz pragmatisch: „Der Mensch verbraucht Ressourcen. Und da bin ich immer dafür, dass wir die nachhaltige Ressource Holz nutzen, bevor wir Erdgas, Öl oder Kohle verwenden.“
Angesichts des Klimawandels könne man aber immer nur „nach bestem Wissen und Gewissen“ arbeiten. Denn fest vorhersagen ließen sich die Auswirkungen nicht. „Wenn da jemand sagt, er kennt schon alle Antworten, dann würde ich das infrage stellen.“ Aus diesem Grund gibt es die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, die in Forschungsprojekten beispielsweise nach Pflanzenarten sucht, die sich in den heimischen Wäldern unter wärmeren und trockeneren Bedingungen wohlfühlen könnten. So soll sichergestellt werden, dass der Wald auch in Zukunft seine vielfältigen Funktionen erfüllen kann.
Ein paar Grundsätze behalte man dabei aber immer im Blick. „Wir nutzen in Bayern zum Beispiel weniger Holz als nachwächst.“ Nachgehalten wird die Entwicklung der Baumbestände in der Bundeswaldinventur, die alle zehn Jahre stattfindet.
Digitaler Überblick
Neben den Abwägungen verschiedener Interessen gehören aber auch ganz pragmatische Aufgaben zum Alltag der Försterin. Wem gehört welcher Baum? Früher hatten Forstämter große Karten-Kompendien, mit denen man die Eigentümer und Grenzen dokumentierte. Heute kann Lisa Schubert dank mobiler Endgeräte und GPS auf dem Smartphone sehen, wer für den Abschnitt zuständig ist, in dem sie sich gerade befindet. Und was



sie vor Ort findet, kann sie dank robuster Technologie gleich in einer E-Mail festhalten – ob illegale Müllablagerung oder Schädlingsbefall. Der Dienst-Laptop kann im Auto laden und wird später im Büro wieder an das Netzwerk angeschlossen. Die verwaltenden Aufgaben seien durch die Digitalisierung viel handlicher geworden, betont Schubert
Die Grenzen im Kopf Bei allen Maßnahmen und Plänen für Wälder und Naturschutz ist es wichtig, auch über die eigene Zuständigkeit hinaus zu denken. „Wir können nicht sagen, wir hier in Bayern oder in Deutschland stellen alles unter Naturschutz und klopfen uns auf die Schulter, wenn wir gleichzeitig in Bangladesh die Flüsse verschmutzen lassen, weil wir unsere T-Shirts für zwei Euro kaufen möchten.“ Es sei wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben,
Auch auf lokaler Ebene könne man aktiv werden. Etwa wenn es um die Entscheidung gehe, ob jede Kommune ein eigenes Gewerbegebiet brauche oder ob es hier eine interkommunale Lösung gebe. Mit jeder so nicht bebauten Fläche bleibe auch ein Stück Wald erhalten. Und das sei schließlich der erste Schritt, bevor man den nicht abgeholzten Wald dann nachhaltig bewirtschaften könne.
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Weilheim in Oberbayern ist zuständig für eine Fläche von 2.466 Quadratkilometern. Mit den 113.000 Hektar Waldfläche und 79.500 Hektar landwirtschaftlicher Fläche sind rund 78 Prozent des Dienstgebiets land- und forstwirtschaftlich genutzt. Das AELF mit Landwirtschaftsschule ist Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie land- und forstwirtschaftliche Unternehmen. Dort sind außerdem die Fachstelle Schutzwaldsanierung und der überregionale Sachbearbeiter für Jagd angesiedelt. Seit der Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung 2021 widmen sich die 32 bayerischen ÄELF verstärkt den Themen Gewässerschutz, Tierwohl und Wildlebensräume.
Auf den Waldflächen des AELF Weilheim steht ein Holzvorrat von ca. 35 Millionen Erntefestmetern (Efm) bei einem Holzzuwachs von 11,2 Efm pro Hektar im Flachland bzw. 7,1 Efm im Hochgebirge. Auf Bayern gerechnet entsteht so rund ein Kubikmeter Holz pro Sekunde.
