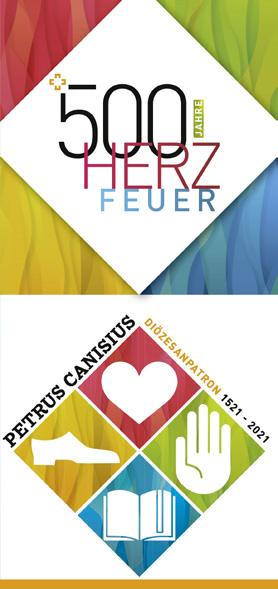13 minute read
CONTEMPLATIO Zur Geschichte des Stiftes Wilten
Zur Geschichte des Stiftes Wilten
28. Kapitel Die Wiltener Äbte von 1687 bis 1765. Umbau der Stiftsgebäude zu ihrer heutigen Gestalt, Erbauung der „Wiltener Basilika“.
Text: Prior Klemens Halder OPraem
Der Großteil des Stiftes war in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut worden. Schon Abt Dominikus Loer hatte 1670 die Erneuerung des westlichen Traktes in Angriff genommen.
Es ist zu bewundern, wie die Innsbrucker Hofbaumeister Gumpp – zunächst Christoph und später Johann Martin – von zirka 1670 bis 1730 unter Einbeziehung romanischer und gotischer Gebäudeteile die heutige einheitliche barocke Stiftsanlage schufen.
Abt Johann Mayr (16871693) war ein großer Marienverehrer. Von ihm wurde gerühmt, dass er das Gnadenbild „Unsere Liebe Frau unter den vier Säulen“ in der Pfarrkirche Wilten wieder zu Ehren gebracht hat. Er nahm an den Prozessionen dorthin teil. 1693, im Jahr seines frühzeitigen Todes gestattete er seinem Prior Gregor Stremer, Bautätigkeiten an den Klostergebäuden zu beginnen, „die teils von Erdbeben übel zerschüttelt, teils von Alter sehr baufällig waren“.
Der Großteil des Stiftsumbaus geschah unter Abt Gregor Stremer (1693-1719). Eine besondere Maßnahme dabei war die Abtragung des Traktes an der Ostseite des ursprünglich quadratischen Kreuzgangs. In jenem schmalen Gebäude waren im Erdgeschoß die Sakristei der Kirche, der Kapitelsaal mit Kapitelkapelle und der Unterhaltungsraum (Parlatorium), im Obergeschoß der gemeinsame Schlafsaal (Dormitorium) untergebracht. Durch den Umbau und die Erweiterung der Stiftsgebäude konnten Einzelzimmer geschaffen werden, wie sie der damalige „moderne Mensch“ wünschte. Dadurch konnten auch mehr neue Mitglieder aufgenommen werden. Abt Stremer ließ von 1702 bis 1707 die Kirche mit dem kraftvollen Stuck des Italieners Bernardo Pasquale und den Fresken des Innsbrucker Barockmalers Kaspar Waldmann schmücken und schließlich noch ab 1713 die ursprünglich einfache Kirchenfassade durch den kunstvollen Portalvorbau samt den Statuen am Eingang und oben am Giebel verschönern.
In die Abtzeit von Gregor Stremer fällt der kriegerische Einfall Bayerns in Tirol im Jahr 1703. Von 1701 bis 1714 tobte nämlich zwischen den Großmächten Europas der Spanische Erbfolgekrieg, nachdem der letzte spanische Habsburger kinderlos gestorben war. Bayern hatte sich in der Hoffnung auf Landgewinn auf die Seite Frankreichs gestellt. Kurfürst Max II. Emanuel zog deshalb am 15. Juni 1703 mit einem großen Aufgebot von bayerischen und französischen Truppen gegen Tirol, schnell hatte er das Unterinntal erobert. Innsbruck wurde dem Kurfürsten gegen Ende Juni übergeben. Der Tiroler Landsturm, der sich in der Zwischenzeit erst richtig formiert hatte, wollte das nicht hinnehmen. Strategisches Ziel der Bayern war, sich mit den aus Norditalien ins große alte Tirol vorstoßenden Franzosen zu vereinigen. Eine bayerisch-französische Truppe auf dem Weg zum Reschenpass wurde aber in der Engstelle vor Prutz vernichtend geschlagen. Auch auf dem Weg über den Brenner nach Süden wurde dem Kurfürsten Einhalt geboten. Zuletzt war er mit seinem Heerlager auf den Wiltener und Saggener Feldern eingeschlossen. Max Emanuel, der am 26. Juli 1703, dem Tag der Hl. Anna, das Gebiet um Innsbruck räumte, musste sich den Rückzugsweg über Seefeld nach Mittenwald freikämpfen. Dabei wurden die Dörfer und Weiler westlich von Innsbruck niedergebrannt, es wurde geplündert und Gräueltaten an Frauen und Kindern verübt. Allerdings taten
Abt Johann Mayr, Äbtebilder, Stift Wilten Abt Gregor Stremer, Stift Wilten


die Tiroler in der Folgezeit am Gebirgsrand Bayerns Ähnliches, um sich einen Ersatz zu verschaffen für das ihnen Geraubte und Vernichtete. Als Dank für die Befreiung wurde 1706 in der heutigen Maria-Theresien-Straße die sogenannte Annasäule errichtet. Abt Stremer berichtet in seinem Tagebuch über die kriegerische Zeit. Er schreibt auch, dass er einige Male für den Kurfürsten und sein Gefolge in der Stiftskirche die Heilige Messe feiern musste.
Wie es schon bei den vorhergehenden Äbten der Fall war, legte Stremer auf eine gute Ausbildung der jüngeren und Weiterbildung der älteren Mitbrüder großen Wert. Wöchentlich fanden im Stift philosophisch-theologische Konferenzen statt, an denen der ganze Hauskonvent samt Abt teilnahm. Getreu seinem Ausspruch - „Ein schlechter Prämonstratenser, der sich nicht getraut, zehn Jahre früher zu sterben“ – übte Abt Stremer trotz ernster gesundheitlicher Probleme im Jahr 1719 seine Tätigkeiten weiter aus, bis er nach einem zweiten Schlaganfall am 5. September im Alter von 57 Jahren starb.
Abt Martin von Stickler (1719-1747) ließ zusätzlich zur neuen Klosteranlage den Trakt nördlich der Kirche erbauen. In jenem Gebäude wurde die zweigeschossige Große Bibliothek untergebracht, weiters fand dort das Archiv mit seinen Urkunden und Chronikschriften einen geeigneten Platz. Im Nordtrakt wurden auch weitere Zimmer für den stark gewachsenen Abt Martin Stickler, Gemälde im Konvent geschaffen. Alten Landhaus
Schon immer war die Pfarrseelsorge ein Schwerpunkt der Wiltener Prämonstratenser. In früheren Zeiten hatte sie mehr oder weniger nur in der Messfeier und Sakramentenspendung bestanden. Nun aber wurden die Stiftsangehörigen geschult für die religiöse Unterweisung der Kinder und Jugendlichen, eine gute Predigt, geeigneten Dienst an den Beichtenden und Aufmerksamkeit für die Armen und Kranken. Bis zur Zeit von Abt Stickler hatte es auswärts wohnende Konventualen nur in der Urpfarrhöfen Ampass und Patsch, seit 1687 auch in Hötting gegeben. 1721 kaufte dann Abt Stickler einen Hof in Tulfes, 1730 einen solchen in Gries im Sellraintal als Wohnmöglichkeit für die dortigen Seelsorger. Da es in Gries keine Kirche gab, ließ Abt Martin die heutige Kirche erbauen, die 1735 eingeweiht wurde. Eine Reihe von anderen Orten wurde aber weiterhin direkt vom Stift aus betreut. Eine Aufstellung aus dem Jahr 1753 nennt Natters, Mutters, Völs mit Wallfahrtsseelsorge am Blasienberg, Igls, Vill, Lans, Sistrans und Amras. Im Kirchlein Heiligwasser war besonders viel Dienst an den Wallfahrern zu leisten. An jedem Sonntag wurde in den Orten eine Hl. Messe gefeiert, an Werktagen die dort gestifteten Messen. Die den einzelnen Orten zugeordneten Seelsorger wa-
Annasäule, erbaut 1706, MariaTheresien-Straße, Innsbruck
Die Hl. Anna als Schutzpatronin, im Vordergrund das Heerlager der Bayern auf den Wiltener Feldern, Stiftskirche Wilten, Anna-Seitenkapelle, Kaspar Waldmann, zirka 1703



Die barocke Anlage des Prämonstratenser-Chorherren Stiftes Wilten mit dem Leuthaus und der Basilika Wilten

ren auch zuständig für die dortigen Begräbnisse und die Betreuung der Kranken. Die Priester mussten zu Fuß bei jeder Witterung in ihre Seelsorgeorte gehen. 1720 gehörten 35 Priester zum Stift, von denen 25 im Kloster lebten. Im Jahr 1753 zählte Wilten 51 Chorherren von denen 38 im Stift wohnten. Vor allem in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts leisteten einzelne Wiltener Konventualen Dienste in anderen Prämonstratenserklöstern als Professoren für Philosophie und Theologie oder auch in Leitungsämtern. Das war der Fall im kärntnerischen Griffen und in den bayerischen Stiften St. Salvator, Osterhofen und Windberg.
Eine große Bedeutung für die christliche Erneuerung Tirols hatten im 18. Jahrhundert die Glaubensmissionen der Jesuiten. Johann Baptist Fenner von Fennberg, Salinendirektor in Hall, erlebte bei Holzkäufen in entlegenen Tälern, dass die Menschen sehr mangelhaft im Glauben unterrichtet waren und oft sittlich sehr ungeordnet lebten. Gemeinsam mit dem Bischof von Brixen, Kaspar Ignaz Graf Künigl, leitete er in die Wege, dass 1719 eine ständige Mission der Jesuiten im großen Tirol begann. Für die Finanzierung des Lebensunterhalts der dafür bestimmten vier Jesuiten trugen er und seine Frau den größten Teil bei. Durch immer wiederkehrende Missionen der Jesuiten geschah eine religiös-sittliche Erneuerung des Tiroler Volkes. Von 1719 bis 1784 konnten die Missionen durchgeführt werden. Die Missionare motivierten die Menschen zur Umkehr auch durch das Aufzeigen der großen Liebe Jesu zu uns, die bildlich am durchstoßenen Herzen Jesu deutlich wird. Von daher kommt die starke Verankerung der Herz-Jesu-Verehrung in Tirol. Das einzige Kind des Ehepaars Johann und Katharina Fenner trat ins Stift Wilten ein und trug den Ordensnamen Thomas. Das Ehepaar führte in jeder Hinsicht ein vorbildhaftes Leben; die beiden ließen sich nach ihrem knapp aufeinanderfolgenden Tod im Jahr 1743 in der Stiftskirche Wilten bestatten. Bei den archäologischen Grabungen 2005/06 wurden ihre Grabstätten festgestellt. Heute erinnert eine Bodenplatte vor der ersten Reihe des vorderen linken Bankblocks an sie. Wie andere Wiltener Äbte war Martin Stickler als Mitglied der Hohen Geistlichkeit in der Landesverwaltung tätig. Tirol wurde zwar seit 1665 zentral von Wien aus regiert, es brauchte aber für die konkreten Entscheidungen im Land Ausschüsse, die sich öfters trafen und aus den vier Ständen – Adelige, Prälaten, Bürger (Vertreter der Städte) und Bauern (Vertreter der Landgerichte) – zusammensetzten. Das größte Verdienst bei
seiner Tätigkeit in der Verwaltung des Landes erwarb sich Abt Stickler als Bauinspektor bei der Erbauung des hochbarocken „Alten Landhauses“ in der Maria-Theresien-Straße. Da das vorherige Gebäude alt und baufällig war, entschloss man sich 1724 zum Neubau unter der Leitung des Baumeisters Georg Anton Gumpp. In besonderer Weise war Abt Stickler mit der Durchführung der kunstvollen Innenausstattung befasst. Darin wird der große Kunstsinn von Abt Stickler deutlich. Die Innenausstattung zog sich bis 1734 hin. Ein umfangreicher Schriftverkehr des Abtes mit dem Baumeister und den Künstlern ist im Stiftsarchiv erhalten geblieben.
Nach dem Tod von Martin Stickler wurde Norbert Bußjäger zum Abt gewählt (1747-1765). Bei seiner Wahl machte sich das staatliche Kirchenregiment schon deutlich bemerkbar. Es wurde bemängelt, dass man nicht zuerst den Tod von Abt Stickler der Regierung in Wien mitgeteilt hatte, bevor man den Wahltermin dem Bischof von Brixen und dem Vaterabt in Rot meldete. Es musste das Stift Wien seinen materiellen Stand bekanntgeben, auch war eine hohe Wahltaxe an die Regierung zu entrichten. In der Abtzeit von Bußjäger wurde das Verhältnis zur bayerischen Ordenszirkarie,
Erinnerungsplatte in der Stiftskirche Wilten für Johann und Katharina Fenner Altes Landhaus, Maria-Theresien-Straße, Innsbruck


der Wilten angehörte, felmusik großzügig bewirtet wurden. Die Gebetszeit um und zur Ordenslei- Mitternacht, für die der Schlaf unterbrochen wurde, tung im französischen war schon 1640 abgeschafft worden; das Chorgebet Prémontré immer begann seit damals um vier Uhr früh. lockerer. Der Haupt- Der Vater des Abtes Norbert Bußjäger, namens grund dafür war die Matthias, war Maler. Von Rottenbuch in Oberbayern Betonung der Staats- war er nach Meran ausgewandert. 1716 malte er für autorität, die eine die Wiltener Stiftskirche das Altarbild des mittleren linKirche mit internati- ken Seitenaltars, darstellend die Aussendung der Apoonalem Charakter stel. Im Kloster selbst sind zwei Gemälde von ihm erhalund ausländischen ten geblieben. Für die Kirche in Vill schuf er um 1715 Oberen nicht dulden das Hochaltarbild mit dem Kirchenpatron Martin. Von wollte. seinem Vater dürfte Abt Bußjäger einen guten KunstDas staatliche Kir- sinn geerbt haben. Während seiner Abtzeit wurde die chenregiment hatte heutige Wiltener Basilika erbaut. Durch die archäoloals Wurzel den fürst- gischen Ausgrabungen in den 1990er Jahren wissen wir, lichen Absolutismus, dass an jener Stelle schon um 400 eine frühchristliche aber auch die Aufklä- Kirche stand, die freilich um einiges kleiner war. Um 1300 Abt Norbert Bußjäger, rung, die als geistige wurde sie erneuert und ein wenig vergrößert. Unter Abt Äbtebilder, Stift Wilten Bewegung ab 1690 Martin Stickler waren 1728/29 die Mauern jener Kirche in Europa entstand. erhöht und das Innere barockisiert worden. Schon 1750 Quelle der Erkenntnis sollte nicht nur die Offenbarung brach aber ein Stück des neuen Gewölbes herab. Abt Gottes an die Menschen sein, sondern wesentlich die Norbert entschloss menschliche Vernunft. Das konkrete Leben der Men- sich deshalb zu einem schen, für dessen Verbesserung man sich einsetzte, völligen Neubau, mit rückte in den Vordergrund. Man kämpfte für Toleranz dem er den Tiroler gegenüber Andersdenkenden, Lehr- und Pressefreiheit. Priester und KirchenManche Anhänger der Aufklärung ließen in der Religion baumeister Franz de nur mehr das gelten, was mit der Vernunft verstanden Paula Penz, gebürtig werden konnte, nämlich die Existenz eines Gottes und aus Navis, betraute. die Pflicht aller Menschen, sich gegenseitig zu lieben Penz hatte damals und zu achten. Die anderen religiösen Lehren wurden schon eine Reihe von als Zusätze, Betrug und Aberglauben abgelehnt. Das Pfarrhäusern und KirDenken der Aufklärung förderte im 18. Jahrhundert die chen, vor allem in verstärkte Hinwendung der Kirche zur konkreten Seel- Nordtirol, unter großsorge, da und dort auch ein Überdenken kirchlicher em Einsatz in allen Strukturen. Baubelangen errich- Franz de Paula Penz, Sakristei,
Bei Mitgliedern des Stiftes Wilten lässt sich schon ab tet beziehungsweise Basilika Wilten Abt Stickler Kritik an klösterlichen Anordnungen feststel- umgestaltet. Von 1751 bis 1756 dauerte die Erbauung len. Die Wiltener Konventualen stammten im 18. Jahr- und Innenausstattung dieser herrlichen Kirche in Wilten. hundert zu einem großen Teil aus dem niederen Be- Für den Rokokostuck gewann er Franz Xaver Feuchtamtenadel und dem reichen Bürgertum. Aus diesem mayr aus dem bayerischen Wessobrunn, für die großarGrund legten sie Wert auf manche Annehmlichkeiten tigen Fresken den Augsburger Matthäus Günther. des Lebens wie ein Taschengeld, das allerdings beim Die meisten Kirchen der anderen Seelsorgsorte des Prior hinterlegt war, die Möglichkeit für gemeinschaft- Stiftes waren in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts im liche Spiele oder gemeinsame Erholungswochen im gotischen Stil erbaut worden. Im 18. Jahrhundert wurKloster mit weniger klösterlichen Verpflichtungen. Es den sie großteils ein wenig vergrößert und barockisiert. wurde üblich, dass die Konventualen zu Theaterauf- Schon Abt Stremer hatte jene Maßnahmen durch fiführungen in der Stadt gehen durften und in Innsbruck nanzielle Hilfen des Stiftes unterstützt. Dieser Prozess der Besuche machen konnten. Abt Bußjäger lud gerne an Kirchenerneuerung zog sich in manchen Orten fast bis bestimmten Festen vornehme Gäste ein, die unter Ta- zum Ende des 18. Jahrhunderts hin.


Die Wiltener Basilika von Südosten
1761 war Abt Norbert Bußjäger 71 Jahre alt, ein hohes Alter für die damalige Zeit. Er war immer wieder kränklich. Im Konvent gab es Tendenzen zur Disziplinlosigkeit.
Als Anfang März 1765 im Stift bekannt wurde, dass die Regierung plane, in Wilten einen weltlichen Administrator einzusetzen, stimmte Bußjäger seiner Resignation zu. Das Stift hatte damals vor allem wegen des Neubaus der Pfarrkirche hohe Schulden. Norbert Bußjäger starb am 25. September 1765.

Quellen: St.A.W. A 11 02 20, Abttagebuch, 20.03.1670: „Die alte Abtei vor dem rechten (nur halb aufgebauten) Turm wird abgerissen.“ Franz Caramelle, Barock im Stift Wilten – Baugeschichte – Baubeschreibung. In: 850 Jahre, 199-202. St.A.W. A 04 03 02, Adalbert Tschaveller, Continuatio Annalium Wilthinensium …, Cap. 92, n. 8, f. 8 r. Martin Mittermair, Zur Baugeschichte der romanischen Stiftsanlage von Wilten/Innsbruck. In: Michaela Frick, Gabriele Neumann (Hg.), Beachten und Bewahren … Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Caramelle. Innsbruck 2005, 183-188. Szántó, 179. Forcher, 172-175; Fritz Kirchmayr, Der „bayerische Rummel“ im Jahr 1703. In: Tiroler Landesausstellung 1993. Bayerisch-Tirolische G´schichten … eine Nachbarschaft. Bd. II, Beiträge, 54-64. St.A.W. A 11 02 44; Szántó, 181-183. Szántó, 199f. Barbara Kern, Abt Martin Stickler von Gassenfeld und das Stift Wilten von 1719-1747, Dissertation, Innsbruck 1984, 204-207. Barbara Kern, 190-197. Szántó, 324-328. Lentze, Geschichte, 250. Klemens Halder (Hg.), Verzeichnis der Mitglieder des Prämonstratenser-Stiftes Wilten. Manuskript, Innsbruck 2005, Dokumente Nr. 400, 401, 406, 412, 414, 421, 448, 458. Humer, Die Gründung der ständigen Mission. In: Hanns Humer, Werner Kunzenmann (Hg.), Tirol – Heiliges Land?. …, Innsbruck 2002, 11-19; W. Kunzenmann, Die Methode der ständigen Mission. In: Tirol – Heiliges Land?, 20-30. Forcher, 176-181; Kern, 52-59. Szántó, 310-314, 334f. LThK, Bd. 1, 1993, Aufklärung, Raffaele Ciafardone, Philosophie, Prozeß und Einfluß, 1207-1211; Rudolf Reinhardt, Kirchengeschichte, 1211-1213. Szántó, 329-334, 338-340; Lentze, Geschichte, 251. Irma Kustatscher-Pernter, Der Meraner Maler Matthias Pussjäger, Innsbruck 1978, Zeittafel (ohne Seitenangabe); Seite 8; Abbildung 10 (ohne Seitenangabe); Gertrud Beinsteiner-Krall, Die St. Martinskirche und andere Kunstdenkmäler in Vill, In: Vill. Vom Dorf zum Stadtteil in Geschichte, Kunst und Leben, Innsbruck 1992, 144-148. Blasius Marberger, Die Kirchen Wiltens. In: Wilten. Nordtirols älteste Kulturstätte, 2. Bd., Innsbruck-Wien-München 1926, 20-24; Karl Bayer, Franz de Paula Penz, Innsbruck-Wien 1991, 15f., 51-53. Hannelore Steixner, Die Wiltener Pfarreien in Vergangenheit und Gegenwart. In: 850 Jahre, 293-336. Szántó, 344-349.