
24 minute read
BERICHTE UND ANALYSEN IHK-STUDIE
IHK-STUDIE
Renditen der Bildung
Advertisement
BERUFLICHE AUS- UND FORTBILDUNG BIETET BIS 60 HÖHERES EINKOMMEN ALS DAS STUDIUM
Eine neue Studie der Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammern (BWIHK) zur Bildungsrendite belegt nun, dass Personen mit einer Berufsausbildung bis zu ihrem 37. Lebensjahr in der Regel mehr verdienen, als Absolventen mit einem Studium. Personen mit einer Fortbildung, also mit einem Meister-, Techniker- oder Fachwirtabschluss, verdienen im Durchschnitt bis zu ihrem 60. Lebensjahr gar genauso viel wie Arbeitnehmer mit einem direkten Hochschulabschluss im Anschluss zur Schulbildung. Personen, die erst eine Ausbildung und dann ein Studium absolvieren, verdienen etwa gleich viel wie die, die direkt nach dem Schulabschluss ein Studium absolvieren. Lediglich die Menschen und Arbeitnehmer, die ohne jegliche Berufsausbildung im Arbeitsleben stehen, verdienen weniger beziehungsweise am wenigsten. Das sind die zentralen Ergebnisse der Studie, die das Institut für angewandte Wissenschaft (IAW) in Tübingen über die Bildungsprofile von mehr als 12.000 Personen untersucht hat.
Die von den Baden-Württembergischen Industrie und Handelskammern in Auftrag gegebene Studie vergleicht die Verdienstmöglichkeiten einer Berufsausbildung, beruflicher Fortbildung, Hochschulbildung und Personen ohne Berufsabschluss. Der kumulierte Verdienst einer Person mit Ausbildung und anschließender Weiterbildung steht demnach am Ende des Erwerbslebens fast gleichauf mit dem von Personen mit Hochschulabschluss: nämlich bei etwa 1,4 Mio. Euro. Vorteil für die beruflich Aus- und Fortgebildeten: sie haben bis zum 60. Lebensjahr und somit während des größtenteils ihres Berufslebens, finanziell gegenüber den Akademikern die Nase vorn. Personen, mit Berufsausbildung ohne Fortbildung verdienen zwar rund 0,4 Mio. Euro weniger über das Erwerbsleben hinweg gesehen als Personen mit Hochschulabschluss, verfügen aber dafür bis zu einem Alter von 36 Jahren über mehr Geld.
Die Studie zeigt über neue Untersuchungsansätze erstmals, in welcher Altersphase welche Personengruppen wie viel verdienen und betrachtet dabei, anders als bisherige Untersuchungen zu diesem Thema, nicht nur den höchsten Bildungsabschluss einer Person, sondern die gesamte Bildungsbiografie und die Entwicklung des individuellen Lebenseinkommens. Dabei wurde ersichtlich, dass Personen mit Meister, Techniker oder Fachwirtabschluss über ihr Erwerbsleben hinweg fast gleich viel und lange Zeit zunächst mehr verdienen als Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium; und sie verdienen eben auch immer mehr als Personen ohne Fortbildungsabschluss, die eine Berufsausbildung absolviert haben. Ein interessanter Punkt ist auch, dass Personen die zunächst eine Berufsausbildung absolvieren und daran dann ein Studium anschließen, ebenso in den ersten Jahren mehr und im gesamten Erwerbsleben nicht weniger verdienen als die, die direkt ein Hochschulstudium nach dem Schulabschluss anstreben. Neben der beruflichen Fortbildung ist also auch das Studium bewusst erst nach der Ausbildung aufzunehmen, eine attraktive Möglichkeit, seine Berufung und Bildung zu vertiefen.
IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle: „Getreu dem oft schon gehörten Motto ‚Ich bin jung und brauche das Geld‘ ist ein Kernaspekt der Studie, dass beruflich Ausgebildete und noch mehr die beruflich Aus- und Fortgebildeten bis kurz vor dem Rentenalter über ein höheres kumuliertes Einkommen verfügen als Hochschulabsolventen. Geld braucht man ja nicht erst am Ende seines Arbeitslebens, sondern schon früher. Beispielsweise wenn man eine Familie gründen oder ein Eigenheim erwerben möchte. Der Meister, der schon früher Geld verdient hat, konnte sich noch ein Eigenheim leisten, bevor die Preise angestiegen sind. Derjenige, der studiert hat, wartet ewig, bis er genügend Startkapital zusammen hat.
Und was den Aspekt der beruflichen Orientierung und des Findens seiner Berufung anbelangt, räumt eine Berufsausbildung einen weiteren kritischen Punkt aus: die Jugendlichen müssen sich nicht zu einem Zeitpunkt festlegen – vielfach sind sie nicht einmal volljährig dabei – zu dem sie oft noch gar nicht wissen, ob sie ein Studium beenden werden. Das Risiko dabei ist schließlich, dass das kumulierte Lebenserwerbseinkommen, das ein Studium mit sich bringen würde, eventuell gar nicht erreicht wird.“
Die Studie zeigt auch die Entwicklung des Einkommens, wenn nach einem abgebrochenen Studium nochmal Zeit in eine Ausbildung investiert wird. Diese Personen verdienen am Ende fast genauso viel wie diejenigen, die nach dem Studienabbruch direkt in einen Job wechseln. „Für diese Personen wäre es besser gewesen, gleich eine Ausbildung zu machen. Denn eine Bildungsentscheidung ist im Grunde auch immer eine Art Investitionsentscheidung“, so Eberle weiter.
Personen, die nach abgeschlossener Ausbildung noch ein Studium absolvieren, würden ziemlich genauso viel verdienen wie jemand, der gleich nach der Schule ein Studium absolviert. Ein großer Vorteil sei jedoch, dass erstere in jungen Jahren bereits Geld verdienen und bis etwa 50 Jahre ein höheres kumuliertes Einkommen hätten. Die Entscheidung für mehr Bildung, Ausbildung oder Studium, lohne sich über die letzten Jahrzehnte gesehen im Vergleich zu keiner abgeschlossenen Ausbildung immer mehr. Zwar konnten in der Industrie in der Vergangenheit auch Ungelernte relativ gut verdienen. Dort habe sich ein Studium erst deutlich später gelohnt, nämlich ab etwa 55 Jahren gegenüber 46 Jahren im Dienstleistungsbereich. Es zeigt sich aber, dass dies bei den jüngsten untersuchten Geburtenjahrgängen, nämlich von 1975 bis 1986, anders aussieht. Dort lohne es sich in jedem Fall, eine Berufsausbildung anzustreben.
Wie sollen sich Jugendliche im Hinblick auf
Karriere- und Verdienstmöglichkeiten denn nun am besten entscheiden? Ein Studium sei für diejenigen, die gern wissenschaftlich arbeiten und eher theoretische Aufgabenstellungen schätzen, sicherlich eine gute Entscheidung. Wenn diese Personen das Studium beenden, würden sie am Ende des Arbeitslebens, wenn alles gut ginge, das größte Einkommen vorweisen können. „Viele beginnen aber ein Studium und wären wahrscheinlich mit einer Ausbildung glücklicher.
Zudem sind sie damit ja nicht auf Ewigkeiten festgelegt, sondern haben die Möglichkeit im
Anschluss zu studieren oder einen anerkannten
Fortbildungsabschluss anzuschließen“, erklärt
Cornelia Kirchmayr, Leiterin der Weiterbildung bei der IHK Ostwürttemberg. Studierende, die »Eine Bildungsentscheidung ist im Grunde auch immer eine Art Investitionsentscheidung.«
IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle sich gedanklich mit einem Wechsel in eine duale Berufsausbildung beschäftigen, empfiehlt die IHK Ostwürttemberg gerne das persönliche Gespräch, denn hier gibt es viele Möglichkeiten, eine Ausbildung anzuschließen, abzukürzen oder sogar mit einem Fortbildungsabschluss direkt zu kombinieren. Damit stehen die künftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einkommenstechnisch in jedem Fall besser da, als wenn sie nach einem Studienausstieg direkt in einen Job wechseln.
Andre Louis: „Unsere Ausbildungsexperten unterstützen kostenlos bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf und einem geeigneten Ausbildungsbetrieb. Sie sprechen mit den Ausbildungsplatzsuchenden über ihre beruflichen Vorstellungen, erstellen ein Qualifikationsprofil und vermitteln den Kontakt zum potenziellen Ausbildungsbetrieb.“ Die IHK-Lehrstellenbörse www.ihk-lehrstellenboerse.de ist zudem eine gute Plattform, um nach dem geeigneten Ausbildungsplatz zu suchen. Dort veröffentlichen viele Ausbildungsbetriebe ihre freien Lehrstellen. Filterfunktionen nach Postleitzahlen oder Ausbildungsberufen erleichtern die Suche. Mehr Informationen dazu sowie zu weiteren Angeboten für Ausbildungs- und Wechselinteressierte der IHK Ostwürttemberg gibt es auf www.ostwuerttemberg.ihk.de in der Rubrik Ausbildung, speziell für Studienabbrecher auf der Seitennummer 3317472.. Kostenloser Download der Studie unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennr. 4726424.
Kumuliertes durchschnittliches Lebenseinkommen und höchster Bildungsabschluss
kumuliertes Lebenseinkommen in Euro

Alter in Jahre
Zahlen und Fakten
124,4 MILLIONEN
Von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland traten im Jahr 2019 rund 124,4 Millionen Fluggäste eine Flugreise an. Damit wurde der Höchstwert aus dem Jahr 2018 (122,6 Millionen Fluggäste) noch einmal übertroffen. Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr schwächte sich mit +1,5 Prozent aber deutlich ab (2018: +4,2 Prozent). Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
853.100 TONNEN
2018 wurden in Deutschland insgesamt 853.100 Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräte von Recycling- und Wertstoffhöfen und anderen Anlagen zur Erstbehandlung angenommen. 85,6 % dieser Geräte (729 900 Tonnen) wurden recycelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 1,7 % beziehungsweise 12 000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Die Recyclingquote, also Anteil der recycelten oder zur Wiederverwendung vorbereiteten Geräte an allen angenommenen Geräten, blieb jedoch nahezu unverändert (2017: 85,8 %). Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
989.800
Nach den vorläufigen Ergebnissen der amtlichen Schulstatistik besuchen im aktuellen Schuljahr in Baden-Württemberg rund 989.800 Schülerinnen und Schüler eine öffentliche allgemeinbildende Schule. Dies sind gut 4.600 weniger als im Vorjahr (−0,5 Prozent). Der Trend einer rückläufigen Schülerzahlentwicklung, der ab dem Schuljahr 2004/05 einsetzte, schwächt sich damit im Vergleich zum Vorjahr leicht ab. Seit dem Schuljahr 2003/04 sank die Schülerzahl um knapp ein Fünftel auf ihr diesjähriges Niveau. Quelle: Statistisches Landesamt
59 PROZENT
59 Prozent aller deutschen Unternehmen mit einer ortsfesten Breitbandverbindung und mindestens zehn Beschäftigten verfügten im Jahr 2019 über einen schnellen Internetanschluss. Darunter wird ein fester Breitbandanschluss mit einer vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verstanden. Damit ist der Anteil der Unternehmen mit schnellem Internet um 8 Prozentpunkte (2018: 51 Prozent) gestiegen. Im EU-Durchschnitt hat sich der Anteil mit 6 Prozentpunkten etwas schwächer erhöht als in Deutschland und lag im Jahr 2019 bei 54 Prozent (2018: 48 Prozent). Deutschland liegt damit wie in den Vorjahren im europäischen Mittelfeld. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
%3,1 Prozent2018 wurden in Deutschland 104,8 Mrd. Euro für Forschung und Entwicklung (F+E) ausgegeben. Der Anteil der F+E-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag damit bei 3,1 Prozent. Damit hat Deutschland nach derzeitigem Rechenstand das in der Wachstumsstrategie für die Europäische Union „Europa 2020“ festgelegte Ziel eines Anteils von mindestens 3 Prozent am BIP für Forschung und Entwicklung übertroffen. Dem Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2025, 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aufzuwenden, ist Deutschland mit einer Steigerung von 2,9 % in den Jahren 2015 und 2016 auf 3,1 % im Jahr 2018 jetzt nähergekommen. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
49,8 MILLIARDEN EURO
Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss. Mit 49,8 Mrd. Euro reicht dieser nicht ganz an das Rekordergebnis von 2018 heran, als der Staat einen Überschuss von 62,4 Mrd. Euro erzielt hatte. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (3 435,8 Mrd. Euro) errechnet sich daraus für den Staat eine Überschussquote von +1,4 Prozent (2018: +1,9 Prozent). Die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen profitierten damit weiterhin insbesondere von einer günstigen Beschäftigungsentwicklung. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
41.159

KILOGRAMM
Im Jahr 2019 wurden dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) Baden-Württemberg, der im Stuttgarter Regierungspräsidium angesiedelt ist, von der Polizei und anderen Behörden 852 Munitionsfunde (2018: 1.062) gemeldet. Die geborgene Munition hatte ein Gesamtgewicht von 41.159 Kilogramm (2018: 29.332 Kilogramm). Der Anstieg des Gesamtgewichts der Munitionsfunde ist der starken Baukonjunktur geschuldet. Zwar gingen im Jahr 2019 weniger Fundmeldungen ein, das Munitionsaufkommen an den einzelnen Fundorten hatte jedoch vielfach ein deutlich höheres Volumen als im Jahr 2018. Unter den Funden befanden sich 16 Bomben (2018: 14) mit einem Mindestgewicht von 50 Kilogramm. Quelle: Statistisches Landesamt
338.500
Am 1. März 2020 trat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, das die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten entsprechend dem Bedarf der Wirtschaft erleichtern soll. Laut Statistischem Landesamt waren zur Jahresmitte 2019 in Baden-Württemberg 338.500 Arbeitnehmer mit der Staatsangehörigkeit eines Drittstaats sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Bezogen auf die 4,75 Millionen (Mill.) sozialversicherungspflichtig Beschäftigten entsprach dies einem Anteil von 7,1 Prozent, gemessen an den 793.700 Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit betrug der Anteil 42,7 Prozent. Bundesweit waren 2019 insgesamt 1,92 Mill. Personen aus Drittstaaten sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter die meisten in Nordrhein-Westfalen (442 000) und Bayern (359 200), gefolgt von BadenWürttemberg. Der Anteil der Beschäftigten mit der Staatsangehörigkeit eines Drittstaats an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer lag in Berlin am höchsten (8,6 Prozent) gefolgt von Hessen (8,0 Prozent) und BadenWürttemberg (7,1 Prozent). Unter den ausländischen Beschäftigten waren in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin die Anteile der Beschäftigten aus Drittstaaten mit jeweils mehr als der Hälfte bundesweit am höchsten. Baden-Württemberg lag mit einem entsprechenden Anteil von 42,7 Prozent spürbar unter dem Bundeswert von 46,0 Prozent und lediglich auf Rang 11 der Bundesländer. Die Zahl der ausländischen Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Im Zeitraum 2014 bis 2019 nahm sie um 49 Prozent zu, wobei der Zuwachs bei den Beschäftigten aus den Drittstaaten in den letzten beiden Jahren sowohl zahlenmäßig als auch prozentual stärker ausfiel als bei den Beschäftigten aus den EU- und EFTA-Ländern.
51 PROZENT
Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2018 gut 51 Prozent ihres Konsumbudgets verwendet, um die Ausgaben für Wohnen, Ernährung und Bekleidung zu decken. Das waren je Haushalt durchschnittlich 1.390 Euro im Monat. Insgesamt lagen die Konsumausgaben der Haushalte bei monatlich 2.704 Euro. Das sind rund 10,5 Prozent mehr als bei der letzten Erhebung im Jahr 2013 (2.448 Euro) und 31,2 Prozent mehr als 1998 (2.061 Euro). Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
24 PROZENT
Die Zahl der Einpersonenhaushalte wird nach der neuen Vorausberechnung der privaten Haushalte von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3 Millionen im Jahr 2040 steigen. Damit werden 24 Prozent aller in Privathaushalten lebenden Menschen alleine wohnen. Im Jahr 2018 waren es 21 Prozent. Damit wird die Gesamtzahl der Privathaushalte von 41,4 Millionen im Jahr 2018 voraussichtlich auf 42,6 Millionen im Jahr 2040 zunehmen (+ 3 Prozent). Zugleich dürfte jedoch die Zahl der Menschen in Privathaushalten um rund 1 Prozent von 82,5 Millionen auf 81,7 Millionen sinken. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
930.000
Im April 2018 wurden in Deutschland 930.000 Jobs mit dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro brutto je Arbeitsstunde bezahlt. Damit hat sich die Zahl der Jobs mit Mindestlohn von 2015 bis 2018 mehr als halbiert (2015: 1,91 Millionen Jobs). Im April 2018 wurde in 2,4 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse der Mindestlohn gezahlt. In Ostdeutschland lag der Anteil mit 4,6 Prozent noch deutlich höher, allerdings nicht einmal halb so hoch wie 2015. Eine Tendenz zur Angleichung an das Westniveau ist damit deutlich erkennbar. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)
IHK-PRÄSIDENT MARKUS MAIER ÜBER DIE CHANCEN DER REGION UND ÜBER VERBESSERUNGSBEDARF SOWIE ÜBER DIE BEDEUTUNG EUROPAS FÜR DIE REGION
(Foto: IHK / Engelbert Schmidt)



Der Jahresempfang der IHK Ostwürttemberg ist auch in diesem Jahr wieder ein gesellschaftliches Ereignis gewesen. Dank des furiosen, temperamentvollen und begeisternden Auftritts von Lee Mayall und seiner Band war er darüber hinaus auch ein musikalischer Leckerbissen erster Güte. Rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft waren der Einladung ins IHK-Gebäude in Heidenheim gefolgt – 100 weniger, als sich ursprünglich angemeldet hatten. Die Absagen hatten fast ausschließlich einen einzigen Grund: Das Coronavirus. Dieses hatte auch in der regionalen Wirtschaft bereits deutliche Spuren hinterlassen, machte IHK-Präsident Markus Maier deutlich. Die Auslandskammern in China melden, dass kein einziges Mitgliedsunternehmen nicht vom Virus und seinen Folgen betroffen ist.
Im Mittelpunkt der Rede des Präsidenten standen aber nicht nur die weltweiten Probleme, mit denen auch die Wirtschaft in Ostwürttemberg zu kämpfen hat. Maier sprach regionale Themen an und verhehlte nicht, dass er in einigen Punkten erheblichen Verbesserungsbedarf sieht. Maier rief daher dazu auf, regionale Solidarität zu leben. „Mir geht es nicht um Kumpanei, sondern um Kooperation. Und am langen Ende wird jeder in irgendeiner Form davon profitieren!“
Verbesserungsbedarf in der Region sieht der Präsident bei der Infrastruktur. Hat man sich vor kurzem noch über den schleppenden Baufortschritt beim Agnesberg-Tunnel gewundert, so muss man sich erst recht beim nur wenige Kilometer entfernten Virngrund-Tunnel bei Ellwangen verwundert die Augen reiben. Für die zwei 468 Meter langen Röhren sind für betriebstechnische Neuerungen und Baumaßnahmen 17 Monate vorgesehen. Maier: „Ich frage mich, warum beansprucht dies einen derart langen Zeitraum. Wer über eine so lange Zeit mit seinen zwangsläufigen Verkehrsbehinderungen in den einschlägigen Radiomeldungen erscheint, sollte sich Gedanken machen. Die volkswirtschaftlichen Kosten sind erheblich, die im Einzelfall unkalkulierbaren Stauzeiten mehr als ärgerlich!“
EINHEITLICHE VERFAHREN
Wir wissen, ist er überzeugt, wie es besser und im Ergebnis schneller gehen könnte: Durch einheitliche Verfahren für alle Infrastrukturvorhaben, weniger Planungsstufen, zusammengeführte Plan- und Genehmigungsverfahren, verpflichtende Online-Portale, erweiterte Genehmigungsfreiheiten, verkürzte Gerichtsverfahren über Instanzenregelungen und mehr Planungssicherheit durch Präzisierung von Rechten und das Schaffen von verbindlichen Normen. Und: Die Information an den Baustellen über die geplante Dauer der Maßnahmen fehlt. Maier: „Wir geben Millionen für jeden einzelnen Kilo-

meter aus, sparen aber an ein paar Tafeln. Information würde fast zwangsläufig zu besserer Akzeptanz führen!“
Doch es gab auch Lob vom Präsidenten. Die Verkehrskonferenz für Oberkochen/Königsbronn und damit für den Großraum zwischen Aalen und Heidenheim nennt er ein bemerkenswertes Vorhaben. Das gilt für das Wie, nämlich Aufgaben gemeinschaftlich, stadt- und kreisübergreifend anzugehen, das Wissen aus der Region mit externem Know-how zu verschmelzen. Für Maier ein hervorragender Ansatz, der gleichzeitig auch das Was würdigt. Er ist sich nämlich sicher, dass wir dabei neben traditionellen Lösungsvorschlägen, die wir brauchen, auch innovative Überlegungen gewinnen, die wir wünschen.
Über das Thema hinaus gilt ihm zufolge, dass wir immer dann stark waren, wenn wir die Kräfte in Ostwürttemberg gebündelt haben. Immer dann, wenn wir zugunsten des Ganzen auf einen individuellen standortpolitischen Vorteil verzichtet haben. Maier: „Setzen wir den weltweiten Antagonismen, die es zuhauf gibt, unser Regionaldenken entgegen. Und wenn es einmal klemmt, wenn persönliches Miteinander hintangestellt wird, sollten wir der Lösung den Vorzug geben!“ Und das ist die regionale Solidarität.
DEUTSCHLAND FÜHRT WELTWEIT
Erfreuliches erkannte Maier auch mit dem Blick auf Deutschland. Das Land führt weltweit den aktuellen Innovations-Index einer bekannten Nachrichtenagentur an. Es toppt somit Südkorea, das sechs Jahre lang an der Spitze stand. Das ist Deutschland gelungen dank einer Industrie, die von vielen als digitaler Nachzügler betrachtet wurde. Nach vorne gebracht haben unsere deutsche Wirtschaft offenbar die Kriterien Wertschöpfung, High-Tech-Dichte und Patentaktivität. Der Maschinenbau bleibt der Analyse zufolge ein Rückgrat der Wirtschaft. Maier: „Die Leistung Deutschlands bei solchen Indikatoren ist also nach wie vor stark und Volkswirtschaftler sagen, sie sei weit besser als die jüngste Wirtschaftsschwäche möglicherweise vermuten lässt.“
Mit der Wertschöpfung, fügte er hinzu, mit der High-Tech-Dichte, mit Investitionen in Forschung und Entwicklung und bei den Patenten können wir in Ostwürttemberg seit Jahren punkten und haben mitgeholfen, dass Baden-Württemberg die Nummer eins in der bundesweiten Patentstatistik geworden ist. Maiers Schlussfolgerung: „Ich denke nicht, dass wir allzu sorgenvoll in die Zukunft schauen müssen.“ Dass deutschlandweit in diesem Jahr das Wachstum bescheiden ausfallen wird, damit hat man sich bereits abgefunden, sagte Maier, bevor das Corona-Virus aufgetreten ist. „Diese Hoffnung geben wir nicht auf!“ In einer Zeit, die fraglos zum „Hype“ neigt, wie Maier weiter sagte, solle man sich an den Namensgeber der Straße erinnern, an der sich das IHK-Gebäude befindet. An Ludwig Erhard, der gebetsmühlenartig wiederholt hat, dass Wirtschaft zu 50 Prozent Psychologie ist, woran sich nichts geändert hat.
NEU NACHDENKEN ÜBER EUROPA
Maier: „Das Grenzenlose und die Wucht der weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen sollten meines Erachtens zu einem neuen Nachdenken über die Rolle Europas und die Bedeutung des Binnenmarkts in der EU führen. Gerade wir hier in Ostwürttemberg wissen, mit über 50 Prozent Exportanteil unserer Industrie, dass wir nur mit der EU als großem integriertem Wirtschaftsraum im internationalen Wettbewerb eine hörbare Stimme haben.“
Erachtens zu einem neuen
Nachdenken über die Rolle
Europas und die Bedeutung des Binnenmarkts in der
EU führen.«
Das Coronavirus und seine Folgen trifft Ostwürttemberg ebenso wie ganz Deutschland, sagte der Präsident weiter. China fällt temporär als Markt aus und kann nicht oder nur bedingt liefern. „China ist als Kunde derzeit nicht mehr präsent.“ Jedes verantwortungsvolle Unternehmen hat deshalb an Notfallplänen gearbeitet. Maier: „Offen bleibt die Frage, wie lange der Ausnahmezustand läuft. Keiner kann dies momentan einschätzen.“ Hier wie bei anderen Themen sei das Ende offen: Bei der Zukunft des chinesischen Regimes, beim Brexit und bei der rigiden amerikanischen Wirtschaftspolitik.
DANK FÜR ENGEN AUSTAUSCH
Der IHK-Präsident sprach auch den rassistischen Anschlag in Hanau an, wenngleich er sich einer allgemein politischen Aussage aufgrund einer höchstrichterlichen Entscheidung enthalten musste. Die Folgen für das Ansehen unseres Landes im Ausland aber nannte er fatal. Das deutsche Bild im Ausland ist Maier zufolge nicht nur für das Wirtschaften bedeutsam, es ist auch die Frage, wie es sich auswirkt auf Menschen, die vom Ausland zu uns kommen, um hier zu studieren oder zu forschen, weil sie als Fachleute willkommen sind, weil sie unser Kulturleben bereichern können oder weil sie als Gäste unser Land bereisen und kennenlernen wollen. Der IHKPräsident: „Unser Ruf nach Sicherheit, Zuverlässigkeit und Freiheit klingt politisch, ist am Ende
jedoch das Fundament unserer Wirtschaft!“ Zu Beginn seiner mit viel Beifall aufgenommenen Rede hatte Maier allen Gästen dafür gedankt, dass sie den engen und konstruktiven Austausch mit ihrer IHK pflegen. „Wir wissen Ihre Expertise, sei es aus Politik, Bildung und Wissenschaft, Verwaltung und etwa 34 000 Mitgliedsunternehmen, sehr zu schätzen. Erst mit Ihnen, speziell mit den mehr als 2000 ehrenamtlich für unsere IHK Tätigen, ist eine erfolgreiche Arbeit überhaupt erst möglich!“
IHK-JAHRESEMPFANG 2020 In der digitalen Zukunft
FESTREDNER DR. JAN MROSIK, CHIEF OPERATING OFFICER (COO) VON SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES, ÜBER UMWÄLZUNGEN IN DER WIRTSCHAFT, DIE CHANCEN DER DIGITALISIERUNG UND WAS UNTERNEHMEN TUN MÜSSEN
Die digitale Zukunft hat bereits begonnen und sie bringt große Umwälzungen mit sich. Deshalb dürfen Unternehmen nicht warten, bis die Wettbewerber sie überholen, denn dann haben sie keine Zeit mehr, dies aufzuholen. Diese Überzeugung hat Dr. Jan Mrosik als Festredner beim Jahresempfang der IHK Ostwürttemberg vertreten. Er sagte aber auch, Deutschland habe keinen Grund, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Hier agierten viele Weltmarktführer und viele CEO seien visionär und mit einem Plan unterwegs. Vor allem machte Mrosik deutlich, welche Veränderungen und welche großen Chancen die – unaufhaltsame – Digitalisierung für die Industrie von morgen mit sich bringt.
Dr. Jan Mrosik ist seit April vergangenen Jahres Chief Operating Officer (COO) der Siemens Operating Digital Industries und seit 1986 bei der Siemens AG tätig. Als eine der drei Operating Companies des Unternehmens beschäftigt Digital Industries mit Sitz in Nürnberg rund 76.000 der weltweit etwa 385.000 Mitarbeiter des Konzerns und bietet Automatisierungs-, Digitalisierungs- und Transformationslösungen für die Industrie. Sein Unternehmen setzt auf Megatrends, sagte der gebürtige Freiburger Mrosik seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die gespannt und aufmerksam seinem kurzweiligen und informativen Vortrag folgten. Diesen hatte er mit „Digitalisierung und IoT (Internet der Dinge) überschrieben. Megatrends sind ihm zufolge etwa die Globalisierung, die Urbanisierung, der demografische Wandel, der Klimawandel und eben die Digitalisierung. 2007 hätten bei Siemens virtuelle und reale Welt begonnen zusammenzuwachsen. Das Unternehmen habe seither zehn Milliarden Euro für 35 Akquisitionen aufgewendet und so ein Portfolio aus einem Guss geschaffen. Plattformen, Software und Know-how hätten in der digitalen Transformation zusammenkommen müssen.

Für Dr. Jan Mrosik, Chief Operating Officer (COO) der Siemens Operating Digital Industries sind die Megatrends die Globalisierung, die Urbanisierung, der demografische Wandel, der Klimawandel und vor allem die Digitalisierung. (Fotos: IHK)
Die Herausforderungen von heute seien beispielsweise, nachhaltiger zu produzieren, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig auf die Qualität zu achten. Alle diese Fragen beantworte eine voll digitalisierte Wirtschaft, aber sie sei disruptiv. Das bedeute, es werde bei der digitalen Transformation dramatische Änderungen geben, wenn die Welt der Maschinen mit der virtuellen Welt verschmelze. Die ungeheuren Vorteile liegen für Mrosik klar auf der Hand. Erst wird das Produkt in der Software simuliert und dann erst in der realen Welt tatsächlich hergestellt.
DIGITALE ZWILLINGE
Bisher, sagte er weiter, habe man Prototypen – ebenfalls in der realen Welt – extrem ineffizient hergestellt. Künftig wird das Produkt virtuell designt und simuliert, so lange, bis es passt. Fast beliebig lange, denn es könne ja nichts kaputt gehen. Und nicht nur das Produkt: Ganze Fertigungen, ja sogar Fabriken werden nach seinen Worten erst virtuell, als digitaler Zwilling, in Betrieb gehen, ehe es in der realen Welt ernst wird. Es sei das Zusammenspiel von Digitalisierung, Automatisierung und Technologie, also eine voll digitale Wertschöpfungskette.
Produktion und Fertigung würden dadurch deutlich effektiver und kostengünstiger, wie der Referent an Beispielen eindrucksvoll belegte. Da war von 30 Prozent Effizienzsteigerung die Rede, von 50 Prozent kürzeren Entwicklungszeiten, von 60 Prozent geringeren Herstellungskosten, von 25 Prozent mehr Produktivität, in einem Fall bei Siemens sogar von 1.400 Prozent mehr Produktivität bei gleich bleibender Mitarbeiterzahl. Man werde überall und jederzeit produzieren können, Systeme würden automatisiert und so eigene Entscheidungen treffen. Man werde genau bilanzieren können, ob man die CO2-Ziele schaffe und die Herkunft seiner Produkte nachvollziehen können. Die Einsparungsmöglichkeiten seien massiv, Roboter würden mit Robotern zusammenarbeiten.
All das, auch daran ließ Mrosik keinen Zweifel, gehe jedoch nicht ohne die passende Technik, die mit der Funktechnologietechnik 5G im Anmarsch sei. Erst sie ermögliche die virtuellen Anwendungen, die der Festredner skizziert hatte. Er unterstrich: „5G wird für die Unternehmen eine erhebliche Rolle spielen.“ Dieses Netz müsse jedes Unternehmen aufbauen und nutzen. „Sonst entgeht Ihnen Kapital!“
MENSCH KEINE KONKURRENZ ZUR MASCHINE
Mrosik warnte vor dem Versuch, Mensch und Maschine in Konkurrenz gegeneinander treten zu lassen. Menschen hätten Fähigkeiten, die Maschinen abgehen, etwa Kreativität, Koordination und Empathie. Es gehe also nicht darum, Menschen gegen Maschinen einzusetzen, sondern Menschen und Maschinen. Man müsse auch berücksichtigen, dass vieles nicht auf Anhieb funktioniere. Digital finde man immer eine Lösung.
Im Dialog mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle räumte Mrosik ein, dass Deutschland die Digitalisierung zwar nicht verschlafen habe, dass es aber Probleme bei Clouds und Cloudplattformen gebe. Daher habe sich Siemens vollkommen unabhängig von den Anbietern gemacht. „Es gibt Bereiche, wo wir aufholen müssen“. Das sah Michaela Eberle ebenfalls so, um dann aber stolz darauf hinzuweisen, dass die Region Ostwürttemberg das Digitalisierungszentrum (digiZ) mit den Standorten in Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd hat. Mit dem Gast gab sie den Startschuss für ein neues Projekt. Auszubildende werden sogenannte Digital Leaders. Gemeinsam wollen die IHK Ostwürttemberg und das digiZ Azubis methodisch so weiterbilden, dass sie in der Lage sind, ein eigenes kleines Digitalisierungsprojekt zu entwickeln.
Die Azubis selbst sagten im Gespräch mit der IHK-Hauptgeschäftsführerin, sie wollten in den Firmen etwas bewirken, neue Lösungsmöglichkeiten finden, möglichst etwas, das noch gar nicht da ist. Und sie wollten sich auch auf der persönlichen Ebene weiterentwickeln. Diese Aussagen ließen Michaela Eberle vor Freude über das ganze Gesicht strahlen.
NEU: DIGITAL LEADERS
Sechs Schritte bis zum „Digital Leader“ sind vorgesehen: Nach der Auftaktveranstaltung werden in einzelnen Gruppen Digitalisierungspotenziale analysiert und erschlossen. Daraus entsteht ein Projektvorschlag, der zunächst Ausbildern, IHK, digiZ und anderen Gruppen und danach der Geschäftsleitung präsentiert wird. Gibt diese grünes Licht, folgen Umsetzung und Evaluation. „Super“, geizte Mrosik nicht mit Lob für das unternehmens- und berufsübergreifende Projekt. „Das ist genau das Richtige und führt in den praktischen Bereich hinein. Macht es möglichst groß und habt viel Spaß dabei. Bürstet
IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle im Gespräch mit Dr. Jan Mrosik.


gegen den Strich! Das wird ein Selbstläufer!“ (Siehe dazu Seite 51)
Wie schon in der Rede von IHK-Präsident Markus Maier spielte das Thema Europa auch im Dialog von Mrosik und Michaela Eberle eine Rolle. „Was wünschen Sie sich von der EU der Zukunft?“, hatte sie gefragt. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Europa ist alternativlos!“ Denn die Einzelstaaten des Kontinents, sagte der Festredner, würden in der Welt nicht gehört, Europa aber werde sehr wohl wahrgenommen. Und auch wenn es darum gehe, Digitalisierungsdefizite auszugleichen, sei Europa stärker als einzelne Staaten allein.
Michaela Eberle war es auch, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IHK dankte, die beim Jahresempfang im Einsatz waren und sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten. Für beste musikalische Unterhaltung sorgten auch hier Lee Mayall & Band.

»Liebe Leserinnen und Leser, natürlich haben wir darüber nachgedacht, ob es in der aktuellen
Situation angebracht ist, diese Seite mit Impressionen des Jahres empfangs wie in ‚üblichen‘ Zeiten zu gestalten.
Und wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden. Denn es ist aktueller denn je, dass eine gesunde Wirtschaft, gesunde Netzwerke, gesunde Menschen und ein gesundes Augenmaß an politischen Rahmenbedingungen benötigt.«











Michaela Eberle IHK-Hauptgeschäftsführerin

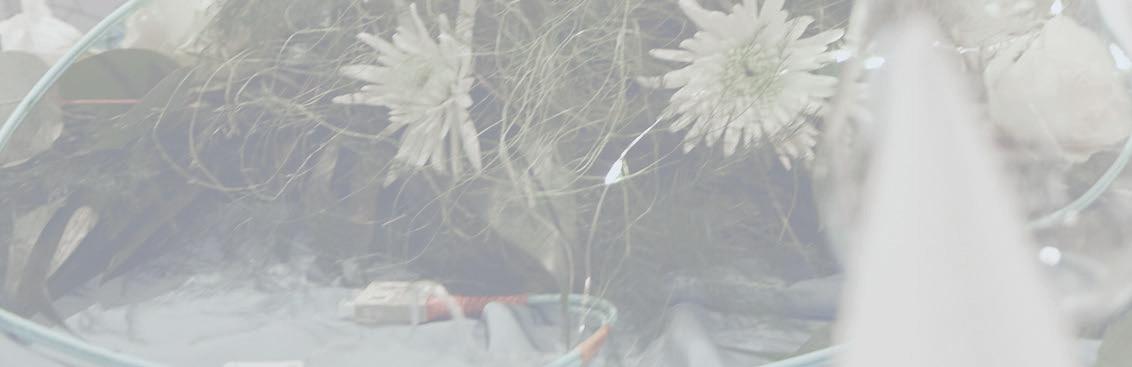
2020 IMPRESSIONEN IHK-JAHRESEMPFANG

























