

Lösungsheft
Rationale Antworten auf emotionale Fragen.
FINANZBILDUNG:
Warum wir über Geld reden müssen.
TAKTGEBER:
Vom Dirigieren für die Führung lernen.
KLARHEIT STATT CHAOS: UMIT TIROL: eine Bestandsaufnahme









Exklusive Saggenvilla in bester Lage
Stilvolles Juwel
1914 errichtet besticht die historische Villa im Innsbrucker Saggen heute noch mit ihrem ursprünglichen Charme, der mit viel Liebe zum Detail erhalten wurde. Gepaart mit modernster Technik eröffnet sich das stilvolle Ambiente über drei Stockwerke hinweg bis hin zum Pavillon im gepflegten Garten. Aktuell befindet sich im ersten Obergeschoss auf einer Fläche von 131 Quadratmetern eine Arztpraxis, das Erdgeschoss sowie das zweite Obergeschoss bieten großzügige Wohnflächen inklusive Fitnessraum, Schrankraum, Terrasse und Wintergarten. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz und verfügt über ein Notstromaggregat.
GESAMTWOHNFLÄCHE: 377 M² AUF DREI ETAGEN
KELLER, LIFT, PAVILLON, GARAGE UND MEHRERE PKW STELLPLÄTZE VOR DEM HAUS
Unverbindliche Besichtigung nach Terminvereinbarung unter 0676-9069525!
6114 KOLSASS, FLORIAN-WALDAUF-STR. 28 Telefon 0676-90-69-525 info@immokirchmair.at www.immokirchmair.at

eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin Marina Bernardi
DAS JAHR DER MÖGLICHKEITEN
Wer nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Künftige Herausforderungen lassen sich jedoch nur selten mit vergangenen Methoden lösen. Lassen Sie uns deshalb ordentlich in der Werkzeugkiste kramen.
Die Aussichten aufs heurige Jahr sind wahrlich betrüblich. Die Umfrage der Wirtschaftskammer unter Tirols Tobetrieben fällt ebenso wenig erfreulich aus wie das Stimmungsbarometer der Industrie. Nach derzeitigem Stand soll Österreichs Wirtschaftsleistung heuer nur um 0,6 Prozent zulegen. Sagt das WIFO. Wir haben definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Auch (welt)politisch. Und gesamtgesellschaftlich. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: Wir können uns in Selbstmitleid suhlen, jammern und sudern, den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass wieder bessere Zeiten kommen, bevor wir dort unten ersticken, oder wir können das Beste daraus machen. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade daraus, heißt es. Alternativ können Sie einen Tequila dazu bestellen. Selbst in düsteren Zeiten hat man immer eine Wahl.
In der ersten Ausgabe geben wir traditionell einen Ausblick auf das Jahr: Was kommt, was geht, was bleibt? Heuer machen wir das anders und ändern ein wenig die Perspektive. Wir schauen uns nicht an, was wird, sondern was ist und wie es besser werden kann. Dazu haben wir uns die drei Bereiche Energie, Wohnen und Verkehr herausgepickt und mit Experten (in dem Fall ist das Gendern tatsächlich hinfällig) erörtert, wo es hakt und was man tun kann, um es in Zukunft anders zu machen. Viele Lösungen liegen bereits in den Schubladen. Es ist höchste Zeit, sie dort herauszuholen und zur Umsetzung zu bringen. Außerdem haben wir mit Martin Granig über das Thema Finanzbildung gesprochen – auch die ist eine Baustelle in unserem Land. Granig ist bereits von Reden ins Tun gekommen und hat mit Monkee ein Unternehmen gegründet, mit dem er Menschen hilft, ihre finanzielle Gesundheit zu verbessern und ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. Zudem haben wir Gerrit Prießnitz, den Chefdirigenten des Tiroler Landestheaters, und Susanne Fohr, Orchesterdirektorin des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck, zum Gespräch getroffen. Wir haben dabei nicht nur einiges über Musik gelernt, sondern auch, was das Dirigieren mit Führungsqualitäten zu tun hat und was man daraus fürs Unternehmertum mitnehmen kann.
Wer nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
Probleme lähmen, Lösungen treiben an. Wer sich nur auf das Problem fokussiert, verstärkt es in Gedanken – es wächst, scheint unüberwindbar. Wer jedoch in Lösungen denkt, öffnet den Blick für neue Wege, für Chancen und Handlungsmöglichkeiten. Lösungen bringen Fortschritt. Richten wir also den Fokus auf das, was möglich ist.
Denken wir in Lösungen, nicht in Problemen! Ihre Redaktion der eco.nova







FOTOS: ANDREAS FRIEDLE, WETSCHER, UMIT TIROL/KATHARINA KERN, EMPL, MARIAN KRÖLL, TOM BAUSE
ECO.TITEL
14 NEUE ENERGIEZUKUNFT
Für die Energiesysteme der Zukunft muss die Energiegeschichte neu geschrieben werden. Dazu müssen wir uns womöglich von einer Erzählung der Energiewende verabschieden, die so gar nie wirklich stattgefunden hat.
18 ( UN ) LEISTBARES WOHNEN
Messbare Fortschritte beim schwer messbaren Ziel nach „leistbarem Wohnen“ sind nicht wirklich zu beobachten. Eine Wohnbedarfsstudie soll helfen.
24 VERKEHRSPLANUNG
Tirol steht vor Verkehrsproblemen, die sowohl die Lebensqualität als auch die Umwelt betreffen. Lösungsansätze können nur durch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft gefunden werden.
ECO.WIRTSCHAFT
28 WOHN - SINN
Die Stimmung in der heimischen Wirtschaft ist nach wie vor angespannt, besonders der Handel leidet unter der anhaltenden Rezession. Auch den Möbelhandel hatʼs erwischt. Martin Wetscher im Interview.
ECO.ZUKUNFT
38 NISCHENWELTMEISTER
Das Familienunternehmen Empl hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem weltweit anerkannten Hersteller von LKWSonderaufbauten entwickelt. Die Geschichte eines Hidden Champion.
44 BESTANDSAUFNAHME
UMITTIROLInterimsrektor
Rudolf Steckel über Lehre und Forschung, Geld und Image und warum Tirol die Privatuniversität weiterhin braucht.
ECO.GELD
50 FINANZBILDUNG
Wir haben mit MonkeeCoFounder und CEO Martin Granig über Geld gesprochen.
ECO.MOBIL
66 RINGE - GOLF
Im Jahr 1996 erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt, verpasst Audi der mittlerweile vierten Modellgeneration des Audi A3 ein ordentliches Facelift.
68 KOMPAKTES CROSSOVER
Ein Mini ist mehr als ein Auto. Mini ist Kult. Der Countryman SE im Test.
70 ITALIANITÀ AUF RÄDERN
Als Nachfolger des 500X konzipiert, präsentiert sich der neu erschienene Fiat 600 von seiner besten Seite.
ECO.LIFE
76 DAS RICHTIGE GESPÜR
Zwischen dem Führen eines Betriebes und dem Leiten eines Orchesters bestehen auffallend viele Parallelen. Ein musikalisches Interview.
03 EDITORIAL
10 KOMMENTAR
12 KREATIVE IMPULSE
60 ECO.SERVICE
82 KULTUR.TIPP
84 HOTEL.TIPPS
88 IM.GESPRÄCH
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, DI Caterina Molzer-Sauper, Katharina Reitan // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // eco. life: Marina Bernardi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Matteo Loreck LAYOUT: Tom Binder LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH
UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco.nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben).
// Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!
traumjobs
auf den punkt.
unser team begeistert mit leidenschaft, expertise & ausgezeichneter kulinarik –prämiert mit drei hauben von gault&millau!
sei dabei - wir suchen:
• chef de rang – für erstklassigen service mit herz
• lehrling für service & küche – dein einstieg in die spitzen-gastronomie
dein upgrade in der gastro:
• 4- oder 5-tage-woche –flexibel nach vereinbarung
• freie tage: sonntag & montag oder individuell abgestimmt
• kreativer freiraum & entwicklungsmöglichkeiten
• top trinkgeld & wertschätzende gäste
• ganzjahresstelle in einem stilvollen, gepflegten lokal
• ein großartiges team & familiäres betriebsklima
das grander
+43 (0) 52 24 52 6 26 info@das-grander.at das-grander.at
DIE VERMESSUNG DES JAHRES
Wie haben die Österreicher*innen das vergangene Jahr erlebt? marketagent hat nachgefragt.
SPORT UND BEWEGUNG
14,6
x
WAREN DIE BEFRAGTEN 2024 IM SCHNITT IM FITNESSSTUDIO.
12,4 x WANDERN
5,7 x IN EINEM ÖFFENTLICHEN SCHWIMMBAD 1,8 x SKIFAHREN / SNOWBOARDEN
BESONDERS DIE GENERATION Z BEVORZUGT BEIM SPORT DAS FITNESSSTUDIO, WÄHREND DIE ÄLTERE GENERATION LIEBER WANDERT. GENERELL HAT SICH DAS WANDERN SEIT DER PANDEMIE ZUM TREND ENTWICKELT. INSGESAMT SIND DIE ÖSTERREICHER*INNEN SEIT 2017 DEUTLICH AKTIVER GEWORDEN.
8,9
NÄCHTE
WURDEN 2024 IM SCHNITT IN EINEM HOTEL IM AUSLAND VERBRACHT
MOBILITÄT
99,1
TAGE
SIND DIE BEFRAGTEN IM SCHNITT OHNE AUTO AUSGEKOMMEN / IN KEINEM AUTO GESESSEN
SIE FUHREN
42,8 x MIT DEM BUS / 34,3 x MIT DER BAHN
3,3 x MIT DEM TAXI/UBER UND FLOGEN 2,1 x
5,8
NÄCHTE
VERBRACHTEN DIE ÖSTERREICHER*INNEN DURCHSCHNITTLICH IN EINEM HOTEL IM INLAND
DIE MOBILITÄTSDATEN ZEIGEN DEUTLICH: DAS JAHR 2024 MARKIERT DEN ENDGÜLTIGEN ABSCHIED VON DEN CORONAJAHREN. DIE HOTELNÄCHTIGUNGEN LIEGEN NATURGEMÄSS DEUTLICH ÜBER JENEN DES JAHRES 2020, ALLERDINGS AUCH KLAR ÜBER JENEN VON 2017. DIE AUTOFREIEN TAGE, BUS-, BAHN- UND TAXIFAHRTEN SOWIE DIE GETÄTIGTEN FLÜGE HABEN SICH NACH STARKEN ABWEICHUNGEN IN DEN CORONAJAHREN GROB AUF 2017ER-NIVEAU EINGEPENDELT, WOBEI DIE TAGE OHNE AUTO ANGESTIEGEN SIND.
FREIZEIT & UNTERHALTUNG
3,2 x
WAREN DIE BEFRAGTEN 2024 IM SCHNITT ZU EINER HEILIGEN MESSE IN DER KIRCHE
SIE WAREN WEITERS
2,1 x IM KINO
1,5 x BEI EINEM LIVE-SPORTEVENT, WOFÜR MAN EIN TICKET BENÖTIGT
1,4 x IM MUSEUM
1,0 x AUF EINEM LIVE-KONZERT
1,0 x IM THEATER/MUSICAL ODER IN DER OPER 0,8 x IN EINEM KABARETT
0,6 x IM CASINO
DIES STUDIENERGEBNISSE ZEIGEN, DASS KULTUR- UND SPORTVERANSTALTUNGEN ZWAR WIEDER FESTER BESTANDTEIL DES LEBENS IN ÖSTERREICH SIND, DENNOCH BLEIBEN DIE BESUCHSFREQUENZEN UNTER DEN WERTEN VON 2017 – EIN HINWEIS AUF VERÄNDERTE PRÄFERENZEN ODER PRIORITÄTEN. VOR ALLEM KINO- UND KIRCHENBESUCHE GINGEN AUFFÄLLIG ZURÜCK.
57,9 TAGE
KAMEN DIE BEFRAGTEN IM SCHNITT OHNE FERNSEHEN AM TV-GERÄT AUS
9,5 TAGE
WURDEN INTERNETFREI VERBRACHT
10,5 x
WAREN DIE BEFRAGTEN 2024 IM MITTEL IN EINEM MODEGESCHÄFT
7,5 x IN EINEM BAU- ODER GARTENMARKT
5,0 x IN EINEM SCHUHGESCHÄFT
4,6 x IN EINER BUCHHANDLUNG / BÜCHEREI
4,2 x IN EINEM MÖBEL-/EINRICHTUNGSGESCHÄFT
3,7 x IN EINEM ELEKTROGESCHÄFT
3,1 x IN EINEM SPORTGESCHÄFT
27,9 x
WURDE IM INTERNET BESTELLT / IN EINEM ONLINESHOP GEKAUFT
GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN
8,8 TAGE
BEFANDEN SICH DIE BEFRAGTEN DURCHSCHNITTLICH IM KRANKENSTAND
SIE WAREN AUSSERDEM
6,6 x BEIM ARZT
2,2 x BEIM ZAHNARZT
1,5 TAGE ALS PATIENT IM KRANKENHAUS
0,4 x BLUTSPENDEN
18 x
IM JAHR HABEN DIE STUDIENTEILNEHMER*INNEN IM SCHNITT EIN VOLLBAD IN DER BADEWANNE GENOMMEN.
5,4 x WAREN SIE BEIM FRISÖR / 3,2 x IN DER SAUNA / 1,0 x IM SOLARIUM
3,0 x WURDE EINE MASSAGE IN ANSPRUCH GENOMMEN / 1,7 x EINE KOSMETIKBEHANDLUNG
1,8 x THERMENBESUCHE
EMOTIONALE MOMENTE:
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die hohe Belastung durch Stress im Alltag. Besonders angespannt zeigt sich die Situation der Generation Z und der Millennials. Diese Altersgruppen berichten mit 68,5 bzw. 72,1 Tagen deutlich größeren Leidensdruck als die Generation X (54 Tage) und Babyboomer (26,6 Tage). Besorgniserregend ist vor allem der Wellenvergleich: Der Stresslevel nahm gegenüber 2020 signifikant zu (Schnitt 2024: 55,3 Tage / Schnitt 2020: 42,6 Tage). Und auch ein Gefühl wird durch die Umfrage bestätigt: Die Emotionen der heimischen Bevölkerung kochen schneller und stärker hoch. Die Befragten gaben an, mehr zu weinen, außerdem wird deutlich mehr gestritten. „Die Kombination aus globalen Krisen und individuellen Belastungen scheint die emotionale Belastbarkeit auf die Probe zu stellen. Gleichzeitig kann dies aber auch ein Hinweis auf eine zunehmende Sensibilität für eigene Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen sein“, analysiert Studienleiterin Andrea Berger.
• Babyboomer: geboren zwischen 1946 und 1964 (Nachkriegsgeneration / geburtenreichste Jahrgänge / Wirtschaftswunder erlebt / Arbeit hat hohen Stellenwert)
• Generation X: geboren zwischen 1965 und 1979 (von Wirtschaftskrise geprägt / berufliches Vorankommen wichtig / ausgeprägtes Konsumverhalten / Streben nach hoher Lebensqualität)
• Millennials: geboren zwischen 1980 und 1993 (erste Digital Natives / mit Globalisierung groß geworden / hohes Bildungsniveau / Arbeit und Privatleben verschmelzen)
• Generation Z: geboren zwischen 1994 und 2010 („Generation Smartphone“ / Differenzierung zwischen Arbeit und Privatleben / unsichere Zukunft / Selbstverwirklichung in der Freizeit gesucht)

BEZIEHUNGSSTATUS:
ES BLEIBT KOMPLIZIERT
Die wirtschaftliche Lage in Tirol bleibt angespannt: Laut den aktuell vorliegenden volkswirtschaftlichen Kennziffern erwartet die Wirtschaftskammer Tirol aufgrund einer Bundesländerprognose des Forschungsinstituts economica für das Jahr 2025 ein reales Wachstum der Bruttowertschöpfung zwischen 0,5 und 0,9 Prozent. Laut der regelmäßigen TopTirolBefragung bewerten aktuell außerdem nur 21 Prozent der Leitbetriebe ihre wirtschaftliche Situation als gut, während 30 Prozent sie als schlecht einstufen. Besonders die Tiroler Industrie, die Bauwirtschaft und der Handel leiden unter Auftragsmangel, hohen Lohnstückkosten, hohen Zinsniveaus und Konsumzurückhaltung. Der Wirtschaftsstandort hat generell an Wettbewerbsfähigkeit verloren, was zu struktureller Wachstumsschwäche führt. Die größte Wachstumsbremse für Tirols Wirtschaft sind dabei die hohen Arbeitskosten. Gleich danach findet sich der unrühmliche „Aufsteiger“: Bei der TopTirolUmfrage vor einem Jahr wurden bürokratische Aufgaben noch von 27 Prozent der Betriebe als Problem genannt, aktuell sind es 62 Prozent. Die Bürokratie ist damit das zweitgrößte Wachstumshemmnis geworden. Ein drängendes Problem ist außerdem die stagnierende Investitionstätigkeit. Viele Unternehmen sind aktuell nicht bereit oder nicht in der Lage, notwendige Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Unsicherheiten über die wirtschaftliche Entwicklung, hohe Kosten und eine unzureichende steuerliche Entlastung bremsen wichtige Projekte. Positive Wachstumsimpulse indes kommen aus dem Tourismus, dem Gewerbe (ohne Bau) und teilweise aus dem Bereich Information und Consulting. Potentielle Handelskonflikte mit den USA und China, volatile Energiemärkte und innen und außenpolitische Unsicherheiten lassen Tiroler Unternehmen alles in allem allerdings eher pessimistisch auf 2025 blicken.
Die detaillierte Konjunkturbarometer-Broschüre gibt’s hier zum Download.


DEZ-Center-Manager Florian Prodinger
REKORDJAHR
Mit Vollvermietung, sieben Millionen Besucher*innen und einer Umsatzsteigerung von acht Prozent zählt das Einkaufszentrum DEZ im Osten von Innsbruck zu den erfolgreichsten Einkaufszentren Österreichs. Auf einer Gesamtfläche von rund 7.000 Quadratmetern wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Neueröffnungen und Umbauten realisiert, ein Meilenstein war die Eröffnung des ersten Nike-Stores Westösterreichs und die Fertigstellung des Interspar Hypermarkts, der nach sechs Monaten Umbauzeit als modernster Supermarkt Tirols seine Türen öffnete. Neben weiteren Modernisierungsmaßnahmen ist auch für 2025 die Ansiedlung weiterer neuer Marken geplant.
BAUWESEN TRIFFT MASCHINENBAU
Die WESTCAM Group, basierend auf der Westcam Datentechnik GmbH aus Mils und mittlerweile vier Unternehmen umfassend, hat sich Ende des letzten Jahres mit auxalia mit Hauptsitz in Hamburg zusammengetan, einem der führenden Softwareanbieter für das Bauwesen auf Autodesk-Basis in der DACH-Region. Bis dato deckte jeder Partner jeweils eine Kernkompetenz schwerpunktmäßig ab: Während auxalia primär im Bauwesen punktete, lag der Fokus von WESTCAM auf Produktdesign und Fertigung. Die Fusion komplettiert strategisch somit die Angebotspalette des jeweils anderen und ergibt ein ganzheitliches Portfolio, mit dem man Lösungen in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit bieten möchte. So sollen unter anderem komplexe Bauplanungsprozesse einfach und effizient gestaltet werden. Die Bündelung erfolgt mittels gemeinsamer Holding, auxalia und WESTCAM bleiben als Unternehmensmarken bestehen. Die neue Tech-Gruppe geht mit einem rund 180-köpfigen Expert*innenteam in die Zukunft.

auxalia-CEO Andreas Hofherr und Westcam-CEO Markus Ebster
ARBEITGEBERQUALITÄT: TOP
Bereits zum siebten Mal in Folge konnte Novartis Österreich mit seinem Standort für Innovative Medizin in Wien und den beiden Entwicklungs- und Produktionszentren in Kundl und Schaftenau in Tirol internationale Auditoren überzeugen und die begehrte Auszeichnung als „Top-Employer“ erlangen. Besonders punktete Novartis in den Bereichen „Geschäftsstrategie“, „Arbeitsumfeld“, „Wellbeing“ und „Ziele & Werte“. Novartis ist mit rund 4.000 Mitarbeiter*innen einer der größten Arbeitgeber in Tirol (Mitarbeiter*innen weltweit: ca. 120.000) und nach wie vor auf der Suche nach qualifizierten Bewerber*innen. In Österreich sind aktuell mehr als 250 Stellen offen – gesucht wird auch ein Feuerwehrmann.

Marina Bernardi, Chefredaktion
Entpört euch!
Ein Plädoyer für ein bisschen gepflegte Langeweile.
Wir leben in einer Welt permanenter Informationsflut. Social Media, quasi durchgehender Internetzugang, WhatsApp und – mein ganz persönlicher GAU – PushNachrichten schreien förmlich „Lies mich! Sofort!“ Und meist dauert es nicht lange, bis sie da ist: die Empörung. Das führt dazu, dass wir den gesamten Tag mit einer Negativität zu tun haben, die sich – wenig verwunderlich – irgendwann auf unsere Innenwelt schlägt. Vor einigen Jahren hat mein Mann im Urlaub bewusst keine Nachrichten gelesen. Drei Wochen lang keine Zeitung, keine Onlinemedien, kein Fernsehen, kein Radio. Was passiert ist? Nichts. Drei Wochen später war die Welt die gleiche, kein Ereignis hatte nachhaltige Auswirkungen auf sein (Arbeits) Leben. Das mag ein Stück weit Glück gewesen sein, es zeigt allerdings, dass die meiste Aufregung nur von extrem kurzer Dauer ist. Während ich also täglich meinen kleinen Entrüstungsmoment hatte, war mein Mann gänzlich tiefenentspannt.
Es ist nicht nötig, jede Stunde die Nachrichtenwelt zu checken, viel mehr Sinn macht es, seine Quellen und Medienzeiten mit Bedacht zu wählen. Es ist auch nicht nötig, zu allem eine Meinung zu haben und schon gar nicht, sie laufend fröhlich kundzutun. Lesen Sie doch lieber wieder einmal ein Buch, nehmen Sie ein Bad, gehen Sie Joggen oder ins Kino. Machen Sie etwas nur für sich und mit sich ganz allein.
Für dieses Jahr und alle kommenden wünsche ich Ihnen zahlreiche AstridLindgrenMomente, die dereinst befand: „Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen.“ Die Welt wäre eine bessere.
Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at
9

WELCOME TO BABYLON
Im Alten Testament verhindert Gott den Turmbau zu Babel, indem er mit der „babylonischen Sprachenverwirrung“ dafür sorgt, dass keiner mehr den anderen versteht. Heute erleben wir eine moderne Version davon: Die Gesellschaft zerfällt in unversöhnliche Lager, zwischen denen nicht einmal mehr über Grundlegendes Einigkeit besteht.
Der Kern von Diktaturen ist, dass sie nicht nur das Monopol über Meinungen, sondern auch über Fakten haben. Die bekannteste Tageszeitung Russlands heißt nicht zufällig „Prawda“, Wahrheit. Um diese so genannte „Wahrheit“ durchzusetzen, werden Kritiker mundtot gemacht, Journalisten eingesperrt, Oppositionelle nach Sibirien verbannt. Noch besser laufen Diktaturen, wenn sie dafür sorgen, dass anderswo der Glaube an Fakten abhandenkommt. Es hat schon seine Logik, dass Wladimir Putin die Medienkanäle des Westens mit Desinformation flutet. Das Ziel? Nicht dass Menschen die russische Version der Dinge glauben, sondern dass sie gar nichts mehr glauben. Vertrauen in Institutionen, Medien, Wissenschaft – all das soll systematisch erodieren. Diese Strategie ist brandgefährlich, denn sie zerstört das Fundament jeder Demokratie: den Konsens über grundlegende Tatsachen. Wenn jeder seine eigenen Fakten hat, gibt es gar keine mehr. Wir befinden uns auf direktem Weg in ein modernes Babylon, wo es zwar keine Sprachbarrieren im herkömmlichen Sinn mehr gibt, wir aber trotzdem nicht mehr miteinander kommunizieren können. Befeuert wird das von sozialen Medien, die riesige Blasen bilden, in die keine fremden Fakten – schon gar nicht die richtigen – eindringen. Weil das so gut funktioniert, werden nun die lästigen Faktenchecks aus den allesbeherrschenden MetaPlattformen Facebook, Instagram und WhatsApp verbannt. Das macht es in Zukunft noch einfacher, sich mit Gleichgeschalteten über Vorurteile auszutauschen und diese in Urteile umzuwandeln. In der sozialen Bubble mag vieles gelten – die Unschuldsvermutung sicher nicht. Die westlichen Demokratien haben diesen Druck bisher ausgehalten, auch wenn perfekte FakeProduktionen aus der KIWelt es schwerer machen als bisher. Womit der Westen aber noch nicht ernsthaft konfrontiert war, ist der Angriff aus den eigenen Reihen. Mit Donald Trump marschiert nun
auch im Herzen der westlichen Welt ein Faktenzerstörer an vorderster Front – und in seinem Windschatten folgen die Orbans, die Melonis, die Le Pens und vielleicht auch die Kickls. Selbst den Sturm aufs Kapitol hat Trump in eine alternative Erzählung verpackt: Für ihn war es ein „Day of Love“, die Täter „Märtyrer“, die Verurteilten „Geiseln“. Das ist Faktenpluralismus in Perfektion: Wenn die Realität nicht passt, wird sie passend gemacht.
Populisten weltweit haben sich diese Mechanismen abgeschaut und die Macht der Desinformation erkannt. Sie nutzen alle verfügbaren Medienkanäle, um unkontrolliert Narrative zu setzen – und überlassen das mühsame Ringen um Wahrheit und moralische Verantwortung den klassischen Medien, deren Reichweite immer kleiner wird. Während Influencer millionenfach ihre Botschaften verbreiten, wird es für faktenbasierte Information immer schwieriger, durchzudringen. Wie Politikberater Thomas Hofer treffend formulierte: Die Demokratie droht zur Emokratie zu werden. Fakten zählen weniger als Gefühle, sachliche Argumente werden durch Empörung ersetzt, differenzierte Diskussionen durch unversöhnliche Lagerbildungen, Ethik durch Opportunismus.
Gegensteuern ist schwierig, aber es ist möglich. Ein stärkerer Fokus in den Schulen auf den Umgang mit Medien und Politik kann für einen Schutz vor Manipulation sorgen. Der öffentlichrechtliche Rundfunk und der Qualität verpflichtete Medien müssen zudem als Leuchttürme zentrale Fakten außer Streit stellen – etwa Wirtschaftsdaten oder das Faktum des Klimawandels. Und wir selbst müssen unseren Medienkonsum laufend hinterfragen und versuchen, uns eine kritische Meinung aus verschiedenen Quellen zu bilden. Das hilft, um nicht unvorbereitet in jede Emotionsfalle zu laufen.
Der Wahrheit auf die Spur zu kommen war nie einfach oder gar bequem. Aber wer sich dem Strudel aus Lügen, Empörung und blinder Wut hingibt, macht sich zum Handlanger derer, die Babylon errichten wollen.
VON KLAUS SCHEBESTA

Wah r e We r te s eit

SCHENKEN SIE IHRER MARKEN-DNA BEACHTUNG
Neues Jahr, altes Problem: Was tun, damit mein Unternehmen erfolgreich bleibt? Ein essenzieller Aspekt davon sind Marke und Kommunikation. Doch bevor man wild drauflos-wirbt, sollte man sich dem Kern der Sache zuwenden: der Marken-DNA. In ihr finden sich versteckte Potentiale, ignorierte Probleme und einzigartige Identitätsmerkmale. Wenn wir Ihnen also einen Neujahrsvorsatz ans Herz legen dürfen: Gehen Sie Ihrer Marken-DNA auf den Grund.
VON DOMINIQUE PFURTSCHELLER UND PETER EINKEMMER

Marken und Menschen sind sich ähnlicher, als Sie es vielleicht vermuten. Beide wachsen, lernen und verändern sich. Haben an Niederlagen zu knabbern und feiern Siege, werden aber auch gerne bequem, wenn sie längere Zeit erfolgreich sind. Sie wollen geliebt werden und sind eifersüchtig, wenn jemand ihren Konkurrenten mehr Beachtung schenkt als ihnen. Sie reagieren auf und interagieren mit ihrer Umwelt. Somit verfügen auch Marken über eine „DNA“ – für uns ist diese der Schlüssel zu kommunikativem Erfolg.
DNA BEDEUTET EINZIGARTIGKEIT …
… aber auch die Herausforderung, tief zu schürfen, um wirklich zum Kern vorzudringen. Schicht für Schicht müssen die Kernelemente freigelegt werden, beginnend bei der Geschichte, Herkunft sowie den Zielen und Visionen des Unternehmens. Ebenso wichtig ist das Wesen der Marke und der Menschen, die
hinter dieser stehen. Über welche (einzigartigen) Kompetenzen verfügt man, welche Werte werden verkörpert und – vor allem – gelebt? Welches Leistungsversprechen kann gegeben und gehalten werden? Wie sieht das Unternehmensumfeld aus – denn auch dieses ist lebendig und verändert sich durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Faktoren. Wie ist man am Markt positioniert und hat das Unternehmen einen wirklichen USP (Unique Selling Proposition)? Wer ist meine Zielgruppe und welche Bedürfnisse hat sie? Und zu guter Letzt: Welche kommunikativen Maßnahmen wurden bis dato gesetzt? Das war jetzt viel auf einmal – daher: kurz Pause machen und einen Kaffee holen (sofern weniger Kaffeekonsum nicht zu Ihren Neujahrsvorsätzen gehört) …
VON EVOLUTION BIS REVOLUTION
All diese Wesensmerkmale sowie Divergenzen zwischen Außen und Innenwahrnehmung müssen genau durchleuchtet
werden. Wie bei der alljährlichen Gesundenuntersuchung gehört der gesamte Markenorganismus regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Nur so können klare, nachhaltige Lösungswege erarbeitet und abgeleitet werden. Um Stärken zu stärken und an Schwächen zu arbeiten. Um Einzigartiges zu Tage zu fördern und damit aus Problemen Lösungen entstehen. So wird man sich auch klar darüber, wer zu einem passt (sowohl potenzielle Kund*innen als auch Mitarbeiter*innen). Und je nach Zusammenspiel all dieser Parameter ist von einer kleinen, feinen Evolution bis hin zur markentechnischen Revolution alles möglich. Wichtig ist nur, sich diesem Weg zu öffnen.
VORSÄTZE
FÜR 2025
Ihre privaten Neujahrsvorsätze gehen uns ja nichts an, aber, wenn wir an die Tiroler Wirtschaft appellieren dürfen, dann, wenn es ums Thema Marke geht. Wer seinem Unternehmen Gutes tun will und sich 2025 in Sachen Kommunikation, Marketing oder Employer Branding weiterentwickeln möchte, sollte sich mit dem Kern der Marke beschäftigen. Denn: Marken leben. Auch die Ihre. Und damit dies auch so bleibt: der DNA auf den Grund gehen – schließlich ist sie die Basis für nachhaltigen kommunikativen Erfolg.

Was sind Ihre Marketingziele und kommunikativen Vorsätze für 2025? Wir freuen uns über Ihre Impulse.
Bei uns gibt’s keine Möbel
ohne das schöne
Beim Möbelkauf zählt Qualität. Und stets ein gutes Gefühl dabei zu haben. föger: Immer schon ehrlich bei Produkt, Beratung & Service.
www.foeger. at

Willkommen da hoam.
Peter Einkemmer (Konzept & Strategie) und Dominique Pfurtscheller (Geschäftsführung) von northlight (northlight.at)
ENERGIE
Neue Energie zukunft
Das europäische Energiesystem muss zweifellos umgebaut werden. Das ist eine geopolitische und -strategische Notwendigkeit. Tirol verfolgt indes das ambitionierte Ziel, auf Basis seiner erneuerbaren Ressourcen energieautonom zu werden. Wir haben mit Professor Fabian Ochs von der Uni Innsbruck einen Blick auf die Energiewende geworfen, ein mittlerweile wohlbekanntes Konzept, das der französische Historiker Jean-Baptiste Fressoz in seinem neuen Buch ernsthaft in Frage stellt.
TEXT: MARIAN KRÖLL
it der Rückkehr des russländischen Imperialismus, der sich nicht nur im völkerrechtswidrigen Einmarsch in die souveräne Ukraine manifestiert hat, sondern zunehmend auch in Sabotageakten auf europäischem (Meeres)Boden, hat sich dramatisch gezeigt, dass das europäische Energiesystem mit seinem Fokus auf billiges russisches Öl und Gas auf tönernen Beinen steht. Auch im Zusammenhang mit dem voranschreitenden Klimawandel zeigt sich deutlich, dass Europa eine neue Energiestrategie braucht. Eine, die dem wirtschaftlich zuletzt ins Hintertreffen geratenen alten Kontinent neues Leben einhaucht. In Tirol hat man sich schon vor Jahren intensiv Gedanken darüber gemacht und die Strategie TIROL 2050 energieautonom formuliert. „Tirol hat zum Ziel, bis 2050 unabhängig von fossilen Energieträgern zu sein. Die nächsten Generationen sollen künftig in der Lage sein, ihren gesamten Energiebedarf aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen klimaschonend zu decken“, heißt es darin.
AMBITIONIERTE ZIELE
Das Ziel ist vorgegeben, es lässt an Ambition nicht zu wünschen übrig und stellt die Energiewende als alternativlos dar. „Kaum jemand zweifelt an der Notwendigkeit der Energiewende. Am vehementesten eingefordert wird sie oft von denjenigen, die dann am lautesten gegen Projekte der Energiewende protestieren, gegen Großwasserkraft auftreten, Windräder an alpinen Standorten anprangern, Holz zwar toll finden, aber kein Fernheizwerk in der Umgebung haben wollen“, heißt es in Josef Geislers Vorwort zum 2024 aktualisierten EnergieZielszenario. Der Landesrat spielt damit auf die – wohl nicht nur in Tirol, sondern fast überall – ausgeprägte NIMBYMentalität der Bevölkerung an. Energiewende ja bitte, aber not in my backyard. „Das ist ein verbreitetes Phänomen, das sich nicht nur auf Tirol beziehen lässt. Man muss die Menschen da abholen, wo sie sind, und die Rahmenbedingungen entsprechend schaffen, dass sie dieses Projekt mittragen können“, sagt der assoziierte Professor Fabian Ochs von der Universität Innsbruck. Der Energieexperte forscht und lehrt im Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen. Die Frage, ob es eine Energiewende
DER MENSCH NEIGT DAZU, SICH VIELES EINFACHER
VORZUSTELLEN, ALS ES IN DER REALITÄT TATSÄCHLICH IST.

BUCHTIPP
More and More and More Jean-Baptiste Fressoz Vermilion Verlag, 320 Seiten, EUR 29,99
Eine radikal neue Geschichte der Energie und des unersättlichen Ressourcenbedarfs der Menschheit, die die Art und Weise verändern wird, wie wir über den Klimawandel sprechen. In englischer Sprache. Auch als EBook erhältlich.
braucht, stellt sich für ihn nicht, sondern lediglich die, wie eine solche zu bewerkstelligen ist. „Der Begriff Energiewende ist vielleicht etwas irreführend, weil man glauben könnte, dass er sich nur auf die Art und Weise, wie Energie bereitgestellt wird, bezieht“, räumt Ochs ein. „Nur die Energiequellen umzustellen und dabei zu glauben, dass wir in allen Bereichen so weitermachen können wie bisher, wird nicht funktionieren.“ Die Folgen eines ungemilderten Klimawandels würden alle Anstrengungen einer Energiewende weit in den Schatten stellen, ist sich der Wissenschaftler sicher.
Wer heutzutage von Verzicht spricht, kann politisch gleich einpacken. An der Wahlurne wirkt das höchst zuverlässig toxisch. Die Menschen wollen in der Gewissheit leben, dass alles seinen gewohnten Gang gehen kann. „Man kann den Menschen den gewohnten Komfort – und ein gutes Leben –nicht wirklich wieder nehmen wollen. Dieser Komfort muss zukünftig aber mit möglichst geringem Energie und Materialaufwand und möglichst nachhaltig bereitgestellt werden“, formuliert Ochs seine diesbezüglichen Gedanken. Der Nachhaltigkeit nähert er sich gern über die Begriffe Effizienz, Suffizienz und Konsistenz. „Diese drei Hebel müssen zusammenspielen. Auf einen allein zu setzen, ist sicher keine Lösung.“ Im Kontext der Effizienz scheint es auch angezeigt, über das sogenannte JevonsParadox zu reden: Es beschreibt ein Phänomen aus der Ökonomie, bei dem technologische Fortschritte, die die Effizienz einer Ressourcennutzung erhöhen, paradoxerweise zu einem Anstieg des Gesamtverbrauchs dieser Ressource führen können. Das Paradoxon ist relevant für Debatten über Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Es zeigt, dass reine Effizienzsteigerungen ohne begleitende Regulierung oder Verhaltensänderungen oft nicht ausreichen, um Ressourcenverbrauch oder Emissionen zu senken. Fabian Ochs ist mit dem sogenannten ReboundEffekt vertraut und

„Ich halte es für einen Fehler, die Produktion zu bilanzieren und nicht den Verbrauch.“
FABIAN OCHS
meldet Zweifel an: „Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Effizienzmaßnahmen zu Energieeinsparungen führen. Nehmen wir als Beispiel die Elektromobilität, die für die Dienstleistung – jemanden von A nach B zu bewegen – deutlich weniger Energie braucht als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.“
FORTSCHRITTSREALISMUS
Der Mensch neigt dazu, sich vieles einfacher vorzustellen, als es in der Realität tatsächlich ist. Schrankenloser Fortschrittsoptimismus scheint im Kontext der Energiewende jedenfalls nicht geboten. Manches, das derzeit zur Bewältigung der globalen Klimakrise vorgesehen ist, ist nämlich im großtechnischen Maßstab ganz einfach noch keine Option. Bei der immer wieder genannten CO2Abscheidung und Speicherung ist es ungewiss, ob sich das jemals in der angedachten Dimension wirtschaftlich darstellen lässt und/oder technologisch überhaupt funktioniert. Geht man davon aus, dass es neue, noch längst nicht marktreife Technologien schon irgendwie richten werden können, stellt man ungedeckte Schecks auf die Zukunft aus. „Wenn man von Zukunftstechnologie ausgeht, die unendlich viel grüne und nachhaltige Energie zur Verfügung stellen können wird, dann verschwindet bei jedem Einzelnen die Notwendigkeit, selbst ins Handeln zu kommen“, formuliert Ochs den mit Technologiegläu
bigkeit einhergehenden Motivationsverlust. „Man verschiebt das Problem woanders hin. Wundertechnologien wird es nicht geben. Es wird auch nicht reichen, einfach auf die Fusion zu warten.“ Dennoch sei es sinnvoll, an neuen Lösungen zu forschen.
Die Tiroler Energie(spar)ziele sind ambitioniert und nicht immer erreichbar, wie auch aus dem aktualisierten EnergieZielszenario hervorgeht: „Da sich gegenüber der Vorgängerstudie des Jahres 2021 gezeigt hat, dass die bisher angesetzten Effizienzsteigerungen im Gebäudebereich realistischerweise nicht erreicht werden können, wird nun für das Jahr 2050 ein gestiegener Endenergiebedarf im Sektor Sonstige/Gebäude erwartet“, heißt es dort. „Es wurden sehr ambitionierte Annahmen für den Gebäudebereich getroffen, dahingehend, dass alle Neubauten im Passivhausstandard gemacht werden und viel mehr saniert wird“, erklärt Ochs. Diese Annahmen wurden mittlerweile durch realistischere ersetzt. „Technisch ist es durchaus möglich, in diesen Zielbereich zu kommen, auch im ursprünglichen Szenario, aber das ist natürlich mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden, der sich aber über den Lebenszyklus der Gebäude durchaus lohnen würde“, führt Ochs aus, der sich beim Baustoff der Wahl nicht festnageln lassen will. „Holz ist sicher dort, wo ausreichend vorhanden, ein guter Bau
stoff. Ich würde das aber nicht so eng sehen, weil auch Betonbauten mit sehr langer Nutzungsdauer und kreislaufwirtschaftlicher Weiterverwendung durchaus überzeugen können. Das Hauptthema, das wir im Gebäudebereich derzeit immer noch haben, ist die Betriebsenergie, nicht die Rohstoffe. Es ist deshalb wichtiger, die Betriebsenergie auf ein Minimum zu reduzieren, anstatt den Fokus zu viel auf den Baustoff zu richten.“ Ochs verweist außerdem auf ein Manko in der derzeitigen Debatte: „Wir sollten den Gebäudesektor als Säule der Energieversorgung betrachten. Erzeugung und Verbrauch machen miteinander das Energiesystem aus, nicht nur die Erzeugung. Wer bei der Energiewende nur die Erzeugung im Blick hat, vergisst ein wichtiges Element. Der Gebäudebereich ist ein Hebel, der in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden muss.“
MORE AND MORE AND MORE Nicht nur darüber, wie die Energiewende denn zu bewerkstelligen sei, gibt es unterschiedliche Auffassungen, sondern auch darüber, ob wir beim Konzept Energiewende nicht einem großen historischen Missverständnis oder Irrtum unterliegen. Letzteres legt die Forschung des französischen Wissenschafts und Energiehistorikers JeanBaptiste Fressoz dringend nahe, die jüngst auf Englisch in Buchform unter dem Titel „More and More and More – An AllConsuming History of Energy“ erschienen ist. Das darf als Leseempfehlung gelten, zumal Fressoz’ Argumentation schlüssig und folgenreich erscheint.
Für Tirol ist es ein wichtiges – und prinzipiell erreichbares – Ziel, zumindest bilanziell energieautonom zu werden. Dafür gibt es im Land ausreichend erneuerbare Ressourcen, Wasser, Sonne und auch Wind. Generell sollte aber das Ding, das im globalen Maßstab gewendet werden soll, die Energie, auch global betrachtet werden. Der Klimawandel ist schließlich kein regionales Phänomen. Wir sitzen alle im selben Boot, beim Klima ebenso wie beim globalen Rohstoff und Energieverbrauch. JeanBaptiste Fressoz erzählt die Energiegeschichte neu und argumentiert, dass wir es nicht mit der Ablösung eines Energieträgers durch einen anderen, sondern vielmehr mit einer symbiotischen Expansion verschiedener Energieträger (Holz, Kohle, Öl, Gas…) und einer Akkumulation derselben zu tun haben. Primärenergiequellen, meint Fressoz, neigten historisch dazu, einander zu ergänzen statt zu ersetzen. Aus seiner Sicht ist die Energiewende daher nicht
NACH ZWEI JAHRHUNDERTEN DER „ENERGIEWENDE“
HABE DIE MENSCHHEIT NOCH NIE SO VIEL ÖL UND GAS, SO VIEL
KOHLE UND SO VIEL HOLZ VERBRANNT WIE HEUTE.
mehr als ein industrieller Slogan, der seit mehr als 50 Jahren für wissenschaftliche Verwirrung und politische Prokrastination sorgt. Die vermeintliche Dekarbonisierung Europas beschreibt Fressoz als „statistisches Artefakt“, weil die CO2Emissionen den produzierenden Ländern angerechnet werden und nicht den konsumierenden. „Da ist etwas dran. Wandert die Stahlproduktion aus Europa ab, haben wir sie nicht mehr in der Bilanz, aber die Länder, in die sie abwandert. Ich halte es auch für einen Fehler, die Produktion zu bilanzieren und nicht den Verbrauch“, schließt sich Ochs in diesem Punkt Fressoz’ Sichtweise an. Nach zwei Jahrhunderten der „Energiewende“ habe die Menschheit noch nie so viel Öl und Gas, so viel Kohle und so viel Holz verbrannt wie heute, schreibt Fressoz. Holz stelle derzeit global doppelt so viel Energie zur Verfügung wie die Atomkraft. Merkels Deutschland verbrauchte dreimal so viel Kohle wie Bismarcks. Das sind nur einige aus einer ganzen Sammlung an Indizien, die darauf hindeuten, dass wir möglicherweise das Konzept der Energiewende in seiner bisherigen Ausformung – neue, saubere Energiequellen lösen die alten, schmutzigen ab – hinterfragen müssen. Was könnten die möglichen Schlussfolgerungen sein, wenn die Energiewende weitgehend Wunschdenken ist? Die Energiewende, argumentiert der Historiker in seinem Buch, sei ein Begriff der Futurologen und nicht der Historiker. Um einen klareren Blick auf eine mögliche Energiezukunft zu bekommen, muss man sich womöglich von einem Zerrbild verabschieden, das so – historisch nachweislich – nicht stattgefunden hat. Die globale Erwärmung beschreibt JeanBaptiste Fressoz eher als „eine Tragödie des Überflusses als der Knappheit, eine Tragödie, die umso hartnäckiger und ungerechter ist, als ihre Opfer im Allgemeinen nicht dafür verantwortlich sind. Die Bekämpfung der globalen Erwärmung bedeutet eine beispiellose Umgestaltung der materiellen Welt durch schiere Willenskraft, und das in einem außerordentlich kurzen Zeitraum.“ Die Behauptung, dass „Innovation“ – sei sie inkrementell, granular, grün, sparsam oder disruptiv – dieser beispiellosen Herausforderung gewachsen ist, sei nur Schall und Rauch, so das
ernüchternde Urteil des französischen Historikers. Er will der gängigen Erzählung von der Energiewende etwas entgegensetzen. Anpassung sei der Schlüssel, um den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. „Wir müssen über Suffizienz und Degrowth sprechen“, sagt Fressoz in einem Interview. Diese Themen seien von Ökonomen bisher völlig vernachlässigt worden. Und dieser Eindruck täuscht nicht. Mit Degrowth bzw. Postwachstum – grundsätzlich heißt das, dass die Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern sogar schrumpft – will sich niemand ernsthaft befassen. Fabian Ochs ist jedenfalls dafür, dass sich Tirol – wie ganz Österreich – weiterhin und mehr denn je anstrengt. „Wenn kleine Länder nichts tun, fällt das nicht groß auf,
aber wenn sie vorangehen, werden sie wahrgenommen und können sogar Vorbildwirkung entfalten. Es ist für Österreich eine wichtige Aufgabe, eine Vorreiterrolle einzunehmen.“ VogelStraußPolitik will Fabian Ochs nicht sehen. Damit geht es ihm nicht anders als den meisten Österreicher*innen und wohl auch Tiroler*innen. Energieautonomie ist zudem ein Schlüssel, um den für das Land so wichtigen Industriestandort abzusichern und mit sicherer, sauberer und konkurrenzfähiger Energie neue Unternehmen ansiedeln zu können. „Sich hinzustellen, mit den Schultern zu zucken und nichts zu tun, ist sicher nicht der richtige Weg“, sagt Ochs. Wer handelt, kann dabei Fehler machen, wer nichts tut, macht ganz sicher einen Fehler.

Tirols modernes Krankenhaus und Ärztezentrum
Persönlich betreut vom Facharzt Ihrer Wahl
Einfühlsame und kompetente Pflege
Hochwertige Medizintechnik, modernste OP-Säle
Freundliche, helle Zimmer am sonnigen Plateau über Innsbruck Vorzüglich speisen, Wahlmenüs und Diätküche, frisch zubereitet
SANATORIUM DER KREUZSCHWESTERN GMBH A-6063 Rum · Lärchenstr. 41 · Tel. 0043 512 234-0
E-Mail: office@pk-hochrum.com · www.privatklinik-hochrum.com
WOHNEN
(Un -) leistbares Wohnen
Die Debatte über leistbares Wohnen gehört in Tirol schon zum politmedialen Hintergrundrauschen. Wie der Inn schwillt sie manchmal an und tost, um dann wieder dahinzuplätschern. Messbare Fortschritte bei diesem schwer messbaren Ziel nach „Leistbarkeit“ sind indes nicht wirklich zu beobachten. Die Wohnbedarfsstudie Tirol 2024–2033 von Land und Universität Innsbruck bringt etwas Licht ins Dunkel, doch nach wie vor mangelt es an einer Vision.
TEXT: MARIAN KRÖLL
raditionell brandet der Leistbarkeitsdiskurs immer dann auf, wenn Wahlen anstehen. Die Parteien überbieten einander mit mehr oder weniger realistischen Forderungen und Versprechen, an die sie sich später nicht immer erinnern können. Wohnen ist genauso ein Grundbedürfnis wie ein Wirtschaftsgut. Leistbares Wohnen, heißt es in einer Definition, „beschreibt eine Situation, in der die Kosten für das Wohnen – sei es in einer Mietwohnung oder einem Eigenheim – in einem angemessenen Verhältnis zum Einkommen stehen“. Eine andere geht so: „Leistbares Wohnen bedeutet, nach Abzug der Wohnkosten noch genug Geld für alle anderen notwendigen Ausgaben zur Verfügung zu haben.“ Was angemessen und genug ist, ist dehnbar.
Die Lautstärke der Leistbarkeitsdebatte steigt direkt proportional mit den Wohnbzw. Lebenshaltungskosten. Die sind in Tirol naturgemäß – hier werden immer wieder gern die topografische Situation und die geringe bebaubare Landesfläche ins Feld geführt – hoch. Die Einkommen der Tiroler*innen liegen dagegen im hinteren Drittel. Das ist keine gute Ausgangssituation. Mehr Angebot sollte nach der Marktlogik auch die Preise dämpfen. Doch so einfach ist es längst nicht. Immerhin wollte es das Land Tirol einmal genauer wissen und hat bei der Universität Innsbruck, genauer gesagt beim Institut für Geographie, angeklopft und eine Studie in Auftrag gegeben, die klären soll, wie es um den konkreten Wohnbedarf in Tirol gegenwärtig bestellt ist und in Zukunft vermutlich bestellt sein wird. „Steigende Grundstückspreise und Baukosten, ein begrenztes Angebot an Boden, eine hohe und stark volatile Nachfrage und Spekulation mit Wohnraum“ würden die Aufgabe der öffentlichen Hand zunehmend erschweren, „Rahmenbedingungen zu schaffen, die angemessenes Wohnen für die Bevölkerung ermöglichen“, heißt es gleich eingangs in der Studie, die inhaltlich von einem Team von Innsbrucker Geograph*innen rund um Christian Obermayr verantwortet wurde. Dazu kommen erschwerend die Alterung der Gesellschaft ebenso wie die gesellschaftlichen Trends Flexibilisierung und Individualisierung.

„Oft sind so viele Daten da, dass sich das niemand genau ansieht, weil es zu wenig Ressourcen dafür gibt.“
CHRISTIAN OBERMAYR
NEUBAU > BEVÖLKERUNGSWACHSTUM
Die Studie verfolgte das Ziel, „Grundlagenwissen zur Tiroler Wohnsituation zu erarbeiten“. Dadurch kann zumindest im WohnraumDiskurs, in dem bisher vieles im Ungefähren geblieben ist, die Spekulation eingedämmt werden. Wir haben bei Christian Obermayr nach Überraschungsmomenten gefragt: „Wir haben anhand der Zahlen gesehen, dass sowohl die Zahl der Bevölkerung als auch die Zahl der Wohnungen in den letzten zehn Jahren in einem ähnlichen Ausmaß zugenommen hat. Dies hat uns sehr überrascht, denn die Zunahme an Wohnungen war deutlich größer, als man es anhand des Bevölkerungswachstums erwartet hätte.“ Obermayr geht mit seinem Team auf Ursachenforschung und der Frage nach, „warum die Preise trotzdem so steigen, obwohl doch eigentlich genügend Wohnraum da ist.“
Tirol verfügt am Papier heute schon über ausreichend Wohnraum für seine Bevölkerung. Die tatsächlichen Mangelerscheinungen kann sich Obermayr noch nicht letztgültig erklären. Sie hängen mit unterschiedlichen Faktoren zusammen. „Es gibt viele Menschen, die hier Wohnraum nutzen, hier leben, aber in der Statistik nicht aufscheinen“, ist ein Teil des Puzzles. Dazu zählen nicht gemeldete Zweitwohnsitze oder Ferienwohnungen, Saisonniers ebenso wie Studierende, die keinen Wohnsitz in Tirol anmelden. In der Landeshauptstadt dürfte das auch damit zusammenhängen, dass seit 2016 Mieter*innen erst einen Antrag auf Mietzinsbeihilfe stellen können, nachdem sie zwei Jahre ihren Hauptwohnsitz in der
RUNDER TISCH MIT STAKEHOLDERN
19 Landeshauptstadt gemeldet haben. Für nicht wenige Studierende „könnte sich daraus auch eine fehlende Notwendigkeit ergeben, eine Hauptwohnsitzmeldung zu unternehmen“, heißt es im Bericht.
Den Studienautor*innen war es wichtig, auch Stakeholder einzubeziehen. Dafür hat man einen runden Tisch veranstaltet, zu dem neben Fachexpert*innen und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft auch die Politik eingeladen war. „Schaut euch das bitte an, da stimmt etwas nicht, da muss man gemeinsam überlegen. Wir finden diese Entwicklung nicht gut und bedenklich, wissen aber nicht genau, welche Faktoren wie ins Gewicht fallen“, erinnert sich Obermayr an die Ausgangslage vor dem runden Tisch.
Mit einfachen Lösungen wartet die Studie folglich nicht auf. Solche sind bei komplexen Problemen auch meistens falsch. Tirol ist zweifellos ein Land, in dem es sich gut leben lässt. Das ist weit über die Grenzen des Landes im Gebirg bekannt. „Spekulation“, räumt Obermayr bezüglich der WohnMalaise ein, „spielt auch eine Rolle. Das hängt mit der voranschreitenden Finanzialisierung von Wohnraum – Stichwort Wohnungen als Investment – zusammen und auch der Tourismus spielt eine Rolle.“ Ein klarer Einblick in die touristische Nutzung von Wohnraum gestaltete sich als schwierig, ebenso wie die trennscharfe Abgrenzung von privater und gewerblicher Nutzung. „Die Ferienwohnungsstatistik ist eine andere als das Gebäude und Wohnungsregister. Ich kann nicht hergehen und von den rund 75.000 Woh
TIROL VERFÜGT AM PAPIER HEUTE SCHON ÜBER AUSREICHEND WOHNRAUM FÜR SEINE BEVÖLKERUNG.
DIE TATSÄCHLICHEN MANGELERSCHEINUNGEN HÄNGEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FAKTOREN ZUSAMMEN.
nungen in Tirol, für die keine Wohnsitzmeldung vorliegt, einfach die Ferienwohnungen abziehen“, sagt Obermayr, der an dieser Stelle die Stopptaste drückt, damit die Studie nicht ausufert. „Wie sich der Tourismus auf den Bereich Wohnen auswirkt, sollte im Rahmen einer eigenen Studie untersucht werden.“ Mit neuen Vermietungsformen wie Airbnb und Co. ist die Sachlage nicht einfacher geworden. Obermayr legt Wert auf die Feststellung, dass die im Bericht genannten Zahlen und Daten der Interpretation bedürfen. Die Darstellung in der Studie ist nämlich differenzierter als in den ersten Schlagzeilen, die medial dazu getrommelt wurden. Die Datenqualität insgesamt sei in den letzten Jahren besser geworden, die Datenmenge habe zugenommen. Das bringt allerdings ein weiteres Problem mit sich, weiß Obermayr: „Oft sind so viele Daten da, dass sich das niemand genau ansieht, weil es zu wenig Ressourcen dafür gibt.“ Das ist ein Thema, das uns quer durch die Informationsgesellschaft hindurch verfolgt. Der Mensch verfügt heute über eine Unzahl an Daten, wird jedoch mangels Zeit und oft auch Kompetenz nicht immer schlau daraus.
LANGER LÖSUNGSWEG
„Die Frage des leistbaren Wohnraums lässt sich nicht in einer Legislaturperiode beheben. Das braucht Jahrzehnte“, sagt Christian Obermayr. Die schnelle Nummer wird es hier nicht spielen, es braucht vielmehr Geduld und Beharrlichkeit, um die Situation zu verändern. Man sollte auch nicht den Fehler machen, so naiv zu sein und gleichlautende Interessen zu vermuten, wo es in Wahrheit große Gegensätze gibt. „Die Bauwirtschaft hatte die Befürchtung, dass wir zu wenig Neubaubedarf feststellen“, vermutet Obermayr. Eben diese Bauwirtschaft hat natürlich ein legitimes Interesse daran, arbeiten zu können. Anton Rieder, Bauunternehmer und WirtschaftskammerTirolVizepräsident sowie stellvertretender Innungsmeister der Bauinnung in Österreich, hat mit der Studie keine große Freude. „Ich hoffe, dass sich auch Professoren verrechnen können“, sagte er unlängst einer Tageszeitung. „3.100 neue Wohneinheiten pro Jahr anstelle von bis zu
LÖSUNGSWEGE
Fünf Handlungsempfehlungen hat das Autorenteam der Wohnbedarfsstudie auch ohne Vision bereits formuliert:
1. BAULAND MOBILISIEREN:
Raumordnungsinstrumente wie die Vertragsraumordnungen und Nachverdichtungen sollten stärker genutzt werden, um Bauland effizient zu mobilisieren.
2. LEERSTAND AKTIVIEREN: Es braucht eine landesweite Leerstandsdatenbank, um ungenutzten Wohnraum zu identifizieren. Fördermaßnahmen könnten dazu beitragen, leerstehende oder unbewohnbare Wohnungen wieder bewohnbar zu machen.
3. WOHNBEDARFSPLANUNG:
Eine gemeinsame Definition und regionale Erfassung des Wohnbedarfs sowie eine abgestimmte Vergabe ist entscheidend, um Bedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen wie unter anderem Studierende, zugewanderte Menschen oder Familien besser abzudecken.
4. LEISTBAREN
WOHNBAU PRIORISIEREN: Gemeinden sollten Zielwerte für leistbaren Wohnraum festlegen und die Leistbarkeit im Neubau muss kontinuierlich überwacht werden. Raumordnungsinstrumente zur Sicherung leistbaren Wohnens sind stärker zu nutzen.
5. NEUE WOHNFORMEN UND VISION ZUKUNFT WOHNEN 2035: Die Förderung innovativer Wohntypologien wie Mehrgenerationenwohnen oder inklusives Wohnen ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Eine Vision zum zukünftigen Wohnen in Tirol sollte entwickelt werden.
7.000 in den vergangenen Jahren. Wenn dies so eintritt, dann dürfte es kaum mehr neues Eigentum in Tirol geben. Unsere WKOStudie geht von 4.800 Wohneinheiten aus, auch weniger, aber noch akzeptabel“, hält Rieder fest. Obermayr und sein Team sind nach überprüfbaren wissenschaftlichen Kriterien vorgegangen und haben keine politischen Motive. Neue und alternative Wohnformen sind in Tirol noch kaum ein Thema. Der Traum vom Einfamilienhaus im Grünen sei nach wie vor da, meint der Studienautor. „Wir wollen niemandem sein Einfamilienhaus streitig machen, aber prinzipiell braucht es einmal eine Diskussion darüber, wo wir überhaupt hinwollen“, wünscht sich der Geograph eine auf die Bestandsaufnahme folgende, breit angelegte Grundsatzdebatte, wie es mit dem Wohnen in Tirol weitergehen soll. „Es ist schwierig, Empfehlungen auszusprechen, wenn wir nicht wissen, was das Ziel ist. Und das ist definitiv normativ. Was ist das Ziel überhaupt, wer legt es fest? Ich sehe für Tirol noch keine Vision.“ Akute Visionslosigkeit gibt es in der Politik nicht nur in der Domäne des Wohnens. Die „Schau ma mal“Mentalität scheint man fast parteiübergreifend verinnerlicht zu haben. Fachlich ist das Ziel, eine nachhaltige Siedlungspolitik zu betreiben, unumstritten. Im Hinblick auf die Erhebungsmodalitäten sieht Obermayr auch noch Luft nach oben. Der Wohnbedarf wird in den größeren Gemeinden über Bedarfslisten erhoben. Dabei wird er jedoch nach unterschiedlichen Kriterien definiert und die Zahlen sind nicht immer gut und aussagekräftig. „Auf den Bedarfslisten finden sich Menschen mit dringendem Wohnbedarf und solche, die ihre Wohnsituation schlicht verbessern wollen“, erläutert Obermayr. Gemeinsame Kriterien zur Erfassung des Wohnbedarfs und eine regional abgestimmte Vergabe wären wünschenswert. „Das ist praktisch schwierig, weil man damit in die Gemeindeautonomie eingreifen würde und die Bürgermeister*innen da lieber die Hand drauf behalten wollen.“
Hier geht’s zur gesamten Wohnbedarfsstudie.
Apropos Gemeindeautonomie: In den Gemeinden gibt es teilweise noch große Flächen gewidmeten und teils seit Jahrzehnten unbebauten Baulandes, das sich kaum mobilisieren
lässt. Obermayr spricht diesbezüglich von „Altlasten“ und verweist auf das Instrument der Vertragsraumordnung, von dem Gemeinden heutzutage bereits häufig Gebrauch machen würden.
VISION GESUCHT
Wer nur einen Hammer hat, für den wird jedes Problem wie ein Nagel aussehen. Bislang war das Mittel der Wahl in Tirol immer „mehr Neubau“. Das ist eine ebenso einfache wie falsche Lösung, ganz einfach deshalb, weil sie nicht ausreichend funktioniert. Es deutet einiges darauf hin, dass es in Tirol eine virulente BetongoldProblematik gibt. „Spekulation ist sicher ein Faktor. Diese Problematik sollte man sich intensiver anschauen. Das wäre für dieses Land sehr wichtig“, pflichtet Obermayr bei. Die Datenlage ist derzeit aber nicht gut genug, um definitive Aussagen zu treffen, genau genommen müsste man wohl erheben, wer beim Tiroler Wohnungsbestand in den Grundbüchern steht. „Es wäre interessant, sich das einmal anzusehen“, räumt Obermayr ein. Solange Wohnungen zweckmäßig verwendet werden, sei das noch kein großes Problem, dienten diese nur der Spekulation und bleiben leer stehen, sieht die Sache anders aus.
Fest steht, dass es im Tiroler Wohnungsbestand beträchtliche Leerstände gibt. Geben muss. Andernfalls würden tatsächlicher Wohnbedarf und Wohnungsangebot besser zusammenpassen. „Es gibt keine umfassende Leerstandsstatistik. Das ist ein Problem. Deshalb empfehlen wir auch die Errichtung einer Leerstandsdatenbank.“
Das Engagement der Gemeinden in Sachen Leerstände ist ausbaufähig, deshalb hat sich auch die Leerstandsabgabe bisher als zahnlos erwiesen. Dennoch hat das Autorenteam den Leerstand in Tirol als wirksamen Hebel erkannt, um den zukünftig entstehenden Wohnbedarf teilweise decken zu können. „Wir sind da von konservativen Annahmen ausgegangen und selbst dann hat sich gezeigt, dass die Aktivierung von Leerstand das Neubauvolumen signifikant verringern kann“, erklärt Obermayr. Für eine gezieltere Steuerung müsste aber der Blindflug rund um den Leerstand beendet werden. Man müsste sich dafür allerdings erst einmal auf gemeinsame Definitionen einigen, was Objekte, Fristen und Zeiträume betrifft. Für die Immobilienwirtschaft sind Leerstand und Freizeitwohnsitze hingegen nach jüngsten Aussagen von Branchenvertretern bloß „Nebenschauplätze“. Als exklusives Mittel, um den Preisdruck im Immobiliensektor zu mindern, betrachtet man naturgemäß die Schaffung von mehr Angebot am Wohnungsmarkt. Das könnte in einer Marktwirtschaft, in der Wohnraum ausschließlich dem Zweck dient, diesen auch tatsächlich zu bewohnen, grundsätzlich funktionieren. Die Realität sieht bekanntermaßen ein wenig anders aus. „Wir haben mit der Studie Bewusstsein schaffen können“, zeigt sich Christian Obermayr mit der Rezeption derselben vorerst zufrieden. Der Ball liegt nun wieder in der Arena der Politik. Man wird sehen, ob es die politisch Verantwortlichen noch genauer wissen wollen, wie es um den leistbaren Wohnraum im Land bestellt ist.

ALT, ABER GOLD
Wir haben Georg Fischer, Gremialobmann für Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandel der Wirtschaftskammer Tirol, ein paar Fragen zum Thema Altgold gestellt.
ECO.NOVA: Kann ich meinen alten Schmuck beim Juwelier eintauschen oder verkaufen? GEORG FISCHER: Ja, die erste Anlaufstelle, um alten Schmuck, Alt oder Bruchgold zu tauschen oder zu verkaufen, sollte der Juwelier sein. Hier können sich Kund*innen darauf verlassen, von Expert*innen beraten zu werden. Der Juwelier ist Ihr seriöser Partner, der Sie auch in Zukunft als Kunde behalten will. Daher erhalten Sie auch ein gutes und faires Angebot.
Welche Tipps können Sie Menschen geben, die ihre alten Schätze eintauschen oder verkaufen möchten? Informieren Sie sich über Ihren alten Schmuck: Vielleicht haben Sie Schmuck, der aufgrund seines zeitlosen Designs immer noch aktuell ist, wie Solitärringe, oder Sie sind im Besitz eines ganz außergewöhnlichen Schmuckstückes, das es so nicht mehr gibt. Für den Verkauf wenden Sie sich an einen Juwelier Ihres Vertrauens oder ein anderes stationäres Fachgeschäft.
Wie stellen Sie sicher, dass der Ankaufprozess transparent und für den Kunden nachvollziehbar ist? Ich arbeite nur mit seriösen Goldankäufern zusammen, die ihre Ankaufspreise für Altgold auch im Internet veröffentlichen. Damit kann ich meinen Kunden die Preisentstehung nachvollziehbar aufzeigen.
Wie wird der Wert von Altgold bestimmt? Der Wert von Altgold wird anhand seines Goldgehalts und seines Gewichtes bestimmt. Darauf basierend erstellt der Juwelier sein Angebot für den Kunden. PR
© DIE FOTOGRAFEN

Georg Fischer ist Gremialobmann für Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandel der Wirtschaftskammer Tirol
BAUEN AUSSERHALB DER NORM
Baumeister und Bundesinnungsmeister-Stellvertreter Anton Rieder treibt seit Jahren eine Initiative voran, die das Potenzial hat, Bauen kostengünstiger zu machen. Doch dafür braucht es noch gesetzliche Voraussetzungen und auf allen Seiten mündige Vertragspartner*innen, die den Mut haben, die Kostenspirale zu durchbrechen.
INTERVIEW: MARIAN KRÖLL
ECO.NOVA: Warum muss man sich heute abseits von Normen und Standards umsehen, um das Bauen kostengünstiger machen zu können? ANTON RIEDER: Es bestehen viele Irrtümer darüber, wie sich die Kosten einer Wohnung in Tirol im geförderten Bereich zusammensetzen. Eine solche Wohnung kostet momentan rund 6.000 Euro pro Quadratmeter, abhängig von Ort, Lage und Ausstattung. Davon gehen 15 bis 20 Prozent ins Grundstück. Es ist wichtig, allerdings nicht so wichtig, wie immer getan wird. Das hängt damit zusammen, weil im Rahmen der Wohnbauförderung auch der Grundstückspreis gedeckelt ist. Der Deckel liegt bei einem Drittel bis zur Hälfte vom Marktpreis. Der Anteil an Steuern und Abgaben liegt bei einer solchen Wohnung bei ungefähr 40 Prozent. Zahlt der Tiroler also 6.000 Euro, gehen davon 2.400 Euro über verschiedenste Wege – Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Sozialabgaben – in den Staatssäckel. Der Rest ist die Leistung der Bauwirtschaft, die eigentlichen Baukosten.
Was kann bei den Baukosten gemacht werden? Da gibt es drei Bereiche, die man sich anschauen muss. Einmal die Gesetze und Vorschriften, die uns der Gesetzgeber vorgibt. Da kommen wir trotz jahrzehntelanger Diskussionen nie nach unten, sondern immer nur nach oben. Der zweite Bereich ist der brancheninterne. Wir haben zwei Probleme: eine schlechte Produktivität und sehr hohe Fehlerkosten. Das kann man prinzipiell durch eine kostenoptimale Planung, mehr serielles Bauen, Vorfertigung und Prozessoptimierung gut in den Griff bekommen. Immer unter der Voraussetzung, dass wir dürfen. Der dritte Bereich sind die Normen und Richtlinien.

Es gibt jede Menge Richtlinien, die nicht gesetzlich verbindlich erklärt und damit eigentlich freiwillig einzuhalten sind.
Aber nur eigentlich… Aufgrund von Themen wie Haftung und Gewährleistung sieht die Realität anders aus. Ja, denn wenn man diese grundsätzlich unverbindlichen Richtlinien nicht einhält, bekommt man ein Problem. Nur zehn Prozent der Normen sind gesetzlich für verbindlich erklärt, der Großteil ist unverbindlich. Da könnte man ansetzen.
Der Gesetzgeber ist also gar nicht erster Adressat, wenn es um den Abbau der Normenflut geht? Doch, denn er muss der Bauwirtschaft in der Haftungskette eine bessere Absicherung geben, damit sich die Bauherren überhaupt trauen, von freiwilligen Normen abzuweichen. In Deutschland ist man mit dem Baustandard E diesbezüglich schon weiter. Dort kann man nach einer entsprechenden vollen Aufklärung schriftlich vereinbaren, von gewissen Nor
men abzuweichen. Bei uns traut sich momentan noch niemand, weil er – obwohl es eigentlich möglich wäre – Angst davor hat, in Haftung genommen zu werden. Bauen außerhalb der Norm ist kein Allheilmittel, gleichwohl eine Möglichkeit, in diesem Teilbereich der Normen und Richtlinien billiger zu bauen. Es geht jedoch darum, ein neues, etwas anderes Spiel zu spielen und eine Dynamik zu durchbrechen, die immer nur mehr und mehr kennt. Als ich vor vielen Jahren aus der HTL gekommen bin, haben wir pro Kubikmeter Beton ca. 50 Kilogramm Bewehrung gebraucht, heute schaffen wir es nicht mehr unter 100. Und das, obwohl Stahl und Beton besser geworden sind und es die tollste Computersoftware gibt. Das ist doch eigenartig!
Wer profitiert denn von diesen Praktiken? Letztlich wohl auch wieder die Industrie und auch die Bauwirtschaft? Wir sind da Täter und Opfer zugleich. Natürlich gibt es industrielle Interessen, die da Ausdruck finden. Es geht aber auch um das Thema Sicherheit. Alles muss subjektiv immer sicherer werden. Das sehen wir in anderen Lebensbereichen auch. In den normsetzenden Gremien gibt es zudem so etwas wie eine „hochakademische Überlegenheit“, in der jeder klüger sein will als der andere und immer noch einen draufsetzt.
In einem Bauen außerhalb der Norm, das kostengünstiger ist als das Herkömmliche, würden Hausverstand und Ingenieurskunst einander die Hand geben? So kann man das formulieren. Wir brauchen mehr Freiheiten in der Branche, um mit unserer Ingenieurskunst zu guten und kostenschonenden Lösungen zu kommen.
Wir müssen dazu aber erst wieder lernen, mit Freiräumen umzugehen, weil man uns in den letzten Jahrzehnten Eigenverantwortung, Kreativität und Eigeninitiative abtrainiert hat. Mit dieser Initiative „Bauen außerhalb der Norm“ preschen wir jetzt einmal vor, weil Bedenkenträger gibt es ohnehin genug. In der Branche wird diese Initiative gut aufgenommen, wenn es um die Umsetzung geht, überwiegt noch die Angst den Mut.
Halten Sie das heutige Normengerüst für innovationshemmend? Das Hauptproblem ist gar nicht zwingend die Norm selbst, sondern vielmehr noch die Haftungskette, weil sie uns faktisch dazu zwingt, jede Norm nach Punkt und Beistrich einzuhalten. Damit gibt es gar keinen Spielraum, andere Ideen zu verfolgen. Deswegen muss dieser Haftungsrahmen angepasst werden.
Nachhaltigkeit und Ökologie sind heutzutage in der Politik große Hebel. Bauen außerhalb der Norm ist grundsätzlich ressourcenschonend in dem Sinne, in dem es nicht diesem Mantra „schneller, höher, weiter“ folgt, sondern spart, wo das sinnvoll möglich ist. Absolut. Wir haben uns das anhand eines konkreten Beispiels angesehen. Wenn man geringfügig größere Rissbreiten in der Betondecke akzeptiert, lassen sich elf Prozent Kosten und sieben Prozent CO2 einsparen. Das bringt auf der Ressourcenseite sehr viel. Das macht mich optimistisch, dass es gehen könnte.
„Es geht uns darum, diese Spirale des Mehr und Mehr zu durchbrechen.“
ANTON RIEDER
Der Klimaschutz dürfte auf der Prioritätenliste einer neuen Regierung nach unten rutschen. Ja, doch grundsätzlich ist es egal, ob ganz kapitalistisch nur das Geld zählt oder ökologisch bewegt nur das CO2Budget. Hauptsache, es lässt sich einsparen. Politisch decken wir mit unserer Initiative beide Reichshälften ab.
Wie viel an Einsparungspotenzial ist beim Bauen außerhalb der Norm zu heben? Das kann ich heute nicht seriös beziffern. Der Anspruch ist zunächst, Einsparungen im einstelligen Prozentbereich zu erzielen. Wir müssen uns der Sache Schritt für Schritt nähern. Es wäre nicht klug, von einem Tag auf den anderen alles ganz anders zu machen. Wir haben im Wohnbau ein großes Thema und brauchen alles, was das Bauen kostengünstiger macht. Lassen sich so drei, vier, fünf Prozent einsparen, dann ist das schon ein wesentlicher Beitrag. Von der Vorschriftenseite haben wir noch gar nicht geredet. Dort gibt es mit Stellplätzen und Co. noch viel größere Hebel. Das ist allerdings noch viel schwieriger, weil
man dabei sofort in politisches Fahrwasser gerät. Wenn man an allen möglichen Stellhebeln dreht, sind vielleicht Einsparungspotenziale in der Größenordnung von 15, vielleicht sogar 20 Prozent drin. Dorthin ist es aber noch ein enorm weiter Weg. Jedenfalls wird man nicht davon träumen können, dass Bauen zukünftig nur noch die Hälfte kostet. Wir müssen mit realistischen Erwartungshaltungen arbeiten.
Bauen außerhalb der Norm soll nicht nur konkrete Einsparungen erzeugen, sondern auch eine Signalwirkung in der Branche entfalten? Ganz genau. Es geht uns darum, einmal diese Spirale des Mehr und Mehr zu durchbrechen. Egal, ob das Grundstückspreise sind, Gesetze, Vorschriften, Steuern und Abgaben. Wir wollen das durchbrechen und glauben, dass es viel bringt, zu zeigen, dass wir die Dinge nicht immer linear fortschreiben können, sondern daran arbeiten müssen, die Kurve abzuflachen und zumindest in einem Teilbereich eine Trendwende zu schaffen.

VERKEHR
Von Lösungen für Luft, Landschaft und Leben
Tirol steht vor mehreren Verkehrsproblemen, die sowohl die Lebensqualität der Bewohner*innen als auch die Umwelt betreffen. Lösungsansätze können nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft sowie eine langfristige Planung gefunden und umgesetzt werden.
TEXT:
KATHARINA REITAN
ransitverkehr ist immer der unangenehmste Verkehr. Der fährt bei uns durch und wir haben nichts davon – außer die negativen Effekte.“ Markus Mailer, Verkehrsplaner an der Universität Innsbruck, ist da ganz klar. Man müsse aber unterscheiden: „Wenn wir die Schlagzeile ‚Transit‘ in den Zeitungen lesen, dann ist in erster Linie immer der LkwTransit, der Gütertransit, gemeint“, erklärt sein Kollege Stephan Tischler und meint weiter: „Was man vergisst, ist, dass der PkwTransit eigentlich zahlenmäßig noch viel stärker dominiert bzw. nach wie vor sogar ansteigt.“ Kapazitätsmanagement auf der Straße sei sein Ansatz, dies in den Griff zu bekommen – also die Kapazität, die die Straße erbringen kann, für alle Verkehrsteilnehmer*innen koordinierend zu steuern. Er erklärt das so: „Ausgehend von der sogenannten Maximalkapazität zu sagen, was ist für die Bevölkerung, für die Aufrechterhaltung der Flüssigkeit des Verkehrs, für die Erreichbarkeit – auch für Einsatzfahrzeuge – die maximale Kapazität, die zumutbar ist.“
GÜTER! FREIHEIT?
Klaus Schlosser, Geschäftsführer des Büros für Verkehrs und Raumplanung (BVR) in
MOBILITÄTSWENDE
Tirol ist stark von Verkehrsbelastungen betroffen, die zu hohen Treibhausgasemissionen und Umweltproblemen führen. Um dem entgegenzuwirken, setzt das Land auf eine Mobilitätswende mit mehreren Schwerpunkten. Ein Auszug aus der Tiroler Nachhaltigkeits und Klimastrategie aus dem Handlungsfeld Mobilität und Infrastruktur.
1. Förderung des Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehrs: Der Anteil der Wege, die mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, ist gestiegen. Initiativen wie das EuregioTicket und soziale Schultickets fördern diese Entwicklung. Der Ausbau des ÖPNV wird durch neue Züge, dichtere Taktungen und grenzüberschreitende Verbindungen vorangetrieben.
2. Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene: Ein Großteil des Güterverkehrs erfolgt noch über die Straße. Projekte zur Stärkung des Schienengüterverkehrs sollen den Energieverbrauch senken und Emissionen reduzieren.
3. Reduzierung der negativen Verkehrsauswirkungen: Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Verkehrssicherheit werden umgesetzt, darunter Geschwindigkeitsreduktionen und Kampagnen gegen Alkohol am Steuer.
4. Nachhaltige Touristenmobilität: Projekte wie „Tirol auf Schiene“ fördern umweltfreundliche An und Abreisen von Gästen. Der Ausbau von ELadepunkten unterstützt die steigende EMobilität im Tourismus.
5. Ganzheitliche Planungsansätze: Neue Ticketmodelle und multimodale Verkehrsknotenpunkte sollen den öffentlichen Verkehr attraktiver machen. Initiativen wie ECarsharing und Radverleihsysteme ergänzen das Angebot.
Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und eine nachhaltige Mobilität in Tirol zu fördern.
Innsbruck, ist realistisch: „Zum GüterTransitverkehr ist zu sagen: Das ist der freie Warenverkehr in Europa. Wir sind in der EU. Ein gewisses Maß werden wir immer zu tragen haben.“ Dennoch: „Die 2,5 Millionen Lkw, die auf der Autobahn durch Tirol fah

„Das ist der freie Warenverkehr in Europa. Wir sind in der EU. Ein gewisses Maß an Güter-Transitverkehr werden wir immer zu tragen haben.“
KLAUS SCHLOSSER, BVR
ren, sind dort stark spürbar“, bringt Markus Mailer Zahlen, die nicht wegzudiskutieren sind. Lösungsansätze beim LkwTransit seien – im Gegensatz zum Personenverkehr –allerdings etwas leichter zu finden, da die Komponente „Mensch“ und seine Verhaltensentscheidungen wegfielen, sind sich die Experten einig. Da gehe es eher um betriebswirtschaftliche, ökonomische Ansätze. Stephan Tischler: „Das beginnt bei den finanziellen Vorteilen, die die Straße aufweist, und der Unflexibilität der Schiene. Hier gibt es eine Reihe von potentiellen Maßnahmen, die man ergreifen muss.“ Das könne Tirol jedoch nicht alleine. Es bräuchte einerseits den Bund dazu, aber auch die Nachbarstaaten. Dessen sei man sich in der Politik grundsätzlich bewusst.
LÖSUNGSANSATZ: ZEITFENSTER
Der Verkehrsplaner macht sich diesbezüglich für ein sogenanntes SlotSystem stark. „Das ist der Baustein einer Maßnahme, die mittlerweile schon 20 bis 30 Jahre zurückliegt. Damals war das die Forderung nach der Einführung einer so genannten AlpenTransitBörse.“ Das Prinzip erklärt er so: „Im SlotSystem legt man eine bestimmte Höchstanzahl an Fahrten in einer bestimmten Zeiteinheit fest, die verteilt werden. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten: First come
DER GÜTERVERKEHR IST IN ERSTER LINIE KOSTENORIENTIERT. WENN ES AUF DER STRASSE WEITERHIN GÜNSTIGER IST, WIRD ES KEINEN GRUND GEBEN, ZU VERLAGERN.
– first serve oder die Fahrt wird versteigert, man kann sie auch wie Flugzeugtickets vergeben: Je später jemand einen Slot kauft, desto teurer wird er. Das heißt, der letzte Slot ist der teuerste.“ Technisch sei das mittlerweile kein Problem. Auch rechtlich wäre es grundsätzlich möglich, dazu gäbe es eine Studie, die grenzüberschreitend geprüft worden sei – von Tiroler und bayrischer Seite auf politischer Ebene gäbe es eine Art Absichtserklärung. Es mache aber nur Sinn, wenn alle Staaten entlang dieses Korridors, also Italien und Deutschland, daran mitwirkten: „Von der Wirksamkeit der Maßnahmen wäre es grundsätzlich ein geeignetes Instrument, um den Durchfluss steuern zu können.“
LÖSUNGSANSATZ:
ANREIZE SCHAFFEN
Markus Mailer sieht, dass beim Transitverkehr viel Umwegverkehr durch Tirol fährt, weil es die günstigste Route ist. „Da spielen Themen wie Tanktourismus oder Mautkorridore eine Rolle. Man muss schauen, dass die Kostenstruktur keine Anreize schafft, extra durch Österreich zu fahren.“ Und man müsse
33 %
des EndenergieEinsatzes in Tirol entfielen im Jahr 2022 auf den Verkehr.
Die CO2Emissionen sanken zwischen 2021 und 2022 vor allem durch geringeren Dieselverbrauch und günstige Witterung um
5 %
auf 4 Millionen Tonnen. Mit
41 %
ist der Verkehr der größte Treibhausgasemittent in Tirol.
73 %
des Güterverkehrs über den Brenner werden nach wie vor auf der Straße abgewickelt.

„Im Slot-System legt man eine bestimmte Höchstanzahl an Fahrten in einer bestimmten Zeiteinheit fest, die verteilt werden.“
STEPHAN TISCHLER, UNIVERSITÄT INNSBRUCK
diesen Langstreckenverkehr auf die Schiene verlagern. Das ginge nicht ohne Anreize, um diese Alternative attraktiv zu machen. „Der Güterverkehr ist in erster Linie kostenorientiert. Wenn es auf der Straße weiterhin günstiger ist, wird es keinen Grund geben, zu verlagern.“
„Die Bahnstrecke München – Verona müsste so gut ausgebaut sein, dass der gesamte Transitverkehr – und da muss man auch den Personenverkehr mitdenken – weg von der Straße kommt.“ Klaus Schlosser vom BVR denkt in die Zukunft. Was den zweiten großen Punkt ins Spiel bringt: den Ausbau der Zulaufstrecken der Bahn. „Wir haben den Brenner Basistunnel, der ab 2032 voraussichtlich in Betrieb geht. Die Strecke im Unterinntal ist 2012 in Betrieb gegangen und bis Kundl fertig ausgebaut, der weitere Ausbau ist in Vorbereitung“, fasst Stephan Tischler die Situation zusammen. In Bayern allerdings fehlten zwei NeubaustreckenGleise. Die Bestandsstrecke habe zur Zeit Kapazitätsreserven. Wenn allerdings mit dem Brenner Basistunnel deutlich mehr Verkehr auf der Schiene stattfände, dann ergäbe dies dort erst recht ein Bottleneck. Dann wäre es zu spät, mit dem Aufbau anzufangen. Langfristig würde kein Weg an einer Neubaustrecke vorbeiführen. „Die Lösung müssen unsere Nachbarn für uns treffen“, folgert Klaus Schlosser.
LÖSUNGSANSATZ: IM EINKLANG
„Was ich als viel dringlicher ansehe, ist die Harmonisierung der bahnbetrieblichen Vorschriften. Etwas, das viel weniger Geld kosten würde, was aber im Betrieb viele Abläufe deutlich vereinfachen und auch den Bahntransport auf der Schiene günstiger machen würde“, sagt Stephan Tischler. Unterschiedliche Stromspannungen, Zugführerwechsel, Sprachregelungen, Lokomotivzulassungen, Bremsproben: Das alles behindere den Güterverkehr, der dadurch langsam und vor allem teurer würde. „Das ist einer der Gründe, warum viele Speditionen sagen, das tun wir uns nicht an. Sie wären durchaus geneigt, die Bahn zu nehmen und sogar gewisse Kostennachteile in Kauf zu nehmen. So rechnet sich das aber momentan nicht“, schließt Tischler.

„Die Frage ist, wie kommen unsere Gäste zu uns, wie bewegen sie sich, wenn sie da sind, und vor allem, wie lange bleiben sie.“ MARKUS
URLAUBERVERKEHR
AUGEN ZU UND DURCH
Die Durchreise durch Tirol ist für Urlauber aus dem Norden der schnellste Weg in den Süden. Der PkwTransit sei, ähnlich wie der Güterverkehr, eine Herausforderung, der im Moment durch Symptombekämpfung entgegengetreten wird, so Markus Mailer. Es gelte zu erreichen, dass die einheimische Bevölkerung so wenig wie möglich darunter leide. „Abfahrverbote, wie sie zur Zeit bereits gelten, kann man irgendwann einmal klüger lösen, wenn die Navigationsgeräte das mitabbilden“, so Mailer. Darüber hinaus gelte in Tirol Tempo 100 auf der Autobahn. „Das ist eine Maßnahme, die sehr wertvoll ist zum Schutz der Bevölkerung.“ Im Übrigen müsse – wie generell bei der Fahrt in den Urlaub – die Fahrt mit der Bahn an Attraktivität gewinnen.
Die Durchreise durch Tirol und die Anreise von Urlaubsgästen mit dem PKW überrollt Tirol. „Der Besetzungsgrad in den PKW ist nicht so hoch, da sind oft wirklich nur zwei Personen im Auto“, weiß Klaus Schlosser. Markus Mailer gibt weiters zu bedenken: „Die Frage ist, wie kommen unsere Gäste
zu uns, wie bewegen sie sich, wenn sie da sind, und vor allem, wie lange bleiben sie. Je kürzer sie bleiben, desto mehr Gäste müssen anreisen, um die Betten zu füllen. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der An und Abreisen viel stärker gestiegen als die Zahl der Übernachtungen. Das bedeutet mehr Verkehr. Für uns Verkehrsplaner ist das ein wesentlicher Faktor.“
LÖSUNGSANSATZ: CHARTER -
ANGEBOTE & MOBILITÄT VOR ORT „Das müsste so funktionieren, wie auf einer griechischen Insel. Da fahr ich auch nicht mit dem Auto zum Hotel.“ Klaus Schlosser vergleicht die Fahrt zu Tirols Destinationen mit der durchaus üblichen Anreise in südliche Ferienregionen und fordert: „Das Ganze müsste mit der Bahn abwickelbar sein. Vor Ort braucht der Urlauber meist kein Auto mehr.“ Charterzüge aus Holland oder Deutschland wären eine Idee, ist Schlosser überzeugt: „Die Leute würden das annehmen, wenn das gut funktioniert.“
Braucht es vor Ort doch ein Auto, gilt es, kluge Mobilitätslösungen parat zu haben. „Wenn ich ein gutes VorOrtAngebot habe, sind die Leute eher bereit, ihr Auto zu Hause zu lassen. Gerade im Sommertourismus spielt die VorOrtMobilität eine große Rolle“, ist sich Markus Mailer sicher. Man gäbe dem Gast die Sicherheit, dass er das, was er im Urlaub erleben möchte, erleben könne,
auch wenn er kein eigenes Auto dabei habe. Gute Beispiele dafür gibt es, etwa das Zurverfügungstellen von CarSharingAngeboten. Immer mehr Gemeinden, Regionen und Unterkünfte stellen dafür bereits einen Pool EAutos zur Verfügung.
LÖSUNGSANSATZ:
PERSÖNLICHER GEWINN
„Verhaltensänderung bedeutet immer, Angebote und Motivation zu schaffen. Wir nennen das Push and Pull Measures, also Anreize zu bieten und auf der anderen Seite auch Maßnahmen zu setzen, die das Verhalten, das negative Effekte hat, unangenehmer zu machen“, erklärt Markus Mailer. Für die Anreise in den Urlaub brauche es einen Impuls, um aus einem gewohnten Verhalten herauszukommen. Stephan Tischler bestätigt den Ansatz: „Wir wissen, dass man bei Urlaubsfahrten durchaus geneigt ist, seine Alltagsgewohnheiten zu verändern.“ Anreize seien etwa Rabatte auf Zimmerpreise oder Liftkarten oder kostenlose Transfers vor Ort. „Eine Veränderung, damit sie auch langfristig weiterverfolgt wird, muss als Gewinn empfunden werden. Wenn ich das Neue ausprobiere, muss ich es als positiv empfinden“, führt Mailer aus.
LÖSUNGEN TO GO
REGIOFLINK
RegioFlink ist ein OnDemandShuttleservice des VVT, der in bestimmten Regionen Tirols nach Bedarf fährt. Buchungen können über eine App oder telefonisch vorgenommen werden, wobei die App den Abholpunkt und die Route optimiert. Der Service ergänzt den Linienverkehr und nutzt die allgemeinen VVTTarife, mit Ermäßigungen für bestimmte Gruppen. Fahrten sind kostenlos mit einem gültigen VVTTicket in den entsprechenden Zonen. Buchungen können bis zu sieben Tage im Voraus erfolgen, und das System bündelt Fahrgäste für effiziente Routenplanung.
E - CARSHARING DES VVT
Besitzer eines KlimaTickets können mit dem VVT auch Elektroautos der Partner floMOBIL, beecar und FLUGS nutzen. Ab 21 Jahren ist die Buchung einfach online möglich, ohne sich um Wartung oder Versicherungen kümmern zu müssen. Für das Carsharing wird ein Zusatzprodukt im VVT Ticketshop benötigt, je nach Art des KlimaTickets. Nach Übermittlung eines Führerscheinscans erhält man Zugangsdaten und eine Carsharing Card. Die Autos müssen am selben Ort zurückgegeben werden, an dem sie ausgeliehen wurden.
DIE BESTE VERSION
Die Stimmung in der heimischen Wirtschaft ist nach wie vor angespannt, besonders der Handel leidet unter der anhaltenden Rezession. Auch der Möbelhandel verzeichnete im vergangenen Jahr Einbrüche. Das hat indes nicht ausschließlich mit der Wirtschaftslage zu tun. Wir haben Martin Wetscher in seinen gleichnamigen Wohngalerien in Fügen besucht und mit ihm über die derzeitige Situation gesprochen und darüber, wie Wirtschaften dennoch nachhaltig erfolgreich funktionieren kann.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
ie Situation im heimischen Möbelhandel war in den vergangenen rund 30 Jahren eine sehr spezielle. Rund 80 Prozent des österreichischen Marktes teilten sich die großen zwei –Kika/Leiner und Lutz – gemeinsam mit Ikea auf. Das ist anderswo anders. In Österreich führte dies letzlich zu einer Konzentration, die nicht nur ob der Kleinheit des Marktes nicht guttat.
VON FAMILIEN UND ANDEREN GESCHICHTEN
Bis heute liegt das oberösterreichische Unternehmen XXXLutz in der Hand der Gründerfamilie Seifert, die vor allem in den Jahren 1983 bis 1998 zur großen Expansion ansetzte. Bis dorthin war man ein eher kleiner Player am Markt und Kika in der durchaus besseren Position. Bis ein Mitarbeiter der Chefetage just zur Konkurrenz wechselte. „Daraus ist meiner Meinung nach ein persönlicher Wettbewerb der beiden Unternehmen entstanden. Lutz hat Kika überholt … und letztlich überlebt“, sagt Martin Wetscher. „Was im Schatten dieses wahnsinnig starken Wettbewerbs im Einzelhandel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen allerdings passiert ist, ist, dass viele mittelständische
Unternehmen dabei zerrieben wurden. Viele davon haben aufgegeben. Nicht alle mussten tatsächlich Insolvenz anmelden, sie fanden jedoch keine Nachfolger, wurden verkauft oder Standorte aufgelöst. Der Mittelstand wurde quasi ausradiert. Das hat unter anderem dazu geführt, dass über Jahrzehnte hinweg die Innovationskraft in der Branche verloren gegangen ist.“ Wetscher blieb als einer von wenigen in seinem Segment über
ECO.NOVA: Die Coronapandemie führte zu einem Revival des eigenen Zuhauses. Die Möbel- und Einrichtungsbranche hat’s gefreut, die Umsätze sind gestiegen. Nun steht der Möbelhandel unter Druck. Wie kommt’s? MARTIN WETSCHER: Während der Pandemie mit all ihren Lockdowns und (Reise)Beschränkungen haben die Menschen den Wert des eigenen Zuhauses wiederentdeckt und begonnen, ihre eigenen vier Wände zu erneuern, zu
verschönern und zu verbessern. Weil man nicht reisen konnte, flossen viele dieser Budgets ins Wohnen. Das führte bei manchem Händler zur fälschlichen Annahme, das wäre der Anfang eines anhaltenden Aufschwungs. Die Ernüchterung war entsprechend radikal, als Mitte/Ende 2020 die Frequenz und damit Umsätze massiv zurückgegangen sind. Vielfach war man noch mit der Abarbeitung bestehender Aufträge beschäftigt, sodass man erst relativ spät bemerkt hat, dass sich die Zeiten bereits wieder geändert haben. Zu diesem Einbruch kamen gleichzeitig empfindliche Steigerungen bei Energie und Personalkosten. Das hat viele Branchen betroffen, auch den Möbelhandel.
Hat die Pandemie langfristige Auswirkungen auf die Branche? Viele Lieferanten sind in dieser Zeit unter Druck geraten. Sie haben Kapazitäten aufgebaut, um liefer
„Wir werden unsere beiden Marken – Wetscher Wohngalerien und Wetscher Max – behutsam, aber bestimmt weiterentwickeln.“
MARTIN WETSCHER

Das Team rund um Martin Wetscher gestaltet Wohnwelten, die nicht nur die Seele der Bewohner*innen widerspiegeln, sondern die beste Version ihrerselbst zum Vorschein bringen.




Der italienische Komplettanbieter Poliform vereint Eleganz und Raffinesse mit funktionalen Details und durchdachten Systemen. Im April 2024 eröffnete Wetscher das neue Poliform-Küchenstudio, das auf großzügiger Fläche eine umfassende Kollektion präsentiert – teilweise personalisiert mit Ergänzungen aus den Wetscher Werkstätten. Ende September folgte Österreichs größtes Poliform-Studio, das die beeindruckende Vielfalt der Marke zeigt. Mit spannenden Neuheiten und zeitlosen Klassikern bietet Poliform ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für jeden Wohnbereich – vom Ess- und Wohnzimmer bis hin zum Ankleide- und Schlafzimmer.
fähig zu bleiben, oder versucht, Allianzen zu schließen. In Deutschland erleben wir gerade, dass viele dieser Lieferanten nun gänzlich vom Markt verschwinden oder bestimmte Produktgruppen aus dem Sortiment nehmen. Das ist schlimm. Bei den italienischen Marken ist das Gott sei Dank anders, die sind breiter und internationaler aufgestellt. Die großen Steigerungen sind aber auch dort vorbei. Außerdem haben einige Hersteller den Preisbogen überspannt, sodass das PreisLeistungsVerhältnis nicht mehr stimmt. Damit haben sie sich langfristig nichts Gutes getan.
Die wirtschaftliche Lage ist aktuell nicht sonderlich rosig. Sind Ihre Kund*innen preissensibler geworden? Nicht unbedingt. Abgesehen davon haben wir in den Wetscher Wohngalerien die Möglichkeit, auf unterschiedliche Preisniveaus Rücksicht zu nehmen, und bieten mit Wetscher Max ein kostengünstigeres Einstiegssortiment. Was wir aktuell spüren, ist die allgemeine Unsicherheit, die die Investitionsfreude generell hemmt. Es ist momentan schlichtweg weniger Lust da, in sein Zuhause zu investieren. Viele Investitionen sind in der Pandemiezeit zudem vorweggenommen worden, dieser Vorzieheffekt sollte sich im nächsten Jahr hoffentlich wieder normalisieren. Die Verhaltenheit im Konsum liegt meiner Meinung nach nicht nur am fehlenden Geld – wie man etwa anhand der regen Reisetätigkeiten sehen kann –, vielmehr hat sich die Gewichtung verschoben, wofür man sein Geld ausgibt.
Welche Auswirkungen hat die Insolvenz von Kika/Leiner Ihrer Meinung nach auf den heimischen Markt? Auf gut Tirolerisch würde ich sagen: Schau’ ma mal, dann seh’ ma schon. Mit Kika/Leiner ist ein mächtiger Anbieter aus dem Markt ausgeschieden, wobei dessen Bedeutung in den vergangenen Jahren bereits sukzessive abgenommen hat. In Tirol etwa wurden die Filialen in Wörgl und Imst schon vorher geschlossen. Auf der einen Seite kann das eine Chance für den Mittelstand sein, sich wieder entsprechend zu positionieren, auf der anderen Seite ist die Situation dort nach wie vor angespannt. Die Nachfolge kleinerer Betriebe ist oft schwierig, weil sich die Jungen Unternehmertum nicht mehr „antun“ wollen. Sie sehen den Druck, die Arbeit und die Mühen, die Bürokratie und hohe (Steuer)Belastungen mit sich bringen. Auch die Mitarbeitersituation wird nicht einfacher.
„Das äußere Erscheinen eines Wohnraumes sollte die beste Version von einem selbst sein.“
Die Mitarbeiter*innen von heute sind anders als vor 20 Jahren: anspruchsvoller und mit anderen Erwartungen an die Führung. Hinzu kommt ein gravierender Personalmangel. Ich bin seit 35 Jahren Unternehmer, die Komplexität der Geschäftsabläufe ist in dieser Zeit eklatant gestiegen.
Die Wetscher Wohngalerien beschäftigen rund 100 Mitarbeiter*innen, Wetscher Max etwa 30. Wie gehen Sie mit dem anhaltenden Arbeitskräftemangel um? Wir haben uns in den letzten Jahren stark auf unsere Mitarbeiter*innen fokussiert. Wir wollen, dass sich jeder Einzelne bei uns wohl fühlt. Wir haben mit der Wetscher Meisterklasse für angewandte Innenarchitektur eine eigene Akademie gegründet, in der wir Mitarbeiter*innen auf
MARTIN WETSCHER
Basis ihrer Ausbildung mit entsprechenden Modulen weiterentwickeln – sowohl fachlich als auch in ihrer Persönlichkeit. Und wir haben ein eigenes Mitarbeiterhaus gebaut, in dem wir kostengünstiges Wohnen für all jene zur Verfügung stellen, die von weiter her kommen oder noch keine Wohnung in der Nähe haben. In der eigenen MitarbeiterDesignküche wird regelmäßig gekocht und es gibt einen Rückzugs und Pausenraum auf der Dachterrasse.
In den Wohngalerien gibt es eine eigene Planungsabteilung, die die Innenarchitekt*innen technisch unterstützt und Wohnräume lebendig macht. Was macht für Sie generell guten Stil aus? Die große Frage ist: Wie gehe ich mit Raum um und wie lässt sich Komfortqualität herstellen,
damit die Umgebung dem Menschen entspricht, der darin lebt? Man sagt immer, die Einrichtung sei ein Spiegel der Bewohner. Das ist so nicht ganz richtig: Das äußere Erscheinen eines Raumes ist im Idealfall die beste Version von dem, der darin wohnt. Je besser diese Vision sichtbar wird, desto wohler fühlt man sich. Das ist das Geheimnis des Stils. Und des schönen Wohnens.
Wetscher ist eines der wenigen mittelständischen Möbelhäuser, das dem Druck der Großen in der Vergangenheit standhalten konnte. Warum? Wir haben in den 1990erJahren rund 450 Marken aus dem Sortiment genommen und uns darauf besonnen, wo unsere Wurzeln liegen: in der Tischlerei, im Handwerk und in hochwertigen Marken. Anfangs sind wir für diesen ra

09.03.2025

OLYMPIAHALLE
Österreichs größte Zaubershow. Ein junger Niederösterreicher wandelt auf den Spuren von Harry Houdini und David Copperfield. Mit erst 23 Jahren hat Fabian Blochberger alias FAB FOX das geschafft, wovon viele träumen: Eine eigene fulminante Zaubershow, die sich mit den großen Vorbildern in Las Vegas messen kann.
OLYMPIAHALLE
Das Kultmusical GREASE kehrt nach vielen Jahren zurück auf die Bühnen Österreichs! Die Neuinszenierung entführt die Zuschauer in die 50er Jahre mit Hits wie „You’re The One That I Want“, „Summer Nights“ und „Sandy“. Ein mitreißender Musical-Spaß voller Liebe, Sehnsucht und Rebellion.


16.– 18.01.2026
HOLIDAY ON ICE
HORIZONS
OLYMPIAHALLE
Mit der neuen Produktion HORIZONS knüpft HOLIDAY ON ICE nahtlos an die Erfolge vergangener Jahre an und feiert erneut ein spektakuläres Showerlebnis. Die weltbesten Eiskunstläufer:innen entfesseln auf und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung und ziehen das Publikum mit ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann. Jetzt Bestpreisgarantie -25% nutzen!


Die großzügige Minotti-Ausstellung bei Wetscher präsentiert die gesamte aktuelle Kollektion der italienischen Premiummarke. Die lässige Internationalität und zeitlose Eleganz des Designs finden sich in jedem einzelnen Möbelstück wieder und fügen sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein. Ende Mai wird das Studio umfassend neu gestaltet und Wetscher zählt zu den ersten Händlern im deutschsprachigen Raum, die die Neuheiten der diesjährigen Mailänder Möbelmesse präsentieren werden.
dikalen Schnitt belächelt worden. Uns wurde vorausgesagt, das könne sich nicht ausgehen. Doch es war unser Überlebenstrieb, der uns dazu brachte, den Weg durchzuziehen. Wir sind im Zillertal zuhause, abseits der Metropolen. Damit die Leute zu uns kommen, müssen wir etwas Besonderes und Einzigartiges bieten: Die Kombination aus erstklassiger Markenqualität mit herausragenden Produkten und außergewöhnlicher Präsentation, durchdachter Planung und hauseigener Tischlerei hat uns mittlerweile zu internationalem Renommee verholfen. Wir gelten heute als die Größten der kleinen Premiumhändler und für viele – internationale – Händler als Vorbild.
Mit Wetscher Max haben Sie vor ein paar Jahren eine Möbel-Einstiegsschiene etabliert. Was ist der Hintergrund? Wir wollten schon immer beide Segmente abdecken und hatten parallel zu den Wohngalerien in Fügen erst unter dem Namen Lagerverkauf, dann Avanti eine günstige Marke. Während der Pandemie ist daraus Wetscher Max geworden – quasi der „junge Wetscher“, deshalb trägt das Unternehmen den Namen meines Sohnes. Wetscher Max soll der Einstieg in stilvolles Wohnen sein und selbst wenn das Sortiment günstiger ist, legen wir dennoch Wert auf Qualität –bei den Produkten wie bei der Planung. Neu ist der hohe digitale Anteil, aus dem wir viele Erfahrungen für die Zukunft ziehen. Wir werden die Marke Wetscher nicht revolutionieren oder neu erfinden können
– das wollen wir auch nicht –, trotzdem werden wir sie behutsam, aber bestimmt weiterentwickeln.
Hat sich die Wahrnehmung der Kund*innen gegenüber der Marke verändert, als aus Avanti Wetscher Max wurde? Avanti hat man nicht zwangsläufig mit uns in Verbindung gebracht. Das war so gewollt, nun haben wir die Grundstrategie unseres Unternehmens in eine Art InnenarchitekturlightKonzept mit planungstechnischen und stilistischen Beratungselementen gegossen, den Ladenbau auf ein neues Niveau gehoben und die Art der Präsentation weg von einer reinen Möbelausstellung hin zu Wohn und Stilwelten, wie wir es auch in den Wohngalerien praktizieren, geändert. Das liegt näher an unserer Philosophie, weshalb „Wetscher“ nun auch im Namen vorkommt. Wir stehen voll und ganz hinter jedem einzelnen Produkt.
Was sind die Lerneffekte aus den vergangenen Jahren mit Wetscher Max? Was wir unterschätzt haben, ist, dass es gerade in der Filiale in Innsbruck zu Verwechslungen mit den Wohngalerien kam und andererseits Kund*innen in den Wohngalerien nach dem Einstiegssortiment gesucht haben. Hier müssen wir nachschärfen. Generell ist Wetscher Max aktuell unser Spielplatz für digitale Tools und künftige Kundenbeziehungen. Wir haben damit gerechnet, dass die digitale Revolution im Möbelhandel viel schneller vonstattengeht, als sie tatsächlich
passiert ist, uns ist jedoch bewusst, dass es Veränderungen geben wird. Die Wohngalerien sind ein traditionsreiches Unternehmen mit tiefen Wurzeln und gleichzeitig ein riesiges Schiff, das sich in manchen Belangen nur langsam bewegen und verändern kann. Die dringend notwendigen Erfahrungen im digitalen Bereich holen wir uns über Wetscher Max, um daraus für die Zukunft gerüstet zu sein. Hier können wir uns ausprobieren, Ideen wieder verwerfen, Funktionierendes optimieren und so die Sicherheit gewinnen, die Digitalisierung und ihre Mechanismen zu verstehen.
Wie sehen Sie die Zukunft des stationären Möbelhandels? Einrichten ist nach wie vor mit einem stark haptischen Aspekt verbunden. Mir wird also nicht bang. Das nächste Jahr wird auf Umsatzseite noch schwierig bleiben, vor allem weil der Bau aktuell schwächelt. Wir denken als Familienunternehmen allerdings nicht in Quartalen oder Einjahreszielen, sondern langfristig, und ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Beratung und ein gutes Gespräch nicht gänzlich digitalisieren lassen. Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen den Wert der Innenarchitektur zu verstehen lernen, und wissen, dass es einen ganzheitlichen Planer braucht, der nicht nur einzelne Einrichtungsgegenstände, sondern das große Ganze sieht und damit das Optimum aus einem Raum herausholt. Ich hoffe, dass sich damit der Mittelstand in der Branche wieder erholen kann und seinen Platz findet.
Ihr Eigentum. Unsere Unterstützung.
Vermieten. Ohne Ärger. Ohne Risiko.
Verfl**** Sch****
jetzt hob i schon wieder die K**** am Dampfen beim Vermieten meiner Wohnung. De D****** kennen ma jetzt endgültig in Schuach aufblosn, Kruzifix noamol.
Damit´s Ihnen nicht auch so geht, haben wir die Initiative Sicheres Vermieten ins Leben gerufen. Sie vermieten, wir übernehmen das Risiko und zahlen sogar Schäden in Ihrer Wohnung.






EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE
Fotografie ist mehr als das Produzieren eines Bildes. Ein professionelles Foto ist das optimale Zusammenspiel von Technik und Know-how, Planung und Organisation, Kreativität, Emotion, Atmosphäre und Inszenierung. Und Erfahrung. Es hält Situationen fest, bildet Stimmungen ab, erzählt Geschichten, transportiert Information. Unternehmen kommunizieren anhand ihrer Bildsprache, deshalb ist es wichtig, das richtige Foto in die Hand von Expert*innen zu legen.
Hinter einem professionellen Foto stecken viel Planung, Fachwissen und Technik sowie das Gespür für den perfekten Augenblick. „Die Arbeit eines Fotografen besteht nicht nur darin, ein gutes Bild zu erstellen“, sagt Klaus Maislinger, Innungsmeister der Tiroler Berufsfotografie. „Ein Foto lässt sich heute mit einem Smartphone relativ einfach machen, doch es geht darum, das Potenzial zu wecken, das in jedem Augen
blick steckt, darum, die richtige Perspektive zu finden, die Lichtsetzung zu beachten, um das gewünschte Gefühl zu transportieren. Ein Porträt zum Beispiel ist nicht nur das Abbild eines Gesichts. Ziel ist es, die Persönlichkeit einzufangen samt all ihren Emotionen und Ausdrücken. In Unternehmen geht es darum, ihre Markenstrategie in Bilder zu transferieren. In einem Bild soll man auf den ersten Blick erfassen können, worum es geht.“
PROFESSIONELLE FOTOGRAF*INNEN HABEN DAS WISSEN UND DIE ERFAHRUNG, UM HOCHWERTIGE BILDER MIT KORREKTER BELICHTUNG, KOMPOSITION UND FARBE ZU ERSTELLEN. PHOTOSHOP KANN KLEINE SCHWACHSTELLEN VERBESSERN, ERSETZT
ABER NIE DIE QUALITÄT EINES GUT
AUFGENOMMENEN ORIGINALS.
Viele Unternehmen oder Institutionen greifen für ihre Homepage bzw. Geschäftsunterlagen nach wie vor auf so genannte Stockbilder zurück, also auf meist lizenzfreie Bilder, die nicht für einen bestimmten Zweck oder auf bestimmten Auftrag produziert wurden, sondern quasi auf Vorrat (stock = Lager). Diese Bilder finden sich in der Regel auf globalen Plattformen im Internet und können dort (gegen ein kleines Entgelt oder kostenlos) von jedem unzählige Male heruntergeladen werden. Manchmal sind diese Bilder bereits KIgeneriert, immer jedoch sind sie austauschbar und beliebig. Es fehlt ihnen an Authentizität, am Besonderen. Deshalb lassen sie sich relativ rasch als solche erkennen. Ein Unternehmen, das Wert auf individuelle Fotografie legt, zeigt, dass es Qualität und Professionalität priorisiert – im besten Fall auch Regionalität, indem es mit heimischen Fotograf*innen zusammenarbeitet. Aktuell gibt es in Tirol rund 950 Berufsfotograf*innen, einige davon verfügen

über internationales Renommee. Durch ihr Engagement fördert man regionale Betriebe und hält die Wertschöpfung im Land. Professionelle Fotografen bieten nicht nur die technischen Fähigkeiten, sondern auch eine kreative Perspektive und strategisches Denken, das Unternehmen dabei hilft, ihre Ziele visuell zu erreichen. Photoshop kann diese Expertise zwar unterstützen, sie jedoch niemals ersetzen. Künstlerisches Geschick geht weit über die Möglichkeiten einer Software hinaus. Fotografen können Szenen inszenieren, die authentisch sind und gezielt für die jeweilige Zielgruppe arbeiten. Sie arbeiten mit einer hochwertigen Ausrüstung und kennen deren technische Feinheiten. Und letztlich liefert ein professioneller Fotograf Bilder, die den rechtlichen Anforderungen etwa hinsichtlich Urheber und Nutzungsrecht entsprechen. Wir haben Klaus Maislinger in der Landesinnung Berufsfotografie in der Wirtschaftskammer zum Gespräch getroffen.
ECO.NOVA: Was ist für Sie das Faszinierende an der Fotografie? KLAUS MAISLINGER: Der Beruf des Fotografen ist abwechslungsreich, aufregend und immer wieder neu. Bei jedem Projekt heißt es, von vorne anzufan

gen, neu zu überlegen. Es ist immer wieder spannend, sich in andere Welten hineinzudenken, sich Gedanken zu machen, was hinter Menschen, Unternehmen oder Produkten steckt, welche Visionen und Ideen dahinterstehen und das folglich in ein Bild zu verpacken. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass professionelle Fotografie auch in Zeiten von Photoshop und Künstlicher Intelligenz ihre Berechtigung hat und es sie braucht. Vielleicht mehr denn je, weil Menschen das Ehrliche, Authentische wieder mehr zu schätzen wissen und ihm mehr Vertrauen schenken.
Warum sollten sich vor allem Unternehmen professionelle Fotografen leisten? Die Bildsprache ist ein wesentlicher Teil der Corporate Identity und die Visitenkarte des Unternehmens. Das lässt sich nicht künstlich erzeugen. Mit den entsprechenden Fotos können sich Unternehmen von der Masse abheben und bekommen eine unverwechselbare Identität. Das braucht ein geschultes Auge und Erfahrung.
Braucht es in Zeiten der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz noch Pro-
YETIFINDER
duktfotografie? Definitiv. Stockbilder lassen sich hier ohnehin nicht verwenden und ausschließlich mit Renderings zu arbeiten, ist langfristig nicht zielführend. Produktfotografie ist für mich die Königsklasse, weil es darum geht, Materialien und Haptiken darzustellen. Das Produkt muss so fotografiert sein, dass man es gefühlsmäßig angreifen kann, ohne dass man es in die Hand nimmt. Diese Dreidimensionalität in ein zweidimensionales Bild zu bringen, ist eine große Herausforderung, die viel technisches Knowhow braucht.
Sieht man als Fotograf die Welt mit anderen Augen? Ich denke schon – aber auch nicht jedes Fotografenauge ist gleich. Ist man mit fünf Fotografiekollegen unterwegs, wird man am Ende des Tages fünf verschiedene Perspektiven, Sichtweisen und Ansichten haben. Jeder hat einen anderen Fokus und unterschiedliche Erfahrungen, wie er die Welt erlebt. Das spiegelt sich in den Bildern wider.
Wie findet man den richtigen Fotografen? Man sollte sich unbedingt das Portfolio eines Fotografen anschauen, um zu sehen, ob er generell einen Stil hat, der einem gefällt. Viele Fotografen haben sich zudem auf bestimmte Genres spezialisiert – Architektur, Menschen, Food, Outdoor, Produkte. Auch das gilt es zu berücksichtigen. In einem persönlichen Gespräch findet man schließlich heraus, ob man zusammenpasst, die Ideen des Fotografen mit den Vorstellungen des Auftraggebers zusammenpassen und die Chemie stimmt. Das macht eine erfolgreiche Partnerschaft aus. Mit https://yetifinder.at haben wir zur ersten Vorauswahl eine Suchplattform der Tiroler Berufsfotograf*innen zusammengestellt, an der man sich durch verschiedene Kategorien und Bildstile klicken kann und dann zu den entsprechenden Fotografen kommt. Hier ist sicher für jeden etwas Passendes dabei. PR
Die Tiroler Berufsfotogaf*innen verfügen über eine umfassende technische Ausbildung, jahrelange Erfahrung und ein breites Portfolio. Sie demonstrieren täglich, dass ihre Expertise und ihr kreativer Blick weit über das hinausreichen, was ein Schnappschuss mit dem Smartphone leisten kann. Von Hochzeitsfotografie über klassische Porträt- und atemberaubende Landschaftsbilder bis zu aussagekräftigen Unternehmensporträts beherrschen Tirols Berufs fotograf*innen eine Vielzahl an Stilen und Techniken. Den passenden Fotografen für sich zu finden, ist auch eine Frage des Gefühls. Yetifinder ist die Suchplattform der Berufsfotografie Tirol, anhand derer man über die Bildsprache zum jeweiligen Fotografen kommt. Gesucht werden kann nach bestimmten Themengebieten (Architektur, Familie, Food, Hochzeit, Industrie, Produkt, Reportage, Sport etc.), spricht einen ein Foto an, kommt man mit einem Klick zum Fotografen sowie seinem gesamten Portfolio. Natürlich lässt sich dort auch nach konkreten Fotografen bzw. Eigenschaften (z. B. Drohnenführerschein, eigenes Studio …) suchen. https://yetifinder.at
Klaus Meislinger, Innungsmeister der Tiroler Berufsfotografie
Die Landesinnung der Berufsfotografie Tirol: Patrick Saringer, Reinhard Helweg, der Yeti, Irene Ascher, Klaus Maislinger und Eva Schlögl
FORSCHUNG & INNOVATION

DIE VIREN - BEOBACHTERIN
Manche Viren haben das Potential, eine Pandemie auszulösen. Doch wie kann ein größerer Ausbruch verhindert werden? Diese Frage steht unter Virologen aktuell hoch im Kurs. Gisa Gerold (im Bild), seit 1. November 2024 neue Leiterin des Instituts für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck, und ihr Team verfolgen derzeit beispielsweise den Ausbruch der Vogelgrippe. In Ostösterreich wurden seit 1. September 2024 61 Ausbrüche in Wildvögeln, sechs in Geflügel und zwei bei Vögeln, die in Gefangenschaft leben, registriert. In Tirol gibt es aktuell keine bekannten Fälle, das Institut für Virologie ist dennoch vorbereitet: Dank intensiver Zusammenarbeit mit der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) stehen bereits Testmethoden bereit, um im Fall eines Ausbruchs schnell reagieren zu können. Zudem betont Gerold die Bedeutung von Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere bei toten Vögeln: „Verendete Tiere sollten niemals mit bloßen Händen angefasst werden.“ Gerold ist darüber hinaus Expertin für das Dengue sowie ChikungunyaVirus (CHIKV). Beide Erreger waren bisher vor allem in tropischen und subtropischen Regionen verbreitet, dringen allerdings zunehmend nach Europa vor. Das CHIKV etwa wird durch Insektenstiche übertragen und löst bei Infizierten schwere Gelenksentzündungen aus. „Unser Ziel ist es, die molekularen Mechanismen zu verstehen, die diese Symptome auslösen, und darauf basierend Medikamente zu entwickeln“, erklärt Gerold. In Europa ist die Bekämpfung von Stechmücken eine zentrale Präventionsmaßnahme, etwa durch die Reduzierung von Brutstätten, zum Beispiel, indem stehende Wasserflächen in Gärten vermieden werden.
Das Institut für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck hat mit virologie.i-med.ac.at auch eine neue Webseite, auf der aktuelle Daten zu respiratorischen Erregern wie Influenza, Rhinoviren und SARS-CoV-2 veröffentlicht werden.

Senior Scientist Dr. Lára R. Hallsson und Univ.Prof. Dr. Uwe Siebert, Leiter des Institutes für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment der UMIT TIROL
Zusammen gegen Krebs
Anfang Jänner fand das erste Konsortialtreffen der Partner des HorizonEuropeProjektes „UNCANCONNECT“ statt, das durch eine europaweite datengestützte Zusammenarbeit die Krebsforschung und behandlung revolutionieren soll. Im Rahmen des fünfjährigen Projektes mit einem Forschungsvolumen von 30 Millionen Euro arbeiten europaweit 53 Partnerorganisationen und unternehmen zusammen. Das Institut für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment (IPH) der Privatuniversität UMIT TIROL leitet in diesem wegweisenden EUProjekt einen Anwendungsfall mit einem Forschungsvolumen von einer Million Euro. Hintergrund für das Projekt ist die Tatsache, dass Krebserkrankungen nach HerzKreislaufErkrankungen mittlerweile die zweithäufigste Todesursache darstellen. Ohne entschiedene Maßnahmen werden sie bis 2035 zur führenden Todesursache in Europa. Das Projekt legt den Fokus auf die sechs großen Krebsarten pädiatrische Tumore, lymphoide Malignome, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Eierstockkrebs, Lungenkrebs und Prostatakrebs, die UMIT TIROL leitet den Anwendungsfall zu Eierstockkrebs.

WINTERWISSEN
Winter ist super, hat allerdings seine Tücken. Die Online-Wissensplattform www.snow.institute bietet kostenlose Lehr- und Lernmaterialien, die unter anderem Fragen wie „Wie entsteht Schnee und was ist ein Schneekristall?“, „Welche Arten von Lawinen gibt es und was ist bei Notfällen im Zusammenhang mit Lawinen zu beachten?“ beantworten. Im November 2023 als gemeinsames Projekt des Landes Tirol, der Bergrettung Tirol und des Österreichischen Alpenvereins unter Einbeziehung aller zehn Arge-Alp-Regionen gestartet, konnten im ersten Jahr rund 21.500 Besucher*innen verzeichnet werden. Die Unterlagen wurden 6.500 Mal heruntergeladen. Die Website wird laufend erweitert.

FORSCHUNG STÄRKEN
Die meisten Kinder, die in Tirol, Vorarlberg und Südtirol – dem Einzugsgebiet der Kinderonkologie und -hämatologie an der Universitätsklinik für Pädiatrie I in Innsbruck – an Krebs erkranken, haben mittlerweile sehr gute Chancen, die Krankheit zu überleben. Die Heilungsrate etwa bei akuter lymphatischer Leukämie liegt inzwischen bei über 94 Prozent. Das ist ein Verdienst der Wissenschaft. Die Kinder-Krebs-Hilfe Tirol und Vorarlberg, die schon lange mit der Medizinischen Universität Innsbruck kooperiert, hat im ersten Schritt eine Stiftungsprofessur für Kinderonkologie finanziert und damit die Forschung rund um die Erkrankungen wesentlich unterstützt. Nach Ablauf der Stiftungsprofessur hat Rektor Wolfgang Fleischhacker Roman Crazzolara nun zum Professor für pädiatrische Hämatologie und Onkologie berufen. Die Kinder-Krebs-Hilfe stellt zu diesem Anlass neuerlich 500.000 Euro zur Verfügung, um die Forschung des Teams weiterhin zu stärken.
REDEN WIR ( NICHT ) DRÜBER
Vor Kurzem wurde erstmals ein fundierter globaler Bericht zu den Wechselwirkungen zwischen Informationsökosystemen und Demokratie veröffentlicht. 60 aktiv beteiligte Expert*innen – darunter Prof. Matthias Kettemann vom Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Universität Innsbruck – haben eine Gesamtbeurteilung über die Auswirkungen von Desinformation erstellt. „Zuvor hat keine Studie auf dieser breiten Grundlage empirisch untersucht, welchen Einfluss die Digitalisierung auf globale Demokratie hat. Die ursprüngliche Idee war es – analog zum Klimawandelbericht – eine eindeutige Faktengrundlage für den Gesprächsklimawandel in der digitalisierten Welt zu definieren“, schildert Kettemann. Die Untersuchungen zeigten ein überraschendes Ergebnis: „Wir konnten empirisch keine Belege finden, dass Desinformation die Demokratie kaputt macht. Auch wenn es anhand von Einzelphänomenen so scheint.“ Was die Expert*innen allerdings nachweisen konnten, ist, dass der Diskurs über Desinformation ein wachsendes Misstrauen gegenüber Medien erzeugt. „Das Problem ist also eher, dass wir zu viel über Desinformation sprechen“, so der Internetforscher. Den gesamten Report finden Sie (in englischer Sprache) hinter dem QR-Code zum Download.
Empl steht auf den drei Säulen Nutzfahrzeuge, Defence & Behörden sowie Feuerwehrfahrzeuge. 2022 wurde ein Teil der bestehenden Produktionsfläche zu einem modernen Kundencenter bzw. Übergabehalle umgebaut.

HIDDEN CHAMPION
NISCHENWELTMEISTER EMPL
Das Tiroler Familienunternehmen Empl Fahrzeugwerk GmbH hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem weltweit anerkannten Hersteller von LKW-Sonderaufbauten entwickelt. Gegründet 1948 unter dem Namen „Alpenländischer Fahrzeugbau –J. Empl“, begann das Unternehmen mit der Produktion landwirtschaftlicher Anhänger. Heute ist Empl ein global agierendes Unternehmen, dessen maßgeschneiderte Feuerwehr-, Nutz- und Spezialfahrzeuge weltweit im Einsatz sind, um Sicherheit und Mobilität zu gewährleisten.
TEXT:
MARINA BERNARDI

Gegründet in der Zwischenkriegszeit hat sich die ehemalige Schmiede zum Marktführer im Bereich individuell gebauter LKWSonderaufbauten entwickelt. Die Geschichte von Empl Fahrzeugwerk ist dabei eine von Innovation und Mut – bis heute.
Als der Vater stirbt, ist sein Sohn Josef 17 Jahre alt. Es herrscht Krieg. Der junge Schmied tut alles, um die Produktion im elterlichen Betrieb, dessen Geschicke nun auf seinen Schultern lasten, am Laufen zu halten. Die Kaltenbacher Schmiede hatten seine aus Ellmau stammenden Eltern 1926 gekauft. Hergestellt wurden dort damals unter anderem die im ganzen Land bekannten Zillertaler Holzpflüge. 14 Jahre später liegt es am Sohn und dessen Mutter, das Werk fortzuführen. Drei Jahre lang gelingt ihnen das, damals mit drei Angestellten, der neue Chef ist der jüngste von ihnen. Er ist ambitioniert, nutzt die kurzfristige Befreiung vom Wehrdienst zur Ablegung der Meisterprüfung

Die Empl-Spitze: Joe Empl (re. sitzend) ist als CEO gesamtverantwortlich für sämtliche Bereiche des Unternehmens, schwerpunktmäßig für Vertrieb, Service und Marketing, Gregor Drühe (li. sitzend) ist seit 2000 bei Empl tätig und als COO verantwortlich für den Produktions- und Technikbereich. Alexander Geisler (re. hinten) ist 2023 ins Unternehmen eingestiegen und übernimmt als CFO die Bereiche Finanzen und Personal, Thomas Baumann (li. hinten), seit 2013 bei Empl, ist als CVO verantwortlich für IT, Organisationsentwicklung, Projektmanagement und Logistik. Parallel ist er Geschäftsführer des deutschen Werks in Elster.
40 und wird der jüngste Schmiedemeister im damaligen Deutschen Reich. Dann streckt der Krieg seine Klauen auch nach Josef Empl II aus. Als er zwei Jahre später aus der Gefangenschaft heimkehrt, ist der Betrieb geschlossen. Er packt es an und erweckt die Firma nicht nur wieder zum Leben, sondern haucht ihr ein neues ein.
Josef Empl startet mit einer auf den Bedarf zugeschnittenen Produktion, beginnt, Fahrzeuge für die Landwirtschaft zu konstruieren – unter widrigsten Bedingungen, denn auch in der Nachkriegszeit herrscht Materialknappheit. Aus alten Armeebeständen, die man sich mit viel Mühe organisiert, fertigen Empl und seine kleine Mannschaft Neuartiges und Innovatives: Er konstruiert Wechselsysteme für Anhänger, womit sowohl Rundholz als auch andere Dinge transportiert werden können. Bei der ersten Klagenfurter Messe nach dem Krieg präsentiert er einen luftbereiften landwirtschaftlichen Anhänger – und erregt Aufsehen.
Der „Alpenländische Fahrzeugbau – J. Empl“ beginnt zu wachsen. Als Empl 1964 mit der Fertigung der ersten LKWAufbauten beginnt, legt er den Grundstein dafür, was das Unternehmen heute zum Marktführer macht. 1967 tritt schließlich Herbert Empl ins Unternehmen ein, seine Brüder Josef Empl III 1970 und Heinz Empl 1983.
Lagen die Anfänge des Unternehmens noch in landwirtschaftlichen Anhängern, kaufte man Mitte der 1970erJahre einen Kipperbauer aus Innsbruck, der keine interessierten Nachfolger hatte. Die ersten LKWAufbauten gingen Hand in Hand mit der zunehmenden Bewirtschaftung des Tals, mit den Kraftwerksbauten, der Inntalautobahn. Die Jahre markierten den steilen Aufschwung, 1983 stieg Empl mit intelligenten Produkten ins Exportgeschäft ein und lieferte seine Aufbauten von Australien bis Zimbabwe. Drei Jahre später folgt die Produktion der ersten Feuerwehraufbauten. Die weitere Geschichte ist geprägt von Standorterweiterungen, Investitionen sowie dem Bau einer Technologieschmiede samt LKWTeststrecke und einer unternehmenseigenen Schulungsakademie. 2015 übergab Herbert Empl die Geschäftsführung an seinen Sohn Joe. Wie alle Familienmitglieder zog er sich damit mit 65 Jahren aus dem operativen Geschäft zurück.
WACHSTUMSKURS
2013 wurde Empl von der Österreichischen Wirtschaftskammer als „Hidden Champion“ ausgezeichnet. Diese Bezeichnung gilt für Unternehmen, die zwar weniger bekannt, in ihrem Bereich jedoch Europa oder Weltmarktführer sind. Empl überzeugt bis heute nicht nur durch die herausragende Qualität seiner Produkte, sondern auch durch ein starkes Engagement in Forschung und Entwicklung. Dank dieser Innovationskraft sichert sich das Unternehmen einen entscheidenden Marktvorteil und legt strategische Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft. Trotz einer angespannten Wirtschaftslage, gezeichnet von Fachkräftemangel, stark gestiegenen Lohn und Energiekosten sowie dem damit verbundenen Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und erhöhtem bürokratischem Aufwand, setzt Empl seinen Erfolgskurs konsequent fort. Frühzeitig investierte das Unternehmen in Photovoltaik, rüstete alle Hallendächer mit entsprechenden Anlagen aus und implementierte zahlreiche Energiesparmaßnahmen. Diese nachhaltige Ausrichtung zahlt sich in der aktuellen Situation aus. Empl profitiert zudem von seiner Diversifikation in die drei unabhängigen Geschäftsbereiche Feuerwehrfahrzeuge, zivile Nutzfahrzeuge und den Behörden bzw. Verteidigungssektor. Dieses DreiSäulenModell, kombiniert mit weltweiten Absatzmärkten, hat dem Unternehmen bereits in der Vergangenheit geholfen, Krisen erfolgreich und stabil zu bewältigen.
Das liegt unter anderem daran, dass sich die drei Geschäftsbereiche unabhängig voneinander entwickeln. Im Bereich Zivile Nutzfahrzeuge, der unter anderem Baufahrzeuge umfasst, zeigt sich ein konjunkturabhängiger Rückgang des Auftragseingangs – ausgenommen hiervon ist der Lebensmitteltransport, der weniger stark schwankt. Die Feuerwehrsparte folgt erfahrungsgemäß mit zeitlicher Verzögerung den allgemeinen Konjunkturzyklen. Hier präsentiert sich der Auftragseingang aktuell stabil und Empl kann auf eine ausgezeichnete Auslastung der Produktionskapazitäten in den kommenden
MIT SEINER NACHHALTIGEN STRATEGIE UND BREITEN AUFSTELLUNG BEWEIST EMPL ERNEUT, DASS ES AUCH UNTER SCHWIERIGEN RAHMENBEDINGUNGEN
AGIEREN KANN.
Jahren blicken. Als antizyklischer Bereich erweist sich der Verteidigungssektor derzeit als äußerst robust. Ein Großauftrag des Österreichischen Bundesheers sowie weitere Aufträge von Ministerien aus Deutschland, Lettland, Norwegen, dem Nahen Osten und Afrika sichern dem Unternehmen eine positive Zukunftsperspektive. Derzeit verzeichnet Empl den höchsten Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte.
ARBEITGEBER MIT TRADITION
Mit über 75 Jahren Erfahrung gehört Empl zudem zu den attraktivsten Arbeitgebern Tirols. Die Unternehmenskultur basiert auf gegenseitiger Wertschätzung, Flexibilität und Teamgeist. Mit Standorten in Österreich und Deutschland ist die Empl Gruppe seit Generationen ein geschätzter Arbeitgeber. Viele Mitarbeiterfamilien sind seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig und teilen die Leidenschaft für Spezialfahrzeuge. „Unsere Mitarbeiter*innen profitieren nicht nur von der einzigartigen Lage in der Zillertaler Bergwelt, sondern auch von einem zukunftssicheren Arbeitsplatz“, betont Geschäftsführer und CEO Joe Empl. Flexible Arbeitszeitmodelle gewährleisten eine optimale WorkLifeBalance. Über 430 Beschäftigte in Tirol arbeiten mit Leidenschaft und Fachkompetenz an Feuerwehr und Nutzfahrzeugen sowie an speziellen Lösungen für den Defence und Behördenbereich – individuell angepasst



ARBEITEN BEI EMPL
Empl ist ein global führendes Familienunternehmen mit den drei Sparten Feuerwehr, Nutzfahrzeuge, Behörden/Defence und führender Hersteller von LKWSonderaufbauten. In Tirol sind aktuell 430 Mitarbeiter*innen beschäftigt, in acht Lehrberufen werden ca. 30 Lehrlinge ausgebildet. Empl ist ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb und staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb.
FEELGOOD - BENEFITS
• spannende, abwechslungsreiche Aufgaben
• flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)
• Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen
• gezielte, individuelle Aus und Weiterbildung
• sicherer Arbeitsplatz
• coole Team und Mitarbeiterevents
• vergünstigte, frisch gekochte Mittagsmenüs (eigene Kantine)
• gute Verkehrsanbindung (Nähe Bahnhof & Bus)
• Mitarbeiterrabatte bei regionalen Partnern
• Quereinsteiger willkommen
• Schnuppern jederzeit möglich
• Job Rotation / Traineeprogramm
• Bikeleasing – vergünstigtes Firmenrad www.team.empl.at




„Bergen, löschen, schützen und versorgen“ lautet das Motto von Empl. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind vielfältig, die Tätigkeitsbereiche abwechslungsreich. Aktuell sind über 50 Stellen in verschiedenen Bereichen zu besetzen.
Die alte Schmiede in Kaltenbach markiert 1926 den Start des Unternehmens Empl.

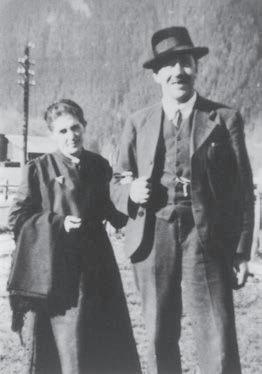

Im Jahr 1964 beginnt Empl mit der Fertigung der ersten LKWAufbauten. Seit damals ist die Herstellung maßgeschneiderter Sonderanfertigungen eine Domäne des Zillertaler Werks.

Die vorhandenen Grundkapazitäten sind Anfang der 1970er-Jahre ausgeschöpft, 1975 übersiedelt Empl schließlich vom Ortskern an den Rand von Kaltenbach.

an die vielfältigen Anforderungen der Kunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. „Empl – gewöhnlich ist woanders. Wir bergen, löschen, schützen und versorgen“, fasst Joe Empl die Mission des Unternehmens zusammen.
Die Arbeit bei Empl ist vielseitig und spannend. Expert*innen aus Einkauf, Vertrieb, Technik, Qualitätssicherung, Marketing und Produktion arbeiten Hand in Hand, um maßgeschneiderte Lösungen zu realisieren. Eine breite Produktpalette und ständig wechselnde Anforderungen sorgen für einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit Raum für persönliche Weiterentwicklung. Durch ein umfassendes Weiterbildungsangebot fördert das Unternehmen gezielt Talente und ermöglicht individuelle Karriereschritte. „Unsere Mitarbeiter*innen setzen ihr Wissen und ihre Leidenschaft ein, um Kunden mit einzigartigen Lösungen zu begeistern und gemeinsam erfolgreich zu sein“, erklärt Gregor Drühe, Geschäftsführer Produktion, stolz.
TALENTSCHMIEDE
Als ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb und staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb blickt Empl auch auf eine lange Tradition der Lehrlingsausbildung zurück. Seit über 50 Jahren werden Lehrlinge ausgebildet. Fast jährlich darf sich Empl über einen Landes und/oder Bundessieger freuen. Während ihrer Ausbildung durchlaufen die Lehrlinge alle Produktionsprozesse von LKWSonderaufbauten. Dabei können sie ihre Interessen entdecken, Fachkenntnisse vertiefen und sich persönlich weiterentwickeln. Die EmplAkademie legt besonderen Wert auf praxisnahe Schulungen sowie die Förderung sozialer und wirtschaftlicher Kompetenzen.
Dank langfristiger Großaufträge, die eine Grundauslastung bis 2029 garantieren, bietet Empl seinen Mitarbeiter*innen einen sicheren Arbeitsplatz. Aktuell sind bis zu 50 Stellen in verschiedenen Bereichen zu besetzen. Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine optimale Balance zwischen beruflichen und privaten Interessen. Zudem wird großer Wert auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen gelegt: Eine hauseigene Kantine bietet täglich frisch zubereitete, regionale Speisen zu fairen Preisen. Mitarbeiterrabatte, eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Fahrradleasing und regelmäßige Teamevents tragen zusätzlich zu einem positiven Betriebsklima bei.
1940 übernimmt Josef Empl II. im Alter von 17 Jahren den Betrieb nach dem unerwarteten Tod des Vaters. Er beschäftigt drei Mitarbeiter.
Gründer Josef Empl I. mit seiner Frau
VOLKSBANK TIROL AG


Ihr Investment in die Region Tirol mit jährlich steigenden Zinsen in Höhe von 2,375 %, 2,625 % und 3,000 % p.a. vor KESt bei einer Laufzeit von 3,5 Jahren

Beachten Sie, dass eine Veranlagung in diese Anleihe mit erheblichen Verlusten verbunden sein kann.
Infos bei Ihrem/Ihrer Berater:in oder hier:

Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf dieser Anleihe noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Rechtsverbindlich und maßgeblich sind alleine die Angaben der Endgültigen Bedingungen dieser Anleihe. Diese sind im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der Emittentin vom 11.06.2024 zu lesen. Der Basisprospekt wurde von der Emittentin, der Volksbank Tirol AG, am 11.06.2024 veröffentlicht. Potentiellen Anleger:innen wird empfohlen, den Basisprospekt einschließlich aller Nachträge zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risken und Chancen der Entscheidung, in die Anleihe zu investieren, vollends zu verstehen. Der Basisprospekt einschließlich aller Nachträge und die Endgültigen Bedingungen werden in deutscher Sprache von der Volksbank Tirol AG, 6020 Innsbruck, Meinhardstraße 1, jederzeit auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Ein Nachtrag wird durch die Emittentin dann veröffentlicht, wenn ein wesentlicher neuer Umstand eingetreten ist. Anleger:innen, die zwischen dem Eintritt des Umstandes und der Veröffentlichung des Nachtrags gezeichnet haben, werden über die Veröffentlichung des Nachtrags und ein mögliches Widerrufsrecht durch ihre Bank informiert. Diese wird bei einer Ausübung des Widerrufsrechts behilflich sein. Der Basisprospekt ist auf folgender Internetseite der Emittentin verfügbar: https://www.volksbank. tirol/boersen-u-maerkte/anleihen/basisprospekt Die Endgültigen Bedingungen sind auf folgender Internetseite der Emittentin verfügbar: https://www.volksbank.tirol/boersen-u-maerkte/anleihen/volksbanktirol-emissionen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Impressum: Medieninhaberin und Herstellerin: Volksbank Tirol AG, Meinhardstraße 1, 6020 Innsbruck, Tel.: 050 566, kundenservice@volksbank.tirol, Foto: ©photog.raph-stock.adobe.com, Verlag und Herstellungsort: Innsbruck, Stand: Jänner 2025 www.volksbank.tirol VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.
„DIE UMIT TIROL ERWIRTSCHAFTET MEHR GELD, ALS SIE BEKOMMT“
Betriebswirtschaftsprofessor Rudolf Steckel hat die UMIT TIROL interimsmäßig als Rektor übernommen. Er ist mit dem Ziel angetreten, die Voraussetzungen zu schaffen, damit in der Universität wieder fokussiert und auf hohem Niveau gelehrt und geforscht werden kann. Im Zuge einer Profilschärfung will Steckel besser nach außen kommunizieren, was die UMIT TIROL für den Tiroler Hochschulstandort sowie den Wirtschaftsstandort Hall in Tirol leistet.
INTERVIEW: MARIAN KRÖLL
ECO.NOVA: Sie sind nach der plötzlichen Trennung von Ex-Rektorin Sandra Ückert an der UMIT TIROL gewissermaßen als Feuerwehrmann eingesprungen. In welchem Zustand haben Sie das Haus vorgefunden? RUDOLF STECKEL: Im Normalzustand, würde ich sagen. Das Ganze hat sich ja überwiegend auf der Führungsebene und zwischen Aufsichtsrat und Gesellschafterebene abgespielt. Im Haus herrschte Normalbetrieb. Da ist gearbeitet worden.
Was würden Sie als Ihre vordringliche Mission als interimistischer Rektor sehen? In der Führungsfunktion dafür zu sorgen, dass in Ruhe und gut weitergearbeitet werden kann und dass die Berichterstattung nach außen in etwas ausgewogenerer Form erfolgt. Ich bemühe mich dabei, Fakten zu transportieren, nicht Emotionen. Sie wissen, es gab ja eine Standortanalyse.
Die UMIT TIROL ist bei dieser Analyse des Tiroler Hochschulstandorts nicht besonders gut weggekommen. Da möchte ich leise widersprechen. Die UMIT TIROL ist in dieser Studie eigentlich sehr gut weggekommen. Es wurde ganz klar festgestellt, dass die UMIT TIROL in der Forschung exzellent unterwegs ist, ähnlich hochkarätige – auch internationale – Forschungsprojekte hat wie die beiden öffentlichen Universitäten. Und, das wiederholt auch die Landesrätin immer wieder, dass die UMIT TIROL ein ganz wichtiges Element der Hochschullandschaft in Tirol ist. Das ist dabei herausgekommen. Es wurde lediglich gesagt, dass es bei den Studienangeboten gewisse Dopplungen gibt. Darüber soll nachgedacht werden, hieß es. Dopplung heißt aber noch nicht, dass es sich um identische Angebote handelt oder Dinge angeboten werden, die nicht notwendig sind. Teilweise handelt es sich um Koopera

„Ich bemühe mich, Fakten zu transportieren, nicht Emotionen.“
tionen, die bewusst so geschaffen wurden, beispielsweise im Bereich Mechatronik. Das gibt es an der UMIT TIROL und an der Universität und wurde gemeinsam aufgebaut. Deswegen gibt es da auch keine Konkurrenzbeziehung. In der Pflege ist es ganz ähnlich. Das kommt in der Öffentlichkeit oft falsch an. Da tauchen dann Worte wie „Baustelle“ auf. Davon kann keine Rede sein.
Es geht immer auch ums liebe Geld. Der UMIT TIROL hält man gerne vor, sie sei so teuer. Die Darstellung, dass die UMIT TIROL immer so viel Geld vom Land bekommt, ist nur insofern richtig, als dass sie Förderungen bekommt wie jede andere Universität und Fachhochschule auch. Dass die UMIT TIROL aber mehr Eigenerlöse erwirtschaftet, geht in der öffentlichen Betrachtung unter. Die UMIT TIROL erwirtschaftet mehr Geld, als sie bekommt. Es gibt meines Wissens in ganz Österreich keine Universität mit einem so hohen Eigenfinanzierungsanteil.
Sie haben dennoch angeregt, an der Finanzierungsstruktur etwas zu ändern. Was haben Sie damit konkret gemeint? Die UMIT TIROL ist ein Landesunternehmen – mehrheitlich im Besitz des Landes, auch die Universität ist beteiligt –, damit gibt es sehr klare Vorgaben, was die Finanzie
rung bzw. die Förderungen betrifft. Das ist grundsätzlich richtig und wichtig. Die UMIT TIROL braucht aber mehr Flexibilität in der selbst erwirtschafteten Finanzierung, um eigene Ideen weiterentwickeln und finanzieren zu können. Da ist das Korsett noch etwas zu eng.
Die UMIT TIROL erwirtschaftet also aus eigener Kraft mehr Geld, als sie dem Steuerzahler kostet. Sie dürfte auch in der Region Hall selbst als beträchtlicher Wirtschaftsfaktor nicht zu vernachlässigen sein? Ja. Da wären einmal die 1.300 Studierenden und 240 Mitarbeiter*innen, die wirtschaftliche Impulse geben, die man nicht unberücksichtigt lassen darf. Die UMIT TIROL zahlt Kommunalsteuer, es werden Mieten gezahlt, es wird konsumiert. Wie groß die direkten wirtschaftlichen Effekte aus der UMIT TIROL heraus sind, müsste man volkswirtschaftlich untersuchen. Mit dem hier investierten Geld hat das Land außerdem die Möglichkeit, zu steuern, was in der UMIT TIROL geschieht. Das ist eine einmalige Möglichkeit. Ich glaube, dass die UMIT TIROL auch gesellschaftlich für Tirol eine hohe Bedeutung hat, weil die Pflege und Gesundheitsthemen, an denen hier geforscht und gelehrt wird, gesellschaftlich höchst relevant sind. Dieser Impact lässt sich nicht so
einfach quantifizieren. Die UMIT TIROL ist ein wichtiges Element in der Gesamtstruktur der Tiroler Hochschullandschaft.
Sie haben argumentiert, dass es für das Land eine Chance sei, über eine Landesuniversität das Studienangebot direkt steuern zu können. Das ist aber zugleich ein Einfallstor für Kritik. Die Tiroler Oppositionsparteien haben damit nicht hinterm Berg gehalten, es war von „Postenschacher“ und „Freunderlbiotop“ die Rede. Was sagen Sie zu derartigen Vorwürfen? Dabei handelt es sich vermutlich um alte Geschichten. Ob es einen Postenschacher gegeben hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bin jedenfalls nicht auf einem Parteiticket hergekommen, sondern weil ich bei den Entscheidungsträgern als ruhige Führungskraft bekannt bin. Für mich ist außerdem der Blick in die Zukunft ausschlaggebend und nicht die Vergangenheit.
Die zuständige Landesrätin Cornelia Hagele hat ihren Willen bekundet, die UMIT TIROL weiterentwickeln zu wollen. Gibt es dazu schon konkrete Vorstellungen, wie eine solche Entwicklung aussehen könnte? Es gab schon vor dieser Standortanalyse einen Diskussionsprozess und gewisse Ideen. Es gibt zum Beispiel eine
45

„Es gibt meines Wissens in ganz Österreich keine Universität mit einem so hohen Eigenfinanzierunganteil wie die UMIT TIROL.“
Ausschreibung für eine Professur Kinderund Jugendpsychologie. Dafür gäbe es einen großen Bedarf. Wir haben außerdem einen Profilschärfungsprozess in Gang gesetzt, in dem intensivere Überlegungen angestellt werden, inwiefern sich die UMIT TIROL aus der Innensicht weiterentwickeln kann. Es gibt da schon einige sehr interessante Ideen.
Apropos Profilschärfung: Wie sehen Sie die Zukunft der dislozierten Standorte, vor allem Landeck? Aus Lienz hat man sich ja bereits zurückgezogen. Das stimmt so nicht ganz. Wenn man nur das Gebäude, den Campus Lienz, hernimmt, ist das richtig. Der wird nun vom MCI bespielt. Der Campus Lienz war überdies immer ein gemeinsamer Standort der Universität Innsbruck und der UMIT TIROL. Das wird in der Berichterstattung oft vergessen. Bei uns war es so, dass es beim einen oder anderen UMITTIROLLehrgang in Lienz einfach wenig Teilnehmer*innen gab. Man muss auch einmal etwas zurückdrehen, wenn es nicht sinnvoll ist. Es gibt aber auch noch das Zentrum für Lernen und Lernstörungen am Standort Lienz. Das ist durchaus erfolgreich und sehr beliebt, deswegen werden wir uns beim Land darum bemühen, dass das Zentrum weiter bestehen kann. Das empfinde ich als sehr wichtige und gute Einrichtung. Wir als UMIT TIROL haben den Standort Lienz also nicht abgedreht, sondern uns lediglich aus verschiedenen Lehrgängen zurückgezogen.
Wie sieht es mit dem Standort Landeck aus? Der Studienstandort Landeck, an dem die Privatuniversität UMIT TIROL gemeinsam mit der Universität Innsbruck das Ba
chelorstudium Wirtschaft, Gesundheits und Sporttourismus anbietet, entwickelt sich durchaus positiv. Die Zusammenarbeit mit der regionalen Tourismuswirtschaft funktioniert sehr gut. Von den Projekten, die dabei gemeinsam mit den Unternehmen durchgeführt werden, profitieren sowohl die regionale Wirtschaft als auch die Studierenden.
Es gibt immer wieder Kritik an den relativ niedrigen Studierendenzahlen an der UMIT TIROL. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Nein, das ist mir nicht nachvollziehbar. Wenn man es real sieht, gab es in den letzten Jahren sogar leicht steigende Studierendenzahlen. Im Pflege und Gesundheitsbereich gab es neue bundesgesetzliche Bestimmungen, die dafür gesorgt haben, dass gewisse Studiengänge, die früher an der UMIT TIROL angeboten wurden, heute nur noch an FHs angeboten werden dürfen. Die UMIT TIROL war in Österreich Pionierin in der Akademisierung der Pflege. Hier wurde das Kombistudium Pflege entwickelt, das die alte Diplomausbildung und das Bachelorstudium Pflegewissenschaft kombiniert hat. Aus den ursprünglich jeweils drei Jahre dauernden Ausbildungen wurde ein Paket geschnürt und man konnte in vier Jahren beide Abschlüsse – den akademischwissenschaftlichen und die Diplomausbildung – machen. Wir waren damit so erfolgreich, dass Universitäten das einfach kopiert haben. Zu Spitzenzeiten wurden rund 260 Studierende ausgebildet, die wir abwickeln mussten. Bei den medizinischtechnischen Diensten war es ähnlich. Da hatte die UMIT TIROL die Physiotherapieausbildung mit 110 Studienplätzen. Es
mussten also insgesamt 370 Studienplätze abgebaut werden. Rechnet man diese durch gesetzliche Änderungen verlorenen Studierenden heraus, hat die UMIT TIROL nicht an Zuspruch verloren. Ganz im Gegenteil.
Wie wollen Sie nach Ihrer Interimsrektorschaft die UMIT TIROL für die Zukunft aufgestellt sehen? Ich möchte das Haus so hinterlassen, dass wieder mit Optimismus intensiv gearbeitet werden kann. Wir haben, das kann ich durchaus behaupten, wieder ein sehr gutes Arbeitsklima. Das war durch gewisse Geschichten in der Führungsebene in der Vergangenheit nicht optimal. Mittlerweile herrscht wieder gute Stimmung. Die hausinterne Kommunikation funktioniert wieder sehr gut. Ich möchte in meiner Zeit hier dazu beitragen, dass eine Profilschärfung gelingt und die Außenwahrnehmung verbessert wird. Ich war sehr lange Zeit an einer anderen Universität und muss zugeben, auch ich habe wenig von der UMIT TIROL gewusst. Wir sind mittlerweile intensiv damit beschäftigt, besser herauszuarbeiten, was die UMIT TIROL macht und welche Bedeutung sie im Tiroler Hochschulsektor hat.
Sie wollen dadurch erreichen, dass die Frage nach der Daseinsberechtigung der UMIT TIROL verstummt? Ja. Meine persönliche Meinung ist, dass es für Tirol eine einzigartige Geschichte ist, so eine private Universität zu haben, die sich zu einem beträchtlichen Teil selbst finanziert. Die Förderungen halten sich – das sage ich als Wirtschaftler – in Grenzen. Wenn man die Gesamteffekte berücksichtigt, ist das wirklich sehr gut investiertes Geld.
WEITERBILDUNG ALS WETTBEWERBSVORTEIL
Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von stetigem Wandel und technologischen Innovationen. Daher wird die Weiterbildung von Mitarbeiter*innen zur zentralen strategischen Aufgabe. Doch warum ist es für Unternehmen so wichtig, kontinuierlich in die Aus- und Weiterbildung ihres Teams zu investieren?

Regelmäßige Weiterbildung sorgt dafür, dass Mitarbeiter*innen auf dem neuesten Stand bleiben – sei es bei branchenspezifischen Entwicklungen, neuen Technologien oder geänderten gesetzlichen Anforderungen. Unternehmen, die frühzeitig in die Qualifikation ihrer Belegschaft investieren, schaffen nicht nur Wettbewerbsvorteile, sondern sichern langfristig auch ihre Innovationskraft.
MOTIVATION UND BINDUNG
DER BELEGSCHAFT
Mitarbeiter*innen, die sich durch Weiterbildungsangebote gefördert fühlen, erleben Wertschätzung und bleiben ihrem Unternehmen häufiger treu. Dies reduziert nicht nur Fluktuation und die damit verbundenen Kosten, sondern stärkt auch das Betriebsklima. Weiterbildung fördert die persönliche Entwicklung und steigert die Motivation.
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT UND ARBEITGEBERATTRAKTIVITÄT
Unternehmen müssen heute agiler sein denn je. Eine gut ausgebildete Belegschaft kann

schneller neue Herausforderungen meistern. Besonders in Zeiten von Digitalisierung und globalen Veränderungen ist dies ein entscheidender Erfolgsfaktor. Unternehmen, die in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter*innen investieren, werden nicht nur von ihren bestehenden Teams geschätzt, sondern ziehen auch neue Talente an. In einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt ist dies ein wesentlicher Vorteil, um die besten Köpfe zu gewinnen.
Regelmäßige Aus und Weiterbildung ist ein Schlüssel, um Unternehmen zukunftsfähig zu machen – und gleichzeitig ein klares Signal der Wertschätzung.
MASSGESCHNEIDERTE
INHOUSE - SCHULUNGEN
In persönlichen Gesprächen ermittelt das BFI Tirol Ihre individuellen Anforderungen, gestaltet mit Ihnen die relevanten Inhalte sowie die eingesetzte Methodik und übernimmt auf Wunsch die komplette Organisation des Trainings. Mit unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir über ein großes Netzwerk an erfahrenen Trainer*innen. PR
WEITERBILDUNG STÄRKT UNTERNEHMEN, SICHERT ERFOLG UND BINDET
MOTIVIERTE MITARBEITER*INNEN.
Othmar Tamerl, BFI-Tirol-Geschäftsführer
AKTUELLE SEMINARE
• KI in der Medizin und Psychologie –Vortrag Manfred Spitzer
Online am 13. Feber 2025
• Lehrgang Data Science und Business Analytics
Start am 3. März 2025
• Elektrotechnik Grundlagen
Start am 3. März 2025
• Einführung in Microsoft 365 Copilot
Start am 5. März 2025
• Fachausbildung für KI-Beauftragte
Start am 7. März 2025
• Ausbildung zum/zur Dampfkesselwärter*in
Start am 10. März 2025
• Sicherheitsfachkrafttag Am 13. März 2025
• BI Business Intelligence mit PowerBI für Einsteiger*innen
Start am 20. März 2025
• Ausbildung zum/zur Buchhalter*in –Praxislehrgang
Start am 21. März 2025
• Ausbilder*innentraining
Start am 7. April 2025
• Effektive Datenstrategie für Unternehmen: Von der Datensammlung bis zur Umsetzung
Start am 11. April 2025

BFI TIROL
Ing.-Etzel-Straße 7 6020 Innsbruck
Tel.: 050 9660 675 firmenservice@bfi-tirol.at www.bfi.tirol
Finanzen
VERANLAGEN & VERSICHERN

ES BLEIBT SPANNEND
„2024 war ein ausgesprochen gutes Jahr für Anleger*innen. Für 2025 erwarten wir weiterhin eine moderate Performance der Aktienmärkte, auch wenn die Marktrisiken größer geworden sind“, sagte Nils Kottke, Mitglied des Vorstandes im Bankhaus Spängler, im Rahmen eines aktuellen Kapitalmarktausblicks. Was die Konjunktur betrifft, könne man derzeit von zwei Welten sprechen. Die USA heben sich vom Rest deutlich ab und haben insbesondere gegenüber der Eurozone weiterhin die Nase vorn.
„Die Stimmung in Europa ist nach wie vor eingetrübt, in den USA hingegen steht die erneute Präsidentschaft von Donald Trump bevor, und der Optimismus bei Managern und Verbrauchern ist hier nach wie vor groß”, ergänzt AssetManager Markus Dürnberger. Was Trumps Amtszeit tatsächlich für die Wirtschaft bringen werde, sei aber noch offen. Welche Lehren Anleger*innen aus 2024 ziehen können? „Aus 2024 haben wir wieder einmal gelernt, dass es wichtig ist, so lange investiert zu bleiben, bis sich die Fundamentaldaten ändern. Weiterhin hat die Inflation einen langfristigen Eindruck auf Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen und Gold sich als Absicherung gegen globale Risiken bewährt“, so Dürnberger. Für das Jahr 2025 rechnet der Vermögensverwalter mit einem moderaten Wirtschaftswachstum, einer Inflation in Europa auf Zielkurs Richtung zwei Prozent, gedämpften Zinssenkungserwartungen und moderat steigenden Unternehmensgewinnen. Zu den Risiken gehören laut Dürnberger die Gefahr einer Rezession, ein möglicher erneuter Anstieg der Inflation, geopolitische Unsicherheiten, Staatsschuldenkrisen und ein vielleicht zu großer Optimismus an den Kapitalmärkten.
Der Kapitalmarktausblick wurde im Jänner via Videostream übertragen. Das gesamte Gespräch zum Nachschauen (ca. 40 Minuten) finden Sie hinter dem QR-Code.
Quelle: Kapitalmarktausblick, Jänner 2025, Bankhaus Spängler. www.spaengler.at.

ZUCKERLN MIT ZUKUNFT
Die Versicherungsexperten von GrECo haben in ihrer umfangreichen Health-&-Benefits-Studie nachgefragt, welche Benefits sich Österreichs Arbeitnehmer*innen am meisten wünschen. Dabei zeigt sich ein großer Trend: Noch nie haben sich die Menschen so intensiv mit ihrer Zukunft auseinandergesetzt. So halten rund 90 Prozent der Befragten eine Pensionsvorsorge, private Krankenversicherung und steuerfreie Zukunftsleistungen wie eine lohnsteuerfreie betriebliche Vorsorge für besonders attraktiv. Vor allem für die Generation Z sind Angebote für die mentale Gesundheit sowie Work-Life-Balance wichtig. Die Hälfte der jungen Mitarbeiter*innen würde für Zusatzleistungen sogar auf bis zu zehn Prozent ihres Gehalts verzichten. Langfristige Sicherheit ist aktuell also der größte Loyalitätsfaktor, dennoch schöpfen rund zwei Drittel der Unternehmen die Vorteile betrieblicher Vorsorgeleistungen nicht aus. Rund ein Drittel der befragten Unternehmen gab zudem an, nicht zu wissen, wie viel Prozent der Lohnsumme für Benefits aufgewendet wird. Aufholbedarf gibt’s außerdem in der Kommunikation: Werden Benefits angeboten, sind die nur etwa der Hälfte der Mitarbeiter*innen bekannt. Um die detaillierten Ergebnisse der Umfrage anzufragen, scannen Sie bitte den QR-Code.

WISSENSCHAFT TRIFFT PRAXIS
Innfoliolytix, gegründet 2019 von den Innsbrucker Universitätsprofessoren Matthias Bank und Jochen Lawrenz als universitäres Spin-off und seit 2024 mit eigener Konzession als Wertpapierfirma am Markt tätig, möchte mit Erkenntnissen aus der theoretischen Kapitalmarktforschung einen spürbaren Mehrwert für die praktische Vermögensverwaltung liefern. Mithilfe eines wissenschaftlichen Zugangs sollen Märkte (besser) verstanden und daraus entsprechende Strategien und Modelle für ein professionelles Portfolio-Management abgeleitet werden können. Wir haben in unserer vergangenen Juni-Ausgabe darüber berichtet – zum Beitrag geht’s über den QR-Code. Dass das Modell in der Praxis funktioniert, zeigt sich unter anderem in der Auszeichnung des „Quant Global Plus“ – ein von Innfoliolytix beratener und von der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft verwalteter Fonds – als bester Aktienfonds beim Österreichischen Dachfonds Award 2024, bei dem man aus dem Stand auf Platz eins gelandet ist. innfoliolytix.at
FÖRDERUNG
Die Sparkasse Imst begleitet seit ihrer Gründung 1882 wichtige Einrichtungen im Tiroler Oberland. 2016 wurde von der Sparkasse Imst Privatstiftung außerdem ein Förderpreis ins Leben gerufen, der gemeinnützige und nachhaltige Initiativen in der Region unterstützt. Bisher erhielten 54 Preisträger*innen eine finanzielle Unterstützung in Höhe von ingesamt 313.000 Euro. Zum zehnjährigen Jubiläum wird die Fördersumme auf 55.000 Euro erhöht. Die Einladung richtet sich an Vereine, Bildungseinrichtungen, Institutionen und Organisationen, die Initiativen unter anderem in den Bereichen Kultur, Soziales und Karitatives, Bildung, Umwelt, Sport oder Wissenschaft und Forschung entweder bereits umsetzen oder dies in naher Zukunft planen. Die Konzepte können bis zum 31. Mai 2025 eingereicht werden. Informationen und Bewerbungsunterlagen gibt es online unter www.sparkasse.at/imst

Leiter Private Banking, Tiroler Sparkasse Mit Jahreswechsel übernahm Christian Karasek die Leitung des Private Bankings der Tiroler Sparkasse und folgt damit DésiréeMarie Holjevac, die in die Erste Bank Oesterreich wechselt. Karasek startete seine Berufslaufbahn 1996 bei der Sparkasse Schwaz und hat dort das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt. In verschiedenen Funktionen konnte der Vater dreier Kinder in den letzten 28 Jahren umfassende Vertriebs und Führungserfahrungen sammeln. Karasek war seit 2008 maßgeblich am Aufbau der PrivateBankingAbteilung in der Sparkasse Schwaz beteiligt. Zuletzt verantwortete er das komplette Wertpapiergeschäft des Bankinstituts und fungierte als Spezialist im Veranlagungsbereich.

FATMA CÖMERT
Vorstandsvorsitzende des Raiffeisen Service Center Tirol Ab 1. April 2025 übernimmt Fatma Cömert die Position der Vorstandsvorsitzenden des Raiffeisen Service Center Tirol. Sie folgt auf Elke Pagitz, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird. Die diplomierte Betriebswirtin war sieben Jahre lang in verschiedenen Positionen bei der Teambank AG (easycredit) tätig, unter anderem in den Bereichen Controlling, Bestandsmanagement und Marketing, und sammelte außerdem wertvolle Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen. In ihrer neuen Rolle als Vorstandsvorsitzende des RSC Tirol wird Fatma Cömert gemeinsam mit Christian Gschliesser maßgeblich die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben.
CHRISTIAN KARASEK
Matthias Bank und Jochen Lawrenz

„DIE ANGST VOR DEM THEMA GELD NEHMEN “
Monkee-Co-Founder und CEO Martin Granig will mit seinem Unternehmen das Buy-now-pay-later-Prinzip umkehren. Finanzbildung ist ein wesentliches Instrument dafür. Je früher man (mit Kindern) über Geld spricht, desto besser.
INTERVIEW: MARIAN KRÖLL
ECO.NOVA: Laut Allianz Global Wealth Report hat der durchschnittliche Deutsche ein Finanzvermögen von rund 70.000 Euro. Wie viel sind es bei Frau und Herr Österreicher und – noch wichtiger – warum ist diese Betrachtungsweise Unsinn? MARTIN GRANIG: Deutschland und Österreich liegen beim Nettogeldvermögen ziemlich gleichauf, Österreich liegt mit 70.400 Euro sogar leicht über Deutschland mit 69.800 Euro. Global ist es 2023 um 7,4 Prozent gewachsen, in Österreich nur um 3,6 Prozent. Berücksichtigt man die Inflation, ist es sogar um vier Prozent geschrumpft. Das ist das Bild, wenn man sich die Durchschnitte anschaut. Das macht allerdings sehr wenig Sinn. Der Median ist da schon etwas aussagekräftiger. Da liegt das Nettogeldvermögen der Österreicher*innen bei 20.800 Euro, das heißt, die Hälfte der Österreicher*innen hat weniger als das. Selbst der Median verzerrt die Realität. Die Vermögensverteilung ergibt ein klareres Bild.
Wie sieht dieses Bild aus? Es zeigt, dass Österreich im Euroraum die schlechteste Wohlstandsverteilung hat. Das oberste Prozent der Vermögenden besitzt 55 Prozent des Gesamtvermögens, die untere Hälfte weniger als vier Prozent.
Wie lässt sich das erklären? In der öffentlichen Debatte – besonders im Kontext von Vermögenssteuern – wird ja gerne darauf verwiesen, dass es in Österreich so gerecht zugehe? In der medialen Ver
„Das oberste Prozent der Vermögenden besitzt 55 Prozent des Gesamtvermögens, die untere Hälfte besitzt weniger als vier Prozent.“
kürzung bedient man sich gerne der Durchschnittswerte. Die verdecken die Probleme. Die Zahlen sind an und für sich klar und bekannt, es wird aber nicht gerne transparent darüber gesprochen, weil sie Handlungsbedarf auf gleich mehreren Ebenen offenbaren. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Zahlen ja nicht so sind, weil hier Menschen besonders innovativ gewesen sind oder hart gearbeitet hätten. Der größte Teil der Vermögen ist ererbt.
Das ist im gesamten deutschsprachigen Raum die gängige Methode, zu Vermögen zu kommen. Ganz genau. Sieben der zehn bzw. 15 der 20 reichsten Österreicher*innen sind Erben, während in den USA die Vermögen von neun der zehn reichsten Amerikaner*innen „self made“ sind.
Beim Thema Vermögensbesteuerung sind die politischen Fronten in Österreich verhärtet, ohne Aussicht auf Änderung. Warum ist das so? Die, die mehr Kapital haben, haben die Macht, sowohl wirtschaft
lich als auch politisch Einfluss zu nehmen. Reiche Menschen haben eine starke Lobby, arme Menschen keine. Ich bin grundsätzlich nicht unbedingt dafür, neue Steuern einzuführen. Mehr zu arbeiten, um dadurch mehr zu verdienen, soll ja ein Incentive bleiben. Man müsste aber dafür den sogenannten Mittelstand deutlich entlasten, so dass man von der Mehrarbeit mehr profitiert und sich auch etwas aufbauen kann.
Es wird gerne darauf herumgeritten, dass Österreicher altmodisch am Sparbuch hängen würden, während ihnen die große Rendite an der Börse entginge. Wird bei diesem auf den ersten Blick einleuchtenden Vorhalt etwas übersehen? Das ist eine sehr undifferenzierte Betrachtung. Bei uns wird das Thema Vermögen und Unternehmertum kulturell ganz anders gehandhabt als beispielsweise in den USA. Als ich mich selbständig gemacht habe, war das Erste, was ich von meinen Eltern gehört habe: „Wirklich? Magst nicht lieber noch in deinem Angestelltenjob bleiben?“

Das Sicherheitsdenken dominiert vor einer generell eher schaumgebremsten Unternehmungslust. So ist es. Daran hat auch unser Schulsystem einen nicht unwesentlichen Anteil. Es erzieht tendenziell eher dazu, ein guter Angestellter zu sein, als Risiko einzugehen und ins Unternehmertum einzusteigen. Ich bin ein Fan unseres Sozialsystems und möchte niemals in amerikanischen Verhältnissen leben, …
Jetzt kommt normalerweise ein Aber? Es gibt einige Fehlanreize und negative Aspekte in unserem System. Wir haben heute ein so gut gestricktes Sozialsystem, dass man sich in niedrigen Einkommensgruppen teilweise überlegen muss, ob es sich überhaupt rentiert, zu arbeiten. Außerdem wird Mehrarbeit bürokratisch verkompliziert und steuerlich bestraft. In den USA gibt es das in der Form nicht. Man kann nur aufsteigen, wenn man härter arbeitet und mehr Risiken eingeht. Österreich ist konservativer, weil wir es uns in der Vergangenheit leisten konnten, konservativer zu sein. Ob das in Zukunft noch so sein wird, steht in Frage.
Baut die Politik mit der stärkeren Betonung der Eigenverantwortung vor für eine Zeit, in der aufgrund der Demografie und chronisch leerer Staatssäckel der Generationenvertrag Makulatur geworden sein wird? Definitiv wird in diese Richtung kommuniziert: Ihr müsst mehr investieren, das Sparbuch ist schlecht, da verliert das Geld nur an Wert. Das ist aber ein bisschen so, wie wenn ich einem Verdurstenden in der Wüste sage, er solle doch einfach mehr
trinken. Ein viel zu großer Teil der Österreicher*innen lebt von der Hand in den Mund. Den Leuten, die nicht einmal einen Notgroschen auf der Seite haben, zu sagen, sie mögen mehr investieren, ist zynisch. Generell sind wir in Österreich aber spät damit dran, die Pensionen etwas stärker auf einen Mix aus staatlicher, privater und betrieblicher Pensionsvorsorge unter stärkerer Einbeziehung des Kapitalmarkts auszurichten.
Wie vielen Österreicher*innen ist es gegenwärtig unmöglich, etwas zur Seite zu legen? Das dürfte zumindest ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung betreffen. Das TopProzent spart 35 Prozent des Vermögens, die TopZehnProzent 70 Prozent des Vermögens und die unteren 50 Prozent verschulden sich im Durchschnitt mit 300 Euro pro Jahr. Die unteren 30 Prozent sind jedenfalls weit davon entfernt, etwas ansparen zu können.
Wo würden Sie hierzulande bei der Finanzbildung, an der es offensichtlich in weitesten Teilen der Bevölkerung nach wie vor mangelt, ansetzen, um finanziell mündigere, informiertere und selbstbewusstere Bürger*innen zu produzieren? Finanzbildung ist nicht Rocket Science. Es geht um Basics, darum, zu verstehen, wo mein Geld hinfließt. Zu verstehen, wie man Kosten senken, sein Einkommen erhöhen und sich
gegen Risiken – kurzfristig der Notgroschen, langfristig das Investment und die Versicherung – absichern kann und wie man für die Pension vorsorgt. Es geht nicht darum, das Steuersystem im Detail zu verstehen. Ziel muss es sein, die Angst vor dem Thema Geld zu nehmen. Da geht es auch wieder um unsere Kultur, in der gesagt wird: Über Geld spricht man nicht.
Das ist zum Nachteil derer, die ohnehin wenig davon haben, weil Menschen, die Geld haben, sehr wohl – wenn auch nur mit Eingeweihten – darüber sprechen und vor allem intensiv darüber nachdenken oder nachdenken lassen, wie sich das Geld weiter vermehren lässt. Genau. In der Regel ist es so, dass man jahrelang nicht über Geld spricht, bis man sein erstes Geld verdient. Dann kann man zwar Goethe rezitieren, weiß aber immer noch nichts über Geld.
Ich möchte meinen, dass man sowohl über Goethe als auch über Geld Bescheid wissen kann. Auf jeden Fall. Wenn sich Jugendliche besser mit Geld auskennen, dann lässt sich auch ein positiver SpilloverEffekt beobachten. Das strahlt dann auch auf die Elterngeneration aus. Ich komme aus einer klassischen BlueCollarFamilie, von der ich nichts über Geld lernen konnte. Ich habe mich hingegen schon immer für das Thema interessiert und begonnen, mit meinen Eltern über Geld zu reden.
Warum scheitert unser Bildungssystem bisher daran, den Schüler*innen beim Thema Finanzbildung grundlegende Inhalte zu vermitteln? Das ist zum einen sicher eine Prioritätsfrage. Man muss in den bestehenden Stundenplänen gezielt Platz dafür schaffen. Zum anderen scheitert es sicher auch teilweise an den Ausbildungen der Pädagog*innen. Denn nur was man selber versteht, kann man Kindern beibringen, und meist haben die Pädagog*innen in dem Bereich selbst zu wenig Ausbildung erhalten.
Sind die Österreicher – wie die Deutschen – einfach „patscherte“ Sparer oder sehen Sie ein systemisches Problem? Ich glaube nicht, dass wir ungeschickte Sparer sind.
„Der Zinseszinseffekt ist das achte Wunder der Menschheit.“
„Es ist unglaublich einfach geworden, auf Pump zu konsumieren.“
Nach dem Abzug der monatlichen Kosten muss halt noch etwas zum Sparen übrigbleiben. Wenn nichts da ist, kann nichts gespart werden.
Das weist möglicherweise auf ein systemisches Problem hin, wenn sich Erwerbsarbeit für viele Menschen nicht mehr lohnt. Gut möglich. Hohe Lebenshaltungskosten bei gleichzeitig geringen Durchschnittseinkommen sind ein Problem, das sich auch hier in Tirol beobachten lässt.
Oft unterschätzt wird auch, dass der Faktor Zeit grundsätzlich aufseiten des Sparers ist. Je früher man mit dem Sparen beginnt, umso besser. Der Zinseszinseffekt ist das achte Wunder der Menschheit. Würde man es schaffen, seinem Kind mit 18 Jahren ein Portfolio mit 25.000 Euro zu übergeben und dieses würde nichts mehr darauf einzahlen, sondern es nur 40 Jahre liegen lassen, würde fast eine Million daraus werden, weil der Kapitalmarkt im Schnitt mit acht Prozent pro Jahr wächst. Ja, es gibt zwar immer wieder Korrekturen, doch der Trend geht in diese Richtung. Als Staat müsste man es sich einmal ansehen, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, einen Teil des Kindergeldes bzw. der Familienbeihilfe nicht auszuzahlen, sondern am Kapitalmarkt schon für die Pension zu veranlagen. Das würde vielen Kindern später den Start ins Erwachsenenleben maßgeblich erleichtern. Besser könnte man aus staatlicher Sicht in die Zukunft von Kindern kaum investieren.
In Zeiten wie diesen drängt sich leider die Frage fast schon auf, ob der Staat überhaupt – noch – ein Interesse daran hat, mündigen Bürger*innen gegenüberzutreten? Ich bin da naiv und unterstelle, dass der Staat das Wohl seiner Bürger im Auge hat. Es gibt aber starke Lobbys und Interessen, die nicht immer diesem Ziel dienen.
Veranlagungen am Kapitalmarkt sind inhärent riskanter als das Geld am Sparbuch zu lassen. Wie halten Sie es mit dem Thema Risiko? Ja, der Kapitalmarkt schwankt, manchmal gibt es auch stärkere Korrekturen. Wenn man aber viel Zeit hat, kann man das komplett vernachlässigen. Nehmen wir als Beispiel den MSCI

Dr. Philipp Schwarz ist Notar in Innsbruck
DAS VERLASSENSCHAFTSVERFAHREN
In Österreich wird bei jedem Todesfall amtswegig ein Verlassenschaftsverfahren eingeleitet und von dem/der nach der gerichtlichen Verteilungsordnung zuständigen Notar*in als Gerichtskommissär*in durchgeführt.
• Am Beginn jedes Verfahrens steht die Todesfallaufnahme. Diese wird mit einer informierten Auskunftsperson durchgeführt und dient der Feststellung der persönlichen und vermögensrechtlichen Verhältnisse der Verstorbenen.
• Im Rahmen des Verfahrens werden Registerabfragen vorgenommen (u. a. im Grundbuch, Firmenbuch sowie im Zentralen Testamentsregister der österreichischen Notare) und das Verlassenschaftsvermögen erhoben. Letztwillige Verfügungen bzw. sonstige erbrechtsbezogene Urkunden werden übernommen und an Verfahrensbeteiligte zugestellt.
• Nach Vorliegen aller Informationen wird geprüft, ob eine Verlassenschaftsabhandlung unterbleibt oder durchzuführen ist. Eine Abhandlung unterbleibt mangels vorhandener Aktiven oder wenn diese den Wert von 5.000 Euro nicht übersteigen. Bei einer überschuldeten Verlassenschaft erfolgt auf Antrag eine Überlassung der vorhandenen Nachlassaktiven an aktenkundige Gläubiger*innen gemäß den Bestimmungen der Insolvenzordnung.
• Ist eine Verlassenschaftsabhandlung durchzuführen, erfolgt im Rahmen einer Tagsatzung vor dem/der Gerichtskommissär*in die Belehrung der Parteien über rechtliche Bestimmungen, die Aufnahme von Erbantrittserklärungen, die Inventarisierung der Verlassenschaft bzw. Erstellung einer Vermögenserklärung sowie die Protokollierung allfälliger Erboder Pflichtteilsübereinkommen. Der verfahrensbeendende gerichtliche Beschluss ist diesfalls der Einantwortungsbeschluss, mit welchem der Eigentumserwerb des Verlassenschaftsvermögens erfolgt. PR
Als Gerichtskommissär*innen informieren Notar*innen über Rechte und Pflichten und unterstützen alle Beteiligten:
• bei der unparteiischen, unabhängigen Abwicklung des Verlassenschaftsverfahrens und
• bei der ordnungsgemäßen Übertragung des Verlassenschaftsvermögens an den oder die Erben.
Die jeweils zuständigen Gerichtskommissär*innen finden Sie unter www.ihr-notariat.at/zustaendigkeiten-bei-verlassenschaftsverfahren.
NOTARIATSKAMMER
FÜR TIROL UND VORARLBERG
Maximilianstraße 3, 6020 Innsbruck ihr-notariat.at
„Finanzbildung ist nicht Rocket Science.“
World, der aus rund 1.500 Aktien aus mehr als 20 Industrieländern besteht. Betrachtet man dort einen beliebigen 15JahresZeitraum, hat es noch nie einen gegeben, in dem man negativ ausgestiegen wäre. Wer allerdings erst mit 55 Jahren damit beginnt, für die Pension etwas zur Seite zu legen, hat natürlich ein Risiko, dass innerhalb dieser zehn Jahre eine Korrektur kommt und das Portfolio gerade dann weniger wert ist, wenn man das Geld braucht. Wer mit 18 Jahren beginnt, für den ist das Risiko dagegen wirklich vernachlässigbar. Sogenannte BlackSwanEvents kann man natürlich nie ausschließen, aber auch nicht vorhersehen.
Wie würden Sie Kindern den richtigen Umgang mit Geld beibringen? So früh wie möglich. Ich habe bei meiner heute achtjährigen Tochter sehr früh mit dem Thema Taschengeld begonnen. Und das, obwohl manche gemeint haben, dass es noch ZU früh sei. Kinder verstehen jedoch schon sehr, sehr früh. Gibt man dem Kind einen Euro pro Woche und es möchte sich etwas kaufen und muss dafür einige Wochen sparen, dann lernt es dadurch. Später kann man dazu übergehen, das Taschengeld einzuteilen. Einen Teil kann das Kind nach Gutdünken ausgeben, ein Teil wird gespart. Noch später kann man auch das Thema Spenden mittransportieren. Meine Tochter war auch der Auslöser für unser MonkeeWimmelbuch, das wir mit dem Ziel entwickelt haben,
dass schon früh über Geld geredet wird. Studien zeigen, dass bereits Kinder unter sechs Jahren wichtige Einstellungen zum Thema Geld von ihren Eltern lernen. Da entscheidet es sich, ob sie später in ihrem Leben einen positiven oder negativen Bezug zum Geld haben. Wird zu Hause nie über Geld gesprochen oder immer nur negativ, wird das Kind auch später als Erwachsener keinen positiven Bezug zum Geld entwickeln können. Dann arbeitet man als Erwachsener – meist Vollzeit – für etwas, mit dem man nichts Positives verbindet. Und in der Folge wird über die geschimpft, die über einen anderen, positiveren Zugang zum Geld verfügen.
Mit einer negativen Einstellung zu Geld tut man sich folglich auch selbst keinen Gefallen? Nein. Das ist absolut kontraproduktiv. Im deutschsprachigen Raum ist diese Einstellung leider weit verbreitet. Im anglophonen Raum sind Menschen, die es finanziell geschafft haben, eher noch Vorbilder, denen man nacheifern will.
Doch auch dort hat die Erzählung, man könne es mit Fleiß „vom Tellerwäscher zum Millionär“ schaffen, Risse bekommen. Die westlichen Gesellschaften leiden zunehmend unter einer Kaste von – ich weiß nicht, ob Sie mit dieser Terminologie etwas anfangen können – Überreichen, die es sich auf Kosten aller anderen richten wollen. Im Zusammenhang
5 FINANZTIPPS, DIE SIE IM ALTER VON 30 JAHREN WISSEN SOLLTEN
1. DIE 50/30/20 - REGEL
Planen Sie Ihr Einkommen nach folgender Regel:
• 50 % für Notwendiges (Miete, Nahrungsmittel, Lebenshaltung)
• 30 % für Wünsche (Urlaub, Auto etc.)
• 20 % für konkrete Ziele (Sparen, zusätzliche Schuldentilgung, Ausbildung)
2. DIE 4 - % - REGEL
Sie können im Ruhestand jährlich 4 % Ihrer Ersparnisse ausgeben, ohne dass Ihnen das Geld ausgeht. Beispiel: Sie haben 200.000 Euro gespart, 4 % davon sind 8.000 Euro, die Sie im Jahr zusätzlich zur Verfügung haben. Das wären monatlich brutto 667 Euro.
3. DIE 3X– 6X- NOTFALLREGEL
Sparen Sie in einem Notfallfonds die Lebenshaltungskosten für 3 bis 6 Monate. So müssen Sie zur Deckung unerwarteter Ausgaben keinen Kredit aufnehmen.
4. DIE 1⁄3 - MIETREGEL
Die Miete sollte 1⁄3 Ihres monatlichen Einkommens nicht übersteigen.
5. DIE 2X- ANLAGEREGEL
Investieren Sie für jeden Euro, den Sie für ein Luxusgut ausgeben, den gleichen Betrag in eine langfristige Anlage. Quelle: Seek Wiser
mit Trumps Amtseinführung hat man dazu auch den überaus passenden Begriff „Broligarchy“ gehört. Am Problem „Überreichtum“ werden nur sehr wenige Menschen leiden. Doch es heißt, die erste Million sei die schwierigste, und ich glaube, dass da etwas dran ist. Wer ein gewisses Vermögen hat, bewegt sich in gewissen Kreisen, kommt schneller zu neuen Informationen und Veranlagungsmöglichkeiten und kann sein Vermögen auch steuerschonend strukturieren. Demokratiepolitisch ist Überreichtum aber sicher eine ernstzunehmende Herausforderung.
Was war der Gründungsimpetus hinter Monkee? Wir wollten Menschen dabei helfen, ihre finanzielle Gesundheit zu verbessern, indem sie ihre kurzfristigen Finanzen besser im Griff haben können und nicht mit Geld konsumieren, das sie eigentlich gar nicht haben. Wir wollen die Menschen mit einem Tool dabei unterstützen, auf gewisse finanzielle Ziele hinzusparen. Das Prinzip „Buy now, pay later“ vom Kopf auf die Füße zu stellen, zu „Save now, buy later“.
Sind wir als Menschen überhaupt dazu angelegt, Belohnung zu verschieben? Unsere Psyche ist tatsächlich eher für Instant Gratification, die sofortige Belohnung, ausgelegt. Das wird von unserer Konsumindustrie massiv bespielt. In unserer physischen und mentalen Gesundheit geht es aber nicht um Instant Gratification, sondern um Delayed Gratification. Ich muss heute mit dem Laufen beginnen, damit ich irgendwann einmal konditionelle Vorteile davon habe. Es hilft auch schon, wenn man etwas, das man sich anschaffen möchte, einfach vor dem endgültigen Kauf 24 Stunden im Warenkorb lässt. Mindestens die Hälfte dieser Produkte sind einen Tag später tatsächlich schon wieder uninteressant.
Worin sehen Sie für Menschen die größten Schuldenfallen? In der Kombination aus schlechtem Finanzwissen, genialen Algorithmen und mächtigen Influencern in den sozialen Medien und dem Umstand, dass es unglaublich einfach geworden ist, auf Pump zu konsumieren. Will ich ein Aktiendepot anlegen, muss ich mich mit meinem Reisepass authentifizieren, RisikoAssessments machen und mehr. Für einen Ratenkauf brauche ich nur eine Telefonnummer.
VORSORGE KOMMT
VOR DER SORGE
Die Bedeutung von privater finanzieller Vorsorge liegt in Tirol weiterhin auf hohem Niveau. Geschuldet ist dies unter anderem der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Verbindung mit den herrschenden geopolitischen Unruhen.
2.300 EURO
BETRUG DIE DURCHSCHNITTLICHE PENSIONSHÖHE BEI MÄNNERN IM JAHR 2023. BEI FRAUEN WAREN ES LEDIGLICH 1.290 EURO.
67 %
FÄNDEN EIN „VORSORGEDEPOT“, BEI DEM DIE ERZIELTEN GEWINNE NACH EINER BESTIMMTEN (MINDEST-) BEHALTEFRIST STEUERFREI FÜR DIE PRIVATE ALTERSVORSORGE ZUR VERFÜGUNG STEHEN SOLLEN, SEHR INTERESSANT. 36 PROZENT WÜRDEN ES NUTZEN, FALLS DIES VON DER POLITIK BESCHLOSSEN WÜRDE.

52 %
DER TIROLER*INNEN GEHEN DAVON AUS, DASS SICH DIE WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE UND DIE LEBENSQUALITÄT IN DEN KOMMENDEN MONATEN VERSCHLECHTERN WERDEN. 38 % GEHEN VON EINEM GLEICHBLEIBEN AUS, NUR 9 % ERWARTEN EINE VERBESSERUNG.
250 EURO
BETRÄGT DER DURCHSCHNITTLICHE BETRAG, DER MONATLICH IN DIE PRIVATE PENSIONS- UND GESUNDHEITSVORSORGE INVESTIERT WIRD.
40 %
SORGEN PRIVAT VOR, WEIL SIE NICHT MEHR DARAN GLAUBEN, DASS DER STAAT EIN VERLÄSSLICHER PARTNER BEI PENSIONEN IST.
69 %
NUTZEN IMMER NOCH DAS SPARBUCH ALS VORSORGEINSTRUMENT. 39 % EINE LEBENSVERSICHERUNG, 35 % DAS BAUSPAREN
Quelle: Vorsorgestudie 2025. Erste Bank und Sparkassen sowie Wiener Städtische Versicherung beauftragten das Marktforschungsinstitut IMAS mit einer Onlinebefragung zum Thema der privaten Altersvorsorge. Ende 2024 beantworteten
„Zwei Drittel in Tirol gehen davon aus, später im Alter keine ausreichend hohe staatliche Pension zu bekommen. Und: Es steigt die Sorge, sich den gewünschten Lebensstandard im Ruhestand später einmal nicht leisten zu können.“
PATRICK GÖTZ, VORSTAND TIROLER SPARKASSE
1.000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren Fragen rund um ihre Vorsorgestrategien in turbulenten Zeiten, ihr konkretes
Sparund Vorsorgeverhalten, die Einschätzung ihrer finanziellen Situation im Alter sowie ihren Erwartungen für die Zukunft.
51 %
ERWACHSEN WERDEN
Mit 18 Jahren wird man in Österreich volljährig, ab wann fühlen sich die Österreicher*innen jedoch tatsächlich erwachsen? Fazit: Die finanzielle Unabhängigkeit spielt dabei eine große Rolle.
DER TIROLER*INNEN ZWISCHEN 18 UND 29 JAHREN FÜHLEN
SICH SELBST ERWACHSEN, WENN SIE FINANZIELL EIGENSTÄNDIG SIND. 45 %, WENN SIE AUS DEM ELTERNHAUS AUSGEZOGEN SIND, 42 %, GEBEN DEN BERUFSEINSTIEG AN.
53 %
DER TIROLER*INNEN WÜNSCHEN SICH FÜR DIE ZUKUNFT EIN SCHULDENFREIES LEBEN. 40 % MÖCHTEN IHREN AKTUELLEN LEBENSSTANDARD HALTEN, 39 % SICH VIELE URLAUBE BZW. REISEN LEISTEN KÖNNEN. NUR RUND 6 % WÜNSCHEN SICH LUXUSARTIKEL WIE LUXUSKLEIDUNG ODER -ACCESSOIRES. Quelle: UNIQA Finanzvorsorge-Studie. Die Studie wurde 2024 zum vierten Mal durchgeführt und beleuchtet Einstellungen, Meinungen sowie Barrieren, die es in unterschiedlichen Zielgruppen zum Thema finanzielle Vorsorge gibt. 2024 lag ein besonderer Fokus auf der Zielgruppe der jungen Erwachsenen (18bis 29-Jährige). Durchgeführt wurde die für Österreich repräsentative Studie vom Marktforschungsinstitut Reppublika Research & Analytics, das zwischen 26. April und 3. Juni 2024 insgesamt 3.427 Personen befragt hat.
85 %
DER 18- BIS 29-JÄHRIGEN TIROLER*INNEN BEZIEHEN EIN EINKOMMEN AUS EINER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT. 19 % WERDEN VON IHREN ELTERN REGELMÄSSIG FINANZIELL UNTERSTÜTZT.
40 %
DER JUNGEN TIROLER*INNEN GEBEN AN, SICH IHR LEBEN NACH EIGENEN EINSCHÄTZUNGEN KOMPLETT SELBST FINANZIEREN ZU KÖNNEN. 29 % FINANZIEREN SICH IHR LEBEN GROSSTEILS SELBST, 9 % KÖNNEN DIES GAR NICHT, 21 % ZUM TEIL.

64 %
DER BEFRAGTEN IN TIROL SEHEN JUNGE MENSCHEN IN FINANZIELLER HINSICHT ALS ERWACHSEN AN, WENN DAS EIGENSTÄNDIGE FINANZIEREN VON WOHNEN, LEBENSMITTELN, MOBILITÄT UND WEITEREN (FIX-)AUSGABEN OHNE REGELMÄSSIGE FINANZIELLE ZUSCHÜSSE VON ELTERN ODER ANDEREN PERSONEN MÖGLICH IST.
68 %
DER BEFRAGTEN JUNGEN ERWACHSENEN IN TIROL FÜHLEN SICH (SEHR) SICHER BEIM ÜBERBLICK ÜBER DIE EIGENEN FINANZEN. 70 % KÖNNEN IHRE NOTWENDIGEN ZAHLUNGEN ZEITGERECHT BEGLEICHEN.
Ca. 50 %
DER ÖSTERREICHISCHEN MÄNNER SEHEN EINE VOLLZEITBESCHÄFTIGUNG ALS EINES DER WESENTLICHSTEN ANZEICHEN FÜR FINANZIELLE SELBSTSTÄNDIGKEIT. BEI FRAUEN SIND NUR RUND EIN DRITTEL DIESER MEINUNG.
„Es ist gut und wichtig, wenn Menschen ihre Finanzlage nicht einfach ausblenden, sondern Verantwortung dafür übernehmen. Geld bedeutet schließlich auch Freiheit.“
MICHAEL ZENTNER, UNIQA - LANDESDIREKTOR TIROL



NACHHALTIGES WACHSTUM DURCH REGIONALES ENGAGEMENT
Seit 1. Jänner 2025 steht ein neues Vorstandsduo an der Spitze der Volksbank Tirol. Martin Holzer, bereits seit vielen Jahren als Marktvorstand der Bank tätig, hat mit Jahresbeginn den Vorstandsvorsitz übernommen. Andreas Mißlinger, ebenfalls seit Jahrzehnten in der Bank, ist seit September 2024 für das Ressort Marktfolge verantwortlich. Im Interview sprechen die beiden über das Erfolgsrezept der starken Tiroler Regionalbank.
ECO.NOVA: Was macht die Volksbank Tirol so besonders? MARTIN HOLZER: Die Volksbank Tirol ist tief in der Region verwurzelt. Seit über 150 Jahren verstehen wir uns als Partnerin der Menschen und Unternehmen in Tirol. Unsere Stärke liegt in der persönlichen Nähe zu unseren Kund*innen, kombiniert mit einer nachhaltigen und langfristigen Denkweise. Wir sind keine anonyme Großbank, sondern eine genossenschaftlich organisierte Regionalbank, die Verantwortung für ihr Marktgebiet Tirol und die Menschen, die hier leben, übernimmt. Das bedeutet, dass für uns nicht ausschließlich wirtschaftlicher Profit im Vordergrund steht, sondern vielmehr das gemeinsame Wachstum – mit unseren Kund*innen und unserer Heimat Tirol.
Wie kann man sich dieses gemeinsame Wachstum konkret vorstellen? MH: Als genossenschaftlich organisierte Aktiengesellschaft liegt die regionale Kreislaufwirtschaft in unserer DNA: Wir betreiben traditionelles Bankgeschäft – nehmen Spareinlagen unserer Kund*innen an und emittieren Anleihen, wie aktuell die neue Volksbank Tirol Stufenzinsanleihe. Dieses Geld wird wiederum Menschen und Betrieben in der Region in Form von Krediten zur Verfügung gestellt. Jeder in diese Anleihe investierte Euro fließt in den Wohnbau, den Kauf von Häusern und Eigentumswohnungen und in Unternehmen, den Handel, die Bauwirtschaft oder den Tourismus in Tirol. Die Anleger*innen profitieren zum einen von den
jährlich steigenden Zinsen bis drei Prozent, zum anderen haben sie Gewissheit, einen wertvollen Beitrag für das Wachstum und den Wohlstand Tirols zu leisten. Denn damit werden Eigenheime für Tiroler Familien geschaffen und das bedeutet wiederum Aufträge für Tiroler Handwerker*innen und andere Betriebe und damit Sicherung von Arbeitsplätzen. Kurzum, die Volksbank Tirol ist Nachhaltigkeitsdrehscheibe in der Region.
Nachhaltigkeit steckt also in den Genen der Volksbank Tirol. Gibt es dazu weitere Beispiele? ANDREAS MISSLINGER: Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen. Wir achten darauf, dass unsere Finanzierungen ökologisch und sozial verantwortungsvoll sind. Beispielsweise unterstützen wir gezielt Projekte im Bereich erneuerbare Energien oder energieeffizientes Bauen. Auch intern setzen wir auf Nachhal
„JEDER
tigkeit: Wir haben im Jahr 2024 den Anteil weiblicher Führungskräfte um 20 Prozent erhöht und auch 2025 möchten wir dieses Ziel wieder erreichen. Unsere Gebäude werden zunehmend auf klimafreundliche Technologien umgestellt, und wir fördern umweltbewusstes Verhalten bei unseren Mitarbeiter*innen – etwa durch die Aktion JobBike, EAutos und EBikes im Fuhrpark oder Dienstreisen mit der Bahn statt mit dem PKW oder Flugzeug. Auch die wirtschaftlichen Erträge der Volksbank Tirol fließen über den regionalen Dividendenkreislauf als Ausschüttungen an ihre vier Tiroler HoldingGenossenschaften – die Volksbanken KufsteinKitzbühel, Schwaz, Landeck und die HAGEBANK Tirol in Innsbruck. Diese Ausschüttungen werden in Form von Spenden, sozialem Engagement und Projekten wieder an die Region zurückgegeben. So möchten wir sicherstellen, dass die Erträge der Volksbank Tirol für lokale, kulturelle und soziale Initiativen genutzt werden, die
IN DIE VOLKSBANK TIROL STUFENZINSANLEIHE INVESTIERTE EURO FLIESST IN DEN WOHNBAU, DEN KAUF VON HÄUSERN UND EIGENTUMSWOHNUNGEN, SOWIE IN UNTERNEHMEN, DEN HANDEL, DIE BAUWIRTSCHAFT ODER DEN TOURISMUS IN TIROL.“
Martin Holzer

einen echten Mehrwert für die Gemeinschaft und insbesondere die Jugend schaffen. Das beste Beispiel dafür ist der Volksbank Tirol FIT4FUTURE AWARD.
Sie sind mit dem Volksbank Tirol FIT4FUTURE AWARD für Tiroler Schüler*innen medial gerade sehr präsent. Worum geht es bei dem Preis? MH: Der Fokus des ersten FIT4FUTURE AWARDS liegt auf der Förderung von Projekten rund um die Themen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Wir möchten Tiroler Jugendliche für nachhaltige Themen sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen einzubringen. Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg: Es nehmen über 50 Tiroler Schulen mit über 110 Projekten teil. Eine regionale Fachjury wird die Einreichungen bewerten und die besten Ideen bei den vier Abschlussevents in den Regionen Kufstein, Schwaz, Innsbruck und Landeck heuer im Mai und Juni mit dem FIT4FUTURE AWARD prämieren. Insgesamt werden tirolweit 124.000 Euro an Preisgeldern vergeben. Diese sind so gestaffelt, dass je Region und je Ober und Unterstufe der erste Platz 7.500
„UNSER ZIEL IST, EINEN ECHTEN MEHRWERT FÜR DIE GEMEINSCHAFT UND INSBESONDERE DIE JUGEND ZU SCHAFFEN. DAS BESTE BEISPIEL DAFÜR IST DER VOLKSBANK TIROL FIT4FUTURE AWARD.“
Andreas Mißlinger
Euro erhält, der zweite Platz 5.000 Euro und der dritte Platz 3.000 Euro. Das Preisgeld steht der gesamten Klasse zur Verfügung und kann beispielsweise in die Umsetzung des Projekts oder in einen Klassenausflug investiert werden. Eventuell ergibt sich aus dem einen oder anderen Projekt auch die Möglichkeit für eine weitere Zusammenarbeit.
Was ist aus Ihrer Sicht wichtig für den weiteren Erfolg der Volksbank Tirol? AM: Wir müssen sicherstellen, dass unsere Entscheidungen nachhaltig und in Bezug auf das einzugehende Risiko angemessen sind. Parallel dazu wollen wir den steigenden re
gulatorischen Anforderungen gerecht werden, aber gleichzeitig flexibel genug bleiben, um unseren Kund*innen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. MH: Unser Ziel ist es, weiter nachhaltig zu wachsen und gleichzeitig unseren Werten treu zu bleiben: Regionalität, Nähe und Vertrauen. Die Welt verändert sich schnell – sei es durch technologische Entwicklungen oder gesellschaftliche Umbrüche. Aber eines hat Bestand: der persönliche Kontakt und das Vertrauen zwischen Berater*in und Kund*in. Wir setzen weiterhin alles daran, die verlässliche regionale Partnerin für die Menschen und Unternehmen in Tirol zu bleiben. PR
Das neue Vorstandsduo der Volksbank Tirol: Andreas Mißlinger (li.) und Martin Holzer
PHOTOVOLTAIKANLAGEN:
STEUERLICHE BESONDERHEITEN EINER ALTERNATIVEN LÖSUNG
Gefragt sind also alternative Lösungen. Das leuchtet jedem ein und so gibt es auch steuerliche Anreize. Aber nicht nur, es ist – wie so oft hierzulande – steuerlich auch etwas kompliziert. Lesen Sie hier, was Sie auch noch wissen sollten, bevor Sie in eine solche Anlage investieren.
TEXT: VERENA MARIA ERIAN, RAIMUND ELLER
Eine Photovoltaikanlage kann zu steuerpflichtigen Einkünften führen. Dies ist dann der Fall, wenn Volleinspeisung oder Überschusseinspeisung vorliegt. Dann haben Sie möglicherweise einen Gewerbebetrieb am Hals. Aus dieser Nummer kommen Sie nur dann he
raus, wenn Sie nachhaltige Verluste erzielen (Liebhabereibetrieb) oder Ihre Photovoltaikanlage eine Engpassleistung von 35 kWp und eine maximale Anschlussleistung von 25 kWp nicht überschreitet. Trifft das zu, sind Einspeisungen von 12.500 kwh pro Jahr von der Einkommensteuer befreit. Das
wird bei den meisten Anlagen auch der Fall sein. Bei einer Insellösung kommt es diesbezüglich zu keinen Komplikationen, sprich zu keinem steuerrelevanten Einkommen. Wird der erzeugte Strom im Rahmen von einkommensteuerpflichtigen Einkünften (Betrieb, Vermietung) verwendet, kann die Anlage steuerlich abgeschrieben werden. Dabei kann laut einem Erlass des Bundesministeriums für Finanzen von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen werden.
Hat man aus einer PVAnlage Einkünfte aus Gewerbebetrieb, kann bei fehlenden festen betrieblichen Räumlichkeiten ein Arbeitsplatzpauschale in Höhe von 300 Euro p. a. von der Steuerbemessungsgrundlage in Abzug gebracht oder mitunter auch die sogenannte Kleinunternehmerpauschalierung in Anspruch genommen werden. Liegen die Voraussetzungen dafür vor, so können die Betriebsausgaben einfach pauschal in Höhe von 45 Prozent der Einnahmen in Abzug gebracht werden.
AUCH UMSATZSTEUER KANN FÄLLIG WERDEN
Die Einnahmen aus einer Einspeisung sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Bis zu einem Umsatz von 55.000 Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen allerdings die sogenannte Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen werden. Falls Umsatzsteuerpflicht gegeben ist, geht die Steuerpflicht in der Regel auf den Abnehmer der Stromeinspeisung über. Der Anlagenbetreiber haftet allerdings für die Umsatzsteuer und hat Umsatzsteuervoranmeldungen sowie eine Umsatzsteuerjahreserklärung abzugeben. Andererseits kann in einem solchen Fall die in den Anschaffungskosten der Anlage enthaltene Vorsteuer vom Finanzamt zurückgeholt werden. Für einen Volleinspeiser und bei einer Insellösung im betrieblichen Bereich oder eines Vermietungsobjekts reduzieren sich somit die Anschaffungskosten um 20 Prozent. Bei Überschusseinspeisung steht ab 10 Prozent betrieblicher Nutzung ebenso

der volle Vorsteuerabzug zu. Im Ausmaß der privaten Nutzung ist davon ein anteiliger Eigenverbrauch auszuscheiden.
DERZEIT NOCH ZEITLICH
BEFRISTETE UMSATZSTEUERBEFREIUNG
Die gute Nachricht für all jene, die keinen Vorsteuerabzug geltend machen können, ist, dass für die Lieferung und Installation von PVModulen im Zeitraum 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2025 eine Umsatzsteuerbefreiung gilt. Allerdings ist diese Umsatzsteuerbefreiung wiederum an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So darf die Engpassleistung maximal 35 kWp betragen und der Betrieb der PVAnlage muss auf oder in der Nähe von Gebäuden stattfinden, die Wohnzwecken dienen oder von einer Körperschaft öffentlichen Rechts genutzt werden oder von Körperschaften, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Weiters darf kein Investitionszuschuss nach dem EAG (Erneuerba
renAusbauGesetz) in Anspruch genommen werden. Andere Förderungen wie Landesförderungen sind jedoch unschädlich. Nicht begünstigt sind Hybridkollektoren, das heißt, es darf ausschließlich Sonne zu Strom werden.
INVESTITIONSFREIBETRAG NUR
IM BETRIEBLICHEN BEREICH
Liegt eine betriebliche Nutzung von mehr als 50 Prozent vor, dann kann ein Investitionsfreibetrag in Höhe von 15 Prozent geltend gemacht werden. Dieser kann zusätzlich zur Absetzung für Abnutzung (Afa) im Jahr der Anschaffung sofort zur Gänze von der Steuerbemessungsgrundlage in Abzug gebracht werden.
RESÜMEE
Kommt man über bestimmte Leistungsgrenzen, dann kann so eine Photovoltaikanlage außerhalb einer Insellösung steuerlich zum sprichwörtlichen Klotz am Bein werden. Dabei kann nicht nur die Einkommensteuer, sondern auch noch die Umsatzsteuer zuschlagen. Dies kann vor allem bei Anlagen im außerbetrieblichen Bereich ein Störfaktor sein. Im betrieblichen Bereich kann zudem ein Investitionsfreibetrag von 15 % lukriert werden. Bei einer Einspeisung von maximal 12.500 kwh p. a. und einer Engpassleistung von höchstens 35 kWp bzw. Anschlussleistung von maximal 25 kWp kommt eine Einkommensteuerbefreiung zum Tragen, was meist der Fall ist.
Die Ärztespezialisten vom Team Jünger: StB Mag. Dr. Verena Maria Erian und StB Raimund Eller
NEUE CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR KLEINUNTERNEHMER:
UMSATZSTEUERLICHE
ÄNDERUNGEN SEIT 1. JÄNNER 2025
Kleinere Unternehmen stehen in der Steuerwelt oftmals vor komplexen Herausforderungen. Während zahlreiche Regelungen darauf abzielen, die laufende Compliance für diese Gruppe zu vereinfachen, können diese Maßnahmen auch gegenläufige Effekte haben. Ob die seit dem 1. Jänner 2025 in Kraft befindlichen neuen Vorschriften eine effektive Erleichterung oder doch zusätzliche Belastungen mit sich bringen, bleibt abzuwarten.
TEXT: ANDREAS KAPFERER, SABINE MANDAHUS
is zum 31. Dezember 2024 war die Kleinunternehmerbefreiung ausschließlich für inländische Unternehmer verfügbar, deren Jahresumsatz in Österreich die Grenze von 35.000 Euro netto nicht überschritt. Ausländische Unternehmer waren hingegen bis Ende 2024 von dieser Befreiung für ihre Umsätze in Österreich ausgeschlossen, selbst bei nur gelegentlichen Umsätzen.
Mit Wirkung ab dem 1. Jänner 2025 ändert sich dies grundlegend. Die Kleinunter
nehmerregelung wird auf den gesamten Binnenmarkt ausgeweitet, was bedeutet, dass ein österreichischer Unternehmer zukünftig auch im EUAusland steuerbefreite KleinunternehmerUmsätze erzielen kann. Neben den nationalen Umsatzgrenzen für Kleinunternehmer, die in den Mitgliedstaaten individuell geregelt werden (in Österreich ab 2025 von 35.000 auf 55.000 Euro brutto pro Jahr erhöht), gilt nun zusätzlich eine unionsweite Umsatzschwelle von 100.000 Euro. Konzeptionell unverändert bleibt es bei der Versagung des Vorsteuerabzugs: Wird keine Umsatzsteuer aufgrund der unechten Kleinunternehmerbefreiung in Rechnung gestellt, steht auch kein Vorsteuerabzug zu. Weiterhin freiwillig kann auch bei geringen Umsätzen zur Umsatzsteuerpflicht optiert werden.
ÄNDERUNGEN BEI DER NATIONALEN KLEINUNTERNEHMERBEFREIUNG
Legen wir zunächst den Fokus auf die Änderungen in Österreich. Die Umsatzgrenze für die Kleinunternehmerbefreiung in Österreich wurde auf 55.000 Euro angehoben. Diese Grenze stellt einen Entgeltbetrag dar, bei dem die Umsatzsteuer nicht mehr herausgerechnet wird. Bislang war ein einmaliges Überschreiten dieser Grenze um bis zu 15 Prozent innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren unwesentlich, wobei das Überschreiten rückwirkend auf den Jahresbeginn wirkte und den Unternehmern daher rückwirkend die Kleinunternehmerbefreiung versagt wurde. Diese rückwirkende Versagung der Befreiung entfällt ab 2025. Wird die Grenze von 55.000 Euro um nicht mehr als
10 Prozent überschritten, kann die Kleinunternehmerbefreiung nun bis zum Ende des Kalenderjahres noch weiter genutzt werden. Im Folgejahr entfällt die Befreiung und der Unternehmer muss umsatzsteuerpflichtige Umsätze melden. Überschreitet der Unternehmer jedoch auch die 10ProzentToleranzschwelle innerhalb des Jahres, entfällt die Steuerbefreiung ab dem Zeitpunkt des überschreitenden Umsatzes und für alle folgenden Umsätze.
ERLEICHTERUNGEN IN DER PRAXIS
Erfreulicherweise müssen Kleinunternehmer, die ausschließlich in Österreich tätig sind, weiterhin keine Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) oder andere Meldungen abgeben, sofern keine besonderen Ausnahmesituationen vorliegen. Eine weitere Vereinfachung betrifft die Rechnungsausstellung gemäß § 11 Abs. 6 UStG: Die bisher nur für Kleinbetragsrechnungen (bis zu 400 EUR) geltenden Vereinfachungen sind nun für alle Rechnungen von Kleinunternehmern anwendbar, unabhängig vom Rechnungsbetrag. Wurde eine KleinunternehmerIdentifikationsnummer vergeben (Suffix „EX“), sollte diese auf der Rechnung angegeben werden, und es empfiehlt sich in der Praxis, auf die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer auf der Rechnung hinzuweisen.
NEUE REGELUNGEN ZUR GRENZÜBERSCHREITENDEN KLEINUNTERNEHMERBEFREIUNG
Seit dem 1. Jänner 2025 können Kleinunternehmer auch in anderen EUMitgliedstaaten steuerbefreite Umsätze erzielen. Sowohl österreichische Kleinunternehmer, die in anderen Mitgliedstaaten Umsätze erzielen, als auch Unternehmer aus anderen Mitgliedstaaten, die in Österreich Umsätze tätigen, profitieren von dieser Neuerung. Innerhalb des Binnenmarktes können Umsätze bis zu 100.000 Euro steuerbefreit behandelt werden, wobei auch die nationalen Schwellenwerte der einzelnen Mitgliedstaaten beachtet werden müssen (für Österreich 55.000 Euro). Überschreitet ein Unternehmer die unionsweite Schwelle von 100.000 Euro, gilt die grenzüberschreiten


FAZIT
Für Kleinunternehmer, die ausschließlich in Österreich tätig sind, ändert sich wenig. Die Erhöhung der Umsatzgrenze auf 55.000 Euro und der Wegfall der rückwirkenden Umsatzbesteuerung sind positiv zu werten. Auch die neue 10ProzentToleranzgrenze erleichtert die Umsetzung in der Praxis. Die Neuerungen zu der grenzüberschreitenden Kleinunternehmerbefreiung hingegen stellen für Kleinunternehmer, die EUweit tätig sind, eine bedeutende Erleichterung dar. Beispielsweise müssen österreichische Unternehmer, die eine Wohnung im EUAusland vermieten, sich nicht mehr im Ausland umsatzsteuerlich erfassen lassen, was die administrative Abwicklung von unionsweiten Umsätzen deutlich vereinfacht. Der Aufwand zur Registrierung für das grenzüberschreitende Verfahren sollte jedoch auch nicht unterschätzt werden. Ob die Kleinunternehmerregelung eine Erleichterung darstellt, ist einzelfallbezogen zu prüfen.
de Kleinunternehmerregelung ab diesem Umsatz nicht mehr. Für die 100.000EuroGrenze gibt es keine Toleranzgrenze oder Übergangsregeln.
Um die Kleinunternehmerregelung im EUAusland anwenden zu können, muss sich der Unternehmer bei der Finanzverwaltung registrieren und eine Vorabmitteilung über das Bundesministerium für Finanzen einreichen. Bei Erfüllung aller Voraussetzungen wird ihm eine KleinunternehmerIdentifikationsnummer zugewiesen, und er ist verpflichtet, zukünftig quartalsweise die erzielten Umsätze über das FinanzministeriumPortal zu melden. Um für Geschäftspartner als Kleinunternehmer leichter erkennbar zu sein, werden UIDNummern für Kleinunternehmer mit dem Zusatz „EX“ versehen, zum Beispiel. „ATU123456EX“.
VORTEILE UND HERAUSFORDERUNGEN IM BINNENMARKT Ein wesentlicher Vorteil der Kleinunternehmerregelung im Binnenmarkt ist die steuerliche Entlastung bei Umsätzen an Kunden, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind (z. B. private Endverbraucher, Versicherungen, Vermietungen ohne Vorsteuerabzugsberechtigung). Diese Regelung bringt jedoch auch administrative Meldepflichten mit sich. Ein weiterer Nachteil ist der generelle Ausschluss vom Vorsteuerabzug –insbesondere bei hohen Investitionskosten kann dies ein entscheidender Faktor sein. In solchen Fällen empfiehlt sich die Involvierung eines professionellen Beraters, um die Vorteilhaftigkeit der Regelung zu prüfen. www.deloitte.at/tirol
Mag. Andreas Kapferer LL.M., Partner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, und Sabine Mandahus, L.LM. (WU), M.Sc. (WU), Steuerberaterin bei Deloitte Tirol

HAPPY VIERTELJAHRHUNDERT
Am 25. Jänner 2025 feierte Honda den Marktstart seines neuen HRV e:HEV und gleichzeitig 25 Jahre HondaHybridtechnologie. Der kompakte Vollhybrid vereint dabei die Eleganz eines Coupés mit dem selbstbewussten Stil eines SUV. Das überarbeitete Innen und Außendesign sorgt für einen klarer definierten Look, der von der neuen Farbpalette zusätzlich betont wird, zudem wurde das Fahrverhalten merklich verbessert. Der effiziente und leistungsstarke HybridAntriebsstrang erhöht Effizienz und Spaßfaktor gleichermaßen, dazu bringt der HRV e:HEV weiterhin zahlreiche Sicherheitsfunktionen und Fahrerassistenzsysteme – einige davon sind die fortschrittlichsten seiner Klasse – sowie ein äußerst flexibles Interieur mit. Nebst einer Leistung von 131 PS und einem maximalen Drehmoment von 253 Nm überzeugt der Kleine mit einer angegebenen Reichweite von bis zu 740 Kilometern. Eingestiegen wird in der EleganceVersion ab 35.790 Euro.

Hallo Fremder
Ende letzten Jahres kam der neue Outlander angerollt und mit ihm die vierte Generation des chicen MisubishiSUV. Daher kommt er mit dynamikbetontem Design, erweitertem Raumangebot, fortschrittlichen Assistenzsystemen und einer erweiterten PluginHybridTechnologie, deren überarbeiteter Antriebsstrang den Hübschling fast 90 Kilometer weit rein elektrisch voranbringt. Zur Markteinführung stehen vier Ausstattungslinien zur Wahl, die schon in der Basisversion deutlich machen: Das neue MitsubishiFlaggschiff erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, Komfort und Qualität. Zu feinster japanischer Handwerkskunst kommen zahlreiche MultimediaOptionen und DigitalisierungsFeatures, die Serienausstattung ist bereits in der Einstiegsvariante (ab 51.990 Euro) umfangreich.
SOLIDE
Škoda geht mit seinem Enyaq neue Designwege und hat dem Auto eine komplett überarbeitete, markante Frontpartie samt Tech-Deck-Face inklusive durchgehendem Lichtband statt klassischem Kühlergrill mitgegeben. Die klare Linienführung sorgt für eine optimierte Aerodynamik, der Innenraum präsentiert sich komfortabel und großzügig. Mit an Bord sind außerdem zahlreiche Assistenzsysteme und digitale Funktionen, die maximale Reichweite liegt laut WLTP bei 433 Kilometern. Markteinführung ist für April geplant, die Preise starten in Österreich bei 43.390 Euro.


ÜBERRASCHUNGSEI
Nach der Einführung des Plug-in-Hybrids erweitert Peugeot mit dem E-408 sein Angebot an Elektrofahrzeugen und geht mit dem fließenden Fastback-Design abermals mit einer unerwarteten Optik an den Start. Die großzügigen Abmessungen und die breite Radspur ermöglichen außerdem den Einbau der Batterie in den Unterboden zwischen den Reifen, wodurch der Platz im Innenraum trotz coupéartiger Silhouette erhalten bliebt. Im Auto werkelt ein 210 PS starker Elektromotor, der ein maximales Drehmoment von 345 Nm entwickelt und laut WLTP Reichweiten von bis zu 453 Kilometer ermöglichen soll. Die Atmosphäre im Innenraum ist warm und angenehm, die Technik auf dem neuesten Stand. Ab 47.070 Euro.

POTZ BLITZ!
Robust, geräumig, modern und hocheffizient: So beschreibt Opel seinen neuen Elektro-Frontera, der im Frühjahr zu den Händlern kommt. Die aufrecht gestaltete Front und die durchdachten Proportionen bilden die Basis für eine ebenso funktionale wie großzügige Kabine, in der schlaue Lösungen für Vernetzung und Komfort auf viel flexiblen Platz treffen. Wer ganz viel davon braucht, für den ist der Frontera wahlweise auch als Siebensitzer erhältlich. Mit der batterieelektrischen Variante mit 113 PS sind laut WLTP bis zu 305 Kilometer Reichweite möglich, alternativ steht ein Hybrid zur Wahl. Weiteres Plus: Der Einstiegspreis liegt bei elektro-erschwinglichen 30.000 Euro, der Hybrid ist ab 25.100 Euro zu haben.
PREMIUM GOLF
Im Jahr 1996 erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt, verpasst Audi der mittlerweile vierten Modellgeneration des Audi A3 ein ordentliches Facelift. Das Ziel? Noch mehr Emotion, Präzision und natürlich Fahrfreude. Wir sind den A3 35 TFSI als Sportback Probe gefahren.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE

In Sachen Außendesign hat es Audi definitiv wieder einmal geschafft: Das Facelift des A3 wirkt noch sportlicher und angriffslustiger als der Vorgänger –insbesondere dank der optionalen von den RSModellen inspirierten Sline sowie dem Optikpaket schwarz plus. Auch die gegen Aufpreis erhältlichen 19Zöller im 5SpeichenTrapezoidDesign verleihen dem Fahrzeug den gewissen Tick Aggressivität – im besten aller Sinne.
Erkennungsmerkmale des Facelifts sind darüber hinaus ein in die Breite gezogener (von in unserem Fall mit schwarzen Akzenten umrandeter) Singleframe, seitlich angeordnete vergrößerte Lufteinlässe und ein optisch aufgewerteter Frontspoiler sowie Diffusor am Heck. Verfeinert wird das Gesamtkonzept von markentypisch emotional gestalteten MatrixLEDScheinwerfern mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht. Als kleines Highlight sind beim A3 wie bei anderen Modellen insgesamt vier verschiedene Tagfahrlichtsignaturen verfügbar, die sich über das MMI auswählen und umschalten lassen. Dadurch soll sich das Fahrzeug noch etwas mehr an den persönlichen Kundengeschmack anpassen lassen.
FAHRERORIENTIERTES COCKPIT
Das Interieur überzeugt auf ganzer Linie. Sowohl am Shifter, den Luftausströmern als auch der Innenraumbeleuchtung wurde sichtlich nachjustiert. Dazu wurde die Serienausstattung deutlich aufgewertet. Das heißt im Ergebnis: Das DreiSpeichenMultifunktionslenkrad, die Klimaautomatik und das AmbienteLichtpaket gehören von nun an mit zum Standard. Hinzu kommt neben dem 10,1ZollTouchdisplay und dem Audi virtual cockpit auch die induktive Lademöglichkeit fürs Smartphone. Wer es im Innenraum gern ein wenig heller hat, dem sei das optionale PanoramaGlasdach wärmstens empfohlen. Aus technischer Sicht hat Audi eine weitere Neuheit zu bieten: die sogenannten Functions on Demand. Um das Erlebnis noch flexibler zu gestalten, lassen sich auch nach Fahrzeugkauf online über die MyAudiApp bis zu fünf Funktionen aus den Bereichen Komfort und Infotainment hinzubuchen. Die Idee dahinter? Nachdem beispielsweise der optionale Geschwindigkeitsassistent nur bei längeren Urlaubsfahrten genutzt wird, lässt sich dieser über die App wahlweise von einem Monat bis zu drei Jahren (oder dauerhaft) dazubuchen. Dass Audi zudem großen Wert auf Sicherheit legt, zeigt ein Blick auf die bereits in der Serienausstattung enthaltenen

DIE VIERTE MODELLGENERATION
DES AUDI A3 KOMMT MIT DEUTLICH AUFGEWERTETER SERIENAUSSTATTUNG, ETLICHEN INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN UND GEWOHNT GEFÜHLSREICHEM FAHRERLEBNIS.
Sicherheits und Assistenzsysteme. Audi pre sense front, der Ausweich und Abbiegeassistent und die Einparkhilfe sind nur einige der Standardsysteme. Optional ergänzen lässt sich der A3 um einen adaptiven Fahrassistenten mit assistiertem Spurwechsel, einen adaptiven Geschwindigkeitsassistenten sowie beispielsweise einer Spurwechselwarnung.
FAHRFREUDE GARANTIERT
Bei der von uns getesteten Modellvariante 35 TFSI handelt es sich um die mittelstarke Benzinervariante. Der 110 kW (150 PS) starke 1,5LiterReihenvierzylinder in Kombination mit einem 48VoltMildHybridSystem spricht ungemein spritzig auf den Beschleunigungsbefehl an. Durch das MildHybridSystem und das maximale Drehmoment von 250 Newtonmetern ergibt sich dabei eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 8,1 Sekunden. Deutlich konkurrenzfähiger präsentiert sich mit rund 5,9 Liter auf 100 Kilometer der Verbrauch. Abgerundet wird das sportlich präzise Fahrgefühl von einer direkten Progressivlenkung und einem wunderbar geschmeidigen 7GangDoppelkupplungsgetriebe.
Wer gerne etwas mehr Power unter der Haube hat, dem sei der neue Audi S3 mit satten 245 kW (333 PS) und 420 Newtonmetern schwer ans Herz gelegt. Als Neuheit hat
Audi für etwas rustikal angehauchte Kunden außerdem erstmals ein CrossoverModell mit dem schicken Namen Audi A3 Allstreet veröffentlicht. Dieser kommt im markanten OffroadLook, hat drei Zentimeter mehr Bodenfreiheit und eine erhöhte, fast schon SUVähnliche Sitzposition. Audi setzt also große Hoffnung in den technisch mit dem VW Golf verwandten A3.
Wie sich der A3 unterm Strich schlägt? Insbesondere die angewachsene Serienausstattung ist uns positiv in Erinnerung geblieben, auch die Functions on Demand bilden ein an sich spannendes Konzept. Einzig der Preis lässt Raum zur Diskussion. Wenngleich das Basismodell des 35 TFSI ab 39.114,63 Euro zu haben ist, schafft es der Testwagen aufgrund zahlreicher, aber doch human gehaltener Extras auf über stolze 55.000 Euro.
AUDI A3 SPORTBACK 35 TFSI
Antrieb: Front
Leistung: 110 kW/150 PS
Drehmoment: 250 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 8,1 sec
Spitze: 226 km/h
Verbrauch: 5,9 bis 4,7 l/100 km
Spaßfaktor: 8,5 von 10
Testwagenpreis: 55.409,03 Euro

KOMPAKTES CROSSOVER
Nur wenige Automarken präsentieren sich als derart charakterstarke Marke, wie das bei Mini der Fall ist. Der Grund ist weniger das außergewöhnlich gute Fahrverhalten – das können einige Hersteller vorweisen –, vielmehr liegt die Antwort in den Modellen selbst.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
Ein Mini ist mehr als ein Auto. Mini ist Kult. Auch der 2010 erstmals eingeführte Countryman – der erste Mini mit über vier Metern Länge –ist kaum mehr aus dem heimischen Straßenbild wegzudenken. Mit seiner dritten Generation macht Mini nun einen weiteren Schritt in Richtung des selbst gesetzten Ziels, bis 2030 zur vollelektrischen Marke zu werden, und möchte gleichzeitig seine Position im BSUVSegment festigen. Wir
dürfen vorstellen: der neue vollelektrische Countryman SE ALL4.
ERHEBLICH GEWACHSEN
Dass der Markenname für den neuen Countryman eigentlich etwas unpassend ist, zeigt sich bereits nach einem kurzen Blick auf das Datenblatt. So hat die dritte Generation im Vergleich zum Vorgänger sechs Zentimeter an Höhe sowie satte 13 Zentimeter an Länge gewonnen. Um einen „Mini“ im klassischen Sinn handelt es sich bei dem 4,4 Meter langen BSUV also nicht mehr. Hinzu kommen in unserem Fall 20ZollFelgen im TwoToneDesign sowie deutlich breitere Radkästen.
Generell präsentiert sich das Gesamtbild ungemein erwachsen. Die kantige Optik wird sowohl vom markanten, oktogonalen Kühlergrill als auch den eckig ausgeformten LEDScheinwerfen fortgeführt. Das Design dient dabei einem aufgefrischten Look und
SELBST MIT GRÖSSEREN ABMESSUNGEN
KOMMT IM NEUEN COUNTRYMAN PURES GO-KART-FEELING AUF.
aerodynamischen Zwecken gleichermaßen. Unterm Strich führt das zu einem mit 0,26 um 0,05 herabgesenkten cWWert.
Auch aus der Heckansicht gibt sich der Countryman kaum noch als Mini, sondern als echtes BSUV zu erkennen. Das Hauptaugenmerk fällt beim in eine obere und untere Partie geteilten Heck unweigerlich auf die eckigen Leuchten, die dem Auto – wie im Übrigen auch die Frontscheinwerfer – optional in mehreren vorgegebenen Lichtsignaturen noch mehr persönlichen Charakter verleihen. Abgerundet wird das Gesamtkonzept von der kurzen Motorhaube, die den Fokus auf den im Verhältnis zur Gesamtlänge deutlich angewachsenen Radstand lenkt. Das sorgt nebst purem Fahrspaß außerdem für komfortable Platzverhältnisse im Inneren.
AUFGERÄUMT UND STYLISCH
Die Fahrerkabine bietet in der ersten Sitzreihe und im Fond im Bein wie Schulterbereich im Verhältnis zu den kompakten Abmessungen überaus angenehme Platzverhältnisse. Optisch besonders gefallen haben uns die zweifarbigen, textilen Oberflächen aus recyceltem Polyester am Armaturenbrett und den Türverkleidungen. Abgerundet wird das Interieurdesign von einem optionalen PanoramaGlasdach und auch aus technischer Sicht gibt es beim Countryman eine kleine Besonderheit: So kommt das Cockpit ohne zusätzliches Instrumentendisplay hinter dem beheizten SportLenkrad aus. Stattdessen werden alle relevanten Informationen ausschließlich auf der klassischen, runden Anzeige im Zentrum – das hochauflösende OLEDDisplay fällt dabei erstmals selbst rund aus – und dem optionalen HeadupDisplay angezeigt. Aus praktischer Sicht mag das anfangs ein wenig ungewöhnlich sein, ertappt man sich doch ab und an bei der verzweifelten Suche nach der Geschwindigkeitsanzeige, im Ergebnis erfüllt das Konzept jedoch den eigentlichen Gedanken, nämlich den Blick auf die Straße zu lenken. Das Handling des kombinierten Fahrer und Infotainmentsystems mit dem MINI Operating System 9 gelingt überaus intuitiv, sowohl Touch wie Sprachbedienung funktionieren einwandfrei. Weil gerne gesehen und schlicht und ergreifend markentypisch, hat sich Mini auch bei der neuen


MINI COUNTRYMAN SE ALL4
Antrieb: Allrad
Leistung: 225 kW/306 PS
Drehmoment: 494 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 5,6 sec
Spitze: 180 km/h
Reichweite (lt. WLTP): 432 km
Ladedauer (von 10 auf 80 %): 29 Min.
Spaßfaktor: 9 von 10
Testwagenpreis: 55.400 Euro
Generation wieder dazu entschieden, eine, wenn auch neu ausgeformte, ToggleLeiste mit insgesamt fünf Kipphebelschaltern für die wichtigsten Fahrfunktionen unterhalb des Zentraldisplays zu positionieren. Ansonsten verzichtet man abgesehen von vereinzelten Ausnahmen auf weitere Tasten. Absolute Highlights der Zusatzausstattung sind das HarmanKardonSurroundSoundSystem sowie die MININavigation Augmented Reality. Wenngleich sich die Abmessungen des Countryman ein wenig geändert haben mögen, so ist das Fahrverhalten genial geblieben. So ermöglicht der 225 kW (306 PS) starke Elektromotor in Kombination mit dem maximalen Drehmoment von 494 Newtonmetern eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden. Einziges Manko ist die Reichweite: Die wird zwar mit 432 Kilometern nach WLTP angegeben, die Realität indes sieht anders aus – besonders im Winter. So war uns eine komfortable Fahrt nur bis zu circa 280 Kilometer möglich. Das wird durch die sportliche Ladezeit von 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent bei einer maximalen Ladeleistung von 130 kW etwas abgedämpft. Wen das also nicht stört, der wird mit dem schicken Countryman in der Allradvariante durchaus eine Menge Freude haben. Preislich gibt es den Mini Countryman SE ALL4 ab 44.900 Euro, der Testwagenpreis (inklusive einiger Zusatzoptionen) liegt bei 55.400 Euro.
ITALIANITÀ
AUF RÄDERN

Als Nachfolger des 500X konzipiert, präsentiert sich der neu erschienene Fiat 600 von seiner besten Seite. Sowohl technisch als auch farblich hat das B-SUV einiges zu bieten.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
Fiat selbst spricht von seinem Fiat 600 als „urbanem Eyecatcher“ –dieser Aussage ist angesichts der kunterbunten Farbauswahl wohl auch nicht zu widersprechen. So ist die Topvariante La Prima in insgesamt vier Farben erhältlich, die allesamt der wunderschö
nen Natur Italiens entspringen sollen, beispielsweise auch das hier gezeigte Orange – Sun of Italy. Nun, wo sich auch das Wetter endlich in Richtung Sommer bewegt, wirklich passend (zum Aperol Spritz). So kann die warme Jahreszeit gerne kommen. Neben der Topversion La Prima bietet Fiat
in Kooperation mit (RED) – wie schon beim 500 – einen (600 Elektro)RED an. (RED) ist eine Organisation, die globale Gesundheitsnotlagen bekämpft. Mit dem Kauf eines (600 Elektro)RED löst man gleichzeitig eine Spende an den Global Fonds aus. Wer also auf Details wie die 18ZollFelgen, Fahrersitz mit Massagefunktion und (leider) auch die besonders farbenfrohe Auswahl der Wagenfarbe verzichten kann, spart sich nicht nur 6.000 Euro Aufpreis, sondern trägt auch zu einem guten Zweck bei. Zu haben gibt es den Fiat 600 in der REDVersion ab 36.000 Euro, für den vollausgestatteten La Prima sind mindestens 42.000 Euro fällig, wobei die Liste an Extras bei beiden gering ist.
SOLIDE TECHNISCHE DATEN
Angetrieben wird der 600e in beiden Varianten von einem 115 kW (156 PS) starken Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 260 Newtonmetern. Dank der Batterie mit 54 kWh Bruttokapazität (wie sie im Übrigen beispielsweise auch im Jeep Avenger verwendet wird) schafft es der frontgetriebene 600e laut Datenblatt mit einem Verbrauch von rund 15 kWh auf 100 Kilometer knapp über 400 Kilometer weit, was auf den ersten Blick durchaus machbar klingt. Die Ladezeit für das 4,17 Meter lange BSUV –damit ist der 600e länger als ein VW Golf –liegt dank der maximalen Ladeleistung an der Schnellladesäule von 100 kW bei unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent, an der herkömmlichen Wallbox gelingt die Vollla
dung dank 11kWOnboardCharger in unter sechs Stunden.
Trotz der schmalen Abmessungen von 4,17 Metern Länge und 1,52 Metern Höhe eignet sich der rund 1,5 Tonnen schwere 600e dennoch als Familienauto. So bietet neben dem Kofferraum mit 360 Litern – sofern man den doppelten Ladeboden zum Verstauen des Ladekabels mitzählt – auch die Fahrerkabine und insbesondere die vordere Sitzreihe angenehm Platz. Ein wenig eng werden könnte es für Erwachsene hingegen im Fond, doch für vier oder gar fünf Erwachsene ist der 600e auf Dauer auch nicht gedacht.
SCHICKES DESIGN
Auch optisch hat der 600e La Prima einiges zu bieten. Als Kontrast zu den kräftigen Farben erhält er schwarz glänzende Seitenspiegel. Dazu verpasst Fiat – übrigens auch der REDVariante – LEDScheinwerfer mit einem in der Motorhaube integrierten Tagfahrlicht. Als kleiner Eyecatcher wurde das 600Logo verchromt und eine LaPrimaBadge an der BSäule positioniert. Im Interieur fallen die in Elfenbeinoptik gehaltenen Sitze aus Kunstleder mit MonogrammBestickung ins Auge. Die Farbe kann nicht angepasst werden, was zwar das Konfigurieren deutlich einfacher macht, aber vermutlich nicht jeden ansprechen wird. Dafür ist der Fahrersitz elektrisch verstellbar und kommt mit Massagefunktion und Sitzheizung. Oberhalb der Mittelkonsole mit 15 Litern Stauraum und einer induktiven Ladestation findet


FIAT 600E LA PRIMA
Antrieb: Front
Leistung: 115 kW/156 PS
Drehmoment: 260 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 9,0 sec
Spitze: 150 km/h
Reichweite (lt. WLTP): 409 km
Ladedauer (von 20 auf 80 %): 27 Min.
Spaßfaktor: 8,5 von 10
Preis: ab 42.000 Euro
71 sich ein 10,25ZollZentraldisplay, das um ein 7ZollKombiinstrument hinter dem SofttouchMultifunktionslenkrad ergänzt wird. Abgerundet wird das Innenraumdesgin von einer Ambientebeleuchtung mit 64 verschiedenen Farbkombinationen.
FAZIT FÜR DAS SCHICKE B - SUV
Insgesamt fällt das Resultat für den Fiat 600e La Prima überaus positiv aus. Das elegante BSUV überzeugt durch ein äußerst angenehmes Fahrverhalten – es kann zwischen Eco, Normal und Sport gewechselt werden –, eine großartige Verarbeitung sowie sein modisches Design. Besonders Eindruck hat das knallige Orange mit den Seitenspiegeln in Kontrastfarbe hinterlassen. Nicht zuletzt gefällt auch die überaus großzügige Liste an allen gängigen Fahrsicherheits und Assistenzsystemen. Im Ergebnis also wirklich top. Ob nun die paar Extras beim La Prima den Aufpreis von 6.000 Euro im Vergleich zur REDVariante rechtfertigen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die knalligen Farben spielen unserer Meinung nach der Topvariante allerdings eindeutig in die Karten. Und Hand aufs Herz: Ein echter Fiat verträgt einen ordentlichen Farbklecks. Farbloses Exterieur ist nichts für Italiener. Im Gegenteil: Olivier François, FiatChef und ChiefMarketingOfficer von Stellantis, hat –bevor er sich mitsamt dem wohl einzigen grauen Fiat 600 in einen überdimensionalen Farbtopf hat tauchen lassen – im Juni 2023 verkündet, dass Fiat fortan keine grauen Autos mehr bauen wird.
KULTUR & TRENDS




Oben: Helmut Hable
Helmut Hable studierte von 1962 bis 1968 Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck und war danach als Manager und Landesleiter einer Versicherungsgesellschaft tätig. Seit 1962 bildete er sich autodidaktisch in Seminaren, Kursen, Malwochen und Sommerakademien weiter, unter anderem mit Hermann Nitsch, mit dem ihn eine freundschaftliche Beziehung verbindet. Seit seiner Pensionierung widmet er sich ausschließlich seiner künstlerischen Tätigkeit. Hable war von 1990 bis 2011 als Obmann und Gründungsmitglied des Völser Kulturkreises tätig, ist Mitglied der IG Bildende Kunst (Wien) sowie der Künstlergemeinschaft Westliches Weinviertel und der Kulturvernetzung Niederösterreich. Hable lebt und arbeitet in Völs und in Straden, wo er ein ehemaliges Kellerstöckl samt Weingarten zu einem Atelier mit Kunstgalerie ausbaute.
Unten: Eugenie Bongs-Beer Eugenie Bongs-Beer ist in Solbad Hall geboren und entstammt der Familie der Vorarlberger Barockbaumeister Beer aus Au im Bregenzerwald. Von 1966 bis 1974 studierte sie Bildhauerei, Kunstwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und an der Hochschule für Bildende Künste Berlin (1. und 2. Staatsexamen), 1973 war sie Meisterschülerin der Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse Prof. Joseph Beuys, 2008 Visiting artist in residence im Arlington Arts Center in den USA. Ihr künstlerischer Schwerpunkt war während ihres Studiums die Bildhauerei, Malerei und Grafik kamen erst in den 1990erJahren dazu. Sie arbeitet stets aus der Imagination, ohne Modell, ohne fotografische Vorlagen, bereit, Zufälliges zuzulassen, zu koordinieren und in den Gesamtzusammenhang einzubinden.
DIE STILLE SPRACHE DER KUNST
Unter diesem Titel sind Eugenie BongsBeer (Malerei & Skulptur) und Helmut Hable (Malerei & Installation) ab 11. Februar zu Gast in der Innsbrucker Galerie Nothburga. Gezeigt werden Arbeiten, die in den letzten Jahren entstanden sind und sich jeweils aus der Fülle direkt erlebbarer Eindrücke ableiten. Auf unterschiedliche Weise nähern sie sich dabei dem Wortlosen. Sie orientieren sich dafür nicht am Außen, sondern laden dazu ein, den Körper von der Äußerlichkeit zu befreien, zur wahren Wirklichkeit vorzustoßen und in der Kunst in das Unsichtbare des Menschen vorzudringen. Während Helmut Hable versucht, in seinen Bildern durch eine informelle, zeitlose Gestaltung mit gezielt im Raum stehenden Linien und raumgestaltenden Farbflecken die Leere und das Nichts darzustellen und sie dem Betrachter eindrücklich zu vermitteln, dominiert vor allem in den beeindruckenden Bronzeplastiken von Eugenie BongsBeer die Verbindung von Körper und Raum. Ihre plastischen Arbeiten sind Energieträger in einem Netz von Spannungspunkten, „Seelenlandschaften“ in der Malerei sowie Grafik ergänzen ihr Œuvre.
Vernissage: 11. Februar 2025, mit Einführung in die Arbeiten von Dr. Bernhard Braun. Kuratorin: Dr. Sibylle Saßmann-Hörmann
Die Ausstellung ist bis 8. März 2025 in der Galerie Nothburga, Innrain 41, zu sehen. www.galerienothburga.at

BITTE LÄCHELN!
Aus dem Archiv von Foto Margit, deren Porträtstudio bis in die 1970er-Jahre bestand, sind im Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck über 25.000 Negative erhalten. Mehr als 1.000 Bilder von Stadtbewohner*innen wurden für die aktuelle Ausstellung „Bitte lächeln! Foto Margit und Much Heiss“ ausgesucht. Der Bilderbogen großteils in Schwarz-Weiß zeigt dabei die Arbeit von Margarethe „Margit“ Oberhaidinger, geborene Heiss, als Chronistin der Innsbrucker Lebenswelt der Nachkriegszeit. Der im Titel vorkommende Much Heiss ist übrigens Margits Vater. Als Landschaftsfotograf reiste und wanderte er in der Zwischenkriegszeit durch Tirol und baute seinen „Alpinen Kunstverlag“ auf. Die Ausstellung ist noch bis 18. April 2025 im Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck zu sehen. Und vielleicht ist auch das ein oder andere Ihnen bekannte Gesicht dabei.

TANZ - KUNST
Die Limonada Dance Company, gegründet und geleitet von Enrique Gasa Valga, zählt nur ein Jahr nach der fulminanten Premiere von „Lágrimas Negras“ im Feber 2024 zu den innovativsten und vielseitigsten Tanzensembles Europas. Mit einem unverkennbaren Stil, der zeitgenössischen Tanz, Musik, Theater und Bildende Kunst vereint, begeistert die Company ein internationales Publikum. Und auch 2025 verspricht ein Jahr voll tänzerischer Emotion zu werden. Im Feber kehrt im Zuge des Innsbruck Winter Dance Festivals „Lágrimas Negras“ auf die Bühne zurück (15. Feber), dazu werden „Dorian Gray“ (20. Feber) und „Boléro – Carmina Burana“ (22. Feber) zur Aufführung gebracht. Am 10. und 11. Mai führt „Der Fall Wagner“ im Haus der Musik nach der Uraufführung in Erl auch das Innsbrucker Publikum tänzerisch in die Welt von Richard Wagner ein. www.limonada.at
ZEIT, DIE BLEIBT.
Zeitlose Eleganz in limitierter Auflage.
Wir handeln mit feinster Ware aus der Welt der Zeit. Edle Zeitmesser ist spezialisiert auf erlesene Uhrenklassiker, seltene Unikate und Besonderem aus der Branche.

DIE CARTIER ROTONDE DE CARTIER AUS DER COLLECTION PRIVÉE CARTIER PARIS ist ein Meisterwerk subtiler Eleganz und handwerklicher Exzellenz.
Dieses limitierte Modell ist eine Hommage an die Kunst des Uhrmacherhandwerks. Ihr 18karätiges Weißgold mit einem Durchmesser von 42 mm balanciert mühelos klassische und moderne Designaspekte. Unter dem Zifferblatt schlägt das Herz des Kalibers 9602 MC, ein Handaufzugswerk, das auf einem JaegerLeCoultreUhrwerk basiert


WEITERE INFORMATION:
Diese Uhr und viele weitere Unikate renommierter Marken sind verfügbar in unserer BOUTIQUE in Innsbruck, Palais Trapp, MariaTheresienStraße 38. www.edlezeitmesser.at
Maria Theresien Straße 38 Palais Trapp, 6020 Innsbruck
Im „Der Fall Wagner“ trifft historische Tiefe auf modernen Tanz

Köstliche Düfte
#FragranceTok ist ein auf TikTok wachsender Trend, der Düfte und Parfüms zu einem wichtigen Teil der persönlichen Beautyroutine macht, wobei es nicht nur um den Duft selbst geht, sondern auch um das Gefühl, das er vermittelt. Da kommen GourmandDüfte, deren Inhaltsstoffe sich unter anderem in der Welt der Kulinarik bedienen, gerade richtig. Lush hat passend zum Trend eine feine Auswahl an Produkten im Sortiment, in denen Vanille, Karamell, Popcorn oder Kakaonoten zum Einsatz kommen. „GourmandDüfte können mit Lebensmittelzutaten in Verbindung gebracht werden und bieten einen echten Wohlfühlfaktor“, sagt LushParfümeurin Emma Vincent. Wer es bei Düften gern sonnigsüß mag, dem legen wir das neue „Chelsea Morning“ ans Herz, das mit hellen Bisquitnoten und einem Hauch von Zitrus daherkommt. 100 ml um 50 Euro. www.lush.com








STERNSTUNDEN
Der Guide Michelin ist seit seiner letzten nationalen Ausgabe 2009 wieder zurück in Österreich. Dafür nehmen die acht Landestourismusorganisationen sowie die Österreich Werbung auch gerne Geld in die Hand. Diese öffentliche Subvention finden andere heimische Restaurantguide-Herausgeber zwar wenig prickelnd, in der Welt der Luxuskulinarik gibt es allerdings nur eine internationale Währung ... und das sind Sterne. Am 21. Jänner wurde die Restaurantselektion präsentiert und das Vorhaben, Österreich damit als Kulinarikdestination international zu verankern, scheint geglückt. Auf Anhieb wurden österreichweit 82 Restaurants mit Sternen dekoriert, das Steirereck im Stadtpark erhielt neben dem Amador in Wien drei davon. Dazu kommen 13 Zweisterner und 53 1-Stern-Restaurants. Vor allem Tirol tut sich mit 20 ausgezeichneten Restaurants quantitativ besonders hervor. Qualitativ auch: Mit dem Stüva in Ischgl, dem Schwarzen Adler in Hall, dem Restaurant 141 by Joachim Jaud in Mieming sowie dem Gourmetrestaurant Tannerhof in St. Anton am Arlberg hat Tirol aktuell vier Zwei-Sterne-Restaurants. Dem Gannerhof in Innvervillgraten, Guat‘z Essen in Stumm und s’Morent in Innvervillgraten wurden außerdem grüne Michelin-Sterne für Nachhaltigkeit verliehen, sieben Restaurants erhielten den so genannten Bib Gourmand für ihr besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Julian Stieger vom „Rote Wand Chef’s Table“ in Lech wurde als Young Chef ausgezeichnet. Auffallend: Die Landeshauptstadt blieb unbeleuchtet. guide.michelin.com

BERG - FEIER
Musik ist universell – unabhängig von Herkunft, Kultur oder Sprache bringt sie Menschen zusammen, weckt Emotionen und schafft Erlebnisse, die weit über Worte und Klänge hinausgehen. Ischgls legendäre Konzertreihe Top of the Mountain bringt seit 30 Jahren das Paznaun zum Feiern und hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Eröffnet wurde die aktuelle Wintersaison von Ellie Goulding, am 6. April ist Andrea Berg zum Spring Concert zu Gast, am 20. April spielt Shaggy auf der Idalp in 2.300 Metern Höhe das Easter Concert. Abgeschlossen wird die Saison heuer am 3. Mai von der Grammy-nominierten USBand OneRepublic. Der Eintritt zum Konzert ist im Skipass für vier oder mehr Tage enthalten. Tagesgäste können am Konzerttag einen Tagesskipass für 145 Euro erwerben, der sowohl Zugang zum Konzert als auch unbegrenztes Skivergnügen in einem der renommiertesten Skigebiete der Alpen bietet. Hier geht’s zum Ischgl-Gästemagazin mit vielen weiteren Infos aus dem Tal.
Benjamin Parth, Gourmet Restaurant Stüva, Ischgl / Dennis Ilies, Gourmetrestaurant Tannerhof, St. Anton / Johannes Nuding, Schwarzer Adler, Hall / Joachim Jaud, Restaurant 141 im Alpenresort Schwarz, Mieming
RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC
ab € 19.990,– 1)
bei Finanzierung und Versicherung inkl. E-Mobilitätsbonus
1) Unverb. Kaufpreise inkl. USt, Boni und E-Mobilitätsbonus/Importeursanteil iHv € 2.400,- und Bundesförderung (E-Mobilitätsbonus gemäß der Förderrichtlinie klimaaktiv mobil auf Grundlage des Klima- und Energiefondsgesetzes) iHv 3.000,- (genaue Informationen unter www.umweltfoerderung.at, Auszahlung der Bundesförderung nach positivem Bescheid eines von Ihnen gestellten Antrags), zzgl. Auslieferungspauschale. Kein Rechtsanspruch. Gültig für Privatkunden bei Kaufvertragsabschluss vom 01.02.2025 bis 28.02.2025. Beinhaltet Boni iHv. € 2.000,- von Mobilize Financial Services (Marke für RCI Banque SA Niederlassung Österreich) mit Finanzierungsbonus (Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50% vom Kaufpreis) & Versicherungsbonus (gültig bei Finanzierung über Mobilize Financial Services und bei Abschluss von Vollkaskound Haftpflichtversicherung bei carplus (Wr. Städtische) – Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. Stromverbrauch: 15,2-14,9 kWh/100km, homologiert nach WLTP.
STANDORTE
Innsbruck Neu-Rum, Serlesstraße 1
Tel. +43 50 2611, office@dosenberger.com
renault.at


Dosenberger-Plaseller Zams, Buntweg 8
Tel. +43 50 2611 53, zams@dosenberger.com
Neurauter, Stams-Mötz, Staudach 23, Tel. 05263/6410 Schöpf, Imst, Industriezone 54, Tel. 05412/64526 Hangl, Pfunds, Nr. 432, Tel. 05474/5273 Wolf, Bach, Stockach 29, Tel. 05634/6156

DAS RICHTIGE GESPÜR
Gerrit Prießnitz ist Chefdirigent des Tiroler Landestheaters, Susanne Fohr Orchesterdirektorin des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. Beide sind seit September 2024 in ihren Rollen. Wir haben sie zum Interview gebeten und erstaunliche Analogien zwischen Kultur und Unternehmertum sowie Dirigieren und Führungsqualität gefunden. Was wir aus dem Kulturbetrieb für unser (Arbeits-)Leben lernen können und warum es dringend notwendig ist, sich zwischendurch zwang- und gedankenlos einfach dem Schönen hinzugeben.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Hineingeboren in eine musikaffine Familie ist Susanne Fohr schon früh mit Musik in Berührung gekommen. Aufgewachsen mit drei älteren, Instrumente spielenden Brüdern, erlernte sie im Alter von viereinhalb Jahren Geige und Klavier und spielte rasch in einem Orchester. Es hätte eine klassische Musikerinnenkarriere werden können: „Ich hatte immer viel Spaß dabei, habe allerdings bald festgestellt, dass es mir mehr Freude bereitet, zwar mit guten Leuten, aber nicht professionell zu musizieren.“ Fohr studierte Jura und begann nach dem zweiten Juristischen Examen im Staatstheater Mainz zu arbeiten, 2007 übernahm sie ihr erstes Orchester als Orchesterdirektorin. „Meine Erinnerungen sind ganz anders“, erzählt Gerrit Prießnitz, „insofern, als dass ich aus überhaupt keinem musikalischen Elternhaus kam.“ Es war ein Zufall, dass der Familie ein Klavier vererbt wurde, das schließlich in die Obhut des Erstgeborenen fiel. Dazu kam eine Klavierlehrerin, die ob ihres Auftretens so gar nicht in den gutbürgerlichen Haushalt
passte, jedoch etwas im damals achtjährigen Gerrit Prießnitz auslöste: „Sie hat etwas in mir geweckt, das vorher nicht da war und mich sehr ansprach.“ Relativ früh erkannte eben jene Lehrerin, dass er zwar ganz gut Klavier spielte, aus ihm aber dennoch kein Pianist würde. Sondern Dirigent. Sie sollte recht behalten.
In Innsbruck sind die Geschichten von Gerrit Prießnitz und Susanne Fohr im vergangenen Jahr aufeinandergetroffen. Wir haben die beiden im Haus der Musik Innsbruck besucht und bald gemerkt, dass zwischen dem Führen eines Betriebes und dem Leiten eines Orchesters auffallend viele Parallelen bestehen. Es geht um ein achtsames Miteinander, um das Vertrauen auf das Können des anderen, um Freiheiten und Grenzsetzung und darum, aus der Summe der Einzelteile mehr zu machen als ein großes Ganzes. Und: Führung braucht Erfahrung.
ECO.NOVA: Was braucht es, damit ein Orchester funktioniert? GERRIT PRIESSNITZ: Unterm Strich geht es darum, aus einem
großen Ganzen mehr zu machen als die Summe seiner Teile. Die Fragen für mich als Dirigent sind: Was will ich mit dem Stück, was soll passieren, welche Stimmung und Atmosphäre möchte ich erzeugen? Folglich muss ich es schaffen, dass selbst Orchester, die schon lange gemeinsam spielen und im wahrsten Sinne eingespielt sind, mir in meiner Interpretation folgen. In einem Orchester geht es um mehr als nur darum, die Noten zu lesen, den passenden Auftakt zu geben oder das richtige Tempo zu wählen. Es geht um Kommunikation. Wie dosiere ich meine Energie, mit wem kommuniziere ich wann und auf welche Weise.
Wie geht man damit um, wenn man in ein solches eingespieltes Orchester kommt? Wie balancieren Sie Ihre eigene Vision mit der Interpretationstradition eines Werkes? Setzt man die Erfahrungen auf Null zurück und beginnt gänzlich von vorne? GP: Ich nehme immer gerne an, was ein Orchester mir anbietet. Es ist mit einem bestimmten Ansatz gewachsen, und
das hat seinen ganz eigenen Wert. In der Folge beginnt man behutsam Veränderungen vorzunehmen, man probiert ein anderes Tempo, feilt an der Artikulation, mischt manche Klänge neu, doch immer mit Respekt vor dem Bestehenden. Wenn Musiker*innen wissen, was zu tun ist, bringt das auch eine gewisse Sicherheit, gleichzeitig ist es für das Orchester wichtig, Neues zu probieren. Sonst sitzen wir irgendwann nur mehr unsere Zeit ab.
Kommt es vor, dass man Sie fragt, wozu es Sie als Dirigenten überhaupt braucht? GP: Ja, durchaus. Es ist nicht allzu lange her, dass mich ein Taxifahrer danach gefragt hat. Die Musiker*innen hätten doch alle studiert und wüssten, wie man Noten liest und Stücke spielt. Damit hat er natürlich recht. Es gibt Dinge unterhalb einer gewissen Komplexitätsschwelle, sie sind für jeden Einzelnen zu bewältigen, trotzdem muss es in einer Gruppe eine Führungspersönlichkeit geben, damit alle in dieselbe Richtung gehen. Selbst wenn keiner mit einem Taktstock vor dem Orchester stünde, würde einer aus dem Orchester diese Funktion innehaben (müssen). Wenn 24 Musiker*innen nach 24 persönlichen Tempoempfindungen spielen, wäre das Stück nach dem ersten Takt zu Ende. Durch immer selektivere Auswahlverfahren gibt es heute kaum mehr schlechte Orchester. Alle Musiker*innen sind professionell ausgebildet und beherrschen ihre Instrumente perfekt. Dirigent*innen können deshalb auf eine technokratische Weise heutzutage mehr abrufen als je zuvor. Das ist allerdings noch keine Musik. Die entsteht erst, wenn diese technische Präzision durch Ausdruck und Interpretation geformt wird.
Dirigent*innen brauchen eine Vielzahl an Fähigkeiten: Einerseits die „hard facts“ wie fachlich-technisches Verständnis oder musikalisches Wissen, andererseits „softe“ Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit und Empathie. Welche Rolle spielt die Erfahrung? SUSANNE FOHR: Früher durchliefen Dirigent*innen eine wahre Ochsentour. Man hat als Assistent und Korrepetitor angefangen, bekam eine Dirigentenverpflichtung und hat alle Leute im Haus kennengelernt. Man hat nicht gleich die Premieren oder Chefstücke dirigiert, sondern klein angefangen. Man hat gelernt, die Zusammenhänge und die Musik damit auf eine ganz andere Weise zu begreifen. Viele Dirigent*innen, die heute auf dem Zenit ihrer Laufbahn stehen, haben dieses Prozedere
KURZBIOGRAFIEN
Seit September 2024 ist Gerrit Prießnitz Chefdirigent des Tiroler Landestheaters. Der international renommierte Dirigent ist indes kein Unbekannter in Tirol: Zuletzt stand er bei Puccinis „La Bohème“ am Dirigierpult. Mit seinem internationalen Werdegang, der ihn von der Volksoper Wien bis nach Asien und in die großen Konzertsäle Europas führte, bringt er eine Fülle an Erfahrung mit nach Innsbruck. Unter seiner Leitung werden in der Spielzeit 2024/25 Mozarts „La clemenza di Tito“ (Premiere am 8. Feber 2025 im Großen Haus) und die Doppelinszenierung von Leoncavallos „Pagliacci“ und Schönbergs „Von heute auf morgen“ (Premiere am 10. Mai 2025 im Großen Haus) aufgeführt. Der gebürtige Bonner hat seit 2023 eine Professur am Institut für Musiktheater der Kunstuniversität Graz inne und wurde 2024 mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.
Susanne Fohr, gebürtig aus Freiburg im Breisgau, ist seit September 2024 Orchesterdirektorin des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. Nach dem zweiten Juristischen Examen in Passau begann sie ihre berufliche Laufbahn als persönliche Referentin des Kaufmännischen Geschäftsführers am Staatstheater Mainz. 2007 übernahm sie als Orchesterdirektorin die Leitung der RobertSchumannPhilharmonie beim Städtischen Theater in Chemnitz. Von 2015 bis 2022 war sie Orchesterdirektorin des Philharmonischen Staatsorchesters an der Staatsoper Hamburg. Auch die Organisation von internationalen Gastspielreisen, Streamingkonzerte sowie die Kooperationen mit Bildungseinrichtungen oder die Förderung von Kinder und Jugendprojekten sind Teil ihrer Expertise. Ihre Verbundenheit mit der Natur und ihre Leidenschaft für die Berge führten sie schließlich nach Innsbruck, wo sie ihre Erfahrung in der Konzertplanung und im Orchestermanagement einbringt.
durchlaufen. Sie kennen jedes aufgeführte Stück aus dem Effeff, jede Eigenheit ihrer Musiker*innen und Sänger*innen. Das klingt nicht sonderlich glamourös oder sexy, doch erst aus dieser Verlässlichkeit bekommt das Musizieren seine Freiheit. Heute gewinnen junge Leute einen Dirigierwettbewerb, die es früher in dieser Form und Vielzahl nicht gab, sie werden gehypt und dirigieren zum Beispiel ein halbes Jahr später „Ein Heldenleben“ mit dem Cleveland Orchestra, ohne jemals zuvor mit einem großen Orchester gearbeitet zu haben. Das ist ein Problem. Ich glaube, dass es trotz der heute sehr diversen Karrierewege wichtig ist, eine Basis zu schaffen, auch wenn es an Attraktivität verloren hat, einen Beruf von der Pike auf zu lernen. Erfahrung zu sammeln, kann man jedoch nicht überspringen. Damit geht Substanz verloren. Und damit Wissen und Qualität.
Wie bereiten Sie sich auf ein Stück vor, insbesondere wenn es sich um eine weniger bekannte Komposition handelt?
GP: Die Vorbereitung hat bei mir weniger mit der Bekanntheit eines Stückes zu tun. Ich schlage ein Werk auf und habe unmittelbar ein gutes Gefühl oder ich weiß, ich muss es mir Stück für Stück erarbeiten, damit es Gestalt annimmt. Es gibt Komponisten wie Strauss oder Britten, deren Stücke sich mir quasi vom ersten Takt an von allein erschließen, und es gibt Offenbach, den ich enorm schwierig finde und zu dem ich anhand meiner Erfahrung und Ausbildung erst eine Verbindung herstellen muss.
Ist das ein Prozess, den Sie mögen? GP: Ich mag beides, obwohl es schon sehr schön ist, wenn sich gleich ein vertrautes Gefühl einstellt. Es passiert auch äußerst selten, dass ich mich mit einem Stück anfreunde, wenn es mir von Anfang an Schwierigkeiten bereitet. Und man muss auch ehrlich sagen: Manche Werke wurden völlig zu Recht vergessen. Würde ich mein dirigiertes Repertoire durchforsten, gäbe es durchaus manche Stücke, die ich kein zweites Mal aufführen wollen würde. Auf der anderen Seite entbinden einen ja solche Stücke nicht von seinem Vertrag. Ich muss es auch dann zur Aufführung bringen, wenn ich von dessen Qualität nicht überzeugt bin. Und man kann dem Orchester nichts vormachen. Dann ist es meiner Erfahrung nach klüger, zu sagen, okay, das wird nun vielleicht für uns alle nicht unser Lieblingsstück, aber wir gehen da gemeinsam durch, lösen das professionell und holen heraus, was herauszuholen
ist. Aufgeben ist keine Lösung. Und in der Regel auch keine Option.
Wie viel Risiko kann man eingehen bzw. wie sehr kann man sein Publikum in Bezug auf die Werksauswahl sowie die Interpretation (heraus)fordern? SF: Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind heute extrem vielfältig. Die Frage ist also: Wie bekomme ich die Leute zu uns? Mit ausschließlich Altbewährtem funktioniert das nicht. Demgegenüber gilt es Erstaufführungen oder ein zeitgenössisches Programm wohl zu dosieren. Wir sind also stets gefordert, einem breiten Publikum gerecht zu werden und dabei auch schon die jungen Menschen abzuholen. Theater und Orchester würden im deutschsprachigen Raum allerdings nicht zu einem großen Teil von der öffentlichen Hand finanziert, wenn sie nur reinen Unterhaltungszweck hätten. Wir haben auch einen Kulturauftrag, der sich dem Erhalt unseres kulturellen Erbes widmet, wir haben einen Bildungsauftrag im Sinne dessen, dass jemand, der Beethovens 5. Sinfonie noch nie gehört hat, sie auch zu hören bekommt und das Ganze soll natürlich nicht vor leeren Reihen stattfinden. Man muss also das Publikum mitnehmen. Dieses Dreieck müssen wir bei der Programmgestaltung ständig neu austarieren. GP: Ich persönlich bin ja sehr für Risikofreude und der festen Überzeugung, dass sie sich auszahlt, wenn die Qualität stimmt – des Stücks und der Wiedergabe. Unser Job ist es, überzeugend zu spielen und eine Stimmung zu erzeugen, die das Publikum erreicht. Dann glaube ich, kann man diesem

Dreieck aus Kultur und Bildungsauftrag und dem Erreichen des Publikums auch mit Risiko gerecht werden. SF: Bei schwierigeren Stücken, die sich vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließen, macht es durchaus Sinn, zusätzlich mit Moderation und Erklärungen zu arbeiten. Unsere Einführungen, die vor vielen Aufführungen stattfinden, werden gerne angenommen. Es gibt in unserem Haus zahlreiche Vermittlungsprojekte, die schon bei Kleinkindern ansetzen. So öffnen sich plötzlich selbst große Werke, die manchmal unzugänglich scheinen, in die Breite. Wird man in ein Stück hin und eingeführt, können viele Hürden abgebaut werden. Wichtig ist es, das Publikum auf die Reise mitzunehmen und ihnen eine Erlebnisqualität zu bieten, die

„Der Dirigent ist dafür da, anzustoßen, was nicht ohnehin von allein passiert.“
sie weder in der Kneipe noch im Stadion und schon gar nicht vor dem Bildschirm geboten bekommen. Junge Leute versuchen wir über kreative Formate zu erreichen. Im vergangenen Jahr haben wir zum Beispiel einen PoetrySlam mit einer MendelssohnSymphonie kombiniert, im nächsten Jahr ist ein Beatboxer zu Gast. Wir versuchen unsere Programme so zugänglich und ansprechend zu gestalten, dass es die Menschen begeistert und sie im besten Fall dauerhaft zu unserem Publikum werden. Wir müssen ihnen neue Welten eröffnen und ihnen Möglichkeiten bieten, um über Vertrautes hinauszuschauen, Neues zu erleben und zu fühlen. Indem wir über unser Angebot neue Assoziationen, Wahrnehmungen und Erkenntnisse fördern, bieten wir eine wichtige Alternative zu algorithmusgesteuerter Unterhaltung und Information.
Welche Rolle spielt die (Hoch-)Kultur generell in einer Gesellschaft? SF: Kunst und Kultur sind kein „nice to have“, sondern essenziell für unsere Demokratie, die Wertehaltung unserer Gesellschaft und das Sozialgefüge. Sie sind wichtig, um Traditionen weiterzuführen und zugleich immer wieder Neues zu schaffen, kreativ zu sein, Diskussionen anzuregen und sich mit sich selbst und seinen eigenen Ansichten auseinanderzusetzen. GP: Da stimme ich dir prinzipiell zu. Natürlich ist es wünschenswert, wenn Kultur in die Gesellschaft hineinwirkt – im besten Fall positiv. Darüber hinaus glaube ich, sollten wir jedoch selbstbewusst genug sein, in der Kultur selbst einen Wert zu sehen und sie nicht nur hinsichtlich ihres soziologischen Nutzens zu betrachten. Kultur ist etwas genuin Öffentliches, deshalb stellt sich für mich auch die Frage nicht, ob
Gerrit Prießnitz beim Neujahrskonzert am 1. Jänner 2024
sie öffentliche Unterstützung verdient. Ich bin der Letzte, der immer gleich nach dem Steuerzahler oder dem Staat schreit, Kultur ist jedoch nicht das Sahnehäubchen, sie ist Substanz.
Müssen Kunst und Kultur generell immer einen klassischen Nutzen haben oder ist es nicht auch ein Wert, sich einfach einmal drei Stunden nur für sich zu gönnen, sich aus dem Alltag zu nehmen, sich keine Gedanken machen zu müssen? GP: Natürlich. Dieses Empfinden ist ein Wert an sich, für den wir uns auch nicht rechtfertigen müssen. Es kann nicht sein, dass wir nach jeder Vorstellung mit dem Rechenschieber dastehen und sich jemand fragt, ob man den Nutzen in einen Algorithmus verpacken kann. Diese drei Stunden Schönheit lassen sich nicht monetär messen, sind aber extrem wertvoll.
Wie beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage der klassischen Musikszene, insbesondere in Hinblick auf kleinere Orchester? SF: Unabhängig von der Größe von Häusern müssen sich Städte und Regionen überlegen, welches Angebot sie ihren Bürger*innen machen wollen. In den meisten Städten ist der Kulturetat der kleinste von allen, hier nochmals zu sparen, halte ich für kontraproduktiv. Größere Häuser können das eine gewisse Zeit aus eigener Kraft ausbalancieren, bei kleineren wird das schwierig. Die haben keine Ressourcen und Kapazitäten mehr. Stellen Sie sich Innsbruck ohne das Landestheater oder das Haus der Musik

„Um grandios zu werden, braucht es eine profunde Basis.“
SUSANNE FOHR
Innsbruck vor. Es würde viel verloren gehen. GP: Orchester, die aus dem Vollen schöpfen können, gibt es heute kaum mehr. Deshalb wird in den meisten Häusern sehr verantwortungsvoll mit den Geldern umgegangen, die zum großen Teil aus der öffentlichen Hand kommen. Wir schauen uns sehr gewissenhaft an, wofür wir das uns zur Verfügung stehende Geld ausgeben. Doch Aufführungen kosten Geld und wir dürfen uns nicht in eine Negativspirale begeben, indem wir immer noch mehr Kompromisse eingehen und damit die Qualität gefährden. Werden die Budgets knapper, müssen die Programme kleinformatiger oder Vorstellungen ge

Unter dem Titel „Poetry-Slam meets Orchestra” wurde klassische Musik auf besondere Weise vermittelt: Heimische Poetry-Slammer trafen auf Felix Mendelssohn Bartholdys Symphonie Nr. 4, „Die Italienische“.
strichen werden. Das wiederum senkt die Attraktivität und folglich die Publikumszahlen. Damit tut man sich auch in Sachen Rentabilität keinen Gefallen. Ein Werk wie „Der Rosenkavalier“ ist beispielsweise mit einem enormen Aufwand verbunden und zugleich ein enormer Publikumsmagnet. Es braucht die richtige Balance und Weitblick, ein Gespür für die Menschen, die Umgebung und die Zeit, dann kann Musik im Theater und bei Konzerten langfristig funktionieren.
VORSCHAU
Die nächsten Termine des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck
SYMPHONIEKONZERT:
4. Symphoniekonzert – Helden 2.0 mit Werken von Martin Ohrwalder, Arvo Pärt, Maurice Ravel und Philip Glass: 20. und 21. Feber jeweils um 20 Uhr im Saal Tirol, Congress Innsbruck
MUSIKTHEATER:
La clemenza di Tito: Opera seria von Wolfgang Amadeus Mozart Premiere am 8. Feber um 19 Uhr im Großen Haus, Einführung: 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn
MUSIKVERMITTLUNG:
Gstanzl feiert Geburtstag: Sitzkissenkonzert für Kinder ab drei Jahren und die ganze Familie
9. Feber um 10.30 und 14.30 Uhr, Haus der Musik Innsbruck, Kleiner Saal
Wie schön ist der Mai: Ein frühlingshaftes Mitsingkonzert
8. März um 17 Uhr, Großes Haus
Weitere Infos und Termine finden Sie auf www.tsoi.at




Ferienhaus in Apulien (Provinz Lecce)

VON 4. BIS 20. APRIL GESTALTEN JUNGE ENSEMBLES UND BEKANNTE KÜNSTLER*INNEN VERSCHIEDENER GENRES BEIM OSTERFESTIVAL TIROL AUSSERGEWÖHNLICHE ABENDE MIT ZAHLREICHEN UR- UND ERSTAUFFÜHRUNGEN.

Klangforum Heidelberg
Beytna, Maqamat
Von Schein und Sein
Das Osterfestival Tirol verbindet verschiedene Kulturen, Menschen und Genres. Unter dem Motto „sein_schein“ betrachtet die diesjährige 37. Auflage den Umgang mit der Realität, fiktiven Welten, Fakten und Falschdarstellungen. Von 4. bis 20. April sind dafür über 250 Künstler*innen aus aller Welt in Hall, Innsbruck und Umgebung zu Gast.
TEXT: MARINA BERNARDI
Hannah Crepaz hat mit der Übernahme der Organisation von ihren Eltern vor einigen Jahren dem Osterfestival Tirol eine neue Ordnung gegeben und widmet die Veranstaltungen seither stets einem großen Leitthema. Heuer steht das Festival unter dem Motto „sein_schein“ und nähert sich der Welt aus Realität und Fiktion mit Alter und Neuer Musik, Tanz, Performance, Filmen und Gesprächen. Jede Kunstform drückt sich dabei anders aus und bereitet dieselbe Thematik unterschiedlich auf. Jeder kann, soll und darf sich im Programm wiederfinden. Bereits die Eröffnung „Da Pacem“ bewegt sich zwischen Alt und Neu, Schmerz, Trauer und Zuversicht und führt damit mitten ins Herz des Mehrspartenfestivals. Domenico Scarlattis impulsivsinnliches „Stabat mater“ steht unter anderem der österreichischen Erstaufführung von Salvatore Sciarrinos „Due Cori“ gegenüber. Zum zweiten Mal wird dabei das Klangforum Heidelberg das Osterfestival Tirol eröffnen. Das Tiroler Ensemble Windkraft widmet sich im Konzert „Sine nomine“ Blechbläserquintetten. Neben einer Uraufführung von Johannes Maria Staud erlebt man im Salzlager Hall eine eindrucksvolle InstrumentenKlangvielfalt. Das Ensemble Gli Incogniti unter der Leitung der Geigerin Amandine Beyer – eine der wichtigsten und anerkanntesten Simmen der Barockmusik – macht in „Membra Jesu nostri“ gemeinsam mit den Sänger*innen des Schweizer Ensembles Voces Suaves die unfassbar schöne Musik von Dietrich Buxtehude erfahrbar. Kreativ, spannend und außergewöhnlich wird es bei den abwechslungsreichen Theater, Performance und Tanzvorstellungen, die das Festival heuer auch beschließen. So bildet die niederländische Compagnie LeineRoebana mit „Silenzio“, das die faszinierende, einzigartige Tanzsprache eindrucksvoll mit LiveMusik verwebt, am Ostersonntag den glorreichen Abschluss. Ergänzt wird das Programm durch die drei Filme „How to build a truth engine“ (Regie: Friedrich Moser), „Inland Empire“ (Regie: David Lynch) und „Dancer in the Dark“ (Regie: Lars von Trier), die jeweils im Innsbrucker Leokino gezeigt werden, sowie durch ein Gespräch von Moderatorin MarieLuise Frick mit Prosa und Theaterautorin Kathrin Röggla und Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in der Innsbrucker Stadtbibliothek und einer Lesung von Raoul Schrott im Salzlager Hall.
40 ORTE
In der Fastenzeit – Aschermittwoch, 5. März, bis Karsamstag, 19. April – wird zudem täglich außer sonntags ein anderer Ort zwischen Wattens, Hall und Innsbruck besucht, um gemeinsam 30 Minuten lang jeweils Inseln des Innehaltens zu erleben. Im Zentrum der kurzen Aktionen um 15 Uhr stehen vor allem Musik und Text, die sich dem Thema „sein_schein“ widmen. Die Kunst soll Utopie und Harmonie in den rauen Räumen unserer Gesellschaft aufleben lassen. Eintritt: freiwillige Spenden. Für nähere Infos scannen Sie bitte den QRCode. www.osterfestival.at
PROGRAMM:
ALTE & NEUE MUSIK
Eröffnung: Da Pacem Fr., 4. April, Salzlager Hall
Scarlatti, Sciarrino (ÖEA) u.a., Klangforum & Schola Heidelberg, Ltg.: Walter Nußbaum
NEUE MUSIK
Sine nomine Di., 8. April, Salzlager Hall
Staud (UA), Gubaidulina, Rihm u.a. Windkraft – Kapelle für neue Musik
Waves Mi., 16. April, Salzlager Hall
Furrer, Nemtsov (UA)
Phace, Cantando Admont
Ltg.: Cordula Bürgi
Geheimnisvolle Nachtwesen
Mi., 16. April, Kulturlabor Stromboli Hall
Animali Notturni – Marco Stagni (Bass), Matteo Cuzzolin (Saxophon), Philipp Ossanna (Gitarre), Max Plattner (Perkussion)
ALTE MUSIK
Buxtehude – Membra Jesu nostri Fr., 11. April, Salzlager Hall
Gli Incogniti, Voces Suaves Ltg.: Amandine Beyer
Zelenka – Gesù al Calvario
Fr., 18. April, Salzlager Hall, Collegium 1704 Chor & Orchester Ltg.. Václav Luks
THEATER, PERFORMANCE & TANZ
Fünf Uhr morgens
Sa., 5. April, Salzlager Hall mit Lubna Abou Kheir und Xulianna Khomenko
Regie: Ursina Greuel, ÖEA
Destination FCKD
So., 6. April, Salzlager Hall
Hungry Sharks
Choreographie: Valentin Alfery
Mellowing
Sa., 12. April, Congress Innsbruck
Dance On Ensemble
Choreographie: Christos Papadopoulos
The making of Berlin Di., 15. April, Congress Innsbruck
Berlin
Regie: Yves Degryse
Baytna
Do., 17. April, Congress Innsbruck Maqamat | Omar Rajeh
Silenzio
So., 20. April, Congress Innsbruck
Compagnie LeineRoebana
ATMOSPHÄRISCHE REGENERATION
Wellness in neuen Sphären: Das Hotel Krallerhof in Leogang im Salzburger Land ist mit seinem von Stararchitekt Hadi Teherani designten „Atmosphere“ in die erste Wintersaison gestartet und lässt Gäste im Spa in wohliger Wärme relaxen.

Von der Piste geht es buchstäblich direkt hinein in das neue, puristischreduzierte Bauwerk aus Glas, Holz und Sichtbeton, das sich respektvoll in die Landschaft integriert. Während rundherum die Schneeflocken die Umgebung mit einer weißen Schicht bedecken und die Naturkulisse ein wahres Schauspiel liefert, genießen Gäste das warme Wasser des 50 Meter langen InfinityPools. Schwimmen in olympischer Dimension ist hier ein besonderes Highlight – zum Abschalten, Dahinschweben und neue Energie schöpfen. Kraft und Harmonie prägen das Spa auch im Inneren. Im Blick die Berge, im Mittelpunkt das Wasser, zwei Welten, die verschwimmen. Der Fokus des Spas liegt vollkommen auf Wasser und Atmosphäre, in der Blauen Grotte als energetisches Zentrum, im Infrasalzraum, in den Saunen, in der Eisgrotte oder in der Rotunde mit alpinem ZenGarten. Zusätzlich sorgen ein Whirlpool im See, ein speziell für Allergiker geeigneter Ruheraum, ein Kältebecken, ein Yogaraum sowie das Café am See für ein exklusives Wellnessangebot für Erwachsene. Das Einbeziehen von Natur und Landschaft spiegelt sich


auch bei der Wahl der verwendeten Materialien wider: Linden, Eschen und Eichenholz, Alpenmarmor, Glas und Sichtbeton, überwiegend aus der Region.
Dank der direkten Lage des Krallerhofs am Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und der Steinbergbahn (gleich vor der Tür) bildet das familiengeführte Hotel die ideale Basis für eine sportliche Auszeit im Schnee. Mit 270 Pistenkilometern, Skiin/Skiout und der eigenen Skischule überzeugt man sowohl Anfänger*innen als auch Profis. Ob Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Winterspaziergänge: Am Hausberg Asitz laden die zum Haus gehörenden Berghütten AlteSchmiede und AsitzBräu sowie die KrallerAlm gleich neben dem Hotel zur gemütlichen Einkehr ein.
HOTEL KRALLERHOF
Rain 6, 5771 Leogang Tel.: 06583/8246
urlaub@krallerhof.com www.krallerhof.com

CHARMING PLACE


Sandburgen, Strandträume und Familienglück
In Gargano, im Herzen Apuliens, eingebettet in einen 20 Hektar großen Pinienwald und direkt am 400 Meter langen Privatstrand, liegt das Gattarella Family Resort. Die besondere Lage bietet nicht nur kristallklares, sanft abfallendes Wasser, sondern auch eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt.
Der private Strand des Gattarella Family Resort mit feinem Sand und sanft abfallendem Wasser bildet das Herzstück des idyllischen Rückzugsortes. Hier können Kinder unbeschwert Sandburgen bauen oder im sicheren, flachen Meer planschen, während Eltern unter schattenspendenden Sonnenschirmen entspannen. Mit großzügigen Abständen von fünf Metern zwischen den Liegen wird hier nicht nur Komfort, sondern auch eine seltene Privatsphäre geboten – ein echter Luxus, der den Strandbesuch besonders erholsam macht.
Das Gattarella Resort ist darauf spezialisiert, Familien eine unvergessliche Zeit zu bereiten. Die Allerkleinsten werden im Babyclub liebevoll versorgt, während der Mini Club Kindern bis 14 Jahre Raum für Spiel, Abenteuer und neue Freundschaften bietet. Und auch die vierbeinigen Familienmitglieder kommen nicht zu kurz: Hunde sind im Resort herzlich willkommen – ob am Strand, im Restaurant oder in der Weitläufigkeit der Anlage: Hier ist Platz für alle.
KULINARISCHE VIELFALT
UND NACHHALTIGE WERTE
Die Küche des Resorts ist ein Genuss für die ganze Familie. Regionale Produkte, da

GATTARELLA
FAMILY RESORT
AUSSTATTUNG: 350 Zimmer und Suiten, Restaurants, Pizzeria, Privatstrand, Animation, Baby und MiniClub, Pools, Sportmöglichkeiten
TOP: Nachhaltigkeit, energieeffiziente Zimmer, schonender Umgang mit Naturressourcen
BESONDERHEIT: Privater Liegenbereich mit fünf Metern Abstand zwischen den Sonnenschirmen
Dieses Refugium ist ein Hoteltipp aus der Kollektion von charmingplaces. de exklusiv für eco.nova. Anja Fischer und ihr Team haben ein glückliches Händchen für schöne Orte und besondere Reiseinspirationen.
runter das hauseigene Olivenöl, stehen im Mittelpunkt der Speisekarte. Während Erwachsene die apulischen Spezialitäten genießen, freuen sich Kinder über eigens gestaltete Menüs und Buffets. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: Energieeffiziente Technologien und ein schonender Umgang mit der Natur machen den Urlaub nicht nur erholsam, sondern auch umweltbewusst. Die 350 Zimmer und Suiten des Resorts bieten dazu für jeden Bedarf die passende Unterkunft – vom romantischen Doppelzimmer bis zur geräumigen Familiensuite. Besonders beliebt sind die DeluxeZimmer mit Meerblick, die in unmittelbarer Nähe des Strandes liegen und den Duft der Pinien direkt ins Zimmer bringen. Ein Aufenthalt im Gattarella Resort verspricht nicht nur erholsame Tage am Meer, sondern auch die Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden. Ob ein Ausflug in die malerische Küstenstadt Vieste, ein Spaziergang durch die unberührte Foresta Umbra oder ein Bootsausflug zu den TremitiInseln – das GarganoGebiet hält für jeden Geschmack etwas bereit. Abends genießen die Gäste den atemberaubenden Sonnenuntergang am Meer oder ein stilvolles Abendessen im Gourmetrestaurant, während die Kinder noch einmal den Tag bei Tanz und Musik ausklingen lassen.








Gesund in die Zukunft
Das Mount Med Resort in der Wildschönau setzt neue Maßstäbe in Architektur, Interior und Konzept im Gesundheitstourismus.
Mit Dezember 2024 hat das MedicalFlagship Mount Med Resort seine Pforten geöffnet. Aufbauend auf den 850 Jahre alten Mauern eines ehemaligen Zehenthofs ist hier ein architektonisch und konzeptionell einzigartiges Resort mit visionärem Medical Spa entstanden. Zehn Gebäude vereinen sich zu einer Welt in sich, harmonisch eingebettet in die unberührte Natur des Hochtals.
MYLIFE CHANGING RESORT
Im revolutionären Gesundheitskonzept des Mount Med Resort finden integrative Diagnostik, Präzision und zukunftsweisende, zellverjüngende Methoden sowohl in der Prävention als auch in der Behandlung Anwendung. Achtsamkeit und Balance ebnen darüber hinaus den Weg zu einer Transformation des Bewusstseins und des Lebensstils. Ziel ist es, die körperliche
und geistige Gesundheit, Schönheit und Leistungsfähigkeit der Gäste mit maßgeschneiderter Ernährung, NeuroBiohackingTechnologien und natürlichen Nootropika zu optimieren. Der Mensch wird in seiner Gesamtheit betrachtet, vom Mindset bis zu den schmerzenden Gelenken und allem dazwischen – angefangen in der kleinsten Zelle des Körpers. Das Mount Med Resort bietet sohin weit mehr als nur einen Aufenthalt – es ist ein bewusst gewählter Rückzugsort, der seinen Gästen eine Welt der Regeneration, Kraftschöpfung und Inspiration eröffnet.
MOUNT MED RESORT
Kirchen, Oberau 72, 6311 Wildschönau Tel.: 05339/29300 info@mountmedresort.com www.mountmedresort.com

Im Gespräch
NEWS & EVENTS




Oben li.: Rechtsanwalt Franz Pegger (Kanzlei GPK – Pegger Kofler & Partner), Anna Jenewein, WK-Fachgruppenobmann Immobilien- und Vermögenstreuhänder Philipp Reisinger und Peter Jenewein // Oben re.: Peter und Anna Jenewein // Unten li.: Peter Jenewein mit Prokuristin und Gesellschafterin Iris Foidl // Unten re.: Rechtsanwalt Matthias Waldmüller, Christine Jenewein, Rudi Förg (TISPA), Juristin Laura Fessler, Alex Öhm (Mo Ingenieure GmbH), Rechtsanwältin Iris Tinzl und Rechtsanwältin Patrizia Fessler
JEDEM ENDE WOHNT EIN ANFANG INNE
Ende Jänner fand in den Büroräumlichkeiten von Immobilienmanagement Jenewein in Innsbruck im Rahmen eines gelungenen Festes mit zahlreichen illustren Gästen die Feier für den Ruhestand von Firmengründer Peter Jenewein statt. Gleichzeitig legte er das Unternehmen damit offiziell in die Hände von Tochter Anna Jenewein. Peter Jenewein bedankte sich herzlich bei seiner Familie, bei Freund*innen, Geschäftspartner*innen und langjährigen Weggefährt*innen für die gemeinsamen schönen Zeiten, Erlebnisse und Geschäftserfolge. Bei feinen Speisen und gutem Wein wurde nach weiteren emotionalen Ansprachen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, die Jagdhornbläsergruppe Vill/Igls sorgte mit mehreren Ständchen für den musikalischen Rahmen. www.immobilien-jenewein.at


Thomas Bodner (geschäftsführender Gesellschafter der BODNER Gruppe) mit Volker Steindl (Präsident Lions Club Kufstein) und Mario Morandell (Präsident Rotary Club Kufstein) mit Markus Rohrmoser (Geschäftsführer BODNER Gruppe)
FÜR DIE GUTE SACHE
Mit ihrer traditionellen Weihnachtsspende unterstützt die Kufsteiner BODNER Gruppe jedes Jahr soziale Organisationen in der Region. Dieses Mal gehen jeweils 5.000 Euro an den Rotary Club Kufstein und den Lions Club Kufstein, die sich seit Jahrzehnten für eine rasche und unbürokratische Hilfe für in Not geratene Menschen einsetzen. Im Dezember nahmen die Clubpräsidenten Volker Steindl und Mario Morandell die Spendenschecks in der neuen BODNERZentrale entgegen. Das Geld wird konkret in die Unterstützung des Sozialmarkts SOMA Kufstein sowie in Projekte und Initiativen fließen, die generell gestiegene Lebenshaltungskosten abfedern sollen. Sie wollen helfen oder brauchen Hilfe? Infos unter kufstein.rotary.at oder kufstein.lions.at
SICH KLÜGER LESEN
Ende des Jahres ist die vierte Auflage des Standardlehrbuches „Allgemeine Psychologie“ erschienen. Das Lehrbuch, das von Univ.Prof. Dr. Martina Rieger vom Institut für Psychologie der Privatuniversität UMIT TIROL (im Bild mit UMITInterimsrektor Rudolf Steckel, mit dem wir ab Seite 44 gesprochen haben) und Prof. Dr. Jochen Müssler von der RWTH Aachen University herausgegeben wurde, bietet einen umfassenden Einblick in zentrale Aspekte menschlichen Erlebens und Verhaltens. Die neue Auflage wurde grundlegend aktualisiert und durch zusätzliche Kapitel ergänzt.
Allgemeine Psychologie, Springer Berlin, 1.014 Seiten, EUR 61,50

Karoline Obitzhofer, Vorsitzende von Rettet das Kind Tirol, mit NovartisGeschäftsführer Roland Gander
KINDERN EINE CHANCE GEBEN
Seit über 55 Jahren setzt sich der Verein Rettet das Kind Tirol für die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein – für Kinder in Not, die schnelle und unbürokratische Hilfe benötigen. Möglich ist diese nur durch private Spender*innen, die den Verein regelmäßig unterstützen, sowie viele Tiroler Firmen, deren Mitarbeiter*innen sammeln oder auf Feiern und Geschenke verzichten. Ende letzten Jahres übergab Novartis einen großzügigen Scheck in Höhe von 10.000 Euro. Die Summe wurde in den Kauf von SPARGutscheinen investiert. Infos zu Spendenmöglichkeiten oder schneller Hilfe unter ww.rettet-das-kind.tirol

NEU IM AMT
Die Universität Innsbruck hat einen neuen Vizerektor für Infrastruktur. Bauingenieur und Baumeister Manfred Lechner trat sein Amt am 1. Jänner 2025 an und folgt damit Christian Mathes nach, der sich aus privaten Gründen zurückzieht. Lechner war von 1990 bis 2023 für den Baukonzern STRABAG AG in verschiedenen Positionen und ab 2005 als Technischer Direktionsleiter für Tirol und Vorarlberg beschäftigt. In seinen Funktionen war er dort für insgesamt ca. 1.000 Mitarbeiter*innen zuständig. Außerdem war Lechner 15 Jahre Sprecher der Tiroler Bauindustrie in der Wirtschaftskammer Tirol.

WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr, WirtschaftsbundLandesobfrau und Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler, Landeshauptmann Anton Mattle und Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Peter Seiwald
FÜR EINEN STARKEN STANDORT
Ende Jänner wurde das Grand Tirolia Kitzbühel zum Zentrum für Wirtschaft und Politik: Der Tiroler Wirtschaftsbund lud zum traditionellen Hahnenkammempfang und begrüßte rund 300 Gäste. Landesobfrau Barbara Thaler und Bezirksobmann Peter Seiwald freuten sich über hochkarätige Teilnehmer, Wirtschaftsexperte Gabriel Felbermayr konnte für eine Keynote gewonnen werden.

proHolz-Vorstand Manfred Saurer, Stefan Demetz, Gerhard Oberrauch (beide ATP) und proHolz-Geschäftsführer Rüdiger Lex
HOLZBILDUNG
Auch heuer organisierte proHolz Tirol zu Jahresbeginn einen Programmteil zur 54. Bildungswoche der österreichischen Holzbau und Zimmermeister in Alpbach. Der Abend zum Thema „Best of Holzbau – Integrale Planung für nachhaltige Architektur“ sorgte für reges Interesse. Über 200 Expert*innen aus dem Bauwesen und am Holzbau Interessierte fanden sich zum Vortrag und anschließenden Netzwerken im Congress Centrum Alpbach ein. Der Abend bildete den Auftakt für ein spannendes Programmjahr 2025.

AI ETHICS BY DESIGN
Die Innsbrucker Wirtschaftskanzlei GPK Pegger Kofler & Partner lud zum Vortrag mit Sabine Singer, Gründerin und CEO der Sophisticated Simplicity GmbH. Die globale Pionierin im Bereich der KIEthik sprach im Festsaal der Wirtschaftskammer Tirol vor rund 250 Gästen zum Thema „AI Ethics by Design – vom Digitalen Humanismus zur wertebasierten KIStrategie“. Sie sprang für den krankheitsbedingt ausgefallenen Referenten Tobias Haar, General Counsel beim deutschen KIEntwickler Aleph Alpha, ein und machte das ganz wunderbar – unterhaltsam verständlich, informativ. Bitte unbedingt mehr davon!

NEUE PARTNERIN


SCHICKSALSJAHR 2025
Explodierende Kosten, Bürokratie und die längste Rezession der Nachkriegsgeschichte setzen Tirols Industrie massiv unter Druck. Max Kloger, Präsident der Industriellenvereinigung Tirol, forderte beim Neujahrsempfang mutige Reformen und klare Entscheidungen, um Arbeitsplätze, Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern: „2025 ist das Schicksalsjahr für die heimische Industrie – entweder wir ergreifen die Chancen, die vor uns liegen, oder wir riskieren die Zukunft des Industriestandorts und damit unser aller Wohlstand.“
Die Rechtsanwaltskanzlei GPK Pegger Kofler & Partner hieß mit Beginn des Jahres Mag. Kristina Pegger als neue Partnerin willkommen. Sie verstärkt das Team insbesondere in den Bereichen Real Estate, Corporate Governance und Compliance. Mit ihrer Ernennung setzt die Kanzlei ihren Weg fort, junge Talente zu fördern und die nächste Generation von Jurist*innen aktiv in Führungspositionen einzubinden. Kristina Pegger ist seit 2023 Teil der Kanzlei und hat in dieser Zeit durch ihre Fachkompetenz, ihr Engagement und ihre praxisorientierte Herangehensweise überzeugt. Sie bringt zudem wertvolle Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit im Bereich Wirtschaftsforensik sowie aus internationalen Wirtschaftskanzleien mit. Mit dem Eintritt von Kristina Pegger zählt die Kanzlei nun insgesamt 13 Partnerinnen und Partner. MITMACHEN! STARKE FRAUEN
Der Tiroler Frauenpreis soll Vorbilder würdigen, die sich für Chancengleichheit einsetzen und das Wirken engagierter Frauen sichtbar machen. Im Vorjahr wurde der mit 5.000 Euro dotierte Preis erstmals vergeben, gegangen ist er an Katharina Lhotta, Geschäftsführerin des Vereins ARANEA für Mädchen und junge Frauen. Ab sofort können Nominierungen für den zweiten Tiroler Frauenpreis eingereicht werden – infrage kommen Einzelpersonen oder Projekte (natürlich dürfen daran auch Männer beteiligt gewesen sein), die sich für die Gleichstellung in Wirtschaft oder Kunst, für Frauengesundheit oder mehr Frauen in Entscheidungspositionen einsetzen. Über die Vergabe des Preises entscheidet eine fünfköpfige Expertinnenjury. Infos und Nominierungsformular unter www.tirol.gv.at/frauenpreis. Die Nominierungsfrist läuft bis 16. März 2025. Der Preis wird am 14. Mai 2025 übergeben.
Oben: Landesräte René Zumtobel und Mario Gerber, Landeshauptmann Anton Mattle, Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Vizepräsidentin Gabriele Punz-Praxmarer (Montanwerke Brixlegg), Präsident Max Kloger (Tiroler Rohre) sowie die Vizepräsidenten Karlheinz Wex (Plansee Holding) und Simon Meinschad (hollu Systemhygiene)
Links: Josef Negri (Unternehmerverband Südtirol) und Reinhard Schretter (Schretter & Cie)

Hans-Joachim Holstein (LC Via Oy Salina), Alexander Wassner (LC Innsbruck Nordkette), Leonardo Leonardi und Tanja Guetti (LC TioneValle Giudicarie-Rendena)
PARTNERSCHAFT
Der Lions Club Innsbruck Nordkette lud Ende letzten Jahres zur Gründung einer internationalen Jumelage in den Bierwirt nach Innsbruck ein. Künftig wollen die drei Clubs LC Innsbruck Nordkette, LC Via Oy Salina aus Deutschland und LC TioneValle GiudicarieRendena aus Italien in freundschaftlicher Verbundenheit noch enger zusammenarbeiten. Beide Clubs sind dafür mit einer größeren Delegation nach Tirol gereist. Ziel der Partnerschaft ist es, in einem starken Netzwerk Spenden für soziale Projekte zu sammeln, um die Lebensqualität und das Wohlergehen so vieler Menschen wie möglich zu verbessern. Neue gemeinsame Projekte wurden bereits auf den Weg gebracht. innsbruck-nordkette.lions.at




Die Ärztespezialisten
Kaiserjägerstraße 24 · 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 59 8 59-0 · Fax: DW-25 info@aerztekanzlei.at www.aerztekanzlei.at
Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
UNTERSTÜTZUNG BEI IHRER PRAXISGRÜNDUNG
UNTERSTÜTZUNG BEI IHRER PRAXISGRÜNDUNG
DAS REZEPT FÜR IHRE FINANZIELLE GESUNDHEIT!
Wir beraten Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 40 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet.
Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 40 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet.
Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzteund das seit 40 Jahren. Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vorteil!
Unser ressourcenreiches Team steht für bestes Service und maximalen Klientennutzen.
Erwarten Sie von uns ruhig mehr, denn wir sind die Spezialisten!
v. li. Raimund Eller, Karin Fankhauser, Dr. Verena Maria Erian, Mag. Johannes Nikolaus Erian
v. li. Mag. Johannes Nikolaus Erian, Raimund Eller, Mag. Dr. Verena Maria Erian, Karin Fankhauser
Wer kommt, will bleiben.
Wir haben neue Räumlichkeiten mit mehr Platz für Sie und für uns. Kostenlose Parkplätze direkt vor unserer Haustüre.
Unser Team freut sich auf Sie. und das seit über 40 Jahren. Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vorteil!
Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.
Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.

www.aerztekanzlei.at
REMINDER! WAHLKARTEN-ANTRAG ZURÜCKSENDEN!
Noch sind einige Wahlkarten-Anträge nicht retourniert worden. Schicken Sie uns bitte Ihren ausgefüllten Wahlkarten-Antrag rechtzeitig zu. Danke! Bei Fragen: wahl2025@wktirol.at – Hotline: 05 90905-2025 – wkwahl.tirol
Alle Infos zur WK-Wahl:
