INTERNATIONALES
MUSIKFEST HAMBURG
Julia Bullock
Kirill Serebrennikov
Tamara Stefanovich
Sona Jobarteh
LUST, LEID, LEIDLUST

Franz Schubert und die Liebe
CHANSON D’AMOUR
Frankreichs quicklebendige Tradition








MUSIKFEST HAMBURG
Julia Bullock
Kirill Serebrennikov
Tamara Stefanovich
Sona Jobarteh
LUST, LEID, LEIDLUST

Franz Schubert und die Liebe
CHANSON D’AMOUR
Frankreichs quicklebendige Tradition







Liebe Leserin, lieber Leser, wo sie schon der Urstoff des Lebens an sich ist, da kann die Liebe gar nicht anders, als auch der Treibstoff für die Töne und die Zwischentöne der Musik zu sein. Die Liebe, erfüllte wie unerfüllte, erhörte wie unerhörte, ist das höchste der Gefühle, obgleich (oder weil) sie selbst ein Gemisch aller möglichen Gefühle ist. Sie ahnen es: Wenn ganz große Wörter wie Liebe aufs Titelblatt des »Elbphilhar monie Magazins« kommen, dann ist es Zeit für eine weitere Ausgabe des Internationalen Musikfests Hamburg. Das diesjährige steht unter eben diesem Motto, kalendarisch perfekt abgestimmt auf den in Hamburg ja häufig wirklich wunderschönen Monat Mai, den das Musikfest mehr als komplett ausfüllt.
Um Sie ein wenig auf die Vielfalt des Programms und die mannigfachen Bezüge zum FestivalMotto einzustimmen, haben sich die Autorinnen und Autoren dieses Hefts jede Menge erhellende und bereichernde Gedanken zum Thema aller Themen gemacht. Der einleitende Essay spürt biografischen LiebesBezügen quer durch die Musikgeschichte nach und gewährt manchen Blick durchs metaphorische Schlüsselloch, ohne je das guilty pleasure der Kolportage zu bedienen. Wir haben uns auch gestattet, aus diesem Anlass einmal die liebestiftenden Qualitäten der Elbphilharmonie selbst im
Hinblick auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beleuchten (S. 70).
Lesen Sie, welche Lieblingsliebeslieder einige der kreativen Köpfe der Musikszene haben (S. 58), führen Sie sich den wunderbar kenntnisreichen und emotionalen Text über Franz Schubert und die Liebe zu Gemüte (S. 28) und erfahren Sie, wie ein FilmemacherPaar aus Hamburg, eine hier sesshaft gewordene BestsellerAutorin und ein ziemlich begnadeter Singer/Songwriter aus der Liebe Kunst gemacht haben – und dies weiterhin tun (S. 74).
Zum Musikfest gehört traditionell auch ein mit Hamburg verbundener KomponistenSchwerpunkt. Den gibt es auch in diesem Jahr – mit Alfred Schnittke. Dass er in diesem Heft nicht vorkommt, ist der Pandemie geschuldet. Ein großes, überaus lesenswertes Portrait über ihn erschien bereits vor zwei Jahren, als das Musikfest mit Schnittke im Zentrum nahezu komplett entfiel. Im guten OnlineGedächtnis der Elbphilharmonie existiert es weiterhin. Sie finden es in der Mediathek auf unserer Website (www.elbphilharmonie.de/mediathek).
Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre dieses Magazins sinnliches Vergnügen bereitet. Mit lieben Grüßen!
Ihr Christoph LiebenSeutter
 Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle
Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle
4
ESSAY
TOUR D’AMOUR
Alle Aspekte der Liebe findet man in der Musik.
VON VOLKER HAGEDORN
16
GLOSSE
DIE FALSCHE STADT IN DER RICHTIGEN
Was aus Heimatliebe in der Fremde wird
VON TILL RAETHER
28
MUSIKGESCHICHTE
LUST, LEID, LEIDLUST
Franz Schubert und die Liebe
VON ALBRECHT SELGE
60
JULIAN LAGE
DER WILL NUR SPIELEN
Lässige Leichtigkeit zwischen Blues, Jazz und Rock’n’Roll

VON JAN PAERSCH
65
34
FOTOSTRECKE
DAS LICHT DER LIEBE
VON JULIA KNOP
48
MUSIKLEXIKON STICHWORT »LIEBE«
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
VON CLEMENS MATUSCHEK
18
LOVE EST. 2023
WIE WIR LIEBEN
Das CommunityProjekt der Elbphilharmonie
VON DOMINIK BACH
50
BAROCCO
TÜREN IN DIE GEGENWART
Kirill Serebrennikov feiert die Einzigartigkeit des Individuums.

VON JOACHIM LUX
25
TAMARA STEFANOVICH
DIE ALLROUNDERIN
Die Pianistin und ihr Konzertmarathon
VON SIMON CHLOSTA
58
UMGEHÖRT
LIEBLINGS-LIEBES-LIEDER
Eine Frage, sieben Antworten
VON LAURA ETSPÜLER
SONA JOBARTEH
NICHT EINFACH DIE ERSTE
Ein neues Rollenverständnis für die GriotTradition
VON STEFAN FRANZEN
68
ENGAGEMENT
ICH BIN EIN FAN
VON CLAUDIA SCHILLER

70
MITARBEITER
TATSÄCHLICH LIEBE!
Diese Paare haben sich über die Elbphilharmonie kennengelernt.
VON FRÄNZ KREMER
74
REPORTAGE
DIE LIEBE, EIN KUNSTSTÜCK
Wie wird eigentlich aus Liebe Kunst?
VON STEPHAN BARTELS
82 IMPRESSUM
FÖRDERER UND SPONSOREN
88
CHANSON
ICH SCHREIBE, ALSO SINGE ICH
In Frankreich ist das Chanson nicht nur nationales Kulturgut, sondern auch quicklebendige Tradition.
JULIA BULLOCK
»DUNKELHEIT KANN FASZINIEREND SEIN«
Die Sängerin über Olivier Messiaens Liebesliederzyklus »Harawi« und ihren musikalischen Erkenntnismoment

VON BJØRN WOLL
ALTE MUSIK
HIMMLISCHES VERLANGEN
Kaum eine Liebeslyrik hat so viel Musik inspiriert wie das biblische »Hohelied des Salomo«.

VON REGINE MÜLLER

ACHTZIG STICHWORTE AUS
ROLAND BARTHES »FRAGMENTE EINER SPRACHE DER LIEBE« (1977)

 FOTOS VON
MARTINA MATENCIO
FOTOS VON
MARTINA MATENCIO
och, sogar Frédéric Chopin hat Liebeslieder geschrieben, aber nicht sie machen ihn zum vielleicht größten Seelenversteher und Menschenkenner, der je komponiert hat. Es sind seine Klavierwerke, die einfache Genretitel tragen, Balladen, Scherzi, Nocturnes, Mazurken, Études, Préludes, unterschieden nach Opuszahlen und Tonarten. Hie und da ein Widmungsträger, eine Widmungsträgerin, jahrelang eine komplexe Beziehung mit einer außergewöhnlichen Frau – alles kein Grund, nach versteckten Botschaften zu suchen oder gar ein Stück auf einen Eindruck festzulegen. Aber es gibt bei Chopin einen ungeheuren Reichtum an Nuancen, Gesten, Blicken, Bildern, Atmosphären, an Ausbrüchen und Innigkeiten, alles zu einer Klarheit verdichtet, zu Charakteren auch, in denen man das Leben erkennt.
Oder einen geliebten Menschen. Der Autor wird hier nicht erzählen, welche Takte Chopins sein Leben veränderten, weil sie ihm die Augen öffneten. Aber dass Musik uns verstehen, bewegen und verändern kann, so binsenweise das klingt, sollte man schon bedenken. Musiker aller Zeiten haben sich mit dem Thema Liebe und seinen unzählbaren Aspekten befasst, explizit und programmatisch ebenso wie indirekt und verschlüsselt. Dass Musik »nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte« ausspreche, wie Felix Mendelssohn schrieb, macht sie zum vielleicht
einzig angemessenen Medium für den übergreifenden »Diskurs über die Liebe«, den der französische Denker Roland Barthes anregte.
Dieser Diskurs werde zwar »von Tausenden von Subjekten geführt«, aber »in extremer Einsamkeit«. In historischer Umkehrung sei »nicht mehr das Sexuelle unschicklich, sondern das Empfindsame«. Um den Diskurs zu starten, trug Barthes 1977 »Fragmente einer Sprache der Liebe« zusammen. Achtzig Stichworte, sortiert von »Abhängigkeit« bis »Zugrundegehen«. Die Musikwelt der Liebe und des Liebens kann man nicht in solchen Fragmenten erkunden. Aber wie Barthes können wir anstelle einer Ideengeschichte den Situationen und Affekten folgen, in denen sich so viele individuelle Leben treffen. Die »Süße des Anfangs«, wie er es nennt, die Hürden und Verbote, die Erfüllung, die Sinnlichkeit, die Eifersucht … Es könnte sich zeigen, dass Musiker und Hörer schon lange den Diskurs führen, den Barthes vermisste.

Diskurs! Was für ein Wort, wenn man Elton Johns »Blue Eyes« hört. Aber wo kommt er her, der Septnonenakkord, mit dem der Sänger uns zum Weinen bringen kann? Erstens natürlich vom Himmel, aber zweitens aus jahrhundertelanger Arbeit am klingenden Ausdruck von Gefühlen. Was an Emotionswundern allein in Jazz, Pop, Rock zusammenkommt, welche Linien sich in ihnen treffen, das würde diesen Text allerdings komplett sprengen. Hören wir sie einfach innerlich mit bei dieser kleinen tour d’amour durch die Klassik.

Übers Verknalltsein sind Aberhunderte von Liedern geschrieben worden, vier der berühmtesten am Beginn der »Dichterliebe« von Robert Schumann zu Heinrich Heines Gedichten: »Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen / da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.« Im letzten Lied freilich wird die Liebe eingesargt, samt Herz und Schmerz. Wo auch immer ein Komponist, eine Komponistin einen größeren Bogen spannt, scheint im Beginn der Liebe bereits ihr Ende zu liegen (selbst in den »Blue Eyes« schimmern schon Tränen). Wer allein die tausenden von Opern seit Claudio Monteverdis »Orfeo« daraufhin untersuchen wollte, hätte keine Zeit mehr für amouröse Verabredungen.
In seiner Symphonie dramatique »Roméo et Juliette« nimmt sich Hector Berlioz Zeit für das Glück. In ADur zeigt er den nächtlichen Garten, aber diese Tonart weitet sich in sanften Klängen zu einem magischen Moment, als um ein einsames E der Querflöte sich das A der ersten und das C der zweiten Geigen legen, darunter in den Bratschen ein Fis. Man muss diese Töne so genau benennen, wir werden dem Akkord (um einen Halbton versetzt) wiederbegegnen, bei Wagner – der für den Abend der Pariser Uraufführung 1839 auf der Gästeliste steht –, in einer anderen Musik der Liebe, »Tristan und Isolde«. Bald beginnen Romeo und Julia im Orchester zu sprechen. Es ist eine zärtliche, aber auch traurige Musik, es ist Rückblick darin, Beschwörung. Wagner wird Berlioz später nicht von ungefähr ein Exemplar der Partitur des »Tristan« mit diesen Worten widmen: »Au cher et grand auteur de Roméo et Juliette.«
In beiden Werken geht es um eine Liebe gegen Widerstände und Verbote. Die Musik ist aber auch jenseits dieser Dramen voll von Hürden und Ungelebtem. Die vom Vater weggeschlossene Angebetete, von der die Komponistin Barbara Strozzi in ihrer bewegenden Arie »Lagrime mei« erzählt, ist nicht nur venezianische Realität des 17. Jahrhunderts. Unsichtbare Mauern gibt es überall, bis heute. »Kann unsre Liebe anders bestehn als durch Aufopferungen, durch nicht alles verlangen, kannst du es ändern, daß du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin«, schreibt der 41jährige Ludwig van Beethoven einer Frau mit dem Bleistift, den sie ihm geschenkt hat. »Ich weine wenn ich
denke daß du erst wahrscheinlich Sonnabends die erste Nachricht von mir erhältst – wie du mich auch liebst –stärker liebe ich dich doch …« Am nächsten Tag: »guten Morgen am 7ten Juli – schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir meine Unsterbliche Geliebte, hier und da freudig, dann wieder traurig. […] leben kann ich entweder nur gantz mit dir oder gar nicht […].« Antonie von Brentano, die mutmaßliche Empfängerin, war verheiratet. Da man Beethovens Brief in seinem Nachlass fand, ist nicht einmal sicher, ob er ihn je abschickte oder ihn von Antonie zurückerhielt. Er hat nie weitere Beziehungen zu Frauen gehabt.



Er hat aber vier Jahre später den Liederzyklus »An die ferne Geliebte« vollendet; der eigens dafür geschriebene Text von Alois Jeitteles endet so: »Dann vor diesen Liedern weichet / Was geschieden uns so weit, / Und ein liebend Herz erreichet / Was ein liebend Herz geweiht.« Die »ferne Geliebte« wurde umgehend ein Zentralbegriff der deutschen musikalischen Romantik, und als Johannes Brahms sich mit zwanzig Jahren aussichtslos in die Frau seines Mentors Robert Schumann verliebte, zitierte er in seinem sehnsuchtsvollen Klaviertrio Opus 8 genau das Motiv aus Beethovens »Ferner Geliebter«, das auch Schumann selbst gern auf Clara bezog. Auch da zeichnet sich ein Diskurs über die Liebe ab – wobei Brahms in einer späteren Fassung des hMollTrios alle ClaraBezüge tilgte.
IN STETEM HERZKLOPFEN
Alban Berg hielt es derweil mit »Tristan«, als er sich, vierzehn Jahre nach der Eheschließung mit Helene Nahowsky, 1925 in eine andere Frau verliebte: Hanna FuchsRobettin, die Schwester Franz Werfels, verheiratet mit einem Prager Industriellen, mit dem sie Kinder hatte. Die Zuneigung zwischen dem 40jährigen Komponisten und der zehn Jahre jüngeren Hanna war gegenseitig und zumindest auf Bergs Seite von ungeheurer Heftigkeit. »Ich bin seit diesem größten Ereignis nicht mehr ich«, schrieb er ihr. »Ich bin ein in stetem Herzklopfen dahintorkelnder Wahnsinniger geworden, dem alles, was ihn früher bewegte …, vollständig gleichgültig, unerklärlich, ja verhasst geworden ist. Der Gedanke an meine Musik ist mir ebenso lästig und lächerlich, als jeder Bissen Nahrung, den ich gezwungen bin hinunterzuwürgen …«
Doch weder trennte sich Berg von Helene noch von der Musik. All seine Gefühle brachte er hinein in sein Streichquartett »Lyrische Suite«, dessen geheimes Programm er Hanna mitteilte. Der verzweifelte letzte Satz, Largo desolato, folgt demnach den Worten eines Gedichts von Charles Baudelaire in Stefan Georges Übersetzung: »Zu dir · du einzig teure · dringt mein schrei«. In der Mitte des Finales werden die ersten Takte des »Tristan« zitiert, in denen der Zahlen und Buchstabenfetischist Berg etwas ganz Persönliches gefunden hatte: seine und Hannas Initialen in Verschränkung. A und F in der ersten kleinen Sexte, B und H im Übergang zum EDurSeptakkord. Zu solchen Projektionen sind nur Kabbalisten, Psychotiker
Dann vor diesen Liedern weichet Was geschieden uns so weit, Und ein liebend Herz erreichet Was ein liebend
Alois Jeitteles’»Nimm sie hin denn, diese Lieder« in Ludwig van Beethovens »An die ferne Geliebte« (1816)





und Liebende fähig. Bergs Musik hat aber die Hörer schon bewegt, als sie vom heimlichen Programm noch gar nichts wussten.
ALL NIGHT LONG

Wie schön, nach all den Hürden und Heimlichkeiten nun mit Walther von der Vogelweide zur Erfüllung zu kommen, deren Spuren er im »Lindenlied« um 1200 sichert: »Under der linden an der heide / da unser zweier bette was / da muget ir vinden schone beide / gebrochen bluomen unde gras.« Und hinter Joseph Haydns fisMollKlaviertrio leuchtet eine Reiseliebe. Der Mann aus Esterháza, knapp 60 Jahre alt, war 1791 Stargast in London, wo er Rebecca Schroeter begegnete, der jungen Witwe eines Pianisten. Bald beginnen Rebeccas Briefe an ihn mit »My D« wie »Dear«. »My heart was and is full of TENDERNESS for you, but no language can express HALF the LOVE and AFFECTION I feel for you, you are DEARER to me EVERY DAY of my life.« Sie schreibt Noten für ihn, ist besorgt um seinen Schlaf, seine Kopfschmerzen, besucht seine Konzerte – und wird von ihm besucht: »I hope to see you my D[ea]r L[ove] on tuesday as usual to Dinner and all […] with me.« – Als Haydn das alles später seinem Biografen übergab, strich er den Satz ab »Dinner« fast bis zur Unentzifferbarkeit durch. Zwischen »all« und »with me« konnte der Musikwissenschaftler H. C. Robbins Landon das Wort »night« ergänzen – es ist zu anrührend, um es im Sinne Haydns zu verschweigen.
Wenn Joseph Rebecca portraitiert hat, dann im Adagio seines Klaviertrios in der so nächtlichen wie für Haydn noch entlegenen Tonart fisMoll aus einem der Bände, die er in London drucken ließ. Die Sammlung ist »Mrs Rebecca Schroeter« gewidmet, und in der Mitte des letzten Trios (HB XV /26 ) steht ein abgründig schönes, bewegtes FisDurAdagio. Haydn mochte es so gern, dass er es – in leichter spielbarem FDur – in seine Sinfonie Nr. 102 übernahm.
Claude Debussy bekannte sich in aller Öffentlichkeit zu dem Glück, das ihm im Sommer 1904 beschert war, und verband es mit drei Liedern. Nur war das Bekenntnis verschlüsselt. Zur Drucklegung schrieb er seinem Verleger: »Bei den ›Fêtes galantes‹ bitte ich Sie inständig, die folgendermaßen konzipierte Widmung nicht zu vergessen: ›Mit Dank an den Monat Juni 1904, gefolgt von den Buchstaben A.l.p.M.‹ Das ist ein bisschen mysteriös, aber man muss ja etwas für die Legende tun …« Er schrieb das auf Jersey, der Kanalinsel, auf die er mit seiner Geliebten geflohen war, jener Emma Bardac, die seine zweite Frau wurde und der die Widmung gilt: »À la petite Mienne«, »Für die kleine Meine«. Die erste der mélodies für sie, Paul Verlaines Gedicht »Les Ingénus« (»Die Arglosen«), beginnt so: »Die hohen Hacken kämpften mit dem langen Kleid / so, dass, je nach dem Weg und nach dem Wehen / des Winds, das Schimmern heller Waden kurz zu sehen / war! Und wir liebten diesen Hauch Verfänglichkeit.«
Bar solcher Eleganz, aber nicht der Magie sind in derselben Epoche die erotischen Visionen des russischen Musikmystikers Alexander Skrjabin. Als größtes Projekt plante er ein Ritual aus Tönen, Farben, Düften, Aromen, Bewegungen und Körperkontakten, an dessen Ende ein kollektiver Orgasmus die kosmische Ekstase auslösen sollte. Auf dem Weg dorthin wurde 1908 »Le Poème de l’Extase« vollendet, ein gigantisch besetztes Werk mit Spielanweisungen wie »mit zunehmend ekstatischer Wollust« – ein komplex und in soghafter Harmonik auskomponiertes Crescendo von 20 Minuten, an dessen Ende eine CDurFontäne aus dem Orchester hochschießt. Gut, man kann das auch anders hören. Aber selbst explizite Sexnummern in Pop und Rock nehmen sich gegen Skrjabins Ekstase wie keusche Versuchsanordnungen aus.
Im Gegensatz zur Intimität ist Eifersucht zuerst eine Projektion, so machtvoll freilich, dass sie oft keine handfesten Gründe braucht, um alles zu zerstören wie in Leo Tolstois Novelle »Kreutzersonate«: Ein Mann ist so überzeugt von der Untreue seiner jungen Ehefrau, dass er sie umbringt. Anlass ist deren gemeinsames Musizieren mit dem Geiger, den sie in Beethovens Sonate für Violine und Klavier, ADur, Opus 47, begleitet. Das Stück ist dem Geiger Rodolphe Kreutzer gewidmet, der es nie spielte, und dank Tolstoi ist es seit der Erstveröffentlichung seiner Novelle 1890 untrennbar mit einem tödlichen Ehedrama verbunden. Mehr noch: Leoš Janácˇek hat 1923 ein ganzes Streichquartett zu diesem Ehedrama komponiert, einschließlich eines Zitats aus Beethovens Kreutzersonate, ohne aber TolstoiSzenen in Tönen auszubuchstabieren. Beim Anhören dieser melodisch zerfetzten, formsprengenden und unglaublich lebendigen Sätze stört es fast, an ihr »Programm« zu denken – es ist das geniale SturmundDrangWerk eines Siebzigjährigen. Zur Eifersucht hatte Janácˇek schon 1895 ein Orchesterstück
Die hohen Hacken kämpften mit dem langen Kleid so, dass, je nach dem Weg und nach dem Wehen des Winds, das Schimmern heller Waden kurz zu sehen war! Und wir liebten diesen Hauch Verfänglichkeit.
geschrieben, »Žárlivost«, Vorspiel zur Oper »Jenu ˚ fa«, und er war um die Jahrhundertwende nicht der einzige Komponist, den dieses Thema fesselte. Maurice Maeterlincks Drama »Pelléas et Mélisande«, in dem ein verzweifelter Ehemann den jungen Rivalen ermordet, beschäftigte Claude Debussy seit 1893. Im Monat der Uraufführung seiner bahnbrechenden Oper, April 1902, begann Arnold Schönberg mit seiner sinfonischen Dichtung »Pelleas und Melisande«, noch in nachromantischer Musiksprache. Sechs Jahre später geriet er selbst in ein Ehedrama, das mit dem Tod des »Rivalen« endete.
Der Eifersuchtskomponist schlechthin ist einer, der sich diesem Thema gar nicht explizit genähert hat – wenn auch dem Liebesschmerz, wie alle Madrigalisten des 16. Jahrhunderts. An dessen Ende treibt Carlo Gesualdo die polyphone Harmonik seiner Vokalmusik in Bereiche, in denen ein Tristanakkord gar nicht auffiele. Zugleich lebt er mit der grauenhaften Schuld, einen Doppelmord beauftragt und mitbegangen zu haben – an seiner Frau und ihrem Liebhaber. Ein Blutbad sondergleichen, von dem diese Gestalt nicht zu trennen ist. Juristisch wurde er, ein Fürst und mit der vatikanischen Elite eng verbunden, nicht verfolgt; man sah den Mord als Ehrensache. Ihn selbst aber verfolgte es. Und uns nötigt es zum Leben mit dem Widerspruch, der auch nicht verschwände, würde man eines der bedeutendsten Œuvres der Musikgeschichte einfach canceln: Ein großer Künstler kann ein grauenvoller Mensch sein – und umgekehrt.
Richtig lustig ist Eifersucht wohl nur einmal in der Musikgeschichte gewesen, im Kino. Billy Wilders erbarmungslose Komödie »Kiss me, Stupid« von 1964 spielt in einem amerikanischen Provinzkaff mit dem schönen Namen Climax. Kaum hat der biedere Klavierlehrer mit seiner jungen Gattin geschäkert, da packt ihn jäh die Eifersucht. Denn während sein Schüler in der guten Stube »Für Elise« weiterstümpert, sieht der Lehrer vorm Fenster den muskulösen Milchmann und verliert hörbar den Boden unter den Füßen. Was mag auf dem Zettel stehen, den seine Frau diesem Typen gibt? Orchesterbässe rumpeln unter der braven KlavierElise in den Abgrund, ein Cembalo fletscht die Zähne, Bässe, Schnitt – eine PsychoCollage des damals 35jährigen Filmkomponisten André Previn, der danach als Dirigent berühmt wurde.


Vom Ende einer Liebe erzählen viele Werke, als berühmtestes Arnold Schönbergs Streichquartett Opus 10 von 1908, in dem auch die Tonalität an ihr Ende kommt und eine Sopranistin Stefan Georges Worte singt: »… und Du lichter / Geliebter schatten – rufer meiner qualen – // Bist nun erloschen ganz in tiefern gluten …« Und da ist György Kurtág, der 1981 gleichsam das moderne Pendant zur »Dichterliebe« schreibt – aus der Perspektive und mit den Worten einer Frau, der russischen Dichterin Rimma Dalos und ihren »Botschaften der entschlafenen R. V. Trussova«, 21 Gedichte von rasendem Begehren bis zur Ernüchterung: »Ich stehe nackt vor dir – beiß mich irgendwo!« Die Stimme der Sopranistin springt durch eine verrückte Zirkusnummer. Die Nacktheit ist geschützt durch Übermut: quietschende Klarinette, triviale Repetitionen eines kleinen Ensembles, knappe Aktionen, rhythmisch verkantet. Alles in gedrängter Kürze, unter Druck. Am Ende ist die Liebende so tief verwundet, wie sie einmal glücklich war. »Für alles, was wir irgendwann zusammen taten, bezahle ich.«
Und dann ist da noch einmal Frédéric Chopin. Nein, immer noch keine Botschaft, kein Programm! Nur das letzte Werk, das er in Nohant begann, dem Landsitz von George Sand, im Sommer 1846, knapp zehn Jahre nach jenem Oktoberabend, an dem er ihr Zettelchen in seiner Tasche fand: »On vous adore. George.« In diesem letzten gemeinsamen Sommer hat sie ihm und Eugène Delacroix aus ihrem entstehenden Roman »Lucrezia Floriani« vorgelesen, in dessen männlichem Protagonisten sich Chopin als intolerant, hochmütig und eifersüchtig portraitiert findet. Am 17. Februar 1847 lauscht Sand, dem Gefährten längst entfremdet, mit Freunden in Chopins Pariser Wohnung seinem inzwischen vollendeten Werk, einer Sonate für Violoncello und Klavier. Es ist ein Dialog, ein Gespräch, wie Chopin es noch nie komponierte. Ohne sich als virtuoser Pianist zu verleugnen, lässt er sich ganz auf das andere Singen des Cellos ein, lässt sich in Doppelgriffen begleiten, begleitet selbst, eine beschwingte Unberechenbarkeit ist dabei, auch eine weite Melancholie. Es ist ein großes Gespräch, eine Wanderung durch Welt und Jahre, die nicht in der Wüste der Entfremdung endet. Es ist, wie es auch hätte werden können. Mit Schmerz und Trauer und Einsamkeit, das ja, aber immer einander zugewandt – in Liebe.


 Claire Pommet alias Pomme
SCHULZ
Claire Pommet alias Pomme
SCHULZ
Kaum geschminkt steht sie am Bühnenrand im Scheinwerferlicht, den hübschen Bob nachlässig gekämmt, als wäre die Frisur vor einem Millionenpublikum nicht etwas, dem eine Frau allzu viel Aufmerksamkeit schenken sollte. Zum warmen Klang eines Streichorchesters ist die junge Französin soeben eine Showtreppe hinabgestiegen, hat sich seelenruhig ihre bereitstehende Gitarre umgehängt und dann allein zu singen und zu spielen begonnen, frei von jeder sichtbaren Aufregung. Auf einer großen Tafel über der Bühne leuchten die Worte »Pomme Göttingen«. Letzteres ist nicht etwa der Ort der Fernsehaufzeichnung, bei der die Sängerin mit dem fruchtigen Künstlernamen – Pomme heißt Apfel –ihren Auftritt hat; die Show läuft im Théâtre du Châtelet in Paris. »Göttingen« heißt das Lied der legendären Chansonnière Barbara, das Pomme an jenem Abend im März 2021 singt.
Der Mitschnitt davon ist auf YouTube zu sehen. Er steht mittlerweile bei zweieinhalb Millionen Klicks, zigtausend Likes und über 1.000 Kommentaren. Menschen aus aller Welt schreiben von Gänsehaut und Tränen, die ihnen Pommes schöne und ernsthafte, trotzdem irgendwie unbeschwerte Darbietung des Dreiminutenlieds bereitet. Viele der YouTubeKommentatoren haben es nie zuvor gehört. »Göttingen« ist selbst in Frankreich, Grande Nation auch des Chansons, inzwischen kein Allgemeingut mehr, schon gar nicht für die Generation Pomme. Seine Schöpferin Barbara (1930–1997) ist zwar die Ikone der aus gutem Grund für spezifisch französisch gehaltenen Liedermacherkunst, vor allem der von Frauen geschaffenen; aber sind Künstler erst einmal in die höheren Sphären mythischen Ruhms aufgestiegen, lösen sich Werk und Name mehr und mehr voneinander. Jeder weiß dann von der Bedeutung der Person, doch ihr Werk kennt man kaum noch.
Viele sehen in Pomme, 1996 als Claire Pommet in der Nähe von Lyon geboren und aufgewachsen, wenn nicht eine Wiedergängerin, so doch die erste würdige Nachfolgerin der unvergessenen Barbara. Sie ist jedenfalls die bekannteste junge Stimme des französischen Chansons,
dem das Internationale Musikfest Hamburg im Mai einen Themenschwerpunkt widmet – außer Pomme gastieren auch Albin de la Simone und Keren Ann im Kleinen Saal der Elbphilharmonie.
HOMMAGE IN SCHWARZ
Der feine schwarze Rollkragenpullover, den Pomme bei der »Symphonissime«Fernsehshow im Châtelet trug, war gewiss als ExistenzialistenReverenz an Barbara zu verstehen, die stets in Schwarz und mit Schwarz ummalten Augen vor ihr Publikum trat. Für Barbara, deren Kindheit und Jugend als Jüdin im besetzten Frankreich von latenter Lebensgefahr und Ausgrenzung geprägt war, kam der Ruhm, der ihr das Leben etwas erleichterte, vergleichsweise spät. Pomme singt und denkt sich Lieder aus, seit sie ein Kind ist, und sie wusste immer, wo sie hinwollte: auf die Bühne, mit eigenen Liedern. Früh hat sie sich zu ihrer sexuellen Orientierung (Frauen) bekannt und ihre Karriereanfänge mit 16 Jahren im von Männern geprägten Business als sexuell traumatisierend beschrieben. Das enge Umfeld der Chansonlegende Barbara ist sich einig, dass Barbara als Heranwachsende von ihrem Vater wiederholt sexuell missbraucht wurde. Manche Texte der Sängerpoetin, zwischen den Zeilen gelesen, stützen diese Annahme. Sie selbst hat darüber ihr Leben lang geschwiegen. Pomme hat sich über ihre leidvollen Erfahrungen in der Öffentlichkeit mit der gebotenen nachträglichen Wut geäußert. Sie ist ein Kind unserer Zeit, wie Barbara eines der ihren war.
Wie aber kommt eine Spätgeborene und früh Berufene wie Pomme, die sich sonst Texte und Musik selbst schreibt, mit Mitte zwanzig darauf, ausgerechnet »Göttingen« zu singen, jenes Lied, das Barbara an einem Julinachmittag des Jahres 1964 im Innenhof des Jungen Theaters Göttingen schrieb, am Ende einer triumphalen, dabei von ihr zunächst nur widerstrebend angenommenen Konzertreise ins Nachbarland rechts des Rheins, ins Land der Täter? »Göttingen« ist eine feine poetische Skizze und doch unmissverständlich; ein humanistischer, vorsichtig versöhnlicher Kommentar
In Frankreich ist das Chanson quicklebendige Tradition und nationales Kulturgut, für uns rechts des Rheins auch Projektionsfläche und Identifikationsgenuss.
VON TOM R.
zum schwierigen deutschfranzösischen Verhältnis, das sich, politisch verordnet, damals zur Freundschaft zwischen den beiden so lang verfeindeten Nationen zu wandeln hatte. Ein Jahr zuvor hatten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im ÉlyséePalast einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.
»Göttingen« wurde für die Deutschen zu einem bedeutsamen Lied – auch deshalb, weil das französische Chanson ansonsten sehr gut auf Deutschland verzichten kann. Umgekehrt war das ganz anders. Französische Chansons dienten ab den späten Fünfzigerjahren als ideale Projektionsfläche für jene Deutschen, denen die Scham über die Okkupation Frankreichs und die zahllosen dort verübten Verbrechen während der Hitlerjahre in den Knochen saß. Insgeheim sehnte sich der deutsche Michel ja schon mindestens seit Heinrich Heines Zeiten nach der Libertinage linksseits des Rheins, bewunderte den rebellischen Geist der Nachfahren der Gallier, ihr Misstrauen gegen den Staat. Frankreich blieb bis weit hinein in die Siebziger das Sehnsuchtsland, die Wunschheimat unzähliger Deutscher, von denen indes nur wenige die Tücken und Hürden der anderen Sprache so weit meisterten, dass man sie im Ausland nicht sofort als boches identifizierte –und spürbar Abstand von ihnen nahm.
Gern unterwarf sich der frankophile Nachkriegsdeutsche der Herablassung und der Neigung zur grenzenlosen Nabelschau der Franzosen, in deren Land sich aufhalten zu dürfen, als kaum steigerbares Vergnügen galt. Wer hätte nicht leben wollen wie Gott in Frankreich? Das Savoir vivre der Nachbarn wurde zur Kopiervorlage: Wein, Baguette, Boursin direkt aus der Packung für die Schüler und Studentengeneration, die im Renault R4 mit Lenkradschaltung bei aufgeschobenem Seitenfenster mit herausgestrecktem Ellenbogen lässig durch Heidel
berg, Berlin oder Köln schaukelte, Gauloises ohne Filter rauchend und zu Hause mit roten Ohren »Je t’aime … moi non plus« von Serge Gainsbourg und Jane Birkin hörend. Bei den Betuchteren unter den gallomanen Deutschen sorgten Foie gras, Chablis, Petits fours und die von Roland Barthes zum Mythos des Alltags verklärte Citroën DS, die maximal weich dahinrollende Göttin auf vier Rädern, für Identifikationsgenüsse.

Unter allen Desideraten aber war das größte und verlockendste der Eros, befeuert von Henry Millers »Stille Tage in Clichy«, von Brigitte Bardots Mund, von der amourösen Hitze JeanPaul Belmondos und Jean Sebergs in Godards »Außer Atem«. Und natürlich lehrten Lieder von Chansonniers wie Léo Ferré, Georges Brassens oder Jacques Brel, von Édith Piaf, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Dalida und Charles Aznavour, von Georges Moustaki, Jacques Dutronc und Françoise Hardy die germanischen Puritaner: Die Franzosen sind uns in der Kunst des Lebens weit voraus. Wenn sie’s vermasseln, tun sie es mit Anmut, und sie verstehen einfach mehr von der Liebe.
VIVE LA RENAISSANCE!
Dass eine auf Französisch singende junge Künstlerin wie Pomme heutzutage zu Hause wieder auf so große Begeisterung und Zustimmung stößt und auch in Deutschland auffallend viel Gehör findet, freut den nicht mehr ganz so jungen auf Französisch singenden Künstler Albin de la Simone ganz außerordentlich. Und das nicht nur deswegen, weil er ihr zweites Album (»Les failles«, 2020) produziert hat. Der Mann mit dem sonderbaren Nachnamen – die Simone ist ein Rinnsal in der Picardie im französischen Nordosten, wo seine Familie herkommt –beobachtet gerade eine Renaissance des Chansons, jener Gattung des Liedschaffens, die in Frankreich, wenn überhaupt, nur dadurch definiert ist, dass in französischer Sprache gesungen wird.
»Inzwischen sind sich viele junge Leute nicht mehr zu schade, wieder auf Französisch zu singen, im Gegenteil, sie finden da ihre Identität.«Albin de la Simone
Anfang des Jahrtausends sei das zuletzt in Mode gewesen, sagt de la Simone, aber mit eher mittelmäßigen, wenig poetischen Texten über allzu Alltägliches. »Davon hatten die Leute bald genug«, erzählt er. »Dann gab es sehr viel Folk von Leuten, die sich weiße Gewänder anzogen und zur AkustikGitarre auf Englisch sangen. Inzwischen sind sich viele junge Leute nicht mehr zu schade, wieder auf Französisch zu singen, im Gegenteil, sie finden da ihre Identität. Es ist seltsam: Es gibt die Alten und die Jungen, viele bis 30, viele ab 45. Dazwischen aber eigentlich nichts.«
Viele Chansonniers aus Frankreich sind, wie einst die Cantautori in Italien oder die Liedermacher in Deutschland, Texter und Komponisten in Personalunion. Das gilt auch für Albin de la Simone. Er hat Jazz studiert, als Keyboarder mit Größen wie Angélique Kidjo und Salif Keïta Konzerte gegeben und war als Studiomusiker in Paris lange Jahre gut im Geschäft. Musik geht ihm vergleichsweise leicht von der Hand. Er liebt schlichte, dafür oft raffiniert zusammengesetzte Akkorde und schreibt Melodien, die sich unmerklich und dann sehr hartnäckig im Gedächtnis einnisten. Aber das Finden der richtigen Worte ist für ihn jedes Mal eine Qual. Manche Texte brauchen Jahre, ehe sie seinen Maßstäben genügen. »Ich schreibe Notizbuch um Notizbuch voll, aber das allermeiste ist einfach nur Mist«, sagt er. «Oft fühle ich mich als der totale Versager.«
Am Ende der Schinderei aber hat Albin de la Simone das Lebensgefühl und die Lebensrealität seiner
Generation einmal mehr in knappe, minutiös gearbeitete Zeilen verdichtet, die oft beiläufig klingen und einen doch ins Herz treffen. Vor allem die Chansons seiner beiden letzten Alben, »L’un de nous« (2013) und »Un homme« (2017), gewinnen bei jedem Hören, mal durch ihre sanfte Ironie, mal durch die Perspektive, die er einnimmt, mal durch überraschende Wendungen. Albin de la Simone verbindet auf fast mirakulöse Weise Worte und Klänge zu einer neuen, schwerelosen, unauflöslichen Substanz, die die Seele nährt und dem Geist genügend Futter gibt. Und tanzen kann man zu seinen Chansons auch.
NOBLE MONOCHROMIE, KLUGE MELANCHOLIE
»Ich schreibe, also singe ich«, sagt de la Simone, und variiert dabei offenbar ganz aus Versehen René Descartes’ berühmte Maxime »Ich denke, also bin ich«. Eigentlich nur deshalb singen, weil man Texte schreibt: Diese Haltung lässt sich auch bei Keren Ann vermuten, der vorzüglichen Musikerin mit vielen Mutter und Vaterländern – Israel, die Niederlande, Frankreich, England. Ihr Gesang ist warm timbriert, aber er geht zum Hörer wie auf leise Distanz. Ihre Stimme klingt auf noble Weise monochrom, und immer scheint sie mehr zu wissen, als sie preisgibt.
Weil sich in den zwanzig Jahren ihrer Berufstätigkeit viel exquisites Material angesammelt hat, feiert Keren Ann, eine Meisterin der klugen Melancholie, ihr Bühnenjubiläum mit sehr ausgefeilten Arrangements ihrer besten Chansons für Streichquartett. Doch steht sie nicht allein als Sängerin da vorn am Bühnenrand und überlässt das Musizieren den vier Herren vom Quatuor Debussy. Sie hat neben sich ein paar Gitarren stehen, akustische und elektrische. Unter den drei Gästen beim Internationalen Musikfest aus Frankreich hat Keren Ann die viel bewunderte endemische Kunst des Chansons am weitesten in die Welt hinausgetragen. Wohl deshalb, weil sie nicht nur auf Französisch, sondern die Hälfte ihrer Lieder auf Englisch singt. Die Chansonnière als Singer/Songwriterin: Das ist für deutsche Ohren inzwischen das ungleich vertrautere Terrain.
M MEHR RUND UM DAS INTERNATIONALE MUSIKFEST
FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
ALBIN DE LA SIMONE
Sa, 29.4.2023 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal albin de la simone (Gesang, Gitarre, Bass, Klavier), Marie Lalonde (Gitarre, Bass), Marielle Chatain (Posaune, Klavier, synthesizer), Franck M’Bouéké (schlagzeug)
KEREN ANN

So, 14.5.2023 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Keren ann (Gesang, Gitarre)
Quatuor Debussy
POMME
Mi, 7.6.2023 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Pomme (Gesang, autoharp) »Consolation«
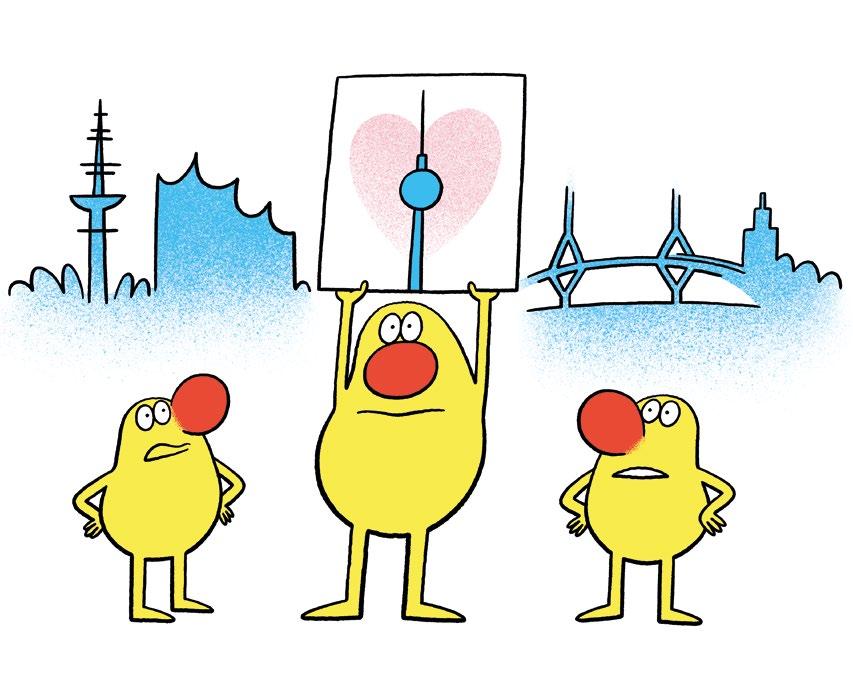
Unser Kolumnist liebt seine Heimat –aber nicht so sehr, wie seine Kinder ihre.
VON TILL RAETHER
ILLUSTRATION NADINE REDLICH
Es gibt sehr merkwürdige Menschen in Hamburg, sie heißen Berliner. Sie ziehen »nur wegen der Arbeit« nach Hamburg und kleben sich als erstes einen zwar dezenten, aber unübersehbaren Aufkleber von Hertha BSC oder Union Berlin ans Auto. Sie lesen am Frühstückstisch in Altona die Lokalnachrichten aus TreptowFriedrichshain und reden über den Ausbau der A 100, bevor sie sich auf der Elbchaussee in den Stau stellen. Sie schaffen es, in jede Unterhaltung einfließen zu lassen, dass sie aus Berlin kommen. Dies ist nicht immer einfach, aber sie sind darin sehr geschickt (gewissenlos). Sag ihnen, du gehst Dienstag und Freitag auf den Isemarkt, und sie werden dir antworten: »Also, auf dem Winterfeldplatz ist ja immer Mittwoch und Sonnabend Markttag.«
Diese Menschen haben ihre BerlinLiebe, die sie sich in Berlin niemals hätten anmerken lassen, in Hamburg zum Hauptbestandteil ihrer Persönlichkeit gemacht. Sie halten es nicht aus, in der einen Stadt zufrieden zu sein, ohne ständig darauf hinzuweisen, dass sie aus der anderen kommen. Das einzige, was den Umgang mit diesen Menschen erträglich macht, ist die Aussicht, dass sie »in zwei bis drei Jahren wieder zurück nach Berlin« gehen. Zumindest flechten sie dieses leere Versprechen in jedes Gespräch ein.
Ich habe jedes Recht und alle Kenntnisse, um mich über diese Menschen lustig zu machen, denn ich war einer von ihnen. Bis ich feststellen musste, dass BerlinLiebe nicht vererblich ist, und dass sie sich auch nicht erzeugen lässt, indem man seine Kinder mit PlattenhardtTrikots, PeterFoxAlben und LoriotAbenden ausstattet. Meine Kinder lieben Hamburg. Ja, sie lieben – und hier wird es kompliziert – sie lieben Hamburg mehr, als ich Berlin je geliebt habe. Es ist für sie selbstverständlich, weil sie es aus ihrer Geburtsstadt an Alster und Elbe nicht anders kennen: An Hamburg erfreut man sich unvoreingenommen; die Liebe der Menschen zu ihrer Stadt ist hier
unkompliziert wie ein MatjesBrötchen. In Berlin merkt man immer erst, was man an der Stadt geliebt hat, wenn man weg ist von den stundenlangen Wegen, dem monatelangen Warten auf Behördentermine, der jahrzehntelang verschandelten Innenstadt und den tollwütigen Füchsen auf den Parkplätzen der Gewerbegebiete. Berlin wird liebenswerter, je länger man weg ist.
Es hat zwanzig Jahre gedauert, bis mir klar wurde: Meine durch Wegzug aus der Hauptstadt entstandene BerlinLiebe wird von meinen Kindern nicht geteilt. Sie sitzen mit mir am Ottenser Abendbrottisch und geben völlig ungeniert zum Besten, wie sehr sie Hamburg »feiern«, und dass Altona »bestes life« ist (dieses Gespräch fand etwa 2017 statt). Streng weise ich sie darauf hin, dass ihre Großeltern noch in Berlin leben, und dass ihre Mutter und ihr Vater dort aufgewachsen sind, und dass es ihnen (mir gehen die Argumente aus) dort doch immer so gut gefällt, wenn wir zu Besuch sind.
Sie zucken die Achseln und sagen: »Aber Hamburg ist schöner.« Dann schwärmen sie weiter. Es tut ein bisschen weh.
Meine Kinder können lieben, wen und was sie wollen. Und ich weiß ja, womöglich haben sie recht. Ich ertappe mich selbst immer häufiger dabei, wie ich sage, ich hätte zwar Heimweh nach Berlin, aber zumindest die »Lebensqualität« sei in Hamburg zugegebenermaßen besser. Ist Lebensqualität nicht eigentlich nur ein ängstliches Wort für »alles«?
Ich glaube, was mich an der HamburgLiebe meiner Kinder wirklich schmerzt, ist der Abschied von meinem Persönlichkeitskern. Du kannst nicht für immer Berliner in Hamburg bleiben. Spätestens, wenn du selber Hamburger in die Welt gesetzt hast, wird es Zeit, sich eine andere Persönlichkeit zuzulegen. Ich glaube, ich schaffe mir ein Longboard an.
Beim Community-Projekt »Love est. 2023« erarbeiteten unterschiedlichste Menschen aus Hamburg ein szenisches Konzert zur größten Sache der Welt.

VON DOMINIK BACH
FOTOS ISABELA PACINI
Einmal auf der Bühne im Großen Saal der Elbphilharmonie stehen – dieser Traum geht für einige Hamburgerinnen und Hamburger beim bevorstehenden Internationalen Musikfest in Erfüllung. Passend zum Festivalmotto »Liebe« startete die Elbphilharmonie bereits vor Monaten ein mehrteiliges CommunityProjekt, dessen Ergebnisse im Mai zusammen mit dem Ensemble Resonanz präsentiert werden. Unter dem Titel »Love est. 2023. Wie wir lieben« gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit September den Mysterien der Liebe auf den Grund und suchten unter professioneller Anleitung in unterschiedlichen Workshops und mit verschiedenen Kunstformen Antworten auf eine Frage, die die Menschheit von jeher beschäftigt: »Was ist Liebe?«

schen Radiosender »UVoice Radio«. Beim Thema Liebe denkt er in letzter Zeit häufig an seine Familie, an seine Mutter und seine zwölfjährige Schwester, die in ihrer Heimat, auf okkupiertem Gebiet im Osten der Ukraine geblieben sind. Den Kontakt zu halten, ist schwierig. Doch die Liebe zur Familie hat Pavlo dazu verleitet, sich für das CommunityProjekt der Elbphilharmonie anzumelden. Denn für den ausgebildeten Schauspieler ist Kunst ein Lebenselixier und der beste Weg, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. »Ich glaube, Kunst ist immer auch eine Art seelische Therapie«, erzählt er auf Englisch, »denn man muss sehr vieles hinterfragen: Wer bin ich? Wie fühle ich mich? Was will ich ausdrücken? Wie schaffe ich es, dass andere mich verstehen?«
ohne auch nur ein einziges Wort gesprochen zu haben – einen Dialog, nur über den Körper! Ich wusste gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin. Es war verrückt.«
KUNST ALS SPIEGEL DER SEELE
Einer der 118 WorkshopTeilnehmer ist Pavlo Kruzhnov. Der 31Jährige ist im März 2022 aus Kiew nach Deutschland geflohen. Seitdem versucht er, in Hamburg Fuß zu fassen, besucht Sprachkurse und arbeitet als Sprecher für den ukrainischdeut
Pavlo hat sich für den Workshop »Body & Soul« entschieden, bei dem der Körper als Ausdrucksmittel der Seele im Zentrum steht. Körpersprache ist universell verständlich, kennt keine Sprachbarrieren – für Pavlo ein entscheidender Punkt, denn trotz seiner Fortschritte im Deutschkurs, stellt ihn die Sprache im Alltag immer wieder vor Herausforderungen. »Doch als der Workshop vorgestellt wurde, fragte mich die Dozentin: ›Hast du einen Körper? Hast du eine Seele? –Dann bist du hier genau richtig.‹« Sie sollte Recht behalten, ein Großteil der Kommunikation verlief nonverbal. Pavlo erinnert sich an ein Schlüsselerlebnis: »Bei einer Übung sollten wir eigentlich nur die Bewegungen der anderen imitieren. Doch meine Übungspartnerin und ich fingen an, zu improvisieren, und probierten verschiedene Gesten aus, tasteten uns an unsere Grenzen heran, berührten uns. Irgendwann nahm ich sie auf den Rücken und trug sie durch den Raum. Als die Musik im Hintergrund verstummte, wurden wir beide von unseren Emotionen übermannt und brachen gleichzeitig in Tränen aus, weil wir realisierten, dass wir soeben einen tiefgründigen Dialog geführt hatten,

Sanjana Rastogi ist ebenfalls ein Teil von »Body & Soul«. Die 30Jährige ist im indischen Lakhnau geboren und im westafrikanischen Ghana aufgewachsen, ihre Familie ist über mehrere Kontinente verstreut. Für Sanjana ist die familiäre Fernbeziehung aber längst alltäglich geworden. Sie wohnt seit acht Jahren in Hamburg und arbeitet in einem Unternehmen für soziales Wohnen. Als das CommunityProjekt in einer der Wohneinheiten vorgestellt wurde, kribbelte es der HobbyTänzerin sofort in den Füßen: »Ich bin keine berühmte Sängerin und keine berühmte Tänzerin. Trotzdem öffnete sich hier plötzlich die Möglichkeit, auf einer Bühne zu stehen – in der Elbphilharmonie! Hier gehört die Bühne nicht nur den großen Stars, sondern auch normalen Menschen wie dir und mir.« ›
Der Workshop habe ihr sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil sie in einem geschützten Raum ihre Stärken und Schwächen austesten und besser kennenlernen konnte. Dadurch habe sich nicht nur ihr Verhältnis zu sich selbst, sondern auch das zu ihren Mitmenschen verändert: »Das Projekt hat mir gezeigt, dass ich meine Grenzen überschreiten und jede Menge erreichen kann, und dass alle Menschen auf ihre Art und Weise Stars sind.« Sie selbst würde diese Erkenntnis so formulieren: »Nur wer mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst liebt, ist in der Lage, andere Menschen zu lieben.«
des Betriebs überrascht. »Ich habe Menschen kennengelernt, die ich zuvor noch nie gesehen habe, obwohl wir alle in der Elbphilharmonie arbeiten«, gesteht sie. Allein dafür habe sich der Workshop gelohnt. Denn durch das gemeinsame Musizieren sei der Umgang mit den Kollegen tatsächlich herzlicher und liebevoller geworden. Und auch persönlich freut sie sich: »Ich habe in diesem Haus schon so viel erleben dürfen, so viele Ecken gesehen, so viele Leute kennengelernt – lauter positive Erinnerungen. Aber auf der Bühne stand ich noch nie. Dass ich das bald im Großen Saal tun kann, ist eine große Sache für mich.«
Ulrike van der Ven hat ihr Arbeitsleben schon hinter sich und genießt seit einiger Zeit ihren Ruhestand. Wobei von Ruhe eigentlich keine Rede sein kann. Nachdem sie über 35 Jahre als Zahnmedizinerin in Hamburg gearbeitet hat, findet die 65Jährige nun endlich wieder Zeit, sich ihren Hobbys zu widmen. Früher hat sie Querflöte gespielt, bei »Love est. 2023« wollte sie aber etwas Neues ausprobieren und hat sich für den »Lyrics«Workshop entschieden, wo sie zusammen mit anderen Musikbegeisterten eigene Songs komponierte. Vor allem den intergenerationalen Austausch empfand sie als großen Gewinn. »Es hat mich sehr berührt, dass die Jüngeren noch ganz andere Fragen an die Liebe haben.

Auch Sarah Schneider liebt es zu tanzen. Deshalb hat sie ihr Hobby nach der Schule zum Beruf gemacht und Tanzpädagogik studiert. Heute arbeitet die 29Jährige freiberuflich als Tanzlehrerin für Kinder und Jugendliche. Da sie seit 2017 aber auch in Teilzeit im Backstagebereich der Elbphilharmonie tätig ist, konnte sie an dem Workshop teilnehmen, der sich eigens an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses richtete, um den Teamgeist zu stärken. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung ist Sarah immer wieder von der Größe
Zum Beispiel: ›Wie kann man so etwas Komplexes lernen?‹« Dann fügt sie schmunzelnd hinzu: »Wir Älteren waren da schon etwas abgeklärter.«
Ein Patentrezept für die Liebe kann van der Ven aber trotz ihrer großen Lebenserfahrung nicht geben – möchte sie auch nicht. »Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass in den berühmten Liebesliedern und filmen stets die klassische, romantische Liebe glorifiziert wird. Die Menschen mögen das ja, es muss also ein gewissen Verlangen, eine gewisse Sehnsucht danach geben. Wenn man die Liebe aber
selbst beschreiben soll, sieht es oft ganz anders aus.« Insofern müsse jeder Mensch zu seinem individuellen Verständnis von Liebe gelangen. Ein paar Zutaten, die ihr besonders erfolgversprechend erscheinen, verrät sie dann aber doch: »Mit Neugierde und Fantasie, Beharrlichkeit und Disziplin kann man schon einiges erreichen.«
Würde man Sheida Mohammadi fragen, was sie dieser Auflistung noch hinzufügen wollte, sie würde »Mut« sagen. Denn das Projekt hat der 23Jährigen einiges an Überwindung abverlangt. Im »Expression«Workshop hat sie eine Choreografie erarbeitet, die das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft reflektiert. Vor allem der enge Körperkontakt war für sie zu Beginn recht befremdlich – und das, obwohl sie als Kind viel körperliche Zuneigung erfahren hat. Sheida ist im Iran, in der Nähe von Teheran, aufgewachsen und studiert nun seit drei Jahren Kulturwissenschaften in Lüneburg.
Neben dem Studium kellnert sie in einem Hamburger Restaurant, und eben dort, so sagt sie, habe sie die größte Veränderung an sich bemerkt: »Ich bin eigentlich eher introvertiert.



Aber das Projekt hat mir geholfen, aufgeschlossener gegenüber fremden Menschen zu sein. Bei der Arbeit habe ich früher immer einfach kassiert und wollte dann so schnell wie möglich wieder vom Tisch weg. Heute betreibe ich Small Talk und mache sogar Witze!« Durch den
Workshop hat sie zu sich selbst gefunden und geht nun selbstbewusst und offenherzig auf Menschen zu –für Sheida ist auch das eine Facette der Liebe.
Auch Jamil Alhamo hat am »Expression«Workshop teilgenommen. 2017 ist er mit seiner Familie von Syrien nach Hamburg gezogen, lernte Deutsch und nahm Unterricht in Schauspiel, Tanz und Gesang. In diesem Jahr macht er sein Abitur an der Stadtteilschule Hamburg Mitte, und auch künstlerisch hat er sich stark weiterentwickelt. Dass er all das aus eigener Kraft geschafft hat, darauf ist er sehr stolz. »Ich wollte eigentlich immer alles allein schaffen. Das machte mich unantastbar, ich wollte bloß niemanden an mich heranlassen«, erzählt er rückblickend. Beim »Expression«Workshop war jedoch Teamgeist gefragt, und tatsächlich gelang es Jamil, sich fallen zu lassen und den anderen zu vertrauen.

»Zu wissen, dass ich hier nicht alles allein tragen muss, war ein ungewohntes Gefühl – gleichzeitig aber auch sehr befreiend.«
Von diesem Gefühl möchte er sich auch in Zukunft etwas beibehalten, selbst wenn er genau weiß, dass er sich dafür etwas Zeit geben muss. Für diese Erfahrung ist er sehr dankbar und freut sich: »Dass eine Institution wie die Elbphilharmonie neben Musik auf allerhöchstem Niveau auch einen Platz für niederschwellige Angebote hat, bei dem alle mitmachen können, das ist schon klasse.«
LOVE EST. 2023. WIE
So, 14.5.2023 | 16 Uhr und 19 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal ensemble Resonanz Tobias schwencke (Komposition) andreas heise (Choreografie) Michael Müller, Marie Petzold (Regie) abschlusskonzert des CommunityProjekts mit rund 80 hamburgern und hamburgerinnen


Tamara Stefanovich liebt Programme mit einem roten Faden durch die Musikgeschichte. Diesmal langt der Stoff für einen ganzen Konzertmarathon.
VON SIMON CHLOSTA

Für Eines hat die Pianistin Tamara Stefanovich überhaupt kein Verständnis: »Wir können uns nicht Künstler nennen, wenn wir nicht auch die Kunst unserer Zeit entdecken.« Oder, noch deutlicher formuliert: »Wer nur Romantik oder nur Klassik spielt, hat seinen Beruf irgendwie verfehlt.« Da trifft Stefanovich schon einen Punkt: Neue und neueste Musik hat im Klassikbetrieb ja tatsächlich noch oft eine Sonderstellung. Entweder widmen sich ihr ausgewiesene Spezialisten, gern auf Festivals wie in Darmstadt und Donaueschingen. Oder sie wird vorzugsweise in der ersten Konzerthälfte gespielt, vor dem Beethoven, weil man fürchtet, das Publikum könne sonst davonrennen.

Stefanovich hingegen integriert die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts so selbstverständlich, so klug und nachvollziehbar und aus einem inneren Bedürfnis heraus in ihre Programme wie wenige andere ihrer Kolleginnen und Kollegen. Dabei war sie in puncto Neue Musik selbst eine Spätzünderin. 1973 in Jugoslawien geboren, lernte sie das Klavierspiel »in einem OstblockBootcamp«, wie sie selbst sagt. Während dieser Zeit ging es vor allem um technische Perfektion, was Fluch und Segen zugleich bedeutete: »Es ist auf jeden Fall wichtig, das Instrument zu beherrschen. Man muss diesen Ferrari fahren können, ohne Gefahr für sich und das Publikum. Aber es gab in dieser Pädagogik damals den Wunsch, dass man ein absolutes Resultat anstreben soll. Damit kommt man in eine sportliche Art der Vorbereitung, in der jedes Detail durchgeplant wird.«
Als Anfang der Neunzigerjahre die Jugoslawienkriege ausbrachen, zog Stefanovich von Belgrad in die USA , um ihr Studium am Curtis Institute of Music in Philadelphia fortzuführen. Drei Jahre später ging es dann weiter nach Deutschland, was sich vor allem zu Beginn als Herausforderung darstellte: »Ich kam mit vollem DAAD Stipendium und vielen Extras, doch dann verhängte Deutschland wegen der Balkankriege Sanktionen gegen Serbien. Und plötzlich wurde mein Leben viel reduzierter, weil ich mit dem Ende Jugoslawiens für jedes Land ein Visum brauchte. Viele Konzerte waren futsch, auch zu Wettbewerben konnte ich nicht fahren. Ich habe von 300 DMark im Monat gelebt, jahrelang im Studentenwohnheim gewohnt, an der Garderobe, in der Bibliothek und als sehr schlechte Kellnerin gejobbt und nur einmal am Tag gegessen.« Als Opfergeschichte möchte sie das allerdings nicht verstanden wissen.
Trotz des schwierigen Starts sollte sich Deutschland bald als Glücksfall herausstellen. Denn mit PierreLaurent Aimard, dessen Schülerin sie an der Kölner Musikhochschule wurde und mit dem sie bis heute eine enge künstle
rische Partnerschaft verbindet, trat nun mit Nachdruck die Neue Musik in ihr Leben. Aimard bot damals einen Kurs über Pierre Boulez’ hochkomplexes Klavierwerk »Structures« an, an dem Stefanovich teilnahm: »Ich kam also in den Kurs, hörte diese Musik und wusste nicht, ob ich sie mochte. Damals habe ich gelernt, wie wichtig es sein kann, nicht immer sofort einen klaren Standpunkt zu vertreten, sondern abzuwarten, sich Offenheit zu bewahren. In der Pause kam Aimard zu mir und wollte wissen, wie es mir gefallen habe. Ich sagte: ›Weiß nicht.‹ Er darauf: ›Wunderbar. Bleiben Sie einfach neugierig.‹ Das war wie eine Initialzündung für mich: Auf zu neuen Ufern!« Dass solchen Werken, die inzwischen ja gar nicht mehr so neu sind, wie es das Etikett »Neue Musik« suggeriert, in der Hochschulausbildung nach wie vor nur wenig Raum geschenkt wird, kritisiert Stefanovich stark: »Es kann nicht sein, dass man an deutschen Musikhochschulen tausende von Studenten ausbildet, die dann das Konzertexamen machen, ohne ein Stück von Stockhausen gelernt zu haben. Oder allenfalls in den Prüfungen ein einziges DreiMinutenStück Neue Musik spielen, und fast immer die gleichen, eine LigetiEtüde oder etwas von Arvo Pärt. Nichts gegen diese Komponisten, im Gegenteil. Aber es ist erstaunlich, dass man so gar nicht in Kontakt mit der eigenen Zeit ist.« Ihr Vorschlag zur Güte: »Es muss nicht jeder Neue Musik spielen, aber man muss sie wenigstens kennen.« ›
Stefanovich, die sich selbst als musikalischen »Vielfraß« bezeichnet, ist bei allem Einsatz für den Klang der Gegenwart eine Allrounderin geblieben. Die hochromantischen Klavierkonzerte von Sergej Rachmaninow hat sie ebenso im Repertoire wie Werke von Johann Sebastian Bach. Und unter Kirill Petrenko gab sie unlängst ihr Debüt beim Israel Philharmonic Orchestra in Tel Aviv –mit Mozart. Meist geht das eine jedoch nicht ohne das andere, das Alte nicht ohne das Neue, weshalb sie besonders Konzeptprogramme mit einem roten Faden durch die Musikgeschichte liebt. »Es ist doch interessant, zu zeigen, dass niemand alleine wie ein Himmelskörper nur um sich selbst kreist.« Soll heißen: Alles hängt mit allem zusammen, gerade auch in der Musik, weshalb ihre Konzerte oft einem Thema folgen. So spielte sie 2019 im Londoner Barbican Centre ein mehrteiliges Programm nur mit Etüden, was ihr viel Beachtung einbrachte. »Konzeptuell, musikalisch und technisch war das gesamte Konzert eine großartige Leistung«, konnte man hinterher zum Beispiel im »Guardian« lesen.
Nun legt Stefanovich nach und präsentiert einen mehrstündigen SonatenMarathon, der sie im Mai auch nach Hamburg führt. Das Besondere: Die klassische Hochphase dieser Gattung – Haydn, Mozart, Beethoven –spart sie dabei aus. Stattdessen wechseln sich Barockkomponisten wie Bach und Scarlatti mit Vertretern der Moderne ab, darunter so solitäre Figuren wie der Amerikaner Charles Ives oder die Russin Galina Ustwolskaja. »Ich will zeigen, wie eine alte Form mit starrer Struktur sich im Barock und im 20. und 21. Jahrhundert bereichert, und wie man sie mit Leben füllen kann«, erklärt Stefanovich ihr Konzept. Anhand von 19 Werken macht sie nachvollziehbar, wie die Gattung Sonate einst ihren Anfang nahm und standardisiert wurde und wie sich ihre Formen dann im 20. Jahrhundert erst individualisierten und

schließlich auflösten. Musikgeschichte live – oder eine Möglichkeit, »unsere Ohren zu reinigen«, wie es Stefanovich selbst ausdrückt: »Ich nutze solche Projekte, um meine archäologische Seite zu erkunden. Und ich nehme das Publikum mit auf eine Reise.«
Auch sie selbst begab sich jüngst noch einmal auf für sie völlig unbekanntes Terrain: die Improvisation, die heutzutage für klassische Musiker beinah keine Rolle mehr spielt – ganz im Gegensatz zu Mozarts und Beethovens Zeiten. Mit einem JazzTrio, bestehend aus dem Vibrafonisten Christopher Dell, dem Schlagzeuger Christian Lillinger und dem Kontrabassisten Jonas Westergaard, brachte Stefanovich unter dem Titel »SDLW « (die Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen) ein gemeinsames Album heraus, auf dem die vier »in Echtzeit komponieren«. Für Stefanovich eine ganz neue Herausforderung, die sie anfangs scheute – »weil ich dachte, nein, Improvisieren kann ich wirklich nicht. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr viel über die Kontrolle und Erforschung von Kompositionen machen und mit Komponisten zusammenarbeiten. Der Prozess auf der Bühne ist also nur das Ergebnis einer sehr langen Arbeit. Die Freiheit oder auch Lockerheit für die Improvisation aber – dachte ich –, die habe ich nicht.« Das Trio lud sie trotzdem ein und überredete sie mitzumachen: »Ich wurde sehr glücklich gekidnappt!«
Besonders gefällt ihr an diesem Projekt, wie offen sich der künstlerische Prozess beim Improvisieren gestaltet – ganz im Gegensatz zu komponierter Musik: »Wir gehen nie mit diesem Optimierungswunsch ins Konzert, dass es gut wird. Es ist ja deine eigene Musik – du spielst, was du präsentieren willst. Deswegen kann auch niemand von außen sagen, wie es war. Und das hat mich wahnsinnig befreit.« Das einhellige Lob seitens der Kritik dürfte sie natürlich trotzdem freuen.
Und was folgt jetzt? Stefanovich weiß es selbst nicht so genau. »Ich spüre, dass ich zum ersten Mal kein Ende in Sicht habe, was Kreativität angeht.« Seit Kurzem lebt sie auch ihre künstlerische Ader aus und teilt unter dem Pseudonym »Aramat Art« Bilder auf Instagram; ein Hobby, das sie im vergangenen Jahr während ihrer CoronaIsolation begann – zunächst mit einem Eyeliner, weil gerade nichts anderes zur Hand war. Auch musikalisch wird sie weiterhin die ganze Palette bedienen: »Ich liebe es einfach, zwischen verschiedenen Arten der Musik hin und her zu fliegen – mal schauen, was da noch kommt.«
PIANOMANIA-MARATHON
Sa, 6.5.2023 | 17 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Tamara stefanovich (Klavier)
sonaten von J. s. und C. P. e Bach, Busoni, D. scarlatti, Ives, Bartók, eisler, soler, hindemith, skrjabin, Roslawez, Janáček und Ustwolskaja
Das Konzert besteht aus drei je rund einstündigen Teilen; dazwischen gibt es zwei längere Pausen.

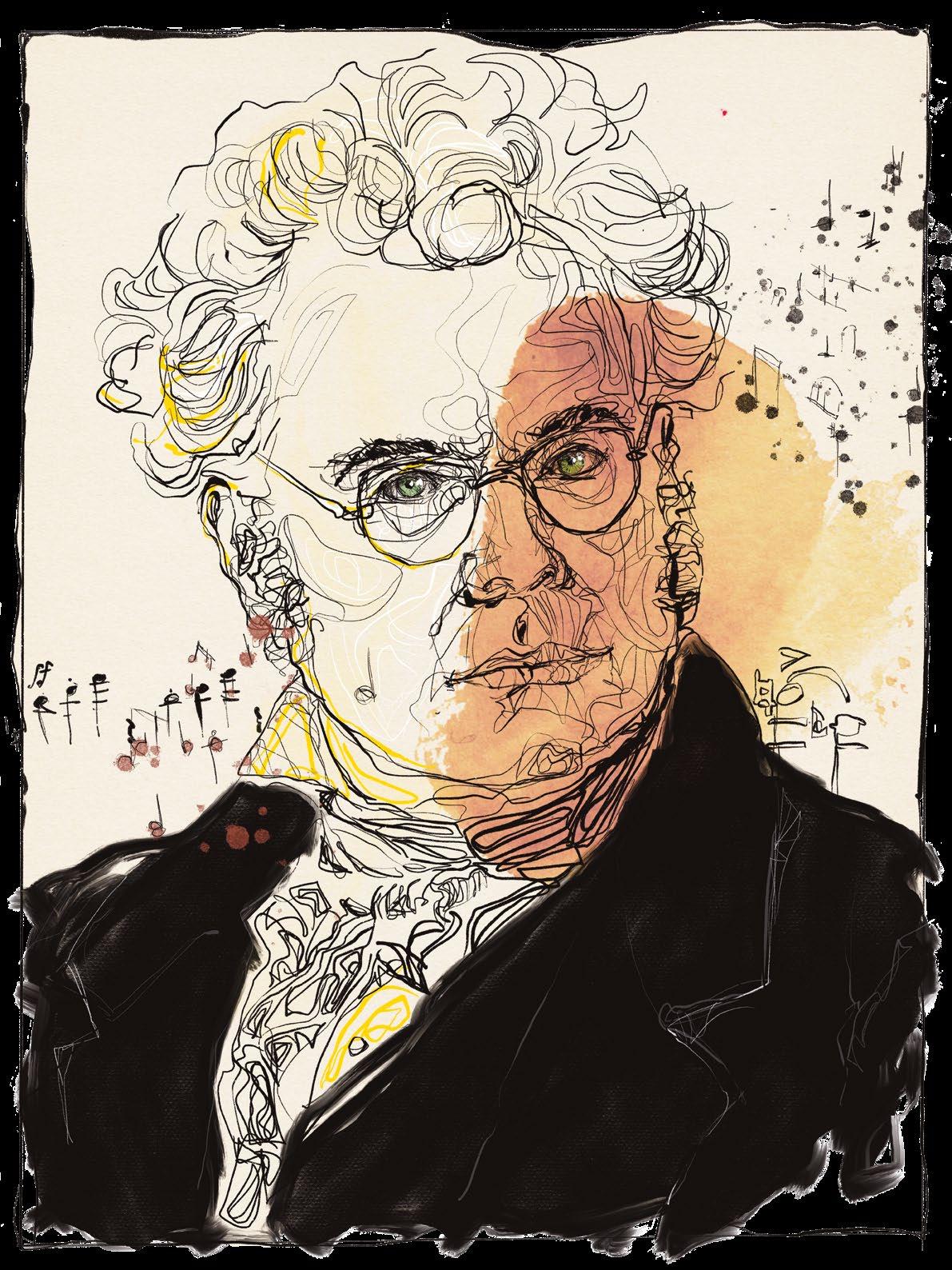
Franz Schubert und die Liebe
Ob Beethoven denn auch mein Lieblingskomponist sei, fragte mich vor kurzem eine Schülerin eines Bonner Gymnasiums, wo ich meinen Roman »Beethovn» vorstellte. Und so sehr ich Beethovens Musik liebe (vor allem sein Spätwerk), zögerte ich einen Moment, bevor ich aus dem Bauch heraus antwortete: Wenn ich einen einzelnen Lieblingskomponisten nennen müsse, dann würde ich Franz Schubert wählen. Ich bemerkte dabei, dass die Deutschlehrerin, die in der zweiten Reihe saß, zustimmend nickte, anscheinend ebenso intuitiv.
Was hat es mit dieser unmittelbar einsichtigen Schubertliebe auf sich? Hat sie mit der klischeehaften Schubertgemütsseligkeit früherer Jahre zu tun, der Vorstellung vom Schwelgen in Melodien und Wein? Vielleicht ist es das genaue Gegenteil. Viele Werke insbesondere aus den letzten vier Jahren von Schuberts allzu kurzem Leben (1797–1828) können einen stets aufs Neue derart erschüttern, dass man es kaum erträgt. Zum Beispiel Schuberts letztes Streichquartett aus seinem drittletzten Lebensjahr, im maßgeblichen Verzeichnis nach Otto Deutsch nummeriert als D 887, in der Tonart GDur. Nur, was heißt das hier schon: in GDur? Bereits das allererste Ereignis dieses Stücks besteht darin, dass ein anschwellender GDurAkkord schlagartig nach gMoll kippt. Simpler geht’s eigentlich nicht, und doch reißt es einem beim Hören die Beine weg oder eben den Konzertsessel, auf dem man sitzt, das Sofa, auf dem man lauschend liegt –den Boden unter der Seele. Allegro molto moderato, lautet die Spielbezeichnung für diesen ersten Satz. In emotionaler Hinsicht eine grobe Irreführung. Wie überhaupt bei Schubert die ergreifendsten Dinge und heftigsten Ungeheuerlichkeiten immer wieder unter dem Etikett Moderato stehen.
Im GDur/MollQuartett setzt sich der Sturz ins Bodenlose konsequent fort: Heftige Kontraste fegen im zweiten Satz das einleitende un poco moto fort. Die Erfahrung des unendlich zarten Mittelländlers zwischen den heftigen Zitterattacken der ScherzoAußenteile erinnert an die geradezu erschreckende Wirkung der Drei Klavierstücke D 946 aus Schuberts Todesjahr. Und das Finale ist eine einzige galoppierende Hetzjagd.
Wie nicht wenige seiner bedeutendsten Kompositionen wurde auch dieses »extremste Instrumentalwerk Schuberts« (Karl Böhmer) lange unterschätzt. Noch 1871, also fast ein halbes Jahrhundert nach Schuberts Tod, bezeichnete es ein Kritiker der ehrwürdigen Leipziger »Allgemeinen Musikalischen Zeitung« in orthodoxem Klassizismus als »wild, bunt, formlos« und monierte, dass »ein sehr verschwenderischer Gebrauch von äußerlich wirkenden Manieren, z. B. vor allem von dem sogenannten Tremolo gemacht (wird). Eine auch in manchen seiner Lieder angewandte Manier Schuberts, fortwährend mit Dur und Moll auf derselben Tonstufe zu wechseln, kommt hier bis zum Überdrusse vor, … ja, einer der vier Sätze schließt sogar mit dieser sinnlosen Wendung ab«. Musikwissenschaftliche Darlegungen, dass der simple Harmoniewechsel fürs ganze Quartett kompositorisch konstitutiv sei, darf man getrost dem Fachpersonal überlassen – und sich selbst als Hörer dem eigenen Erleben. Wer je Schuberts »Winterreise« gehört hat, wird sich wohl der Tränen entsinnen, die er vergoss, als er zum ersten Mal dem überwältigenden Umschlag von Moll nach Dur ausgesetzt war: »auf derselben Tonstufe« in der Traumruhe der verlorenen Geliebten im Eröffnungslied »Gute Nacht«. Oder auf anderer Tonstufe in der nächsten Phase des Wirklichkeitsverlusts, wenn an fünfter Stelle ›
mit dem »Lindenbaum« erstmals ein Lied in einer DurGrundtonart erklingt – und dieses betörend schöne Dur alles nur noch viel trauriger macht.
Die vollendete Trostlosigkeit der »Winterreise« rundet sich nicht nur in der perfekten Tristesse des abschließenden gespenstischen »Leiermanns« ab, sondern auch durch die biografische Überlieferung, Schubert habe noch im November 1828 auf dem Sterbebett an den Korrekturen dieses Werks gearbeitet. Nun hat die enorme Wirkung seiner Musik auf unsere Gefühle immer wieder das Bedürfnis hervorgerufen, eine ebenso enorme Lebensgeschichte des Komponisten aufzufinden. Oder eben zu erfinden. Keine Frage, worum sich diese große Story drehen muss: Wo war die Liebe im Leben des Komponisten, der so ergreifend über die Liebe schrieb, oder eben über deren Fehlen, den totalen, tödlichen Verlust?

Dabei stößt der Liebeslebensrückschluss ja selbst im Fall Beethoven an seine Grenzen, bei dem doch emotionales und (hetero)sexuelles Begehren noch vergleichsweise offen zutage liegen. Selbst dessen legendärer »Brief an die Unsterbliche Geliebte«, der jede Menge fiktionale und wissenschaftliche Biografik entzündete, könnte im prosaischsten Fall gar kein konkretes Bekenntnis sein, sondern lediglich eine Fantasie oder auch bloß eine Stilübung.
Was Schubert angeht, verlief vor einigen Jahren der beherzte Versuch, sein Liebesleben vom heteronormativen Kopf auf queere Füße zu stellen, einigermaßen im Sande. Zu den treibenden Kräften dieser Unternehmung gehörte
der psychoanalytisch inspirierte Amerikaner Maynard Solomon, der schon 1977 in seiner noch immer (zu) viel gelesenen genialischabwegigen BeethovenBiografie Haarsträubendes über aktives wife-sharing im Freundeskreis des Meisters fabuliert hatte; der taube Titan im Swingerklub, sozusagen. Die Erwähnung von »jungen Pfauen« und dem RenaissanceBildhauer Benvenuto Cellini im Zusammenhang mit Schubert im Tagebuch eines seiner Freunde sollte nun Evidenz in Sachen tabuisierter Homosexualität des Komponisten liefern. Als Indizien hinzugefügt wurden Schuberts zahlreiche enge Freundschaften mit Männern, zeitweilige Wohngemeinschaften, schwärmerische Briefstellen.
Dass man die Umdefinierung der oft verkitscht dargestellten Schubertiaden im Männerkreis zu einer Art schwuler Subkultur dubios findet, bedeutet natürlich ebenso wenig die Gewissheit, dass Schubert nicht homosexuell gewesen sein könnte. Genau diese Gewissheit der (natürlich kreuzunglücklichen) Liebe zu Frauen zu erbringen, bemühten sich aber früher jahrzehntelang GeschichtenErfinder auf der dünnen Grundlage einer erwähnten Therese hier, einer Caroline dort. »Franz Schuberts letzte Liebe« (1926) oder »Zwei Herzen im DreiviertelTakt« (1930) hießen einige der unzähligen Schubertfilme, »Dein ist mein Herz« (1934) oder »Seine einzige Liebe« (1947), und immer wieder die notorischen drei Mäderl. Paul Hörbiger in der Hauptrolle in »Drei Mäderl um Schubert« anno 1936, das berühmtberüchtigte »Dreimäderlhaus« in den Verfilmungen von 1918 und 1958. Das war einmal derart populär, dass bis vor
kurzem noch eine Eckkneipe im seinerzeit proletarischen Berliner Bezirk Moabit so hieß! (Und bestimmt gibt es irgendwo auch einen Swingerklub oder ein Bordell an einer Autobahnausfahrt mit diesem Namen.)
Ob es nun tatsächlich eines windig herbeiindizierten Dreibubenhauses bedarf, um diese im Grunde ja längst vergessenen Klischees nochmals zu entsorgen? Vielleicht spricht es gegen die Dringlichkeit nicht allein heterosexuellen, sondern alles sexuellen Begehrens, was Schuberts Freund Anselm Hüttenbrenner in seinen »Erinnerungen« schrieb: »Von der Zeit an, als ich Schubert kennenlernte, hatte er nicht die mindeste Herzensangelegenheit. Er war gegen das schöne Geschlecht ein trockener Patron, daher nichts weniger als galant. Er vernachlässigte seinen Anzug, besonders die Zähne, roch stark nach Tabak, war sonach zu einem Kurmacher gar nicht qualifiziert und auch nicht salonfähig, wie man sagt.«
Ein Schmuddelschubert mit schlechten Zähnen, das liest man als Verehrer seiner Musik natürlich nicht gern. Was aber, wenn es Schubert schlicht und einfach ebenso ging wie uns: Dass seine Liebe und sein Begehren vor allem der menschlichen Stimme und dem Unglück der Welt galt – will sagen, seiner Musik? Die Abenteuer des Inneren bedürfen nicht unbedingt aufregender äußerer Umstände.

ENDZEIT? AUFBRUCH INS TROSTLOSE!
Begibt man sich freilich zurück auf den Boden der biografischen Tatsachen, bleibt zu konstatieren, dass Schuberts seit 1822/23 bezeugte Syphilis zweifellos irgendwo hergekommen sein muss. Ebenso klar ist, dass Schubert zwar an dieser langwierigen Erkrankung litt: Dass ihm »das Glück der Liebe u. Freundschaft nichts biethen als höchstens Schmerz«, schrieb er in diesem Zusammenhang in einem berühmten Brief vom 31. März 1824. Aber er starb nicht an dieser Syphilis, dachte auch wohl gar nicht daran, zu sterben. Zumindest nicht so bald. Die finstere, verzweifelte Todesfixierung, die man etwa aus dem dMollStreichquartett D 810 heraushören kann (mit dem auf ein darin verwendetes Liedzitat zurückgehenden, nicht von Schubert benutzten Beinamen »Der Tod und das Mädchen«), resultiert gewiss aus einer allgemeineren Krankheit des Menschen zum Tode als Schuberts konkreter »venerischer Erkrankung« – um jenes professorale Wort zu benutzen, das noch im seriösen SchubertHandbuch des BärenreiterVerlags steht, um den peinlichen Begriff »Geschlechtskrankheit« zu vermeiden. Dass es sich bei der ansteckenden »Venus« um eine jener bedauernswerten Grabennymphen (egal welches Geschlechts) handelte, von denen es in der europäischen Prostitutionshauptstadt Wien wimmelte, darf man wohl vermuten.
Schubert korrigierte im Herbst 1828 auf seinem Krankenlager, das keineswegs ein Sterbebett sein sollte, nicht nur die »Winterreise«, sondern las auch den eben ins Deutsche übersetzten »Letzten Mohikaner« und bestellte sich weitere Bücher von James Fenimore Cooper. In seinem fundierten SchubertBüchlein von 2011 hebt der Musikwissenschaftler HansJoachim Hinrichsen hervor,
dass die unglaublichen Meisterwerke aus Schuberts letzten Lebensjahren Teil einer systematischen Karriereplanung waren, eines äußerst selbstbewussten Wegs ins Zentrum der musikalischen Öffentlichkeit und auf die großen Bühnen. Vermutlich war es eine TyphusInfektion, die diesen Weg im November 1828 tragisch abbrach: kein konsequenter Endpunkt einer persönlichen Endzeit(be)stimmung, sondern unerwartet und völlig sinnlos. Die bittererweise zum »Spätwerk« gewordenen Kompositionen trugen in Wahrheit »die Züge einer überwältigend produktiven Aufbruchsstimmung« (Hinrichsen).
Wenn Schubert also keineswegs des nahen Todes gewiss war, sondern durchaus der Zukunft zugewandt, so mag es dennoch die Zukunft in einer grundsätzlich trostlosen Welt gewesen sein. Die Finsternis und die Ausbrüche von Verzweiflung in Schuberts späten Werken bleiben ja eine Tatsache, die keinem Hörer entgehen kann. Zur allgemeinen Todesgewissheit des Menschen kam wahrscheinlich hinzu, so nochmals Hinrichsen, dass »Schubert und viele seiner Freunde die MetternichÄra als epochale Eiszeit empfunden haben«. Die apokalyptische Stimmung etwa der »Winterreise« (über deren metaphorischpolitische Dimension der Tenor Ian Bostridge 2015 ein eindrucksvolles Buch geschrieben hat) liegt ja auch darin begründet, dass ihre »Handlung« erst nach dem endgültigen Scheitern aller Liebeshoffnung einsetzt.
Damit verglichen ist die drei Jahre zuvor entstandene »Schöne Müllerin« noch innerweltlich, konventionell: Hier sind Verzweiflung und Scheitern das dramaturgische Ziel, nicht der Ausgangspunkt. Am Anfang stehen Aufbruch und Hoffnung, in der Mitte Enttäuschung und ›
STREICHQUARTETTE
11. bis 13.5.2023 | jeweils 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Quatuor Modigliani
11.5.: streichquartette g-Moll D 173, es-Dur D 87 und d-Moll D 810 (»Der Tod und das Mädchen«)
12.5.: streichquartette e-Dur D 353, C-Dur D 46 und a-Moll D 804 (»Rosamunde«)
13.5.: streichquartette D-Dur D 94, G-Dur D 887 und Quartettsatz c-Moll D 703
DIE SCHÖNE MÜLLERIN
Mi, 31.5.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Musicbanda Franui, Florian Boesch (Bassbariton), nikolaus habjan (Puppenspieler, stimme, Regie)
Die schöne Müllerin – ein Musiktheaterabend nach Franz schubert
KLAVIERSONATEN
So, 11.6.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Francesco Piemontesi (Klavier)
Franz schubert: sonaten G-Dur D 894 (»Fantasiesonate«) und B-Dur D 960
Desillusionierung, am Ende steht der Tod. Die solipsistischen und vielleicht sogar psychopathischen Züge, die den Winterreisenden auszeichnen, sind allerdings schon in der »Schönen Müllerin« spürbar. Oder kann man es unbedenklich finden, dass das musikalische Ich sich den ganzen Zyklus über mit niemand anderem unterhält als mit einem Bächlein? Ebenjenem Bächlein, das dann im letzten Lied dem Müller sein Todesschlummerlied singen wird?
Das Lied »Die liebe Farbe« ist dabei die denkbar trübste Erwachsenenversion von »Grün, grün, grün sind alle meine Kleider«. An Untröstlichkeit wird es vielleicht noch von den »Trocknen Blumen« übertroffen. Dass aber die Ausweglosigkeit für den Komponisten Mittel und Gegenstand von Kunst war und nicht etwa persönliche Lähmung und Aporie, zeigt sich auch in einer unbeschwerten Souveränität, die den SchubertleidUltra schockieren mag: Das Thema der »Trocknen Blumen« diente ganz pragmatisch gleich nach der »Schönen Müllerin« auch für die Flötenvariationen D 802, die man wohl eher der Gebrauchs als der Bekenntniskunst zuordnen wird.
Doch wie strikt ist diese Linie überhaupt zu ziehen? Am nachdrücklichsten wurde sie wohl im Fall der Streichquartette gezogen, explizit auch von Schubert selbst: Zwölf Stück davon komponierte er in jungen Jahren, vor allem fürs innerfamiliäre Musizieren. Als Solitär steht dann nach vierjähriger Pause 1820 ein einzelner, erschütternd expressiver QuartettSatz. Und nach nochmals vierjähriger Pause folgen die drei letzten Quartette, die zweifellos zum Olymp aller Kammermusik zählen, zu den Werken, die Leben verändern und den Musikliebenden ein Leben lang begleiten können.
Die zwölf Jugendwerke jedoch tat Franz Schubert in einem Brief an seinen Bruder Ferdinand pauschal ab: »Aber besser wird es seyn, wenn Ihr Euch an andere Quar tetten als die meinigen haltet, denn es ist nichts daran, außer daß sie vielleicht Dir gefallen, dem alles von mir gefällt.«
Nun ist es eine alte Binse, dass kaum einer Sache auf der Welt so sehr zu misstrauen ist wie den Aussagen von Künstlern über ihre eigenen Werke. Schuberts abschätzige Selbsteinschätzung ist gewiss auch im Sinn der bewussten Karriereplanung zu sehen, die oben erwähnt wurde: auf dem Weg an die absolute Spitze seiner musikalischen Gegenwart. Dass die frühen Quartette in ihrer Unbefangenheit für den ebenso unbefangenen Hörer nicht nur einen spannenden Blick in die Werkstatt des jugendlichen Künstlers bieten, sondern von ganz eigenem musikalischem Reiz sind, machte in jüngster Zeit das französische ModiglianiQuartett mit seiner Gesamteinspielung deutlich. Dem wahren SchubertLiebenden aber kann es mit dieser Musik ebenso ergehen wie dem Bruder Ferdinand: dass sie ihm gefällt, wie ihm alles von Schubert gefällt.

Kaum einer Sache auf der Welt ist so sehr zu misstrauen wie den Aussagen von Künstlern über ihre eigenen Werke.
Die Elbphilharmonie und der Porsche Taycan: Diese zwei ausgeklügelten Kunstwerke sorgen für Gänsehaut pur. Erleben Sie atemberaubende Momente weit über einen Abend hinaus – im vollelektrischen Porsche Taycan.
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 24,1–19,6 (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 370–512 (WLTP) · 440–630 (WLTP innerorts); Stand 03/2023


Gibt es so etwas wie ein Licht der Liebe? Vielleicht das Licht des späten Nachmittags, das alles und jeden in mildem Glanz erstrahlen lässt und mit flüchtigen Reflexen, warmen Schatten und leuchtenden Spiegelungen eine ganz besondere Schönheit zu zeichnen vermag. Unsere Fotografin hat sich in einem solchen Licht der Elbphilharmonie genähert – und für ihren liebevollen Blick diese Stimmung auch gleich mit ins Haus genommen.
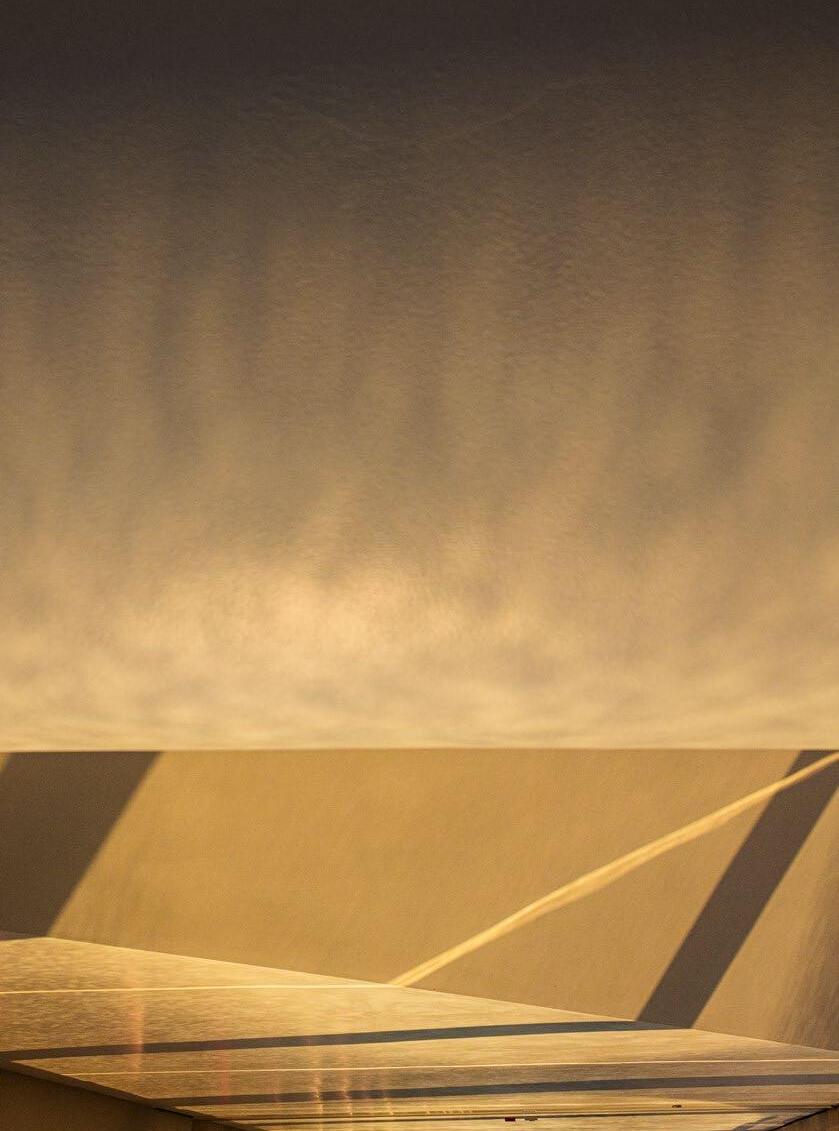 FOTOS JULIA KNOP
FOTOS JULIA KNOP


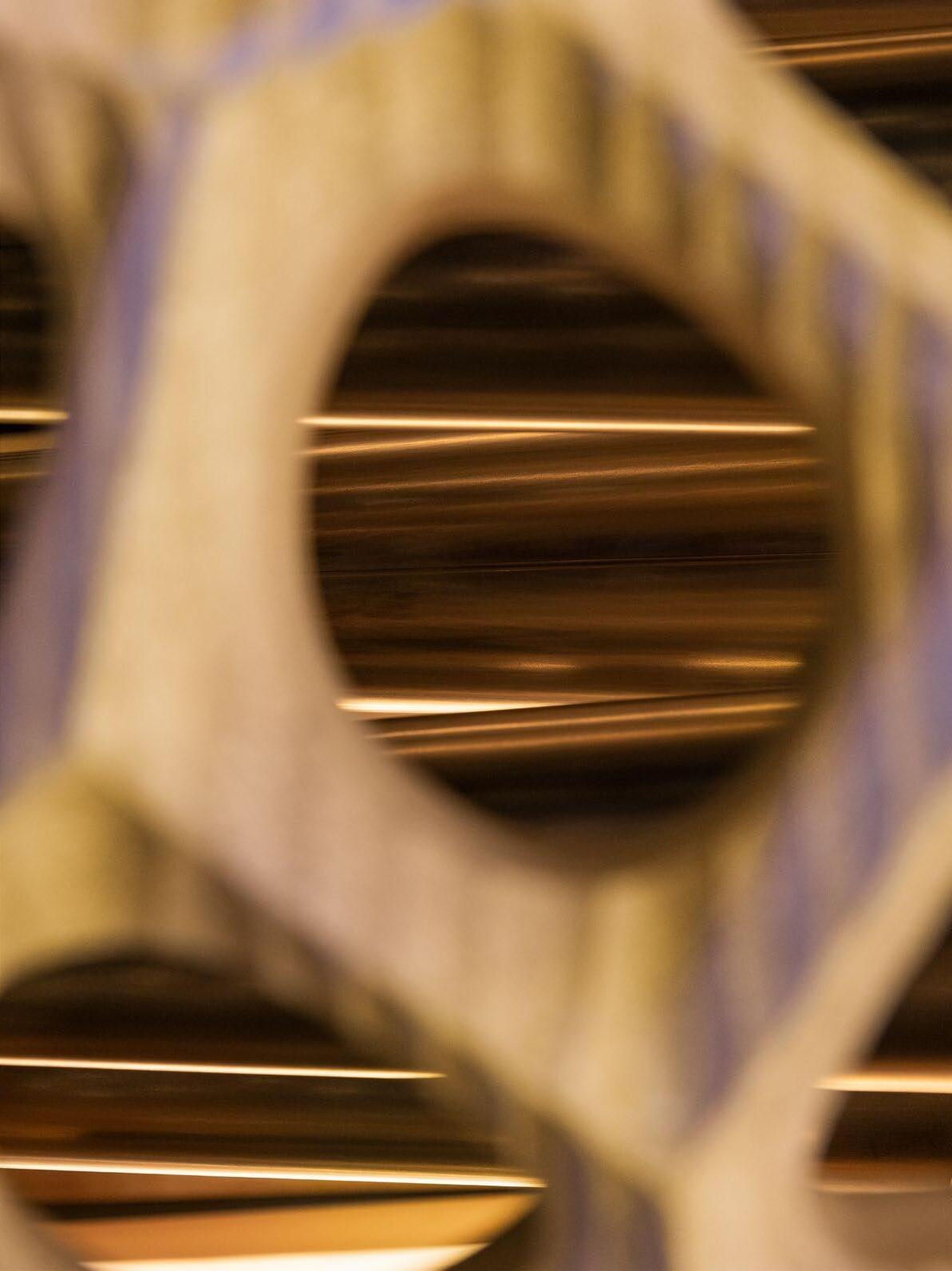





 VON BJØRN WOLL
VON BJØRN WOLL
Es ist fast zehn Jahre her, dass der Regisseur Peter Sellars mit einer eigenen Fassung von Henry Purcells unvollendet gebliebener SemiOpera »The Indian Queen« (1695) für Furore gesorgt hat. In einer opulentsinnlichen Ausstattung ging es bei ihm weniger um historische Figuren als um brandaktuelle Themen von der europäischen Kolonialgeschichte bis hin zur gesellschaftlichen Rolle der Frau. Mit dabei war auch die Sängerin Julia Bullock, damals noch ein bisschen unter dem Radar, am Anfang ihrer Karriere, in der sie mittlerweile etliche Stufen weiter nach oben geklettert ist.
Besondere Projekte wie »The Indian Queen« sind längst zu einem Markenzeichen dieser so versatilen Künstlerin geworden. Erneut mit Peter Sellars hat sie erst kürzlich »Perle Noire: Meditations for Joséphine« entwickelt, eine Hommage an die legendäre Josephine Baker; für Aufsehen sorgte auch die Saisoneröffnung der New Yorker Met 2021 mit der Oper »Fire Shut Up In My Bones« von Terence Blanchard, in der es um Polizeigewalt und schwarze Menschen ging. Doch auch im traditionellen Repertoire fühlt sich Bullock zu Hause, sie singt Händel und Mozart, dazu viel Zeitgenössisches. Eine besondere
ihren musikalischen Erkenntnismoment und die Veränderung ihrer Stimme.

Beziehung verbindet sie hier mit John Adams, der ihr in seiner Oper »Girls Of The Golden West« 2017 eine Partie auf den Leib schneiderte (das Libretto stammt übrigens von Peter Sellars).

Auch abseits der Bühne ist Julia Bullock eine engagierte Künstlerin, sie organisiert Benefiz und Educationkonzerte, setzt sich immer wieder für soziale Projekte und die Chancengleichheit für Frauen und Schwarze im Kulturbetrieb ein. »Jung, höchst erfolgreich und politisch engagiert«, war über sie in »Vanity Fair« zu lesen; vom Magazin »Musical America« wurde sie 2021 zur Künstlerin des Jahres gewählt und als »Repräsentantin des Wandels« ausgezeichnet. 1987 in Saint Louis, Missouri, geboren, ging sie nach Zwischenstationen an der Eastman School of Music und am Bard College an die berühmte Kaderschmiede der Juilliard School. Dort lernte sie auch ihren Ehemann, den Dirigenten Christian Reif kennen, mit dem sie seit einiger Zeit in München lebt. Ende des vergangenen Jahres wurde sie Mutter – und schon wenige Wochen später gab sie beim Silvesterkonzert ihr Debüt in der Elbphilharmonie, mit Songs von George Gershwin und seiner Zeitgenossin, der schwarzen Komponistin Margaret Bonds.

Wie war’s denn an Silvester in der Elbphilharmonie? Das war auf ganz unterschiedlichen Ebenen eine besondere Erfahrung. Zum einen, weil ich nach langer Zeit wieder mit Alan Gilbert arbeiten konnte. Nach dem Konzert bin ich in mein Hotel gegangen, das im gleichen Gebäude ist, und habe auf dem Weg dorthin Menschen aus dem Publikum getroffen. Dieser Austausch zwischen
Künstlern und Konzertbesuchern ist sozusagen als DNA in die offene und fließende Architektur des Hauses eingeschrieben. Außerdem ist es eine spektakuläre Architektur, sie beflügelt unsere Fantasie und Vorstellungskraft.
Kurz zuvor sind Sie nicht nur zum ersten Mal Mutter geworden, sondern haben auch Ihr Debüt auf CD gegeben, mit dem Solo-Album »Walking In The Dark«. Der Titel klingt ganz schön düster, oder? Für mich ist Dunkelheit nicht nur etwas Schlechtes. Dunkelheit kann auch faszinierend sein, geheimnisvoll, ein Ort der Ruhe und Stille, ein Ort der Kontemplation, an dem wir zu uns selbst finden können. In unserer Wahr nehmung wird Licht immer als etwas Positives wahrgenommen, während Dunkelheit meist negativ konnotiert ist. Dieser Projektion stimme ich aber nicht zu.
Erstaunlich ist die Vielfalt der Genres auf dem Album, es gibt Jazz, Blues, Spirituals und klassische Stücke. Betrachten Sie sich überhaupt als klassische Sängerin? Ich sehe mich definitiv als klassische Sängerin. Allerdings würde ich mich nicht mehr unbedingt als Sopranistin bezeichnen. In der Oper singe ich zwar überwiegend das Repertoire für dieses Stimmfach. Aber wenn es um Recitals geht, fühle ich mich freier, da programmiere ich Stücke, zu denen ich mich hingezogen fühle, deren Temperament ich auf der Bühne gerecht werden kann. Dabei geht es mir nicht darum, bewusst Barrieren zu durchbrechen oder unkonventionell zu sein. Ich folge einfach meiner Liebe zum Gesang und möchte sie mit dem Publikum teilen.
Wenn klassische Sänger nichtklassisches Repertoire singen, hört man die klassische Stimme oft heraus. Bei Ihnen ist das nicht der Fall. Wie machen Sie das? Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht nur mit klassischer Musik aufgewachsen bin. Ich versuche einfach, meine Art zu singen dem jeweiligen Repertoire anzupassen. Das ist doch das Schöne am Gesang, dass die menschliche Stimme in der Lage ist, sich auf so viele verschiedene Arten auszudrücken. Seit ich Mutter bin, hat meine Stimme auch eine größere Leichtigkeit und Direktheit, was ich sehr genieße.
Auch andere Sängerinnen erzählen, dass sich die Stimme nach einer Geburt verändert. Anita Ratschwelischwili zum Beispiel musste erst wieder die richtige »Position« für die Stimme im Körper finden. Wie war das bei Ihnen? Seit der Geburt fühle ich mich noch wohler in meinem Körper, spüre eine stärkere Verbindung von Körper und Geist. Ich habe mich selbst dadurch besser kennengelernt. Außerdem habe ich nicht mehr so sehr das Gefühl, dass ich mich beweisen muss. Klar möchte ich meine Stimme weiterentwickeln. Eben weil ich mich so wohl in meinem Körper fühle, habe ich gerade das Gefühl, dass die Kanäle dafür offen sind. Schauen wir mal, wo das hinführt.
Woher kommt Ihre Liebe zum Gesang, von der Sie eben gesprochen haben?
Ich singe schon, solange ich mich erinnern kann. Für mich war es das Natürlichste auf der Welt, mich selbst und meine Gefühle durch Musik auszudrücken. Keine Ahnung, woher genau das kommt. Vielleicht, weil ich schon als Kind ständig von Musik umgeben war. Mein Vater hatte eine schöne Stimme, und auch meine Mutter hat uns oft vorgesungen. Bis heute liebe ich es auch, anderen Sängern und Sängerinnen zuzuhören. Musik hat mein Leben so unglaublich bereichert. Daher ist es für mich etwas Besonderes, das heute mit meinem Publikum teilen zu können.
Welche Kolleginnen hören Sie besonders gern?
Oh mein Gott, wo soll ich da nur anfangen? Die FolkSängerinnen Judy Colins und Joni Mitchell, im Jazz vor allem Nina Simone und Billie Holiday. Außerdem liebe ich Jimi Hendrix und Pink Floyd. Und eines der ersten Konzerte, das ich besucht habe, war von Tina Turner. Es gibt einfach so viele Musikerinnen und Musiker, die mich inspiriert haben! Aber wenn wir von klassischen Sängerinnen sprechen, dann ist es zum Beispiel Régine Crespin. Es gibt ein Album aus den Sechzigerjahren, auf dem sie Lieder von Berlioz, Ravel und Poulenc singt –das hat meine Welt nachhaltig erschüttert. Oder Edita Gruberová mit ihrer unübertroffenen Interpretation der »Glöckchenarie« aus Delibes’ »Lakmé«. Dann sind da noch Frederica von Stade, Renée Fleming, Kiri Te Kanawa, Janet Baker und Lorraine Hunt Lieberson.
Lorraine Hunt Lieberson wird von vielen Sängerinnen immer wieder als Vorbild genannt, dabei war sie in Europa kaum bekannt. Bejun Mehta hat mir einmal gesagt, dass man in ihrer Interpretation von »As With Rosy Steps The Morn« aus Händels »Theodora« hören könne, worum es im Gesang eigentlich geht: um Wahrhaftigkeit.
Recht hat er! Eben diese Produktion von »Theodora«, 2004 von Peter Sellars inszeniert, war eine der ersten szenischen Aufführungen von klassischer Musik, die ich gesehen habe. Als Lorraine Hunt Lieberson die Szene betrat, hat das mein Leben verändert, weil ich auf einmal wusste, was in dieser Kunstform möglich ist.
Kommen wir noch einmal zurück zum Thema Dunkelheit, denn das spielt auch bei Ihrem nächsten Auftritt in der Elbphilharmonie eine Rolle. Da werden Sie den 1945 entstandenen Liederzyklus »Harawi« von Olivier Messiaen singen, der mit dem Lied »Dans le noir« (»In der Dunkelheit«) endet. Was bedeutet Ihnen das Werk?
Ich erinnere mich, dass ich sehr stark auf die Musik reagiert habe, als ich den Zyklus zum ersten Mal hörte. Auch die kraft und wirkungsvolle Poesie der Worte schlug mich direkt in Bann. Irgendwie fühlte ich mich berufen, das selbst zu singen – wartete aber noch auf den richtigen Moment. Meine Idee war es zunächst, die Lieder auf zwei Sänger und sogar zwei Pianisten zu verteilen, denn es geht darin um verschiedene Dualitäten, zwischen Mann und Frau, Natur und Kosmos, Liebe und Verlust.
In Hamburg singen Sie den Zyklus nun aber allein. Warum?
Weil ich als Künstlerin gereift bin, fühle ich mich dem nun auch alleine gewachsen. Dennoch greifen wir das Thema der Dualitäten auf, wenn auch anders, nämlich in der Verbindung mit Tanz. Messiaen hat sich in »Harawi« von der traditionellen Musik der Anden inspirieren lassen –und der Tanz ist Teil der Tradition dieser Lieder. Als Gegenparts zu mir als Sängerin und dem Pianisten wird es daher auf der Bühne einen Tänzer und eine Tänzerin geben.
»Gesang über Liebe und Tod« lautet der Untertitel zu »Harawi«. Um welche Art von Liebe geht es da?
Messiaen selbst war damals in einer persönlich schwierigen Lage. Seine erste Frau, Claire Delbos, litt an einer Nervenkrankheit und musste in einer Anstalt betreut werden. Als sie immer weniger ansprechbar wurde, verliebte sich Messiaen in eine andere Frau, Yvonne Loriod, die er später auch geheiratet hat. Das spiegelt sich für mich in »Harawi«: Es ist, als würde man sich von jemandem verabschieden, mit dem man eine tiefe Verbindung hatte, und gleichzeitig beginnt etwas Neues. Es sind also fünfzig Minuten Musik, um sich zu verabschieden und eine neue Liebe willkommen zu heißen. Es ist wie ein Liebesbrief von Messiaen an seine beiden außergewöhnlichen Partnerinnen. Und ich hoffe, dass die Verbindung von Musik und Bewegung hilft, diese Geschichte erfahrbar zu machen.
»Harawi« hat einen ethnischen Hintergrund, ähnlich wie das bei Purcells »Indian Queen« der Fall ist, die Sie einst mit Peter Sellars auf die Bühne gebracht haben. Suchen Sie sich solche Projekte bewusst aus, oder werden Sie dafür eher angefragt?
Vermutlich spielt beides eine Rolle. Klar, aufgrund meines Aussehens, meiner Herkunft und ethnischen Zugehörigkeit werde ich gebeten, an bestimmten Projekten mitzuwirken. Als Künstlerin fühle ich mich allerdings vor allem von einem bestimmten Repertoire und dessen Geschichten angezogen. Im Fall von »Harawi« wusste ich zunächst ›
»Es ist, als würde man sich von jemandem verabschieden, mit dem man eine tiefe Verbindung hatte, und gleichzeitig beginnt etwas Neues.«
nichts über die Tradition, mit der es verbunden ist – und trotzdem fühlte ich mich sofort zu diesem Material hingezogen und wusste, dass ich es singen möchte. Die Frage von kultureller Aneignung schwingt latent natürlich oft mit. Darauf kann ich aber keine Antwort geben. Als Künstlerin sehe ich meine Aufgabe vielmehr darin, Fragen zu stellen und mir genau zu überlegen, warum ich etwas auf die Bühne bringen möchte.
In der letzten Spielzeit hatten Sie einen großen Erfolg in Terence Blanchards Oper »Fire Shut Up In My Bones«, in der es um das Leben schwarzer Menschen und Polizeigewalt in den USA geht. Fühlen Sie eine besondere Verpflichtung bei Werken mit einer solchen Thematik?
Fühle ich mich verantwortlich? Nein! Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich von anderen positioniert oder für eine Sache vereinnahmt werde. Ich fühle mich eher berufen, manche Dinge zu singen. Wenn das nicht so ist, lasse ich die Finger davon. Wenn ich mich für ein Projekt entscheide, ist es mir vor allem wichtig, dass jeder im Team die Arbeit ernst nimmt. Denn die Zeit, die wir auf der Bühne verbringen, ist einzigartig und kostbar. Und ich habe das Gefühl, dass es eine gute Gelegenheit für uns ist, einzuüben, wie wir am besten miteinander umgehen: mit gegenseitigem Respekt, mit Ehrlichkeit, Offenheit und Verantwortlichkeit. Wenn diese Grenzen überschritten werden, kann ich das nicht tolerieren.
In der letzten Zeit sind gleich einige Alben schwarzer Opernsängerinnen erschienen, von Golda Schultz, Jeannine De Bique, Pene Pati. Wie nehmen Sie, als Teil dieser Gemeinschaft, diese Entwicklung wahr?
Alle Sängerinnen und Sänger, die ich verehre, haben eine Aufnahmegeschichte und sind damit zu einem Teil der Gesangsgeschichte geworden, die für die Nachwelt konserviert wurde. Meine ersten Begegnungen mit klassischem Gesang fanden durch Aufnahmen statt. Natürlich freue ich mich, dass ich, dass wir nun auch ein Teil dieser Geschichte werden. Nicht zuletzt weil die von Ihnen erwähnten Künstlerinnen Freundinnen von mir sind.
Woher kommt eigentlich Ihr starkes soziales Engagement?
Das hängt vermutlich mit meiner Biografie zusammen, denn meine Eltern waren sozial engagierte Menschen. Sie wollten immer, dass wir uns bewusst sind, was in der Welt vor sich geht und wie wir damit umgehen. Manchmal passieren Dinge, zu denen ich nicht schweigen möchte. Zum Glück lebe ich in einer Zeit und an einem Ort, an dem ich frei sagen kann, was ich denke. Aber es gibt derzeit viele Künstler und Menschen, die darum kämpfen müssen, öffentlich ihre Meinung zu äußern. Solange ich eine Gelegenheit dazu habe, werde ich es tun.
Sie leben mit Ihrem Mann und dem Baby in München. Warum dort und nicht in den USA?
Der Umzug nach Deutschland war zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass wir etwas verändern wollten. Ich war bereit, New York zu verlassen. Das hat auch etwas mit den aktuellen Verhältnissen in Amerika zu tun: mit den Waffengesetzen, der mangelnden Gesundheitsfürsorge, ganz allgemein mit dem Sozialsystem. Das ist wie ein politischer WrestlingKampf, in dem das Recht des Stärkeren gilt, ein echter Mangel an Rücksichtnahme auf die Menschen, die dort leben. All das sind Realitäten, die ich selbst beobachten konnte. Für mein Kind wünsche ich mir aber einen Ort, an dem es sich wohlfühlen kann und nicht in ständiger Sorge leben muss.
M DEN STREAM VON JULIA BULLOCKS SILVESTERKONZERT FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/JULIABULLOCKSTREAM
HARAWI – GESANG VON LIEBE UND TOD
Mi, 10.5.2023 | 19:30 Uhr Elbphilharmonie Kleiner Saal american Modern opera Company Julia Bullock (sopran) Conor hanick (Klavier) Bobbi Jene smith und or schraiber (Tanz, Choreografie) olivier Messiaen: harawi –Chant d’amour et de mort / Zwölf Lieder für sopran und Klavier



Für wen ist das Abonnement?
Für mich selbst ein Geschenk
Das Abo soll starten mit der aktuellen ausgabe der nächsten ausgabe
Rechnungsanschrift:
name Vorname
Zusatz
straße / nr.
PLZ ort
Land
e-Mail (erforderlich, wenn Rechnung per e-Mail)
Mit der Zusendung meiner Rechnung per e-Mail bin ich einverstanden.
hamburgMusik gGmbh darf mich per e-Mail über aktuelle Veranstaltungen informieren.
Ggf. abweichende
name Vorname
Zusatz
straße / nr.
PLZ ort
Nutzen Sie die Vorteile eines Abonnements und lassen Sie sich die nächsten Ausgaben direkt nach Hause liefern. Oder verschenken Sie das Magazin-Abo.
3 Ausgaben zum Preis von € 15 ( ausland € 22,50) Preis inklusive Mwst. und Versand
Unter-28-Jahre-Abo: 3 ausgaben zum Preis von € 10 (bitte altersnachweis beifügen)
Jetzt Fan der elbphilharmonie Facebook-Community werden: www.fb.com / elbphilharmonie.hamburg
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular zu:
ELBPHILHARMONIE M a G a ZI n Leserservice, PressUp Gmbh
Postfach 70 13 11, 22013 hamburg
Oder nutzen Sie eine der folgenden Alternativen:
Tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299 e-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de
Internet: www.elbphilharmonie.de
Land
Jederzeit kündigen nach Mindestfrist: ein Geschenk-abonnement endet automatisch nach 3 ausgaben, ansonsten verlängert sich das abonnement um weitere 3 ausgaben, kann aber nach dem Bezug der ersten 3 ausgaben jederzeit ohne einhaltung einer Kündigungsfrist zum ende der verlängerten Laufzeit gekündigt werden.
Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen ohne angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax oder e-Mail) oder telefonisch widerrufen werden. Die Frist beginnt ab erhalt des ersten hefts. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels) an: elbphilharmonie Magazin Leserservice, PressUp Gmbh, Postfach 70 13 11, 22013 hamburg
Tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299, e-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de Elbphilharmonie Magazin ist eine Publikation der HamburgMusik gGmbH
Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg, Deutschland
Geschäftsführer: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Zahlungsweise: Bequem per Bankeinzug Gegen Rechnung
Kontoinhaber
IBan
BIC (bitte unbedingt bei Zahlungen aus dem ausland angeben) Geldinstitut
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die hamburgMusik gGmbh bzw. deren beauftragte abo-Verwaltung, die PressUp Gmbh, Gläubiger-Identifikationsnummer De32ZZZ00000516888, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der hamburgMusik gGmbh bzw. deren beauftragter abo-Verwaltung, die PressUp Gmbh, auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.
hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die einzugsermächtigung erlischt automatisch mit ablauf des abonnements.
Datum Unterschrift


RICHARD WAGNER: TRISTAN UND ISOLDE
Die ganze Welt der (unglücklichen) Liebe in einem einzigen Klang – das gelang Richard Wagner Mitte der 1850erJahre mit seinem »TristanAkkord«, der sehnt und drängt und will und doch keine Auflösung findet und aus dem eine ganze Oper erwächst. Damit schuf er eine bestechende Chiffre für die verbotene Liebe zwischen Ritter Tristan und Prinzessin Isolde, quasi die keltische Version von Romeo und Julia. Für den egomanischen Komponisten war Tristan die ideale Identifikationsfigur, schließlich verführte Wagner routinemäßig die Gemahlinnen von Freunden und Gönnern: die Kaufmannsfrau Mathilde Wesendonck, in deren Haus er gemeinsam mit seiner eigenen Gattin (!) Zuflucht vor politischer Verfolgung fand, oder Cosima, die Frau seines Lieblingsdirigenten Hans von Bülow. Die erste gemeinsame Tochter aus letzterer Affäre erhielt prompt den Namen Isolde, ein Sohn den Namen des Opernhelden Siegfried. Letztlich liebte Wagner wohl vor allem sich selbst.
JOHANNES BRAHMS: KLARINETTENTRIO OP. 114
CLAUDIO MONTEVERDI: PUR TI MIRO
Ist das ein Happy End oder eine Frechheit? Da besingt ein Liebespaar sein Glück, die Stimmen in wollüstigen Vorhalten aneinander reibend und sich vereinigend in seligem Unisono. Ach, die Oper! Sie allerdings ist eine intrigante Hofdame, die ihren unversehens aus dem Krieg zurückgekehrten Verlobten abserviert hat; er ein egomanischer Kaiser, der seine Ehefrau in die Wüste geschickt und seinen engsten Berater zum Selbstmord gezwungen hat. Doch der gerechtfertigten Empörung über ein solch amoralisches Libretto ist völlig der Wind aus den Segeln genommen durch die göttliche Musik, in die Claudio Monteverdi das Finale seiner Oper »L’incoronazione di Poppea« 1643 kleidete. Damit prägte er die noch junge Gattung nachhaltig und schuf gleich einmal eines der atemberaubendsten Duette aller Zeiten. Fazit: Musik darf alles, solange am Ende die Liebe triumphiert.
Eigentlich hatte Johannes Brahms der Liebe abgeschworen. »Habe ich Ihnen nie von meinen schönen Prinzipien erzählt?«, schrieb er 1888 einem Freund. »Dazu gehört, keine Oper und keine Heirat mehr zu versuchen!« Befriedigt nahm er die Hamburger Ehrenbürgerschaft entgegen und wollte sein Skizzenbuch schon ein für allemal zuklappen. Doch dann hörte er Richard Mühlfeld von der Meininger Hofkapelle, und es war um ihn geschehen. Diese anmutige Beweglichkeit, dieser einschmeichelnde Ton! Hals über Kopf verliebte sich der fast 60Jährige in die Klarinette, die »Fräulein Nachtigall« (OTon Brahms) Mühlfeld so wunderbar zu spielen wusste. Also ließ er alle endzeitlichen Vorsätze fallen und komponierte seinem neuen Schwarm ein Trio, ein Quintett und zwei Sonaten auf den schlanken, schwarzen Leib. Die treffendste Zusammenfassung des Trios für Klarinette, Cello und Klavier lieferte Brahms’ Freund Eusebius Mandyczewski: »Es ist, als liebten sich die Instrumente.«

Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
WOLFGANG AMADEUS MOZART:
REGISTER-ARIE AUS DON GIOVANNI

640 Italienerinnen, 231 Deutsche, 100 Französinnen, 91 Perserinnen und 1.003 Spanierinnen: So viele Damen hat der unverbesserliche Don Giovanni laut akribischem Protokoll seines Dieners Leporello (der dank dieser Arie Namensgeber für ein Faltblatt wurde) bereits verführt, wofür er am Schluss der Oper völlig zu Recht zur Hölle fährt. Ansonsten aber scherte sich Mozart in seinen Opern eher wenig um Anstand und Moral, sondern spielte lieber alle denkbaren amourösen Konstellationen durch. So ist »Così fan tutte« eine PartnertauschTreuetestKomödie auf dem dramaturgischen Niveau einer MatthiasSchweighöferSchmonzette. Und in »Le nozze di Figaro« wird ein vertrottelter notgeiler Adeliger durch den Kakao gezogen, der das archaische Recht der ersten Nacht durchsetzen will. Auf dem Höhepunkt singt er seiner Ehefrau zum mutmaßlich ersten Mal eine von Herzen kommende Liebeserklärung – allerdings nur, weil er sie für eine andere hält.
PIOTR TSCHAIKOWSKY:
VIOLINKONZERT
»Ich habe mich immer bemüht, in meiner Musik die ganze Qual und Ekstase der Liebe auszudrücken.« Piotr

Tschaikowsky wusste, wovon er sprach. Zeitlebens litt er darunter, seine Homosexualität – die damals unter Strafe stand – nicht offen leben zu können. Mitte der 1870erJahre bändelte er mit einem seiner Studenten am Moskauer Konservatorium an, dem 15 Jahre jüngeren Geiger Josef Kotek: »Ich bin so verliebt wie lange nicht. Wenn ich stundenlang seine Hand halte und mich beherrschen muss, ihm nicht zu Füßen zu fallen, ergreift mich die Leidenschaft mit übermächtiger Wucht, meine Stimme zittert wie die eines Jünglings und ich rede nur noch Unsinn.« Um die Fassade zu wahren, heiratete Tschaikowsky eine ihm völlig unbekannte Frau, die ihm brieflich einen Antrag gemacht hatte, hielt es dann aber nur drei Monate mit ihr aus. Gemeinsam mit Kotek flüchtete er in ein Dorf am Genfer See, wo er mit dessen Rat und Hilfe in wenigen Wochen sein hochemotionales Violinkonzert komponierte.
JOHN COLTRANE: A LOVE SUPREME

»Wie Moses, der vom Berg Sinai herabsteigt«, sei der Saxofonist John Coltrane an einem Spätsommertag 1964 die Treppe heruntergekommen, erzählte seine Frau Alice einmal. In der Hand die Noten für eines der besten und berühmtesten Jazzalben aller Zeiten: »A Love Supreme«, göttliche Liebe. In einer einzigen Session aufgenommen, stellt es den Gipfelpunkt einer Entwicklung dar, die Coltrane schon als Sideman von Miles Davis mit angestoßen hatte: Die Musik folgt nicht mehr dem altbekannten Bluesschema, sondern beruht auf modalen Skalen und polyrhythmischen Beats. Coltrane, der einerseits streng methodistisch erzogen und andererseits heroinabhängig war, öffnete dem Jazz zudem den Kosmos der Spiritualität, womit er im Zeitalter von Hippies und Hare Krishna offene Türen einrannte. Im letzten Teil der durchkomponierten Suite »spricht« das Saxofon Silbe für Silbe ein Gebet nach. Fans und Kollegen waren aus dem Häuschen, etwa Carlos Santana: »Als ich ›A Love Supreme‹ zum ersten Mal hörte, traf es mich wie ein Überfall. Was mich anging, hätte es vom Mars stammen können oder von einer anderen Galaxie.«

HANS ALBERS:
AUF DER REEPERBAHN NACHTS UM HALB EINS
Zur inoffiziellen Einbürgerungsprüfung eines jeden NeuHamburgers zählt es, den hierorts weltberühmten Schlager auswendig singen zu können – auch alkoholisiert am Ort und zur Uhrzeit, die im Titel angegeben sind. Die »sündige Meile« der käuflichen Liebe ist schließlich eine (genüsslich touristisch ausgeschlachtete) Sehenswürdigkeit und Baustein der hiesigen liberalen Identität. Ursprünglich als Produktionsstätte für Schiffstaue angelegt, zeugt die Reeperbahn außerdem von der Bedeutung der Seefahrt für die Hansestadt. Beide Aspekte kommen im Film »Große Freiheit Nr. 7« zusammen, in dem der traurige Matrose
Hans Albers das Lied singt und der von den Nazis als »wehrkraftzersetzend« verboten wurde.
Dabei artikuliert er doch vor allem eins: Heimatliebe.
M DIE PLAYLIST ZUM LEXIKON FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/PLAYLIST

VON JOACHIM LUX
Mit der Barockmusik ist es, als wäre man in einem anderen Universum«, sagt Kirill Serebrennikov. Der russische Regisseur brennt für Musik, Oper, Schauspiel, Film und Tanz, mehr noch aber brennt er für das alle Gattungen überschreitende und verschmelzende Gesamtkunstwerk – in Opern und Schauspielhäusern oft erträumt, doch kaum je zu sehen. Mit »Barocco« hat er genau dies umgesetzt: »Barocco« ist Musiktheater pur – und zugleich Schauspiel, Film, Tanz.

Das Stück entstand 2018 für das Moskauer Theater Gogol Center, dessen künstlerischer Leiter Serebrennikov damals war, als ein Manifest für die Freiheit der Kunst, für die Schönheit des Menschen, für den Widerstand gegen die Unterdrückung der Freiheit. Doch schon die Proben mussten ohne ihn stattfinden, ebenso die Uraufführung zu Weihnachten 2018 – der Regisseur saß im politisch begründeten Hausarrest. Dennoch: »Barocco« war umjubelt und stets ausverkauft. Mehrere Versuche, die Produktion nach Hamburg einzuladen, scheiterten, zunächst an der Pandemie. Schließlich wurde Serebrennikov als Leiter des Gogol Centers abgesetzt und das Theater in seiner bisherigen Form aufgelöst.
Mittlerweile hat der Regisseur aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine Russland verlassen; seither lebt der heute 53Jährige in Berlin und Hamburg, derzeit als Artist in Residence am Thalia Theater. Dort wird er »Barocco« nun gemeinsam mit seinem musikalischen Leiter, Daniil Orlov, weiterentwickeln.
Damals in seinem Moskauer Hausarrest hatte Serebrennikov unvermutet die Schönheit und den Schmerz des Barock für sich entdeckt – eines Zeitalters, welches das Individuum, seine Besonderheit und zugleich seine Todesnähe feierte. »Die Barockmusik war für mich etwas Neues, ganz anders als all die Spielarten der schwermütigen russischen Romantik«, sagt er. »Für mich ist sie sehr zeitgemäß, da gehen Türen zu meiner Gegenwart auf. Die Art, wie hier Emotionen ausgedrückt werden, erschien mir plötzlich vielschichtiger, ambivalenter als die nicht selten etwas simplen Handlungsverläufe traditioneller Opern – fast vergleichbar mit unserer heutigen Zeit. Seit der Postmoderne verknüpfen und überlagern wir gern mehrere Bedeutungsebenen, und die Barockmusik ist ähnlich komplex. Man kann mit dieser engelsgleichen Musik über den Tod nachdenken, über den Schmerz, über Vergeblichkeit und zugleich über die Schönheit von allem. Das Barockzeitalter und seine Musik stehen mit diesen Widersprüchlichkeiten und Uneindeutigkeiten für die grundsätzliche comédie humaine.«
Auf die Frage, was es für ihn bedeutet habe, in der Isolation einer kleinen Wohnung irgendwo in Moskau monatelang nur noch Barockmusik zu hören, antwortet Serebrennikov überraschend praktisch und erzählt, wie er die Arien über einen USBStick gehört, wie er recht
Mit der schillernden Schönheit des Barock feiert Kirill Serebrennikov die Einzigartigkeit des Individuums und das Feuer der Hoffnung.
schnell die Idee zu einem Gesamtkunstwerk entworfen habe, obwohl sein Theater eigentlich gar kein Geld gehabt hätte. Hat ihn diese Musik glücklicher gemacht? »Glück oder Unglück, Traurigkeit oder Freude – das sind nicht die Kategorien. Ich glaube, dass mir diese Musik zwischen der grauen, hässlichen Wirklichkeit, mit der ich mich in den letzten Jahren auseinandersetzen musste, und der Flucht in die Phantasmagorie den Zugang zu einer ›dritten Welt‹ geschenkt hat, zu einer Welt der Kunst und der Freiheit. Das hat mir sehr geholfen.«
BAROCK ALS PRINZIP: DIE FEIER DES BESONDEREN
Ich wende ein, dass man angesichts seiner damals politisch wie persönlich bedrückenden Lage die Hinwendung zur Künstlichkeit des Barocks eher bizarr und exzentrisch finden könnte. Nach einer kurzen Stille holt
Serebrennikov etwas aus: Das Wort barocco stamme aus dem Portugiesischen und bezeichne eine Perle mit unregelmäßiger Form; sie passe nicht auf eine Schnur, sei eigenartig, schief, ein bisschen verrückt, wie ein interessanter Fehler – und beanspruche dennoch, im Zentrum zu stehen. So sei der Mensch in seiner Seltsamkeit. Er lasse sich nicht in Systeme einordnen, widersetze sich allem, was zu viel Kontrolle über sein Leben verlangt, ja, er sei – warum leugnen, was doch wahr ist – in diesem Sinne exzentrisch.
So gesehen sei »Barocco« nicht nur ein Zeitalter, sondern ein Prinzip – ein Prinzip des Individualismus, wie es
Gilles Deleuze entwickelt habe, gültig von Tiepolo über Andy Warhol bis hin zu David Bowie oder Grace Jones’ »Pride«. Wir fragen uns, was Monteverdi oder Vivaldi dazu sagen würden, verlieren uns ein wenig in Debatten über das Ornamentale und über Oscar Wilde, und kommen dann doch zum Kern zurück. »Es geht um den Kampf darum, einzigartig sein zu dürfen. Das ist der Kampf gegen ein System der Unterdrückung, wie ich es erfahren habe«, sagt Serebrennikov. »Im Barock versucht jeder Mensch, der eine ungewöhnliche, eine abweichende ›Perle‹ ist, sich selbst als jemand zu behaupten, der ein Recht auf seine besondere Existenz hat, kurz: Es geht um Macht.«

Die Feier des Lebens beinhaltet aber auch die des Todes. Die Moskauer Aufführung zeigte eine berühmte Szene aus Andrei Tarkowskis Film »Nostalghia«: Da verbrennt sich ein Verrückter zu Beethovens »Freude, schöner Götterfunken« – eine ungeheuerliche Szene. Serebrennikov: »Das Motiv des Feuers spielt in der Inszenierung tatsächlich eine große Rolle. Buddhistische Mönche haben sich in Vietnam 1963 selbst verbrannt, um einen Diktator zu vertreiben (sie waren erfolgreich), Jan Palach hat sich 1969 auf dem Prager Wenzelsplatz verbrannt, um gegen die Invasion der Sowjetunion zu protestieren (und ist gescheitert). Manche Menschen möchten offenbar lieber sterben, als sich selbst aufzugeben, und ertragen dafür
große Schmerzen. Feuer ist Schmerz und Schönheit zugleich, es ist zerstörerisch und Vorschein von etwas Neuem. Ich will in ›Barocco‹ davon erzählen, wie Menschen ihr Leben riskiert haben, weil sie die unverwechselbare Einzigartigkeit des Menschen nicht aufgeben wollten. Deshalb ist es für mich ein musikalisches Manifest.«
Der Form nach hingegen ist »Barocco« eine Oper ohne feststehendes Libretto, ein Musiktheater, das an einer Schauspielbühne herauskommt, ein Abend mit Arien des Barockzeitalters, eine Aufführung mit singenden Schauspielern, mit dem Opernstar Nadezhda Pavlova, die noch nie an einer Schauspielaufführung beteiligt war, aber bei den Salzburger Festspielen die Donna Anna gesungen hat, mit Tänzern, einem Barockmusik spielenden Streichquintett, einer Band aus dem Hier und Heute, einem Pianisten etc. pp. – ja, was ist es eigentlich?

»Die Form des Abends ist tatsächlich ungewöhnlich«, sagt Serebrennikov. »Ich wollte ein Gesamtkunstwerk schaffen, das aber zugleich ein Pasticcio ist, bei dem viele verschiedene Einzelteile etwas Neues ergeben, das es zuvor so noch nicht gegeben hat.« Pasticcio, wende ich ein, klingt edel, ist aber, um ins banal Wörtliche abzudriften, schlicht ein Auflaufgericht der mediterranen Küche.
Zugegebenermaßen schmeckt im Auflauf oft vieles besser als einzeln zubereitet, dennoch: Ist das nicht respektlos im Umgang mit dem Werk der Komponisten? »Nein«, sagt
der musikalische Leiter und Pianist Daniil Orlov, der am Moskauer Konservatorium und am Bolschoi studiert hat: »Das Genre des Pasticcio gibt es nicht nur schon lange, es ist sogar im Barockzeitalter entstanden. Und es existiert bis heute. Berühmt dafür ist etwa der Dirigent William Christie mit seinem Barockensemble Les Arts Florissants –er kombiniert Verschiedenes und schafft sehr organisch etwas faszinierend Neues.«
Für Hamburg entwickeln Kirill Serebrennikov und Daniil Orlov »Barocco« nun weiter, Themen fortschreibend, neues Material hinzufügend, anderes weglassend: »Es ist seither so viel passiert, und es ist natürlich etwas anderes, das Stück für ein westeuropäisches Publikum weiterzudenken. Aber das grundsätzliche Thema bleibt: Das Feuer, das Licht bringt und wärmt, aber auch Altes zum Verschwinden bringt – es lässt mich nicht los.« Vor vier Jahren aus Protest gegen die Unterdrückung entstanden, ist »Barocco« zugleich eine Feier der menschlichen Möglichkeiten und ihrer Unzerstörbarkeit. Und es erzählt heute, in einer neu verfinsterten Welt, von Menschen, die im Feuer verbrennen, die selbst zur Flamme werden, um eine mögliche Zukunft zu erleuchten.
BAROCCO Do, 25.5.2023 | 20 Uhr
Thalia Theater
Kirill serebrennikov (Regie, Bühne, Kostüm)
Daniil orlov (Klavier, Musikalische Leitung)
nadezhda Pavlova, yang Ge, svetlana Mamresheva (sopran) odin Biron, Felix Knopp, João Victor, Tilo Werner, Viktoria Trauttmansdorff (schauspiel)
The young Classx u. a.
Kirill serebrennikov: Barocco – ein musikalisches Manifest mit Musik von Bach, händel, Lully, Monteverdi, Rameau, Vivaldi u. a.
Weitere Vorstellungen: 26., 28., 29. und 30.5. sowie 25. bis 27.6.
»Feuer ist Schmerz und Schönheit zugleich, es ist zerstörerisch und Vorschein von etwas Neuem.«

Nicht etwa in einer delikaten Sammlung antiker Liebeslyrik findet sich diese glühende Poesie, sondern in einem heiligen Buch – im »Buch der Bücher«, im Alten Testament der Bibel: »Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht hinweg.« (Hohelied 8, 6–7)
Das »Hohelied der Liebe« – nach dem als Verfasser geltenden König von Jerusalem auch das »Hohelied Salomos« genannt – ist eine faszinierende Dichtung, ein kulturübergreifender Mythos. Genaue Herkunft und Datierung sind nicht letztgültig geklärt, was freilich der beispiellosen Karriere dieser Verse nicht im Wege stand. Kaum ein anderer Text war bis heute so einflussreich auf die nachfolgende Literatur, wurde so oft adaptiert, zitiert und vertont wie das »Hohelied« – es ist wahrhaft das »Lied der Lieder«.
Die Textsammlung kreist um die Liebe als treibende Kraft des Lebens, als existenziellstes aller menschlichen Gefühle. Doch was hat diese poetische Feier der irdischen Liebe überhaupt in der Bibel verloren? Schließlich finden sich im »Hohelied« explizit erotische Verse, die das fiebrige Suchen nacheinander und das sinnliche EinanderFinden lustvoll schildern, mit prallen Metaphern die körperlichen und sexuellen Vorzüge der Liebenden preisen. Gott wird im »Hohelied« an keiner Stelle ausdrücklich genannt; nur von den Töchtern Jerusalems ist die Rede.
So elementar die Liebe als menschliche Grundkonstante schon allein durch ihre arterhaltende Funktion ist, so komplex und vielfältig sind ihre erotischen, emotionalen und geistigen Spielarten. Ihre großen Mythen und Erzählungen wie eben das »Hohelied«, aber auch der Orpheus und der PygmalionMythos, wandeln sich im Laufe der Zeiten, werden über Generationen und geo
grafische Grenzen hinweg weitergetragen, finden andere Ausprägungen, verändern sich in unterschiedlichen Kulturen mit ihren je eigenen Lesarten. Sie werden gedeutet, geistig sublimiert, allegorisch überhöht, aber auch reglementiert durch Religionen und gesellschaftlich normierte Moralvorstellungen.
Das Christentum, das sich gerne als »Religion der Liebe« bezeichnet, setzt dem alttestamentlichen »Hohelied Salomos« im Neuen Testament ein zweites »Hohelied der Liebe« entgegen (im ersten Korintherbrief des Paulus), in dem jedoch die erotische, körperliche Liebe ausgespart wird. Stattdessen werden hier ganz andere Qualitäten gepriesen: »Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. (…) Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.« (1. Kor 13, 4–7) Paulus versteht die Liebe als eine Säule des segensreichen Dreiklangs aus Glaube, Hoffnung und Liebe – und mehr noch: »Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.« (1. Kor 13, 13)
Flüchtig betrachtet mag es also scheinen, dass die erotische Liebe im Alten Testament (nicht nur im »Hohelied«) noch unbefangen geschildert und dichterisch gefeiert wird, während das Christentum des Neuen Testaments seine Aufmerksamkeit eher der domestizierten Form der Liebe in der Ehe zuwendet. Doch so einfach ist es nicht. Denn das »Hohelied Salomos« war schon an sich keineswegs ein Solitär, sondern beeinflusst von vielen Strömungen und Kulturen. Der Text ist zwar der berühmteste seiner Art, fügt sich letztlich aber nahtlos in die Tradition der Liebespoesie des östlichen Mittelmeerraumes ein, vor allem der griechischen, aber auch der sehr viel früheren ägyptischen Poesie. Gerade in Ägypten gab es schon seit etwa dem 13. Jahrhundert v. Chr. vergleichbare Dichtungen. Eine weitere Blüte erlebte die Liebesdichtung in der griechischen Antike zu Zeiten Homers im 8. Jahrhundert v. Chr. Die Dichtung Israels profitierte offenbar von beiden Traditionen.
Kaum eine Liebeslyrik hat so viel Musik inspiriert wie das biblische »Hohelied des Salomo«.
The Tallis Scholars singen eine Auswahl von der Renaissance bis in die Gegenwart.
Laut biblischer Darstellung war König Salomo im 10. Jahrhundert v. Chr. als Nachfolger seines Vaters David Herrscher des vereinigten Königreichs Israel und der Erbauer des ersten jüdischen Tempels in Jerusalem. Er öffnete sein Reich anderen Kulturen und Religionen, was ihm hohes Ansehen verschaffte; seine Regentschaft wird von der Forschung als »salomonische Aufklärung« bewertet.
Salomo gilt zwar traditionell als Autor mehrerer biblischer Schriften, darunter das »Hohelied«; in der jüngeren Forschung jedoch nimmt man an, dass er allenfalls Sammler oder Auftraggeber eines Teils der »Sprüche Salomos« war. Unter der arabischen Namensform Sulaiman tritt er auch im Koran auf, wo ihm übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben werden. Im orientalischen Volksglauben, wie er etwa in »Tausendundeiner Nacht« tradiert ist, gilt er unter dem Namen Soliman als Inbegriff der Weisheit. Das abendländische Mittelalter wiederum sieht in ihm ein Idealbild des christlichen Herrschers, den gerechten König; so stellte etwa Kaiser Karl IV. im 14. Jahrhundert seine Regentschaft mit unter das Leitbild Salomos.
Mit Salomo war auch das ihm zugeschriebene »Hohelied« im Mittelalter nach wie vor präsent und wirkte tief in die christliche Ikonografie hinein. Doch nicht nur das: Die Forschung vermutet, dass der Text durch seinen expliziten Gebrauch erotischer Bilder damals auch als Legitimation für profane Liebesdichtung fungierte.
Die Parallelen des »Hohelieds« zu einem der ältesten erhaltenen Liebesgedichte in deutscher Sprache drängen sich jedenfalls auf: »Dû bist mîn, ich bin dîn: / des solt dû gewis sîn. / dû bist beslozzen / in mînem herzen, / verlorn ist daz sluzzelin: / dû muost ouch immêr darinne sîn.«
Auch und vor allem in der Musik lassen sich die Spuren des »Hohelieds« bis an die prominentesten Stellen verfolgen: In der »Matthäuspassion« übernimmt Bachs Textdichter Picander zu Beginn des zweiten Teils in der AltArie das »Hohelied« in Teilen sogar wörtlich und schreibt es fort, wenn der Chor der Altstimme auf ihre Frage »Ach, wo ist mein Jesus hin?« mit Salomos Worten antwortet: »Wo ist denn dein Freund hingegangen, O du Schönste unter den Weibern?«
Dieses Verfahren, die erotische Dichtung allegorisch umzudeuten, das vermeintlich Profane als Bild für etwas Höheres zu interpretieren, war Jahrhunderte lang gängige Praxis. So entstand eine Auslegungsgeschichte, in der immer wieder neue religiöse Zuordnungen gefunden bzw. konstruiert wurden. Das im »Hohelied« beschriebene Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau meint in der allegorischen Deutung des Judentums die Beziehung Gottes zu seinem Volk Israel. Und in der christlichen Tradition wurde die ekstatische Verbindung der Liebenden analog auf die Verbindung Christus’ zu seiner Kirche oder der mystischen Einheit der Seele mit Gott ausgedeutet.
Auf diesem Weg fanden die sinnlichen Texte ihren Weg in den biblischen Kanon, nur eben in einer theologischen, »entschärften« Deutung: Mann und Frau oder Braut und Bräutigam aus den Texten des »Hohelieds« wurden zum Sinnbild der Liebe zwischen Gott und seinem Volk oder zwischen Christus und einer gläubigen Seele. Seit dem Mittelalter sah man im weiblichen Part sogar die Gottesmutter Maria als gütige Mittlerin zwischen Himmel und Erde.
THE TALLIS SCHOLARS
Mo, 15.5.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
The Tallis scholars, Peter Phillips
»Das hohelied der Liebe«: Werke von heinrich Isaac, orlando di Lasso, sebastián de Vivanco, Francis Poulenc, Judith Weir u. a.

Braut und Bräutigam aus dem »Hohelied« wurden zum Sinnbild der Liebe zwischen Gott und seinem Volk.
Rund um diesen mythischen, erotischen, biblischen Text hat das britische Vokalensemble The Tallis Scholars nun ein eigenes Konzertprogramm zusammengestellt. Für den Gründer und Leiter, Peter Phillips, war die Auswahl der Werke nicht einfach: »Das ›Hohelied‹ hat einige der schönsten Liebeslieder des geistlichen Chorrepertoires inspiriert. Wir haben bereits einiges davon gesungen, viele herrliche Beispiele von der Vier bis zur Achtstimmigkeit. Für diesmal habe ich vor allem Stücke gewählt, die nicht nur die besten Kompositionen von der Renaissance bis zur Gegenwart präsentieren, sondern sich auch in den Überbau dieses vielfältigen Programms einfügen.«
Und diesen Überbau sieht Phillips in einer ganz besonderen Verbindung der gewählten Werke über die Jahrhunderte hinweg: »Es ist schwer zu sagen, was genau dazu führt, dass moderne geistliche AcappellaMusik gut zur Polyphonie der Renaissance passt. Vielleicht, dass die Texte auf Latein sind und die Klangwelt rein vokal ist? Es muss noch etwas mehr sein. Ein unterschwelliger Respekt vor den Texten? Etwas, das in seinem Kern still ist?
Wenn man zeitgenössischen Komponisten wie Arvo Pärt, John Taverner, Nico Muhly oder Judith Weir lauscht, erkennt man sofort, dass es da einen roten Faden hin zu Leuten wie Heinrich Isaac und Orlando di Lasso gibt.« Peter Phillips’ Beschreibung – »etwas, das in seinem Kern still ist« – trifft womöglich nicht nur eine die Jahrhunderte überbrückende, geheimnisvolle Gemeinsamkeit der Werke seines neuen Programms. Sondern vielleicht auch das Verbindende zwischen dem weltlichen und dem spirituellen Verständnis des »Hohelieds«. Nämlich die Erfahrung dessen, was die Religionswissenschaft als das »Numinose« beschrieben hat: der Eindruck des Erhabenen, Überwältigenden, die Offenbarung eines Wesens oder einer Kraft, die über dem umtriebigen Menschen und der elementar waltenden Natur steht. Das, was staunen macht und stumm werden lässt. Und in seinem Kern still ist.

HANNAH PEEL

VON LAURA ETSPÜLER
»Vor ein paar Jahren hatte ich eine ziemlich schwierige Trennung«, erinnert sich der Countertenor

Jakub Józef Orlin´ski. »Damals war ›Fix you‹ von Coldplay einer meiner Lieblingssongs.« Lights will guide you home, Lichter leiten dich nach Hause, haucht Frontman
Chris Martin darin über der gleißenden SynthieOrgel. Und ich versuche, dich zu heilen. »Der Song half mir, meine Gedanken zu sortieren. Es klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber die Musik hatte tatsächlich einen sehr positiven, reinigenden Effekt auf mich.« Beruflich ist der begehrte Sänger und Breakdancer andauernd in Liebesdramen verstrickt: Als Orfeo (Monteverdi) holte er in der Elbphilharmonie kürzlich seine Geliebte aus der Unterwelt, im Mai verliert er sie als entmachteter Ägypterkönig Tolomeo (Händel). Den vielen Gesichtern der Liebe hat er sogar ein ganzes Album gewidmet, »Facce d’amore«. »Ich singe ja ständig Liebeslieder für so viele Leute, in all meinen Programmen. Aber ich gebe zu: Einmal habe ich auch ein modernes Liebeslied für jemanden gesungen. Es ging nicht gut aus. Aber einen Versuch war es wert!«
»Liebeslieder sind wie ein akustisches Tagebuch des Lebens, der Stimmungen, der Wellenbewegungen einer Beziehung. Wie könnte ein einziger Song das Ausmaß von Liebe fassen?« Hannah Peel ist Komponistin, Klangforscherin und naturgemäß keine Freundin von Vereinfachungen. Sie hantiert mit Synthesizern und Spieluhren und hat schon Soundtracks für »GameofThrones«Dokumentationen produziert, kantige AmbientTracks und Alben mit Alzheimer oder YogaFokus. Schließlich fällt der »Queen of headphone dreamscapes« (The Arts Desk) doch ein Lieblingslovesong ein: Jeff Buckleys »Last Goodbye« von 1994. »Seit ich ihn als Teenager gehört habe, komme ich immer wieder darauf zurück. Jedes Mal durchlebe ich dann aufs Neue die Phase, in der man zum ersten Mal die Wucht der Gefühle spürt – das erste Verliebtsein, in dem Kopf und Körper völlig überfordert sind von dem Hormonbündel, das man in diesem Alter ist.«
Sara Correia spricht nicht wie eine 29Jährige. Sie hat den Fado in den Genen, Portugals wehmütige Nationalmusik, für deren glühenden Vortrag sie schon als 13Jährige gefeiert wurde. »Meine Wahrheit zu singen: Das ist die Essenz des Fado. Du musst ihn in den Knochen spüren und nach außen tragen, als Schrei, als Klage, als Ausdruck deines tiefsten Wesens.« Ein bisschen Wahnsinn, ein bisschen Weltschmerz, das steckt auch in ihrem Lieblingsliebeslied, einem Popsong ihres Landsmannes Pedro Abrunhosa: »›Tudo o que eu te dou‹ (Alles, was ich dir gebe) ist eine Hymne an die Liebe«, so Correia. »Die Worte sind mit so viel Sorgfalt und Eleganz verwoben. Sie zeigen, worum es in der Liebe wirklich gehen sollte: um’s Geben.« Töte mich mit deiner Liebe oder lass mich frei, ächzt Abrunhosa. Ein Vers wie ein Fallbeil, ganz wie im Fado. Liebe ist halt nichts für Feiglinge.

Was hören Musiker, wenn sie verliebt sind? Sieben Offenbarungen.

»Ich bin wohl ein seltsames Mädchen, das sich nicht für Liebeslieder interessiert«, entschuldigt sich die Jazzpianistin Sylvie Courvoisier. Seit mehr als 20 Jahren lebt die Schweizerin in New York. Ihre Art, Musik wahrzunehmen, ist intellektuell geprägt: »Ich benutze Musik nicht als Trostpflaster oder emotionale Krücke. Eher ist sie für mich wie Meditation, eine Erkundungsreise. Die Schönheit einer Darbietung von Martha Argerich oder Thelonious Monk mag mich emotional berühren, aber es ist wahrscheinlicher, dass ich weine, wenn ich einen Film oder ein Gemälde betrachte, als wenn ich ein trauriges Lied höre. Allerdings hilft mir Musik dabei, schmerzhafte Gefühle zu überwinden: Ich übe und tauche in Klänge ein, um den Kummer hinter mir zu lassen.«


Rolando Villazón windet sich. Zu viele Liebeslieder hat der Mexikaner in seinem langen Tenorleben gesungen. »Da kann ich mich gar nicht entscheiden!« Zwei seiner Helden nennt er dann doch: Der eine ist Silvio Rodríguez, die glockenhelle SängerIkone der kubanischen Revolution, die noch heute von vielen Linken in Lateinamerika verehrt wird. Villazón hat einige seiner Lieder auf CD aufgenommen. »Mittlerweile habe ich ihn sogar persönlich kennengelernt.« Mit aufs Podest muss aber unbedingt auch die »Abendempfindung« von Wolfgang Amadeus Mozart. Viele Erinnerungen verbindet Villazón mit diesem Stück, »Emotionen, die Mozarts Musik jedes Mal in mir auslöst. Für mich ist er der allerwichtigste Komponist, er bedeutet mir so viel. Ich habe neun seiner Opern gesungen, alle Konzertarien, das Requiem – und dieses Lied ist ein absolutes Meisterwerk. Ich liebe es sehr.«
WU WEI
»Ich bin in einer Kleinstadt in der chinesischen Provinz Jiangsu aufgewachsen«, erzählt der Multiinstrumentalist Wu Wei. »1982 starben meine Großeltern, mein Vater verkaufte ihr Haus. Von dem Geld besorgte er zuallererst einen Kassettenrekorder. Auf diesem Rekorder habe ich zum ersten Mal den melancholischen Klang der Laute Erhu gehört. Das Stück hieß ›Xin Hunbie‹, übersetzt etwa ›Die Trennung der Frischvermählten‹. Bis heute kann ich es nicht vergessen. Die Melodie ist elegant und schwermütig, ihre Schönheit ist für mich unbeschreiblich.« Wu Wei lebt seit mehr als 25 Jahren in Berlin. Die Erhu war zwar seine erste Liebe, doch seine größte ist die Sheng: eine 3.000 Jahre alte Mundorgel, fast vier Kilo schwer, ein armlanger Apparat aus BambusPfeifen, Mundstück und Klappen. Alles kann Wu Wei mit seinem Instrument ausdrücken, er spielt Minimal und Jazz, GagakuMusik aus dem 7. Jahrhundert und Bachs »GoldbergVariationen«. Sogar ein passendes Liebeslied fällt ihm ein: »An diesem fernen Ort«, eine Weise aus China. »Ein junger Mann vermisst seine Geliebte, doch die ist weit weg.«
»Ich bin eine gespaltene Persönlichkeit«, gibt die französische Dirigentin Laurence Equilbey zu. »Einerseits liebe ich die Abstraktion, die bildende Kunst und die Architektur. Auf der anderen Seite bin ich sehr romantisch – sensibel, utopisch, hingebungsvoll. Ich liebe Bach, Ligeti und Schumann zugleich.« Das schönste Liebeslied begegnete Equilbey jedoch weitab des Klassikkanons, im schwermütigen IndiePop des zauseligen Iren Damien Rice. »Sein ›Accidental babies‹ begleitet mich schon sehr lange, es handelt von einer Trennung. Rice singt nuanciert, mit großer Genauigkeit und außergewöhnlichen Harmonien. Wie im klassischen Lied herrscht hier eine Ökonomie der Mittel: nur seine Stimme und das Klavier. Ich lege den Song auf, wenn ich traurig bin, und paradoxerweise fühle ich mich dann gut. Es ist wie eine süße Klage, die durch die Magie der Wiederholung langsam verblasst.«

Es existieren professionelle VideoAufnahmen von Julian Lage, die den Gitarristen am Anfang seiner Karriere vorstellen. Ganz am Anfang. Die Dokumentation »Jules at Eight« zeigt einen Achtjährigen, der Blues und Jazz spielt, ohne je prüfend auf sein Griffbrett zu schauen. Seine Mitmusiker sind einige Jahrzehnte älter. Seine Abgeklärtheit ist kaum zu fassen. Lages Gesichtsausdruck in dem Film von 1996 unter scheidet sich kaum von seiner Mimik bei heutigen Konzerten: Große Augen schweifen staunend durch den Raum. Als wundere sich Lage selbst über das, was da aus den Lautsprechern kommt.
Fast 30 Jahre später ist Julian Lage beinahe so etwas wie ein Star – sofern man unter den als frugal geltenden Jazzmusikern eine Liga unterhalb der Hancocks und Methenys überhaupt ein Star sein kann. Der Gitarrist war für drei Grammys nominiert, bei Spotify wurden seine Songs mehr als zehn Millionen Mal gestreamt. Ein Musiker, der die Grenzen von Blues und Jazz längst überwunden hat. In seinem Sound finden sich Bebop, früher Rock’n’Roll und Surf Music, garniert mit der Raffinesse
eines FlamencoVirtuosen und dem Twang eines AmericanaAltmeisters.
Seine Alben erscheinen mittlerweile beim renommierten Label Blue Note; das jüngste, »View With A Room«, wurde von der »Süddeutschen Zeitung« als »perfektes zeitgenössisches Jazzgitarrenalbum« bezeichnet –und prompt kam unter dem Titel »The Layers« ein Nachschlag mit sechs weiteren Nummern aus derselben Aufnahmesession heraus. Lage war mit seinem eingespielten Trio um den Kontrabassisten Jorge Roeder und den Schlagzeuger Dave King im Studio. Als Gast und viertes Bandmitglied tritt ein gewisser Bill Frisell auf, einer der gefragtesten Gitarristen der Welt. Dabei macht das Label um dieses Gastspiel kein großes Gewese. Es scheint fast, als sei eine solche Zusammenarbeit nur eine Zwischenetappe, wie sie zwangsläufig während der Entwicklung eines Supertalents passiert.
Julian Lage wurde 1987 in Santa Rosa nördlich von San Francisco geboren. Die Bezeichnung »Wunderkind« hat ihn während der ersten Hälfte seines Lebens stets begleitet. Schon mit sechs Jahren gab er öffentliche
Der Gitarrist Julian Lage verbindet Blues, Jazz und Rock’n’Roll mit lässiger Leichtigkeit – besonders bei seinen Konzerten.
VON
Große Augen schweifen staunend durch den Raum. Als wundere sich Lage selbst über das, was da aus den Lautsprechern kommt.

Konzerte, Carlos Santana holte ihn für ein Duett auf die Bühne. Es folgte die Oscarnominierte Doku »Jules at Eight«. Als er 15 Jahre alt war, gab er einen JazzWorkshop an der Stanford University. Im Elternhaus wurde er gefördert, aber nie gedrängt. »Es gab keinen Druck«, erzählte Lage in einem Interview. »Es war eher so: ›Warum übst du nicht Gitarre?‹«
Lage wurde Sideman von Größen wie Gary Burton, es gab DuoPlatten mit dem AvantgardeGitarristen Nels Cline und dem Pianisten Fred Hersch. Stets wählte der Kalifornier dafür die akustische Gitarre. Erst seit 2016 spielt Lage überwiegend elektrisch verstärkt, mit Vorliebe auf einer 1954er Fender Telecaster. Seitdem ist er auf zahlreichen Alben des New Yorker Allroundkünstlers John Zorn zu hören – und trat auch 2022 als Teil von dessen Entourage beim »Reflektor John Zorn« in der Elbphilharmonie auf.
Das einstige Wunderkind hat sich die Spontaneität und vielleicht sogar etwas von der Naivität des achtjährigen Jules bis heute bewahrt. Für seine Alben verwendet der mittlerweile 35Jährige fast immer den ersten oder zweiten Take; endlose StudioTage oder nachträgliche Overdubs gibt es bei ihm nicht. Kaum etwas interessiert ihn so wenig wie Klangperfektion. Über George Barnes und Charlie Christian, frühe Pioniere der elektrischen Gitarre, sagt Lage: »Sie hatten eine gewisse Sprunghaftigkeit. Ihr Sound ist sowohl schön als auch scharfkantig; gedämpft und warm, aber auch grobkörnig.«
Diese Liebe zu unfertigen, rohen Klängen empfand Lage schon früh: beim Auflegen alter Bluesplatten. Als Kind hörte er Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan und Eric Clapton, ehe ihm ein Lehrer InstrumentalGenies wie Jim Hall nahebrachte. Jazzmusiker spielten eine zunehmend größere Rolle in Lages Studium, was sich bald auch in seinem Ton niederschlug: »Sein Sound hat die Wärme von Joe Pass, die Schärfe von Les Paul und die Gewandtheit von beiden«, schrieb ein OnlineMagazin.
Musician’s musician nennt man im Englischen einen Künstler, bei dem Kollegen sich Dinge abschauen. Lage ist so einer. Doch er stapelt tief, wenn er auf die virtuosen Fertigkeiten an seinem Instrument angesprochen wird: »Technik ist wie das Wetter. Du sagst dir ja morgens auch nicht: Heute arbeite ich am Wetter. Du arrangierst dich damit, wie es ist.«
Lauscht man dem fröhlich plaudernden Gitarristen beim PodcastGespräch mit einem Kollegen im New Yorker Central Park, nimmt man ihm solche Bescheidenheit tatsächlich ab. Lage mag »einer der schillerndsten Improvisatoren der Welt« (The New York Times) sein; er könnte auf der Gitarre wohl fast alles spielen, Hendrix’sche Kunststücke genauso wie minutenlange FrankZappaSoli, aber der Punkt ist: Er will das gar nicht.
Wer Lage live erlebt, erlebt stets ungefilterten Enthusiasmus, eine jugendlich wirkende Begeisterung für seinen Job. Der Mann sprüht nur so vor Verspieltheit. Mit soviel Verve geht er sowohl an Eigenkompositionen als auch hundert Jahre alte Standards heran. Einem RoyOrbisonSchmachter wie »Crying«, den Lage mit viel RockabillyTwang interpretiert, würde er aber nie den

»Technik ist wie das Wetter. Du sagst dir ja morgens auch nicht: Heute arbeite ich am Wetter. Du arrangierst dich damit, wie es ist.«
VirtuosenStempel aufdrücken: »Ich glaube, ich spiele Songs, die ich wirklich, wirklich liebe, viel besser als Songs, die ich nur schätze. Die Liebe zu einem Song bewahrt dich davor, ihm jemals wehzutun.«
Das aktuelle Album »View With A Room« ist, ähnlich wie seine Vorgänger, ein zugleich abenteuerlustiges und gefühlvolles Album, dabei aber eine Nuance zurückhaltender. Julian Lage weiß schließlich, was er kann. Es ist sein achtes Album und das zweite mit dem Drummer Dave King (The Bad Plus) und seinem alten Freund Jorge Roeder am Bass – zwei Musiker, die der Gitarrist als »irrwitzig gut« bezeichnet. »Ich bin der Bandleader, aber erst mit den beiden erwacht die Musik zum Leben«, sagt er. »Für sie wurde diese Musik geschrieben. Das Songwriting ist nur der erste Schritt. Der zweite ist Konversation, das kann man nicht oft genug betonen.«
JULIAN LAGE TRIO

Do, 4.5.2023 | 20:30 Uhr Elbphilharmonie Kleiner Saal
Julian Lage (Gitarre)
Jorge Roeder (Kontrabass)
Dave King (schlagzeug)
Die »Süddeutsche« kommentierte kürzlich, Lages Instrument klinge stets so roh und unverfälscht, »als hätte er es gerade eben in einer Bar in den Verstärker gestöpselt«. Auch in der deutlich geräumigeren Elbphilharmonie wird diese Rohheit wohl zu spüren sein. Es wird ein Musiker zu sehen sein, der seit seinem fünften Lebensjahr fast keinen Tag ohne Üben zugebracht hat. Der die forschen Ausbrüche eines Rock’n’Rollers mit den zärtlichen Improvisationen eines Jazzers zu verschmelzen weiß. Der stets seinen Bandkollegen zugewandt ist, oft mit breitem Grinsen. Den die pure Lust am Spielen umtreibt. Ein Musiker, in dem der achtjährige Junge noch immer präsent ist.

Mit ihrem neuen Rollenverständnis schafft die Kora-Spielerin Sona Jobarteh eine lebendige Verbindung zur Vergangenheit.
VON STEFAN FRANZENeit dem 12. Jahrhundert, seit der Blütezeit des MandeImperiums, fungieren die Griots als Bewahrer und Träger der westafrikanischen Kultur durch Gesang, Dichtung und Musik. Diese Funktion füllten schon immer beide Geschlechter aus, doch waren die Aufgaben stets klar verteilt: Während der beeindruckend majestätische und leidenschaftliche Gesang überwiegend aus Frauenkehlen kam, war das Spiel auf der Kora strikt den Männern vorbehalten. Doch mittlerweile wankt das Rollenverständnis: Die 1983 in London geborene und aufgewachsene Gambierin Sona Jobarteh ist tatsächlich die erste Frau, der mit der 21saitigen Stegharfe eine internationale Karriere gelungen ist.
Die von der Atlantikküste bis tief hinein in den Sahel weit verzweigte GriotSippe der Jobarteh (im frankophonen Afrika: Diabaté) ragte immer wieder mit großen KoraVirtuosen heraus. So war auch Sona Jobartehs Großvater, Amadu Bansang Jobarteh, eine führende Persönlichkeit der gambischen Musikgeschichte. Doch die Enkelin betont immer wieder gerne, dass auch ihre Großmutter ihr wichtige Impulse gegeben hat, indem sie sie zum Singen aufforderte. Tatsächlich findet sich in ihrem Repertoire auch ein Loblied auf die Oma, mit tiefempfundenen Vokallinien, in denen es immer wieder Anklänge an den GriotGesang mit seinen kräftigen, schneidenden Phrasen gibt – auch wenn Sonas Stimme eigentlich einen zarten, empfindsamen Grundcharakter besitzt.
»Ich wollte meinem Herzen folgen und mich nicht einfach in die herkömmlichen Schemata fügen«, betont Jobarteh. Die charismatische, hochgewachsene Frau mit dem wachen Blick kam über Umwege zu ihrem Instrument. Als Tochter einer Engländerin und eines Gambiers ist sie in ihrer Londoner Schulklasse die einzige dunkelhäutige Schülerin. Harte Jahre, erinnert sie sich. Die Musik hilft bei der Identitätsfindung. Zunächst studiert sie klassisches Cello und Komposition. »Auf dem Instrument fühlte ich mich aber sehr weit von meinem afrikanischen Erbe entfernt«, erzählte sie einmal. »Im Fach Komposition konnte ich eher eine Brücke zur afrikanischen Musik schlagen.« Die eigentliche Faszination für die Jugendliche strahlt jedoch das Instrument ihres älteren Bruders aus: Die Kora zieht sie magisch an.
Zwar lebt ihr Vater, der KoraSpieler Sanjally Jobarteh, schon lange getrennt von der Mutter in Gambia. Doch jetzt sucht sie ihn auf, denn sie will von ihm das lernen, was bisher nur an männliche Nachkommen weitergegeben wurde. »Mein Vater sagte zu mir:
»Ich wollte meinem Herzen folgen und mich nicht einfach in die herkömmlichen Schemata fügen.«
›Wenn du das wirklich willst, dann sorge dafür, dass du eine gute KoraVirtuosin wirst und nicht einfach die erste Frau, die auf der Kora spielt. Dann gebe ich dir all mein Wissen weiter.‹ Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, dass er Vertrauen in mich hatte.« Und weiter: »Es geht auf der Kora nicht nur um Technik. Du musst diese Jahrhunderte alte, mündlich überlieferte Tradition verinnerlichen, und das dauert viele Jahre.« Gerade dieser orale Aspekt reizte sie wieder, nachdem sie die westliche Musik studiert hatte, in der mündliche Überlieferung kaum eine Rolle spielt, fast alles schriftlich fixiert wird.
2010 entwickelt Sona Jobarteh eigens für ihren Soundtrack zum Dokumentarfilm »The Motherland« einen InstrumentenZwitter aus Kora und der Spießlaute Ngoni, einem Vorläufer des Banjos. In dieser Filmmusik verknüpft sie pionierhaft europäische Klassik mit westafrikanischer Tradition. Das öffnet ihr Türen: Plötzlich ist sie in Hollywood gefragt, wird als Vokalistin in mehreren Filmen verpflichtet, darunter »Mandela: Long Walk to Freedom« (2013) und die TVSerie »Roots« (2016). Die schönste Frucht ihrer Arbeit kann sie jedoch mit ihrem

Debütalbum »Fasiya« (2015) ernten. Es ist eine eindrucksvolle Sammlung von Traditionals und Eigenkompositionen, in denen sie die gambische Tradition in ein neues Klanggewand kleidet, uralte Überlieferungen in eine zeitgemäße Sprache mit Folk und Akustikpop übersetzt.
Die Weltbürgerin, die London ihre Heimat nennt, aber ihre Wurzeln in Gambia sieht, engagiert sich schließlich auch ganz konkret für den kleinsten der afrikanischen Staaten: 2015 gründet sie ihre Gambia Academy of Music and Culture im Dorf Kartong nahe der senegalesischen Grenze – es ist das erste Kulturzentrum des Landes seiner Art. Hier verwirklicht Sona Jobarteh ihre Vision: ein Ort, an dem Tradition bewahrt und modernisiert wird, kultureller Austausch stattfindet und soziale Verantwortung spürbar wird. Jungen Menschen, darunter viele Waisen, wird eine profunde musikalische Erziehung ermöglicht, eingebettet in eine umfassende Bildungsarbeit. Das Spiel auf Instrumenten, Gesang, Tanz, Film und MultimediaArbeit wird gelehrt, eine Konzerthalle und eine Bücherei sind geplant. Unter den Studenten sind auch viele junge Frauen, die das Koraspiel erlernen wollen. Sie kommen aber selten aus den GriotClans. »In den GriotFamilien ist die Tradition noch immer streng festgelegt, es gibt viele Restriktionen«, so Jobartehs Einschätzung.
»Du kannst afrikanische Kultur in Europa und Amerika studieren, aber in Afrika findest du dafür keine Institution. Das ergibt für mich keinen Sinn!«, begründet sie ihr Engagement und beklagt, dass viele junge Menschen in Afrika leichter Zugang zu amerikanischem Rhythm & Blues und HipHop haben als zu ihrem eigenen Erbe.
»Ich sehe mich selbst nicht als Brecherin der Tradition. Die Tradition muss sich entwickeln, mit der Menschheit weiterwachsen.«
»Wir können nicht über gesellschaftliche Entwicklung sprechen, ohne die Bildung zu thematisieren. Das gambische Bildungssystem stammt, wie in allen afrikanischen Staaten, noch aus der kolonialen Zeit, in der die Afrikaner nicht ermächtigt, sondern kleingehalten werden sollten. Ich möchte Unterrichtsmethoden entwickeln, mit denen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, in Afrika nicht nur zu überleben, sondern aufzublühen.« Die Investition in Afrikas Zukunft ist für sie heute die wichtigste Aufgabe einer Griotte.
Bei all diesen Aktivitäten muss es fast verwundern, dass Sona Jobarteh nach sieben Jahren Zeit gefunden hat, ihr zweites Album, »Badinyaa Kumoo«, fertigzustellen. Ganz im Gegensatz zu vielen Kolleginnen in Westafrika, die in ihrer Klangsprache auf einen global verständlichen Pop schielen, bleibt Jobarteh trotz zeitgenössischem Soundgewand verankert in der GriotTradition. Und darin gelingt es ihr immer noch, Neues zu sagen – als Komponistin, Performerin und Produzentin in Personalunion. Ein Schaukasten ist das Stück »Musolou« mit dichter Arrangierkunst, perfektem Bandgroove, seelenvollem Sologesang, Backgroundchören, perkussivem Flechtwerk sowie Soli auf Kora und Balafon. Diese Dichte zieht sich durch das gesamte neue Repertoire, an dem auch zahlreiche Gäste Anteil haben, ob im Zwiegesang mit Youssou N’Dour aus dem Senegal oder im feingliedrigen Duo mit dem KoraKollegen Ballaké Sissoko aus Mali, ob im Teamwork mit den Schülern ihrer Academy oder im TêteàTête mit dem kratzstimmigen Falsett des Jemeniten Ravid
Kahalani. Weitere Überraschungen bergen ein Duo mit Bluesharmonika und Jazzsaxofon.
Stets eindrucksvoll, stets geprägt von einer warmherzigen, direkten Ansprache des Publikums sind Jobartehs LiveAuftritte. In ihrem SoloSpiel wohnt eine lebendige Verbindung zur Vergangenheit. In langen Instrumentalstücken brilliert sie mit pointierten, scharf akzentuierten, virtuosen Soli – eine charakterstarke Spielweise, die sich deutlich absetzt von etlichen Kollegen, die eher die fließende Variante bevorzugen. Sie verfügt über eine souveräne und einfühlsame Band, in der vor allem der Perkussionist Mamadou Sarr an Congas und Kalebasse heraussticht. Am Balafon ist ihr Sohn Sidiki Jobarteh zu hören. Geistreich und spielfreudig kommen Dialoge zwischen den Instrumenten zum Zuge, sind von punktgenauem Miteinander, von witzigen TonfürTonImitationen geprägt.
Natürlich legt Sona Jobarteh besonderen Wert auf den Kontakt zum weiblichen Teil ihres Publikums, widmet eine lange Passage ihrer Konzerte der Feier der Frau. »Ich sehe mich selbst nicht als Brecherin der Tradition«, betonte sie mit Nachdruck in einem Interview. »Die Tradition muss sich entwickeln, mit der Menschheit weiterwachsen. Dass ich heute als Frau die Kora spiele, ist absolut notwendig, damit dieses Instrument und diese Musik in unserer modernen Gesellschaft noch Relevanz haben.«
»Geistreich und spielfreudig«: Sona Jobarteh mit Mamadou Sarr
SONA JOBARTEH
So, 21.5.2023 | 17 und 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal sona Jobarteh (Kora, Gesang), eric appapoulay (Gitarre, Gesang), Mamadou sarr (Perkussion, Gesang), andi McLean (Bass, Gesang), sidiki Jobarteh (Balafon), yuval Wetzler (schlagzeug)


Musik war immer in meinem Leben, ich bin mit ihr aufgewachsen. Schon als Kind und Jugendliche war ich oft in der Laeiszhalle oder der Hamburgischen Staatsoper. Die günstigen Karten erwarb ich über den »Kulturring der Jugend«, ein subventioniertes Kulturprogramm der Stadt, das es heute in dieser Form nicht mehr gibt. Wir waren eine Clique von etwa zehn Freunden unterschiedlichen Alters, was sehr spannend war. Auf unseren Plätzen im obersten Rang spähten wir dann immer aus, wie wir uns in der Pause am besten umsetzen können.
Ich wollte unbedingt ein Instrument spielen, am liebsten Cello oder Klarinette, und fragte in der Schule meinen Musiklehrer nach einem Leihinstrument. Er sagte, dass ich für die Klarinette zu klein und zart und als Mädchen sowieso dafür ungeeignet sei – daraufhin wollte ich es natürlich umso mehr und ließ nicht locker, bis es schließlich geklappt hat. Ich fand eine wunderbare Lehrerin, die mich sehr geprägt hat. Nach einer Unterbrechung in meinen Zwanzigern habe ich dann wieder Unterricht genommen und viel Kammermusik gespielt.
Nachdem der Regisseur Max Färberböck mir 2003 überraschend eine Rolle in seinem Film »September« anbot und sich daraus zu meinem großen Glück eine gemeinsame Autorenarbeit entwickelte, musste ich mich entscheiden: Ich konnte nicht gleichzeitig arbeiten, fünf Kinder großziehen und Klarinette spielen. Da kam das Instrument eben zu kurz. Hinzu kam, dass im Vergleich zu den professionellen Künstlern, mit denen ich jetzt arbeitete, mir mein eben doch amateurhaftes Klarinettenspiel auf die Nerven ging. Dafür genieße ich Konzerte nun noch mehr.
Ich liebe Gesang und bin ein großer Fan von Cecilia Bartoli, die ich im vergangenen Dezember sogar in einer Probe in der Elbphilharmonie erleben durfte. Bei der Gelegenheit auch Lea Desandre zum ersten Mal zu hören, war absolut großartig. Ich bin auch neugierig auf neues Repertoire und besitze zwei ElbphilharmonieAbonnements. Das Konzertprogramm ist so vielseitig, dass wirklich jeder etwas finden kann, was ihn fesselt und zu weiteren Besuchen animiert.
Die einzige Einladung, um die ich mich in meinem Leben bisher wirklich gerissen habe, war die Einladung zum Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie im Januar 2017.
Ich habe den Abend sehr genossen, er bleibt für mich unvergesslich. Die Menschen haben sich so unfassbar gefreut, es waren unglaubliche Vibes zu spüren, es war so viel Glück im Raum.
Highlights waren für mich auch zwei Veranstaltungen, die sehr früh, noch lange vor der Fertigstellung der Elbphilharmonie auf der Baustelle stattfanden. Zum einen das »Human Requiem«, das 2012 im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals auf der Plaza im 8. Stock aufgeführt wurde: Brahms’ »Deutsches Requiem«, bei dem sich der Chor gemeinsam mit dem Publikum durch den Raum bewegte – das Konzept hatte Sasha Waltz mitentwickelt. Ich habe früher selbst im Chor gesungen und weiß, wie herausfordernd es ist, singend umherzugehen und nicht bei seiner Stimmgruppe stehen zu können. Für mich war diese Veranstaltung ein geradezu körperliches Erlebnis, auch wir Zuschauer wurden von der Kraft der Musik bewegt, am liebsten hätte ich mitgesungen. Sehr gut erinnere ich mich auch an ein anderes faszinierendes Projekt auf der Baustelle: die interaktive »rerite«Ausstellung 2013 im Parkhaus, eine Art begehbare Klanginstallation mit Strawinskys »Le sacre du printemps«. Der immense Erfolg der Elbphilharmonie hat für mich viel mit Christoph LiebenSeutter zu tun. Natürlich ist sie ein großartiges Bauwerk, das jeder besichtigen möchte. Doch der schönste Bau nützt nichts, wenn es dort nicht jemanden gibt, der es mit Leben und Seele füllt. LiebenSeutter und seinem Team ist es gelungen, schon während der Bauphase ein Musikprogramm in der Stadt zu entwickeln und zu präsentieren, das es in dieser Qualität und Vielfalt zuvor nicht gegeben hat. Dank dieser exzellenten Vorarbeit konnte das Haus dann auch unmittelbar nach seiner Eröffnung mit einem Programm gefüllt werden, das dem Bauwerk angemessen ist.
Auch heute ist es immer wieder ein Ereignis, in die Elbphilharmonie zu kommen. Ich bin froh, dass der Druck, sich blitzschnell Konzertkarten sichern zu müssen, ein wenig nachgelassen hat. Die Konzerte sind immer noch gut verkauft, doch besteht jetzt eine größere Chance, auch wirklich seine Wunschkonzerte besuchen zu können. Die Kartenbuchung ist nicht mehr so stressig.
AUFGEZEICHNET VON CLAUDIA SCHILLER FOTO GESCHE JÄGERCatharina Schuchmann weiß genau, warum sie sich im Freundeskreis der Elbphilharmonie engagiert.
BÜRO AN BÜRO:
EYCK UND KRISTINA KUCKUK

Sollte irgendwann mal jemand ein Musical über die Elbphilharmonie schreiben – die Liebesgeschichte von Eyck und Kristina Kuckuk müsste auf jeden Fall darin vorkommen.
Sie beginnt am 4. Januar 2017: An diesem Tag war im NDR Ticketshop die Hölle los, die halbe Welt wollte Karten für die Elbphilharmonie, die Telefone liefen heiß, und Kristina Kuckuk hatte ihren ersten Arbeitstag. Zum Glück wurde ihr ein sympathischer Kollege an die Seite gesetzt, der sie anlernen sollte: Eyck.
(Anmerkung: Hier käme im Musical jetzt das erste Duett.)
Zwei Monate lang arbeiteten sie Stuhl an Stuhl, fast exklusiv an ElbphilharmonieThemen. Eyck Kuckuk ging danach zu den Funke Konzertkassen zurück, von wo er nur ausgeliehen war. Doch die Beziehung blieb bestehen. Und 2018 wurde die Elbphilharmonie dann endgültig Teil ihres gemeinsamen Lebens: Erst fing sie im März einen neuen Job an den ElbphilharmonieKonzertkassen an. Dann überraschte er sie im Oktober auf dem Dach des Hauses mit einem Heiratsantrag. In seinen Plan waren
»Es kam alles so, wie es kommen sollte.«
Die Liebe wird gern auf der Bühne besungen, aber noch schöner ist sie dort, wo sie echt ist: hinter den Kulissen. Diese Paare haben sich über die Elbphilharmonie kennengelernt.
einige »Türöffner«Kollegen aus der Elbphilharmonie eingeweiht, die er heimlich im Vorfeld kontaktiert hatte. Und schließlich trat Eyck Kuckuk im Dezember 2018 dann selbst eine Stelle im Vertrieb des Hauses an. Dort richtet er heute vor allem neue Veranstaltungen ein, gibt sie für den Verkauf frei und betreut Veranstalter. Kristina Kuckuk sitzt heute nicht mehr in den Konzertkassen, sondern im Nebenbüro ihres Mannes im Concierge Service, wo sie sich um Karten und Sonderwünsche von Sponsoren und Förderern sowie um die Kontaktdatenbank des Hauses kümmert. Schnittstellen zur Arbeit des anderen gibt es einige. »Zum Beispiel gibt es bei jedem Konzert festgelegte Plätze für Förderer und Sponsoren. Die richtet Eyck in der Regel ein – und ich verkaufe sie dann«, sagt sie. »Schon lustig, wie sich das entwickelt hat.« »Es kam alles so, wie es kommen sollte«, blickt Eyck Kuckuk zurück. »Die Elbphilharmonie hatte für uns seit dem Kennenlernen eine besondere Bedeutung. Und sie wurde über die Zeit zu einem echten Lebensmittelpunkt.«
BRÜCKE ZU DIR: ANKE FISCHER
UND ANKE GAUTER
Ein solches Zentrum ist das Haus auch schon seit Jahren im Leben von Anke Fischer und Anke Gauter. Beide arbeiten schon seit 2015 für die Elbphilharmonie. »Wir waren immer in ganz anderen Bereichen tätig, aber über die Jahre gab es regelmäßig Anlässe mit dem Team, wo man ins Gespräch kam«, sagt Anke Gauter. »Irgendwann haben wir gemerkt, dass es menschlich ganz gut passt …« »Ja, und dann haben wir uns verliebt«, ergänzt Anke Fischer.

Wenn sie mal morgens zusammen zur Arbeit kommen, nehmen sie allerdings nicht in zwei direkt benachbarten Büros Platz wie Eyck und
Kristina Kuckuk, sondern verabschieden sich schon draußen an der MahatmaGandhiBrücke. Der Arbeitsplatz von Anke Gauter ist in einem Bürogebäude Am Sandtorkai, das Büro von Anke Fischer im 10. Stock der Elbphilharmonie.
Fischer leitet dort das 30köpfige Musikvermittlungsteam des Hauses und verantwortet damit einen riesigen Programmbereich: Workshops, Mitmachangebote, Kinder und Schulprogramm, unzählige Sonderformate. »Es geht generell in unserer Abteilung darum, Teilhabe zu er möglichen, Türen zu öffnen, speziell auch für Leute, die den Weg ins Konzerthaus bisher nicht finden«, sagt sie. »Und wir wollen als Haus relevant sein, für gewisse Haltungen stehen. Damit sind wir schnell auch gesellschaftspolitisch unterwegs.«
Gauter ist auf der anderen Seite der Brücke stellvertretende Leiterin
der Konzertkassen und damit Ansprechpartnerin für die 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt an den Kassen sitzen. »Außerdem bin ich eine Art technische Schnittstelle zwischen der IT, die hier vor Ort sitzt, und den Konzertkassen, wo wir viel Technik und Software brauchen.« Ob es die beiden reizen würde, mal die Teams zu tauschen, die Leitungsrolle auf der anderen Seite der Brücke zu übernehmen? »Also durch die HomeofficeZeit haben wir schon ein bisschen mehr von der Arbeit der anderen mitbekommen, deswegen kann ich sagen: Spannend wäre es –
»Irgendwann haben wir gemerkt, dass es menschlich ganz gut passt.«
aber ich könnte das überhaupt gar nicht«, lacht Fischer. »Umgekehrt würde das mit mir drüben auch keine zwei Stunden gut gehen«, schmunzelt Gauter. »Das sind wirklich ganz andere Kompetenzen.«

Rollen tauschen ist für Marte Darmstadt und Martin Renner kein großes Problem. Schließlich arbeiten beide nicht nur in der gleichen Abteilung, sondern machen auch weitgehend die gleiche Arbeit. Sie leiten Workshops für die fast 20.000 Kinder und Erwachsenen, die jährlich in die Instrumentenwelt kommen. Mit Gruppen von bis zu 30 Personen probieren sie Orchesterinstrumente aus oder bauen selbst neue, komponieren
oder suchen Klänge im Haus. Manche Kurse leiten sie sogar zusammen als Duo.
Seit sieben Jahren arbeiten sie schon im gleichen Team, seit drei Jahren sind sie ein Paar. »Wir waren von Anfang an eng befreundet«, erzählt Darmstadt. »Generell ist das so in unserem Team, dass viele auch Freunde außerhalb der Elbphilharmonie sind, wir unternehmen sehr viel zusammen. Bei uns zweien ist die Freundschaft dann irgendwann immer größer geworden.« Sie hätten es bisher nie als Schwierigkeit empfunden, als Paar so eng zusammenzuarbeiten. »Wir kannten den beruflichen Alltag zusammen ja schon davor«, sagt Renner, »genauso lief das dann weiter.« Und Darmstadt ergänzt: »Das Einzige, was jetzt manchmal vorkommt, ist, dass man abends mal sagt: So, jetzt haben wir genug über die Elbphilharmonie geredet.«
Wie gerne sie Seite an Seite arbeiten, haben sie auch bewiesen, als sie im Sommer 2022 gemeinsam in ein neues Großprojekt eingestiegen sind. Bei »Love est. 2023«, dem großen
CommunityProjekt der Saison (siehe S. 18), sind Menschen aus Hamburg aufgerufen, zusammen künstlerisch aktiv zu werden, in Workshops zu texten, Musik und Choreografie zu erfinden und am Ende alles auf die Bühne des Großen Saals der Elbphilharmonie zu bringen. »Im Sommer sind wir mit zwei anderen durch die Stadt gezogen und haben Werbung für das Projekt gemacht, haben überall Leute angesprochen, Flyer verteilt, gesungen, Samba getrommelt«, erzählt Darmstadt. Im Herbst haben sie Workshops in Gruppen gemacht. Die Ensembleproben vor der großen Aufführung von »Love est. 2023« im Mai leiten sie nun teilweise zusammen. Welches Duo wäre für dieses Thema auch besser geeignet?
M WEITERE GESCHICHTEN AUS DEM TEAM DER ELBPHILHARMONIE FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
»Wir waren von Anfang an eng befreundet.«

Genießen Sie ein echtes Stück Hamburg im 5-Sterne-Hotel Louis C. Jacob! Mit unserem Thomas Martin Gourmet Special erleben Sie eine Jacob-Auszeit der Extraklasse:
Zwei Übernachtungen im luxuriösen Zimmer
Reichhaltiges Frühstück
Begrüßung in der Küche, anschließend Thomas Martin 7-Gänge Gourmet-Menü in Jacobs Restaurant am zweiten Tag

2 Nächte ab 495,00 € pro Person im Doppelzimmer*
Jetzt buchen unter: +49 40 300322-530 oder reservierung@hotel-jacob.de



Entdecken Sie auch unsere exklusiven Elphi-Pakete mit unvergesslichem Rahmenprogramm.
hotel-jacob.de
Wie wird eigentlich aus Liebe Kunst? Ein Songwriter, eine Schriftstellerin und zwei Menschen, die Filme machen, geben Auskunft.




Es gab eine Zeit, da hat Claudia Schumacher vor allem für Geld geschrieben. Zwölf war sie damals, sie wollte unbedingt einen Hund haben, ihre Eltern nicht, da sagte ihr Vater: Kannst du haben. Aber erst, wenn du dein eigenes Geld verdienst. Also setzte sie sich hin und schrieb, Zitat Schumacher, »eine Novelle« – das erschien ihr der einfachste Weg, um an die benötigten finanziellen Mittel zu kommen.
»Irgendwo gibt es das Ding noch«, murmelt sie ein Vierteljahrhundert später in einem Eppendorfer Restaurant und nimmt einen Schluck Apfelschorle. Was das leichtverdiente Geld angeht, da ist Schumacher heute einen Ticken schlauer. Ja, sie hat gerade einen Roman geschrieben, der ein Bestseller geworden ist. Und ja, »Liebe ist gewaltig«, dieses Debüt einer Mittdreißigerin, war nicht nur ein Liebling der Kritik; auch die Leserschaft war von dem Buch kollektiv geflasht. Weil es voller Sprachgewalt und Rotzigkeit und Sehnsucht und Schmerz steckt, in einer Art, die selten ist. Aber nichts daran sei leicht gewesen für sie – der Ruhm, die Liebe der Leser: alles unter massiven Schmerzen erarbeitet. Und trotzdem. Für Schumacher war es vor allem eine Arbeit der Liebe. Aus Nürtingen kommt sie, tief im Schwäbischen, eine sehr bodenständige Gegend. Als sie begann, in Berlin Literatur und Kunstgeschichte zu studieren, galt das bei ihr daheim als keine besonders zukunftsträchtige Wahl. Sie wurde dann Journalistin, zwar frei, aber in Vollbeschäftigung. Zog 2012 für sechs Jahre in die Schweiz, wurde Redakteurin im Gesellschaftsressort der »Neuen Zürcher Zeitung«, dort doch in Festanstellung. Dann lernte sie, die deutsche Journalistin in der Schweiz, einen Schweizer Kollegen kennen, der in Hamburg arbeitet. Seinetwegen wechselte sie Stadt und Land.
Sie hätte hier nahtlos weiterarbeiten können, lukrative Jobangebote gab es. Aber da war diese andere Sache, an der sie arbeitete. Claudia Schumacher nennt sie: der Text. Der Text also handelte von häuslicher Gewalt, ein Thema, das sie seit einer Recherche jahrelang umtrieb. Einen Roman hatte sie noch in der Schweiz daraus gemacht, es gab ein halbfertiges Manuskript, geschrieben am Wochenende und jeden Werktag ab morgens um fünf. Es gab eine Agentur und irgendwann auch einen Plan, das Ding zu veröffentlichen. Aber Schumacher zog den Stecker. »Das war nicht gut genug«, sagt sie. »Ich bekam das Thema und die Figuren noch nicht in ihrer Vielschichtigkeit zu fassen.«
Aber das Thema rumorte weiter in ihr. Irgendwann nach ihrem Umzug fuhr sie mit dem Rad durch Hamburg, als plötzlich in ihrem Kopf ein Monolog losratterte. Das war Juli, ihre Protagonistin, die ihr in genau dem rotzigen Sound, nach dem Schumacher lange gesucht hatte, den Beginn ihres Romans diktierte. Schumacher fuhr nach Hause, setzte sich hin und schrieb zehn Seiten im Rausch herunter. Und beschloss danach, jetzt in Vollzeit Schriftstellerin zu werden.
Kunst, sagt Schumacher, müsse radikal sein. »Und diese Radikalität hat auch was mit Liebe zu tun. Die Liebe scheißt auf alles, die setzt Energie frei.« Ihre Energie floss komplett in ihren Text. Schumacher vergrub sich. Kratzte alle Ersparnisse zusammen, schottete sich ab, arbeitete drei Jahre lang manisch in Vollzeit an ihrem Buch. Menschen hat sie nicht viele gesehen in dieser Zeit. »Das Thema hat mich an den Rand gebracht«, sagt sie, »es ist ein toxischer Stoff, der ist mir beim Schreiben mehrfach ins eigene Gesicht explodiert.«
Oh ja, toxisch ist der Stoff. Es geht um Juli, die in der Region um Stuttgart scheinbar behütet aufwächst. »Ich wollte kein Klischee erzählen«, sagt Schumacher, »keine Ehrenmorde bei Einwandererfamilien, keine Gewalt in prekären Verhältnissen, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Denn das ist die statistische Wahrheit.« Der Vater Rechtsanwalt, die Mutter schön, die Brüder wohlgeraten. Doch der Vater schlägt seine Familie und terrorisiert sie psychisch. Schumacher begleitet Juli auf der schmerzhaften Suche nach einer Liebe, die nicht dysfunktional und toxisch ist. Mehr noch: Schumacher wurde zu Juli, und nicht nur zu der. »Ich habe mich im ersten Anlauf in der Schweiz nicht so sehr den Figuren ausgesetzt«, sagt sie. »Beim zweiten Mal habe ich mir ihre verschrammte Haut angezogen. Ich war die alle: der prügelnde Vater, die geschändete Mutter, die wütende Göre. Das war gefährlich.«
Für ihren Freund war das auch nicht leicht. Da war Claudia nun endlich in Hamburg und irgendwie doch nicht da. Abends, wenn er aus der Redaktion kam, fand er sie nur zu oft weltabgewandt am Schreibtisch vor, manisch gefangen im Schreibprozess, der ganze Körper eiskalt. Er hat sie dann vorsichtig vom Stuhl gelöst, ins Bett gelegt und ihren Körper warmgeföhnt.
Am Ende dieser Tortur von drei Jahren hatte Schumacher 256 Textdokumente in drei Ordnern beisammen, »das war mit allen Überarbeitungen und Versionen am Ende ein verrücktes Opus«. Dessen Druckversion einschlug wie eine Bombe. Diese Sprache. Diese Intensität. »Ich wollte etwas Wahres schreiben und gleichzeitig etwas, das die Leute berührt«, sagt Claudia Schumacher. »Deshalb habe ich das Buch mit meinem Blut geschrieben. Und wenn Leser sagen, es habe sie emotional überwältigt, bin ich glücklich.«
Schumacher war völlig ausgelaugt, als sie den Text endlich losgelassen hatte. Eigentlich ist das der schönste Moment für Autoren: die Zeit zwischen der letzten Korrektur und dem Erscheinen. Luftholen, Seele, Beine –alles mal baumeln lassen. Aber sie hat sich sofort an ihr zweites Buch gemacht. Es ist wieder ein Thema, das sie packt, das sie anzündet, »dark und abgründig«. Warum sie sich das wieder antut? Weil, sagt Claudia Schumacher, sie liebt, was sie tut. Sie ist eine liebende Radikale. Sie kann nicht anders. ›

»Ich wollte etwas Wahres schreiben und gleichzeitig etwas, das die Leute berührt.«

»Es geht nicht darum, wer diese Menschen sind, die einander lieben. Es geht um die Liebe selbst.«
Bei der Liebe war es zwischen Ali Hakim und Maike Rasch so: Er hatte eine Idee, und sie fand sie blöd. »Da gab es vom NDR diese Art Wettbewerb für Filmemacher, ›Nordlichter‹ heißt das«, sagt Hakim, »und damals war das Thema des Jahres: Liebe«. Hakim ist Filmemacher, Drehbuch, Regie, Produktion, alles sein Ding, er hat 2011 mit Mitte zwanzig sogar eine eigene Firma dafür gegründet, die »let’s be awesome filmproductions«, und bei diesem Wettbewerb wollte er unbedingt mitmachen. Also hat er über die Liebe nachgedacht.
»Ich hatte ziemlich schnell so’n Bonnie & ClydeDing im Kopf«, sagt er. Erst mit einer JungetrifftMädchenGeschichte, aber dann dachte er: Das müssen zwei Mädchen sein, die ihre Liebe gegen alle Widerstände durchkämpfen. Der NDR fand die Idee gut, er sollte loslegen – aber Hakim bekam irgendwie Manschetten: Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, erzählt bloß von einem Typen, nee, das geht so nicht. Die Produktionsfirma, mit der er den Film drehen wollte, empfahl ihm eine zweite Drehbuchautorin, die Ali nicht kannte. Das war Maike Rasch. Die las das Skript. Und sagte: Kann man so machen. Kann man aber auch ganz anders machen.
So ging das los mit Maike und Ali: mit Diskussionen um Gefühle, mit dem Ringen um die Bilder der Liebe, um die Frage, wie viel Drama ein Film verträgt – und wie viele Herzen dabei brechen dürfen. In »Bonnie & Bonnie«, entstanden 2019, geht es um die Beziehung zwischen der 17jährigen Yara und der bloß ein bisschen älteren Kiki. Die wohlbehütete Yara kommt aus einer Familie muslimischer Albaner in Wilhelmsburg, Kiki ist als Heimkind familiär komplett entwurzelt. Für die eine bedeutet die andere Freiheit, für die andere die eine Geborgenheit. Aber Yaras Familie macht da nicht mit, die beiden Mädchen fliehen Richtung Südfrankreich, und auf dem Weg … tja. »Damals dachten wir, dass unser Ende eine richtig gute Idee ist«, sagt Maike Rasch, »aber ich glaube, ich würde Kiki heute nicht mehr sterben lassen.« Ali nickt, »ich auch nicht«, sagt er dann. Sie seien für dieses Ende auf eine Menge Unverständnis gestoßen, aber sie setzten sich durch – sie hielten das Opfer für unvermeidbar, für die Liebe, für die Kunst. »Dabei wollen wir alle doch bloß ein Happy End«, sagt Maike Rasch.
Hakim sagt, dass er eine Sache nicht bedacht hatte: Lesbische Liebe im Film ging bis vor ein paar Jahren nie gut aus. »Auch dafür wurden wir angefeindet«, sagt er. »Da wurde ich gefragt, ob ich Frauen kein Glück gönnen würde.« Und ihr, sagt Rasch, wurde komplettes Geschlechterunverständnis entgegengebracht, sie sei doch schließlich eine Frau. Stimmt schon, »aber ich bin eben auch Drehbuchautorin, eine Geschichtenerzählerin. Und überhaupt: Es geht nicht darum, wer diese Menschen sind, die einander lieben. Es geht um die Liebe selbst. Und wie aus ihr Kunst wird.«
Rasch hat schon viele Drehbücher geschrieben, sie ist gut im Geschäft. Früher habe sie immer gedacht,
Komödien seien die schwerste Disziplin. Sieht sie heute anders. »Bei Liebesfilmen ist es unheimlich schwierig, die eine Geschichte zu finden, die noch nicht erzählt worden ist«, sagt sie. »Das Umschiffen von Klischees, vom ewigen Wiederholen bekannter Motive, das ist echt eine Aufgabe.« Klar, sagt Ali: »Everything is a remix. Aber was ich wirklich schwierig finde: Die Hindernisse, die zwei Liebende heute überwinden müssen, werden immer geringer. Verbotene Liebe gibt es nicht mehr.« Na ja, schränkt er ein: zumindest im Westen. In Afghanistan, dem Land, in dem er 1985 geboren wurde und die ersten vier Jahre seines Lebens verbracht hat, sieht die Sache noch anders aus. Und auch noch in Teilen von HamburgWilhelmsburg, wo Hakim mit seiner Familie seit 1989 lebt. »Meine eigene Familie tickt nicht so, da darf man lieben, wen man will. Aber in meinem Kulturkreis gibt es noch Verbote«, sagt er, »ich habe das in Wilhelmsburg erlebt.« Seine Erfahrungen stecken in »Bonnie & Bonnie«, der Film wurde auch auf der Elbinsel gedreht.
»Aber brauchst du immer die verbotene Liebe?«, fragt Maike Rasch. Der beste Liebesfilm aller Zeiten sei schließlich »Love Story«, »und der ist einfach nur unfassbar traurig.«
»Mein Lieblingsfilm ist ›Before Sunrise‹«, sagt Hakim. »Och nö«, sagt Meike, eine tiefe Falte der Verachtung über der Nasenwurzel.
»Oh ja,« sagt Ali und grinst wohlig, »alle drei Teile.« »Aber was passiert da?«, fragt Rasch, immer noch ungläubig.
»Na ja«, sagt Hakim, »die reden. Da geht etwas los. Das ist doch toll.«
Und so palavern die beiden darüber, was man in einem Liebesfilm zeigen will. »Kann der Anfang sein«, sagt Ali. »Oder das Ende«, sagt Maike. »Oder die Liebe in einer Katastrophe«, sagt Ali. »Dann ist ›Speed‹ ja auch ein Liebesfilm«, sagt Maike, »da geht doch was ab zwischen Sandra Bullock und Keanu Reeves. Aber übersteht diese Liebe auch das Ende des Dramas? Das ist doch die Frage!«
Maike Rasch, Ottenserin seit ihrem Zuzug nach Hamburg, ist mit ihrem Mann seit 24 Jahren zusammen, ihr Sohn ist gerade volljährig geworden. Das prägt. Sie hat bei »Bonnie & Bonnie« auch ihre eigenen Erfahrungen des Verliebtseins in die Geschichte einfließen lassen. Und noch viel mehr: was sie sich mit 17 selbst von der Liebe gewünscht, was sie gern erlebt hätte. »Diesen Quatsch, den Yara und Kiki machen, die Freiheiten, die sie sich nehmen – das hätte ich mich damals nie getraut.« Aber in so einen Liebesfilm gehört all das dringend hinein.
Und apropos Liebesfilme, das sei schon seltsam, sagt Hakim: Wenn er mal einen Film streamen will, gibt es bei Netflix oder Amazon Prime die Kategorien Krimi, Action, Familie, Komödie – »aber Liebe gibt es nicht«. Echt?, fragt Maike Rasch. Dann denkt sie einen Moment nach. Und sagt schließlich: »Vielleicht liegt es daran, dass Liebe in allem steckt. Ohne sie funktioniert gar nichts.«
Im Folgenden eine kurze Aufzählung von Worten der Liebe: Einwegfeuerzeugstichflamme, Glückskeks, Waschmaschine, eine lauwarme Heizung. Putzlicht und Waschbeckenrand und Fahrradlenker und klapperndes Geschirr. Und nicht zu vergessen: HMilch und Tiefkühltruhe. Niels Frevert ist Musiker, einer der besseren des Landes, er schreibt Lieder voller Liebe, was, wollen wir mal ehrlich sein, jeder Songwriter tut, mindestens neunzig Prozent aller Lieder handeln in irgendeiner Form von der Liebe. Frevert aber ist besonders – die Worte oben, die gehören ihm. Diese sehr oft profanen Gegenstände des Alltagslebens sind das Vehikel, über das er seine Geschichten erzählt.
Vor etwa 20 Jahren hat er damit angefangen. Da hatte er schon ein Dutzend Jahre im Musikgeschäft hinter sich. War Frontmann der Band Nationalgalerie, vier Alben lang, 1997 erschien sein SoloDebüt. Mit Mitte 30 aber ging er in eine andere Richtung. »Seltsam öffne mich« hieß seine zweite Platte, und da war sie plötzlich, diese andere Art zu texten. Aber warum? »Weil die Worte, die ich dafür benutzt habe, noch frei waren«, sagt Frevert, »und damit beschäftige ich mich bis heute – ich will Geschichten erzählen, die noch nicht erzählt worden sind, mit einem Vokabular, das noch nicht dafür verwendet wurde.« Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Begriffe zu singen, die eigentlich unsingbar sind. Siehe oben: Einwegfeuerzeugstichflamme. »Ich suchte nach Worten für etwas, das nicht an der Straße der Worte lag«, singt er auf »Putzlicht«, seinem Album von 2019, das von nicht wenigen Kennern als sprachliches Meisterwerk gehandelt wird.
Niels Frevert ist 55 Jahre alt, er ist ein sanfter, ein leiser, ein sehr freundlicher Mann. Für einen Popstar macht er auffallend wenig Aufhebens von sich selbst, »meine Eltern haben mich relativ streng zu protestantischer Bescheidenheit erzogen«, sagt er. Social Media beißt sich damit, er ist nicht gut darin, und das ist womöglich einer der Gründe, warum sein Können und sein Ruhm in einem gewissen Missverhältnis zueinander stehen. »Das und der Algorithmus«, sagt er. Und meint: Wer ihn nicht kennt, findet seine Musik auf den gängigen Plattformen nicht so schnell, weil es so etwas wie Niels Frevert nicht noch mal gibt. »Es würde mir das Leben erleichtern, wenn es noch fünf oder zehn andere von meiner Sorte gäbe« sagt er, »dann würde mich der Algorithmus auf den Streamingplattformen auch finden.« So muss man schon anders auf ihn kommen. Aber dann gilt mit unwahrscheinlicher Trefferquote: Frevert kennen heißt Frevert lieben.
In Niendorf ist er aufgewachsen, mit Musik, die an Bedingungen geknüpft war. Eine Konzertgitarre durfte er haben, eine elektrische nicht, »dabei wollte ich nicht zupfen, sondern Bob Dylan nachschrammeln«. Die EGitarre kaufte er sich heimlich mit 13, gebraucht für 70 Mark inklusive Verstärker. Er deponierte sie bei einem Freund in der Garage. Das war auch die Zeit, als er mit dem Liederschreiben anfing, »das war meine Insel«. Songs über Mädchen und das Verknalltsein. Mit 17 ist er ausgezogen, zu seiner älteren Freundin nach St. Pauli, bis zum Abi ist er jeden Morgen in seine Schule am Stadtrand rausgefahren, immer ein bisschen zu spät dran. Nach dem Zivildienst wusste er dann, dass es die Liebe zur Musik war, die sein Leben bestimmen würde, Jobperspektive inklusive. Das allerdings war der harte Teil. In sich zu schürfen und Melodien und Texte zu finden: kein Problem. Damit in die Welt zu gehen: schwierig. »Da gibt es definitiv geilere Checker als mich«, sagt Frevert.
Aber wie ist das nun eigentlich mit der Kunst und der Liebe? »Gegenfrage«, sagt Niels Frevert, »geht’s ohne?«
Und antwortet selbst: »Nö. Wenn du etwas neu schaffst, wenn du etwas von null auf die Beine stellst, ist es unmöglich, das ohne Liebe zu tun«, sagt Frevert. Natürlich hat er ein anderes Wort für Liebe: Idealismus. Das Brennen für etwas, das Ausstülpen des eigenen Inneren, »das hat nichts zu tun mit Ruhm und Reichtum, darum darf es nicht gehen bei der Liebe. Und bei der Kunst.« Die Liebe kommt in seinen Texten eher beiläufig vor, oft unabsichtlich, »aber irgendwann stelle ich fest: Die ist auf eine Art immer dabei.« Meist hat er nur einzelne Zeilen, aus denen seine Songs wachsen, »ich merke oft erst am Ende, worum es in dem Stück geht, und staune darüber.« Seine eigene Gefühligkeit ahnt man in den Songs, denn da ist sie wieder, diese Frevert’sche Zurückgenommenheit: Seine Geschichten sind assoziativ, die Liebe guckt bloß vorsichtig um die Ecke.
Und damit fährt er ausgezeichnet. Es geht ihm gut, das war nicht immer so. Es gab Phasen des Zweifels, ob dieses Popbusiness noch sein richtiges Zuhause ist. Aber er wird oft genug auf der Straße angesprochen, von Menschen, deren Augen leuchten, wenn sie von ihrem letzten FrevertKonzert erzählen oder von einem Stück auf der aktuellen Platte »Pseudopoesie«, das sie berührt hat, auf eine ebenso diffuse wie tiefe Art. »Ich spüre dann, dass es Leute gibt, denen meine Musik etwas bedeutet«, sagt Niels Frevert. »Und das ist auch eine Liebe. Eine, die mich weitermachen lässt.«
»Wenn du etwas neu schaffst, von null auf die Beine stellst, ist es unmöglich, das ohne Liebe zu tun.«

Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die Elbphilharmonie als Konzerthaus von Weltrang begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe im internationalen Konzertbetrieb setzen.

MÄZENE
ZUWENDUNGEN AB 1.000.000 EURO
Prof. Dr. Dr. h. c. helmut und Prof. Dr. h. c. hannelore Greve
Prof. Dr. Michael otto und Christl otto
hermann Reemtsma stiftung
Christine und Klaus-Michael Kühne
Körber-stiftung
Peter Möhrle stiftung
Familie Dr. Karin Fischer
Reederei Claus-Peter offen (Gmbh & Co.) KG
stiftung Maritim hermann & Milena ebel
hans-otto und engelke schümann stiftung
Christiane und Klaus e oldendorff
Prof. Dr. ernst und nataly Langner
PLATIN
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO
Ian und Barbara Karan-stiftung
Gebr. heinemann se & Co. KG
Bernhard schulte Gmbh & Co. KG
Deutsche Bank aG
M. M. Warburg & Co
hamburg Commercial Bank a G
Lilli Driese
J. J. Ganzer stiftung
Claus und annegret Budelmann
Berenberg – Privatbankiers seit 1590
Mara und holger Cassens stiftung
Christa und albert Büll
Christine und heinz Lehmann
Frank und sigrid Blochmann
else schnabel
edel Music + Books
Dr. Markus Warncke
Berit und Rainer Baumgarten
Christoph Lohfert stiftung
eggert Voscherau
hellmut und Kim-eva Wempe
Günter und Lieselotte Powalla
Martha Pulvermacher stiftung
heide + Günther Voigt
Gabriele und Peter schwartzkopff
Dr. anneliese und Dr. hendrik von Zitzewitz
Prof. Dr. hans Jörn Braun †
susanne und Karl Gernandt
Philipp J. Müller
ann-Mari und Georg von Rantzau
Dr. Gaby schönhärl-Voss und Claus-Jürgen Voss
Lennertz & Co.
GOLD ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO
Rainer abicht elbreederei
Christa und Peter Potenberg-Christoffersen
he RI s To a G
Christian Böhm und sigrid neutzer
amy und stefan Zuschke
SILBER
ZUWENDUNGEN AB 10.000 EURO
Ärzte am Markt: Dr. Jörg arnswald, Dr. hans-Carsten Braun
Marlis u. Franz-hartwig Betz stiftung
hans Brökel stiftung für Wissenschaft und Kultur
Jürgen und amrey Burmester
Rolf Dammers ohG
Deutsche Giganetz Gmbh
FR os Ta a G
anna-Katrin und Felix Goedhart
Katja holert und Thomas nowak
Isabella hund-Kastner und Ulrich Kastner
Knott & Partner VDI
hannelore Krome
Dr. Claus und hannelore Löwe
stiftung Meier-Bruck
Riedel Communications Gmbh & Co. KG
BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO
Dr. Ute Bavendamm / Prof. Dr. henning harte-Bavendamm
Ilse und Dr. Gerd eichhorn
hennig engels
Dr. T. hecke und C. Müller
Marga und erich helfrich
Korinna Klasen-Bouvatier
Mercedes-Benz hamburg
Georg-Plate-stiftung
hella und Günter Porth
Carmen Radszuweit
Colleen B. Rosenblat
Rölke Pharma Gmbh
hannelore und albrecht von eben-Worlée stiftung

Jürgen abraham | Rolf abraham | andreas ackermann | anja ahlers | Margret alwart | Karl-Johann andreae | Rainer und Berit Baumgarten | Gert hinnerk Behlmer | Michael Behrendt | Robert von Bennigsen | Joachim von Berenberg-Consbruch | Tobias Graf von Bernstorff |
Peter Bettinghaus | Marlis und Franz-hartwig Betz | ole von Beust | Wolfgang Biedermann | alexander Birken |
Dr. Frank Billand | Dr. Gottfried von Bismarck |
Dr. Monika Blankenburg | Ulrich Böcker | Birgit Bode |
andreas Borcherding | Tim Bosenick | Vicente Vento Bosch |
Jochen Brachmann | Gerhard Brackert | Verena Brandt |
Beatrix Breede | heiner Brinkhege | nikolaus Broschek |
Marie Brömmel | Tobias Brinkhorst | Claus-G. Budelmann |
*Peter Bühler | engelbert Büning | amrey und Jürgen
Burmester | stefanie Busold | Dr. Christian Cassebaum |
Dr. Markus Conrad | Dr. Katja Conradi | Dierk und Dagmar
Cordes | Familie Dammann | Carsten Deecke |
Jan F. Demuth | Karl Denkner | Dr. Peter Dickstein |
heribert Diehl | Detlef Dinsel | Kurt Dohle |
Benjamin Drehkopf | Thomas Drehkopf | oliver Drews |
Klaus Driessen | herbert Dürkop | Christian Dyckerhoff |
hermann ebel | stephanie egerland | hennig engels |
Claus epe | norbert essing | heike und John Feldmann |
alexandra und Dr. Christian Flach | Dr. Peter Figge | Jörg Finck |
Gabriele von Foerster | Dr. Christoph Frankenheim |
Dr. Christian Friesecke | sigrid Fuchs | Manhard Gerber |
Birgit Gerlach | Dr. Peter Glasmacher | Prof. Phillipp
W. Goltermann | Inge Groh | annegret und Dr. Joachim Guntau |
amelie Guth | Michael haentjes | Petra hammelmann |
Jochen heins | Dr. Christine hellmann | Dr. Michael heller |
Dr. Dieter helmke | Jan-hinnerk helms | Kirsten henniges |
Rainer herold | Gabriele und henrik hertz | Günter hess |
Prof. Dr. Dr. stefan hillejan | Bärbel hinck | Joachim hipp |
Dr. Klaus-stefan hohenstatt | Christian hoppenhöft | Prof. Dr. Dr. Klaus J. hopt | Dr. stefanie howaldt | Rolf hunck | Maria Illies | Dr. Ulrich T. Jäppelt | Dr. Johann Christian Jacobs | heike Jahr | Martin Freiherr von Jenisch | Roland Jung | Matthias Kallis | Ian Kiru Karan | Tom Kemcke | Klaus Kesting | Prof. Dr. stefan Kirmße | Kai-Jacob Klasen | Renate Kleenworth | Gerd F. Klein | Jochen Knees | annemarie Köhlmoss | Matthias Kolbusa | Prof. Dr. Irmtraud Koop | Petrus Koeleman | Bert e König | sebastian Krüper |
arndt Kwiatkowski | Christiane Lafeld | Marcie ann Gräfin Lambsdorff | Dr. Klaus Landry | Günther Lang | Dirk Lattemann | Per h Lauke | hannelore Lay | Dr. Claus Liesner | Lions Club hamburg
elbphilharmonie | Dr. Claus Löwe | Prof. Dr. helgo
Magnussen | Dr. Dieter Markert | sybille Doris Markert |
Franz-Josef Marxen | Thomas J. C. und angelika Matzen
stiftung | helmut Meier | Gunter Mengers | axel Meyersiek | erhard Mohnen | Dr. Thomas Möller | Christian Möller | Karin Moojer-Deistler | Ursula Morawski | Katrin MorawskiZoepffel | Jan Murmann | Dr. sven Murmann |

Dr. Ulrike Murmann | Julika und David M. neumann | Michael R. neumann | Franz nienborg | Dr. ekkehard nümann |
Dr. Peter oberthür | Thilo oelert | Dr. andreas
M. odefey | Dr. Michael ollmann | Dr. eva-Maria und Dr. norbert Papst | Dirk Petersen | Dr. sabine Pfeifer | sabine Gräfin von Pfeil | aenne und hartmut Pleitz | Bärbel Pokrandt | hans-Detlef Pries | Karl-heinz Ramke | horst Rahe | Ulrich Rietschel | Ursula Rittstieg | Thimo von Rauchhaupt | Prof. Dr. hermann Rauhe | Prof. Michael Rutz | Bernd sager | siegfried von saucken | Jens schafaff | Birgit schäfer | Dieter scheck | Mattias schmelzer | Vera schommartz | Katja schmid von Linstow | Dr. hans Ulrich und Gabriele schmidt | nikolaus h schües | nikolaus W. schües | Kathrin schulte | Gabriele schumpelick | Ulrich schütte | Dr. susanne staar | henrik stein | Prof. Dr. Volker steinkraus | Wolf o storck | Greta und Walter W. stork | Dr. Patrick Tegeder | Jörg Tesch | ewald Tewes | Ute Tietz | Dr. Jörg Thierfelder | Dr. Tjark Thies |
Dr. Jens Thomsen | Tourismusverband hamburg e. V. |
Prof. Dr. eckardt Trowitzsch | John G. Turner und Jerry G. Fischer | Resi Tröber-nowc | hans Ufer |
Dr. sven-holger Undritz | Markus Waitschies |
Dr. Markus Warncke | Ulrike Webering | Thomas Weinmann | Peter Wesselhoeft | Dr. Gerhard Wetzel | erika Wiebecke-Dihlmann | Dr. andreas Wiele |
Dr. Martin Willich | Ulrich Winkel | Dr. andreas Witzig |
Dr. Thomas Wülfing | Christa Wünsche | stefan Zuschke
sowie weitere Kuratoren, die nicht genannt werden möchten.
VORSTAND: Christian Dyckerhoff (Vorsitzender), Roger hönig (schatzmeister), henrik hertz, Bert e. König, Magnus Graf Lambsdorff, Katja schmid von Linstow und Dr. Ulrike Murmann
EHRENMITGLIEDER: Dr. Karin Fischer †, Manhard Gerber, Prof. Dr. Dr. h. c. helmut Greve †, Prof. Dr. h. c. hannelore Greve, nikolaus h schües, nikolaus W. schües, Dr. Jochen stachow †, Prof. Dr. Michael otto und Jutta a Palmer †
D e R U n T e R neh M e RKR e I s D e R e LBP h IL ha RM on I e
a B a CU s a sset Management Gmb h
a ddleshaw Goddard LLP

ahn & s IMR o CK Bühnen- und Musikverlag Gmb h
a LLCUR a Versicherungs- a ktiengesellschaft
a llen o very LLP
a nja h enning Interior & Design
a-tour a rchitekturführungen
Bankhaus D onne R & R e U s C he L
Barkassen-Meyer
BB s Werbeagentur
BDV Behrens Gmb h
bmk h amburg cosy architecture
B n P Paribas Real e state
Bornhold Die e inrichter
Braun h amburg
British a merican Tobacco Germany
C. a . & W. von der Meden
Capgemini Invent
Carl Robert e ckelmann
Clayston
Company Companions
D n W
Dr. a schpurwis Gmbh & Co. KG
Drawing Room
ene RPa RC aG
e ngel & Völkers a G
e ngel & Völkers h amburg Projektvermarktung
e sche s chümann Commichau
e ventteam Gmb h
Flughafen h amburg
Fortune h otels
FR an K -Gruppe
Freshfields Bruckhaus Deringer
Garbe
Gerresheim serviert Gmb h
Groth & Co. Gmb h & Co. KG
Grundstücksgesellschaft Bergstrasse
h amburg Team
h anse Lounge, The Private Business Club
h BB h anseatische Betreuungs- und Beteiligungs -
gesellschaft mb h
h einrich Wegener & s ohn Bunkergesellschaft
h ermann h ollmann Gmb h & Co.
hh L a
h otel Wedina h amburg
IK Investment Partners
I n P - h olding
I n T e R naTI ona L es MU s IKF es T ha MBURG
Jürgen a braham
Corinna a renhold-Lefebvre und n adja Duken
Ingeborg Prinzessin zu s chleswig- h olstein und n ikolaus Broschek
a nnegret und Claus-G. Budelmann
Christa und a lbert Büll
Birgit Gerlach
Ulrieke Jürs
e rnst Peter Komrowski
Dr. Udo Kopka und Jeremy Zhijun Zeng
h elga und Michael Krämer
s abine und Dr. Klaus Landry
Marion Meyenburg
Iris von a rnim Jäderberg & Cie.
J a R a ho LDI n G Gmb h
Joop!
Kesseböhmer h olding KG
KLB h andels Gmb h
Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette Gmb h
Lauenstein & Lau Immobilien Gmb h
Larimar Portugal
Lehmann Immobilien
Lennertz & Co. Gmb h
loved
Lupp + Partner
Madison h otel
Malereibetrieb otto Gerber Gmb h
Miniatur Wunderland
nordwest Factoring und s ervice Gmb h
n otariat am Gänsemarkt
n otariat an den a lsterakaden
o ppenhoff otto Dörner Gmb h & Co. KG
PL aT h Corporation Gmb h
print-o-tec Gmb h
Robert C. s pies Gewerbe & Investment
Rosenthal Chausseestraße GbR
R oxa LL Group
s chlüter & Maack Gmb h
sh P Primaflex Gmb h
s teinway & s ons
s tenzel’s Werbebüro
s tolle s anitätshaus Gmb h
s trahlenzentrum h amburg MVZ
s trebeg Verwaltungsgesellschaft mb h
Taylor Wessing
The Fontenay h otel
Trainingsmanufaktur Dreiklang
UB s e urope se h amburg
Unger h amburg
Vladi Private Islands
Weischer.Media
WIRT s C ha FT s R aT Recht Bremer Woitag
Rechtsanwaltsgesellschaft mb h
Worlée Chemie
Wünsche Group
s owie weitere Unternehmen, die nicht genannt werden möchten.
K. & s Müller Zai und e dgar e n ordmann
Christiane und Dr. Lutz Peters
Änne und h artmut Pleitz
e ngelke s chümann
Martha Pulvermacher s tiftung
Margaret und Jochen s pethmann
Birgit s teenholdt- s chütt und h ertigk Diefenbach
Farhad Vladi a nja und Dr. Fred Wendt
s owie weitere Förderer, die nicht genannt werden möchten.

PRINCIPAL SPONSORS
PRODUCT SPONSORS






Herausgeber hamburgMusik gGmbh
Geschäftsführer: Christoph Lieben-seutter (Generalintendant), Jochen Margedant Platz der Deutschen einheit 4, 20457 hamburg magazin@elbphilharmonie.de www.elbphilharmonie.de
Chefredakteur Carsten Fastner
Redaktion Katharina allmüller, Melanie Kämpermann, Clemens Matuschek, Tom R. schulz; Gilda Fernández-Wiencken (Bild)
Formgebung GRooT h UI s . Gesellschaft der Ideen und Passionen mbh für Kommunikation und Medien, Marketing und Gestaltung; groothuis.de Gestaltung Lina Jeppener (Leitung), Janina Lentföhr; Bildredaktion angela Wahl; herstellung Carolin Beck; Projektleitung alexander von oheimb; CvD Rainer Groothuis
Beiträge in dieser Ausgabe von Dominik Bach, stephan Bartels, simon Chlosta, Laura etspüler, stefan Franzen, Volker hagedorn, Lars hammer, anselm hirschhäuser, Gesche Jäger, Julia Knop, Fränz Kremer, Joachim Lux, Clemens Matuschek, Regine Müller, Isabela Pacini, Jan Paersch, Till Raether, nadine Redlich, Claudia schiller, Tom R. schulz, albrecht selge, Bjørn Woll

Lithografie alexander Langenhagen, edelweiß publish, hamburg
Korrektorat Ferdinand Leopold Druck gutenberg beuys, Feindruckerei Gmbh, Langenhagen
Dieses Magazin wurde klimaneutral auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.
Anzeigenleitung
antje sievert, anzeigen Marketingberatung sponsoring Tel: 040 450 698 03, office@kultur-anzeigen.com
Vertrieb PressUp Gmbh, hamburg
Leserservice / Abonnement elbphilharmonie Magazin Leserservice PressUp Gmbh
Postfach 70 13 11, 22013 hamburg leserservice@elbphilharmonie.de Tel: 040 386 666 343, Fax: 040 386 666 299
Das elbphilharmonie Magazin erscheint dreimal jährlich.
Bild- und Rechtenachweise
Cover: Julia Knop; s 1 Michael Zapf; s 2 unten: olga Radmanovich, Mitte: Ira Polyarnaya, oben: african Guild; s 3 oben: Julien Mignot, Mitte rechts: akgimages / De agostini Picture Lib. / a Dagli orti, unten: allison Michael orenstein; s 4–11 Martina Matencio, Textauszüge: suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1984/1977 by editions du seuil Paris; s 12 Lian Benoit, s 14 Julien Mignot, s 15 Rodolphe engrand; s 16–17 nadine Redlich; s 18–22 Isabela Pacini; s 24–26 Marco Borggreve; s 28–32 anselm hirschhäuser;
s 34–41 Julia Knop; s 42–43 allison Michael orenstein, s 44 Vibrant Pictures / alamy stock Foto, s 46 allison Michael orenstein; s 48–49 Lars hammer; s 50 IIra Polyarnaya, s 51 Fabian hammerl, s 52–53 IIra Polyarnaya; s 54: hervé Champollion / akg-images, s 56 nick Rutter, s 57 hervé Champollion / akg-images; s 58 oben: Pal hansen, Mitte: sophie Wolter, unten: Pedro afonso, s 59 oben: Véronique hoegger, Mitte links: Dario acosta, Mitte rechts: Felix Broede, unten: Julien Benhamou; s 61 noah Torralba, s 62 shervin Lainez, s 63 noah Torralba; s 64–66 african Guild, s 67 Jacob Bain; s 68 Gesche Jäger; s 70–72 Gesche Jäger; s 74–81 Jewgeni Roppel; s 82 BIhaIBo/ i-stockphoto, s 84 ipopba/i-stockphoto, s 86 andrey Danilovich/i-stockphoto; s 88 andrea Grützner
Redaktionsschluss 16. März 2023
Änderungen vorbehalten. nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Printed in Germany. alle Rechte vorbehalten.
Träger der hamburgMusik gGmbh:
Die
des Elbphilharmonie Magazins erscheint im August 2023.
Alles Gute zum Geburtstag, liebe Melitta Bentz! Dein Erfindungsreichtum, deine Entschlossenheit und deine Weitsicht bringen uns Kaffeetrinkern köstlich schmeckenden Kaffee.
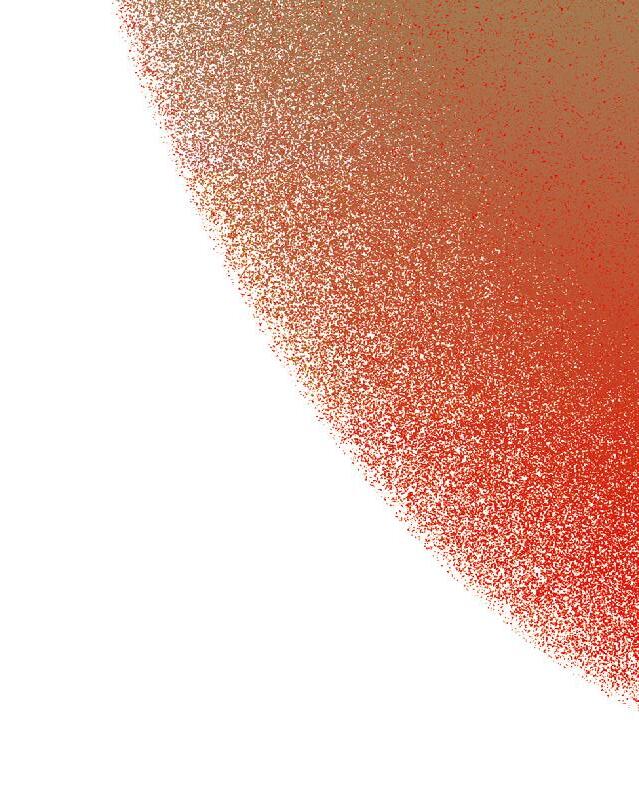
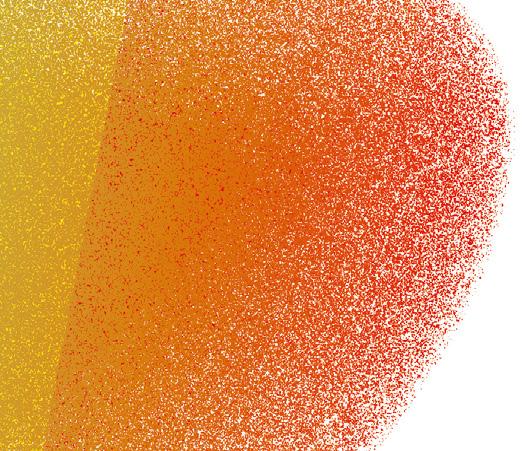


Hier den QR Code scannen und mehr erfahren. www.melitta-group.com

