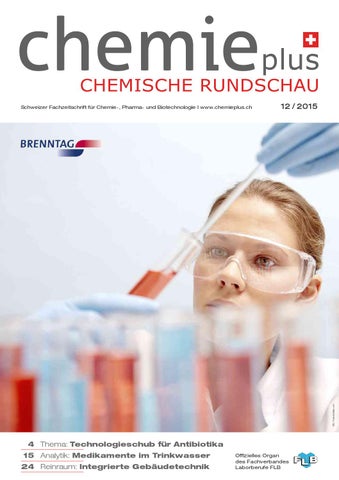12 / 2015
Bild: ©istockphoto.com
Schweizer Fachzeitschrift für Chemie-, Pharma- und Biotechnologie | www.chemieplus.ch
4 Thema: Technologieschub für Antibiotika 15 Analytik: Medikamente im Trinkwasser 24 Reinraum: Integrierte Gebäudetechnik
Offizielles Organ des Fachverbandes Laborberufe FLB