DEUTSCH FÜR ALLE
Monyk, Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer




Monyk, Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer









Elisabeth Monyk, Patricia Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer

LadedieeSquirrelLern-Appaufdein Smartphone,wählediesesBuchaus, gibdenCodeeinundlosgeht’s! www .eS qui rrel .a t
DEUALLE3
Schwierige oder für dich neue Wörter sind im Text orange hervorgehoben und werden erklärt.
Aufgaben und Arbeitsaufträge, die du während des Unterrichts – alleine oder mit der ganzen Klasse – lösen kannst, werden mit blauer Farbe hervorgehoben.

Alle Aufgaben sind folgenden drei Kategorien zugeteilt:
Anforderungsbereich I: Reproduktion
auflisten, aufzählen, aufzeigen auswendig lernen, berichten beschreiben, benennen, einsetzen, ergänzen, erinnern ersetzen, erzählen, kontrollieren, markieren, nachschlagen, nennen, skizzieren, wiedergeben wiederholen, zusammenfassen
Anforderungsbereich II: Reorganisation
analysieren, auswählen, beantworten, begründen bestimmen, darlegen, darstellen, ein-/zuordnen, erkennen, erklären, erläutern, erstellen, fortsetzen, herausarbeiten, gestalten, in Beziehung setzen, nachweisen, ordnen, präsentieren, sammeln, umwandeln, untersuchen, zusammenfassen, zusammensetzen
Deine Übungs-App: Auf eSquirrel findest du zu jedem Kapitel viele Übungen.
Anforderungsbereich III: Reflexion
abwägen, bearbeiten, besprechen, beurteilen bewerten, diskutieren entwickeln, erklären mit Hilfe von Konzepten, erörtern, erstellen, gegenüberstellen, interpretieren, kritisieren, recherchieren, Schlüsse ziehen, Stellung nehmen, überprüfen, verfassen, vergleichen, zeigen
Merktext Grammatik Merktext Rechtschreibung
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Unter diesem Motto findest du an vielen Stellen in diesem Sprachbuch Arbeitsseiten, die du ausfüllen kannst. Diese beziehen sich immer auf das zuvor Gelernte.
Zum Schluss sollst du deine Fähigkeiten mit dem Kompetenz-Check selbst einschätzen.



kann ich super geht gerade so muss ich auf jeden Fall noch üben
Folgende Symbole findest du im Buch:

Höre aufmerksam zu, was dir deine Lehrerin oder dein Lehrer vorspielt! Du kannst dir das Hörbeispiel aber auch mit deinem Handy anhören, indem du den QR-Code einscannst.



Arbeite digital!
Filmtipp
EIN BLICK ZURÜCK UND EINER NACH VORNE
Was ich schon alles gelernt habe5
ICH – HEUTE UND MORGEN
Was ich alles tun möchte – Pläne für die Zukunft17
Wie die Zeit vergeht und was noch alles sein wird/Präsens – Futur I.
„Jungsein“ heißt für mich … 18
Ein Dilemma nach dem anderen * Wie Konflikte entstehen
M1 Konfliktvermeidung22
Modalverben: Musst du? Darfst du? Willst du?24
Modalverben im Präteritum * Modalverben im Perfekt *
Modalverben im Plusquamperfekt * Modalverben im Futur
Der Innere Monolog27
Rezept Innerer Monolog * Der Außenseiter
M2 Schnelles Entspannen31
Immer wieder die Rechtschreibung33
V / v oder F / f * Wörter mit Ph /ph
Blick ins Buch39
Exzerpt mit persönlicher Stellungnahme
Innerer Monolog Zeitungsberichte
- geschichte

GENIALE, MEDIALE WELT
Internet & Co, was nutzt du so?40
M3 Fragebogen auswerten und Ergebnisse darstellen42
Exzerpieren – Schritt für Schritt45
Das Organigramm * Rezept Expert mit persönlicher Stellungnahme *
Social Media * Die Mechanismen hinter der Suchtgefahr
Das Attribut53
JFYI – einige Chatabkürzungen – akla?56
Das Satzgefüge57
Blick ins Buch63


ALLES ZEITUNG ODER WAS?
M4 Internetrecherche64
Wissenswertes über Zeitungen66
Crashkurs für Zeitungseinsteigerinnen und Zeitungseinsteiger
Aufbau eines Zeitungsartikels72
Aussageweisen des Verbs 74
Indikativ * Konjunktiv I * Konjunktiv II * Imperativ Die indirekte Rede und der Konjunktiv 78
Indirekte Rede
Einen Zeitungsbericht schreiben81
Rezept Zeitungsbericht * Tipps der Chefredakteurin * Nominalstil Zeitung auch online? 87
Wissenstest: Fremdwörter90


EINE HEIßE SPUR
Dem Täter auf der Spur93
Kriminalistik – Was du wissen solltest
M5 So trainierst du dein Gedächtnis96
Der richtigen Schreibung auf der Spur99 tod oder tot * ent- oder end-? * Staat – Stadt – Statt – (an)statt * -d- oder -dt- in Verben * seid oder seit?





Schreiben wie ein Kriminalschriftsteller
103
Adjektive in Krimis * Rezept Kriminalgeschichte Strafmündig – Was heißt das?109
Das Passiv110 Blick ins Buch113
Freundschaft – Was wahre Freunde ausmacht115

Eine Inhaltsangabe schreiben117
Rezept Inhaltsangabe
M6 Fünf Schritte zur erfolgreichen Langzeitlektüre 119
Die Ballade – eine besondere Form der Dichtung121
Typische Themen von Balladen * Eine Ballade zu Freundschaft und Treue
Die Präposition (das Vorwort)127 Helden wie du und ich?128
Das Präpositionalobjekt
Superman und Co131
Groß- und Kleinschreibung133 Zeitangaben richtig schreiben * Nominal gebrauchte feste Wendungen



IST DAS NICHT FANTASTISCH?
Der Zauber des Lesens137 Fantastisches Schreiben139
Rezept Fantasiegeschichte
Fabelhafte Wesen und Geschichten142
Fantastische Schreibwerkstatt
Das Relativpronomen (bezügliches Fürwort)144
Die Deklination der Relativpronomen Fantastische Reisen146
Reisen durch die Zeit Blick ins Buch149
Inhaltsangabe

DAFÜR ODER DAGEGEN?
Fantasiegeschichte

Pro und Kontra: Was spricht dafür? Was spricht dagegen?150
Immer dieses Handy! * Handyverbot an Schulen
M7 Mit guten Argumenten in Diskussionen punkten154
Das Adverb (das Umstandswort)158



Das Temporaladverb (Umstandswort der Zeit) * Das Lokaladverb (Umstandswort des Ortes) * Das Modaladverb (Umstandswort der Art und Weise) * Das Kausaladverb (Umstandswort des Grundes)
Die S-Schreibung161
S-Regeln * Stamm- und Lautprinzip



Selbsteinschätzung: Kreuze an, was du sehr gut , einigermaßen gut und weniger gut kannst!

1. Modalverben: Ich kann die Modalverben einem Wunsch (wollen/mögen), einer Möglichkeit (können/dürfen) und einer Notwendigkeit/Aufforderung (müssen/sollen) sinngemäß zuordnen.
2. Adjektivdeklination: Ich kann ein Adjektiv einem Nomen anpassen (Geschlecht, Zahl, Fall).
3. Pronomen: Ich kann zwischen Personal-, Possessiv- und Demonstrativpronomen unterscheiden.
4. Präpositionen: Ich weiß, welche Präpositionen welche Fälle verlangen.
5. Zeiten und Zeitenfolge: Ich kenne die fünf Zeitformen und kann diese richtig einsetzen (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).
6. Imperativ: Ich kann den Imperativ bilden und sinngemäß verwenden.
7. Aktiv und Passiv: Ich kann das Passiv vom Aktiv unterscheiden, das Passiv bilden und anwenden.
8. Hauptsätze und Hauptsatzreihen: Ich erkenne Hauptsätze und die entsprechenden Konjunktionen.
9. Adverbiale Ergänzungen: Ich kann Umstandsergänzungen benennen (Zeitergänzungen, Ortsergänzungen, Artergänzungen, Begründungsergänzungen).
10. Ich kann die Regeln der Beistrichsetzung anwenden.
11. Ich kann Wörter mit ähnlich klingenden Lauten (e – ä/eu – äu/ei –ai/x-Laut) richtig schreiben.
12. Ich weiß, wann Wörter getrennt- oder zusammengeschrieben werden.
13. Ich kenne die Regeln zur Groß- und Kleinschreibung von Numeralien.
14. Ich weiß, ob ich „das“ oder „dass“ schreiben muss. Dabei kann ich zwischen Artikel, Demonstrativ- und Relativpronomen unterscheiden.






Übung macht den Meister: Übe nun folgende Bereiche, bei denen du den roten oder den gelben Daumen angekreuzt hast, in den „Aufgaben nur für dich“!
Unterstreiche zuerst in jedem Satz die Modalverben! Bestimme dann die Stärke der Aussage, indem du die Sterne entsprechend ausmalst!
1 Stern = schwach (Wunsch), 2 Sterne = mittel (Möglichkeit), 3 Sterne = stark (Notwendigkeit/Aufforderung)
Meine Eltern wollen nicht, dass ich die Schule wechsle.
Wir dürfen heute früher nach Hause gehen.
Ich möchte einmal Astronaut werden.
Soll ich dir bei den Hausaufgaben helfen?
Ich kann dir einfach nicht die Wahrheit sagen.
Du musst in der Pause durch die Gänge flitzen.
Entscheide aufgrund der Begründung, welches Modalverb am besten passt!
Attilaheute nicht trainieren. Er ist zu müde.
Attilaheute nicht trainieren. Er hat seine Trainingshose vergessen.
Attilaheute nicht trainieren. Er ist verkühlt.
Attilaheute nicht trainieren. Er hat keine Lust.
Attilaheute nicht trainieren. Er hat eine ärztliche Entschuldigung.
Attilaheute nicht trainieren. Keiner kann ihn dazu zwingen.
2 3
Schritt für Schritt zur richtigen Lösung – Fülle in diesen Fragen zum „Deklinieren von Adjektiven“ die Lücken!
1. Welchen _______________________ hat das Nomen? 2. In welchem _________ steht das Nomen?
3. Wird ein _______________________ ein unbestimmter oder kein Artikel verwendet?
Bestimme das Geschlecht (G), die Zahl (Z) und den Fall (F)!
Beispiel:
das kalte GetränknSg.1./4. den großen Paketen einem hellen Blitzden kaputten Ball
lustiger Kinderdas teure Handy
der bunten Vasedem neuen Tablet
ICH suche DICH: Personalpronomen gesucht – Ergänze die fehlenden Pronomen in der Tabelle!
1. P.2. P.3. P. m.3. P. f.3. P. n.
Nominativ (wer? was?) ich es
Genitiv (wessen?) seiner ihrer
Dativ (wem?) dir
Akkusativ (wen oder was?)
Erstelle in deinem Heft die gleiche Tabelle für den Plural!
Ergänze die fehlenden Adjektivendungen!
Luise Winter besitzt drei bunt___ Fahrräder. Sie hat ein grün___ Mountainbike, ein braun___ E-Bike und ein gelb___ Rennrad.

Das grün___ Mountainbike benützt Luise Winter im Frühling. Die grün___ Farbe passt gut zur blühend___ Jahreszeit.
Ihr gelb___ Rennrad verwendet sie am liebsten im heiß___ Sommer. Dann flitzt sie mit ihrem schnell___ Rennrad die glühend___ Straßen entlang. Sie genießt dabei den kühl___ Fahrtwind. Wenn der verregnet___ Herbst ins trüb___ Land zieht, steigt sie auf ihr braun___ E-Bike. Nach zwei kräfteraubend__ Jahreszeiten braucht sie nun beim anstrengend___ Radeln elektrisch___ Unterstützung. Mit diesem Fahrrad legt sie allerdings nur mehr kurz___ Strecken in der groß___ Stadt zurück. Und im kalt___ Winter? Da geht die sportlich___ Luise Winter zu Fuß.
Dekliniere in deinem Heft folgende Beispiele! Erstelle dazu eine Tabelle! der rosa Pudel * eine gefleckte Kuh * ein sauberes Schwein * die wilden Tiere
Nominativ (wer? was?) der rosa Pudel
Genitiv (wessen?)
Dativ (wem?)
Akkusativ (wen was?)
(wen was?) 6 5 7 8

Nominativ (wer? was?) die wilden Tiere
Genitiv (wessen?)
Dativ (wem?)
Setze die passenden Possessivpronomen richtig ein! Kreise den passenden Fall ein!
_______________ Handschuhe gefallen mir gar nicht.
Ich trage _____________ Handschuhe nur selten.
Die Farbe _____________ Handschuhe ist nämlich violett.
Mit ________________ Handschuhen gehe ich nicht auf die Straße.
_______________ Haus ist schon uralt.
________________ Haus hilft nur mehr eine Renovierung.
Denn das Dach ________________ Hauses ist schon lange undicht.
Wir möchten _____________ Haus aber auf gar keinen Fall verkaufen.
Das Mädchen liebt _______________ Hund.
Der Name _____________ Hundes ist außergewöhnlich.
___________ Hund heißt tatsächlich „Keksnase“.
Täglich muss es mit ______________ Hund spazieren gehen.
Kreise zuerst das passende Demonstrativpronomen ein! Dann übertrage die Sätze in dein Heft!
Hast du diesem / jenen / derjenige Film gesehen? Diesen / Jenem / Denjenigen Samstag gehen wir ins Kino. Diesem / Jenen / Demjenigen Schauspieler kenne ich nicht.
Hörst du gerne derjenigen / jenes / diese Hip-Hop-Musik? Das ist jenem / derjenige / diesen, den ich gestern auf der Straße getroffen habe. Desjenigen / Jene / Dieses Auto gehört uns, jenes / diesem / denjenigen unseren Nachbarn. Nimm doch jenes / diese / diejenige Buch! Diese / Jenes / Dasjenige Kappe steht dir nicht. Wollt ihr diesem / jene / dasjenige Spiel spielen? Genau in jenen / derjenigen / diesem Moment läutet die Schulglocke und ich bin mit diejenige / jenem / dieser Übung noch immer nicht fertig.

Ordne die Präpositionen den Fällen richtig zu, indem du sie in die Kreise schreibst! Präpositionen, die zu beiden Fällen passen, kommen in die Schnittfläche!
an M aus M durch M für M gegen M in M vor M mit M nach M unter M auf M ohne M zu M von M wider

auf – unter – neben? Verfasse in deinem Heft zehn Sätze zu folgendem Bild! Richte dich nach dem Beispielsatz und hebe die Präpositionen bunt hervor!


Beispiel: Der Teppich liegt vor dem Sofa.
Kreuze für jedes Beispiel Person, Zahl und Zeitform richtig an! Halte dich an das Farbsystem – z. B. dürfen für das rote Beispiel nur die roten Kreise angekreuzt werden!
er hatte gesungen
du suchst sie sind
wir werden springen
ihr wart gelandet
sie isst
ich habe gehabt wir werden sein es läutete
Unterstreiche zuerst alle Prädikate! Dann kreuze die entsprechende Zeitenfolge an!
In den letzten 30 Jahren hatte sich die digitale Welt rasant verändert, und mit ihr das Leben der Menschen. In den 1990er Jahren hatten nur wenige Familien einen Computer zu Hause, und das Internet war gerade erst im Aufschwung. Menschen trafen sich noch hauptsächlich persönlich, um Zeit miteinander zu verbringen, und Handys waren selten. Doch nach und nach hatte sich die Technologie weiterentwickelt. Die ersten sozialen Netzwerke entstanden, und immer mehr Erwachsene und Jugendliche verbrachten ihre Zeit online. Mit der Einführung von Smartphones in den 2000er Jahren änderte sich das Leben komplett. Kinder und Jugendliche, die zuvor draußen gespielt hatten, verbrachten nun Stunden an ihren Geräten. Die Art und Weise, wie sie kommunizierten und interagierten, hatte sich grundlegend gewandelt.
Präsens – PerfektPräteritum – Plusquamperfekt
Übertrage nun den Text in der angekreuzten Zeitenfolge in dein Heft!
Setze die richtigen Imperativformen ein! Vergiss nicht auf das Rufzeichen!
Vom Aktiv zum Passiv – Wandle die Sätze um!
Eiernockerl einfach zubereitet
Zuerst bereitet man den Nockerlteig zu. Man verrührt dazu die Milch mit Wasser. Ebenso fügt man eine Prise Salz, Butter und drei geschlagene Eier hinzu. Zum Schluss gibt man das Mehl dazu. Jetzt rührt man diese Masse so lange, bis ein cremiger Teig entsteht.


Anschließend bringt man einen Topf Wasser mit ein wenig Salz zum Kochen. Man drückt den Nockerlteig durch ein Sieb in das kochende Wasser. Die Eiernockerl kocht man so lange, bis sie an der Wasseroberfläche schwimmen. Nach dem Abseihen schwenkt man die Nockerl in etwas Butter in einer Pfanne. Dann verquirlt man drei Eier und gießt sie in die Pfanne zu den Nockerln. Man würzt das Gericht abschließend mit Salz und Pfeffer.
GUTEN APPETIT!
So geht’s: Zuerst wird der Nockerlteig zubereitet.
Verwechslungsgefahr – Setze richtig ein! Tipp: ä – äu O Führe auf das Stammwort zurück R a – au!
n_____lich
ver___rgert
___ndlos
kl___ren
j___hrlich
kr___ftig
tats___chlich
B___cher ___ngstlich
leb___ndig
Gespr___ch
W___rme
Ang___bot
Bl___tter
Fl___ck
h_____slich
T_____fel
R_____ber
L_____se
l_____chten
L_____te
l_____ten
Fr_____de
Ger_____sch
d_____tlich
B_____te
tr_____
h_____llos
f_____r
R_____se
Det_____l
K_____ser
L_____stung
W_____senhaus
H_____fisch
S_____tenstechen
Brotl_____b
schw_____gen
verz_____hen
M_____
vers_____men
str_____en
tr______nieren
S_____de
Tausche mit deiner Partnerin oder deinem Partner und kontrolliere! Besprecht eure Fehler!
X-Laute: Setze zuerst richtig ein! Übertrage dann die Wortgruppen richtig geschrieben in dein Heft!
se_____ Ke_____e in der Bü_____e * unterwe____ mit dem Ta____i * e____treme
E____perimente * wa_____ende Eide_____en * ein schla____iger Lu_____ *
anfan____ lu____uriös, später genü____am * lin____ schreiben * neuerdin____
Glü_____pilz * blindlin____ kle_____en * mu_____mäuschenstill * allerdin____ ein
An____thase * vormitta____ kni_____en * Te____t mit Fortsetzun____geschichte *
schi_____alshafte Verwe_____lung * schnurstra_____ in die Vol____schule * rin____um Par____ * we_____elnde Sa____ophonklänge * ma____imale
Bo____enanzahl * zwe_____ Strei____ * fi____er Fu_____
19 21 18 20 ___hnlich
Kontrolliere mit dem Duden online!

x, chs, gs, ks, cks

Nun geht’s los – Aufgaben nur für dich!
Getrennt oder zusammen? Schreibe die Schlangensätze in dein Heft!
Ichmöchteheute lieberKlavierspielenalseislaufen. Nomenwerden g roßgeschrieben. AufeinemPlaka t musstdugroßschreiben.Wenndunichtwe i terweißt,schauindeinemWör terbuchnach. Emimöchteaufd e mSofasitzenbleiben. Tommusslerne n , damiternichtsitzenbleibt. DerPyjamaistbl a ugestreift. DieRechtschrei b ungistgemeingefährlich. Heutebleibtdie g anzeKlassezuHause. Stanifühltsichz u h auseamwohlsten. DasEinkaufenge henistmeinHobby.

Groß oder klein? Suche dir einen Zettel aus und übertrage die Sätze unter Beachtung der Großund Kleinschreibung in dein Heft!

WIR ZWEI SIND EIN GUTES TEAM. ELLA HAT MEHRMALS HINTEREINANDER EINE EINS GEWÜRFELT. IM DUTZEND KOSTEN DIE SCHOKORIEGEL WENIGER. CHARLES LINDBERGH GELANG ALS ERSTEM DIE ATLANTIKÜBERQUERUNG. DREI VIERTEL DES WEGES HABEN WIR SCHON GESCHAFFT. DAS MUSS JEDER EINZELNE FÜR SICH ENTSCHEIDEN. MEINE KLEINE SCHWESTER KANN SCHON BIS HUNDERT ZÄHLEN. NUR WENIGE WISSEN DAS.




WIE VIEL HAT DAS GANZE GEKOSTET? ES IST VIERTEL SIEBEN. ES IST VIERTEL NACH SECHS. DER NÄCHSTE BITTE! MEIN PAAR TURNSCHUHE IST SCHON SEHR ABGETRAGEN. DIE SIEBEN IST MEINE GLÜCKSZAHL. MORGEN WIEDERHOLEN WIR KAPITEL DREI. DU BIST ZWAR EINE NULL IM SPORT, ABER EIN EINSERKANDIDAT IN MATHEMATIK. ES NAHMEN TAUSENDE AM WETTBEWERB TEIL.

AM LETZTEN JEDES MONATS BEKOMME ICH MEIN GEHALT. MIGEL HAT EINEN EINSER AUF DIE SCHULARBEIT BEKOMMEN. TRAU KEINEM ÜBER DREIßIG! WIEN WIRD IM JAHR 2030 DREI MILLIONEN EINWOHNER HABEN. ICH KAUFE EINEN HALBEN LITER MILCH. ES FEHLT NOCH EIN ACHTEL. ES MUSS NOCH VERSCHIEDENES GETAN WERDEN. AM ERSTEN MAI IST FEIERTAG. JEDER DRITTE WAR DAFÜR.
geht’s los – Aufgaben nur für dich!
Hauptsätze – Bilde mit den Wortgruppen Hauptsätze! Konjugiere dazu die Verben und setze sie ins Präsens!
das Frühstück mein Vater MACHEN am Sonntag für die ganze Familie immer
TREFFEN jeden Tag meine Freunde im Park ich
am Handy ich meine tägliche Zeit VERKÜRZEN
Hauptsatzreihe und Konjunktion – Bilde aus den folgenden Sätzen Hauptsatzreihen! Verwende dazu die angegebene Konjunktion! Setze Beistriche, wenn nötig!
Digitale Geräte erleichtern den Alltag. Sie sind überall im Einsatz. (und)
Man kann online schnell etwas nachschlagen. Man fragt eine Suchmaschine. (oder)
Der digitale Fortschritt bringt Vorteile. Vieles geht schneller. (denn)
Adverbiale Ergänzungen – Ordne die Beispiele den adverbialen Bestimmungen zu!





um 20 Uhr blitzschnell mit letzter Kraft
27 gestern
voller Vorfreude nach Kroatien bis zum Eingang aus Angst vor lauter Müdigkeit in meinem Zimmer letztes Wochenende wegen des starken Regens







Zeitergänzung ZE Ortsergänzung OE Artergänzung AE Begründungsergänzung BE

Beistriche – Setze in den folgenden Sätzen Beistriche, wenn nötig!
Ich lerne heute für Biologie und Englisch aber nicht für Deutsch.
In meine Schultasche habe ich mein Geografie- und mein Geschichtebuch sowie meine Turnsachen eingepackt.
Auf dem Foto ist Bruno der Hund meiner Oma.
Martin beeil dich doch!
Steigerung erwünscht – Setze „das“ oder „dass“ richtig ein! Kreuze an, ob ein Ersatzwort möglich wäre! Tipp: Für „das“ könntest du die Ersatzwörter „dieses/ dies – jenes) einsetzen.
________ Handy ist nicht aufgeladen.JANEIN
Ich weiß aber, ________ ich es geladen habe.JANEIN
Ich hoffe, ________der Akku nicht kaputt ist.JANEIN
________ wäre nämlich nicht so gut.JANEIN
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ________ mit der „das-dass-Schreibung“ verstanden habe.
Andernfalls müsste ich mir _______ noch einmal anschauen.JANEIN
Nochmal „das“ oder „dass“ – Setze richtig ein! Gibt es ein Ersatzwort, schreibe es auf! Tipp: Auch „welches“ kann ein Ersatzwort für „das“ sein.
Ich greife nach meinem Handy, ______ schon halb leer ist._____________
Ich bin mir sicher, ________ mein Akku nicht mehr lange halten wird._____________
_______ meine Handys immer wieder kaputtgehen, fällt mir schon auf._____________
Mein Handy, ________ in der Früh vollständig geladen war, ist jetzt halb leer._____________ ______ glaube ich einfach nicht._____________
Ein Handy, ______ länger als ein Jahr hält, wäre ein Hit._____________
Aller guten Dinge sind DREI – Setze richtig ein und schreibe das passende Ersatzwort darunter, sofern es eines gibt!
Ich bin betrübt, ____________ ____________ Handy nun kaputt ist. ____________ ist ____________ Handy, ____________ ich von meiner Mama geschenkt bekommen habe. ___________ hätte ich nicht gedacht, ___________ sie mir ___________ Handy zum Geburtstag schenkt.
Was ich alles tun möchte – Pläne für die Zukunft

HB1: Höre dir an, was John Goddard zu sagen hat! Nimm ein Blatt und mach dir während oder nach dem Anhören Notizen! Vergleiche sie mit den anderen der Klasse!
Die Lebensgeschichte des berühmten Abenteurers John Goddard hat alle ein wenig nachdenklich gestimmt. In der Pause unterhalten sie sich darum über ihre eigenen Zukunftspläne.
Wenn ich 30 Jahre alt bin, möchte ich einen Sportwagen fahren.
Ich
auf
NAME Was würdest du in deinem Leben gerne tun? Warum? 1 2 3



Eine Expedition den Amazonas entlang, das wäre was.



Nimm ein A4- Blatt und gestalte deine eigene „Lebensliste“! Überlege dir zumindest 10 Punkte!
Mögliche Satzanfänge: Ich werde …
Spätestens in 10 Jahren … Ich möchte unbedingt …
Einer meiner Träume war schon immer ...
Es wird großartig sein, wenn ich …
Eine Familie zu gründen, ist mir wichtig.
Meine Lebensliste

Befrage drei Mitschülerinnen oder Mitschüler über ihr wichtigstes Ziel! Notiere die Antwort!

„Jungsein“ heißt für mich…
Notiere in Stichworten deine Gedanken zu diesem Thema!



„Jungsein“ heißt für mich…




Aktivitäten
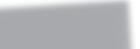



Vorschriften



Nimm ein A4- Blatt und ordne deine Begriffe in einem Cluster mit folgenden Kategorien!

Gefühle



Wünsche

Probleme
Lies diese Aussagen von Jugendlichen! Kreuze an, welchen du zustimmst!

Wenn ich fortgehen will, sagen
meine Eltern immer nur: „Das erlauben wir nicht, denn du bist erst 13.“ Geht es aber ums Zimmeraufräumen, bin ich plötzlich alt genug dafür.




Momentan ist alles echt anstrengend. Man ist schon extrem zickig Bei jeder Kleinigkeit bin ich sofor t auf 180.
Ich habe keine Lust mehr, immer auf das zu hören, was andere sagen. Ich will jetzt einfach selber herausfinden, was für mich das Beste ist.

Früher war mir das echt nicht so wichtig. Aber jetzt habe ich viel mehr Probleme mit der Figur, bin unzufriedener mit mir.




Für mich ist Zukunft nur ein Begriff, der mich noch nicht so beschäftigt. Momentan spiele ich lieber Onlinespiele, chatte mit meinen Freunden und so weiter.

Überlege, wie es dir mit dem Erwachsenwerden geht! Schreib drei deiner Überlegungen auf!

Bildet Vierergruppen! Lest eure Überlegungen vor und schaut, ob sie ähnlich sind! Tauscht euch darüber aus!
Lies die Geschichten von Isabel und Mio!

Dilemma, das:
Zwangslage, sich zwischen zwei gleichermaßen schwierigen oder unangenehmen
Dingen/Situationen entscheiden zu müssen
15 20 25
Isabels Eltern meinen, sie sei alt genug, zuhause selbständig ihre Arbeiten für die Schule und den Haushalt zu erledigen. Doch wie wird sie von ihren Eltern behandelt?
„Isabel, setz dich gerade hin!“
„Was hast du schon wieder mit all deinem Taschengeld gemacht? Du musst endlich sparen lernen!“
„Mit DEN Klamotten gehst du sicher nicht zur Schule! Und überhaupt – wie du immer herumläufst!“
„Es ist schon nach 21 Uhr – du musst endlich ins Bett, sonst kommst du morgen wieder nicht aus den Federn.“
Isabel hat diese Bevormundung satt. Sie findet, sie hat auch allen Grund dazu...
„Mio, hör endlich mit dem Tratschen auf, sonst wirst du wieder einmal nacharbeiten müssen! Du weißt, wie toll das ist, in der Schule zu sitzen und die Schulübung nachzuschreiben, wenn alle anderen frei haben. Außerdem kannst du dir das überhaupt nicht leisten, du stehst zwischen Vier und Fünf. Also bitte – pass endlich auf!“
Mio murmelt etwas Unverständliches. Weil der Lehrer glaubt, dass er ein Schimpfwort gehört hat, bekommt Mio auch gleich einen Eintrag in sein Mitteilungsheft.
Mio ist stinksauer und schreit den Lehrer an: „Joanna und Andrea quatschen die ganze Zeit – und die beiden ermahnen Sie nie! Das finde ich total ungerecht! Und außerdem habe ich Sie überhaupt nicht beleidigt. Ich habe nur gesagt: ,Nicht schon wieder!’ “


Hast auch du schon einmal eine ähnliche Situation erlebt?
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
Wie würdest du heute in einer derartigen Situation reagieren?
Sucht euch eine Partnerin/ einen Partner! Stellt euch gegenseitig die Fragen der Seitenspalte und tauscht euch aus!
Das nervt! – Was bringt dich persönlich auf die Palme? Notiere in den Sprechblasen Situationen, die DICH verärgern!


Wie Konflikte entstehen
Welche Situationen provozieren dich und enden daher manchmal mit Streit? Nummeriere! (1 – das provoziert mich am meisten, 2 - …) Füge zwei eigene Beispiele hinzu!
Ich fühle mich provoziert, wenn...
_____ mich jemand beschimpft.
_____ jemand meine Familie beschimpft.
_____ man mir den „Stinkefinger“ zeigt.
_____ jemand meine Hilfe nicht annimmt.
_____ man mich nicht ernst nimmt.
_____ ich angestarrt werde.
_____ über meinen Kleidungsstil gelästert wird.
_____ ich geschubst oder angerempelt werde.
_____ ich ausgelacht werde.
_____ ich im Sport immer als Letzter/Letzte ausgewählt werde.
5 SITUATION
_____ meine Mitschüler/innen von mir abschreiben.
_____ ich gemobbt werde.
_____ ich zu einer Party nicht eingeladen werde.
_____ man meine Sachen, ohne mich zu fragen, benutzt.

Schreibe in Stichwörtern eine Situation auf, die dich sehr provoziert hat! Wie hast du reagiert? Überlege, ob eine andere Reaktion besser gewesen wäre!

REAKTION
Ich habe...
Vielleicht hätte ich...
Am besten ist es natürlich, wenn erst gar keine Konflikte entstehen. Das ist nicht immer einfach, aber „Übung macht den Meister“!


Aktives Zuhören und Verständnis zeigen:
Höre genau zu, was die andere Person sagt, ohne sie zu unterbrechen.
Wiederhole, was du gehört hast.
Versetze dich in die Lage der anderen Person und versuche, ihre Gefühle zu verstehen.


Klare Kommunikation und Kompromisse:
Drücke deine Gedanken und Gefühle klar aus, ohne aggressiv zu sein. Verwende Ich-Botschaften, um zu beschreiben, wie du dich fühlst.
Sei bereit, Kompromisse einzugehen. Manchmal ist es wichtig, einen Mittelweg zu finden.


Respekt bewahren und Emotionen kontrollieren:

Behandle die anderen mit Respekt, auch wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Vermeide Beleidigungen oder abwertende Kommentare.
Wenn du merkst, dass du wütend oder aufgeregt wirst, nimm dir einen Moment Zeit, um durchzuatmen und dich zu beruhigen, bevor du reagierst.
ICH-Botschaften
Mit ICH-Botschaften kannst du ausdrücken, wie es dir geht, wie du etwas verstanden hast und wie du dich fühlst.
Wichtig dabei – das Wort DU sollte nicht vorkommen.

DU lachst immer über mich!

Versuche es selbst:
ICH habe das Gefühl, ich werde ausgelacht. Das macht mich unsicher.


DU-BotschaftICH-Botschaft
Du lässt mich nie mitmachen!
Du redest über mich!
Du borgst mir nie etwas!
Das geht leicht – Das fällt mir noch schwer!
Ein Problem sofort ansprechen
In der ICH-Form sprechen
Nicht beim Reden unterbrechen
Keine Beleidigungen



Modalverben: Musst du? Darfst du? Willst du?
1
Was verändert sich? Nimm dein Heft und schreib die folgenden Sätze mit allen Modalverben auf! Besprecht die veränderte Bedeutung!
Zur Erinnerung: müssen, sollen, dürfen, können, wollen, mögen!
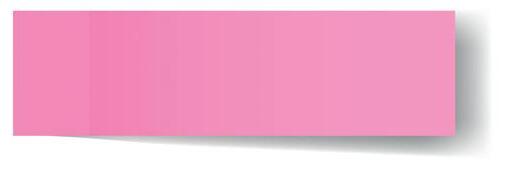
Jugendliche _______________ im Haushalt nicht mithelfen.

Schülerinnen und Schüler _______________ früh ins Bett gehen.

Jedes Kind _______________ ein Instrument lernen.

Modalverben im Präteritum

Im PRÄTERITUM steht das Modalverb im Aussagesatz an zweiter Stelle, das Verb im Infinitiv an letzter Stelle (Verbklammer).
Beispiel: Ich musste ihn noch unbedingt vor der Schularbeit etwas fragen
Verbklammer

SUBJEKT
mochte/wollte M mussten M bezahlen M gehen M konntet M fortgehen M durftest M essen M wollte M bekommen M sollten M ausprobieren
MODALVERB PRÄTERITUM
Lückenfüller – Vervollständige die Sätze! Tipps: Der Lerncoach auf S. 165 kann hilfreich sein. Statt „mochte/ mochtest/ mochten/ mochtet“ kannst du auch „wollte/ wolltest/ wollten/ wolltet“ verwenden. Das klingt oftmals schöner.
Wir fünf Euro für den Kinobesuch
Ihrwegen des Regens nicht nach Hause
Ich unbedingt das neue Spiel
Du dieses Mal bis 22 Uhr
Kinder etwas Taschengeld
Dani keine Schokolade
Modalverben im Perfekt
MODALVERB
IM PERFEKT
Im PERFEKT steht das Hilfsverb HABEN an zweiter Stelle.
Die Infinitivformen des Verbs und Modalverbs stehen an vorletzter und letzter Stelle des Satzes.
Verbklammer
Schreibe die Sätze von Ü2/ S. 24 im Perfekt in dein Heft!
Modalverben im Plusquamperfekt
MODALVERB IM PLUS QUAMPERFEKT
Modalverben im Futur
Beispiel: Das habe ich gestern noch machen wollen. 3 4 5 6
Im PLUSQUAMPERFEKT wird das Hilfsverb HABEN ins Präteritum gesetzt und steht an zweiter Stelle.
Die Infinitivformen des Verbs und des Modalverbs stehen an vorletzter und letzter Stelle des Satzes.
Beispiel: Der Elektriker hatte den Schaden nicht beheben können
Verbklammer
Schreibe die Sätze von Ü2/ S. 24 im Plusquamperfekt in dein Heft!
Modalverben im Futur
MODALVERB FUTUR
Im FUTUR steht das Hilfsverb WERDEN an zweiter Stelle. Die Infinitivformen des Verbs und des Modalverbs stehen an vorletzter und letzter Stelle des Satzes.
Beispiel: Wir werden morgen die Schularbeit schreiben müssen
Verbklammer
Schreibe die Sätze von Ü2/ S. 24 im Futur in dein Heft!
ACHTUNG: Eine Übersicht zu den in den Zeitformen konjugierten Modalverben findest du im Anhang (S. 171–172)!

Kuddelmuddel – Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge und bilde Sätze! Schreib sie in dein Heft, setze die Verbklammer und bestimme die Zeitform!
a) Unsere Kinder – müssen – arbeiten – noch sehr viel – werden
b) seine Pizza – hatte – Timon – unbedingt – wollen – aufessen
c) das Spielfeld – dürfen – nicht – betreten – Die Fans
d) werden – die Wahl – Sie – nicht – können – gewinnen
e) Tim – nehmen – hat – dreimal täglich – das Medikament – sollen
f) gar nicht – heute – Wir – aufstehen – mochten/wollten
g) werden – einmal – Anna – Schauspielerin – wird – wollen
h) nichts – bei der Busfahrt – Wir – essen – durften

Markiere in diesem Text über Roboterautos alle Modalverben!
Hände
Roboterautos – ein Traum oder bereits Realität? Die Technik soll schon so weit sein.
Ein Auto muss sein – so sehen es die meisten Menschen.
Doch immer geradeaus auf der Autobahn fahren, kann eintönig sein. Fahrerin oder Fahrer müssen muss kaum noch etwas tun.

Will man den Autoherstellern glauben, wird der Mensch nicht mehr das Auto steuern müssen, es wird selbst fahren können. Fahrzeuge können beispielsweise heute schon vollautomatisch einparken. Die Autofahrerinnen und -fahrer werden sich über die neuen Entwicklungen freuen dürfen. Doch wie sicher mögen diese Fahrzeuge wohl sein? Denn auch bei autonom fahrenden Autos kann es zu Unfällen kommen. Sensoren können ausfallen, aber auch Gefahrensituationen können vom System zu spät erkannt werden. Mit Tests im weltweiten Zentrum des autonomen Fahrens – in Silicon Valley (Kalifornien) – will man beweisen, dass autonomes Fahren sicher ist. Deshalb dürfen dort bereits ca. 1 000 Roboterautos selbständig fahren. Das Ergebnis lautet: Sensoren können wesentlich zuverlässiger, schneller und präziser reagieren als der Mensch.
Lass dich führen – Folge der Anleitung!
Im Jahr 2030 möchten immer mehr Menschen ein Elektroauto fahren.
Vor etwa 100 Jahren hat man die Autos noch ankurbeln müssen.
In naher Zukunft werden Autos autonom fahren können.
In den 1950er Jahren hatte jeder ein Auto haben wollen.
Vor 70 Jahren durften die Autofahrerinnen und -fahrer in vielen Bundesländern Österreichs nicht auf der rechten Straßenseite fahren.
Nach Möglichkeit sollen die Autobesitzerinnen und Autobesitzer ihr Fahrzeug so wenig wie möglich benutzen.
Ich kann Modalverben und die Zeitformen, in denen sie stehen, erkennen. (1 + 2)
autonom: selbständig, unabhängig

ANLEITUNG:
1. Bestimme im letzten Satz die Zeit!
2. Kreuze jenen Satz an, der im Perfekt steht!
3. Kreise jenes Modalverb ein, das im Präteritum steht!
4. Unterstreiche jenen Satz, der im Futur steht!
5. Unterwelle jenen Satz, der im Plusquamperfekt steht!
6. Markiere jenes Modalverb, das im Präsens steht!
Verfasse einen Aufsatz in deinem Heft und schildere, wie dein Leben im Jahre 2050 aussehen wird! Verwende dazu deine „Lebensliste“ von Ü2/ S.15!



Ich kann anhand meiner Lebensliste eine Planung für meine Zukunft erstellen. (3)
Mara fällt in letzter Zeit auf, dass sie oft in Gedanken mit sich selbst spricht. In 15 Minuten, wenn die große Pause vorbei ist, soll sie ein Referat über ihr Lieblingsbuch halten. Gerade passiert es wieder.
Nur mehr 15 Minuten, gleich ist es soweit. Habe ich mich wirklich gut vorbereitet oder war es doch zu wenig? Eigentlich bin ich ja ein schüchterner Typ... Wieso muss ich dann vor der ganzen Klasse stehen und etwas vortragen? Mein Referat kann nur gelingen, wenn ich das Spannende aus dem Buch vorstelle. Was hat mir eigentlich gefallen – das ist der springende Punkt – den muss ich meinen Zuhörern näherbringen. Eigentlich konnte ich ja selbst dieses Buch nicht zur Seite legen, weil es so spannend zu lesen war, aber ... Na ja, warum soll es denn den anderen nicht auch so gehen?
Wichtig ist auf jeden Fall, die Vortragsregeln einzuhalten. In der 1. Klasse haben wir das genau durchgenommen. Also – nur Mut – es wird schon klappen! Ich muss auf jeden Fall frei sprechen, doch wenn mich alle anschauen, werde ich nervös. Jetzt fängt es an – ich werde nervös! Mir ist ganz flau im Magen – ich zittere sogar leicht.Habe ich Fieber? Nur mehr fünf Minuten, dann startet mein Vortrag. Tief durchatmen soll helfen, hat meine Mutter gemeint. Alle laufen um mich herum, sind fröhlich und unbeschwert, denn keiner weiß, wie es mir geht. Warum vergeht die Zeit nur so langsam? Schnell noch alles herrichten, gleich läutet es. Ich fühle mich furchtbar! Ich wünschte, ich hätte es schon hinter mir!
Welche Überschrift würde für den inneren Monolog von Mara passen?
Schreibe deinen Einfall auf die leere Zeile über den Text!
Denke daran, der innere Monolog ist wie ein Selbstgespräch, also eine Abfolge von Gedanken, die jemand hat
1. Schreibe im Präsens und verwende die Ich-Form, also die 1. Person Singular! z. B.: Ich weiß nicht, wo ich bin. Habe ich mich verlaufen?
2. Beschreibe Gefühle und Gedanken! z. B.: Ich bin fröhlich, denn... Ärger steigt in mir auf, ich platze bald vor Wut...



3. Übernimm die Denk- und Sprechweise der Figur! Verwende dazu Kurzsätze, Wiederholungen oder den mündlichen Sprachgebrauch! Baue Ausrufeund Fragesätze in deinen Text ein! Sie machen deinen Text lebendiger. z. B.: Was für ein Blödsinn! Was soll das alles?
4. Verdeutliche Gedanken und Gefühle durch passende Satzzeichen! z. B.: Fragen = ? Gefühle = ! Denkpausen = – abbrechende Gedanken = ... Aneinanderreihung von Gedanken = ,
5. Beschreibe die Stimmung rund um dich herum! z. B.: Es ist kalt, überall liegt nur Schnee und ich friere...
6. Überlege dir auch zum Schluss eine passende Überschrift!
Markiere im inneren Monolog von Mara, alle Fragen (?) grün , alle Gedanken (!) blau , alle Denkpausen (-) rot und alle abbrechenden Gedanken (…) gelb
Lies folgende Symptome! Kennst du sie? Ordne sie dem Gefühlszustand zu, der dir passend erscheint! Schreibe in die ausgewählten Kästchen Situationen, in denen du das jeweilige Symptom erlebt hast oder erleben könntest! Manche Symptome passen sowohl zur Angst als auch zur Nervosität.
Ich habe Angst.
Zittern: Mein Körper kann anfangen zu beben oder zu zittern.
Schwitzige Hände: Meine Handflächen werden ganz feucht.
Kurzatmigkeit: Ich habe das Gefühl, ich bekomme nicht genug Luft, als ob ich schnell laufen würde.
Bauchschmerzen oder Übelkeit: Mein Magen fühlt sich komisch an.
Kopfschmerzen: Ich habe ein unangenehmes Druckgefühl im Kopf.
Muskelverspannungen: Meine Muskeln, besonders im Nacken oder Rücken, können sich hart und angespannt anfühlen.
Herzrasen: Mein Herz fühlt sich an, als würde es einen Sprint hinlegen und es schlägt superschnell.
Trockener Mund: Es fühlt sich an, als wäre all mein Speichel einfach verschwunden und ich müsste ständig schlucken.
Zappeligkeit: Ich kann nicht stillsitzen und ertappe mich selbst dabei, wie ich mit den Fingern trommle oder mit den Füßen wippe.
Konzentrationsschwierigkeiten: Es ist schwer, mich zu konzentrieren oder klare Gedanken zu fassen, weil ich so aufgeregt oder abgelenkt bin.
Ich bin nervös.

Suche dir eine Partnerin / einen Partner! Erzählt euch, in welcher Situation ihr Angst hattet oder nervös wart!
Überlege dir fünf Symptome, die du in deinem Körper spürst, wenn du dich sehr freust und schreib sie in dein Heft! Lest sie der Klasse vor und vergleicht!
Lies die Textteile! Markiere alle Teile der ersten Geschichte rot und alle Teile der zweiten Geschichte grün! Bringe die Teile, durch Nummerierung, in die richtige Reihenfolge!

Warum bin ich nur mitgegangen! Alle anderen plaudern und lachen zusammen, und ich stehe hier einfach allein rum. Warum spricht denn niemand mit mir? Ich fühle mich wie unsichtbar! Alle fühle mich furchtbar und... Vielleicht sollte ich einfach mein Handy rausholen und so tun, als ob ich beschäftigt bin? Ich könnte einfach vorgeben, dass ich dringend was aus meinem Rucksack holen muss. Aber
Da steht sie wieder… Ich wünschte, ich wüsste, ob sie mich überhaupt bemerkt. Einerseits will ich, dass sie mich sieht, andererseits… Was,


sind fröhlich und quatschen - nur ich stehe allein. Es fühlt sich an, als ob eine unsichtbare Mauer um mich herum wäre. Vielleicht sollte ich einfach zu ihnen hingehen und versuchen mitzureden! Aber was, wenn sie mich gar nicht beachten oder komisch anschauen? Das wäre so peinlich! Ich

wenn sie mich komisch findet oder mich nicht mag? Das wäre so peinlich – mir wird ganz heiß im Gesicht. Werde ich gerade rot? Vielleicht




Warum bin ich …

wünschte, ich könnte einfach wissen, was sie über mich denkt. Ob sie überhaupt weiß, wer ich bin? Vielleicht sollte ich versuchen, sie anzulächeln oder Hallo zu sagen. Aber was, wenn sie das komisch findet?

das ist doch doof! Warum sollte ich so tun, als ob ich beschäftigt bin, nur um nicht allein dazustehen?

sollte ich einfach versuchen, cool zu wirken und hoffen, dass sie mich bemerkt. Ich könnte versuchen, in ihrer Nähe zu sein, ohne dass es so aussieht, als ob ich es extra tun würde. Aber was, wenn sie mich dann doch nicht beachtet? Ich
Da steht sie …



Suche dir einen der beiden „innerer Monologe“ aus und schreib ihn in dein Heft! Überleg dir eine passende Überschrift!
Wähle nun ein Thema aus und schreibe einen inneren Monolog auf ein A4-Blatt! Überlege dir auch eine passende Überschrift! Umfang: ca. 180 Wörter

Du möchtest am Wochenende mit Freunden etwas unternehmen.
Deine Eltern haben aber für die Familie schon etwas anderes geplant. Beschreibe, was du überlegst, um deine Eltern zu überzeugen, dass sie dich doch mit deinen Freunden gehen lassen!
Deine Eltern weigern sich, deinem sehnlichsten Wunsch zuzustimmen. Was geht in dir vor? Was denkst du in diesem Moment?
Einige Satzanfänge als Hilfestellung


Du hast dich mit einem Freund/einer Freundin zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort verabredet und wartest nun auf ihn/sie. Deine „Verabredung“ kommt zu spät. Du wartest schon seit zehn Minuten. Was denkst du, welche Zweifel kommen in dir auf, wie fühlst du dich?
Du hast ein neues Handy bekommen, doch plötzlich ist es weg. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?
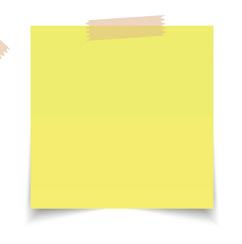
r Es ist … schrecklich, schön, wunderbar, einfach super, kalt, heiß, unglaublich, furchtbar...
r Ich habe Angst. Ich bin überglücklich. Ich kann es nicht glauben.
r Wie kann das sein? Was soll ich nur tun? Was habe ich falsch gemacht? Warum ist das passiert?
r Super, endlich ist es soweit. Mein Gott, was soll ich tun? Ja, ich habe es geschafft! Nein, bitte nicht schon wieder!
Wähle ein weiteres Thema aus oder überlege dir ein eigenes! Verfasse dazu einen inneren Monolog am Computer und drucke ihn aus!

Der innere Monolog ist im Präsens geschrieben.
Der Text ist in der Ich-Form verfasst.
Es wurden Gefühle und Gedanken dargelegt.
Es wurden Ausrufe- und Fragesätze eingebaut.
Im Text kommen Denkpausen (-) und abbrechende Gedanken (…) vor.
Die Stimmung rundherum ist beschrieben.
Ich habe den Text 3-mal gelesen.
Ich habe das Wörterbuch verwendet.

Wenn du aufgeregt oder nervös bist, ist es wichtig, dass du dich sofort wieder gut entspannen kannst. Das geht eigentlich mit etwas Übung leicht.
Nimm dir einen kurzen Moment, um tief durchzuatmen.
Atme ein und zähle dabei in Gedanken bis 4!
Atme aus und zähle dabei wieder in Gedanken bis 4!
Beim nächsten Einatmen zähle bis 5! Ebenso beim Ausatmen!
Dann bis 6 …
Diese Atemtechnik kannst du fast überall anwenden.


Spanne eine Muskelgruppe, z. B. deine Füße an, so fest du kannst, und zähle dabei in Gedanken bis 5!
Dann lass die Muskeln wieder locker!
Danach machst du das Gleiche mit den Unterschenkeln, mit den Oberschenkeln, mit dem Popo, …
Arbeite dich so hoch, bis zum Kopf!

Wähle einen Punkt oder ein Objekt in deiner Umgebung!
Konzentriere all deine Aufmerksamkeit darauf!


Nun betrachte alle Details wie Farbe, Material und Form ganz genau!







Diese Technik gefällt mir am besten:
Der Außenseiter von Lars Krüsand
Es war wieder mal soweit. Die meisten in der Klasse waren der Meinung, man sollte mal wieder richtig was zusammen machen. Jetzt würde es also wieder losgehen. Man würde ihn fragen, ob er vielleicht doch noch mitmachen wollte. Insgesamt hatten sie akzeptiert, dass er lieber für sich war.
Auch in den Pausen suchte er sich fast immer ganz schnell ein ruhiges Plätzchen, wo er nachdenken oder sich auch in Ruhe etwas notieren konnte.
Wenn die andern vorbeikamen und ihn ansprachen, unterbrach er sofort das, was er gerade machte, und war auch schnell mit ihnen im Gespräch. Er hatte überhaupt nichts gegen die anderen, war auch hilfsbereit, er konnte nur mit vielem nichts anfangen, was den andern wichtig war.
„Hi Lars, wie sieht es denn aus? Wir wollen am Freitagabend Inas Geburtstag feiern und sind alle eingeladen. Das wird bestimmt richtig lustig und wäre auch was für dich.“
Er sah auf, Tim stand vor ihm. Der lächelte freundlich, aber so war er eigentlich immer. Er akzeptierte einfach, dass andere Menschen so waren, wie sie waren, und verteidigte sie auch mal, wenn das zum Beispiel bei neuen Schülern nötig war.
Besprecht gemeinsam folgende Fragen!
„Ich überlege es mir“, sagte er und schon war da das zweite Problem. Er war nicht nur gerne für sich, sondern wollte auch andere nicht vor den Kopf stoßen. Deshalb ließ er solche Dinge bis zum Schluss offen. Das gab natürlich einige Probleme. Immerhin musste man ja schließlich schon wissen, wie viele Leute mitmachten.
Aber auch daran hatte man sich in seinem Fall gewöhnt und nahm es hin. Auch Tim reichte das anscheinend für den Augenblick, er schien es auch eilig zu haben. Jedenfalls verabschiedete er sich schnell und verschwand.
Dann kam dieser Freitag und er überlegte ziemlich lange, was er tun sollte. ... Lies den Anfang dieser Kurzgeschichte!


HB 2: Wie meine Geschichte weitergeht, erfährst du nun.
Tipp: Die Fortsetzung findest du auch im Leseteil auf S. 15!


Kann man Lars als „typischen“ Außenseiter bezeichnen? Was spricht dafür, was dagegen? Welche Arten von Außenseitern gibt es? Welche Talente – so wie Lars – könnt ihr aufweisen?
Wie kann Lars am treffendsten beschrieben werden? Kreise ein! Tipp: Kläre zuerst mit Hilfe des Wörterbuchs oder Duden online dir unbekannte Wörter!
Einzelgängerselbstbewusstfür Neues offenunflexibel spontannachdenklichhilfsbereit unentschlossen extrovertiertrücksichtsvollentschlussfreudigzielstrebig grüblerischfreundlichrespektlosTeamplayer
Stell dir vor, du bist an Lars’ Stelle! Schreibe einen inneren Monolog darüber, was dir durch den Kopf gehen würde, wenn du entscheiden müsstest, ob du zur Party gehst oder nicht!
V/v oder F/f?
• In den meisten Fällen wird der f-Laut auch mit F/f geschrieben.
D Falke, Film, finden, fleißig, …
• nach dem Konsonanten „n“
D Zukunft, Auskunft, Einfahrt, …
• Wörter mit den Vorsilben „fort-, fertig-, fern-, fehl-, …“
D fortgehen, fertigstellen, Fernseher, Fehlverhalten, …
Setze die Verben passend ein!
ABER VORSICHT! viel ≠ fiel Verse ≠ Ferse

Kläre den Unterschied!
fertigstellen M fertigschreiben M fertiglesen M fertigmachen M fertigkochen M fertigbauen
Die Suppe muss noch eine Stunde __________________________ .
Ich möchte heute mein Buch ______________________ .
Am Wochenende wollen mein Vater und ich das Modellauto ________________________ .
Sollen wir das Werkstück bis zur nächsten Werkstunde _____________________________ ?
Beeil dich – du musst dich für die Schule ______________________ !
Meinen Aufsatz sollte ich doch bis morgen ____________________ .
Forme die Sätze von Ü1 so um, dass keine Modalverben vorkommen und schreib sie auf! Überlege, was dir auffällt und notiere es!
Die Suppe kocht noch eine Stunde fertig.
Mir fällt auf, dass...
Lies die Verben! Verbinde sie mit den passenden Bedeutungen!
fortbleibenweitermachen fortbringennichtzurückkehren fortsetzenentfernen forteileneinenOrtverlassen fortfahrensichschnellentfernen fortgeheneinenOrtverlassenODERweitermachen
Bilde mit jedem Wort der linken Spalte von Ü3 einen Satz und schreibe ihn in dein Heft!
Suche im Duden online oder im Wörterbuch je sechs Wörter zu den Vorsilben „fern- und fehl-“ und schreib sie auf!
Bilde mit den Wörtern von Ü5 Sätze und schreib sie in dein Heft!

Zur Erinnerung: Vorsilben stehen immer vor einem Wortstamm!
7
Ferien, vortragen, vergeben, Forscherin, Vorfall, Verhaftung, Ferkel, Vorsatz, Verlag, formen, Ferse, Forderung, Olympe
• Wörter mit den Vorsilben „ver-, vor-, voll- und viel-“
D verfolgen, vorstellen, vollziehen, vielfach
• Wörter mit der Nachsilbe „-iv“
D aktiv, passiv, intensiv, Stativ, …
• Wörter, die mit einem w-Laut ausgesprochen werden
D Vase, Vampir, Villa, Universität, …
• Für manche Wörter gibt es keine Regel. Die musst du dir einprägen.
D Vater, Vogel, Vieh, Vers, vier, vom, von, …
Markiere alle „Ver-, ver-, Vor-, vor-, Fer-, fer-, For- und for-“! Betrachte die nicht markierten Wortteile und notiere, was dir auffällt!
Ver-/ ver-, Vor-/ voroder Fer-/ fer-, For-/ for-?

Suche die 15 waagrecht und senkrecht versteckten Wörter, die den Buchstaben V/v enthalten, und notiere sie hier!
Vorsilbe „ver-“ oder „vor-“:
Anfangsbuchstabe:

Fremdwörter (v als w-Laut gesprochen):
Setze richtig ein!
viel oder fiel?

viel: eine große Menge, nicht wenig
fiel: Präteritum zum Infinitiv „fallen“
Das klingt _______versprechend. Der Film ge_______ ihm.
_______ Stifte __________ auf den Boden.
Der ______fach preisgekrönte Film ge_______ allen.

Kläre mit Hilfe des Wörterbuchs oder Duden online die Bedeutung dir unbekannter Wörter! Notiere sie mit Artikel in deinem Heft!
V/v – f-Laut V/v – w-Laut

Wortschatzkiste

VaterVogel
Volkvoll
vierVers
ViehVeilchen

Bilde mit allen Wörtern Sätze und schreib sie in dein Heft!
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Diktiert euch die Wörter der Wortschatzkiste! Korrigiert sie gegenseitig!
Wörter mit Ph/ph
Kläre zuerst mit Hilfe des Wörterbuchs oder mit Duden online die Wortbedeutung dir unbekannter Fremdwörter! Notiere sie in deinem Heft, vergiss dabei auch nicht auf den Artikel!
Wörter, die mit ph geschrieben werden:
Alphabet Aphrodite Apostroph

Asphalt Atmosphäre Euphorie


Graph KatastropheNymphe
Peripherie Phantom Pharao
Pharmazie Phase Phänomen
Philippinen Philosophie Phobie
Phosphor Phönix Phrase
Physik physisch Prophet




Präge dir nun immer drei Fremdwörter aus der Wort-Schatzkiste ein und schreibe sie aus dem Gedächtnis richtig auf!
Sucht euch eine Partnerin oder einen Partner! Sagt euch die Wörter der Wortschatzkiste gegenseitig an und korrigiert sie anschließend!
Wähle 15 Fremdwörter mit ph aus und bilde mit ihnen sinnvolle Sätze in deinem Heft!
Tausche bei diesen Fremdwörtern die „ph“ gegen ein „f“ aus!
phantastisch: __________________________
Biographie: ___________________________
Mikrophon: ___________________________
Viele Fremdwörter mit ph kannst du auch mit f schreiben, denn es gibt hierfür keine Regel.
Beispiel: Geographie Geografie

Paragraph: ____________________________ Graphik: _____________________________
Delphin: ______________________________
Choreographie: _________________________
Orthographie: __________________________
Triumph Trophäe Xylophon 4 1 2 3 5 6 7
Phantasie: _____________________________
Graphit: _____________________________
Photosynthese: _________________________
Kläre die Wortbedeutung jener Fremdwörter aus Ü5, die mit einem Stern versehen sind. Schreibe Wörter und Bedeutung in dein Heft

HB 3: Hördiktat – Überprüfe dein Können! Schreibe die Wörter in dein Heft, gib dabei den Nomen auch die passenden Artikel!


2
Verkauf mir doch kein X für ein F oder V! Schreibe die Wörter richtig auf!
Marie Curie war eine berühmte Xorscherin. ______________________________
Der Marathonläufer hat bereits drei Minuten Xorsprung. ______________________________
Der Xortschritt brachte den Menschen Wohlstand.______________________________
In der Xerhandlung wurde seine Unschuld bewiesen.______________________________
Unter Xorst versteht man bewirtschaftete Wälder.______________________________
Der Autofahrer hielt sich nicht an die Xerordnung.______________________________
Dieser Xorfall zieht Konsequenzen nach sich.______________________________
Seine Xorderungen wurden nicht erfüllt.______________________________
Bären in Alaska fangen Xorellen im Xluge.______________________________
Mit dem neuen Xerfahren geht alles schneller. ______________________________
Diese Xormulierung ist dir gelungen.______________________________
Max hat Xorsätzlich die Scheibe eingeschlagen.______________________________
Mit dem Mikroskop kannst du 15 000-fach Xergrößern.______________________________
Damen lässt man den Xortritt. ______________________________
Du hast dich in Deutsch deutlich Xerbessert.______________________________
Präpositionen sind Xorwörter.______________________________
Das Xormular ist in Blockbuchstaben auszufüllen.______________________________
Wir brauchen ein Heft im A4-Xormat.______________________________
Setze F/f oder V/v richtig ein!
Mein Groß__ater __ritz __erspeist zum __rühstück o__t __iel __ettes __leisch. Mein __ater __ährt häu__ig mit dem __ahrrad in die __irma. Mein __etter __alentin __iel __orgestern __om Oli__enbaum. Mein __riseur __erdinand __risiert __rauen __antastische __risuren. __iel __ergnügen!

Selbstdiktat – Nimm den Text von Ü2 mit deinem Handy auf und spiele ihn als Diktat für dich selbst ab!
Löse dieses Kreuzworträtsel!


waagrecht:
1. Rechtschreibung
4. Wissenschaft von den Arzneimitteln
5. Abschnitt
9. grafische Darstellung in Form von Knoten und Linien
10. Auslassungszeichen
12. Hochstimmung, Freudentaumel
13. Energieproduktion bei Pflanzen
14. bemerkenswerte Erscheinung

senkrecht:
2. Schaubild oder Illustration
3. Randgebiet
4. Inselgruppe in Südostasien
6. griechische Göttin der Liebe
7. extreme Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen
8. Beschreibung der Lebensgeschichte eines Menschen
11. Formulierung

Wähle eine Überschrift aus und verfasse dazu einen Inneren Monolog!
Ich kann…
Ich beherrsche die f-/v-/ph-Schreibung. (1 + 2 + 3 + 4)
Ich kann mit Hilfe des Rezepts einen Inneren Monolog verfassen. (5)



„13 Wochen“ von Harry Voß
INHALT: Nach einer unheimlichen Gewitternacht gerät Simons Welt völlig durcheinander. Gegenstände verschwinden, Menschen verhalten sich merkwürdig, man unterstellt ihm Dinge, die er niemals getan hat. Und dann taucht immer wieder dieser mysteriöse Typ auf, der ihn beobachtet – und dabei aussieht wie er selbst.
Ist das etwa alles eine Verschwörung? Wird er langsam verrückt oder ist das doch nur ein Traum? Simon nimmt den Kampf gegen das Unbekannte auf und kommt dabei ins Nachdenken über sich selbst.

„In der Faulheit liegt die Kraft: Geniale Chaoten fallen nicht vom Himmel“ von Jakob M. Leonhardt
INHALT: Felix ist ein Held, ein Genie auf dem Gebiet des Zeichnens und Graffiti-Sprayens. Die Mädchen werfen ihm bewundernde Blicke zu und trotzdem geht irgendwie alles schief. Denn Felix ist immer noch eine sportliche Null und ein hoffnungsloser Fall in punkto gutes Aussehen.
Er weiß weder, wie er sich gegen den berüchtigten Fightclub wehren, noch wie er die süße Nina beeindrucken soll. Stöhn und Doppelstöhn!
AUSZUG: Leseteil auf S. 20








Suche im Internet ein Jugendbuch zum Thema „Erwachsen werden“, das dich interessiert! Versuche dazu Bewertungen zu finden, die Leserinnen und Leser dieses Buches bereits ins Netz gestellt haben! Notiere Titel, Autorin oder Autor des Buches! Schreibe in Stichworten auf, worum es in dem Buch geht!
TITEL:
„Jungs, meine Mutter und der ganze andere Mist“ von Yvonne Struck KOMMENTAR: Mara (13 J.)
Meine Mutter hatte im Urlaub nichts Besseres vor, als am Strand mir dieses Buch in die Hand zu drücken! Meine Freude war gering, doch als ich anfing, kam ich aus dem Lachen nicht mehr heraus.
Es geht darin um Marie, einer Expertin in Sachen Liebe – zumindest theoretisch, denn die Dr. Sommer-Fragen aus der Bravo könnte sie alle beantworten.
Doch in der Praxis sieht es leider völlig anders aus: Ihre Erfahrungen beschränken sich auf Knutschübungen mit dem eigenen Unterarm. Dabei würde sie viel lieber...
AUTOR/IN:



INHALT:


Internet & Co, was nutzt du so?



1 2



Welche Medien erkennst du auf den Fotos?


Beantworte diese Fragen zu deiner persönlichen Mediennutzung!

Welche dieser Geräte besitzt du? Kreuze an! Fernseher Tablet
Smartphone PC oder Notebook stationäre & portable Spielkonsolen
CD-Player MP3-Player Radio

Wie oft bist du ONLINE?
täglich mehr als 60 min täglich weniger als 60 min
mehrmals die Woche mehrmals im Monat nie
Wofür nutzt du das INTERNET? Mehrfachnennungen sind möglich:
Kommunikation Fernsehen/Filme Online-Spiele
Inhalte in das Netz stellen
Du kommunizierst über... soziale Netzwerke
Musik hören
Chatrooms E-Mails
Einkaufen
Recherche
Downloads
Weblogs
Auf welches MEDIUM kannst du am wenigsten verzichten? Kreuze an!
Internet Buch Radio TV Zeitung
Welche BÜCHER liest du am liebsten? Kreuze eine Gattung an!
Sachbücher Romane Comics
Welches BUCH liest du zurzeit?

Titel & Autor/in: _________________________________________________________________________
Warum liest du?
Spaß Interesse bessere Deutschnote Zwang/Pflicht Informationsbeschaffung
Welche Sendungen siehst du im FERNSEHEN?
Mehrfachnennungen sind möglich:

Serien Spielfilme Musikvideos Wissenssendungen
TV-Shows Nachrichten Zeichentrick Sport
Du siehst fern mit... Familien-TV eigenem TV Computer Handy Tablet
Wie lange siehst du fern? täglich mehr als 60 min täglich weniger als 60 min
Über welches Medium hörst du häufig RADIO? Radio Handy Internet
RADIO bedeutet für dich:
Musik hören aktuelle Informationen Interviews/Reportagen Gewinnspiele
Wie heißt dein Lieblingssender?

Was liest du lieber? Zeitungen Zeitschriften
Welche Bereiche interessieren dich in einer ZEITUNG?

TV-Programm Rätsel/Sudoku Wetter Gesellschaft
Veranstaltungstipps Chronik/Lokales Politik Kultur Sport
Wirtschaft
Du liest Zeitschriften zu folgenden Bereichen... Jugend
TV-Programm
Sonstiges:
Mode/Livestyle
Auto-/Motorsport
Musik/Film
Technik & Natur
Sport
Politik
PC/Internet
Bildet 6 Gruppen! Vergleicht innerhalb der Gruppe die Antworten des Fragebogens zur Mediennutzung von Ü2! Erstellt gemeinsam ein Gruppendiagramm! Im Anschluss daran präsentiert eure Ergebnisse und erstellt ein Diagramm für die Klasse mit dem Titel „Unser Medienverhalten“
Tipp: M3 auf S. 38 hilft dir dabei!
Ein Fragebogen ist eine Methode, herauszufinden, wie andere über etwas denken, ohne mit jedem einzeln sprechen zu müssen. Die Auswertung zeigt dir, was z.B. am beliebtesten ist, die meisten Leute mögen oder nicht mögen, am meisten genutzt oder nicht genutzt wird, usw.

Meinungen sammeln:
Man kann leicht herausfinden, was eine Gruppe von Leuten über ein Thema denkt.

Entscheidungen treffen:
Wenn viele Leute dasselbe mögen oder wollen, kann das helfen, zu entscheiden, was man macht.
Zur Präsentation der Auswertung von Fragebögen verwendet man meist Diagramme. Sie zeigen auf einen Blick deine Ergebnisse. Säulen- und Balkendiagramme eignen sich oftmals am besten.

BALKENDIAGRAMME
Die Balken sind horizontal ausgerichtet. Diese Diagramme werden oft verwendet, wenn die Kategoriennamen länger sind oder viele Datenpunkte verglichen werden, da der Platz für die Beschriftungen nach links hin besser genutzt werden kann. Sie sind gut geeignet, um Produkte oder Umfrageergebnissen zu vergleichen.

SÄULENDIAGRAMME
Die Säulen sind vertikal ausgerichtet. Säulendiagramme sind typisch, um zeitliche Entwicklungen oder Mengenvergleiche darzustellen. Sie sind auch gut geeignet, um z. B. Umsätze, die über Monate oder Jahre hinweg gemacht wurden, sichtbar zu machen.
horizontal: waagrecht
vertikal: senkrecht
Beispiel Balkendiagramm
Handymarke D
Handymarke C
Handymarke B
Handymarke A
Beliebtheit


Zu welchen Zeiten wird das Handy am meisten genutzt?
M – morgens; VM – vormittags; M – mittags; NM – nachmittags; A- abends
Mit Hilfe einer Strichliste kannst du die Ergebnisse von Fragebögen leicht auswerten. Dafür notierst du bei jeder Antwortmöglichkeit, in Form von Strichen, wie oft sie vorkommt.
BEISPIEL: Frage: Auf welches MEDIUM kannst du am wenigsten verzichten?
Zur Präsentation kannst du ein Diagramm erstellen. Es zeigt auf einen Blick deine Ergebnisse. Säulen- und Balkendiagramme eignen sich oftmals am besten.
Anleitung – Balkendiagramm:
Nimm ein kariertes A4- Blatt (quer), ein Lineal und Stifte!
Zeichne mit dem Lineal eine x- und eine y-Achse!
Die gestellte Frage ist die Überschrift des Blattes!
Schreibe links der x-Achse von unten nach oben alle Antwortmöglichkeiten!
Beschrifte die y-Achse mit dem Wort „Anzahl“!
Male bei jeder Antwortmöglichkeit, von links nach rechts, ein Kästchen an, wenn sie als Antwort gewählt wurde!


BEISPIEL: Skizze eines Balkendiagramms zum Beispiel der Strichliste
Erstellt euer Diagramm, wenn möglich, im Fach DG am Computer!
Wähle dir eine Partnerin oder einen Partner! Entscheidet euch gemeinsam für eines der Medien von Seite 39 und 40 und füllt den Fragebogen aus! Wie viele Stunden pro Tag verwendest du das ausgewählte Medium?

























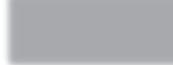





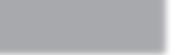





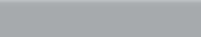
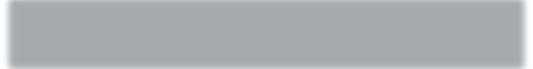
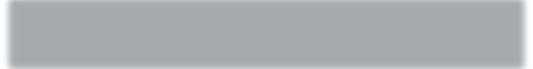
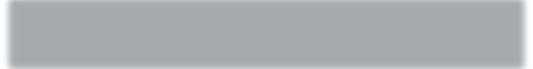

Vergleicht eure Antworten und erstellt ein Säulendiagramm! Präsentiert euer Ergebnis und diskutiert darüber!
Erstelle das Diagramm, wenn möglich, im Fach DG am Computer!

Lies den Artikel über das Medienverhalten von 10- bis 14-jährigen Jugendlichen!
Für die vorliegende Studie wurden 391 Heranwachsende im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren an vier Tiroler Schulen befragt.
A. Für Kinder und Jugendliche wird der Medienkonsum als Freizeitaktivität immer wichtiger. Im Schnitt beschäftigen sie sich bis zu 10,3 Stunden pro Tag mit Handy, Tablet und Co. Körperliche Aktivitäten wie Sport verlieren dabei an Bedeutung, hier kommen die Jugendlichen nur auf knapp über fünf Stunden pro Woche. Am Wochenende verbringen Kinder und Jugendlich sogar bis zu zwölf Stunden mit den unterschiedlichen Medien. Der Konsum von Medien mit Bildschirmen macht davon unter der Woche im Durchschnitt 8,2 Stunden aus, am Wochenende sind es 9,9 Stunden.
B. Im Schnitt verfügt jeder der Befragten über fünf bis sechs der folgenden Geräte: Fernseher, Smartphone, Tablet, PC oder Laptop, stationäre und
portable Spielkonsolen, CD-Spieler, MP3-Player und Radio. Die Anzahl der verfügbaren Medien ist dabei unabhängig von Alter, Schultyp, möglichem Migrationshintergrund und dem sozialen Status der Familien. „Über 60 Prozent der Kinder haben ein eigenes TV-Gerät in ihrem Zimmer und sitzen bereits vor dem Schulbeginn vor dem Fernseher“, so Studienautor Klaus Greier.
C. Dabei gilt es zu beachten, dass die Jugendlichen immer stärker dazu neigen, ihre Geräte parallel zu nutzen. „Wir konnten erheben, dass die Jugendlichen heutzutage oft verschiedene Medien gleichzeitig im Einsatz haben“, erklärt Klaus Greier. Es sei demnach mittlerweile üblich, dass „Kinder zugleich den Fernseher oder Computer nutzen und parallel dazu mittels Smartphone oder Tablet aktiv sind“. Knapp ein Drittel, 31,1 Prozent der Befragten, sagte außerdem von sich selbst, dass sie ohne Smartphone nicht leben könnten. (derStandard online vom 22. August 2017)
Ein Organigramm hilft dir, mit einem Blick eine Übersicht über wichtige Informationen aus einem Text zu bekommen. Das erleichtert dir das Schreiben deines Exzerptes. Erstelle in deinem Heft ein Organigramm und trag die markierten Schlüsselwörter und -sätze ein!
Titel/Thema: Erscheinungsort/Jahr:

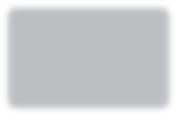
Exzerpt, das: schriftlicher Auszug aus einem Text


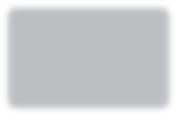
Lies das Exzerpt von Marco! Schau, ob er alle Schlüsselwörter, -sätze des Artikels von S. 39 verwendet hat! Markiere sie!
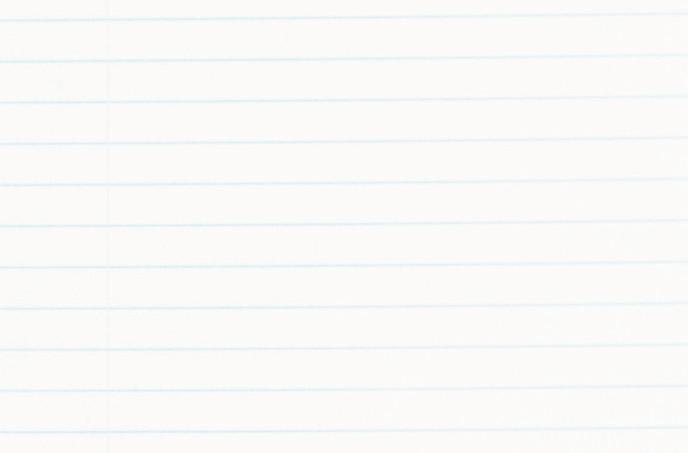
Exzerpt: Laptop und Smartphone statt Fußball und Radfahren
Der Online-Artikel von 2017 beschäftigt sich mit dem Medienkonsum im Alltag von Kindern und Jugendlichen in Tirol.
Die Studie zeigt, dass sich die 10- bis 14-Jährigen über zehn Stunden am Tag mit elektronischen Unterhaltungsmedien beschäftigen, an Wochenenden sind es sogar bis zu zwölf Stunden. Dadurch verlieren körperliche Aktivitäten mehr und mehr an Bedeutung. Weiters lässt sich feststellen, dass die Befragten unabhängig von Alter, Schultyp, Migrationshintergrund und sozialem Status fünf bis sechs elektronische Geräte besitzen. Auffallend dabei ist, dass die Geräte von den Jugendlichen immer mehr parallel genutzt werden. Laut Aussagen der Befragten kann etwa ein Drittel nicht ohne sein Smartphone leben.
Ich kann mich den Aussagen über das Medienverhalten von Jugendlichen nur anschließen. Auch ich verbringe mehrere Stunden täglich mit meinen elektronischen Unterhaltungsmedien. Verzichten könnte ich keinesfalls auf mein Smartphone, da ich damit jederzeit erreichbar sein möchte. Außerdem kann ich soziale Medien wie Instagram oder Twitter jederzeit nutzen.

Schreibe die verwendeten Schlüsselwörter, -sätze auf:
Gibt es Schlüsselwörter, -sätze, die Marco nicht verwendet hat? Wenn ja, schreibe sie auf:
Markiere in Marcos Exzerpt, seine persönlichen Aussagen! Was wären deine? Geht es dir ähnlich? Schreibe es auf:
Das Exzerpt ist eine sachliche Zusammenfassung der wesentlichsten Inhalte eines Textes.

1. Lies den Text mehrmals! Schlage unbekannte Wörter nach, damit du alles verstehst!
2. Markiere Absatz für Absatz die Schlüsselwörter oder Schlüsselsätze!
3. Erstelle damit ein Organigramm oder einen Stichwortzettel!
4. Schreib im Präsens!
5. EINLEITUNG:
Stelle einen Bezug zum Thema her! (z.B.: Titel, Erscheinungsjahr, -ort, Thema)
6. HAUPTTEIL:
Fasse anhand der Schlüsselwörter den wichtigsten Inhalt zusammen! Bleibe sachlich und erfinde nichts dazu!
7. SCHLUSS:
Eine persönliche Stellungnahme ist nicht immer notwendig, wenn du eine verfasst, beschränke sie auf wenige Sätze. Geh nochmals auf das Thema ein! Begründe deine Meinung!

Zusammenfassung?
Exzerpt?

EXZERPT
•Enthält ausgewählte Textstellen und Zitate
•Zeigt eine genaue Wiedergabe des Originaltexts
•Hat gegebenenfalls eigene Notizen oder Anmerkungen
•Regt zu Diskussionen an
ZUSAMMENFASSUNG


•Konzentriert sich auf das Wesentliche
•Gibt Inhalte kurz in eigenen Worten wieder
•vermeidet wörtliche Übernahmen
•Soll einen schnellen Überblick geben
Fasse die Grundaussage jedes Absatzes aus Ü1/ S. 44 in ein paar Sätzen in deinem Heft zusammen! Verwende dazu dein bereits erstelltes Organigramm!
Verfasse nun mit Hilfe des Rezeptes dein eigenes Exzerpt zum Text „Laptop und Smartphone statt Fußball und Radfahren“ von S. 43! Die folgenden Satzanfänge helfen dir dabei.

Die Autorin, der Autor möchte verdeutlichen, dass … Der Artikel bringt zum Ausdruck, dass …

Im Artikel geht es darum, dass …

Die Autorin/ der Autor weist auf folgende Punkte hin …

Die Autorin/ der Autor erklärt, warum …

Es wird beschrieben, wie …


Die Hauptaussage der Autorin, des Autors lautet …

Im Fokus des Artikels steht … Eine zentrale Aussage ist …

Lies den Artikel! Unterstreiche in jedem Absatz für dich wichtige Schlüsselwörter und -sätze! Schlage unbekannte Wörter nach!
Medien sind wichtiger als Abendessen

Kinder kommen immer früher mit digitalen Medien wie Smartphones oder Tablets in Kontakt. Die Mediennutzung der Eltern betrifft unweigerlich auch den Alltag der Kinder. So imitieren bereits die Allerkleinsten beispielsweise das „Wischen“ auf dem Bildschirm oder halten sich ihr Spielzeug als Handy-Ersatz ans Ohr. Bildschirme jeglicher Art – ob vom Handy oder Computer – üben eine unglaubliche Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Geht es in jungen Jahren vor allem um das Anschauen von bunten Bildern und das Spielen, so wird mit dem Älterwerden zunehmend die Kommunikation mit Freunden wichtig, zum Beispiel über Messenger-Apps wie WhatsApp. Auch wenn sich die Interessen also im Laufe der Zeit ändern, haben digitale Medien in jeder Lebensphase große Anziehungskraft. Und dies steht nicht immer im Einklang mit einem „geordneten“ Familienleben. So kann es sein, dass das Abendessen nicht beginnen kann, weil ein Kind noch eine Fernsehsendung fertig ansehen möchte, ein anderes in einem Handy-Spiel noch nicht an
einem Speicherpunkt angekommen ist und ein drittes noch unbedingt ein Buchkapitel fertiglesen muss. Aber auch Eltern sind vor den „medialen Verlockungen“ nicht gefeit: Es werden zum Beispiel auch zuhause noch E-Mails aus der Arbeit beantwortet oder ein Anruf eines Kunden entgegengenommen.
Die Konkurrenz zwischen Medien und Familienleben lauert an allen Ecken und Enden. Niemand ist davon ausgenommen und Konflikte sind vorprogrammiert.
Gemeinsame Familienregeln beugen Konflikten vor Um Konflikte zu vermeiden, ist es hilfreich, Regeln für die Mediennutzung aufzustellen. Diese sollten nach Möglichkeit von allen Familienmitgliedern gemeinsam entwickelt werden – nur so können sie von allen verstanden und eingehalten werden. Wichtig ist auch, zu vereinbaren, was bei Missachtung der Regeln geschieht. Aber nicht vergessen: Regeln leben davon, dass Ausnahmen möglich sind! (Aus: saferinternet.at)
Erstelle in deinem Heft ein Organigramm zu diesem Artikel!
Verfasse im Heft ein Exzerpt zu diesem Artikel!
Tausche dein Heft mit einer Partnerin oder einem Partner! Überprüft anhand der Checkliste, ob alle Kriterien eines Exzerpts erfüllt wurden! Besprecht eure Exzerpte!

Ich habe den Text mehrmals gelesen, unbekannte Wörter nachgeschlagen und den Text verstanden.
Ich habe Schlüsselwörter und -sätze markiert.
Ich habe ein Organigramm erstellt.
Die Einleitung beinhaltet Thema, Erscheinungsjahr, -ort.
Im Hauptteil habe ich mit Hilfe meiner Schlüsselwörter, -sätze den wichtigsten Inhalt des Artikels zusammengefasst.
Meine eigene Meinung ist, im Schlussteil, in wenigen Sätzen aufgeschrieben und begründet.
Ich habe meinen Text 3-mal gelesen – Inhalt, Rechtschreibung und Grammatik. Ich habe das Wörterbuch/ Duden online verwendet.
Beschrifte folgende Icons auf dem Handy! Dann kreuze das von dir am meisten genutzte Medium an!








HB 4: Höre dir wichtige Facts zu den sozialen Medien an! Dann kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind!
WhatsApp ist weltweit die beliebteste Messenger-App.
WhatsApp darfst du offiziell ab 12 Jahren nutzen.
Unterhaltungen sind in Gruppen von bis zu 256 Personen möglich.


richtig falsch
Instagram ist eine kostenpflichtige App zum Teilen von Fotos und Videos.
Bei Instagram kann jeder dein Profil und deine Fotos einsehen.
Bilder können mittels # kategorisiert und verknüpft werden.
Snapchat ist eine kostenpflichtige Messenger-App.
Bei Snapchat werden Fotos direkt in der App erstellt.
Die Fotos sind für zehn Sekunden sichtbar und können nie mehr aufgerufen werden.
14
gewählt: 13
Expertinnen und Experten gesucht! Wähle einen der Social Media-Anbieter aus Ü12 aus und erstelle hier einen kurzen Informationstext über diesen!


Lies den Text! Markiere in jedem Absatz für dich wichtige Schlüsselwörter, -sätze! Schlag unbekannte Wörter nach!
Wenn der 13-jährige Max von der Schule nach Hause kommt, schaut er sich auf YouTube Videos an. Seine Hausaufgaben recherchiert er auf Wikipedia. Wenn er Probleme hat, fragt er in Onlineforen um Rat. Max ist das, was Experten einen „Digital Native“ nennen: Er ist ein Eingeborener der neuen Medienwelt. Wissenschaftler meinen, Max’ Denkweise unterscheide sich von der seiner Eltern und Großeltern, den „Digitalen Einwanderern“. Weil er täglich im Netz ist, nehme er seine Umwelt anders wahr, er lerne und erinnere sich anders.
In den vergangenen Jahren befasste man sich in der Hirnforschung eingehend damit, ob und wie sich die Nutzung von Social Media auf unser Denken auswirkt. Die Ergebnisse sind aufschlussreich: Wer regelmäßig soziale Netzwerke nutzt, beginne wieder, wie ein Kind zu denken. Die Abhängigkeit von Aufmerksamkeit und Bestätigung durch virtuelle Freunde, ähnle der eines Kindes von seiner Mutter. Das Motto: Nur wenn ein Post viele „Gefällt mir“-Klicks oder Retweets erhält, war das Erlebte etwas wert. Am Ende wisse die Userin oder der User nicht mehr, wie sie oder er selbst zu den Dingen steht. _______________________________________________________________________________________
Instagram und TikTok sind mittlerweile mehr als Online-Communitys. Auf fast jeder Internetseite finden sich heute Share-Buttons, die Nutzerinnen und Nutzer direkt mit den sozialen Medien verbinden: Wer online etwas bestellt, einen Artikel liest oder ein Video sieht, kann dies sofort mit virtuellen Freundinnen und Freunden teilen.
In der Realität sind soziale Medien aber nicht immer sozial. Datenschützerinnen und Datenschützer bemängeln, wie mit Informationen von Mitgliedern umgegangen wird. Wer sich in einem sozialen Netzwerk registriert, berechtigt das jeweilige Unternehmen, alle eingestellten Inhalte verwenden zu können. Sie bleiben auch gespeichert, wenn Userinnen oder User das Konto löschen. Die Betreiberinnen und Betreiber behalten sich zudem das Recht vor, Daten wie Alter oder Geschlecht an z.B. Werbeanbieterinnen und -anbieter weiterzugeben.
Verfasse anhand deiner Schlüsselwörter zu jedem Absatz eine Überschrift und schreibe sie auf die jeweilige Zeile!
Nimm dein Heft und verfasse zu diesem Artikel ein Exzerpt mit einer persönlichen Stellungnahme! Überprüfe deinen Text anhand der Checkliste!

Was interessiert dich wirklich? Gehe auf www.geo.de und klicke weiter auf geolino! Wähle dann unter dem Menüpunkt WISSEN einen Artikel aus und verfasse ein Exzerpt!
Tausche dein Exzerpt mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler! Überprüft den Text anhand der Checkliste! Gebt euch gegenseitig Feedback!
Lies den Artikel! Markiere für dich wichtige Textstellen! Diskutiert in der Klasse über die Fragen der Seitenspalte!
Bei Plattformen wie YouTube, TikTok und Co. bleibt man oft hängen, weil sie gezielt darauf ausgelegt sind, dass wir genau das tun. Die Betreiberinnen und Betreiber dieser Plattformen wollen sicherstellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer so lange wie möglich auf ihren Seiten sind.
Einige Gründe, warum das so gut funktioniert:
Algorithmus-gesteuerte Inhalte
YouTube und TikTok verwenden hochentwickelte Algorithmen , die analysieren , was dir gefällt und was du öfter anschaust. Basierend auf deinem Verhalten schlagen sie dir ähnliche und oft noch spannendere Inhalte vor. Je mehr Videos du ansiehst, desto genauer „versteht“ der Algorithmus deine Interessen und zeigt dir Videos, die du wahrscheinlich mögen wirst. Dadurch wird dein Interesse immer wieder neu geweckt.
Endlos-Scrollen und Autoplay
Viele dieser Apps nutzen das sogenannte „endlose Scrollen “, bei dem immer wieder neue Videos automatisch nachgeladen werden, sobald du nach unten scrollst. Es gibt also keinen „Endpunkt“, an dem du aufhören musst. Zusätzlich sorgt die Autoplay-Funktion dafür, dass direkt das nächste Video startet, ohne dass du etwas tun musst. Dadurch fällt es schwerer, die App zu verlassen, weil du nicht aktiv nach weiteren Videos suchen musst – sie kommen einfach von selbst.
Kurze, fesselnde Inhalte


Algorithmus, der: Rechenvorgang nach einem bestimmten Schema
analysieren: auf einzelne Merkmale hin untersuchen
Scrollen: auf einem Bildschirm nach oben oder unten verschieben
Autoplay: automatisches Abspielen von Videos
Social Proof: das Verhalten anderer bestimmt das eigene Handeln
Meme, das: interessantes oder witziges Bild/ Video, das in sozialen Netzwerken schnell und weit verbreitet wird
Plattformen wie TikTok setzen auf besonders kurze Videos, die oft unter einer Minute dauern. Diese kurzen Inhalte sind darauf ausgelegt, sofort die Aufmerksamkeit zu erregen. Da die Videos schnell vorbei sind, schaut man oft „noch eins“ und „noch eins“. Das wirkt auf unser Gehirn wie eine ständige Belohnung.
Likes, Kommentare und Social Proof
Likes, Kommentare, Followerinnen und Follower bilden ein Belohnungssystem, das den Drang verstärkt, immer länger auf der Plattform zu bleiben. Wenn du siehst, dass ein Video Millionen von Aufrufen oder Likes hat, steigert das dein Interesse, da du das Gefühl hast, „mitreden“ zu können.
Psychologische Effekte und FOMO
FOMO (Fear of Missing Out), also die Angst, etwas zu verpassen, ist ein starker Anreiz. Wer regelmäßig TikTok und YouTube nutzt, möchte immer auf dem Laufenden sein, um aktuelle Trends und Memes nicht zu verpassen. Das Gefühl, ständig auf dem neuesten Stand sein zu wollen, führt dazu, dass viele Nutzer täglich stundenlang auf diesen Plattformen bleiben.
Diese Plattformen setzen also gezielt auf psychologischen Tricks, um Nutzerinnen und Nutzer zu fesseln. Ein bewusster Umgang mit der eigenen Zeit und das Setzen von Grenzen können helfen, die Kontrolle zu behalten. (Eigendarstellung)
(28.10. 2024, Spittal/ Drau)
Wie beeinflusst lange SocialMedia-Nutzung unsere Beziehungen?
Was macht das ständige Vergleichen mit Likes und Followern mit dem Selbstwertgefühl?
Gibt es neben Social-MediaPlattformen gesündere Alternativen zur Unterhaltung?
Welche Regeln könnten helfen, Social-MediaPlattformen bewusster zu nutzen?
Du hast bestimmt schon von deinen Eltern, Lehrerinnen oder Lehrern gehört, wie ungesund es ist, stundenlang vor dem Computer zu sitzen. Vielleicht hat man dir auch schon gesagt, dass du bereits ein Problem hast und womöglich süchtig bist.
Sicher ist in jedem Fall: Nur wenige Menschen, die viel Zeit am Computer oder am Handy verbringen, sind tatsächlich süchtig. Ob du zu diesen wenigen Menschen zählst, erfährst du, wenn du dich in nachfolgenden Aussagen zum Großteil wiedererkennst.
20
Entscheide für dich im Stillen, ob folgende Aussagen auf dich zutreffen!







Nichts anderes geht mehr:
Du verbringst den Großteil des Tages mit dem Computer oder dem Handy.
Kontrollverlust:
Der Versuch, weniger Zeit im Netz zu verbringen, gelingt dir nicht.
Die „Dosis“ muss gesteigert werden:
Du verbringst immer häufiger und längere Zeit im Internet.
Entzugserscheinungen:
Befindet sich dein Handy oder Computer nicht in deiner Nähe, wirst du unruhig, gereizt, sogar aggressiv.
Negative Folgen:
Die Sucht führt zu schlechteren Leistungen in der Schule und bringt Schwierigkeiten in der Familie und im Freundeskreis.
Ich könnte etwas verpassen:
Hast du Angst, etwas zu versäumen, wenn du nicht ständig mit anderen in Kontakt bist?
Lückenfüller:
Die Nutzung deines Handys oder Computers dient dir zur Bekämpfung deiner Langeweile.

Versuche doch einmal den Online-Selbsttest „Bin ich süchtig?“!www.ins-netzgehen.de/check-dichselbst/bin-ich-suechtig

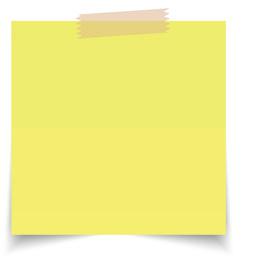
Hast du dich wiedererkannt?
Rede mit deinen Eltern, Freundinnen, Freunden, Lehrerinnen oder Lehrern darüber.Du erhältst auch kostenlos und anonym Hilfe bei 147 Rat auf Draht.
Mehr über die Gefahren des Internets erfährst du im Leseteil auf S. 27.

Das Attribut (Beifügung) bestimmt einen Satzgliedkern näher und gibt uns zusätzliche Informationen. Es macht einen Satz informativer.
Der Hund heißt Quinn.
•Pronomen als Attribut
Mein Hund heißt Quinn.
•Adjektiv als Attribut Der junge Hund heißt Quinn.
•Genetiv als Attribut Der Hund des Nachbarn heißt Quinn.
Beispiel: Der junge Hund des Nachbarn heißt Quinn.
•Verb im Partizip I als Attribut Der bellende Hund heißt Quinn.
•Verb im Partizip II als Attribut Der gekaufte Hund heißt Quinn.
Das Attribut kann VOR oder NACH dem Satzgliedkern, aber auch DAVOR und DANACH stehen.
1
Das Partizip I verwendest du als Attribut, um eine aktive, gleichzeitige Handlung auszudrücken.
•der bellende Hund ( = der Hund, der gerade bellt)
Das Partizip II verwendest du als Attribut, um eine abgeschlossene oder passive Handlung auszudrücken.
•der gekaufte Hund ( = der Hund, der gekauft wurde)
Finde in den Sätzen die Attribute und unterstreiche sie mit Grün !
informativ: Auskunft gebend

Unser stabiles Regal der Marke Bobby ist das beliebteste und meistverkaufte Produkt weltweit. Bobby gibt es in unterschiedlichen Höhen und Breiten, aber auch in verschiedenen Farben. Die verstellbaren Böden des Regals bieten Platz für Bücher in jeder Größe. Außerdem lassen sich Türen aus Holz oder Glas anbringen. Das praktische Möbelstück besticht nicht nur durch seine schlichte Form, sondern auch durch seinen günstigen Preis.
Erweitere die Satzgliedkerne durch Attribute und bilde Wortgruppen! Schreibe sie in dein Heft!
Satzgliedkernals Attribute verwendenvor und/oder nach das Festgelungenvor die CDneu * meine Lieblingsbandvor und nach die VerfilmungBuchnach ein Schülerelfjährigvor die SchuleNeunkirchennach der Mathematikergenialst * die Weltvor und nach
Bilde mit den erstellten Wortgruppen sinnvolle Sätze in deinem Heft!

1
Schreibe zu diesem Artikel ein Exzerpt (ca. 150 Wörter)! Tipp: Rezept (S. 47) und Checkliste (S. 48)
Was sind Instagram, Snapchat, TikTok und Pinterest? von Judith Hinterhofer
Social Media sind bei Jugendlichen sehr beliebt, und Apps wie Instagram, Snapchat, TikTok und Pinterest gehören zu den meistgenutzten Plattformen. Jede App hat ihren eigenen Stil und bietet verschiedene Funktionen, die unterschiedlich genutzt werden können.
Instagram ist eine Plattform, die sich auf Fotos und Videos konzentriert. Nutzerinnen und Nutzer können dort ihre Bilder und Clips teilen und sie mit Filtern oder Texten bearbeiten, um ihre Beiträge persönlicher zu gestalten. Besonders beliebt ist das Posten von Storys, die nur 24 Stunden sichtbar sind. Instagram wird oft als „persönliches Tagebuch“ genutzt, in dem Momente geteilt werden, sei es ein Bild vom Essen, ein Urlaubsschnappschuss oder kreative Fotokunst. Die App bietet auch die Möglichkeit, durch Kommentare und Nachrichten mit Freundinnen und Freunden oder Followerinnen und Followern zu kommunizieren.
Snapchat hebt sich durch das Prinzip der „flüchtigen“ Nachrichten und Fotos hervor. Bilder und Videos, die hier verschickt werden, sind meist nur ein paar Sekunden sichtbar und verschwinden dann automatisch. Diese
Unterstreiche alle Attribute!
Besonderheit macht die App sehr beliebt bei Jugendlichen, da sie eine spontane und schnelle Art der Kommunikation ermöglicht. Es gibt auch die Möglichkeit, Snaps in Storys zu teilen, die dann 24 Stunden sichtbar sind.
TikTok hat sich zu einer Plattform für kurze Videos entwickelt. Besonders beliebt sind hier Tanzvideos, Challenges und kreative Clips. Die App bietet viele Bearbeitungsmöglichkeiten, mit denen Nutzerinnen und Nutzer ihre Videos schneiden und mit Effekten, Musik und Filtern aufpeppen können. TikTok setzt stark auf Trends und Herausforderungen, was die Plattform sehr dynamisch macht. Der Algorithmus schlägt Videos vor, die Userinnen und Usern gefallen könnten, was oft dazu führt, dass man länger auf der App bleibt als geplant.
Pinterest hingegen ist eine Plattform, auf der man Ideen und Inspirationen zu verschiedenen Themen findet. Die Nutzerinnen und Nutzer können Bilder, sogenannte „Pins“, zu Themen wie Mode, DIY-Projekten, Kochen oder Reisen sammeln und in eigenen „Pinwänden“ ordnen. Pinterest dient dabei weniger der Selbstdarstellung und mehr dazu, Interessen zu entdecken und zu organisieren. (6. 11. 2024, Wien)
Der Blobfisch wurde zum hässlichsten Tier der Welt gewählt. Er sieht nämlich wie ein kahlköpfiger, mürrischer, alter Mann aus. Dieser unschöne Fisch bewohnt den Meeresboden des Südwestpazifiks.
Der Körper des Blobfisches besteht aus einer glibberigen Masse. So kann er dem besonders hohen
Druck in der stockdunklen Tiefsee standhalten. Der Blobfisch bläst sich bei fehlendem Druck wie ein unförmiger Ballon auf.
Ich habe 101215 Attribute erkannt.
Nun geht’s los – Aufgaben nur für dich!
3
Setze die Attribute passend ein!
verquollen M nahend M
verschieden M flach M Seeigel M hässlichst M riesig M natürlich M bedroht M eigentümlich M von Tiefseefischern M kaum muskulös M Krebse




Der kaum muskulöse Blobfisch treibt über dem ______________ Meeresboden und schnappt sich die ____________________ Beute. Der __________________________ Fisch ernährt sich von ____________________________
Meerestieren wie _________________ und ________________.
Obwohl der Blobfisch keine ______________________ Feinde hat, gehört er dennoch zu den _____________________Tierarten.
Denn diese Fische geraten immer wieder in die Fangnetze ________________________________. 2013 wurde dieser Fisch zum „ _________________________ Tier der Welt” gewählt. Mit seinem _____________________ Gesicht und seiner _________________ Nase hat er eindeutig den Titel verdient.
Ich kann…
Ich kann Schlüsselwörter, -sätze in einem Text erkennen. (1)
Ich kann zu einem Artikel ein Organigramm erstellen. (1)
Ich kann ein Exzerpt mit persönlicher Stellungnahme verfassen. (1)
Ich erkenne Attribute. (2)
Ich kann Attribute dekliniert einsetzen. (3)



JFYI – einige Chatabkürzungen – akla?
Fast jeder verwendet mittlerweile beim Schreiben von Nachrichten Abkürzungen. Du auch?

Geht in Zweiergruppen zusammen! Recherchiert die Abkürzungen folgender Chat-Kürzel und erstellt eine Liste im Heft! Sucht zumindest fünf weitere und ergänzt die Liste!
aldi M BD M CU M dad M
dn M glg M hf M ic M K M
KA M omg M sry M thx M u M vlt M xoxo



Viele Abkürzungen kommen eigentlich aus dem Englischen!
JFYI Just for your information Nur zu deiner Info akla --------------------------------- Alles klar?
Schreibe auf, welche Chatkürzel du selbst oft verwendest!
Bildet Vierergruppen und diskutiert folgende Aussagen über Chatkürzel! Was spricht dafür, was dagegen? Teilt der Klasse eure Diskussionsergebnisse mit!

Man versteht nicht immer alles, wenn man „diese Sprache“ nicht kennt.
Man gehört dazu und ist cool, wenn man mit Kürzel schreibt.

Man braucht weniger Platz, weil die Nachrichten kürzer sind.
Man macht keine Grammatik- oder Rechtschreibfehler, weil man keine ganzen Sätze schreiben muss.

Erstellt eine gemeinsame Klassen-Chat-Kürzelliste!
Man spart damit Zeit, weil man beim Tippen schneller ist.
Ein Satzgefüge besteht aus mindestens einem Hauptsatz (HS) und einem Gliedsatz (GS)
Gliedsätze sind immer durch einen Beistrich vom Hauptsatz getrennt und zumeist durch Konjunktionen (Bindewörter) an ihn angebunden.
Beispiel:
Hauptsatz
Gliedsatz
Das Internet hat viele Vorteile, obwohl es nicht ungefährlich ist.
Konjunktion
Unterschiede zwischen Haupt- und Gliedsatz:
Hauptsatz R kann als Satz „für sich alleine stehen“: Das Internet hat viele Vorteile.
Gliedsatz R kann als Satz „nicht für sich alleine stehen“: obwohl es nicht ungefährlich ist.
Gliedsatz R die Personalform des Verbs steht meist an letzter Stelle: obwohl es nicht ungefährlich ist
Häufige Konjunktionen: als * bevor * bis * da * damit * dass * falls * indem * nachdem * obwohl * solange * während * weil * wenn
Manchmal steht der Gliedsatz (GS) an erster Stelle. In diesem Fall tauschen dann das Subjekt und das Prädikat des Hauptsatzes (HS) ihre Plätze
Beispiel:
Hauptsatz
S P
Gliedsatz
Das Internet hat viele Vorteile, obwohl es nicht ungefährlich ist.
Gliedsatz
Hauptsatz
P S
Obwohl es nicht ungefährlich ist, hat das Internet viele Vorteile.
Überlege und kreuze an, welche Sätze „alleine stehen“ können!
ABER IM INTERNET IST NICHT ALLES WAHR A
WEIL JEDER ALLES INS NETZ STELLEN KANN T
DA NIEMAND DIE INHALTE KONTROLLIERT E
ICH MÖCHTE DICH VOR DEN GEFAHREN WARNEN K
FOLGLICH HÖRST DU DIR DIESE RATSCHLÄGE AN L
Markiere jeweils in den Hauptsätzen das Subjekt und das Prädikat!
Aleks schrieb seiner Tante eine SMS, als er Geld brauchte.
Florian surft im Internet, obwohl es ihm sein Vater verboten hat.
Ella fing sich einen Virus ein, als sie ein Spiel downloaden wollte.

Schreib die Sätze in dein Heft und tausche die Stellung von Hauptsatz und Gliedsatz!
Markiere abermals Subjekt und Prädikat der Hauptsätze!
Unterstreiche zuerst in den Sätzen alle Prädikate! Dann kreise die richtige Variante ein!
Eine Studie zeigte, dass Jugendliche ihre Geräte parallel nutzen.
Wenn sie Probleme haben, fragen Jugendliche häufig in Onlineforen um Rat.
In den vergangenen Jahren hat man in der Hirnforschung untersucht, ob sich die Nutzung von Social Media auf unser Denken auswirkt.
Wenn Userinnen oder User ihr Konto löschen, bleiben die Daten dennoch gespeichert.
TikTok ist eine Social-Media-Plattform und sie ist auf das Teilen kurzer Videos spezialisiert.
PC und Handy sind Teil unseres Alltags, denn die Digitalisierung schreitet täglich voran.
Zur Erinnerung:
Können beide Satzteile „für sich alleine stehen“, dann sind es zwei Hauptsätze, die eine Hauptsatzreihe bilden!
LÖSUNGSWORT: . . . A?
(Chat-Kürzel)
HS+HSHS+GSGS+HS
HS+HSHS+GSGS+HS
HS+HSHS+GSGS+HS
HS+HSHS+GSGS+HS
HS+HSHS+GSGS+HS
HS+HSHS+GSGS+HS

Tausche in deinem Heft bei den vier Satzgefügen aus Ü4 die Stellung von Hauptsatz und Gliedsatz!
Unterstreiche alle PRÄDIKATE und bestimme, ob es sich dabei um einen Haupt- oder Gliedsatz handelt! Schreibe die entsprechende Abkürzung HS bzw. GS darüber!
Mario geht in die Bibliothek, denn er muss für sein Referat im Internet recherchieren.
Ella löscht ihre Bilder auf Snapchat, aber sie können wieder sichtbar gemacht werden.
Frau Professor Abakus stellt knifflige Mathematikrätsel(,) und Simon löst sie online.
Nikolay postet ein Foto von seinem Freund, aber er hat nicht seine Einwilligung dazu.
Doga spielt am Computer, bis ihre Mutter sie um Hilfe bittet.
Facebook ist ein soziales Netzwerk, Mark Zuckerberg entwickelte es 2003.
Obwohl meine Großmutter eine Digitale Einwanderin ist, surft sie im Internet.
Weil du erst 13 Jahre alt bist, darfst du WhatsApp nur mit Zustimmung deiner Eltern nutzen.
Verbinde die Sätze mit den angegebenen Konjunktionen in deinem Heft!
Tipp: Achte dabei auf die Stellung des Prädikats!
Ich kann mir keine Jause kaufen. Ich habe mein Geld verloren. [weil]
Er sucht schon seit Stunden sein Handy. Er kann es einfach nicht finden. [aber]
Die Schüler wundern sich. Sie bekommen immer so viel Hausübung. [warum]

Ich bekomme einen Eintrag ins Mitteilungsheft. Ich bin zu spät gekommen. [nachdem]
Du machst die Hausübung. Du bleibst morgen länger in der Schule. [oder]
Er ruft sie morgen an. Sie freut sich schon sehr darauf. [und]
Sie bleibt bei ihm. Er hat sie nicht darum gebeten. [obwohl]
8
Verbinde zuerst die Satzteile mit einem Lineal! Dann schreibe die Sätze mit passenden Konjunktionen in dein Heft!
Er erstellt ein Organigramm,er hat über 500 Freunde.
Migel ist beliebt,sie Online-Lernplattformen nutzt.
Tülay lernt für die Schule,du computersüchtig bist.
Du weißt hoffentlich,eigentlich gefällt er mir nicht.
Ich habe einen Beitrag geliket,er ein Exzerpt schreiben wird.
Kennst du diese Chat- Kürzel? Recherchiere im Internet und schreib die Bedeutung auf!




Diese Abkürzungen kennst du bestimmt schon. Schreibe ihre Bedeutung auf!

allg. bzw. ca. d.h. geb. insg.
Jh. mind. u.a. z.B.



Sei mein Lückenfüller! Fülle die Lücken im Merktext und übertrage ihn dann in dein Heft!
Hauptsatz und Gliedsatz können aufgrund der Stellung des Prädikats unterschieden werden. Im Hauptsatz steht die Personalform des Verbs an _________ Stelle. Sind zwei
Hauptsätze aneinandergereiht, sprechen wir von einer

Hauptsätze werden mit Konjunktionen wie und, oder, denn usw. verbunden.
Im Gliedsatz steht fast immer die Personalform des Verbs an _________ Stelle.
Gliedsätze können nicht alleine stehen. Eine Verbindung von Haupt- und Gliedsatz wird _______________ genannt. Konjunktionen, die Gliedsätze einleiten, sind z. B. weil,
Unterstreiche zuerst alle Prädikate mit Rot! Dann kreuze die richtige Variante an!
Delfine sind die intelligentesten Tiere der Welt, weil sie ein so hoch entwickeltes Gehirn wie der Mensch haben.
Sie sind nicht nur intelligent, sondern sie besitzen womöglich auch ein Selbstbewusstsein.
Diese klugen Tiere können sich selbst im Spiegel erkennen, aber können auch ihre Artgenossen voneinander unterscheiden.
Delfine erkennen einander an einem typischen Laut, dieser ist mit einem menschlichen Namen vergleichbar.
Diese intelligenten Tiere kennen positive und negative Empfindungen und sie können ihr Verhalten steuern.
Da Delfine ein Gedächtnis haben, können sie auf Fragen mit ja oder nein antworten.
Dass Delfine auch Werkzeuge nutzen, ist erst seit Kurzem bekannt.
Delfine werden als unser „Ebenbild im Meer“ bezeichnet, weil sie uns so ähnlich sind.
Da diese Tiere die Menschen schon immer fasziniert haben, galten sie bereits in der Antike als heilig.

Überleg dir eine passende Konjunktion und trag sie in die Kästchen ein! Bilde Hauptsatzreihen oder Satzgefüge und schreib sie in dein Heft!
Beispiel: Der Bus war so voll besetzt.Kein Sitzplatz war mehr zu ergattern.
Der Bus war so voll besetzt, dass kein Sitzplatz mehr zu ergattern war.
a) Die Burschen der 3C wollten Fußballspielen gehen.Es regnete zu stark.
b) Ich gebe dir fünf Euro. Du schreibst mir die Hausübung dafür.
c) Julia schickt mir das Foto. Sie denkt daran.
d) Tom chattet mit seinem besten Freund.Er schaut dabei seine Lieblingsserie.







Ich kann…













Mir sind Abkürzungen bekannt und ich kann ihre Bedeutung erklären. (1 + 2)
Ich kenne die Merkmale eines Hauptsatzes. (3)
Ich kenne die Merkmale eines Gliedsatzes. (3)
Ich kann Satzgefüge und Hauptsatzreihen unterscheiden. (4)
Ich weiß, welche Konjunktionen passend sind. (5)
Ich beachte die Satzstellung bei der Bildung von Hauptsatzreihen und Satzgefügen. (5)


„Mein Leben im Hotel Royal“ von Katy Birchall
KOMMENTAR: Lili (13 J.)

LESEPROBE im Leseteil auf S. 25

„Notruf per Mail“ von Karin Ammerer
INHALT: Wer hat das geheimnisvolle
Notruf-Mail geschickt und wer ist der wahre Absender dieser peinlichen
Liebes-SMS? Warum wurde Lord Forester in seinem Landhaus niedergeschlagen und wodurch verrät sich der Porschefahrer, der Fahrerflucht begangen hat? Wie konnte Harry Halunke zur selben Zeit an zwei verschiedenen Orten sein und wie entlarven Daniel Data und Sonja Scroll ihren Hauptverdächtigen?
„Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich“ – dieser Untertitel hat mich gleich angesprochen, denn er verrät sofort, dass hier Social-Media-Fans ein Abenteuer in der analogen Welt finden werden. Es geht um die 14-jährige Flick Royal, die im Hotel ihrer Eltern wohnt, drei Burschen gleichzeitig den Kopf verdreht und deren Dackel zum Instagram-Star wird. Das Buch ist witzig geschrieben und so spannend, dass ich fast nicht aufhören konnte zu lesen.



„Im Chat war er noch so süß“ von Annette Weber
INHALT: Wie Sarah da hineingerät? All ihre Freundinnen sind verliebt und haben plötzlich keine Zeit mehr. Frustriert stürzt sie sich in die virtuelle Welt der Chatrooms. Hier lernt sie den charmanten „Sonnenkönig" kennen. Doch aus dem harmlosen Flirt wird schnell gefährlicher Ernst.

„Erebos“ von Ursula Poznanski
KOMMENTAR: Oliver (13 J.)
Das Buch ist einfach WOW, es hat mich echt umgehauen. Es geht darin um ein Computerspiel namens






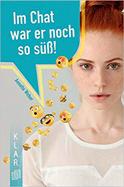

EREBOS, das in einer Londoner Schule herumgereicht wird. Wer es startet, kommt nicht mehr davon los. Dabei sind die Regeln äußerst streng: Jeder hat nur eine Chance. Er darf mit niemandem darüber reden und muss immer allein spielen. Wer gegen die Regeln verstößt oder seine Aufgaben nicht erfüllt, fliegt raus und kann Erebos auch nicht mehr starten.
HB 5: Höre dir doch einen Ausschnitt aus Erebos an!














%
Informiere dich selbstständig über diese Bücher im Internet! Bewerte anschließend diese Bücher, indem du Sterne vergibst und sie bei jedem Buch anmalst!
= will ich unbedingt lesen
= bin daran interessiert
= habe wenig Interesse
Im Internet kannst du sehr viele Informationen zu nahezu jedem Thema finden. Diese Fülle kann für dich als Userin oder User (Nutzerin oder Nutzer) aber auch sehr schnell unüberschaubar werden.


1. Überleg dir genau, was du wissen willst – das ist deine Suchfrage
2.Nutze eine Suchmaschine wie z.B. Google oder Bing und gib Stichworte zu deiner Frage ein.
3.Schau dir die ersten paar Ergebnisse an – die sind meistens am wichtigsten.
4. Achte darauf, ob die Informationen von einer vertrauenswürdigen Seite kommen, wie von Schulen, Universitäten oder bekannten Organisationen.
5. Lies mehr als eine Quelle, um sicherzugehen, dass das, was du gefunden hast, auch stimmt.
6.Wenn du viele Infos hast, mach dir Notizen zu den wichtigsten Punkten
7.Vergiss nicht, dir die Links zu den Seiten zu speichern, falls du sie später nochmal brauchst oder in einer Arbeit angeben musst. Informationen suchen:

Probiere auch andere Suchmaschinen aus, z.B. DuckDuckGo oder Qwant.
Sie speichern deine Daten nicht!
Informationen überprüfen:
1.Schau nach, ob die Seite eine Adresse hat, die mit „https://“ beginnt – das „s“ steht für sicher.

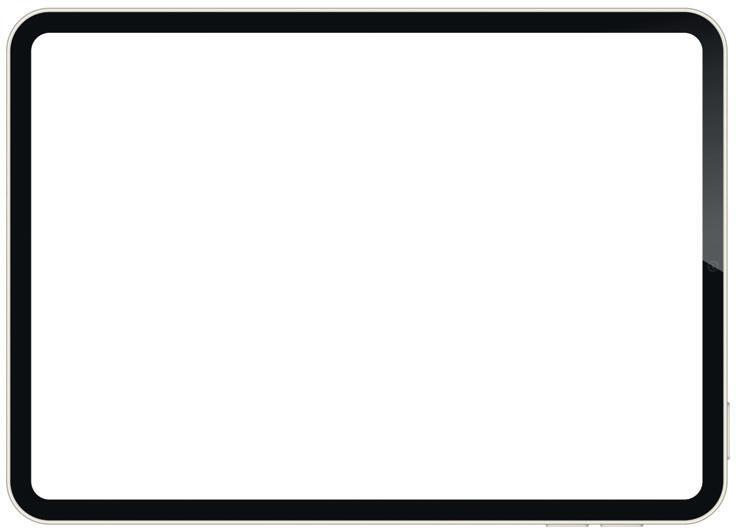
2.Suche nach Infos über die Autorin oder den Autor oder die Organisation, die die Seite gemacht hat – sind sie bekannt und seriös?
3.Check, ob die Seite ein Impressum hat, also Angaben dazu, wer verantwortlich ist.
4.Achte auf Rechtschreibfehler oder komische Grammatik – seriöse Seiten achten meistens darauf, dass alles richtig geschrieben ist.
5. Sieh nach, ob die Seite ein Datum hat, wann der Artikel oder die Infos veröffentlicht wurden – je aktueller, desto besser
6.Schau, ob die Seite Werbung hat und ob die Werbung seriös aussieht – zu viel oder unseriöse Werbung ist kein gutes Zeichen.
Unter www.Saferinternet.at findest du noch mehr Infos zum Thema.

Verfasse mit Hilfe der Post-it-Informationen einen kurzen Text über das Printmedium Zeitung! (mind. 10 Sätze)

1. Entstehungsgeschichte: Johann Gutenberg * 15. Jh. * Buchdruck * bewegliche Lettern

2. erste Zeitungen: in Form von Flugblättern * 16. Jh.

3. erste österreichische Tageszeitung: Wiener Zeitung * 1780

4. Massenmedium: günstig * informiert viele Leserinnen und Leser

5. regelmäßiges Erscheinen: täglich

Printmedium, das: gedrucktes Mittel wie Zeitung, Buch, …

6. Ereignisse: aus verschiedenen Lebensbereichen * Politik * Sport * Kultur


7. Aktualität: informiert über Neuigkeiten


2
Vervollständige die Namen der Tageszeitungen!

OB.R.ST.RR..CH.S..E N.CH..CH.EN _____________________________________________
SA.ZB..G.. N..HR...T.. ______________________________________
KU.I.. ________________________
W..N.R .EI.U.G ________________________________
KR.N.N Z..T..G __________________________________
.IE P..SS. _______________________
D.R ST.ND.RD _________________________________
Tipp: Gib im Internet den Suchbegriff „Tageszeitungen Österreich“ ein, dann ist die Aufgabe ganz einfach!
KL..NE Z..T..G ______________________________________
3
Regionale Zeitung (unter „regional“):
Überregionale Zeitung (unter „überregional“):

Suche im Wörterbuch oder Duden online folgende Begriffe und schreib ihre Bedeutung auf!

Ordne die Zeitungen von Ü2 der passenden Kategorie zu!
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Analysiert gemeinsam eine Zeitung eurer Wahl!
1. Notiert in Stichworten auf einem Blatt alles, was euch an der Zeitung auffällt! Größe, Druck, Farbe, Werbung, Inhalte, Bilder, …
2. Stellt eure Ergebnisse der Klasse vor!
Vergleicht eure Ergebnisse mit anderen, die die gleiche Zeitung gewählt hatten!


Reichweite von Zeitungen – Beantworte mit Hilfe des Balkendiagramms folgende Fragen!
Die sieben beliebtesten Tageszeitungen Österreichs (von insgesamt 16 Tageszeitungen – 2018)

Die Presse
Der Standard
Heute (GRATIS)
Kleine Zeitung
Kronen Zeitung
Kurier
Österreich (GRATIS)
500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000
Quelle: ARGE Media-Analysen 2018, Befragung von 15 075 Personen ab 14 Jahren
Aus welchem Jahr stammen die Daten? ______________
Wie viele Personen nahmen an der Umfrage teil? ____________________
Welche Personen waren von der Umfrage ausgeschlossen? ________________________________________
Wie viele Tageszeitungen erscheinen täglich in Österreich? _______
Welche Zeitung wird am häufigsten gelesen? ______________________________
Welche Gratiszeitung wird am meisten gelesen? _________________
Welche Zeitung wird von 556 000 Lesern und Leserinnen gelesen? ________________
Welche Zeitung nimmt den letzten Platz im Ranking ein? ______________________
7
Interviewe eine Person in deinem Zuhause und schreibe die Antworten auf!

Fragen
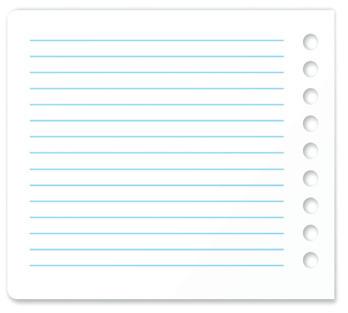

Welche Zeitungen liest du?
Wie oft liest du Zeitung?
Wann liest du Zeitung?
Was interessiert dich am meisten?

Interviewpartnerin/Interviewpartner:

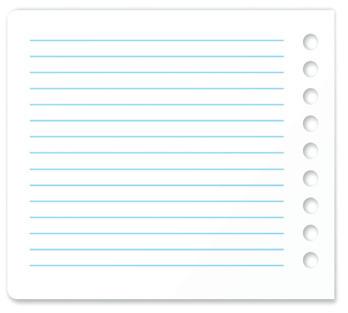
Für einen Lehrausgang in die Redaktion der Tageszeitung „Lokalzeit“ bekommt die Klasse 3c vom Chefredakteur Herr Renner, vorab einige Informationen. Lies den Informationstext!
Wie ist eine Zeitung aufgebaut?
Jede Tageszeitung ist in verschiedene Themenbereiche, von den Zeitungsprofis Rubriken genannt, unterteilt. Hier finden sich Informationen zu den unterschiedlichsten Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Eine wichtige Rubrik ist auch der Lokalteil, in dem es Aktuelles über deine Stadt oder deine Region zu lesen gibt.
Wer schreibt eigentlich die Beiträge in einer Zeitung?
Für eine Zeitung arbeiten Journalistinnen und Journalisten. Das sind Autoren und Autorinnen, die Berichte für eine Zeitung, das Radio, das Fernsehen oder das Internet verfassen. Alle Journalisten und Journalistinnen bilden zusammen die Redaktion. Weil sich die Journalisten und Journalistinnen auf bestimmte Themenbereiche spezialisiert haben, ist die Redaktion in unterschiedliche Abteilungen, in der Fachsprache Ressorts genannt, aufgeteilt.
Österreich ist ein Land der Zeitungsleser/innen.
Und vielleicht gehörst auch du bald dazu.

Alle Beiträge in einer Zeitung müssen täglich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, den man Redaktionsschluss nennt, fertiggestellt sein. Das ist oft wirklich stressig für alle!
Die Entscheidung, wie ausführlich ein Thema behandelt werden soll oder welcher Artikel tatsächlich gedruckt wird, trifft letztendlich die Chefredakteurin oder der Chefredakteur. Seinen oder ihren Namen findest du im Impressum, das jede Zeitung haben muss. Es enthält Angaben über den Verlag, die Herausgeberin oder den Herausgeber und die Redaktionsleitung.
Welche Textarten gibt es in der Zeitung?
Die Texte, die in einer Zeitung erscheinen, nennt man Artikel. Wir unterscheiden zwischen längeren Artikeln, die man Berichte nennt, und kürzeren Artikeln, die Meldungen genannt werden. Diese beiden Textarten müssen sachlich geschrieben sein, dürfen also keine persönlichen Eindrücke oder Wertungen enthalten. Wir geben also ausschließlich die Fakten wieder. Als Aufmacher bezeichnet man in den Printmedien den wichtigsten, auf der Titelseite insbesondere einer Zeitung hervorgehoben präsentierten Artikel. Er ist auf der oberen Blatthälfte platziert und oft mit einem Aufmacherfoto kombiniert.
Eine Reportage hingegen ist ein ausführlicher Text über ein Ereignis, der auch persönliche Eindrücke der Journalistin/ des Journalisten enthält. Auch bei einem Kommentar äußert die Journalistin/ der Journalist ihre/ seine persönliche Meinung zu einem Sachverhalt. In der Zeitung finden sich auch Interviews, bei denen Experten oder Prominente Antworten auf die Fragen von Journalistinnen/ Journalisten geben.

ZEITUNGSENTE:
So nennt man eine Falschmeldung in der Zeitung, egal ob sie beabsichtigt oder nicht beabsichtigt ist.
LESERBRIEF: Hier kommen die Leserinnen und Leser zu Wort. Sie schreiben ihre Meinung meist zu einem Artikel und senden ihn an die Zeitung. Nur ein kleiner
Teil der Leserbriefe kann in der Zeitung veröffentlicht werden.
AUFLAGE:
Das ist die Anzahl der Exemplare, die täglich gedruckt werden.
Suche die 16 Fachbegriffe, die sich hier waagrecht und senkrecht versteckt haben! Kreise sie ein und schreib sie auf!



Schreib die Erklärungen der 16 Fachbegriffe von Ü9 mit Hilfe des Informationstextes von S. 67 „Crashkurs für Zeitungseinsteiger“ ins Heft! Tausche mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn das Heft! Überprüft gegenseitig eure Ergebnisse!
Erledige die folgenden Aufgaben in deinem Heft! Schreibe in vollständigen Sätzen!
1 Verwende die Begriffe „Rubrik“ und „Kultur“ in einem Satz!
1 Erkläre den Unterschied zwischen „Bericht“ und „Meldung“!
1 Was ist in einem Kommentar im Gegensatz zu einem Artikel erlaubt?
1 Ich möchte der Zeitung meine persönliche Meinung zu einem Thema mitteilen.
Welche Textsorte verwende ich dazu?
1 Aus welchen Personen setzt sich eine Redaktion zusammen?
1 Formuliere fünf Interviewfragen an eine Person deiner Wahl!
Wähle eine Zeitung aus! Analysiere sie mit Hilfe der folgenden Fragen!
NAME der Zeitung:
Datum:
Woher hast du die Zeitung: Gratiszeitungsbox Trafik Zeitungsständer
Abonnement Zeitungsverkäufer Sonstiges: ___________________________
Die Zeitung erscheint: täglich wöchentlich monatlich
Preis: __________ € Format: Kleinformat (DIN A4) Großformat (30 x 45)
Beschreibung des Titelblatts (erste Seite):
Wo ist das Logo platziert? ____________________________________________________________________
Wie lautet die Hauptschlagzeile? ______________________________________________________________
Wie viele Bilder (Fotos, Karikaturen usw.) sind zu sehen? ___________________________________________
Was findet sich noch auf dem Titelblatt? weitere Schlagzeilen Kurzartikel
Inhaltsverzeichnis Wetter Werbung Kolumne (Meinungsbeitrag)
Sonstiges: _____________________________________________________________________________
Die Zeitung informiert über: Innenpolitik Außenpolitik Sport

Horoskop TV-Programm Anzeigen
Wirtschaft Klatsch & Tratsch Kultur
Rezepte Chronik (Unfall, International Einbruch usw.)
Sonstiges: ________________________________________________________________________________
13
Kreise die sechs Schlagzeilen mit den entsprechenden Farben der Ressorts ein! Wirtschaft, Kultur, Außenpolitik, Sport, Chronik, Innenpolitik England scheidet aus
2-jähriger bei Unfall verletzt – Fahrerflucht
Österreichs Wirtschaft bleibt wachstumsstark
Wirbel um die Sparpläne der Regierung Ferrari startet wieder aus der Poleposition Chinas teuerster Film erweist sich als Megaflop
Schlagzeile (Hauptüberschrift)
•fett gedruckt
Nicht jeder Zeitungsartikel
hat eine Anreißerzeile.
Oft beinhaltet die Hauptüberschrift bereits so viele Informationen, dass sie nicht mehr nötig ist.


•kurz und treffend
•soll Aufmerksamkeit erregen
•bringt den Inhalt auf den Punkt
Beispiel: KEBAP-VERBOT in
Anreißerzeile (Unterüberschrift)
Keyword, das: Suchbegriff, den Internetnutzerinnen und -nutzer in eine Suchmaschine (z.B. Google) eingeben, um Informationen zu erhalten
Suchmaschinenoptimierung: Methode, um das Auffinden von Informationen in Suchmaschinen zu verbessern
chronologisch: zeitlich geordnet

•ergänzt die Hauptüberschrift durch Details
•gibt einen kurzen Überblick
•erregt Aufmerksamkeit durch auffällige Schrift
•soll zum Weiterlesen motivieren
•enthalten Keywords zur
Suchmaschinenoptimierung (bei digitalen Medien)
Beispiel:
Stadt Wien verbietet Müffelspeisen wie Pizzaschnitten, Kebap & Co in U-Bahnen

Summary (Kurzzusammenfassung)
•fett gedruckt
•fasst das Wichtigste kurz zusammen
•beantwortet kurz die wichtigsten W-Fragen (wer? Was? Wann? Wo?)
•soll interessant geschrieben sein
•soll neugierig machen, noch mehr zu erfahren

•beschreibt den Ablauf des Geschehens ausführlich
•geht auf Hintergründe ein
•schildert Ereignisse in chronologischer Reihenfolge
•ist in Abschnitte gegliedert
•sachlich und ohne Ausschmückungen
•enthält keine persönliche Meinung
•beantwortet die sechs W-Fragen: wer? wo? wann? was? wie? warum?
•endet mit den (möglichen) Folgen des Ereignisses
Lies zuerst den Artikel, dann ordne die Fachbegriffe richtig zu!

1. Journalist/in M 2. Anreißerzeile M 3. Bericht M 4. Bildtitel M 5. Summary (Zusammenfassung) M 6. Schlagzeile M 7. Bild
In Oberösterreich rettete eine Hündin ihre Besitzer vor dem sicheren Flammentod.
Oberösterreich: Kleine Hündin ganz groß! Weil sie nicht aufhörte, Alarm zu schlagen, konnte eine Hündin Frauchen und Herrchen aus dem Schlaf reißen und sie noch rechtzeitig vor den Flammen retten.
Das Ehepaar, 71 und 85 Jahre alt, aus Kematen an der Krems, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:45 Uhr durch lautes Bellen ihrer „Gini“ aufgeweckt. Das Ehepaar stellte sofort fest, dass ihr
Schlafzimmer stark verraucht war und aus einem Türspalt bereits schwarzer Rauch eintrat. Den beiden gelang es, in letzter Minute noch den Bauernhof zu verlassen und die Feuerwehr zu alarmieren. Die Feuerwehrleute rückten an und konnten den Brand in der

Küche rasch lokalisieren und löschen.
Das Ehepaar blieb unverletzt, wurde aber zur Kontrolle von der Rettung ins UKH Linz eingeliefert. Verletzte Tiere gab es keine, auch die kleine Heldin ist unversehrt.
Obwohl der Brand auf die Ausbruchsstelle beschränkt blieb, entstand im Wohnbereich durch den Brandrauch erheblicher Sachschaden.
Als Brandursache konnte vom Brandursachenermittler ein technischer Defekt an einem Küchengerät festgestellt werden. Brandstiftung oder eine fahrlässige Herbeiführung des Brandes kann ausgeschlossen werden. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.
Elvira Hofstätter
Die kleine Heldin „Gini“ in den Armen eines Feuerwehrmannes
Suche im Artikel die Antworten auf die W-Fragen! Markiere sie in den Farben der Fragewörter!
Wer war beteiligt? Was geschah? Wo geschah es?
Wie kam es dazu? Wann passierte es? Warum passierte es?
Beantworte im Heft die W-Fragen zum Artikel von Ü1! Schreibe vollständige Sätze!
Die unterschiedlichen Aussageweisen des Verbs helfen, die Absicht der Sprecherin oder des Sprechers klar auszudrücken.
D beschreibt Tatsachen und reale Geschehnisse
Bildung: Die Nennform wird in die passende Personal- und Zeitform gesetzt. Beispiel: Er geht morgen zur Arbeit.
Ergänze die Tabellen, indem du das Verb passend konjugierst!
Erstelle am PC eigene Tabellen zu den Verben „laufen, sehen, holen, spielen“! Kontrolliere mit dem Wörterbuch oder Duden online!

D wird hauptsächlich für die indirekte Rede verwendet
D drückt das Gesagte oder Behauptete als Möglichkeit oder Vorstellung aus.
Bildung:
Zum Wortstamm des Infinitivs, fügt man die Endungen -e, -est, -e, -en, -et, -en hinzu.
Beispiel:
Er sagt: „Ich gehe zur Arbeit.“
Er sagt, er gehe zur Arbeit.
Achtung: Beim Hilfsverb „sein“ verändert sich ALLES!.
1
Markiere die Endungen im Konjunktiv I grün! Achte dabei auf den Tipp der Eule! Dann ergänze die Tabelle mit dem Verb „lesen“ im Indikativ!
KONJUNKTIV I
Singular
Plural
ich lese wir lesen
du lesest ihr leset
er/sie/es lese sie lesen
kauf
Wortstamm en Endung
INDIKATIV
Singular Plural ich wir du ihr er/sie/es sie

2
Vergleiche die beiden Formen! Formuliere selbst eine Regel zur Bildung des Konjunktivs I!
Meine Regel:
Ergänze die Tabelle im Indikativ!
KONJUNKTIV I
Singular
Plural
ich sei wir seien
du sei(e)st ihr seiet

Singular
Vorsicht beim Hilfsverb „sein“!
er/sie/es sei sie seien INDIKATIV
Plural ich bin wir sind du ihr er/sie/es sie
Konjugiere im Heft folgende Verben im Konjunktiv I! Markiere die Endungen farblich!




D wird für höfliche Bitten, Wünsche und Zweifel verwendet
D wird anstelle des Konjunktiv I verwendet, wenn dieser sich nicht vom Indikativ unterscheidet.
Bildung:
Dem Wortstamm des Präteritums werden die Endungen -e, -est, -e, -en, -et, -en hinzugefügt.
Bei starken Verben werden oftmals die Stammvokale umgelautet. (a D ä, o D ö, u D ü)
Beispiel: kam D käme, flog D flöge, trug D trüge
Achtung:
Klingt der Konjunktiv II wenig gebräuchlich, wie zum Beispiel „flöge, trüge, …“ umschreibt man ihn mit „würde + Infinitiv“.
Beispiel:
Sie sagten, sie tragen die Koffer. (sie tragen: Konjunktiv I = Indikativ)
D Konjunktiv II
Sie sagten, sie trügen die Koffer. (sie trügen: wenig gebräuchlich)
D Umschreibung
Sie sagten, sie würden die Koffer tragen. 1
Lies die Sätze! Schreibe zu jedem Satz ein W für Wirklichkeitsform oder ein M für Möglichkeitsform!
Jeden Morgen erscheinen neue Zeitungen mit den wichtigsten Nachrichten. ______
Ich könnte auch einmal eine Zeitung lesen. ______
In einer Zeitung gibt es oft einen Teil mit Sport- und Freizeitthemen. ______
Viele Menschen lesen die Zeitung, um über Politik und Wirtschaft informiert zu sein. ______
Mein Freund wünschte, er könnte spannendere Berichte schreiben. ______
Journalistin wäre ein toller Beruf für mich. ______
Ergänze die Tabelle! Setze die richtigen Formen ein! Nimm das Wörterbuch oder Duden online zu Hilfe!
INDIKATIV
ich bin sie fährt wir müssen du bringst es gibt es gelingt
PRÄTERITUM KONJUNKTIV II
Fülle die Lücken! Setze die Verben der Klammer in den Konjunktiv II!
Sara wünschte, ihr Bericht _________________ (sein) schon fertig.
Ich _____________________ (wissen) nicht, wie ich dir da am besten helfen
__________________ (können).
Wir glauben alle, dass es ohne Handy nicht ____________________ (gehen).
Die ganze Klasse dachte, wir _____________ (haben) keinen Test.
D wird für Befehle und Aufforderungen verwendet
D verlangt ein „Ausrufezeichen !“ am Ende des Satzes
Bildung:
2. Person/ Singular D Endung -st weglassen (gehst D geh!)
2. Person/ Plural D normale Pluralform (geht!)

Setze die folgenden Verben in den Imperativ! Bilde damit Sätze und schreib sie auf!

holen M schreiben M legen M tragen M haben M sein

Zur Erinnerung: Die direkte Rede gibt ein Gespräch wörtlich wieder. Die Verben stehen im Indikativ.
D gibt wieder, was ein anderer gesagt hat
Bildung: Dafür wird zumeist der Konjunktiv I verwendet.
Beispiel: Direkte Rede: Der Lehrer sagt: „Ich freue mich über meine Schülerinnen und Schüler.“
Indirekte Rede: Der Lehrer sagt, er freue sich über seine Schülerinnen und Schüler.
ODER
Der Lehrer sagt, dass er sich über seine Schülerinnen und Schüler freue.

1
2
Tipp: Wenn sich der Konjunktiv I vom Präsens Indikativ nicht unterscheidet, kann man stattdessen
D Konjunktiv II oder D Nennform des Hauptverbes + würde verwenden.
Beispiel: Max sagt: „Ich esse gerne Nutella.“
Max sagt, dass er gerne Nutella esse. (Konjunktiv I = Indikativ)
D Konjunktiv II:
Max sagt, dass er gerne Nutella äße. (äße = wenig gebräuchliche Form)
D Nennform des Hauptverbs + würde: Max sagt, dass er gerne Nutella essen würde.
Vergleiche die Sätze der direkten Rede mit denen der indirekten Rede! Markiere die Unterschiede, die dir auffallen!
direkte Rede
Die Journalistin fragt: „Wann hat der Unfall stattgefunden?“
„Meine Hausaufgabe“, erklärt Mona, „mach ich immer am Abend.“
„Geh mit dem Hund Gassi!“, ermahnt
Noahs Mutter ihn täglich.
Joel fragt seinen Bruder: „Holst du mich von der Schule ab?“

Schreibe auf, was sich ändert!

indirekte Rede
Die Journalistin fragt, wann der Unfall stattgefunden habe
Mona erklärt, sie mache ihre Hausaufgabe immer am Abend.
Noahs Mutter ermahnt ihn täglich, dass er mit dem Hund Gassi gehen solle.
Joel fragt seinen Bruder, ob er ihn von der Schule abhole.
Formuliere deine Regel dafür, was sich bei der Umformung der direkten in die indirekte Rede ändert!
Regel:
1. Sätze in der indirekten Rede werden üblicherweise mit „dass“ eingeleitet.
2. Bei Fragesätzen wird das Fragewort (Wo? Wer? Was?) der direkten Rede wiederholt.
3. Gibt es kein Fragewort, kannst du das Wort „ob“ verwenden“.
Verbinde die passenden Wortteile und schreibe sie auf!
DiePolizistinbatdieZeugin:

„BeschreibenSiemirdenTätergenau!“

„WohastdudenndieSchmerzen?“,

obderFeuerwehrmannschondieBrandursachekenne.


DiePolizistinbatdieZeugin,

dasssieIhrdenTätergenaubeschreibe.DieReporterinfragte,


DieReporterinfragtedenFeuerwehrmann:


direkte Rede:
indirekte Rede:
direkte Rede:
indirekte Rede:
direkte Rede:

„KennenwolltederSanitätervomAchtjährigenwissen. SiedieBrandursacheschon?“

indirekte Rede: Wandle in deinem Heft die Sätze von der direkten in die indirekte Rede um!
Die Tierschützerin meinte: „Ich rette auch Goldfischen das Leben.”
Der Polizist erklärte: „Der Täter ist ein 53-jähriger Oberösterreicher.”
„Wer hat den Artikel eigentlich geschrieben?”, wollte der Chefredakteur wissen.
DerSanitäterwolltevomAchtjährigenwissen,woerSchmerzenhabe. Olympe
Der Anwalt betonte: „Mein Mandant ist unschuldig.”
Die Einwohner fragten sich: „Warum hat er das getan?”
Die Sanitäter erkundigten sich: „Herr Weber, haben Sie die Blutgruppe 0 positiv?”
„Es muss sich schnellsten etwas ändern”, sagte die Politikerin.
Der Richter stellte dem Angeklagten die Frage: „Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?”
Streiche in jeder Zeile das Wort, das nicht passt!
ChronikSportLesenPolitik
SchlagzeileAnzeigeAnreißerzeileSummary
KurierKroneTV-MediaKleine Zeitung
JournalistRedakteurReporterModerator
Brand in GrazRaub in Wien 10Preise steigenHund biss Kind
Übertrage diese Kurzmeldung in deinem Heft in die indirekte Rede!
Ein japanischer Tourist hat sich im Nationalpark Hohe Tauern verirrt. Nach drei Tagen des Herumirrens hat ihn die Tiroler Bergrettung gefunden. Der Rettungshubschrauber hat den Touristen nur mit FlipFlops und einer Short bekleidet auf einer Lichtung im Wald entdeckt. Die aufwändige Rettungsaktion nach dem Vermissten ist somit gelungen. Zum Überleben hat der Mann Regenwasser getrunken und sich von Beeren und Pilzen ernährt. Er ist nun im Spital und muss dort noch einige Zeit bleiben. Der Japaner kann schon wieder sprechen und hat bereits mit seinen Angehörigen in Japan telefoniert.
Der Reporter berichtet, dass...
Gib folgende Fragen in deinem Heft in der indirekten Rede wieder! Tipp: Dein Einleitungssatz könnte lauten: Ich frage mich/Ich meine – Die Ärztin fragt mich/Sie will von mir wissen – Meine Mutter erkundigt sich/Sie fragt mich
Wo bin ich denn eigentllich?
Wird mich jemand hier finden?
Warum bin ich nur so leichtsinnig?


Nehmen Sie Medikamente? Haben Sie Schmerzen? Wie geht es Ihnen?

Geht es dir gut?
Was ist passiert?
Wie lange musst du im Spital bleiben?
Ich kann…
…Wörter einem Oberbegriff zuordnen. (1)
…einen Text und Fragen in die indirekte Rede übertragen. (2 + 3)



Einige Schüler und Schülerinnen der 3 C wollen sich für die berufspraktischen Tage um eine Stelle bei der Tageszeitung „Lokalzeit“ bewerben. Das Auswahlverfahren umfasst neben einem persönlichen Vorstellungsgespräch auch das Schreiben eines Zeitungsberichts. Chefredakteur Renner stellt daher das Rezept zum Verfassen eines Zeitungsartikels zur Verfügung.
1. Schreibe im Präteritum!
2. Bleibe sachlich!
3. Gliedere deinen Artikel!
Schlagzeile R soll spannend klingen
Anreißerzeile R 1 Satz, der die Schlagzeile erklärt
Summary R 2 – 3 Sätze mit kurzen Antworten auf die W-Fragen wer? wo? wann? was? wie? warum?

Bericht R das Geschehen wird mit Hilfe der 6 W-Fragen ganz genau geschildert
4. Berichte am Ende über die tatsächlichen oder möglichen Folgen des Geschehens!

Schreibstil: Tipps der Chefredakteurin Fr. Hofbauer
Schreibe in kurzen und knappen Sätzen!
Schreibe objektiv!
Lass persönliche Gedanken und Gefühle weg!
Schreibe im Nominalstil, d. h. Verben und Adjektive werden nominalisiert verwendet.
Zeugen befragen R Befragung der Zeugen; gefährdet R Gefährdung
Berichte sachlich, d. h. ohne Ausschmückung! Vermeide eine persönliche Stellungnahme!

Nenne die beteiligten Personen nur mit abgekürztem Namen! Gib auch das Alter an! Beispiel: Herbert M. (27)
Vermeide die „Ich-Form“, denn du bist der Reporter, der informiert!
Verwende anstatt der wörtlichen Rede die indirekte Rede!
Die Zeugen sagten, dass...
Erstelle in deinem Heft eine eigene Checkliste für das Schreiben eines Zeitungsberichtes! Vergleiche deine Liste mit jener deiner Sitznachbarin oder deines Sitznachbarn!
Der Nominalstil
Texte, die im Nominalstil geschrieben sind, wirken sehr klar, sachlich und neutral. Um in diesem Stil zu schreiben, formst du Verben oder Adjektive zu Nomen um.
Verben nominalisieren …
… mit einem Artikel laufen D das Laufen hämmern D ein Hämmern
… mit einer Präposition (+ verstecktem Artikel) sprechen D zum (zu dem) Sprechen gehen D beim (bei dem) Gehen
… mit dem Partizip II + Artikel geschrieben D das Geschriebene geholt D das Geholte erzählt D das Erzählte
… mit Adjektiven rennen D schnelles Rennen tragen D schweres Tragen
… mit einem Possessivpronomen singen D ihr Singen schreien D sein Schreien
… mit Nachsilben wie „-nis, -schaft, -tum, oder -ung“ wachsen D Wachstum erleben D Erlebnis erfahren D Erfahrung
… mit der Vorsilbe „Ge-“ schreien D Geschrei schimpfen D Geschimpfe
Markiere in jedem Satz das nominalisierte Verb! Schreib die Infinitivform des nominalisierten Verbs auf! Kreuze an, auf welche Art das Verb nominalisiert wurde!
Ein Quietschen der Reifen kündigte den Unfall an.___________________
Dem Fahrer blieb zum Ausweichen keine Zeit mehr.___________________
Die Polizei stellte das Gestohlene sicher. ___________________
Heftiges Bremsen konnte den Aufprall nicht stoppen.___________________
Am Unfallort hörte man lautes Geschrei. ___________________
Die Rettung der Unfallopfer dauerte mehrere Stunden. _________________
Die Unfallzeugen hörten ihr Schreien. ___________________
1 2 3 4 5 6 7 1 2 Olympe
Überlege dir zehn Verben und nominalisiere sie durch Anhängen von Nachsilben! Schreibe sie in dein Heft!
Übertrage die nominalisierten Sätze von Ü1 in verbalisierter Form ins Heft!
Beispiel:
Beim Evakuieren der Stadt entstand Chaos. Als sie die Stadt evakuierten, entstand Chaos.
1
… mit einem Artikel schön D das Schöne
… mit unbestimmten Numeralen wie nichts, alles, etwas, … groß D etwas Großes sauber D nichts Sauberes
Lies die Sätze und kreuze die passende Antwort an!
Letzte Nacht geschah etwas Schreckliches.
Wenn es dunkel ist, wird es gruselig.
… mit Präpositionen dunkel D im Dunkeln
… mit Nachsilben wie „-e, -heit, -keit, oder -nis“ breit D Breite wahr D Wahrheit
Die Klugheit des Kommissars überführte den Verbrecher.
nominalisiert
JA NEIN Letzte Nacht geschahen schreckliche Dinge.
Das Schöne ist der Zusammenhalt der Menschen.
JA NEIN
JA NEIN Im Dunkeln wird es gruselig.
Nominalisiere folgende Wörter und bilde damit Sätze in deinem Heft! 3
JA NEIN
JA NEIN Durch den klugen Kommissar konnte der Verbrecher überführt werden.
2 3 4 4 5 6 tragen M wissen M erklären M schlampig M frei M wertvoll
JA NEIN
JA NEIN Es ist schön, dass die Menschen zusammenhalten.
JA NEIN
Nominalisiere die Sätze und schreib sie in dein Heft! Tipp: Die unterstrichenen Wörter helfen dir!
Als der Fahrer die Kreuzung überquerte, übersah er die rote Ampel.
D Bei der Überquerung …
Das entgegenkommende Fahrzeug bremste zu spät.
D Das Bremsen …
Innerhalb weniger Minuten trafen die Rettungskräfte ein.
D Das Eintreffen …

Markiere in diesen Kurzzusammenfassungen die wichtigsten Aussagen! Verfasse zu jeder Summary eine Schlag- und eine Anreißerzeile!

a) Bregenz: Der Feuerteufel von Bregenz schlug wieder zu, und zwar als die Stadt schlief. 17 Autos und vier Motorräder verbrannten in den Morgenstunden in Vorarlberg. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
b) Kottingbrunn: Mit einem Hund krachte ein Radfahrer in Niederösterreich zusammen. Der 58-Jährige stürzte mit seinem Rennrad. Harald D. erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Spital geflogen.
c) Bad Schallerbach: Um Leben und Tod ging es nach der TV-Übertragung des Ländermatches in einem Mehrparteienhaus in Oberösterreich. Während die Feuerwehr den Brand löschte, schliefen im Obergeschoß drei Bewohner.
Schreib die W-Fragen in der richtigen Reihenfolge auf! Ordne die Begriffe zu!
Attentat
Popstar Michael Mackson (35) war geistig verwirrt Sänger stürzte blutend zu Boden Fan Dallas (Texas) zwei Schüsse fielen vor seinem Lieblingslokal 2. 11. 1999, 12:30
Verfasse mit den Angaben von Ü3 einen Zeitungsartikel in deinem Heft! Überprüfe ihn mit deiner Checkliste!
Lies diesen Bericht aufmerksam durch! Dann wähle eine passende Schlagzeile!
Party mitten auf der Straße: Autolenker verletzte einen Schüler auf der B 45 schwer
Niederösterreich: Gestern Nacht erfasste ein 43-jähriger Bauarbeiter mit seinem Auto einen 14-jährigen Schüler auf der Bundesstraße B 45 und verletzte ihn schwer. Der Schüler feierte mit seinen Freunden mitten auf der Straße.
Mitten auf der Straße B 45 Richtung Staatz vor Siebenhirten saßen Sonntag in der Früh sechs Jugendliche aus Mistelbach auf ihren Schlafsäcken und hörten Musik in voller Lautstärke. Dieses leichtsinnige Verhalten führte zu einem schweren Unfall. Der Bauarbeiter Johann B. (43) aus
Wilfersdorf, der mit seinem PKW nach Laa an der Thaya unterwegs war, konnte die Jugendlichen auf Grund einer unübersichtlichen Kurve nicht sehen. Erst im letzten Moment versuchte Johann B. mit einer Vollbremsung das Schlimmste zu verhindern. Trotzdem erfasste der Autofahrer noch den zum Fahrbahnrand flüchtenden Schüler Georg L. (14). Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert und so schwer verletzt, dass er sofort ins Krankenhaus Mistelbach geflogen werden musste. Seine Freunde, die den Unfall mitansehen mussten, erlitten einen schweren Schock.
Vollbremsung verhindert einen Auffahrunfall M Rockmusik tötete Jugendlichen M Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt M Bauarbeiter schwer verletzt M Immer mehr Verkehrstote in Wien M
Unerfahrener Autofahrer schuld an Verkehrsunfall

Beantworte in deinem Heft in Stichwörtern die sechs W-Fragen!
Markiere in der Wortschatzkiste jene Wörter, die dir beim Schreiben Schwierigkeiten bereiten könnten! Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Diktiert euch gegenseitig die Wörter und kontrolliert im Anschluss!
Wort-Schatzkiste:
PKW, LKW, Fahrzeug
Autolenker, Fahrzeuglenker
Insassen ins Schleudern geraten von der Straße abkommen riskantes Überholmanöver
Glatteis, Nebel
überhöhte Geschwindigkeit unübersichtliche Kurve
Vollbremsung
Rettung
Notarzt unter Schock stehen erlitt tödliche Verletzungen Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.
Großbrand, Wohnungsbrand
Rauchentwicklung
Flammen
evakuieren
Brandursache
defektes elektronisches Gerät
Brandstiftung
Blitzschlag
Brandmelder
Feuerwehr alarmieren
Krankenhaus
Rauchgasvergiftung
Verbrennungen
geschätzter Schaden von... der/die Tote
Brandopfer
Räuber, Einbrecher
Komplize
Diebesbande
Einstieg durch das Fenster
Aufbrechen der Tür gewaltsames Eindringen
Brecheisen
Alarmanlage
Wertgegenstände wie Schmuck, Bargeld, Antiquitäten, elektronische Geräte
Polizei, Polizist/in, Beamter
Festnahme
Befragung
Zeugen
Anzeige


Bilde zu jeder Kategorie drei Sätze! Verwende für jeden Satz so viele Wörter der Kategorie wie möglich!
Verfasse mit Hilfe dieser Angaben einen Zeitungsbericht am Computer (ca. 150Wörter)!
Tausche dein Heft mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn und überprüfe den Text anhand der Checkliste!
WANN gestern Abend M gegen 22:00 Uhr
WO in Achau M Niederösterreich
WER Autolenkerin Silvia B. (60) M Polizeistreife – zwei Polizisten

WAS Autofahrerin stoppte erst ihren Wagen, nachdem sie einen Polizisten überfahren hatte.
WIE Autolenkerin verursachte einen Blechschaden in Achau M wenige Minuten später von einer Polizei-Streife entdeckt M Lenkerin beschleunigte ihr Fahrzeug M rammte das Einsatzfahrzeug M PKW kam zum Stehen M Polizisten stürmten los M Silvia B. legte Rückwärtsgang ein und fuhr los M ein Beamter wurde überrollt M erlitt schwere Verletzungen M mit dem Notarzthubschrauber ins AKH geflogen
WARUM Alkohol am Steuer M 1,6 Promille
FOLGEN Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung und schwerer Körperverletzung

Mein Bericht ist im Präteritum geschrieben.
Es gibt eine spannende Schlagzeile.
Die Anreißerzeile erklärt das Ereignis kurz.
In meiner Kurzzusammenfassung (Summary) sind die 6 W-Fragen mit 2 – 3 Sätzen beantwortet.
Mein Bericht erklärt das Ereignis anhand der W-Fragen (wer? wo? wann? was? wie? warum?) ganz genau.
Ich habe in meinem Schlussteil auch (mögliche) Folgen des Geschehens beschrieben.
Meine Sätze sind kurz.
Der Text ist sachlich und ohne persönliche Meinung.
Ich habe, anstelle der direkten Rede, die indirekte Rede verwendet.
Ich habe meinen Aufsatz 3-mal durchgelesen. D Inhalt, Rechtschreibung, Grammatik
Ich habe das Wörterbuch verwendet.
Die meisten Zeitungen haben eigene Online-Ausgaben. Damit sprechen sie mehr Leserinnen und Leser an. Als Nutzerin oder Nutzer der Online-Ausgabe einer Zeitung solltest du bestimmte Auswahlkriterien beachten.
Bewerte diese zwei Online-Ausgaben nach folgenden Kriterien!
www.krone.at
Übersichtlichkeit:
unübersichtlich gutes Navigieren möglich

Menge an Werbung: zu viel kaum keine
Farbgebung: zu bunt zu langweilig angemessen
Links: gute Hinweise keine Verlinkung
Darstellung: sachlich, wahrheitsgetreu sensationslustig, übertrieben
Ausführlichkeit der Artikel: Kurzfassungen vollständige Berichte

www.kurier.at
Übersichtlichkeit: unübersichtlich gutes Navigieren möglich

Menge an Werbung: zu viel kaum keine
Farbgebung: zu bunt zu langweilig angemessen
Links: gute Hinweise keine Verlinkung
Darstellung: sachlich, wahrheitsgetreu sensationslustig, übertrieben
Ausführlichkeit der Artikel: Kurzfassungen vollständige Berichte

Vergleiche zum gleichen Thema jeweils einen Artikel aus der krone.at und dem kurier.at! Notiere, was dir auffällt! Aufmachung, Wortwahl, Schreibstil, Umfang, Bilderauswahl usw.
Sucht eine Partnerin oder einen Partner und überlegt gemeinsam, welche Vor- oder Nachteile E-Paper und Printmedium (online-Zeitung und gedruckte Zeitung) haben! Stellt eure Ergebnisse der Klasse vor und diskutiert darüber!
Gestalte auf einem A4- Blatt einen „roten Zeitungsfaden“!
a) Wähle einen Artikel aus einer Zeitung aus, der dich besonders anspricht! Tipp: Achte darauf, dass alle W-Fragen im Artikel beantwortet werden!
b) Nimm ein A4-Blatt, schreibe als Überschrift „Roter Zeitungsfaden“ und übertrage auch die Schlagzeile!
c) Notiere auf sechs Post-its (jedes steht für eine W-Frage) die wichtigsten Schlüsselwörter!
d) Verbinde nun deine Post-its mit einem dicken roten Strich!
e) Zum Schluss stelle mit Hilfe deines roten Fadens deinen Top-Artikel deiner Klasse vor!




Markiere im folgenden Zeitungsartikel die sechs nominalisierten Verben! Beschrifte die Abschnitte des Artikels! (B-Bericht, F-Folgen, A-Anreißerzeile, S-Schlagzeile, K-Kurzzusammenfassung) Beantworte die 6 W-Fragen des Zeitungsberichtes in deinem Heft!

Rettungswagen krachte in PKW: Vier Verkehrsteilnehmer in der Steiermark teils schwer verletzt
Köflach: In der Weststeiermark stieß am Sonntagnachmittag ein Rettungsfahrzeug während einer Einsatzfahrt mit einem PKW zusammen. Dabei wurden beide Lenker und zwei weitere Personen verletzt.


Das Rettungsfahrzeug, das von einem 23-jährigen Sanitäter aus dem Bezirk Voitsberg gelenkt wurde, war am 12. 10. gegen 15:15 Uhr mit Blaulicht auf der B70 aus Richtung Pichling kommend nach Voitsberg unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung im Stadtgebiet von Köflach beschleunigte der Rettungsfahrer und fuhr bei Rot über die Kreuzung. Eine Kollision mit einem 42-jährigen PKW-Lenker war unausweichlich.
An Bremsen war nicht mehr zu denken. Der Rettungswagen kam ins Schleudern und erst auf dem Parkplatz eines Autohauses zum Stehen, nachdem er eine Reklametafel, einen Fahnenmast und zwei

abgestellte Fahrzeuge gerammt hatte. Die Reklametafel stürzte auf ein weiteres geparktes Auto. Zeugen des Unfalls alarmierten die Rettung.
Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden zunächst die beiden Lenker der Unfallwägen erstversorgt. Weiters mussten auch die Insassen des Rettungswagens, eine 20-jährige Sanitäterin und eine 37-jährige Patientin, ärztlich versorgt werden. Alle Verletzten wurden in das LKH Voitsberg gebracht.
An den fünf beteiligten Fahrzeugen sei ein hoher Sachschaden entstanden, gab die Polizeiinspektion Köflach bekannt.

Welche W-Fragen wurden NICHT beantwortet? Kreuze an!
Raddiebe mittels
Sender gefunden
Mit sehr genauen Informationen kam eine 18-Jährige am Montag zur Polizei. Der jungen Frau war das Fahrrad gestohlen worden.
Dank eines daran angebrachten Ortungssystems wusste sie genau, wo sich ihr Gefährt gerade befand. Beamte machten sich auf den Weg zu der Adresse und fanden in einer Wohnung gleich mehrere gestohlene Fahrräder. Insgesamt wurden vier Verdächtige von 18, 19, 30 und 32 Jahren festgenommen.
Wo? Wann? Wer? Was? Wie? Warum?
Wohnungsbrand in Salzburg Lehen.
Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg sind rund zehn Personen leicht verletzt worden.
Laut Polizei wurden elf Bewohner von Rauchgasen beeinträchtigt und neun davon im Landeskrankenhaus behandelt. Das Gebäude musste vorübergehend evakuiert werden. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand innerhalb einer halben Stunde. Als Brandursache wird ein defektes Heizgerät vermutet, das einen Kurzschluss verursachte.
Wo? Wann? Wer? Was? Wie? Warum?
Mutter und Tochter aus Gletscherspalte am Dachstein gerettet Oberösterreich. Eine 42-jährige Deutsche und ihre Tochter sind am Montagnachmittag am Dachstein in Oberösterreich verletzt aus einer Gletscherspalte gerettet worden. Laut Angaben der Polizei waren die beiden rund 50 Meter in die Tiefe auf eine Schneebrücke in der Gletscherspalte gestürzt. Die Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.
Wo? Wann? Wer? Was? Wie? Warum?
Suche in dieser Kurzmeldung der APA (Austria Presse Agentur) nach den W-Fragen und beantworte sie in deinem Heft! Dann überlege dir eine Schlagzeile, eine Anreißerzeile und verfasse einen Zeitungsbericht!
13. 1. M Sonntagfrüh M Graz Eggenberg M 13-jährige Schülerin M rettete 4-jährigen Bruder M Mutter schaltete Herdplatte nicht aus M Morgenzeitung holen M Pfanne mit Öl M Küchenbrand M Feuerwehr von Nachbarin alarmiert M Feuerwehreinsatz zwei Stunden M Schaden ca. 10 000 € M Verdacht auf Rauchgasvergiftung M Klinikum Graz M kurz darauf entlassen
Ich kann anhand meiner gewählten Schlüsselwörter den Inhalt eines Zeitungsartikels mündlich präsentieren. (1)
Ich erkenne nominalisierte Verben in einem Text. (2)
Ich erkenne die Abschnitte in einem Zeitungsartikel und kann sie richtig benennen. (2)
Ich erkenne in Kurzmeldungen, welche W-Fragen unbeantwortet bleiben. (4)
Ich kann anhand einer Kurzmeldung einen vollständigen Zeitungsbericht verfassen. (4)



Wissenstest: Fremdwörter
Mona stolpert beim Lesen von Zeitungsartikeln oft über Wörter, die sie nicht kennt und die auch schwer auszusprechen sind. Es sind zumeist Wörter, die aus anderen Sprachen in das Deutsche übernommen wurden.
FREMDWÖRTER aus dem...


Griechischen haben oft... Lateinischen haben oft... Französischen haben oft... Englischen haben oft... die Buchstabenfolgen die Endung -iv oder -ion die Endungen -eur, -ette die Buchstabenfolgen Sh-, ph, th und rh und -ee-ea oder die Endung -y
Atmosphäre, Thema, aggressiv, Diskussion Ingenieur, Kassette, ArmeeShampoo, Jeans, Hobby Rhetorik 1
Ordne die Fremdwörter der Tabelle den passenden Erklärungen zu! Tipp: Wenn du nicht weiterweißt, benutze dein Wörterbuch oder Duden online!

2 3
Freizeitbeschäftigung: ________________________________________
angriffslustig, streitlustig: ________________________________________
Gespräch über ein Thema oder Problem
Techniker________________________________________
Lufthülle der Erde________________________________________
gesamte Streitmacht eines Landes ________________________________________
flüssiges Haarwaschmittel________________________________________
Redekunst
Hosen aus Baumwollstoff (Denim)
Kästchen zur Aufbewahrung
Gegenstand z. B. einer Rede
Erstelle in deinem Heft eine Tabelle! Trage die Fremdwörter alphabetisch gereiht ein! Schreibe zu jedem Fremdwort die Bedeutung! Tipp: Verwende dein Wörterbuch oder Duden online!
die Hygiene M die Strophe M der Chor M das Asyl M die Phase M die Methode M die Pyramide M der Rhythmus M die Party M das Gelee M die Allee M der Hydrant M die Tradition M die Qualität M der Chirurg M der Nerv M der Rhombus M die Inspektion
Fremdwort Bedeutung die Alleevon hohen Bäumen gesäumte Straße
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Diktiert euch die Fremdwörter und korrigiert sie im Anschluss!
Schreib die passenden Artikel zu den Fremdwörtern! Schlag sie in deinem Wörterbuch oder im Duden online nach!
_______Fasson_______Toilette_______Route_______Niveau
_______Saison _______Montage _______Redakteur_______Journal
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Erklärt euch gegenseitig die jeweils vier Fremdwörter von Ü4!
Teste doch deine Fremdwortkenntnisse! Kreuze die richtige Bedeutung an!
1. adäquat angemessen einfach freundlich
5. das Chaos Verformung Durcheinander Gemälde
9. dezidiert vereinzelt entschieden oft
13. das/der Event Veranstaltung Fluss in London Schreibrichtigkeit
17. heterogen gleichartig verschiedenartig schwierig
21. die Neutralität Nichtigkeit Nichtwissen Nichteinmischung
25. die Prognose Zustimmung Vorhersage Zukunft
29. trivial einfach echt taktlos
2. die Ambition Faulheit Ehrgeiz Gespräch
6. das Copyright Kopiermaschine Urheberrecht meistverkauftes Buch
10. dominieren benehmen beherrschen befehlen
14. die Fairness Glück Schweigen anständiges Verhalten
18. intervenieren eingreifen einladen einstehen
22. kognitiv verstandesmäßig gefühlsmäßig vertrauensvoll
26. optimal neueste veraltet bestens
30. relevant passend wichtig weise
3. der Blazer Schreibtisch langer Rock Jackett
7. debattieren verleugnen verhandeln vertrauen
11. dynamisch tatkräftig langweilig nachdenklich
15. flexibel anpassungsfähig uneinsichtig gefährlich
19. innovativ ideenreich einfach unmöglich
23. luxuriös scharf prunkvoll einfach
27. die Revolution Uferstraße Umfärbung Umwälzung
31. urban ländlich sachlich städtisch
4. das Brainstorming Denkrunde Gemälde Denkleistung
8. das Defizit Verlust Fruchtgetränk Fehler
12. die Empathie Rücksichtslosigkeit Abneigung Einfühlungsvermögen
16. grandios langweilig schnell fantastisch
20. die Manieren Minderheiten Verkleinerung Umgangsformen
24. das Prestige Ansehen Abbild Abdruck
28. suspekt zweifelhaft zwanghaft zügellos
32. zynisch saftig spöttisch sagenhaft
Wähle zehn Fremdwörter aus und verwende sie in sinnvollen Sätzen! Wer schafft es, in einem Satz zwei Fremdwörter zu verwenden?
Schreibe den Text in dein Heft! Ersetze dabei die fett gedruckten Wörter durch die angegebenen Fremdwörter!
Bunt und zum Essen anreizend sehen die großformatigen Papiere aus, mit denen Schnellgericht-Unternehmen für ihre Erzeugnisse Anpreisungen machen und um die Gunst der Käufer wetteifern. Weil Jugendliche noch keine prüfenden Verbraucher sind, fallen sie verhältnismäßig leicht auf solche Werbung herein.
Im Gegensatz zu einem zerdrückten Nachtschattengewächs oder den langen schnurartigen Nudeln mit Saft bringen schnelle Happen aber kein Sättigungsgefühl. Zum mit gebratenem Fleisch belegten Brötchen gehört natürlich auch noch der verpflichtende Becher Zuckerwasser. So sind alleine in 100ml koffeinhaltigem Erfrischungsgetränk zehn Stück Würfelzucker und 10mg bitter schmeckender Stoff mit anregender Wirkung enthalten. Durch den Verzehr dieser Lebensmittel und Getränke steigt aber die

1. ABSATZ: kritischen Konsumenten * Plakate * Produkte * Reklame * appetitlich * konkurrieren * relativ * Fast Food-Konzerne

2. ABSATZ: Effekt * Koffein * Risiko * Sauce * Light-Produkte * Snack * Burger * Limonade * Spaghetti * Cola * obligatorische * Konsum * drastisch * Kartoffelpüree * Attacken
Gefahr, an Fettleibigkeit oder Zuckerkrankheit zu erkranken, deutlich an. Aber auch der Verzehr von Leicht-Handelsgut bringt oft den gegenteiligen Erfolg. Richtige Angriffe an Heißhunger können sich einstellen.
Wie kann man aber wirklich das Essverhalten von Jugendlichen ändern? Zum erlaubten Trinken von Wasser während des Unterrichts sollten auch nebeneinander laufende Maßnahmen zum Gegenstand „gesunde Ernährung“ durchgeführt werden. Auch ein Verkaufstisch in der Schule muss mehr auf gesunde Ernährung ausgerichtet sein. Ungesundes wie in Fett gebackene Kartoffelscheiben, belegter und gebackener Hefeteig oder dickflüssige kalte Soße gehören verringert oder gar nicht mehr angeboten.

3. ABSATZ: Buffet * Chips * konkret * Mayonnaise * parallel * Pizza * Projekte * reduziert * Thema


HB 6: Höre dir den Minikrimi an! Ordne die orangen Wörter den Erklärungen der Seitenspalte zu!
Tipp Inspektor Carter: Lies den Krimi nach dem Hören noch mindestens zwei Mal!
Susan Brannigan wartete vor dem Rechtsmedizinischen Institut auf Inspektor Carter. „Sie haben einen Toten gefunden?“, fragte sie kühl. „Einen Mann? In der Themse?“„Ja“, antwortete Carter. „Danke, dass Sie hergekommen sind, um ihn zu identifizieren. Es ist jedoch nicht sicher, ob es sich um Ihren Mann handelt.“ Dave Brannigan, Inhaber eines Autoverleihs, war vor drei Wochen gegen Abend aus dem Büro seiner Firma losgefahren und seitdem verschwunden. Carter hatte die Suche eingeleitet – und bisher keine Spur entdeckt. Mit der detaillierten Beschreibung von Brannigans Gesundheitszustand, die ein Jahr vor seinem Verschwinden im Queens Hospital anlässlich einer schweren Gallenblasenoperation erstellt worden war, hatte Carter bei allen Krankenhäusern nachgefragt – ohne Erfolg. „Bitte kommen Sie“, bat Carter. Susan folgte dem Inspektor in den gekachelten Raum der Pathologie. Auf dem Edelstahltisch lag die Leiche des Mannes, die am Morgen am Themseufer angetrieben worden war. Susan schluckte, als sie vor dem mit einem Tuch bedeckten Leichnam stand. Doktor Hellstroem, die Rechtsmedizinerin, kam aus ihrem Büro.



Lies nach dem Hören den Krimi mindestens zwei Mal! Ordne auch die fett gedruckten Wörter den Erklärungen zu!
in allen Einzelheiten
________________________________
Hinweis zur Aufklärung eines Verbrechens
„Die erste Untersuchung habe ich bereits gemacht“, sagte sie leise zu Carter. „Ein Mann, circa 45 Jahre alt, 1,75 m groß, dunkles Haar mit grauen Strähnen, Stirnglatze. Die Haut sehr hell, kaum gebräunt, keine sichtbaren Narben oder Spuren von Eingriffen.“ Doktor Hellstroem schlug das Laken von dem Toten zurück. Susan musterte die Leiche. Ihre Lippen bewegten sich stumm. „Ja“, flüsterte sie schließlich. „Das ist er. Das ist mein Mann.“ „Ich brauche noch den Namen seines Zahnarztes“, bat Hellstroem. „Um einen Zahnabgleich zu machen.“ „Aber warum?“, fragte Susan bitter. „Die Leiche ist ganz klar mein Mann. Eindeutig. Ich erkenne ihn.“ Sie wandte sich an Carter. „Wurde er … ermordet?“ „Bislang gibt es keine Spuren eines Verbrechens“, antwortete Carter. Er ging mit Susan wieder in den Vorraum. „Wie lange wird es dauern, bis mir der Pathologe den Totenschein zuschickt?“, wollte sie wissen. „Brauchen Sie das Dokument so dringend?“, wunderte sich Carter. Sie nickte. „Bisher weigert sich die Lebensversicherung, ohne Vorlage eines Totenscheins zu zahlen.“ Carter schüttelte den Kopf. „Sie bekommen den Totenschein nicht, Mrs. Brannigan. Denn Sie haben gelogen. Das werden wir hundertprozentig sicher feststellen, wenn wir das Gebiss des Toten mit den Zahnunterlagen Ihres Mannes vergleichen. Aber auch so ist ganz klar, dass der Tote in der Pathologie nicht Ihr Mann ist.“
ärztliche Bescheinigung, durch die jemandes Tod offiziell bestätigt wird
weißes Tuch
Abteilung, in der Tote seziert werden
Fluss, der durch London fließt lebloser Körper genau wiedererkennen
Notiere in einem Satz, woran Inspektor Carter erkannte, dass der Tote nicht Dave Brannigan war!
Mark Klug, dessen Vater als Chefinspektor bei der Polizei arbeitet, erklärt: „Mein Vater sagt immer ,Lügen haben kurze Beine, denn das perfekte Verbrechen gibt es nicht.‘“
Für die Aufklärung von Verbrechen sorgen unter anderem auch die Leute, die bei der Spurensicherung arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, an den Tatorten Beweise, wie z. B. Fingerabdrücke, Fußspuren, Haare und Stofffasern zu sichern. Diese Spuren können Hinweise auf Täterinnen oder Täter geben.
Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Er besteht aus Hautlinien, die ein Leben lang unverändert bleiben. Sogar eineiige Zwillinge haben unterschiedliche Abdrücke.
Die Polizei speichert Fingerabdrücken in einer eigenen Datenbank. So können sie weltweit nach ihnen suchen und sie vergleichen.
Ein Fingerabdruck entsteht, weil Fett und Schweiß der Haut an berührten Gegenständen haften bleibt. Sichtbar gemacht wird das, indem man mit einem weichen Pinsel farbiges Pulver über den Abdruck verteilt. Es bleibt nämlich am Fett haften.


Seit 1984 ist es möglich, einen genetischen Fingerabdruck – auch Fingerprinting genannt – zu erstellen. Der genetische Fingerabdruck ist in der DNA (Desoxyribonukleinsäure) und –wie der Fingerabdruck, – bei jedem Menschen einzigartig. DNA befindet sich in jeder einzelnen Zelle und ist in jeder Körperflüssigkeit nachzuweisen. Sie ist ein langes, spiralig gedrehtes Molekül, auf dem unsere Erbinformationen angesiedelt sind.
Beim genetischen Fingerabdruck wird die DNA in einem Labor in unterschiedlich lange Bruchstücke zerlegt. So entsteht eine Art Streifenmuster (DNAProfil), ähnlich einem Strichcode. Kein DNA-Profil gleicht dem anderen.
Auch DNA-Profile werden weltweit in Datenbanken gespeichert, so dass sie mit, an Tatorten gesammelter DNA verglichen werden können. NUR: Hier sind eineiige Zwillinge die Ausnahme! Ihr Profil ist gleich.


Da Mark selbst gerne Kriminalgeschichten schreibt, kennt er viele Fachbegriffe. Du auch? Versuche es! Ordne die Fachbegriffe den Erklärungen zu!
DNAsichergestelltes Beweisstück
Asservatgezielte Suche nach Personen
PathologeBeweggrund für eine Tat
HehlerDesoxyribonukleinsäure
MotivBefragung einer tatverdächtigen Person
FahndungNachweis der Abwesenheit vom Tatort zur Tatzeit
Alibijemand, der gestohlene Sachen weiterverkauft
Meineidfalsche Aussage vor Gericht
RazziaRechtsmediziner
Verhörnach Angaben eines Zeugen gezeichnetes Bild
Phantombildüberraschende Fahndungsaktion der Polizei
Übe dein kriminalistisches Gespür! Lies genau und überlege!
Trage deine Ergebnisse in die Tabelle ein!
1. Ladislaus Knast trägt nicht die weißen Schuhe.
2. Der Gangster mit den blauen Schuhen steht rechts neben dem Verbrecher mit den braunen Schuhen.
3. Tom Bunker ist der Trickbetrüger.
4. Der Dieb heißt Pete Sing-Sing.
5. Tom Bunker steht direkt neben Ladislaus Knast.
6. Die weißen Schuhe gehören nicht Pete Sing-Sing.
7. Der Gangster mit den braunen Schuhen steht nicht neben dem Verbrecher mit den weißen Schuhen.
NAME VERBRECHEN
FARBE derSchuhe
HB 7 + 8: Höre aufmerksam zu und löse den Fall! 3








Gedächtnistraining ist wichtig, besonders wenn du viel Neues lernst. Es ist wie ein Workout, aber für dein Gehirn statt für deine Muskeln. Wenn du regelmäßig übst, zum Beispiel mit Gedächtnisspielen oder Rätseln, kannst du dir besser Dinge merken. Das ist auch hilfreich für die Schule. Du kannst dir schneller Fakten merken und es wird leichter, für Prüfungen zu lernen.
Außerdem kann es sogar Spaß machen, dein Gedächtnis zu trainieren, und du wirst merken, wie du bei Herausforderungen im Alltag, wie beim Erinnern von Namen oder beim Einkaufen, immer besser wirst!
Erstelle Mind Maps, um Informationen visuell zu organisieren. Das hilft, Zusammenhänge besser zu verstehen und sich Dinge leichter zu merken.
Beispiel:
Hautlinien
Sichtbar durch farbiges Pulver
durch Fett und Schweiß an Gegenständen
Fingerabdruck
Bei jedem Menschen anders
Bei jedem Menschen anders im Labor analysiert
DNA- Profil Streifenmuster, ähnlich Strichcode
in Datenbanken gespeichert
Gedächtnisspiele
in Datenbanken gespeichert
DNA in jeder Zelle
Spiele wie Memory, Sudoku oder Kreuzworträtsel können Spaß machen und gleichzeitig dein



Gedächtnispalast
Du stellst dir im Kopf einen vertrauten Weg vor und gehst ihn gedanklich entlang. Dabei stellst du an verschiedenen Punkten deines Weges Informationen ab.
Gehst du dann mit deinen Gedanken den gleichen Weg wieder, erinnerst du dich an jedem Punkt an die dort abgelegte Information.
Anstelle des Weges kannst du auch dein Haus, deine Wohnung oder dein Kinderzimmer nehmen, dir vorstellen und darin deine Informationen an verschiedenen Stellen ablegen.
Dabei denkst du dir kleine Reime oder Geschichten aus, die dabei helfen, dir etwas besser zu merken.
Beispiel: Um sich die Reihenfolge der Himmelsrichtungen besser zu merken, gibt es folgenden Satz:

Nie ohne Seife waschen. R N O S W
Um sich die Notrufnummer gut zu merken und nicht zu verwechseln, ordne sie nach dem Alphabet, denn auch die Nummern sind aufsteigend:
Hier noch eine kleine Rechtschreibeselsbrücke aus „alten Zeiten“:

Wer „nämlich“ mit „h“ schreibt, ist „dämlich“.
Hast du für etwas eine Eselsbrücke? Schreib oder male sie hier auf!

Gaunersprache – Nur eine Bedeutung ist richtig. Kreuze an!
der Gauner der Knast
eine weiße Weste haben
Leine ziehen ein krummes Ding drehen
Schmiere stehen jemanden im Auge behalten den Braten riechen eingelocht werden hochgehen
verpfeifen
hinter Schloss und Riegel bringen die Knarre der Kies

eine heiße Spur haben die Beute etwas unter die Lupe nehmen beschatten o das Geld o das Gefängnis o sauber angezogen sein o mithelfen o ein Verbrechen begehen o jemanden durchsuchen o jemanden fixieren o einen Verdacht haben o jemanden verraten o Verfolgungsjagd aufnehmen o jemanden verraten o den Täter einsperren o der Fingerabdruck o der/das Laptop o Angst bekommen o das Diebesgut o schlecht lesen können o entkommen lassen o der Zeuge o das Wachzimmer o unschuldig sein o abhauen o einen Meineid leisten o aufpassen, um jemanden zu warnen o jemanden verfolgen o Täter frei lassen o ins Gefängnis gesperrt werden o mit Helikopter aufsteigen o eine falsche Aussage machen o den Täter überfahren o die Pistole o die Juwelen o mit dem Fluchtauto abhauen o der Tresor o etwas genauer prüfen o einen Schatten werfen o der Betrüger o der Verbrecher o gefährlich wirken o ablegen o seine Unschuld beteuern o Juwelier ausrauben o jemanden beobachten o Hunger haben o Golfball einlochen o festgenommen werden o ein Lied pfeifen o den Täter überführen o der Fluchtwagen o das Geld o einen konkreten Hinweis untersuchen o die Patrone Vergrößerungsglas einsetzen o jemanden unauffällig beobachten

Alles Krimi: Nur eine Schreibweise ist richtig. Triff die richtige Entscheidung!
krieminel
Komisar
alermieren
Motiv
Alibie
Hinweiß
Details
Dedektiv
Schpur
Verdächtige
bedeuern
veruhrteilen
Straffe
Inspecktor
Däter
Asisstent
Verbrechen
Politzei
kriminell
Kommisar
alamieren
Motief
Aliebi
Hienweis
Deteils
Detektiv
Spuhr
Verdechtige
beteuern
ferurteilen
Schtrafe
Inspektor Täter Asistent
Verbrächen
Poliezei
krimminel
Kommissar
allermieren
Motif
Allibi
Hinweis
Dedeils
Detecktiv
Spur
Verdechtigte
bedäuern
verurdeilen
Strafe
Inschpektor
Tähter
Assistent
Ferbrechen
Polizei
kriminel
Kommisa
alarmieren
Motiev
Alibi
Hinweiss
Teteils
Detektif
Spurr
Verdächdige
betäuern
verurteilen
Strahfe
Insbektor
Dähter
Assisdent
Ferbrächen
Polietzei
Suche dir drei Beispielwörter aus der Aufgabe 1 und erkläre anhand dir bekannter Rechtschreibregeln, warum du dich für die jeweilige Schreibweise entschieden hast!
tod oder tot?
„TOD“ finden wir in Zusammensetzungen mit Adjektiven.
Die Silbe „tod“ finden wir auch im Adjektiv tödlich

Beispiele: todkrank, todmüde
Ergänze selbstständig jeweils zwei Beispiele!
Setze „d“ oder „t“ richtig ein!
Der Tod kam überraschend.
Das Opfer ist seit zwei Stunden tot. Die Tote ist 65 Jahre alt.
„TOT“ finden wir häufig in Zusammensetzungen mit Verben.

Beispiele: totlachen, totschweigen
Achtung: totenstill, totenblass
Hier wird nicht das Adjektiv verstärkt, sondern der Zustand der Toten als Beschreibung verwendet
D so still wie Tote, so blass wie Tote
Es lebte einmal ein Mann, der den ganzen Tag nichts anderes tat, als zu weinen und auf seinen To__ zu warten. Er war schon so lange to__traurig, dass er gar nicht mehr wusste, warum. So vergingen Tage, Wochen, ja Monate und um den to__ernsten Mann bildete sich ein Tränenmeer. Der Mann war to__sicher, dass er nie wieder glücklich werden würde. Er war so mit seinem Selbstmitleid beschäftigt, dass er gar nicht merkte, wie laut er den ganzen Tag und die ganze Nacht schluchzte. Die Nachbarn begannen sich to__zuärgern, weil sie wegen des to__unglücklichen Mannes nicht mehr schlafen konnten und schon to__müde waren. Das Gejammere wurde für alle zur To__esqual und der Mann zum To__feind eines jeden Dorfbewohners.


Schreibt man mich nun mit „d“ oder „t“?
Eines Tages kam ein to__esmutiger Wanderer des Weges, der dem Übel ein Ende setzen wollte. Der Fremde wurde vom Gemeinderat beauftragt, der To__esfurcht zu widerstehen und sie ein für alle Mal von dem Höllenlärm zu befreien. Der Wanderer machte sich auf den Weg. Keiner konnte genau sagen, was sich dort abspielte, aber plötzlich war es to__enstill. Als ein lautes Gelächter zu hören war, mussten sich die Dorfbewohner ihre Ohren zuhalten und da kam der Fremde wieder – alleine.
Sie wollten wissen, was da passiert sei und der Wanderer meinte: „Ich habe dem einsamen Mann nur einen Witz erzählt, da hat sich der arme Kerl to__gelacht.“
ent- oder end-?

Die Vorsilbe ent- steht zu Beginn von Verben.
Beispiele: entkommen, entlaufen, entrinnen usw.

Die Nachsilbe -end wird für das Partizip I verwendet.
Beispiele: weinend, laufend, fallend usw.

Die Silbe End-/end- findet man bei Wörtern, die mit dem Nomen das Ende verwandt sind.
Beispiele: Endsumme, Endziel, Endspiel, endgültig usw.
Fehlerwörter – Kreise die falsch geschriebenen Wörter ein und übertrage alle Beispiele in Form einer Tabelle richtig in dein Heft! Achte dabei auf die Groß- und Kleinschreibung!
ENTGÜLTIG – ENTSICHERN – KÄMPFENT – ENDERGEBNIS – ENDLICH – ENDFÜHREN – ENTSPRINGEN
– SUCHEND – ENDDECKEN – MACHEND – ENTSORGEN – ENDLOS – ENDLASSEN – ENDFERNEN –BEENDEN – ENDSTATION – DRÜCKENT – ENDSETZEN – ENDSCHEIDUNG – ENDEN
Vorsilbe ent-
(an)statt
Nachsilbe -end Silbe End-/end-
der Staat = ein Land R der Staat Österreich die Stadt = eine Siedlung R die Stadt Wien die Statt = ein Ort, ein Platz, eine Stelle R die Werkstatt (an)statt = anstelle von R Anstatt zu kommen, bist du zu Hause geblieben.
Bilde mit jedem Wort drei Sätze und schreib sie in dein Heft!
-d- und -dt- in
Suche im Wörterbuch oder im Duden online drei weitere Beispiele und schreib sie auf!
VER/WENDEN: wandte sich ... um * gewandt * Verwandte * verwendeten
SENDEN: sandte * Gesandte BE/LADEN: lädt ... ein * belädt
seid oder seit?

HB 9: Übe mit dem Hördiktat die richtige Schreibweise!


ZUR WIEDERHOLUNG:
seit = eine Zeitangabe seid = 2. Pers. Pl. von „sein“


Übertrage die Sätze in dein Heft! Achte auf die Groß und Kleinschreibung!

Nach der anstrengenden Reise waren wir müde. * In einigen Ländern der Welt gibt es noch immer die esstrafe. * Wir hatten einen esfall zu beklagen. * Auf einer Piratenflagge befindet sich ein enkopf. * Ich hatte angst. Ich erschrak und wurde bleich. * Plötzlich wurde es enstill in der Klasse.






Korrigiere alle falsch geschriebenen Wörter! Kontrolliere mit dem Wörterbuch oder Duden online!

seid Jahren – im Endeffekt – entbehren – stadtfinden – überlädt – endsagen – beenten – abgewant – enden – brüllend – entgültig – laufende Ermittlungen – ihr seit –entnehmen – die Lernwerkstatt – suchend – endfernen – die Hauptstadt – verwandt –entfliehen – telefonierendt – verlädt – verrät – füllent – entführen
Lies den Text und markiere die für dich schwierigen Wörter! Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Diktiert euch den Text gegenseitig und kontrolliert im Anschluss!
Die Arbeit bei der staatlichen Polizei ist abwechslungsreich, doch ganz so rasant und todesmutig wie in den Fernsehserien geht es nicht zu. Nicht jeder Fall hat mit Mord oder Totschlag zu tun. Oftmals werden von Polizeibeamten Unfälle aufgenommen. Dabei geht es entweder um harmlose Blechschäden oder um Fahrerflucht. Doch oft fährt leider buchstäblich der Tod mit. Findet ein Verkehrsunfall in der Stadt oder auf dem Land mit tödlichem Ausgang statt, ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.
Ich kann…
Schließlich müssen bei Todesfällen die Angehörigen benachrichtigt werden. Der Tod ist immer endgültig – tot ist tot. Aber nicht immer hat die Polizeiarbeit einen todsicheren Ausgang. Bei Einbrüchen wird genaues Arbeiten verlangt, es werden zum Beispiel Proben entnommen und Spuren gesichert. Seit jedoch die DNA als Beweismittel vor Gericht zugelassen wird, können Verbrecher leichter hinter Gitter gebracht werden.



…zwischen der Schreibweise TOT und TOD unterscheiden. (1)
…ent-, -end, End-/end-, Wörter mit dt, Staat, Stadt, statt/(an)statt: Ich erkenne die Fehlerwörter. (2)
…ein Partnerdiktat durchführen. (3)
Schreiben wie ein Kriminalschriftsteller
Um wie eine Krimiautorin oder ein Krimiautor spannend schreiben zu können, ist es wichtig, verschiedene Fachausdrücke, treffende Verben und Adjektive zu kennen. In den folgenden Aufgaben findest du eine Auswahl solcher Begriffe, die beim Verfassen einer Kriminalgeschichte nicht fehlen sollten.
2 1
Finde die Synonyme – Welche Verben haben dieselbe Bedeutung? Male die Rahmen der Kästchen mit gleicher Farbe aus!
sich ergeben verfolgen fliehen beobachten inhaftieren flüchten
Meine Worte sind meine Waffen!

ertappen einschüchtern einsperren erwischen verwüsten beschatten sich stellen festnehmen jagen bedrohen
Über welche Fähigkeiten sollte ein guter Ermittler oder eine gute Ermittlerin verfügen? Schreibe Erklärungen zu diesen Fähigkeiten und finde selbst ein Beispiel!
FÄHIGKEIT
Spürsinn
Kombinationsgabe
(Wie zeigt sich diese Fähigkeit?) verhaften zerstören
ERKLÄRUNG
gute Menschenkenntnis
Adjektive in Krimis
Krimis wimmeln nur so von Adjektiven. Denn wer bei seinen Lesern oder Leserinnen Spannung erzeugen will, schreibt so, dass durch das Geschriebene genaue Bilder im Kopf entstehen können.
Lies den Text! Markiere alle Adjektive! Zähle sie!
Der Entführer, eine grausame und finstere Gestalt, zog dem verängstigten Mann einen groben Baumwollsack über seinen schmalen Kopf, gab ihm eine zerrissene, schmutzige Hose zum Anziehen und hängte ihm einen pechschwarzen Mantel um. Verzweifelt bettelte das Entführungsopfer um Gnade, doch der Täter kannte kein Mitleid. Skrupellos schlug er dem Mann mit einem dicken Knüppel auf den Kopf, bewusstlos sackte das wehrlose Opfer zu Boden. In diesen vier Sätzen finden sich _____ Adjektive.
Lies den Text von Ü3 ohne Adjektive! Teile der Klasse mit, was dir auffällt!
Von hinten nach vorne – Wenn du von rechts zu lesen beginnst, ergeben sich sinnvolle Adjektive. Schreibe sie auf!
esöb ___________________treiniffar ____________________________
aulhcs ___________________ gidludegnu ____________________________
leknud ___________________ hcsiuartssim ____________________________ dnlessef ___________________ llovsneuartrev____________________________
Traue keinem Adjektiv – In jeder Zeile findest du ein Adjektiv, das man vorrangig nicht mit einer Kriminalgeschichte verbindet. Streiche es durch! Hinweis: Selbstverständlich dürfen jene Adjektive in deiner Kriminalgeschichte vorkommen.
lustigspannendschnellwiderlichunglaublich dummunfassbarromantischtypischaufregend interessantmächtiglangweiligschrecklichunheimlich seltsamfantastischängstlichleisedüster riskantliebenswertinstinktivkostbarspektakulär
Finde das Gegenteil! Suche zu den folgenden Adjektiven ein passendes Gegenteil und bilde Gegensatzpaare!
schuldig _________________________nervös ________________________
lebendig _________________________ einfach________________________
ängstlich
Bevor du deinen Krimi zu schreiben beginnst: Überlegungen für deinen Stichwortzettel

Beginne ich meine Geschichte mit dem Verbrechen?



Welche Motive gibt es?



Welche Hinweise sollen zur Täterin oder dem Täter führen?



Gibt es in meiner Geschichte eine Täterin, einen Täter oder sollen es mehrere Personen sein?















Kommt zuerst die Kommissarin oder der Kommissar an den Tatort?



Wann werden die Zeuginnen oder Zeugen befragt?




Welches Ende soll mein Krimi haben?



1. Ein Stichwortzettel erleichtert das anschließende Schreiben.
2. Eine Kriminalgeschichte wird im Präteritum geschrieben.
3. Es gibt zwei Erzählperspektiven:
Ich-Perspektive: Er-Perspektive: Langsam näherte ich mich... Inspektor Klug näherte sich...
4. Gliederung:
Einleitung R Personen und Ort
Hauptteil R Höhepunkt


Schluss R Auflösung oder offenes Ende (Leserinnen und Leser überlegen selbst, wer die Täterin oder der Täter sein könnte oder ob es vielleicht gar kein Verbrechen war)
5. Durch Adjektive wird die Geschichte genauer und bildlicher.
6. Kurze Sätze erhöhen die Spannung. Es war totemstill. Er blickte sich um.
7. Direkte Reden machen die Geschichte lebendiger und lassen sie „wirklich“ erscheinen.
8. Der Titel der Geschichte (Überschrift) soll spannend klingen, aber nicht zu viel verraten

Die Beschreibung des Bildes ist nicht besonders gelungen. Du kannst es bestimmt besser.
Beschreibe in vollständigen Sätzen, was du siehst!


Das Zimmer war verwüstet. Besser:
Lies die spannenden Satzanfänge und vervollständige die Sätze!

Morgendämmerung brach herein, als...
Plötzlich verstummte das Flüstern und...
Ein Schrei zerriss die...

Vervollständige die Satzanfänge in deinem Heft!
Die Polizistin bat die Zeugin:
Fußstapfen führten in …
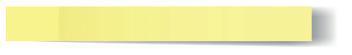

Dichter Rauch umhüllte …

Das Tagebuch offenbarte schließlich … Der Kommissar betrachtete nachdenklich …
Wähle einen der Satzanfänge von Ü9 oder Ü10! Überlege dir zu diesem Satz eine Geschichte und schreib das Wichtigste auf den Stichwortzettel!
Ort der Handlung:
Das Verbrechen:
Das Opfer:
Die Beweise:
Das Motiv:
Der Ermittler/die Ermittlerin:
Der Verdächtige/ die Verdächtige:
Der Täter/ die Täterin:



Schreibe mit deinen Stichwörtern von Ü11 eine Kriminalgeschichte in dein Heft! Überprüfe sie im Anschluss mit der Checkliste!
Die Geschichte ist im Präteritum geschrieben.
Ich habe eine der zwei Erzählperspektiven (Ich-Perspektive, Er-Perspektive) gewählt.
Es gibt eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss.
Ich habe vorab einen Stichwortzettel gemacht.
In meiner Geschichte wurden viele Adjektive verwendet.
Auch kurze Sätze wurden eingebaut.
Im Text kommen direkte Reden vor.
Meine Überschrift klingt spannend und macht neugierig.
Ich habe meine Geschichte 3-mal durchgelesen. R Inhalt, Rechtschreibung, Grammatik
Ich habe ein Wörterbuch oder Duden online verwendet.
Notiere zu jedem Bild passende Schlüsselwörter! Schreib deine Kriminalgeschichte zu den Bildern am Computer! Überprüfe anhand der Checkliste!








Entscheide dich für eine der beiden Reizwortkisten! Überlege dir eine Geschichte und schreib einen Stichwortzettel in dein Heft! Verfasse anhand deiner Stichwörter eine Kriminalgeschichte! Tausche dein Heft mit einer Partnerin oder einem Partner und überprüfe die Geschichte mit Hilfe der Checkliste!
Kasten, Konto, Knarre, Koffer, Kunst, Krach, kochen, kitzeln, kratzen, kriechen, kaufen, kalt, komisch, kostbar, kaltschnäuzig, kaltblütig, kampflos

Hund, Hose, Hilfe, Haustür, Hof, Hand, halten, heben, hüpfen, husten, holen, hart, hitzig, heiß, höhnisch, höllisch, höflich
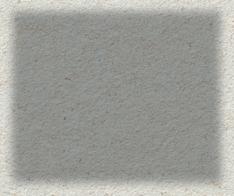
WICHTIG: In deiner Geschichte muss jedes Reizwort der Kiste zumindest 1x vorkommen!


Kriminaltango
Lies die Einleitung der Kriminalgeschichte! Notiere Stichwörter zu Hauptteil und Schluss! Schreibe die vollständige Geschichte in dein Heft! Kontrolliere mit der Checkliste!
Als die Turmuhr bereits Mitternacht schlug, waren die Straßen menschenleer. Das matte Licht der nur wenigen Straßenlaternen warf fahle Kreise auf das Kopfsteinpflaster. Tiefschwarze Nacht hüllte die Häuser der Altstadt ein, der Mond war von dichten Wolken bedeckt. Ein älterer Mann hastete durch die dunklen Straßen des historischen Stadtkerns. Es nieselte leicht und der Mann hatte den Mantelkragen hoch aufgeschlagen. Da löste sich ein Schatten aus einem dunklen Hausflur...

Hauptteil:
Schluss:



Strafmündig – Was heißt das?
Was vermutest du? Welche Straftaten werden vor Gericht landen? Kreuze an!
1
16-Jähriger blendete
Flugzeug mit einem
Laserpointer
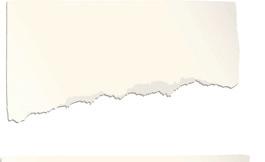
2

Parkbänke mutwillig zerstört: 11-Jährige als Randaliererin


13-Jähriger als Seriendieb und Brandstifter ausgeforscht


Schülerin einer Grazer Berufsschule wurde zum Langfinger

Lies dieses Gespräch zwischen unserer Reporterin Kathi und dem Polizisten Rosenhofer, der regelmäßig Schulen zur Gewaltprävention besucht!
Ab wann sind Jugendliche strafbar?
Ab dem 14. Geburtstag sind Jugendliche deliktfähig und strafmündig. Das heißt, sie müssen für ihre strafbaren Handlungen die Verantwortung übernehmen.


deliktfähig: fähig, das Unerlaubte einer Handlung einzusehen
Jugendliche unter 14 Jahren können daher keine Anzeige bekommen und nicht verurteilt werden. Es können aber Erziehungsmaßnahmen gesetzt werden (z. B. Beratung, Belehrung, Unterbringung außerhalb der Familie).
Was passiert, wenn 14-Jährige straffällig werden?
Das Gesetz behandelt jugendliche Straftäter nicht gleich wie Erwachsene. Deshalb gilt für minderjährige Jugendliche das Jugendstrafrecht. Sie werden zur Verantwortung gezogen und sind schadenersatzpflichtig.
Ein Strafverfahren beginnt mit der Einvernahme bei der Polizei. Dabei werden dem Tatverdächtigen verschiedene Fragen gestellt. Meist kommt der Termin für die Einvernahme mit der Post. Wer zu diesem Termin nicht erscheint, wird von der Polizei abgeholt und zur Einvernahme gebracht.
Wie kann ich mir so eine Einvernahme vorstellen?
Bei der Einvernahme muss der Tatverdächtige nicht aussagen. Außerdem kann er einen Anwalt oder eine Anwältin hinzuziehen. Als Zeuge oder Zeugin ist das anders. Hier muss eine Aussage gemacht werden, außer man würde damit ein Familienmitglied einer Straftat beschuldigen. In diesem Fall kann man auch die Aussage verweigern. Wurde eine Aussage gemacht, wird ein Vernehmungsprotokoll erstellt.
Was passiert nach der Einvernahme?
Dann leitet die Polizei alle Unterlagen an die Staatsanwaltschaft weiter. Diese entscheidet, ob ein Verfahren eingestellt wird, es zu einer Gerichtsverhandlung kommt oder anstelle eines Strafverfahrens andere Maßnahmen (z. B. Sozialstunden, Geldbetrag) gesetzt werden.

Überprüfe deine Einschätzung von Ü1, nachdem du all diese Informationen bekommen hast!
Das Passiv
VORGANGSPASSIV (VP)
Zur Wiederholung: Hilfsverb werden + Partizip II
Beispiel: Die Tatwaffe wird auf Fingerabdrücke untersucht.
Das Vorgangspassiv stellt den Vorgang, die Handlung oder das Geschehen in den Vordergrund.
ZUSTANDSPASSIV (ZP)
Neu: Hilfsverb sein + Partizip II
Beispiel: Die Tatwaffe ist auf Fingerabdrücke untersucht
Das Zustandspassiv zeigt einen erreichten Zustand, also ein abgeschlossenes Ereignis
Die Passivformen in allen Zeiten findest du im Anhang auf S. 174.
Sieh dir die Beispiele an und beschreibe unter den Bildern den Unterschied! Ordne die Begriffe ZUSTANDSPASSIV und VORGANGSPASSIV richtig, als Überschrift, zu!



Der Täter wird festgenommen. Der Täter ist festgenommen.
Bilde Sätze, die im Zustandspassiv und im Präsens stehen! Schreib sie in dein Heft!

Einbrecher stellen * Täter verhaften * Dieb ertappen * Nachbarn warnen * Mörder verurteilen * Bande schnappen * Fahrrad stehlen * Verdächtigen verhören * Frau verletzen * Verbrechen klären
Bestimme die Passivform der Sätze (VP oder ZP)! Dann schreib die Sätze in der jeweils anderen Passivform in dein Heft!
______Der reiche Unternehmer wird aus seiner Villa entführt. * _____Das Auto für die Flucht ist vom Parkplatz gestohlen. * _____Die Polizei wird eingeschaltet. * _____Die Zeugen sind befragt. * _____Die Lösegeldsumme wird telefonisch übermittelt. * _____Der Treffpunkt der Übergabe ist ausgemacht. * _____Die Geldscheine werden markiert. * _____Das Geld wird übergeben. * _____Die Geisel ist gerettet.
Wähle einen Fall aus und schreibe dazu eine spannende Kriminalgeschichte in dein Heft! Mach dir Notizen auf einem Stichwortzettel! Überprüfe anhand der Checkliste von S.95!
VerbrechenOpferTäterTatzeit/TatortVerdächtige
Fall 1

Fall 2


Mord aus Rache
Dr. Lukas Pollak (55) Rechtsanwalt sehr wohlhabend
anonymer Erpresserbrief
Diebstahl eines wertvollen Gemäldes
Frau Gertrude Maier (40) Mathematikprofessorin
Hubertus Hohenegger Millionär und Privatier
22:00 in der Kanzlei des Opfers um 7:45 im Lehrerzimmer 23:00 in der Villa des Millionärs
1. Susanne Mangold; Sekretärin des Opfers
2. Gerhard Schreiner; Klient, dessen Fall das Opfer verloren hat
1. Schüler/innen aus der 4 C
2. Harald Niedermeyer; geschiedener Mann
1. Privatsekretär Max Möller
2. das „Phantom“
Welche zwei Aussagen sind richtig? Lies das Interview auf S. 109 nochmals, dann kreise die Buchstaben ein!
A Jugendliche Straftäter werden genauso verurteilt, als wären sie Erwachsene.
B Ein Zeuge einer Straftat kann eine Aussage bei der Polizei nicht verweigern, außer er ist mit dem Beschuldigten verwandt.
C Mit dem 14. Geburtstag haben Jugendliche laut Gesetz die Reife, das Unrecht ihrer Taten einzusehen.
D Der Termin für die Einvernahme bei der Polizei kommt immer mit der Post.
E Straffällige minderjährige Jugendliche sind nicht schadenersatzpflichtig.
F Ab dem 14. Lebensjahr führt eine Straftat zur Unterbringung außerhalb der Familie.
Fall 3 1 2 3
Zeichne, was du siehst! Schreibe dazu eine spannende Geschichte in dein Heft!
Überprüfe mit der Checkliste von S. 107!
Es ist mitten in der Nacht. Du bist alleine unterwegs, als du plötzlich ein seltsames Geräusch hörst.
Schnell schaltest du deine Taschenlampe ein und...

Das Vorgangs- und Zustandspassiv – Ergänze den Merktext!
Das Vorgangspassiv wird mit dem Hilfsverb und dem Partizip II. gebildet.
Dabei steht der Vorgang, die _____________________ oder das Geschehen im Vordergrund.
Das Zustandspassiv wird mit dem Hilfsverb __________ und dem _____________________ gebildet. Es beschreibt eine bereits abgeschlossene Handlung.
5
Bilde in deinem Heft mit den Wortgruppen jeweils Sätze im VP und im ZP!
Beispiel: den Täter festnehmen (Präteritum)
VP: Der Täter wurde festgenommen. ZP: Der Täter war festgenommen.
den Inspektor benachrichtigen (Perfekt) * die Beweismittel sicher verwahren (Präsens) * die Polizei rufen (Präteritum) * das Urteil verkünden (Futur) * die Journalisten informieren (Präsens) * einen Haftbefehl ausstellen (Perfekt) * die Handschellen anlegen (Futur) * den Tatort reinigen (Plusquamperfekt)
Die Tabelle im Anhang auf der S. 158 hilft
6
Aktiv oder passiv? – Unterstreiche die Prädikate und kreuze richtig an!

AktivPassiv
Die Täter wurden auf frischer Tat ertappt. o o
Die Polizisten haben sie noch am Tatort festgenommen. o o Nun werden die Tatverdächtigen vernommen. o o Beide haben die Tat gestanden. o o
Jetzt warten die Geständigen auf ihren Prozess. o o Sie werden wegen Raubes angeklagt. o o Der Richter verurteilt die beiden Straftäter zu sieben Jahren Haft. o o
Ich kann…
…nach einer Angabe eine Kriminalgeschichte schreiben. (1 + 2)
…Aussagen aus einem Text ableiten. (3)
Ich weiß über die Bildung und die Verwendung des Vorgangs- und Zustandspassivs Bescheid. (4)
…zwischen Aktiv und Passiv unterscheiden. (5)
…das Vorgangs- und Zustandspassiv bilden. (6)



„Theo Boone und der unsichtbare Zeuge“ von John Grisham
INHALT: Verbrecher aufgepasst! Theo Boone, Anwaltssohn mit ausgeprägtem Sinn für Recht und Gerechtigkeit, löst die schwierigsten Fälle – und er ist dreizehn! Als in seinem Heimatstädtchen Strattenburg ein aufsehenerregendes Verbrechen geschieht, ist Theo wie elektrisiert – nun endlich kann er aus nächster Nähe einen großen Prozess verfolgen. Es scheint das perfekte Verbrechen zu sein – oder nicht?

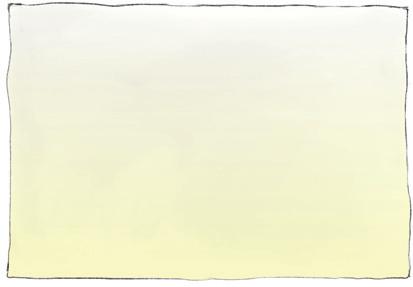
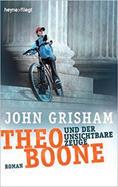

„RETRO – Geh nicht online“ von Jarrod Shustermann und Sofia Lapuente INHALT: Als Wiedergutmachung für ihr Cybermobbing- Vergehen meldet sich Luna für die RETRO –Challenge: ein Jahr ohne Smartphone, Internet und Social Media.
Zuerst ist alles gut, die RETROS feiern das Leben, doch dann verschwinden plötzlich die ersten.
„Ein MORDs-Team: Der lautlose Schrei“ von Andreas Suchanek
KOMMENTAR: Moritz (13 J.)
Der erste Band der MORDs-Team Reihe legt spannend, actiongeladen und geheimnisvoll einen klasse Serienstart hin. Schon von der ersten Seite an geht es fesselnd los und ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Mason, Olivia, Randy und Danielle sind vier Jugendliche, die dem Geheimnis um den Mord an der Schülerin Marietta King auf der Spur sind. Sie beginnen zu ermitteln, um die eine Frage zu klären, die alles überschattet: Wer tötete vor dreißig Jahren Marietta King?

„Young Sherlock Holmes: Der Tod liegt in der Luft“ von Andrew Lane
AUSZUG: Sherlock musterte die Gemälde. Obwohl er sie genauestens untersucht hatte, war er sich immer noch nicht sicher. ...

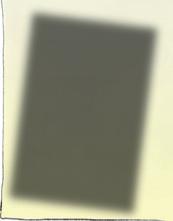
„Dieses hier ist nicht besonders gut gemalt“, probierte er sein Glück.
„Die Perspektive ist völlig verzerrt und die Anatomie stimmt nicht. Ist das die Fälschung?“
FORTSETZUNG folgt: Wie es weitergeht, erfährst du im Leseteil auf S. 49.

„Herr der Diebe“ von Cornelia Funke









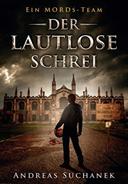


„Schön, schöner, tot!“ von Roxanne St. Claire KOMMENTAR: Lili (14 J.) Tolles Buch, das ich in drei Tagen fertiggelesen habe. Es geht um ein Mädchen namens Kenzie, das auf der Liste der zehn heißesten Mädchen der Schule steht. Doch dann passieren mysteriöse Unfälle. Das erste Mädchen der Liste stirbt, kurz darauf Nummer 2. Alles nur Zufälle? Und die Uhr tickt, denn Kenzie ist die Fünfte auf der Liste!
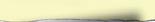
AUSZUG: „Spektakulärer Einbruch im Palazzo Contarini“, las Riccio stockend vor.
„Wertvoller Schmuck und diverse Kunstgegenstände geraubt. Keine Spur von den Tätern!“ Erstaunt hob er den Kopf. „Contarini? Wir haben doch den Palazzo Pisani beobachtet.“
FORTSETZUNG: Diese findest du im Leseteil auf S. 49.








„Löcher: Die Geheimnisse von Green Lake“ von Louis Sachar INHALT: Der Roman zeigt auf, welche Konsequenzen eine Straftat für Jugendliche in den USA (Strafcamps) haben kann. Schon der Anfang ist unglaublich: Stanley Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke durch, als ihm die riesigen, übelriechenden Turnschuhe eines berühmten Baseballspielers auf den Kopf fallen. Und weil sein Vater an einem bahnbrechenden Recycling-Verfahren mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält Stanley die muffelnden Treter für ein Zeichen und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon nach dem Dieb sucht. Er muss für 18 Monate ins Camp Green Lake. FORTSETZUNG folgt: Was er dort erlebt, erfährst du im Leseteil auf S. 50.
„A Good Girl's Guide to Murder“ von Holly Jackson KOMMENTAR: Lara (13. J.)
Ich fand das Buch spannend und aufregend. Pip ist eine mutige Ermittlerin, die die Wahrheit hinter einem alten Mordfall aufdeckt. Dabei deckt sie dunkle Geheimnisse auf und gerät selbst in Gefahr. Das Buch ist voller Überraschungen und hält einen bis zum Ende in Atem.

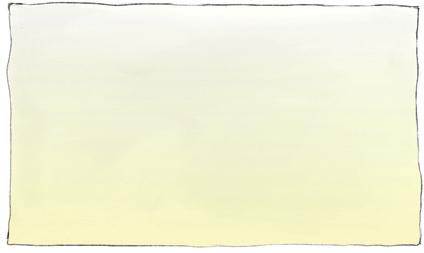

„Eine Leiche zum Tee“ von Aleandra Fischer-Hunold
INHALT: Das Buch handelt von der 13-jährigen Amy, die mit ihrer Großtante Clarissa in Ashford-on-Sea lebt. Bei einem Dorffest stirbt Amys Klavierlehrerin nach dem Verzehr von Amys Torte. Amy und Clarissa ermitteln als Hobbydetektive, um den wahren Mörder zu finden und Amys Schwarm Finn zu entlasten.






James Bond. Stille Wasser sind tödlich von Charlie Higson AUSZUG: Er spähte ins Wasser. Unter der Oberfläche waren hunderte. Es war eine zusammengeballte, zuckende Masse, ein wirres Medusenhaupt. Aale. ... Seine verletzte Hand tauchte ins Wasser und sofort zerrten gierige Mäuler an dem blutigen Taschentuch und rissen es in Fetzen. Panik erfasste den Jungen. Er versuchte mit großen Sprüngen ans Ufer zu gelangen, doch er rutschte aus. ... „Hilfe!“ Dann sank er wieder in die Tiefe.

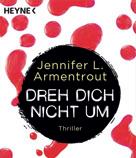






„Bist du vielleicht der Neue?“, fragte er. „Könnte durchaus sein“, antwortete James.
„Heißt du James Bond?“ „Ja.“
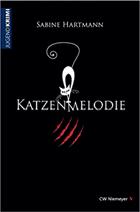


Wähle ein Buch aus und erstelle mit Hilfe des Internets einen Klappentext!

Freundschaft – Was wahre Freunde ausmacht
Was bedeutet Freundschaft für dich? Fülle die Sprechblasen mit deinen Gedanken!

2
Erstelle in deinem Heft oder am PC einen Steckbrief über deine beste Freundin/ deinen besten Freund!
Mein (e) BFF (Best Friend Forever)
Name:
Alter:
Look:
Was er/sie voll mag:
Was er / sie nicht leiden kann:
Besondere Skills:


Geburtstag:
Wohnort:
Warum wir BFFs sind:
Unser Ding: Erinnerung fürs Leben:
Lies diese Geschichte über Freundschaft!
In meiner Jugend war das Fußballspielen mein Lebensinhalt. Ich verbrachte jede freie Stunde mit meinen Kumpels auf dem Bolzplatz. Fast täglich sah ich am Rande des Platzes einen Jungen, der alleine mit seinem Ball vor sich hin kickte. Raphael war neu an der Schule und ging in meine Parallelklasse. Ich mochte ihn nicht ansprechen. Was soll man auch zu einem Jungen sagen, der keine Arme hat?
Bald darauf wurde ich zum neuen Kapitän der Schulmannschaft gewählt und war mächtig stolz! Ich war ein richtig cooler Typ! Unter meiner Führung siegten wir fast immer und die Mädchen scharten sich reihenweise um mich!
Am Ende der Saison hatten wir ein äußerst wichtiges Spiel, von dem unser Aufstieg in die nächste Liga abhing! Doch an jenem ereignisreichen Tag mussten wir ohne Austauschspieler ins Spiel gehen, da ein schlimmer Virus die Hälfte meiner Mannschaft lahmgelegt hatte. Die Gegner sahen darin ihre Chance und setzten noch dazu unseren besten Spieler außer Gefecht. Ich schaute hilflos in die Zuschauermenge und entdeckte dort Raphael.
Ich hatte nichts mehr zu verlieren und so rief ich ihm zu: „Hey, Raphael, kannst du uns aushelfen?“ Er warf sich unser Trikot über und kam zu uns auf das Spielfeld. Lag es daran, dass unsere Gegner von dem Erscheinungsbild unseres neuen Spielers irritiert waren oder an seiner genialen Spieltechnik? Ich weiß es nicht. Wichtig war, dass wir gewonnen haben. Und nicht einfach nur gewonnen, sondern mit einem sensationellen Ergebnis von 10:1!!!
Nach dem Spiel nahm ich Raphael in die Arme, um mich bei ihm zu bedanken. Niemals werde ich diese
Umarmung vergessen. Ich lernte, dass Berührungen nicht von Körperteilen kommen, sondern von Herzen! Von diesem Tag an entwickelte sich eine Freundschaft zwischen uns. Wir gingen gemeinsam zum Fußball, ins Kino und auf Partys. Raphael blühte immer mehr auf. Er wurde zum besten Spieler unserer Mannschaft.
Zum Schulabschluss sollte Raphael als Schülersprecher eine Rede halten. Ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen. Auf der Bühne vor Hunderten von Menschen zu sprechen, das war echt nicht mein Ding.
Raphael bestieg sichtlich aufgeregt das Podium. Er begann seine Rede und holte weit aus. Er erklärte den Zuhörern, dass er bereits ohne Arme auf die Welt gekommen sei. Seine Eltern hatten ihn jedoch nie seinen körperlichen Mangel spüren lassen und in seinem Heimatdorf hatte er seinen festen Platz in der Gemeinschaft. Als jedoch seine Eltern bei einem tragischen Autounfall ums Leben kamen, musste er zu seiner Großmutter ziehen. Ganz alleine in der fremden Stadt, ohne Freunde, kam er sich ziemlich verloren vor. Er schluckte kurz und sprach weiter: „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich sah keinerlei Sinn mehr in meinem Dasein und überlegte schon, mir das Leben zu nehmen. Doch das konnte ich meiner Großmutter nicht antun, die sich so rührend um mich kümmerte und versuchte, mir Vater und Mutter zu ersetzen.“
Im Publikum vermeinte man, eine Nadel fallen zu hören. Raphael lächelte mir dankbar zu und fuhr fort: „Die Lebensfreude kehrte an jenem Tag wieder zu mir zurück, an dem mich mein bester Freund auf das Fußballfeld rief.“

Lies die Fragen! Schreib auf einem Blatt Papier deine Antworten und Gedanken dazu auf!
a) Aus welcher Perspektive wird diese Geschichte erzählt?
b) Warum wollte der Erzähler Raphael in der Schule nicht ansprechen?
c) Was war der wahre Grund, weshalb der Mannschaftskapitän ihn ins Spiel holte?
d) Welche zwei Erkenntnisse hatte der Erzähler nach dem Spiel?
e) Wie gingen Raphaels Eltern und sein Umfeld mit seiner Behinderung um?
f) Mit welchen Problemen hatte Raphael nach dem Tod seiner Eltern zu kämpfen?
g) Welchen Stellenwert nimmt Raphaels bester Freund in seinem Leben ein?
h) Welche Lehren könnt ihr aus dieser Geschichte ziehen?
Bildet Vierergruppen! Diskutiert eure Antworten zu den Fragen!
Perspektive, die: Standpunkt, von dem aus etwas gesehen wird
Ana besitzt einen Golden Retriever und ist ganz begeistert von dem Film „Hachiko – eine wunderbare Freundschaft“, den ihre Klasse in der Schule gesehen und besprochen hat. Ihre Aufgabe ist es nun, eine Inhaltsangabe zu schreiben. Dazu verwendet sie folgendes Rezept.
1. Eine Inhaltsangabe wird im Präsens geschrieben.

2. Sie ist in Einleitung, Hauptteil und Schluss gegliedert.
Einleitung:
1 Textsorte oder Filmgattung
1 Autorin / Autor oder Regisseurin / Regisseur
1 Jahr der Veröffentlichung
1 Handlungsort und Handlungszeit
Schaut euch gemeinsam mit der Klasse diesen Film an!
1 Kernaussage R Handlung wird mit ein bis zwei Sätzen umrissen)
Hauptteil:
1 richtige Reihenfolge der Handlung
1 knappe Zusammenfassung
1 sachliche Sprache
1 keine direkten Reden und keine Zitate (wörtlich wiedergegebene Textstellen)
1 Wirkung des Textes / Filmes auf die Leserin / den Leser oder die Zuschauerin / den Zuschauer
Schluss: Ein kurzer abschließender Satz, der entweder:
1 die Folgen der Handlung nennt (z. B. „Am Ende bleibt die Hauptfigur alleine zurück.“),
1 oder eine Aussage zur Wirkung oder Bedeutung des Textes macht (z. B. „Die Geschichte zeigt, wie wichtig Freundschaft in schwierigen Zeiten ist.“).
Wichtig: Der Schluss sollte keine eigene Meinung oder Interpretation enthalten!
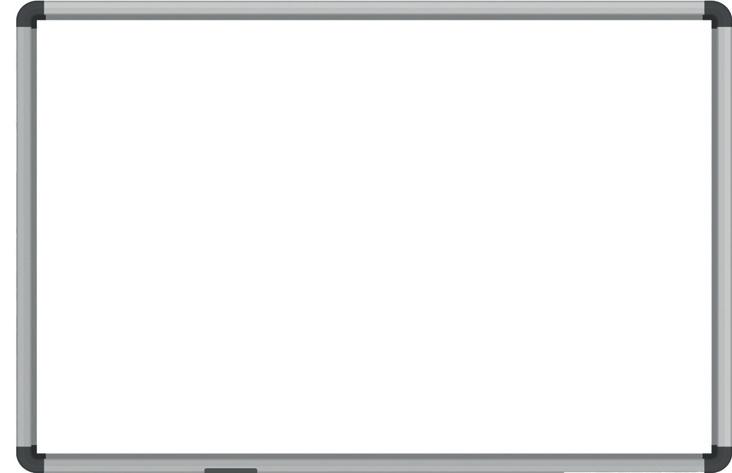
Wo werden Inhaltsangaben verwendet und wofür? Lies und verbinde richtig!
Verlage nutzen Inhaltsangaben, um mögliche Leser kurz über den Inhalt des Buches zu informieren und neugierig zu machen.
In Katalogen oder online werden sie verwendet, um Lesern zu helfen, mehr über ein Buch zu erfahren, bevor sie es ausleihen oder kaufen.
Werbeteams erstellen kurze Inhaltsangaben für Filme, die in Trailern oder Programmheften verwendet werden, um Zuschauer anzulocken.
Lies die beiden Inhaltsangaben! Beurteile sie nach den Kriterien der untenstehenden Checkliste! Begründet eure Beurteilung in Zweiergruppen!
„Hachikō - Eine wunderbare Freundschaft“ ist ein amerikanischer Film. Er handelt von der Geschichte des berühmten japanischen Akita-Hundes Hachikō, der seinem Besitzer bis über seinen Tod hinaus treu blieb.
Dem Musikprofessor Parker Wilson läuft auf seinem Weg von der Arbeit nach Hause an der Bahnstation von Bedridge ein Akita-Welpe zu. Auf seinem Halsband steht Hachikō, sein Name. Wilson versucht zwar, den Besitzer des Hundes ausfindig zu machen, doch bleibt die Suche erfolglos. Daraufhin nimmt Wilson den jungen Hund mit nach Hause. Seine Frau Cate meint: „Und du dachtest, du nimmst ihn mit, und überredest mich, ihn zu behalten?“ Sie akzeptiert den Hund erst, als sie sieht, wie das Tier ihren Mann glücklich macht. Hachikō begleitet seinen neuen Besitzer jeden Morgen zum Bahnhof und wartet auf ihn, bis er um 17 Uhr von der Universität zurückkommt. Eines Tages stirbt aber der Musikprofessor während einer Vorlesung an Herzversagen. An diesem Tag wartet Hachikō am Bahnhof vergeblich auf sein Herrchen.
Die Witwe zieht aus Bedridge fort und überlässt Hachikō ihrer Tochter Andy. Doch der Hund läuft weg. Der Bahnhof wird sein neues Zuhause. Da er weiterhin Tag für Tag auf sein Herrchen wartet, wird Hachikō im Laufe der Jahre zu einer Berühmtheit.
Als Mrs. Wilson nach zehn Jahren wieder in die Stadt kommt, um das Grab ihres Mannes zu besuchen, sieht sie Hachikō wie immer wartend am Bahnhof sitzen und setzt sich zu ihm.
Einige Zeit später stirbt der treue Hund und trifft auf der „anderen Seite“ sein Herrchen wieder.
Der Film hat mich sehr berührt, weil er mir gezeigt hat, dass die Treue eines Hundes über den Tode hinaus besteht.




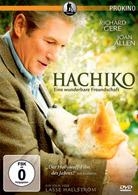

„Hachikō – Eine wunderbare Freundschaft“", unter der Regie von Lasse Hallström und im Jahr 2009 erschienen, ist ein bewegender Film, der die wahre Geschichte von Hachiko, einem treuen Akita-Hund, erzählt.
Der Film beginnt, als Professor Parker Wilson, ein Musiklehrer, Hachiko an einem Bahnhof findet. Trotz des Versuchs, den rechtmäßigen Besitzer zu finden, bildet sich eine untrennbare Bindung zwischen den beiden.
Jeden Tag begleitet Hachiko seinen Herrchen zum Bahnhof und wartet dort auf dessen Rückkehr. Als Parker unerwartet verstirbt, zeigt Hachiko unerschütterliche Treue, indem er weiterhin jeden Tag zum Bahnhof zurückkehrt, in der Hoffnung auf Parkers Wiederkehr. Über die Jahre berührt Hachikos Loyalität die Herzen der Gemeinde und inspiriert viele.
Der Film zelebriert die bedingungslose Liebe und Treue zwischen einem Hund und seinem Besitzer, die über den Tod hinausgeht.



Einleitung: die Autorin / der Autor, der Titel, das Erscheinungsjahr, die Textsorte / Filmgattung und die Kernaussage
Der Inhalt ist sinnvoll gekürzt und gibt wichtige Handlungsschritte wieder.
Der Text wurde eigenständig formuliert. Es gibt abwechslungsreiche Satzanfänge. Der Schreibstil (Ausdruck) ist sachlich.
Die Zeitform ist richtig und einheitlich im Präsens gehalten. Es wurden keine direkten Reden oder Zitate übernommen.
Schlussteil: enthält eine kurze Bewertung oder die Wirkung des Textes / Filmes auf die Leserin / den Leser, die Zuschauerin / den Zuschauer
Verfasse eine Inhaltsangabe zur Geschichte „Was Freundschaft bewirken kann“ (S.112)! Überprüfe sie im Anschluss anhand der Checkliste!
Bücher sind wie Fenster in andere Welten – sie bringen uns neue Ideen und Erfahrungen. Durch das Lesen lernen wir viel über andere Menschen und Kulturen. Bücher helfen uns, unsere Fantasie zu entwickeln und unsere Gedanken zu erweitern.
Die Schritte für das Lesen einer Langzeitlektüre können dich dabei unterstützen, das Buch zu verstehen und zu genießen. Sie sollen dich motivieren und dir helfen, dass das Lesen deiner Bücher für dich zu einem wunderbaren Erlebnis wird.
•Wähle ein Buch aus, das dich interessiert und motiviert.


•Erstelle einen Zeitplan, um sicherzustellen, dass du das Buch in einem angemessenen Zeitraum fertiglesen kannst.
•Finde einen geeigneten Leseort, der ruhig und bequem ist.
•Teile das Buch in Abschnitte ein, um es überschaubarer zu machen.
•Mache regelmäßig Pausen, damit du konzentriert bleibst.
•Notiere wichtige Punkte oder Gedanken, die dir im Laufe des Lesens einfallen.
•Denk über die Zeit und den Ort nach, in der die Geschichte spielt.
•Schau dir die Figuren genau an: Was wollen sie und wie stehen sie zueinander?
•Frage dich: Was will uns der Autor mit dem Buch sagen?
•Fasse das Gelesene zusammen: Schreibe eine kurze Zusammenfassung des Inhalts.
•Diskutiere mit anderen: Teile deine Gedanken und Erfahrungen mit Freunden oder in einer Lese-Gruppe.
•Bewerte das Buch: Überlege dir, ob das Buch deine Erwartungen erfüllt hat.
•Plane die nächste Lektüre: Wähle ein neues Buch aus, das dich anspricht.

Notiere in Stichworten deinen perfekten Leseort! Beschreibe ihn der Klasse!




Trag deine Bücher in die Leseliste ein!




Meine Leseliste für das Schuljahr ________
BuchtitelAutorStartEndeBewertung
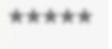



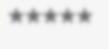

Suche im Internet die Balladen „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe und „Der Handschuh“ von Friedrich Schiller! Lies sie und überlege, welche Merkmale beide Balladen gemeinsam haben! Schreib sie auf und stell sie der Klasse vor!
Merkmale der Ballade:

In ihr werden Elemente aus Epik, Lyrik und Dramatik kombiniert.

Ursprünglich war eine Ballade ein Lied, das gesungen und zu dem getanzt wurde.

Viele Balladen enthalten Dialoge, die die Handlung spannender und lebendiger machen.

Sie ist in gegliedert.Strophen


Balladen werden in Reimen verfasst.
Lies die Texte! Markiere in jedem Absatz deine Schlüsselwörter!
Erzählendes Merkmal (episch): Die Ballade erzählt eine Geschichte oder ein Ereignis, das häufig spannungsvoll und dramatisch ist. Die Themen reichen von historischen Ereignissen bis zu Legenden und Sagen. Das erklärt auch, weshalb Balladen, im Gegensatz zu vielen lyrischen Gedichten, oftmals sehr lang sind.
Lyrische Elemente: Wie ein Gedicht ist die Ballade in Versen und Strophen geschrieben, oft mit einem festen Reimschema und Rhythmus. Dadurch werden der Klang und die Musikalität der Sprache hervorgehoben.
Dramatische Elemente: Die Handlung ist oft spannend, dramatisch oder schicksalhaft, und es gibt Dialoge und Monologe, die an ein Theaterstück erinnern. Dadurch wird die Erzählung lebendig und emotional ansprechend.
episch: erzählend
umfasst Erzähltexte
Lyrik, die: umfasst Gedichte
lyrisch: gefühlvoll, stimmungsvoll
Dramatik, die: Spannung, bewegter Ablauf
dramatisch: aufregend, spannungsreich
Dialog, der: von zwei oder mehreren Personen abwechselnd geführte Rede, Gespräch
Element, das: Bestandteil
Monolog, der: laut geführtes Selbstgespräch

Viele Balladen handeln von der Kraft der Natur und von schicksalhaften Ereignissen, die das Leben der Figuren beeinflussen.

Einige Balladen beinhalten übernatürliche Elemente, Geistererscheinungen oder moralische Konflikte.


Wähl dir eine Partnerin oder einen Partner! Sucht im Internet gemeinsam nach folgenden Balladen und lest sie! Kreuzt an, welche euch am besten gefallen hat!
„Die Löwenbraut“ von Adalbert von Chamisso
„Die Rache“ von Ludwig Uhland
„Der tugendhafte Hund“ von Heinrich Heine

Oft stehen Figuren im Mittelpunkt, die besondere Taten vollbringen oder tragische Schicksale erleben.

Mystik, die: Form der Religiosität
moralischer Konflikt: innerer Entscheidung zwischen „Gut und Böse“, „richtig und falsch“
Tragik, die: Leid, Schicksalsschlag, Unglück
tragisch: traurig, erschütternd, verhängnisvoll
Schreibt die Begründung für eure Wahl in ein paar Sätzen auf!

HB 10: Hör dir die Lebensgeschichte des Verfassers an! Erstelle einen Steckbrief!
Wichtig dabei: Dein Steckbrief sollte folgende Informationen beinhalten: Name; lebte von… bis …; lebte in…, wichtige Stationen im Leben; besondere Werke; am meisten beeindruckt mich…
Recherchiere im Internet, ob du noch etwas Wichtiges zum Autor findest!
1. Strophe
Bürgschaft von Friedrich Schiller (1759 – 1805)
Zu Dionys’, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande: Ihn schlugen die Häscher in Bande, „Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich!“ Entgegnet ihm finster der Wüterich „Die Stadt vom Tyrannen befreien!“ „Das sollst du am Kreuze bereuen.“
2. Strophe
„Ich bin“, spricht jener, „zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben: Doch willst du Gnade mir geben, Ich flehe dich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; Ich lasse den Freund dir als Bürgen, Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen.“
3. Strophe
Da lächelt der König mit arger List Und spricht nach kurzem Bedenken: „Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, Eh' du zurück mir gegeben bist, So muss er statt deiner erblassen, Doch dir ist die Strafe erlassen.“
4. Strophe
Und er kommt zum Freunde: „Der König gebeut, Dass ich am Kreuz mit dem Leben Bezahle das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich komme zu lösen die Bande.“
schlugen in Bande: in Ketten legen, einsperren
Häscher: Leibwächter
Wüterich: jemand, der vor Wut tobt
Tyrann: Gewaltherrscher
freien: verheiraten
Bürge: jemand, der für einen anderen einsteht







Damon ist bereit zu sterben, doch will er drei Tage Zeit, um bei der Hochzeit seiner Schwester anwesend zu sein. Im Gegenzug bietet er dem Tyrannen seinen besten Freund als Bürgen. Käme er nicht rechtzeitig zurück, würde der Freund an seiner Stelle sterben.
Damon erzählt seinem Freund, dass er am Kreuz sterben soll. Er berichtet auch weiter, dass er für die Hochzeit seiner Schwester eine Frist von drei Tagen bekommen hat. Zum Schluss bittet er den Freund, sich an seiner Stelle einsperren zu lassen, bis er ihn wieder auslöse.
Als Damon mit einem Dolch bewaffnet einen Mordanschlag auf den Tyrannen Dionys wagt, wird er gefasst und eingesperrt. Sein Plan, die Stadt vom Tyrannen zu befreien, ist gescheitert. Der Tyrann kennt keine Gnade und kündigt an, dass Damon gekreuzigt werden soll.
Der König nimmt das Angebot an, denn er will Damon mit einer List auf die Probe stellen. Er gewährt ihm drei Tage Zeit. Doch wenn die Frist verstrichen ist, muss der Freund an seiner Stelle sterben, während er aber am Leben bleibt.
entrinnen: sich durch Flucht entziehen
erblassen: sterben gebeuen: gebieten
frevelnd: eine unrechte Tat ausübend
Pfand: Geisel als Bürgschaft
Bande: Fessel
3 Lies die einzelnen Strophen und bei jeder auch die Kurzzusammenfassung des Inhaltes!
Lies die Ballade weiter und ordne dann die Kurzzusammenfassungen den Strophen zu!
5. Strophe
Und schweigend umarmt ihn der treue Freund Und liefert sich aus dem Tyrannen; Der andere ziehet von dannen Und ehe das dritte Morgenrot scheint, Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht verfehle.
6. Strophe
Da gießt unendlicher Regen herab, Von den Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel herab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.
7. Strophe
Und trostlos irrt er an Ufers Rand: Wie weit er auch spähet und blicket Und die Stimme, die rufende, schicket. Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, Der ihn setze an das gewünschte Land, Kein Schiffer lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.


von dannen ziehen: weggehen
Morgenrot: rote Färbung des Himmels bei Sonnenaufgang
Strudel: Wasserwirbel
Woge: starke Welle
Gewölbe: gemauerter Bogen spähen: suchend blicken
die rufende Stimme schicken: um Hilfe rufen
Nachen: kleines Boot

Strophe: ______
Damon irrt am Ufer des Flusses entlang. Er hält Ausschau nach einem Boot und ruft um Hilfe. Doch kein Boot legt ab, das ihn ans andere Ufer bringen würde. Auch macht sich niemand mit seiner Fähre auf den Weg, während der Fluss immer breiter wird.
Strophe: ______
Damon umarmt seinen treuen Freund. Während sich der Freund dem Tyrannen ausliefert, macht sich Damon auf den Weg. Noch bevor der letzte Tag der Frist anbricht, hat er seine Schwester verheiratet. Er macht sich schnell auf den Rückweg, denn er ist in Sorge, ob er die Frist einhalten kann.
Strophe: ______
Plötzlich beginnt es heftig zu regnen. Das Quellwasser von den Bergen füllt die Bäche und Flüsse, sodass das Wasser schnell ansteigt. Als Damon mit seinem Wanderstab am Ufer des Flusses ankommt, reißt gerade ein riesiger Wasserwirbel die Brücke in die Tiefe, die dadurch vollständig zerstört wird.


Fasse nun mit einer Partnerin oder einem Partner den Inhalt der Strophen kurz schriftlich zusammen!
8. Strophe
Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, Die Hände zum Zeus erhoben:
„O hemme des Stromes Toben!
Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Sonne, und wenn sie niedergeht
Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muss der Freund mir erbleichen.“


9. Strophe
Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut, Und Welle auf Welle zerrinnet, Und Stunde an Stunde ertrinnet.
Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut
Und wirft sich hinein in die brausende Flut
Und teilt mit gewaltigen Armen
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

10. Strophe
Und gewinnt das Ufer und eilet fort
Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die raubende Rotte
Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Pfad ihm sperrend, und schnaubert Mord
Und hemmet des Wanderers Eile
Mit drohend geschwungener Keule.
11. Strophe
„Was wollt ihr?“, ruft er vor Schrecken bleich, „Ich habe nichts als mein Leben, Das muss ich dem Könige geben!“
Und entreißt die Keule dem nächsten gleich: „Um des Freundes willen erbarmet euch!“
Und drei mit gewaltigen Streichen Erlegt er, die ander’n entweichen.
hemmen: blockieren; hindern erbleichen: sterben ertrinnen: eigentlich „entrinnen“ D vergehen Erbarmen: Mitgefühl





raubende Rotte: Gruppe von Räubern
schnaubern: Luft heftig aus der Nase blasen erlegen: töten, niederstrecken
Höre dir die weiteren Strophen der Ballade „Die Bürgschaft“ an!
Ende gut, alles gut – Wie könnte die Ballade enden? Entscheide dich für eine Möglichkeit!
Der beste Freund wird an Stelle von Damon gekreuzigt, weil dieser es nicht rechtzeitig schafft, von der Hochzeit seiner Schwester zurückzukehren.
In letzter Minute erreicht Damon die Stadt und sieht seinen Freund schon tot am Kreuz hängen. Die List des Tyrannen geht auf, denn er lässt auch Damon kreuzigen.
Damon rettet seinen Freund vor der Kreuzigung, weil es ihm gerade noch gelungen ist, die Frist einzuhalten. Nun kann er seine Strafe antreten und wird gekreuzigt.

Damon kommt zu spät und sieht seinen Freund tot am Kreuze. Die Schuld lastet so schwer auf ihm, dass er sich das Leben nimmt.
Damon schafft es noch rechtzeitig in die Stadt. Die Freunde fallen sich vor Freude in die Arme. Dies rührt den Tyrannen so sehr, dass er beide begnadigt und um ihre Freundschaft bittet.
Nachdem Damon die Frist einhalten konnte, wird sein Freund freigelassen. Damon soll nun seine Strafe erhalten, aber sein bester Freund geht für ihn freiwillig in den Tod.
Teile deine Wahl der Klasse mit und begründe dabei deine Entscheidung!
HB 11: Vergleiche nun deine Entscheidung mit dem tatsächlichen Ausgang der Ballade! Höre dir dazu das Ende der Ballade an!


Schreibe hier auf, was in dieser Ballade unter „Freundschaft “ und „Treue“ verstanden wird!

HB 12: Höre dir nun die ganze Ballade an! Dann verfasse eine Inhaltsangabe!
Tipp: Folgende Einleitung kannst du verwenden.
Die Ballade „Die Bürgschaft“ stammt von dem deutschen Dichter Friedrich Schiller und entstand 1798. Sie gehört zu den bekanntesten Gedichten Schillers.
In der Ballade behandelt er die Stärke und die Kraft von Freundschaft und Treue.


PRÄPOSITIONEN
… verbinden Wörter und Wortgruppen miteinander
… stehen meist vor ihrem Bezugswort, dem Nomen oder Pronomen
Beispiel: Ich hole ein Eis für dich. Viele Menschen leben fern der Heimat.
… sind unveränderlich
GENITIV
DATIV

Weißt du noch? Hier findest du nochmals einen Überblick über häufig verwendete Präpositionen und ihre Fälle.
… verlangen einen bestimmten Fall ab aus außer bei entsprechend gegenüber mit nach nächst nahe nebst samt seit von zu bis durch für gegen ohne wider per pro um je anhand anstatt außerhalb halber infolge innerhalb kraft längs mangels mittels oberhalb statt unterhalb während zeit
an auf hinter in neben über unter vor zwischen binnen dank entgegen fern laut gemäß trotz
AKKUSATIV
Wähle aus jedem Fall eine Präposition aus und notiere einen Beispielsatz!
GENITIV: ____________________________________________________________________________
GENITIV oder DATIV:
DATIV: _______________________________________________________________________________
DATIV oder AKKUSATIV: ________________________________________________________________
AKKUSATIV: __________________________________________________________________________
Die Präposition im Präpositionalobjekt:
… steht am Beginn der Objektergänzung
… ist Teil der Frage nach der Objektergänzung (… auf wen? … über wen? … für wen? … wofür?
… worüber? … mit wem? … womit? … nach wem?
… wonach?)
… bestimmt den Fall der Objektergänzung (immer Dativ oder Akkusativ)
… ist mit dem Prädikat des Satzes verknüpft
… kann nicht durch eine andere Präposition ausgetauscht werden.
Beispiel: PO 4
Alle Schülerinnen und Schüler warten auf den Sportlehrer.
D Frage: Auf wen warten alle Schülerinnen und Schüler?
Überprüfung:
D Frage ohne Präposition: Wen warten alle Schülerinnen und Schüler? D nicht möglich!
DAustauschen der Präposition:
Alle Schülerinnen und Schüler warten in/ um/ nach den Sportlehrer. D nicht möglich!
Lies die Inhaltsangabe der von dem deutschen Schriftsteller Theodor Fontane geschriebenen Ballade „John Maynard“!
Die Geschichte vom Steuermann John Maynard
„John Maynard“ wurde erstmals 1886 in Berlin veröffentlicht. Die Ballade handelt von der Heldentat des Steuermannes John Maynard. Er steuert das Schiff „Die Schwalbe“ über den Eriesee von Detroit nach Buffalo.
Der Steuermann John Maynard kümmert sich um die Passagiere auf der brennenden „Schwalbe“. Er denkt an seine Verantwortung und versucht, das Schiff an Land zu bringen. Maynard konzentriert sich auf das Steuer und ignoriert die Flammen um sich herum. Einige Passagiere beten für ihre Rettung und beobachten seine Entschlossenheit. Maynard hört auf die Rufe der Menschen, die ihn anfeuern. Schließlich bringt er das Schiff an die Küste und ermöglicht allen die Flucht. Doch er selbst kann sich nicht retten und opfert sein Leben für die anderen. Die Menschen sprechen noch lange über seine Tapferkeit und feiern ihn als Helden


Frage nach den ersten vier markierten Satzgliedern! Schreib Frage und Antwort auf! Kreuze den richtigen Fall an! Überlegt in Zweiergruppen, was euch auffällt!
F1: Von wem/Wovon handelt die Ballade?
D von der Heldentat des Steuermannes John Maynard.
PO 3 PO 4
F2: Um wen ____________________________________________________________________________
D _____________________________________________________________________________________
PO 3 PO 4
F3: ___________________________________________________________________________________
D _____________________________________________________________________________________
PO 3 PO 4
F4: ___________________________________________________________________________________
D _____________________________________________________________________________________
PO 3 PO 4
Schreib die Fragen und Antworten für die restlichen markierten Satzteile in dein Heft! Überleg auch, ob es sich um Präpositionalobjekte im Dativ oder Akkusativ handelt und schreib es dazu! Achtung: Der Text enthält zwei Sätze, die anstelle eines Präpositionalobjektes eine adverbiale Bestimmung enthalten. Markiere sie rot!
Recherchiere im Internet über den Schriftsteller „Theodor Fontane“! Erstelle einen Steckbrief! WICHTIG! Dein Steckbrief sollte folgende Informationen beinhalten: Name; lebte von… bis …; lebte in…; wichtige Stationen im Leben; besondere Werke; am meisten beeindruckt mich …
Manche Verben sind untrennbar mit einer bestimmten Präposition verbunden. Suche dir aus den folgenden Beispielen zehn aus und bilde damit Sätze! Schreib sie in dein Heft und bestimme das Präpositionalobjekt, indem du Frage und Antwort aufschreibst! 4

sich kümmern um träumen von sich beschäftigen mit sich erinnern an sprechen über sich interessieren für überzeugen von sich verabreden mit sich beschweren über sich wundern über sich verabschieden von warten auf anfangen mit antworten auf beteiligen an bitten um denken an danken für erinnern an glauben an hören auf informieren über interessieren für lachen über
sorgen für sich freuen über schreiben an denken an fragen nach sich entschuldigen für schimpfen über halten von abhängen von achten auf zählen auf sich freuen auf
Suche im Internet das Gedicht „John Maynard“ von Theodor Fontane und lies es! Verfasse eine Inhaltsangabe“ Tipp: Das Rezept von S. 117 hilft dir.

HB 13: Höre dir den Song „Held für einen Tag“ an und lies dabei mit!
Achtung: Der geschriebene Text weicht stellenweise vom gesungenen ab!
Held für einen Tag Songtext von Unheilig
Ich würd’ so gern ein Held sein, wenn auch nur für einen Tag. Der aufsteht und beschützt, Hilft und selbstlos ist.
Ich würd' so gern ein Held sein, Der tut, was sein Herz ihm sagt. Handelt und nicht wegsieht, Wenn die Angst am größten ist.
Heute werden wir wie Helden sein, wenn auch nur für einen Tag.
Heute stehen wir für andere ein, wenn auch nur für einmal.
Helden geben alles in dem einen Augenblick.
Lasst uns heute wie Helden sein und tun, was richtig ist.



Ich würd' so gern ein Held sein, Der lebt, wovon er träumt. Der daran glaubt, dass das Gute siegt Und sich selbst nicht wichtig nimmt.
Ich würd' so gern ein Held sein, Der das Licht im Dunkeln sieht.
Aufsteht und nicht weg sieht, Wenn die Angst am größten ist.
Heute werden wir wie Helden sein, Wenn auch nur für einen Tag.
Heute stehen wir für andere ein, Wenn auch nur für einmal...
Unterstreiche im Songtext alle Stellen, die angeben, was eine Heldin oder einen Helden ausmacht!
Lies nun den Zeitungsbericht zu einer aktuellen Heldentat!

Ein junger Zuwanderer aus Mali ist in Paris zum Volkshelden avanciert, nachdem er am Samstagabend ein Kleinkind in einer spektakulären Aktion von einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses gerettet hatte.
Passanten filmten, wie sich der 22-jährige Mamoudou Gassama an der Fassade des Hauses von Balkon zu Balkon emporhangelte und den vierjährigen Buben, der an einem Balkongeländer hing und hinunterzustürzen drohte, in Sicherheit brachte.
Das Video verbreitete sich rasant in sozialen Medien, wo Gassama als „Held von Paris“ bezeichnet wird.
„Ich habe nur an seine Rettung gedacht“, sagte der Westafrikaner, der ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich lebt. „Und Gott sei Dank habe ich ihn gerettet.“
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dankte Gassama bei einem Empfang im Élysée-Palast für seinen Mut und sagte ihm die französische Staatsbürgerschaft zu.
avancieren: zu etwas aufsteigen
Bildet Vierergruppen! Besprecht folgende Fragen und macht Notizen! Diskutiert eure Ergebnisse mit der Klasse!
a)Was macht jemanden zur Heldin oder zum Helden?
b) Welche Eigenschaften haben alltägliche Heldinnen oder Helden?
c) Was versteht ihr unter heldenhaften Taten?
d) Wer ist für euch eine Heldin oder ein Held und warum? Nennt auch konkrete Beispiele!
Welche dieser Comic-Superheldinnen und Comic-Superhelden kennst du? Kreuze an!
























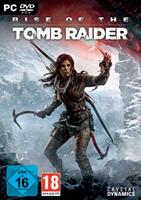
Schreibe auf, welche Superheldinnen und Superhelden du noch kennst!



Notiere, woher du die Superheldinnen und Superhelden kennst! (z. B. Film, Fernsehen usw.)
Überlege dir Eigenschaften von Superheldinnen und Superhelden! Schreibe sie auf!

Erstelle mit Hilfe der Eigenschaften einen Steckbrief zu deiner Lieblingssuperheldin / deinem Lieblingssuperheld!
Name im realen Leben


Beruf
Name als Superheldin/als Superheld

Eigenschaften als Heldin/Held

Superkräfte
Das mag sie/er besonders gerne



Das mag sie/er gar nicht
Am meisten beeindruckt mich/am tollsten finde ich

Suche dir eine Partnerin/einen Partner! Lasst gemeinsam eine neue Superheldin/einen neuen Superhelden entstehen!
a) Macht eine Liste mit ihren / seinen drei tollsten Superkräften!

b) Erfindet einen Namen! Bezieht dabei ihre / seine Persönlichkeit mit ein! (z.B. Lady Superschnell, Dr. Schreckenreich, …)
c) Entwerft ein leicht erkennbares Logo!
d) Entwerft eine Ausrüstung! (Farbe, Maske, Superheldencape, …)
e) Überlegt, wofür eure Heldin / euer Held kämpft, wen er oder sie rettet!
EIGENSCHAFTEN:

AUSRÜSTUNG: KÄMPFT FÜR/ RETTET:
NAME:


LOGO:



Erstellt gemeinsam ein Comic mit Sprechblasen und lasst ihn/ sie ein Abenteuer bestehen!
Stell dir vor, du bist für einen Tag eine Superheldin / ein Superheld! Schreib ein Abenteuer, dass du dabei erlebst in dein Heft!
Jeden Morgen, auch am Abend und spät nachts gehe ich auf Verbrecherjagd.

Tageszeitangaben werden großgeschrieben:
… nach einem Artikel
D der Morgen, die Nacht, das Wochenende, ein Abend, …
… nach Possessivpronomen
D mein Morgen, unser Abend, sein Nachmittag, …
… nach Präpositionen
D ab Donnerstag, zu Mittag, gegen Abend, …
… nach Präpositionen mit bestimmtem Artikel (Verkürzungen)
D am (an dem) Morgen, im (in dem) Morgengrauen, zum (zu dem) Nachmittag, …
… nach Adverbien
D heute Abend, morgen Früh, übermorgen Nacht, gestern Mittag, …
Des Öfteren rette ich die Welt vor dem Untergang.
Tageszeitangaben werden kleingeschrieben:
… wenn sie auf -s enden
D montags, vormittags, nachts, …
… wenn man ausdrücken möchte, dass etwas wiederholt und regelmäßig zu dieser Zeit stattfindet.
D Ich gehe immer abends joggen.
D Ich bin vormittags in der Schule.
Groß oder klein? Setze richtig ein!
Am ___ontag in der ___rüh frühstückt auch Superman. Zu ___ittag isst er nichts, weil er ___bends eine Verabredung zum Essen hat. Deshalb hat er ___estern ___achmittag einen Tisch für zwei Personen im Nobelrestaurant bestellt. Am ___bend steigt seine
Aufregung, denn er trifft Supergirl. Schon ___rühmorgens hat Supergirl bereits einen
Termin bei ihrem Friseur. Sie weiß nämlich, so einen feschen Superhelden trifft frau nicht jeden ___ag. Am späten ___achmittag steigt auch ihre Nervosität. Ihr Date dauert nur bis ___itternacht, dann müssen sie gemeinsam die Welt retten.
Nominal gebrauchte feste Wendungen
Die folgenden Beispiele sind feste Wendungen und werden immer nominal gebraucht. Wähle 15 feste Wendungen aus, bilde damit Sätze und schreib sie auf!
außer Acht lassen im Allgemeinen Angst haben im Besonderen zum Besten wenden in Bezug auf der Dritte im Dunkeln tappen im Einzelnen
das Folgende im Folgenden als Ganzes nicht im Geringsten im Großen und Ganzen im Grunde zu Grunde liegen im Klaren sein auf dem Laufenden sein
zu guter Letzt das Letzte im Nachhinein der/die Nächste des Näheren des Öfteren alles Übrige im Voraus des Weiteren
Verfasse im Heft, mit Hilfe des Rezeptes von S. 117, eine Inhaltsangabe zu deinem Lieblingsfilm oder deinem Lieblingsbuch! Überprüfe sie anhand der Checkliste von S. 118!
Setze die Präpositionen sinnvoll ein und ergänze die fehlenden Endungen!

_______ einer Woche haben wir _____ d___ Schule einen besonderen Film gesehen. Ich muss ständig _____ d___ Film _____
nächsten Woche wird die DVD ____ m___ ankommen.

d____ Hund Hachiko denken – ____ d___ Hund, der Tag für Tag _____ s___ Herrchen wartet, obwohl es nie wieder kommen wird. Ich habe mir den Film sofort _____ Amazon bestellt. _________ d___
Unterstreiche in jedem Satz das Präpositionalobjekt! Formuliere den Fragesatz! Bestimme den Fall!
Spider-Man träumt von einer Welt ohne Verbrechen.
F: ________________________________________________________________________________________
Er denkt oft an seine Verantwortung gegenüber der Stadt.
F: ________________________________________________________________________________________
Die Menschen danken ihm für seinen heldenhaften Einsatz.
F: ________________________________________________________________________________________
3 4 1 auf M auf M mit M an M an M innerhalb M in M vor 2
Unterstreiche und bestimme in den Sätzen alle Satzglieder! Schreibe die Abkürzungen darüber!
Wonder Woman kämpft für Gerechtigkeit und Frieden.
Sie schützt die Menschheit vor bösen Mächten.
Schwierige Entscheidungen bespricht sie mit ihrer Mutter, um sich zu beraten.
Lies der Reihe nach, jeden Satz des Diktates, deck ihn ab und schreib ihn in dein Heft! Tausche dein Heft mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler! Kontrolliert eure Arbeiten!
a) Sieh dir die erste Zeile des Diktats an und decke diese anschließend ab!
b) Übertrage dann den Satz in dein Heft!
c) Das wiederholst du auch mit den übrigen Zeilen. Lasse zuletzt deine Arbeit von einem Mitschüler/einer Mitschülerin kontrollieren!
1. Am Samstagabend bin ich bei meinem besten Freund Tom zu einer Party eingeladen.
2. Im Grunde liebe ich Partys, aber ich weiß, dass Tom des Öfteren schnell weg muss.
3. Seine Hilfe wird häufig abends gebraucht, da um diese Zeit Verbrecher am liebsten ihr Unwesen treiben.
4. Mein Freund ist nämlich Superheld von Beruf und nur er kann wieder alles zum Besten wenden.
5. Nachdem Tom wieder unzählige Leben gerettet hat, kommt er nicht selten erst frühmorgens wieder heim.
6. Dann heißt es für ihn, schnell ins Bett und morgen in der Früh wieder zur Arbeit.
Schreibe die Zeitangaben und die festen Wendungen unter Beachtung der Großund Klein- und der Getrennt- und Zusammenschreibung richtig auf!
Superhelden sind (imbesonderen) ___________________________ (spätabends) ________________________ unterwegs. Am (frühenmorgen) ______________________________ gehen sie wie du und ich zur Arbeit oder zur Schule. Sie unterscheiden sich dabei (nichtimgeringsten) __________________________________ von uns. Zu (mittag) _____________________ oder am (abend) ___________________ essen sie genauso gerne Fastfood wie wir. Dennoch müssen wir uns darüber (imklarensein) _________________________, dass sie stets wachsam sind. Sie tappen nur selten (imdunkeln) __________________________ und (desnachts) _________________________ haben sie auch keine (angst) ________________ .
Ich kann…





…mit Hilfe des Rezeptes und der Checkliste eine Inhaltsangabe verfassen. (1)
…Präpositionen einsetzen. (2)
Ich erkenne Präpositionalobjekte in einem Text und kann danach fragen. (3 + 4)
…alle Satzglieder in einem Satz bestimmen. (5)
Ich beherrsche die Groß- und Kleinschreibung der Zeitangaben und ich kenne nominal gebrauchte Wendungen. (6 + 7)
Die Zwillinge Olivia und Oliver sind Fans von fantastischen Geschichten. Hier stellen sie dir ihre momentanen Fantasy-Lieblingsbücher vor.
Manche Bücher müssen gekostet werden, manche verschlingt man, ...
Tintenherz von Cornelia Funke
... Maggie schlug das Buch auf. Sie blätterte in den Seiten, bis sie das große K wiederfand, auf dem das Tier saß, das Gwin so ähnelte. „Maggie! Hey, ich rede mit dir!“ Elinor rüttelte sie unsanft an den Schultern. ... Maggie klappte das Buch zu, strich über den Einband und betrachtete es von allen Seiten. „Der Titel steht nicht drauf“, murmelte sie. ...
„Einen Titel hat es natürlich trotzdem: Es heißt Tintenherz. Ich vermute, dein Vater hat es mit Absicht so gebunden, dass man dem Einband nicht ansieht, um welches Buch es sich handelt. Nicht mal innen auf der ersten Seite findest du den Titel, und wenn du genau hinsiehst, wirst du erkennen, dass er die Seite herausgetrennt hat.“ ... „Vielleicht steckt irgendein Geheimnis darin“, murmelte Maggie. ... Staubfinger schlich erst in Maggies Zimmer, als er ganz sicher war, dass sie schlief. ... Er kam keineswegs, um ihr das Buch zu stehlen, obwohl Capriccorn es natürlich immer noch wollte: Das Buch und Zauberzunges Tochter dazu, so lautete der neue Auftrag. Aber das musste warten. Heute Nacht kam Staubfinger aus einem anderen Grund. Heute Nacht trieb ihn etwas in Maggies Zimmer, das ihm seit Jahren das Herz zernagte. ...
Ihren Vater an Capriccorn zu verraten, war nicht weiter schwer gefallen, bei ihr würde das schon anders sein. ...

...und nur einige wenige kaut man und verdaut sie ganz.

Eragon – das Vermächtnis der Drachenreiter von Christopher Paolini
... Eragon war fünfzehn, nur noch ein knappes Jahr vom Mannesalter entfernt. ...
Er war bereits die dritte Nacht auf der Jagd und sein Proviant war zur Hälfte verbraucht. Wenn er die Hirschkuh nicht erlegte, war er gezwungen, mit leeren Händen heimzukehren. ...






Die Hirschkuh, auf die er es abgesehen hatte, lag etwas abseits des Rudels und hatte ihr linkes Vorderbein unbeholfen ausgestreckt. Eragon schlich langsam näher und spannte den Bogen. Die ganze Mühsal der letzten drei Tage war auf diesen Augenblick gerichtet gewesen. Er atmete ein letztes Mal tief durch und – eine Explosion erschütterte die Nacht. ...
Hinter ihm, wo eben noch die Hirsche gewesen waren, schwelten Gras und Bäume in einem kreisrunden Areal. ... Im Zentrum des Explosionsherds lag ein blau polierter Stein. ... Eragon hielt mehrere Minuten nach Gefahr Ausschau, aber das einzige, was sich rührte, waren die Nebelschwaden. Vorsichtig ließ er den Bogen sinken und ging los. Der Mondschein warf sein mattes silbriges Licht auf ihn, als er vor dem Stein stehen blieb. ... Nie hatte die Natur einen Stein so glatt poliert wie diesen. Seine makellose Oberfläche war dunkelblau, bis auf die feinen weißen Adern, die ihn wie ein Spinnennetz überzogen. ...

Beurteile die beiden Buchausschnitte! Kreuze an, welches Buch dich mehr anspricht und begründe deine Entscheidung!
Begründung:


Schreibe auf, welches Geheimnis hinter jedem Buch stecken könnte!
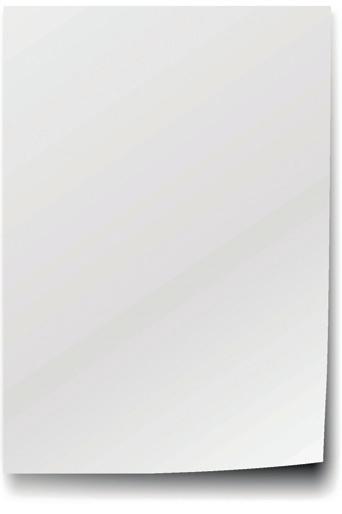
Tintenherz


Eragon

Ergänze die folgenden, spannenden Satzanfänge in deinem Heft!
Als es bei mir an der Tür klopfte, ...
Kapitän Nemo zeigte uns sein Reich am Meeresgrund...
Wir bestiegen den Heißluftballon zu unserer Reise um die Welt...
Aufgeregt bestieg ich den Rücken meines Drachen...
Beim lauten Lesen erweckte ich mit der Kraft meiner Stimme...
Da stand er plötzlich vor mir – er war nicht größer als 50 cm...

Überlege dir vier eigene spannende Satzanfänge und schreib sie auf ein Blatt! Tausch mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn und ergänzt eure Sätze!
Lies die Geschichte „Thomas träumt“!
Thomas träumt von Sigrid Mordi
Auf einmal war alles anders. Thomas war nicht mehr klein. Er konnte die Schubladen vom Schrank öffnen, er konnte überhaupt überall hinkommen. Er war groß und stark. Sicher war er größer als der Vater. Und genauso stark wie Tarzan. Es war wunderbar. Mit einer Hand hob Thomas den Küchentisch hoch bis an die Zimmerdecke. Es war ganz einfach. Thomas konnte es nicht glauben, er probierte es noch einmal. Es ging wirklich. Als die Eltern dann heimkamen, war er für sie wie ein Riese. Der Vater reichte ihm gerade bis zum Bauch. Die Mutter war noch kleiner. Thomas sagte, sie sollten sich ordentlich an den Tisch setzen und alles aufessen. Sie kletterten auf die Stühle, die viel zu hoch für sie waren.
Dann mussten sie sich ausziehen, waschen und Zähne putzen, und dann schickte Thomas sie ins Bett. Er selbst machte es sich gemütlich. Er legte die Füße auf den Tisch, schaltete das Radio ganz laut und schaute sich seine Bilderbücher an. Der Vater kam nochmals aus dem Bett. Er hatte Durst. „Nichts da“,
sagte Thomas, „geh sofort ins Bett! Und schlaf endlich.“
Etwas später fuhr er mit einem Auto weg. Sein Auto war schneller und größer als alle anderen. Es war ein schönes Gefühl, so dahinzurasen. Auf einmal war sein Auto kein normales Auto mehr. Er merkte, wie sich plötzlich Propeller einschalteten, und er begann hochzusteigen. Sein Auto war ein Auto, das auch fliegen konnte! Ein Fliegauto!
Er flog höher und höher. Thomas hatte sich schon immer gewünscht, einmal zu fliegen. Ganz tief unter sich sah Thomas die Stadt. Winzig klein die Häuser, Bäume und Autos. Wie eine Spielzeugstadt sah alles aus. ...
Er stieg höher und immer höher. Als er fast die Sonne erreicht hatte, merkte er plötzlich, dass er nicht mehr höher stieg, sondern erst langsam und dann immer schneller hinabsank. Er spürte sich fallen und fallen –und wachte auf. Und alles war wie vorher.
Notiere die drei fantastischen (= unmöglichen) Elemente, die es in dieser Geschichte gibt!
Analysiere die Geschichte „Thomas träumt“ und male an, was zutrifft!

Es gibt keine direkten Reden.

Es gibt wenige Adjektive. Die Geschichte ist geordnet, sinnvoll und logisch aufgebaut.
Im Text kommen Ausrufe- und Fragesätze vor.


Die Überschrift ist spannend. Die Gedanken und Gefühle der handelnden Personen werden beschrieben.

Verben und Adjektive beschreiben das Geschehen anschaulich.
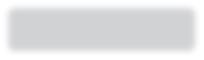

Direkte Reden kommen vor.

Es gibt mehrere fantastische Sachverhalte.

Es werden Sinneseindrücke wie, Geräusche, Gerüche und Eindrücke wiedergegeben.


Die Geschichte ist im Präteritum geschrieben.
Vergleiche deine Analyse mit dem REZEPT Fantasiegeschichte!

1.Eine Fantasiegeschichte kann sowohl im Präsens als auch im Präteritum geschrieben werden.
2.Es gibt zwei Erzählperspektiven:
Ich-PerspektiveEr-Perspektive Erstaunt blickte ich mich um.Erstaunt blickte er sich um.
3.Gliederung:
Einleitung R Personen, Ort, Zeitpunkt und Handlung werden kurz vorgestellt
R Wechsel von der Wirklichkeit in die Fantasiewelt Hauptteil R Höhepunkt
Schluss R Ende des Erlebnisses oder
R Wechsel von der Fantasiewelt in die Wirklichkeit
4.Damit die Geschichte spannend wird, verwende:
R passende Adjektive
R passende Verben
R direkte Reden
R Frage- und Ausrufesätze
5.Eine gute Überschrift macht neugierig.
Lies die Geschichte von Marco! Überlege, ob etwas fehlt und wenn ja, notiere es!

Lenas Abenteuer
Lena lag, wie jeden Abend, bereits in ihrem Bett und versuchte zu schlafen. Es gelang ihr nicht. Die Augen wollten und wollten nicht zufallen. Auf einmal hörte sie ein Geräusch. Es kam von draußen und hörte sich an wie ein Klingeln. Neugierig stand sie auf und eilte zum Fenster. Im Garten war ein leuchtender Pfad zu sehen. Neugierig folgte sie ihm in einen bunten Zauberwald. Dort traf sie einen sprechenden Fuchs, der sie durch das Wunderland führte. Sie überquerten Flüsse und kletterten auf Wolkenberge. Jedes Wesen erzählte Lena eine magische Geschichte.
Am Ende entdeckten sie einen geheimen See, der in der Nacht leuchtete. Lena wünschte, die Reise möge nie enden. Bei Tagesanbruch war sie zurück in ihrem Bett, voller Sehnsucht, eines Tages wiederzukehren.
Lies die Geschichte von Asmahan! Überlege, ob etwas fehlt und wenn ja, notiere es!

Der leuchtende Pfad
Lena lag, wie jeden Abend, in ihrem weichen Bett. Ihre Eltern hatten ihr bereits eine „Gute Nacht“ gewünscht, aber … sie war noch gar nicht müde. Auf einmal hörte sie ein zartes Klingeln. Neugierig geworden, setzte sie sich auf, blickte im Zimmer umher, konnte aber nichts erkennen. Da – wieder ertönte das Klingeln: „Kling – kling –kling!“. Es kam vom Fenster, das plötzlich offenstand. Schnell sauste Lena hin, blickte hinaus und entdeckte einen leuchtenden Pfad. „Wo führt der Pfad wohl hin?", fragte sie sich und schritt mutig voran, hinein in einen geheimnisvollen Zauberwald. Dort begegnete sie einem sprechenden Fuchs. „Willkommen, Lena! Ich werde dein Führer sein", sagte der Fuchs mit einem Lächeln. Gemeinsam durchquerten sie das Wunderland, über tanzende Flüsse und Wolkenberge. „Jeder Ort hier hütet seine eigenen Geheimnisse", erklärte der Fuchs. Als sie einen geheimen See erreichten, der golden glitzerte, flüsterte der Fuchs: „Dieser See erfüllt Wünsche bei Nacht." Lena, überwältigt von Staunen, wünschte sich leise: „Ich möchte, dass diese Reise nie endet." Doch mit den ersten Sonnenstrahlen fand sie sich in ihrem Bett wieder. „War das alles nur ein Traum?", fragte sie sich. Doch in ihrem Herzen wusste sie, dass sie eines Tages zurückkehren würde.

Kreuze für jede Geschichte an, welche Punkte der Checkliste erfüllt wurden!
Checkliste
Die Geschichte ist im Präsens oder im Präteritum geschrieben.
Ich habe die Erzählperspektive durchgehend eingehalten.
Meine Einleitung gibt Aufschluss über die Handlung und zeigt den Wechsel von der Wirklichkeit in die Fantasiewelt.
Im Hauptteil gibt es einen Höhepunkt.
Der Schluss enthält das Ende der Erlebnisse.
Ich habe direkte Reden verwendet.
Adjektive und unterschiedliche Verben machen die Geschichte anschaulich.
Es gibt Ausrufe- und Fragesätze.
Die Überschrift klingt spannend.
Marco Asmahan
In Fantasy-Romanen wimmelt es nur so von übernatürlichen, märchenhaften und magischen Gestalten und Orten. Welche kennst du schon? Benenne folgende magische Wesen mit Hilfe der Silben aus dem magischen Buch!


-ber- *-ber- * -che * Dra- * Ein- * El- * -er * -fe * -frau * Goll- * He- * -horn * -jung- * Meer- * -taur * -um * -wald * -xe * Zau- * Zau- * Zen-




Male auf einem A4- Blatt dein Land „Fantasien“! Stell dir dabei folgende Fragen:
Wie sieht es dort aus? Wen treffe ich dort? Was kann ich dort alles tun? Wie fühle ich mich dort?
Bildet Dreiergruppen und stellt euch gegenseitig eure Zeichnungen vor!
Notiere, welche Fantasy- Romane, Fantasy- Filme oder Fantasy- Serien du kennst! Stell sie der Klasse kurz vor!

Schreibe in deinem Heft drei mögliche Situationen auf, die du verwenden könntest, wenn du von der realen Welt in die Fantasiewelt und zum Schluss wieder zurück wechselst!
z. B.: Ich sah einen Süßwarenladen, öffnete die Tür und ging hinein. Die Verkäuferin gab mir ein Stückchen Schokolade zum Probieren. Nachdem ich es gegessen hatte…
Suche dir eine Schreibpartnerin oder einen Schreibpartner! Wählt gemeinsam eine Fantasy-Figur aus Ü1/ S. 142 aus! Schlüpft in ihre Rolle und schreibt ein spannendes Erlebnis auf!
Besprecht vorab gemeinsam: Welchen Charakter soll die Figur haben? Wo soll die Fantasiegeschichte spielen? Welche Situationen fallen uns ein? Wie fängt die Geschichte an? Welchen Höhepunkt bauen wir ein? Welchen Schluss wollen wir schreiben?
Wähle einen der folgenden Schreibanlässe aus! Notiere zuerst Stichwörter, dann verfasse mit Hilfe des Rezepts von S. 140 eine fantastische Geschichte! Tausche mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn und überprüft eure Geschichten gegenseitig anhand der Checkliste von S. 141!

A. Entscheide dich für eine Überschrift aus der Wortschlange und verfasse eine Fantasiegeschichte in der ICH-Form! Ich, der Drachenflüsterer * Plötzlich unsichtbar * Als ich mit Tieren sprechen konnte * Ein Tag als Zwergenwesen * Mein Abenteuer mit dem Zauberring
B. Reizwortgeschichte: Schreibe eine Fantasiegeschichte mit Hilfe der Stichwörter! Wanderung * gestolpert * sprechende Bäume * Zwerge * Höhle * Schatz * Drache * Gesang * Reichtum
C. Erzähle eine fantastische Geschichte zu diesem magischen Schlüsselloch! Notiere aber, bevor du eintrittst, in Stichwörtern um den Eingang herum, wie du dieses Schlüsselloch gefunden hast und welche Abenteuer dich in der Fantasiewelt erwarten! Dann verfasse deine Fantasiegeschichte!



HB 14: Schließe die Augen und höre dir folgende Geräusche an! Dann baue fünf davon in eine kurze fantastische Geschichte ein! Überprüfe mit der Checkliste von S. 141!




Die Relativpronomen „der“, „die“, „das“, „welcher“, „welche“, „welches“ sowie deren Genitivformen „dessen“ und „deren“ leiten einen Relativsatz ein.

Vor einem Relativpronomen kann auch eine Präposition stehen.

Der Relativsatz bezieht sich auf einen zuvor genannten Satzteil im Hauptsatz. Er beschreibt das Bezugswort genauer und liefert zusätzliche Informationen dazu.
Das Relativpronomen stimmt in Zahl und Geschlecht mit dem Bezugswort überein.
Die Genitivformen „dessen“ und „deren“ werden verwendet, wenn ein Besitz oder eine Zugehörigkeit ausgedrückt wird.
Beispiel: Das ist der Schüler, der Fantasy-Geschichten liebt.
Bezugswort
Relativpronomen
Das ist das Buch, das ich gelesen habe.
Das ist die Lehrerin, deren Stimme sehr freundlich ist.
Das ist der Autor, dessen Werke weltberühmt sind.
Welcher Fall verwendet wird, hängt davon ab, ob das Relativpronomen im Relativsatz ein Subjekt oder Objekt ersetzt.
Beispiele: Das Fantasy-Buch gehört Hannes, der auch mein Nachbar ist
Die fantastischen Fantasy-Filme, mit denen du heute aufwächst, gab es damals noch nicht.
Erklärung: „Die fantastischen Fantasy-Filme“ stehen hier im Nominativ. Die Präposition „mit“ verlangt den Dativ, deshalb steht das Relativpronomen auch im Dativ.
Die Relativpronomen „der, die, das“ werden wie die bestimmten Artikel dekliniert.
Im Genitiv lautet die Form „dessen“ bzw. „deren“. Im Dativ Plural wird ein -en angehängt.
Das Relativpronomen „welcher, welche, welches“ wird ebenfalls dekliniert, jedoch gibt es keine Genitivform davon.
Tipp: Die vollständigen Deklinationstabellen findest du im Anhang auf Seite 159.
1
Setze beide Relativpronomen in die Beispielsätze ein und kreise die Bezugswörter ein!

Marie, _________ / _____________ den neuesten Band der Time Riders besitzt, wird von allen beneidet. * Nutze die Fantasie, _____________ / _____________ du hast! * Bilbo Beutlin, _________ / _____________ sich auf eine Reise durch Mittelerde begibt, verpflichtet sich, bei der Suche nach dem verlorenen Schatz zu helfen. * Ihm gelingt es, in den Besitz eines wertvollen Ringes zu gelangen, ________ / __________________ er später an seinen Neffen Frodo weitergibt. * Fantasy-Romane aufwendig zu verfilmen, ist der Trend, ___________ / ________________ Hollywood-Produzenten in den letzten Jahren folgen. * Joanne Kathleen Rowling ist eine der bekanntesten Autorinnen, über _______ / _____________ noch immer regelmäßig in den Medien berichtet wird. * Die Harry Potter-Romane, mit _____________ / _____________ Rowling untrennbar verbunden ist, wurden in über 80 Sprachen übersetzt.
Verfasse eine fantastische Geschichte zu einem dieser Bilder! 4 1 2 3
Setze die Relativpronomen „der, die, das“ im richtigen Fall ein!
Ist das der Fantasy-Roman, …
Wir haben morgen eine Autorenlesung, … _________ so erfolgreich ist?_________ sicher sehr spannend wird.
_________ du gestern gekauft hast?auf _________ ich mich schon sehr freue. _________ dir gestohlen wurde?_________ ich aufmerksam folgen werde.
Hast du schon alle Bände gelesen, … Harry Potter, ..., ist weltweit beliebt. von _________ wir heute gehört haben?_________ Schüler eines Zauberinternats ist über _________ wir heute gesprochen haben?_________ gegen einen bösen Magier kämpft
_________ uns heute vorgestellt wurden?_________ ständig viele Gefahren drohen
Verbinde die beiden Sätze in deinem Heft miteinander!
Harry Potter ist ein Zauberer. Du kennst ihn auch.
Was kostet der neuste Harry Potter-Band? Er steht in der Auslage. Sandra besucht morgen eine Autorenlesung. Sie freut sich schon darauf.
Der Autor lebt jetzt in Berlin. Seine Romane waren schon immer erfolgreich.
Das ist die glückliche Gewinnerin. Sie hat bei einem Preisausschreiben eine Reise gewonnen. Man hat das Haus nun abgerissen. In diesem Haus hat der berühmte Autor sein Leben lang gelebt.

Frage immer nach dem markierten Nomen im Satz! Schreibe die Beispiele in dein Heft!
Beispiel: Meine Schwester hat mein Buch zerrissen. Was hat meine Schwester zerrissen?
Meine Eltern haben mir eine Kinokarte geschenkt. * Dein Hund hat dein neuestes Buch zerbissen. * Sein Kind liest von früh bis spät. * Du hast 1 000 Euro bei einem Preisausschreiben gewonnen. * Der FantasyRoman gefällt Simon gar nicht. * Evas eBook funktioniert nicht mehr. * Ich habe diesen Roman gefunden. * Noemi hat alte Bücher geerbt. * Du hast eine Einladung zu einer Autorenlesung bekommen.



Ich kann das Relativpronomen im richtigen Fall einsetzen. (1)
Ich kann einen Relativsatz bilden. (2)
Ich kann eine Fantasiegeschichte zu einem Bild schreiben. (3)



Wie schnell kann man die Welt umrunden?
1873 veröffentlichte der französische Science-FictionSchriftsteller Jules Verne seinen erfolgreichsten Roman mit dem Titel „Reise um die Erde in 80 Tagen”.
INHALT: Der reiche englische Gentleman Phileas Fogg sorgt im ganzen Land für Aufsehen und bei seinen Freunden für Zweifel. Er wettet um sein Vermögen, in 80 Tagen um die Welt reisen zu können, und macht sich alsbald mit seinem Diener auf den Weg. Per Bahn, Schiff und Elefant beginnt sein Wettlauf gegen die Zeit.




Wer glaubt, heute gäbe es das schnellste Flugzeug, um einmal um die Welt zu fliegen, der irrt. Den bisher ungebrochenen Rekord stellte 1995 die Concorde auf. Das Überschallflugzeug startete in Paris und flog in weniger als 31,5 Stunden einmal um die Erde. Auf der Strecke mit ihrer Gesamtlänge von 36 784 km mussten sechs Zwischenstopps eingelegt werden. Die Fluggäste konnten während dieser Reise zwei Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge erleben.
HB 15: Lies zuerst die Fragen zu dem Hörbeispiel aus dem Buch „In 80 Tagen um die Welt“! Höre dann den Textausschnitt und kreuze richtig an!
F1: Wo schließt Phileas Fogg seine Wette ab?
F2: Was machen Phileas Bekannte gerade, als sie sich über den Bankraub unterhalten?


in einem Wettbüroim Reform-Klubbei sich im Salon
Sie lesen die Zeitung.Sie speisen. Sie spielen Karten.
F3: Welche Bank wurde beraubt?
Bank of DoverBank of LiverpoolBank of England
F4: Wie wird der Bankräuber beschrieben?
als vornehmer Gentlemanals verkleideter Gentlemanals einfacher Mann
F5: Wer behauptet, dass die Welt kleiner geworden ist?
Phileas FoggAndrew StuartJohn Sullivan
F6: Wie hoch ist die Wettsumme? zwanzigtausend Pfunddreißigtausend Pfundfünfzigtausend Pfund
F7: Wann will Phileas Fogg abreisen? am nächsten Tagin zwei Tagenam gleichen Abend
Science-Fiction erzählt Geschichten, die oft in der Zukunft oder in anderen Welten spielen. Es geht um Dinge wie Raumschiffe, Roboter, Zeitreisen oder neue Erfindungen.
Fantasy erzählt oft von magischen Welten mit Zauberern, Drachen oder anderen Fabelwesen.
Alles, was passiert, wird mit Technik oder Wissenschaft erklärt – auch wenn es diese Dinge heute noch nicht gibt.
Statt Technik gibt es hier Magie, Zaubersprüche oder magische Gegenstände.
Meine fantastische Reise um die Welt – Begib dich auf die Spuren von Jules Verne! Wähle ein Transportmittel aus und schreibe ein Erlebnis mit diesem auf! Tauscht eure Geschichten mit eurer Sitznachbarin oder eurem Sitznachbarn und überprüft anhand der Checkliste von S. 141! Gebt euch gegenseitig ein Feedback!





















Zeitmaschinen sind fiktive Maschinen, mit denen man Reisen durch die Zeit vornehmen kann. Sie sind ein beliebtes Thema der Science-Fiction-Literatur und kommen oft in Serien, Filmen und Büchern vor.
Was ist was? Ordne folgende Angaben den Fotos zu!
1. Der 1895 erschienene Roman von Herry George Wells „Die Zeitmaschine” ist ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Er ist die erste Beschreibung einer Zeitreise in die Zukunft mit Hilfe einer Zeitmaschine. H. G. Wells Roman wurde 1960 zum ersten Mal verfilmt. Die Neuverfilmung „The Time Machine” entstand 2002.
2. In der Fernsehserie „Dr. Who” reist ein mysteriöser Zeitreisender mit einer Polizei-


Notrufzelle durch die Zeit. Diese Serie bekam sogar, als die bisher am längsten erfolgreich laufende Science-Fiction-Fernsehserie, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.
3. Die Filmtrilogie „Zurück in die Zukunft” handelt von einem Jugendlichen, der mit einer von einem befreundeten Wissenschaftler entwickelten Zeitmaschine Abenteuer erlebt.
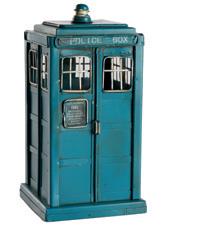



Wähle eine Zeitmaschine aus! Begib dich auf eine Reise in die Vergangenheit! Notiere dir Stichwörter und verfasse eine Fantasiegeschichte!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Gestalte hier zuerst ein Cluster zu dem Thema „Meine Traumreise“! Dann schreibe deine eigene fantastische Erzählung!

Du bist Captain eines Raumschiffes im Jahre 3051. In den unendlichen Weiten des Weltalls nähert ihr euch einem unbekannten Ziel. Zeichne zuerst ein, was du als erstes erblickst! Dann schreibe eine fantastische Erzählung, in der du schilderst, was du alles mit deiner Crew erlebst!





…Ideen zu einer Fantasiegeschichte sammeln. (1)
…nach Bildern eine Fantasiegeschichte schreiben. (2)
„Der kleine Hobbit“ von John Ronald Reuel Tolkien INHALT: Vorbei ist es mit dem beschaulichen Leben von Bilbo Beutlin, als er sich auf eine Reise begibt, die ihn quer durch Mittelerde führen wird. Er lässt sich vom Zwergenkönig Thorin als Meisterdieb unter Vertrag nehmen und verpflichtet sich, den Zwergen bei der Rückgewinnung ihres geraubten Schatzes zu helfen. Auf seiner abenteuerlichen Reise gelangt Bilbo in den Besitz eines Ringes, den er später an seinen Neffen Frodo weitergibt. Auszug im Leseteil auf S. 70

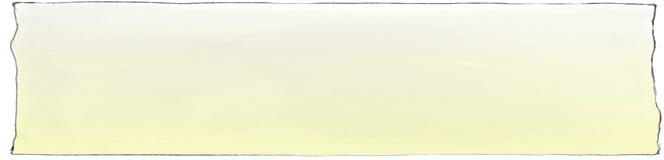


„Caraval“ von Stephanie Garber
INHALT: Scarlett und ihre Schwester Tella leben unter der Tyrannei ihres gewalttätigen Vaters auf der Insel Trisda. Sie erhalten eine Einladung zum mysteriösen Spiel Caraval und fliehen mit Hilfe des rätselhaften Julian. In Caraval verschwindet Tella plötzlich, und Scarlett muss sie finden. Sie taucht in eine Welt voller Magie, Rätsel und Gefahren ein, wo Realität und Illusion verschwimmen. Scarlett entdeckt verborgene Wahrheiten und ihre eigene Stärke.




„Brunnengeister – Ich verspreche dir alles, was du willst …“ von Christian Handel

AUSZUG: „Wenn das hier ein Wunschgeist ist …“, murmelte sie, „dann ist das …“ „… ein Wunschbrunnen.“ Klaas klang jetzt ganz ehrfürchtig. Sie ließen von der Krötenstatue ab und marschierten hinüber. Gänsehaut bildete sich auf Linas Unterarmen. Ob aus Angst oder vor Aufregung, hätte sie nicht zu sagen gewusst. Ihr Herz schlug schnell in ihrer Brust, ihre Handfläche begannen zu schwitzen, doch sie konnte nicht anders. Sie musste zum Brunnen. Sprich niemals einen Wunsch aus, hörte sie die Stimme ihrer Mutter, eindringlich und mit einem Hauch von Furcht. Niemals, Lina, hörst du?




„Time Riders –Wächter der Zeit“ von Alex Scarrow KOMMENTAR: Jasemin (13 J.)
Die Geschichte ist wirklich fantastisch: Liam O'Connor hätte 1912 an Bord der Titanic sterben sollen. Maddy Carter 2010 in einem Flugzeug über Amerika. Saleena Vikram 2026 bei einem Brand in Mumbai. Doch Sekunden vor dem Tod der drei taucht ein mysteriöser Mann auf und reicht ihnen die Hand – und nun sind sie Agenten einer streng geheimen Organisation, die nur eine Aufgabe hat: die Welt vor der Zerstörung durch Zeitreisende zu schützen.







HB 16: Höre dir den Anfang des Romans an! Dann erstelle deinen eigenen kurzen Kommentar zu diesem Buch!



Pro und Kontra: Was spricht dafür? Was spricht dagegen?
Immer dieses Handy!
Keiner passt mehr auf! Handys sofort weg!
Mein Profil auf Instagram ist doch super!
Cooles Spiel!



Mit dem Handy kann ich schneller rechnen!


Super, dass du anrufst, Mama! Ich will heute Pizza!

Wow, ist das fad! Gott sei Dank, hab’ ich ein Handy! Was gibt es Neues?


Notiere hier in Stichworten, für welche Aktivitäten du dein Handy verwendest!

Bildet Vierergruppen, vergleicht eure Aktivitäten! Stellt sie auf einem A4- Blatt in Cluster dar! Teilt eure Ergebnisse der Klasse mit!
Lies den kurzen Ausschnitt aus diesem Jugendbuch!
Florian Buschendorff
Kapitel 1:
„Lernen Sie so etwas in der Lehrerausbildung?“ Aaron war nicht zu Unrecht zum Klassensprecher gewählt worden. Er konnte Lehrern manchmal ordentlich einheizen. Er hatte den Mut, das auszusprechen, was die schweigende Mehrheit dachte.
„Herr Schmidt, das ist schon eine ziemlich durchgeknallte Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das wirklich durchziehen wollen.“
„Warum nicht?“, erwiderte Herr Schmidt ruhig. „Es ist doch ein interessantes Experiment. Nach zwei Wochen wird ausgewertet.“ „Aber wir sind nicht Ihre Versuchskaninchen!“, sagte Johanna. „Können Sie Ihr Experiment nicht mit einer anderen Klasse machen?“
„Nein, kann ich nicht“, antwortete Herr Schmidt. „Ihr seid meine Prüfungsklasse und ich möchte über dieses Experiment meine Abschlussarbeit schreiben. Außerdem lernt ihr dabei sicher eine ganze Menge.“
Aaron stand auf. Das tat er gern, wenn er zu Lehrern redete, um zum Ausdruck zu bringen, dass er für die ganze Klasse sprach.
„Lieber Herr Schmidt. Wir hatten ja schon zwei Referendare. Frau Euler zum Beispiel, letztes Jahr. Die hatte auch immer so lustige Ideen. Bei ihr mussten wir uns bei der Gruppenarbeit Papierhütchen aufsetzen. Und dann malte sie uns Teamsternchen auf die Dinger.“ Die Klasse lachte. Auch Herr Schmidt musste schmunzeln.
„Am Anfang fanden wir das ganz witzig und haben uns alles Mögliche gegenseitig auf die Hütchen gemalt. Aber dann fanden wir das ziemlich bald ziemlich bescheuert.“
„Wir sind schließlich keine Babys mehr“, sagte Johanna. „Wir können schon ganz gut selbst entscheiden, wie oft und wozu wir unser Handy benutzen.“
Aaron ging nach vorne und stellte sich neben Herrn Schmidt.


„Wir leben doch in einer Demokratie, Herr Schmidt“, sprach er weiter.
„Das haben Sie uns doch gerade beigebracht. Dann fragen Sie doch mal, wer überhaupt mitmachen will.“
Aaron wandte sich zur Klasse. „Also: Wer will bei dem Experiment von Herrn Schmidt mitmachen? Bitte melden!“
Aaron zeigte auf die schweigende Klasse. „Sehen Sie, Herr Schmidt? Niemand! Also lassen Sie uns doch einfach weiter ganz normalen Unterricht machen.“ ...
„Vielleicht stimmen wir noch einmal richtig ab“, sagte Herr Schmidt, „nachdem ich euch die Einzelheiten erklärt habe.“
In ruhigen Schritten ging er durch den Klassenraum. „Also ich brauche keine Details“, sagte Johanna. „Ich werde mein Handy mit Sicherheit nicht abgeben. Nicht für einen Tag und schon gar nicht für zwei Wochen.“
Amelie meldete sich, obwohl jetzt ohnehin alle durcheinanderredeten.
„Amelie!“, sagte Herr Schmidt.
„Also, ich finde, wenn Herr Schmidt das machen will, sollten wir ihn wenigstens mal ausreden lassen.“
„Schleimer!“, rief Tom.
auswerten: etwas in Hinblick auf seine Aussagekraft prüfen
Referendar: Begriff in Deutschland für einen Lehrer, der noch in Ausbildung ist
Diskutiert in der Klasse, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr auf euer Handy verzichten müsstet!
Markiere im Lesetext von S. 151, welche zwei Argumente Johanna und Aaron konkret gegen den Vorschlag des Lehrers vorbringen!
Formuliere in vollständigen Sätzen zwei Argumente, die der Lehrer anführen könnte, um für einen Verzicht auf das Handy im Unterricht zu plädieren!





Formuliere in ganzen Sätzen zwei Argumente, welche der Lehrer ins Treffen führen könnte, die für einen Verzicht auf das Handy im Unterricht sprechen!

Grundschule: Volksschule
Eine Entscheidung, die für Aufregung sorgt – Lies den Artikel rund um das Handyverbot an französischen Schulen!
In Frankreichs Schulen dürfen Schüler bis 15 Jahre ihre Handys nicht mehr auf dem Schulgelände oder auf Ausflügen benutzen. Vor allem Eltern kritisieren das Gesetz. Das französische Parlament hat ein erweitertes Verbot von Handys in Schulen beschlossen. Es verbietet grundsätzlich, Mobiltelefone in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I zu benutzen, wie der Radiosender France Info berichtete. Es betrifft Kinder und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren. Gymnasien haben die Möglichkeit, ebenfalls ein Handyverbot einzuführen, eine Pflicht besteht dort aber nicht. ...
Die Idee des Verbots ist, dass sich Schüler ohne Ablenkung durch Handys in der Schule besser konzentrieren können sollen. Auch Mobbingfälle, in denen mit Handys auf dem Schulhof gefilmt wird, wie Kinder verprügelt werden, sollen damit ausgeschlossen werden. Neu ist die Idee des Handyverbots nicht: Schon seit 2010 gibt es im Schulgesetz einen Artikel, der Handys an allen Grundschulen und im weiterführenden Collège im Schulgebäude verbietet. Nur waren bisher die Pausenhöfe von der Regelung ausgeschlossen. Neben Handys sind auch Tablets und Smartwatches in allen Schul-
Collège: höhere Schule in Frankreich
Smartwatch: am Handgelenk getragener Minicomputer
räumen und bei Schulausflügen verboten. Ausnahmen gibt es, wenn das Gerät für den Unterricht selbst gebraucht wird, aber auch für Kinder mit Behinderung. Vor allem Eltern kritisieren den Vorstoß. Sie sind es inzwischen gewohnt, ihre Kinder immer erreichen zu können. Wenn sich die Nachmittagsplanung ändert, sollen die Kinder informiert werden können. Manche Eltern wollen ihre Kinder auch in der Pause unterstützen, falls diese gemobbt werden.
Fraglich ist auch die Umsetzung des umfassenden Verbots. Ob Lehrer jeden Morgen alle Handys konfiszieren sollen, ist noch unklar.
a) Welche Altersgruppe ist vom Handyverbot betroffen?
von ________ bis _________ Jahren
b) Wo muss das Handy ausgeschaltet sein?
e) Welche Geräte sind neben dem Handy ebenso verboten? f) Welche zwei Ausnahmeregelungen gelten trotz Handyverbot?
c) Für welche Schulform gilt das Verbot nicht?
d) Wer hat das Verbot beschlossen?
g) Wer ist in Frankreich gegen das Handyverbot an Schulen?
Lies nun den zweiten Artikel, der ein Handyverbot an Schulen in Österreich thematisiert!

von Rosa Schmidt-Vierthaler
In Österreich regeln die Schulen in ihrer Hausordnung, ob die Kinder am Handy hängen dürfen oder nicht. Mut würde sich hier auszahlen.
... In Österreich gibt es keine generelle Regelung dazu, wann und wo die Kinder ihre Handys benutzen dürfen, die Schulen regeln das in der Hausordnung. In den Volksschulen ist die Sache meist noch ein geringeres Problem, erst bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen nimmt der Konsum überhand. Und oft sind es gerade die Eltern, die gegen ein Handyverbot in „ihrer“ Schule auftreten: Sie wollen ihre Kinder jederzeit erreichen können und sehen die Probleme oft nicht, die durch übermäßigen Handykonsum entstehen.
Dabei werden Psychologen nicht müde, zu verkünden, dass weniger mehr ist. Dass Kinder „analog“ miteinander spielen sollen, dass immer mehr von ihnen suchtgefährdet sind. Studien zeigen, wie sehr
analog spielen: bedeutet, ohne Computer zu spielen
profitieren: einen Nutzen aus etwas ziehen
Autonomie: Selbstständigkeit
die ständige Kommunikation Kinder und Jugendliche stresst. Eine Studie der London School of Economics belegt auch, dass in handyfreien Schulen besser gelernt wird und besonders Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen profitieren.
Man muss aber kein Experte sein, um zu wissen: Kinder brauchen Pausen, um gut lernen zu können. Pausen, in denen sie sich bewegen. Pausen, in denen sie essen. Pausen, in denen sie miteinander spielen oder sich unterhalten.
Wenn es auch unwahrscheinlich und im Sinne der Schulautonomie unnötig scheint, dass Österreichs Regierung so vehement vorgeht wie die französische – nämlich ein komplettes Handyverbot in Schulen für Kinder, die unter 15 Jahre alt sind, zu erwirken –, so kann man doch nur den einzelnen Schulen Mut zusprechen, dies autonom zu tun und die Eltern auf ihre Seite zu ziehen. Immerhin schaffen die Schulen es ja auch, Softdrink-Automaten zu verbannen.
In Diskussionen gibt es immer PRO- und KONTRA-Behauptungen.

PRO:
Behauptungen FÜR etwas
KONTRA:
Behauptungen GEGEN etwas

Um in einer Diskussion überzeugend zu wirken, ist es wichtig, starke Argumente zu sammeln und vorzubringen. Die folgenden Punkte zeigen dir, wie du das schaffst.

Lies Bücher, Artikel oder schaue Videos zum Thema. Je mehr du weißt, desto besser kannst du argumentieren. Es ist wie bei einem Spiel – je mehr Karten du hast, desto besser kannst du spielen.
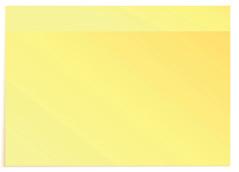
Schreib's auf
Manchmal hilft es, deine Gedanken und Argumente aufzuschreiben. So kannst du sie besser organisieren und behältst den Überblick.
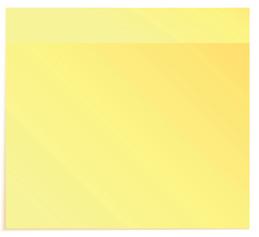
Beispiele sind wie Beweise für deine Argumente. Sie zeigen, dass das, was du sagst, auch in der echten Welt passiert. Suche nach Geschichten oder Fakten, die zeigen, dass deine Argumente stimmen.
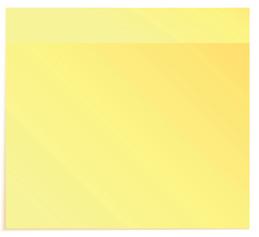

Rede mit anderen
Diskutiere mit Freunden oder Familie über das Thema. Das hilft dir, deine Argumente zu testen und zu sehen, was gut funktioniert und was nicht.
Jedes Argument stichhaltig
Beginne mit deiner Behauptung (was du denkst), nenne dann eine Begründung (warum du das denkst) und zeige zum Schluss einen Beleg (einen Beweis oder ein Beispiel, dass deine Begründung stimmt).
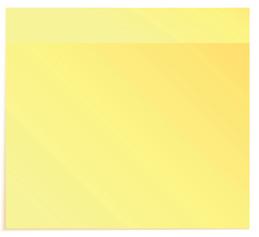
Versteh die andere Seite
Denk darüber nach, was andere gegen deine Argumente sagen könnten. Wenn du darauf gute Antworten hast, bist du noch stärker in Diskussionen. Es ist wie beim Schach – du denkst schon ein paar Züge voraus.
Unterstreiche in den Artikeln auf S. 152 und auf S. 153 die PRO- und KONTRA-Behauptungen in den passenden Farben!
PRO-Behauptung: sprechen für ein Handyverbot
KONTRA-Behauptung: sprechen gegen ein Handyverbot
Handyverbot an Schulen – Ja oder nein? Wie du ein Argument aufbaust, erfährst du hier!
a) Erstelle zuerst in deinem Heft eine Tabelle!
b) In diese trägst du zuerst die Behauptungen, die dafürsprechen (PRO), mit einer passenden Begründung mit „weil“ ein!
c) Dann überlegst du dir Behauptungen, die dagegensprechen (KONTRA) und fügst Begründungen ein!
d) Verwende auch passenden Satzanfänge!

1. Behauptung: Ein Handyverbot hilft, gegen Mobbing in der Schule vorzugehen, ...
Begründung: ...weil es die Möglichkeit des Mobbings durch Fotos und Videos einschränken würde.
SATZANFÄNGE

Für ... spricht, dass…
Außerdem kommt hinzu, dass…
Ein Argument dafür ist...
Hinzu kommt, dass...
Ebenso zeigt sich, dass...
3-B-Schema für gute Argumente
Behauptung
Begründung
Beleg (Beispiel) G G
1. Behauptung: Außerdem würde es die persönliche Freiheit einschränken, ...
Begründung: ...weil kein Schüler/keine Schülerin dann mehr selbst entscheiden kann, was er/sie tun will.
SATZANFÄNGE

Gegen ... spricht...
Ein weiteres Argument dagegen ist...
Dagegen spricht, dass…
Andererseits weiß man, ...
Außerdem...
e)Um deiner Behauptung mehr Nachdruck zu verleihen, hilft es, Beispiele als Belege anzuführen. Finde deshalb zu jeder deiner vorgebrachten Behauptungen ein Beispiel!
Beleg: So berichten auch die Medien davon, dass Gewaltszenen auf Schulhöfen gefilmt werden, um sie dann in das Internet zu stellen.
Beleg: Durch ein auferlegtes Handyverbot ist es mir nur schwer möglich, den richtigen Umgang damit zu erlernen...
Rollenspiel-Handynutzung: Bildet zu dritt eine Gruppe und erarbeitet kurze Szenen zu diesen Fotos! Präsentiert dann eure Ergebnisse vor der Klasse!


Gesprächsregeln helfen immer: Denke an ein gelungenes Gespräch, das du einmal geführt hast! Schreibe auf, weshalb du glaubst, dass es dir gelungen ist!
Ich habe
Setze in der Wörterschlange Trennlinien und erkenne die Gesprächsregeln! Schreibe sie in dein Heft! Achte dabei auf die Groß- und Kleinschreibung und setze die passenden Satzzeichen!
SICHMELDENWENNEINBEITRAGERWÜNSCHTISTAUFDENVORREDNERB EZUGNEHMENINVOLLSTÄNDIGENSÄTZENSPRECHENBEIMREDENDIEA NDERENANSCHAUENLAUTUNDDEUTLICHSPRECHENDASWORTANAN DEREWEITERGEBENBEIMTHEMABLEIBENAUFFRAGENEINGEHENNIEMA NDENAUSLACHENODERHERABSETZENMEINUNGENUNDBEHAUPTUNG ENBEGRÜNDENGUTZUHÖRENDIESCHWEIGERZUMSPRECHENERMUTI
GENNEBENGESPRÄCHEVERMEIDEN
Talkshow: Veranstaltet eine Talkshow zu diesem Thema!
„Soll ein Handyverbot an Schulen in Österreich eingeführt werden?“
r Bestimmt zuerst einen Moderator oder eine Moderatorin!
r Bestimmt vier bis fünf Personen, die im Fernsehstudio bei der Talkshow auftreten!
r Die anderen in der Klasse sind das Publikum und dürfen, wenn sie vom Moderator oder der Moderatorin aufgerufen werden, auch mitdiskutieren.
r Schildert dort eure Erfahrungen, sprecht für oder gegen das Handyverbot!
Tipp: Folgende PHRASEN (= Formulierungen) helfen euch bei jeder Diskussion!
Ich möchte betonen/hervorheben, dass...
Besonders wichtig aber erscheint, ...
Man darf auch nicht übersehen, dass...
Entscheidend ist jedoch, ...
Außerdem spielt noch...
eine wichtige Rolle, ...
Allerdings muss man auch sehen, dass...
Weitaus wichtiger ist aber noch, ...
Wie bereits erwähnt, ...

Wie bereits beschrieben, ...
Ich bin der Meinung, dass...
Ich vertrete den Standpunkt, dass...
Meiner Einschätzung nach...
Die stumme Diskussion: Wie so etwas funktioniert, erfährst du, wenn du der Anleitung folgst!
a) Dein Sitznachbar oder deine Sitznachbarin soll dein Diskussionspartner sein!
b) Lege ein A4-Blatt auf den Tisch! Auf dieses notiere in der Mitte eine Fragestellung, über die ihr diskutieren wollt!
c) Jeder von euch nimmt nun einen Stift in einer anderen Farbe! Der Erste beantwortet z. B. mit einem roten Stift die Frage mit einem Argument (3-B-Schema), der Zweite macht dies mit einem grünen Stift.
d) Dann geht ihr auf die Antwort des jeweilig anderen ein: Entweder kommentierst du diese (Beispiel anführen) oder du stellst eine neue Frage mit deinem Farbstift!
e) Die Diskussion geht so lange, bis euch die Argumente ausgehen!

Geht durch das Fotohandy die Privatsphäre verloren?
Nimmt die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen durch Gewaltszenen im Internet zu?
2



Führt die ständige Verwendung von Social Media zu einem Verlust der Kommunikationsfähigkeit?
Ein schwerer Konflikt: Ein schwerer Konflikt: Sieh dir die Bildfolge an! Wähle aus der Liste ein Thema, zu dem Jan mit seinen Eltern eine Diskussion führen könnte! Notiere, was Jans Mutter ihn fragen könnte!
Verbot bestimmter Freunde Im Haushalt helfen Für das Taschengeld arbeiten
Höhe des Taschengeldes Urlaubsplanung Nutzungszeiten des Internets




Nimm nun zu deiner Frage Stellung! Erstelle dazu in deinem Heft eine Pro- und Kontra-Liste! Dann finde jeweils drei bis vier Behauptungen, die dafür oder dagegen sprechen und formuliere auch Begründungen mit Beispielen!
Das Adverb (das Umstandswort)
Adverbien … beschreiben Umstände
… sagen, wann, wo, wie oder warum etwas geschieht
… beziehen sich immer auf das Verb
… bleiben in ihrer Grundform, werden also nicht dekliniert
Beispiele: Ich treffe mich morgen mit meinen Freunden im Park.
Meine Schlüssel liegen oben auf dem Regal.
Sie hat die Nachricht gern überbracht.
Der Zug hatte Verspätung, folglich kam er zu spät.
MERKE:
Adverbien sind im Satz entweder ein eigenes Satzglied oder werden als Attribut verwendet.

Temporaladverbien geben einen Zeitpunkt, eine zeitliche Dauer oder eine Wiederholung an. Sie geben Antworten auf die Fragen: Wann? Wie lange? Wie oft?
Wann? abends, jetzt, später, damals, heute ...
Wie lange? bisher, immer, seitdem ...
Wie oft? manchmal, selten, häufig ...
Unterstreiche in folgenden Beispielsätzen von Jonas alle Temporaladverbien!
Vorhin diskutierten wir in der Klasse über ein Handyverbot an unserer Schule. Wir konnten uns bisher nicht einig werden. Ich frage mich, ob wir uns jemals einigen werden? Oftmals bin ich nicht der Meinung meiner Eltern. Dann halten sie mir sofort einen langen Vortrag darüber, dass ich keine Ahnung hätte. Erst gestern meinten sie, dass ich uneinsichtig und noch viel zu unerfahren sei, um das auch nur annähernd verstehen zu können. Schon bald werde ich ihnen das Gegenteil beweisen.
Das Lokaladverb (Umstandswort
Wo? dort, oben, hier, mitten, unten ...
Woher? daher, dorther ...
Wohin? dahin, aufwärts, hierhin/hierher ...

Lokaladverbien geben einen Ort, die Herkunft oder ein Ziel an. Sie antworten auf die Fragen: Wo? Woher? Wohin?
2
Kreise das jeweils passende Adverb ein!
Dahinter/Daher/Mitten stehe ich. Deine Meinung ist heute dr außen/oben/hier gefragt.
Dort/Rechts/abwärts musst du die Gesprächsregeln für eine Diskussion beachten.
Du kannst sie innen/von oben/oben nachlesen. Haben wir uns erstmal geeinigt, geht es nur noch abwärts/aufwärts/seitwärts. Daher/Dorther/Hierher hast du das also!
Modaladverbien geben die Art und Weise, wie etwas getan wird, an. Sie antworten auf die Fragen: Wie? Auf welche Weise? Mit wem?
Wie? sehr, kaum, äußerst, ziemlich, …
Auf welche Weise? anders, irgendwie, teilweise, so, …
Mit wem? allein, gemeinsam, zusammen, getrennt, …
Setze die Modaladverbien passend ein!

Die Schülerin lernte die Vokabeln _______ schnell, indem sie Karteikarten nutze. Da der Jongleur die Bälle _________ in die Luft warf, fielen alle zu Boden. Er ging __________ in den Park, um nachzudenken.
Die Familie verbrachte den Abend ________________ und sah sich einen Film an. Ich bin mit meinen Noten _________ zufrieden.
Kausaladverbien geben Gründe oder Ursachen an. Sie antworten auf die Fragen: Warum? Weshalb? Weswegen?
Warum? Weshalb? darum, deshalb, daher, wegen, somit, … Weswegen? infolgedessen, demzufolge, folglich, also, …
Verbinde die Satzteile und schreib die Sätze auf! Markiere die Kausaladverbien!
sehr M zusammen M irgendwie M allein M teilweise 3 4
Ich war müde darum fragen wir sie um Rat.
somit nehmen wir an, er kommt nicht.
Es hat die ganze Nacht geregnet deshalb ging ich früh ins Bett. Sie ist die Expertin auf diesem Gebiet,
Er hat nicht geantwortet, daher sind die Straßen nass.
Kreuze richtig an!

Mit „Wie lange?“ erfragt man das …
O Umstandswort des Ortes
O Umstandswort der Zeit
O Umstandswort des Grundes
O Umstandswort der Art und Weise
Mit „Woher?“ erfragt man das …
O Umstandswort des Ortes
O Umstandswort der Zeit
O Umstandswort des Grundes
O Umstandswort der Art und Weise

O Umstandswort des Ortes
O Umstandswort der Zeit
Mit „Warum?“ erfragt man das …
O Umstandswort des Grundes
O Umstandswort der Art und Weise

Mit „Mit wem?“ erfragt man das …
O Umstandswort des Ortes
O Umstandswort der Zeit
O Umstandswort des Grundes
O Umstandswort der Art und Weise

Welches Wort ist ein Adverb?
Welches Wort ist
KEIN Adverb?
Welches Adverb passt NICHT in die Reihe?
O WIR
O WOLLEN
O LINKS
O SUCHEN
O JETZT
O ÖFTER
O HIER
O SEIN
O JETZT
O SOFORT
O GLEICH
O HIER
Welches Wort ist ein Adverb?
Welches Wort ist
KEIN Adverb?
Welches Adverb passt NICHT in die Reihe?
O GLÜCKLICH
O WIRST
O DU
O DORT
O ADVERBIEN
O OBEN
O UNTEN
O ÜBERALL
O DA
O DAHIN
O HIER
O DAMALS
Die s-Schreibung
Für die richtige Schreibweise von s, ss und ß gibt es bestimmte Regeln. Dein Gehör und deine Aussprache können dir bei der richtigen Anwendung dieser Regeln helfen. Besonders wichtig ist es, dass du dafür zwischen lang und kurz gesprochenen Vokalen (Selbstlauten) und stimmhaftem und stimmlosem s unterscheiden kannst.
Ein kurzer Vokal klingt abgehackt.
Ein langer Vokal klingt ausgedehnt.

Sprich die Wörter laut aus! Setze unter alle markierten Vokale einen „ “, wenn er lang und einen „ . “, wenn er kurz ausgesprochen wird!
VaterfallenModemalenMilchSonnesenden
Zur Überprüfung kannst du deine Hand unter das Kinn legen. Senkt es sich beim Sprechen des Vokals, ist dieser kurz. .
rechnenlinksSchildTafeltankenBlödsinnrufen
nichtNotenschwimmenDotterDoseparkenRatte
Erkennst du eine Regelmäßigkeit? Schreibe sie auf!
Stimmhaftes und stimmloses s:
Das stimmhafte s wird weich gesprochen.
Es klingt ein wenig wie das Summen einer Biene.

Das stimmlose s wird hart und scharf ausgesprochen.
Es klingt ein wenig wie das Zischen einer Schlange.
Zur Überprüfung kannst du zwei Finger auf deinen Kehlkopf legen.
Ist das s stimmhaft, spürst du eine Vibration im Kehlkopf.
Geht in Zweiergruppen zusammen und lest euch die Wörter vor! Kreuzt die passenden Antworten an!


Stimmhaftes s JANEINStimmloses s JANEIN reisenreißen
Welche Regel erkennst du? Notiere sie!
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Lest gemeinsam die folgenden Wörter und markiert alle s-Laute! Überlegt, welche Regelmäßigkeiten euch auffallen und notiert sie!
Stellt eure Erkenntnisse der Klasse vor!
Zur Erinnerung:
TIPP: Achte auch auf lange und kurz gesprochene Vokale und stimmhafte und stimmlose s!


Vokale: a, e, i, o, u Umlaute: ä, ö, ü Konsonanten: b, c, d, f, g, h, … Zwielaute: ai, au, äu, ei, eu ACHTUNG: ie gehört nicht zu den Zwielauten, da es als einzelner Laut (langer Vokal) ausgesprochen wird!
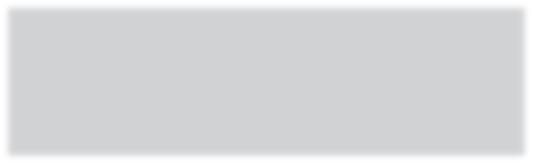
MERKE: Wenn keine Regel zutrifft, ist ein einfaches s der Normalfall.
1
Ein stimmhafter s-Laut wird immer mit einem einfachen s geschrieben.
D Hose, reisen, …
Bist du dir unsicher, verlängere das Wort, um zu hören, ob der s-Laut stimmhaft ist.
D Gras – Gräser
Ein stimmloser s-Laut kann mit s, ss oder ß geschrieben werden.
2Nach einem kurz gesprochenen Vokal wird meistens ss geschrieben.
D lassen, Fluss, …
3Nach einem kurz gesprochenen Vokal wird ein s geschrieben, wenn danach ein Konsonant folgt.
D Mist, knusprig, …
4Nach einem lang gesprochenen Vokal wird meistens ein ß geschrieben.
D Fuß, Straße, …
5Nach einem Diphthong steht meistens ein ß.
D Fleiß, außen, …
AUSNAHMEN: aus, hinaus, raus, heraus
ACHTUNG: Ist der s- Laut in der Wortverlängerung stimmhaft, dann ebenfalls nicht.
D Maus – Mäuse

Ordne die Wörter von Ü4 den passenden Regeln zu! Trage sie in die Tabelle ein!

Stamm- und Lautprinzip

Deklinierst du starke Verben, dann gilt entweder das Stamm- oder das Lautprinzip. Als Regel kannst du dir merken: Das Lautprinzip steht über dem Stammprinzip!
Beispiele: lesen – las – gelesen D Der Stammvokal wird sowohl bei „lesen“ als auch bei „las“ lang gesprochen, daher bleibt das s! D Stammprinzip
fließen – floss – geflossen D Der Stammvokal wird bei „fließen“ lang, aber bei „floss“ kurz gesprochen, daher verändert sich die s- Schreibung! D Lautprinzip
Überlege dir je zwei Verben zum Stamm- und zwei zum Lautprinzip! Schreibe sie auf!
Stammprinzip:
Lautprinzip:
Suche dir aus jeder Spalte aus Ü5 zwei Wörter aus! Bilde damit Sätze und schreib sie auf!
Wähle dir eine Partnerin oder einen Partner! Diktiert euch die Wörter von Ü5 und kontrolliert gegenseitig!
1
Ordne den Behauptungen mit Pfeilen die passenden Begründungen zu!
Handys sollten in der Schule verboten werden,
Soziale Netzwerke sind nützlich,
Handys sollten in der Schule erlaubt sein,
Respektvoller Umgang in Diskussionen ist wichtig,
Bei Streitgesprächen gut zuzuhören ist notwendig,
Der Turnunterricht sollte mehr Stunden bekommen
weil man dadurch lernt, verantwortungsvoll damit umzugehen.
weil ich den anderen dadurch verstehen kann.
weil dort Informationen schnell verbreitet werden können.
weil dadurch weniger Cybermobbing entsteht.
weil viele Jugendliche in ihrer Freizeit oft nur noch am Computer sitzen.
weil man auch von Meinungen anderer etwas lernen kann.
2
Verfasse zu den folgenden Behauptungen Begründungen und gib auch einen Beleg dazu an!
Rauchen ist gefährlich, _______________________________________________________________________
Beleg:
Smartphones können wichtig für den Unterricht sein, _____________________________________________
Beleg:
An allen Schulen sollten Schuluniformen eingeführt werden,
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Ordne die Adverbien den passenden Fragewörtern zu!

Wann?
Wie lange?
Wie oft?
Wo?
Woher?
Wohin? Wie? Mit wem? Warum?
bald M daher M dorther M allein M ziemlich M dorthin M draußen M zusammen M besonders M darum M gestern M hierher M hinein M hinten M kaum M immer M manchmal M meistens M nun M auswärts M gemeinsam M sehr M deshalb M demnächst M stets M überall M irgendwo

Setze die Adverbien passend ein!

Deshalb M gestern M dort M sehr M besonders M daher M bald M hier
1. Wir trafen uns _________ zum Mittagessen.
2. Der Schlüssel liegt __________ auf dem Tisch.
3. Er arbeitet _____________ schnell.
4. Es hat die ganze Nacht geregnet, ____________ ist der Boden nass.
5. Sie sprach __________ leise, um niemanden zu wecken.
6. Sie hat das Buch ___________ fertiggelesen.
7. Wir treffen uns ___________ am Eingang.
8. Sie war sehr müde, _____________ ging sie früh ins Bett.
6
Schreib die Adverbien der Sätze von Ü4 zur passenden Adverbiengruppe!
Umstandswörter der Zeit:
Umstandswörter der Art und Weise:
Umstandswörter des Grundes:
Umstandswörter des Ortes:
Setze „s, ss, ß“ richtig ein!
Handy___ werden haupt___ächlich für Kommunikation und Unterhaltung verwendet, aber ihre Funktionen gehen weit darüber hinau___. Studien haben gezeigt, da___ soziale Medien auf dem Handy da___ Kaufverhalten der Nutzer beeinflu___en können.
Ein Kompromi___ bei der Bildschirmzeit könnte der Schlü___el sein, um sowohl die Bedürfni___e der Jugendlichen als auch die Sorgen der Eltern zu berück___ichtigen.
Nach der Einführung neuer Datenschutzrichtlinien zeigten sich viele Nutzer mehr an den Ma___nahmen intere___iert, die ihre per___önlichen Informationen schützen.
Ich kann…
…einer Behauptung die passende Begründung zuordnen. (1)
…zu einer Behauptung sowohl eine passende Begründung als auch einen passenden Beleg formulieren. (2)
…Adverbien den passenden Fragewörtern zuordnen. (3)
…Adverbien sinnvoll einsetzen. (4)
…Adverbien den passenden Adverbiengruppen zuordnen. (5)
…s, ss und ß richtig einsetzen. (6)




Diese Tabelle soll dich dieses Jahr begleiten. Immer, wenn du etwas Neues in der Grammatik lernst, trage es samt Beispielen gewissenhaft in diese Tabelle ein!

FACHBEGRIFF BEISPIEL(E)

Diktate für das ganze Jahr! Wie jedes Jahr hast du hier die Möglichkeit zu üben. So wirst du zum Rechtschreibmeister/zur Rechtschreibmeisterin.
So geht’s ...
a) Lass dir die Diktate von jemandem ansagen (Eltern, Freund/innen, Mitschüler/innen...)!
b) Du kannst auch die Texte oder Wörter alleine üben, indem du sie mit deinem Handy selbst aufnimmst und abspielst oder
c) ein Laufdiktat oder Dosendiktat machst!
A. verrückter Professor * Vorsilben auf der Vorderseite * fast vorbei * viele Veilchen fielen um * vorher vergleichen * eventuell folgen * Verse verstehen * Vitamine vergessen * Falten finden * Ferngespräche führen * vielleicht verspeisen * Vorträge an der Universität * anfangs vegetarisch * vergleichsweise einfach * Feste feiern

B. katastrophale Fremdwörter * ferne Atmosphären * fantastische Physik * triumphale Trophäen * phänomenale Euphorie * flüssiger Phosphor * fesche Aphrodite * alphabetisch Phrasen ordnen * Apostrophe setzen * philosophische Phasen * orthografische Verbesserungen * auf Asphalt verzichten * fortschrittliches Mikrofon

elektronische Unterhaltungsmedien nutzen * das Smartphone als Suchtfaktor für viele Jugendliche * Körperliche Aktivitäten verlieren an Bedeutung. * User nutzen elektronische Geräte parallel. * Soziale Medien verändern unseren Alltag. * Abhängigkeit von der Aufmerksamkeit und Bestätigung virtueller Freunde entsteht. * Durch die tägliche Nutzung des Internets wird die Umwelt anders wahrgenommen. * Virtuelle Welten bergen Gefahren. * Durch eine Registrierung wird der Anbieter medialer Dienste berechtigt, Daten an andere Firmen weiterzugeben. * sinnvollen Umgang mit den Medien lernen * Blogs erstellen * mit dem Computer E-Mails schreiben * Man chattet und surft tagelang im Internet. * Klicke das offene Fenster auf dem Bildschirm weg!
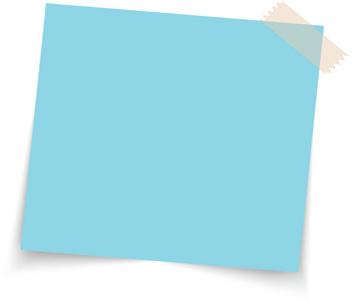
A. adäquat * Aggression * Allee * Armee * Asyl * Chaos * Diskussion * Event * flexibel * Gelee * Hobby * Hygiene * Ingenieur * Journal * Kassette * Montage * Methode * Niveau * Pyramide * Qualität * relevant * Rhetorik * Rhythmus * Saison * Shampoo * Strophe * suspekt * Thema * Tradition


alarmieren * das Alibi * beschatten * beteuern * der Betrüger * das Detail * der Detektiv * die Fahndung * festnehmen * der Fingerabdruck * flüchten * das Gefängnis * der Inspektor * der Kommissar * kriminell * das Motiv * das Phantombild * die Polizei * der Täter * das Verbrechen * das Verhör
B. Ambition * Apotheke * Attacke * Bibliothek * Buffet * Debatte * drastisch * dynamisch * Effekt * Export * Funktion * grandios * Illustration * Jubiläum * Konkurrenz * konsumieren * Kritik * Labyrinth * luxuriös * obligatorisch * parallel * Prestige * Produkt * Prognose * Reklame * relativ * Reparatur * Risiko * Sympathie * Temperatur

anstatt * endgültig * endlich * entsetzt * gewandt * laufend * ihr seid * seit heute * der Staat * die Stadt * der Tod * todernst * die Todesfurcht * todesmutig * der Todfeind * todkrank * tödlich * tot sein * totärgern * der Tote * totenstill * totschweigen * die Verwandtschaft * die Werkstatt
gestern Abend * im Laufe des Vormittags * vormittags * heute * gegen Mittag * des Nachts * nachts * jeden Tag * täglich * früh am Morgen * frühmorgens * montags * am Sonntagabend * morgen Nachmittag * spätabends * übermorgen im Allgemeinen * im Grunde * im Voraus * des Weiteren * im Dunkeln tappen * im Besonderen * im Großen und Ganzen * im Folgenden * im Klaren sein * im Einzelnen * auf dem Laufenden sein * des Öfteren * alles Übrige * zu guter Letzt
hauptsächlich * riesig * lösen * grundlos * Ansicht * bedeutsam * beweisen * insbesondere * meistens * Ergebnis * Gesichtspunkt * ebenso
SS beeinflussen * Kenntnisse * wissen * lassen * Diskussion * Abschluss * Kompromiss * vergessen * schlussendlich * sich befassen * Interesse * zusammenfassen * umfassen ß

Äußerung * maßgeblich * sinngemäß * anschließend * bloß * Maßnahme * gemäß * anmaßen * außerordentlich * außerdem * schließlich * dermaßen * begrüßen
Modalverben im Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur
müssenPräsensPräteritumPerfektPlusquamperfektFutur ichmussmusstehabe...müssenhatte...müssenwerde...müssen dumusstmusstesthast...müssenhattest...müssenwirst...müssen er/sie/esmussmusstehat...müssenhatte...müssenwird...müssen wirmüssenmusstenhaben...müssenhatten...müssenwerden...müssen ihrmüsstmusstethabt...müssenhattet...müssenwerdet...müssen siemüssenmusstenhaben...müssenhatten...müssenwerden...müssen
PartizipIIgemusst
Beispiel: Präsens: Ich muss das Buch noch zu Ende lesen Verbklammer
sollenPräsensPräteritumPerfektPlusquamperfektFutur ichsollsolltehabe...sollenhatte...sollenwerde...sollen dusollstsolltesthast...sollenhattest...sollenwirst...sollen er/sie/essollsolltehat...sollenhatte...sollenwird...sollen wirsollensolltenhaben...sollenhatten...sollenwerden...sollen ihrsolltsolltethabt...sollenhattet...sollenwerdet...sollen siesollensolltenhaben...sollenhatten...sollenwerden...sollen
PartizipIIgesollt
Beispiel: Präteritum: Ich sollte das Buch noch zu Ende lesen.
dürfenPräsensPräteritumPerfektPlusquamperfektFutur ichdarfdurftehabe...dürfenhatte...dürfenwerde...dürfen dudarfstdurftesthast...dürfenhattest...dürfenwirst...dürfen er/sie/esdarfdurftehat...dürfenhatte...dürfenwird...dürfen wirdürfendurftenhaben...dürfenhatten...dürfenwerden...dürfen ihrdürftdurftethabt...dürfenhattet...dürfenwerdet...dürfen siedürfendurftenhaben...dürfenhatten...dürfenwerden...dürfen PartizipIIgedurft
Beispiel: Perfekt: Ich habe das Buch noch zu Ende lesen dürfen
Modalverben im Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur
PartizipIIgekonnt
Beispiel: Plusquamperfekt: Ich hatte das Buch noch zu Ende lesen können
wollenPräsensPräteritumPerfektPlusquamperfektFutur ichwillwolltehabe...wollenhatte...wollenwerde...wollen duwillstwolltesthast...wollenhattest...wollenwirst...wollen er/sie/eswillwolltehat...wollenhatte...wollenwird...wollen wirwollenwolltenhaben...wollenhatten...wollenwerden...wollen ihrwolltwolltethabt...wollenhattet...wollenwerdet...wollen siewollenwolltenhaben...wollenhatten...wollenwerden...wollen
PartizipIIgewollt
Beispiel: Futur: Ich werde das Buch noch zu Ende lesen wollen
mögenPräsensPräteritumPerfektPlusquamperfektFutur ichmagmochtehabe...mögenhatte...mögenwerde...mögen dumagstmochtesthast...mögenhattest...mögenwirst...mögen er/sie/esmagmochtehat...mögenhatte...mögenwird...mögen wirmögenmochtenhaben...mögenhatten...mögenwerden...mögen ihrmögtmochtethabt...mögenhattet...mögenwerdet...mögen siemögenmochtenhaben...mögenhatten...mögenwerden...mögen PartizipIIgemocht
Beispiel: Perfekt: Ich habe das Buch noch zu Ende lesen mögen
Partizip II: Wird das Modalverb als Vollverb verwendet, d. h. dass es kein weiteres Prädikat im Satz gibt, so werden das Perfekt und das Plusquamperfekt mit dem Partizip II gebildet.
Beispiel: So habe ich es gewollt.Das hatte ich gemusst. könnenPräsensPräteritumPerfektPlusquamperfektFutur ichkannkonntehabe...könnenhatte...könnenwerde...können dukannstkonntesthast...könnenhattest...könnenwirst...können er/sie/eskannkonntehat...könnenhatte...könnenwird...können wirkönnenkonntenhaben...könnenhatten...könnenwerden...können ihrkönntkonntethabt...könnenhattet...könnenwerdet...können siekönnenkonntenhaben...könnenhatten...könnenwerden...können
Regel 1: Zwischen zwei oder mehr Hauptsätzen stehen Beistriche.
MERKE: Einen Hauptsatz erkennst du daran, dass die Personalform des Verbs an zweiter Stelle oder an zweiter UND letzter Stelle steht.
Beispiel: Marie surft im Internet, ihre Schwester sieht in der Zwischenzeit fern
Regel 2: Wenn Hauptsätze durch „und“ oder „oder“ verbunden sind, kannst du selbst entscheiden, ob du einen Bestrich setzt.
Beispiel: Marie surft im Internet(,) und ihre Schwester sieht in der Zwischenzeit fern.
Regel 3: Bei den Konjunktionen „aber – denn – doch – sondern“ musst du zwischen den Hauptsätzen Beistriche setzen!
Beispiel 3: Marie surft im Internet, aber ihre Schwester sieht in der Zwischenzeit fern.
Regel 4: Gleichrangige Satzteile (wie Aufzählungen, die du dir mit einem „und“ verbunden vorstellen kannst) werden durch einen Beistrich getrennt. Gleiches gilt, wenn sie durch „aber“, „doch“, „sondern“, „daher“ usw. verbunden werden.
Beispiele: In meiner Wohnung habe ich einen Laptop, einen Fernseher, ein Radio.
Ich nutze häufig den Laptop, den Fernseher, aber auch das Radio gleichzeitig.
Regel 5: Kein Beistrich steht, wenn gleichrangige Satzteile durch „und“, „sowie“ oder „oder“ miteinander verbunden sind.
Beispiel: In meiner Wohnung habe ich einen Laptop und einen Fernseher sowie ein Radio.
Regel 6: Appositionen (Beisätze) und erklärende Einschübe werden durch Beistriche vom Hauptsatz getrennt.
Beispiel: Marie, meine große Schwester, surft ununterbrochen im Internet!
Regel 7: Anreden und Ausrufe werden durch einen Beistrich voneinander getrennt.
Beispiel: Marie, lege jetzt bitte endlich das Handy weg!
Regel 8: Es gibt Konjunktionen (als, dass, wenn, während, nachdem, bevor, weil, da, damit, ob, obwohl), die einen Gliedsatz einleiten und einen Beistrich verlangen.
MERKE: Einen Gliedsatz erkennst du daran, dass die Personalform des Verbs meist an letzter Stelle steht. Er kann niemals alleine stehen und wird zumeist von Konjunktionen (Bindewörtern) eingeleitet.
Beispiel: Marie legt ihr Handy nicht weg, obwohl ihre Mutter sie darum gebeten hat.
Regel 9: Zwischen Hauptsatz und Attributsatz steht ein Beistrich.
MERKE: Ein Attributsatz ist ein Gliedsatz, der das vorangegangene Nomen oder Pronomen näher bestimmt und mit einem (Relativ-)Pronomen (der, welcher usw.) eingeleitet wird. Wenn ein Attributsatz in einen Hauptsatz eingeschoben wird, dann wird er durch zwei Beistriche vom Hauptsatz getrennt.
Beispiel: Maries Handy, das noch ganz neu ist, legt sie keine Minute aus der Hand.
Regel 10: Eine erweiterte Infinitivgruppe mit „zu“ kann durch einen Beistrich getrennt werden.
ACHTUNG: Bei der Konjunktion „um ... zu“ muss immer ein Beistrich gesetzt werden.
Beispiele: Marie war überrascht(,) ihre Mutter so verärgert zu hören.
Marie legte ihr Handy dann doch aus der Hand, um ihre Mutter nicht noch mehr zu verärgern.
Im Vorgangspassiv steht die Handlung im Vordergrund.
Du kannst den Passivsatz mit den folgenden Fragesätzen erfragen: „Was passiert?“ (Gegenwärtiges), „Was ist passiert?“ (Vergangenes), „Was wird passieren?“ (Zukünftiges) Das Vorgangspassiv wird mit dem Hilfszeitwort „werden“ UND dem Partizip II gebildet.
Beispiele: wird festgenommen; werden ertappt
Das Vorgangspassiv kann in alle Zeitstufen gesetzt werden, indem du das Hilfszeitwort „werden“ in die entsprechende Zeitform setzt.
Präsens
Präteritum
Perfekt
Das Opfer wird bei dem Überfall leicht verletzt.
Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt
Das Opfer ist bei dem Überfall leicht verletzt worden.
Plusquamperfekt Das Opfer war bei dem Überfall leicht verletzt worden
Futur
Das Opfer wird bei dem Überfall leicht verletzt werden.
Das Zustandspassiv beschreibt den Zustand NACH einer Handlung.
Erklärung: Das Opfer wurde überfallen. Jetzt ist es verletzt. Der Überfall ist bereits geschehen – also die Handlung abgeschlossen.
Während des Überfalls wurde das Opfer verletzt. R Sein jetziger Zustand: Das Opfer ist verletzt. Es wird mit dem Hilfszeitwort „sein“ UND dem Partizip II gebildet.
Beispiele: ist bewiesen; sind verurteilt
Das Zustandspassiv kann ebenso in alle Zeitstufen gesetzt werden, indem du das Hilfszeitwort „sein“ in die entsprechende Zeitform setzt.
Präsens
Präteritum
Das Opfer ist nach dem Überfall leicht verletzt.
Das Opfer war nach dem Überfall leicht verletzt.
Perfekt Das Opfer ist nach dem Überfall leicht verletzt gewesen.
Plusquamperfekt Das Opfer war nach dem Überfall leicht verletzt gewesen.
Futur
Das Opfer wird nach dem Überfall leicht verletzt sein.
Das Relativpronomen „der, die, das“
Die Relativpronomen „der, die, das“ werden wie die bestimmten Artikel dekliniert
Nur im Genitiv und Dativ Plural wird ein -en angehängt.
maskulinfemininneutrumPlural
Nominativ derdie dasdie
Genitiv dessenderendessenderen
Dativ demderdemdenen
Akkusativ dendiedasdie

Bei der Deklination der Relativpronomen „welcher, welche, welches“ gibt es KEINEN Genitiv.

maskulinfemininneutrumPlural
Nominativ welcherwelche welcheswelche
Genitiv
Dativ welchemwelcherwelchemwelchen
Akkusativ welchenwelchewelcheswelche
Beginne bei der Satzgliederbestimmung immer mit dem Prädikat! Vom Prädikat aus kannst du alle übrigen Satzglieder erfragen.
Prädikat
Subjekt
O2 (Objekt im 2. Fall)
O3 (Objekt im 3. Fall)
O4 (Objekt im 4. Fall) Olympe
Was geschieht? Was passiert?
Wer oder was?
Wessen?
Wem?
Wen oder was?
TO (Temporalobjekt)
LO (Lokalobjekt)
MO (Modalobjekt)
KO (Kausalobjekt)
PO (Präpositionalobjekt)
Wann? Seit wann?
Wie lange? Bis wann?
Wo? Woher? Wohin? Wie weit?
Wie? Wie sehr?
Warum? Weshalb? Weswegen?
ein Fragewort in Kombination mit einer Präposition (Vorwort) z. B.: Worauf? Wobei?
Seite 20: Geschichte von Isabel und Mio. Erstellt nach: www.digitaleschule-bayern.de/dsdaten/387/11.doc (16. 12. 2017)
Seite 26: Hände weg vom Lenkrad –die Autos der Zukunft. Erstellt nach: https://www.welt.de/print/die_welt/wi rtschaft/article168552113/Haendeweg-vom-Lenkrad.html (22. 1. 2018)
Seite 32: Lars Krüsand: Der Außenseiter. Aus: https://www.schnelldurchblicken.de/durchblick-auch-indeutsch/analyse-von-kurzgeschichtenklassenarbeit/kurzgeschichte-derau%C3%9Fenseiter/ (7. 2. 2018)
Seite 39: Artikel: Laptop und Smartphone statt Fußball und Radfahren. Bearbeitet nach: derStandard online (4. 7. 2018)
Seite 48: Medien in der Familie. Broschüre von Saferinternet.at (o.J.), S. 4.
Seite 69: Crashkurs für Zeitungseinsteiger. Erstellt nach: Die Zeitung entdecken, Ein Unterrichtsprojekt für die Jahrgangsstufen 4 bis 7. Landesinstitut für Schule und Medien. BerlinBrandenburg (2010), S. 24.
Seite 73: Elvira Hofstätter: Bellender Hund „Gini“ rettet Besitzern das Leben. Aus: http://www.heute.at/oesterreich/ober oesterreich/story/Bellender-Hundrettet-seinen-Besitzern-Leben43154279 (20. 7. 2018)
Seite 89: Raddiebstahl: Kurier 8. 8. 2018, S. 16 / Wohnungsbrand: https://kurier.at/chronik/oesterreich/w ohnungsbrand-in-salzburg-rund-zehnpersonen-leicht-verletzt/400065797 (8. 8. 2016) / Dachstein: https://kurier.at/chronik/oesterreich/m utter-und-tochter-aus-gletscherspalteam-dachstein-gerettet/400076426 (8. 8. 2016)
Seite 93: John Miller: Eine eiskalte Frau. Aus: https://www.ccbuchner.de/_files_med ia/mediathek/downloads/97.pdf (9. 8. 2018)
Seite 116: Gisela Rieger: Was Freundschaft bewirken kann. In: Geschichten, die dein Herz berühren. Erzählungen, Weisheiten und Zitate. Tuntenhausen-Beyharting (2016), S. 90 – 92.
Seite 123: Friedrich Schiller: Die Bürgschaft. Aus: http://gutenberg.spiegel.de/buch/ged ichte-9097/149 (14. 8. 2018)
Seite 130: Einbürgerung nach Heldentat – Kurier 29. 5. 2018. Aus: https://www.pressreader.com/austria/ kurier/20180529/281749860029388 (17. 8. 2018)
Seite 139: Thomas träumt. Aus: Sigrid Mordi: Roland mag nicht. Arena Verlag GmbH, Würzburg (1974), S. 44ff.
Seite 151: Florian Buschendorff: Ohne Handy – voll am Arsch. Verlag an der Ruhr (2015), S. 5 – 8.
https://www.zeit.de/politik/ausland/20 18-07/frankreich-parlament-schulenhandyverbot-mobiltelefon (28. 9. 2018)
Seite 152: Parlament beschließt Handyverbot an Schulen (30. 7. 2018/k. A.). Aus:
Seite 153: Rosa Schmidt-Vierthaler: Warum Schulen das Handy verbannen sollten (13. 12. 2017). Aus: https://diepresse.com/home/meinung /kommentare/5337677/WarumSchulen-das-Handy-verbannen-sollten (28. 9. 2018)