DEUTSCH FÜR ALLE
Monyk, Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer




Monyk, Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer









Elisabeth Monyk, Patricia Lang bearbeitet von Judith Hinterhofer

Lade die eSquirrel Lern-App auf dein Smartphone, wähle dieses Buch aus, gib den Code ein und los geht’s!
rrel .at DEUALLE3


Das möchte ich alles tun

Die Geschichte mit dem Hammer/ Förderungsfähige Eltern13
Dichterwerkstatt: Reimschema 14
Fortsetzung folgt: Der Außenseiter 15
17
19
Leseprobe: In der Faulheit liegt die Kraft 20


Leseprobe: Mein Leben im Hotel Royal –Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich 25
Meine Website, mein Blog, mein Profil 26
Sicher durchs Netz 27
Und am Anfang stand nicht Google 29


EINE HEIßE SPUR
Rätselkrimis: Der Sumatra-Saphir/ Die Geheimbotschaft/41
Krimi auf der Spur
Dichterwerkstatt: Der Mann mit dem schwarzen Bart 47
Leseprobe: Herr der Diebe / Young Sherlock Holmes: Der Tod liegt in der Luft 49
Leseprobe: Löcher – Die Geheimnisse von Green Lake 50
ALLES ZEITUNG ODER WAS?

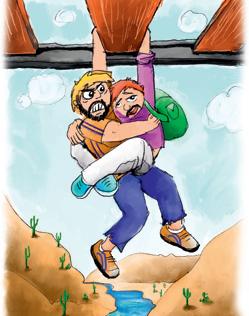

GESCHICHTEN ZUM NACHDENKEN
Morphs Konsequenz
sind Balladen
Die Bürgschaft



In 80 Tagen um die Welt

DAFÜR ODER DAGEGEN?
Jede Meinung zählt: Sollen Handys in der Schule verboten werden? 73 Wer überzeugen kann, hat auch Erfolg 74 Heiß diskutiertes Thema „Schuluniformen“ 76
Das Verbot von Killerspielen 77 …wenn sich die Regeln für die
Mein Lesenavigator
Die folgenden Seiten verfeinern deine Lesestrategien. Da kannst du sehen, wie gut du schon bist.
Finger weg – alle Stifte aus der Hand! Lies dir zuerst diese spezielle Geschichte leise durch! Trage sie dann deinem Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin richtig gestellt vor! Wechselt zum Schluss die Rollen!
Eine kurze Schegichte
Letzten Hut verlor ich meinen Herbst, ich fand lange, ehe ich ihn suchte.
Da hauste ich an ein Kam, lochte durch ein Guck und sah drei Stühle auf ihren Herren, die karteten Spiele.
Ich trat ein, nahm meinen Kopf vom Hut und sagte: „Gute Herren, mein Tag!”
Da lachten sie an zu fingen, bis ihnen der Platz bauchte. Als das Telebimmel fonte, bin ich die Rannte runtergetreppt und gegen die Bums getürt.
Da hörte ich die Zwitschlein vögern. wie sie asten von Hüpf zu Hüpf.

Und so funktioniert’s...
Eine kurze Geschichte
Letzten Herbst verlor ich meinen Hut, ich suchte lange, ehe ich ihn fand
Zahlen kann man lesen? Überzeuge dich selbst und versuche, den folgenden Text zu lesen!
D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N GR0554RT1G3N L315TUNG3N UN53R
G3H1RN F43H1G 1ST! 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R, D45 ZU L353N, 483R M1TTL3RW31L3 K4NN5T DU D45 W4HR5CH31NL1CH 5CHON G4NZ GUT L353N, OHN3 D455 35 D1CH W1RKL1CH AN5TR3NGT. D45 L315T3T D31N G3H1RN M1T 531N3R 3N0RM3N L3RNFA3H1GKE1T. 8331NDRUCK3ND, OD3R? DU D4RFST D45 G3RN3 53LB5T 4U5PR0B13R3N, W3NN DU 4UCH 4ND3R3 D4M1T 83G31ST3RN W1LL5T!
3 2
Verfasse nun selbst eine solche Nachricht und lasse dir diese von deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn vorlesen!
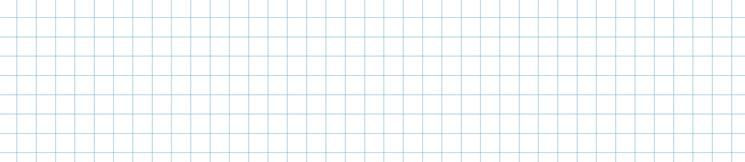

In China und in Japan wurden Texte traditionell von oben nach unten verfasst. Heute wird auch dort vielfach, wie bei uns, von links nach rechts geschrieben. Mian aus China hat uns eine Origamianleitung zum Falten einer Fledermaus geschickt. Origami ist eine alte japanische Papierfaltkunst. Leider hat er die Satzzeichen vergessen. Versuche den Text zu lesen!

Origami, das: alte japanische Kunst des Papierfaltens

6 Na logisch! Löse folgende Wortgleichungen wie im Beispiel vorgegeben!
Beispiel: Der Tag verhält sich zur Nacht wie die Sonne zu den/zum/zur...?
a) Sternen b) Himmel c) Mond d) Eule
LÖSUNG: c) Mond R Der Tag verhält sich zur Nacht wie die Sonne zum Mond. WARUM? Am Tag scheint die Sonne, in der Nacht der Mond.
1) Die Mütze verhält sich zum Kopf wie der Schuh zur/zum...?
a) Sohle b) Fuß c) Leder d) Turnschuh
2) Das Orchester verhält sich zum Dirigenten wie das Schiff zum...?
a) Matrosen b) Steuermann c) Schiffskoch d) Kapitän
3) Das Buch verhält sich zum Autor wie die Oper zur/zum...?
a) Bühne b) Komponisten c) Orchester d) Musik
4) Die Note verhält sich zur Leistung wie der Tachometer zur/zum...?
a) Geschwindigkeit b) Kraft c) Masse d) Bewertung
5) Die Töne verhalten sich zur Musik wie die Wörter zur/zum...?
a) Stimme b) Ausdruck c) Klang d) Sprache
Na los, konzentriere dich! Zähle alle „d“, die mit maximal zwei Strichen gekennzeichnet sind und notiere die Anzahl am Zeilenende! Notiere auch, wie lange du für diese Aufgabe gebraucht hast!

Mit Wörtern rechnen – Lies die Rechenaufgaben, notiere sie darunter und löse sie!
a) Addiere die Zahlen siebenundachtzig und sieben!
b) Multipliziere die Zahlen sieben und zehn!
c) Dividiere die Zahl neunundneunzig durch elf!
d) Welche Zahl muss ich halbieren, um vierundzwanzig zu erhalten?

e) Welche Zahl musst du verdoppeln, um sechsundneunzig zu erhalten?
f) Wenn ich zu einer Zahl siebenundzwanzig addiere, so erhalte ich neunundsechzig.
g) Welche Zahl muss ich zu siebenunddreißig addieren, um hundert zu erhalten?
h) Von welcher Zahl muss ich neunundvierzig subtrahieren, um siebzehn zu erhalten?
i) Welche Zahl muss ich mit sieben multiplizieren, um siebenundsiebzig zu erhalten?
j) Welche Zahl muss durch neun dividiert werden, damit man den Quotienten Neun erhält?
k) Wenn ich zu einer Zahl zuerst zwölf, dann siebzehn addiere, so erhalte ich als Summe zweiundvierzig.
Figurenreihen-Test! Setze die Figurenreihe sinnvoll fort! Überlege, welches der vier untenstehenden Kästchen passt und kreise es ein!


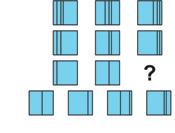



Herbstbild von Friedrich Hebbel (1813 – 1863)

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum, und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

Lese: Ernte, besonders von Wein

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält; Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

Bilde zu diesem Gedicht Assoziationsketten wie im Beispiel vorgegeben!
HERBST: Blätter verfärben sich – fallen vom Baum – Früchte werden geerntet und in Körbe gefüllt
FRÜCHTE: ______________________________________________________________________
NATUR:
LESE:
SONNENSTRAHL: ________________________________________________________________
2 1
Ergänze diese Liste und gib auch eigene Beispiele an!
Kein Ei gleicht dem anderen
Poliz-Ei
Gauner-Ei
Zauber-Ei
Drucker-Ei
Putzer-Ei
Keiler-Ei
Prügel-___________Mongol-______________

Redere-Ei
Sakrist-Ei
Mandschur-Ei
Tandemlesen ist eine Methode, bei der zwei Personen gemeinsam einen Text lesen. Dabei unterstützen sie sich gegenseitig, ihr Leseverständnis und die Leseflüssigkeit zu verbessern.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Reihum lesen:

Jeder Partner liest abwechselnd einen Absatz oder eine Seite, während der andere zuhört und bei Bedarf hilft.


gemeinsam lesen:
Beide Partner lesen den Text gleichzeitig laut. Das hilft dabei, Lesetempo und die flüssige Aussprache zu verbessern.


Echolesen:
Ein Partner liest einen Satz oder Abschnitt vor, und der andere wiederholt ihn danach.


Frage-und-Antwort-
Lesen:
Nach jedem Abschnitt stellt einer der Partner eine Frage zum Text, und der andere beantwortet sie. Dies stärkt das Verständnis des Gelesenen.


Rollenlesen:
Bei Dialogen in Geschichten übernimmt jeder Partner die Rolle eines Charakters und liest dessen Teile vor.



Einer liest laut, während der andere zuhört und bei einem Fehler oder bei Unklarheiten in der Aussprache eine kurze Pause macht, um sofort zu korrigieren.

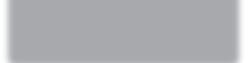
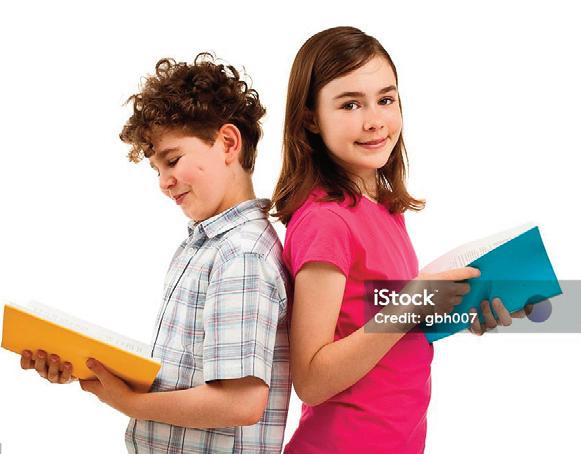
Schritt für Schritt zum Tandemlesen:
Schritt 1: Partner finden
Sucht euch einen Text aus, der für beide interessant ist und dem Leseniveau entspricht. Der Text sollte nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer sein.
Schritt 2: Lesemethode festlegen
Entscheidet euch für eine Methode des Tandemlesens. Ihr könntet abwechselnd Satz für Satz lesen oder jeder eine Seite oder einen Abschnitt lesen, bevor der andere weitermacht.
Schritt 3: Leseumgebung schaffen
Findet einen ruhigen Ort, an dem ihr ungestört lesen könnt.
Schritt 4: Zuhören und helfen
Wenn der andere liest, hör gut zu. Falls dein Partner beim Lesen auf ein unbekanntes Wort stößt oder einen Fehler macht, hilf ihm, indem du das Wort richtig aussprichst oder den Satz erklärst.
Schritt 5: Diskussion
Nachdem ihr einen Abschnitt oder den ganzen Text gelesen habt, besprecht, was ihr gelesen habt. Stellt sicher, dass ihr beide den Inhalt verstanden habt und tauscht Meinungen oder Gedanken dazu aus.
Schritt 6: Feedback geben
Gebt euch gegenseitig konstruktives Feedback zur Aussprache, Betonung und zum Lesefluss.
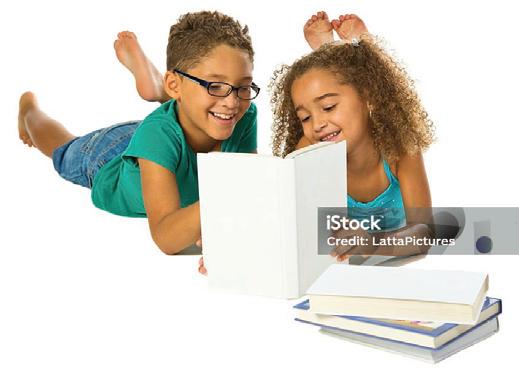
a) Aus welchem Land stammte John Goddard?
b) Wie alt war er, als er seine Lebensliste schrieb?
_______ Jahre
c) Durch welche Länder fließen diese Flüsse hauptsächlich?
NIL:
AMAZONAS:
KONGO:
d) In welchen Ländern liegen diese Berge?
MOUNT EVEREST:
KILIMANDSCHARO:
MATTERHORN:
e) Wie viele Wünsche hatte Goddard insgesamt?
f) Schreibe fünf Bereiche auf, die dich interessieren!
Lies die Geschichte über den Abenteurer John Goddard und beantworte die Fragen in der Seitenspalte!
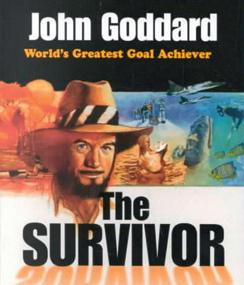
John Goddard wurde 1925 in den USA geboren und gilt als einer der bekanntesten Abenteurer seiner Zeit.
Goddard wurde dadurch berühmt, dass er im Alter von 15 Jahren alle Dinge, die er in seinem Leben unternehmen wollte, auf eine Liste schrieb. Damals lebte er in Los Angeles in Kalifornien.
Goddard träumte von weit entfernten Ländern und wollte ein großer Forscher werden. Seine Liste nannte er „Meine Lebensliste“. Hier ein Ausschnitt aus ihr:

1.Erforschung des Nils, Amazonas und Kongos
2.Ersteigung des Mount Everests, Kilimandscharos, Matterhorns
3. reiten auf einem Elefanten, Kamel und Ochsen
4. reisen auf den Wegen Marco Polos und Alexanders des Großen
5. Schauspieler sein in einem Tarzan-Film
6. ein Flugzeug selbst fliegen
7. ein Buch schreiben
8. jeden Kontinent der Welt besuchen
9. heiraten und Kinder haben
10.zum Mond reisen…
Goddard nummerierte jeden Wunsch. Als er mit seiner Aufzählung fertig war, hatte er 127 Wünsche. Aber diese Liste war nicht nur ein Traum, sie war für ihn viel mehr.
So erklärte er auch in einem Interview: „Ich schrieb diese Liste, weil ich mit 15 Jahren aus meinem Leben etwas machen wollte. Ich war an allem interessiert, an Reisen, Medizin, Musik, Natur usw. Ich wollte alles kennenlernen. Ich schrieb diese Liste, damit ich mir immer etwas vornehmen konnte.“ Und er verlor keine Zeit, um seine Träume zu verwirklichen.
Mit 16 Jahren erforschte er gemeinsam mit seinem Vater die Everglades in Florida. „Das war das erste Abenteuer, welches ich von meiner Liste streichen konnte“, erinnerte er sich.
Mit 20 Jahren hatte er schon in der Karibik und im Roten Meer getaucht.
Mit 21 Jahren war er schon in 21 Ländern gewesen.
Mit 22 Jahren entdeckte er einen Maya-Tempel tief im Dschungel Guatemalas.


Im selben Jahr begann er mit der Reiseplanung zur Erforschung des Nils. Er war 26 Jahre alt, als sein Traum in Erfüllung ging. Mit zwei Freunden befuhr er den Nil und zwar von seinem Ursprung in den Bergen Burundis bis zur Mündung im Mittelmeer. Das war eine Reise über 6 852 km in kleinen Kajakbooten. Sie wurden von Banditen und Nilpferden angegriffen, kamen in Sandstürme und erkrankten an Malaria. Aber nach zehn Monaten hatten sie es geschafft.
Nach der Nilexpedition schaute Goddard auf seine Liste und nahm den nächsten Punkt in Angriff. Er bereiste 1954 ganz Colorado und erforschte den Kongo 1956. Goddard lebte mit Kopfjägern und Kannibalen in Südamerika, Borneo und Neu Guinea. Er kletterte auf den Berg Ararat und den Kilimandscharo, flog ein Flugzeug, schrieb ein Buch, heiratete und bekam fünf Kinder. Goddard, der 2013 starb, war auf 100 Safaris und Expeditionen gewesen. Er machte Filme und hielt Vorträge über seine Reisen, um Geld für neue Expeditionen zu bekommen.
Zu seiner Lebensliste befragt, meinte er nur: „Fast jeder von uns hat Träume, aber nur wenige verwirklichen sie dann auch. Ich schrieb meine Lebensliste, als ich noch sehr jung war. Natürlich gibt es auf ihr Dinge, die ich nicht tun werde. Dazu zählen zum Beispiel auf den Mount Everest klettern oder in einem TarzanFilm mitspielen. Ich bin aber nicht traurig, wenn nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Die Liste schreibt mir nicht vor, was ich tun muss. Aber ich nehme mir jedes Jahr etwas Neues vor und füge es meiner Liste hinzu. Wir alle haben Träume, gib sie nicht auf, sondern lebe sie!“
g) Welches unterstrichene Wort passt?
westlicher, tropischer Teil des Atlantischen Ozeans Sumpfgebiet in Florida
Nebenmeer des Indischen Ozeans zwischen Nordost-Afrika und der Arabischen Halbinsel
Maya: Volk in Mittelamerika
h) Suche Guatemala im Atlas!
i) Beschrifte die Bilder mit Hilfe der orangen Wörter!


Malaria: durch Stechmücken übertragene Infektionskrankheit mit hohem Fieber
Colorado: US-Bundesstaat
Kopfjäger: Menschen, die Köpfe ihrer Feinde erbeuten
Kannibale: jemand, der Menschenfleisch verzehrt
Ararat: Vulkan in Ostanatolien
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!


Auf welcher seiner Reisen hättest du ihn gerne begleitet und warum? Schreibe das hier auf!
Reise: weil
Welche Wünsche hat er sich nicht erfüllt? Kreuze an!


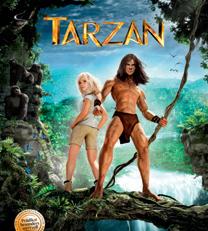











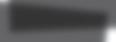









Die Geschichte mit dem Hammer von Paul
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht´s mir wirklich.
Bevor du weiterliest, überlege, wie die Geschichte weitergehen könnte!
Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er „Guten Tag" sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“

vorgeschützt: vorgetäuscht
Stelle Überlegungen zu dieser Geschichte an! Nimm ein Blatt Papier und schreibe sie in Stichwörtern auf! Teile deine Überlegungen der Klasse mit!
a) Welche Macht haben negative Gedanken? b) Was wäre passiert, wenn der Mann sich durch den flüchtigen Gruß nicht gekränkt gefühlt hätte? c) Wie könnte die Geschichte weitergehen?
Versetze dich in die Rolle des Nachbarn und schreibe einen inneren Monolog! Überprüfe im Anschluss deinen Text mit der „Checkliste Innerer Monolog“ (Sprachbuch, S. 30/ Ü9)!
Tipp: Das „Rezept Innerer Monolog“ (Sprachbuch, S. 27) hilft dir beim Schreiben.
Also mein Nachbar, sein Verhalten war unmöglich, so kenne ich ihn...
Förderungsfähige Eltern von Gisela Rieger
Ein 16-jähriges Mädchen klagt der klugen Lieblingstante ihr Leid: „Jeden Tag gibt es Streit mit den Eltern. Ich verstehe sie einfach nicht mehr! Sie haben keinen Sinn für Modernes, haben altmodische Ansichten, sind bestimmend, konservativ, rückständig und einfach uncool!“
Die Tante nickt verständnisvoll: „Ich kann dich bestens verstehen. Als ich in deinem Alter war, ging es mir genauso mit meinen Eltern. Du musst nur ein wenig Geduld haben. Ältere Leute entwickeln sich langsamer. Meine Eltern hatten nach wenigen Jahren schon so viel dazugelernt, dass ich mich ganz vernünftig mit ihnen unterhalten konnte. Und du wirst es kaum glauben. Heute, nach fünfzehn Jahren, gehe ich jedes Mal zu meinen Eltern, wenn ich einen Rat brauche. Siehst du, so können die sich ändern!“
1 2 3

Wie hängt dieses Zitat mit der Geschichte zusammen? Schreibe deine Gedanken dazu auf!
Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.

(Augustinus von Hippo, Bischof und Philosoph, 354 – 430)


Füge die Strophen zusammen, indem du die passenden Nummern sowie den Titel und den Namen des Dichters einsetzt!
1. Ärgerlich / Wilhelm Busch M 2. Die Feder/ Joachim Ringelnatz M 3. Im Winter / Georg Trakl
Titel:__________________________
Ein Federchen flog durch das Land; Ein Nilpferd schlummerte im Sand. Die Feder sprach: „Ich will es wecken!“ Sie liebte, andere zu necken.


So geht's immer, wie ich finde, Rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlts am Winde, Hat man Wind, so fehlt das Korn.
Autor:_______________________________
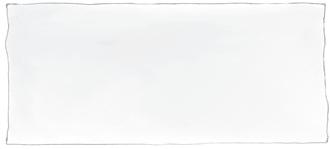

Titel:______________________________
Aus der Mühle schaut der Müller, Der so gerne mahlen will.
Stiller wird der Wind und stiller, Und die Mühle stehet still.
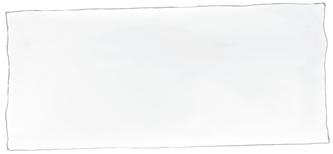

Titel: ________________________________
Der Acker leuchtet weiß und kalt. Der Himmel ist einsam und ungeheuer. Dohlen kreisen über dem Weiher Und Jäger steigen nieder vom Wald.
Aufs Nilpferd setzte sich die Feder Und streichelte sein dickes Leder.
Das Nilpferd sperrte auf den Rachen Und musste ungeheuer lachen.


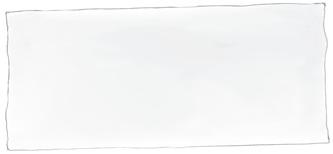

Autor:_______________________________________
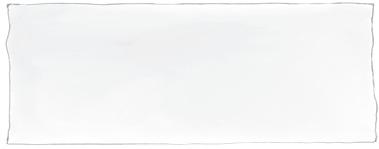


Ein Schweigen in schwarzen Wipfeln wohnt. Ein Feuerschein huscht aus den Hütten. Bisweilen schellt sehr fern ein Schlitten Und langsam steigt der graue Mond.
Autor: _____________________________
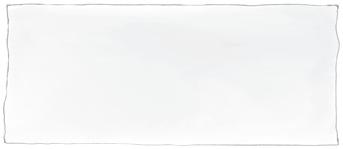
HB 17: Höre dir die Lösung an und überprüfe so dein Ergebnis!
Reimschema: Bestimme nun das Reimschema der Gedichte, indem du die Reimwörter in der entsprechenden Farbe unterstreichst!
Paarreim: a a b b Kreuzreim: a b a b Umarmender Reim: a b b a
Entscheide dich für ein Reimschema und verfasse selbst ein kurzes Gedicht!

Und so geht’s:
a)Überlege dir zuerst das Thema deines Gedichts! Dazu kannst du auch ein Cluster gestalten!
b) Verwende ein Reimlexikon! Gehe dazu ins Internet und suche unter dem Stichwort „Reimlexikon“!
c) Lies dein Gedicht mindestens zwei anderen Mitschülern oder Mitschülerinnen vor!
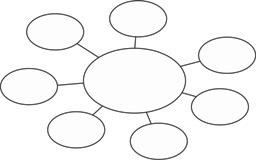



Dann kam dieser Freitag und er überlegte ziemlich lange, was er tun sollte. Er hatte auch ein bisschen Angst, denn in der Zeitung war letztens ein langes Gespräch mit einem Psychologen abgedruckt worden, das ihn ziemlich mitgenommen hatte. Menschen, die zurückgezogen lebten, würden im Laufe der Zeit immer seltsamer und gingen schließlich gar nicht mehr aus dem Haus.
Seitdem hatte er angefangen, in seinem Tagebuch genau zu notieren, wie oft er unabhängig von Schule und dringenden Besorgungen rausgegangen war und was er mit wem unternommen hatte. Seine Eltern waren bei solchen Fragen keine große Hilfe. Ihnen reichte es, dass ihr einziger Sohn keine Probleme machte und ganz nebenbei auch noch das Haus bewachte, wenn sie beruflich oder privat unterwegs waren.
Irgendwann gegen Abend hatte sich die Sache mit Inas Geburtstag von selbst entschieden. Keine Entscheidung war in solchen Fällen schließlich auch eine Entscheidung. Er würde also zu Hause bleiben. Seine Eltern waren wieder ausgegangen, er hatte seine Ruhe und konnte tun und lassen, was er wollte.
Kurz vor 8:00 Uhr abends klingelte es plötzlich. An der Tür stand Tim. Erst war Lars ein bisschen sauer. Fingen sie jetzt schon an, ihn abends abzuholen, das ging ja wohl entschieden zu weit. Dann aber sah er den Schmutz an Tims Händen und sein Schulterzucken in Richtung Fahrrad, das mit Platten auf dem Bürgersteig stand. Das war natürlich etwas anderes.
„Komm rein, da vorne rechts ist die Gästetoilette, da kannst du dir die Hände waschen.“ Während Tim hinter der Tür verschwand, überlegte Lars, wie er ihm helfen konnte. Einen Fahrradschlauch konnte er zwar nicht reparieren, aber sie hatten einige Fahrräder in der Garage stehen. Über die Frage, welches man nehmen sollte, musste er dann aber gar nicht mehr lange nachdenken. Tim kam nämlich zurück und hatte seine Panne anscheinend fast vergessen.
„Was machst du eigentlich an solch einem Abend, wo wir alle unterwegs sind?“ „Ach, ich sitze an meinen Gedichten...“ „Wie, du schreibst Gedichte?“
„Nein, nicht wirklich. Wenn ich ein schönes Gedicht finde, das schon etwas älter ist, dann versuche ich es umzuschreiben, dass es mir nicht nur von der Idee
Astronomie, die: Stern-, Himmelskunde als exakte

her gefällt. Manches drücken wir heute einfach anders aus.“
„Darf ich mal sehen?“ Damit hatte Lars kein Problem. Er wusste ja, dass Tim ziemlich tolerant war und auch niemanden gerne verletzte. Kurze Zeit später saßen sie zusammen und Lars war gespannt, was Tim sagen würde, nachdem er sich ein paar Beispiele durchgelesen hatte.
„Das ist ja unglaublich, was du aus diesen Gedichten machst, die wir in der Schule besprochen haben. Warum liest du die nicht zur Abwechslung mal im Deutschunterricht vor?“ „Ach, weißt du, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ihr euch dafür interessiert. Ich wollte auch nicht noch mehr zu einem Außenseiter werden: Erstens nicht auf Feten gehen und dann auch noch Gedichte schreiben.“
Tim überlegte einige Zeit, dann meinte er plötzlich: „Du, da kann ich dir, glaube ich, helfen. Ich betreibe doch nebenbei Webseiten zu Themen der Astronomie. Ich hoffe ja immer noch, dass ich eines Tages einen neuen Planeten entdecke.“ Jetzt war Lars erst mal platt. Er war also nicht der einzige, der, ohne dass es die Klasse wusste, etwas Besonderes machte. Aber erst mal ging es jetzt um die Frage der Gedichte.
„Was haben die denn mit Astronomie zu tun?“, fragte er Tim vorsichtig. Der lächelte: „Gar nichts, aber ich weiß inzwischen, wie man Webseiten so gestaltet, dass nicht jeder sofort weiß, wer dahintersteckt. Da könnte man doch eine einrichten, auf der wir deine Gedichte unterbringen und dann melden wir uns einfach im Deutschunterricht und verweisen darauf. Mal sehen, wann den anderen auffällt, dass auf der Seite immer gerade die Gedichte zu finden sind, die wir gerade im Unterricht besprechen.“
Suche im Text jene Stellen, die die folgenden Fragen beantworten! Markiere die Textstellen mit den Buchstaben, die vor den Fragen stehen!
A Welche Aussage hat Lars nach dem Lesen der Zeitung ziemlich mitgenommen?
B Was macht Lars mit einem älteren Gedicht?
C Welche Überlegungen stellt Lars an, um Tim zu helfen?
D Was bedeutet der Satz, dass sich die Sache mit Inas Geburtstag selbst entschieden hat?
E Was könnte Lars noch mehr zum Außenseiter machen?
F Wie will Tim Lars’ Gedichte der Klasse vorstellen?
G Was notiert Lars in sein Tagebuch?
H Welcher Ausspruch von Tim macht Lars „platt“?
Formuliere nun die Antworten in deinem Heft in ganzen Sätzen und mit eigenen Worten!
Mache es wie Lars! Verfasse zu diesem Gedicht ein Parallelgedicht! Tipp: Denke dabei an alles, was dir Vergnügen bereitet!
Vergnügungen von Bertolt Brecht (1898 – 1956) Vergnügungen von
Dialektik: Kunst der Gesprächsführung/des

Unterstreiche beim Lesen dieses Beitrags aus dem Magazin „Geolino“ Themenschwerpunkte, die du besonders interessant findest, und kläre dir unbekannte Wörter!

Pubertät
Sie ist ganz plötzlich da, verdreht einem den Kopf und lässt den Stress daheim und in der Schule genauso wachsen wie Bart und Busen – die Pubertät.
Es klingt ganz harmlos im Biologie-Buch: „Pubertät“, heißt es da, „ist eine Entwicklungsphase, in der sich die Geschlechtsorgane weiterentwickeln, bis die Geschlechtsreife eintritt. Normalerweise verläuft die Pubertät zwischen dem 10. und 17. Lebensjahr.“ Aber im wahren Leben, da ist Pubertät … Gefühlschaos, Ärger mit den Eltern oder in der Schule und ein Körper, der irgendwie aus den Fugen gerät: Die Pubertät, so viel ist sicher, verwandelt Leib und Seele in Großbaustellen. In keiner anderen Lebensphase verändert sich ein Mensch so schnell und so sehr wie in der Pubertät. Wie kommt es dazu?
In der Pubertät verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch Ansichten, Charakterzüge und manchmal auch der Freundeskreis. ...
Sich nichts mehr vorschreiben lassen: Damit machen es sich viele vielleicht schwer, aber sie können oft nicht anders. Denn nur, wenn sie sich mit den Eltern streiten und sich von deren Ansichten lösen, können sie ihre eigenen finden.
Dieser plötzliche Sinneswandel und die 1000 Gedanken haben einen guten Grund: Auch das Gehirn wird gründlich umgebaut. ...
Chaos im Kopf! Warum das Hirn verrückt spielt
Das Gehirn gleicht während der Pubertät einer großen Baustelle. Wenig genutzte Nervenverbindungen werden gekappt, wichtige Verbindungen zu „Informations-Autobahnen“ ausgebaut. So sortiert sich das Gehirn komplett neu, wird leistungsfähiger und schneller. Der präfrontale Kortex lässt uns vernünftig und überlegt handeln –eigentlich.
Nicht so in der Pubertät: Die Umbaumaßnahmen dauern dort am längsten, und alle Informationen müssen die Umleitung über den Mandelkern nehmen. Der steuert Bauchentscheidungen – und sorgt so dafür, dass man während der Pubertät wegen jeder Kleinigkeit explodiert.
Andere brauchen den noch größeren Kick: fahren darum mit dem Fahrrad eine Treppe runter oder trinken so viel Bier, bis sie irgendwann doppelt sehen.
Aussprüche
„Also ich finde die Zeit gar nicht so schlimm. Auch wenn man jetzt Konflikte hat, die gehören ja zum Leben. Und so was wird man ja auch später immer haben.“ Asha (15)
„Man reagiert oft über. Kleine Dinge machen einen auf einmal so rasend, dass man sich total dumm verhält.“

Jonas (15)
„Früher hieß es immer: Iiiihhh, Jungs! Und jetzt ist da viel mehr Anziehung. Man sucht nach dem anderen Geschlecht und möchte eine richtige Beziehung.“ Lotta (14)
„Ich habe mich darüber gefreut, als ich zum ersten Mal meine Periode hatte, weil man einfach merkt, dass man jetzt wirklich zur Frau wird.“ Lisa (14)
„Und wenn irgendjemand meint, befehlen zu müssen, dann lehnt man das sofort ab. Das möchte man schon aus Prinzip nicht annehmen.“
Marco (14)


„Klar, man probiert extreme Sachen aus. Es gibt Leute, die laufen nur in Schwarz mit Nieten rum. Die wollen provozieren. Vor allem dann, wenn Eltern es gar nicht mögen, dass sie solche Klamotten anziehen.“ Paul (14)
Das Gehirn von Jungen und Mädchen nimmt während der Pubertät Gefühle und Erlebnisse nämlich nicht mehr so stark wahr wie noch in der Kindheit. Reichte damals der Sprung vom Drei-Meter-Brett aus, um sich mutig zu fühlen, werden jetzt die Ansprüche höher und auch die Bereitschaft, echte Risiken einzugehen. In keinem anderen Lebensabschnitt passieren daher mehr Unfälle als in der Pubertät.
Aber manchmal geschieht auch das Gegenteil – und Mädchen und Jungen ziehen sich komplett zurück. Sie werden traurig, sind völlig überfordert von den vielen Veränderungen. Ganz gleich, wie man die Pubertät erlebt, dieses Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsensein – seltsam, komisch und ein bisschen schwierig ist es wohl irgendwie immer, für alle.
Beruhigend aber ist: Nach ein paar Jahren legt sich das Chaos meist wieder. Was dann bleibt, ist die Erinnerung an ein paar völlig verrückte Jahre.
Suche aus dem Artikel fünf Informationen heraus, die für dich neu waren!
Ich habe erfahren, dass
Ich habe gelesen, dass
Ich wusste nicht, dass
Dass
Begründe auch warum! 2 3
Schreibe hier einen Ausspruch aus der Seitenspalte auf, dem du nicht zustimmst!
Zitat:
Begründung:
Es war mir neu, dass ____________________________________________________________________________
mir neu.
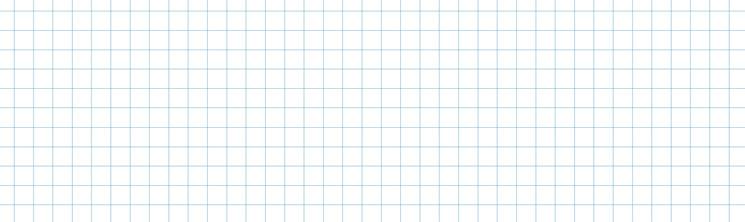

1
Lest diese Kurzgeschichte im Tandem! Klärt unbekannte Wörter mit Hilfe des Wörterbuchs oder Duden online! Beantwortet die Fragen zum Text!
Fünfzehn von Reiner Kunze
Sie trägt einen Rock, den kann man nicht beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu lang. Ihr Schal dagegen ähnelt einer Doppelschleppe: lässig um den Hals geworfen, fällt er in ganzer Breite über Schienbein und Wade. (Am liebsten hätte sie einen Schal, an dem mindestens drei Großmütter zweieinhalb Jahre gestrickt haben – eine Art NiagaraFall aus Wolle. Ich glaube, von einem solchen Schal würde sie behaupten, dass er genau ihrem Lebensgefühl entspricht. Doch wer hat vor zweieinhalb Jahren wissen können, dass solche Schals heute Mode sein würden.) Zum Schal trägt sie Tennisschuhe, auf denen jeder ihrer Freunde und jede ihrer Freundinnen unterschrieben haben.
Sie ist fünfzehn Jahre alt und gibt nichts auf die Meinung uralter Leute – das sind alle Leute über dreißig. Könnte einer von ihnen sie verstehen, selbst wenn er sich bemühen würde? Ich bin über dreißig.
Wenn sie Musik hört, vibrieren noch im übernächsten Zimmer die Türfüllungen. Ich weiß, diese Lautstärke bedeutet für sie Lustgewinn. Teilbefriedigung ihres Bedürfnisses nach Protest. Überschallverdrängung unangenehmer logischer Schlüsse. Trance. Dennoch ertappe ich mich immer wieder bei einer Kurzschlussreaktion: Ich spüre plötzlich den Drang in mir, sie zu bitten, das Radio leiser zu stellen. Wie also könnte ich sie verstehen – bei diesem Nervensystem? Noch hinderlicher ist die Neigung, allzu hochragende Gedanken erden zu wollen.
Auf den Möbeln ihres Zimmers flockt der Staub. Unter ihrem Bett wallt er. Dazwischen liegen Haarklemmen, ein Taschenspiegel, Knautschlacklederreste, Schnellhefter, Apfelstiele, ein Plastikbeutel mit der Aufschrift ,,Der Duft der großen weiten Welt“, angelesene und übereinander gestülpte Bücher (Hesse, Karl May, Hölderlin), Jeans mit in sich gekehrten Hosenbeinen, halb- und dreiviertel gewendete Pullover, Strumpfhosen, Nylon und benutzte Taschentücher. (Die Ausläufer dieser Hügellandschaft erstrecken sich bis ins Bad und in die Küche.)
Ich weiß: Sie will sich nicht den Nichtigkeiten des Lebens ausliefern. Sie fürchtet die Einengung des Blicks, des Geistes. Sie fürchtet die Abstumpfung der Seele durch Wiederholung! Außerdem wägt sie
die Tätigkeiten gegeneinander ab nach dem Maß an Unlustgefühlen, das mit ihnen verbunden sein könnte, und betrachtet es als Ausdruck persönlicher Freiheit, die unlustintensiveren zu ignorieren.
Doch nicht nur, dass ich ab und zu heimlich ihr Zimmer wische, um ihre Mutter vor Herzkrämpfen zu bewahren, – ich muss mich auch der Versuchung erwehren, diese Nichtigkeiten ins Blickfeld zu rücken ... Einmal bin ich dieser Versuchung erlegen. Sie ekelt sich schrecklich vor Spinnen. Also sagte ich: „Unter deinem Bett waren zwei Spinnennester.“

Ihre mit lila Augentusche nachgedunkelten Lider verschwanden hinter den hervortretenden Augäpfeln, und sie begann ,,Iix! Ääx! Uh!“ zu rufen, so dass ihre Englischlehrerin, wäre sie zugegen gewesen, von soviel Kehlkopfknacklauten – englisch ,,glottal stops“ – ohnmächtig geworden wäre. „Und warum bauen die ihre Nester gerade bei mir unterm Bett?“ „Dort werden sie nicht oft gestört.“ Direkter wollte ich nicht werden, und sie ist intelligent.
Am Abend hatte sie ihr inneres Gleichgewicht wiedergewonnen. Im Bett liegend, machte sie einen fast überlegenen Eindruck. Ihre Hausschuhe standen auf dem Klavier. ,,Die stelle ich jetzt immer dorthin“, sagte sie. ,,Damit keine Spinnen hineinkriechen können.“
Wie ist das gemeint, dass ein einziges Wort für den Rock zu lang wäre?
Wer könnte der Erzähler sein?
Was meint der Erzähler mit Nichtigkeiten?
Welche Gegenstände geben dir Auskunft über die Hobbys der Tochter?
Was bereitet dem Vater Probleme?
Was glaubst du, empfindet der Vater für seine Tochter?
Welche Hinweise geben dir Aufschluss darüber?
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Lest die Fragen und beantwortet sie gemeinsam auf einem Blatt!
Leseprobe: aus „In der Faulheit liegt die Kraft“ von Jakob M. Leonhardt
1 Mädchen sind magisch. Manche ihrer 2 Eigenschaften lassen sich einfach nicht
3 mit den Naturgesetzen erklären. Nina
4 Kamphagen zum Beispiel. Ich kenne sie,
5 seit wir vor vier Jahren zusammen auf die 6 Gesamtschule gekommen sind. Aber bis 7 jetzt hat sie mich ungefähr so sehr
8 interessiert wie ein Rezept für 9 Haferschleim.
10 Ich komme zur Schule und mache mich
11 wie üblich auf die Suche nach 12 jemandem, von dem ich die 13 Hausaufgaben abschreiben kann. Musti 14 muss ich gar nicht erst fragen, der macht
15 sie auch nie. Larissa von Eckstein kann
16 ich abhaken, die würde sich lieber mit 17 einem Gewicht an den Füßen in einer 18 Pfütze ertränken, als mir ihre
19 Hausaufgaben zu überlassen.
20 Dann fällt mein Blick auf Nina. Ich also 21 hin und: „Hey Nina. Kann ich Deutsch von 22 dir abschreiben? Bommel schlachtet mich,
23 wenn ich wieder mit `nem leeren Heft
24 aufkreuze.“
25 Sie zuckt mit den Schultern und sagt: „Geht
26 mir leider genauso. Was hältst du davon,
27 wenn wir einfach schwänzen?“
28 Überrascht sehe ich sie an. Ich dachte,
29 dieses Mädchen fehlt nie im Unterricht,
30 nicht einmal, wenn sie krank ist.
31 „Los Felix, wir verdrücken uns. Können
32 doch irgendwo Kaffee schlürfen gehen“,
33 hakt sie nach. „Cool“, sage ich nur. Wir
34 lassen dann nicht nur Deutsch sausen,
35 sondern den ganzen restlichen Schultag.
36 Hängen bei Starbucks rum und schlürfen
37 uns mit Frappuccino in die Nähe einer
38 Herzattacke.
39 Bangboombang. Laberlaber.
40 Die Zeit vergeht wie nichts.
41 Dann verabschieden wir uns am
42 Nachmittag mit einem innigen Hug und

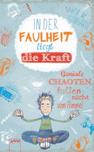
43 einem tiefen Blick in die Augen. Ich sehe ihr
44 hinterher und denke nur: Boa, ist die süß!
45 Will haben!
46 Verdammt, ich bin mal wieder verliebt.
47 Muss das denn sein?
48 Verliebt sein ist Mist, weil: Ist totaler Stress.
49 Man muss dem Mädchen, auf das man es
50 abgesehen hat, beweisen, dass man ein
51 cooler Typ ist. Man muss auf sein Äußeres
52 achten, sich kämmen, die Zähne putzen,
53 ein Deo benutzen. Man muss aufpassen,
54 was man sagt, wie man sich gibt, wie man
55 rüberkommt.
56 Das ist kein Spaß, das ist harte Arbeit.
57 Schwitz und Doppelschwitz.
58 Andererseits hat Verliebtsein auch positive
59 Seiten. Dinge, die sonst wichtig sind, 60 spielen auf einmal keine Rolle mehr.
61 Schule, Fernsehen, Sport, Freunde treffen –62 alles nicht so wichtig. Stress mit Eltern,
63 Lehrern, Schwestern, mit anderen Jungen –64 alles egal.
65 Wichtig ist nur eins: Nina Kamphagen. Und 66 wie ich es anstelle, mit ihr
67 zusammenzukommen!
68 Weil: Boa, ist die süß! Will haben!
Boa! Gar nicht einfach zu verstehen diese Jugendsprache – Suche für jede Erklärung das passende Wort im Text und schreibe die Zeilennummer auf!
sich irgendwo zum Zeitvertreib aufhalten: _________________________ ( ) * wie etwas vom anderen verstanden wird: ____________________________ ( ) * einsaugen: ____________________ ( ) * aufgeben: ____________________________ ( ) * Umarmung: ___________ ( ) *
sich nicht aus der Fassung bringen lassen: ______________________ ( ) * Ausruf, der Erstaunen ausdrückt: __________ ( ) *
sich heimlich davonmachen: __________________________ ( )
Wie wird in dieser Leseprobe „Verliebtheit“ beschrieben? Tausche dich mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn darüber aus!
In jedem Absatz fehlen Worte. Hole sie dir beim Lesen aus der rechten Seitenspalte und füge sie ein!
Von alten und neuen Medien
Beim „Medien“ denkt man oft zuerst an Fernsehen und Nachrichten, Computer und Soziale Medien. Aber Briefe und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Fotos und Filme, Handy, SMS und E-Mails und die Sprache kann man zu den „Medien“.
Was haben all diese Dinge gemeinsam?
Das Wort „Medien“ ist die des lateinischen Wortes „Medium“, das übersetzt „Mitte“ heißt. Ein Medium steht sozusagen zwei Menschen, die miteinander kommunizieren möchten. Medien spielen die als „Vermittler“, denn sie helfen dabei, Informationen in Form von Texten, Bildern und von einer Person zur weiterzuleiten. Sich informieren, bilden, unterhalten und austauschen – all das wird Medien möglich.
Weil Medien wie Fernsehen, Radio, Film, aber auch CDs sehr viele Menschen erreicht werden können, man diese auch als „Massenmedien“. „Medien“ es übrigens bereits im Mittelalter, ja sogar in der Antike! Damals haben aber natürlich nicht Radio oder Fernsehen als gedient. Vielmehr waren dies Menschen, die z. B. als wandernde von Hof zu Hof zogen und den Geschichten und „Nachrichten“ überbrachten.
Ist das neu?
Man könnte meinen, ein neu erschienenes ist ein neues Medium. Oder eine uralte ist ein altes Medium. Das stimmt aber nicht. Wenn von Neuen Medien die ist, dann sind damit Medien gemeint, welche die neueste verwenden. Neue Medien sind elektronisch und verwenden Daten in Form, zum Beispiel das E-Mail oder das World Wide Web. Im engeren Sinne sind jene Medien gemeint, die das benötigen.
Der Beginn der sozialen Medien – vor 5000 Jahren?
Neu waren im der Jahrhunderte natürlich ganz unterschiedliche Medien für uns Menschen und es gab viele Schritte und so manche großen „Sprünge“ zu unseren Neuen Medien.
Sicherlich hat die des Internets unglaublich viel verändert. Aber wichtige auf dem Weg zu den heutigen Medien gab es schon sehr viel früher!
Beispielsweise war die Nutzung der Elektrizität für und Maschinen revolutionär. Oder noch früher die Erfindung des Buchdrucks die Welt auf Kopf.
Einige Entdeckungen und, welche Voraussetzungen für die moderne Medienwelt sind, liegen sehr, sehr in der Menschheitsgeschichte zurück. Überleg mal: Die heutigen Medien wären vorstellbar, wenn nicht irgendwann die erfunden worden wäre. Das ist aber schon etwa 5 000 Jahre!
Kennst du diese Medien? Benenne sie!

Wort auch sogar zählen
Mehrzahl zwischen
Rolle Tönen anderen durch über bezeichnet gab Vermittler Sänger Adeligen Buch Website Rede Technologie digitaler Internet Laufe kleine bis Erfindung Meilensteine Licht stellte den Neuerungen weit kaum Schrift her









… eine Art Collage aus zufälligen Wörtern und Sätzen.

Die Wörter für dein FLARFGedicht, erhältst du über das Internet. Dazu werden verschiedenste
Suchbegriffe in eine Suchmaschine eingegeben und anschließend die Ergebnisse kopiert. Hat man eine bestimmte Anzahl an Ergebnissen, stellt man sie zu einem Text/ Gedicht zusammen.
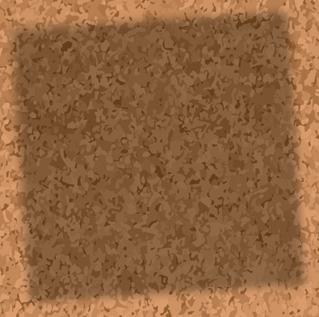
FLARF ist wie ein Experiment, bei dem man mit Worten spielt und schaut, was für verrückte Sachen dabei rauskommen.
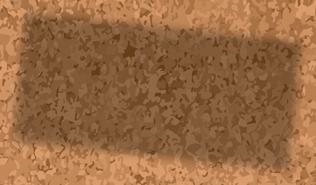

Es entstehen oft sehr witzige Texte.

Verfasse dein eigenes FLARF- Gedicht! Folge der Anleitung!
Notiere auf einem Notizzettel das Thema deines Gedichts und fünf dazu passende Stichwörter!
Schreibe dein Thema als Überschrift des Gedichts ganz oben in ein Word-Dokument!
Gib nun in einer Suchmaschine das erste Stichwort ein!


Gehe zur 5. Trefferseite, klicke dort auf den 5. Treffer und nimm die 5. Zeile im Fließtext von oben.
Markiere das 1. + 2. + 3. Wort von links und kopiere sie (Strg + C)!
Füge die drei Wörter im Word-Dokument unter deiner Überschrift ein (Strg + V)! Dann wiederhole diesen Vorgang mit den anderen vier Stichwörtern!
Hast du alle Wörter beisammen, kannst du sie solange umstellen, bis du mit deinem Gedicht zufrieden bist. ACHTUNG: Es dürfen keine neuen Wörter hinzugefügt werden.
Zum Schluss veranstaltet eine Wahl zum „FLARF-POET OFT THE UNIVERSE“!
Trage der Klasse dein Gedicht vor!
INSTA von Judith Hinterhofer
Instagram – Mehr als nur Fotos – Chancen und Herausforderungen für Jugendliche
Instagram gehört zu den beliebtesten sozialen Netzwerken, besonders bei Jugendlichen. Die App, die ursprünglich für das Teilen von Fotos entwickelt wurde, bietet heute zahlreiche Möglichkeiten: Neben Bildern und Videos kann man Storys posten, die nach 24 Stunden verschwinden, und Reels –kurze, kreative Clips – hochladen. Instagram ist ein Ort, um sich auszudrücken, Erlebnisse zu teilen und mit anderen in Kontakt zu bleiben.
Was macht Instagram so beliebt?
Ein Grund, warum Instagram so beliebt ist, liegt in der visuellen Gestaltung. Viele Jugendliche nutzen Instagram, um ihre Interessen und Hobbys zu zeigen, sei es Mode, Sport oder Reisen. Die App bietet zahlreiche Filter und Bearbeitungstools, mit denen Bilder professionell aussehen können. Likes und Kommentare geben außerdem direktes Feedback, was den Austausch anregt und Anerkennung vermittelt.
Die Kehrseite von Likes und Followern
Umgang mit Instagram
So viel Spaß Instagram auch macht, die Plattform hat auch Schattenseiten. Für viele Jugendliche steht der Wettbewerb um Likes und Follower im Vordergrund, was schnell zu einem Druck führen kann, sich perfekt zu präsentieren. Dies kann Stress verursachen und dazu führen, dass man sich ständig mit anderen vergleicht. Besonders inszenierte Fotos und „perfekte“ Körperbilder können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und das Gefühl auslösen, nicht gut genug zu sein.
Datenschutz und Privatsphäre Instagram sammelt viele Daten, wie das Nutzungsverhalten und Vorlieben, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Jugendliche sollten daher auf Privatsphäre-Einstellungen achten. Es ist ratsam, das Konto privat zu halten, damit nur bestätigte Follower die Inhalte sehen können. Zudem sollten persönliche Informationen wie Telefonnummer oder Wohnort nicht öffentlich geteilt werden.
Ein bewusster Umgang mit Instagram kann helfen, die Vorteile zu genießen und die Nachteile zu vermeiden. Hier einige Tipps:
•Überlege, was du postest: Poste nur Inhalte, die du auch in ein paar Jahren noch gerne sehen würdest.
•Grenzen setzen: Achte darauf, wie viel Zeit du auf Instagram verbringst.
•Selbstbewusst bleiben: Lass dich nicht von Likes und Followern beeinflussen.
6. 11. 2024, Wien
Reel (Clip): kurzes, unterhaltsames Video, das zwischen 15 und 60 Sekunden lang ist
visuell: durch das Auge aufgenommen
Tool: Werkzeug
Feedback: Rückmeldung
Like: online abgegebene positive Bewertung
Follower: Nutzerinnen und Nutzer einer Social Media Plattform, der einem anderen Nutzer folgt
Privatsphäre: nicht öffentlicher Bereich
Bildet Vierergruppen und besprecht die Fragen! Notiert eure Egebnisse und stellt sie der Klasse vor!
Wie steht ihr zu Instagram?
Wer von euch nutzt die App, wer nicht? Was spricht für, was gegen Instagram?
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner! Sucht in den einzelnen Absätzen des Textes „INSTA“ von S. 23 die Schlüsselwörter und markiert sie!
Erstellt mit den Schlüsselwörtern ein Organigramm!
Titel:
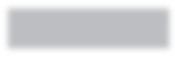
Absatz 1
Absatz 3


Absatz 2
Absatz 4
Absatz 5


Fasst nun anhand der Schlüsselwörter die Grundaussagen jedes Absatzes in ein paar Sätzen zusammen und schreibt sie auf!
Absatz 1

Absatz 2

Absatz 3

Absatz 4

Absatz 5
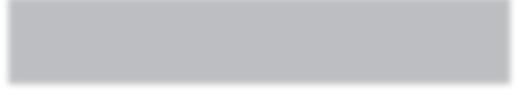
Leseprobe: aus „Mein Leben im Hotel Royal – Warum mein Dackel mehr Follower hat als ich“ von Katy Birchall
Kapitel 1: Prinz Gustav hat meinen Selfiestick geklaut. Daher saß ich jetzt in seinem Wandschrank, während sein Personal Assistant dem Prinzen beibrachte, wie man sich perfekt in Pose schmiss.
„Bei Instagram kommt es allein aufs Selbstbewusstsein an“, erklärte der Assistant. Prinz Gustav schaute derweil nervös in den nächstbesten Spiegel und inspizierte seine Zähne. „Die Schultern schön locker, und dann zeigt denen, wer Ihr seid. Sie wollen Euer wahres Gesicht sehen.“
Ich linste durchs Schlüsselloch des Schranks. Draußen in der Suite hielt der Assistant gerade meinen Selfiestick hoch und wartete geduldig, während Prinz Gustav die Schultern kreisen ließ.
„Seid Ihr bereit?“ „Ich weiß nicht so recht, Freddie.“ Prinz Gustav stieß einen übertriebenen Seufzer aus. „Ich war mir so sicher, dass ich einen InstagramAccount will. Aber jetzt stresst mich die Vorstellung nur noch.“
„Das verstehe ich ja“, lenkte Freddie ein, „aber dafür bin ich schließlich da. Wir gehen alles gemeinsam durch. Es ist höchste Zeit, dass Ihr ein Profil bekommt. Glaubt mir, bald schießt Ihr in jeder Lebenssituation Selfies, ohne lange darüber nachzudenken.“
„Was mache ich mit meinem Kopf?“
„Das ist alles ganz einfach. Ich habe ausführlich recherchiert und die besten Apps heruntergeladen. Damit finden wir bestimmt den richtigen Filter.“ Freddie lotste Prinz Gustav näher ans Fenster. „Als Erstes brauchen wir optimale Lichtverhältnisse. Hier, bitte schön, das ist doch wunderbar. Und jetzt den Kopf leicht neigen.“
Beurteile nun den Auszug aus dem Jugendbuch!
„Ich komme mir vor wie ein Labrador.“
„Der Winkel ist großartig“, beharrte Freddie. „Einfach perfekt! Und jetzt nehmt den Selfiestick, und wenn Ihr das Gefühl habt, bereit zu sein, dann drückt auf den Knopf da unten.“
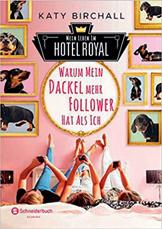
Misstrauisch nahm Prinz Gustav das Ende des mit rosa und silbernen Strasssteinen besetzten Selfiesticks entgegen und versuchte, die beste Position zu finden. Er fuchtelte so energisch mit dem Stab herum, dass er Freddie um ein Haar k. o. geschlagen hätte.
Wie war es möglich, dass jemand nicht mit einem Selfiestick umgehen konnte? Der Prinz war doch noch gar nicht so alt! Gab es in Schlössern denn nicht auch so was wie WLAN?
Freddie, der rasch den Kopf eingezogen hatte, reckte dem Prinzen vor Begeisterung zwei Daumen entgegen. Schweigen senkte sich über den Raum, während alle gebannt abwarteten. Prinz Gustav hielt den Kopf in Position und zupfte mit der freien Hand an seinem Hemdkragen herum, ehe er sich räusperte und die Lippen zu einem leichten Schmollmund verzog. Nach wenigen Sekunden war ein leises Klicken zu hören. ... Er hielt Prinz Gustav das Display hin, damit er sich selbst ansehen konnte. „Ich würde sagen, ein königlicher Volltreffer.“
„Nicht übel für mein erstes Selfie“, rief Prinz Gustav stolz. „Lass uns noch eins machen!“
Oh. Mein. Gott. Schlimmer konnte es echt nicht werden.
Der Textauszug ist einfach zu lesen. schwierig geschrieben.
Ich finde das Thema interessant. eher langweilig.
Die Personen wirken echt. gekünstelt. Ich möchte das Buch weiterlesen. nicht lesen
Lies die Fragen und notiere dir Antworten auf ein Blatt! Diskutiert in der Klasse darüber!
Kannst du dich in die Rolle des Prinzen hineinversetzen? Wie stehst du dazu? Wie steht die Person im Schrank dazu? Warum ist der Prinz gestresst?
Lies die folgenden Informationen!
Kreise bei jedem Text ein, was auf dich zutrifft!

PROFIL


ist mir bekanntwusste ich teilweiseist mir neu
Die meisten Jugendlichen haben ein Profil in einem sozialen Netzwerk, eine eigene Website oder einen Blog.
Auf diesen Profilen stellen sich Jugendliche selbst dar und präsentieren sich so der Internetgemeinde. Varianten gibt es dabei viele, aber auch ebenso viele Möglichkeiten, in Schwierigkeiten zu geraten.



Sinn und Zweck von sozialen Netzwerken ist es, Kontakte zu knüpfen und mit anderen Nutzerinnen und Nutzern in Verbindung zu bleiben. Dafür muss man zuerst eine Art virtuellen Steckbrief mit Angaben zur eigenen Person einrichten. Nun kann man von anderen gefunden werden oder selbst nach Nutzerinnen und Nutzern suchen und diese kontaktieren. Wird ein Kontakt bestätigt, kann man Informationen und Fotos austauschen, Videos oder Links empfehlen, Gruppen erstellen oder auch chatten.



Blogs oder Weblogs (zusammengesetzt aus den Wörtern „Web“ und „Log“ = Logbuch) sind Tagebucheinträge auf einer Internetseite. Herausgeberinnen und Herausgeber oder Verfasserinnen und Verfasser werden als Bloggerinnen und Blogger bezeichnet. Jede und jeder kann Blogs verfassen und Beiträge lesen. Meist können sie auch kommentiert werden. Neben Hobby-Bloggerinnen und -bloggern nutzen inzwischen auch professionelle Journalistinnen und Journalisten, aber auch Politikerinnen und Politiker und große Unternehmen diese Form der Web-Kommunikation.



Fotos und Grafiken sind wie Musikstücke, Videos und Programme urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein fremdes Foto auf deine Website stellen willst, darfst du dies NUR MIT Zustimmung der Herstellerinnen und Hersteller tun.



Auch für private Websites oder Blogs gilt die Offenlegungspflicht. Du musst deinen NAMEN und WOHNORT (allerdings nicht die genaue Adresse) ständig und leicht auffindbar auf der Website zur Verfügung stellen.



Lies den Artikel „Sicher durchs Netz“! Markiere für dich wichtige Schlüsselwörter und -sätze!
Die oberste Regel im Web lautet:
GIB NICHT ZU VIEL VON DIR PREIS!
Ganz klar, soziale Netzwerke sind eine tolle Sache:
Nirgendwo sonst kannst du so einfach Kontakte pflegen, dich selbst im Netz präsentieren, neue Leute kennen lernen und Fotos oder Videos austauschen. Aber ganz ehrlich, hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, was andere Menschen mit deinen persönlichen Informationen alles anstellen können?
Warum ist es eigentlich so wichtig, persönliche Daten im Internet zu schützen?
Im Web ist man nicht so anonym, wie man glaubt: Alle Inhalte, die du in das Netz stellst, sind nicht nur deinen Freundinnen und Freunde zugänglich, sondern theoretisch auch für alle anderen Userinnen und Usern auf der Welt. Außerdem können all deine Einträge zu dir zurückverfolgt werden.
Alle Computer, die mit dem Internet verbunden sind, haben eine zuordenbare Adresse, über die sie eindeutig identifiziert werden können – die so genannte IP-Adresse. Das ist ein Zahlencode, der einem Rechner zugeordnet werden kann.
Wann immer eine Userin oder ein User zum Beispiel chattet, E-Mails verschickt oder Websites besucht, wird diese IP-Adresse gespeichert.
Diese Spuren sind nicht immer sofort einer bestimmten Person zuordenbar, können aber, wenn z. B. eine Anzeige bei der Polizei eingeht, miteinander verknüpft werden und führen dann zur Identität der Userin oder des Users. Auch Benutzerinnen und Benutzer desselben Computers können sehen, welche Websites besucht oder welche Programme aufgerufen wurden.
MAN HINTERLÄSST ALSO SPUREN, WENN MAN SICH IM INTERNET BEWEGT!
Das Internet vergisst nicht
Beispielsweise Fotos, die du heute cool findest, können dir in einigen Jahren sehr unangenehm und peinlich sein. ABER einmal veröffentlichte Daten sind oft nicht mehr zu entfernen und können dir sogar bei deiner späteren Jobsuche schaden.
Wie kann ich mich und meine Daten in sozialen Netzwerken schützen?
Gib keine persönlichen Daten (voller Name, Wohnadresse, Telefonnummer, Kontonummer usw.) von dir bekannt. Diese Informationen über dich ermöglichen es nämlich Fremden, dich im „echten“ Leben aufzuspüren.
Veröffentliche keine Bilder und Texte, die dir später schaden könnten. Bedenke, dass du auch keine Bilder

von deinen Freundinnen und Freunden ins Netz stellen darfst, wenn diese „nachteilig“ dargestellt werden.
Nutze die Einstellungsoptionen in sozialen Netzwerken für mehr „Privatsphäre“, indem du zum Beispiel den Zugriff auf dein Profil nur deinen Freundinnen und Freunden erlaubst.
Verwende sichere Passwörter (eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) und halte diese geheim!
Solltest du von Userinnen oder Usern in einem sozialen Netzwerk belästigt werden, kannst du diese Personen blockieren (lassen). Kontaktiere die Betreiberin oder den Betreiber der Seite, falls die Belästigung nicht aufhört.
Erstelle in deinem Heft anhand deiner Schlüsselwörter/ -sätze ein Organigramm! Verfasse anschließend ein Exzerpt mit persönlicher Stellungnahme!
Ordne die folgenden acht Tipps den Erklärungen richtig zu!
Nicht alles ist wahr!
Urheberrechte beachten!
Schütze deine Privatsphäre!

Quellen angeben!
Das Recht am eigenen Bild!
Auch im Web gibt es Regeln!
Bei kleinsten Zweifeln Hilfe suchen!
ACHT TIPPS: So surfst du richtig!
Computer schützen! 1 2 3 4 5 6 7 8 1
Alles, was man im realen Leben nicht tun sollte oder nicht tun darf, sollte man auch in der virtuellen Welt des Internets bleiben lassen.
__________________________________________________________________________________________
Überlege dir genau, welche Informationen du über dich im Web öffentlich machst! Gib, wenn möglich, keine persönlichen Daten wie deinen vollständigen Namen, deine genaue Wohnadresse, deine Handynummer usw. bekannt! Halte Passwörter auch vor deinen Freund/innen geheim!
__________________________________________________________________________________________
Oft ist nicht klar, woher Informationen stammen und man weiß nicht, wer die Inhalte in das Netz gestellt hat. Sei misstrauisch und überprüfe Informationen besser mehrfach!
__________________________________________________________________________________________
Das Anbieten und Weiterverwenden von Texten, Musik, Videos, Bildern und Software ist ohne Einwilligung der Urheber/innen verboten. Dies stellt eine strafbare Handlung dar.
__________________________________________________________________________________________
Das Verbreiten von Fotos oder Videos, die andere Personen nachteilig darstellen, ist verboten. Frage zur Sicherheit immer zuerst die Abgebildeten, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind!
__________________________________________________________________________________________
Wenn du zum Beispiel für ein Referat Textauszüge von anderen Autoren und Autorinnen verwendest, musst du eine dazugehörige Quellenangabe machen, um klarzustellen, dass es sich dabei nicht um dein eigenes Werk handelt.
__________________________________________________________________________________________
Verwende zum Schutz deines Computers und deiner Daten ein Anti-Viren-Programm und aktualisiere es regelmäßig! Bring auch laufend deine Software auf den aktuellsten Stand, am besten per automatischem Update!
Reagiere nicht auf irritierende oder gar bedrohliche Nachrichten! Suche dir stets Hilfe, wenn du auch nur kleinste Zweifel hast, damit später daraus erst gar keine Probleme werden!
Ja, es gab einmal ein Internet ohne Google, denn am Anfang der Geschichte der Suchmaschine stand Archie. 1990 an einer kanadischen Universität entwickelt, gehörte die erste Suchmaschine der Welt bald zu den am meisten genutzten Internetdiensten. Mit Archie konnten aber keine Texte durchsucht werden, sondern lediglich Dateien und Ordner. Die Dateien wurden gesammelt, anschließend sortiert und den Benutzern aufbereitet zur Verfügung gestellt. Mit der Ausbreitung des World Wide Web im Jahr 1993 gingen dann immer mehr Webseiten ans Netz wie Yahoo, Lycos und Alta Vista, die das Geschäft mit der Websuche unter sich aufteilten.
1998 betrat Google die Bühne und hatte sofort Erfolg. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Google schon von Anfang an neben dem Inhalt einer Webseite auch deren Popularität in das Ranking der Suchergebnisse miteinbezog. Da Google als Erster nach der besten Seite, die zu einer Suche passt, fahndete, konnte die Menge an unsinnigen Suchergebnissen – sprich Spam – minimiert werden. Außerdem bestach Google durch hohe Geschwindigkeit und übersichtliche Oberfläche.
Interessant wird es, wenn man Google selbst googelt. Dabei stellt sich heraus, dass Google eine große Firma in den USA ist. Sie ist also mehr als nur eine Suchmaschine, denn zu dieser Firma gehören auch Youtube und ein eigenes Forschungslabor. Dort wurden immer mehr zusätzliche Leistungen wie Google Bilder, Google Maps, Google Mail, Google Übersetzer usw. entwickelt. Bis heute wächst die Zahl der Nutzer und Nutzerinnen, die Google als Suchmaschine verwenden, stetig an.
Ob lustige Videos, die neuesten Nachrichten oder die besten Computerspiele, im riesigen und damit total unübersichtlichen Internet findet man alles Mögliche. Für das Internet, das wie ein Spinnennetz die Welt umspannt, besitzen Suchmaschinen eigene Computerprogramme. Diese „Spiders“ haben die Aufgabe, den ganzen Tag lang durch das Internet zu surfen, um genau die Seiten zu finden, die jemand sucht. Sind sie mit einer Webseite fertig, folgen sie einfach den weiterführenden Links. Mit diesem Netz aus Links springen sie von Seite zu Seite und stellen einen Überblick her, was auf den einzelnen Internetseiten steht. Dabei verwenden Suchmaschinen einen „Index“. Diesen Index kann man sich wie das „Stichwortverzeichnis“ eines Buches vorstellen. Doch anstelle von Seitenzahlen enthält der Index die Internetadressen (URL) der Dokumente, auf denen bestimmte Stichwörter auftauchen. So erhalten wir eine Liste mit tausenden Ergebnissen, in denen überall unser Suchbegriff vorkommt.

Suchmaschinen zählen zu den am häufigsten genutzten Diensten im Internet. Sie sind kostenlos, denn sie verdienen Geld mit bezahlter Werbung, die im Kontext des Suchbegriffes geschaltet wird. Gibt man bei „Google“ oder „Bing“ etwa den Begriff „Spielzeug“ ein, so erscheint auch Spielzeugwerbung. Bei Google und Facebook sollten sich die Benutzer/innen jedoch immer bewusst sein, dass ihre Daten gesammelt und weiterverwendet werden.
Schreibe die folgenden Fragen zu den passenden Absätzen in die Seitenspalten!
Markiere die zutreffenden Antworten als Schlüsselwörter, -sätze!
Wie verdienen Suchmaschinen ihr Geld? M Wie treffen Suchmaschinen im Internet ihre Auswahl? M Wo und wann gab es die erste Suchmaschine? M Wodurch wurde
Google so erfolgreich? M Womit vergleicht man das Internet? M Was erfährt man, wenn man „Google“ googelt?


Datei: elektronischer Bestand an Dokumenten
Ordner: Teil des Speicherplatzes einer Festplatte, in dem Dateien abgelegt werden
online gehen: an das Internet angeschlossen werden, im Internet veröffentlicht werden
Ranking: Rangliste, in der jemand etwas nach Größe, Leistung, Erfolg usw. einordnet
minimieren: verkleinern
surfen: im Internet wahllos oder gezielt nach Informationen suchen
Links: grafisch gekennzeichnete Verknüpfung mit einer anderen Datei
1990 wurde die erste Suchmaschine der Welt, die Archie genannt wurde, an einer kanadischen Universität entwickelt. Archie konnte aber keine Texte durchsuchen, sondern lediglich Dateien und Ordner. Mit der Ausbreitung des World Wide Web im Jahr 1993 gingen dann immer mehr Webseiten online. Bald teilten Suchmaschinen wie Yahoo, Lycos und Alta Vista das Geschäft mit der Websuche unter sich auf.
1998 startete die Suchmaschine Google und war sofort erfolgreich. Als erste Suchmaschine fahndete sie nach den besten Seiten, die zu einer Suche passten. Mit diesem erstellten Ranking konnte die Menge an unsinnigen Suchergebnissen – sprich Spam – minimiert werden. Außerdem bestach Google durch seine hohe Geschwindigkeit und seine übersichtlich gestaltete Oberfläche.
____________________________________________________________________
Ob lustige Videos, die neuesten Nachrichten oder die besten Computerspiele, im Internet findet man alles Mögliche. Das Internet ist wie ein Spinnennetz, das die Welt umspannt. Um hier das beste Ergebnis zu finden, benutzen Suchmaschinen eigene kleine Computerprogramme. Diese „Spiders“ (deutsch: Spinnen) haben die Aufgabe, den ganzen Tag lang durch das Internet zu surfen. So finden die Spinnen genau die Seiten, die jemand sucht. Sind sie mit einer Webseite fertig, folgen sie einfach den weiterführenden Links.
Mit diesem Netz aus Links springen die Spinnen also von Seite zu Seite. Sie stellen einen Überblick her, was auf den einzelnen Internetseiten steht. Dabei verwenden Suchmaschinen einen „Index“. Diesen Index kann man sich wie das „Stichwortverzeichnis“ eines Buches vorstellen. Doch anstelle von Seitenzahlen enthält der Index die Internetadressen (URL) der Dokumente, auf denen bestimmte Stichwörter auftauchen. So erhalten wir eine Liste mit tausenden Ergebnissen, in denen überall unser Suchbegriff vorkommt.
____________________________________________________________________
Suchmaschinen zählen zu den am häufigsten genutzten Diensten im Internet. Sie sind kostenlos, da sie ihr Geld mit bezahlter Werbung verdienen. Diese Werbung hängt aber immer mit dem Suchbegriff zusammen. Gibt man zum Beispiel bei „Google“ oder „Bing“ den Begriff „Spielzeug“ ein, so erscheint auch Spielzeugwerbung.
ACHTUNG: viele SocialMediaPlattformen sammeln deine Daten und verwenden sie weiter! 1
Ordne die folgenden Überschriften den Inhalten zu und schreibe sie auf die freien Linien!
Spinnen surfen durch das Internet M Warum sind Suchmaschinen kostenlos? M Ein Index für Internetadressen M Warum war gerade Google so erfolgreich? M Die ersten Suchmaschinen
Überfliege den Artikel nochmals und markiere die Erklärung für folgende Wörter:

Die Anfänge
Bereits in alten Zeiten war es den Menschen wichtig, Neuigkeiten zu erfahren. Im Mittelalter nutzte man in Europa das Lehnwort „tidinge“ für Nachrichten oder Berichte. Im antiken Rom wurden tägliche Nachrichtenblätter, bekannt als „Acta Diurna“, für die Bürger ausgestellt. Diese frühen „Zeitungen“ waren eine Sammlung von wichtigen Informationen, die auf Tafeln oder Papier geschrieben und an öffentlichen Orten aufgehängt, vorgetragen oder vorgesungen wurden.
Der Buchdruck und die ersten gedruckten Zeitungen
Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert änderte sich die Verbreitung von Nachrichten. Texte konnten nun in größerer Stückzahl hergestellt werden. Besonders revolutionär war die Rotationsmaschine. Sie erlaubte es, Papierbögen kontinuierlich zu bedrucken und somit die Produktion von Zeitungen effizienter machte. Die erste gedruckte Zeitung der Welt, die „Relation“, erschien 1605 in Deutschland. Sie nutzte Holzschnitte und Kupferstiche, um Bilder und Illustrationen darzustellen, was die Artikel lebendiger und interessanter machte.
Die Blütezeit der Zeitung
Im 19. Jahrhundert erreichte die Zeitungsbranche einen Höhepunkt. Die Erfindung der Telegrafie konnten Nachrichten schnell über weite Strecken übermittelt werden. Die Zeitung wurde zu einer wichtigen Quelle für aktuelle Informationen. Sie berichteten über globale Ereignisse, politische Debatten und lokale Neuigkeiten. Die Menschen lasen erstmals am Frühstückstisch, was auf der anderen Seite der Welt geschah.
Die moderne Ära und das digitale Zeitalter
Heute, im digitalen Zeitalter, hat sich die Art und Weise, wie wir Nachrichten konsumieren, weiterentwickelt. Die OnlineNachrichten haben die traditionellen Printmedien ergänzt und in manchen Fällen sogar ersetzt. Trotzdem gibt es nach wie vor gedruckte Zeitungen, die mit Hilfe modernster Drucktechnologien wie der Rotationsmaschine hergestellt werden. Diese klassischen Medien bleiben für viele ein wichtiger Bestandteil ihres täglichen Lebens.

Lies dir den Text Absatz für Absatz genau durch! Schlag unbekannte Wörter im Wörterbuch oder Duden online nach! Markiere für dich wichtige Schlüsselwörter, -sätze und schreib sie auf einen Stichwortzettel!
Bildet Vierergruppen! Teilt euch gegenseitig mit Hilfe eurer Stichwortzettel Informationen über den Text mit!
Der Beginn
Früher, als es noch keine Handys oder Computer gab, wollten die Menschen auf dem Laufenden bleiben. In Rom, vor sehr langer Zeit, gab es „Acta Diurna“ genannte Blätter, die wie eine Zeitung funktionierten. „Acta Diurna“ bedeutet „tägliche Nachrichten“. Sie wurden an Plätzen aufgehängt, wo viele Menschen vorbeiliefen, damit alle die neuesten Geschichten lesen konnten.
Die ersten Zeitungen zum Blättern
Im 15. Jahrhundert kam der Buchdruck auf, erfunden von Johannes Gutenberg. Dies machte es möglich, viele Kopien von Texten schnell zu drucken. Die allererste Zeitung, so wie wir sie heute kennen, kam 1605 in Deutschland heraus und hieß „Relation“. Nach dieser Zeitung fingen immer mehr Leute in Europa an, ihre eigenen Zeitungen zu drucken.
Im 19. Jahrhundert, mit der Erfindung der Telegrafie, wurden Zeitungen richtig beliebt. Sie waren die Hauptquelle für Neuigkeiten, von großen politischen Ereignissen bis hin zu kleinen lokalen Geschichten. Jetzt konnten die Leute beim Frühstück lesen, was auf der ganzen Welt geschah.
Heute, im Zeitalter des Internets, beziehen viele Menschen ihre Nachrichten digital über Handys und Computer. Aber es gibt auch noch gedruckte Zeitungen. Sie werden mit großen Maschinen, den Rotationsmaschinen, gedruckt und sind für einige Leute ein wichtiger Teil ihres Tages. Zeitungen existieren schon lange und sind nach wie vor eine wichtige Quelle, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Sucht euch eine Partnerin oder einen Partner zum Frage- und Antwort- Lesen (M1, S 8)! Schreibt im Anschluss gemeinsam die wichtigsten Informationen des Textes auf den Stichwortzettel! Teilt eure Informationen der Klasse mit!
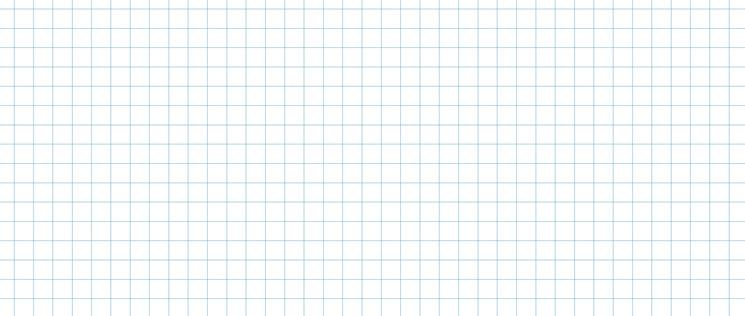
Meine Notizen:

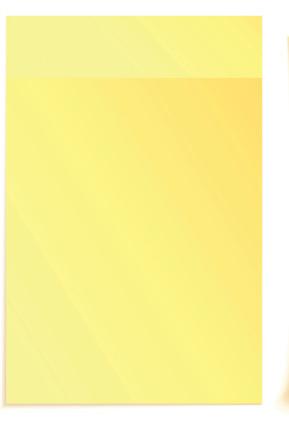
Ihr habt alle dieselbe Zeitung, aus der eine Mitspielerin oder ein Mitspieler einen Artikel auswählt. Ohne Schlagzeile und Anreißerzeile wird der Bericht laut vorgelesen. Wer zuerst den Bericht gefunden hat, unterbricht sofort die Vorleserin oder den Vorleser und ruft STOPP. Dann setzt die Person an der gestoppten Stelle das Lesen fort, bis die nächste Mitspielerin oder der nächste Mitspieler STOPP ruft und weiterliest. Das Spiel endet mit dem Ende des Berichtes.

Einer oder eine von euch sucht sich eine Schlagzeile aus der Zeitung aus, die der Mitspielerin oder dem Mitspieler vorgelesen wird. Nun muss diese oder dieser die Schlagzeile so schnell wie möglich in der Zeitung finden. Dann wechselt die Rollen!

Lies deiner Partnerin oder deinem Partner einen Zeitungstext mit unterschiedlicher Betonung vor, z. B. eine Politikerin, ein Politiker, eine Pensionistin, ein Pensionist, eine gestresste Managerin, ein gestresster Manager, eine Lehrerin, ein Lehrer usw. Deine Partnerin oder dein Partner ergänzt nun deinen Vortrag spontan mit der passenden Gestik und Mimik.

Ressort-Bingo – Ein Spiel für die ganze Klasse
1 Alle tragen folgende Ressorts auf dem Spielplan in beliebiger Reihenfolge ein!



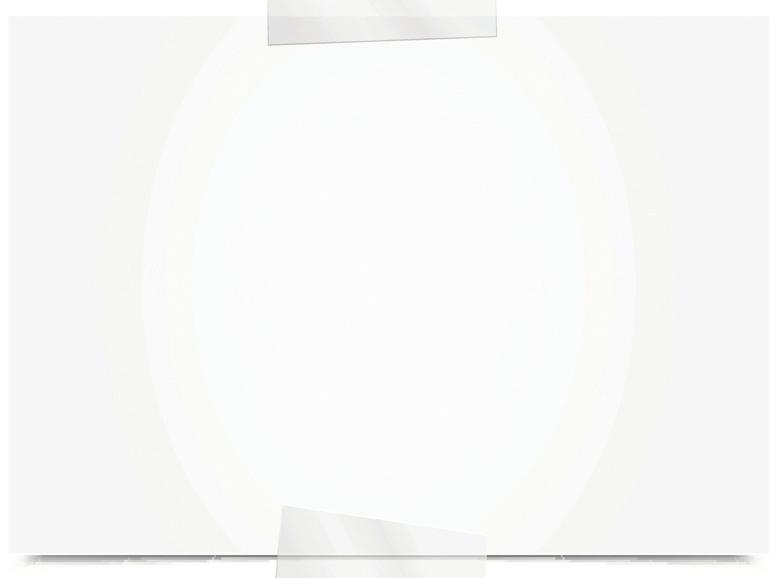
Innenpolitik M Außenpolitik M Kultur M Sport M Chronik M International M Wirtschaft M Klatsch & Tratsch MAnzeigen

1 Deine Lehrerin oder dein Lehrer liest nun eine Schlagzeile aus der Zeitung vor. Aus welchem Ressort stammt diese?


1 Weißt du es, lege eine Münze auf das entsprechende Ressort! Tipp: Du benötigst maximal sechs Münzen. War deine Antwort richtig, darf die Münze liegen bleiben.
1 Wer als Erster drei Münzen nebeneinander oder untereinander in einer Reihe platziert hat, ruft BINGO und hat gewonnen.
SPIELPLAN

HB 18: Hören will gelernt sein – ...und so geht’s!
1. Lies dir vor jedem Hörbeispiel die Fragen und Antwortmöglichkeiten durch!
2. Höre dann genau zu! Die Beispiele werden zweimal hintereinander abgespielt
3. Nun kreuze die EINE richtige Antwort an!

Beispiel 1:

In welchem Bezirk liegt Großebersdorf?
Hollabrunn Mistelbach Eibesbrunn

Beispiel 2:

Weswegen musste der Achtjährige im Spital nicht behandelt werden?
Kopfschmerzen
Erbrechen

Beispiel 3:

„Michael“ ist ein...
Taifun
Tornado
Übelkeit
Bauchschmerzen



Hurrikan
Orkan
In welchem mittelamerikanischen Land richtete „Michael“ bereits Schäden an?
El Salvador
Mexiko

Beispiel 4:

Guatemala
Chile
Welche Veränderungen bewirkte bereits die globale Erwärmung um 1,5 Grad?
sinkende Meeresspiegel
extreme Wetterphänomene
Hervorbringen neuer Pflanzenarten
ertragreichere Ernten
sinkende Wassertemperaturen
Vermehrung des arktischen Eises

Lies die Artikel! Überlege, welcher eine Zeitungsente sein könnte! Schreibe deine Begründung auf!

Ängstlicher Einbrecher alarmiert die Polizei
In Rumänien rief ein Einbrecher im April 2015 selbst die Polizei an den Tatort seines Verbrechens. Er war in ein Haus in Benesti eingedrungen, als er ein verdächtiges Geräusch hörte. Aus Angst vor einem weiteren Einbrecher versteckte sich der Mann unter einem Bett und rief sicherheitshalber die Polizei.


Begründung:
Reichster Hund der Welt
Ihrem geliebten Hund „Gunther IV.“ hinterließ die deutsche Gräfin Carlotta Liebenfürst ihr gesamtes Vermögen, geschätzte 100 Millionen Schweizer Franken. „Gunther IV.“ wird sogar von einem eigenen Koch verwöhnt.


Lies den folgenden Text! Suche den „Text im Text“ und schreibe ihn auf“

Eine Zeitungsente ist eine falsche Nachricht in der Zeitung. Manchmal passiert das aus Versehen, weil jemand etwas missverstanden hat. Aber einige Leute erfinden auch absichtlich Enten, um andere zu täuschen. Das ist nicht richtig, denn Nachrichten sollten wahr sein. Wenn eine Ente aufgedeckt wird, müssen Zeitungen das klarstellen. Sie sagen dann, dass sie einen Fehler gemacht haben. Es ist wichtig, kritisch zu sein und nicht alles sofort zu glauben, was man liest. Immer nachdenken und prüfen, ob eine Geschichte wirklich stimmt, das hilft, Enten zu erkennen. Hast du schon einmal eine Zeitungsente entdeckt und wie hast du reagiert?

Lies zuerst die Kurzgeschichte!
Da sowohl hier als auch jenseits des Flusses allerhand Schauergeschichten verbreitet werden darüber, was sich letzten Freitag Vormittag auf der Trinidad-Brücke abgespielt hat, so bringe ich eine wahrheitsgemäße Darstellung jener Vorfälle, die geeignet ist, allen alten Weibern den Mund zu stopfen. Mein Zeuge ist Don Gasparro Schüetzli, ein Mann, der seit Jahren die Rangierlokomotive „Elvira“ führt und als vorsichtiger und erfahrener Staatsbürger bekannt ist.
Ich, der verheiratete Minenarbeiter Pedro Alverde, beschritt an jenem Vormittag die Trinidad-Brücke von der Station Santa Anna aus, um mich nach Aranagua zu begeben, da ich meine Gattin besuchen und meinen Anspruch auf eine Silberader anmelden wollte, die ich in Rocca Palumba gefunden hatte. Nun weiß man ja, was unsere Brücke vorstellt: Seit fünfzehn Jahren schwindelt sie sich „provisorisch“ über den Fluss und ist dabei so baufällig, dass den Kaimanen unten auf der Sandbank jedes Mal der Mund wässerig wird, wenn ein Zug hinüberdampft. Im Grunde ein auf spinnenbeinigen, wurmstichigen Pfeilern ruhendes Schienengeleise, das notdürftig durch Holzschwellen zusammengehalten wird.
Als ich etwa die Mitte der Brücke erreicht hatte, kam es mir vor, als ob die Schwellen merkwürdig zitterten und die Schienen wie unter einem Druck ächzten. Ich wandte mich blitzschnell um und sah eine ungeheure Güterzuglokomotive rasch auf mich zufahren. Ich schrie und winkte mit dem Arm, allein die Lokomotive fuhr mit unveränderter Geschwindigkeit drauflos: Wahrscheinlich erzählten sich die Maschinisten gerade etwas Interessantes. Zur Seite springen konnte man nicht, auch war der nächste Brückenpfeiler zu weit entfernt, und darum tat ich, was jedermann getan hätte – ich klammerte mich mit den Händen an eine Bahnschwelle zwischen den Schienen und ließ
Trinidad-Brücke: Brücke in Bolivien
Weib/ Weiber: veraltete Bezeichnung für Frau bzw. Ehefrau, die im Mittelalter neutral, aber seit dem 17. Jhdt. abwertend verwendet wird
rangieren: Eisenbahnwagen auf ein anderes Gleis fahren
Silberader: silberhaltige Gesteinsschicht
provisorisch: vorübergehend, behelfsmäßig
Kaiman: Krokodilart
mich hinunterhängen. Plötzlich baumelte ich über dem furchtbaren Abgrund. Mit Funkensprühen fuhr jetzt die Lokomotive über mich hinweg.

Als der letzte Waggon endlich vorübergerollt war, machte ich angestrengte Versuche, wieder nach oben zu kommen. Ich schwang mich wie an einer Reckstange auf und ab, um endlich mit den Füßen eine andere Schwelle fest zu kriegen. Aber das ging nicht, weil man Gefahr lief, mit der Hand vom eigenen Balken abzurutschen. Dann versuchte ich, mich hinaufzustemmen, aber mein Rucksack hinten war zu schwer. Dann versuchte ich es mit einem Bauchaufschwung, doch stellte sich’s heraus, dass ich jetzt dazu bereits zu schwach war.
Sandbank: Anhäufung von Sand oder Schlamm in Flüssen und Meeren
wurmstichig: vom Holzwurm befallen
Pfeiler: senkrechte Stütze, die dazu dient, größere Teile eines Bauwerks zu tragen
Schwelle: Balken, auf dem das Gleis befestigt ist
ächzen: stöhnen
sich umwenden: sich umdrehen
Maschinist: Fachkraft zur Überwachung einer Maschine
Und endlich versuchte ich, wenigstens die eine Hand von der anderen Seite um den Balken herumzubekommen, damit ich über der umschlungenen Schwelle die Hände festhalten und also sicherer hängen konnte. Dazu hätte ich aber einen Sekundenbruchteil an einer Hand hängen müssen – und ich fühlte plötzlich: dazu reichte es nicht mehr. Und so blieb ich, mit einer Anmeldung in der Tasche, mitten in der Luft hängen und schrie, so laut ich konnte. Aber der Fluss ist breit.
Es war heiß; alles schien zu schlafen. Ich riskierte einen Blick in die Tiefe und sah ein paar dunkle Striche an der Sandbank. Das waren Kaimane. Unterdessen hatte sich ein zweiter Mann von Santa Anna auf den Weg gemacht. Ein Angler hat mir erzählt, dass das sehr merkwürdig ausgesehen habe: wie von der Brückenmitte etwas kleines Schwarzes herunterhing und wie eine andere kleine Figur sich langsam näherte. Diese war Ramon Guijarro, ein Mann, dessen Charaktereigenschaften nach ein paar Schritten ans volle Licht treten werden. Er wollte ebenfalls nach Aranagua – aber um einer Anzeige zu entgehen. Einer Anzeige wegen fortgesetzten Pferdediebstahls. Als er mein Schreien hörte, beeilte er sich, und bald hörte ich seinen Sprung von Schwelle zu Schwelle. Er kam mir wie ein Engel vom Himmel vor. Er blieb plötzlich vor meiner Schwelle stehen. Und was ich jetzt bringe, ist wörtlich:
„Machst du Turnübungen, he?“, fragte Guijarro und steckte die Hände in die Taschen.
„Halt mich fest! – Gott sei Dank, dass du gekommen bist... Zieh, zieh, ich muss sonst gleich loslassen!'“, schrie ich zu seinen Füßen hinauf.
„Was gibst du mir dafür?“, fragte Guijarro und spuckte in den Fluss.
„Zehn Pesos.“
„Das ist zu wenig", sagte er nachdenklich. „Bedenke –ich rette dir das Leben!“
„Wie viel willst du?“, brüllte ich. „Schnell: Fünfzehn? Zwanzig? Fünfundzwanzig? – Santissima, ich muss gleich loslassen!“
„Wie viel hast du bei dir?“
„Sechsundvierzig Pesos – oh, so halt mich doch...“
„Geht in Ordnung“, meinte Ramon Guijarro und beugte sich über die Schwelle, um mir zu helfen.
Doch in diesem Augenblick bewog ihn ein dumpfes Geräusch, sich schnell umzublicken. Der ungestüm anwachsende Leib einer Lokomotive kam in voller Fahrt auf ihn zu. Mit einem Fluch hatte Ramon gerade noch Zeit, sich geschwind an die Bahnschwelle zu hängen – an meine Bahnschwelle, mit dem Gesicht mir zugekehrt, mit seinen Augen in meinen Augen!
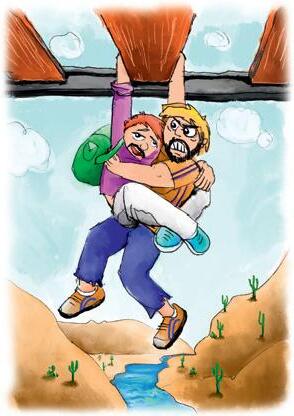
Der stämmige Guijarro hing mit seinem Gesicht dicht gegenüber meinem und schaute mich wütend an. Ich aber fühlte mich unsäglich elend – ich schlenkerte mit den Füßen – ich hatte keine Kraft mehr, die entsetzliche Schwelle festzuhalten – und klemmte plötzlich Guijarros Leib, der sich zuckend wehrte, mit meinen Beinen wie eine Zange fest! Nachdem ich so einen neuen Halt bekommen, ließ ich meine Linke von der Schwelle abgleiten und umschlang den Mann mit meinem frei gewordenen Arm.
Ich empfand ein wunderbares Gefühl des Gerettetseins. Das war ja seine eigene Schuld, warum hatte er mich nicht gleich emporgezogen!
Pesos: Währungseinheit in Süd- und Mittelamerika
Santissima: Du lieber Himmel ungestüm: stürmisch, wild
Dann konnte auch meine Rechte die Schwelle nicht mehr halten – und nun hing Ramon Guijarro mit einer doppelten Menschenlast von der Brücke herunter und schrie seinerseits, so laut er konnte. Mich abzuschütteln, wagte er nicht, denn er wäre mit mir zusammen in die Tiefe gestürzt. An irgendetwas muss sich der Mensch im Leben halten.
Indessen hatte die Lokomotive (denn es war bloß eine Rangierlokomotive und kein ganzer Zug – aber wer konnte das von den Schienen aus sehen?) kurz vor dieser Unglücksstelle Halt gemacht. Und Don Gasparro Schüetzli, der Maschinist, kletterte längs des Kessels nach vorn und ließ sich über die Laternen vorsichtig aufs Geleise herunter. Er hatte von Santa Anna aus beobachtet, wie mitten auf der Brücke zwei Männer plauderten: einer oben stehend, der andere unten hängend – und das war ihm verdächtig vorgekommen! Darum hatte er seiner alten „Elvira“ Volldampf gegeben, um sich an der Unterhaltung zu beteiligen.
Ramon fauchte mich unterdessen an wie eine Katze: „Bestie! Loslassen, du Vampir! ... Ich kann nicht mehr halten!“, brüllte er und versuchte dazwischen mit Beißen, mich von sich loszulösen.
Aber ich dachte nicht daran! Ich wich den Zähnen mit abgewandtem Kopf aus und klammerte mich nur umso fester an meinen einzigen Halt. In diesem Augenblick war Don Gasparro bis an die Schwelle heran gelaufen. Er sah zwei ins Holz verkrampfte Hände, unter deren Fingernägeln Blut hervorquoll, und auf der anderen Seite der Schwelle eine dritte, fieberhaft ausgestreckte Hand – die meine. Diese einzige Hand, welche frei war, packte der Maschinist fest an. Und zog. Allein – zugleich hörte er einen lang gezogenen Schrei und sah die blutigen Hände von der Schwelle abgleiten.
Ramon Guijarro hatte die Doppellast nicht mehr halten können ... Einen Augenblick noch schlenkerte er kopfabwärts, in meinen Beinen hängend, verzweifelt suchte ich mit meiner freien Linken nach ihm zu greifen – und dann stürzte Ramon Guijarro, immer kleiner werdend, in die Tiefe. Weiß spritzte das Flusswasser auf. Die Kaimane machten sich von der Sandbank wohl auf den Weg.
Don Gasparro aber zog mich jetzt mit einem Ruck nach oben. Er sagte mir später, dass er mich wie ein hilfloses, zitterndes kleines Kind auf die Lokomotive habe tragen müssen. Und während die „Elvira“ langsam ihren Weg nach Aranagua fortsetzte, hatte
ich mich bald soweit gefasst, um Don Gasparro den Hergang der Sache zu erzählen.
„Das ist ihm recht geschehen!“, meinte er. „Warum feilschte er? Warum war er nicht mit zehn Pesos zufrieden? ...Er hat übrigens bei Lebzeiten Pferde gestohlen ... Friede seiner Seele!“
Bekanntlich macht die Bahn kurz vor Aranagua hart an dem Fluss einen Bogen. Als wir so langsam am Ufer herfuhren, sahen wir plötzlich, wie sich aus dem Wasser irgendetwas erhob, das über und über mit Schlamm und Pflanzen bedeckt war. Eine menschliche Gestalt, die mit Würde dem Ufer zustrebte und wie eine Art Flussgott an Land stieg.
Und als wir hielten, schien uns auf einmal, als ob die Gestalt eine gewisse Ähnlichkeit hätte...

Kessel: unter Druck stehendes Gefäß
feilschen: hartnäckig um einen niedrigen Preis verhandeln
Würde: hier R Haltung, Stolz
„Santissima!“, flüsterten wir, „Guijarros Gespenst!“ „Hallo, bist du es, Ramon?“, rief Don Gasparro.
Da zeigte er uns bloß stumm die Faust. Und als wir ihn dann fragten, wie er sich denn vor den Kaimanen gerettet habe, da sagte er, dass er von den Indios noch ganz andere Sachen gelernt habe, als mit Kaimanen umzugehen, und dass wir uns vorsehen sollten... „Da sieht man“, sagte Don Gasparro Schüetzli und gab Volldampf, „dass die Kaimane doch wählerisch sind.“
So und nicht anders war der Hergang der Sache. Insbesondere ist es nicht wahr, dass Guijarro später zu mir gekommen sei, um die sechsundvierzig Pesos abzufordern. Ich hätte sie ihm auch auf keinen Fall gegeben.
Es besteht also nicht der mindeste Grund zur Aufregung.
Indios: süd- und mittelamerikanische Ureinwohnerinnen und Ureinwohner vorsehen: sich in Acht nehmen
Unterstreiche in der Kurzgeschichte die direkten Reden! Verwende BLAU für Pedro Alverde, ROT für Ramon Guijarro und GRÜN für Don Gasparro!
Lies die folgenden Aussagen! Kreuze an, ob sie richtig oder falsch sind!
Don Gasparro erzählt von einem Ereignis, das sich einst auf der Trinidad-Brücke zugetragen hat.
Pedro Alverde war zu Fuß auf dem Weg nach Aranagua.
Um sich vor einer Lokomotive zu retten, musste er sich an einer Bahnschwelle festhalten.
Zum Glück kam Don Gasparro vorbei und bat ihm gegen Bezahlung seine Hilfe an.
Eine weitere Lokomotive zwang nun auch Ramon, sich an einer Bahnschwelle festzuhalten.
Da Pedro nun keine Kraft mehr hatte, musste er sich an Ramons Körper klammern.
Der Maschinist Don Gasparro hielt an und rettete Ramon Guijarros Leben.
Pedro fiel hinab in den Fluss, überlebte jedoch den Sturz und drohte beiden mit der Faust.
Selbst die Kaimane rührten den Verunglückten nicht an, da dieser ein Betrüger war.
Bildet Vierergruppen und inszeniert einen „Talk zu Mittag“! Verteilt folgende Rollen: Moderatorin/ Moderator, Pedro Alverde, Ramon Guijarro, Don Gasparro! Spielt der Klasse vor! Tipp: Trainiert vor eurem Auftritt eure Stimmen! Wie, erfährt ihr bei M2 auf S.40. 2

ABLAUF:
Bestimmt eine Moderatorin oder einen Moderator!
richtig falsch
Wählt anschließend drei Mitspielerinnen oder Mitspieler für die Rollen des... ...Pedro Alverde ...Ramon Guijarro Don Gasparro!
a) Die Moderatorin oder der Moderator berichtet kurz über das heutige Thema der Sendung und begrüßt anschließend die Gäste und stellt diese kurz vor.
b) Nun erzählen die Studiogäste das Erlebnis aus IHRER Sicht.
c) Dazwischen wird auch immer wieder von der Moderatorin oder vom Moderator das Publikum um seine Meinung gefragt.
d) Sollte es zu Streitigkeiten kommen oder die Studiogäste durcheinanderreden, muss die Moderatorin oder der Moderator schlichtend eingreifen.
e) Zuletzt fasst die Moderatorin oder der Moderator das Gesagte der Studiogäste nochmals kurz zusammen.



Bevor du moderierst, ist es wichtig, dass deine Stimme bereit ist und du klar und selbstsicher auf dein Publikum wirkst. Hier sind vier schnelle Übungen, die du direkt vor deinem Auftritt machen kannst:
1. Summen:

•Fang an leise, und mit geschlossenen Lippen zu summen, sodass ein gleichmäßiger Ton zu hören ist.
•Ändere die Höhe des Tons rauf und runter, um deine Stimme locker zu machen.

2. Zungenbrecher:
•Suche dir einen Zungenbrecher aus und sag ihn zuerst langsam und deutlich.
•Dann versuche schneller zu werden, um deine Aussprache zu trainieren. So machst du auch deine Zunge locker.

3. Sirenenübung:
•Stell dir vor, deine Stimme ist wie eine Sirene, die von ganz tief zu ganz hoch und wieder runter geht.
•Starte mit einer tiefen Stimme und geh langsam hoch und dann wieder runter. Das macht deine Stimmbänder geschmeidiger.

4. Atemtechnik:
•Sitze oder stehe gerade und atme tief durch die Nase ein.
•Halte die Luft kurz an und atme dann langsam durch den Mund aus, als ob du durch einen Strohhalm pustest.
•Das hilft dir, deine Atmung zu kontrollieren und gibt deiner Stimme mehr Power.
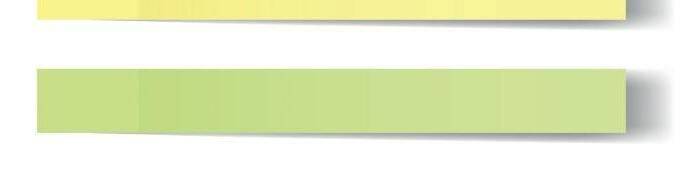
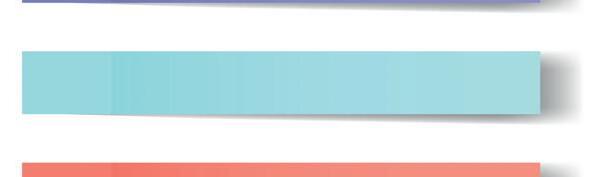

Betätige dich als Detektiv oder als Detektivin und löse die nächsten drei Fälle!
Der Sumatra-Saphir von Jürg Obrist
Wilfried Täuschbein geht unruhig in seinem Juweliergeschäft auf und ab. „Der Sumatra-Saphir, mein schönstes Stück, ist weg“, stottert er.
Gitta Gurke schaut sich im Geschäft um. „Erzählen Sie bitte alles der Reihe nach“, sagt sie.
Herr Täuschbein holt tief Luft: „Es ging alles so schnell. Um ca. 17:15 Uhr betrat ein Herr den Laden. Er interessierte sich für den Sumatra-Saphir. Wir gingen in den Kundenraum hinter dem Laden, um ungestört zu sein. Der Herr schaute sich den wertvollen Stein an. Plötzlich sprang er auf und rannte damit in den Laden hinaus. Von dort schlug er die Tür zum Kundenraum mit einem Fußtritt zu und flüchtete auf die Straße. Durch den Vorsprung konnte er sich leicht unter die vielen Passanten mischen.“
Gitta mustert das Geschäft noch einmal genau und hat dann nur noch eine Frage an den Besitzer: „Ist der Stein versichert?“
Als Herr Täuschbein die Frage bejaht, ist sie sich sicher, dass der Juwelier den Diebstahl nur vortäuscht, um die Versicherungssumme zu kassieren. In seiner Schilderung kann nämlich eine Kleinigkeit nicht stimmen. Welche Kleinigkeit stimmt nicht?
Die Geheimbotschaft von Jürg Obrist
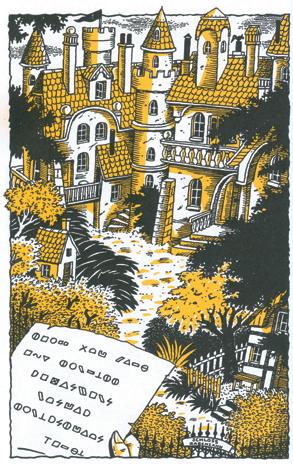

Waldo und Fimmel haben sich mit gefälschten Schecks wieder einmal eine schöne Stange Geld ergaunert. Gleich nach ihrer Aktion trennen sie sich, um nicht erwischt zu werden. Fimmel taucht bei seiner Großmutter unter, Waldo bringt die Beute noch in ein sicheres Versteck, dann verschwindet auch er. Wie vereinbart lässt er Fimmel etwas später eine wichtige Mitteilung in Geheimschrift zukommen. Kurz darauf wird Fimmel aber von der Polizei entdeckt. Weil die Polizisten mit den wirren Zeichen nichts anfangen können, rufen sie Kalle und Gitta zu Hilfe. Sie erstellen einen Schlüssel, knacken den Code und sind bereits unterwegs, um das Geld sicherzustellen. Wer die Botschaft entschlüsselt, der weiß, wo sie suchen werden!
Botschaft:
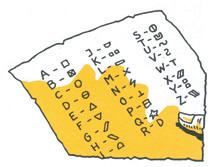
Wo ist der Sack mit dem Geld versteckt? Kreise auf dem Bild ein!
Mord im Museum von Frank Goyke
Der Kommissar war eine Kommissarin. Auch das Opfer war weiblich. Es lag auf dem Linoleumboden der Frühgeschichtlichen Abteilung zwischen Glasvitrinen mit ausgebleichten Knochen. Mit Steingeld aus dem Pazifischen Ozean war die Frau erschlagen worden.
Der Museumsdirektor hatte die Tote gefunden. Außer ihm waren ein junger Mann und eine ältliche Frau in dem Saal. Der junge Mann scharrte mit den Sohlen seiner Turnschuhe über den Boden, die Frau wirkte in ihrer blauen Museumsuniform penibel wie eine Oberschwester. Von der Spurensicherung wusste die Kommissarin, dass ein Schlüssel benutzt worden war, um in den Saal zu gelangen. Sie nahm den Direktor beim Arm und führte ihn außer Hörweite. „Wer hat Zugang zu dieser Abteilung?“, wollte sie wissen. „Ich natürlich“, erwiderte der Direktor. „Und das Personal, das in diesem Saal zur Aufsicht eingesetzt ist. Also Herr Schmieder“, er deutete auf den jungen Mann, „Frau Bachmann“, er wies auf die Oberschwester, „und auch ...“ Der Direktor brach ab.
„Die Tote? Frau Richter, meinen Sie?“ Er nickte. „Das heißt“, überlegte die Kommissarin, „falls kein Nachschlüssel verwendet worden ist, kommt nur einer von ihnen drei in Betracht.“
„Ja, leider“, sagte der Direktor. Frau Bachmann weinte. Sie hatte der Toten offenbar nahe gestanden. „Frau Richter war so etwas wie eine Nachtwächterin?“, fragte die Kommissarin.
„Nein, Gott bewahre!“, rief der Direktor. „Wir haben hier 24-Stunden-Dienste. Von Morgen zu Morgen. Vom Montag zum Dienstag hatte Frau Bachmann Dienst, vom Dienstag zu gestern Herr Schmieder, und Frau Richter ...“ Erneut brach er ab.
Die Kommissarin widmete sich Frau Bachmann. „Schrecklich!“, schluchzte diese. „Die arme, arme Ruth!“ Dann warf sie dem jungen Mann einen giftigen Blick zu. „Wäre der Chef nicht ein so gutmütiger Mensch, wäre das nie passiert.“ „Was hat die Güte des Direktors mit einem Mord zu tun?“„Schmieder“, zischte Frau Bachmann. „Ich war dagegen. Von Anfang an. Aber der Chef hat eine soziale Ader.“
Linoleum:
„Für den Umgang mit Herrn Schmieder braucht man eine?“, fragte die Kommissarin. „Überprüfen Sie denn nicht alle Verdächtigen? Herr Schmieder hat doch ...“, Frau Bachmann senkte ihre Stimme, „er hat im Gefängnis gesessen.“ Triumphierend warf sie ihren Kopf in den Nacken.
Die Kommissarin winkte Herrn Schmieder in eine Ecke des Saales. „Die alte Zicke hat Ihnen bestimmt gesagt, dass ich es war“, polterte Schmieder sofort los. „Einmal Blechnapf, immer Blechnapf? Die ist bloß neidisch.“
„Auf Sie?“ Die Kommissarin musterte das Goldkettchen an Schmieders gebräuntem Hals. „Weil ich für jeden Wochentag ein anderes Mädchen habe“, sagte Schmieder stolz.
„Und Frau Bachmann hat nicht für jeden Wochentag ein anderes Mädchen?“ „Nicht mal einen Mann“, entgegnete Herr Schmieder etwas irritiert „Die Perlen!“, kreischte Frau Bachmann. Das kam so plötzlich, dass sogar die Kommissarin zusammenfuhr. „Die Kette!“
Alle liefen zusammen: Der Direktor, Schmieder und die Kommissarin. Frau Bachmann war kreidebleich und zeigte auf die Tote.
„Da ... da hat ...“, stammelte sie. Sie drehte sich zu Schmieder um. „Wo ist die Perlenkette? Herr Schmieder?“ „Welche Perlenkette?“, wollte die Kommissarin wissen. „Ihr Mann hat Ruth zum Geburtstag eine sehr kostbare Perlenkette geschenkt“, erklärte Frau Bachmann. „Ein wirklich schönes Stück. Gestern hatte Ruth die Kette noch.“
„Tatsächlich?“ Der Direktor trat näher. „Das wäre doch ein Motiv, Frau Kommissarin? Habgier?“ „Allerdings“, bestätigte die Kommissarin. „Habgier war das Motiv. Von Frau Bachmann!“
Weshalb weiß ich, dass Frau Bachmann die Täterin ist?
Bedeutung „Einmal
penibel: gewissenhaft, exakt
irritiert: verwundert



Der Kriminalroman ist eine noch recht junge Textgattung des 19. Jahrhunderts, die ihren Ursprung im 18. Jahrhundert hat. Im Laufe der Zeit entwickelten sich auch Detektivromane und Detektivgeschichten. Während im Kriminalroman die Entstehung eines Verbrechens in chronologischer Reihenfolge geschildert wird, geht es in der Detektivgeschichte darum, dass ein Detektiv oder Ermittler erst die Vorgeschichte einer Tat rekonstruieren muss. Da die Leserin oder der Leser also nicht weiß, wer der Täter ist, erhöht sich die Spannung.


chronologisch:


Entstanden ist die Kriminalliteratur ursprünglich im englischsprachigen Raum. Die erste Detektivgeschichte stammt aus dem Jahr 1841 und wurde von dem amerikanischen Schriftsteller Edgar Allan Poe verfasst. In der Erzählung „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ werden zwei Frauen im 4. Stock eines Pariser Hauses ermordet aufgefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel, da alle Türen versperrt sind und man sich nicht erklären kann, wie der Mörder vom Tatort flüchten konnte. Dies ist der Einsatz für den ersten Detektiv der Weltliteratur – C. Auguste Dupin –, der schließlich einen aus dem Zoo entflohenen Orang-Utan als Mörder überführt.



1886 erschuf Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes die wohl bekannteste Detektivfigur aller Zeiten. Sherlock Holmes löst alle Fälle nur mit seinem messerscharfen Verstand. Mit detailgenauen Beobachtungen und danach folgenden logischen Schlussfolgerungen schafft er es, auch scheinbar unlösbare Fälle zu lösen. Stets wird er von seinem Freund und Helfer – Dr. Watson – begleitet, der auch die Geschichten aus seiner Erinnerung erzählt. Neben zahlreichen Verfilmungen gibt es auch seit 2010 die englische Fernsehserie „Sherlock“. In dieser ermitteln die beiden Detektive äußerst erfolgreich in der Gegenwart.







Ab den 1920er-Jahren gelang es der englischen Schriftstellerin Agatha Christie zur bekanntesten Autorin von Detektivgeschichten aufzusteigen. Die verkaufte Weltauflage ihrer Bücher soll über zwei Milliarden betragen, womit sie zu den erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte zählt. Sie schuf den etwas selbstverliebten belgischen Detektiv Hercule Poirot, der mit seinem Freund Hastings knifflige Fälle löst sowie eine etwas schrullige ältere Dame mit dem Namen Miss Marple, die durch ihre Hartnäckigkeit jedes schwierige Rätsel löst und damit immer die Polizei zum Staunen bringt. Ihre Romane und Kurzgeschichten waren und sind die Vorlage für unzählige Fernsehfilme und Serien. Sehr bekannt ist die Verfilmung „16:50 ab Paddington“ mit Margaret Rutherford als Miss Marple aus dem Jahr 1961. In diesem Film gibt sich Miss Marple als Haushälterin aus, um den Mörder zu überführen. 2017 wurde auch Agatha Christies Roman „Mord im Orientexpress“ neu verfilmt, in dem Hercule Poirot in einem eingeschneiten Zug dem Mörder auf der Spur ist.

Erkläre zuerst die orangen Wörter in der Seitenspalte, dann beschrifte mit Hilfe des Textes die Fotos!
Fertige eine Mindmap zu diesem Sachtext an! Schreibe das Wort „KRIMINALLITERATUR“ als Thema in die Mitte!
rekonstruieren: knifflig: schrullig:
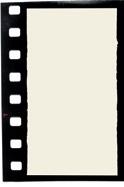

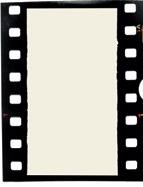
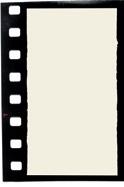

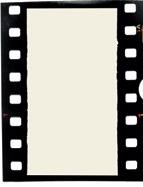





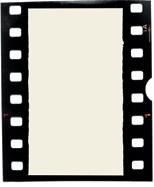


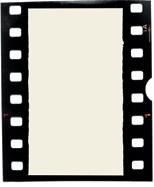


Lupenlesen – Versuche, den Informationstext zu lesen!

Den Kriminalroman gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit entwickelten sich auch Detektivromane und Detektivgeschichten. Im Kriminalroman wird die Entstehung eines Verbrechens in chronologischer Reihenfolge geschildert. In der Detektivgeschichte geht es darum, dass ein Detektiv oder Ermittler erst die Vorgeschichte einer Tat rekonstruieren muss. Da die Leserin oder der Leser also nicht weiß, wer der Täter ist, erhöht sich die Spannung.



Entstanden ist die Kriminalliteratur ursprünglich im englischsprachigen Raum. Die erste Detektivgeschichte stammt aus dem Jahr 1841 und wurde von dem amerikanischen Schriftsteller Edgar Allan Poe verfasst. In der Erzählung „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ werden zwei Frauen im 4. Stock eines Pariser Hauses ermordet aufgefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel, da alle Türen versperrt sind. Niemand kann erklären, wie der Mörder vom Tatort flüchten konnte. Dies ist der Einsatz für den ersten Detektiv der Weltliteratur – C. Auguste Dupin. Er überführt schließlich einen aus dem Zoo entflohenen Orang-Utan als Mörder.



1886 dachte sich Arthur Conan Doyle den wohl bekanntesten Detektiv aller Zeiten aus: Sherlock Holmes, der alle Fälle nur mit seinem messerscharfen Verstand löst. Er beobachtet alles genau, wägt alle Fakten logisch ab und löst damit auch angeblich unlösbare Fälle. Stets wird er von seinem Freund und Helfer – Dr. Watson – begleitet. Dr. Watson ist auch der Erzähler der Geschichten rund um Sherlock Holmes. In der englischen Fernsehserie „Sherlock“ ermitteln die beiden Detektive seit 2010 äußerst erfolgreich in der Gegenwart.




Ab den 1920er-Jahren stieg die Schriftstellerin Agatha Christie zur bekanntesten Autorin von Detektivgeschichten auf. Die verkaufte Weltauflage ihrer Bücher soll über zwei Milliarden betragen. Damit zählt sie zu den erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte.

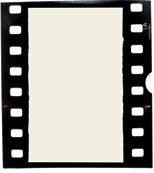


Ihr bekanntester Detektiv ist Hercule Poirot, der mit seinem Freund Hastings knifflige Fälle löst. Daneben gibt es auch die sehr erfolgreiche Miss Marple, die als Hobby-Ermittlerin immer wieder die Polizei zum Staunen bringt. Die Romane und Kurzgeschichten von Agatha Christie wurden sehr oft verfilmt. Sehr bekannt ist der Film „16:50 ab Paddington“ mit Margaret Rutherford als Miss Marple aus dem Jahr 1961. In diesem Film gibt sich Miss Marple als Haushälterin aus, um einen Mörder zu überführen. 2017 wurde auch Agatha Christies Roman „Mord im Orientexpress“ neu verfilmt: Hercule Poirot steht in einem eingeschneiten Zug vor der schwierigen Aufgabe, einen Mörder zu stellen.

Ordne zuerst die orangen Wörter den Erklärungen in der Seitenspalte zu, dann beschrifte mit Hilfe des Textes die Fotos!
Fertige eine Mindmap zu diesem Sachtext an! Stelle das Wort „KRIMINALLITERATUR“ als Thema in die Mitte!
Welche Textsorten sind das? Wähle aus und setze den richtigen Buchstaben zur passenden Zahl!
Tipp: Der Reihe nach ergeben die Buchstaben ein Lösungswort!
O. Filmbewertung M B. Interview M C. Romanauszug M L. SMS M A. Programmzeitschrift M D. Leserbrief M U. Google-Eintrag M M. Fabel M E. Gedicht M T. Klappentext M
F. Kurzgeschichte M I. Illustration M H. Tagebucheintrag M R. Buchinformation M
S. Kochrezept M J. Gedicht M K. Märchen M N. Lexikoneintrag M G. Songtext M P. Brief

20: 15 Agatha Christies Poirot
Doppelte Sünde

Krimi nach einer Vorlage nach den Büchern von Agatha Christie, GB 1990 Zweikanalton, HDTV
Poirot und Captain Hastings treffen auf Mary Durrant. Diese will wertvolle Miniaturen an einen reichen Amerikaner verkaufen, doch auf dem Weg zum Kunden werden die Miniaturen gestohlen...
Regie: Richard Spence
Drehbuch: Clive Exton, Agatha Christie
Darsteller: David Suchet (Hercule Poirot), Hugh Fraser (Captain Hastings), Philip Jackson (Chief Inspector Japp)...
Produzent: Brian Eastman
MMMMM Meisterwerk
Überragende Serie im Filmformat!
Jede Folge ist einfach atemberaubend spannend und extrem clever. Das Zusammenspiel von Dr. Watson und Sherlock ist zudem überaus lustig. Besser geht’s nicht! Ich freu mich jetzt schon auf Staffel 3 und 4!!!

Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington | Trailer Dezember |
Kabel Eins ... https://www.youtube.com/watch?v=6reGK6Z9ouw 30.12.2017 - Hochgeladen von TrailerClips Deutschland [Since 2017]
Abonnieren Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington am Neujahr um 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Und im ...
Der größte Detektiv aller Zeiten in seinen spannendsten Fällen

3

Der junge Sherlock Holmes soll seine Sommerferien auf dem Land verbringen – bei Tante Anna in Farnham. Stundenlang dauert die Reise und nichts als Gerstenfelder weit und breit. Noch öder geht es ja wohl kaum, Sherlock ist stocksauer. Doch dann kommt alles ganz anders, und plötzlich ist er mittendrin in seinem ersten Fall. Mysteriöse Todesfälle, prügelnde Muskelprotze und ein böser Baron – das erste Abenteuer des jungen Meisterdetektivs beginnt.
Taschenbuch: 132 Seiten
Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (25. Dezember 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 1481843273
ISBN-13: 978-1481843270

Größe und/oder Gewicht: 14 x 0,8 x 21,6 cm
Durchschnittliche Kundenbewertung: MMMM
Edgar Allan Poe, US-amerikanischer Schriftsteller, * 19. 1. 1809 Boston, Mass., † 7. 10. 1849 Baltimore; Wegbereiter der modernen Kurzgeschichte, bedeutender Vertreter der fantastischen Literatur und Begründer des modernen Kriminalromans. In seinen Kurzgeschichten und Gedichten, die von den englischen Romantikern beeinflusst sind, tritt das Grotesk-Unheimliche und Visionäre besonders hervor. Poe war der erste bedeutende Literaturkritiker Amerikas und entwickelte eine eigene Literaturtheorie („The Philosophy of Composition“ 1846). Hauptwerke: „Der Untergang des Hauses Usher“ 1839, deutsch 1883; „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ 1841, deutsch 1853; „Das verräterische Herz“ 1843, deutsch 1922; „Der Rabe u. a. Gedichte“ 1845, deutsch 1909.
LÖSUNGSWORT:




Finde die Mörderin oder den Mörder – Bei diesem Krimirätsel musst du genau auf die Aussagen der Beteiligten achten. Kreuze an, welche zwei Aussagen jeweils stimmen! Begründe auch, wie du darauf gekommen bist!
In einer Villa lebt ein Millionär mit seiner Millionärsgattin und vier Angestellten. Eines Morgens findet man den Millionär tot in seinem Zimmer. Da die Zufahrtsstraße durch ein Unwetter nicht passierbar war, konnte ihn nur jemand getötet haben, der in der Villa lebt.


Millionärsgattin:
1. Ich habe meinen Mann nicht getötet.
2. Der Gärtner ist der Mörder.
3. Ich bin unschuldig.
Gärtner:
1. Die Millionärsgattin lügt, wenn sie mich beschuldigt.
2. Der Butler ist der Mörder.
3. Ich habe es nicht getan.

Zimmermädchen:
1. Ich bin nicht schuldig.
2. Letzte Nacht habe ich tief und fest geschlafen.
3. Der Gärtner ist der Mörder.


Butler:
1. Ich bin nicht der Mörder.
2. Das Zimmermädchen kann bezeugen, dass wir letzte Nacht in der Küche Karten gespielt haben.
3. Die Köchin hat den Millionär ermordet.
Köchin:
1. Ich war es nicht.
2. Seit 13 Jahren arbeite ich schon hier.
3. Der Butler weiß, wer den Mord verübt hat.
Wer ist der Täter oder die Täterin?
Als die Bewohner und Bewohnerinnen des Schlosses von Kommissar Schnüffler befragt werden, gibt jeder drei Antworten. Zwei sind richtig und eine ist eine Lüge.
Begründung:



Versuche zuerst, diesen Liedtext zu lesen, der in Umgangssprache verfasst ist! Die Worterklärungen helfen dir dabei.
Der Mann mit dem schwarzen Bart von Heinz Conrads
Vor ein paar Wochen war's, ich ging am Ring spazieren, Ganz ohne Geld ich durch die Kärntnerstraß'n geh, Und grüb‘l hin und her: „Wie könnt’ ich mich sanieren?“, Schau auf das Pflaster, liegt vor mir ein Portemonnaie
Ich denk’ mir erst: „Ich heb’ es lieber nicht gleich auf. Ich überleg’ ma‘s erst.“ und steig darauf.
Heb ich‘s auf und steck ich‘s ein, könnt’ das ein Verbrechen sein, Wann ich‘s lieg’n lass und geh, is mir leid ums Portemonnaie, Geb’ ich‘s ab, was ich ja könnt’, krieg’ ich doch nur 10 Prozent, Steh ich lang auf einem Bein, schlaft da andre Fuaß mir ein.
Drum schau ich mich um und seh‘, ich bin allein, Gib schnell den Fuaß weg und steck das Börsl ein.
Ich war zwar sehr nervös, doch mach ich ruhige Schritte
Und denk’: „Es hat doch niemand mich dabei geseh’n?“
Da hör’ ich hinter mir fortwährend Tritte
Und seh‘ an Mann mit schwarz‘n Bart hinter mir stehn.
Da denk ich mir: „Der könnt doch was gesehen haben?“
Bei dem Gedanken ich zu Tod‘ erschreck‘, Renn‘ in an Karree zurück bis hintern Grab'n, Nimm das Börsl aus‘n Rock und hau es weg.
„Also jetzt“, denk ich bloß, „Gott sei Dank, ich bin es los, Denn ich habe doch riskiert, dass man mich noch arretiert
Und so lang ich dafür sitz‘, hat das Geld für mi kan Witz
Komm’ ich raus nach zwanzig Jahr, wär’n die Zinsen wunderbar.“
Und ganz verbittert überleg ich mein Geschick: Wann ana Pech hat, hat er Pech sogar im Glück.
Ich geh schön weiter, tu mich durch die Menge drücken, Und bleib dann stehn, weil eine Tramway rüberfahrt, Da plötzlich klopft von hinten jemand mir am Rücken, I drah mi um, es is dar Mann mit‘n schwarz’n Bart.
Er sagt: „Verzeih'n, der Herr, der hat da was verloren, Ein Portemonnaie mit 1 000 Schilling, sapperment, Es liegt mir fern, bei der Gelegenheit zu schnorren Doch hab ich rechtliche Gebühr auf 10 Prozent.“
Ich mach’ das Börsl zitternd auf und schau hinein Und geb’ ihm einen Hundertschillingschein.
2 1
Ring: Ringstraße in Wien
sanieren: seine finanziellen Schwierigkeiten überwinden
Portemonnaie: Geldbörse, Geldbeutel
Börsl: Wiener Ausdruck für Geldbörse
in an Karree rennen: im Kreis laufen
Grab’n: Straße im 1. Bezirk in Wien
arretieren: festnehmen
Geschick: Schicksal
Tramway: Straßenbahn
Schilling: Währung in Österreich bis 2002 (1€ = 13,76 Schilling)
sapperment: Ausruf mit der Bedeutung wie sapperlot oder Donnerwetter
schnorren: um etwas anbetteln, ohne Gegenleistung zu bieten
Wachmann: Polizist
Er sagt: „Danke vielmals!“ und geht ruhig weiter. Ich denk’ mir: „Gott sei Dank, ich hab wieder mein Geld!“, Da steht ein Wachmann vis a vis, ein großer, breiter, Der mich die ganze Zeit im Aug‘ behält, ...

vis a vis: gegenüber

Überlege, wie die Geschichte weitergehen könnte!
Lies nun die Geschichte weiter!
Da denk’ ich mir: „Der könnte was gesehen haben?“
Bei dem Gedanken ich zu Tod‘ erschreck‘, Renn‘ in an Karee zurück bis hintern Grab’n Nimm das Börsl aus‘n Rock und hau es weg.
Und ganz verbittert überleg ich mein Geschick: Wann ana Pech hat, hat er Pech sogar im Glück.
Aber kaum war ich fort, kommt der Mann mit‘n schwarzen Bart, Sagt: „Verzeihung“ zu mir, „Ihna Börsl hab ich hier.“
Weil er schon den Inhalt kennt, sagt er nur mehr: „10 Prozent!“
Und ich drück ihm elegant 90 Schilling in die Hand.
Und i denk ma: „Wann i des no oft verlier‘, Hab i für‘n Finderlohn zuwenig Geld bei mir.“
Doch wie soll ich das erzähl‘n, wo ma doch die Worte fehl'n: Sieben Mal, so wie dressiert, hat ma der das apportiert Und mei ganzes Geld hat der und das Börsl war schon leer, Bis beim achten Mal sogar ich ihm noch was schuldig war.
Plötzlich kommt wie im Nu der Inspektor auf mich zu „Ich beobacht‘“, sagt er schlau, „Sie zwei Stunden schon genau. Und ganz deutlich ich empfind, dass sie nicht ganz richtig sind, Denn ich halt auf gar kan Fall, was sie aufführ’n, für normal:


apportieren: Gegenstände herbeibringen
wie im Nu: sehr schnell
amtieren: ein Amt ausüben
Steinhof: früher eine Klinik in Wien, in die man kam, wenn man psychische Probleme hatte
Ganz zuerst hab ich gesehn, Sie auf einem Bein dort stehn, Dann, hab ich festgestellt, schenken‘s fremden Leuten Geld. Dann schau‘n Sie sich stumm wie ein Irrsinniger um, Und wenn niemand geht und fährt, dann haun‘s a Börsl um die Erd‘.
Es tut mir Leid um Sie, jedoch ich muss amtier'n, Nach Steinhof muss ich sie überführ‘n.“
Wie ich hinkomm‘, nebenan in der Zelle saß ein Mann, Der verfolgt war und verflucht, weil er stets ein Börsl sucht.
Immer sucht er es und rennt, plötzlich schreit er: „10 Prozent!“
Seit ana Stund‘ war der schon dort –es war da Mann mit‘n schwarz‘n Bart!


HB 19: Hör nun das ganze Lied und lies dabei mit!
Bildet Gruppen zu viert und spielt diese Geschichte nach!




a) Verteilt zuerst die Rollen: Erzählerin oder Erzähler – Mann mit schwarzem Bart – Wachmann b) Dann entscheidet euch für eine der beiden Varianten:
Variante 1: Einer ist die Erzählerin oder der Erzähler und trägt die Geschichte vor, die anderen spielen pantomimisch ihre Rollen.
Variante 2: Jeder übernimmt auch eine Sprechrolle. Tipp: Leichter fällt es, wenn ihr zuerst den Text entweder in das Hochdeutsche oder in euren eigenen Dialekt übersetzt!
Leseprobe: aus „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke
...Scipio zuckte die Schultern. „Ich habe es mir eben anders überlegt. Der Palazzo Pisani kommt später. Er läuft ja nicht weg, oder? Im Palazzo Contarini ...“, er schwenkte den Beutel, den er mitgebracht hatte, vor Riccios Nase, „... war auch einiges zu holen.“
Einen Augenblick lang weidete er sich an den gespannten Gesichtern um ihn herum, dann hockte er sich im Schneidersitz vor den Sternenvorhang und schüttete den Inhalt des Beutels vor sich auf den Boden. „Den Schmuck habe ich schon verkauft“, erklärte er, während die anderen andächtig näher traten. „Ich hatte noch ein paar Schulden zu begleichen, und neues Werkzeug brauchte ich auch, aber das hier ist für euch.“
Silberne Löffel blitzten auf dem frisch gefegten Boden, ein Medaillon, eine Lupe, um deren Griff sich eine geschuppte Silberschlange wand, und eine goldene Zange, besetzt mit winzigen Steinchen, deren Griff wie eine Rose geformt war. Bo beugte sich mit großen Augen über Scipios Beute. Vorsichtig, als könnten ihm die Kostbarkeiten zwischen den Fingern zerbrechen, nahm er ein glitzerndes Teil nach dem anderen in die Hand, betastete es und legte es wieder zu den anderen. „Alles ganz echt, oder?“, fragte er und sah Scipio an. Der nickte nur spöttisch, reckte die
Arme, zufrieden mit sich und der Welt, und ließ sich auf die Seite sinken.
„Nun, was sagt ihr? Bin ich der Herr der Diebe?“
Riccio nickte nur andächtig, und selbst Wespe konnte nicht verbergen, dass sie beeindruckt war.
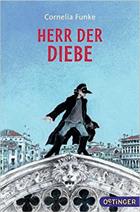

„Mann, irgendwann werden sie dich doch noch mal erwischen“, murmelte Mosca, während er die Schlangenlupe bestaunte.
„Ach was!“ Scipio rollte sich auf den Rücken und blickte zur Decke hinauf. „Zugegeben, diesmal war es etwas knapp. Die Alarmanlage war nicht so altmodisch, wie ich erwartet hatte, und die Hausherrin ist wach geworden, als ich ihr gerade das Medaillon vom Nachttisch gepflückt habe. Aber ich war schneller auf dem Dach des Nachbarhauses, als die Dame aus ihrem Bett gekommen ist.“ Er zwinkerte Bo zu, der sich bewundernd an sein Knie lehnte.
Leseprobe: aus „Young Sherlock Holmes: Der Tod liegt in der Luft“ von Andrew Lane
„Die Sache mit Betrügern“, sagte Crowe und begutachtete das Gemälde, „ist die, dass die Ungeschickten von ihnen ziemlich schnell erwischt werden. Aber häufig bringen Betrüger bessere Werke zustande als das Original. Du hast recht, was die schlechte Ausführung des Gemäldes anbelangt. Aber es ist echt.“
Er ging hinüber zu einer dramatischen Kunstszene, in welcher sich die Wellen am Strand brachen, während im Hintergrund ein Schiff in den Wogen schwankte. „Das ist eine Fälschung.“
Sherlock starrte auf das Bild. „Woher wissen Sie das?“ „Wie einige andere Gemälde deines Onkels stammt auch dieses von Claude Joseph Vernet. Dein Onkel besitzt außerdem auch ein paar Bilder von Vernets Sohn Horace. Der ältere Vernet war bekannt für seine Küstenlandschaften. Dieses hier ist ein Bild von Dover Harbour. Aber Vernet ist niemals in England gewesen.
Die Details sind so realistisch, dass es offensichtlich nach dem Leben gemalt worden ist. Deswegen ist es erklärtermaßen kein Vernet. Es ist eine Fälschung in seinem Stil.“

„Das konnte ich nicht wissen“, protestierte Sherlock. „Ich habe nie was über Vernet gelernt. Und über andere Maler auch nicht.“ „Und was sagt dir das?“, fragte Crowe.

... „Dass man zwar alles, was man will, ableiten kann, aber dass es ohne Wissen zwecklos ist. ...Informationen sind die Grundlage allen rationalen Denkens. Finde sie heraus. Sammle sie gewissenhaft. Stopf die Speicherkammer deines Gehirns mit so vielen Fakten wie nur möglich voll...“
Leseprobe: aus „Löcher – Die Geheimnisse von Green Lake“ von Louis Sachar
Stanley duschte sich – soweit man das so nennen konnte –, aß sein Abendessen – soweit man das so nennen konnte – und ging ins Bett – soweit man diese stinkende, kratzige Koje als Bett bezeichnen konnte.
Weil das Wasser so knapp war, durfte jeder Lagerbewohner nur vier Minuten lang duschen. Etwa so lang brauchte Stanley, um sich an das kalte Wasser zu gewöhnen. Einen Knopf für warmes Wasser gab es nicht. Immer wieder trat er unter den Wasserstrahl, um gleich im nächsten Moment wieder zurückzuspringen, und dann war die Zeit auch schon um. ... Das Essen bestand aus gekochtem Fleisch mit Gemüse. Das Fleisch war braun und das Gemüse war einmal grün gewesen. Alles schmeckte ziemlich gleich. Stanley aß alles auf und wischte mit einem Stück Brot die Sauce auf. Stanley hatte noch nie zu denen gehört, die etwas auf dem Teller lassen, ganz egal, wie es schmeckte.
„Was hast du gemacht?“, fragte ihn einer der anderen. Zuerst wusste Stanley gar nicht, was der Junge meinte. „Es hat doch einen Grund, dass sie dich hergeschickt haben!“ „Ach so“, sagte Stanley. Jetzt kapierte er. „Ich hab ein Paar Turnschuhe geklaut.“
Die anderen fanden das komisch. Stanley war sich nicht sicher, wieso eigentlich. Vielleicht hatten sie selbst ja viel Schlimmeres gemacht als Schuhe zu klauen. „Aus einem Laden oder hast du sie einem von den Füßen geklaut?“
„Öh – weder noch“, antwortete Stanley. „Sie gehörten Clyde Livingstone.“ Das nahm ihm keiner ab. „Du meinst – Sweet Feet?“, sagte X-Ray. „Das gibt’s doch
nicht!“ „Ausgeschlossen!“, sagte Torpedo.
Als Stanley später auf dem Bett lag, kam es ihm erst richtig komisch vor: Keiner hatte ihm geglaubt, als er sagte, dass er unschuldig sei. Aber als er sagte, er hätte die Dinger wirklich geklaut, da glaubte ihm auch keiner.


Clyde „Sweet Feet“ Livingstone war ein berühmter Baseballspieler... Stanley hatte ein Poster von Clyde Livingstone in seinem Zimmer an der Wand hängen. Jedenfalls hatte er es mal gehabt. Wo es jetzt war, wusste er nicht. Die Polizei hatte es als Beweisstück mitgenommen und vor Gericht als Indiz für seine Schuld präsentiert.
Auch Clyde Livingstone war im Gericht erschienen. Als Stanley hörte, dass Sweet Feet kommen würde, war er trotz allem ganz gespannt darauf, seinem Helden zu begegnen.
Clyde Livingstone bezeugte, dass es sich bei den Turnschuhen tatsächlich um seine handelte und dass er sie einem Heim für Straßenkinder gespendet hatte. Er sagte, er könne nicht begreifen, wie ein Mensch so gemein sein könnte, Kindern, die kein Zuhause hätten, etwas zu stehlen.
Das war das Schlimmste für Stanley. Sein Held hielt ihn für einen elenden, nichtsnutzigen Dieb.
Ordne diese neuen Textauszüge den zuvor vorgestellten Büchern zu!
Herr der Diebe ______ Löcher ______Young Sherlock Holmes
A ... war kein schlechter Junge. Er hatte die Tat, wegen der man ihn verurteilt hatte, nicht begangen. Er war einfach im falschen Moment am falschen Ort gewesen.
B ... Mit ungeduldigen Fingern durchsuchte Prosper die Fächer, doch zwischen verknitterten Kassenbelegen, Restaurantrechnungen und Vaporettokarten steckten gerade mal ein paar Tausend-Lire-Scheine.
C ... „Du beobachtest mich schon seit einer halben Stunde.“... „Überall auf den Bäumen um uns herum hocken Vögel. Mit Ausnahme von einem. Und zwar dem, auf dem du gesessen hast ...“
Welches der drei vorgestellten Bücher regt dich zum Lesen an? Kreuze bei Ü1 an!
von Johanna und Günter Braun
Als Herr Morph am Abend die dreitausendfünfhundert Mark vermisste, die er am Tag zuvor geholt und in seinen Schreibtisch gelegt hatte, fragte er seine Frau, ob sie das Geld woanders hingelegt habe.
Sie hatte es nicht, und daraus schlussfolgerte Herr Morph, dass ihm das Geld gestohlen war. Er fragte Frau Morph, ob sie Wilfried Naumann, seinen Freund, der, als Morph noch nicht von der Arbeit zurück war, ein Buch zurückgebracht hatte, einen Augenblick alleingelassen habe.
Ja, sagte sie, um ihm einen Kaffee zu bereiten.
Dann hat er das Geld gestohlen, sagte Morph.
Das kannst du nicht ohne weiteres behaupten.
Es ergibt sich logisch, sagte Morph.
Vielleicht war es ein Einbrecher, sagte sie.
Wir waren die Nacht zu Hause, und es war alles verschlossen. Es gibt nicht die geringsten Spuren eines Einbruchs. Es bleibt nur Freund Naumann übrig.
Unmöglich, er ist unser Freund, sagte Frau Morph.
Es hat sich gezeigt, dass er nicht unser Freund ist, sagte Morph. Ich fahre jetzt zu ihm und hole das Geld.
Naumann war empört, als Morph ihm unterstellte, das Geld genommen zu haben. Er versicherte, es nicht genommen zu haben, er beschwor es. Und argumentierte damit, dass er einen Freund nicht bestehlen werde.
Konsequenz: Auswirkung
Das behaupten falsche Freunde oft, sagte ungerührt Morph, gib das Geld heraus.
Ich habe es nicht, sagte der Freund.
Es wäre wenigstens ein kleiner Freundschaftsdienst, ein Rest von Freundschaft, wenn du es mir jetzt geben würdest.
Ich kann nicht geben, was ich nicht habe.
Damit erkläre ich unsere Freundschaft für beendet, sagte Morph und verließ den Freund.
Mark: Währung in Deutschland bis 2002
argumentieren: begründen


Dann fand Morph in seinem Schreibtisch das Geld. Er hatte es zu gut versteckt, zwischen die Seiten seines Tagebuchs siebenmal einen Fünfhundertmarkschein gelegt, so dass es nicht auffiel.
Kurz darauf brachte der Sohn des Freundes einen Umschlag mit dreitausendfünfhundert Mark. Unserer Freundschaft zuliebe, schrieb der Freund, damit sie erhalten bleibt, schicke ich Dir das Geld, auch wenn ich, was ich hiermit noch einmal beschwöre, es nicht genommen habe.
Morph schickte das Geld zurück und schrieb dazu: Es bleibt dabei, unsere Freundschaft ist beendet. Ich habe das Geld gefunden. Damit ist bewiesen, dass ich der Freundschaft nicht wert bin.
Zu welcher Textsorte zählt die Geschichte? Kreuze an!
Was fällt dir stilistisch beim Lesen der Geschichte sofort auf?
stilistisch: Art und Weise, wie etwas geschrieben ist
Anekdote: kurze, meist witzige Geschichte, die eine Persönlichkeit treffend charakterisiert
Lies die Geschichte von S. 51 ein zweites Mal und unterstreiche beim Lesen diese wichtigen Angaben!
Titel * Autor/Autorin * Orte * vorkommende Personen * verlorene Geldsumme * Aufbewahrungsort des Geldes * Fundort des Geldes * Konsequenz
Beantworte folgende Fragen mit Hilfe des Textes!
a) Herr Morph ist sicher, dass sein Freund das Geld genommen hat. Wie begründet Herr Morph sein Urteil?
Er sagt, dass
b) Was macht Herr Morph, als sein Freund die Tat leugnet?
Herr Morph
c) Wie verhält sich Herr Morph, als er erkennt, dass er sich geirrt hat?
d) Was meinst du zu seiner Konsequenz?
Herr Morph zeigt ganz bestimmte Verhaltensweisen. Notiere hier, wie du ihn charakterisieren würdest!

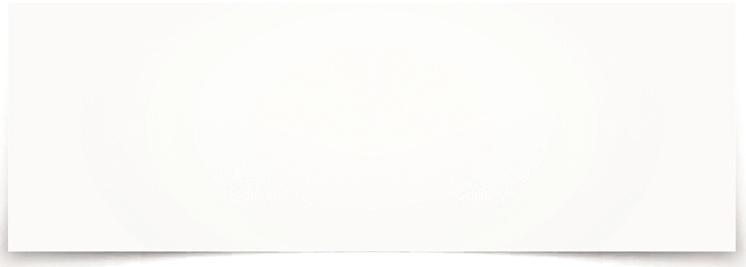
Verfasse eine Inhaltsangabe zu dieser Anekdote!
Entscheide dich zuerst für die schwere oder einfache Version dieses Informationstextes!
Unterstreiche dann im Text wichtige Schlüsselwörter!
Was sind Balladen?
Ab dem 12. Jh. gab es schon Tanzlieder, die Balladen genannt wurden. Das lateinische Wort „ballare“ bedeutet nämlich „tanzen“. Bald erfolgte der Wandel vom Tanzlied hin zum epischen (= erzählenden) Lied. Im 18. Jh. wurde der Begriff Ballade auf Erzählgedichte übertragen, die ein besonderes Ereignis mit wörtlichen Reden darstellen.
Goethe bezeichnete die Ballade als „Ur-Ei“ der Dichtung, weil in ihr lyrische, epische und dramatische Elemente untrennbar miteinander verbunden sind.
Die lyrischen Elemente zeigen sich darin, dass Balladen meist lange Gedichte sind, die häufig aus Strophen, Versen und Reimen bestehen. Ähnlich einem Gedicht vermitteln sie dem Leser oder der Leserin eine besondere Stimmung und Atmosphäre.
Daneben weisen Balladen auch epische Elemente auf, denn wie eine Geschichte erzählen sie spannende Handlungen und schildern außergewöhnliche Ereignisse. Balladen enthalten auch dramatische Elemente, denn sie sind lebendig geschrieben und mit Dialogen ausgeschmückt. Die Geschichte und die Ereignisse können sich zu einem dramatischen Höhepunkt zuspitzen oder in einer überraschenden Wende enden.
Kreise den Buchstaben der richtigen Antwort ein!
Aus welcher Sprache stammt des Wort „ballare“?
Seit wann gibt es Balladen?
Balladen gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Doch damals meinte man, wenn man Ballade sagte, ein Tanzlied. Das lateinische Wort „ballare“ bedeutet nämlich „tanzen“. Bald nannte man aber Lieder, die etwas erzählen, Balladen. Im 18. Jahrhundert wurde der Begriff Ballade auf Erzählgedichte übertragen. In diesen wird ein besonderes Ereignis mit wörtlichen Reden dargestellt.
Was ist das Besondere an einer Ballade?
Schon der deutsche Dichter Goethe nannte die Ballade ein „Ur-Ei“, weil sie eine Mischform aus Gedicht, Erzählung und einem kleinen Drama ist.
Gedicht: Balladen sind meist lange Gedichte. Man erkennt ihre Gedichtform an den Strophen, Versen und Reimen.
Erzählung: Eine Ballade hat eine spannende Handlung. Sehr oft wird ein außergewöhnliches Ereignis geschildert.
Drama: Wie in einem Theaterstück ist die Handlung abwechslungsreich und enthält Dialoge. Sehr oft spitzen sich die Geschichte und die Ereignisse zu einem dramatischen Höhepunkt zu oder enden in einer überraschenden Wende.
Wer bezeichnete die Ballade als „Ur-Ei“?
In einem Drama gibt es viele...
Gedichte

HB 20: Höre dir zuerst die beiden Vortragsversionen der ersten beiden Strophen der Ballade „Die Bürgschaft“ an! Welche hat dir besser gefallen? Kreise ein!






Eine Ballade gut vorzutragen, ist wichtig, weil du damit die Geschichte und die Gefühle, die darin stecken, richtig rüberbringen kannst. Es ist, als würdest du den Zuhörern ein Fenster in eine andere Welt öffnen, wo sie genau spüren können, was du fühlst.
1. Schritt:
Es geht nicht nur darum, was du sagst, sondern wie du es sagst – das macht den großen Unterschied und kann aus Worten echte Magie machen!
Suche in der Ballade alle wörtlichen Reden und markiere jede sprechende Person in einer eigenen Farbe!
2. Schritt:
Überlege dir, welchen Charakter oder welches Alter die Personen haben! So kannst du deine Stimmlage zur Darstellung der Person anpassen.
3. Schritt:
Das Farbsystem erleichtert dir nun das Lesen und Vorbereiten. Lies dir das Gedicht mindestens 3 x laut vor! Übe schwierige Wörter!
4. Schritt:
Probiere nun für die verschiedenen Sprechrollen folgendes aus: unterschiedliche Stimmlagen R schreien, flüstern, mit zittriger Stimme sprechen, mit tiefer Stimme sprechen, kreischen, … unterschiedliche Geschwindigkeiten R langsam, schnell, mit Pausen, …
5. Schritt:
Entscheide, welche Stimmlage und Geschwindigkeit am besten zu den einzelnen Rollen passt!
Notiere deine „Regieanweisungen“ neben den einzelnen Strophen!
6. Schritt:
Nun übe deinen Vortrag!
Nimm ihn mit dem Handy auf!
Überprüfe, welche Stellen du noch üben musst!
7. Schritt:
Nun kommt dein Auftritt!
Tief durchatmen - das hilft gegen Lampenfieber
Tipp: Seid ihr mehrere Vortragende, verteilt die Rollen und übt gemeinsam!


Bildet Dreiergruppen, um gemeinsam die Ballade vorzutragen! Übt nach der Methode von S. 54!
1. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande:
Ihn schlugen die Häscher in Bande, „Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich!“ Entgegnet ihm finster der Wüterich. „Die Stadt vom Tyrannen befreien!“ „Das sollst du am Kreuze bereuen.“
2. „Ich bin“, spricht jener, „zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben:
Doch willst du Gnade mir geben, Ich flehe dich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; Ich lasse den Freund dir als Bürgen, Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen.“
3. Da lächelt der König mit arger List Und spricht nach kurzem Bedenken: „Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, Eh' du zurück mir gegeben bist, So muss er statt deiner erblassen, Doch dir ist die Strafe erlassen.“
4. Und er kommt zum Freunde: „Der König gebeut, Dass ich am Kreuz mit dem Leben Bezahle das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich komme zu lösen die Bande.“
5. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund Und liefert sich aus dem Tyrannen; Der andere ziehet von dannen. Und ehe das dritte Morgenrot scheint, Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, Eilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht verfehle.
6. Da gießt unendlicher Regen herab, Von den Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel herab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.
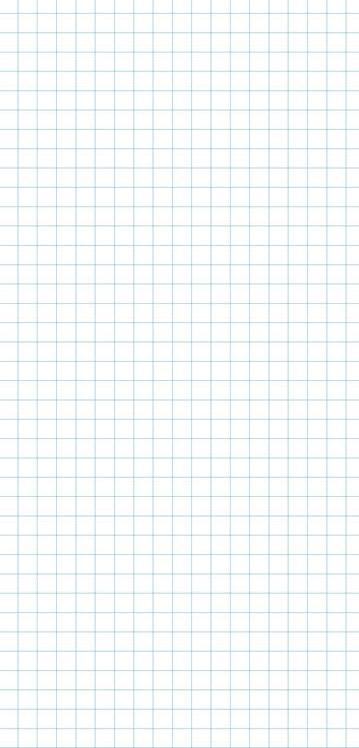


7. Und trostlos irrt er an Ufers Rand: Wie weit er auch spähet und blicket Und die Stimme, die rufende, schicket. Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, Der ihn setze an das gewünschte Land, Kein Schiffer lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.
8. Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, Die Hände zum Zeus erhoben:
„O hemme des Stromes Toben! Es eilen die Stunden, im Mittag steht Die Sonne, und wenn sie niedergeht Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muss der Freund mir erbleichen.“
9. Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut, Und Welle auf Welle zerrinnet, Und Stunde an Stunde ertrinnet. Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut Und wirft sich hinein in die brausende Flut Und teilt mit gewaltigen Armen Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.
10. Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die raubende Rotte Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord Und hemmet des Wanderers Eile Mit drohend geschwungener Keule.
11. „Was wollt ihr?“, ruft er vor Schrecken bleich, „Ich habe nichts als mein Leben, Das muss ich dem Könige geben!“ Und entreißt die Keule dem nächsten gleich: „Um des Freundes willen erbarmet euch!“ Und drei mit gewaltigen Streichen Erlegt er, die andern entweichen.


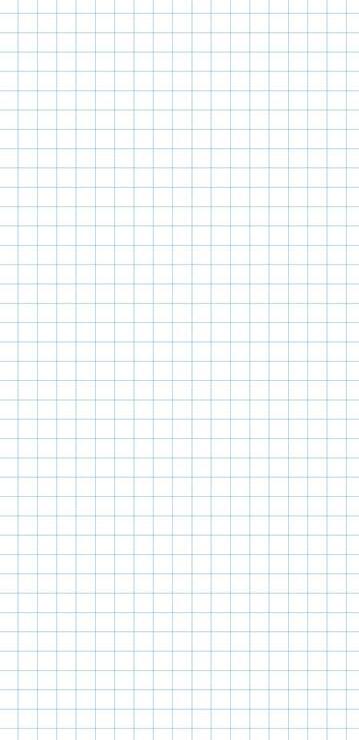
Präsentiert eure Ballade vor der Klasse!




Löse die Aufgaben zu den Strophen 12 bis 17 in der Seitenspalte!
Und die Sonne versendet glühenden Brand, Und von der unendlichen Mühe Ermattet sinken die Kniee. „O, hast du mich gnädig aus Räubershand, Aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, Und soll hier verschmachtend verderben, Und der Freund mir, der liebende, sterben!“
Und horch! da sprudelt es silberhell, Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, Und stille hält er, zu lauschen; Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, schnell, Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, Und freudig bückt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.
Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün Und malt auf den glänzenden Matten Der Bäume gigantische Schatten; Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn, Will eilenden Laufes vorüber fliehn, Da hört er die Worte sie sagen: „Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.“
ermattet: an Kraft verlierend, schlapp gnädig: wohlwollend verschmachtend verderben: leidend untergehen stille halten: ganz ruhig werden lebendiger Quell: sprudelndes Quellwasser gigantisch: riesig groß die Straße ziehn: auf der Straße vorbeigehen
F1: Wie sind die Strahlen der Sonne?
schwach sehr heiß warm
F2: Warum bricht Damon zusammen?
weil er verletzt ist weil er traurig ist
weil er erschöpft ist
F3: Das Land ist für Damon „heilig“, weil ...
es das rettende Ufer ist er sehr gläubig ist
er den Tyrannen treffen wird
F4: Mit wem spricht Damon am Ende der Strophe?
Freund Dionys Zeus
F1: Welches Geräusch wird mit einer „geschwätzigen“
Quelle sprachlich gezeichnet?
Gurgeln Zischen Wispern
F2: Weshalb ist Damon über das Quellwasser erfreut?
Er ist erfreut, weil er nach dem Kampf…
tauchen kann
sich abkühlen kann
trinken kann
F3: Was könnte man statt „Glieder“ einsetzen?
Arme und Beine Gesicht Kopf
F1: Was ist mit „der Zweige Grün“ gemeint?
Stamm Wurzeln Blätter
F2: Was heißt „die glänzenden Matten“?
Moos, Gras Steine Zweige
F3: Welche Tageszeit wird mit diesem sprachlichen Bild gezeichnet?
Morgen Mittag Abend
F4: Was bedeutet, dass „er ans Kreuz geschlagen wird“?
Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß; Ihn jagen der Sorge Qualen; Da schimmern in Abendrots Strahlen Von ferne die Zinnen von Syrakus, Und entgegen kommt ihm Philostratus, Des Hauses redlicher Hüter, Der erkennet entsetzt den Gebieter:
„Zurück! Du rettest den Freund nicht mehr, So rette das eigene Leben! Den Tod erleidet er eben.
Von Stunde zu Stunde gewartet' er Mit hoffender Seele der Wiederkehr, Ihm konnte den mutigen Glauben Der Hohn des Tyrannen nicht rauben.“
„Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht, Ein Retter, willkommen erscheinen, So soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, Dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, Er schlachte der Opfer zweie
Und glaube an Liebe und Treue!“
beflügeln: anregen, dass etwas schneller wird
Zinnen: quaderförmiger Teil der Burgmauer redlich: aufrichtig, ehrlich
Hüter: jemand, der auf etwas aufpasst


F1: Weshalb sorgt sich Damon?
Gebieter: jemand, der über einen anderen oder etwas herrscht
hoffende Seele: tief empfundene Hoffnung
Hohn: Spott
sich rühmen: auf etwas stolz sein
weil er die Hochzeit versäumt
weil er zur Rettung seines Freundes zu spät kommt
weil er Angst vor Räubern hat
F2: Wer ist hier der „Hüter“, der Damon entgegenkommt?
Schäfer Diener sein Freund
F3: Wer ist der „Gebieter“?
Dionys Damon Räuber
F1: Wer spricht hier?
Dionys Diener Damon
F2: Wie lautet der Ratschlag?
das Leben des Freundes zu retten
das eigene Leben zu retten
das Leben von Dionys zu retten
F3: Wie geht es dem Freund?
Er hat die Hoffnung verloren.
Er ist schon seit Stunden tot.
Er glaubt an Damons Rückkehr.
F1: Wer spricht hier?
Diener Dionys Damon
F2: Welchen Plan hat Damon?
Er will flüchten.
Er will mit dem Freund sterben.
Er will den Tyrannen töten.
F3: Wer sind die „Opfer“?
Damon und sein Freund
der Freund und Dionys
Dionys und Damon
Welche Entscheidung würdest du treffen?


1

Bildet wieder Dreiergruppen! Übt die letzten Strophen der Ballade und tragt sie der Klasse vor!
18. Strophe
Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor, Und sieht das Kreuz schon erhöhet, Das die Menge gaffend umstehet; An dem Seile schon zieht man den Freund empor, Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: „Mich, Henker“, ruft er, „erwürget! Da bin ich, für den er gebürget!“
19. Strophe
Und Erstaunen ergreifet das Volk umher, In den Armen liegen sich beide Und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge tränenleer, Und zum Könige bringt man die Wundermär'; Der fühlt ein menschliches Rühren, Lässt schnell vor den Thron sie führen.
Und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er: „Es ist euch gelungen, Ihr habt das Herz mir bezwungen; Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn –So nehmet auch mich zum Genossen an: Ich sei, gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der Dritte!“


erhöhen: aufrichten
gaffen: jemanden oder etwas anstarren
Henker: jemand, der die Todesstrafe vollstreckt
Wundermär: seltsame oft unwahre Geschichte
Rühren: innere Bewegtheit
Wahn: Einbildung; falsche Vorstellung von etwas

Genosse: Kamerad, Begleiter, Gefährte
2
Beantworte anhand der letzten beiden Strophen folgende Fragen!
Welche Veränderung in der Beziehung zwischen Dionys, Damon und seinem Freund ist eingetreten?
Worauf ist das zurückzuführen?

Nicht jeder Raum eignet sich zum Nachdenken, und wenn man hundert Räume besitzt, muss man herausfinden, welcher von ihnen die Gedanken am meisten fördert.
Sooft der Sultan von Tubodin über etwas nachsinnen wollte, begab er sich in die Grüne Kammer, legte sich auf ein Sofa und schloss die Augen; fast immer kam er zu guten Einsichten. Allerdings musste es in der Kammer ganz, ganz still sein, vor allem durfte dort nie eine Fliege summen, denn dieses Geräusch war dem Sultan verhasst.
Der Sklave Maurus hatte dafür zu sorgen, dass in die Grüne Kammer keine Fliege drang. Ein bequemes Amt, wird mancher sagen, ein Faulenzerposten, wie er nur im Morgenland vergeben wird. Doch damit tut man dem Sklaven Maurus Unrecht. Zum einen hatte er sich das Amt ja nicht erwählt, sondern es war ihm, der in seiner Heimat als ein kundiger Baumeister galt, vom Schicksal auferlegt worden, und er litt unter der Erniedrigung. Zum anderen ist es gar nicht so leicht, im Orient Fliegen aus dem Zimmer zu halten.
An dem Tage, von dem hier berichtet wird, ruhte der Sultan in der Grünen Kammer auf dem Sofa und sann vor sich hin. Maurus, der mit seiner Fliegenpatsche bei der Tür stand, war unruhig. Er wusste es nicht geradezu, aber er ahnte, er argwöhnte , dass irgendwo eine Fliege sitze, und konnte nur hoffen, dass sie sich nicht zeige. Doch da hörte, da sah er sie schon. In taumeligen Kurven flog sie umher und summte wie eine Hornisse
Der Sultan schlug die Augen auf. „So liederlich“, sprach er, „versiehst du dein Amt! Wie soll ich nachdenken, wenn das Zimmer voller Fliegen ist?“
„Verzeiht, Herr“, antwortete Maurus. „Es ist nur eine einzige Fliege, und ich werde sie sofort erlegen.“
Der Sultan blickte nach seinem Tisch aus Jaspis, auf dem vielerlei Kostbarkeiten standen. „Wende die goldene Sanduhr um! Solange der Sand rieselt, hast du Zeit, die Fliege zu töten. Gelingt es dir nicht, stirbst du.“
Es war eine kurze Frist, denn das goldene Ding diente als Zeitmaß für die Ansprachen, die der Sultan an seine Minister richtete; in vier Minuten lief der Sand durchs Glas. Mit zitternder Hand kehrte Maurus die Sanduhr um und begann eine Jagd, die keinen guten
Ausgang versprach. In der Grünen Kammer standen auf sieben langen Tischen unzählige Kunstgegenstände, an den Wänden hingen Ampeln, Waffen und geschnitzte Figuren: lauter Verstecke für die Fliege, sichere Verstecke, weil Maurus nichts beschädigen durfte.
Die Fliege stieß ans Fenster, zweimal, dreimal, und Maurus schlich hinzu. Als sie erneut gegen die Scheibe fuhr, schlug er nach ihr; doch er verfehlte sie. Mit empörtem Gesumm stürzte und wirbelte die Fliege umher, sie führte sich auf wie eine Besessene.
Obwohl ein winziges Wesen nur und des Denkens nicht fähig, spürte sie genau, dass man ihr ans Leben wollte. Zudem war es die Stunde, in der alle Fliegen der Welt, auch wenn sie sich nicht bedroht fühlen, unsinnige Tänze aufführen – die Stunde vor Sonnenuntergang. Die Fliege in der Luft zu treffen, schien unmöglich. Blitzschnell schoss sie dahin und änderte in einem fort die Richtung.
Warum ist es für Maurus so schwierig, mich zu fangen?


nachsinnen: über etwas nachdenken
Erniedrigung: Demütigung
Orient: vorder- und mittelasiatische Länder
Fliegenpatsche: argwöhnen: vermuten


Hornisse: liederlich: nachlässig
Jaspis: Halbedelstein
Sanduhr:

Frist: für einen bestimmten Zweck festgelegte Zeitspanne

Maurus behielt sie im Auge, er betete im Stillen, sie möge sich endlich niedersetzen. Es kam ihm jetzt nicht mehr darauf an, ob er mit seiner Patsche etwas beschädigte: wenn er nur das leidige Insekt dabei erschlug.
Da setzte sich die Fliege nieder, und es war, als vermöge sie doch zu denken, denn nunmehr befand sie sich jenseits aller Gefahr. Sie saß auf der rechten Schulter des Sultans.
Maurus blickte auf die Sanduhr und sah, dass sie zur Hälfte abgelaufen war. Was sollte er bloß tun? Es ging nicht an, den Sultan von Tubodin mit der Fliegenklappe zu treffen, und wer es dennoch unternahm, musste mit einem qualvollen Tode rechnen. Da war der flinke Säbel des Henkers noch das kleinere Übel.
Der Sultan lag mit geschlossenen Augen auf dem Sofa, er tat, als sinne oder träume er vor sich hin: er weidete sich jedoch an der Verzweiflung des Sklaven. Er horchte auf dessen Schritte und suchte zu erraten, wie es um die Fliegenjagd stand. Als er Maurus nicht mehr gehen, die Fliege nicht mehr summen hörte, wurde er unmutig. Am Ende gelang es dem Tölpel, sich im allerletzten Augenblick zu retten! Der Sultan konnte nicht wissen, dass die Fliege auf seiner eigenen Schulter saß, dass sie seinen hohen Schutz genoss.
Maurus stand reglos, er hatte keine Hoffnung mehr. Ohne hinzuschauen, sah er, wie die Sanduhr drüben ihm eilig das Urteil ausfertigte. Vor seinen Augen wuchsen Häuser empor, Rathäuser und Handelshöfe und Getreidespeicher, eine ganze Stadt, die er hätte bauen wollen und die nun ungebaut blieb, einer Fliege wegen. Indem er dies dachte, hob die Fliege sich von des Sultans rechter Schulter und kreiste in der Luft. Gleich darauf fuhr sie nieder, dicht an Maurus vorbei. Sie streifte die Fliegenpatsche, flog das Sofa an, lief darüber hin, stieg erneut auf und setzte sich schließlich auf des Sultans rechtes Knie. Dort verhielt sie.
Ein wilder Zorn befiel Maurus. „Wenn ich ohnedies sterben muss“, dachte er, „soll auch der Sultan sterben. Er ist nicht allzu kräftig, es wird leicht sein, ihn zu erwürgen, und hinterher werde ich mich aufhängen.” Aber schon kam ihm ein neuer Gedanke: „Meine Tat wird sicherlich nicht gleich entdeckt. Ich fliehe – vielleicht habe ich Glück, nach so viel Unglück.“
Er trat leise auf den Sultan zu und streckte seine Hände aus. Sie zitterten nicht, wie vorhin, als er die Sanduhr umgewendet hatte, sie waren ganz ruhig. Jetzt kam es darauf an, den Hals des Sultans rasch und fest zu umklammern, damit ihm kein Schrei mehr entfahre. In diesem Augenblick verließ die Fliege ihren Sitz, zog einen Halbkreis und ließ sich auf der Stirn des Sultans nieder. Der Sultan schlug nach ihr, die Fliege fiel auf das Sofa herab.
Im Zuschlagen öffnete der Sultan die Augen. Er sah die Hände des Sklaven dicht bei seinem Hals und erkannte, was jener mit ihm vorhatte. „Du willst mich töten?“ fragte er.
Maurus nickte. „Ich wollte es, Herr, weil ich um einer Fliege willen sterben sollte.“
Als dem Sultan aufging, wie nahe ihm der Tod gewesen, erschrak er. Sein Herz pochte, er wurde bleich. „Einer Fliege wegen“, sann er und konnte es gar nicht fassen, „einer kleinen Fliege wegen wäre ich ums Haar ermordet worden.“

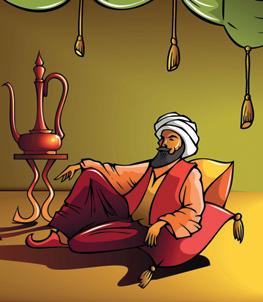
Wie könnte die Geschichte weitergehen?

sich weiden: sich an etwas erfreuen
unmutig: schlecht gelaunt
Tölpel: ungeschickter Mensch
entfahren: unbeabsichtigt ausgesprochen
Lies nun das Ende der Geschichte „Die Fliege“!
Er brauchte ein Weilchen, bis er seine Stimme wiederfand. Dann sprach er: „Dass du mich töten wolltest, lassen wir beiseite. Fest steht, dass nicht klar entschieden worden ist, ob du dein Leben verwirkt hast oder nicht, denn als ich die Fliege erschlug, war die Frist noch nicht abgelaufen. Oder irre ich mich?“
„Ich weiß es nicht, Herr“, erwiderte Maurus. „Ich habe zuletzt den Anblick der Sanduhr gemieden.“
„Wir wollen“, fuhr der Sultan fort, „den Fall zu Ende bringen. Du wendest jetzt noch einmal die Sanduhr; dann rennst du, so schnell du kannst und so weit du kommst, um dein Leben. Sobald die Zeit um ist, schicke ich meine Aufseher und die Jäger mit den
verwirken: einbüßen, verlieren
meiden: ausweichen, ignorieren
Kurier: Bote
Hunden hinter dir her. Fasst man dich, gehörst du dem Henker.“
Maurus tat, wie ihm befohlen war. Er kehrte die Sanduhr um, stürzte aus der Grünen Kammer, rannte die Treppen hinab, durcheilte die Höfe, die Tore und erreichte im Nu die engen Gassen der Stadt. Alle, an denen er vorüberschoss, hielten ihn für des Sultans schnellsten Kurier.
In der Grünen Kammer lief die Sanduhr aus. Der Sultan griff nach einer Glocke, um die Aufseher herbeizuläuten; da sah er, was er nicht glauben mochte. Die Fliege auf dem Sofa, die er tot gewähnt, hatte sich erholt, sie kroch umher. Als sie sich gar in die Luft schwang und auf ihn zuflog, duckte er sich wie unter einer Gefahr. „Ein Zeichen!“ dachte er furchtsam. „Eine Warnung! Ich soll nicht läuten.“
So kam es, dass die Jagd auf den Sklaven Maurus unterblieb, dass er seine Heimat erreichte und wieder ein Baumeister wurde.
Schreibe die Antworten zu folgenden Fragen in vollständigen Sätzen in dein Heft!
a) Warum empfindet der Sultan das Weiterleben der Fliege als Zeichen und Warnung?
b) Weshalb wirkt die Geschichte teilweise lustig?
Ergänze die Angaben!
Titel der Geschichte:Autor:
Textsorte:
Namen der Hauptpersonen:
Ort und Zeit der Handlung:
Überlege, welche Parallelen es zur Ballade „Die Bürgschaft“ gibt! Notiere mindestens zwei!
Verfasse in deinem Heft eine Inhaltsangabe zur Geschichte „Die Fliege“!
Tipp: Der Einleitungssatz hilft dir dabei.
In seiner Kurzgeschichte „Die Fliege“ erzählt der Autor Kurt Kusenberg...



HB 21: Höre dir vor dem Lesen die Ballade als Lied der Band „Holly Loose“ an!
John Maynard von Theodor Fontane (1819 – 1898)
John Maynard!
„Wer ist John Maynard?“
„John Maynard war unser Steuermann, Aus hielt er, bis er das Ufer gewann, Er hat uns gerettet, er trägt die Kron, Er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn.
John Maynard.“
1. Strophe
Die „Schwalbe“ fliegt über den Erie-See, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee; Von Detroit fliegt sie nach Buffalo –die Herzen aber sind frei und froh, Und die Passagiere mit Kindern und Fraun Im Dämmerlicht schon das Ufer schaun, Und plaudernd an John Maynard heran Tritt alles: „Wie weit noch, Steuermann?“ Der schaut nach vorn und schaut in die Rund: „Noch dreißig Minuten ... Halbe Stund.“
2. Strophe
Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei –Da klingt's aus dem Schiffsraum her wie Schrei, „Feuer!“ war es, was da klang, Ein Qualm aus Kajüt und Luke drang, Ein Qualm, dann Flammen lichterloh, Und noch zwanzig Minuten bis Buffalo.
3. Strophe
Und die Passagiere, bunt gemengt, Am Bugspriet stehn sie zusammengedrängt, Am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht, Am Steuer aber lagert sich´s dicht, Und ein Jammern wird laut: „Wo sind wir? Wo?“ Und noch fünfzehn Minuten bis Buffalo.
4. Strophe
Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht, Der Kapitän nach dem Steuer späht, Er sieht nicht mehr seinen Steuermann, Aber durchs Sprachrohr fragt er an:
„Noch da, John Maynard?“ „Ja, Herr. Ich bin.“
Kron: Krone

Bug: vorderster Teil eines Schiffes
Kajüte: Wohn- und Schlafraum auf einem Schiff oder Boot


5. Strophe
„Auf den Strand! In die Brandung!“

„Ich halte drauf hin.“
Und das Schiffsvolk jubelt: „Halt aus! Hallo!“
Und noch zehn Minuten bis Buffalo.
6. Strophe
„Noch da, John Maynard?“ Und Antwort schallt's Mit ersterbender Stimme: „Ja, Herr, ich halt's!“ Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, Jagt er die „Schwalbe“ mitten hinein.
Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. Rettung: der Strand von Buffalo!
Das Schiff geborsten. Das Feuer verschwelt. Gerettet alle. Nur einer fehlt!
7. Strophe
Alle Glocken gehn; ihre Töne schwell'n Himmelan aus Kirchen und Kapell'n, Ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt, Ein Dienst nur, den sie heute hat: Zehntausend folgen oder mehr, Und kein Aug' im Zuge, das tränenleer.
8. Strophe
Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, Mit Blumen schließen sie das Grab, Und mit goldner Schrift in den Marmorstein Schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein:
9. Strophe
„Hier ruht John Maynard! In Qualm und Brand Hielt er das Steuer fest in der Hand, Er hat uns gerettet, er trägt die Kron, Er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn. John Maynard.“
Bereite mit Hilfe der Methode „Texte gut vorbereiten“ von S. 54 einen Einzelvortrag vor! Präsentiere ihn der Klasse!
Luke: verschließbare als Ein- und Ausstieg dienende Öffnung bei Schiffen
Bugspriet: über den Bug hinausragende Segelstange
Steuer: Ruder zum Steuern des Schiffes
Brandung: sich an der Küste brechende Wellen bersten: mit großer Gewalt auseinanderbrechen verschwelen: niederbrennen
Markiere in der Ballade „John Maynard“ die Textstelle, die sich wiederholt!
Überlege und erkläre, welche Funktion diese Wiederholung haben könnte!
Fülle den Steckbrief von „John Maynard“ aus!
NAME: _________________________________
BERUF: ________________________________
NAME DES SCHIFFES:
HELDENTAT: _____________________________________________________


Erstelle eine Spannungskurve zu der Ballade „John Maynard“! Stufe dazu auf der vorgegebenen Skala (sehr niedrig bis sehr hoch) jede Strophe ein und verbinde zum Schluss die Punkte miteinander! Begründe die Stufen deiner Spannungskurve!
SPANNUNG
sehr hoch hoch mittel niedrig sehr niedrig
Verfasse einen spannenden Zeitungsbericht über das Unglück auf der „Schwalbe“!
Lies die Geschichte bis zum Pausenzeichen! Dann löse jeweils die Aufgabe in der Seitenspalte!
Die Schule von Isaac Asimov (1920 – 1992)

Margie schrieb es am Abend sogar in ihr Tagebuch. Auf die Seite mit der Titelzeile 17. Mai 2157 schrieb sie: „Heute hat Tommy ein richtiges Buch gefunden!“
Es war ein sehr altes Buch. Margies Großvater hatte ihr einmal erzählt, dass er als kleiner Junge von seinem Großvater gehört hätte, wie in früheren Zeiten alle Geschichten auf Papier gedruckt gewesen wären.
Sie wendeten die Seiten, die schon vergilbt und brüchig waren, und es war ungemein komisch, Worte zu lesen, die stillstanden, statt sich über den Bildschirm zu bewegen, wie es sich gehörte. Und dann, wenn sie wieder zurückblätterten, konnten sie auf den vorhergehenden Seiten dieselben Worte lesen, die sie schon beim ersten Mal gelesen hatten.
„Denk mal“, sagte Tommy, „was für eine Verschwendung. Wenn du mit dem Buch fertig bist, musst du es wegwerfen. Unser Fernseher hat schon viele tausend Bücher gezeigt, und er ist noch gut für viele tausend mehr. Den braucht man nie wegzuwerfen.“
„Wo hast du das Buch gefunden?“, fragte Margie neugierig. Sie war elf und hatte noch nicht so viele Telebücher gesehen wie Tommy.
Er war dreizehn. „Bei mir zu Haus.“ Er zeigte mit dem Daumen in die Richtung, ohne hinzusehen, denn er war mit Lesen beschäftigt. „Auf dem Dachboden.“
„Wovon handelt es?“ „Schule.“


Margie wurde zornig. „Schule? Was kann man denn schon über die Schule schreiben? Ich hasse die Schule!“ Margie hatte die Schule schon immer gehasst, aber jetzt hasste sie sie mehr als je zuvor. Der mechanische Lehrer hatte sie wieder und wieder in Geografie abgefragt, und bei jedem Mal war sie schlechter gewesen, bis ihre Mutter bekümmert den Kopf geschüttelt und die Schulinspektion angerufen hatte.
Der Schulinspektor war ein runder kleiner Mann mit einem roten Gesicht gewesen, der eine ganze Kiste mit Instrumenten, Drähten und Werkzeugen bei sich getragen hatte. Er hatte Margie angelächelt und ihr einen Apfel gegeben, dann hatte er sich über den mechanischen Lehrer hergemacht und ihn auseinandergenommen.
Margie hatte gehofft, dass er ihn nicht wieder zusammenbringen würde, aber er hatte Bescheid gewusst, und nach einer Stunde oder so hatte das Ding wieder dagestanden, groß und schwarz und hässlich, mit einer großen Mattscheibe darauf, wo alle Lektionen gezeigt wurden, und mit einem Lautsprecher daneben, der die Fragen stellte.
Aber das war nicht das Schlimmste. Der Teil, den Margie am meisten hasste, war ein Schlitz, in den sie alle Hausarbeiten und die Antworten auf seine Fragen stecken musste.

Schließe die Augen und spule die Zeit zurück!
a) Denk an die Jugend deiner Eltern, als nur wenige Menschen einen Computer zu Hause hatten!
b) Spul die Zeit bis heute vor: Denke jetzt an deinen Alltag mit Internet, SocialMedia-Plattformen, KI usw.
c) Nun spul schnell weiter in das Jahr 2157 und überlege, wie der Alltag der Menschen in der Zukunft aussehen könnte!
VORTEILE: Mache eine Gedankenreise!
Welche Vorteile bringe ich? Notiere drei!

Alles das musste sie in einem Lochcode schreiben, den sie mit sechs Jahren gelernt hatte, und der mechanische Lehrer rechnete die Noten im Nu aus.
Der Schulinspektor hatte Margie noch einmal angelächelt und ihr den Kopf getätschelt, nachdem er seine Arbeit beendet hatte. Und zu ihrer Mutter hatte er gesagt: „Ihre Tochter kann nichts dafür, Mrs. Jones. Ich glaube, der Sektor Geografie war ein wenig zu schnell eingestellt. So etwas kann mitunter vorkommen. Ich habe ihn verlangsamt, dass er dem durchschnittlichen Leistungsniveau einer Zehnjährigen entspricht. Ansonsten sind die Fortschritte Ihrer Tochter recht befriedigend.“ Und er hatte Margie wieder über die Haare gestrichen.
Margie war enttäuscht gewesen. Sie hatte gehofft, dass man den Lehrer ganz fortschaffen würde. Einmal hatten sie Tommys Lehrer fast für einen Monat weggebracht, weil er auf dem Sektor Geschichte überhaupt nicht mehr funktioniert hatte.
Welche Nachteile bringe ich? Notiere drei!

NACHTEILE:
So sagte sie jetzt zu Tommy: „Warum sollte jemand über die Schule schreiben?“ Tommy blickte auf sie und sah sie überlegen an. „Weil es nicht unsere Art Schule ist, du Dummkopf. Das ist die alte Art Schule, wie man sie vor Hunderten von Jahren hatte.“ Von oben herab und mit sorgfältiger Betonung fügte er hinzu: „Vor Jahrhunderten.“


Margie war verletzt. „Woher soll ich denn wissen, was für eine Art Schule sie vor so langer Zeit hatten.“ Sie schaute ihm über die Schulter und las eine Weile mit, dann sagte sie: „Jedenfalls hatten sie auch einen Lehrer.“
„Sicher hatten sie einen Lehrer, aber es war kein richtiger Lehrer. Es war ein Mann.“
„Ein Mann? Wie kann ein Mann ein Lehrer sein?“
„Na, er hat eben den Jungen und Mädchen Sachen erzählt, ihnen Fragen gestellt und Hausaufgaben gegeben.“
„Ein Mann ist dafür nicht klug genug.“
„Klar. Mein Vater weiß so viel wie mein Lehrer.“
„Das kann er nicht. Ein Mann kann nicht so viel wissen wie ein Lehrer."
„Er weiß beinahe so viel, darauf wette ich mit dir.“
Margie fühlte sich für eine Diskussion nicht stark genug. Sie sagte: „Mir würde es nicht gefallen, wenn ein fremder Mann ins Haus käme, um Schule zu halten.“ Tommy kreischte vor Lachen. „Du weißt nichts, Margie. Die Lehrer haben nicht bei den Kindern im Haus gelebt. Sie hatten ein besonderes Haus, und alle Kinder gingen dorthin."
„Und alle Kinder lernten dasselbe?“
„Klar, wenn sie im gleichen Alter waren.“
„Aber meine Mutter sagt, ein Lehrer muss genau für den Jungen oder das Mädchen eingestellt werden, die er lehrt, und dass jedes Kind andere Lektionen bekommen muss, weil die Kinder im Lernen ganz verschieden sind.“
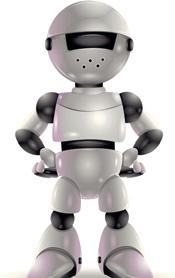
Schreibe vier Bereiche auf, in denen in der Zukunft Roboter eingesetzt werden könnten!
„Trotzdem haben sie es damals nicht so gemacht. Wenn es dir nicht gefällt, brauchst du das Buch ja nicht zu lesen.“
„Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt“, sagte Margie hastig. Sie wollte gern mehr über diese komischen Schulen lesen. Sie hatten das Buch noch nicht einmal zur Hälfte durch, als Margies Mutter vor die Tür kam.
„Margie! Schule!“
Margie blickte auf: „Noch nicht, Mama!"
„Jetzt!“, sagte Mrs. Jones. „Und für Tommy wird es wahrscheinlich auch schon höchste Zeit.“
Margie fragte Tommy schüchtern: „Darf ich nach der Schule mit dir weiter in dem Buch lesen?“
„Vielleicht", erwiderte er herablassend. Dann schlenderte er pfeifend davon, das staubige alte Buch unter den Arm geklemmt.
Beantworte deinem Roboter-Lehrer diese Fragen!
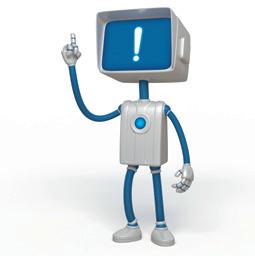
Margie trottete unlustig in ihr Schulzimmer. Es befand sich neben ihrem Schlafzimmer, und der mechanische Lehrer war bereits eingeschaltet und wartete auf sie. Der Unterricht fand jeden Tag um die gleiche Zeit statt, außer samstags und sonntags, weil ihre Mutter sagte, dass kleine Mädchen besser lernten, wenn es nach einem regelmäßigen Stundenplan geschah.
Der Bildschirm war erleuchtet, und der Lautsprecher sagte: „Unsere heutige Rechenaufgabe besteht aus der Addition einfacher Brüche. Bevor wir anfangen, steckst du die gestrige Hausaufgabe in den Aufnahmeschlitz.“
Margie gehorchte seufzend. Sie dachte an die alten Schulen zu der Zeit, als der Großvater ihres Großvaters ein kleiner Junge gewesen war. Alle Kinder aus der ganzen Nachbarschaft kamen dort lachend und schreiend im Schulhof zusammen, saßen miteinander im Klassenzimmer und gingen nach dem Unterricht zusammen nach Hause. Sie lernten dieselben Aufgaben, damit sie einander bei der Hausarbeit helfen und darüber sprechen konnten. Und die Lehrer waren Leute...
Auf dem Bildschirm des mechanischen Lehrers erschienen die Worte: „Wenn wir die Brüche ½ und ¼ addieren wollen...“ Margie musste daran denken, wie glücklich die Kinder in den alten Tagen gewesen sein mussten. Wie schön sie es gehabt hatten.
a) Wie würdest du es finden, von einem Roboter unterrichtet zu werden?
sehr gut
gut
weniger gut
gar nicht gut
b) Weshalb glaubt Margie, dass es früher schöner war?
Da die Kurzgeschichte aus dem Jahr 1966 stammt, kannte der Autor viele technische Neuerungen wie Computer, Internet usw. noch nicht, die für dich eine Selbstverständlichkeit sind. Welche Passagen an der Geschichte würdest du ändern? Notiere sie hier!
Meine Schule im Jahr 2157 – Verfasse zu diesem Thema einen Fantasieaufsatz! Bau in deine Geschichte auch einen Rückblick auf heute ein!
aus
Im Jahre 1872 wurde das Haus Nummer 7 in der Saville Row von Herrn Phileas Fogg bewohnt. Herr Fogg zählte zu den sonderbarsten und bemerkenswertesten Mitgliedern des Londoner Reform-Klubs, obgleich ihm offenbar sehr daran gelegen war, keinesfalls etwas zu tun, das Aufmerksamkeit erregen könnte. Eine rätselhafte Persönlichkeit, über die niemand etwas wusste, galt er dennoch als einer der galantesten Kavaliere und bestaussehensten Gentlemen der feinen englischen Gesellschaft. ...
Nachdem Phileas Fogg sein Haus um halb zwölf verlassen und fünfhundertfünfundsiebzig Mal den rechten Fuß vor den linken sowie fünfhundertfünfundsiebzig Mal den linken Fuß vor den rechten gesetzt hatte, erreichte er den Reform-Klub. Unverzüglich ging er in den Speisesaal, dessen neue Fenster auf einen schönen, bereits herbstlich gefärbten Garten hinausgingen. Sein Tisch war bereits gedeckt. ...
Um zwölf Uhr siebenundvierzig begab er sich in den großen Salon. Dort reichte man ihm die noch nicht aufgeschnittene Times. ... Die Lektüre der Times dauerte bis drei Uhr fünfundvierzig, die des Standards bis zum Abendessen.
Um zwanzig Minuten vor sechs begab sich Herr Fogg erneut in den großen Salon, um sich in den Morning Chronicle zu vertiefen, und eine halbe Stunde später betraten einige wenige Klubmitglieder den großen Salon, in dem ein großes Feuer brannte. Mit diesen Herren pflegte Herr Fogg Karten zu spielen. Es handelte sich um so hoch angesehene Persönlichkeiten wie den Herrn Ingenieur Andrew Stuart, die Bankiers John Sullivan und Samuel Fallentin, den Bierbrauer Thomas Flanagan sowie Herrn Walter Ralph, Vorstandsmitglied der Bank von England.
Kavalier: Mann, der Frauen gegenüber besonders hilfsbereit und höflich ist
Gentleman: Mann von Anstand und Charakter
Salon: großer Raum als Gesellschaftszimmer
Bankier: Inhaber oder Vorstandsmitglied einer Bank
„Nun, Ralph“, fragte Thomas Flanagan, „wie steht’s jetzt mit dem Bankraub?“
„Meiner Meinung nach“, sagte Andrew Stuart, „wird die Bank ihr Geld wohl nie wiedersehen.“

„Im Gegenteil“, entgegnete Herr Walter Ralph. „Ich bin überzeugt, dass wir den Dieb bald gefasst haben werden. In Amerika wie in Europa sind in allen wichtigen Häfen die tüchtigsten Kriminalbeamten postiert. Er dürfte kaum entkommen.“ ...
Der Fall, der in sämtlichen Zeitungen lebhaft diskutiert wurde, hatte sich vor drei Tagen zugetragen. Ein Bündel Banknoten in der unglaublichen Höhe von fünfundfünzigtausend Pfund war vom Tisch des Hauptkassiers der Bank von England entwendet worden. ...
Das Geld war weg und in Liverpool und Glasgow, in Le Havre und in Suez, in Brindisi, New York und vielen anderen Häfen suchten Kriminalbeamte mit der Aussicht auf eine hohe Erfolgsprämie fieberhaft nach dem geflüchteten Dieb und kontrollierten alle ankommenden und abreisenden Passagiere. Man ging davon aus, dass der Dieb keiner der bekannten Banden angehörte, weil am 29. September, am Tag des Geldraubs, ein vornehm auftretender, gut gekleideter Gentleman mit besten Manieren beobachtet worden war, wie er den Auszahlungsraum betrat und wieder verließ. ...
„Ich glaube, dass seine Chancen nicht schlecht stehen, denn er muss ja wohl ein geschickter Mensch sein“, meinte Andrew Stuart.
„Aber ich bitte Sie, wo soll er denn hin? In welches Land könnte er flüchten?“, entgegnete Ralph.
„Die Welt ist groß“, sagte Andrew Stuart.
„Das war sie einmal ...“, sagte Phileas Fogg mit halblauter Stimme. ... Sie verfielen wieder in Schweigen.
Doch bei nächster Gelegenheit begann Andrew Stuart von Neuem: „Was soll das heißen? Ist die Welt etwa kleiner geworden?“

„Zweifellos. Da muss ich Herrn Fogg zustimmen. Man kann sie heute zehnmal so schnell befahren wie vor hundert Jahren. Und das wird in unserem Fall die Suche erleichtern.“
„Aber auch die Flucht.“ ...
Doch Andrew Stuart ließ sich nicht so leicht entmutigen und nahm kurz darauf den Faden wieder auf: „Zugegeben, Herr Ralph, Sie haben eine nette Erklärung dafür gefunden, dass die Welt kleiner geworden sein soll. Zumal man sie jetzt schon in drei Monaten umfahren kann ...“
„In achtzig Tagen“, sagte Phileas Fogg. „Stimmt, meine Herren“, fügte John Sullivan hinzu. „In achtzig Tagen. Seit die Teilstrecke zwischen Rothal und Allahabad auf dem indischen Subkontinent für den Eisenbahnverkehr freigegeben wurde.“ ...
„Ja, achtzig Tage“, rief Andrew Stuart. „Aber was ist mit schlechtem Wetter, ungünstigem Wind, Schiffbruch, Entgleisungen und so weiter?“
„Alles einkalkuliert“, sagte Phileas Fogg.
„Und wenn die Hindus oder die Indianer die Schienen herausreißen, die Züge überfallen, die Reisenden skalpieren?“
„Alles einkalkuliert.“
„Theoretisch haben Sie ja Recht, Herr Fogg, aber in der Praxis ...“
„Auch in der Praxis, Herr Stuart.“
„Das würde ich gerne sehen.“
„Das hängt von Ihnen ab. Fahren wir gemeinsam.“
„Um Himmels willen! Aber ich wette viertausend Pfund, dass eine solche Reise unmöglich ist.“
„Im Gegenteil. Die ist sehr gut möglich“, entgegnete Herr Fogg.
„Dann machen Sie sie.“
„Eine Reise um die Welt in achtzig Tagen?“
„Ja.“
„Mit Vergnügen.“
„Wann?“
„Sofort.“
„Aber das ist heller Wahnsinn! Spielen wir lieber Karten.“ ...
Gedankenverloren nahm Herr Stuart die Karten auf und legte sie wieder hin. „Gut, Herr Fogg“, sagte er.
„Ich wette viertausend Pfund.“
„Gut“, sagte Herr Fogg. „Ich habe zwanzigtausend Pfund bei den Gebrüdern Barin deponiert. Die setze ich gerne ...“
„Zwanzigtausend Pfund“, rief John Sullivan. „Zwanzigtausend Pfund, die Sie durch einen unvorhergesehenen Aufenthalt verlieren könnten!“
„Mein lieber Stuart“, sagte Fallentin. „Beruhigen Sie sich. Das ist doch nicht ernst gemeint.“
„Wenn ich sage, ich wette, dann ist das immer ernst gemeint.“
„Das Unvorhergesehene gibt es nicht“, entgegnete Phileas Fogg ruhig.
„Aber Herr Fogg, diese achtzig Tage sind das Minimum!“
„Ein klug genutztes Minimum reicht aus.“
„Aber um es nicht zu überschreiten, muss man doch mit mathematischer Genauigkeit von der Eisenbahn auf die Dampfer und von den Dampfern wieder auf die Bahn springen.“
„So ist es.“
„Sie scherzen!“
„Ein guter Engländer“, entgegnete Phileas Fogg, „scherzt niemals, wenn es sich um etwas so Ernstes wie eine Wette handelt. Ich wette zwanzigtausend Pfund, dass ich die Reise um die Welt in achtzig Tagen oder weniger machen werde, also in eintausendneunhundertzwanzig Stunden oder hundertfünfzehntausendzweihundert Minuten. Nehmen Sie die Wette an?“
„Wir nehmen an“, erwiderten die Herren Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan und Ralph.
„In Ordnung“, sagte Herr Fogg. „Der Zug nach Dover fährt um acht Uhr fünfundvierzig. Den nehme ich.“ ... „Heute Abend?“
„Heute Abend.“
Diskutiert in Vierergruppen folgende Fragen! Schreibt eure Ergebnisse auf und stellt sie der Klasse vor!
Warum ist sich Phileas Fogg so sicher, dass er die Welt in 80 Tagen umrunden kann? Warum glauben die anderen Klubmitglieder, dass er die Wette verlieren wird? Wie viel Geld setzt Phileas Fogg bei der Wette ein? Warum ist es ihm so wichtig, diese Wette einzugehen? Was fällt dir auf, wenn du über den Londoner Reform-Klub liest?
Wie verbringt Phileas Fogg seinen Tag? Woran erkennst du, dass er sehr oft im Klub ist?
den Faden aufnehmen: ein Gespräch fortsetzen
Hindu: Anhänger des Hinduismus (Religion)
Pfund: englische Währung
deponieren: etwas hinterlegen
Minimum: Mindestmaß
VORGESCHICHTE: Am Ende des ersten Tages ihrer Reise suchten Bilbo und die Zwerge einen trockenen Platz zum Schlafen. Als sie ein rot flackerndes Licht in der Nähe bemerkten, beschlossen die Zwerge, ihren Meisterdieb zum Auskundschaften auszuschicken.
... Bilbo pirschte sich also an den roten Lichtschein heran und nicht einmal einem Wiesel zuckte ein Schnurrbarthaar: Bilbo ging geradewegs auf das Feuer zu – denn ein Feuer war es – ohne irgendwen aufzustören. Und dies sah unser Hobbit:
Drei mächtig große Kerle saßen rund um ein gewaltiges Feuer aus Buchenstämmen. Sie brieten Hammelfleisch an langen hölzernen Bratspießen und leckten das Fett von ihren Fingern. Ein außerordentlich wohltuender Duft stach ihm in die Nase. Auch stand ein Fass mit einem guten Tropfen neben ihnen und die Kerle tranken aus Krügen. Es waren augenscheinlich Trolle. Selbst Bilbo, trotz seines bisher wohl geordneten Lebens, konnte das sehen: an den groben Gesichtern, an ihrer Größe, an der Länge ihrer Beine – nicht zu erwähnen ihre Sprache, die keineswegs gepflegt war. Keineswegs.
„Hammelfleisch gestern, Hammelfleisch heute, und verdammich, wenn es nicht morgen auch nach Hammelfleisch riecht“, sagte einer von den Trollen.
„Seit langem haben wir nicht einen winzigen Fetzen Menschenfleisch gegessen“, sagte der Zweite. ...
Bill verschluckte sich. „Halt dein Maul!“, sagte er, sobald er die Sprache fand. „Ihr könnt doch nicht erwarten, dass die Leute hier bleiben und von dir und Bert gefressen werden wollen. Mittlerweile habt ihr zusammen eineinhalb Dörfer gefressen, seit wir aus dem Gebirge herunterkamen. Wie viel wollt ihr noch fressen?“ ... Nachdem Bilbo das erlauscht hatte, hätte er eigentlich sofort etwas unternehmen müssen. ... Er wünschte sich hundert Meilen fort. Und doch – irgendwie brachte er es nicht übers Herz, stracks mit leeren Händen zu Thorin und seinen
Überlegt euch zu zweit, wie die Geschichte ausgehen könnte, bevor ihr das Ende hört! Schreibt euer Ende auf ein Blatt und stellt es der Klasse vor!
Gestalte auf einem A4-Blatt eine Troll-Speisekarte! Hier siehst du eine Vorlage!
Gesellen zurückzugehen. ... Da ihm von den verschiedenen Diebesgeschäften, von denen er gehört hatte, das Ausnehmen von Trolltaschen das am wenigsten Schwierige schien, kroch er zuletzt hinter den Baum, vor dem Bill saß. Bert und Tom gingen ans Fass. Und Bill tat einen neuen kräftigen Zug. Da nahm Bilbo all seinen Mut zusammen und steckte seine kleine Hand in Bills riesige Tasche. Es war eine Geldbörse darin, für Bilbo so groß wie ein Sack. Ha!, dachte er, als er die Börse vorsichtig herausholte – und seine neue Arbeit gefiel ihm dabei schon bedeutend besser –, das ist ein schöner Anfang.
Und das war er auch! Trollbörsen sind nämlich ein Unglück und diese war keine Ausnahme. „Hier bin ich, wer seid Ihr?“, quieckte sie, als sie aus der Tasche herausgezogen wurde, und Bill drehte sich sofort um und griff Bilbo beim Nacken. ... „Was ist es denn?“, fragten die anderen und kamen heran.
„Na, wenn ich’s selbst wüsste! He, wer bist du?“ „Bilbo Beutlin, ein Meister – ein Hobbit“, sagte der arme Bilbo ...
„Kann man den wohl kochen?“, meinte Tom. „Du kannst es ja versuchen“, entgegnete Bert und nahm einen kleinen Bratspieß auf. ...

HB 22: Höre nun das Ende des Abenteuers!





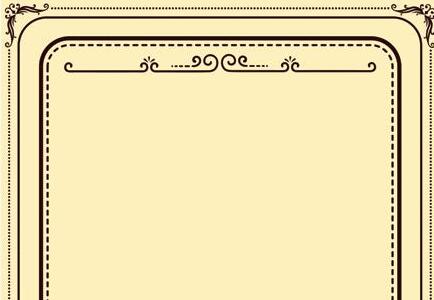
VORSPEISEN: Schleimsuppe mit Augäpfeln
HAUPTSPEISEN: gebratener Hobbit
NACHSPEISEN: kandierte Gedärme
GETRÄNKE: Blutcocktail




HB 7: Lausche zuerst dem Vortrag der Ballade „Der Erlkönig“!
Lies nun die Ballade Strophe für Strophe und beantworte die Fragen und Aufgaben dazu!
Der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
1. Strophe
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm, Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.
2. Strophe
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht!
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
3. Strophe
„Du liebes Kind, komm geh' mit mir!
Gar schöne Spiele, spiel ich mit dir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“
4. Strophe
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt der Wind.
„Willst feiner Knabe du mit mir geh'n?
Meine Töchter sollen dich warten schön, Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“
Kron’: Krone gülden: golden säuseln: durch eine leichte Bewegung der Luft ein Geräusch erzeugen jemanden warten: sich um jemanden kümmern
Reihn: Reigen; von Gesang begleiteter Rundtanz


1. a) Wer ist hier unterwegs?
b) Was ist ein Knabe?
2. a) Übersetze „birgst dein Gesicht“!
b) Was heißt „bang“?
c) Unterstreiche nach folgenden Angaben: Vater spricht Sohn spricht
3. a) Wer spricht in der 3. Strophe?
b) Was verspricht er dem Kind?
4. a) Unterstreiche wie in Strophe 2!
b) Wie reagiert der Vater auf das Flehen seines Sohnes?
Er bekommt es mit der Angst zu tun.
Er glaubt nicht an den Erlkönig.
5. a) Was verlangt der Erlkönig von dem Kind?
b) Wie will er ihn dazu überreden?
6. Strophe
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düsteren Ort?
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau.
7. Strophe
„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!“
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan!
8. Strophe
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, Er hält in den Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Not; In seinen Armen das Kind war tot.


6. a) Unterstreiche mit den Farben die Dialoge!
b) Was sieht der Sohn am düsteren Ort?
c) Was sieht hingegen der Vater?
7. a) Unterstreiche alles, was der Knabe spricht mit Grün!
b) Weshalb will der Erlkönig den Knaben?
Weiden: Baumart
willig: bereit zu tun, was gefordert wird
grausen: sich gruseln
ächzend: jammernd

c) Wie will er ihn mit sich nehmen?
8. a) In welchem Zustand befindet sich das Kind?
b) Womit endet die Ballade?
Erlkönig mit Spannung – Gehe nach der Anleitung M3 von S. 54 vor!
a) Bildet Gruppen, teilt die Rollen auf und unterstreicht noch die fehlenden Rollen im Gedicht: Erzähler Erlkönig
b) Versetzt euch so richtig in eure Rolle hinein! Und so geht’s:
Erlkönig = unheimlich Vater = besorgt und beruhigend Kind = ängstlich, in Panik
Erzähler = 1. Strophe neutral, 8. Strophe spannend erzählen
Wähle eine Strophe aus und gestalte ein Bild dazu, auf dem die Grundstimmung der Strophe ausgedrückt wird!
Lies zuerst die unterschiedlichen Meinungen zum Thema „Handyverbot an Schulen“! Entscheide dann, wie die jeweilige Person der Thematik gegenübersteht, indem du das passende Symbol einkreist! = positiv = negativ = neutral


Sollten Handys in der Schule verboten werden?








Nerviges Piepsen, Vibrationsgeräusche und Blicke auf die Smartphones statt an die Tafel... Immer wieder lesen und schreiben, so berichten Pädagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen und Schüler im Unterricht Nachrichten, surfen im Internet, filmen oder fotografieren. Ausflüge ohne Handy – unvorstellbar für den Großteil der Jugendlichen.
Sollten die Mobiltelefone zu Hause bleiben? Wohin gehören die Smartphones während der Schulzeit?














Lukas Grabner: Mobiltelefone haben in der Schule nichts zu suchen! Schule setzt Konzentration voraus. Ablenkungen gibt es außerhalb der Schule schon genug.
Johannes Haider: Persönliche Kommunikation hat Vorrang. Für den Notfall kann das Handy in der Tasche sein.
Elke Schönfeld: Ein klingendes Mobiltelefon stört immer den Unterricht. Spiele und Musik auf Handys lenken Schüler/innen ab. Sie können mit Smartphones bei Schularbeiten leichter betrügen. Außerdem: Teure Mobiltelefone sind ein Statussymbol und fördern Mobbing in der Schule. Während der Schulzeit –einschließlich der Pausen – sollen Mobiltelefone unbedingt ausgeschaltet bleiben.
Werner Deutsch: Das kommt darauf an: Für Schulen, die das Potenzial der Digitalisierung nutzen möchten, kann es sinnvoll sein, elektronische Geräte der Schüler/innen in den Unterricht zu integrieren. Für die private Nutzung sollte die Schule aber klare Regeln vereinbaren.
Gerlinde Pusch: Ein generelles Handyverbot wäre realitätsfern. Die Schulen müssen diese Frage gemeinsam mit den Lehrkräften, Eltern und Schüler/innen klären. Akuten Handlungsbedarf sehe ich, wenn das Bedürfnis, permanent erreichbar zu sein, und das Verlangen, sich pausenlos in sozialen Netzwerken aufhalten zu müssen, eine größere Bedeutung bekommen als die persönliche Kommunikation.
Robert Ertl: Durch ein generelles Handyverbot werden unsere Schüler/innen kaum einen vernünftigen Umgang mit Mobiltelefonen lernen. Besser wären verbindliche Verhaltensregeln.
Gabriela Ihm: Ein Handyverbot ist gesetzlich nicht umsetzbar. Handys und Smartphones sind Bestandteil der Lebenswirklichkeit junger Menschen. Sie können und sollen nicht einfach aus dem Alltag verbannt werden. Natürlich gibt es eine klare Grenze: Während des Unterrichts sind Handys tabu. Die Telefone müssen ausgeschaltet bleiben.
Wer überzeugen kann, hat auch Erfolg
Kennst du das? Lest folgende Diskussion zwischen Sabrina und ihrer Mutter mit verteilten Rollen!
1. Ich geh zu Lisa. Bis später!
3. Wie bitte? Ist das dein Ernst?
5. Das ist ja wieder typisch für dich! Alle dürfen bis elf Uhr weg bleiben! Keine Mutter meiner Freunde ist so! Die bemitleiden mich schon alle...
7. Die üblichen Ausgehzeiten für Jugendliche sind wohl noch nicht bis zu dir vorgedrungen. Aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen!
2. Sei bitte um neun Uhr zu Hause.

9. Nur deshalb, weil DU Übergewicht hast, werden deine Argumente nicht gewichtiger.
4. Ja, du bist 14 und du hast morgen Schule!
6. Dann bemitleiden sie dich eben. Aber ich bin für dich verantwortlich und entscheide deshalb, wann du nach Hause kommst!
8. Wie gesagt, du bist 14 und hast morgen Schule.
Analysiert zu zweit, wie Sabrina versucht ihre Mutter zu überzeugen! Macht euch Notizen! Teilt eure Ergebnisse der Klasse mit!
Überlegt nun, ob Sabrina mit diesen Argumenten ihre Mutter von ihrem Standpunkt überzeugen kann!
Hier findest du ein paar Grundregeln, die du einhalten solltest, wenn du überzeugen willst:
3 Begründe stets, was du behauptest!
3 Stütze deine Argumente immer mit passenden Beispielen!
3 Du musst in der Lage sein, deinen Standpunkt begründen zu können.
3 Achte auf eine logische Schlussfolgerung!
3 Bleibe bei deiner Argumentation immer sachlich!
3 Bringe deinen Standpunkt klar und verständlich zum Ausdruck!
3 Berücksichtige, wen du mit deinen Argumenten überzeugen willst!
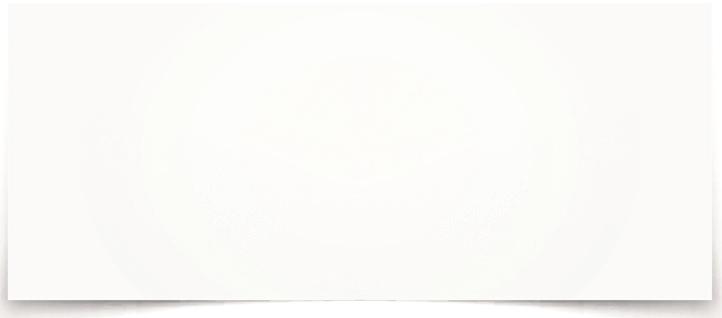
Meine Tipps!

Überprüft anhand dieser Fragen, welche Fehler Sabrina bei ihrer Argumentation unterlaufen sind! Kreuzt das Entsprechende an!
Waren ihre vorgebrachten Argumente alle wesentlich?
Sind ihre Argumente logisch nachvollziehbar?
Entsprechen ihre Argumente der Wahrheit?
Sind die genannten Beispiele wichtig, um das Argument zu stützen?
Hat Sabrina auf Vorurteile und Verallgemeinerungen verzichtet?
5 6 4
Rollentausch – Versucht nun in einem Rollenspiel die Diskussion zwischen Sabrina und ihrer Mutter nachzuspielen! Tauscht auch die Rollen!
TIPP: Achtet jedoch dieses Mal darauf, dass ihr nicht dieselben Fehler wie Sabrina macht und berücksichtigt die Tipps auf der Seite 74! Ihr wollt doch eure Mutter mit schlagkräftigen Argumenten davon überzeugen, dass auch ihr bis 23 Uhr weg bleiben dürft!

Möchtest du ein berühmter Star sein?
Überzeugend argumentieren – Nimm zu nachfolgenden Fragen bzw. Aussagen Stellung und bring überzeugende Argumente dafür ODER dagegen vor!


Eine gesunde Ohrfeige hat noch keinem geschadet!
Sollen in den Schulen die Hausübungen generell abgeschafft werden?
generell: für die meisten Fälle geltend
– Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer: Revolution oder Risiko? von Judith Hinterhofer
Künstliche Intelligenz (KI) hält zunehmend Einzug in die Klassenzimmer und verspricht, den Unterricht grundlegend zu verändern. Diese neue Technologie bietet viele Möglichkeiten, das Lernen zu verbessern und anzupassen.
Ein großer Vorteil ist das individualisierte Lernen. KI kann den Unterricht an jede Schülerin und jeden Schüler anpassen, sodass alle Aufgaben erhalten, die genau zu ihrem Lerntempo passen. Das könnte vielen helfen, besser zu lernen und zu verstehen.
Auch für Lehrpersonen könnte KI eine große Hilfe sein. Sie kann Routineaufgaben wie das Korrigieren von Hausaufgaben übernehmen, was ihnen mehr Zeit gibt, sich um ihre Schülerinnen und Schüler zu kümmern und ihnen individuell zu helfen. Zudem eröffnet KI neue, spannende Lernmethoden wie interaktive Spiele oder virtuelle Experimente, die den Unterricht interessanter und motivierender gestalten könnten.
Trotz dieser Vorteile gibt es auch einige Bedenken. Ein wichtiges Thema ist der Datenschutz, da KI-Systeme viele Daten über ihre Nutzerinnen und Nutzer sammeln. Es muss sichergestellt werden, dass diese Informationen gut aufgehoben sind und nicht missbraucht werden.
Einige Experten warnen auch davor, dass zu viel computergestütztes Lernen den persönlichen Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern


und ihren Lehrerinnen und Lehrern verringern könnte. Schule ist schließlich nicht nur zum Lernen da, sondern auch ein Ort für gemeinsame Aktivitäten und die Entwicklung zwischenmenschlicher Fähigkeiten.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Frage der Chancengleichheit. Nicht alle Schulen können sich teure KI-Systeme leisten, was zu einer Verstärkung bestehender Bildungsungleichheiten führen könnte. Es ist wichtig, allen den Zugang zu diesen neuen Technologien zu ermöglichen.
Trotz dieser Herausforderungen bietet KI im Unterricht enorme Chancen. Die Zukunft des Lernens könnte dynamischer und individueller gestaltet werden. Es ist wichtig, dass Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen, wie man KI sinnvoll im Unterricht einsetzt. Die Art, wie Kinder und Jugendliche lernen und wie Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, wird sich zweifellos verändern.
Die Herausforderung besteht darin, KI so zu nutzen, dass sie Lernen unterstützt und bereichert. Die Schule der Zukunft könnte ein Ort sein, an dem Technologie und menschliche Fähigkeiten perfekt zusammenspielen.
Bildet Kleingruppen! Diskutiert folgende Fragen! Notiert auf einem Blatt in Stichwörtern eure Argumente (Behauptung-Begründung-Beleg)!
•Wie kann individualisiertes Lernen durch KI im Unterricht aussehen?
•Inwiefern könnte der Einsatz der KI die Motivation von Schülerinnen und Schülern beeinflussen?
Technologie, die: Wissenschaft der Technik individualisiert/individuell: auf eine einzelne Person oder Sache zugeschnitten
•Wie verändert der Einsatz von KI die Rolle der Lehrpersonen im Klassenzimmer?
•Wie kann kritisches Denken trotzdem gefördert werden, auch wenn die KI schnelle Antworten liefert?
•Welchen Einfluss hat die KI auf die Vorbereitung für die zukünftige Arbeitswelt?
Routine, die: gewohnte, sich wiederholende Handlung virtuell: nicht in der Wirklichkeit vorhanden dynamisch: aktiv, schwungvoll
Das von Politikern geforderte Verbot von gewalttätigen Spielen hätte weitreichende Konsequenzen. Kann man Millionen Spielern und Spielerinnen weltweit ihr Hobby verbieten?
Millionen von Fans zocken regelmäßig. Viele Spielerinnen und Spieler sind in sogenannten „Clans“ organisiert, das sind vereinsähnliche Gruppierungen, die in Turnieren und Ligen gegeneinander antreten und sowohl national als auch international um den Platz an der Tabellenspitze wetteifern. Natürlich beschränkt sich dieses Zusammensein nicht auf das gemeinsame Spielen im Internet, die Clanmitglieder treffen sich auch im realen Leben. So gehen, wie überall sonst auch, aus einem gemeinsamen Hobby echte Freundschaften hervor.
In den USA sind die „eSports“-Turniere längst zu sportlichen Großereignissen avanciert – „CyberAthlets“ werden die Spielerinnen und Spieler dort genannt. Preisgelder von bis zu 50 000 Euro sind bei solchen Turnieren keine Seltenheit. Rund 32 000 registrierte E-Sportler gibt es in Österreich.
Erfolgsaussicht für Verbot gering
Die gängige Praxis der Indizierung von Spielen und Filmen hat seit jeher das Gegenteil der gewünschten Wirkung erzielt. Eine Indizierung soll den Verkauf eines Titels an Jugendliche verhindern. De facto verschwindet ein indizierter Titel jedoch aus den Kaufregalen, wodurch auch Personen über 18 Jahren der Erwerb erheblich erschwert wird. Viele Händler werden die Spiele gar nicht mehr anbieten. So weit, so gut.
Jedoch scheint man sich nicht ganz über den Reiz im Klaren zu sein, den das Verbotene gerade auf Minderjährige ausübt. Im Zeitalter des Internets ist es für computerversierte Kids kein Problem, an jeden gewünschten Titel heranzukommen – schnell, bequem und außerdem noch kostenlos.
Gewalt in den Medien
Die Forscherinnen und Forscher streiten sich über etwaige Folgen: Kriminalisierung, Zerschlagung und Aggression.
Das Problem an einem generellen Verbot ist in erster Linie die damit einhergehende Zerschlagung einer blühenden Szene von Clans, von Freundschaften.

Durch ein Verbot würden Hunderttausende von Spielerinnen und Spielern mit einem Mal ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung beraubt. Das Spielen auf Servern und öffentlichen LAN-Partys wäre nicht mehr möglich. Die legale Szene würde mit Gewalt in den Untergrund gedrängt, die Spielerinnen und Spieler würden kriminalisiert. Wer ernsthaft denkt, dass die Fans von heute auf morgen ihr Hobby einstellen würden, der irrt gewaltig.
Wie würden wir reagieren, wenn der meistgeliebte Freizeitspaß plötzlich zur illegalen Machenschaft erklärt würde? Wenn der Fußball-Verein plötzlich verboten würde? Ein Verbot von Computerspielen würde bei hunderttausenden von Fans nur eines auslösen: Eine ungeheure Aggression, Wut im Bauch und vielleicht Hass. Wollen wir das wirklich?
Die Wissenschaft diskutiert sich seit Jahren über die Folgen von Gewalt in den Medien.
Manche vertreten die Ansicht, dass der Konsum von Gewalt in den Medien eine reinigende Wirkung habe, dass er eigene Aggressionen abbauen könne. Jedoch kann eine labile Psyche durch den ungesund überhöhten Konsum von Gewaltfilmen, gewalttätigen Spielen und Hass-Musik möglicherweise tatsächlich einen Knacks davontragen.
Aber: Warum ist die Psyche denn überhaupt labil? War der Knacks nicht vielleicht schon vorher da? Im menschlichen Miteinander vielleicht? In der Familie?


3 1 4 2 fatal:
Suche die Wortbedeutungen der orange markierten Wörter des Artikels „Das Verbot von Killerspielen“ von S. 77 im Wörterbuch oder Duden online und schreib sie auf!
Konsequenz:
zocken: _______________________________________________________________________________
avancieren: ___________________________________________________________________________
Indizierung: de facto: labil: __________________________________________________________________________________
Unterstreiche im Artikel „Das Verbot von Killerspielen“ auf S. 77 die PRO-Argumente grün und die KONTRA-Argumente rot! (PRO – für ein Verbot von Killerspielen; KONTRA – gegen ein Verbot von Killerspielen)
Erstelle nun eine Rangliste vom stärksten PRO-Argument zum schwächsten! Die gleiche Aufgabenstellung gilt für die KONTRA-Argumente!
Wähle abschließend zwei PRO- und KONTRA-Argumente aus und erstelle Argumentationsketten in deinem Heft!
...wenn sich die Regeln für die Rechtschreibung ändern...
Lies die Beispielsätze und entscheide, welche Rechtschreibregel abhanden gekommen ist! Notiere sie zum Schluss auf die gelben Post-its!

einer sofortigen einführung steht nichts im weg, zumal schon grafiker und werbefachleute zur kleinschreibung übergegangen sind.

Dise Masname eliminirt schon di gröste Felerursache in der Volksschule, den Sin oder Unsin unserer Konsonantenverdopelung hat onehin nimand kapirt.

Das Alfabet wird um swei Buchstaben redusirt, Sreibmasinen fereinfachen sich und wertfole Arbeitskräfte geen gans einfach ferloren.

Iest sind son seks Bukstaben ausgesaltet, di Sulseit kann sofort fon neun auf swei Iare ferkürst werden. Anstat aksig Prosent Rektsreibunterikt könen Fäker wi Fisik, Kemi oder Reknen ferstärkt gelert werden.

Ales Uberflusige ist iest weg, die Rektsreibung ist wider einfak. Naturlik benotigt es einige Seit, bis diese Fereinfakung uberal riktig umgesetst wird – fileikt ein bis swei Iare. Als Nakstes sol dan die Fereinfakung der nok swirigeren und unsinigeren Gramatik in Angrif genomen werden.

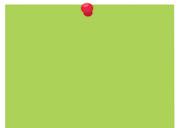
Wegfall der Dehnungen und Schärfungen
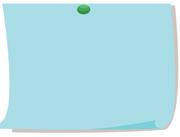
Q, C und CH werden zu K; J und Y werden zu I; PF wird zu F.

Wegfall der Großschreibung

Ä, Ö und Ü werden durch A, O und U ersetzt.

V und PH werden zu F; Z, TZ und SCH werden zu S.
Viel Spaß beim Lesen des Buchauszuges aus „Kill you“ von Daniel Höra!
Verdammt, beinahe hätte er mich erwischt. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig ducken. Feuerte fast das gesamte Magazin auf den Bastard. Blutfontänen spritzten aus den Wunden. Eine Frau schrie. Ich drehte mich um die eigene Achse. Nichts. Also weiter, die Zeit lief.
Wo war der plötzlich hergekommen? Ich hatte doch alles abgesichert. Ich war wohl nachlässig geworden, hatte mich zu sicher gefühlt. Unterwegs schaltete ich noch ein paar Gegner aus und rannte, rannte, rannte. Wieder hörte ich die Frau schreien.
Das verwirrte mich für einen Augenblick. Doch der Moment reichte aus, um den Typen vor mir nicht gleich zu bemerken. Er fuchtelte bereits in meinem Gesichtsfeld rum. Ich drückte den Abzug. Zu spät. Als ich den Knall hörte, explodierte schon mein Kopf. Shit, Shit, Shit! Ausgerechnet jetzt. Ich war so nah dran gewesen. Wieder schrie die Frau. „Tim!“
Es war meine Mutter. Sie stand in der Tür und wirkte ziemlich wütend.
„Sag mal, hörst du mich nicht? Ich hab schon ein paarmal gerufen.“ Sie schüttelte den Kopf. „Mich kotzt das an. Du bist völlig versunken, wenn du an der Konsole sitzt. Das wird immer schlimmer. Ich finde, wir sollten mal über ein Zeitlimit nachdenken.“
Blablabla. Das kannte ich schon, das kam ständig. Aber am Ende passierte nix und ich ballerte weiter. Ja, es stimmte, ich verbrachte Zeit an der Konsole. Aber nicht übertrieben viel. Vielleicht drei Stunden pro Tag. Na gut, manchmal vergaß ich auch einfach die Zeit.
Ich hatte die Konsole zum zwölften Geburtstag bekommen. Seitdem zockte ich eben nach der Schule. Anfangs richtig viel, wie das so ist bei neuen Sachen. Strategiespiele, Autorennen, Fifa und so was. Aber das hat man schnell durch und dann wird es öde. Es hatte Tage gegeben, da spielte ich gar nicht. Ich hab sogar darüber nachgedacht, die Konsole zu verkaufen.
Aber dann kam Call of the Force raus. DAS Spiel! Das war vor einem halben Jahr und seitdem faszinierte es mich total. Es war einfach alles drin: Strategie, Geballer, Action, Rätsel, Autorennen. Das Spiel forderte einen richtig, und wenn man weiterkam, hatte man wirklich was geschafft.



Ich kannte jede Menge Leute, die schnell aufgaben, weil das Spiel zu knifflig war. Umso besser. Call of the Force spielten nur die richtig guten Gamer. Mütter kapierten so was nicht. (Vielleicht hätte mein Vater es geschnallt, aber der interessierte sich nur für seine neue Familie.)
Ich schlurfte in die Küche, hockte mich an den Tisch und bekam den nächsten Anschiss.
„Setz dich doch mal richtig hin. Irgendwann kriegst du noch einen Buckel!“
Die Bemerkung sollte witzig sein, war es aber nicht. An meiner Mutter war gar nichts witzig. Sie war der pure Stress.
Das Essen verlief wie immer: Ich stocherte auf meinem Teller rum, meine Mutter laberte und ich hörte nicht zu. Nickte nur hin und wieder.
„Wie war es in der Schule?“, fragte sie irgendwann. „Toll“, gab ich zurück.
Sie schaute genervt. „Kannst du vielleicht etwas mehr erzählen?“
„Wie immer.“
Sie hob hilflos die Arme. „Ich hab keine Ahnung, wie es immer in der Schule ist. Allzu viel höre ich ja nicht von dir.“
„Langweilig.“
„Geht es vielleicht auch in ganzen Sätzen?“
„Die Schule war langweilig. Subjekt, Prädikat, Objekt.“ „Danke für das Gespräch“, antwortete sie und aß dann schweigend weiter. Es war eines dieser Schweigen, das sich wie ein schwarzes Tuch über uns legte. Jetzt war sie schon wieder wütend. Das war sie dauernd...
Ich war mit Josh, einem anderen Call oft the ForceSpieler, online verabredet. Wir wollten zusammen dieses verdammte Depot mit den Waffen für die Rebellen finden. Das war eine Aufgabe, die erledigt werden musste. Klick!
Diskutiert in Partnerarbeit folgende Fragen! Schreibt eure Ergebnisse auf und stellt sie der Klasse vor!
Wie ist das Verhältnis zwischen Tim und seiner Mutter?
Weshalb stört es Tims Mutter, dass er Computerspiele spielt?
Was glaubst du, warum Tim ständig spielt?
Wie siehst du das?