3
www.eS quirrel.at

Monyk, Schreiner, Brzobohaty, Mann
Verlag





GESCHICHTE FÜR ALLE
3
Verlag
Monyk, Schreiner, Brzobohaty, Mann
bearbeitet von Eva Schreiner

Lade die eSquirrel Lern-App auf dein Smartphone, wähle dieses Buch aus, gib den Code ein und los geht’s!
GPALLE3
rrel .at
Dieses Buch ist laut Bescheid des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 3. 4. 2025 (GZ: 2024-0.246.129) gemäß § 14 Abs. 2 und 5 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBL. Nr. 472/86, und gemäß den derzeit geltenden Lehrplänen als für den Unterrichtsgebrauch für die 3. Klasse an Mittelschulen und für die 3. Klasse an allgemein bildenden höheren Schulen - Unterstufe im Unterrichtsgegenstand Geschichte und Politische Bildung (Lehrplan 2023) geeignet erklärt.

Deine Übungs-App:
Auf eSquirrel findest du zu jedem Kapitel viele Übungen.
Häufig verwendete Abkürzungen:
Abb: Abbildung
D: Darstellung
K: Karte
ÖNB: Österreichische Nationalbibliothek
OeNB: Österreichische Nationalbank
Verlag
Q: Quelle
KHM: Kunsthistorisches Museum (Wien) RZ: Rekonstruktionszeichnung
NHM: Naturhistorisches Museum (Wien)
Kopierverbot:
Dieses Werk ist für den Einsatz im Schulunterricht bestimmt. Laut Urheberrecht in der gültigen Fassung des Urheberrechtsgesetzes (§ 42 (6)) darf es weder ganz noch in Teilen kopiert oder vervielfältigt werden.
Umschlagbilder: Eva Schreiner, Elisabeth Monyk, istockphotoscom: Thomas_Marchhart, wikimedia commons: ford company
Schulbuchnummer: 220.926
© Olympe Verlag GmbH, Oberwaltersdorf, 2025
Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigungen jeder Art gesetzlich verboten 7. Auflage (2025)
Lektorat: Marion Ramell, BA Umschlaggestaltung, Satz, Layout: Raoul Krischanitz, Wien, transmitterdesign.com Sprecherin/Sprecher der Hörbeispiele: Roswitha Szyszkowitz, Clemens Matzka Grafik: Raoul Krischanitz, transmitterdesign.com Druck, Bindung: Druckerei Berger, Horn Bildrechte: © Bildrecht/Wien, 2025
ISBN: 978-3-903328-52-5




Olympe Verlag
DIE NEUZEIT BRINGT VERÄNDERUNG
DAS ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG





KOLONIALISMUS, IMPERIALISMUS UND RASSISMUS
1. Kolonialismus
2. Imperialismus
3. Die Aufteilung der Welt
4. Der Vielvölkerstaat Österreich
5. Das Osmanische Reich – ein Vielvölkerstaat
BONUS-SEITE: Alltag, Kunst und Kultur im Vielvölkerstaat
1. Migration – Integration – Asyl
Statistiken untersuchen
2. Wien im 19. Jahrhundert – Zentrum der Zuwanderung
3. Auswanderung in die USA
4. Österreich – Ein Einwanderungsland?
DER ERSTE WELTKRIEG
1. Nationalismus und Imperialismus führen zum Ersten Weltkrieg
2. Der Verlauf des Ersten Weltkriegs
3. Kindheit und Jugend während des Ersten Weltkriegs
M7: Feldpostkarten und Feldpostbriefe untersuchen
4. Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen
Humanitäres Völkerrecht
IDENTITÄTEN
1. Was ist Identität?
Eine Pro- und Contra-Diskussion
2. Nationale Identitäten
3. Europäische Identität
WAHLEN UND WÄHLEN
1. Du hast die Wahl
Die Entwicklung des Wahlrechts
2. Politische Parteien in Österreich
Wahlplakate analysieren
3. Wahlwerbung
MEINE BUCH-RALLYE
Damit du dein neues Buch besser kennenlernst, haben wir 11 Aufgaben für dich zusammengestellt. Nach ihrer Lösung wirst du dich bestens in deinem Buch zurechtfinden.
1. INHALTSVERZEICHNIS: Schlage das Inhaltsverzeichnis in deinem Buch auf! Die mit Großbuchstaben in Farbe geschriebenen Überschriften sind die Hauptthemen. Lies sie durch!
Welches Thema interessiert dich am meisten? Schreibe es auf!


2. FLIEßTEXT: Auf den Textseiten erhältst du einen ersten Einblick in die verschiedenen Themen, mit denen du dich im Unterricht beschäftigen wirst. So erfährst du auf S. 86 von der Entwicklung des Frauenwahlrechts.


Notiere Stationen des Wahlrechts für Frauen!
Verlag
3. INFORMATION: Im Fließtext und in den Seitenspalten findest du immer wieder zusätzliche Informationen, die dein Wissen erweitern. Gib den Titel der Zusatzinformation auf S. 77 an!

4. SEITENSPALTEN: Sie sind wirklich interessant für dich, denn dort findest du...
...Erklärungen für die im Fließtext orange markierten Wörter! Suche die Erklärung für „Hausmacht“ im 1. Großkapitel „Aspekte neuzeitlicher Kulturen“ und schreibe sie auf!

Erörtert anhand von Normen, die euch selbst betreffen, was bei ihrer Übertretung geschehen kann!
analysieren: etwas genau betrachten; zerlegen
...Aufgaben mit einem Symbol in Grün, Blau und Magenta. Die Farben zeigen dir, ob du etwas Gelerntes wiederholen, anwenden oder darüber nachdenken sollst. Suche nach jeweils drei weiteren Operatoren (= Handlungsanweisungen) in den Seitenspalten und ordne sie richtig zu!
5. SCHRIFTLICHE QUELLEN UND DARSTELLUNGEN: Viele Aufgaben, die es zu lösen gilt, beziehen sich auf schriftliche Quellen oder Darstellungen. Sie sind im Buch farbig umrandet und mit Q oder D gekennzeichnet. Blättere zu S. 54 und schreibe den Artikel 10 der Rechte der Frau und Bürgerin hier auf!
6. BILDLICHE QUELLEN UND DARSTELLUNGEN: Im Buch gibt es auch viele Fotos, Gemälde Rekonstruktionszeichnungen und Karikaturen. Sie sind auch nummeriert und oft mit Aufgaben versehen! Gehe auf S. 57 und schreibe auf, wie die Bildunterschrift der Karikatur lautet!
Bildlegende:
7. AUFGABEN: Fast jedes Unterkapitel endet mit der oder den Seite(n) „Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe“. Hier kannst du dein Wissen und Können testen und die neu erworbenen Kompetenzen (gekennzeichnet durch die drei Farben) anwenden. Gehe auf S. 116 und schreibe auf, wie die Anleitung zu Aufgabe 4 lautet!
Verlag
8. METHODENSEITEN : Sie zeigen dir Schritt für Schritt, wie du arbeiten sollst! Suche die Methodenseite STATISTIKEN UNTERSUCHEN und schreibe auf, was du bei Schritt 3 machen sollst!




SCHRITT 3:
9. BONUS-SEITE : Diese kannst du machen, musst aber nicht. Du kannst sie auch für die Vorbereitung zu einem Referat verwenden. Gehe zur Bonus-Seite „Der Aufstieg der Habsburger“ und gib den Namen von Maximilans Ehefrau an!
10. KOMPETENZ-CHECK & BUCHTIPPS: Am Ende jedes Großkapitels kannst du selbst einschätzen, was du kannst. Hier findest du auch Buchtipps zum Vertiefen deiner Kenntnisse. Gehe zum Kompetenzcheck „DAS ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG“ und gib an, wie die Autorin des Buches „Die Stimme der Frauen“ heißt!

11. In deinem Buch gibt es auch Hörbeispiele. Scanne mit deinem Handy den QR-Code ein und höre dir an, was es Interessantes zu erfahren gibt!









1. GELEHRTE BEGINNEN, DIE WELT ZU ERFORSCHEN
Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und sich die Sonne um sie drehe – das sogenannte geozentrische Weltbild Hingegen ist die Idee, dass man im Mittelalter dachte, die Erde sei eine Scheibe, eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Dass die Erde eine Kugel ist, war schon in der Antike bekannt. Die Vorstellung, am Rand der Erde liege die Hölle, gehört nicht zu den echten mittelalterlichen Überzeugungen.
Schon lange vor dem 15. Jahrhundert beobachteten Menschen die Natur. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts, zu Beginn der Neuzeit, begannen jedoch immer mehr Gelehrte, sich intensiver mit wissenschaftlichen Beobachtungen und Experimenten zu befassen. Diese wurden wichtiger als das Studium alter Bücher. Durch ihre Beobachtungen lernten die Gelehrten die Geheimnisse der Natur besser kennen.
Einer dieser Gelehrten war der Astronom Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543), der aus dem heutigen Polen stammte. Er studierte unter anderem in Bologna und Padua Medizin und Kirchenrecht. Kurz vor seinem Tod veröffentlichte er eine Schrift, in der er die Bahnen der Planeten um die Sonne beschrieb.
Kopernikus fand heraus, dass die Erde ebenso ein Planet ist und sich wie alle anderen Planeten um die Sonne dreht. Dies nennt man das Heliozentrische Weltbild.



Verlag

Der Mathematiker Johannes Kepler und der Astronom Galileo Galilei erweiterten im 17. Jh. dieses „Kopernikanische Weltbild“.
Galilei (1564 – 1642) unterrichtete nach dem Studium der Mathematik als Hochschullehrer an den Universitäten in Pisa und Padua. Hier baute er ein Teleskop, mit dem er seine Himmelsbeobachtungen durchführte. 1630 veröffentlichte er ein Buch, in dem er das geozentrische dem heliozentrischen Weltbild gegenüberstellte. Wegen dieser Schrift musste er in einem Inquisitionsverfahren seine Lehre, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, widerrufen. Einer später erfundenen Legende nach soll er bei diesem Verfahren gegen ihn gesagt haben: Eppur si muove! (Und sie bewegt sich doch!).
Neben der Astronomie entwickelten sich auch andere Einzelwissenschaften wie Medizin und Physik. Die Menschen gelangten zu neuen Erkenntnissen und wussten bald mehr über die Geheimnisse der Natur.
Geo: Erde heißt auf Griechisch „geo“.
zentrisch: im Mittelpunkt
Gelehrter, der: ein Mensch, der sehr viel weiß Astronom, der: beschäftigt sich mit der Stern- und Himmelskunde
Helio: Sonne heißt auf Griechisch „helios“.
Abb. 1: Beschreibe mit eigenen Worten einer Mitschülerin / einem Mitschüler eines dieser beiden Weltbilder!
Teleskop, das: Fernrohr Inquisition, die: kirchliches Beweisverfahren, welches 1215 eingeführt wurde

Abb. 2: Fernrohr aus dem Besitz Galileis (1630, Museo delle Scienze, Florenz) Mit diesem Galileo-Fernrohr betrachtete er 1609 als Erster Planeten und Sterne.
Reflektiere, warum die katholische Kirche die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht anerkannte! Schreibe deine Überlegungen in Stichpunkten auf und bereite eine kurze Erklärung vor, die du der Klasse präsentierst!
2. TECHNISCHE ERFINDUNGEN VERÄNDERN DAS LEBEN
Diskutiert in Vierergruppen, ob der Buchdruck oder die Digitalisierung einschneidendere Auswirkungen auf das Leben der Menschen hatte!
Vergleicht die Bedeutung beider Entwicklungen für Gesellschaft, Kultur und Kommunikation und stellt eure Ergebnisse abschließend vor!
Auch heute verändern Erfindungen und Entwicklungen unser tägliches Leben. Wir leben in einer Zeit rascher Veränderungen. Kommunikationsmittel, die vor einigen Jahren als modern galten, wie einfache Mobiltelefone (Handys), wurden mittlerweile von Smartphones und anderen fortschrittlichen Technologien abgelöst. Was früher neu und innovativ war, ist heute oft schon veraltet.
Abb. 1: Besprecht zu zweit, warum man den Buchdruck auch „Schwarze Kunst“ nennt!
Erklärt, was die Menschen lernen mussten, um Nutzen aus dem Buchdruck zu ziehen!
Erkläre, welche Bedeutung diese Entwicklungen und Erfindungen heute noch haben!
Wähle eine dieser Erfindungen aus und verfasse dazu einen kurzen Text über die heutige Bedeutung der damaligen Erfindung! Erstelle dazu ein Plakat!
Bewerte die Auswirkungen des Schießpulvers auf den Ritterstand!
Auch zu Beginn der Neuzeit sollte sich das Leben großer Teile der Bevölkerung in Europa durch viele bedeutende Erfindungen verändern.
BUCHDRUCK: Johannes Gutenberg erfand um 1450 in Mainz den Buchdruck. Er entwickelte bewegliche Bleilettern. Dazu erfand er ein Handgießinstrument, um unterschiedliche Lettern gießen zu können.



Verlag




TASCHENUHR: Der Schlossermeister Peter Henlein baute bereits kurz nach 1500 Kleinuhren aus Eisen, die überall hin mitgenommen werden konnten. Das „Nürnberger Eierlein“ galt lange Zeit als die erste Taschenuhr, stammt jedoch nicht von Peter Henlein und ist weitaus später datiert.

Abb. 1: einige Erfindungen der Neuzeit



FERNROHR: Um 1608 erfand der holländische Brillenmacher Hans Lipperhey das Fernrohr. Dieses wurde von Galileo Galilei weiterentwickelt.

Bedeutende Erfindungen

MIKROSKOP: Mit dieser Erfindung konnte man eine 250-fache Vergrößerung erreichen.



Für die Kriegsführung entscheidend, wurde die Erfindung der Hakenbüchse. Geübte Soldaten konnten mit dieser frühen Feuerwaffe etwa einen Schuss pro Minute abfeuern, was die Kampftechnik grundlegend veränderte.
Das Schießpulver und der Kompass wurden zwar in Europa „erfunden“, waren aber davor schon den Chinesen bekannt.
3. HUMANISMUS UND RENAISSANCE
Der Humanismus
In der Zeit des Humanismus stand der Mensch im Mittelpunkt des Denkens. Die Gelehrten bewunderten die antike Kultur und beschäftigten sich sehr intensiv mit den Autoren des Altertums. Sie lasen deren Texte in der Originalsprache.
Q1: „Gargantua und Pantagruel“ – (fünfbändiges Werk von Francois Rabelais/1494 – 1553)
Der Vater belehrt seinen Sohn: „Ich wünsche und verlange, dass du die Sprachen vollkommen erlernst: erstens das Griechische, […] zweitens Latein und das Hebräische wegen der Heiligen Schriften, und desgleichen Chaldäisch und Arabisch.“
Aus: Rabelais, Francois: Gargantua und Pantagruel. Band 1. Aus dem Französischen übersetzt von Widmer, Walter; Horst, Karl August. Wien (1970), S. 356.
Der Humanismus nahm seinen Ausgang von Italien. Der Reichtum der Handelsherren von Genua, Pisa, Venedig und anderer italienischer Städte förderte das Entstehen einer neuen Lebensart. Die Freude am Leben, an der Schönheit der Kunst und das Interesse am Wissen zeichnete die Humanisten aus.
Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahre 1453 flüchteten viele Gelehrte nach Italien. Sie brachten neben ihrem eigenen Wissen auch viele wertvolle antike griechische Schriften mit. Berühmte Humanisten waren Erasmus von Rotterdam, Ulrich von Hutten und Petrarca.
Die Renaissance
Die Renaissance war ein Zeitabschnitt, in dem Wissenschaft und Kunst gefördert wurden. Es galt als Ideal, den Griechen und Römern nachzueifern. Die Antike wurde als Vorbild gesehen. Deshalb nennt man die Renaissance auch die Wiedergeburt der Antike. Durch den neu entstandenen Buchdruck verbreiteten sich die Gedanken des Humanismus und der Renaissance sehr schnell.
Die Kunst der Renaissance löste die Gotik ab. In der Malerei kam es zu Darstellungen aus dem Alltagsleben. Das Porträt gewann an Bedeutung. Die Menschen und die Natur wurden wirklichkeitsnah abgebildet.
Im Baustil und in der Bildhauerei wurden die Formen der Antike übernommen. In der Renaissance entdeckte man auch die Perspektive. Mit ihrer Hilfe kann eine Raumtiefe vorgetäuscht werden.
Albrecht Dürer
Olympe Verlag

Der berühmte Maler Albrecht Dürer zeichnete diesen Feldhasen 1502. Der Feldhase ist in der Albertina (Wien) und wird nur ganz selten öffentlich gezeigt, weil diese alte Zeichnung sehr lichtempfindlich ist.

Abb. 1: Der Feldhase – Aquarell von Albrecht Dürer (1502); Albertina Wien
Humanismus, der: von lateinisch „humanitas“; bedeutet Menschlichkeit
Chaldäer, die: semitisches Volk in Südmesopotamien im 1. Jt. v. Chr.
semitisch: Semitisch bezieht sich auf eine Sprachfamilie, die die semitischen Sprachen umfasst. Dazu gehören unter anderem Hebräisch, Arabisch, Aramäisch und Amharisch. Diese Sprachen stammen ursprünglich aus dem Nahen Osten und Nordafrika.
Q1: Fasse den Wunsch des Vaters an seinen Sohn mit eigenen Worten zusammen!
Erkläre, warum das Studium fremdsprachiger Texte in der Renaissance mehr Bedeutung bekam!
Erörtert in Partnerarbeit den Wert der Kenntnis mehrerer Sprachen im 16. Jahrhundert!
Diskutiert in der Klasse, welche Rolle Bildung und Mehrsprachigkeit in der Renaissance spielten und vergleicht sie mit der Bedeutung von Bildung und Sprachen heute!
wirklichkeitsnah: der Wirklichkeit nahekommend
Perspektive, die: Raumtiefe
Genie: ein besonders kluger Mensch
konzipieren: einen Entwurf anfertigen

Leonardo da Vinci (Rötelzeichnung um 1512); Königliche Bibliothek zu Torino
Sixtinische Kapelle: Kirche im Vatikan

Abb. 5: Davidstatue (1501 –1504), Galleria dell´Accademia, Florenz
HB 1: Mehr über den Bau der Sixtinischen Kapelle erfährst du in HB 1!


Künstler der Renaissance
Einer der vielseitigsten Künstler war Leonardo da Vinci . Er war Maler, Bildhauer, Baumeister, Bronzegießer, Erfinder und Kriegsingenieur – ein richtiges Universalgenie. Leonardo da Vinci konzipierte viele Dinge, die erst viel später neu erfunden wurden. Dazu zählen Flugzeug, Fallschirm und Panzer.
Olympe Verlag
Entscheide anschließend, ob es sich um eine Quelle oder um eine Darstellung handelt!
Quelle Darstellung
Begründe deine Entscheidung!
Leonardo da Vinci war auch ein genialer Zeichner und führte genaue Beobachtungen der Natur und des menschlichen Körpers durch. So untersuchte er Muskeln, Organe und Skelette an Leichen und setzte seine Erkenntnisse bei der Entwicklung von Hebeln, Gelenken und Maschinenteilen ein.
Damit niemand seine Unterlagen lesen konnte, schrieb Leonardo da Vinci in einer Geheimschrift, die auch Spiegelschrift genannt wird. Bei seinem Tod hinterließ er 13.000 Seiten an Zeichnungen und Notizen. Davon blieben 7.000 bis heute erhalten.
Eines der berühmtesten Werke von Leonardo da Vinci ist das Portrait der Mona Lisa.

Michelangelo Buonarotti war neben Leonardo da Vinci einer der berühmtesten Bildhauer, Maler und Baumeister seiner Zeit. Er baute im Auftrag des Papstes die Peterskirche in Rom fertig. In der Sixtinischen Kapelle kann man sein berühmtes Deckengemälde, das die Schöpfungsgeschichte zeigt, bewundern. Seine mehr als fünf Meter hohe Statue des Jünglings David steht in Florenz.

Abb. 3: Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle
Weitere berühmte Maler der Renaissance waren Tizian, Boticelli, Raphael, Brueghel der Ältere und Hans Holbein.
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
In diesem Setzkasten aus der Buchdruckerwerkstatt haben sich sieben wichtige Begriffe und Eigennamen versteckt. Finde sie, indem du senkrecht und waagrecht suchst!
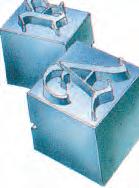
Verlag
Hier siehst du einige Skizzen und Texte von Leonardo da Vinci. Analysiere die Skizzen und Texte. Achte dabei auf:
• Inhalt der Skizzen (z. B. Gegenstände, Menschen, Bewegungen)
• Thema oder Idee der Darstellung
• Zweck der Skizzen (z. B. Forschung, Beobachtung, Erfindung)
• Zusammenhang zwischen Bild und Text
• Gestaltung der Skizzen (z. B. Linienführung, Details, Perspektive)

Diese Erfindung ist aus Holz und hat Pedale. Die Verbindungsstange fehlt noch.

Diese Maschine enthält bereits viele grundlegende Bauteile, welche später für die Beherrschung der Lüfte ausschlaggebend waren

Bei diesem Modell eines Helikopters zieht sich die Luftschraube selbst in die Höhe

Dieses erste Modell eines Fahrzeuges hat ein Differential mit Zahnrädern. Die Räder drehen sich unterschiedlich.
Entscheide, bei welchen der Abbildungen/Texte es sich um eine Quelle oder eine Darstellung handelt, indem du Q für Quelle und D für Darstellung einträgst!




Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, auch Deklaration der Menschenrechte oder UN-Menschenrechtscharta oder kurz AEMR, sind unverbindliche Empfehlungen der Vereinten Nationen zu den allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte. Sie wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Palais de Chaillot in Paris genehmigt und verkündet.



Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
1948
Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. [...]

Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Artikel 4: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.
Begründung: Begründung: Begründung:







Begründung: Begründung: Begründung: 4
Begründe nun deine Entscheidung in der Tabelle!



Blättere nun in diesem Buch und suche jeweils drei Beispiele für eine ...
M1 HERRSCHERGEMÄLDE ENTSCHLÜSSELN
Herrscherinnen und Herrscher ließen sich gerne abbilden oder porträtieren, um Gegner einzuschüchtern, einen Heiratsantrag zu machen oder um ihren Nachfahren in
1. SCHRITT: Informationen suchen
D
Erinnerung zu bleiben. Dabei ließen sie sich nicht immer wirklichkeitsgetreu malen. Um Herrschergemälde zu entschlüsseln, folge dieser Anleitung!
Finde heraus, welche Informationen dir zu einem Herrschergemälde zur Verfügung stehen!
Fließtext im Buch Bildlegende Informationstext Internet
In wessen Auftrag wurde das Bild erstellt?
2. SCHRITT: Beschreibung des Gemäldes
D
Studiere das Gemälde genau und beschreibe, was du siehst!
Welche Personen und Gegenstände sind zu erkennen? Welche Herrscherin oder welcher Herrscher wird dargestellt? Welche Herrschaftssymbole oder Insignien sind sichtbar (Krone, Zepter, Thron, usw.)?
3. SCHRITT: Analyse des Gemäldes
D
Kläre folgende Fragen!
Untersuche den Aufbau des Bildes: Wie ist die Herrscherin oder der Herrscher positioniert?
Welche Farben werden verwendet und welche Wirkung erzeugen sie?
Welche Symbole und Gegenstände haben eine besondere Bedeutung?
Was vermittelt die Körpersprache oder der Gesichtsausdruck der Herrscherfigur?
4. SCHRITT: Deutung und Bewertung
D
Nimm eine abschließende Interpretation des Herrschergemäldes vor! Überlege, welche Absicht hinter dem Gemälde steckt. Warum wurde es gemalt?
Was könnte das Gemälde über die Macht und Herrschaft der dargestellten Person sagen?
1
Entschlüssle das Herrschergemälde in deinem Heft!
Tipp: Verwende dazu den Informationstext und die Fragen aus den einzelnen Schritten. Du musst nicht alle Fragen beantworten, wähle aber insgesamt mindestens 8 aus!

Maria Theresia (1717 – 1780) war Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen. Ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen wurde 1745 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt. Deshalb nannte man Maria Theresia allgemein „Kaiserin Maria Theresia“. Mit diesem Gemälde zeigt der Hofmaler Martin van Meyten Maria Theresia als „Erste Dame Europas“. Auf dem Gemälde trägt sie ein kostbares Kleid aus Spitze. Zu ihrer Rechten liegen die ungarische Stephanskrone, die böhmische Wenzelskrone und der österreichische Erzherzogshut als Symbole ihrer Macht und Würde.
Olympe Verlag
An wen richtet sich das Gemälde? Was soll es bei der Betrachterin oder beim Betrachter auslösen? Wird etwas betont oder weggelassen? Warum könnten bestimmte Aspekte verschwiegen worden sein? Wie wirkt die dargestellte Person auf den ersten Blick?

BONUS-SEITE DER AUFSTIEG DER HABSBURGER

Die Heirats- und Erbpolitik der Habsburger
Zu Beginn der Neuzeit herrschte in Österreich Maximilian I. (1459 –1519) aus dem Herrschergeschlecht der Habsburger. Durch geschickte Heirats- und Erbpolitik vergrößerte er seine Hausmacht. Er heiratete die damals reichste Erbtochter Europas – Maria von Burgund. Dies war der Beginn des Aufstiegs der Habsburger.
D1: Zitat aus der Zeit Maximilians I. (nach 1490)
Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube! Kriege führen mögen andere, du, glückliches Österreich, heirate.
Aus: Kudla, Hubertus: Lexikon der lateinischen Zitate. München (2001), S. 172.
Abb. 1: Maximilian I. (Ölgemälde von Albrecht Dürer, 1519, KHM) Heiratspolitik, die: durch Heiraten ihre/seine Macht vergrößern Erbpolitik, die: Erbverträge abschließen, die eine Vergrößerung des Landes bringen Hausmacht, die: Gebiete, die einer adeligen Familie gehören und weitervererbt werden
D1: Formuliere die Hauptaussage dieses Zitats in eigenen Worten! (Es ist nicht bekannt, von wem dieses Zitat stammt – vermutlich wurde es erst lange nach Maximilians Regierungszeit formuliert, um die Heiratspolitik Maximilians zu beschreiben.)
D1 + K1: Vergleiche die Hauptaussage des Zitats mit der abgebildeten Europakarte und belege die Aussage des Textes anhand der Darstellung! Notiere deine Ergebnisse in Stichpunkten und präsentiere sie in einem kurzen Vortrag der Klasse!
Abb. 2 + K1: Beurteile die Vor- und Nachteile der Heiratspolitik der Habsburger! Schreibe deine Überlegungen in eine Pro- und ContraTabelle!
Reflektiere, wie sich die Erbpolitik anders hätte entwickeln können! Stelle deine Ideen der Klasse in einer kurzen Diskussion vor und überlege gemeinsam mit den anderen, welche Alternativen realistisch gewesen wären! 14
Burgund, Belgien, Niederlande
Burgundische Heirat 1496 Spanische Heirat
Spanien, Sizilien, Unteritalien, Kolonien in Südamerika

1515
Bo¨hmisch-Ungarische Heirat
Böhmen und Ungarn
Irland England Schottland
Maximilian I. von Habsburg

der Schöne

von Kastilien
Frankreich
Burgund
Spanien
Verlag
Karl V.


Ferdinand I.

Anna von Böhmen-Ungarn
Johann von Aragon und Kastilien

Ludwig II. von Böhmen-Ungarn
Norwegen Schweden
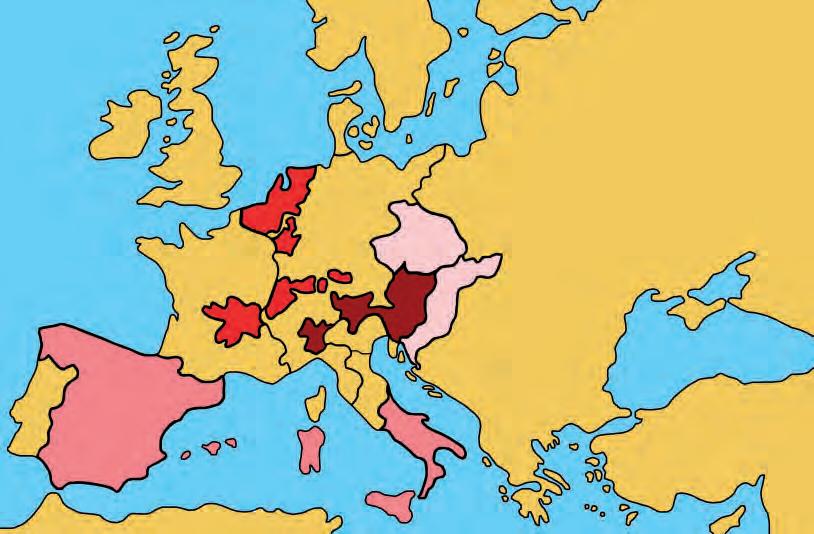
Heiliges Römisches Reich
Böhmen ÖsterreichUngarn

Habsburger Stammlande (bis 1477)

Burgundische Heirat (1477)

Spanische Heirat (1496)

Böhmisch-Ungarische Heirat (nach 1515)

Osmanisches Reich
ASPEKTE NEUZEITLICHER
Teilung des Besitzes
Nach dem Tod Maximilians I. wurde sein Enkel Karl von den Kurfürsten zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewählt. 1530 wurde er als letzter Römischer Kaiser vom Papst gekrönt.
Karl V. (1519 – 1556), der Sohn von Johanna von Kastilien und Philipp dem „Schönen“, regierte ein Weltreich, da er als König von Spanien auch über die Kolonien in Amerika herrschte. Der folgende Ausspruch soll von ihm stammen: „In meinem Reich geht die Sonne nie unter“.


Abb. 3: Beurteile, wie der Maler Kaiser Karl V. mit diesem Gemälde bewertete! Nenne dazu mindestens drei Bilddetails, die diese Bewertung belegen!
K2: Kaiser Karl V. teilte sein Reich 1556 in zwei Herrschaftsgebiete.
Abb. 3: Kaiser Karl V. als Herrscher der Welt (Ölgemälde, Allegorie von Peter Paul Rubens, um 1640, Residenzgalerie Salzburg)
Verlag
1555 trat Karl V. nach jahrelangen Kriegen gegen Frankreich und auf Druck seines Bruders Ferdinand als Kaiser zurück. Er regelte seine Nachfolge, indem er das große Reich zwischen der spanischen und der österreichischen Linie der Habsburger aufteilte.
Nach Kaiser Karl V. wurde sein Bruder Ferdinand I. von den Kurfürsten zum Heiligen Römischen Kaiser deutscher Nation gewählt.
In den folgenden Jahrhunderten blieb die Kaiserwürde in der österreichischen Linie der Habsburger, da die spanische Linie der Familie bald ausstarb. Die Habsburger behielten die Kaiserwürde bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806, als Kaiser Franz II. infolge der Niederlagen gegen Napoleon abdankte.
Beurteile die Folgen der Teilung Europas! Nutze dazu auch die Weltkarte!
Arbeitet in der Gruppe und stellt eure Ergebnisse vor! Beachtet dabei folgende Punkte:
• Folgen für die Machtverhältnisse in Europa
• Veränderungen durch die Teilung
• Zuordnung der Länder (Ost/West)
Erläutert in Patnerarbeit, welche Folgen die Trennung in eine spanische und österreichische Linie der Habsburger gehabt haben könnte!
Allegorie, die: Darstellung eines abstrakten Begriffes


Besitzungen der österreichischen Linie Besitzungen der spanischen Linie
4. GLAUBENSKONFLIKTE UND MACHTPOLITIK

Abb. 1: Der Antichristus (Holzschnitt von Lucas Cranach dem Älteren, 1521)
Abb. 1: Beschreibe die Details des Bildes, einschließlich der sichtbaren Figuren, ihrer Handlungen, Kleidung und Gesten!
Interpretiere, welche Bedeutung der Antichrist als Hauptfigur hat und warum er in dieser Weise dargestellt wurde! Vergleiche deine Ergebnisse mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn!
Gebot, das: religiöses Gesetz, das ein bestimmtes Handeln vorschreibt
Theologe, der: Lehrer der Wissenschaft von Gott
Sünde, die: Übertretung eines kirchlichen Gebotes
These, die: Lehrsatz widerrufen: zurücknehmen
Missstände in der Kirche
Olympe Verlag
Reichsacht, die: Keiner darf den Verurteilten unterstützen, seine Lehre darf nicht verbreitet werden
Im Spätmittelalter gab es viele Missstände innerhalb der katholischen Kirche. Die Betreuung der Gläubigen war mangelhaft. Sehr oft wurden Priester eingesetzt, die kaum lesen und schreiben konnten. Außerdem führten die Kirchenfürsten ein prunkvolles und verschwenderisches Leben. Sogar die Päpste hielten sich nicht an kirchliche Gebote und lebten wie weltliche Fürsten. Diese Missstände führten dazu, dass einige Priester Reformen forderten.
Der Ablasshandel und seine Folgen
Ab dem 14. Jh. kritisierten einige Theologen, dass nicht mehr die Bibel die Grundlage des Glaubens bildete. Alle späteren Ergänzungen wie die Beichte, die Heiligenverehrungen und vieles mehr wurden kritisiert. Als Papst Julius II. in Rom die größte aller Kirchen, den Petersdom, bauen wollte, führte er den Ablasshandel ein. Gegen entsprechende Geldspenden konnten die Gläubigen sich von ihren Sünden freikaufen.
Martin Luther und die Reformation
Ein wichtiger Reformer jener Zeit war Martin Luther. Als Professor für Theologie an der Universität von Wittenberg sah er die damals herrschende Kirchenpolitik äußerst kritisch und entwickelte neue Glaubensrichtlinien Für Luther gab es nur eine Grundlage des Glaubens, nämlich die Bibel. Ebenso lehnte er den Ablasshandel ab. Jeder Christ, der aufrichtig bereute, sollte vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld bekommen.

Martin Luther fasste seine Kritik in 95 Thesen zusammen. Diese veröffentlichte er 1517. Eine seiner 95 Thesen lautete: „Wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablassprediger kennen würde, würde er davon nicht den Petersdom in Rom bauen lassen“.
Abb. 2: Martin Luther (Porträt von Lucas Cranach dem Älteren, Öl auf Holz, 34,3 x 24,4 cm, 1528, Lutherhaus Wittenberg)
Papst Leo X. forderte Luther auf, seine Thesen zu widerrufen. Er drohte ihm mit dem Kirchenbann, dem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Auch Kaiser Karl V. ließ die Schriften Luthers verbieten und verhängte über ihn die Reichsacht.
Damit war Luther „vogelfrei“ – jeder konnte ihn straffrei töten. Luthers Landesherr, der sächsische Kurfürst, beschützte ihn und ließ ihn auf die Wartburg bringen. Dort übersetzte Luther als Erster die Bibel ins Deutsche, was für die Gläubigen von enormer Bedeutung war, da sie nun erstmals selbst die Bibel lesen und verstehen konnten, ohne auf die Deutung durch Priester angewiesen zu sein. Diese Übersetzung legte den Grundstein für eine tiefgreifende Veränderung im Glaubensleben und in der Bildung.

Da die Anhängerinnen und Anhänger Luthers gegen die Maßnahmen des Kaisers protestierten, wurden sie Protestanten genannt. Luthers neue Lehre löste eine religiöse Bewegung aus, die eine innere Umgestaltung der Kirche anstrebte, die Reformation. Die Reformation führte aber zu einer Kirchenspaltung, da sich die Anhängerinnen und Anhänger Luthers von der katholischen Kirche abwandten.
1530 – Augsburger Bekenntnis: Die Protestanten legten auf dem Reichstag zu Augsburg ihr religiöses Bekenntnis in schriftlicher Form vor. Kaiser Karl V. lehnte es ab. Dies führte zu Spannungen, die schließlich im Krieg gipfelten, in dem Karl V. zunächst militärische Erfolge verzeichnen konnte. Trotz dieser Siege erlitt der Kaiser später auch Rückschläge. Nach anhaltenden Kämpfen und politischem Druck wurde 1555 ein Kompromiss gefunden, der im Augsburger Religionsfrieden mündete. Kurz darauf dankte Karl V. ab.
1555 – Augsburger Religionsfriede: Ferdinand I. schloss diesen mit den Protestanten. In diesem wurde unter anderem festgelegt, dass der Landesfürst das Bekenntnis für das ganze Land und seine Untertanen bestimmte.
Die Reformation erfasst große Teile Europas
In der Schweiz begründete Johannes Calvin im 16. Jh. den Calvinismus. Fleiß und Pflichterfüllung sind Tugenden, welche diese Religion ihren Gläubigen vorschreibt.
Der englische König Heinrich VIII. (1509 – 1547) wollte die Ehe mit seiner ersten Frau auflösen, erhielt aber vom Papst dafür keine Zustimmung. Er gründete daraufhin eine eigene, von Rom unabhängige Kirche. Oberhaupt dieser Anglikanischen Hochkirche ist seit damals die Königin oder der König.
Folgen der Kirchenspaltung

• Bildung von Territorialstaaten mit einheitlicher Konfession
Verlag

Reformation in Europa um 1570
• religiöse Intoleranz führte zu blutigen Kriegen
territorial: ein Gebiet betreffend
K1: Beschreibe mit Hilfe der Landkarte, welche Länder und Regionen überwiegend protestantisch oder katholisch waren!
Erörtert gemeinsam in der Klasse die möglichen Konflikte, die durch diese religiösen Unterschiede entstanden sind!
Erörtert auch, wie diese Konflikte das Leben der Menschen in Europa geprägt haben könnten!

Die Gegenreformation – die katholische Kirche erneuert sich
Die Vertreter der katholischen Kirche wollten eine Erneuerung der Kirche von innen her. Dies geschah durch die Gründung neuer katholischer Orden wie des der Jesuiten, die Schulen einrichteten. Ebenso sollten die Gläubigen durch Predigten wieder zur Kirche zurückgeleitet werden. Auf dem Konzil von Trient (1545 – 1563) wurden die katholischen Glaubensinhalte neu festgelegt.

• Ablasshandel wurde abgeschafft
• Priesterausbildung verbessert
• Tätigkeit der Priester von Bischöfen überwacht
• Zölibat bleibt bestehen
• Verbot bestimmter Bücher, die den Glauben vermeintlich gefährdeten
• Untersuchungsgericht (die Inquisition) wurde in Rom eingerichtet
Zölibat, der: Ehelosigkeit der Priester
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Dieses Bild stellt Heinrich VIII. dar, der in England die Anglikanische Hochkirche gründete. Durch seine Ablehnung des Papstes bereitete er den Weg für die protestantische Reformation in England vor. Lies zuerst die Informationen zu diesem Gemälde! Analysiere anschließend dieses Gemälde mit Hilfe der Fragestellungen sowie der Methode M1 auf S. 13!


Dieses Wandbild für einen Saal des Palace of Whitehall stammt von dem deutschen Maler Hans Holbein dem Jüngeren (1497–1543). Seine Bilder gefielen dem englischen König Heinrich VIII. (1509 – 1547) so gut, dass er ihn zum Hofmaler ernannte. Dieses Bild entstand 1537. Es ist 2,39 m hoch und 1,34 m breit. Das Original wurde 1698 bei einem Brand zerstört, doch gibt es eine Kopie aus dem Jahr 1667.
A. Kreuze an, welche Elemente du auf dem Bild finden kannst!
Barett (Hut aus Samt) Krone
Schaube (Überrock aus Pelz) Dolch
Jacke mit langen Ärmeln
Lederhandschuhe
Ringe
Verlag
Schnallenband am Knie
Strümpfe
Goldkette
Ordenskette
Zepter
B. Kreise jene Gegenstände bei Aufgabe A ein, die verdeutlichen, dass es sich auf diesem Bild um einen Herrscher handelt!
C. Kreuze drei Eigenschaften an, die den Herrscher in diesem Gemälde charakterisieren!
stolz freundlich zornig lustig traurig
ernst bestimmt imposant aggressiv böse
D. Kreuze jene Fragen an, die deiner Meinung nach für die Arbeit mit einem Herrscherporträt besonders wichtig sind!
1) Lebten Künstler und dargestellte Person zur gleichen Zeit?
2) An wen richtet sich das Bild?
3) Wer könnte die Auftraggeberin oder der Auftraggeber gewesen sein?
4) Was wurde mit der Darstellung bezweckt?
5) Wofür wurde das Bild verwendet?
Beurteile, ob es sich bei dem Gemälde um eine Quelle oder Darstellung handelt! Begründe auch deine Einschätzung!
Quelle Darstellung Begründung:
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies zuerst diesen Informationstext und den Auszug aus dem Werk „Utopia“ von Thomas Morus aufmerksam durch!
Thomas Morus
Die Reformationszeit veränderte den Glauben in die Allmacht Gottes. Immer mehr Menschen beschlossen, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Wissenschaftler beschäftigten sich auch mit der Frage, welche Verantwortung der Staat gegenüber seinen Einwohnerinnen und Einwohnern hat – eine zentrale Frage seit den ersten Hochkulturen.

Thomas Morus (1480 – 1535) war ein geistreicher und gebildeter Mann, der als Kanzler von Heinrich VIII. in England arbeitete. Als Gegner der Reformation wandte er sich gegen den König und wurde zum Tode verurteilt. In seinem Buch „Utopia“ (Wunschtraum) beschrieb er die Zustände in einem Fantasieland. materiell: wirtschaftlich, finanziell
Q1: Utopia – von Thomas Morus (1516)
Die Utopier [...] teilen die Zeit eines Tages und einer Nacht in vierundzwanzig gleiche Stunden. Sechs Stunden werden für materielle Arbeiten in Anspruch genommen; das Verhältnis ist folgendes: drei Arbeitsstunden am Vormittag; dann wird gegessen; am Nachmittag zwei Ruhestunden, drei Arbeitsstunden und hierauf folgt das Abendessen. Sie zählen ein Uhr, wenn wir Mittag haben. Um neun Uhr legen sie sich zur Ruhe und widmen sich dem Schlafe neun Stunden.
Die Zeit zwischen der Arbeit, den Mahlzeiten und dem Schlafe darf jeder nach seinem Gefallen verwenden, [...].
Verlag
Man wird vielleicht sagen: sechs Arbeitsstunden täglich genügen nicht für die Befriedigung des öffentlichen Bedarfs; Utopia muss kein unglückliches Land sein.
Es tritt aber das Gegenteil davon ein. Die sechs Arbeitsstunden liefern im Überfluss alle Bedürfnisse und Annehmlichkeiten des Lebens und außerdem einen Überfluss an Lebensmitteln weit über den Bedarf. Sie werden dies leicht begreifen, wenn Sie nur die große Anzahl von müßigen Menschen [damit meint Morus jene Personen, die kaum oder gar nicht arbeiten] bei anderen Nationen bedenken wollen. [...] Denn in diesem Jahrhundert des Geldes, wo dieses eine Gottheit und das herrschende Maß ist, wird eine Menge von eitlen und anzüglichen Künsten im Dienst des Luxus und der Verschwendung geübt. Aus: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Allgemeinen Geschichte. Zürich (1919), S. 38 – 42.
Mit welchen vier Fragen beschäftigte sich Thomas Morus in diesem Textauszug? Kreise die angesprochenen Themen ein!
Warentransport Bedürfnisbefriedigung Arbeitszeit Firmengründung Armut
Freizeit Aufteilung der Arbeit Demokratie Verschwendung und Luxus
Thomas Morus erkannte die materiellen Probleme seiner Zeit und präsentierte Lösungen. Arbeite in Partnerarbeit die beschriebenen Ungerechtigkeiten zwischen den arbeitenden Menschen heraus! Erklärt gemeinsam eine seiner vorgestellten Alternativen der Klasse!
Vergleicht in Partnerarbeit die Ideen von Morus mit heutigen Herausforderungen wie Arbeitszeiten, gerechter Bezahlung oder der Balance zwischen Arbeit und Freizeit! Diskutiert, welche Aspekte aus Utopia in der heutigen Gesellschaft hilfreich sein könnten!
Entwerft anschließend auf einem Plakat eigene Vorschläge für eine gerechtere und nachhaltigere Arbeits- und Lebensgestaltung in der heutigen Welt! Bezieht dabei auch globale Perspektiven ein, z. B. Arbeitsbedingungen in verschiedenen Ländern!
Präsentiert eure Ergebnisse der Klasse. Diskutiert gemeinsam, welche Vorschläge realistisch und umsetzbar sind und welche Hindernisse überwunden werden müssten!
5. DER DREIßIGJÄHRIGE KRIEG
Kammergüter, die: persönliches Eigentum von Königinnen und Königen, Kaiserinnen und Kaisern oder Fürstinnen und Fürsten
Elle, die: frühere Längeneinheit (ca. 55 – 85 cm)
Abb. 1 + Q1: Markiere in der Quelle den Satz, der sich möglicherweise auf das Bild des Malers bezieht!
Analysiert in Partnerarbeit, ob der markierte Satz eine zentrale Rolle für die Darstellung spielt und wie der Maler ihn im Bild umgesetzt hat!
Abb. 1: Beschreibe, was im Gemälde zu sehen ist! Achte dabei auf:
• Thema des Bildes
• wichtige Personen, Gegenstände oder Handlungen
• Stimmung oder Wirkung des Bildes Analysiere, welche Ursachen für den Prager Fenstersturz im Bild gezeigt werden und was der Maler besonders betont!
Interpretiere, warum die Person in der Bildmitte mit dem Rücken zum Publikum gezeigt wird und welche Bedeutung sie im Bild haben könnte! Achte dabei auf:
• Haltung, Kleidung und Stellung der Person
• Wirkung auf die Betrachtenden
• mögliche Absicht des Künstlers
Stelle deine Ergebnisse der Klasse vor!
Q1: Untersuche die Perspektive der Quelle und die Beschreibung des Geschehens durch Martinitz! Analysiert gemeinsam in der Klasse, welche Rückschlüsse dies auf seine eigene Rolle und das Verhältnis der Beteiligten zulässt!
Ausbruch des Krieges
1608 gründeten die Protestantischen Fürsten ein Verteidigungsbündnis, die Union. Ein Jahr später schlossen sich die Katholischen Reichsstände zur Liga zusammen. Beide Bünde verfügten über ein eigenes Heer und standen einander kampfbereit gegenüber. Als aber 1609 Kaiser Rudolf II. in einem Majestätsbrief den protestantischen Ständen im Königreich Böhmen Religionsfreiheit und die Errichtung von evangelischen Kirchen unter anderem auch auf den königlichen Kammergütern gewährte, führte dies zu Spannungen. Religiöse Gründe dienten aber häufig nur als Vorwand, um die eigene Macht zu vergrößern.
1618 warfen protestantische böhmische Adelige zwei kaiserliche Statthalter und einen Kanzleisekretär aus dem Fenster der Prager Burg.
Q1: Bericht des zuerst gestürzten Statthalters Martinitz über den Sturz des anderen Statthalters Slavata
Verlag
Aus: Milger, Peter: Der Dreißigjährige Krieg. Gegen Land und Leute. München (2001), S. 40.
Sie haben erst die Finger seiner Hand, mit der er sich festgehalten hat, bis aufs Blut zerschlagen und ihn durch das Fenster ohne Hut, im schwarzen samtenen Mantel hinab geworfen. Er ist auf die Erde gefallen, hat sich noch 8 Ellen tiefer als Martinitz in den Graben gewälzt und sich sehr mit dem Kopf in seinen schweren Mantel verwickelt.
Nach diesem Aufstand griff der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches – Ferdinand II. – in Böhmen hart durch. Das Heer der Liga unterstützte den Kaiser und siegte 1620 in der Schlacht am Weißen Berg. Damit war der Krieg aber noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, er erfasste die übrigen Gebiete des Reiches, vor allem das Gebiet des heutigen Deutschlands.
Abb. 1: Fenstersturz zu Prag (Ölgemälde von Wenzel von Brozik, 1889)

Der Krieg wandelte sich schließlich von einem Glaubenskrieg zu einem politischen Machtkampf. Der Kaiser ernannte Fürst Wallenstein zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee. Dieser stellte dem Kaiser ein Söldnerheer zur Verfügung. Nach und nach griffen andere europäische Mächte in das Kriegsgeschehen ein.
Auf Seiten der Union kämpften unter anderem: 2 Die Niederlande, Schweden, Dänemark, Frankreich und englische Truppen
Auf Seiten der Liga kämpften unter anderem: 2 Spanien, Bayern, kaiserliche Truppen, Truppen des Papstes
Die katholischen Truppen unter Fürst Wallenstein blieben siegreich und drangen bis an die Ostsee vor. Der protestantische Schwedenkönig Gustav Adolf kam mit seinen Truppen bis nach Bayern. 1632 starb er in einer Schlacht. 1634 wurde Fürst Wallenstein ermordet. Obwohl beide Seiten bereits kriegsmüde waren, wurde der Krieg erst 1648 mit dem Westfälischen Frieden beendet.
Die Schrecken des Krieges
Im Dreißigjährigen Krieg beherrschten Angst, Schrecken, Leid und Tod das Leben der Menschen. Soldaten, die keinen Lohn erhielten, zogen plündernd und mordend durch die Dörfer. Häuser wurden zerstört, Schweine, Hühner und Rinder wurden geschlachtet, Felder niedergetrampelt. Die häufigsten Todesursachen waren Hunger sowie Krankheiten und Seuchen wie Typhus, Pest und Grippe.

Abb. 2: Überfall auf ein Dorf durch Marodeure (zeitgenössischer Kupferstich, 1618, unbekannter Künstler)
Da ist es geschehen, daß die Stadt mit allen ihren Einwohnern in die Hände und Gewaltsamkeit ihrer Feinde gerathen. […] Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern, Peinigen, Prügeln gewesen. Insonderheit hat ein Jeder von den Feinden nach vieler und großer Beute gefragt. […] wenn er alles hingegeben und nichts mehr vorhanden gewesen, alsdann ist die Noth erst angegangen. Da haben sie angefangen zu prügeln, ängstigen, gedrohet zu erschießen, spießen, henken […] und um 10 Uhr gegen die Nacht die ganze Stadt, zusammt dem schönen Rathhause und allen Kirchen und Klöstern, völlig in der Aschen und Steinhaufen gelegen.
Aus: Schneider, Ditmar: Otto von Guericke.
Nach dem Krieg waren weite Gebiete Mitteleuropas verwüstet. Dörfer, Städte und Schlösser waren zerstört und nach Schätzungen von Historikerinnen und Historikern ungefähr ein Drittel der Bevölkerung gestorben.
Das Ende des Krieges und der Westfälische Friede 1648 wurde nach langen Verhandlungen endlich Friede zwischen den Kriegsgegnern geschlossen.

Wichtige Bestimmungen des Westfälischen Friedens
2 Katholiken und Protestanten waren ab nun gleichgestellt.
2 Die Religion wurde jedoch weiterhin vom Landesfürsten bestimmt.
2 Die österreichischen Länder blieben katholisch.
2 Das Heilige Römische Reich zerfiel in viele Einzelstaaten und war nur mehr ein lockerer Staatenbund. Dadurch ging die Macht des Kaisers im Reich verloren.
2 Frankreich gewann in Europa an Bedeutung.
2 Die Schweiz und die Niederlande wurden selbständige Staaten.
Abb. 3: Bestimmungen des Westfälischen Friedens
Marodeur, der: plündernde Nachzügler einer Truppe
Brennen, das: in Brand setzen
Peinigen, das: jemanden quälen
spießen: durchstechen, durchbohren
Q2: Benenne die Schrecken des Krieges, die hier angeführt werden!
Q2 + Abb. 2: Erläutere, welche Schrecken des Krieges der Künstler in seiner Darstellung wiedergibt!
Abb. 3: Analysiere gemeinsam mit einer Partnerin/einem Partner die Auswirkungen des Westfälischen Friedens auf die Machtverhältnisse in Europa!
Bewertet anschließend, welche Parteien davon profitierten und welche Nachteile erlitten!
Interpretiere, welche positiven und negativen Bestimmungen der Friedensvertrag fur die Bevölkerung enthielt! Diskutiert eure Ergebnisse anschließend in der Klasse!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
1 2
Vergleiche zuerst Q3 mit der Schilderung des Dreißigjährigen Krieges auf S. 21! Dann unterstreiche all jene Textstellen, die als historische Grundlage für den Schulbuchtext dienten!
Q3: Deutschlands Verwüstung – aus Exitium Germaniae (Vernichtung Deutschlands) von Menzel, Geschichte der Deutschen, Band III.
Wie jämmerlich stehen nun die großen Städte? Da zuvor tausend Gassen gewesen sind, sind nun nicht mehr hundert. Wie elend stehen die kleinen Städte, die offenen Flecken! Da liegen sie verbrannt, zerfallen, zerstört, dass weder Dach, Gesparr, Türen oder Fenster zu sehen sind. Wie sind sie mit den Kirchen umgegangen? Sie haben sie verbrannt, zu Pferdeställen und Marketenderhäusern gemacht, die Altäre entweiht und die Glocken hinweggeführt. Ach Gott, wie jämmerlich stehet es auf den Dörfern! Man wandert bei zehn Meilen und siehet nicht einen Menschen, nicht ein Vieh, nicht einen Sperling, wo nicht am etlichen Orten ein alter Mann oder ein paar alte Frauen zu finden. In allen Dörfern sind die Häuser voll Leichname und Äser gelegen, Mann, Weib, Kinder und Gesinde, Pferde, Schweine, Kühe und Ochsen, neben- und untereinander, vom Hunger und von der Pest erwürgt [...]. Deutschland liegt in Schmach, Jammer, Armut und Herzeleid; die vieltausendmal tausend armen jungen Seelen, so unschuldig in diesem Krieg sind hingeschlachtet worden, schreien Tag und Nacht unaufhörlich zu Gott um Rache, und die Schuldigen, die es verursacht, sitzen in stolzer Ruhe, Freiheit, Frieden und Sicherheit und halten
Gastereien und Wohlleben.
Aus: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Geschichte der Neuzeit. Zürich (1919), S. 151.



Fürst Wallenstein Bürgermeister Guericke




Söldner Gustav Adolf v. Schweden

Sta¨ndig mu¨ssen meine Mutter und ich Hunger leiden!
Olympe Verlag
Gesparr, das: Teile des Dachstuhls (Dachsparren)
Marketender, der: Händler/innen, die die Heereszüge begleiteten
Meilen, die: Längenmaßeinheit
Sperling, der: Singvogel
Äser, die: Mehrzahl von „Aas“ D totes Tier
Schmach, die: etwas, was als Kränkung oder Schande empfunden wird
Gastereien, die: Festmahl
Wohlleben, das: sorgloses Leben im Wohlstand
Wer sagt was? Ordne den Personen die passenden Aussagen zu! Besprich danach deine Zuordnungen mit deiner Sitznachbarin oder deinem Sitznachbarn und begründe deine Entscheidungen!



Statthalter Martinitz Marlene, Bauernmädchen

Ich ka¨mpfe fu¨r jeden, der mir genu¨gend bezahlt!
Ich u¨berlebte einen Sturz aus 17 Meter Ho¨he.
Da ist nichts als Morden, Brennen, Plu¨ndern und Peinigen gewesen!
Ich landete mit meinem Heer in Norddeutschland.
Ich werde des Verrates bezichtigt!
6. GERICHT UND GERICHTSSTRAFEN IN DER NEUZEIT
Über Gefängnisse und deren Haftbedingungen ist nur wenig bekannt, da es nur selten Quellen dazu gibt. Bekannt ist allerdings, dass in der Geschichte der Rechtsprechung viele Personen und Behörden die Befugnis hatten, Recht zu sprechen. So gab es unter anderem kaiserliche und königliche Gerichte. Auch Fürsten und Städte hatten eigene Gerichte. Eine besondere Bedeutung kam den kirchlichen Gerichten zu. Diese unterteilten sich in Bischofsgerichte und Gerichte der Inquisition.
So unterschiedlich wie die Gerichte, waren auch die Strafen, die verhängt wurden.
Gerichtsbarkeit und Strafen
Bei einfachen Vergehen wurde die Straftäterin oder der Straftäter vom Richter ermahnt oder zu einer Geldstrafe verurteilt. Konnte sie/er diese nicht bezahlen, drohte ihm eine Haftstrafe. Haftstrafen waren damals aber nicht häufig. Gefängnisse waren vor allem dazu da, um auf die Gerichtsverhandlung oder auf die Vollstreckung eines Gerichtsurteils zu warten. Gefängnisse befanden sich oft in den Türmen der Stadtmauer, der Burg, oder es handelte sich um Verliese, die in Kellern lagen.
Bis 1800 wurde über verurteilte Adelige die Festungshaft verhängt. Die oder der Inhaftierte lebte dabei nicht in einem Gefängnis, sondern verbrachte die Haftzeit in streng bewachten Räumen, meist in einer Burg. Diese Hafträume waren durchaus komfortabel, die Haft für Adelige sollte standesgemäß sein.
Eine der am häufigsten verhängten Strafen war die Verbannung . Diebe und Landstreicher wurde man dadurch los, dass man sie zwang, die Stadt zu verlassen. Mit der Entdeckung neuer Kontinente wurde die Verbannung ausgeweitet. Vor allem in den Mittelmeerländern landeten Kriminelle häufig auf Galeeren, auf denen sie als Ruderer strafweise arbeiten mussten. Auch die Verschickung in Kolonien wurde als Strafe eingesetzt.
Seit dem Mittelalter wurden bei kleineren Vergehen Schandstrafen verhängt. Die Verurteilten wurden dabei öffentlich an den Pranger gestellt. Als Zeichen der Schande mussten sie oft Masken oder Gewänder tragen, die auf die Art des Verbrechens hinwiesen. Von den vorübergehenden Menschen ausgelacht und bespuckt, hatten sie dort mehrere Stunden oder Tage zu verbringen.
Die am häufigsten verwendete Körperstrafe war die Prügelstrafe. Sie wurde oft zusammen mit anderen Strafen wie Verbannung oder Haft verhängt. Um Wiederholungstäter oder von den Galeeren geflüchtete Sträflinge zu erkennen, wurde den Verurteilten oft ein Zeichen in die Haut gebrannt. In Österreich wurde die Prügelstrafe erst 1867 abgeschafft.
Verlag
Verlies, das: unterirdisch liegender, schwer zugänglicher Raum, der als Kerker diente
komfortabel: mit Komfort (Bequemlichkeit, Annehmlichkeit) ausgestattet standesgemäß: dem sozialen Stand, Status entsprechend
Galeere, die: Schiff mit zum Rudern verurteilten Sklaven, Sträflingen oder Gefangenen
Abb. 1 + 2: Lege dar, bei welcher dieser Abbildungen es sich um eine Quelle handelt!
Abb. 1 Abb. 2
Begründe deine Entscheidung!
Beschreibe, welche Vorstellungen von Vergangenheit auf der Postkarte dargestellt werden! Achte dabei auf:
• gezeigte Ereignisse, Orte oder Personen
• Kleidung, Gebäude, Gegenstände oder Landschaften
Abb. 1: Bestrafung eines Zotenreißers (Bildpostkarte, 1905, Nürnberg)

• was betont oder besonders hervorgehoben wird
Halte in Stichpunkten fest, was auf der Postkarte (um 1905) dargestellt wird und wie die Vergangenheit gezeigt wird! Bereite eine kurze Präsentation vor, in der du erklärst, welche Vorstellungen von Geschichte oder Vergangenheit die Postkarte vermittelt!



Diskutiert anschließend in der Klasse, wie diese Darstellungen die Wahrnehmung der Vergangenheit beeinflussen könnten!
Abb. 2: Mittelalterliche Schandmaske (Museum der Festung Hohensalzburg)
Zoten, die: derbe, obszöne Witze


Abb. 3: Peinliches Verhör (kolorierter Holzschnitt aus Deutschland, 1509)
willkürlich: beliebig, zufällig Erblande, die: Stammland einer Dynastie Tortur, die: Folter
Q1: Art. 5 der UN-Menschenrechtskonvention 1948
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Aus: https://www.menschenrechtserklaerung.de/folter-3551/ (18. 2. 2024)
D1: Erläutere, welche Einstellung zur Folter Maria Theresia noch 1769 hatte!
Beurteile die Aussage Ferdinands von Leber hinsichtlich der Aussagekraft von Geständnissen unter Folter!
D1: Erörtert in Partnerarbeit, warum dieses Verbot gegen Folter wichtig ist!
Vergleicht in Vierergruppen den Umgang mit Strafen in verschiedenen Epochen und arbeitet heraus, welche Veränderungen im Verlauf der Zeit erkennbar sind!
Beurteile, warum dieses Verbot heute weltweit wichtig ist!
Ketzerin, die/Ketzer, der: jemand, der von der öffentlichen Kirchenmeinung abweicht
Sühne, die: eine Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufheben
Eine besonders grausame Methode, um Geständnisse zu erhalten, war die Folter. Diese wurde „Peinliches Verhör“ genannt und in der weltlichen Gerichtsbarkeit seit Anfang des 14. Jh. eingesetzt. Beim Verhör, das durch einen Richter geleitet wurde, wurden der oder dem Beschuldigten körperliche Schmerzen zugefügt.
Im Laufe der frühen Neuzeit setzte sich die Befragung unter Folter im Heiligen Römischen Reich immer mehr durch. Da es zu Beginn keine gesetzlichen Regeln für die Folter gab, lag das Ausmaß der Folter im Ermessen des Richters. Willkürliche Foltern führten aber auch zu Klagen der Gefolterten. Ab 1532 regelte die „Peinliche Gerichtsordnung“ die Verhängung, Anwendung und den Ablauf der Folter. Erst unter Maria Theresia (1717 –1780) wurde die Folter für die österreichischen Erblande abgeschafft.
D1: Abschaffung der Folter in Österreich
Im Januar 1776 schließlich wurde die Tortur auch auf dem Gebiet der österreichischen Erblande aufgehoben. Dabei hatte Kaiserin Maria Theresia erst 1769 eine „Peinliche Gerichtsordnung“ („Constitutio Criminalis Theresiana“) erlassen, die die Folter zwar gesetzlich klar regelte, aber nicht in Frage stellte. Das Umdenken am Habsburger Hof verdankte sie wohl ihrem Sohn Joseph II. und nicht zuletzt auch dem Bemühen von Personen wie dem Arzt Ferdinand von Leber, der sich immer wieder gegen die Folter empört hatte, „weil Unschuldige, überwältigt von der Heftigkeit der Schmerzen, sich zu Verbrechen bekannten, die sie nie begangen hatten“.
Aus: http://www.damals.de/de/27/Abschaffung-der-Folter-in-Oesterreich.html?aid=169424&cp=63&action=showDetails&cmtUri=/ de/27/Uebersicht-Seite-63.html (18. 2. 2024)
Bei schweren Verbrechen wurde die Todesstrafe verhängt. Hinrichtungen wurden meist öffentlich vollzogen, um bei den Zuschauerinnen und Zuschauern eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Die Inquisition stellte in der frühen Neuzeit ein Prozessverfahren der römischkatholischen Kirche dar, mit dem Straftaten aufgedeckt werden sollten, die mit dem katholischen Glauben in Zusammenhang standen. Dazu zählte die Verfolgung von Ketzern und ab der frühen Neuzeit auch Protestanten
Das Strafrecht verändert sich
Die Ideen der Aufklärung bewirkten auch eine umfassende Veränderung des Rechtssystems. Im 18. und 19. Jh. wurden Strafen immer weniger als körperliche Sühne für begangene Verbrechen gesehen. Vielmehr ging es um die Frage, ob und wie die Strafe den Täter „verbessern“ könnte. Damit änderten sich auch die Formen der Bestrafung. Todesstrafen wurden zunehmend als grausam empfunden, sodass Freiheitsstrafen an Bedeutung gewannen.
So wurde ab 1871 in Österreich nur mehr bei Mord die Todesstrafe verhängt, wobei von den verurteilten Tätern nur ca. drei Prozent hingerichtet wurden. Die Hinrichtungen fanden auch nicht mehr öffentlich statt, sondern wurden in den Gefängnissen vollstreckt. Hingegen waren die Prozesse und Urteilsverkündungen nun öffentlich zugänglich.
7. EHE, LIEBE UND SEXUALITÄT
Erst seit dem 18. Jahrhundert stellt die Liebe zwischen Mann und Frau ein wichtiges Motiv für die Eheschließung dar. Davor wurden Ehen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen eingegangen und dienten der finanziellen Versorgung der Angehörigen. Die Wahl der Ehepartner wurde von Eltern und Verwandten stark kontrolliert und beeinflusst. So musste eine Ehepartnerin oder ein Ehepartner entweder ihre/seine Arbeitskraft oder Kapital in die neue Familie mitbringen.
Ehefähigkeit und Partnerwahl in der vorindustriellen
Zeit
Bei den Bäuerinnen und Bauern hatten die Ehewilligen zuerst eine Heiratsbewilligung durch den Grundherrn einzuholen und eine hohe Gebühr zu zahlen. Durch diese Gebühr war es Knechten und Mägden nicht möglich zu heiraten. Diese Bestimmung, die bis auf das 16. Jh. zurückgeht, garantierte, dass die Dienstboten ledig blieben.
Erst Ende des 18. Jh. erfolgte eine teilweise Lockerung dieser Heiratsverbote. Doch schon zu Beginn des 19. Jh. gab es wieder Einschränkungen, gerade wenn die Heiratswilligen arm waren, keiner geregelten Erwerbstätigkeit nachgingen und ein unbeständiges Leben führten.
Verlag
Motiv, das: Grund Konsens, der: Zustimmung, Einwilligung
unansässig: Bevölkerung, die dort nicht beheimatet war; nicht eingesessen

Q1: Politischer Ehekonsens 1820 für Tirol und Vorarlberg
[...] folgende Vorschrift erlassen: 1) unansässige Personen aus der Klasse der Dienstboten, Gesellen und Tagwerker, oder sogenannte Inwohner, die sich verehelichen wollen, haben sich vorläufig bei ihrer politischen Obrigkeit zu melden und von derselben ein Zeugniss beizubringen, dass gegen ihre Verehelichung kein politisches Hinderniss obwalte. 2) Den Pfarrern und Seelsorgern ist es verbothen, solche Personen ohne beigebrachten politischen Zeugnisse zu trauen.
Aus: Porubszky, Gustav: Die Rechte der Protestanten in Österreich. Wien (1867), S. 19.
Dieser spezielle Ehekonsens wurde für Tirol erst 1921 aufgehoben.
Partnerwahl und Heiratsgründe
Inwohner, der: Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt oder Gemeinde, die kein Haus- oder Grundeigentum besaßen
obwalten: vorhanden, gegeben sein; bestehen trauen: verheiraten
Abb. 1: Deute, welchen Eindruck das Hochzeitspaar macht! Berücksichtige dabei auch den Titel des Bildes!
Q1: Zähle auf, welchen Personen es nicht erlaubt war, ohne Zustimmung zu heiraten!
Nenne einen Grund für das Heiratsverbot!
Erkläre, wo im 19. Jahrhundert Ehen rechtsgültig geschlossen werden konnten und wo dies im 21. Jahrhundert der Fall ist!
In fast allen Gesellschaftsschichten der vorindustriellen Zeit gab es große Altersunterschiede zwischen den Ehepartnern, weil häufig sogenannte „Versorgungsehen“ geschlossen wurden.
Auch in den adeligen Schichten war Liebe keine Voraussetzung für die Eheschließung. Man heiratete aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen. Es wurde sogar davor gewarnt, die Geliebte zur Ehefrau zu nehmen.
Außereheliche Liebesverhältnisse gefährdeten nicht die Ehe, da Liebe und Ehe getrennt voneinander betrachtet wurden.
Reflektiere, wie dieses Gesetz das Leben der Menschen in der damaligen Zeit beeinflusst haben könnte!
Beurteile, was die Quelle über die Stellung der einfachen Bevölkerung und ihre Beziehung zur Obrigkeit aussagt!
patriarchalisch: Ein Verhalten, das Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber dem Mann fordert. Es geht dabei oft um ein Machtungleichgewicht, bei dem Männer die Vormachtstellung in der Gesellschaft, Familie oder Gemeinschaft haben. Frauen und andere Geschlechter werden in diesem System oft als untergeordnet betrachtet, was zu einer hierarchischen Struktur führt, die auf der Überlegenheit von Männern basiert.
Machtgefälle, das: der eine hat mehr, der andere weniger Macht
Abb. 2: Ermittle, welche Vorstellung von Liebe mit diesem Bild vermittelt wurde!
Diskutiert gemeinsam, welche Formen von Partnerschaften es derzeit gibt, und setzt euch damit auseinander, wie sich Liebe und Sexualität in verschiedenen Lebensbereichen und Kulturen ausdrücken! Beschreibt, wie sich Partnerschaften in der Zukunft entwickeln könnten und welche Rolle gesellschaftliche Entwicklungen und persönliche Werte dabei spielen!
Abb. 2 + 3: Vergleicht in Partnerarbeit das vermittelte Ideal von Liebe mit der Realität!
wilde Ehe, die: damals ein abwertender Begriff für Paare, die unverheiratet zusammenleben
Erkläre, was sich heute im Vergleich zu früher verändert hat, wenn es um Liebe, Ehe oder Sexualität geht!
Liebe und Romantik als Ideal
Um 1800 entstand eine romantische Vorstellung von Liebe und Ehe. Diese Idee ging davon aus, dass nur große und wahre Gefühle zur Heirat führen sollten. In der Ehe sollte der Mann für das äußere Leben zuständig sein, die Frau für das Wohl der Familie. Diese Vorstellung fand sich auch in Literatur und Kunst wieder – daher nennt man diese Zeit Romantik.
Liebe und Romantik in der Realität

Verlag
Abb. 2: Der romantische Heiratsantrag (Ölgemälde von Johann Hamza, 1885)
Im 19. Jahrhundert waren bürgerliche Ehen patriarchalisch geprägt. Männer heirateten oft spät, Frauen waren deutlich jünger – das führte zu einem Machtgefälle. Nach dem damaligen Recht hatte der Mann die Vormachtstellung: Er verwaltete das Vermögen seiner Frau und vertrat sie rechtlich. Das Ideal der Liebesheirat blieb daher meist nur eine Vorstellung. Gleichberechtigung gab es nicht.
Auch in der Arbeiterschaft schlossen viele trotz unsicherem Einkommen Ehen. Sie übernahmen das Ideal der Liebesheirat, doch viele Frauen mussten mitarbeiten –meist zu sehr geringem Lohn. Heimarbeit war verbreitet. Auch Kinderarbeit und andere Formen von Familienarbeit waren nötig, um das Einkommen zu sichern.
In der Arbeiterschaft gab es viele „wilde Ehen“, da Wohnungen knapp und Männer oft als Untermieter oder in Wohnheimen untergebracht waren. Das Rollenbild blieb ähnlich wie im Bürgertum: Der Mann sollte „fleißig und brav“ sein, die Frau eine „tüchtige Wirtschafterin“.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich das bürgerliche Familien- und Liebesideal in allen Schichten durch. Es wurde zum Vorbild der modernen Familie und prägt unsere Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft bis heute.
Liebe und Sexualität heute – im Wandel der Zeit
Früher war die Ehe oft eine wirtschaftliche oder familiäre Entscheidung. Heute entscheiden sich viele Menschen aus Liebe für eine Partnerschaft – oder leben ganz bewusst ohne Ehe. Auch das Verständnis von Liebe und Sexualität hat sich verändert: Menschen dürfen ihre Gefühle offen zeigen – unabhängig davon, ob sie hetero-, homo, bi- oder pansexuell sind. In vielen Ländern, auch in Österreich, ist es mittlerweile möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten oder gemeinsam Kinder großziehen.

Die gesellschaftliche Vielfalt hat zugenommen – das betrifft auch die Vorstellungen von Körper, Geschlecht und Rollenbildern. In der Schule, in den Medien und in Familien wird zunehmend über Themen wie sexuelle Orientierung , Genderidentität und Diskriminierung gesprochen.
Abb. 3: Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter im sächsischen Erzgebirge beim Anfertigen von Holzspielzeug (koloriertes Foto, um 1910)
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
1
Lies zuerst diese Kurzinformationen und unterstreiche die wesentlichen Inhalte! Formuliere dann zwei Fragen zu diesen!


2
AMNESTY INTERNATIONAL
1961: In London wurde „Amnesty International“/AI (amnesty=Begnadigung) gegründet. Weltweit setzt sich ai für die Menschenrechte ein, wobei sich die Organisation auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beruft. Als Inspiration für ihr Logo diente das Sprichwort: „Es ist besser eine Kerze anzuzünden, als sich über die Dunkelheit zu beklagen.“

TODESSTRAFE
Heute ist die Todesstrafe in vielen Staaten bereits abgeschafft. Amnesty International setzt sich weltweit für die gänzliche Abschaffung der Todesstrafe ein. AI bringt folgende Argumente gegen die Todesstrafe vor: Diese verletzt das grundlegende Recht auf Leben sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Viele Unschuldige werden zum Tode verurteilt, weil Fehler bei den Gerichtsverfahren passieren können. Außerdem werden Todesurteile häufig über politische Gegner verhängt. In Österreich wurde die Todesstrafe 1968 endgültig abgeschafft.

3
Irren ist menschlich. Die Todesstrafe nicht. Sie ist ein unmenschlicher Irrtum, unwürdig einer zivilisierten Gesellschaft. (AI)
Olympe Verlag


Entwirf ein Plakat gegen Folter oder die Todesstrafe auf einem Zeichenblatt! Diese Vorlagen von Amnesty International helfen dir dabei! Entwickle selbst einen Slogan oder benutze die hier angegebenen Zitate!

Warum töten wir Menschen, die Menschen töten, um den Menschen zu zeigen, dass Töten falsch ist? (AI)
Verfasse einen fiktiven Bericht für die Schülerzeitung, in dem du dich mit Ehe und Liebe im Jahr 2200 auseinandersetzt!
Berücksichtige dabei folgende Aspekte:
2 Was ist Familie? Versuche, eine Definition für das Jahr 2200 zu geben!
2 Wird es Ehen überhaupt noch geben?
2 Wie wird die Kindererziehung organisiert sein?
8.
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG – ZWISCHEN AUSGRENZUNG UND INKLUSION
paternalistisch: autoritär, entmündigend, nicht selbstbestimmt
Der Umgang mit Menschen mit Behinderung hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert. In der Zeit vor 1500 wurden Menschen mit Behinderungen oft als Ausgestoßene betrachtet. Sie wurden häufig isoliert oder gar versteckt, da sie als Unglück oder Strafe Gottes angesehen wurden.

Inklusion, die: keine Person wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen
Potenzial, das: Gesamtheit aller vorhandenen, verfügbaren Mittel, Möglichkeiten, Fähigkeiten
D1: Fasse die Ziele des Übereinkommens zusammen!
Schlag unter www.behindertenrechts konvention.info nach!
Wähle einen Artikel aus, der dich besonders interessiert und stelle diesen anschließend der Klasse vor!
Untersuche, wie in der Behindertenrechtskonvention die Rechte von Menschen mit Behinderungen geschützt werden sollen und wie sich dies im Vergleich zu allgemeinen Menschenrechtsdokumenten, wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, unterscheidet! Diskutiert in Vierergruppen, warum es notwendig war, ein eigenes Übereinkommen für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln, obwohl es bereits universelle Menschenrechte gab!
Verlag
Während der Renaissance begann sich das Verständnis zu ändern. Einige Künstler und Gelehrte begannen, Menschen mit Behinderungen als Teil der Gesellschaft zu betrachten und in ihre Werke zu integrieren. Dennoch blieb die gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung stark eingeschränkt.
Im 18. und 19. Jahrhundert entstanden erste Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, die jedoch oft als Asyle oder Anstalten betrieben wurden. Die Einstellung zur Behinderung blieb vielerorts paternalistisch und bevormundend.
Abb. 1: „Narrenturm in Wien“ – errichtet 1784 in Wien als erste psychiatrische Klinik Europas
Erst im 20. Jahrhundert begannen sich die Ansichten grundlegend zu ändern. Die Behindertenrechtsbewegung setzte sich für die Rechte und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. Die Einführung von Gesetzen und Programmen zur Barrierefreiheit, zur Integration in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz trugen dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen besser in die Gesellschaft integriert werden konnten.
Heute streben viele Gesellschaften nach Inklusion und Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen. Doch es gibt immer noch zahlreiche Herausforderungen, wie den Zugang zu Bildung, Arbeit und öffentlichen Räumen. Viele Menschen mit Behinderungen sind weiterhin von Diskriminierung betroffen, sei es durch mangelnde Barrierefreiheit, Vorurteile oder unzureichende politische Unterstützung. Es ist daher wichtig, Barrieren abzubauen und eine wirklich inklusive Gesellschaft zu schaffen, in der jeder Mensch gleiche Chancen hat, sein Potenzial zu entfalten.
Ein Meilenstein für die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung war das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Dieses Übereinkommen, kurz UN-Behindertenrechtskonvention genannt, wurde am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der UNO beschlossen und trat 2008 in Kraft.
D1: Die Behindertenrechtskonvention im historischen Kontext
[...] Ziel des Übereinkommens ist es, den gleichberechtigten Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Mit dieser Zielsetzung bezieht sich das Übereinkommen auf die universellen Menschenrechte, wie sie in anderen menschenrechtlichen Übereinkommen der Vereinten Nationen anerkannt sind, und steht im engen Zusammenhang mit diesen Übereinkommen. […]
Aus: Die
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
1 2
Bildet Vierergruppen! Versetzt euch nun in die Lage von blinden Menschen. Welche Hindernisse in eurer Klasse und in eurem Schulhaus fallen euch auf? Erstellt eine Liste mit den gefundenen Hindernissen und stellt auch Überlegungen an, wie man diese beseitigen könnte!


Macht nun dieselbe Übung, versetzt euch aber nun in die Lage einer Rollstuhlfahrerin oder eines Rollstuhlfahrers!
Entwickelt konkrete Ideen, wie eure Schule zugänglicher und inklusiver für Menschen mit Behinderungen werden kann! Denkt dabei auch an die Umsetzungsmöglichkeiten und stellt sicher, dass eure Lösungsvorschläge realistisch sind!

4
Stellt eure Vorschläge der Klasse vor und diskutiert, welche Maßnahmen besonders wichtig und umsetzbar sind! Erstellt gemeinsam eine Prioritätenliste, die ihr an die Schulleitung weitergeben könnt!
5
Lies diesen Zeitungsbericht und fasse ihn mit eigenen Worten zusammen!
D2: „Worte zählen“: Mar Galcerán, Europas erste Abgeordnete mit Down-Syndrom
Mar Galcerán ist nicht irgendeine Politikerin. Mit 46 Jahren, von denen sie 26 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, schrieb Galcerán 2023 Geschichte, als sie als erste Person – und als erste Frau – mit Down-Syndrom in ein Regionalparlament in Spanien und möglicherweise in ganz Europa gewählt wurde.
Nur wenige Menschen mit Down-Syndrom haben jemals für einen Sitz in den nationalen und regionalen Parlamenten der europäischen Länder kandidiert. Das hat die valencianische Politikerin jedoch nicht abgehalten. Im vergangenen September trat sie ihr Mandat als Abgeordnete mit einer klaren Mission an: die Mentalität gegenüber Menschen mit Behinderungen zu ändern. […] Galcerán war zunächst Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Autonomen Exekutivkomitee von Valencia und anschließend Kandidatin bei den Regionalwahlen.
Es bleibt noch viel zu tun
Obwohl sie sich in der Politik, in ihrer Partei oder bei ihrer Arbeit nie diskriminiert gefühlt hat, haben ihre schlechten Erfahrungen als Studentin sie für immer geprägt. „Damals habe ich gemerkt, dass ich anders behandelt wurde. In dieser Zeit hatte ich keine Freunde, sondern Klassenkameraden. Sie sahen mich anders, sie wandten sich von mir ab. Damals habe ich wirklich unter Ablehnung gelitten, und das ist eine Phase, die mich geprägt hat“, sagte sie. „Es gibt noch viel zu tun. In der Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist Behinderung ein Querschnittsthema, das sich auf Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Beschäftigung auswirkt, und es gibt noch viel zu tun“, fügte sie hinzu.
Aus: „Worte zählen“: Mar Galcerán,

Abb. 2: Abgeordnete Mar Galcerán im valencianischen Parlament, 2024
6 7 9 8
Arbeite jene Punkte heraus, die die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aufzeigen! Markiere dazu die Stellen im Text, die dies ausdrücken!
Beurteile, welche Bedeutung ihre Leistungen für die Gesellschaft und die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben!
Diskutiert in Vierergruppen, inwieweit Diskriminierung von Menschen mit Behinderung in Österreich vorhanden ist und was man dagegen tun könnte!
Entwerft nun gemeinsam ein Plakat mit Forderungen gegen Diskriminierung!
So schätze ich mich nach dem Großkapitel „ASPEKTE NEUZEITLICHER KULTUREN“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich
kann…
... bedeutende Erfindungen am Beginn der Neuzeit nennen.
... die Bedeutung dieser Erfindungen für das tägliche Leben erfassen.
… Wesentliches über den Humanismus wiedergeben.
... Künstler der Renaissance zuordnen.
... ein Herrschergemälde mit der Methode M1 entschlüsseln
... die Ursachen und die Auswirkungen der Reformation erklären.
... die Auswirkungen der Gegenreformation beurteilen.
… über den Dreißigjährigen Krieg berichten.
... anhand dieses Krieges die Auswirkungen und Folgen von Krieg bewerten.
... über unterschiedliche gerichtliche Verurteilungen reflektieren.
... über unterschiedliche Gründe für Eheschließungen berichten.
... mich mit Inklusion auseinandersetzen und den Umgang mit Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft reflektieren.
Buchtipps



Verlag
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
Jürgen Teichmann: Galilei, Röntgen & Co. (Impian 2020).
Simone Grünewald: Die Abenteuer des Simplicissimus: Grimmelshausen nacherzählt für Jugendliche und Junggebliebene (TRIGA Der Verlag Gerlinde Heß 2022).
Alexander Hogh: Gotteskrieger: Eine wahre Geschichte aus der Zeit der Reformation. (TintenTrinker 2017).
Günther Bentele: Augenblicke der Geschichte: Die Neuzeit. (cbj 2007).


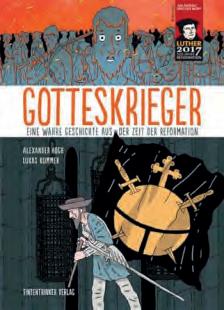





1. EIN NEUES WIRTSCHAFTSSYSTEM –DER FRÜHKAPITALISMUS
Seit dem Ende des 15. Jh. wandelte sich in Europa die feudale Wirtschaft zu einer Marktwirtschaft. War im Feudalismus der Grundbesitz die Grundlage des Reichtums, war dies im Frühkapitalismus der Fernhandel.
Zentren dieser Entwicklung waren zu Beginn die italienischen Stadtrepubliken und hier vor allem Venedig. Selbst produzierte Luxusgüter aber auch aus dem Orient importierte Luxusartikel wurden nach West-, Ost- und Mitteleuropa transportiert und verkauft.
Im Frühkapitalismus setzte sich anstelle der Naturalwirtschaft die Geldwirtschaft durch. Jedes Land und jede Stadt hatte das Recht, Münzen selbst zu prägen. Da die Münzen sehr oft umgewechselt werden mussten, übernahmen Geldwechsler dieses Geschäft. Für ihre Tätigkeit erhielten sie Provisionen, die sie reich machten.
Mit dem Vordringen der Osmanen in den Mittelmeerraum verlagerten sich auch die Handelsrouten. Spanier und Portugiesen unternahmen Entdeckungsfahrten und gründeten Kolonien in Übersee
Fernhändler und Großkaufleute handelten mit Edelmetallen wie Gold, Silber und Kupfer, betrieben Finanzgeschäfte und häuften dabei riesige Vermögen an.
Eine der bekanntesten Handelsfamilien war die der Fugger in Augsburg. Sie wurde so unermesslich reich, dass sie sogar den Päpsten und Kaisern Geld gegen Zinsen leihen konnte.

begünstigt durch …
2 Erfindungen im Bergbau und Hüttenwesen
2 Buchdruck
Fernhandel, der: Handel mit weit entfernt liegenden Ländern oder Gebieten
Verlag
Stadtrepublik, die: Stadt, die unabhängig ist und sich selbst regiert, wie ein eigener kleiner Staat
Provision, die: Bezahlung für die Vermittlung eines Kaufes oder Verkaufes
Übersee: Gebiete, die jenseits des Meeres, des Ozeans liegen
Was ist ein Verlagssystem?

Dies ist eine frühe Form der arbeitsteiligen Erzeugung von Gütern. Eine Person – der Verleger – beschafft die Rohstoffe, gibt diese den Handwerkern zur Produktion in Heimarbeit und sorgt für den Absatz der Produkte.
Abb. 1: Beschreibe die dargestellten Gegenstände und Personen!
Analysiere, welche Aufgaben der Geldwechsler vermutlich ausgeführt hat und wie die Gegenstände in seinem Alltag genutzt worden sein könnten!

2 Verlagssystem

FRÜHKAPITALISMUS




gehemmt durch …

2 politische Zersplitterung
2 Macht der römischkatholischen Kirche
2 Leibeigenschaft
2 Zunftwesen

Vergleiche die Arbeit des Geldwechslers in der dargestellten Zeit mit heutigen Berufen im Finanzund Bankwesen!


stärkere Trennung zwischen und innerhalb der Stände

2 stärkere Trennung zwischen und innerhalb der Stände
2 Reichtum der Bürger
2 steigende Ausbeutung der Bauern und der armen Stadtbevölkerung
2 Verarmung des niederen Adels
2 Teilung in reichen und armen Klerus
Abb. 2: Entstehung des Frühkapitalismus
Beurteile die Rekonstruktionszeichnung: Wirkt die Darstellung realistisch oder idealisiert? Begründe, welche Aspekte des Geldwechselberufs unvollständig oder unkorrekt wiedergegeben sein könnten, und präsentiere deine Ergebnisse!
Abb. 2: Beschreibe die Auswirkungen des Frühkapitalismus auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und nenne Gewinner sowie Verlierer!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies die beiden folgenden Darstellungen aufmerksam durch!
D2: Die Fugger – Schulbuchtext: Forum Geschichte 2 (2008)
J a k o b Fugger

seit dem 14. Jahrhundert in Augsburg ansässiges Geschlecht, ursprünglich Weber und Tuchhändler. Jakob I. († 1469) ist der Stammvater der Linie Fugger von der Lilie und Gründer des Fugger’schen Handelshauses, dem seine Söhne Georg († 1506), Ulrich († 1510), Jakob II. und andere Nachfahren durch Handels- und Geldgeschäfte, Bergwerksunternehmen, Faktoreien, Agenturen und Verbindungen nach Übersee Weltgeltung und Einfluss auf die Reichspolitik verschafften.
Jakob II., der Reiche (* 1459, † 1525) besaß das Kupfermonopol in Europa durch den Erwerb von Bergwerken in Spanien, Tirol, Kärnten und Ungarn und war am ostindischen Gewürzhandel beteiligt. Als größter Bankier seiner Zeit profitierte Jakob II. u. a. vom Ablasshandel. Maximilian I. verpflichtete sich durch Annahme von Geld zur Unterstützung seiner weitreichenden unternehmerischen Pläne. Karl V. wurde durch seine Finanzierung gewählt [...].
Aus: Boesch, Joseph; Schläpfer, Rudolf; Utz, Hans (Hg.): Weltgeschichte. Von 1500 bis zur Gegenwart. Zürich (2014), S. 40.
profitieren: einen Vorteil durch etwas, jemanden haben
Faktorei, die: größere Handelsniederlassung, besonders in Kolonien
Analysiere diese beiden Darstellungen anhand folgender Schritte!



Hans Fugger, ein Weber, war 1367 in die süddeutsche Stadt Augsburg gekommen. In kurzer Zeit erwarb sein Familienunternehmen durch Erfolge im Verlagswesen, im Fernhandel und durch Einheirat in die alteingesessenen Familien der Stadt Reichtum und Ansehen. Der Enkel, Jakob Fugger (1459 – 1525) erhielt in Italien seine Ausbildung zum Kaufmann. Nach dem Tod seiner beiden Brüder übernahm Jakob Fugger die Firma. Er vervielfachte das Firmenkapital durch Gewinn bringende Handelsgeschäfte, vor allem mit Textilien, Metallen und Gewürzen, mit Bankgeschäften und im Bergbau. Seine Handelsgesellschaft hatte Niederlassungen unter anderem in Lissabon, Antwerpen, Rom und Krakau. Bankwesen und Politik waren durch ein enges Netz aus „silbernen Fäden“ – Geld – miteinander verbunden. [...] Fürsten und Kaiser führten ein aufwändiges Leben und waren die Hauptabnehmer teurer Luxusartikel. Fast immer hatten sie Zahlungsschwierigkeiten, besonders durch die Kosten der Kriegsführung. Davon profitierte Jakob Fugger: Er gewährte ihnen Kredit und ließ sich als Sicherheiten deren Schürfrechte in Silber- und Kupferminen übertragen.
Aus: Forum Geschichte 2. Nordrhein-Westfalen, Teilband 1, Berlin 2008, S. 46.
1. Schritt: An welchen Merkmalen erkennst du, dass es sich bei den beiden Texten um Darstellungen handelt?
2. Schritt: Wodurch unterscheiden sich diese Merkmale im Lexikon- und im Schulbuchtext?
3. Schritt: Welche Bewertung der Fugger wird im Lexikontext sowie im Schulbuchtext vorgenommen?
Dekonstruiere die beiden Darstellungen, indem du die passenden Fragestellungen auswählst und diese in deinem Heft beantwortest!
Wer hat die Texte verfasst? Wann wurden diese Texte veröffentlicht? Welche historischen Fragen können mithilfe dieser Texte beantwortet werden? Welche Personen werden genannt, welche nicht erwähnt? Was wird positiv dargestellt, was eher negativ bewertet? Welche Absicht könnte die Autorin bzw. der Autor mit diesen Texten verfolgt haben?
Olympe Verlag
Untersuche, welche Aspekte des wirtschaftlichen und politischen Einflusses der Fugger-Familie in jeder der beiden Darstellungen betont werden!
Vergleiche, wie die Erzählstruktur der Lexikon-Darstellung von der Schulbuch-Darstellung abweicht: Welche Informationen werden in der einen Darstellung ausführlicher beschrieben, welche in der anderen?
2. DIE GESELLSCHAFT VERÄNDERTE SICH
In der Zeit vom 14. bis 16. Jahrhundert veränderte sich das politische Leben in Europa grundlegend. Die mittelalterliche Ordnung, die sich auf Papst und Kaiser stützte, geriet in Bewegung. Während Papst und Kaiser je nach Epoche unterschiedliche Einflussmöglichkeiten behielten, verlor vor allem der Ritterstand stark an Bedeutung.
Das Bürgertum gewann an Bedeutung
Mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft und dem zunehmenden Handel veränderte sich die Gesellschaft. Das Bürgertum spielte eine immer wichtigere Rolle, und Handwerker profitierten von guten Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte. Neue Gewerbe, wie die Buchdruckereien entstanden und florierten
Die Handwerker blieben weiterhin in Zünften organisiert und versuchten, ihre wirtschaftlichen Privilegien zu schützen. Dabei wehrten sie sich gegen wirtschaftliche Veränderungen, die ihre Position bedrohten, stellten sich jedoch nicht pauschal gegen jede Entwicklung.
Gleichzeitig entwickelte sich eine bürgerliche Oberschicht aus Unternehmern, Großkaufleuten und Bankiers, die auf Gewinnmaximierung setzten. Sie betrieben Fernhandel, gründeten Handelsgesellschaften, führten Geldgeschäfte durch und besaßen Bergwerke.
Die sozial schwächeren Gesellen, die stark von der Wirtschaftslage abhängig waren, kämpften gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen. Dennoch hatten viele mit Armut und Arbeitslosigkeit zu kämpfen, und nur wenigen gelang der Aufstieg zum Meister.
Verlag

Abb. 1: Jacob Fugger mit seinem Hauptbuchhalter Mattheäus Schwarz im Kontor der „Goldenen Schreibstube“ – Book of Clothes of Matthäus Schwarz; Herzog-Anton-UlrichMuseum Braunschweig (1517)
Auch die Bedeutung des Adels änderte sich
Politisch verlor der Adel an Bedeutung. Die Verbesserung der Schusswaffen führte dazu, dass Landsknechte die Ritter ersetzten. Landesfürsten waren nicht mehr auf die Ritter angewiesen, sondern stellten Söldner ein. Auch in den Landtagen mussten sich in der Folge die Adeligen den Herrschern unterordnen.
Auch wirtschaftlich gerieten die Adeligen unter Druck. Die traditionellen Einnahmequellen, wie Ländereien und Abgaben von Bauern, verloren an Wert aufgrund der Geldentwertung. Um ihren aufwändigen Lebensstil weiter aufrechtzuerhalten, griffen die Adeligen zu Maßnahmen wie der Unterdrückung und Ausbeutung der Bauern.
Die adeligen Grundherren erhöhten den Zins und den Frondienst der Bauern, sie verbaten den Bauern Jagd- und Fischfang. Einige verjagten sogar die Bauern von ihren Höfen, um den freigewordenen Grund selbst zu bewirtschaften.
Fasse kurz zusammen, wie die Fugger ihren Reichtum erworben haben! Schreibe deine Zusammenfassung in dein Heft und bereite eine kurze Erklärung vor, die du der Klasse präsentierst!
Versetze dich in die Lage eines Handwerksmeisters und verfasse einen kurzen Bericht über deine Lage! Beachte dabei besonders die folgenden beiden Themen: Geldwirtschaft, Zünfte
Lies deinen Bericht in einer Kleingruppe vor und vergleicht anschließend, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede eure Berichte aufweisen!
Diskutiert, wie sich die Veränderungen durch die Fugger auf die Handwerksmeister ausgewirkt haben könnten!
florieren: sich geschäftlich günstig entwickeln
Privileg, das: Vorteil, den nur eine bestimmte Personengruppe hat
pauschal: sehr allgemein, nicht aufgegliedert
Beschreibe das Bild!
Begründe, warum der Handel in dieser Zeit wichtig war!
Landsknecht, der: zu Fuß kämpfender Söldner
Analysiere, wie sich die Gesellschaft durch Geldwirtschaft und Handel verändert hat!
Erkläre die neue Rolle des Bürgertums in dieser Zeit!
3. DIE BAUERNAUFSTÄNDE
Deutscher Bauernkrieg

Abb. 1: Titelblatt zu den 12 Artikeln der Bauern (Flugschrift 1525)
Abb. 1: Beschreibe, wie das Titelblatt gestaltet ist! Gehe dabei auf Farben, Schrift, Bilder und Symbole ein!
Erkläre, welche Wirkung das Titelblatt haben könnte! Nutze dazu Begriffe wie z. B. auffällig, ernst, traurig, spannend oder informativ!
Beurteile, ob die Gestaltung zur vermuteten Aussage oder zum Thema passt! Begründe deine Meinung mit Beispielen vom Titelblatt!
Fasst eure Ergebnisse in der Kleingruppe zusammen! Erstellt ein Plakat oder eine Folie und präsentiert eure Gedanken der Klasse!
Abb. 2: Belege anhand der Bildquellen die Behauptung im Fließtext, dass die Bauern schlecht ausgerüstet waren!
Diskutiert in Partnerarbeit, ob die Forderungen der Bauern aus heutiger Sicht gerechtfertigt waren!
Beurteile, welche Auswirkungen eine Umsetzung dieser Forderungen auf die damalige Gesellschaft gehabt hätte!
Die Lage der Bäuerinnen und Bauern verschlechterte sich, da sie immer mehr für ihren Grundherrn arbeiten und immer höhere Abgaben leisten mussten. Sie finanzierten mit ihrer Arbeit das Leben des Adels und der Geistlichkeit, waren politisch aber völlig rechtlos
Die Bäuerinnen und Bauern begannen sich gegen die Übergriffe der Grundherren zur Wehr zu setzen. Auch forderten sie die freie Ausübung des evangelischen Glaubens.
1525 fassten die Bauern in Deutschland ihre Forderungen in 12 Artikeln zusammen. Die wesentlichen Punkte dieser 12 Artikel waren ...
2 die Aufhebung der Leibeigenschaft
2 das Recht auf Jagd und Fischfang

2 Reduzierung der Frondienste
Die Grundherren und Fürsten wollten aber ihre alten Rechte nicht aufgeben und den Forderungen der Bauern nicht nachgeben.
Verlag


Abb. 2: Ritter von Bauern umringt (Holzschnitt später koloriert, 1532)
So kam es unter anderem in Süddeutschland, Tirol, Salzburg und der Steiermark zu lokalen Bauernaufständen. Die Bauern griffen zu den Waffen, waren aber schlecht ausgerüstet. Daher waren sie den Fürsten und Landsknechtschaften im Kampf hoffnungslos unterlegen.
Die Bauern hatten keine Kampferfahrung und ihre Waffen waren umgearbeitete bäuerliche Arbeitsgeräte. Heugabeln und Dreschflegel gegen Schwerter und Kanonen, das waren ungleiche Bedingungen. Von den Söldnerheeren wurden die Aufstände in kurzer Zeit niedergeworfen.
1526 wurden die aufständischen Bauern daher besiegt und viele ihrer Anführer hingerichtet.
4. DIE ABSOLUTE MONARCHIE IN FRANKREICH
Die Herrscherinnen und Herrscher der Nationalstaaten strebten nicht nur nach Vergrößerung ihrer Gebiete, sondern auch danach, den Staat im Inneren völlig zu kontrollieren. Dazu beanspruchten sie die absolute, uneingeschränkte Macht.
Wo es ihnen gelang, schwächten sie die Macht des Adels auf verschiedenen Gebieten. Rücksichtslose Steuerpächter hoben im Namen des Königs die Steuern ein, ausländische Söldnerheere kämpften im Namen des Königs und die Kirche wurde auf den König ausgerichtet. Widerspenstige Adelige wurden mit gesellschaftlichen Aufgaben und Funktionen am Hof des Königs „ruhiggestellt“.
Höfischer Absolutismus
„Ein König, ein Gesetz, ein Glaube“ – Diese Worte beschreiben den Grundgedanken dieser Regierungsform, die im 17. Jh. in vielen Ländern Europas entstand und heute mit dem Begriff Absolutismus bezeichnet wird.
Q1: Rechtfertigung des
Die Monarchie ist die allgemeinste, die älteste und auch die naturgemäßeste Regierungsform. Die ganze Welt beginnt mit Monarchien und fast die ganze Welt hat sich darin wie in dem naturgemäßesten Zustand erhalten. Wenn sie die naturgemäßeste Regierungsform ist, so ist sie folglich auch die dauerhafteste und daher auch die stärkste. [...]
Die königliche Gewalt ist erstens heilig, und zweitens väterlich, drittens unumschränkt. [...]
Verlag
Der Fürst braucht niemand Rechenschaft abzulegen von dem, was er verfügt. Ohne diese unumschränkte Gewalt kann er das Gute nicht fördern und das Böse nicht unterdrücken; seine Macht muss so beschaffen sein, dass niemand ihr zu entfliehen hoffen kann; [...] Wenn der Fürst gerichtet hat, gibt es kein anderes Urteil. Man muss den Fürsten wie der Gerechtigkeit selbst gehorchen, sonst gibt es weder Ordnung noch Ende in Rechtsstreitigkeiten.
Ludwig XIV. – ein absoluter Herrscher
Als Paradebeispiel eines absoluten Herrschers gilt
Ludwig XIV. (1643 – 1715). Er war erst vier Jahre alt, als sein Vater starb und er König wurde. Die ersten Jahre regierten jedoch seine Mutter und Kardinal Mazarin für ihn.
Mit 22 Jahren übernahm er die Regierungsgeschäfte. So wie viele andere Könige seiner Zeit, war er davon überzeugt, dass er seine Macht direkt von Gott erhalten hätte. Deshalb sah er sich auch als „König von Gottes Gnaden“.
Ludwig XIV. bestimmte über alles in „seinem Staat“ alleine. Seine Minister waren vollkommen von ihm abhängig und durften ohne seine Zustimmung keine Entscheidung treffen. Als König war er zugleich oberster Gesetzgeber, Richter und militärischer Oberbefehlshaber
Abb. 1: Ludwig XIV. bei seiner Krönung (Ölgemälde von Justus van Egmont, 1651, Innsbruck)
Absolutismus, der: auch absolute Monarchie; bedeutet unumschränkte Herrschaft eines Einzelnen
Q1: Fasse die Kernaussagen des Textes zusammen!
Analysiere, warum Bischof Jacques Bossuet die Monarchie als die „naturgemäßeste Regierungsform“ bezeichnet!
Stelle deine Analyse in einer Kleingruppe vor und besprecht gemeinsam, ob seine Argumente überzeugend sind!
Beurteile, wie der Autor die absolute Macht des Fürsten rechtfertigt! Gehe dabei auf seine Argumente zur Monarchie, zur königlichen Gewalt und zur Rolle des Fürsten ein! Beziehe auch deine eigene Meinung mit ein: Welche Vor- und Nachteile könnte eine solche Herrschaftsform haben?
Verfasse einen Brief an den Bischof, in dem du seiner Argumentation widersprichst! Erörtert gemeinsam, warum Menschen zur Zeit des Absolutismus solche Aussagen über den König gemacht haben! Abb. 1: Was könnte der junge König zu den Betrachterinnen und Betrachtern sagen? Fülle die Sprechblase mit einem Satz! Kardinal: höchster Würdenträger nach dem Papst; der Titel wird vom Papst verliehen
Ministerin, die/Minister, der: Mitglied der Regierung eines Staates oder Landes, das einen bestimmten Geschäftsbereich verwaltet


Abb. 2: König Ludwig XIV. (Ölgemälde von Hyacinthe Rigaud, 277 x 194 cm, 1701, Louvre, Paris)
Abb. 2: Beschreibe das Bild in allen Einzelheiten und halte deine Beobachtungen schriftlich fest. Teile deine Beschreibung mit einer Partnerin oder einem Partner und überprüft gemeinsam, ob alle wichtigen Details berücksichtigt wurden!
Analysiere die Einzelheiten und ihre Symbolik in Stichworten und präsentiere deine Ergebnisse auf einem Plakat oder in einer Präsentation!
Bewerte, wie das Gemälde auf Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gewirkt haben könnte!
Schreibe in einfachen Sätzen, wie das Gemälde auf eine Französin oder einen Franzosen zur Zeit Ludwigs XIV. gewirkt haben könnte!Tausche deinen Text anschließend mit einer Partnerin oder einem Partner aus und vergleicht eure Gedanken!
Geistlichkeit, die: Kardinäle, Bischöfe, Äbte
Beurteile, ob die gesellschaftliche Ordnung im Absolutismus gerecht war, und begründe deine Meinung anhand der Lebensbedingungen der einzelnen Stände!


So bestimmte er, welche Gesetze in seinem Land galten, nahm aber auch Einfluss auf die von königlichen Gerichten gefällten Urteile. Ebenso führte Ludwig XIV. mehrere Kriege, um seine Macht und seinen Ruhm zu vergrößern. Darunter waren vor allem drei bedeutende Angriffskriege: gegen die Spanischen Niederlande, die Niederlande selbst und die Pfalz. In diesen Kriegen stand Frankreich oft Bündnissen gegenüber, die aus mehreren Staaten bestanden.

Ludwig XIV. sah sich als Mittelpunkt des Staates. Er verglich sich selbst mit der Sonne, die er als sein Symbol wählte. Das Volk nannte ihn deshalb auch „Sonnenkönig“.
Die Säulen der absoluten Macht

Die Säulen der absoluten Macht bildeten der Hofstaat, die Verwaltung, die Kirche und das Heer
HOFSTAAT: Auf Ludwigs XIV. Schloss lebten auch viele Adelige. Sie bildeten den neuen Stand des Hofadels Ludwig XIV. verlieh ihnen zwar klangvolle Titel, doch sie besaßen keine politische Macht im Staat. Er lieh ihnen Geld, sodass sie vom König abhängig wurden.
Verlag
VERWALTUNG: Ludwig XIV. führte Reformen durch. So setzte er Beamte ein, die ihre Anweisungen direkt vom König erhielten. Ihre Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass die Gesetze des Königs ausgeführt und die Steuern bezahlt wurden.
KIRCHE: Der König bestimmte 1685 den katholischen Glauben zur Staatsreligion. Die Anhängerinnen und Anhänger anderer Religionen ließ er verfolgen.
HEER: Ludwig XIV. ließ zur Sicherung seiner Macht ein stehendes Heer aufstellen. Im Krieg oder bei inneren Unruhen konnte er stets auf die Armee aus Berufssoldaten zurückgreifen.
Gesellschaftsaufbau im Absolutismus
Die Ständegesellschaft in Frankreich geht auf das Mittelalter zurück und war in Europa bis zum Ende des 18. Jahrhundert weit verbreitet. Das „Standesamt“ oder der „Berufsstand“ beziehen sich noch heute auf diesen gesellschaftlichen Ordnungsbegriff. Den ersten Stand bildete die Geistlichkeit (ca. 0,5 % der Bevölkerung), den zweiten Stand der Adel (ca. 1,5 % der Bevölkerung) und den dritten Stand die übrige Bevölkerung.
Die einzelnen Stände unterschieden sich durch ihren Lebensstil. So besaßen die Geistlichen und Adeligen Ländereien und Schlösser und waren von den Steuern befreit. Unter Ludwig XIV. zogen immer mehr Adelige an den Hof des Königs und lebten in großem Luxus. Sie erhielten vom König gut bezahlte Ämter ohne Verpflichtungen. Die Bürgerinnen und Bürger der Städte waren gebildet und interessiert an wirtschaftlichen Neuerungen und Reformen, hatten aber im Staat keine politische Macht.
Die Mehrheit der Bevölkerung lebte als Bäuerinnen und Bauern auf dem Land. Sie und die Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter in den Städten waren wenig gebildet, hatten keine Rechte und wurden daher verachtet. Trotz ihrer großen Armut mussten sie Steuern und Abgaben bezahlen.
BONUS-SEITE
Barocke Pracht – Schloss Versailles
In einer sumpfigen Ebene südlich von Paris ließ sich Ludwig XIV. ein prunkvolles barockes Schloss erbauen – Schloss Versailles . Dieses Schloss wurde zum Vorbild für viele barocke Bauten in Europa. Symmetrische Gebäude, kaum gerade Linien, ovale Formen, üppiger Stuck und prachtvolle Deckengemälde prägten diesen neuen Baustil.
Stuck, der: Gemisch aus Kalk, Gips, Sand und Wasser zur Formung von Plastiken und Ornamenten

1: Schloss Versailles mit Parkanlage
von
Das Hauptgebäude des Schlosses ist 580 Meter lang. Es bot Platz für 10 000 Gäste. Die Räume im Inneren waren prunkvoll ausgestattet. Parkettböden, Seidentapeten, wertvolle Teppiche, kostbare Spiegel und Goldverzierungen sollten die gottähnliche Stellung des Königs unterstreichen. Trotz der prunkvollen Ausstattung lebte man im Schloss aber nicht bequem. Die riesigen Räume ließen sich im Winter nur schwer beheizen. Auch gab es in Versailles kein fließendes Wasser und keine einzige Toilette.
Im königlichen Schloss herrschte strenge Etikette. Das Schlafzimmer des Königs war der Mittelpunkt des Hofes. Jeder, der den Raum betrat, verneigte sich vor dem leeren Bett. Morgens wurde der König vor dem Hofstaat angekleidet, was eine Stunde dauerte und nur dem höchsten Adel erlaubt war. Die Mahlzeiten des Königs waren öffentlich, eine Ehre, ihn zu sehen, noch mehr, mit ihm zu speisen.
Ludwig widmete sich vormittags den Regierungsgeschäften, nachmittags spielte er und jagte. Abends gab es oft Theater- und Opernaufführungen. In Versailles lebten viele Künstler. Große Feste für Tausende dauerten oft mehrere Tage und kosteten viel Geld. Der König diente als Vorbild für den Adel, der sich schminkte, Perücken trug und wie er gekleidet war.
Olympe Verlag
Der Park von Versailles

Hinter dem Schloss liegt eine riesige Gartenanlage. Die Wege führen strahlenförmig vom Schloss weg. Bäume, Büsche und Hecken sind nach geometrischen Formen geschnitten. Künstliche Wasserleitungen versorgen zahlreiche Springbrunnen, Teiche und Bäche.
Etikette, die: genaue Regeln, die vorschreiben, wie sich die Menschen am Königshof zu benehmen haben
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Löse dieses Rätsel!

senkrecht
1. In Frankreich gab es drei Stände, deshalb spricht man auch von einer …
2. Die Regierungsform, bei der eine Herrscherin oder ein Herrscher die unumschränkte Macht hatte, wurde später … genannt.
3. Ludwig XIV. sah sich selbst als Mittelpunkt des …
5. Ludwigs Symbol war die …
waagrecht
2. Den zweiten Stand bildete der …
4. Ludwig sah sich als König von … Gnaden.
6. Mitglied der Regierung eines Staates oder Landes, das einen bestimmten
Geschäftsbereich verwaltet
7. Name des Kardinals, der die Regierungsgeschäfte führte, bis Ludwig volljährig war
8. Ludwigs Heer bestand aus …
9. Kardinäle, Bischöfe und Äbte
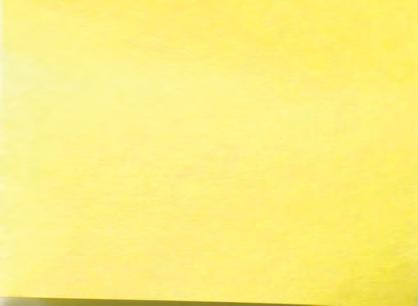

Verlag

Wer sagt was? Ordne die Personen den Aussagen zu!
Wir leben in der Stadt und werden ausgebeutet.

Wir sind die Vertreter der einzigen Religion im Staat.

Wir liefern alle Nahrungsmittel und haben trotzdem Hunger.

Wir leben im Schloss des Königs und haben alles im Überfluss.



Wir sind gebildet, haben im Staat aber keine Macht. Der Staat bin ich!


Untersuche, welche Probleme und Ungerechtigkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen bestehen! Erörtere, welche Forderungen oder Reformen jede Gruppe stellen könnte, um ihre Situation zu verbessern! Begründe, wie diese Veränderungen die Machtverhältnisse im Staat beeinflussen könnten! Präsentiere deine Ergebnisse in einem kurzen Vortrag oder einer Diskussion mit der Klasse!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
4
Fasse die wichtigsten Aussagen der Textquelle mit eigenen Worten zusammen!
Q1: Ein Franzose über die Pariser Mode – Bericht des französischen Schriftstellers Montesquieu (1717)
6
Es ist erstaunlich, welchen Wechsel die Launen der Mode bei den Franzosen unterworfen sind. Sie haben schon vergessen, wie sie in diesem Sommer gekleidet waren; aber noch viel weniger wissen sie, was sie im Winter anziehen werden. Das Unglaublichste jedoch ist der Aufwand, den ein Mann zu machen hat, damit seine Frau sich immer nach der Mode tragen könne.
Was könnte es mir nützen, Dir eine genaue Beschreibung ihrer Tracht und ihres Putzes zu geben? Eine neue Mode würde meine ganze Arbeit umstoßen, gerade wie diejenige der Schneider; und ehe Du noch meinen Brief erhieltest, würde sich alles verändert haben. [...]
Mit den Gebräuchen und Lebensweisen steht es wie mit den Moden; je nach dem Alter ihres Königs ändern die Franzosen ihre Sitten. Sogar ernsthaft könnte der Monarch die Nation machen, wenn er es darauf anlegte. Der Fürst überträgt seine Geistesart auf den Hof, der Hof auf die Stadt, die Stadt auf die Provinzen. Die Seele des Landesherrn ist ein Modell, nach welchem alle andere sich formen.
Aus: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Allgemeinen Geschichte. Zürich (1919), S. 205f.
Erkläre, wie Montesquieu die Beziehung zwischen dem König, seinem unmittelbaren Umfeld und in weiterer Folge dem Staat darstellt!
Nimm Stellung!
Verlag
Sitte, die: für eine Gemeinschaft übliche Gewohnheit oder Gepflogenheit
Wie wird dieser Text vom König selbst aufgenommen worden sein – als gutgemeinte Kritik oder als vorwurfsvolle Anklage? In welcher Beziehung steht die Quelle zum System des Absolutismus? 5

Betrachte diese drei Frauen, die Ende des 17. Jh. in Frankreich lebten! Dann ordne zu!

Bürgerin © Hofdame © Bäuerin







Abb. 2: Mode zur Zeit Ludwig XIV. (Collage) von links nach rechts: Kostüm einer Adeligen unter König Ludwig XIV. von Alfred Grevin; Porträt einer edlen Dame, die ein Morgennegligé trägt, Posterdruck 1676 ; Französische Milchmagd von Bagnolet im Jahr 1680, Zeichnung von Xavier Willemin
Arbeite mit Hilfe der Abb. 2 vier besondere Merkmale der französischen Mode am Hof heraus!
Erkläre die Zusammenhänge zwischen Mode und dem Leben am Hof!
Olympe Verlag
Beurteile, inwiefern die Mode ein Abbild der gesellschaftlichen Ungleichheit in Frankreich gewesen sein könnte!
JA, die Mode ist ein Abbild der gesellschaftlichen Ungleichheit, weil
NEIN, die Mode ist kein Abbild der gesellschaftlichen Ungleichheit, weil
MINDMAP ERSTELLEN GEDANKEN STRUKTURIEREN
Eine Mind-Map ist eine nützliche Hilfestellung sowohl für den Schulunterricht als auch für den späteren Berufsalltag. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Themen und ist daher äußerst beliebt. Der Begriff „Mind-Map“ stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt „Gedanken-Landkarte“. Eine Mind-Map stellt grafisch ein bestimmtes Thema, einen Prozess oder eine
1. SCHRITT: Vorbereitungen treffen
Assoziation dar. In der Regel steht ein zentrales Thema im Mittelpunkt, das den Stamm bildet. Von diesem zentralen Thema aus gehen verschiedene Verbindungen zu anderen (Unter-)Themen ab, die als Äste fungieren. Diese Zweige können wiederum weitere Verbindungen zu Unterthemen aufweisen.
Bestimme zuerst, für wen du die Mind-Map erstellst!
Verwende ein A4 bzw. ein A3 Papier im Querformat!
Präsentierst du die Mindmap vor der ganzen Klasse bewährt sich Plakatpapier.
Achte darauf, dass du gut funktionierende Filzstifte verwendest!
2. SCHRITT: Thema eintragen
D
Trage in der Mitte des Papiers das Thema in großen, gut leserlichen Buchstaben ein!
Verlag

Verwende dazu maximal 3 bis 4 Wörter. Um das Thema herum wird ein Oval, ein Kasten oder eine Wolke gezogen.
3. SCHRITT: Unterthemen festlegen und Äste anordnen
D
Lege fest, wie viele Unterthemen notwendig sind!
Es sollten nicht mehr als 5 bis 6 Unterthemen sein. Notiere nun die Unterthemen rund um dein im Mittelpunkt stehendes Thema! Es werden wiederum nur die wichtigen Wörter notiert. Kreise diese wieder ein, oder verwende eine von dir bevorzugte Umrandungsform, und verbinde sie mit deinem Themenfeld.
4. SCHRITT: Mind-Map vervollständigen
D
Notiere nun weitere wichtige Begriffe!
Achte darauf, dass jeder Zweig nur einen wichtigen Begriff bekommt. Verwende verschiedene Farben, diese können Begriffe besonders hervorheben oder betonen! Durch die Verwendung der gleichen Farbe für zwei Begriffe kannst du deutlich machen, was zusammengehört.
1
Wähle nun eines der Themen aus dem Themenspeicher aus und erstelle deine persönliche Mind-Map!
Themenspeicher:

Absolutismus © Bauernkriege © Reformation © Aufstieg der Habsburger © Humanismus © Renaissance © Frühkapitalismus


5. EINE NEUE WIRTSCHAFTSFORM – DER MERKANTILISMUS

Abb. 1: Das System des Merkantilismus
Nation, die: Gemeinschaft von Menschen mit übereinstimmenden Merkmalen wie Sprache, Kultur, Abstammung und Geschichte
Abb. 1: Beschreibe das System des Merkantilismus mit eigenen Worten!
Begründe, warum das System europaweit unweigerlich zum Scheitern verurteilt war! Notiere deine Argumente und präsentiere sie in einem kurzen Vortrag der Klasse!
Q1: Nenne die wichtigsten Vorteile und Nachteile der Arbeitsteilung, wie sie Adam Smith beschreibt!
Erstelle dazu eine Tabelle mit zwei Spalten: Vorteile und Nachteile!
Beurteile, ob die Arbeitsteilung eher für die Arbeiterinnen und Arbeiter oder für die Manufakturbesitzer Vorteile hatte! Begründe deine Meinung in 2–3 Sätzen!
Tauscht euch in der Kleingruppe aus: Stimmt ihr bei euren Einschätzungen überein oder habt ihr unterschiedliche Meinungen?

Einfuhr von Rohstoffen
Ausfuhrverbot für Rohstoffe
Verlag
Ausfuhr von Fertigprodukten
Ab dem 16. Jh. setzte sich in den absolutistischen Staaten eine neue Wirtschaftsform durch, der Merkantilismus. Das oberste Ziel dieser Wirtschaftspolitik bestand in einer Vermehrung des Reichtums eines Staates, um die Macht und den Einfluss der Herrscherin oder des Herrschers zu stärken und zu vergrößern.
In Frankreich benötigte Ludwig XIV. für seinen aufwändigen Lebensstil, seine Beamten und sein Heer viel Geld. Sein Finanzminister Colbert förderte den Export von teuren Waren in das Ausland. Der Import von Waren aus dem Ausland wurde verboten oder mit hohen Zöllen belegt. Nur billige Rohstoffe durften aus dem Ausland nach Frankreich gebracht werden. Durch den Bau von neuen Straßen und Kanälen sollte der Transport der Güter erleichtert werden.

Einfuhrverbot für Fertigprodukte Anwerbung von Fachkräften
Manufaktur statt Handwerksbetrieb
Um Waren schneller und billiger herstellen zu können, förderte der Staat die Errichtung von Manufakturen. Dies waren Großbetriebe, in denen Waren von mehreren Arbeiterinnen und Arbeitern nach dem Prinzip der Arbeitsteilung hergestellt wurden. Das heißt, jede Arbeiterin und jeder Arbeiter machte nur einen Teil eines Werkstücks. Keiner von ihnen hatte gelernt, den ganzen Gegenstand herzustellen.
Q1: Der Wohlstand der Nationen – Buch des schottischen Aufklärers Adam Smith (1776)
Ein Mann zieht den Draht, ein Anderer streckt ihn, ein Dritter schneidet ihn in Stücke, ein Vierter spitzt ihn zu, ein Fünfter schleift ihn am oberen Ende, wo der Kopf angesetzt wird; die Verfertigung des Kopfes erfordert zwei oder drei verschiedene Verrichtungen; sein Ansetzen ist ein eigenes Geschäft, die Nadel weiß zu glühen ein anderer; sogar das Einstecken der Nadel ins Papier bildet eine Arbeit für sich. Und so ist das wichtige Gewerbe, Stecknadeln zu machen, in ungefähr achtzehn verschiedene Tätigkeiten geteilt […]. Ich habe eine kleine Fabrik dieser Art gesehen, in der nur zehn Menschen beschäftigt waren […]. Jene zehn Personen konnten mithin zusammen täglich über acht und vierzig Tausend Nadeln machen […]. Aus: Prager, Robert (Hg.): Adam Smith Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes. Berlin (1905), S. 7f.
Die Manufakturarbeiterinnen und Manufakturarbeiter bekamen wenig Lohn, lebten mit ihren Familien in armseligen Wohnungen und hatten meist keine Möglichkeit, ihr Leben zu verändern. Colbert verlängerte auch die Arbeitszeit der Arbeiterinnen und Arbeiter und erließ ein Versammlungs- und Streikverbot, um niedrige Löhne sicherzustellen.
los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Beschreibe in deinen eigenen Worten die verschiedenen Maßnahmen des Merkantilismus, die ergriffen wurden, um die Produktionskosten so gering wie möglich zu halten!
Erläutere, welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf die Arbeitsbedingungen, die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter und die Qualität der Produkte hatten!

1 4 2 5 3
Vergleicht nun eure Ergebnisse in der Klasse!

Gestaltet in Vierergruppen eine Mindmap zum Thema Merkantilismus! Geht dabei nach M2 „Eine Mind-Map erstellen – Gedanken strukturieren“ vor!
Versetze dich in die Lage einer Manufakturarbeiterin/eines Manufakturarbeiters und verfasse einen fiktiven Brief an König Ludwig XIV., in dem du deine Situation schilderst und Verbesserungen für die Manufakturarbeiterinnen und Manufakturarbeiter verlangst.



So schätze ich mich nach dem Großkapitel „DIE NEUZEIT BRINGT VERÄNDERUNG“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…die Unterschiede zwischen einer feudalen Wirtschaft und einer Marktwirtschaft erklären.
…wesentliche Merkmale des Frühkapitalismus nennen.
…die Bedeutung der Fugger für die Kaiser des Römischen Reiches deutscher Nation erläutern.
…die gesellschaftlichen Umbrüche am Beginn der Neuzeit nachvollziehen.
…die veränderte Stellung des Adels gegenüber der Herrscherin oder dem Herrscher beschreiben.
…reflektieren, inwieweit die Ursachen der Bauernaufstände auf soziale Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Unterdrückung zurückzuführen sind.
…über Ludwig XIV. berichten.
…wesentliche Merkmale des Absolutismus nennen und diese Herrschaftsform kritisch bewerten.
…reflektieren, wie der Gesellschaftsaufbau im Absolutismus die soziale Ungleichheit beeinflusst hat.
…Mode als Abbild der gesellschaftlichen Unterschiede erkennen.
…eine Mind-Map mit Hilfe der Methode M2 erstellen.
…das System des Merkantilismus beschreiben und kritisch hinterfragen.
…die Vor- und Nachteile der Arbeitsteilung erklären sowie die Auswirkungen kritisch hinterfragen.



Buchtipps für besonders Wissensdurstige
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
Johannes Willms: Louis XIV. Der Sonnenkönig und seine Zeit (C.H.Beck 2023).
Olympe Verlag
Margarete Lenk: Wolfgang und Edeltraut. Erzählung (BookRix 2019).
Holger Höcke: Der Mönch von Eberbach (Conte Verlag 2014).



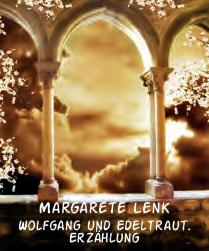




1. DIE AUFKLÄRUNG
Im 18. Jh. waren einige Philosophen, die Aufklärer genannt wurden, davon überzeugt, dass der Mensch nicht nur die Natur erforschen kann, sondern dass es auch die Aufgabe des Menschen sei, das Leben aller Menschen zu verbessern. Für diese Aufklärer besaß jeder Mensch ein natürliches Recht auf Freiheit.
Die Aufklärer waren gegen soziale Ungerechtigkeit. Deshalb traten sie gegen die absolute Herrschaft der Könige und gegen die Allmacht der Kirche ein. Sie setzten sich für die Rechte der ungebildeten und unterdrückten Menschen ein.
Forderungen der Aufklärer
Alle Menschen sollen vor dem Gesetz gleich sein.
Jeder Mensch soll ein Recht auf Schulbildung haben.
Jeder Mensch soll sich nur von seinem Verstand leiten lassen.
Hexenprozesse und die Folter sollen abgeschafft werden.
Jeder Mensch soll frei seine Meinung sagen können.
Jeder Mensch soll das Recht besitzen, seine Religion frei zu wählen.
Kranke und Arme sollen ein Recht auf Hilfe haben.
Der König ist nicht von Gott auserwählt, sondern soll vom Volk bestimmt werden.
Ein Einzelner soll nicht die gesamte Macht im Staat haben D Gewaltentrennung
Philosoph, der: griechisch „Freund der Weisheit“; Wissenschaftler, der sich mit vielen Fragen des Lebens beschäftigt


Die Ideen der Aufklärung fanden vor allem beim Bürgertum großen Anklang. Ärzte, Anwälte und Lehrer lasen die Schriften der Aufklärer und verbreiteten die Ideen weiter.

Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen!


Der Mensch wird frei geboren, doch überall ist er in Ketten!

Immanuel Kant




Die meisten absoluten Herrscherinnen und Herrscher, die Adeligen und die Kirchenfürsten waren gegen diese neuen Gedanken.
Aufklärung und Schule
Bis ins 18. Jh. konnten nur wenige Personen lesen und schreiben. Nur die Söhne reicher Familien besuchten eine Schule. Vornehme Mädchen wurden zu Hause unterrichtet. Die Kinder der armen Leute besuchten höchstens die Volksschule. Auch die Schulmeister in den Dorfschulen hatten keine besondere Ausbildung. Oft konnten sie selbst nicht gut lesen und schreiben.
Olympe Verlag
Eine der wichtigsten Forderungen der Aufklärer lautete deshalb: Alle Menschen haben ein Recht auf Schulbildung. Jeder Mensch sollte seinen Geist benutzen und selbstständig Entscheidungen treffen können. Immanuel Kants Forderung: „Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen“, wurde ein Leitsatz der Aufklärung. Wissen und Bildung sollten Unterdrückung und Not beseitigen.
Es ist klar, dass jeder, der einen Menschen wegen seiner abweichenden Meinung verfolgt, eine erbärmliche Kreatur ist.
Abb. 1: Berühmte Aufklärer (Collage)
Abb. 1: Diskutiert in der Klasse darüber, welche Bedeutung diese Aussprüche der Aufklärer für unsere Gesellschaft haben! Bezieht auch die wesentlichen Forderungen der Aufklärer in eure Diskussion mit ein!
Q1: Fasse die Quelle mit eigenen Worten zusammen!
Begründe anhand der Quelle, weshalb Rousseau als Ziel der weiblichen Erziehung vor allem die Erfüllung der männlichen Bedürfnisse sah! Präsentiere deine Ergebnisse in einer Kleingruppe!
Erörtert gemeinsam, was Rousseau über Männer und Frauen gesagt hat und welche Auswirkungen dies auf Männer und Frauen hatte!
Beurteile, gegen welche gesellschaftlichen Zwänge sich die Aufklärer nicht wandten!
Besprecht gemeinsam, ob und welche Unterschiede es heute in der Erziehung von Mädchen und Buben gibt!
Toleranz, die: Dulden oder Respektieren der Überzeugungen Anderer
Reform

Unter einer Reform versteht man eine Um- bzw. Neugestaltung, die in der Regel auch zu Verbesserung für die Betroffenen führt.
aufgeklärter Absolutismus, der: Die Herrscherin oder der Herrscher führte Reformen durch, die das Leben ihrer oder seiner Untertanen verbessern sollten; das Volk durfte aber nicht mitbestimmen.
Grundbuch, das: Liste aller Grundstücke, in der die Eigentümerinnen und Eigentümer angegeben sind
Analphabetin, die/Analphabet, der: jemand, der weder schreiben noch lesen kann
Aufklärung – auch für die Frau?
Die Forderung nach Bildung galt in der Zeit der Aufklärung nur für Knaben. Mädchen sollten zu Hause auf den Beruf der Ehefrau und Mutter vorbereitet werden. Das galt damals als der „wahre Beruf der Frau“.
Q1: Rousseau über die Ziele der Erziehung von Mädchen (1762)
Da Mann und Frau in Charakter und Temperament nicht gleich geartet sind, noch sein sollen, dürfen sie auch nicht die gleiche Erziehung erhalten. […]
Vielmehr ist die Erziehung der Frauen schon früh und umfassend auf die Bedürfnisse der Männer auszurichten: „Ihnen gefallen und nützlich sein, ihnen liebens- und achtenswert sein, sie in der Jugend erziehen und im Alter umsorgen, sie beraten, trösten und ihnen das Leben angenehm machen und versüßen, das sind zu allen Zeiten die Pflichten der Frau […]“
Aus: Ines M. Breinbauer: Einführung in die Allgemeine Pädagogik. Wien (2000), S. 70.
Aufklärung und Kirche
Die Aufklärer stellten sich nicht grundsätzlich gegen die Kirche. Aber sie waren gegen jede Form von Aberglauben, gegen Hexenprozesse und gegen die geistige Bevormundung der Menschen durch die Kirche. Sie forderten religiöse Toleranz: Jeder Mensch sollte frei seine Religion wählen können und wegen dieser Religion nicht verfolgt werden.
Die Aufklärung in Europa
Verlag
Die Ideen der Aufklärung hatten im Europa des 18. Jh. großen Einfluss. Auch einige absolute Herrscherinnen und Herrscher schlossen sich den Gedanken der Aufklärung an. Sie führten in ihren Ländern Reformen durch. An ihrer absoluten Macht hielten sie jedoch fest. Diese Regierungsform wird daher von Historikerinnen und Historikern aufgeklärter Absolutismus genannt. Herrscherinnen und Herrscher des aufgeklärten Absolutismus waren Friedrich II. von Preußen, Katharina II. von Russland und Maria Theresia von Österreich sowie ihr Sohn Joseph II
Reformen am Beispiel Maria Theresias
Maria Theresia erkannte, dass in ihrem Reich Reformen notwendig waren und beauftragte ihre Berater mit umfassenden Neuerungen. Diese mussten oft gegen den Widerstand des Adels durchgesetzt werden.

Steuerreform
Um genaue Aufzeichnungen über ihr Land zu erhalten, ließ Maria Theresia eine Volkszählung durchführen. Alle Häuser wurden nummeriert und in ein Grundbuch eingetragen. Auch Adelige und Geistliche mussten nun für ihren Grundbesitz Steuern bezahlen.

Schulreform
In Österreich waren viele Menschen Analphabetinnen und Analphabeten. Maria Theresia führte deshalb 1774 die Unterrichtspflicht ein. Mit dieser Reform wollte sie den Bildungsstand der Bevölkerung heben.

Verwaltungsreform
Maria Theresia gründete in Wien mit der „Haus- Hof- und Staatskanzlei“ eine zentrale Verwaltungsstelle. Alle wichtigen Entscheidungen für die Erblande und Böhmen wurden nun in Wien getroffen.

Heeres- und Rechtsreformen
Maria Theresia gründete die Militärakademie in Wiener Neustadt und führte die lebenslange Wehrpflicht für Bauernsöhne und Taglöhner ein. Die Adeligen verloren das Recht, willkürlich über ihre Untertanen zu richten. Unter Maria Theresia wurde auch die Folter abgeschafft.
Ein aufgeklärter Herrscher – Joseph II.
Der älteste Sohn Maria Theresias, Joseph II. (1741 – 1790), war bereits seit 1765 Kaiser des Römischen Reiches deutscher Nation und Mitregent seiner Mutter. 1780 übernahm er nach dem Tod seiner Mutter die Herrschaft in Österreich.
Joseph II. war ein überzeugter Anhänger der Aufklärung. Er wollte die Lebensbedingungen seiner Untertanen verbessern. Um Land und Leute näher kennen zu lernen, unternahm er zahlreiche Reisen. Oft fuhr er inkognito in seiner Kutsche als Graf Falkenstein durch sein Land. Joseph II. sah sich als ersten Diener des Staates.
„Alles für das Volk, nichts durch das Volk“
Dieser Satz beschreibt die Regierungsweise Josephs II. Seine Reformen sollten Verbesserungen für das einfache Volk bringen. Er traf aber alle Entscheidungen, ohne die betroffenen Menschen um ihre Meinung zu fragen. Viele seiner Reformen lösten daher Widerstände aus und mussten durch seinen Nachfolger, Kaiser Leopold II. (1790 – 1792), wieder zurückgenommen werden.
Reformen Josephs II.
Toleranzpatent
Verlag

Abb. 3: Joseph II. mit seinem Bruder Leopold in Rom (Ölgemälde von Pompeo Batoni, 1769, KHM)
inkognito: unter falschem Namen Patent, das: hier D eine königliche Verordnung;
Durch das 1781 erlassene Toleranzpatent wurde evangelischen und orthodoxen Christinnen und Christen erlaubt, ihren Glauben durch das Bauen von Kirchen (ohne Türme) offen zu bekennen. Ebenso durften sie Schulen einrichten.
Später wurde auch den jüdischen Einwohnerinnen und Einwohnern die freie Religionsausübung ermöglicht. Sie mussten nicht mehr in bestimmten Stadtvierteln (Ghettos) wohnen und vorgeschriebene Kleidungsstücke tragen. Auch durften sie nun ein Handwerk erlernen.
Untertanenpatent
Mit dem ebenfalls 1781 erlassenen Untertanenpatent hob Joseph II. die Leibeigenschaft der Bauern auf. Sie waren nun persönlich frei, konnten auch ohne Einwilligung des Grundherrn heiraten sowie ihren Beruf und ihren Wohnort frei wählen. Die Abhängigkeit vom Grund und Boden ihres Herrn (Grunduntertänigkeit) blieb aber weiterhin bestehen.
Kirchliche Reformen
Joseph II. verbot mit einem Erlass 1782 alle katholischen Klöster, die keine „nützliche“ Tätigkeit ausübten. Nur Klöster, die eine Schule betrieben, oder sich um Arme und Kranke kümmerten, durften weiterbestehen. Mit dem Geld der geschlossenen Klöster ließ Joseph neue Pfarrkirchen bauen. Keiner seiner Untertanen sollte länger als eine Stunde gehen, um eine Kirche zu erreichen. Durch die Schließung der Klöster gingen aber viele wertvolle alte Handschriften und kostbare Bücher verloren, da man sie als nicht notwendig betrachtete.
Soziale Reformen
Seine besondere Aufmerksamkeit schenkte Joseph II. der einfachen Bevölkerung. In Wien ließ er das Allgemeine Krankenhaus, Schulen sowie Armen- und Waisenhäuser bauen.
Q2: Handbillet Joseph II. (1786)
2. (Muss) in Einem Bette niemals mehr als Ein Kind liegen und nicht, wie es bisher geschehen ist, 4, auch 5 zusammengelegt werden. […]
3. Sind die Kinder alle Wochen wenigstens Einmal durch Waschen und Kämmen zu reinigen und zu säubern.
Aus: Adolf Schauenstein: Handbuch der Öffentlichen Gesundheitspflege in Österreich. Wien (1863), S. 128.
Q 2: Erörtere die möglichen Gründe für die Hygienetipps Josephs II.! Notiere Gründe dafür und präsentiere deine Argumente der Klasse!
Vergleiche die beschriebenen Tipps zur Gesundheitspflege mit den heutigen Standards in deinem Umfeld! Halte deine Beobachtungen in einer Tabelle fest und präsentiere sie der Klasse! Waisenhaus, das: Heim für Kinder, die keine Eltern haben
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Arbeite die Hauptaussage des Textes heraus und notiere sie in einem Satz! Achte besonders auf die Bedeutung der territorialen Erweiterung und der Reformen in der Habsburgermonarchie!
D1: Das Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus
Doch die territoriale Erweiterung der Monarchie war nicht die wichtigste Veränderung dieser 52 Jahre von 1740 bis 1792. Bedeutende Weichenstellungen erfolgten in der Regierungszeit Maria Theresia und ihrer Söhne Joseph II. und Leopold II., die für die Habsburgermonarchie wesentliche Modernisierungs- und Zentralisierungsimpulse setzten.
Die traditionelle Bezeichnung als Zeitalter des „aufgeklärten Absolutismus“ zeigt gut die beiden Facetten, welche die Epoche charakterisieren. [...]
Die Maßnahmen der Herrscher muten uns moderner an, sie sind rationaler als die der Generationen davor: Einer der wichtigsten Grundsätze aller Neuordnung war der Gedanke für das Wohl des Staates und seiner Bevölkerung. Damit gingen aber auch Gedanken einher, die mehr vom Absolutismus als von der Aufklärung geprägt waren. Die Herrscher versuchten eine Vereinfachung der Verwaltung und eine Zentralisierung des Staates durchzusetzen. In dieser Hinsicht steht das Zeitalter Maria Theresias und ihrer Söhne in keinem Gegensatz zum Absolutismus, sondern war eher dessen Fortsetzung und Höhepunkt.
Der Gedanke der immer lückenloser werdenden Überwachung der Untertanen war damit aufs Engste verbunden. [...] Eines kann man zusammenfassend sagen: Das Eigenschaftswort „aufgeklärt“ darf über das Hauptwort „Absolutismus“ nicht hinwegtäuschen.
Aus: Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur-Gesellschaft-Politik. Graz-Wien-Köln (2002), S. 154f.
zentralisieren: einer zentralen Leitung, Verwaltung und Gestaltung unterwerfen
Impuls, der: Anstoß, Anregung
Facetten, die: Teilaspekte
anmuten: einen bestimmten Eindruck machen
rational: vernünftig, sinnvoll
Hauptaussage:
Vergleiche den Begriff „aufgeklärter Absolutismus“ in der Regierungszeit von Maria Theresia und Joseph II. mit dem klassischen Absolutismus!
Untersuche, wie in der Darstellung die Modernisierung und Zentralisierung des Staates beschrieben werden!
Erläutere, warum es wichtig ist, das Wort „aufgeklärt“ im Zusammenhang mit „Absolutismus“ kritisch zu betrachten. Welche Vorteile und Nachteile dieser Herrschaftsform lassen sich erkennen?
Arbeite anhand der angeführten Reformen Maria Theresias heraus, welche Forderungen der Aufklärer dadurch erfüllt wurden! Notiere deine Ergebnisse in Stichworten!

Lies zuerst den Informationstext zu diesem Bild, um die folgenden Aufgaben lösen zu können! Dann studiere alle Details des Gemäldes!
Verlag


Dieses Bild stammt von dem Schweizer Maler Albert Anker (1831 – 1910). Er gilt als bedeutender Maler von Kinderdarstellungen. Dieses Gemälde stellte er 1896 her. Es befindet sich im Kunstmuseum Basel. Das Bild hat die Maße 104 x 175,5 cm und ist mit Ölfarben auf Leinwand gemalt.

Beschreibe nun, was du auf dem Bild erkennen kannst, in deinem Heft mit mindestens 60 Wörtern!
Du könntest so beginnen: Auf dem Bild ist ein Klassenraum zu sehen ...
Ziehe einen Vergleich zu deiner Schule und deiner Klasse in deinem Heft! Charakterisiere die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu dem Bild von Albert Anker!
Reflektiert in Partnerarbeit darüber, welche Eindrücke von Schule und Bildung Albert Anker in seinem Bild vermitteln wollte. Welche Botschaft könnte er gehabt haben?
Erschließt in Partnerarbeit, wie es den Kindern auf dem Bild in ihrer Schulzeit ergangen sein könnte! Versetzt euch in die Situation der Kinder auf dem Bild und stellt euch vor, wie ihr Schulalltag ausgesehen hat und wie sie sich gefühlt haben könnten.
Präsentiert eure Ergebnisse anschließend der Klasse!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Arbeite aus dem folgenden Text drei zentrale Schwerpunkte der Aufklärung heraus und beschreibe, wie diese die gesellschaftlichen oder politischen Veränderungen in der Zeit beeinflussten! Konzentriere dich auf die allgemeinen Ideen der Aufklärung, wie Vernunft, Freiheit oder Gleichheit, und erkläre, wie diese Grundsätze zu Veränderungen in der Gesellschaft geführt haben!
D2: Die Kritik an der Gesellschaft
Die neuen Ideen beschränkten sich nicht allein auf die Erziehung, sondern stellten auch andere gesellschaftliche Zustände in Frage. In Frankreich wuchs die Kritik am Einfluss von Adel und Geistlichkeit auf den König, der immer mehr als Despot angesehen wurde.
Damit begann das „Zeitalter der Aufklärung“, das ungefähr die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts umfasst, als die Gesellschaftskritik immer mehr an Boden gewann. [...]
Für die Philosophen der Aufklärung bestand die erste Aufgabe der Regierungen darin, sich um das Wohlergehen ihrer Völker zu kümmern, die individuelle Freiheit der Untertanen so wenig wie möglich anzutasten und die freie Religionsausübung zu gewährleisten. [...]
Nach dem Vorbild Josephs II. in Österreich übten die Herrscher Einfluss, ja sogar Kontrollrechte gegenüber der Kirche aus und setzten deshalb ihre Vorstellungen von religiöser Toleranz im kirchlichen Leben zunehmend durch.
Verlag
Despot, der: uneingeschränkt Herrschender
Atheismus, der: Weltanschauung, die die Existenz [eines] Gottes verneint bzw. bezweifelt
salonfähig: akzeptabel, respektabel; in den Rahmen einer Gesellschaft passend
Schwerpunkt 1:
Glaubensfreiheit bedeutete indes keineswegs Gleichheit in Bezug auf die bürgerlichen Rechte. Denn obwohl Rousseau den Atheismus salonfähig gemacht hatte, galt die Religionsfreiheit, die später sogar in die Erklärung der Menschenrechte aufgenommen wurde, noch viele Jahre lang für den jüdischen Glauben nicht.
Aus: Delouche, Frederic (Hg.): Europäisches Geschichtsbuch. Stuttgart/Düsseldorf/Berlin/Leipzig (1992), S. 268.
Schwerpunkt 2:
Schwerpunkt 3:
Lies D2 nochmals und überprüfe dann, inwiefern der Titel des Textes mit dem Inhalt übereinstimmt! Kreuze an und begründe deine Entscheidung!
stimmt überein, weil
stimmt nicht überein, weil
Lies die folgende Darstellung aus einem Geschichtsbuch zuerst aufmerksam durch!
D3: Die Reaktionen der Monarchien auf den Geist der Aufklärung
Trotz der Kritik der aufgeklärten Denker blieb die auf dem Gottesgnadentum ruhende absolute Monarchie, die Ludwig XIV. von 1661 bis 1715 verkörperte, die traditionelle staatliche Organisationsform. Republiken und parlamentarische Monarchien bildeten die Ausnahme. Der Herrscher leitete seine Macht und seine Legitimität aus der Gnade Gottes ab. [...]
Legitimität, die: Rechtmäßigkeit der Staatsgewalt
antiklerikal: kirchenfeindlich
Der Fürst umgab sich mit Ministern und Beratern für besondere Angelegenheiten, die vor allem aus dem Adel stammten, damit diese ihn bei seinen Aufgaben unterstützten. In ganz Europa war das 18. Jahrhundert durch die Zentralisierung der Staatsgewalt gekennzeichnet. [...]
Einige Herrscher, die ihre Politik wirkungsvoller gestalten wollten oder das Wohl des Volkes im Blick hatten, verfolgten eine von der Aufklärung beeinflusste Modernisierungspolitik. [...]
Diese Herrscher waren Vertreter des aufgeklärten Absolutismus. Sie rationalisierten die Verwaltung und das Rechtssystem. Joseph II. schaffte die Folter und die Todesstrafe ab. 1781 veröffentlichte er für Protestanten, Orthodoxe und Juden ein Toleranzpatent und ordnete die Schließung der Klöster an, die er für sozial nutzlos hielt. [...]
Verlag
Doch die autoritär durchgeführten Reformen trafen auf zahlreiche Widerstände. So führte die antiklerikale Politik Josephs II. 1787 zum Aufstand der österreichischen Niederlande. Die Zeit war noch nicht reif für politische Freiheit und Demokratie.
Aus: Bendick Rainer (Hg.): Historie/Geschichte. Europa und die Welt von der Antike bis 1815. Deutsch-französisches Geschichtsbuch. Stuttgart/Leipzig (2012), S. 184.
Vergleiche nun D2 und D3! Unterstreiche mit drei unterschiedlichen Farben jene Textstellen, die folgende Schlagworte des aufgeklärten Absolutismus beschreiben!


Einfluss des Adels auf die Herrscherin oder den Herrscher Politik zum Wohlergehen des Staatsvolkes
religiöse Toleranz und ihre Folgen

Erläutere, welche Auswirkungen die Reformen Josephs II. auf folgende Bevölkerungsgruppen hatten!
Auswirkungen
BAUERN
GRUNDBESITZER
EINFACHE PRIESTER
HOHER KLERUS
Bereite eine Präsentation vor, in der du die Reformen von Joseph II. und ihre Auswirkungen auf das Leben der Menschen in seinem Reich vorstellst!
Erläutere dabei die wichtigsten Reformen und reflektiere, wie sie das tägliche Leben der Bevölkerung beeinflusst haben könnten!
Stelle abschließend deine eigene Einschätzung vor, ob diese Veränderungen eher positiv oder negativ waren, und begründe deine Meinung vor der Klasse!
M3 KARIKATUREN DEUTEN
Bei Karikaturen handelt es sich um Zeichnungen, die oft auf humorvolle Weise Probleme und Missstände der aktuellen Zeit darstellen. Weil Karikaturen ein verzerrtes Abbild der bestehenden Ordnung sind, zeigen sie gleichzeitig, wie eine Karikaturistin oder ein Karikaturist über diese denkt. Beliebte Stilmittel der Karikaturistinnen und Karikaturisten sind: Übertreibung, Überzeichnung
(Persiflage), Spott, Komik, Vornehmen von Wertungen und Emotionalisierungen.
Da es die Absicht einer Karikaturistin oder eines Karikaturisten ist, die Betrachterinnen und Betrachter zum Nachdenken anzuregen, ist es deine Aufgabe, die Zeichnung unter Einbeziehung der historischen Fakten zu deuten.
1. SCHRITT: Eingehende Betrachtung und Beschreibung
Betrachte die Karikatur genau und beschreibe sie anhand folgender Fragestellungen!
Was ist auf der Karikatur zu sehen? Was fällt auf? Gibt es einen Bildtitel? Gibt es einen Informationstext? Was ist das Thema der Karikatur? Welche Gegenstände, Sachverhalte, Tiere oder Personen sind zu sehen?
Auf welches Ereignis oder welche Situation spielt die Karikatur an? Wurden besonders auffällige Farben verwendet? Sind auf der Karikatur Symbole zu sehen und wenn ja, welche?
2. SCHRITT: Erklären der Karikatur
Erkläre, was abgebildet ist! Verwende dazu auch dein historisches Wissen!
Wofür stehen die Personen? (Gruppe, Volk, …) Was bedeuten die verwendeten Symbole? Was wird übertrieben dargestellt? Warum wird gerade das übertrieben dargestellt?
3. SCHRITT: Die Karikatur deuten
Lege fest, wie viele Unterthemen notwendig sind!
Aus welcher Zeit stammt die Karikatur? Wo wurde die Karikatur das erste Mal veröffentlicht? Gegen wen richtet sich die Kritik? Welches Urteil äußert die Karikaturistin oder der Karikaturist? Mit welchen Mitteln wird in dieser Karikatur übertrieben? Welche Wirkung will die Zeichnerin/der Zeichner bei der Betrachterin bzw. dem Betrachter erreichen? Welches Publikum will die Karikaturistin/der Karikaturist ansprechen? Wie beurteilst du die Aussage dieser Karikatur?
Deutet nun diese Karikatur in Partnerarbeit! Verwendet dazu auch den Informationstext!


Olympe Verlag
Links ist William Pitt, der Premierminister von Großbritannien zu sehen, rechts Napoleon. Als der britische Karikaturist James Gillray seine Karikatur 1805 entwarf, befanden sich die beiden Erzfeinde Großbritannien und Frankreich schon seit zwei Jahren im Krieg. Seine Arbeiten wurden auch auf dem europäischen Kontinent in Zeitungen abgedruckt.

Abb. 1: Der Plumpudding in Gefahr oder Ein kleines Souper der Staats-Epikuräer (James Gillray, 1805)
2. DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION
Frankreich vor der Revolution
Während in einigen europäischen Ländern aufgeklärte Herrscherinnen und Herrscher Reformen durchführten, welche die Lebenssituation der Bevölkerung zumindest teilweise verbesserten, herrschten die französischen Könige weiterhin absolut . Die Lage der Bevölkerung verschlechterte sich auch durch Missernten , die zu enormen Preissteigerungen führten. Hungersnöte und Plünderungen in den Städten waren die Folge.
Auch die Ausgaben für die Armee, die prunkvolle Hofhaltung und den Straßenbau waren deutlich höher als die Einnahmen des Staates, sodass Frankreich vor dem Bankrott stand. König Ludwig XVI. berief deshalb nach mehr als 150 Jahren am 5. Mai 1789 die Generalstände ein. Die Abgeordneten der drei Stände trafen sich in Versailles zu Beratungen.

Diese Beratungen scheiterten aber, da der 3. Stand auf einer Abstimmung nach „Köpfen“ bestand und nicht nach „Ständen“. So bestand der 3. Stand aus 600 Abgeordneten, der 1. und der 2. Stand aus jeweils 300 Abgeordneten. Aus Protest erklärten sich die Abgeordneten des 3. Standes zum alleinigen Vertreter der Mehrheit des Volkes und bildeten eine Nationalversammlung
Der Ausbruch der Revolution …
Um die neu gegründete Nationalversammlung zu unterstützen, kam es zu gewaltsamen Aufständen in Paris und in den Provinzen. Die Revolution brach aus!
Verlag
Am 14. Juli 1789 stürmte das Volk von Paris das Staatsgefängnis – die Bastille. Dieser Tag ist in Frankreich bis heute Nationalfeiertag.


Abb. 1: Der Bauer trägt Adel und Klerus auf seinem Rücken (kolorierte Radierung, 1789)
Abb. 1: Deute diese Karikatur mit Hilfe der Methode M3!
Erörtere, auf welche Ereignisse oder Zustände sich der Zeichner bezogen hat! Beziehe dich dabei auf den Fließtext! Tausche dich in einer Kleingruppe über eure Erörterungen aus! Erstellt gemeinsam eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse oder Zustände, die in der Zeichnung dargestellt werden könnten!
Diskutiert in der Klasse, inwieweit der Karikaturist eine Bewertung vornimmt und wenn ja, welche!
Entwerft in Partnerarbeit eine Karikatur, die zentrale Themen oder Herausforderungen unserer Zeit darstellt!
Bankrott, der: Zahlungsunfähigkeit
Generalstände, die: Versammlung der Vertreter der drei Stände
Nationalversammlung, die: Vertretung des Volkes
Abb. 3: Diskutiert im Klassenplenum, welche Bedeutung die Schlagwörter der Französischen Revolution in Gegenwart und Zukunft besitzen!
Die Schlagworte der Französischen Revolution lauteten:
Abb. 3: Flagge der Revolution mit den Schlagwörtern

Freiheit
Gleichheit
Brüderlichkeit

Abb. 4: Zug der „Pariser Marktweiber“ nach Versailles am 5. 10. 1789 (kolorierte Radierung, 1789)
Q1: Recherchiere im Internet unter dem Schlagwort „Olympe de Gouges“, um mehr über das Leben dieser Frau in Erfahrung zu bringen!
… führt zur Erklärung der Menschenrechte …
Verlag
Eine Lebensmittelknappheit ließ im Oktober den Zorn auf Ludwig XVI. und seine Frau Marie Antoinette, eine Tochter Maria Theresias, wieder aufflammen. 6 000 bewaffnete Frauen zogen nach Versailles, um Brot für das Volk zu fordern. Sie zwangen die Königsfamilie, nach Paris zurückzukehren, und stellten sie unter die Aufsicht der Pariser Bevölkerung. Dieser Aufstand war ein bedeutender Wendepunkt. Die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Lebensbedingungen und der königlichen Herrschaft führte zu verstärktem Druck auf die Regierung, grundlegende Reformen einzuführen.
Dies war einer der vielen Faktoren, die die Nationalversammlung veranlasste, die Erklärung der Menschenrechte zu verabschieden. Im Zuge dieser politischen Veränderungen gab die Nationalversammlung Frankreich eine Verfassung, die das Land zu einer konstitutionellen Monarchie machte. Die Grundidee war, dass der Monarch keinen Einfluss auf die Gesetzgebung und somit auch keinen Einfluss auf die Menschenrechte haben sollte.
Verfasse eine kurze Reportage über ihr Leben! Lies deine Reportage in einer Kleingruppe vor! Tauscht euch darüber aus, welche Aspekte besonders interessant oder wichtig erscheinen, und ergänzt gegebenenfalls fehlende Punkte!
Beurteile, ob die Forderung nach gleichen Rechten in Artikel 10 auch bedeutet, dass alle Menschen gleiche Pflichten und Risiken haben sollen! Diskutiert anschließend in der Klasse, wie Rechte und Pflichten heute in unserer Gesellschaft verteilt sind!

EXEKUTIVE Verabschiedung von Gesetzen und Regeln


LEGISLATIVE Ausführung von Gesetzen durch Regierung und Verwaltung

JUDIKATIVE Kontrolle und Rechtssprechung
König ernennt und entlässt
Abgeordnete für die Nationalversammlung kontrollieren die Minister und die Gerichte Minister beaufsichtigen

Beamte für die Verwaltung

Q1: Olympe de Gouges: Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin (1792)
Art. 10: Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Gleichermaßen muss ihr das Recht zugestanden werden, eine Rednertribüne zu besteigen. […]
Aus: Sommer, Gert; Stellmacher, Jost: Menschenrechte und Menschenrechtsbildung. Berlin (2009), S. 26.
Schafott: meist erhöhtes Gerüst, auf dem Hinrichtungen durch Enthauptung vorgenommen werden

Wahlmänner wählen


Richter und Geschworene

Alle Männer über 25 Jahren mit einer Steuerleistung von mindestens drei Arbeitstagen wählen

Abb. 5: Verfassung von 1791
Doch nur die Männer hatten ein Mitbestimmungsrecht im Staat erreicht. Aus Protest gegen diese Ungerechtigkeit verfasste Olympe de Gouges die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“, in der sie zum ersten Mal auch ein Wahlrecht für Frauen forderte.
... lässt Europa eingreifen...
König Ludwig XVI. bat Österreich und Preußen um Hilfe. Das revolutionäre Frankreich erklärte daraufhin Österreich und Preußen den Krieg. Österreichische und preußische Truppen marschierten in Frankreich ein.
Um die Revolution nicht scheitern zu lassen, mussten alle jungen Franzosen zur Waffe greifen. Frankreich führte somit als erstes Land die allgemeine Wehrpflicht ein. Revolutionäre Frauen forderten die Bildung eines Frauenregiments, das wurde aber abgelehnt. Trotzdem traten rund 30 Frauen der Revolutionsarmee bei. Das Marschlied der Soldaten aus Marseille wurde zum Symbol für die Französische Revolution. Die „Marseillaise“ ist noch immer die französische Nationalhymne.
Der König unternahm einen Fluchtversuch, wurde aber gefangengenommen und am 21. Jänner 1793 hingerichtet. Seine Frau, Marie Antoinette, wurde ebenfalls mit der Guillotine enthauptet. Frankreich war ab nun Republik!
... eine Schreckensherrschaft beginnt...

Die Revolutionsführer Maximilien de Robespierre und Jean Paul Marat rissen die Macht an sich und errichteten eine Schreckensherrschaft.
Ab dem Sommer 1793 wurden Revolutionsgerichte eingerichtet. Diese fällten von Oktober bis Dezember 1793 in Paris 177 Todesurteile; im Sommer 1794 kam es sogar innerhalb von sechs Wochen zu 1.285 Hinrichtungen. Zu den Opfern zählten nicht nur Adelige, sondern vorwiegend Bürger, Revolutionäre und Bauern. Diese Schreckensherrschaft endete im Juli 1794, als Robespierre selbst verhaftet und am 28. Juli 1794 hingerichtet wurde. Sein Sturz markierte das Ende des Terrors und führte zu einer weniger radikalen Phase der Französischen Revolution.
... die von einem Direktorium abgelöst
wird!
Am 27. Juli 1794 endete diese Schreckensherrschaft. Ein Direktorium von fünf Männern übernahm ab nun die Regierungsgeschäfte. Die Zeiten des Terrors waren vorbei.
Errungenschaften der Revolution
2 Einführung des allgemeinen Wahlrechts (mit Ausnahme der Frauen und Dienstboten; das Frauenwahlrecht wurde in Frankreich erst 1944 eingeführt)
2 Möglichkeit der Ehescheidung für Mann und Frau
2 Einführung des metrischen Systems (Kilogramm und Meter): Zuvor galt das Duodezimalsystem mit zwölf Ziffern als Basis („ein Dutzend“).
2 Einrichtung des Schwurgerichts, bei dem Laienrichter („Geschworene“) über das Urteil entscheiden

Guillotine, die: neu entwickelte Tötungsmaschine, die ein rasches Köpfen ermöglichte
Opfer der Revolution:
Olympe Verlag
2 Einführung von Papiergeld (neben der weiteren Verwendung von Münzen)
2 neue Aufteilung der Regionen Frankreichs in Departements (regionale Verwaltungseinheiten)
Abb. 6: Soldat des Revolutionsheeres (RZ aus einem Jugendsachbuch 2007)
†
Abb. 6: Analysiere diese Darstellung mit der Methode „Rekonstruktionszeichnungen dekonstruieren“ (2. Klasse)!


2 Rund 50.000 Frauen und Männer wurden hingerichtet – viele davon mit der Guillotine.
2 Die meisten der Opfer waren Handwerker, Händler, Bauern und Revolutionäre, deshalb auch der zeitgenössische Ausspruch: „Die Revolution frisst ihre Kinder“.
2 500.000 Französinnen und Franzosen starben in den Revolutionskriegen gegen Österreich und Preußen.
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies dir die folgenden Sachtexte zu Revolution und Reform gut durch! Erstelle dann eine Gegenüberstellung REVOLUTION – REFORM in deinem Heft, bei der du wesentliche Merkmale und Unterschiede in Stichworten zusammenfasst!
D1: Revolution – aus dem Politik-Lexikon für Kinder
Wenn Menschen sich durch eine bestehende Ordnung, durch ihre Regierung oder ihre Herrscher unterdrückt oder ungerecht behandelt fühlen, sehen sie manchmal keine Möglichkeit mehr für ein besseres Leben. Sie schließen sich zusammen, werden gemeinsam stark und verändern schnell (und oft mit Gewalt) die bestehende Ordnung. Ein solches Handeln nennt man „Revolution“. Dieses französische Wort bedeutet auch „Umwälzung“ (ursprünglich kommt es vom lateinischen Begriff „revolvere“, das heißt „Zurückrollen“). Die bekannteste Umwälzung in der Geschichte ist die Französische Revolution von 1789. Damals wurde durch einen großen Volksaufstand der König gestürzt. Unter schweren Opfern entstand eine neue politische Ordnung, in der nicht mehr der König, sondern das Volk die Macht hatte. [...]
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen, meist gewaltsamen Umstürzen, gibt es auch den Begriff „friedliche Revolution“. Als Beispiel dafür gilt das Ende der DDR (= Deutsche Demokratische Republik, 1949 – 1990) und die deutsche Wiedervereinigung im Jahre 1990. Dies geschah, ohne dass ein einziger Schuss fiel – alleine durch den friedlichen Protest der Bevölkerung der damaligen DDR, die in großen Massen auf den Straßen demonstriert hatte.
Verlag

D2: Reform und Reformpolitik – aus dem Hanisauland Internetlexikon
Reform:
Das Wort „Reform“ findet man vor allem in der Politik. Damit wird eine Umgestaltung bezeichnet, mit der man Dinge oder Strukturen verändert, ohne sogleich alles radikal anders zu machen.
Reformpolitik:
In Zeitungen und im Fernsehen schreiben und reden Journalisten und Politikerinnen oft von „Reformpolitik“. Damit ist gemeint, dass man Dinge neu ordnen oder verbessern will.
Aus: Begriffserklärung Reform - Hanisauland – Politik für dich, im Internet: https://www.hanisauland.de/lexikon/r/reform.html 3. 3. 2024
D3: Reform – aus dem Politiklexikon für junge Leute
Das lateinische Wort reformare heißt auf Deutsch umgestalten oder verwandeln.
Auch eine schnelle Entwicklung in Wissenschaft und Technik nennt man „Revolution“. So war zum Beispiel die Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt im 18. Jahrhundert der Auslöser der „Industriellen Revolution“. Die Erfindung der Eisenbahn läutete eine Verkehrsrevolution ein. Als „revolutionär“ bezeichnet man auch die Veränderungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft, die durch die Erfindung der Computersysteme und Informationsmedien eingetreten sind.
Reform ist also eine Um- oder Neugestaltung. Reformen sind immer dann notwendig, wenn bestimmte Strukturen, Organisationen oder Regelungen nicht mehr zeitgemäß sind und die gewünschten Ergebnisse nicht mehr erzielt werden. Wenn in einer PISA-Studie festgehalten wird, dass die Ergebnisse des Unterrichtens verbessert werden könnten, so wird eine Bildungsreform überlegt. Wenn die Verfassung eines Staates veraltet ist und der Wirklichkeit nicht mehr entspricht, wird eine Verfassungsreform diskutiert.
Aus: Politiklexikon für junge Leute, im Internet unter: http://www.politik-lexikon.at/reform/ (3. 3. 2024)
Eine der wesentlichsten Forderungen der Aufklärung war die Forderung nach Gewaltentrennung, das heißt, die Trennung von Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Beurteile in zwei Sätzen, warum Gewaltentrennung die Grundlage moderner Demokratien ist!
Nun
los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies unter: http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nach! Wähle anschließend drei Menschenrechte aus, die sich deiner Meinung nach auf die Aufklärung zurückführen lassen! Begründe auch deine Auswahl!
Menschenrecht
Beurteile nun die Wichtigkeit der Menschenrechte in einem kurzen Leserbrief in deinem Heft! Welche Bedeutung haben diese in einer Demokratie? Welche Auswirkungen haben die Menschenrechte für dich persönlich in deinem Lebensalltag? Was würde es für dich bedeuten, in einem Land zu leben, in dem die Menschenrechte nicht gesetzlich verankert sind?
Diese Karikatur bezieht sich auf die gescheiterte Flucht der königlichen Familie. Löse die folgenden Aufgaben und beziehe auch die Bildlegende mit ein!


a) Der Karikaturist verwendet mehrere Symbole. Benenne zwei Symbole!
Abb. 7: Karikatur – Die königliche Familie wird nach Paris zurückgebracht (kolorierte Radierung, 1791, Nationalbibliothek, Paris)
b) Beschreibe in mindestens 20 Worten in deinem Heft, wo und wie sich der Karikaturist in diesem Beispiel des Stilmittels der Übertreibung bedient!
c) Warum wurden die Mitglieder der königlichen Familie in Form von Tieren dargestellt? Was könnte der Künstler mit dieser Darstellung kritisieren oder ausdrücken wollen?
d) Analysiere die Bedeutung der Darstellung der königlichen Familie als Schweine! Erläutere, wie diese Darstellung nicht nur Kritik, sondern auch eine bewusste Entmenschlichung symbolisieren könnte!
e) Welche Wirkungen könnte diese Tierdarstellung auf die Wahrnehmung des Publikums gehabt haben?
M4 HISTORIENMALEREI ENTSCHLÜSSELN
Historienbilder sind Darstellungen der Vergangenheit, die einen außergewöhnlichen Moment oder eine bedeutende Persönlichkeit zeigen. Sie sind keine realistische Darstellung eines vergangenen Geschehens, sondern dienen der Verherrlichung einer Person oder eines Ereignisses. Ein wichtiges Kennzeichen der Historienmalerei ist, dass die dargestellten
1. SCHRITT: Informationen suchen
Hauptpersonen namentlich bekannt sind. Sehr häufig wurden diese großformatigen Gemälde von den Herrschenden in Auftrag gegeben.
Weil diese Gemälde keine getreue Abbildung der Ereignisse darstellen, ist es deine Aufgabe, diese zu dekonstruieren. Wie dies geht, zeigen dir die folgenden Arbeitsschritte.
Finde heraus, welche Informationen dir zu dem Gemälde zur Verfügung stehen!
Fließtext im Buch
Bildlegende
2. SCHRITT: Beschreibung des Gemäldes
3. SCHRITT: Analyse des Gemäldes
Kläre folgende Fragen!
Verlag
Informationstext Internet
Betrachte das Bild genau und beschreibe es anhand folgender Fragestellungen! Welche Personen und/oder Handlungen sind auf dem Bild zu sehen? Was fällt auf? Gibt es einen Bildtitel? Wie werden die Personen oder Szenen dargestellt? Was steht im Zentrum des Bildes? Welche Herrschaftssymbole verwendet die Künstlerin oder der Künstler?
Wie sind der Aufbau und die Gliederung des Bildes? Wie ist die Herrscherin bzw. der Herrscher auf dem Gemälde platziert? Welche Farben setzte die Künstlerin oder der Künstler ein und welche Wirkung wird damit erzielt? Haben Künstlerin/Künstler und dargestellte Person zur gleichen Zeit gelebt? Was wird betont, was wird verschwiegen? Welche Symbole werden verwendet?
4. SCHRITT: Deutung und Bewertung
Nimm eine abschließende Interpretation des Bildes vor!
Aus welcher Zeit stammt das Gemälde? Welche Wirkung will die Malerin bzw. der Maler bei der Betrachterin bzw. dem Betrachter erreichen? Welches Publikum soll angesprochen werden? Wer war der Auftraggeber des Bildes? Welche Absicht hatte diese oder dieser? An wen richtet sich das Gemälde und welche Botschaft wird vermittelt? Welche Bewertungen werden in dem Bild vorgenommen? Was scheint am wichtigsten zu sein? Wie wirkt das Gemälde auf dich?
Entschlüssle den Bildausschnitt in deinem Heft!

Die Krönung Napoleons zum Kaiser der Franzosen fand am 2. September 1804 in Notre Dame statt. Nach dem Vorbild Karls des Großen bestand Napoleon auf einer Krönung durch den Papst. Bei der Krönungszeremonie nahm Napoleon aber dem Papst die Krone aus der Hand und setzte sie sich selbst aufs Haupt. Anschließend tauschte er sie gegen einen goldenen Lorbeerkranz und krönte seine Gattin Josephine. Napoleons Mutter war bei der Krönung nicht anwesend. Auf Anordnung Napoleons musste der Maler sie trotzdem in das Krönungsgemälde einfügen. Das Gemälde wurde im Auftrag Napoleons I. vom französischen Maler Jacques-Louis David gemalt.


3. FRANKREICH WIRD KAISERREICH
Nach der Niederschlagung eines Aufstandes von Anhängerinnen und Anhängern der Monarchie in Paris stieg der erst 26-jährige General Napoleon Bonaparte 1796 zum Oberbefehlshaber über die Italienarmee auf. Seine Siege machten ihn beim Volk immer beliebter. 1799 unternahm Napoleon einen Staatsstreich und stürzte das Direktorium. Er regierte ab nun als Erster Konsul im Staat. 1804 ließ er sich zum Kaiser der Franzosen krönen.


Staatsstreich, der: gewaltsamer Umsturz
Verlag
Abb. 1: Die Krönung Napoleons (Ausschnitt des Ölgemäldes von Jacques Louis David, 1806, Louvre, Paris)
Der neue französische Kaiser regierte fast absolut, indem er seine Gegner durch Spitzel überwachen ließ, die Polizei kontrollierte und von ihm abhängige Beamte ernannte.
Der Staat wird umgestaltet
Napoleon wollte Frankreich in einen modernen Staat umwandeln. So blieben gewisse Errungenschaften aus der Revolution bestehen und wurden erstmals in einem Gesetzesbuch zusammengefasst. Dieser Code Civil diente als Vorlage für fast alle europäischen Gesetzeswerke. Auch unser „Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch“ (ABGB) leitet sich vom Code Civil ab.
Unter Napoleon wurde ein einheitliches Schulsystem für alle Schülerinnen und Schüler eingeführt. Formal war dieses Schulsystem für alle gleich, aber die Inhalte und Bildungswege waren für Jungen und Mädchen unterschiedlich.
Abb. 2: Beurteile, wie sich der Unterricht verändert, wenn fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler ihre Mitschüler unterrichten! Gehe dabei auf mögliche Vorteile und Nachteile ein!
Bewerte die möglichen Vorteile und Nachteile dieses Systems! Vergleiche die dargestellte Unterrichtssituation auf dem Bild mit deinem eigenen Unterricht!
Beschreibe, ob und wie es heute vorkommt, dass Schülerinnen und Schüler anderen etwas beibringen, und reflektiere, wie du dieses Vorgehen empfindest!
Konsulat, das: Napoleon hatte als Erster Konsul die Alleinherrschaft
Abb. 1: Napoleon verlangte vom Papst die Salbung und Segnung. Die Krone setzte er sich und seiner Frau jedoch selbst auf das Haupt. Interpretiere Napoleons Verhalten bei der Krönung, insbesondere die Selbstkrönung! Notiere deine Überlegungen schriftlich und tausche dich in einer Kleingruppe aus! Diskutiert, welche verschiedenen Interpretationen seines Verhaltens möglich sind!
Erläutere, welche Botschaft oder Bedeutung er mit diesem Vorgehen vermitteln wollte!
Stellt eure Ergebnisse der Klasse vor und diskutiert, ob Napoleons Selbstkrönung als Zeichen von Stärke, Unabhängigkeit oder Selbstüberschätzung gedeutet werden kann!
Spitzel, der: jemand, der Informationen sammelt und weitergibt
Leitgedanken des Code Civil

• Vor dem Gesetz sind alle gleich.
• Jeder hat das Recht auf Eigentum.
• Jeder ist persönlich frei.
• Jeder hat das Recht, seinen Wohnsitz frei zu wählen.
• Die Religion hat keinen Einfluss mehr auf die Rechtsprechung.
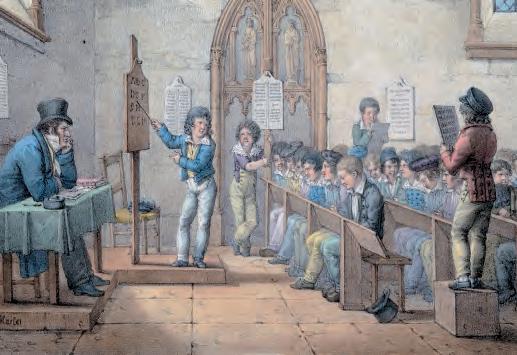
Abb. 2: Fortgeschrittene Schüler unterrichten ihre Mitschüler (kolorierte Lithographie von Jean Henri Marlet, 1821, Nationalbibliothek, Paris)
Nordsee
Kgr. GROSSBRITANNIEN und IRLAND
Atlantischer
Ozean
Kgr. PORTUGAL
Kgr. SPANIEN
Kaiserreich FRANKREICH
Herrschaft über Europa

Mittelmeer
Kgr. NORWEGEN

K1: Einflussgebiet des Kaiserreichs Frankreich um 1812
K1: Fasse die Aussage der Karte in einem Satz zusammen!
Bearbeite die Karte mit der Methode „Geschichtskarten auswerten“ aus der 2. Klasse!
Nenne drei Gründe, weshalb den Franzosen der Sieg über Großbritannien nicht gelang!
Stellt in Partnerarbeit dar, wie sich die Verbannungen Napoleons auf Elba und St. Helena voneinander unterscheiden, und diskutiert, ob diese Maßnahmen die richtigen Konsequenzen für sein Handeln waren!
Kgr. DÄNEMARK
Kgr. HOLLAND
Kgr. BAYERN Kgr. WESTFALEN
RHEIN BUND
SCHWEIZ Kgr. ITALIEN
Kgr. NEAPEL
Kgr. SCHWEDEN
Ostsee
Kgr. PREUSSEN
Ghzm. WARSCHAU
Kaiserreich ÖSTERREICH
IllyrischeProv.
Osmanisches Reich
Kaiserreich RUSSLAND
Schwarzes Meer
Von 1804 bis 1809 gab es ununterbrochen Kriege in Italien, Preußen, Österreich und Spanien. Die eroberten Gebiete teilte Napoleon unter seinen Geschwistern und Freunden auf, die damit ebenfalls zu Monarchen aufstiegen. Nachdem es den französischen Truppen aber nicht gelang, Großbritannien zu besiegen, verhängte der Kaiser eine Kontinentalsperre. Waren aus Großbritannien durften nicht mehr auf dem Kontinent verkauft werden.
SIZILIEN
verbannen: jemanden des Landes verweisen
Frankreich 1804 französische Eroberungen bis 1812 von Verwandten Napoleons regierte Länder von Frankreich abhängige Staaten Frankreich und seine Verbündeten

Verlag
1805: Französische Truppen besiegten Österreich und Russland in der Schlacht bei Austerlitz und besetzten Wien.
1806: Unter Napoleons Druck gründeten die deutschen Reichsfürsten den Rheinbund, woraufhin Kaiser Franz II., der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die römische Kaiserwürde niederlegte und die Auflösung des Reiches bekannt gab. Bereits seit 1804 war er als Franz I. Kaiser des neu gegründeten Kaiserreichs Österreich.
1809: Österreich begann neuerlich einen Krieg gegen Frankreich. Bei Aspern (heute ein Stadtteil von Wien) erlitten die französischen Truppen unter der Führung Napoleons ihre erste Niederlage, blieben jedoch in der Folge siegreich. Nach dem Friedensschluss mit Österreich heiratete Napoleon Marie Louise, die Tochter von Kaiser Franz I.
Der Russlandfeldzug führt zum Ende des Kaiserreiches
1812: Napoleon griff Russland mit einer „Großen Armee“ an, die aus über 400.000 Soldaten bestand. Diese Armee war jedoch nicht nur aus Franzosen zusammengesetzt, sondern auch aus Soldaten aus vielen anderen Ländern, die unter seiner Kontrolle standen. Bevor die französische Armee Moskau erreichte, brannten die Russen die Stadt nieder, damit die Franzosen dort keinen Unterschlupf für den Winter finden konnten. Als Napoleons Armee sich schließlich zurückzog, wurden die Soldaten von einem extrem harten Winter überrascht. Viele starben an Hunger, Kälte oder wurden von russischen Truppen angegriffen. Nur wenige Tausend Soldaten überlebten und kehrten nach Hause zurück. Diese Kriege, die Napoleon führte, brachten große Zerstörung über viele Länder Europas und kosteten unzählige Menschenleben.
1813: Russland, England, Österreich, Preußen und andere europäische Staaten verbündeten sich gegen Frankreich und besiegten dieses in der Völkerschlacht bei Leipzig. Napoleon musste abdanken und wurde auf die Insel Elba verbannt
1814: Napoleon gelang die Flucht. Er kehrte nach Frankreich zurück und erlangte für 100 Tage erneut die Herrschaft.
1815: Nach seiner endgültigen Niederlage in der Schlacht von Waterloo wurde Napoleon auf die Insel St. Helena verbannt, wo er 1821 starb.
4. DIE NEUORDNUNG EUROPAS
Der Wiener Kongress
Nach dem Sturz Napoleons musste Europa neu geordnet werden. Auf dem 1814/1815 in Wien stattfindenden Kongress versuchten die Großmächte, die poltische Ordnung – so wie vor der Französischen Revolution – so gut wie möglich wiederherzustellen.
Um das Gleichgewicht der Mächte wiederherzustellen, mussten die Grenzen in Europa zum Teil neu gezogen werden. So beanspruchte Russland ganz Polen, Preußen ganz Sachsen. Österreich hingegen strebte ein geeintes Mitteleuropa unter seiner Führung an. Jeder der teilnehmenden Staaten wollte möglichst viel Macht für sich gewinnen.

Beschlüsse des Wiener Kongresses – 1815
2 In ihren Staaten wollten die Fürsten die absolute Herrschaft wiederherstellen. Diese Bemühungen nannte man Restauration
2 Neue Grenzen wurden willkürlich festgelegt. Das politische Gleichgewicht zwischen den fünf Großmächten – Großbritannien, Frankreich, Österreich, Preußen und Russland – sollte den Frieden sichern.
2 Die 39 deutschen Staaten blieben unabhängig. Sie waren im Deutschen Bund, der unter der Führung Österreichs stand, locker zusammengefasst.
2 Wo es möglich war, sollten die legitimen Herrscherhäuser wieder eingesetzt werden.
Verlag
2 Österreich, Preußen und Russland gründeten die Heilige Allianz, um revolutionäre Bewegungen in Zukunft zu unterdrücken.
Abb. 1: wesentliche Beschlüsse des Wiener Kongresses
Die Wünsche der Völker nach Freiheit oder auch nach nationaler Einigung wurden dabei nicht berücksichtigt.

Abb. 1: Erklärt in der Gruppe, warum der Bund „Heilige Allianz“ genannt wurde!
Sammelt Ideen, was das Wort „heilig“ für die Bedeutung des Bündnisses aussagt! Fasst eure Ergebnisse zusammen und stellt sie kurz der Klasse vor!
Allianz, die: Bündnis

K1: Fasse zusammen, welche Veränderungen der Grenzen Europas auf dem Wiener Kongress beschlossen wurden!
Nimm zu den möglichen nationalen und internationalen Auswirkungen der neuen staatlichen Gebilde Stellung!
K1: Europa nach dem Wiener Kongress (1815)
Grenze des Deutschen Bundes 1815
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies diesen Schulbuchtext zuerst aufmerksam durch! Dann nimm Stellung zu den getroffenen Aussagen und begründe deine Einschätzung!
Der Aufstieg Napoleons



Napoleon wurde 1769 als Sohn eines Adeligen in Ajaccio auf Korsika geboren und durchlief von 1779 bis 1789 die französische Offiziersausbildung. [...] Als Hauptmann war er am 10. August 1792 beim Sturm auf die Tuilerien dabei. [...] Als Mann der Revolution und dann im Dienste des Direktoriums stieg er in der Armee auf. In Italien errang er gegen die dort herrschenden Österreicher entscheidende militärische Erfolge. Weniger erfolgreich war er 1798 bei seinem Feldzug in Ägypten, der den Engländern den Weg nach Indien abschneiden sollte. Eigentlich war es sogar Fahnenflucht, als er 1799 ohne Auftrag Ägypten verließ.
Doch das Direktorium in Paris unternahm nichts gegen ihn. Es konnte wohl auch nichts unternehmen, denn die Macht lag bei der Armee – und die stand hinter Napoleon. Mit ihrer Hilfe stürzte er im November 1799 das Direktorium und jagte das Parlament auseinander.
Der Ausbau der Alleinherrschaft
Nach seinem geglückten Staatsstreich wurde Napoleon von der Bevölkerung begeistert empfangen. Man hoffte, dass er dem Land endlich Ruhe bringen würde. Als „Retter der Nation“ gefeiert, nutzte er diese Stimmung aus, um zügig eine Alleinherrschaft aufzubauen.
Verlag
Noch 1799 trat eine neue Verfassung in Kraft, die an die Staatsspitze drei Konsuln stellte, von denen der erste – Napoleon – über die meiste Macht verfügte. [...]
Gestützt auf seine militärischen Erfolge ließ er durch ein Plebiszit 1802 sein Konsulat auf Lebenszeit verlängern. Und 1804 hatten die Franzosen wieder einen Monarchen: In der Kirche Notre-Dame krönte sich Napoleon im Beisein des Papstes selbst zum Kaiser. Welch eine Wende! 1793 noch die Hinrichtung Ludwigs XVI. – elf Jahre später eine prunkvolle Kaiserkrönung.
Aus: Günther-Arndt, Hilke; Kocka, Jürgen (Hg.): Geschichtsbuch 2, Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Dokumenten. Von der Renaissance bis 1849., Berlin (1997), S. 139f.
Tuilerien, die: Stadtschloss der französischen Herrscher in Paris
Plebiszit, das: Volksabstimmung
richtig falsch
Der Aufstieg Napoleons zum Kaiser Frankreichs ist in der richtigen zeitlichen Reihenfolge dargestellt.
Begründung:
Napoleons Aufstieg zum Herrscher Frankreichs wird subjektiv dargestellt, d.h. wir erfahren nur von seinen Erfolgen.
Begründung:
Rollenspiel – Veranstaltet einen Friedenskongress zu einem Streitfall, den es in eurer Klasse gegeben hat bzw. gibt!
Analysiert auch anschließend eure Diskussionsführung!
• Wie verhalten sich die einzelnen Beteiligten dabei?
• Welche Forderungen stellen sie und zu welchem Zeitpunkt geschieht dies?
• Unter welchen Umständen gibt jemand nach?
subjektiv: voreingenommen, unsachlich
Analysiere diese Rede, indem du die folgenden Aspekte markierst!
Napoleons Meinung über die Republik seine Meinung über die Bedürfnisse des Volkes Ziele Napoleons
Q1: Gespräch mit einem französischen Gesandten – Toskana 1. Juni 1797
Glauben Sie vielleicht, daß ich eine Republik begründen will? Welcher Gedanke! [...] Das ist eine Wahnvorstellung, in die die Franzosen vernarrt sind, die aber auch wie so manche andere vergehen wird. Was sie brauchen, ist Ruhm, die Befriedigung ihrer Eitelkeit, aber von der Freiheit verstehen sie nichts. Blicken Sie auf die Armee! Die Erfolge und Triumphe, die wir soeben davongetragen haben, die haben den wahren Charakter des französischen Soldaten hervortreten lassen. Für ihn bin ich alles. Das Direktorium soll es sich nur einfallen lassen, mir das Kommando über die Armee abzunehmen! Dann wird man sehen, wer der Herr ist. Die Nation braucht einen Führer [...], aber keine Theorien über Regierung, keine großen Worte, keine Reden von Ideologien, die die Franzosen nicht verstehen.
Aus: Görtemaker, Manfred: Deutschland im 19. Jahrhundert. Opladen (1983), S. 44.
Erstelle eine kurze Charakteristik Napoleons in deinem Heft! Gehe dabei auf die von dir in Q1 herausgearbeiteten Aspekte ein!
Vergleiche Abb. 2 und Abb. 3, indem du die vermittelten „Bilder“ über Napoleon herausarbeitest! Beachte dabei auch die Entstehungsjahre der beiden Gemälde!

Abb. 2: Napoleon beim Übergang über die Alpen (Ölgemälde von JacquesLouis David, 1800/1801, Schloss Malmaison, Frankreich)
Abb. 3: Bonaparte überquert die Alpen (Ölgemälde von Paul Delaroche, 1848, Louvre, Paris)

Das Rösselsprung-Quiz: Entdecke einen berühmten Ausspruch über den Wiener Kongress! Beginne mit dem orangen Feld mit der Schrift! Von diesem Feld springst du wie die Springer-Figur beim Schach: zwei Felder in eine Richtung (zum Beispiel zwei Felder nach oben oder unten) und dann ein Feld im rechten Winkel dazu (zum Beispiel ein Feld nach links oder rechts)! Folge dieser Sprungregel, um nach und nach die Wörter des Ausspruchs zu finden!
Ein Beispiel: Wenn du auf einem Feld in der Mitte startest, kannst du:
• Zwei Felder nach oben und ein Feld nach rechts springen oder
• Zwei Felder nach rechts und ein Feld nach unten springen.
FEL ICH NICHT HIM DIE SCHIERT TEU DER WIE AN DEM KEN SO MEL ER DEN
MAR HÖL KON PAKT AUCH SCHLIES
BER MIT ES MUSS SO TANZT
LE GRESS DER EI SE Lösungssatz:


5. DIE ZEIT DES VORMÄRZ
Vormärz in Österreich – Das „System Metternich“

Abb. 1: Porträt von Klemens Wenzel von Metternich (Gemälde von Thomas Lawrence, 1820, KHM)
System, das: Ordnung, Regierungsform
Naderer, der: Spitzel, Denunziant
Vormärz wird die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1814/15 und dem Ausbruch der Revolution im März 1848 genannt. Wie fast alle europäischen Staaten wurde auch Österreich im Vormärz absolut regiert. Die politische Ordnung, die vor der Französischen Revolution bestanden hatte, war wiederhergestellt worden.
Staatskanzler Metternich vertrat die Meinung, dass die Bürgerinnen und Bürger sich zwar wirtschaftlich betätigen sollten, aber nicht politisch. Metternich wurde damit in Österreich zu einem Symbol der Unterdrückung. Die Bürgerinnen und Bürger sprachen vom „System Metternich“.
Die Bürgerinnen und Bürger verlangten jedoch immer stärker mehr Freiheit und das Recht auf politische Mitbestimmung. Auf Betreiben Metternichs wurden zwischen österreichischen und preußischen Politikern die Karlsbader Beschlüsse vereinbart. Sie besagten, dass in allen Ländern des Deutschen Bundes Forderungen nach Freiheit und politischer Mitbestimmung mit Gewalt unterdrückt werden müssten.
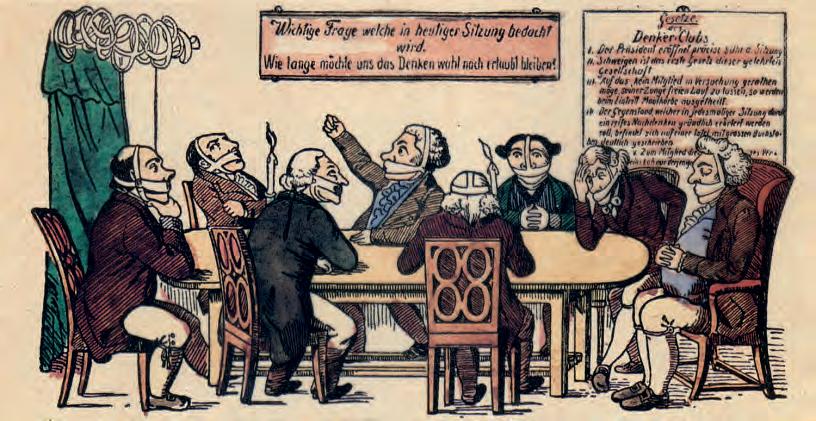
Verlag
Um eine Verbreitung neuer politischer Ideen zu verhindern, unterlagen alle Bücher und Zeitungen der Zensur. Dies bedeutete, sie wurden vor dem Druck von Beamten gelesen und Stellen, die der Regierung unangenehm waren, wurden gestrichen. Sogar private Briefe überprüfte die Zensurbehörde. Metternich ließ aber auch politisch verdächtige Bürgerinnen und Bürger überwachen. Sogenannte „Naderer“ saßen in den Gast- und Kaffeehäusern, belauschten die Gespräche der Bürgerinnen und Bürger und tätigten Anzeigen bei der Polizei.
Abb. 2: Der „Denker-Club“, Karikatur auf die Unterdrückung der Meinungs– und Pressefreiheit durch die Karlsbader Beschlüsse (kolorierte Radierung, 1825)
Abb. 1: Staatskanzler Metternich wurde auch „Kutscher Europas“ genannt! Erläutere, was damit gemeint sein könnte!
Q1: Beschreibe, welche Auswirkungen die Karlsbader Beschlüsse auf kritische Lehrer hatten!
Erkläre, wie diese Beschlüsse das Verhalten und die Arbeit von Lehrern beeinflussten, die sich kritisch gegenüber der Regierung äußerten! Formuliere deine Gedanken in Stichworten!
Beschreibt in der Klasse, wie sich die Beschlüsse auf das Bildungssystem und die Meinungsfreiheit ausgewirkt haben! Sammelt Beispiele für Einschränkungen und haltet sie gemeinsam an der Tafel oder auf einem Plakat fest!
Abb. 2: Formuliere drei Fragen zu dieser Karikatur und stelle sie deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn!
Q1: aus den Karlsbader Beschlüssen, 1819
Die Bundesregierungen verpflichten sich [...] Universitäts- und andere Lehrer, die [...] durch Verbreitung verderblicher, der öffentlichen Ordnung und Ruhe feindseliger oder die Grundlagen der bestehenden Staatseinrichtungen untergrabender Lehren ihre Unfähigkeit [...] an den Tag gelegt haben, von den Universitäten oder sonstigen Lehranstalten zu entfernen [...] [...] dürfen Schriften, die in der Form täglicher Blätter oder heftweise erscheinen, [...], in keinem deutschen Bundesstaate ohne Vorwissen [...] der Landesbehörden zum Druck befördert werden.
Aus: Majer, Diemut; Hunziker, Margarete: Juris Fontes – Rechtsquellen in Vergangenheit und Gegenwart. Verfassungsstrukturen, Freiheits- und Gleichheitsrechte in Europa seit 1789. Karlsruhe (2009), S. 267.
BONUS-SEITE DIE KULTUR DES BIEDERMEIERS
Aufgrund der Politik des Vormärz und der Zensur, welche die Menschen überall überwachte, zogen sich die reichen Bürgerinnen und Bürger ins Privatleben zurück. Dichtkunst, Malerei und Musik pflegte man im Privaten. Die Menschen wollten ihr Leben im Kreis der Familie und mit Freunden reicher und erfüllter gestalten.
Wohn- und Arbeitsplatz waren nun getrennt. Dadurch entstand im Wohnbereich ein neuer Wohnraum, der Salon, in dem man Gäste empfing.
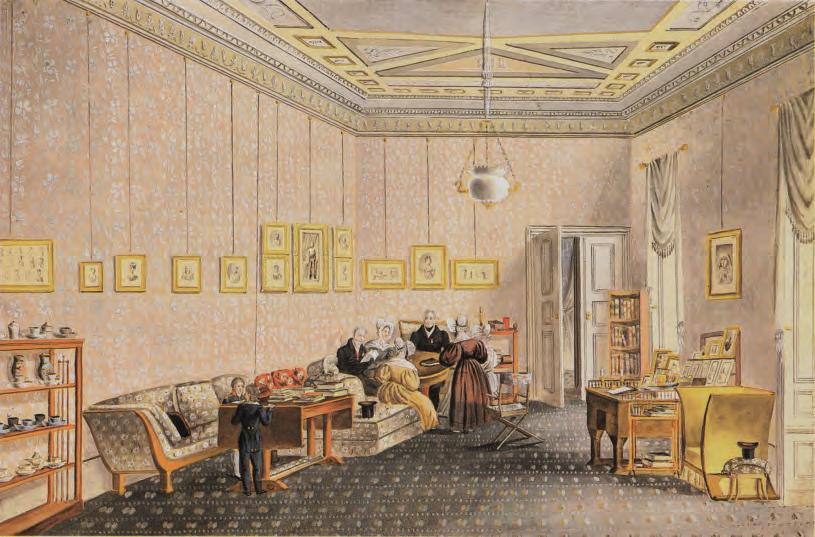
Nach und nach brachte es das Bürgertum zu einem gewissen Wohlstand. Das Bürgertum stieg im Biedermeier zum Träger der Kultur auf.

Die Bürgerinnen und Bürger entwickelten auch eine eigene Mode. Neu war in der Frauenmode die Wespentaille, die durch das Tragen eines engen Korsetts erreicht wurde. Eine absolute Notwendigkeit waren auch der Hut sowie das Tragen von Schals, Schirmen, Handschuhen und Fächern. Die Herren trugen erstmals lange Hosen, einen hohen Kragen – den sogenannten „Vatermörder“ – und einen Zylinder
Abb. 3: Mode des Biedermeiers
Im Biedermeier blühten Kunst und Kultur auf. Der Wiener Walzer war der Modetanz des Biedermeiers. Bedeutende Walzerkomponisten wie Johann Strauß und Joseph Lanner füllten die Ballsäle. Weitere wichtige Musiker jener Zeit waren Ludwig van Beethoven und Franz Schubert.

Olympe Verlag
Wichtige Vertreter der Literatur waren im Biedermeier Franz Grillparzer, Johann Nestroy und Ferdinand Raimund. Zu den bekanntesten Malern zählten Carl Spitzweg und Ferdinand Waldmüller.
Biedermeiermöbel

Biedermeiermöbel waren einfacher gearbeitet als die Möbel in den Adelspalästen.
Abb. 1: Schreibe einen kurzen Text, in dem du erklärst, wie das Leben einer bürgerlichen Familie im 19. Jahrhundert ausgesehen haben könnte! Beschreibe dazu die Personen, den Raum, die Einrichtung und was die Menschen auf dem Bild machen! Gib deinem Text eine passende Überschrift!
Beschreibe die Anordnung der Möbelstücke und interpretiere, welche Alltagsszene hier dargestellt sein könnte!
Reflektiere in der Klasse, wie Darstellungen des Alltags Einblicke in vergangene Lebensweisen geben können!
Korsett, das: eng geschnürtes Mieder


Zylinder, der: ein hoher Hut
Formuliere drei Fragen, die du einer Person aus der Biedermeier-Zeit zu den Themen Mode, Tanz oder Kultur stellen würdest! Stellt euch vor, ihr lebt als Jugendliche im Biedermeier! Entwickelt in Gruppen eine kurze Szene, in der ihr zeigt, wie ihr über Politik, Schule oder eure Zukunft denkt – trotz politischer Unterdrückung!
6. EUROPA BRENNT
Nationalismus

Nationalismus bedeutet, dass Menschen sich als Teil eines Volkes fühlen, das durch eine gemeinsame Sprache, Kultur oder Geschichte verbunden ist. Oft wollten sie, dass ihr Volk ein eigenes Land hat, anstatt von fremden Herrscherinnen und Herrschern regiert zu werden. Nationalismus hat aber auch negative Seiten. Er kann dazu führen, dass andere Völker ausgeschlossen, abgewertet oder unfair behandelt werden. In der Geschichte hat dies oft zu Konflikten und Gewalt geführt, weil Herrscherinnen und Herrscher ihre Macht behalten wollten und viele Menschen keine Rücksicht auf andere Gruppen nahmen.
K1: Fasse die wesentlichen Ziele des Nationalismus anhand der Karte und des Fließtextes mit eigenen Worten zusammen Nationalismus, der: übersteigertes Nationalgefühl
Revolutionen im Vormärz
In verschiedenen europäischen Staaten brachen nach 1815 Aufstände gegen die Herrschenden aus. Die Bevölkerung forderte Freiheit, politische Mitbestimmung und immer öfter auch die Unabhängigkeit ihres Volkes. Dies nennt man nationalistische Bestrebungen
Belgien (1830)
10 Revolution in Venedig
11 Aufstand in Moldau
12 Pfälzer Aufstand
13 Dresdner Aufstand
14 Revolution in Siebenbürgen
15 Prager Aufstand
16 Aufstand in der Walachei
17 Aufstand in Rom
Verlag
1 Revolution in Palermo
2 Revolution in Paris
3 Badische Revolution
4 Münchner Aufstand
5 Revolution in Wien
6 Revolution in Buda und Pest
7 Revolution in Berlin
8 Revolution in Mailand
9 Großpolnischer Aufstand

Griechenland


Abb. 1: Straßenschlacht vor dem Rathaus in Paris (Ölgemälde von Jean Victor Schnetz, 1830, Museum im Kleinen Palast, Paris)
Bourbonen, die: französische Herrscherdynastie
Abb. 1: Beschreibe, welche Symbole im Bild zu sehen sind (z. B. Fahnen, Kleidung, Waffen, Gesten)! Erkläre, was diese Symbole über die Revolution und den Kampf der Menschen aussagen könnten! Notiere deine Ergebnisse in kurzen Stichpunkten oder in einem kurzen Text!
Formuliere in einem Satz die Aussage dieses Gemäldes!
Vergleicht in Partnerarbeit heutige Proteste oder Demonstrationen mit der Darstellung auf dem Gemälde und arbeite Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus!
K1: Europa brennt – Zentren der Revolutionen (1821 – 1848)
1821: In Europa erhoben sich die Griechen gegen die osmanische Fremdherrschaft. Das Königreich Griechenland wurde 1829 zum ersten unabhängigen Balkanstaat.
1830: Die Belgier lösten sich in einer Revolution von den Niederlanden und gründeten das Königreich Belgien.
1830: Die sogenannte Julirevolution brachte den endgültigen Sturz der Bourbonen in Frankreich. Das Bürgertum übernahm die Macht. Ein entfernter Verwandter des Königs, Louis Philippe von Orleans, genannt der Bürgerkönig, wurde zum König ernannt.
Revolutionsbewegungen 1848/1849
Aufgrund von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Spannungen kam es in verschiedenen europäischen Ländern zu gewaltsamen Erhebungen gegen das „System Metternich“.
... in Frankreich
Im Februar 1848 kam es in Frankreich neuerlich zu einer Revolution der Bürgerinnen und Bürger und Arbeiterinnen und Arbeiter. Frankreich wurde Republik. Zum Präsidenten der Republik wählte man einen Neffen Kaiser Napoleons. Dieser unternahm wenig später einen Staatsstreich und regierte als Kaiser Napoleon III. bis 1870 absolut.
Nationale und liberale Ideen lösten die Revolution von 1848 in Österreich aus. So verlangten die Ungarn einen eigenen Staat, die Deutschösterreicher wollten eine Verfassung und die Italiener forderten einen Anschluss an das Königreich Sardinien-Piemont.
13. März 1848: Die Forderungen nach einer konstitutionellen Umwandlung der Monarchie sowie einer Verfassung für die österreichischen Länder führten in Wien zum Ausbruch der Revolution. Das Militär erhielt von Kaiser Ferdinand I. den Befehl, gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorzugehen und die Herrengasse zu räumen. Dabei fielen die ersten Schüsse. Aus Demonstranten wurden Revolutionäre. Ein Bürgerausschuss übernahm am selben Tag die Regierungsgewalt, Staatskanzler Metternich dankte ab und floh nach England. Die Zensur wurde abgeschafft und Kaiser Ferdinand I. ließ eine Verfassung ausarbeiten, die dem Kaiser oberste Gewalt gab.

Mai 1848: Da Arbeiter, Studenten und Bürger die Märzverfassung als undemokratisch ansahen, kam es erneut zu einem Ausbruch der Revolution in Wien. Kaiser Ferdinand I. floh mit dem kaiserlichen Hof heimlich nach Innsbruck. Überall im Reich kam es jetzt zu revolutionären Aufständen.
September 1848: Der Reichstag beschloss die Aufhebung der Grunduntertänigkeit. Alle bäuerlichen Abhängigkeitsverhältnisse, Abgaben und Frondienste und die grundherrschaftliche Gerichtsbarkeit wurden abgeschafft. Die Bauern wurden gegen Bezahlung einer Ablöse zu freien Eigentümern von Grund und Boden. Damit verloren aber die Bauern das Interesse an der Revolution.
Dezember 1848: Nach dem Rücktritt Kaiser Ferdinands I. bestieg sein Neffe Franz Joseph I. mit 18 Jahren den Thron. Mit Hilfe der Armee ließ er die Revolution niederschlagen. Die Siege der österreichischen Truppen unter Feldmarschall Radetzky beendeten schließlich auch die Erfolge der italienischen Revolutionäre in Mailand.
1849: Der Aufstand wurde in Ungarn mit Hilfe russischer Truppen beendet. Kaiser Franz Joseph und seine Regierung ließen 114 Führer der Revolution hinrichten. Die Revolution war gescheitert!
... in den Staaten des Deutschen Bundes
Auch in den deutschen Ländern kam es zu Aufständen und Volksversammlungen. Gefordert wurden von den deutschen Fürsten Presse- und Versammlungsfreiheit sowie Reformen des Wahlrechts und die Umwandlung des Deutschen Bundes in einen Nationalstaat. Am 18. Mai 1848 trat eine deutsche Nationalversammlung in Frankfurt am Main in der Paulskirche zum ersten Mal zusammen, um eine Verfassung auszuarbeiten. Erzherzog Johann, der Bruder von Kaiser Franz I., wurde zum Reichsverweser gewählt. 1849 bot aber die Nationalversammlung dem König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., die Deutsche Kaiserkrone an. Doch dieser sah sich als Herrscher von Gottes Gnaden und lehnte ab. Die Revolution wurde mit Gewalt niedergeschlagen!
liberal: freiheitlich, nach Freiheit strebend
Deutschösterreicher, die: deutschsprachige Österreicher
Olympe Verlag
Abb. 2: Schüsse in der Herrengasse am 13. 3. 1848 (kolorierte Lithografie von J. Albrecht, 1850, Wien Museum)
Abb. 2: Benenne die Bilddetails, die für dich den Begriff „Revolution“ zum Ausdruck bringen!
Analysiere, welche Stimmung das Bild durch die Darstellung der Menschen und die verwendeten Farben vermittelt! Vergleiche deine Ergebnisse mit einer Partnerin/einem Partner!
Besprecht die Gründe, welche zur Revolution 1848 in Österreich führten! Diskutiert anschließend, ob und unter welchen Bedingungen es nochmals zu einer „Revolution“ in Österreich kommen könnte! Reichstag, der: erste Volksvertretung nach der Revolution; Parlament
grundherrschaftliche Gerichtsbarkeit, die: Der Grundherr ist gleichzeitig auch Richter für seine Bauern.
Reichsverweser, der: ehrenamtliches Oberhaupt des Reichsministeriums
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Beschreibe, mit welchen Mitteln die Wiener Studenten 1848 gegen die herrschenden Politiker demonstrierten!
Q1: Carl, Techniker und akademischer Legionär, berichtet
Also fielen alle Studenten in diesen Chor ein. Nachdem wir mehrmals hintereinander ein Studentenlied vor des Grafen Haus [Anm.: Haus des Grafen Ficquelmont, österr. Ministerpräsident vom 4. April bis zum 4. Mai 1848] aufgeführt, setzte die Katzenmusik ungeheuerlich stark ein. Verstummten die Hölleninstrumente, so folgte ein zermürbendes Miauen, Kreischen, Quaken und Schnalzen, aber auch Hundegeheul durfte nicht fehlen.
Aus: Dörferning, Peter Frank: Die Donner der Revolution über Wien. Wien (1988), S. 69.
Erörtere den Sinn und die Wirkung dieser Form des Protests in einem Satz!
Lies dir die folgenden Kurzmeldungen aufmerksam durch und schreibe anschließend mit einer Partnerin oder einem Partner einen Leserbrief! In diesem sollt ihr die angegebenen Missstände aufzeigen und vom Verlauf der Revolution in Wien berichten!


Neulerchenfeld (Wien): In einer Fabrik wurden
1 500 Spinnereiarbeiter entlassen. Schuld daran ist eine drastische Erhöhung der Baumwollpreise. Die entlassenen Arbeiter und Arbeiterinnen plünderten am 10. Oktober 1847 die Bäckerläden in Wien.







Olympe Verlag



Chronik: Im Jahr 1845, 1846 und 1847 führten Missernten zu erheblichen Teuerungen der Grundnahrungsmittel in den Städten der Monarchie. So stieg z. B. der Weizenpreis von 3 Gulden Anfang 1845 auf das Dreifache an. Arbeiter, Gesellen und einfache Bürger waren am stärksten davon betroffen.


Wien: Die Herrengasse war am Montag, dem 13. März 1848, voller Menschen. Reden wurden gehalten, Pressefreiheit gefordert. Das Militär marschierte auf. Immer wieder kam es zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen den Truppen und den Demonstranten. Um 15:00 fielen die ersten Schüsse und es gab die ersten Toten. Tumult brach aus, alle Straßen füllten sich und in den Vorstädten kam es zu Plünderungen. Am Abend trat Staatskanzler Fürst Metternich zurück.




Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Erkläre anhand der Karikatur und des Informationstextes die Folgen für die Revolutionäre in den Ländern Preußen, Frankreich und Österreich in eigenen Worten!

Die Revolutionäre werden von Preußen in die Schweiz gekehrt und vom französischen Präsidenten Louis-Napoleon (Napoleon III.) nach Amerika verschifft. In England entwickelt sich unter Queen Victoria der Handel, in Dänemark triumphiert der König, während sich in Österreich das Volk vergeblich gegen das Feudalsystem auflehnt.
Verlag

Abb. 3: „Rundgemälde von Europa 1849“ – Niederlage der Revolutionen in Europa (Karikatur von Ferdinand Schröder, 1849, Düsseldorfer Monatshefte)
7. JÜDISCHES LEBEN IN ÖSTERREICH: ZWISCHEN REFORMEN UND VORURTEILEN
Diskriminierung, die: Benachteiligung und Schlechterstellung von Menschen aufgrund bestimmter Merkmale
tabu: verboten
Erstelle drei Fragen, die sich auf das tägliche Leben, die beruflichen Möglichkeiten und die religiösen Freiheiten eines Mitglieds der jüdischen Gemeinde im 19. Jahrhundert beziehen! Teile deine Fragen in einer Kleingruppe und vergleicht, welche Aspekte ihr alle berücksichtigt habt und welche zusätzlichen Fragen ergänzt werden könnten!
Diskutiert, warum bestimmte Themen besonders wichtig erscheinen!
Im 18. und 19. Jahrhundert spielte das jüdische Leben in Österreich eine bedeutende Rolle. Die jüdische Gemeinschaft hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft, obwohl sie oft mit Herausforderungen konfrontiert war.
Einerseits wurden im 18. Jahrhundert unter Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II. Reformen eingeführt, die die rechtliche Situation der Juden verbesserten. Die „Toleranzpatente“ von 1782 und 1789 ermöglichten den Juden eine gewisse rechtliche Gleichstellung und eröffneten ihnen neue Berufsfelder. Diese Maßnahmen trugen zur wirtschaftlichen Entwicklung vieler jüdischer Gemeinden bei.
Auf der anderen Seite waren Jüdinnen und Juden jedoch oft noch von gesellschaftlichen Vorurteilen und Diskriminierung betroffen. Viele waren auf bestimmte Wohnviertel, die sogenannten „Judenviertel“ beschränkt, und ihre Bewegungsfreiheit war begrenzt. Darüber hinaus galten bestimmte Berufe für Juden als tabu.

Abb. 1: „Juden-Tempel“ in der Leopoldstadt (Rudolf von Alt, 1860, Wien-Museum)
Der Leopoldstädter Tempel

Dieser wurde zwischen 1854 und 1858 in Wien Leopoldstadt erbaut und 1938 zerstört.
Liberalismus, der: eine politische Denkweise, die für wichtige Dinge wie gleiche Rechte, Freiheit und Sicherheit eintritt; jeder sollte vor dem Gesetz gleich sein
Antisemitismus, der: Feindschaft gegenüber dem Judentum
Verlag
Im 19. Jahrhundert setzte sich die rechtliche Entwicklung fort. Mit dem Oktoberpatent von 1860 unter Kaiser Franz Joseph I. wurden den Jüdinnen und Juden in Österreich weitreichende politische Rechte gewährt, darunter das Recht auf Freizügigkeit und die Möglichkeit, am politischen Leben teilzunehmen.
1867 wurde durch die Dezemberverfassung die Gleichstellung der Juden im Habsburgerreich vollendet. Erstmals in ihrer Geschichte war ihnen in ganz Österreich der ungehinderte Aufenthalt und die Religionsausübung gestattet. In der Folge wurden auch zahlreiche Synagogen erbaut. Diese Veränderungen führten zu einem verstärkten kulturellen und intellektuellen Austausch zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Gemeinschaften.
Dennoch blieben soziale Spannungen und Vorurteile bestehen. Die religiöse Vielfalt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, bestehend aus orthodoxen, reformierten und assimilierten Juden, führte zu internen Konflikten. Trotzdem trugen die jüdischen Gemeinden maßgeblich zur kulturellen und wirtschaftlichen Vielfalt Österreichs bei.
Einige wenige Familien wurden durch ihre Geschäfte in Banken, beim Bau von Eisenbahnen, in der Industrie und im Handel, besonders im Textilhandel, sehr wohlhabend. Die meisten jüdischen Menschen gehörten jedoch zum Kleinbürgertum.
Die meisten erfolgreichen Juden waren eher deutsch-liberal eingestellt. Kritik am Liberalismus vermischte sich jedoch mit starkem Antisemitismus. Dieser begann mit religiösen Argumenten und entwickelte sich später zu wirtschaftlich-sozialen Ansichten, wie sie Karl Lueger, der von 1897 bis 1910 Bürgermeister von Wien war, vertrat. Später gewann der Antisemitismus auch rassistische Züge, besonders durch Personen wie Georg von Schönerer.
Insgesamt war das jüdische Leben im 18. und 19. Jahrhundert in Österreich von einem Wechselspiel zwischen Fortschritt und Herausforderungen geprägt.
8. REVOLUTIONEN DES 20. JAHRHUNDERTS
Die russische Revolution
Zu Beginn des 20. Jh. war Russland seit über 400 Jahren von Zaren regiert worden. Die meisten ihrer Untertanen – hauptsächlich Bauern und Arbeiter – lebten in großer Armut. Gegner des Zaren forderten politische Veränderungen. Arbeiterstreiks und Bauernaufstände führten im Februar 1917 zur Revolution. Das neu eingesetzte Parlament (Duma) und die Armeeführung zwangen den letzten Zaren Nikolaus II. dazu, im März 1917 abzudanken.
Nach weiteren Revolutionen kamen die Bolschewiken im Oktober 1917 unter der Führung von Wladimir Iljitsch Lenin (1870 – 1924) gewaltsam an die Macht und errichteten eine „Diktatur des Proletariats“.
Die Oktoberrevolution begann unter dem allgemeinen Banner der Befreiung aus der Knechtschaft. […] Alles, was lebt und noch lebensfähig ist, wird aus den verhaßten Fesseln befreit. Es bleiben nur noch die Völker Rußlands, welche Unterdrückung und Mutwilligkeit erduldet haben […]
Aus: Altrichter, Helmut (Hg.): Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod.
Im Dezember 1917 schied Russland aus dem Ersten Weltkrieg aus. Zar Nikolaus II. und seine Familie wurden 1918 von den Bolschewiken ermordet.
Die
Volksrepublik China
Nach dem Zweiten Weltkrieg brach in China ein Bürgerkrieg aus. Die Nationale Volkspartei unter Chiang Kai-shek kämpfte gegen die Kommunisten unter Mao Tse-tung (1893 – 1976).
1949 nahmen die Kommunisten den Großteil des Landes ein und riefen die „Volksrepublik China“ aus. Ähnlich wie in anderen kommunistischen Ländern begann man auch in China mit der Verstaatlichung von Grund und Boden, sowie Industrieanlagen, Handelsbetrieben und Banken. Begleitet waren diese Veränderungen von brutaler politischer Unterdrückung. Politische Gegner und Andersdenkende wurden gefangen genommen, in Umerziehungsund Arbeitslager geschickt oder hingerichtet.
Der „Große Sprung nach
vorn“
1958 leitete Mao den „Großen Sprung nach vorn“ ein. Er wollte die wirtschaftliche Lage des Landes verbessern. Bisher selbstständige Bäuerinnen und Bauern hatten sich zu Volkskommunen zusammen zu schließen. Viele von ihnen mussten nun in Industriebetrieben arbeiten. In diesen Fabriken wurden große Mengen von Waren hergestellt, meist von schlechter Qualität.
Die Ergebnisse des „Großen Sprungs nach vorn“ waren wirtschaftlich verheerend. Ein großer Teil der Industrieprodukte wurde nicht gebraucht und die Volkskommunen produzierten zu wenig Nahrungsmittel. Ergebnis war die größte von Menschen ausgelöste Hungersnot der Geschichte. Die Jahre 1960 bis 1962 kosteten Millionen Chinesinnen und Chinesen das Leben.
Zar, der: Titel des Monarchen in Russland
Olympe Verlag

Abb. 1: Lenin spricht eine Rede auf ein Tonaufzeichnungsgerät im Moskauer Kreml (koloriertes Foto, 1919)
Bolschewiken, die: Gruppe innerhalb der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die eine radikale Veränderung der russischen Gesellschaft anstrebte
Q1: Die „Deklaration der Rechte der Völker Rußlands“ war eines der ersten Dokumente, welches die Bolschewiken nach ihrer Machtübernahme verabschiedeten.
Arbeite anhand der Deklaration der Bolschewiken heraus, wie diese die Situation der Menschen in Russland einschätzten! Notiere deine Ergebnisse und präsentiere sie in einer Kleingruppe!
Erstellt gemeinsam eine Übersicht der wichtigsten Punkte und diskutiert, wie realistisch die Einschätzungen der Bolschewiken waren!
Fasse in eigenen Worten zusammen, was in China nach 1949 unter Mao Tse-tung passierte!
Beurteile, welche Folgen der „Große Sprung nach vorn“ für die chinesische Bevölkerung hatte!
Reflektiere, wie die Menschen auf die neuen Regelungen reagiert haben könnten und welche Auswirkungen dies auf die Gesellschaft hatte!
Nenne die Ziele der Französischen Revolution und der Kulturrevolution in China!
Vergleiche die Ziele beider Revolutionen in einfachen Stichpunkten! Achte dabei auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede!
Beurteilt in der Gruppe, welche Ziele für die Menschen besonders wichtig waren!

2: Revolutionsposter aus der Zeit der Kulturrevolution (1966 – 1969)
Beschreibe, was das Ziel der Kulturrevolution war!
Beurteile anschließend in einfachen Worten, ob es dabei eher um Veränderungen oder um Machtsicherung ging!
Abb. 2 + 3 + 4: Vergleicht in Kleingruppen den Schulbuchtext mit den Abbildungen! Beschreibt, welche Stimmung die Bilder zeigen (z. B. fröhlich, streng, kämpferisch).
Sprecht in der Klasse darüber, ob die Stimmung auf den Bildern zum Schulbuchtext passt!
Die „Große Proletarische Kulturrevolution“
Um nach dem Scheitern des „Großen Sprunges“ seine Position wieder zu festigen, leitete Mao 1966 die „Große Proletarische Kulturrevolution“ ein. Diese richtete sich nicht nur gegen westliche Gedanken, sondern auch gegen traditionelle chinesische Denk- und Lebensweisen
Verlag
Mao rief die Jugend dazu auf, die ältere Generation – Gebildete, Lehrerinnen und Lehrer und auch Eltern – zu kritisieren. Mehr als eine Million Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten wurden bewaffnet, um in den „Roten Garden“ zu dienen.

Die Roten Garden versetzten das Land in Angst und Schrecken, bekämpften Maos Gegner und zerstörten jahrhundertealte Kulturgüter wie Tempel oder Kirchen. Viele Schulen und Universitäten blieben in dieser Zeit geschlossen. Erst 1969 beendete Mao selbst die Kulturrevolution durch den Einsatz der Armee.
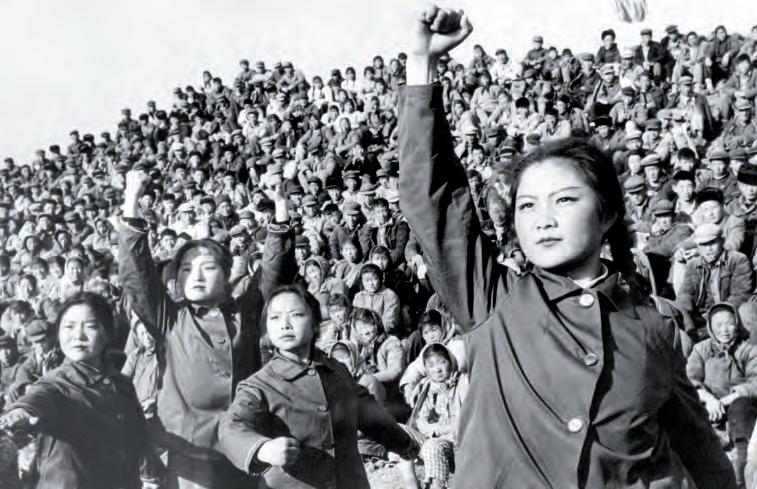
Vergleiche die Französische Revolution mit der Russischen Revolution, indem du die Begriffe in die Tabelle einträgst! Beachte dabei, dass es sich bei einigen Punkten um Ziele oder Vorstellungen der Revolutionen handelt, die nicht vollständig oder nachhaltig erreicht wurden.

Gleichheit ohne Freiheit © Parlamentarismus © vorübergehende Diktatur des Proletariats © aristokratisches System wird durch Revolution der Bürgerinnen und Bürger abgeschafft © sozialistische Gesellschaft © Zentralverwaltungswirtschaft © Menschenrechte © Ende von Aristokratie © Ende aller Gesellschaftsstufen © Staatseigentum © Garantie des Eigentums © Bürgerliche Gesellschaft ©

1 2
Erörtere anschließend gemeinsam mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn, welche der genannten Ideen in beiden Revolutionen erfolgreich umgesetzt wurden und welche nicht!
3 4 5
Begründet, warum manche Ziele nicht erreicht wurden und welche Faktoren dafür verantwortlich sein könnten!
Wenn Menschen unterdrückt werden, ist eine Revolution das einzig mögliche Mittel!“ Nimm Stellung zu diesem Satz in deinem Heft und begründe deine Argumentation!
Arbeite anhand der letzten Kapitel (S. 45 – 72) mindestens fünf Gründe heraus, die Auslöser für Revolutionen und Reformen sind!

Revolutionen:
Reformen:
So schätze ich mich nach dem Großkapitel „REVOLUTIONEN, WIDERSTAND, REFORMEN“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…Unterschiede zwischen Reform und Revolution benennen.
…über bedeutende Aufklärer berichten.
…die wichtigsten Reformen Maria Theresias und Josephs II. nennen.
…die Auswirkungen der Reformen Josephs II. auf verschiedene Bevölkerungsgruppen erklären.
…eine Karikatur mit Hilfe der Methode M3 deuten.
…Gründe für den Ausbruch der Französischen Revolution nennen und erläutern.
…über die Erklärung der Menschenrechte und deren Bedeutung reflektieren.
…mit Hilfe der Methode M4 Historienmalereien entschlüsseln.
…die Beschlüsse des Wiener Kongresses und die folgenden Revolutionen einordnen.
…Vorurteile gegenüber der jüdischen Bevölkerung und deren Auswirkungen erläutern.
…die russische Revolution historisch einordnen.



Verlag
…wesentliche politische Entwicklungen in China analysieren.
Buchtipps
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
Waltraud Lewin: Der Wind trägt die Worte – Geschichte und Geschichten der Juden von der Neuzeit bis in die Gegenwart (cbj 2013).
Harald Parigger: Die Französische Revolution oder der Preis der Freiheit (Impian 2020).
Harald Parigger: 1848 – Robert Blum und die Revolution der vergessenen Demokraten (Arena 2011).
Harald Parigger: Napoleon – Der unersättliche Kaiser (Arena 2013).














1. DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION UND IHRE FOLGEN
Erfindungen und Fortschritte der Naturwissenschaften
Wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfindungen veränderten ab der zweiten Hälfte des 18. Jh. die Wirtschaft. Die Maschine trat ihren Siegeszug an, Fabriken wurden gebaut, die Industrielle Revolution setzte ein.
Auch in der Medizin wurden große Fortschritte erzielt. So erkannte Louis Pasteur um 1860 Mikroben als Krankheitserreger und führte daraufhin die ersten Schutzimpfungen durch.
Der Wiener Arzt Ignaz Semmelweis wurde als Retter der Mütter bekannt. Ihm fiel auf, dass die Ärzte sich vor der Geburtshilfe nicht die Hände wuschen und damit Krankheitserreger auf die Mütter übertrugen. Den Weltruf der Wiener Medizinischen Schule begründete der Chirurg Theodor Billroth. Er führte als Erster bahnbrechende Operationen wie die Entfernung des Magens bei Magenkrebspatienten durch.
Durch die Entdeckung vieler Krankheitserreger konnten auch erstmals Schutzimpfungen dagegen entwickelt werden. Bahnbrechend war die Entwicklung von Penicillin.
Entstehung der Industrie
Die Industrielle Revolution wirkte sich auf viele Gebiete des menschlichen Lebens aus. So veränderte die Industrialisierung die Arbeitswelt, das soziale Gefüge und die Lebensbedingungen der Menschen grundlegend.
Die ersten Dampfmaschinen wurden in Bergwerken sowie zum Antrieb von Spinnmaschinen und dem mechanischen Webstuhl eingesetzt. Für den Kauf von Maschinen wurde aber viel Vermögen, also Kapital benötigt. Dieses besaßen zumeist reiche Bürger, Adelige und in einigen wenigen Fällen auch Handwerker. Sie verwendeten ihr Kapital und gründeten Fabriken, stellten dort Maschinen auf und wurden so zu Unternehmern. Damit war die Industrialisierung eingeleitet.
Schwerindustrie: Es wurden Hochöfen und Stahlwerke errichtet. In diesen erzeugte man Stahl, der vor allem für den Bau von Eisenbahnen und Schiffen benötigt wurde.
Textilindustrie: Hier verdrängte der mechanische Webstuhl die Handweberinnen und Handweber, da die maschinengewebten Stoffe billiger waren.
Chemische Industrie: Diese erzeugte unter anderem billige Farbstoffe und Mineraldünger. Auch Soda wurde chemisch hergestellt. Es diente als Grundstoff für die Seifenherstellung. Nun konnte Seife billiger produziert werden und wurde so zum Gebrauchsartikel, den sich jeder leisten konnte. Die neuen Möglichkeiten der Seifenherstellung führten zur Entwicklung des Waschmittels.
Mikroben, die: Bakterien
Olympe Verlag
Penicillin, das: Heilmittel, das gegen Bakterien wirkt
Beurteile, wie diese wissenschaftlichen und medizinischen
Fortschritte die Lebensqualität der Menschen verbessert haben!
Diskutiert in Vierergruppen zu folgendem Thema: Welche Auswirkungen könnte die Erfindung der Dampfmaschine auf die Arbeitswelt gehabt haben?

produzieren: erzeugen
D1: Analysiere, welche wirtschaftlichen, geographischen und politischen Voraussetzungen Großbritannien erfüllt hat, um zur „Werkstatt der Welt“ zu werden!
Entwickle historische Fragestellungen, die der Autor zur Erstellung der Darstellung möglicherweise untersucht hat!
Stelle Fragen, um den Text besser zu verstehen, besonders zum hohen Energieverbrauch Großbritanniens und seiner Rolle in der Industrialisierung!
Vergleiche die Voraussetzungen Großbritanniens für die Industrialisierung mit denen eines anderen europäischen Landes!
Diskutiere, ob die Bezeichnung „Werkstatt der Welt“ für Großbritannien gerechtfertigt ist!
Pionierin, die/Pionier, der: Wegbereiterin/Wegbereiter D jemand, die/der auf einem bestimmten Gebiet bahnbrechend ist
Diskutiert darüber, welche Voraussetzungen im 21. Jh. wesentlich sind, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können!
D2: Verfasse eine passende Überschrift!
D2 + Q1: Rekonstruiere anhand dieser beiden Texte die Reaktion der Menschen auf die Lokomotive!
Die Industrielle Revolution breitet sich aus Die Industrielle Revolution begann in Großbritannien. Die Entwicklung der Dampfmaschine, aber auch reiche Bodenschätze, eine große Flotte und wirtschaftsfreundliche Gesetze zur Gründung von Unternehmen begünstigten die Industrialisierung. Großbritannien profitierte nicht nur von eigenen Ressourcen, sondern auch von der Ausbeutung der Arbeitskraft und Rohstoffen aus den Kolonien, die eine zentrale Rolle während der Industrialisierung spielten.
D1: Die Werkstatt der Welt
Großbritannien war nicht nur der Pionier der Industrialisierung im späten 18. Jahrhundert gewesen; um die Mitte des 19. Jahrhunderts galt das Land geradezu als die „Werkstatt der Welt“: Es stellte zwar nur etwa zehn Prozent der europäischen Bevölkerung, aber es verarbeitete 59 Prozent der von Europa importierten Baumwolle. Großbritannien verfügte ferner über 58 Prozent der europäischen Eisenund sogar 68 Prozent der europäischen Kohleproduktion. Entsprechend verbrauchte Großbritannien fast genauso viel Energie wie der gesamte Rest des Kontinents zusammen.
Aus: http://www.damals.de/de/16/Die-Werkstatt-der Welt.html?issue=177096&aid=177081&cp=1&action=showDetails (17. 9. 2016)
Verlag
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. erfasste die Industrialisierung auch viele andere europäische Staaten. In Österreich kam es zwischen 1860 und 1914 zu einem Aufschwung der Industrie. Diese Zeit, in der viele Fabriken errichtet wurden und das Eisenbahnnetz entstand, nennt man Gründerzeit. Um 1900 stiegen Japan und die USA zu den ersten Wirtschaftsmächten der Welt auf.
Die Revolution des Verkehrs
Die in Massen hergestellten Waren mussten nun auch schnell und über weite Strecken zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern transportiert werden. Die schrittweise Weiterentwicklung der Dampflokomotive machte dies möglich. 1815 baute der Engländer George Stephenson die erste verkehrstaugliche Lokomotive. In Österreich fuhr 1837 die erste Eisenbahn von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram.

Abb. 2: Stephensons Lokomotive „The Rocket“(RZ)
Der 27. September 1825 wurde zu einem historischen Tag. Stephensons Maschine beförderte zum ersten Mal einen Zug über die 15 km lange Strecke. Und mit diesem Zug wurden nicht nur Güter, sondern auch Menschen befördert. […] Zehntausende Menschen hatten sich eingefunden, um Zeugen dieser ersten sausenden Fahrt zu werden. Die Geschwindigkeit war so groß, dass stellenweise über 20 km/h zurückgelegt wurden.
Aus: Dolby, Edward: Vom Zauber alter Eisenbahnen. Freiburg im Breisgau (1980) S. 17.
Q1: Als ich das erstemal auf dem Dampfwagen saß aus Peter Roseggers Buch „Waldheimat“ (1877)
Auf der eisernen Straße heran kam ein kohlschwarzes Wesen. Es schien anfangs stillzustehen, wurde aber immer größer und nahte mit mächtigem Schnauben und Pfustern und stieß aus dem Rachen gewaltigen Dampf aus. […] „Kreuz Gottes!“ rief der Jochem, da hängen ja ganze Häuser dran!“ Und wahrhaftig […] sahen wir nun einen ganzen Marktflecken mit vielen Fenstern heranrollen, und zu den Fenstern schauten lebendige Menschenköpfe heraus, und schrecklich schnell ging's, und ein solches Brausen war, daß einem der Verstand still stand.
Aus: http://gutenberg.spiegel.de/buch/waldheimat-1308/12 (17. 9. 2016)
Neue Motoren werden entwickelt
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. wurden neue Motoren erfunden, die für die Weiterentwicklung des Verkehrs wichtig waren. 1875 entwickelte der Österreicher Siegfried Marcus den Vorläufer des Kraftwagens. Nur elf Jahre später (1886) meldete der Deutsche Karl Benz ein Patent für einen dreirädrigen Kraftwagen mit Benzinmotor an. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung leistungsstarker Motoren war die Erfindung des Dieselmotors durch den Deutschen Rudolf Diesel 1897.

Aber auch in der Luftfahrt gelang Bahnbrechendes. So unternahmen die Brüder Wright 1903 den ersten Motorflug in den USA.
Das Zeitalter der Elektrizität beginnt
Der Siegeszug der Elektrizität setzte gegen Ende des 19. Jh. ein. Kraftwerke erzeugten elektrischen Strom, der zur Beleuchtung und zum Antrieb von Elektromotoren verwendet wurde. Ein Netz von Stromleitungen zum Transport der Elektrizität entstand.
Nachrichten verbreiten sich
Vor der Industriellen Revolution wurden Nachrichten mit Hilfe berittener Boten oder den Postkutschen überbracht. Die Erfindung des elektrischen Telegrafen durch Samuel Morse ermöglichte schon 1837 die Übermittlung von Nachrichten. Morse entwickelte einen Code aus langen und kurzen Stromstößen zum Verschlüsseln der Wörter – das Morsealphabet. Das Telefon wurde von Alexander Graham Bell 1876 entwickelt. Das Zeitalter der Massenkommunikation begann.
Neuerungen in der Landwirtschaft
Verlag
Patent, das: Schutzrecht für eine Erfindung

Um die Abrechnung der Postgebühren zu erleichtern, führte man 1840 in England die erste Briefmarke ein. Zehn Jahre später wurden auch in Österreich Briefmarken produziert. Zur Zeit der Jahrhundertwende erreichte die Verbreitung von Briefmarken ihren Höhepunkt.
Kommunikation, die: Übermittlung von Information
Aufgrund der medizinischen Fortschritte stieg die Bevölkerungszahl in der zweiten Hälfte des 19. Jh. stark an. Da immer mehr Menschen Nahrungsmittel benötigten, wurde die Entwicklung von landwirtschaftlichen Produktionstechniken immer wichtiger.
In der Landwirtschaft wurde die Fruchtwechselwirtschaft eingeführt, der Mineraldünger verwendet und auch Dampfmaschinen eingesetzt. Dadurch konnten die Erträge der Bauern gesteigert und die Versorgung der Industriegebiete gewährleistet werden. Doch der Import von Agrarprodukten, die im Ausland billiger hergestellt werden konnten, führte zur Verbilligung der eigenen Produkte, sodass die Bauern zu wenig einnahmen und zum Teil verarmten.
D3: Warum sprechen wir von einer Industriellen Revolution?
Die technischen Erfindungen verändern die Produktionsverfahren, führen daneben auch zu einer ungeahnten Intensivierung des Kommunikationswesens. Mit Kommunikationswesen sind hier alle Formen gemeint, in denen Menschen miteinander verkehren – durch räumliche Bewegung und durch Mitteilung.
Diese Intensivierung, d.h. Verstärkung oder Verdichtung ist zuerst durch die Eisenbahn eingetreten. Später setzten Erfindungen wie drahtlose Telegraphie, Telefon, Fotografie, Rotationsdruck von Zeitungen, Auto den Prozess fort; im 20. Jahrhundert kommen Radio, Fernsehen, Satellitentechnik hinzu.
Aus: Günther-Arndt, Hilke; Kocka, Jürgen (Hg.): Geschichtsbuch – Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Dokumenten 3. Berlin (1986), S. 77.
Fruchtwechselwirtschaft, die: Bebauung der gesamten Ackerfläche, doch mit jährlichem Wechsel der Feldfrüchte
Agrarprodukte, die: landwirtschaftliche Erzeugnisse
D3: Erörtere, welche Rolle die Technisierung bei der Industrialisierung spielt! Halte deine Überlegungen in Stichworten fest und erstelle eine Mind-Map, die die wichtigsten Aspekte wie Produktionssteigerung, soziale Veränderungen und neue Arbeitsstrukturen aufzeigt! Diskutiere mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler, ob eine Industrialisierung auch ohne Technisierung möglich wäre, und begründe deine Antwort, indem du auf zentrale technologische Entwicklungen eingehst, die für die Industrialisierung entscheidend sind!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Die Abbildungen zeigen zwei bedeutende Erfindungen, welche die Industrialisierung beschleunigten. Wähle eine davon aus, recherchiere im Internet oder in Lexika und erkläre anschließend die Funktionsweise!

Abb. 4: „Spinning Jenny“ (kolorierter Holzstich 1887)

Abb. 5: Dampfmaschine von James Watt (kolorierter Holzstich, 1890

Verlag

Erläutert in Partnerarbeit, welche Vorteile die Industrialisierung brachte und welche Nachteile! Stellt anschließend eure Ergebnisse der Klasse vor!
Stelle anhand von D4 und Abb. 6 dar, welche Herausforderungen der Bau der Semmeringbahn für folgende Personen war!
D4: Der Bau der Semmeringbahn
Carl Ritter von Ghega * Arbeiterinnen * Arbeiter
Ein besonders schwieriges Vorhaben stellte der Bau einer Bahnlinie über den Semmering dar. 1848 wurde unter der Leitung von Carl Ritter von Ghega mit dem Bau der Semmeringbahn begonnen. 20 000 Arbeiter, davon ein Drittel Frauen, arbeiteten sechs Jahre daran. Die Arbeiten erwiesen sich als äußerst gefährlich: So starben 89 Menschen bei Arbeitsunfällen und mehrere hundert an Krankheiten. 1854 erfolgte die feierliche Eröffnung dieser ersten Gebirgsbahn der Welt. Eigendarstellung nach: Die Semmeringbahn - Geschichte (10. 3. 2024)

Abb. 6: Bau der Semmeringbahn (Lithographie von E. Benkert, 1850, Technisches Museum)
Vergleiche die beiden Darstellungen D3 und D4! Untersuche, welche Orientierung die beiden Darstellungen (D3 und D4) zum Thema „technische Erfindungen und die industrielle Revolution“ bieten! Analysiere, wie jede Darstellung den Fokus auf verschiedene Aspekte wie Technik, soziale Auswirkungen und gesellschaftliche Veränderungen legt!
Reflektiere, wie hilfreich die beiden Darstellungen sind, um die industrielle Revolution und ihre Auswirkungen zu verstehen! Bewerte, ob beide Darstellungen zusammen ein umfassendes Bild bieten oder ob wichtige Punkte fehlen! Diskutiere deine Ergebnisse anschließend mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn!
Formuliere drei Interviewfragen, die du an jemanden stellen würdest, der am Bau der Semmeringbahn beteiligt war!

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Hier siehst du eine alte Waschmittelwerbung der Marke Henkel. 1907 kam Persil als erstes Waschmittel auf den Markt. Entscheide anhand des Werbeplakates (Abb.7) und D5, welche Aussagen richtig sind! Begründe auch deine Entscheidung!
D5: Das erste selbsttätige Waschmittel aus www. berliner-zeitung.de (2016)
„Pauline, lass das Reiben sein“ ist ein Werbeslogan […]. Selbst gestandene Hausfrauen werden nicht ohne weiteres darauf kommen, dass es dabei ums Wäschewaschen geht. Vor hundert Jahren freilich hatte nicht nur Pauline ihre liebe Mühe, die Wäsche sauber zu kriegen. Erst musste sie, also die Wäsche, in Seifenlauge eingeweicht werden, dann wurde jedes einzelne Stück in derselben ausgiebig gedrückt, geknetet und eben gerieben, bis der Dreck raus war, und nach dem Spülen, Auswringen und Trocknen kam alles, was weiß war, auf die Wiese, um von der Sonne gebleicht zu werden. Falls sie gerade schien. Dass die Prozedur heute in deutlich vereinfachter Form abläuft, ist einer Pioniertat der Firma Henkel aus Düsseldorf zu danken. Sie brachte am 6. Juni 1907 das erste selbsttätige Waschpulver auf den Markt. Selbsttätig war zwar eine gewisse Übertreibung, doch immerhin bewirkte das neue Wundermittel, dass das Reiben und Kneten der Wäsche sich erübrigte.

Verlag
Aus: Vor hundert Jahren kam das erste selbsttätige Waschmittel in die Läden. Es nannte sich Persil: Da weiß man, was man hat (berliner-zeitung.de) (10. 3. 2024)
AUSSAGE stimme zu lehne ab
Persil war ein selbsttätiges Waschmittel.
Begründung:
Wäschewaschen war damals Frauensache.
Begründung:
Persil war ein neues Wundermittel.
Begründung:
Diese Abbildungen zeigen die Entwicklung des Fahrrades! Ordne die Bildlegenden zu!









Entwickle in einer kurzen Beschreibung in deinem Heft das Fahrrad der Zukunft! Fertige dazu auch eine Zeichnung an!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
In diesem Fachtext analysiert der Autor große technische und wirtschaftliche Veränderungen. Erörtere, wie vergleichbare Entwicklungen in Gegenwart und Zukunft ablaufen könnten! Arbeite in deinem Heft!
D6: Industrielle Revolution oder Industrialisierung von Christoph Nonn (2007)
Umwälzungen wie die Französische Revolution 1789 oder die russische Oktoberrevolution 1917 verwandelten die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Verfassung der betreffenden Länder innerhalb weniger Monate oder zumindest binnen weniger Jahre. Die Industrialisierung war dagegen ein wesentlich langfristigerer Prozess. Vom Einsetzen technischer Neuerungen und dem damit zusammenhängenden explodierenden Wachstum der Produktion in der Baumwollspinnerei bis zum Umbruch in eine Industriegesellschaft [...] dauerte es in Großbritannien etwa fünfzig Jahre. [...]
Dieser langfristige Charakter legt es nahe, die durch eine Häufung technischer Neuerungen zuerst im Großbritannien des späten 18. Jahrhundert angestoßene Entwicklung als Industrialisierung statt als Industrielle Revolution zu bezeichnen.
Historiker, die dennoch den Begriff der Industriellen Revolution bewusst verwenden, verweisen dagegen auf sogenannte „take-off“-Phasen in der Entwicklung einiger Volkswirtschaften. Den Prozess der Industrialisierung vergleichen sie mit dem Start eines Flugzeugs, das zunächst langsam beschleunigt, um schließlich mit großem Getöse steil in die Luft abzuheben.
Aus: Christoph, Nonn: Das 19. und 20. Jahrhundert – Orientierung Geschichte. Paderborn/München/Wien/Zürich (2007), S. 43f.
„take-off“-Phase, die: Die „take-off“-Phase ist ein Begriff aus der Wirtschaftstheorie und beschreibt den Moment, in dem ein Land von einer agrarischen zu einer industrialisierten Wirtschaft übergeht, mit schnellem Wachstum und steigendem Wohlstand.
Verlag

Entscheide dich nun für eine der beiden möglichen Zukunftsvisionen und begründe möglichst ausführlich deine Meinung!
Hilfe, die Roboter übernehmen die Weltherrschaft!
Begründung:
Wir Menschen entscheiden über unsere Zukunft.
Begründung:

Mit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert konnten Menschen erstmals historische Momente festhalten. Auch das alltägliche Leben wurde auf Fotos festgehalten. Diese Fotos sind wichtige Quellen für die Geschichte. Doch wir müssen Fotos
1. SCHRITT: Das Foto genau beschreiben
kritisch betrachten, denn sie zeigen nur einen Teil der Realität. Manchmal werden Fotos manipuliert, um die Betrachterin und den Betrachter zu beeinflussen. Manche werden sogar nachträglich verändert, also absichtlich gefälscht.
Betrachte das Foto ganz genau und achte dabei auch auf die Details!
Wann ist das Foto entstanden? Wo ist das Foto entstanden? Was zeigt das Foto?
Welche Details kannst du erkennen? Ist die Fotografin oder der Fotograf bekannt?
2. SCHRITT: Das Foto analysieren
Gehe nun auf die Details des Fotos ein!
Was befindet sich in der Mitte des Fotos, was ist im Vordergrund, was im Hintergrund zu sehen? Handelt es sich um einen Ausschnitt oder ist die ganze Aufnahme zu sehen? Ist es ein Schnappschuss oder eine gestellte Aufnahme? Wo stand die Fotografin bzw. der Fotograf zum Zeitpunkt der Aufnahme? Ist es eine private Aufnahme oder ein offizielles Foto (Pressefoto)? Sind auf dem Foto Symbole zu sehen? Wenn ja, welche? Was könnten diese Symbole bedeuten?
3. SCHRITT: Interpretiere das Foto
Kläre folgende Fragen!
Verlag
Beschreibe die Wirkung des Fotos! Möchte das Foto eine Botschaft vermitteln? Wenn ja, welche? Welche Mittel werden eingesetzt, um die Botschaft zu vermitteln? Welche Stimmung herrscht auf dem Foto? Wie wirkt das Foto auf dich? Spricht es dich emotional an oder ist es eher sachlich gehalten? Will die Fotografin oder der Fotograf sachlich informieren oder will sie/er eine bestimmte Wirkung bei der Betrachterin bzw. dem Betrachter erzielen? Fasse zusammen, welche Erkenntnisse du aus dem Foto über die damalige Zeit gewinnst! Gibt es wichtige Dinge, über die man nichts erfährt?
1 2
Untersuche diese Fotografie in deinem Heft!
Versetze dich in die Lage einer der Personen auf diesem Foto! Wie fühlst du dich bei diesem Fototermin? Schreibe dazu drei bis vier Sätze!
Abb. 1: Wohnungsnot einer Arbeiterfamilie – Fotografie um 1900 (ÖNB)


2. WIRTSCHAFTLICHER WANDEL
Die Freie Marktwirtschaft
Abb. 1: Beschreibe, welcher Moment der Fließbandproduktion des Modell T hier aufgenommen wurde!
Q1: Erkläre anhand des Zitats von Henry Ford die Beziehung zwischen Produkt und Lohn der Arbeiterinnen bzw. Arbeiter! Schreibe deine Ergebnisse auf und präsentiere diese in einer Kleingruppe!
Im Mittelalter regelten die Zünfte die Arbeitszeit, die Qualität und den Preis der Waren. Durch die Entstehung neuer Großbetriebe in der Zeit der Industriellen Revolution verloren die Zünfte ihre Bedeutung und ihre Berechtigung. Ausschließlich Angebot und Nachfrage bestimmten ab nun den Markt. In vielen Ländern wurde die Zunftordnung aufgehoben und durch eine Gewerbefreiheit ersetzt. Nun konnte jeder erzeugen, was er wollte.
Massenproduktion steigert den Umsatz
Q1: Ausspruch von Henry Ford (1863 – 1947)
Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt – er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt. Aus: http://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html (7. 3. 2018)
Abb. 2: Vergleiche ein aktuelles CocaCola-Werbeplakat mit dem historischen Plakat und analysiere dabei die verwendeten Farben, ihre mögliche Bedeutung, die Botschaft der Werbung sowie die angesprochenen Gefühle oder Ideen. Berücksichtige zudem die Darstellung der Menschen und ihre Rolle auf den Plakaten!
Diskutiert anschließend in der Klasse, wie Werbung damals und heute unterschiedliche Zielgruppen anspricht und welche gesellschaftlichen Werte sie widerspiegelt!

2:
Olympe Verlag
Die Freie Marktwirtschaft brachte einen Konkurrenzkampf zwischen den Unternehmen und beschleunigte die Industrialisierung. Jeder Unternehmer versuchte, bessere und preiswertere Produkte auf den Markt zu bringen. In den Fabriken wurden die Waren in Massen produziert. Dies gelang durch den Einsatz von Maschinen und eine stärkere Zerlegung der Arbeit in einzelne Handgriffe. In Amerika beschleunigte die Einführung der Fließbandmontage ab 1908 durch Henry Ford die Herstellung von Autos.
Das Modell T „Lizzy“ war das erste Auto, das von Arbeiterinnen und Arbeitern gebaut wurde, die auf bestimmte Arbeitsschritte spezialisiert waren. Die Arbeiterinnen und Arbeiter standen am Fließband und jede Gruppe baute immer dieselben Teile ein.


Abb. 1: Fließbandproduktion des Ford T-Modells. Dieses wurde innerhalb von 19 Jahren mehr als 15 Millionen Mal verkauft (1913, Detroit, USA)
Dadurch war es möglich, in kürzerer Zeit eine größere Zahl an Fahrzeugen zu fertigen. In der Folge sank der Preis für Automobile und immer mehr Menschen konnten sich ein Auto kaufen. Die Motorisierung der Menschheit nahm Fahrt auf.
Die in Massen hergestellten Waren mussten auch verkauft werden. Deshalb wurden neue Handelsgeschäfte und Kaufhäuser gegründet. Um das Interesse an neuen Produkten zu wecken, entwickelte sich die Werbung weiter. Durch die Werbung lernten die Konsumentinnen und Konsumenten Produkte kennen, die ihnen vorher nicht vertraut waren und die sie ohne Werbung möglicherweise nicht gekauft hätten.
3. DIE GESELLSCHAFT VERÄNDERT SICH
Eine Landflucht setzt ein
Vor der Industriellen Revolution bestimmte in Europa die feudale Gesellschaftsordnung das Leben der Menschen. Der Großteil der Bevölkerung waren Bäuerinnen und Bauern, die in Abhängigkeit von einem Grundherrn standen. Die vorherrschende Produktionsform war die Naturalwirtschaft. Im 19. Jh. führten aber die Aufhebung der Grunduntertänigkeit, die Ausbreitung der Geldwirtschaft, das starke Wachstum der Städte und viele wichtige Erfindungen zur Entstehung der Industriegesellschaft
Ein wesentlicher Faktor für das starke Bevölkerungswachstum in Europa, das von etwa 195 Millionen im Jahr 1800 auf etwa 422 Millionen im Jahr 1900 stieg, waren nicht nur diese wirtschaftlichen Veränderungen, sondern auch verbesserte hygienische Bedingungen, medizinische Fortschritte und eine bessere Ernährungssituation, die die Lebensbedingungen deutlich verbesserten.
D1: Mehr Menschen – Bevölkerungswachstum in der Monarchie aus www.habsburger.net (2016)
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten war das Bevölkerungswachstum der Habsburgermonarchie eher gering und setzte mit dem Ende des 18. Jahrhunderts erst spät ein. Während auf heutigem österreichischem Gebiet zu Beginn des 18. Jahrhunderts etwa zwei Millionen Menschen lebten, waren es am Ende des Jahrhunderts bereits drei Millionen. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es in ganz Europa zu einer regelrechten Bevölkerungsexplosion, was vor allem auf steigende Geburtenraten und sinkende Sterbebraten zurückzuführen war. In der Habsburgermonarchie konzentrierte sich das Wachstum besonders in Wien, wohin vor allem im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen zogen.
Aus: http://www.habsburger.net/de/kapitel/mehr-menschen-bevoelkerungswachstum-der-monarchie (10. 3. 2024)
D1: Markiere im Text jene drei Gründe, die zu einer Bevölkerungsexplosion führten!
Erörtert gemeinsam, welche Maßnahmen ein Staat setzen kann, um die Bevölkerungszahlen zu steigern oder zu senken! Erstellt eine Liste der möglichen Maßnahmen und ordnet sie in zwei Kategorien: „Steigerung der Bevölkerungszahlen“ und „Senkung der Bevölkerungszahlen“!
Bevölkerung Wiens, 1815 bis 1910
Abb. 1: Bevölkerungswachstum von Wien (1815 – 1910)
Abb. 1: Beschreibe die Bevölkerungsentwicklung Wiens! Bestimme auch den Zeitraum, in welchem der stärkste Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen war!
Die neu gegründeten Fabriken benötigten mehr Arbeitskräfte zur Herstellung der Waren. Vor allem Menschen vom Land wie Mägde und Knechte versprachen sich ein besseres Leben durch die Fabrikarbeit in den Städten. Eine Landflucht setzte ein.
Die Unternehmer errichteten in der unmittelbaren Umgebung der Fabriken Zinskasernen. In diesen Mietshäusern wohnten die Arbeiterinnen und Arbeiter.
Die Arbeiterschaft entsteht
Da immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken beschäftigt waren, entstand eine neue Bevölkerungsschicht – die Arbeiterschaft. In den Fabriken waren die Arbeitsbedingungen sehr hart. Die Arbeitszeit betrug in der Regel zwischen 12 und 16 Stunden am Tag. Oft wurde auch sonntags gearbeitet, es gab keinen Urlaub und auch keine Absicherung bei Krankheit oder Unfällen.
Olympe Verlag
Abb. 2: Arbeiterwohnhaus in Pottendorf /NÖ (Foto um 1900, Foto Schächter, Pottendorf)


3: Frauen und Mädchen in einer Spinnerei (Foto, 1903)
Abb. 3: Analysiert gemeinsam die Abbildung!
Reflektiert die Veränderungen in den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung von Frauen seit dieser Zeit!
Diskutiert die Gründe für die weiterhin bestehenden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen und entwickelt mögliche Lösungsansätze, um diese Ungleichheiten zu verringern!
Arbeitsalltag der Fabrikarbeiterinnen
Mit der Industrialisierung erfolgte die Trennung von Lohnarbeit und Hausarbeit. Da der Lohn der Männer nicht zum Leben ausreichte, mussten auch die Ehefrauen in den Fabriken arbeiten, um die Familie zu ernähren. Frauen bekamen für die gleichen Arbeiten aber wesentlich weniger Geld als Männer (Hälfte bis ein Drittel des Männerlohnes).
Frauen wurden zumeist bei ungelernten Tätigkeiten eingesetzt. Um 1900 war ein Viertel der Arbeiterinnen in Baumwollspinnereien beschäftigt. Sie wurden als „Fadenknüpferinnen“ oder „Spulenaufsteckerinnen“ eingesetzt, da die Arbeitgeber ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit schätzten.
Kinderarbeit in den Fabriken
Zu Beginn der Industrialisierung hielten Fabrikbesitzer und Unternehmer Kinderarbeit für nützlich, bildend und förderungswürdig. Für die Arbeiterfamilien wiederum brachte die Arbeit ihrer Kinder ein zusätzliches Einkommen und sicherte so ihr Überleben. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken stellten besonders für Kinder eine gesundheitliche Belastung dar.
D2: Soziale Folgen der Mechanisierung von Andrea Komlosy im Ausstellungskatalog „Magie der Industrie“ (1989)
Gearbeitet wurde in den Fabriken des südlichen Niederösterreichs von 4 Uhr früh bis 8 Uhr abends. Eine 1 ½-stündige Mittagspause sowie vier Stunden des arbeitsfreien Sonntags dienten den Kindern zum Schulbesuch. Nachtschichten, permanente Übermüdung, Arbeitsunfälle und Erkrankungen standen auf der Tagesordnung.
Verlag
Aus: Komlosy, Andrea: Die frühe mechanische Baumwollspinnerei in Niederösterreich. Alles spinnt. In: Magie der Industrie. Leben und arbeiten im Industriezeitalter. Ausstellungskatalog, hg. von NÖ-Landesregierung, München (1989) S. 308.
D2: In vielen Ländern der Erde müssen Kinder auch heute noch arbeiten. Bildet Gruppen und informiert euch über Kinderarbeit im Internet unter dem Stichwort „Kinderarbeit“!

Abb. 4: Kinderarbeit in einer Wiener Maschinenfabrik (Ausschnitt eines Fotos, 1908)
Gestaltet als Ergebnis eurer Recherche eine Mappe mit wesentlichen Informationen!
1842 wurde die Kinderarbeit in Fabriken in Österreich verboten. Trotz dieser Verordnung gab es immer wieder zahlreiche Ausnahmen. So legte auch die Gewerbeordnung von 1859 fest, dass 10- bis 12-jährige Kinder in Unternehmen mit einem Erlaubnisschein der Gemeinde sehr wohl arbeiten durften.
Arbeitsalltag in den Fabriken
Die Arbeit in den Fabriken begann zumeist um fünf Uhr in der Früh. Schon eine Viertelstunde vor Arbeitsbeginn wurde geläutet, nach dem zweiten Läuten wurden die Tore der Fabrik geschlossen. Die durchschnittliche Arbeitszeit betrug 12 Stunden, doch konnte diese jederzeit um einige Stunden verlängert werden.
Abb. 4: Der Bub im Vordergrund ist ca. zehn Jahre alt. Beurteile, wie der Bub auf dich wirkt, und begründe deine Einschätzung anhand seiner Haltung, seines Gesichtsausdrucks und der Gesamtkomposition der Abbildung!
Teile deine Einschätzung in einer Vierergruppe und vergleicht eure Meinungen!
In den Augen der Unternehmer waren die Arbeiterinnen und Arbeiter „unzivilisiert“ und mussten erst zu Disziplin und Ordnung erzogen werden. Deshalb stellten sie Fabriksordnungen auf und zwar ohne Mitsprachemöglichkeit der davon betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Arbeitsverträge enthielten strenge Arbeitsvorschriften. Geringfügige Vergehen wie Tratschen während der Arbeitszeit oder Zuspätkommen wurden mit Lohnkürzung bestraft. Entlassungen gab es bei Vergehen wie nachlässiger und schlechter Arbeit, rauchen oder Trunkenheit.
Arbeiterwohnungen in eigenen Stadtvierteln
In den großen Städten entstanden in den Industriegebieten neue Stadtviertel, in denen die Arbeiterinnen und Arbeiter in Zinshäusern lebten. In den ZimmerKüche-Wohnungen gab es kein Klosett und keine Bassena (Wasserstelle). Diese befanden sich am Gang und wurden von allen Bewohnerinnen und Bewohnern eines Stockwerkes benutzt. Die Mieten dieser Wohnungen waren sehr hoch, da es keine Gesetze gab, die den Mietpreis regelten.
Aufstieg des Bürgertums
Vor der Industriellen Revolution bestand das Bürgertum vorwiegend aus Kaufleuten und Handwerkern. Durch die Industrialisierung bildeten sich drei neue bürgerliche Schichten heraus: Großbürger (Unternehmer), Mittelschicht (Beamte, Angestellte, freie Berufe) und Kleinbürger (Handwerker, Kaufleute). Das Großbürgertum besaß Fabriken, arbeitete als Unternehmer und erlangte dadurch auch große wirtschaftliche Macht. Als bürgerliche Haupttugenden galten Sparsamkeit und Fleiß, ohne die man kein Vermögen erarbeiten konnte. Den Besitz galt es aber auch zu bewahren. Deshalb erwarteten sie von ihren Arbeiterinnen, Arbeitern und Angestellten denselben Einsatz.


Verlag

1902)
Die Mittelschicht war ab der Mitte des 19. Jh. zahlenmäßig stark angewachsen. Ihre wirtschaftliche Lage war zwar sehr unterschiedlich, doch war ein ausreichender Lebensstandard gewährleistet.
Die Konkurrenz der Fabriken machte vor allem den Kleinbürgern zu schaffen. Einige Handwerksbetriebe hielten diesem Konkurrenzdruck nicht stand und mussten schließen, aber auch neue Handwerksberufe entstanden. Durch den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg forderte das Bürgertum vermehrt ein politisches Mitspracherecht.
Abb. 6: Stelle fest, wer die „Frau des Hauses“ ist! Woran erkennst du sie?
Abb. 5 + 6: Vergleiche die Wohnsituation der beiden Schichten und analysiere die auffälligen Unterschiede!
Q1: Erörtert in Vierergruppen, welche Tugenden gegenwärtig als wichtig erachtet werden! Stellt eure Ergebnisse der Klasse vor und diskutiert, ob es Unterschiede in den als wichtig erachteten Tugenden gibt!
Q1: Testament eines Fabrikanten (Wien, 1906)
Lieber Pepi, [...] verlange nicht, gar zu schnell reich zu werden. Du übernimmst ein gutes altes Geschäft mit einem guten Namen, welches Dich immer anständig ernähren wird [...] erziehe Dir Deine Kinder gut bürgerlich und mache aus Deinen Lieben ebenso tüchtige Geschäftsleute, wie Du einer unter meiner Leitung geworden bist.
Aus: Streller, Vera: Fleiß und Leichtsinn. In: Magie der Industrie. Leben und arbeiten im Industriezeitalter. Ausstellungskatalog, hg. NÖ-Landesregierung, München (1989), S. 238.
4. FRAUEN FORDERN MITBESTIMMUNG
Versetze dich in die Rolle eines Kindes aus einer bürgerlichen Familie der damaligen Zeit und beschreibe deinen Alltag! Vergleiche dein Leben mit dem eines Kindes aus einer Arbeiter- oder Bauernfamilie!
Abb. 1: Analysiere diese Karikatur! Arbeite dabei heraus, welche persönliche Einstellung zum Frauenwahlrecht der Karikaturist einnahm! Gehe ebenso darauf ein, welche Wirkung er bei den Betrachterinnen und Betrachtern erreichen wollte!
Durch die Veränderungen in der Gesellschaft wurde die bürgerliche Familie zum Vorbild für alle anderen Gesellschaftsschichten. Während in der bäuerlichen und handwerklichen Familie neben den Eltern und Kindern auch die Mägde, Knechte, Lehrlinge und Gesellen zur Familie gezählt wurden, bestand die bürgerliche Kernfamilie aus Eltern und Kindern. Großer Wert wurde auf eine gute Ausbildung und Erziehung der eigenen Kinder gelegt.
In der bürgerlichen Familie widmete sich die Frau der Kindererziehung, dem Haushalt oder der Aufsicht über das Dienstpersonal. Die Mehrheit meinte, dass die Frauen nicht arbeiten sollten, denn dies wurde als Zeichen für den sozialen Aufstieg gesehen. Arbeiterfrauen, Bauerntöchter, Mägde, Köchinnen, Dienstmädchen und Schneiderinnen mussten aber arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten
Auf die Ausbildung der Frauen wurde weniger Wert gelegt. Der Besuch von Gymnasien oder gar Universitäten war ihnen anfangs nicht gestattet. Erst 1878 durften Mädchen in Österreich eine Matura ablegen, mussten dafür aber eigene Mädchenschulen besuchen. Ab 1897 konnten Frauen auch an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien studieren.


Verlag
Auch die Zahl der berufstätigen Frauen nahm zu, da immer mehr Mädchen aus bürgerlichen Familien einen Beruf anstrebten, um unabhängig zu sein. Durch die vermehrte Berufstätigkeit der Frau änderte sich auch ihre soziale Stellung. Die Frauen forderten mehr Rechte, vor allem das Recht auf Arbeit und Ausbildung, aber auch das Wahlrecht. Frauenrechtlerinnen in England und den USA kamen vorwiegend aus dem Bürgertum. Diese sogenannten Suffragetten organisierten sich und forderten das Wahlrecht.
Stationen des Wahlrechts für Frauen

2 Als erster europäischer Staat setzte Finnland 1906 das Frauenwahlrecht um.
2 In Österreich wurde das Gesetz für das Frauenwahlrecht am 12. November 1918 beschlossen.
2 Die USA führten erst 1920 das Wahlrecht für Frauen ein.
2 Im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden durften Frauen auf kommunaler und kantonaler Ebene sogar bis 1991 nicht wählen.
Abb. 1: Karikatur Frauenrecht (Flugblatt, 1907, Kreisky Archiv)
Nun
geht’s los
– Aufgaben für schlaue Köpfe!
Zunftordnung oder Freie Marktwirtschaft – Lies zuerst diese Gegenüberstellungen! Wäge diese beiden Wirtschaftsordnungen gegeneinander ab und kreuze an!

Zunftordnung
• Die Anzahl der Meister, Lehrlinge und Gesellen wird durch die jeweilige Zunft bestimmt.
• Der Preis und die Qualita¨t der Waren sind vorgeschrieben.
• Die Waren du¨rfen nur in bestimmten Gebieten verkauft werden.
• Jeder soll genug zum Leben haben.
• Die Zunft unterstu¨tzt in Notfa¨llen Witwen, Waisen, Kranke und Arbeitsunfa¨hige.
Freie Marktwirtschaft
• Jeder kann einen Betrieb gründen und so viele Arbeiterinnen und Arbeiter oder Angestellte beschäftigen, wie er braucht.
• Preis und Qualität der Waren unterliegen dem Angebot und der Nachfrage.
• Es gilt der Freihandel, das bedeutet, man kann überall seine Waren verkaufen.
• Der Tüchtige setzt sich durch!
• Keine Versorgung; erst gegen Ende des 19. Jh. werden Sozialgesetze schrittweise erlassen.

mehr Sicherheit mehr Chancen stabile Preise Qualität Freihandel Zunftordnung
Freie Marktwirtschaft
Verlag
Gestalte mit Hilfe dieser Grafik eine eigene Erzählung!
Einstieg: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte der Siegeszug...
Erste Industrielle Revolution – 19. Jh.
Siegeszug der Maschinen: Maschinen ersetzen Arbeit mit der Hand.
1 4
Siegeszug der Elektronik: Computer übernehmen körperliche und geistige Arbeit.
Arbeitsplätze im Handwerk werden durch Arbeitsplätze in der Industrie ersetzt.
Zweite Industrielle Revolution – Gegenwart
Arbeitsplätze in der Industrie gehen verloren.
2 3 Olympe
angelernte Arbeiterin, angelernter Arbeiter, Fabrikarbeiterin, Fabriksarbeiter
Facharbeiterin, Facharbeiter, Technikerin, Techniker
Entwickle deine eigene Dritte Industrielle Revolution für die Zukunft! Was könnte Arbeitsplätze revolutionieren? Wie werden die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen? Welche Fertigkeiten werden benötigt?
Ordne den Bildern die passenden Begriffe zu!
















Abb. 1: Bearbeite die folgenden Aufgaben in deinem Heft!
Beschreibe den Schauplatz der dargestellten Szene!
Nenne Personen und Personengruppen, die auf dem Gemälde zu erkennen sind!
Stelle fest, wie diese dargestellt werden (Körperhaltung, Kleidung, Gesichtsausdruck)!
Interpretiere das Gemälde als Momentaufnahme, indem du mögliche Ereignisse davor, währenddessen und danach beschreibst und deine Überlegungen begründest!
Rekonstruiere mit Hilfe des Gemäldes die Stellung der Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber den Fabriksbesitzern!
Beschreibe, woran die Notlage der Arbeiterinnen und Arbeiter erkennbar ist!
Interpretiere die dargestellte Stimmung des Gemäldes!
Vergleiche, wie sich der Unternehmer von den Arbeiterinnen und Arbeitern unterscheidet!
Interpretiere, welche Rolle die Frau mit dem Kind und dem Baby auf dem Arm in der Darstellung einnimmt!
Interpretiere, welche Absicht der Maler mit diesem Gemälde verfolgt haben könnte!
Erläutere, ob er die Notlage der Arbeiterinnen und Arbeiter betonen oder auf soziale Ungerechtigkeit hinweisen will!
Reflektiert in Partnerarbeit, welche Einstellung zum Streik der Maler möglicherweise zum Ausdruck bringt!
Schutzzoll, der: Einfuhrzoll, der die eigene Wirtschaft gegen Konkurrenz schützt Ideologie, die: Weltanschauung
Die Soziale Frage
Unter Sozialer Frage werden alle wirtschaftlichen und sozialen Probleme bezeichnet, die sich beim Übergang von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft ergaben. Dieser Übergang setzte in den europäischen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein: in England bereits um 1750, in Österreich erst um 1850.
Verlag
Mit der Industriellen Revolution stiegen die Spannungen und Gegensätze an, da die Bevölkerung stark zunahm, viele Handwerksbetriebe schließen mussten und es mehr Fabriken gab. Mit dem Übergang zur Industriegesellschaft verschlechterte sich die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter deutlich.

In der freien Marktwirtschaft war der Schwächere dem Stärkeren weitgehend ungeschützt ausgeliefert. Der Unternehmer bestimmte die Arbeitsbedingungen. Die Arbeiterin und der Arbeiter waren bei Unfall, Krankheit oder Arbeitslosigkeit nicht abgesichert. Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterschaft waren geprägt durch großes Elend und große Not.
Die Arbeiterinnen und Arbeiter forderten daher Sozialgesetze wie die Einführung einer Unfall- und Krankenversicherung. Die Bäuerinnen und Bauern wiederum wollten die Einführung von Schutzzöllen, während der Mittelstand das Recht forderte, sich in Vereinen zusammenschließen zu dürfen. Eine gemeinsame Forderung war die Erweiterung des Wahlrechts auch auf arme Schichten.
Politische Programme
Die Not der Arbeiterinnen und Arbeiter veranlasste viele Denker, sich mit der Sozialen Frage auseinanderzusetzen und neue Ideologien zur Lösung zu entwerfen. Diese bildeten die Grundlage für politische Programme, die teilweise sehr unterschiedlich von ihren Ansätzen und Zielen her waren.
Der Kommunismus
Die deutschen Gesellschaftskritiker Karl Marx (1820 – 1895) und Friedrich Engels (1818 – 1883) gelten als Begründer des Kommunismus. In ihrem Kommunistischen Manifest von 1848 geht es um die Verwirklichung einer klassenlosen Gesellschaft.
Private Unternehmen, Fabriken und Bergwerke sowie privater Landbesitz sollten, weil sie Produktionsmittel waren, keinem einzelnen gehören, sondern zu gesellschaftlichem Eigentum werden. Für Marx und Engels war ein Klassenkampf zwischen besitzendem Bürgertum, der Bourgeoisie, und der besitzlosen Arbeiterschaft, dem Proletariat, unausweichlich: Da die Zahl der Großbetriebe stetig anstieg, würde ebenso auch die Zahl der Proletarier steigen.
Der Kommunismus als politische Idee schließt Demokratie nicht unbedingt aus. Marx und Engels sahen die Herrschaft des Proletariats vor, die theoretisch auch demokratische Prozesse umfassen könnte. In der Realität jedoch, wie z.B. in der Sowjetunion, wurden demokratische Rechte oft eingeschränkt, und die Kommunistische Partei übernahm die alleinige Macht. Dies zeigt den Unterschied zwischen der Theorie und der oft autoritären Praxis des Kommunismus in der realen Politik.
Der Sozialismus
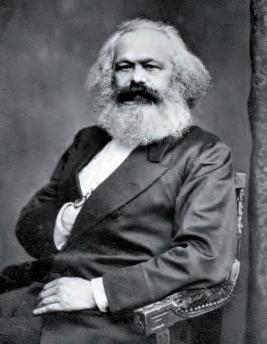
Verlag
Ihr entsetzt euch darüber, dass wir das Privateigentum abschaffen wollen. Aber in eurer bestehenden Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben.
Aus: Marx, Karl; Engels, Friedrich: Manifest der Kommunistischen Partei. Zittau (2009), S. 43.
Auch der Sozialismus trat für eine Überwindung des Kapitalismus und eine Befreiung der Arbeiterklasse aus Armut und Unterdrückung ein.
Im Gegensatz zu den Kommunisten traten die Sozialisten jedoch für die Staatsform der Demokratie ein. Sie wollten eine Veränderung der bestehenden Ordnung auf gesetzlichem Weg erreichen und eine Gesellschaftsordnung herstellen, die an Gleichheit, Solidarität und Emanzipation ausgerichtet war. Deshalb kam es zu Beginn des 20. Jh. zu einer Trennung von Kommunismus und Sozialismus
Die Christliche Soziallehre
Christlich-soziale Denker übertrugen die Lehren des Christentums auch auf Wirtschaft und Gesellschaft. 1891 verfasste Papst Leo XIII. ein päpstliches Rundschreiben, die Enzyklika rerum novarum. In dieser hielt der Papst fest, dass es keinen unversöhnlichen Gegensatz zwischen der besitzenden Klasse und der Arbeiterklasse gebe.
Q2: „Enzyklika rerum novarum“ – Über die Arbeiterfrage (1891)
Die Arbeiter dürfen nicht wie Sklaven angesehen werden; ihre persönliche Würde, welche geadelt ist durch ihre Würde als Christen, werde stets heilig gehalten. [...] Unehrenvoll dagegen und unwürdig ist es, Menschen bloß zu eigenem Gewinn auszubeuten.
Aus: Brusatti, Alois, Haas; Wilhelm, Pollak, Walter (Hg.): Geschichte der Sozialpolitik mit Dokumenten. Wien (1962), S. 181.
Die christlich-sozialen Denker vertraten die Ansicht, dass der Staat den sozial Schwächeren durch Reformen helfen müsste.
Der Liberalismus
Nach den liberalen Vorstellungen sind alle Menschen von Natur aus frei, gleichberechtigt und selbstverantwortlich für ihr Tun. Für die Anhängerinnen und Anhänger der Liberalen waren Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit Voraussetzungen der Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung des Menschen. Die Liberalen traten im 19. Jh. ebenso für die Einführung einer schriftlichen Verfassung und die Gewaltenteilung ein.
Manifest, das: öffentlich abgedruckte Erklärung
Klasse, die: Gruppe der Bevölkerung, deren Angehörige sich in der gleichen wirtschaftlichen und sozialen Lage befinden
Q1: Erkläre, wen Marx meinte, wenn er von jenen spricht, die 1/10 des Eigentums besitzen!
Erkläre, warum es so schwierig ist, die ursprünglichen Ideen von Marx und Engels in der Praxis umzusetzen! Halte deine Argumente schriftlich fest und tausche dich in einer Gruppe aus!
Diskutiert in der Klasse, inwiefern eine klassenlose Gesellschaft mit demokratischen Prinzipien vereinbar sein könnte, und beleuchtet dabei die möglichen Herausforderungen!
Q2: Rekonstruiere, wie der Papst die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Arbeiterschaft bewertete!
6. SOZIALGESETZGEBUNG UND GRÜNDUNG VON PARTEIEN IN ÖSTERREICH
Q1: Liste die von Victor Adler in seinem Brief angeprangerten Missstände auf und formuliere eine Antwort an ihn, in der du auf seine Kritik eingehst!
Abb. 1: Analysiere, welche Personen und Gegenstände auf dem Bild dargestellt werden, und beschreibe die dargestellte Szene!
Beurteile, welche Aussage das Bild über die Arbeitsbedingungen der Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter vermittelt! Gehe dabei auf die Haltung, Kleidung und Umgebung der Personen ein!
Re
flektiert in Partnerarbeit die Gefühle oder Gedanken, die das Bild bei euch hervorruft!
fl.: Abkürzung für einen Gulden (1 Gulden ca. 16 €)
Fachinspekteur: jemand, der in einem bestimmten Bereich etwas überprüft
Sozialstaat: Staat, der soziale Sicherheit garantiert
Q2: Fasse zusammen, welche Rechte kranke Arbeiterinnen und Arbeiter laut dem Gesetz von 1888 erhielten!
Stelle die Regelungen des Arbeiterkrankenversicherungsgesetzes von 1888 den heutigen Krankenversicherungsleistungen gegenüber!
(Recherchiere dazu im Internet!)
Beurteile, inwiefern dieses Gesetz ein Fortschritt für die Arbeiterinnen und Arbeiter im 19. Jahrhundert war!
Präsentiere deine Ergebnisse der Klasse! Nutze Plakate, digitale Präsentationstools oder ein Handout, um deine Ergebnisse visuell darzustellen!
Die Soziale Frage gewinnt an Bedeutung
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Österreich einen wirtschaftlichen Aufschwung, der jedoch keine Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter brachte. Victor Adler, ein Arzt, verkleidete sich 1888 als Arbeiter, um die schlechten Arbeitsbedingungen der Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter am Wienerberg zu untersuchen. In der Ziegelfabrik Wienerberger arbeiteten vor allem Böhminnen und Böhmen unter extrem schlechten Bedingungen und für sehr niedrige Löhne. Sie wurden im Volksmund „Ziaglbem“ genannt.
Abb. 1: „Ziaglbem“ am Wienerberg, Bezirksmuseum Favoriten
Verlag

Q1: Die Lage der Ziegelarbeiter – Auszug aus einem Brief von Victor Adler an Friedrich Engels (1888) (Es) müssen alle Arbeiter im Werk schlafen. Für die Ziegelschläger gibt es elende „Arbeitshäuser“. In jedem einzelnen Raume, sogenanntem „Zimmer“, dieser Hütten schlafen je 3, 4 bis 10 Familien; Männer, Weiber, Kinder, alle durcheinander, untereinander, übereinander. Für diese Schlafhöhlen scheint die Gesellschaft sich noch „Wohnungsmiethe“ zahlen zu lassen, denn der Bericht des Gewerbe-Inspektors meldet 1884 von einem Mietzins von 56 – 96 fl., der auf dem Wienerberg vorkommt. Aus: Adler, Victor; Engels, Friedrich: Briefwechsel. Hg. von Callesen, Gerd; Maderthaner, Wolfgang. Berlin (2011), S. 119.
Nach Vorbild der Sozialreformen in Deutschland wurden nach und nach auch in Österreich erstmals Gesetze zum Schutz der Arbeiterschaft beschlossen.

1885 Arbeiterordnung:
2 Höchstarbeitszeit pro Tag auf 11 Stunden beschränkt
2 Verbot der Kinderarbeit für Kinder unter 14 Jahren
2 Nachtarbeit von Jugendlichen und Frauen verboten
2 Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften durch staatliche Fachinspekteure
1888 Arbeiterkrankenversicherungsgesetz:
2 Einführung einer Krankenversicherung
2 Eine Arbeiterunfallversicherung wurde zwar beschlossen, aber erst 1890 eingeführt.
Q2: Arbeiterkrankenversicherungsgesetz (30. März 1888)
Im Falle die Krankheit mehr als 3 Tage dauert [...] ist [...] ein Krankengeld in der Höhe von 60 % des [...] üblichen Taglohns [...] zu gewähren.
Aus: Brusatti, Alois, Haas; Wilhelm, Pollak, Walter (Hg.): Geschichte der Sozialpolitik mit Dokumenten. Wien (1962), S. 181.
Mit diesen Sozialgesetzen begann die Entwicklung des Sozialstaates in Österreich.
DAS ZEITALTER DER
Die Gründung der österreichischen Parteien
Die Reichstagswahlreform von 1873 bestand aus einem Kurien- und Zensuswahlrecht. Nur sechs Prozent der erwachsenen männlichen Bevölkerung und einige wenige eigenberechtigte Frauen, die über ausreichend Grundbesitz verfügten, waren demnach wahlberechtigt. Dies bedeutete, dass 94 % der Männer und fast alle Frauen im Land nicht wählen durften.
Vor allem Personen mit niedrigem Einkommen waren mit diesem Wahlrecht nicht einverstanden. In Österreich schlossen sich die benachteiligten Schichten vorwiegend in zwei Parteien zusammen. Dies waren die Sozialdemokratische Partei und die Christlichsoziale Partei
Die Sozialdemokratische Partei Österreichs
1874 wurde auf dem Parteitag in Neudörfl im Burgenland die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet. Eine Einigung der unterschiedlichen Richtungen innerhalb der Sozialdemokraten gelang Victor Adler am Parteitag von Hainfeld 1889. Anhängerinnen und Anhänger dieser Partei waren zum größten Teil Arbeiterinnen und Arbeiter. Bekannte Vertreter waren Karl Seitz und Karl Renner.
Abb. 2: Victor Adler – Republikdenkmal (Büste von Anton Hanak, 1928)
Die Christlichsoziale Partei Österreichs
Verlag
Wählen durfte nur, wer eine bestimmte Summe Steuern im Jahr bezahlte (in Wien z. B. mindestens 10 Gulden). Zensuswahlrecht

Kurienwahlrecht


1893 kam es in Wien zur Gründung der Christlichsozialen Partei Österreichs unter der Führung des Wiener Bürgermeisters Karl Lueger. Wähler dieser Partei stammten aus dem Kleinbürgertum, dem Bauernstand und der christlich gesinnten Arbeiterschaft. Bekannte Vertreter waren Leopold Kunschak und Prinz Alois von Liechtenstein.
ZIELE
CHRISTLICHSOZIALE
2 staatliche Schutzgesetze für Bauern und Handwerker
2 Einführung von Sozialgesetzen
2 Schutz des Privateigentums
2 allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer


ZIELE
SOZIALDEMOKRATEN
2 staatliche Arbeiterschutzgesetzgebung
2 gemeinsamer Kampf mit der Arbeiterschaft aller Länder
2 allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht für Männer und Frauen
2 8 Stunden Arbeitszeit pro Tag
Abb. 3: Zielsetzungen der Christlichsozialen und der Sozialdemokratischen Partei
Schrittweise gelang es den Parteien Wahlreformen durchzusetzen, bis 1907 das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht für Männer eingeführt wurde.
Durch dieses wurden aber Frauen, die aufgrund des Kurienwahlrechts wählen durften, nun ausgeschlossen.

Der Wert der Stimme hatte unterschiedliches Gewicht –je nachdem, welcher Kurie (Wählergruppe D z. B. Großgrundbesitzer) man angehörte.
Erörtere die Folgen des Kurien- und Zensuswahlrechts und erkläre, welche Auswirkungen es hatte, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung wahlberechtigt war! Schreibe deine Überlegungen auf und erstelle eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte!
Abb. 2: Recherchiere im Internet, was das Republikdenkmal ist und wo es steht! Stichwort: „Republikdenkmal“ Diskutiert in der Klasse, welche Bedeutung das Denkmal heute noch hat und wie es die Erinnerung an die Errichtung der Republik wachhält!
Abb. 3: Vergleiche die Zielsetzungen der beiden Parteien, analysiere ihre Unterschiede und identifiziere mögliche Gemeinsamkeiten! Beurteile, wie die neuen Parteien die Interessen benachteiligter Gruppen vertreten haben! Bildet Gruppen und gründet eigene Parteien! Formuliert eure vier eigenen Zielsetzungen!
los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Welche Absichten stehen hinter diesen Aussprüchen! Unterstreiche bei jedem Zitat zuerst wichtige Schlüsselwörter, dann entscheide, zu welcher Ideologie diese Aussprüche passen würden und welche Absichten dahinterstehen!

Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Ideologie

Absicht
Die einfachste Formel für dieses Verhalten, aus welcher sich dann alle weiteren Konsequenzen ableiten lassen, heißt: Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst!
Ideologie
Absicht
Beschreibe die Lebensbedingungen der Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter am Wienerberg! Welche Probleme hatten die Arbeiterinnen und Arbeiter? (Tipp: Lies dazu nochmal S. 90!)
Vergleiche die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter im 19. Jahrhundert mit denen der Arbeiterinnen und Arbeiter heute in Österreich! Was ist heute anders?
Stelle eine Vermutung an, wie sich die schlechte Bezahlung und die harten Arbeitsbedingungen auf das Leben der Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter ausgewirkt haben! Welche Folgen könnten diese Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter und ihre Familien gehabt haben?
Erörtert folgende Fragestellungen in Vierergruppen! Warum ist es wichtig, die Lebensumstände der Arbeiterinnen und Arbeiter im 19. Jahrhundert zu kennen? Wie könnte dieses Wissen uns heute helfen, über Arbeitsbedingungen nachzudenken?
6
1867 wurde in der österreichischen Reichshälfte von Österreich-Ungarn durch die Dezemberverfassung die Versammlungs- und Vereinsfreiheit beschlossen. Dies führte zur Bildung wirtschaftlicher Interessenvertretungen. Benenne diese Interessenvertretungen, indem du aufgrund ihrer Aufgaben die Namen zuordnest!

Zusammenschluss von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; treten für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ein.


Genossenschaften, die die landwirtschaftlichen Produkte ihrer Mitglieder verkaufen.
Genossenschaften, die Waren zu günstigeren Preisen an ihre Mitglieder verkaufen. Sie geben Kredite zu günstigen Zinsen.
Analysiere diesen Aufruf zu einer Wählerversammlung mit Hilfe der Fragestellungen!
Was bedeutet eine Kurie?
Aus welchem Jahr stammt dieser Aufruf?
Wer gab den Auftrag für diesen Aufruf?
Für welchen Wahlkreis war dieser Aufruf?
Was ist das Besondere an dieser Wahl?
Wer ist wahlberechtigt?
Welche Frage würdest du an den Gestalter des Plakates stellen?
Olympe Verlag



Abb. 4: Die österreichische Socialdemokratische Arbeiterpartei ruft zu einer Wählerversammlung anlässlich der Reichsratswahl 1897 auf; Rudolf Lehr: Landeschronik Oberösterreich, 2004
Welche Unterschiede bei der Gestaltung dieses Plakates zu derzeit gebräuchlichen Plakaten fallen dir auf? Nenne einen Unterschied!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies zunächst diesen Bericht über den Zusammenhang zwischen Industrialisierung und Umweltverschmutzung! Markiere anschließend Schlüsselwörter!
D1: Die industrielle Umweltkatastrophe (aus Planet Wissen)
Mit der Industrialisierung stieg der Energieverbrauch besonders ab Anfang des 19. Jahrhunderts sprunghaft an. Die erhöhte Produktion von Eisen und Stahl sowie der Bau von Maschinen erforderte enorme Mengen an Kohle, deren Verbrennung die Luft stark belastete. Vor allem in den Ballungszentren konnte man kaum mehr atmen, die Luft war voller Rauch, giftige Schwefeldioxidverbindungen führten zu einem Waldsterben größeren Ausmaßes.
Auch Gewässern und Böden wurden während der Industrialisierung dauerhafte Schäden zugefügt. Klärwasser, giftige Chemikalien, Düngemittel und andere industrielle Abwässer landeten in den Flüssen und verseuchten sie so stark, dass das oft gefärbte Wasser ungenießbar wurde. Rund um Industrieansiedlungen herum wurden die Böden mit Blei, Cadmium, Quecksilber und anderen Giften verseucht, Altlasten aus den Betrieben taten ein Übriges. Aus: Umweltverschmutzung: Industrielle
Vergleicht in Partnerarbeit die im Text beschriebenen Umweltprobleme der Industrialisierung mit aktuellen Umweltproblemen!
Stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus und beurteilt, welche Lehren aus den Umweltkatastrophen der Industrialisierung für die heutige Zeit gezogen werden können! Präsentiert eure Ergebnisse in Form einer Mind-Map!
Informiere dich im Internet auf der folgenden Seite Klimawandel – Klexikon – das Kinderlexikon (zum.de) welchen Anteil die Industrialisierung heute noch immer am Klimawandel hat! Fasse deine Erkenntnisse mit eigenen Worten zusammen!



Diskutiert in der Klasse, was ihr konkret dazu beitragen könnt, um den Klimawandel zu bekämpfen! Achtet dabei auf folgende Fragestellungen:
2 Welche kleinen Veränderungen im Alltag (z.B. Energie sparen, weniger Plastik verwenden) könnt ihr umsetzen?
2 Wie könnt ihr als Gruppe (z.B. in der Schule oder im Freundeskreis) gemeinsame Aktionen starten, um die Umwelt zu schützen?
2 Welche Möglichkeiten habt ihr, um andere auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und sie zu motivieren, ebenfalls aktiv zu werden?
2 Was kann jede Einzelne/jeder Einzelne von euch in den Bereichen Konsum, Mobilität oder Ernährung tun, um die Umwelt zu entlasten?
Erstellt am Ende der Diskussion eine Liste mit konkreten Vorschlägen und legt gemeinsam fest, welche Aktionen ihr umsetzen möchtet!
So schätze ich mich nach dem Großkapitel „DAS ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…bedeutende Erfindungen des 18. Jh. nennen.
…über die Neuerungen im Verkehr und in der Landwirtschaft berichten.
…die Vor- und Nachteile der Industrialisierung reflektieren.
…Historische Fotografien mit der Methode M5 untersuchen.
…die Unterschiede zwischen Zunftwirtschaft und Freier Marktwirtschaft erkennen.
…die Auswirkungen der Industrialisierung auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen erläutern.
…die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen und Arbeitern reflektieren.
…über das Frauenwahlrecht reflektieren.
…die soziale Frage und die damit verbundene Entstehung von politischen Parteien erläutern.
…die wesentlichsten Stationen der Sozialgesetzgebung in Österreich sowie die Gründung der österreichischen Parteien nennen.
Buchtipps

Verlag


Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
Andreas Bödecker und Christian Arpasi [K]ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung (be.bra Verlag 2021).
Martin Rowsen: Das kommunistische Manifest: Die Bibel des Kommunismus als moderne und lebhafte Graphic Novel (Knesebeck 2018).

Caroline Stevan: Die Stimme der Frauen: Das Frauenwahlrecht Kindern (und ihren Eltern) erklärt (Helvetiq 2021).
Hans-Christoph Liess: Karl Marx und der Fluch des Geldes (Arena audiolino 2018).








1.
KOLONIALISMUS – AUSBEUTUNG
UND IHRE FOLGEN
Die europäische Expansion und der Kolonialismus
Rohstoffe, die: Kohle, Eisen, Baumwolle, Erdöl
kartieren: ein Gebiet, eine Landschaft auf einer Karte darstellen
Missionar, der: Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, der Andersgläubige zu seiner Religion bekehren will
Ressourcen, die: natürlich vorhandener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck, (Ernährung, wirtschaftliche Produktion) benötigt wird
Ab dem 15. Jahrhundert errichteten europäische Mächte wie Spanien, Portugal, die Niederlande, Großbritannien und Frankreich Kolonialreiche in Übersee. Sie nutzten ihre Macht für wirtschaftlichen Gewinn, indem sie Rohstoffe wie Gold, Silber und Zucker ausbeuteten, was zu Umweltschäden und sozialen Verwerfungen führte.
Abb. 1: Suche die Victoriafälle in deinem Atlas!
Recherchiere im Internet! Seit wann gehören die Victoriafälle zum Weltnaturerbe?
Erstelle eine MindMap, in der du die Hauptfolgen des Kolonialismus für die betroffenen Länder darstellst! Ergänze dabei Aspekte wie wirtschaftliche Ausbeutung, Umweltzerstörung und soziale Ungleichheiten!
Präsentiere deine Mind-Map in einer Kleingruppe und tausche dich über weitere mögliche Folgen aus!
Die einheimische Bevölkerung wurde oft unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit gezwungen, wodurch Gemeinschaften zerstört wurden. Die negativen Folgen, wie wirtschaftliche Abhängigkeit und soziale Ungleichheit, prägen viele ehemalige Kolonien bis heute.
Entdeckungsreisen und Forschung im 19. Jahrhundert

Verlag
Im 19. Jahrhundert bereisten europäische Forscher Afrika, Asien und die Polargebiete. David Livingstone suchte in Afrika nach der Nilquelle und benannte die Victoriafälle. Henry Morton Stanley kartierte den Kongo-Fluss und wurde als Journalist bekannt. Seine Reisen unterstützten jedoch auch die koloniale Ausbeutung, etwa im Auftrag von König Leopold II. von Belgien. Die Entdeckungen dienten oft der Kartenerstellung für wirtschaftliche und militärische Zwecke.
Missionare verbreiteten das Christentum oft auf Kosten einheimischer Kulturen. Polargebiete wurden von Entdeckern wie Robert Edwin Peary (Nordpol) und Roald Amundsen (Südpol) erforscht und meist nach europäischen Herrschern benannt. Abb. 1: Victoriafälle
Die Suche nach Rohstoffen und ihre Folgen
Mit der Industriellen Revolution wuchs der Bedarf an Rohstoffen wie Kohle, Kupfer und Gummi stark an. Industriestaaten suchten in Afrika, Asien und Amerika gezielt nach billigen Rohstoffquellen, um ihre maschinelle Produktion anzutreiben. Diese wirtschaftliche Ausbeutung brachte Europa enormen Reichtum, während die betroffenen Regionen oft langfristig geschädigt wurden.
Die einseitige Nutzung der Ressourcen führte zu Umweltzerstörung, wirtschaftlicher Abhängigkeit und tiefgreifenden sozialen Ungleichheiten in den Kolonien. Diese Ungerechtigkeiten wirken bis heute nach und prägen die globale Ungleichheit zwischen Nord und Süd.
Langfristige Auswirkungen
Der Kolonialismus war kein Austausch zwischen Kulturen, sondern eine einseitige Durchsetzung europäischer Interessen , die auf Unterdrückung und Ausbeutung beruhte. Viele der heutigen Probleme in den ehemaligen Kolonien, wie wirtschaftliche Instabilität, politische Konflikte und soziale Ungleichheit, haben ihren Ursprung in dieser Zeit.
Die Erinnerung an diese Vergangenheit ist wichtig, um die Auswirkungen des Kolonialismus zu verstehen und die Verantwortung für eine gerechtere globale Zusammenarbeit zu übernehmen.
Diskutiere mit einer Partnerin/einem Partner, welche Ziele die Forscher neben der Entdeckung Afrikas hatten!
Erörtert, inwiefern ihre Unternehmungen neben der Erforschung auch andere Absichten wie Macht, Einfluss oder wirtschaftliche Interessen umfasst haben könnten!
Erkläre, wie der Kolonialismus und die Reisen von Entdeckern wie Livingstone zur Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen führten! Denke dabei an die wirtschaftlichen Interessen der europäischen Länder in Afrika.
Verlag


Beschreibe das Bild!
Welche Personen, Gegenstände und Orte kannst du erkennen? Wie sind Stanley und Livingstone dargestellt? Was fällt dir auf?
3 6 7 8 4 5
Fasse zusammen, welche Informationen das Bild vermittelt!

Interpretiere, welche Details möglicherweise absichtlich hervorgehoben wurden, und erläutere, welche Wirkung dadurch bei der Betrachterin/beim Betrachter erzielt werden könnte!
Beurteile, warum der Künstler bestimmte Elemente, wie die Kleidung oder den Gesichtsausdruck, so dargestellt haben könnte! Was sagt uns das Bild über die Begegnung von Stanley und Livingstone?
Erstelle eine kurze Erzählung über die Begegnung zwischen Stanley und Livingstone, basierend auf dem Bild. Versuche, verschiedene historische Perspektiven (z. B. die von Stanley, Livingstone oder einem afrikanischen Begleiter) zu berücksichtigen und stelle dir vor, wie die Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschrieben worden wäre!
2. IMPERIALISMUS
Imperialismus, der: Herrschaft eines Reiches über die Bevölkerung eines fremden Reiches
In der Zeit von 1880 bis 1914 strebten die europäischen Industriestaaten danach, sich noch nicht kolonialisierte Gebiete in Afrika und Asien anzueignen. Im Wettstreit um die neuen Kolonialgebiete lagen England, Frankreich und Deutschland an der Spitze. Aber auch Russland, Japan, Italien und die USA sicherten sich ihre Ansprüche an den neu zu erobernden Gebieten.



Deutscher Besitz
Britischer Besitz
Französischer Besitz
Spanischer Besitz
Portugies. Besitz
Italienischer Besitz
Belgischer Besitz
Niederländ. Besitz
Dänischer Besitz
Russischer Besitz
Japanischer Besitz
Besitz der USA
Verlag

K1: Finde im Atlas heraus, welche heutigen Länder früher britische Kolonien waren!
Erkläre, wie Kolonialmächte Rohstoffe nutzten und welche Vorteile sie daraus hatten!
Beurteile, wie diese Ausbeutung die Lebensbedingungen in den Kolonien beeinflusste!
Recherchiere, welche Übersee-Regionen (DOMROM) Frankreich heute besitzt, z. B. mit dem Suchbegriff „ÜberseeDépartement“!
Absatzmarkt, der: Möglichkeit, Waren zu verkaufen
Zivilisation, die: Gesamtheit der Veränderungen durch Wissenschaft und Technik
K1: Die Aufteilung der Welt zwischen 1800 und 1914
Imperialistische Politik
Die Regierungen der imperialistischen Staaten schlossen mit lokalen Herrschern Verträge oder setzten sie militärisch unter Druck, um die Kontrolle über ihre Gebiete zu erlangen. Aus diesen sogenannten Schutzgebieten wurden später Kolonien.
Die Kolonialherren ignorierten dabei weitgehend die Interessen der betroffenen Bevölkerung. Sie suchten gezielt nach Bodenschätzen und beuteten die Kolonien aus. Auf riesigen Plantagen wurden Produkte wie Baumwolle, Kaffee und Tee in großen Mengen angebaut, die in Europa sehr begehrt waren. Die Rohstoffe wurden nach Europa verschifft und dort verarbeitet. Der Verkauf der fertigen Waren brachte sowohl den Staaten als auch den Unternehmen hohe Gewinne.
Die Kolonien dienten jedoch nicht nur als Rohstofflieferanten, sondern auch als Absatzmärkte für billige, in Europa hergestellte Massenwaren. Dies führte dazu, dass in den Kolonien viele traditionelle Handwerkskünste verloren gingen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Kolonien von den europäischen Staaten wuchs dadurch immer weiter.
Die Kolonialmächte rechtfertigten ihr Vorgehen mit der Behauptung, dass sie den Menschen in den eroberten Gebieten Fortschritt und Zivilisation bringen würden. Tatsächlich nutzten sie diese Gebiete vor allem für ihre eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen.
3. DIE AUFTEILUNG DER WELT
Im 19. Jahrhundert rechtfertigten europäische Länder ihre Herrschaft über andere Teile der Welt mit Theorien wie dem Sozialdarwinismus. Diese Idee übertrug Darwins Gedanken zur Natur fälschlicherweise auf Menschen und behauptete, dass nur die „stärksten“ Gesellschaften überleben könnten. Solche Ansichten wurden genutzt, um Kolonialismus und die Unterdrückung anderer Völker zu erklären und scheinbar zu rechtfertigen. Besonders afrikanische Gesellschaften wurden als „weniger entwickelt“ dargestellt, um die gewaltsame Kontrolle durch Europa zu rechtfertigen. Heute wissen wir, dass es aus biologischer Sicht keine verschiedenen Menschenrassen gibt. Alle Menschen gehören zur gleichen Art, und Unterschiede wie Hautfarbe, Sprache oder Kultur sagen nichts über den Wert eines Menschen aus.
Der Begriff „Rasse“ wurde früher aus der Tierzucht übernommen und später auf Menschen übertragen, um Ungleichheiten zu rechtfertigen. Er wurde unter anderem genutzt, um Vorurteile zu verstärken und Menschen zu benachteiligen.
Q1: Cecil Rhodes – britischer Regierungschef der Kapkolonien (1877)
Ich behaupte, daß wir die erste Rasse der Welt sind und daß es für die Menschen umso besser ist, je größere Teile der Welt wir bewohnen. Ich behaupte, daß jedes Stück Land, das unserem Gebiet hinzugefügt wird, die Geburt von mehr Angehörigen der englischen Rasse bedeutet, die sonst nicht ins Dasein gerufen worden wären. Darüber hinaus bedeutet es einfach das Ende aller Kriege, wenn der grössere Teil der Welt in unserer Herrschaft aufgeht.
Aus: http://de.metapedia.org/wiki/Rhodes,Cecil (3. 9. 2016)

Abb. 1: Cecil Rhodes (Karikatur von Edward Linley, 1892, satirische englische Wochenzeitschrift „Punch“)
Q1: Lies das Zitat von Cecil Rhodes!
Erklärt in Partnerarbeit, wie Rhodes die britische Expansion rechtfertigt!
Reflektiert, warum seine Aussagen problematisch sind und bewertet seine Behauptung!

Schutt und Schnee abladen ist hier verboten!
Abb. 2: Diese Karikatur zeigt, dass es auch kritische Stimmen zur „Vormachtstellung des weißen Mannes“ gab (Thomas Theodor Heine, 1904, deutsche satirische Wochenzeitschrift „Simplicissimus“)
Kolonialherrschaft und ihre Folgen
In den Kolonien setzten die europäischen Mächte ihre Gesetze durch und nahmen oft das beste Land für sich. Viele Menschen wurden von ihrem Land vertrieben, was zu Protesten führte, die brutal niedergeschlagen wurden. Traditionelle Kulturen und Lebensweisen wurden durch westliche Regeln verdrängt. In einigen Kolonien wurden Schulen eingerichtet, in denen Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen lernten – jedoch meist nach europäischen Inhalten und in europäischen Sprachen.
Olympe Verlag
Diskutiert in der Klasse die Folgen, wenn eine Kultur von einer anderen kontrolliert wird!
Abb. 1: Beurteile, wie Cecil Rhodes in der Karikatur dargestellt und eingeschätzt wird!
Abb. 2: Interpretiert die Zeichnung in Vierergruppen:
• Rolle des Krokodils
• Bedeutung des „Maulkorbanlegens“
• Botschaft des Schildes „Schutt und Schnee abladen ist hier verboten“
Auch wenn Straßen, Eisenbahnen und Häfen gebaut wurden, dienten sie vor allem dazu, Rohstoffe aus den Kolonien nach Europa zu bringen. Die Menschen in den Kolonien hatten davon oft wenig Nutzen und wurden ausgebeutet.
• Eigenschaften, die den Deutschen zugeschrieben werden Erklärt in Partnerarbeit welche Kritik mit den Symbolen, wie den Giraffen, dem Helm, den deutschen Soldaten, dem Krokodil und der Schrift auf dem Schild an der deutschen Kolonialpolitik gezeigt wird! Analysiert die Stilmittel, die der Zeichner verwendet! Präsentiert eure Ergebnisse in der Klasse!
100 KOLONIALISMUS, IMERALISMUS UND RASSISMUS
Englische Kolonialherren in Indien
East India Company, die: englische Handelsgesellschaft, die mit besonderen Privilegien ausgestattet war
Abb. 3: Analysiere das Foto von Queen Victoria anhand folgender Punkte in deinem Heft!
• Art des Fotos (z. B. offizielles Porträt, privates Foto)
• Hinweise zur Persönlichkeit und Rolle von Queen Victoria (Kleidung, Gesichtsausdruck, Körperhaltung)
• Erkennbare Symbole und ihre Aussage über Macht und Stellung
• Zweck der Anfertigung des Fotos (z. B. Repräsentation, Propaganda)
• Perspektive und Komposition des Fotografen und ihre Wirkung
Hungerlohn, der: sehr geringer Lohn („zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig“)
Dominion, das: ein in der Verwaltung selbstständiges Land des Britischen Reiches oder des Commonwealth

Seit Vasco da Gama 1498 den Seeweg nach Indien entdeckt hatte, gab es in Indien europäische Handelsniederlassungen. Ab 1757 dehnten die Briten mit Hilfe der East India Company ihre Macht in Indien immer weiter aus. Durch Verträge mit indischen Fürsten beziehungsweise auch mit Waffengewalt errichteten sie 1858 eine Kronkolonie, die Britisch-Indien genannt wurde. 1876 nahm die englische Königin Viktoria den Titel „Kaiserin von Indien“ an. Die englischen Kolonialherren veränderten das traditionelle Wirtschaftssystem Indiens völlig. Sie legten riesige Plantagen an, auf denen Tee, Baumwolle oder Jute angebaut wurde. Die indischen Bauern verloren ihr Land und verarmten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen bekamen nur einen Hungerlohn, während die Plantagenbesitzer mit dem Verkauf der Rohstoffe ein Vermögen verdienten. Aufstände der unterdrückten indischen Bevölkerung wurden mit Waffengewalt niedergeschlagen.
1947 erlangte BritischIndien seine Unabhängigkeit. Danach erfolgte eine Teilung in zwei Dominions: Indische Union und Pakistan.
1948 erlangte die Provinz Burma (das heutige Myanmar) im Osten Britisch-Indiens die Unabhängigkeit.
Verlag

Auswirkungen der Kolonialpolitik auf Indien
Indien war für das britische Empire eine der wertvollsten Kolonien und wurde oft als „die Perle der Krone“ bezeichnet. Die britische Herrschaft über Indien begann offiziell 1858, nachdem die Britische Ostindien-Kompanie jahrhundertelang Einfluss im Land gehabt hatte. Die Herrschaft der Briten brachte jedoch zahlreiche schwerwiegende Auswirkungen auf die indische Bevölkerung und Wirtschaft.

Wirtschaftliche Auswirkungen: Die britische Kolonialregierung richtete die indische Landwirtschaft auf den Anbau von Rohstoffen wie Baumwolle und Tee aus, was Hungersnöte verursachte, da weniger Nahrungsmittel produziert wurden. 1943 starben etwa 3 Millionen Menschen an einer Hungersnot. Zudem zerstörten britische Fabriken die indische Textilindustrie, was zur Verarmung vieler Handwerker führte.
Soziale und kulturelle Auswirkungen: Die britische Kolonialregierung setzte westliche Werte in Indien durch, indem sie das Rechtssystem und die englische Sprache einführte. Eine kleine, an englischen Schulen ausgebildete Elite übernahm Verwaltungsaufgaben, während die Mehrheit der Bevölkerung arm und ohne Zugang zu Bildung blieb. Viele indische Traditionen wurden unterdrückt, was zu Spannungen führte, die später Unabhängigkeitsbewegungen auslösten.
Infrastrukturelle Entwicklungen: Die britische Kolonialmacht baute Straßen, Eisenbahnen und Telegrafenlinien, die Indien wirtschaftlich halfen und das Land verbanden. Diese Infrastruktur diente jedoch vor allem dem Transport von Rohstoffen nach Großbritannien, wodurch der Nutzen für die indische Bevölkerung oft begrenzt war.
Politische Auswirkungen: Die Briten regierten Indien autoritär und unterdrückten jede Form des Widerstands. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts forderten indische Intellektuelle zunehmend Selbstbestimmung. Diese Bemühungen führten 1885 zur Gründung des Indischen Nationalkongresses, der eine Schlüsselrolle im Unabhängigkeitskampf spielte.
Kolonialpolitik in Afrika
1884 fand in Berlin die Westafrika-Konferenz statt, organisiert von Fürst Bismarck, um die Machtverhältnisse in Afrika zwischen europäischen Ländern und den USA zu klären. Afrikaner waren nicht vertreten. Europäische Mächte waren an wertvollen Bodenschätzen wie Kupfer, Gold und Diamanten interessiert und zwangen die Bevölkerung oft mit Gewalt zur Arbeit in Bergwerken und auf Plantagen.
Spezialfall Freistaat Kongo
Der Kongo wurde auf der Konferenz dem belgischen König Leopold II. als Privatbesitz übergeben. Henry Morton Stanley hatte zuvor „Kaufverträge“ mit einheimischen Führern abgeschlossen, meist ohne ihr Verständnis. Leopold kontrollierte ein Gebiet, das 75-mal größer als Belgien war, und kolonialisierte den Kongo gewaltsam. Die Bevölkerung musste Kautschuk abgeben, was den Anbau von Nahrungsmitteln erschwerte. Wer die Abgaben nicht leistete, wurde getötet, und Männer wurden durch die Entführung ihrer Frauen und Kinder zur Arbeit gezwungen. Aufstände gegen die Unterdrücker wurden brutal niedergeschlagen.

1908 sorgte ein Bericht über die Gräueltaten im Kongo international so sehr für Empörung, dass Leopold II. den Kongo an den belgischen Staat verkaufen musste. In der Kolonie Belgisch-Kongo wurde zwar die Zwangsarbeit abgeschafft, doch die Ausbeutung ging weiter.







Verlag
K2: Beschreibe die Landkarte und nenne mindestens drei europäische Länder mit Kolonien in Afrika im Jahr 1880!
Analysiere die kolonialisierten Regionen Afrikas und finde Gebiete, die im betrachteten Zeitraum unabhängig blieben!
Kennzeichne in der Karte die Regionen, die in diesem Zeitraum unabhängig blieben!
Vergleiche die Größe und Lage der Kolonien der verschiedenen europäischen Länder!
Analysiere, welche Kolonialmacht die größten Gebiete besaß und in welchen Regionen diese lagen!
Reflektiere die Gründe für den Ausschluss der Afrikaner bei der Aufteilung ihres Kontinents!
Erörtere die Auswirkungen der Kolonialisierung auf Afrikas heutige Situation!
Erstelle eigene Fragen zur Landkarte, um dein Wissen über die Kolonialisierung Afrikas zu erweitern, und finde Möglichkeiten, diese mit historischen Quellen zu beantworten!
Präsentiere deine Ergebnisse der Klasse! Wähle eine Form der Darstellung, z. B. ein Kurzvortrag, eine Mind-Map, ein Plakat oder eine Tabelle!
Sezession, die: bedeutet Abspaltung
Amerika im 19. Jahrhundert
In den Jahren 1861 bis 1865 fand in den USA ein Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten statt. Dieser Krieg wird auch Sezessionskrieg genannt. Dabei ging es um die Frage, ob die Sklaverei weiterhin erlaubt bleiben sollte.
Ursachen des Krieges
Beschreibe den Grundkonflikt zwischen Nord- und Südstaaten im Bürgerkrieg, besonders zur Bedeutung der Sklaverei und den unterschiedlichen Ansichten!
Erkläre, warum Lincolns Wahl 1860 zum Austritt der Südstaaten führte, welche Ziele er zur Sklaverei hatte und warum dies eine Bedrohung war!
Vergleiche die Wirtschaft von Nord- und Südstaaten und analysiere, wie die Unterschiede die Haltung zur Sklaverei beeinflussten!
Präsentiere deine Ergebnisse der Klasse!
Abb. 4: Beschreibe, was auf dem Bild zu sehen ist! Achte besonders auf:
• die Kleidung der Personen (weiße Gewänder, Masken)
• die Symbole (z. B. Flagge, brennendes Kreuz)
• die Stimmung der Szene (z. B. Bedrohung, Einschüchterung)
Erkläre, wie mit diesen Mitteln Angst verbreitet werden sollte! Halte deine Ergebnisse auf einem Plakat fest oder stelle sie der Klasse mündlich vor!
Ein wichtiger Grund für den Bürgerkrieg in den USA war der Streit um die Sklaverei. In den Südstaaten war die Sklaverei weit verbreitet, da auf den großen Baumwollplantagen viele Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Sklavinnen und Sklaven mussten dort hart arbeiten, und die Plantagenbesitzer wollten die Sklaverei behalten, weil sie so billige Arbeitskräfte hatten.
Die Nordstaaten hatten eine andere Meinung. Ihre Wirtschaft war moderner und von Fabriken geprägt. Sie fanden die Sklaverei unmenschlich und wollten, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Für sie war Sklaverei ein Verstoß gegen die Menschenrechte
Es gab aber noch mehr Gründe für den Krieg. Der Norden und der Süden hatten unterschiedliche Ideen, wie das Land regiert werden sollte. Der Süden wollte, dass die einzelnen Bundesstaaten mehr Entscheidungen treffen können, während der Norden wollte, dass die Regierung in Washington mehr Macht hat.
Verlag
Ein weiterer Streitpunkt war, ob es in den neuen Staaten, die zu den USA hinzukamen, Sklaverei geben sollte. Als Abraham Lincoln 1860 zum Präsidenten gewählt wurde, versprach er, die Ausbreitung der Sklaverei zu stoppen. Das führte dazu, dass viele Südstaaten aus der Union austraten und die Konföderierten Staaten von Amerika gründeten. All diese Konflikte führten schließlich zum Bürgerkrieg.
Der Verlauf des Krieges
Der Bürgerkrieg begann, als die Nordstaaten unter der Führung von Abraham Lincoln versuchten, die Union zu erhalten und die Südstaaten wieder in die USA zurückzuholen. Der Krieg dauerte vier Jahre und führte zu vielen blutigen Schlachten.
Die Folgen des Krieges
Nach dem Sieg der Nordstaaten wurde die Sklaverei abgeschafft , und die Sklavinnen und Sklaven erhielten ihre persönliche Freiheit. Allerdings bekamen sie nicht sofort die vollen Bürgerrechte, und viele von ihnen blieben weiterhin arm und benachteiligt.
In den Südstaaten gründeten sich radikale Gruppen wie der Ku-Klux-Klan, die die Freiheit der Schwarzen bekämpften. Der Ku-Klux-Klan verbreitete Angst und Schrecken, indem er rassistische Gewalt ausübte, Menschen bedrohte und auch ermordete. Diese Gruppe entstand nach dem Bürgerkrieg und hatte das Ziel, die gesellschaftliche Gleichstellung von Schwarzen zu verhindern. Bis heute existiert der Ku-Klux-Klan in manchen Teilen der USA und vertritt weiterhin extrem rassistische und menschenfeindliche Ideologien.
Abb. 4: Ku-Klux-Klan (1923, Pariser Tageszeitung „Le Petit Journal“)


Auswirkungen des Kolonialismus
Der Kolonialismus hatte große Auswirkungen auf die eroberten Länder in Afrika, Asien und Amerika. Die europäischen Mächte nutzten diese Gebiete, um Rohstoffe wie Gold, Silber, Zucker und Baumwolle nach Europa zu bringen. Dabei kontrollierten sie das Land und zwangen die einheimische Bevölkerung oft zu harter und schlechter bezahlter Arbeit. Dies führte zu Armut und sozialer Ungleichheit.
Die Kolonialherren unterdrückten auch die Kultur und Traditionen der einheimischen Bevölkerung. Europäische Werte und Religionen wurden durchgesetzt, während lokale Bräuche als „minderwertig“ angesehen und oft verboten wurden. Dadurch gingen die kulturelle Identität und das soziale Gefüge vieler Gesellschaften verloren.
Q2: Zerstörung der Lebensformen – Der deutsche Naturforscher Wilhelm von Humboldt notiert 1803 in seinem Tagebuch
Die Idee der Kolonie selbst ist eine unmoralische Idee, diese Idee eines Landes, das einem andern zu Abgaben verpflichtet ist, eines Landes, in dem man nur zu einem bestimmten Grad an Wohlstand gelangen soll. Je größer die Kolonien sind, je konsequenter die europäischen Regierungen in ihrer politischen Bosheit sind, umso stärker muss sich die Unmoral der Kolonien vermehren. Man sucht Sicherheit in der Uneinigkeit, man trennt die Kasten, man schürt Hass und ihre Streitigkeiten, man beklagt (heuchlerisch) ihren gegenseitigen Hasse, man. verbietet ihnen, sich durch Heiraten zu verbinden, man fördert die Sklaverei.
Aus: Alexander von Humboldt, Lateinamerika am Vorabend der Unabhängigkeitsrevolution, hrsg. Von Margot Falk, Berlin 1982, S. 65 (gekürzt)
Folgen für die indigene Bevölkerung
Verlag
Die indigene Bevölkerung, die seit jeher in den eroberten Gebieten lebte, litt besonders stark unter der Kolonialherrschaft. Viele Menschen wurden versklavt oder zur Zwangsarbeit auf Plantagen und in Minen gezwungen, oft unter katastrophalen Bedingungen. Die Kolonialmächte betrachteten die indigene Bevölkerung als „unzivilisiert“ und minderwertig, was zu massiver Diskriminierung führte.
Auch eingeschleppte Krankheiten wie Pocken und Masern trafen die einheimischen Völker schwer, da sie keine Abwehrkräfte dagegen hatten. Diese Seuchen breiteten sich schnell aus und richteten in vielen Gemeinschaften verheerenden Schaden an. Dadurch wurden die indigenen Gesellschaften nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesundheitlich und sozial stark geschwächt.
Verbreitung und Folgen von Rassismus durch den Kolonialismus
Der Kolonialismus sorgte dafür, dass sich Rassismus weltweit verbreitete. Rassismus bedeutet, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft als weniger wertvoll angesehen werden. Die europäischen Kolonialmächte nutzten diese Idee, um ihre Herrschaft und die Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung zu rechtfertigen.
Durch den Rassismus wurden viele Menschen diskriminiert und ausgegrenzt. Sie hatten weniger Rechte, wurden ausgebeutet und oft schlecht behandelt. Auch nach dem Ende des Kolonialismus blieben rassistische Vorurteile in vielen Ländern bestehen. Diese führen bis heute zu Ungerechtigkeiten, zum Beispiel bei der Arbeit, in der Schule oder im Umgang mit Behörden.
Die Folgen des Kolonialismus zeigen, wie wichtig es ist, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und für eine gerechte und gleiche Behandlung aller Menschen einzutreten. Nur so können alte Ungerechtigkeiten überwunden werden.
Kaste, die: Eine Kaste ist eine feste soziale Gruppe, in die Menschen hineingeboren werden. Diese Gruppe bestimmt oft ihren Beruf, ihre Heiratsmöglichkeiten und ihren sozialen Status. Kasten sind hierarchisch organisiert, wobei manche als „höher“ und andere als „niedriger“ gelten.
Q2: Erkläre, warum Wilhelm von Humboldt die Idee von Kolonien als unmoralisch betrachtet!
Vergleicht in Partnerarbeit Wilhelm von Humboldts Kritik mit der Realität in den Kolonien!
Beurteile, warum Wilhelm von Humboldt den Kolonialismus als „unmoralisch“ bezeichnet! Glaubst du, dass seine Kritik gerechtfertigt war? Begründe deine Meinung, indem du auf seine Aussagen eingehst!
Diskutiert in Vierergruppen, inwiefern die Trennung der Menschen in „Kasten“ und die Förderung von Hass in den Kolonien langfristige Folgen für die betroffenen Länder hatte!
Diskriminierung, die: Benachteiligung
Schreibe aus der Sicht einer Person, die während der Kolonialzeit von Diskriminierung betroffen war, einen kurzen Text über ihre Erfahrungen und Wünsche für eine gerechtere Zukunft!
Beurteilt in Partnerarbeit die Folgen des Kolonialismus auf die indigene Bevölkerung und die heutige Gesellschaft!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Hier siehst du Leopold II. von Belgien, wie er in einer zeitgenössischen Karikatur dargestellt wurde.
Entschlüssle diese Karikatur Schritt für Schritt mit der Methode M3 Karikaturen deuten (S. 52) in deinem Heft!
Beurteile, wie wirksam die Karikatur ist, um die Ausbeutung im Kongo darzustellen!
Glaubst du, dass die Menschen, die diese Karikatur 1906 gesehen haben, verstanden haben, was im Kongo geschah? Warum oder warum nicht?
Verlag
Abb. 5: König Leopold II. als Schlange umschlingt einen Gummisammler (Karikatur, 1906, Zeitschrift Punch)

Beurteile, ob und wenn ja, warum der Karikaturist König Leopold II. kritisch gegenübersteht!
Meine Meinung: Ich finde, dass
Begründung:
1 2 4 3
Welche Fragen hast du nach dem Betrachten der Karikatur? Welche Informationen würdest du gerne noch wissen? Erörtert in Partnerarbeit, welche weiteren Quellen hilfreich wären, um mehr über die Kolonialherrschaft von Leopold II. zu erfahren!
Löse dieses Rätsel!

waagrecht:
3. ein in der Verwaltung selbständiges Land des Britischen Reiches oder Commonwealth
4. Abspaltung
5. Möglichkeit, Waren zu verkaufen
6. gesetzlich anerkannt, rechtmäßig


senkrecht:
Verlag
1. Gesamtheit der Veränderungen durch Wissenschaft und Technik
2. Herrschaft eines Reiches über die Bevölkerung eines fremden Reiches
Untersuche die Karikatur von Queen Victoria und analysiere ihre Darstellung, Botschaft und Stilmittel in etwa 15 Sätzen! Tipp: Der Informationstext und die weiteren Aufgabenstellungen helfen dir dabei!

Diese nachträglich kolorierte Karikatur entstand 1876 und wurde im britischen satirischen Wochenmagazin „Punch“ veröffentlicht. Links ist der britische Premierminister Benjamin Disraeli zu sehen, rechts Königin Victoria.

a) Beschreibe die dargestellten Personen, ihre Kleidung und die Umgebung! Gehe darauf ein, wie die Landestracht des Premierministers und die Kleidung der Queen ins Bild gesetzt werden!
b) Analysiere, auf welches historische Ereignis sich die Karikatur bezieht! Erkläre, wie das Ereignis in der Karikatur dargestellt wird (positiv, negativ, neutral) und welche Absicht der Künstler damit verfolgen könnte!
c) Interpretiere die Bedeutung des Spruchs „New crowns for old ones“ und beurteile, welche Botschaft die Karikatur damit vermitteln will!
d) Untersuche, welche stilistischen Mittel der Übertreibung in der Karikatur eingesetzt werden, und beurteile, welche Wirkung diese auf die Betrachterin oder den Betrachter haben könnten!
e) Beurteile, wie die beiden dargestellten Personen (Premierminister und Queen) auf dich wirken!
f) Analysiere, welche Botschaft über ihre Rollen und Handlungen vermittelt wird und ob die Darstellung deine Wahrnehmung beeinflusst!
g) Diskutiere, wie Karikaturen wie diese genutzt werden können, um politische oder historische Ereignisse zu kommentieren oder zu kritisieren!
106 KOLONIALISMUS, IMERALISMUS UND RASSISMUS
4. DER VIELVÖLKERSTAAT ÖSTERREICH

Abb. 1: Franz Joseph I.
(Gemälde von Franz Xaver Winterhalter,1865, Wiener Hofburg)
neo: bedeutet „neu“ oder „erneuert“. Es bezeichnet etwas, das in einer neuen Form oder Interpretation auftritt, wobei es sich nicht zwingend an etwas Früheres anlehnen muss, sondern auch neue Ansätze oder Entwicklungen beschreiben kann, die mit alten Begriffen oder Konzepten verbunden werden. In diesem Fall wird „neo“ genutzt, um den Absolutismus in einer erneuerten Form zu beschreiben.
Tadel, der: Vorwurf
Hochverrat, der: Verbrechen gegen den eigenen Staat, zumeist mit Todesstrafe bedroht
Q1: Begründe anhand der Quelle, weshalb Franz Joseph als neoabsolutistischer Herrscher zu bezeichnen ist! Besprecht gemeinsam in der Klasse, wie in einer Demokratie mit Kritik an der Regierung umgegangen wird!
K1: Warum wurde die Doppelmonarchie als „Völkerkerker“ bezeichnet? Finde zu dieser Frage einen Erklärungsansatz! Vergleiche deine Erklärung mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn!
1848 begann die Regentschaft von Franz Joseph I. in Österreich. Der erst 18-jährige Kaiser regierte zu Beginn seiner Herrschaft absolut. Im Neoabsolutismus wurden alle Neuerungen, die Kaiser Franz Joseph I. durchführte, „von oben her verordnet“. Der Kaiser war niemandem verantwortlich, er allein ernannte und entließ die Regierung und die Minister. Das Volk wurde regiert und hatte keinerlei Mitspracherechte
Q1: Ausspruch Franz Josephs I. zu Feldmarschall Windisch-Graetz (14. April 1852)
Nun, wo mein Name allein unter allen Verordnungen steht, ist jeder Tadel von derlei Maßregeln Hochverrat.
Aus: Corti, Egon Caesar Conte; Sokol, Hans Hugo: Kaiser Franz Joseph. Wien (1960), S. 73.
In Westeuropa verlor Österreich Mitte des 19. Jh. außenpolitisch an Einfluss und Bedeutung. Innenpolitisch wurde der beginnende Nationalismus für die Donaumonarchie zu einem immer größeren Problem.
Donau
Verlag

K1: Vielvölkerstaat Österreich um 1911

Polen
Ungarn Italiener Deutsch-Österreicher Tschechen und Slowaken Serben, Kroaten, Bosnier Slowenen Ukrainer Rumänen
Im Staat Österreich lebten viele verschiedene Völker. Daher bezeichnete man ihn als „Vielvölkerstaat“. Die Völker der Monarchie, vor allem die Ungarn und Tschechen, forderten verstärkt die Gleichstellung mit den Deutschösterreichern.
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn
1867 stimmte Kaiser Franz Joseph einem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn zu, um innenpolitische Spannungen zu lösen. Die Monarchie wurde in zwei gleichberechtigte Reichshälften geteilt: die österreichische und die ungarische. Damit entstand die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn Im selben Jahr wurde Franz Joseph in Budapest mit der Stephanskrone zum König von Ungarn gekrönt.
Abb. 2: Stephanskrone, Ungarisches Parlament, Budapest

KOLONIALISMUS, IMERALISMUS UND RASSISMUS
Dieser Ausgleich brachte aber keine Lösung des Nationalitätenproblems. Vor allem die slawischen Völker der Donaumonarchie waren unzufrieden, da sie nicht die gleichen Rechte wie die Ungarn zugestanden bekommen hatten.
Zwei Reichshälften – ein Herrscher
FRANZ JOSEPH I.
PERSONALUNION
Kaiser v. Österreich u. König v. Ungarn k.u.k. Monarchie

REALUNION
gemeinsame Ministerien:
Außenministerium
Kriegsministerium
Finanzministerium

Österreichische Reichshälfte
Österreichische Regierung eigene Ministerien
Österreichischer Reichsrat

slawischen Völker der Donaumonarchie, die: Polen, Tschechen, Slowaken, Serben, Kroaten, Bosnier, Slowenen, Ukrainer, Rumänen




Ungarische Reichshälfte



EXEKUTIVE = Regierung: Minister setzen die Gesetze um.


Ungarische Regierung eigene Ministerien Ungarischer Reichstag

Abb. 3: Personal- und Realunion in der Doppelmonarchie
Das Ende des Neoabsolutismus



FRANZ JOSEPH I.


Verlag


ernennt ernennt


nimmt Gesetze an oder lehnt sie ab





LEGISLATIVE = Gesetzgebung: Reichstag beschließt die Gesetze.


JUDIKATIVE = Gerichtsbarkeit: Richter wachen über die Einhaltung der Gesetze.

HERRENHAUS
Adelige, vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt

ABGEORDNETENHAUS gewählte Volksvertreter (Zensuswahlrecht)


Q2: Ermittle, welcher Artikel bezieht sich auf die...
Beide Reichshälften der Doppelmonarchie waren gleichberechtigte, selbstständige Partner, die durch die Person desselben Herrschers verbunden waren. Dies nennt man eine Personalunion. Außerdem hatten die Reichshälften gemeinsame Ministerien. Dies nennt man eine Realunion.
Im Dezember 1867 erließ Kaiser Franz Joseph eine Verfassung für die österreichische Reichshälfte und beendete damit den Neoabsolutismus.
Q2: Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867
Art. 2: Vor dem Gesetz sind alle Staatsbürger gleich.
Art. 3: Die öffentlichen Ämter sind für alle Staatsbürger gleichzugänglich. [...]
Art. 5: Das Eigentum ist unverletzlich. [...]
Art. 8: Die Freiheit der Person ist gewährleistet. [...]
Art. 13: Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Die Presse darf weder unter Zensur gestellt werden, [...]
Art. 14: Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist jedermann zu gewähren.
Aus: http://www.verfassungen.de/at/at-18/stgg67-2 (20.9.2016)
Diese neu erlassene Verfassung enthielt auch das Wahlrecht für männliche Staatsbürger (Kurien- und Zensuswahlrecht).
Einige in dieser Verfassung enthaltenen Grundrechte sind noch heute Teil der österreichischen Bundesverfassung
Pressefreiheit
Gleichheit vor dem Gesetz
Glaubensfreiheit
Persönliche Freiheit
Wähle drei Artikel aus dem Staatsgrundgesetz von 1867 aus und stelle dar, welche Bedeutung sie in deinem Leben haben oder haben könnten!
Erläutere, warum Franz Joseph I. als neoabsolutistischer Herrscher gilt!
Analysiere, wie sich die Herrschaft von Franz Joseph I. im Laufe seiner Regentschaft verändert hat!
Beurteile abschließend, welche Herausforderungen Franz Joseph I. in seiner langen Regierungszeit bewältigen musste!
Präsentiert eure Ergebnisse der Klasse!
108 KOLONIALISMUS, IMERALISMUS UND RASSISMUS
5. DAS OSMANISCHE REICH – EIN VIELVÖLKERSTAAT
D1: Leben im Vielvölkerstaat
Religion spielte für die Gesellschaft eine wichtige Rolle. Aber auch Familie, Stammeszugehörigkeit, regionale Herkunft und Beruf bestimmten die Situation der Menschen. Absoluter Herrscher war der Sultan. Zwar verfügte er über ein Beratungsgremium und auch über Minister, aber es gab kein Parlament und keine andere Vertretung der Bevölkerung.
Aus: www.annefrank.de (2016)
regional: eine bestimmte Region betreffend
Gremium, das: zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe gebildete Gruppe von Expert/innen
D1: Beurteile, welche Rolle die Religion im Vielvölkerstaat gespielt haben könnte! Nutze die Information aus der Darstellung und ergänze eigene Überlegungen dazu, wie religiöse Überzeugungen das tägliche Leben, die Gesetze oder die gesellschaftliche Ordnung beeinflusst haben könnten!
Entwickle eigene Überlegungen, wie die fehlende parlamentarische Vertretung die Lebenssituation der Menschen in dieser Gesellschaft beeinflusst haben könnte!
K1: Liste auf, welche Gebietszuwächse es zwischen 1481 und 1683 gab! Verwende parallel dazu deinen Atlas und benenne die heutigen Ländernamen!
Rekonstruiere anhand der Karte die imperialistischen Ziele der Hohen Pforte!
Hohe Pforte, die: osmanische Regierung in Konstantinopel
Aufstieg zur Großmacht
Osman I. Gazi, der Anführer eines türkischen Stammes, begründete Ende des 13. Jh. die osmanische Dynastie und das Osmanische Reich. Sein Sohn Orhan I. führte ab 1326 den Titel Sultan. Nach und nach erweiterten die Herrscher des Osmanenreiches ihr Einflussgebiet.
HEILIGES RÖMISCHES REICH
Bosnien
Herze gowina
Serbien
Walachei
Bulgarien
Albanien
Verlag
Im 17. Jh. erreichte dieses Reich seine größte Ausdehnung. Es war wie die Habsburgermonarchie ein Vielvölkerstaat. Das Osmanische Reich erstreckte sich über ein riesiges Gebiet. Es umfasste fast den gesamten Balkan, die heutige Ukraine und die meisten arabischen Gebiete. Erst die Niederlage bei der zweiten Osmanenbelagerung vor Wien (1683) beendete den Vormarsch nach Mitteleuropa.
Rumelien Kurdistan
Konstantinopel
Mesopotamien Mazedonien

Osmanisches Reich 1481 Erwerbungen bis 1520 unter Suleiman I. 1520 – 1566 Erwerbungen bis 1683 tributpflichtige Staaten sind heller dargestellt
K1: Expansion und größte Ausdehnung des Osmanischen Reichs zwischen 1481 und 1681
Die Nationalitätenprobleme nehmen zu
Während des 19. Jh. wurde das Osmanische Reich immer mehr aus dem Kaukasus, aus der heutigen Ukraine sowie aus Südosteuropa verdrängt. Auch Gebiete wie Tunesien, Algerien und Ägypten sowie Zypern gingen verloren und kamen unter die Kontrolle europäischer Mächte.
Für den Vielvölkerstaat war der aufkeimende Nationalismus zu einem großen Problem geworden. Da sich in ganz Europa im 19. Jh. die nationale Idee durchsetzte, sahen sich immer mehr Bevölkerungsgruppen mit gleicher Sprache und Religion als eigenständige Nationen an.
Auch in den von den Osmanen besetzten Gebieten forderten die Völker mit Aufständen und nationalen Bewegungen verstärkt die Gründung eigener Nationalstaaten.
Von 1821 bis 1829 erkämpften die Griechen ihre Autonomie. Auch Länder wie Moldawien und die Walachei (Rumänien), Bulgarien, Serbien und Montenegro setzten ihre Unabhängigkeit durch. So verlor das Osmanische Reich innerhalb eines halben Jahrhunderts etwa die Hälfte seines ehemaligen Einflussgebietes.
Tanzimat – die inneren Reformen
Die militärischen Niederlagen führten zur Einleitung von Reformen. Diese werden „Tanzimat“ (Neuordnung) genannt.
2 Per Erlässen wurde allen Untertanen – unabhängig von ihrer Religion – das Recht auf Unverletzlichkeit der Person und des Eigentums zugestanden.
2 Erlassung eines Grundgesetzes 1876: Dieses brachte die Gleichstellung aller Bürger und auch die Einführung einer eingeschränkten konstitutionellen Monarchie mit Parlament.
2 Reformierung der Verwaltung und die Gründung neuer Schulen und Hochschulen
2 Einführung eines Pressewesens
Autonomie, die: Unabhängigkeit, Selbstständigkeit
Hochschule, die: Universität
D2: Griechenland und die Orientfrage
Die Griechen erhoben sich 1821 gegen die osmanische Herrschaft und erreichten nach blutigen Kämpfen 1829 ein unabhängiges, wenn auch noch kleines Königreich Griechenland. Der griechische Unabhängigkeitskampf hatte Erfolg, weil die Großmächte ihm gegenüber nicht mehr geschlossen auftraten: Russland, Frankreich und Großbritannien unterstützten ihn [...]. Denn sie wollten sich rechtzeitig einen Teil des schwachen und zerfallenden Osmanenreichs sichern.
Aus: Boesch, Joseph; Schläpfer, Rudolf; Utz, Hans: Weltgeschichte von 1500 bis zur Gegenwart. Zürich (2014), S. 85f.
Doch viele dieser Reformen hatten nicht lange Bestand. Sultan Abdülhamid II., der 1876 den Thron bestieg, regierte ab 1878 ohne Parlament. Oppositionelle und Intellektuelle ließ er von der Geheimpolizei verhaften oder schickte sie ins Exil.
Die Kritik an den herrschenden Zuständen führte 1876 zur Gründung einer Oppositionsbewegung, den Jungtürken. Dieser Geheimbund entwickelte sich immer mehr zu einer türkisch-nationalen Bewegung. Die Anhänger der Jungtürken sahen sich als bestimmende Nation und propagierten als Leitspruch: „Vaterland, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“.
Nach einer Revolution und einem Putsch wurden die Jungtürken zur beherrschenden Macht im Osmanischen Reich. Abdülhamid II. musste abdanken und sein Bruder Mehmed V. wurde neuer Sultan.
Im Ersten Weltkrieg (1914 – 1918) gehörte das Osmanische Reich dem Bündnis der Mittelmächte an und war damit auch mit Österreich-Ungarn verbündet. Nach der Niederlage 1918 setzte sich im Türkischen Befreiungskrieg eine Nationalregierung unter Mustafa Kemal Pascha durch. 1923 wurde als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches die Republik Türkei gegründet.
Olympe Verlag
Abb. 1: Mustafa Kemal Pascha am Tag der Ausrufung der Republik Türkei (1923)


Intellektuelle, die/der: Gebildete/r
D2: Bewerte die Unterstützung Russlands, Frankreichs und Großbritanniens im griechischen Unabhängigkeitskampf hinsichtlich der möglichen Interessen dieser Mächte! Vergleiche die Rolle der Großmächte im griechischen Unabhängigkeitskampf mit der internationaler Mächte in heutigen Konflikten wie Syrien oder Ukraine! Erläutere die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Großmächte in beiden Fällen! Beurteile, warum der griechische Unabhängigkeitskampf erfolgreich war! Gehe dabei auf die Rolle der Großmächte und den Zustand des Osmanischen Reiches ein! Nutze die Informationen aus der Darstellung und ergänze eigene Überlegungen! Präsentiere deine Ergebnisse der Klasse!
propagieren: für etwas werben oder sich einsetzen
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies zuerst diese Darstellung und folge dabei der Anleitung!
a) Lies den Text zweimal durch!
b) Unterstreiche danach wichtige Schlüsselwörter!
c) Markiere mit unterschiedlichen Farben die Aussagen zu den beiden Staaten!
D3: Der Zerfall zweier Imperien – von Eva Obermüller (science.ORF.at)
Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich waren sich vor dem ersten Weltkrieg recht ähnlich. Die beiden Imperien besaßen eine vergleichbare innere Struktur. Es waren monarchistisch geprägte, multiethnische Reiche. Beide hatten mit inneren Konflikten zu kämpfen, allen voran das Nationalitätenproblem. Die Tagespolitik in den Parlamenten von Wien und Budapest wurde zu 60 oder 70 Prozent von Debatten über Nationalitätenrechte dominiert. Die wichtigsten Brennpunkte im Nationalitätenkonflikt waren nach dem Ausgleich Böhmen und Mähren, wo Tschechen und Deutsche zusammenlebten. Im Osmanischen Reich wiederum gab es Streitigkeiten zwischen den Osmanisten, die eine eigenständige imperiale Identität wollten, und den vom europäischen Nationalismus beeinflussten Jungtürken sowie anderen nationalen Bewegungen an der Peripherie des Imperiums. Trotz Verteilungsproblemen war auch die wirtschaftliche Lage stabil. Dennoch war die Krisenstimmung in beiden Reichen schon seit Ende des 19. Jahrhunderts allgegenwärtig. Dies zeigen Zeitungsberichte aus der Zeit vor 1914, in denen eine gewisse Schwarzmalerei und Untergangsstimmung vorherrschte, welche die gesamte Gesellschaft prägte. Schon vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren die beiden Großmächte aber auch außenpolitisch schwer angeschlagen und galten als die schwächsten Imperien. Das Osmanische Reich hatte in den Balkankriegen einen enormen Machtverlust erlitten und dort fast alle europäischen Territorien verloren. Diese neu erstarkten Nationalstaaten, die sogenannten Balkanstaaten, wandten sich dann gegen Österreich-Ungarn. Auch insofern gab es eine klare Gemeinsamkeit zwischen den Imperien, denn beide waren in der Defensive gegenüber den Balkanstaaten. Bearbeitet nach: http://sciencev2.orf.at/stories/1731782//index.html (3.10.2016)

multiethnisch: viele Ethnien umfassend
Ethnie, die: Menschengruppe mit einheitlicher Kultur
Brennpunkt, der: Mittelpunkt
Peripherie, die: Randgebiet allgegenwärtig: überall und immer da sein
Schwarzmalerei, die: eine allzu hoffnungslose Darstellung
Balkankriege, die: zwei Kriege am Balkan; 1912 und 1913
Territorium, das: Herrschaftsbereich
Defensive, die: Abwehr, Verteidigung
Kreuze nun an, welche Aussagen auf beide Staaten oder auf die Einzelstaaten passen! beide Österreich-Ungarn Osmanisches Reich
Die Balkanstaaten verlangten ihre Unabhängigkeit.
Alle europäischen Territorien gingen verloren.
In den Parlamenten wurde zum Großteil über das Nationalitätenproblem debattiert.
Die Herrschaftsform war die Monarchie.
Es lebten viele unterschiedliche Ethnien im Reichsgebiet.
Eine imperiale Identität wurde angestrebt.
Der europäische Nationalismus beeinflusste die „Jungtürken“.
Zeitungsberichte gaben eine Untergangsstimmung wieder.
Olympe Verlag
Brennpunkte waren Böhmen und Mähren.
Bewertet in Partnerarbeit, inwiefern die inneren und äußeren Probleme von Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich zu ihrem Zerfall beigetragen haben, und zieht Parallelen zu Herausforderungen, vor denen heutige multiethnische Staaten stehen! Präsentiert eure Ergebnisse in Form einer Mind-Map!
geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
4
Rekonstruiere anhand der Darstellung den Umgang der türkischen Regierung mit den Armenierinnen und Armeniern sowie den Umgang der britischen Regierung mit den Kurdinnen und Kurden! Achte darauf, welche Maßnahmen und Einstellungen die jeweiligen Regierungen gegenüber diesen Volksgruppen hatten! Welche Gründe und Interessen könnten hinter dem Verhalten der beiden Regierungen stecken?
D4: Zwei Völker als Verlierer
Die alteingesessenen armenischen und kurdischen Bevölkerungsgruppen waren die eigentlichen Verlierer bei der Auflösung des Osmanischen Reichs. Beide hatten nämlich darin eine gewisse kulturelle Selbstständigkeit und politische Autonomie genossen. Nun richtete sich das türkische Nationalbewusstsein vor allem gegen die selbstbewussten christlichen Armenier, die in Wirtschaft und Verwaltung einflussreiche Positionen bekleideten. Schon während des Ersten Weltkriegs hatte die Armee den Kampf gegen eine russische Invasion über armenisches Gebiet dazu benutzt, um am armenischen Volk einen eigentlichen Genozid, einen Völkermord, zu verüben. Sie trieb die Männer zusammen, entwaffnete und erschoss sie und trieb die enteigneten Frauen und Kinder auf bis zu 1800 Kilometer langen Todesmärschen in die syrische Wüste. Vermutlich gegen [Anmerkung: ca.] eine Million Menschen, mehr als die Hälfte der armenischen Bevölkerung, kam ums Leben. Nach dem Krieg bemühten sich die Siegermächte nur halbherzig um die Gründung eines unabhängigen Armenien. Als sich Sowjetrussland und die Türkei 1921 über dessen Aufteilung einigten, ging der dreijährige armenische Staat wieder verloren. Heute leben drei Millionen Armenier/innen im 1991 unabhängig gewordenen, verkleinerten Staat, aber 7,7 Millionen verstreut über die Welt. Auch das kurdische Volk wurde im Stich gelassen. Im Vertrag von Sevres von 1920 versprachen die Siegermächte den unter ehemals osmanischer Herrschaft lebenden Kurden und Kurdinnen Autonomie, ja sogar Unabhängigkeit [...]. Schon drei Jahre später ließen die Siegermächte im Vertrag von Lausanne zu, dass die Kurden auf schließlich fünf Staaten verteilt und die kurdische Sprache und Selbstverwaltung vor allem in der Türkei systematisch unterdrückt wurden. Denn Großbritannien wollte die wasser- und ölreiche Provinz um Kirkuk nicht an einen starken kurdischen Staat verlieren.
Aus: Boesch, Joseph;
Türkische Regierung:
Britische Regierung:
5
Untersuche die Postkarte anhand folgender Aufgaben! Arbeite in deinem Heft!
a) Analysiere, welches Bündnis auf der Postkarte dargestellt wird, und identifiziere die abgebildeten Herrscher sowie ihre Länder!
b) Beurteile den politischen Zweck der Postkarte im Zusammenhang ihres Entstehungsjahres und der historischen Situation!
c) Interpretiere den Spruch auf der Banderole „Vereinte Kräfte führen zum Ziel“ und erläutere, welche Botschaft die Postkarte damit vermitteln möchte!
d) Analysiere die Darstellung der Herrscher auf der Postkarte!
Olympe Verlag

Invasion: feindliches Einrücken von militärischen Einheiten in ein fremdes Gebiet
e) Beurteile, welche Stimmung die Postkarte vermittelt und wie diese Darstellung die Wahrnehmung des Bündnisses bei den Betrachterinnen und Betrachtern beeinflussen könnte! Nutze dazu auch eigene Überlegungen zur Wirkung von Farben, Symbolen und Personen auf der Postkarte!

Abb. 2: von links nach rechts: Wilhelm II. / Deutsches Reich, Franz Josef I. / Österreich, Mehmet V. / Osmanisches Reich, Ferdinand I. / Bulgarien (Postkarte 1916)
BONUS-SEITE ALLTAG, KUNST UND KULTUR IM VIELVÖLKERSTAAT ÖSTERREICH-UNGARN
Historismus, der: Nachahmung griechischer, gotischer und barocker Baustile
Abb. 1 + 2: Vergleiche die Malstile und beschreibe die Unterschiede, die dir auffallen!
Abb. 3: Interpretiere den Spruch, der auf der Sezession zu lesen ist! Was wollten die Künstler/innen ihren Zeitgenossen mitteilen?
Vergleiche deine Ergebnisse mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler!

„Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit!“
Kunst und Kultur
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. stieg Wien als Hauptstadt des Vielvölkerstaates zum kulturellen Mittelpunkt des Reiches auf und entwickelte sich zu einer Großstadt. 1857 ließ Kaiser Franz Joseph I. die mittelalterliche Stadtmauer schleifen und an deren Stelle die Wiener Ringstraße erbauen. Entlang dieser Prachtstraße entstanden Bauwerke im Stile des Historismus wie die Votivkirche, das Rathaus, die Universität, die Staatsoper und das Parlament.
Gegen Ende des 19. Jh. schlossen sich junge Künstlerinnen und Künstler aus Protest gegen den Historismus in der Künstlervereinigung Sezession zusammen. Diese neue Kunstrichtung, der Wiener Jugendstil, zeichnete sich durch viele Ornamente und geschwungene Linien und Muster aus. Berühmte Vertreter des Jugendstils waren der Architekt Otto Wagner und der Maler Gustav Klimt.
Verlag


Abb. 3: Wiener Sezession mit Inschrift (erbaut 1898)
Bettgeher, der: Untermieter, der nur eine Schlafstelle benützen darf
Palais, das: französisches Wort für Palast, Stadtschloss
Gänsehäufel, das: Strandbad an der Alten Donau in Wien


Alltag in der Großstadt Wien
Großbauvorhaben wie der Bau der Stadtbahn, die Wienfluss- und Donauregulierung und die Errichtung von Geschäfts- und Wohnhäusern ließen viele Arbeiterinnen und Arbeiter ab der zweiten Hälfte des 19. Jh. aus allen Teilen der Monarchie nach Wien kommen. Aufgrund der Wohnungsnot entstanden in den Vorstädten Zinskasernen mit Zimmer-Küche-Wohnungen, in denen kinderreiche Familien wohnten. Um sich die Miete leisten zu können, nahmen sie Untermieterinnen und Untermieter auf, die nur eine Schlafstelle in der Wohnung zum Benützen hatten. In Wien gab es um 1900 ca. 66.000 sogenannter Bettgeher. Die schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen und die unzureichende ärztliche Versorgung führten dazu, dass Krankheiten (z. B. Tuberkulose) viele Todesopfer forderten. Betroffen waren vor allem Kinder unter fünf Jahren. Starken politischen Einfluss hatte nach wie vor nur der Adel. Der gesellschaftliche Alltag wurde aber vom Bürgertum bestimmt, das vom wirtschaftlichen Aufschwung am meisten profitiert hatte. Wohlhabende Bürger ließen sich prachtvolle Palais bauen, die auf den zum Kauf angebotenen Gründen zwischen den Prachtbauten der Ringstraße errichtet wurden. Prunkvolle Feste, Theater- und Opernbesuche bestimmten ihren Lebensalltag. Die einfachen Leute aber besuchten den Prater, das Gänsehäufel und Sportplätze. Freizeitorganisationen wie die Naturfreunde entstanden.
So schätze ich mich nach dem Großkapitel „KOLONIALISMUS, IMPERIALISMUS UND RASSISMUS“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…die Auswirkungen des Kolonialismus benennen.
…über die Folgen des Kolonialismus für die indigene Bevölkerung reflektieren.
…den Begriff „imperialistische Politik” definieren.
…mich mit Rassismus und seinen Folgen auseinandersetzen.
…die Auswirkungen der englischen Kolonialpolitik auf Indien erläutern.
…über die Kolonialpolitik der Europäer in Afrika berichten.
…die Kolonialpolitik der Belgier im Kongo bewerten.
…die Gründe für den amerikanischen Bürgerkrieg nennen.
…die beiden Vielvölkerstaaten Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich miteinander vergleichen.
…die Herrschaft Kaiser Franz-Joseph I. reflektieren.
…jene Staaten, die nach Unabhängigkeit strebten, benennen.
…Gründe für den Zerfall der beiden Vielvölkerstaaten anführen.
Buchtipps

Verlag


Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
Howard W. French: Afrika und die Entstehung der modernen Welt: Eine Globalgeschichte (Klett-Cota 2023).
Frank Maria Reifenberg: An den Ufern des Orowango: Gustavs und Kulus abenteuerliche Reise zum Kongo (Ueberreuter Verlag 2023).

Kathrin Schrocke: Weiße Tränen (mixtvision Mediengesellschaft mbH 2023).









1. MIGRATION – INTEGRATION – ASYL
Weltweite Migration
Teilt euch in zwei Gruppen auf! Eine Gruppe analysiert die Auswirkungen von Auswanderung auf den Staat, der Menschen verliert, die andere die Folgen von Einwanderung für den aufnehmenden Staat!
Jede Gruppe erstellt ein Plakat oder eine kurze Präsentation, in der die wichtigsten Ergebnisse dargestellt werden!
Abb. 1: Ergänze Abb. 1 um je zwei weitere Pushund Pullfaktoren!
Abb. 2: Reflektiert in Partnerarbeit, welche Botschaft das Plakat vermitteln soll, und beurteilt die Haltung der Gestalterin/des Gestalters zum Thema Flucht!
Besprecht in Gruppen die Herausforderungen für die Familie und das Zielland! Entwickelt realistische Lösungsstrategien und diskutiert, welche zusätzlichen Maßnahmen hilfreich sein könnten!

„Asyl ist Menschenrecht“ (Pro Asyl Deutschland, 2016)
Status, der: Stellung
Nach einer Definition der UNO sind Migranten Personen, die ihren Wohnsitz für mindestens ein Jahr in das Ausland verlegen. Die Gründe, warum jemand seinen Wohnort verlegt, sind für diese Definition jedoch nicht von Bedeutung.
Weltweit leben derzeit ca. 200 Millionen Menschen nicht in dem Land, in dem sie geboren wurden. Das sind etwa drei Prozent der Weltbevölkerung. Verlassen Menschen ihre Heimat, um in ein anderes Land zu ziehen, spricht man von Emigrantinnen und Emigranten. Im Gegensatz dazu sind Immigrantinnen und Immigranten Personen, die sich in ihrer neuen Heimat ansiedeln. Migration wird auch immer von verschiedenen Faktoren bestimmt: Menschen werden einerseits von einem Gebiet oder dem Land, in dem sie leben „weggedrückt“ (push), oder andererseits von einem anderen Gebiet „angezogen“ (pull).
Krieg, Verfolgung, Armut, keine oder nur schlecht bezahlte Arbeit, politische Instabilität, Naturkatastrophen
Friede, Sicherheit, bessere Lebensbedingungen, Arbeitsplätze, politische Stabilität
Abb. 1: Darstellung der Push- und Pullfaktoren
Binnenmigration
Verlegt jemand seinen Wohnsitz innerhalb ein und desselben Staates, so spricht man von Binnenmigration. Diese ist wesentlich häufiger als internationale Migration.
Flucht und Vertreibung
Unter Flucht versteht man das meist überstürzte Verlassen einer akuten Gefahrensituation. Die Flüchtlinge treffen die Entscheidung, ihre Heimat zu verlassen, daher nicht freiwillig, sondern weil ihr Leben bzw. ihre Gesundheit in Gefahr sind. Werden die Menschen gezwungen, ihr Land zu verlassen, spricht man von Vertreibung. Flüchtlinge haben unter allen Migrantinnen und Migranten einen speziellen Status, da sie besonderen Schutz brauchen.
Menschenrecht Asyl – Die Genfer Flüchtlingskonvention
Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), offiziell „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“, legt fest, wer als Flüchtling gilt. Ein Flüchtling ist ein Mensch, der sein Herkunftsland verlassen muss, weil er dort verfolgt wird.
Das Flüchtlingswerk der UNO (UNHCR) nennt verschiedene Gründe für Flucht: religiöse, soziale, politische, rassistische oder ethnische Verfolgung. Auch Gewalt, Bürgerkriege und Naturkatastrophen zählen zu den häufigsten Ursachen, warum Menschen ihr Land verlassen müssen. Dieser Schutz durch das Asylrecht ist ein wichtiger Bestandteil der Menschenrechte und stellt sicher, dass Flüchtlinge in anderen Ländern aufgenommen und geschützt werden können.
Sucht in Partnerarbeit Beispiele aus der Geschichte oder aus aktuellen Nachrichten, die zu den Fluchtgründen passen (z. B. Bürgerkriege oder Naturkatastrophen)!
Beschreibt, wie diese Ereignisse Menschen zur Flucht gezwungen haben!
D1: Sudan: Die vergessene humanitäre Katastrophe (Deutschlandfunk, 11. 3. 2024 – gekürzt)
Q1: Parlamentsrede des damaligen Außenministers Sebastian Kurz (21. Juni 2017) Der Sudan steht nach UN-Angaben vor der weltgrößten Hungerkrise: […] Im Sudan tobt ein blutiger Machtkampf zwischen Machthaber Abdel Fattah Abdelrahman Burhan und seinem ehemaligen Vize Mohammed Hamdan Daglo.
Wegen der seit April 2023 andauernden Kämpfe sind Millionen Menschen auf der Flucht und von Hunger bedroht. Die humanitäre Lage im Sudan ist katastrophal. Die medizinische Versorgung ist vielerorts zusammengebrochen, Menschen leiden unter Hunger und werden selbst zum Opfer von militärischen Attacken. […] Außerdem verschärfe sich die Lage in den Nachbarstaaten Südsudan und Tschad. Dort haben sich Hunderttausende vor den Kämpfen im Sudan in Sicherheit gebracht. […] Laut der UNO-Flüchtlingshilfe sind infolge des Konflikts 1,6 Millionen Menschen unter anderem in die Nachbarländer Tschad, Ägypten und den Südsudan geflohen. Gut sechs Millionen Menschen sind innerhalb des Landes vor der Gewalt auf der Flucht.
Aus: Warum im Sudan gekämpft wird (deutschlandfunk.de) (16. 3. 2024)
Asyl in Österreich
Wenn wir [Anmerkung: Europäische Union] Druck machen würden auf die afrikanischen Staaten und ihnen Entwicklungsgelder bzw. andere europäische Fördergelder streichen würden, wenn sie nicht bereit sind, Flüchtlinge zurückzunehmen, würden die ihre Politik ändern.
Aus: Oberösterreichische Nachrichten, 22. Juni 2017
Um in Österreich Asyl, also Schutz vor Verfolgung, zu bekommen und damit als Flüchtling anerkannt zu werden, müssen die Asylwerberinnen und Asylwerber in einem Asylverfahren nachweisen, dass sie in ihrem Heimatort persönlich verfolgt werden. Sobald das Asylverfahren positiv abgeschlossen ist, werden die betroffenen Personen als Flüchtlinge anerkannt. Dadurch dürfen sie dauerhaft in Österreich bleiben und erhalten viele, aber nicht alle Rechte und Pflichten, die auch für Österreicherinnen und Österreicher gelten. Zum Beispiel haben sie kein Wahlrecht.

Rechte und Pflichten von Asylberechtigten in Österreich

Asylberechtigte in Österreich haben das Recht auf dauerhaften Schutz, Arbeit, Bildung und soziale Unterstützung. Sie dürfen Wohnungen frei wählen und ihre Familie nachholen. Gleichzeitig haben sie die Pflicht, sich an die Gesetze zu halten, Deutsch zu lernen und aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen.
Abb. 3: minderjährige Flüchtlingskinder (2023)
D2: 51.000 geflüchtete Minderjährige vermisst Stand: 30.04.2024 06:00 Uhrwww.tagesschau.de
51.433 minderjährige Geflüchtete werden aktuell in ganz Europa vermisst. Das ergibt eine exklusive Datenrecherche des europäischen Journalistennetzwerks „Lost in Europe“, […] Noch vor drei Jahren lag diese Zahl bei etwa 18.300. […] Während einige Länder wie Italien und Österreich besonders drastische Zahlen melden, mit jeweils mehr als 20.000 verschwundenen Kindern und Jugendlichen, sammeln andere wie zum Beispiel Spanien oder Griechenland gar keine Informationen über unbegleitete Kinder und Jugendliche.
Olympe Verlag
D1: Fasse den Bericht mit eigenen Worten zusammen!
Erläutere, welche Gründe laut Darstellung dazu führen, dass Menschen aus dem Sudan fliehen müssen! Beurteile, welche dieser Gründe besonders schwerwiegend sind und warum!
Erörtert gemeinsam, was die humanitäre Krise im Sudan für die Nachbarländer bedeutet! Formuliere eine Frage zu den politischen, humanitären oder regionalen Folgen des Konflikts!
Q1: Beurteile, wie du die Aussage von Sebastian Kurz über den Umgang mit afrikanischen Staaten und Flüchtlingspolitik einschätzt! Gehe dabei auf mögliche Folgen für die betroffenen Länder und für die Europäische Union ein!
D2: Arbeite die wichtigsten Daten im Zusammenhang mit minderjährigen Flüchtenden heraus!
Erkläre, warum sich Kinder und Jugendliche alleine auf die Flucht begeben!
Aus: Europaweit werden 51.000 geflüchtete Minderjährige vermisst | tagesschau.de (4. 10. 2024)
Erörtert gemeinsam, welchen möglichen Gefahren Minderjährige auf der Flucht ausgesetzt sein könnten!
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies zunächst diesen Text zum Thema „Integration“! Mache dich ebenso schlau mit der Infobox!
Die Integration von Migrantinnen und Migranten bedeutet, dass Menschen, die in ein neues Land ziehen, in die Gesellschaft aufgenommen werden und aktiv daran teilhaben können. Ziel der Integration ist es, dass Migrantinnen und Migranten Zugang zu den gleichen Rechten und Möglichkeiten wie Einheimische haben, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung. Ein wichtiger Teil der Integration ist auch, dass Migrantinnen und Migranten die Sprache des neuen Landes lernen und sich mit den kulturellen Gepflogenheiten vertraut machen. Gleichzeitig sollen ihre eigene Kultur und Identität respektiert werden. Integration bedeutet nicht, dass Migrantinnen und Migranten ihre Kultur aufgeben müssen, sondern dass sie in die neue Gesellschaft eingebunden werden, während Vielfalt und gegenseitiger Respekt gefördert werden. Integration findet auf verschiedenen Ebenen statt, zum Beispiel in der Schule, am Arbeitsplatz oder im täglichen Leben. Sie erfordert die Zusammenarbeit von Regierungen, Bildungseinrichtungen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und der Gesellschaft insgesamt, um den Menschen zu helfen, sich im neuen Land zu Hause zu fühlen.
Eigendarstellung

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Bei diesem geht es um die europaweite Vergleichbarkeit der jeweiligen Sprachkenntnis: A2-Niveau beschreibt die elementare Sprachanwendung (Person kann einfache Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen), B1-Niveau definiert die Beherrschung der Standardsprache.
Subsidiär Schutzberechtigte: Krieg ist nicht automatisch ein Asylgrund. Menschen, die aus einem Kriegsgebiet fliehen, erhalten einen sogenannten subsidiären Schutz. Dieser muss in regelmäßigen Abständen verlängert werden.
Lies den Text zum Thema „Integration“ und nutze die Infobox, um die Begriffe „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen“ und „subsidiär Schutzberechtigte“ besser zu verstehen. Schreibe zu jedem Begriff eine kurze Erklärung in eigenen Worten!
Erkläre, warum Integration sowohl für Migrantinnen und Migranten als auch für die Gesellschaft wichtig ist! Gehe darauf ein, wie Sprache, Bildung und gegenseitiger Respekt zur Integration beitragen können! Präsentiere deine Ergebnisse der Klasse!
Beurteile, welche Rolle das Sprachniveau (A2 oder B1) für die Integration spielt!
Nenne zwei Beispiele, wie Integration in deiner Schule oder deinem Wohnort stattfinden kann! Erstelle zusätzlich eine kurze Checkliste mit Maßnahmen, die es Menschen aus anderen Ländern erleichtern, Anschluss in der Schule oder im Sportverein zu finden!
Verfasse eine Reportage für die Schülerzeitung „Pause aktiv“ zum Thema Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern in Österreich! Gehe dabei auf folgende Punkte ein: wesentliche Bedingungen für eine gelungene Integration – Situation von subsidiär Schutzberechtigten – Bedeutung des Spracherwerbs Stelle dir vor, du müsstest wie viele Geflüchtete alles zurücklassen und in einem fremden Land neu anfangen. Notiere in Stichwörtern, welche Schwierigkeiten du dabei hättest!
Vergleiche diese Situation mit deinem aktuellen Alltag und schreibe drei Privilegien auf, die du im Vergleich zu Geflüchteten hast und die dir dabei bewusst werden!
Erkläre folgende wichtige Begriffe mit eigenen Worten in deinem Heft! ASYL – GENFER FLÜCHTLINGSKONVENTION – BINNENMIGRATION

Besprich in der Klasse, welche Rechte für geflüchtete Menschen wichtig sind – zum Beispiel Schutz, Unterkunft oder Zugang zu Bildung! Nenne anschließend Rechte, die für dich ganz selbstverständlich sind!

Mein Migrationsstammbaum – Recherchiere in deiner Familie, ob Familienmitglieder jemals migriert sind! Es kann dies einerseits vom Land in die Stadt oder umgekehrt (Binnenmigration), aber auch von einem anderen Land nach Österreich sein. Auch wäre es möglich, dass ein Familienmitglied Österreich verlassen hat. Trage deine Ergebnisse in deinen persönlichen Migrationsstammbaum ein!
OPA
geboren in:
aufgewachsen in:
derzeit wohnhaft in:
geboren in:
aufgewachsen in:
derzeit wohnhaft in:
OPA
geboren in:
aufgewachsen in:
derzeit wohnhaft in:
Verlag
geboren in:
aufgewachsen in:
derzeit wohnhaft in:
ELTERNTEIL 1
geboren in:
aufgewachsen in:
derzeit wohnhaft in:

geboren in:
aufgewachsen in:
ELTERNTEIL 2
geboren in:
aufgewachsen in:
derzeit wohnhaft in: ICH
derzeit wohnhaft in: Dein Foto

Woher komme ich? – Stellt in Form eines kurzen Referats eure Familiengeschichte der Klasse vor! Präsentiert dazu auch Fotos und Gegenstände!
Reflektiere, inwiefern deine eigene Meinung zur Integration durch Gespräche, Medien oder Schule geprägt wurde!
M6 STATISTIKEN UNTERSUCHEN
Historikerinnen und Historiker verwenden für ihre Arbeit neben Bild- und Textquellen auch immer wieder Statistiken. Diese Statistiken können dabei helfen, Zahlen und Daten besser zu verstehen und diese auch mit anderen Daten zu vergleichen. Um Statistiken zu untersuchen, muss man verstehen, wie sie erstellt
werden und welche Informationen sie liefern. Die Arbeit mit Diagrammen, Tabellen und Grafiken sollte dir bereits aus dem Deutschunterricht bekannt sein. Ebenso die verschiedenen Diagrammtypen, wie Balken- oder Kreisdiagramme.
1. SCHRITT: Die Statistik genau beschreiben
Fasse alle wesentlichen Informationen, die die Statistik enthält, zusammen!
Wie lautet die Überschrift? Welche Informationen lassen sich daraus ablesen?
Gibt es eine Legende und wenn ja, was sagt diese aus? Welchen Zeitraum behandelt die Statistik? Über welche Länder/Regionen/Gebiete berichtet die Statistik?
2. SCHRITT: Die Statistik verstehen
Gehe nun auf die Details der Statistik ein!
Wie wird die Statistik dargestellt? (Tabelle, Säulendiagramm, Kreisdiagramm, Liniendiagramm?)
Ist die Darstellungsform übersichtlich? Wie werden Zahlen angegeben – in absoluten Zahlen oder in Prozentsätzen? Wird ein Sachverhalt dargestellt oder werden mehrere Sachverhalte miteinander verglichen?
3. SCHRITT: Die
Statistik untersuchen
Kläre dazu folgende Fragen!
Welche Entwicklungen werden durch die Statistik deutlich? Gibt es extreme Werte bzw. auffallende Veränderungen? Welche Entwicklungen kann man aus der Statistik ablesen? Fehlen eventuell Daten? Woran könnte das liegen?
4. SCHRITT: Deutung und Bewertung
Nimm eine abschließende Bewertung der Statistik vor! Benötigt man weitere Informationen? Welche Ergebnisse kann man zusammenfassen? Welche Schlüsse kann man aus den Daten ziehen? Ist die Statistik hilfreich beim Erklären der Zusammenhänge? Warum wurde diese Statistik erstellt? Gab es ein bestimmtes Ziel oder eine Botschaft, die vermittelt werden sollte? Könnte die Auswahl oder Darstellung der Daten beeinflusst worden sein, um bestimmte Ergebnisse oder Meinungen zu unterstützen?
Untersuche die folgende Statistik in deinem Heft anhand der vier Schritte!
Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Zuwanderergenerationen
2. WIEN IM 19. JAHRHUNDERT – ZENTRUM DER ZUWANDERUNG
Im 19. Jh. übte Wien auf Zuwanderinnen und Zuwanderer aus den Gebieten der Habsburgermonarchie eine große Anziehungskraft aus.
Einerseits waren 1781 die Leibeigenschaft und die Schollenpflicht aufgehoben worden, weshalb es vielen in der Landwirtschaft tätigen Menschen erst möglich war, ihre Heimat zu verlassen. Andererseits gab es in vielen ländlichen Gebieten der Monarchie aufgrund der zunehmenden Industrialisierung immer weniger Arbeit. In Wien hingegen fanden die Zuwanderinnen und Zuwanderer vor allem in der Bau- und Textilindustrie Arbeit.
Sie siedelten sich in neu entstehenden Massenquartieren in der Vorstadt an. Die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Massenquartieren waren katastrophal.
Die Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter am Wienerberg
Die größte Gruppe der Zuwanderinnen und Zuwanderer bildeten die Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter am Wienerberg. In den dortigen Ziegelwerken wurden Ziegel für die Bauten der Wiener Ringstraße und die Modernisierung der Stadt hergestellt.
Verlag

Die meisten dieser Arbeiterinnen und Arbeiter stammten aus Böhmen und Mähren
In den Ziegelwerken leisteten diese Menschen Schwerstarbeit und zwar ohne jede soziale Absicherung.
D1: Wohnungselend der Ziegelarbeiter/innen
[…] den 1870er Jahren verschlimmerte sich die Situation. Die Küchen wurden herausgerissen, die Räume mit 40 bis 50, manchmal sogar mit bis zu 70 Personen vollgestopft, die teilweise am nackten Fußboden schliefen.
Die Menschen hatten kaum Luft zum Atmen. Schmutz, Gestank und Lärm waren allgegenwärtig. Sogar Ringöfen und Pferdeställe dienten, vorwiegend für ledige junge Männer – auch „Ringspatzen“ genannt – als Schlafstätten. In Erzählungen wird immer wieder berichtet, dass in einer Ecke eines überfüllten Wohnraumes ein Kind geboren wurde, während gleichzeitig in einer anderen Ecke lauthals gestritten wurde und in einer weiteren Ecke gerade jemand im Sterben lag. Alle Bandbreiten des Lebens spielten sich auf engstem Raum und oft gleichzeitig ab.
Aus:
(2014), S. 12.
Abb. 1: Arbeiterwohnung in Berlin (Foto um 1910, Deutsches Historisches Museum Berlin) Schollenpflicht, die: an das Land gebunden sein Ringofen, der: Einrichtung zum Brennen von Ziegeln, Kalk und Gips
Abb. 1: Dieses Foto zeigt die Wohnung einer Arbeiterfamilie an der Wende vom 19. zum 20. Jh. In vielen europäischen Großstädten wohnten Arbeiterfamilien genau so, wie du es auf diesem Foto sehen kannst.
Erkläre, wofür dieser Raum genutzt wurde!
Beurteile, welche Botschaft der Fotograf mit diesem Foto vermitteln wollte!
D1: Erklärt gemeinsam die Bedeutung des Begriffs „Bandbreite des Lebens“ in diesem Zusammenhang!
Analysiert das Bild der Vergangenheit, das durch die Darstellung entsteht, und beschreibt die Auswirkungen einer solchen Wohnsituation auf die Menschen!
Stellt in Partnerarbeit dar, welche Absicht hinter der drastischen Darstellung des Wohnungselends der Ziegelarbeiterinnen und Ziegelarbeiter steckt!
Erläutert anschließend, welche Wirkung diese Beschreibung auf die Leserin oder den Leser haben soll und welche Probleme dadurch besonders hervorgehoben werden!
3. AUSWANDERUNG IN DIE USA
Der Aufbruch
stetig: ohne Unterbrechung sich fortsetzend
Abb. 1: Analysiere die Entwicklung der Auswanderung aus Österreich-Ungarn von 1846 bis 1913 und identifiziere Phasen mit starkem oder geringem Anstieg sowie die Spitzenzeiten!
Vergleiche die Auswanderung um 1900 mit der Mitte des 19. Jahrhunderts und analysiere die Gründe für den Anstieg sowie die Aussagekraft über die Lebensbedingungen!
Schreibe aus der Sicht einer Person um 1900, warum du ÖsterreichUngarn verlässt, wohin du gehst und welche Hoffnungen oder Ängste dich begleiten!
Erkläre, wie diese Grafik hilft, die historische Entwicklung der Auswanderung zu verstehen!
Beurteile, welche Informationen fehlen könnten, um ein vollständiges Bild der damaligen Migration zu erhalten!
Präsentiere deine Ergebnisse der Klasse!
Zwischendeck, das: unterhalb des Decks gelegener Raum
registrieren: in ein Verzeichnis eintragen, aufzeichnen
1867 wurde im Staatsgrundgesetz das Prinzip der Freiheit der Auswanderung aller Bürgerinnen und Bürger verankert. Daraufhin stieg die Auswanderung aus der Habsburgermonarchie in die USA stetig an. So zählten ab 1900 neben Russen und Italienern Einwandererinnen und Einwanderer aus Österreich-Ungarn zur größten Gruppe.
Auswanderung aus Österreich-Ungarn in den Jahren 1846 bis 1913
Abb. 1: Auswanderung aus Österreich-Ungarn in die USA zwischen 1846 und 1913 (Quelle: Statista 2024)
Die Gründe für die Auswanderung waren vielfältig. Einerseits war die wirtschaftliche Situation in vielen Teilen Österreich-Ungarns schlecht. Die Menschen versprachen sich durch die Auswanderung eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Andererseits wurde die Auswanderung durch verbesserte Bahn- und Schiffsverbindungen erleichtert. Nicht zuletzt wurden in den USA billige Arbeitskräfte gesucht. Auch die Löhne waren für ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter wesentlich höher als in Österreich-Ungarn.
Reise und Ankunft
Die meisten Auswanderinnen und Auswanderer traten ihre Reise zu Fuß und dann mit der Bahn zum nächstgelegenen Hafen an. Bremen oder Hamburg (Deutschland), Le Havre (Frankreich), Antwerpen oder Rotterdam (Niederlande) sowie Triest (Österreich) waren jene Häfen, von denen Schiffe nach Amerika ablegten. Die Überfahrt erfolgte zumeist im Zwischendeck, in das provisorisch kleine Kabinen eingebaut wurden, die auf der Rückreise nach Europa wieder herausgenommen wurden. Dann wurden an Stelle der Passagiere Waren befördert.

Der überwiegende Teil der Einwanderinnen und Einwanderer kam in New York an. 1892 wurde auf einer Insel vor New York, auf Ellis Island, eine Kontrollstation eingerichtet. Hier wurden die Menschen registriert, medizinisch untersucht und auch entschieden, ob sie bleiben durften oder ob sie zurückgeschickt wurden.
Abb. 2: medizinische Untersuchung der Einwanderinnen und Einwanderer auf Ellis Island (Foto, ca. 1905)
4. ÖSTERREICH ALS EINWANDERUNGSLAND: MIGRATION UND FLUCHT
Arbeitsmigration in den 1960er-Jahren
In den 1960er-Jahren benötigte Österreich mehr Arbeitskräfte und warb deshalb gezielt Frauen und Männer aus der Türkei und der Republik Jugoslawien als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter an. Sie sollten nur vorübergehend bleiben, um zu arbeiten, doch viele blieben dauerhaft und holten ihre Familien nach. In den 1970er-Jahren erhielten viele von ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft. Trotzdem wurden sie oft aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft als „Ausländer“ wahrgenommen, was zu Vorurteilen führte, die bis heute anhalten.
Migration und Flucht seit 2015
Seit dem Bürgerkrieg in Syrien ab 2011 sind viele Menschen auf der Flucht. Besonders im Sommer 2015 kamen viele Flüchtlinge über die Balkanroute nach Österreich. In Absprache mit Deutschland ließ die österreichische Regierung tausende Menschen einreisen. Ein Großteil reiste weiter nach Deutschland, doch viele blieben in Österreich. Die verstärkte Migration seit 2015 brachte soziale und politische Herausforderungen, wie die Integration von Flüchtlingen, den Zugang zu Arbeit und Bildung sowie Diskussionen über kulturelle Identität und Sicherheit.
Verlag
Unterschied zwischen Arbeitsmigration und Flucht
Es ist wichtig, zwischen Migration und Flucht zu unterscheiden. Migrantinnen und Migranten kommen meist freiwillig nach Österreich, um bessere wirtschaftliche Chancen oder Lebensbedingungen zu suchen. Sie entscheiden sich aktiv für eine Umsiedlung, meist auf der Suche nach Arbeit oder einem besseren Leben. Flüchtlinge hingegen verlassen ihre Heimat unfreiwillig, da sie vor Krieg, Verfolgung oder schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen fliehen müssen. Diese Menschen suchen Schutz und Sicherheit, oft unter extremen Bedingungen, und haben laut der Genfer Flüchtlingskonvention einen besonderen rechtlichen Status.
Aufenthaltsstatus der Drittstaatsangehörigen am 1. 1. 2024
Sonstige (u. a. anerkannte Flüchtlinge, subsidiärer Schutz, Saisonarbeitskräfte): 31,4%
Asylwerber:innen (laufende Verfahren): 4,4%
Vorübergehender Aufenthalt: 2,5%

Abb. 2: Aufenthaltsstatus der Drittstaatsangehörigen am 1. 1. 2024
aus: Statistik Austria: Statistisches
Jahrbuch Migration & Integration. Zahlen, Daten Fakten 2023, S. 39
Befristete Niederlassung: 22,8%
Unbefristeter Daueraufenthalt (>5 Jahre): 38,9%
Republik Jugoslawien: Staat in Südosteuropa, der von 1945 bis 1992 bestand; Staaten, die auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens liegen, sind: Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien

Abb. 1: Plakat gegen Vorurteile im Auftrag der Aktion Mitmensch (1973, Wien Bibliothek im Rathaus)
Abb. 1: Beschreibe die Personen, Farben, Symbole und den Text auf dem Plakat!
Erkläre, warum „Tschusch“ diskriminierend ist und wie es auf dem Plakat thematisiert wird!
Interpretiere die Zielsetzung der Aktion „Mitmensch“ und wie das Plakat Vorurteile hinterfragt!
Formuliere eine eigene Frage zum Thema Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen in der Geschichte – zum Beispiel gegenüber Frauen, religiösen Gruppen oder Menschen aus anderen Ländern!
Beurteile, wie effektiv das Plakat im Kampf gegen Vorurteile sein kann und welche Veränderungen es bewirken könnte!
Beurteile, wie der Aufenthaltsstatus das Leben von Menschen in Österreich beeinflussen könnte!
Beurteile die Herausforderungen, die Drittstaatsangehörige mit einem unsicheren oder befristeten Status erleben könnten!
Drittstaatsangehörige: sind Personen, die weder EU-Bürgerinnen/EU-Bürger noch sonstige EWR-Bürgerinnen/EWRBürger (aus Island, Liechtenstein oder Norwegen) noch Schweizerinnen/Schweizer sind.
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies zuerst die vier Darstellungen auf dieser und der nächsten Seite! Dann notiere in den Überschriften, über welchen Zeitraum und welche geografischen Räume sie berichten!
Garnitur, die: eine Reihe verschiedener, zusammengehörender Gegenstände, die einem bestimmten Zweck dienen
Fäkalien, die: von Menschen und Tieren ausgeschiedener Kot
etabliert: einen sicheren Platz innerhalb einer bürgerlichen Ordnung/ Gesellschaft innehaben
Cockney-Slum: Slum in London, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner einen eigenen Slang sprechen
stet: über eine relativ lange Zeit gleichbleibend
Bosporus, der: Meerenge zwischen Asien und Europa
D1 – Scheußliche Portale zur modernen Welt: Als ein mageres 14-jähriges Mädchen namens Jeanne Bouvier im Jahr 1879 zum ersten Mal die neu errichteten Außenmauern von Paris durchschritt, hatte sie nur zwei Garnituren Kleidung dabei, die sie übereinander trug, ein paar Toilettenartikel in einem Tuch, dessen vier Ecken sie zusammengeknotet hatte, und die zeitlosen Erwartungen, die Migranten vom Land in die Städte mitnehmen. [...]
Die Mutter hatte nach einer deprimierenden Zeit, in der sie in den Vororten von Paris als Bürstenfärberin ihr Glück versucht hatte, aufgegeben und war in ihr von einer Hungersnot heimgesuchtes Dorf zurückgekehrt. [...]
Ihre erste Unterkunft, ein winziger Raum, dessen einzige besondere Merkmale ein schlichtes Bett aus Brettern und eine Abflussrinne für Fäkalien waren, die direkt unter ihrem Fenster verlief, bestätigte die schlimmsten Vorstellungen von der Ankunftsstadt, [...]. In einigen Stadtbezirken wurde die Ankunftsstadt durch diese „vertikale Schichtung“ definiert: Die bereits etablierten Stadtbewohner belegten die untersten Stockwerke, die armen Neuankömmlinge vom Land die obersten zwei oder drei Etagen.
D2 – Heimliche Ankünfte:
Verlag
Joseph Thorne hatte 1905 genug von den Cockney-Slums von Bermondsey im Süden Londons, die für ihn und seine Frau die Endstation zu sein schienen, [...]. Er buchte eine Überfahrt nach Kanada mit einem Vertrag, der ihn zu einem Jahr Arbeit auf einer Farm verpflichtete. Den größten Teil seines Lohns schickte er nach Hause. Anschließend arbeitete er ein Jahr lang im Stadtzentrum von Toronto und sparte dabei etwas Geld, mit dem er ein kleines Stückchen Land [...] jenseits der Stadtgrenze kaufte, [...].
Thorne besorgte sich eine Schaufel, grub ein Loch, deckte es mit Wellblech ab und bezeichnete es als sein Zuhause. Ein paar Monate später trafen seine Frau und ihre fünf Kinder aus London ein, und er klaubte genügend Holz und Pappe für eine Zweizimmerhütte mit Lehmboden zusammen.
D3 – Tod und Leben in einer großen Ankunftsstadt: Der Busbahnhof Harem wurde in den 1950-Jahren gebaut, in einer Zeit, in der es das moderne türkische Straßennetz der Bevölkerung erstmals ermöglichte, zügig große Entfernungen zurückzulegen. Seit jener Zeit ist dieser Ort die wichtigste Anlaufstelle für einen steten Zustrom von Neuankömmlingen, die ihre wenigen Habseligkeiten in Plastiktüten bei sich tragen und aus den Dörfern Zentral- und Ostanatoliens stammen. Diese Neuankömmlinge haben die Einwohnerzahl des Großraums Istanbul von unter einer Million Ende der 1950er-Jahre bis heute auf 14 Millionen anwachsen lassen. Harem war bis 1973 – als die erste Brücke über den Bosporus gebaut wurde – die letzte Haltestelle auf einem Weg, der einst die Hauptader der Seidenstraße gewesen war. Es bleibt für viele Menschen das Endziel der Reise.
Im Lauf der 1980er- und zu Beginn der 90er-Jahre ließ sich hier Jahr für Jahr eine halbe Million Dorfbewohner nieder, und Harem ist heute noch – obwohl inzwischen routinemäßig zu hören ist, Istanbul sei „voll“ – ein zentraler Ankunftsort für die jährlich 250 000 oder mehr Einwohner, die sich unter die Bevölkerung der Stadt mischen.
D4 – Intensität, Spontanität, Autonomie
Mohammed Mallauch kam mit einem Flug aus Marrakesch [...] an, nahm den Zug zu den westlichen Vororten Amsterdams und staunte über die geometrischen grünen Muster, die er zu sehen bekam. Im Vergleich zu den aus niedrigen Lehmhäusern bestehenden Dörfern seiner gebirgigen Heimatregion im Norden Marokkos und den hektischen Enklaven von Marrakesch war das hier doch eine ganz andere Lebensweise. [...]
„Zunächst sah das alles perfekt aus“, sagt Mohammed, „und in vielerlei Hinsicht ist es auch ein guter Wohnort, aber nach ein paar Wochen in Slotervaat war mir klar, dass es hier ein sehr ernstes Problem gab. Das Viertel war zum Abladeplatz für Migranten geworden, die vom gesellschaftlichen Leben vollkommen abgeschnitten waren.“ Mohammed war aus Marokko gekommen, um hier als Lehrer zu arbeiten. Bei seiner Ankunft im Jahr 1992 stellten die Migranten aus Marokko etwa die Hälfte der 45 000 Einwohner von Slotervaart [...] „Das größte Problem, mit dem ich von Anfang an zu kämpfen hatte, war, dass so wenige Kinder Niederländisch sprachen. Niemand half ihnen, die Sprache zu lernen und es gab keinen Grund für sie, sie überhaupt lernen zu wollen.“
Aus: Saunders, Douglas: Die neue Völkerwanderung – Arrival City. München (2011), S. 217 – 491
Autonomie, die: Unabhängigkeit, Selbstständigkeit
Marrakesch: Stadt im Südwesten Marokkos
Enklave, die: vom eigenen Staatsgebiet eingeschlossener Teil eines fremden Staatsgebiets
Arbeite die Gründe für Migration aus der jeweiligen Darstellung heraus! Fasse dabei mögliche Gemeinsamkeiten zusammen, hebe eventuelle Unterschiede hervor!
Gründe für Migration:
Gemeinsamkeiten:
Unterschiede:
2 3 4 5
Erkläre anhand der Darstellungen die wesentlichen Merkmale für Migration!
Olympe Verlag
Bewerte die Unterschiede zwischen Arbeitsmigration und Flucht! Welche Unterschiede kannst du dabei feststellen? Erkläre diese Unterschiede in einem kurzen Text, indem du beschreibst, wie sich die Gründe und Umstände der beiden Migrationsarten voneinander unterscheiden!

Wähle eine Person aus den Darstellungen aus und führe mit ihr ein fiktives Interview! Schreibe dieses in dein Heft!
Analysiere die vorliegende Statistik und achte dabei besonders auf die Extreme, wie hohe Ablehnungen oder geringe Anerkennungen von Asylanträgen!
Asylanträge und Anerkennung von Flüchtlingen in Österreich 2012 bis 2022
Asylanträge Anerkennung von Flüchtlingen
Aus: Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch Migration & Integration. Zahlen, Daten Fakten 2023, S. 31 (Die Anzahl der Anerkennungen steht in keinem Zusammenhang mit der Zahl der im selben Jahr gestellten Asylanträge)
Fasse die wesentlichsten Aussagen der Statistik zusammen! Arbeite dabei auch insbesondere heraus, wie sich das Verhältnis Asylanträge und Anerkennung von Flüchtlingen entwickelt hat! Formuliere in ganzen Sätzen!


Nun geht’s los
–
Aufgaben für schlaue Köpfe!
Betrachte dieses Foto genau und lies den Informationstext dazu!

Erörtere, welche Fragen für den Fotografen beim Erstellen dieses Bildes wichtig gewesen sein könnten!
a) Wenn du die Möglichkeit hättest, mit dem Fotografen über dieses Bild zu sprechen, welche Fragen würdest du ihm zu seinen Motiven und zur Entstehung des Bildes stellen? Schreibe eine konkrete Frage auf, die sich auf die Bedeutung oder Absichten des Fotos bezieht!
b) Formuliere nun eine Antwort auf deine Frage, in der du vermutest, was der Fotograf zu seiner Bildgestaltung gesagt haben könnte!
Verlag

Bearbeite nun die Fotografie in deinem Heft! Wähle dazu aus jedem Bereich zwei Fragen aus!
BESCHREIBEN: Welche Personen, Gegenstände und Gebäude sind auf dem Foto zu sehen? Welche Details kannst du erkennen? Was wird durch diese Gegenstände oder Personen im Bild besonders hervorgehoben, und welche Bedeutung könnten sie haben?
ANALYSIEREN: Welche Rolle spielen die Gegenstände und die Umgebung auf dem Foto? Welche Hinweise liefert das Foto über die Zeit und den Kontext, in dem es aufgenommen wurde? Gibt es Elemente, die einen bestimmten historischen Zusammenhang andeuten?
Dieses Foto zeigt eine italienische Familie unmittelbar nach ihrer Ankunft in den USA. Es wurde 1905 von dem berühmten USFotografen Lewis Hine aufgenommen, der als einer der Ersten sozial benachteiligte Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellte. 8 9 10 11
INTERPRETIEREN: Welche Botschaft vermittelt das Foto und welche Absicht könnte der Fotograf gehabt haben? Welche historischen Fragen lassen sich mit Hilfe dieses Fotos beantworten? Welche Wirkung hat das Bild auf dich –emotional oder sachlich? Gehe auf die Seite „Flüchtlinge erzählen ihre Geschichte“ (unofluechtlingshilfe.de). Dort sammelt das UN-Flüchtlingshilfswerk persönliche Lebensberichte von Flüchtlingen. Höre dir auch HB 2 und HB 3 an! Wähle einen der Berichte aus und löse die folgenden Aufgaben dazu!
a) Erstelle einen Lebenslauf der ausgewählten Person!
b) Beschreibe in drei bis vier Sätzen die Schwierigkeiten, die bei der Flucht auftraten!


c) Schreibe ein fiktives Interview, das du mit der ausgewählten Person geführt hast, auf ein A4-Blatt!
d) Sammle Informationen zum Heimatland deiner ausgewählten Person!
e) Erstelle zum Abschluss ein Plakat und stelle deine Person der Klasse vor!


Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Analysiere die beiden Bilder auf einem A4-Blatt! Arbeite dabei alle erkennbaren Details wie Symbole, Farbgebung, Anordnung, Stilmittel der Übertreibung usw. heraus!

Die beiden Karikaturen drücken den Wandel in der Einstellung der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner gegenüber den Einwanderinnen und Einwanderern gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus. Gezeichnet wurden sie von Joseph Keppler (1838 – 1894), einem aus Wien stammenden Zeichner, der 1867 in die USA emigrierte und dort als Karikaturist arbeitete.

Verlag



Informationen zu Bild 1
Schild neben der Tür:
Free Education (freie Bildung)
Free Land (freies Land)
Free Speech (Redefreiheit)
Free Ballot (freie Wahlen)
Free Lunch (freies Essen ohne Speisevorschriften)
Über der Tür:
U.S. Ark of Refuge (US-amerikanische Arche für Flüchtende)
weißes großes Schild:
No oppressive taxes (keine unterdrückenden Steuern)
No expensive kings (keine teuren Könige)
No compulsive military service (kein verpflichtender Militärdienst)
No knouts in Dungeons (keine Gewalt in Gefängnissen)
Ordne diese Originaltitel den Karikaturen zu, indem du die Jahreszahl dazuschreibst!
_________: wellcome all
_________: looking backward
Erkläre, welche Veränderung in der Einwanderungspolitik der USA durch diese beiden Karikaturen abgebildet wird! Gehe dabei besonders auf den Titel „looking backward“ ein!
So schätze ich mich nach dem Großkapitel „MIGRATION VOM 19. JAHRHUNDERT BIS IN DIE GEGENWART“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…die Begriffe Migration – Integration – Asyl unterscheiden und diese definieren.
…wesentliche Push- und Pullfaktoren nennen.
…die Bedeutung der Genfer Flüchtlingskonvention für Flüchtlinge reflektieren.
…erklären, warum Menschen nach Österreich flüchten und die Rechte und Pflichten von Asylberechtigten beschreiben.
…mich in die Lage von flüchtenden Menschen hineinversetzen und deren Situation verstehen.
…mich mit meiner eigenen familiären Migrationsgeschichte auseinandersetzen.
…Statistiken mit der Methode M6 untersuchen.
…über die Zuwanderung nach Wien im 19. Jh. berichten.
…die Auswanderung in die USA historisch einordnen.
…die Gründe, Formen und Folgen von Migration nach Österreich erklären und die Situation von Migranten im Land verstehen.

Verlag


…die wesentlichsten Fakten über Arbeitsmigration und Flucht nach Österreich nennen.
…über die Folgen von Migration nach Österreich reflektieren.
Buchtipps
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
Abdullah Al-Sayed; Geflüchtet. Zu Hause in Deutschland, daheim in Syrien (Arena 2018).
Barbara Warning: Heimisch und doch fremd: Junge Migranten erzählen, wie Integration gelingt (Ravensburger Verlag GmbH 2016).
Sultana Barakzai (Hg.): Unsere Geschichten: Die Flucht in eine fremde Heimat (Büchner Verlag 2024).








1. NATIONALISMUS UND IMPERIALISMUS FÜHREN ZUM ERSTEN WELTKRIEG
Rüstungswettlauf, der: Staaten versuchen, einander durch immer mehr und bessere Waffen zu übertrumpfen.
Entente, die: Bündnis, Einvernehmen auf Französisch
K1: Erkläre anhand der Karte die Bündnissituation innerhalb Europas vor dem Ersten Weltkrieg!
neutral: hier D keiner der kriegführenden Parteien angehörend
Q1: Auszug aus dem Buch „Die Waffen nieder“ von Bertha von Suttner (1889)
Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecke mit Tinte, Ölflecke mit Öl wegputzen zu wollen – nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden.
Aus: Suttner, Bertha von: Die Waffen nieder! München (o. J), S. 219.
HB 4: Hier kannst du noch mehr hören!


Q1: Fasse mit eigenen Worten die Aussage Bertha von Suttners zusammen!
Pazifistin/Pazifist, die/der: Person, die Gewalt und Krieg ablehnt und sich für den Frieden einsetzt
Ende des 19. Jh. und am Beginn des 20. Jh., nachdem die Industriestaaten die Welt unter sich aufgeteilt hatten, kam in Europa ein immer stärker werdender aggressiver (Reichs-)Nationalismus auf. Es ging vermehrt darum, die vermeintliche Vorrangstellung der eigenen Nation gegen andere Nationen durchzusetzen. Die Nachbarländer wurden als mögliche Feinde gesehen und die Vorurteile nahmen zu. Die Kategorisierung zwischen „Freund“ oder „Feind“ der eigenen Nation sollte den Zündstoff für die kriegerische Mobilisierung liefern.
Wettrüsten und Blockbildung
Um für künftige Kriege gut gerüstet zu sein, begannen die Großmächte am Beginn des 20. Jh. ihre Heere aufzurüsten. Sie kauften Waffen und bauten Kriegsschiffe. Ein Rüstungswettlauf setzte ein.
Die Großmächte schlossen sich daraufhin zu zwei großen Blöcken zusammen: die Entente und die Mittelmächte. Durch diese Blockbildung wurde es immer schwieriger, politische Probleme durch Diplomatie und Verhandlungen zu lösen. Die Bereitschaft zu kriegerischen Auseinandersetzungen nahm zu, und die Diplomatie wurde zunehmend vernachlässigt.
Mittelmächte Entente Verbündete der Entente Neutrale Staaten
GROSSBRITANNIEN
NIEDER LANDE BELGIEN LUXEMBURG
FRANKREICH
ÖSTERREICHUNGARN DEUTSCHES REICH
SERBIEN MONTENEGRO
ALBANIEN
RUSSISCHES REICH
RUMÄNIEN
BULGARIEN
GRIECHEN LAND
Olympe Verlag



OSMANISCHES REICH
K1: Entente und ihre Verbündeten und Mittelmächte (1914)
So warnte auch schon 1912 die österreichische Schriftstellerin und Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner vor den Gefahren eines internationalen Krieges.
Abb. 1: Bertha von Suttner – Pazifistin und Friedensforscherin. 1905 erhielt sie als erste Frau den Friedensnobelpreis (Euromünze 2002)
2. DER VERLAUF DES ERSTEN WELTKRIEGS
Das Attentat – Kriegsbeginn
Am 28. Juni 1914 wurden der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin Sophie in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Bosnien-Herzegowina war 1908 von der Donaumonarchie annektiert worden.

Der Tathergang
Franz Ferdinand und Sophie fuhren in einem offenen Wagen, zu beiden Seiten der Straße winkten Schaulustige. Plötzlich wurde eine Bombe gegen das Auto geworfen, sie explodierte aber erst unter dem nachfolgenden Wagen. Das Thronfolgerpaar blieb unverletzt. Trotz des Vorfalles setzte das Paar seine Fahrt fort. Die Gefahr schien vorbei zu sein. Da sprang plötzlich ein Mann aus der Menge, hob einen Revolver und schoss auf Franz Ferdinand und Sophie. Beide brachen getroffen zusammen.

Die Verschwörer
Der Attentäter Gavrilo Princip wurde unmittelbar nach der Tat verhaftet. Er war Angehöriger einer nationalistischen Gruppe namens „Schwarze Hand“. Die Mitglieder dieser Gruppe wollten mit allen Mitteln ein Großserbisches Reich begründen, das alle slawischen Völker vereinen sollte.

Das Motiv Als Motiv für seine Tat nannte Gavrilo Princip Rache für die Unterdrückung der Serben in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.
Thronfolger, der: Nachfolger des Kaisers annektieren: ein Land gewaltsam in Besitz nehmen
Ultimatum, das: Forderung, die innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllt werden muss
Q1: Proklamation Kaiser Franz Josephs „An Meine Völker!“ vom 28. Juli 1914

Nach diesem Attentat erwartete ganz Europa Vergeltungsmaßnahmen von Österreich-Ungarn. Die österreichischen Politiker aber holten zuerst die Zustimmung ihres wichtigsten Verbündeten, des deutschen Kaisers Wilhelm II., ein.
Österreich stellte nach einem Monat ein Ultimatum an Serbien. Dieses nahm Serbien nicht an, da die Teilnahme österreichischer Beamter an der Untersuchung des Attentates nicht akzeptiert wurde. Daraufhin erklärte der österreichische Kaiser Franz Joseph I. am 28. Juli 1914 Serbien den Krieg.
Aufgrund ihrer Bündnisverpflichtungen traten kurz darauf fast alle europäischen Staaten in den Krieg ein. Kaum einer der mitentscheidenden Politiker, Diplomaten oder Militärs war davon „überzeugt“ den Krieg nach kurzer Zeit zu gewinnen.
Olympe Verlag
Abb. 1: Auszug deutscher Soldaten nach der Mobilmachung (August 1914, Deutsches Militärarchiv)

Die Umtriebe eines haßerfüllten Gegners zwingen Mich, zur Wahrung der Ehre Meiner Monarchie, zum Schutze ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung ihres Besitzstandes nach langen Jahren des Friedens zum Schwerte zu greifen. […] Aus: Wiener Zeitung vom 29. Juli 1914, Nr. 175/1914, Amtlicher Teil, S. 1.
Proklamation, die: öffentliche Verkündigung
Q1: Analysiere, wie Franz Joseph I. die Notwendigkeit des Krieges in dieser Proklamation begründet! Achte dabei auf seine Argumente und seine Wortwahl!
Fließtext + Q1: Vergleiche Q1 mit dem Fließtext! Achte dabei auf die Begründung für die Kriegserklärung!
Abb. 1: Analysiere, wie die Fotografie Propaganda zur Kriegsbegeisterung im Ersten Weltkrieg unterstützt!
Beurteile, ob die Fotografie die Kriegsstimmung realistisch darstellt oder eine gewünschte Botschaft vermittelt!
Verfasse einen kurzen Text (max. 100 Wörter), in dem du deine Erkenntnisse zu den Aufgaben zu Q1 und Abb. 1 zusammenfasst!
Mobilmachung, die: Vorbereitung der Streitkräfte eines Landes auf den Krieg † † † † †
Front, die: vorderste Kampflinie
K1: Kriegsgebiete des Ersten Weltkrieges:
1) Westfront
2) Ostfront
3) Serbien wurde von österreichischen Truppen besetzt
4) Südfront
5) Deutschland begann einen U-Boot-Krieg, um die englische Seeblockade zu durchbrechen.
Stellungskrieg, der:
Kriegstaktik, bei der sich die Gegner in befestigten Stellungen (Gräben, Erdwällen) gegenüberstehen

Abb. 3: Kaiser Franz Joseph I. (Gemälde von Leopold Horowitz, 1902, Österreichische Galerie Belvedere)

Mitten im Krieg, am 21. November 1916, starb Kaiser Franz Joseph I. im 86. Lebensjahr. Sein Großneffe Karl wurde Kaiser.

Der Kriegsverlauf 1914






bis 1918










Olympe Verlag
Abb. 4: Kaiser Karl I. (Foto 1917, Wienbibliothek im Rathaus)
Auf Seiten der Mittelmächte kämpften 24 Mio. Soldaten, die Entente und die mit ihr verbündeten Staaten verfügten hingegen über 45 Millionen Soldaten. Die Mittelmächte führten einen Krieg an mehreren Fronten.








Italien, ein Verbündeter der Mittelmächte, blieb zu Beginn des Krieges neutral. 1915 wechselte Italien das Lager und trat der Entente bei, nachdem es das Versprechen erhalten hatte, Gebiete wie Südtirol, Istrien und Triest zu erhalten, die von Italien als historisch und strategisch wichtig angesehen wurden.
Die Technisierung des Krieges
Die Erwartung aller Kriegsteilnehmer, bald zu siegen, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil, der Erste Weltkrieg sollte vier Jahre dauern, immer grausamer werden und immer mehr Opfer fordern.
Im Ersten Weltkrieg wurden viele neue Waffen und Kampftaktiken eingeführt. Erstmals kamen Flugzeuge zum Abwurf von Bomben zum Einsatz. U-Boote griffen gegnerische Schiffe an. Mit Panzern konnten Stacheldrahtsperren überwunden werden. Sogar Giftgas wurde von beiden Seiten als Waffe eingesetzt.
Da keine Seite entscheidende Siege erringen konnte, begann an vielen Fronten ein Stellungskrieg. Die Soldaten bauten Schützengräben, aus denen sie angreifen und Gegenangriffe abwehren mussten. Um manche Städte und Festungen wurde monatelang gekämpft, ohne dass ein Ergebnis zu sehen war. Besonders dieser Stellungskrieg forderte viele Opfer.

Abb. 2: Fokker Dr. I, legendäres Jagdflugzeug (Foto von Matthias Kabel, Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien)
Im Jahr 1917 gab es zwei Ereignisse, die den Kriegsverlauf wesentlich beeinflussten:
2 der Kriegseintritt der USA im Frühjahr 2 das Ausscheiden Russlands aus dem Krieg im Dezember
Nach dem Kriegseintritt der USA war die Entente den Mittelmächten weit überlegen. Sie verfügte über mehr Soldaten und über mehr und bessere Waffen. Daher ging nach weiteren schweren Niederlagen im November 1918 der Krieg für die Mittelmächte endgültig verloren
Q2: Feldpost von Anton Steiger – geb. 7. Oktober 1896, gefallen 14. Oktober 1916 an der Somme.
17. Juli 1916.
Der letzte Tag vor Verdun und der schrecklichste! Am 11. Juli ist unsere Kompanie nach dem Fosseswalde abmarschiert. [...] Darunter ich und meine beiden Schulkameraden Steiner und Reiser. Ungefähr 600 Meter vor unserem Bestimmungsort rasteten wir in einem Granatloch, um Kraft zu sammeln, da wir diese Strecke möglichst schnell im Marsch-Marsch machen mußten; denn da war schreckliches Sperrfeuer. Ein Granatloch könnt Ihr Euch am besten vorstellen, wenn Ihr Euch einen großen Baum samt den Wurzeln ausgerissen denkt. Ich hatte mich kaum hingelegt, da ststst! – schlägt eine Granate direkt vor uns ein. Geschrei, Gewinsel, Geheule, zugleich der Ruf: „Auf, auf, marsch, was noch kann!“ Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und sprang auf (wir waren natürlich alle bepackt); ich bin die 600 Meter nicht mehr gegangen, sondern gefallen von einem Granatloch ins andere. Im Unterstand gingen von den 17 Mann sechs ab, drei waren tot, darunter Reiser, der die neun Jahre mit mir auf der Schulbank rumgebummelt. Von den drei Verwundeten schleppte sich einer am anderen Tag bei der Frühe in unseren Unterstand. Er wurde nachts von unseren Leuten mitgenommen. Eine Granate schlug ein unter ihnen und der Verwundete samt den vier Trägern waren tot. […]
Aus: http://www.lexikon-erster-weltkrieg.de/Feldpost:_Anton_Steiger (27.2.2024)
Leid und Not – nicht nur an der Front
Von den Schrecken des Krieges waren nicht nur die Soldaten betroffen. Auch das Leben der Menschen in der Heimat verschlechterte sich. Frauen mussten in Industrie und Landwirtschaft die Arbeit der Männer – die ja an der Front waren – übernehmen. Das tägliche Leben wurde immer schwerer. Es gab nicht genügend Lebensmittel, sodass viele Hunger litten. Ab 1916 wurden Lebensmittelkarten ausgegeben. Mit diesen konnte die Bevölkerung nur die allernotwendigsten Grundnahrungsmittel in den Geschäften bekommen. Aber auch alle anderen Dinge des täglichen Lebens waren knapp: Kleidung, Schuhe und vor allem Heizmaterial. Oft stellten sich die Menschen stundenlang an, um Waren zu bekommen.

Abb. 6: Wartende Menschen vor einem Lebensmittelgeschäft in Berlin (Foto 1917, APA)
Olympe Verlag
Abb. 5: Frauen bei der Arbeit an Geschoss-Kartuschen (Foto 1916, APA)
Fließtext + Q2: Beschreibe mithilfe des Fließtextes auf S. 128 die Kriegssituation und die Herausforderungen, welche die Soldaten an der Front während des Ersten Weltkriegs erleben mussten!
Erläutere, warum der Stellungskrieg für beide Seiten so verlustreich war und welche Auswirkungen er auf die Soldaten hatte!
Fließtext + Abb. 5 + 6 +7: Überprüfe die Aussage „Leid und Not – nicht nur an der Front – mit Hilfe der Abbildungen! Welche Mangelsituationen werden durch sie belegt?
Kompanie, die: militärische Einheit von 100 bis 200 Mann

Abb. 7: Österreichische Brotkarte im Ersten Weltkrieg (1916)
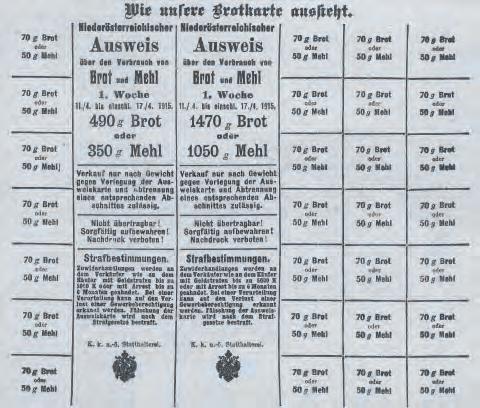

3. KINDHEIT UND JUGEND WÄHREND DES ERSTEN WELTKRIEGS
Kinderarbeit und neue Aufgaben
Propaganda, die: Verbreitung politischer, weltanschaulicher o. ä. Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen

Abb. 1: Der Bombenpeter. (…) Der mit Haut und Haaren / Sich verschrieb dem Zaren”. (Antirussische Karikatur). Farbdruck. Aus: Karl Ewald Olszewski, Der Kriegs-Struwwelpeter. Lustige Bilder und Verse, München (Holbein-Verlag) Verlag) 1915, Bl. 1 (Freie Bearbeitung der Verse und Bilder des Kinderbuches “Der Struwwelpeter” von Heinrich Hoffmann von 1847). Berlin, Sammlung Archiv für Kunst und Geschichte.
Beschreibe die Darstellung von „Bombenpeter“! Welche Merkmale und Symbole werden genutzt, um seine Verbindung zum Zaren darzustellen?
Interpretiere, welche Botschaft der Künstler mit dieser Karikatur vermitteln möchte!
Erläutere, warum Kinderbuchcharaktere wie der Struwwelpeter verwendet werden, um diese Botschaft zu verdeutlichen!
Präsentiere deine Ergebnisse der Klasse!
Lebensmittelknappheit und Schulausfall
Während des Ersten Weltkriegs veränderte sich das Leben von Kindern und Jugendlichen stark. Da viele Väter und ältere Brüder an die Front mussten, übernahmen Kinder oft Aufgaben, die sonst Erwachsenen vorbehalten waren. Jungen und Mädchen arbeiteten in der Landwirtschaft oder Fabriken, Mädchen halfen darüber hinaus auch im Haushalt und betreuten jüngere Geschwister. Diese zusätzlichen Pflichten waren eine große Belastung für die Kinder, da sie mehr Verantwortung tragen mussten als zuvor.
Die Versorgungslage verschlechterte sich im Verlauf des Krieges zunehmend. In vielen Städten wurden Lebensmittelrationen eingeführt, und Kinder litten unter Hunger und Mangelernährung. Die Schulen mussten oft geschlossen werden, da sie als Krankenhäuser oder Unterkünfte für Soldaten dienten. Dies führte dazu, dass viele Kinder weniger Zugang zu Bildung hatten und stattdessen verstärkt in die Kriegsarbeit eingebunden wurden.
Propaganda und Kriegsbegeisterung
Kinder wurden im Ersten Weltkrieg gezielt durch Propaganda beeinflusst. In der Schule, auf Plakaten und in Zeitungen wurde ihnen der Krieg als patriotische Pflicht dargestellt.
Verlag
Lehrerinnen und Lehrer nutzten den Unterricht, um den Krieg als eine wichtige und heldenhafte Aufgabe darzustellen und die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für die Kriegsanstrengungen zu verstärken. Es gab spezielle „Kriegsstunden“, in denen die aktuelle Lage an den Fronten besprochen, Heldentaten hervorgehoben und für die Soldaten gebetet wurde. Bücher, Lieder und andere Materialien wurden eingesetzt, um den Krieg in verschiedene Fächer zu integrieren. Kinder sammelten auch Metalle und andere Rohstoffe für die Kriegsanstrengungen. Mit der Zeit schwand jedoch die anfängliche Begeisterung, als die Kinder die harten Auswirkungen des Krieges im eigenen Leben spürten.
Psychische Belastungen und Verluste
Der Krieg belastete die Kinder auch emotional sehr. Viele hatten Angst um ihre Väter und Brüder an der Front. Sie mussten oft den Verlust von Familienmitgliedern verkraften, was ihre seelische Entwicklung stark beeinträchtigte. Der K rieg prägte das Leben der Kinder, und viele verarbeiteten die Erlebnisse in ihren Aufsätzen und Zeichnungen.
Keine unbeschwerte
Kindheit
Insgesamt hatten Kinder und Jugendliche während des Ersten Weltkriegs eine besonders schwierige Zeit. Der Krieg beeinflusste nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihre Zukunft. Die Belastungen durch Arbeit, Hunger und psychischen Stress prägten ihre Entwicklung und hinterließen tiefe Spuren.
M7 FELDPOSTKARTEN UND FELDPOSTBRIEFE UNTERSUCHEN
Während des Ersten Weltkriegs waren Feldpostkarten und Feldpostbriefe oft die einzige Möglichkeit zur Kommunikation zwischen den Soldaten an der Front und den Familienmitgliedern und Freundinnen und Freunden zu Hause. Täglich wurden schätzungsweise 16 Millionen Postsachen über eigens dafür eingerichtete Ämter transportiert. Die Gesamtzahl der Feldpostkarten und Feldpostbriefe wird auf 28,7 Milliarden geschätzt.
1. SCHRITT: Betrachtung und Beschreibung
D
Da auf einer Postkarte nicht sehr viel Platz war, waren die Berichte oft sehr kurz, aber trotzdem sehr unterschiedlich. Es machte einen Unterschied, ob der Verfasser während des Stellungskrieges an der Westfront in einem 40.000 km langen Grabensystem verharrte oder an der Ostfront verwundet worden war. Auch das jeweilige Kriegsjahr ist bei einer Analyse zu berücksichtigen.
Betrachte die Postkarte oder den Brief genau und beschreibe sie oder ihn anhand folgender Fragestellungen!
Handelt es sich um eine Feldpostkarte oder einen Feldpostbrief? Wann wurde die Karte bzw. der Brief geschrieben? Von wem wurde die Karte oder der Brief geschrieben? An welcher Front war der Verfasser stationiert? An wen war die Karte bzw. der Brief adressiert?
2. SCHRITT: Untersuchen und inhaltlich analysieren
D
Kläre folgende Fragen!
Verlag
Worum geht es in der Postkarte oder dem Brief? Welche Ereignisse werden erwähnt? Wieso könnte der Verfasser die Karte oder den Brief geschrieben haben? Welche Gefühle werden zum Ausdruck gebracht? Werden nur Tatsachen berichtet oder schreibt der Verfasser auch seine Meinung? Welche historischen Ereignisse gab es vor und nach dem Verfassen der Karte oder des Briefes?
3. SCHRITT: Deuten
D
Nimm eine abschließende Interpretation der Karte oder des Briefes vor!
Wie wird auf der Postkarte oder im Brief die Stimmung an der Front beschrieben? Welche Wirkung soll die Karte bzw. der Brief auf die Empfängerin oder den Empfänger haben? Welche Wirkung hat die Karte bzw. der Brief auf dich?
1
Untersuche diese Feldpostkarte mit der soeben kennengelernten Methode!

Liebe Erna!
Solch ein „Farman“ besucht uns fast täglich. Es ist bedeutend leichter gebaut wie unsere Maschinen, fliegt aber sehr geräuschlos und schnell. Lege bitte alle Ansichten fort, es ist später mal eine nette Erinnerung. Wie findest du das Schreib[…]?
Tausend herzliche Grüße
Dein Karl

Der evangelische Carl-Ludwig Voltmer wurde am 13. September 1895 in Hannover geboren und lebte vor Kriegsbeginn mit Frau und Kindern in Hannover Walsrode, wo er als Landwirt arbeitete. Während des Krieges diente er unter anderem als Feld-Flieger in der Abteilung 32 des 14. Reserve-Korps.

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies zuerst diese Gedanken des österreichischen Schriftstellers Karl Kraus zum Krieg! Analysiere dann den Text, indem du folgende Fragen beantwortest!
Welche 4 Schritte im Kriegsverlauf beschreibt Karl Kraus?
Wer sind laut Karl Kraus die Verliererinnen und Verlierer eines Krieges?
Inwieweit treffen diese Aussagen auch noch auf aktuelle kriegerische Konflikte zu?
treffen zu treffen nicht zu
Begründung:
Q1: Karl Kraus – Nachts
Krieg ist zuerst die Hoffnung, daß es einem besser gehen wird, hierauf die Erwartung, daß es dem andern schlechter gehen wird, dann die Genugtuung, daß es dem andern auch nicht besser geht, und hernach die Überraschung, daß es beiden schlechter geht.
Aus: http://gutenberg.spiegel.de/buch/aphorismen-4692/6 (3. 10. 2016)
Entscheide, welche Fragestellungen der Autor in seinem Text berücksichtigte!
D1: Der Erste Weltkrieg und der Zusammenbruch der Monarchie
Nachdem mehrere Konflikte des beginnenden 20. Jahrhunderts von den Großmächten relativ problemlos gemeistert werden konnten (Annexion Bosniens und der Herzegowina 1908 und Balkankriege 1911 bis 1913) führte eine zunächst als lokale Krise betrachtete Auseinandersetzung zu einem Wirksamwerden der Bündnissysteme. Der Thronfolger, Franz Ferdinand, paradierte an einem sehr sensiblen Tag („vivov dan“, dem Jahrestag der Schlacht am Amselfeld 1389, einem nationalen Trauertag der Serben) bei Manövern in Sarajewo. Franz Ferdinand, der Pläne zu einem Umbau der Monarchie hegte, die einen Zusammenschluss der Südslawen unter der Führung der Kroaten und damit Österreichs (mit Annexion Serbiens, eine seiner Lieblingsideen) vertraten, wurde von vielen national eingestellten Serben als eine Feindfigur ersten Ranges betrachtet. Aus: Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur-Gesellschaft-Politik. Graz-Köln-Wien (2002), S. 266f.
Warum war die Situation zu diesem Zeitpunkt in Sarajewo so kritisch?
Warum herrschten die Habsburger über Serbien?
Weshalb war Franz Ferdinand eine Feindfigur für die Serben?
Wieso gab es schon seit langem Spannungen auf dem Balkan?
Weshalb kam es zur Entstehung von Bündnissystemen?
Annexion, die: gewaltsame und widerrechtliche Aneignung fremden Gebiets
paradieren: in einer Parade auf- oder vorbeimarschieren
Parade, die: prunkvoller Aufmarsch militärischer Einheiten
Manöver, das: große militärische Übung im Gelände, bei der Truppenbewegungen zweier gegnerischer Heere simuliert werden
simulieren: vortäuschen 4
Vergleicht eure Ergebnisse in Partnerarbeit!
Olympe Verlag
Untersuche, ob der Autor des Textes Franz Ferdinand eine indirekte Mitschuld an den Spannungen zuschreibt! Reflektiere dabei, ob die Darstellung des Thronfolgers objektiv ist oder ob der Autor eine bestimmte Sichtweise vertritt! Begründe deine Einschätzung mit konkreten Stellen aus dem Text!
Verfasse eine Geschichte, die dieser Ring erlebt haben könnte! Lies dazu den Informationstext!
Da der Krieg hohe Kosten verursachte, forderte der Staat seine Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Wertgegenstände zu spenden. Sogar Eheringe gaben die Menschen unter dem Leitspruch „Gold gab ich für Eisen“ ab. Stattdessen erhielten sie Ringe aus Eisen.
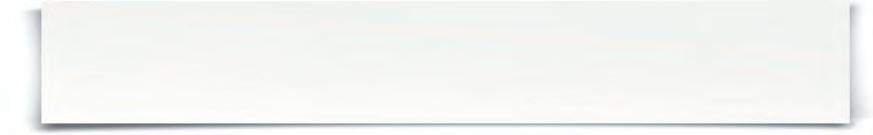

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Analysiere diesen Feldpostbrief mit der Methode M7!
Liebes Frauchen!

Ich hatte noch keine Gelegenheit das Geld abzuschicken, brauchst also nicht darauf warten. Heute nacht 1 Uhr gehen wir in Stellung und bleiben 12 Tage dort. 4 Tage im vordersten Graben 4 Tage im zweiten und 4 Tage im dritten. Hoffentlich geht alles wieder so glatt ab wie das erstemal wir hatten nur einen Verwundeten, Schuß durch den Fuß. Man muß verflucht vorsichtig sein und die Nase nicht so weit raus stecken, ein bischen Dreck ist mir auch um die Ohren gespritzt von den Granaten die in der Nähe eingeschlagen sind ich habe den Kopf aber schnell wieder runter gesteckt. Gestern Sonntag war hier sehr schönes Wetter und ist es schön abgetrocknet, hoffentlich regnet es nicht so sehr, dann ist es im Graben auch gemütlicher, unser halbes Gepäck nehmen wir auch nur mit das Andere bleibt bei der Bagage ist auch viel wert. Läuse habe ich auch schon eine Menge, die kann man alle Tage absuchen, werden aber immer mehr, ist fürchterlich.

Verlag


Gestern mittag hatten wir Dörrgemüse und Klippfisch (getrocknete Kohlrüben) und heute giebt es wieder Kohlrüben, abscheuliches Futter, ich kann auch jetzt nicht viel essen, habe mir den Magen verdorben und immer aufstoßen und Sodbrennen, du kennst es ja, ein klein bischen ist es schon besser, wird schon wieder werden. Das Regiment 227 ist erst kurz vor Weihnachten von Rußland gekommen, die Leute sagen, sie möchten lieber ein ganzen Jahr in Rußland sein als hier 8 Tage. Die Streichhölzer kostet die Schachtel 18 � ein Licht kostet 1 Mk 10 � ein [...] Wurst 8 Mk und 1 [...] Schinken 12 Mk schöne Preise was? ich habe natürlich noch nichts kaufen brauchen, habe noch eine Büchse Schmalz und den Schinken reicht noch eine ganze Weile. Tabak kriegen wir viel ich habe schon einen ganzen Beutel voll, also nichts schicken, nur eine Büchse mit Deckel zur Marmelade, aber nicht so groß. Schreibe mir doch mal Georg Appel seine Adresse, wirst Du ja in Velten erfahren.
Nun sei recht herzlich gegrüßt u. geküßt von Deinen Karl
Aus: Die Briefsammlungen der Museumsstiftung Post und Telekommunikation (16. 3. 2024)
Verfasse ein Antwortschreiben an den Absender dieses Feldpostbriefes!
Bildet Vierergruppen und gestaltet ein Plakat, auf dem ihr darstellt, welche Auswirkungen Krieg auf Menschen hat!
Lies zunächst den folgenden Informationstext aufmerksam durch!
D2: Der Erste Weltkrieg und seine Bedeutung
Der Erste Weltkrieg veränderte die Welt stark. Millionen Menschen starben, und viele Länder litten unter Zerstörungen.
Früher wurde der Krieg oft als Heldengeschichte erzählt, doch heute erinnern wir uns auch an das große Leid, das er brachte. Soldaten, Zivilistinnen und Zivilisten waren betroffen, viele Menschen hungerten oder mussten fliehen. Heute verstehen wir den Ersten Weltkrieg als Warnung vor den schlimmen Folgen von Gewalt und Krieg. Gedenktage und Denkmäler erinnern uns daran, wie wichtig es ist, Frieden zu bewahren.
Eigendarstellung
Ordne den Ersten Weltkrieg in den historischen Kontext ein! In welchem Zeitraum fand er statt und welche Länder waren beteiligt?
Zeitraum:
Beteiligte Länder:
Recherchiere, wie heute durch Denkmäler oder Gedenktage an den Ersten Weltkrieg erinnert wird! (Internet)
Beschreibe mindestens zwei Beispiele!
Verlag
Beurteile, welchen Eindruck die gezeigten Erinnerungsformen oder Denkmäler auf dich machen! Erläutere, welche Botschaften sie deiner Meinung nach vermitteln und wie du diese findest!
Diskutiert abschließend in der Klasse, warum das Gedenken an den Ersten Weltkrieg auch heute noch wichtig ist!
Stellt in Partnerarbeit dar, warum der Erste Weltkrieg als eine Warnung vor Gewalt und Krieg gilt! Welche Lehren können wir daraus ziehen?
Formuliere Fragen! Welche Fragen würdest du den Menschen stellen, die den Ersten Weltkrieg miterlebt haben?
3. DAS ENDE DES ERSTEN WELTKRIEGS UND SEINE FOLGEN
Die Neuordnung Europas
Am 3. November 1918 schlossen Österreich-Ungarn, am 11. November Deutschland, Waffenstillstandsabkommen mit der Entente. Damit endeten die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges. Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zerfiel in mehrere unabhängige Staaten. Kaiser Karl I. musste am 11. November 1918 auf die Regierung verzichten. Am 12. November 1918 wurde in Wien die Republik Deutschösterreich ausgerufen.
Nach den Vorstellungen des US-Präsidenten Woodrow Wilson sollte es keine Sieger oder Besiegten geben. Die anderen Siegermächte lehnten dies jedoch ab. In Versailles wurde der Friedensvertrag mit Deutschland beschlossen, während in St. Germain der Vertrag für Österreich und in Trianon der Vertrag für Ungarn ausgehandelt wurde.
Die harten Bedingungen der Verträge sollten verhindern, dass die unterlegenen Staaten, die wesentlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs beigetragen hatten, erneut eine aggressive Politik verfolgen konnten.
2 Deutschland, Österreich und andere Verliererstaaten wie Ungarn wurden für den Krieg verantwortlich gemacht.

2 Alle diese Länder mussten hohe Reparationszahlungen an die Siegermächte leisten.
2 Rüstungsfabriken und Waffenbestände mussten zerstört werden, um zukünftige Kriege zu verhindern.
Verlag
Zusätzlich wurden Deutschland und Österreich weitere Bedingungen auferlegt:
2 Deutschland musste die Souveränität Österreichs anerkennen.
2 Der Name „Deutschösterreich“ und ein möglicher Anschluss an das Deutsche Reich wurden verboten.
2 Österreich musste große Gebiete abgeben, darunter Südtirol an Italien.
Im Vertrag von Trianon wurde auch festgelegt, dass Westungarn größtenteils an Österreich fiel und als neues Bundesland Burgenland gegründet wurde.

St. Germain, Trianon: Schlösser in der Nähe von Paris
Abb. 2: Beurteile die Friedensbedingungen, die Deutschland und Österreich nach dem Ersten Weltkrieg akzeptieren mussten! Analysiere die Ziele der Siegermächte bei der Festlegung dieser Bedingungen!
Erkläre die möglichen Auswirkungen dieser Friedensverträge auf die Lebensbedingungen in den besiegten Ländern! Verfasse einen kurzen Text (max. 100 Wörter), in dem du deine Einschätzung der Friedensbedingungen zusammenfasst!
K1: Beschreibe die wesentlichen Veränderungen der innereuropäischen Staatsgrenzen!

Mit der Neuordnung Europas waren aber die Probleme, die zum Krieg geführt hatten, nicht gelöst. Im Gegenteil, die harten Bedingungen der Siegermächte schufen viel Unzufriedenheit bei den besiegten Völkern.
K1: links – Europa vor dem Ersten Weltkrieg / rechts –Europa nach dem Ersten Weltkrieg
BONUS-SEITE HUMANITÄRES VÖLKERRECHT
Humanitäres Völkerrecht und Gründung des Roten Kreuzes
Q1: Rekonstruiere anhand der Quelle die medizinische Versorgung auf den Schlachtfeldern im 19. Jh.!

Abb. 1: Henry Dunant: Für seine Leistungen erhielt Dunant 1901 den Friedensnobelpreis (kolorierter Holzstich, 1865)
Der Nobelpreis

Alfred Nobel war ein schwedischer Chemiker, der das Dynamit erfand. Bertha von Suttner brachte ihn in Gesprächen über Krieg und Frieden dazu, die Nobelstiftung zu gründen. Diese vergibt bis heute jedes Jahr hoch dotierte Preise in den Bereichen Physik, Chemie, Physiologie sowie Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen.
hoch dotiert: sehr gut bezahlt
1859 bereiste der Schweizer Kaufmann Henri Dunant Italien und beobachtete in der Schlacht von Solferino, dass die verwundeten Soldaten nicht ausreichend versorgt wurden.
Q1: Henry Dunant „Eine Erinnerung an Solferino“
Abb. 2: Erläutere, für welche Personen das humanitäre Völkerrecht gelten soll, und beschreibe, wie die dargestellte Szene auf dem Bild mit den Prinzipien des humanitären Völkerrechts zusammenhängt!
Das Schlachtfeld ist allerorten bedeckt mit Leichen von Menschen und Pferden. In den Straßen, Gräben, Bächen, Gebüschen und Wiesen, überall liegen Tote, und die Umgebung von Solferino ist im wahrsten Sinne des Wortes mit Leichen übersät. Die Felder sind verwüstet, Getreide und Mais sind niedergetreten, die Hecken zerstört, die Zäune niedergerissen, weithin trifft man überall Blutlachen [...] Auf den steinernen Fliesen der Spitäler und Kirchen von Castiglione liegen Seite an Seite Kranke aller Nationen: Franzosen und Araber, Deutsche und Slawen [...] sie haben nicht mehr Kraft sich zu bewegen [...] Flüche, Lästerungen und Schmerzensschreie [...] hallen von den Gewölben der geweihten Räume wider.
Aus: Dunant, Henry: Eine Erinnerung an Solferino. Zürich (1942), S. 42/62.
Verlag
Das Elend, welches er erlebte, veranlasste ihn, die Gründung von Hilfsorganisationen zu fordern. Das Internationale Komitee für Verwundete entstand 1863 und war ein Vorläufer des Roten Kreuzes
Bereits ein Jahr später – 1864 – unterzeichneten 12 Staaten die Erste Genfer Konvention. In dieser wurde der Grundstein für das humanitäre Völkerrecht gelegt. Es wurde festgelegt, dass Sanitätspersonal, Ambulanzen und Lazarette als neutral anerkannt und geschützt werden müssen. Verwundete werden ohne Unterschied der Nationalität aufgenommen und gepflegt.


„Das humanitäre Völkerrecht (HVR) enthält Regeln, die in Zeiten eines bewaffneten Konfliktes Personen schützen sollen, die nicht oder nicht länger an den Feindseligkeiten teilnehmen und mit denen die angewandten Methoden und Mittel der Kriegsführung begrenzt werden sollen.“
Abb. 2: Definition des HVR/US-Soldaten bringen Kinder im Irakkrieg in Sicherheit (1991)
Das humanitäre Völkerrecht ergänzt bis heute die in Friedenszeiten geltenden Menschenrechte. In Kriegszeiten können einige Menschenrechte vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Einige, ganz wesentliche Menschenrechte müssen aber auch im Kriegsfall eingehalten werden. Dazu gehören unter anderem das Folterverbot, das Verbot der Sklaverei und das Recht auf Rechtsfähigkeit.
Rotes Kreuz, Roter Halbmond und Roter Kristall
Das Rote Kreuz entstand als neutrale und unparteiliche Hilfsorganisation für Verwundete in Kriegen. Das Rotkreuzzeichen wurde zu Ehren der Schweiz als Gründungsland ausgewählt. Gegenwärtig gibt es in fast allen Staaten der Erde nationale Organisationen des Roten Kreuzes. Freiwillige und hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Menschen in Not, nach Naturkatastrophen und in Kriegen. Seit 1876 ist in islamischen Ländern das Symbol Roter Halbmond in Verwendung. Seit 2005 ist auch der Rote Kristall als Zeichen für humanitäre Helferinnen und Helfer im Einsatz. Der Rote Kristall wird vor allem in Ländern verwendet, in denen Kreuz und Halbmond nicht als neutral angesehen werden. Seit 1930 wird auch innerhalb Israels als Symbol der Rote Davidstern eingesetzt.
Gründung des Völkerbundes

Abb. 4: „non-violence“Skulptur (Carl Fredrik Reutersward, Sitz der Vereinten Nationen. New York)

Verlag

Recht auf Rechtsfähigkeit: bedeutet, dass jeder Mensch von Geburt an das Recht hat, rechtlich anerkannt zu werden, also z. B. etwas besitzen oder vor Gericht klagen kann.




Bereits im Januar 1918, noch während die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs andauerten, veröffentlichte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson seinen 14-Punkte-Plan. In diesem skizzierte er eine mögliche Nachkriegsordnung und legte seine Ideen für eine friedliche und stabile europäische Friedensordnung dar. Er legte damit den Grundstein für den 1920 gegründeten Völkerbund.
Der Völkerbund sollte den Weltfrieden sichern und die internationale Zusammenarbeit fördern. Seine Macht reichte jedoch nicht aus, um die Interessenskonflikte zwischen den europäischen Staaten zu lösen. Auch gehörten ihm wichtige Großmächte wie die USA nicht an. Andere Staaten wie Deutschland traten wieder aus. 1946 wurde der Völkerbund wieder aufgelöst.
Das Genfer Protokoll
Das Genfer Protokoll ist eine Erweiterung der Regelungen zur Kriegsführung. 36 Staaten unterzeichneten 1925 in der Schweiz das Genfer Protokoll über das „Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder anderen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege“. Das bis heute gültige Dokument verbietet den Einsatz von chemischen und biologischen Waffen. Der Einsatz zu „Vergeltungszwecken“ bedeutet, dass chemische oder biologische Waffen als Reaktion auf einen Angriff mit solchen Waffen eingesetzt werden dürften. Das Protokoll verbietet jedoch grundsätzlich den Erstgebrauch solcher Waffen.
Gründung der Vereinten Nationen
Noch vor seiner endgültigen Auflösung wurde bereits 1945 der wenig erfolgreiche Völkerbund durch eine neue Organisation ersetzt. Bei einer Konferenz in San Francisco gründeten 50 Staaten die Vereinten Nationen. Die wichtigsten Aufgaben der UNO sind die Sicherung des Weltfriedens, der Schutz der Menschenrechte und die Einhaltung des Völkerrechts. Die UNO setzt sich aber auch für die Erhaltung von Kulturgütern und gefährdeten Naturgebieten ein.




Abb. 3: Rotes Kreuz, Roter Halbmond, Roter Kristall und Roter Davidstern


Aus dem 14-Punkte-Plan Wilsons:
Die europäischen Völker sollten:
• ein Selbstbestimmungsrecht haben
• freien Handel treiben können
• ihr Militär abrüsten
• diplomatische Verträge öffentlich abschließen
Abb. 4: Interpretiere die Aussage dieser Skulptur in Zusammenhang mit den Zielen der UNO! Erläutere die Symbolik des Revolvers als Darstellungsobjekt! Beurteile die Bedeutung des Knotens am Ende des Laufs und seine Verbindung zur Botschaft der Skulptur! Diskutiert eure Ergebnisse in der Klasse!
So schätze ich mich nach dem Großkapitel „DER ERSTE WELTKRIEG“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…die Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs nennen.
…den Begriff (Reichs)-Nationalismus definieren.
…die Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs analysieren.
…den Verlauf des Ersten Weltkriegs schildern.
…die kriegsentscheidenden Ereignisse benennen.
…die Forderungen Bertha von Suttners wiedergeben.
…die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung – insbesondere Frauen und Kinder – nennen.
…über die Auswirkungen des Kriegs auf die Zivilbevölkerung reflektieren.
…mit der Methode M7 Feldpost untersuchen.
…die Auswirkungen der Friedensverträge beurteilen.
…die innereuropäischen Veränderungen der Staatsgrenzen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs beschreiben.
Buchtipps



Verlag
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
Herbert Günther: Zeit der großen Worte (cbt 2018).
Alexandra Rak (Hg.): Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen: Erzählungen über den Ersten Weltkrieg (Fischer KJB 2014).
Nikolaus Nützel: Mein Opa, sein Holzbein und der große Krieg: Was der Erste Weltkrieg mit uns zu tun hat (arsEdition 2013).










1. WAS IST IDENTITÄT?
Wer bin ich eigentlich?
Im Allgemeinen verwendet man den Begriff Identität dazu, um alle Merkmale eines Menschen oder einer Gruppe zu beschreiben. Der Begriff individuelle Identität wird verwendet, wenn man von nur einem Menschen spricht, im Gegensatz zu kollektiver Identität, die eine Gruppe beschreibt.
INDIVIDUELLE IDENTITÄT
wird geprägt durch ...
Herkunft, Sprache, Kultur
Abb. 1: Auswahl – Prägende Faktoren der Identität
KOLLEKTIVE IDENTITÄT wird geprägt durch ...
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Familie, Freundeskreis, Nation usw.)
D1: Eine Frage, die nervt – Welche Identität hast du eigentlich? von Barbara Coudenhove-Kalergi (Standard 17. 8. 2016)
Dominik hat einen österreichischen Vater und eine amerikanische Mutter, ist in England geboren und aufgewachsen. Dominik, was bist du eigentlich? Diese Frage hört er nicht gern. Von allem ein bisschen, sagt er, leicht genervt. Gabi kam als ungarisches Flüchtlingskind nach Wien und fühlt sich seither in Österreich als Ungarin und in Ungarn als Österreicherin. Miriam, in Afghanistan geboren, im Iran aufgewachsen, seit zwei Jahren in Österreich, hat auf die bewusste Frage eine Universalantwort parat: Ich bin Mensch, erklärt sie. […] Darf man in einer globalisierten Welt wirklich nur ein einziges Vaterland haben? Ist das überhaupt möglich? Dominiks Vater verbrachte fast sein ganzes Berufsleben in England und fühlte sich dort heimisch, aber er brachte von jedem Österreichaufenthalt einen Laib gutes hiesiges Schwarzbrot mit und sprach mit seinen Kindern konsequent Deutsch. […] die Antwort auf die Frage: Wer bist du eigentlich? wird in Hinkunft nicht mehr einfach lauten können: Österreicher und sonst gar nichts.
Aus: http://derstandard.at/2000042977363/Eine-Frage-die-nervt/ (23. 2. 2024)
Identität durch Staatsbürgerschaft?
Verlag
Erkläre die wesentlichen Elemente von Identität!
Definiere deine individuelle und kollektive Identität!
D1: Fasse die Kernaussage des Textes mit eigenen Worten zusammen!
Beurteile, inwiefern eine auf die eigene Nation beschränkte Identität in einer globalen Welt sinnvoll ist!
Erstellt in Kleingruppen ein Plakat oder eine MindMap zu individueller und kollektiver Identität und ergänzt sie mit den Kernaussagen des Textes!
globalisiert: auf die ganze Welt ausgedehnt
konsequent: (fest) entschlossen
recht

Jede und jeder aus eurer Klasse besitzt in der Regel die Staatsbürgerschaft eines Landes. Es ist dies die formale Zugehörigkeit zu einem Staat. Damit verbunden sind auch gewisse politische Rechte , wie ab einem bestimmten Alter das Wahlrecht.
Durch die Staatsbürgerschaft haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Staates einerseits Rechte und Pflichten gegenüber dem Staat. Andererseits bildet sich durch den Besitz der gleichen Staatsbürgerschaft auch eine politische und symbolische Gemeinschaft der Menschen, die in diesem Staat leben. Diese Menschen entwickeln ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine kollektive Identität entsteht. Das Entstehen einer solchen kollektiven Identität birgt aber auch gewisse Gefahren. So haben jene Menschen, die nicht im Besitzt der Staatsbürgerschaft sind, aber trotzdem in diesem Staat leben, nicht die gleichen Rechte und Pflichten wie die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Sie sind „die Anderen“, die nicht dazugehören.

Das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht erlaubt im Allgemeinen keine Doppeloder Mehrfachstaatsbürgerschaften.
Erörtere die Vor- und Nachteile einer doppelten Staatsbürgerschaft!
Diskutiert, warum Österreich Doppelstaatsbürgerschaften einschränkt!
Beurteile, ob die Regelung geändert werden sollte!
Reflektiert in Partnerarbeit, wie eine Änderung Integration und Identität beeinflussen könnte!
Nun
Das bin ich – das macht mich aus! Der Fächer steht für dich und das, was dich ausmacht. Notiere auf dem Fächer, was für dich wichtig ist!
Tipp: Du kannst dir vorher eine Stichwortliste anfertigen und Begriffe sammeln oder gleich beginnen. Falls du nicht genug Platz hast, kannst du auch einen eigenen Fächer aus Packpapier basteln. Arbeite so, wie es für dich am besten passt! Klebe zum Abschluss ein Foto von dir ein und schreibe deinen Namen dazu!

GRUNDBEDÜRFNISSE
MEINE FÄHIGKEITEN / STÄRKEN
MEINE INTERESSEN / HOBBYS
MEINEWÜNSCHE/ TRÄUME

Stelle nun deinen persönlichen Fächer deinen Mitschülerinnen und Mitschülern vor!
2 Achtet darauf, dass jeder ausreichend Zeit hat!
2 Sprecht in ganzen Sätzen und fragt nach, wenn etwas unklar ist!
2 Eure persönlichen Fächer könnt ihr anschließend im Klassenraum aufhängen.
Erstellt nun gemeinsam eine Tabelle nach folgendem Muster, in die ihr eure Gemeinsamkeiten eintragt!
Jeder Mensch hat seine eigene Meinung – und das ist auch gut so. In Diskussionen, Streitgesprächen und Gesprächen geht es immer um ein bestimmtes Thema. Deine Mutter ist der Meinung, dass es gut für dich ist, um spätestens neun Uhr im Bett zu sein, wenn am nächsten Tag wieder Schule ist. Du bist jedoch der
1. SCHRITT: Richtig Zuhören und Verstehen
Missverständnisse und Probleme vermeiden!
Meinung, dass es nicht so schlimm wäre, länger aufzubleiben und trotzdem am nächsten Tag nicht unausgeschlafen und müde in der Schule zu sein. Jeder hat also seinen Standpunkt oder seine Meinung die pro (für) oder kontra (gegen) ein Thema ist.
Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es wichtig, dass du zuerst die Meinung deines Gesprächspartners genau anhörst und sicherstellst, dass du sie richtig verstehst. Stelle Nachfragen, wenn etwas unklar ist, und wiederhole eventuell in deinen eigenen Worten, was du verstanden hast. So kannst du sicherstellen, dass du richtig reagierst und keine Fehlinterpretationen entstehen.
2. SCHRITT: Meinungen formulieren
Wenn du deine Meinung anderen gegenüber überzeugend darstellen möchtest, musst du sie klar und logisch formulieren. Wichtig ist dabei, dass die Person, die eine Behauptung aufstellt, die Beweislast trägt. Das bedeutet, du solltest deine Aussagen mit stichhaltigen Argumenten und Fakten belegen. Verwende die drei großen „B“:
3. SCHRITT: Verwende Signalwörter

Behauptung – Was ist dein Standpunkt?
Begründung – Warum vertrittst du diesen Standpunkt?
Beispiel - Womit kannst du dein Argument untermauern?
Meinungen kannst du am Inhalt der Aussage sowie an bestimmten Signalwörtern erkennen. Sie helfen dir auch, deine Meinung zu unterstreichen und geben Auskunft darüber, ob jemand für oder gegen ein Thema ist. Zu den Signalwörtern für „pro“ zählen: immer, zweifellos, sicher, … Zu den Signalwörtern für „kontra“ zählen: keinesfalls, niemals, nicht, … Folgende Signalwörter deuten auf „Unentschlossenheit“ hin: eventuell, vielleicht, möglicherweise, anscheinend, …
4. SCHRITT: Vermeide Fehlargumentationen
Achte darauf, dass du nicht auf Fehlargumentationen hereinfällst oder sie selbst nutzt. Eine häufige Fehlargumentation ist der sogenannte Whataboutism. Dabei wird auf Kritik nicht eingegangen, sondern die Aufmerksamkeit auf ein anderes, oft nicht relevantes Thema gelenkt („Aber was ist mit…?“). Das lenkt vom eigentlichen Argument ab und verhindert eine sachliche Diskussion.
5. SCHRITT: Zu seiner Meinung stehen
Wenn du eine Meinung hast, ist es wichtig, zu deinem Standpunkt zu stehen und diesen überzeugend zu vertreten. Argumentiere klar und erkläre deinen Standpunkt. Gleichzeitig ist es ebenso wichtig, die Meinung anderer zu respektieren und offen für neue Perspektiven zu sein. Manchmal ist es sinnvoll, einen Kompromiss zu finden oder sich von guten Argumenten der anderen Seite überzeugen zu lassen.
Eine Gruppendiskussion
Olympe Verlag
Das Parlament beschließt ein neues Gesetz, das den Lehrerinnen und Lehrern vorschreibt, dass ab dem kommenden Schuljahr keine Hausaufgaben mehr gestellt werden dürfen. Lernen und Üben soll ausschließlich in der Schule stattfinden.
Teilt nun die Klasse in eine „Pro-neues-Gesetz Gruppe“ und eine „Kontra-neues-Gesetz Gruppe“. Auch wenn du vielleicht nicht in der Gruppe bist, deren Meinung du tatsächlich persönlich vertrittst, versuche treffende und gut formulierte Argumente zu finden! Deine Lehrperson sollte die Diskussion leiten und steuern! Beachte die Gesprächsregeln!
2. NATIONALE IDENTITÄTEN
† D1: Erkläre, was mit dem Selbstbestimmungsrecht im 14-Punkte-Programm gemeint war! Beschreibe, warum diese Idee viele Nationalistinnen und Nationalisten im Habsburgerreich begeisterte!
Beurteile, warum die Umsetzung schwierig war, insbesondere wegen der Annahme einheitlicher Sprachgebiete und der tatsächlichen Vielvölkerstruktur!
Ziehe Parallelen zwischen den Problemen im Habsburgerreich nach dem Ersten Weltkrieg (z. B. durch ethnische und sprachliche Vielfalt) und aktuellen Konflikten, bei denen ähnliche Spannungen auftreten!
Abb. 1: Beschreibe das Bild!
Erörtere, warum es wichtig ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenleben können!
Analysiere, welche Rolle die Staatsbürgerschaft dabei spielt, Menschen mit verschiedenen Hintergründen in einer Gesellschaft zu integrieren!
Erläutert gemeinsam, warum ein gemeinsames Verständnis von Rechten und Pflichten wichtig ist!
Kulturnation oder Staatsnation?
Bei einer Kulturnation fühlt sich eine Gemeinschaft von Menschen durch Sprache, Traditionen, Kultur und Religion miteinander verbunden. Diese Faktoren begründen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, welches von staatlichen Grenzen unabhängig ist, sodass eine Kulturnation auf verschiedene Staatsgebiete verteilt sein kann. So bildete sich auch gegen Ende des 18. Jh. bei der Bevölkerung der Kleinststaaten des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation das Bewusstsein einer nationalen Zusammengehörigkeit heraus.
Frankreich wiederum galt seit der Französischen Revolution als Beispiel für eine Staatsnation, die auf einer gemeinsamen Geschichte und Verfassung beruht. Staatsnationen sind unter anderem durch ein Staatsgebiet, Staatsinsignien wie Flaggen, Hymnen usw., Staatssprache(n) und eine eigene Währung gekennzeichnet.
D1: Hintergrund: Idee und Praxis des „Selbstbestimmungsrechts der Völker“ am Ende des Ersten Weltkriegs – Haus der Geschichte Österreich
Verlag
Den „Völkern“ Österreich-Ungarns […] sicherte das 14-Punkte-Programm (siehe S. 139) ein Selbstbestimmungsrecht zu. Von vielen NationalistInnen im Habsburgerreich wurde es daher mit großer Begeisterung aufgenommen. Es kam zur Gründung unabhängiger Staaten wie der Tschechoslowakei, die sich als vermeintlich einheitliche „Nationalstaaten“ verstanden, die nun das Problem des Vielvölkerstaates gelöst hätten. In Wahrheit war aber jeder neu gegründete Staat ein Vielvölkerstaat im Kleinen. Der Fehler war in einer grundlegend falschen Annahme zu suchen: Das „Selbstbestimmungsrecht“ ging von einheitlichen Sprachgebieten aus, deren Bevölkerung eben selbst entscheiden sollte, wohin sie sich zugehörig fühlte und welchem Staat sie sich anschließen wollte. Das war erstens mit der Situation der Menschen nicht vereinbar, von denen sich viele nicht eindeutig einer Nation zugehörig fühlten. Selbst wenn es einheitliche Sprachgruppen gab, beschränkten sie sich aber oft auf kleinere Siedlungsgebiete oder sogar Familien, die eng neben den Angehörigen anderer Sprachgruppen wohnten. Die Vorstellung eines einheitlichen Sprachgebiets war daher eine Fiktion. Aus: Hintergrund: Idee und Praxis des „Selbstbestimmungsrechts der Völker“ am Ende des Ersten Weltkriegs - hdgö (26. 12. 2024
Der Prozess der Demokratisierung
Im 19. Jahrhundert begann in Europa mit der Bildung von Nationalstaaten auch der Prozess der Demokratisierung. Vor allem Studenten und Bürger kämpften in den Nationalbewegungen für mehr Mitsprache und Pressefreiheit. Durch die Entstehung demokratischer Nationalstaaten veränderte sich das Verhältnis zwischen Menschen und Staat grundlegend: Sie waren nicht länger Untertanen, sondern aktive Bürgerinnen und Bürger. Ein ständiger Diskussionsprozess entstand, um zu klären, wer innerhalb der Nationalstaaten mitbestimmen sollte.

Heute leben viele Menschen nicht mehr in dem Land, in dem sie geboren wurden, was die Frage der Mitbestimmung neu stellt. Weltweit sind jedoch nur etwa ein Drittel der Staaten demokratisch, viele davon in Europa. In anderen Regionen herrschen oft autoritäre Strukturen. Innerhalb von Nationen gibt es neben einem positiven Wir-Gefühl oft auch negative Abgrenzungen, was man als Nationalismus bezeichnet.
Abb. 1: Österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger (Fotomontage 2024)
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Eigene nationale Symbole sollten in den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) keine Bedeutung mehr haben. 1 2 3 4
Nationale Symbole – Bildet zunächst Fünfergruppen und wählt gemeinsam ein Land aus der Länderliste aus! Entscheidet euch dabei für ein Land, das euch besonders interessiert oder dessen nationale Symbole ihr näher kennenlernen möchtet! Folgt nun der Anleitung!
Österreich © Deutschland © Türkei © Serbien © Spanien © Frankreich © Großbritannien © Russland © Italien © Belgien © Japan © USA

a) Sobald ihr euch für ein Land entschieden habt, teilt euch die Arbeit auf! Folgende fünf Bereiche stehen zur Auswahl:
1. Erstellen eines Steckbriefs – Recherchiere Informationen zum ausgewählten Land (Bilder, Grafiken, Statistiken usw.)!
2. Nationalflagge – Erläutere, wofür die auf der Flagge verwendeten Symbole und Farben stehen!
3. Nationalhymne – Erläutere die Entstehungsgeschichte der Hymne! Welche immer wiederkehrenden Worte kommen darin vor?
4. Wappen – Wie entstand das Wappen? Welche Symbole zeigt es? Welche Farben werden verwendet und welche Bedeutung haben diese?
5. Feiertage – Welche nationalen Feiertage gibt es und welchen Stellenwert haben diese in dem jeweiligen Land?
b) Erstellt nun gemeinsam ein Plakat mit euren Ergebnissen!
Verlag
c) Vergleicht nun die Ergebnisse innerhalb der Klasse! Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten lassen sich zwischen den einzelnen Ländern feststellen?
Sammle Argumente, die für und gegen die Verwendung von nationalen Symbolen sprechen! Notiere deine Pro- und Kontra-Argumente!
PRO CONTRA

Teilt nun die Klasse in eine „Pro-Gruppe“ und eine „Kontra-Gruppe“ und führt eine Gruppendiskussion! Beachtet dabei die Gesprächsregeln!
Formuliere dein eigenes begründetes Urteil zu folgender Aussage!

Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Lies zuerst den Informationstext und studiere dann die Grafik!

Im August 2022 ließ die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ eine telefonische Umfrage mit Österreicherinnen und Österreichern ab 16 Jahren von einem Meinungsforschungsinstitut durchführen.
Die Österreicherinnen und Österreicher sind stolz auf ihr Land aber was heißt das genau? DER STANDARD hat nachfragen lassen und herausgefunden: Es sind die touristischen Klischees, die Identität vermitteln.
Worauf die Österreicherinnen und Österreicher stolz sind Wähle aus der Grafik Bereiche aus, die auch deiner Einstellung entsprechen!
auf die landschaftliche Schönheit auf die hohe Lebensqualität auf die österreichische Küche Hilfsbereitschaft der Österreicher bei Katastrophen auf Tradition und Brauchtum auf die Neutralität typisch österreichische Sehenswürdigkeiten und Spezialitäten auf die kulturellen Leistungen des Landes dass Ö ein demokratisches Land ist, wo sich jeder in die Politik… auf die angebotene Schul- und Berufsausbildung hohe persönliche Sicherheit, niedrige Kriminalität auf bekannte Forscher, Erfinder, Entdecker auf die sportlichen Leistungen der Österreicher auf die Umweltqualität Leistungen der modernen Wissenschaft und Forschung hohe soziale Sicherheit, dass es keine sichtbare Armut im Land… auf bekannte Künstler auf die Leistungsfähigkeit der Industrie und Wirtschaft auf die Geschichte des Landes dass in Österreich jeder, der wirklich fleißig ist, ein kleines… guten Beziehungen zu den ehemaligen Ostblockstaaten auf die politische Stabilität dass es bei den Einkommen in Österreich ziemlich gerecht… auf die Ausländerfreundlichkeit der Österreicher auf unsere Rolle in der EU auf das internationale Ansehen unserer Politiker
repräsentativ: Repräsentativ bedeutet, dass etwas typisch für eine größere Gruppe ist. Zum Beispiel: Wenn eine Umfrage repräsentativ ist, spiegelt sie die Meinung einer größeren Anzahl von Menschen wider.
Verlag
Klischee: festgefahrene Vorstellung; Vorurteil
Abb.2: repräsentative Umfrage des market-Instituts 2022 (n=817)
Besprecht in Partnerarbeit Gründe, die für die Platzierung der letzten beiden Plätze ausschlaggebend gewesen sein könnten! 3 Bereiche, auf die ich weniger stolz bin 3 Bereiche, auf die ich stolz bin
Nun
geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Recherchiere unter www.politik-lexikon.at die Begriffe PATRIOTISMUS und NATIONALISMUS und erkläre diese mit eigenen Worten! Erläutere auch den Unterschied!
Patriotismus:
Nationalismus:
Unterschied:
Lies zuerst den Informationstext! Anschließend gestaltet in Partnerarbeit eine Mind-Map zum Thema „Heimat“! Gehe dabei nach der Methode M2 „Eine Mind-Map erstellen – Gedanken strukturieren“ vor!

In vielen Ländern gewinnen nationalistische Gruppen und Parteien an Einfluss, was teils eine Herausforderung für die Demokratie darstellt. Nationalismus kann sowohl eine positive Betonung der eigenen Kultur und Heimat als auch eine problematische Einschränkung der Rechte von Minderheiten bedeuten.
Anhängerinnen und Anhänger des Nationalismus betonen oft den Begriff Heimat, der für Sicherheit und Zusammenhalt steht. Dies kann positiv sein, wenn es um den Schutz der kulturellen Identität geht. Allerdings kann diese Fokussierung auch zur Ausgrenzung anderer Kulturen führen.
Es ist wichtig, den Begriff „Heimat“ differenziert zu betrachten: Er kann Zugehörigkeit und Sicherheit vermitteln, sollte jedoch Offenheit und Vielfalt nicht ausschließen.
Vergleicht nun eure Ergebnisse in der Klasse! Gibt es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?

Diskutiert eure Ergebnisse in der Klasse! Begründet auch, warum ihr teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen seid!
Recherchiert im Internet nach den Stichworten „Heimat politische Diskussion Österreich“, um herauszufinden, von wem und in welchen Zusammenhängen der Begriff „Heimat“ politisch genutzt wurde!

Olympe Verlag
Entschlüssle die Karikatur mit der Methode M3 „Karikaturen deuten“!
Erläutere, was der Karikaturist mit den einzelnen Elementen der Karikatur insgesamt aussagen will!
Beurteile, inwieweit du dem Karikaturisten und seiner Kritik Recht gibst! Notiere deine Überlegungen in deinem Heft!
Abb. 3: Karikatur Das Europa der zwei Geschwindigkeiten: Von Reformen und Neugründung ist die Rede von Oliver Schopf, 2018
3. EUROPÄISCHE IDENTITÄT

Abb. 1: Plakat anlässlich der Gründung der EGKS (1952)
montan: den Bergbau betreffend
Stationen der europäischen Zusammenarbeit
Nach zwei Weltkriegen bestand in Europa der Wunsch nach einem dauerhaften Frieden. Deshalb schlug 1950 der französische Außenminister Robert Schuman vor, die französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion gemeinsam in einer neu gegründeten Organisation zu kontrollieren. Die Kohle- und Stahlindustrie sollte nicht länger zu Kriegszwecken eingesetzt werden, sondern gemeinsam verwaltet werden.
Am 18. April 1951 gründeten Belgien, die BRD, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die in den folgenden Jahren auch Montanunion genannt wurde. So kam es zum ersten Mal seit den beiden Weltkriegen zu einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Erzfeinden Deutschland und Frankreich. Damit war der Grundstein für einen dauerhaften Frieden gelegt.
Abb. 1: Beschreibe Schritt für Schritt, welche Elemente und Symbole auf dem Plakat zu sehen sind!
Analysiere die Bedeutung der dargestellten Symbole!
Untersuche, welche Elemente auf dem Plakat besonders betont werden und wie die Gestaltung diese Wirkung unterstützt!
Interpretiere die zentrale Botschaft des Plakats im Zusammenhang mit der Überschrift „Tag des freien Europa“ und dem Hinweis „Erster Schritt: Kohle und Stahl“!
1957 wurde die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) gegründet, um eine friedliche Nutzung der Kernenergie zu gewährleisten. Im gleichen Jahr erfolgte die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit dem Ziel, einen europäischen Markt zu entwickeln und einen schrittweisen Abbau von Handelsschranken zu erreichen. Dies sollte der Friedenssicherung sowie einer Stärkung des Solidaritätsgedankens in dem damals gespaltenen Europa dienen.
Verlag
Die Europäische Union
Aus der EWG entwickelte sich zunächst die Europäische Gemeinschaft (EG) und schließlich die Europäische Union (EU). Dabei haben die Mitgliedsstaaten, aber auch die EU einen stetigen Wandel durchlaufen. Heute (Stand: 1. 9. 2024) hat die EU 27 Mitgliedsstaaten.
Die Bevölkerung dieser Staaten fühlt sich in unterschiedlichem Ausmaß als Europäerin oder Europäer. Ob und wie sehr jemand sich als Europäerin oder Europäer fühlt, hängt einerseits davon ab, welchen Nutzen man mit Europa und der Europäischen Union verbindet. Andererseits spielen auch Gefühle eine große Rolle. Welche Gefühle man Europa und der Idee eines geeinten Europas entgegenbringt, bestimmt wesentlich die Einstellung zur eigenen europäischen Identität. Noch ist die europäische Identität nicht sehr ausgeprägt. Sie gerät immer wieder in einen Konflikt mit den nationalen Identitäten und einem übersteigerten Nationalismus. Außerdem fehlen der Europäischen Union identitätsstiftende Gemeinsamkeiten. So gibt es etwa keine gemeinsame Sprache. Die große Herausforderung der kommenden Jahrzehnte liegt nun darin, zu einer verbindenden europäischen Identität zu gelangen.


K1: Die Mitgliedstaaten der EU 2024
K1: Vergleiche die geografische Lage der EUMitgliedstaaten! Welche Länder grenzen an Nicht-EU-Staaten, und wie könnte diese Lage ihre Politik oder Wirtschaft beeinflussen?
Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
1
Fülle zuerst den folgenden Fragebogen aus! Dann vergleiche dein Ergebnis mit den anderen in der Klasse!

3 2
a) Fühlst du dich als Österreicherin/Österreicher und zwar unabhängig von der Staatsbürgerschaft?
JA, weil
NEIN, weil
b) Gibt es etwas an dir, das du als typisch österreichisch beschreiben würdest?
JA NEIN mein Beispiel:
c) Fühlst du dich als Europäerin/Europäer?
JA, weil
NEIN, weil
Verlag
d) Gibt es etwas an dir, das du als typisch europäisch beschreiben würdest?
JA NEIN mein Beispiel:

Formuliere möglichst viele Ergänzungen zu diesem Satz in deinem Heft, um zu zeigen, welche Bedeutung die Europäische Union für dich hat!
Europa bedeutet für mich...
Findet in Partnerarbeit mindestens fünf Gemeinsamkeiten der EU-Mitgliedsstaaten!
GEMEINSAMKEITEN DER EU-MITGLIEDSSTAATEN





150 IDENTITÄTEN
So schätze ich mich nach dem Großkapitel „IDENTITÄTEN“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…zwischen individueller und kollektiver Identität unterscheiden.
…mich mit meiner eigenen Identität auseinandersetzen.
…identitätsstiftende Vorgänge erklären.
…eine Pro- und Kontra-Diskussion mit der Methode M8 führen.
…zwischen Kulturnation und Staatsnation unterscheiden und Beispiele dafür anführen.
…mich mit der Frage nach der nationalen Identität einer Österreicherin/eines Österreichers beschäftigen und darüber reflektieren.
…die Bedeutung nationaler Symbole analysieren.
…zwischen Patriotismus und Nationalismus unterscheiden und diese Begriffe definieren.
…mich mit dem Begriff Heimat auseinandersetzen sowie beurteilen, wie dieser in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird.
…Stationen der europäischen Zusammenarbeit bis zur Gründung der EU nennen.
…den Begriff Europäische Identität reflektieren.
Buchtipps



Verlag
Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
Wolfgang Korn: Was ist schon normal?: Warum alle Menschen gleich und doch verschieden sind (arsEdition 2011).
Wolfgang Böhm und Otmar Lahodynsky: EU for you!: So funktioniert die Europäische Union (G & G Kinder- und Jugendbuch 2018).
Gesine Grotrian und Susan Schädlich: Fragen an Europa: Was lieben wir? Was fürchten wir? (Beltz und Gelberg 2019).










1. DU HAST DIE WAHL
Demokratie im Alltag
Manches in deinem Leben kannst du wählen wie deinen Freundeskreis, welche Schule du besuchen möchtest oder deinen Beruf. Aber dafür musst du immer wieder Entscheidungen treffen mit mehr oder weniger weitreichenden Folgen
Die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen, ist das Merkmal der Demokratie. Demokratie begegnet dir auch immer wieder im Alltag. Sogar im Schulalltag findest du Demokratie, z. B. bei der Wahl der Klassensprecherin oder des Klassensprechers.
Demokratie in der Schule
... Wahl der Klassenvertreter/innen
Das österreichische Schulunterrichtsgesetz legt fest, dass ab der fünften Schulstufe in jeder Klasse eine Klassensprecherin oder ein Klassensprecher für ein Schuljahr zu wählen ist.

Die Aufgaben der Klassensprecherin oder des Klassensprechers umfassen die Vertretung der Interessen der Klasse gegenüber den Lehrkräften und der Schulleitung. Sie sind verantwortlich dafür, Anliegen und Probleme der Mitschülerinnen und Mitschüler zu sammeln und weiterzugeben, Vorschläge für die Gestaltung des Schullebens einzubringen und die Kommunikation zwischen der Klasse und den Lehrkräften zu unterstützen. Folgende Grundsätze gelten bei dieser Wahl:
Verlag
PASSIVES WAHLRECHT: Dieses ist das Recht eines Menschen, sich bei einer Wahl als Kandidatin oder Kandidat aufstellen zu lassen und gewählt zu werden. Bei der Wahl der Klassenvertreterin oder des Klassenvertreters bedeutet dies:
Jede Schülerin, jeder Schüler einer Klasse kann für dieses Amt kandidieren. Sie oder er hat somit das passive Wahlrecht
AKTIVES WAHLRECHT: Dieses ist das Recht eines Menschen, sich durch Stimmabgabe an einer Wahl beteiligen zu können, also zu wählen. Bei der Wahl der Klassenvertreterin oder des Klassenvertreters bedeutet dies:
Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse dürfen wählen. Sie besitzen das aktive Wahlrecht
... Wahl der Klassensprechervertreterinnen oder Klassensprechervertreter


Alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher einer Mittelschule (MS) oder AHSUnterstufe wählen eine Person aus ihrem Kreis als Schülervertreterin oder Schülervertreter. Diese Person hat das Recht, an den Schulforen (in der AHS: Schulgemeinschaftsausschuss, kurz SGA) teilzunehmen, jedoch nur in beratender Funktion. Das bedeutet, sie kann sich aktiv an den Gesprächen beteiligen, hat aber bei Abstimmungen kein Stimmrecht. In der MS sind die Schulsprecherin oder der Schulsprecher und zwei weitere Vertreterinnen oder Vertreter der Schülerinnen und Schüler Mitglieder des Schulforums.
Abb.1: Symbolfoto einer Schülerin bei einer Wahl zur Klassensprecherin oder zum Klassensprecher (gestellt), aufgenommen 2016
Abb. 1: Führt eine politische Diskussion zum Thema: Welche zusätzlichen Rechte würde eine Klassensprecherin/ein Klassensprecher benötigen, um eure Interessen besser durchsetzen zu können? Gestaltet in Partnerarbeit einen Stimmzettel für eine Klassensprecherwahl! Was müsst ihr dabei beachten? Was muss unbedingt auf dem Stimmzettel stehen? Schulforum, das: gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
152 WAHLEN UND WÄHLEN

GLEICH
Jede Stimme ist gleich viel wert.
Regeln für diese Wahlen
Die Wahlen der Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie der Schulsprecherinnen und Schulsprecher sind gesetzlich genau geregelt.
Für sie gelten – wie bei allen politischen Wahlen in Österreich – vier Grundsätze bzw. Prinzipien.
GEHEIM
Die Stimmabgabe muss alleine und unbeobachtet stattfinden.
Abb. 2: Prinzipien einer Wahl
Begründet zu zweit, warum es wesentlich ist, dass die Stimmabgabe geheim erfolgt!
Nenne Beispiele, wo Menschen gemeinsam Entscheidungen treffen müssen, die alle betreffen!
Abb. 3: Notiere, welche Anliegen du an einen Klassenrat hättest!
Organisiere gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen, deinen Mitschülern einen Klassenrat zum Thema „Klassenregeln“!
Protokoll, das: wortgetreue Niederschrift über eine Sitzung
PERSÖNLICH
Alle Wählerinnen und Wähler wählen selbst. Wer bei der Wahl nicht dabei ist, gibt keine Stimme ab. Es ist nicht gestattet, sich vertreten zu lassen.
UNMITTELBAR
Die Kandidatin oder der Kandidat des Vertrauens wird direkt gewählt.
Die Oberste Wahlbehörde ist die Schulleiterin bzw. der Schulleiter oder eine beauftragte Person. Die Aufgabe der Obersten Wahlbehörde besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Wahl ordnungsgemäß abläuft.
Gesprächskultur lernen
Im Zusammenleben von Menschen gibt es immer wieder Situationen, in denen gemeinsam Entscheidungen getroffen werden müssen, die alle betreffen und die auch von allen akzeptiert werden müssen.
Verlag
Ob auf hoher politischer Ebene – im Parlament, in den Landtagen – oder in der Klasse, immer müssen diesen Entscheidungen Gespräche und Diskussionen vorausgehen, denn nur selten sind alle Beteiligten von Beginn an einer Meinung.
Der Klassenrat
Miteinander diskutieren ist aber nicht immer einfach. In der Schule haben Schülerinnen und Schüler die Chance, das zu lernen. Eine Möglichkeit dazu ist der „Klassenrat“. Dies ist eine Versammlung der Schülerinnen und Schüler einer Klasse gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Im Klassenrat werden in regelmäßigen Sitzungen anfallende Probleme und Konflikte besprochen und gemeinsam Lösungen gesucht.
Zuerst stellen alle Beteiligten im Mehrheitsverfahren gemeinsam Regeln auf und legen Rechte, Ämter und Aufgaben fest. Sie beraten, diskutieren und entscheiden gemeinsam über selbst gewählte Themen, Klassenaktivitäten, Lernvorhaben, usw.

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen aber auch Aufgaben wie Gesprächsleitung und Protokollführung
Abb. 3: Klassenrat in einer 5. Schulstufe (2018)
Versetze dich in diese Rolle hinein! Du bist Klassensprecherin oder Klassensprecher eurer Klasse – Was würdest du in diesem Fall tun?
Während eurer Turnstunde wird euer Klassenraum von einer anderen Klasse als Unterrichtsraum benutzt! Danach herrscht oftmals Unordnung: Federpennale oder Lineale liegen auf anderen Tischen oder am Boden, Jausensackerl und leere Getränkeflaschen liegen auf dem Boden, die Tafel ist nicht gelöscht usw.
Entscheide dich nun für eine Möglichkeit!
mit den Schülerinnen und Schülern der anderen Klassen sprechen und sie bitten, Ordnung zu halten sich an den Klassenvorstand der anderen Klasse wenden und diese/n bitten, das Problem zu lösen ein Gespräch mit dem eigenen Klassenvorstand suchen, damit dieser einschreitet sich an die Direktion wenden und zwar mit der Bitte, das Problem zu lösen anderer Vorschlag nichts unternehmen


Begründe auch deine Entscheidung!
Verlag
Informiere dich über die Regeln und Anforderungen für die Teilnahme an einer Demonstration und diskutiere anschließend in einem Klassengespräch die Vor- und Nachteile politischer Teilnahme auf diesem Weg! Erläutere, warum Demonstrationen besonders für nicht wahlberechtigte Menschen eine Möglichkeit politischer Teilhabe sein können!
Ich will an einer Demonstration gegen eine politische Entscheidung teilnehmen.

2 Recherchiere: Wer muss dir als Schülerin oder Schüler die Erlaubnis zur Teilnahme an einer Demonstration geben (Eltern, Schule)?
2 Finde heraus, ob die Demonstration, an der du teilnehmen möchtest, offiziell angemeldet ist. Wie kannst du das überprüfen?
2 Informiere dich über verschiedene Arten von Demonstrationen (z. B. friedliche Versammlungen, Kundgebungen, Sitzblockaden) und deren Regeln.
2 Erörtere, welche Risiken bei der Teilnahme an einer Demonstration auftreten könnten, wie beispielsweise Sicherheitsaspekte oder mögliche rechtliche Folgen! 4 5
Finde zwei weitere Beispiele für politische Entscheidungen, die du treffen kannst!
Das österreichische Parlament besteht aus zwei sogenannten „Kammern“, dem Nationalrat und dem Bundesrat. Finde bei deiner Internetrecherche auf www.politik-lexikon.at unter den Stichwörtern „Parlament“, „Nationalrat“ und „Bundesrat“ Antworten auf folgende Fragen!
• Wie viele Abgeordnete haben Nationalrat und Bundesrat?
• Welche Funktion haben diese beiden Kammern?
Wählen mit 14? – Sammelt in Partnerarbeit Argumente dafür und dagegen und gestaltet zu diesem Thema ein Plakat!
154 WAHLEN UND WÄHLEN
BONUS-SEITE DIE ENTWICKLUNG DES WAHLRECHTS
Nenne die Unterschiede zwischen Zensuswahlrecht und Kurienwahlrecht!
Verhältniswahlrecht

Gilt in einem Staat das Verhältniswahlrecht, werden zunächst alle Wählerinnenstimmen und Wählerstimmen zusammengezählt. Anschließend wird berechnet, wie viele Mandate die einzelnen Parteien erhalten.
Ziel des Verhältniswahlrechts ist, die Mandate verhältnismäßig nach der Verteilung der Wählerinnenstimmen und Wählerstimmen zu vergeben und so allen politischen Kräften, die mehr als 4 % der Wählerstimmen erreichten, Sitze im Parlament zu sichern.
Eine Partei, die bei einer Wahl wenig Stimmen erhalten hat, ist mit wenigen Abgeordneten im Parlament vertreten, eine Partei mit vielen Stimmen mit vielen Abgeordneten.
Untersuche die Entwicklung des Wahlrechts in Österreich von 1848 bis 2007! Beschreibe die wichtigsten Änderungen und erkläre, welche Fortschritte in Richtung Demokratie gemacht wurden!
Beurteile, welche Wahlrechtsreform in der Geschichte Österreichs am meisten zur Stärkung der Demokratie beigetragen hat! Begründe deine Meinung mit konkreten Beispielen aus der Übersicht! Diskutiert eure Ergebnisse in der Klasse!
Mehrheitswahlrecht: Das Mehrheitswahlrecht ist ein Wahlsystem, bei dem die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen das Mandat oder den Sitz erhält. Dieses System wird oft als „Winner-takes-all“ bezeichnet, da nur eine Person pro Wahlkreis gewählt wird, unabhängig davon, wie groß der Stimmenunterschied zu den anderen Kandidatinnen oder Kandidaten ist.
Wie du bereits gehört hast, ist die Möglichkeit zu wählen, ein Kennzeichen der Demokratie. Doch nicht immer durften die Menschen in Österreich wählen. Dieses Recht wurde erst langsam erkämpft. Die folgende Übersicht gibt dir einen ersten Überblick über die Entwicklung des Wahlrechts.
Während der Revolution kam es zur Ausarbeitung einer Verfassung und sogar zu ersten freien Wahlen zum Reichstag. Die Revolution wurde jedoch mit Gewalt niedergeschlagen und die folgenden Jahre regierte Kaiser Franz Joseph I. alleine.
Der Kaiser erließ das Februarpatent. Ab da gab es in Österreich ein Abgeordneten- und ein Herrenhaus. Die Abgeordneten zum Herrenhaus wurden vom Kaiser bestellt. In das Abgeordnetenhaus wurden die Abgeordneten von den Landtagen geschickt. Diese Landtage wurden mittels Kurienwahlrecht gewählt.
Reichstagswahlreform: Einführung des Zensuswahlrechts Wahlberechtigt sind nur rund 6% der männlichen Bevölkerung ab 24 Jahren;
Wahlrecht für alle männlichen Staatsbürger! Die einzelnen Stimmen zählen jedoch – je nach Steuerleistung – unterschiedlich viel.
Abschaffung des Kurienwahlrechts und Einführung des allgemeinen Wahlrechts für alle männlichen Personen ab 24 Jahren, die die österreichische Staatsbürgerschaft seit mindestens drei Jahren besitzen und eine einjährige Sesshaftigkeit vorweisen können.
Einführung des Frauenwahlrechts!
In dieser Zeit fanden keine freien Wahlen in Österreich statt!
Herabsetzung des aktiven Wahlalters bei Nationalratswahlen auf 19 Jahre.
Wahlrecht für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher: Personen mit österreichischem Pass können per Wahlkarte im Beisein österreichischer Wahlzeuginnen und Wahlzeugen in einer österreichischen Vertretungsbehörde ihre Stimme bei Nationalratswahlen abgeben.
Herabsetzung des aktiven Wahlalters bei Nationalratswahlen auf 18 Jahre.
Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre, Einführung der Briefwahl im Inland.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei unterschiedliche Systeme, wie bei einer Wahl ermittelt wird, welche Partei wie viele Abgeordnetensitze im Parlament erhält – das Verhältniswahlrecht und das Mehrheitswahlrecht. In Österreich werden der Nationalrat, die Landtage, die Gemeinderäte und die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. Bei Nationalratswahlen muss eine Partei mindestens 4 % der abgegebenen Stimmen erreichen, um ein Mandat zu erhalten.
2.
POLITISCHE PARTEIEN IN
ÖSTERREICH
Politische Parteien sind Vereinigungen von Menschen mit ähnlichen Werten und ähnlichen gesellschaftspolitischen Vorstellungen
In Europa entstanden viele politische Parteien im 19. Jahrhundert. Auch die österreichischen Parteien SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) und die ÖVP (Österreichische Volkspartei) haben ihre Wurzeln in dieser Zeit, auch wenn sie damals andere Namen hatten. Die FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) hingegen hat ihre Ursprünge in dem Verband der Unabhängigen (VdU), welche erst nach 1945 gegründet wurde. Aus dieser ging 1955 die FPÖ hervor. Die grünen Parteien Europas entstanden meist in den 1970er oder 1980er-Jahren.

Untersuche die Grafik „Offizielle Wahlergebnisse bei Nationalratswahlen in Österreich“ und analysiere die Entwicklung der Parteienlandschaft von 1945 bis 2019 anhand der dargestellten Daten! Wann kommen neue Parteien dazu? Wie sieht die Entwicklung der Großparteien aus?
Verlag
Abb. 1: offizielle Wahlergebnisse bei Nationalratswahlen in Österreich seit 1945
Derzeit gibt es in Österreich über 1 200 registrierte Parteien. Fünf dieser Parteien – FPÖ, ÖVP, SPÖ, die NEOS und Die Grünen – sind derzeit im Nationalrat vertreten. Im steirischen Landtag ist die KPÖ vertreten, im Kärtner Landtag das Team Kärnten und im Tiroler Landtag die Liste Fritz Dinkhauser. Die Ziele einer Partei dürfen der Verfassung Österreichs nicht widersprechen und die Statuten der Partei müssen beim Bundesministerium für Inneres hinterlegt werden.
Politische Parteien verwenden für ihre öffentlichen Auftritte häufig Farben und Symbole. Deshalb werden Regierungskoalitionen auch oft mit ihren Farben benannt. Man spricht z.B. von einer rot-schwarzen oder einer schwarz-grünen Koalition. Bei wichtigen politischen Versammlungen tragen Politikerinnen und Politiker manchmal spezielle Parteisymbole.
Parteiprogramme
In Parteien arbeiten Menschen mit ähnlichen politischen Vorstellungen zusammen. Diese gemeinsamen Vorstellungen und Ziele werden in Parteiprogrammen schriftlich zusammengefasst.
Ein Parteiprogramm enthält grundsätzliche Forderungen, Haltungen und Ziele der Partei. Ein Parteiprogramm ist so formuliert, dass es für längere Zeit Gültigkeit hat. Das Parteiprogramm kann jeder lesen und sich dann überlegen, ob sie/er die Ziele der Partei gut findet oder nicht. Wer möchte, kann Mitglied einer Partei werden. Die Mitglieder einer Partei können das Parteiprogramm mitbestimmen und setzen sich dafür ein, dass die Ideen ihrer Partei unter den Wählerinnen und Wählern bekannt werden.
Wozu gibt es Wahlprogramme?

Antworten auf aktuelle politische Fragen werden nicht in Parteiprogrammen, sondern in Wahlprogrammen festgeschrieben. Wahlprogramme beziehen sich direkt auf die aktuelle Situation und werden daher immer in Verbindung mit bevorstehenden Wahlen herausgegeben.
Statut: Zusammenfassung der Regeln
Diskutiert in Vierergruppen! Welche Rolle spielt es für die Demokratie, dass Bürgerinnen und Bürger sich in Parteien engagieren und ihre Vorstellungen durch ein Parteiprogramm bekannt machen können?
M9 WAHLPLAKATE ANALYSIEREN
Wir sehen täglich viele verschiedene Bilder. Auch wenn wir nicht immer bewusst auf Bilder achten, bleiben sie oft in unserem Gedächtnis und beeinflussen unsere Meinung. Im Wahlkampf bemühen sich die Parteien darum, die Gunst der Wählerinnenschaft und Wählerschaft zu gewinnen, indem sie ihre Programme sowie Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren. Neben traditionellen Wahlveranstaltungen, Hausbesuchen und Fernsehauftritten
1. SCHRITT: Beschreibung
Bestimme den ersten Eindruck!
nutzen sie auch verschiedene Online-Plattformen. Dennoch sind Wahlplakate für Parteien im Wahlkampf unverzichtbar, da sie eine ständige Präsenz in der Öffentlichkeit sicherstellen. Jedes Plakat wird mit einem bestimmten Ziel entworfen. Obwohl es viele Unterschiede zwischen den Plakaten gibt, gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Indem wir diese erkennen, können wir besser verstehen, welche Wirkung die Plakate auf uns haben sollen.
Beschreibe, was dir auf den ersten Blick auffällt: Welche Farben, Formen oder Motive springen dir sofort ins Auge?
2. SCHRITT: Analyse
Untersuche die formalen Kennzeichen des Plakats!
Wer hat das Plakat erstellt (z.B. Partei oder Organisation)? Für welche Wahl oder Kampagne wurde es verwendet? Welche Personen, Symbole oder Texte sind darauf zu sehen?
Wie werden die Farben, Schriftarten und Symbole eingesetzt, um bestimmte Botschaften zu transportieren?
Welche Bedeutung könnten die verwendeten Symbole haben? Wie werden Personen oder Objekte dargestellt?
Verlag
3. SCHRITT: Interpretation und Bewertung
Deute die Botschaft und die Wirkung des Plakats!
Welche politischen oder gesellschaftlichen Botschaften vermittelt das Plakat? Wie wird versucht, die Betrachterin oder den Betrachter emotional anzusprechen? Welche Ängste, Hoffnungen oder Meinungen werden angesprochen? Welche Stimmung oder Emotionen werden durch das Plakat vermittelt?
Bewerte den Gesamtcharakter des Plakats: Ist es aggressiv, argumentierend, aufklärend oder emotional? Wie könnte das Plakat auf unterschiedliche Zielgruppen wirken?
Analysiere dieses Wahlplakat, indem du die Methodenschritte 1 – 4 anwendest! Tipp: Du musst nicht alle Fragen beantworten, wähle aber insgesamt mindestens 8 aus!

Formuliere zwei Fragen, die du an die Gestalterin oder den Gestalter dieses Plakats stellen möchtest!
3. WAHLWERBUNG
Die Macht der Werbung
Im Wahlkampf treten die Parteien in Konkurrenz um die Zustimmung der Bürgerin und des Bürgers zu ihren Programmen. Alle Parteien setzen im Wahlkampf Werbemaßnahmen ein, um Botschaften über politische Positionen und Parteiinhalte zu vermitteln.
Die moderne Wahlwerbung verwendet dazu unterschiedliche Formate. Plakate, Fernseh- und Radiowerbung, Wahlveranstaltungen, Werbegeschenke wie Kugelschreiber, Einkaufstaschen und ähnliches sollen die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger überzeugen, diese oder jene Partei am Wahltag zu wählen. In den letzten Jahren hat auch die Werbung über Social Media und Internet zunehmend an Bedeutung gewonnen. Viele Parteien betreiben mittlerweile eigene YouTube-Kanäle, nutzen Facebook, Instagram, Tiktok und andere Plattformen, um direkt mit Wählerinnen und Wählern zu kommunizieren. Diese Kanäle ersetzen teilweise sogar herkömmliche Medien, da sie es Parteien ermöglichen, ihre Botschaften ungehindert und ohne Filterung durch Journalistinnen und Journalisten zu verbreiten.
Die Rolle der Medien im Wahlkampf

Abb. 1: Wahlgeschenke der Parteien vor der Landtagswahl in Kärnten 2023
Abb. 1: Diskutiert das Pro- und Kontra von Wahlgeschenken!
In den letzten Jahrzehnten haben die Medien im politischen Wahlkampf eine immer wichtigere Rolle übernommen.
Was in den Medien nicht gezeigt wird, bleibt in der Öffentlichkeit häufig unbeachtet. Die große Mehrheit der Bevölkerung sieht täglich fern, liest Zeitung und hört Radio. Politische Botschaften erreichen die Menschen daher vor allem über diese Medien. Dass sich die Medienberichterstattung infolgedessen auch auf die Wahlentscheidung auswirkt, ist unbestritten. Diskussionen im Fernsehen können unter Umständen wahlentscheidend sein.
Die politischen Parteien nutzen diese Tatsache gezielt, um über die Medien ihre Inhalte zu vermitteln. Den Medien kommt mit dieser Vermittlerrolle eine wichtige Funktion im Wahlkampf zu, die leider auch missbraucht werden kann. Nicht alle Medien berichten immer objektiv.
Das Wahlplakat
Eine weitere wichtige Rolle bei der Kommunikation zwischen politischen Parteien und Wählerin/Wähler spielt das Wahlplakat. Das Wahlplakat bietet den politischen Parteien die Möglichkeit, sehr viele Menschen mit ihren Botschaften zu erreichen. Allein die Tatsache, dass Wahlplakate sehr lange Zeit in der Öffentlichkeit zu sehen sind, unterstreicht ihre besondere Bedeutung für einen Wahlkampf.




Abb. 2: Beschreibe die abgebildeten Wahlplakate! Fasse mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammen! Analysiere, wie die verschiedenen Elemente der Wahlplakate (z.B. Farben, Schriftarten, Bilder, Slogans) gezielt eingesetzt werden, um Wählerinnen und Wähler zu überzeugen! objektiv: sachlich, unvoreingenommen, unparteiisch


Nun geht’s los – Aufgaben für schlaue Köpfe!
Das kleine PARTEIENLEXIKON der im Nationalrat vertretenen Parteien (Stand: Oktober 2024). Markiere Signalwörter in diesen Textpassagen!





Wofür steht die FPÖ? – Die Freiheitliche Partei Österreichs ist eine rechtspopulistische und EU-skeptische Partei. Sie bekennt sich zum Heimatland Österreich. Außerdem sieht sich die FPÖ als Verfechterin eines „Europa der freien Völker und Vaterländer“.
Wofür steht die ÖVP? – Die Österreichische Volkspartei fühlt sich einem christlichen Menschenbild verpflichtet. In der Stärkung der Wirtschaft und der Sicherung des Wohlstandes aller Bürgerinnen und Bürger des Landes liegt der Schwerpunkt der politischen Arbeit.
Wofür steht die SPÖ? – Die Sozialdemokratische Partei Österreichs ist dem Ideal einer humanen, demokratischen und gerechten Gesellschaft verpflichtet. Sie strebt eine Gesellschaft an, in der Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität an oberster Stelle stehen.
Wofür stehen die NEOS? – Die politische Vereinigung Neues Österreich tritt für eine Öffnung der Gesellschaft ein, die den Menschen in Österreich berufliche und persönliche Gerechtigkeit durch Bildung und Leistung bietet statt durch persönliche Vorteile.
Wofür stehen die Grünen? – Die Grünen setzen sich neben dem Klimaschutz auch für die Rechte von Minderheiten und für eine ökosoziale Steuerreform ein. Ihre Grundwerte gemäß dem Grundsatzprogramm von 2001 lauten: „basisdemokratisch, gewaltfrei, ökologisch, solidarisch, feministisch, selbstbestimmt“.
Verlag
Vergleiche diese Auszüge aus den Parteiprogrammen der drei stimmenstärksten Parteien zu dem Thema Bildung! Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede kannst du feststellen? Recherchiere im Internet, wie DIE GRÜNEN und die NEOS zum Thema Bildung stehen!
Das Vermitteln der Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens, der umfassende Erwerb von Wissen, Kompetenzen und Fertigkeiten, das Fördern individueller Talente und Begabungen, die bestmögliche Ausbildung als Vorbereitung auf das Berufsleben sowie die Vermittlung von Werten und Traditionen unseres Gemeinwesens sind die Hauptaufgaben der staatlichen Schul- und Bildungspolitik. [...] Das Beherrschen der deutschen Unterrichtssprache ist Voraussetzung für die Teilnahme am Regelunterricht an öffentlichen Schulen in Österreich. FPÖ-Parteiprogramm 2011
Wir bekennen uns zum uneingeschränkten Recht auf Bildung. [...] Wir setzen uns für eine vielfältige Bildungslandschaft in Österreich ein, die von öffentlichen und privaten Einrichtungen gestaltet wird. [...] Wir sind für den Kindergarten als erste, wichtige Bildungseinrichtung. [...] Wir bekennen uns zum Leistungsprinzip und zu einem differenzierten Schulsystem, das den unterschiedlichen Talenten und Interessen der Kinder gerecht wird. [...] ÖVP-Grundsatzprogramm 2015
Gleiche Entwicklungschancen [...] Bildung zur Förderung von Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Solidarität [...] Bildung für ein selbstbestimmtes Leben [...] Interesse wecken statt Disziplinieren [...] Bildungsinhalte aktiv gemeinsam erarbeiten [...] Gemeinsame Erziehung von Mädchen und Buben [...] Chancengleichheit im Bildungssystem [...] Europaweiter Austausch der Lernenden [...] Informationsrevolution nutzen [...] SPÖ-Parteiprogramm 2018
Vergleiche, inwieweit die Einstellung der Parteien zum Thema Bildung mit den Aussagen im Parteienlexikon (Aufgabe 1) übereinstimmen!
Die Bildungspolitik welcher Partei spricht dich am meisten an? Begründe deine Entscheidung!
Wahlsimulation – Gründet eure eigenen Parteien!
• Themenwahl: Jede Schülerin bzw. jeder Schüler wählt in geheimer Wahl eines der Themen aus dem Themenspeicher. Die Themen können z. B. Umweltschutz, Bildung, Gleichberechtigung, Digitalisierung oder Verkehrspolitik sein.
• Parteigründung: Die Schülerinnen und Schüler, die sich für dasselbe Thema entschieden haben, bilden eine Partei.
• Aufgabe der Partei: Formuliert gemeinsam ein Hauptziel und drei bis fünf Nebenziele, die euer Parteiprogramm bilden. Diskutiert innerhalb der Gruppe, welche Ziele euch wichtig sind, und wählt anschließend eine/n Parteivorsitzende/n.
• Wahlkampf: Entwerft ein Wahlplakat für euren Wahlkampf. Nutzt das Plakat, um eure wichtigsten Ziele hervorzuheben und eure Partei ansprechend zu präsentieren. Anschließend präsentier t jede Partei ihr Plakat vor der Klasse und erklärt ihr Parteiprogramm.
• Wahlvorbereitung: Bereitet die Wahlzettel vor, auf denen die Namen der Parteien und ihrer Vorsitzenden stehen. Stellt eine Wahlurne bereit, in der die Stimmzettel gesammelt werden. Organisiert eine Ecke des Klassenraums als Wahllokal. Diese sollte einen Tisch für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer enthalten, eine Wahlkabine (z. B. abgetrennter Bereich für geheimes Wählen) und die Wahlurne.
• Wahl durchführen: Alle Schülerinnen und Schüler erhalten einen Wahlzettel und geben ihre Stimme ab. Die Wahl sollte geheim erfolgen. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler darf nur einmal wählen und legt den ausgefüllten Zettel in die Wahlurne.
• Stimmenauszählung und Ergebnis: Zählt gemeinsam die Stimmen aus und präsentiert die Ergebnisse der Wahl. Diskutiert danach kurz in der Klasse, welche Parteien die meisten Stimmen erhalten haben und warum. Welche Ziele haben die Wählerinnen und Wähler überzeugt?
Themenspeicher
Verlag
Umwelt und Klima © Schule und Bildung © Frieden und Gerechtigkeit © Tiere © Technik und Wissenschaft © Sport und Freizeit © Gesundheit

Welche Wahlkampfmittel würdet ihr sonst noch für eure Partei nutzen, um Jung- und Erstwählerinnen und -wähler zu erreichen? Begründet eure Auswahl in mindestens 20 Worten in eurem Heft!
Wähle eines der Wahlplakate von Abb. 2 aus! Analysiere und beurteile anschließend dieses Wahlplakat mit der Methode M9 in deinem Heft!
Lies zunächst den folgenden Artikel aus der Tageszeitung „der Standard“ aufmerksam durch!
Wem das Superwahljahr superegal ist? Den Nichtwählern 21. Februar 2024 Sie gewinnen regelmäßig und mit Abstand die EU-Wahl, auch bei Kommunalwahlen sind sie meist die Wahlsieger. Und bei der Nationalratswahl 2019 war nur die ÖVP stärker. Trotzdem stellen sie aber keine einzige Abgeordnete, keinen Bürgermeister, sie regieren nicht mit. Die Rede ist von den Nichtwählern. Aus: Wem das Superwahljahr superegal ist?
Führt anschließend eine Pro- und Kontradiskussion – M8 – zu diesem Thema!

Pro-Argumente für Nichtwählen: Warum entscheiden sich manche Menschen bewusst, nicht zur Wahl zu gehen? Welche Kritikpunkte könnten Nichtwählerinnen und Nichtwähler am politischen System oder den Parteien haben? Kontra-Argumente gegen Nichtwählen: Warum ist es wichtig, sich an Wahlen zu beteiligen? Welche Auswirkungen hat eine hohe Zahl von Nichtwählerinnen und Nichtwählern auf die Demokratie und die Wahlergebnisse?
Diskutiert auch, ob Nichtwählen eine Form von Protest ist und ob es alternative Wege gibt, Unzufriedenheit mit der Politik auszudrücken! Nun geht’s
Nun
Im Folgenden siehst du eine Auswahl von den Instagram-Accounts der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von FPÖ, ÖVP und SPÖ im Jahr 2024!



Analysiert in Partnerarbeit die Hauptbotschaften der drei Instagram-Beiträge! Beschreibt, welche Themen angesprochen werden und welche Zielgruppen die jeweiligen Politikerinnen und Politiker ansprechen wollen!
Vergleicht anschließend die Beiträge der FPÖ, ÖVP und SPÖ! Untersucht, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Sprache, den Bildern und den Botschaften zu erkennen sind!
Interpretiert, wie sich die Politikerinnen und Politiker selbst darstellen! Geht dabei auf ihre Sprache, Bilder und den Einsatz von Emotionen ein. Was wollen sie durch ihre Beiträge vermitteln?
Präsentiert eure Ergebnisse in der Klasse und diskutiert gemeinsam darüber!
Entwirf selbst ein Demonstrationsbanner, einen Flugzettel oder einen Beitrag für soziale Medien zu einem aktuellen politischen Thema, das dir wichtig ist! Achte darauf, welche Wörter, Bilder und Symbole du wählst, um deine Botschaft klar und überzeugend zu machen!


So schätze ich mich nach dem Großkapitel „WAHLEN UND WÄHLEN“ selbst ein: Kreuze jenen Daumen an, der für dich am ehesten zutreffend ist!
Ich kann…
…die Bedeutung von Wahlen in einer Demokratie einschätzen.
…zwischen aktivem und passivem Wahlrecht unterscheiden.
…die Wahlprinzipien nennen.
…die Bedeutung dieser Wahlprinzipien begründen.
…einen Klassenrat organisieren.
…mich mit den Begriffen Parlament – Nationalrat – Bundesrat auseinandersetzen und deren Funktionen erläutern.
…über die Politischen Parteien in Österreich und ihre Programme berichten.
…ein Wahlplakat mit der Methode M9 analysieren.
…die Rolle der Medien in Wahlkämpfen beleuchten.
…die Wahlprogramme der im Nationalrat vertretenen Parteien analysieren.
…eine Wahlsimulation durchführen.

Verlag
...die Rolle von Nichtwählerinnen und Nichtwählern auf den Ausgang einer Wahl erläutern.
Buchtipps


Um deine Kompetenzen noch mehr zu steigern, hier unsere Buchtipps:
für besonders Wissensdurstige
LeFloid: Wie geht eigentlich Demokratie? # Frag Floid (FISCHER New Media 2017).
Livia Josephine Kerb: How to Politik? Von Hä zu Ah! (Du hast die Wahl!) (Dressler 2021).
Reinhold Gärtner: Politiklexikon für junge Leute (Jungbrunnen 2010).








ENTDECKUNGEN KOLONIEN

1487: Diaz erreicht Südspitze Afrikas
1492: Kolumbus entdeckt Amerika
1498: Vasco da Gama erreicht Indien
1519: Cortez erobert Aztekenreich
1519 – 1522: Weltumsegelung
1532: Pizarro erobert Inkareich

1757: East India Company
TECHNIK WISSENSCHAFT

1450: Erfindung des Buchdrucks
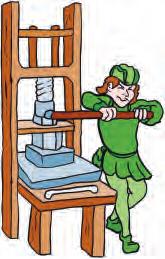
1609: Heliozentrisches Weltbild

KULTUR GESELLSCHAFT
Verlag
1721: Vorläufer der Dampfmaschine
1487: Hexenhammer, Beginn der Inquisition
1517: Luthers 95 Thesen
1530: Augsburger Bekenntnis
1555: Augsburger Religionsfriede
1861 – 1865: Amerikanischer Bürgerkrieg
1884: Westafrika-Konferenz, Aufteilung
Afrikas
1909: Peary erreicht Nordpol
1911: Amundsen erreicht Südpol
1773: Dampfmaschine (James Watt)

1810: Nähmaschine (Madersberger)
1815: Lokomotive
1825: erste Eisenbahnlinie
1827: Schiffsschraube
1831: Mineraldünger
1837: Telegraf (Morse)
1840: Briefmarken
1848 – 1852: Bau der Semmeringbahn
1860: Schutzimpfungen
1864: Schreibmaschine
1875: Markuswagen
1876: Glühbirne (Edison)
1876: Telefon (Bell)
1897: Dieselmotor
1898: Radioaktivität
1908: Fließbandproduktion (Ford)
1848: „Das Kapital“ (Marx)
1858: Bau der Wr. Ringstraße
1863: Rotes Kreuz
1874: Sozialdemokratische Partei
1878: Mädchen dürfen maturieren
1888: Arbeiterkrankenversicherung
1896: Christlichsoziale Partei
1918: Frauenwahlrecht in Österreich

EUROPA ÖSTERREICH

1477: Burgundische Heirat
1496: Spanische Heirat
1515: Böhmisch-Ungarische Heirat
1529: Erste Osmanenbelagerung Wiens
1526: Beendigung der Bauernaufstände
1618: Prager Fenstersturz, Beginn des 30-jährigen Krieges
1648: Westfälischer Friede, Ende des 30-jährigen Krieges

1789: Französische Revolution 1794: Ende der Schreckensherrschaft
1804: Krönung Napoleons zum Kaiser 1814/1815: Wiener Kongress
1813: Völkerschlacht bei Leipzig
1814: Napoleon flieht aus Elba, „Herrschaft der 100 Tage“
1829: Unabhängigkeit Griechenlands
1830: Julirevolution in Frankreich
1848: Frankreich wird Republik
1860: Garibaldi einigt Italien
1871: Deutschland wird Kaiserreich
1793: Hinrichtung Ludwigs XVI. 1799: Napoleon wird Erster Konsul
1806: Ende des Heiligen Römischen Reiches
1815: Schlacht bei Waterloo 1821: Tod Napoleons
1830: Unabhängigkeit Belgiens 1848: Kleindeutsche Lösung


1917: Russische Revolution
1920: Gründung des Völkerbundes



1683: Zweite Osmanenbelagerung Wiens
1740–1780: Maria Theresia
1774: Unterrichtspflicht in Österreich
1780–1790: Joseph II.
1804: Österreich wird Kaiserreich 1814/1815: Wiener Kongress
1848: Märzrevolution
1866: Schlacht bei Königgrätz
1867: Doppelmonarchie, Ausgl. Österreich und Ungarn
1907: Wahlrecht für Männer
1914: Ermordung des Thronfolgers, Beginn des Ersten Weltkriegs (bis 1918)
Wer ist das?
Wenn du diese Steckbriefe genau liest, weißt du sofort, um wen es sich dabei handelt. Finde die passenden Namen heraus und schreibe sie zu dem entsprechenden Bericht!







Von 1519 bis 1522 umsegelt dieser Entdecker die Welt. Nach einem Jahr erreicht er Südamerika. Die Rückkehr nach Europa erlebt er nicht mehr. Auf den Philippinen wird er bei einem Kampf getötet. Durch seine Weltumseglung ist endgültig bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist.
Wer ist das?
Verlag


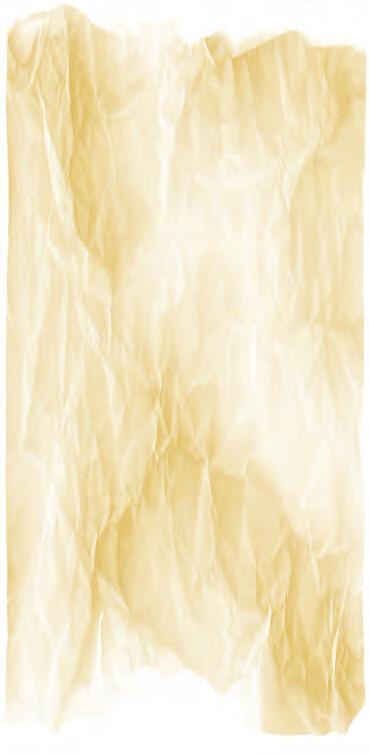
Er gilt als Entdecker Amerikas und will einen neuen Seeweg nach Indien finden.
1492 segelt er westwärts und erreicht nach 3 Monaten Land. Bis zu seinem Tod glaubt er, Indien erreicht zu haben.
Wer ist das?
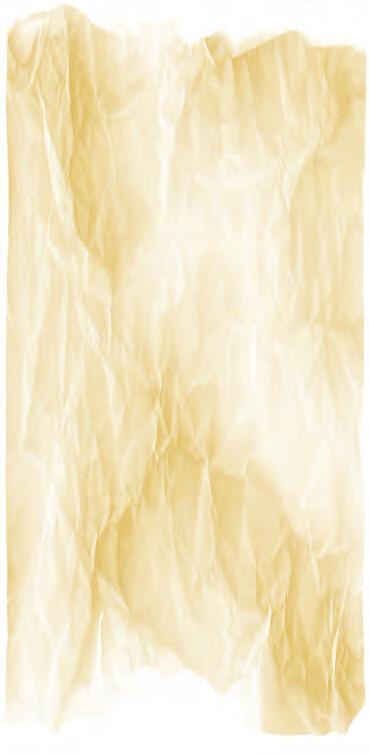
Dieser Seefahrer sticht 1487 in See, um einen Seeweg nach Indien zu finden. Auf seiner Reise umsegelt er das Südkap Afrikas. Er nennt es „Kap der tosenden Stürme“. Später heißt es „Kap der Guten Hoffnung“.
Wer ist das?

1498 erreicht er nach langen Strapazen endlich Indien, nachdem er das afrikanische Südkap erfolgreich umsegelt hat. Er bekommt Hilfe von einem arabischen Lotsen.
Wer ist das?
Revolutionskalender
Dieser wurde im Jahre 1793 als neuer Kalender der Revolution eingeführt. Jedes Monat hatte 30 Tage, die fehlenden 5 Tage wurden einfach ans Ende des Jahres gesetzt und „Ohne-Hosen-Tage“ genannt. Du kannst mit der folgenden Tabelle jedes beliebige Datum ausrechnen. Unter jedem Revolutionsmonat findest du das Datum, das unserem Kalender entspricht. Von da aus zählst du einfach weiter bis zum gesuchten Tag.
Herbst
Vendémiaire (Vindemira = Weinlese) 22.9.
Brumaire (Brumes = Nebel) 22.10.
Frimaire (Frimats = Reif) 21.11.
Beispiel: 31.5. = 11. Prairial
Winter Frühling Sommer
Nivôse (Nix = Schnee) 21.12.
Pluviôse (Pluvia = Regen) 20.1.
Ventôse (Ventus = Wind) 19.2.
Germinal (germinare = hervorsprossen) 21.3.
Floréal (Flos = Blüte) 20.4.
Prairial (Prairies = Wiesen) 20.5.
Sansculottides (Ohne-Hosen-Tage) : 17.9. bis 21.9.
Verlag
Wie heißt der 3. November? Wann ist dein Geburtstag?
Lösung: Geburtstag:
Weitere Aufgaben für Profis:
14.2. Lösung: 24.12. Lösung:
17.5. Lösung: 22.7. Lösung:
1.1. Lösung: 4.6. Lösung:
5.4. Lösung: 26.11. Lösung:
27.3. Lösung: 4.3. Lösung:
Messidor (Messis = Ernte) 19.6.
Thermidor (Thermi = Hitze) 19.7.
Fructidor (Fructus = Frucht) 18.8.
Der Stein von Rosette
Im Jahr 1799, während Napoleons Feldzug in Ägypten, entdeckten französische Soldaten den „Stein von Rosette“. Dieser besondere Stein war der Schlüssel zur Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen. Auf ihm standen Texte in drei Sprachen: Hieroglyphen, Demotisch und Griechisch. Dank dieser Entdeckung konnten Forscher wie Jean-François Champollion später die Geheimnisse der alten ägyptischen Schrift und Kultur entschlüsseln.
Hier kannst du die Geschichte des Steins von Rosette nachlesen. Einige Wörter sind aber in einer Geheimschrift verschlüsselt. Wenn du den Code knackst, kannst du die geheime Nachricht lesen! Tipp: Schreibe das Alphabet auf, dann findest du leichter den Schlüssel zum Entziffern!




Am 15. Juli 1789 wurde bgcpcp ecfcgklgqtmjjc Qrcgl von einem unbekannten Soldaten 7,5km nordwestlich von Rosette am Nil gefunden.
Der Stein war so groß wie eine Tischplatte und aus schwarzem Basalt. Die eine Seite uyp poliert. Sie zeigt 3 Inschriften, zum Teil tcpugrrcpr slb auch schon verwischt, wobei die linke obere Ecke yzecqnpcler ist.
Verlag

Die Gelehrten in Frankreich erkannten, dass die 3 Inschriften hieroglyphisch, demotisch und griechisch waren. Sie versuchten qmdmpr das Rätsel zu lösen.
Der originale Stein und andere ägyptische Kunstschätze ksqqrcl nach der Kapitulation Alexandrias 1801 an die Engländer abgegeben werden. Vorher wurden Imngcl cpqrcjjr und nach Frankreich gebracht.
Zwanzig Jahre sollte es dauern, bis der französische Sprachgelehrte slb Historiker JeanFrancois Champillion 1822 das Rätsel lösen konnte. Schon als Kind hatte er behauptet, dass er hinter byq Ecfcgklgq bcp Fgcpmejwnfcl kommen würde. Nachdem die Aufschrift auf dem Stein von Rosette entschlüsselt war, war es den Archäologen möglich, alle anderen ägyptischen Inschriften zu entziffern. Dies kann als die Geburtsstunde der modernen Ägyptologie angesehen werden.
Wo ist der Stein heute zu sehen?
Bcp Qrcgl tml Pmqcrrc zcdglbcr qgaf fcsrc gk Zpgrgqafcl Ksqcsk.



Morsealphabet
Hier siehst du das Morsealphabet: Du kannst auch mit einer Taschenlampe morsen, indem du das Licht benutzt, um kurze oder lange Signale zu geben wie SOS: kurz-kurz-kurz-lang-lang-lang-kurz-kurz-kurz


Verlag

Das internationale Notrufsignal SOS wurde 1908 als einheitliches Signal für Schiffe in Not eingeführt. Die Titanic sandte kurz vor ihrem Sinken noch zwei Signale aus – CQD und SOS! Als Merkhilfe verwendeten die Matrosen folgende englische Eselsbrücken – Entschlüssle die Nachrichten!
Englisch:
Deutsch: Englisch:
Deutsch:
Fehlersuchbild
Dieses Bild zeigt das Parlament in Wien. Vor dem Parlament steht die Pallas Athene, die griechische Göttin der Weisheit. Auf dem zweiten Bild haben sich aber 10 Fehler eingeschlichen. Suche sie!


Olympe Verlag


Das ABC-Spiel

Anfangsbuchstabe
Was fällt dir ein? Spiele dieses Spiel entweder mit mehreren anderen oder in Teams!
REGELN: Du musst zu jedem Anfangsbuchstaben einen Begriff oder Namen aus dem Unterrichtsstoff dieses Jahres finden. Gewonnen hat diejenige oder derjenige, der die meisten Begriffe oder Namen findet. Das gleiche gilt auch für Teams!
Begriffe/Namen

Gesamtpunktezahl:
Revolutions-Sudoku!
Nachdem du nun auf der vorigen Seite dein Wissen getestet hast, kannst du dich hier als Sudokumeisterin/Sudokumeister beweisen. Schneide die Bilder aus! Lege sie richtig in das Sudoku auf der nächsten Seite! Dann erst klebe sie ein!
ACHTUNG: In jeder Zeile und jeder Spalte darf jeweils nur ein gleiches Bild sein!
Olympe Verlag
























Revolutions-Sudoku!









Verlag








Weißt du noch…
… was du in diesem Schuljahr in Geschichte gelernt hast?
Teste dein Wissen! Wenn du alle Paare findest, erhältst du einen Lösungssatz, dem du sicher zustimmen kannst!











Inkas, Mayas, Azteken 4


Humanismus 5 Merkantilismus 9 Identität 11




Franz Joseph I. 24


Henry Dunant 19




„In meinem Reich geht die Sonne nie unter!“ 6

Wirtschaftsform im Absolutismus O



„Die Waffen nieder!“ 22


Karl Marx und Friedrich Engels 17 Guillotine 14




Santa Maria, Nina und Pinta 3



Suffragetten 16 „Und sie bewegt sich doch!“ 2 Gewaltenteilung 18

Ausspruch Ludwigs XIV. S
Roman von Bertha von Suttner I

Begründer des Kommunismus N



Heliozentrisches Weltbild 1 „Der Staat bin ich!“ 8 Bettgeher 23

Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit 12










Victor Adler 20 Legislative 10




Karl Lueger 21 Ablass 7

Marseillaise 13 St. Helena 15






Schiffe des Christoph Kolumbus D
Ausspruch Karls V. C Insel, auf der Napoleon starb O

Frauenrechtlerinnen in England und den USA N


Gründer des Roten Kreuzes F

Freikauf von Sünden H



Ausspruch von Galileo Galilei N Kaiser von ÖsterreichUngarn von 1848 – 1916 N





Der Mensch steht im Mittelpunkt des Denkens I



Mitbegründer der Christlichsozialen Partei Österreichs R



Untermieter, der nur ein Bett benutzt E

Frühe Hochkulturen in Südamerika L
Schlagworte der Französischen Revolution E



Erkenntnis, dass sich die Erde um die Sonne bewegt E Französische Nationalhymne R

alle Merkmale eines Menschen oder einer Gruppe M



gesetzgebende Gewalt M

Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei Österreichs E



Trennung von Gesetzgebung, Rechtssprechung und Verwaltung E

Maschine zum raschen Enthaupten von Menschen S




PERSONEN UND SACHREGISTER
Abgeordnetenhaus: 154
Ablasshandel: 16
Absolutismus: 35, 36
Adler, Victor – Arzt: 90
Amundsen, Roald – Entdecker: 96
Anglikanische Hochkirche: 17
Arbeiterkrankenversicherungsgesetz: 90
Arbeiterordnung: 90
Arbeiterschaft: 26, 83, 88, 89, 90, 91
Arbeitsmigration: 121
Aspern, Schlacht: 60
Asyl: 114, 115
Aufgeklärter Absolutismus: 46
Aufklärung: 24, 45, 46, 47
Augsburger Bekenntnis: 17
Augsburger Religionsfrieden: 17
Austerlitz – Schlacht: 60
Balkanroute: 121
Barock: 37
Bastille: 53
Bauernkrieg: 34
Belgisch-Kongo: 101
Bell, Alexander Graham –Erfinder: 77
Benz, Karl – Erfinder: 77
Bettgeher: 112
Biedermeier: 65, Billroth, Theodor – Arzt: 75
Binnenmigration: 114
Bolschewiken: 71
Buchdruck: 8, 9
Bündnispolitik:
Bürgertum: 33, 45, 64, 66, 85, 86, 89, 112
Calvin, Johannes – Reformator: 17
Christliche Soziallehre: 89
Christlichsoziale Partei: 91
Code Civil: 59
Colbert, Jean-Baptiste –Wirtschaftsminister: 42
Dampfmaschine: 75, 76, 77
Darwinismus: 99
Demokratie: 89, 147, 151, 154
Diesel, Rudolf – Erfinder: 77
Direktorium: 55, 59
Donaumonarchie: 106, 107, 129
Dreißigjähriger Krieg: 20, 21
Dunant, Henri –
Geschäftsmann: 138
Dürer, Albrecht – Maler: 9
Eisenbahn: 70, 75, 76, 99
Elba: 60
Elektrizität: 77
Ellis Island: 120
Engels, Friedrich – Politiker: 89
Entente: 128, 130, 135
Enzyklika rerum novarum: 89
Erbpolitik: 14
Erster Weltkrieg: 71, 107, 128, 129, 130, 131, 135, 137, 142, 146
Etikette: 37
EU – Europäische Union: 146
Exekutive: 57
Fabriken: 71, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 88, 89
Ferdinand I. – Heiliger Römischer Kaiser: 15, 17
Ferdinand I: – Kaiser von Österreich: 67
Feudalismus: 31
Fließband: 82
Flucht: 114, 115
Ford, Henry – Unternehmer: 82
Franz Ferdinand –
Thronfolger: 129
Franz II. (ab 1804 Franz I.) –Kaiser: 60
Franz Joseph I. – Kaiser: 67, 70, 106, 108, 112, 129, 130
Franz Stephan v. Lothringen –Kaiser: 13
Franz-Joseph-Land: 96
Französische Revolution: 53, 54, 55, 56
Frauenwahlrecht: 55, 86, 154
Freie Marktwirtschaft: 82
Friedrich II. v. Preußen – König: 46
Historismus: 112
Hofadel: 25, 36
Hohe Pforte: 108
Hugenotten: 17
Humanismus: 9
Identität: 141, 144, 148
Imperialismus: 98, Industriegesellschaft: 83, 87
Industrielle Revolution: 75, 76 Inquisition: 7, 17, 23 Integration: 28, 114. 121
Joseph II. – Kaiser: 24, 46, 47, 69
Judikative: 57
Jugendstil: 112
Julirevolution: 66
Kant, Immanuel – Philosoph: 45
Kapital: 25, 75, Karl I. – Kaiser: 130, 137
Karl V. – Kaiser: 15, 17
Karlsbader Beschlüsse: 64
Katharina II. – Zarin: 46
Kepler, Johannes – Astronom: 7
Kernfamilie: 86
Ketzer: 24
Kinderarbeit: 84, 90
Klassenkampf: 89
Kommunismus: 89
Kongo: 101
Konsul: 59
Verlag
Fruchtwechselwirtschaft: 77
Frühkapitalismus: 31
Fugger – Handelsfamilie: 31, 33
Galilei, Galileo –Wissenschaftler: 7, 8
Gegenreformation: 17
Generalstände: 53
Genfer Flüchtlingskonvention: 114, 121
Genossenschaften: 93
Geozentrisches Weltbild: 7
Gesetze: 28, 36, 76, 85, 91, 101
Gewaltentrennung: 45
Gewerkschaften: 93
Ghega, Karl Ritter von –Baumeister: 78
Gouges, Olympe de –
Frauenrechtlerin: 54
Große Proletarische Kulturrevolution: 72
Gründerzeit: 76
Grundherrn: 25, 34, 47, 83
Grunduntertänigkeit: 47, 67, 83
Guillotine: 55
Gustav Adolf v. Schweden –König: 21
Gutenberg, Johannes – Erfinder: 8
Hausmacht: 14
Heilige Allianz: 61
Heinrich VIII. – König: 18, 19
Heiratspolitik: 14
Klimt, Gustav – Maler: 112
Kolonialpolitik: 100, 101
Kolonien: 15, 23, 31, 32, 96, 98, 99, 100, 101, 103
Konzil von Trient: 17
Ku-Klux-Klan: 102
Kulturnation: 144
Kunschak, Leopold – Politiker: 91
Kurienwahlrecht: 91, 154
Landflucht: 83
Lebensmittelkarten: 131 Legislative: 57
Leibeigenschaft: 31, 34, 47, 119
Lenin, Wladimir Iljitsch –Politiker: 71
Leo X. – Papst: 16
Leo XIII. – Papst: 89
Leopold II. – Kaiser: 47, 101 Liberalismus: 70, 89 Liga: 20
Lincoln, Abraham – Präsident: 102 Livingstone, David – Entdecker: 96 Ludwig XIV. – König: 35, 36, 37, 42 Ludwig XVI. – König: 53, 54, 55 Lueger, Karl – Politiker: 70, 91 Luther, Martin – Reformator: 16
Manufaktur: 42
Marat – Revolutionär: 55
Marcus, Siegfried – Erfinder: 77 Maria Theresia – Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn: 13, 24, 46, 47, 54, 70
So verwendest du dieses Register:
So findest du z. B. auf der S. 112 in deinem Buch das Wort „Historismus“. Oft kommen Begriffe nicht nur einmal, sondern öfter im Buch vor. Daher stehen manchmal neben dem gesuchten Begriff auch mehrere Seitenzahlen. Olympe
Heliozentrisches Weltbild: 7
Herrenhaus: 154

Ein Register hilft dir, wichtige Begriffe in deinem Geschichtslehrbuch einfach zu finden. Diese sind alphabetisch angeordnet und mit Seitenzahlen versehen.
PERSONEN- UND SACHREGISTER
Marie Antoinette – Königin: 54, 55
Marie Louise – Kaiserin: 60
Marx, Karl – Ökonom: 89
Maximilian I. – Kaiser: 14
Menschenrechte: 28, 54, 102, 139
Merkantilismus: 42
Michelangelo – Maler: 10
Migration: 114, 115, 121, Mineraldünger: 75, 77
Missionare: 96
Mittelmächte: 109, 128, 130
Morse, Samuel – Erfinder: 77
Morsealphabet: 77
Motoren: 77
Napoleon Bonaparte – Kaiser: 59
Napoleon III. – Kaiser: 66
Nationalismus: 66, 106, 108, 128, 144, 148
Nationalversammlung: 53, 54, 67
Nationalversammlung –
Frankfurt: 67
Naturalwirtschaft: 31, 83
Neoabsolutismus: 106, 107
NEOS: 155
Nikolaus II. – Zar: 71
Osman I.: 108
Osmanen: 9, 31, 108
Parteiprogramme: 155
Pasteur, Louis – Arzt: 75
Peary, Edwin – Forscher: 96
Personalunion: 107
Plantagen: 98, 100
Prager Fenstersturz: 20
Protestanten: 17, 24, 25
Pullfaktoren: 114
Pushfaktoren: 114
Realunion: 107
Reformation: 16, 17, 41
Reichsacht: 16
Reichstag zu Augsburg: 17
Renaissance: 9, 10, 28, 41
Renner, Karl – Politiker: 91
Restauration: 61
Revolutionsgerichte: 55
Rheinbund: 60
Rhodes, Cecil – Politiker: 99
Ringstraße: 112, 119
Robespierre – Revolutionär: 55
Rotes Kreuz: 139
Rudolf II. – Kaiser: 20
Russische Revolution: 71
Russlandfeldzug: 60
Schießpulver: 8
Schlacht am Weißen Berg: 20
Schreckensherrschaft: 55
Schützengräben: 130
Schutzzölle: 88
Seitz, Karl – Politiker: 91
Semmelweis, Ignaz – Arzt: 75
Semmeringbahn: 78
Sezession: 102, 112
Sezessionskrieg: 102
Sklaven: 23, 89, 102
Solferino, Schlacht: 138
Sozialdemokratische Partei
Österreichs: 91, 155
Sozialdarwinismus: 99
Soziale Frage: 88, 90
Sozialgesetze: 88, 90, 91
Sozialismus: 89
Sozialstaat: 90
Spinnmaschinen: 75
Spitzel: 59, 64
St. Germain – Friedensvertrag: 137
St. Helena: 60
Staatsbürgerschaft: 121, 141, 154
Staatsnation: 144
Staatsgrundgesetz: 107, 120
Stände: 20, 31, 36, 53
stehendes Heer: 36
Stellungskrieg: 130, 131, 133
Suffragetten: 86
Taschenuhr: 8
Telegraf: 77
Thesen: 16
Toleranzpatent: 47, 70
Tuberkulose: 70
Ultimatum: 129
UNO: 28, 114, 137
Union: 20, 102, 115, 148
Unternehmer: 33, 75, 82, 83, 84, 85, 88, 100
Unterrichtspflicht: 46
Untertanenpatent: 47
Vereine: 88
Verfassung: 54, 67, 89, 107, 144, 154, 155
Versailles, Schloss: 37
Vertreibung: 114
Vielvölkerstaat Österreich: 106, 112
Vinci, Leonardo da – Maler: 10
Völkerbund: 139
Völkerschlacht bei Leipzig: 60
Volksrepublik China: 71
Vormärz: 64, 65, 66
Wagner, Otto – Baumeister: 112
Wahlplakate: 156, 157
Wahlprogramme: 155
Wahlrecht: 54, 55, 67, 86, 88, 91, 107, 115, 141, 151, 154
Olympe Verlag
Wallenstein, Albrecht Wenzel von –Feldherr: 20, 21
Waterloo, Schlacht: 60 Watt, James – Erfinder: 56, 78
Webstuhl: 75
Weltrevolution: 89
Westfälischer Frieden: 21
Wettrüsten: 128
Wiener Kongress: 61, 64
Wilhelm II. – Kaiser: 129
Wilhelm IV. – König: 67 Wilson, Woodrow – Präsident: 137, 139
Wright, Orville u. Wilbur – Piloten: 77
Zensur: 64, 65, 67, 107
Zensuswahlrecht: 91, 107, 154
Ziegelarbeiter: 90, 119
Zimmer-Küche-Wohnung: 85
Zinskasernen: 83, 112 Zunftordnung: 82
9/Q1: Rabelais, Francois: Gargantua und Pantagruel. Band 1. Aus dem Französischen übersetzt von Widmer, Walter; Horst, Karl August. Wien (1970), S. 356.
14/D1: Kudla, Hubertus: Lexikon der lateinischen Zitate. München (2001), S. 172.
18/Q1: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Allgemeinen Geschichte. Zürich (1919), S. 38 – 42.
20/Q1: Milger, Peter: Der Dreißigjährige Krieg. Gegen Land und Leute. München (2001), S. 40.
21/Q2: Schneider, Ditmar: Otto von Guericke. Ein Leben für die Alte Stadt Magdeburg. Leipzig (1997), S. 68.
22/Q3: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Geschichte der Neuzeit. Zürich (1919), S. 151.
24/D1: http://www.damals.de/de/27/Abschaffung-der-Folter-in-Oesterreich.html?aid=169424&cp=63&action=showDetails&cmtUri=/d e/27/Uebersicht-Seite-63.html (18. 2. 2024)
24/Q1: Folter | Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (18. 2. 2024)
25/Q1: Porubszky, Gustav: Die Rechte der Protestanten in Österreich. Wien (1867), S. 19.
28/D1: Die Behindertenrechtskonvention im historischen Kontext | UNBehindertenrechtskonvention (18. 2. 2024)
29/D2: „Worte zählen": Mar Galcerán, Europas erste Abgeordnete mit Down-Syndrom | Euronews (19. 2. 2024)
32/D1: Boesch, Joseph; Schläpfer, Rudolf; Utz, Hans (Hg.): Weltgeschichte. Von 1500 bis zur Gegenwart. Zürich (2014), S. 47.
32/D2: Forum Geschichte 2. Nordrhein-Westfalen, Teilband 1, Berlin 2008, S. 46.
35/Q1: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Allgemeinen Geschichte. Zürich (1919), S. 169 – 171.
39/Q2: Flach, Heinrich; Guggenbühl, Gottfried: Quellenbuch zur Allgemeinen Geschichte. Zürich (1919), S. 205f.
42/Q1: Prager, Robert (Hg.): Adam Smith Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes. Berlin (1905), S. 7f.
46/Q1: Ines M. Breinbauer: Einführung in die Allgemeine Pädagogik. Wien (2000), S. 70.
47/Q2: Adolf Schauenstein: Handbuch der Öffentlichen Gesundheitspflege in Österreich. Wien (1863), S. 128.
48/D1: Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur-Gesellschaft-Politik. Graz-Wien-Köln (2002), S. 154f.
50/D2: Delouche, Frederic (Hg.): Europäisches Geschichtsbuch. Stuttgart/Düsseldorf/Berlin/Leipzig (1992), S. 268.
51/D3: Bendick Rainer (Hg.): Historie/Geschichte. Europa und die Welt von der Antike bis 1815. Deutsch-französisches Geschichtsbuch. Stuttgart/Leipzig (2012), S. 184.
56/D1: Schneider, Gerd; Tojka-Seid, Christiane: Politik-Lexikon für Kinder. Von Aufschwung bis Zivilcourage. Frankfurt/New York (2006), S. 237f.
56/D2: https://www.hanisauland.de/lexikon/r/reform.html (3. 3. 2024)
56/D3: http://www.politik-lexikon.at/reform/ (3. 3. 2024)
62/D1: Günther-Arndt, Hilke; Hofacker, Hans-Georg; Kocka, Jürgen (Hg.): Geschichtsbuch 2. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Quellen. Berlin (1997), S. 80.
63/Q1: Görtemaker, Manfred: Deutschland im 19. Jahrhundert. Opladen (1983), S. 44.
64/Q1: Majer, Diemut; Hunziker, Margarete: Juris Fontes – Rechtsquellen in Vergangenheit und Gegenwart. Verfassungsstrukturen, Freiheitsund Gleichheitsrechte in Europa seit 1789. Karlsruhe (2009), S. 267.
68/Q1: Dörferning, Peter Frank: Die Donner der Revolution über Wien. Wien (1988), S. 69.
71/Q1: Altrichter, Helmut (Hg.): Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Band 1: Staat und Partei. München (1985), S. 135 ff.
76/D2: Dolby, Edward: Vom Zauber alter Eisenbahnen. Freiburg im Breisgau (1980) S. 17.
77/D2: Günther-Arndt, Hilke; Kocka, Jürgen (Hg.): Geschichtsbuch – Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Dokumenten 3. Berlin (1986), S. 77.
78/D4: Die Semmeringbahn - Willkommen (10. 3. 2024)
79/D5: http://www.berliner-zeitung.de/vor-hundert-jahren-kam-daserste-selbsttaetige-waschmittel-in-die-laeden--es-nannte-sich-persilda-weiss-man--was-man-hat-15786072 (10.3.2024)
80/D6: Christoph, Nonn: Das 19. und 20. Jahrhundert – Orientierung Geschichte. Paderborn/München/Wien/Zürich (2007), S. 43f.
82/Q1: http://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html (7. 3. 2018)
83/D1: http://www.habsburger.net/de/kapitel/mehr-menschen-bevoelkerungswachstum-der-monarchie (10. 3. 2024)
84/D2: Komlosy, Andrea: Die frühe mechanische Baumwollspinnerei in Niederösterreich. Alles spinnt. In: Magie der Industrie. Leben und arbeiten im Industriezeitalter.
85/Q1: Streller, Vera: Fleiß und Leichtsinn. In: Magie der Industrie. Leben und arbeiten im Industriezeitalter. Ausstellungskatalog, hg. NÖLandesregierung, München (1989), S. 238.
89/Q1: Marx, Karl; Engels, Friedrich: Manifest der Kommunistischen Partei. Zittau (2009), S. 43.
89/Q2: Brusatti, Alois, Haas; Wilhelm, Pollak, Walter (Hg.): Geschichte der Sozialpolitik mit Dokumenten. Wien (1962), S. 181.
90/Q1: Adler, Victor; Engels, Friedrich: Briefwechsel. Hg. von Callesen, Gerd; Maderthaner, Wolfgang. Berlin (2011), S. 119.
90/D1: https://www. arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/krankheitundpflege/kran kheit/Geld_bei_Krankheit.html (4. 10. 2024)
90/Q2: Brusatti, Alois, Haas; Wilhelm, Pollak, Walter (Hg.): Geschichte der Sozialpolitik mit Dokumenten. Wien (1962), S. 181.
94/D2: Umweltverschmutzung: Industrielle Revolution - UmweltNatur - Planet Wissen (planet-wissen.de) (10. 3. 2024) 99/Q1: http://de.metapedia.org/wiki/Rhodes,Cecil (3. 9. 2016)
103/Q2: Alexander von Humboldt, Lateinamerika am Vorabend der Unabhägigkeitsrevolution, hrsg. Von Margot Falk, Berlin 1982, S. 65
106/Q1: Corti, Egon Caesar Conte; Sokol, Hans Hugo: Kaiser Franz Joseph. Wien (1960), S. 73.
107/Q2: http://www.verfassungen.de/at/at-18/stgg67-2 (20.9.2016)
108/D1: http://www.annefrank.de
/mensch/johann-meyer/schwerpunktthemen/vom-osmanischenreich-zur-tuerkischen-republik/ (3.10.2016)
109/D2: Boesch, Joseph; Schläpfer, Rudolf; Utz, Hans: Weltgeschichte von 1500 bis zur Gegenwart. Zürich (2014), S. 85f.
110/D3: http://sciencev2.orf.at/stories/1731782//index.html (3.10.2016)
111/D4: Boesch, Joseph; Schläpfer, Rudolf; Utz, Hans: Weltgeschichte. Von 1500 bis zur Gegenwart. Zürich (2014), S. 157f.
115/D1: Warum im Sudan gekämpft wird (deutschlandfunk.de) (16. 3. 2024)
115/Q1: Oberösterreichische Nachrichten, 22. Juni 2017
115/D2: Europaweit werden 51.000 geflüchtete Minderjährige vermisst | tagesschau.de (4. 10. 2024)
119/D1: Wohnservice Wien (Hg.): Wien und die Ziegelböhm. Zur Alltagsgeschichte der Wiener ZiegelarbeiterInnen. Wien (2014), S. 12.
122/D1: Saunders, Douglas: Die neue Völkerwanderung – Arrival City. München (2011), S. 217 – 491
122/D2: Saunders, Douglas: Die neue Völkerwanderung – Arrival City. München (2011), S. 217 – 491
122/D3: Saunders, Douglas: Die neue Völkerwanderung – Arrival City. München (2011), S. 217 – 491
123/D4: Saunders, Douglas: Die neue Völkerwanderung – Arrival City. München (2011), S. 217 – 491
134/Q1: http://gutenberg.spiegel.de/buch/aphorismen-4692/6 (3. 10. 2016)
134/D1: Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur-Gesellschaft-Politik. Graz-Köln-Wien (2002), S. 266f.
136/D2: Schreiner, Eva (2024)
Olympe Verlag
76/D1: http://www.damals.de/de/16/Die-Werkstatt-der Welt.html?issue=177096&aid=177081&cp=1&action=showDetails (17. 9. 2016)
76/Q1: http://gutenberg.spiegel.de/buch/waldheimat-1308/12 (17. 9. 2016)
128/Q1: Suttner, Bertha von: Die Waffen nieder! München (o. J), S. 219.
129/Q1: Wiener Zeitung vom 29. Juli 1914, Nr. 175/1914, Amtlicher Teil, S. 1.
131/Q2: http://www.lexikon-ersterweltkrieg.de/Feldpost:_Anton_Steiger (27. 2. 2024)
138/Q1: Dunant, Henry: Eine Erinnerung an Solferino. Zürich (1942), S. 42/62.
141/D1: Barbara Coudenhove-Kalergi (der Standard 17. 8. 2016)
144/D1: Hintergrund: Idee und Praxis des „Selbstbestimmungsrechts der Völker“ am Ende des Ersten Weltkriegs - hdgö (26. 12. 2024)
BILDQUELLEN 176
akg-images: 3/2, 12/3, 20/1, 21/1, 23/1, 24/1, 26/2, 34/1, 34/2, 57/1, 59/2, 65/2, 71/1, 78/1, 78/2, 85/1, 85/2, 121/2, 132/1
akg-images / M. Schwarz: 33/1
akg-images / Fototeca Gilardi: 102/1
akg / North Wind Picture Archives: 75/1
akg-images / Pictures From History: 72/2, 105/1
akg-images / UIG / Underwood Archives: 84/1
akg-images / WHA / World History Archive: 72/3
akg-images / Zhou Thong: 72/1
Amnesty International: 27/1, 27/2
Angelika Warmuth / dpa / picturedesk.com: 152
Arena 2011: 74/3
Arena 2013: 74/4
Arena 2018: 127/1
Arena audiolino 2018: 95/4
arsEdition 2011: 150/1
arsEdition 2013: 140/3
be.bra Verlag 2021: 95/1
Beltz und Gelberg 2019: 150/3
Bezirksmuseum Favoriten: 90/1
BookRix 2019: 44/2
Büchner Verlag 2024: 127/3
cbj 2007: 30/4
cbj 2013: 74/1
cbt 2018: 140/1
C.H.Beck 2023: 44/1
Christian Monyk: 7/1, 7/2, 14/3, 15/2, 17/1, 42, 59/1, 98/1, 106/2, 108/1, 112/3, 128/1, 130/1, 137/1, 137/2, 148/2, 162, 163
Conte Verlag 2014: 44/3
Deutsches Historisches Museum: 119/1
DoGi spa, Florenz, 2000: Giudici, La storia economica del mondo: 31/2
Dorling-Kindersley Ltd., London, 1995: Chris and Melanie Rice, How Children Lived: A First Book of History: 170/3
Dressler 2021: 161/2
Edition Fleurus, Paris, 2005: Imagia – Inventions 76/1
Edition Fleurus, Paris, 2004: Imagia - Les grandes explorations: 164/1, 164/3, 164/4
Eduard Walther, Bilder zum Anschauungsunterricht für die Jugend, 1890, Verlag J.F. Schreiber, Stuttgart: 87/1
FISCHER New Media 2017: 161/1
Fischer KJB 2014: 140/2
Foto Schächter Pottendorf: 83/2
Galleria dell'Academia, Venedig: 10/3
Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 2007: Ulrich Thamer: Geschichte erleben: Die Französische Revolution: 3/3, 55/1, 55/2, 170/5
G & G Kinder- und Jugendbuch 2018: 150/2
Getty Images: 79/3
Hachette Livre, Paris, 1987: Luxardo/Probst, Au Temps De La Revolution Francaise: 170/4
Helvetiq 2021: 95/3
Henkel AG & Co. KGaA: 79/1
IMAGNO/Austrian Archives: 67/1
Impian 2020: 30/1, 74/2
Internet: 29/3, 79/4, 115/1, 125/1, 126/1, 138/2, 151/3, 157/1, 157/4, 157/6, 157/7, 160/1, 160/2, 160/3
iStockphoto.com: 79/5, Alexey Yaremenko: 166/1, 166/2, amriphoto: 12/2, Anja W.: 143/1, art-4-art: 65/5, artisteer: 43/4, Aygull: 41/1, beyhanyazar: 32/2, 56/1, blackwaterimages: 78/4, 147/1, davorr: 51/1, devke: 169/1, dimamorgan12: 41/2, Dimitris66: 38/1, duncan1890: 40/1, 40/2, 40/3, ferrantraite: 8/2, Flavio Vallenari: 168/1, fotosuper: 78/6, ilbusca: 22/6, ivanmateev: 12/4, J J Osuna Caballero: 3/1, 8/4, klaravlas: 96/1, Liudmila Chernetska: 29/2, Morrison1977: 10/5, numbeos: 43/2, OLJensa: 110/1, Photoplotnikov: 43/3, Rawpixel: 144/1, Ri-
dofranz: 4/4, 141/1, 153/2, RonBailey: 29/1, Ruslan Maiborodin: 149/2, saemilee: 65/4, stockcam: 149/1, stoonn: 8/1, Tolga TEZCAN: 39/1, 43/1, 48/1, 49/2, 52/2, 58/1, 73/1, 78/3, 86/2, 116/1, 123/1, 135/2, 139/3, 146/1, 153/1, 153/3, tomograf: 97/1, 160/4, TPopova: 4/5, 152/1, tumdee: 94/1, Vectorpower: 124/2, VikaSuh: 80/1
Jungbrunnen 2010: 161/3
JupiterImages Corporation: 10/1, 14/2, 5/1, 45/3, 68/1, 68/2, 22/3, 167/1, 167/2
kidsweb.de: 151/2
Klett-Cota 2023: 113/1
Knesebeck 2018: 95/2
Kreisky-Archiv: 86/1
Kunsthistorisches Museum, Wien: 14/1 le petit journal, Paris, 1908: 87/4
McRae Books Srl: 129/1
Miles Kelly Publishing, Great Bardsfield: 100 Things You Should Know About Explorers: 164/4
mixtvision Mediengesellschaft mbH 2023: 113/3
Münze Österreich: 128/2
Museumsstiftung Post und Telekommunikation: Feldpost 1914 bis 1918, Die Briefsammlungen der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Carl-Ludwig Voltmer an seine Freundin am 20.09.1915 (15. 5. 2024): 133/1
Museumsstiftung Post und Telekommunikation: Feldpost 1914 bis 1918, Die Briefsammlungen der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, Karl Stein an seine Ehefrau am 21.01.1918 (16. 3. 2024): 135/1
Oliver Schopf: 147/2
Österreichische Nationalbibliothek: 81/1
picturedesk.com/ Austrian Archives (AA) / brandstaetter images: 9/1 picturedesk.com: 65/3, 83/1, 85/2
www.pixelio.de / O. Fischer: 139/2
Pulfer / Interfoto / picturedesk.com: 148/1
Raoul Krischanitz: 54/3, 61/1, 66/1, 83/1, 101/1, 118/1, 120/1, 121/2, 124/1, 146/2, 155/1, 168/2
Ravensburger Verlag GmbH 2016: 127/2
ROBERT JAEGER / APA / picturedesk.com: 157/3
Scherl / SZ-Photo / picturedesk.com: 131/3
Sotheby's / akg-images: 3/3, 26/1
Technisches Museum Wien: 3/4, 77/1
The Ohio State University/University Libraries: 126/2
thinkstockphotos.com: a1977: 31/1, asterisk11: 117/1, dvarg: 145/1, FARBAI: 117/2, Jiradelta: 142/1, lisafx: 151/1, monkeybusinessimages: 116/1, Zeffss1: 54/1
TintenTrinker 2017: 30/3
TRIGA Der Verlag Gerlinde Heß 2022: 30/2
Ueberreuter Verlag 2023: 113/2
ullstein bild / picturedesk.com: 131/1
ullstein bild / Ullstein Bild / picturedesk.com: 131/2
Wien Museum: 87/2
Wienbibliothek im Rathaus, Plakatsammlung, Signatur P 40365: 121/1
Weingartner-Foto / picturedesk.com: 156/1, 157/4, 157/5
wikimedia commons: 7/3, 8/3, 10/2, 12/1, 13/1, 15/1, 16/1, 16/2, 18/1, 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 25/1, 32/1, 35, 36, 37/1, 45/2, 45/4, 49/1, 52/1, 53/1, 54/2, 58/2, 59/1, 62/1, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65/1, 66/2, 69/1, 70/1, 78/5, 79/2, 87/3, 88/1, 89/1, 93/1, 99/2, 100/1, 104/1, 106/3, 107/1, 109/1, 112/1, 112/2, 130/3, 130/4, 138/1, 139/1, 170/1, 170/2, Aaron Logan: 10/4, Buchhändler: 91/1, coca-cola company: 82/2, Crochet.david: 11/5, Deutsches Bundesarchiv: 129/2, Diagram Lajard: 11/3, Edward Linley Sambourne: 4/1, 99/1, ford company: 82/1, Gryffindor: 28/1, Jacques-Louis David: 170/6
www.proasyl.de: 4/2, 114/1
www.sammlerecke.at: 134
Olympe Verlag
Jakub Hałun: 11/4, 130/2, Matthias Kabel: 4/3, Maxim91: 106/1, Steve Collins: 23/2, Thaler Tamas: 47, TSAK43: 111/1, Wellcome Collection gallery: 97/2
www.histoire-image.org: 53/2

