SIEGFRIED

RICHARD WAGNER






Zweiter Tag des Bühnenfestspiels «Der Ring des Nibelungen» Dichtung vom Komponisten
Mit freundlicher Unterstützung der Freunde der Oper Zürich




Wotan hat der Welt eine auf Verträgen basierende Ordnung gegeben und sich so zu ihrem obersten Herrscher gemacht. Von den Riesen Fasolt und Fafner liess er sich eine prachtvolle Burg bauen, die er mit einem dem Nibelungen Alberich entwendeten Goldschatz bezahlte. Aber er stahl Alberich nicht nur den Schatz, sondern auch einen Tarnhelm sowie einen aus dem Rheingold geschmiedeten Ring, der seinem Besitzer masslose Macht verleiht. Alberich verfluchte den Ring: Er soll jedem den Tod bringen, der ihn berührt. Von der Urmutter Erda eindringlich gewarnt, war Wotan schliesslich bereit, den Ring den Riesen zu überlassen. Im Streit um das verhängnisvolle Kleinod erschlug Fafner seinen Bruder Fasolt als erstes Opfer von Alberichs Fluch
Da Wotan selbst sich den Ring nicht aneignen kann, ohne als oberster Hüter der Gesetze gegen seine eigene Weltordnung zu verstossen, entwickelte er einen Plan: Er zeugte ein menschliches Zwillingspaar, Sieglinde und Siegmund, die an seiner Stelle agieren sollten. Er verschaffte Siegmund das göttliche Schwert Nothung, mit dem dieser vermeintlich freie Held Fafner erlegen und den Ring für Wotan erringen sollte.
Erst Wotans Gattin Fricka machte ihm unmissverständlich klar, dass er mit diesem Plan einer Selbsttäuschung unterlag. Er konnte Siegmund nicht in seinem Sinne handeln lassen, ohne seine eigene Machtposition zu untergraben. Mehr noch: Er hatte dafür zu sorgen, dass Siegmund im Zweikampf fiel.
Wotans Lieblingstochter, die Walküre Brünnhilde, versuchte aber Siegmund entgegen Wotans Befehl zu retten. Durch Wotans Eingreifen fiel Siegmund schliesslich doch, aber Brünnhilde verhalf seiner Braut Sieglinde, die bereits Siegfried im Schoss trug, zur Flucht. Als Strafe für ihren Ungehorsam war Wotan gezwungen, Brünnhilde auf dem Walkürenfelsen in einen tiefen Schlaf zu versetzen, aus dem sie ein Mann erwecken wird, dem sie als einfache Menschenfrau zu folgen hat. Jedoch umgab er den Felsen mit einem Feuerring, den nur der furchtlos freieste Held durchschreiten kann. Beide wissen: Dieser Held wird Siegfried sein.
Weitab von der Welt, nahe der Neidhöhle, in welche sich der Riese Fafner in Gestalt eines Riesenwurms zurückgezogen hat, wurde Siegfried von Alberichs Bruder Mime grossgezogen. In der Hoffnung, der junge Held werde den Lindwurm töten und ihm so Alberichs Ring verschaffen, hat Mime ihn über seine Herkunft im Unklaren gelassen. Doch der Knabe erkennt, dass Mime nicht sein Vater sein kann, und erzwingt von ihm Aufschluss über seine Herkunft. Mime berichtet notgedrungen, wie er eines Tages vor seiner Höhle eine erschöpfte Frau mit Namen Sieglinde gefunden und in seine Behausung gebracht hat, wo sie schliesslich einen Sohn gebar und starb. Vor ihrem Tod habe die Mutter dem Kind den Namen Siegfried gegeben und ihm das zerbrochene Schwert Nothung hinterlassen, das sein Vater in seinem letzten Kampf geführt hatte. Siegfried verlangt von Mime, ihm dieses Schwert zu reparieren, und stürmt hinaus. Doch Mime weiss, dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen ist, hat doch der Knabe alle Schwerter, die er bisher geschmiedet hatte, im Handumdrehen zerbrochen. Wotan, der Walhall verlassen hat und nun als Wanderer ruhelos durch die Welt zieht, erscheint vor Mime und nötigt ihm ein gefährliches Ratespiel auf: Er verpfändet sein eigenes Leben, sollte er nicht in der Lage sein, drei Fragen zu beantworten, die Mime ihm stellt.
Der Wanderer gewinnt das Spiel mit Leichtigkeit und wendet es nun gegen Mime, der jetzt seinerseits drei Fragen um denselben Preis beantworten muss. Als Mime an der Frage scheitert, wer das Schwert Nothung neu schmieden wird, verlässt der Wanderer Mime mit der geheimnisvollen Prophezeiung, dies werde nur dem gelingen, der das Fürchten nicht kennt. Und dieser werde Mime schliesslich auch das Leben nehmen.
Der zurückgekehrte Siegfried wundert sich über Mime, der sich vor Angst verkrochen hat und ihm erklärt, das Fürchten sei eine Fertigkeit, ohne die niemand in die Welt hinausziehen sollte. Siegfried wird neugierig, und Mime verspricht, ihn zu Fafner zu bringen, der ihn das Fürchten lehren könne. Der junge Held beschliesst, sobald er diese Lektion gelernt hat, Mime zu verlassen und endlich in die Welt zu ziehen. Da es Mime offensichtlich nicht gelungen ist, Nothung neu zu schmieden, nimmt Siegfried die Sache selbst in die Hand.
Es gelingt Siegfried, das Schwert vollkommen neu zu erschaffen, indem er die Stücke zerfeilt, einschmilzt und in eine neue Form giesst. Für Mime bestätigt sich damit die Prophezeiung des Wanderers. und er erkennt sein Dilemma: Zwar schmiedet der Furchtlose das Schwert neu und kann somit Fafner erlegen – wird aber unweigerlich auch Mime töten, sollte Fafner ihn nicht vorher das Fürchten lehren. Lernt der Furchtlose das Fürchten jedoch zu früh, kann er Fafner nicht besiegen, und der Ring, der Mime zum Herrscher der Welt machen soll, bleibt weiterhin unerreichbar. Um sich zu retten, fasst Mime den Entschluss, den jungen Helden nach seinem siegreichen Kampf mit Hilfe eines Schlaftrunks wehrlos zu machen und zu töten.
Vor der Neidhöhle wartet Alberich auf den Moment, da Fafner dem Fluch zum Opfer fallen wird und er sich den Ring zurücknehmen kann. Er trifft dort auf den Wanderer Wotan und überschüttet diesen mit Hohn und Spott: So mächtig sich der Gott auch dünkt, er darf den Ring nicht stehlen und wird von der Angst umgetrieben, er, Alberich, könne ihn als rechtmässiger Besitzer wiedererlangen. Der Wanderer warnt ihn vor Mime und Siegfried, die kommen werden, um Fafner zu erlegen. Er schlägt Alberich vor, mit dem Wurm einen Handel zu schliessen: Alberich erhält von Fafner den Ring und verhindert im Gegenzug den Anschlag auf dessen Leben. Bevor der erschreckte Alberich einschreiten kann, weckt Wotan den schlafenden Riesen. Aber Fafner ist nicht interessiert. Ihm genügt es, auf seinem Schatz zu liegen und sich an seinem Besitz zu freuen.
Mime zeigt Siegfried den Ort, wo der Wurm liegt, von dem er das Fürchten lernen soll, und zieht sich in Erwartung von Siegfrieds Sieg zurück.
Siegfried versinkt in Gedanken an seine Eltern, die er bedauert, nie gekannt zu haben, als ein Waldvogel sein Interesse weckt. Er versucht, sich mit diesem zu verständigen, zunächst, indem er auf einem Schilfrohr bläst, schliesslich mit seinem Horn, und weckt damit unabsichtlich den Lindwurm, der sich sofort daran macht, den Störenfried zu fressen. Doch Siegfried erschlägt den Wurm, der sich im Sterben als Fafner, der letzte aus dem Geschlecht der Riesen, zu erkennen gibt und ihm Mimes Mordplan enthüllt.
Als Siegfried sein Schwert aus der Wunde des Wurms zieht, benetzt das Blut seine Lippen. Wie durch ein Wunder kann er nun verstehen, was der Waldvogel ihm sagt. Er folgt dem Rat des Vögleins, Ring und Tarnhelm aus der Höhle zu holen, ohne jedoch zu wissen, was er damit anfangen soll.
Mime und Alberich streiten sich um den Nachlass des Wurms, als sie entdecken, dass Siegfried sich die beiden kostbarsten Güter schon angeeignet hat. Alberich bringt sich in Sicherheit, während Mime daran geht, seinen Plan auszuführen. Mit übersüssen Worten versucht er Siegfried zu umgarnen und ihn zum Trinken des Schlaftrunks zu bewegen. Aber das Drachenblut bewirkt auch, dass Siegfried hört, was Mime zwar denkt, aber nicht sagt, so dass dieser seine Mordabsicht ausplaudert, ohne es zu merken. Auch er fällt Siegfrieds Schwert zum Opfer.
Der Waldvogel erzählt Siegfried von der auf dem Walkürenfelsen schlafenden Brünnhilde und zeigt ihm den Weg.
Ein letztes Mal sucht Wotan die Urmutter Erda auf, um sie zu fragen, ob und wie sein Untergang und der Untergang seiner Welt zu verhindern ist. Sie bleibt ihm die erhoffte Antwort schuldig: Es gibt keinen Ausweg, seine Herrschaft wird unausweichlich enden, wie alles endet, was einmal entstanden ist. Nur sie, die Erde, ist ewig. Wotan versteht und gibt endgültig auf. Freudig weist er sein Erbe den beiden freien Menschen zu, deren Liebe eine neue Ära einleiten wird: Brünnhilde und Siegfried.
Als er aber kurz darauf Siegfried begegnet, der auf dem Weg zu Brünnhilde ist, kommt es zu einer unerwarteten Auseinandersetzung. Als sein lang ersehnter Enkel Siegfried ihm den geforderten Respekt verweigert, stellt Wotan sich ihm in den Weg. Der furchtlos freieste Held jedoch zerschlägt Wotans Speer mit dem Schwert, das einst an ihm zersplitterte, und zieht weiter. Wotan muss erkennen, dass er endgültig von der Weltbühne abgetreten ist.
Siegfried durchdringt den Feuerring zum Walkürenfelsen und glaubt, einen schlafenden Krieger zu finden. Er lernt das Fürchten, als er erkennt, dass es sich um eine Frau handelt. Dann fasst er Mut und weckt sie mit einem Kuss …

Regisseur Andreas Homoki im Gespräch über seine Inszenierungskonzeption
In der Literatur zu Wagners Ring taucht immer wieder der Vergleich der Tetralogie mit einer Sinfonie in vier Sätzen auf. Aus diesem Blickwinkel wird dem Siegfried die Rolle des Scherzos zugewiesen. Kannst du mit dieser Betrachtungsweise etwas anfangen?
Ich glaube es bringt nichts ein, die Tetralogie in ein solches Formschema zu pressen. Aber wenn man das denn tun will, ist die Zuordnung schon richtig, denn der Siegfried ist zweifellos eine Komödie, wenn man so will, also das Scherzo.
Findest du das Stück wirklich lustig?
Wenn man den Zyklus im Zusammenhang und in seinen Kontrasten betrachtet, stellt er sich etwa so dar: Das Rheingold ist ein leichtfüssiges Konversationsstück, fast so etwas wie BoulevardTheater. Im denkbar schärfsten Kontrast dazu kommt Die Walküre als eine fast übermenschliche, monumentale Tragödie daher. Siegfried ist eine Komödie, die gleichermassen von grotesken Momenten und Situationskomik wie auch von rührenden und die Tragödie streifenden Szenen geprägt ist. Die Götterdämmerung fasst als Abschluss Elemente aus den Vorgängerstücken zusammen: Tragisches, Groteskes, Rührendes und Ironisches. In allen vier Stücken finden sich, wie immer bei Wagner, durchaus auch humoristische Momente, aber in keinem dominieren sie so stark wie im Siegfried. Nehmen wir nur den Drachenkampf, der im Mittelpunkt des Stücks steht, oder den sprechenden Vogel, der in die Handlung eingreift, oder den Zwerg, der so gern die Welt beherrschen würde – das alles sind Elemente, die deutlich genug zeigen, dass in diesem Stück spielerischer Witz und ironischer Spass eine grosse Rolle spielen.
Solche Dinge kann man schliesslich nur ernsthaft anbieten, wenn man sie mit einem Augenzwinkern nimmt.
Betrifft das auch den Titelhelden? Den blonden, blauäugigen Helden des Nordens?
Auf jeden Fall! Wir erleben die Geschichte eines Knaben, der mitten im Wald, fern aller Zivilisation, aufwächst und deshalb vollkommen unwissend ist. Er kennt den Wald und die Tiere und hat dort viel beobachtet, aber er weiss gar nichts von Menschen und Göttern, ja, nicht einmal, dass es ausser Mime noch andere Menschen gibt, von Frauen ganz zu schweigen. Das allein bietet schon viel Material für komische Situationen. Er ahnt aber, dass hier etwas nicht stimmt, und hat eine tiefe Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe. Er hat das nie erfahren, aber bei den Tieren des Waldes gesehen, dass es so etwas gibt. Wenn man ihm zuhört, wie einfühlsam er diese Beobachtungen beschreibt, merkt man, dass er keineswegs der brutale Schlagetot ist, als der er traditionell gesehen wird. Wagner hat einen Siegfried geschaffen, der sich ganz erheblich von den traditionellen Darstellungen dieser Figur unterscheidet. Er schildert seine Unwissenheit und seine Liebessehnsucht mit liebevoller Ironie. Das ist oft gleichzeitig ebenso komisch wie rührend, aber es führt auch direkt zum utopischen Kern der Figur, auf den es Wagner ankam: Der Held aus dem Wald, der von der Zivilisation unberührt ist und die Liebe nur als natürlichen Trieb kennt, ist der Einzige, der die Überwindung der korrumpier ten Welt anzustossen vermag und den Keim einer besseren, weil liebevolleren Welt in sich trägt.
Allerdings hat dieser utopische Komödienheld immerhin zwei Tote auf dem Gewissen. Ist Siegfried ein Mörder?
Eigentlich nicht, denn einmal handelt er in Notwehr, einmal tötet er im Affekt: Der Lindwurm will ihn fressen, Mime will ihn vergiften. Er muss sich gegen diese Angriffe zur Wehr setzen, und wie soll er das denn tun, wenn nicht mit seinem Schwert?
Das komplette Programmbuch können Sie auf
Nichtsdestoweniger fallen ihm zwei Leben zum Opfer. Taugt er damit noch zur Identifikationsfigur?
Es gibt ein traditionelles Bild dieser Figur, das genau besehen gar nicht stimmt. Dieser Auffassung nach ist Siegfried ein mehr oder weniger debiler Schlagetot, der die antisemitischen Klischees Wagners sozusagen verinnerlicht hat und loszieht, die Welt von allem Abweichenden zu reinigen. Dieses Bild, egal, ob es positiv oder negativ bewertet wird, ist so allgemein herrschend, dass man genau hinschauen muss, um wirklich die Figur zu sehen und nicht das Klischee. Ein solcher Titelheld wäre – zumindest für mich – in der Tat kaum zur Identifikationsfigur geeignet.
Und wie siehst du ihn? Magst du ihn, und willst du, dass das Publikum ihn mag?
Ja, ich mag ihn. Und zwar umso mehr, je genauer ich ihn durch diese Arbeit kennenlerne. Wenn man sich bemüht, der Musik so vorurteilsfrei wie es eben möglich ist zuzuhören, merkt man irgendwann, dass sie gar nicht so massiv «deutsch» ist, wie es zu diesem Bild passt. Natürlich gibt es gewaltige emotionale Ausbrüche, aber denen stehen mindestens ebenso viele, wenn nicht mehr, Passagen von berührender Zartheit gegenüber. Wenn man die Partie des Siegfried so betrachtet, entdeckt man ihn als einen sensiblen, liebesfähigen jungen Menschen, der in schrecklichen Verhältnissen aufwächst: bei Mime, der ihn fortwährend belügt und nur für seine Zwecke ausnutzen will. Er spürt die Lieblosigkeit und hat nur einen Wunsch: so schnell wie möglich da wegzukommen. Siegfried zeigt sich also wie alle grossen Komödienfiguren als eine Verbindung von komischen und tragischen Elementen, und gerade deshalb kann er einem so ans Herz wachsen. Mir ist er jedenfalls ans Herz gewachsen, und ich möchte, dass es den Zuschauern auch so geht.
Wie verhält es sich nun aber mit dem Antisemitismus? Findet sich der in diesem Stück?
Wagners Antisemitismus ist ja zweifelsfrei überliefert, und es wurde auch entsprechend viel darüber geschrieben, dass er unsympathische Figuren mit antisemitischen Klischees ausgestattet hat.
Der Musikwissenschaftler Jens Malte Fischer, dessen Forschungen unser Wissen über dieses Thema sehr erweitert haben, verweist immer wieder auf eine gut verbürgte Geschichte über Gustav Mahler, der sich nach einer SiegfriedVorstellung über den Darsteller des Mime verärgert geäussert hat: Es sei ja unstrittig, dass Mime von Wagner als Judenkarikatur disponiert sei, aber es sei doch nicht nötig, diesen Zug so schamlos zu übertreiben. Allein dieser Vorfall zeigt deutlich genug, dass die Zeitgenossen die antisemitischen Elemente in dieser Figur und in diesem Stück ganz klar gesehen haben.
Umso bemerkenswerter ist, dass der Jude Mahler dieses Stück trotzdem dirigiert hat.
Das war natürlich nur möglich, weil er deutlich sah, dass solche Elemente zwar vorhanden sind, aber nicht die Substanz des Stücks bilden. Es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob Wagner eine Figur mit Eigenschafen versieht, die Menschen zugeschrieben werden, die er für verächtlich hält, oder ob er ein Stück schreibt, dessen zentrale Botschaft die Aufstachelung zur Feindschaft gegen diese Menschen ist.
Muss man sich aber nicht trotz allem irgendwie zu diesem Problem verhalten und es zum Thema machen?
Wenn man das will, wird man im Stück sicher Material finden, das Thema zu bearbeiten. Mir scheint aber, dass man sich dann mit einem MetaProblem beschäftigt, also mit einem, das im Stück zwar in gewisser Weise vorhanden ist, aber doch erst auf einer höheren Abstraktionsebene, nicht in der Erzählung selbst. Wenn ich die Geschichte vom jungen Siegfried erzählen will, hilft der Gedanke an Wagners Antisemitismus nicht weiter. Wenn ich allerdings der Meinung wäre, dass die Geschichte antisemitisch ist und nur antisemitisch erzählt werden kann, würde ich es sein lassen. Das könnte ich gar nicht. Übrigens gilt, was ich vorhin über Siegfrieds Musik sagte, auch für Mime. Seine Musik macht sich keineswegs nur über ihn lustig. Auch Mime hat seine zarten und traurigen Momente. Immer wieder öffnet sich für einen Moment ein Blick in seine geschundene Seele, wo wir des Leids gewahr werden, das der Zwerg auf der Jagd nach dem Ring ausgestanden hat. Man sieht auch
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
hier wieder: Wagner war ein grosser Theaterkenner und wusste, dass nur widersprüchliche Gestalten auf der Bühne interessant sind. Und so ist auch Mime eine pralle TheaterFigur, die sich beim Publikum immer grosser Beliebtheit erfreut.
Zurück zu Siegfried: Wo immer man Darstellungen dieses Helden sieht, seien sie aus alter oder neuer Zeit, ist er von seinem Schwert nicht zu trennen. Allerdings muss Siegfried sein Schwert erst herstellen, ein Ereignis, um das sich der erste Akt fast ausschliesslich dreht. Was ist daran so bedeutend?
Dass und wie Siegfried sein Schwert schmiedet, hat mit dem utopischen Potenzial der Figur zu tun. Auch hier gibt wieder die Musik den entscheidenden Hinweis: Wenn Siegfried die Bruchstücke des alten Schwerts nicht zusammenklebt, wie es Mime versucht hat, sondern schreddert und neu einschmilzt, spielt das Orchester eine Musik von geradezu apokalyptischer Gewalt, die den Vorgang weit über eine simple Schmiedearbeit hinaushebt. Sie lässt hinter Siegfried den Anarchisten Bakunin aufscheinen, Wagners Freund aus seiner Dresdner Zeit, der forderte, alles Alte müsste zerstört werden, damit aus den Trümmern Neues hervorgehen kann. Die Schmiedemusik, die quasi die ganze Welt überwältigt und im Feuer reinigt, verweist auf die Revolution, für die Wagner gemeinsam mit Bakunin in Dresden auf die Barrikaden gegangen ist. Gleichzeitig und damit in engem Zusammenhang kann man die Szene auch als Metapher für den Umgang mit der Tradition lesen: Wagner lehnt ein Traditionsverständnis der sorgfältigen Konservierung des brüchigen Alten ab und plädiert nachdrücklich für einen radikalen Umgang mit dem Überlieferten, das nur bewahrenswert ist, insofern es erneuert werden und dem Neuen nützen kann.
Gilt das auch für den Umgang mit alten Stücken? Nimmst du den Rat an und schredderst sie?
Wenn man etwas schreddert, sollte man das nur tun, wenn man sicher ist, hinterher etwas besseres hervorzubringen. Was aber in diesem Falle gar nicht erforderlich ist. Das Stück ist keine Sammlung von unbrauchbaren
Bruchstücken, sondern ein sehr kraftvoller Organismus. Um den zu erschaffen, hat Wagner mit der Kühnheit seines Siegfried die altnordische Überlieferung sozusagen selbst geschreddert, eingeschmolzen und etwas Neues, ganz Zeitgenössisches daraus geschmiedet. Und wir stehen in einem lebendigen Dialog mit diesem Werk, in dem es heutige Antworten auf bedeutende Fragen gibt. Wagner hätte den bekannten Ausspruch von Jean Jaurès bestimmt gern unterschrieben: «Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.»
Wotan und Alberich sind die beiden Hauptkontrahenten der Tetralogie. Um so verwunderlicher ist es, dass beide im Siegfried so gut wie nichts zur Entwicklung der Handlung beitragen … Wotan hat zwar in der Walküre erklärt, auf seine Macht verzichten zu wollen, tut sich aber offenbar schwer, tatsächlich aus dem aktiven Geschehen auszuscheiden – ein allzu bekanntes, zeitloses Phänomen gerade bei dominanten Führungspersönlichkeiten. Aber man muss ihm zugutehalten: Er fühlt sich verantwortlich, Alberich davon abzuhalten, durch den Ring doch noch die Weltherrschaft zu erlangen. Zu Anfang des zweiten Aktes lässt Wagner die beiden Antagonisten ein letztes Mal aufeinander los – eine Begegnung, die überdeutlich zeigt, dass beider Zeit eigentlich abgelaufen ist. Es ist ein schöner Zug, dass sich der tragische Verfall beider Figuren in einer komischen Szene offenbart. Das Stück ist eben tatsächlich eine richtige Komödie. Wotans eigentliches Augenmerk gilt nunmehr vor allem Siegfried, denn der steht ja endlich für den «freien Helden», den er sich seit langem gewünscht hat. Leider geht die Begegnung mit seinem sehnsuchtsvoll erwarteten Enkel aufgrund eines dummen Missverständnisses denkbar schief. Es kommt zum Streit, denn der freie Held respektiert und fürchtet den Gott nicht. Sein neu geschmiedetes Schwert zerschlägt den Speer, der die alte Ordnung symbolisiert. Erst da erkennt Wotan, dass er ausgespielt hat und tritt endgültig von der Bühne: In der Götterdämmerung werden wir ihn nicht mehr sehen.
www.opernhaus.ch/shop
Wenn Siegfried Wotans Schwert zerschlägt und zu Brünnhilde gelangt, scheint es aber mit der komödiantischen Leichtigkeit vorbei zu sein. Das letzte Bild lässt selbst eingefleischte Wagnerianer seufzen, weil es sich so endlos hinzuziehen scheint. Warum dieser lange Weg zum Happy End?
Es lässt sich nicht leugnen: Die letzte Szene ist eine harte Nuss, an der sich schon viele die Zähne ausgebissen haben. Sie dauert nicht nur fast doppelt so lange wie das zweite Bild von La bohème, sondern hat anscheinend auch gar keine Handlung. Aber wenn man die Länge der Szene mit der Uhr misst, hat man eigentlich nichts erfahren, weil Wagners Musik eine ganz eigene Zeitstruktur erzeugt. Sie ermöglicht eine Dehnung aller Vorgänge, die zu einer erheblichen Verstärkung der emotionalen Wirkung führt, so dass die gedehnte Zeit doch gefüllt ist. Das kann, wenn es gelingt, eine geradezu rauschhafte Wirkung entfalten, und zweifellos hat die nahezu religiöse WagnerVerehrung ihren Ursprung genau in diesen ekstatischen Erlebnissen, die der Komponist mit solchen Szenen kreiert.
Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere, für das Theater wichtigere, tritt hervor, wenn man die Musik in ihrer theatralischen Bedeutung genau betrachtet. Aus diesem Blickwinkel offenbart sie auch in dieser Szene eine grosse Vielfalt, eine immer wieder verblüffende Präzision in der Formung des jeweiligen Gestus. Tatsächlich handelt es sich um eine der wichtigsten Szenen der ganzen Tetralogie, deren Grundkonflikt der zwischen Macht und Liebe ist. Bis zu diesem Moment zeigte sich immer wieder, wie die Liebe der Macht zum Opfer fällt und die Liebenden untergehen, während die Machtgierigen triumphieren. Nun, auf dem Walkürenfelsen, im Niemandsland ausserhalb der Welt kann die Liebe endlich zu ihrer vollen Entfaltung kommen: in der Begegnung zweier Menschen, die den Weg von anfänglicher Fremdheit über das erotische Begehren zur vollständigen Hingabe vollziehen. Die erkennen, dass sie sich selbst aufgeben müssen, um sich in der Gemeinschaft mit dem geliebten Menschen neu und reicher zu finden. Das aber ist, auf die knappste Formel gebracht, das Ideal der künftigen Menschheit, wie sie Wagner vorschwebte, das ist der utopische Kern der gesamten Tetralogie.



Die Entstehungsgeschichte von Wagners Ring des Nibelungen ist lang und komplex; alles in allem beschäftigte ihn die Tetralogie über 25 Jahre seines Lebens. Mitten in der Komposition des Siegfried hat Wagner seine Arbeit am Ring 1857 unterbrochen und erst 12 Jahre später wieder aufgenommen. Spüren Sie diese Unterbrechung in der Musik?
Ich würde nicht sagen, dass ich nach dem zweiten Akt einen starken Bruch empfinde. Aber ich glaube sehr wohl zu spüren, dass Wagner zwischen dem zweiten und dritten Akt den Tristan komponiert hat. Der dritte Akt von Siegfried ist – im Vergleich zu Rheingold und Walküre, aber auch im Vergleich zu den ersten beiden Akten von Siegfried – sehr viel komplexer in der Orchestrierung. Nicht nur in der Musikgeschichte gibt es eine Zeit vor und eine Zeit nach Tristan; auch in Wagners eigener kompositorischer Entwicklung markiert der Tristan einen grossen Entwicklungsschritt. Die unglaublich kühne Art zu schreiben, die er im Tristan erreicht hatte, bleibt für seine nächsten Opern erhalten.
Meinen Sie mit kühn vor allem die harmonische Ebene?
Ich meine die Komplexität der Partitur insgesamt. In gewisser Weise ist es ja ein Wunder, dass Wagner nach so langer Unterbrechung überhaupt zu seinem Material zurückkehren und die Erzählung fortsetzen konnte. Denn das musikalische Material bleibt dasselbe! Tristan ist harmonisch komplexer als Siegfried, aber auch die Art und Weise, wie hier die Leitmotive untereinander verbunden sind, und die Transformation dieser Leitmotive zeugt von einer sehr viel grösseren kompositorischen Reife. Das hängt auch mit den Erfahrungen zusammen, die er bei der Komposition der Meistersinger gesam
melt hat, die man ja fast als eine Übung in Polyphonie und Kontrapunkt bezeichnen kann. Dadurch hat er zu neuen Möglichkeiten im Umgang mit den Motiven gefunden, die bis zum zweiten Akt des Siegfried nur andeutungsweise zu finden sind. Aber auch die Instrumentation ist im dritten Akt im Vergleich zu den ersten beiden Akten sehr viel raffinierter geworden. Für mich ist Siegfried die sinfonischste Oper der Tetralogie, auch was die Orchestrierung und die Klangfarben angeht. Auch die Tempi sind hier feiner aufeinander abgestimmt, was von grosser kompositorischer Reife zeugt. Für mich als Dirigent heisst das: Wenn ich zu Beginn der Oper das richtige Tempo anschlage und die Temporelationen stimmen, ergibt sich die Architektur des Werks fast von selbst. Die Struktur von Siegfried scheint mir besonders klar zu sein.
Vielleicht empfindet man auch deshalb keinen so starken Bruch, weil uns der dritte Akt in eine ganz andere Welt führt – Siegfried erweckt Brünnhilde, lernt die Sexualität kennen und wird erwachsen...
Genau, deshalb steht eine andere, komplexere Kompositionsweise zumindest nicht im Widerspruch zur inneren Logik des Werks. Wagner war ja zudem um 1856 in Folge seiner SchopenhauerLektüre in eine Art Sinnkrise geraten, was sich sehr gut an seinem Herumbasteln am Schluss der RingDichtung ablesen lässt. Er hat nämlich eine recht lange Passage aus Brünnhildes letzter Rede in der Götterdämmerung durch eine Neudichtung ersetzt. Der ursprüngliche Text fasst auf ziemlich tendenziöse Weise die feuerbachische Grundidee des Rings zusammen, also dass die Welt durch die Liebe erlöst werden kann und muss. Die zweite Fassung des Textes ist eine ebenso tendenziöse Zusammenfassung, nun aber im Sinne Schopenhauers und eines Gemischs aus jeweils halb verstandenem Hinduismus und Buddhismus, das Wagner ihm entnommen hatte.
Auf ganz ähnliche Weise hat er ja auch versucht, den Fliegenden Holländer seinen späteren Überzeugungen anzupassen, als er den «Erlösungsschluss» dazu komponierte.
Ja, aber im Falle des Rings hat er zum Glück gemerkt, dass das nicht geht, und einfach die ganze Passage gestrichen. Dieser Entschluss zeigt, dass
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
er die Krise produktiv überwunden hat: Der Theatermann war stärker als der Ideologe. Sicher hat auch hier die Erfahrung mit der Komposition des Tristan geholfen. Er hat diese neuen, aus der SchopenhauerBeschäftigung entstandenen Ideen dort ausgiebig entwickelt, wusste nun, dass sie hier nicht am Platz sind, und konnte zu seinem ursprünglichen Plan zurückkehren: Das Schlussduett von Brünnhilde und Siegfried, der nach der Erweckung Brünnhildes endlich das Fürchten lernt, ist jedenfalls ähnlich komplex wie der zweite Akt des Tristan, aber auch deutlich lebensbejahender.
Siegfried wird ja oft als das Scherzo der Tetralogie bezeichnet. Wie sehen Sie das?
Es gibt viele komische Elemente in dieser Oper. Zum Teil entsteht Komik aus Missverständnissen, nicht nur zwischen Siegfried und Mime, sondern auch zwischen Wotan und Erda; da gibt es Elemente von Ironie, die man nicht unbedingt erwarten würde. Diese komischen Elemente entdecke ich übrigens jetzt ganz neu. Als ich früher Aufführungen des Rings besuchte, schien mir der Siegfried immer am sperrigsten. Das lag vielleicht auch daran, dass es so lange dauert, bis wir im zweiten Akt mit dem Waldvöglein endlich eine Frauenstimme hören... Aber seit ich mich intensiv mit Siegfried beschäftige, scheint mir, dass diese Oper mir fast noch besser liegt als die beiden vorangegangenen.
Das Waldvöglein, das Sie gerade erwähnt haben, ist Teil der Naturdarstellung im Siegfried, zu der auch das Waldweben gehört.
Das Rheingold beginnt ja mit dem berühmten Vorspiel in den Tiefen des Rheins; in der Walküre werden wir dann schon mit dem Orchestervorspiel in eine ganz andere Welt hineingeschleudert, in die Welt der Menschen und der Zivilisation. Siegfried spielt nun zu grossen Teilen auch wieder in der Natur, der Held wächst in einer Höhle beim Zwerg Mime auf, fernab der Zivilisation, und ist der Natur eng verbunden. Das Waldweben im Siegfried ist musikalisch aus dem Motiv des Rheins aus dem Rheingold abgeleitet.
Beide Motive beschreiben fliessende Bewegungen – im Rheingold ist es die Bewegung des Wassers, im Siegfried die der Luft, der Wind, der die Blätter
und Zweige im Wald in Bewegung versetzt. Die Naturschilderung im Siegfried scheint mir – nicht zuletzt wegen der kompositorischen Entwicklung Wagners, die dazwischen liegt – avancierter. Man sieht geradezu das Leben im Wald vor sich – die vielen Insekten, die Blätter, die sich im Wind bewegen, Sonnenstrahlen, die durch das Dunkel brechen.
Wir sprachen vom Scherzo und den komischen Elementen im Siegfried –das Vorspiel zum zweiten Akt weist aber auf düstere, todbringende Momente in der Handlung hin.
Ja, Siegfried bringt zuerst den Drachen und dann Mime um – aber er hat kein Bewusstsein dafür, wie dramatisch seine Handlungen sind. Er denkt nicht darüber nach. Das Vorspiel zum zweiten Akt beginnt mit den dunkelsten und düstersten Orchesterfarben, die überhaupt möglich sind, und der Tritonus, der «diabolus in musica», spielt eine zentrale Rolle. Das Vorspiel evoziert sofort eine sehr düstere Atmosphäre. Ich liebe diese mysteriösen, geisterhaften Vorspiele zum ersten und zweiten Akt sehr, sie sind Beispiele für Wagners unglaublich raffinierte Instrumentationskunst.
Sie haben gesagt, Siegfried versteht nicht, was er da tut, wenn er Fafner und Mime umbringt; ist er wirklich so naiv?
Er ist sehr jung und begreift die Konsequenzen seiner Handlungen noch nicht. Ihm fehlt ein Wertesystem, ein moralischer Kompass; den hat ihm Mime in seiner Isolation nicht vermittelt. Er tötet den Drachen, weil es eine Herausforderung für ihn ist – und weil Mime ihm gesagt hat, er würde so endlich das Fürchten lernen. Wenn Siegfried den Drachen tötet, dann tötet er zum ersten Mal nur, um zu zeigen, dass er stärker ist – anstatt wie bisher ein Tier zu jagen und zu töten mit dem Zweck, sich zu ernähren. Das hinterlässt einen Fleck auf seiner Seele, oder anders gesagt: Er verliert seine Unschuld.
Durch den Genuss des Drachenbluts versteht er dann die Worte des Waldvögleins; er versteht auch, dass Mime ihn anlügt und in Wahrheit vergiften will. Insofern ist Mimes Tötung auch Selbstverteidigung.
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Siegfried ist zugleich auch der Held, der eine Utopie verkörpert – die Hoffnung und die Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt.
Ja, das war, wie wir auch an anderen Opern wie Lohengrin und Parsifal sehen, Wagners grosse Sehnsucht – ein Mensch, der die Welt durch die Liebe zum Besseren verändern kann. Wenn Siegfried im dritten Akt Brünnhilde geweckt hat, dann strahlt die Musik in reinstem C Dur – Siegfried hat das Licht gebracht. Wir sind hier, auch im Vergleich zu den beiden Vorspielen zum ersten und zweiten Akt, musikalisch in einer vollkommen anderen Welt angekommen. Die Harmonik mit deutlich weniger MollKlängen und auch die Instrumentation zeigen es deutlich: Dies ist der Moment, in dem wir innerhalb des Rings der Utopie von einer besseren Welt am nächsten sind. Doch diese Utopie wird in der Götterdämmerung scheitern, weil Siegfried zu wenig auf die Welt um ihn herum vorbereitet ist.
Wagner war Antisemit, was in seinen Schriften deutlich zum Ausdruck kommt; wie stehen Sie zu der Frage, ob sich sein Antisemitismus auch in seinen Werken zeigt?
Leider kennen wir das Problem auch bei anderen Komponisten, wenn wir zum Beispiel an den Geldverleiher in Sergej Rachmaninows Oper Der geizige Ritter oder Mussorgskis Samuel Goldenberg und Schmuyle in Bilder einer Ausstellung denken. Nichtsdestotrotz sind das fantastische Werke. Und Wagners Musik ist trotz seiner Judenfeindlichkeit, die so sehr zu seiner Gedankenwelt gehörte, dass sie auch in seine Opern eingeflossen ist, eines der grössten Geschenke, die wir haben. Auch schlechte Menschen können grossartige Künstler sein. Ich fürchte, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als diesen Widerspruch auszuhalten.
Sie haben während Ihrer Arbeit an Rheingold und Walküre betont, dass Ihnen der schlanke, durchhörbare Orchesterklang wichtig ist. Mit Klaus Florian Vogt debütiert ein Sänger in der Partie des Siegfried, der über eine eher leichte, hell timbrierte Stimme verfügt. Passt er besonders gut in Ihr musikalisches Konzept?
Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, an welche Art von Stimme Wagner wirklich dachte, als er den Siegfried komponierte. Was wir aber wissen, ist, dass im 19. und frühen 20. Jahrhundert die Stimmfächer nicht so eng gedacht wurden wie heute. Enrico Caruso sang an einem Tag Nemorino aus dem Elisir d’amore und am nächsten Tag Cavaradossi in Tosca. Hier im eher kleinen Zürcher Opernhaus brauchen wir für den Siegfried eine Stimme mit sehr guter Projektion und ausgezeichneter Technik, mit guter Höhe und genügend Flexibilität für die schnellen Tempi, die Wagner besonders im ersten Akt vorgibt. Es muss nicht unbedingt der Heldentenor im klassischen Sinne sein. Klaus Florian Vogt bringt alles mit, was man für den Siegfried braucht, und er passt wunderbar zur Brünnhilde von Camilla Nylund. Ich freue mich auf die Rollendebüts der beiden. Und ich kann mir vorstellen, dass die zarten, eher leisen Momente, von denen es viel mehr gibt in dieser Oper als man gemeinhin annimmt, mit Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt besonders anrührend gelingen werden.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach
komplette
können Sie auf www.opernhaus.ch/shop oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben




Hans Rudolf Vaget
Dass Wagner ein Antisemit avant la lettre war – der Begriff Antisemitismus kam erst Ende der 1870er Jahre in Umlauf –, wurde die längste Zeit achselzuckend mehr oder weniger beifällig zur Kenntnis genommen. Als jedoch in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Debatte über den Holocaust in Gang kam und die Judenfeindschaft als mentale Voraussetzung des Völkermords an den Juden Europas erkannt wurde, rückte Wagners Verhältnis zum Judentum in den Vordergrund der Diskussion über seine Wirkungsgeschichte in Deutschland. Heute, nach einem halben Jahrhundert kontroverser Debatten weltweit, kann ein Fazit gezogen werden. Es herrscht ein breiter Konsens über die zentrale Rolle der obsessiven Judenfeindschaft in Wagners Weltanschauung und Selbstverständnis. Nach wie vor kontrovers ist allein die Frage, ob sich Wagners Judenfeindschaft auch in seinem musikdramatischen Werk niedergeschlagen hat. Ein besonders erhellendes Selbstzeugnis liefert Wagners Brief an Franz Liszt vom 18. April 1851. Liszt hatte ihn gefragt, ob er der Verfasser des Artikels über Das Judentum in der Musik sei, der unter einem Pseudonym im September 1850 erschienen war. Natürlich sei er’s, war die Antwort; Liszt kenne ihn doch gut genug, um zu wissen, dass er einen lange unterdrückten Groll gegen die «Judenwirtschaft» hege. Dieser Groll sei seiner «Natur so nothwendig, wie galle dem blute». Mit anderen Worten: Die Judenfeindschaft sei für ihn überlebensnotwendig – so wie der Blutkreislauf ohne Gallensäure und ihre Stimulierung der Verdauung Schaden nehme, was in letzter Konsequenz zum Tod führt. Der Groll gegen Juden stellte sich ihm also geradezu als eine Grundvoraussetzung seines Künstlertums dar.
Wie der Brief an Liszt klarstellt, ist die Rivalität mit Meyerbeer als Keim der ganzen üblen Sache anzusehen: «ich kann als Künstler vor mir und meinen Freunden nicht existieren ohne meinen volkommenen Gegensatz zu Meyerbeer zu empfinden und laut zu bekennen.» Die völlige Distanzierung von Meyerbeer sei ein «nothwendiger Akt der vollen geburt meines gereiften Wesens».
Wagner gab seine Wortmeldung als Beitrag zu einer laufenden Debatte über den «hebräischen Kunstgeschmack» aus. Dies sollte jedoch nicht davon ablenken, dass sein Groll tiefe Wurzeln hatte, die bis in die Pariser Jahre 1839 bis 1842 zurückreichen. Wagner erfuhr die Musikhauptstadt Europas als eine schwer zugängliche Welt des Antichambrierens, der Konnexionen und Hintertreppen, in der alle Macht bei zwei deutschen Juden zu liegen schien: bei Giacomo Meyerbeer, dem Meister der Grande Opéra, und Maurice Schlesinger, dem Musikverleger. Es ist diese Pariser «Judenwirtschaft», die als das Urerlebnis des Wagner’schen Antisemitismus anzusehen ist.
Folgerichtig ist Das Judentum in der Musik zum grossen Teil eine Polemik gegen Meyerbeer, der ungenannt bleibt, aber leicht zu erkennen ist, sowie gegen Felix Mendelssohn Bartholdy, dem zwiespältiger Respekt gezollt wird. Der tief bösartige Charakter des Artikels besteht darin, dass Wagner es nicht bei künstlerischen Gesichtspunkten belässt – diese führt er in Oper und Drama ins Feld –, sondern zu rassistischen Stereotypen greift und Gift und Galle spuckt (um bei seiner eigenen Metaphorik zu bleiben). Er geht mit gespielter Arglosigkeit von der angeblich tiefen Abneigung des Volkes gegen «jüdisches Wesen» aus und illustriert diese mit allen verfügbaren Klischees samt sprachlichen, stimmlichen und körperlichen Merkmalen, die den Juden als nicht dazugehörig ausweisen sollen. Entscheidend ist der Gesichtspunkt, dass der Jude, da er eigentlich ein Fremder ist, keinen Zugang zum «Geist des Volkes» hat, der dem Aberglauben der Romantik zufolge die einzige Quelle grosser, bewegender Musik ist.
An den Schluss des Artikels stellt Wagner die Aussicht auf ein gemeinsames Erlösungswerk, das Juden und NichtJuden erst zu «wahrhaften Menschen» machen werde. Ein universelles Emanzipationsprojekt also, das alles Trennende aufhebt, vorausgesetzt, der Jude hört auf, «Jude zu sein». Dem Juden wird somit abverlangt, was dem aufgeklärten NichtJuden nicht zuzumuten ist: Untergang und Selbstvernichtung. Wagners Erlösung ist ein Erlösungsantisemitismus (Saul
Das komplette Programmbuch können Sie auf
Friedländer). Ob Absicht oder nicht, der Schluss erhält dadurch eine zusätzliche Pointierung, dass Meyerbeer stolz auf sein Judentum war und sich, anders als Mendelssohn, nicht taufen liess.
Sein aufgestauter Groll, so Wagner weiter, habe eine «Veranlassung» gebraucht, um ihn «endlich einmal» losplatzen zu lassen. Die Veranlassung lieferte Meyerbeers Le Prophète, den Wagner im Februar 1850 in Paris erlebte. Nicht ohne Neid registrierte er den ungeheuren Erfolg dieser Oper und den Enthusiasmus des Pariser Publikums. Eben dies jedoch liess eine Aktion gegen die Dominanz des Meyerbeer’schen Operntypus umso dringlicher erscheinen. Erfüllt von dem erregenden Bewusstsein, die «Geburt» seines «gereiften Wesens» zu erleben, sprich: die Geburt eines neuartigen Musikdramas, warf er alle Bedenken moralischer Art von sich, unterdrückte seine vielfache Dankesschuld dem noblen, anfänglich ebenso bewunderten wie beneideten Mann gegenüber, und ging zum Angriff über. Vergessen war, dass sein bisher grösster Erfolg, Rienzi (1842), ohne das Modell der Meyerbeer’schen Grand Opéra nicht zu denken ist; vergessen auch, dass Meyerbeer ihm in Paris, Dresden und Berlin mit Empfehlungen kollegiale Freundschaftsdienste erwiesen hatte.
Ein letzter, tief persönlicher Gesichtspunkt ist in Anschlag zu bringen: Wagners lebenslanger Kampf mit dem Dämon Geld. Meyerbeer und Mendelssohn kamen im Reichtum zur Welt und genossen alle damit verbundenen Vorteile für ihre Laufbahn, einschliesslich Privaterziehung, wie sie einem Prinzen gemäss war. Wagner hingegen musste sich alles selbst erarbeiten; seine Anfänge waren mühevoll; Nietzsche sprach tief blickend von «dilettantisieren».
Allein schon der Umstand, dass Wagner das Pamphlet fast zwei Jahrzehnte nach der Erstpublikation neu auflegte, spricht für die Bedeutung der «Judenfrage» in Wagners emotionalem Haushalt. Die Neuauflage von 1869, diesmal in eigenem Namen, hat den doppelten Umfang; sie markiert auch sonst eine Eskalation in Wagners feindlicher Einstellung. Der im Wesentlichen unveränderte Text von 1850 wird ergänzt durch eine Einleitung und Widmung an Marie Muchanoff, Gräfin Kalergis, eine Mäzenin, mit der er 1860 in Paris verkehrte.
Der wahrscheinliche Auslöser der Neuveröffentlichung war die unfreundliche Besprechung der 1868 uraufgeführten Meistersinger durch Eduard Hanslick in der Wiener Neuen Freien Presse. Dass Hanslick ihm ein äusserst irritierender
Dorn im Auge war, geht daraus hervor, dass er in einer früheren Fassung der wichtigen MerkerFigur den Namen Veit Hanslich gab. Taktloserweise hatte Wagner diesen Namen in Anwesenheit Hanslicks bei einer Lesung 1862 in Wien verwendet – sicher mit Absicht. «Veit Hanslich» war ihm schliesslich aber doch zu plump. Sein verlässlicher Kunstverstand wählte einen suggestiveren Namen: Sixtus Beckmesser. «Keiner besser.»
Ein erster Schritt zur Eskalation ist darin zu erblicken, dass er nun nicht lediglich einen Gegner und Konkurrenten vor sich sieht, sondern eine ganze Verschwörung. Als ihr Haupt will er Eduard Hanslick ausgemacht haben, den Verfasser einer konservativen Musikästhetik, Vom musikalisch-Schönen (1854), und Verfechter der «absoluten» Musik. Befangen in seinem chimärischen Antisemitismus sieht Wagner nicht bloss sein eigenes Werk bedroht, sondern «unser geistiges Leben». Mehr noch: Er spricht vom «Verfall unserer Kultur» nicht als Bedrohung, sondern als einer bereits vollendeten Tatsache – eine rhetorische Finte, deren sich auch antisemitische Agitatoren wie Wilhelm Marr (Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum, 1879) und Édouard Drumont (La France juive, 1886) mit Erfolg bedienten. Am Ende seiner Einleitung lanciert Wagner den Gedanken, dass der «Verfall unserer Kultur» möglicherweise nur durch «eine gewaltsame Auswerfung des zersetzenden fremden Elementes» rückgängig zu machen sei – dies die äusserste Eskalation seines galligen Grolls gegen das Judentum. Die Judenfeindschaft blieb, wie die Tagebücher Cosimas belegen, eine Konstante in seinem Denken und grundiert seine späten weltanschaulichen Schriften.
Zu Wagners Entlastung wird gern angeführt, dass er unter seinen Mitarbeitern auch Juden duldete. Die bedeutendsten Beispiele sind Carl Tausig, Joseph Rubinstein und Hermann Levi. Wagners Verhalten gleicht bis zu einem gewissen Grade dem des Wiener Bürgermeisters Dr. Karl Lueger, der nach dem Prinzip regierte: «Wer a Jud ist, bestimm’ ich.» Es ist dies jedoch eine zutiefst judenfeindliche Einstellung.
Sind nun wirklich, wie Theodor W. Adorno anmerkte, alle «Zurückgewiesenen in Wagners Werk Judenkarikaturen»? In der Frage des antisemitischen Gehalts der Werke haben sich zwei gegensätzliche Positionen herausgebildet. Auf der einen Seite wird argumentiert, dass es schlicht nicht angehe, die Bühnen
werke ohne Berücksichtigung seiner obsessiven Judenfeindschaft zu interpretieren. Diese habe in der Charakterisierung Alberichs, Mimes, Beckmessers und Kundrys Gestalt angenommen. Auf der anderen Seite wird geltend gemacht, dass diese nicht ausdrücklich als jüdisch gekennzeichnet seien; mehr noch, dass Wagner, um ihren universellen «appeal» nicht zu beeinträchtigen, seine Judenfeindschaft bewusst von seinen Werken ausgeschlossen habe.
Weder die eine noch die andere Position vermag in ihrer Ausschliesslichkeit zu überzeugen. Um zu erkennen, mit welcher Raffinesse die Judenfeindschaft in die multimedialen Bühnenwerke eingearbeitet ist, bedarf es einer Besinnung auf das Konzept der Metapolitik und die Technik der Hundepfeife. Der Ton der Hundepfeife liegt zu hoch für das menschliche Gehör, wird aber von denen vernommen, für die er intendiert ist, den Hunden. Die Signale, die von diesem Instrument ausgehen, sind codiert und lassen keine politische Absicht erkennen. Vielmehr operieren sie im Raum der Metapolitik – ein Begriff, den Constantin Frantz mit Blick auf Wagner und mit dessen Zustimmung geprägt hat. Sie operieren kraft immanenter Wertsetzungen (Lichtalbe/Schwarzalbe und dergleichen mehr) und besonders effektiv mittels der mimischen Fähigkeit der Musik, hinter dem Rücken und über die Köpfe der Protagonisten hinweg, diese als «Juden» kenntlich zu machen.
Ein Beispiel muss genügen. Beckmesser wird nirgends als Jude bezeichnet. Andererseits jedoch ist sein Charakter mit vielen stereotypen Merkmalen behaftet, die ihn in seinem Wesen als Juden ausweisen: Er ist weder kreativ noch originell; er ist unfähig, die neue Musik zu verstehen und opponiert ihr; er wird in Walters Probelied mit dem Märchen vom Juden im Dorn verglichen; er begehrt die Tochter des reichsten Manns in Nürnberg ob ihrer Mitgift und dergleichen mehr. In den Köpfen der «Hunde» im Publikum summieren sich diese Signale zu einer unmissverständlichen Botschaft.
Über Wagner und seine Bedeutung für den Nationalsozialismus und für Hitler werden immer noch scheinbar selbstverständliche Gemeinplätze verbreitet, die jedoch einer kritischen Nachprüfung nicht standhalten. Der Judenhass des deutschen Diktators nährte sich aus den verschiedensten Quellen. In keiner seiner «Kulturreden» jedoch beruft er sich auf Wagners Antisemitismus zur Legitimierung seines eigenen: Wagner war ihm zu wert, um als Quelle antisemi
tischer Propaganda herzuhalten. Auch die Zeugnisse der WagnerRezeption während der HitlerJahre belegen, dass Wagners Opern nicht wegen ihrer antisemitischen Obertöne geschätzt wurden, sondern ob ihrer exemplarischen «Deutschheit». Was in der HitlerWagnerBeziehung historisch ins Gewicht fällt, ist ihre Entwicklung. Der WagnerKult des jungen Hitler mutierte nach dem Weltkrieg zu einem bösartigen Amalgam aus Ästhetik und Rassismus. Wagner war ihm der schlagendste Beleg für die einzigartige Fähigkeit der «germanischen Rasse», Genialität hervorzubringen. Je reiner die Rasse, desto höher ihr Geniepotenzial. Deutschlands Suprematiestreben sowie seine in letzter Konsequenz mörderische Rassenpolitik waren nach dieser sozialdarwinistischen Logik gleichsam metaphysisch gerechtfertigt.
Die herausragende Manifestation des Hitler’schen WagnerKults war sein Engagement für die Bayreuther Festspiele, die er als Chefsache betrachtete und zu seinem «Hoftheater» (Thomas Mann) umfunktionierte. Aufs Ganze gesehen war der WagnerKult des Dritten Reichs jedoch eine EinMannShow. Goebbels war kein Wagnerianer; in Sachen Wagner redete er aus anerzogener Unterwürfigkeit seinem Führer nach dem Munde. Rosenberg, der eigentliche Ideologe des Nationalsozialismus, war de facto ein AntiWagnerianer. Die zu den «Kriegsfestspielen» in Bayreuth abkommandierten Soldaten hatten andere Sorgen und nutzten die Stunden im Festspielhaus, wie bezeugt, statt zur ideologischen Ertüchtigung zum Schlafen.
Was Wagners Wirkungsgeschichte betrifft, so sind weniger die zwölf Jahre der HitlerHerrschaft relevant als die fünfzig Jahre von Wagners Tod bis zur Machtübernahme durch Hitler 1933, denn dieses Halbjahrhundert war die Inkubationszeit des deutschen Faschismus. Zu fragen ist, über welche Identifikationsschienen der WagnerKult des gebildeten Bürgertums die Deutschen für eine charismatische Retterfigur wie Hitler empfänglich gemacht hat. Doch das steht auf einem anderen Blatt.
Hans Rudolf Vaget ist emeritierter Professor of German Studies and Comparative Literature am Smith College (Northampton), Mitherausgeber von wagnerspectrum und Autor von «Wehvolles Erbe. Richard Wagner in Deutschland» (2017).
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben


Thomas Mann
Wagners dramatische Fähigkeit, das Volkstümliche und das Geistige in einer Gestalt zu binden, offenbart sich am schönsten in dem Helden seiner revolutionären Epoche, in Siegfried. Das «atemlose Entzücken», das der zukünftige Theaterdirektor von Bayreuth eines Tages als Zuschauer einer Kasperltheatervorstellung empfand – er erzählt davon in seinem Aufsatz Über Schauspieler und Sänger – dies Entzücken ist praktisch, ist produktiv geworden in der Inszenierung des Ringes, dieser idealen Volksbelustigung mit ihrem unbedenklichen Helden. Wer wollte die hohe Ähnlichkeit dieses Siegfried mit dem kleinen Pritschenschwinger des Jahrmarkts verkennen? Zugleich jedoch ist er Lichtsohn und nordischer Sonnenmythus, was ihn nicht hindert, drittens etwas sehr Modernes aus dem neunzehnten Jahrhundert, der freie Mensch, der Brecher alter Tafeln und Erneuerer einer verderbten Gesellschaft, Bakunin, wie Bernard Shaws vergnügter Rationalismus ihn einfach immer nennt, zu sein. Ja, er ist Hanswurst, Lichtgott und anarchistischer Sozialrevolutionär auf einmal, das Theater kann nicht mehr verlangen; und diese Kunst der Mischung ist nur der Ausdruck von Wagners eigenem gemischten und in allen Stücken mehrdeutigem Wesen. Er ist kein Dichter und ist kein Musiker, sondern etwas Drittes, worin diese beiden Eigenschaften auf eine sonst nicht vorkommende Weise verschmelzen, nämlich ein Theaterdionysos, der unerhörte Ausdrucksvorgänge dichterisch zu unterbauen und gewissermassen zu rationalisieren weiss. Aber soweit er also eben dennoch Dichter ist, ist er es nicht in einem modernen, kulturellen und literarischen Sinn, nicht aus dem Geiste und dem Bewusstsein, sondern auf eine viel frömmere und tiefere Weise: Die Volksseele ist es, die aus ihm und durch ihn dichtet; er ist nur ihr Mundstück und Werkzeug, nur «Bauchredner Gottes»,
um Nietzsches guten Witz zu wiederholen. Zum mindesten ist dies die korrekte und orthodoxe Auffassung seines Dichtertums, und eine gewisse mächtig geartete Stümperei, die, kulturell und literarisch gesprochen, darin einschlägig ist, scheint diese Auffassung zu stützen. Dabei aber ist er imstande, in einem Briefe zu schreiben: «Schlagen wir die Kraft der Reflexion nicht zu gering an, das bewusstlos produzierte Kunstwerk gehört Perioden an, die von der unseren fernab liegen: das Kunstwerk der höchsten Bildungsperiode kann nicht anders als im Bewusstsein produziert werden.» – Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Theorie einer durchaus mythischen Herkunft seiner Produktion; und wirklich findet sich in dieser neben Dingen, die den Stempel der Inspiration und blindseligen Hingerissenheit an der Stirne tragen, so viel sinnig und witzig Gedachtes, Anspielungsvolles, verständig Gewobenes, so viele kluge Zwergenarbeit neben dem Riesen und Götterwerk, dass es unmöglich ist, an Trance und Dunkelschöpfung zu glauben. Der ausserordentliche Verstand, den er in seinen kritischen Schriften bekundet, dient zwar nicht eigentlich dem Geiste, der «Wahrheit», der abstrakten Erkenntnis, sondern seinem Werk, das er erläutern, rechtfertigen, dem er innerlich und äusserlich den Weg bereiten soll, – aber eine Tatsache ist er darum nicht weniger. Es bliebe die Möglichkeit, dass er bei der Produktion ganz und gar ausgeschaltet gewesen sei und der einflüsternden Volksseele den Platz geräumt habe. Aber unser Gefühl, dass dem nicht so gewesen sein könne, wird durch allerlei mehr oder weniger authentische Überlieferungen aus seinem Lebenskreise bestätigt, des Inhalts, dass Ausdauer sehr oft bei ihm habe für Spontaneität eintreten müssen; dass er nach eigener Aussage sein Bestes nur mit Hilfe der Reflexion habe leisten können; durch solche ihm in den Mund gelegten Äusserungen wie: «Ach, ich habe versucht und versucht, nachgedacht und nachgedacht, bis ich endlich das herausbekam, was ich brauchte.»
Kurzum, sein Dichter und Künstlertum unterhält sowohl Beziehungen zu Perioden, «die von der unseren fernab liegen», wie es solchen angehört, in denen die Entwicklung des Grosshirns ins ModernIntellektualistische sich längst vollzogen hat; und dem entspricht die unauflösliche Mischung von Dämonie und Bürgerlichkeit, die sein Wesen ausmacht, – sehr ähnlich wie bei Schopenhauer, der gerade hierin ihm zeitgenössisch und individuell aufs nächste verwandt ist. Der unbürgerliche Extremismus seiner Natur, den er der Musik
in die Schuhe schiebt – «Sie macht mich nun einmal zum exklamativen Menschen», sagte er, «und das Ausrufungszeichen ist im Grunde die einzige mir genügende Interpunktion, sobald ich meine Töne verlasse!» – dieser Extremismus äussert sich in dem enthusiastischen Charakter aller seiner Zustände, namentlich der depressiven; er tritt zutage in seinen äusseren Schicksalen (denn Schicksal ist ja nur Auswirkung des Charakters), in seinem Missverhältnis zur Welt, seinem zerrissenen, verfemten, gehetzten, hin und her geworfenen Leben, wie er es in dramatischer Lyrik durch den Mund seines WehwaltSiegmund ausspricht: «Mich drängt es zu Männern und Frauen: wieviel ich traf, wo ich sie fand ob ich um Freund, um Frauen warb, immer doch war ich geächtet, Unheil lag auf mir. Was Rechtes je ich riet, andern dünkte es arg; was schlimm immer mir schien, andere gaben ihm Gunst. In Fehde fiel ich, wo ich mich fand; Zorn traf mich, wohin ich zog. Gehrt’ ich nach Wonne, weckt’ ich nur Weh.»
– Da kommt jedes Wort aus Erfahrung; es ist keines darin, das nicht genau auf sein eigenes Leben gemünzt wäre. Nein, das ist kein bürgerlicher Mensch im Sinne irgendwelcher Regelrechtheit und Angepasstheit.

MIME in höchster Angst Halte! halte! wohin?
höre mich, Siegfried, hör!
Er stürmt mir fort! – he, Siegfried!
Wie halt’ ich das Kind mir fest?
Er ruft mit der grössten Anstrengung in den Wald Nicht alles ward dir schon kund: von der Mutter musst du noch hören!
Verschmähst du der Mutter Rat?
SIEGFRIED kommt zurück:
Von der Mutter? – rede heraus!
MIME
So tritt nur ein, traue dem Alten:
Wichtiges musst du noch wissen.
SIEGFRIED wieder eintretend:
Ich bin ja da:
was bargst du mir noch?
MIME verlegen
Ja, das ist so bald nicht gesagt! Er hustet.
Doch hör: ich hab’s, was du hören musst! –
Du willst aus dem Wald
fort in die Welt?
Hör, was deine Mutter
Mime vertraut. –
«Mime» – sprach sie –
«kluger Mann!
Wenn einst mein Kind erwächst, hüte das kühne im Wald!
Die Welt ist tückisch und falsch, Dem Tör’gen stellt sie Fallen: Nur wer das Fürchten gelernt, mag dort sich leidlich behüten.»
SIEGFRIED
Das hat dir die Mutter gemeldet?
MIME
Glaube, ich rede ihr gleich.
SIEGFRIED
Das Fürchten möcht’ ich lernen!
MIME
Ein Kluger kann es leicht; Dumme lernen es schwer.
Der Kluge spürt und späht umher, ob Gefahr ihn noch befiel.
Naht der Feind, neigt er sich fein, dass ihn nicht der Dräuende trifft.
SIEGFRIED
Das, Mime, wäre das Fürchten?
MIME
Die List ist es, die Furcht uns lehrt: sie ist des Fürchtens Frucht.
SIEGFRIED
Listen kenn’ ich, sie lernt’ ich vom Fuchs. Wer aber lehrt mich das Fürchten?
MIME
Wie dumm du noch bist, das nicht zu wissen!
So wolltest du in die Welt? –Im Walde bist zu vertraut, in der Welt trügt sich dein Blick: Dein Auge lugt, es lauscht dein Ohr, –wie Gefahr dich auch umlauert, du erlügst und erlauschest nichts, zeigt dir die Furcht nicht die Gefahr, dass mit List du dich gegen sie legst.
SIEGFRIED
Das Fürchten muss ich drum lernen.
MIME
Wenn dein Auge nicht hell mehr sieht, wenn dein Ohr nur träumend noch hört: wenn dir’s dann schwirrend näher schwebt,
verschwimmend die Sinne dir schwinden, die Glieder dir schwankend versagen, im Busen bang
das Herz dir erbebt: –dann hast du das Fürchten gelernt.
SIEGFRIED
Nun fühl’ ich, das lernt’ ich noch nicht.
MIME
O töriger Knabe, dummes Kind, bleibe im Wald, lass die Welt!
Für deine Mutter
mahne ich dich.
Lass es der Mutter zulieb!
Fühltest du noch das Fürchten nicht, in der list’gen Welt verlierst du dich; wo dein Vater fiel, fällst auch du.
Dich warne der Mutter Weh!
Wem die Furcht die Sinne neu nicht schuf, in der Welt erblindet dem der Blick. Wo nichts du siehst, wirst du versehrt; wo nichts du hörst, trifft es dein Herz.
Nicht schneidet der Stahl, eh’ die Glut ihn nicht schmolz, wem die Furcht die Sinne
nicht scharf gefegt, blind und taub in der Welt schlingt ihn die Welle hinab!
Drum achte des Alten Wort: bleib, du Dummer, im Wald!
SIEGFRIED
Das Fürchten mag und muss ich lernen. Durch deinen Witz gewinn’ ich’s nie.
Drum aus dem Wald fort in die Welt: Sie lehrt mich das Fürchten allein!
Bei dir versäss’ ich säumig den Tag, ich bliebe dumm, taub und blind.
Und lern’ ich das Fürchten, lern’ ich es nicht, wo man’s lernt, da will ich doch sein!
Drum rat’ ich dir jetzt, rüste das Schwert, schweisse die starken Stücken zu ganz!
Täusche mich nicht mit schlechtem Tand!
Den Trümmern allein
trau’ ich was zu.
Find’ ich dich faul, gefällt mir es nicht, machst du mir Flausen
und flickst es schlecht:
Dir sag’ ich, Alter, hab acht!
Denn scheid’ ich, das Fürchten zu lernen, dich lehr’ ich das Fegen zuvor!
Er läuft in den Wald.
MIME allein
Nun sitz’ ich da, hab zur Schande noch den Schimpf;
zur alten Not
die neue noch:
vernagelt bin ich nun ganz!
Greulicher Geiz, verfluchte Gier nach des Reifes Gold!
Nun duld’ ich wahrlich
schönen Dank, ich alter, dummer Narr! –





Siegfrieds tapferste Tat ist sein siegreicher Kampf mit Fafner, darin ist Wagner mit seinen skandinavischen Quellen einig. Doch ist sein Held noch um einiges tapferer als das altnordische Vorbild, denn der Sigurd der Völsunga Saga erringt den Sieg auf eine Weise, die wenig heldenhaft, ja geradezu heimtückisch erscheint und kaum den Namen Kampf verdient: Auf Regins, seines Ziehvaters, Rat gräbt Sigurd auf dem Weg, auf dem der Wurm zur Tränke zu kriechen pflegt, eine Grube, in der er sich verbergen und aus der heraus er den Drachen angreifen will. Als Fafnir nun zum Wasser kriecht, stösst Sigurd dem Ahnungslosen ohne Umstände das Schwert von unten in den Leib.
So die Darstellung der Völsunga Saga, der Wagner ostentativ nicht folgt. Obwohl sein Schlangenwurm genauso furchtbar gezeichnet ist wie in der Saga (selbst der giftige Geifer fehlt nicht), tritt Siegfried dem Unhold offen entgegen und verlässt sich nicht auf List und Tücke, sondern allein auf seine Stärke und Geschicklichkeit. Zudem gestaltet Wagner den Auftritt mit grosser Sorgfalt so, dass Siegfrieds Handeln beinahe als Notwehr, zumindest als gerechtfertigte Selbstverteidigung erscheint. Hierzu betreibt der Meister beträchtlichen Aufwand, der eine nähere Betrachtung verdient:
Obwohl Siegfried mit der ausdrücklichen Absicht zur Neidhöhle gekommen ist, sich mit Fafner im Kampf zu messen und ihn zu töten – «Notung stoss’ ich dem Stolzen ins Herz!» –, ist diese Absicht doch kaum noch präsent, als die beiden sich schliesslich begegnen: Über all dem Sinnieren über Vater und Mutter, über Waldweben und Pfeifenschnitzen hat der Held – wie das Publikum
den Wurm ganz vergessen, und als er ins Horn stösst, will er keinen Drachen aufscheuchen, sondern einen lieben Gesellen anlocken. Zum Kampf kommt es erst, nachdem Fafner unmissverständlich klargemacht hat, dass er Siegfried als «Frass» betrachtet, der Held also keine andere Wahl hat als entweder zu sterben oder aber selbst zu töten. Nach dem tödlichen Schwertstoss kann Siegfried ehrlich sagen: «Mit dir mordlich zu ringen reiztest du selbst meinen Mut.» Siegfried meuchelt Fafner also nicht wie der altnordische Sigurd, sondern siegt im ehrlichen Duell. Diese Änderung musste Wagner vornehmen, denn er schrieb für ein anderes Publikum als die Eddadichter, deren Lieder der Völsunga Saga zugrunde liegen. Diesen Dichtern waren die Ideale der Ritterlichkeit fremd, die im christlich geprägten Europa seit dem Hochmittelalter kultiviert wurden und die es erfordert hätten, dass der Held sich einem Feind, selbst einem Unhold, zum offenen Zweikampf stellte. Ihre Ideale gehören einer archaischeren Zeit an, in der List und Tücke gegen einen übermächtigen Gegner den Helden nicht schändeten, sondern ehrten. Zwar ist der altnordischen Literatur die Idee des fairen Zweikampfes nicht unbekannt, doch gilt das Anwenden von List oder auch das Ausnutzen zahlenmässiger Übermacht nicht als unehrenhaft. Einem Untier wie Fafnir fair play zu bieten, wäre diesen Autoren und ihrem Publikum als sinnlose, selbstmörderische Dummheit erschienen – es kommt ihnen daher gar nicht in den Sinn. Wagner, andererseits, schrieb für ein Publikum, das, wenn nicht Gottfrieds Tristan und Wolframs Parzival, so doch jedenfalls Walter Scotts Ivanhoe gelesen hatte und von einem Helden Ritterlichkeit erwartete. Wenn auf Siegfried, den Lichthelden, kein Schatten fallen sollte, dann musste er, wenn Wagner ihn auch ansonsten so naturwüchsig wie möglich zeigt, hier einmal den Artusritter spielen. Wagners Kunst bewährt sich freilich wieder darin, dass er auch dieses Verhalten scheinbar zwanglos gerade aus der naturwüchsigen Persönlichkeit des Helden und ganz ohne Rekurs auf moralische Konventionen entwickelt.
Mit dem Sieg über den RiesenWurm Fafner lässt sich Staat machen, mit der nur wenige Minuten später folgenden Tötung Mimes dagegen weniger – einen
oder
alten Zwerg zu erschlagen, das lässt sich beim besten Willen nicht zur Heldentat erklären. Gleichwohl gestaltet Wagner auch in diesem Fall den Hergang so, dass Siegfried sich seiner Handlung zumindest nicht schämen muss. Deutlich wird das wieder im Vergleich mit der Darstellung der altnordischen Quelle: Auch in der Völsunga Saga tötet Sigurd nach dem Kampf gegen Fafnir seinen Ziehvater, nachdem er von einem gegen ihn gerichteten Anschlag des tückischen Schmiedes erfährt. Anders als Wagners Mime offenbart Regin seine üblen Absichten jedoch nicht selbst; die Wirkung des Drachenblutes, dass der Held «des Schelmen Heuchlergered’» durchschauen und ihn verstehen kann «wie sein Herz es meint», gibt es in den Quellen nämlich nicht. Hier besteht der einzige Effekt darin, dass Sigurd nun die Vögel versteht, und einzig auf deren Warnung hin tötet er Regin. Als sie ihn über die bösen Pläne des Alten informiert und ihm die materiellen Vorteile vor Augen geführt haben, die ihm aus dessen Ableben erwachsen würden, folgt Sigurd dem Vorschlag des letzten Vogels buchstäblich: Nach kurzem Raisonnement schlägt er Regin tot, ohne ihm Gelegenheit zur Verteidigung zu geben. Ganz anders, abermals, das Geschehen im Ring. Wagner erfindet den wunderbaren Dialog, in dem Mime, während er Siegfried mit traulichem TrugGerede betören will, ganz gegen seinen Willen dem durch «des Blutes Genuss» hellhörig gewordenen Siegfried seinen Mordplan, dazu seinen Hass und seine ganze Erbärmlichkeit offenbart. Erst als der Zwerg dem Helden «mit widerlicher Zudringlichkeit» das Horn mit dem Betäubungsmittel aufnötigen will, greift Siegfried zum Schwert. Damit wird seine Tat natürlich, anders als im Fall Fafners, noch nicht zur Notwehr oder Selbstverteidigung, denn Siegfried tötet diesmal nicht, um sein eigenes Leben zu wahren, aber Wagner hat zweifellos alles getan, um das gewaltsame Ende des Zwergs als Konsequenz seiner eigenen üblen Pläne erscheinen zu lassen, als gerechte Strafe, die Siegfried lediglich vollstreckt. Er tötet, so heisst es im Nebentext, «wie in einer Anwandlung heftigen Ekels», provoziert durch die «widerliche Zudringlichkeit» des Alten. Zivilisierte Reflexion wird dies kaum als Rechtfertigung für einen Totschlag durchgehen lassen, aber Siegfried ist kein Teil einer zivilisierten Gesellschaft und fühlt sich in keiner Weise schuldig: «Neides Zoll zahlt Notung, dazu durft’ ich ihn schmieden.» Er bereut seine Tat also keineswegs, erklärt sie vielmehr für not
wendig («nun musst’ ich ihn gar erschlagen!») und verschweigt sie auch nicht etwa schamhaft, als er später Mären aus seinen jungen Tagen zum Besten gibt. Und nicht nur mit sich selbst ist er ob dieser Tat im Reinen, sondern offensichtlich auch mit seinem Schöpfer, denn sie zieht keinerlei üble Folgen nach sich (und solche in die Handlung einzubauen, wäre für Wagner ein Leichtes gewesen: Immerhin ist Siegfrieds Mörder Hagen Mimes Neffe, und es hätte Wagner wenig Mühe gekostet, Rache für den Tod des Onkels zumindest als sekundäres Mordmotiv anzubringen). Ob wir mit dieser Haltung sympathisieren, ist eine andere Sache, aber Siegfrieds Tat ist jedenfalls, auch vor unserem modernen Gefühl und Verständnis, viel besser gerechtfertigt als die Sigurds in der Völsunga Saga.
Wesentlich wichtiger als diese zwar charakteristischen, aber letztlich marginalen Modifikationen ist Wagners Eingriff in das Geschehen des ersten Aktes. Jeder der drei Akte steht ja im Zeichen einer bedeutenden Handlung Siegfrieds: Schwertschmiedung, Drachenkampf und Erweckung der Walküre. Doch nur die letzten beiden kommen auch in den Quellen dem Helden zu; die erste, die Schwertschmiedung, ist dagegen dort das Werk von Sigurds Ziehvater Regin, der bei Wagner Mime heisst. Wagner nimmt diese Tat also dem intriganten Zwerg, gibt sie dem Helden selbst und stellt damit zunächst einmal das Verhältnis dieser beiden Figuren, den Kontrast ihrer Charaktere aufs Schärfste heraus: hier der furchtlose Held, dem aus sich selbst heraus alles gelingt – dort der mutlose Zwerg, dessen Mutterwitz schon lange magerte, und der mit all seinem angehäuften Wissen nichts fertig bringt, noch nicht einmal in seinem eigenen Fach. Gerade weil Siegfried nicht fleissig Mimes Kunst gepflegt hat, kann er unbefangen an die Aufgabe herangehen und furchtlos «zu ganz fegen», wovor Mime, die Memme, verzagen musste. Nur wer das Fürchten nie erfuhr, schmiedet Nothung neu.
Doch nicht nur von Mime und dessen Kunst und Rat zeigt sich Siegfried unabhängig, sondern – und das ist für den Ring insgesamt von noch viel grösserer, zentraler Bedeutung – auch von Wotan, dem ursprünglichen Herrn des Schwertes. Denn der Held lötet die Stücken nicht einfach wieder zusammen,
wie Mime es getan hätte, sondern zerfeilt sie in Späne, zerstört das Überlieferte, Ererbte, und schafft es sich dann ganz neu. Damit ist es nicht mehr die alte Waffe, das «Wotansschwert», sondern ein neues Schwert und völlig Siegfrieds Eigentum. Dass und wie das Schwert in Siegmunds Hand gelangte, war Teil von Wotans Plan, und damit blieb Siegmund von Wotan abhängig, der dem Sohn die Waffe auch wieder nehmen oder zerschlagen konnte. Siegfried dagegen ist wirklich der freie Held, keine Marionette seines Grossvaters. Er hat das Schwert nicht von Wotan zugespielt bekommen, und darum kann er es nicht nur gegen Wurm und Zwerg, sondern auch gegen den Gott mit Erfolg führen, den Speer zerschlagen. Er ist Herr des Schwertes, und damit auch Herr der Taten, die er damit vollbringt.
Um diese Unabhängigkeit Siegfrieds, so wichtig für seine Rolle im Ring, sinnfällig zu machen, musste Wagner den Helden als seinen eigenen Schmied zeigen.
Dass und wie Siegfried sein Schwert schmiedet, ist nicht nur von grösster Bedeutung für die Stellung dieser Figur innerhalb der RingHandlung, für das Problem des freien Helden. Der Vorgang steht vielmehr, gleichnishaft, auch für die Entstehung des RingDramas selbst. Wie Siegfried, sein Geschöpf, handelte auch Richard Wagner, der Schöpfer. Zwei kleine Parallelerzählungen sollen dies verdeutlichen:
Irgendwann in mythischer Zeit lebt in einer Höhle im Wald ein junger Mann. Die Höhle und der Wald gefallen ihm nicht mehr, und die Gesellschaft, die er dort hat, gefällt ihm am wenigsten. Alles ist ihm zu klein und zu eng; er will hinausziehen und in der Welt grosse Taten vollbringen. Die Kraft dazu fühlt er in sich, doch er braucht ein Schwert. Viele hat er probiert, aber keines war passend für ihn. Da endlich entdeckt er eines, von dem er gleich weiss, dass es das Richtige ist. Es ist alt, viel älter als er selbst, und es ist in Stücke zerbrochen. Den Trümmern allein traut er was zu. Damit steht er nicht allein: Auch andere setzen grosse Hoffnungen in dieses Schwert. Aber selbst dem berühmtesten Fachmann, dem sorglichsten
Schmied, ist es trotz vieler Mühen nicht gelungen, die Stücke wieder zusammenzuschweissen. Doch unser junger Held traut nicht nur den Trümmern was zu, sondern auch sich selbst. Er versucht gar nicht erst, die Stücke des alten Schwertes zu flicken. Furchtlos zerfeilt er sie in ihre kleinsten Einzelteile und schmiedet daraus ein ganz neues Schwert, sein Schwert. Mit diesem neuen Schwert zieht er hinaus und vollbringt Taten, die die Welt verändern, und auch nach seinem Tod unvergessen bleiben.
Und es lebt, im berühmten Jahr 1848, in Dresden ein nicht mehr ganz so junger Mann. Die Gesellschaft, in der er dort lebt, gefällt ihm immer weniger. Er fühlt die Kraft zu grossen Taten in sich, Taten der Kunst, und er hat schon Proben dieser Kraft gegeben. Doch um sein Bestes zu leisten, das ganz Grosse, Unerhörte, braucht er einen grossen Stoff. Viele hat er erwogen. Da endlich sieht er den richtigen vor sich. Es ist ein alter Stoff, eine uralte Sage, und die Überlieferung ist trümmerhaft. Viele haben grosse Hoffnungen in diese Trümmer gesetzt und versucht, die alte Sage neu zu fügen, aber selbst berühmten Dichtern ist es trotz grosser Mühen nicht gelungen. Doch unser Held der Kunst traut nicht nur den Trümmern was zu, sondern auch sich selbst. Er versucht gar nicht erst, aus der Überlieferung das Alte wieder zu gewinnen. Furchtlos zerlegt er sie in ihre kleinsten Teile und macht daraus etwas ganz Neues, ein neues Werk, sein Werk. Mit diesem Werk verändert er die Welt, und es sieht heute, über ein Jahrhundert später, nicht danach aus, dass es bald in Vergessenheit geraten könnte.
Dieses Heldentum der Freiheit und Furchtlosigkeit, in dem Wagner seinem Siegfried glich, hat den Ring zu dem gemacht, was er ist: die gültige Version der Nibelungensage in der Neuzeit.
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
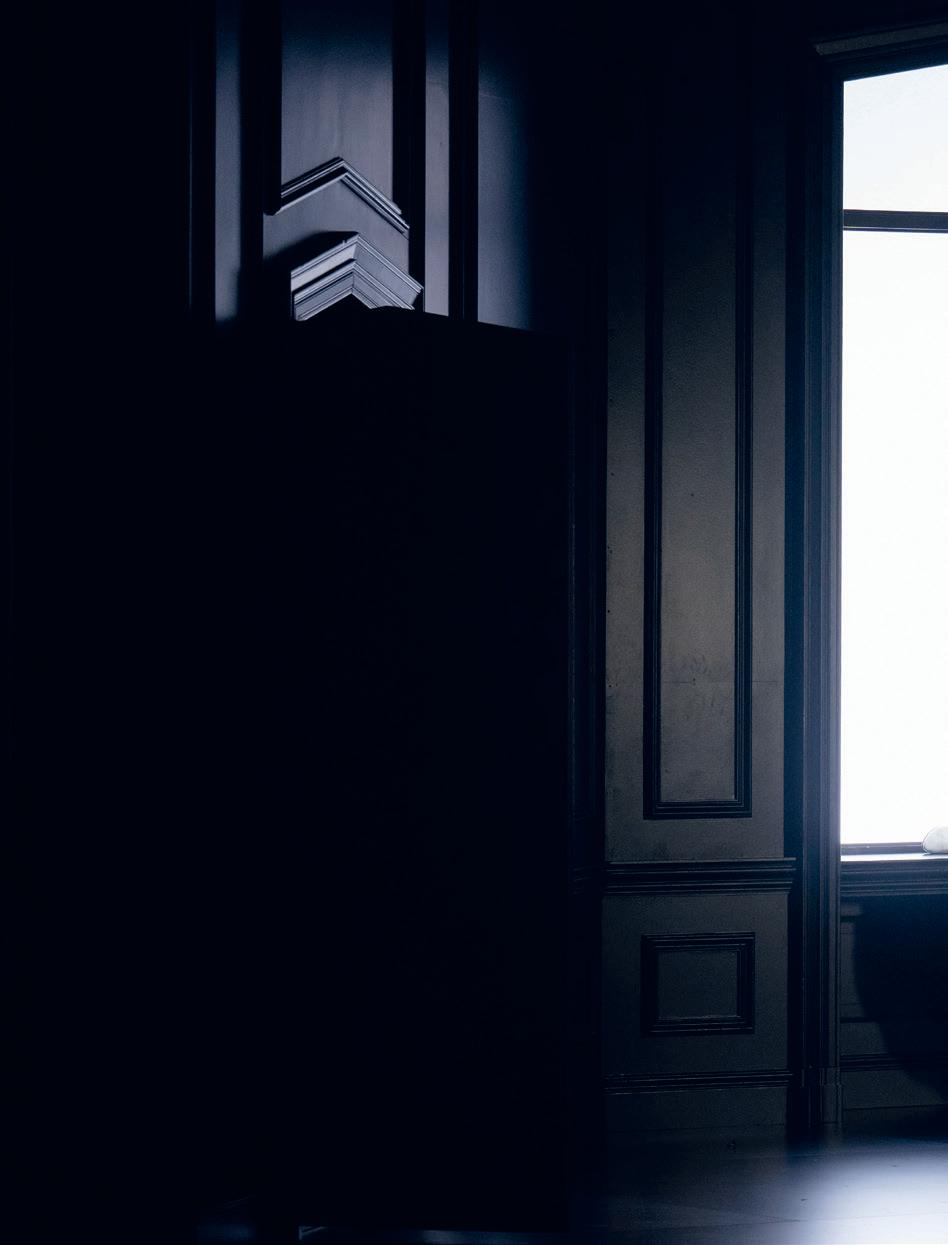






RICHARD WAGNER 1813-1883
Zweiter Tag des Bühnenfestspiels «Der Ring des Nibelungen»
Dichtung von Richard Wagner
Siegfried Tenor
Mime Tenor
Der Wanderer Bass
Alberich Bass
Fafner Bass
Erda Alt
Brünnhilde Sopran
Waldvogel Sopran
Erster Aufzug: Eine Felsenhöhle im Walde
Zweiter Aufzug: Tiefer Wald
Dritter Aufzug: Wilde Gegend am Fusse eines Felsenberges, dann: auf dem Gipfel des «Brünnhildensteines»
Wald.
Den Vordergrund bildet ein Teil einer Felsenhöhle, die sich links tiefer nach innen zieht, nach rechts aber gegen drei Vierteile der Bühne einnimmt. Zwei natürlich gebildete Eingänge stehen dem Walde zu offen: der eine nach rechts, unmittelbar im Hintergrunde, der andere, breitere, ebenda seitwärts. An der Hinterwand, nach links zu, steht ein grosser Schmiedeherd, aus Felsstücken natürlich geformt; künstlich ist nur der grosse Blasebalg: die rohe Esse geht – ebenfalls natürlich – durch das Felsendach hinauf. Ein sehr grosser Amboss und andre Schmiedegerätschaften.
MIME sitzt, als der Vorhang nach einem kurzen Orchestervorspiel aufgeht, am Ambosse und hämmert mit wachsender Unruhe an einem Schwerte. Endlich hält er unmutig ein Zwangvolle Plage! Müh’ ohne Zweck! Das beste Schwert, das je ich geschweisst, in der Riesen Fäusten hielte es fest; doch dem ich’s geschmiedet, der schmähliche Knabe, er knickt und schmeisst es entzwei, als schüf’ ich Kindergeschmeid!
Mime wirft das Schwert unmutig auf den Amboss, stemmt die Arme ein und blickt sinnend zu Boden. Es gibt ein Schwert, das er nicht zerschwänge: Nothungs Trümmer zertrotzt’ er mir nicht, könnt’ ich die starken Stücke schweissen, die meine Kunst nicht zu kitten weiss! Könnt’ ich’s dem Kühnen schmieden, meiner Schmach erlangt’ ich da Lohn! Er sinkt tiefer zurück und neigt sinnend das Haupt. Fafner, der wilde Wurm, lagert im finstren Wald; mit des furchtbaren Leibes Wucht der Niblungen Hort hütet er dort. Siegfrieds kindischer Kraft erläge wohl Fafners Leib, des Niblungen Ring erränge er mir. Nur ein Schwert taugt zu der Tat; nur Nothung nützt meinem Neid, wenn Siegfried sehrend ihn schwingt: und ich kann’s nicht schweissen, Nothung, das Schwert!
Er hat das Schwert wieder zurechtgelegt und hämmert in höchstem Unmut daran weiter. Zwangvolle Plage! Müh’ ohne Zweck! Das beste Schwert, das je ich geschweisst, nie taugt es je zu der einzigen Tat! Ich tappre und hämmre nur, weil der Knabe es heischt. Er knickt und schmeisst es entzwei, und schmäht doch, schmied’ ich ihm nicht! Er lässt den Hammer fallen.
Siegfried, in wilder Waldkleidung, mit einem silbernen Horn an einer Kette, kommt mit jähem Ungestüm aus dem Walde herein; er hat einen grossen Bären mit einem Bastseile gezäumt und treibt diesen mit lustigem Übermute gegen Mime an.
SIEGFRIED
Hoiho! Hoiho! Hau’ ein! Hau’ ein! Friss ihn! Friss ihn! Den Fratzenschmied!
Er lacht unbändig.
Mimen entsinkt vor Schreck das Schwert; er flüchtet hinter den Herd; Siegfried treibt ihm den Bären überall nach.
MIME
Fort mit dem Tier!
Was taugt mir der Bär?
SIEGFRIED
Zu zwei komm ich, dich besser zu zwicken: Brauner, frag’ nach dem Schwert!
MIME
He! Lass das Wild! Dort liegt die Waffe, fertig fegt’ ich sie heut’.
SIEGFRIED
So fährst du heute noch heil!
Er löst dem Bären den Zaum und gibt ihm damit einen Schlag auf den Rücken.
Lauf’, Brauner!
Dich brauch’ ich nicht mehr!
Der Bär läuft in den Wald zurück.
MIME kommt zitternd hinter dem Herde hervor Wohl leid’ ich’s gern, erlegst du Bären. Was bringst du lebend die braunen heim?
SIEGFRIED setzt sich, um sich vom Lachen zu erholen
Nach bessrem Gesellen sucht’ ich, als daheim mir einer sitzt; im tiefen Walde mein Horn
liess ich hallend da ertönen, ob sich froh mir gesellte ein guter Freund, das frug ich mit dem Getön’!
Aus dem Busche kam ein Bär, der hörte mir brummend zu; er gefiel mir besser als du, doch bessre fänd’ ich wohl noch!
Mit dem zähen Baste zäumt’ ich ihn da, dich, Schelm, nach dem Schwerte zu fragen. Er springt auf und geht auf den Amboss zu.
MIME nimmt das Schwert auf, um es Siegfried zu reichen
Ich schuf die Waffe scharf, ihrer Schneide wirst du dich freun.
Er hält das Schwert ängstlich in der Hand fest, das Siegfried ihm heftig entwindet.
SIEGFRIED
Was frommt seine helle Schneide, ist der Stahl nicht hart und fest!
das Schwert mit der Hand prüfend
Hei! Was ist das für müss’ger Tand!
Den schwachen Stift nennst du ein Schwert?
Er zerschlägt es auf dem Amboss, dass die Stücken ringsum fliegen; Mime weicht erschrocken aus.
Da hast du die Stücken, schändlicher Stümper!
Hätt’ ich am Schädel dir sie zerschlagen!
Soll mich der Prahler länger noch prellen?
Schwatzt mir von Riesen und rüstigen Kämpfen, von kühnen Taten und tüchtiger Wehr; will Waffen mir schmieden, Schwerte schaffen; rühmt seine Kunst, als könnt’ er was Rechts.
Nehm’ ich zur Hand nun, was er gehämmert, mit einem Griff zergreif’ ich den Quark!
Wär’ mir nicht schier zu schäbig der Wicht, ich zerschmiedet’ ihn selbst mit seinem Geschmeid, den alten albernen Alp!
Des Ärgers dann hätt’ ich ein End’!
Siegfried wirft sich wütend auf eine Steinbank zur Seite rechts. Mime ist ihm immer vorsichtig ausgewichen.
MIME
Nun tobst du wieder wie toll!
Dein Undank, traun, ist arg!
Mach’ ich dem bösen Buben nicht alles gleich zu best, was ich ihm Gutes schuf, vergisst er gar zu schnell!
Willst du denn nie gedenken, was ich dich lehrt’ vom Danke?
Dem sollst du willig gehorchen, der je sich wohl dir erwies.
Siegfried wendet sich unmutig um, mit dem Gesicht nach der Wand, so dass er Mime den Rücken kehrt.
Das willst du wieder nicht hören!
Er steht verlegen; dann geht er in die Küche zum Herd. Doch speisen magst du wohl?
Vom Spiesse bring’ ich den Braten. Versuchtest du gern den Sud?
Für dich sott ich ihn gar.
Er bietet Siegfried Speise hin; dieser, ohne sich umzuwenden, schmeisst ihm Topf und Braten aus der Hand.
SIEGFRIED
Braten briet ich mir selbst, deinen Sudel sauf’ allein!
MIME stellt sich empfindlich. Mit kläglich kreischender Stimme
Das ist nun der Liebe schlimmer Lohn!
Das der Sorgen schmählicher Sold!
Als zullendes Kind zog ich dich auf, wärmte mit Kleidern den kleinen Wurm, Speise und Trank trug ich dir zu, hütete dich wie die eigne Haut.
Und wie du erwuchsest, wartet’ ich dein; dein Lager schuf ich, dass leicht du schliefst. Dir schmiedet’ ich Tand und ein tönend Horn; dich zu erfreun, müht’ ich mich froh, mit klugem Rate riet ich dir klug, mit lichtem Wissen lehrt’ ich dich Witz. Sitz’ ich daheim in Fleiss und Schweiss, nach Herzenslust schweifst du umher. Für dich nur in Plage, in Pein nur für dich verzehr’ ich mich alter, armer Zwerg! schluchzend
Und aller Lasten ist das nun mein Lohn, dass der hastige Knabe mich quält und hasst!
Siegfried hat sich wieder umgewendet und ruhig in Mimes Blick geforscht. Mime begegnet Siegfrieds Blick und sucht den seinigen scheu zu bergen.
Das komplette Programmbuch können Sie auf
erblindest du nicht?
Wie mein Arm dich presst, entbrennst du mir nicht?
Wie in Strömen mein Blut entgegen dir stürmt, das wilde Feuer, fühlst du es nicht? Fürchtest du, Siegfried, fürchtest du nicht das wild wütende Weib? Sie umfasst ihn heftig.
SIEGFRIED in freudigem Schreck
Ha! Wie des Blutes Ströme sich zünden, wie der Blicke Strahlen sich zehren, Wie die Arme brünstig sich pressen, –kehrt mir zurück mein kühner Mut, und das Fürchten, ach!
Das ich nie gelernt, das Fürchten, das du mich kaum gelehrt: das Fürchten, – mich dünkt –ich Dummer vergass es nun ganz! Er hat bei den letzten Worten Brünnhilde unwillkürlich losgelassen.
BRÜNNHILDE im höchsten Liebesjubel wild auflachend
O kindischer Held!
O herrlicher Knabe!
Du hehrster Taten töriger Hort!
Lachend muss ich dich lieben, lachend will ich erblinden, lachend zugrunde gehn!
Fahr’ hin, Walhalls leuchtende Welt!
Zerfall in Staub deine stolze Burg!
Leb’ wohl, prangende Götterpracht!
End’ in Wonne, du ewig Geschlecht!
Zerreisst, ihr Nornen, das Runenseil!
Götterdämm’rung, dunkle herauf!
Nacht der Vernichtung, neble herein!
Mir strahlt zur Stunde Siegfrieds Stern; er ist mir ewig, ist mir immer, Erb’ und Eigen, ein’ und all’: leuchtende Liebe, lachender Tod!
SIEGFRIED
Lachend erwachst du Wonnige mir: Brünnhilde lebt, Brünnhilde lacht!
Heil dem Tage, der uns umleuchtet!
Heil der Sonne, die uns bescheint!
Heil der Welt, der Brünnhilde lebt!
Sie wacht, sie lebt, sie lacht mir entgegen.
Prangend strahlt mir Brünnhildes Stern! Sie ist mir ewig, ist mir immer, Erb’ und Eigen, ein’ und all’: leuchtende Liebe, lachender Tod!
Brünnhilde stürzt sich in Siegfrieds Arme. Der Vorhang fällt.
Programmheft
SIEGFRIED
Richard Wagner 1813-1883
Zweiter Tag des Bühnenfestspiels «Der Ring des Nibelungen»
Premiere am 5. März 2023, Spielzeit 2022 / 23
Herausgeber Opernhaus Zürich Intendant Andreas Homoki
Zusammenstellung, Redaktion Beate Breidenbach, Werner Hintze
Layout, Grafische Gestaltung Carole Bolli
Titelseite Visual François Berthoud Anzeigenverkauf Opernhaus Zürich, Marketing Telefon 044 268 66 33, inserate@opernhaus.ch
Schriftkonzept und Logo Studio Geissbühler
Druck Fineprint AG
Textnachweise:
Die Handlungserzählung, die Gespräche mit Andreas Homoki und Gianandrea Noseda sowie der Essay von Hans Rudolf Vaget sind Originalbeiträge für dieses Programmheft. – Torsten Meiwald, Der Held und sein Schwert. In: ders., Randbemerkungen zu Richard Wagners «Ring des Nibelungen». Westerstede 2015. – Hans Rudolf Vaget (Hrsg.): Im Schatten Wagners. Thomas Mann über Richard Wagner. Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch Verlag 2010. – Richard Wagner: Dichtungen und Schriften. Jubiläumsausgabe in 10 Bänden. Frankfurt/M., Insel Verlag 1976.
Bildnachweise:
Monika Rittershaus fotografierte die Klavierhauptprobe am 21. und 22. Februar 2023.
Urheber, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.
Die Werkeinführungen der Dramaturgie sind auch online und mobil auf jedem Smartphone abrufbar.
Unsere Vorstellungen werden ermöglicht dank der Subvention des Kantons Zürich sowie den Beiträgen der Kantone Luzern, Uri, Zug und Aargau im Rahmen der interkantonalen Kulturlastenvereinbarung und den Kantonen Nidwalden, Obwalden und Schwyz.
PRODUKTIONSSPONSOREN
AMAG
Atto primo
Clariant Foundation
Freunde der Oper Zürich
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
PROJEKTSPONSOREN
René und Susanne Braginsky-Stiftung
Freunde des Balletts Zürich
Ernst Göhner Stiftung
Hans Imholz-Stiftung
Max Kohler Stiftung
Kühne-Stiftung
Marion Mathys Stiftung
Ringier AG
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stiftung
Hans und Edith Sulzer-Oravecz-Stiftung
Swiss Life
Swiss Re
Zürcher Kantonalbank
GÖNNERINNEN UND GÖNNER
Josef und Pirkko Ackermann
Alfons’ Blumenmarkt
Familie Thomas Bär
Bergos Privatbank
Margot Bodmer
Maximilian Eisen, Baar
Elektro Compagnoni AG
Stiftung Melinda Esterházy de Galantha
Fitnessparks Migros Zürich
Egon-und-Ingrid-Hug-Stiftung
Walter B. Kielholz Stiftung
KPMG AG
Landis & Gyr Stiftung
Fondation Les Mûrons
Neue Zürcher Zeitung AG
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
StockArt – Stiftung für Musik
Else von Sick Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Elisabeth Weber-Stiftung
FÖRDERINNEN UND FÖRDERER
Theodor und Constantin Davidoff Stiftung
Dr. Samuel Ehrhardt
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Garmin Switzerland
Stiftung Lyra zur Förderung hochbegabter, junger Musiker und Musikerinnen
Irith Rappaport
Richards Foundation
Luzius R. Sprüngli
Madlen und Thomas von Stockar
