Zeitung Neudeker Heimatbrief

Sudetendeutscher
2023
Heimat in Bildern: Der Sudetendeutsche Kalender 2023 spiegelt in 25 großartigen Fotos die Schönheit Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens wider.
Der einzigartige Kalender erscheint in etwa einem Monat. Abonnenten der Sudetendeutschen Zeitung, Amtsträger oder Spender der Sudetendeutschen Landsmannschaft erhalten den Kalender Ende November per Post zugeschickt.
Weitere Exemplare können ab sofort bei der Sudetendeutschen Landesmannschaft Bundesverband bestellt werden, und zwar per eMail an info@ sudeten.de oder telefonisch unter der Nummer (0 89)48 00 03 70.



Der Kalender-Sendung wird dann ein Spendenüberweisungsträger zur freundlichen Beachtung beigelegt.
Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Landsleute mit ihren wunderschönen und eindrucksvollen Bildern zum Gelingen des Kalenders beigetragen.
Die Fotografen des Sudetendeutschen Kalenders 2023 sind: Ralph Toman, Tomáš Brdička, Marianne Kaehler, Felix Meyer, Miroslav Václavek, David Stašek, Sven Müller, Gabriele Müller, Leonhard Niederwimmer, Manfred Gischler, Gottfried Herbig, Karl Lukas, Martin Minarik, Ulrich Möckel, Sebastian Weise, Klaus Svojanovsky und Johannes Schimpfhauser.

Das Duell der Agenten wider Willen –Schlammschlacht ums Präsidentenamt
❯ Oberbürgermeisterin Erstmals regiert eine Frau Budweis
Mit 23 von 43 Stimmen ist Dagmar Škodová Parmová von der ODS am Montag zur ersten Oberbürgermeisterin in der Geschichte von Budweis gewählt worden. Parmová führt eine Koalition aus ODS, Piraten und zwei lokalen Wählerinitiativen an und löst Jiří Svoboda (Ano) ab, der acht Jahre lang an der Spitze der Stadt gestanden hat.

Nach ihrer Wahl sagte Parmová: „Es ist eine große Freude, aber auch eine große Verantwortung. Wir werden es nicht leicht haben, wir werden mit der hohen Inflation und der Energiekrise zu kämpfen haben. Ich hoffe, daß wir die Stadt gemeinsam durch diese Zeit führen und eine Metropole des 21. Jahrhunderts aufbauen werden.“
Seit 2019 ist die Mutter von drei Kindern Dekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Budweis.
Nach ihrer Matura in Österreich hatte sie in Budweis Betriebswirtschaft studiert und anschließend an der Universität in Linz promoviert. Parmová: ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gremien an verschiedenen Universitäten. Im Jahr 2012 erhielt sie eine außerordentliche Professur für Wirtschaft und Management.
Der eine, Andrej Babiš, wurde als inoffizieller Mitarbeiter vom tschechischen Geheimdienst StB geführt, der andere, Petr Pavel, nahm an einem Lehrgang des Militärgeheimdienstes teil. Im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs sagen beiden, sie seien keine Agenten der kommunistischen Regierung gewesen, während ihre politischen Unterstützer genau das vom jeweiligen Gegner behaupten. Das Duell der Agenten wider Willen wird zur Schlammschlacht um die Nachfolge von Staatsoberhaupt Miloš Zeman.
Bis zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe war es noch offen, ob Babiš überhaupt bei der Präsidentschaftswahl antreten wird. Der ehemalige Premierminister hatte noch vor Monaten die Umfragen mit großem Vorsprung angeführt, aber da er seit Herbst wegen des Vorwurfs des Subventionsbetrugs vor Gericht steht, geht es für den Multi-Milliardär rapide bergab. Mittlerweile ist General Petr Pavel der haushohe Favorit.
❯
Babiš läßt dennoch nichts unversucht, seinen möglichen Kontrahenten ins schlechte Licht zu stellen. So teilte der ehemalige Regierungschef einen Beitrag, der sich mit Pavels Vergangenheit beschäftigt. In dem Beitrag wird ein ehemaliger Lehrgangskamerad zitiert, der aussagt, Petr Pavel sei mit ihm „an der Eliteschule für Geheimdienstler“ gewesen. Dort hätte man sie „zu Agenten in einem diplomatischen Umfeld ausgebildet, d. h. im Volksmund zu Spionen, die in demokratischen Ländern unter dem Deckmantel der Diplomatie

operieren“. Pavel selbst behauptet dagegen, er sei Fallschirmjägeraufklärer gewesen. Er habe zwar an einem Lehrgang teilgenommen, doch dort habe er vor allem Französisch gelernt. Der Kurs habe 1988 stattgefunden, also ein Jahr vor der Samtenen Revolution.
In den Sozialen Medien konterten Pavels Unterstützer mit der Karteikarte, die Babiš als StB-Agenten ausweist. Der ExRegierungschef hat dagegen immer wieder bestritten, sich gegenüber dem StB verpflichtet zu haben. „Es ist alles eine Lüge“,
konterte Babiš und erklärte: „Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, daß ich die Zusammenarbeit unterzeichnet habe – und das kann es auch gar nicht geben. Es gibt keine Beweise dafür, daß ich jemanden verraten habe – und das kann auch nicht sein. Deshalb habe ich logischerweise alle Prozesse gewonnen, deshalb haben alle Gerichte logischerweise festgestellt, daß der StB mich ohne mein Wissen registriert hat.“
Belegt ist, daß die Karriere von Petr Pavel bereits unter der kommunistischen Diktatur begann. Pavel war sogar selbst Mitglied der Kommunistischen Partei, was er heute als „Fehler“ bezeichnet. Er habe aber nie, so sagt Pavel, mit dem StB oder der ihm unterstellten militärischen Spionageabwehr zusammengearbeitet.
Fakt ist, daß Pavel später mehrere Nato- und UN-Verwendungen hatte und am 25. Juni 2015 zum 31. Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses befördert wurde – als erster General eines ehemaligen Warschauer-PaktStaates. Diese beispiellose Karriere wäre bereits im Ansatz ge-
scheitert, wenn bei den obligatorisch vorgeschriebenen und intensiven Sicherheitsüberprüfungen, bei der auch Zeitzeugen und Weggefährten befragt werden, Zweifel an Pavels Haltung oder Vergangenheit bestanden hätten.
Das zur Regierungskoalition gehörende Wahlbündnis Spolu aus ODS, KDU-ČSL und Top 09 hat mittlerweile entschieden, bei der Präsidentschaftswahl ein Trio zu unterstützen, und zwar Senator Pavel Fischer, Danuša Nerudová und Petr Pavel.
In der aktuellen Wahlumfrage liegt General Pavel mit 24 Prozent vor Babiš, der auf 23,5 Prozent der Stimmen käme. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Nerudová erreicht mit 10 Prozent Platz drei, gefolgt von Pavel Fischer mit 8 Prozent. Allerdings: 44 Prozent der Wähler gaben an, noch keinen Favoriten zu haben.
Der erste Wahlgang findet am 13. und 14. Januar 2023 statt, eine eventuelle notwendige Stichwahl am 27. und 28. Januar.
 Torsten Fricke
Torsten Fricke
SL-Landesgruppe Bayern Zwei Amtsenthebungen nach Spaltungsversuch
„Das Bestreben mit dem neu gegründeten Verein die Volksgruppe zu spalten, ist offensichtlich“, hat SL-Landesobmann Bayern, Steffen Hörtler, festgestellt, nachdem zwei Amtsträger einen eigenen Sudetendeutschen Landesverband Bayern gegründet hatten. Die klare Konsequenz: Die Betroffenen wurden ihrer Ämter enthoben.
Die Vorgeschichte: Bereits im März 2021 hatten die beiden Amtsträger der SL-Landes-
gruppe Bayern und weitere Personen einen Verein namens „Sudetendeutscher Landesverband Bayern e.V.“ gegründet. Die Satzung wurde in weiten Teilen dekkungsgleich von den Satzungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband e.V., als auch von der Landesgruppe Bayern e.V. übernommen.
Als im September 2022 die Sache publik wurde, reagierte die Sudetendeutsche Landsmannschaft, die seit ihrer Gründung vor über 70 Jahren die Sudetendeutsche Volksgruppe reprä-
sentiert, umgehend und konsequent.
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft stellte in einer Sondersitzung am 6. Oktober 2022 einstimmig fest, daß die Mitgliedschaft und Amtsträgerschaft in beiden Organisationen unvereinbar ist.
Der Landesvorstand Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft beschloß daraufhin in seiner Sitzung am 19. Oktober, die beiden betreffenden Personen ihrer SL-Ämter in den Bezirksgruppen Oberbayern und
Schwaben mit sofortiger Wirkung zu entheben.
Die Arbeit der Bezirksgruppe Oberbayern wird ab sofort von den Stellvertretenden Bezirksobleuten Dr. Marc Stegherr und Bernhard Lerner weitergeführt. Und für die Bezirksgruppe Schwaben übernehmen die Stellvertreter Kurt Aue und Dr. Thomas Jahn Verantwortung.


Nach der klaren Entscheidung blickt die SL-Landesgruppe Bayern jetzt wieder nach vorne.
Landesobmann Steffen Hörtler: „Wir stellen uns den Heraus-


forderungen. Die Landesgruppe Bayern befindet sich derzeit in einem Reformprozeß, um unsere Arbeit zum Wohl der Volksgruppe auch in Zukunft erfolgreich leisten zu können. Diese Zukunftsaufgaben wollen wir gemeinsam mit unseren Landsleuten bewältigen. Der Landesvorstand ist sich seiner großen Verantwortung dafür bewußt.“
Der Landesvorstand hat deshalb alle Orts- und Kreisvorsitzenden der Bezirke Oberbayern und Schwaben zu einem Meinungsaustausch eingeladen.

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Die Vergangenheit läßt sich manchmal verstecken oder, wie man sagt, „unter den Teppich kehren“. Oft taucht sie jedoch wieder auf, wie jetzt bei den Renovierungsarbeiten im Prager Stadtviertel Holeschowitz, wo vor dem Zweiten Weltkrieg bis zur nachfolgenden Vertreibung sehr viele Deutsche gelebt hatten.
Es stimmt zwar, daß es in der Hauptstadt üblich war, nach tschechischen Inschriften auch deutsche hinzuzufügen, aber bereits nach der Entstehung der Ersten tschechoslowakischen Republik ließ diese Regelung nach. So verschwand das deutsche
Element langsam aus den Prager Straßen und war nur ab und zu noch sichtbar.
Bei der Renovierung eines Hauses an der Ecke Bubner Straße (Bubenská) und Messestraße (Veletržní) in Prag, entdeckte SL-Büroleiter Peter Barton die Reste einer deutschen Gasthausreklame mit den Worten „Vorzüglich“ und „Bierausschank“.
Das Gasthaus gibt es seit langem nicht mehr, und bald werden vielleicht auch diese Worte von der Fassade des Hauses verschwinden. Deshalb hat unser Fotograf diese Spuren der Vergangenheit mit seiner Kamera eingefangen und sie so für unsere Leser bewahrt.
In ihrem Amt als neue Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München hat Ivana Červenková erstmals zum Empfang anläßlich des Tschechischen Staatsfeiertages eingeladen. Die Bayerische Staatsregierung wurde hochrangig vonMelanie Huml, Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, vertreten. Und aus Prag reiste der tschechische Vize-Außenminister Martin Smolek an die Isar.

Gastgeberin Červenková hob bei dem festlichen Zusammentreffen in der Hanns-Seidel-Stiftung das hervorragende Niveau der tschechisch-bayerischen Beziehungen hervor und dankte allen Institutionen, die sich im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit engagieren.
Anschließend stellte Vizeaußenminister Smolek die Prioritäten der Tschechischen EU-Ratspräsidentschaft vor. Zuvor hatten sich Smolek und Huml zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Hauptthemen waren dabei die Migration und die Unterstützung der Ukraine.
In ihrer Rede hob Staatsministerin Huml die gute Nachbarschaft hervor. „Wir in Bayern sind sehr stolz auf unsere lang-
jährigen und guten Beziehungen mit Tschechien. Tschechien und Bayern sind in den letzten Jahrzehnten eng zusammengewachsen. Wir sehen einen gemeinsamen Wirtschafts- und Kulturraum im Herzen Europas.“
Dabei verwies die Ministerin auf den Vorschlag, den der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Besuch in Prag dem tschechischen Premierminister Petr Fiala unterbreitetet hatte. Demnach solle eine Bayerisch-Tschechische Nachbarschaftsstrategie die Basis für eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr und Dateninfrastruktur, Wirtschaft, Umweltund Naturschutz, Grenzraum, Sprache und Jugend bilden.



Melanie Huml: „Erst vor drei Wochen war ich selbst in Prag zu Gast, um den Tag der Deutschen Einheit und die bayerischtschechische Freundschaft zu feiern. Mit dem tschechischen Außenminister Jan Lipavsky habe ich mich dabei über Ideen für die Zusammenarbeit der Zukunft zwischen unseren Ländern, insbesondere im gemeinsamen Grenzgebiet, ausgetauscht. Ich freue mich sehr, daß Bayern und Tschechien die Wissenschaftskooperationen weiter vertiefen – beispielsweise in den wichtigen Bereichen Supercompu-
ting, Nanotechnologie und 5GAusbau – und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und in der Inneren Sicherheit ausbauen. Auch auf Kabinettsebene gab es in diesem Jahr einen regen Austausch zwischen bayerischen Kabinettsmitgliedern und ihren Amtskollegen.“
Tschechien, so Ministerin Huml weiter, sei ein starker Partner in der Europäischen Union. Unter der tschechischen Ratspräsidentschaft habe es sehr schnell Maßnahmen zu Gaseinsparung und Strompreisen gegeben. Au-



ßerdem habe sich die Tschechische Regierung auf die Agenda geschrieben, die Resilienz demokratischer Institutionen zu stärken, also für Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Medienfreiheit einzutreten.
Huml: „Desinformationen, Haßrede und gezielte Einflußnahme Dritter auf unser demokratisches System müssen wir gemeinsam unterbinden. Die Menschen in Europa, Bayern und Tschechien gehen den Weg für ein starkes Europa gemeinsam.“ Torsten Fricke
Das Festabzeichen für Regensburg
Unter dem Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“ steht der 73. Sudetendeutsche Tag, der von Freitag, 26. Mai bis Pfingstsonntag, 28. Mai 2023 in Regensburg stattfindet. Das aktuelle Festabzeichen wurde jetzt veröffentlicht.



Erster Höhepunkt des 73. Sudetendeutschen Tages wird wieder die festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sein. Ebenfalls feste Programmpunkte des großen Tref-
fens der Landsleute sind die Verleihung des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen sowie der Volkstumsabend am Pfingstsamstag und die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe und des Bayerischen Ministerpräsidenten, Schirmherr der Sudetendeutschen, bei der Hauptkundgebung am Pfingstsonntag sowie der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest.
Unter dem Motto „Ja zur Heimat im Herzen Europas“ war Re-
gensburg bereits 2019 Gastgeberstadt des Sudetendeutschen Tags. Der erste Sudetendeutsche Tag hat 1950 in Kempten stattgefunden. 1959 fand dann erstmals ein Sudetendeutscher Tag in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Am häufigsten Gastgeberstadt war Nürnberg, wo bislang 24 Sudetendeutsche Tage ausgetragen wurden. München, der Sitz der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundesverband, war bislang 14 Mal Veranstaltungsort.
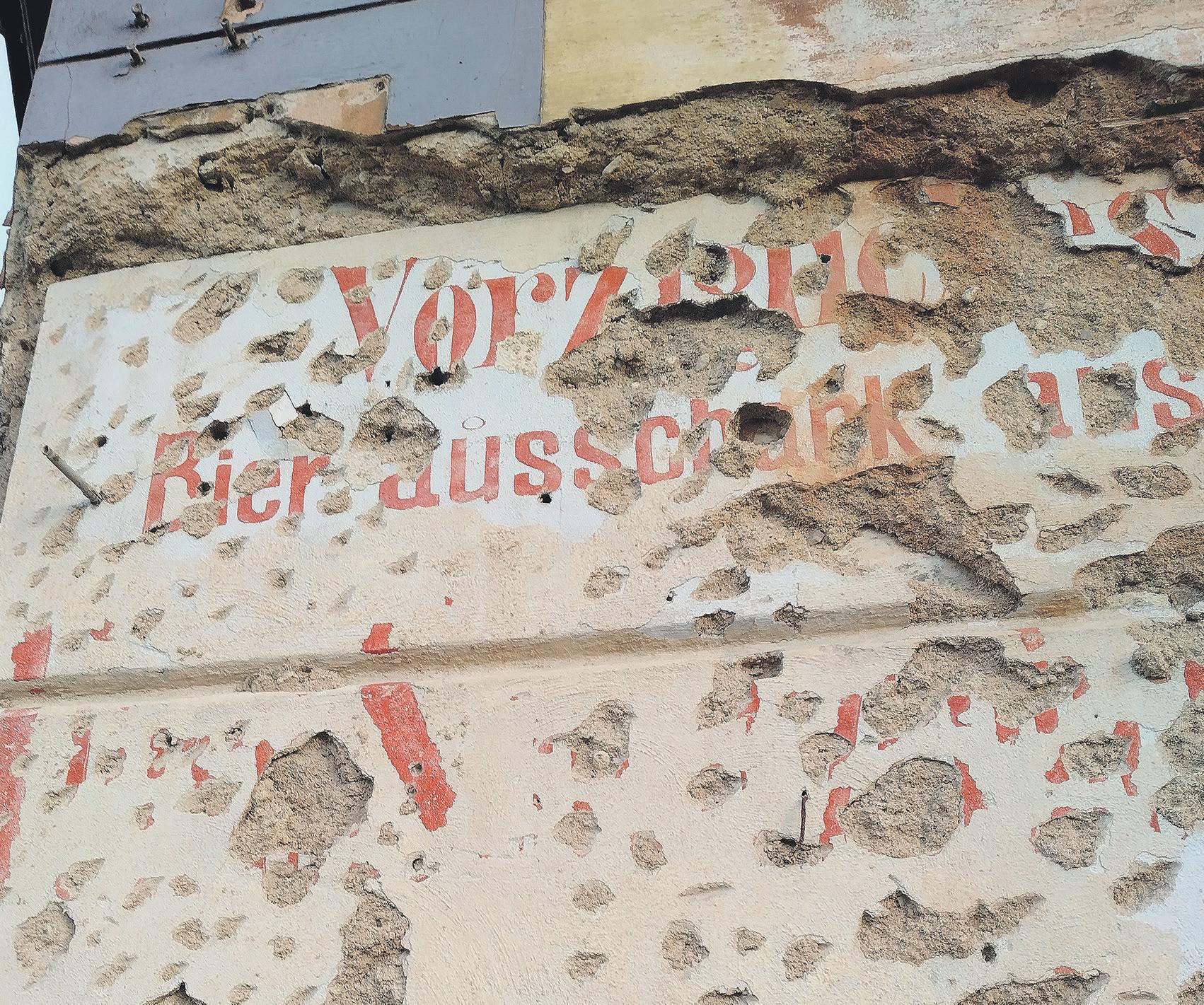 PRAGER SPITZEN
PRAGER SPITZEN
Neuer Nachtzug von Prag nach Zürich Mit dem Fahrplanwechsel bringen die Tschechischen Bahnen (České dráhy, ČD) den neuen EuroCity „Canopus“ auf die Schiene. Der Nachtzug fährt von Prag über Dresden, Leipzig, Frankfurt, Karlsruhe, Freiburg und Basel nach Zürich beziehungsweise in die andere Richtung. „Das Interesse an der Fahrt mit Nachtzügen erlebt innerhalb Europas eine gewisse Renaissance“, begründet ČD-Vorstandsmitglied Jiří Ješeta und verweist auf die bereits bestehende Nachtlinie von Prag über Linz und Innsbruck nach Zürich, die regelmäßig ausgebucht ist. Für die neue Strekke über Deutschland setzen die Tschechischen Bahnen ihre modernsten Schlafwagen ein, die Liegewagen stellt hingegen die schweizerische SBB.
Hertschawa muß erneut wählen
Die Kommunalwahlen von Ende September müssen in der ostmährischen Gemeinde Hertschawa wiederholt werden, hat das Kreisgericht in Ostrau am Dienstag entschieden. Dem Urteil nach wurde das Wahlergebnis durch die gezielte Ansiedlung neuer Einwohner in der 243-Seelen-Gemeinde beeinflußt. Kurz vor dem Urnengang meldeten mehrere Personen ihren dauerhaften Wohnsitz in zwei Immobilien an, die dem Bürgermeister Marek Sikora (Pro Hertschawa) gehören. Eine davon gilt als unbewohnbar. Zuvor hatte ein Gericht bereits für die Erzgebirgsgemeinde Moldau eine Wahlwiederholung angeordnet. In dem 272-Einwohner-Ort hatte zunächst die rechtsradikale SPD gewonnen. Unter den Wahlberechtigten waren aber 46 Bürger, die zuvor aus dem Wählerverzeichnis gestrichen worden waren, da sie nicht in der Gemeinde leben.
Corona-Lage hat sich weiter entspannt
Harte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, wie zuletzt vor einem Jahr, wird es nach den Worten von Gesundheitsminister Vlastimil Válek (Top 09) in diesem Winter nicht mehr geben. Die Lage habe sich entspannt, da neue Impfstoffe sowie Medikamente zur Verfügung stünden und die aktuellen Virusvarian-
ten sich anders auf die Gesundheit auswirkten, so der Minister. Die Ausrufung des Notstandes oder flächendeckende Schutzmaßnahmen seien daher nicht geplant, sagte Válek am Dienstag vor Journalisten. Das tschechische Pandemiegesetz läuft im Dezember aus. Zur Epidemiebekämpfung sollen künftig das Staatliche Gesundheitsinstitut (SZÚ) sowie die Kreisgesundheitsämter über lokale Maßnahmen entscheiden. Bis Jahresende wolle er eine Gesetzesnovelle vorlegen, die solche Anordnungen von der Notwendigkeit eines Pandemiegesetzes befreie, kündigte Válek an.
Klage gegen Tagebau-Abkommen
G
reenpeace Tschechien hat gemeinsam mit dem Bund Sachsen und dem tschechischen Verein Sousedský spolek Uhelná bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde zum tschechisch-polnischen Abkommen über den Tagebau Turów eingereicht. Der Vertrag, der den Weiterbetrieb der polnischen Kohlegrube sowie den Schadensersatz für Tschechien regelt, halte keine Lösung für die negativen Folgen bereit, hieß es am Dienstag in einer Presseerklärung. Nach Ansicht der Beschwerdeführer würden aber weiterhin Umweltschäden entstehen, wegen des Abkommens sei allerdings keine Klage beim EU-Gerichtshof möglich. Wie in der Sudetendeutschen Zeitung mehrfach berichtet, soll der polnische Tagebau Turów noch bis 2044 in Betrieb bleiben. Anliegergemeinden auf der tschechischen Seite beklagen Grundwasserschwund, Lärm und Staubbelastung. Den bilateralen Vertrag hatten die Premierminister Tschechiens und Polens am 3. Februar dieses Jahres unterschrieben. Polen zahlte daraufhin 45 Millionen Euro Schadensersatz, und Tschechien zog seine Klage beim EU-Gerichtshof zurück.
Renovierung abgeschlossen
In Hostau ist seit Sonntag nach einer Sanierung die St. JudasThaddäus-Kapelle wieder geöffnet. Vor sieben Jahren, als mit der Instandsetzung begonnen wurde, sah der Sakralbau wie eine Ruine aus. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Kapelle betrugen elf Millionen Kronen (440 000 Euro).
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Sudetendeutsche Akzente in Wien
Bei einer viertägigen politischen Rundreise durch Mitteleuropa, die Volksgruppensprecher Bernd Posselt nach Wien, in die Slowakei, nach Ungarn und nach Kroatien führte, gelang es ihm, auch wichtige deutschtschechische und sudetendeutsche Akzente zu setzen. In Wien traf Posselt, der von seiner politischen Assistentin, Stephanie Waldburg, und dem Bundesgeschäftsführer der PaneuropaUnion Deutschland, Johannes Kijas, begleitet wurde, mit dem neuen tschechischen Botschafter in Österreich, Jiří Šitler, zusammen, den er seit Jahrzehnten kennt. Šitler hatte entscheidenden Anteil am Aufbau des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds Ende der 1990er Jahre sowie an der Gründung des Gesprächsforums, dem der jetzige Volksgruppensprecher von Anfang an angehört.
Im Tschechischen Zentrum, das in der Wiener Herrengasse zwischen dem Palais Harrach und dem Palais Kinsky gelegen ist – benannt nach zwei der bedeutendsten Familien der böhmischen Geschichte –, führte Posselt Gespräche mit dessen Leiter, Mojmír Jeřábek, der sich schon beim Sturz des Kommunismus in der Brünner Freiheitsbewegung engagierte, dort zum engsten Umfeld des jetzigen tschechischen Premierministers Petr Fiala gehörte und als internationaler Beauftragter der Stadt Brünn einen wichtigen Anteil an der Entstehung des Brünner Versöhnungsmarsches hatte.
Im Dezember wird Jeřábek nach fünf Jahren in Wien nach Brünn zurückkehren, wo sich seine Frau, die den Vorsitz des Begegnungszentrums in der alten mährischen Landeshauptstadt innehat, um literarische Nachlässe, wie den des Dichters und Diplomaten Jiří Gruša, kümmert.
Posselt besichtigte bei seinem Besuch im Tschechischen Zentrum in Wien die dort jetzt eröffnete Patočka-Ausstellung.
Der tschechische Philosoph Jan Patočka gab in der Zwischenkriegszeit eine der bedeutendsten philosophischen Zeitschriften in deutscher Sprache heraus und war in Freiburg als Kollege von Edith Stein Assistent am Lehrstuhl des aus dem mährischen Proßnitz stammenden Begründers der Phänomenologie, Edmund Husserl.
Die Schlesierin Edith Stein wurde als Nonne mit jüdischen Wurzeln von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet und von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen. Sie ist eine der drei Patroninnen Europas.
Der im nordböhmischen Turnau geborene Jan Patočka fiel den Kommunisten zum Opfer, als er 1977 die tschechoslowakische Charta-Bewegung gründete und von der Geheimpolizei bei einem Verhör förmlich zu Brei geschlagen wurde. Er war der Lehrer des jungen Václav Havel und hat diesen geistig wie kein zweiter geprägt.
Posselts Besuch sollte die überragende Persönlichkeit Patočkas, eines Vorkämpfers der deutsch-tschechischen Verstän-
❯ Prof. Dr. Peter Michael Huber hält Festrede





Festakt
70 Jahre Heiligenhof
Diese Festrede dürfte für große Aufmerksamkeit sorgen: Unter dem Titel „Die Europäische Union ist für die Menschen da“ wird Prof. Dr. Peter Michael Huber, dessen Amtszeit als Richter am Bundesverfassungsgericht dieser Tage zu Ende geht, am 18. November auf dem Heiligenhof sprechen. Anlaß ist das 70jährige Jubiläum der sudetendeutschen Bildungs- und Begegnungsstätte sowie das zwanzigjährige Bestehen der Akademie Mitteleuropa e.V.
Professor Huber ist einer der renommiertesten und versiertesten Staatsrechtler in Deutschland und ein Verfechter der direkten Demokratie. Seit 2010 ist der gebürtige Münchner Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sowie seit 2002 Professor am hochgeschätzten Juristischen Lehrstuhl der Ludwig-Maximilians-Universität. Von November 2009 bis zu seinem Wechsel nach Karlsruhe war der 63jährige Innenminister in Thüringen. Außerdem ist er Vorsitzender des Kuratoriums der Akademie Mitteleuropa, was die Verbindung zum Heiligenhof erklärt, Mitglied von CDU und CSU sowie Reserveoffizier bei den Gebirgsjägern.
In einem aktuellen Portrait würdigte die Frankfurter Allgemeine Zeitung Prof. Huber als „Wächter der Demokratie“ und schrieb: „Die Erosionstendenzen sieht er nicht nur in demo-
kratischer Hinsicht, sondern auch im Föderalismus und mit Blick auf den Rechtsstaat. Wer ihm ein antiquiertes Verständnis von Verfassungsprinzipien vorwirft, muß mit einer scharfzüngigen Antwort rechnen. Wenn etwa die Regierung alles äußern dürfe, wie manche meinen, ist aus Hubers Sicht der Weg zu Putin nicht mehr weit.“
Der Titel des Festvortrags, den Huber auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen hält, läßt vermuten, daß er ein Resümee seiner zu diesem Zeitpunkt zu Ende gegangenen Tätigkeit als Bundesverfassungsrichter ziehen wird.
Der Zweite Senat, dem Huber angehörte, ist im Wesentlichen zuständig für Organstreitverfahren, für Bund-Länder-Streitigkeiten, für Parteiverbotsverfahren und für Wahlbeschwerden. Damit mußte Huber auch in vielen wichtigen Europa-Fragen mitentscheiden. So war Huber Berichterstatter im Verfahren zur verfassungsrechtlichen Überprüfung des Euro-Rettungsfonds ESM und beim Public Sector Purchase Programme.
Auch privat ist Huber der Juristerei verbunden. Seine Frau ist Richterin am Bundespatentgericht in München. Das Paar hat zwei Töchter.

digung wie auch der Freiheitsbewegung gegen den totalitären Kommunismus, würdigen.
Anschließend stand eine Besichtigung des Wiener Böhmerwald-Museums auf dem Programm, das mit einer Sonderausstellung sein 70jähriges Bestehen feiert. Es befindet sich in der Ungargasse 3, direkt neben dem Haus, in dem Ludwig van Beethoven die 9. Symphonie und damit die heutige Europahymne komponiert hatte.
Die in mehreren Generationen liebevoll aufgebaute Sammlung wird heute vom Leiter dieses faszinierenden Museums, Gernot Peter, sowie vom Vorsitzenden des dortigen Böhmerwaldbundes, Franz Kreuss, betreut. Die beiden empfingen Posselt und seine Delegation herzlich und berichteten über die Fortschritte in der Zusammenarbeit zwischen den heimatvertriebenen Böhmerwäldlern und der tschechischen Seite. Dazu gehört die neue Schulpartnerschaft zwischen dem Ingolstädter Katharinengymnasium, das das Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Stadtrat Matthias Schickel, leitet, und der entsprechenden Einrichtung im südböhmischen Prachatitz.

Gernot Peter erläuterte den Gästen, daß sein einzigartiges Museum auf eine Privatinitiative zurückgeht und bis heute aus eigenen Mitteln der Böhmerwäldler erhalten wird. Es solle bewußt immer nur schrittweise ergänzt und nicht grundlegend erneuert werden, da es so etwas wie das „Museum eines Museums“


sei. Mit der Zeit haben sich dort auch Exponate aus anderen Heimatlandschaften eingefunden. Besonders sehenswert sind Gegenstände und Schriftstücke aus dem Besitz des früheren Wiener Kardinals Theodor Innitzer, der aus Neugeschrei im böhmischen Erzgebirge stammte; sie wurden
vor nicht allzu langer Zeit von seiner Verwandtschaft zur Verfügung gestellt.
Weitere Höhepunkte der Reise waren Begegnungen mit der Abgeordneten im Slowakischen Parlament sowie in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Anna Záborská, aus
dem von Karpatendeutschen geprägten Hauerland, mit Anna Grünwald aus der so genannten Schwäbischen Türkei, dem südungarischen Fünfkirchen sowie mit Delegationen aus fast allen Balkanländern und dem kroatischen Außenminister Gordan Grlić Radman.


Erwachsene
Sonderausstellung „Allerley kunststück. Reliefintarsien aus Eger“ mit dem Künstler Clemens Söllner



Im Workshop nähern wir uns unter fachlicher
einen Einblick
die vielfältigen
Handwerks durch das Ausprobieren
Holzeinlegearbeit


folgende
vermitteln.

Drei Seminare, ein Themenkreis: Krieg, Flucht und Vertreibung
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet auch die politische Bildungsarbeit und rückt die Folgen von Flucht und Vertreibung wieder in den Fokus. Auf dem Heiligenhof beschäftigen sich gleich drei Seminare mit dem Themenkreis.
Von Sonntag, 30. Oktober bis Freitag, 4. November lädt die Akademie Mitteleuropa Studierende aus Deutschland und Ostmitteleuropa zu einer „Mitteleuropäischen Begegnung im Krieg“ ein.
Als Referenten zugesagt haben Dr. Yuliya Kazhan („Meine Flucht aus Mariupol nach vier Wochen der Hölle“), Oberst i.G. a.D. Herbert Danzer („Von Jelzin zu Putin – Meine Jahre an der Russischen Militärakademie und als Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Moskau“), Prof. Dr. Matthias Stickler („Anmerkungen zu den historischen Hintergründen des russischen Überfalls auf die Ukraine“), Oberstleutnant a.D. d. R. Ulrich Feldmann („Multiple Krisen in Europa und der Welt“), Prof. Dr. Vita Hamaniuk („Europäische
■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin, Bundeskulturtagung mit Exkursion ins Egerland Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz. Anmeldung unter eMail jobst@ egerlaender.de
■ Samstag, 29. Oktober, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de
■ Donnerstag, 3. November, 9.30 bis 15.00 Uhr, Museumspädagogik: „Kinderferientag für Kinder ab 6 Jahren“. Holzcollagen gestalten mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Freitag, 4. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler
Werte und ukrainische Unabhängigkeit“), Ass. Prof. Dr. Olena Biletska („Universität im Exil“), Dr. Roxana Stoenescu („Geopolitik Rußlands – Am Fallbeispiel des Ukrainekrieges“), Dr. Lenka Matusková („Auf den Spuren der tschechischen Widerstandsgruppe Silver A 80 Jahre nach dem Heydrich-Attentat“), Ph.D. Jindra Dubová („Die Aussöhnung von Deutschen und Tschechen anhand zeitgenössischer Literatur“) und Dr. Jan Čapek („Das Bild der Slaven in deutschen und
in tschechischen Lehrbüchern“).
Das Format der „Mitteleuropäischen Begegnungen“ – seit fast zwei Jahrzehnten bewährt –führt Studierende aus Deutschland mit gleichaltrigen Partnern aus Ost- und Ostmitteleuropa zusammen, um über die gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Länder und Völker zu debattieren.
Im Anschluß findet von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. November die „Herbsttagung des Arbeitskreises Sudetendeutsche Aka-
demiker“ statt. Thema sind die Auswirkungen von Flucht, Vertreibung und Migration in Geschichte und Gegenwart
Es werden unter anderem sprechen zum Umgang mit den Sudetendeutschen seit 1945 in Österreich der Politikwissenschaftler Dr. Niklas Perzi vom Institut für Geschichte des ländlichen Raumes, St. Pölten, sowie zur Fluchtbewegung aus der Ukraine die Soziologin Dr. Tetyana Panchenko vom Münchener ifo-Zentrum für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung.
Von Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November findet dann die zweiteilige Seminarwoche für Multiplikatoren in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband auf dem Heiligenhof statt (Programm siehe rechts).

Mehr Informationen über die Seminare und Tagungen sowie die Anmeldemöglichkeiten: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Webseite www.heiligenhof.de, eMail info@heiligenhof.de oder telefonisch unter (09 71) 7 14 70.

Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.
■ Freitag, 4. bis Sonntag, 6. November, Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker: Herbsttagung (siehe oben). Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Samstag, 5. November, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Legende kehrt zurück – die Geschichte des Fußballclubs DFC Prag“. Filmvorführung und Gespräch mit Filmemacher Thomas Oellermann (Prag). Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November, SL-Bundesverband: Seminarwoche (siehe oben). Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Mittwoch, 9. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Rübezahl-Tag (nicht nur) für Kinder“ mit dem Buchautor Ralf Pasch. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Mittwoch, 9. November, 19.00 Uhr: Gerhart-HautpmannHaus. „Das Mädchen im Tagebuch. Auf der Suche nach Rywka aus dem Getto in Łódź“. Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 31. Januar 2023 gezeigt wird. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Freitag, 11. bis Samstag, 12. November, Sudetendeutscher Heimatrat: Jahrestagung des Sudetendeutschen Heimatrates. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Donnerstag, 17. November, 18.00 bis 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Kunstkammer Georg Laue: Reliefintarsien aus Eger für die fürstlichen Kunstkammern Europas“. Vortrag von Dr. Virginie Spenlé. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 26. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmerwald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Musikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de
■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: Symposium „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
❯
Ausstellungseröffnung am 8. November
Gestrandet im Münchner Norden
■ Dienstag, 8. November, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 in München. Die Ausstellung ist bis zum 27. Januar zu sehen.
Zur Ausstellungseröffnung sprechen Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, und Dr. Falk Bachter, der gemeinsam mit PD Dr. Peter MünchHeubner die Ausstellung kuratiert hat.
Die Ausstellung „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“, die in Kooperation mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft entstanden ist, gibt am Beispiel der bayerischen Landeshauptstadt einen Einblick in die Auswirkungen der erzwunge-
nen Massenwanderung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Dokumente zeigen, mit welch unerhörter Energie sich die Entwurzelten in ihrem Zufluchtsort ein neues Zuhause schufen. Nach einer Darstellung der allgemeinen Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen im Münchner Norden – in Freimann, Kieferngarten, Karlsfeld und Oberschleißheim/Hochbrück – liegt der Fokus der Präsentation auf den Leistungen der Neubürger beim Wiederaufbau, auf ihrer Rolle als Gründer und Gestalter neuer Ortsteile, auf Fragen ihrer politischen, beruflichen, sozialen und kulturellen Integration.
Sie bietet einen Gesamtüberblick über das Thema und befaßt sich zugleich mit Einzelund Familienschicksalen.
■ Montag, 21. November, 19.00 bis 21.00 Uhr: SL-Bundesverband: „Nuntius Alois Muench (1889–1962) – Der ‚Retter Deutschlands‘“. Vortrag von Prof. Dr. Stefan Samerski im Rahmen der Reihe „Böhmen macht Weltgeschichte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.
■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Online-Lesung der Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.
■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Sonntag, 4. Dezember, 15.30 bis 16.30 Uhr und 17.00 bis 18.00, Sudetendeutsches Museum: Finissage und Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
„Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“
■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November: Zweiteilige Seminarwoche in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband unter dem Motto „Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“. Restplätze noch verfügbar. Anmeldung unter www.sudeten.de und www.heiligenhof.de
Teil 1: Ost- und Südosteuropa

Sonntag, 6. November 19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung.
19.30 bis 22.00 Uhr: Prof. Dr. Stefan Samerski, Theologe, Priester und Kirchenhistoriker: „Franziskus und Kyrill – Von den Schwierigkeiten päpstlicher Friedensvermittlung in der Ukrainekrise“.
Montag, 7. November
9.00 bis 10.30 Uhr: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor: „Die Sudetendeutschen: Volksgruppe mit Zukunft“.
10.45 bis 12.15 Uhr: Petra Laurin, Journalistin, und Monika Hanika, Systemische Familientherapeutin: „Zweisprachigkeit in Kindheit und Jugend als Voraussetzung zur Überwindung von Grenzen“.
14.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe und Medienpädagoge: „Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung“.
16.00 bis 17.30 Uhr: Mathias Heider, Historiker (online): „Das Internet als neue Heimat? Chancen und Möglichkeiten beim Aufbau digitaler sozialer Netzwerke“.
19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.
Dienstag, 8. November
9.00 bis 10.30 Uhr: Dr. Raimund Paleczek, Historiker: „Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie“.
10.15 bis 12.15 Uhr: Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen: „Vertriebenenpolitik in den östlichen Bundesländern am Beispiel Sachsen“.
13.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Helmut Altrichter, Hochschullehrer: „Krieg der Erinnerungen. Geschichte und Geschichtsbilder in Rußland und der Ukraine 1991 bis 2022“.
15.40 bis 16.10 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion.
Teil 2: Deutschland und Tschechien

Dienstag, 8. November
19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung.
19.30 bis 21.30 Uhr: Jan Polák, Historiker: „Warum nur? Alte Klischees und Vorurteile über den Nachbarn in den Nachkriegsgenerationen in Deutschland und der Tschechischen Republik“.
Mittwoch, 9. November
9.00 bis 10.30 Uhr: Jan Blažek, Autor und Dokumentarist der Nichtregierungsorganisation „Post Bellum“: „Zeitzeugenprojekte: Orte des nationalen Gedächtnisses“.
10.45 bis 12.15 Uhr: Ingrid Sauer, Archivarin, Bayerisches Hauptstaatsarchiv: „Informationsquellen zum politisch-kulturellen Erbe der Sudetendeutschen“.
14.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Katrin Boeckh, Hochschullehrerin, IOS Regensburg/LMU München: „Geschichte und Emotionen. Tätigkeitsfelder der Forschungsstelle Kultur und Erinnerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“.
16.00 bis 17.30 Uhr: Ulrich Rümenapp: „Die Ost-West-Jugendakademie – Ein best-practice-Beispiel einer Veranstaltungsreihe für Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien“.
19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.
Donnerstag, 10. November
9.00 bis 12.30 Uhr: Werner Honal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher: „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“.
14.00 bis 15.30 Uhr: Dr. Veronika Hofinger, Centrum Bavaria Bohemia e.V.: „Das Grüne Band Europas – eine Landschaft mit Gedächtnis“.
16.00 bis 17.30 Uhr: Alfred Wolf, Vorsitzender Via Carolina-Goldene Straße e.V.: „Erinnerungs- und Versöhnungskultur am ehemaligen Dorf Paulusbrunn im böhmischen Wald“.
19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.
Freitag, 11. November
9.00 bis 10.30 Uhr: Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in Tschechien: „Gedenkstätten der Deutschen in der Tschechischen Republik als lebendige Kultur“.
10.30 bis 11.30 Uhr: Christina Meinusch, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Ein Bild von Heimat – Ausstellungsprojekt in Kooperation mit der Museologie an der Universität Würzburg“.
11.45 bis 12.15 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion und Seminarbilanz.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
VERANSTALTUNGSKALENDER100. Geburtstag: Peter Demetz erzählt aus seiner Zeit in Bayern
Peter Demetz lebt seit einigen Jahren in Highland Park, einer Kleinstadt im amerikanischen New Jersey, nur rund 10 Kilometer von den Ausläufern New Yorks entfernt. Dort feierte er am 21. Oktober seinen 100. Geburtstag.
Dem in Prag 1922 geborenen Literaturwissenschaftler, der in Prag, an der Columbia University und schließlich in Yale (New Haven) studierte und dort ab 1956 bis zu seiner Emeritierung 1991 auch lehrte, gratulierten in einer ZoomSchaltung wichtige Weggefährten der letzten Jahrzehnte.

Ludger Hagedorn und Klaus Mellen vom Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien, wo Demetz in den letzten Jahren noch häufig zu Gast war und seine Forschungen vorantreiben konnte; Manfred Müller von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur auch in Wien, wo Demetz immer wieder und auch gleich nach der Gründung Mitte der 1960er Jahre erste Vorträge hielt; Hans Dieter Zimmermann mit seiner tschechischen Frau in Berlin, mit dem Demetz die 33bändige Tschechische Bibliothek bei der Deutschen Verlags-Anstalt von 1999 bis 2007 mit herausgegeben hat und der ihn schon aus seiner Mitgliedschaft in der West-Berliner Akademie der Künste in den 1970er Jahren kennt; und Herbert Ohrlinger vom 1924 gegründeten Zsolnay-Verlag in Wien, dessen Verlag zwar zwei Jahre jünger als Demetz ist, aber dafür die wesentlichen Bücher Peter Demetz‘, die sich mit seiner böhmischen Herkunft beschäftigen, publiziert hat. 1996: „Böhmische Sonne, Mährischer Mond – Essays und Erinnerungen“; 2002: „Die Flugschau von Brescia. Kafka, d’Annunzio und die Männer, die vom Himmel fielen.“; 2006: „Böhmen böhmisch, Essays“ (mit einem Vorwort von Karel Schwarzenberg); 2007: „Mein Prag. Erinnerungen“ und zuletzt 2019: „Diktatoren im Kino – Lenin, Mussolini, Hitler, Goebbels, Stalin“.
noch im Entstehungszustand befand. Wir hatten keine Wohnungen in München, einer der Redakteure schlief in der Badewanne, kann ich mich erinnern, weil er keine Bleibe hatte, die Redaktionssitzungen fanden romantischerweise in Münchner Wirtshäusern statt. Aber dann konsolidierte sich das Ganze.
Ich war eineinhalb Jahre da, machte mit Herrn Čáp Kultur. Jan Čáp saß neben mir, er war Kulturredakteur. Ich machte die berühmte Sendung ,In the Mood‘.


Von 23 bis 1 Uhr nachts wurde Musik gespielt, und ich habe immer Lyrik dazu gefunden, die dazwischen rezitiert wur-
mitmachte und in der Mensa des Radios am Englischen Garten alle Salzfässer mit Arsen versah in der Hoffnung, daß die gesamte Redaktion an Arsenvergiftung umkommt. Man hat es rechtzeitig entdeckt, und ich glaube, der Agent wurde verhaftet und ausgewechselt, aber politisch war es eine ziemlich komplizierte Sache. Es war wie James Bond.“
Dzambo fragte nach dem Austausch von Informationen im wissenschaftlichen Bereich, und Demetz berichtete über die Situation in den 1950er Jahren. „Es gab eine kleine Buchhandlung in Furth im Wald, die alle tschechischen


gar eine deutsche Ausgabe herausgegeben, sie hieß Democratia militans, und sie mußte dem Bayerischen Innenministerium vorgelegt werden, das weiß ich noch, weil ich sie organisert habe – die liegt da irgendwo im Archiv des Bayerischen Innenministeriums. Wir waren alle wissenschaftlich interessiert: Soziologen, Literaturwissenschaftler, und nach fünf Jahren haben wir uns entschlossen, an Universitäten zu gehen. Wir haben gesagt, das ist keine Zukunft für uns, wir können nicht ewig tschechische National- und Nestpolitik betreiben, wir haben auch andere Interessen. Der eine ist eben nach Paris gegangen, wo er ein angesehener Soziologe wurde, der andere ging nach Harvard, der dritte ging nach New York; der ganze Kreis hat sich dann etwas zerstreut. Und wir denken mit großem Vergnügen an die Zeit dieser Dissidenten zurück, die sich gegen die ältere Generation und gegen die national-patriotischen Gemeinplätze gerichtet haben.“
Daß Peter Demetz dann später vor allem der Germanistik-Professor aus Yale im deutschen Literaturbetrieb wurde, mag erstaunen. Aber mit seinen Arbeiten beispielsweise über Theodor Fontane wurde er bald zum Mitarbeiter im Feuilleton der FAZ, war von 1986 bis 1996 in der Jury und teilweise Vorsitzender des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt und war auch zweimal Gast im Literarischen Quartett von Marcel Reich-Ranicki.



 ❯ Mut tut gut
❯ Mut tut gut

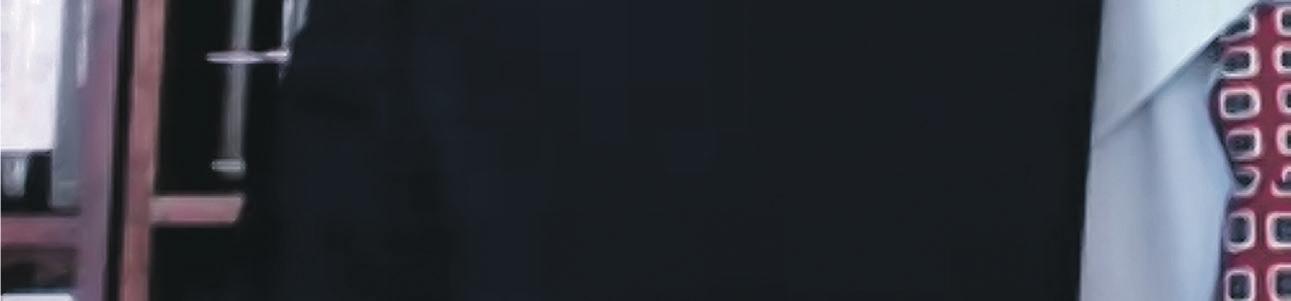
Abschied nehmen
Als Pfarrer habe ich in meiner Gemeinde einen Friedhof mitzuverwalten. Es sind an die dreißig Beerdigungen, die ich pro Jahr auf diesem Friedhof halte. Für die Begleitung der trauernden Angehörigen nehme ich mir immer ausreichend Zeit, weil ich der Meinung bin, daß es sich um eine der wichtigsten seelsorglichen Aufgaben handelt. Von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, ist für niemanden einfach. Aber auch, wenn das Verhältnis zu einem Verstorbenen zu dessen Lebzeiten angespannt war, löst der Tod viele Gefühle aus, mit denen Angehörige besser nicht alleine bleiben sollen.
Gerne frage ich in den Trauergesprächen vor den Beerdigungen: „Wie werden Sie Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihre Ehefrau, Ihren Ehemann und so weiter in Erinnerung behalten?“ Dabei erlebe ich, daß die Angehörigen in der Regel nicht lange nachdenken müssen. Es fallen ihnen gute, aber auch weniger gute Eigenschaften ein. Sie erzählen von besonderen Fähigkeiten, aber auch von kleineren oder größeren Macken. Oft kommt auch das Leben des Verstorbenen als solches zur Sprache mit Brüchen und Verletzungen, mit ungelösten Fragen und uneingestandenen Sehnsüchten.
Fast immer habe ich den Eindruck, daß beim Tod eines nahen Menschen für dessen Angehörigen etwas offenbleibt. Nicht alles konnte zu Lebzeiten eines nun verstorbenen Menschen ausgeredet werden. Nicht immer ist eine notwendige Versöhnung in befriedigender Form gelungen. Manchmal blieb man füreinander rätselhaft. Manchmal zeigt erst der Tod, daß man dem Verstorbenen mehr Zeit und Liebe hätte schenken müssen. Darunter leiden die Angehörigen. Zuweilen tragen sie sich mit Schuldgefühlen, die nicht so leicht aus der Welt zu schaffen sind. Auch dafür darf in einem Trauergespräch Platz sein.
Die wenigen Minuten des virtuellen Zusammenseins über den Teich verbanden Demetz vor allem mit einigen Institutionen in Wien, wohin er leider nunmehr nicht mehr reisen könne, wie er gleich am Anfang bemerkte. Sein Lebensweg, der ihn nach seiner Promotion in Prag, bei der er sich mit Kafka beschäftigte, über die „Wäldergrenze“ nach Bayern führte, war nach eigenem Urteil, das er in einem Gespräch mit Jozo Dzambo vom Adalbert-Stifter-Verein im Jahre 2003 äußerte, ein Gehen wollen nicht unbedingt müssen. „In einer Gesellschaft, in der alle Leute das gleiche sagen, das ist nichts für mich. Dann bin ich eben, wie sie sagen, unter gefährlichen Umständen über die Wäldergrenze gegangen.“
In Bayern gehörte Demetz dann zur Gründergeneration von Radio Freies Europa. „Ich war damals im Flüchtlingslager Bad Aibling – das war ein Kinderund Waisenlager für Kinder der Displaced Persons – und wurde dann engagiert für das Radio, das sich damals
de, aber auch Kulturkommentare. Die Sache war, daß die Sendungen gestört wurden, daß die Zuhörer in Prag selten Gelegenheit hatten, wirklich zuhören zu können.“
Der Trick war, so erzählt Demetz, daß die Zuhörer eine Wellenlänge fanden, die die Abhörtrupps des tschechoslowakischen Geheimdienstes nutzten, um die Sendungen auf Band aufzuzeichnen.
Der ursprüngliche Sender war in Holzkirchen, erst später kam ein neuer großer Sender in Lissabon hinzu. „Ich hoffe, daß dieser Sender nützlich war. Wir haben uns alle sehr angestrengt. Wir haben selbst wieder den tschechischen Rundfunk abgehört, das war ein wechselseitiges Abhören. Ich hatte die ganzen Protokolle des Prager Rundfunks vom Vortag vor mir, bevor ich meine Kulturkommentare geschrieben habe.“
Den Machthabern in Prag war dieses Tun ein Dorn im Auge. „Ich erinnere an diese berühmte Affäre, die kaum zu glauben ist, als sie einen Agenten der Staatssicherheit einschmuggelten, der
Publikationen frei erhielt und frei verkaufte. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, nicht nur tschechische Zeitungen zu lesen, sondern auch tschechische wissenschaftliche Periodika über diese spezialisierte Buchhandlung, die dann nach München kamen und die in die Bibliothek des Senders eingereiht wurden. Wir waren ziemlich gut informiert; wir haben nicht alle Periodika nehmen können, aber doch die wichtigsten.“ Einen Austausch mit Wissenschaftlern gab es damals nicht. Das tschechoslowakische Exil, in dem Demetz dann auch in den Vereinigten Staaten aktiv war, war in der älteren Generation „eigentlich sentimental und unrealistisch, vor allem waren sie nicht masarykisch genug. Deshalb gründeten wir eine Zeitschrift, die hieß Skutečnost (Die Wirklichkeit) – die ist dann vier, fünf Jahre lang erschienen – wo wir einfach gesagt haben: Man muß realistisch verfahren, so wie Masaryk es gemacht hat. Wir waren die ersten, die die Frage der Vertreibung auf den Tisch brachten. Wir haben so-
Erst nach der Samtenen Revolution kehrte er in seine Geburtsstadt Prag und nach Brünn zurück, wo er auch aufgewachsen war und sein Vater Hans Demetz zeitweise Theaterdirektor war. Und die Themen seiner literaturwissenschaftlichen Arbeiten wanderten zu den böhmischen Herkünften und eigenen Erinnerungen. Erst im August dieses Jahres erschien beim Wallstein-Verlag eine Sammlung Literarischer Essays von 1960 bis 2010: „Was wir wiederlesen wollen“ von Peter Demetz. Am Tag seines 100. Geburtstages hielt er ein Exemplar davon in die Kamera seines Computers, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen, noch immer aktiv zu sein. Und er sprach von seiner momentanen Übersetzungstätigkeit. Er übersetze das 2016 in Amerika erschienene Buch „Kafka’s Son“, das er für sich entdeckt habe, und mit dessen mittlerweile 90jährigem Autor Curt Leviant, 1932 in Wien geboren, ab 1938 in Amerika lebend und mittlerweile emeritierter Professor für Jüdische Studien, er in Kontakt stünde.
Man kann also noch auf weitere Arbeiten des Peter Demetz in Zukunft hoffen, auch wenn der hundertste Geburtstag, der erste sei, den er feiere. Er also unerfahren sei und nunmehr improvisiere, wie er in der Videoschaltung gleich am Anfang bemerkte. Ulrich Miksch

Als einen wirklich großen Segen erlebe ich immer die Beerdigungsfeierlichkeiten. Ich persönlich bin dankbar, wenn eine Beisetzung mit einem Requiem in Verbindung steht. In der Feier der Eucharistie sind wir als gläubige Christen in tiefer Weise mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi verbunden. Die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod wird dabei nicht nur verkündet, sondern feiernd begangen und vergegenwärtigt. Oft findet dies auch darin Ausdruck, daß die Angehörigen mir gegenüber bestimmte Liedwünsche äußern, an denen ich erkenne, wie sehr der Trost des christlichen Glaubens trotz aller Trauer bereits in ihnen wirkt.
Für die Abschiedsfeier am Friedhof selbst habe ich eine kleine Litanei des Dankes entwickelt. Wir danken dann für jedes gute Wort, das der Verstorbene gesprochen hat, für jedes Zeichen der Liebe, das er verschenkt hat, für seine Begabungen, die er genützt hat, für das Schöne, das man mit ihm erleben durfte, für das Schwere, das ihn im Leben reifen lies, und für manch anderes mehr. Wenn der Abschied von Dank begleitet ist, dann läßt sich leichter loslassen, und die Angst wird kleiner, daß es sich um einen Abschied auf ewig handelt.
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei Ellwangen-Schönenberg ❯
❯
Prager Obus-Jubiläum Letzte Fahrt vor 50 Jahren
Der letzte Oberleitungsomnibus (Obus) im Prager Nahverkehr fuhr am 15. Oktober 1972.

Die Geschichte der Trolejbusse, so der tschechische Name, beginnt am 29. August 1936 im heutigen sechsten, ziemlich hügeligen Stadtbezirk. Im Gegensatz zu den anderen damaligen Autobussen hatten sie keine Probleme mit den Steigungen. 1963 beschloß der Nationalausschuß, den Betrieb der damals 180 Obusse einzustellen. Doch erst neun Jahre später, am 15. Oktober 1972, verkehrte der letzte Obus zum letzten Mal zwi-

schen den Stationen Orionka und Strahov-Stadion.
Angesichts des Klimawandels wandelte sich auch die Prager Einstellung zu seinen Trolejbussen. Wegen ihres niedrigen Schadstoffausstoßes und des energieeffizienten Betriebs veranlaßte der Magistrat mittlerweile die Rückkehr dieser Busse. Bereits im Januar begann der Ausbau einer Linie, die von Palmovka über Prossek und Letňany nach Čakovice führen wird. Die ersten Passagiere sollen bereits im kommenden Jahr auf der elf Kilometer langen Strecke transportiert werden.
Unser Angebot Probeabo!
Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)
Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail Geburtsjahr, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontobezeichnung (Kontoinhaber)
Kontonr. oder IBAN Bankleitzahl oder BIC Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de
FORUM
PERSONALIEN
Norbert Quaiser 90


Am 31. Oktober feiert der Reichenberger Norbert Quaiser 90. Geburtstag im hessischen Bad Nauheim. Er bereicherte nicht nur die Sudetendeutsche Landsmannschaft, er war auch unzählige Jahre Mitarbeiter der Sudetendeutschen Zeitung
Sein Vater Kurt stammte aus Karbitz im Kreis Aussig, seine Mutter Hilde, geborene Knechtel, aus dem Aussiger Stadtteil Schrekkenstein. Als Entwurfszeichner kam Kurt Quaiser zur Firma Gebrüder Jäger nach Gablonz, wo er Schmuckstücke entwarf, die auch heute noch den Betrachter fesseln. In der Schmuckstadt kam Norbert Quaiser im Wöchnerinnenheim zur Welt. Da der Vater oft noch abends in Proschwitz zu Hause arbeitete, sah der kleine Norbert schon damals Zeichnungen von Walt Disneys Märchenfiguren, die, bei Gebrüder Jäger in Bakelit gepreßt, in die ganze Welt gingen. Nach dem Umzug nach Reichenberg folgten unbeschwerte Schuljahre, die die wilde Vertreibung im Juni 1945 jäh beendete.
Über die Sowjetische kam die Familie in die Britische Besatzungszone und strandete in Schöppenstedt in Niedersachsen. Nach Schule und einer Lehre zum Betriebselektriker studierte Norbert Quaiser in Braunschweig Elektrotechnik. Als Diplom-Inge-
nieur interessierte ihn besonders die Vortriebstechnik im Stollenund Tunnelbau. Die langjährige Tätigkeit als Verkaufsingenieur in dieser Branche hat zur Folge, daß er auch heute noch seine Gäste mit „Glück auf“ begrüßt.
Die Eltern waren schon seit dem Gründungsjahr 1949 Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie fehlten auf keinem Sudetendeutschen Tag. Quaiser begleitete sie, so oft es seine Arbeit zuließ, und engagierte sich schon früh in der Verbandsarbeit.
Vor 55 Jahren heiratete er die Bad Nauheimerin Erika Kissel und zog in die hessische Kurstadt, wo das Paar heute noch lebt. Als der BdV-Ortsverband Bad Nauheim wegen Überalterung der nur noch wenigen Mitglieder vor der Auflösung stand, begann eine intensive Verbandsarbeit. Getreu Norbert Quaisers Motto „Der Verkauf beginnt, wenn der Kunde nein sagt“, setzte er sich mit anderen an die Spitze des Ortsverbandes, der bald danach eine führende Stelle im dortigen Verbandswesen einnahm.
Zu den monatlichen Begegnungsnachmittagen kamen die Gäste von weither. Quaiser, der diese Veranstaltungen organisierte, moderierte und musikalisch begleitete, war dabei ganz in seinem Element. „Ich bin zwar Zirkusdirektor und Löwe in einer Person“, sagte er, „aber die in-
nere Verbindung mit den Landsleuten beim Singen der Heimatlieder, den politischen Vorträgen und den persönlichen Berichten aus der Heimat ist für mich eine Bereicherung.“
Unermüdlich war er darüber hinaus als Referent für Öffentlichkeitsarbeit für den BdV-Landesverband und die SL-Landesgruppe Hessen unterwegs. Und immer war seine Frau Erika mit ihrer Spiegelreflexkamera mit von der Partie und steuerte die passenden Bilder für seine zahlreichen Berichte bei, die auch in dieser Zeitung regelmäßig erschienen.
Kaum zu glauben, aber wahr: Norbert und Erika Quaiser führten auch ein Leben jenseits des Bundes der Vertriebenen und der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Sie haben die Welt schon mehrmals in alle Himmelsrichtungen erkundet und umrundet. Dafür lernten sie sogar Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.
Zum Geburtstag gratulierten ihm außer seiner Frau seine Söhne Martin und Stefan mit Familie sowie seine vier Enkel: zwei Pauls, ein Eric und ein Jan. Sein Geburtstagswunsch: „Prag soll sich für das Unrecht der Vertreibung bei den Sudetendeutschen entschuldigten.“ Dem immer fröhlichen und kundigen Landsmann und langjährigen Pressekollegen gratuliert auch diese Zeitung und wünscht ihm Gesundheit, Zuversicht und Gottes überreichen Segen.
Nadira HurnausDiese Umarmung von Charlotte Knobloch und Bernd Posselt nach der Karls-Preisverleihung in Regensburg geht zu Pfingsten 2019 durch die deutschen und tschechischen Medien. Bild: Egon Lippert
❯ Prominente Mitstreiterin Charlotte Knobloch 90


Am morgigen 29. Oktober feiert Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, in München 90. Geburtstag.
Peter Becher 70
Irgendwo in Oberbayern wird Peter Becher am 3. November seinen 70. Geburtstag feiern –wenn er nicht gerade zwischen München, Prag und Wien in Sachen Kulturvermittlung und Verständigung unterwegs ist.
Geboren wurde er in München und wuchs in einem Vorort auf. Sein Vater, der Politiker Walter Becher, stammte aus Karlsbad und war lange Volksgruppensprecher. Seine Mutter kam aus der Steiermark, wo er viele Sommerfrischen verbrachte. Auch Erzählungen der Großeltern väterlicherseits, die von einer Heimat träumten, die man lange nicht besuchen konnte, prägten ihn. Tschechisch lernte er erst später. 1975 bis 1981 studierte er Germanistik und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), wo er 1981 über das Ende der Donaumonarchie promovierte. Nach Mitarbeit im Goethe-Institut war er 1982 bis 1985 Bildungsreferent in der Jugendarbeit beim Bund der Pfadfinder. 1986 bis 2018 war er Geschäftsführer des AdalbertStifter-Vereins in München und hatte Lehraufträge an der LMU in Bayerischer Literaturgeschichte und Tschechischer Landeskunde. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins.
Über sein stetiges Wirken im kultur- und im allgemeinpolitischen Bereich sagen mehr seine Berufungen, Mitgliedschaften und Ehrungen aus: 1992 Aufnahme in den Tschechischen PENClub, 1995 Eintritt in die Seliger-Gemeinde, 2000 Berufung in den Beirat des deutsch-tschechischen Gesprächsforums, 2002 Berufung in den Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen und Erhalt des Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreises sowie 2006 des Sudeten-
deutschen Kulturpreises für Literatur. Seit 2008 ist er Mitglied der Klasse der Künste und der Kunstwissenschaften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. 2008 erhielt er den Gratias-Agit-Preis der Tschechischen Republik und 2012 die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber. In Berlin gehört er dem Wissenschaftlichen Beraterkreis der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ an.
Zu seinen literarischen Werken gehören „Zwischen München, Prag und Wien“, „Literatur unter dem Hakenkreuz. Böhmen und Mähren 1938–1945“, die Biographie „Adalbert Stifter. Sehnsucht nach Harmonie“, der halbautobiographischen Roman „Nachtflug“ und die Anthologie „Der Löwe vom Vyšehrad“.

Seit 2014 leitet er das Herausgebergremium der Vierteljahresschrift „Sudetenland“, die sich unter seiner Ägide zu einer wahren Europäischen Kulturzeitschrift entwickelt.
Neben den großen Feierlichkeiten zum 70jährigen Jubiläum des Adalbert-Stifter-Vereins 2016 lief 2017 ein wichtiges Projekt des Vereins zur Erforschung der frühen Geschichte des Hörfunks in der ČSR, wozu Becher 2017 mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Anna Knechtel die Publikation „Hörfunk und Hörfunkpolitik in der Tschechoslowakei und im Protektorat Böhmen und Mähren“ herausbrachte. Auch ein Lexikon der deutschsprachigen Literatur in Böhmen und Mähren, das mehr als 50 Autoren vorstellt, ist in Arbeit. 2021 erschien sein „Prager Tagebuch“, und zum Geburtstag kommt – „Mein erstes Geburts-
tagsgeschenk.“ – „Unter dem Steinernen Meer“ im Prager Vitalis-Verlag heraus.
Seine jahrzehntelange umsichtige und sinnstiftende Leitung des Adalbert-Stifter-Vereins ließ ihn fast zu einem Synonym für dessen völkerverbindendes und freundschaftstiftendes Wirken werden.
Bernd Posselt als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe ist seit Jahrzehnten mit Peter Becher befreundet und wünscht ihm alles Gute zum Geburtstag:
„Wenn es das Musterbild eines gleichzeitig sehr kritischen und sehr konstruktiven Menschen gibt, so ist dies Peter Becher. Einer bedeutenden Karlsbader Familie entstammend, ist er ein herausragender Literat, ein ungemein kreativer Kulturvermittler, ein zu echter Verständigung mit dem tschechischen Volk hochbegabter Brükkenbauer, ein moderner Widerschein des übernationalen alten Böhmen und der habsburgischen Vielvölkermonarchie, ein leidenschaftlicher Gegner jedes Nationalismus und jeder ideologischen Verhärtung.
Sein Essay ‚Mein Sudetenland’ gehört zum Besten, was je über unsere gemeinsame Wurzelheimat geschrieben wurde; das Gleiche gilt für seine Bücher sowie die Fülle seiner anderen Publikationen. Ich danke ihm für seinen Einsatz, für den er auch einiges einstecken mußte, und für eine Freundschaft, die mir in schwierigen Zeiten immer wieder wichtigen Rückhalt gibt. Ich bin froh über seinen Rat und hoffe, daß er noch lange so intensiv für unsere Gemeinschaft tätig bleibt.“ Susanne Habel
V
olksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert der KarlsPreisträgerin von Herzen zum 90. Geburtstag:
„Es ist mir eine große Ehre und Freude, daß ich seit Jahrzehnten eng und freundschaftlich mit Charlotte Knobloch zusammenarbeiten darf. Trotz des entsetzlichen Schicksals ihrer Familie, an dem viele zerbrochen wären, ist sie ein zutiefst positiver Mensch, der andere begeistern, motivieren und mitreißen kann. Sie hat einen entscheidenden Anteil am Aufbau der deutschen Demokratie und einer demokratischen Stadtgesellschaft geleistet, weshalb sie zu Recht Ehrenbürgerin Münchens und damit der größten sudetendeutschen Kommune, die es jemals gab, wurde.
Mit uns verbindet sie auch ihr begeistertes Europäertum, das ich besonders intensiv erleben durfte, als sie mit einem ganzen Bus von der Israelitischen Kultusgemeinde auf meine Einladung das Straßburger Europaparlament besuchte. Dort herrschte gerade Krisenstimmung, aber Charlotte Knobloch entwickelte in ihrer Rede im Parlamentsgebäude eine derart positive Vision von der europäischen Einigung, daß sich die dunklen Wolken am Horizont rasch verzogen.
Zu ihrem Lebenswerk gehört der Aufbau des Jüdischen Zentrums am Münchener Jakobsplatz, das sie mit dem ihr eigenen, mit Hartnäckigkeit gepaarten Charme durchsetzte. Mit Freude blickte sie aber auch auf den Erfolg des Sudetendeutschen Hauses und die Schaffung des Sudetendeutschen Museums, an dessen Grundsteinlegung sie mitwirkte. Zeichen ihrer Verbundenheit mit unserer Volksgruppe war auch, daß sie beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg im historischen Reichsratssaal unseren Europäischen Karls-Preis entgegennahm.
Beim ersten Besuch eines tschechischen Premierministers, nämlich Petr Nečas, an der Isar war sie beim Staatsbankett auf Einladung von Ministerpräsident Horst Seehofer meine Tischdame und schaffte es, sehr skeptische tschechische Diplomaten vom Verständigungswillen der Sudetendeutschen zu überzeugen. Ich gratuliere dieser Grande Dame der jüdischen Gemeinschaft von Herzen und danke ihr dafür, daß sie weiterhin unentwegt Gutes tut und durch ihre Menschlichkeit Maßstäbe setzt.“
Symbole für die Heimatlandschaften
AdlergebirgeEin sinnstiftendes Symbol des Adlergebirges ist das Trostbärnla („Trostborn“), das als eine in zwei offene Hände fließende Quelle dargestellt wird. Es ziert sämtliche Publikationen der Adlergebirgler und war auch namensgebend für ihr seit 1921 erscheinendes Heimat-Jahrbuch.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft besteht aus vierzehn Heimatlandschaften, die jeweils über ihre eigenen Wahrzeichen und Symbole verfügen. In Werbung, Kommunikation und Außendarstellung werden diese Sinnbilder künftig an Bedeutung gewinnen.
Der Freistaat Bayern ist nicht nur das Schirmland der Sudetendeutschen und Heimat für über dreizehn Millionen Menschen, sondern auch eine äußerst erfolgreiche Marke, die weltweit mit positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. Ihre
Das Netzwerk: www.sudeten.net .
Bekanntheit verdankt diese Marke unter anderem einer klaren und eingängigen Symbolik: Das weiß-blaue Rautenmuster wird international erkannt und mit Bayern identifiziert.
Daß nicht nur Staaten und Un-
ternehmen, sondern auch Volksgruppen ihre Marken-Kommunikation pflegen können und sollten, beweisen die sudetendeutschen Heimatlandschaften: So sind etwa der Altvaterturm, die Böhmerwald-Rose, der Egerländer Huasnoantoutara und der Kuhländler Bauernbrunnen zu unverwechselbaren Wahrzeichen ihrer Regionen geworden.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, die Strahlkraft dieser Symbole weiter zu stärken. In einem ersten Schritt wurden deshalb Piktogramme angefertigt, die die Wahrzeichen der Hei-
matlandschaften in einheitlicher Weise abbilden. Vorgabe war dabei eine möglichst einfache, stilisierte Form der Darstellung, die eingängig, in allen Größen klar erkennbar und auch im Zweifarben- oder Schwarzweißdruck verwendbar ist.
Künftig sollen diese Symbolbilder immer dann zum Einsatz kommen, wenn es um die sudetendeutschen Heimatlandschaften geht – in Information und Werbung, in gedruckten Publikationen und im Internet. Schon jetzt sind sie auf Sudeten.net, dem sozialen Netzwerk der Sudetendeutschen, zu sehen.
SchönhengstgauDer Schönhengstgau, benannt nach dem langgestreckten Schönhengster Rücken in der Böhmisch-Mährischen Höhe, war die größte Sprachinsel und führt ein sprechendes Wappen: Über einer zinnenbewehrten Mauer erhebt sich ein steigender Hengst.


Altvatergebirge
Das Wahrzeichen des Altvatergebirges ist der Altvaterturm, der von 1912 bis 1959 die höchste Erhebung des Gebirges –den Altvater – krönte. Ein originalgetreuer Nachbau des Turms steht seit 2004 auf dem Wetzstein im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
BöhmerwaldAb dem 12. Jahrhundert zählte das Adelsgeschlecht der Witigonen zu den größten Landbesitzern Südböhmens. Ihr Wappenbild, die fünfblättrige Rose, fand Eingang in zahlreiche städtische Wappen, darunter die von Krummau, Kaplitz, Rosenberg und Wittingau.



Elbetal
An der Böhmischen Pforte durchbricht die Elbe das Mittelgebirge und durchfließt es auf einer Länge von rund 50 Kilometern bis zur sächsischen Grenze. Der Flußlauf versinnbildlicht –in stilisierter Form – die umgebende sudetendeutsche Heimatlandschaft.
KuhländchenDas Wahrzeichen des Kuhländchens ist der Bauernbrunnen am Marktplatz von Neutitschein. Dieses von Franz Barwig dem Älteren geschaffene Kunstwerk wurde 1929 eingeweiht. Die Brunnenfigur zeigt ein tanzendes Bauernpaar in traditioneller Kuhländler Tracht.
Polzen-Neiße-Niederland
Diese große Heimatlandschaft setzt sich aus dem Isergebirge, dem Böhmischen Niederland und der Region um Böhmisch Leipa zusammen. Ein gemeinsames Symbol für die vielfältige Landschaft ist das Neue Jeschkenhaus auf dem Gipfel des Jeschken bei Reichenberg.
SprachinselnIn den Böhmischen Ländern gab es viele deutsche Sprachinseln, darunter die von Brünn, Iglau, Olmütz, Prag und Wischau. Ihre besondere Stellung symbolisiert das „e“, der häufigste Buchstabe der deutschen Sprache, ausgezeichnet durch verschiedene diakritische Zeichen.
Südmähren Beskiden1893 wurde im Herzogtum Teschen der Beskidenverein gegründet. Die meisten seiner Mitglieder entstammten dem deutschsprachigen Bürgertum aus Bielitz, Friedek-Mistek, Mährisch Ostrau und Teschen. Das Wappen zeigt eine typische Beskiden-Baude.
Egerland
Das Egerland besitzt ein traditionsreiches, bekanntes Wahrzeichen: Den Huasnoantoutara, den Schmuckhosenknopf der Egerländer Männertracht. Von seiner charakteristischen Gestalt abgeleitet, ist die reine AchteckForm zu einem Symbol für das Egerland geworden.
Erzgebirge-Saazerland
Diese Heimatlandschaft besteht aus zwei Kulturregionen: Das Erzgebirge wird durch Schlägel und Eisen, das international bekannte Symbol für den Bergbau, repräsentiert. Für das Saazerland steht dessen bekanntestes landwirtschaftliches Produkt, die Hopfendolde.
MittelgebirgeDas Böhmische Mittelgebirge ist bekannt für die typischen Kegelformen seiner Berge, die häufig vulkanischen Ursprungs sind – darunter der Milleschauer und der Borschen. Die markanten Silhouetten dieser Gipfel sind im Symbolbild des Mittelgebirges zu sehen.
RiesengebirgeDer Berggeist Rübezahl ist eine über alle Grenzen hinweg bekannte Symbolfigur dieser sudetendeutschen Heimatlandschaft. Traditionell wurde der Rübezahl mit Stock und ohne Hut, dafür mit einer enganliegenden Kappe oder auch einer offenen, wallenden Haarmähne dargestellt.
Das Wappen der Südmährer vereinigt die Heimatkreise: den mährischen Adler (Znaim), zwei Winzermesser (Nikolsburg), einen schwarzen Adler (Neubistritz) und die fünfblättrige Rose der Witigonen (Zlabings). Als einigendes Element wirkt das silberne Band der Thaya.
Weltkulturerbe trifft Weih nachtszauber: Während der Ad ventszeit ist Prag das attraktiv ste Reiseziel weltweit – haben die Leser der amerikanischen Zeitung USA Today bereits 2015 entschieden. „Der Advent in Prag ist magisch und die beste Zeit, die mit Weihnachtsbäu men, Lichtern und Märkten ge schmückte Stadt zu besuchen“, hieß es in der Begründung.
In diesem Jahr dürfte die An ziehungskraft der Goldenen Stadt noch stärker sein – zumin dest für Besucher aus Deutsch land. Während in vielen bundes deutschen Städten in dieser Ad ventszeit die Lichter ausgehen, also Kirchen, Schlösser und an dere historische Bauwerke we gen der Energiekrise nicht mehr angestrahlt werden, lädt Prag als Weltkulturerbestadt zum großen Fest der Sinne ein.
Der beliebteste und größte Weihnachtsmarkt in der Haupt stadt findet auf dem Altstädter Ring statt, dem Zentrum der Pra ger Altstadt. Umrahmt vom Alt städter Rathaus mit der weltbe
Überblick:Weltberühmt: Prag und seine Weihnachtsmärkte

stündlich wiederholt. Den besten Blick hat man, wenn man den Rathausturm besteigt. Von oben kann man den Tausenden von Menschen folgen, die – meist mit einem Glas Glühwein in der Hand – an den Dutzenden Bu den vorbeiziehen, die traditionel le Handwerkserzeugnisse, Weih nachtsschmuck oder diverse Lek kereien von in Zucker gerösteten Nüssen bis zu köstlichen Würst chen und Bratwürste anbieten.
ke, das gilt insbesondere im Ad vent, wenn die älteste Brücke der Stadt geschmückt ist und den Blick auf die festlich beleuchte te Burg freigibt, auf der ebenfalls ein Weihnachtsmarkt stattfindet.
� Weihnachtsmärkte Orte und Termine
n Altstädter Ring (Staroměstské Náměstí): 26. November bis 6. Januar, 10.00 bis 22.00 Uhr.
n Wenzelsplatz (Václav ské námestí): Öffnungszei ten noch nicht veröffent licht.
n Platz der Republik (Náměstí Republiky): 26. November bis 24. Dezem ber, 10.00 bis 19.00 Uhr.
rühmten astronomischen Uhr, der gotischen Teynkirche, der barocken Nikolauskirche und dem Rokoko-Palais Golz-Kinsky wird der große Weihnachtsbaum direkt neben dem Denkmal von
schönsten
Auch viele kleine und große Städte in der Tschechischen Re publik präsentieren ein speziel les Adventsprogramm, bei dem traditionelle Christbäume die Marktplätze schmücken und weihnachtliche Klänge für ei ne märchenhafte Stimmung sor gen. Und natürlich ist auch im mer für Speis und Trank gesorgt.
Eger, 27. November bis 26. Dezember: Weihnachtsmarkt auf dem dem Marktplatz.

Karlsbad, 28. November bis 27. Dezember: Weihnachtsmarkt vor dem Elisabethbad.
Olmütz, 18. November bis 23. Dezember: Olmützer Weih nachtsmarkt auf dem Obermarkt (Horní náměstí).
16. bis 19. Dezember: Weih nachten auf dem Messegelände Flora.
Pilsen, 23. November bis 23. Dezember: Weihnachtsmarkt auf dem Platz der Republik (Náměstí Republiky).
Budweis, 25. November bis 6. Januar: Advents- und Weih nachtsmärkte im Stadtzentrum.
12. bis 17. Dezember: Weih nachtsmarkt am Rathaus.
18. Dezember: Weihnachten in der Altstadt.
Brünn, 26. November bis 23. Dezember: Weihnachtsmärk te auf dem Platz der Freiheit (Náměstí Svobody) und weiteren Straßen und Plätzen.
09. bis 18. Dezember: Weih nachtsmarkt auf der Messe.
Znaim, 25. November bis 21.
Dezember: Znaimer Advent auf dem Masaryk-Platz (Masaryko vo náměstí)
Sichrow (Nordböhmen, Regi on Reichenberg), 26. bis 27. No vember: Advents- und Weih nachtsmarkt auf dem Schloß Sichrow.
Wittingau (Südböhmen), 24. November bis 18. Dezember:
Jan Hus wieder die Blicke auf sich ziehen. Ab 16.30 Uhr wird der Christbaum mit einem un vergeßlichen Lichter- und Mu sikspektakel in Szene gesetzt. Bis 20.30 Uhr wird diese Show
Ein weiterer Höhepunkt ist die lebende Krippe, in der nicht nur Menschen die Geschichte um die Geburt von Jesus Christus nach spielen, sondern auch Ziegen und Esel zum Einsatz kommen.
Kein Prag-Besuch ohne ei nen Gang über die Karlsbrük
Ein Geheimtipp neben den weltberühmten Weihnachts märkten auf dem Altstädter Ring (Staroměstské náměstí) oder auf dem Wenzelsplatz ist der Ma nifesto Market Andel (Ostrovs kého 34 ) mit seinen originellen und modernen Interpretationen der alten Traditionen. Der etwas andere Weihnachtsmarkt eröff net Ende November, und in die ser Saison dreht sich ein großes Karussell im französischen Stil für Gäste jeden Alters.
Torsten Fricken Friedensplatz (Náměstí míru): 20. Novem ber bis 24. Dezember, 10.00 bis 19.00 Uhr.
n Tylplatz (Tylovo náměstí): 26. November bis 24. Dezember, 10.00 bis 19.00 Uhr.
n Prager Burg (Hrad schin, Hradčany): Öff nungszeiten noch nicht ver öffentlicht.
n Eislaufbahn (Na Františku): Öffnungszeiten noch nicht veröffentlicht.
in der Tschechischen Republik
bis 23. Dezember: Weihnachts markt auf dem Pernstein-Platz (Pernštýnském náměstí). Neutitschein (Beskiden), 2. bis 23. Dezember: Weihnachtsund Adventsjahrmarkt, MasarykPlatz (Masarykovo náměstí). Strakonitz (Südböhmen), 2. bis 4. Dezember: Adventsmarkt auf der Burg Strakonitz. Pribram (Mittelböhmen), 5. bis 16. Dezember: Weihnachten im Bergbauhäuschen (Vánoce v Hornickém domku).
Königgrätz, 9. bis 28. De zember: Weihnachtsmarkt auf dem Großer Marktplatz (Velké náměstí).

Saubernitz (Nordböhmen, Region Aussig), 10. und 11. De zember: Weihnachten im Frei lichtmuseum Saubernitz.
Ungarisch Hradisch (Regi on Zlin), 10. bis 22. Dezember: Weihnachtlicher Jahrmarkt auf dem Masaryk-Platz (Masaryko vo náměstí).
Elbogen (Egerland), 10. und 11. Dezember: Weihnachtsmarkt auf der Burg Elbogen.
Schwarzenberger Weihnachten auf Schloß Wittingau. 26. November sowie 3., 10. und 17. Dezember: Adventsmärkte auf dem Masaryk-Platz (Masary kovo náměstí).
Hlinsko (Böhmisch-Mähri sche Höhe), 26. November bis 4. Dezember: Weihnachten im Frei luftmuseum Veselý kopec. Ostrau, 26. November bis 3.
Januar: Weihnachtsmarkt auf dem Masaryk-Platz (Masaryko vo náměstí). 10. und 11. Dezember: Weih nachten auf der Schlesisch-Ost rauer Burg. Aussig, 27. November bis 23. Dezember: Weihnachtsmärk te auf dem Lidické náměstí und weiteren Plätzen. Iglau, 27. November bis 31.
Dezember: Weihnachtsmarkt auf dem Masaryk-Platz (Masarykovo náměstí).
Groß Karlowitz (Beskiden), 27. November: Katharinen- und Adventsjahrmarkt. Krumau, 29. November bis 6. Januar: Weihnachtsmärkte auf dem Platz Náměstí Svornosti und weiteren Orten.
Pardubitz, 30. November
Gablonz, 14. bis 17. Dezem ber: Weihnachtsmärkte auf dem Friedensplatz (Mírové náměstí) und weiteren Plätzen.
Melnik (Mittelböhmen), 16. bis 18. Dezember: Weihnachts markt auf dem Platz des Friedens (Náměstí Miru).
Auscha (Nordböhmen, Regi on Aussig), 17. Dezember: Ver sammlung der Engel und Weih nachtsmarkt.
Mit den Förderpreisen zeich net die Sudetendeutsche Lands mannschaft Persönlichkeiten aus, die künftig außergewöhn liche Leistungen auf den Ge bieten Bildende Kunst und Ar chitektur, Literatur und Publizi stik, Musik, Wissenschaft sowie Volkstumspflege erhoffen las sen.
Bildende Kunst und Architektur
Julia Bertlwieser (geboren 1992 in Miltenberg): Sie studier te nach dem Abitur an der Akademie der Bildenden Künste Stutt gart Kostümund Büh nenbild und schloß daran eine Ausbil dung zur Büh nenmalerin am Mainfranken theater Würzburg an. Bereits während ihres Studiums absol vierte sie verschiedene Prakti ka im Bereich Masken-, Kostümund Bühnenbild und bei einem Kirchenmaler. Seit 2012 absol viert sie ein Erasmus-Plus-Prak tikum am Kungliga Dramatis ka Teatern in Stockholm und am Stadtsteatern in Stockholm. Seit August 2021 arbeitet sie als Bühnenmalerin am Stadtsteatern Stockholm.


Bertlwiesers Großvater Jo hann stammte aus Reitschlag und gründete nach dem Fall des Eisernen Vorhangs einen Spen denverein, mit dessen Hilfe und vielen Stunden Arbeit auf der Baustelle er die Wallfahrtskirche St. Thoma in Wittinghausen re novierte.
Darstellende und Ausübende Kunst Lisa Maria Kebinger (geboren 1994 in München): Die Alt-So listin studiert derzeit Gesang am Mozarte um. Bereits seit 2014 gestaltet sie verschiede ne Konzertrei hen, zum Bei spiel das Po dium junger Solisten oder die Carl-OrffFesttage, mit und hat feste Engagements bei verschiedenen Oratorien. Neben regelmäßigen Engagements für Orchestermessen wirkte sie auch bei mehreren Opernproduktio nen mit. Die Bewerbung um den Förderpreis nahm sie zum An laß, sich intensiver mit der Ge schichte ihrer Familie auseinan derzusetzen. Dabei beeindruckte sie besonders, dass ihre Groß mutter Irma Reinholz, geborene Siegl trotz der prägenden Ver treibungserfahrungen eine star ke, lebensfrohe und hilfsberei te Frau war. Ihrer Spurensuche zu den eigenen Wurzeln will sie sich weiter widmen und das be reits entdeckte Neuland auch auf musikalischem Gebiet ausbauen.
Musik
Leonard Willscher (gebo ren 1997 in Hamburg): Urenkel des bekann ten Troppauer Dichterkompo nisten Gustav Willscher und Sohn des Kom ponisten und Organisten Andreas Will scher Bereits

im Alter von knapp sechs Jahren begann Willscher mit dem Violinunterricht. Sein Ab itur machte er am Hamburger
Johannes-Brahms-Gymnasium. In dieser Zeit entstanden eini ge Dubstep-Kompositionen (ei ne größtenteils in Süd-London entstandene Musikrichtung, die aus Reggae, Dub, Garage und Two Step hervorging). Gelegent lich trat er auch als Geiger in Schul- und Kirchenkonzerten in Erscheinung. Nach der Aufnah meprüfung begann er ein Schul musikstudium an der Hamburger Hochschule für Musik und Dar stellende Kunst mit dem Haupt fach Violine und dem Neben fach Informatik. Diesem Studium schließt sich seit 2020 das Stu dium der Musiktheorie und der Komposition an. In diesem Zu sammenhang entstanden bemer kenswerte Kompositionen, die er zu einem Teil für seine Abschluß prüfungen konzipierte.
Leonard Willscher hat sich schon früh als Musiker einen Na men gemacht und eigenen Ton gefunden, der neugierig auf wei tere Werke aus der Feder des jungen Komponisten macht.

Wissenschaft






Luděk Němec (geboren 1999 in Krummau): Nach Studienauf enthalten in Wien und Ber lin spricht Němec perfekt Deutsch und Tschechisch. Berufserfah rungen sam melte er bereits als Schloß- und Museumsfüh rer, etwa im Museum Fotoatelier Seidel in Krummau. Durch seine mehrjäh rigen Depot- und Archivierungs arbeiten im Heimatmuseum Nie mes/Prachatitz in Ingolstadt ist er in besonderer Weise mit dem Böhmerwaldheimatkreis Pracha titz verbunden. Im Rahmen sei nes Geschichtsstudiums hat er bereits Bücher über die Orte Schönberg und Böhmisch Röh ren veröffentlicht und ein drittes Buchprojekt über die Gemeinde Kuschwarda in Angriff genom men. Alle diese Orte liegen im Kreis Prachatitz und im Grenz bereich zu Bayern. Luděk Němec kann trotz seiner Jugend als pro funder Kenner der Geschich te des Sudetenlandes im Allge meinen und des Böhmerwaldes im Besonderen bezeichnet wer den. Auch im Rahmen seines Studiums an der Universität Wi en hat er sich mit sudetendeut scher Geschichte beschäftigt und strebt auch beruflich eine Tätig keit an, die sich mit der sudeten deutschen Geschichte beschäf tigt und der Verständigung zwi schen Tschechen und Deutschen. Er wurde 2022 zum zweiten Vorsitzenden des Böhmerwald heimatkreises Prachatitz ge wählt und schreibt Artikel für die Zeitschrift „Der Böhmerwald“. Weiters ist er seit Juli 2022 Vor standsmitglied des Förderver eins Böhmerwaldmuseum Passau und bringt sich dort in das Digi talisierungsprojekt ein.

Volkstumspflege

Anna-Lena Hamperl (geboren 1998 in Trostberg): Der Vater ist Dr. med. Wolf-Dieter Hamperl, geboren in der Neumüh le, Gemein de Zummern/ Kreis Tachau im südlichen Egerland.


Im Zeitraum vom 1. Novem ber 2021 bis 28. Februar 2022 erfaßte AnnaLena Hamperl die Buchbestände der Vereinsbi bliothek. Nach Zusammenführen der Bücher aus verschiedenen Räumen und Regalen und nach dem Aussortieren „artfremder“
Bücher begann sie die Inventa risierung der Bücher. Der Be stand wurde nach den Kriterien „Eger“, „Egerland“ und „Sude tenland“ gegliedert und digital erfasst. Der Buchbestand umfaßt 260 Bücher „Eger“, 530 Bücher „Egerland“ und 607 Bücher „Su detenland“.





Jan Vrána (geboren 2003 in Jungbunzlau): Vránas Urgroß vater kaufte in Rochlitz an der Iser Ende der 1940er Jah re ein Haus, das die Fami lie seitdem als Wochenend haus nutzt. Vrána ist sich des schwieri gen Erbes, das mit dem Haus verknüpft ist, sehr bewußt und möcht es pfle gen und erhalten. In seiner Ab iturarbeit hat er sich dem Berg bau in Rochlitz gewidmet. Diese Arbeit beinhaltet die Bergwerks

geschichte und deren deutsche Spuren, die man noch in Rochlitz finden kann (z.B. die Namen Sa cherkamm, Schwefelstatt etc.). Vrána liebt seine Heimat, findet aber die Veränderungen dieser Regionen in den letzten 70 Jah ren sehr traurig. Sein Ziel ist es, das alte Aussehen zu zeigen und vielleicht ein bißchen zu bewah ren incl. des Geists dieser Regio nen. Die Vertreibung der Sude tendeutschen aus der Tschecho slowakei hatte in seinen Augen nicht nur schrecklichen Einfluß auf die Kultur und Natur, son dern auch auf das Erscheinungs bild seines Landes. Deshalb en gagiert er sich seit 2021 im Hei matkreis Hohenelbe.


Die Preisgelder werden geför dert vom Bayerischen Staatsmi nisterium für Familie, Arbeit und Soziales über das Haus des Deut schen Ostens.

Man spielt deutsch



Die festliche Preisverleihung findet am 28. Januar 2023 durch die Sudetendeutsche Stiftung statt.
Vorhang auf: Zum 27. Mal findet das Prager Theaterfestival deut scher Sprache statt.
Vom 9. November bis 4. De zember werden in der Haupt

stadt deutschsprachige Pro duktionen aus Hamburg, Ber lin, Hannover und Wien gezeigt. Den Auftakt macht das Schau spielhaus Hamburg mit „Richard the Kid and the King.“ Anzeige


„Ich will an die Leichenberge erinnern, an die toten Menschen. Es waren unzählige.“


Die Hinrichtungen dauerten über acht Stunden. Im Zwei-Minuten-Takt wurde die KZ-Häftlinge einzelnd in einen Raum geführt und dann mit einem Kopfschuß ermordet. An diesem Tag vor achtzig Jahren, am 24. Oktober 1942, wurden insgesamt 262 Leben im KZ Mauthausen ausgelöscht. Die Frauen und Männer sollen, so ein Standgericht der Gestapo, die mutigen tschechischen Fallschirmjäger unterstützt haben, die den Nazi-Massenmörder Reinhard Heydrich erfolgreich beseitigt hatten. Eine der wenigen Überlebenden ist Eva Lukash (geborene Kral), die im Rahmen eines Zeitzeugenprojektes der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ihre Geschichte erzählt hat.
Als Tochter einer bürgerlichjüdischen Familie wurde Eva Kral 1926 in Prag geboren. Mit dem Einmarsch von Hitlers Wehrmacht am 15. März 1939 in die Tschechoslowakei änderte sich für die Familie Kral alles. Evas Vater mußte seinen Beruf aufgeben, und ein Jahr nach der Annexion durften Juden nicht mehr zur Schule. „Alle Juden mußten Gold und Geld abgeben, ebenso Pelze und andere Wertgegenstände. Als ich nicht mehr die Schule besuchen durfte, beschlossen meine Eltern, daß ich eine Lehre machen soll“, erinnert sich Eva Lukash in ihrem Zeitzeugen-Interview. In dieser Lehrzeit zur Schneiderin lernte sie junge Menschen kennen, die dem Widerstand angehörten und im Untergrund für die Kommunistische Partei arbeiteten. „In dieser Zeit gab es bereits die ersten Deportationen nach Theresienstadt“, so Eva Lukash.
Nach der geglückten Ausschaltung von Reinhard Heydrich, dem Schlächter von Prag und Architekten des Holocausts, habe es ab Mai 1942 eine Verhaf-


tungswelle gegeben. Durch Folterungen und Verhöre sei dann auch irgendwann ihr Name genannt worden. Als sie einen Freund besuchte, sei sie zusammen mit drei weiteren Mädchen
von der Gestapo verhaftet worden. „Das war am 9. Juni 1942. Sie brachten uns zunächst in die Kleine Festung nach Theresienstadt. Nach ein paar Tagen wurden wir zurück nach Prag in die Sammelstelle für Juden gebracht und anschließend ins Ghetto Theresienstadt deportiert.“
Viermal gelingt es Eva Lukash und ihrer Mutter, ihren Weitertransport ins KZ Auschwitz zu verhindern, doch am 1. Oktober 1944 werden auch diese beiden

Frauen in das Todeslager deportiert. Wie durch ein Wunder bleiben die beiden Frauen von den Gaskammern verschont, werden stattdessen am 14. Oktober ins Lager Freiberg bei Dresden, ein Außenlager des KZ Flossenbürg, verlegt.
„Als im März 1945 die Front immer näherkam, wurden wir zwei Wochen lang in offenen Waggons und ohne Verpflegung transportiert und nach Mauthausen gebraucht. An einem Bahn-
Anthropoid – die erfolgreichste Kommando-Aktion im Zweiten Weltkrieg
Militärisch war die Operation Anthropoid ein Erfolg – wenn auch mit Verzögerung. Bei der Kommando-Aktion der tschechischen Fallschirmjäger am 27. Mai 1942 wurde Reinhard Heydrich, der Schlächter von Prag und Planer des Holocausts, zunächst nur schwer verletzt, erlag dann aber Tage später im Krankenhaus einer Blutvergiftung.


Die Rache der Nazis war fürchtlerlich. Zwar konnten sich Josef Gabčík und Jan Kubiš, die die Operation vor Ort ausgeführt hatten, und ihre Kameraden mit Hilfe des Bischofs Gorazd in der Kirche St. Cyrill und Method in Prag verstecken. Doch Karel Čurda, ein ehemaliger Widerstandskämpfer, verriet der Gestapo seine ehemaligen Kameraden, wofür er übrigens nach dem Krieg zum Tode verurteilt und gehängt wurde.




Bei dem stundenlangen Feuergefecht mit der Wehrmacht hatten die tschechischen Helden keine Chance. Sie fielen oder nahmen sich selbst das Leben.
Doch der Rachefeldzug der Nazis war damit nicht beendet. Weil zwei der festgenommenen Widerstandskämpfer aus dem Ort Lidice (deutsch: Liditz) stammten, umstellten Gestapo und SS am Abend des 9. Juni 1942 den Ort nahe Prag und verübten ein grauensames Kriegs-

verbrechen. Alle 172 Männer des Dorfes, die älter als 15 Jahre waren, wurden erschossen. Die Frauen und viele Kinder wurden in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, wo viele von ihnen die Strapazen nicht überlebten. Im ganzen Land kam es anschließend zu weiteren Verhaftungen (siehe oben).
Nach dem Massenmord und den Deportationen brannten die Nazis das Dorf nieder und ließen es durch den Reichtsarbeitsdienst einebnen. Der perfide Plan der Nazis, daß nichts mehr an Lidice erinnern sollte, ging jedoch nicht auf. Heute ist die Gedenkstätte Lidice einer der wichtigsten Erinnerungsorte im (sudeten-)deutsch-tschechischen Verhältnis. So führte 2011 der zweite offizielle Besuch des damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, maßgeblich organisiert und geplant worden war, auch nach Lidice. Zum 80. Jahrestag der Operation Anthropoid sagte Premierminister Petr Fiala: „Josef Gabčík, Jan Kubiš und all die anderen, die an der Vorbereitung und der Beseitigung Heydrichs beteiligt waren und dafür mit ihrem Leben bezahlt haben, sind Helden, deren Taten und Verdienste niemals vergessen werden dürfen.“
hof haben wir gesehen, wie Bomben fielen. Wir hatten natürlich Angst, getroffen zu werden. Gleichzeitig hat ein Mädchen neben mir im Waggon ein Kind entbunden. Wir kamen an einem Nachmittag in Mauthausen an, und bereits am nächsten Vormittag wurde eine Gruppe von Frauen in die Gaskammer geschickt. Wir waren aus irgendeinem Grund nicht dabei.“
In Mauthausen sei sie wohl nur deshalb nicht verhungert,

weil andere Untergrundkämpfer, die dort ebenfalls gefangen waren, sie unterstützten. „Meine Freunde, die schon länger in Mauthausen waren, beschützten mich und sorgten dafür, daß ich nicht auf den Transport komme.“ Mit Transport war das Außenlager Wiener Graben gemeint, ein Steinbruch, an dessen Todesstiege und „Fallschirmjägerwand“ viele Häftlinge ums Leben kamen.
Einer, der Eva Lukash damals das Leben gerettet hat, war Zdeněk Štich, ein Arzt, der ebenfalls inhaftiert war und vielen weiteren Gefangenen vor dem Tod bewahrt hat. Nach dem Krieg arbeitete Stich im Gesundheitsministerium und an der Karls-Universität.

„Nach der Befreiung hat mir ein Freund die Todesstiege im Steinbruch gezeigt und mir erzählt, daß jeder, der die schweren Steine nicht mehr hochschleppen konnte, erschossen oder die Fallschirmjägerwand hinabgestoßen wurde“, erzählt Eva Lukash. Sie und ihre Mutter hatten das Grauen, wenn auch nur knapp, überlebt: „Meine Mutter war in einem sehr schlechten Zustand. Ich hatte Angst, ihre Hand zu halten, weil sie so dünn und so gebrechlich war.“
Nach ihrer Rückkehr nach Prag holte Eva ihren Schulabschluß nach und begann ein Medizinstudium. Nach der Machtübernahme durch die Kommunisten emigrierte sie mit ihrem Mann nach Israel, arbeitete zunächst in einem Hühnerzuchtbetrieb, später als Pharmareferentin. 1968 kam dann ihre Tochter bei einem Unfall ums Leben.
Ihr Interview für die KZ-Gedenkstätte Mauthausen hat Eva Lukash 2009 mit einem klaren Statement überschrieben: „Ich will an die Leichenberge erinnern, an die toten Menschen. Es waren unzählige.“Torsten Fricke
Mitte Oktober fand die Haupt versammlung der AckermannGemeinde (AG) im Burkardus haus in Würzburg statt.
Geistlicher Beirat Monsigno re Dieter Olbrich erinnerte nach einem Lied und der Begrü ßung durch Bundesvorsitzenden Martin Kastler in seinem geistli chen Einstieg an einige verstor bene Verbandsmitglieder der zu rückliegenden drei Jahre, dar unter der langjährige Geistliche Beirat Monsignore Anton Otte und die kürzlich verstorbene frü here Staatsministerin und Land tagspräsidentin Barbara Stamm. Als Vertreter des tschechischen Partnerverban des Sdružení AG betonte dessen Stell vertretender Vorsitzender Petr Křížek die Freude über die gute Zu sammenarbeit beider Ver bände. „Trotz der schwieri gen Zeit haben wir viel unter nommen“, sag te Křížek. Sein besonderer Dank galt dem scheidenden Bundesvorsitzen den Kastler, einen gesegneten Weg wünschte er dessen Nach folger.

Von drei bewegten Jahren sprach Kastler in seinem Tätig keitsbericht, wobei besonders die wegen Corona wieder hochgezo genen Grenzen in Erinnerung geblieben und mehrere Monate direkte Begegnungen nicht mög lich gewesen seien. Doch Kastler erwähnte auch angenehme As pekte. So das deutsch-tschechi sche Picknick am 7. August 2021 auf der Prager Hochburg mit viel Kultur, Dialog und Begeg nung. „Das war eine ganz wichti ge Botschaft, daß sich die Acker mann-Gemeinde nach den Co rona-Restriktionen als einer der ersten Player der deutsch-tsche chischen Versöhnung und Nach barschaft zurückgemeldet hat.“
Stabwechsel
Zentrales Element der Verbands arbeit von 2019 bis 2021 sei die Leitziel-Entwicklung, die unter anderem in der Digitalisierung und im neuen Erscheinungsbild sichtbar sei. Damit sollten auch neue Mitglieder gewonnen wer den. Das im Kontext der Coro na-Krise neu entstandene For mat der zunächst wöchentlichen und nun monatlichen Zooms ha be sich etabliert, 2021 und 2022 seien die Prä senzveranstal tungen wie der zurückge kehrt: Brünner Symposium, Mitwirkung beim Katholi kentag, Sude tendeutschen Tag und an Meeting Brno sowie zahlrei che Veranstal tungen in den Regionen und Diözesen.
Der schon acht Mona te dauernde Krieg in der Ukrai ne wecke nicht selten alte Trau mata und Berichte von Flucht und Vertreibung. Daher sei es wichtig, daß die AG auch weiter Flagge zeige und in der UkraineHilfe mitarbeite. Abschließend zollte er der Arbeit der Jungen
Aktion, aller weiteren Gruppen in der AG sowie der Bundesge schäftsstelle mit der seit Juli tä tigen Bundesgeschäftsführerin Marie Smolková Anerkennung. Einen besonderen Dank richtete er an die Mitglieder des Bundes vorstands der letzten drei Jahre. „Die AG ist eine Gemeinschaft, die es auch in Zukunft braucht“, schloß Kastler.
Unter Leitung von Kai Ko cher wählten die 58 Delegier ten den neuen Bundesvorstand. Mit 91 Prozent wurde Albert-Pe ter Rethmann zum neuen Bun desvorsitzenden gewählt (Ý SdZ 42/2022). Er ist Sprecher der Ge schäftsführung der Barmherzige Brüder Trier gGmbH (BBT-Grup pe) und war in der Vergangen heit bereits mehrere Jahre Mit glied des Bundesvorstandes. Ein stimmig in seinem Amt bestätigt wurde der Geistliche Beirat Ol brich, der in seiner Vorstellung sein Wirken als Präses der Sude tendeutschen, also auch für wei tere sudetendeutsche Gruppen und Vereine, betonte.


Stellvertretende Bundesvor sitzende bleiben Marie Bode und Martin Panten und wurde Rainer Karlitschek. Für die Junge Akti on sitzen nun Niklas Böhm und Katharina Heinz im Bundesvor stand. Die Diözesen und Regio nen vertreten Manfred Heerde gen, Stephanie Kocher, Seba
stian Kraft, Christoph Lippert, Kaplan Markus Ruhs und Sandra Uhlich. Die Delegierten wählten darüber hinaus noch Adriana In sel und Hermann Lüffe in den Bundesvorstand.

Über die Umstrukturierungen in der AG-Bundesgeschäftsstel le, insbesondere den zweifachen Wechsel im Amt der Bundesge schäftsführung, informierte Kle mens Heinz, Vorsitzender des Trägervereins AG. Vor allem galt sein Dank Marie Smolko vá, die bereits nach dem Weg gang von Matthias Dörr zu Reno vabis im Frühjahr viele Arbeiten übernommen und seit Juli das Amt der Bundesgeschäftsführe rin übernommen habe. Damit sei, so Heinz, auch eine Umstruktu rierung der Bundesgeschäftsstel le verbunden, was vor allem die Assistenz und Vertretung Smol kovás betreffe. Neue Jugendbil dungsreferentin sei zudem seit April Judith Rösch.
„Die AG ist lebendig und über alle Generationen hinweg ak tiv. Mit diesem Selbstverständ nis können wir in die nächsten drei Jahre gehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, schloß Rethmann die Versammlung.
Beim Gottesdienst im Hono rine-Saal der Kongregation der Schwestern des Erlösers erläuter te Monsignore Olbrich anhand des Tagesevangeliums zwei Auf gaben der AG: die Verkündigung des Wortes Gottes und das Gebet – füreinander sowie für die An liegen der Welt und der Kirche. Die musikalische Gestaltung ob lag Stephanie Kocher und Chri stoph Lippert. Markus Bauer
� Ackermann-Gemeinde verabschiedet Martin Kastler
Wir bleiben Christen in Europa
Nach zwölf Jahren im Amt kandidierte Martin Kastler MdEP a. D., der inzwischen für die Bayerische Europaministerin Me lanie Huml tätig ist, nicht mehr als Bundesvorsitzender der Ak kermann-Gemeinde. Sein Nachfolger Albert-Peter Rethmann war ebenfalls bei der Hauptversammlung 2010 in das weite re Leitungsamt des Geistlichen Beirats gewählt worden, das er nach seinem Wechsel in den Laienstatus wieder zurückgege ben hatte.
Barbara Krause und Margareta Klieber geehrt

Martin Kastlers letzte Amts handlung als Bundesvorsitzen der der Ackermann-Gemein de (AG) war die Verleihung der Goldenen Ehrennadel an Barba ra Krause und Margareta Klie ber. Ein Zeichen, daß Frauen die AG stark prägen.
Im badischen Bad Dürrheim kam Barbara Krause 1945 zur Welt, doch die Wurzeln der Fa milie liegen in Böhmen. Daher war sie von Beginn an eng mit der AG verbunden. „Du warst bei der historischen Predigt von Pa ter Paulus Sladek 1955 in Haid mühle zugegen. Auch wenn Du seine Aussagen damals nicht ein ordnen konntest, spürtest Du die Bedeutung dieses Moments“, er innerte Kastler an ein wichtiges Datum in der AG-Geschichte. 1964 bis 1969 studierte Krause in Freiburg und Wien Politikwis senschaft, Geschichte und Ger manistik und machte das Erste Staatsexamen, 1973 promovierte sie. 1969 bis 1971 war sie Bundes führerin der Jungen Aktion (JA), 1972 bis 1978 war sie hauptamtli che Bundesvorsitzende des Bun des der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – wohlgemerkt in einer Zeit des Aufbruchs in der Kirche nach dem Zweiten Vati kanum und während der Würz burger Synode 1971 bis 1975. Ei nige Tätigkeiten in der Erwach senenbildung und insbesondere regelmäßige Lehraufträge an der Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen in Aachen mündeten 1997 bis 2010 in die Professur für Politikwissenschaf ten. Ihr Schwerpunkt war Sozi
ale Arbeit mit Gender, Migrati on und Integration. „Gerade Mi gration und Integration sind für Dich als Flüchtlingskind ein Her zensthema. Von Deinen Erfah rungen und Deiner Kompetenz durften wir in der AG sehr profi tieren“, erklärte Kastler.
Neben ihrem Beruf engagier te sich Krause auch ehrenamt lich als Mitglied im Zentralkomi tee der deutschen Katholiken, als Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax, als Vorstandsmitglied des Diözesan-Caritas-Verbandes Aa chen, als Mitglied der Unterkom mission für die Wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Kommission X – Weltkirchliche Aufgaben – der Deutschen Bischofskon ferenz und als AG-Mit glied. Nach ihrer Emeri tierung ar beitete sie im Bundes vorstand mit. „Dir ist es zu ver danken, daß das Thema Migration und Integra tion in unse rer Arbeit gestärkt wurde. Deine Fähigkeit, divergierende Positio nen oder unterschiedliche Ansät ze zu verbinden, wurde oft ge braucht. Auch viele inhaltliche Positionierungen und Ausgestal tungen von Veranstaltungen tra gen Deine Handschrift. Du bist inhaltlich wie menschlich eine Bereicherung für jede Diskussi
on. Geschätzt wirst Du auch als Referentin in der AG und als Mo deratorin bei Brünner Symposi en, Begegnungstagen von AG und SAG oder Katholikentag. Wenn Du eine Moderation über nahmst, konnten wir uns darauf verlassen, daß diese lebendig, wertschätzend und zugleich ziel gerichtet verlief“, lobte Kastler. „Dein jahrzehntelanger, nach haltiger Einsatz für unsere Ziele gibt mir Anlaß, Dir im Namen des Bundesvorstandes für alles Mit denken und Mittun von Herzen zu danken“, sagte Kastler und verlieh Krause die Goldene Eh rennadel.
Margareta Klieber stammt aus dem westfälischen Höxter. Zu nächst wurde sie Krankenschwe ster. Nach Stationen in Düsseldorf und Sieg burg stieg sie zur Un terrichts schwester auf und wur de Stell vertreten de Leitende Unterrichts schwester an der Kran kenpflegeschule in BielefeldBethel. Dann zog sie nach Athen, wo sie in der deutschen Katho lischen Gemeinde zunächst eh renamtlich und dann hauptbe ruflich arbeitete. Nach sieben Jahren wechselte sie nach Prag. Sie wurde Mitarbeiterin der neu en katholischen Seelsorgestel le für Deutschsprachige und traf

dort Monsignore Anton Otte. „Er brachte Dir nicht nur unser Nach barland und die deutsch-tsche chischen Beziehungen näher, er lebte Dir auch vor, was die AG ausmacht: Dialog und Versöh nung, um auf den schmerzhaf ten Erfahrungen der Geschichte gemeinsam eine europäische Zu kunft zu bauen. Über Toni durf test Du erleben, daß die AG mit ihrer Mission etwas Besonderes ist“, sagte Kastler.
1997 bis 1999 übernahm Klie ber in der Bundesgeschäftsstel le in München die JA-Bundes geschäftsführung und setzte mit der deutsch-tschechischen Kin derfreizeit Plasto Fantasto neue Akzente. 2005 ernannte die JA sie zum Ehrenmitglied.
Nun wurde sie Assistentin des Generalsekretärs oder später des Bundesgeschäftsführers. 2011 bis 2014 arbeitete sie in Kastlers Europabüro, der damals MdEP war. Bis zum Ruhestand arbei tete sie in der AG-Diözesange schäftsstelle München-Freising. Bis heute verwaltet sie stunden weise Karteien und Spenden in der Bundesgeschäftsstelle. Es gebe keine andere Person, die als Hauptamtliche in der AG so viele verschiedene Positionen beklei det habe, sagte Kastler. „Dein jahrzehntelanger, engagierter und nachhaltiger Einsatz für un sere gemeinsamen Ziele gibt mir Anlaß, Dir im Namen des Bun desvorstandes für alles Mitden ken und Mittun von Herzen zu danken“, drückte Kastler seine Anerkennung aus und überreich te die zweite Goldene Ehrenna del. Markus Bauer
Nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprä chen mit meiner Familie ha be ich bei unserer letzten Bun desvorstandssitzung Ende Ju ni unserem Bundesvorstand mitgeteilt, daß ich nicht mehr für das Amt des Bundesvor sitzenden zur Verfügung ste hen werde.“ Mit diesen Wor ten hatte sich Kastler zuvor per Rundschreiben an die De legierten der Hauptversamm lung gewandt. In seinem Rückblick bei der Versammlung sprach er von „spannenden Jahren mit vie len Highlights“. Auf Vorschlag des früheren Bundesvorsitzen den Walter Rzepka hatte Kast ler seit 2004 dem Bundesvor stand angehört, so daß er 18 Jahre die Arbeit auf Bundes ebene begleitet und mitgestal tet hatte. Unvergessen bleiben ihm die Bundestreffen 2009 in Pilsen und 2015 in Budweis so wie das Treffen 2012 in Baut zen und die deutsch-tschechi schen Begegnungstage 2019 in Landshut. Weitere Höhe punkte waren für ihn die Wall fahrt nach Rom 2016 und das Picknick auf dem Wyschehrad 2021. Diese und viele weite re Veranstaltungen und Aktio nen hätten, so Kastler, zur Ver wurzelung der AckermannGemeinde (AG) im kirchlichen Geflecht beigetragen.
„Es war mir stets eine Eh re und Freude, als Nachfol ger von Adolf Ullmann die Geschicke unserer Gemein schaft so lange mitzuprägen. Wir haben gemeinsam viel ge schafft, viele Meilensteine er reicht und sind gut aufgestellt, bestens vernetzt – gesell schaftlich wie kirchlich. Allen Weggefährten und Geschwi stern im Glauben in Deutsch land wie in Tschechien, in der Ackermann-Gemeinde, der Sdružení Ackermann-Ge meinde und anderen befreun deten Verbänden danke ich für die freundschaftliche und vertrauensvolle Zusammenar beit“, hatte er im Rundschrei ben gedankt. Auch ging er auf die aktuellen Zeitumstän de ein. „Es herrscht mitten in Europa wieder Krieg, und der Dialog über unsere Freiheit, Demokratie und Europa wird jetzt um so nötiger. Unser Auf trag als AG bleibt aktuell: Als Christen in Europa wollen wir uns aktiv in die Gesellschaft einbringen, für Frieden und Versöhnung streiten. Jeder an seinem Ort und mit seinem Ta lent.“
Ausführliche und persönli che Dankesworte richtete für
die AG Bundesgeschäftsfüh rerin Marie Smolková an Kast ler. „Seit mehr als zwölf Jahren gestaltest Du die inhaltliche Arbeit unserer Gemeinschaft. Damals hast Du mit Albert-Pe ter Rethmann einen Weg der Erneuerung eingeschlagen.“ Damals sei es darum gegan gen, wie ein Vertriebenenver band zu einem Verband in der katholischen Kirche mit dem Schwerpunkt „Christsein in Europa“ werde. Kastler habe den Europäischen Essaywett bewerb im Rahmen des Brün ner Symposiums eingeführt sowie neue und offene For mate bei den Bundestreffen wie Sternfahrt, Europa-Puzzle oder die bayerisch-böhmische Kulturnacht initiiert. All dies beweise, daß der Reifungs prozeß der AG dank Kastlers Ideen und politischen Stand punkte die Gemeinschaft wei tergebracht habe. „Besonders wichtig war Dir immer der er weiterte Blick auf ein friedli chen Miteinander in Europa. Das zeigt sich in dem 2016 for mulierten Leitziel ‚Unser Mit einander stärkt das europä ische Denken‘.“

Smolková sagte, der Bun desvorstand habe nicht mit Kastlers Entscheidung, das Amt des Bundesvorsitzenden abzugeben, gerechnet. „Du bist eine wichtige Säule im Prozeß der Erneuerung und Weiterentwicklung unserer Gemeinschaft durch Deine Er fahrungen und Perspektiven, Ideen, politischen Kontak te – aber auch durch Deinen Blick über den Tellerrand. (…) Du hast unsere Gemeinschaft durch diese Reifephase be gleitet. (…) Für all das sind wir Dir dankbar. Wir hoffen, wie Du versprochen hast, auf Dei ne weitere Unterstützung.“
Zum Abschied schenkte Smolková Kastler ein hölzer nes Schneidebrettchen und ei nen Picknickkorb. Diesen füll ten danach die Vorstandsmit glieder mit Gegenständen aus ihrer Region oder mit Utensili en, die an Begebenheiten und Anekdoten mit Kastler erin nerten.
„Die Erinnerungen blei ben“, sagte Kastler über die zahlreichen Geschenke und erwähnte den Tod seiner Mut ter einige Tage zuvor, die Wur zeln in Böhmen gehabt habe. Er versprach, auf Diözesan ebene aktiv zu bleiben und am Symposium in Brünn wieder teilzunehmen. „Wir bleiben Europäer und Christen in Eu ropa“, schloß Kastler. Markus Bauer
Die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Kün ste veranstaltete letzten Frei tag im Sudetendeutschen Haus in München ihren Festabend 2022. Den Festvortrag über „Von den Erbsen zu mRNA-Impfstof fen“ zu Gregor Mendels 200. Ge burtstag hielt der Zellbiologe Widmar Tanner. Mit dem AdolfKlima-Preis ausgezeichnet wur de der Musiker Linus Köring, auf den Wolfram Hader die Lau datio hielt. Die musikalischen Werke des Festabends boten Ja mina Gerl und Dietmar Gräf am Flügel, Anette Luig und KlimaPreisträger Köring dar. Fast al le Beteiligten auf der Bühne wa ren SL-Kultur- oder -förderpreis träger.
Gregor Mendel hat die wis senschaftliche Genetik be gründet“, erklärte Widmar Tan ner bei seinem Bildervortrag. Die Anwendung von Genetik sei für unsere Landwirtschaft und Me dizin und damit unser Leben von immenser Bedeutung. „Neben Darwin gilt Mendel als der be deutendste Biologe aller Zeiten und ist wohl auch der berühm teste Wissenschaftler unserer Heimat.“ Der Zellbiologe wurde 1938 im mährischen Wag stadt geboren, nicht weit entfernt von Heinzendorf, wo Gregor Johann Men del vor 200 Jahren zur Welt kam.
In seiner Festrede er klärte Tanner anschaulich, wie Mendel als Mönch im Augustinerkloster zu Brünn mit Erbsenpflan zen Kreuzungs-Versuche durchführte. Damals habe die Meinung geherrscht, daß der Pollen einer Pflan ze den präformierten Emb ryo enthalte, und die Eizel le diesem nur als „Amme“ diene. Mendel habe sich gefragt, wie dennoch gut unterscheidbare Merkma le an die jeweils nachfol genden Generationen weiterge geben werden könnten.
Von den Ergebnissen sei ner 28 000 Erbsen-Kreuzungen im Lauf von sieben Jahren habe Mendel seine Regeln abgeleitet, die er 1866 veröffentlicht habe.
„Da sie keiner verstand, notier te Mendel: ,Keine Fragen, keine Diskussion.‘“ Erst 34 Jahre nach ihrer Publikation und 16 Jahre nach Mendels Tod seien diese Entdeckungen von der Wissen schaft wahrgenom men und verstanden worden. „Aufbau end auf Mendels Be obachtungen ergab sich eine Fülle von Fragen, die mit Hil fe einer neuen Fach richtung, der Mo lekularbiologie, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun derts weitgehend ge löst wurden.“ Tanner zählte viele der nach folgenden Wissen
Komponisten und Oden
finden können. Als Geschenk der Akademie an ihren Altpräsiden ten hatte damals Ursula Haas ei ne „Anakreontische Ode“ ver faßt, deren Vertonung nun vom Komponisten, dem Musikall rounder Dietmar Gräf, gemein sam mit der Sängerin Annette Luig uraufgeführt wurde.


schaftler auf, die weitere Mosa iksteine für die Genetik lieferten. Neben den „üblichen Verdächti gen“ wie die Biochemikerin Ro salind Franklin und danach die Molekularbiologen James Wat son und Francis Crick mit ihrer Entdeckung der DNA-Doppelhe
sowie Cytosin und Guanin je weils immer im gleichen mola ren Verhältnis vorkommen, for mulierte Chargaff die Regel, daß diese Basen stets paarweise auftreten.
„Das angehäufte Wissen über Details der Genetik führte zu ei
te. „Dazu zählen auch die gen technisch hergestellten mRNA Impfstoffe gegen Corona-Viren“, schloß Tanner.
Der aktuelle und hochwissen schaftliche Vortrag stellte ein ty pisches Beispiel für die großar tigen Veranstaltungen der Su
darunter 59 ordentliche Mitglie der, so Krejs. Und trotz der Lie ferschwierigkeiten von Papier sei gerade die jüngste Publikation aus der Schriftenreihe der Aka demie erschienen: Der Band 41 über „Akademie und Universi tät“ mit 203 Seiten enthalte elf
Die Ode richtet sich an Ze man, der darin mit dem griechi schen Lyriker und Hofdichter Anakreon verglichen wird. Ähn lich wie dieser sei der österreichi sche Germanist Zeman aufgebro chen, um „Poetae austriaci weit in die Welt zu tragen / von Wien nach Rom, von Stanford, Kai ro hin bis Cordoba. / Kehrt heim er mit Olympisch Gold der Wis senschaft / wie einst Odysseus in sein Ithaka ...“ Die Lobeshym ne von Haas und Gräf erwider te Zeman mit einer eigenen Dan kesode: „Ein Lied ist‘s, eine Ode, ernsthaft und auch heiter / ein Wunder auf der Musen hehren Töne-Leiter. / Zu seinem Ruh me sei es jedermann verkündet / Glanzvoll sind Wort und Ton im Werk verbündet.“
Danach kam es zum näch sten Höhepunkt: Der Kompo nist Linus Köhring wurde mit dem Adolf-Klima-Preis 2022 ausgezeichnet und freu te sich sehr, als Präsident Krejs ihm mit der PreisStifterin Luitgard Klima die Anerkennungsurkun de überreichte.

lix 1953 erwähnte Tanner erfreu licherweise in seinem Vortrag auch die Leistung des Chemikers Erwin Chargaff.
Geboren 1905 in Czernowitz in der Bukowina, stellte dieser die Chargaff’schen Regeln auf. Nachdem er in der zweiten Hälf te der vierziger Jahre festge stellt hatte, daß in der DNA je des untersuchten Lebewesens die von Albrecht Kossel entdeck ten Basen Adenin und Thymin
ner Vielzahl von Anwendungen von großer Bedeutung, die un ser tägliches Leben erleichterten, ja sogar menschliches Überleben ermöglichten“, resümierte Tan ner. Betroffen seien besonders Züchtungen, etwa gentechnisch veränderter Pflanzen, die dann teilweise als Kraftfutter für Vieh und Mensch die Gentechnik in die Nahrungskette brächten.
Eine weiterer Nutzen sei die Entwicklung neuer Medikamen
detendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste dar.
Aktueller Festvortrag
Einige davon erwähnte Aka demiepräsident Günter J. Krejs in seinem Jahresrückblick. Der in diesem Zeitraum fünf verstorbe nen Mitglieder – darunter vier SL-Kulturpreisträger – wurde in einer Schweigeminute gedacht. Derzeit habe die Akademie 152,


Beiträge, die konzis um die Fra gen des akademischen und un versitären Lebens kreisten, er läuterte Stefan Samerski. Der Akademie-Vizepräsident war als Sekretar der Geisteswissen schaftlichen Klasse federführen der Redakteur.
Krejs freute sich, daß endlich wieder nach dem Corona-Aus fall etliche Veranstaltungen der Akademie mit Gästen stattfin den konnten, etwa im vergange nen Juli ein Symposi um zum 75. Geburts tag des Präsidenten selbst. Auch die dies jährige Vortragsreihe von Akademie-Vize präsident Stefan Sa merski über „Böh men macht Weltge schichte“ habe reges Interesse gefunden. Im März habe endlich auch das verschobe ne Symposium zum 80. Geburtstag von Herbert Zeman statt
Die Laudatio auf den jungen Musiker hielt der Musikverleger Wolfram Hader. Der Sekretar der Klasse der Künste und Kunstwissenschaften er läuterte, daß Linus Köh ring väterlicherseits aus dem Riesengebirge stam me und im Jahr 2000 ge boren worden sei. Früh habe Köhring mehrere Instrumente zu spielen ge lernt. „Mit fünf Jahren un ternahm er erste Kompo sitionsversuche. Als Sie benjähriger errang er für zwei Werke seinen ersten Kompositi onspreis“, schilderte Hader den Beginn dieser Karriere. Köh ring sei ein „äußerst produkti ver Komponist“ und mehrfacher Preisträger nationaler und inter nationaler Kompositionswett bewerbe. Der Preisträger liefer te virtuos auf seiner Geige einen musikalischen Dank mit drei Sät zen aus seinen „42 Symphoni schen Capricen“.




Linus Köhrings Geigenspiel war nur einer der Höhepunkte des musikalischen Programms. Neben der „Anakreontischen Ode“ von Haas und Gräf gab es am Festabend auch fünf Werke von Markus Karas, die Jamina Gerl zauberhaft auf dem Flügel spielte. Mit reichem Applaus be lohnte das Publikum den Klang genuß. Leiblichen Genuß gab es dann bei einem dionysischen Buffet von Fino-Feinkost beim Empfang der Akademie im Ottovon-Habsburg-Foyer.
 Susanne Habel
Susanne Habel


Im Sudetendeutschen Haus in München wurde der neueste Film von Edwin Bude gezeigt.
Der diesjährige Kulturpreis träger für Publizistik (Þ SdZ 22/2022) stellte „Sagen, Mär chen und Mythen aus den Sude tenländern und den ehemaligen deutschen Ostgebieten“ vor.


Die Vorführung war eine Veran staltung der Sudetendeutschen Heimatpflegerin Christina Meinusch und dem Haus des Deut schen Ostens (HDO) in Mün chen.
Sagen, Märchen und Mythen
bezahl. Ihr braucht keine Angst vor ihm zu haben. Er hilft allen Bedrängten, und so wird er auch uns helfen.“ Und Rübezahl und der Glaube an ihn hätten tatsäch lich geholfen, schloß Broßmann. „Unversehrt wurde später unse re ganze Familie in Westdeutsch land wieder zusammengeführt.“
I
n Schlesien und Ostpreußen, Böhmen und Mähren sowie weiteren Landschaften des östli chen Europas, darunter Ostpreu ßen, Siebenbürgen, das Banat, die Ukraine und Rußland, brach te die deutschsprachige Erzähl tradition zahlreiche Märchen, Sagen und Mythen hervor. Ed win Bude war ursprünglich Pro grammierer und ist in den letz ten Jahren als Filmemacher her
Ergebnisse sind in seinem Film nach Re gionen geordnet. Es geht darin von Schle sien mit Rübezahl über die Beskiden und Karpaten zu den Donauschwaben und Siebenbürger Sach sen. Im zweiten Teil des Filmes kommen Deutsche aus Bessa rabien und Ukraine, die Wolgadeutschen sowie aus Ostpreu ßen und dem Balti kum dran.
Die ausgewähl ten Märchen, Legen den und Sagen wer den meist von einem Referenten vor einem passenden Hinter grundbild mit Bluescreen-Tech nik vorgetragen und ganz selten vor Ort in den heimatlichen Re gionen gedreht. Die Handlung der Texte wird dabei nicht fil misch dargestellt. Zum Einstieg erzählt Bude selbst die Sage „Der Pfarrer im Moor“. Am Ende des Films trägt Helmut Hahn exem plarisch für das Sudetenland die Egerländer Saga „Der Hans-Hei ling-Felsen“ vor. Für Freunde al ter Sagen und Märchen ist dieser Film eine Fundgrube für fast in Vergessenheit geratenes Volks gut.
Historisch wichtiges Wissen über die Regionen wird bei Bu de von sachkundigen Experten vermittelt. Sein Mitarbeiter Cor nelius von der Heyden führt da für Gespräche unter anderem mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt, der Vorsitzenden der Karpatendeutschen, Brunhilde Reitmeier-Zwick, und dem HDODirektor Andreas Otto Weber.
sonderer Bedeutung erwies sich dabei, daß dieser Film die dar in präsentierten Märchen, Sagen und Mythen in die Geschichte je ner Gebiete des östlichen Euro pas einordnet, in denen man ih re Ursprünge annimmt, sowie in den Kontext ihrer transkulturel len Prozesse.“ Die meisten Mär chen und Sagen, die in Budes Film vorkämen, stammten aus dem Buchbestand der HDO-Bi bliothek, die eine Sammlung von über 700 Märchen- und Sagen bücher besitze.
Heimatpflegerin Christina Meinusch trug das Grußwort von Sylvia Stierstorfer MdL vor. Die

Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussied ler und Vertriebene betonte: „Sagen, Märchen und Mythen entführen uns in eine magi sche Welt und immer auch ein wenig in unsere eigene Kind heit.“ Sie freue sich, so Stier storfer, über den Film von Ed win Bude, der ein Meisterwerk sei, „weil er uns eine Welt na hebringt, die lange verschol len schien“.
Auch der SL-Bundeskultur referent äußerte sich in seinem Grußwort sehr persönlich. Ulf Broßmann erzählte eine Anek dote aus seiner eigenen Kind
heit. Seine Mutter sei im April 1945 mit ihren Kindern vom Kuhländchen bis ins Riesengebirge geflo hen, wo sie schwer bei einem Bauern ge arbeitet habe.
Bei einer Wande rung nach Johannis bad habe am Eingang zum Kurpark eine große Granitskulptur mit einem Kopf mit wilden Augen und zotteligen Haaren gestanden, erinner te sich Broßmann. Er und seine Geschwi ster hätten Angst be kommen. Die Mutter habe sie jedoch be ruhigt: „Das ist Rü
Das große Publikum im Adal bert-Stifter-Saal freute sich über die Wieder- oder Neuentdek kung von sagenhaften Gestalten und märchenhaften Geschehnis sen und genoß die leckere Bewir tung durch die HDO-Gaststätte Zum Alten Bezirksamt. Und auch die DVDs mit dem Film gingen weg wie warme Semmeln.
Susanne HabelEdwin Bude: „Sagen, Märchen und Mythen aus den Sudetenlän dern und den ehemaligen deut schen Ostgebieten“. Eigenver lag, München 2022; 90 Minuten, 20 Euro plus Versandkosten. Er hältlich bei Edwin Bude, Würm talstraße 43 a, 81375 München. Telefon (01 77) 6 51 45 52; eMail waldfreund@edwin-bude.de


vorgetreten. Für seine jüngste Dokumentation begab er sich auf die Spurensuche nach my thischen und märchenhaften Fi guren im Deutschen Osten. Die
Zur alljährlichen Großveran staltung der Landesversamm lung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik war die Heimatpflegerin Christina Meinusch nach Prag eingela den (Þ SdZ 42/2022). In ihrem Gepäck hatte sie die Böhmer wald Sing und Volkstanzgrup pe München. Andreas Schmal cz hatte die Fahrt organisiert und die Gruppe zum Hotel und Kongreßzentrum geführt, wo die Großveranstaltung stattfand.
Da die Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik seit 30 Jahren besteht, wurde dies mit einem Festakt unterstrichen. Anfangs sprachen die Gäste von verschiedenen Ministerien und Organisationen Grußworte. Dar
Dazu erläuterte in Webers Ver tretung im Adalbert-Stifter-Saal die HDO-Öffentlichkeitsreferen tin Lilia Antipow: „So war es auch dem Haus des Deutschen Ostens ein Anliegen, Edwin Budes Film nach dem Förderungsprogramm des Bayerischen Staatsministeri ums für Familie, Arbeit und So ziales zu unterstützen. Von be
in betonten sie die gute Zusam menarbeit und den wertvollen Beitrag der deutschen Vereine für die Gesellschaft.
Als ein Beispiel für grenzüber schreitende Arbeit und Partner schaften wurden die Böhmerwäl der aus München auf die Bühne gebeten, um ihre musikalischen Grüße zu überbringen. Mit „Grüaß di Goud“ im Böhmer wäldler Dialekt standen die Sän gerinnen und Sänger frohgemut auf der Bühne. „Auf der Prager Brück“ sangen sie hier in Prag und hatten es spontan schon am Vorabend auf der Karlsbrük ke über die Moldau gesungen. Das bekannte Lied „Blaui Fen stal“ stammt aus Krummau, der Stadt die ebenfalls an der Mol dau liegt. Die Handwerksarbeit im Böhmerwald beschrieben die
Sang und Tanz
„Hulzknechtbuama“ und der „Stoahauer“, bevor die Böhmer wäldler mit dem Wuldalied die Moldau besangen.
Geleitet wurde der Chor von Martin Januschko. Janusch ko und Mitsängerin Birgit Un fug sind übrigens Mitglieder der Sudetendeutschen Bundesver sammlung.

Zwischendurch zeigte die Sing- und Volkstanzgruppe auch Tänze aus ihrer Heimat wie den Böhmerwald-Landler. Er ist ein beliebter Ländler, der der Über
lieferungen zufolge aus Krum mau stammt, weshalb er auch den Namen „Krummauer“ trägt.
Der Spinnradltanz ist aus dem oberösterreichischen Mühlvier tel, dem nördlichen Niederö sterreich, dem Innviertel, dem Böhmerwald und dem Bayeri schen Wald sowie aus Oberbay ern überliefert. Die Wickelfigur dieses Tanzes dürfte in einem ur sächlichen Zusammenhang mit dem Namen stehen, zu dessen Verbreitung allerdings das da zugehörige Tanzlied vom Spinn
radldrahn in erster Linie beige tragen hat.
Die Sternpolka ist ein Figu rentanz, der auf die Linzer Pol ka zurückgeht. Die Linzer Pol ka stammt ursprünglich aus dem Mühl- und Waldviertel in Obe rösterreich und wurde von dort wahrscheinlich von tschechi schen Musikanten nach Bud weis in Südböhmen gebracht. Dort wurde sie unter dem Namen „Doudlebska Polka“ gespielt und getanzt. Heute ist sie als „Stern polka“ oder dem ursprünglichen Namen „Doudlebska Polka“ be kannt und wird in Westeuropa und Nordamerika getanzt. Die Sternpolka fand weite Verbrei tung in ganz Bayern, da sie 1972 als Aufführung für die Abschluß feier der Olympischen Spie le in München vorgesehen war


und daher in vielen bayerischen Trachtenvereinen geprobt wur de.
Weitere Gruppen der deutsch sprachigen Bevölkerung gestal teten den schönen Kulturnach mittag. Zum Abschluß kamen al le Trachtenträger auf die Bühne und sangen mit den Besuchern „Kein schöner Land“. Textsicher führte die Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München noch die vierte Strophe weiter.
Anschließend gab es noch ein gemütliches Beisammensein mit dem „Prager Hradschiner Orche ster“ von Josef Kocůrek. Thomas, das jüngste Mitglied der Böh merwäldler, wagte sich allein auf die Tanzfläche und bat minde stens seine Eltern zum Tanz. Die mitreißende Musik ließ kaum ei nen auf dem Stuhl sitzen. no


Vertreibung ist keine Migration
Der hessische BdV-Kreisver band Limburg-Weilburg hat te zum Tag der Heimat Mit te Oktober wieder nach Weil münster in das Bürgerhaus eingeladen.

Kreisvorsitzender Josef Plahl sagte, das diesjähri ge Leitwort laute „Vertriebene und Spätaussiedler – Brük kenbauer in Europa“. Mit der Verabschiedung der Charta der deutschen Heimatvertrie benen vor 72 Jahren in Stutt gart hätten diese versprochen, – trotz Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend – für eine bessere Zukunft für sich selbst, aber mehr noch für Deutsch land und dessen Nachbarlän der hart zu arbeiten. Der BdVKreisverband Limburg-Weil burg habe daher vor 1989 und danach Reisen nach Polen, Ungarn, Kroatien, Slowenien und in die Tschechische Repu blik sowie in die Slowakei or ganisiert.
Josef Plahl begrüßte ei ne stattliche Zahl von Eh rengästen wie Markus Koob MdB, Marion Schardt-Sauer MdL, Tobias Ek kert MdL, An dreas Hofmei ster MdL und Joachim Vey helmann MdL, die Bürgermei ster Mario Ko schel aus Weil münster, Britta Löhr aus Wein bach, Peter Blum aus Wald brunn und Tho mas Scholz aus Mengerskir chen, Rupprecht Keller als Vertreter des Landrats und Christian Wendel, CDU-Frak tionsvorsitzender im Kreistag, sowie Arnold Radu.
Besonders herzlich will kommen hieß Plahl Margarete Ziegler-Raschdorf, Festredne rin und Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spät aussiedler, und die Egerländer Maderln aus Mengerskirchen, unter der Leitung von Jennifer Nowak.
Grußworte sprachen der Bürgermeister von Weilmün ster, der Bundestagsabgeord nete, zwei Landtagsabgeord nete und der Vertreter des Landtags sowie ein einheimi scher Bürger aus Weilmün ster, der die Freundschaft mit den Vertriebenen betonte.
Margarete Ziegler-Rasch dorf überbrachte die Grüße des neuen Ministerpräsiden ten Boris Rhein und des In nenministers Peter Beuth. In ihrer Festansprache brach
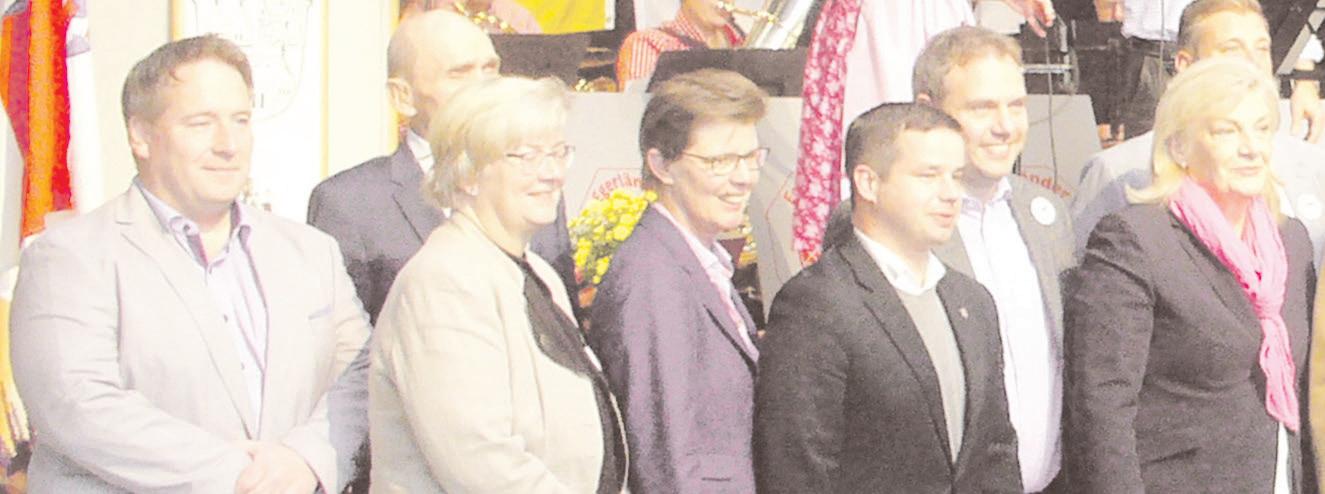
te sie zum Ausdruck, was die Menschen und insbesonde re die Heimatvertriebenen als „Stunde Null“ erlebt hätten. Rund 15 Millionen Deutsche seien aus den früheren Ostge bieten des Deutschen Reiches und den angestammten Sied lungsgebieten in Ost-, Mittelund Südosteuropa aus ihrer Heimat vertrieben und in eine ungewisse Zukunft geschickt worden.
Die Vertreibung, die Millio nen Deutsche nach dem Zwei ten Weltkrieg hätten erleben müssen, stehe in der Reihe der dramatischen, menschen verachtenden Ereignisse die ser Zeit – dem brutalen und völkerrechtswidrigen Vernich tungskrieg Rußlands gegen die Ukraine. Dabei habe die Spaltung unseres Kontinents nach dem Ende des Kalten Krieges ein für alle Mal über wunden geglaubt. Wladimir Putins imperialer Wahn zer störe das Leben der Ukrainer, aber nicht nur das Leben, auch das Land und die Lebens grundlagen der Menschen.
Weiterhin führte ZieglerRaschdorf aus, daß die Charta der deutschen Heimatvertrie benen, ein Do kument der Ver söhnungsbe reitschaft und des Rachever zichts, aus der Feder der Men schen stamme, die erst kurz zu vor ihre Heimat und damit al les verloren hät ten. Und die Brückenfunkti on sei durch die Charta über haupt erst möglich geworden. Sie sagte mit großer Über zeugung, daß sie allen Ver triebenenverbänden und den Landsmannschaften in Hessen dankbar sei, die über sieben Jahrzehnte hinweg Erinne rungs- und Kulturpflege gelei stet hätten, wozu insbesonde re auch die Tage der Heimat zählten.
Die Landesbeauftragte äu ßerte sich auch zum Thema Migration, das heute die po litische Aufmerksamkeit be herrsche. Unter diesem Be griff sollten zunehmend auch Flucht, Vertreibung und De portation zusammengefaßt werden. Das lehne sie ent schieden ab. „Flucht und Ver treibung sind keine Form der Migration“. Migration habe immer einen Moment der Ei geninitiative und der Freiwil ligkeit, nicht aber Flucht und Vertreibung. fl
Brückenbauer in Europa
„Vertriebene und Spätaussied ler – Brückenbauer in Europa“: Unter diesem Leitwort steht heu er der Tag der Heimat in Verbin dung mit dem Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation. Der oberfrän kische BdV-Kreisverband Bay reuth hatte für Mitte Oktober zu einer Feierstunde in den Gast hof Specht in Fichtelberg-Neu bau eingeladen.
Die Bedenken des BdV-Kreis vorsitzenden Helmut Hem pel bezüglich eines Neuanfangs nach zwei Jahren Corona-Pau se waren schnell zerstreut. Mehr als 70 Besucher, unter ihnen vie le Ehrengäste, waren zu der Ver anstaltung gekommen. Die Ver anstaltung sei, betonte Hempel, ein Beitrag zum demokratischen Bewußtsein in unserem Land und diene dem Auftrag der Völker verständigung in Europa. „Unse re Solidarität“, so der Kreisvorsit zende, „gilt aber auch heute den Betroffenen weltweit, besonders der Bevölkerung in der Ukraine.“ Dabei könne sich die eine oder der andere sicher noch an das ei gene Schicksal erinnern.
An Gedenktage und an die Wallfahrten mit erfreulicherwei se jetzt wieder mehr Leuten, dar unter auch junge Menschen, er innerte der Vertriebenenseel sorger des Erzbistums Bamberg, Monsignore Herbert Hautmann. Er sei sich sicher, daß Integrati on wie nach 1945 auch eine Auf gabe der Religion sei. Seine Bot schaft lautete: „Wir sind für euch alle da!“

„Fichtelberg ist meine Hei mat“, sagte Bürgermeister Se bastian Voit. Flucht und Vertrei bung kenne er nur aus den Medi en, betonte er. Er verbeuge sich vor den Leistungen des BdV und der Sudentendeutschen Lands mannschaft und verspreche, daß die Gemeinde, die im vergange nen Jahr 112 ukrainische Flücht linge aufgenommen habe, auch weiterhin die deutschen Vertrie benen unterstützen werde.
Stephan Unglaub, der als Stellvertreter des Landrats Flori an Wiedemann gekommen war, nannte den BdV einen Experten der Verständigungspolitik und deren wichtigstes Sprachrohr. Er bat, weiterhin Brücken zu bau en. Gerührt und beeindruckt von der Geschichte der Vertriebenen zeigte sich auch CSU-Kreisvor sitzender Franc Dierl, der selbst sudetendeutsche Wurzeln be sitzt.
Vor seiner sehr persönlichen Festrede dankte BdV-Landes vorsitzender Christian Knauer Fichtelbergs SL-Ortsobmann Ru dolf Kiesewetter, der die Versam melten begrüßt hatte, für des sen jahrzehntelanges Engage ment mit einer Chronik. Knauer schenkte Monsignore Herbert Hautmann ebenfalls eine Chro nik und dankte ihm von Herzen für sein langes, verdienstvolles Wirken.
Der Tag der Heimat sei seit 72 Jahren für die deutschen Heimat vertriebenen, Aussiedler, Spät aussiedler und deren Nachkom men eine willkommene Gelegen heit, an den eigenen Verlust der
angestammten Heimat zu erin nern und deren Wert und Einma ligkeit herauszustellen, beton te der BdV-Landesvorsitzende. Denn heute wie morgen erlebe jeder Mensch, der gezwungen sei, die Heimat zu verlassen, ei nen dramatischen Bruch in der eigenen Biographie.
Mit dem diesjährigen Leitwort stelle der BdV ganz bewußt sei nen verständigungspolitischen Einsatz heraus. Schließlich leb ten wir in einer Zeit, in der ein Angriffskrieg der Russischen Fö deration in der Ukraine als Ver brechen gegen die Menschlich keit tobe und die Menschen sich vor einem kalten Winter und so zialer Not fürchteten.
Sorge mache ihm auch der zu nehmende deutschfeindliche Nationalismus in Polen. Der äu ßere sich in der Kürzung aus schließlich des muttersprachli chen Deutschunterrichts von drei auf eine Stunde und sei verbun den mit der Entlassung Hunder ter von Deutschlehrern aus dem Schuldienst. Dieses politische Handeln der polnischen Regie rung stelle eine Diskriminierung für rund 50 000 Kinder und ihre Familien dar, die der deutschen Minderheit in Polen angehörten.
Interessantes habe er, Knauer, bei seinen Vorträgen an Schulen festgestellt. Gebannt und ohne Blick auf Handy oder Tablet hör ten die Schüler zu, wenn er ihnen über die Geschichte von Flucht und Vertreibung erzähle. Aller dings wüßten nicht sehr viele et was über die Herkunft ihrer Fa milien; die meisten wüßten auch
nicht, was Flucht und Vertrei bung bedeute. „Wenn ich dort bei Vorträgen die Hypothese auf stelle, daß die Schüler in acht Stunden ihre Wohnungen mit 30 Kilogramm Gepäck verlassen müssen und anschließend mit unbekanntem Ziel in eine fremde Region gebracht werden, löst das ungläubiges Staunen und spä ter Nachdenken und eine neue Betrachtungsweise über Vertrei bung und Flucht aus der Heimat aus.“
Knauer hatte sogar einen Ge schenkvorschlag für Kinder und Enkel parat: „Besucht einmal zusammen mit den Eltern oder Großeltern die ,alte‘ Heimat.“ Und noch einen Rat für den Fort schritt beim gegenseitigen Ver ständnis gab er den Zuhörern mit auf den Weg, nämlich weitere Vereine bei diesbezüglichen Ver anstaltungen einzubinden, die dann noch eine ganz andere Aus strahlung bekämen.
Erzählen, aufschreiben, nach denken, weitergeben liegt SLKreis- und Bezirksobfrau Mar garetha Michel am Herzen, ver bunden mit der Freude, daß das Paurische derzeit eine Neubele bung erfahre. Ebenso wie Hel mut Hempel dankte sie für all die Worte, für Wertvolles und Wis senswertes, Ernstes und Humor volles. Wolfgang Hagen spiel te Heimatlieder zum Mitsingen und Mitsummen. Und die fröhli chen Mundartbeiträge von Horst Skripalle und Gerhard Lang quit tierten die Festgäste mit herzhaftem Lachen.
Gisela KuhbandnerNeuer Ehrenkreisobmann
Mitte Oktober fand die Jahres hauptversammlung der hessi schen SL-Kreisgruppe Oden waldkreis in Michelstadt statt.

Im Rahmen der Versammlung stellte Kreisobmann Helmut Seidel sein Amt aus gesundheitli chen Gründen zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde Gün ther Wytopil gewählt, der bereits seit einigen Jahren Betreuer der Heimatlandschaft Adlergebirge ist. Der neue Kreisobmann wür digte in seiner Laudatio das ver dienstvolle Wirken von Helmut Seidel für die Sudetendeutsche Landsmannschaft und den Bund der Vertriebenen.
Bereits im Jahre 1955 wur de Helmut Seidel Mitglied der Adalbert-Stifter-Trachtengrup pe in Darmstadt. Zehn Jahre spä
ter, 1965, trat er in die SL und in den BdV ein. 1967 bis 1973 war er Mitglied im SL-Kreisvor stand Offenbach, übte das Amt des SL-Kreisobmanns ab 1984, das des BdV-Kreisvorsitzenden ab 1987 aus. Darüber hinaus be kleidete er Ämter im BdV- und SL-Landesvorstand Hessen und organisierte viele Heimatwan derwochen sowie Begegnungs fahrten in die Vertreibungsgebiete.
Landsmann Helmut Sei del zeichnet sich durch ein ho hes Maß an ehrenamtlichem En gagement für unsere sudeten deutsche Volksgruppe und für den Bund der Vertriebenen aus und wurde hierfür mit der Gol denen Ehrennadel der Sudeten deutschen Landsmannschaft, der Rudolf-Lodgman-Plakette

der SL und dem Goldenen Eh renzeichen des BdV ausgezeich net. Dank seines jahrzehntelan ges Wirkens wurde Helmut Sei del zum Gesicht des BdV und der SL im Odenwaldkreis.
Zum äußeren Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichte ihm Kreisobmann Günther Wytopil die Urkunde zur Ernennung zum Ehrenkreis obmann. Außerdem dankte Wy topil Seidels Ehefrau Helene mit einen Blumenstrauß dafür, daß sie die vielen ehrenamtlichen Ak tivitäten ihres Ehemannes mitge tragen habe.
Landesschatzmeister Hagen Novotny übermittelte Helmut Seidel in Namen des BdV-Lan desvorsitzenden Siegbert Ort mann dessen Dank und Aner kennung. rl
Junge

Frau referiert
Gut besucht trotz Corona war der Tag der Heimat, zu dem der hessische BdV-Kreisverband Odenwald nach Michelstadt in das Hotel Michelstädter Hof eingeladen hatte.

Kreisvorsitzender Helmut Seidel konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Unter ihnen waren Erbachs Erster Stadtrat Erwin Gieß mit dem Erbacher Stadtverordneten Erich Petersik, Pfarrer Christoph Zell, Leiter der katholischen Pfarrgruppe Bad König, Michelstadt und Vielbrunn, außerdem der CDU-Kreisvorsitzende Kevin Schmauß mit CDUKreistagsabgeordneten Anni Resch. Vom Landesvorstand des BdV waren Schatzmeister Hagen Novotny sowie Markus Harzer, Obmann der SL-Landesgruppe Hessen, sowie die Mitglieder der Kreisvorstände von BdV und SL gekommen.

Ein besonderer Willkommensgruß galt den Egerländer Musikanten, der BdV-Singgruppe Biebesheim-Dornheim unter der Leitung von Rudi Mohr, die den Nachmittag mit Liedern und flotter Akkordeonmusik stimmungsvoll bereicherten. Ganz besonders herzlich aber wurde Emilia Hotz, die junge Referentin dieser Gedenkveranstaltung, begrüßt. Sie hatte erst im Sommer ihre Realschulzeit an der Georg-Ackermann-Schule in Rai-Breitenbach, einem Stadtteil von Breuberg, beendet.



Bemerkenswert war dabei vor allem das Thema, welches sie für ihre Jahresabschlußarbeit gewählt hatte: „Die Vertreibung aus dem Sudetenland“. Damit würdigte sie das Schicksal ihrer Großeltern. Die Großeltern, so Emilia Hotz, seien 1946 aus ihrer mährischen Heimat vertrieben worden und mit einem der 19 Transporte, die für das Lager Breuberg-Sandbach bestimmt gewesen seien, hier im Odenwald zusammen mit mehr als 8000 anderen Deutschen angekommen. Die Referentin präsentierte ihre Arbeit mittels Tablet und Beamer unter Einbeziehung zahlreicher Karten und Bilder.
In seinen Dankesworten lobte Helmut Seidel die sorgfältige Recherche über das Problem der Sudetendeutschen vor und nach 1945. SL-Landesobmann Markus Harzer hob zudem den Mut und das Engagement für das Thema in dem jugendlichen Alter hervor.
Mit Gedanken über den Tag der Heimat vom BdV-Vorsitzenden des Nachbarkreises Bergstraße, Gerhard Kasper, einem Gedicht von Gerti Donko und einem Gebet klang die Gedenkveranstaltung traditionell mit der Nationalhymne aus.
Besuch in Reichenberg
Jüngst unternahm das DeutschEuropäische Bildungswerk in Hessen (DEBWH) eine einwöchige verständigungspolitische Seminarfahrt ins Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechische Republik.
Im Rahmen dieser Seminarfahrt besuchten die Teilnehmer aus allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland auch das Begegnungszentrum der Deutschen Minderheit in Reichenberg. In Reichenberg begrüßten Petra Laurin, Direktorin des Hauses der Deutsch-Tschechischen Verständigung „Riegerhaus“ in Gablonz-Reinowitz, und Andreas Sanmann, der Leiter der

Deutsch-Abteilung des staatlichen Reichenberger F.X.-ŠaldaGymnasiums, die Seminaristen sehr herzlich. Außerdem informierten sie umfassend über Pro-
bleme der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik und über Deutsch als verbindende Sprache in einem multikulturellen Raum.
Seminarleiter Siegbert Ortmann, zugleich Vorsitzender des BdV-Landesverbandes Hessen und des DEBWHVorstands, bedankte sich nach lebhafter Diskussion für die in diesen Einrichtungen seit Jahren praktizierte Verständigungsarbeit durch Kultur, Traditionen und Bildung sowie die enge Zusammenarbeit unter den gesellschaftlichen Gruppen in dieser Region. Schließlich wünschte Ortmann den Gastgebern eine erfolgreiche Zukunft.

Lange Nacht der Museen
Zum 18. Mal nahm das Wiener Böhmerwaldmuseum an der ORF-Aktion „Lange Nacht der Museen“ teil. Sie dauerte von 18.00 Uhr am 1. Oktober bis 1.00 Uhr am 2. Oktober. Die SLÖ berichtet.
Und wieder konnten wir uns über einen Rekordbesuch von 200 Personen freuen. Das Interesse an der Geschichte der Vorfahren, deren Erlebnissen während und nach dem Zweiten Weltkrieg, den Ursachen der Vertreibung der deutsch-altösterreichischen Bewohner des Böhmerwaldes und an vielen anderen Zusammenhängen ist in den letzten Jahren immer größer geworden.

Ganz besonders erfreulich war auch heuer wieder der große Zustrom an jungen Besuchern.
Die 90jährige Böhmerwäldlerin Walburga Rudolf stand als Zeitzeugin für Auskünfte und Erzählungen ihres eigenen Schicksals zur Verfügung. Kustos Herwig Kufner und unser Museumsfreund Christian Aussprung unterstützten Museumsobmann Gernot Peter. Dieser war stets umringt von wissensdurstigen Gästen.

Unter den Besuchern waren auch Gerhard Zeihsel, der Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich, mit seiner Frau Reinhilde, Günther Zotter von den Südmährern sowie Gäste aus Deutschland, Frankreich, der Tschechischen Republik, Slowakei, Amerika und auch aus dem asiatischen Raum.
Gerade die kleinen Museen mit historischem Hintergrund wecken immer mehr das Interesse während der „Langen Nacht der Museen“. Ganz besonders freute uns auch der Besuch des im Hause wohnenden ehemaligen Rechtsreferenten der Universitätsbibliothek Wien und bedeutenden Kunstexperten Leopold Freiherr von Cornaro. Über 25 Jahre war er künstlerisch im Bereich Radierungen und hier vor allem Ätzradierungen tätig. Seine Aufmerksamkeit galt besonders den Bildern und Grafiken im Museum. Auch äußerte er sich erfreut über die positive Entwicklung des Museums, welche er in den vergangenen Jahren mitverfolgen konnte.
Franz Kreuss ist Obmann des Wiener Böhmerwaldbundes und zugleich Stellvertreter im Museumsverein. Er sorgte wieder mit heiteren Vorträgen in Böhmerwäldler Mundart für zusätzliche Unterhaltung. Und nach dem Besuch der Ausstellungsräume gab es bei einem, vom Wiener Böhmerwaldbund und der Familie Kreuss gesponserten Buffet bei Wein, Limonade, Mineralwasser, Brötchen, Nußbrot und Punschkrapferln ausreichend Möglichkeit zu weiterem Gedankenaustausch. Beim Verlassen des Museums erhielt jeder noch als Wegzehrung eine Tafel Schokolade.
Mit den beiden just noch um zehn Minuten vor ein Uhr nachts kommenden Besuchern wurde die überaus erfreuliche Zahl 200 an Gästen erreicht. Das war wieder ein wunderbarer Erfolg für ein so kleines Museum, welches sich ganz besonders der Völkerverständigung widmet.
53 Jahre alt und 170 Mitglieder
Anfang November wird der deutsche Kulturverband (KV) Graslitz – er ist 53 Jahre alt und hat 170 Mitglieder – sein alljährliches Herbstfest feiern. Das ist ein Anlaß, sich an seine Geburt zu erinnern, ein wenig von seinem Werdegang zu erzählen und auf die schlagkräftige mittlerweile fast 20köpfige Graslitzer Gruppe um den Vorstand herum zu blicken.


Beginnen wir mit Edeltraud Rojík. Sie kam am 26. Januar 1928 in Frühbuß im böhmischen Erzgebirge als Tochter des Maurers, Bergmanns und Steigers Franz Pichl und dessen Frau Marie Pichl/Gerber zur Welt. Sie begann eine Lehrerausbildung in Eger, die der Krieg beendete. 1946 wurde sie Lageristin im Frühbußer Zinnschacht.
1948 kam Tochter Sonja zur Welt, doch Edeltraud durfte deren tschechischen Vater Karel Rojík erst ein Jahr später heiraten, nachdem sie 1949 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zurückerhalten hatte. 1957 kam Petr zur Welt, und die Familie zog ins nahe Rothau im ehemaligen Kreis Graslitz. Dort arbeitete Edeltraud in der Zweigstelle von Škoda Pilsen. 1963 verunglückte Karel Rojík tödlich.

söhungsarbeit überaus erfolgreich fort.
Sonja war mit Leib und Seele Gymnasiallehrerin für Deutsch in Rokitzan. Nach der Wende kümmerte sie sich intensiv um den Schüler- und Lehrerausstauch mit dem oberpfälzischen RegentalGymnasium in Nittenau. Seit ihrer Pensionierung 2010 widmet sie sich mit ihrem Mann Josef und ihrem Bruder Petr dem Kulturverband Graslitz.
Petr Rojík ist promovierter Geologe, autodidaktischer Organist und von einem verschmitzten Humor beseelt.
Seit 2018 ist er Kurator der geologischen Sammlung des Museums Falkenau. 90 Prozent seiner Arbeit sind Museumspädagogik. Da freut sich das von der Mutter geerbte Lehrergen. Seit 40 Jahren spielt er sonntags um acht Uhr die Orgel in der Rothauer Peter-und-Paul-Kirche, seit zehn Jahren anderthalb Stunden später die Orgel in der Graslitzer Corpus-Christi-Kirche.
Weber läßt Jüngere ran

Ende Juli fand die Jahreshauptversammlung des hessischen SL-Altkreises Schlüchtern statt.
Ein letztes Mal eröffnete Kreisobmann Walter Weber die Veranstaltung. Aus Altersgründen überläßt er der jüngeren Generation das Feld. Nach der Totenehrung durch den Stellvertretenden Kreisobmann Roland Dworschak zollten der Stellvertretende Landesobmann Lothar
Streck und Bernd Klippel, Obmann der Kreisgruppe Gelnhausen, dem scheidenden Kreisobmann Walter Weber und dessen Frau Gesine großen Respekt.
Der Jahresbericht des Obmannes folgte, der als besonderen Höhepunkt 2021 die Einweihung des sudetendeutschen Denkmals in Schlüchtern nannte. Ich bedankte mich im Namen des erkrankten Vermögensverwalters Markus Harzer für die hervorra-
gende Spendenbereitschaft der Mitglieder und Sponsoren. Nach der Entlastung des Vorstandes wurde der neue Vorstand gewählt.
Neuer Kreisobmann ist Roland Dworschak, seine Stellvertreter sind Bernd Giesemann und Hildegard Ellenbrand. Vermögensverwalter ist Markus Harzer, seine Stellvertreterin Jennifer Hartelt. Ich bleibe Schriftführerin, meine Stellvertreterin ist Gesine Weber. Beiräte sind Liese Gieler, Dorothea Herden, Sigrid Lamm, Bettina Starick, Gerhard Bucher, Manfred Gischler, Alfred Richter und Gernot Strunz.


Der neue Kreisobmann Roland Dworschak bedankte sich für die seit der Gründung 2006 geleistete Arbeit von Walter und Gesine Weber und versprach, „unsere Landsmannschaft“ auch weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen. Antje Hartelt
Mit Gesinnungsgenossen gründete Edeltraud Rojík 1969 den Kulturverband der Bürger der ČSSR deutscher Nationalität (KV). 1981 starb ihr Lebensgefährte Josef Horáček, mit dem sie seit 1965 zusammengelebt hatte. Zur Vorsitzenden der KV-Grundorganisation Graslitz wählten die verbliebenen Landsleute sie 1984. Ein Jahr später wurde sie in den KV-Vorstand in Prag delegiert, und 1989 gründete sie den Heimatchor, den sie auch leitete. Dieser wurde vor allem für seine Interpretation von Anton-Günther-Lieder berühmt und verbreitete auf tschechischem und deutschem Boden viel Freude.


Seit Edeltraud Rojíks Tod am 29. Juli 2014 pflegen ihre Kinder Sonja Šimánková und Petr Rojík sowie die Graslitzer KV-Ortsgruppe die deutsche Tradition und führen die Ver-
Ihm zur Seite steht seine Schwester Sonja, deren riesengroßes Herz jedem Heimat gewährt. Sie erzählt: „Wir nehmen auch regelmäßig an der Großveranstaltung der deutschen Vereine in Prag teil, die die Landesversammlung organisiert. Kürzlich feierte die Landesversammlung 30. Geburtstag. Und wir feierten mit
43 Graslitzer Heimatverbliebenen und ihren Nachkommen und Freunden in Prag mit. Diesmal waren wir allerdings nicht auf der Bühne vertreten.“ Doch am 5. November heißt es in Graslitz: „Bühne frei für die Deutschen in Böhmen und ihre Freunde.“ Mittlerweile sind die Graslitzer Feste allerdings so beliebt, daß Eintrittskarten rar sind.
Nadira HurnausNeudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.

50 Jahre gelebte Patenschaft
Mit einer dreitägigen Jubiläumsfahrt nach Neudek wurden 50 Jahre Patenschaft zwischen den Städten Augsburg und Neudek gefeiert.
Laut der Patenschaftsurkunde übernahm im Jahr 1954 die damalige Gemeinde Göggingen – ab 1969 Stadt Göggingen –die Patenschaft über die Vertriebenen aus Neudek/Nejdek und Umgebung.
Als im Jahr 1972 im Zuge der Gebietsreform Göggingen nach Augsburg eingemeindet wurde, gehörten einige gebürtige Neudeker, unter anderem Erich Sandner, Otto Slatina und Herbert Götz, dem Gögginger Stadtrat an. Genau diesen Personen ist es zu verdanken, daß bei der Eingemeindung die Stadt
Augsburg auch diese Patenschaft übernehmen mußte. Dies wurde sogar unter Paragraph 18 im Eingemeindungsvertrag verankert und im Jahr 1975 mit einer von dem damaligen Oberbürgermeister Hans Breuer unterschriebenen Urkunde bestätigt.
So konnte man heuer nicht nur 50 Jahre Eingemeindung begehen, sondern auch 50 Jahre Patenschaft zwischen Augsburg und Neudek. Dies war der Anlaß zu einer DreiTages-Bus-Jubiläumsfahrt nach Neudek.

mat ihrer inzwischen zu Freunden gewordenen Mitbürger, Kollegen und Nachbarn Interesse gefunden haben.
„Die ehemalige Stadt Göggingen hat am 1.8.1954 die Patenschaft über die sudetendeutsche Stadt Neudek übernommen. Durch die Eingemeindung Göggingens am 1.7.1972 ging diese Patenschaft auf die Stadt Augsburg über. Alle Augsburger Bürger werden bestrebt sein, den Heimatvertriebenen aus der Stadt und dem Landkreis Neudek eine zweite Heimat zu geben.“






In Vertretung der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber begleitete Andreas Jäckel MdL die Reisegruppe. Zu dieser Gruppe gehörten nicht nur frühere Neudeker, sondern auch etliche Gögginger, welche an der alten Hei-


Am Tag der Anreise stand ein Besuch mit Besichtigung des Stifts Tepl auf dem Programm. Überwältigt von der riesigen Bibliothek konnten die Besucher auch viel über die Geschichte von Stift Tepl nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren. Am Abend in Neudek angekommen, wurden im Hotel Anna die Zimmer bezogen. Nach dem Abendessen begrüßten der frühere Bürgermeister Lubomir Vítek, die Zweite Bürgermeisterin Pavlina Schwarzová, Pavel Andrš und Sonja Bourová von der Bürgerorganisation „JoN“ offiziell die Reisegruppe und hießen sie herzlich willkommen.

Der Samstag war ganz Karlsbad gewidmet. Der Bus brachte die Gäste in die Kurstadt. Ge-
mütlich spazierte man durch das Kurviertel oder fuhr mit der Kutsche bis zum Hotel Pupp. Von dort ging es mit der Standseilbahn zur Freundschaftshöhe, dem späteren Hotel Diana, wo jeder seinen Hunger und Durst stillen konnte.
Der Turm war bequem mit dem Lift zu besteigen. Oben angekommen wurde man mit einem herrlichen Ausblick sowie einem Rundblick über Karlsbad belohnt. Auch die Rückfahrt mit der Standseilbahn bot einen herrlichen Eindruck der
wunderschönen Landschaft, verzaubert durch die Herbstverfärbung.
Die Erkundungstour ging beim Hotel Pupp auf der anderen Seite des Flüßchens Tepl zurück vorbei am Karlsbader Museum, dem Stadttheater, der Sprudelhalle und dem Hotel International. Von dort aus brachte uns die Imperial-Standseilbahn hoch zum Hotel Imperial, wo wir uns Kaffee und Kuchen schmekken ließen. Am Abend erwartete uns im Hotel Anna in Neudek ein schmackhaftes, kaltes Buffet.

Am Sonntag hieß es schon wieder, Koffer packen und Abschied nehmen. Mit einem letzten Blick auf Kirche, Turm und Schöne Aussicht verabschiedeten wir uns von Neudek.

Für die Heimfahrt war noch ein Zwischenaufenthalt in Elbogen/Loket geplant. Dort wartete Jana Motliková auf uns. Sie erzählte Wissenswertes über Elbogen sowie über die Besuche des deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe im Hotel Zum Weißen Roß. Eine kurze Besichtigung der Brauerei und der Schnaps-Brennerei sowie des Familien-Museums rundete die Führung ab.
Mit dem gemeinsamen Mittagessen im Elbogener Hotel Zum Weißen Roß endeten drei wunderschöne Tage in der alten Heimat unter dem Leitwort „50 Jahre Patenschaft zwischen Augsburg und Neudek“.
Anita Donderer HeimatkreisSiedlungen oberhalb von Merkelsgrün
Pavel Andrš berichte te in „Krušnohorský Herzgebirge Luft“ im Juni unter Verwen dung von Do kumenten von Michal Urban über die Ent wicklung der beiden Dör fer Ullersgrün und Lindig. Josef Grimm übersetzte den Text aus dem Tschechi schen.
Die beiden ehemals selbständigen Dörfer Ullersgrün und Lindig haben eine ähnliche historische Entwicklung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie Teil der Gemeinde Merkelsgrün. Gleich zeitig gehörten sie allerdings im mer zu der Pfarrei Lichtenstadt, und ihr Gebiet war von der Land wirtschaft geprägt.
Infolge der Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945 begannen sich beide Or te zu entvölkern. Seit den 1980er und 1990er Jahren läßt sich der gegenteilige Trend feststellen. Seitdem steigt die Zahl der stän dig ansässigen Einwohner.
Ullersgrün, dessen Zentrum auf einer Höhe von 610 Me

tern über dem Meeresspiegel liegt, wurde im Zuge der land wirtschaftlichen Besiedlung im 13. Jahrhundert als sogenanntes Walddorf gegründet.
Ullersgrün
Davon zeugen noch heute teil weise die langen, senkrecht zu der Erschließungsachse verlau fenden Landstreifen, welche ur sprünglich bis nach Maria Sorg reichten.
Die erste schriftliche Erwäh nung von Ullersgrün stammt aus dem Jahr 1273, als es zur Herr schaft Lichtenstadt unter der Ver waltung des Prämonstratenser
klosters in Tepl gehörte. Ab 1850 wurde Ullersgrün Teil des Be zirks Sankt Joachimsthal. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es 20 Bauernhöfe mit 135 Ein wohnern, 1921 waren es 23 Häu ser mit 165 Einwohnern.


In der Mitte der Siedlungist in der Nähe des Dorfteiches ei ne kleine Kapelle erhalten ge blieben. Vor dem Eingang befin det sich eine Steinstele, ein Über bleibsel eines Denkmals für die Opfer des Ersten Weltkrieges.


Laut der erhaltenen Schulchronik wurden 36 Männer aus der Gegend zum Wehrdienst ein berufen, und sechs Männer kehr ten nicht von den Kriegsfron
ten zurück, vier davon fielen und zwei wurden vermißt.
Die erste Erwähnung des Schulunterrichts stammt aus dem Jahr 1825, als es in Ullers grün noch kein Schulgebäude gab und der Unterricht in ver schiedenen Häusern stattfand. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Wanderschule, die von immerhin zwölf bis 14 Schü lern besucht wurde.

Im Jahr 1867 wurde die Wan derschule geschlossen, und im Haus Nummer 25 wurde schließ lich ein fester Raum für den Un terricht eingerichtet.
Die Anzahl der Schüler stieg allmählich an: 1870 besuchten
20 Schüler die Schule, in den 1880er Jahren waren es so gar 40 Schüler, und schließlich sank die Zahl der Schüler auf 32 (1893).
Im Schuljahr 1944/1945 be trug die Ge samtzahl der Schüler in der einklassigen Schule noch 13 Personen.
Heute befin det sich in der Siedlung ein Familienbe trieb, welcher sich auf Agro tourismus spe zialisierte.
Hinter dem Tal des Eliasba ches erhebt sich das Bergmas siv aus Ullersgrüner Berg und Wolfsberg, über das ein belieb ter Weg von Lichtenstadt zu dem ehemaligen Wallfahrtsort Maria Sorg führte. Der höchste Teil des Bergrückens verbirgt eine Gra nitfelsformation, welche nach ih rer Ähnlichkeit mit einem Wa gen, der mit der Aussteuer einer Landbraut beladen ist, Brautbett genannt wird.
Lindig
Lindig liegt auf einer Höhe von 630 bis 720 Metern über dem
Meeresspiegel und verdankt seine Entstehung der landwirt schaftlichen Besiedlung in der er sten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Lindig war bis in die 1870er Jah re immer ein kleines Dorf mit nur 16 Häusern und weniger als ein hundert Einwohnern. Ein wenig außerhalb gab es eine Siedlung namens Kaff. Das Dorf wuchs erst mit der Industrialisierung ab dem Ende des 19. Jahrhun derts.
Die Siedlung Kaff am südöst lichen Hang des Pleßberges ge hörte zu Lindig und bestand aus verstreuten Häusergruppen na mens Ober , Mittel und Unter Kaff mit insgesamt 13 Häusern und 62 Einwohnern im Jahre 1921. Nach dem Zweiten Welt krieg wurde die Siedlung aufge löst. Heute führt ein Berglehr pfad von Merkelsgrün durch das Gebiet.
Der treuen Bezieherin des Neudeker Heimatbriefs, die im Monat Oktober Ge burtstag feiert, wünschen wir von Herzen alles Gu te und viele schöne Jahre in Gesundheit und Zufrie denheit:
n Bärringen. Dr. Hei de Sonnevend, Beethoven straße 16, 18069 Rostock, 24. Oktober 1939.
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau


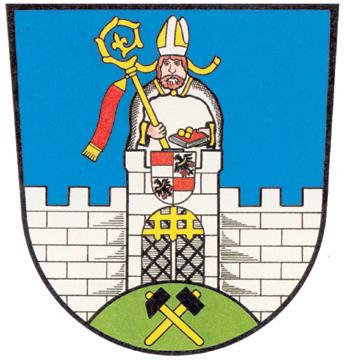

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Tele fon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
OsseggDer IV. Symbolische Lückenschluß lädt zum deutsch-tschechischen Treffen ein
Zur Unterstützung der Initiati ven der Montanregion Erzgebir ge/Krušnohoří für eine erneute Verbindung der Städte Freiberg, Most/Brüx und Teplitz durch die Errichtung der fehlenden Ei senbahngleise im Bereich Holz hau bis Moldau/Moldava wur den Interessenten auf beiden Seiten der Grenze zum bereits IV. Symbolischen Lückenschluß am vorletzten Augustwochenen de nach Ossegg eingeladen. Jut ta Benešová berichtet.
An diesem Wochenende feier te ganz Ossegg das 500. Jubi läum seines traditionellen Stadt festes zu Ehren der Muttergot tes. Die diesjährige Feier stand unter dem Motto „Mit der Eisen bahn zum Ossegger Marienfest“. Besonders am Samstag wurden die historischen Waggons nach Ossegg eingesetzt: für die Gäste

aus Moldau in Deutschland aus und für die tschechischen Gä ste aus Brüx und Teplitz. Trotz des schlechten Wetters wa ren viele Neugierige gekommen.
Die obere Bahn mit der Sta tion Stadt Ossegg hatte bis zum Jahr 1945 die Stadt Ossegg mit der Bergstadt Freiberg und der Stadt Nossen einschließlich des ehemaligen Klosters Altzella ver bunden. Gerade deshalb wähl te die sächsische Montanregion Erzgebirge beide Klöster – also Kloster Ossegg und Kloster Alt zella – zum diesjährigen Haupt ziel des IV. symbolischen Lük kenschlusses.
Die untere Eisenbahnstation Osek verbindet die Stadt mit Te plitz, Oberleutensdorf und Brüx.
Die Organisatoren wollen die In itiative zur Rettung des Bahn hofsgebäudes in Ossegg aus dem
Jahr 1872 mit den Veranstaltun gen am unteren Bahnhof verbin den. Die Bahnlinie feiert heuer ihren 150. Geburtstag. Auf dieser Strecke wurden die historischen Waggons von einer Dampfloko motive gezogen, welche immer noch auf alt und jung ihren Reiz ausübt.
Aber Ossegg hatte an die sem Wochenende seinen Gästen noch viel mehr zu bieten. Der Umbau des alten Gasthofes Stro pník zu einem modernen Kultur haus mit großem Saal im Oberge schoß war im März vollendet wor den. Der Georgendorfer Verein mit Petr Fišer und der Teplitzer Verein mit Vlasta Mládková hat ten dort zum IV. Symbolischen Lückenschluß ihre deutschen und tschechischen Gäste emp fangen. Zu Beginn begrüßte sie der Ossegger Bürgermeister Jiří Macháček.
Als Sonderprogramm anläß lich dieses Treffens war die Be sichtigung der restaurierten ba rocken Klosterkirche sowie ein Besuch der barocken Klosterbi bliothek vorgesehen, welche re gulär nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Durch die zahlrei che Beteiligung mußten die Gäste drei Gruppen bilden, damit al le in den vollen Genuß der Be sichtigungen kommen konnten.
Jitka Firstová vom Informati onszentrum des Klosters führte durch die Geschichte der herrli chen hochbarocken Klosterkir che. Und Jiří Wolf weihte die Gä ste in der Klosterbibliothek in die Geheimnisse der Barockliteratur ein.

Die Restaurierung der Abtei kirche Mariä Himmelfahrt hat te im Herbst 2018 begonnen und wurde Ende des letzten Jahres beendet. Die Kosten beliefen sich


auf fast 130 Millionen Tschechi sche Kronen, umgerechnet etwa 5,5 Millionen Euro. Dabei deckte eine europäische Subvention aus dem Integrierten Operationellen Regionalprogramm den größten Teil ab.
Die barocke Klosterbibliothek zeichnet sich wiederum dadurch aus, daß sie die einzige original erhaltene Räumlichkeit ihrer Art in der Region Aussig ist. Die Bi bliothek umfaßt etwa 250 000 Bände, welche zur Zeit einer um fangreichen Restaurierung und Katalogisierung unterliegen. Ein Teil seltener Handschriften wurde bereits nach 1950 in die Tschechische Nationalbibliothek überführt.
Für alle Teilnehmer war ein Mittagessen im Restaurant Stro pník bestellt. Und an einem Stand der Tschechischen Post im
Klosterareal gab es anläßlich des IV. Symbolischen Lückenschlus ses einen Sonderstempel.






Gegenwärtig laufen die Vor bereitungen für die III. tsche chisch-deutsche Konferenz zur Erneuerung der Verbindung der Moldauer und Freiberger Eisen bahn. Diese ist für Oktober in Te plitz geplant. Dabei wird erwar tet, daß auf dieser Tagung Staats minister Martin Dulig die lang erwartete Machbarkeitsstudie des Sächsischen Wirtschaftsmi nisteriums vorstellt.
Die Ergebnisse werden mit den tschechischen und sächsi schen Bürgermeistern der an den Bahnstrecken gelegenen Gemeinden, mit weiteren Politi kern und Experten aus der Regi on, sowie mit Vertretern des Eu ropäischen Parlaments diskutiert.
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergFÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ HEIMATBOTE Bischofteinitz Ronsperg Hostau
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de,
Vom Dorf zur Stadt


Mit Anlage und Ausbau der Stadt Ronsperg beschäftigt sich Franz Bauer in diesem Beitrag.
Wenn die Angaben von Jaroslaus Schaller zutreffen, so ist die erste Burganlage dort zu suchen, wo heute der Pfarrhof und das Gebäude der Volksbank stehen, also am Südrand des Höhenrückens, um den unser Städtchen sich ausdehnt. Der Kern der Siedlung Pobiezowicz lag wohl am Fuße der Burg, und zwar um den Unteren Ringplatz. Man erzählt sich freilich auch, das alte Dorf sei jenseits der Piwonka gegen Wilkenau hin gelegen.
Als das Dorf 1424 zum Oppidum, zur Stadt erhoben wurde, erhielt es wohl – es war die Zeit der Hussitenkriege – zum erstenmal eine Befestigung. Die Burg selbst freilich soll um die Mitte des 15. Jahrhunderts verödet gewesen und von Břenek, dem Bruder Dobrohosts von Ramsperg, als Neu-Ronsperg wieder aufgebaut worden sein.
Große Bautätigkeit entfaltete Dobrohost als Herr der Stadt.
Auf ihn geht die Kirche Mariä Himmelfahrt (1490) zurück, aber auch die Erweiterung des Schlosses. Schon unter Břenek ist wohl die Burganlage weiter auf die Höhe nach Nordosten auf den heutigen Platz gerückt worden.
An der Stelle der alten Burg ent-

meyer. Der Obere oder Forsterteich wurde erst in diesem Jahrhundert zugeschüttet.
Zwischen Reithmeyer und Kohlen-Füßl stand das Teinitzer Tor. Von hier lief die Mauer zurück zur Burg, die den Eckpfeiler der ganzen Stadtbefestigung bildete. Weitere Stadttore dürfen wir noch beim alten Friedhof in Richtung Hostau und nach Wilkenau hin zwischen Gasthaus Forster und Schlosser Schröpfer annehmen, obwohl sie in keiner uns bekannten Urkunde Erwähnung finden.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts, als Johann Georg von Schwanberg Besitzer war, werden auch Vorstädte erwähnt, wie etwa in dem Privileg, daß die Ronsperger auf eigenen Beschluß Bürger in die Stadt und in die Vorstädte aufnehmen dürfen. Diese Vorstädte müssen wir im Westen der Stadt vor dem Deutschen Tor, aber wohl auch nach Süden hin über der „Faberbruck“ suchen.
1632 wurde die Stadt von einer Brandkatastrophe heimgesucht. Der Wiederaufbau fand zwar die finanzielle Unterstützung des damaligen Grundherrn Severin Thalo, doch dürfte er wegen der Kriegsunruhen und der ungeheueren Verluste an Menschen weder rasch noch vollständig durchgeführt worden sein.


bereits Ende des 17. Jahrhunderts die Papiermühle.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt vor allem im Gebiet um den Hütplatz weiter. Hier fanden die Garnund Leinwandbleicher die Voraussetzungen für ihr Gewerbe: Wasser und Grünflächen.
1778 errichtete Freiherr von Linker am Oberen Ringplatz neben dem Pfarrhof ein neues Schulhaus. 1770 erhielten alle Gebäude der Stadt Hausnummern, die der christlichen Bewohner arabische, die der Juden römische. Erst 1927 sollten diese sowie einige herrschaftliche Gebäude, etwa die Meierhöfe in Sankt Georgen und Ronsperg, und auch die Hausnummern mit a und b umnumeriert werden.
Die Stadt hatte sich um diese Zeit über ihren eigentlichen Kern schon ganz beträchtlich hinausentwickelt. Auch die Mariengasse (Strohhäusl) reicht ins 18. Jahrhundert zurück.
Das Patrozinium der Spitalkapelle Mariä Heimsuchung wurde als Strohhäuslfest besonders in diesem Stadtteil gefeiert. Hier erhielt sich ein Stück Vorstadttradition.
Schon unter den Freiherrn von Linker wurde damit begonnen, Teile der Stadtmauer, die bei dem damaligen Stand der Kriegstechnik ihren Sinn verloren hatte, ab-
der Stelle des „Brotladens“, eines Branntweinausschankes, und der alten Schule entstand der Bau der Spar- und Vorschußkasse, später Volksbank.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde unsere Gegend elektrifiziert. Träger war der Elektrizitätsverband der nördlichen Böhmerwaldbezirke, der 1919 in Tachau gegründet worden war. Sitz des Unternehmens war zuerst Tachau, dann Staab und ab 1926 Mies. Die einzelnen Bezirke waren im Vorstand durch den Bezirksvertreterausschuß vertreten: für Ronsperg waren es Josef Stahl, Kleinsemlowitz, und Georg Malzer, Neugrammatin. 1923 wurde Ronsperg an die Leitung angeschlossen, die von Nürschan über Holleischen und Stankau nach Westen führte. Im folgenden Jahr wurde das Hauptverteilungsnetz von Ronsperg aus weitergebaut in Richtung Haid.
Aus der gleichen Zeit stammt auch die heutige Gestalt der „Faberbruck“ als Betonbrücke. Bis um die Jahrhundertwende mußte jedes Fahrzeug, das die Brükke passierte, noch Maut zahlen. Wie sich alte Leute erinnern, habe der Brückenzoll fünf Kreuzer betragen.
In die dreißiger Jahre fallen der Ausbau des Schloßturmes und der Erwerb der Maa-Wirtschaft durch Hans Graf Coudenhove-Kalergi, der sie zum Hotel Hubertus umbaute.
Im Osten der Stadt baute 1936/37 der Orden der Borromäerinnen neben der um 1900 errichteten Mädchenschule ein für die damalige Zeit hochmodernes Bürgerschulgebäude. Weit außerhalb des Ortes in Bahnhofsnähe hatten die Tschechen ihr eigenes Schulhaus errichtet. Zwischen ihm und der Spatmühle stand die Mandler-Villa. In ihr war nach 1938 der weibliche Arbeitsdienst untergebracht. Für den männlichen Arbeitsdienst wurden am Ostrande des Schloßparks gegenüber vom Bahnhof Baracken aufgestellt.
Jakob Lenz
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der dritte Teil seiner Arbeit über Pfarrer Jakob Lenz (1801–1863).
In seiner Stellungnahme erläutert Dechant Jakob Lenz seine Gründe. Es sei ihm nicht möglich, diesen Kreuzweg zu beten, da er sonntags in der Schule jeweils Wiederholungsstunden von 13.00 bis 14.00 Uhr und anschließend um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche die Christenlehre, eine allgemeine Katechese, zu halten habe. Nach der Christenlehre werde eine Litanei gebetet mit abschließendem Segen. So sei es ihm nicht möglich, der Forderung nachzukommen, um 13.00 oder 14.00 Uhr in der Kirche eine Kreuzwegandacht abzuhalten.
Des weiteren führt er aus, daß es bei vielen Hostauern üblich sei, an den Nachmittagen aller Fastensonntage einen Kreuzweg in Heiligenkreuz zu besuchen. Abschließend bemängelt aber Lenz, daß die Kreuzwegbilder aufgrund der anstößig aufgetragenen Farben ohnehin nicht zum Gesamtbild der Kirche paßten, und nennt die Beschwerde der selbst ernannten Stifter dieses Kreuzwegs nur Lüge und Prahlerei hinsichtlich der Stiftung.
sten Fastensonntag statt der Abhaltung der Christenlehre eine Kreuzwegandacht erfolgen solle.
Im Januar 1853 wendet sich Dechant Lenz an den Hostauer Bürgermeister und bittet ihn, dafür Sorge zu tragen, jährlich 16 Gulden für die Kreuzwegandacht bereitzustellen. Falls dies nicht binnen einer Woche geschehe, werde kein Hostauer Priester den Kreuzweg vorbeten. Abschließend bemerkt er, daß die Pfarrkinder wahrscheinlich zu beliebigen Zeiten beginnen werden, den Kreuzweg gemäß dem bischöflichen Erlaß ohne Priester zu beten, wie es angeblich in den meisten böhmischen Pfarrgemeinden üblich sei.
Dechant Lenz ist auch an der Ernte sehr interessiert. So beschreibt er, daß im Jahr 1854 der Getreideertrag sehr ergiebig gewesen sei, und die Verkaufserlöse aufgrund der Mißernte von 1853 gestiegen seien. Bedauerlich sei die Kartoffelernte, da die Kartoffelfäulnis seit 1845 jährlich wiederkehre. Auch sei im Jahr 1854 die Not in den ärmeren Volksklassen so groß gewesen, daß Grasgattungen gekauft und noch vor der Ernte verspeist worden seien. Im Jahr 1857 sei die Ernte wieder durch einen überdurchschnittlich heißen und trockenen Sommer gefährdet.
stand das sogenannte Frauenhaus, das die Witwe Dobrohosts bewohnt haben soll.
Unter Dobrohost ist auch die Stadtmauer ausgebaut worden.
Der uns noch heute bekannte Verlauf der Befestigung geht sicher im wesentlichen auf diese Zeit zurück. Die Nordmauer verlief vom Feilenhauer am alten Friedhof entlang bis hin zum Hause Nr. 73 (Knödl) und bog dann nach Süden ab. Zwischen den Häusern von Geschmay und Reiniger befand sich das Deutsche Tor, wo man ins Reich fuhr. Weiter führte die Mauer in einem Bogen hin zu Schlosser Schröpfer und von dort am Gasthaus Forster vorbei zwischen dem Oberen und Unteren Weiher und der Judengasse zur Gärtnerei Reith-
Wälle und Gräben an Schloß und Stadt sollen 1645 erneuert worden sein, eine Maßnahme, die bei den zahlreichen Plünderungen durch schwedische Truppen, wie sie vor allem im letzten Jahrzehnt des Krieges in unserer Gegend vorkamen, wohl bitter nötig war.
Unter Matthias Gottfried Freiherr von Wunschwitz wird 1682 das Schloß erweitert und dabei die Schloßkapelle errichtet. In diese Zeit fällt auch der Bau des Pfarrhofes. Vor der Stadtmauer entstehen das Armenhaus (Spital) für sieben Arme und die Spital-kapelle (1698). Spital und Kapelle wurden während des Zweiten Weltkriegs abgebrochen, an ihrer Stelle ein Wohnblock gebaut. Am Ostrand der Stadt steht
zubrechen. Um 1840 ebnete man Mauern, Wälle und Gräben völlig ein. Bemerkenswert aus der Mitte des vorvorigen Jahrhunderts ist der Bau des Gerichtsgebäudes, in das neben dem neuen Bezirksgericht auch das Steueramt einzog.
Den Bahnhof hat Ronsperg seit dem Bau der Eisenbahnlinie von Stankau nach Ronsperg im Jahre 1900, der 1910 die Strecke von Taus nach Tachau folgte. Bereits 1894 war unterhalb des Gerichtsgebäudes die neue Volksschule nach den Plänen eines Tauser Architekten errichtet worden. 1912 wurde der Obere Ringplatz, den zahlreiche recht interessant gestaltete alte Giebel umsäumen, um ein neues, stattliches Gebäude bereichert. An
Schaller gibt in seiner „Topographie Böhmens“ von 1789 für Ronsperg mit Sankt Georgen und Wellowitz 128 Hausnummern an. Fünf Jahrzehnte später, 1839, berichtet Johann Gottfried Sommer bereits von 222 Häusern. Bis zur Jahrhundertwende stieg die Zahl der Häuser nur leicht an. So hatte 1893 Ronsperg 241, im Jahr 1913 261 Häuser.
Für die folgende Zeit ist auffallend, daß zwar die Bevölkerung zurückging, die Stadt aber trotzdem in der Fläche sich rapide ausdehnte. Besonders in den beiden Jahrzehnten zwischen den Kriegen vergrößerte sich Ronsperg nach Nordwesten hin mit dem Neuen Viertel und entlang der Straßen nach Hostau, Trohatin, Münchsdorf, Wilkenau und Wottawa. Hier wurde die KassaWiese verbaut. Nachdem 1926 das beim Bahnhof errichtete Lagerhaus mit der Hostauer Straße verbunden worden war, entstand auch zwischen dieser Verbindungsstraße und der Bahnlinie bald eine lückenlose Reihe moderner Häuser. 1939 hatte Ronsperg 379 Hausnummern.
Das Konsistorium sieht sich darauf veranlaßt, den Bezirkssekretär nach Hostau zu entsenden, um mit den Konfliktparteien ein Protokoll aufzunehmen.
Dechant Lenz fordert zudem, daß für jede Kreuzwegandacht zwei Gulden zu zahlen seien. Dabei kommt es unausweichlich zum offenen Konflikt. Das aufgenommene Protokoll kann nicht abgeschlossen werden, da die vorgeladenen Bürger unwillig das Gespräch abbrechen, indem sie zu bedenken geben, daß sie die Stolagebühren nicht bezahlen können, da die Stiftung des Kreuzweges sie ohnehin 300 Gulden gekostet habe. Schließlich verweigern sie ihre Unterschriften unter das Protokoll. Es wird auch festgehalten, daß junge Leute beiderlei Geschlechts anstatt des Kreuzwegs in Heiligenkreuz dort nur die Wirtshäuser aufsuchten.
Im August 1852 erfolgt dann eine Anordnung des Konsistoriums. Dabei wird bemerkt, daß der Eifer des Dechanten hinsichtlich der Christenlehren etwas überspannt sei, und es wird verfügt, daß künftig an allen Freitagen der Fastenzeit der Kreuzweg in Hostau durch einen Priester vorzubeten sei. Ferner wird gestattet, daß am ersten und sech-
Hinsichtlich der Dechanteikirche werden auch Instandsetzungen durchgeführt. So werden im Jahr 1854 der große und der kleine Turm durch den ortsansässigen Klempnermeister Anton Ingrisch mit Blech neu verkleidet.

Ebenso erhält die Pfarrei ein neues Meßgewand geschenkt.
Am Heiligen Abend des Jahres 1856 wird auf Initiative des Bezirksamtmannes Franz Kowanda unter seinen k. k. Beamten eine Sammlung für arme Schulkinder durchgeführt. Für das gesammelte Geld wird im Speisesaal der Dechantei am Heiligen Abend unter anderem ein Christbaum aufgestellt. Die versammelte Jugend erhält nach einer Ansprache des Dechanten Geschenke in Form von Kleidungsstücken, Büchern, Schreibtafeln und Lebkuchen. Den Abschluß bilden Gesang und Dankreden der Kinder.
An Ostern erhält die Kirche auf Betreiben des k. k. Finanzwache-Kommissars Ignaz Neuwirth ein neues Heiliges Grab. Der Kommissar baut das Grab größtenteils selbst. Die Bretter dafür liefern die Müller aus Zwirschen und Hassatitz. Dechant Lenz freut sich über diesen Eifer, der zur Andacht der Gläubigen in der Heiligen Woche sehr viel beigetragen hat. Fortsetzung folgt
Heimatbote für den Kreis Ta<au
Für den 16. Oktober war der letz te deutsche Gottesdienst in die sem Jahr in der Maria Loreto in Haid angekündigt worden. Pfar rer Klaus Öhrlein war gelun gen, daß der emeritierte Bischof von Würzburg, seine Exzellenz Friedhelm Hofmann, den weiten Weg nach Haid auf sich nahm, um den Gottesdienst am Altar der Klattauer Muttergottes zu zelebrieren. Das war ein beson deres Ereignis.





Die würdige und noble Art des Bischofs und sei ne vornehme Sprache beein druckten sehr. Er drückte sei ne Freude aus, daß er hier an der Grenze einen Gottes dienst zur Verständigung der Völker feiern könne. In sei ner Predigt, die er unter das Moto stellte „Tut alles, was er Euch sagt!“, erklärte er aus führlich das Weinwunder zu Kana.
Das Evangelium nach Jo hannes lautete: „In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mut ter Jesu war dabei. Auch Je sus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie ha ben keinen Wein mehr. Jesus


Pontifikalamt am Klattauer Altar
erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mut ter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen dort sechs steinerne Wasserkrü ge, wie es der Reinigungsvor schrift der Juden entsprach; je der faßte ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt, und bringt
es dem, der für das Festmahl ver antwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wuß te nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das Wasser ge schöpft hatten, wußten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sag te zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken ha ben, den weniger guten. Du je doch hast den guten Wein bis
jetzt zurückgehalten. So tat Je sus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.“
Der Bischof riet auch dazu, diese Worte zu überdenken und in dieser unsicheren Zeit wie der mehr das Beten zu entdek ken. Am Ende des Pontifikalam tes zogen die Pilger vom Klattau er Altar aus singend und betend ins Innere der Gnadenkapelle. In


der Gnadenkapelle erteilte Altbi schof Friedhelm den Wallfahrern seinen Segen. Die schwarze Mut tergottes in ihrem schönen blau en Mantel blickte gütig auf die Pilger.
20 Wallfahrer waren aus Waid haus, Pleystein, aber auch von sehr weit her wie Würzburg, Hochheim bei Frankfurt, Alten markt an der Alz und Traunreut gekommen. Mit Pfarrer Klaus Öhrlein, der als Kantor fungier
Wallfahrtslied „Maria Loreto in Haid“

Maria Loreto, in heimischer Au,

Der Mutter des Heilands zu eigen es ist,
Das Schönste und Lieblichste, was ich erschau‘.
Voll göttlicher Gnade du stets für uns bist.
O göttliche Mutter, erhör‘ mich, dein Kind!
Gib, daß ich den Himmel, die Seligkeit find“!
Maria Loreto, wir eilen zu dir, Die Hoffnung auf Hilfe uns hin zu dir lenkt.
Du Zuflucht der Sünder, du himmlische Zier, Vergebung bei Gott sei doch hier
uns geschenkt.
O heilige Mutter, erweck‘ uns zur Reu‘, Schaff um unser Inn‘res ganz reich und ganz neu!
Maria Loreto, Vertrauen auf Gott, Das Hören auf ihn so wie du es getan, Sind mächtigste Mittel in Leid und in Not.
So führ‘ doch im Glauben zu Gott uns heran.
O weiseste Mutter, dein Vorbild uns zeigt,
Wo diese „Heil-Pflanze“ uns immerfort zweigt.
Maria Loreto, in jeglicher Not Des Lebens und Sterbens du nahe uns bist.
Du trocknest die Tränen, du tröstest im Tod –Und kein‘s deiner Kinder du jemals vergißt.
O mächtige Mutter, im Leben mich stärk‘, Und Gottes Huld kröne mein armselig Werk!
Maria Loreto, du Schmuck dieser Stadt, Hilf allen, die kommen, dein Bild hier zu schau‘n.
Vermehre die Tugend und heilige Gnad‘, Bestärk‘ einen jeden auf Jesus zu bau‘n.
O treueste Mutter, wir schwören auf‘s neu Dir unsere Liebe und ewige Treu‘!
Text: Vikar Franz Lang, Haid 1917; zum Jubiläum adaptiert Pfarrer Klaus Oehrlein 2018.
Melodie: „Maria dich lieben“, dabei die beiden letzten Verszei len wiederholen.
te, waren fünf Tachauer unter den Gottesdienstbesuchern. Das wunderbare Herbstwetter hat die weite Fahrt angenehmer erschei nen lassen.
Konzelebrant Adam Kar colczak, der neue Pfarrvikar des Pfarrsprengels Pleystein, Burk hardsrieth, Miesbrunn und Waid haus, hatte sich eingangs vorge stellt. Er trage einen polnischen Namen, sei in Gdingen bei Dan zig zur Welt gekommen, habe an der Theologischen Hochschu le in Regensburg studiert und sei von Bischof Rudolf Voder holzer – dessen Mutter Maria stammte aus Kladrau – zum Priester geweiht worden. Seit 1. Oktober leite er zusammen mit seinem indischen Kolle gen Pater John Gali den neu en Pfarrverband.

Nach dem Gottesdienst er freute das rührige Mesnerehe paar Michaela und Jan Mo ravec mit Kaffee und Kuchen die Gläubigen. So konnte der Nachmittag bei gemütlichem Beisammensein harmonisch ausklingen.
Diese deutschsprachigen Pilgergottesdienste in der Hai der Loretto werden im näch sten Jahr ab Mai fortgesetzt. Wolf-Dieter Hamperl Siegfried Zeug/nh

