Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger Zeitung


HEIMATBOTE



VOLKSBOTE










Im zu Ende gehenden Jahr danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit und wünsche auch namens meiner Kolleginnen und Kollegen in der Bundesgeschäftsstelle ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2023.
Für das neue Jahr wünsche ich mir, daß unsere Angebote auch weiterhin Anklang finden und unsere Landsleute unsere Serviceangebote nutzen.
Mir ist bewußt, daß gerade bei der Werbung für den Sudetendeutschen Tag in Regensburg in den nächsten Monaten viel Kraft und Zeit aufgewendet werden muß. Oftmals sind persönliche Gespräche erforderlich.
Dennoch: Im Interesse unserer gemeinsamen Verantwortung für unsere Geschichte, den Erhalt unserer Kultur und unseres Brauchtums bitte ich sehr herzlich darum, uns beim Verkauf der Festabzeichen zu unterstützen.
Mittlerweile stehen auch die beliebten Briefaufkleber kostenlos zur Verfügung und können wie die Festabzeichen in der Bundesgeschäftsstelle unter der Telefonnummer (0 89) 48 00 03 70 oder per eMail: service@sudeten. de angefordert werden.


Wichtig ist auch, gezielt Kinder und Enkel unserer Landsleute anzusprechen. Gerade die Enkelgeneration ist es, die sich zunehmend für die Heimat ihrer Vorfahren interessiert. Der Sudetendeutsche Tag gibt Antworten.
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle, bieten Unterstützung für den ehrenamtlichen Einsatz unserer Landsleute zugunsten unserer Volksgruppe.
Für diese Unterstützung danke ich im Voraus und freue mich auf zahlreiche Bestellungen.
Andreas Miksch, SL-Bundesgeschäftsführer



Die Christkindlmärkte in Prag werden jedes Jahr zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Welt gezählt. In jedem Fall gehören sie zu den längsten. Erst am 6. Januar ist Schluß.

In der Hauptstadt finden gleichzeitig mehrere Weihnachtsmärkte statt, so auf dem Platz der Republik, dem Wenzelsplatz, dem Friedenplatz und auf der Prager Burg. Auf dem Altstädter Ring, dem größten Christkindlmarkt, leuchtet der Weihnachtsbaum bis Heilige Drei Könige. Was Prag und die anderen Regionen den Besuchern außerdem im Winter bieten, lesen Sie auf Seite 16.
Foto: CzechTourism/Sven Hansche
Je näher der Termin der Präsidentschaftswahl am 13. und 14. Januar rückt, desto schmutziger wird der Wahlkampf. Mit anonymen Kettenbriefen wird derzeit Stimmung gegen die demokratischen Bewerber Danuše Nerudová und General Petr Pavel gemacht. Thema sind wieder die Beneš-Dekrete, die bereits im Wahlkampf 2013 dem damals aussichtsreichen Bewerber Karl von Schwarzenberg den Sieg gekostet haben.
In einem TV-Schlagabtausch mit Miloš Zeman hatte von Schwarzenberg die Debatte um die Beneš-Dekrete als obsolet bezeichnet und auf die in der tschechischen Verfassung verankerte EU-Grundrechtscharta verwiesen. Außerdem erklärte von Schwarzenberg, ein Beneš käme heute vor den Strafgerichtshof in Den Haag.
Obwohl juristisch korrekt, löste der Außenminister damals eine heftige Diskussion aus. NochStaatspräsident Václav Klaus setzte sich an die Spitze der AntiSchwarzenberg-Bewegung und sagte, er könne „dem Minister dessen Aussagen nie verzeihen“. Die Kampagne zeigte maximale Wirkung. Von Schwarzenberg verlor die Wahl, und Zeman zog als Präsident in die Burg ein.
dová oder Pavel gewinnt, werden die Beneš-Dekrete aufgehoben. Genug bitte.“
Ironie im Wahlkampf geht immer nach hinten los. Jüngstes Beispiel: Eine Bemerkung von Danuše Nerudová.
Die aussichtsreiche Kandidatin konterte auf die Frage, was ihre größte Hürde sei, ironisch: „Ich bin eine Frau, jung und gut aussehend. Das ist mein größtes Handicap.“ Was folg-


te, waren negative Schlagzeilen, Spott und Entrüstung.
Am souveränsten reagierte noch (der ebenfalls gutaussehende) Mit-Präsidentschaftskandidat General Petr Pavel, der ein Foto von sich und seiner Frau postete und meinte: „Mein Handicap ist, daß ich nicht mehr der jüngste Mann bin und sicherlich nicht so gut aussehe.“
Nach dem gleichen Muster wird jetzt wieder versucht, Stimmung zu machen. Laut aktuellen Meinungsumfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Kandidaten – der Wirtschaftswissenschaftlerin und ExRektorin der Mendel-Universität in Brünn, Prof. Dr. Danuše Nerudová, dem ehemaligen Nato-General Petr Pavel und dem früheren Premierminister und Chef der Ano-Partei, Andrej Babiš. Profitieren würde von dieser Beneš-Kampagne nur einer –Populist Babiš.
Aufgedeckt hat das falsche Spiel mit den Beneš-Dekreten der mehrfach preisgekrönte Journalist Jindřich Šídlo, der twitterte: „Es ist wieder da. In den eMails heißt es, wenn Neru-
Welche abstrusen Behauptungen in diesen anonymen eMails verbreitet werden, zeigt ein Textauszug, in dem auch Premierminister Petr Fiala angegriffen wird. Dort heißt es: „Herr Petr Fiala ist leitendes Mitglied der staatsfeindlichen Paneuropa Union. Und deren Leiter ist der Chef der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, der langfristig die Abschaffung der Beneš-Dekrete anstrebt. Das beginnt ihm zu gelingen.“
In einem Interview für die tschechischen Medien hat Bernd Posselt Position bezogen: „Die Beneš-Dekrete sind Unrecht, weil sie, wie bereits Václav Havel klargestellt hat, von der Kollektivschuld ausgehen. Ich sage aber auch ganz deutlich: Die Beneš-Dekrete sind eine moralische, und keine juristische Frage. Unabhängig von der Eigentumsfrage wollen wir die BenešDekrete moralisch aufarbeiten. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel geschehen, beginnend mit der Rede des damali-

gen Premiermisters Petr Nečas 2013 im Bayerischen Landtag und dem Satz ,Wir bedauern, daß durch die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei, durch die Enteignung und Ausbürgerung, unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt wurde.‘ Heute weiß die Mehrheit der Tschechen, daß die Vertreibung ein Unrecht war und daß sich das Land damit auch selbst sehr geschadet hat. Wir als Sudetendeutsche wissen aber auch, daß dieses Unrecht der Vertreibung nie entstanden wäre ohne die Verbrechen der Nationalsozialisten. Auch das arbeiten wir auf.“ Wie sehr das falsche Spiel mit den Beneš-Dekreten verfängt, wird sich zeigen. Immerhin hat General Pavel bereits mit der Debatte um seine frühere Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei die Führung in den Meinungsumfragen verloren, während es Babiš derzeit nicht schadet, daß er von der damaligen slowakischen Staatssicherheit als inoffizieller Mitarbeiter geführt worden ist. Auch sein Prozeß wegen eines möglichen Subventionsbetrugs um das Ressort Storchennest (Sudetendeutsche Zeitung berichtete mehrfach), der diese Woche in Prag fortgesetzt wurde, hat bislang keine nennenswerten Spuren bei Babiš hinterlassen. Im Gegenteil: Nach seiner Sommertour unter dem populistischen Slogan „Unter Babiš war alles besser“ profitiert der ehemalige Premierminister von den zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der tschechischen Bürger infolge des russischen Angriffskriegs und der Energiekrise. Und da Tschechien noch immer keinen Euro eingeführt hat, leidet das Land besonders unter der Inflation und dem Währungsverfall.

Derzeit gehen alle Experten davon aus, daß die endgültige Entscheidung über Tschechiens neuen Präsidenten
Stichwahl fällt, die für den 27. und 28. Januar terminiert ist.
 Pavel Novotny/Torsten Fricke
Pavel Novotny/Torsten Fricke
Frau, jung, gut aussehend –„mein größtes Handicap“Festabzeichen und Briefaufkleber. Petr Pavel Im Interview: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland. Foto: Mediaservice Novotny
Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Andreas Künne, ist seit mehr als einem Jahr im Amt. Über seine Aktivitäten hat die Sudetendeutschen Zeitung bereits mehrfach bereicht, da Künnes Interesse auch den Anliegen der Sudetendeutsche gilt, die in der Tschechischen Republik seit fast zwanzig Jahren durch das Sudetendeutsche Büro vertreten werden.
Dessen Leiter Peter Barton freute sich, Botschafter Künne wie üblich vor den Weihnachtsfeiertagen in seinem Prager Bü-
ro begrüßen zu können. Das Gespräch dieses Tre ens war nicht nur von aktuellen Fragen der (sudeten-) deutsch-tschechischen Beziehungen geprägt, es ging dabei auch um die Pläne und Projekte des SL-Büros für das Jahr 2023.
Barton erwähnte zum Schluß, daß er die gute und o ene Zusammenarbeit seiner Einrichtung mit der Deutschen Botschaft in Prag sehr zu schätzen wisse. Er hat volles Vertrauen zu dem höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland in der Tschechischen Republik.
Heimat geht auch durch den Magen: Mit ihrem Buch „Kochund Backrezepte aus der ehemaligen deutschen Sprachinsel bei Wischau“ haben Rosina Reim, Tochter Monika OfnerReim und die vielen Mitstreiter im vergangenen Jahr einen Nerv getroffen (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). Pünktlich zu den Festtagen lassen die beiden Wischauerinnen wieder in ihre Töpfe gucken und erzählen, wie in der Heimat Weihnachten gefeiert wurde.
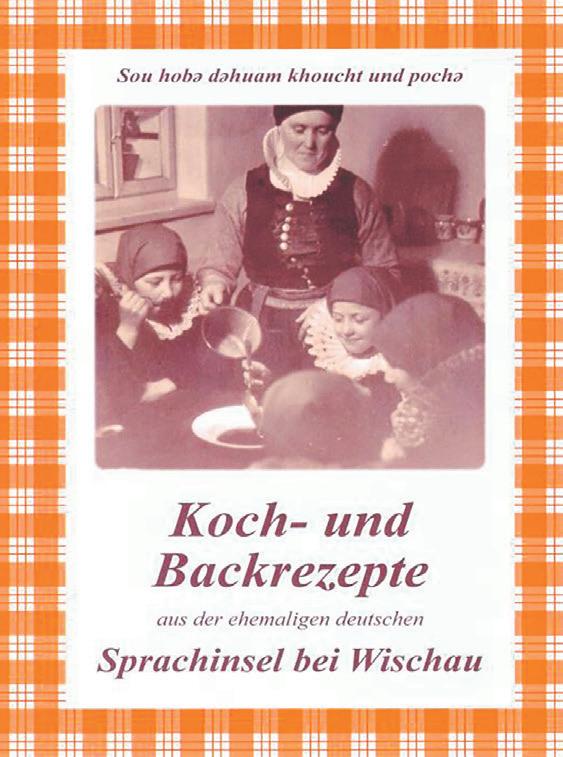
Extra für die Festtage habe man das Haus und die Stube geputzt und Zuckerwerk gebakken, erinnert sich Rosina Reim und erzählt: „Der Christbaum war ein kleines Fichtenbäumchen. Kugeln wie wir sie heute kennen, hatte man damals noch nicht. Der Baum wurde einfach mit Zuckerradal, kleinen Äpfeln, in Staniolpapier eingewickelten Nüssen und Lametta oder Engelshaar geschmückt. Das fertige Bäumchen stand am Heiligen Abend in der Guten Stube und später entweder im Fenster oder auf einem Stuhl vor dem Fenster, damit man ihn von außen begutachten konnte.“
Die Familie fand sich am Heiligen Abend in der Stube zusammen. Es wurde ein einfaches Essen eingenommen und Weihnachtslieder gesungen. Nach der Christmette wurden Mettn-Würste warm gemacht. Am 1. Weihnachtsfeiertag gab es Ente oder Gans. Bevor jedoch gegessen wurde, gingen Bauer und Bäuerin mit einem großen Laib Brot
und einem Messer in die Stallungen und gaben jedem Tier ein Stück Brot – denn auch für die Tiere sollte Weihnachten etwas Besonderes sein.
Monika Ofner-Reim: „Bis heute orientiert sich unser Weihnachtsmenü an den in unserer Familie überlieferten Traditionen. Am Weihnachtsabend gibt es etwas Leichtes, meist Fisch – nach der Christmette dann die Mettn-Würste. Am 1. Weih-
nachtsfeiertag wird eine Ente oder Gans gebraten, mit Kraut und Knödel. Bei den Knödeln macht sich der Einfluß unserer neuen Heimat Bayern bemerkbar, denn statt Hefeknödel werden meist bayerische Teigknödel als Beilage gereicht. Den süßen Abschluß bilden selbst gebackene Plätzchen.“
Tschechien unterstützt die Ukraine mit neun Generatoren. Der leistungsstärkste davon ist imstande, ein kleineres Krankenhaus mit Energie zu versorgen. Die anderen Generatoren werden fürs Heizen in den Unterkunftszentren genutzt. Der Industrie- und Handelsminister Jozef Síkela (parteilos) erinnerte daran, daß die Ukrainer nach der Zerstörung ihrer Infrastruktur durch die russische Armee vor dem schwierigsten Weihnachten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stehen. Es sei unsere Pflicht und strategische Notwendigkeit, der Ukraine zu helfen, merkte Síkela an.

mee ihre Mali-Mission beendet. Brigadegeneral Radek Hasala übergab das Kommando über die EU-Ausbildungsmission im Rahmen eines Appells an seinen spanischen Kameraden, Brigadegeneral Santiago Fernandez OrtizPepis.
erlängerung wegen der Energiekrise: Die Kohleförderung in der ČSM-Mine in der Region Karwin in Mährisch-Schlesien wird bis Ende 2025 fortgesetzt, haben Finanzminister Zbyněk Stanjura (ODS) und der Vorstandsvorsitzende des Bergbauunternehmens OKD, Roman Sikora, am Freitag bekannt gegeben. Das ČSM-Bergwerk ist das letzte, in dem das Unternehmen Steinkohle abbaut. Nach den ursprünglichen Plänen sollte der Abbau in diesem Jahr enden.

am Buchprojekt haben: Elisabeth Butschek, Marille Czapka, Alois Drabek, Hilde Fink, Maria Grössl, Jutta Hilsenbek, Annemarie Hross, Resi Hross, Yvonne Karig, Anneliese Kästl, Emilie Kutscherauer,
Christine Legner, Hilde Mader, Gernot Ofner, Monika Ofner-Reim, Bernhard Reim, Rosina Reim, Julia Schimmele, Notburga Schmiedt, Ute Soutschek, Margarete Swobodnik, Julie Trittler, Elisabeth Weiss und Katharina Witzemann.
Mit ihrem Back- und Kochbuch, so erklärte Rosina Reim bei der Vorstellung in der Sudetendeutschen Zeitung vor einem Jahr, wollen die Autoren Heimat bewahren: „Die einfachen überlieferten Rezepte aus den ehemals deutschen Dörfern zu erhalten und weiterzugeben, das war uns wichtig. In der heutigen Zeit wird oft eine aufwendige Küche angepriesen, oder die Ernährung geht über Fertigprodukte. Wir wollten mit diesem Buch zeigen, daß es auch mit sehr einfachen Zutaten gelingt, etwas Schmackhaftes zuzubereiten.“ Nicola Fricke

Das Koch- und Backbuch kann per eMail an wischauer. sprachinsel@email.de bestellt werden und kostet 9,50 Euro zuzüglich Versandkosten. Außerdem ist es unter anderem an der Kasse des Sudetendeutschen Museums, Hochstraße 10, in München erhältlich.
Gänse oder Enten werden mit Salz und Kümmel eingerieben und mit der Bauchseite nach unten in die Pfanne gelegt. Dann mit etwas Wasser aufgießen und braten lassen.
Wenn der Rücken braun ist, wird der Braten gewendet und stets regelmäßig mit dem eigenen Saft begossen. Wenn der eigene Saft schon schön braun ist, kann etwas Wasser zugegossen werden.
Wenn die Tiere sehr fett sind, schöpft man während des Bra-
tens das überflüssige Fett ab. Zum Schluß wird der Braten aus dem Rohr genommen, der entfettete Bratensaft mit etwas Wasser nochmals aufgekocht und abgeseiht.
Enten benötigen circa zwei Stunden Bratzeit, Gänse circa zwei bis drei Stunden.
Seimol (früher): Viele Familien haben früher selbst Gänse gehalten. Wenn diese geschlachtet wurden, hat man daraus nicht nur einen Braten gemacht, sondern selbstverständlich alle Teile der Gans verwendet.
Hefeknödel passen perfekt zum Gans- oder Entenbraten.
Als Alternative werden heute oft normale Knödel gereicht.
Zutaten 500 Gramm Mehl 1 Ei ½ Würfel Hefe etwas Milch 1 Prise Zucker
Zubereitung: Die frische Hefe wird mit einer Prise Zucker verrührt und mit Mehl, Milch, Ei und etwas Salz zu einem nicht zu lockeren Teig verarbeitet. Diesen
Teig läßt man an einem lauwarmen Ort aufgehen. Danach formt man gleichmäßige runde Knödel und läßt sie nochmals gehen, bis der Teig ganz schön locker ist.
So wurden sie früher gegart:
Über einen Topf mit heißem Wasser wird ein Tuch gespannt und die Knödel daraufgelegt. Mit einer umgedrehten Schüssel werden die Knödel abgedeckt und 10 bis 13 Minuten gegart.
In der heutigen Zeit legt man die Knödel einfach in kochend heißes Wasser und läßt sie ebenfalls 10 bis 13 Minuten garen.
as letzte Jahr war für niemanden einfach, und auch die folgenden Monate werden nicht leicht sein, das Regierungskabinett unternimmt alles, um die Situation zu bewältigen“, hat der tschechische Premierminister Petr Fiala (ODS) am Samstag anläßlich des ersten Jahrestags der Ernennung seiner Koalitionsregierung erklärt. Auch Tschechien stehe infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor zahlreichen großen Herausforderungen, die man sich noch vor kurzem nicht hätte vorstellen können. Fiala erinnerte in seiner Jahresbilanz daran, daß Tschechien bereits mehr als 460 000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat. Der Premierminister lobte zudem die Erfolge, die während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, die mit dem Jahreswechsel zu Ende geht, erzielt wurden, und kündigte an, sich am 1. Januar mit einer Neujahrsansprache an die Bürger zu wenden.



Das Friedenslicht von Bethlehem, das vor einer Woche über Wien nach Brünn gebracht wurde, wird jetzt von Pfadfindern im ganzen Land verteilt. In Prag können die Menschen das Licht an einer historischen Trambahnhaltestelle abholen.
Nach über zehn Jahren Einsatz hat die tschechische Ar-
Škoda wird erneut als „Exportunternehmen des Jahres“ ausgezeichnet. Der zum VWKonzern gehörende Autobauer aus Jungbunzlau hat im vergangenen Jahr Autos und Ersatzteile im Wert von 379 Milliarden Kronen (15,62 Milliarden Euro) exportiert, im Vorjahr waren es 384 Milliarden Kronen (15,83 Milliarden Euro). Das Unternehmen belegt seit 2000, als der Wettbewerb erstmals durchgeführt wurde, jedes Jahr den ersten Platz. Das zweitgrößte Warenvolumen in einem Wert von 132 Milliarden Kronen (5,44 Milliarden Euro) wurde 2021 vom Elektronikhersteller Foxconn CZ Group exportiert. Den dritten Platz belegte Agrofert mit Ausfuhren im Wert von 111 Milliarden Kronen (4,58 Milliarden Euro).
Als Weltpremiere wird der Animationsfilm „Deniska zemřela“ (Dede ist tot) von Philippe Kastner aus der Prager Filmhochschule Famu auf der Berlinale in Berlin gezeigt. Bei diesem internationalen Filmwettbewerb geht der Streifen in der Sektion Generation Kplus an den Start. In dieser Kategorie werden jedes Jahr zwölf Spiel- und Kurzfilme für Kinder gezeigt. Die 73. Berlinale findet vom 16. bis 26. Februar in der deutschen Hauptstadt statt.
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen
aus dem Buch „Koch- und Backrezepte aus der ehemaligen deutschen Sprachinsel bei Wischau“
Tom Gubik gehört zu den jungen Musikkabarettisten, die in Bayern immer mehr Fans haben. Hauptberuflich ist der 36-jährige Grundschullehrer, steht aber seit über zehn Jahren regelmäßig auf der Bühne. Auch wenn sein Motto „Natürlich bayerisch, natürlich original“ lautet, hat Gubik sudetendeutsche Wurzeln. Sein Großvater väterlicherseits stammte aus der Nähe von Pilsen. Und die Vorfahren mütterlicherseits mußten einst aus Ungarn fliehen, wie Gubik im Sudetendeutschen Gespräch mit der Sudetendeutschen Zeitung erzählt.
zu Gast. So gab es bereits Begegnungen. Das hat sich durch die Schulzeit in Rohr vertieft und wird jetzt noch weiter verstärkt, da ich inzwischen ja selbst ein Rohrer geworden bin.
Zurück zu Ihrer Kabarett-Tätigkeit. In welcher Region bewegen sich Ihre Auftritte?
ie Schule – konkret die Grundschule Nord in Kelheim – zieht sich zumindest in großen Etappen durch Ihr Leben. Erst als Schüler, nun als Lehrer. Wie kam es dazu, daß Sie (Grundschul-) Lehrer wurden?

Tom Gubik: In den letzten Jahren auf dem Gymnasium habe ich festgestellt, daß ich Grundschullehrer werden möchte. Ich habe damals in der Pfarrjugendarbeit mitgearbeitet und gespürt, daß meine Beziehung zu Menschen, besonders zu Kindern, gut klappt, und daß ich hier viele meiner Talente einbringen kann – sei es Musik oder Humor.
Gab es in den ersten Berufsjahren als Grundschullehrer prägende Erlebnisse – oder auch Personen?
Gubik: In Amberg hatte ich einen tollen Seminarleiter, der mir viel beigebracht und nicht unnötig Druck ausgeübt hat. Er war ein gutes Vorbild. Bei der Stelle in Garching konnte ich mich vielfach ins Schulleben einbringen, vor allem im Musikbereich und in der Technik. Da ich früher in Kelheim auch Gästeführungen gemacht habe, kann ich im Heimat- und Sachunterricht der vierten Klasse zum Beispiel bei der Geschichte der Stadt Kelheim viele Inhalte von damals verwenden. Und in der Heimat schlägt das Herz ganz anders. Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß, auch wenn er oft anstrengend ist und sich die Umstände in den letzten Jahren verändert haben.

Können Sie diese Veränderungen etwas konkretisieren?
Gubik: Der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund ist größer geworden im Vergleich mit den Zahlen vor 20 Jahren.
Für mich ist die Grundmaxime als Lehrer, mit den Menschen zu kommunizieren, ja Humor reinzubringen. Kinder lachen gerne, sie wollen immer wieder mal einen Gag hören. Und die Musik erleichtert vieles. Bei mir gehört jeden Morgen ein Lied dazu – zum Start in den Unterricht. Oder auch zwischendurch. Singen und gemeinsames Musizieren funktionieren nur, wenn sich alle nach dem Dirigenten richten. Da ist es gerade in einer Gesellschaft, die vielfach antiautoritär geprägt ist, wichtig, daß man auch lernt, sich unterzuordnen, mit der Gruppe mitzugehen und so weiter. Genau das läßt sich durch Musik ganz gut spielerisch umsetzen. Und Kinder sind von Grund auf ja sehr musikalisch. Wie und wann kamen Sie zum (Musik-)Kabarett?

Gubik: Ich bin ja in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Schon in der ersten Klasse habe ich Akkordeon gelernt, ab der sechsten Klasse Trompete. Als Jugendlicher haben mir Fredl Fesl und Willy Astor ganz gut gefallen, beide prägen mich sehr. Ich habe deren Lieder nachgesungen und bei kleinen Gelegenheiten aufgeführt. 2010/11 habe ich dann begonnen, mir auch eigene Sachen auszudenken. Es schlummerten viele Ideen in meinem Kopf –da sollte ich doch auch selbst etwas aufs Blatt bringen. Ich habe mit einzelnen Liedern angefangen und diese dann bei Auftritten aufgeführt.
Woher kommen die Inspirationen?
Gubik: Die kommen einfach
❯
❯
❯ Geboren am 30. August 1986 in Kelheim, dort auch aufgewachsen – in der Bauer-Siedlung und in einer musikalischen Familie.
Grundschule Nord in Kelheim, Donau-Gymnasium Kelheim und Johannes-Nepomuk-Gymnasium Rohr.
❯ Studium für das Lehramt an Grundschulen an der Universität Regensburg, ein Semester lang Zivildienst beim Bayerischen Roten Kreuz in Kelheim (Rettungsdienst, Krankentransporte), im Hauptstudium auch Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts (Prof. Dr. Burkhard Porzelt).

❯ ab 2012 Referendariat in Amberg.
❯ ab 2014 Tätigkeit als Grundschullehrer an der privaten Montessori-Grundschule Weiden.

❯ ab 2015 Staatsstelle als Grundschullehrer in Garching bei München.

❯ Seit 2019 Rückversetzung in die Heimatregion – an die Grundschule Nord in Kelheim.
❯ Seit 2010/11 Auftritte als Musikkabarettist.
❯ Hobbys: Arbeit auf dem eigenen Pferdehof der Familie, Garten und Natur; Radfahren und Mountainbiken.

aus dem Alltag. Ich gehe mit wachen Augen durchs Leben. Wenn mir etwas Peinliches oder Lustiges passiert oder wenn ich nervige Situationen erlebe, dann spinne ich das im Kopf ein wenig weiter – auch als Schutzmaßnahme: daß ich mich nicht aufrege oder ich mich über mich selbst schäme, sondern das Ganze mit Humor betrachte oder mit dem Gedanken, es könnte ja noch schlimmer sein. So spinne ich Anekdoten zusammen, die eigentlich einen wahren Kern haben, die ich aber noch ein wenig auf die Spitze treibe, etwas überhöhe.


Wie entwickelt sich so ein abendfüllendes Programm?
Gubik: Zunächst habe ich einzelne Lieder in meine kleinen Auftritte eingeflochten. Daraus wurde dann eine halbe Stunde, die ich bei einem Pfarrfest aufgeführt habe. Aus diesen Anfängen ist dann die Idee entstanden, auch mal wie ein großer Kabarettist ein abendfüllendes Programm zu präsentieren. Das habe ich der Pfarrei St. Pius in Kelheim sozusagen als Benefizkonzert vorgeschlagen. Die Pfarrei unterstützte mich, und ich wollte einfach nur einen schönen Abend gestalten, mich ausprobieren und die Einnahmen für die Renovierung der Kirche spenden.
So lief es dann auch. Der Saal war mit 150 Leuten ausverkauft, weil mich die Leute gekannt haben. Sie waren neugierig auf mich, ich war neugierig auf die Situation – letztlich ist daraus ein schöner Abend entstanden, und es folgten weitere Auftritte. Das erste Programm ist ein paar Jahre gelaufen. Dann war ich der Meinung, es müßten neue Lieder her, es entstand das zweite Programm. Aktuell läuft – seit Frühjahr 2019 – mein drittes Programm „Des pressiert ned“. Dann kam Corona, aber mittlerweile bin ich wieder mit dem Programm unterwegs.

Sie haben Stücke, die Sie mit der Gitarre, der Ukulele und dem

Klavier begleiten. Werden die Stücke spezifisch auf das jeweilige Instrument hin erarbeitet und komponiert?



Gubik: Meistens habe ich parallel zum Text schon eine Melodie im Kopf und habe eine Vorstellung davon, wie ich das Lied präsentieren werde. Die Mischung macht’s aus. Ich bin kein besonders guter Klavierspieler, und ich glaube, auch ein eher durchschnittlicher Gitarrenspieler, was die Technik betrifft. Aber mir ist wichtig, diese Abwechslung auf die Bühne zu bringen. Ich glaube, das wirkt auch für das Publikum auflockernd, wenn ein anderes Instrument, eine andere Klangkulisse, etwas Kreativität reinkommt.
Ihr Großvater väterlicherseits hat einen sudetendeutschen Hintergrund. Können Sie diesen näher erläutern?
choslowakischen Staat zum Militärdienst eingezogen. Als junger Mann zog er mit seiner Geige von Haus zu Haus, als sogenannter Böhmwenz, also als BöhmWenzel. Diese Figur war für das Musizieren bekannt. Später, als älterer Mann, spielte er die Geige nicht mehr. Vielleicht sind darin meine Musikgene begründet.
Wie erlebte Ihre Großvater die Nazis, den Krieg und die Vertreibung?
Gubik: Nach dem Anschluß des Sudetenlandes ans Deutsche Reich wurde er in die Wehrmacht eingezogen. Im Zweiten Weltkrieg war er in Bari in Süditalien im Einsatz. Zum Kriegsende geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Als er in seinen Heimatort zurückkam, erfolgte die Vertreibung. Er landete schließlich in Grafenstadl bei Hemau, wo er auf einem Hof als Arbeiter tätig war. Hier lernte er Thekla Meier, kennen, die er im Jahr 1953 geheiratet hat. In Kelheim kauften die beiden sich schließlich ein Haus. Drei Kinder – darunter mein Vater – gingen aus dieser Ehe hervor. In Kelheim arbeitete mein Opa wieder als Maschinenschlosser, im Jahr 2002 ist er verstorben. Zu uns Enkelkindern war er immer nett und lieb, er hat im selben Haus gelebt.
Hat Ihr Großvater seine Heimat nach der Vertreibung noch einmal gesehen?
die Familie oder auch die berufliche Tätigkeit bis hin zum Kabarett-Programm?
Gubik: Für die Tätigkeit als Lehrer bringt dieser Aspekt eine gewisse Bereitschaft beziehungsweise ein Verständnis für das Thema Migration. Der Opa väterlicherseits stammte ja aus der Tschechoslowakei beziehungsweise dem Sudetenland, Oma und Opa mütterlicherseits sind aus einem deutschen Dorf in Ungarn geflüchtet. Ich habe also ungarische wie auch sudetendeutsche Wurzeln, der Rest sind oberpfälzische und niederbayerische. Das vertieft das Verständnis, daß solche Durchmischungen auch etwas Gutes haben, Kulturen zusammenkommen, daß man von anderen viel lernen kann, und man sich mit Achtung und Respekt begegnet. Darüber hinaus wächst das Interesse für andere Sprachen, kurzum für die Weltoffenheit.
Und für Ihre Arbeit als Kabarettist?
Gubik: Ich habe natürlich meine verschiedenen Schulstandorte ausgenutzt und probiert, dort Fuß zu fassen. Ich habe geschaut, wo man in der jeweiligen Gegend auftreten kann: Amberg, Weiden, Garching bei München und natürlich Kelheim. Ich habe versucht, bei Einrichtungen, zu denen ich auf privater Basis Kontakte hatte, unterzukommen – Pfarrfeste, Frauenbund und so weiter. Angesprochen wurden aber auch Kleinkunstbühnen oder Veranstalter, die etwas Neues ausprobiert haben. In München hat das Ganze an Professionalität gewonnen, da hier eben Lokalitäten wie das Vereinsheim in Schwabing, das durch das Bayerische Fernsehen bekannt ist, dabei waren. Ich war zwar nie bei einer Fernsehaufzeichnung dabei, trat aber dreimal an einem Montagabend auf – auch das war ganz toll. Auf der Iberl-Bühne in München war ich mit meinen drei Programmen. Der erste Auftritt hier ist auch deshalb gut gelungen, weil die Schüler mit ihren Eltern fast alle Plätze besetzt hatten, es war eine Riesenstimmung. So bin ich auch mit meinen weiteren Programmen hier gut reingekommen. Es ist einfach toll, auch in so einem Haus zu spielen.
Wie bringen Sie die Lehrerund die Kabarett-Tätigkeit unter einen Hut?
Gubik: Mein Opa wurde 1913 in Guscht, dem heutigen Kůští, bei Pilsen geboren und ist dort auf einem Bauernhof aufgewachsen. Er machte beruflich eine Lehre als Maschinenschlosser. Als junger Mann war er in Prag und wurde dort vom tsche-
Gubik: Ja, mit meinem Vater und unserer Familie ist er im Zuge der Grenzöffnung 1989/90 auch in seinen Geburtsort gefahren. Damals war ich selbst aber noch zu jung, um die Zusammenhänge zu verstehen. In seinen letzten Jahren hat der Opa nicht mehr selber musiziert. Aber er war immer ein geduldiger Zuhörer – ob bei Weihnachtsliedern oder einem Gstanzl zum Geburtstag.
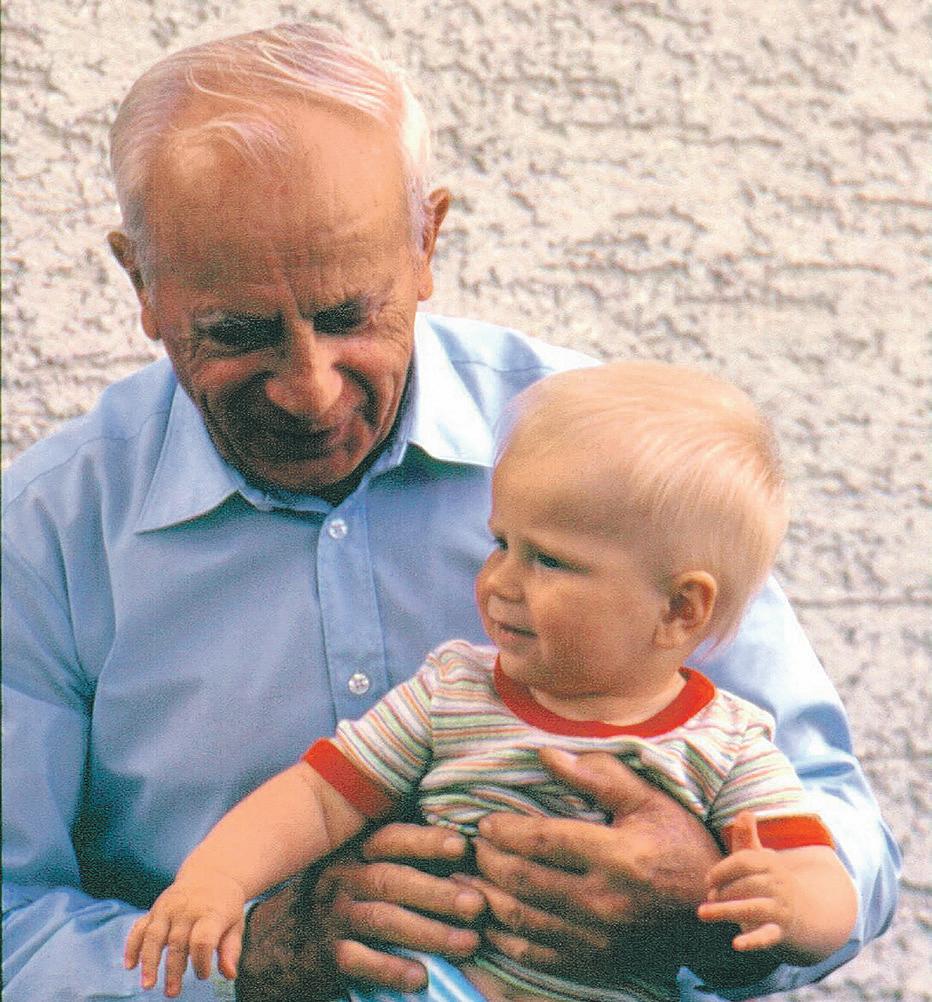
Welche Bedeutung hat die Herkunft des Großvaters für Sie, für
Gubik: Fürs Kabarett sehe ich keine Verbindung. Ich fühle mich als Bayer, ich mache bairisches Kabarett, ich rede bairisch – beziehungsweise ein wenig vermischt mit der Hochsprache. Ich sehe im Bairischen außerdem tolle Möglichkeiten zum Dichten und zum Schreiben, weil man viel mehr Möglichkeiten hat als auf Hochdeutsch. Für meinen Vater spielen die Wurzeln und die Herkunft dagegen schon eine große Rolle. Er ist sehr daran interessiert und hat viele Ausflüge in die Heimat meines Opas unternommen, auch noch mit ihm zusammen. Dieser Aspekt gehört immer als Teil zur Familiengeschichte.
Sie wohnen und leben unweit von Rohr, wo nach 1945 die vertriebenen Benediktiner aus dem Kloster Braunau in Nordostböhmen Unterkunft fanden. Sicher haben Sie auch zum Kloster Rohr und dessen Patres und Fratres Kontakte?
Gubik: Ich hatte schon vor meinen letzten beiden Gymnasialjahren, die ich ja im Johannes-Nepomuk-Gymnasium verbrachte, Kontakte nach Rohr. Die Familie meiner Mama stammt nämlich aus Rohr. Und Altabt Gregor Zippel ist verwurzelt mit der Familie, es herrscht ein guter Kontakt. Schon als Kleinkind habe ich Abt Gregor beim Schlagzeugspielen erlebt. Er war immer wieder auch bei Familienfesten


Gubik: Man kann natürlich oft die Synergien nutzen. Dort, wo man im Einsatz ist, hat man einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und durch die Wechsel bekam man immer wieder ein neues Feld. Ich hoffe aber, daß mein jetziger Schulstandort noch lange bleibt. Durch die Lehrertätigkeit hatte ich also immer schon Publikum. Grundsätzlich habe ich mir immer gesagt: es muß noch ein Leben zusätzlich zum Lehrerberuf geben. Das sollen die Leute auch wissen und kennen. Das heißt, ich zeige mich in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, daß mir das eher hilft. Mein Beruf als Lehrer ist ja etwas Undefiniertes. Als Lehrer kann man – rein theoretisch – bis in die Nacht arbeiten. Man findet immer etwas zum Erstellen, Verbessern, Individualisieren. Da ist es wichtig, ein weiteres Feld zu öffnen und zu sagen: Das ist mir auch wichtig, das bin ich, das ist mein Privatleben, mein Hobby. Da muß sich meines Erachtens jeder etwas suchen, sonst geht er voll im Beruf zugrunde. Für mich waren und sind das die Musik und das Kabarett.
In welchem Rhythmus wechseln Sie Ihre Programme? Gibt es da Erfahrungswerte?

Gubik: Einerseits kann man ein Kabarett-Programm zeitlich auf zwei bis vier Jahre fixieren, auch weil das Thema dann in Bezug auf die Gegebenheiten der einzelnen Beiträge nicht mehr aktuell ist. Und man kann es daran festmachen, wenn einem die Gelegenheiten, also die bekannten Auftrittsorte, ausgehen. Dann ist es Zeit für ein neues Programm, das man dann an den festen Spielorten, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat, präsentieren kann.
Für ein neues Programm muß es natürlich auch neue Lieder geben. Wann schreiben Sie diese?
Gubik: Es läuft immer nebenher. Sobald mir lustige Sachen einfallen, notiere ich es sofort –am besten direkt ins Handy. Meistens kommt dann an einem ruhigen, verregneten Sonntagabend der Gedanke, daraus ein Lied zu basteln. Aber es passiert auch, daß ich mich hinsetzte und ganz speziell zu einem Anlaß ein Lied mache.
Der Eintritt ist frei – das Programm jeweils hochkarätig. Mit einem Neujahrskonzert des weltberühmten Wihan Quartetts aus Prag am Samstag, 21. Januar, und dem Festakt zur Verleihung der kulturellen Förderpreise am Samstag, 28. Januar, startet das Sudetendeutsche Haus fulminant ins neue Jahr.
Als Interpret der tschechischen Komponisten sowie der klassischen, romantischen und modernen Meisterwerke des Streichquartett-Repertoires hat das Wihan Quartett einen erstklassigen Ruf. So bezeichnete das renommierte Fachmagazin International Record Review die vier Prager Künstler als „eines der besten Quartette der Welt“.

Auf Einladung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau gibt das Wihan Quartett am Samstag, 21. Januar, im Sudetendeutschen Haus ein Neujahrskonzert. Beginn ist um 19.00 Uhr.
Eine Woche später steht der nächste Kulturhöhepunkt im Sudetendeutschen Haus auf dem Programm. Um 15.00 Uhr beginnt der Festakt zur Verleihung der kulturellen Förderpreise.
Mit den Förderpreisen zeichnet die Sudetendeutsche Lands-
■ Noch bis Freitag, 23. Dezember, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband, Ausstellung zu Waltsch: „Gemeinsam für die Heimat“. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, SL-Bundesgeschäftsstelle, Hochstraße 8, München.
■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. Vom 24. Dezember bis 8. Januar geschlossen. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Dienstag, 27. Dezember, 17.00 Uhr, Duo Connessione: Weihnachtliche Abendmusik. Gespielt werden Werke böhmischer und deutscher Barockmusik und der Vorklassik. St. Sebastian, Untersimonswald. Weiterer Auftritt: Freitag, 30. Dezember, 17.00 Uhr, St. Urban, Freiburg-Herdern.
■ Dienstag, 27. Dezember, 19.30 bis 21.00 Uhr, Erzdiözese Wien: Kinderführung im Stephansdom. Kinder ab 8 Jahren und deren Begleitpersonen können den weihnachtlich geschmückten Dom und die Krippendarstellungen kennenlernen. Anmeldung ausschließlich unter Angabe einer Telefonnummer, Alter der Kinder und Anzahl der Teilnehmer unter eMail fenstergucker@gmx.at
■ Sonntag, 8. Januar 2023, 15.00 bis 16.00 Uhr, SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land: Neujahrsgottesdienst der Vertriebenen in München. Es zelebrieren Msgr. Dieter Olbrich, Msgr. Karl Wuchterl, Dekan Adolf Rossipal und Pfarrer Mathias Kotonski. Für die musikalische Umrahmung sorgt der „Chor der Sudetendeutschen Landsmannschaft“, bestehend aus der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, der Egerländer Gmoi z‘ Geretsried und dem Iglauer Singkreis München unter der Leitung von Roland Hammerschmied. Die Orgel spielt Thomas Schmid. Kirche St. Michael, Neuhauser Straße 6,
mannschaft Persönlichkeiten aus, die künftig außergewöhnliche Leistungen auf den Gebieten Bildende Kunst und Architektur, Literatur und Publizistik, Musik, Wissenschaft sowie Volkstumspflege erhoffen lassen. Preisträger sind in diesem Jahr: Bildende Kunst und Architek-
tur: Julia Bertlwieser (geboren 1992 in Miltenberg).




Darstellende und Ausübende Kunst: Lisa Maria Kebinger (geboren 1994 in München).
Musik: Leonard Willscher (geboren 1997 in Hamburg).


Volkstumspflege: Anna-Lena Hamperl (geboren 1998 in Trost-
München.
■ Samstag, 14. Januar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: Bericht von der Fahrt nach Aussig und Tetschen im Oktober 2022. Vortrag von Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 21. Januar, 13.00 bis 15.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum, Workshop im Winter: „Es schneit!“ Gemeinsam entdecken Kinder und Familien glitzernde Winterwelten und gestalten mit Nadja Schwarzenegger eigene Schneekugeln. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. Anmeldung per eMail an anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de
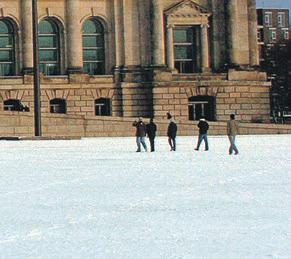
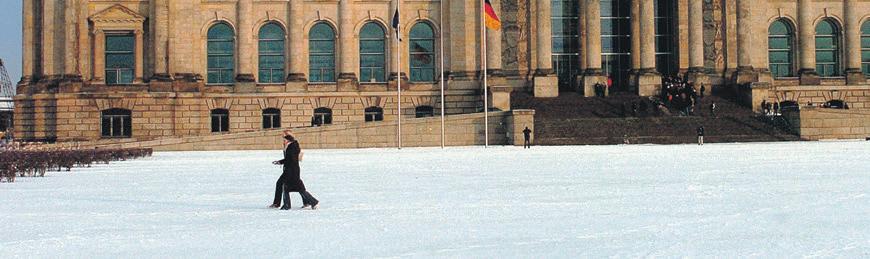
■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau: Neujahrskonzert mit dem Wihan Quartett aus Prag. Eintritt frei (siehe oben). Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 27. Januar, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel, Wien. Anmeldung an eMail sekretariat@vloe.at

■ Samstag, 28. Januar, Sudetendeutscher Rat: Plenum. Programm und Örtlichkeiten folgen.
■ Samstag, 28. Januar, 15.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei (siehe oben). Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer
Straße, Bad Kissingen.
■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen (auch in deutscher Sprache) unter www.jiz50.cz
■ Mittwoch, 15. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.
■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversamm-
berg) sowie Jan Vrána (geboren 2003 in Jungbunzlau).
Die Preisgelder werden gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales über das Haus des Deutschen Ostens HDO und der Festakt der Preisverleihung durch die Sudetendeutsche Stiftung.

lung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. In dem Film erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad (Programm und Örtlichkeiten folgen).
■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.
■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Genaues Programm mit den jeweiligen Veranstaltungsorten folgt.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Montag, 9. bis Mittwoch, 11. Januar 2023: „Politische Akteure und Verfahren in Deutschland und Europa“. Seminar mit der Konferenzsimulation „Der Bundestag entscheidet“. Veranstaltung für Multiplikatoren und politisch Interessierte.


Das Seminar vermittelt in erster Linie die grundlegenden Kenntnisse über das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Neben fundamentalen Verfassungs- und Institutionenkenntnissen werden spezifische Probleme des deutschen Regierungssystems beleuchtet. Im Mittel-
punkt stehen dabei die Analyse der Struktur und der Arbeitsweise politischer Institutionen, die im politischen System laufenden Prozesse unter Berücksichtigung von einflußnehmenden Akteuren sowie ausgewählte Beispiele der innenpolitischen Entwicklung. Eine Konferenzsimulation verdeutlicht die theoretischen Ausführungen.
Ein ergänzender Blick auf die Geschichte, den institutionellen Aufbau und verschiedene Politiken der Europäischen Union rundet das Seminar ab und zeigt zudem Hintergründe und Lösungsansätze für aktuelle europäische Herausforderungen.
Das Foto zeigt das Reichstagsgebäude in Berlin, in dem der Deutsche Bundestag seinen Sitz hat (Foto: Deutscher Bundestag/Achim Melde)
Fragen und Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
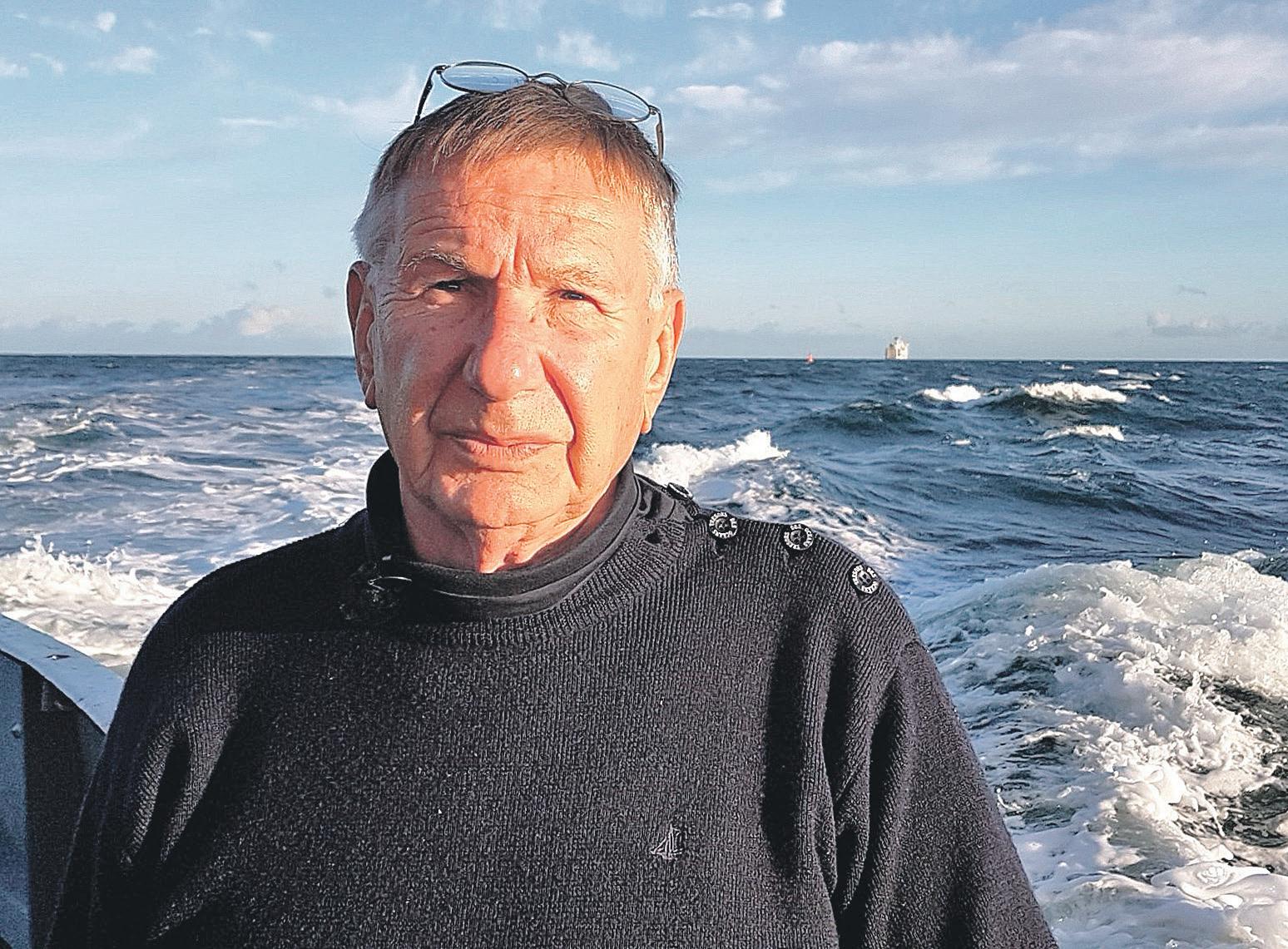

■ Dienstag, 10. Januar 2023, 19.00 Uhr: Filmsoirée „Seestück“. Referent: Volker Koepp. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Vor der magischen Naturkulisse der Ostsee begegnet der Film Menschen, die an den deutschen, polnischen, skandinavischen, baltischen und russischen Küsten dieses Binnenmeers leben. Sie erzählen von ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Erinnerungen und Hoffnungen und entwerfen dabei ein Bild von unserer Gegenwart, in der ökologische Probleme, politische OstWest-Konflikte und nationale Sichtweisen auf globale Entwicklungen allgegenwärtig sind. Viele Bilder und Gespräche aus den Drehtagen des Jahres 2017 lassen die unheilvolle Entwicklung der kommenden Jahre vorausahnen.
„Hintergrund ist stets die Geschichte, ich aber will die
Gegenwart erzählen“, lautet das Motto von Volker Koepp. Der 1944 in Stettin geborene Filmemacher studierte an der Technischen Universität Dresden und an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg, wo er 1969 sein Diplom erwarb. Im Anschluß war er bis 1991 als Regisseur im DEFAStudio für Dokumentarfilm in Potsdam-Babelsberg und Berlin tätig. Danach machte er sich als Regisseur, Autor und Produzent selbstständig und gründete „Vineta Film“. Seine zahlreichen Dokumentarfilme, die Regionen und Gebiete mit ihren historischen Entwicklungen und Eigenarten erkunden und dabei Landschaften wie Menschen gleichermaßen in den Mittelpunkt rücken, gewannen in Deutschland und international verschiedene Preise. 2014 bekam Volker Koepp das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.
Es ist ein Symbol der Freiheit, eine Institution, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wieder im Bewußtsein ist: Die Ukrainische Freie Universität (UFU) mit Sitz in München. Als der Bayerische Landtag im Rahmen einer Aktuellen Stunde am 10. März über den Krieg in Europa diskutierte und Putins Verbrechen gegen die Menschlichkeit fraktionsübergreifend verurteilte, war auch die Rektorin der UFU, Prof. Dr. Marija Pryschljak, im Maximilianeum anwesend.

Als Zeichen der unverminderten Solidarität hat der Vertriebenenbeirat der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag im Dezember die Ukrainische Freie Universität (UFU) in München-Nymphenburg besucht, wo sie seit 2011 in einer ehemaligen Anwaltskanzlei untergebracht ist.
Das Bewußtsein um diese wichtige ukrainische Institution der freien Wissenschaft in Bayern beflügelte viele Parlamentarier, dieser Einrichtung, auch im Hinblick auf viele flüchtende Studenten aus der Ukraine, eine bessere Existenz zu sichern.


Der langjährige Landtagsabgeordnete und jetzige Vorsitzende des BdV Bayerns, Christian Knauer, schrieb dazu Anfang Mai eine Petition an den Bayerischen Landtag, man möge doch die Staatsregierung bitten, Gespräche mit dem Bund für eine gemeinsame finanzielle Unterstützung aufzunehmen, um eine Ausweitung der Studienkapazitäten zu ermöglichen. Die erste Antwort war eher ernüchternd, da der Status einer Privatuniversität Schwierigkeiten mache.
Die Landtagsausschüsse beschäftigen sich akutell dennoch mit der Materie, weil die Zahlen unmißverständlich sind. Vor dem 24. Februar hatte die UFU 280 Studenten, jetzt, im Wintersemester 2022/23, studieren 472 Studenten an der UFU. Das ist fast das Doppelte. Hinzu kommt, daß zwischen 100 und 150 Anmeldungen aus Kapazitätsgründen nicht berücksichtigt werden konnten. Nur aus humanitären Gesichtspunkten, wie bei Anfragen aus Mariupol oder Cherson, wo die Lage entsetzlich ist, konnten Ausnahmen gemacht werden. Der tatsächlichen Situation nachzuspüren, diente der Besuch der SPDAbgeordneten.
Zuerst fand ein Gespräch mit Studenten statt, die hier Aufbaustudien betreiben und von ihren Nöten berichteten. Nur wenige haben Stipendien, und sie müssen eigentlich 600 Euro pro Semester als Studiengebühren bezahlen. Vielen wird das in der gegenwärtigen Lage erlassen, aber die Universität finanziert sich wesentlich durch diese Studiengebühren.
Durch eine einmalige Hilfe von 100 000 Euro, die Bayerns Kultusmi-

nister Markus Blume angewiesen hat, konnten für zwei Jahre mit Unterstützung der MEAG – einem Vermögensverwalter der Münchner Rück und der ERGO-Gruppe – zusätzlich 1200 Quadratmeter Fläche angemietet werden. Auch technische Unterstützung für Hybrid-Unterricht konnte gewährt werden. Aber es gibt noch ganz andere Herausforderungen. Für das erste Semester brauchen die neuankommenden Studenten eine Unterkunft. Den meisten
gelingt es danach, mit Hilfe anderer Studenten sich eine Wohnmöglichkeit zu organisieren.
Im Gespräch mit den Abgeordneten stand allen Studenten die Sorge um die eigene Familie in der Ukraine ins Gesicht geschrieben. Alle versuchen Kontakt zu halten und organisieren humanitäre Hilfe, davon zeugen auch Unmengen an Kartons, in denen Hilfsgüter gesammelt und in den Gängen der UFU zwischengelagert werden. Die engagier-
ten männlichen Studenten fahren auch bis zur Grenze Hilfsgüter, reisen aber nicht in die Ukraine ein, denn sonst dürften sie das Land dann nicht mehr verlassen und nach München zurückkehren. Der Krieg wirft seine Schatten auf viele alltägliche Abläufe.
Im Anschluß an die Gespräche besuchte der Vertriebenenbeirat unter Leitung von Volkmar Halbleib die Kellerräume, in denen sich das Archiv und die Bibliothek befinden. 35 000 ukrainischsprachige Bücher hat die UFU, aber sie sind nicht genügend erfaßt und schon gar nicht digitalisiert. Dies wäre aber ein wichtiges Anliegen, das nur mit einer zusätzlichen Förderung außerhalb des täglichen Betriebes realisiert werden könnte. Nur so könnten ukrainische Universitäten und Studenten dort auf die wichtigen Bestände seit 1945 zurückgreifen.

Peter Hilkes, seit 2006 Lehrbeauftragter für ukrainische Landeskunde an der LMU und seit 2016 auch an der UFU tätig, führte durch die Räume und präsentierte einige besonders interessante Archivalien. So zeigte er eine 1946 gedruckte Sammlung von Briefen und Reflexionen über die ukrainische Identität von Wjatscheslaw Lypynskyj (18821931), die er 1920 schrieb. Und das Leben dieses ukrainischen Historikers, politischen Philosophen, Publizisten und Botschafters ist Gegenstand eines Romans von Tanja Maljartschuk, die als Ukrainerin in Wien lebt, 2018 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann und 2019 das Buch „Blauwal der Erinnerung“ veröffentlichte. Und Hilkes wies auf die einmalige Sammlung der UFU von Quellen der ukrainischen Diaspora, aber auch von offiziellen sowjetischen Publikationen auf Ukrainisch hin, die einzigartig seien und unbedingt zugänglich gemacht werden müßten.
Eine kleine Darstellung der Geschichte durch Dieter Rippel, Beirat der UFU, öffnete den Blick auf die mittlerweile über 100-jährige Geschichte dieser Verkörperung der freien Wissenschaft mit ukrainischer Identität in Wien, Prag und München.
Dann sprach die Rektorin Marija Pryschljak über ihre Sorgen und Nöte, die schon in der Unterredung mit den Studenten deutlich wurden. Raumnöte, Studentenunterkünfte, aber auch die Frage, wie Deutschland eigentlich die Entwicklung der Ukraine bis hin zur EUMitgliedschaft unterstützen will, wenn sie diese Einrichtung, die schon einmal von Deutschland und dem Freistaat Bayern unterstützt wurde und die für eine freie und demokratische Bildung ukrainischer Studenten steht, nicht auf eine längere Zeit bezuschußt.
Volkmar Halbleib sicherte der Rektorin seine Unterstützung zu. Man wird sehen, wie sich auch der Bund dazu verhalten wird. Ulrich Miksch
In der Weihnachtszeit denke ich häufig an die Prager Karmeliterkirche. Sie hat eine bewegte Geschichte. Deutsche Protestanten erbauten sie zwischen 1611 und 1613. Wenige Jahre später aber, nach dem Sieg der Katholischen Liga in der Schlacht am Weißen Berg, wurde sie der Ordensgemeinschaft der Karmeliter übergeben, umgebaut und erhielt den Titel „Sancta Maria de Victoria – Maria vom Siege“. Noch einmal einige Jahre später, 1628, schenkte Fürstin Polyxena von Lobkowicz dieser Kirche eine ursprünglich aus Spanien stammende rund 60 Zentimeter große Statue des Jesuskindes. Als Prager Jesulein (➝ Seite 12) ist diese Statue seit Jahrhunderten ein Magnet, nicht nur in der Goldenen Stadt, sondern in Form von zahllosen Nachbildungen auch an vielen Orten rund um den Globus.
Gerne besuchte ich in meinen Prager Jahren die Karmeliterkirche. Ich reihte mich in die bunte internationale Pilgerschar ein, schaute voll Vertrauen zur Figur des Jesuskindes am rechten Seitenaltar hinauf, vor allem aber ließ ich mich selbst von diesem Kind mit seinem milden Lächeln anschauen. Nur selten gelang es einem Künstler in der langen Geschichte der christlichen Kunst die Liebe und Barmherzigkeit Gottes so ansprechend wiederzugeben wie hier. Dabei wird das Kind fast das ganze Jahr über wie ein kleiner Herrscher gezeigt: mit einer übergroßen Krone auf dem Haupt, bekleidet mit einem wertvollen Krönungsmantel, mit der rechten Hand huldvoll grüßend und segnend, in der linken Hand trägt es eine Weltkugel.
Oft fiel mein Blick auf diese Weltkugel in der linken Hand. Die linke Körperhälfte ist in der Neuropsychologie Ausdruck für die emotionale Seite des Menschen. So zeigt das Prager Jesulein, daß der Gottessohn gefühlvoll die Welt in seiner Hand hält. Ihm liegt an dieser Erde, die die Menschen oft als Spielball unterschiedlicher Interessen mißbrauchen. Er suchte diese Erde durch seine Menschwerdung in Bethlehem auf und gab allen, die an ihn glauben, Hoffnung und Zuversicht. Die adventliche Verheißung aus dem Jesaja-Buch „Taut, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, laßt Gerechtigkeit regnen! Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es vollbringen“, diese Verheißung ist in Jesus wahr geworden. An Weihnachten feiern wir dies in besonderer Weise.



Professoren und Studierende der Kiewer Universität flohen vor dem Einmarsch der Roten Armee 1921 nach Wien und gründeten dort die UFU, was sich jedoch schnell als Fehler herausstellte, da die nötigen Kompatibilitäten in Wien fehlten.
Da die neugegründete Tschechoslowakei auch die Karpato-Ukraine umfaßte, gab es dort ein Interesse zur Unterstützung einer freien Universität in ukrainischer Sprache. In Prag stellte die tschechoslowakische Regierung unter Präsident Masaryk mit Hilfe der Karls-Universität geeignete Räume zur Verfügung und beteiligte sich an der Finanzierung, wodurch die UFU bereits im Herbst 1921 nach Prag übersiedeln und bis 1945 auch noch unter deutscher Verwaltung arbeiten konnte.
Beim Einmarsch der Roten Armee zur Befreiung der Tschechoslowakei ging ein Teil der UFU unter Obhut der Amerikaner nach München, wo viele Displaced Persons – Ukrainer, die aus
Angst um ihr Leben nicht in die Sowjetunion zurück wollten, in Lagern lebten und studieren wollten. Der andere Teil, der sich mit der Sowjetunion zu arrangieren gedachte und zurückkehrte, wur-
de von den kommunistischen Machthabern getötet. Die Bibliotheken und Archive wurden zerstört und gingen verloren.



In München bekam die UFU, die erst zwei, heute die drei Fakultäten Staats- und Wirtschaftswissenschaften, Ukrainistik, Philosophische Fakultät umfaßt, die Anerkennung der Bayerischen Staatsregierung und das Recht zu Promotion und Habilitation. Die Ukraine erkennt seit 1992 die Diplome der UFU an.
Eine finanzielle Unterstützung gab es vom Bund bis 1997, zuletzt 907 000 DM.
Der Freistaat gewährte ab 1981 auf Anordnung von Ministerpräsident Franz Josef Strauß einen jährlichen Zuschuß von 180 000 DM, zuletzt bekam die UFU 2003 von Bayern eine Unterstützung.

Im Laufe der Jahrzehnte änderte sich die Arbeit der UFU. Viele Ukrainer übersiedelten in die USA und nach Kanada, wo auch erhebliche Spenden akquiriert wurden. Die heutige Rektorin Marija Pryschljak ist eine amerikanischukrainische Historikerin, die nach Lehrtätigkeiten an der Georgetown-University, Präsidentin einer Universität in Warschau war, bevor sie nach München kam, zuerst als Dekanin der Staats- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, dann ab 2016 als Rektorin.
Die Studenten waren anfangs Emigranten oder kamen aus der Diaspora, seit den 1990er Jahren kommen sie überwiegend aus der Ukraine und lernen so
Wenn mitten in die weihnachtliche Festzeit auch der Neujahrstag fällt, der nicht von ungefähr als Weltfriedenstag begangen wird, höre ich vom Prager Jesulein ein besonderes Anliegen: „Geht auf dieser Erde friedlich miteinander um, schließt aber auch Frieden mit der Erde selbst. Mißbraucht und gefährdet sie nicht, beutet sie nicht über Gebühr aus, verschmutzt sie nicht mit Euren Schadstoffen. Sie soll auch noch jenen Menschen eine lebenswerte Erde sein, die nach Euch kommen. Ihr habt nämlich keinen Planeten B, keine zweite Erde, zur Verfügung. Es gibt nur diesen Planeten A. Deswegen muß Euer Plan A sein, diesen Planeten zu schützen. Jeder Plan B verbietet sich.“ Ob es uns 2023 gelingt, diesem Anliegen ein wenig besser als bisher zu entsprechen?
Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Pfarrei Ellwangen-Schönenberg
Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)
Adresse:
Name, Vorname
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief

Vergangenes Jahr veröffentlichte der Amerikaner Stephen Budiansky „Journey to the Edge of Reason“ über den in Brünn geborenen Mathematiker Kurt Gödel, den eine Freundschaft mit Albert Einstein verband. Im November erschien das von Hans-Peter Remmler ins Deutsche übersetzte Buch „Reise zu den Grenzen der Vernunft. Kurt Gödel und die schwerste Krise der Mathematik“.
heiratet. Dachte, er käme zwecks Beurteilung seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit – was ich
se allein, in einer Weise und auf Gebieten, die der gegenwärtigen Richtung zuwiderlaufen. –
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Straße, Hausnummer
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Postleitzahl, Ort
Telefon E-Mail
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)
Neudeker Heimatbrief, für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Geburtsdatum, Heimatkreis
Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)
Wer ist Kurt Gödel? In der Internet-Enzyklopädia „Wikipedia“ lesen wir: „Kurt Friedrich Gödel (* 28. April 1906 in Brünn, Österreich-Ungarn, heute Tschechische Republik; † 14. Januar 1978 in Princeton, New Jersey, Vereinigte Staaten) war ein österreichischer und später USamerikanischer Mathematiker, Philosoph und einer der bedeutendsten Logiker des 20. Jahrhunderts. Er leistete maßgebliche Beiträge zur Prädikatenlogik (Vollständigkeit und Entscheidungsproblem in der Arithmetik und der axiomatischen Mengenlehre), zu den Beziehungen der intuitionistischen Logik sowohl zur klassischen Logik als auch zur Modallogik sowie zur Relativitätstheorie in der Physik. Auch seine philosophischen Erörterungen zu den Grundlagen der Mathematik fanden weite Beachtung.“
Kurz gesagt, er entdeckte, daß jedes sinnvolle logische System Sätze enthalten muß, die wahr, aber niemals beweisbar sind. Mit seinem Unvollständigkeitssatz stürzte Gödel die Mathematik in ihre schwerste Krise.
Kein geringerer als Albert Einstein, schreibt Budiansky in seinem Prolog, habe Gödel „den größten Logiker seit Aristoteles“ genannt. „Selbst in Princeton, einer Kleinstadt mit mehr Nobelpreisträgern als Verkehrsampeln, stach sein einzigartiges Genie heraus.“ Solche Sätze geben dem schweren Stoff eine Leichtigkeit, die feine Ironie verzerrt aber die Bedeutung nicht.
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der unverzüglich mit.
Kontoinhaber
ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft
(SVG), Hochstraße 8, 81669 München,
Kontonummer oder IBAN
DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Bankleitzahl oder BIC
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Danach zitiert Budiansky Notizen von Gödels Psychiater Philip Ehrlich aus dem Jahr 1970: „Kurt Gödel 64. Seit 32 Jahren verheiratet mit Adele, 70. Keine Kinder. Frau war zuvor ein Mal ver-
Albert Einstein (1979–1965), Lewis Strauss, Kurt Gödel und Julian Seymour Schwinger bei der ersten Verleihung des Albert Einstein Awards. Dieser Preis ist ein vom Lewis-und-Rosa-Strauss-Gedächtnisfonds über das Institute for Advanced Study (IAS) vergebener Physik-Preis, der zu Albert Einsteins 70. Geburtstag gestiftet wurde. Einstein war Mitglied des IAS und Lewis Strauss in dessen Kuratorium. Im Komitee für den ersten Preis war auch Einstein vertreten. Anfangs war er mit einem Preisgeld von 15 000 Dollar verbunden, später auf 5000 Dollar reduziert. Er wird seit 1951 verliehen. Die ersten Preisträger 1951 waren Kurt Gödel und Julian Seymour Schwinger (1918–1994). Schwinger erhielt 1965 den Physiknobelpreis.



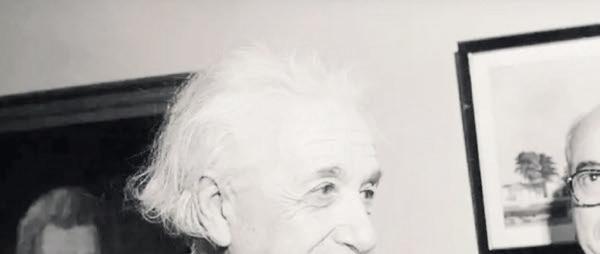
verneinte – um ,ihm zu helfen‘, sofern möglich. – Kam auf Drängen von Bruder und Ehefrau.
Glaubt, er hätte die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht –wäre folglich ein ,Versager‘ –deshalb würden andere, vor allem am Institut, ihn ebenfalls für einen Versager halten und versuchen ihn loszuwerden. – Glaubt, man hätte ihn für unzurechnungsfähig erklärt und würde eines Tages erkennen, daß er frei ist, dann würde man ihn fortschaffen, da er zu gefährlich sei.
Angst vor Verarmung, Verlust der Stellung am Institut, weil er im letzten Jahr nichts geleistet hätte – hätte 35 Jahre lang so gut wie nichts geleistet –vier bis fünf Veröffentlichungen. –Nahm sich große Themen vor, war vielleicht nicht talentiert genug gewesen. – Arbeitet normalerwei-
Fühlt sich möglicherweise für schuldig, weil er nicht produktiv genug sei und nicht die gleiche Anerkennung erreiche wie in jungen Jahren.“
Dies deutet Gödels Ende an. Da er glaubte, vergiftet zu werden, aß er nur, was seine Frau Adele gekocht und in seiner Gegenwart gekostet hatte. Als sie wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus mußte, verhungerte er.
Über den Umzug von Kurt Gödel und seinem Bruder Rudolf 1924 zum Studieren nach Wien schreibt Budiansky: „Sie waren ein Teil des unvermeidlichen Exodus‘ junger Tschechen-Deutscher, die ihre Zukunft in einer Nation bezweifeln, die beschlossen hatte, ihre Existenz nicht allein in Form von Unabhängigkeit von Österreich-Ungarn zu denfinieren, sondern auch als ethnolingusitischen Triumph über die einstigen Unterdrücker. ,Ich bin ein echter Wiener‘, witzelte der ebenfalls aus Brünn stammende Leo Slezak in seinen Memoiren. ,Alle echten Wiener sind aus Brünn.‘“
Mit diesen zwei Sätzen beginnt tatsächlich das Kapitel „Brünn“ in Leo Slezaks Buch „Rückfall“. Die folgenden zwei Sätze lauten: „Jeder, der etwas auf sich hält, etwas bedeuten will, ist aus Brünn. Ist dies einmal nicht der Fall, so bildete das eine Ausnahme.“ Und diese Ausnahme bildet der fröhliche mährische Heldentenor selber. Er war 1873 in Mährisch Schönberg als Sohn eines Müllers zu Welt gekommen und starb 1946 im oberbayerischen Rottach-Egern.
Stephen Budiansky: „Reise zu den Grenzen der Vernunft. Kurt Gödel und die schwerste Krise der Mathematik“. Deutsch von HansPeter Remmler. Propyläen Verlag, Berlin 2022. 464 Seiten, 28,00 Euro. (ISBN: 9783-549-10039-4).
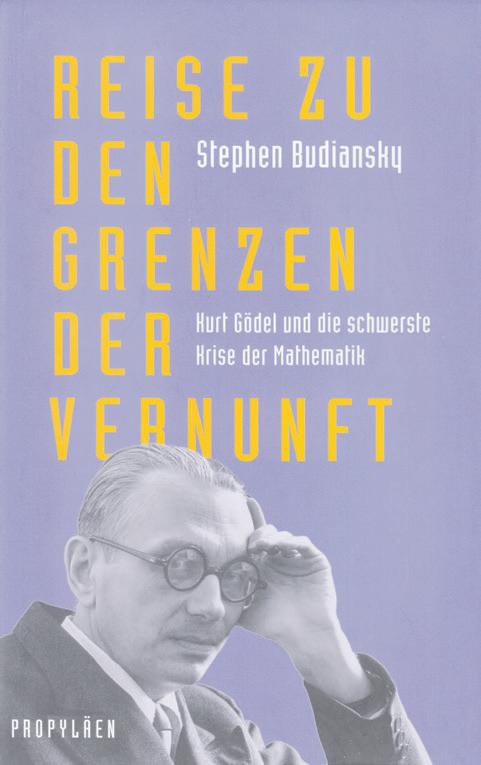
Zunächst schilder Budiansky die Welt, in die Gödel hinein geboren wurde, das von der Habsburger Monarchie geprägte wohlhabende mährische Manchester Brünn. Der spätere Heldentenor Leo Slezak, ein Zeitgenosse von Gödels Eltern, habe im selben Mietshaus gewohnt, in dem Gödel zur Welt gekommen sei: in der Bäckergasse Nummer 5.
Laut Verlag erzählt Stephen Budiansky das Leben des brillianten Denkers vom Wien der Wissenschaftler und Intellektuellen in der Vorkriegszeit über Gödels Flucht in die USA bis zu seinem neuen Wirkungskreis in Princeton. Budiansky kann sich erstmals auf Gödels vollständigen Nachlaß stützen und erkundet so auch die lähmenden Paranoia-Anfälle dieses genialen, aber zerquälten Menschen.

Der US-amerikanische Chemiker, Schriftsteller, Historiker und Biograph Stephen Budiansky kam 1957 in Boston zur Welt. Er ist Autor zahlreicher Bücher, Wissenschaftsjournalist und schreibt regelmäßig für die „New York Times“, das „Wall Street Journal“ und die „Washington Post“. „Journey to the Edge of Reason“ wurde von der Zeitschrift „Kirkus Reviews“ als „Best Science Book of 2021“ ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau Martha Polkey auf einer kleinen Farm in Loudoun County, Virginia.
 Nadira Hurnaus
Nadira Hurnaus
Anfang Dezember zeichnete die Karls-Universität Prag den ehemaligen Deutschen Botschafter in Prag, Christoph Israng, aus.
Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München

E-Mail svg@sudeten.de
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit. Kontoinhaber
Im November ehrte der hessische BdV-Kreisverband Limburg-Weilburg sein treues Mitglied Margit Zohner.

Beim Kreisverbandstag des BdV Limburg-Weilburg in Löhnberg ehrten Kreisvorsitzender Josef Plahl und Vorstandsmitglied Anneliese Ludwig Margit Zohner aus Limburg für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, überreichten ihr die Eh-

renurkunde und dankten für die langjährige Treue.
In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte Josef Plahl den Tag der Heimat mit dem Motto „Vertriebene und Spätaussiedler: Brückenbauer in Europa“. Erfreulich sei die Teilnahme eines Bundestagsabgeordneten, von vier Landtagsabgeordneten, von vier Bürgermeistern und eines Stadtrates gewesen. Der Tag der Heimat 2023 werde am 8. Oktober stattfinden. fl
Christoph Israng nahm die Goldene Gedenkmedaille der Prager Karls-Universität aus den Händen des ehemaligen Rektors der Hochschule und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten Tomáš Zima in der Tschechischen Botschaft in Berlin entgegen. Zur Begründung verwies Zima in seiner Laudatio auf die „tolle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Universität“. Vergangenen Sommer hatte die SL-Landesgruppe Israng in Prag mit ihrer Goldenen Verdienstmedaille geehrt.
Kommenden Juni wird die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen den rumänischen Staatsprädenten Klaus Iohannis auszeichen. Klaus Iohannis wird den FranzWerfel-Menschenrechtspreis 2023 für seinen Einsatz für Menschenrechte und Minderheiten in der Frankfurter Paulskirche erhalten. Die Laudatio auf den zukünftigen Preisträger wird der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, JeanClaude Juncker, halten.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hatte Iohannis ihren Europäischen Karls-Preis 2020 wegen Corona erst heuer beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Hof überreicht.
Rechtzeitig zum Dritten Advent hielt
Ulf Broßmann den Vortrag „Krippenkunst und mechanische Krippen“. Der SL-Bundeskulturreferent stellte mit Fotografien und Filmsequenzen Krippentraditionen in den Böhmischen Ländern und ausgewählte Krippen vor.
Mein Vater stammte aus Wagstadt im Kuhländchen und war ein richtiger Krippennarr, wie meine Mutter ihn nannte“, erinnert sich Ulf Broßmann. „Jedes Jahr im Herbst bastelte er mit mir eine neue Krippe“, so der SL-Bundeskulturreferent im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses in München. Als Kind sei sein Vater an Weihnachten gerne in die dortige Nikolauskirche gegangen. Wenn man an deren Krippe an einem Handrad gedreht habe, hätten sich die Windmühlenflügel, die Hirten mit den Schafen und die Heiligen Drei Könige bewegt.
Er habe diese Erzählung seines Vaters nicht ganz glauben können. Jahre später jedoch habe er bei seinem Cousin, dem Pfarrer Ernst Kretschmer, ein Schwarz-Weiß-Foto der Wagstädter Krippe von 1860 gesehen, auf dem sie in ihrer einzigartigen Pracht gezeigt worden sei: sieben Meter lang, eineinhalb Meter breit, zwei Meter hoch und mit einem ein Meter hohem Panoramahintergrund. „So bekam ich von meinem Vater
das wertvolle Krippen-Gen übertragen“, scherzt Broßmann, „und ich interessierte mich fortan auch für mechanische Krippen.“
Bei solchen Krippen hätten Menschen und Tiere die Figuren auf Laufbändern bewegt. Anfangs seien sie dabei händisch mit Kurbeln angetrieben worden, später auch mit Uhrwerken mit bis zu 60 Kilogramm schweren Steingewichten, danach mit Motoren und elektrisch.
abläufe von Handwerkern und Bauern dargestellt seien. Ein Beispiel dafür sei das „Krippenspiel“ aus Tachau, das ab 1910 von Josef Brunner geschaffen, aber 1945 verschollen sei.
Das Krippenspiel von Hohenbruck sei vor 1900 entstanden und zeige auf sieben Ebenen die biblische Geschichte von der Geburt Jesu bis zu seiner Auferstehung sowie viele bewegliche Handwerker.

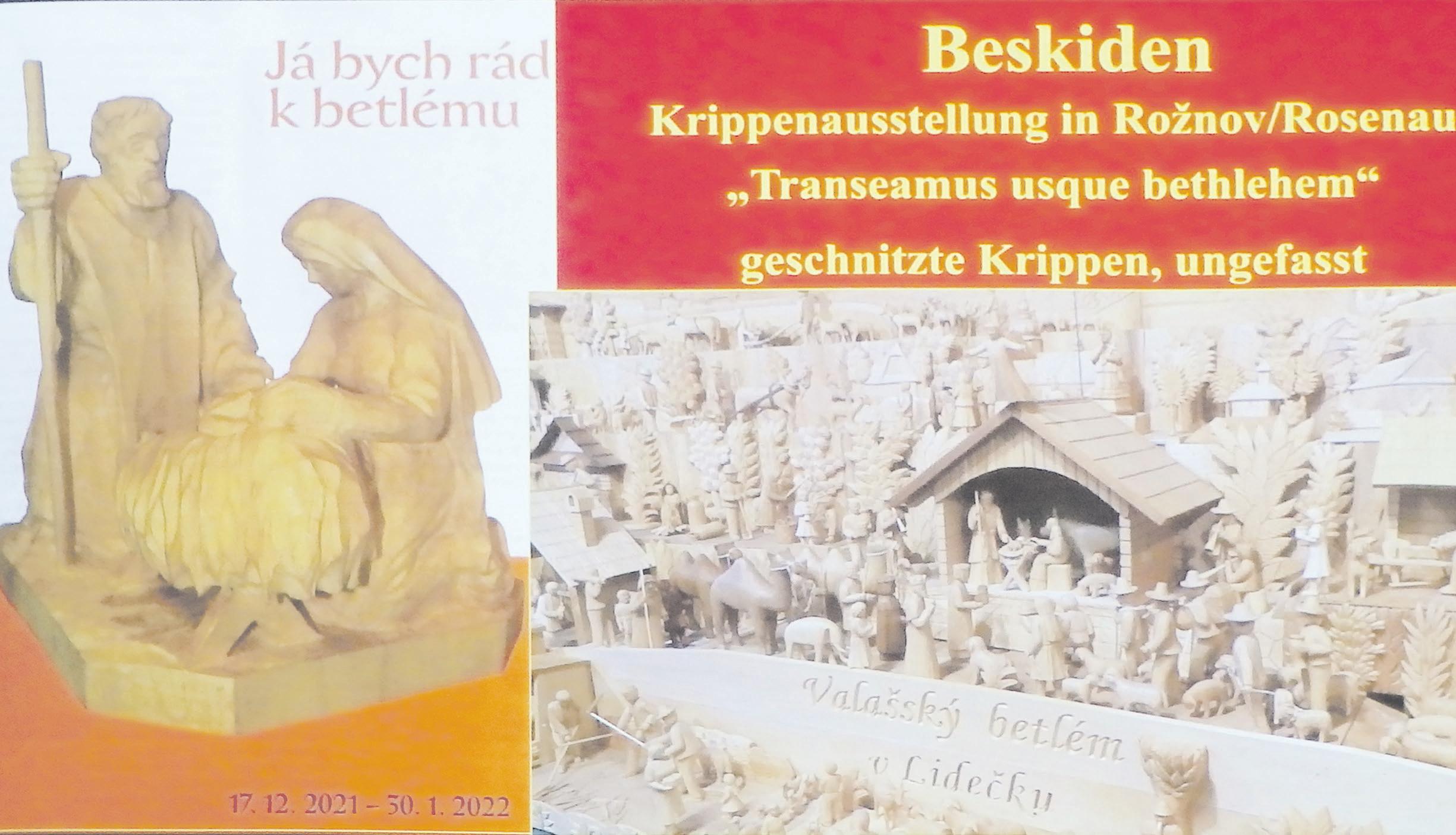
Dreißigjährigen Krieg. In der später zur Kirche erweiterten Kapelle habe schon Mitte des 18. Jahrhunderts eine Krippe gestanden. „Sie fiel dem josephinischen Krippenverbot von 1782 zum Opfer, aber die Figuren wurden an eine Neutitscheiner Familie verkauft, die sie bei der Vertreibung retten konnte.“ 1860 sei wieder eine Krippe mit Holzfiguren für 100 Gulden gekauft und um 1900 durch eine zweite ergänzt worden. „In derselben Zeit wurde die gesamte Krippe mechanisiert.“ Insgesamt handele es sich um 194 Figuren, davon 30 bewegliche, die verschiedenen Stilepochen entstammt hätten, ab 1945 jedoch nicht mehr gezeigt worden seien.
Broßmann stellte dann einige der bekanntesten Mechanik-Krippen aus Böhmen vor. Neben der zuvor beschriebenen – und heute verschollenen – Krippe in Wagstadt auch eine offene mechanische Kastenkrippe aus dem Erzgebirge mit Felsenlandschaft, die um 1920 konzipiert worden sei.
Ein weiterer Typ sei das „Krippenspiel“, bei dem neben den Hauptszenen,
Eine weitere Krippenlandschaft, die walachischen Beskiden im Osten Mährens, habe spezielle Krippen mit unbemalten Figuren in Beskidentracht. Das Beispielbild zeigte eine Krippe, die 2021 in Rosenau/ Rožnov pod Radhoštěm in einer Ausstellung zu sehen war.
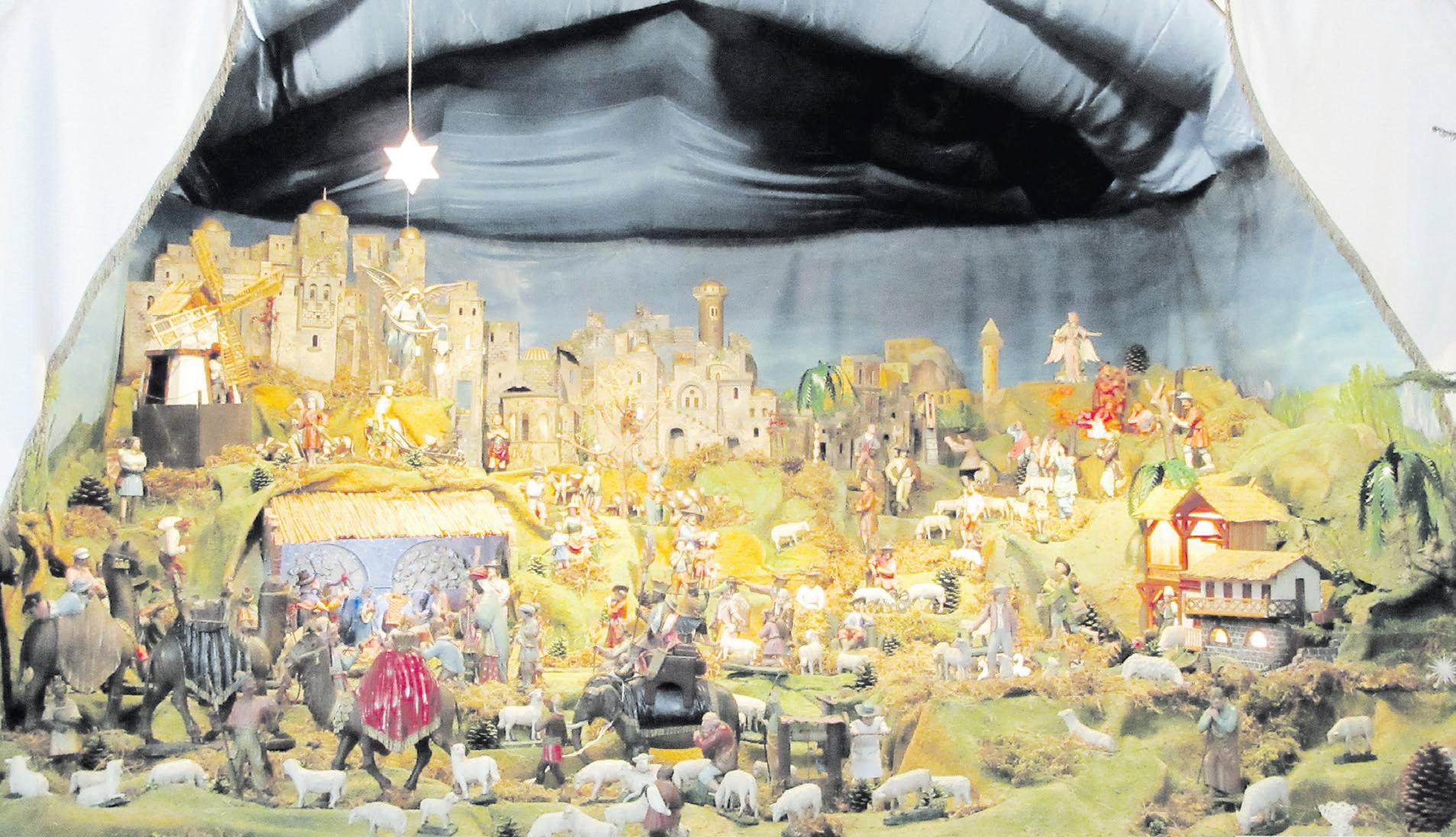
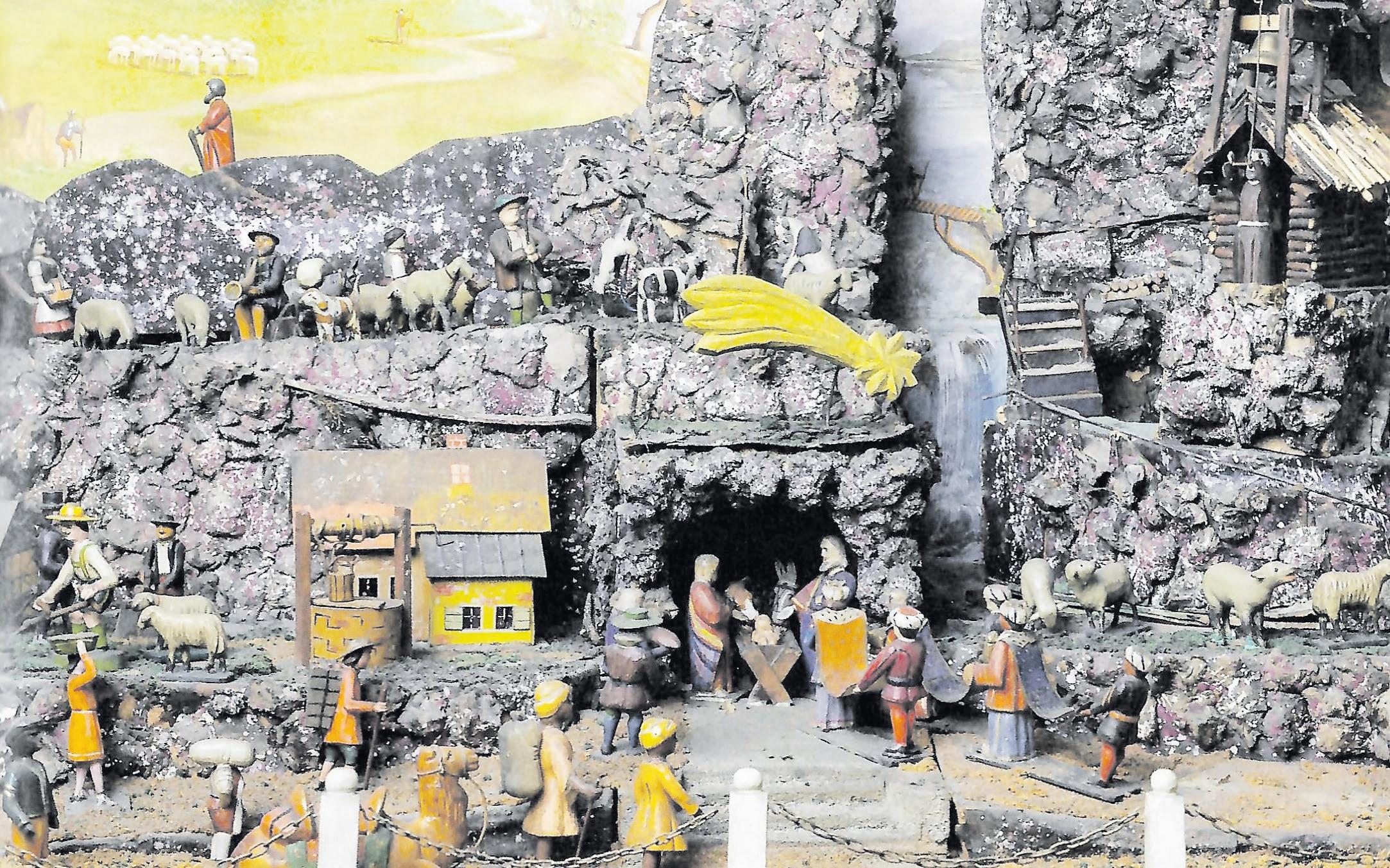
Zuletzt beschreibt Broßmann die Krippe in Neutitschein im Kuhländchen in der dortigen „Spanischen Kapelle“ aus der Zeit nach dem
„Tschechische Krippenfreunde nahmen sich in den sechziger Jahren der langsam verrottenden Krippe an und restaurierten sie“, freut sich Broßmann. „Seit 1960 kann man die Krippe und die 30 beweglichen Figuren mit Licht- und Toneffekten wieder bewundern.“ Über diese Krippe gibt es kurze Videos.

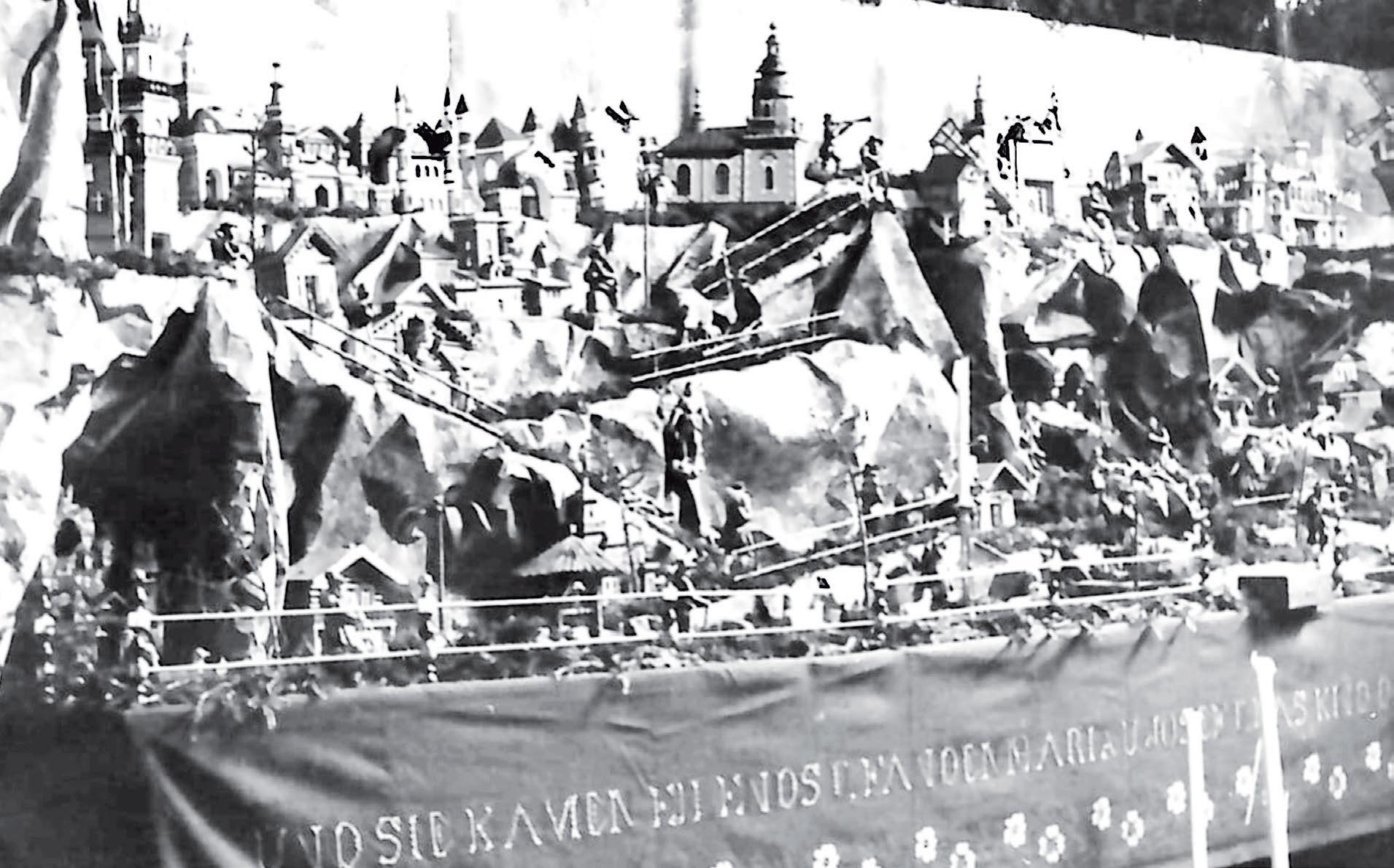
Zum Abschluß zeigt Broßmann ein Foto seines freudig strahlenden Enkels Lukas mit einer Krippe, die Broßmann vor 60 Jahren aus Streichhölzern bastelte. „Ich glaube, Lukas hat das Krippengen von mir geerbt!“, schmunzelt der Referent und verabschiedet sich mit dem Krippengruß „Gloria“.
 Susanne Habel
Susanne Habel

Beim Konzert „Grenzenlos –Aus dem Konservatorium in die Welt“ spielte das „Duo Jost Costa“ aus Yseult Jobst und Domingos Costa vierhändig auf dem Flügel. Dazu referierte der Musikwissenschaftler Joachim Kremer über den Einfluß der Konservatorien auf die Musikwelt in den Ländern Ostmitteleuropas im 19. Jahrhundert. Veranstalter des Benefizkonzerts für die Ukraine im Sudetendeutschen Haus waren das Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein (ASV), das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU (IKGS), das Haus des Deutschen Ostens (HDO) und das Tschechische Zentrum München (TZM).
In der Reihe „Böhmische Spuren in München“ des Adalbert-StifterVereins (ASV) sprach dessen Geschäftsführerin Zuzana Jürgens mit Bischof Rudolf Voderholzer über sein Leben.

In München wurden Sie am 9. Oktober 1959 geboren“, so Zuzana Jürgens. „ Wuchsen Sie dort auch auf“, fragt die ASVGeschäftsführerin ihren Gast. „Ja, die ersten Jahre in der Türkenstraße in Schwabing“, so Rudolf Voderholzer. Später sei er gemeinsam mit seinen drei jüngeren Geschwister in MünchenSendling aufgewachsen, wo er auch das Dante-Gymnasium besucht habe. Während seines Promotionsstudiums habe er in München-Haidhausen im Kirchlichen Zentrum in der Wolfgangstraße gelebt. „Also sogar hier ganz in der Nähe des Sudetendeutschen Hauses“, schmunzelt der Regensburger Bischof.
Von Jürgens befragt, erzählt er von seiner Mutter. Maria Voderholzer, geborene Schill, habe aus dem westböhmischen Kladrau gestammt, wo sie 1927 auf die Welt gekommen sei. Sie sei schon 1945 mit Freundinnen nach Bayern geflohen und habe dort weiter Lehramt studiert. Bei der Vertreibung 1946 sei der Rest der Familie Schill nachgekommen und habe sich nach einiger Zeit in Reitmehring-Au im Kreis Rosenheim niedergelassen. „Auf dem Bauernhof meiner Großeltern mütterlicherseits verbrachten wir vier Kinder immer die Ferien“, erinnert sich Voderholzer.
„Meinem aus Niederbayern stammenden Vater begegnete meine Mutter erst in München während ihres Aufbaustudiums für Sonderpädagogik“, als der Vater schon im Kultusministerium gearbeitet habe. „Jakob Voderholzer lief ihr an einer Tramhaltestelle in der Ludwigstraße erstmals über den Weg – so lautet die Familienlegende!“
Danach lebte die Mutter in München als Lehrerin und Autorin von Kinderbüchern. „Zwei davon schrieb sie zusammen mit
Vor dem gigantischen Schlußapplaus spielten die Pianisten Yseult Jost und Domingos Costa Friedrich Smetanas „Moldau“ vierhändig auf dem Flügel. Schon zuvor hatte das Duo Jost Costa mit seinem fabelhaften Spiel beeindruckt und gerührt. Zwischen den Stücken schilderte Joachim Kremer die wichtige Rolle der im 19. Jahrhundert entstandenen Konservatorien, die ein überregionales System für die Ausbildung von Musikern gebildet hätten. Beispielhaft erklärte der Musikwissenschaftler das an sechs Kom-
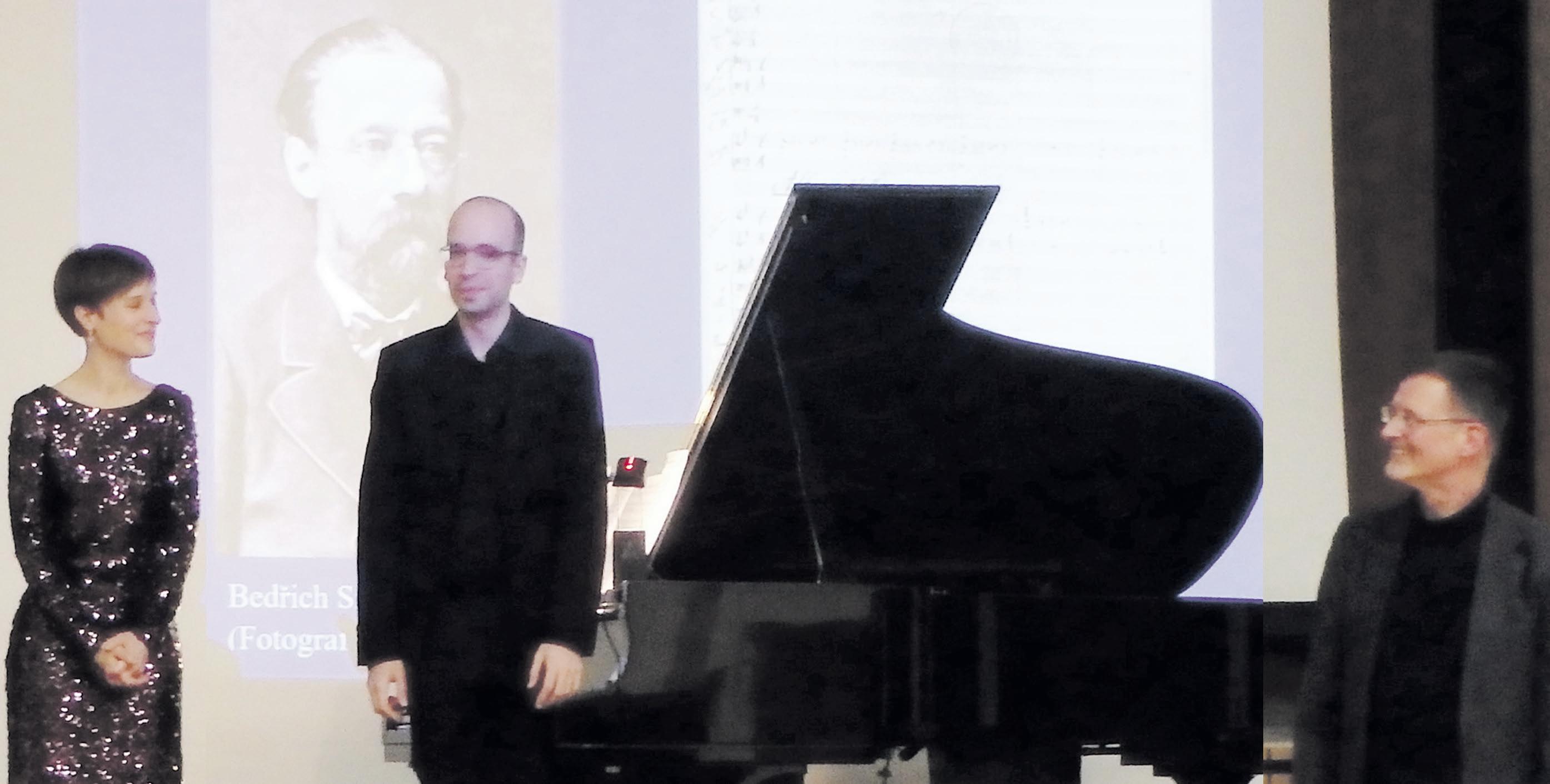
ponisten aus Ostmitteleuropa und einigen ihrer Werke.
Neben Smetana (1824–1884) waren dies Moritz Moszkowski (1854–1925) mit vier von seinen „Polnischen Volkstänzen“, Ignaz Moscheles (1794–1870) mit „Abendempfindung“ aus seinen „Drei Charakterstücken“ und Salomon Jadassohn (1831–1902) mit einigen seiner „Sechs Kinderstücke“. Schließlich hörte man noch zwei Partien aus „Já-
Prager Frühlings große Hoffnungen gehabt, die der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes zerschmettert habe.
Voderholzer schloß ein Studium an der Hochschule der Philosophie ab, die Hans Zwiefelhofer (1932–2008) aus Aussig leitete, und machte seinen Abschluß in Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität ab. 1987 wurde er in Freising zum Priester geweiht. Bis 1991 war er Kaplan, zunächst an Sankt Konrad in Haar bei München. „Dort waren überproportional viele Sudetendeutschen und Schlesier in Klerus und Laiengremien vertreten.“ Danach war er in der Vertriebenensiedlung Traunreut tätig. „Alle möglichen Deutschen aus dem Osten erzählten mir als Seelsorger ihre Geschichten.“
1997 habe er in München mit einer Arbeit über Henri de Lubac promoviert. 2003 bis 2005 habe er am Departement für Glaubensund Religionswissenschaft und Philosophie an der Katholisch Theologischen Fakultät der Universität Fribourg in der Schweiz gelehrt und sei danach Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät Trier gewesen. Ab 2008 sei er Direktor des Instituts Papst Benedikt XVI. gewesen und habe die Veröffentlichung der Schriften von Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI. betreut.

tekók“ (Spiele) von Györgi Kurtág (*1926) und „Három lakodalmi tánc“ (Drei Hochzeitstänze) von Györgi Ligeti (1923–2006).
Kremer erzählte die Lebenswege der Komponisten, die fast alle von den im 19. Jahrhundert neu entstandenen Konservatorien geprägt gewesen seien. Der Einfluß dieser bedeutenden Musikschulen in Würzburg, Prag, Wien, Leipzig oder München habe durch den Erfolg ihrer Ab-
solventen somit „grenzenlos“ gewirkt und die Musikwelt verändert. Diese gegenseitige Beeinflussung konnte man symbolisch sehen bei Kúrtags „Blumen die Menschen... (sich umschlingende Töne)“: Dabei griffen die beiden Pianisten überkreuz in das Tastenfeld des Spielpartners, eine grandiose Leistung des Duos, das seit 2006 zusammen auftritt (Ý SdZ 19/2022).
Das Duo Jost Costa aus Yseult Jost und Domingos Costa gibt weltweit Konzerte und produziert Aufnahmen für viele Rundfunksender. Joachim Kremer ist Institutsleiter für Musikwissen-
� Reihe „Spot on“ des Adalbert-Stifter-Vereins
schaft, Musikpädagogik und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.
Nach dem langen Schlußapplaus bedankte sich Andreas Otto Weber herzlich bei den Musikern und dem Moderator, die alle für den guten Zweck ohne Gage aufgetreten waren. Der HDO-Direktor bat das Publikum im Adalbert-Stifter-Saal des Sudetendeutschen Hauses angesichts der hohen Qualität des Konzerts um angemessene Spenden für die kriegsgeschüttelte Ukraine. Um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine hatten eingangs auch ASV-Kulturreferent Wolfgang Schwarz und IKGS-Direktor Florian KührerWielach gebeten.Susanne Habel
Der Adalbert-Stifter-Verein (ASV) und sein Kulturreferat für die böhmischen Länder beschäftigen sich mit der deutschsprachigen Kultur und Kunst auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. In der Reihe „Spot on“ werfen sie einen Blick auf bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, die mit den Böhmischen Ländern verknüpft sind. Die kurzen Videos stellen in einer breitgefächerten Auswahl grenzüberschreitende Persönlichkeiten aus Literatur, Kunst und anderen Gebieten vor.
Im neuesten der Videos berichtet Anna Knechtel über den Böhmerwaldschriftsteller Sepp Skalitzky (1901–1992).
mir; so wurde ich mit zehn Jahren schon zum Autor.“ Später habe er noch einiges mehr geschrieben, sagt der Bischof bescheiden, der zahllose wissenschaftliche Veröffentlichungen aufweisen kann.

Am Gymnasium habe ihn besonders der philosophische Religionsunterricht des Kapuzinerpaters Victricius Berndt (1915–2003) aus Waltschim ehemaligen Kreis Luditz geprägt. „Und mein Deutschlehrer schlug mir für meine schriftliche Abiturarbeit einen Vergleich zwischen Bildungsromanen von Adalbert Stifter und Hermann Hesse vor“, erinnert er sich.
1968 sei er erstmals mit einem kroatischen Studienfreund in die böhmische Heimat seiner Mutter gefahren. Man habe wegen des
Dies habe indirekt zu seiner Ernennung durch Papst Benedikt XVI. zum 78. Bischof von Regensburg geführt. „Vor fast genau zehn Jahren, am 6. Dezember 2012.“ Also vor einer Dekade. Bei seiner Weihe zum Bischof in Regensburg sei auch der Pilsener Bischof František Radkovský gewesen, mit dem er später viele grenzüberschreitende Aktivitäten unternommen habe.
Auch seine Sammelleidenschaft für Krippen sei wohl ein Erbe seiner Herkunft. „Die erste Krippe haben 1562 Jesuiten in Prag aufgestellt.“ Über Weihnachtskrippen erzählte der Bischof noch viel und spannend, was man auf dem YouTube-Kanal des ASV nachhören kann.
Susanne HabelDie wissenschaftliche Mitarbeiterin der ASV erzählt viel über das Leben des Schriftstellers. In einem früheren Beitrag der Reihe beschäftigt sich Knechtel mit der mährischen Literatin Maria Stona alias Maria Stonawski (1891–1944), die auf Schloß Strebowitz bei Mährisch Ostrau einen Literatenkreis geführt hatte.
Zuzana Jürgens stellt den jüdisch-böhmischen Schriftsteller Gerhard Scholten (1923–1995) vor. Die ASV-Geschäftsführerin führt sensibel in die Lebensgeschichte des Auschwitzüberlebenden ein, der ab 1947 als Schriftsteller in Wien lebte.


Dem Prager Dichter Leo Perutz (1882–1957) und seinem fantastischen Romanwerk widmet sich Franziska Mayer. Als Germanistin stellt die Mitarbeiterin des ASV auch die mühsame
in Zieditz/Citice bei Falkenau/ Sokolov wuchs Kühnhackl in einer deutschsprachigen Familie auf. Da sein Vater als Baggerfahrer unverzichtbar war, entging die Familie der Vertreibung. Der Eishockey-Spieler verließ erst 1969 die kommunistische Tschechoslowakei und kam ins niederbayerische Landshut. Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft wurde im Jahr 2000 zum „Deutschen Eishockeyspieler des Jahrhunderts“ gewählt.

Publikationsgeschichte seines Romans „Nachts unter der Steinernen Brücke“ (1951) vor.
Eine ganz andere Art von „Berühmtheit“ ist Thema bei Wolfgang Schwarz. Der Kulturreferent für die Böhmischen Länder im ASV wagt sich aufs Glatteis und spricht über Erich Kühnhackl. Geboren im Jahr 1950 in
Die Kollegin von Schwarz, Anna Paap, hat eine erfolgreiche Schauspielerin und Rundfunksprecherin im Visier. Die ASVKulturreferentin plaudert über Margarete Schell, geborene von Noé (1911–1969), die von 1945 bis 1946 in tschechischen Lagern Zwangsarbeit leisten mußte. Bekannt wurde die gebürtige Pragerin vor allem als Mutter von Maria und Maximilian Schell. Die Beiträge werfen tatsächlich kurze Spots –Scheinwerferlichter – auf Menschen, die dies- und jenseits der Grenze aktiv waren.
Susanne Habel


Ende November fand wieder der traditionelle sudetendeutsche Advent der SLÖ im Haus der Heimat in Wien statt.
Am ersten Adventssonntag war es seit vielen Jahren Tradition, unser Adventssingen zu veranstalten. Zwei Jahre mußten wir leider wegen Corona darauf verzichten. Um so mehr Sorgen machten wir uns, ob unsere Freunde und Landsleute heuer unserer Einladung Folge leisten würden.
Doch wir waren überrascht, daß sich der weihnachtlich dekorierte Saal unseres Hauses nach und nach füllte, gab es doch vorher schon einen Weihnachtsmarkt mit Bücherbasar, der auch zum Schauen und Kaufen einlud.
Als man sich gegenseitig kurz begrüßt und ein jeder einen Platz gefunden hatte, begrüßte der Landesobmann von Wien, Niederösterreich und Burgenland, Professor Erich Lorenz, auch im Namen von SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeihsel alle Besucher und gab seiner Freude Ausdruck über die große Teilnahme mit den Worten: „Unsere Landsmannschaft lebt noch lange fort!“
Ich schloß mich der Begrüßung an und stellte meine Mitwirkenden dieses Nachmittags vor. Vor allem begrüßte ich Hedi Lowak, die mit 101 Jahren in der schlesischen Mundart zu Wort kam, Inge Prinz – ihre Mutter Susanne Svoboda stammte aus dem Riesengebirge und leitete vor mir
viele Jahre lang das Sudetendeutsche Adventssingen –und Franz Kreuss, Obmann des Böhmerwaldbundes. Heuer begleitete uns eine Flötengruppe unter der Leitung von Senta Jeglitsch musikalisch und stimmungsvoll durch das Programm. Davor aber waren die Kinder an der Reihe. Die drei Mädel der Fami-
lie Lukas begannen mit dem vorweihnachtlichen Lied „Tal und Hügel sind verschneit“, Antonia und Viktoria Stingl rezitierten das Adventsgedicht „Heilige Nacht, auf Engelsschwingen“, und Johanna und Valerie Rottensteiner spielten Gitarre und Klavier. Für alle diese Darbietungen gab es natürlich großen Beifall.

Die Flötengruppe leitete zum besinnlichen Teil der Adventsfeier über, die aus Gedichten und Erzählungen von sudetendeutschen Dichtern und Autoren bestand. Hedi Lowak erhielt für ihre humorigen Mundartbeiträge spontanen Beifall. Flöten und gemeinsam gesungene Lieder rundeten das Programm ab.
Zum Schluß sangen wir das Lied „Die Glocken von Böhmen“. Als kleines Dankeschön für ihre Teilnahme und ihren Beitrag zum Gelingen unserer Feier bekamen alle Mitwirkenden Glocken für den Christbaum aus böhmischem Glas.
Für die meisten Besucher gab es dann bei Imbiß und Getränken ein gemütliches Plaudern, bis es Zeit war, den Heimweg anzutreten. Herta Kutschera
Am Samstag vor dem dritten Advent feierte die oberbayerische SL-Ortsgruppe Prien am Chiemsee im Rimstinger Seecafé Toni Advent.

Obfrau Gabriele Schleich begrüßte Herbert Wanka, Obman der SL-Ortsgruppe Grassau im Nachbarkreis Traunstein, Herbert Schreiber aus Reit im Winkel, der den weitesten Weg gehabt hatte, Alexander „Sascha“ Klein, Vizepräsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, und den Rimstinger Bürgermeister Andreas Fenzl.
kleine Laterne“ vor. Anschließend dankte Bürgermeister Andreas Fenzl. „Ich bin in diesen Tagen natürlich viel unterwegs von einer Adventsfeier zur nächsten. Jetzt geht es gleich zur Wasserwacht. Aber diese Minuten der Besinnung mit den meditativen Geschichten und den weihnachtlichen Harfenklängen haben mich doch zur Ruhe gebracht und adventlich gestimmt.“
„Die Miliz im österreichischen Bundesheer – eine Standortbestimmung“ war eine Vortragsveranstaltung der VLÖ mit Generalmajor Erwin Hameseder Anfang Dezember im Haus der Heimat in Wien.
Als Helmut Hempel, Obmann der SL-Ortsgruppe Warmensteinach, Vize-Obmann der SLKreisgruppe Bayreuth und BdVKreisvorsitzender, von dem Angriff auf die Ukraine erfuhr, wurden bei ihm Erinnerungen an die eigene Vertreibung als Sechsjährier aus dem Sudetenland vor 77 Jahren wach.

Das veranlaßte ihn, beim Tag der Heimat Mitte Oktober im Fichtelberger Ortsteil Neubau eine Spendenbox zugunsten der Ukraineflüchtlinge aufzustellen. Zuvor hatte er von Bürgermeister Sebastian Voit erfahren, daß sich im Gemeindebereich rund 70 ukrainische Flüchtlinge aufhielten.
Hempels Idee fand Anklang. 120 Euro kamen zusammen. Den Betrag stockten Gerlinde und Rudolf Kiesewetter sowie die SL-Ortsgruppe Fichtelberg 300 Euro auf.
ger und Dolmetscherin Jolanthe Pasek an Bürgermeister Sebastian Voit übergeben, der sich über den stattlichen Betrag freute.
„Stolz bin ich auf das, was wir hier mit unserem tatkräftigen Team geleistet haben“, betonte er und dankte den Spendern sowie den Helferinnen und Helfern fürs ständige tatkräftige Kümmern. Mit Blumen dank-
te Helmut Hempel Barbara Reichenberger, stellvertretend für das Helferteam. Voit war beeindruckt von den Erzählungen am Tag der Heimat, wobei es für ihn unvorstellbar sei, innerhalb von 24 Stunden die Heimat verlassen zu müssen.
Das Geld kommt den Flüchtlingen in Form von Einkaufsgutscheinen im EDEKA-Markt zugute.
Z
u dieser Veranstaltung im Rahmen der Serie „Forum Heimat“ hatte VLÖ-Präsident Norbert Kapeller mit seinen Vorstandskollegen eingeladen. Er freute sich, daß Generalmajor Erwin Hameseder – Milizbeauftragter des österreichischen Bundesheeres und seit 2022 Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes – als Referent gekommen war.
Im Zuge seines Vortrages ging Hameseder auf die vielfältigen Aufgaben des Österreichischen Bundesheeres ein, welches nach den Grundsätzen eines Milizsystems eingerichtet ist.
„Teamfähigkeit, Lösungskompetenz in Krisensituationen und Notfällen, interkulturelle Kompetenz, Zuverlässigkeit und Führungskompetenz sind nur einige Eckpfeiler, die Milizsoldatinnen und Milizsoldaten in Unternehmen auszeichnen und als qualifizierte Mitarbeiter dabei einen entsprechenden Mehrwert erbringen“, betonte Hameseder.
Quasi als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk wurde die Spende nun im Beisein des Helferteams mit Petra Markhof, Barbara Reichenber-
Unter den zahlreichen Besuchern der Advents- und Jahresabschlußfeier der SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf war die weihnachtliche Vorfreude bereits zu spüren.

Bei Kaffee und Christstollen stimmten sich die Landsleute im Haus der Begegnung in Giebel auf das Christfest ein. Eigentlich waren dazu auch Pfarrer Jörg Bohnet und Bezirksvorstehe-
rin Sabine Mezger angekündigt, um Advents- und Weihnachtsgeschichten vorzutragen.
Da beide krank geworden waren, übernahm Obfrau Waltraud Illner diesen Teil des Programms und erfreute die Gäste mit weihnachtlichen Geschichten, die vom gestohlenen Jesuskind und von fehlendem Lametta am Christbaum erzählten. Aber auch die Mundart kam nicht zu kurz, die Alfred Neugebauer mit dem Gedicht „Der Vierte der Heiligen Drei Könige“ in Erinnerung rief. Helmut Heisig
In ihrem Jahresrückblick berichtete Schleich zunächst vom Besuch des Sudetendeutschen Tages zu Pfingsten in Hof und von der überaus erfolgreichen Teilnahme mit einem eigenen Stand beim Priener Fest 125 Jahre Markterhebung. Vor allem junge Leute hätten sich für die SL interessiert. Und sogar Priens Bürgermeister Andreas Friedrich habe den selbstgebackenen Kleckselkuchen und die Minikolatschen oder Kirtakücherl gekostet.


In München habe die Ortsgruppe das Sudetendeutsche Museum besucht, in Regensburg eine Krippenführung mit dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer mitgemacht. Der Bischof habe erzählt, er sei kürzlich in einem Geschäft gewesen, das Kunst und Handwerk angeboten habe. Er habe etwas Weihnachtliches gesucht. Die Verkäuferin habe ihm Hirsche und Elche aus Holz gezeigt. Nein, habe er gesagt, er suche etwas Weihnachtliches. „Ach, Sie meinen etwas Christliches. Das führen wir leider nicht.“

Zwischendurch spielte die Harfenistin Katharina Thaurer aus Aschau im Chiemgau weihnachtliche Weisen. Dann bat Schleich um etwas Ruhe und las die besinnlichen Geschichten „Ich bin ein Stein, ein kleiner Stein“ und „Die

Er dankte der SL für ihren Einsatz und wünschte frohe Weihnachten. Dem schloß sich Klein an, der seinerseits die Bedeutung solcher landsmannschaftlicher Treffen und der Pflege des heimatlichen Brauchtums betonte. Anschließend erzählte Schleich von der Geschichte des Adventskranzes. Advent, lateinisch für Ankunft, bezeichne die Jahreszeit, in der die Christenheit sich auf das Fest der Geburt Jesu Christi, auf Weihnachten, vorbereite und Jesus erwarte.
„Der Adventskranz wurde 1839 von dem evangelischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern (1808–1881) im evangelischen Hamburg, im Rauhen Haus, eingeführt, um armen Straßenkindern die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Knapp 100 Jahre später war der Adventskranz auch in katholischen Gegenden zu finden.“ Die Urform habe mindestens 22 und höchstens 28 Kerzen für jeden Tag bis Weihnachten gehabt. Daraus habe sich der Adventskranz mit vier Kerzen entwickelt. Dann zeigte Schleich eine Apfelpyramide alias Paradiesbaum in Anspielung auf den Apfel im Paradies, die sie eigens gebastelt hatte. Die habe häufig einen Adventskranz auf dem Tisch ersetzt.
Schließlich sangen alle von der Harfenistin begleitet „Süßer die Glocken nie klingen“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „O Du fröhliche“.
Nadira Hurnaus
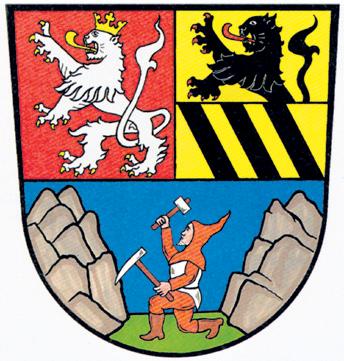


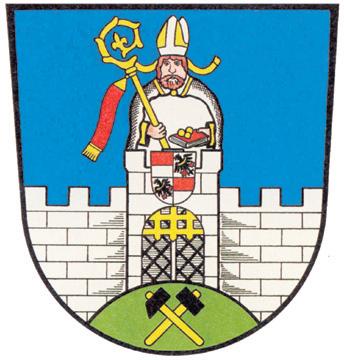

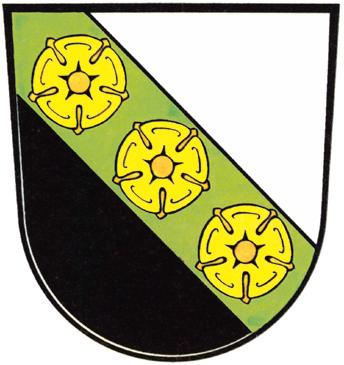

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –
Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –


Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard.spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Lexa Wessel, eMail heimatruf@ sudeten.de
Weihnachtsmärkte in den Adventstagen haben als festliche Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ihren Ursprung bereits im Mittelalter vor allem in Deutschland und Österreich.
Von Deutschland und Österreich aus verbreitete sich die Tradition der Weihnachtsmärkte in die ganze Welt. Zu einem der ersten Weihnachtsmärkte gehörte der Dresdener Striezelmarkt, der zunächst als einfacher Markt erstmals 1434 genannt wird. In Bautzen wird solch ein Markt schon 1384 erwähnt. Und der Wiener Christkindlmarkt reicht in seiner ursprünglichen Form sogar bis ins Jahr 1294 zurück. Die frühen Weihnachtsmärkte dienten vor allem dazu, um sich für die kalte Jahreszeit mit Lebensmitteln, warmer Kleidung und weiteren Dingen zu versorgen, die halfen, den Winter zu überstehen.
Typisch für Weihnachtsmärkte sind auch heute noch kleine Stände aus Holz oder Zelte, die eine reiche Auswahl an Weihnachtsdekorationen, im Erzgebirgsland vor allem aus Holz und Glas, aber auch wärmende Getränke wie Glühwein, Honiglikör oder Punsch anbieten. Außerdem wird für den kleinen Hunger gesorgt, wobei das Angebot typisch für jedes Land ist. In Böhmen sind es vor allem Klobassi, Bratwürste, Kartoffelpuffer, Langosche, die auch aus der österreich-ungarischen Gegend stammen, und als süße Variante der Apfelstrudel oder ein frisches Hefegebäck, das sich Trdelník nennt. Es ist schwer auszusprechen, schmeckt dafür mit Zimt und Zucker sehr weihnachtlich!
Jede Stadt, die einen Weihnachtsmarkt ausrichtet, hat auch ein eigenes Programm. Es be-
ginnt bei uns in Teplitz immer am ersten Adventssamstag mit dem feierlichen Entzünden
erfreuen groß und klein. Nach den beiden Coronajahren, in denen keine Märkte zugelassen waren, war nun heuer die alte Tradition zu neuem Leben erwacht und wurde dankbar angenommen. In Teplitz finden wir den Weihnachtsmarkt auf dem ehemaligen Marktplatz, heute Platz der Freiheit, am Rathaus.
Zusätzlich veranstaltet jeweils in der Woche vor dem vierten Advent unser Behindertenverband Arkadie an der Konzertmuschel in Schönau einen eintägigen Weihnachtsmarkt, wobei die Produkte der Geschützten Werkstätten von Arkadie angeboten werden. Aber auch der Duft von Glühwein und Apfelstrudel durchzieht den Platz. Das Besondere dieses Vorweihnachtsnachmittags ist eine lebende Krippe aus Maria und Joseph und einem warm eingemummelten Baby in der Krippe und wolligen Schäfchen im Stroh. Diese Krippe ist ein echter Anziehungspunkt für Familien und strahlt vor allem den christlichen Gedanken des Weihnachtsfestes aus. Diese Atmosphäre der vorweihnachtlichen Freude auf das Jesulein, das Christkindl, unterstreichen kleine musizierende Gruppen von Vorschulkindern in der Konzertmuschel, denen die Freude an diesen Vorführungen anzumerken ist.





sphäre. In diesem Jahr hatten auch die Salesianer mit den Organisatoren des im Bau befindlichen Lebendigen Hauses ihren Stand auf dem Schloßplatz, so daß sich viele Gleichgesinnte beim Glühwein zusammenfanden. Zur Tradition gehört hier auch, daß für den Glühwein Trinkbecher zum Mitnehmen unserer Eichwalder Porzellanfabrik angeboten werden. Auf diese Art hat wohl jeder Teplitzer bereits eine schöne Sammlung dieser Porzellanbecher mit weihnachtlichen Motiven zu Hause.
In diesem Jahr fand auch am zweiten Advents-Wochenende im Schloßmuseum im Foyer eine Verkaufsausstellung für Weihnachtsgebäck statt, wo jeder nach Anmeldung seine eigenen hausgemachten Produkte anbieten und verkaufen konnte. Wer da nicht zugegriffen hat, war selbst schuld! Die Tradition der böhmischen Weihnachtsbäckerei ist über-
all berühmt, hat auch teilweise ihren Ursprung im alten Österreich, wozu einst Böhmen gehörte, wie Ischler Törtchen und Linzer Plätzchen. Vanillehörnchen sind bereits weltweit verbreitet. Ein kommentierter Ausstellungs-
besuch der Bäckerei Kaschik (Ý HR 50/2022) mit der Kuratorin Pavlina Boušková beendete am vierten Adventssonntag diese Museumsexposition.
Als besonderer Höhepunkt dieses vierten Adventssonntags wurde in der SanktJohannes-Kirche auf dem Schloßplatz wieder die Böhmische Weihnachtsmesse von Jakub Jan Ryba (1765–1815) aufgeführt. Diese volkstümlichen Melodien über die frohe Botschaft der Geburt Jesu Christi erfüllen alle Menschen mit Freude und Hoffnung auf die bevorstehenden Festtage.
Und dann sind es nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest, zum Fest der Familie, zum Fest des Lichtes und der Einkehr. So bleibt nur zu wünschen, daß uns allen der Friede erhalten bleibe und dort, wo Menschen zerstritten sind, das Licht der Hoffnung die Waffen zum Schweigen bringe.
Jutta Benešováder Weihnachtsbaumbeleuchtung. Dazu singen auf einem kleinen Podium Kinder aus den örtlichen Kindertagesstätten und Grundschulen Weihnachtslieder, auch Märchen-Vorführungen mit weihnachtlichem Inhalt


Auch zu karitativen Zwecken veranstaltet der Teplitzer Lions-Club am vierten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt auf dem Schloßplatz, überragt von der Dreifaltigkeitssäule und den beiden Kirchen. Vom Schloßbalkon ertönen jede Stunde weihnachtliche Posaunenklänge. Auch dieser Markt hat seine eigene, besonders freundschaftliche Atmo-

 Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau
Graupen Niklasberg
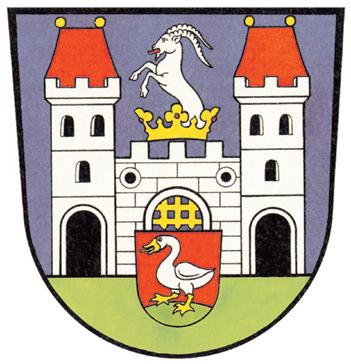
Anfang Dezember eröffneten im Chodenmuseum in Taus eine Ausstellung, die Papierkrippen von Vratislav Altmann, und eine Ausstellung, die Holzmalereien von Tomáš Záborec zeigt. Karl Reitmeier berichtet.
Bei der Vernissage dieser zwei Ausstellungen wurde Hans Dendorfer, dem Vorsitzenden der Krippenfreunde des Oberen Bayerischen Waldes und früherem Präsidenten des Weltkrippenverbandes, schnell klar, daß es viele Gemeinsamkeiten zwischen Böhmen und Bayern gibt. Darauf verwies er dann auch in seiner Ansprache vor den zahlreichen Gästen der Ausstellungseröffnung. Zuvor hatten Schülerinnen der Musikschule aus Neugedein mit Musik und Gesang die Veranstaltung eröffnet. Viktorie Janiurková vom Chodenmuseum hieß dann die Besucher, insbesondere

aber die beiden Aussteller, herzlich willkommen. Danach sprach Vratislav Altmann, wobei er seine Freude darüber zum Ausdruck brachte, daß auch Hans Dendorfer mit seiner Gattin Dora zur Vernissage nach Taus gekommen war.
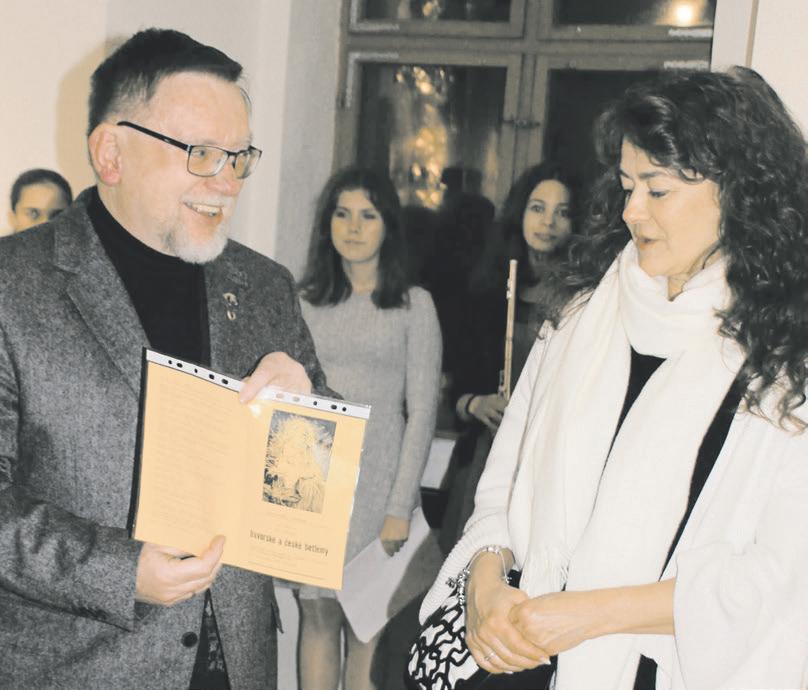

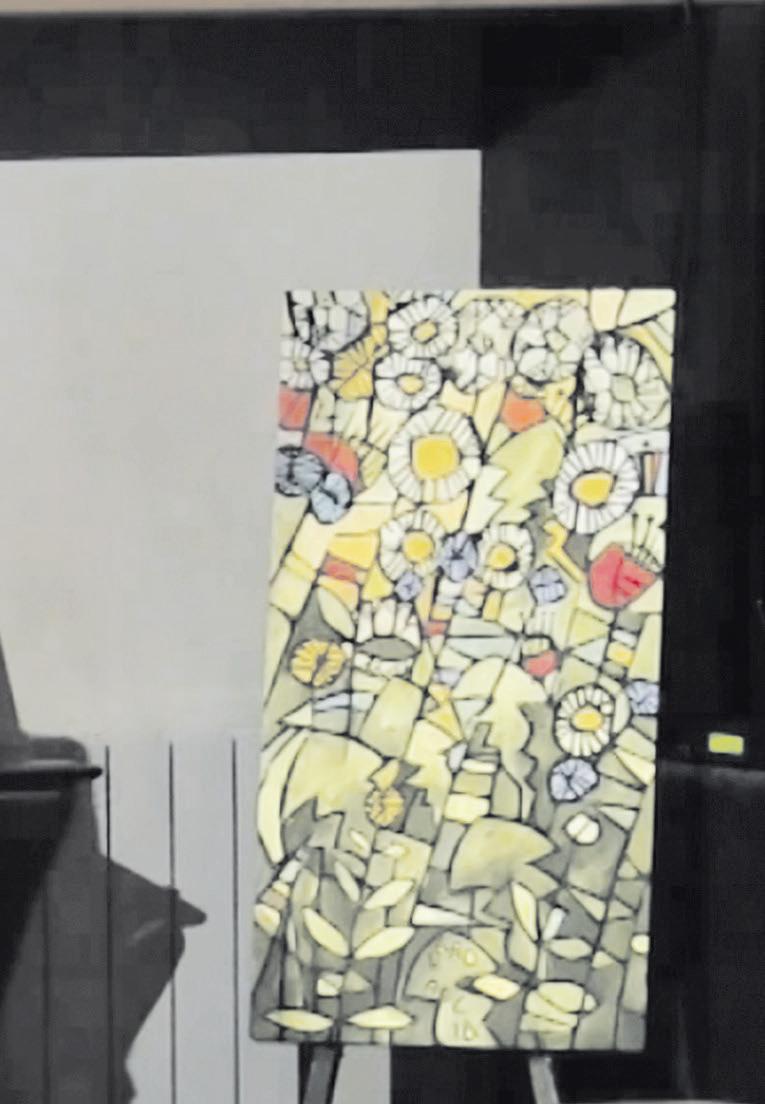
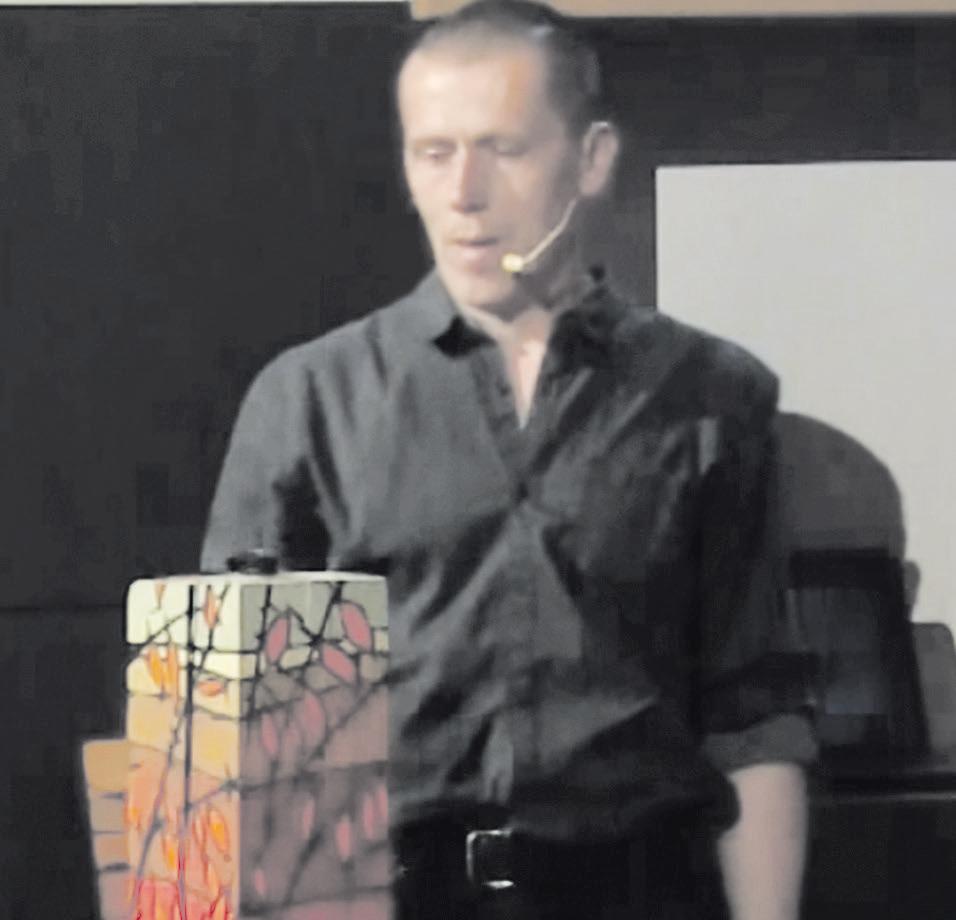
Angesichts der Musik und des Gesangs habe er, so Dendorfer, zunächst sein Herz ausleeren wollen. Er stelle viele Gemeinsamkeiten zwischen Bayern und Böhmen auch bei den Weihnachtsliedern fest, und so seien diese Lieder auch Brücken zwischen den Menschen über die Grenze hinweg. Das gleiche gelte aber auch für die Krippen. Diese seien ebenfalls Brücken von Mensch zu Mensch über die Grenzen hinweg, und das sogar weltweit.
Und dann präsentierte Dendorfer ein Plakat von der ersten Krippenausstellung einer westlichen Krippenorganisation bereits am 1. Dezember 1990 im Chodenmuseum. „Wenn mir im Frühjahr 1990 jemand gesagt hätte, daß ich zu Weihnachten im selben Jahr eine Krippenausstellung in Taus zeigen würde, dann hätte ich ihn für verrückt gehalten“, bekannte Dendorfer offen.
Und diese Ausstellung habe tatsächlich stattgefunden.
Ab diesem Zeitpunkt habe er viele Krippenfreunde im Nachbarland kennenlernen dürfen, die für ihn zu großen Lehrmeistern geworden seien.
Dendorfer bemerkte, daß ihn schon lange interessiert habe, was die Nachbarn zu Weihnachten machten und ob auch sie Krippen hätten. Er erzählte, daß er viele liebenswürdige Menschen habe kennenlernen dürfen, von denen er viel über die großartige Krippentradition in der Tschechischen Republik erfahren habe. Und er habe in dieser Zeit seine große Liebe zu den tschechischen Papierkrippen entdeckt.
Auch auf diesem Gebiet habe es große Lehrmeister gegeben. Stellvertretend für alle erinnerte er an Jana Hanová. Von ihr und seinem Freund Vratislav Altmann habe er sehr viel gelernt. Bei Altmann habe er die ganzen Krippenfiguren gesehen, die er, Dendorfer, nur von den Papierbogen kannte. Er habe dann gesehen, wie sie ausgeschnitten worden seien und dann ihre Wirkung entfaltet hätten. Dendorfer wünschte Altmann für die Ausstellung viel Erfolg.
Anschließend stellte Tomáš Záborec seine sehenswerten Holzmalereien vor. Zum Dank erhielten die beiden Aussteller Tauser Bier.
Die Ausstellungen im Tauser Chodenmuseum laufen bis 21. Januar Montag bis Sonntag 9.00–12.00 und 13.00–16.00 Uhr.

Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der vierte Teil über Pfarrer Matthias Bräuer (1817–1899).
Den hinter dem herrschaftlichen Meierhof gelegenen Platz nutzte die Schule bis zum großen Brand 1877 als Turnplatz. Zum erforderlichen Neubau der Schule gestattet Dechant Bräuer die Zufuhr von Baumaterial durch den Dechanteigarten zur Schule.
Nach dem Abschluß der Bauarbeiten ist jedoch die Bepflanzung jenes Gartenteils komplett zerstört, so daß der Dechant diesen der Schule als neuen Turnplatz zu jährlichen zehn Gulden verpachtet. Ein schriftlicher Vertrag wird nicht abgeschlossen. Beim Amtsantritt von Dechant Steinbach im Jahr 1885 stellt jener fest, daß der Pachtzins seit geraumer Zeit nicht beglichen worden sei.
Steinbach forciert die Ausarbeitung eines schriftlichen Pachtvertrages und droht der Schulgemeinde mit der Kündigung, falls dieser nicht abgeschlossen wird. Ohne sichtlichen Erfolg beschließt Steinbach, auf einen günstigeren Zeitpunkt zu warten, um diese Angelegenheit in seinem Sinne regeln zu können.
Im Oktober 1877 wird Bischof Peter Josef Blum aus der Diözese Limburg vom preußischen Gerichtshof aufgrund seiner Haltung gegenüber den sogenannten Maigesetzen als abgesetzt erklärt.
Als Maigesetze werden im Allgemeinen während des Kulturkampfs in Preußen und im Deutschen Kaiserreich erlassene kirchenpolitische Gesetze bezeichnet. Das Gericht verpflichtet das Limburger Domkapitel, einen Bistumsadministrator zu bestimmen. Das Domkapitel weigert sich jedoch. Fürst Karl zu Löwenstein-WertheimRosenberg (1834–1921), Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken von 1872 bis 1898, Reichstagsabgeordneter der Zentrumspartei 1871 und ab 1908 Ordenspriester der Dominikaner, gewährt dem vertriebenen Bischof auf seinem Schloß in Haid Asyl. Von Haid aus verwaltet Bischof Blum seine Diözese.
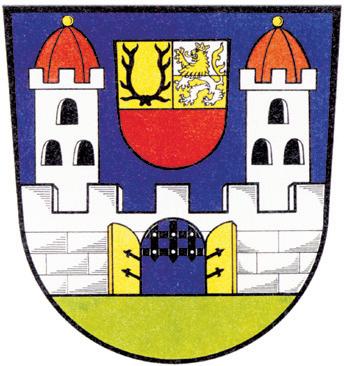

Dechant Steinbach wird am 1. Juli 1883 anläßlich einer Wallfahrt nach Haid dort von Bischof Blum empfangen. Dabei schildert dieser dem anteilnehmenden Steinbach seine Situation in Haid und das komplizierte Vorgehen hinsichtlich der Korrespondenzen nach Limburg. Steinbach schreibt vom „armen Bischof“, der nach seiner Rückkehr im Jahr 1883 nach Limburg dort ein Jahr später verstirbt.




●

Folgende Spenden gingen über das Jahr 2022 beim Hostauer Förderverein ein:
● 100 Euro: Marianne Saufler, Gundelfingen; Stadt Dillingen an der Donau; Wolfgang Stippler, Nördlingen.
● 70 Euro: Johann Wenisch, Isen.
● 50 Euro: Edgar Dietrich, Bruchmühlbach; Thomas Fischer, München; Reinhard Köstner, Penzberg; Karl Meidl, Linz; Horst Muschik, Lauingen; Markus Schreiner, Regensburg; Rudolf Schreiner, Bachhagel; Wolfgang Schreiner, Bachhagel; Hermine Wiehler, Lauingen.
● 40 Euro: Bernhard Kalupke, Herbrechtingen.
● 30 Euro: Walter Stiemer, Gemmingen.
● 25 Euro: Martin Brix, Sinzing; Herta Stanzl, Waiblingen.
● 20 Euro: Emmi Bauer, Höchberg; Peter Gaag, Stuttgart; Maria Hegele, Reistingen; Dr. Waldemar Nowey, Mering; Peter Ochsenmeier, Furth im Wald; Ursula Renn, Furth im Wald; Oswald Rothmeier, Haunsheim; Ute Steinbach, Freiburg; Dr. Lothar Steinbock, Linkenheim.
Allen Spendern ein herzliches Vergelt‘s Gott für ihre wertvollen Beiträge zur Finanzierung der Hostauer Heimatarbeit. Bitte unterstützen Sie uns auch zukünftig.
Das Finanzamt Nördlingen hat unseren Förderverein im Sinn der §§ 51 ff. AO als unmittelbar steuerbegünstigt gemeinnützig anerkannt. Die Finanzämter akzeptieren bis zu einem Betrag von 100 Euro den Einzahlungsbeleg als Spendenquittung. Als Verwendungszweck muß aber „Spende“ eingetragen sein. Für höhere Geldbeträge können wir Ihnen gerne Spendenbescheinigungen ausstelen.
Spendenkonto: Förderverein Heimatstadt Hostau e. V., Postbank München – IBAN: DE47 7001 0080 0041 1288 01, BIC: PBNKDEFF.







Ihnen allen gesegnete Weihnachten, alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes Segen für 2023 wünscht
Stefan Stippler Ortsbetreuer

Maria Oppermann, letzte Besitzerin des Hauses Reichenthal 29, war am 19. August 1944 mit der Eisenbahn nach Waidhaus unterwegs, um ihre Schwester am Ernestinenhammer zu besuchen.
Auf der Strecke von Weiden nach Waldthurn kam sie mit dem ihr schräg gegenüber sitzenden Soldaten Anton Kalhammer ins Gespräch, dessen Ehefrau Josefine saß neben Maria Oppermann. Den Hauptteil der Unterhaltung bestritt der Soldat, der „heimtückische Äußerungen gebrauchte“, so das Urteil, und deshalb zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde.


gerichtet habe. „Sie trägt, wie ihr Wortlaut und Inhalt ohne weiteres erkennen läßt, gehässigen Charakter und ist geeignet, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, wenn es der Angeklagten auch nicht darum zu tun war, wehrzersetzenden oder -lähmenden Einfluß auszuüben. Die Bemerkung fiel in einem öffentlichen Eisenbahnwagen vor unbestimmt vielen Personen; dessen war sich die Angeklagte bewußt.
dienst
strator und Werbegrafiker. Er unterstützte
nauer VHS und begann 1985 als Dozent
Kleinmeierhöfen und Wurken
Ende November erhielt das Tachauer Heimatmuseum in Weiden in der Oberpfalz wunderbare Raritäten aus Wurken und Kleinmeierhöfen. Heimatkreisbetreuer Wolf-Dieter Hamperl berichtet.
Anita Foler aus Buchloe im Ostallgäu kam zu mir ins oberbayerische Altenmarkt und brachte alte Trachten aus Wurken mit. Die Kleider stammten von Susanne und/oder Anna Flor (Hausname Geiger), die in Wurken Nr. 18 gelebt hatten. Das waren eine sehr schöne Joppe, ein Rock, eine Schürze, ein Unterrock und ein schwarzes Wolltuch, drei wunderschön bestickte – und nicht wie sonst üblich bedruckte – Tücher, eine Goldhaube mit zwei bunten Bändern und eine reich geschmückte Flinnerlhaube. Flinnerlhauben durften bei Hochzeiten in
In
diesem Hof stammte Anna Peyerl, verheiratete Flor, und hatte

nach Wurken geheiratet. Die Figur hatten die Peyerltöchter bei einem Besuch von der heute dort wohnenden tschechischen Familie bekommen. Sie war dann lange Zeit im Besitz von Resi Rotter, geborene Peyerl, in Schnaittsee. Rotter hatte ich wegen einer notwendigen Operation in der Kreisklinik Trostberg kennenlernen dürfen. Sie hatte die Keramikfigur von einem Schnaittseer Kunstmaler 2008 restaurieren lassen. Sie schmückte den Hausaltar der Familie.
Nach Rotters Tod kamen die schönen Dinge nach Buchloe zu Anita Foler, die sie mir jetzt für unser Tachauer Heimatmuseum in Weiden übergab. Sie sind wirklich eine großartige Bereicherung unserer reichhaltigen Textil-Bestände, und das Prager Jesulein, das ja beson-



ders im Bistum Prag verehrt wurde und wird, wird einen besonderen Platz in unserer Abteilung „Volksfrömmigkeit“ erhalten.
Diese schönen alten Sachen sind ein echtes Weihnachtsgeschenk für unser Heimatmuseum. Herzlichen

Maria Oppermann stimmte wohl den Worten Kalhammers zu und äußerte, als das Gespräch auf das Attentat vom 20. Juli 1944 kam, Folgendes: „Nun ja, da hat es damals geheißen, der Führer sei nur durch eine Gnade verschont geblieben; darüber kann man nur lachen.“ Die Angeklagte bestritt, sich in diesem Wortlaut und Sinn geäußert zu haben. Sie machte geltend, „sie habe im Bezug auf das Attentat vom 20. Juli lediglich gesagt, sie habe in der Wochenschau die verletzten Generäle gesehen; der Führer sei jedoch, wie sie beobachtet habe, nicht verletzt gewesen; das werde eben die Vorsehung gewesen sein.“
Doch woher wußte das Gericht von dem Gespräch? Maria Oppermann saß die Kindergärtnerin Maria Müller gegenüber, die das Gespräch mithörte und den Soldaten und Maria Oppermann denunzierte. Maria Müller beeidete auch ihre Aussage. Die Angaben von Josefine Kalhammer waren nach dem Text des Urteils unterschiedlich, immerhin habe die Zeugin betont, daß Oppermann das nicht gesagt habe. Es wäre ihr aufgefallen, wenn sie sich so geäußert hätte.
Festgestellt wurde, daß die Äußerung der Angeklagten sich gegen die von der Partei- und Staatsführung gegebene Darstellung der Errettung des Führers aus dem verräterischen Anschlag
Die Äußerung erfüllte somit den Tatbestand eines Vergehens nach § 2 Abs. 1 Heimtückegesetz, dessen die Angeklagte schuldig zu sprechen war. Die Strafverfolgung aus der angezogenen Bestimmung (Abs. 3 a. a. O.) ist angeordnet.
Für die Angeklagte sprach, daß sie nicht vorbestraft und auch politisch nicht belastet war. Im Leben hatte sie sich bisher bewährt. Sie sei keine Staatsfeindin.
Ihre Äußerung stellte eine unbedachte Entgleisung dar. Andererseits war die Äußerung sehr geschmacklos und gerade um jene Zeit sowie in diesem Zusammenhang, zumal öffentlich im Eisenbahnzug, nicht ungefährlich, insbesondere wegen ihrer möglichen, von der Angeklagten allerdings ungewollten nachteiligen Wirkung auf die Haltung anderer. Die Auslassung konnte daher nicht so leicht hingenommen werden. Aus diesen Erwägungen war eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten schuldangemessen, notwendig und ausreichend.
Als verurteilt hat die Angeklagte die Kosten zu tragen.“
Unterzeichnet vom Landesgerichtsdirektor Lohrer und den Beisitzern Dr. Bäumler und Dr. Hoffmann. Datum der öffentlichen Sitzung war der 8. Februar 1945.
Mit Stempel vom 20. Februar 1945 war das Urteil rechtskräftig und vollstreckbar. Doch kam es wegen der rasch vorrückenden Truppen und der vorhersehbaren Niederlage nicht mehr zu einer Verhaftung der 44 Jahre alten Maria Oppermann.

 Wolf-Dieter Hamperl
Wolf-Dieter Hamperl
Zum Artikel „Albert ‚Bertl‘ Reiter erzählt“ über den Neuanfang eines vertriebenen Tachauers im ehemaligen Sprengstoffwerk im oberbayerischen Gartenberg, heute ein Stadtteil von Geretsried, von Gernot Schnabl (Ý HB 49/2022).
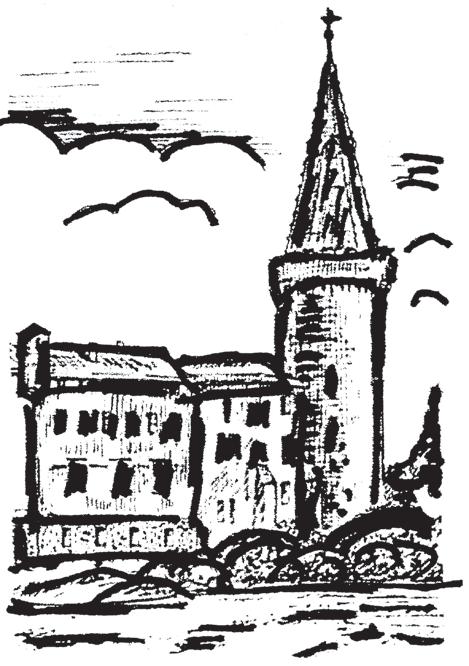
Im Vorspann steht: „Das Interview, in dem Reiter eghalandrisch spricht, wurde 2003 aufgezeichnet und von Schnabl ins Hochdeutsche transkribiert.“ Das ist nur zur Hälfte richtig, denn Gernot Schnabl hatte das Interview vorbereitet und vor allem geführt.
Außerdem fehlt der Bildnachweis unter Fotografie von Albert Reiter. Das Bild stammt natürlich auch von Gernot Schnabl, dem gegenwärtigen Stadtbetreuer von Tachau. Die Redaktion bedauert die Fehler.
Kleinmeierhöfen nur verheiratete Frauen tragen. Sie waren eine Spezialität des reichen Haider Landes. einer Schachtel war außerdem das sehr schöne 35 Zentimeter hohe Prager Jesulein, das ehemals in der Hausnische des Hofes der Familie Peyerl in Kleinmeierhöfen stand. AusVielleicht liegt es an ihren sudetendeutschen Genen: Die gebürtige Trautenauerin Jenny Schon, ist eine Kämpferin – auch weil sie immer hat kämpfen müssen.
Die Vertreibung war ein brutaler Einschnitt für ihre Familie, die Kindheit im Rheinland schwierig, der Aufstieg in Berlin mit dem Nachholen des Abiturs, dem anschließenden Studium und den ersten Schritten als Autorin und Herausgeberin hart. 2021 wurde dieser Einsatz entsprechend gewürdigt. „In Anerkennung ihrer großen künstlerischen Leistungen“ ernannte die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaft und Künste Jenny Schon zum ordentlichen Mitglied. Zum 80. Geburtstag der sudetendeutschen Künstlerin dokumentiert die Sudetendeutsche Zeitung einen Auszug aus einer ihrer Lesungen aus ihrem Werk „Böhmen nicht am Meer“, das 2016 im Gerhard-Hess-Verlag erschienen ist. Ein literarisches Dokument, das zeigt, wie einschneidend die Vertreibung und deren Folgen nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die damaligen Kinder waren.
Von Jenny SchonWortfetzen haben meine frühe Kindheit begleitet. An mehr erinnere ich mich nicht. Heimat, Winter im Riesengebirge, Blaubeeren und Pfifferlinge. Die gab es auch auf der Hardthöhe in Bonn, wohin Opa und Oma vertrieben wurden und heute die Bundeswehr über neue Kriege nachdenken muß.
Rübezahl, der Herr der Berge, war schon konkreter, weil Opa mir ein Buch schenkte. Aber der Herr der Berge im flachen Rheinland, wo große Schiffe über den Strom zogen und die Schiffer aus aller Herren Länder von einer Sehnsucht sangen, die Loreley ihnen entlockt.
Ich hörte Worte, Hochmoor zum Beispiel, worunter ich mir nichts vorstellen konnte, wenn meine Mutter davon erzählte. Das war aber erst nach der Samtenen Revolution. Sie brachten im Fernsehen viele Bilder aus Prag und anderen tschechischen Städten. Sieh mal, da war ich auch in Prag auf der Burg, in Aussig an der Elbe und in Reichenberg auf dem Jeschken, da bin ich mit der Jeschkenseilbahn hoch. Der Opa hat viele Ausflüge mit uns gemacht, er war bei der Bahn, da hatten wir Freifahrten, meine Mutter erzählt, und das eigentlich zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten.
Ich erinnere nur schwach, daß in der Tischschublade ihre Trautenauer Erinnerungen lagen, viel war es nicht, weil sie kaum was mitnehmen durfte, weil wir 1945 bei der wilden Vertreibung waren. Wilde Vertreibung, damals als Kind klang das wie eine Karl-May-Geschichte.
Auch die kleine schwarze Handtasche lag in der Schublade, in der sie Fotos von uns, den Verwandten und Freunden aus Trautenau aufbewahrte, die durfte ich aber nicht öffnen. Doch kürzlich hat sie sie mir geschenkt, und ich hüte sie wie meinen Augapfel, eine kleine schwarze Unterarmtasche mit Überschlag aus Leder, für den Theaterbesuch, in Trautenau gab es ein Theater anders als in Brühl, wohin wir nach dem Krieg gezogen sind. Sie hatte auch eine Mappe mit Papieren, darin ein Zeitungsartikel, den liebte ich sehr. Da waren Häuser auf einem Hügel zu sehen und ein wunderschöner Blick auf das Riesengebirge.
Das ist deine Heimat gewesen, sagte meine Mutti, so ein Haus wollten wir auch bauen. Wir haben schon darauf gespart. Aber jetzt hast du ja eine neue Heimat.
Bauen wir denn hier auch ein Haus? Ja, ein Haus wär schön! soll ich gesagt haben.
Wir haben den Krieg verloren, wir haben jetzt erst ein bißchen Lastenausgleich bekommen, davon haben wir ein Schlaf-
❯
da war und die Fotos vom Ferienhaus der Kölner Firma Maddaus zeigte. Ja, das gibt es ja nicht, wie 1945, als wir es verließen. Sieh dieses Fenster, da haben wir gewohnt.
Aus dem Fenster habe ich geschaut, nachts, ich spüre die Frische, den Wind um die Nase, der vom Wald herunterpurzelt und gleich über den dunklen Tannen der Himmel, angestrahlt vom Mond, ja aus diesem Fenster habe ich geschaut. Ob Mutti bald kommt? Sie hat es doch versprochen, daß ich nicht lange allein bleiben muß. Sie muß für uns sorgen, wir sind ganz alleine auf uns gestellt, sagt sie. Ich habe auch versprochen, daß ich brav bin. Wo bleibt sie denn nur? Und ich schaue in den Himmel, zähle die Sterne, bis ich müde werde und mich wieder ins Bettchen lege. Und dann spüre ich was Warmes, einen Hauch, einen Kuß: Mutti. Und ich kuschele mich an sie und wir schlafen zusammen in einem Bett, denn mehr haben wir nicht.
Nie mehr in meinem Leben war ich einem Menschen so nahe wie hier in diesem Bett bei den Wolken, die gleich hinter unserem Haus geboren wurden… Und hätte nicht Monate später, am 9. November 1945, der Bruder meiner Mutter uns gefunden und uns ins ferne Rheinland geholt, so würde ich vielleicht noch heute dort oben bei den Wolken wohnen. Mutti hatte schon Holz aus dem Wald im Keller gelagert und Kartoffeln
❯ Zur Person: Jenny Schon
❯ Geboren am 16. Dezember 1942 in Trautenau.
❯ 1961 Umzug nach Berlin, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg.
❯ Ab 1969/70 Studium der Sinologie und Publizistik.
❯ 1972 Einladungsreise in die Volksrepublik China.
zimmer gekriegt, und du kriegst dann unser Bett und mußt nicht mehr ins Kinderbettchen, dazu bist schon zu groß, da kommt dein Brüderchen rein. Wir haben kein Geld für ein Haus.
Ein Brüderchen. Das verdanken wir der Nachbarstochter Ute. So, Tante Anni, sagte sie zu meiner Mutter, hier hab ich den Zukker mitgebracht, ich streue ihn jetzt auf das Fensterbrett, dann kommt der Storch und bringt dir das Kind, und an mich gewandt: Und du kriegst ein Brüderchen. Und wenn das klappt, dann kommste zu mir und machst es auch so, und dann kriege ich auch ein Brüderchen.

Alle haben immer nur vom Brüderchen geredet, nicht vom Schwesterchen, als dann das Brüderchen tatsächlich kam, war alles so aufregend, daß wir das alles erst mal vergessen haben. Später hat dann Ute auch nicht
um ihm den Löffel in den Mund stopfen zu können, da öffnete sie die Schublade und zeigte ihm die Bildchen und all das andere, was mir so am Herzen gelegen hatte aus Trautenau. Der aber fetzte alles über den Tisch, und Mutti mußte es wieder einsammeln.
Wenn der jetzt seinen Brei auf mein Häuschen klatscht, klatsche ich ihm eine … ich war zornesrot, sagte aber nichts, weil diese Schubladengeschichten eh zu Ende waren, das Brüderchen lief rum und man mußte höllisch aufpassen, daß er nicht alles herrunterriß, also blieben die Schubladen zu.
Ich aber hatte diese Bruchstükke, diese Wortfetzen ganz tief in mein Herz, in meine Erinnerung gepflanzt, da würden sie in Ruhe ihren ewigen Schlaf haben. Fortan wurde nicht mehr von früher erzählt, es war ja ein Jetzt vorhanden, jemand, der in Brühl ge-
in uralten Zeiten der Dresdner Bahnhof im Mündungsgebiet eines Nebenflüßchens lag, als also von Dresden bis Prag Landunter angesagt war … kamen sie wieder, die Worte vom Hochmoor, vom Riesengebirge, von den Pfifferlingen, den Blaubeeren.
Hatte es 1945, als wir dort ankamen, nicht auch so ausgesehen, verwüstet, zerstört, die Menschen auf der Flucht? Angeregt von meiner Mutter machte ich mich auf.
Ich fuhr nach Zinnwald, direkt an die Grenze, wo die Tschechen uns rausgejagt hatten: Verreckt ihr Deutschen. Mit einem Schubs waren wir in einer neuen Wirklichkeit, in einer fremden, kargen Welt. Ich im Kinderwagen, auf unserer ganzen Habe sitzend. Mit dem Kinderwagen habe ich später meine Puppen spazierengefahren, und das Kopfkissen besitze ich noch heute. Meine Mutter mußte gleich zum Gesundheitsamt wegen Geschlechtskrankheiten unter den Frauen, das hat sie mir erst jetzt erzählt, als ich sie fragte, wie war es denn in Sachsen, damals. Denn bevor wir Brühler wurden, wurden wir Sachsen.
Um mehr kümmerte man sich nicht, Sachsen war überfüllt von Flüchtlingen und Vertriebenen und eigenen Bombenopfern im Sommer 1945.
Außer der Odsun-Ausweisung vom 29. Juli 1945 waren wir ohne Papiere, ohne Essensmarken und wir mußten sehen, wie wir zurechtkamen.
❯ 1988 bis 1993 Aufbaustudium in den Fächern Philosophie und Kunstgeschichte.
❯ 1988 bis 1991 Lehraufträge an der Freien Universität Berlin zum Thema „Chinesische Philosophie“.
❯ Seit 1998 selbständige Stadtführerin in Berlin.
❯ Gründungs-Mitglied des Vereins Kunst.Raum.Steglitz e.V. Berlin, Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland, Künstlergilde e.V. Esslingen, in der GEDOK e.V. Berlin und in der Künstlerkolonie e.V. Berlin.
❯ Zahlreiche Literaturpreise für Lyrik, Romane sowie Beiträge in Anthologien.
❯ 2021 Berufung in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste.
te eine tschetschenische Familie im Wald gelagert und auf Asyl gehofft. Hier an der Grenze sind immer wieder Fremde angekommen. 1728 emigrierten 800 Evangelische aus dem böhmischen in das sächsische Zinnwald. 1731 gab es eine erneute Verfolgungswelle in Böhmen, daraufhin wurde nach einem festen Plan NeuGeorgenfeld angelegt.
Auch meine Mutter hatte nach unserer Vertreibung 1945 eine Unterkunft in einem Ferienhaus am Waldrand in Georgenfeld gefunden, uns mit illegalen Grenzüberschreitungen am Leben gehalten. Sie wurde nächtliche Führerin im Moor, zeigte Flüchtlingen den Weg über den Knüppeldamm, ständig in Gefahr, im Moor zu versinken oder den Grenzwächtern vor das Gewehr zu laufen. Hier ist sie auch von einem Tschechen vergewaltigt worden. Er war wenigstens hübsch, war ihr einziger Kommentar, den ich ihr entlocken konnte.
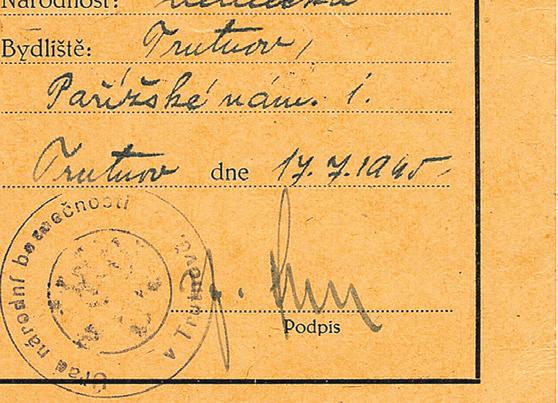
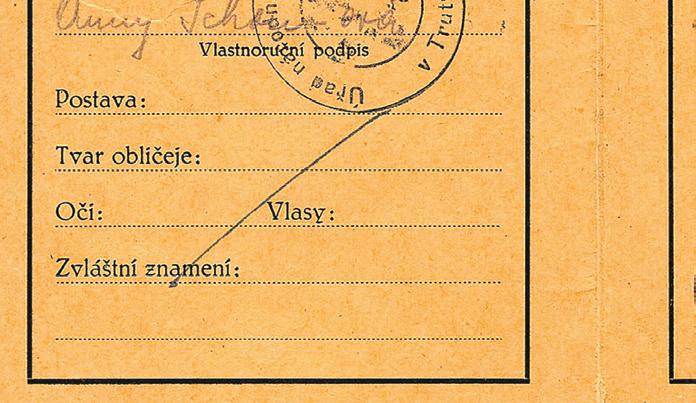
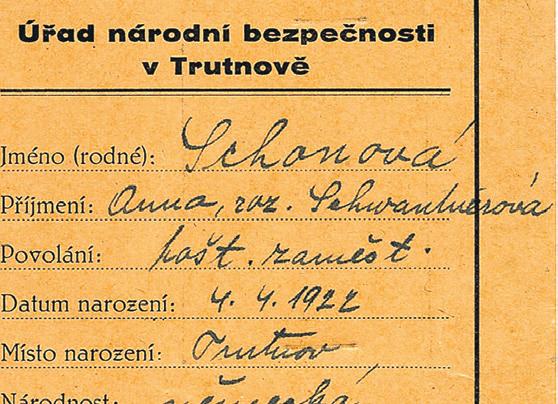
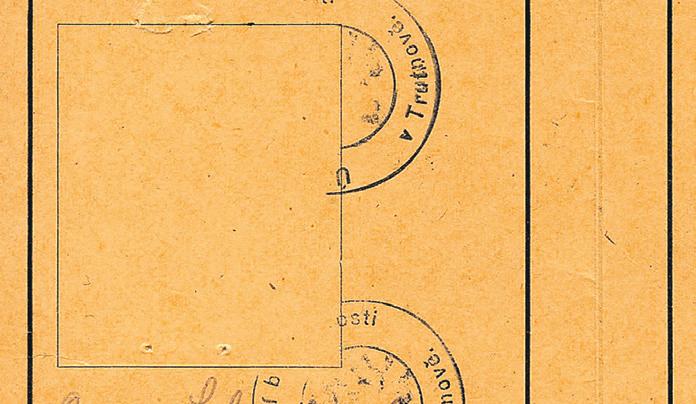
erhamstert. Wir haben es dort gelassen, das hat Nachkommenden geholfen, den Winter zu überstehen, hoffe ich, sagt Mutti noch heute.
75 Jahre nach dem Kriegsende ist den Bewohnern im sächsischen Grenzort Hinterhermsdorf gedankt worden, daß sie 1945 in der ersten Not der Vertreibung den Sudetendeutschen geholfen haben.
mehr davon geredet. Wir waren ja schon zehn Jahre alt und groß, wie sie meinte. Und sie hat schon gewußt, daß Kinder nicht vom Zucker, der dem Klapperstorch gestreut wird, in die Welt kommen, sondern von ganz anderen Verlockungen, denn sie war eine Gastwirtstochter und durfte auch viel länger aufbleiben als ich. Ich glaubte noch mit vierzehn, daß ein Kind vom Küssen entsteht.
Als nun mein Bruder schon herumhampelte und gefüttert wurde und nicht so richtig sein Breichen essen wollte und meine Mutter ihn beschäftigen mußte,
boren war und eine Brühler Geschichte haben würde. Und auch ich mußte eine Brühler Geschichte bekommen.
Als eines Tages viele Jahrzehnte später die Elbe verheerende Schäden anrichtete, die kleinen Flüßchen, die meist als Bäche herumsprudelten, gar den Dresdner Bahnhof bedrohten, weil die Natur eine bessere Erinnerung hat als Menschen, und
An das Wie – daran erinnere ich mich kaum, ich war drei Jahre alt. Ich habe seitdem die halbe Welt bereist, was sollte mich also ein Hochmoor interessieren.
Und doch: Dieses Hochmoor hat mich nie ganz losgelassen, und ich habe es gefunden; ein Achtel in Sachsen, kultiviert, auf Holzstegen begehbar, sieben Achtel in Tschechien, Urwald. Vorbeirauschend der Verkehr von Sachsen nach Tschechien und umgekehrt, Zinnwald Grenzübergang mit all den Problemen der modernen Zeit.
Auch heute noch versuchen Menschen, über die Grenze zu kommen. Vor einiger Zeit hat-
Und ich war alleine in dem fremden Bettchen. Damals muß ich meine Liebe zu dem nächtlichen Himmel gefunden haben, denn nirgendwo sonst hab ich so nahe bei ihm gewohnt. In Georgenfeld, gleich hinter unserem Haus, in fast tausend Metern Höhe, war das Moor und dort wurden die Wolken geboren, davon habe ich mich jetzt noch einmal überzeugen können. Ein Firmament zum Greifen nahe, Wolken, weiß und zum Kuscheln aufgeplustert wie ein Plumeau oder vom Abendlicht angelächelt wie Weihnachtsäpfel.
Ich hatte alles schon besorgt, erzählt Mutti, jetzt nachdem ich
Die Sudetendeutsche Landesgruppe Berlin hat ihnen deshalb ein Denkmal gesetzt. Sie haben einen Spendenaufruf gestartet: Wir gedenken der Menschen in Hinterhermdorf und in den umgebenden Gemeinden, die im Jahr 1945 den deutschsprachigen Vertriebenen aus Böhmisch Kamnitz und Umgebung sowie aus dem Böhmischen Niederland um Kreibitz geholfen haben zu überleben. Viele Vertriebene haben sich persönlich bedankt. Hier war der erste deutsche Ort für Menschen, die von einem Tag zum anderen ihre Heimat zu Fuß, enteignet und ausgeraubt verlassen mußten.
Mehrere tausend Vertriebene lagerten in den Wäldern an der Grenze, informierten sich hier an der Buchenparkhalle gegenseitig, hofften auf Rückkehr, manche beendeten verzweifelt ihr Leben, die anderen zogen weiter ins Innere Deutschlands. Die Überlebenden danken den hilfsbereiten Menschen dieser Region und reichen allen die Hand, die gemeinsam mit ihnen des damaligen Unrechtsgeschehens gedenken.
Die Sudeten sind reich an besonderen Ausblikken. Der älteste – und vielleicht schönste – Aussichtsturm des Isergebirges ist die Stephanshöhe auf dem gleichnamigen Berg (958 m ü.d.M.) bei Bad Wurzelsdorf. Aus einer Höhe von 24 Metern bietet der im Stil der Neugotik gestaltete Turm einen einmaligen Blick auf das Isergebirge und das angrenzende Riesengebirge. Auch die Bauzeit ist einmalig: Von der Grundsteinlegung im Jahr 1847 bis zur Eröffnung 1892 vergingen ganze 45 Jahre. Grund war eine 40jährige Bauunterbrechnung.



Das langgezogene Städtchen Rochlitz im westlichen Riesengebirge liegt malerisch umgeben von Wäldern und Bergen. Kein Wunder also, daß Rochlitz bereits Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend für den aufkommenden Fremdenverkehr entdeckt wurde. Zunächst kamen die Sommerfrischler und später auch Gäste im Winter. Dazu trug erheblich die Ausbreitung des Skifahrens bei, das in Rochlitz einige Pioniere fand, wie den schlesischen Hauptmann Otto Vorwerg.
Es gibt nur noch wenige Restexemplare: „Heimat in Bildern“, der Sudetendeutsche Kalender 2023, spiegelt in 25 großartigen Fotos die Schönheit Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens wider und erzählt Geschichten aus den Regionen.
Alle Abonnenten der Sudetendeutschen Zeitung, Amtsträger und Spender der Sudetendeutschen Landsmannschaft haben den Kalender bereits zugeschickt bekommen.
Solange der Vorrat reicht, können weitere Exemplare von jedermann direkt bei der Sudetendeutschen Landesmannschaft Bundesverband bestellt werden, und zwar per eMail an
info@sudeten.de oder telefonisch während der üblichen Bürozeiten unter der Nummer (0 89) 48 00 03 70.
Der Kalender kann gratis bestellt werden und wird noch vor dem Jahreswechsel zugestellt. Der Kalender-Sendung wird dann ein Spendenüberweisungsträger zur freundlichen Beachtung beigelegt.
Die Fotografen des Jahreskalenders 2023 sind: Ralph Toman, Tomáš Brdicka, Marianne Kaehler, Felix Meyer, Miroslav Václavek, David Stašek, Sven Müller, Gabriele Müller, Leonhard Niederwimmer, Manfred Gischler, Gottfried Herbig, Karl Lukas, Martin Minarik, Ulrich Möckel, Sebastian Weise, Klaus Svoja-
novsky und Johannes Schimpfhauser.
Übrigens: Die Vorbereitungen für den Jahreskalender 2024 werden bald beginnen. Spätestens im Sommer wird die Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband dann über die Sudetendeutsche Zeitung, die Webseite www.sudeten.de und alle anderen Kanäle dazu aufrufen, Bilder aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien einzuschicken. Wer also in den kommenden Wochen und Monaten unterwegs ist, sollte seinen Fotoapparat nicht verbessen. Wichtig ist, daß die Bilder möglichst hochauflösend sind, damit die Fotos in dem Kalender auch entsprechend zur Geltung kommen.
Weniger als einen Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegt der größte Gletschersee und zugleich der größte natürliche See Tschechiens: der Schwarze See. Der malerisch von Felsenwänden und Nadelbäumen umgebene See ist mit 41 Metern Tiefe zugleich der tiefste See und gilt als sehr fischreich. Zwischen ihm und dem nahe gelegenen Teufelssee – dem zweitgrößten natürlichen See des Landes – verläuft die Europäische Hauptwasserscheide: Der Teufelssee entwässert zur Donauseite hin, der Schwarze See hingegen zur Elbe.



Schloß Ronsperg im Egerland war von 1846 bis 1945 Sitz der böhmischen Adelsfamilie Coudenhove-Kalergi. Einer der wohl bekanntesten Sprosse dieser Familie ist Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Philosoph, Schriftsteller, Politiker und Begründer der Paneuropa-Union, der ältesten europäischen Einigungsbewegung. Der in Tokio geborene Sohn einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters wuchs im westböhmischen Ronsperg mehrsprachig auf und genoß eine umfassende humanistische Bildung.
„Lebendiges Erzgebirge“ – so lautet der Titel einer Handy-App für Besucher des böhmischen und sächsischen Erzgebirges. Sie enthält Informationen zu sieben Orten rund um den Keilberg: Annaberg-Buchholz und Breitenbrunn in Sachsen sowie Abertham, Böhmisch Wiesenthal, Gottesgab, Sankt Joachimsthal und Schlackenwerth in Böhmen. So „begegnet“ der Anwender etwa dem Rechenmeister Adam Ries in Annaberg oder dem Erzgebirgssänger Anton Günther in Gottesgab.

„Im Märzen der Bauer“ ist eines der bekanntesten deutschen Volks- und Kinderlieder. Nur wenigen dürfte indes bewußt sein, daß es sich dabei ursprünglich um ein sudetendeutsches Musikstück mit Wurzeln im nordmährischen Altvatergebirge handelt. Seine Grundlage bildete das Kalenderlied „So hasset die Sorgen“, das seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Mähren und anderen deutschsprachigen Teilen der Habsburger Monarchie verbreitet war. Jedem Monat im Jahreslauf war darin eine eigene Strophe gewidmet.
Der Sudetendeutsche Tag findet von Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai in Regensburg statt. Das diesjährige Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“ paßt gut nach Regensburg, schließlich verbindet die Donau mit Deutschland, Österreich, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, der Republik Moldau und der Ukraine zehn europäische Länder. Übrigens: Daß Regensburg und die Sudetendeutschen gut zusammenpassen, befand man schon 1951, als die Stadt die Patenschaft für die Sudetendeutschen übernahm.

Wer auf der interaktiven Landkarte von Sudeten.net nach Muschau sucht, findet den Ort auf einer Insel inmitten eines großen Sees. Diese Lokalisierung mag zunächst wie ein Fehler erscheinen – lag Muschau doch zeit seines Bestehens niemals an oder gar in einem See. Tatsächlich weist die kartographische Darstellung auf ein Schicksal hin, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehreren sudetendeutschen Gemeinden widerfuhr: Sie versanken in den Fluten neu angelegter Stauseen., so auch Muschau in den 1970er Jahren.
Die Nacht zu Karfreitag war eine Nacht voller Angst, die Christus durchlitten hat. Der Gründonnerstag war deshalb seit jeher Gegenstand der frommen christlichen Andacht und rückte in besonderer Weise im 17. Jahrhundert in den Fokus, als sich unter dem Einfluß der Jesuiten Bruderschaften von der Todesangst Christi gründeten. Diese regten die Errichtung von Kalvarienbergen, besonders im österreichischen Raum an. In diese Zeit fällt auch der Bau der Todesangst-Christi-Kapelle auf dem Schafberg im Egerland.
Rübezahl, der Berggeist des Riesengebirges, erfreut sich bis heute größter Beliebtheit. Der Berggeist des benachbarten Adlergebirges, Rampusch (Rampušák) , ist dagegen hierzulande so gut wie unbekannt. Das hat einen einfachen Grund: Rampusch wurde erst im Jahr 1962 erfunden. Der Journalist Jiří Dvořák entwickelte ihn für eine ReiseSendung des Tschechoslowakischen Rundfunks. In Anlehnung an den Rübezahl sollte damit eine Symbol- und Werbefigur geschaffen werden, um den Tourismus im Adlergebirge zu fördern.
wo der Böhmerwald ins Böhmische Becken übergeht. Auch in sprachlicher Hinsicht war dies eine Übergangsregion. Von hier an wurde mehrheitlich Tschechisch gesprochen. Im Jahr 1910 lebten im Ort 567 Tschechen und 52 Deutsche. Durch zahlreiche Eingemeindungen reicht das Tschachrauer Gemeindegebiet heute im Süden bis Eisenstein und damit in Regionen, die vor 1946 fast ausschließlich von Deutschen bewohnt waren.
Tschachrau liegt
Ein Höhepunkt für jeden Besucher Südböhmens ist das Schloß Frauenberg an den Ausläufern des Böhmerwaldes im Budweiser Becken. Errichtet wurde an dieser Stelle bereits im 13. Jahrhundert eine Burg, die sich zeitweise im königlichen Besitz befand. Im Jahr 1661 wurde sie Eigentum der Familie Schwarzenberg. Sein heutige Ähnlichkeit mit Schloß Windor verdankt das Schloß Frauenberg einer Reise von Fürst Johann Adolf zu Schwarzenberg und seiner Gattin Eleonore zur Krönung von Queen Victoria.




Die Talsperre Fleyh befindet sich im Erzgebirge bei Georgendorf und staut die Flöha in ihrem Oberlauf. Die einzige Pfeilerstaumauer Tschechiens wurde bereits 1963 fertiggestellt. Die Talsperre wird als Trinkwasserreservoir für den Bezirk Most genutzt, weshalb das Baden und das Betreten des Ufers verboten sind. Die Staumauer ist 56 Meter hoch und 416 Meter lang. Der Stausee nimmt eine Fläche von 153 Hektar ein. Gestaut wird das Wasser aus einem Einzugsgebiet von rund 43 Quadratkilometern.







Zwischen Freiwaldau und Mährisch Schönberg liegt der Rotbergsattel. Der Sage nach stellte dereinst ein Jäger einem Hirschen nach und verletzte das Tier am Bein. Der Hirsch humpelte zu einer Quelle und stellte sein blutendes Bein hinein. Im selben Moment stoppte die Blutung, und der Hirsch konnte mit kräftigen Sprüngen davonspringen. Als Jahre später seine Familie erkrankte, erinnerte sich der Jäger an das Ereignis und holte von dort Wasser. Mit Erfolg. Alle wurden geheilt.

Der Berg Taubenhaus (Holubník) bietet auf 1070 Metern Höhe über dem Meeresspiegel einen weiten Rundumblick über das Isergebirge. Durch die dichten Wälder des Isergebirges streifte dereinst auch der Lehrer und Volkskundler Josef Syrowatka (1891–1967) mit seinem Sohn Otfried. Er sammelte Sagen aus der Gegend, die er natürlich auch seinem Sohn erzählte. Die Geschichten, die er von Kindesbeinen an hörte, beflügelten die Phantasie des jungen Mannes, der als Otfried Preußler ein bekannter Schriftsteller wurde.
Mit seinen knapp 1200 Einwohnern macht Wernstadt nahe der Elbe keinen städtischen Eindruck. Tatsächlich wurde der Ort jedoch schon vier Mal zur Stadt erhoben, erstmals 1497. Nach der wechselvollen Geschichte brach mit der Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung die Einwohnerzahl so stark ein, daß die Ortschaft erneut ihr Stadtrecht verlor. Erst 2006 wurde Wernstadt wieder zur Stadt erhoben. Auf einer Anhöhe befindet sich seit 2003 ein Sende- und Aussichtsturm, von dem aus Wernstadt und das Elbetal überblickt werden können.


Heumoth – dieser Ortsname könnte sich von der „Hohen Maut“ herleiten, die erhoben wurde, als im 13. Jahrhundert hier die Grenze zwischen Böhmen und Österreich verlief. Andere Theorien gehen davon aus, daß damit die Heuernte, also „Heumahd“, bezeichnet wird. Am 29. Mai 1945 um 8 Uhr mußten die deutschsprachigen Bewohner den Ort innerhalb von eineinhalb Stunden verlassen. Dazu wurden sieben Männer als Geiseln genommen, von denen einer ermordet wurde.

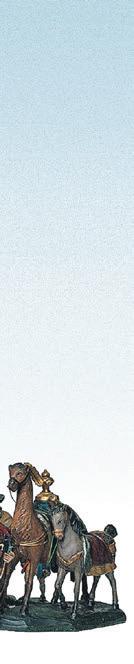






„Bad Neudorf liegt unweit der Bezirksstadt Weseritz, Egerer Kreis, im Königreiche Böhmen, von der Bahnstation Mies zwei Stunden, eben so weit von der Bahnstation Plan und zweieinhalb Stunden von dem Weltbade Marienbad entfernt“, beschrieb Richard Dlauhy 1876 den Kurort. Weiter schrieb der Autor: „Die Gegend repräsentriert sich als eine von waldigen, engen Thälern durchschnittene, gegen Süden und Osten sich sanft abdachende, gegen Westen und Norden durch das Endgebirge des Kaiserwaldes geschützte Hochebene.“
Der Schwarzenberg im östlichen Riesengebirge erhebt sich 1299 Meter über dem Meeresspiegel. Talort ist das Kurstädtchen Johannisbad, dessen Heilquellen seit 1000 Jahren bekannt sind. Wer sich von Johannisbad aus zum Berggipfel aufmacht, erlebt eine beeindruckende Naturlandschaft mit Moosen, Knieholz und Flechten. Zu den landschaftlichen Attraktionen zählt auch das auf dem Plateau zwischen dem Schwarzenberg und dem Forstberg gelegene Hochmoor. Ein Lehrpfad führt durch die 66 Hektar große Moorlandschaft.
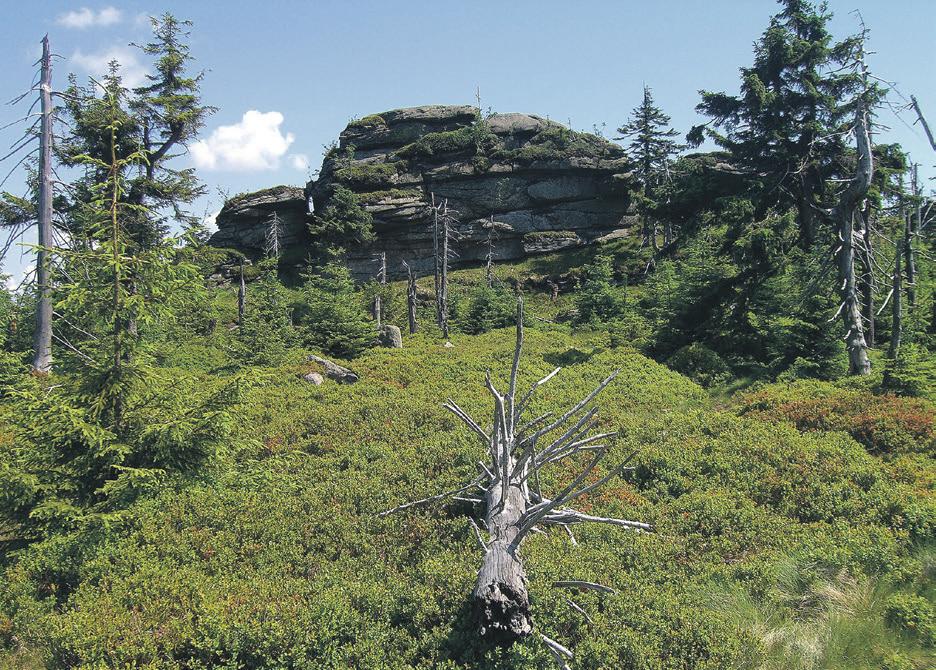



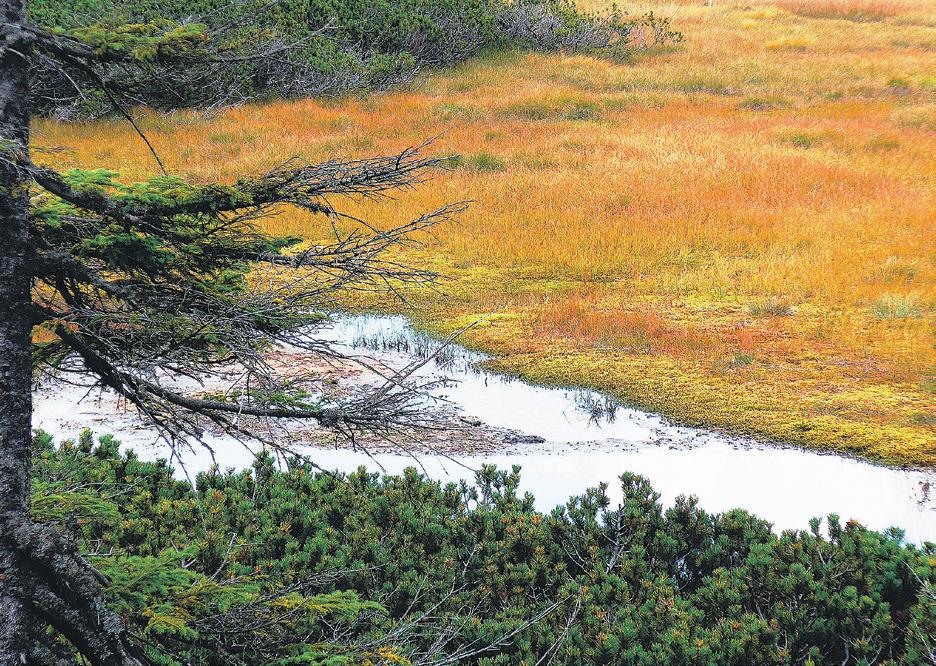
erhoben, wurde im 13. Jahrhundert eine imposante Burganlage errichtet. Zu den frühsten Besitzern zählen die Herren von Krawarn, eine der damals mächtigsten Adelsfamilien in Mähren. Der tschechische Name des Kuhländchens „Kravařsko“ leitet sich von dieser Familie ab, die von der Burg aus ein weites Gebiet bewachte und beherrschte.
In ihrer Blütezeit war die Burg Schwamberg, dessen Ruinen auf dem gleichnamigen Hügel thronen, eine der größten und schönsten Burgen in Westböhmen. Im Grundriß ist die Burg ein langes Dreieck. Bemerkenswert ist die Kirche St. Maria Magdalena mit der Grabstätte der Herren von Schwamberg. Die Kirche wurde 1707 erneuert, der Turm stammt von 1880. Von der eigentlichen Kernburg sind nur der runde Turm am Spornende, ein Teil des anliegenden Palas und ein Kellerraum mit Gewölbedecke erhalten.



In Böhmen und Mähren gab es zahlreiche sudetendeutsche Sprachinseln – von der größten, dem Schönhengstgau, über die Sprachinseln von Wachtl/Deutsch Brodek, Olmütz, Wischau, Brünn, Iglau, Budweis, Stritschitz und Pilsen bis nach Prag. Die kleinste Sprachinsel bestand aus einem einzigen Dorf mit weniger als 300 Einwohnern: Libinsdorf an der böhmisch-mährischen Grenze in den Saarer Bergen. Hier ließ das nahegelegene Zisterzienserkloster Saar im 15. Jahrhundert einen Fischteich – den Großen Zdarskoteich – anlegen.
Diese Weihnachtskrippe aus Zwittau im Schönhengstgau umfaßt mehr als 200 Einzelelemente. Hergestellt hat sie im Jahr 1835 Thomas Haberhauer. Dem Zwittauer Brauchtum entsprechend wurde die Krippe in Stufenform aufgebaut: auf der linken Seite die Stadt Bethlehem und auf der rechten das Feld mit den Hirten und Schafen. Als die Familie Tyrolt aus Zwittau vertrieben werden sollte, stand für den Vater fest, daß die Krippe irgendwie mit mußte, denn: „Alles andere ist zu ersetzen, nur die Krippe nicht.“


Im Evangelium, das in der katholischen Liturgie am zweiten Adventssonntag verlesen wird, zitiert Johannes der Täufer den Propheten Jesaja: „Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.“ Von einer biblischen Wüstenlandschaft ist das Adlergebirge weit entfernt, dafür bietet es im Advent eindrucksvolle Winterlandschaften.

im Egerland Einst eine schöne Burg
In diesem Winter kostet der Skipaß in Kitzbühel 65 Euro, in St. Moritz bis zu 90 Euro – pro Tag und pro Person. Auch in anderen Skiorten der Alpen ist Skifahren ein schöner, aber vor allem teurer Spaß, da neben den Kosten für die Skipässe auch noch die Ausgaben für Essen und Trinken das Urlaubsbudget belasten. Insbesondere für Familien bieten deshalb Riesengebirge, Böhmerwald, Altvatergebirge und Erzgebirge mit über hundert Skiorten eine gute und preiswertere Alternative. So gibt es den Tagesskipaß für das berühmteste Skigebiet Tschechiens, das Skiareal Spindlermühle (Skiareál Špindlerův Mlýn) im Riesengebirge, im Online-Vorverkauf bereits ab 28 Euro.
Das beliebteste und gleichzeitig höchste Gebirge des Landes ist das rund hundert Kilometer nördlich von Prag liegende Riesengebirge (Krkonoše). Hier befinden sich auch die bekanntesten Skigebiete, in denen vor allen Dingen anspruchsvolle Wintersportler auf ihre Kosten kommen.
Besonders beliebt ist das Skigebiet Spindlermühle. Auf fünf verschiedene Skizentren verteilen sich hier 27 Kilometer präparierte Pisten, drei Snowparks, eine U-Rampe, zwei Kinderparks und mehr als 90 Kilometer Langlaufstrecken.


Direkt im Schatten des höchsten Berges Tschechiens, der 1603 Meter hohen Schneekoppe, liegt das Gebiet Petzer (Pec pod Sněžkou). Das Skiresort Schwarzberg-Petzer (Černá hora-Pec) besteht aus sechs miteinander ver-

bundenen Skigebieten, um das komplette östliche Riesengebirge mit einem Skipaß erleben zu können. Dabei gibt es hier nicht nur beste Skibedingungen, sondern auch Spaß für Groß und Klein, zum Beispiel auf der Rodelbahn Glockenweg.
Direkt unter dem Gipfel des Glatzer Schneebergs (Králický Sněžník) befindet sich eines der modernsten Skigebiete in Tschechien – Dolní Morava in Ostböhmen. Ein Urlaub hier verspricht ausgezeichnet präparierte Pisten sowie eine Menge Spaß beim Snowtubing oder bei Adrenalinfahrten auf der Bobbahn.
Die Neuigkeit der Saison ist die längste Hängebrücke der Welt, die Sky Bridge 721, die zu einem
spektakulären Spaziergang mit Nervenkitzel einlädt.
Vor allem Familien fühlen sich auf den Hängen im Böhmerwald (Šumava) an der tschechischdeutsch-österreichischen Grenze wohl. Das bedeutendste Gebiet ist Spitzberg bei Markt Eisenstein (Špičák in Železná Ruda), das gemeinsam mit dem Skigebiet auf deutscher Seite zu den größten Skizentren in Mitteleuropa – außerhalb der Alpen –gehört.
Bestens präparierte Pisten finden sich auch in Zadov, in Kaltenbach (Nové Hutě) oder am Ufer des größten tschechischen Stausees Lipno. Im Skigebiet Lipno lohnt es sich zudem, die Skier zwischenzeitlich gegen Schlitt-

schuhe einzutauschen, um auf dem See die mit elf Kilometern längste Schlittschuhstrecke der Welt zu testen oder mit bequemen Wanderschuhen den ältesten Baumwipfelpfad in Tschechien zu besteigen.
In Mähren garantiert das Altvatergebirge (Jeseníky) Pistengaudi pur. Das Skigebiet Karlov am Altvater (Karlov pod Pradědem) umfaßt 14 Pisten, die sich unter anderem bestens für Familien und Anfänger eignen. Höhepunkte sind außerdem die Bobzone, zwei Langlaufloipen, eine Slalomstrecke mit Zeitmessung, ein brandneuer Spielplatz und der Snowpark. Ideal für Kinder ist die Kinderecke an der Seilbahn. Hier können die Kleinen Pause oder früher Schluß machen und werden betreut, während die Eltern noch unbeschwert Ski fahren können.
Die steilen Hänge der tschechischen Seite des Erzgebirges (Krušné hory) ziehen mitunter auch die Profis an. Der höchste Berg des tschechischen Erzgebirges mit knapp über 1200 Metern und zugleich das größte Skizentrum ist Keilberg (Klínovec). Zum Saisonstart wurde hier die mit 3,5 Kilometern längste Abfahrtstrecke Tschechiens eröffnet. Nach oben befördert werden die Skifahrer dabei von einer modernen Vier-Sessel-Seilbahn mit Haube.
Ein weiteres Skigebiet befindet sich in Gottesgab (Boží Dar), dem höchstgelegenen Städtchen in Mitteleuropa. Und in Pleßberg (Plešivec) befindet sich das jüngste Skigebiet Tschechiens.
Als Antwort auf die Energiekrise investieren auch Tschechiens Skigebiete diesen Winter viel Geld in energiesparende, nachhaltige Maßnahmen. Der Großteil des 30-Millionen-Euro-Budgets fließt in den Bau von Wasserspeichern, die die Beschneiung mit Wasser aus der Natur ermöglichen und auch in Bezug auf die notwendige Kühlung deutlich energiesparender sind. Zusätzlich wird vor Ort zunehmend die sogenannte SNOWsat-Technologie eingesetzt, die mit Hilfe von Satellitenbildern und GPS zeigt, wie viel Schnee wo liegt. „Das ermöglicht ein sehr viel effizienteres Management von natürlichem und künstlichem Schnee“, erklären die Skilift-Betreiber.
Die Digitalisierung hilft auch den Winterurlaubern Geld zu sparen. So können in immer mehr Skizentren Skipässe und Leihausrüstungen vorab online geordert werden. Dafür gewähren die Betreiber oft zwischen 20 und 30 Prozent Rabatt. Wer clever bucht, kann so als Erwachsener an vier Tagen, die nicht aufeinander folgen müssen, für etwas mehr als 90 Euro Ski fahren. Also zu einem Viertel des Preises, was im schweizerischen St. Moritz aufgerufen wird.
Prag gilt als eine der weltweit besten Partydestinationen und ist damit ein perfekter Ort, um fröhlich (und feucht) das neue Jahr zu begrüßen.
Die offiziellen SilvesterFeierlichkeiten finden jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt am Altstädter Ring und auf dem Wenzelsplatz statt.
Um 18.00 Uhr startet hier ein großes Musik- und Kulturprogramm. Den besten Blick auf das mitternächtliche Feuerwerk hat man an Bord eines Raddampfers auf der Moldau, die kurz vor dem Jahreswechsel vor der Karlsbrücke vor Anker gehen.

Wer die Natur dem Partyleben vorzieht, kann einer alten, vorchristlichen Tradition folgen, wonach man in Böhmen und Mähren am Neujahrsmor-
gen einen Berg besteigen sollte.
Wer besonders mutig ins neue Jahr starten will, wandert auf den Glatzer Schneeberg. Hier befindet sich der Sky Walk. Der bis zu 55 Meter hohe Baumwipfelpfad ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen in der Tschechischen Republik und auch am Neujahrstag zugänglich.


Erst vor wenigen Monaten wurde in direkter Nachbarschaft die nächste Attraktion eröffnet – die Sky Bridge 721. Bis zu 95 Meter über dem Talgrund verbindet die mit 721 Metern längste Hängebrücke der Welt zwei Bergrücken im Altvatergebirge. Die Betreiber versprechen dabei vieldeutig: „Wir garantieren ein außergewöhnliches Erlebnis fürs Leben.“
