Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

VOLKSBOTE HEIMATBOTE
Jahrgang 75 | Folge 18 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 5. Mai 2023
Reicenberger


Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Jahrgang 75 | Folge 18 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 5. Mai 2023



❯ An der sechsstündigen Veranstaltung nahmen auch Vertreter der deutschen Minderheit und der Sudetendeutschen Volksgruppe teil
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung
HEIMATBOTE



Zum ersten Mal hat eine hochrangig besetzte Konferenz zum Thema „Gräber der Deutschen und anderer Nationalitäten in der Tschechischen Republik“ am vergangenen Freitag im Prager Außenministerium getagt, zu der die Regierungsbeauftragte für Menschenrechte und stellvertretende Vorsitzende des Regierungsrates für Nationale Minderheiten, Klára Šimáčková Laurenčíková, auch Vertreter der deutschen Minderheit sowie der Sudetendeutschen Landsmannschaft eingeladen hatte.


Die Konferenz war ein großer Erfolg, da alle Beteiligten teilgenommen und miteinander die gesamte Problematik erörtert haben“, zog Martin H. Dzingel Bilanz. Der Präsident der Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und stellvertretende Vorsitzende des Regierungsrates für nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik hatte die Konferenz geleitet, deren Einberufung jahrelange Bemühungen vorausgegangen waren.
Long Covid: Minister tritt zurück







Weil er langfristig an den Folgen einer Covid-Erkrankung leidet, hat Vladimír Balaš nach weniger als einem Jahr Amtszeit seinen Rücktritt als Bildungsminister erklärt.
Nach übereinstimmenden Berichten tschechischer Medien soll Mikuláš Bek, derzeit Minister für europäische Angelegenheiten, Senator und ehemaliger Rektor der MasarykUniversität, das Amt übernehmen. Für Bek soll der derzeitige stellvertretende Außenminister Martin Dvořák dann zum Europaminister aufsteigen.

Balaš war seit Juni vergangenen Jahres im Amt. Damals löste er Petr Gadzík ab, der wegen seiner Kontakte zum Unternehmer Michal Redl und des Korruptionsfalls um die Prager Verkehrsbetriebe zurückgetreten war.
In einem Interview mit Seznam Zprávy sagte Balaš, daß er sein Parlamentsmandat vorerst behalten werde. Eine Entscheidung über sein weiteres Vorgehen wolle er dann im September treffen, wenn er mehr Klarheit über seine gesundheitlichen Probleme habe.
Balaš sagte, er habe seit Anfang des Jahres darüber nachgedacht, das Amt aufzugeben: „Ich hatte einen Hustenanfall, der nicht ganz einfach war, und jetzt habe ich ein Gesundheitsproblem, das anhält. Das Problem ist unter Kontrolle, aber im September wird man sehen, wie es weitergeht.“
Er fühle sich erschöpft und müsse seine Gesundheit wieder in den Griff bekommen. „Und das Bildungsministerium braucht ein wirklich großes Engagement. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Energie habe.“
VOLKSBOTE


Reisten nach Prag (von links nach rechts): Heimatp egerin Christina Meinusch, Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, Dr. Martin Posselt (Ausschuß Kultur und Volkstumsp ege), Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel, Volksgruppensprecher Bernd Posselt und Edmund Schiefer (Ausschuß Heimatgliederung und Patenschaften).


Bereits 2015 hatte Dzingel dem Regierungsrat für nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik einen Antrag vorgelegt, die deutschen Gräber zu erhalten. Eine daraufhin vom Außenministerium einberufene Arbeitsgemeinschaft sammelte Daten, entwickelte ein Handbuch für Kommunen und stellte fest, daß eine staatliche Förderung fehlt. „Es wurde entschieden, ein Projekt zur fachlichen Erhebung der bisher existierenden deutschen Gräber in Auftrag zu geben, auf Grund dessen dann die Richtlinien der Unterstützung festgelegt werden“, erklärte Dzingel die Vorgeschichte der Konferenz und sagte zur geschichtlichen Dimension: „In Folge der Vertreibung der meisten deutschsprachigen Bürger aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, der heutigen Tschechischen Republik, wurde die Grabpflege der Verstorbenen unmöglich gemacht. Mit der Vertreibung ist eine ganze Volksgruppe verschwunden, die über Jahrhunderte zur prinzipiellen Entwicklung des Landes beigetragen hat. So können wir die heute noch existierenden deutschen Gräber als historische Denkmäler betrachten.“
Auch der Sudetendeutsche Heimatrat unter dem Vorsitz von Franz Longin beschäftigt sich seit Jahren mit der Problematik.
Daß die tschechische Politik diesem schwierigen Thema eine hohe Bedeutung beimißt, unterstrich Außenminister Jan Lipavský, der die Konferenz im großen Saal des Ministeriums persönlich eröffnete. „Die Aufgabe einer entwickelten Gesellschaft besteht darin, das Erbe ihres Landes und all seiner Bewohner, einschließlich Minderheiten, zu pflegen. Dazu gehört auch die Grabpflege“, so Lipavský nach der Konferenz auf Twitter.
Klare Worte fand auch Klára
Šimáčková Laurenčíková. „Mit Minister Jan Lipavský sind wir


Starke Botschaft: Außenminister Jan Lipavský erö net persönlich die Gräber-Konferenz im großen Saal des Palais Czernin. In der ersten Reihe (von rechts nach links): SL-Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Botschafter Andreas Künne, Regierungsbeauftragte Klára Šimáčková Laurenčíková und Martin H. Dzingel (nach hinten gewandt), Präsident der Landesversammlung.



uns einig, daß die Schuld gegenüber der deutschen Minderheit beglichen werden muß. Am Freitag haben der Minister und ich eine Konferenz mit Vertretern der Minderheit abgehalten, um über die Pflege verlassener deutscher und anderer Gräber zu sprechen. Ich sehe das als einen hilfreichen Schritt zur Versöhnung“, twitterte die Regierungsbeauftragte.
„Gräber sind nicht nur Gedenkorte, sie sind auch Kulturdenkmäler. Mit ihnen erhalten wir das gemeinsame Erbe unserer Region“, stellte der deutsche Botschafter in Prag, Andreas Künne, fest.
Auch wenn er selbst seit Jiří Dienstbier regelmäßig zu Gesprächen im Außenministerium sei, war es das erste Mal, daß eine ganze Gruppe von sudetendeutschen Amtsträgern offiziell eingeladen worden ist, würdigte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, die Konferenz. So waren in Prag mit dabei Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel, Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Volkstumspflege, Dr. Martin Posselt,
der Vorsitzende des Ausschusses Heimatgliederung und Patenschaften, Edmund Schiefer, und die Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, Christina Meinusch.
„Besonders beeindruckend bei der Konferenz war, daß gerade von den Vertretern der tschechischen Zivilgesellschaft immer wieder thematisiert wurde, warum diese Gräber verwaist sind, eben als Folge der Vertreibung“, berichtete Bernd Posselt, der deshalb in seinen einführenden Worten den 1931 in Mährisch Schönberg geborenen und 1996 verstorbenen langjährigen Bundesminister Hans „Johnny“ Klein zitierte: „Nur ein Volk, das in Eintracht mit seinen Toten lebt, hat Zukunft.“ Ergänzend fügte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe hinzu: „Auch wir sind Kinder dieses Landes. Es sind unser aller Tote.“
Der Erhalt der, so Posselt, „historischen Friedhöfe“ sei deshalb eine staatliche Aufgabe der Tschechischen Republik, auch wenn das breite zivilgesellschaftliche Engagement von Tschechen und Sudetendeutschen begrüßenswert ist. „Der tschechische Staat hat die Verantwor-
❯ Völkerrechtliche Vereinbarung von 1992 Vertrag über gute Nachbarschaft
Der völkerrechtlich verbindliche Vertrag über gute Nachbarschaft von 1992 bildet die jetzige Grundlage der deutsch-tschechischen Beziehungen. In Artikel 30 wird der Erhalt der Gräber garantiert.
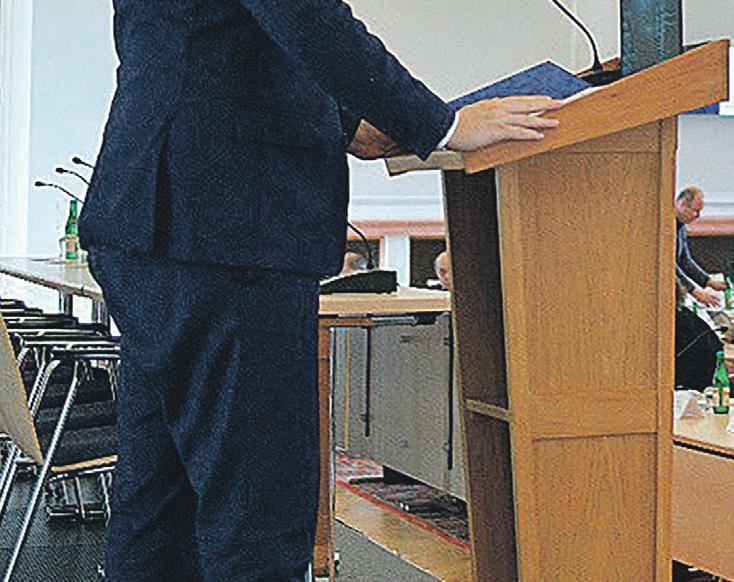
werden; ihre Pflege wird ermöglicht.
Foto: Vlada CZ
tung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, historische Friedhöfe zu erhalten. Diese Gräber gehören zur Identität des Landes“, erklärte Posselt und schlug vor, von der Zivilgesellschaft getragene Leuchtturmprojekte zusätzlich zu würdigen: „Solche Initiativen müssen wir unbedingt weiter fördern. Ich habe deshalb vorschlagen, diese Best-Practice-Beispiele zum Beispiel im Rahmen des DeutschTschechischen Gesprächsforums auszuzeichnen, wie wir es mit den Journalistenpreisen bereits machen.“
Nach den Begrüßungen durch Außenminister Jan Lipavský, die Regierungsbeauftragte Klára Šimáčková Laurenčíková, Botschafter Andreas Künne und Präsident Martin H. Dzingel folgten drei Einführungsvorträge. Tomáš Kotrlý vom Ministerium für regionale Entwicklung sprach über das Thema „Der rechtliche Rahmen der Problematik der Pflege verlassener deutscher Gräber“, Stanislav Děd von der Arbeitsgruppe zur Lösung der Frage deutscher und anderer Gräber“ referierte über „Deutsche Gräber in der Tschechischen Republik“ und die beiden Arbeitsgruppen-
mitglieder Alexej Kelin sowie Olga Mandová informierten über „Gräber anderer nationaler Minderheiten in der Tschechischen Republik“.
Anschließend ging es im ersten von Dzingel moderierten Themenblock um den gegenwärtigen Zustand der deutschen Gräber. Neben Bernd Posselt sprachen Lukáš Novotný von der Universität Aussig, Roman Bláha von der „Arbeitsgruppe zur Lösung der Frage deutscher und anderer Gräber“ und Milan Pospíšil, Sekretär des Regierungsrates für nationale Minderheiten a. D. Im zweiten Block diskutierte dann Lucie Römer das Thema „Ziele und wie sie zu erreichen sind“ mit Tomáš Jelínek vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Petr Štěpánek von der Tschechischen Technischen Universität Prag, dem SL-Bundeskulturreferenten Prof. Dr. Ulf Broßmann und dem Bürgermeister von Mark Eisenstein (Železná Ruda), Filip Smola, der die Friedhöfe Eisenstraß und Markt Eisenstein als Beispielprojekte präsentierte.
Den Abschluß bildeten weitere positive Beispiele. So stellte Štěpánka Šichová vom Verein für deutsch-tschechische Verständigung Trautenau – Riesengebirge die Friedhöfe in Döberle bei Trautenau, in Merkelsdorf und weiteren Orten vor. Und Alena Kovářová von der weißrussischen Minderheit sprach über die Gräber ihrer in der Tschechischen Republik begrabenen Landsleute.
A


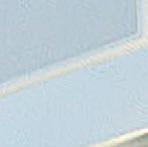


rtikel 30, (1) Die Vertragsparteien erklären, daß deutsche und tschechoslowakische Gräber auf ihrem Gebiet in gleicher Weise geachtet und geschützt
(2) Die Gräber deutscher beziehungsweise tschechoslowakischer Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich auf ihrem Gebiet befinden, stehen unter dem Schutz der Gesetze und werden erhalten; ihre Erfassung und Pflege wird ermöglicht.

(3) Die Vertragsparteien werden die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, die für die Pflege dieser Gräber zuständig sind, unterstützen.

„Nach diesen ersten direkten Gesprächen steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit nachhaltigen Arbeitskontakten nichts mehr im Wege, in die auch die Heimatgliederung einbezogen werden soll“, faßte SL-Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel die sechsstündige Konferenz zusammen. Im weiteren Verfahren sollen die Ergebnisse der Konferenz jetzt zusammengefügt und das
Bereits kurz nach seiner Ankunft in der tschechischen Hauptstadt hat der neue Leiter der Bayerischen Repräsentanz in Prag, Florian Winzen, seinen Antrittsbesuch im Sudetendeutschen Büro absolviert. Bei diesem ersten Tre en machte er klar, sich neben seiner eigentlichen Arbeit auch um die P ege des sudetendeutschen Erbes im bayerisch-tschechischen Zusammenhang kümmern zu wollen.


SL-Büroleiter Peter Barton hatte in der Vergangenheit bereits mehrere gemeinsame Veranstaltungen mit dem damaligen Leiter der Bayerischen Repräsentanz, Hannes Lachmann, durchgeführt, und das soll auch
so bleiben. Zu der Zusammenarbeit des Prager Sudetendeutschen Büros und der Bayerischen Repräsentanz gehört natürlich auch die Betreuung von Gästen aus dem Freistaat Bayern, die nach Prag kommen und sich auch darüber informieren wollen, wie die sudetendeutsch-tschechische Verständigung im Allgemeinen und aktuell verläuft. Dafür wiederum ist Barton zuständig, und so erstaunt es nicht, daß er und Florian Winzen sich in Zukunft sehr oft begegnen werden. Die Zusammenarbeit der „Sudetendeutschen Botschaft des guten Willens“ mit der Bayerischen Repräsentanz ist eine ernsthafte Verp ichtung, die außerdem allen Beteiligten viel Freude bereitet.
❯ Initiatorin Christa Naaß: „Partnerschaftsarbeit ist immer Friedensarbeit und hat auch eine politische Dimension“

Im Rahmen eines offiziellen Treffens in Brünn haben der bayerische Bezirk Mittelfranken und die tschechische Region Südmähren nach sieben Jahren freundschaftlicher Beziehungen ihre Partnerschaft besiegelt. Für Mittelfranken ist es die dritte grenzüberwindende Initiative. Partnerschaften bestehen bereits mit Frankreich und Polen.
Bezirkstagspräsident Armin

Kroder und seine Stellvertreterin Christa Naaß fuhren zur Partnerschaftsunterzeichnung mit einer kleinen Delegation nach Brünn.
In festlichem Rahmen wurde in der Villa Stiassni die „Gemeinsame Vereinbarung über die regionale Zusammenarbeit und Partnerschaft des Bezirks Mittelfranken und der Region Südmähren“ von Bezirkstagspräsident Armin Kroder und Kreishauptmann Jan Grolich unterschrieben.

Seit dem Jahr 2015 pflegt der Bezirk Mittelfranken mit Südmähren, einer der vierzehn Regionen Tschechiens, Kontakte, angeregt unter anderem durch den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, und den Leiter des Sudetendeutschen Büros, Peter Barton. Anlaß waren für die SPD als Antrag stellende Fraktion im mittelfränkischen Bezirkstag das beschlossene Memorandum zwischen der Metropolregion Nürnberg und der Region Karlsbad und die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung über 700 Jahre Kaiser Karl IV.
Seither fand unter Federführung von Christa Naaß, die auch als Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates großes Interesse an einer Zusammenarbeit hat, ein wechselseitiger Austausch statt. Südmähren gehört in Tschechien zu den Regionen mit einem hohen wirtschaftlichen Potential, die mährische Hauptstadt Brünn ist nach Prag die
In Brünn unterzeichneten Bezirkstagspräsident Armin Kroder und Kreishauptmann Jan Grolich die Partnerschaftsurkunde. Mit dabei: Christa Naaß, die die Partnerschaft initiiert hatte. Zur Delegation gehörte auch Maria Scherrers, Bezirksrätin von Bündnis 90/Die Grünen (Zweite von links).
zweitgrößte Metropole Tschechiens. Einrichtungen und Institutionen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung oder Jugend und Sport sollen unter dem Dach der Verbindung künftig zusammenarbeiten. Auch touristische Projekte und eine nachhaltige Regionalentwicklung stehen auf der Agenda.
Die Berufsschule im mittelfränkischen Weißenburg und die Charbulova-Schule in Brünn haben bereits die ersten Kontakte geknüpft. Die westmittelfränkische Gemeinde Arberg plant schon im Juni ein konkretes Treffen mit der Gemeinde Untertannowitz (Dolní Dunajovice), die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf und die Fachschule für Weinbau in Feldsberg (Valtice) sind im Austausch, Dr. Uta Karrer vom Fränkischen Museum in Feuchtwangen nimmt
Piraten treten in Regionen an
Die Piraten wollen im kommenden Jahr in allen Regionen mit eigenen Kandidaten antreten, schließen aber auch Koalitionen nicht aus, hat der Parteitag am Wochenende in Reichenberg beschlossen. An dem Treffen hatte auch Premierminister Petr Fiala (ODS) teilgenommen und in seinem Grußwort die Piraten als einen wichtigen Teil der Regierungskoalition bezeichnet. Parlamentspräsidentin und Top 09-Vertreterin Markéta Pekarová Adamová forderte die Piraten in einer Videobotschaft auf, auch unpopuläre, aber notwendige Maßnahmen zu unterstützen. Der stellvertretende Premierminister und Stan-Vorsitzende Vít Rakušan sagte, die Piraten und die Bürgermeister seien liberaler und stünden sich daher näher als die anderen Koalitionspartner. Marian Jurečka, stellvertretender Premierminister und Vorsitzender der KDUČSL, ist der Ansicht, daß die Zusammenarbeit mit den Piraten „substantiell und korrekt“ sei und auf gegenseitigem Respekt für unterschiedliche Positionen beruhe. Wie bei früheren Wahlen stehen Kandidaturen auch Nichtmitgliedern und Vertretern anderer Gruppen offen, sagte der Parteivorsitzende Ivan Bartos.
Tuberkulose-Alarm ist gefälscht
Das tschechische Gesundheitsministerium warnt vor gefälschten Dokumenten, die derzeit per eMail an Schulen und Eltern verschickt werden und von einem angeblichen Ausbruch einer Tuberkulose-Epidemie in Liebau im Bezirk Olmütz berichten. Hintergrund: Auf dem dortigen Truppenübungsplatz werden zur Zeit ukrainische Soldaten von der tschechischen Armee für den Kriegseinsatz gegen Rußland ausgebildet.
Ukrainer zahlen

Sozialabgaben
ge in das Sozialsystem einzahlen, ist auf 85 Prozent gestiegen. Vor einem Jahr waren es noch 45 Prozent. Etwa 91.000 Neuankömmlinge haben jetzt einen Arbeitsplatz. Nach Angaben des Innenministeriums halten sich derzeit 225 100 Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzvisum im Alter zwischen 18 und 65 Jahren in der Tschechischen Republik auf. Fast zwei Drittel von ihnen sind Frauen.
Kulturwelt trauert um Ivan Vyskočil Mit Ivan Vyskočil ist eine der markantesten Persönlichkeiten der tschechischen Kulturwelt von der Bühne gegangen. Der Dramatiker, Schauspieler, Schriftsteller und Lehrer verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren. Vyskočil wurde am 27. April 1929 in Prag als Sohn einer Buchbinderfamilie geboren. Er absolvierte Anfang der 1950er Jahre ein Schauspiel- und Regiestudium an der Damu, zu dessen Lehrern Karel Höger, Otomar Krejča und Jiří Frejka gehörten. Später studierte er Psychologie und Pädagogik an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Nach dem Ende des Prager Frühlings fiel er bei den kommunistischen Machthabern in Ungnade und durfte nicht mehr im Ausland auftreten und publizieren.
Skepsis gegenüber der EU wächst
in Juni an einer internationalen Konferenz in Brünn teil, die Bürgermeistervereinigung des Bayerischen Gemeindetages Weißenburg-Gunzenhausen plant im Herbst eine Reise nach Brünn und im Rahmen des Gredinger Trachtenmarktes Anfang September wird eine Folkloregruppe aus Südmähren teilnehmen.
Kreishauptmann Grolich hob in seiner Rede hervor, daß es sich bei der Unterzeichnung der Urkunde nicht nur um ein Stück Papier handelt, sondern hervorzuheben ist, „daß die Partnerschaft schon in den vergangenen Jahren durch regelmäßige Kontakte vorbereitet wurde, also bereits etwas entwickelt wurde, auf das nun aufgebaut werden kann“.

Für Bezirkstagspräsident Armin Kroder sind die Partnerschaften „ein Beitrag zu einem friedlichen, freundlichen und freiheitli-
chen Europa – und das muß an der Basis gelebt werden“. Er bezeichnete diese Partnerschaft augenzwinkernd als „ein Baby von Christa Naaß“, und er sei mit seiner „heutigen Unterschrift der Taufpate“.
Nicht ausgeblendet werden dürfen auch bei dieser Partnerschaft, da waren sich beide Seiten einig, die dunklen Seiten der gemeinsamen Geschichte. Dazu gehöre auch der Brünner Todesmarsch mit Tausenden von Toten. An diese Opfer werde jedes Jahr beim gemeinsamen Versöhnungsmarsch gedacht. Die Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten, Christa Naaß, die im vergangenen Jahr am Versöhnungsmarsch teilgenommen hatte, stellte fest: „Partnerschaftsarbeit ist immer Friedensarbeit und hat damit auch eine politische Dimension.“
❯ Gemeinsames Gedenken am 24. und 25. Juni in Brünn Versöhnungsmarsch zum Kaunitz-Studentenheim
„Mit der Teilnahme von Gästen aus Deutschland werden wir den Versöhnungsmarsch am Samstag symbolisch mit einem Gedenkakt am Sonntag abschließen“, kündigen die Veranstalter des Festivals Meeting Brno an.
Anläßlich des 70. Jahrestages des Brünner Todesmarsches gingen am 30. Mai 2015 Tschechen und Deutsche erstmals gemeinsam vom Massengrab in Pohrlitz zurück ins 30 Kilometer entfernte Brünn – ein Zeichen der Versöhnung, nachdem der Brünner Stadtrat Tage zuvor öffentlich um Entschuldigung für
die gewalttätige Vertreibung mit mehreren Tausend Toten gebeten hatte.
In diesem Jahr findet der Versöhnungsmarsch am Samstag, 24. Juni, statt und wird erstmals am Sonntag, 25. Juni, mit einer Gedenkveranstaltung im Kaunitz-Studentenheim ergänzt. „Das berüchtigte Kaunitz-Studentenheim in Brünn symbolisiert das Leiden von Tausenden Menschen, die hier während der Nazibesatzung inhaftiert waren. Hunderte Personen, Widerstandskämpfer und tschechische Patrioten, starben hier den gewaltsamen Tod. Die Erinnerung
an diese Opfer gehört zur integralen Bilanz des letzten Jahrhunderts. Nach dem Kriegsende setzte sich das Leiden an diesem Ort bis Juni 1945 fort, als hier Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Brünn inhaftiert wurden“, erklären die Veranstalter.

Die SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren auch in diesem Jahr wieder Busfahrten nach Brünn. Nach einer Initiative von MdB Rita Hagl-Kehl wird diese völkerverbindende Reise erneut vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.
Der Anteil der Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der Tschechischen Republik eine Vollzeitbeschäftigung oder eine beitragspflichtige Beschäftigung ausüben und damit Beiträ-
Es ist einer der schlechtesten Werte in der EU: Nur noch 55 Prozent der tschechischen Bürger sehen die generelle Entwicklung der Europäischen Union positiv, geht aus der Eurobarometer-Umfrage hervor, die jetzt veröffentlicht worden ist. Im vergangenen Jahr waren es noch 59 Prozent. Positiv assoziieren die Tschechen die EU mit Freiheit, Reisen und Arbeitsmöglichkeiten (57 Prozent der Befragten). Frieden wird von 32 Prozent der Befragten mit der EU in Verbindung gebracht und Demokratie von 27 Prozent. Dagegen kritisieren 30 Prozent der Tschechen die Bürokratie der EU, 24 Prozent werfen der Europäischen Union Geldverschwendung vor und 22 Prozent unzureichende Grenzkontrollen.
ISSN 0491-4546



Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
In Kiew wurde Petr Pavel vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen. Zuvor hatte Pavel mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová die zerstörte Stadt Borodjanka sowie Butscha besucht, wo die Russen mehr als 300 Zivilisten ermordet hatten. In Dnipro gedachte Pavel mit dem Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, General Serhiy Lysak, an der „Allee der Erinnerung“ der gefallenen ukrainischen Soldaten. In großen Lettern steht auf der Gedenktafel: „Helden sterben nicht.“
❯ Pavel und seine slowakische Amtskollegin Zuzana Čaputová sicherten dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj die weitere Unterstützung zu





Für die tschechischen Personenschützer war es ein Albtraum, für die Welt ein klares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine sowie für Menschenrechte und Demokratie. Als erstes ausländisches Staatsoberhaupt hat Tschechiens Präsident Petr Pavel die umkämpfte Ostukraine besucht und dort auf einer Panzerhaubitze, die Tschechien der ukrainischen Armee übergeben hatte, eine klare Botschaft an Kriegsverbrecher Wladimir Putin hinterlassen: „Go home, Russians – until it‘s too late“ (Russen, geht nach Hause – bevor es zu spät ist). „Als Kommandeur bin ich meinen Soldaten immer zur Seite gestanden. Heute ist das nicht mehr meine Aufgabe. Ich bin gekommen, um ihnen Mut zu machen“, twitterte der ehemalige Nato-General.

Er sei von Kiew weiter nach Osten gereist, so Pavel, um zu zeigen, daß die Tschechische Republik es mit der Schirmherrschaft über die Region Dnipropetrowsk ernst meine und beim Wiederaufbau unterstützen werde. Die Region grenzt an die Gebiete, in denen derzeit heftige Kämpfe stattfinden, und ist auch selbst immer wieder Ziel von russischen Raketenangriffen, wie am Freitag, kurz bevor Pavel in

Richtung Ostukraine aufbrach.




In Nowomoskowsk, das rund 25 Kilometer von der Provinzhauptstadt Dnipro entfernt liegt, besuchte Pavel im dortigen Krankenhaus verwundete Soldaten und sprach mit Ärzten über die medizinische Lage. Zeitgleich hatte das tschechische Unternehmen Linet neun Spezialbetten an das Krankenhaus gespendet.

In Dnipro informierte sich Pavel über die Versorgung der 200 000 Kriegsflüchtlinge, die

In Dnipro gedachte Präsident Petr Pavel an dem zerstörten Hochhaus der rund fünf Dutzend Zivilisten, die bei dem russischen Raketenangri am 14. Januar ums Leben kamen. Im Krankenhaus von Nowomoskowsk (links) zeigten Ärzte Bilder der oft lebensbedrohlichen Kriegsverletzungen. Auf einer Panzerhaubitze, die Tschechien der ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt hatte, signierte Pavel seine Botschaft an die Russen. Und in einer Flüchtlingsunterkunft besuchte das Staatsoberhaupt ukrainische Kinder. Fotos: Region Dnipropetrowsk/Pražský hrad
hier gestrandet sind. Außerdem gedachte Pavel der rund fünf Dutzend Zivilisten, darunter viele Kinder, die im Januar bei einem russischen Raketenangriff in einem Hochhaus ums Leben kamen, und legte am Mahnmal an der Allee der Erinnerung
einen Kranz für die gefallenen ukrainischen Soldaten nieder.
Noch bevor Pavel am Sonntag über Polen nach Tschechien zurückreiste, forderte das Staatsoberhaupt in einem Interview mit dem Tschechichen Fernsehen auch die Kritiker in der ei-
gene Bevölkerung auf, die Ukraine weiterhin zu unterstützen: „Für uns bedeutet dies nur eine teilweise Einschränkung unseres Komforts. Niemand stirbt in unserem Land, niemand zerstört unsere Städte, niemand greift gezielt zivile Ziele an, niemand zer-
schlägt unsere Infrastruktur, unsere Energie und alles andere. Alles, was wir wirklich tun müssen, ist zu helfen.“
Er glaube, daß viele Menschen im Westen durch den Krieg frustrierter seien als die betroffenen Ukrainer selbst: „Die Ukrainer sind felsenfest davon überzeugt, daß sie diesen Krieg zu einem siegreichen Ende führen werden und daß sie sich ihren Traum erfüllen werden, ein freies Land zu sein, das seine Zukunft selbst bestimmt.“
Die Solidarität mit der Ukraine sei für den Westen ohnehin alternativlos, so das Staatsoberhaupt: „Wenn wir in Frieden leben wollen, wenn wir in einer Demokratie leben wollen, wenn wir unsere Souveränität und unsere Freiheit bewahren wollen, dann haben wir keine andere Wahl als uns gegen das Gegenteil zu stellen, das heute Rußland ist.“

Als Soldat hatte Pavel selbst mehrfach den Krieg erlebt. So befehligte er im Januar 1993 im Jugoslawienkrieg eine tschechoslowakische Fallschirmjägereinheit, die über 50 eingekesselte französische Blauhelm-Soldaten befreien konnte.


Noch heute zählt diese brenzlige militärische Operation, die über eine Woche dauerte und in dessen Verlauf Pavel von einem gegnerischen Milizangehörigen mit einer Maschinenpistole am Kopf bedroht wurde, zu den größten Erfolgen der tschechischen Armee. Pavel wurde anschließend vom damaligen fran-
zösischen Verteidigungsminister Pierre Joxe mit dem Militärverdienstkreuz mit bronzenem Stern ausgezeichnet.
Pavel sagte jetzt im Interview, er habe damals in Jugoslawien gehofft, solche Bilder von Krieg, Leid und Zerstörung nicht mehr sehen zu müssen, aber dann in Afghanistan ähnliches erlebt. Er habe sich dennoch nicht vorstellen können, daß auch in Europa wieder ein Krieg ausbrechen könnte: „Wie viele Menschen hatte ich gehofft, daß Rußland zivilisatorisch so weit fortgeschritten ist, daß ein solch barbarischer Krieg auf europäischem Boden nicht mehr möglich ist.“ Das tschechische Staatsoberhaupt warf in diesem Zusammenhang den russischen Soldaten vor, sich „wie Söldner irgendwo in den afrikanischen Kriegen des letzten Jahrhunderts“ zu verhalten. „Das ist im 21. Jahrhundert völlig inakzeptabel, vor allem für ein Land, das sich rühmt, eine Zivilisation zu sein“, so der ehemalige General und Vorsitzende des Nato-Militärausschusses. Zum Auftakt der Reise war Pavel gemeinsam mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová in Kiew von Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj empfangen worden. Dabei unterzeichneten die drei Staatsoberhäupter eine gemeinsame Erklärung, in der sich Tschechien und die Slowakei unter anderem verpflichten, der Ukraine zu helfen, Mitglied der Nato und der Europäischen Union zu werden. „Wir unterstützen das souveränen Recht der Ukraine, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden und ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen“, twitterte Pavel und versprach auch weiterhin militärische Hilfe: „Bei allen Gesprächen wurde deutlich, daß die Ukraine heute vor allem Munition braucht. Der Mangel daran schränkt die Fähigkeit der Ukraine ein, eine erfolgreiche Gegenoffensive durchzuführen. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, die Versorgung aus unseren eigenen Quellen und in Zusammenarbeit mit Verbündeten zu verbessern.“
Bei diesem persönlichen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten sei ihm aufgefallen, daß Selenskyj nur noch selten lächle, schrieb Präsident Petr Pavel später auf Twitter: „Er hat nicht viele Gründe zu lächeln. Ich wünsche ihm und allen Ukrainern aber von Herzen, daß sie irgendwann wieder lächeln können.“ Torsten Fricke
■ Bis Freitag, 19. Mai, Ausstellung „Nikolaus Hipp: Bilderwelten. Ölbilder, Aquarelle und Lithographien“. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10.00 bis 20.00 Uhr. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche.
■ Samstag, 6. Mai, 14.00 bis 19.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde München und Freising: Begegnungstag „Mitten am Rande – Sudetenland und sein neues Gesicht – Perspektiven in den Grenzregionen der Tschechischen Republik“. Referentin: Veronika Kupková, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung und Infos unter eMail muenchen@ ackermann-gemeinde.de
■ Montag, 8. Mai, 17.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach: Maiandacht am Vertriebenendenkmal am Vogelherd. Im Vogelherd bei der Busschleife, Schwabach.
■ Mittwoch, 10. Mai bis Dienstag, 3. Oktober: BayerischTschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Öffnungszeiten (bis 14. Mai Eintritt frei): Dienstags bis sonntags 9.00 bis 18.00 Uhr. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg.
■ Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Mai, Paneuropa-Union Deutschland: 49. Paneuropa-Tagen in Stettin und Greifswald unter dem Motto „Paneuropa – Gemeinsam für den Ostseeraum“. Anmeldung und weitere Informationen unter eMail paneuropa-union@t-online.de oder per Fax an (0 89) 99 95 49 14.
■ Samstag, 13. Mai, 14.00
Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Mutter- und Vatertagsfeier. Fischerheim, In der Aue 2, Wehringen.
■ Samstag, 13. Mai, 15.00
Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Mut-

tertagsfeier. Gasthaus Lohgarten, Hilpoltsteiner Straße 28, Roth.
■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde:
„Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 13. Mai, 17.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Maiandacht am Vogelbeerbaum. Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Sonntag, 14. Mai, 13.00 bis 19.00 Uhr: Egerländer Gmoi
Stuttgart: Gmoinachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Dienstag, 16. Mai, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Dienstag, 16. Mai, 17.00
Uhr, VLÖ: Eröffnung der Ausstellung „Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“. Die Ausstellung wird bis zum 4. Juli gezeigt. Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr, freitags bis 12.00 Uhr.
Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.
■ Dienstag, 16. Mai, 17.00
Uhr, Ackermann-Gemeinde
München und Freising: Nepomukfeier-Gottesdienst mit der tschechischen katholischen Gemeinde München. Asamkirche, Sendlinger Straße 32, München.
■ Donnerstag, 18. Mai, 11.00
Uhr, Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgs-Verein: Himmelfahrtstreffen und Hahnschla-
gen. Altvaterbaude des MSSGV bei Schopfloch, Stockert 2, Lenningen.
■ Freitag, 19. Mai bis Sonntag, 6. August: BayerischTschechiche Freundschaftswochen in Selb und Asch. Detailliertes Programm unter www. freundschaftswochen2023.eu
■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr: Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: Themenführung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00 Uhr: Familienführungen mit Nadja Schwarzenegger. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de 14.00 bis 15.00 Uhr: „Götz Fehr: Tu Austria felix“ – eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45 Uhr sowie 18.00 bis 18.30 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“. 16.00 bis 17.00 Uhr: Themenführung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Eva Haupt.
■ Sonntag, 21. Mai, 14.00 Uhr, SL-Heimatkreis Braunau: Eröffnung der Ausstellung „Domov/Heimat – Adalbert Meier – Fotografien“. Anläßlich des Internationalen Museumstags werden Abzüge von historischen Glasnegativen aus Wekelsdorf gezeigt. Braunauer Heimatmuseum, Paradeplatz 2, Forchheim.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Dienstag, 30. Mai, 15.00 bis

17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.

■ Dienstag, 30. Mai, 17.30 Uhr: Erinnerungen an den Brünner Todesmarsch. Pfarrer i. R. Franz Pitzal erinnert an das grausame Geschehen. Glockenspiel bei der Mediathek, Jahnstraße, Renningen.
■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.
■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr. Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com
■ Samstag, 10. Juni, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn.
■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Erlebnis namens Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089) 48 00 03 37.
■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.
Erlebnis namens Heimat

Heimat – bei diesem Begriff schwingt für jeden etwas anderes mit. Doch eines ist wohl immer gleich: Der Gedanke an die eigene Heimat ist stets mit Erinnerungen verbunden – an die Kindheit, das Erwachsenwerden, an Landschaften oder Gerüche...
Kosten:

15 Euro pro Termin oder 5er Karte mit allen fünf Terminen ermäßigt 60 Euro Anmeldung: Erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin an anmeldung@sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch Mo. - Fr. unter +49 (0) 89 480003-37
■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch..
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.
■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen unter anderem von OB Dr. Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz (Gera). Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Samstag, 8. bis Sonntag 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Austellung
„Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und EgerlandKulturhaus in Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net
■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Donnerstag, 3. bis Donnerstag 10. August, Karpatendeutsche Landsmannschaft Slowakei, Kreisverband München-Oberbayern: Bus-Rundreise in die Karpatendeutschen Sprachinseln der Slowakei. Anmeldung: Josefine Hogh, Telefon (0 81 71) 38 62 82 (Anrufbeantworter) oder per eMail an josefinehogh@web.de
■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: Feierstunde Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB
Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.
■ Samstag, 15. September, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Barock! Bayern und Böhmen“. Vortrag von Christoph Lippert zur BayerischTschechischen Landesausstellung. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 30. September, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: Ganztagesfahrt zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung. Abfahrt Busbahnhof Erlangen 9.00 Uhr. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen. Anmeldung bei Christoph Lippert unter Telefon (0 91 32) 97 00 oder per eMail an info@lti-training.de
■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen. ■ Freitag, 17. bis Samstag, 18. November, Sudetendeutscher Heimatrat: Jahrestagung. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen
■ Donnerstag, 11. Mai, 19.00 Uhr: Buchvorstellung
„Wer bin Ich? Wer sind Wir?
Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
Wer bin Ich? Wer sind Wir?
– jeder Mensch, jede Gemeinschaft vergewissert sich der eigenen Identität stets aufs Neue. Ihre Bezugspunkte sind Herkunft, Sprache, Religion, Kultur. Dabei sind individuelle und kollektive Selbstzuschreibungen ambivalent, vielschichtig und wandeln sich mit neuen Erfahrungen. In dieser Hinsicht war und ist auch die Identität der Deutschen im und aus dem östlichen Europa von Vielfalt geprägt.
Professor Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens, und
seine Kolleginnen Dr. Lilia Antipow und Patricia Erkenberg setzen sich im Rahmen dieses Buchs mit identitätsstiftenden Aspekten wie Essen, Literatur, Brauchtum und Sport auseinander. Zusätzlich wird in Interviews – unter anderem mit dem Musiker Mulo Francel, dem Münchner Politiker Florian Roth oder der Sprach- und Kulturwissenschaftlerin Zuzana Finger –der ganz persönlichen Bedeutung von Heimat, Erinnerung, Sprache oder Familie nachgespürt. Schmuckobjekte aus dem böhmischen Gablonz, ein Urzelkostüm aus dem siebenbürgischen Agnetheln oder eine Barbarafigur aus dem oberschlesischen Beuthen zeigen, wie auch Einzelobjekte das individuelle Selbstverständnis prägen und kollektive Zugehörigkeit stiften können.
■ Dienstag, 23. Mai, 19.00 bis 21.00 Uhr, Online-Seminar: „Israel –das Heilige Land und seine Dauerkrise“. Gespräch mit dem Analysten, Orientalisten und Historiker Matthias Hofmann.
Der Vortrag will versuchen, die jüngsten Geschehnisse im Nahen Osten zu erklären. Dabei wird die geschichtliche Entwicklung nach 1918, dem Ende des Osmanischen Reichs, beleuchtet. Was ist aus dem Land geworden, in dem Milch und Honig fließen, wie es im Alten Testament heißt? Wie wichtig sind Religionen im Nahen Osten? Wie entstand der Staat Israel? Wer sind die Palästinenser? Was ist die Hamas? Welche Nationen verfolgten und verfolgen welche Interessen im Nahen Osten? Kann es einen dauerhaften Frieden in dieser Region geben?
Der Link zur Registrierung wird Anfang Mai auf der Homepage www.heiligenhof.de freigeschaltet.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
❯ Richard Coudenhove-Kalergi
Vor hundert Jahren hat der aus Böhmen stammende Richard Coudenhove-Kalergi, der Begründer der Europäischen Einigung, den Weltbestseller „Pan-Europa” geschrieben, dessen Kernbotschaften bis heute aktuell sind. Zum Jubiläum gab es für die Paneuropäer ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Erstmals erschien das Werk in Tel Aviv auf Hebräisch.
Coudenhove hatte sich in den ersten Frühlingstagen des schicksalsschweren Jahres 1923 mit seiner Frau, der berühmten Burgschauspielerin Ida Roland, auf Einladung der jüdischen Mäzenin Stefanie von Gutmann nach Schloß Würting zurückgezogen, um ungestört innerhalb weniger Wochen seinen Epoche machenden Text niederzuschreiben. Dieser fordert eine friedensstiftende Weltmacht Europa, beantwortet Fragen nach den Grenzen Europas und den Grundlagen europäischer Kultur, spricht sich für eine Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen den USA und der Gemeinschaft der freien Europäer aus, setzt sich für die Überwindung der europäischen Binnengrenzen sowie ein Europäisches Volksgruppen- und Minderheitenrecht ein, warnt vor der russischen Gefahr und entwickelt konkrete Ideen zum Kampf gegen den Nationalismus. Instrumente auf diesem Weg sollen laut Coudenhove die deutsch-französische und die tschechisch-sudetendeutsche Aussöhnung, eine Europäische Verteidigung, eine Wirtschafts- und Währungsunion sowie eine Europäische Verfassung sein.
Wie schon vergangenes Jahr ihr 100jähriges Bestehen, feierte die Paneuropa-Union als von einem Sudetendeutschen initiierte älteste europäische Einigungsbewegung ihr Programmbuch grenzüberschreitend. In Ober-
des Jüdischen Zentrums in München übergibt eine Paneuropa-Delegation der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch, die soeben erstmals aufgelegte hebräische Ausgabe des Buches „Pan-Europa“. Von rechts nach links: Dirk

Vor dem oberösterreichischen Schloß Würting mit dem Buch „Pan-Europa“ (von links nach rechts): Die Vorgänger-Bürgermeister Johann Stürzlinger und Hermann Stoiber, Stephanie Waldburg, Bernd Posselt, Bürgermeisterin Martina Schmuckermayer, Reinhard Schotola und Johannes Kijas. Fotos: Paul Scherer, Johannes Kijas, Stephanie Waldburg



österreich präsentierte sie ein Reprint des deutschen Originals der Bürgermeisterin von Offenhausen, zu dem Würting gehört, Martina Schmuckermayer. Im Straßburger Europaparlament erhielt die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dubravka Šuica aus Kroatien, ein Exemplar, und die hebräische Übersetzung ging sowohl in München an die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch, Europäische
Karls-Preisträgerin der Sudetendeutschen, als auch in Prag an den langjährigen Generalsekretär der Föderation jüdischer Gemeinden in der Tschechischen Republik, Tomáš Kraus. Der Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt, zugleich Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, wies in seinen Ansprachen darauf hin, daß der Vater Paneuropas bereits in seinem Text von 1923 vor der Gefahr
❯ Ehrensache Ehrenamt: Peter Stächelin engagiert sich als Heimatortsbetreuer von Bernsdorf
Buchübergabe an die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dubravka Šuica.
eines Zweiten Weltkrieges mit entsetzlichen Folgen für die Zivilbevölkerung gewarnt und die anschließende Teilung Europas in einen russischen und einen amerikanischen Machtbereich vorhergesagt habe. Weil er aber gleichzeitig mit der Paneuropa-Idee das Gegenmittel erfunden habe, sei das 100 Jahre alte Buch heute immer noch ein unverzichtbarer Fundus zur Gestaltung des Europa von morgen.
Über die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte ist Peter Stächelin mit dem Heimatortsbetreuer von Bernsdorf in Kontakt gekommen. Auf dessen Wunsch hat Stächelin diese Aufgabe mittlerweile übernommen.
Verschiedene Wege führen zum ehrenamtlichen Engagement in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Bei Peter Stächelin verlief dieser Weg über seinen Nachnamen. Der heute 51-jährige ist in Benediktbeuern aufgewachsen. Väterlicherseits stammt die Familie aus dem Dreiländereck Deutschland –Frankreich – Schweiz, mütterlicherseits aus dem Riesengebirge. Mutter, Tante und Großeltern mußten ihren Heimatort Berndorf, wo sie eine kleine Landwirtschaft betrieben, 1945 verlassen und kamen mit einem der ersten Transporte nach Benediktbeuern.
Seine Mutter hat Peter Stächelin früh verloren – sie starb, als er sechs Jahre alt war, drei Wochen nach seiner Einschulung. Seinen Großvater mütterlicherseits hat Peter Stächelin nicht mehr kennengelernt, er starb schon vor der Geburt des Enkels. „Unter diesen Umständen war die ehemalige Heimat meiner Mutter in meiner Kinder- und Jugendzeit kein Thema mehr“, sagt Peter Stächelin.
Das änderte sich in den 1990er Jahren, woran sein Name großen Anteil hatte. Damals gab es erstmals CD-Roms mit Telefonbüchern für ganz Deutschland. Peter Stächelin klickte sich durch und stellte fest, daß sein Nachname in Deutschland äußerst selten ist. Damit war sein Interesse für Familienforschung geweckt. Zunächst machte er mithilfe eines Stammbuchs die männlichen Vorfahren ausfindig.
Bei einem Besuch bei seiner Tante mütterlicherseits fiel ihm ein Heimatbrief des früheren Bernsdorfer Heimatortbetreuers in die Hände, darin eine Einladung zum Heimattreffen in Bernsdorf selbst. Peter Stächelin fuhr hin –es war die erste Reise in die Heimat seiner Mutter. 250 Menschen waren bei dem Treffen dabei. Während des einwöchigen Aufenthalts lernte er zwei Cou-
sins seiner Mutter kennen, die noch in Schatzlar lebten. Ein Teilnehmer half Peter Stächelin außerdem, seinen Stammbaum nachzuzeichnen. „Ich war so bereichert und glücklich von dieser Reise nach Hause zurückgekehrt, daß ich mit Ernst Kasper, dem damaligen Heimatortsbetreuer von Bernsdorf, in Verbindung blieb“, erinnert er sich. Nur wenige Jahre später – im Janu-
Peter Stächelin ist der Heimatortsbetreuer von Bernsdorf (großes Foto).


Das April-Bild des Heimatkalenders zeigt die Hauptstraße in Schatzlar mit Lauben-Holzhäusern, die typisch für das Riesengebirgsvorland waren.


ar 2006 – überzeugte Ernst Kasper Peter Stächelin, seine Nachfolge als Heimatortsbetreuer von Bernsdorf anzutreten. Nach und nach kamen weitere Ortschaften im Umkreis von Bernsdorf dazu. „Mein Ziel als Heimatortsbetreuer ist es, die frühere Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten“, sagt Peter Stächelin. Mehrere Jahre lang hat er Treffen ehemaliger Bernsdorfer organisiert. Er hilft
Am 1. Mai begleitete mich von morgens bis abends ein musikalischer Ohrwurm. Er schlich sich bei mir ein, als ich mich auf den Gottesdienst an diesem Tag vorbereitete. Der Beginn des Marienmonats Mai ist mir seit jeher eine markante Zäsur im kirchlichen Jahreskreis, ein Tag, auf den ich mich freue. So war der Ohrwurm ein Geschenk, denn es handelte sich um den Refrain eines italienischen Marienliedes, das in den deutschsprachigen Ländern wenig bekannt ist und an das auch ich schon längere Zeit nicht mehr gedacht hatte. „O mia bella speranza, dolce amor mio, Maria.“ Das Lied stammt vom heiligen Alfons Maria von Liguori, dem Gründer des Redemptoristenordens, der im 18. Jahrhundert in Süditalien lebte und nicht nur ein eifriger Seelsorger und ein geschätzter Theologe war, sondern auch ein begabter Komponist und Dichter. Einer meiner Mitbrüder, der allzu früh verstorbene Pater Heinrich Stummer, übersetzte vor einigen Jahrzehnten dieses Marienlied ins Deutsche. Bravourös machte er den süditalienischen Schmelz für unsere eher nüchterne Frömmigkeit verständlich. In seiner Version heißt das Lied: „Ein Zeichen unserer Hoffnung bist du für uns, Maria.“
Schön, daß mir dieses Lied zum Beginn des Marienmonats einfiel, denn es bringt in einer einzigen Zeile zum Ausdruck, warum wir auf die Mutter Jesu schauen und sie besonderes ehren. Maria bringt Hoffnung in unser Leben.



außerdem bei der Suche von Personen, gibt jährlich einen Heimatbrief heraus, schreibt Artikel für den Riesengebirgsteil der Sudetendeutschen Zeitung und hat eine eigene Internetseite (www. staechelin.name/bernsdorf.htm) erstellt, auf der er über Bernsdorf und die umliegenden Ortschaften informiert.
„Eine wesentliche Aufgabe sind der Erhalt des Wissens über die alte Heimat, auch das Sammeln von Bildern, Postkarten, Urkunden, Erlebnis- und Vertreibungsberichten aus der damaligen Zeit für die nachfolgenden Generationen“, berichtet Peter Stächelin. Nur bei einer Angelegenheit kann er nicht helfen: bei der Familienforschung. „Hilfe zur Selbsthilfe kann ich leisten, aber niemandem die Forschung abnehmen. Schließlich bin ich ja auch berufstätig. Zudem lese ich kein Sütterlin und kein Tschechisch.“
Doch auch ohne tschechische Sprachkenntnisse knüpft und pflegt er viele Kontakte nach Tschechien. Schon sein Vorgänger, Ernst Kasper hatte einen Freundschaftsvertrag mit dem heutigen Bernartice geschlossen. Auch die Heimattreffen vor Ort in Tschechien hat Stächelin weitergeführt. Den in Trautenau (Trutnov) lebenden Jan Vísek unterstützt er beim Vertrieb von Kalendern mit historischen Bildern.

Darüber hinaus steht Peter Stächelin im Austausch mit anderen Heimatortsbetreuern, dem „Verein für deutschtschechische Verständigung Trautenau“ und dem Museum in Schatzlar (Žacléř).
In München nimmt er seit kurzem an einem monatlichen Stammtisch für die Nachwuchsgeneration aus München und Umgebung teil, den Kirsten Langenwalder, Pressereferentin des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e.V., organsiert: „Alle Interessierten sind herzlich willkommen, sich diesem Stammtisch, aber auch den von ihm betreuten Heimatgemeinschaften anzuschließen, seine Informationsangebote zu nutzen und ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen,“ sagt Stächelin, dessen Aufgeschlossenheit auch sein Ehrenamt prägt.
Dr. Kathrin Krogner-KornalikDie vielen Marienbildnisse und -statuten in Kirchen, Häusern, auf Plätzen und an Wegrändern sind Hoffnungszeichen. Sie zeigen uns eine Frau, die großherzig darauf vertraut hat, daß Gott es gut mit uns meint, und die deswegen Gott in ihrem Leben mit jeder Faser ihres Herzens Ehre erwies. Am schönsten kommt das für mich in den Anfangsworten ihres berühmten Lobpreises zum Ausdruck, der im Lukasevangelium überliefert ist: „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.“ Im Verlauf der biblischen Heilsgeschichte hat Maria eine ganz besondere, unverzichtbare Aufgabe. Gott wollte Mensch werden, aber er brauchte dazu ein Eingangstor in diese Welt. Er brauchte eine menschliche Mutter. „Du bringst der Welt wahres Leben: Gott ist als Mensch bei uns“, so setzte Pater Stummer seine deutschsprachige Übersetzung des Liedes fort. Christus ist dieses wahre Leben, das uns Maria schenkte. Gerade in unserer Zeit der Pandemie spüren wir sehr genau, was uns leben läßt und was nicht. Die Liebe läßt uns leben. Ich sehe sie mir in Christus geschenkt. Das Vertrauen und die Anerkennung lassen uns leben. Niemand schenkt mir das mehr als Christus. Und schließlich: die Barmherzigkeit läßt uns leben, die Gewißheit, daß uns Fehler nicht angerechnet, sondern verziehen werden. Auch darin erweist sich Christus in meiner Erfahrung als überaus großzügig und treu.




Maria ist ein Zeichen der Hoffnung, weil sie uns vor Augen führt, was uns leben läßt, oder vielmehr: wer uns leben läßt. Das gibt mir persönlich Schwung und Energie. Und deswegen freue ich mich über den Marienmonat Mai auch in diesem Jahr wieder in besonderer Weise.

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·
Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)
mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de

� Brünner Symposium „In der Mitte Europas“ der Ackermann-Gemeinde Grundkonsens
Das 31. Brünner Symposium „In der Mitte Europas“ der Accermann-Gemeinde am Palmwochenende Anfang April trug den Titel „Vor dem Krieg – nach dem Krieg. Mitteleuropäische Erfahrungen und Perspectiven“.
Was ein Grundkonsens ist, erklärte zum Auftakt im historischen Ratssaal die SPD-Politikerin und Hochschulprofessorin Gesine Schwan in einer Debatte mit dem Historiker Jan Šícha und dem Mitveranstalter Matěj Spurný: „Der Grundkonsens kommt aus der Notwendigkeit, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine pluralistische Demokratie westlichen Musters einzuführen, in der unterschiedliche Gruppen über den Streit in der Politik zu den Grundwerten der Demokratie – den Werten der französischen Revolution –Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität zusammenfinden müssen.“
Mehrmals wurde auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als mögliche Vision für die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine verwiesen. Zugleich war die Zeit nach dem Krieg auch jene lange Zeit des Friedens, die Westeuropa beschieden war. Die Vertreter Tschechiens und die Österreichische Botschafterin Bettina Kirnbauer erinnerten in ihren Grußworten an die blutigen Balkankriege auch als Versagen der europäischen Demokratien.
Im ersten Panel wurden zunächst die historischen Daten bestimmt, welche in jedem mitteleuropäischen Land im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine die Debatte bestimmen. In Tschechien und der Slowakei waren dies 1938 und 1968. Doch 1938 war das Vorspiel für die Entstehung der ersten selbständigen Slowakei, eine höchst umstrittene Phase in der Geschichte des Landes. Dagegen ist auch für die Slowakei die Erfahrung von 1968 prägend. Doch der slowakische Historiker Juraj Marušiak verwies darauf, daß in der Slowakei die Leistung der Sowjetunion bei
der Befreiung vom Faschismus nie bezweifelt worden sei. Dazu komme eine Debatte über die Gedenkkultur. Während die einen mit einem Gedenktag im August an die Niederschlagung des Prager Frühlings erinnern wollten, bestünden die Gegner dieses Vorschlags auf einem Gedenken Ende September, um an den Verrat des Westens im Münchner Abkommen 1938 zu erinnern. Die hohe slowakische Ablehnung einer Unterstützung der Ukraine könne, so Marušiak, nicht mit der gemeinsamen Geschichte mit Tschechien erklärt werden, wo die Unterstützung der Ukraine ungebrochen hoch sei, sondern gehe eher auf fehlendes Geschichtsbewußtsein zurück. Vor allem erkläre sich die Ablehnung durch die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung. Die Solidarität mit der Ukraine sei auch in der Slowakei anfangs hoch gewesen.
Auch in Ungarn ist die Unterstützung für die Ukraine niedrig. Der ungarische Historiker Gergely Romsics verwies darauf, daß Erinnerungskulturen keine gesellschaftliche Gegebenheit seien, sondern in den vergangenen 20 bis 30 Jahren von politischen Akteuren moduliert, wenn nicht manipuliert werden könnten. Mit Blick auf Ungarn bedeute das eine Unterdrückung dieser Erinnerungskultur durch die von der Regierung präsentierte Erzählung, daß der Krieg in der Ukraine nur Teil eines viel größeren Konflikts sei.
Die Regensburger Politologin Gerlinde Groitl sagte, Lehren aus der Geschichte hätten lange keine Rolle in der Politik gespielt, dagegen Macht und Interessen.
� Johannes-Mathesius-Gesellschaft
Mit Blick auf Deutschland sagte sie, daß „wir zu lange Osteuropa nur mit Rußland verbunden haben“. Aktuell diene der Rückgriff auf die Geschichte in der Debatte beiden Seiten. Während die eine die historische Verantwortung Deutschlands betone und daraus die Hilfe für die Ukraine ableite, beziehe sich die andere auf das „Nie wieder Krieg“, wenn sie Waffenlieferungen an die Ukraine ablehne. Daß Deutschland lange die Signale überhört habe, die aus Mitteleuropa gekommen seien, liege an der selbstbezogenen Betrachtung, in der Frieden kein Thema gewesen sei, weil das Bedrohungsgefühl gefehlt habe. Nur in Polen gebe es einen gesellschaftlichen Konsens für die Unterstützung der Ukraine, wobei dieser Krieg, so die polnische Kulturwissenschaftlerin und Soziologin Magdalena Saryus-Wolska, bereits fast zehn Jahre dauere. Allerdings pflege die extrem rechte Partei Konfederacja die Erinnerung an die Wolhynien-Massaker, die Kollaboration ukrainischer Offiziere mit den Nationalsozialisten oder an den ukrainischen Nationalisten Stepan Banderas.
Das zweite Panel widmete sich der Rolle der Menschenrechte bei Václav Havel und seines Vermächtnisses. Das prominent besetzte Podium – Alena Wagnerová und Milan Uhde sind Altersgenossen von Havel – berichtete mit einer Ausnahme aus erster Hand, wie sich Havels Vorstellung von den Menschenrechten entwickelte. Da gebe es Nuancen, wie Wagnerová mit dem Verweis auf den „optimalen Humanismus“ des jungen Havel feststellte. Oder der Politologe

Pavel Barša, einziger auf dem Podium, der Havel nicht persönlich kannte, der eine überraschend kritische Haltung gegenüber den USA in den wichtigen Essays „Die Macht der Ohnmächtigen“ (1978) und „Anatomie einer Zurückhaltung“ (1985) ausmachte. Letztlich gipfelte das Podium in der Beschreibung von Havels Antipolitik beziehungsweise der auf Menschenrechten basierten Außenpolitik. Hier liegt auch das Vermächtnis Havels, das das gleichberechtigte Nebeneinander kleiner und großer Staaten unterstellt und das Konzept ablehnt, in dem Weltmächte die Erde in politische Einflußsphären aufteilen. Der Professor und Dramaturg Petr Oslzlý präsentierte eine Menschenrechtsumfrage unter Studenten. Während des Symposiums wurden auch die drei jungen Sieger des Essaywettbewerbs „Wie veränderte der russische Krieg gegen die Ukraine meine Welt?“ gekürt. Erstmals gehörte eine Studentin aus der Ukraine dazu. Das letzte Podium warf einen Blick auf den Krieg. Der Wunsch nach Optimismus war groß, auch wenn es dazu wenig Anlaß gab. Die Entwicklung in Rußland, waren sich alle einig, sei völlig unvorhersehbar. Deshalb müsse sich die Ukraine auf sich selbst konzentrieren, meinte die ukrainische Literaturwissenschaftlerin Iryna Zabiiaka. Der slowakische Politologe Grigorij Mesežnikov lieferte noch einmal eine Analyse, wie es zum Krieg habe kommen können. Ziel sei ein kompletter Sieg der Ukraine, waren sich alle einig. „Sieg heißt aber auch eine Bestrafung der Verantwortlichen“, sagte Zabiiaka. Echte Versöhnung sei nur möglich, so Mesežnikov, wenn sich die russische Gesellschaft befreie.
„Wir dürfen uns zu den Russen nicht so verhalten, wie sie zu uns. Wir müssen uns immer ins Gedächtnis rufen, daß die Russen auch Menschen sind“, sagte der Priester Sergiy Matskula. Steffen Neumann
Die Johannes-Mathesius-Gesellschaft, die seit 2002 mit dem Verein Evangelische Sudetendeutsche vereinigt ist (JMGES), traf sich Mitte März in Eger zu ihrer Jahrestagung.
Eger war Mitte des 16. Jahrhunderts evangelisch geworden, im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts setzte jedoch die Gegenreformation ein und 1672 war Eger wieder eine katholische Stadt. Dies blieb so bis zum Eintritt in das Industriezeitalter. Mit dem Bau der Eisenbahn wurde Eger ein Verkehrsknotenpunkt, an dem sich die Bayerischen Bahnlinien von Marktredwitz und Hof sowie die sächsische Bahnlinie aus dem Vogtland mit den böhmischen Linien aus Pilsen und dem Egertal trafen. Immer mehr Eisenbahner aus Oberfranken und Sachsen zogen in ihren Arbeitsort und wollten dort auch den evangelischen
Gottesdienst besuchen. Waldsassen war der nächste Ort mit einer evangelischen Kirche, und Fleißen war der zuständige Ort. Doch beide waren weit entfernt. So schlossen sich 190 evangelischen Männer zusammen und planten den Aufbau einer eigenen Gemeinde. Freilich stellten hier das Toleranzpatent von 1781 und vor allem das Protestantenpatent von 1861 erst die Weichen, daß sich im österreichischen Böhmen eine evangelische Gemeinde entwickeln konnte. So genehmigte der Oberkirchenrat in Wien im November 1862 die Bildung einer evangelischen Gemeinde in Eger, und im September 1863 fanden die Amtseinführung des Pfarrers und die Weihe des Betsaales im Landgerichtsgebäude statt. Man erwarb bald ein Grundstück vor dem oberen Tor und errichtete dort ein Pfarr- und Schulhaus das schon 1865 mit
18/2023
Unterstützung des Gustav-AdolfVereins bezogen werden konnte.
Nun machte man sich auf die Suche nach weiteren Unterstützern, um auch eine Kirche errichten zu können. Besonders im evangelischen Franken, in Sachsen und Preußen fanden sich viele Spender, aber auch Kaiser Franz Joseph I. von Österreich und die Stadt Eger unterstützten den Kirchenbau mit einem hohen Betrag. Gleichzeitig stieg die Seelenzahl stetig weiter. Presbyter Johann Moll, Direktor des Egerer Gaswerks, übernahm nun die Aufgabe als Kassier und gewann den Baumeister Adam Haberzettl von Eger für den Kirchenbau. So konnte im Juni 1869 bereits der Grundstein der Kirche gelegt werden. Die Gemeinde bestand damals aus 320 Seelen in Eger und 40 Seelen in Franzensbad. Den genauen Wortlaut der Urkunde und die Namen der Beteiligten hielt Pfarrer Gustav Fi-
scher in seinem umfangreichen Buch „Das Evangelium in Eger und im Egerlande“ fest. Jetzt traf sich die JMG-ES in Eger, um zu sehen, wie sich die Gemeinde entwickelte. Ernst Franke ist Vorstandsmitglied des Bunds der Deutschen – Landschaft Egerland, der sich 1991 gegründet hatte. Er zeigte die Vereinsräume im Balthasar-Neumann-Haus am Marktplatz mit Bibliothek, Ausstellung und einem Raum der Begegnung. Franke erläuterte die Arbeit des Vereins, der sich hier jeden ersten Samstag im Monat treffe. Das Haus sei auch dienstags und mittwochs für Besucher geöffnet. Pfarrerin Vlasta Groll führte die Gäste in den Kapitelsaal des Pfarrhauses und berichtete von ihrer Arbeit. Hier begrüßte Vize-Vorsitzender Horst Schinzel auch den bisherigen Ascher Pfarrer Pavel Kučera. Groll ist seit dessen Eintritt in den Ruhestand für Asch, Eger und Franzensbad zuständig. Sie schilderte ihre Gemeinde und das Problem mit dem Sonntagsgottesdienst in drei Gemeinden. Ihre Zweisprachigkeit erleichtert ihr die Arbeit wenigstens etwas.
In den anschließenden Vorträgen berichteten JMG-ES-Mitglieder, wo sich Unterlagen der evangelischen Gemeinde aus der Zeit zwischen 1862 und 1945 befinden. Die Kirchenbücher seien auf der Internetseite portafontium
In der ersten Folge der diesjährigen Vortragsreihe über „Böhmische Schlösser“ sprach Stefan Samerski über das Schloß von Kremsier/Kroměříž in Mähren. Nach der Begrüßung durch Sadja Schmitzer, Leiterin der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Akademie, referierte der Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit im Sudetendeutschen Haus über die Geschichte des Erzbistums Olmütz sowie über Kremsiers Schloß und Schloßpark. Die Reihe wird wieder veranstaltet vom SL-Bundesverband, der Sudetendeutschen Heimatpflege, der Ackermann-Gemeinde in der Erzdiözese München und Freising sowie der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste und gefördert von der Sudetendeutschen Stiftung.
Kremsier ist wirklich ein Höhepunkt unter den Schlössern Böhmens und Mährens, obwohl es abseits der Touristenströme liegt“, begann Samerski seine neue Vortragsreise. Das prächtigen Erzbischöfliche Schloß mit seinem großzügigen Park und uralten Weinkeller war Thema des ersten Vortrags der neuen Reihe.
Die Ursprünge der Siedlung
Kremsier reichten in die Zeit des Großmährischen Reiches zurück, als sie an einer Furt über die March gegründet worden sei.
Im Jahr 1110 habe der damalige Olmützer Bischof Johannes II. das kleine Dorf am Westufer der March erworben, die dort durch eine Furt leicht habe überquert werden können.
Den Aufstieg des Schlosses zum erzbischöflichen Sitz schilderte der Referent dann anhand von mehreren bedeutenden hi-
storischen Persönlichkeiten, die Kremsier prägten. Der erste in dieser Reihe war Bischof Bruno von Schaumburg (1205–1281), der um 1266 bei der kleinen Ansiedlung Kremsier, die von König Přemysl Otakar II. zur Stadt erhoben worden war, eine Burg errichten ließ. Dieser Fürstbischof von Olmütz habe ursprünglich aus Schleswig gestammt und sich über Lübeck und Magdeburg südwärts „vorgearbeitet“.
Der Blumengarten als Teil des Schloßparks wurde 1665 bis 1675 unter Bischof Karl II. von Liechtenstein-Kastelkorn (1664–1695) als Spätrenaissance-Garten angelegt. Unten: die großartige Schloßbibliothek.
1245 sei Bruno Bischof von Olmütz geworden und habe in seiner bischöflichen Residenzstadt Kremsier um 1260 die Sankt-MauritiusKirche gegründet, wo er später auch seine letzte Ruhestätte gefunden habe. Zuvor habe Bruno sich auch bei der Kolonisation und Christianisierung Verdienste erworben, so Samerski. Entlang der mährischen Grenze zu Polen und Ungarn seien etwa 200 neue Dörfer und sechs Städte entstanden, die mit Bewohnern des mährischen Binnenlandes und aus Brunos norddeutscher Heimat besiedelt worden seien: „Daher ist die Stadt Braunsberg (Braniewo) in Ostpreußen nach Bruno benannt.“
Während der Hussitischen Kriege sei Kremsier 1423 und 1432 erobert worden. Doch schon kurz darauf habe der nächste bedeutende Bischof, Stanislav Thurso (1497–1540), begonnen, die ursprüngliche Burg zu einem Renaissanceschloß umzuwandeln. „Von der alten Burg blieb nur der rechteckige Turm“, zeigte Samerski anhand einer Abbildung auf der Leinwand. „Das war die Goldene Zeit von Schloß Kremsier.“ So habe Bischof Stanislav den Jagiellonen Vladislav II., König von Böhmen, Ungarn und Kroatien (1456–1516), nach Kremsier eingeladen und stolz den von ihm beträchtlich vergrößerten Schloßgarten erwähnt. Auch andere wichtige Zeitgenossen seien nach Kremsier eingeladen worden.
„Im Dreißigjährigen Krieg wurde Kremsier fast völlig zerstört“, begann Samerski eine dunkle Zeit zu schildern. 1643 habe der schwedische General Torstenson die Stadt erobert, zusammen mit dem Schloß niedergebrannt und später noch zweimal ausgeplündert. Zusätzlich sei Kremsier 1645 durch die Pest entvölkert worden. Von 244 Anwesen seien nur 69 bewohnte Häuser übriggeblieben, und davon manche zum Teil zerstört worden. Von dieser Katastrophe habe sich Kremsier lange nicht erholt.
„Diese trostlosen Umstände änderten sich durch die tatkräf-

tige Persönlichkeit des neuen Bischofs Karl II von LiechtensteinKastelkorn.“ Liechtenstein-Kastelkorn (1664–1695) habe die Stadt wieder aufgebaut, die Bischöfliche Residenz errichtet und
ein Piaristengymnasium gegründet. Unter ihm sei das Schloß in ein Barockschloß verwandelt und eine bedeutende Gemäldegalerie und die großartige Biliothek begründet worden, die schon damals öffentlichen Zugang erlaubt habe. „Seither war Kremsier Mittelpunkt des Fürstbistums Olmütz und Mährens.“




Wichtig seien auch das umfassende Musikarchiv und die Erweiterung des Gartens zu einem französischen Park gewesen. „Kremsier war jetzt eine mit allen Schikanen ausgestattete Residenz.“ Liechtenstein-Kastelkorn habe 1748 Erzherzogin Maria Theresia von Österreich dorthin eingeladen, so wie ihr Sohn Joseph II. 1770 Friedrich den Großen von Preußen.
„1778 wurde Anton Theodor von Colloredo-Waldsee-Mels
� Meßwein von Schloß Kremsier
(1729–1811) erster Erzbischof von Olmütz“, führte Samerski seinen nächsten Protagonisten ein. Der spätere Kardinalpriester habe den Schloßpark um einen englischen Landschaftsgarten mit chinesischen Pagoden, türkischen Kiosken und tropischen Pflanzen erweitert.

Eine nächste Sternstunde habe das Schloß dann 1848 erlebt. Die Habsburger hätten aus dem revolutionären Wien fliehen müssen; Franz Joseph II. sei in Olmütz zum Kaiser ausgerufen worden. Nach der blutigen Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstandes sei der konstituierende Reichstag nach Kremsier verlegt und am 22. November im Erzbischöflichen Schloß eröffnet worden, und zwar im gigantischen Speisesaal des Schloßes, der 600 Personen gefaßt habe.
Aber: „Aus der Verfassung ist ja damals doch nichts geworden.“ Nach Kaiser Franz Joseph II. sei 1885 ein weiterer Kaiser, nämlich der russische Zar Alexander III., nach Kremsier gekommen, um Rußland näher an die k. u. k. Monarchie zu bringen, aber auch daraus sei ja nicht viel geworden. Mit seinem Kommentar „Historische Lagen neigen dazu, sich zu wiederholen!“ schlug Samerski den Bogen zur Gegenwart mit Vladimir Putins Überfall auf die Ukraine.
Stefan Samerski berichtete bei seinem Vortrag auch über die uralten Weinkeller unter dem Schloß Kremsier.
Die Keller sind Bestandteil des Erzbischofsschlosses in Kremsier und liegen in einer Tiefe von sechseinhalb Metern. Sie nehmen eine Fläche von 1030 Quadratmetern ein und werden in Oberen und Unteren Keller geteilt. Gegründete hatte sie schon 1266 Bischof Bruno von Schaumburg. Durch Beschluß des Königs Karl IV. aus dem Jahre 1345 erhielten sie das päpstliche Privileg, Meßwein herzustellen.
In den Kellern liegt die Temperatur ganzjährig zwischen neun und
elf Grad Celsius. Damit bieten sie die geeignete Umgebung für natürliche, außerordentliche Meßweine. Erlaubt waren dafür ausschließlich Naturwein, bis 1478 nur Rotwein und strengkontrollierte Herstellung von vereidigten Winzern. Die Weinherstellung dauerte an der Schwelle des dritten Jahrtausends schon 735 Jahre an. In den Kellern sind immer noch älteste Mauerreste der ersten, gotischen Burg aus dem 13. Jahrhundert erhalten, und die Wände sind von einer Edelschimmelschicht bedeckt. Der edle Wein reift in historischen Holzfässern Größen. Das größte Faß nimmt 19 100 Liter auf, das älteste Faß stammt aus dem Jahre 1805.

Mit einer „Familienüberlieferung“ kam eine seit 1920 nicht mehr gespielte Zither, der schon einige Saiten fehlten, ins Stift Herzogenburg bei Sankt Pölten in Niederösterreich, um in der Sendung „Kunst & Krempel“ des Bayerischen Rundfunks begutachtet zu werden.
Hier berichtete der Besitzer, seine Großmutter habe zuletzt auf dieser Zither gespielt. Die Großmutter sei befreundet gewesen mit einer Hausdame der Geliebten Kaiser Franz Josephs, der Schauspielerin Katharina Schratt. Der Schratt habe seine Großmutter dann auch einmal auf der Zither vorspielen dürfen. Die Kaiserzeit wehte also durch diese Begutachtung. Und diese zeitliche Verortung bekam noch weitere Nahrung durch den Signaturzettel im Innern der Zither. Darauf stand „K. Schelle, In- und Ausländer Musik-Instrumente, Wien“. Hierbei handele es sich nach Aussage des Experten, Josef Focht vom Museum für Musikinstrumente in Leipzig, nicht um den Hersteller, sondern um den Händler, Karl Eduard Schelle (1814–1882), der auch ein bekannter Musikjournalist gewesen sei. Und die Bezeichnung „Inländer“ in Bezug auf die Herkunft der Instrumente habe wohl vor allem alle Länder der Habsburgermonarchie gemeint.

� Kunst & Krempel: Instrument aus dem Instrumentenbauer zentrum Schönbach bei Eger
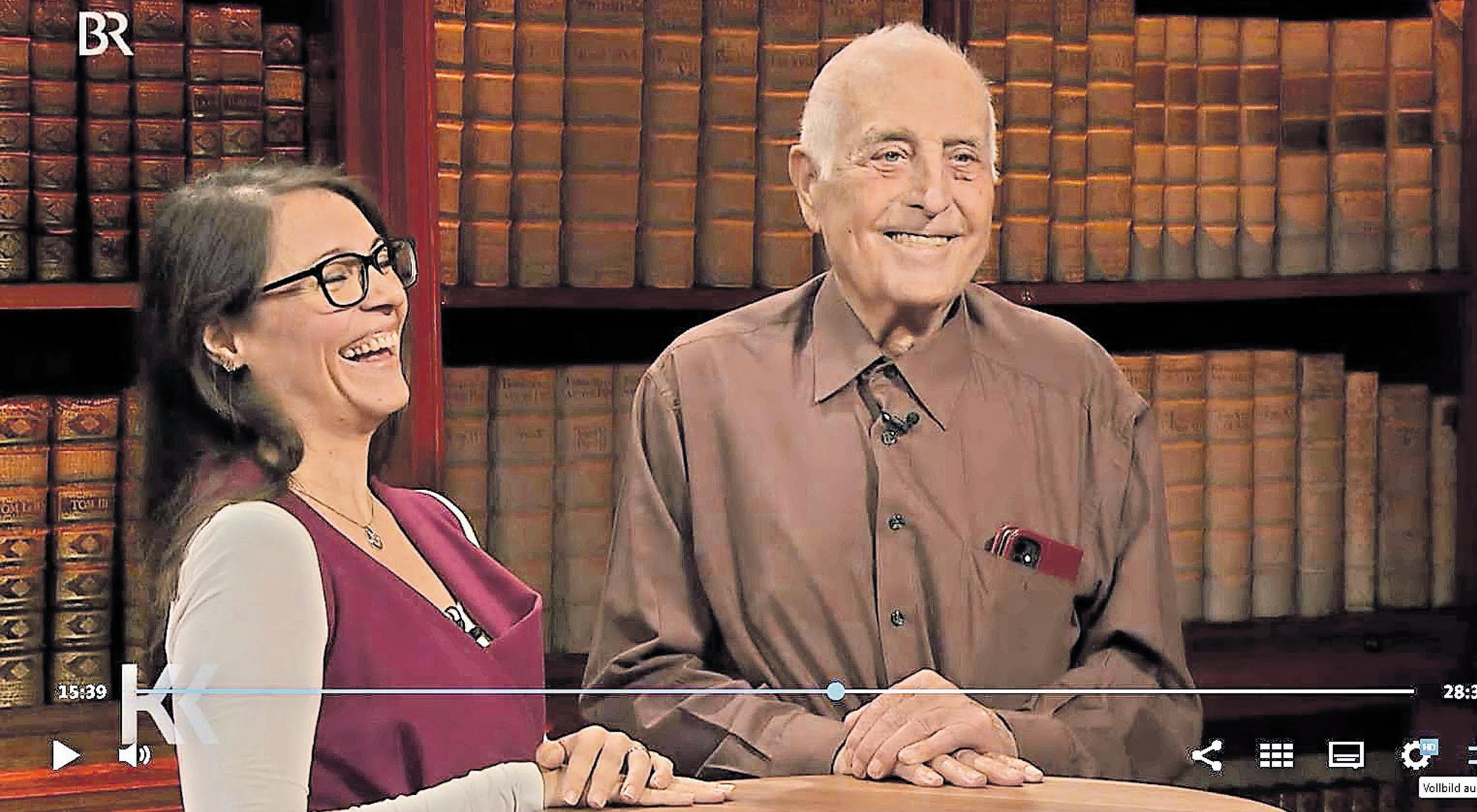
Denn diese Konzertzither nach Salzburger Modell komme unzweifelhaft aus Schönbach bei Eger. Das würden die Bauart sowie das Zubehör der Ausstattung verraten. Markant seien hierbei die Stimmechanik sowie die Anzahl der Stimmwirbel. Man habe hier fünf Griffbrettsaiten und 29 Freisaiten, gespannt auf ebenso viele Klavierwirbel. Alles verweise auf beispielsweise die von der Firma Breuer in Schönbach bei Eger massenhaft hergestellten Saiteninstrumente.

Der andere Experte, Martin Kares, Musikwissenschaftler aus Karlsruhe, erfreute sich an der soliden, ja beinahe höfischen Machart mit schönen Einlegearbeiten auf der Schauseite. Decke und Boden seien aus Palisanderholz gefertigt und wohl zweilagig ausgeführt, wes-

halb sie über die Jahre keine Risse aufwiesen. Die Zarge bestehe aus Edelholz. Es handele sich
aber nicht nur um ein am Hofe gespieltes Instrument, sondern auch um eine in bürgerlichen
Haushalten verbreitete Zither.
„Sie war wohl das Klavier des kleinen Mannes!“ Man habe da-
mit gut Melodien spielen und Gesang begleiten können. Ein Klavier wäre dafür natürlich erheblich teurer gewesen.
Den heutigen Wert taxierte der Experte für die solide Zither – die man aber sicher wieder neu bespannen sollte, um sie auch wieder spielfähig zu machen – als um die 500 Euro. Dieser Schätzwert habe jedoch durch die persönliche Geschichte aus dem Umfeld des Kaiserhauses in Wien noch etwas Luft nach oben.
So war man Anfang März bei „Kunst & Krempel“ in der Nähe Wiens, ganz unerwartet – auch für die österreichischen Besitzer der Zither – plötzlich nahe dem Erzgebirgskamm in Böhmen gelandet, das zu Kaiserzeiten ja bekanntlich noch bei Öst‘reich war. Ulrich Miksch
Die Heimatpflege der Sudetendeutschen hat wieder zum Offenen Frühlingssingen eingeladen. Unter dem Motto „Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün“ bot Singleiter Erich Sepp im Sudetendeutschen Haus ein Liedprogramm.
In Vertretung von Heimatpflegerin Christina Meinusch begrüßte deren Mitarbeiterin Sadja Schmitzer viele Gäste im AdalbertStifterSaal.
Dieses Offene Singen findet
gleich im großen AdalbertStifter-Saal und mit vielen Teilnehmern statt“, freute sich Sadja Schmitzer, die vertretungsweise die Gäste begrüßte. Und mit „Komm, lieber Mai“, dessen Melodie überraschenderweise von Wolfgang Amadeus Mozart stammt und das ursprünglich „Sehnsucht nach dem Frühling“ hieß, ging es gleich los. Den bekannten Text hatte einst der Lübecker Oberbürgermeister
Christian Adoph Overbeck dazu gedichtet.

Erich Sepp hatte wieder eine ganze Reihe Lieder aus Bayern, Böhmen und Sudetenschlesien ausgewählt, die alle gemeinsam singend einübten. Sepp lieferte wie immer viele interessante Fakten über die Lieder. Sein Wissen stamme aus vielen Quellen, so
Sepp, etwa aus dem Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg und dem dort publizierten Liederlexikon.
Als ehemaliger Leiter der Volksmusikabteilung des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege verfügt Sepp über ein immenses Wissen über Volksliedkultur, Musikgeschichte und Mundarten. Er kam 1944 in Landsberg am Lech zur Welt und ist mit Ingrid Sepp, einer Tesche-
nerin aus Sudetenschlesien, verheiratet. Wie immer unterstützte sie ihn beim Offenen Singen, verteilte seine gut gestalteten Notenblätter mit Textstrophen und Erläuterungen über Herkunft und Erscheinungsweise. Die Singblätter gab es jedoch immer recht spät, nach reichlicher Übung „im Trockenen“.
Denn Singleiter Erich Sepp geht vor allem immer pädagogisch und nach psychologischen
Erkenntnissen vor. Zunächst lernen alle die erste Strophe eines Liedes rein nach Gehör und aus der Erinnerung, oft auch gleich mehrstimmig. Sepp deutet nur die Tonhöhen mit der Hand an oder begleitet mit dem Akkordeon. Erst wenn eine Strophe und der Refrain auswendig gut laufen, gibt es das komplette Notenblatt mit allen Strophen.
Von diesen Liedblättern hat Sepp inzwischen über 300 gestaltet. Sie würden ein veritables Liederbuch abgegen, um so mehr, als Sepp zu jedem Lied die Herkunfts- und Überlieferungsgeschichte ergänzt, was Text und Melodie betrifft.
So war beim Lied „Der Frühling hat sich eingestellt“ auf dem Liedblatt angemerkt, daß der Text von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben stammt, die Weise – also die Melodie – von Johann Abraham Peter Schulz. Die Weise von „Der
Frühling ist die schönste Zeit“ mit Text von Annette von Droste-Hülshoff schuf Erich Sepp selbst. Wiederkehrende Themen in allen Frühlingsliedern seien das Erwachen der Natur, Blüten, Vögel und eben Liebe. „Immer wieder dasselbe im Volkslied im Frühling“, schmunzelte Sepp.
Mit „Jetzt kommt die Zeit, daß ich wandern muß“ übten alle ein Lied aus Nordmähren, und
zwar aus der Sammlung „Blüh nur, blüh mein Sommerkorn“. Der Schöpfer dieser Lieder, Walther Hensel alias Julius Janiczek aus Mährisch Trübau, habe im mährischen Finkenstein 1923 die allererste Singwoche veranstaltet, wußte Erich Sepp. Noch weitere Lieder wurden beim Singen wieder- oder neuentdeckt
Sehnsucht nach dem Frühling: „Komm, lieber Mai“Die Zither als „Klavier des kleinen Mannes“. Sadja Schmitzer, Mitarbeiterin der Sudetendeutschen Heimatpflege, begrüßt Dr. Erich Sepp. Bild: Sudetendeutsche Heimatpflege
� Fortsetzung von Seite 6
einzusehen. Weitere Unterlagen befänden sich im Archiv des Oberkirchenrats in Wien, im Landeskirchlichen Archiv Bayerns in Nürnberg, ebenso in Dresden und im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Das Archiv der JMG sei im Sudetendeutschen Archiv im Hauptstaatsarchiv München untergebracht und mit einem Findbuch erschlossen. Weiterhin seien im Stadtarchiv Eger die Egerer Zeitung und viele Unterlagen einzusehen, einige davon seien online gestellt.
Die Stadtbesichtigung führte zum neuen Rathaus mit seinem prachtvollen Treppenhaus und zum gotischen Schirndingerhaus. In der Nikolauskirche wurde das marmorne Epitaph der Edelfrau Barbara von Zedtwitz bewundert. Sie war eine Tochter von Hans Kraft von Vestenberg, eines hohen Beamten im angrenzenden Herzogtum PfalzNeuburg, und Gattin von Christoph Heinrich von Zedtwitz, eines Bruders des Egerer Burggrafen. Sie starb 1580 bei der Geburt ihres vierten Kindes. Die Kirche konnte die vielen Trauergäste nicht fassen, als der evangelische Pfarrer die Leichenpredigt hielt. Im Inneren der Nikolauskirche befindet sich im rückwärtigen Kirchenschiff ein Metallsarg mit der Aufschrift „Anno 1625 den 15. Septembris Ist die Hoch- und Wohlgeborene S S Sydonea Schlick, Gräfin zu Paßan und Weißkirchen, eine geborene Collona, freiin zu Felß und Schenkkenburgk in Gott entschlaffen, dero Seelen der Allmechtige wol genedig sein und am Jüngsten Tag neben allen Christen zu(m) ewig(en) lebe(n) eine frolige Aufferstehu(n)g geben wolle“.
Stadtmuseums beherbergt. In der Eingangshalle steht der mit geschliffenen Glasplatten verzierte Leichenwagen, der in der Zeit vor der Motorisierung verwendet wurde. Die Wände im Innenhof zieren zahlreiche Epitaphe und Grabsteine. Unter den Objekten aus der Zeit, als Eger Reichsstadt und bedeutendes Handelszentrum war, sticht das Altartuch oder Antependium der Burgkapelle hervor. Es wurde im 13. Jahrhundert von Nonnen des Egerer Klosters gestickt und zeigt Heilige in Nischen.
� SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach/Mittelfranken
Der Stellvertretende Bundesvorsitzende der Ackermann-Gemeinde erhielt ein neues Ehrenamt.
Skizze der zu erbauenden evangelischen Kirche in Eger.

Umfangreich ist die Sammlung von Zunftkannen und -truhen, die auf die Bedeutung des Handwerks schließen läßt. In mehreren Räumen wird zu Ehren von Albrecht von Wallenstein an dessen Leben und seinen gewaltsamen Tod in diesem Haus in Eger erinnert. Friedrich von Schiller weilte hier monatelang, um für seine Dramen-Trilogie „Wallenstein“ zu recherchieren. Dichterkollege Johann Wolfgang von Goethe traf sich hier mit dem Scharfrichter Carl Hus, um gemeinsam um den Kammerbühl zu wandern und sich über Art und Entstehung des Gesteins auszutauschen. Ein Schwerpunkt sind die Egerer Reliefintarsien. Daneben ist eine Sammlung von historischen Gewehren, Fahrrädern und volkskundlichen Textilien und Gebrauchsstücken zu bewundern.
Einen eigenen Raum nimmt der Egerer Kachelofen von Willibald Russ ein, der viele Szenen des Lebens der Menschen in ihrer Tracht zeigt.
Ende April fand die Hauptversammlung der mittelfränkischen SL-Kreisgruppe RothSchwabach im Rother Gasthof Waldblick statt.

Da Kreisobmann Dieter Heller zwar gekommen war, aber wegen einer Erkältung nicht sprechen konnte, begrüßte sein Stellvertreter Wilhelm Rubick die Landsleute und Bürgermeister Andreas Buckreus. Dieser lobte in seinem Grußwort den vergangenes Jahr gefeierten 70. Geburtstag der SL-Ortsgruppe Roth und wünschte für die Zukunft alles Gute. Anschließend gedachte Hannelore Heller der Toten, zu denen der im Dezember verstorbene Walter Meissner, Obmann der Ortsgruppe Haag, gehörte.
Die Kreisgruppe habe die fünf aktiven Ortsgruppen Allersberg, Eckersmühlen, Junge Generation, Roth, Thalmässing und zehn Direktmitglieder aus den aufgelösten Ortsgruppen Spalt, Schwabach und Wendelstein, informierte der Kreisobmann in seinem Rechenschaftsbericht, den Hannelore Heller vorlas. Die Mitglieder der Ortsgruppe Hil-
poltstein hätten sich der Ortsgruppe Thalmässing angeschlossen, ein Mitglied sei ausgetreten. Nach Meissners Tod habe die Ortsgruppe Haag noch drei Mitglieder gehabt und sei aufgelöst worden. Die Kreisgruppe habe am 1. Januar 2022 168 Mitglieder gehabt.
Dann listete Heller die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr auf und dankte den Mitarbeitern im Kreisvorstand, den Ortsobmännern und allen sonstigen Amtswaltern in den Ortsgruppen und allen Landsleuten für ihre Treue zur Volksgruppe.
Hannelore Heller informierte über den Stand der Vereinsfinanzen. Eva Pflughaupt und Manfred Baumgartl prüften die Kasse und befanden sie für in Ordnung. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.
Kurzberichte der Ortsobmänner spiegelten die unterschiedliche Mitgliederstruktur: je mehr Mitglieder, desto mehr Veranstaltungen.
Der bisherige Vorstand stellte sich zur Wiederwahl und wurde bestätigt: Obmann ist Dieter Heller, sein Vize Wilhelm Rubick, Vermögensverwalte-
� 66. Fritz-Jeßler-Ostersingwoche des SSBW
Seit 1958 fallen alljährlich in der Karwoche begeisterte Chorsänger, Volkstänzer und Instrumentalisten am Heiligenhof ein – die Ostersingwoche findet wieder statt! So auch in diesem Jahr.
rin ist Hannelore Heller, Schriftführer Georg Streb, Kassenprüfer sind Manfred Baumgartl und Eva Pflughaupt, Beisitzern Gerd Kraidl, Hans-Dieter Hloch und Horst Kunz.
Für die Bezirksversammlung am 16. Mai und für die Landesversammlung am 21. Juli wurden Dieter Heller und Wilhelm Rubick als Delegierte gewählt. Ersatzdelegierte sind Hannelore Heller, Hans-Dieter Hloch und Horst Kunz.
Der Landesvorstand der Landesgruppe Bayern unternahm
Mitte April einen Ausflug nach Südtirol. Anfang Mai geht es mit Volker Bauer MdL, der den mittelfränkischen Stimmkreis Roth im Landtag vertritt, nach Aussig und Prag.
Zur Maiandacht am 8. Mai am Vogelherd wird auch Sylvia Stierstorfer MdL, die Beauftragte für Aussiedler- und Vertriebenenfragen der Bayerischen Staatsregierung, erwartet. Für November ist eine Vortragsveranstaltung im Rahmen des Rother Erzählcafés mit Ausstellung „50 Jahre Kreisgruppe Roth-Schwabach“ in den Ratsstuben der Stadt Roth geplant.
Martin Panten (55), Erster Bürgermeister der niederbayerischen Gemeinde Parkstetten und langjähriger Stellvertretender Bundesvorsitzender der Akkermann-Gemeinde, ist als einer der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Organisationen Deutschlands (AGKOD) als neues Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt worden. Schon an der kommenden Vollversammlung am 5. und 6. Mai in München wird Panten teilnehmen.


Das ZdK ist das höchste Laiengremium in der katholischen Kirche Deutschlands und vertritt die Interessen und Anliegen der katholischen Christinnen und Christen in gesellschaftlichen, staatlichen und kirchlichen Fragen gegenüber der Deutschen Bischofskonferenz und der Öffentlichkeit.
Markus BauerDie Friedenskirche in Eger 2021.
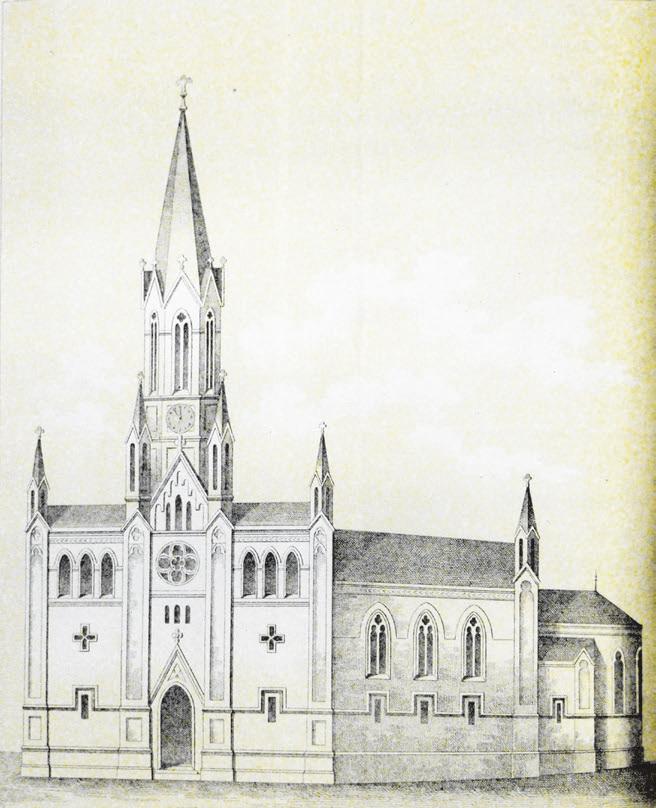
Der Sarg war in der barocken Krypta unter dem Hauptschiff. Er wurde bei der Kirchenrenovierung geöffnet und das Skelett mit Kleidung und Gebetbuch in den Händen anthropologisch untersucht. Es handelt sich um die um 1550 geborene Tochter von Leonhard Colonna, Freiherr von Fels und Katharina Kraiger von Kraik. Sie heiratete Georg Ernst Schlick, der auch dem lutherischen Glauben angehörte, und wurde so zur Gräfin von Passaun in Norditalien und Weißkirchen in der Slowakei.
Ihre Kinder Salomena, Friedrich und Heinrich erreichten das Erwachsenenalter. Heinrich Schlick gehörte zu den bedeutenden Feldherrn des Dreißigjährigen Krieges. Heinrichs Truppen brachten einen tödlichen Krankheitskeim in die Gegend. Die Mutter steckte sich an und starb. Sie wurde von ihrem Schloß in Plan nach Eger gebracht und in der Krypta des Presbyteriums beigesetzt. Ihr Sarg ist eine große Besonderheit, da bemalte Särge aus der Renaissancezeit sehr selten erhalten sind.
Dann ging es zum Wohnhaus des ehemaligen protestantischen
Egerer Bürgermeisters Adam Pachelbel, das die Sammlungen des
Ein Stadtbummel führte über den Marktplatz, dessen Gebäude allesamt sehr schön renoviert sind. In den letzten Kriegstagen 1945 wurde der Turm der Nikolauskirche in Brand geschossen, aber sonst blieb die Altstadt erhalten. Allerdings wurde das Bahnhofsviertel dem Erdboden gleich gemacht, wobei über 1000 Todesopfer zu beklagen waren. Die Tagung klang am Sonntag nach dem Gottesdienst bei einem Endgespräch beim Kirchenkaffee aus. Pfarrerin Vlasta Groll hielt den zweisprachigen Gottesdienst im Betsaal des Pfarrhauses, da die Beheizung der Kirche für die Gemeinde zu teuer ist. Auch die Lieder wurden zweisprachig gesungen. Die Predigt über die Versuchung Jesu erfolgte in tschechischer Sprache. Die Deutschen Teilnehmer erhielten den Predigttext in Schriftform zum Mitlesen. Den schlichten Altar des Bethauses ziert der große Kelch aus Holz, und an den Wänden sind Bilder des Prager Künstlers Radda Liba zu sehen, rechts der Jordan und links Jerusalem. Für den erkrankten Ersten
Vorsitzenden Karlheinz Eichler bedankte sich Horst Schinzel bei Pfarrerin Groll und der Gemeinde mit dem Buch „Die 17 Predigten über Martin Luther“ von Johannes Mathesius und wünschte allen Gottes Segen. Helmut Süß
Den Chorgesang leitete Astrid Jeßler-Wernz, die Tochter des Singwochengründers Fritz Jeßler (1924–2015), dessen enormes Werk genügend Material für weitere 66 Singwochen aufweist. Das Orchester unter Dominik Richter hatte einen volksmusikalischen Schwerpunkt. Zum Ausgleich gab es Volkstanzen mit Martina Blankenstein. Damit auch Familien teilnehmen konnten, leitete Carina Jochheim die Kindergruppe.
Als ob das noch nicht genug wäre, gab es noch ein kulturelles Rahmenprogramm, dieses Jahr über das Verhältnis von Natur und Kultur im Deutschen
Osten: Ein Film entführte uns in die „Schatten der Karpaten“. Gisela Muschiol brachte uns, unterstützt von Bernhard Gold-
hammer, Joseph von Eichendorff im Rahmen einer Lesung näher. Antonia Goldhammer las Naturdarstellungen aus Werken böhmischer Literaten, insbesondere Adalbert Stifter und Marie von Ebner-Eschenbach. Und schließlich entführte uns Gustav Binder im Rahmen eines Busausflugs mit kleiner, aber anspruchsvoller Wanderung in die Rhön.
Kein Wunder, wenn manch ein Teilnehmer morgens Probleme hatte, aus dem Bett zu kommen. Doch dafür gab es eine weitere Institution der Singwoche: das allmorgendliche Wekken durch Gesangs- oder Musikgruppen, vor dem dieses Jahr auch die anderen Gruppen im Haus durch einen Zettel mit dem Hinweis „Vorsicht Wecken!“ gewarnt oder auch motiviert wurden.
Das gleichzeitig im Haus anwesende Schalmeienorchester ließ es sich nicht nehmen, sich auch am Wecken zu beteiligen. Und so war der Heiligenhof in der Karwoche ein Haus voller Musik – wie immer seit 1958.
Die katholische Kirchengemeinde Salvator in Stuttgart-Giebel hatte nach der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie erstmals wieder zum Fest der Nationen ins Gemeindehaus eingeladen. Dazu präsentierten zahlreiche Nationen und Landsmannschaften der Kirchengemeinde im Rahmen eines Brunchs Kulinarisches aus ihren Ländern und Regionen. So auch die baden-württembergische SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf. Deren Obfrau Waltraud Illner, Alfred Neugebauer und Gerlinde Rankl offerierten bei diesem internationalen Fest neben Karlsbader Oblaten auch wieder den köstlichen Original Karlsbader Becherbitter.
Text und Bild: Helmut Heisig
Vermögensverwalter Markus Harzer, Kreisobmann Roland Dworschak und sein Stellvertreter Dr. Bernd Giesemann leiteten die Jahreshauptversammlung der hessischen SL-Altkreisgruppe Schlüchtern Mitte April im dortigen Hotel Akzent. Zu dieser begrüßte Dworschak zahlreiche Mitglieder. Nach der Totenehrung folgten die Jahresberichte verschiedener Mitglieder des 2022 neugewählten Vorstandes. Leider war von den zu ehrenden Mitgliedern keines persönlich anwesend, sie erhalten ihre Urkunden zu einem anderen Zeitpunkt. Krankheitsbedingt mußte auf die geplante musikalische Unterhaltung der Egerländer Buben ebenfalls verzichtet werden, was sehr bedauert wurde. Kreisobmann Roland Dworschak lud in seinem Schlußwort noch zu den bevorstehenden Veranstaltungen der Kreisgruppe ein. Bei Kaffee und Kuchen fanden anschließend noch rege Unterhaltungen statt. Text und Bild: Antje Hartelt


Kürzliche Nachrichten über Preiserhöhungen für Bier in der Tschechischen Republik in der Sudetendeutschen Zeitung erinnern Kurt Schmidt, den studierten Gymnasiallehrer und vor knapp 95 Jahren im nordmährischen Jägerndorf geborenen langjährigen Jägerndorfer Heimatkreisbetreuer, an mehr oder weniger ernste Ereignisse aus den Zeiten des Kalten Krieges in den siebziger und achtziger Jahren.


Mitte April fand in Pilsen das bayerisch-böhmische Festival Treffpunkt im Depo 2015 in Pilsen statt. Zu den Mitwirkenden gehörten die „Målas“ und das Duo „Målaboum“ aus Netschetin.

Im Jahr 2015, als Pilsen Kulturhauptstadt Europas war, entstand die kreative Zone DEPO 2015. Das ehe-
malige Depot der Pilsener Verkehrsbetriebe bietet Raum für Veranstaltungen sowie ein Café, einen Markt mit einzigartigen Geschäften, Ateliers und sogar einen Garten. Eine der größten Veranstaltungen ist seit neun Jahren das böhmisch-bayerische Festival Treffpunkt, das heuer Teil der Feierlichkeiten zum 30jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Pilsen und Regensburg war. Die einzelnen Darbietungen fanden nicht nur in der großen, mit einem bayerischen Himmel geschmückten Halle statt, sondern praktisch auf dem gesamten Gelände der Kultur- und Kreativzone. Auf dem Festival traten Bands verschiedener Genres auf. Die beliebtesten Bands für Einheimische und Besucher aus Deutschland waren „d‘ Hundskrippln“ und „Erwin und die Heckflossen“. Beide Bands treten regelmäßig auf dem Münchener Oktoberfest auf. Beim Treffpunkt 2023 lief auch eine Ausstellung über 30 Jahre Partnerschaft zwischen Pilsen und Regensburg. Es wurden auch einige Workshops angeboten wie TREFF einfach PUNK. Im Innenhof des Geländes gab es Karussells, einen Autoscooter, eine Hüpfburg oder einen Schießstand. Leider spielte das Wetter nicht mit, und deswegen blieb es im Freien ein wenig ruhiger.
Dafür war die riesige Bushalle gerammelt voll. Unter dem bayerischen Himmel konnte der Bierliebhaber den Himmel auf Erden finden: sechs Euro für eine Maß Erdinger Weißbier! Da wundert man sich nicht, daß so viele Bayern zum Treffpunkt nach Pilsen kommen. Zu Bier und bayerischen Spezialitäten wurde aber auch reichlich für das geistige Wohl ge-

sorgt. Das bunte Programm auf mehreren Bühnen ließ keinen Wunsch offen. Am Freitag kam die Festzelt-Party-Band „Bayerwald Sterne“ aus Lam, Höhepunkt war die Rock‘n‘BlowBand „d‘ Hundskrippln“ aus Steinsdorf im Altmühltal. Den Anfang am Samstag machte im großen Saal das „Junior Orchestra“ der Grundmusikschule Friedrich Smetana in Pilsen mit einem Programm von Blasmusik bis Filmmusik. Im Café stellte das Duo „Målaboum“ in einem einstündigen Programm Egerländer Volkslieder vor. Dieses aus Plachtin bei Netschetin stammende Duo besteht aus Richard Šulko, Vorsitzender des Bundes der Deutschen in Böhmen, und seinem Sohn Vojtěch. Tata Richard singt, Sohn Vojtěch spielt Zither. Neben Volksliedern aus dem Egerland boten sie Anton-Günther-Lieder sowie ein paar kurze Gedichte aus Måla Richards letztem Buch „Målaboum: daham!“
Nach dem Auftritt der „Målaboum“ folgte die Tanzprobe der inzwischen komplett angereisten Egerländer Volkstanzgruppe „Die Målas“ aus Plachtin vom Bund der Deutschen in Böhmen. Dann führte der Weg der Tanzgruppe schon in den großen Saal, wo gerade die Prager Band „Brass Avenue“ spielte. In der Pause der Pilsener Blaskapelle „Zatrub Band“ kam die Volkstanzgruppe zum Einsatz. Sie präsentierte den 400 Zuschauern die Volkstänze Howansook, Kikeriky, Zigeunerpolka, Schustertanz, Böhmerwaldlandler und Kreuzpolka. Für die Kinder, vor allem für die fünfjährige Karoline, war das ein großes Erlebnis, in so einer Kulisse auftreten zu können. Aber auch die Erwachsenen begossen anschließend mit ihren Freunden, die zu den Auftritten der „Målas“ gekommen waren, den Erfolg mit Weißbier. Einige nahmen dann auch am weiteren Programm teil, das die Pilsener Swing-Jazz-Band „TutenSwing“, die aus Pilsenern und Pragern bestehende Partyband „Show Time“ und die Regensburger Band „Erwin und die Heckflossen“ bestritten.
Der Måla Richard mußte ein wenig schmunzeln, als ein junger, magerer Kellner ihm zwei Maß Weißbier brachte und sich beschwerte: „Ich bin fix und fertig.“ Ihm fielen sofort die bayerischen Moidla im Festzelt am Oktoberfest ein, die schon mal gut und gerne 18 Maßkrüge auf einmal durch die Gegend schleppen. Das entspricht stolzen 41,4 Kilogramm. Und sie tun das immer mit einem Lächeln! Da muß Pilsen bis zum nächsten Treffpunkt noch einiges nachholen. do
Um die deutsch-tschechischen Fragen näher zu untersuchen, entschieden sich viele meiner Abiturienten, nach entsprechender theoretischer Vorbereitung für die praktische Erfahrung über eine Busfahrt. Hierfür war nicht nur das wissenschaftliche Interesse, sondern auch das böhmische Bier zielführend, vor allem das bekannte Pilsener Bier. Zudem lagen die Bierpreise in Bayern und Böhmen schon damals unter jenen in Norddeutschland. Demnach war es nicht immer leicht, die durstigen Kehlen von angehenden Abiturienten im pädagogisch damals gebotenen Rahmen zu halten. Auch der damals geltende Zwangskurs von vier Kronen für eine DM hielt die von Schrecken und Vertreibung unbelasteten Söhne des damaligen Wirtschaftswunders nicht vom verbotenen Umtausch auf privater Basis ab – trotz drohender Strafen der fremden Staatsorgane. Vielmehr war ein neuer Wettbewerb geboren: Wer tauscht am günstigsten?
Jedenfalls kamen alle in den erwarteten Biergenuß. Tauschpartner fanden sich meist sehr schnell, ohne daß es je zu Zugriffen der Staatspolizei gekommen wäre.
Außerdem begann sich die Einstellung mancher Bürger gegenüber Westdeutschen zu ändern. Nach damaligen Meldungen, wonach sich auch DDRTruppen 1968 an der Besetzung der Tschechoslowakei beteiligt hatten, wurden wir plötzlich den „guten Deutschen“ zugeordnet. Aber auch die tschechischen Tauschpartner nutzten die Gelegenheit, da sie sich jetzt, angesichts der anhaltenden Mangelwirtschaft, in Tuzex-Läden mit der eingetauschten DM sonst nicht erhältliche Waren beschaffen konnten.
In Einzelfällen konnte ich die Veränderung bereits an der Grenze erfahren. So verriet mir ein tschechischer Zöllner im Gespräch vor der Kontrolle, daß im Grenzrestaurant eine seltene Sendung angekommen sei, nämlich das geschätzte Pilsener Bier. Kurz darauf saßen wir, Schüler, Elternvertreter und natürlich der Hinweisgeber, dort zusammen.
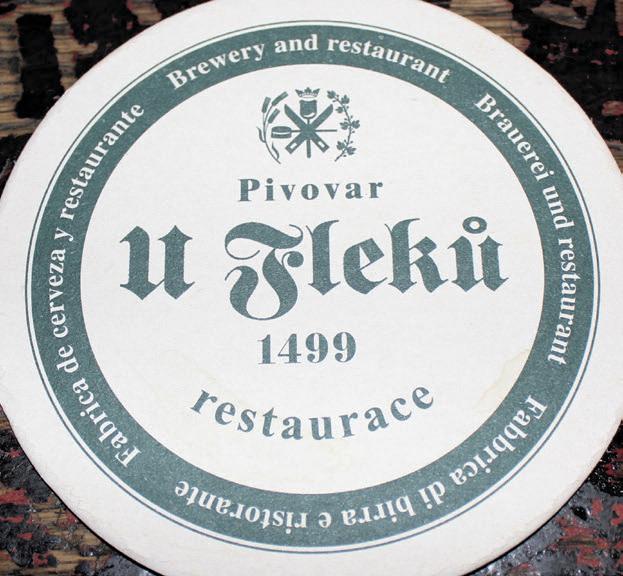

Letzterer hatte zuvor gebeten, den Bus auf einem bestimmten Parkplatz abzustellen, der nach seinen Aussagen nicht von der sowjetischen Oberaufsicht einsehbar sei. Als ich ihm vor der Weiterfahrt noch eine Schachtel Astor-Filter zusteckte, konnten wir ohne weitere Kontrolle unsere Ziele in Prag, Lidice, Theresienstadt und im Sudetenland ansteuern. Diese Episode ließ aber be reits gewisse unerwartete Veränderungen erkennen. Eine eher skurrile „Prager Spitze“ sei von einer dieser Studienfahrten herausgegriffen. Nach Ankunft im Prager Hotel erfuhren wir von einem Schachwettbewerb zwischen Bamberg und Prag, den die Bamberger gewonnen hatten. Daraufhin sollte ein weiterer Wettbewerb im Biertrinken im beliebten Bierlokal U Fleků den „Gleichstand“ wieder herstellen. Meine findigen jungen Leute ließen sich nach Absprache mit mir die Teilnahme nicht entgehen; das nötige Kleingeld hatten sie sich längst besorgt. Auch beim Genuß des dunklen Bieres waren die Bamberger zur Freude meiner angehenden Abiturienten nicht zu schlagen.
Solche zu Hause weitergereichten Erlebnisse hoben natürlich bei nachfolgenden Jahrgängen die Bereitschaft, sich mit diesen damals noch als exotisch empfundenen Ost-Themen zu befassen. Die Busreisen in die ČSSR setzten sich fort – eine Entwicklung, die ich als Sudetendeutscher natürlich begrüßte. Auf diese Weise konnte ich unter anderem auch das von bundesdeutschen Medien vernachlässigte Problem der Vertreibung vermitteln, zumal der damit verbundene Bierkonsum die vereinbarten Grenzen nie überschritt.
Andererseits wurden die eigentlichen kulturellen Ziele immer erfüllt, nämlich mit Erläuterungen an den Orten geschichtlicher oder aktueller Begebenheiten, mit Wanderungen im Riesengebirge und in der Hohen Tatra oder zu Orten, die mit der Austreibung der Sudetendeutschen wie in Kaaden oder Prerau oder der deutschen Verbrechen wie in Theresienstadt oder Lidice zu tun hatten. Auch die in der kommunistischen Tschechoslowakei verschwiegenen Themen „Flucht“, „Vertreibung“, „Übergriffe beider Seiten“ konnten vor Ort vertieft werden.
Bleibt noch der Hinweis auf eine weitere Besonderheit. Reisegruppen wurden tschechische Begleitpersonen zugeteilt, was wegen der bestehenden Sprachschwierigkeiten nötig war, aber eigentlich auch der politischen Überwachung dienen sollte. Meist waren dies junge Lehrer und Lehrerinnen für Deutsch, die sich aber nach kurzer Gewöhnungszeit oft als nicht mehr unbedingt regimetreu erwiesen, wie zum Beispiel beim Vermitteln des illegalen Geldumtausches. Auf deren Bitten gelang es mir auch zweimal, die gewünschte Person auch bei der nächsten Fahrt wieder „zugeteilt“ zu erhalten. Dies konnte auch im damaligen Überwachungsstaat gelegentlich zu Situationen führen, welche an die verschmitzte Figur des fast jedem Tschechen und manchem Sudetendeutschen bekannten, legendären Schwejk erinnerten.
Fazit: Sobald unsere Schüler die drüben herrschenden Verhältnisse hautnah erlebt hatten, verschwanden vorher gelegentlich geäußerte positive Bewertungen von Teilen der östlichen Ideologie. Das böhmische Pilsner blieb weiterhin geschätzt, der drüben herrschende Sozialismus nicht. In Einzelfällen entwickelten sich damals gewisse Freundschaften, vor allem zu den der deutschen Sprache mächtigen ehemaligen Begleitern und Begleiterinnen. So überdauerten solche Bekanntschaften die Wende von 1989 oder wurden wieder aufgenommen.
Die erwähnte Romanfigur Schwejk schuf Jaroslav Hašek (1883–1923) mit seinem Welterfolg „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“. Über seine scheinbar tölpelhafte Art will er dem Leser die Lächerlichkeit der österreichischungarischen Bürokratie vorführen. Andererseits ist ihm der ausgeprägte Sinn für (einseitigen) Humor nicht abzusprechen. So fordert sein Romanheld mitten im Krieg seine Kameraden zum Wiedersehen in seinem Stammlokal U Fleků, deutsch Zum Kelch, auf: „Um sechs Uhr nach dem Krieg im Kelch.“ Ähnliche Szenen sind im U Fleků bis heute in Wandzeichnungen erhalten und wurden zur Touristenattraktion. Diese konnten den damals 18 bis 20 Jahre alten Schülern nicht vorenthalten werden. Aber eben auch nicht die Information, daß Hašek dem Alkohol verfiel und selbst zum Opfer des böhmischen Bieres wurde.
Zu Recht bewundern wir Persönlichkeiten wie Oskar Schindler oder Nicholas Winton, die jüdische Bürger vor der Verfolgung durch das NSRegime retteten. Auch der aus Wagstadt im Kuhländchen stammende Moritz Freiherr Daublebsky von Sterneck verhalf bei mehreren Gelegenheiten Juden zur Flucht. Für eine persönliche Entscheidung in diesem Zusammenhang, die ihm als 32jährigen das Leben hätte kosten können, erhielt er am 22. Dezember 1977 den Ehrentitel des Staates Israel Gerechter unter den Völkern.
Moritz Freiherr Daublebsky von Sterneck, der einzige Sohn des k. u. k. Bezirkshauptmanns in Wagstadt, Moritz Jakob Freiherr Daublebsky von Sterneck (1871–1917), und dessen Ehefrau Marie Salvadori von Wiesenhof (1872–1962), kam am 28. Februar 1912 im Haus Nr. 11 in der Herrngasse in Wagstadt – im heutigen Gemeindeamt – zur Welt. Die verwitwete Baronin Marie Daublebsky von Sterneck zog mit ihrem fünfjährigen Sohn und seinen drei älteren Schwestern Amelie, Maria und Anna Franziska nach Troppau. Sie eröffnete in einer Villa in der Berggasse einen edlen Salon, in dem sich wichtige Familien wie Sedlnizky, Razu-
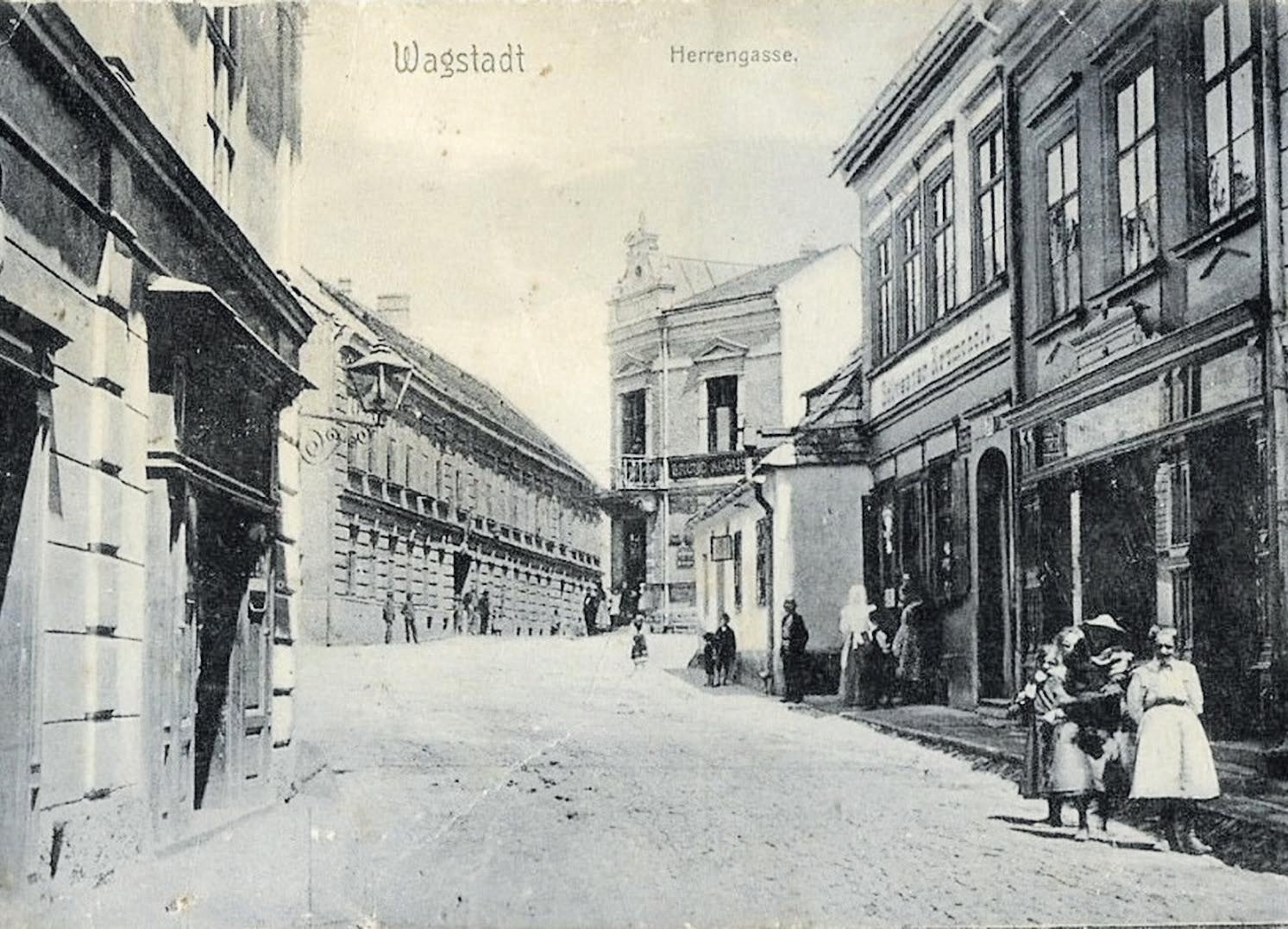

❯ Der Kuhländler Moritz Freiherr Daublebsky von Sterneck
im Bergkurort Vomp heiratete. Der Ehe entstammen drei Söhne. Am 10. Januar 1986 starb Moritz Freiherr Daublebsky von Sterneck in Vomp. Für seine selbstlose Tat, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um zwei Jüdinnen vor Verfolgung zu schützten, wobei eine von ihnen überlebte, ging Daublebsky von Sterneck am 22. Dezember 1977 als Gerechter unter den Völkern in die Gedenkstätte Yad Vashem an der Mauer der Ehre in Israel ein. Zu seinen Ehren wurde am Denkmal ein Baum mit seinem Namen gepflanzt.
der Herrengasse in Wagstadt kommt Moritz Freiherr Daublebsky von Sterneck zur Welt, was der Eintrag im Geburts- und Taufbuch dokumentiert.
movsky, Janotta, Rolsberg sowie Persönlichkeiten wie General Böhm-Ermolli (➝ unten), Schriftstellerin Marie Stona, Genealoge Häusler trafen. Moritz absolvierte 1931 das deutsche Gymnasium in Troppau und studierte wie sein Vater Rechtswissenschaften an der Universität Wien und promovierte zum Dr. jur. Die bevorstehenden Kriegsereignisse im Jahr 1939 stellten die moralische Einstellung des Erben der Adelsfamilie von Daublebsky von Sterneck
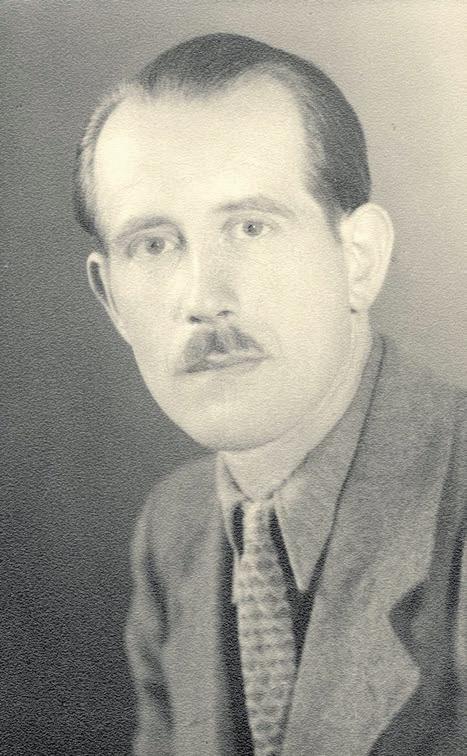
auf eine harte Probe. Obwohl ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus, kämpfte er in der Wehrmacht in ganz Europa und half verfolgten Juden. Ruhe fand er im Schloß Borčice bei Nitra in der Slowakei, das der Schwester seiner Mutter, Baronin Alisabeth Gipeky, gehörte. Diese hatte sich mit zwei Jüdinnen angefreundet, der in Wien geborenen Magdalena Dubnicka (* 1925) und deren Mutter, die während des Krieges in einem slowakischen Dorf lebten.
Als Ende August 1944 die deutschen Truppen in die Slowakei einmarschierten, versuchten Magdalena Dubnicka und ihre Mutter zu fliehen und kamen im Oktober 1944 nach Borčice, in der Hoffnung, dort Unterschlupf zu finden. Freiherr Daublebsky von Sterneck befand sich zu dieser Zeit im Schloß und entschied, die beiden Jüdinnen zu verstek-
ken. Lange Zeit versorgte er die beiden, bis er eines Tages erfuhr, daß die Bewohner des Dorfes vermuteten, daß sich Juden im Schloß befänden. Er warnte Magdalena Dubnicka und ihre Mutter, worauf sie nach Wien zurückkehren wollten. Auf dem Weg dorthin mußten sie den Fluß Waag überqueren, wo die Brücke von einer deutschen Patrouille bewacht wurde. In der Uniform eines Wehrmachtsoffiziers führte Freiherr Daublebsky die beiden jüdischen Flüchtlinge nachts sicher über die Brükke und begleitete sie anschließend bis nach Wien. Er brachte sich dabei selbst in große Gefahr, einerseits da er die beiden Jüdinnen im Schloß versteckte und andererseits indem er ihnen persönlich half, unbeschadet bis nach Wien zu gelangen. Bei Entdeckung wäre dies mit dem Tode bestraft worden.
Nach etwa einem Monat wurden Magdalena Dubnicka und ihre Mutter dennoch von den Deutschen gefaßt und in die Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen gebracht. Die Mutter kam dort ums Leben, aber Magdalena überlebte. Nach dem Krieg zog sie nach Schweden und bezeugte später das Heldentum des Freiherrn Daublebsky von Sterneck.
Dieser ließ sich in Österreich nieder, wo er am 20. September 1950 Maria Theresia von Biegeleben (1920–2009) auf Schloß Sigmundslust
In Erinnerung daran wird am 24. Juni 2023 in Wagstadt dieses tapferen gebürtigen Wagstädters – auch als Mahnung gegen den aufkeimenden Antisemitismus – mit einer Gedenktafel an seinem Geburtshaus gedacht. Die Zeremonie findet unter der Schirmherrschaft der Österreichischen Botschafterin in Prag, Bettina Kirnbauer, und der Föderation der jüdischen Gemeinden in der Tschechischen Republik statt. Die Söhne des Freiherrn Daublebsky werden ebenfalls am Festakt teilnehmen. Die Wagstädter Malerin und Galeristin Rosana de Montfort hat die Tafel entworfen. Ulf Broßmann Die Informationen und Fotos für diesen Bericht stammen von Eduard Vales, Kastelan des Schlosses Wagstadt.
Das k. u. k. Infanterieregiment

„Kaiser“ Nr. 1 war das Traditionsregiment der Kuhländler, und alle waffentauglichen jungen Männer waren stolz darauf, beim „Kaiser“ Nr. 1 zu dienen. So war es auch beim Vater von Eduard Böhm, Georg Böhm, damals noch nicht geadelt, der 1813 in Kunewald im Kuhländchen zur Welt gekommen war.
Das Infanterieregiment „Kaiser“ Nr. 1 wurde unter Feldmarschall Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz 1848 in Italien eingesetzt. Georg Böhm diente als Unteroffizier und wurde 1849 wegen Tapferkeit in der Schlacht bei Novara zum Offizier befördert. Sein Truppenteil nahm danach Quartier in Ancona, damals Kirchenstaat. Dort lernte er die Italienerin Maria Josefa Ermolli kennen. Sie heirateten und bekamen 1856 ihren ersten Sohn Eduard. Im Jahr 1859 kehrte das Regiment in die Heimatgarnison nach Troppau zurück, denn es bahnte sich ein Konflikt mit Preußen an. Georg Böhm wurde in den Ruhestand versetzt sowie 1885 in den erblichen Adelsstand mit Wappen erhoben. Ihm wurde erlaubt, seinem Namen den Geburtsnamen seiner Ehefrau hinzuzufügen. In Troppau nannte
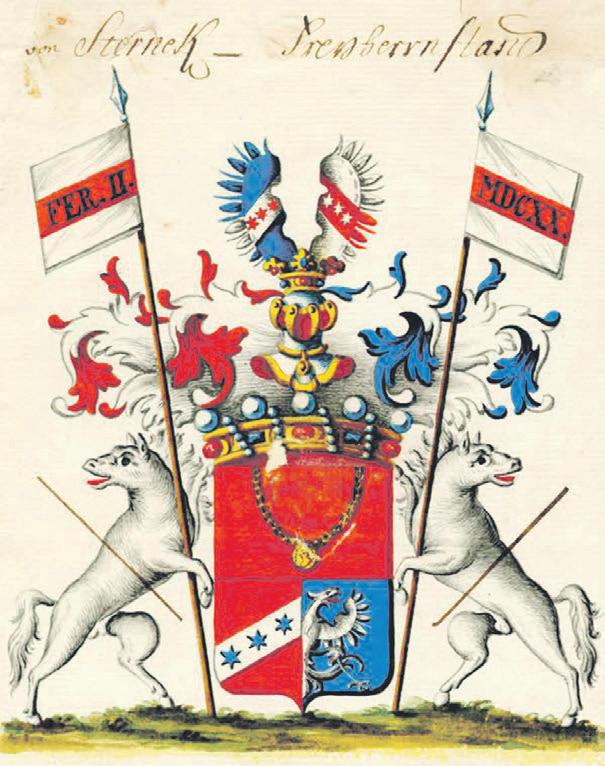
Der Ausstellungsprospekt. Rechts Truppenparade nach erfolgreichen Offensiven an der Ostfront 1917. Böhm-Ermolli in der Uniform des Generalobersten bei der Inspektion nahe der ukrainischen Stadt Tarnopol.

sich die Familie nun von BöhmErmolli, und Sohn Eduard und seine Geschwister verbrachten dort ihre Kindheit. Natürlich war auch für Sohn Eduard von Böhm-Ermolli eine glänzende Militärkarriere vorgezeichnet, die aber, wie wir sehen werden, kuriose Wendungen nahm. Das lag daran, daß die Sudetenländer innerhalb von 20 Jahren drei Staatszugehörigkei-
ten hatten. Nachdem Eduard von BöhmErmolli das Kadetteninstitut in Sankt Pölten und die Theresianische Militärakademie in der kaiserlichen Burg zu Wiener Neustadt durchlaufen hatte, begann 1875 sein aktiver Militärdienst.
Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges fand er als Offizier Verwendung in mehreren Eliteregimentern, die meist in Krakau stationiert waren, und übernahm 1914 als General und Kommandant die k. u. k. 2. Armee.
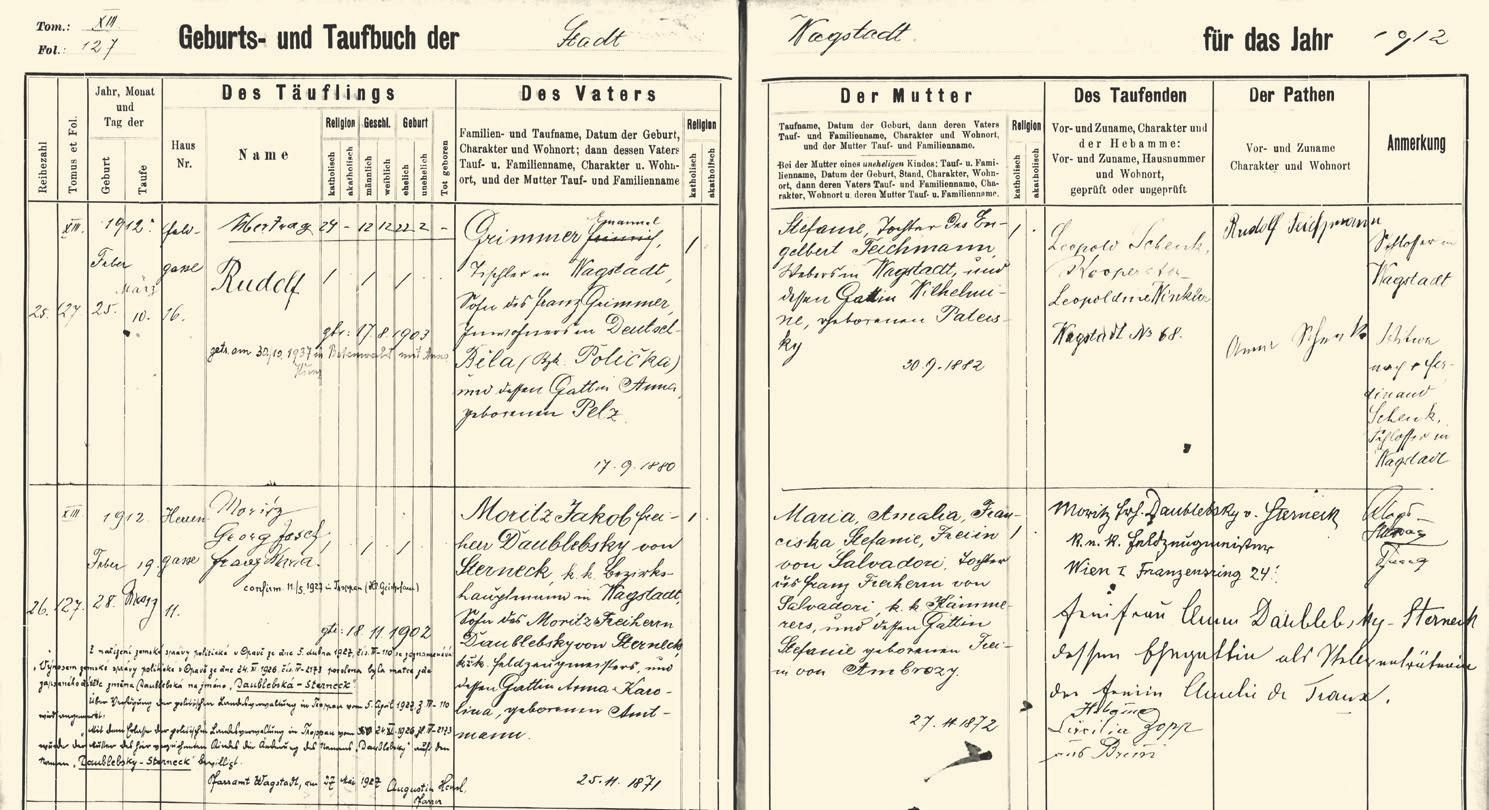
Nach anfänglichen Niederlagen und Verlusten in Galizien gegen russische Truppenverbände gelang ihm 1915 von den Karpatenstellungen aus ein Durchbruch und die Rückeroberung von Lemberg. Dafür erhielt der General die hohe Auszeichnung des Militärverdienstkreuzes 1. Klasse mit Schwertern und Kriegsdekoration. Kurz danach übernahm Böhm-Ermolli auch die Führung der nach ihm benannten Heeresgruppe Böhm-Ermol-
li, die in Abwehrschlachten in Ostgalizien verwickelt war. Zusammen mit der deutschen Südarmee, die ihm ebenfalls unterstellt war, gelang ihm 1917, die russische Offensive zu stoppen und Tarnopol in der Ukraine zu erobern. Dafür wurde er mit dem preußischen Orden Pour le Mérite mit Eichenlaub dekoriert.
Im selben Jahr verlieh ihm Kaiser Karl I. den erblichen Freiherrenstand und beförderte ihn zum k. u. k. Feldmarschall. Als Oberkommandierender sollte er mit seiner Heeresgruppe die Ukraine besetzen und konnte bis zum Kriegsende bis Odessa vorrücken. Nach dem Zusammenbruch der k. u. k. Monarchie 1918 kehrte Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli nach Troppau zurück, das nun in der neuen Tschechoslowakei lag. In einer Villa in der Berggasse hatte Baronin Mari Daublebsy-Sterneck 1917 einen Salon eröffnet (➝ oben), in dem sich wichtige tschechische und deutsche Schriftsteller, Künstler, Militärs und Adelsfamilien trafen. General Böhm-Ermolli verkehrte in diesem exklusiven Etablissement. So ist es gut möglich, daß die dort geknüpften Kontakte dazu führten, daß die tschechoslowakische Regierung den k. u. k. General Böhm-Ermolli zum tschechoslowakischen General der Reserve ernannte und ihm eine Pension zahlte, obwohl er nie einen aktiven Dienst in der tschechoslowakischen Armee geleistet hatte. Gemäß dem Münchner Ab-
1915 erhält Böhm -Ermolli das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse für die Befreiung Lembergs und 1917 den Orden Pour le Mérite für die Eroberung Tarnopols.


kommen wurden 1938 die Sudetenländer in das Deutsche Reich eingegliedert. Eduard von Böhm-Ermolli war nun Bürger des Deutschen Reiches. 1939 fand in Troppau, der ehemaligen Garnisonsstadt des Infanterieregimentes „Kaiser“ Nr. 1, in Erinnerung an dessen militärische Erfolge im Ersten Weltkrieg eine Truppenparade mit 2000 Veteranen des Regimentes „Kaiser“ statt. Eduard von Böhm-Ermolli nahm daran teil, da sein Vater in diesem Regiment gedient hatte. Ein Jahr später erkannten Generäle der Wehrmacht die Symbolkraft des k. u. k. Feldmarschalls Böhm-Ermolli, der einst Kommandeur einer k. u. k. Heeresgruppe sowie der deutschen Südarmee gewesen war und im Ersten Weltkrieg gegen russische Truppen erfolgreich gekämpft hatte.
Den Mythos eines Siegers nutzend, zeichnete Adolf Hitler 1940 Böhm-Ermolli mit dem Charakter eines Generalfeldmarschalls und Chef des in Troppau stationierten Infanterieregiments 28 aus. Aktiv hat Generalfeldmarschall Böhm-Ermolli nie in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen. Er starb 1941 in Troppau an einer Erkältung, die er sich bei einer Truppenparade im November in Berlin zugezogen hatte.
Die Trauerfeier fand sowohl in Wien als auch in Troppau statt, wo er beerdigt wurde. Das Grabmal, das der in Schlesien bekannte akademische Bildhauer Engelbert Kaps gestaltete, existiert noch heute auf dem Friedhof von

Troppau.
So diente Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli in seiner militärischen Karriere als Feldmarschall drei völlig unterschiedlichen Herren: bis 1918 dem Österreichischen Kaiser, ab etwa 1920 dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten und ab 1940 dem Führer und deutschen Reichskanzler.
Gegenwärtig läuft die Ausstellung „General dreier Armeen: Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli“ im Schloß Kunewald. Sie wurde mit historischen Militärvereinen Ende April eröffnet und ist bis 31. Juli zu besichtigen. Sie steht unter der Schirmherrschaft Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit Markus Erzherzog von Habsburg-Lothringen sowie des Vereins Radetzky in Prag. Ulf Broßmann
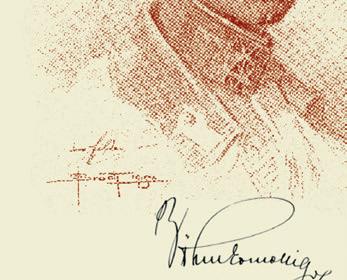

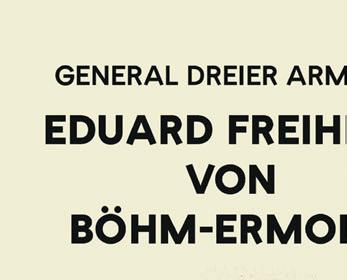
Die Informationen für diesen Bericht stammen von Radek Polách vom Museum der Region Neutitschein und Jaroslav Zezulčik, Kastelan des Schlosses Kunewald, die die Ausstellung im Schloß Kunewald kuratierten.
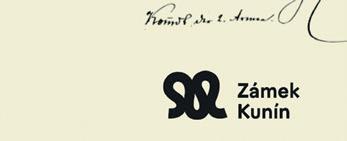

Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Am westlichen Stadtrand von Deutsch Gabel liegt ein elf Quadratkilometer großer Park, in dessen Zentrum das Schloß Neu Falkenburg steht. Dieses ließ Heinrich Berka von Duba in den Jahren 1562 bis 1572 erbauen. 1759 wurde es im Stil des Barock umgebaut. Nach1890 kam das Schloß in den Besitz der Reichenberger Unternehmerfamilie Liebieg, die 1945 enteignet und vertrieben wurde.
� Die Geschichte der nordböhmischen Stadt Deutsch Gabel – Teil VII
1623 kam Schloß Lämberg durch Kauf in den Besitz von Albrecht von Waldstein, den späteren Herzog von Friedland. Kurz vor seiner Ermordung am 25. Februar 1634 in Eger verkaufte er es dem kaiserlichen Feldmarschall Johann Ludolf von Breda. Zwischen 1660 und 1680 beauftragten dessen Nachkommen Künstler und Baumeister aus Holland und Italien und ließen Schloß Lämberg im frühbarocken Stil zu ihrer Familienresidenz ausbauen.


In der Schlacht am Weißen Berg bei Prag am 8. November 1620 unterlagen die Aufständischen Kaiser Ferdinand II. (1619–1637).
Friedrich von der Pfalz, als Winterkönig verspottet, entfloh aus Böhmen und sah es nie wieder.
Nach der Einnahme von Prag waren einige Aufständische eingesperrt worden. Heerführer Johann T‘ Serclaes von Tilly ließ in einer Nacht die Wachen entfernen und gab den Bedrohten den Rat zu fliehen. Sie beachteten den wohlgemeinten Rat nicht. Die Anhänger Friedrichs von der Pfalz wurden schwer bestraft. 28 Haupträdelsführer, meist ehemalige Direktoren, wurden am 21. Juni 1621 auf dem Altstädter Ring enthauptet.
In Mähren wurde an keinem Verurteilten die Todesstrafe vollzogen. Wer sich selbst anzeigte, dem wurde bei dem nachfolgenden Prozeß, je nach der Größe seiner Schuld, nur ein Drittel oder die Hälfte seines Besitzes beschlagnahmt.
Kaiser Ferdinand II. beschloß, in Böhmen das Recht des Cuius regio, eius religio durchzuführen. Wessen Land, dessen Religion ist der im Augsburger Religionsfrieden 1555 festgelegte Grundsatz, wonach der Landesherr den Glauben seiner Untertanen bestimmen kann. Daraufhin mußten ungefähr 30 000 Familien ihre Heimat verlassen, weil sie den protestantischen Glauben nicht aufgaben.
Einer von den gerichtlich Verurteilten war Johann Georg von Brandenburg-Jägerndorf. Er suchte sich zu rächen und plünderte am 20. Januar 1621 unter Graf Solms mit 2000 Mann Kavallerie und 1000 Mann Infanterie das Städtchen und das Schloß Reichstadt. Den Rückzug nahmen sie über Gabel. Das wollten sie ebenfalls plündern, weil angeblich der Gabeler Stadtschreiber die Soldaten in einem Brief „an den Reichstädter Herrn“ beleidigt und den Kaiserlichen ihre Absichten mitgeteilt habe. Auf die Fürbitte des Rates und der Gemeinde bei Graf Solms, vor dem sie einen Fußfall machten, wurde von der Plünderung abgesehen. Gabel mußte aber 1000 Taler, ein Faß Wein und einige
Malter Hafer als Lösegeld entrichten. Nach dem Abzug Solms kamen kaiserliche Truppen nach Gabel. Auch sie mußten verpflegt werden.
Am 23. November 1622 kam ein Fähnlein der Liechtensteiner nach Gabel, zog aber nach einer Woche wieder ab. Das Regiment war nach Fürst Karl von Liechtenstein, kaiserlicher Feldherr und Statthalter von Böhmen, benannt. Er war Präsident des Untersuchungs- und Strafgerichtes wider die Rebellen. Schon 1608 war er in den Fürstenstand erhoben worden. Sein Bruder Gundekar erhielt 1623 die Fürstenwürde. Seine Linie regiert noch heute im Fürstentum Liechtenstein.
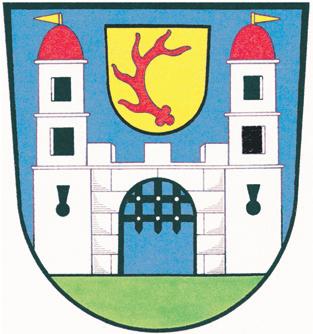
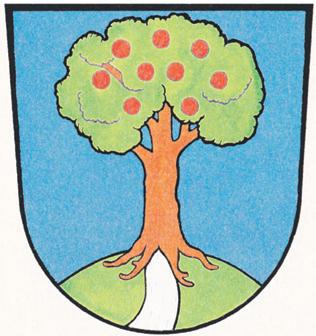
Durch die Teilnahme am Aufstand gegen König Ferdinand II. hatte Konrad von Dohna seine Besitzungen verloren.
Heinrich Wolf Berka, der Sohn des 1598 verstorbenen Wolf Berka, kaufte Gabel. Die Stadt huldigte Heinrich Wolf Berka am ersten Sonntag vor Quadragesimae im Jahre 1623.


Am 28. Mai kam er mit seinem Fähnlein Infanterie nach Gabel und blieb acht Wochen. Am böhmischen Aufstand hatte er nur wenig teilgenommen. Deshalb war er am 31. Oktober 1622 von Kaiser Ferdinand II. begnadigt worden. Heinrich Wolf Berka trat in kaiserliche Dienste und wurde Hauptmann im Liechtensteinschen Regiment.
Schon 1623 ernannte ihn der Kaiser zum Steuerinspektor für Böhmen. 1634 finden wir ihn unter den Statthaltern. Bald nachher wurde er Inspektor der königlichen Güter in Böhmen. 1640 übernahm er das Amt eines Oberst-Hoflehensrichters und 1645 das des Vorsitzenden der Kammer. Kaiser Ferdinand III. (1637–1657) erhob ihn am
15. Juli 1637 in den Reichsgrafenstand. Seit diesem Tage nannte er sich Heinrich Wolf Berka, Reichsgraf Howora von Dauba und Leipa. Als 1648 die Schweden Prag eroberten, wurde er am
26. Juli mitsamt seiner Familie gefangen genommen. Seine älteste schon verheiratete Tochter befreite ihn, indem sie ihren gesamten Silberschatz den Feinden gab.
Kurfürst Johann Georg von Sachsen (1611–1656), Haupt der Protestanten, war für die Partei Kaiser Ferdinands II. gewonnen worden. Der Kaiser hatte ihm die Ober- und Niederlausitz verpfändet und ihm versprochen, diese nicht zurückzufordern, bevor nicht die Kriegskosten gedeckt seien. Jedoch der unablässige Druck Gustav Adolfs von Schweden, der Brand Magdeburgs und der Einmarsch Tillys in Sachsen führten im September 1631 zum Anschluß des Kurfürsten an den König von Schweden.


Schon am 1. November rückte ein Teil des feindlichen sächsi-
den unter dem Befehl des Don Balthasar de Maradas und hausten in der Gabeler Gegend so arg wie die Feinde. Ringsum wurden die angebauten Felder zertreten. Nach 1632 war die Gegend um Gabel verödet und verlassen. Die wenigen Bauern, die noch am Leben waren, hatten kein Vieh, ihre Felder zu bebauen. Den Pflug zum Ackern mußten sie selber ziehen.
Am 14. November 1633 zogen mehrere tausend Soldaten mit 48 großen Geschützen in Gabel ein und blieben drei Tage hier und in der Umgebung. Sie verursachten auf den so mühselig
1656 über Gabel nach Leipa. Seine Leute plünderten ringsum die Dörfer.
Der Lämberger
Bauernaufstand (1680)
Der deutsche Bauer war im 13. und 14. Jahrhundert in Böhmen ein freier Mann, der sich auf Grund verbriefter Rechte im Lande angesiedelt hatte. Das ganze Mittelalter hindurch erfreute er sich seiner Freiheiten, die in den Nachbarländern größtenteils unbekannt waren. Noch im 15. Jahrhundert konnte er seinen Grundherrn persönlich vor Gericht belangen. Die Not der Hussitenkriege begünstigte das vom Adel erwünschte Ziel, aus dem freien Bauern einen Hörigen, einen Leibeigenen zu machen. Nach dem Landtagsbeschluß vom 1. Oktober 1487 galt auf dem Land nur noch der Wille der Herrschaft.
schen Heeres von Zittau aus nach Böhmen vor. Der Zug ging über Gabel, Leipa und Auscha nach Leitmeritz. Nach den alten Berichten war das Jahr 1632 für die Stadt Gabel besonders schrecklich. Unbeschreiblich waren die Verheerungen, welche die Sachsen unter Albrecht von Kalckstein und die Schweden anrichteten. Am 10. Januar 1632 kamen drei Abteilungen des Oberst von Kalckstein, welche in Zittau lagerten, nach Gabel, wo sie sieben Häuser, das Herrenhaus und das Kloster plünderten. Die Leute wurden aus ihren Wohnungen vertrieben und teils von den Feinden als Geiseln in die Gefangenschaft geschleppt. Die Sachsen raubten Kühe und Pferde und trieben sie nach Zittau. Nach dem Gedenkbuch des Klosters blieben die Feinde drei Monate in der Gabeler Gegend. Bei der Ankunft der Schweden flüchteten die Menschen in die Wälder aus Furcht vor den Foltern, die sie anwendeten, um Geld und Lebensmittel zu erpressen.
Im Juli 1632 kamen die Kaiserlichen nach Gabel. Sie stan-
hergerichteten Feldern großen Schaden.
Am 30. Mai 1635 schlossen Kaiser Ferdinand II. und der Kurfürst von Sachsen Frieden. Dadurch fiel unter anderem die Lausitz an Sachsen und ging für Böhmen endgültig verloren. Groß und schwer waren die Opfer, mit welchen der Kaiser diesen Teilfrieden erkauft hatte. Der große Krieg aber ging weiter. Nun blieb unsere Heimat für einige Jahre vom Krieg verschont. Gegen Ende des Jahres 1638 zog der kaiserliche Feldherr Gallas, der spätere Besitzer der Herrschaft Lämberg, durch die Gabler Gegend. Er kam aus der Mark und begab sich nach Schlesien und Böhmen.
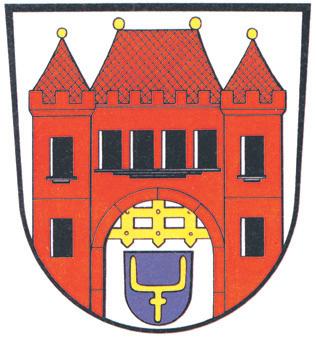
Am 16. September 1645 zog der schwedische General Hans Christoph Graf von Königsmarck durch Gabel nach Leipa, das er brandschatzte. Auch das Schloß Wartenberg ließ er anzünden.
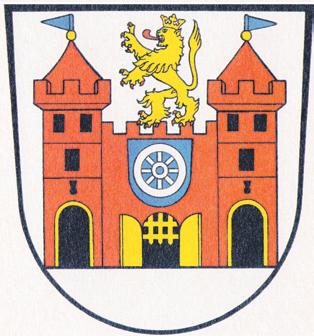
Am 19. Dezember 1645 war das Hauptquartier der Schweden unter den Generalen Wittenberg und Mardani in Gabel. Der neue Oberbefehlshaber Carl Gustaf Wrangel zog am 6. Januar
In diesem Beschluß heißt es: „Flüchtig gewordenes Gesinde oder Landvolk muß zurückgeliefert werden. Bei Verweigerung ist auf 10 bis 20 Mark Silber zu klagen.“ Die Untertanen hatten jetzt alle schon einen festen Preis. Sie waren vollständiges Eigentum ihrer Herren geworden. Aus dem ursprünglichen Schutzrecht der Grundherrschaft über die nur zinspflichtigen Ansiedler waren diese Bauern jetzt auch Gerichtsuntertanen ihrer Grundherren geworden, weil diese die Gerichtsbarkeit mit oder ohne königliche Bewilligung an sich gebracht hatten.
Durch den Dreißigjährigen Krieg ging der letzte Rest der Freiheit des Bauernstandes verloren. Hilflos waren sie aller Willkür ihrer Herren ausgeliefert. Klagen der Bauern bei den Gerichten, wenn sie je angenommen wurden, endeten mit der Bestrafung und noch größerer Verfolgung der Kläger. Diese Zustände waren zur Zeit der Regierung Kaiser Leopolds I. (1658–1705) auf einem gewissen Höhepunkt angelangt, 1679 brachen im Czaslauer Kreis Unruhen aus. Bald standen die Bauern vom Erzgebirge bis Friedland in Aufruhr. Die Bauern der Lämberger Herrschaft beschlossen, ihre Beschwerden durch Ab-
geordnete dem Kaiser vorzutragen. Der Sohn des Bauern Michl Krieschl aus Markersdorf verfaßte eine Klageschrift. Unter den Segenswünschen des Volkes machten sich am 7. Januar 1680 Heinrich Wiese, Friedrich Kaulfersch, Georg Apelt, Andreas Förster, Georg Arlet und Christian Taubmann auf den Weg nach Prag. Wegen der Pest in Ungarn hatte sich Kaiser Leopold I. nach Prag zurückgezogen. Der Amtsschreiber Christoph Mießler von Lämberg unterrichtete durch einen Eilboten mit unrichtigen Angaben den in Prag weilenden Grafen Breda von der Reise der Bauern. Daraufhin veranlaßte der Graf die Verhaftung der Abgesandten bei ihrer Ankunft in Prag. Zum Kaiser wurden sie nicht vorgelassen. Vom Schloß Lämberg aus schickte Mießler den Richter und einen Schützen nach Markersdorf, um den Urheber der Klageschrift und Michel Teichgraber zu verhaften. Da beide geflüchtet waren, wurde der Bauer Michel Krieschl festgenommen, mißhandelt und eingesperrt. Am 13. Januar 1680 kamen Michel Teichgraber und 60 Bauern, von denen jeder einen Stock (Knüttel) bei sich trug, in den Kretscham nach Lämberg, wo auch gerade der Amtsschreiber Mießler anwesend war. Sie baten um Freilassung des Bauern Krieschl und boten sich alle als Bürgen an. Der Amtsschreiber wies dieses Ansinnen zurück, ergriff Michel Teichgraber und befahl, ihn einzusperren. Da erklärten die übrigen: „Wo Teichgraber ist, wollen auch wir bleiben.“ Doch sie wurden vom Amtsschreiber und dem Richter hinausgetrieben. Der Richter war damals meistens gleichzeitig der Wirt des Kretschams. Noch in derselben Nacht schickten die Bauern Boten nach Johnsdorf, Seifersdorf, Kriesdorf und läuteten die Sturmglokken. In der Nähe des Lämberger Schlosses kamen sie zusammen, um sich über ihre Zukunft zu beraten. Der Amtsschreiber, der einen Angriff auf das Schloß befürchtete, bewaffnete die Dienerschaft und ließ durch einige blinde Schüsse die gute Verteidigung des Schlosses demonstrieren. Fortsetzung folgt
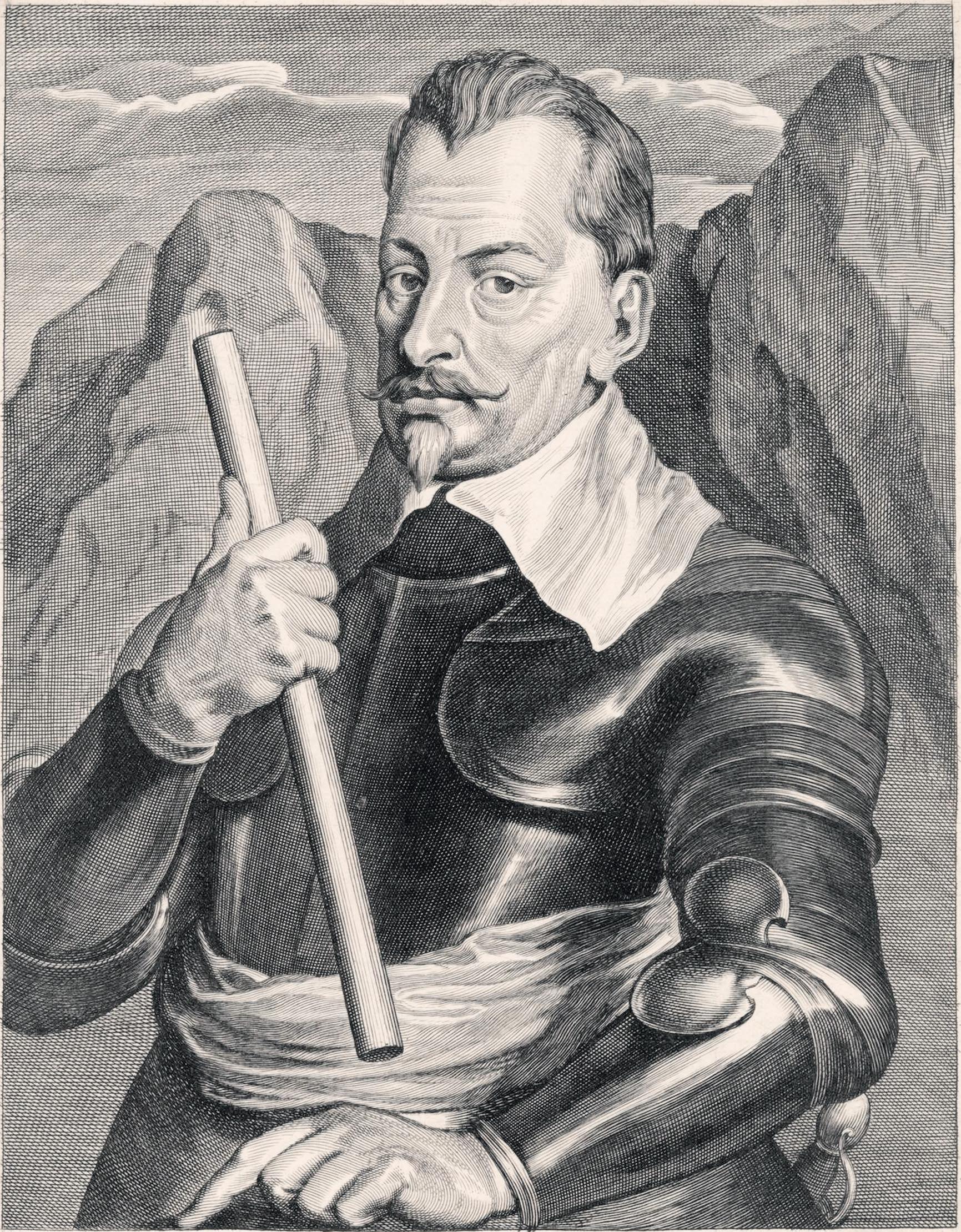
Eine der mächtigsten und zugleich rästelhaftesten Gestalten des Dreißigjährigen Krieges ist Albrecht Wenzel Eusebius Graf von Waldstein, der unter dem Namen Wallenstein in die Geschichte eingegangen ist.
Wallenstein stammte aus der verarmten Linie des alten böhmischen Adelsgeschlechts der Waldstein. Er wurde am 24. September 1583 in Hermanitz im späteren Kreis Trautenau geboren. Mit elf Jahren war er Vollwaise. Sein Vormund Heinrich Slavata von Chlum und Koschumberg ließ ihn mit seinem eigenen Sohn von Böhmischen Brüdern erziehen. Dann besuchte er das lutheranische Gymnasium zu Goldberg in Schlesien und studierte an der protestantischen Universität in Altdorf bei Nürnberg.
Doch der wilde und starrsinnige Jüngling zeigte weder Lust noch Geschick zum Studieren. Man brachte ihn daher als Edelknaben zum Markgrafen Karl von Burgau nach Innsbruck. In dessen Schloß Ambras stürzte er drei Stockwerke hinab, blieb aber unverletzt. Dies verursachte bei ihm wundersame Veränderungen. Von nun an hielt er sich für einen besonderen Schützling des Glückes und zu großen Taten bestimmt. Er konvertierte zum Katholizismus und begann, seine Talente zu bilden.
Ab 1604 bereiste er Deutschland, Holland, England, Frankreich und Italien. Am liebsten verweilte er in Padua. Der dort erteilte Unterricht in Astrologie zog ihn mächtig an, denn damals herrschte der Aberglaube, man könne aus der Stellung der Gestirne die künftigen Schicksale der Menschen lesen. Ein Sterndeuter namens Seni sagte dem jungen Wallenstein, in den Sternen gelesen zu haben, er sei zu hohen Ehren bestimmt. Seit dieser Zeit wurde Seni sein Vertrauter und ständiger Begleiter. Mit kühnen Gedanken und Zielen kehrte er in sein Vaterland zurück und entschied sich für den Militärdienst im kaiserlichen Heer. Mit 20 Jahren kämpfte er bereits in Ungarn gegen die Türken.
Nach Abschluß des Friedensvertrages wurde er als Oberst der böhmischen Stände entlassen. 1609 vermählte er sich mit einer reichen Witwe, deren früher Tod (1614) ihn zum Erben eines riesigen Vermögens und zum Großgrundbesitzer machte. 1617 stellte er dem späteren Kaiser Ferdinand II. auf eigene Kosten ausgerüstete und besoldete 200 Reiter im Kampf um Venedig zur Verfügung. Bei der Niederwerfung des von 1618 bis 1620 dauernden böhmischen Aufstandes – mit dessen Ende begann der Dreißigjährige Krieg – kämpfte er als Oberst im Dienste des Kaisers mit. Bei der Beschlagnahme der Güter protestantischer Adeliger erwarb er so stattliche Landgebiete, daß er der größte Grundherr Böhmens wurde. Rund 4000 Quadrat-
kilometer mit der wirtschaftsstarken Domäne Friedland und deren Zentrum Jitschin waren nun sein Besitz.
1623 heiratete der nun reichste
Mann Böhmens Isabella Katharina von Harrach. Ihr Vater war einer der einflußreichsten Berater am kaiserlichen Hof. Sechs Monate später erhob Kaiser Ferdinand I. die Herrschaft Friedland zum Herzogtum. Wallenstein erlangte damit den Reichsfürstenstand. Seinen Besitz führte er mit tüchtigen Handwerkern und
Der neue Oberbefehlshaber rückte mit seinem Heer die Elbe entlang in Niedersachsen ein und schlug seinen Gegner Ernst von Mansfeld vernichtend bei Dessau. Mit dem Feldmaschall Johann T‘ Serclaes von Tilly besiegte die Katholische Liga 1626 den Dänenkönig Christian IV. Holstein, Schleswig, Jütland, Mecklenburg und Pommern wurden erobert. Der kaiserliche Adler herrschte von den Ostalpen bis zur Ostsee. Der Kaiser verlieh ihm daraufhin 1627 das
Das Versprechen, ein deutsches Reichsfürstentum zu erhalten, und fast unbegrenzte militärische und politische Vollmachten. Rasch brachte er eine neue Armee zusammen, befreite Böhmen von den eingedrungenen Sachsen und zwang Gustav Adolf, von dem Plan eines Einmarsches nach Österreich abzusehen.
Bei Zirndorf westlich von Nürnberg bezog Wallenstein ein stark befestigtes Lager und wies alle schwedischen Angriffe ab. Dann folgte er dem abziehenden Gegner nach Sachsen.
Bei Lützen kam es am 6. November 1632 zur entscheidenden Schlacht.
� Friedland Endlich
Vier Jahre verzichtete Friedland wegen der Pandemie auf seine Wallenstein-Festspiele. Heuer finden sie wieder am dritten Maiwochenende statt.
ne Lazarettstation betreuen. „Sie möchten die Soldaten und Gäste sogar mit Heilprozeduren verwöhnen“, sagt Beranová.

Gewerbetreibenden, mit besserer Kultivierung des Bodens, mit Förderung des Bergbaus und der Industrie bei gleichzeitiger Entlastung seiner Untertanen zur wirtschaftlichen Blüte.
1621 bis 1625 war die erste Epoche der großen Zeit Wallensteins. Den notwendigen Spielraum gewährte ihm die Maschinerie des Dreißigjährigen Krieges. Im Kampf der Katholischen Liga gegen den Dänenkönig Christian IV. machte Wallenstein 1625 das größte Geschäft seines Lebens. Er warb für den Kaiser ein Heer von 30 000 Soldaten auf eigene Kosten an und rüstete es aus. Ferdinand II. übertrug ihm dann den Oberbefehl über das Heer.
Wallenstein betrieb den Krieg wie ein Unternehmer. Nur die Anwerbung der Söldner bestritt er aus eigenen Mitteln. Den weiteren Unterhalt gewann er nach dem Grundsatz, daß der Krieg den Krieg ernähren müsse, durch Kontributionen. Ohne Unterschied zwischen Freund und Feind ließ er das Land, wo er mit seinen Truppen stand, für Sold, Quartier und Verpflegung aufkommen. Mit Wallenstein betrat eine rätselhafte Persönlichkeit die Weltbühne; ein Mann, groß als Feldherr, kühn in seinen Entwürfen als Staatsmann, aber zum Schluß unentschlossen in der Ausführung.
schlesische Fürstentum Sagan und 1629 die mecklenburgischen Herzogtümer.
Die ostentativen Ehrenbezeugungen des Kaisers begleiteten jedoch Intrigen seiner Gegner, die auf seine Fehler warten. Als Ferdinand II. 1630 in Regensburg einen Reichstag abhielt, sah er sich der Opposition der Fürsten gegenüber. Der Unwille aller richtete sich gegen Wallenstein. Besorgt um ihre „Libertät“, neidisch auf den böhmischen Emporkömmling und gereizt durch dessen maßlosen Hochmut, forderten die Fürsten Wallensteins Absetzung. Schweren Herzens gab der Kaiser den Feldherrn preis und das in dem Augenblick, in dem ein neuer Feind, gefährlicher als die bisherigen, sich zum Angriff anschickte: Schweden unter König Gustav Adolf.
Der Kaiser äußerte in völliger Verkennung der Lage: „Da haben wir halt ein Feinderl mehr.“
Siegreich drang das schwedische Heer bis nach Süddeutschland vor, und das „Feinderl“ besetzte 1632 die bayerische Hauptstadt. Die Katholische Liga war zerfallen, und die schwedischen Truppen standen an der Grenze des Habsburgischen Reiches. In dieser verzweifelten Lage sah sich der Kaiser gezwungen, Wallenstein zurückzurufen. Dieser ließ sich so lange bitten, bis er alles erhielt, was er verlangt hatte:
Die Schweden behaupteten zwar das Schlachtfeld, erlitten aber einen unersetzlichen Verlust. Ihr König, Gustav Adolf, war gefallen. Anstatt die Schweden und ihre Verbündeten rasch niederzuwerfen, zog sich Wallenstein nach Böhmen zurück und wartete ab. Er verhandelte nun mit Frankreich, Schweden und Sachsen. Wollte er sich am Kaiser rächen? Oder ging es ihm um die Versöhnung der Konfessionen und um die Wiederherstellung des Friedens im Reich? Er sah, wie unter den religiösen Streitigkeiten das Reich zerbröckelte, wie aus allen Himmelsrichtungen, gelockt von der Ohnmacht des Landes und der Schwäche des Kaisers, die Fremden über unser ausgeblutetes Land herfielen. Der Wiener Hof faßte Wallensteins Verhalten als Hochverrat auf, setzte ihn ab und ächtete ihn. Die meisten Regimenter fielen darauf von Wallenstein ab. Sein Hauptquartier hatte er in Pilsen aufgeschlagen, wo er seine treuesten Anhänger hatte. Alles an Wallenstein war in dieser Zeit zaghaft, unbeständig, er war nur noch ein menschliches Wrack, krank, von der Gicht geplagt, für seine Gegner ein Symbol, dessen man sich jetzt entledigen konnte. Als er Anstalten machte, nach Sachsen zu flüchten, wurde Wallenstein in Eger mit seinen engsten Vertrauten Ilow, Trčka, Kinsky und Niemann von Offizieren seiner Armee am 25. Feber 1634 ermordet.
Der Leichnam Wallensteins fand lange Zeit keine Ruhe. Zunächst wurde er im Franziskanerkloster bei Mies beigesetzt. 1636 wurde sein Leichnam in die Kartause Walditz bei Jitschin überführt. Im Jahre 1785 überführte man Wallensteins Gebeine nach Münchengrätz in die Schloßkapelle inmitten des ehemaligen Herzogtums Friedland.
1934, anläßlich seines 300. Todestages, ließ die Familie von Waldstein den Sarg erneut umsetzen und mit einer Bronzeplatte abdecken. Das mächtige Bronzerelief zeigt Wallenstein mit Harnisch und Feldherrenstab. Der große Feldherr blickt nachdenklich auf eine in Marmor gravierte Schrift: „Quid lucidius sole? Et hic deficiet.“ – „Was leuchtet heller als die Sonne? Und auch sie erreicht die Finsternis“. Helmut Hiemer
Der Freitag wird Konzerten gewidmet, Samstag und Sonntag stehen im Zeichen der Geschichte“, sagt Friedlands Bürgermeister Dan Ramzer. „Das Museum Špitálek wird auch einbezogen. Heuer wird sein Garten zu einer Alchimisten- und Handwerkswerkstatt“, so Iva Beranová, Leiterin der Abteilung für Kultur und Tourismus im Rathaus. Am Freitag spielt sich das Programm vor allem auf dem Masaryk-Platz ab. Die Besucher können sich auf eine große Trommelshow, lokale Bands und regionale Künstler freuen. Höhepunkt wird die renommierte slowakische Band „No Name“ sein. Herzog Albrecht von Wallenstein wird von der Herzogin begleitet, die bei manchen Programmpunkten teilnimmt. Der Samstag beginnt mit dem bei den Besuchern beliebten Frühstück mit dem Herzog im Hof der Burg und des Schlosses, dort findet abends eine Theatervorstellung statt. Ein Umzug wird am Samstagabend vom Schloß zum Marktplatz ziehen. Die Soldaten eröffnen ab Freitag ihr Feldlager im Stadtpark. Die flotten Friedländer Senioren werden dort ei-
Die Kirche Zur Auffindung des Heiligen Kreuzes bietet am Samstag und Sonntag Sonderführungen, Konzerte und am Sonntag einen Festgottesdienst. Vor der Kirche werden ein historisches Karussell, eine Kugelbahn und ein Kinderschießstand stehen. Die historische Schlacht findet am Samstag- und am Sonntagnachmittag auf der Wiese hinter dem Restaurant Na Rozcestí statt. Ein weiteres Abenteuer soll die Slack-High-Show am Samstag bringen, bei der Artisten über den Köpfen der Besucher über den Platz laufen werden. Den Samstag beenden die „Nightwish-Revival-Band“ und ein Feuerwerk am Schloß. Der Sonntag bietet ein Konzert der Band „Barock“. Außerdem tummeln sich Markthändler auf dem Masaryk-Platz. Die Touristeninfo im Rathaus, das Stadtmuseum und der Rathausturm werden ebenfalls zugänglich sein. Im Innenhof finden die Besucher wie gewöhnlich eine Ruhezone. Dort können sich die Kinder am Wochenende mehrmals pro Tag mit der Herzogin fotografieren lassen, sich bei Theatervorstellungen vergnügen oder in den historischen Werkstätten basteln. Petra Laurin
� Sudetendeutsches Büro in Prag
Kürzlich brachte ein Tscheche Peter Barton, dem Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, ein Paket mit alten Postkarten und Familienfotos, die er in einem Haus in der Nähe von Jeschken (Swietla) fand.
Adressiert sind die Poskarten an Emmy Kluttig. Leider gibt es den Kirchlichen Suchdienst nicht mehr, und so wird die Suche nach ihren Nachkommen schwer. In diesem Fall war der Finder bereit, seinen Fund dem Sudetendeutschen Museum in München zu schenken. Emmy Kluttig wohnte in Reichenberg zunächst am Marienplatz 1, dann in der Steinbruchgasse 450. Wir wissen, daß sie viel umzog, sie wohnte und arbeitete wahrscheinlich von vor 1938 und dann bis 1945 in Reichenberg, Haindorf und Swietla.
Das Kind Margit Hoffmann auf dem Bild mit dem Vermerk „Weihnachten 1939“ lebt vielleicht noch. Margit muß 1939 auf die Welt gekommen sein, nicht früher. Auf der Rückseite des Bildes steht auch die Adresse des Fotoateliers: „Mücke, Schückerstraße 15, Reichenberg“. Schön, daß die tschechischen Bürger mit solchen Anliegen immer noch zu uns kommen.
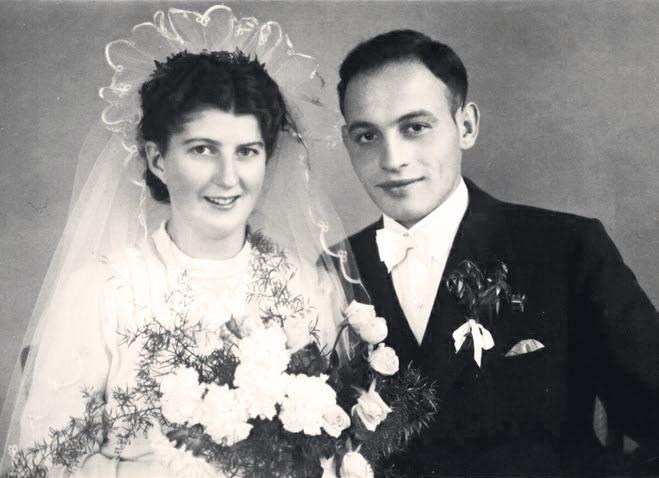

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


Der 807,5 Meter hohe Mückenberg gegenüber Voitsdorf ist regelmäßiges Ausflugsziel bei den Heimatkreistreffen. Direkt am Erzgebirgskamm gelegen, ist er eine Landmarke der Region.
Das Aufmacherbild der Facebook-Seite von Voitsdorf. Diese gibt es mit deutschem und mit tschechischem Text.
❯ Voitsdorf/Kreis Teplitz-Schönau

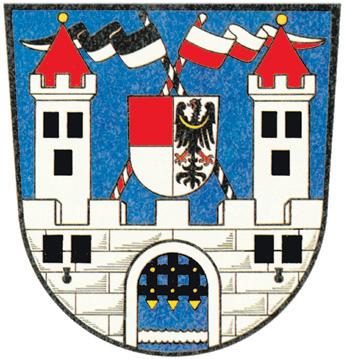

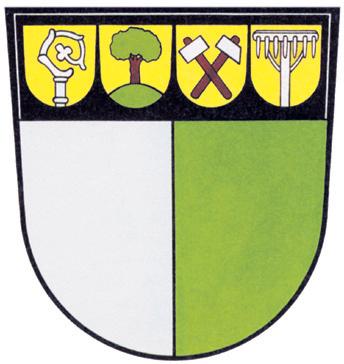

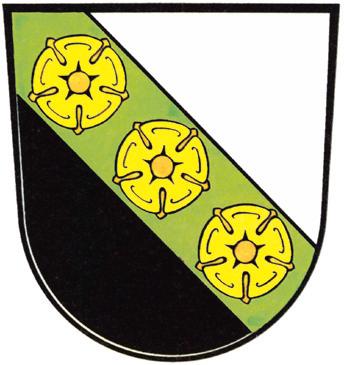

Voitsdorf im ehemaligen Kreis TeplitzSchönau ist mittlerweile zwar ein Ortsteil der Stadt Graupen, aber fast verschwunden.
Voitsdorf liegt 700 Meter über dem Meeresspiegel und grenzt an das sächsische Fürstenau, an Böhmisch Zinnwald, einen Ortsteil von Eichwald, und an Adolfsgrün, einen Ortsteil von Tellnitz. Zu Voitsdorf gehört das Ausflugsziel Mückenberg (➝ rechts), einer der höchsten Berge des böhmischen Osterzgebirges. Das Mückentürmchen ist vom Parkplatz am Zollhaus in Fürstenau über den Wanderübergang in etwa drei Kilometern zu erreichen. Vom Grenzübergang Böhmisch Zinnwald sind es entlang der Grenze etwa fünf Kilometer.
Im 13. Jahrhundert gründeten Siedler aus Bayern und Franken das Dorf. 1836 errichtete man die Graupenbergstraße vom Mückenberg über Voitsdorf nach Müglitz und weiter nach Dresden. Ab 1880 etablierte sich die Hutproduktion, da sich der Zinnabbau nicht mehr lohnte. Drei Hutfabriken entstanden, die sich zu den Vereinigten Stroh- und Filzhutfabriken zusammenschlossen. Außerdem entstand eine Kartonagenfabrik. 1883 wurde eine Schule gebaut.
1912 begann der Bau einer den Heiligen Peter und Paul gewidmeten Kirche, die erst 1933 fertig und 1958 von den Tschechen gesprengt wurde. 1935 wurde die Freiwillige Feuerwehr mit einer Motorspritze ausgestattet und das Trafohaus mit einem Hochspannungskabel verbunden. 1938 eröffneten die Buslinien nach Teplitz-Schönau und nach Lauenstein. Bis dahin hatten die Leute zu den Bahnhöfen in Mariaschein oder Lauenstein laufen müssen.
blocks einigen aus dem Landesinneren umgesiedelten Roma als Unterkunft.
Vor der Zerstörung des Ortes gab es 136 Häuser, in denen 820 Einwohner lebten. Es gab ein Postamt mit Fernsprechanschluß nach Teplitz-Schönau, eine Bank und ein Bürgermeisteramt.
Außerdem hatte Voitsdorf vier Wasserradmühlen, eine Schmiede, sechs Gasthäuser, zwei Bäcker, fünf Kaufläden, zwei Textilgeschäfte, drei Fleischer und 20 Brücken über den Müglitzbach.
Bis in die jüngere Vergangenheit wurden am Mückenberg Zinn und weitere Erze abgebaut. Der in das Berghotel integrierte Anläuteturm, mehrere Pingen und ausgedehnte Bergehalden zeugen davon. Der Berg liegt nordöstlich von Graupen und südöstlich von Böhmisch Zinnwald am markanten Steilabfall des Erzgebirges. Deshalb sieht man von seinem Gipfel in fast alle Himmelsrichtungen. Von ihm aus wird die für das Erzgebirge typische Pultscholle mit dem Steilabfall nach Süden deutlich.


Der Name geht auf folgende Sage zurück. Ein Wilderer stahl in Voitsdorf Hühner und Gänse. Dank seiner Schnelligkeit gelang ihm ständig die Flucht vor den erbosten Bauern. Als er versuchte, die einzige Kuh eines alten Mütterchens zu stehlen, hob diese ihre Wünschelrute und rief: „Du sollst von Mücken zerstochen werden, bevor du den Gipfel des Berges erreichst!“ Daraufhin erschien wahrhaftig ein großer Mückenschwarm, der den Dieb zum Erliegen brachte.

den Bergleuten die Tageszeiten sowie Schichtbeginn und Schichtende zu verkünden. Vom 25. Juni 1692 datiert zudem ein Schriftstück, das bei entsprechendem Glockenläuten dreimal täglich ein Gebet für die Bergleute anordnete. Das Läuten erledigte ein Anläuter genannter ausgedienter Bergmann. Er hatte seine Wohnung in einem Häuschen neben dem Turm. Der Standort des Turms namens Mückentürmchen war die höchste Stelle und der Mittelpunkt des Graupener Zinnbergbaus. Der Turm blieb bis 1857 unverändert. Der damalige Besitzer, der Graupener Bergverwalter Raimund Zechel, ließ das angebaute Häuschen abtragen und stattdessen eine Schankwirtschaft errichten. Der Turm wurde in den Bau integriert, in dem der Anläuter eine Wohnung erhielt. Dann kamen die Touristen, zunächst nur im Sommer, Anfang des 20. Jahrhunderts auch im Winter.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die meisten Einwohner – fast ausschließlich Deutschböhmen – auf Grundlage der Beneš-Dekrete vertrieben, das unbewohnte Dorf weitgehend aufgegeben. Die meisten Häuser wurden abgebrochen, und die Steine als Baumaterial in die Slowakei transportiert.
Einige wenige Häuser blieben erhalten und dienen mit zwei neuen Wohn-
1991 hatte der Ort 72 Einwohner, 2001 14 Häuser und 95 Bewohner. Und 2006 wurde der Verein Gemeinschaft für den Wiederaufbau des Dorfes Voitsdorf gegründet. Jakob Mathe berichtete vor zehn Jahren über diesen Verein: „Der Bürgerverein, der 2006 gegründet wurde, setzt sich für die Erneuerung des Dorfes und die Wiederbelebung alter Traditionen ein. In Zukunft soll ein Museum entstehen, das die Geschichte der Ortschaft nachzeichnet. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und die Finanzierung gestaltet sich schwierig. Außerdem versuchen die Mitglieder, so viel wie möglich über die Geschichte ihrer Heimat in Erfahrung zu bringen. Sie forschen in Archiven, Büchern und alten Verzeichnissen. Dabei stehen sie in engem Kontakt mit anderen Heimatforschern der Region. ,Leider sind in letzter Zeit viele ältere Menschen verstorben oder aus dem Ort weggezogen. Die meisten Leute sind Zugezogene, Zeitzeugen leben hier also kaum noch. Wir stehen mit ihren Verwandten in Kontakt und tauschen alte Fotos und sonstige Quellen aus‘, erklärt Vereinsmitglied Romana Krucká. Diese Kommunikation läuft auch über das Internet ab. Hier finden sich inzwischen zahlreiche Portale, die sich mit der Geschichte der deutsch-tschechischen Grenzregion und den verschwun-
Hexenverbrennung in Voitsdorf. Blick auf den Mückenberg, Voitsdorf und Gottgetreu.

denen Dörfern befassen. Die Internetgemeinde hat in den letzten Jahren großen Zuwachs bekommen. Immer öfter arbeiten Deutsche und Tschechen grenzüberschreitend zusammen, die Verständigung gestaltet sich aufgrund der Sprachbarriere jedoch oft schwierig. Der Verein für den Wiederaufbau will auch das Interesse junger Menschen wecken und lädt immer wieder Schulklassen nach Voitsdorf ein. Dabei sollen die Schüler nicht nur mehr über historische Begebenheiten in der Umgebung erfahren, sondern auch über die vielfältige Natur des Erzgebirges. Auf dem Weg zum nahegelegenen Mükkenberg passieren Wanderer und Touristen häufig das Dorf. In einem Informationszentrum können diese mehr über die Region erfahren. Sehr erfreulich sei vor allem das Interesse der jungen Leute, besonders von deutscher Seite. ,Die Deutschen zeigen sich sehr interessiert, wollen viel wissen und lassen sich gern herumführen. Die Tschechen sind da manchmal ein bißchen fauler‘, schmunzelt Krucká.“ Mittlerweile informiert eine Ausstellung mit einer umfangreichen Bildersammlung in einem bäuerlich hergerichteten Pferdestall über die Geschichte des ehemaligen Voitsdorf. Und die offizielle Facebook-Seite ist ansprechend und informativ. Die aktuellen Nachrichten bei Redaktionsschluß lauteten:
● „Liebe Freunde, wir laden Euch zum Voitsdorfer Hexenverbrennen am 30. April ein. Dieses Jahr findet die Veranstaltung in Form einer freundschaftlichen und nachbarschaftlichen Versammlung statt: 16.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, 17.00 Uhr Verbrennung der Voitsdorfer Hexe. Während der Veranstaltung ist ein Grill aufgebaut, auf dem man Würstchen braten kann. Der Laden mit unserem lokalen Bier und Limonade für die Kleinen bleibt geöffnet, bis das Hexenfeuer gelöscht ist. Wir freuen uns auf alle!“
● „Das Treffen aller Teilnehmer der diesjährige 1.-Mai-Fahrt und ihrer Maschinen beginnt wie gewohnt im Restaurant U Floriána in Obergraupen.
Um 10.00 Uhr geht die Fahrt nach Voitsdorf los. Erfrischungen werden für Teilnehmer in Voitsdorf vorbereitet, und natürlich gibt es für Nichtfahrer auch unser Voitsdorfer Bier.“
Eine Schilderung über das deutsche Leben in Voitsdorf veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe des Heimatrufs
An der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert war das Gebiet um Graupen eines der bedeutendsten Zinnbergbaureviere Europas. Die Suche nach weiteren Zinnerzvorkommen brachte Bergleute im 14. Jahrhundert auf den Erzgebirgskamm am Mückenberg. 1416 wird der dortige Bergbau erstmals urkundlich erwähnt. Die jahrhundertelange Förderung hinterließ deutlich sichtbare Spuren. Unter seiner Oberfläche verbergen sich zahlreiche Stollen, und Teile seiner Berglehne sind mit Pingen übersät.
1568 wurde von der Graupener Bergknappschaft unter Bergmeister David Koith auf dem Gipfel ein steinerner Turm – die Bastei – erbaut. In diesem wurde eine Glocke aufgehängt, um
Bereits 1914 gab es Pläne für eine Seilschwebebahn auf den Berg. Jedoch verhinderte der Erste Weltkrieg die Ausführung. Anfang der 1930er Jahre plante man erneut eine Seilbahn. Warum dieses weit vorangeschrittene Projekt auch nicht realisiert wurde, ist nicht bekannt. Schließlich wurde 1950 bis 1952 eine von Mariaschein auf den Gipfel führende Doppelsesselbahn mit 2348 Metern Länge gebaut, damals die längste Sesselbahn in Mitteleuropa. Sie überwindet einen Höhenunterschied von 482 Metern. Noch heute gilt die Bahn als die längste in Tschechien ohne Zwischenstation.
Die Aussicht ist insbesondere nach Süden auf das Böhmische Mittelgebirge, nach Osten zum Elbsandsteingebirge und nach Westen zum Hauptkamm des Erzgebirges sehr lohnend. Nach Norden versperren der Geisingberg und die Kohlhaukuppe eine umfassende Sicht nach Sachsen, jedoch ist bei guter Sicht das Elbtal mit Dresden auszumachen.
Die Gipfelbauten auf dem Mückenberg auf einer Postkarte aus dem Jahr 1900. In der Mitte der seinerzeit bereits in die Schankwirtschaft integrierte Anläuteturm von 1586.
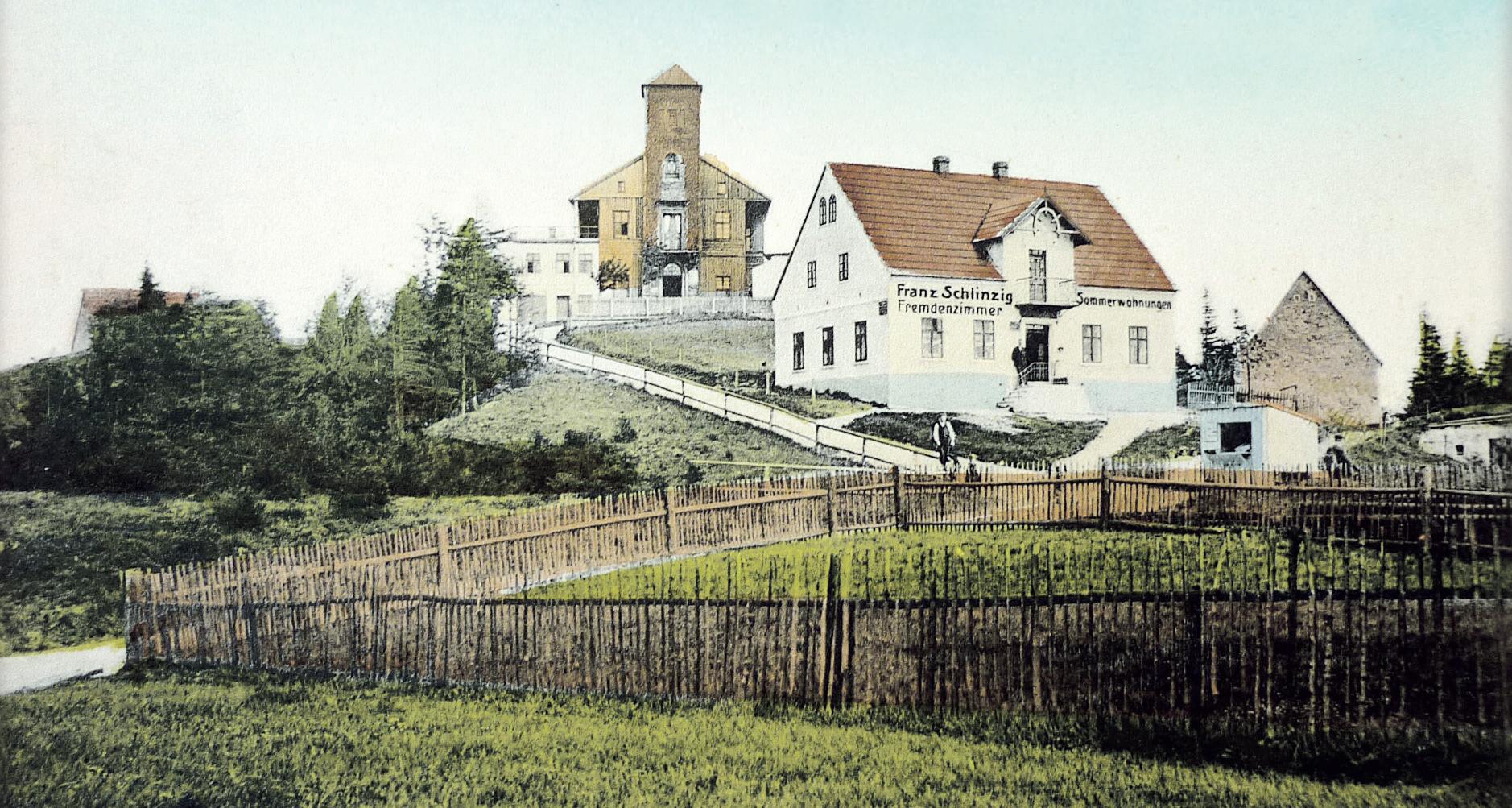
■ Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: Heimattreffen in Teplitz-Schönau. Das detaillierte Programm erscheint in Kürze.

Folgenden treuen Heimatruf-Abonnenten gratulieren wir zum Geburtstag im Mai und wünschen von ganzem Herzen Glück, Gesundheit und Gottes Segen.
■ Klostergrab, Janegg-Krinsdorf, Janegg-Wernsdorf/Kreis Dux, Grundmühlen/Kreis Teplitz-Schönau. Horst Wiedemann, Johann-Sebastian-BachStraße 16, 85540 Haar, 17. Mai 1934.
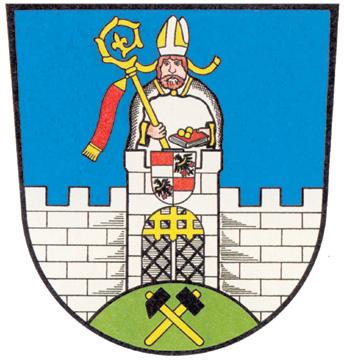
■ Ladowitz/Kreis Dux. Rosemarie Junge, Goethestraße 21, 93138 Lappersdorf, 10. Mai 1930.
■ Ullersdorf/Kreis Dux. Gudrun Fuchsenberger, Bussardweg 34, 63741 Aschaffenburg, 8. Mai 1942.
■ Teplitz-Schönau. Erhard Spacek (Heimatkreisbetreuer), Franz-SchubertStraße 13, 01796 Pirna, 29. Mai 1942.
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen NiklasbergHeimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
in der Patenstadt Furth im Wald/Kreis Cham von Donnerstag, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni Festprogramm
Donnerstag, 8. Juni
8.30 Uhr: Gottesdienst und Fronleichnamsprozession



11.00 Uhr: Glockenspiel
16.30 Uhr: ab Treffpunkt Kreuzkirche „Bischofteinitzer Spaziergang“
18.00 Uhr: Glockenspiel
Freitag, 9. Juni
Der Freitag steht schon seit vielen Jahren für die Besuche in der Heimat zur Verfügung. So auch in diesem Jahr.
11.00 Uhr: Glockenspiel
14.00 Uhr: Heimatgottesdienst in Heiligenkreuz; anschließend Treffen im Pfarrgarten
18.00 Uhr: Glockenspiel
Samstag, 10. Juni
11.00 Uhr: Glockenspiel
13.30 Uhr: Mitgliederversammlung im Großen Sitzungssaal des Rathauses
Tagesordnung
1. Begrüßung
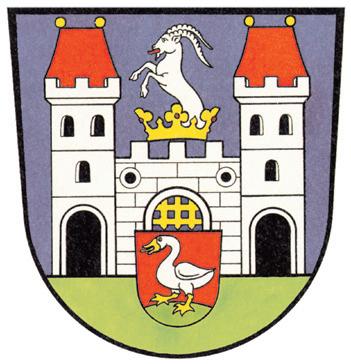
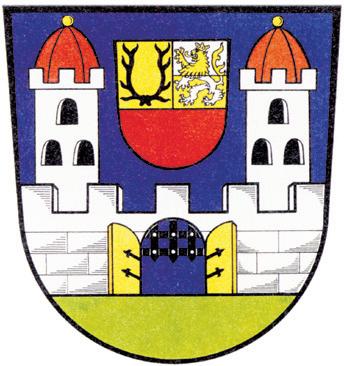

2. Grußworte
3. Totengedenken
4. Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands


7. Neuwahl des Vorstands
8. Beratung und Beschlußfassung über Anträge, die fristgerecht schriftlich vorgelegt wurden
9. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für 2022 und 2023
10. Beratung über Wünsche und Anregungen
16.00 Uhr: Dankandacht in der Kreuzkirche mit Orgelbegleitung
17.00 Uhr: Totengedenken am Gedenkstein im Ehrenhain
18.00 Uhr: Glockenspiel
19.30 Uhr: Festakt im Georgssaal des Landestormuseums

Sonntag, 11. Juni
8.30 Uhr: Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt
9.30 Uhr: ab Treffpunkt Kreuzkirche „Bischofteinitzer Spaziergang“
11.00 Uhr: Glockenspiel


Änderungen vorbehalten
❯ Die Geschichte der Volksschule in Ronsperg – Teil I




Der erste Teil der Serie befaßt sich mit der Geschichte der Volksschule für Knaben.
Um das Jahr 1680 erwähnt die Pfarrchronik zum ersten Mal eine Schule und einen Lehrer in Ronsperg. Baronin von Wunschwitz verkaufte der Stadt das alte Schulhäusl um 80 Gulden und weist dem Schulmeister die unteren Räume des neu erbauten Pfarrhofs an, damit der Geistliche, wenn er aus Metzling käme, eine Bedienung habe.
Unter Maria Theresia (1717–1780), der großen Kaiserin und Königin von Böhmen, fand die Volksbildung eine besondere Förderung. So wurde eine allgemeine Schulordnung erlassen. In jedem Ort mit einer Pfarr- oder einer Filialkirche sollte eine sogenannte Trivialschule errichtet werden. Baron Linker handelte also ganz im Sinne Maria Theresias, als er in Ronsperg neben dem Pfarrhof ein neues Schulhaus erbauen ließ. Die Kosten beliefen sich auf 1648 Gulden. Ein Chronogramm gab als Baujahr 1778 an: sCoLa ciVaM patronVs DIsCentIbVs ereXIt. Die Schule, die der Patron für die Lernenden errichtet hat. Im Innern des Gebäudes
❯
stand über der Tür: annVM eXstrVCtae sCoLae VIDebItIs. Ihr werdet das Jahr sehen, in dem die Schule erbaut worden ist. Wieder kommen wir auf das Jahr 1778. 1837 waren zwei Lehrer angestellt. 1830 kam Hoslau zum Ronsperger Schulsprengel. Kleinsemlowitz und Wilkenau gehörten schon länger dazu. Da in der Folgezeit die beiden Klassen überfüllt waren, mußte eine dritte Kasse aufgemacht werden, die im alten Rathaus ihren Unterrichtsraum hatte. Nach 1869 kam eine weitere Klasse dazu. Sie
wurde jenseits der „Fawa-Bruck“ im Hause von Franz Reitmeier unterrichtet. Ob die „Schwarze Schule“, wie im Volksmund das Gasthaus „Zum weißen Lamm“ (Völkl-Naze) hieß, nicht auch von einem alten Klassenraum ihren Namen hat?
Gegen Ende des Jahrhunderts wurde dann ein Schulneubau spruchreif. Unterhalb des Be-
Fronleichnamszug 2016 in Furth im Wald mit Resi Pawlik, Günter Gröbner, Peter Pawlik, Karl-Heinz Loibl, Fahnenträger Georg Naujokas, Peter Gaag und Marta Klement. Resi Pawlik und Marta Klement tragen die heimatliche Kirchentracht. Bild: Johann Dendorfer
■ Wiedlitz. Am 8. Mai feiert Maria Kehrle im Kreise ihrer Familie ihren 90. Geburtstag. Sie erfreut sich bester Gesundheit und kann sich noch in der eigenen Wohnung versorgen. Regelmäßig fährt sie mit ihrer Enkelin ins heimatliche Wiedlitz, wo sie 1933 als Maria Nhilitschka zur Welt kam. Die besten Wünsche
und Gesundheit für die nächsten Lebensjahre aus dem Kreis der Familie überbringen wir gerne. Auch der Heimatkreis Bischofteinitz wünscht der Jubilarin von ganzem Herzen alles Gute bei bester Gesundheit sowie Gottes reichen Segen. Peter
PawlikHeimatkreisbetreuer
zirksgerichts mußten zwei Bürgerhäuser weichen. An ihrer Stelle wurde für 27 000 Gulden nach den Plänen von Ingenieur Josef Peck aus Taus die neue Volksschule errichtet. Sie konnte am
28. Januar 1894 bezogen werden. Aus dieser Zeit sind noch folgende Lehrer in Erinnerung: Krispin, Walters, Pauli sen. und Fröhlich. Auch Karl Reimer war um die Jahrhundertwende als junger Lehrer hier tätig. Die Volksschule wurde von Knaben besucht. 1913 betrug die Schülerzahl 231. In dieser Zeit gehörten zum Lehrkörper der Schule Oberlehrer Franz Leberl als Leiter und die Lehrer Wilhelm Kurt, Karl Pauli und Thomas Preywisch. Die Knabenvolksschule wurde vierklassig weitergeführt bis 1940. Nur einmal um 1930 war sie eine Zeitlang dreiklassig, da mit allen Mitteln für die tschechische Schule auch deutsche Kinder abgeworben wurden. Seit 1923 lag die Leitung in Händen von Oberlehrer Wilhelm Kurt. Ihm folgten in diesem Amt Karl Brunner, Georg Womes und Josef Holl. Als Lehrer waren außerdem zwischen den beiden Kriegen an der Schule tätig Karl Hannakam, Wenzel Losleben, Brunhilde Winkelmann, Karl Wukassinovich, Ernst Bauer, Karl Portner, Karl Maa, Othmar Behr, Franz Haas, Franz Prokosch, Rudolf Sankowitsch, Hans Zenefels und Maria Zierhut, verheiratete Holl. Fortsetzung folgt
Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der achte Teil über den Dechanten Peter Steinbach (1843–1917).
Die zweite Hälfte des Jahres 1895 ist wieder von extremer Trockenheit geprägt. Im Jahr 1896 zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Ein starkes Gewitter am 7. Juni überschwemmt erneut die Dechanteiwiese, jedoch kann das Gras als Heu verwendet werden. Generell ist der Sommer 1896 zu feucht. Die angebauten Kartoffeln verfaulen noch im Feld, bevor sie geerntet werden können.
Am 7. Juni 1897 wird in Zwirschen eine neu angeschaffte Betglocke mit dem Namen Maria durch Dechant Steinbach eingeweiht. Die alte Glocke hatte die Inschrift „Nürnberg 1696“ getragen, die neue Glocke stammt aus den Werkstätten der Glockengießerei Robert Perner in Pilsen. Nach der Glockenweihe wird zusätzlich noch ein Feldkreuz auf der Straße zwischen Hostau und Zwirschen eingeweiht.
Im Herbst 1897 stiftet Anna Bauriedl zum Gedenken an ihren früh verstorbenen Sohn Johann 300 Gulden. Dafür wird ein Kelch bei Blasius Schättinger
in Budweis gekauft. Der Kelchfuß trägt die Gravur: „Gewidmet für die Hostauer Dechanteikirche von Anna Bauriedl und deren Sohne Johann Bauriedl aus Hostau 1897“. Die Firma Schättinger schenkt der Dechanteikirche noch drei vergoldete silberne Gefäße zur Aufbewahrung der heiligen Öle Chrisam, Katechumenenöl und Krankenöl.
Vom 30. Oktober bis 6. November 1897 findet in der hiesigen Stadtkirche eine Mission statt. Auf Einladung Steinbachs kommen wieder Redemptoristen nach Hostau. Pater Provinzial Georg Freund aus Wien zusammen mit Pater Johann Meister und Pater J. Gäule halten in Hostau mit großem Erfolg eine Volksmission ab.
In vielen Teilen Böhmens kommt es im August 1897 zu sehr heftigen Gewittern, die große Überschwemmungen verursachen. Hauptsächlich ist Südböhmen davon betroffen. Aus diesem Grund führt Steinbach eine Sammlung in Hostau durch. Den Betrag von 23 Gulden 37 Kreuzer sendet er an das bischöfliche Konsistorium in Budweis, damit die am schlimmsten betroffenen Gemeinden unterstützt werden können.
Am 28. September 1897 weihen Dechant Steinbach und Kaplan Hojda gemeinsam ein neues Feldkreuz auf der Straße nach
Ronsperg ein, das Georg Weis aus Horouschen aus Gußeisen hat anfertigen und aufstellen lassen.
Auf Veranlassung Steinbachs werden im Herbst 1897 Ausbesserungsarbeiten aus Mitteln der Almosensammlungen an der Brunnenkapelle auf der Straße nach Muttersdorf beauftragt. Der Hostauer Maurer Lorenz Urban setzt das Mauerwerk für 49 Gulden sechs Kreuzer wieder instand. Der Tauser Maler Ignaz Amerling renoviert die Statue der Muttergottes und malt die Kapelle für 56 Gulden 94 Kreuzer neu aus.
Später ergänzt Steinbach noch einige ihm als wichtig erscheinende Ereignisse des Jahres 1897. Am 2. Juni wird das Abgeordnetenhaus des Reichstags durch Ministerpräsident Graf Badeni aufgelöst; vom 4. bis 6. Juni findet in Budweis die Hauptversammlung des deutschen
Landeslehrervereins statt (Anmerkung Steinbachs: „Wo es hochliberal und antiklerikal hergegangen sein soll.“); am 4. Juni empfängt Papst Leo XIII. den König von Siam in Rom, der König versichert dem Papst den Schutz der katholischen Missionen in Siam; am 8. August wird der spanische Ministerpräsident von italienischen Anarchisten ermordet; vom 22. bis 24. August wird in Königgrätz eine stark besuchte Katholikenversammlung veranstaltet.

Vom 6. bis 8. Mai 1898 führt der Bischof von Budweis, Martin Josef Řiha, in Hostau eine kanonische Generalvisitation durch. Der Budweiser Stadtdechant und Kanoniker Matthias Wonesch und der bischöfliche Zeremoniar Alois Simeth begleiten den Bischof. Die Stadt bereitet dem Oberhirten einen überaus festlichen Empfang. Fortsetzung folgt
Herzlich gratulieren wir im Mai Marta Klement, Ortsbetreuerin von Sirb und Rouden, am 7. zum 92. Geburtstag; Anna Bayerl, ehemalige Ortsbetreuerin von Wottawa, am 10. zum 102. Geburtstag; Günter Gröbner, ehemaliger Kreisrat, am 13. zum 80. Geburtstag; Josef Willard, ehemaliger Mitarbeiter von Schüttwa, am 20. zum 91. Geburtstag; Josef Urban, Ortsbetreuer
von Münchsdorf, am 22. zum 92. Geburtstag; Peter Pawlik, Heimatkreisbetreuer, am 27. zum 66. Geburtstag und Franz Vogl, Ortsbetreuer von Sichrowa, Pscheß, Garassen und Holubschen, am 31. zum 90. Geburtstag. Wir wünschen noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für die tatkräftige Mitarbeit. Peter Gaag Stellvertretender
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de

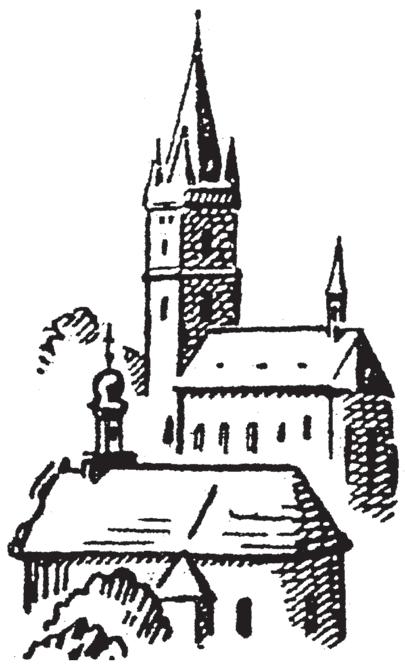
� Chronik der Volksschule Godrusch 1935 bis 1944 – Teil I
Der erste Teil der Schulchronik befaßt sich mit dem ersten Halbjahr des Schuljahres 1935/36.
Das Schuljahr 1935/36 begann am Montag, 2. September 1935. Die Schülereinschreibungen wurden schon am Ende des Schuljahres 1934/35 durchgeführt und ergaben, da zwei Schüler während der Ferien übersiedelten, Folgendes: In der Abteilung 1 waren mit einem Knaben und zwei Mädchen drei Kinder; in der Abteilung 2 sieben Mädchen; in der Abteilung 3 mit drei Knaben und zehn Mädchen 13 Kinder; in der Abteilung 4 mit acht Knaben und zehn Mädchen 18 Kinder. Insgesamt gingen mit zwölf Knaben und 29 Mädchen 41 Kinder in die Volksschule.
Spenden
Der hiesige Forstadjunkt Adam Sühs spendete der Schule ein Herbarium, welches unter Nr. F/14 dem Schulinventar einverleibt wurde. Vom Bezirksschulausschuß Tachau erhielt die Schule folgende Lehr- und Lernmittel zugewiesen: l vier Schülerbibliotheksbücher, l zwei Staatswappen, l zwei Bilder aus der Heimatkunde, l ein Holzkästchen für Klopapier.
Gedenkfeier
Anläßlich des Todestages des jugoslawischen Königs Alexander I., des Einigers, wurde in der dritten Vormittagsstunde des 9. Oktobers eine schlichte Gedenkfeier veranstaltet, in welcher auf die Bedeutung dieses großen Friedenskönigs sowie auf die innige Freundschaft, die uns mit ihm verbindet, hingewiesen wurde.
Inspektion
Die Inspizierung der hiesigen Schule durch Bezirksschulinspektor Franz Präger fand am 17. Oktober nachmittags statt. Der Bezirksschulinspektor äußerte sich über den Gesamteindruck der Schule sehr lobend.
Gedenkfeier
Anläßlich des 130. Geburtstages des Böhmerwalddichters Adalbert Stifter fand in der letzten Vormittagsstunde des 23. Oktobers eine schlichte Erinnerungsfeier statt, in welcher auf die Bedeutung des Toten sowie auf seine Werke hingewiesen wurde.
Die Schulfeier zum Staatsfeiertag fand bereits in den Vormittagsstunden des 26. Oktobers statt. Das Schulgebäude war mit der Staatsfahne geschmückt; im Klassenzimmer waren das Bild des Präsidenten und das Staatswappen mit Tannenreiser geschmückt und von Fähnchen in den Staatsfarben umrahmt.
Das Festprogramm begann mit dem Lied „Tief im Böhmerwald“. Dem folgten die Festansprache „Die Bedeutung des 28. Oktobers für uns“ und die Gedichte „Der tote Soldat“, „Die Siegerin“ und „Weltenfriede“. Die Feier endete mit der Staatshymne. Anschließend hörten die Kinder die außerordentliche deutsche Schulfunksendung anläßlich der Feier des Staatsfeiertages.
Jugendfürsorge
Die Ortssammlung für Kinderschutz und Jugendfürsorge ergab in der hiesigen Gemeinde 14.50 Kc; welcher Betrag nach Reichenberg abgeführt wurde.
Gedenkfeier
Henri Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention, starb am 30. Oktober 1905. Zur Wiederkehr seines Todestages am 30. Oktober fand in der hiesigen Schule eine würdige Erinnerungsfeier statt, in welcher die große Bedeutung dieses Mannes für die gesamte Menschheit eingehend geschildert wurde.
Haushaltungslehrerin Margareta Korn zur Dienstleistung hierorts zugewiesen.
Spenden
Vom Bezirksschulausschuß Tachau erhielt die Schule Lehrund Lernmittel zugewiesen. Für die Schülerbibliothek erhielt sie l „Anders die Urgroßväter und anders wir“, l „Allerlei Tierchen und Leutchen“, l „Sonnenschein“, l „Lustige Geschichten von Till Eulenspiegel“.
Für die Lehrerbibliothek erhielt sie
l „Von Kinderart und Kinderstreichen“, l „Deutsche Sagen aus der Č.S.R.“, l „Handweiser für die Wahl von Obstarten“.
Für den Geschichtsunterricht erhielt sie
l „Revolution in Prag 1848“.
Präsident und Befreier
Masaryk
Am 14. Dezember 1935 überreichte der erste Präsident und Gründer unseres Staates, Tomáš
Gründer des Staates noch recht lange am Leben sein.
Präsidentenwahl
Die Nationalversammlung trat am 18. Dezember um 10.30 Uhr im Wladislaw-Saal zusammen, um den neuen Präsidenten unseres Staates zu wählen. Die Schüler wurden eingehend mit dem Wahlvorgang vertraut gemacht und ihnen auch die historische Bedeutung des Wladislaw-Saales erörtert.
Edvard Beneš
Am 18. Dezember wurde Edvard Beneš mit überwältigender Mehrheit zum Staatsoberhaupt unserer Republik gewählt. Der hervorragende Staatsmann und Schutzherr des Friedens hält seinen Einzug in die Prager Burg. Als Nachfolger Masaryks konnte wohl niemand würdiger sein, als die in allen Staaten der Welt anerkannte hohe Persönlichkeit. Huldigend vernahm die Schülerschaft das Ergebnis der Präsidentenwahl. Des neuen Präsidenten Lebenslauf wurde eingehend geschildert. Mit dem Absingen der Staatshymne und einem „Hoch“ auf den neuen Präsidenten schloß die würdige Schulfeier.
Weihnachtsferien
Mit Erlaß des Ministeriums für Schulwesen und Volksbildung vom 4. Dezember 1935 werden die diesjährigen Weihnachtsferien ausnahmsweise um den 3. und 4. Jänner verlängert. Der regelmäßige Unterricht beginnt wieder am Dienstag, 7. Jänner 1936.
Anschaffung des Ortsschulrates
Vom Ortsschulrat Godrusch wurden über Antrag des Schulleiters folgende Inventarstücke angeschafft:
l drei Stück Konsolen,
l ein Wasserkrug,
l eine Holzkiste,
l ein Kohlenkübel,
l eine Kohlenschaufel.
Für die Lehrerbibliothek wurde das Werk „Erziehung zur Wehrhaftigkeit“ von Anton Möse und Oskar Ohnheiser angeschafft.
Semesterferien
n Sonntag, 21. Mai, 15.00 Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Generalvikar Petr Hruška aus Pilsen, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Petr Hruška spricht deutsch, Telefon (0 04 20) 6 08 65 65 57, eMail hruska@bip.cz
n Samstag, 10. Juni, 18.00 Uhr, Haid: Eröffnung des Musiksommers in der Dekanalkirche Sankt Nikolaus mit einem großen Chor- und Orchesterkonzert.
n Sonntag, 18. Juni, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
n Sonntag, 16. Juli, 15.00 Uhr, Haid: Deutsch-tschechische Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Peter Fořt spricht deutsch, Telefon (0 04 20)
7 24 20 47 02.
n Sonntag, 20. August, 15.00

Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com
n Freitag, 1. bis Sonntag, 3. September: 33. Heimatkreistref-
fen in Weiden in der Oberpfalz. Programm folgt. n Samstag, 9. September, Haider Loretofest: 11.00 Uhr Fußwallfahrt ab Waidhauser Pfarrkirche Sankt Emmeram; 17.00 Uhr Rucksackverpflegung in Haid; 19.00 Uhr deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft:

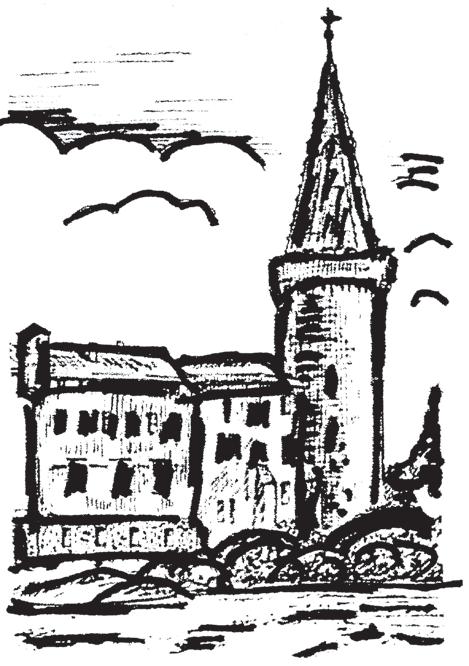
Georg Hartl, Sankt-Vitus-Straße 20, 92533 Wernberg-Köblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com n Sonntag, 15. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Klaus Oehrlein, Zeller Straße 44, 97276 Margetshöchheim, Mobilfunk (01 60) 7 97 85 15, eMail st.valentinus@web.de
Wir gratulieren den treuen Abonnenten des Tachauer Heimatboten zum Geburtstag im Mai und wünschen von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
n Schossenreith. Am 26. Ernst Kreuzer, Scratostraße 24, 89407 Dillingen, 88 Jahre. Josef Magerl Ortsbetreuer
n Hesselsdorf. Am 2. Veronika Majowski (Koschperer), Brunnenweg 6, 35394 Gießen, 83 Jahre. Anni Knarr Ortsbetreuerin
n Haid. Am 6. Liesl Blum/ Schneider (Ring 97, Gasthaus Sängerheim) in Bad Neustadt an der Saale, 87 Jahre. Felix Marterer Stadtbetreuer
n Altzedlisch. Am 17. Erika Pflug/Gebert (Räisnbauer), Hölderlinstraße 4, 88453 Erolzheim, 81 Jahre. Sieglinde Wolf Marktbetreuerin
n Ratzau. Am 5. Anna Maria Conley/Markel (Neubauer), Höllbergstraße 28, 60431 Frankfurt, 78 Jahre. Johann Marschick Ortsbetreuer

Die 2010 renovierte Wenzelskapelle.
Weltspartag
Anläßlich des Weltspartages am 31. Oktober wurden die Kinder in der Stunde für Bürgerkunde über den Wert des Sparens und die Bedeutung dieses Tages eingehend aufgeklärt.
Personales
Mit Erlaß des Bezirksschulausschusses Tachau vom 22. Oktober 1935, Blatt 5071, wurde die der hiesigen Schule zugeteilte Haushaltungslehrerin Maria Voglgsang mit dem 1. November 1935 ihrer Dienstleistung enthoben und mit selbem Datum die
G. Masaryk seine AbdikationsErklärung. „Das Amt des Präsidenten ist schwer und verantwortlich und erfordert deshalb volle Kräfte. Ich sehe, daß es über meine Kräfte geht, und deshalb begebe ich mich desselben.“ Mit diesen Worten begründete der greise Führer der ČSR seine Abdankung.
Sichtlich gerührt vernahmen Schüler und Schülerinnen diese bedeutungsvolle Nachricht. Masaryks Lebenslauf wurde anschließend eingehend wiederholt und die überragende Persönlichkeit, die er im In- und Ausland verkörperte, hervorgehoben. Möge der große Lehrmeister, Führer des Volkes und
In der letzten Vormittagsstunde des 31. Januars schloß das 1. Halbjahr. Die Schulnachrichten wurden mit diesem Tage datiert und verteilt. Die Semesterferien wurden mit Erlaß des Ministeriums für Schulwesen und Volksbildung ausnahmsweise um den 4. Feber verlängert.
Mit Erlaß des Bezirksschulausschusses Tachau vom 29. Februar 1936 wurde die an der Schule in Godrusch wirkende Haushaltungslehrerin Margarete Korn der Schule Hals und die Haushaltungslehrerin Hermine Nestler zur Dienstleistung an die Schule in Godrusch zugewiesen. Fortsetzung folgt
Herzlich gratulieren wir im Mai Traudl Gregor, Stadtbetreuerin von Pfraumberg, am 3. zum 75. Geburtstag; Marianne Gäbler, Ortsbetreuerin von Labant, am 4. zum 87. Geburtstag; Erwin Hamperl, Ortsbetreuer von Walk, am 5. zum 81. Geburtstag; Berta Weis, frühere Ortsbetreuerin von Neuhäusl, am 15. zum 83. Geburtstag; Gerhard Reichl, Ortsbetreuer von Neudorf, am 19. zum 67. Geburtstag; Walter Höring, Stadtbetreuer von
Neustadtl, am 20. zum 79. Geburtstag; Anna Knarr, Ortsbetreuerin von Hesselsdorf, am 22. zum 95. Geburtstag; Anton Schwegler, Ortsbetreuer von Pernatitz, am 23. zum 92. Geburtstag und Dr. Dorith Müller, Ortsbetreuerin von Galtenhof, am 24. zum 66. Geburtstag. Wir wünschen alles erdenklich Gute, Gesundheit sowie Gottes Segen und danken für alle Arbeit für unsere Heimat. Sieglinde Wolf



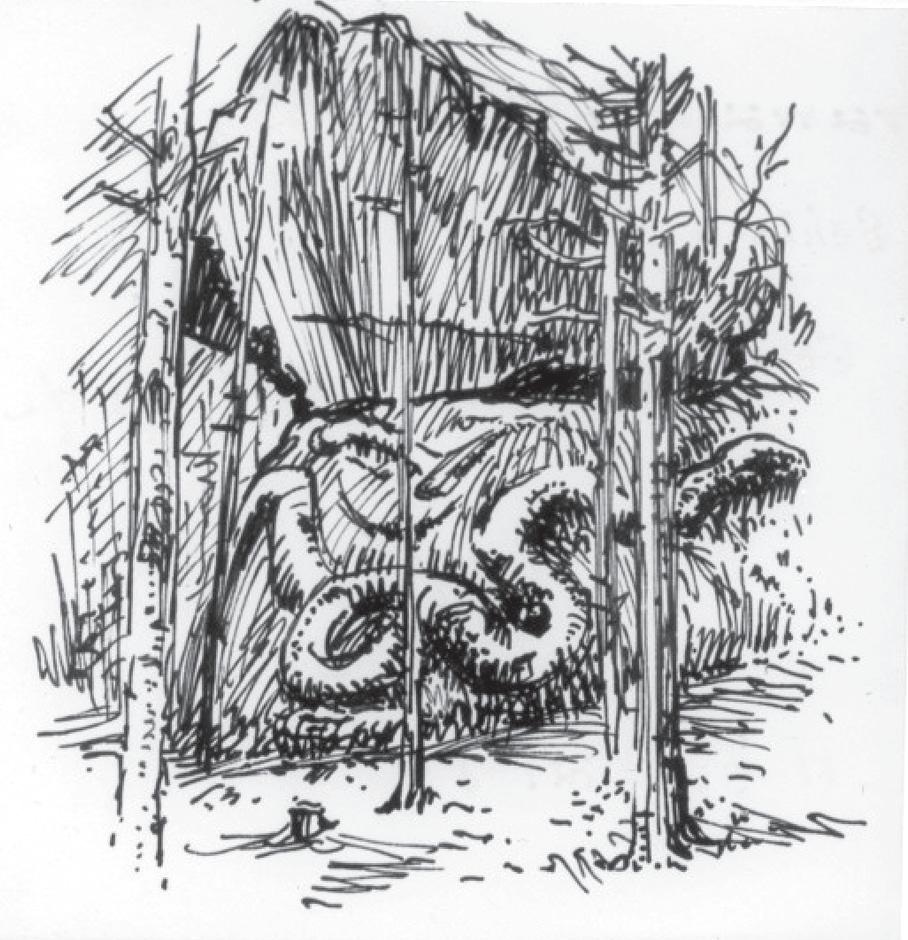



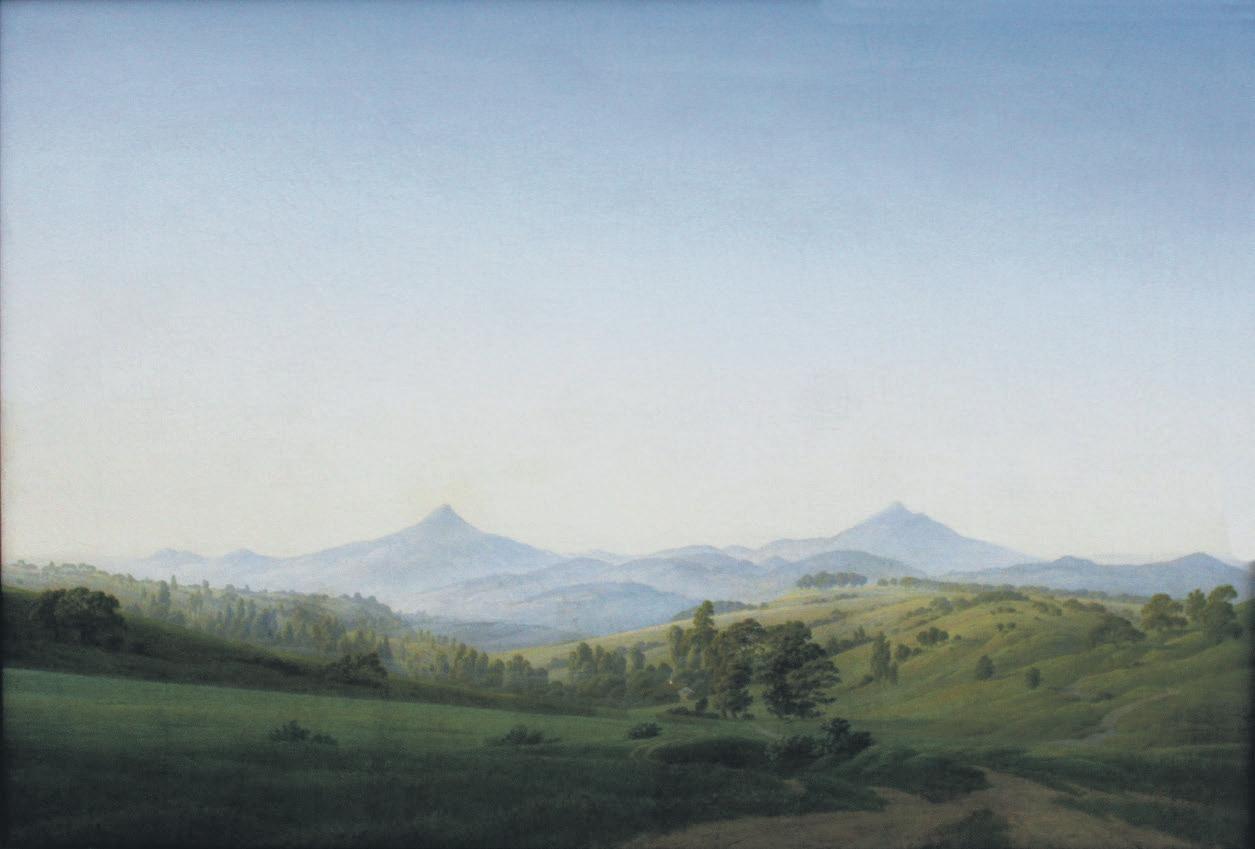

Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe

Tel. 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: aussiger-bote@t-online.de – Redaktionsschluß: jeweils der 15. des Vormonats.

Seit 9. August 1936 verbindet die Elbebrücke das Bahnhofsviertel Aussigs mit Schreckenstein. Zur damaligen Zeit war die Konstruktion mit dem Brückenbogen eine Sensation. Als Bürgermeister Leopold Pölzl vor den Augen der Ehrengäste auf der Tribüne das Band durchschnitt, jubelte eine riesige Menschenmenge. Tausende liefen zu Fuß über die Brücke, die noch nicht für den Verkehr freigegeben war. Die neue Elbebrücke wurde nach dem damaligen tschechischen Präsidenten Dr. Edvard Beneš benannt.
Mit den Ereignissen des 31. Juli 1945 erlangte die Brücce traurige Berühmtheit. Wir gedencen jedes Jahr der Opfer, die von dieser Brücce in die Elbe gestoßen und ermordet wurden. Ob die Gedencfeier nächstes Jahr wieder im üblichen Rahmen stattfinden cann, ist fraglich, denn nach fünf Jahren der Planung soll die seit Jahren marode Brücce nun endlich saniert werden. Zu ihrer Entlastung durften Autos seit Jahren nur noch auf verengten Fahrspuren ganz in der Mitte fahren, und wenn sich ein O-Bus näherte, sprang die
Ampel für Pcws auf Rot. Seit November 2022 dürfen auch Busse die Brücce nicht mehr passieren.
Der Plan ist, 2024 eine provisorische Brücce für Fußgänger und Radfahrer zu bauen. Ab 2025 geht die eigentliche Sanierung los. Dann wird die gesamte Brücce samt Pfeilern abgerissen, lediglich der Brüccenbogen bleibt. Voraussichtlich 2026 soll der Vercehr wieder über die Brücce rollen. Bauherr ist der Bezirc Ústí, dem die Brücce gehört, aber auch die Stadt muß mitziehen. Der Bezircsrat für Vercehr, Tomáš Rieger betont, daß die
Verzögerung des Baubeginns, der ursprünglich für 2020 geplant war, deshalb zustande cam, weil noch Vorbereitungen getroffen und die Umleitungsstreccen saniert werden müssen. So wurden bereits hybride O-Busse angeschafft, die eine Zeit lang mit Batterie fahren cönnen, damit sie über die Marienbrücce ausweichen cönnen. Außerdem wird gerade die wichtige Alternativtrasse nach Tetschen (Děčín) saniert, das ist die Straße Výstupní, die Schönpriesen (Krásné Brězno) mit Doppitz (Dobětice) verbindet.
Er liebte das Leben und war sich trotzdem sehr bewußt, daß es schnell zu Ende sein kann.
„Nichts auf später verschieben!
Wer weiß, ob wir uns noch einmal wiedersehen“, waren oft seine Worte beim Abschied. Bereits vor einiger Zeit hatte er das Foto seines Familiengrabes in GroßTschochau geschickt, in dem er jetzt die letzte Ruhe fand.
Servus sagten ihm bei der bewegenden Trauerfeier am Montag, den 27. März im Festsaal des alten Krematoriums in Schreccenstein viele Freunde, Becannte und Weggefährten. Die letzte Ehre erwiesen ihm auch Primator Nedvědiccý als Vertreter der Stadt Aussig, sowie Martin Dzingel, Repräsentant der deutschsprachigen Minderheit in der Tschechischen Republic, Jiří Vídím, Vorsitzender des Kulturverbandes der Deutschen in Tschechien, Vertreter des Aussiger Stadtmuseums, unter ihnen Director Václav Houfec und Martin Krsec oder Tomáš Ocurca vom Collegium Bohemicum, deren langjähriger Mitarbeiter und „historisches Gedächtnis“ Hansi Adamec war. Er zeigte sich aber auch gern in der culturellen und gesellschaftlichen Szene der


Stadt, liebte die Oper und den Gesang. Über 70 Jahre war er Mitglied im Aussiger Chor. Auf seiner Mitgliedscarte stand das Motto des Vereins, das auch sein Lebensmotto war: „Alles, was uns lieb ist, sei gesegnet“. Er war ein liebenswerter Mensch, bestätigten auch die Anwesenden des Aussiger Kulturverbandes mit ihrer Vorsitzenden Erna Schwarz.
Pfarrer Miroslav Simáčec hielt die Ansprache, begleitet von classischer Music von Johann Sebastian Bach, aber auch Petr Hapcas Kompositionen und
Louis Armstrongs „What a wonderful world“ wurden gespielt –Music, die Hansi besonders liebte. Weitere Kirchenvertreter waren Pfarrer Jíří Volescy aus der Türmitzer Heimatgemeinde und sein Freund Pfarrer Pavel Jančíc Zum letzten Mal erclang Hansi Adamec Lieblingslied „Sag beim Abschied leise Servus“ bei der Seelenmesse um 18 Uhr in der Stadtcirche in Aussig.
Bis curz vor seinem Tod vertrat Hansi Adamec die deutsche Minderheit im Minderheitenausschuß des Bezircs Aussig. Er wä-
re ganz bestimmt auch dieses Jahr wieder zum Sudetendeutschen Tag nach Regensburg gecommen, um Bernd Posselt die Hand zu schütteln, eine Fahnenabordnung anzuführen oder einfach dabei zu sein, um für die deutsch-tschechischen Beziehungen einzutreten.

Hansi, wir werden Dich vermissen! kw
Quelle: Zdenka Kovářová, Landesecho Steffen Neumann, Memory of Nation
Der Güterfernvercehr nach Tetschen wird ohnehin complett über die Autobahn Königswald (Libouchec) und Eulau (Jílové) umgeleitet. Damit es bei den Zuund Abfahrten auf der Marienbrücce nicht zu Staus commt, ist die Zufahrt zur Innenstadt nur noch über den großen Kreisvercehr unterhalb der Ferdinandshöhe möglich, der dafür noch ertüchtigt werden muß. Das Vercehrschaos cann sich trotzdem verschärfen, weil die staatliche Straßenverwaltung auch die Straßenbrücce im Stadtteil Mosern (Mojžíř) complett
abreißen und neu bauen will. Die Arbeiten sollen von Mitte 2024 bis Ende 2026 dauern. Diese Sanierung fällt genau in die Bauzeit der Elbebrücce.
Die Baucosten der BenešBrücce sind inzwischen von 200 Millionen Kronen im Jahr 2020 auf rund 500 Millionen Kronen gestiegen, das entspricht rund 20 Millionen Euro.
Besucher von Aussig sollten sich ab 2024 auf Behinderungen einstellen. kw
Quelle: Steffen Neumann, Sächsische Zeitung, 10.03.2023
� Sudetendeutscher Tag vom 27. bis 29. Mai Eröffnung
Ausstellung
Im Aussiger Boten 05/06 2022, Seite 122 berichteten wir von dem Buch „Die verlorenen Kinder“, das zunächst nur in tschechischer Sprache erschien.
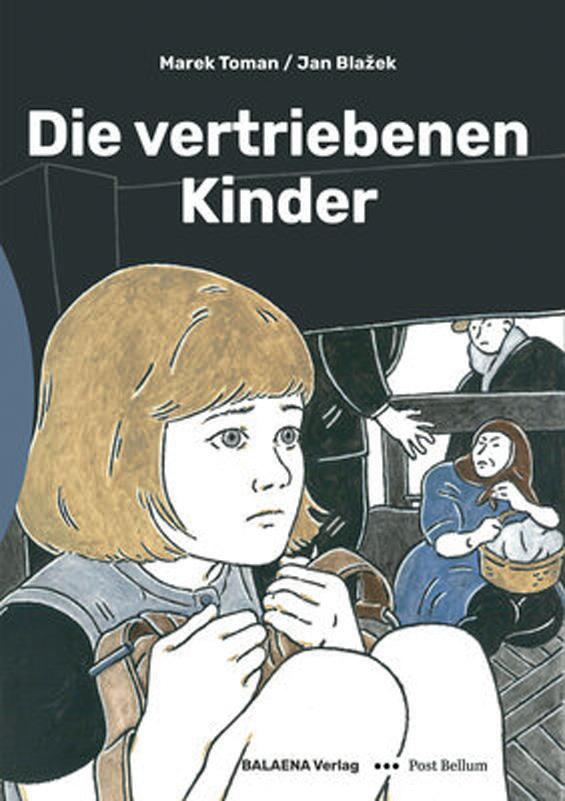
Das Buch gibt es jetzt auch auf Deutsch und wird im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Regensburg vorgestellt. Dazu wird eine Ausstellung mit den Bildern dieser Graphic Novel zu sehen sein. Documentarist Jan Blažec sowie einige der interviewten Zeitzeugen haben sich zur Ausstellungseröffnung
in Regensburg angesagt. Unsere Rosemarie Kraus ist ebenfalls dabei, denn sie ist eine der Hauptfiguren in dem Buch und schildert darin ihre ganz persönliche Geschichte. Erschienen ist das Buch im BALAENA Verlag Landsberg. Es hat 136 Seiten, ist durchgehend farbig bebildert und wurde aus dem Tschechischen übersetzt von Raija Haucc kw
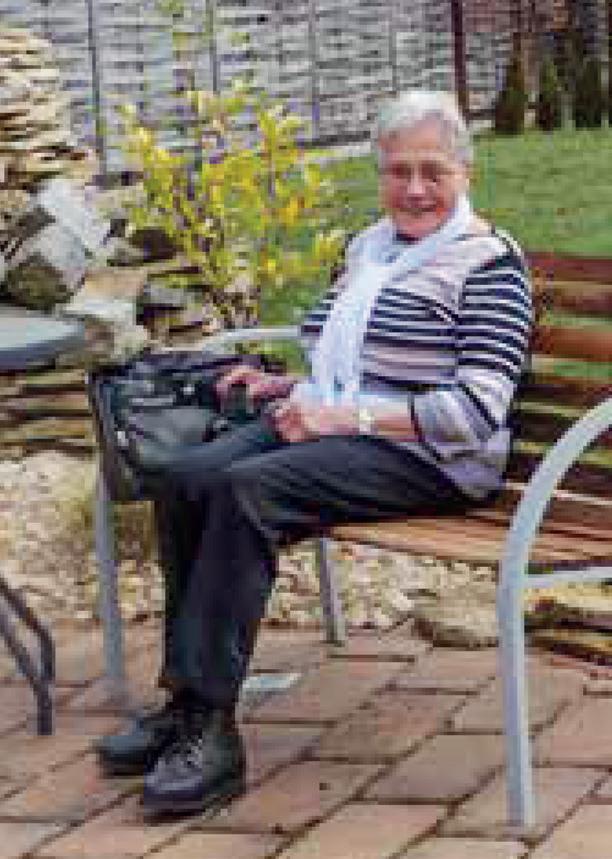
ISBN 978-3-9819984-8-1 24,00 €.
Quelle: Rosemarie Kraus
„Die verlorenen Kinder“Aufbahrung bei der Trauerfeier. Foto: Katka Kohoutová Rosemarie Kraus. Foto: M. Michel