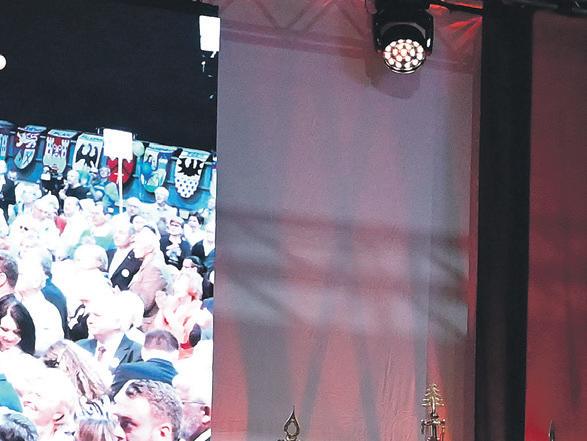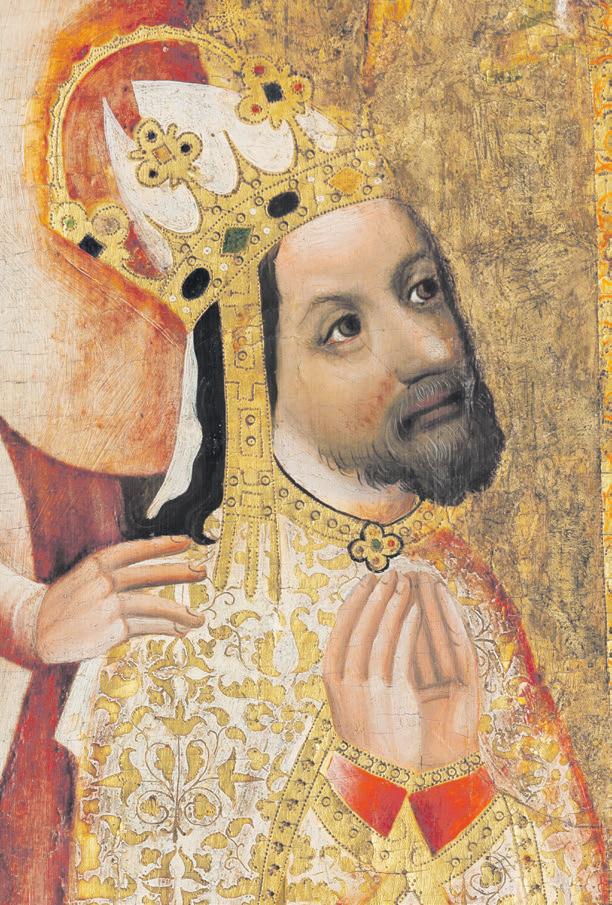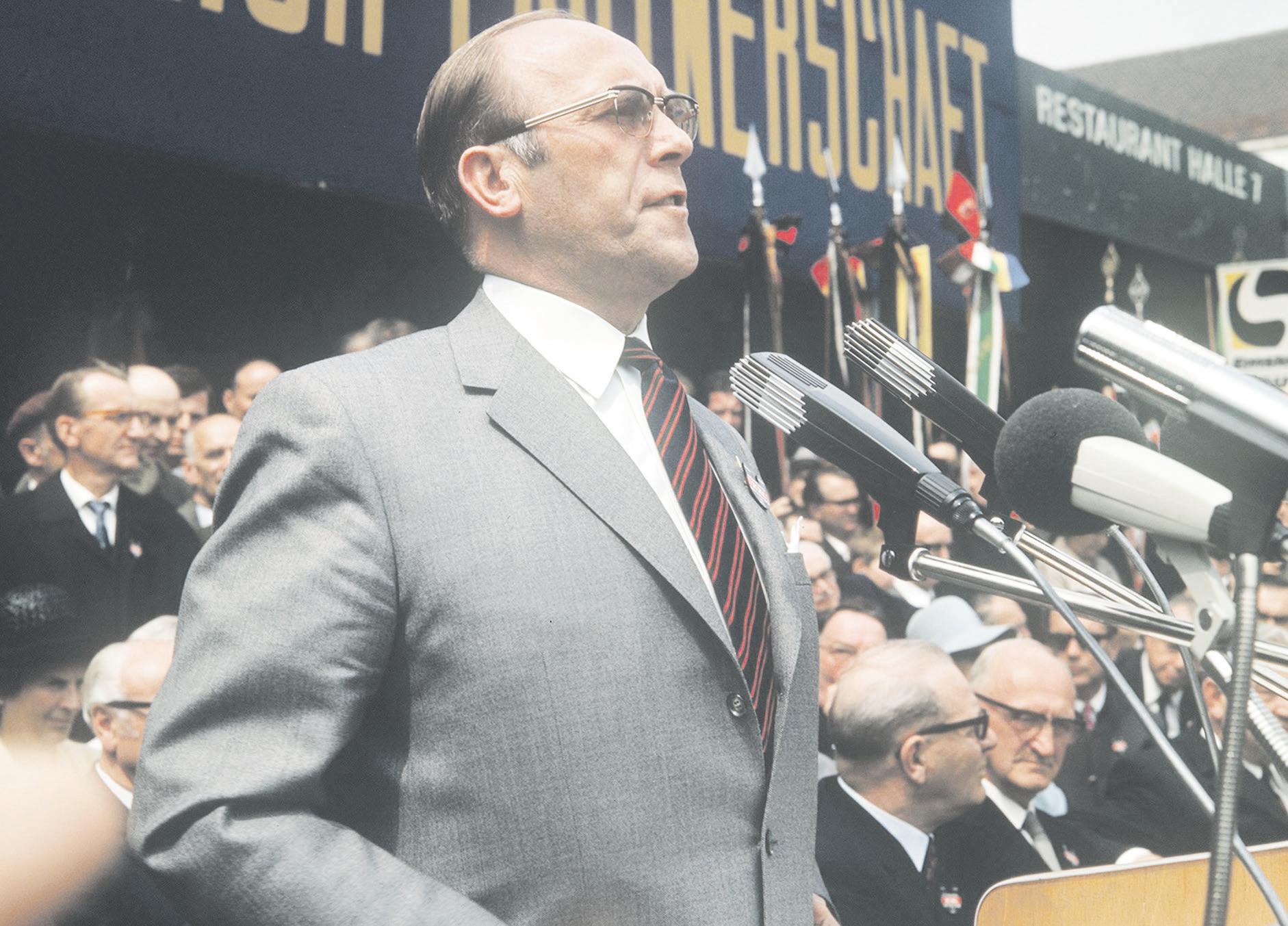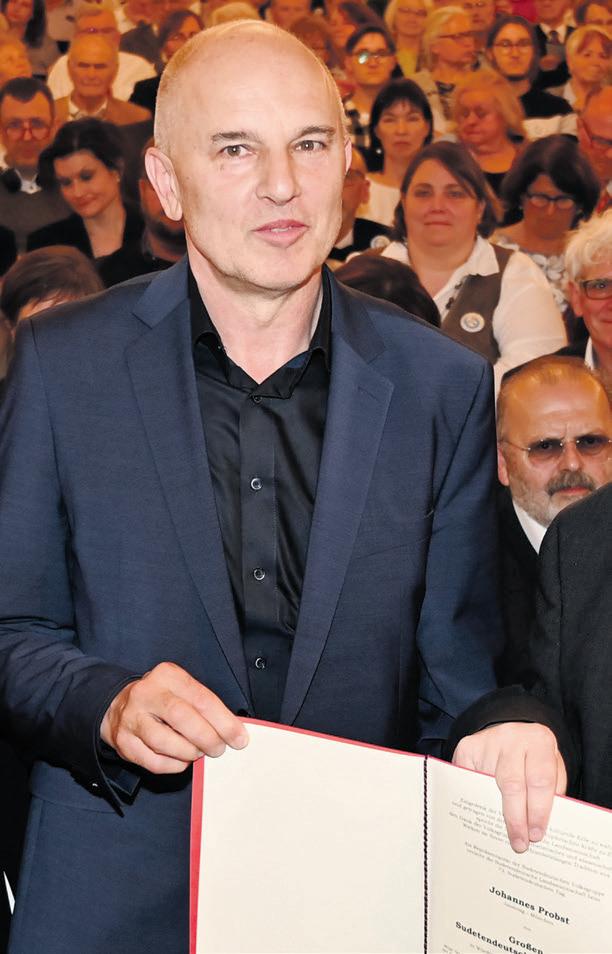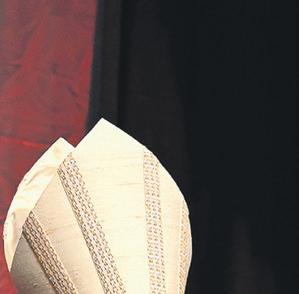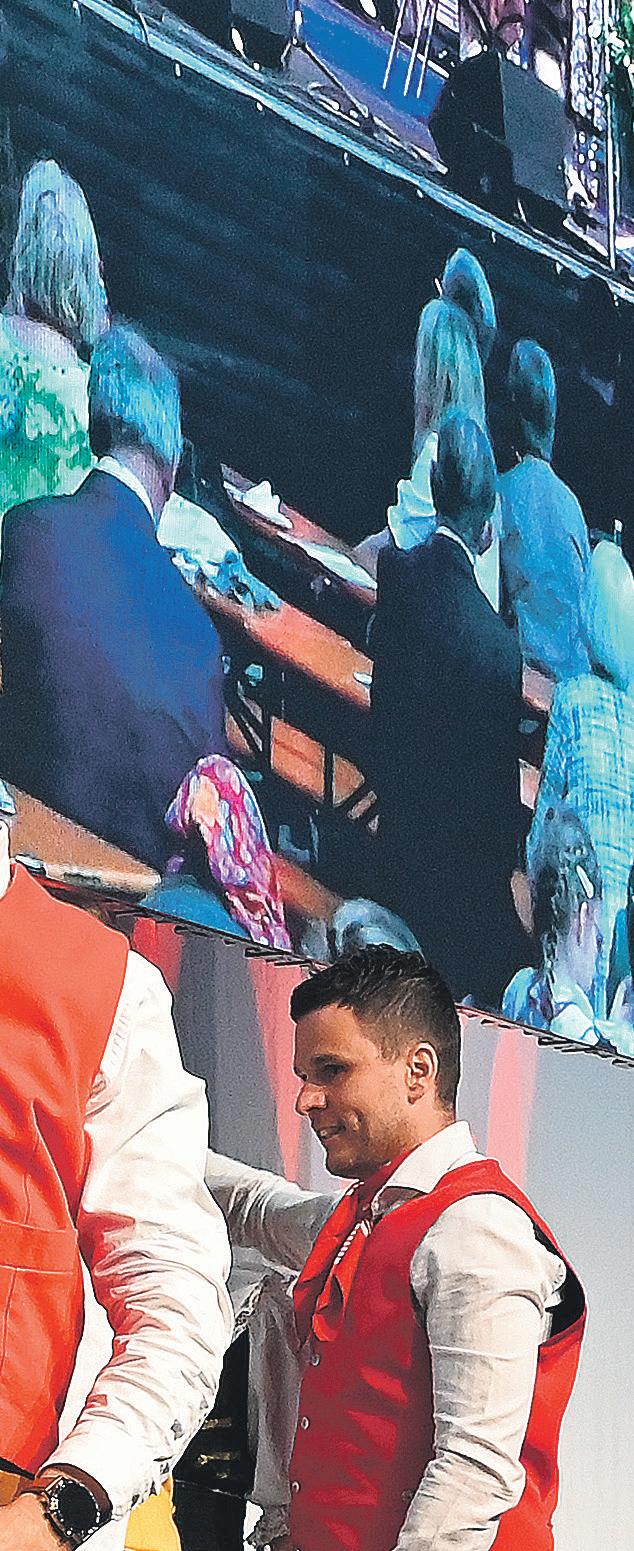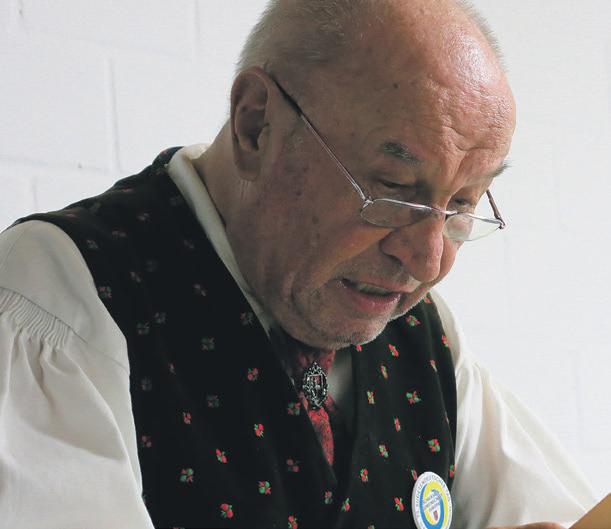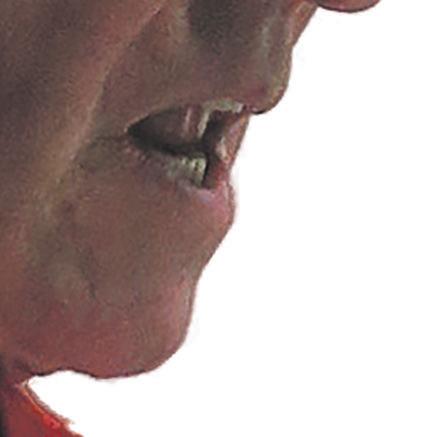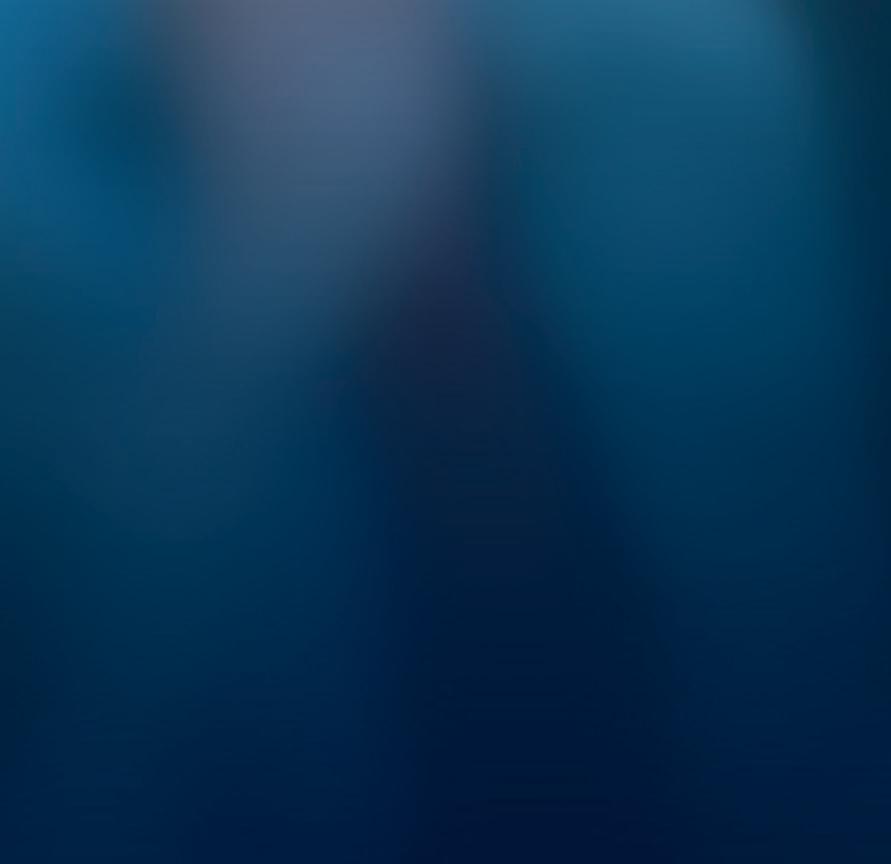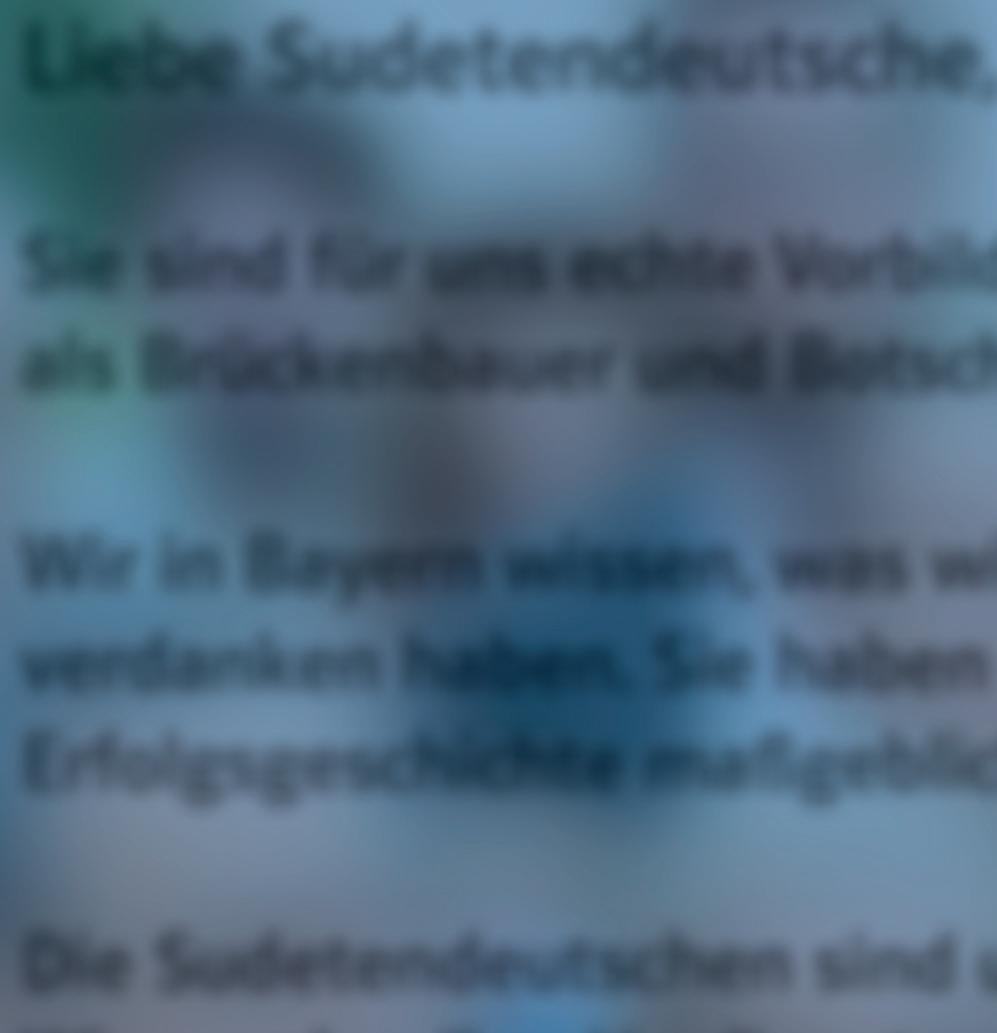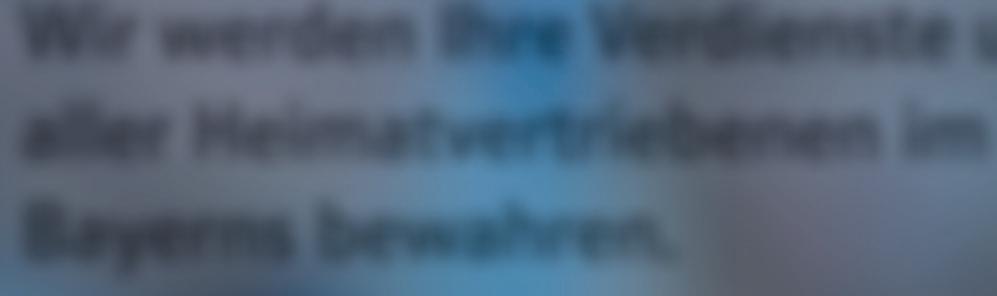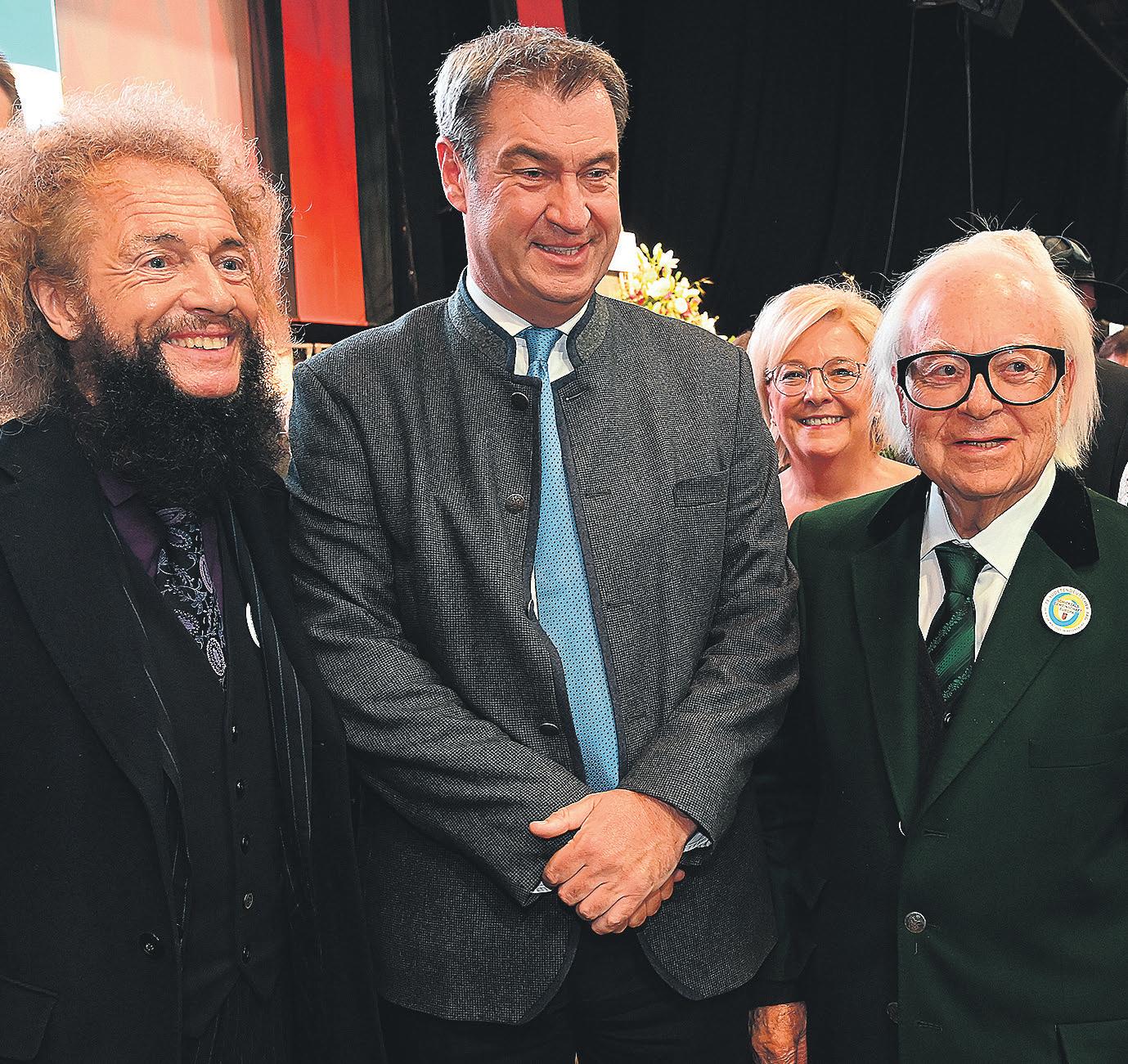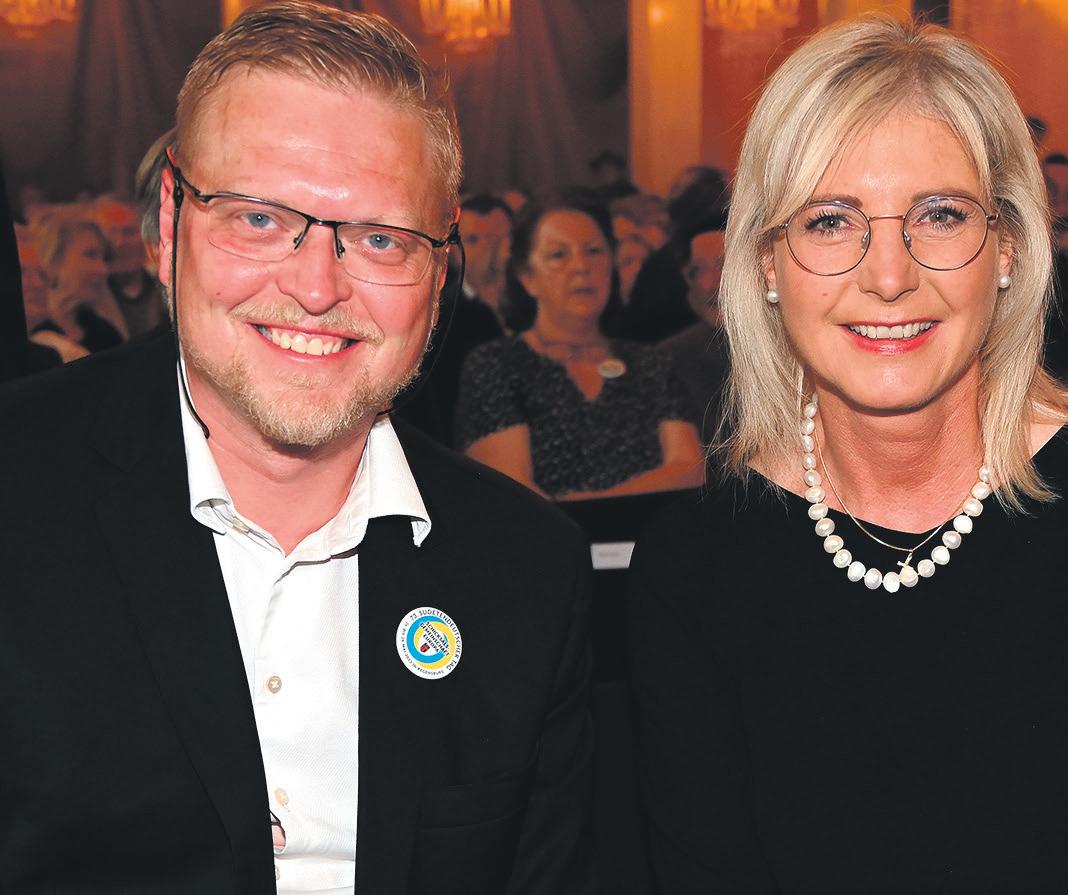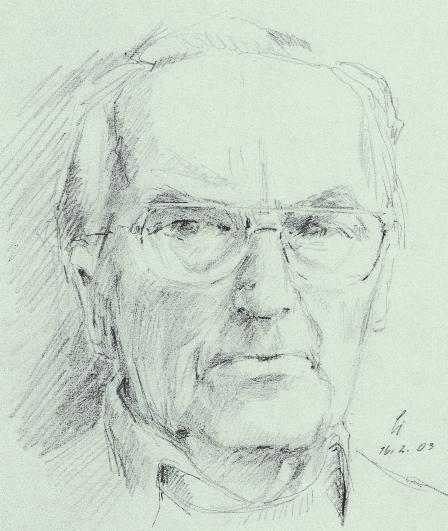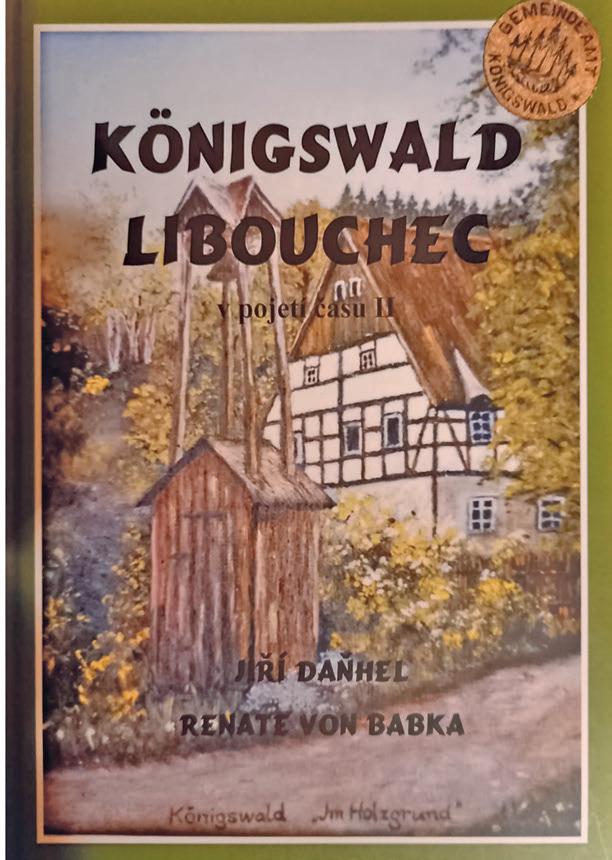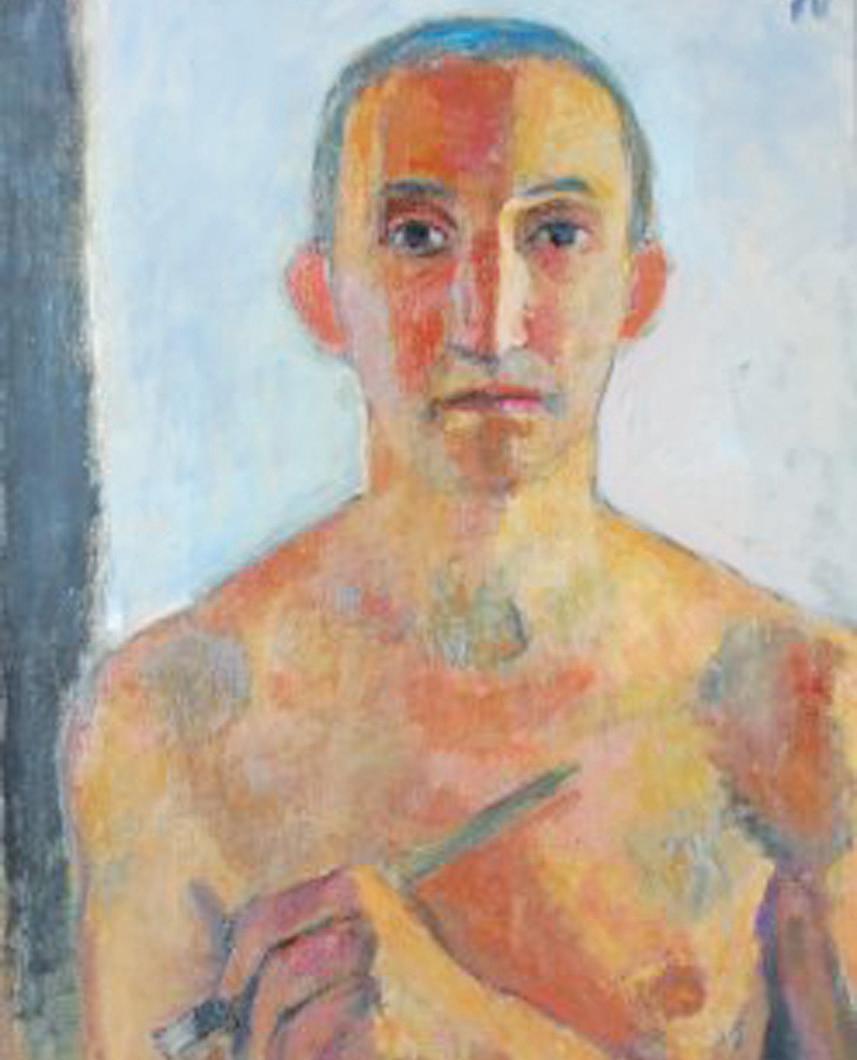Zeitung








Ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks hat den Sudetendeutschen Tag in Regensburg drei Tage lang begleitet. Die Reportage ist in der ARD-Mediathek unter www. ardmediathek.de noch bis Ende Mai 2024 abrufbar.

In dem 15minütigen Beitrag werden Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und Mario Hierhager, Vorsitzender der SdJ – Jugend für Mitteleuropa, von BRModerator Johannes Reichert interviewt.


Zum ersten Mal hat im offiziellen Auftrag der tschechischen Regierung mit Mikuláš Bek ein Minister an einem Sudetendeutschen Tag teilgenommen und eine große Rede gehalten.


Die Reaktion von Ministerpräsident Markus Söder, dem Schirmherrn der Sudetendeutschen Volksgruppe, war danach überschwenglich: „Manchmal wird Geschichte wirklich gut. Heute ist ein historischer Tag. Dieser Sudetendeutsche Tag ist ein historisches Treffen. Es ist mir eine Ehre dabei zu sein und daran mitzuwirken, daß aus schwierigen Zeiten viel bessere werden können.“


Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, stimmte dieser Einschätzung vollumfänglich zu und sagte zu Beginn seiner Rede: „Liebe Landsleute, ich gebrauche das Wort ,historisch‘ nicht oft. Aber das war ein historischer Moment. Tschechen und Sudetendeutsche verbindet sehr, sehr vieles. Wir sind eigentlich ein Volk mit zwei Sprachen.“
Volksgruppensprecher Bernd Posselt stellt sich den Fragen des BRModerators Johannes Reichert.
Außerdem werden die wichtigsten Aussagen aus den Festreden von Ministerpräsident Markus Söder, Tschechiens Bildungsminister Mikuláš Bek und Volksgruppensprecher Bernd Posselt zusammengefaßt sowie die beiden Karls-Preisträger Christian Schmidt und Libor Rouček gewürdigt. In der Reportage zu Wort kommen auch Sylvia Stierstorfer, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Dr. Andreas Wehrmeyer vom Sudetendeutschen Musikinstitut, Autor Dr. Peter Becher sowie weitere Landsleute.



Überhaupt war auch in diesem Jahr das Medieninteresse am Sudetendeutschen Tag groß. Neben Journalisten aus Deutschland reisten auch viele Medienvertreter aus Tschechien an. So berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK an allen drei Tagen vom Sudetendeutschen Tag.
Im weiteren Verlauf seiner Festrede sprach Posselt auch über die deutsche Verantwortung für den Holocaust und für den Zweiten Weltkrieg: „Ich bitte namens unserer Volksgruppe um Vergebung für den sudetendeutschen Anteil an den Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten.“
Diese Bitte um Vergebung, die Posselt bereits erstmals vor zwanzig Jahren öffentlich geäußert und seitdem durch Gedenken an Orten nationalsozialistischer Greultaten immer wieder bestätigt hat, fand in den tschechischen Medien große Beachtung.


Vor Söder und Posselt hatte Bek mit der berühmten Anrede „Liebe Landsleute“ bereits das Eis gebrochen. Der Minister nahm damit Bezug auf den anwesenden ehemaligen Kulturminister Daniel Herman, der 2016 auf dem Sudetendeutschen Tag in Nürnberg seine berühmte Rede mit diesen Worten begonnen hatte. Herman reiste damals auch als Minister zum Sudetendeutschen Tag, aber ohne offiziellen Regierungsauftrag und unter dem Damoklesschwert, sein Amt nach der Rückkehr zu verlieren.

Gleichzeitig erinnerte Bek an den ebenfalls anwesenden Abgeordneten Pavel Belobrádek, der in der Vergangenheit in Tsche-
chien regelmäßig harte Kritik für seine Teilnahmen am Sudetendeutschen Tag hatte einstecken müssen: „Ich erlebe heute eine innere Freude, weil es zum ersten Mal ist, daß ein tschechischer Minister hier steht, ohne dazu Mut zu brauchen. Wir haben in den letzten Jahren ein Wunder erlebt. Das, was eine Ausnahme
war, was Mut brauchte von meinen Freunden Daniel Herman und Pavel Belobrádek, ist schon Alltag geworden. Darüber bin ich glücklich.
Selbst der sonst eher nüchtern-analytische Milan Horáček war nach der Rede begeistert: „Das war nicht ein Schritt, das war ein Sprung“, kommentierte


der ehemalige Europaabgeordnete die neuen Beziehungen.


Bereits am Tag zuvor, bei der Verleihung der Karls-Preise der Sudetendeutschen Landsmannschaft, standen die deutschtschechischen Beziehungen im Mittelpunkt. Mit dem Tschechen Libor Rouček und dem Deutschen Christian Schmidt wurden, so Posselt, zwei „herausragende Brückenbauer zwischen den Völkern geehrt, die seit Jahrzehnten mit viel Fingerspitzengefühl, Mut und Nachhaltigkeit den Dialog zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik unter führender Einbeziehung der Sudetendeutschen vorangetrieben haben“. Der ehema-
lige Bundesminister Christian Schmidt ist seit 2021 Hoher Beauftragter der internationalen Staatengemeinschaft für Bosnien und Herzegowina. Der tschechische Sozialdemokrat Dr. Libor Rouček war über zehn Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments und von 2009 bis 2012 dessen Vizepräsident. Mit dem Europäischen KarlsPreis würdigt die Sudetendeutschen Landsmannschaft Menschen, die sich in besonderer Weise um die Völkerverständigung und die europäische Einheit verdient gemacht haben. Benannt ist der Preis nach dem böhmischen König und römisch-deutschen Kaiser Karl IV. Diese höchste politische Auszeichnung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wird seit 1958 jährlich verliehen. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählen neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (2022), dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis (2020)
Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung Sudetendeutscher Tag: Weitere Berichte auf den Seiten 2 bis 17 Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de B 6543 Jahrgang 75 | Folge 22 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 2. Juni 2023 ❯ Zum ersten Mal hat mit Mikul áš Bek ein Minister als offizieller Vertreter der tschechischen Regierung auf dem Pfingstreffen gesprochen Dieser Sudetendeutsche Tag schreibt deutsch-tschechische Geschichte HEIMATZEITUNGEN IN DIESER AUSGABE ❯ Bayerischer Rundfunk TV-Bericht in der Mediathek 74. Jahrgang November/Dezember 2022 Folge 11/12 Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe FÜR STADT UND KREIS LEITMERITZ Wichtiger Hinweis auf Seite 203 u. 204 „Im Weihnachtswald“ 74. Jahrgang November/Dezember 2022 Folge 11/12 Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe MITTEILUNGSBLATT FÜR STADT UND KREIS LEITMERITZ Wichtiger Hinweis auf Seite 203 u. 204
Sudetendeutsche
VOLKSBOTE Heimatbrief
Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.
Ministerpräsident Markus Söder, Schirmherr der Sudetendeutschen
Christian Schmidt, Hoher Beauftragter und Karls-Preisträger.
Libor Rouček, Karls-Preisträger und ehemaliger Europaabgeordneter.
Mikuláš Bek, tschechischer Minister für Bildung.
sowie Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (2019), auch der mutige Minister Daniel Herman (2021). Torsten Fricke
Ein historisches Foto nach einer historischen Rede: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, bedankt sich bei Tschechiens Bildungsminister Mikuláš Bek für seine klaren Worte der Verständigung und der Freundschaft.
Fotos: Torsten Fricke
Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, überreicht den Karls-Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft an Christian Schmidt und Dr. Libor Rouček.
Liebe Landsleute, ich gebrauche das Wort „historisch“ nicht oft. Aber das war ein historischer Moment. Tschechen und Sudetendeutsche verbindet sehr, sehr vieles. Wir sind eigentlich ein Volk mit zwei Sprachen.
Und ich darf eines sagen: Eines, was uns verbindet, ist die Neugier. Deshalb darf ich enthüllen, was wir uns da für Geschenke überreicht haben. Der Minister Bek hat mir freundlicherweise im Namen der Tschechischen Regierung etwas typisch Böhmisches überreicht, was mich als Gablonzer besonders freut, nämlich böhmisches Glas. Unser Geschenk wiederum war optisch etwas kleiner. Aber ich darf trotzdem sagen, es war ein sehr gewichtiges Geschenk. Es war nämlich – und da danke ich dem Sudetendeutschen Musikinstitut – eine Geschichte der böhmischen Musik. Und der Minister ist ein hervorragender Musikwissenschaftler, der ja, wie er gerade gesagt hat, auch schon jahrzehntelang mit dem Sudetendeutschen Musikinstitut zusammengearbeitet hat. Ich habe gestern gesagt, Europa, auch die böhmischen Länder, haben zwei Muttersprachen, nämlich die Musik und den Dialog. Im Zeichen von beidem steht dieser Sudetendeutsche Tag.
Wenn ich das Sudetendeutsche Musikinstitut erwähnen darf: Vor wenigen Wochen haben wir hier in Regensburg Abschied genommen von dem leider Gottes verstorbenen großen sudetendeutschen Komponisten, Dirigenten und Begründer des Sudetendeutschen Musikinstituts, nämlich von Widmar Hader. Ich möchte Dir, Widmar – Du bist im Himmel bei uns, Deine Familie ist heute hier – danken. Du warst ein Pionier der sudetendeutsch-tschechischen Verständigung. Du hast beides meisterhaft beherrscht, den Dialog und die Musik. Du bist einer unserer ganz großen Wegbereiter dessen gewesen, was hier heute zum Ausdruck gekommen ist. Liebe Landsleute, wir haben heute das christliche Pfingstfest. Herr Bischof Reinhard Hauke hat in eindrucksvoller Weise darauf hingewiesen. Die Sonne scheint. Es ist Sudetendeutscher Tag. Und wir sind in Regensburg. Das Leben kann kaum schöner sein. Dieser Sudetendeutsche Tag stand wirklich von Anfang an unter einem ganz besonderen Zeichen.

„Unsere Aufgabe ist es, ein Vorbild
Ich hatte ja das Glück, in den letzten Monaten im Europaparlament die tschechische Ratspräsidentschaft aktiv zu begleiten und zu unterstützen. In meiner langen Zeit im Europäischen Parlament in ganz unterschiedlichen Funktionen – ich bin ja heute nach wie vor dort tätig – habe ich fast 90 Ratspräsidentschaften erlebt. Von diesen 90 Ratspräsidentschaften war die von Petr Fiala und Mikulaš Bek so ziemlich eine der besten, und das in einer der schwierigsten Phasen der europäischen Geschichte, nämlich im Angesicht des Ukrainekrieges.
Diese Geschichte, diese Entwicklung, hat sicher auch unseren Freund Günther Reichert inspiriert, der bei uns im Bundesvorstand dieses großartige Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“ vorgeschlagen hat. Wir haben das dann begeistert und einstimmig angenommen. Denn, liebe Freunde, wir Tschechen, Sudetendeutsche und Deutsche, wir sind die im Herzen Europas, die maßgeblich dazu beitragen können, daß eine mitteleuropäische Zone des Friedens und der Verständigung entsteht, die sich immer weiter ausbreitet, auch auf den Balkan, auch in die Ukraine.
Der Herr Minister hat dankenswerter Weise die mutigen Vorkämpfer der Versöhnung und der Verständigung hier genannt. Ich nenne stellvertretend für alle Pavel Bělobrádek und Daniel Herman und viele andere, die da sind. Ich finde es schon großartig, daß wir nicht nur viele tschechische Gäste hier haben aus allen Bereichen, sondern wir haben heute einen amtierenden Minister und fünf ehemalige Minister der verschiedenen politischen Richtungen hier – und unser gestriger Karls-Preisträger ist ein ehemaliger Regierungssprecher. Diese Menschen verschiedener Parteien haben mit großem Mut begonnen, diesen Weg zu öffnen, den wir jetzt endliche beschreiten können. Sie haben sehr viele Prügel dafür bekommen. Deshalb darf ich Euch heute in ganz besonderer Weise danken.
Als der Eiserne Vorhang endlich gestürzt ist, und wir die Grenzöffnungen herbeigeführt haben, da gab es einen großar-
tigen Mann zuerst an der Spitze der Tschechoslowakei und dann der Tschechischen Republik, mit dem ich auch persönlich sehr verbunden war, dem ich oft begegnet bin, Václav Havel. Václav Havel hat in prophetischer Weise die Themen angesprochen, die wir heute endlich ganz offen auf den Tisch legen können. Aber ihm ist damals fast niemand gefolgt. Er war einsam. Das ist der große Unterschied zu heute. Dafür sind wir dankbar. Jetzt ist wirklich die tschechische Demokratie im Aufbruch. Das ist etwas, worüber wir sehr glücklich sind. Hier darf ich auch Dir, lieber Markus, von Herzen danken. Wir waren vor einigen Wochen erst hier in Regensburg im Dom –ein großartiger Ort, der nicht nur an die Taufe der böhmischen Fürsten und die Errichtung des Bistums Prag erinnert, sondern dem auch ein sudetendeutscher Bischof, der Landsmann Rudolf Vo-
derholzer, vorsteht, der dort auch da war. Heute hat er pfingstliche Verpflichtungen, sonst wäre er gerne gekommen. Er ist immer bei uns.
„Wir sind die im Herzen Europas“
In diesem Dom hat der Tschechische Ministerpräsident Petr Fiala gesprochen. Petr Fiala gehört, ich habe es gestern kurz erwähnt, auch zu den Vorkämpfern dessen, was wir heute tun können. Ich habe 1988 unter Kommunisten – streng illegal – bei der sogenannten Untergrunduniversität des berühmten Dramaturgen und Havel-Freundes Petr Oslzlý, den ich von hier aus auch grüße, reden dürfen. Das war natürlich streng konspirativ. Ich habe über streng verbotene Themen gesprochen, nämlich über Christentum, über Europa und über die sudetendeutschtschechische Verständigung. 1988 war das ausdrücklich im tschechoslowakischen Strafgesetzbuch verboten. Daher musste ich über die Hinterhöfe zu einem
konspirativen Ort in der schönen mährischen Landeshauptstadt Brünn geführt werden. Ein junger Student, ein überzeugter Christ und Paneuropäer, hat mich über die Hinterhöfe geführt. Dieser Student, mit dem ich seitdem eine Freundschaft pflegen durfte, ist der heutige Tschechische Premierminister Petr Fiala. Ich grüße ihn von hier aus sehr, sehr herzlich. Er kam hierher mit der frohen Botschaft – und die hat er dann verkündet bei der einzigartigen Sitzung des bayerischen Kabinetts hier in Regensburg mit dem tschechischen Ministerpräsidenten. So etwas gab es vorher auch noch nie – nämlich daß die Tschechische Regierung ganz offiziell hier beim Sudetendeutschen Tag durch den Minister Bek vertreten sein würde. Das war die Initiative von Petr Fiala. Das war die Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung. Und Petr Fiala ist nun ein Mann, von dem ich überzeugt bin, daß er diesen Weg weitergehen wird.
❯ Begrüßung: Ste en Hörtler, Landesobmanns der SL-Landesgruppe Bayern (Auszug)
Liebe Landsleute, meine sehr geehrten Damen und Herren, über sieben Jahrzehnte lang haben wir auf unseren Sudetendeutschen Tagen gemahnt: Nie wieder Krieg in Europa! Nie wieder Flucht und Vertreibung!
Ernst genommen wurden wir nicht von allen Menschen, teils sogar verspottet und als ewig Gestrige hingestellt. Krieg in Europa war für viele Menschen nicht denkbar, die Erfahrungen der deutschen Vertriebenen doch nur noch Geschichte. Immer wieder hörten wir, das mit dem Prinzip „Wandel durch Handel“ Voraussetzungen geschaffen wurden, daß es nie wieder zu Krieg, Flucht und Vertreibung kommen wird.
Die „Schicksalsgemeinschaft Europa“ – so auch unser diesjähriges Motto – steht angesichts des Angriffskrieges, den Rußland gegen die Ukraine führt, vor einer gewaltigen Bewährungsprobe, die wir nur gemeinsam meistern können.
Als Sudetendeutsche sind wir zutiefst bestürzt und bewegt über das Schicksal der heimatvertriebenen Ukrainer, daß uns an unser eigenes Schicksal erinnert.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges sind auch wir Sudetendeutsche Teil eines europaweiten Netzwerks der Solidarität.
Für uns gilt auch weiterhin, den bedrängten und verfolgten Ukrainern beizustehen und Putin aufzufordern, diesen verbrecherischen Krieg sofort zu beenden und sich aus der gesamten Ukraine zurückzuziehen. Unser Sudetendeutscher Tag wird damit auch zu einer Kundgebung für den Frieden und Solidarität mit dem tapferen ukrainischen Volk.
Ich habe mich bereits gestern in meiner Rede bei den Bürgerinnen und Bürgern Tschechiens bedankt: Die Tschechische Republik hat weit über 500 000 Flüchtlingen aus der Ukraine aufgenommen, mehr als jedes andere Land in Europa im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl. Eine großartige Leistung der Solidarität!
Unser Sudetendeutscher Tag ist und bleibt das unmißverständliche Bekenntnis für die Menschenrechte, für das Recht auf die Heimat, für Dialog und Begegnung, für die Freiheit der Menschen, für ein geeintes Europa.
Lange Zeit wurden wir als Negativbeispiel vorgeführt. Ich war vor einiger Zeit mit meinem Freund David Macek aus Brünn, der auch hier ist, in Rimini bei dieser großen Gemeinschaft Comunione e libea rzione in Italien. Was ist uns dort passiert? Wir wurden plötzlich als Positivbeispiel vorgeführt. Liebe Landsleute, das ist die Zukunft unserer Gemeinschaft, die Zukunft der Sudetendeutschen und der Tschechen, der mitteleuropäischen Gemeinschaft, die wir bilden. Unsere Aufgabe ist es, ein Vorbild des Dialoges und des Friedens und der Menschenrechte zu sein! Erst vor acht Tagen war der Tschechische Staatspräsident –zwischen ihm und Havel waren zwei andere, auf die gehen wir nicht weiter ein. Jetzt ist es Pavel nach Havel. Der General Pavel als jetziger tschechischer Staatspräsident hat bei der Eröffnungsrede für die ...
Fortsetzung Seite 3
Und unser diesjähriger Sudetendeutscher Tag reiht sich als viertes Großereignis ein in eine Reihe von ganz besonders wichtigen Ereignissen innerhalb des bayerisch-tschechischen „Supermonates“ Mai 2023.
Am 9. Mai hat der Tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hier in Regensburg – als erster tschechischer Ministerpräsident überhaupt – an der Kabinettsitzung der Bayerischen Staatsregierung teilgenommen.

Am Nachmittag des gleichen Tages haben Ministerpräsident Petr Fiala und unser Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder im Regenburger Dom und im Haus der Bayerischen Geschichte gemeinsam in einem Festakt die bayerisch-tschechische Landesausstellung eröffnet.
Und am vorletzten Freitag haben mit einem großen Festakt der Tschechische Staatspräsident Petr Pavel und unser Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder die Freundschaftswochen in Selb eröffnet.
Bernd Posselt und ich waren im Regensburger Dom, im Haus der Bayerischen Geschichte und in Selb dabei. Und ich kann ihnen berichten: Noch nie spür-
te ich als Sudetendeutscher eine solche Wertschätzung von allerhöchster tschechischer Seite. Für mich waren diese Tage historisch und sie zeigten mir: Wir sind auf den richtigen Weg.
2016 war der damalige Kulturminister Daniel Herman der erste Minister überhaupt, der (...) am Sudetendeutschen Tag teilgenommen und mit seiner eindrucksvollen Rede unsere Herzen bewegt hat. (...)
Bereits ein Jahr später war der damalige Stellvertretende Ministerpräsident Pavel Bělobrádek bei uns auf dem Sudetendeutschen Tag. Wir alle wußten: Dieser Besuch war ein großer und wichtiger Schritt zur Normalität im Verhältnis zwischen dem tsche-chischen Volk und seiner Regierung und seinen sudetendeutschen Landsleuten. (...)
Die Ereignisse in diesem bayerisch-tschechischen „Supermonat“ Mai wirkten von außen betrachtet schon fast wie ein sudetendeutsch-bayerischtschechisches Familientreffen. Diese guten und engen Kontakte vermitteln den Eindruck, als wären sie so selbstverständlich. Aber sie sind es nicht. Tatsächlich sind sie hart erarbeitet.
Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 2 73. SUDETENDEUTSCHER TAG
❯ Festrede des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. h. c. Bernd Posselt
Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, bei seiner Festrede auf dem 73. Sudetendeutschen Tag in Regensburg. Fotos: Torsten Fricke
„Wir sind auf dem richtigen Weg“
Ste en Hörtler, Landesobmann der SL-Landesgruppe Bayern.
des Dialogs und des Friedens zu sein“
Fortsetzung von Seite 2 ... tschechisch-bayerischen Freundschaftswochen in Selb, die derzeit zwölf Wochen lang stattfinden, gesagt: Diese Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland besserten sich in einem großartigen Ausmaße, und dies sei vor allem das Verdienst der Sudetendeutschen.“ Er hat uns und auch mir ganz offiziell namens der Tschechischen Republik ganz öffentlich gedankt. Dafür sicher auch Gegenwind bekommen. Das ist ein Staatspräsident, dessen Mut uns Beispiel geben kann.
Er ist in der Tschechischen Republik außer von einem seiner Amtsvorgänger – ich will den Namen nicht nennen – an sich sehr unterstützt worden. Das war der Unterschied zu Havel. Alle demokratischen Parteien haben ihn unterstützt. Die Rechtsund Linksextremisten natürlich nicht. Aber, liebe Landsleute, er hat dann sofort weitergemacht: Er ist dann nach Theresienstadt gefahren, einem Ort nationalsozialistischer Schandtaten, und hat alles, was zu Theresienstadt und den nationalsozialistischen Schandtaten gesagt werden muß, gesagt. Ich war ja schon vor eineinhalb Jahrzehnten mit Horst Seehofer in Theresienstadt und habe einen Kranz niedergelegt und auch entsprechend die Aussagen der Sudetendeutschen zu den nationalsozialistischen Verbrechen getroffen. Er war dort, hat das auch alles gesagt. Aber er hat einen Satz gesagt, der in der deutschen Öffentlichkeit leider weitgehend untergegangen ist:

„Wir müssen die Verantwortung für die von unseren Vorfahren begangenen Verbrechen übernehmen und aus ihnen lernen.“
Vor diesem Hintergrund will ich wiederholen als Antwort auf Präsident Pavel, was ich schon vor 20 Jahren vor einem Millionenpublikum in der tschechischen Fernsehsendung „Naostro“ gesagt habe. Das hat aber damals nicht in die Zeit gepaßt, es ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich will es heute in einer anderen Zeit noch einmal in aller Form wiederholen: Ich bitte namens unserer Volksgruppe um Vergebung für den sudetendeutschen Anteil an den Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten.
Verbrechen ist Verbrechen –egal, wer es begeht, welche Muttersprache derjenige hat, welchen Paß er besitzt. Man muß einfach sagen, das Entscheidende ist für uns bei der Zukunftsgestaltung die Bekämpfung eines der schlimmsten und verpestetsten Gedanken, die unser Europa erfaßt haben immer wieder und
auch heute wieder ihr scheußliches Haupt erheben, das sind der Kollektivschuldgedanke und der Nationalismus. Diese Gespenster wollen wir verbannen aus Europa!
Wir haben letztes Jahr den ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj mit unserem Karls-Preis ausgezeichnet,
Tschechiens Präsident Petr Pavel erinnerte am 21. Mai in der KZ-Gedenkstätte Theresienstadt auch an das tschechische Unrecht an den Sudetendeutschen: „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich.“ Übersetzt: „Wir müssen die Verantwortung für die von unseren Vorfahren begangenen Verbrechen übernehmen und aus ihnen lernen.“ Foto: Pražský hrad


der nach Kaiser Karl IV. heißt. Inzwischen hat er auch den anderen Karlspreis bekommen in unserer Nachfolge, der nach Karl dem Großen heißt. Wir waren mit einem großen Teil des ukrainischen Volkes im Kleineuropa der Habsburger Monarchie eine gemeinsame, multinationale Föderation. Mein Großvater hat in der alten österreichischen Armee nicht nur mit tschechischen Kameraden und Freunden gedient, sondern auch mit ukrainischen. Wir sind dem ukrainischen Volk besonders verbunden. Dieses Volk ist Opfer eines der übelsten Verbrechen der Nachkriegszeit. Wir stehen eindeutig an der Seite des überfallenen und gequälten ukrainischen Volkes. Es ist hundert Jahre her, seit unser Landsmann Richard Coudenhove-Kalergi die PaneuropaBewegung gegründet hat. Die Europäische Einigung ist eine böhmische und auch eine sudetendeutsche Erfindung. Darauf können wir stolz sein. Wir sollten diesen Europagedanken so
� Erklärung der Jugend: Mario Hierhager, Vorsitzender der SdJ – Jugend für Mitteleuropa (Auszug)
Verständigung und Toleranz als Stärke
Sehr verehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in herausfordernden Zeiten, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kaum oder keine Vergleichbarkeit kennen.
Diese Feststellung ist keine Banalität, sondern das Ergebnis einer scheinbar endlosen Abfolge von Krisen. Seit über einem Jahr erreichen uns schokkierende Bilder von Zerstörung, Kriegsverbrechen und unglaublicher Grausamkeit, direkt vor unserer Haustür. Einmal mehr sind die Themen Flucht und Vertreibung in den Mittelpunkt gerückt. Im Schatten dieser Ereignisse treten weitere ernste Probleme wie Inflation, Rezession und Sorgen um die Energieversorgung zutage. Zusätzlich beklagen wir ein Allzeithoch an politisch motivierten Straftaten in Deutschland, bei denen die Grenzen zwischen extremistischen Ideologien immer mehr verschwimmen.
Vielleicht wird gerade deshalb mit erhöhter Leidenschaft über diskriminierungsfreie Sprache und die Freiheit in Film, Literatur und Musik debattiert, um dem wahren Schrecken unse-
rer Zeit nicht ins Auge sehen zu müssen. Inmitten dieser Spannungen steht unsere, die Arbeit der SdJ – Jugend für Mitteleuropa. Oft werden wir von Menschen aller Altersgruppen befremdet gefragt, warum wir uns immer noch mit der Vertreibung der Sudetendeutschen auseinandersetzen, da heute doch andere Themen wie die Klimakrise oder Gleichberechtigung im Fokus der jungen Menschen stehen. Das ist zweifellos richtig, denn sich für eine gesunde Umwelt und die gleichwertige Behandlung aller Menschen einzusetzen, ist der richtige Weg und auch unsere Aufgabe. Es war schon immer das ureigene Interesse der Jugend, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Doch dies wird nicht gelingen, wenn wir nur vereinzelt Schwerpunkte setzen. Die Ächtung von Vertreibungen weltweit, das Engagement für ein starkes und solidarisches Europa und nicht zuletzt das Eintreten für einen vernünftigen, verständlichen und anständigen Diskurs zur Stärkung unserer Demokratie – dies sind nur drei wichtige Aspekte einer gerech-
ten Gestaltung der Zukunft. Die SdJ hat diese Ziele immer verfolgt und wird dies auch weiterhin tun.
Es ist offensichtlich, daß dies brandaktuell ist, angesichts der zunehmenden Verrohung in unserer Gesellschaft. Es liegt seit jeher in der Natur des Menschen, daß sich Generationen in ihrem Denken, Fühlen und Handeln voneinander unterscheiden und auch unterscheiden müssen. Doch wenn niemand mehr dem anderen zuhört, wenn wir uns in unseren Familien und im sozialen Umfeld unversöhnlich in Schubladen stecken, dann läuft etwas gewaltig schief. Stadt gegen Land, Auto gegen Fahrrad, Wokeness gegen Tradition, alt gegen jung – die Gräben scheinen an vielen Stellen immer tiefer zu werden. Wir sagen, das ist definitiv nicht zielführend.
Gerade die Sudetendeutschen haben in ihrer großen Mehrheit gezeigt, daß Verständigung und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Meinungen zu ihren größten Stärken zählen, während sie nur an ihren extremen Rändern den sprichwörtlichen „böhmisch-mährischen Anstand“ vermissen ließen.
Die Grenzen des Verständnisses werden bei jeder Form des Extremismus erreicht, aber nicht in den Teilen unserer pluralistischen Gesellschaft, die sich aufopferungsvoll für die freiheitlichdemokratische Grundordnung einsetzen.
Weder Argwohn, noch Spaltung, noch Haß darf unsere Gesellschaft zerreißen.
Wir appellieren an alle Menschen, unabhängig von ihrer Generation, die Scheuklappen abzulegen, aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und dabei niemals falsche oder bequeme Toleranz gegenüber Hetzern, Lügnern und falschen Propheten walten zu lassen. Denn gegen internationale Verbrecher wie Putin können wir nur erfolgreich sein, wenn wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam für unsere Werte eintreten und mutig in die Zukunft blicken. ...
Wir sind überparteilich und lassen uns niemals auf ideologische Niederungen ein. Wir wehren uns entschieden gegen Verharmlosung und ein Wiederaufleben von Nationalismus, Chauvinismus und allem, was unseren Vorfahren den Verlust ihrer Heimat beschert hat.
sind. Das schönste Erlebnis war, als ich an der Grenze an einer Demonstration mitwirken durfte – Tomáš Linda war auch dabei und Luis Hart und meine Mitstreiter aus der Paneuropa-Bewegung – wo wir demonstriert haben gegen Grenzschließungen und für die Öffnung von Grenzen. Da gab es auf beiden Seiten der Grenze Schilder – die Akkermann-Gemeinde hat etwas Ähnliches gemacht; dafür danke ich auch –, die hoch gehalten wurden und auf denen stand: „Wir brauchen Euch!“ Das ist genau der Punkt. Wir brauchen uns, wenn wir eine gute Zukunft haben wollen. Das ist Schicksalsgemeinschaft. Wir brauchen einander. Wenn wir einander brauchen, müssen wir einander auch begegnen, müssen wir einander kennen und müssen wir einander mögen. Wir müssen nicht jeden mögen, aber möglichst viele. Ich bin unserem Ministerpräsidenten und Schirmherrn, lieber Markus, sehr dankbar. Als in einigen deutschen Bundesländern – ich darf das hier sagen – in allen Parteien plötzlich Stimmen laut geworden sind, man möge zur Tschechischen Republik, die von allen Nachbarländern die längste Grenze zu Deutschland hat, wieder stationäre Grenzkontrollen einführen, daß von hier, von Regensburg, Markus Söder und Petr Fiala dem ein klares Nein entgegengesetzt haben.
verstehen, wie wir es immer getan haben.
Ich danke dem Herrn Bischof auch dafür, daß er das klar herausgestellt hat. Für uns ist das keine Konstruktion. Für uns ist das keine Bürokratie. Es ist eine Idee, die allein unser Überleben im 21. Jahrhundert sichern kann.
Das schönste Wort, das dafür geprägt wurde, ist das Wort von Václav Havel, das ich in Straßburg selbst von ihm hören durfte, das Wort von der Heimat der Heimaten. Europa muß eine Heimat der Heimaten sein. Dazu gehört natürlich Offenheit. Für uns ist Heimat nicht Abschottung. Für uns ist Heimat grenzüberschreitende Vernetzung. Für uns ist Heimat Offenheit. Deshalb –das muß ich sagen – haben wir sehr gelitten, als in der CoronaZeit die Grenzen plötzlich zu waren.
Aber man merkt gerade in solchen Situationen, wie stark gerade aus den Grenzräumen Lebensräume, Kulturräume, Menschen verbindende Räume geworden
Ich darf eine Bitte hinzufügen: Diese stationären Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union halte ich für reine Symbolpolitik. Wir brauchen eine vernünftige Kontrolle der Außengrenzen. Da ist noch viel zu tun. Dieses Europa ist gerade an den Rändern der Nationalstaaten, also an den Binnengrenzen zusammengewachsen.
Ein solcher Rand ist unsere Heimat in den böhmischen Ländern. Das war eigentlich nie ein Rand. Deshalb hasse ich auch das Wort Grenzgebiete. Das sind Herzgebiete, in denen auch unser Herz schlägt. In diesem Sinne danke ich Ihnen, daß Sie hier hergekommen sind in so großer Zahl. Unser Herz schlägt hier in Bayern, im Schirmland. Unser Herz schlägt in Böhmen, Mähren und Schlesien, den böhmischen Ländern. Und unser Herz schlägt in und für Europa.
Gottes Segen unserer Volksgruppe und dem gemeinsamen Europäischen Herzen, das uns mit dem tschechischen Volk und mit Bayern, dem Schirmland, verbindet. Danke!
3
73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023
Bernd Posselt: „Für uns ist Freiheit das Lebenselixier einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, des Staates.“
Fotos: Torsten Fricke
Mario Hierhager, Vorsitzender der SdJ – Jugend für Mitteleuropa.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste aus Tschechien, liebe Landsleute, es ist mir, wie allen Ministerpräsidenten zuvor, keine Pflicht, sondern eine Freude und eine Ehre, heute bei Ihnen da sein zu können. Es ist eine Herzensangelegenheit, Schirmherr für die Sudetendeutsche Volksgruppe zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung!
Bayern war einmal das Armenhaus von Deutschland. Bayern ist heute, man kann wohl sagen, mit das stärkste Bundesland in Deutschland. Wir haben die sechstgrößte Volkswirtschaft.
Wären wir allein, was wir nicht sind, würden wir in Europa eine der stärksten Wirtschaftsnationen sein. Der Weg war aber steinig. Der Aufbau war schwierig. Und die Veränderung in Bayern war lang. Aber eines steht fest: Ohne die Sudetendeutschen, ohne den Fleiß der Sudetendeutschen, ohne den Einsatz der Sudetendeutschen, ohne das Unendliche an Leistung, an Wirtschaft, an Mittelstand, an Handwerk wäre Bayern heute nicht da, wo es steht. Sie waren und sind ein fester Bestandteil Bayerns, eine große Verstärkung und mit die stärksten Bayern. Ein herzliches Vergelt’s Gott für diese historische Leistung!
Bernd Posselt hat Recht: Es ist schon etwas Historisches. Ich kann mich noch an Treffen erinnern – heute ist der Tag, an dem Edmund Stoiber vor drei Jahrzehnten Ministerpräsident wurde, und ich war damals einer seiner Jünger, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich war immer mit dabei. Ich erinnere mich noch an viele Sudetendeutsche Tage, zum Beispiel Nürnberg mit meinem alten Freund Ludwig Spaenle. Ich weiß noch ganz genau, wie ich immer begrüßt wurde. Mein Vorname stand nie auf der Einladungsliste. Jeder wurde richtig begrüßt. Bei mir fehlte immer der Vorname. Deswegen wurde ich immer begrüßt mit: „Lieber Kamerad Söder“. Das waren also sehr strenge Treffen. Und es waren auch Treffen, in denen es hoch politisch zugegangen ist. Ich weiß noch, daß es danach immer wieder mal internationale Debatten und Streitigkeiten gegeben hat. Wenn ich das mit heute vergleiche, mit dieser positiven Stimmung, der europäischen Dimension, mit diesem Nachbarschafts- und Freundschaftstreffen, diesen gemeinsamen Verbindungen, dann muß ich sagen: Manchmal wird Geschichte wirklich gut. Heute ist ein historischer Tag. Dieser Sudetendeutsche Tag ist ein historisches Treffen. Es ist mir eine Ehre dabei zu sein und daran mitzuwirken, daß aus schwierigen Zeiten viel bessere werden können. Herzliches Dankeschön an unsere tschechischen Freunde, die heute so zahlreich da sind.
Wenn man die lange Geschichte betrachtet, ist es spannend, daß wir über die Jahrhunderte immer eng und gut verbunden waren. Es war ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Es war ein einheitlicher Kulturraum.
Es gab viele Gemeinsamkeiten, Verbindungen, unzählige Heiraten, viel Liebe, viel Leben. Und, was uns auch immer verbunden hat neben der Kultur: ein ähnliches Essen. Weder Tschechen noch Bayern sind von der Grundanlage immer Veganer gewesen. Es gab immer viel Gemeinsamkeit.
Bis dieses unselige Gift des Nationalismus gekommen ist, das am Ende Europa fast zerstört hat.
Dieses langsam einträufelnde Gift, in alle Bereiche hinein, hat unseren Kontinent nahezu zerrissen und Europa fast aus der Weltgeschichte verbannt. Nationalismus vor dem Ersten Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, die Zeit danach, die üblen Greueltaten das Nationalsozialismus – und ich sage das auch hier –,
„Manchmal wird Geschichte wirklich
um Süd-Ost-Mitteleuropa gekümmert, als es bei uns in der Bundesrepublik Deutschland kein Interesse dafür gab. Es ist sowieso so, daß der ein oder andere gerade in den Hauptstädten sich schwertut zu verstehen, daß die Verbindung gerade für uns auch mit Mittel- und Osteuropa ganz entscheidend ist für den Frieden und die Zukunft in Europa. Und daß wir alles dafür tun müssen, die Aussöhnung und Freundschaft und Partnerschaft voranzubringen. Gerade als Deutsche und auch Bayern natürlich.


worunter viele, viele gelitten haben, auch gerade in Tschechien. Das war das schlimmste Kapitel in unserer Geschichte. Und ich bin froh, daß es vorbei ist.
Allen, die glauben, nationalistische, nationalsozialistische, rechtsextreme Gedanken seien wieder aktuell, denen sagen wir: Nie wieder und auf keinen Fall! Wir wehren uns dagegen. Wir wehren uns gegen solche Typen und menschenfeindlichen Methoden.

Und auch das Leid der Vertreibung muß angesprochen werden. Auch wenn danach vieles an Aufbau entstand, war das doch ein einzigartig schrecklicher Moment. Unzählige Menschen vertrieben aus der Heimat, von Haus und Hof. Über Nacht. Ich weiß es selber, weil es in meiner Familie auch solche Schicksale gab. Wenn Du über Nacht fliehst, wenn Du über Nacht gehen mußt, ist alles plötzlich weg, gerade für Kinder. Nichts mehr ist so, wie es war. Du kannst nicht viel mitnehmen, vielleicht einen Koffer, eine Kiste, einen Leiterwagen. Im Sudetendeutschen Museum gibt es viele beeindruckende Beispiele davon, wie es gewesen sein muß.
Ich habe höchsten Respekt, daß man überhaupt in der Lage ist, eine neue Heimat aufzubauen. Die Wahrheit ist ja auch, im Rückblick wirkt alles so gut. Es war ja nicht so, daß damals jeder gesagt hat „Super, daß Ihr da seid!“.
Ich habe Verwandtschaft im Kreis Fürth. Da gab es einen großen Gasthof und einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und die Tochter hat einen Mann aus dem Sudetenland geheiratet. Da hieß es: „Das ist ein Flüchtling“.
Mein Onkel Willi hat lange gekämpft, bis er dann irgendwann einer der ihren war – durch doppelt so viel Arbeit, durch doppelt so viel Einsatz, durch doppelt so viel Fleiß wie die anderen.
Was hat man damals gehabt?
Geld hat man nicht viel gehabt. Grund und Boden hat man gar keinen mehr gehabt. Was man aber hatte, war die Ehre, die Erinnerung, das Kulturgut, Lieder, Mundart, Tänze, Gebräuche und die eigenen Fähigkeiten.

Mir hat mal der lange verstorbene Roman Müller von den Eibanesen, einer Faschingsgesellschaft, gesagt: „Man konnte uns alles nehmen, aber nicht diesen inneren Kompaß.“ Daß Ihr den behalten habt und daß er eine Grundlage war, eine neue
Heimat zu finden, in der neuen Heimat Erfolg zu haben, darf niemals vergessen werden.
Gerade diese Aufbauarbeit, auch der unmittelbar nach dem Krieg Vertriebenen, gehört eng verbunden zu unserem Land und zu unserem Schicksal. Wirklich herzlichen Dank - und gleichzeitig große Anteilnahme daran! Das muß eine der schlimmsten Zeiten gewesen sein. Heute, für meine Generation, wird es immer schwerer, das nachzuvollziehen. Aber ich habe riesigen Respekt und sage ein herzliches Dankeschön, das geschafft zu haben für einen Aufbruch.
bleibe dabei: Die Heimatvertriebenen hätten den Friedensnobelpreis verdient. Das war und ist eine einzigartige historische und menschliche Leistung.
wicklungen entstehen. Es war einfach ein herzliches Miteinander. Wir haben sogar eine Landesausstellung der gemeinsamen Geschichte gewidmet.
Brücken bauen –ohne zu vergessen
Dieses Brückenbauen bedeutet übrigens nicht, daß man vergißt. Würde man vergessen, was war, dann könnte man nicht ehrlich neu anfangen und Beziehungen knüpfen. Wüssten wir nicht, was war, dann könnten wir gar nicht wertschätzen, was wir jetzt gerade erleben. Wir würden jetzt vielmehr denken „Naja, die verstehen sich halt wieder, im europäischen Kontext scheint das ja eher das Normale zu sein. Nachbarn tauschen sich eben aus“.
Aber wissen Sie, was mich eigentlich noch mehr beeindruckt? Es nicht nur zu schaffen, neu anzufangen, sondern dabei nicht von Haß, von Neid, von Revanche, von Rache gequält zu sein. Eigentlich wäre das der normale Weg in der Geschichte gewesen. Über Jahrhunderte hinweg gab es Kriege wechselseitig –auch in anderen Teilen. Der eine gewinnt, der andere verliert, der andere wartet auf die Revanche und immer so weiter. So ging es auch in Europa über Jahrhunderte zu.
Die Vertriebenen, die Sudetendeutschen, haben sich nicht dieser Tradition ergeben. Sondern im Gegenteil.
Auch schon Vorgänger vor Bernd Posselt über Jahrzehnte. In der Heimat-Charta der Vertriebenen wurde darauf verzichtet, auf Rache, auf Revanche. Es wurde verzichtet darauf zu fordern, es müsse alles so sein wie vorher, und am besten noch ein bißchen mehr.
Deswegen bin ich der festen Überzeugung, daß die Heimatvertriebenen und die Sudetendeutschen lange vor der Zeit, in der über Entspannungspolitik geredet wurde, lange vor der Zeit, in der über Aussöhnung gesprochen wurde, den wichtigsten Grundstein für ein neues und modernes Europa gelegt haben. Lange bevor der Kalte Krieg losund dann zu Ende gegangen ist, haben die Heimatvertriebenen dies erkannt. Dafür gebührt Euch und Ihnen unendlicher Dank.
Ich kann nur eines sagen, ich
Aber wenn man die Geschichte sieht, und zwar die ganze Geschichte, mit diesen Greueltaten, mit der Vertreibung, mit dem Kalten Krieg, mit vielen Vorwürfen, und dann den Weg, den wir heute gehen – es ist schon etwas Besonderes. Diese Freundschaft, die sich jetzt entwickelt, die da ist, ist wirklich außerordentlich besonders. Deswegen sage ich das auch als Ministerpräsident: Es ist mir eine Ehre, dabei mitzuwirken an dieser neuen Verbindung zwischen Bayern und Tschechien, Tschechien und Bayern.
Vor wenigen Wochen gab es den Doppel-Wumms: erst der tschechische Ministerpräsident, dann der tschechische Staatspräsident zu Gast in Bayern. Der Ministerpräsident war zum ersten Mal in der Geschichte im Bayerischen Kabinett. Es war ein sehr gutes Gespräch mit Ministerpräsident Petr Fiala in Regensburg. Wir sind danach auch gemeinsam durch die Stadt gegangen, haben Bratwurst gegessen. Es war ein toller Termin – übrigens auch deswegen, weil es nicht steif historisch war, sondern freundschaftlich. Man lacht, man ißt, man trinkt gemeinsam. Man bespricht ernsthafte Themen, aber man hat keine Angst mehr, ein kleines falsches Wort zu sagen. Man muß nicht genau auf das Protokoll achten, ob man vielleicht an einer Stelle sich falsch bewegt oder ein falsches Foto entsteht und man Sorge haben muß, daß dadurch neue Ver-
Und dann, einige Tage später, Treffen in Selb. Staatspräsident Petr Pavel war da zu den Freundschaftswochen zwischen Bayern und Tschechien. Freundschaftswochen!
Es sitzen hier einige, die etwas älter sind. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten vor 20 Jahren ein gemeinsames Projekt überlegt, „Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen“. Nahezu unvorstellbar.
Was beeindruckend war, beide - Ministerpräsident und Staatspräsident - haben die besondere Zusammenarbeit, haben die besondere Verbindung ausdrücklich gewürdigt. Ich glaube, daß es eine ganz geniale Verbindung wird und werden kann, und zwar nicht nur wirtschaftlich. Das verbindet uns ohnehin.
Ich freue mich sehr, daß die neue Tschechische Regierung ganz bewußt mehr Akzente setzt auf den Grenzraum, denn da besteht in besonderem Maß unsere gemeinsame Verflechtung. In Oberfranken, der Oberpfalz und in Niederbayern. Aber es geht nicht nur um den Grenzraum.
Bayern ist Schirmherr der Sudetendeutschen. Wir empfinden uns deshalb immer auch als Fürsprecher Tschechiens in Berlin. Für uns ist diese Verbindung außerordentlich wichtig.
Uns freut es, und wir wollen dies weiter intensivieren. Wir wollen die wirtschaftlichen, die kulturellen, die technologischen Verbindungen ausbauen. Wir sind nicht wie früher am Rand, sondern mitten in Europa. Das ist das Herz von Europa, das Herz von Mitteleuropa. Das wollen wir gemeinsam stärken.
Einer spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. Das ist Bernd Posselt. Er wurde schon mehrfach erwähnt. Ich möchte es auch tun. Ich habe es auch im Dom von Regensburg gemacht. Ich habe es in Selb im großen Theater gemacht. Ich möchte es an dieser Stelle auch tun.
Du bist jemand, der über Jahrzehnte nicht nur für Deine Landsmannschaft, nicht nur für Deine Volksgruppe, sondern für den Frieden in Europa arbeitet.
Bernd Posselt ist nicht nur Sudetendeutscher, er ist ein europäischer Geist. Er ist jemand, der die historische Dimension Europas verstanden hat. Er hat sich
Lieber Bernd, ich danke Dir. Du sprichst immer mit Klarheit, mit Kompaß, aber auch mit Diplomatie. Da, wo es möglich war, hast Du mit harter Arbeit dafür gesorgt, daß diese Verbindung gestärkt wurde. Manche Leute stellen immer die Frage, ob Personen Geschichte machenoder ob die Geschichte Personen macht. Beides stimmt. Aber für unsere Geschichte, für das Verhältnis Bayern–Tschechien bist Du eine zentrale Schlüsselfigur. Deshalb danke ich Dir herzlich im Namen der Bayerischen Staatsregierung und Bayerns für Deinen unermüdlich großartigen Einsatz für die Aussöhnung und die Stärkung der Verbindungen zwischen Bayern und Tschechien und die Sudetendeutsche Landsmannschaft. Herzliches Vergelt’s Gott! Wir haben zäh gekämpft, unsere Verbindung zu verbessern, Verflechtungen enger zu knüpfen, Rückschläge zu ignorieren – das ist ja in der Demokratie immer so; es gibt zwar keine falschen Wahlen, aber manchmal überraschende Ergebnisse. Da waren ein paar Jahre, die waren einfacher, andere schwieriger. Aber im Grunde genommen haben wir uns Stück für Stück verbessert. Dabei ist dieses Verhältnis, in dem wir stehen, natürlich nicht losgelöst von der Welt. Wir sind ja nicht isoliert. Wir haben es vorhin ja auch in der Erklärung der Sudetendeutschen Jugend gehört, die ich übrigens stark fand. Seit drei Jahren befinden wir uns in einem Ausnahmezustand. Erst Corona, jetzt dieser Krieg. Ich bin seit 1994 im Landtag. Da gab es immer Herausforderungen, irgendeine Reform, irgendeinen Streit. Aber das, was uns die letzten Jahre bewegt, ist schon außergewöhnlich. Auf der einen Seite erst diese Schwierigkeit mit Corona, die beide Länder sehr stark getroffen hat. Und wechselseitig immer über die Grenze. Da hat man gemerkt, daß Grenzen manchmal überhaupt nichts helfen oder nichts bringen und es dann beide trifft. Wir haben es zusammen auch irgendwie überstanden.
Und als alle gedacht hatten, es geht bergauf, kam dieser furchtbare Krieg in der Ukraine. Dieser Krieg war auch etwas, womit kaum einer gerechnet hatte. Sowas nochmal in Europa? Das eigentlich alte Modell, mit Gewalt Grenzen zu verschieben, dieses anachronistische Modell, anderen mit Militär etwas aufzuzwingen, dieses böse Modell, Leute umzubringen und Zivilisten zu töten in der Hoffnung, damit politische Mehrheiten zu bekommen – ich kann nur eines sagen: Dieser Krieg von Putin ist nicht nur völkerrechtswidrig, ist nicht nur inhuman, ist nicht nur uneuropäisch, er ist grundlegend falsch.
Deswegen sagen wir: Nein zu Machtstreben. Nein zum Krieg. Nein zu dem, was Putin uns allen aufzwingen will. Es wird keine neue Ordnung der Gewalt in Europa geben. Wir stehen zusammen. Wir halten dagegen. Und wir halten zur Ukraine in dieser schweren Zeit.
Fortsetzung Seite 5
Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2022 4 73. SUDETENDEUTSCHER TAG
❯ Festrede des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. Markus Söder
Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident und Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe.
Foto: Torsten Fricke
gut. Heute ist ein historischer Tag.“
Fortsetzung von Seite 4
... Ich fand es sehr beschämend, daß zu Beginn der Krise vermeintliche „Intellektuelle“ in den Medien gesagt haben, am besten wäre es doch, die Ukraine würde aufgeben. Dann wäre der Krieg schnell vorbei.
Neben dem tapferen Einsatz des ukrainischen Volkes für seine eigene Freiheit, neben diesem bewundernswerten Durchhalten, das das ukrainische Volk zeigt, finde ich solche Beiträge aus der Ferne wirklich auch dumm und unangemessen. Denn eines ist doch klar: Wer einmal damit durchkommt – und das haben wir doch aus der gemeinsamen Geschichte gelernt –, andere zu unterjochen, mit Gewalt Grenzen zu verschieben, der hört doch nicht auf. Darum wird die Freiheit der Ukraine unsere Freiheit sein. Nur wenn wir zusammenhalten, können wir die Freiheit der Ukraine und die Freiheit für Europa, die Freiheit für Tschechien, Deutschland und Bayern erhalten.
Tschechien hat auf pro Kopf umgerechnet die meisten Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Großen Respekt dafür. Wir waren auch nicht so schlecht. Bayern hat beispielsweise mehr Menschen aufgenommen als Frankreich.
Wissen Sie, was mich am Anfang schwer betroffen und bewegt hat? Ich weiß noch ganz genau, wie die ersten Menschen gekommen sind, überwiegend Frauen und Kinder. Ich habe sie damals mit unserem Innenminister Joachim Herrmann begrüßt. Es war faszinierend und beklemmend zugleich. Die Frauen bedankten sich: „Danke, daß wir hier sein dürfen.“ „Danke, daß wir nicht verkauft werden.“

„Danke, daß wir nicht in die Prostitution müssen.“ Joachim Herrmann ist ja eher der Gelassene.
Wir waren aber beide völlig konsterniert. „Warum?“, fragten wir.
„Weil es die russische Propaganda überall erzählt hat: Wenn Ihr nach Deutschland, nach Europa geht, dann wird Euch das passieren.“ Da merkt man, daß es nicht nur um Waffen geht. Daß es nicht nur um Gebiete geht. Es geht auch um Gift. Wieder dieses böse Gift, das in die Köpfe gebracht werden soll mit Fake News.
Daher ist es wichtig, daß wir gemeinsam uns auch gegen diese Art von Verführungen, gegen diese Art von Vorführungen, gegen diese Welt der Fake News wehren. Die sind der Anfang für schlimme Entwicklungen. Ich bin dankbar, daß da Deutschland und Tschechien und Bayern und Tschechien so eng und so gut zusammenarbeiten. Wir werden auch weiteren Menschen aus der Ukraine helfen.
Es ist schön heute. Ich komme auch immer sehr gerne, weil ich mir denke, hier gibt es Trachten. Ich mag Trachten. Es ist nicht überall so, daß jeder sie mag. Oder jeder versteht. Manchmal
gibt es darüber Diskussionen. Auch das war vorhin genannt worden: Identität. Wokeness haben sie es, glaube ich, genannt. Es hat nichts mit Essen zu tun, sondern es ist eine Art ideologische Frage von bestimmten Politikformen. Warum sage ich das?
Weil es ganz interessant ist. Das heute ist ja ein Familientreffen. Es gibt zwar die politische Kundgebung, aber es ist schon ein Familientreffen. Es gibt Tracht, es gibt das Wiedersehen von Familien, Wiedersehen von einzelnen Gruppen aus einzelnen Orten. Man tauscht sich aus, man hört nicht umsonst beim Totengedenken heimatliches Glockengeläut. Was heißt jetzt eigentlich Tracht? Ist es etwas Anachro-
nistisches? Ist es falsch? Ist es übertrieben? Oder ist es nur Mode? Es ist schon etwas Besonderes, weil es an die Heimat erinnert. Es erinnert an das, was einen verbunden hat.
Ich selbst wurde schon einmal sehr gescholten, daß wir in Bayern auch zur Tracht stehen. Wir hatten letztes Jahr den G7-Gipfel in Bayern. Das war sehr beeindruckend. Alle Staatsgäste kamen zu uns. Ich habe sie am Flughafen empfangen dürfen. Der US-Präsident stieg sehr agil die steile Flugzeugtreppe hinunter. Er sah unsere bayerischen Trachten und war begeistert. Trachtler, Gebirgsschützen, Blasmusik –alles, was es hier gibt.

Am Tag drauf gab es aus Ber-

lin eine heftige Debatte: Kann man denn ernsthaft zu offiziellen Terminen - quasi als Visitenkarte - überhaupt Tracht zeigen? Sei das nicht rückständig? Sei das nicht sogar falsch und spaltend? Manche hatten dann die große Sorge, daß damit die ganze Welt glauben könnte, daß alle Deutschen Tracht tragen. Daß alle Deutschen aussehen wie Bayern. Im Bayerischen Landtag wurden verschiedene Parteien gefragt. Da gab es intensive Debatten: „Unglücklich!“ „Stillos!“ Und dann wurde ich gefragt „Was sagen Sie denn dazu? Was sagen Sie zu dem Vorwurf, daß die ganze Welt glaubt, alle tragen Tracht in Deutschland? Was sagen Sie zu dem Vorwurf, daß die ganze Welt glaubt, alle Deutschen sähen aus wie Bayern?“
Meine Antwort: „Was für ein Imagegewinn für Deutschland in der Welt!“

Eine Tracht zieht man auch nicht an. Man legt sie an. Und sie ist etwas Besonderes. Deswegen bekenne ich mich hier dazu, in Erinnerung an die gemeinsame Zeit, an das, wo man herkommt – es ist ja sowieso so interessant: Kinder glauben nie, daß sie eigentlich sind wie ihre Eltern. Man erkennt aber sofort Vater und Sohn. Mutter und Tochter. Auch wenn es den Kindern manchmal nicht gefällt. Und Ihr seid auch die Kinder Eurer Eltern und Eurer Großeltern.
„Mutter“? Ich kenne keines. Deswegen würde ich mir wünschen, daß wir irgendwann mal anfangen, über das zu reden, was wichtig ist. Über die historische Herausforderung zu reden und uns manchmal auch in der öffentlichen Diskussion in Deutschland nicht immer mit dem absoluten Unsinn zu beschäftigen.
Wir stehen vor historisch schwierigen Zeiten. Und diese Zeiten meistern wir nur, wenn wir zusammenstehen, wenn wir einen klaren Geist haben, nicht völlig verwirrt mit zwanghaften Dingen.
Ich bleibe übrigens dabei, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich sage „Meine sehr verehrten Damen und Herren“, ich weiß jetzt nicht, wie man Sudetendeutsche gendert, und ich tue es nicht. Ich werde nicht hier an der Stelle zwanghaft gendern.
Wir stehen als Staatsregierung, als Freistaat Bayern auf festem Grund. Auf geistig festem Grund, auf wirtschaftlich stabilem Grund und haben – man nennt es heute Mindset – die richtige Einstellung. Ihr seid Vorbild. Ihr seid eine ganz besondere Volksgruppe. Wer nach so viel Leid, wer nach einer solchen Geschichte so vieles geschafft und gemacht hat, auf das Ihr wirklich stolz sein dürft, und daß Ihr dann heute eigentlich noch die besten Brückenbauer seid.
Auch wenn die Zeit eine andere ist, ist es wichtig, auch das zu ehren, was verbindet. Denn nur wer weiß, woher er kommt, kann wissen, wohin er will, hat einen Plan für die Zukunft.
Keine Erinnerung an die Geschichte zu haben, ist falsch. Deshalb wundere ich mich manchmal, daß es deutsche Bundestagsabgeordnete gibt, die nicht mal mehr wissen, wer Bismarck ist, und glauben, das sei ein Brötchen von einem Fischhändler. Das ist der falsche Weg. Man muß seine Geschichte kennen, um Fehler zu vermeiden und neue Hoffnung zu wecken.
Jetzt gibt es ja neuerdings Debatten darüber, ob man Mutter und Vater noch sagen soll. Bei der Tagesschau wurde tatsächlich mal überlegt zu sagen: Wir streichen das Wort „Mutter“ und ersetzen es durch „gebärende Person“. Man muß ja dann überlegen, wie man Muttersprache nennen würde – „gebärende Personen“-Dialekt? Ich weiß es nicht.
Das Absurde war die Begründung, man wolle niemanden diskriminieren. Das heißt, es gibt eine politische Debatte, nicht nur ob Tracht falsch ist, sondern auch, ob nicht das Wort Mutter eine ausgrenzende, aggressive, diskriminierende Form sei. Weil viele Familien hier sind, frage ich Sie: Gibt es ein schöneres, ein wichtigeres Wort auf der Welt als
Ganz Bayern ist froh, daß wir die Sudetendeutschen haben, weil sie uns helfen und zu unserer Identität gehören. Und daß nicht nur die offiziellen Vertreter aus Tschechien heute da sind, sondern auch noch Standing Ovations bekommen, zeigt, daß wir auf dem richtigen Weg sind. Wir stehen nach langer Zeit gemeinsam auf der richtigen Seite der Geschichte. Es fühlt sich auch im Herzen richtig an. Es ist nicht so, daß die Zeit einfach ist. Keiner kann alles versprechen. Keiner kann garantieren, dass keine schweren Zeiten kommen. Wir wissen nicht, woher die Winde wehen. Aber wie wir das Segel setzen, das ist unsere Verantwortung. Daß wir, Bayern und Tschechien, entschieden haben, gemeinsam in eine Richtung zu fahren, uns auszutauschen, den gleichen Kurs zu setzen, bei Unterschiedlichkeit und doch viel Gemeinsamkeit, das macht uns beide stärker.

Wir Bayern sind viele, aber nur ein Teil in der Welt. Die Tschechen sind viele, aber auch nicht ganz allein. Zusammen sind wir in jedem Fall stärker. Aber ohne die Sudetendeutschen gäbe es nicht diese enge Verbindung. Das ist die Familienbande, die uns letztlich verbindet. Deshalb ist es mir wie immer eine Ehre, ist es eine große Freude – und jetzt sage ich es einmal in Anlehnung an John F. Kennedy: Als Ministerpräsident gilt der Satz: Ich bin ein Sudetendeutscher.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Ich werde alles dafür tun, daß unser Land stark bleibt. Ich werde alles dafür tun, daß man auch in Zukunft trotz dieser ganzen Wirren sicher und gut leben kann, weil das alles nicht so einfach ist. Wir werden alles dafür tun, die Freundschaft auszubauen. Horst Seehofer und Petr Nečas haben die Tür damals geöffnet. Wir können jetzt gemeinsam durchgehen. Wir machen aus einer kleinen Tür ein riesiges Tor mit einer engen Verbindung. Wir haben nicht nur eine Standleitung, sondern wir sind eng verbunden. Gott schütze den Sudetendeutschen Tag. Gott schütze die Sudetendeutschen. Gott schütze diese neue enge Verbindung, unsere tschechischen Freunde. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, alles Gute, viele weitere Begegnungen. Möge der Segen Gottes auf dem liegen, was Sie sich erarbeitet haben. Gott schütze Sie!
Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2022 5
Beauftragte Sylvia Stierstorfer, Ministerpräsident Markus Söder, Staatsministerin Ulrike Scharf und Regensburgs 2. Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein begrüßen die Landsleute beim Einzug. Fotos: Torsten Fricke
73. SUDETENDEUTSCHER TAG
Herzliche Begrüßung: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und Ministerpräsident Markus Söder.
Einzug in die Festhalle: Staatsministerin Ulrike Scharf, Ministerpräsident Markus Söder und Steffen Hörtler, Landesobmann der SL Bayern und stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Söder, sehr geehrter Herr Posselt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, ich möchte Sie sehr herzlich im Namen der Regierung der Tschechischen Republik begrüßen – und besonders im Namen des Ministerpräsidenten Petr Fiala.







Als Bürger und Politiker habe ich immer geglaubt, daß der Weg aus Prag nach Berlin nicht nur durch Dresden, sondern auch durch München führt und daß der Weg aus Prag nach München durch den Dialog mit den Sudetendeutschen führt. Ich muß zugestehen, ich habe einige Tage überlegt, ob ich meine Rede aus dem Stegreif wage oder mich lieber an ein Papier halten sollte. Aber ich habe mich entschlossen, es ist besser direkt zu sprechen, weil die ministerialen Reden, die von Mitarbeitern vorbereitet werden, ein bißchen matt sind. Und in den deutschtschechischen Beziehungen geht es in der ersten Reihe um Aufrichtigkeit, Authentizität und Vertrauen.
Ich erlebe heute eine innere Freude, weil es zum ersten Mal ist, daß ein tschechischer Minister hier steht, ohne dazu Mut zu brauchen. Wir haben in den letzten Jahren ein Wunder erlebt. Das, was eine Ausnahme war, was Mut brauchte von meinen Freunden Daniel Herman und Pavel Bělobrádek, ist schon Alltag geworden. Darüber bin ich glücklich.


Ich bin heuer 59 Jahre alt geworden. So stehe ich vor Ihnen als Zeuge des Prozesses der Annäherung zwischen Deutschen und Tschechen. Ich wage zu sagen, das Werk der Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen ist im Grunde vollbracht.
Ich werde natürlich später noch zu dem „im Grunde“ zurückkommen, um es ein bißchen zu erweitern. Aber es ist wahr.
Ich war eigentlich Zeuge des Prozesses, weil ich in der kommunistischen Tschechoslowakei mit den Haßbildern im damaligen tschechischen Fernsehen, Haßbildern von Sudetendeut-
schen Tagen aufwuchs. Das Bild wurde meistens noch durch private Erzählungen korrigiert. In meiner Familie Erzählungen über meinen Großvater, den ich nicht erlebt hatte. Er ist ziemlich früh verstorben. Er war ein Landarzt im Böhmerwald, in Watzau/ Vacov, gleich an der Sprachgrenze. Seine Geschichten von Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen waren sehr verschieden von dem offiziellen Bild.
Ich bin überzeugt, daß die Geschichte der Versöhnung ziemlich lehrreich ist für alle anderen Völker. Es ging um den Mut von Václav Havel am Anfang der 1990er Jahre. Es ging um den
2016 hatte der damalige Kulturminister Daniel Hermann ein Tabu in der tschechischen Politik gebrochen und als erster Regierungsvertreter auf dem Sudetendeutschen Tag gesprochen.







Auch in diesem Jahr war Herman, der 2021 als Brückenbauer mit dem Sudetendeutschen Karls-Preis ausgezeichnet wurde, wieder Ehrengast.

Nach Beks Rede lobte Hermann via Twitter: „Ihre Rede war absolut brillant, Herr Minister. Die allgemeine Atmosphäre hätte nicht einladender und freundlicher sein können. Das Eis ist definitiv geschmolzen, die Brücken der Freundschaft werden immer größer. Danke!“
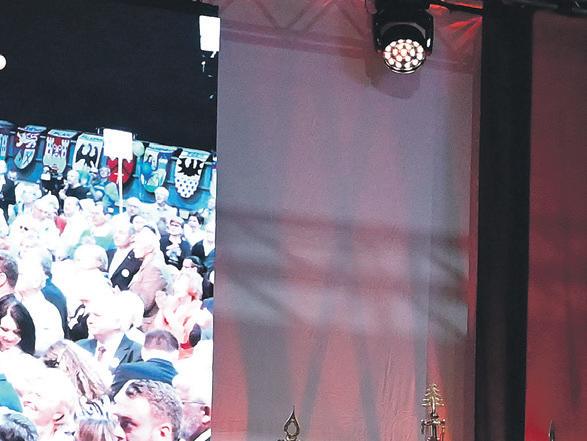
In einem weiteren Beitrag veröffentlichte Herman ein Foto von




Mut von vielen Kollegen auf beiden Seiten, auf der sudetendeutschen wie auch auf der tschechischen Seite.
Ich erinnere mich an die Jahre, die ich in Regensburg verbracht hatte am Sudetendeutschen Musikinstitut als Musikwissenschaftler, teilnehmend an Veranstaltungen über das gemeinsame kulturelle Erbe. Das war für mich die erste Erfahrung mit realen Sudetendeutschen.




Dann kamen die Initiativen von meinen Freunden aus der christdemokratischen Partei Tschechiens. Dann kamen die ersten offiziellen Schritte und Besuche. Und als Höhepunkt viel-










leicht kam das letzte Jahr mit dem Krieg gegen die Ukraine. Damals haben wir irgendwie entdeckt, was uns verbindet. Wir haben endlich gelernt, uns selbst durch die Augen des anderen zu sehen. Tschechen durch die Augen der Deutschen und Sudetendeutschen und andersrum. Wir sind reif geworden. Das ist ganz wichtig.

Dann kam die tschechische Präsidentschaft in der EU. Ich muß sagen, daß unser Erfolg unmöglich ohne die Unterstützung der deutschen Kollegen gewesen wäre. Die Zusammenarbeit funktionierte sehr gut auf verschiedenen Ebenen zwischen der Tschechischen und Deutschen Bundesregierung, aber auch mit Landesregierungen und Landtagen. Das ist ganz wichtig. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet während der tschechischen Präsidentschaft in der schweren Zeit. Danke dafür! Das Werk ist im Grunde vollbracht. Wir haben die Grundlagen gelegt. Und wir müssen natürlich weiterarbeiten. Unsere gemeinsame Aufgabe ist sehr, sehr ähnlich zu der Aufgabe, die die Deutschen und Franzosen im Westen von Europa haben. Hier in Mitteleuropa sind es wir, Tschechen, Deutsche und Sudetendeutsche, die für die Zukunft Europas arbeiten müssen. Wir müssen einstehen für Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen gemeinsam in Europa gegen die Aggression im Osten stehen. Das ist ganz wichtig.
Liebe Freunde, wir haben viel Haß, viel Weh und viel Blut hinter uns. Deshalb müssen wir für den Frieden arbeiten. Hier in Regensburg gestatte ich mir am Ende, ein paar lateinische Worte zu nutzen, weil hier 1200 Jahre früher die böhmischen Adligen getauft wurden: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Dona nobis pacem.
(Anm. d. Red.: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: Erbarme Dich unser. Gib uns Deinen Frieden.)

Minister“

der fahnengeschmückten Donau-Arena, in der der 73. Sudetendeutsche Tag stattfand, und schrieb dazu: „Der Haupteingang der Halle in Regensburg, in der das diesjährige Treffen unserer deutschen Landsleute und ihrer Nachkommen stattfand, spricht für sich selbst. Die tschechische Flagge, die tschechische Hymne, tschechische Lesungen




während des Gottesdienstes, ein Minister der tschechischen Regierung, Worte über Freundschaft und eine Familie mit zwei Sprachen. So sehen unsere Beziehungen heute aus.“ 2016 hatte Herman in seiner großen Rede die Sudetendeutschen als „liebe Landsleute“ angesprochen und die Vertreibung öffentlich bedauert.


Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2022 6 73. SUDETENDEUTSCHER TAG
❯ Grußwort von Prof. Dr. Mikuláš Bek, Bildungsminister der Tschechischen Republik
„Das Werk der Versöhnung ist im Grunde vollbracht“
❯ Daniel Herman lobt Mikuláš Bek via Twitter
„Ihre Rede war absolut brillant, Herr
Daniel Herman beim Singen der tschechischen Nationalhymne. Im Hintergrund: Landesobmann Klaus Ho mann (links) und Milan Horáček.
Ministerpräsident Markus Söder, Ministerin Ulrike Scharf, Pavel Bělobrádek Minister Mikuláš Bek und Volksgruppensprecher Bernd Posselt.
Minister Mikuláš Bek, der in Regensburg als Musikwissenschaftler tätig gewesen war, hielt seine Rede in perfektem Deutsch. Fotos: Torsten Fricke
Für seine Rede auf dem Sudetendeutschen Tag erhält Bildungsminister Mikuláš Bek Standing Ovations. Volksgruppensprecher Bernd Posselt bedankt sich bei Mikuláš Bek und spricht von einem „historischen Moment“.
❯ Auftakt des Sudetendeutschen Tags in der Regensburger Altstadt
Volksmusik und Gedenken
Mit Kunst und Kultur von den Bürgern wahrgenommen werden, aber auch an Tod und Vertreibung erinnern – der Auftakt des Sudetendeutschen Tages fand am Freitag auf dem Bismarckplatz in der Regensburger Altstadt statt.


Auf der Bühne präsentierten den ganzen Nachmittag über Künstler aus dem Böhmerwald, der Oberpfalz, Tschechien und der Ukraine die Vielfalt Europas mit ihrer Volksmusik. Und ein paar Meter weiter informierte die Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband über die Volksgruppe und deren vielfältigen Aktivitäten.
Ein besonderer Moment war die traditionelle Kranzniederlegung vor dem Sudetendeutschen Tag. SL-Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel erinnerte an die vielen unschuldigen Opfer der Vertreibung.


Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel (Mitte) hatte die Kranzniederlegung auf dem Bismarckplatz initiiert. Fotos: Torsten Fricke

Blickfang in der Regensburger Altstadt: vier Böhmerwaldlerinnen in ihren wunderbaren Trachten.
Köstliche Solidarität: Eine Gruppe von Ukrainern hat Spezialitäten aus der Heimat gebacken und informierte am SL-Stand über die Lage.
❯ Podiumsdiskussion zum Auftakt des Sudetendeutschen Tages mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt
Bundesvorstandsmitglied Margaretha Michel erinnerte in ihrer Rede auf dem Bismarckplatz an die vielen unschuldigen Opfer der Vertreibung.
Europa – Schicksalsgemeinschaft zwischen
Ein hochbesetztes Podium unter Leitung von Volksgruppensprecher Bernd Posselt war der Auftakt des Sudetendeutschen Tages in Regensburg. In Anlehnung an das diesjährige Motto ging es um die Frage „Europa – Schicksalsgemeinschaft zwischen Krieg und Frieden“.

Zum vierten Mal wählte man einen aktuellen Bezug der sudetendeutschen Problemstellungen wie der Einsatz für Frieden und Freiheit, die Volksgruppenund Menschenrechte oder der Einsatz für ein starkes und geeintes Europa auf der Basis der Völkerverständigung zu den gegenwärtigen weltpolitischen Herausforderungen.
Gastgeber Posselt beschrieb am Anfang die Situation: „Die Sudetendeutschen galten lange als Miesmacher in einer Zeit, in der man allgemein gesagt hat, unsere Sicherheit, die überlassen wir den Amerikanern, die Chinesen sind für uns ein Markt, die Energieversorgung machen die Russen und wir leben in Wohlstand und müssen uns weiterhin nicht anstrengen. Und wir haben bei der Einigung in Europa viel zu sehr geschlafen. Und das, was im Moment stattfindet, sowohl im Südchinesischen Meer als auch vor unserer Haustür in der Ukraine, deren westlicher Teil im Kleineuropa der Habsburger Monarchie mit den Deutschen und Tschechen eng verbunden war, soll einmal am Anfang des Sudetendeutschen Tages diskutiert werden.“
Dazu begrüßte Posselt den Leiter der Vertretung der Republik Taiwan in Bayern, Ian-tsing Joseph Dieu, den Vorsitzenden der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Ulm, Nestor Aksiuk, der seit der Woche vor dem Angriff Rußlands auf die Ukraine jeden Mittwoch eine Solidaritätskundgebung für das ukrainische Volk in Ulm organisiert, und den Tschechischen Vorsitzenden des
Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums und ehemaligen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Libor Rouček.
Dieu beschrieb, wie die Frage nach der Demokratie und der Krieg in der Ukraine nicht nur die Schicksalsgemeinschaft Europa beschäftigen, sondern auch Taiwan.
Taiwan sei die Gefahr vor einer chinesischen Aggression aber schon seit 70 Jahren sehr bewußt.
Krieg und Frieden
China habe eine sechzigmal größere Bevölkerung und es sei 270mal so groß. Aber was sei die taiwanesische Seele? Zuerst sei man einmal kulturell chinesisch, die kaiserlichen Schätze befänden sich in Taipeh, nicht in Peking. Dann habe man einen Pioniergeist, wie die Sudetendeutschen, die Taiwanesen seien vorwiegend Nachfahren von Immigranten. Und schließlich prägen die Menschen in Taiwan die kolonialen und missionarischen Einflüsse von Europa. Und dann gäbe es einen wichtigen Einfluß von Deutschland. Er sei Jurist, und die Verfassung Taiwans sei eine Übernahme der Weimarer Reichsverfassung des Jahres 1946. Der Grundrechtekatalog und die Sozialstaatsverfassung seien übernommen worden. So gebe es eine allgemeine Krankenversicherung. Und die
Auf dem Podium (von links): Nestor Aksiuk, Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. Libor Rouček, MdEP a. D. und Träger der Sudetendeutschen KarlsPreises, sowie Dr. Ian-tsing Joseph Dieu, Leiter der Vertretung der Republik Taiwan in Bayern. Foto: Torsten Fricke

Demokratie sichere eine Innovationsfähigkeit, wie auch der Umgang mit der Pandemie bewiesen habe.
Nestor Aksiuk betonte zuerst das ständige Bemühen der Ukraine, Teil Europas zu sein. Dieses habe Europa aber bis zum Angriffskrieg nicht wirklich erwidert. Erst der 24. Februar 2022 habe das geändert. Man lebe, was bereits früher galt, aber nunmehr für alle sichtbar ist, in einer Schicksalsgemeinschaft Europa, die mit einem Sieg der Ukraine wieder Frieden finden kann.
Posselt sprach Libor Rouček an und schilderte eine paradoxe Situation in der Tschechischen Republik. Es gab an der tschechischen Staatsspitze massive Ex-
ponenten der China-Lobby und der Rußland-Lobby. Aber andererseits gab es nirgendwo so viel Unterstützung, beispielsweise durch Václav Havel für den Dalai Lama und Tibet sowie für die Uiguren. Die Stadt Prag hat beispielsweise nach Kriegsbeginn den Platz vor der russischen Botschaft nach einem ukrainischen Kriegshelden in „Boris-NemzowPlatz“ umbenannt, was die Russische Botschaft dazu veranlaßte, nur noch durch einen Seiteneingang zugänglich zu sein.
Rouček nahm diese Überlegungen auf und schilderte, daß bereits beide Kammerpräsidenten, des Senates wie der Nationalversammung, in Taiwan waren. Das finde man nirgends in
anderen Staaten. Und weil Tschechien so klein sei, habe das auch Strafen zur Folge gehabt. Es gäbe keine direkten Flüge zwischen China und Prag, aber demnächst wohl nach Taiwan. Aber was wäre, wenn alle Parlamentspräsidenten demokratischer Staaten nach Taiwan gingen, um die Demokratie für Taiwan zu bekräftigen? Das müsse die EinChina-Politik nicht völlig infrage stellen. Da könnte China doch wahrscheinlich nicht mit Strafaktionen reagieren? Und zur Situation mit Rußland. Miloš Zeman sei ja ein Putin-Versteher gewesen. In den 1990er Jahren auch noch völlig verständlich, da unter Präsident Boris Jelzin auch Rußland sich bemüht zeigte, demokratische Strukturen und eine Marktwirtschaft aufzubauen.
Aber mit Putin änderte sich das. Zeman sei zwar immer noch China zugewandt, aber zu Rußland habe er sich um 180 Grad gedreht. Heute unterstütze selbst er die Ukraine, die Waffenlieferungen und die Aufnahme von Flüchtlingen. 400 000 habe die Tschechische Republik aufgenommen, das sei pro Kopf die höchste Zahl in Europa. Und es funktioniere. 100 000 Ukrainer
arbeiten bereits in der Tschechischen Republik, zahlen Sozialabgaben und die Kinder gehen in die Schule.
„Die Schicksalsgemeinschaft ist die Humanität, die Menschenund Bürgerrechte, Demokratie, Rechtsstaat, und das verbindet uns, egal ob wir uns mit Taiwan oder der Ukraine solidarisieren überall in der Welt“, so Rouček. Und das habe er schon als Flüchtling gespürt vor über 40 Jahren. „Als ich nach Deutschland und nach Österreich kam, kam ich in ein Land der Demokratie und der Menschenrechte. Manche in der Tschechoslowakei haben gesagt: ,Das sind doch die Deutschen.‘ Aber ich habe gesagt: ,Ja, das sind die Deutschen, aber in dem Land herrscht Demokratie. Das Land hat gelernt aus dem, was Nationalsozialismus, Nationalismus und Krieg bedeuten.“ Bernd Posselt erinnerte am Ende des Podiums an die Initiative von Ministerpräsident Franz Josef Strauß im Jahr 1987, daß die Bayern, einschließlich des vierten Stammes, also der Sudetendeutschen, das Brudervolk der Ukraine seien. Es wurde eine bayerisch-ukrainische Freundschaft proklamiert, und das vor dem Hintergrund, daß mit der Ukrainischen Freien Universität und vielen Journalisten bei Radio Free Europe und Radio Liberty in München ein Zentrum der eigenständigen Ukraine existierte. Und Posselt berichtete noch vom Auflösungsprozeß der Sowjetunion, der durch den Austritt Rußlands aus der UdSSR begann, und nicht wegen der Ukraine, der die Grenzen im Budapester Abkommen 1994 einschließlich der Krim zugesichert wurden, weil sie ihre Atomwaffen an Rußland abgegeben hatten. Dies war zum Schluß der Debatte ein Ruf zur Aufklärung über die tatsächlichen Vorgänge und die gegenwärtige Situation. Ulrich Miksch
7 73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023
Martina Miksch stimmte mit der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München auf dem Bismarckplatz die Regensburger musikalisch auf den Sudetendeutschen Tag ein.
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau
24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
eMail
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de
� Feierliche Eröffnung
Nie wieder Krieg, nie wieder Vertreibung
„Nie wieder Krieg, nie wieder Vertreibung, das waren die Lehren, die wir aus unserem Schicksal gezogen haben.“ Mit diesen Worten eröffnete Bayerns SL-Landesobmann Steffen Hörtler den Festakt zum großen Treffen am Pfingstsamstag in Hof, das unter dem Motto „Schicksalsgemeinschaft Europa“ stand.
Er fuhr fort: „Das ist Mahnung zu Frieden und Verständigung, aber auch zur Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Völkerrecht. Wir Sudetendeutsche geben damit ein ermutigendes Beispiel für die Gestaltung der Zukunft. Wir haben erlittenes Leid überwunden und stehen für eine friedliche Zusammenarbeit in Europa und ganz besonders mit unserem tschechischen Nachbarn.“
nommen. Darauf wies Oberbürgermeisterin Gertrud MaltzSchwarzfischer noch einmal hin.
habe. Danach sei er als faschistischer Revanchist angefeindet worden, und tschechische Regie
Steffen Hörtler, Obmann der SL-Landesgruppe Bayern und Stellvertretender SL-Bundesvorsitzender, und Pavel Bělobrádek, 2010 bis 2019 Parteivorsitzender der christdemokratischen Partei KDU-ČSL und 2014 bis 2017 Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Wissenschaft, Forschung und Innovation in der Regierung Bohuslav Sobotka.



Bei jeder Gelegenheit und nicht zuletzt bei allen Sudetendeutschen Tagen mahnten die Sudetendeutschen, daß es Vertreibung und Flucht in Europa nie wieder geben dürfe. Dennoch seien mehr als 77 Jahren nach der Vertreibung der sudetendeutschen Volksgruppe in Europa wieder Millionen unschuldiger Menschen gewaltsam gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Sudetendeutschen seien zutiefst bestürzt und bewegt über das Schicksal der heimatvertriebenen Ukrainer, das sie an ihr eigenes Schicksal erinnere.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges rücke Europa noch enger zusammen. Und die Sudetendeutschen seien Teil eines europaweiten Netzwerks der Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Für sie gelte es, den bedrängten und verfolgten
Sie dankte den Sudetendeutschen für ihre Hilfe beim Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im nur zehn Kilometer entfernten Neutraub
rungsmitglieder hätten den Sudetendeutschen Tag lange Zeit gemieden. 70 Jahre kommunistische Propaganda hätten tiefe Spuren hinterlassen. Doch die Zeiten änderten sich, auch wenn Geduld nötig sei. Bělobrádek: „Der Sieg von Wahrheit und Liebe über Lüge und Haß ist unser Weg in die Zukunft.“
Als Vertreterin der Bundesregierung überbrachte sie nicht nur die Grüße von Bundesministerin Nancy Faeser, sondern auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Die sudetendeutschen Heimatvertriebenen seien das Gegenteil von verstaubter Vergangenheit, sie seien die Zukunft. Ihr KarlsPreis werde seit 1958 – das sei inmitten des Kalten Krieges gewesen – verliehen. Sie sei dankbar und hege Respekt für dieses Zeichen des Aufbrechens des Eisernen Vorhangs. Sie beglückwünsche Libor Rouček MdEP a. D. – einen der diesjährigen KarlsPreisTräger. Er habe sich um die europäische Einigung verdient gemacht. Er sei ein erfolgreicher Brückenbauer zwischen Menschen und Staaten. Er habe aus einer hermetischen Grenze eine Brücke geformt.
Das Grußwort des tschechischen Vizepremiers, Wissenschaftsministers und KDU-ČSL-Vorsitzenden Dr. Pavel Bělobrádek wird zu Beginn der Hauptkundgebung des 66. Sudetendeutschen Tages 2015 in Augsburg auf Großleinwand übertragen. Rechts unten sieht man die Spitzen der Fahnen einiger Abordnungen.
ling sei eine der fünf bayerischen Vertriebenenstädte entstanden. Gemeinsam sei man grenzüberschreitend tätig. Beispiele seien die Partnerschaften zwischen den Städten und Bistümern Regensburg und Pilsen. „Der Europäische KarlsPreis setzt heute ein Zeichen der Verteidigung unserer Werte.“ Die diesjährigen Preisträger trügen die Fackel für Frieden und Freiheit von Regensburg in die Welt, schloß Gertrud MaltzSchwarzfischer.
Rita Schwarzelühr-Sutter MdB, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin des Inneren und für Heimat, und Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.

Ukrainern beizustehen und mit ihnen gemeinsam an einer besseren europäischen Zukunft zu arbeiten. Der Sudetendeutsche Tag werde damit auch in diesem Jahr wieder zu einer Kundgebung für den Frieden und für die Solidarität mit dem ukrainischen Volk.
„Die Schicksalsgemeinschaft Europa – so auch unser diesjähriges Motto – steht angesichts der Okkupationen und des Angriffskrieges, den Rußland gegen die Ukraine führt, vor einer Bewährungsprobe. Unsere Erfahrungen als Sudetendeutsche sind in dieser Situation von besonderem Wert“, sagte Hörtler.
Am 10. November 1951 hatte die Stadt Regensburg die Patenschaft über die Sudetendeutsche Volksgruppe über
Pavel Bělobrádek, 2015 KDUČSLChef, VizePremier und Wissenschaftsminister, erinnerte in seinem Grußwort an seine Videobotschaft an den damaligen Sudetendeutschen Tag. Er sei der erste Vertreter einer tschechischen Regierung gewesen, der bei einem Sudetendeutschen Tag gesprochen
„Die Sudetendeutschen geben Bayern einen besonderen Glanz“, begann Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führe dramatisch vor Augen, daß Menschenrechte nicht selbstverständlich seien. Die EU stehe fest an der Seite der Ukraine. Sie sichere den Minderheitenschutz und sichere damit den Frieden. Voraussetzungen für Frieden und Freiheit sei Demokratie.
Die Sudetendeutschen bekennten sich zum Dialog, sie lebten den Dialog, allen voran Bernd Posselt. Keiner stehe mehr hinter der Versöhnungsarbeit als er. Die Tschechen seien mittlerweile nicht nur Partner, sondern Freunde. Der Dialog habe die nächste Stufe erreicht. „Wir bleiben an Ihrer Seite“, versicherte die Schirmherrschaftsministerin.
Rita SchwarzelührSutter MdB ist Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Die Familie Faeser stammt ursprünglich aus Niederschlesien und war nach dem Zweiten Weltkrieg als Heimatvertriebene nach Duisburg gekommen.
Die Sudetendeutschen hätten ihre neue Heimat solidarisch mitgestaltet. Das sei eine Grundlage, um die Zukunft gemeinsam gut zu meistern. Wichtig sei, die Rechte der Minderheiten zu schätzen und zu schützen, sich zu ihnen zu bekennen. Am 20. Juni werde Nancy Faeser im Rahmen des nationalen Gedenktags für die Opfer von Flucht und Vertreibung insbesondere der deutschen Vertriebenen gedenken. Schließlich seien die deutschen Heimatvertriebenen die letzten Opfer des von den Deutschen angezettelten Zweiten Weltkriegs gewesen.
Übrigens sei sie, Rita SchwarzelührSutter, auch Trachtenträgerin. Sie sei Mitglied im badenwürttembergischen Verein Alt Waldshut, der sich der Pflege von Heimat und Brauchtum widme. Auch für sie sei Tradition

Ulrike Scharf MdL, Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales und Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen, und Hubert Aiwanger MdL, Freie-Wähler-Vorsitzender, Bayerns Wirtschaftsminister und Stellvertretender Ministerpräsident.
nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Die Bundesregierung unterstütze die Vertriebenen, versicherte sie. „Gemeinsam setzen wir die grenzüberschreitende Arbeit fort.“ Nadira Hurnaus
73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2022 8
Diese Formation des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad unter der Leitung von Milan Muzikář begleitet die Eröffnung und die Verleihung des Europäischen Karls-Preises.
Bilder: Manfred Gischler (4), Nadira Hurnaus (1), Herbert Fischer (1)
22/2023
Ein Nicht-Sudetendeutscher und ein Träumer
Am Vormittag des Pfingstsamstags ehrte die Sudetendeutsche Landsmannschaft Libor Rouček MdEP a. D. sowie Christian Schmidt MdB a. D., Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, mit ihrem Europäischen Karls-Preis.
Nach anfänglichem Fremdeln, so Volksgruppensprecher Bernd Posselt, sei Pavels Bělobrádeks Grußwort als VideoBotschaft „Die Wahrheit befreit“ 2015 auf große Resonanz gestoßen. 2016 seien die tschechischen Politiker Michaela Marksová (ČSSD) und Daniel Herman (KDU-ČSL) Gäste gewesen. Über Herman und den Sudetendeutschen Tag lesen wir in der Internetenzyklopädie Wikipedia: „Zu
Pfingsten 2016 nahm Herman als erster tschechischer Minister am Sudetendeutschen Tag, dem Treffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, in Nürnberg teil. In einer deutsch vorgetragenen Rede drückte er sein Bedauern über die Vertreibung der Sudetendeutschen aus. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer als Schirmherr der Veranstaltung nannte den Auftritt Hermans historisch und eine Sternstunde in den bayerischtschechischen Beziehungen.“


Der Sternstunde folgte ein Paukenschlag. 2017, so Posselt, habe
Pavel Bělobrádek den Sudetendeutschen Tag offiziell als Regierungsmitglied besucht. Und bei der Hauptkundgebung am Sonntag spreche der tschechische Europaminister Mikuláš Bek zu den Landsleuten. Premier Petr Fiala, sein, also Posselts, alter Freund und Weggefährte, habe ihn nach Regensburg entsandt. Erst kürzlichen habe Staatspräsident Petr Pavel bei der deutsch-tschechischen Freundschaftswoche in Selb gesprochen. Das alles dokumentiere einen klaren und konsequenten Kurs der Verständigung. „Unsere Saat geht auf. Wir müssen diesen Frühling nutzen.“
Die Karls-Preis-Träger Libor Rouček und Christian Schmidt seien in den vergangenen Jahrzehnten von Hoffnungsträgern zum Urgestein der europäischen Einigung geworden. Rouček habe seit den 1970er Jahren im österreichischen Weinviertel im Exil gelebt und sich bedingungslos für Menschenrechte eingesetzt. Wie Rouček sei Schmidt seit der Gründung 1997 Mitglied des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, das nun Früchte trage.

Karl IV: (1316–1378), der Namensgeber des Preises, sagte Christian Schmidt, habe in Prag die erste Universität in Mitteleuropa gegründet und mit der Goldenen Bulle dem Heiligen Römischen Reich ein Grundgesetz gegeben. Er, Christian Schmidt, sei zwar kein Sudetendeutscher, doch er stelle sich der Frage, wie gehe man mit Geschichte um, wie erhalte man Werte angesichts der Geschichte. In diesem Sinn sei er Sudetendeutscher.
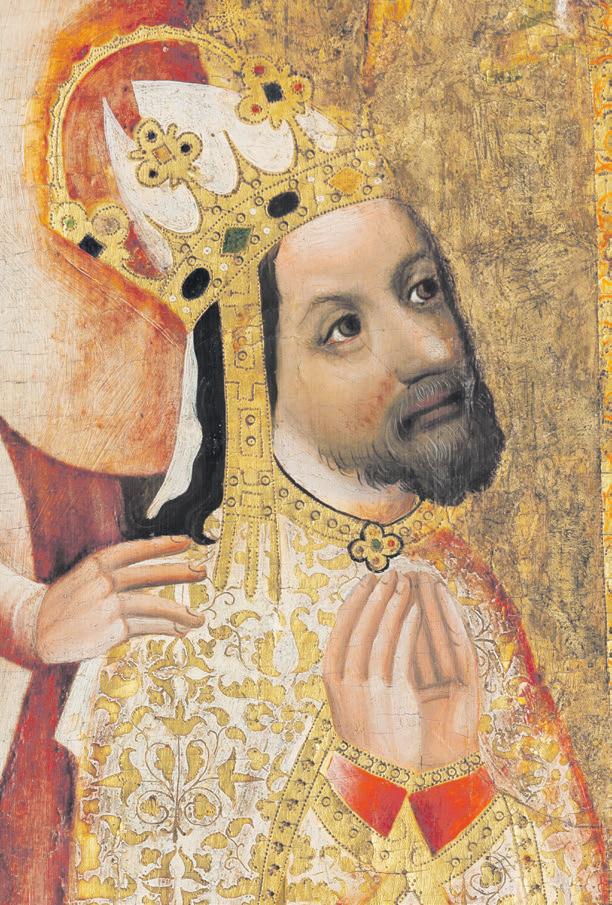
Es sei gelungen, daß die
deutsch-tschechische Erklärung von 1997 über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklung zu einem guten Ergebnis geführt habe. Damals hätten sich Volksgruppensprecher Franz Neubauer und Staatspräsident Václav Havel getroffen, miteinander gesprochen und Impulse gegeben. Hartmut Koschyk, 2014 bis 2017 Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, habe die Frage gestellt, wie man mit den Folgen der Vertreibung umgehen solle. Dem habe sich der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds widmen sollen, zukunftsbezogen, wie der Name sage. Klug habe Havel davor gewarnt, nichts Unmögliches anzustreben. Der Plan sei gewesen, die Geschichte unvoreingenommen zu erforschen, die Wahrheit zu suchen, um eine Grundlage für ein künftiges gutes Zusammenleben zu schaffen.
Diesen Auftrag habe man ernst genommen und zur Umsetzung beigetragen. Man sei sogar viel weiter gekommen, als man vor 30 Jahren erwartet habe. Doch ohne die Sudetendeutsche Landsmannschaft und ihr in die Zukunft gerichtetes Agieren wäre das nicht möglich gewesen.
Das Zentrum Erinnerungskultur der Universität Regensburg sei ein wissenschaftlich-diskursives Forum für die Auseinandersetzung und kritische Reflexion historischer und gegenwärtiger Erinnerungskulturen. Hier gehe es um das Nie wieder und die Erinnerung an Geschehnisse, die nicht wieder gutzumachen seien.
Henry Kissinger, der aus dem mittelfränkischen Fürth stammende ehemalige USA-Außenminister, feiere just an diesem 27. Mai 100. Geburtstag. Der habe gesagt, Europa brauche eine Struktur, lebe aber von der Hand in den Mund.

Grundlage der deutsch-tschechischen Beziehungen sei seit 2015 ihr Strategischer Dialog. Der müsse mehr genutzt werden. Dazu sei er bereit, schloß Schmidt.
seien. Nun habe er geträumt, wenn er groß sei, nach Deutschland zu fahren und das herauszufinden. Seinen zweiten Traum habe er als 13jähriger im Prager Frühling
zu seinem Lebensende werde er diesem Land und dessen Kanzler Bruno Kreisky dankbar sein. Hier habe er arbeiten, studieren und mit seinem Flüchtlingsreisepaß auch reisen können. In Europa, im Nahen Osten, nach Indien und nach Nordamerika.
In den 1970er Jahren habe er in den USA den Traum von einem vereinten und föderalen Europa geträumt. Ihm sei klar gewesen, daß Verständigung und Versöhnung die Voraussetzungen seien. Aus diesem Traum sei das Thema seiner Doktorarbeit an der Wiener Universität über die deutsch-tschechischen Beziehungen entstanden.
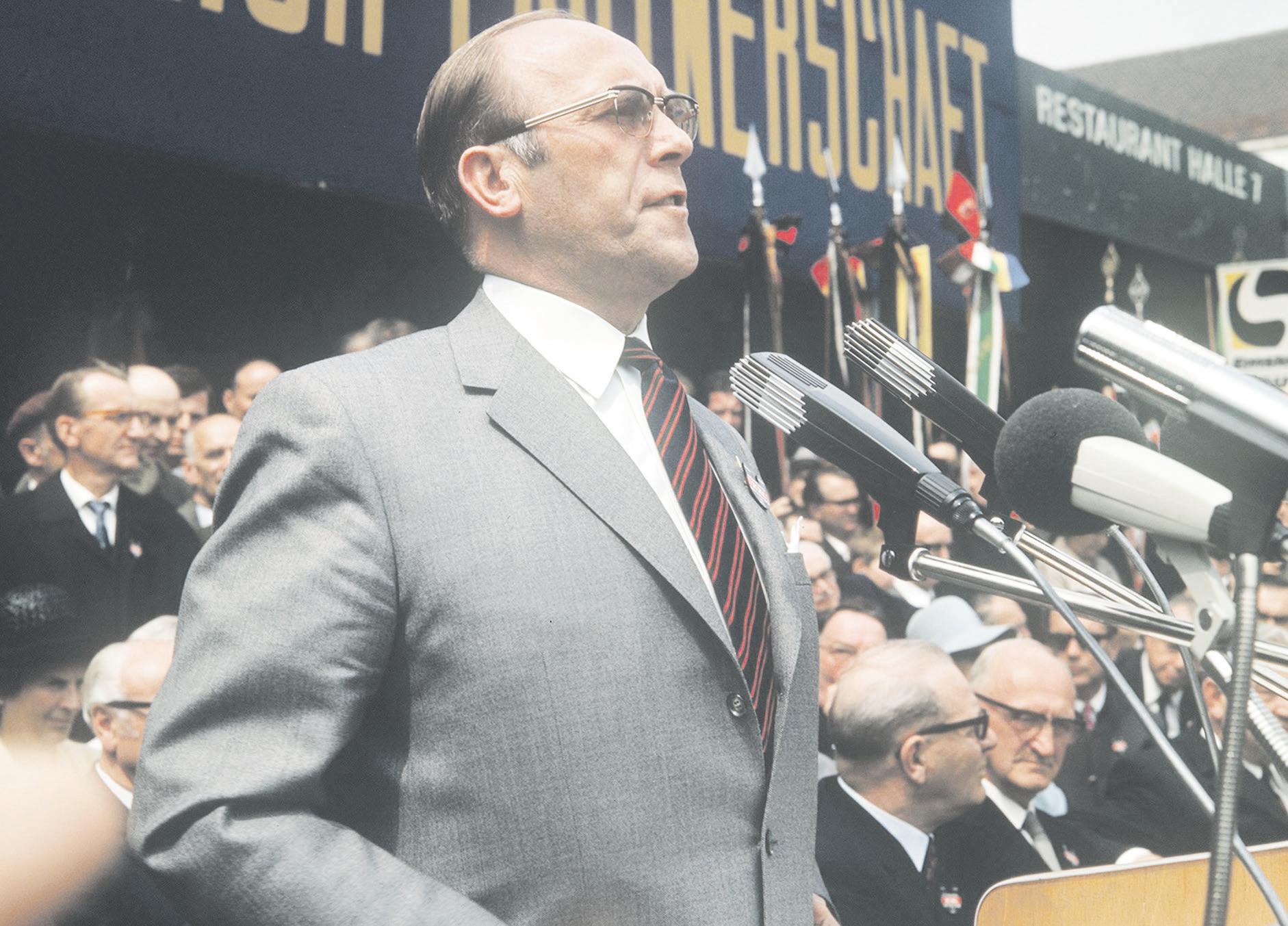
Obwohl sich die Doktorarbeit mit dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegsvertreibung der Sudetendeutschen nicht direkt beschäftigt habe, habe er regen Kontakt mit den Sudetendeutschen unterhalten. Im Collegium Carolinum habe er sudetendeutsche Literatur und die Sudetendeutsche Zeitung gelesen, in München und Bonn alle zugänglichen Archive besucht, in Stuttgart Gespräche mit dem damaligen Vorsitzenden der SeligerGemeinde, Adolf Hasenöhrl, und Volksgruppensprecher Walter Becher geführt.
„Becher lud mich in sein Haus in Pullach zum Abendessen ein.
Traum wahr geworden. Auch die Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen oder Sudetendeutschen hätten begonnen, sich schnell zu ändern. Doch nicht so schnell, wie er gehofft habe. Vorurteile und Vorbehalte, die bei den Tschechen von der kommunistischen Propaganda über den deutschen Revanchismus geprägt gewesen seien, seien im Weg gestanden. Zur Diskussion über die tragische Vergangenheit sei auf Grund der Deutsch-tschechischen Erklärung von 1997 das Deutsch-tschechische Gesprächsforum gegründet worden, das er heute mit Christian Schmidt als Ko-Vorsitzendem repräsentiere. „Ich danke Dir, lieber Christian, für Deine Geduld und Deine politische Weisheit und Erfahrung, mit denen Du jahrelang die Diskussionen und die Arbeit des Forums sowie auch die deutsch-tschechische Zusammenarbeit im positiven Sinne gelenkt und beeinflußt hast.“
Außerdem danke er Bernd Posselt, der von Anfang an am Gesprächsforums beteiligt gewesen sei. Posselt habe für die sudetendeutsch-tschechische und deutsch-tschechische Verständigung und Versöhnung, für die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien, Bayern und Tschechien in den letzten Jahren und Jahrzehnten unheimlich viel getan. Er führe im Diskussionsforum die Arbeitsgruppe „Dialog ohne Tabu“.
Im Unterschied zur Zeit des Kalten Krieges hindere uns jetzt nichts, uns als Prager, böhmische, tschechische und zugleich als europäische Patrioten zu fühlen. Oder als sudetendeutsche, bayerische, deutsche und europäische Patrioten. Die EU biete die Möglichkeit, sogar mehrere Identitäten zu haben.
Tschechen, Sudetendeutsche und Deutsche hätten viel erreicht. Gemeinsam hätten sie auch ein historisches Vorbild geschaffen, wie einst verfeindete Nationen kommunizieren können, sich auch mit manchmal für beide unangenehmen Themen auseinandersetzen, sich dafür entschuldigen, sich verzeihen und sich versöhnen könnten; Freunde würden zusammenarbeiten.
Seine Mutter habe ihn einen Träumer genannt, begann Libor Rouček. Seinen ersten Traum habe er als kleiner Bub im Böhmerwald geträumt. Dort habe es eine wunderschöne wilde Natur gegeben, aber auch verfallene Dörfer, Sperrzonen, Soldaten und geschlossene Grenzen. Auf der anderen Seite der Grenze hätten laut Rundfunk und Fernsehen Revanchisten gelebt. Er habe nicht gewußt, was Revanchisten
1968 geträumt. Damals seien die Sowjets einmarschiert, dann habe sich Jan Palach verbrannt und die kommunistische Normalisierungspolitik begonnen. Damals habe er sich zum Ziel gemacht, alles zu tun, daß auch Tschechen und Slowaken frei atmen und sich frei entwicklen könnten, daß sie den Kommunismus los würden.

Mit 22 Jahren sei er nach Österreich ins Exil gegangen. Bis
Als ich mich von diesem für die tschechoslowakischen Kommunisten ,größten deutschen Revanchisten‘, um Mitternacht verabschiedete, war ich überzeugt, daß wir bei vielen Ereignissen und Fragen nicht der gleichen Meinung waren, daß es aber eines Tages, wenn der Kommunismus und der Eiserne Vorhang fallen, kein Problem sein wird, mit den Sudetendeutschen nicht nur zu reden sondern sich auch zu verstehen.“
Mit dem Fall des Kommunismus und des Eisernen Vorhangs sei sein seit 1968 geträumter
„Ich wünsche mir, und das ist mein Traum für die Zukunft, daß wir dieses positive historische Beispiel auch dort vermitteln könnten, wo es bisher nicht gelang. Auf dem Balkan, um den sich jetzt Christian Schmidt tagtäglich bemüht; in den Beziehungen zwischen Griechen und Türken auf Zypern, den Armeniern und Aserbaidschanern, und es wären noch einige zu nennen.“
„Und auf ein baldiges Wiedersehen! Nächsten Monat in Brünn beim Versöhnungsmarch; und nächstes Jahr hoffentlich schon in einer böhmischen, mährischen oder schlesischen Stadt beim 74. Sudetendeutschen Tag.“
Nadira Hurnaus
73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 9 � Europäischer Karls-Preis
2023
Steffen Hörtler dekoriert Christian Schmidt mit dem Europäischen KarlsPreis. Bilder: Manfred Gischler (2), Nadira Hurnaus (1)
SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch dekoriert Libor Rouček mit dem Europäischen Karls-Preis.
Laudator Bernd Posselt.
Karl IV. auf dem Votivbild.
Henry Kissinger. Walter Becher (1912–2005).
Bruno Kreisky (1911–1990).
Am Abend vor dem Sudetendeutschen Tag sind im Stadttheater in Regensburg die Kulturpreise der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Sudetendeutsche Preis für Heimatund Volkstumspflege 2022 verliehen worden. Bei einem Festlichen Abend im Neuhaussaal überreichten Volksgruppensprecher Bernd Posselt und SLBundeskulturreferent Ulf Broßmann die Urkunden an Preisträger aus Literatur und Publizistik, Bildender Kunst und Architektur, Heimat- und Volkstumspflege sowie den Großen Kulturpreis. Die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen, Ulrike Scharf MdL, hielt eine engagierte Rede. Ein schönes Grußwort kam von der Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Eingangs begrüßte Stiftungsvorstandsvorsitzender Ortfried Kotzian die Gäste. Seine Tochter, die Sängerin Iris Marie Kotzian, moderierte den Festabend.
Die Sudetendeutschen sind als Schicksals- und Kulturgemeinschaft eng mit Europa verknüpft!“, ruft Ortfried Kotzian. „Die Schicksalslinien ganz Europas führen hoffentlich in Richtung Frieden“, so der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung. Ein positives Zeichen dafür sei etwa der Besucheransturm, den das Sudetendeutsche Museum in München seit Ende der Corona-Beschränkungen erlebt habe.



Dies sei sicher auch Verdienst des Architekten Johannes Probst, der dieses Jahr den Großen Sudetendeutschen Kulturpreis erhalten solle. „Ihm als Schöpfer des Museums, aber auch allen anderen diesjährigen Preisträgern, die im Laufe des Abends persönlich vorgestellt werden sollten, gilt meine Anerkennung und Gratulation.“ Die 300 Gäste der Verleihung,– darunter 200 Prominente – könne er nicht alle namentlich begrüßen, heiße jedoch alle willkommenn.
Auch Gertrud Maltz-Schwarzfischer begrüßt die Landsleute herzlich. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg betont: „Die Kulturpreise am Vorabend des Sudetendeutschen Tages zu verleihen, ist eine schöne Gewohnheit.“ Dies spräche für den hohen Rang, den die Kultur bei den Sudetendeutschen einnehme, was sie als Archäologin und Denkmalschützerin besonders gut verstehen könne.

Die Oberbürgermeisterin stellte auch den Schauplatz der Verleihung vor: Das Stadttheater sei schon 1786 als Fürstlich Thurn und Taxisches Hoftheater erbaut und nach einem verheerenden Brand 1849 innerhalb von nur drei Jahren neu errichtet worden. „Jährlich hat unser Stadttheater etwa 180 000 Besucher, und es soll demnächst Staatstheater werden“, freut sich Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die den Preisträgern herzlich gratuliert.
Auch Ulrike Scharf gratuliert und hält eine einfühlsame Fest-

� Preisverleihung der SL-Kulturpreise in Regensburg
Festabend im Stadttheater

ne Freundschaft zwischen den beiden Literaturbegeisterten begann, die freilich ein vorzeitiges Ende fand, als Hana im Oktober 2019 an Krebs starb. Das Leben der tapferen Hana Jüptnerová „verdichtete“ Stroheker in ihrem Bild- und Textband „Hana oder das böhmische Geschenk“ (2021). „Sie geht dabei chronologisch vor: vom jungen, früh verwaisten Mädchen Hana über die begeisterte Germanistin und Deutschlehrerin Jüptnerová bis zur Regimekritikerin und Pflegemutter, die sich dem Christentum zuwendet“, faßte ich in meiner Laudatio auf Stroheker zusammen. „Wer das Buch besser kennenlernen will, kann morgen beim Sudetendeutschen Schatzkästlein in der Donau-Arena an der Lesung von Tina Stroheker teilnehmen“, kündigt die Moderatorin an.
rede über die Sudetendeutschen:
„Kultur offenbart die Schönheit von Völkern“, so die Schirmherrschaftsministerin. „Sie bietet Orientierung in schwierigen Zeiten wie eben der heutigen.“ Die Sudetendeutschen hätten schon oft bewiesen, daß sie in unsicheren Zeiten zusammenhalten könnten. „Sie sind Vorbilder des Zusammenhalts“, lobt Scharf. „Mir ist es wichtig, die Kultur und Geschichte der Heimatvertriebenen lebendig zu halten.“ Die kulturelle Vielfalt, das Geschichtsbewußtsein und die Werte des vierten Stammes seien beeindrukkend. „Gemeinsam arbeiten wir weiter mit ganzer Kraft für ein freies, friedliches und demokratisches Europa.“
Dabei könnten sich die Sudetendeutschen auch der Unterstützung des Bayerischen Staatsregierung sicher sein.
Gerade habe man eineinhalb Millionen Euro für den Erweiterungsbau des Heiligenhofs bereitgestellt. „Und erst letzten Montag konnte ich Ortfried Kotzian in Augsburg mit dem Bundesverdienstkreuz am Band auszeichnen“, verkündet die Schirmherrschaftsministerin, die den Preisträgern ebenfalls gratuliert.
Zur Einstimmung auf die Verleihung hat eingangs Iris Marie Kotzian mit Blauhelm „Sono l‘architetto della città“ frei nach Rossinis Arie „Largo
al factotum“ gesungen, um die Leistungen von Johannes Probst zu würdigen. Iris Marie Kotzian führt charmant durch den Abend. Die Sopranistin ist Trägerin des SL-Förderpreises für Darstellende und Ausübende Kunst und stammt aus dem Riesengebirge und dem Egerland.
Das Bläserquintett des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad begleitet sie und umrahmt auch mit weiteren Stücken musikalisch. Die Marienbader hätten als Komponisten unter anderen den Benediktinerpater Konstantin Mach (1915–1996) gewählt. Außerdem hört man eindrucksvoll Werke von Max Reger (1873–1916) und dem gebürtigen Reichenberger
Edmund Nick (1891–1974). Bei dessen „Elegie in Sachen Wald“, einer Vertonung von Erich Kästners Gedicht, wird die Sängerin von Christoph Weber am Flügel begleitet.
Zwischen den musikalischen Intermezzi stehen ab jetzt die Preisträger im Mittelpunkt, die zur Verleihung zur Bühne kommen. Die Moderatorin geht auf die jeweiligen Biographien ein und entlockt den frisch gekürten Kulturpreisträgern spannende Aussagen über Leben und Werk – eine gelungene, lebendige Ergänzung zu den Laudationes.
Laudatoren sind der Künstler Hansjürgen Gartner, selbst Träger des Großen Kulturpreises, Heimatpflegerin Christi-

na Meinusch, SL-Bundeskulturreferent Ulf Broßmann und ich selbst, die zu Beginn Leben und Werk der diesjährigen Literaturpreisträgerin vorstelle. Und die kommt auch gleich auf die Bühne. Die Schriftstellerin Tina Stroheker erzählt, wie sie sich zuerst lange mit Polen und Oberschlesien beschäftigt und dazu drei Bücher veröffentlicht habe. Erst recht spät sei sie dem Werk des sudetendeutschen Schriftstellers Josef Mühlberger (1903–1985) begegnet. Als erstes habe sie von ihm das 1934 erschienene, bis heute bekannte Buch „Die Knaben und der Fluß“ gelesen. Ein Buch über zwei schwule Jungen habe sie nicht erwartet, und dann alles von ihm, der in ihrer Nähe in Eislingen an der Fils gelebt habe, verschlungen: „Über Mühlberger habe ich das Sudetenland“ kennengelernt.“ Und die Autorin veröffentlichte über Mühlberger 2003 ihre „Vermessung einer Distanz. Aufzeichnungen in der Umgebung Josef Mühlbergers“. Dafür erhielt sie 2003 den JosefMühlberger-Preis.
Bei einer großen Konferenz über Mühlberger 2015 in dessen Heimatort Trautenau/Trutnov habe sie auch erstmals Hana Jüptnerová getroffen, die in Hohenelbe/ Vrchlabí im Riesengebirge gelebt und der Strohekers nächstes Buch gegolten habe. Ei-
Das Werk der Preisträgerin für Bildende Kunst und Architektur bringt sie dem Publikum mit projizierten Bildern nahe. Auf der Leinwand sieht man einige der faszinierenden Kunstwerke von Jo Thoma, die eigentlich Heike Schwarz heißt. „Wie ein Roter Faden zieht sich die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur durch ihr gesamtes bildnerisches und literarisches Werk“, erläutert Hansjürgen Gartner dazu. In die meisten der Bilder sind auch Texte eingebaut: „In nahezu sämtlichen ihrer Bilder sind auch Textfragmente gleichwertig mit der Bilddarstellung, meist mit ergänzendem Charakter als eigenständige Elemente eingebaut“, so der Laudator am Bespiel der Kaltnadelradierung „When you Wake up“ mit ihren spiegelverkehrt radierten Texten. Zu ihrer Zeichnung „Daily Drawings“ erkärt die Künstlerin, wie sie 2020 in Corona-Isolierung jeden Tag eine kleine Zeichnung geschaffen habe, die hier vereint seien.
Den Kulturpreis für Heimatund Volkstumspflege erhält wieder einmal ein ganzes Ensemble: „Die Band ,Mauke‘ hat sich vorgenommen, eine ,Überlebensstrategie‘ für das Paurische zu entwerfen“, lobt Christina Meinusch diese Verfechter der Gablonzer Mundart. Die Heimatpflegerin stellt die Mitglieder vor: Frontmann Wolfgang Klemm, Schlagzeuger Michael O. Siegmund, Gitarrist Herbert Stumpe, Chorsänger Sven „Fastfinger“ Siegmund, Chorsänger Björn Siegmund, Chorsänger und Bassist Dieter Schaurich und Drummer Gregor „Trommlsteckn“ Zasche.
„Der Begriff ,Mauke‘ steht im Paurischen für ,Brei“‚ erläutert sie. „Und dieser Name paßt für die Band, die seit 2006 Dialekt mit Kabarett und Musik zu einem sehr genußvollen, wenn auch nicht eßbaren Brei vermischt. Die Volkstumspreisträger geben das „Lied von der Plätschn“ zum Besten, was von einem fetzigen Kurzfilm über die Band ergänzt wird. Am Pfingstsamstag wird die Band „Mauke“ mit ihrem
großen Auftritt beim Sudetendeutschen Tag Furore machen.
Hinten links: Mitglieder von „Mauke“. Vorne Moderatorin Iris Marie Kotzian, Heimatpflegerin Christina Meinusch, Beauftrage Sylvia Stierstorfer, Tina Stroheker, Staatsministerin Ulrike Scharf MdL, Dr. Heike Schwarz/Jo Thoma, Johannes Probst, Susanne Habel, XYZ, dahinter Hansjürgen Gartner und Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung in München. Bilder: Manfred Gischler (4), Torsten Fricke (3)
Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf MdL beim Grußwort.
Die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.
Dr. Ortfried Kotzian begrüßt live und von der Leinwand über 300 Gäste.
Professor Dr. Ulf Broßmann, SL-Bundeskulturreferent und Laudator.
Architekt Johannes Probst dankt für den Großen Kulturpreis.
73. SUDETENDEUTSCHER TAG 2023 Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 10
Moderatorin Iris Marie Kotzian singt „Sono l‘architetto della città“ (Ich bin der Architekt der Stadt), um die Leistungen von Johannes Probst zu würdigen. Das Bläserquintett des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad begleitet sie und umrahmt musikalisch.
Und dann ist die Festgemeinschaft schon beim Großen Sudetendeutschen Kulturpreis angekommen: Der Architekt Johannes Probst, der mit seinem Team von der 1992 gegründeten pmp Architekten GmbH das Sudetendeutsche Museum entwarf und erbaute, wird diese Ehrung zuteil. „1960 in München geboren, hat Probst sudetendeutsche Wurzeln. Sein Vater stammt aus Jauernig bei Freiwaldau im Altvatergebirge, und seine Tante war jahrelang Leiterin der Paramentenwerkstatt in Dillingen und machte sich um die künstlerisch gestalteten Textilien verdient, die in der Liturgie Verwendung finden, wofür sie mit der Adalbert-Stifter-Medaille ausgezeichnet wurde“, wie SL-Bundeskulturreferent Ulf Broßmann in seiner Laudatio berichtet. So richtig zum Tragen sei diese Herkunft dann bei der Errichtung des Sudetendeutschen Museums in München gekommen.
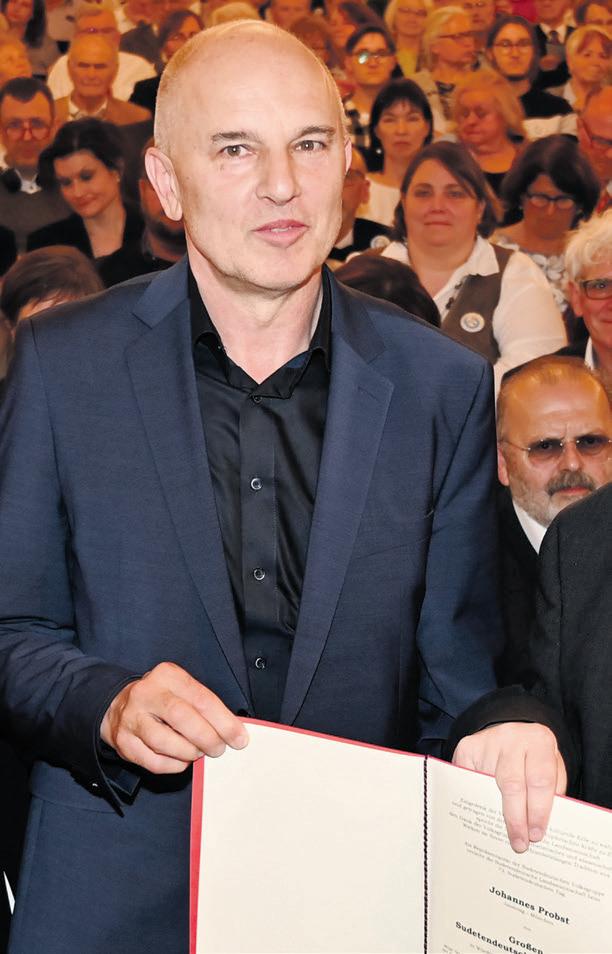


„Erklärtes Ziel des Ausstellungsbaus sei von Anfang an gewesen, sich in einem architektonisch ambitionierten Gebäude selbst eigenständig zu behaupten“, faßt Broßmann Probsts Planung zusammen. Das sei ihm
Beim Sudetendeutschen Schatzkästlein las die diesjährige Kulturpreisträgerin für Literatur, Tina Stroheker, aus ihrem aktuellen, mehrfach ausgezeichneten Buch „Hana oder Das böhmische Geschenk. Ein Album“ und zeigte Bilder daraus. Dazu spielte eine neunköpfige Formation des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad Werke von Charles Gounod (1818–1893) und Antonín Dvořák (1841–1904).
In Tina Strohekers Wohnort Eislingen an der Fils in BadenWürttemberg leben und lebten viele Menschen mit sudetendeutscher Familiengeschichte, so auch der sudetendeutsche Schriftsteller Josef Mühlberger (1903–1985). Tina Stroheker gab von ihm die Werke „Gedichte aus dem Nachlaß“ (1990) und „Mein Kapitel Mühlberger. Erinnerungen an einen Autor“ (1999) mit Interviews und Texten von Menschen, die den Schriftsteller noch persönlich kannten, heraus und kuratierte mit dem Kunstverein Eislingen 1995 die literarische Veranstaltungsreihe „Mühlberger-Tage“. Und sie veröffentlichte über Mühlberger 2003 ihre „Vermessung einer Distanz. Aufzeichnungen in der Umgebung Josef Mühlbergers“. Dafür erhielt sie 2003 den Josef-Mühlberger-Preis.
Bei einer großen Konferenz über Mühlberger 2015 in dessen Heimatort Trautenau/Trutnov begegnete Stroheker auch erstmals Hana Jüptnerová, die in Hohenelbe/Vrchlabí im Riesengebirge lebte. Jüptnerová war eine tschechische Lehrerin, Dolmetscherin, Brückenbauerin zwischen Deutschen und Tschechen und bekennende Christin. Nach dem frühen Krebstod Jüptnerovás veröffentlichte Tina Stroheker das Buch „Hana oder das
� Preisverleihung der SL-Kulturpreise in Regensburg

Festabend im Stadttheater
men aller diesjährigen Preisträger für „die Wertschätzung unserer Arbeit“. Er habe festgestellt, so Probst, daß unter den früheren Trägern des Großen Kulturpreises sehr selten Architekten gewesen seien. „Zuletzt war das vor genau dreißig Jahren der eher als Karikaturist ,Ironymus‘ bekannte Architekt Gustav Peichl.“
Der neugekürte Träger des Großen Kulturpreises erklärt, daß sein Entwurf für ein Sudetendeutsches Museum quasi anonym, also ohne jeglichen Hinweis auf seine sudetendeutschen Wurzeln aus mehr als 100 eingereichten Entwürfen ausgewählt worden sei.
Im vollbesetzten Neuhaussaal freuen sich alle über den Preis für Heimat- und Volkstumspflege: Vorne links die Heimatpflegerin, Christina Meinusch, Staatsministerin Scharf und die Band „Mauke“, denen Sprecher Bernd Posselt und Bundeskulturreferent Ulf Broßmann (ganz rechts) die Urkunde überreichen.
als Architekt und Projektleiter auf wissenschaftlicher und angewandt praktischer Basis hervorragend gelungen. „Damit ist das Sudetendeutsche Muse-
um zur eindrucksvollen Kathedrale der Sudetendeutschen geworden, die in ihrem Inneren das materielle und immaterielle Kulturerbe unserer Volksgruppe be-
herbergt. Wenn man es betritt, lädt das Museum Nachgeborene, künftige Generationen und Interessierte ein, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandeln, und
� Sudetendeutsches Schatzkästlein mit Kulturpreisträgerin in Regensburg
sei es nur für Stunden“, freut sich der Laudator. Abschließend bedankt sich Johannes Probst, neuer Träger des Großen Kulturpreises, im Na-
Geschenke aus Böhmen
böhmische Geschenk“ (2021) mit Fotos aus den 67 Jahren von Hanas Leben, zu denen sie im Buch jeweils eine Episode erzählt. Ihr Buch „Hana oder das böhmische Geschenk“ bildet auch die Grundlage von Tina Strohekers Vortrag, zu dem die passenden Fotos gezeigt werden, die teilweise auch von Hana Jüptnerová stammen. Eingangs bedankt Stroheker sich für die „drei Geschenke“ aus Böhmen, die sie bisher erhalten habe. Das jüngste sei der Sudetendeutsche Kulturpreis für Literatur, dann die Tatsache, daß sie als Nicht-Sudetendeutsche das Sudetenland so gut habe kennenlernen dürfen und schließlich eben die tiefe Freundschaft mit Hana Jüptnerová, deren Angehörigen und Hinterbliebenen zu Strohekers „böhmischer Familie“ geworden seien.
Hanas Nachname stamme von ihrem früherem Ehemann Gert Jüptner, einem heimatverblie-
benen Deutschen, von dem sich Jüptnerová nach kurzer Ehe getrennt habe.
Wie im Buch geht Tina Stroheker bei ihrer Lesung chronologisch vor: vom jungen, früh verwaisten Mädchen Hana über die begeisterte Germanistin und
Deutschlehrerin bis zur Regimekritikerin und Pflegemutter, die sich dem Christentum zuwendet. So liest sie zunächst den Text „Mädelchen“ und zeigt das Foto der kleinen Hana mit braver Brille. Weiter geht es mit den Kapiteln „Gebunden“ über Hanas Fa-


miliengründung und „Laut sprechen“ über den Mut der jungen Dissidentin in der ČSSR.
Nach der Samtenen Revolution gibt es den „Festtag“, bei dem sie mit Václav Havel im Januar 1990 feiert. In dieser Zeit habe Hana auch drei Roma-Kinder adoptiert, erzählt die Autorin.
Um das Sudetenland geht es dann besonders in „Kde domov mŮj“, wo Stroheker Hanas Herkunftsort Hackelsdorf/Herlíkovice im Kreis Hohenelbe im Riesengebirge beschreibt. Dort habe sich auch Hanas Alltagsleben nach der Wende abgespielt. So stellt Hana den „Ersten Advent“ witzig auf einem Foto dar, auf dem – statt Kerze – eine von vier Gasherdplatten brennt.
Auf den Advent folgt Weihnachten mit der rhetorischen Frage „Was schenkst Du mir?“, bei dem das Foto die Gaben im „Weihnachtspäckchen aus dem Rübezahlland“ zeigt, die Hana
Johannes Probst beschreibt auch, wie die Verschmelzung des alten Sudetendeutschen Hauses – das schon 1985 eröffnet wurde und jetzt an neue technische Anforderungen habe angepaßt werden müssen – mit dem neuerbauten Sudetendeutschen Museum gleich daneben so gut habe gelingen können, wie schon an der Fassade ersichtlich: „Eine gemeinsame Leistung von allen Beteiligten, bei denen ich mich hier bedanken möchte“, sagt der große Baumeister als Schlußwort.

Susanne Habel
an Tina in den Westen geschickt hat: ein Becherovká-Fläschchen, Oblaten, ein Spitzentaschentuch („alle einzeln eingepackt!“) und ein Zettelchen mit einem Gedicht von Oldřich Mikulášek.
In der Episode „Gras“ sitzt ein Junge auf einer Wiese über Herlikovice, einer von Hanas Söhnen, der über die Zukunft nachzusinnen scheint. Weiter geht es nach Hackelsdorf, wo heute immer noch die Fischerbaude steht, vor der eine Lilie, die ein Gedicht von Zbigniev Herbert evoziert.
Im letzten Teil der Lesung geht es um Hanas „letzte Zeit“, wie sie zunächst im Kapitel „Segen“ mit einem einfachen Frühstückstisch beschrieben wird, über dem die konvertierte Christin Hana immer den Segen gesprochen habe. Vom Krebsleiden schon schwer geschwächt, sieht man Hana dann mit einem Urenkelchen und Hündchen im Bett liegen. Als Endpunkt zeigt Stroheker ein Foto vom Holzkreuz auf Hana Jüptnerovás Grab, an dem die ihr einst von Hana geschenkte Korallenkette baumelt:
„Die hängt wohl immer noch da“, sinniert Tina Stroheker unter großem Applaus.
Sie bedankt sich auf Tschechisch bei den Musikern, die das Schatzkästlein umrahmt haben: Das neunköpfige Bläserensemble aus den Reihen des Westböhmischen Symphonieorchters Marienbad hat glanzvoll zwei Sätze aus der „Petite Symphonie“ von Charles Gounod und ein Potpourri von „Aus der neuen Welt“ von Antonín Dvořák aufgeführt. Auch die Musiker erhalten viel Applaus im überfüllten Vortragsraum, bevor sie davoneilen zum nächsten Auftritt. Wie schon seit Jahrzehnten hat sich das „Sudetendeutsche Schatzkästlein“ als Gesamtkunstwerk aus Wort, Bild und Musik gezeigt.
Susanne Habel
Laudator Hansjürgen Gartner, Staatsministerin Ulrike Schwarz MdL, Dr. Heike Schwarz/Jo Thoma (Bildende Kunst und Architektur), Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Preisträger Johannes Probst (Großer Kulturpreis), der seine Urkunde zeigt (Bild Mitte) und Laudatorin Susanne Habel, Ministerin Scharf, Tina Stroheker (Literatur und Publizistik). Bilder: Manfred Gischler (1), Torsten Fricke (4)
73. SUDETENDEUTSCHER TAG 2023 Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2022 11
Beim vollbesetzten Schatzkästlein trägt ein Bläserensemble Werke von Gounod und Dvořák vor. Bilder: Torsten Fricke (1), Manfred Gischler (2)
Bundeskulturreferent Ulf Broßmann stellt Tina Stroheker vor.
� Vortragsveranstaltung des Heimatrates
Meilenstein für Fundament
Gertraud Rakewitz, Landesfrauenreferentin in Nordrhein-Westfalen, Gerda Nilges, Obfrau der SL-Ortsgruppe Krefeld, rechts Willi und Brigitta Gottmann, Vorgängerin von Rakewitz als Landesfrauenreferentin der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Nordrhein-Westfalen. Bilder: Nadira Hurnaus



� Vortragsveranstaltung des Bundesfrauenarbeitskreises
Frauenrechte sind Menschenrechte
Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates und Ko-Vorsitzende der SeligerGemeinde, sprach beim Frauenforum des Bundesfrauenarbeitskreises der SL über „Mit den Frauen in die Zukunft. Frauenrechte sind Menschenrechte“.
Zunächst begrüßte Bundesfrauenreferentin Gerda Ott die Gäste. Unter ihnen war auch Klaus Hoffmann, Stellvertretender SL-Bundesvorsitzender und SL-Landesobmann von BadenWürttemberg. Er sagte, er wolle die Männerquote bei den Frauen erhöhen. Ott freute sich besonders, diesmal die erste Präsidentin der Bundesversammlung im Frauenforum willkommen zu heißen. Und Naaß wies darauf hin, daß bei der kürzlichen Bundesversammlung die Arbeit der Frauen ein eigener Tagesordnungspunkt gewesen sei.
Wenige Wochen zuvor, sagte Christa Naaß, sei sie bei einem Treffen der Höheren Kommunalverbände in Ansbach gewesen. Deren Vorsitzende sei Susanne Selbert, die Enkelin der SPD-Politikerin Elisabeth Selbert. Elisabeth Selbert sei eine der vier Frauen des 65köpfigen Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz verabschiedet habe. Daß der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ im Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen worden sei, sei ihr Verdienst.
Die bayerische SPD-Politikerin und erste Gesundheits- und Familienministerin Käthe Strobel habe gesagt: „Politik ist eine viel zu ernste Sache, als daß man sie allein den Männern überlassen könnte.“ Das habe Elisabeth Selbert bewiesen: Auf ihre Initiative sei auch die Übergangsregelung in Artikel 177 Grundgesetz entstanden, nach der alle dem Gleichheitsprinzip entgegenstehenden Gesetze bis 1953 angepaßt sein müßten.
1994 sei der Artikel 3 des Grundgesetzes um folgenden Satz ergänzt worden: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Nun warf Naaß einen Blick auf die Geschichte der Emanzipation. Seit 1908 dürften Frauen politische Versammlungen besuchen, abhalten und politische Vereine gründen. Der erste Internationale Frauentag habe 1911 stattgefunden. Allein in Berlin hätten 45 000 Frauen das Frauenwahlrecht gefordert. Sie hätten es aber erst 1918 erhalten. Als die Frauen am 19. Januar 1919 das erste Mal hätten wählen dürfen, hätten 82,3 Prozent Frauen und
82,4 Prozent Männer gewählt. „Heute wären wir froh über solch ein Interesse.“
Der Frauenanteil in der Nationalversammlung habe 8,7 Prozent betragen. Dieser sei bis zur Bundestagswahl 1983 unerreicht geblieben. Erst die Einführung einer Quote habe hier Veränderungen gebracht.
Die Gegenwart im Blick, sprach Naaß nun über Kommunalparlamente. Nicht einmal jedes zehnte Rathaus in Bayern werde von einer Frau geleitet. In fünf der 71 Landratsämter hätten Frauen das Sagen, und nur 186 Bürgermeisterinnen seien für das Wohl ihrer Gemeinde verantwortlich.
Nach der letzten Landtagswahl sei die Frauenquote im Landtag zum zweiten Mal in Folge auf 26,8 Prozent gefallen. Bayern sei das Bundesland mit den wenigsten weiblichen Abgeordneten. Die Anteile bei den einzelnen Landtagsfraktionen sei-
Gehalt spiegele sich diese Leistung wider. Frauen verdienten in Bayern im Schnitt 25 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die meisten Führungspositionen seien männlich besetzt. Auch dort, wo der Freistaat das Sagen habe, in seinen eigenen Unternehmen, seien Frauen in den Aufsichtsgremien mit nur 18 Prozent vertreten. Die durchschnittliche Frauenrente sei seit Jahrzehnten 50 Prozent niedriger als die durchschnittliche Männerrente.
Freiheit, Offenheit und Toleranz seien im 21. Jahrhundert Werte, die überall gelten sollten. Und überall dort, wo dies noch nicht der Fall sei, sei es unsere Pflicht als Demokraten, die Menschen zu unterstützen, die sich unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens für Grund- und Menschenrechte engagierten.
Jeden dritten Tag sterbe eine Frau in Deutschland durch die Hand ihres Partners oder ExPartners. Dazu kämen wachsende Brutalität im Internet, unerlaubtes Filmen von intimen Bereichen, blanker Haß in den sozialen Medien mit dem Ziel, Frauen zu demütigen und mundtot zu machen.
„Der Zustand der Friedhöfe gibt Aufschluß über den Zustand der Bevölkerung“, sagte ein Tscheche bei der Konferenz „Gräber der Deutschen und anderer Nationalitäten in der Tschechischen Republik“ Ende April in Prag. Professor Ulf Broßmann, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Friedhöfe“ beim Sudetendeutschen Heimatrat, berichtete über die Konferenz bei der Vortragsveranstaltung des Heimatrates.
Zum desolaten Zustand der deutschen Friedhöfe kam es, weil die Sudetendeutschen 1946 bei ihrer Vertreibung die Toten zurücklassen mußten und danach die Gräber nicht pflegen durften. Die voranschreitende Zerstörung deutscher Friedhöfe versuchte ab 2001 Stanislav Děd, damals Direktor des Regionalmuseums in Komotau, mit dem tschechischen Verein Omnium aufzuhalten.
struktion von Grabstätten unter Berücksichtigung des jeweiligen kulturhistorischen und außenpolitischen Kontextes.
l Grundlagen schaffen für die Festlegung der Parameter finanzieller Fördertitel für Gemeinden oder Verbände.
Da sich abzeichnete, daß das Ergebnis erst im September vorliegen würde, beraumten das tschechische Außenministerium und das tschechische Regierungsamt eine Konferenz im Palais Černín über „Gräber der Deutschen und anderer Nationalitäten in der Tschechischen Republik“ im April an. Sie sollte sich den Fragen widmen, wie der aktuelle Zustand der Gräber und Friedhöfe sei, wie die letzten Ruhestätten der Ahnen weiter vor dem Verfall gerettet werden könnten, wer dafür zuständig und was zu tun sei.
Auf Betreiben von Děd und Martin Dzingel, Vize-Vorsitzender des Regierungsrates für Na-
turgut oder als Teil der Geschichte der Gemeinde instandgesetzt und erhalten werden.
Děds Vorschläge decken sich weitgehend mit dem Konzept der Arbeitsgruppe des Heimatrats.
en sehr unterschiedlich. Die SPD habe mit 50 Prozent den höchsten Frauenanteil in ihrer Fraktion, AfD und FDP mit je 9,1 Prozent den niedrigsten.
Der Frauenanteil in den Parlamenten wirke sich auch auf die Umsetzung von Politik für Frauen aus. Wer über den Haushalt einer Kommune entscheide, entscheide auch darüber, daß öffentliche Gelder Frauen und Männern gleichermaßen zugute kämen. Gleichstellungspolitik stehe für mehr Lebensqualität von Frauen, Männern und Kindern. Die Geschichte zeige, wie beharrlich Frauen ihr Vorwärtskommen in der Politik und ihre Einflußnahme auf das öffentliche Leben hätten erkämpfen müssen und immer noch darum kämpfen müßten.
Trotz vieler Fortschritte würden Frauen immer noch benachteiligt. Sie verdienten im Durchschnitt weniger, erhielten geringere Renten und seien dadurch einem höheren Risiko von Altersarmut ausgesetzt. Nach der Geburt ihrer Kinder müßten sie immer noch mit Karriereeinbußen rechnen. Gleichzeitig leisteten sie immer noch einen Großteil der Haus- und Fürsorgearbeit.
Bei den Bildungsabschlüssen hätten Frauen die Nase vorn. Aber weder in ihrer beruflichen Position noch in ihrem
Laut Deutschem Frauenrat engagierten sich 31 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich. Davon seien 41 Prozent Frauen. Während Frauen in den Bereichen Soziales, Bildung und Kultur tätig seien, engagierten sich Männer häufiger in den Bereichen Sport, Technik und Wirtschaft. Frauen übernähmen häufiger unterstützende und ausführende Aufgaben, während Männer häufigerleitendePositioneneinnähmen.
Auch im Ehrenamt zeige sich, je höher Frauen noch oben wollten, desto dünner werde die Luft. Frauen stießen oft auf unsichtbare Barrieren, die es ihnen erschwerten, in höhere Positionen aufzusteigen oder Führungsrollen zu übernehmen. Eine der Herausforderungen sei die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt.
„Wie schaut es in den Gremien aus, in denen wir engagiert sind: in der SL, im Bundesvorstand, in den Landesverbänden, in den Heimatkreisen? Spiegeln sich auch hier noch die unsichtbaren Barrieren, die alten Verhaltensmuster? Wenn ja, was können wir dagegen tun?
Wir stellen mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Deshalb müssen wir uns mit unserem Wissen und Erfahrungsschatz, mit unseren unterschiedlichen Herangehensweisen einbringen. Frauen sind nicht das Problem, sondern die Lösung. Mit Frauen in die Zukunft, dann haben wir eine gute Zukunft“, schloß Christa Naaß. Nadira Hurnaus
Dies erfolgte mit Fotodokumentationen und dem Hinweis auf den deutschtschechischen Staatsvertrag von 1992 mit den Artikeln 24 und 30. In denen verpflichtete sich die Tschechische Regierung, das Problem um das deutsche Kulturgut Friedhöfe und Gräber zu lösen. Die Einrichtung einer „Arbeitsgruppe Friedhöfe“ beim Regierungsrat für Nationale Minderheiten in der Tschechischen Republik und 2017 die Verteilung eines Handbuches für tschechische Gemeinden, wie mit verlassenen deutschen Friedhöfen umgegangen werden soll, sensibilisierten die Öffentlichkeit und die deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik, mit den deutschen Gräbern künftig pietätvoll umzugehen. Auch beim Ausschuß für Kultur und Volkstumspflege der Sudetendeutschen Bundesversammlung berichtete Stanislav Děd 2016 in München über die Verpflichtung der Tschechischen Republik, die sich aus dem Staatsvertrag von 1992 ergebe, und schlug eine internationale Konferenz über die Friedhofsprobleme vor. Damit sollte die SL in die Lösung der Gräberprobleme einbezogen werden. Leider kam es zu einem Rückschlag, denn die Gesprächspartner auf der tschechischen Seite fehlten während der Regierung Andrej Babiš und Corona.
Edmund Schiefer, Vorsitzender des Bundesversammlungsausschusses Heimatgliederung und Patenschaften, Professor Dr. Ulf Broßmann, Stellvertretender Vorsitzender des Heimatrates, und Franz Longin, Vorsitzender des Heimatrates. Bild: Manfred Gischler
tionale Minderheiten und Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, wurden erstmals auch Vertreter der SL eingeladen. Zur Vorbereitung der Konferenz richtete sie die Arbeitsgruppe für historische deutsche Gräber und Friedhöfe in der Tschechischen Republik beim Heimatrat ein.

Bei rechtlichen Fragen sei zu klären, ob die Kommunen die Gräber sanieren müßten oder diese Aufgabe vom Staat übertragen bekämen. Dabei müsse man beachten, daß mit dem Boden verbundene Bauten wie Gruften oder Grabhäuser als Immobilien behandelt würden. Zuständig sei dann der Grundstückbesitzer wie Kommunen, Betreiber der Begräbnisstätte oder der Staat. Grabmale, Umrandungen oder Deckplatten seien Mobilien, die ohne Entwertung beseitigt werden könnten. Exhumierungen seien nur erlaubt, wenn kein anderer Begräbnisplatz für heutige Bewohner vorhanden sei. Dann stellt sich allerdings die Frage, wo die exhumierten Gebeine aufgehoben werden sollen. Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe des Heimatrats sagte ich, daß das Ziel die Sanierung des deutschen Kulturgutes Friedhöfe in der Tschechischen Republik sei, weshalb die Arbeitsgruppe auch eigene Vorschläge erarbeitet habe. Weiter bot ich eine vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit sowie nachhaltige Arbeitskontakte zwischen der tschechischen und der sudetendeutschen Seite an. Wir Sudetendeutschen begrüßen eine förderliche Kooperation für eine künftige Instandsetzung der deutschen Friedhöfe oder Gräber, die ein pietätvolles, historisches Gedächtnis an die Verstorbenen darstellt, aber auch eine Chance bietet für eine gemeinsame, tschechisch-sudetendeutsche Erinnerungskultur.
Es wurde festgestellt, daß die genaue Anzahl der deutschen Gräber unbekannt sei, es müsse sich um mehrere 100 000 auf rund 6000 deutschen Friedhöfen handeln. Ihr Zustand sei desolat, in Militär- und Grenzgebieten seien die Friedhöfe verschwunden.
Deshalb gab 2020 das Tschechische Außenministerium das Projekt „Problematik der deutschen Gräber in der Tschechischen Republik: ein umfassender Ansatz“
in Auftrag. Die Durchführung liegt bei der Technologieagentur der Tschechischen Republik (TAČR), die Unteraufträge an andere Organisationen vergab. Die Ziele des Projekts sind:
l Erarbeitung einer qualifizierten Grundlage für die Umsetzung des bilateralen Vertrages mit Deutschland im Bereich der Pflege deutscher Gräber auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und Entwicklung einer digitalen Karte.
l Erarbeitung eines Vorschlages für ein umfassendes Konzept für die Tschechische Regierung zur Entscheidungsfindung über die Sanierung oder Rekon-
Dzingel eröffnete die Konferenz, Außenminister Jan Lipavský berief sich auf den deutschtschechischen Vertrag von 1992 und bestätigte, daß der tschechische Staat verpflichtet sei, das Problem der deutschen Friedhöfe und Gräber zu lösen. Der Deutsche Botschafter in Prag, Andreas Künne, betonte, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik seien so gut wie nie zuvor und die Lösung des Friedhofproblems für deutsche Gräber müsse angegangen werden.
Der Zustand der Gräber und Friedhöfe konnte dank Děds Vortrag mit Fotomaterial gut dokumentiert werden. Děd schlug auch ein Lösungskonzept vor.
l Es sollen einfache, brauchbare, akzeptable Maßnahmen zum Erhalt der verbliebenen Gräber vorgeschlagen werden.
l Auf größeren Friedhöfen mit genug Platz sollen deutsche Gräber nicht gestört, aufgelöst oder fremdbelegt werden.
l Friedhöfe sollen präventiv gepflegt werden durch Reinigung, Beseitigung von Vandalismusschäden, Rodung überwuchernder Vegetation oder Aufrichten von Grabsteine.
l Nur Grabsteine von nicht mehr vorhandenen Gräbern sollen zu Gedenkstätten zusammengestellt werden. Gezielte Verlegung von Grabsteinen vorhandener Gräber ist nach geltendem Recht und aus Pietätsgründen nicht möglich.
l Historische Grabmale sollen als Teil des europäischen Kulturerbes, als nationales Kul-
Weitere Fragen, wie die letzten Ruhestätten der Ahnen vor dem Verfall gerettet werden könnten, wer dafür zuständig und was zu tun sei, wurden andiskutiert. Konkrete Antworten und belastbare Zahlen über die Kosten, an denen sich der DeutschTschechische Zukunftsfonds beteiligen würde, wird das Projekt des tschechischen Außenministeriums liefern.
Die Situation der Friedhöfe mit deutschen Gräbern ist unumkehrbar. Nun muß auf Grund der Ergebnisse des Projektes bei den noch vorhandenen deutschen Friedhöfen und Gräbern die Zerstörung gestoppt und Sanierung und Erhaltung durchgeführt werden.
Die Konferenz war ein Meilenstein, bei der die Fundamente für eine Lösung des Problems der deutschen Gräber in der Tschechischen Republik gelegt wurden, da die SL erstmals an direkten Gesprächen auf höchster Ebene teilnahm und da alle einhellig der Meinung waren, daß die deutschen Friedhöfe und Gräber saniert und erhalten werden müssen.
Die Arbeitsgruppe des Regierungsrats für Nationale Minderheiten wird mit der Arbeitsgruppe des Heimatrats ein Lösungskonzept erarbeiten, das auf den Ergebnissen des Projekts des Außenministeriums basiert. In einer letzten Konferenz in Prag wird Ende des Jahres wieder mit Beteiligung der Heimatrats-Arbeitsgruppe ein umfassendes Lösungskonzept für die Tschechische Regierung zur Entscheidungsfindung über die Sanierung, Rekonstruktion und Finanzierung von Grabstätten vorgelegt werden. fn/dr
73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 12
Gerda Ott und Christa Naaß. Bild: Nadira Hurnaus
Hoamaterd‘ –der Kultur auf der Spur
Der Heimatabend des 73. Sudetendeutschen Tages hatte ein Ausrufezeichen, zwei Moderatorinnen, die auch Regie führten, das Thema „Hoamaterd‘“ und viele tschechische Besucher.
Die Gartenberger Bunkerblasmusik aus der oberbayerischen Vertriebenenstadt Geretsried begleitete den Einmarsch der Trachten-, Tanz- und Musikgruppen. Heimatpflegerin Christina Meinusch begrüßte dann besonders die tschechischen Politiker einschließlich der Regierungsvertreter. Die, so Meinusch, sorgten dafür, daß es an diesem Abend nicht nur auf der Bühne, sondern auch an den Tischen grenzüberschreitend zugehe. Auf der Bühne würden sich gleich 150 Mitwirkende tummeln, denen sie herzlich danke.
Sylvia Stierstorf MdL, Bayerns Landesbeauftragte für Vertriebene und Aussiedler, erzählte in ihrem Grußwort von ihrer Eghalandrischen Wurzelheimat Blatnitz im ehemaligen Kreis Mies. Immerhin sei ihre Heimatstadt Regensburg die Patenstadt aller vertriebener Sudetendeutscher.
Dann fetzten die Javorníks los. Die Gruppe war 1970 aus einer walachischen Kindertanzgruppe hervorgegangen. Seit 1978 ist Svatoslav Válek der Leiter und Choreograph der Volkstanzgruppe. Früher hatten die Javorníks vor allem Tänze aus der Walachei in ihrem Repertoire, mittlerweile sind auch Tänze aus dem Kuhländchen dazugekommen. Meistens begleitet eine Zimbelkapelle die Tänze der Javorníks.

Die Böhmerwaldjugend bot – wer hätte das gedacht – einen Böhmerwaldlandler und einen Steirischen aus dem Böhmerwald. Die Böhmerwaldjugend besteht aus der Sing- und Volkstanzgruppe München, der Sing- und Spielschar Ellwangen und der Spielschar aus Heidelberg. Sie entstand 1950, um vertriebene Böhmerwäldler in ihrem neuen Zuhause zu unterstützen.

Die Böhmerwaldjugend nimmt seit vielen Jahren an der Europeade teil, einem internationalen Trachten- und Folklorefestival.



Auch die Egerländer Familienmusik Hess war wieder mit von der Partie und begleitete al-







die geschmückten Hüte, bei den Frauen die hohen weißen Tatzl genannten Halskrausen und die reich bestickten Röcke und Blusen. Mehrere Röcke übereinander geben den Trägerinnen die besondere, ausladende und
in der Heimat stattfanden. Vergangenes Jahr feierte der Singkreis mit einem Kammerkonzert sein 80jähriges Bestehen.
Die südmährische Sing- und Spielschar Moravia Cantat sang „Johannissegen“ und „Heint gemmo nimma hoam“. Das Ensemble aus Stuttgart will die deutsche Musikkultur Böhmens und Mährens pflegen und weiterentwickeln und dabei die vielfältigen musikalischen Gemeinsamkeiten und Wechselwirkungen zwischen deutscher, tschechischer und jüdischer Kultur in dieser Region im Herzen Europas zeigen. Sein Repertoire umfaßt weltliche und geistliche Chormusik ebenso wie historischen Tanz und Volkstanz sowie Instrumentalmusik in verschiedenen Besetzungen. Regelmäßig gibt es Konzerte im In- und Ausland.

le Gruppen ohne eigene Kapelle, also die meisten. Sie entstand 1978 und pflegt Eghalanda Musik, Mundart und Trachten. Ihre Wurzeln liegen im Karlsbader, Marienbader und Grulicher Raum. Nach der Vertreibung kamen die Eltern in den Odenwald. Den Grundstein für die Familienmusik legte Heinz Hess. Neben einem Teil der Gründungsmitglieder spielen heute deren Kinder mit.
Die Wischauer stellten ihre Schusterpolka vor, bei der sie zweisprachig – Wischauerisch und Hochdeutsch – das Schusterhandwerk erklären. Die Wischauer Sprachinsel lag 30 Kilometer östlich der südmährischen Metropole Brünn und bestand aus acht Dörfern mit 3500 Einwohnern. Noch immer tragen die Wischauer die Originalfesttagstrachten ihrer Vorfahren. Die Wischauer Tracht ist eine gewachsene Bauerntracht und wurde nicht verändert. Besonders auffallend sind bei den Männern


schwingende Rockform. Mit den speziellen Festtagsröcken können die Frauen leider nicht sitzen.
Der Iglauer Singkreis sang „Wer bekümmert sich und wenn ich wandre“. Er wurde 1941 in Iglau unter dem Komponisten und Musikerzieher Fritz Stolle gegründet. Ziel waren die Pflege heimatlicher Volkskunst und die Erarbeitung von Chorwerken und Spielstücken alter und zeitgenössischer Meister. Nach der Vertreibung trafen sich die Mitglieder in Deutschland wieder, um ihre Arbeit fortzusetzen. Besondere Aufmerksamkeit lag nun auf dem Volkslied aus den ehemals deutschen Sprachgebieten Ostmitteleuropas. Nach 1989 entwickelten sich rege Kontakte zu tschechischen und deutschen Kulturgruppen in Iglau, bereits sieben Singwochen wurden seither in Iglau abgehalten. 2016 konnte der Singkreis die Iglauer Heimattage mitgestalten, die zum ersten Mal nach dem Krieg

Begeisterung beim Publikum löste auch die 1995 entstandene Schönhengster Volkstanzgruppe aus Mährisch Trübau aus. Sie erarbeitet alte deutsche Tänze aus dem nordmährischen Schönhengstgau und aus anderen ehemals deutschen Gebieten. Sie hat 29 Mitglieder von neun bis 30 Jahren. Die Jugend stammt aus deutschen und tschechischen Familien. Die Volkstanzgruppe beteiligt sich an vielen kulturellen Begegnungen in der Tschechischen Republik und vertritt die deutsche Minderheit alle zwei Jahre bei den Folklorefesten in Straßnitz. Sie organisierte bereits einige Auslandsfahrten mit den Heimatkreisen oder anderen Tanzgruppen. So reisten sie in die Slowakei, nach Österreich, Ungarn und Deutschland.
Leiterin ist seit 1996 Irene Kunc, Vorsitzende der Regionalgruppe Schönhengstgau und Leiterin des Begegnungszentrum in Mährisch Trübau.
Und zum Schluß sangen die Jungen und die Alten, die Deutschen und die Tschechen gerührt und ein wenig wehmütig den Heimatklassiker „Kein schöner Land“. Nadira Hurnaus

73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 13
Die Wischauer stellen das Schusterhandwerk vor.
Die Iglauer singen.
Bilder: Manfred Gischler (12), Nadira Hurnaus (5)
Moderatorin Stefanie Januschko, Sylvia Stierstorfer MdL, Landesbeauftragte für Aussiedler und Vertriebene, Moderatorin Elisabeth Januschko und Christina Meinusch, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.
Die brasilianischen Böhmerwäldler Elisangela Leitzke und Denis Gerson Simões mit ihrer Tochter Isis und ihrem Sohn Thomas.
Ein Kuhländler Herrenschuh und ein wallachischer Damenpumps. Die Böhmerwäldler Martin und Sabine Januschko sind die Eltern der moderierenden Zwillinge Elisabeth und Stefanie.
Pavel Bělobrádek und Bernd Posselt klatschen kräftig mit, ebenso Carsten Drexler, der fröhliche Helfer und Mann von Christina Meinusch.
Javorník-Solo
Der Iglauer Harry Höfer und der Egerländer Roland Hammerschmied beantworten Stefanie Januschkos Fragen.
Die Schönhengster aus Mährisch Trübau.
Die Böhmerwäldler
Javorník-Tanz
Moravia Cantat tanzt.
� HEIMAT!abend – Tracht, Musik, Tanz
❯ Weihbischof Reinhard Hauke zelebrierte die römisch-katholische Eucharistiefeier auf dem Sudetendeutschen Tag
„Aus gutem Geist konnte Neues entstehen“

Zum Sudetendeutschen Tag gehören seit jeher, zumal zum traditionellen Veranstaltungstermin Pfingsten, natürlich feierliche Gottesdienste. Der römisch-katholischen Eucharistiefeier stand heuer der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke vor, der seit 2009 Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Vertriebenenund Aussiedlerseelsorge ist.

Neben dem Hauptzelebranten
begrüßte Monsignore Dieter Olbrich, Präses der sudetendeutschen Katholiken und Geistlicher Beirat der Ackermann-Gemeinde, besonders Monsignore Alexander Hoffmann von der Erzdiözese München und Freising (Domvikar und Abteilungsleiter Muttersprachliche Seelsorge) sowie als Vertreter der Tschechischen Bischofskonferenz Monsignore Adolf Pintíř, der auch Vorsitzender der Sdružení Ackermann-Gemeinde ist und am Schluß des Gottesdienstes ein Grußwort sprach.

Das Motto des Sudetendeutschen Tages „Schicksalsgemeinschaft Europa“ nahm auch Vertriebenenbischof Hauke in seiner Predigt auf. Er beleuchtete zunächst den Begriff „Schicksal“ anhand der Herkunft beziehungsweise von Aussagen dazu im Lexikon für Theologie und Kirche. Das Wort stehe theologisch oft im Kontext „Einwilligung in den Willen Gottes“, in Verbindung mit Europa nannte der Vertriebenenbischof die ökologischen Herausforderungen sowie den Frieden und –im historischen Rückblick –die Charta der Heimatvertriebenen von 1950, die eine Antwort auf das Schicksal der Vertreibung zu geben versucht. Zentrale Aspekte seien hier angesprochen: Recht auf Heimat, gleiches Staatsbürgerrecht, gerechte Verteilung, Integration der Vertriebenen.
„Das Schicksal der Vertreibung aus der Heimat ist ein Weltproblem“, stellte Weihbischof Hauke weiter fest und mahnte an, das geistige und religiöse Leid der Vertriebenen in Erinnerung zu rufen. „Es geht darum, die Last der Vertreibung zu spüren und dafür zu sorgen, daß diese Erfahrung sich nicht wiederholt. Aber das Schicksal der Vertreibung wiederholt sich.“ Ursachen dafür seien Armut, Hunger, Umweltkrisen, von Menschen gemachtes Unrecht und Kriege – wie aktuell der in der Ukraine.
Gerade an Pfingsten ergehe daher die inständige Bitte an den
Heiligen Geist, daß er „Veränderungen am Menschen bewirken“ möge, wie es in der Pfingst-Erzählung geschah oder in der Sündenvergebung mittels des Heiligen Geistes.
Aktuell zeige sich Europa als eine besondere Schicksalsgemeinschaft – geprägt vor allem durch die Hilfen und Unterstützung der Ukraine in unterschiedlicher Form. „Mit Schicksal ist
hier eine große Hoffnung verbunden. Gemeinsam suchen wir nach Wegen, um Not zu lindern und Frieden zu schaffen. Als Glaubende stehen wir vor Gott und bitten um Frieden in Europa, wozu auch die verlorene Heimat gehört“, faßte der Vertriebenenbischof seine Gedanken zum Motto des Sudetendeutschen Tages zusammen. Aber er sprach auch Anerkennung und Lob aus:
❯ Regionalbischof Klaus Stiegler feierte den evangelisch-lutherischen Gottesdienst




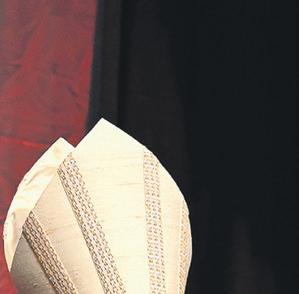

Weihbischof Reinhard Hauke (links) zelebrierte die Eucharistiefeier. Unten: Das Ensemble Moravia Cantat unter der Leitung von Wolfram Hader. Oben: Das P ngstevangelium lasen Monsignore Alexander Ho mann und Monsignore Adolf Pintíř. Rechts: Monsignore Dieter Olbrich bei der Begrüßung. Die Borromäer-Schwester Angelika Pintířova trug die Lesung auf Tschechisch vor.



Fotos: Markus Bauer (3), Torsten Fricke


„Als Vertriebenenbischof ist es mir eine besondere Ehre, Ihnen für die schöpferische Leistung in der alten Heimat und hier zu danken. Aus einem guten Geist konnte Neues entstehen, friedliche Verbindungen der Völker in ganz Europa. Dazu möge Gott auch weiterhin helfen.“ Als Vertreter der Tschechischen Bischofskonferenz sprach Monsignore Adolf Pintíř ein Grußwort.
Bischof mit sudetendeutschen Wurzeln
Den evangelischen Gottesdienst hat der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler gefeiert.


Die familiären Wurzeln des Bischofs liegen im Sude-

tenland. Stieglers Mutter wurde 1945 als 14jähriges Mädchen mit ihren Eltern vertrieben.
In einem 2019 veröffentlichen Interview mit der Sudetendeutschen Zeitung appellierte Stieg-

ler, aus der Vergangenheit zu lernen: „Deutsch-tschechische Nachbarschaft heißt: Unmittelbare, schmerzhafte Kriegserfahrung ist noch in den Familien bewußt. Um so mehr gilt hier
Versöhnung, ein Aufeinanderzugehen, sich kennenlernen, ins Gespräch kommen und dabei auch das Schlimme nicht verschweigen. Eine solche Versöhnungsarbeit und eine gemeinsame Zukunftsgestaltung sollten auf den Weg gebracht werden.“
Als Leitspruch für seine Arbeit als Regionalbischof hat er sich den Satz „miteinander. leben glauben handeln“ gewählt.
Stiegler: „Wir alle leben aus Gottes Zuspruch und Zuwendung, die stärker als alle Bedrohung ist. Daraus wachsen – gerade auch ,im finstern Tal‘ (Psalm 23) – Durchhaltekraft, Zuversicht und Hoffnung.“ Die musikalische Umrahmung hatte das duo connessione mit Carina Kaltenbach-Schonhardt und Tomáš Spurný übernommen. Auf dem Programm standen die Lieder „O komm, du Geist der Wahrheit“ und „Komm, heiliger Geist“.
Darin ging er besonders auf die historischen Bezüge der Bistümer Prag und Pilsen zum Bistum Regensburg (Bischof Wolfgang) ein und lobte die gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit auch auf kirchlicher Ebene.
Die musikalische Umrahmung oblag der Gartenburger Bunkerblasmusik unter der Leitung von Roland Hammerschmied, der auch als Kantor wirkte, und dem
Vokalensemble „Moravia Cantat“, geleitet von Wolfram Hader.

Die Lesungen trugen als Lektoren Christoph Lippert und Schwester Angelika Pintířova (Geistliche Beirätin der Sdružení Ackermann-Gemeinde) vor.
Die Fürbitten lasen Margareta Klieber und Daniel Herman. Die Kollekte war für die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Mariä Ge-

Regionalbischof Klaus Stiegler zelebrierte den evangelischen Gottedienst.



Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 14 73. SUDETENDEUTSCHER TAG
Das duo connessione mit Carina Kaltenbach-Schonhardt und Tomáš Spurný. Fotos: Torsten Fricke
Auch die tschechische Generalkonsulin in München, Dr. Ivana Červenková, verfolgte die Podiumsdiskussion über das Thema „Entschieden für Verständigung. Junge Tschechen und ihre eigene Geschichte“.
❯ Podiumsgespräch von Ackermann-Gemeinde, Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein, Sudetendeutschem Priesterwerk und Tschechischem Zentrum


Was denkt die Jugend über die eigene Geschichte?
„Entschieden für Verständigung. Junge Tschechen und die eigene Geschichte“ hat der Titel des Podiumsgesprächs gelautet, zu dem vier Institutionen gemeinsam beim Sudetendeutschen Tag einluden: Ackermann-Gemeinde, Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein, Tschechisches Zentrum und Sudetendeutsches Priesterwerk. Kein Wunder also, daß der Veranstaltungsraum bis auf den letzten Platz besetzt war.
Die vier Einrichtungen sowie die am Podiumsgespräch beteiligten Personen stellte Kulturreferent Wolfgang Schwarz in seiner Begrüßung und Einführung kurz vor. Es sei inzwischen „unkompliziert, über schwierige Themen zu sprechen, über die Vergangenheit und Zukunft“, stellte er fest und verwies auf die jüngsten Veranstaltungen in Regensburg und Selb mit dem tschechischen Premierminister
Petr Fiala beziehungsweise dem Staatspräsidenten Petr Pavel.

„Auch in der Politik sieht man den Wandel, das hängt auch mit der Gesellschaft zusammen“, stellte Schwarz fest und verwies auf viele Aktivitäten in der Literatur, Wissenschaft sowie bei Vereinigungen.
Vertreter von zwei Vereinen, die sich besonders mit der deutsch-tschechischen Geschichte befassen, bestritten das Gespräch: Veronika Kupková von Antikomplex und Petr Kalousek von Meeting Brno. In den Reihen der Gäste hieß Schwarz die tschechische Generalkonsulin Ivana Červenková, den Vorsitzenden des Sudetendeutschen Priesterwerks Regionaldekan Holger Kruschina und die Bundesgeschäftsführerin der Ackermann-Gemeinde, Marie Neudörfl, willkommen.


Erst seit rund drei Jahren ist Veronika Kupková bei Antikomplex, das heuer bereits auf 25 Jahre Wirken zurückblicken kann. Ein grenzüberschreitend vielfach beachtetes und positiv gewürdigtes Projekt war die Ausstellung „Das verschwundene Sudetenland“, wo jeweils einem Bild von 1900/1905 das gleiche Motiv hundert Jahre später gegenübergestellt wird.
„Einige Ereignisse brauchen eine lange Zeit, bis sie bekannt werden. Die Bilder haben – vor allem in den ersten Jahren – kritische Diskussionen und große Emotionen ausgelöst“, blickte Kupková zurück. Natürlich auch aus dem Grund, weil es bis dahin kaum Möglichkeiten einer kritischen und unpolitischen Diskussion über diese ersten Nachkriegsereignisse (Vertreibung der Sudetendeutschen, Ansiedlung vor allem Angehöriger aus Minderheiten in diesen Regionen) gab.
In jüngster Zeit hat Antikomplex, so die Mitarbeiterin, den
Fokus etwas geändert. Man befaßt sich mit den Menschen, die jetzt in den ehemaligen sudetendeutschen Gebieten leben, wirken und arbeiten, dies heißt mit Projekten zur Verbesserung der Situation dort.
„Das Narrativ ist nun etwas bunter. Das wollen wir zeigen. Natürlich ist nicht alles super. Aber es wird deutlich, daß sich die Dinge entwickeln und auch schon geändert haben. Es geht um Leute, die dem Sudetenland ein neues Gesicht geben wollen“, konkretisierte Kupková. Unter dem Titel „Mitten am Rande“ ist eine erste Dokumentation über die Menschen und die Projekte im Nordwesten im letzten Jahr erschienen, der zweite Teil über den Nordosten wird in Kürze veröffentlicht.
Anhand einer kurzen VideoPräsentation stellte Petr Kalousek das Festival „Meeting Brno“ kurz vor. „Manchmal geht es um schwierige Themen. Aber bei einer guten Atmosphäre lassen sie sich gut behandeln“, stellte er einleitend fest und freute sich, daß die heurige Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des neuen tschechischen Staatspräsidenten Pavel und dessen slowakischer Amtskollegin Zuzana Čaputová steht.
Die dem Festival zugrunde liegende Veranstaltung, der Versöhnungsmarsch, findet natürlich immer noch statt. Im Jahr 2015 jährte sich der Brünner Todesmarsch zum 70. Mal. Das war der Grund damals für Gespräche mit der neuen Stadtspitze über ein angemessenes Gedenken. „Wir waren sozusagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort“, erläuterte Kalousek rückblickend. Die neue Rathausspitze unterstützte nicht nur die angedachten Aktivitäten, sondern unterzeichnete zudem eine Erklärung zur Versöhnung und gemeinsamen Zukunft – übrigens eine von wenigen weiteren derartigen Deklarationen neben der deutsch-tschechischen Erklärung, „in denen man sich zu den Nachkriegsereignissen äußert“, vertiefte der Meeting-Brno-Mitarbeiter.

Doch nicht nur in der politischen Ebene müsse es, so Kalousek, Änderungen in der Haltung geben, sondern allgemein auch auf der lokalen Ebene hinsichtlich tragischer Vorkommnisse vor Ort. „Wir haben die Hoffnung, daß der Sudetendeutsche Tag irgendwann in Tschechien stattfinden kann“, warf Kalousek einen Blick nach vorne.
Von weiteren Projekten, unter anderem einem internationalen Work-Camp im Erzgebirge mit Jugendlichen aus Deutschland, Tschechien, Griechenland, Italien und Spanien berichtete Veronika Kupková. Auf diese Weise würden die Themen auch in den jeweiligen Ländern bekannt.
Speziell die deutsch-tschechische Geschichte könne durch ei-
nen „sensitiven Blick“ und durch Kontakte mit Zeitzeugen entdeckt werden.
Besonders die frühere Stadt Preßnitz, aus der nach 1945 die Deutschen vertrieben wurden und die dann Ende der 1960er Jahre dem Bau einer Talsperre weichen mußte, womit auch die zuvor neu angesiedelten Menschen ihre Heimat verloren,
nannte Kupková als Fallbeispiel. Sie hat sich übrigens intensiv damit beschäftigt. Diesen Ansatz, die große Geschichte durch menschliche Erlebnisse und Schicksale zu vermitteln, verfolgt auch Meeting Brno. Wobei hier auch die früheren jüdischen Bewohner Brünns mit einbezogen werden. Da hier über Brünnlitz ein historischer
erläutert werden. Moderatorin Blanka Navrátová vom Tschechischen Zentrum München interessierte nach diesen inhaltlichen Aspekten der Arbeit der Austausch sowie die Kooperation mit Verbänden und Behörden. Antikomplex habe die Zusammenarbeit mit Vereinen seit der Corona-Pandemie begonnen, vor allem wegen der Synergieeffekte. Bei Meeting Brno ist laut Petr Kalousek die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen „nicht sonderlich intensiv“, auch weil Brünn nicht typisches Sudetenland sei. Für das Festival arbeite man aber mit sudetendeutschen Einrichtungen und Verbänden zusammen. Hinsichtlich der Behörden sei zwischen der politischen Ebene und der Verwaltung zu unterscheiden. „Die Unterstützung durch die Politik ist wichtig, die Zusammenarbeit mit den Verwaltungen nicht immer einfach“, brachte es der Meeting-Brno-Mann auf den Punkt.
Bezug zu Oskar Schindler hergestellt werden kann, ergibt sich ein guter Anknüpfungspunkt für entsprechende Angebote.
Grundsätzlich sieht Kalousek auch bei jungen Leuten eher Interesse an der Orts-, Lokal- und Regionalgeschichte als an der großen Geschichte. Auf diesem Weg könnten dann aber auch die größeren Zusammenhänge
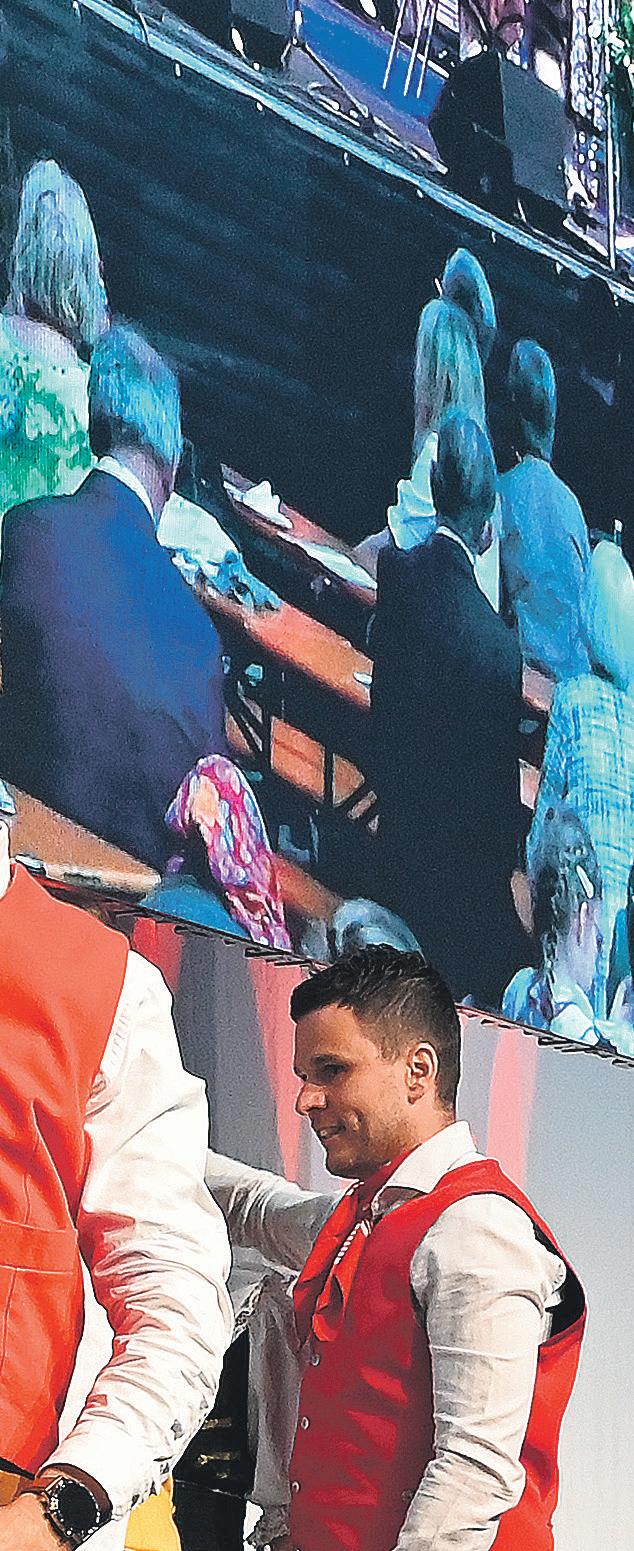
Gefragt nach den Unterschieden bei Geschichtskenntnissen zwischen tschechischen und deutschen Jugendlichen stellte Veronika Kupková fest, daß es eher Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland gebe. Ihrer Meinung nach hängt das auch mit der in der DDR nicht möglichen Gründung von Vertriebenenverbänden zusammen und natürlich dem damaligen Verständnis der ČSSR als Brudervolk, das vor eben diesem Hintergrund keine Vertreibungen durchgeführt hat – so die damalige Propaganda der SED. Abschließend wollte die Moderatorin wissen, ob sich das kollektive Gedächtnis in der tschechischen Gesellschaft zum Thema „Vertreibung“ bereits verändert hat. Differenziert antwortete Kalousek: für einen guten Teil der jungen Generation sei das kein Thema mehr. Dann gebe es Menschen, die sich mit dem Thema auskennen und meinen, daß es schlimm war. Und schließlich würden wieder andere Menschen die Meinung vertreten, daß die Zeit zur Auseinandersetzung mit diesem Thema noch nicht gekommen sei. „Auch 80 Jahre nach dem Krieg ist es noch problematisch, das Thema anzusprechen. Weitere Arbeit an dieser Thematik ist nötig. Aber es bessert sich. Ich bin überzeugt, daß wir immer mehr darüber reden können und damit immer stärker ins Bewußtsein kommen – auch durch Gespräche und freundschaftliche Beziehungen“, faßte Kalousek zusammen. Veronika Kupková gab die Frage zurück. „Wie ist das Thema im Gedächtnis der Deutschen geblieben?“ Sie verwies auf Menschen zwischen 60 und 70 Jahren, die dem Thema „Vertreibung“ oft viele Vorurteile entgegenbringen. Auch da habe die Bildungsarbeit viel zu tun.

Markus Bauer

15 73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023
Moderatorin Blanka Navrátová mit den Podiumsteilnehmern Veronika Kupková und Petr Kalousek sowie Dolmetscherin Milada Vlachová. Fotos (2): Markus Bauer
Verständigung über Kultur und Musik: Junge Tschechen aus Mährisch Trübau tanzen auf dem Heimatabend des Sudendeutschen Tages in Regensburg. Fotos: Torsten Fricke
Margit Bartošová (rechts) und Friedrich Höpp sowie die weiteren Mitstreiter zogen das Publikum mit ihren Mundart-Vorträgen in den Bann. Fotos: Ingrid Deistler

❯ Die verschiedenen Dialekte wurden bei der Mundartlesung lebendig vorgetragen

Mundart– der Atem für die Seele
hören. Es wurde frei erzählt, lange Gedichte auswendig vorgetragen, lustige und nachdenkliche Geschichten aus alter Zeit vorgelesen und manchmal sogar ein bißchen Theater gespielt. Auch ein Stück Regional- und Weltgeschichte spiegelten viele der Texte wider.


konnte man am Sudetendeutschen Tag, abseits vom geschäftigen Treiben an den Ständen und in den Hallen, „Atem schöpfen“ im Raum V bei den Mundartlesungen.

Von „hüben und drüben“ waren 15 Mundartsprecher gekommen. Es waren Gedichte, Geschichten und Erzählungen aus dem Riesengebirge, dem Böhmerwald, dem Egerland, aus Gablonz, dem Kuhländchen, vom Jeschken-Lausitzer Gebirge, aus dem Braunauer Ländchen und der Wischauer Sprachinsel zu
SDie Klänge der Mundarten weckten bei so manchem Erinnerungen an die Sprache der Eltern und Großeltern. Viele freuten sich über die Gelegenheit, einmal wieder miteinander in der vertrauten Mundart zu reden.


Wer Lust auf Mundart hat und ein Wochenende lang Mundart hören, sprechen, singen, in Vorträgen Interessantes erfahren und an Mundart-Workshops teilnehmen möchte, sollte sich die Mundarttagung des Freundeskreises Sudetendeutscher Mundarten vormerken, die im nächsten Frühjahr am Heiligenhof in Bad Kissingen geplant ist.






Zahlreiche Mundartaufnahmen findet man auch online unter https://www.youtube.com/ sudeten Ingrid Deistler
❯ Zum 100. Geburtstag und 20. Todestag würdigte die Seliger-Gemeinde die Verständigungsarbeit ihres langjährigen Vorsitzenden, der aus Dreihunken bei Teplitz-Schönau stammte

Erinnerungen an Brückenbauer Volkmar Gabert

Der sudetendeutsche SPD-Politiker Volkmar Gabert, der bis zu seinem Tod vor zwanzig Jahren die deutsch-tschechischen Beziehungen wesentlich geprägt hat, war Thema einer Diskussionsveranstaltung der SeligerGemeinde.
Christa Naaß, die Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, die auch ihre Mit-Vorsitzende




Helena Päßler auf dem Podium begrüßen konnte, stellte an den Anfang ihrer Diskussionsleitung das Jahresmotto der Seliger-Gemeinde: „In der ganzen Welt gibt es ein Auf und Ab zwischen Freiheit und Unterdrückung. Es ist unsere Aufgabe alles zu tun, die Kräfte der Freiheit zu unterstützen“, so ein Zitat von Volkmar Gabert, dem langjährigen Vorsitzenden der Seliger-Gemeinde, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr mit einer Veranstaltung der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag begangen wurde.
Markus Rinderspacher, VizePräsident des Bayerischen Landtags, übernahm die Aufgabe, in kurzen biografischen Schlaglichtern die Person Volkmar Gabert vorzustellen. Seine Herkunft aus Dreihunken bei Teplitz-Schönau als zweites von vier Kindern eines Schullehrers und sozialdemokratischen Bürgermeisters, seine Tätigkeit als Jugendlicher beim Transport von Druckerzeugnissen der Exil-SPD (SOPADE) über die Grenze nach Deutschland in den Jahren zwischen 1933 und

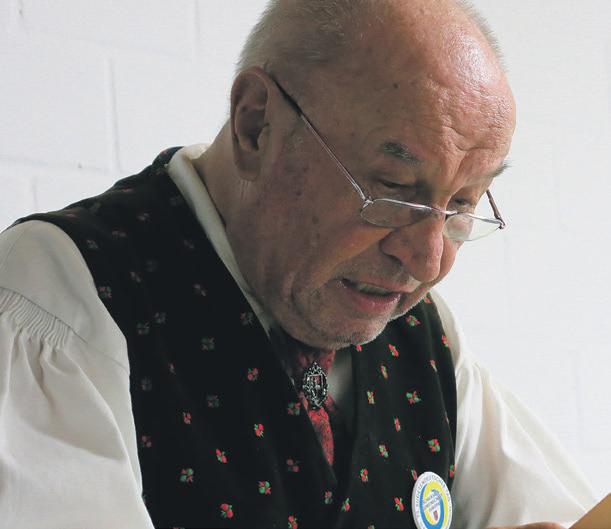





1938, sein Exil mit den Eltern in Großbritannien, seine Ankunft in Bayern, angestellt als Dolmetscher bei der US-Army bis 1948 und dann sein Weg zum erfolgreichsten SPD-Politiker in Bayern, seit 1950 als Mitglied des Landtages, als er hineingewählt wurde, der jüngste überhaupt.
Rinderspacher verwies auf die zwei Volksbegehren, die Gabert erfolgreich durchkämpfte, über die christliche Gemeinschaftsschule, konfessionsunabhängig und über die Rundfunkfreiheit, sowie den Beschluß, die Bürgermeister und Landräte in Bayern direkt wählen zu lassen.
Seine Bemühungen für die SPD als Volkspartei, sein Eintreten für einen
Dialog mit der Bevölkerung führten dann in der Diskussion zum engagierten Bildungspolitiker Gabert, der zwischen 1971 und 1989 die VollmarAkademie der SPD Bayerns leitete. Volkmar Halbleib, der vertriebenenpolitische Sprecher der BayernSPD im
Bayerischen Landtag, verwies auf die Dringlichkeit der Bildungsarbeit in Zeiten des Populismus. Die politische Bildung sollte an den Schulen verstärkt werden, auch die Forderung der SPD nach einem Wahlalter von 16 Jahren steht in diesem Kontext, sodaß man noch in der Schulzeit über die Beteiligung an Wahlen redet und Informationen bereithält über diesen demokratischen Prozeß. Und auf den öffentlichrechtlichen Rundfunk, den man nicht kaputtschießen dürfe. Die neuen sozialen Medien seien dabei eine große Herausforderung. Wo fänden die Menschen ih-
re Informationen? Dieser Frage müsse man sich im Rückgriff auf Gaberts Ansätze der 1960er und 1970er Jahre neu stellen. Volkmar Halbleib hatte zwei Aussagen noch im rhetorischen Gepäck. Die eine stammte aus dem Godesberger Programm: „Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander.“ Ein unscheinbarer Satz, der aber explosiv wirken kann, denn soziale Gerechtigkeit zu erzielen, sei unter Verzicht auf die Freiheit schrecklich. Man müsse sich immer die Frage stellen: Was brauche ich, damit Menschen frei sind? Das sei sozialdemokratisches Urver-
ständnis, schon Willi Brandt habe ja formuliert, im Zweifel für die Freiheit einzutreten. Und die zweite Aussage war ein Titel eines der wenigen schriftlichen Zeugnisse von Volkmar Gabert, das Parteitagsreden zusammenfaßte.

Halbleib hielt dem Publikum das Cover eines Buches von Gabert entgegen: „Mut zur Vernuft“ stand da. Und Halbleib erläuterte: Nicht der Populismus sei eine politische Tugend, auch wenn es in der Politik immer auch um Emotionen ging, um die sich Gabert auch bemühte.
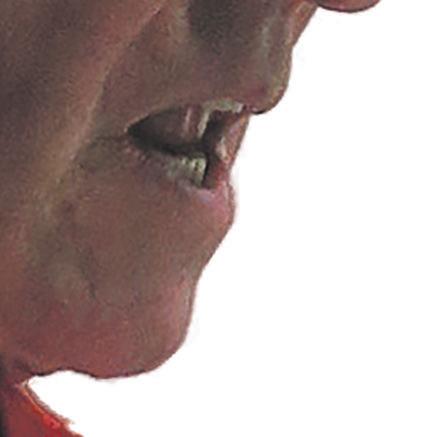
Die Anerkennung Volkmar Gaberts, vor allem für den Eisbrecher in den deutschtschechischen Beziehungen, kam laut Christa Naaß von außen. Václav Havel würdigte Gabert zu seinem 75. Geburtstag, wie folgt: „Ich habe große Wertschätzung für alles, was Sie in Ihrem Leben für die Verteidigung der Demokratie in der Tschechoslowakei vor dem Zweiten Weltkrieg, im

Kampf gegen die Nazis im Laufe des Krieges und für die Festigung der Demokratie im Nachkriegs-Deutschland und für die deutsch-tschechische Verständigung getan haben.“ Libor Rouček, der Gabert mehrmals getroffen hat, beklagte das Fehlen politischer Bildung in Tschechien auch nach der Samtenen Revolution. Wohl gäbe es mittlerweile Politikwissenschaften an den Universitäten, aber für die breite Masse werde nichts getan mit dem scheinheiligen Argument, man wolle doch nicht die „marxistisch-leninistische Abendschule“ der kommunistischen Zeit wiederbeleben.
Auf die Frage von Peter Barton, dem Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, was denn bei der Wahl in der Slowakei Ende September passiere, wenn Fico gewinnen würde, reagierten Rouček und Rinderspacher gleichlautend. Es werde keine Zusammenarbeit mit Fico in der Sozialdemokratie geben. Rouček hofft dabei auf ein anderes Bündnis mit dem Sozialdemokraten Pelligrini und neuen Kräften.
Und Peter Becher meldete sich noch zu Wort, um an die wichtigen Vorarbeiten Volkmar Gaberts mit der Seliger-Gemeinde und in anderen Funktionen zu erinnern, die den Weg zur bayrisch-tschechischen Verstän-
Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 16 73. SUDETENDEUTSCHER TAG
Schon Johann Wolfgang von Goethe hat einst festgestellt: „Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn er ist eigentlich das Element, aus dem die Seele ihren Atem schöpft!
Günter Fiedler Oswald Fuchs Etta Engelmann Ingrid Zasche Rosina Reim Baldur Haase
digung, die mit dem SeehoferBesuch 2016 begann, erst möglich machten. Ulrich Miksch
Diskutierten über das Thema „Die Kräfte der Freiheit unterstützen – Volkmar Gabert (1923 – 2003) und die heutigen deutsch-tschechischen Beziehungen“ (von links): MdL Volkmar Halbleib, die Vorsitzenden der Seliger Gemeinde, Christa Naaß und Helena Päßler, Karls-Preisträger Libor Rouček und Markus Rinderspacher, Vize-Präsident des Bayerischen Landtags. Foto: Ulrich Miksch
Prof. Dr.


„Ostignoranz und Besserwisserei“







Hat die deutsche Erinnerungskultur Putins Geschäft erleichtert? Diese provokante Frage hat Prof. Dr. Manfred Kittel, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Regensburg und Träger des Sudetendeutschen Menschenrechtspreises 2015, zu Beginn seines Vortrags am Sudetendeutschen Tag in Regensburg gestellt.
Der renommierte Historiker sprach auf Einladung der sudetendeutschen Bildungsstätte Der Heiligenhof, der Akademie Mitteleuropa und des Arbeitskreises Sudetendeutscher Akademiker zu dem Thema „Genozide und Vertreibungen verhüten: Sudetendeutsch-ukrainische Perspektiven für eine europäische Erinnerungskultur“.
Anhand zahlreicher Beispiele belegte er, daß in der kollektiven Erinnerung der Deutschen die imperiale Politik Rußlands und der Sowjetunion zu wenig
präsent ist und daß Putins frühes Bekenntnis, an diese wieder anknüpfen zu wollen, teilweise bewußt ignoriert wurde. Kittel sprach von der „Ostignoranz und Besserwisserei“ der Deutschen. Er kritisierte auch die Zurückhaltung vieler, Putins Aggression als versuchten Völkermord an den Ukrainern einzuordnen.
Gemäß der UN-Völkermordkonvention ist es entscheidend, daß der Aggressor die betroffene Volksgruppe in ihrer Identität zerstören möchte. Er zitierte Raphael Lemkin, der als polnischjüdischer Jurist mit schwerem Schicksal den Begriff „Genozid“ einführte und ihn maßgebend prägte.

Lemkin stufte auch die Vertreibung der Deutschen als Völkermord ein und geißelte die „Beneš-Dekrete“ als Grundlage der Vertreibung der Sudetendeutschen.
Kittel mahnte eine Zeitenwende in der deutschen Erinne-
rungskultur an und forderte, sich von vielen Einseitigkeiten zu verabschieden, auch um künftige Fehleinschätzungen mit fatalen Folgen zu verhindern. Als eine konkrete Maßnahme hierzu schlug er vor, ein Dokumentationszentrum zum russischen Imperialismus zu errichten.

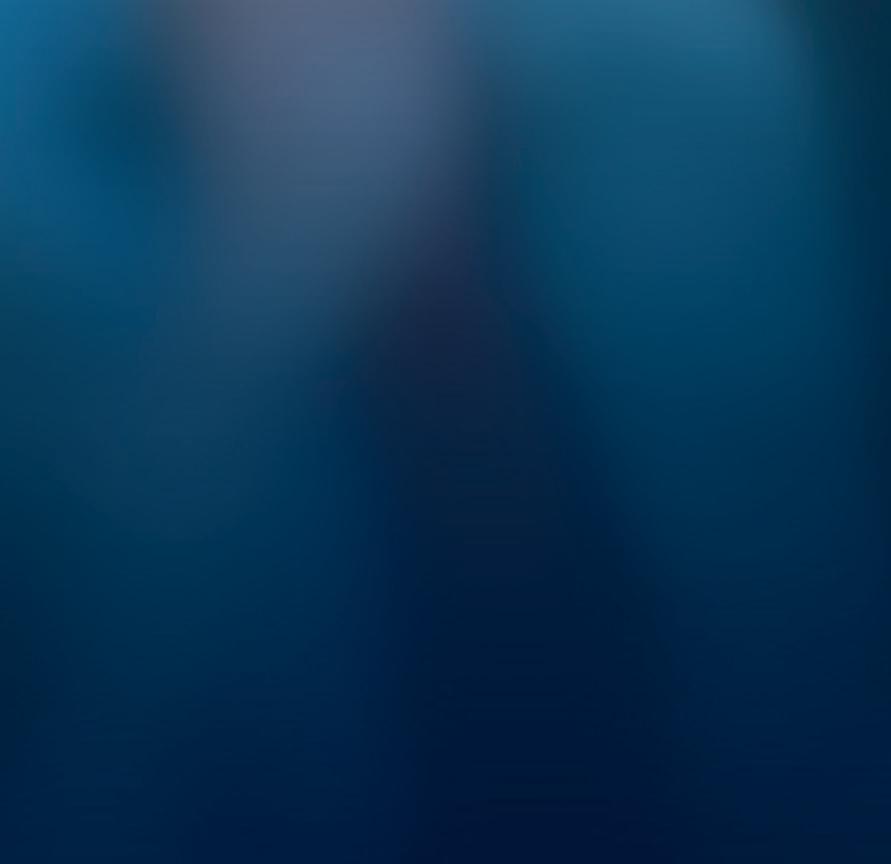

Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks, führte in die gut besuchte Veranstaltung ein und schilderte Manfred Kittel als einen verdienten Wissenschaftler, der sich durch seine vielfältigen Arbeiten dafür einsetze, daß die deutschen Heimatvertriebenen nicht auch noch aus der Geschichte vertrieben würden.
Dr. Andreas Müller, der Vorsitzende des Arbeitskreises Sudetendeutscher Akademiker, leitete die rege Diskussion und dankte Professor Dr. Manfred Kittel für seinen hoch interessanten Vortrag. hkn
� Blasmusiker aus Geretsried und Symphoniker aus Marienbad


Musik als Sprache der Verständigung

Sie sind feste Größe bei den Sudetendeutschen Tagen: Das Westböhmische Symphieorchester Marienbad (rechts) unter Leitung Milan Muzikář und die Gartenberger Bunkerblasmusik (links) unter Leitung von Roland Hammerschmied waren auch beim 73. Sudetendeutschen Tag in Regensburg im Dauereinsatz – ganz dem Motto: Musik ist die Sprache der Verständigung. Fotos: Torsten Fricke
Liebe Sudetendeutsche,
Sie sind für uns echte Vorbilder, als Brückenbauer und Botschafter für den Frieden.
Wir in Bayern wissen, was wir Ihnen zu verdanken haben. Sie haben Bayerns Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgeschrieben!

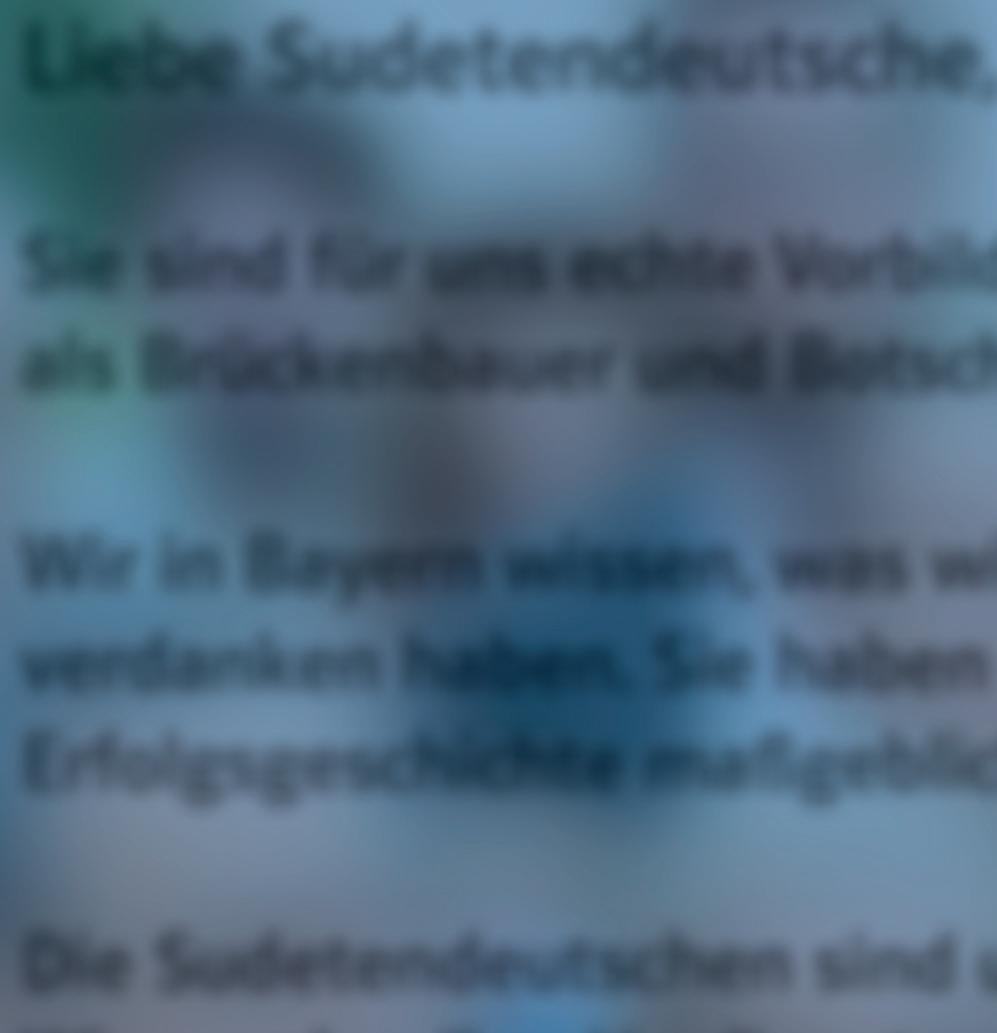

Die Sudetendeutschen sind unser vierter Stamm. Wir werden Ihre Verdienste und die Verdienste aller Heimatvertriebenen im kollektiven Gedächtnis Bayerns bewahren.
Dr. Markus Söder, MdL Vorsitzender der CSU Bayerischer Ministerpräsident


PRESSESTIMMEN
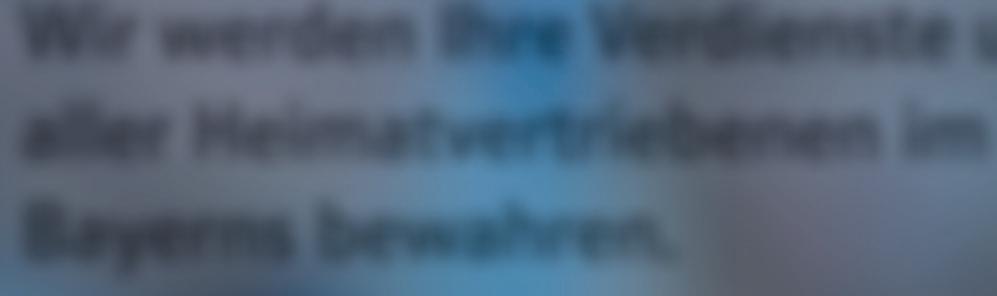
n Deutsche Presse-Agentur: Heimatvertriebene haben nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Friedensnobelpreis verdient. Sudetendeutsche und Vertriebene hätten „verzichtet auf Rache, auf Revanche“ und so den Grundstein gelegt „für ein neues, modernes Europa“.
n Mittelbayerische Zeitung: Sudetendeutsche spüren Frühling in Beziehung zu Prag. Offizieller Besuch eines tschechischen Ministers beim Pfingsttreffen am Wochenende in Regensburg schlägt neues Kapitel auf.
n Abendzeitung: Heimatvertriebene haben nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Friedensnobelpreis verdient.
n Allgemeine Laber Zeitung: „Wir stehen vor einem weiteren Durchbruch.“ Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen, sieht die Beziehungen zu Tschechien auf einem guten Weg. Dennoch warnt er: „Krieg und Nationalismus dürfen nicht ins Herz Europas zurückkehren.“ n Der Neue Tag: Die tschechisch-sudetendeutschen Verbindungen haben sich aus Sicht von Bernd Posselt, dem Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppen, verbessert. Das gelte auch insgesamt für die Beziehung zwischen Tschechien und Deutschland, sagte er ... in Regensburg und sprach von einem „nachhaltigen Fortschritt“. Unter anderem die jüngsten Besuche des tschechischen Premiers Petr Pavel in Selb und des Ministerpräsidenten Petr Fiala in Regensburg seien Beleg dafür. Beim Sudetendeutschen Tag sei zudem der tschechische Bildungsminister Mikulás Bek als offizieller Regierungsvertreter zu Gast. Dies gilt als ein politisches Signal.
17 73. SUDETENDEUTSCHER TAG Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023
Prof. Dr. Manfred Kittel im Gespräch mit Karls-Preisträger Christian Schmidt, Hoher Beauftragter der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina. Foto: Hans Knapek
�
Manfred Kittel wirft der deutschen Politik vor, Putin viel zu lange falsch eingeschätzt zu haben
Anzeige
❯ Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft beim 73. Sudetendeutschen Tag in Regensburg
Auszug aus der Gästeliste
Kirche:
Vertriebenenbischof Dr. Reinhard Hauke, evangelischer Regionalbischof Klaus Stiegler
Monsignore Alexander Hoffmann (Domvikar; in Vertretung für Reinhard Kardinal Marx), Monsignore Dieter Olbrich (Präses der Sudetendeutschen Katholiken), Monsignore Karl Wuchterl, Monsignore
Adolf Pintíř (Vertreter der Tschechischen Bischofskonferenz), Regionaldekan Holger Kruschina (Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks), Pfarrer Tomáš Dittrich und Militärdekan Siegfried Weber.
Politik:
Prof. Dr. Mikuláš Bek, Minister für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik.

Die Karls-Preisträger Milan Horáček, Daniel Herman, Dr. Libor Rouček und Christian Schmidt.
Die Abgeordneten des Tschechischen Parlaments Pavel Bělobrádek, Šimon Heller, Senator Martin Krsek.
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Andreas Künne.
Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger, Staatsministerin Ulrike Scharf, Aussiedler- und Vertriebenenbeauftragte Sylvia Stierstorfer (Bayern), Rita Schwarzelühr-Sutter (Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Inneres und Heimat) sowie Hartmut Koschyk (ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen).
Die Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger (SPD), Stephan Mayer (CSU), Peter Aumer (CSU), Rita Hagl-Kehl (SPD), Erhard Grundl (B90/Die Grünen, Sprecher für Kultur- und Medienpolitik), Thomas Hacker (FDP, Medienpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion).






Die Landtagsabgeordneten
Eva Gottstein (Freie Wähler, Beauftragte der Staatsregierung für das Ehrenamt), Volkmar Halbleib (SPD), Andreas Jäckel (CSU), Jürgen Mistol (B90/Die Grünen), Ruth Müller (SPD), Bernhard Pohl (Freie Wähler), Markus Rinderspacher (SPD, Landtagsvizepräsident), Ludwig Spaenle (CSU) und Josef Zellmeier (CSU).

Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein sowie die Bürgermeister Dr. Erika Rössler (Kaufbeuren), Harald Stadler (Neutraubling), Robert Pötzsch (Waldkraiburg), Anton Kindermann (Waldkraiburg), Anton
Dutz (Wiesau) sowie Filip Smola (Železná Ruda).

Der Regensburger Stadtrat Dr. Walter Boekh.

Die stellvertretenden Landräte
Willibald Hogger (Regensburg) und Birgit Höcherl (Schwandorf) sowie vom Bayrischen Bezirketag Anne Jäger (Referat Kultur, Jugend, Bildung und Umwelt).
Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková, Konsul Lukáš Opartný sowie Petr Janousek, Michaela Marksová (ehemalige Arbeits- und Sozialministerin), Dr. Arnošt Marks (ehemaliger Stellvertretender Wissenschaftsminister), Pavel Svoboda (ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments), Daniel Korte (ehemaliger Parlamentsabgeordneter) und Pavel Hořava (Generalsekretär der KDU-ČSL) sowie Kommunalpolitiker Wilhelm Simeon.
Sudetendeutsche Landsmannschaft:
Volksgruppensprecher Bernd Posselt, die Vize-Vorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Steffen Hörtler und Klaus Hoffmann. Christa Naaß (Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates und Bezirkstagsvizepräsidentin), Dr. Ortfried Kotzian (Vorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung), Franz Longin (Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates), Hans Knapek (Vorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk), Peter Barton (Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag), Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, Frauenbeauftragte Gerda Ott, Mario Hierhager (Vorsitzender Sudetendeutsche Jugend), Dr. Rüdiger Stix (Sudetendeutsche Landsmannschaft Österreich) und die Landesobmänner


Werner Appl (Nordrhein-Westfalen), Rudolf Fischer (Berlin) und Markus Decker (Hessen).
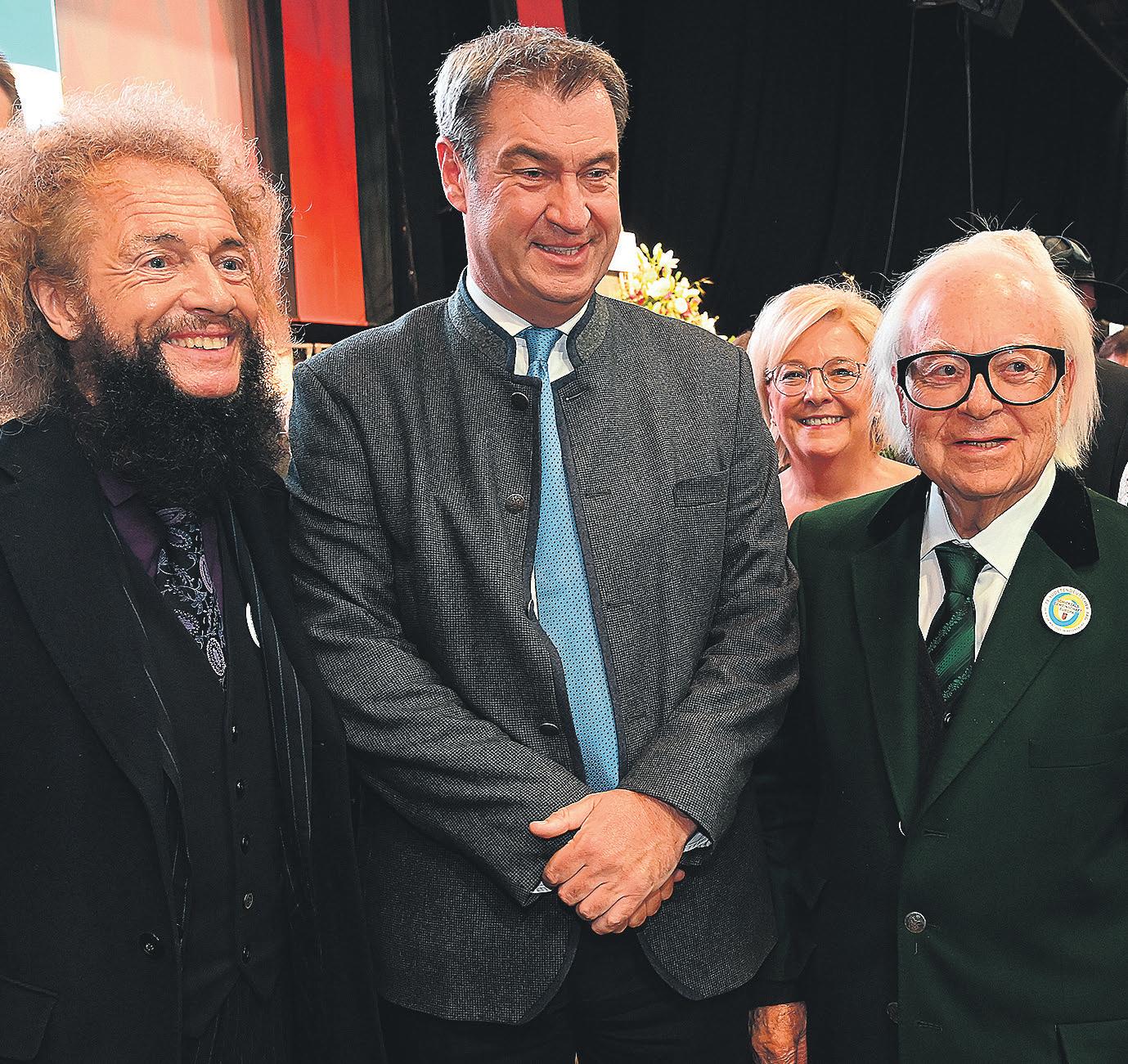


Kulturpreisträger: Tina Stroheker (Kulturpreis für Literatur und Publizistik), Dr. Heike Schwarz alias Jo Thoma (Kulturpreis für Bildende Kunst und Architektur), Mauke – Die Band mit Dieter Schaurich, Gregor Zasche, Herbert Stumpe, Michael O. Siegmund, Sven Siegmund, Björn Siegmund und Wolfgang Klemm (Kulturpreis für Heimat- und Volkstumspflege) sowie Johannes Probst (Großer Sudetendeutscher Kulturpreis).




Institutionen:

BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer, Prof. Dr. Günter Krejs (Präsident der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste), Prof. Dr. Andreas Weber und Dr. Lidia Antipow (Haus des Deutschen Ostens), Dr. Andreas Wehrmeyer (Direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts), Dr. Peter Becher (Vorsitzender des Adalbert Stifter Vereins), Helena Päßler (Bundes-Ko-Vorsitzende der SeligerGemeinde), Marie Neudörfl (Akkermann-Gemeinde), Reinfried Vogler und Dr. Ernst Gierlich (Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen).
Dr. Wolfgang Freytag (Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales), Florian Winzen (Leiter der Bayerischen Repräsentanz in Prag), Ingrid Sauer und Christine Kobler (Bayerisches Hauptstaatsarchiv), Petra Ernstberger, MdB a. D. (Geschäftsführerin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds), Dr. Raimund Paleczek (Vorsitzender des Sudetendeutschen Instituts), Dr. Stefan Planker (Direktor des Sudetendeutschen Museums) und Verwaltungsleiter Jens Bergmann, , Prof. Dr. Manfred Kittel (Professor für neuere und neueste Geschichte) sowie Johannes Kijas (Geschäftsführer der Paneuropa-Union), Brunhilde ReitmeierZwick (Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Karpatendeutschen).

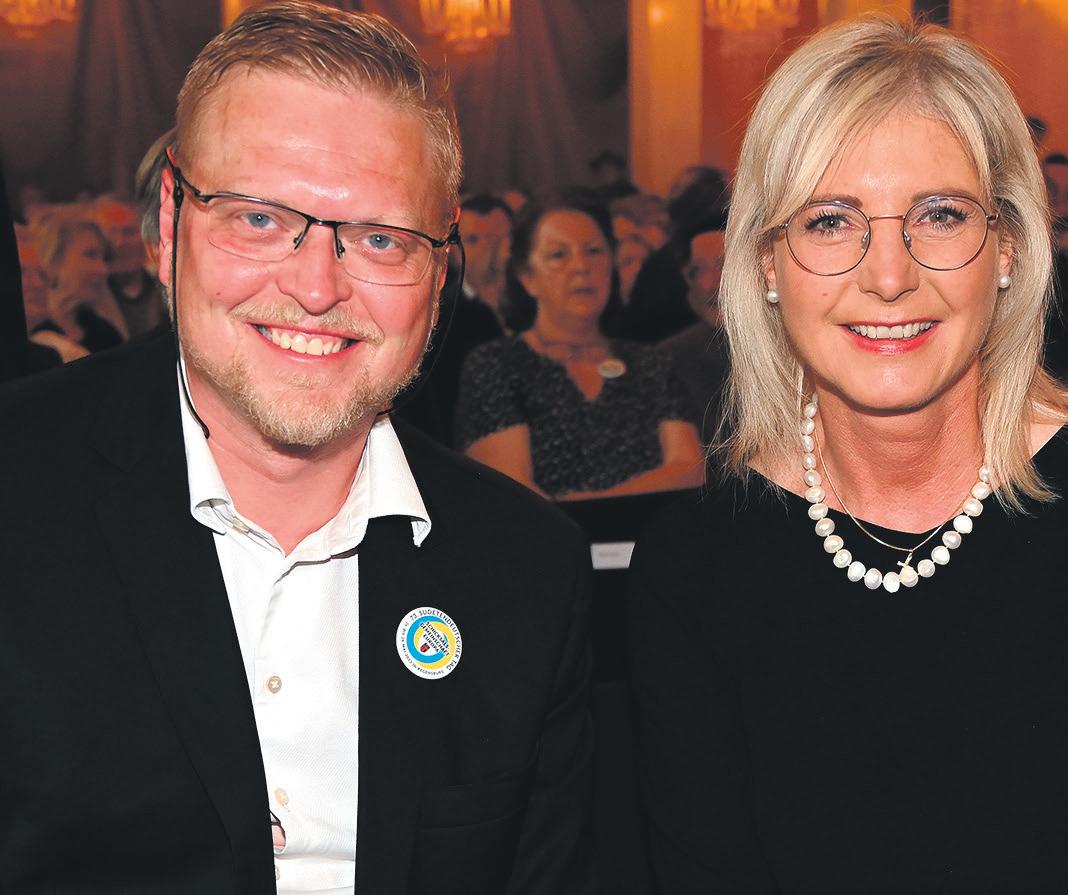

Petr Kalousek, David Macek und Veronika Smyslová vom Festival „Meeting Brno“, Veronika Kupková (Antikomplex), Blanka Návratová (Direktorin des Tschechischen Zentrums in München), Jan Blažek (Post Bellum), Tomáš Linda (Vorsitzender der Wirtschaftskammer der Karlsbader Region), die beiden Vorsitzenden der Deutschen Verbände, Martin Dzingel und
Wirtschaft:
Werner Brombach, Inhaber der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu; Luis-Andreas Hart, Ziegel- und Tonwerk Schirnding.



Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2. 6. 2023 18 73. SUDETENDEUTSCHER TAG
Bayerns Stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger mit BdV-Landesvorsitzendem Christian Knauer und Bundesvüarstäiha Volker Jobst.
Radek Novák sowie Stanislav Děd.
Christa Naaß, Präsidentin der SL-Bundesversammlung, MdL Ruth Müller, Karls-Preisträger Christian Schmidt, Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarz scher, Karls-Preisträger Dr. Libor Rouček, Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und MdL Volkmar Halbleib. Fotos: Torsten Fricke
Dr. Rüdiger Stix, Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich, reiste mit einer Abordnung nach Regensburg zum Sudetendeutschen Tag und schwenkte bei der Aufstellung vor dem Einzug in die Festhalle die rot-weiß-rote Fahne Österreichs.
Dr. Ortfried Kotzian (Sudetendeutsche Stiftung), Klaus Ho mann (SL Baden-Württemberg) und Franz Login (Heimatrat).
Ministerpräsident Markus Söder eingerahmt von den Unternehmern LuisAndreas Hart und Werner Brombach.
Andreas Künne, Deutscher Botschafter in Prag, mit Partnerin Janine Bassenge.
Pavel Bělobrádek, Abgeordneter des Tschechischen Parlaments, und Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf.
� Bundesverdienstkreuz für Dr. Ortfried Kotzian

Hohe Ehre für einen großen Brückenbauer
Ohne sein außergewöhnliches Engagement, sein fundiertes Wissen und seine ruhige Beharrlichkeit wäre das Sudetendeutsche Musuem wohl nie Realität geworden. Wenn Dr. Ortfried Kotzian als Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung einen Ehrengast durch das Sudetendeutsche Museum führt, sollte dieser sich Zeit nehmen, um all die Schätze zu entdecken. Seit fast einem halben Jahrhundert engagiert sich der Sohn einer Vertriebenenfamilie aus Hohenelbe im Riesengebirge für Aussöhnung und Verständigung und wurde jetzt von Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
Es war der legendäre Landesvorsitzende der Deutschen Jugend des Ostens (DJO), Dieter Hüttner, der im Sommer 1967 den frischgebackenen Abiturien-
der Universität Augsburg, kam Kotzian mit dem „Arbeitskreis für Volksgruppen- und Minderheitenfragen“ in Kontakt, den der Studienleiter des Heiligenhofes, Erich Kukuk, und Prof. Dr. Rudolf Grulich initiiert hatten. Der „sudetendeutsche Querdenker“ (Kotzian über Kotzian) übernahm 1978 die Leitung dieses Arbeitskreises, der nicht nur wichtige Impulse beim Thema Volksgruppenrecht gesetzt hat, sondern sich auch das Ziel gab, „Forum für die Begegnung der Vertreter der europäischen Volksgruppen in Europa zu werden“, wie es Kotzian in seinem Beitrag „Der Heiligenhof –Wiege des Volksgruppenrechts“ im Jahr 2022 in der Sudetendeutschen Zeitung formulierte.
Der Themenkreis Volksgruppen, Versöhnung und Verständigung zieht sich wie ein roter Faden durch Kotzians Leben. Nach der Promotion mit summa cum laude an der Universität Augs-
sitzender der Sudetendeutschen Stiftung. In der Laudatio zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes heißt es:
„Herr Dr. Ortfried Kotzian hat sich durch sein berufliches und ehrenamtliches Engagement in der politischen Bildungsarbeit zur Verständigung Deutschlands mit seinen mittel- und osteuropäischen Nachbarvölkern auszeichnungswürdige Verdienste erworben. Seine Eltern stammen aus dem Riesengebirge und fanden nach der Vertreibung in Illertissen ihre erste Bleibe. Die Eingliederung in eine seiner Familie unbekannte Gesellschaft bestimmte seine Kindheit und Jugend. So engagierte sich Herr Dr. Kotzian in der Sudetendeutschen Jugend und für die Bildungs- und Begegnungs-stätte Der Heiligenhof. In dieser Zeit entdeckte Herr Dr. Kotzian sein Interesse für die Situation ethnischer Minderheiten und Volksgruppen in ganz Europa. Kurz nach der Wende nahm das Bukowina-Institut unter der Führung von Herrn Dr. Kotzian Kontakt zu Wissenschaftlern und Persönlichkeiten auf und entwickelte daraus gemeinsame Aktivitäten. Er leistete wichtige und hervorragende Aufbauarbeit nicht nur für das Bukowina-Institut, sondern auch für die Partnerschaft des Bezirks Schwaben mit der Region Bukowina.
1977 war er Mitgründer des Arbeitskreises für Volksgruppenund Minderheitenfragen. Bis heute organisiert dieser jährlich ein bis zwei Tagungen, erstellt Publikationen und bietet Studienreisen an.
Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Dr. Ortfried und Marie-Luise Kotzian, Staatsministerin Ulrike Scharf und Ministerialrat Dr. Wolfgang Freytag. Fotos: StMAS


ten Kotzian überredete, die Leitung einer Kindererholung auf Burg Hohenberg zu übernehmen – in Blickweite zum Eisernen Vorhang, der damals unüberwindbar war.
Später, im Politik-Studium an
burg im Jahr 1983 leitete er von 1989 bis 2002 das Bukowina-Institut und war von 2002 bis 2012 Direktor des Hauses des Deutschen Ostens.
Heute engagiert sich Kotzian unter anderem als Vorstandsvor-
In seiner ehrenamtlichen Funktion als Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung in München (seit 2015) hat Dr. Kotzian den Aufbau und die Fertigstellung des Sudetendeutschen Museums in München ganz entscheidend mit verantwortet. Seit 2015 ist er zudem Mitglied des Stiftungsrats und seit Juni 2021 Vorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk.“
Torsten Fricke
� Beauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf gratuliert im Namen der Landesregierung
SL Hessen: Markus Decker neuer Landesobmann
Die SL-Landesgruppe Hessen der Sudetendeutschen Landsmannschaft hat Markus Dekker einstimmig zum neuen Landesobmann gewählt.
Im Rahmen der Landesversammlung überbrachte Margarete Ziegler-Raschdorf, Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, die Grüße der Landesregierung und sprach zu aktuellen Themen: „Die Sudetendeutschen sind die weitaus stärkste landsmannschaftliche Gruppe der Heimatvertriebenen in Hessen. Mit großem Interesse verfolge ich die unterschiedlichen Projekte, welche die SL in den letzten Jahren mit finanzieller Unterstützung durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport durchführt. Beispielhalft möchte ich die jährlich stattfindende Klöppelwoche, die Durchführung der Landeskulturtagungen, verschiedene Projekte mit Schülerinnen und Schülern sowie Zeitzeugenprojekte nennen. Dies alles sind Projekte, die im Rahmen der Förderung nach Paragraph 96 des Bundesvertriebenengesetzes umgesetzt werden und zur Erhaltung der Kultur der Vertreibungsgebiete beitragen sollen.“ Es sei, so die Beauftragte, „der
Landesbeauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf und Reinfried Vogler (2. v. l.), der die Versammlung leitete, gratulieren dem neuen Vorstand mit SL-Obmann Markus Decker (6. v. l.) und (von links) Hagen Novotny, Schatzmeister Frank Dittrich, Manfred Hüber, Lothar Streck und Reinhard Weinert.
hessischen Landesregierung ein großes Anliegen, die Kultur und das Brauchtum der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler auch weiterhin zu fördern und damit die Verbundenheit mit den Landsmannschaften und Vertriebenenverbänden auszudrükken“. Ziegler-Raschdorf machte deutlich, wie modern und zeitgemäß der Themenkomplex
Flucht und Vertreibung mittlerweile vermittelt werden könne. Ein Beispiel sei das Digitalportal Rußlanddeutsche in Hessen, das mittlerweile auf der Onlineplattform Schulportal Hessen eingestellt sei. Sie hoffe sehr, daß Lehrer das Portal für ihren Unterricht nutzen und die Geschichte der Aussiedler und Spätaussiedler damit an junge Menschen
auf attraktive Weise vermitteln. „Auch im Hinblick auf die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler und ihrer Ankunft in Hessen sind wir einen Riesenschritt vorangekommen. Im vergangenen Monat wurde der Schwerpunktbereich ‚Historische Erinnerung und kulturelles Erbe: Vertriebene und Spät-
aussiedler in Hessen seit 1945‘ an der Justus-Liebig-Universität in Gießen eröffnet. Dieser Forschungsbereich wird in den Jahren 2022 bis 2026 vom Land Hessen mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert. Für unser Thema ist dies ein Meilenstein, und ich bin sehr froh, daß die Landesregierung diesen Punkt des Koalitionsvertrages noch vor Ablauf der Legislaturperiode umsetzen konnte“, so die Landesbeauftragte.
Anlaß der Landesversammlung der SL-Landesgruppe Hessen war nach dem Rücktritt des bisherigen Landesobmannes Markus Harzer die Wahl eines neuen Landesobmannes. Harzer hatte das Amt seit April 2015 inne. In großer Geschlossenheit wählten die Delegierten Markus Decker einstimmig zu ihrem neuen Landesvorsitzenden.
„Ich spreche Markus Dekker zu seiner Wahl in die verantwortungsvolle Funktion des Landesobmannes meine herzlichen Glückwünsche aus. Gerne möchte ich als Landesbeauftragte auch mit dem neuen Vorstand vertrauensvoll zusammenarbeiten und die Arbeit der SL unterstützen. Ich danke Markus Harzer für die geleistete, ehrenamtliche Arbeit der vergangenen Jahre“, betonte Ziegler-Raschdorf.
� Karls-Preisträger Juncker würdigt Iohannis
Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis, der auf dem Sudetendeutschen Tag 2022 in Hof mit dem Sudetendeutschen Karls-Preis 2021 ausgezeichnet wurde, erhält eine weitere Würdigung in Deutschland. Am Sonntag, 4. Juni, wird ihm in der Frankfurter Paulskirche der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis verliehen.
Iohannis habe sich, so heißt es in der Begründung für die Auszeichnungen, in „vielfältiger Art und Weise und mit unermüdlichem Engagement für Menschen- und Minderheitenrechte in Rumänien und Europa eingesetzt“. Schirmherr der Verleihung ist Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Die Laudatio auf den Preisträger wird der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, halten. Zu den Preisträgern zählten bislang unter anderm Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und der Bischof von Banja Luka, Franjo Komarica.
19 AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2.6.2023
Festlicher Moment: Staatsministerin Ulrike Scharf überreicht Dr. Ortfried Kotzian das Bundesverdienstkreuz.
Fotos: LBHS
Passau empfängt die Böhmerwäldler


Auf geht‘s in die Dreiflüssestadt Passau: Der Deutsche Böhmerwaldbund veranstaltet sein 31. Bundestreffen am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juli in der Patenstadt der Böhmerwäldler. Schirmherr ist Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper.
Erster Höhepunkt des Treffens, das seit der Patenschaftsübernahme 1961 alle zwei Jahre im Wechsel mit dem traditionellen Jakobitreffen stattfindet, ist am Samstagvormittag die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Passau für die Böhmerwäldler.
Ausgezeichnet werden in diesem Jahr Emma Marx und Lenka Hůlková aus Tschechien, die sich in vielfältiger Weise dafür engagiert haben, daß die Geschichte des Böhmerwaldes und der Böh-
■ Bis Dienstag, 3. Oktober, Bayerisch-Tschechiche Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr.
■ Samstag, 3. Juni, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Eröffnung der Ausstellung „verloren, vermisst, verewigt – Heimatbilder der Sudetendeutschen“. Die Ausstellung wird bis zum 30. Juni gezeigt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung zur Eröffnung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de
■ Samstag, 17. Juni, 10.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Königsbrunn/Wehringen/Klosterlechfeld: Gedenken am Mahnmal der Sudetendeutschen. Mit Bürgermeister Franz Feigl, Stadtpfarrer Bernd Leumann und dem Kreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Augsburger Land, Kurt Aue. Aussegungshalle, Städtischer Friedhof, Wertachstraße, Königsbrunn.
■ Freitag, 9., 14.00 Uhr, bis Samstag, 10. Juni: 72. Deutschhauser Heimattreffen mit Berichten über eine Heimatreise 2022, Mundart-Quiz und mehr. Café Moritz (neben dem Rathaus), Lichtenfels/Oberfranken. Samstag, 10.00 Uhr: Feierstunde mit Totenehrung am Gedenkstein im Bergschloßpark. Weitere Informationen unter www. deutschhause.jimdofree.com
■ Samstag, 10. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Montag, 12. Juni, 19.00
Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 2: Königswart“ von Prof. Dr. Stefan Samerski Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, München.
■ Dienstag, 13. Juni, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches
Museum: „Erlebnis namens
Heimat – Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren“. Dozentin Gunda Achterhold (Journalistin und Autorin). Teilnahmegebühr 15 Euro. Sudetendeutsches
Haus, Museumspädagogik, Hochstraße 8, München. Anmeldung unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de oder telefonisch unter ( 089)
48 00 03 37.
■ Mittwoch, 14. Juni, 15.00
Uhr, Ackermann-Gemeinde
Augsburg: „Die Geschichte der Juden in Schwaben“. Vortrag von Dr. Johannes Mordstein. Exerzitienhaus St. Paulus, Leitershofen, Krippackerstraße 6, Stadtbergen.
■ Donnerstag, 15. Juni, 14.00
Uhr, Heimatverband der Brünner KV München: BRUNA-Heimatnachmittag. Gaststätte im Haus des Deutschen Ostens, Am
merwäldler nicht in Vergessenheit gerät. Die Kulturpreisverlei-
hung durch Oberbürgermeister Jürgen Dupper findet um 10.00
VERANSTALTUNGSKALENDER

Lilienberg 5, München.
■ Donnerstag, 15. Juni, 19.00
Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz) und Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg: Vortrag von Thomas Kabisch über „Musik und Philosophie zwischen West und Ost. Vladimir Jankélévitch in Prag“. Weinschenkvilla, Hoppestraße 6, Regensburg. Eintritt frei.
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren
wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.
■ Dienstag, 27. Juni, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Ringveranstaltung mit Vortrag von Dr. Michael Henker über „Die Entwicklung der Museumslandschaft in Bayern“ und anschließendem Empfang. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 48.
Uhr im Großen Rathaussaal statt. Ein Trachtenfestzug durch die Innenstadt von Passau und ein Volkstumsabend im Großen Redoutensaal bilden weitere Höhepunkte am Samstag.
Es folgt am Sonntag um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst im Passauer Dom, Zelebrant ist Domkapitular i. R. Alois Ehrl. Daran schließt sich um 11.00 Uhr eine Kundgebung im Großen Redoutensaal mit Sylvia Stierstorfer, MdL, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, als Hauptrednerin an.
Grußworte sprechen OB Dupper, die Bundesvorsitzende der Böhmerwaldjugend, Elisabeth Januschko, und die Bundesvorsitzende des Deutschen Böhmerwaldbundes, Birgit Kern.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße, Marktredwitz.
■ Samstag, 1. Juli, 10.30 bis 16.00 Uhr: SL-Bezirksverband Schwaben: Bezirksneuwahlen. Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, Königsbrunn. (Achtung, verschoben von ursprünglich 10. Juni auf jetzt 1. Juli.)
■ Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Heimatkreis Braunau: 36. Heimattag und „Tage der Begegnung“. Ansprachen von OB Uwe Kirschstein (Forchheim), Bürgermeister Arnold Vodochodský (Braunau) und Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz. Kulturprogramm mit den ZWOlingen Elisabeth und Stefanie Januschko. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.
■ Samstag, 8. bis Sonntag, 9. Juli, SL-Bezirksgruppe Oberfranken mit Werksiedlung Weidenberg: Zweitagesfahrt nach Aussig. Besuch der Ausstellung „Unsere Deutschen“, Übernachtung im Traditionshotel auf der Ferdinandshöhe. Der Bus fährt über Pegnitz-Wiesweiher, Bayreuth-Hauptbahnhof, Orte im Fichtelgebirge und Marktredwitz. Anmeldung bei Margaretha Michel unter Telefon (0 92 41) 36 54 oder per eMail an mail@ familie-michel.net
■ Sonntag, 9. Juli, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Roth: Vogelbeerbaumfest. Vogelbeerbaum im Stadtpark, Otto-Schrimpff-Straße, Roth.
■ Samstag, 15. Juli, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
❯ Ausstellung zu Flucht, Vertreibung und Integration
Ungehört – die Geschichte der Frauen
■ Donnerstag, 15. Juni, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen. Flucht, Vertreibung und Integration“ mit Schirmherrin Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Nach dem Zweiten Weltkrieg mußten Millionen von Deutschen ihre Heimat im östlichen Europa verlassen. Es waren vor allem Frauen, die sich auf den beschwerlichen
Weg machten. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs Zeitzeuginnen, die aus unterschiedlichen Regionen des östlichen Europas stammen. Ihre Wege durch die Nachkriegsgeschichte weisen Gemeinsamkeiten auf – und sind dennoch jeder für sich ganz besonders. Ria Schneider aus der Batschka, Emma Weis und Friederike Niesner aus Mähren, Gertrud Müller aus Oberschlesien, Rosemarie Becker aus Pommern und Edith Gleisl aus Ostpreußen.
Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit
■ Samstag, 22. Juli bis Sonntag, 6. August: Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. 2. Veranstaltung der Akademie Mitteleuropa für Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik.
Über 100 Kinder aus Deutschland und der Tschechischen Republik kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und Weltsicht. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden.
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546
❯ Ausstellung im Rahmen des Comic Festivals München
Sudetendeutschen Haus
Was bedeutete es, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Tschechoslowakei ein Mädchen oder ein Junge deutscher Nationalität zu sein?
Dieser Frage ist der Prager Dokumentarist Jan Blažek in Interviews mit Zeitzeugen nachgegangen. Der Schriftsteller Marek Toman bearbeitete diese Erinnerungen literarisch. Entstanden ist daraus eine Graphic Novel, zu der fünf junge tschechische Zeichner die Illustrationen geliefert haben.

Im Rahmen des Comic Festivals München, das heuer den Schwerpunkt Tschechien hat, werden die Graphic-No-
vel-Arbeiten unter dem Titel „Die vertriebenen Kinder“ bis zum 30. Juni im Sudetendeutschen Haus in der Hochstraße 8 gezeigt.
Am 9. Juni präsentiert Autor Marek Toman das Buch persönlich beim Comic Festival München. Moderiert wird die Veranstaltung von Anna-Elena Knerich (Bayerischer Rundfunk). Beginn ist um 19.00 Uhr im Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8 in München.
Die Veranstaltung wird gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem Adalbert-Stifter-Verein, dem Tschechischen Literaturzentrum CzechLit und der Sudetendeutschen Heimatpflege.
■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Feierstunde zur Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.
■ Montag, 9. Oktober, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 3: Schloß Troja in Prag“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Montag, 20. November, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmische Schlösser – Teil 4: Melnik“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, München.
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2.06.2023 20 TERMINE
„Die vertriebenen Kinder“
im
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
❯
31.
Bundestre en am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juli in der Drei üssestadt
In der Drei üssestadt Passau ießen Inn und Ilz in die Donau. Foto: Hajo Dietz







❯ ❯ ❯ ❯


� � � � � �
Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe


Aussig: Brigitta Gottmann, Hebbelweg 8, 58513 Lüdenscheid, Tel. 02351 51153, eMail: brigitta.gottmann@t-online.de – Kulm: Rosemarie Kraus, Alte Schulstr. 14, 96272 Hochstadt, Tel. 09574 2929805, eMail: krausrosemarie65@gmail.com – Peterswald, Königswald: Renate von Babka, 71522 Backnang, Hessigheimerstr. 15, Tel. 0171 1418060, eMail: renatevonbabka@web.de – Heimatgruppe Graupen, Mariaschein, Rosenthal und Umgebung: Sibylle Schulze, Müggelschlößchenweg 36, 12559 Berlin, Tel. 030 64326636, eMail: sibyllemc@web.de – Redaktion: Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: aussiger-bote@t-online.de – Redaktionsschluß: jeweils der 15. des Vormonats.
Über die Wallfahrtskirche Mariaschein gibt es viele Berichte. Fotos der eindrucksvollen Kirche kennt jeder. Zum 107. Geburtstag des Malers Arthur Lipsch zeigen wir die Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Mutter Gottes“ aus der Sicht des Malers. Dazu die Geschichte der Wallfahrtskirche, die Freiherr Otto von Reinsberg-Düringsfeld (1822-1876) 1861 aufgeschrieben hat.
In dem berühmten Wallfahrtsort Mariaschein bei Teplitz ist Mariä Geburt das Hauptfest des Jahres, für welches bereits 1615 Papst Paul V. den ersten vollkommenen Ablaß erteilte. Das Gnadenbild der schmerzhaften Mutter, welches dort verehrt wird, soll aus Palästina herrühren und von den frommen Nonnen des Klosters Schwaz bei Bilin, die es besaßen, bei ihrer Flucht vor den Hussiten, welche 1421 das Kloster plünderten und zerstörten, in die damals wilde Gegend gebracht worden sein, wo jetzt die Kirche von Mariaschein steht. Der Not, in welcher die vertriebenen Nonnen lebten, während die Hussiten in der Umgegend von Teplitz hausten, soll das Bild seinen ältesten Namen „Maria im Elend“ verdanken. Als die letzte der Nonnen dem Tode nahe war, verbarg sie das gerettete Kleinod in einer hohlen Linde, wo es noch vor der Mitte des 15. Jahrhunderts von einer Dienstmagd aus der nahen Bergstadt Graupen wieder aufgefunden wurde.
Diese kam nämlich an einem 8.September um Gras zu holen zu jener Linde, an deren Fuß ein reichlicher Quell hervorsprudelte; während des Mähens sprang plötzlich eine großen Schlange empor und wand sich ihr um den bloßen Arm, fiel aber bei ihrem Angstschrei: „Jesus Maria!“ wie erlahmt zu Boden und verschwand, ohne sie im Mindesten verletzt zu haben. Die Magd lief erschrocken nach Hause, erzählte die Begebenheit ihrem Dienstherrn, und dieser begab sich mit einem Nachbarn zu der Linde, vielleicht um dort einen Schatz zu finden, den nach dem Volksglauben eine Schlange zu bewachen pflegt. In der Höhlung der Linde entdeckten sie das Vesperbild und zeigten ihren Fund dem Pfarrer an, welcher sogleich eine Prozession veranstaltete, um die Statue der Mutter Gottes in die Graupner Kirche zu übertragen. Aber am nächsten Morgen fand man das Bild wundersamerweise wieder an der Linde, wo es gewesen, und da sich dies noch zweimal wiederholte, sah man endlich von der Übertragung ab und baute an der Linde eine kapellenartige Hütte aus Ästen und Laubwerk. Bald ward eine hölzerne Kapelle daraus, und da sich der Ruf des Bildes von Jahr zu Jahr vergrößerte und der Ort immer besuchter wurde, errichtete schon 1442 Albrecht Kolowrat anstelle der hölzernen Kapelle eine aus Stein, welche ein anderer desselben Namens 1507 noch erweiterte und verschönerte.
Als Georg Popel von Lobkowic 1584 die Herrschaft Graupen kaufte, ließ er die halb verfallene Kirche „Zur schmerzhaften Mutter Gottes“ bei Untergraupen,



� Graupen
Die Wallfahrtskirche Mariaschein
Die vielen wunderbaren Heilungen, deren man 1709 nicht weniger als 308 und 1721 sogar 517 aufgezeichnet hat, haben Mariaschein zu einem der beliebtesten Wallfahrtsorte Böhmens gemacht.
Am besuchtesten ist er an den Marientagen, an Pfingsten, Wenzeslai und Michaeli, wo von den einheimischen Gewerbsleuten bei der Kirche ein nicht unbedeutender Handel mit Heiligenbildern, Rosenkränzen und Gebetbüchern getrieben wird.
An Maria Geburt, wo früher selbst die Stände Böhmens mit dem Erzbischof von Prag an ihrer Spitze ihre jährliche Wallfahrt zu machen pflegten, hat die Stadt Aussig, welche 1521 aus der ganzen Umgegend die erste feierliche Prozession nach Mariaschein angeführt hat, seit 1672 das verbriefte Recht, das erste Hochamt zu halten.
Das älteste noch vorhandene Votivbild trägt die Jahreszahl 1443. Da man das Gnadenbild den Pilgern zum Küssen zu reichen pflegte, wurde es 1709, um es gegen Abnützung zu schützen, mit Goldblech überzogen. Dem Brunnen, welcher unter dem Hochaltar in der Kirche an jener Stelle, wo einst die Linde stand, entspringt, und der „Marienbrunnen“ heißt, wird besonders gegen Augenkrankheiten äußerst heilsame Wirkung zugeschrieben.
Quelle: „Fest-Kalender aus Böhmen: ein Beitrag zur Kenntnis des Volkslebens und Volksglaubens in Böhmen“,1861.
� Aussiger Künstler
Arthur Lipsch 1916 - 2006
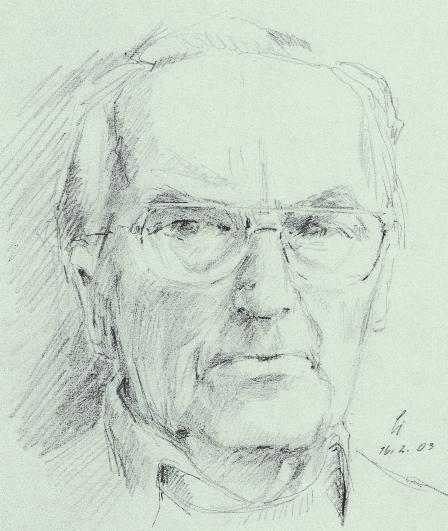
Arthur Lipsch, geboren am 29.07.1916 in Wicklitz, ist einer unserer bedeutendsten Landschaftschronisten. Im Aussiger Archiv befinden sich noch eine Reihe von Tuschezeichnungen und Farbfotos, die seine Aquarelle und Gouachen mit Heimatmotiven wie dem Elbetal, den Marienberg, Dubitz, Schreckenstein und viele andere Ansichten dokumentieren.
Nach einer grafischen Lehrzeit in Aussig studierte Lipsch von 1936 bis 1939 an der Staatlichen Akademie für angewandte Kunst in Dresden als Meisterschüler bei Professor Drescher. Nach seinem Kriegsdienst und der Gefangenschaft, aus der er im Herbst 1949 entlassen wurde, begann er in Halle sein Geld als Gebrauchsgrafiker in der Werbebranche zu verdienen.
Aber Zeichenblock und Aquarellfarbkasten, Tusche, Skizzenbuch und Zeichenstift waren seine ständigen Begleiter, denn seine Passion war das Malen. Wir verdanken ihm die schönsten Bilder unserer Heimat, in denen er sowohl das Charakteristische der Landschaft als auch atmosphärische und jahreszeitliche Stimmungen wiedergibt.
Arthur Lipsch starb am 17.09.2006 in Halle. kw Quelle: AB 09/2005
wie Mariaschein damals hieß, wieder herstellen, eine Ringmauer mit sieben Kapellen um sie herum aufführen und übergab den 1590 vollendeten Bau ein Jahr darauf der geistlichen Obhut der Jesuiten, für welche er unlängst ein Kollegium in Komotau gestiftet hatte. Auf Bitten der Jesuiten erhielt die Kirche 1615 den bereits erwähnten ersten vollkomme-
nen Ablaß, den Papst Innocenz XII.1693 auf jeden Tag des Jahres ausdehnte, nachdem bereits Papst Innocenz XI. im August 1688 einen hunderttägigen Ablaß für alle Frauentage und alle Samstage im Jahr bewilligt hatte. Währen des Dreißigjährigen Krieges mußte das Gnadenbild zu wiederholten Malen in Sicherheit gebracht werden, und die Jesuiten wurden mehr als einmal
vertrieben. Erst nach dem völligen Abschluß des Friedens konnte das Bild nach Mariaschein zurückgebracht werden, wo 1652 die Jesuiten eine eigene Wohnung erhielten. Da der Kirche der Einsturz drohte, wurde 1702 der Bau der jetzigen begonnen, welche 1706 vollendet und 1798 zu einer pröbstlichen Kirche erhoben wurde.
Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2.6.2023 23
Betreuer der Heimatkreise –
Foto: Dipl. Ing. V. Horak
Hochaltar mit dem Gnadenbild „Zur schmerzhaften Mutter Gottes“, 2013.
Foto:SchiDD
Mariaschein, Aquarell von Arthur Lipsch. Archiv.
Foto: Archiv
Stöben, Gouache von Arthur Lipsch.
Renate von Babka zum 70. Geburtstag
Beil 1871 aufstellen ließ. Gemeinsam mit vielen Helfern wurde der Stein auf ihre Initiative hin gesäubert und 2018 wieder am Wanderweg aufgestellt. Sie hat sich sogar Sütterlin, Kurrent und alte Deutsche Schrift angeeignet, um die Chronik von Peterswald zu übertragen. Natürlich war sie enttäuscht, daß nur wenige Exemplare des 480 Seiten starken Buches verkauft wurden. Renate hat nicht nur drei Jahre daran gearbeitet, sondern ist auch noch auf den Kosten sitzen geblieben.
Wechsel an der SLÖ-Spitze
23 Jahre war Gerhard Zeihsel Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Österreich. Am 25. März 2023 wurde MinR. a. D. DDr. Rüdiger Stix von der Bundeshauptversammlung der SLÖ zum neuen Bundesobmann gewählt, um diese verantwortungsvolle Aufgabe weiterzuführen.
Für seine unschätzbare, jahrzehntelange Arbeit wurde Gerhard Zeihsel die VLÖ-Ehrennadel in Gold verliehen. kw Quelle: SLÖ
Liebe Hundertjährige! An dieser Stelle sollen künftig unsere ältesten Leser zu Wort kommen. Wenn Sie also „um die 100“ sind (mehr oder weniger), schicken Sie mir Fotos und Berichte über Ihren Ehrentag und ein paar Zeilen über Ihr langes Leben.
Auch die Nachkommen der Erlebnisgeneration werden älter. Aber Renate von Babka sieht man ihr Alter nicht an. Das liegt vielleicht daran, daß sie sich nie zur Ruhe setzt und sich stets neuen Aufgaben widmet, um die Heimat ihrer Vorfahren, Peterswald, immer wieder in den Fokus zu rücken. Ihr Anliegen ist der Brückenschlag zwischen den früheren und den heutigen Bewohnern. Renate von Babkas Ururgroßvater war Karl Beil, Landwirt aus Peterswald 373, geboren am 27.2.1811, verstorben am 9.6.1876. Auf den Tag genau 77 Jahre später kam Renate zur Welt…
Am Anfang ihrer vielfältigen Aktivitäten in Peterswald stand im Jahr 2007 ein Projekt zur Restaurierung eines Barockkreuzes auf dem Peterswalder Friedhof, das ein Vorfahre im 18.Jahrhundert gespendet hatte. Sie wurde gebeten, in dem eigens für den Zweck gebildeten Komitee mitzuwirken. Bald darauf übertrug man ihr die Verantwortung für die Heimatgemeinschaft Peterswald. Gemeinsam mit Liane Jung organisierte sie bis zum Lockdown 2020 Heimattreffen für die Gemeinde, 2011 sogar in Peterswald (Petrovice).
Anton Bruder ist ein böhmischer Expressionist ganz eigener Prägung. In seinem Schaffen erscheint die lapidare Farbintensität des Brücke-Stils mit einer schlichten, naturverbundenen Eindringlichkeit gepaart, die zuweilen an naive Malerei erinnert. Ein gerade gegenwärtig wieder erststrebter Einklang von Mensch, Natur und Technik wird in Bruders Werken bildnerisch verwirklicht.
Der Maler wurde am 11. Juni 1898 in Aussig geboren. Sein Vater Dr. Georg Bruder stammte aus Tirol und war Studienprofessor der Naturwissenschaften.
Seine Mutter kam aus dem Egerland und brachte als begabte Pianistin das künstlerische Element ins Elternhaus. Die Landschaft der deutschböhmischen Heimat wurde bei ausgedehnten Wanderungen zu einem entscheidenden künstlerischen Erlebnis.
1902 wurde die Idee von nordböhmischen und Lausitzer Gebirgsvereinen geboren, einen Wanderweg entlang der Kammlinien von Elstergebirge, Erzgebirge, Böhmischer Schweiz, Lausitzer Gebirge, Jeschkengebirge, Iser- und Riesengebirge, Glatzer Schneegebirge und Altvatergebirge grenzüberschreitend auf einer Länge von 820 Kilomtern auszuweisen.
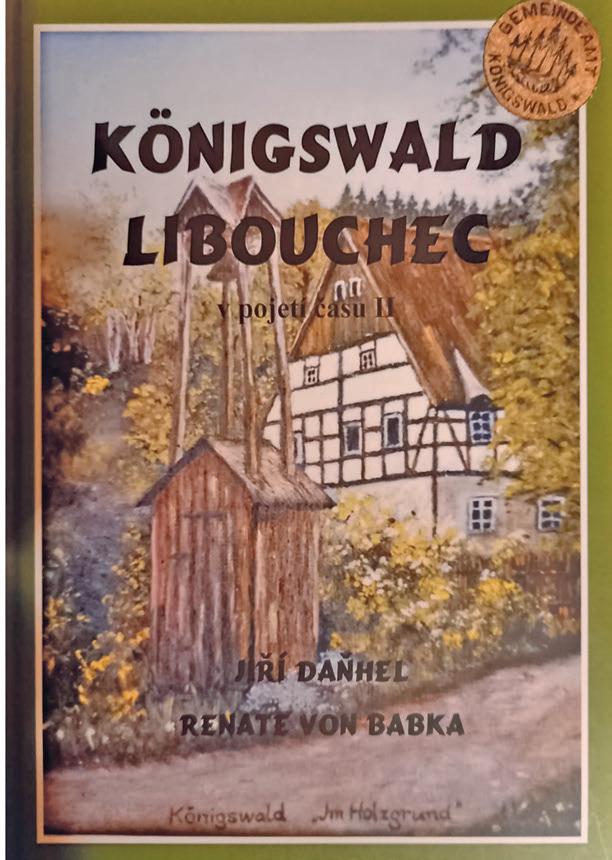
Anläßlich der Eröffnung des Kammwegs im Jahr 1904 veröffentlichte Professor Amand Paudler einen Führer über den Teilabschnitt vom Jeschken zum Rosenberg.
Nach 1945 gab es keine durchgängige Markierung mehr, die meisten Abschnitte wurden aber
Das brachte ihr kritische Stimmen ein, sie erfuhr aber auch viel Zuspruch, etwa von Horst Seehofer, dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten. Als Heimatbetreuerin von Peterswald nahm sie 2019 ohne zu zögern auch noch Königswald (Libouchec) unter ihre Fittiche, nachdem es keinen Nachfolger mehr gab. Ihre Publikationen „Nordböhmische Dörfer –Geschichten aus der Region“ (2016), „Königswalder Erinnerungen und weitere Geschich-
� Persönlichkeiten
Selbst Rückschläge halten sie aber nicht davon ab, immer neue Projekte anzustoßen, wie den Erhalt alter deutscher Gräber auf den Friedhöfen in Peterswald und Königswald, den sie gemeinsam mit dem Verein OMNIUM angestoßen hat. Ganz nebenbei wurde Renate zur Kontaktstelle bei allen Arten von Anfragen. Ihre Recherchen bildeten die Grundlage für ein weiteres Buch, in dem sie die teils spannenden Berichte zusammengefaßt hat. Damit will sie insbesondere Angehörige der Nachkommengeneration erreichen, die in der eigenen Familie niemanden mehr befragen können.
Vorerst keine archivierten Aussiger Boten im Netz: https://www.heimatpresse-moe. de/das-archiv/aussiger-bote/
ten aus nordböhmischen Dörfern“ (2018), „Neue Geschichten aus nordböhmischen Dörfern“ (2019), „Weitere Geschichten aus nordböhmischen Dörfern und damit verbundene Persönlichkeiten aus der Region Aussig“ (2020), die sie gewissenhaft recherchierte, sind ein Vermächtnis an die Nachwelt.
2017 kam ein weiterer Gedenkstein ihrer Familie zum Vorschein, der Sockel eines Eisenkreuzes am Weg von Peterswald nach Raiza und Tyssa, das Karl
Zum 125. Geburtstag von Anton Bruder
Nach dem Abitur 1917 begann Bruder sein Studium an der Kunstakademie in Prag. Sein künstlerischer Werdegang führte ihn weiter über die Kunstakademie in Dresden (1919-1924), wo er den Akademiepreis errang, zur expressionistischen Prager „Pilgergruppe“ von Prof. Brömse und nach dessen Tod zur „Prager Sezession“.
Wesentlich beeinflußt wurde Bruder durch die Künstler der „Brücke“ und durch Oskar Kokoschka, seinen damaligen Akademieprofessor in Dresden.
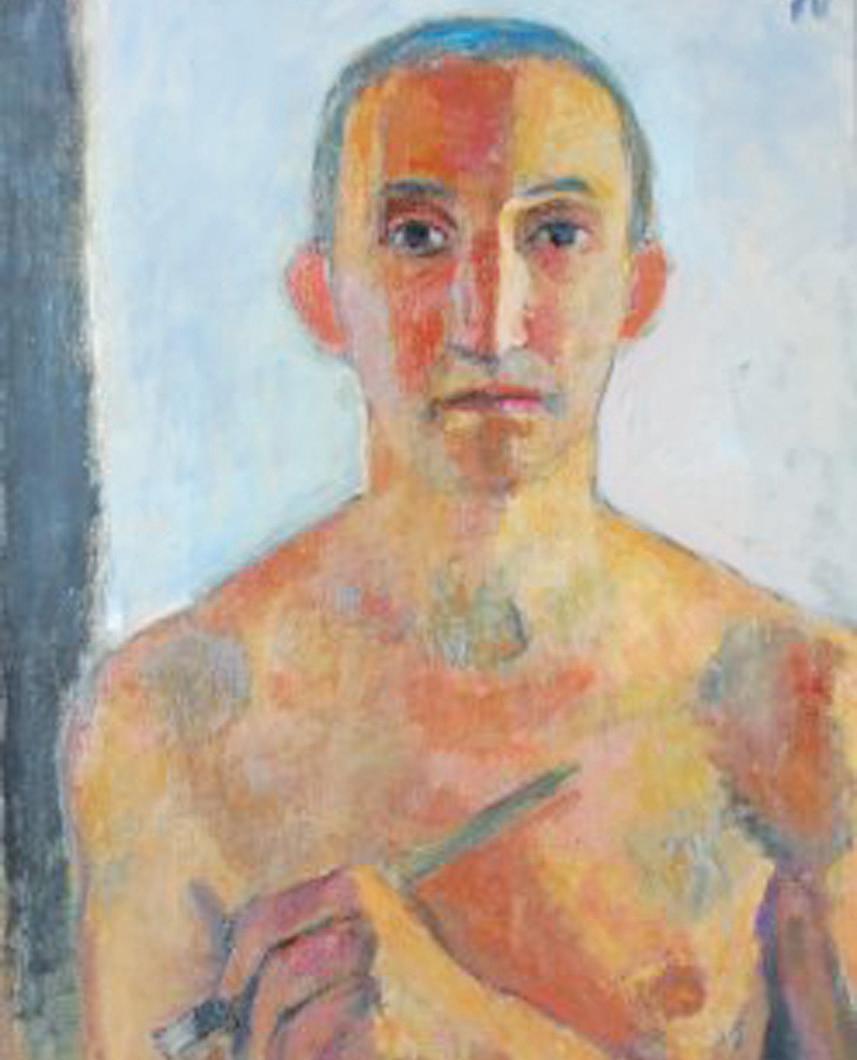
Nach dem Staatsexamen 1925 war Anton Bruder zwanzig Jahre lang, bis 1944, als Kunsterzieher in Aussig, Mährisch-Ostrau und Znaim tätig.
Selbstbildnis 1970. Museen der Stadt Aschaffenburg..
Nach Militärdienst, russischer Kriegsgefangenschaft und Ver-
Wandern auf dem Kammweg
noch als Wanderwege erhalten. Nach 1990 entstand auf weiten Teilen der historischen Wegtrasse der Europäische Fernwanderweg E3. Von tschechischer Seite wur-
de 2022 die Reorganisation eines 101 km langen grenzüberschreitenden Teilstücks angestoßen, das im April dieses Jahres eröffnet wurde. Die Wegführung hat
Peterswald ist neben Backnang zu ihrer zweiten Heimat geworden. Mehrmals im Jahr besucht sie den kleinen Ort im Erzgebirge, pflegt vielfältige Kontakte und organisiert Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge in Schulen und Heimattreffen, an denen ehemalige und heutige Bewohner teilnehmen.
Sie sieht ihr Engagement als kleinen Schritt in Richtung Versöhnung, Frieden und Freundschaft.
Liebe Renate! Am 9. Juni begehst Du Deinen 70. Geburtstag. Dazu wünschen wir Dir alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Bleib weiterhin aktiv und genieße Dein Leben!
Karin Wende-Fuchs im Namen aller Deiner Heimatfreunde
treibung lehrte Bruder von 1949 bis zu seiner Pensionierung 1961 wieder als Kunsterzieher am Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg. Zeitweise wirkte Bruder auch als Designer in Wien und schuf Kirchfenster in Oberbayern. Ab 1962 war er freischaffender Künstler in Oberfranken. Mensch, Tier und Landschaft waren die dominierenden Themen. Seine Werke wurden von Galerien in Prag, Aussig, Brünn, Znaim, Troppau, Dresden, Aschaffenburg, Würzburg, Hamburg, Bremen, Coburg und Regensburg, sowie von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung angekauft. Anton Bruder erhielt 1956 den Kunstpreis der Stadt Aschaffenburg und 1972 den Anerkennungspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Der Künstler starb am 17. Feber 1983 in Aschaffenburg. Helmut Hoffmann †, gekürzt
man gegenüber 1904 dahingehend verändert, daß touristisch interessante Punkte einbezogen werden.
Die neue Variante beginnt in Peterswald, durchquert die Böhmische Schweiz und führt über Tyssa zum Hohen Schneeberg (Děčínský Sněžník 724 m), natürlich mit Abstecher zur Edmundsklamm und zum Prebischtor. Tiefster Punkt der Wanderroute ist Tetschen ( Děčín 135 m). Der Weg endet am Schöbersattel (Stožecké sedlo 602 m) im Lausitzer Gebirge (Lužické hory). Der Kammweg versucht auf der Höhe der jeweiligen Gebirgsformation zu bleiben und quert auch ein großes Stück des Böhmischen Nationalsparks. kw
10 Jahre lief der Vertrag zwischen dem Aussiger Bote e. V. und der Martin-Opitz-Bibliothek für Mittel- und Osteuropa. Damit ermöglichte es der Verein, auch nach seiner Liquidierung Ende 2013, die Aussiger Boten von 1948 bis 2020 im Netz einsehen zu können. Die Kosten wurden vom Verein bis Juni 2023 bezahlt. Unser ehrenamtlicher Archivar Horst Prowinsky hat sämtliche Ausgaben vorsichtshalber heruntergeladen und gesichert. Ob uns die Sudentdeutsche Landsmannschaft eine neue Plattform zur Verfügung stellt, ist noch unklar. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, die Jahrgänge in eine Cloud zu stellen. Es tut uns sehr leid, daß Sie vorerst keinen Zugriff mehr auf die alten Jahrgänge haben, halten Sie aber auf dem Laufenden. kw
n 103. Geburtstag: Am 8.7. Herrmann DEUTSCH aus Kulm in 01744 Dippoldiswalde, Kreischaer Str. 10.
n 98. Geburtstag: Am 21.6. Elisabeth FRANZ (Gaudek Liese) aus Schönpriesen / Lieben Nr. 12.
n 96. Geburtstag: Am 11. 6. Margarete DOLESCHAL aus Aussig-Kleische, Laubenhäuser. –Am 28. 6. Emma TUCEK geb. Mühle aus Herbitz in 76149 Karlsruhe, Heideweg 2.
n 95. Geburtstag: Am 6. 6. Ilsa RAIS aus Kulm in 39218 Schönebeck, Moskauer Str. 25.
n 94. Geburtstag: Am 11.6. Herta LAUERMANN geb. Thume aus Großpriesen, Tel: 05345-1479. – Am 14. 6. Hans
Helmut RÖSLER aus Aussig in 90547 Stein, Oberbüchlein 4. –Am 24. 6. Elfriede KÜHNEL (Krauspenhaar Elli) aus Schönwald in 01816 Oelsen, Oelsener Str. 10. – Am 29.6. Franz LAUERMANN aus Großpriesen, Tel: 05345-1479.
n 93. Geburtstag: Am 10. 6. Gretel WALTHER geb Paul aus Modlan in 06667 Weißenfels, Im Stadtberg 18. – Am 3. 7. Kurt KRAUS aus Großpriesen in 85630 Grasbrunn (Neukeferloh), Hans-Sailer-Str.12.

n 92. Geburtstag: Am 8.6. Erich FÜSSEL aus Schreckenstein, Franz-Schubert-Str. 3. –Am 29. 6. Marianne OTT geb. Palme aus Großkaudern in 63500 Seligenstadt, Schulstr. 7.
n 90. Geburtstag: Am 12. 6. Leopold MARINI aus Salesel in 73527 Schwäbisch Gmünd, Liegnitzer Weg 6.
n 89. Geburtstag: Am 22. 6. Josef WAGNER aus Troschig.
n 88. Geburtstag: Am 14.6. Roland POTZNER aus
Heute: Herbert Lorenz, Estenfeld, früher Aussig, Fabrikstraße. Herbert Lorenz wurde am 18. Jänner 1923 in Aussig geboren. Er lebt mit Sohn und Schwiegertochter in einem Haus in Estenfeld und besucht dreimal wöchentlich eine Tagespflege. Zusammen mit seinen Freunden ließen ihn die Mitarbeiterinnen bei einer kleinen Feier hochleben. Herbert Lorenz wird trotz seines Alters als Unterhalter sehr geschätzt. Oft liest er aus den Aussiger Boten vor oder hält Vorträge. Es ist ihm ein Anliegen, seinen Freunden die Heimat näherzubringen. kw Foto: Privat

Schreckenstein in 78588 Denkingen, Bergstr. 9. – Am 14.6. Erna SCHWARZ aus Gebirgs-Ullersdorf in CZ-40011 Usti nad Labem, Stará 2467/37.


n 87. Geburtstag: Am 10.6. Martha WASENAUER geb. Heller aus Tellnitz. – Am 16.6. Dietmar PILZ aus Aussig, Bertagrund in 06217 Merseburg, Zu den Teichen 4.
n 84. Geburtstag: Am 10.6. Rainer KROMPHOLZ aus Schreckenstein in 84155 Bodenkirchen, Tulpenstr. 7. –Am 8. 7. Helga KÄSER geb. Polivka aus Schönwald.
n 83. Geburtstag: Am 12. 6. Jürgen WILK aus Aussig. – Am 21.6. Ursula LEHMKUHL geb. Pschenitzka aus Aussig in 19061 Schwerin, Vossens Tannen 65. –Am 8. 7. Karl Hans GUHSL aus Prödlitz, Ortsplatz 27. – Am 9.7. Rainer WOLF aus Arnsdorf in 06124 Halle-Neustadt, Stolberger Str. 14.
n 72. Geburtstag: Am 4. 7. Norbert EBERT (Schwiegersohn von Luise Böhlein, Schuster Liesl aus Schönwald) in 90766 Fürth, Eulenstr. 1 c.
n 70. Geburtstag: Am 9. 6. Renate von BABKA geb. Beil (Eltern aus Peterswald Nr. 193, Beil-Korl) in 71522 Backnang, Hessigheimer Str. 15. – Am 10.6. Karl Heinz KNAUTHE (Sohn von Ilse Nickel) aus Ebersdorf.
Liebe Heimatfreunde!
Bitte melden Sie Todesfälle weiterhin der Redaktion. Auch Geburtstage, die noch nicht veröffentlicht sind (mit Datenschutzerklärung!), nehmen wir gern in die Liste auf.
Redaktion Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, eMail: aussiger-bote@t-online.de. Herzlichen Dank!
AUSSIGER BOTE Sudetendeutsche Zeitung Folge 22 | 2.6.2023
24 � Glückwunsch
WIR GRATULIEREN
BETRAUERN
Aktuelles
WIR
�
Annelies
23.01.2023
96 Jahre
Liane Kroiss geb. Rotsch aus Aussig-Pockau, verst. 2022 in Rosenheim, 91 Jahre.
Wolf aus Peterswald 363, verst. am
in Hainburg,
Die jung gebliebene Jubilarin. Fotos: Renate von Babka
Renates Vorfahren stammen aus Peterswald. Ansichtskarte von 1914. Foto: „TAK TO BYLO NA USTECKU 2“ P. Spacek
Bilderbuch über Königswald. Eine Coproduktion mit Jiri Danhel.
„Hundewand“, Felswand an der Südseite des Hohen Schneebergs.
Foto: Norbert Kaiser, 2021.
� Wandertipp