Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Reicenberger


Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft


vereinigt mit Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“

Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
73. Jahrgang














In eigener Sache! Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.

Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt,
Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue. Mit traurigen Grüßen verbleiben wir Kai Raab (Inhaber) Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG



Direkt vor dem wichtigen Nato-Gipfel, der am Dienstag und Mittwoch in Litauens Hauptstadt Vilnius stattgefunden hat, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag mit einer Delegation nach Prag gereist. Ein Thema: der Wiederaufbau der von den Russen zerstörten Städte und Dörfer sowie die Beteiligung der tschechischen Wirtschaft an diesem Milliardenprojekt.

Andrij Jermak saß bei der Konferenz mit Präsident Petr Pavel direkt neben Wolodymyr Selenskyj.




Man kennt sich seit der gemeinsamen Zeit im ukrainischen Fernsehgeschäft: Nach Präsident Wolodymyr Selenskyj ist sein Bürochef Andrij Jermak der zweitmächtigste Mann der Ukraine. Der 51-jährige Anwalt begleitete Selenskyj jetzt auch auf der Reise nach Prag.


Jermak zieht sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik die Fäden. Traditionell wird die Innenpolitik der Ukraine vor allem im Präsidialamt entschieden. Jermak vertritt das Land aber auch bei wichtigen internationalen Treffen, wie dem Wirtschaftsgipfel in Davos, und er ist Ansprechpartner, wenn US-Senatoren Kiew besuchen.
Zudem ist er im ständigen Austausch mit der US-Regierung. So telefoniert er regelmäßig mit Jake Sullivan, dem Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, um das weitere Vorgehen gegen Rußland zu besprechen. Außerdem kämpft er darum, daß der Westen der Ukraine möglichst viele Panzer und anderes militärisches Gerät zur Verfügung stellt.

Erste Station war am Donnerstagabend die Prager Burg, wo Selenskyj und seine Delegation von Staatspräsident Petr Pavel empfangen wurden. Pavel hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt im April Selenskyj in Kiew besucht und war dann – als erster westlicher Politiker und unter Lebensgefahr – in die Ostukraine an die Front gereist. Die tiefe Wertschätzung für den ehemaligen General und Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses machte Selenskyj in seinem Eintrag ins Goldene Buch deutlich: „Mit aufrichtigem Dank an den Präsidenten der Tschechischen Republik, Petr Pavel, für seine starke und konsequente Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit und unsere gemeinsamen europäischen Werte. Sie stehen auf der Seite der Wahrheit und der Gerechtigkeit, auf der Seite einer freien, demokratischen Gesellschaft.“

Pavel, der im JugoslawienKrieg mit tschechischen Fallschirmjägern eine eingeschlossene französische Einheit befreit hatte und seitdem ein Kriegsheld ist, zollte Selenskyj ebenfalls seinen Respekt: „Es ist eine große Ehre für mich, daß mein erster offizieller ausländischer Gast auf der Prager Burg der Präsident der Ukraine ist. Ich möchte nicht nur den Mut des ukrainischen Volkes bei der Verteidigung gegen die russische Aggression würdigen, sondern auch den persönlichen Mut von Präsident Selenskyj. Es ist bewundernswert, daß er angesichts einer direkten Bedrohung seines Lebens durch Rußland die Unterstützung seiner Partner und Verbündeten gewinnen konnte.“ Und als kla-


re Botschaft an den Nato-Gipfel fügte Pavel an: „Es liegt im Interesse der Tschechischen Republik, daß die Ukraine, sobald der Krieg vorbei ist, Verhandlungen über einen Nato-Beitritt aufnimmt. Dies ist gut für unsere Sicherheit, die regionale Stabilität und den wirtschaftlichen Wohlstand. Wir werden uns auch dafür einsetzen, daß die EU-Beitrittsverhandlungen bis zum Ende dieses Jahres beginnen.“

Am Freitag stand dann ein Treffen mit Premierminister Petr Fiala auf dem Programm, der ebenfalls Mut bewiesen hatte, als er gemeinsam mit den Regierungschefs aus Polen und Sloweniens kurz nach Kriegsbeginn im März 2022 nach Kiew gereist ist. Fiala betonte, daß Selenskyjs Be-
such die enge Freundschaft zwischen den beiden Ländern unterstreiche und die Unterstützung der Ukraine eine der außenpolitischen Prioritäten der Regierung sei. „Die Tschechische Republik hat der Ukraine militärische, materielle, finanzielle und humanitäre Hilfe geleistet und wird dies auch weiterhin tun“, so Fiala.
Konkret kündigte der Premierminister an, daß Tschechien der Ukraine zusätzliche Kampfhubschrauber und großkalibrige Munition zur Verfügung stellen und auch bei der Ausbildung von Piloten helfen werde.

Das Hauptthema war der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Tschechien werde das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene 50-Milliarden-
Euro-Paket unterstützen, sagte Fiala und fügte an, daß tschechische Unternehmen sehr daran interessiert seien, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Fiala:


„Präsident Selenskyj hat mir versichert, daß er und die gesamte Ukraine sich der bisherigen Unterstützung durch die Tschechische Republik bewußt sind und daß er bereit ist, die Beteiligung tschechischer Unternehmen am Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel das Interesse von Skoda JS an einer Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie oder von Skoda Transportation erwähnt, das sich in der Endphase der Ausschreibung für die Modernisierung der Kiewer Metro befindet und auch an der Lieferung von Eisenbahnen und anderen möglichen Projekten interessiert ist.“

Noch im Juli werde eine 30-köpfige Delegation aus dem Energie-, Gesundheits- und Verkehrssektor unter der Leitung des Regierungsbeauftragten Tomas Kopecny die Ukraine besuchen. Die Regierung plane außerdem, die Beteiligung tschechischer Unternehmen am Wiederaufbau durch Exportversicherungen zu unterstützen.
Fiala: „Ich bin überzeugt, daß die Zukunft der Ukraine in der EU und in der Nato liegt, die dafür sorgen werden, daß sich eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt in Europa erleben, nicht wiederholt.“ Torsten Fricke

SL-Büroleiter Peter Barton ist
viel unterwegs. Neulich blieb sein Zug auf der schönen Bahnstrecke Prag–Linz im tschechischen Grenzbahnhof Oberhaid (Horní Dvořiště) stehen. Wegen einer kaputten Oberleitung zwischen den österreichischen Bahnhöfen Summerau–Freistadt hatte er über eine Stunde Zeit, um sich am ersten Bahnsteig die Ausstellung „Paměť národa“ (Das Gedächtnis der Nation) anzuschauen. Die meisten der angebrachten Tafeln zeigen aus persönlicher

Sicht von Zeitzeugen historische Ereignisse, die mit der Vertreibung der Sudetendeutschen in dieser südböhmischen Region zusammenhängen. So kam zum Beispiel der Tscheche Karel Mráz im Rahmen der „Neubesiedelung“ des Sudetenlandes mit seinen Eltern nach Oberplan. Fast ein Jahr lang lebte die Familie Mráz mit einer sudetendeutschen Familie in deren Haus zusammen. Um den kleinen Karel kümmerte sich tagsüber die sudetendeutsche Großmutter, die im Jahr 1946 mit ihrer Familie nach Ulrichsberg in Ober-
österreich vertrieben wurde. Nach der Samtenen Revolution kamen manche Vertriebenen über die Grenze, um sich ihre früheren Häuser anzusehen. Seit dieser Zeit erhält die Familie Mráz regelmäßig Besuch von jener Familie, mit der sie ein Jahr lang das Haus geteilt hatte. Auf diese Weise ist eine neue Freundschaft entstanden.
❯ Bernd Posselt war als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union unterwegs
In seiner doppelten Rolle als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland hat Bernd Posselt mit seinen beiden engsten Mitarbeitern, Stephanie Waldburg und Johannes Kijas, eine mehrtägige Sommertour durch Böhmen und die Oberpfalz unternommen, um grenzüberschreitende Aktivitäten für die zweite Jahreshälfte und für 2024 vorzubereiten.

Auf dem Programm standen Beratungen im Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, das für den Freistaat Bayern die Kooperation mit der tschechischen Seite koordiniert, Gespräche mit Landwirtschaftsexperten in Pilsen, ein Informationsbesuch in Ronsperg/Poběžovice sowie die jährliche Sitzung der Arbeitsgruppe „Dialog ohne Tabus“ des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, die wie immer mit der großen Wallfahrt nach Haindorf im Isergebirge kombiniert wurde.

Im Centrum Bavaria Bohemia ging es um das Projekt „Grünes Band“. Dieses verläuft entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges von Norwegen und Finnland bis ans Mittelmeer und hat mittlerweile nicht nur eine ökologische, sondern auch eine historische, kulturelle und tourismuspolitische Dimension. Wesentliche Themen in der bayerisch-böhmischen Grenzregion sind dabei auch Vertreibung, Wiederbesiedlung, Kommunismus, verschwundene Dörfer und die Auswirkungen dieser Phänomene auf die heutige Zeit. Von großer Bedeutung ist bei den Planungen auch die Erschließung historischer und kultureller Tatsachen durch deutsche und tschechische Schulklassen sowie Studenten. In der zweiten Hälfte der Sitzung stieß der neue Bundesvorsitzende der AckermannGemeinde, Prof. Albert-Peter Rethmann, hinzu, der sich intensiv in die Debatte einbrachte.
Arbeitssitzung im Centrum Bavaria Bohemia (von links): Jörg Skriebeleit, Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Werner Karg vom Bayerischen Kultusministerium, Prof. Albert-Peter Rethmann, Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde, Stephanie Waldburg, Volksgruppensprecher Bernd Posselt und die Leiterin des Zentrums, Veronika Ho nger. Fotos: Johannes Kijas

Inflation sinkt auf unter zehn Prozent
Eine Wende zum Besseren ist es noch nicht, aber ein Funken Hoffnung: Zum ersten Mal seit Januar 2022 ist die Inflation in Tschechien offenbar unter die symbolisch wichtige Marke von zehn Prozent gesunken, hat eine Umfrage der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK unter Wirtschaftsexperten ergeben. Im Mai lag die Inflation noch bei 11,1 Prozent. Die offiziellen Zahlen für Juni wird das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) Ende der Woche veröffentlichen. Wichtigste Inflationsbremse waren, so die Experten, die Treibstoffpreise, die im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent gesunken sind.
Olena Selenska nach Prag eingeladen
Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová, hat die ukrainische First Lady Olena Selenska zu einem Parlamentsgipfel eingeladen, der im Oktober in Prag stattfindet. Der Gipfel soll sich mit den Entführungen ukrainischer Kinder beschäftigen. Nach ukrainischen Angaben sind seit Kriegsbeginn mehr als 16 000 Kinder und Jugendlichen nach Rußland verschleppt worden.
Steuersatz im Vergleich hoch
normalen Mehrwertsteuersatz liegt Tschechien mit 21 Prozent im mitteleuropäischen Durchschnitt. Deutschland hat einen Satz von 19 Prozent, die Slowakei und Österreich 20 Prozent, Polen 23 Prozent.
Das erste Jungtier des seltenen Östlichen Spitzmaulnashorns ist im Nationalpark Akagera in Zentralruanda zur Welt gekommen. Seine Mutter ist das Weibchen Jasiri, das im Oktober 2016 im Zoo in Königinhof an der Elbe geboren wurde. Das Weibchen Jasiri wurde 2019 zusammen mit vier weiteren Spitzmaulnashörnern in Ruanda ausgewildert. Dort sollen die Tiere der vom Aussterben bedrohten Nashornpopulation genetische Vielfalt bringen. An dem Projekt „Rhinos to Rwanda“ beteiligen sich mehrere europäische Zoos.
Neuer Minister will keine Revolution
In einer gemeinsamen Erklärung hat sich die tschechische Bischofskonferenz gegen eine Ehe für alle ausgesprochen. Der Vorschlag, die Ehe auch für homosexuelle Paare zu ermöglichen, wird derzeit im Abgeordnetenhaus diskutiert. Seit 2006 können gleichgeschlechtliche
Paare ihre Beziehung zumindest amtlich registrieren lassen.
In der Erklärung, die unter anderem von Prags Erzbischof Jan Graubner unterzeichnet wurde, warnen die Kirchenführer: „Die gesellschaftliche Praxis hat immer wieder gezeigt, daß die
Auf dem Weg vom Haindorfer Wallfahrtsgottesdienst: Vizebürgermeisterin Lucie Podhorová und der Leiter der Bildungsstätte, Jan Heinzl, begrüßen Volksgruppensprecher Bernd Posselt.
In Ronsperg, dem Heimatort des großen Sudetendeutschen Richard Graf Coudenhove-Kalergi, der als Gründer der Paneuropa-Union die europäische Einigungsidee initiiert hatte, informierte sich die Delegation über die erfolgreichen Restaurierungsarbeiten an der Freitreppe des Schlosses sowie am Aufgang in die einstmals berühmte Bibliothek. Deren kostbare Bücherbestände wurden zu einem Großteil im Trauttmansdorff-Schloß in Bischofteinitz wieder aufgefunden. Der Vater von Graf Richard,
An der renovierten Freitreppe des Coudenhove-Schlosses in Ronsperg: Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der PaneurpaUnion, mit Stephanie Waldburg und Johannes Kijas.
der habsburgische Diplomat und Gelehrte Heinrich CoudenhoveKalergi, war der Begründer des interreligiösen Dialoges und verfaßte das bis heute gültige Standardwerk gegen den Antisemitismus. Dabei sammelte er Literatur in zahlreichen Sprachen, die jetzt wieder zugänglich gemacht werden soll.
Die Haindorfer Wallfahrt bot den Rahmen für die diesjährige Arbeitssitzung „Dialog ohne Tabus“ des entsprechenden Gremiums des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, das Bernd
Posselt und Karls-Preisträger Milan Horáček leiten.
Auf der Tagesordnung standen vor allem das Gedenken an Otfried Preußler in diesem und an Oskar Schindler im nächsten Jahr, die Jahreskonferenz des Gesprächsforums im Herbst in Prag, die neuesten Fortschritte im sudetendeutsch-tschechischen Verhältnis, die Lage der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik sowie die beeindruckende Anzahl grenzüberschreitender Kulturprojekte.
Die Tschechische Republik hat unter den Nachbarländern den höchsten ermäßigten Mehrwertsteuersatz, hat eine Studie der Beratungsfirma Mazars ergeben. Laut EU-Gesetzgebung ist es den EU-Ländern erlaubt, zusätzlich zum normalen Mehrwertsteuersatz einen oder zwei ermäßigte Mehrwertsteuersätze anzuwenden. In Tschechien gibt es derzeit zwei ermäßigte Sätze, 10 und 15 Prozent. Das Sparpaket der Regierung sieht vor, die beiden ermäßigten Sätze auf 12 Prozent zu vereinheitlichen. In Polen werden ermäßigte Sätze von acht und fünf Prozent angewandt, in der Slowakei zehn und fünf Prozent, in Österreich 13 und zehn Prozent. In Deutschland gibt es einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Beim
Staatspräsident Petr Pavel hat am vergangenen Donnerstag den Christdemokraten Marek Výborný zum neuen Landwirtschaftsminister ernannt. Výborný ersetzt damit seinen Parteikollegen Zdeněk Nekula, der aufgrund massiver Kritik zurückgetreten war (Sudetendeutsche Zeitung berichtete). „Ich möchte keine Revolution im Ministerium starten, sondern in den erfolgreichen Dingen fortfahren“, sagte Výborný nach seiner Ernennung. Nur eines will der neue Minister in jedem Fall ändern: Die Kommunikation verbessern, denn daran war Výborný, wie er selbst eingeräumt hatte, am Ende gescheitert.

Tschechiens Motto für die Expo 2025
Unter dem Motto „Talent und Kreativität für das Leben“ wird sich Tschechien auf der Weltausstellung Expo 2025 vom 13. April bis 13. Oktober 2025 im japanischen Osaka präsentieren. Die Expo sei eine moderne Marketingplattform, die sehr gut genutzt werden könne, um die Tschechische Republik zu präsentieren, sagte Jan Herget, Direktor von CzechTourism.
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;
Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Ehe zwischen einem Mann und einer Frau eine unverzichtbare Grundlage für die Bildung einer guten Familie und einer gesunden, funktionierenden Gesellschaft ist. Wo die Familie zerbricht, zerbricht auch der Staat. Deshalb müssen Ehe und Familie vom Staat und der Zivilgesellschaft geschützt, gefördert und zielgerichtet weiterentwickelt werden, denn eine stabile Familie ist einer der wichtigsten Bausteine der Gesellschaft in jeder Zeit.“
Die Ehe sei „eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau“, die auf
einer freiwilligen, vertraglichen Beziehung beruhe. Die Bischöfe: „Die Institution der Ehe wurde nicht von Menschen eingeführt, sondern von Gott selbst, als er den Menschen schuf, wie es in der Heiligen Schrift heißt: ,Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.‘“
Die Ehe beruhe auf der Komplementarität des männlichen und des weiblichen Elements.
„Diese Komplementarität ermöglicht die Fortpflanzung und das Kinderkriegen und schafft Raum für die gesunde Entwick-
lung und Erziehung der Kinder“, heißt es in der Erklärung weiter. Demnach ergäbe sich der Charakter der Ehe nicht nur aus der christlichen Lehre, sondern sei auch in der natürlichen Ordnung der Dinge zu erkennen.
Die Bischöfe: „Wir sind davon überzeugt, daß die Ehe nicht neu definiert werden kann; sie war schon immer eine Bundesehe zwischen einem Mann und einer Frau und wird es auch in Zukunft sein. Die Gesellschaft mag sich weiterentwickeln, aber einige Dinge sind unveränderlich und unveränderbar.“ Torsten Fricke
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
❯ „Wo die Familie zerbricht, zerbricht auch der Staat“
Bischofskonferenz gegen „Ehe für alle“
Den Sonderpreis der Jury erhielt der in Deutschland lebende Regisseur Behrooz Karamizade für den Film „Leere Netze“.

Doppel-Erfolg für „Blagas Lektionen“. Schauspielerin Eli Skortschewa, Produzent Eike Goreczka und Regisseur Stephan Komandarew freuen sich über zwei Auszeichnungen in Karlsbad. Fotos: Film Servis Festival Karlovy Vary
� „Blagas Lektionen“ gewinnt in der Kategorie „Bester Film“ – Sonderpreis der Jury für das deutsch-iranische Drama „Leere Netze“



Regisseur Cyril Aris erhielt eine Sonderanerkennung der Jury.
Die deutsch-bulgarische Produktion „Blagas Lektionen“ ist auf dem 57. Internationalen Filmfestival in Karlsbad als bester Film ausgezeichnet worden. Produzent des Sozialdramas ist der Magdeburger Eike Goreczka. Die Regie hatte Stephan Komandarew, der bei der Abschlußgala auch den Kristallglobus von Festivalpräsident Jiří Bartoška entgegennahm. Die Hauptdarstellerin Eli Skortschewa wurde zudem zur besten Schauspielerin gekürt.
In „Blagas Lektionen“ geht es um eine pensionierte Lehrerin, die einem Telefonbetrug zum Opfer fällt und all ihr Erspartes verliert. Das Geld hatte sie zurückgelegt, um ihrem gerade verstorbenen Ehemann ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Aber Blaga gibt nicht auf – und muß dabei selbst zu unmoralischen Mitteln greifen.
Den Sonderpreis der Jury gewann der deutsch-iranische Film „Leere Netze“ von Regisseur
Auf der Abschlußgala des 57. Internationalen Filmfestivals in Karlsbad überreichte Festivalpräsident Jiří Bartoška (im Hintergrund) den „Preis
Behrooz Karamizade, der mittlerweile in Deutschland lebt. Der Film schildert die Geschichte eines jungen Iraners, der illegal fischt, um Geld für seine Hochzeit zu verdienen. Das Filmprojekt wurde vom ZDF sowie von
Hessenfilm und Medien gefördert.
Den Preis für die Regie nahm Babak Jalali für den US-amerikanischen Film „Fremont“ entgegen. Herbert Nordrum erhielt den Preis für den besten Schau-
spieler für seine Rolle in der schwedisch-norwegisch-französischen Produktion „Hypnose“. Eine Sonderanerkennung der Jury ging an den deutsch-libanesischen Dokumentarfilm „Dancing on the Edge of a Volcano“
unter der Regie von Cyril Aris, den die Augsburgerin Katharina Weser mitproduziert hatte. Insgesamt wurden während des Filmfestivals 143 Filme gezeigt.
Auf der Abschlußgala war dann wieder Hollywood in Karls-
bad vertreten. Neben der tschechischen Schauspielerin Daniela Kolářová erhielt der US-amerikanische Star Robin Wright den Preis des Festivalpräsidenten. Ihren internationalen Durchbruch hatte Wright an der Seite von Tom Hanks in dem 1994 gedrehten Welterfolg „Forrest Gump“.
Spätestens seit der Netflix-Serie „House of Cards“ ist Wright weltweit bekannt. Für ihre Rolle als Mrs. Underwood wurde sie als beste Serien-Hauptdarstellerin mit dem Golden Globe ausgezeichnet. In Karlsbad war die Amerikanerin, die 2009 bei den Festspielen in Cannes selbst in der Jury saß, voll des Lobes: „Ich möchte dem gesamten Festivalteam danken – dies ist in der Tat eines der besten Festivals, an denen ich je teilgenommen habe. Danke, daß Sie die Filme unterstützen.“

Im nächsten Jahr findet in Karlsbad das 58. Internationale Filmfestival vom 28. Juni bis 6. Juli statt. Torsten Fricke
� Sonderausstellung des Sudetendeutschen Museums zum 100. Geburtstag und 20. Todestag des weltberühmten Autors
„Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“ oder „Das kleine Gespenst“ – als Autor von Kinderbüchern ist Otfried Preußler weltberühmt. Über 50 Millionen Mal wurden seine Werke gedruckt und in 55 Sprachen übersetzt. In der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt ist, wie der Sudetendeutsche zeitlebens unter Krieg und Vertreibung litt.
thema in seinem Welterfolg „Krabat“. Zehn Jahre lang hatte der Autor an dem Werk gearbeitet, unter Schreibblockaden gelitten und immer wieder das Manuskript in den Papierkorb geworfen, wo es seine Frau Annelies herausfischte, bis das Buch 1971 erschien.
Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren und verstarb am 18. Februar 2013 in Prien am Chiemsee. Foto: privat
� Sonderausstellung des Sudetendeutschen Museums
Ein bißchen Magier bin ich schon
Mit einer Vernisage wird am Donnerstag, 20. Juli, um 19.00 die Sonderausstellung „Ein bißchen Magier bin ich schon“ über Otfried Preußlers Erzählwelten in München eröffnet.
Bis zum 12. November ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Alfred-Kubin-Galerie des
Sudetendeutschen Hauses (Eingang Hochstraße 8) geöffnet. Realisiert hat die Sonderausstellung das Sudetendeutsche Museum in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz. Begleitet wird die Sonderausstellung von zahlreichen Einzelveranstaltungen zu einzelnen Themenbereichen.
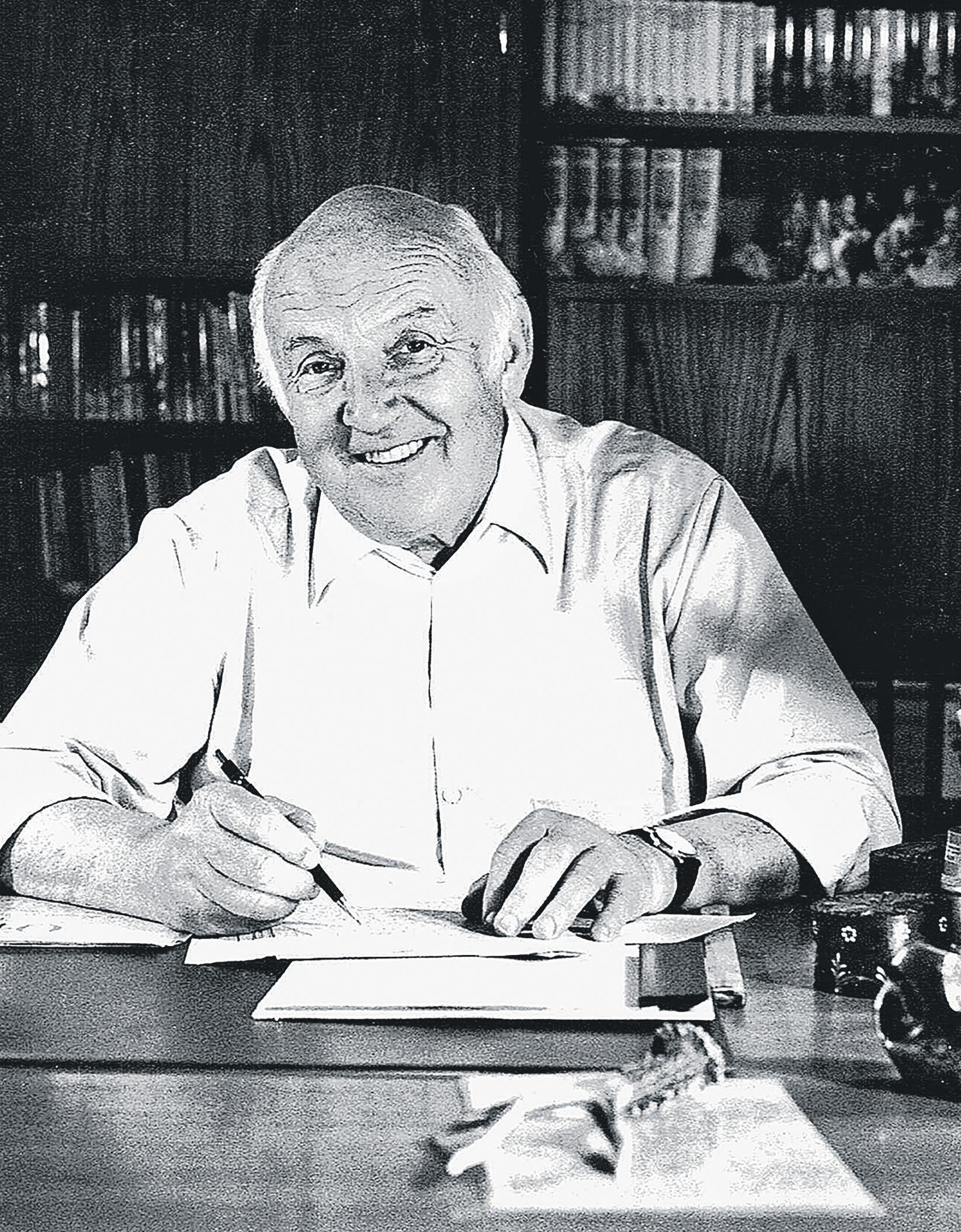
A
ls Otfried Syrowatka wurde der spätere Autor am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren. In Anlehnung an die Großmutter ließ der Vater den Familiennahmen 1941 in Preußler ändern. Direkt nach seinem Abitur wurde Preußler am 20. März 1942 zur Wehrmacht eingezogen. „Ich hatte mich freiwillig in den Krieg gemeldet, von dem wir ja damals glaubten, er sei ein gerechter Krieg.“
Zuvor gehörte Preußler, wie viele seiner Kameraden, erst dem Deutschen Jungvolk und dann der Hitlerjugend an. Für die oft verbreitete Behauptung, Preußler sei auch Mitglied der NSDAP gewesen, gibt es dagegen keinen offiziellen Beleg.
Ein Ernteeinsatz der Hitlerjugend inspirierte den damals 17-jährigen im Winter 1940/41 die Erlebnisse in seinem Erstlingswerk „Erntelager Geyer“ niederzuschreiben, dessen Existenz erst 2015, also Jahre nach Preußlers Tod, allgemein bekannt wurde. Die Anziehungskraft des Bösen, wie es Preußler im Nationalsozialismus selbst erlebt hatte, wird später das Leit-
Grundlage ist eine sorbische Sage: Krabat ist Lehrling eines bösen Zaubermeisters und zunächst begeistert von der schwarzen Magie, bis er sich gegen das Böse stellt.
„Mein Krabat ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation und die aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin verstrikken“, erklärte der Autor die autobiografischen Bezüge.
Die Unmenschlichkeit des Kriegs hat Preußler selbst erlebt: „Diese jungen Burschen, das waren wir – im Lager. Ich war –nach damaligem Recht – noch nicht volljährig, als ich 1944 in Bessarabien für fünf Jahre in russische Gefangenschaft kam. Ich hatte Typhus, Malaria, Fleckfieber. Irgendwann war ich auf 40 Kilo abgemagert, da bin ich in meiner Verzweiflung unter einem Zaun auf das Lazarett zugekrochen, direkt in die Arme einer jüdischen Ärztin. Und die sagte: ,Herr Leutnant, wie schaun Sie denn aus?‘ Und hat mich erst mal kahlgeschoren und in die Wanne gesteckt. Sie weinte und erzählte, ihr Sohn – in meinem Alter – sei in meinem Frontabschnitt gefallen.“
„Der Verlust der Kinderheimat“ sei sein zentrales Motiv gewesen. Erst im Juni 1949 wird Preußler aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Der Heimatlose findet über Umwege seine Verlobte Annelies Kind, die ebenfalls aus Reichenberg stammte, in Rosenheim wieder. Noch im selben Jahr heirateten die beiden.
„Ich habe die Vertreibung selbst nicht erlebt, ich habe davon im Lager von einem Politinstrukteur erfahren. Aber mein Mädchen, meine spätere Frau, hat das alles durchmachen müssen“, erinnerte sich Preußler in einem Interview und schilderte den ersten Besuch im Elternhaus viele Jahre später: „Da hingen noch die Bilder an der Wand, die mein Vater einst von seinen Malerfreunden geschenkt bekommen hatte. Sogar mein Klavier stand noch da, auf dem ich früher mehr schlecht als recht herumgeklimpert habe! Das war eine gespenstische Sache. Der Mann, der mittlerweile darin wohnte, wollte sogar mit mir auf die Rote Armee trinken.“
In dem bemerkenswerten Buch „Kind einer schwierigen Zeit“, das im vergangenen Jahr erschienen ist, hat der Literaturwisssenschaftler Prof. Dr. Carsten Gansel Otfried Preußlers frühe Jahre aufgearbeitet. Grundlage war ein Fund, den Gansel im Russischen Staatlichen Militärarchiv in Moskau gemacht hatte: die Kriegsgefangenenakte von Otfried Preußler. Bei der weiteren Recherche hat
der Wissenschaflter noch viele weitere bislang unbekannte Dokumente entdeckt, wie das Stück „Das geliebte Porzellan“, das im Lager aufgeführt wurde.
Gansel: „Das Schreiben hat Preußler beim Überleben in der Kriegsgefangenschaft geholfen. Mit seinen Gedichten und Dramen brachte er ein Stück Normalität in das Lager, und er hat, was mehrere Quellen belegen, den Mitgefangenen Mut gemacht.
Wie die zehnjährige Arbeit an ,Krabat‘ aber zeigt, war Preußler durch Krieg und Gefangenschaft schwer traumatisiert. Mit seinen Kinderbüchern hat Preußler diese schreckliche Zeit nicht nur für sich selbst verarbeitet, sondern sein Gesamtwerk ist auch eine Botschaft an die Jugend, sich der Macht des Bösen entgegenzustellen.“
Zur Jahrtausendwende nahm Preußler Kontakt zu Frank Schirrmacher auf, einem der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es ging um den Vorabdruck seiner Erinnerungen „Die verlorenen Jahre?“. Gansel: „Mit zunehmenden Alter war Preußler schließlich in der Lage, seine eigene Geschichte nicht mehr über ein Alter Ego, wie in ,Krabat‘ oder als Oberleutnant Trenkler im ,Bessarabischen Sommer‘ zu verarbeiten, sondern in der IchForm zu erzählen.“
Das Manuskript hat Preußler jedoch nie vollendet und in einem Interview angekündigt: „Aber das bekommt vorläufig niemand zu sehen. Erst wenn ich tot bin.“ Torsten Fricke
■ Bis Dienstag, 3. Oktober, Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“. Haus der Bayerischen Geschichte, Donaumarkt 1, Regensburg. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr.
■ Samstag, 15. Juli, 15.00
Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Die verlorene Heimat“. Filmpräsentation über das Braunauer Ländchen von Ondřej Valchař, Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Donnerstag, 20. Juli, 15.00
Uhr, Heimatverband der Brünner in der Bundesrepublik Deutschland (Bruna): Eröffnung der Ausstellung „Deutsche Brünner Persönlichkeiten aus sechs Jahrhunderten“. Rathaus, Stadtplatz 26, Waldkraiburg.
■ Donnerstag, 20. Juli, 19.00







Uhr, Sudetendeutsches Museum und Adalbert Stifer Verein: Eröffnung der Sonderausstellung „Ein bißchen Magier bin ich schon... Otfried Preußlers Erzählwelten“. Die Ausstellung läuft bis zum 12. November. Zusätzlich gibt es ein großes Begleitprogramm. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 21. Juli, 10.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft–Bundesverband und Landesgruppe Bayern informieren am Schrannenplatz in Erding über ihre Arbeit. Zwischen 10.00 und 12.00 Uhr werden Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, kurze Ansprachen halten. Mit Infoständen präsentieren sich: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Sudetendeutsches Museum, Sudetendeutsche Heimatpflege und der Heiligenhof. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die „Altbairische Blasmusik“ Erding unter der Leitung des Kreisvolks-
musikpflegers Reinhard Loechle. Die Privatbrauerei Erdinger Weißbräu ist mit einem Ausschank dort und lädt zur kostenlosen Bierprobe.
■ Freitag, 21. Juli, 13.30 Uhr, SL Bayern: Landesversammlung. Erdinger Weißbräu, Lange
Zeile 1 und 3, Erding.
■ Dienstag, 25. Juli, 18.30 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste und Sudetendeutsches

Musikinstitut: Ringveranstaltung und Komponistenporträt
„Dietmar Gräf zu seinem 80. Geburtstag“. Freier Eintritt mit anschließendem Empfang. Anmeldung per eMail an sudak@
mailbox.org oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 48. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Juli: Deutscher Böhmerwaldbund: 31. Bundestreffen in der Patenstadt Passau. Samstag, 10.00 Uhr: Kulturpreisverleihung im Rathaus mit Oberbürgermeister Jürgen Dupper. Sonntag, 9.30 Uhr: Festgottesdienst im Dom. 11.00 Uhr: Kundgebung im Redoutensaal mit Sylvia Stierstorfer, MdL, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.
■ Sonntag, 30. Juli, 15.00
Uhr: Gottesdienst mit Treffen der aus Schwaden (Kreis Aussig) und Umgebung stammenden deutschen und tschechischen Christen. Monsignore Karl Havelka aus Schüttenitz, Pfarrer Mazura aus Schreckenstein und Pfarrer Jancik aus Aussig werden den Gottesdienst gestalten. Anschließend Kaffee und Kuchen im Garten. Jakobus-Kirche, Schwaden (Svádov).
■ Montag, 31. Juli, 15.00 Uhr: Gedenkstunde an das Massaker auf der Brücke in Aussig mit Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der deut-
schen Vereine in der Tschechischen Republik. Im Anschluß Kaffee und Kuchen im Pfarrhaus in Aussig und um 18.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche.
■ Samstag, 5. August, 11.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Feierstunde zur Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Festrede: MdB Christoph de Vries. Schloßplatz, Stuttgart.
■ Mittwoch, 9. August, 19.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Gegen Hitler –Deutsche Partisanen im besetzten Jugoslawien 1941–1945“. Vortrag von Thomas Dapper. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Sonntag, 13. August, 11.00 Uhr: Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche Maria Kulm (Kreis Falkenau/Sokolov).
■ Montag, 14. bis Freitag, 18. August, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: Zeugnisse jüdischer und christlicher Kultur in Württemberg und Hohenzollern. Studienfahrt in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e. V. Infomationen und Anmeldung unter www.g-h-h.de/aktuelle-reisenund-seminare
■ Dienstag, 15. August: Die Böhmerwaldjugend singt und tanzt auf der Landesgartenschau. Auftritte von 13.15 bis 14.15 Uhr sowie von 17.00 bis 18.00 Uhr. Landesgartenschau. Zuppinger Straße, Freyung.
■ Freitag, 18. August, 18.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Im Gegenlicht –Bilder aus Ermland und Masuren“. Die Fotoausstellung von Wojciech Szulc-Cholnicki läuft bis zum 29. September. Ausstellungsort: Kin-Top DüsseldorfOberbilk, Mindener Straße 20, Düsseldorf.
■ Montag, 21. August, 19.00








Ein bisschen Magier bin ich schon...




Otfried Preußlers Erzählwelten
Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Ein Blick hinter Mauern. Kraft aus Krisen schöpfen“. Buchvorstellung und Gespräch mit Marie-Luise Knopp. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Donnerstag, 24. August, 19.00 Uhr, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Ein kompliziertes Leben in einem komplizierten Land – und große Literatur. Ivo Andric (1892–1975) und seine bosnische Heimat“. Vortrag und Lesung mit Dr. Katja Schlenker und Prof. Dr. Winfrid Halder. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Donnerstag, 24. August bis Dienstag, 31. Oktober, Stiftung Gerhart-HauptmannHaus: „Mein Leben war ein Aufdem-Seile-schweben“ Ausstellung über jüdische Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Montag, 28. August bis Freitag, 1. September, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Grenzüberschreitendes Bildungsseminar zu Zwangsmigration auf deutscher und polnischer Seite mit Stationen in Berlin, Potsdam, Stettin, Frankfurt an der Oder. Weitere Informationen unter Telefon (03 31) 20 09 80 oder per eMail an deutsches@kulturforum.info oder unter www.kulturforum.info
■ Montag, 28. August, 18.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Offene Wunden Osteuropas“. Gespräch mit Katja Makhotina zu Erinnerungskultur und Aufarbeitung in Osteuropa und Deutschland. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.


■ Montag, 28. bis Mittwoch, 30. August, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Babyboomer. Geschichte, Erfahrungen und Perspektiven einer ,großen‘ Generation“. Seminar im Arbeitnehmerzentrum, Johannes-Albers-Allee 3, Königswinter.

■ Sonntag, 3. September, 78. Vertriebenenwallfahrt des Bistums Bamberg nach Gößweinstein mit Vertriebenenpfarrer Monsignore Herbert Hautmann und Peter Fort aus Graslitz. Abfahrt Bayreuth 10.00 Uhr, Abfahrt Pegnitz 10.30 Uhr. Gottesdienst 12.00 Uhr. Anmeldung für die Busfahrt bei Margaretha Michel (Comeniusstraße 40, 91257 Pegnitz, Telefon (0 92 41) 36 54, eMail mail@familie-michel.net) oder bei Rita Tischler unter Telefon (09 21) 4 17 52.
■ Montag, 4. September, 19.00 Uhr, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Stalin ruft an, persönlich. Michail Bulgakow (1891–1940), der Diktator und die Literatur“. Lesung und Gespräch mit der Übersetzerin Dr. Alexandra Berlina. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
❯ Podiumsdiskussion
■ Montag, 17. Juli, 19.00 Uhr, Podiumsdiskussion: „Das Nationalinstitut für das Studium des Totalitarismus der Rumänischen Akademie (INST) und die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien“. Podiumsteilnehmer: Dr. Florin Abraham, Dr. FlorinRăzvan Mihai, Dr. Jianu Octaviana, Dr. Cristina Diac, Dr. Flori Bălănescu (alle Bukarest). Veranstaltungsort: Adalbert-Stifter-Saal, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Das Nationalinstitut für das Studium des Totalitarismus der Rumänischen Akademie (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, INST) ist eine Forschungseinrichtung der Rumänischen Akademie (mit Sitz in Bukarest), die aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Das INST wurde im April 1993 vom ehemaligen politischen Gefangenen und Archäologen Radu Ciuceanu und dem Gelehrten Octavian Roske gegründet. Es ist die führende Forschungs-






einrichtung für Totalitarismus- und Autoritarismusstudien in Rumänien. Zu ihren Tätigkeitsfeldern gehören: Erscheinungsformen des Totalitarismus (Faschismus und Kommunismus) und des Posttotalitarismus in Rumänien und der Welt, die Geschichte des Kalten Krieges und der Autoritarismus von der Zwischenkriegszeit bis hin zur jüngeren Geschichte. Im Rahmen der moderierten Diskussion, an der der Leiter des Instituts, Dr. Florin Abraham, und seine Mitarbeiter teilnehmen, sollen diverse Aspekte der Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien seit Anfang der 1990er Jahre am Beispiel der Tätigkeit des INST erörtert werden. Dabei wird auch auf die Rolle der deutschen Minderheiten in Rumänien in diesem Prozess eingegangen.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kulturwerk der Banater Schwaben e. V. Bayern und dem BdVKreisverband München e. V. statt.
■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. August: Seminar „Verflechtungen und Durchdringungen zwischen Deutschen und ihren östlichen Nachbarn“. Veranstaltung für deutsche, tschechische und polnische Staatsbürger, Angehörige der deutschen Minderheiten in Ostmitteleuropa (ehemalige Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler aus früheren deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten sowie Nachkommen dieser Gruppen) und alle Interessierten.

Deutsche, Polen, Tschechen, Ungarn, Russen und andere Völker waren in Ost- und Ostmitteleuropa über Jahrhunderte miteinander vernetzt, lebten neben- und miteinander, trieben Handel und heirateten. Es waren mehrsprachige und multireligiöse Räume, wo Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Juden und andere Gruppen – meist friedlich – lebten.
Do. 20.07.2023, 19:00 Uhr
Do. 20.07.2023, 19:00 Uhr







Adalbert Stifter-Saal
Adalbert Stifter-Saal
■ Mittwoch, 6. September, SL-Kreisgruppe Krefeld: Fahrt in die Eifel zur Burg Vogelsang. Abfahrt 10.00 Uhr, Zooparkplatz, Uerdingerstraße 377, Krefeld.
■ Donnerstag, 7. September, 19.00 Uhr, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Mögliches und Unmögliches. Eine kurze Einführung in die Geschichte Bosnien-Herzegowinas“. Vortrag von Prof. Dr. Winfrid Halder und Dr. Katja Schlenker. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Freitag, 8. September, 19.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: Eröffnung der Ausstellung „Future is now“ (läuft bis 25. November). GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.



■ Samstag, 9. September, 14.30 Uhr, SL-OG StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag mit Rückblick auf den Versöhnungsmarsch Brünn. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Anmeldung bei Waltraud Illner unter Telefon (07 11) 86 32 58 oder per eMail an illner@ sudeten-bw.de
Im 19. und 20. Jahrhundert breiteten sich dann nationalistische Ideen aus, die die eigene Nation, Sprache und Kultur den anderen gegenüber als überlegen ansah und nach einem gemeinsamen homogenen Staatswesen strebte. Es gab freiwillige und aufgezwungene Assimilationen. Mit dem Ersten Weltkrieg erstarben die multiethnischen und -religiösen europäischen Großreiche. Eine Reihe junger Nationalstaaten wurde geboren, die allerdings meist auch von bedeutsamen Minderheiten bewohnt waren, die sich häufig nicht mit den neuen Mutterländern identifizierten. Neue nationale Spannungen entstanden. Die Minderheiten suchten in neuen Kämpfen Verbündete, nicht immer die richtigen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Schoah war man bestrebt, homogene Nationalstaaten zu schaffen, Minderheiten in ihre Mutterländer abzuschieben oder zu verkaufen. Es verblieben aber auch deutsche Minderheiten in den östlichen Nachbarländern, vielfach ohne Organisations- und Bildungsmöglichkeiten in ihrer Muttersprache. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs änderte sich die Lage nach 1989. In Tschechien, Oberschlesien, Westpreußen und in anderen Landstrichen entwickelte sich teilweise wieder ein blühendes und gemeinschaftliches Leben.
Referenten sind: Gustav Binder (Heiligenhof), Dr. Jan Čapek (Pardubitz), Rudolf Gerr (Bad Brückenau), Dr. Dr. h. c. Axel Hartmann (Preßburg), Dr. habil. Frank Schuster (Clausthal-Zellerfeld), Josef Cyrus (Leverkusen), Gabriela Blank (Ansbach), Wolfgang Freyberg (Weißenburg) und Dr. Meinolf Arens (München).
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
❯ US-Generalkonsul Timothy Liston lud 900 Gäste zum Unabhängigkeitstag ein
Was über Jahrzehnte selbstverständlich schien, ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine keine Selbstverständlichkeit mehr. Bei der Feier des amerikanischen Unabhängigkeitstages, zu der USGeneralkonsul Timothy Liston ins Münchner Generalkonsulat einlud, wurde deutlich, wie wichtig es ist, daß die freie Welt dem Kriegstreiber Wladimir Putin ge- und entschlossen entgegentritt.
In seiner Rede unterstrich der US-Generalkonsul, daß die Nato weitaus mehr als ein militärisches Bündnis ist: „Ein Engagement in der Nato war und ist ein Engagement für ein ganzes, freies und friedliches Europa. Aber bei der Nato geht es um mehr als militärische Macht. Die Nato ist auch eine Verpflichtung zur Verteidigung ihrer Mitglieder und unser gemeinsames Bekenntnis zu den gemeinsamen Werten und Prinzipien, für die wir seit sieben Jahrzehnten stehen. Unsere Nato-Partnerschaft sorgt für Stabilität in unsicheren Zeiten und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer strategischen Zukunft.“


Dr. Florian Herrmann, Staatsminister und Chef der Bayerischen Staatskanzlei, erinnerte in seiner Rede nicht nur an den eigentlichen Anlaß, an die Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 und den großen Satz „All men are created equal“, sondern ergänzte, daß für ihn der Unabhängigkeitstag auch immer eine Erinnerung an die Befreiung von der Nazi-Diktatur durch amerikanische Truppen sei. Die Amerikaner hätten trotz Krieg und Holocaust danach die Hand

Bewegender Moment des Empfangs: Als nach der deutschen und bayerischen Hymne „The Star-Spangled Banner“ erklingt, verneigt die Abordnung des US-Marine-Corps die Truppenfahne vor Generalkonsul Timothy Liston und Staatsminister Dr.



ausgestreckt, um mit dem Marshall-Plan einen demokratischen Rechtsstaat aufzubauen. „Unser Land ist dadurch zurückgekehrt in die Familie der demokratischen Staaten. Wir leben seitdem in Frieden und Freiheit. Seit über 65 Jahren sind die USA unser loyalster Partner. Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken. Uns verbindet eine echte Partnerschaft und eine echte Freundschaft.“
Scherzhaft verriet Herrmann, daß Liston und er eine gemeinsame Schwäche für bestes Fastfood haben – für Philly Cheese-
steak. Die beiden verlegen deshalb ihren Jour Fix so oft es geht auf den Parkplatz vom Edeka in Unterhaching, wo der US-Amerikaner und Wahl-Bayer David Infantado in einem Foodtruck an jedem ersten Montag im Monat die Sandwich-Spezialität aus Philadelphia serviert. Herrmann kennt das Kult-Gericht noch aus seiner Studentenzeit, als er an der Universität von Philadelphia den Master of Laws ablegte. Ebenfalls ein Geheimnis verriet Staatsministerin Ulrike Scharf. Die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen



ist seit Jahren Gast am Unabhängigkeitstag, um ihre Solidarität mit Amerika auszudrücken. In diesem Jahr war das Treffen im US-Generalkonsulat am Englischen Garten aber nur ihr zweitwichtigster Termin des Tages: „Mein Sohn Andreas ist an seinem 30. Geburtstag Vater geworden, und ich freue mich sehr, nachher meinen Enkel Xaver zum ersten Mal zu sehen.“
Unter den Gästen: Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus, der nach seiner Zeit beim FC Bayern 2000 in New York für die Metro Stars spielte.
❯ Konzert der Tschechischen Philharmonie in der Welterbestadt
❯
Nach Jahren der Corona-Einschränkungen hat Bundesinnen- und -heimatministerin Nancy Faeser wieder zu einem nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung eingeladen. Veranstaltungsort war das Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte.
Zeitzeugen von Flucht und Vertreibung, darunter EvaMaria Bette, die als Heimatvertriebene aus Pommern fliehen mußte, und Mohammad Ali Mosavi, Flüchtling von 2015 aus Afghanistan, die im Vorfeld der Gedenkstunde ein Gespräch mit Schülern der RobertJungk-Oberschule aus Berlin-Wilmersdorf führten, kamen zusammen mit Amtsträgern des BdV und seiner Mitgliedsverbände. Unter den Gästen waren MdB Stephan Mayer, Karls-Preisträger Milan Horáček und der tschechische Botschafter Tomáš Kafka. Auch eine größere Delegation der deutschen Minderheit in Polen war anwesend. Die AmpelKoalition war mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Dürr, der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Natalie Pawlik, und der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, die Passagen aus ihrem Buch „Alles, was wir nicht erinnern.“ vortrug, präsent.
Faeser nannte als Klammer dieses Gedenktages die Universalität des Heimatverlustes –damals mit der schwierigen Zeit der Ankunft der Vertriebenen 1945 und den folgenden Jahren, dem harten Aufeinandertreffen unterschiedlicher deutscher Kulturen, dem Sozialneid und den Vorurteilen gegenüber den Ostdeutschen und heute mit den 108 Millionen Flüchtlingen weltweit sowie der größten Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg durch den Ukraine-Krieg.
Die Tschechische Philharmonie habe in Bad Kissingen eindrucksvoll gezeigt, „wie klein man vor der Musik und wie groß man mit der Musik ist“, hat Tschechiens Botschafter Tomáš Kafka getwittert.
Gemeinsam mit SL-Obmann Steffen Hörtler besuchte Kafka das Konzert im Rahmen des Kissinger Sommers und trug sich in das Goldene Buch der Welterbestadt ein. Weiterer Gast in der Loge war Klára Bracht-
lová, Chief External Affairs der Central European Media Enterprises, einem in Prag sitzenden Tochterunternehmen der PPFGruppe der tschechischen Milliardärin Renáta Kellnerová. PPF hält inzwischen direkt 11,6 Prozent an Pro Sieben Sat 1 (Sudetendeutsche Zeitung berichtete), und Brachtlová soll in Unterföhring in den nächsten Tagen für PPF vom Gericht bestellt in den Aufsichtsrat einziehen.



Der Kissinger Sommer, der noch bis zum 16. Juli stattfindet,
steht in diesem Jahr unter dem Motto „La dolce vita“. Die Tschechische Philharmonie unter Leitung des tschechischen Dirigenten Petr Altrichter präsentierte Felix Mendelssohn-Bartholdys Symphonie Nr. 4 A-Dur „Italienische“, Antonín Dvořáks Klavierkonzert g-Moll und Giuseppe Verdis Ouvertüre zur Oper „La forza del destino“.
Kafka: „Bad Kissingen ist mitteleuropäisches Juwel, an dem man sich immer wieder erfreuen kann.“ Torsten Fricke
BdV-Präsident Bernd Fabritius erinnerte an die Verankerung des Wissens über Flucht und Vertreibung im Gedächtnis der Nation. Die Vertriebenenverbände und die Menschen, die sie vereinten, seien dankbar für die Gesten des Gedenkens aller Bundesregierungen, denn nur so erlange auch die Vertreibung der Deutschen aus ihren Heimatgebieten ihren angemessenen Stellenwert im öffentlichen Bewußtsein. Er zitierte den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der beim ersten Gedenktag 2015 vom „Schatten der Erinnerung“ sprach, in Bezug auf die deutsche Wahrnehmung der Heimatvertriebenen über viele Jahrzehnte. Und er zitierte Marlene Dietrich, deren Mann Rudolf Sieber Sudetendeutscher war, und die deshalb die Vertreibung selbst erlebt hat: „Man darf nie vergessen, daß all diese Menschen, die jetzt Flüchtlinge sind, gestern ganz normale Mitbürger waren, genauso wie wir.“ Fabritius schloß mit dem von allen Anwesenden mit großem Applaus bedachtem Bekenntnis: „Wir wollen niemals vergessen, daß jede Vertreibung, jede ethnische Säuberung – gleichgültig wo, wann und warum – immer Verbrechen sind. Sie zerstören Existenzen und schädigen ganze Gesellschaften.“ Ulrich Miksch
„Wir haben Amerika viel zu verdanken“Wolfgang Nierho , Erster Bürgermeister von Pegnitz, nutzt die Gelegenheit zum Sel e mit (von links) Oberst Kevin Poole, Timothy Liston, Dr. Florian Herrmann und General Steven Carpenter. Pegnitz war die erste Stadt, die Liston nach seinem Amtsantritt 2021 besucht hatte.
Heimatministerin Faeser Gedenken an Flucht und VertreibungTorsten Fricke US-Generalkonsul Timothy Liston und Staatsministerin Ulrike Scharf. Die Schirmherrschaftsministerin der Sudetendeutschen nimmt seit Jahren am Unabhängigkeitstag teil, um ihre Solidarität mit den USA auszudrücken. Fotos: Torsten Fricke Florian Herrmann. Foto: US-Generalkonsulat München
Sudetendeutsche Zeitung mit
Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·
Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer
Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler
Heimatbrief
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift
vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung
12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:


Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH
Hochstraße 8
81669 München
eMail svg@sudeten.de 28/2023
❯ Ackermann-Gemeinde
Anfang Juli behandelte der Themenzoom der Ackermann-Gemeinde den „Sonderweg in der Katholischen Kirche in Deutschland: Synodaler Weg, Synodaler Ausschuß, Synodaler Rat“. Der Synodale Lukas Nusser bestritt als eines der jüngsten Mitglieder des Synodalen Weges nach der Zoom-Veranstaltung im Oktober 2021 erneut den Themenzoom.
Darauf wies auch Moderator Rainer Karlitschek hin und auf den allerersten Zoom über dieses Thema mit Professor Thomas Sternberg, dem damaligen Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Den jungen, in Mannheim Jura studierenden Schwarzwälder stellte Karlitschek vor und erwähnte, daß Nusser und seine Position auch in der ZDF-Reihe „37 Grad“ vorgestellt worden sei. Nun ging es um die Entwicklungen seit Herbst 2021 und den aktuellen Stand des Synodalen Weges.
Mit der fünften Synodalversammlung Anfang März sei der Synodale Weg zu einem vorläufigen Abschluß gekommen, erläuterte Nusser. Doch einiges gelte es noch in einem Synodalen Ausschuß zu klären wie offen gebliebene Themen und Anfragen, Vorbereitung des Synodalen Rates, Klärung von Synodalität. Angenommen worden seien die Grundtexte „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“, „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ sowie „Priesterliche Existenz heute“. Keine Mehrheit habe der Grundtext
des Forums „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“ gefunden. Darüber hinaus seien Handlungstexte verabschiedet worden, die als Basis für die pastorale Praxis dienen sollten. So eine Predigtordnung für qualifizierte Laien oder für Segensfeiern für zwei sich liebende Menschen. Inwieweit die Texte in den einzelnen Bistümern auch umgesetzt werden könnten, stellte Nusser in Frage und nannte sein Heimatbistum Freiburg, wo bisher nichts umgesetzt worden sei.


vier Bischöfen gescheitert, alternative Modelle würden angedacht. Die Einladung seitens des Vatikans zu einem Gespräch sieht Nusser zwiespältig, da Rom aussuche, mit wem und worüber gesprochen werde. In der praktischen Arbeit gehe es vor allem darum, die Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt zu minimieren. Dafür seien auch Veränderungen auf struktureller Ebene nötig und damit auch Glaubensfragen und das Verständnis von Kirche. Aus diesem Zusammenhang ergäben sich Konsequen-
„Die Umsetzung liegt nicht an der Synodalversammlung, sondern beim amtierenden Ortsbischof oder bei den Dekanen“, konkretisierte der Student.
Etwas Kritik übte Nusser an Bischöfen, die sich während des gut dreijährigen Prozesses des Synodalen Weges nicht an den Gesprächen beteiligt hätten. „Wir werden nur zu Veränderungen kommen, wenn die Verantwortungsstrategie sich ändert“, forderte Nusser und meinte damit mehr Verantwortung beim „Volk Gottes“. Aktuell sei die Finanzierung des Synodalen Ausschusses wegen des Vetos von
zen für die pastorale Praxis bis hinunter auf die Pfarrgemeinde vor Ort.
Gelernt habe Nusser in den drei Jahren Mitwirkung beim Synodalen Weg vor allem die „Benennung von Ohnmacht da, wo meine Verantwortung endet. Wo ich lebe und arbeite, wirke ich mit und übernehme ich Verantwortung.“ Bischöfen fehle zudem bisweilen das Verständnis für die Realitäten. Daher wünsche er eine Kirche, die der Realität gerecht werde.
Im anschließenden Diskussions- oder Fragenteil stellte Professor Barbara Krause fest, daß
viele der beim Synodalen Weg behandelten Themen weltweit auf Interesse stießen, auch die Frage der Mitwirkung von Frauen in der Kirche. „Die Augen zuzumachen ist eines Christen nicht würdig. Der Klerikalismus erleichtert und ermöglicht Mißbrauch“, äußerte sich Krause unmißverständlich. „Der Synodale Weg hat sich von den ursprünglichen Inhalten wegbewegt“, meinte Professor Bernhard Dick und äußerte leichte Zweifel, ob mit einer Auflösung hierarchischer Strukturen auch der Mißbrauch eingedämmt sei. Vor allem das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes (Erstes Vatikanisches Konzil 1870) als Beginn einer Mißinterpretation der Lehre der Kirche sowie die in starrer Form abgehaltenen Gottesdienste und die Erfahrungen oder die Praxis der Geheimkirche über viele Jahre in der Tschechoslowakei brachte Otfrid Pustejovsky als Aspekte in die Diskussion ein. Werner Honal interessierten die Alternativen zum Synodalen Rat und in der Folge die Finanzierung. Den sexuellen und geistlichen Mißbrauch durch Priester bezeichnete Krause in einem weiteren Statement als einen ungeheuren Vorgang, als Mißbrauch des Evangeliums. Zum Schluß zog Lukas Nusser sein Fazit aus den drei Jahren:
„Der Synodale Weg macht mir Mut, ich habe viele inspirierende Menschen kennengelernt. Ich bin begeistert von Ordensmenschen, Laien und Bischöfen. Aber ich sehe auch, wo der Weg an seine Grenzen kommt. Es geht also darum, ein realistisches Bild von der Kirche zu haben.“

Markus Bauer
❯ Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde aus dem ehemaligen Kreis Teplitz-Schönau im Böhmischen Mittelgebirge
Helena Päßler, Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, der Gesinnungsgemeinschaft der Sudetendeutschen Sozialdemokraten, und Mitglied im DeutschTschechischen Gesprächsforum, feierte mit ihrer Mutter Gerda und ihrem Sohn Mathias am 11. Juli in Wiesbaden ihren 70. Geburtstag.

Zur Welt kam Helena Päßler zehn Minuten nach ihrer Zwillingsschwester Krista im Jahre 1953 in Prasetitz, einem Ortsteil von Teplitz-Schönau im Böhmischen Mittelgebirge. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein großer Teil ihrer Familie nach Mecklenburg-Vorpommern vertrieben worden. Auch ihre Mutter Gerda Pompe. Doch Gerda ging illegal wieder in die Heimat zurück, da sie bereits in Herbert Koc – vor dem Krieg hieß er noch Herbert Kotz – verliebt war. Und Herbert Koc war nicht vertrieben worden, weil er für den Bergbau unentbehrlich war. 1950 heirateten sie.
Herberts Vater Mathias Kotz hatte sich im Konsumverein Teplitz-Schönau engagiert, in Prasetitz gewohnt – damals gehörte Prasetitz zu Wisterschan –und bewegte sich im Umfeld von Josef Seliger. Seliger war nämlich viele Jahre bis zu seinem Tod 1920 Obmann und Aufsichtsrat dieses Konsumvereins. Damit war der Bezug zur späteren Seliger-Gemeinde bei Helena schon früh angelegt. Außerdem pflegte

sie mit ihrer Mutter jahrelang das Grab von Josef Seliger auf dem Friedhof in Wisterschan.
Der nach Mecklenburg-Vorpommern vertriebene Teil der Familie hatte mittlerweile der Sowjetischen Besatzungszone den Rücken gekehrt und war in den Westen nach Hessen gezogen. Um wieder mit der Familie vereint zu sein, beantragte die verbliebene Familie Koc die Erlaubnis, nach Hessen ziehen zu dürfen. 1965 zog sie in den Westen. Hier entwickelte sich Herbert Koc zu einem Heimatforscher, der nicht zuletzt am Heimatbuch von Teplitz-Schönau mitwirkte.
Nach Realschule und Gymnasium in Wiesbaden studierte Helena Päßler in Mainz Deutsch und Geographie für das Lehramt. Nach dem Studium war sie Volkshochschuldozentin.
1983 heiratete sie den gebürtigen Dresdener Edgar Päßler, ihr Kind nannten sie nach Helenas Großvater Mathias. Mathias ist heute Rechtsanwalt, Edgar Päßler lebt leider nicht mehr, und Zwillingsschwester Krista lebt in den USA.
Ab 1992 unterrichtete Helena Päßler an der Wiesbadener Heinrich-Kleist-Schule, wo sie auch viele Jahre lang Schulleiterin war. Daß sie einen langen Atem hat, bewies sie auch in dieser Funktion. Mit dem Elternbeirat hatte sie sich mehr als zehn
Jahre lang dafür eingesetzt, daß ihre Schule eine Integrierte Gesamtschule (IGS) wurde. Zum Schuljahr 2017/2018 wurde die IGS endlich eingeführt. Das Ziel der SPD-Politikerin war immer, „eine Schule für alle, denn kein Kind darf verloren gehen“. An ihrer Schule baute sie darüber hinaus eine Abendhauptschule für die Erwachsenenbildung vor allem für Migrantinnen und Migranten auf.
Päßler ist Vorstandsmitglied der evangelischen Initiative Zeichen der Hoffnung, die Auschwitzüberlebende aus Polen zur Kur und zu Zeitzeugengesprächen einlädt. In ihrer Amtszeit an der Heinrich-Kleist-Schule fanden die ersten Zeitzeugengespräche statt.
Päßler: „Die Geschichte nicht zu vergessen und für Frieden und Demokratie einzutreten, ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was Pädagogen jungen Menschen vermitteln können.“
Seit 2007 ist Päßler, die sich intensiv um ihre hochbetagte Mutter kümmert, Mitglied der Seliger-Gemeinde (SG). Sie gehört schon länger dem SG-Bundesvorstand an, seit Oktober 2019 als Ko-Vorsitzende, bis 2022 mit Helmut Eikam, der im Herbst 2022 den Stab an Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung und Generalsekretärin des Sudeten-
deutschen Rates, weitergab. Seitdem führt diese weibliche Doppelspitze die Seliger-Gemeinde. Naaß dankt Päßler persönlich für das gute und vertrauensvolle Miteinander und vor allem für ihre Bereitschaft, die Seliger-Gemeinde weiterzuentwickeln und neue Schritte zu gehen. „Tradition und Innovation schließen sich nicht aus“, sagt Naaß. Dafür stehe Päßler. Naaß wies außerdem darauf hin, wie wichtig es sei, daß Päßler die Ideen der Seliger-Gemeinde auch in anderen Gremien wie in das Deutsch-Tschechische Gesprächsforum einbringe und regelmäßig an Sitzungen und Veranstaltungen des Sudetendeutschen Rates teilnehme. Damit trage sie intensiv zu Versöhnung, Verständigung und zum Miteinander von Sudetendeutschen und Tschechen bei. Das wichtigste Bestreben der Seliger-Gemeinde sei das friedliche Zusammenleben zwischen den Völkern. Diese Forderung setze Päßler praktisch und persönlich um mit Ukraine-Hilfsaktionen mit ihrem Sohn Mathias, mit der Initiative Zeichen der Hoffnung sowie im Kulturring des Hauses der Heimat in Wiesbaden.
„Wir danken Helena Päßler für ihr großartiges Engagement und wünschen ihr und uns, daß sie noch viele Jahre für die SeligerGemeinde und für die Verständigung zwischen den Völkern arbeitet“, gratuliert Christa Naaß. nh/aß
Das Oberschlesische Landesmuseum (OSLM) in Ratingen-Hösel in Nordrhein-Westfalen feiert Jubiläum – sogar ein doppeltes Jubiläum: 40 Jahre seit der Errichtung und 25 Jahre seit der Eröffnung des Museumsneubaus – und veranstaltet dazu eine Sonderausstellung.

In der thematischen Sonderausstellung geht es ab 16. Juli auf eine historische Spurensuche und 1000 Kilometer westwärts aus der oberschlesischen Perspektive. Chronologisch geht der Ausstellungsmacher Marton Szigeti auf die Vorgeschichte, die Gründung und den Neubau des OSLM ein und stellt das moderne Selbstverständnis dieses kulturgeschichtlichen Museums vor. Anschaulich illustriert durch Fotografien und Objekte aus der museumseigenen Sammlung, geben seine Textbeiträge Antworten auf die so oft gestellte Frage, wie es dazu kam, daß Oberschlesier in NordrheinWestfalen beheimatet sind.
„Am 6. Februar 1945 meldete die ,New York Times‘, daß Polen die Zivilverwaltung der ehemaligen Reichsgebiete ostwärts der Oder-Neiße-Linie übernommen habe. Spätestens mit der endgültigen Einstellung der Kampfhandlungen und der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 begannen die unkontrollierten Vertreibungen der deutschen Bevölkerung aus den ehemaligen östlichen Provinzen. Um der bevorstehenden Zwangsaussiedlungswelle Herr zu werden, organisierte die britische Rheinarmee mit der Operation Swallow einen logistischen Kraftakt. Ohne jegliche Unterstützung der anderen drei alliierten Mächte wurden ab dem 28. Februar 1946 bis zu 4000 schlesische und oberschlesische Flüchtlinge pro Tag mit Güterwaggons Richtung Westen transportiert. So kamen bis zum Sommer 1947 mehr als 1 360 000 Menschen in die britische Besatzungszone und damit auch in das spätere Nordrhein-Westfa-
Im dritten Quartal des Jahres bietet das Gerhart-Hauptmann-Haus (GHH) in Düsseldorf wieder ein interessantes Programm. Hier kündigen wir zwei der ersten Kulturtermine im Hochsommer an.
Montag, 14. August bis Freitag, 18. August: „Zeugnisse jüdischer und christlicher Kultur in Württemberg und Hohenzollern“. Studienfahrt des GHH in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit Düsseldorf.
Schon allein der zu Beginn auf dem Reiseplan stehende jüdische Friedhof am Rande Rexingens, unweit von Horb am Neckar, ist die Reise wert. Und dann nimmt man staunend die Vielfalt der weit über 900 erhaltenen Grabsteine wahr, deren ältester aus dem Jahr 1765 datiert, also in die Zeit unmittelbar nach der Entstehung des Friedhofs zurückverweist. Dieser ist eine der größten jüdischen Begräbnisstätten, die in Württemberg erhalten sind – und mit Sicherheit eine der schönsten und bewegendsten. Wunderbarerweise hat der Friedhof, vielleicht auch wegen seines verborgenen Ortes, alle Zeitläufe überstanden, auch die grauenvollsten der antisemitischen Verfolgung des NS-Regimes und der Shoa. So zeugt er bis heute von der einst großen jüdischen Gemeinde in Rexingen, die nach dem Dreißigjährigen Krieg seit den späten 1640er Jahren herangewachsen war, gegründet von Zuwanderern aus dem östlichen Europa, dem heute polnischen und slowakischen Raum.
Begünstigt durch die herrschaftliche Zugehörigkeit zur örtlichen Kommende des Johan-
len. Für den Wiederaufbau zerbombter Infrastruktur wurde jede Hand, die anpacken konnte, benötigt“, schreibt Szigeti einleitend. Die Vertriebenen suchten neben den alltäglichen Existenz- und Zukunftssorgen aber auch Trost und Seelenfrieden im Kreise ihrer Schicksalsgenossen. Mit dem Ende des Koalitionsverbotes durch die Westalliierten 1948 und der Zulassung von Vertriebenenverbänden wurde es möglich, sich zu organisieren. So stand 1949 der Gründung der Landsmannschaften nichts mehr
niter-Ordens konnte sich hier eine der verhältnismäßig seltenen jüdischen Landgemeinden entwickeln. Diese konnte sich 1836/1837 eine neue, stattliche Synagoge erbauen, die bis heute erhalten ist – seit 1952 in Teilnutzung als evangelische Kirche – und zum Besuchsprogramm gehört. Noch Anfang der 1930er Jahre gehörte ein knappes Drittel aller Einwohner Rexingens der jüdischen Gemeinde an. Bald darauf setzten antisemitische Verfolgung und Massenmord ein, durch welche auch diese Gemeinschaft vernichtet wurde. Wir gehen ihren Spuren nach – und darüber hinaus noch vielen anderen.
UNESCO-Welterbe
Die historische Landschaft Württembergs und Hohenzollerns bietet eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten für das Spurensuchen und birgt zahlreiche Zeugnisse der jüdischen und der christlichen Kultur. Auf dem Programm stehen historische Stätten in und um Tübingen, Hechingen mit der Burg Hohenzollern, Rottenburg und einige mehr. Schlußpunkt soll das einstige Zisterzienserkloster Maulbronn sein. Dessen Ursprünge reichen bis 1138 zurück. Schon 1534 säkularisiert, ist die Klosteranlage bis heute eine der am besten und vollständigsten erhaltenen Zisterzienser-Stätten überhaupt und seit 1993 UNESCO-Weltkulturerbe.
Nähere Informationen über Reiseprogramm, Reisepreis und Anmeldeverfahren unter www.gh-h.de/aktuelle-reisen-und -seminare.
Donnerstag, 24. August bis Dienstag, 31. Oktober: Ausstellung im Gerhart-Hauptmann-Haus „Mein Leben war
ein Auf-dem-Seile-schweben. Jüdische deutschsprachige Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk“.
im Wege. Im Jahr 1953 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Der umgangssprachlich als Kulturparagraph bezeichnete Paragraph 96 des Gesetzes wurde zur zentralen Rechtsgrundlage für die Förderung von Kultureinrichtungen mit Bezug zu den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Als Ausdruck der langjährigen Verbundenheit des Landes mit den Oberschlesiern, von denen viele bereits in den 1870er Jahren als Bergleute ins Ruhrgebiet gekommen waren, übernahm das
Jüdisch, weiblich, dichtend: diese drei Merkmale verbinden die 15 portraitierten Schriftstellerinnen – oft aus dem Deutschen Osten – und prägten ihr Leben und ihre Arbeit: Ilse Aichinger, Rose Ausländer, Esther Dischereit, Hilde Domin, Elfriede Gerstl, Lili Grün, Henriette Hardenberg, Mascha Kaléko, Gertrud Kolmar, Hedwig Lachmann, Else Lasker-Schüler, Selma Meerbaum-Eisinger, Lessie Sachs, Nelly Sachs und Ilana Shmueli.

Das Bild der „Seiltänzerin ohne Netz“, das Mascha Kaléko für ihr Leben fand, paßt auch für die anderen Dichterinnen. Über einem existenziellen Abgrund balancierten diese Frauen, die um die Jahrhundertwende geboren wurden und ihre produktivsten Jahre während der NSZeit hatten.
15 bebilderte Ausstellungsplakate und 15 Gedichttafeln erzählen von Leben und Werk dieser Frauen. Die meisten waren gebildet, sprachen mehrere Sprachen und interessierten sich seit frühester Jugend für Literatur. Im Exil sicherten sie sich ihre materielle Existenz zeitenweise als Wäscherin wie Nelly Sachs, Übersetzerin wie Rose Ausländer, Kunsthandwerkerin wie Lessie Sachs, Deutschlehrerin wie Hilde Domin oder Werbetexterin wie Mascha Kaléko. Am Schreiben hinderte es sie nicht. Nelly Sachs sagte über ihre ersten Jahre im schwedischen Exil: „Ich schrieb, um zu überleben. Ich schrieb wie in Flammen.“ Man findet aktuell wirkende Flüchtlingsgedichte:
„Die Fremde ist ein kaltes Kleid / mit einem engen Kragen…“ (Mascha Kaléko), der Verlust der Heimat ist allgegenwärtig:
Land Nordrhein-Westfalen 1964 die Patenschaft für die in der Bundesrepublik lebenden Oberschlesier. Daraufhin wurde nach einem geeigneten Standort für ein Kulturzentrum der Oberschlesier im Raum Düsseldorf gesucht. Geworden ist es eine Villa in Hösel an der Bahnhofstraße 67. Bis zur Einweihung des ersten Hauses 1983 und der Eröffnung des Museumsneubaus 1998 folgten viele spannende Etappen, zu denen vor allem die Gründung der Stiftung Haus Oberschlesien (SHOS) am 4. Dezember 1970 gehört. Nach der Bundestagswahl 1998 ging mit dem Wechsel zur rot-grünen Bundesregierung eine Neustrukturierung der Kulturförderung nach Paragraph 96 BVFG einher, die den Verzicht auf den Museumsstandort Ratingen zur Folge haben sollte. Nach Protesten und zusichernden Worten des Ministerpräsidenten des Patenlandes NordrheinWestfalen, Wolfgang Clement, der am 3. März 2000 verkündete: „Der Bestand des Museums ist gesichert. Das Haus Oberschlesien bleibt in Ratingen.“, war der Fortbestand des Hauses gewährleistet. Ab dem Jahr 2002 übernahm das Land Nordrhein-Westfalen die institutionelle Förderung.


Diese kurze chronologische Einordnung gibt – wie so oft –nicht die Beweggründe und Anstrengungen der Einzelnen wieder. Das OSLM verweist auf die entgeltfreie Sonderführung des Kurators am Eröffnungstag. 25 Jahre Museumsneubau bedeutet im Juli dank Jubiläumsrabatt nur 2,50 Euro Eintritt. So kann man das Oberschlesische Landesmuseum in diesem Monat besser kennenlernen.
Mittwoch, 16. Juli, Eröffnung 15.00 Uhr: „1000 Kilometer westwärts. Die Geschichte des Oberschlesischen Landesmuseums“ in Ratingen, Oberschlesisches Landesmuseum, Bahnhofstraße 62, Telefon (0 21 02) 96 52 33, Internet www.oslm.de
„Mein Vaterland ist tot / sie haben es begraben / im Feuer...“ (Rose Ausländer). Sie schrieben an gegen Todesgefahr: „Ich möchte leben / Ich möchte lachen und Lasten heben…“ (Selma Meerbaum) und schrieben Liebesgedichte an ihre Kinder: „Ein Träumer wirst du sein und dennoch kühn…“ (Else LaskerSchüler) und an ihre Liebhaber: „Wenn du mich einmal nicht mehr liebst / Dann fürchte keine Predigt…“ (Lili Grün). Sie besingen die Schönheit eines Abends: „Abend, beide Hände voller Glück / Eile nicht so, bleibe, komm zurück…“ (Gertrud Kolmar) oder einer Stadt: „Nachts ist Haifa / ein Muster aus Sternen…“ (Rose Ausländer).
Ängste in die Luft werfen
Ihre Themen sind so vielfältig wie ihre Sprache und ihre Gedichtformen. Ihren Ratschlägen zu folgen, empfiehlt sich noch heute: Seine Ängste in die Luft werfen, das Haben verlernen, einen Fremden warm kleiden, sich nach Freiheit sehnen, jeden Tag ein Gedicht hersagen oder schreiben.
Die literarische Ausstellung ist eine Hommage an diese 15 außergewöhnlichen jüdischen Schriftstellerinnen und wurde erstellt von Barbara Staudacher und Heinz Hoegerle im Auftrag des Träger- und Fördervereins Ehemalige Synagoge Rexingen. 2022 wurde die Schau erstmals im Museum Jüdischer Betsaal in Horb gezeigt.
Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, Deutsch-osteuropäisches Forum in Düsseldorf, Bismarckstraße 90, Telefon (02 11) 1 69 91 34, Internet www.g-h-h.de
Die Heimatpflege der Sudetendeutschen veranstaltete unter dem Motto „Wir sind das ganze Jahr vergnügt“ ein Offenes Sommersingen. Nach der Begrüßung durch Andreas Schmalcz von der Heimatpflege leiteten der Musikkenner Erich Sepp und dessen Frau Ingrid die Veranstaltung im Adalbert-Stifter-Saal. Aufgrund des Jubiläums von Walther Hensels Singwochen waren mehrere Titel des Abends von diesem Begründer der Finkensteiner Singwochen.
Wir sind das ganze Jahr vergnügt“, schallt es vielstimmig aus dem Adalbert-StifterSaal. Bis auf die Hochstraße vor dem Sudetendeutschen Haus kann man die frohe Sängerschar hören, die sich dort zum Offenen Bayerisch-Böhmischen Singen versammelt hat. Unter Anleitung von den Singleitern Ingrid und Erich Sepp werden dort Sommerlieder ausprobiert, einstudiert und intoniert.
Sepp hat wie immer eine ganze Reihe Lieder ausgewählt, die alle gemeinsam schnell lernen.
Nach der Begrüßung geht es gleich schwierig los bei „Wir sind das ganze Jahr vergnügt“, denn die Melodie stammt bei der aktuellen Variante aus dem Allgäu und nicht wie sonst aus Bessarabien.
Zwei Varianten werden auch bei dem fränkischen Gesellenlied „Auf, du junger Wandersmann“ gesungen, denn das ältere „Wanderlied“ („Auf, ihr Brüder“) hat einen anderen Text und viel mehr Strophen. Danach üben alle „Wenn morgens früh die Sonn‘ aufgeht“, ein ungarndeutsches Volkslied aus dem Komitat Tolnau, und danach das „Wachauer Schifferlied“ aus Niederösterreich. Zu allen Stücken liefert Sepp biographische und historische Hintergründe. Denn als ehemaliger Leiter der Volksmusikabteilung des bayerischen Landesvereins für Heimatpflege verfügt er über ein immenses Wissen über Volksliedkultur, Musikgeschichte und Mundarten, das er auch gut verständlich vermittelt.
Vor 100 Jahren fand die erste Singwoche von Walther Hensel in Finkenstein bei Mährisch Trübau im Schönhengstgau statt. Ingrid Sepp schilderte die Entstehung dieser ersten Singwochen.
Genau vor 100 Jahren kamen der Musikwissenschaftler Walther Hensel und seine erste Ehefrau Olga Pokorny, eine Konzertsängerin, darauf, eine Woche dem Singen von Volksliedern zu widmen“, beginnt Ingrid Sepp ihr Kurzreferat.

Walther Hensel war 1887 als Julius Janiczek in Mährisch Trübau zur Welt gekommen und nannte sich später „Hänsel“, also die deutsche Übersetzung des tschechischen Namens, ergänzt Erich Sepp. Hensels Vater Josef Janiczek entstammte einem deutschen Bauerngeschlecht in Weißstätten an der Thaya in Südmähren. Die Mutter Theresia Hlawatsch kam aus dem Dorf Langenlutsch bei Mährisch Trübau im Schönhengstgau.
Walther Hensel studierte in Prag und Wien alte Sprachen,
� Offenes Sommersingen im Sudetendeutschen Haus
gen viel geredet wird: „Hensel hatte eine eher elitäre Auffassung vom Volkslied“, erklärt Sepp. Der Musikwissenschaftler Hensel habe Lieder in vier Kategorien aufgeteilt, bei denen die vierte als „zu schmalzig“ in seinen Augen indiskutabel gewesen sei. Hensels „Klassiker“ aus dem Schönhengstgau war nun dran: „Blüh nur, blüh mein Sommerkorn“ kann jeder gleich singen, auch ohne Notenblatt. Ein ähnlicher Ohrwurm wird schnell „Wann das Lercherl singt“ aus einer Salzburger Liedersammlung. Hier spielt die Liebe eine große Rolle, und man zieht auf die Alm, „weil mia‘s Diandl gfreut“. Noch deutlicher um die Liebe geht es in „Wer is‘ denn drauß“, wo der Liebhaber trotz der Eltern im Haus Einlaß begehrt – und wohl auch erhält: „Des Liacht, des is da Morgenstern / bei mein schöne Diandal waar i gern!“, heißt es im Lied aus der Sprachinsel Stritschitz bei Budweis.
Der gebürtige Oberbayer ist 1944 in Landsberg am Lech zur Welt gekommen und mit Ingrid aus Teschen in Sudetenschlesien verheiratet. Sie unterstützt ihn bei der Recherche und bei Veranstaltungen wie dem Offenen Singen. Auch im Saal ist In-
grid Sepp an seiner Seite, um den Gesang auf dem Akkordeon zu begleiten. Als Singleiter geht Erich Sepp vor allem immer pädagogisch und nach psychologischen Erkenntnissen vor. Zunächst lernen alle die erste Strophe rein nach Gehör und aus der
Erinnerung. Sepp singt nur vor und deutet die Tonhöhen mit der Hand an. Erst wenn eine Melodie recht gut läuft, ist der Blick aufs Notenblatt erlaubt. Von diesen Liedblättern hat Sepp inzwischen über 300 gestaltet. Bei schwierigen Texten sind sie eine große
Hilfe. So mancher Sing-Gast wartet auf eine gebundene Ausgabe. In eine solche „Seppsche Liedersammlung“ kämen sicher auch sehr viele Lieder von Walther Hensel, dessen SingwochenJubiläum in diese Sommer gefeiert wird, worüber bei diesem Sin-


Aus dem Banater Bergland, wohin etliche Böhmerwäldler zur Arbeit gezogen waren, stammte die „Wald-Arie“, die gleich dreistimmig gejodelt wird, was einen überwältigend breiten Klang erzeugt. „Die Böhmerwäldler, die das Lied geprägt hatten, sind inzwischen fast alle von Wolfsberg in Rumänien nach Oberbayern emigriert und leben in Höhenkirchen, Tacherting und Frauenreuth“, erklärt Ingrid Sepp. Direkt aus dem Böhmerwald – und zwar aus der Gegend von Neuern und Eisenstein – stammt „‘S Deandl und da Bauernbua“, eine Art „Tanzlied“ mit Jodlerrefrain. Alle freuen sich über das sommerliche Liedgut, das auf eine Woche in sommerlicher Hitze einstimmt. Den Abschluß bildet diesmal nicht „Kein schöner Land“ von Walther Hensel, sondern das Lied „Freinderl, wann gehn wir hoam“ aus der Oberpfalz, dessen Melodie strophenweise lustigerweise nur als „Summen“ oder „Pfeifen“ ertönt. Summen hört man viele Gäste noch auf dem Weg nach draußen. Susanne Habel
� Kurzvortrag beim Offenen Singen
100
Französisch, Germanistik und Musik, vor allem Gregorianik, und wurde 1911 in Freiburg in der Schweiz zum Doktor summa cum laude mit der Dissertation
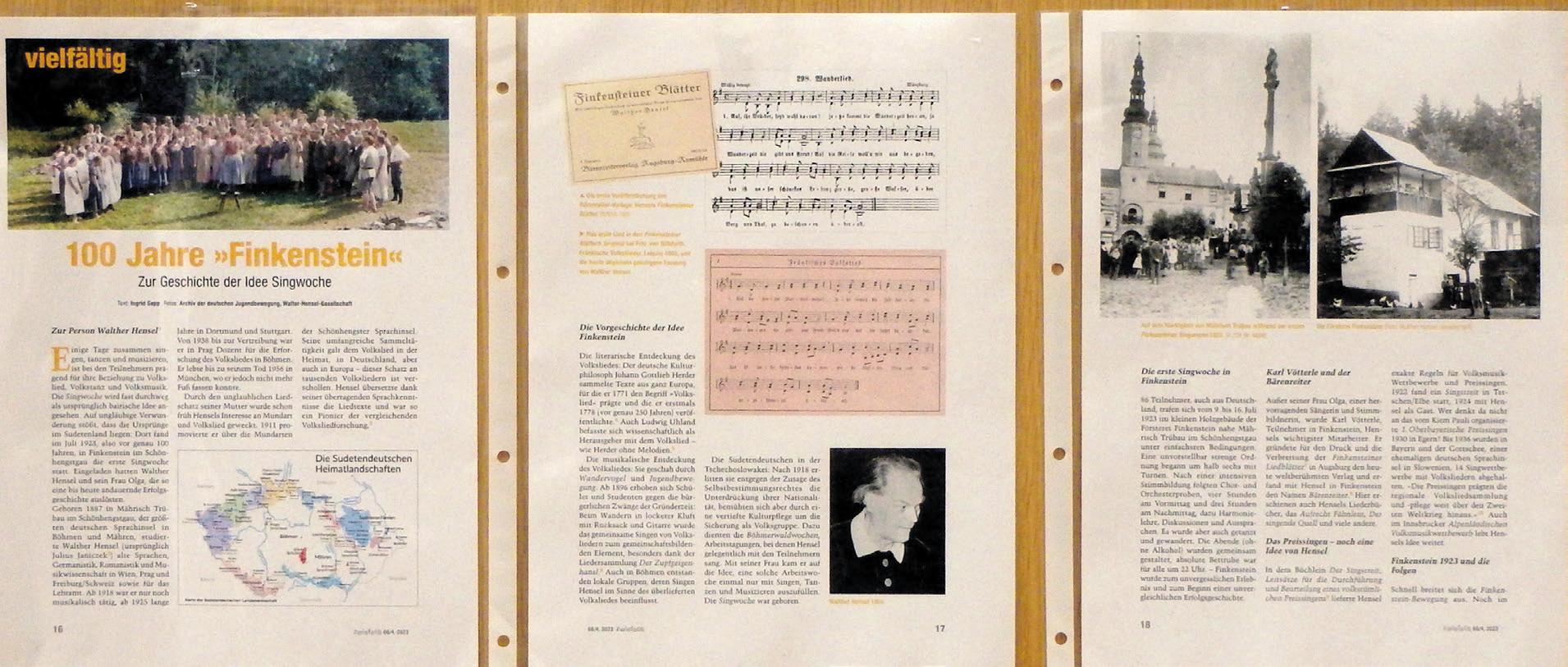

„Der Vokalismus der Mundarten in der Schönhengster Sprachinsel“ promoviert. Nach Prag zurückgekehrt, wirkte er als Lehrer für neuere Sprachen an der dortigen Deutschen Handelsakademie.
Das entscheidende Erlebnis der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg war der „Zupfgeigenhansl“
Hans Breuers, der nach Herders und der Romantiker literarischer Volksliedentdeckung und nach Uhlands wissenschaftlicher Volksliedforschung die dritte Volkslied-Renaissance einleitete: die Wiedergeburt des Volksliedsingens als leben- und gemeinschaftsformendes Tun.

„Hensel ging es um den Erhalt des deutschen Volkstums!“ Denn nach der Gründung der Tschechoslowakei 1919 sei es für die deutsche Bevölkerung zunehmend schwieriger geworden, ihr angestammtes und über Jahrhunderte gewachsenes Brauchtum zu leben.
In dieser Zeit lud er in die kleine Waldsiedlung Finkenstein bei Mährisch Trübau zur Singwoche ein: „86 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten im Juli 1923 dem Ruf, vor allem aus dem Kreis der Wandervogelbewegung.“ Auch Gä-
ste aus dem Deutschen Reich kamen. Nach dieser Singwoche folgten Hunderte von ähnlichen Wochen, zunächst ab 1936 erst in Deutschland und Österreich. „Ein Teilnehmer der ersten Singwoche war der Augsburger Verleger Karl Vötterle“, so Ingrid Sepp. Er hatte zusammen mit Walther Hensel die Idee, ein monatlich erscheinendes Liedblatt herauszugeben, damit auch die unzähligen Singgemeinden, die gegründet wurden, Stoff für ihre Übungsabende hatten. So wurde mit den „Finken-
steiner Blättern“ der Grundstein gelegt für die Gründung des Bärenreiter-Verlags – angeblich benannt nach dem Sternbild des Großen Bären, das die Gäste nachts am Sommerhimmel gesehen hatten. Zehn Jahrgänge von 1923 bis 1933 umfaßte das Finkensteiner Liederbuch. „Hensel wollte sich nicht vereinnahmen lassen von Nationalsozialisten“, betont Erich Sepp, und er habe also auch Lieder aus ganz Europa in seine Blätter aufgenommen.



1941 wurde Hensel der Eichendorff-Preis von der philosophischen Fakultät der Prager Deutschen Universität verliehen.

Nach Kriegsende und der Vertreibung der Sudetendeutschen gab es 1946 eine erste Singwoche in Bergen am Chiemsee, an der unter anderen die später berühmte Trapp-Familie teilge-
nommen habe, sagt Ingrid Sepp. Von da an gab es Gründungen von Spielscharen der weltweit verstreute Landsleute.
1956, fünf Jahre nach Hensels Tod, wurde in München 1961 die Walther-Hensel-Gesellschaft gegründet, die die Singarbeit fortführen wollte. So wurden seither mit großem Erfolg über 150 Singwochen durchgeführt.
Diese Singwochen fanden vor allem in Süddeutschland, aber auch als Singfahrten in ehemals deutsche Siedlungsgebiete oder als Almsingwochen in Österreich oder Brandenburg statt, allein nahezu 50 auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Natürlich wurde neben dem Singen auch immer gewandert, gebastelt, getanzt und in verschiedenen Gruppen musiziert.
Susanne Habel
Sonntag, 30. Juli bis Sonntag, 6. August: Gedenksingwoche auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Anmeldung per eMail post@ walther-hensel-gesellschaft.de oder Info über Internet https:// walther-hensel-gesellschaft.de.
� SL-OG Helmbrechts
Am 11. Juni starb Ernst Heil, langjähriger Obmann der oberfränkischen SL-Ortsgruppe Helmbrechts, kurz vor seinem 84. Geburtstag. Nur wenige Tage später, am 18. Juni, folgte ihm seine 81jährige Frau Erika in die ewige Heimat.

Mit Ernst Heil und seiner Frau Erika starb innerhalb von wenigen Tagen ein beliebtes und in den örtlichen Vereinen engagiertes Ehepaar, das die Menschen aus der Region in guter Erinnerung behalten werden. Und das nicht nur wegen des guten Gebäcks, das die beiden bis zum Jahr 2010 in ihrer inhabergeführten Bäckerei in Helmbrechts verkauften.
Inzwischen nahm eine große Trauergemeinde Abschied von Ernst, der wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag am 19. Juni überraschend das Zeitliche segnete und seiner zwei Jahre jüngeren Gemahlin Erika, die wenig später im Krankenhaus entschlief.
Ernst Heil führte von 2005 bis zu seinem Tod die SL-Ortsgruppe Helmbrechts, zuvor war er Stellvertretender Ortsobmann gewesen. Für seine Leistungen erhielt er 2019 die Verdienstmedaille der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Unter anderem war er auch im Geflügelzuchtverein und in der Hofer Strässer Gma aktiv, dabei gehörte er zu den Leuten, die, wenn sie gebraucht werden, tatkräftig anpacken, immer unterstützt von seiner Erika.
Am 19. Juni 1939 kam er in der Nähe von Marienbad zur Welt. Nach der Vertreibung strandete die Familie in Brand im Stiftland, wo Ernst Heil aufwuchs. In Wunsiedel erlernte er den Beruf des Bäckers. Nach der Weiterbildung zum Bäckermeister und der Heirat übernahm er mit seiner Frau Erika ein Geschäft in Helmbrechts. Als legendäre Köstlichkeit gelten seine Klann Koung, die er selbst Ausgezogene nannte. Diese Krapfen buk er noch manchmal im Ruhestand. So auch zwei Tage vor seinem plötzlichen Ableben, da verschenkte er sie – wie es seiner Art entsprach – an Freunde.
Das Ehepaar widmete sich zudem mit viel Herzblut Tätigkeiten in der katholischen Kirchengemeinde. Ernst Heil galt als typischer Egerländer. Dies ist ein Menschenschlag, dem man Sparsamkeit, Aufrichtigkeit, Humor, Arbeitseifer und Gottesfurcht nachsagt. Werte, die auch seine Ehefrau, die am 21. September 1941 als Erika Steger in der fränkischen Schweiz zur Welt kam, mit ihm teilte.
In einem Nachruf würdigte Adalbert Schiller, Obmann der oberfränkischen SL-Kreisgruppe Hof, bei der Trauerfeier die Heils als Persönlichkeiten, die die Landsmannschaft entscheidend mitgeprägt hätten. „Für mich waren Ernst und Erika Vorbilder.“
Das Ehepaar hinterläßt zwei Kinder, die mit ihren Familien in Spanien und Bayreuth leben. Ihnen entbietet Adalbert Schiller sein aufrichtiges und von Herzen kommendes Mitgefühl.
� SL-Orts- und -Kreisgruppe Bayreuth/Oberfranken
Die oberfränkische SL-Orts- und -Kreisgruppe Bayreuth hatten für Anfang Juni zu Volksmusik und Mundart ins Schloß Goldkronach eingeladen.



Rund 30 Sangesfreudige waren gekommen. Geboten wurde ein bunter Strauß bekannter Volkslieder und Mundartbeiträge aus dem Sudetenland, aus Schlesien und dem Raum Bayreuth. Alle sangen stimmgewal-
tig mit. Es gab keine Lala-Lieder, weil die Texte auf einer Leinwand übertragen wurden.
Den Liederreigen begleitete Peter Rubner mit seinem Akkordeon. Seine Leidenschaft, sein Temperament und seine exzellente Beherrschung des Instrumentes begeisterten alle. Bayreuths Ortsobmann Manfred Kees moderierte humorvoll die Veranstaltung. Günter Ammon und der 91jährige Rudi Kiese-


wetter brillierten in paurischer und Bayreuther Mundart.
Mitveranstalter war das Alexander-von-Humboldt-Kulturforum Schloß Goldkronach. Deshalb begrüßte Schloßherr Hartmut Koschyk die Gäste und freute sich über das historische Volksliedersingen im Gewölbesaal seines Schlosses. Seine Eltern stammen aus Oberschlesien, seine Frau Gudrun hat sudetendeutsche Wurzeln. ds
Anfang Juli kamen die nordmährischen Heimatfreunde aus Setzdorf im Kreis Freiwaldau zum jährlichen Heimattreffen im bayerisch-schwäbischen Westendorf bei Augsburg zusammen. Thema war „Zukunft gestalten“.
Ortsbetreuerin Inge Alesi begrüßte neben vielen Landsleuten aus ihrem Heimatort auch Landsleute aus der Nachbarschaft von Schwarzwasser. Ein besonderer Gruß ging an die Landsleute aus den Kreisen Troppau, Jägerndorf, Freudenthal und des Mährisch-Schlesischen Sudetengebirgsvereins (MSSGV). Der MSSGV möchte den Landsleuten die Gelegenheit bieten, sich zukünftig auch in größeren Zusammenschlüssen zu treffen.
� SL-Kreisgruppe Nürnberger Land/Mittelfranken

Ende Juni unternahmen die Ortsgruppen der mittelfränkischen SL-Kreisgruppe Nürnberger Land unter Leitung von Rüdiger Hein und Edith Wirth die Amtswalterfahrt nach Suhl und Lauscha in Thüringen.



Da sich die SL-Ortsgruppe Rückersdorf mit 30 Personen beteiligt hatte, war der Bus voll besetzt. Auf der Autobahn A3 passierten wir Erlangen, Forchheim, Bamberg und Staffelstein. Dann erreichten wir unser erstes Ziel, die Waffenstadt Suhl. Die Stadt wird auch Stadt des Friedens genannt. Dank reichhaltiger Erz- und Goldfunde entwickelte sich hier die Zunft der Büchsenmacher. Das dortige Waffenmuseum ist ein Spezialmuseum für Technik und Kulturgeschichte der Suhler Waffenfertigung. Auf drei
fen“, „Heimat der Büchsenmacher“, „Jagdwaffen“, „Sportwaffen“ und „Militärwaffen“ unter-
ter, so daß uns Zeit blieb, die vielen Glasmanufakturen und Geschäfte zu ergründen. In der
gen der fehlenden Ortsbetreuer.
In diesem Zusammenhang sprach Wilhelm Rubick, Ortsbetreuer von Schwarzwasser, jetzt wohnhaft im mittelfränkischen Thalmässing, auch für Edgar Bauer und Eduard Beutel vom Heimatkreis Freudenthal, Alfred Olbrick vom Heimatkreis Troppau, Gerhard Wurps vom Heimatkreis Jägerndorf und Gerhard Pohl vom MSSGV über „Heimattreffen weiterentwickeln“.
Etagen bietet es den Besuchern einen einzigartigen Einblick in die fast 600jährige Geschichte der Suhler Fertigung und Entwicklung von Handfeuerwaffen. Das Museum ist in die fünf Kernbereiche „Welt der Waf-
teilt. Es informiert den Besucher umfassend, und er kann sich tiefgründige, fachspezialisierte Details erschließen. Leider konnten wir uns in einer Stunde nur kurze Anregungen einholen.
Weiter ging es mit unserem Bus nach Lauscha zum Mittagessen. Im Gasthof Brandt wurden wir schon erwartet. Auf der Spei-
Vorangegangen war ein Gottesdienst in der Sankt-Georgs-Kirche in Westendorf, zelebriert von Heimatpfarrer Andreas Ehrlich. Das anschließende Treffen fand im dortigen Gasthaus Zur Krone statt.
sekarte standen typische thüringische Spezialitäten. Unsere Mitfahrer waren von dem guten Essen und der hervorragenden Bedienung begeistert.
Der Bus erwartete uns am Bahnhof erst zwei Stunden spä-
Farbglashütte Lauscha konnten wir den Glasmachern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Lauscha gilt als die Geburtsstadt des gläsernen Christbaum- und Weihnachtsschmuckes. Er wurde in Heimarbeit gefertigt und über die Sonneberger Verlagshäuser in alle Welt verkauft. Er verhalf der Stadt und ihren Glasbläsern zu Ansehen.
Vorbei an mit Schindel gedeckten und verkleideten Häusern, die hier typisch sind, erreichten wir wieder unseren Bus, um unsere Heimreise anzutreten.
Zwischenstation war Hirschaid bei Bamberg, wo wir zum Abendessen im Biergarten der Brauerei Kraus erwartet wurden. Selbstbedienung war angesagt. Nach anderthalb Stunden traten wir unsere Weiterfahrt an. Müde, aber mit vielen schönen Eindrücken, kehrten wir zurück. Die Mitfahrer freuen sich schon heute auf die Fahrt im Oktober in die Rhön. Bärbel und Otmar Anclam
In ihrer Begrüßungsrede ging Inge Alesi auch auf die Schicksalsjahre 1945/1946 ein. „Besonders die Erlebnisgeneration ist davon geprägt und behält dieses Unrecht, verbunden mit den leidvollen Ereignissen, lebenslang in Erinnerung“, sagte sie. „Solange wie möglich wollen wir an den Treffen festhalten, auch wenn sich in den vergangenen Jahrzehnten nach der Vertreibung die Reihen unserer Lieben schon schmerzlich gelichtet haben. Wir von der Erlebnisgeneration können aus der Erinnerung schöpfen und weitergeben.“
Erfreulich sei, so Inge Alesi, daß sich auch Nachgeborene für die angestammte Herkunftsheimat interessierten und in den verschiedenen Organisationen mitarbeiteten.
Doch fehlten in vielen Orten bereits die Heimattreffen und die Berichterstattung we-
„Unser Ziel ist, die Leistungen vergangener Generationen lebendig zu halten“, erklärte Rubick. „Das Erreichte darf nicht mit unserer Generation aussterben.“ Und: „Gerade in Veranstaltungen wie dieser lebt unsere Identität weiter und zeigt, wie stark und wie gut die gegenseitigen Beziehungen sind.“ Es gelte, bei Veranstaltungen an größere Dimensionen zu denken und auch zu handeln, wie es beim Setzdorfer Heimattreffen praktiziert werde. „Das ist die Zukunft unserer Vertriebenen und der Nachgeborenen in den Landsmannschaften“, hob Rubick hervor. Man müsse vor allem auch die heutige junge Generation für die Themen der Vertreibung sensibilisieren. Nur dann werde gelingen, die berechtigten Interessen der Vertreibung in die Zukunft zu transportieren. Er würde es begrüßen, wenn Bildungseinrichtungen dieses Thema offensiver als bisher in den Lehrplänen berücksichtigen würden, schloß der Ortsbetreuer von Schwarzwasser. Bevor es zur Kaffeetafel ging, zeigte Erich Hanke Filme von früheren Fahrten in die Heimat Setzdorf. Zum Schluß wies Inge Alesi darauf hin, daß das nächste Treffen der vereinten Orte Setzdorf, Domsdorf, Friedeberg und Schwarzwasser – das Friedeberger Ländchen – Anfang Juli 2024 wieder in Westendorf stattfinde. Robert Unterburger
Ende Mai wurde auf der Grünfläche vor dem Gartenhaus in der Nähe des Schlosses von Teplitz-Schönau eine Statue enthüllt, die Anlaß zu Diskussionen bietet und gleichzeitig auf die historische Verknüpfung der kulturellen Szene von Teplitz mit bedeutenden künstlerischen Richtungen und avantgardistischen Tendenzen hinweist. Konkret handelt es sich um Dadaismus.
Dadaismus ist eine der unkonventionellsten und avantgardistischsten Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts. Ausgelöst vom gesellschaftlichen Klima in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, lehnte der Dadaismus die Kriegspolitik, die bürgerliche Kultur und den Kapitalismus ab. Im Wesentlichen bot er nihilistische und antirationalistische Kritik am Status quo. Mit nichttraditionellen Materialien, unsinnigen Inhalten, Satire und dem Fantastischen verwandelten die Dada-Künstler das Bekannte in das Unbekannte.
Die nun enthüllte Statue heißt „Dr. Hugo Dux. Kopf der tschechoslowakischen Dadaisten“.
Ihr Schöpfer ist Jan Hendrych (* 1936), Bildhauer, Maler, Restaurator, Kurator und emeritierter Professor der Akademie der Bildenden Künste in Prag. Inspiration gab ihm der Teplitzer Arzt Hugo Dux (1884–1932), der zum „Klügsten Teplitzer und






Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Kopf der tschechoslowakischen Dadaisten“ gekürt wurde. Dies geschah laut literarischer Quellen am 26. Februar 1920.
Damals traten die deutschen
Dadaisten Richard Huelsenbeck, Raul Hausmann und Johannes Baader im Rahmen ihrer Tournee durch Mitteleuropa auch in Teplitz-Schönau auf. Die damalige Presse nannte ihren Auftritt im ausverkauften Saal des Kaiserbades ein schreckliches Theater, was wohl am besten die künstlerische Äußerung der Dadaisten ausdrückte. Beim folgenden wilden Gelage erhielt Hugo Dux den genannte Ehrentitel, obwohl er sich nie besonders künstlerisch hervorgetan hatte. Dux ist auf dem Teplitzer Jüdischen Friedhof beigesetzt.

Ganz im Sinn dieser avantgardistischen Kunstrichtung schuf nun Jan Hendrych seine Skulptur. Die Gestalt, die sich aus einer Muschel erhebt, gestaltete er aus hochwertigem französischen Beton. „Die Muschel sind die hiesigen Bäder. Die Kugeln sollen aufsteigende Blasen ein. Hier ist auch ein Hinweis auf Sandro
Botticellis ,Geburt der Venus‘. Dieser ergibt sich aus der Muschel und dem weiblichen Körper. In meinem Fall also bis zum Hals,“ erklärte Hendrych bei der Eröffnung sein Werk. Der Kopf sei aber männlich – im EmpireStil eines napoleonischen Solda-

mit der barocken Architektur des Gartenhauses und der Dreifaltigkeitssäule auf dem Schloßplatz ganz in der Nähe dieser neuen Statue. Der unideologische, verspielte und sogar humorvolle Ton der Statue steht ganz im Gegensatz zu der Tatsache, daß
ten. „Als ich gesehen habe, daß sich die Stadt nicht gescheut hat, wohl als einzige Stadt am Eingang vor ihrem Rathaus eine rauchende Zigarette als ein Kunstwerk zur Erinnerung an den ehemaligen Bürgermeister Jaroslav Kubera anzubringen, da war mir klar, daß die Stadt auch ein dadaistisches Kunstwerk verträgt.“
Die dynamische Handschrift Jan Hendrychs korrespondiert
1971 an derselben Stelle vor dem Gartenhaus eine Statue des „ersten Arbeiterpräsidenten“ Klement Gottwald aufgestellt wurde. Aber auch diese Statue entbehrte nicht einer gewissen Komik, denn diese kippte der 1969 in Teplitz geborene, später in den USA lebende Musiker Koonda Holaa alias Kamil Kruta Mitte der 1980er Jahre aus Protest um.

So war zu erwarten, daß die angekündigte Enthüllung vor dem Gartenhaus zahlreiche Teplitzer anlockt. Vertreter der Stadt wie der Oberbürgermeister Jiří Štábl, sein Stellvertreter Hynek Hanza, die Kulturbeauftragte Radka Růžičková und die Kuratorin Vendula Fremlová sprachen einleitende Worte. Immer wieder wurde betont, daß die Stadt stets der modernen Kunst aufgeschlossen gegenüber stehe und dieser historischen Tradition nun folge. Vor allem Ex-Oberbürgermeiser Hynek Hanza sagte, daß dieses neue Kunstwerk sicher kontroverse Meinungen hervorrufen werde. Er sei aber überzeugt, daß ein Kunstwerk, das nicht zu Diskussionen ermuntere, seinen Zweck verfehlt habe.

Anläßlich der Enthüllung wurde auch das Gartenhaus nach mehrmonatigem Umbau mit einer Jan-Hendrych-Ausstellung in der Galerie im ersten Stock wiedereröffnet. Die Stadt erfüllte damit ihr Versprechen, die Galerie mit einer Rampe am Eingang und einem Aufzug im Treppenhaus barrierefrei zu gestalten.
Vor allem dem Einbau des Aufzugs hatte das Denkmalamt schließlich mit einigen Auflagen zugestimmt. Sowohl die steinernen Stufen am Eingang als auch die Marmortreppen des Aufgangs zur Galerie wurden in das Projekt einbezogen, so daß sich zwar das Aussehen von Eingang und Treppenhaus veränderte, aber die originalen Teile erhalten blieben. Nun können auch Rollstuhlfahrer die Galerie besuchen.

Die aktuelle Ausstellung zeigt das Schaffen Jan Hendrychs im breiten Kontext. Sie stellt zum einen Skizzen und Modelle der Dux-Statue vor. Gleichzeitig zeigt sie Hendrychs Reichtum und Vielfalt bei seinen Figuren in seinen Zeichnungen. Die Ausstellung akzentuiert das Thema „Kopf“. Das zeigen nicht nur die expressiven Zeichnungen, sondern auch die Plastiken, die sich zwischen realistischer Nachbildung und abstrakter Darstellung bewegen.

Wieder einmal bewies Teplitz, daß es neben seinen vielen Springbrunnen, dem gezielten Einsatz von Sgrafitti- und Streetart-Malerei und den neuen Denkmalen und Statuen sich der jungen Kunst verpflichtet fühlt und gleichzeitig an die historischen und avantgardistischen Traditionen der Stadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anknüpft. Wenn auch mitunter kontrovers, ist es dennoch lebendige Kunst. Jutta Benešová
n Donnerstag, 31. August bis Sonntag, 3. September: 9. Teplitz-Schönauer Kreistreffen in der Heimat. Donnerstag eigene Anreise nach Teplitz-Schönau (Teplice), Hotel Prince de Ligne (Zámecké náměstí 136); 19.00 Uhr dort Abendessen; anschließend zwei Dokumentar-


filme über die Zeitzeugen Pater Benno Beneš SDB (1938–2020) und Hana Truncová/John (1924–2022). Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Saubernitz (Zubrnice) im Böhmischen Mittelgebirge; dort Besichtigung des Freilichtmuseums; anschließend Mittagessen in der Dorfgaststät-
te und Weiterfahrt nach Leitmeritz (Litoměřice); von dort Schifffahrt auf der Elbe mit Kaffee und Kuchen nach Aussig (Ústí nad Labem); Rückfahrt zum Abendessen in der Teplitzer Brauereigaststätte Monopol. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt in die Königstadt Kaaden (Kadaň); dort

Besichtigung des Franziskanerklosters mit Mittagessen in der Klostergaststätte und Rundgang; anschließend Kranzniederlegung auf dem Friedhof am Denkmal für die Opfer des 4. März 1919; 19.00 Uhr festliches Konzert in der Schönauer Elisabethkirche; anschließend Abendessen
im Wirtshaus. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienstmöglichkeit in der Dekanatskirche Johannes der Täufer am Schloßplatz und eigene Heimreise. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag inklusive drei Übernachtungen, Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, allen Mahlzeiten, Besichtigun-
gen, Führungen, Schiff und Konzert pro Person im Doppelzimmer 435 Euro, im Einzelzimmer 520 Euro. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Auskunft: Erhard Spacek, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail spacek@teplitz-schoenaufreunde.org
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg


Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Hostaus Pfarrer – Teil XXVIII

Stefan Stippler, Ortsbetreuer von Hostau, schildert die Geschichte Hostaus anhand des zweiten Memorabilienbuches der Hostauer Dechantei für die Jahre 1836 bis 1938. Hier der zweite Teil über den Dechanten František Lorenc (1882 –1941).
In Mirkowitz segnet Lorenc am vierten Adventssonntag 1918 eine neue Gemeindeglocke, und am 21. September 1919 erfolgt die Weihe einer neuen Stahlglocke in Zwirschen. Beide Glokken müssen neu angeschafft werden, da ihre Vorgängerinnen zu Kriegszwecken eingeschmolzen wurden.

Anfang Juni fand das Heimatkreistreffen der Bischofteinitzer statt, in dessen Rahmen sie in Heiligenkreuz einen Heimatgottesdienst feierten (➞ HBBI 26 und 27/2023). Konzelebrant Pfarrer Klaus Oehrlein berichtet von einem dort noch existierenden Bildstock beziehungsweise Wegkreuz, auf das er am Ende der Messe hingewiesen hatte.
Du, Christus, hast Dein Kreuz wie eine Brücke über den Tod gespannt, damit die Menschen darüber vom Land des Todes in das des Lebens schreiten können.“ Auf dieses Zitat aus einer Homilie des heiligen Ephräm des Syrers (306–373) verwies Pater Miroslav Martiš aus Mies in seiner Predigt über das Thema „Kreuz“ beim Heimatgottesdienst. Denn an jenem Tag wird dieses frühchristlichen Heiligen gedacht, der vor 1650 Jahren starb.
An ein Jubiläum für den Ort –auch in Zusammenhang mit dem Kreuz – von 350 Jahren, das vielen ehemaligen wie heutigen Bewohnern von Heiligenkreuz wohl nicht bewußt ist, erinnerte ich zum Schluß dieses Gottesdienstes – und verteilte dazu ein Erinnerungsbildchen. Die Details finden sich in der handschriftlichen Pfarrchronik von Heiligenkreuz. Wie viele andere unschätzbare historische Notizen über die Lokalgeschichte verdanken wir Pfarrer Karl Pöhnl auch diese Information. 1845 in Weißensulz geboren, kam er 1876 als Kaplan in die Nachbarschaft seines Geburtsortes und wirkte ab 1878 bis zum seinem Tod 1921 als Pfarrer für Heiligenkreuz. Sein Grab auf dem dortigen Friedhof ist noch erhalten.
Pöhnl schreibt: „Von einem Denkmale aus alter Zeit muß hier auch noch Erwähnung geschehen, es ist dies ein großes steinernes Kreuz, im Volksmunde Steinerne Marter genannt, auf dem
noch immer die Steinerne Marter.
Von ihrer originalen Höhe hat sie einiges verloren. Noch steht der Sockel, in den ein eisernes Kreuz einzementiert ist.
Am 8. September 1919 wird unter Leitung des Hostauer Lehrers Peter Axmann in der Dechanteikirche ein Kirchenkonzert veranstaltet. Der Reinerlös von 675 Kronen und fünf Heller wird zur Anschaffung einer Weihnachtskrippe verwendet. Diese wird zum ersten Mal am Weihnachtsfest 1920 auf dem Seitenaltar der Geißelung Christi aufgestellt und vor der Christmette von Dechant Lorenc gesegnet. Die Krippe ist beim akademischen Bildhauer Bohumil Vlček in Prag für 4600 Tschechische Kronen inklusive Fracht in Auftrag gegeben worden. Der Betrag wird durch das Kirchenkonzert und andere gespendete Summen bestritten.
den und toten Helden Hostaus im Ersten Weltkrieg statt. Der Hostauer Mesner Josef Liebermann stirbt am 18. März 1923. Lorenc nennt ihn einen eifrigen und braven Mann. Unter reger Beteiligung der Hostauer Bevölkerung wird Liebermann am 20. März beigesetzt. Am 21. April 1923 kommt der Bischof von Budweis, Šimon Bárta (1864–1940), im Rahmen einer Generalvisitation nach Hostau. Die meisten Häuser der Stadt sind mit Kränzen und Girlanden geschmückt. Der katholische Burschenverein von Hostau errichtet am Ortseingang ein Triumphportal. Mitglieder des katholischen Frauenbundes schmücken die Hostauer Dechanteikirche. Die Gläubigen bereiten dem Oberhirten einen imposanten Empfang. Befremdet vermerkt Lorenc allerdings das Nichterscheinen der gesamten Stadtvertretung und ergänzt, daß dies auch bei der Generalvisitation im Jahr 1912 der Fall gewesen sei.
Weg, der von Heiligenkreuz über den Berg nach Weißensulz führt und der in alter Zeit auch den einzigen Fahrweg nach Weißensulz abgab. Diese Steinerne Marter bei Heiligenkreuz – benützt an den Bittagen als Stationskreuz – trägt folgende Inschrift in Stein gehauen: ,Diese Marter Säul hat zu Ehren der Allerheiligen Mutter Gottes Maria (bereits unleserliches Wort) Hans Georg
Doimaier, dieser Herrschaft bestellter Haubtmann, aufrichten lassen 1673.‘ Sie hat somit heute das ehrwürdige Alter von 231 Jahren erreicht.“ Das schrieb Pöhnl 1904.

„Ob dieses Kreuz wohl heute noch exisitiert?“, dachte ich mir des öfteren, nachdem ich diese Notiz erstmals gelesen hatte.
In der alten Generalstabskarte um 1880 ist es sogar eingezeichnet. Damit machte ich mich Anfang Juni auf die Suche und begann beim Feldweg, der am Ortsende von der Straße in Richtung Engelmühle auf die Höhe führt. Dort legte man jüngst einen kleinen Flugplatz mit einer Landebahn an; eine große Halle daneben ist im Bau. Und gegenüber, am Wegesrand, stand zu meiner freudigen Überraschung
Die ursprünglich darauf stehende Granitsäule fehlt. Das erkennt man an der runden Basis und an den Schraubenlöchern, in denen einst der eiserne Stützstab für das Kreuz an der Spitze befestigt war. Von der Inschrift lassen sich – mit dem Wissen aus der Dokumentation von Karl Pöhnl – nur mehr die letzten drei Worte „Haubtmann aufrichten lassen“ erkennen. Wie Pöhnl erwähnt, habe er bereits

1904 ein Wort nicht mehr lesen können. Und auch beim Familiennamen des Hauptmanns muß es ähnlich gewesen sein. Denn sein richtiger Name findet sich – in schwungvoller Schrift des damaligen hochgebildeten Pfarrers Magister Lucas Ramsmayer (1659–1686) – in der Taufmatrikel: Hans Georg Pachmayer.
Über den konkreten Anlaß für die Stiftung dieses Bildstocks gibt es keine Nachricht. Eine Vermutung meinerseits ist die: Am 4. Mai 1671 wird ihm und seiner Frau Dorothea eine Tochter Barbara geboren, deren Patin eine Gräfin Guttenstein ist. Am 5. September 1672 wird der Sohn Hans Christoph getauft, dessen Pate der „Zollbereiter“ namens Schuheknecht aus Pfraumberg ist. Vielleicht steht somit diese Säule in Verbindung mit dem Dank für das Geschenk dieser Kinder oder explizit des Sohnes.
Ich überlege, vielleicht mit dem Bürgermeister zu sprechen und anzuregen, ein Schild neben dem Kreuz aufzustellen – mit dem Text und gerade auch der Jahreszahl. Denn dieses kleine Denkmal zählt heute wohl –neben der Kirche – zu den ältesten noch sichtbaren historischen Monumenten wie auch des christlichen Glaubens dieses Dorfes. Es erinnert alle Vorbeigehenden daran, was Pfarrer Martiš in seiner Predigt zitierte: „Du, Christus, hast Dein Kreuz wie eine Brücke über den Tod gespannt, damit die Menschen darüber vom Land des Todes in das des Lebens schreiten können.“

Aufgrund des Kleinpächtergesetzes vom 27. Mai 1919 wird das Hostauer Dekanalbenefizium um den Grundbesitz von ungefähr sechs Hektar enteignet und den bisherigen Kleinpächtern als Eigentum zuerkannt. In diesem Zusammenhang befürchtet Lorenc, daß jener Gartenanteil, der von der Schulgemeinde als Turnplatz genutzt wird, vom Ortsschulrat als Eigentum beansprucht wird, da die Pacht mehrere Jahren unterbrochen war. Jedoch entscheidet das Bezirksgericht im Sinn des Dechanten. Dieser erneuert daraufhin den Pachtvertrag für sechs Jahre mit einem jährlichen Pachtzins von 20 Kronen. Vom 29. März bis 4. April 1920 wird in Hostau durch die Jesuitenpatres Josef Conrath und Karl Egger aus dem Konvent in Mariaschein eine Volksmission durchgeführt. Die Hostauer kommen zahlreich zu den Predigten, die Gemeindeerneuerung ist ein Erfolg. Darauf aufbauend kommt Pater Karl Egger erneut zur Abhaltung einer Volksmission vom 18. bis 26. März 1923 nach Hostau, bei der die Predigten wieder sehr gut besucht sind. 1270 Personen gehen zur Beichte und 1560 Gläubige empfangen die heilige Kommunion.
Auf Anregung des Hostauer Gesangvereins „Liedertafel“ segnet Dechant Lorenc während einer Feldmesse am 9. Juli 1922 das neu errichtete Gefallenendenkmal am Stadtplatz neben der Dreifaltigkeitssäule. Ansprachen halten Bürgermeister Bauriedl und Distriktarzt Gustav Gröbner. Am Nachmittag finden ein Volksfest und abends ein „Kränzchen“ zu Ehren der leben-
Dessen unbeirrt spendet Bischof Bárta am 22. April 1923 insgesamt 329 Firmlingen das Sakrament der Firmung. Dechant Nikolaus Nový aus Taus, Erzdechant Karl Klima aus Bischofteinitz, Pfarrer Knut Knarr aus Heiligenkreuz und Pfarrer Ferdinand Folger aus Weißensulz nehmen an der Meßfeier teil. Am 23. April visitiert der Bischof Martin Mehrsitz Hostau, am 24. April Schüttarschen und Muttersdorf. In Begleitung des Bischofs befinden sich der Kanoniker Alois Simeth und der Zeremoniar Benedikt Benda sowie der bischöfliche Kammerdiener. Vom caritativen Engagement des katholischen Frauenbunds ist Dechant Lorenc sehr angetan. Auf Anregung von dessen Präsidentin, der Kaufmannsgattin Dietz, wird ein Betrag von 2300 Kronen gesammelt. Für dieses Geld wird ein neuer prachtvoller weißer Rauchmantel angeschafft. Ebenso wird auf Kosten des Frauenbundes die Kapelle der versperrten Muttergottes neu ausgemalt. Dechant Lorenc läßt auch das Presbyterium neu ausmalen und die Sakristei für insgesamt 300 Kronen weißeln. Der Thronsessel und die beiden Sedilien in der Dechanteikirche werden mit einem grünen Stoff für 238 Kronen bezogen. Diese Beträge müssen jedoch schrittweise durch den Klingelbeutel eingesammelt werden.
Im Spätherbst 1923 werden Reparaturen am Pfarrhaus vorgenommen. Das Dach wird mit neuen Schieferschindeln eingedeckt, in der Küche ein neuer Fußboden gelegt und die eingestürzten Teile des Gartenzauns werden wieder ausgebessert. 1924 werden im Kirchturm neue Glockenstränge angebracht.
Am 16. Mai 1924 findet in Hostau eine katholische Jugendtagung statt. Verschiedene katholische Knaben- und Mädchenorganisationen besuchen die Veranstaltung zahlreich. Fortsetzung folgt


Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


� Kladrau

Das Tachauer Heimatmuseum Heimat – Vertreibung – Integration im Kulturzentrum Hans Bauer in Weiden in der Oberpfalz. Bild: Karin Wilk � 33. Heimatkreistreffen 2023



n Samstag, 2. September: 8.30 Uhr Abfahrt Busunternehmen Zitzmann in Störnstein/Oberpfalz; 9.00 Uhr Zustieg in Weiden, Bushaltestelle Schlörplatz am Finanzamt. 10.00 Uhr Besichtigung der ehemaligen Pfarrkirche in Tutz und der Gedenkstätte am Friedhof in Haid. 11.30 Uhr Führung durch die neue Ausstellung „Die Fürsten Windischgrätz“ im Kloster Kladrau; anschließend Mittagessen im Klosterrestaurant. 15.00 Uhr Führung durch die neue Ausstellung im Franziskanerkloster in Tachau/Muzeum Cesky Les. 17.30 Gottesdienst in der ehemaligen Pfarrkirche Sankt Wenzel mit Pfarrer Georg Hartl; anschließend Abendessen im Römmererhäusl, Oberströbl 1, Waidhaus. n Sonntag, 3. September: 9.00 Uhr Feier am Tachauer Gedenkstein. 10.00 Uhr Sitzung des Heimatkreisrates im Kulturzentrum Hans Bauer; 12.00 Uhr dort Eröffnung der Ausstellung „Lebenswerk des Tachauer Künstlers Bernd Fleißner“. 13.00 Uhr Mittagessen im Ratskeller.
Anmeldung: WolfDieter Hamperl Ý Impressum oben oder Sebastian Schott (09 61) 81 41 02.
n Sonntag, 16. Juli, 15.00
Uhr, Haid: Deutschtschechische Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Peter Fořt spricht deutsch, Telefon (0 04 20)
7 24 20 47 02.
n Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juli, Bruck am Hammer und Mähring: 33. Jakobifest und SanktAnnaFest. Freitag, 14.30 Uhr Festgottesdienst mit Pfarrer Jiří Majkov aus Plan, einem deutschen Priester und dem Quartett „Corona“ in der Jakobuskirche in Bruck am Hammer; anschließend Gang durch den dortigen Friedhof und Zusammenkunft im Gasthaus am Bahnübergang mit der Familie Jan Šícha und Bürgermeister Erik
Mára. Samstag, 10.00 Uhr Sankt
AnnaGottesdienst in der SanktAnnaWallfahrtskirche in Plan. Sonntag, 10.00 Uhr SanktAnnaGottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Katharina in Mähring mit Prozession zum Wallfahrtsgottesdienst in der SanktAnna
Gedächtniskirche auf dem Pfaffenbühl; anschließend Zusammenkunft im Festzelt unter dem Leitwort „70 Jahre SanktAnnaGedächtniskirche in Mähring“. n Sonntag, 20. August, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei. Auskunft: Georg Hartl, SanktVitusStraße 20, 92533 WernbergKöblitz, Telefon (0 96 04) 9 09 99 95, eMail ukatubona@gmail.com

Wir gratulieren folgendem treuen Abonnenten des Tachauer Heimatboten zum Geburtstag im Juli.
n Schossenreith. Am 4. Schwester Gudula Reiss (Oilnbauern), 89 Jahre. Josef Magerl Ortsbetreuer
Herzlich gratulieren wir im Juli Manfred Kassekkert, Ortsbetreuer von Ringelberg, am 2. zum 69. Geburtstag, Franz Josef Schart, Ortsbetreuer von Godrusch, am 4. zum 74. Geburtstag, Gernot Schnabl, Stellvertretender Kreisbetreuer und Stadtbetreuer von Tachau, am 5. zum 86. Geburtstag, Helmut Gleißner, Ortsbetreuer von Pau
lusbrunn, am 10. zum 76. Geburtstag, Werner Schlosser, Ortsbetreuer von Strachowitz, am 25. zum 83. Geburtstag und Stefan Heller, Ortsbetreuer von Speierling, am 30. zum 58. Geburtstag. Wir wünschen alles erdenklich Gute, Gesundheit sowie Gottes reichen Segen und danken für den Einsatz für unsere Heimat. Sieglinde Wolf
Die Ausstellung im ehemaligen Benediktinerkloster Kladrau war in die Jahre gekommen. Bis vor zwei Jahren war sie seit Jahrzehnten unverändert geblieben. Mit ordentlicher Unterstützung der Europäischen Union wurde der hochbarocke Baukomplex renoviert und zwei neue Museen eingebaut.
Eines der zwei Museen befaßt sich mit dem Leben der Mönche im Kloster. Vier Zellen werden mit entsprechender Einrichtung gezeigt. Darin auch zahlreiche Exponate über Wissenschaft und Kunst. Schließlich waren die Benediktiner kein Bettelorden, sondern der Bildung sehr verbunden. Eine zweite Ausstellung ist den Fürsten Windischgrätz gewidmet, die die Herrschaft im Jahr 1832 erwarben.
Ihr Hauptwohnsitz war in Tachau. Neben Wappen, Urkunden, Portraits, Fahnen, Münzen und Orden wird auch das Leben der Untertanen in dieser Zeit gezeigt. Kamil Betram trat mit der Bitte an uns heran, Exponate zur
Verfügung zu stellen. Wir übergaben dem Museum zwei Trachten als Leihgaben, die jetzt in einem historischen Glasschrank gezeigt werden. Außerdem werden Fotografien des Lebens der Landbevölkerung aus dem reichhaltigen Bestand von Hildegard
Preiß gezeigt. Natürlich wird unser Museum als Spender genannt. Magister Kamil Betram, der das Depot des ehemaligen Klosters Kladrau betreut, führte Sebastian Schott, zuständig für unser Tachauer Museum in Weiden in der Oberpfalz, und mich durch die Ausstellungen. Ludmila Ourodova, Chefin der Abteilung für Konservierung und Restaurierung im nationalen Denkmalamt in Budweis, war eigens von dort angereist. Sie bedankte sich sehr herzlich bei uns, daß wir zum Gelingen der neuen Ausstellung beigetragen hätten. Ich freue mich sehr über die gelungene Zusammenarbeit, geht es doch uns und den Kulturträgern in der Tschechischen Republik jetzt um eine wahrheitsgemäße Darstellung der Vergangenheit unserer Vorfahren.
Die als Leihgaben zur Verfügung gestellten Trachten im historischen Glasschrank mit Dr. Sebastian Schott, Dr. Ludmila Ourodova und Dr. Wolf-Dieter Hamperl. Bilder: Karin Wilck
Wolf-Dieter Hamperl
Magister Kamil Betram, der Betreuer des Depots des Klosters Kladrau, erklärt am Beginn der Führung das Aussehen des mittelalterlichen Klosters. Rechts Gang im Dientzenhofer-Bau.
Blick in die Bibliothek der Fürsten Windischgrätz.
� Heimatfahrt

Der neu angelegte Kräutergarten des ehemaligen Benediktinerklosters, das Opfer der Hussitenkriege, des Dreißigjährigen Krieges und der Josephinischen Reformen war. 1864 wurde es eine Brauerei.
Seit 1992 ist es Tradition, daß wir anläßlich des Heimatkreistreffens eine Busfahrt in die Heimat unternehmen. Da sich zur Zeit so viel verändert, laden wir zu einer Fahrt in den ehemaligen Kreis Tachau und seine neuen Museen ein. Bis auf einen kleinen Beitrag übernimmt der Heimatkreis die Kosten.
ie Fahrt beginnt in Störnstein bei Neustadt an der Wald
naab auf dem Parkplatz des Busunternehmens Zitzmann. Zustiege sind in Weiden am Finanzamt möglich. Weiter geht die Fahrt über Vohenstrauß und Waidhaus, wo wieder Zustiege möglich sind, nach Tutz. Die ehemalige Pfarrkirche Sankt Michael errichtete 1748 die Familie LöwensteinRosenbergWertheim und stattete sie sehr gut aus. In den vergangenen zehn Jahren wurde die Kirche von Privatleu
ten sehr gut restauriert. In Haid besichtigen wir die neue, von der Stadt auf dem Friedhof errichtete Gedenkstätte für die Gefallenen der Weltkriege und legen einen Kranz nieder.

Im neu renovierten Kloster Kladrau wird uns Kamil Betram durch die Ausstellung „Die Fürsten Windischgrätz“, die Herren der Herrschaften Tachau und Kladrau, führen. Für diese Ausstellung lieferte der Heimatkreis
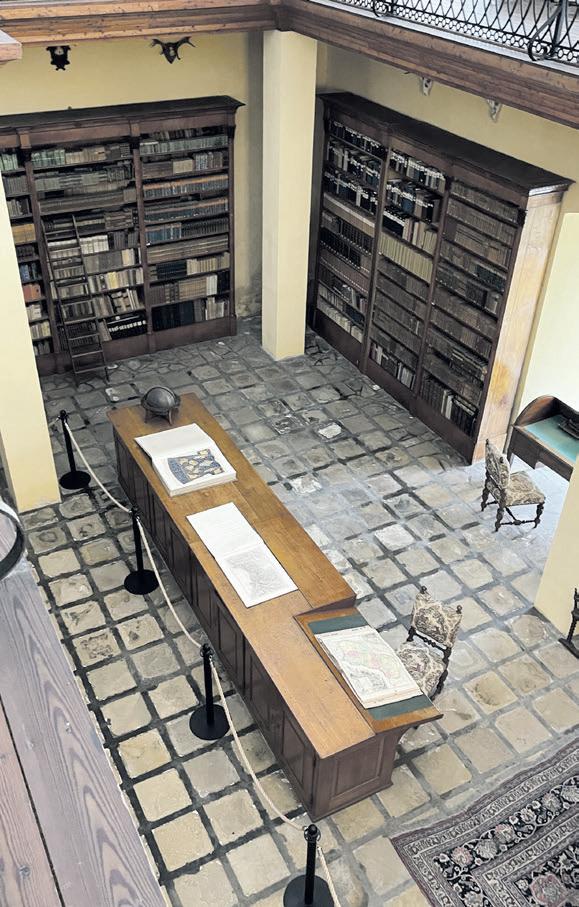
Fotografien und zwei Trachten als Leihgaben. Anschließend führe ich durch die neu konzipierte Ausstellung im Franziskanerkloster Tachau mit einer Darstellung unserer Geschichte. Gegen Abend sehen wir uns die ehemalige Pfarrkirche Johannes und Paul in Hals an, die um 1800 errichtet wurde. Dann besuchen wir dort das Grab des Pfarrers und Pendlers Franz Thomas. Wolf-Dieter Hamperl

mit
� Bund der Eghalanda Gmoin e.V. – Bund der Egerländer
Roland Helmer erhielt dieses Jahr den Egerländer Kulturpreis „Johannes-von-Tepl“ vom Bund der Egerländer. Ralf Heimrath berichtet über die Preisverleihung und umrahmt Helmers Leben und Wirken:
Am Samstag, den 1. Juli 2023, erhielt der international bekannte bildende Künstler Roland Helmer aus Fürstenfeldbruck den großen Egerländer Kulturpreis „Johannes-von-Tepl“. Die feierliche Übergabe fand im Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz statt.
Helmer wurde, wie der Laudator Wolf-Dieter Hamperl berichtete, im Jahr 1940 in Fischern bei Falkenau geboren.
Nach der Vertreibung absolvierte er von 1954 bis 1958 eine Ausbildung zum Graphiker.
Von 1961 bis 1967 studierte er Malerei an der Akademie für Bildende Künste in München.
In den Jahren von 1972 bis 1978 war er auch als Assistent an die-
� Die nächsten Termine
Egerländer
Kalender
n Samstag, 22. Juli, bis Sonntag, 23. Juli:
71. Vinzenzifest und 48. Egerländer Treffen des BdEG-LV Baden-Württemberg in Wendlingen/Neckar.
n Sonntag, 30. Juli: 70 Jahre Sankt-Anna-Fest in Mähring. Veranstalter: Heimatkreis PlanWeseritz.
n Samstag, 5. August:
Hutzennachmittag im Emil-Renk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach. Kontakt unter der eMail iris.plank@egerlaenderoffenbach.de
n Freitag, 11. August: Gäuboden-Festzug in Straubing. Anmeldung beim Landesvorstand Helmut Kindl unter eMail helmut.kindl@t-online.de
ser Akademie tätig. Und im Jahr 1984 wurde er dort zum Professor berufen.
Schon seit den 1960er Jahren widmet Helmer sich der konkreten Malerei. Er wurde mit den Jahren einer der angesehensten Vertreter dieser Kunst.
In der konkreten Malerei sind
Linien und Farben nicht ein Mittel zur Darstellung von Personen, Gegenständen oder Landschaften, sondern sie stehen für sich selbst. In diesem Sinne zeigt der Künstler geometrische Formen mit Linien und Flächen, welche mit Farben gefüllt sind.
Helmers Bilder sind in verschiedenen Galerien zu sehen, unter anderem auch in der Kunstgalerie im Egerlandhaus.
Seine Werke wurden in zahlreichen Sonderausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert.
Eine Reihe von Ehrungen künden von seiner künstlerischen Bedeutung. Darunter befindet sich schon 1978 der Förderpreis des Freistaats Bayern für junge
Künstler, ebenso der Kunstpreis des Landkreises Fürstenfeld-

bruck in den Jahren 1997 und 2001, sowie 2007 der Kulturpreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft für bildende Kunst.
� Bund der Eghalanda Gmoin e.V. Bunte Vorschau
Vom 22. Juli bis 23. Juli 2023 findet das 71. Vinzenzifest zusammen mit dem 48. Egerländer Treffen des Bundes der „Eghalanda Gmoin e.V. – Bund der Egerländer“ in Wendlingen statt. Jeder ist dazu eingeladen mitzufeiern. Hier eine kleine Vorschau zum Ablauf des Vinzenzifestes mit Bildern bisheriger Feiern:
Auch in diesem Jahr findet das Vinzenzifest am letzten Wochenende vor den Sommerferien, also vom 21. Juli bis zum 23. Juli 2023, in Wendlingen am Neckar statt. Das Traditionsfest, welches im Egerland stark verwurzelt ist, wird bereits zum 71. Mal in Wendlingen am Neckar gefeiert, verbunden mit dem 48. Egerländer Landestreffen.

Für Jung und Alt wird wieder einiges geboten sein. Neben den traditionellen Inhalten ist aber auch Platz für Neues.
Folklore aus Europa; Ein vergnüglicher Abend mit der Musikschule Köngen-Wendlingen am Neckar, der Tanzgruppe der Banater Schwaben KV Esslingen/Wendlingen und „De Selle – a kloina Blosmusik“ (Treffpunkt Stadtmitte).


Seit dem Jahr 2008 ist Helmer Mitglied in der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Heimrath betonte bei der Preisverleihung als Vorsitzender der Jury, daß der Egerländer Kulturpreis „Johannes-von-Tepl“ seit 1995 von dem Bund der Eghalanda Gmoin (BdEG) zusammen mit dem Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender (AEK) und dem Landschaftsrat Egerland als Dachorganisation der verschiedenen Egerländer Heimatkreise vergeben werde. Der Egerländer Kulturpreis werde einzig aus Mitteln dieser Organisationen, der Hausner-Stiftung, sowie weiterer Spenden aus Kommunen, Institutionen und Privatpersonen, finanziert. Er dankte den unterstützenden Spendern und Geldgebern. Den diesjährigen Preisträger würdigte er als einen Künstler, welcher sich als Egerländer hervorragende Verdienste in der Kulturarbeit erworben hat.
mung durch den Akkordeonclub Wendlingen. (Treffpunkt Stadtmitte).
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Böhmische Blasmusik mit den Weinbergmusikanten, (Saint-Leu-laForêt-Platz).
13.30 Uhr: Festumzug (Innenstadt – Festzugende Marktplatz).
Anschließend: Siebenbürger Musikanten Heidenheim; dazu Volkstänze mit verschiedenen Trachten- und Tanzgruppen, (Marktplatz).
17.00 Uhr: Festausklang
mit dem Musikverein Wendlingen, (Marktplatz). n Für die kleinen Gäste: Samstag und Sonntag: Vergnügungspark, (Albstraße); Sonntag: Kinderattraktionen, (Dorog-Platz);
Sonntag: ab 11.00 Uhr Spielstraße, (Albstraße).
Weitere Informationen rund um das Fest und aktuelle Meldungen finden Sie auf der Website www.vinzenzifest.de Wir freuen uns auf ein tolles Vinzenzifest 2023 bei hoffentlich bestem Sommerwetter.
Kommen Sie gerne vorbei und feiern Sie mit uns mit!
beitrag: 5,00 Euro).
n Sonntag, den 23. Juli 2023:
8.00 Uhr: Vinzenzimarkt (Krämermarkt im Bereich Unterboihinger-, Brücken- und Kirchheimer Straße)
n Sonntag, 13. August: Egerländer Gebetstag in Maria Kulm.
n Samstag, 9. September, bis Sonntag, 10. September:
Heimattage Baden-Württemberg in Biberach.
n Sonntag, 17. September, 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr: 70 Jahre Egerländer Gmoi Offenbach und 65 Jahre Egerland-Jugend Offenbach. Willy-Brandt-Halle, Dietesheimer Straße, Mühlheim.
n Sonntag, 1. Oktober: Erntedank-Festzug zur Fürther Kärwa. Anmeldung bei Ingrid Deistler von der Gmoi Nürnberg unter eMail deistler@egerlaender.de

n Dienstag, 3. Oktober: Landeshauptversammlung des BdEG-LV Hessen.
n Samstag, 14. Oktober, um 15.00 Uhr: Hutzennachmittag. Emil-Renk-Heim, Gersprenzweg 24, Offenbach. Veranstalter: Egerländer Gmoi Offenbach.
n Samstag, 28. Oktober, und Sonntag, 29. Oktober:
Kulturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoin in Marktredwitz.
Unter anderem können sich die kleinen minderjährigen Festgäste auf eine Spielstraße und weitere Kinderattraktionen freuen. Zudem öffnen auch viele Einzelhändler am „Verkaufsoffenen Sonntag“ ihre Türen. Auch kulinarisch verwöhnen die örtlichen Vereine und Organisationen wieder die zahlreichen Festgäste.
Festprogramm:
n Freitag, den 21. Juli 2023: 17.00 Uhr: „Vinzenzifest –Spuren des Egerländer Dudelsackes“:
– Vortrag mit historischen Live-Tonbeispielen;
– Georg und Claudia Balling (Vortrag)
– Gerhard und Andrea Ehrlich (Live-Tonbeispiele)
– Eröffnung der Ausstellung
„Egerländer Dudelsäcke“ (Rathaus)
19.30 Uhr: „Für die Ohren, für die Augen“: Musik, Mundart und Tanz –
n Samstag, den 22. Juli 2023: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr: Weißwurstfrühstück: mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Unterboihingen (Saint-Leu-laForêt-Platz).
9.30 Uhr: Vinzenziprozession: von der Kirche Sankt Kolumban bis zum Marktplatz;
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
14.00 Uhr: Festsitzung des Patenschaftsrates: „Die deutsche Ostsiedlung und das Egerland“ – ein Vortrag von Alexander Friedl, Stellvertretender Vorsitzender und Landeskulturwart des Landesverbands Egerländer Gmoin Baden-Württemberg (Treffpunkt Stadtmitte, Vorspielraum).
16.00 Uhr: Festliche Eröffnung des 71. Vinzenzifestes und des 48. Egerländer Landestreffens: mit Trachten- und Tanzgruppen; Musikalische Umrahmung durch „De Selle – a kloina Blosmusik“, (Saint-Leu-la-ForêtPlatz).
19.00 Uhr: Faßanstich und Party: mit der Party-Band „LOLLIES“, (Marktplatz; Unkosten-
Anschließend: Ökumenischer Festgottesdienst, mit Dekan Paul Magino und Pfarrer Peter Brändle. Mitwirkende: Katholischer Kirchenchor Sankt Kolumban, Wendlinger Kantorei, Gesangverein Eintracht Unterboihingen und Musikverein Unterboihingen; (Marktplatz).
Birnsonntag:
Verteilen von Birnen, (Marktplatz).
10.30 Uhr bis 17.00 Uhr: DRKHocketse mit Live-Musik (Dorog-Platz).
11.00 Uhr: Frühschoppenkonzert, mit dem Musikverein Unterboihingen (Marktplatz).
11.00 Uhr: Empfang der Stadt Wendlingen am Neckar:
Vinzenzirede: „THE LÄND zwischen bewährten Traditionen und neuen Herausforderungen: der Blick nach vorne in unsicheren Zeiten“, von Thomas Strobl, Stellvertretender Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Musikalische Umrah-
der Eghalanda Gmoin e. V., Egerland-Kulturhaus,
FÜR DIE AUS DEM BEZIRK FALKENAU/EGER VERTRIEBENEN
Offizielles Organ des „Heimatverbandes der Falkenauer e.V.“
vereinigt mit
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
Heimatkreis Falkenau, Heimatkreisbetreuer: Gerhard Hampl, Von-Bezzel-Straße 2, 91053 Erlangen, eMail geha2@t-online.de
Heimatverband der Falkenauer e. V. Internet: www.falkenauer-ev.de 1. Vorsitzender: Gerhard Hampl; 2. Vorsitzender: Otto Ulsperger; eMail kontakt@falkenauer-ev.de
Falkenauer Heimatstube, Brauhausstraße 9, 92421 Schwandorf; Besichtigungstermine bei Wilhelm Dörfler, Telefon (0 94 31) 4 90 71, eMail wilhelm.doerfler@freenet.de
Spendenkonto: Heimatverband der Falkenauer e. V. , Sparkasse im Landkreis Schwandorf, IBAN DE90 7505 1040 0380 0055 46 Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Gerhard Hampl. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Für die Städte Elbogen und Schlaggenwald und den Landkreis im Egerland
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaft liches Arbeiten unmöglich machen würden.
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein / zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden.
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG mehr möglich ist
Viele Gossengrüner sind im Zweiten Weltkrieg gefallen. Gerhard Hampl erzählt von dem Verzeichnis mit den Namen der Gefallenen:
In unserem Buch „Gossengrün und sein Umland“ haben wir 1979 ein Verzeichnis der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Einwohner von Gossengrün veröffentlicht. Dieses beruhte auf den Meldungen von Familienangehörigen nach der Vertreibung an Pfarrer Rösch.
Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich ist
men. Bei vielen Namen ist aber der Geburtsort nicht aufgeführt, so daß viele Gossengrüner auf diese Weise nicht zu finden sind. Mit anderen Eingaben, wie dem genauen Geburtsdatum, kann man unter Umständen weitere Namen ermitteln. In der Übersicht sind diese Nennungen mit „VB“ gekennzeichnet.
Ich habe alle Quellen zusammengeführt. Insgesamt 129 Personen fielen oder wurden danach als vermißt gemeldet. Gossengrün hatte im Jahr 1938 insgesamt 1591 Einwohner. Der Blutzoll unserer Heimatgemeinde lag damit bei 8,1 Prozent. Einschließlich der Verfolgungstoten waren es im gesamten Sudeten-
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie unseren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Es enthält Namen von den zum Zeitpunkt ihres Todes in Gossengrün standesamtlich Gemeldeten, welche aber an einem anderen Ort geboren wurden. Ebenso enthält es die Namen von in Gossengrün geborenen Personen, welche jedoch an einem anderen Ort gelebt haben. Die aus dieser Zusammenstellung stammenden 106 Namen wurden in der Tabelle in der Spalte „Buch“ gekennzeichnet.
Mit traurigen Grüßen verbleiben wir
Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
land etwa 6,8 Prozent. Durch die Vertreibung im Jahr 1946 konnten den Gefallenen aus den Vertreibungsgebieten in ihrer Heimat keine Kriegerdenkmäler errichtet werden. Oft wurden diese Namen aber in den Wohnorten von nach 1946 auf den Kriegerdenkmälern aufgeführt.
Wir bedauern diesen Schritt sehr, gerade weil wir wissen, wie un seren Leserinnen und Lesern die Heimatzeitung am Herzen liegt, aber wenn eine Sache unwirtschaftlich wird, muß man sie beenden. Wir bedanken uns für Ihre jahrelange Treue.
Mit traurigen Grüßen verbleiben wir
Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG
Inzwischen sind im Internet die Unterlagen des Standesamtes mit den Sterbebüchern veröffentlicht auf der Website: Porta fontium/Inhalt/ Matriken/Standesamt 1938–1945/Kraiková Standesamt Gossengrün
Dort sind die Gefallenen einzeln aufgeführt.
In den von 1938 bis 1945 geführten Matriken sind 51 Namen von Gefallenen aufgeführt. Der erste dort angeführte Gefallene ist Georg Dürbeck aus Plumberg. Er fiel schon am 11. September 1939 in Polen, also zehn Tage nach Kriegsbeginn.
Der letzte standesamtliche Eintrag überhaupt stammt vom 2. August 1945. Spätere Gefallenenmeldungen sind demnach nicht berücksichtigt.
Insgesamt sind 28 in Gossengrün Geborene sowie 23 Gefallene, welche aus den zum Standesamt Gossengrün gehörenden Nachbargemeinden stammten, aufgeführt.
Im Band aus dem Jahr 1945 ist am Ende eine Liste der abgegebenen Sterbeurkunden gefallener Soldaten, welche an das Amt für Kriegsopfer in Falkenau abgesandt wurden, veröffentlicht.

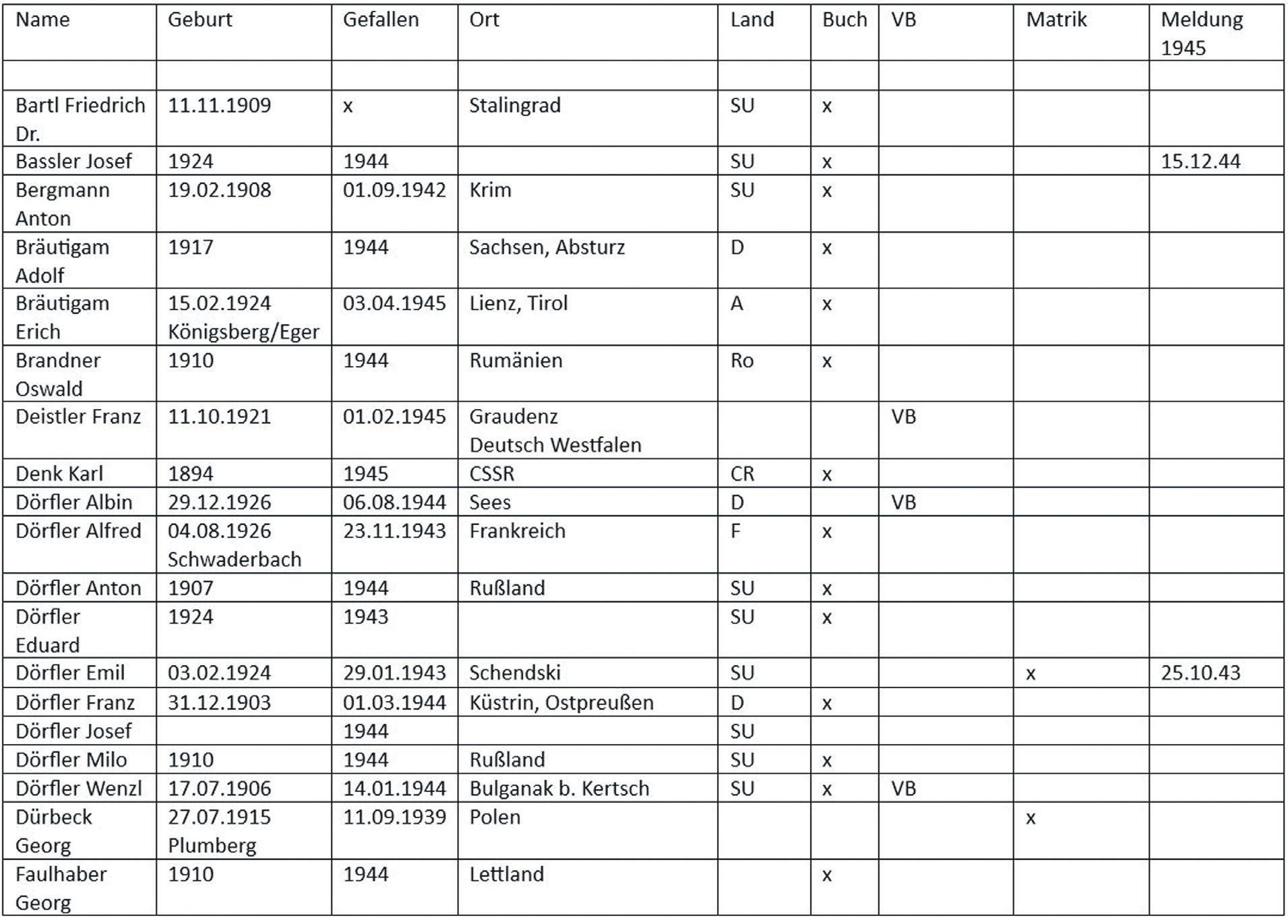
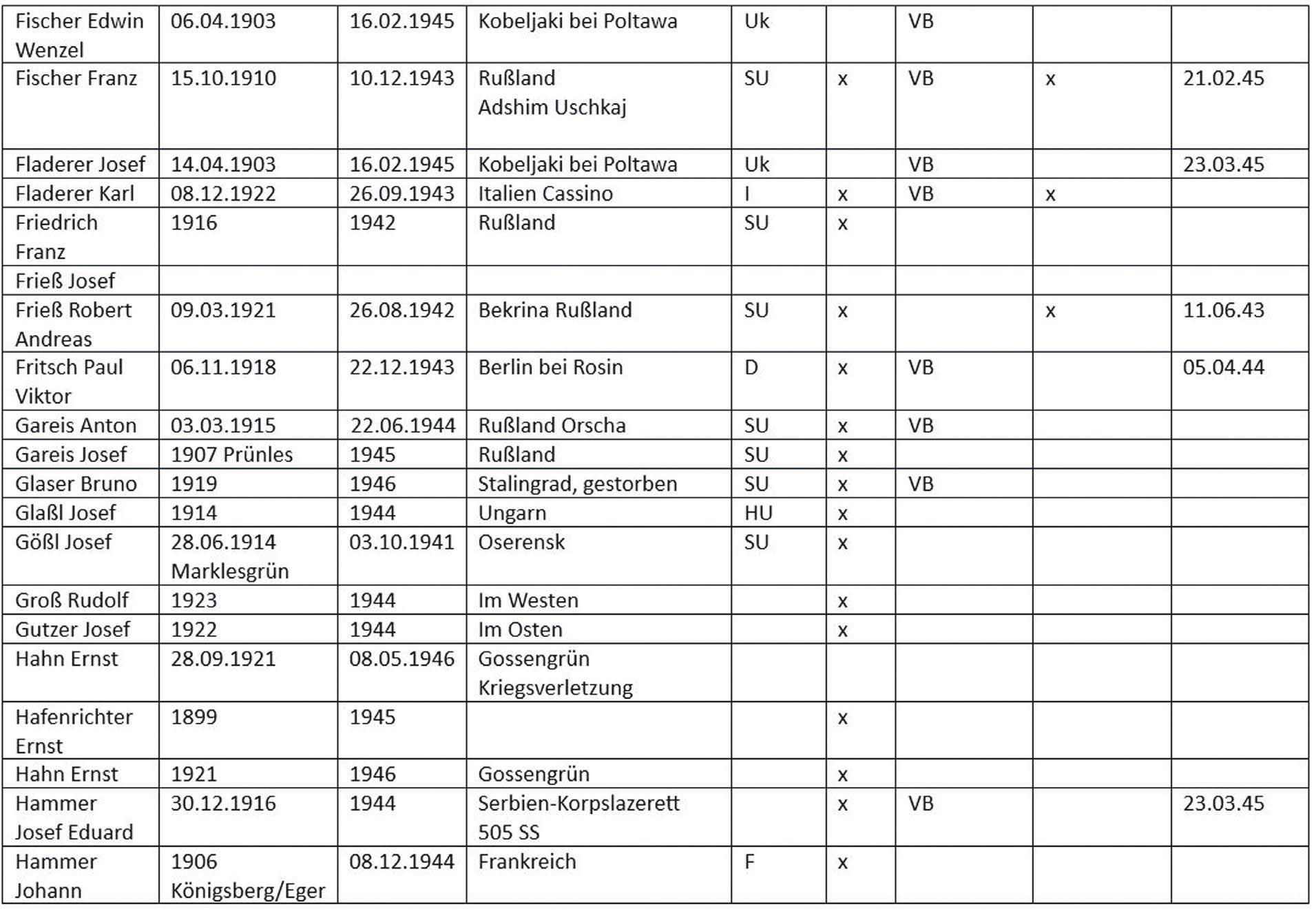
Diese enthält 64 Namen. Enthalten sind aber nicht nur Namen von Gossengrünern, sondern auch wieder Namen von Bewohnern der angegliederten Nachbarorte. In der Übersicht wurden diese Personen mit „Meldung 1945“ gekennzeichnet. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterhält unter „Gräbersuche online“ eine Homepage. Auf dieser Website kann man mittels Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum und Geburtsort gefallene oder vermißte Soldaten ermitteln. Insgesamt sind dort derzeit 4 841 398 Kriegstote verzeichnet. Sucht man mit dem Geburtsort „Gossengrün“, findet man 35 Na-
Ausschnitte (oben und unten) der Tabellen mit dem Namensverzeichnis der Geborenen und Gefallenen.
Der Heimatverband der Falkenauer gratuliert herzlich den im Monat Juli geborenen Landsleuten zum Geburtstag:
–100. Geburtstag: Treml, Hans, (Bleistadt), 03.07.1923.
–98.: Schreiter, Valerie, geb. Wildner (Boden), 06.07.1925.
–97.: Mandler, Hilde, geb. Zartner (Kirchenbirk), 13.07.1926.
–96.: Ulsperger, Bruno, (Wudingrün), 19.07.1927;
Schmidt, Elisabeth, (Tiefengrün), 19.07.1927.

–95.: Theisinger-Schülle, Waltraud, (Falkenau), 21.07.1928.


–94.: Zartner, Anna, geb. Siegl, (Haberspirk-Rad), 03.07.1929;
Schönecker, Anton, (Marklesgrün), 04.07.1929;
Riedl, Siegfried, (Schaben), 22.07.1929.
–92.: Wolf, Anna, geb. Müller, (Falkenau), 01.07.1931.
–91.: Keller, Erika, geb. Dörfler, (Zwodau), 29.07.1932.
–90.: Schilling, Maria, geb. Hofbauer-Becher, (Kogerau), 07.07.1933.
–89.: Wegerich, Anna-Maria, geb. Zuber, (Kirchenbirk), 08.07.1934; Hammerschmied, Ilse, geb. Wolfert, (Haberspirk-Rad), 17.07.1934;
Raab, Alma, geb. Dörfler, (Lanz), 30.07.1934. –86.: Sanftleben, Anna-Elisabeth, geb. Nickerl, (Haberspirk), 26.07.1937.
–85.: Mader, Helmut, (Grasseth-Königswerth), 27.07.1938.
–84.: Ölmüller, Emma, geb. Hrabak, (Prösau), 13.07.1939; Seiler, Elfriede, geb. Patzelt, (Falkenau), 16.07.1939.
–83.: Knorr, Herbert, (Schönbrunn), 30.07.1940; Hampl, Karl, (Meierhöfen), 29.07.1940.
–82.: Fritsch, Walter, (Schaben), 09.07.1941; Mayer, Ilse, (Prünles), 23.07.1941.
–81.: Lössl, Franz jun., (Oberneugrün), 11.07.1942.
–80.: Vater, Marianne, geb. Brandl, (Unterneugrün), 09.07.1943.
–78.: Seiler, Reinhard, (Zwodau), 09.07.1945.
Erinnerung an das Steinbach Prösau Oberreichenauer Treffen zu Maria Himmelfahrt:
n Samstag, 12. August:
14.00 Uhr: Treffen beim Prösauer Kriegerdenkmal mit kurzem Gedenken. Anschließend gemeinsame Fahrt zum Steinbacher Kriegerdenkmal mit Totengedenken.
Danach treffen wir uns wie im Vorjahr im „Steinbacher Wirtshäusl“. Auch interessierte Gäste aus der Umgebung sind herzlich will-
kommen. Dies gilt insbesondere auch für die „Daheimgebliebenen“.
n Sonntag, 18. August:
10.00 Uhr: „Egerländer Gebetstag“ in Maria Kulm (Heilige Messe). Anschließend „Wallfahrertreffen“ und Mittagskonzert der Egerländer Blaskapelle Münchenreuth am Marktplatz.
–Kontakt: Gerhard Hampl, Telefon (0 91 31) 50 11 15, email geha2@t-online.de
–Kontakt: Bruno Püchner, Telefon (0 81 65) 39 47, email Bpuechner@t-online.de
STAMMESZEITSCHRIFT –EGHALANDA BUNDESZEITING vereinigt mit
Egerer Landtag e. V., Geschäftsstelle in 92224 Amberg, Paradeplatz 11;
Vorsitzender: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, eMail wolf-dieter.hamperl@online.de Stellvertretende Vorsitzende: Helmut Reich und Dr. Ursula Schüller Für die Egerer Zeitung zuständig: Prof. Dr.-Ing. Alfred Neudörfer, eMail A.Neudoerfer@gmx.de – Kassenführung: Ute Mignon, eMail ute.mignon@online.de Spenden an: Sparkasse Amberg-Sulzbach, IBAN: DE73 7525 0000 0240 1051 22 – BIC: BYLADEM 1 ABG
Verantwortlich vonseiten des Egerer Landtag e. V.: Dr. Wolf-Dieter Hamperl – Redaktion: Lexa Wessel, Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
� Wirmsthal/Thalmässing
Das zehnjährige Heimattreffen der Sudetendeutschen fand im Wirmsthal/Thalmässing statt.
Die Nähe zu den Landsleuten ist eine unbedingte Voraussetzung für eine hohe Stufe der Verständigung. Dies bewies sich auch dieses Jahr wieder bei dem Jubiläumstreffen der Landsleute aus dem „Friedeberger Ländchen“ im Wirmsthal.
Brigitte Toharski aus Euerdorf, eine nachgeborene Franke und Mitarbeiterin in der Ortsbetreuung von Schwarzwasser, konnte zu diesem Treffen, neben vielen Bekannten aus der alten Heimat ihrer Eltern, Schwarzwasser/ Černá Voda, auch Landsleute aus dem Egerland und dem Erzgebirge begrüßen.
Dabei ist es schon Tradition, daß sich die Landsleute beim „Weinsommer“, welchen die Wirmsthaler Feuerwehr und der dortige Sportverein gemeinsam ausrichten, jedes Jahr treffen. Toharski betonte in ihrer Begrüßung: „Unsere Arbeit in der Ortsbetreuung ist geprägt von der Liebe zur Herkunftsheimat unserer Familien. Wir sind heute zwar fest verwurzelt in unserer neuen Heimat, aber wir haben uns die Liebe und das kulturelle Interesse bewahrt für die Länder und Regionen, aus denen unsere Familien stammen.“ An die
vielen Teilnehmer gerichtet sagte sie: „Unser gemeinsames Wirken hält die Erinnerungen aufrecht und wach.“
Als Gäste konnte Toharski auch die Ortsbetreuerfamilie
Brunhilde und Wilhelm Rubick begrüßen, die eigens aus ihrem jetzigen Heimatort Thalmässing (Mittelfranken) angereist war. Rubick bedankte sich bei Toharski und ihrer Tochter Silke für die vorbildliche Arbeit vor Ort. „Solche Heimattreffen können nur gelingen, wenn sich engagierte Landsleute dafür interessieren und Verantwortung übernehmen“, sagte Rubick, „Es sind die mutigen Menschen, die solche Dinge tun.“
Den Gedenkstein selbst besorgt die Gemeinde Schwarzwasser/Černá Voda. Die Inschrift in deutscher und in tschechischer Sprache wird lauten: „Den Toten der Heimat“. Nächstes Jahr soll der Gedenkstein voraussichtlich eingeweiht werden.
Die Stadt Eger öffnet die Katakomben unterhalb der Kaiserburg.
Die Egerer Burg, die einzige staufische Kaiserpfalz in Böhmen, welche nicht nur im Mittelalter eine bedeutende Rolle spielte, ist immer einen Besuch wert. Sie ist um eine neue Attraktion reicher geworden.
Die Burgverwaltung öffnete für die Öffentlichkeit mehrere hundert Meter unterirdischer Gänge, welche sich im Inneren der massiven barocken Befestigungsanlage befinden. Die „Schanzen“ entstanden in der Zeit, als um die Burg eine starke Festung für österreichische Garnisonen errichtet wurde.

Damals dienten die Katakomben wohl vornehmlich im Fall einer Belagerung als Lagerstätte für alles, was die Verteidiger brauchten, damit die Festung im Kriegsfall einer Belagerung Stand gehalten hätte. Wahrscheinlich waren militärische Ausrüstungsgestände und Waffen dort gelagert, möglicherweise auch Vorräte.
fühlen und zielgerichtet Denkmäler mit geheimnisvollen Gängen besuchen, dort nicht. „Es ist interessant, aber in unserem weitläufigen und komplexen Untergrund wird manchen Menschen unwohl, während andere euphorisch reagieren“, bestätigte der Burgkastellan, welcher die Besucher durch das Netzwerk der unterirdischen Gänge führt.
„Das Bild hat also eher etwas mit den traditionellen Wallensteinfesten der ursprünglichen deutschen Bürger zu tun, die hier stattfanden. Offenbar hatten sie auch Spaß im Untergrund, wahrscheinlich hatten sie dort in der angenehmen Kühle eine Kneipe, in der sie sich an heißen Sommertagen erfrischten“, mutmaßte der Kastellan.
Das Prager Jesulein wurde und wird in Böhmen sehr verehrt. Fast in jeder Pfarrkirche ist es zu finden. Das dargestellte Prager Jesulein steht in einem Glasschrein auf dem Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Heiligen Ulrich und Prokop in Altzedlisch im ehemaligen Bezirk Tachau. Es durfte 2008 die Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.
Ein besonderer Gruß Rubicks ging an die Egerländer und Erzgebirgler – schließlich ist er doch selbst in Ulrichsgrün/ Oldřichov am Fuße des Tillen, dem Hausberg der Egerer, geboren worden.
Rubick gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene erste Halbjahr mit Treffen am
1. Mai in Pfronten und beim „Sudetendeutschen Tag“ in Regensburg. Das Setzdorfer Heimattreffen findet am 2. Juli in Westendorf bei Augsburg statt.
Die diesjährige Heimatfahrt in das „Friedeberger Ländchen“ mit Schwerpunkt Schwarzwasser findet vom 31. August bis zum
4. September statt mit Gesprächen über die Aufstellung eines Gedenksteins in Schwarzwasser, so Rubick. Von kirchlicher Seite liegt die Genehmigung bereits vor, daß der Stein im Kirchenzentrum aufgestellt werden darf.
Rubick lernte den Betreuer dieser Region, Roland Jäger, im Jahr 2022 bei einer Fahrt zum Friedensmarsch nach Brünn kennen. In Gesprächen stellte sich heraus, daß er bei Bad Kissingen beheimatet ist und die Landsleute aus der Region Egerland und Erzgebirge betreut. Spontan gab er die Zustimmung, sich mit seinen Landsleuten am „Weinsommer“ in Wirmsthal zu beteiligen, was er nun auch eingehalten hat.
Die älteste Teilnehmerin war Hermine Schimmel mit 92 Jahren, geboren im Kreis Jägerndorf.


Heute fällt auf, daß die Gänge relativ feucht sind. Denn unter dem kommunistischen Regime wurden viele Öffnungen zugemauert. Diese dienten dazu, das Innere des Bauwerkes zu belüften sowie das durchgesikkerte Wasser abzuleiten. Wie es wirklich war, könne heute wahrscheinlich nicht mehr eindeutig ermittelt werden, da sich der ursprüngliche Zustand der Festung nicht mehr genau ermitteln lasse, stellte die Burgverwaltung dazu fest.
An Überraschungen mangelt es für Besucher, welche sich zur unterirdischen Welt hingezogen
Ihm zufolge gibt es tradierte Gerüchte, daß der Eingang zu dieser Unterwelt von einer Gestalt in einem schwarzen Umhang und mit einem schwarzen Hut bewacht würde. Dieser Geist könne ungebetene Besucher schnell aus dem Schloß geleiten.
An der Wand eines der Gänge hängt ein in Schwarz gehaltenes Bild: angeblich ein Bildnis des Teufels. Es heißt, daß genau solch ein Zeichen den Ort markiere, an welchem man in die Hölle oder vielleicht in eine andere Welt gelangen könne.

Aber im gleichen Atemzug fügte er hinzu, daß der Eingang zur Hölle die Inschrift „Guter Wein lindert Kummer“ trägt.
Die Unterwelt der ehrwürdigen, von den Staufen erbauten Burg mit ihrem markanten Schwarzen Turm darf aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung von Fach- und Ortskundigen besichtigt werden.
Interessenten können den barocken Untergrund während der Sommerferien bis zum 27. August 2023 jede Woche, von Mittwoch bis Sonntag, besichtigen. Führungen finden immer zu jeder vollen Stunde von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt.
Weiterführende Informationen hält das Touristenzentrum auf dem Marktplatz bereit. Kontakt: Telefon +42 03 54 44 03 02, eMail infocentrum@cheb.cz dr
Bis um 20.00 Uhr saß die rührige Ortsbetreuerin Toharski mit den Landsleuten zusammen. Bis es hieß: „Wenn nächstes Jahr der ,Weinsommer‘ ruft, sehen wir uns wieder.“ Robert
Unterburger� Juli 2023 – Geburtstage und Danksagung
Wir gratulieren allen, die im Monat Juli in Langgrün Geburtstag haben, und wünschen ihnen alles Gute und Gesundheit im neuen Lebensjahr:
– 84. Geburtstag: Werner Männl, 1. Juli, 65399 Kiedrich/Rheingau, Rheinblick Nummer 5 (Schuasta Resl).
– 82. Geburtstag: Herbert Dressler, 20. Juli, 92334 Berching, Walnsdorf, (Matzn Hannasn).
– 82. Geburtstag: Horst Dressler, 20. Juli,, 92334 Berching, Maria-Hilf-Straße 12, (Matzn Hannasn).
– 83. Geburtstag: Werner Lifka, 29. Juli, 84095 Furth, Birkenstraße 5.
Erhaltene Spende: Außerdem bedanken wir uns für eine eingegangene Spende an die Zeitung: 30,00 Euro, Wunderlich Gisela. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Die Archivalien des „Egerer Landtags e.V.“ kamen in das Staatsarchiv Amberg:

Bei dem letzten Bericht aus der Geschäftsstelle in Amberg konnte ich Ihnen mitteilen, daß die Archivierung unseres Vereinsarchivs, des heimatkundlichen Archivs und persönlicher Dokumente, wie zum Beispiel Zeugnisse, Urkunden oder Ausweise, Ende Februar 2023 durch Leonhard Strobel M.A. abgeschlossen worden ist.
Am Montag, den 24. April
2023 wurden die 25 Archivkartons und drei Holzkarteikästen vom Personal des Staatsarchivs Amberg abgeholt und dort in den Aufnahmeraum gebracht. Maria Rita Sagstetter, die Direktorin des Staatsarchivs Amberg, empfing uns, den Vorsitzenden, die Stellvertretende Vorsitzende Ursula Schüller, Bruni und Wilhelm Rubick und Georg Gottfried, in ihren Amtsräumen zur feierlichen Übergabe und Unterschrift des Schenkungsver-

trages.
Sagstetter bedankte sich sehr für das ihr und ihrem Archiv entgegengebrachte Vertrauen. Wolf-Dieter Hamperl erinnerte daran, daß Sagstetter von Anfang an großes Interesse an unserem Vorhaben zeigte und uns stets mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie hat uns auch den Historiker Strobel vermittelt, welcher leider nicht anwesend sein konnte.
Anschließend führte uns die Archivdirektorin durch Teile des weitläufigen Archivs, zeigte uns
den Aufnahmeraum mit den dort gelagerten Kartons, demonstrierte uns, wie die Kartons noch gekennzeichnet und wo sie letztendlich gelagert werden.
Zwei Mappen mit Landkarten des Egerlandes, Stadtplänen von Eger, alten Grafiken von Eger, Aquarellen, Zeichnungen und Ölbildern zum historischen Aussehen der einst freien Reichsstadt werden nachgereicht.
Wir sind sehr glücklich, daß zwischen unserem Verein und dem Staatsarchiv Amberg ein so
vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut werden konnte. Ebenso freuen wir uns, daß die Archivalien der 70jährigen Geschichte des „Egerer Landtags e.V.“ im Staatsarchiv Amberg aufgenommen worden sind, das der letzte Stadtarchivar von Eger, Heribert Sturm, über Jahre hinweg geleitet hatte. So konnte auch in dieser Hinsicht eine Kontinuität fortgesetzt werden.
Daß das Amberger Staatsarchiv auch viele Egerländer Archivalien besitzt, zeigt das Ge-
schenk von Sagstetter: eine Reproduktion einer „handgezeichneten Karte des zu dem kaiserlichen Rittergut Kinsberg gehörigen Reichsforstes und der umliegenden Gründe und Ortschaften (Eger, Schönlind, Neualbenreuth, und andere).
Für die nahe Zukunft ist geplant, die Bestände zu digitalisieren und in dem europäischen, grenzüberschreitenden bayerisch-böhmischen Programm www.portafontium zugängig zu machen. fl
Wilhelm Rubick teilt seine Erinnerungen an die Vertreibung:
Es war im August 1984. Wir, meine Mutter, meine Frau Brunhilde, unsere beiden Töchter Nicole und Gabi und ich, waren unterwegs nach Ulrichsgrün, meinem Geburtsort sowie dem Geburtsort meiner Mutter.
Ulrichsgrün ist beziehungsweise war eine kleine Ansiedlung im Egerland, am Fuß des „Tillen“, nahe der bayerisch-tschechischen Grenze. Der Tillenberg mit einer Höhe von 939 Metern ist der nördlichste Ausläufer des Böhmerwaldes. Von seinen Hängen aus erstreckt sich nach Norden das Egerbecken. Typisch für diese Gegend waren die stattlichen Vierseithöfe.
Über Tirschenreuth führte uns unser Weg durch Neualbenreuth eine Anhöhe hinauf, am Grenzlandturm vorbei, ein paar hundert Meter über einen Feldweg.
Am Ende mußten wir das Auto stehen lassen.
Ich kannte diese Strecke von früheren Fahrten, auch meiner Mutter war das letzte Wegstück bestens bekannt. Nutzte sie doch diesen Weg vor dem Krieg, übrigens wie viele andere Ulrichsgrüner auch, um über die bayerisch-tschechische Grenze zu „baschen“ (schmuggeln).
Zu Fuß ging es weiter, linker Seite an einem Waldstück entlang. Die rechte Seite war Ackerland. Dahinter aber schon der Ulrichsgrüner Wald und der Tillen, der uns stets begleitete.
Dabei diskutierten Mama und ich eifrig über Land und Leute und beantworteten vorweg schon einmal die neugierigen Fragen der Kinder.
Als wir dann eine kleine Anhöhe erreichten und um die Kurve bogen, sahen wir den Ort, unseren Geburtsort – oder besser das, was die Tschechen davon übriggelassen haben. Nämlich gar nichts.
Links am Waldrand saßen zwei deutsche Grenzer, weiter hinten, vom Gestrüpp verdeckt, befand sich ein älterer hölzerner Unterstand, schon ein wenig schief und mit Sicherheit nicht mehr wasserdicht.
Ich versuchte ein Gespräch mit den beiden, doch sie zuckten nur mit den Schultern. Sie äußerten sich auch nicht, als wir weiter zur Grenze marschierten.
Ungefähr mittig zwischen Wald und Ulrichsgrün verläuft die bayerisch-tschechische Grenze. Auf bayerischer Seite verläuft ein breiter Streifen Niemandsland, auf dem wir uns bereits befanden. Es war nicht ratsam, sich länger dort aufzuhalten. Jedoch
war unser unbändiger Wunsch, dem Dorf so nahe wie möglich zu kommen, größer als die Furcht vor den Tschechen.
Und da standen wir nun an der Grenze, etwa 300 Meter entfernt von unserer total zerstörten Ortschaft. Keine Anlage wie die der früheren „DDR“ mit Stacheldraht und Selbstschußanlagen. Lediglich alle 50 Meter ein rot-weißer Pfosten. Eine Grenze, die eigentlich einlädt, sie zu überschreiten.
Was wäre wohl geschehen, hätten wir die Grenze überschritten, wären in unser Dorf, unsere Heimat, unser eigenes Land gegangen?
In Gedanken ließen wir die Grausamkeiten der Tschechen vor 1945 aufleben. Da standen wir nun, vor einem „geschleiften“ Ort, der einmal unsere Heimat war. Dort, wo einmal prächtige Gehöfte standen, waren nur noch Gestrüpp und schnellwachsende Bäume, die keinen Blick auf Mauerreste oder Ruinen freigaben. Es war, als würde die Zeit stillstehen. Mama war eine starke Frau – im Februar 1945 mußte sie den Verlust ihres Mannes hinnehmen, welcher in Ungarn vermißt gemeldet wurde.
1946 erfolgte die Flucht und anschließend ein Hungerjahr im Schwäbischen. Ein Jahr später war der Umzug nach Liebenstadt
bei Heideck. Und in dieser elenden Zeit mußte sie alleine drei Kinder großziehen. Sie hat dies alles großartig bewältigt – und war nun ihrer zerstörten Heimat so nahe.
Sie wandte sich ab, als ihr die Tränen über die Wangen rollten. Es war ein stilles Weinen. Keiner sprach, jeder hing seinen Gedanken nach.
In meinen Erinnerungen lasse ich das Dorf wieder auferstehen: 17 meist großartig mit Fachwerk verzierte Vierseithöfe, zwei Gasthäuser, eine nahezu neue Schule und ein Schuhmacher bildeten den Kern von Ulrichsgrün.
Etwas außerhalb das Forsthauses und in entgegengesetzter Richtung gab es eine Pelztierfarm. Am Tillen stand das Tillenberg-Schutzhaus. Die Wanderer aus Eger und der Umgebung verbrachten dort unvergeßliche Stunden.
Unterhalb von Ulrichsgrün, von der Grenze nicht einsehbar, standen zwei Mühlen, die Gleisinger- und die Buchamühle, aus der meine Mutter stammt. Meine zwei Schwestern, Anni und Marianne, und auch ich wurden dort geboren.
Nach meiner Geburt 1940 wohnten wir im Gemeindehaus, etwa in der Mitte des Ortes. Daneben lag der Gemischtwarenhandel der Familie Renz. Die Familie Renz hatte zwei Töchter.

Marianne, die Jüngere, damals 17 Jahre alt, trug 1944 als Christkind verkleidet bei uns den Christbaum die Stiege herunter. Dabei stieß sie mit der Spitze oben an – und weg war die Christbaumspitze!
Ein Jahr darauf widerfuhr ihr ein furchtbares Unglück. Sie war eines von zehn Opfern, die nach dem Krieg an der Grenze von Ulrichsgrün erschossen wurden. Es war der 13. November 1945, als ein fröhliches, blühendes Leben ausgelöscht wurde.
Erst kam ein Bauchschuß der Tschechen, und dann folgte der Gnadenschuß in den Kopf. Ich denke, daß so furchtbare Taten nicht verschwiegen werden dür-
fen.
Eine gewaltige Detonation riß mich ruckartig aus meinen Träumen. Der Giebel einer noch verbliebenen Großscheune wurde gesprengt und brach in einer gewaltigen Staubwolke in sich zusammen. Diese Scheune war der Rest, einer bis vor ein paar Jahren noch betriebenen Kolchose.
Als wir nach der Wende 1989 unsere ehemalige Ortschaft aufsuchten – diesmal von der tschechischen Seite – waren die letzten Mauerreste unter Gras, Gebüsch, Brennnesseln und schnellwachsenden Bäumen verschwunden, wie auch

das übrige Dorf. Die Natur hatte sich zurückgeholt, was ihr Mitte des 12. Jahrhunderts von fränkischen Siedlern abgetrotzt wurde. Am 6. März 1946 flüchteten wir über die nahe Grenze nach Neualbenreuth in Bayern. Wenn ich jetzt, 60 Jahre nach der Vertreibung, zurückblicke, muß ich gestehen, daß mich noch eine unbändige Liebe mit der Heimat verbindet. Sind wir denn nicht dort zu Hause, wo wir geboren wurden? Wo wir in einer heilen Welt unter den Fittichen einer fürsorglichen Familie geborgen und unbeschwert aufwachsen? Fortsetzung folgt

Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.
Heimatzeitung des Weltkulturortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt und Landkreis Mitteilungsblatt des Heimatverbandes der Karlsbader e. V.

Heimatzeitung des Weltkurortes Karlsbad/Sudetenland – Stadt- und Landkreis vereinigt mit
Heimatkreis Karlsbad, Heimatkreisbetreuerin: Dr. Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de

Heimatverband der Karlsbader, Internet: www.carlsbad.de 1. Vorsitzender: Dr. Peter Küffner; 2. Vorsitzende: Dr. Pia Eschbaumer; Schatzmeister und Sonderbeauftragter: Rudolf Baier, eMail baier_rudolf@hotmail.de Geschäftsführerin: Susanne Pollak, eMail heimatverband@carlsbad.de. Patenstadt Wiesbaden. Karlsbader Museum und Archiv, Oranienstraße 3, 65185 Wiesbaden; Besichtigungstermine bei Dr. H. Engel, Telefon (06 41) 4 24 22.
Spendenkonto: Heimatverband der Karlsbader, Kreissparkasse München, IBAN: DE31 7025 0150 0070 5523 44, BIC: BYLADEM1KS –Verantwortlich von seiten des Heimatverbandes: Pia Eschbaumer. Redaktion: Lexa Wessel. Redaktionsschluß: 20. des Vormonats.
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
Unabhängiges und überparteiliches Mitteilungsblatt für den Kreis Luditz-Buchau und Deutsch-Manetin
66. JAHRGANG Jänner 2016 FOLGE 1
Dr. Pia Eschbaumer – weiter auf Seite 18
72. JAHRGANG Dezember 2022
Liebe Landsleute, zum Geburtstag im Juli gratulieren wir herzlich unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, nämlich zum: –83. Geburtstag am 13. Juli Helga Müller/Haschek, ehemalige Gemeindebetreuerin Fischern und Meierhöfen, 08258 Markneukirchen; –79. am 11. Rudolf Baier, Gemeindebetreuer Edersgrün, Espenthor und Schneidmühl, Beirat im HVdK, 84030 Ergolding; –74. am 21. Rudolf Kreisl, Gemeindebetreuer Grasengrün, Rodisfort, Sodau/Halmgrün/Großenteich, 90455 Nürnberg.
Wir wünschen alles Gute, besonders aber gute Gesundheit!
An dieser Stelle möchte ich auf die mir schon bekannten Treffen in diesem Jahr hinweisen:
– Die Sittmesgrüner kommen bereits am Sonntag, den 30. Juli 2023, in Nürnberg-Katzwang zusammen (genaueres dazu finden Sie unter Sittmesgrün).
– Die Drahowitzer ruft Erwin Zwerschina am Sonntag, den 10. September 2023, wie gewohnt in den Kapellenhof in Roßtal.
– Unsere jährliche Hauptversammlung des HVdK wird am 24. September in Roßtal stattfinden; die Mitglieder werden wieder eine schriftliche Einladung erhalten.
Heute will ich aus gegebenem Anlaß über die Grenzen des Karlsbader Kreises hinausblikken: Ich kam nämlich kürzlich von einer viertägigen Reise nach Aussig zurück, welche überaus sachkundig und freundlich von Dr. W. Schwarz vom „Adalbert Stifter Verein“ geleitet wurde. Ziel war an erster Stelle die dort vor fast zwei Jahren eröffnete Ausstellung „Naši Němci“ („Unsere Deutschen“). Der Ort Aussig, besonders die dortige Brücke über die Elbe, steht stellvertretend für die vielen Grausamkeiten, welche nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges den deutschen Einwohnern Böhmens zugefügt wurden. Und nun an diesem Ort eine Ausstellung mit dem Titel „Unsere Deutschen“? – darauf war ich gespannt.
Aber es stand auch viel mehr
auf dem Programm, und ich verstand bald, daß die Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen dabei stets eine wichtige Rolle spielten. Wir haben so viel gesehen, daß ich hier nicht auf alle Stationen eingehen kann. Ich will nur diese herausgreifen, die mich am meisten berührt haben.
Unser erstes Ziel, noch vor der Grenze, war Schönsee mit dem „Centrum Bavaria Bohemia“ –schon dort war das Thema gesetzt. Veronika Hofinger, Leiterin des „Centrum Bavaria Bohemia“ (CeBB), gewährte uns Einblikke in die vielfältigen grenzüberscheitenden Aktivitäten, die dort organisiert werden: Gesprächsrunden, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Begegnungen aller Art – das war beeindruckend und verdient unser aller Bewunderung. Die Grenze trennt nicht mehr, sondern ist, wie in früheren Zeiten, durchlässig. Die Menschen kommen von beiden Seiten zusammen, lernen sich kennen und schließen Freundschaften. Ein Sinnbild dafür ist die Doppelstatue des Heiligen Nepomuk vor dem „Centrum Bavaria Bohemia“: Der eine blickt nach Böhmen, der andere nach Bayern. In beiden Ländern ist er ein hochverehrter Heiliger.



Am nächsten Tag stand dann die Ausstellung „Naši Němci“/ „Unsere Deutschen“ in Aussig auf dem Programm, durch welche uns zunächst sachkundig ein Vertreter des Collegium Bohemicum führte, bevor wir sie dann individuell betrachten konnten. Sie ist so umfangreich, daß zumindest ich nicht alle Texte lesen, alle Schubladen mit Dokumenten aufziehen konnte. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, daß die Geschichte recht objektiv dargestellt und nichts verheimlicht oder beschönigt wird.
Die frühe Geschichte wird nur sehr knapp dargestellt. Jedoch wird deutlich gemacht, daß die vor langer Zeit aus den deutschsprachigen Ländern zugewanderten Menschen seit Jahrhunderten Teil der Bevölkerung
Böhmens waren. Sie kamen keineswegs als Okkupanten, son-
dern wurden von den Landesherren häufig aufgefordert, das Land zu besiedeln und ihre Kenntnisse einzubringen.
Ausführlich geht es dann um die Geschichte ab dem 19. Jahrhundert, als der Nationalismus auf beiden Seiten das Zusammenleben immer konfliktreicher machte. Noch nie hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, wie schmerzlich es für Tschechen und Slowaken gewesen sein muß, im Ersten Weltkrieg gegen slawische Völker kämpfen zu müssen. Aber dennoch rechtfertigen solche Erfahrungen nicht die Art, wie die deutsche Bevölkerung dann nach dem Weltkrieg behandelt wurde, bis hin zu getöteten Zivilisten bei Protesten.
Die wenigen Jahrzehnte bis zum bitteren Ende der gemeinsamen Geschichte werden mit vielen Dokumenten erlebbar gemacht, bis hin zu berührenden Zeugnissen der Vertreibung, die auch Teil der Darstellung ist.
Angesichts der konfliktreichen Vorgeschichte sowie der Geschichtsverfälschung unter dem kommunistischen Regime, mit der zwei Generationen aufgewachsen sind, und den vielen daraus resultierenden Vorurteilen kann man die Einrichtung solch einer Ausstellung nicht hoch genug einschätzen. Sie hat übrigens, wie man uns auf Nachfrage versicherte, keine Proteste hervorgerufen. Auch das empfinde ich als ermutigendes Zeichen.
Nun wird es Zeit, wieder einmal durch das Sudetendeutsche Museum in München zu gehen und zu sehen, ob und wie die Er-

� Juli 2023 – weiter auf Seite 22
Karlsbad Stadt


Gemeindebetreuerin Pia Eschbaumer, Elektrastraße 44a, 81925 München, Telefon (0 89) 92 40 96 31, eMail kreisbetreuung@carlsbad.de
Wir gratulieren herzlich allen Geburtstagskindern des Monats Juli, namentlich zum:
–98. Geburtstag am
Forschungsraum“ verfügen sollte.
eignisse unterschiedlich dargestellt werden.
Ein besonderer Ort ist das Kulturzentrum in Groß Tschochau/ Řehlovice: ein riesiges, teilweise verfallenes Anwesen, ehemalige Meierei mit Brauerei. Aus diesem Ort machte Lenka Holíková eine „Plattform für Kulturveranstaltungen verschiedenster Art“ und einen „Begegnungsort für Menschen aus Deutschland und Bitte umblättern
19. Juli Nitsche/Ritter, Edeltraud, (Prager Gasse), 63667 Nidda; –89. am 01. Zaha/Pech, Anna, (Röhrengasse 9), 95131 Schwarzenbach am Wald.

Wir wünschen Gesundheit und viele schöne Tage!
Liebe Landsleute, es ist soweit: Nach mehrjähriger Renovierung ist das Kaiserbad gerade wieder eröffnet worden.
Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder einmal dazu geschrieben: Im Januar/Jänner 2020 war ich noch recht skeptisch bezüglich der Meldung, daß dort ein Konzertsaal entstehen soll: „Hoffentlich wird daraus etwas!“
Im März 2020 gab es einen Blick zurück auf die jüngste Geschichte und den desolaten Zustand des Gebäudes. Aber es gab auch einen Blick in die Zukunft, in welcher der Bau über „einen multifunktionalen Raum, mehrere Museumsausstellungen, ein Café, einen Lesesaal und einen
Im Juli 2020 habe ich über die baubegleitende Ausgrabung berichtet, bei der Teile der früher dort ansässigen Bürgerbrauerei freigelegt wurden (auf meine Frage: „Und wer kann mir sagen, wie es nach 1893 mit der Bürgerbrauerei weiterging? Ist sie umgezogen, wohin? Oder wurde sie eingestellt?“ habe ich leider bis heute keine Antwort erhalten). Im letzten Oktober konnte ich dann mit einer Fotografie der Baustelle belegen, daß die Renovierung schon sehr weit fortgeschritten war.
Nun ist das Werk also tatsächlich vollendet, und es scheint wunderbar gelungen zu sein, wie ich den Dokumentationen entnehmen kann. Denn selbst konnte ich leider nicht vor Ort sein –entgegen meiner wohl allzu vorwitzigen Aussage „ich merke mir die Einweihung im Jahr 2023 schon einmal vor“; aber heuer werde ich mir das noch ansehen! Vorläufig muß ich mich mit einem Filmbericht des tschechischen Fernsehens von der Eröffnung begnügen, den man online abrufen kann auf der Website: https://www.ceskatelevize.cz/ porady/15766570303-slavnostniznovuotevreni-cisarskych-lazniv-karlovych-varech/ Zu Beginn gibt es eine Performance zur Renovierung, als Hauptteil dann das Festkonzert; dazwischen führt ein Moderator durch das Haus – das kann man Bitte umblättern
„Unsere Deutschen“Das Kaiserbad in Karlsbad. Fotos: Karlovy-vary.cz Die Villa von Johanna von Herzogenberg in Aussig-Birnai. Statue des Heiligen Nepomuk in Schönsee. Die Klosterkirche in Ossegg/Osek. Das Karlsbader Kaiserbad in der Abendsonne.
❯ Bericht der Kreisbetreuerin Dr. Pia Eschbaumer – Fortsetzung zu Seite 17
aus Tschechien“. Auch dort war also wieder unser Thema zu finden.
Um ein anderes, noch größeres Anwesen kümmert sich ein in Sachsen ansässiger Freundeskreis unter Leitung von W. Sperling; er wurde gegründet, um
❯ Juli 2023 – weiter auf Seite 19
auch genießen, ohne der tschechischen Sprache mächtig zu sein. Wunderschöne Bilder, ich kann das nur empfehlen. Weitere Informationen gibt es im Netz auf der Website cisarskelazne.cz – diese Seite wird hoffentlich noch mehrsprachig gestaltet.
Vielleicht fragen Sie sich, wo in dem Gebäude denn ein Konzertsaal Platz findet – es hat schließlich einen Grundriß wie ein breites „D“. Man hat ihn in den offenen Innenhof eingebaut, den man zu diesem Zweck überdacht hat – was man von außen jedoch nicht sieht.
Dieser vielfältig nutzbare Saal – nicht nur für Konzerte – bietet eine Bühne und rund 300 Sitzplätze in ansteigenden Reihen. Auch weitere Räume, wie der große Zandersaal (früher mit Fitneß-Geräten bestückt), stehen für Veranstaltungen zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Bades, die für Kaiser FranzJoseph bestimmte luxuriöse Badekabine wurde detailgetreu restauriert – bei einer Führung kann man eintauchen in das Badeflair der, nach G. Clemenceau, „wohl prunkvollsten Badeanstalt der Welt“.
Doch das ist etwas für den Winter – in den nächsten Wochen genießen wir doch besser das Freibad oder einen kühlen See. Einen schönen Sommer wünscht Ihnen, Pia Eschbaumer
Im Stadtkreis: Drahowitz
Gemeindebetreuer Erwin Zwerschina, Am Lohgraben 21, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Telefon (0 96 61) 31 52, Fax (0 96 61)







8 13 78 37
Im Monat Juli gratulieren wir unseren Jubilaren herzlich zum: –99. Geburtstag am 24. Juli Zink/ Netwal, Helene, (Danziger Straße 8), 91085 Weisendorf, Erlanger Stra-
das ehemalige Zisterzienserkloster Osek „bei der Erfüllung religiöser, sozialer und völkerverbindender Aufgaben zu unterstützen.“ Ein großer Erfolg: Die reich stukkierte Klosterkirche, ein barockes Juwel, erstrahlt in frischem Glanz.
Am Morgen unserer Rückfahrt von Aussig führte uns der Weg zunächst zu einer Villa im Vorort Birnai/Brná, in der Johanna von Herzogenberg ihre Jugend verbrachte. Die langjährige Geschäftsführerin des „Adalbert Stifter Vereins“ hat
diesen wesentlich geprägt. Sie hat sich unermüdlich darum bemüht, die trennende Grenze zu überwinden und damit „dazu beigetragen, daß trotz des Eisernen Vorhangs Osteuropa als Teil des Europäischen Kulturraumes in unserem Bewußt-
sein gegenwärtig blieb“. Im Garten las Dr. Schwarz einige Passagen aus ihrer Autobiographie Bilderbogen vor – Begebenheiten, die sich genau an diesem Ort zugetragen haben. Ein berührender Ausklang unserer Reise.
ße 11a; –91. am 01. Brumeisl/ Meissl, Berta (Oststraße 93), 64665 Alsbach, Hähnleiner Straße 9; –84. am 10. Scheuerer/ Leicht, Herta, (Mattoni Straße 305), 93095 Hagelstadt, Eichenstraße 12.
Der „Sudetendeutsche Tag“ in Regensburg führte 22 Besucher im Drahowitzer Erinnerungsbuch zusammen, davon gerade einmal drei Drahowitzer, mit mir Berta Brumeisl und Sibylle Ottmann – welch ein Vergleich zu vergangenen Treffen. Wie schon im Jahr 2019 in Regensburg hatte ich auch dieses Mal unseren Sachsengrüner Kollegen Gerhard Hacker ab Wackersdorf als Beifahrer dabei. Und erfreulicherweise war ab dem Regensburger Bahnhof auch unser früherer Pirkenhammerer Kollege Albin Peter dabei, welcher, trotz seines stolzen Jahrgangs 1925, von Neuburg/Donau angereist war.
Der Bummel entlang der sudetendeutschen Ausstellungsstände war auch diesmal wieder ein kultureller Leckerbissen und führte hier und dort zu Gesprächen, anknüpfend an eigene Erinnerungen. Organisatorisch die geografische Gebietseinteilung im großen Saal betreffend würde ich die Zeugnisnote Drei erteilen und daher sagen: „Schaun ma mal, wo ma s‘nächste Mal san“. Unsere nächsten Termine bitte ich recht zahlreich anzunehmen: – Drahowitzer Treffen in Roßtal am Sonntag, 10. September 2023, und die Jahreshauptversammlung des Heimatverbandes der Karlsbader in Roßtal am 24. September 2023 mit einer Übernachtungsmöglichkeit für weit Angereiste.
Ihr Erwin Zwerschina
Kohlhau
Gemeindebetreuer Albin Häring, Clemens-Brentano-Str. 22, 35043 Marburg/L.-Cappel, Telefon/Fax (0 64 21) 4 53 02 Über den “73. Sudetendeutschen Tag“ zu Pfingsten in Regensburg wurden Sie, liebe Landsleute, durch die Berichte mit vielen Fotografien in der Sudetendeutschen Zeitung
informiert. Ich selbst habe auch teilgenommen, trotz Bedenken wegen der weiten Entfernung und den damit verbundenen körperlichen Herausforderungen. Aber ich habe es nicht bereut. Die „Sudetendeutschen Tage“ heute, 76 Jahre nach unserer Vertreibung, sind nicht mehr mit denen aus der Zelt etwa vor dem Jahr 2000 zu vergleichen. Bis dahin hat sich noch die Erlebnisgeneration, unsere Eltern und Großeltern, aus der alten Heimat getroffen. Die Bilder von den überfüllten Messehallen seinerzeit sind allen, die dabei waren, bekannt und in guter Erinnerung. Seinerzeit lebten auch etliche Kohlhauer Landsleute in Regensburg beziehungsweise in der weiteren Umgebung.
In diesem Jahr ist mir kein Kohlhauer mehr begegnet. Dennoch bin ich froh, dabei gewesen zu sein und die Atmosphäre unter den Sudetendeutschen Landsleuten sowie die Darbietungen und Präsentationen der immer noch vorhandenen Sudetendeutschen Gemeinschaften erlebt zu haben. Darüberhinaus ist Regensburg, unabhängig von dem „Sudetendeutschen Tag“, eine wunderschöne, geschichtsträchtige Stadt, in welcher man es auch gut länger aushalten könnte.
In diesem Monat möchte ich Sie wieder an unser Kohlhauer (Sankt-Anna-) Fest erinnern, am 26. Juli.
Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag allen, die auf den Namen „Anna“ getauft sind.
Solange der nach unserer Vertreibung in Donawitz wirkende Pfarrer, Monsignore Josef Mixa, lebte, hatte er an diesem Tag auch in Kohlhau vor der Sankt-Anna-Kapelle einen Gottesdienst abgehalten, und unsere im Jahr 2019 verstorbene Herta Hess mit ihrer Familie war immer dabei gewesen. Monsignore Mixa ist, hochbetagt, auch schon verstorben und in Donawitz be-
erdigt worden. Gerne erinnert man sich an die Gottesdienste, die er für uns bei den verschiedenen, von dem damaligen Ortsbetreuer Helmut Hain organisierten Kirchsprengeltreffen, zuletzt lm Jahr 2009, in der Donawitzer Pfarrkirche gestaltet hatte.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag im Monat Juli zum:
–86. Geburtstag am 20. Juli Elfriede Müller Baumwald, 95457 Waltersdorf; –83. am 02. Helga Schöniger (Tochter von Erwin und Anna Schöniger), Schwerin; –83. am 06. Gerhard Rödl, 31134 Hildesheim; –83. am 12. Helga Reinl/Richter, 95158 Kirchenlamnitz; –82. am 22. Elfi Maresch/Schöniger (Tochter von Anton und Rosa Schöniger), Neuburg/Donau. Ihr Albin Häring

Im Landkreis: Altrohlau
Gemeindebetreuer Rudi Preis, Weingartenstraße 42, 77948 Friesenheim, Telefon (0 78 08) 5 95, eMail Rudolf.Preis@t-online.de Geburtstage im Juli –wir gratulieren herzlich zum:
–94. Geburtstag am 11. Juli Herbert Schmidt, 88145 Opfenbach; –92. am 13. Hildegard Heinrich, 72285 Pfalzgrafenweiler; –91. am 26. Elisabeth Siegl/ Dellner, 63110 Rodgau; –84. am 13. Maria Roth, B-1420 Braine l‘Alleud; –61. am 02. Ramona Bittner, 95659 Arzberg.
In der Juni-Ausgabe habe ich Johann Alboth erwähnt und einen ausführlichen Bericht von dem Altrohlauer Oberlehrer und Lyriker zugesagt. Johann Alboth ist kein gebürtiger Altrohlauer, doch seine Lebensjahre von 1893 bis 1925 haben ihn untrennbar mit Altrohlau verbunden.

Alboth wurde am 23. November 1861 in Joachimsthal geboren. Er besuchte nach der Bürgerschule die Lehrerbildungsanstalt in Prag. Alboth widmete sich dem Studium der Literatur und
bereitete sich auf das Hochschulstudium vor. In Graz legte er die Reifeprüfung zum Volksschullehrer ab. Er nahm seine Tätigkeit als Lehrer in Tissau bei Petschau auf, wo er fast zwölf Jahre lang die Kinder unterrichtete.
Im Jahr 1893 kam Alboth nach Altrohlau, wo er 1897 Oberlehrer der neu errichteten MädchenVolksschule wurde. In Altrohlau wohnte er bis zu seiner Pensionierung auf dem Schneiderberg.
Er zog im Jahr 1925 nach Edersgrün. Dort verstarb er am 10. Juni 1940.
Alboth lebte zeitlebens sehr zurückgezogen. Selbst namhafte Ehrungen, welche ihm von der „Gesellschaft zur Förderung der deutschen Kunst, Wissenschaft und Literatur“ in Prag als Anerkennung für sein literarisches Schaffen verliehen wurden, oder die Vertonung mehrerer seiner Gedichte durch den Karlsbader John Bey konnten sein Wesen nicht ändern.
Insgesamt erschienen drei Gedichtbändchen im Verlag „Neue Literatur und Kunst“ in Wien und Leipzig:
– Band 1: Singen und Ringen, 1896
– Band 2: Aus der Stille, 1903
– Band 3: Herz und Welt, 1911
In Altrohlau und in Edersgrün entstand Alboths Alterswerk. Gedichte wie „Lebensabend“ und „Spätherbst“ verraten den tiefgründigen Meister der Sprache. Bedauerlicherweise ist von Alboths Schaffen kaum etwas bekannt beziehungsweise es ist in Vergessenheit geraten. Seine Kreativität spiegeln hier die wohl zwei letzten bekannten Gedichte wider:
„Im Spätherbst“ von Johann Alboth
„Leis raschelt unter meinen Schritten Des späten Herbstes welkes Laub. Der Frost hat es vom Baum geschnitten Und hin geworfen in den Staub.
Aus Bronze-, Gold- und Silberblättern
Gewebt, dehnt sich ein Teppich weit, Dazwischen steht in schwarzen Lettern
Das herbe Wort: Vergänglichkeit.
Ein Hauch von Moder weht im Winde, Der schwer auf alle Pulse drückt Mir ist ums Herz wie einem Kinde, Dem man im Sarg die Mutter schmückt.“
„Lebensabend“ von Johann Alboth
„So soll mein Lebensabend sein: Groß, weit und schön vor mir gebreitet.
Schau ich ins Heimatland hinein. Draus mir der Herbst entgegen schreitet.
Zum Abschied rüstet er sich sacht, Hat seine Gaben all‘ vergeben; Als Letztes hat er mir gebracht Den kühlen Kranz goldgelber Reben.
Hoffen wir, daß es auf diesem steinigen Weg der Aussöhnung stetig weiter vorangeht – die Anzeichen stimmen zuversichtlich, wie auch die politischen Signale der letzten Zeit aus Prag. Herzliche Grüße, Pia Eschbaumer
Wie der die Schläfen mir umlaubt, Fühl‘ ich die Pulse lässig säumen, Wie reife Frucht neigt sich mein Haupt Zu Bildern aus erlebten Träumen. Des Tages Orgelspiel verklingt Wie fernhin Rauschendes Gefieder; Im Nachhall meine Seele schwingt Dann senkt der Friede sich hernieder.
Der Himmel thront, ein weiter Dom, Drin‘ schon des Abends Ampel glutet, Und näher rauscht der breite Strom, Mit dem ins All mein Leben flutet.“
Laßt uns nun voller Freude und Tatendrang die Sommermonate genießen. Dazu wünscht der gesamten Leserschaft unvergessliche Tage, Ihr Rudi Preis
Edersgrün
Gemeindebetreuer Rudolf Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de
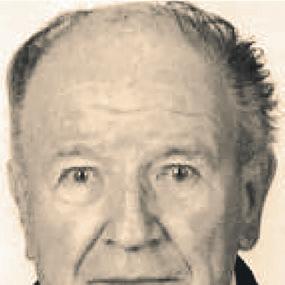
Wir gratulieren zum Geburtstag all denen, die in den nächsten Tagen Geburtstag feiern. Wir wünschen Euch alles erdenklich Gute, vor allem wünschen wir Euch Gesundheit und Gottes Segen, und den Kranken gute Besserung.
Liebe Edersgrüner, die Transportlisten von Karlsbad enthalten insgesamt 148 Personen, die aus dem Ort Edersgrün ausgesiedelt wurden. Der erste Transport fand am 8. Juni 1946, der letzte Transport am 21. September 1946 statt. Dazwischen lagen die Transporte am 8. Juli, 12. Juli und 16. Juli, am 12. August und am 9. Oktober 1946.
Ein Transport umfaßte in der Regel 40 Waggons zu je 30 Personen. In den Listen sind die Namen, das Alter, das Geschlecht, teilweise der Beruf, das Wunschziel, das Datum, die Transportnummer, die Nummer des Waggons und der voraussichtliche Ankunftsort vermerkt. Auf dem Titelblatt zum jeweiligen Transport ist die Anzahl der Männer, Frauen und Kinder, die Abfahrtszeiten des Zuges in Karlsbad und die Ankunftszeiten in Eger vermerkt. Ich wünsche Ihnen allen erholsame Sommertage, Ihr Rudi Baier
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de Heute habe ich für Sie die GeBitte umblättern
chichte vom „Bittna Voda“: „Da ålt Bittna Voda va Grosngröin kinnt ei af Kårlsbod, döi haffm Leit döi dau ümma-rananna wusln behag‘n nan neat recht. Wöi a onnan Brunna vabei kinnt, bleibt‘a a Wal stäih, schaut af’s Wåssa wäi’s schäi oilafft un siaht afframål ån dean Brunna a Tåfl mit sein Nouma draf: ,Pitná voda‘. Manna denkt a sich, homm’sa doch tatsächli dean Brunna mein Nouma geb’m: ,Bittna Voda!‘ Fängt a glei as schimpfn und grummln oah, wål da Schildlschreiwa sein Nouma falsch g’schrieb’m håut.“
s
(Verfasser ist der österreichische Lyriker Rainer Maria Rilke)
Pullwitz
Das Schild „Pitná voda“ war tschechisch und heißt übersetzt „Trinkwasser“.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Juli mit viel Sonnenschein und trotzdem erträglichen Temperaturen; bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
Gemeindebetreuerin Magdalena Geißler, Karlsbader Straße 8, 91083 Baiersdorf-Hagenau, Telefon (0 91 33)33 24 Heimatstube in 90513 Zirndorf, Fürther Straße 8; betreut von Christina Rösch-Kranholdt, Egloffsteiner Ring 6, 96146 Altendorf, Telefon (0 95 45) 35 98 13

Allen Geburtstagskindern im Monat Juli wünschen wir die besten Glückwünsche zum:
–94. Geburtstag am 14. Juli Katharina Stoll, geborene Gößl; –88. am 24. Dieter Konrad, Eggersdorf; –80. am 11. Ulrike Langhammer-Tannheimer, Neuwied.
Gestorben ist am 29. April 2023 Anneliese Wolf im Alter von 83 Jahren. Es trauern ihr Ehemann Manfred, ihre Tochter Eva und alle Verwandten und Freunde. Auch ihnen gilt unsere herzliche Anteilnahme.
Magdalena Geißler
Im Juni war eine Fahrt nach Lichtenstadt geplant, um die Gedenkstätte wieder zu pflegen. Fotografien dazu kommen in der August-Ausgabe.
Christina und Daniel
„Und es gibt ja auch Augenblicke, da sich ein Mensch vor dir still und leise abhebt, von seiner Herrlichkeit.
Das sind seltene Feste, welche du niemals vergißt. Du liebst diesen Menschen fortan.
Das heißt, du bist bemüht, die Umrisse seiner Persönlichkeit, wie du sie in jener Stunde erkannt hast, nachzuzeichnen mit deinen Händen.“
Gemeindebetreuer Wolfram Schmidt, Am Buchberg 24a, 91413 Neustadt/A., Telefon (0 91 61) 72 00 Liebe Pullwitzer, ich wünsche allen ein herzliches Grüß Gott. Im Juli 2023 gratulieren wir zum Geburtstag zum: –82. Geburtstag am 12. Juli Ilse Breidenbach, langjährige stellvertretende Ortsbetreuerin von Pullwitz, 97215 Uffenheim; –81. am 15. Herbert Schöniger, 90599 Dietenhofen.

Für das neue Lebensjahr wünschen wir alles erdenklich Gute, viel Glück, vor allem jedoch Gesundheit und Zufriedenheit. Es grüßt Sie recht herzlich, Ihr Wolfram Schmidt
Rodisfort
Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de
Geburtstage im Monat
Juli: Wir gratulieren zum 84. Geburtstag am 25. Juli Ernst Steiger, 84184 Tiefenbach bei Landshut.
Liebe Rodisforter, wir starten nun in die zweite Hälfte dieses Jahres. Leider beginnt sie mit einer traurigen Nachricht. Unser Landsmann Heinrich (Heiner) Grund, wohnhaft in Neuhaus/Pegnitz ist im hohen Alter von 92 Jahren, in der Nacht vom 13. Juni auf den 14. Juni, nach einem Sturz mit Komplikationen und anschließender Operation im Krankenhaus von Bayreuth verstorben. Den Angehörigen gehört unsere aufrichtige Anteilnahme. Am 6. Juni jährte sich der Geburtstag unserer Egerländer Dichterin Margareta Pschorn zum 101. Mal. Im Rückblick war ihr Leben voller Leid, aber auch voller Liebe und Güte in einem glücklichen Elternhaus, welches weder zwei Weltkriege noch die Vertreibung aus der geliebten Heimat erschüttern konnten. Das Kreuz Christi war ihr und ihren Lieben immer Trost und Halt in allen Lebenslagen, in Sorgen und schwerer Krankheit, und echte Menschenliebe war das Fundament allen Denkens und Handelns. „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide!“
Diese Worte des Dichters Johann Wolfgang von Goethe fanden bei Pschorn reiche Erfüllung. Eine Dichtergabe voll tiefs-
ter Ausdruckskraft wurde ihr als köstlichstes Lebensgeschenk in die Wiege gelegt. Und sie hat wahrlich damit gewuchert, ihr zur Freud, uns zum Segen. Daher wurde aus der durch schwere Krankheit behinderten Kindergärtnerin eine Dichterin und freischaffende Schriftstellerin. Deren Werk zählt heute zu dem Besten, was das Egerland seinen vertriebenen Landsleuten und dem ganzen deutschen Volk bieten kann. Denn neben tiefer Glaubensinnigkeit ist es eine glühende Volks- und Heimatliebe und eine felsenfeste Heimattreue, welche die Grundlagen ihres Schaffens bilden.
Da Pschorn in Rodisfort an der Eger ihre Kindheit und in Dallwitz bei Karlsbad ihre Jugend verlebte, wurde die Egerländer Mundart ihre „Muttersprache“. Somit erschien bereits im Jahr 1958 ihr Band Egerländer Mundartgedichte voll stärkster Ausdruckskraft und seelischer Glut unter dem Titel „Erdverwurzelt“. Tief greift ihr Sinnen und Trachten in die altererbte Heimatscholle. Und immer wieder legt sie Zeugnis ab, daß ihr ganzes Sein nur dort daheim sei, wo ihre Wiege stand. Daher legt sie uns besonders drei Dinge ans Herz: „‘s is da Herrgott, ‘s is dan Mutta u dan Hoimat!“
In einer Weihefeier „Heimweh nach Böhmen und Mähren“ (1961) führt uns die Dichterin durch das ganze Sudetenland. Und jede Landschaft spricht in besinnlichen Versen zu uns und mahnt uns zu Liebe und Treue. Und schon ihr erstes Gedichtbändchen „Brennende Kerzen“ (1956) bringt uns so einprägsame Gedichte der Wehmut und des Heimwehs wie „Heimatlose Mutter“, „Wallfahrt im Egerland“, „Samstag Abend im Duppauer Gebirge“ und „Heimatdorf“.
Aber Pschorn weiß nicht nur um die Schönheit des Egerlandes, für sie ist auch noch ganz Böhmen das Land ihrer Sehnsucht und Liebe. Und sie endet ihr Gedicht „Böhmischer Hirt“ mit den jubelnden Versen: „Müßt ja das Herz mir springen, müßt voller Lieb vergehn, dürft ichs nicht immer singen: Böhmen, wie bist du schön!“
Die Quelle ihrer wundersamen Lyrik hat viele Landsleute berührt. Und viele haben wenigstens ein Werk von unserer Pschorn im Bücherschrank stehen.
Nun wünsche ich uns allen, daß der Juli ein schöner Sommermonat wird, in welchem wir uns wieder in ein Café oder einen Biergarten mit Verwandten und Bekannten setzen können und es uns so richtig gut gehen lassen können.
Es grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
Schneidmühl
Gemeindebetreuer Rudolf Baier, Am Gänsgraben 45, 84030 Ergolding, Telefon (08 71) 7 38 02, Fax (08 71) 1 42 33 07, eMail baier_rudolf@hotmail.de
Im Monat Juli gratulieren wir zum Geburtstag herzlich zum: –88. Geburtstag am 7. Juli
Frieda Ursprung, geborene Hess, 35041 Marburg; –85. am 03. Maria Wießner, geborene Schloßbauer, 35469 Allendorf; –82. am 01. Elvira Heinzl, geborene Schneider, 90768 Fürth-Burgfarnbach.
Wir wünschen ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen. Den Kranken wünschen wir baldige Genesung.
Liebe Schneidmühler, im Schuljahr 1922/1923 wurden die 158 Kinder in vier Klassen von folgenden Lehrkräften unterrichtet:
Oberlehrer Hugo Heinz (zum

1. November 1922 in den Ruhestand versetzt), Heinrich Falb (ab 1. November 1922 Schulleiter), weiterhin zeitweise die Lehrkräfte Alois Gabriel, Wilhelm Wirkner, Ernst Schneider, Gabriele Kauzner, Johann Schiffner und Wilhelm Lederer.
Religionslehrer war damals Kaplan Karl Pietsch. Den Handarbeitsunterricht erteilte die Handarbeitslehrerin Hermine Schindler.
Weitere Besonderheiten während des Schuljahres: Am 17. Juni 1923 fand im Saal des Gasthauses Till eine sehr gelungene Schüleraufführung statt (Lieder und Sketche). Der Überschuß in Höhe von damals knapp 560 Kronen wurde für die Anschaffung von Lehrmitteln verwendet.
Ich wünsche Ihnen allen erholsame Sommertage und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Gemeindebetreuer Rudi Baier
Sittmesgrün
Gemeindebetreuer Rudi Hannawald, Turmstraße 13, 95698 Neualbenreuth, Telefon (0 96 38) 7 24 Liebe Sittmesgrüner und Freunde, hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem Sittmesgrüner Treffen am Sonntag, den 30. Juli 2023, ein.





Aufgepaßt, es gibt eine Änderung: Es findet nicht mehr in der „Seerose“ am kleinen Karpfensee in Roth statt, denn die neuen Betreiber haben uns beim letzten Treffen 2022 sehr enttäuscht. Aber dank eines „Ehren-Sittmesgrüners“, der Mitglied im TSV Katzwang 1905 ist, haben wir einen wunderschönen neuen Treffpunkt gefunden. Es handelt sich um die Vereinsgaststätte neben den Sportanlagen: Gaststätte zum Rednitzgrund, Ellwanger Straße 7, 90453 Nürnberg-Katzwang.

Fränkische und Griechische Gerichte werden seit Jahren von der freundlichen und tüchtigen Wirtsfamilie Kimon Poulinakis serviert.
– Kontakt Kimon Poulinakis: Telefon (0 91 22) 7 74 33, eMail
Poulinakiskimon@gmail.com
Ein wunderschöner großer blühender Garten wartet auf Sie. Und es gibt genügend freie Parkplätze.
Ab 9.00 Uhr ist geöffnet. Aber die meisten werden wohl zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr eintreffen. Wir Sittmesgrüner freuen uns schon aufeinander und auf die treuen Freunde, die wieder zu uns „zum Hutzn“ kommen!
Besonders freuen wir uns auf Anneliese Heckel, welche am 24. Juli 94 Jahre jung wird.
Die immer lustige SchürerLuis wird aber nicht mehr dazukommen. Sie ist kurz nach ihrem 100. Geburtstag friedlich im Kreis ihrer Familie eingeschlafen und verstorben. Wir werden sie nie vergessen.
„Siamasgräina holt's Enks zam!“
Gemeindebetreuer Rudi Hannawald aus Sittmesgrün und seine Frau Elfriede aus Sauersack freuen sich darauf, am Sonntag, den 30. Juli 2023, recht viele Sittmesgrüner, Nachkommen, Freunde aus Karlsbad und der Karlsbader Landschaft, sowie Freunde aus dem Nürnberger Umland, in der „Gaststätte zum Rednitzgrund“ in Nürnberg-Katzwang begrüßen zu können. Rudi Hannawald

Gemeindebetreuer Rudi Kreisl, Memminger Straße 15, 90455 Nürnberg, Telefon (09 11) 88 82 02, eMail: Rudolf. Kreisl@gmx.de Heute habe ich für Sie „A
wåuhas Gschichtl“ aus Sodau: „Bin i dåu in Soda ban Boust Ferdl (Funk Ferdinand) amål an kaffm gwest. Da gånz Lodn woar voll Weiwa, döi hobm an Dischkursch ghått u glåcht grodoan. Dåu wiard af oan mål d‘ Lodntüar afgrissn, daß ma denkt håut, sie gäiht a’n Ångln u a kluina Boub kinnt einagwoust. Ear wulchert sich durch döi Haffm Weiwa durch bis za da Budl. Da Ruaz is nan einghängt bis ins Maal. Ear zöiht nan affi, wischt mitn Hemm-üarwl unta da Nosn hin, daß da Ruaz öitza am Båckn picht, åffa sågt a: ,Ich mächt gearn üm an Kreuza, ich wåiß nuh neat wos i nimm, åffa an Famülezucka (Vanillezucker) u a Nahnåudl. Döi mouß owa ran gråußn Oarsch (Nadelöhr) hobm, daß man Mutta gout anfadln koan. Sie siaht nimma gout.‘ Ålls håut glåcht üwa dean gschaftinga Boubm u d‘Funk Anna håut nan aa san Zeugh glei gebm. Füar sein Kreuza håut a se Tschegakugln kafft u åffa woar a aa scho wieda draß ban Lodn. Miar Weiwa håbm owa nuh mit da Funk Annl üwa döi Nahnåudl glåcht.“ Das war einmal wieder eine kleine Erinnerung an längst vergangene Zeiten.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie den schönen Monat Juli. In diesem Sinne grüßt Sie alle recht schön, Ihr Rudi Kreisl
In dieser Ausgabe der Reihe „Verdiente Karlsbader“ geht es um den Egerländer Volkstumsforscher und Heimatforscher Otto Zerlik. Rudi Baier erzählt von Zerliks Leben und Wirken:
Otto Zerlik wurde am 4. Januar 1907 in Uittwa geboren und ist am 24. April 1989 in Geislingen/Steige verstorben. Er war ein bedeutender Egerländer Volkstumsforscher, Mundartlyriker und Heimatforscher.
Zerlik wuchs auf dem Land auf, wo es nur eine zweiklassige Volksschule gab. Er war zwei Jahre lang Hüterbub und kam schon als Zwölfjähriger in die Lehre.
Über die Maurerlehre und Gesellenzeit im Kamin-, Ofen- und Feuerungsbau kam Zerlik zur Volkstumspflege. Der Karlsbader Volkskundler und Dichter Josef Hofmann wurde sein Vorbild und Lehrmeister. Den Weg zu seiner Berufung fand er über den Bürgermeister von Luditz und späteren Senator der „Sudetendeutschen Partei“, den Industriellen Hugo Liehm. Dieser erkannte seine großen Fähigkeiten und vermittelte ihm eine Anstellung als Wanderlehrer bei dem „Bund der Deutschen in Böhmen“. Er arbeitete vor allem im Egerländer Volkshochschulwesen, in der Erzgebirgsheimindustrie und in der Kinderbetreu ung als Leiter eines Jugendheims auf Schloß Hartenberg. Im Jahr 1936 wurde er der Geschäftsleiter des „Reichsverbandes des Bundes der deutschen Landjugend“ für die Tschechoslowakei mit Sitz in Karlsbad.
Nach der Auflösung des Verbandes im Jahr 1938 war er Angestellter der Kreisbauernschaft Karlsbad, und schließlich wurde er zum Kulturreferenten der Landesbauernschaft. Er war Mit-
� Meldungen der Ortsbetreuer
arbeiter der sudetendeutschen Volkskunde-Sammelbewegung, die von den Professoren Jungbauer und Hanika geführt wurde.
Sein Sammelgut und seine Erfahrungen stellte er für den Volkskundeatlas, für die „Zeitschrift für sudetendeutsche Volkskunde“, für die „Sudetendeutsche Flurnamenstelle“ und für das „Sudetendeutsche Mundartwörterbuch“ zur Verfügung. Die „Gesellschaft für sudetendeutsche Volksbildung“ in Reichenberg ernannte ihn zum Mitglied.
In den Jahren 1929/1930 studierte er am Technikum in Bodenbach an der Elbe mit Schwerpunkt Hochbau.
Im Jahr 1942 wurde Zerlik zum Kriegsdienst verpflichtet. Er kam 1945 in US-amerikanische und englische Kriegsgefangenschaft.
Im Jahr 1948 wurde er entlassen.
Nach der Vertreibung war Zerlik bei einer sudetendeutschen Vertriebenenstelle in Hamburg, und er war als Geschäftsführer des „Adalbert-Stifter-Vereins“ in München tätig.
Im Jahr 1953 wurde er der Schriftleiter des „Karlsbader Badeblattes“. Das „Karlsbader Badeblatt“ erschien ab 1964, nach der Vereinigung mit dem „Karlsbader Echo“, als „Karlsbader Zeitung“. Zerlik war von 1954 bis 1983 der berufliche Schriftleiter der „Karlsbader Zeitung“.
sonders hervorzuheben ist sein segensreiches Wirken für den „Heimatverband der Karlsbader“.
Für seine hervorragenden Verdienste erhielt Zerlik eine große Anzahl an Auszeichnungen und Ehrungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande der „BRD“, 1967 den sudetendeutschen Volkstumspreis, im Jahr 1972 die Josef-HofmannPlakette, 1974 die Karlsbad-Plakette, 1967 die Dr.-LodgmanMedaille, sowie im Jahr 1986 den Nordgau Kulturpreis des oberpfälzer Kulturbundes.
Der 1986 erstmals verliehene „Albert-Reich-Wanderpreis“ im Heimatkundewettbewerb der Egerlandjugend besteht aus der
Otto-Zerlik-Büste, einer Bronzeplastik, welche der akademische Bildhauer Wilhelm Hager geschaffen hatte.
Ein Dutzend Weltreisen führten Zerlik auf alle Kontinente. Er war immer suchend nach Egerländer Volksgut und Egerländern.
Zerlik war verheiratet und hatte mehrere Kinder.
Nachfolgend ein Gedicht aus Zerliks Feder: „Laß dich zoudekt, laß dich zoudekt, deine Boinla schäin asgstrekt, denn drassna is‘s kolt. Schai‘n still schlaufn d Hosen zammaduckt unterm Wosn und d Vügharla im Wold. Laß dich zoudekt, laß dich zoudekt.“ (Otto Zerlik)
viele Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande der „BRD“. Bild: Ordensmuseum.de
Der Heimatverband und die Ortsbetreuer wünschen allen Jubilaren aus den zuvor nicht aufgeführten Gemeinden, besonders den treuen Abonnenten der Karlsbader Zeitung, alles Gute zum Geburtstag!
Aich
23. Juli: Herta Muhlfinger/Klein, 97215 Weigenheim, 96. Geburtstag.
Dallwitz
10. Juli: Sieglinde Wilhelm/ Tichai, 89278 Nersingen, 94. Geburtstag.
Donawitz
31. Juli: Otto Martinek, 81825 München, 97. Geburtstag.
Donitz
30. Juli: Elfriede Oppel, 86199 Augsburg, 102. Geburtstag.
Eichenhof und Schömitz
6. Juli: Emma Moyses/Lorenz (Schömitz Nummer 3), 83043 Bad Aibling, 99. Geburtstag.
7. Juli: Horst Lippert (Sohn von Rudolf Lippert, Hammelhof Nummer 3) in Baiersdorf, 63. Geburtstag.
Engelhaus
15. Juli: Helene Brandler/ Schmidt, 86368 Gersthofen, 91. Geburtstag.
21. Juli: Marianne Gaugler/ Fuchs, 86637 Wertingen, 92. Geburtstag.
Grasengrün
25. Juli: Rolanda Leicht (Ehefrau von Franz), 89420 Höchstädt, 86. Geburtstag.
Haid-Ellm-Lessau
7. Juli: Horst Tilp (Haid), 74670 Forchtenberg, 84. Geburtstag.
Hartmannsgrün
4. Juli: Ilse Eschig, 86675 Buchdorf, 82. Geburtstag.
27. Juli: Christian Staudacher, 85080 Gaimersheim, 93. Geburtstag.
Pirkenhammer
9. Juli: Erwin Herb, 87600 Kaufbeuren, 85. Geburtstag.
16. Juli: Erika Thoma, 65343 Eltville, 94. Geburtstag
Ranzengrün
27. Juli: Anneliese Chaumond-Klier/Klier (Ranzengrün Hausnummer 2 „beim Siemer“), 64295 Darmstadt, 79. Geburtstag.
Ruppelsgrün
6. Juli: Hildegard Friedrich/Reim, 72488 Sigmaringen, 89. Geburtstag.
Schlackenwerth
3. Juli: Wilhelm Englert, 35112 Fronhausen, 90. Geburtstag.
Schönfeld
2. Juli: Josef Rödl, 64589 Stockstadt, 86. Geburtstag.
25. Juli: Manfred Lochner, 80804 München, 84. Geburtstag. Trossau
4. Juli: Erika Jakob/Rühl, 61532 Bad-Homburg, 86. Geburtstag.
Tüppelsgrün
14. Juli: Bernhard Merklinger (Sohn von Merklinger/Knaut, Bertl), 68219 Mannheim, 72. Geburtstag.
Weheditz
9. Juli: Elfriede Holzner/Teschner, 85646 Anzing, 95. Geburtstag.
Welchau
2. Juli: Helmut Klemm, 55128 Mainz, 79. Geburtstag.
3. Juli: Anselm Schneider (Neffe von Alfred Schneider), 54. Geburtstag.
8. Juli: Karl Steinbach, 35043 Marburg, 82. Geburtstag.
24. Juli: Hannelore Hofmann/ Petz, 35321 Laubach, 79. Geburtstag.
25. Juli: Ernst Steiger, 84184 Tiefenbach, 84. Geburtstag.
26. Juli: Walter Richter (Gatte von Helga Richter), 39359 Velsdorf, 80. Geburtstag.
26. Juli: Matthias Täubl (Sohn von Ewald Täubl), 58. Geburtstag.
27. Juli: Helga Talarowski/ Schuh, 35043 Marburg, 84. Geburtsta
Ohne Ortsangabe
1. Juli: Erna Gellen, 90574 Roßtal, 81. Geburtstag.
15. Juli: Leo Friedl, 26954 Nordenham, 64. Geburtstag.
13. Juli: Claudius Schnee, 60598 Frankfurt, 56. Geburtstag.
Im Jahr 1949 war er der Herausgeber des „Egerländer Heimatbriefes“, und 1955/1956 gab er die Zeitschrift „Der Egerländer“ heraus. Er war drei Jahrzehnte lang Herausgeber des inhaltsreichen „Jahrbuches des Egerländer“, und er verfaßte unter anderem Festschriften zu verschiedenen Heimattreffen. Be-
� Juli 1923
Der Heimatforscher Otto Zerlik erhielt einige Ehrungen, darunter auch die Dr.-Lodgman-Medaille.


n 1. Juli 1923: Eine neue Zeitung, betitelt mit „Deutsche Wehr“, wird von Ing. Gustav Matschak herausgegeben. Sie ist das Parteiblatt der „Alldeutschen Partei“.
Die tschechischen OpernGastspiele werden aufgrund von Verhandlungen der Stadtgemeinde, dem Theaterdirektor Basch und dem Direktorenund Musikerverband einerseits, und dem Minister des Inneren anderseits, von 14 auf fünf Gastspieltage im Juli festgesetzt. Ein Vergleich kam dahin zustande, daß Direktor Drasar aber für jede Vorstellung einen Spesenbeitrag von 2500 Kronen erhält. Dem Direktor Basch wurde die Erlaubnis erteilt, während der tschechischen Aufführungen im Stadttheater im Kurhaus Vorstellungen zu geben.
Die Straßentafeln müssen an erster Stelle die tschechische Bezeichnung, an zweiter Stelle erst die deutsche Bezeichnung tragen.
n 5. Juli 1923: Die Polizeimannschaft wird mit Helmen ausgestattet.
n 6. Juli 1923: Eine Einbrecherin wird auf frischer Tat im Haus Hispania ertappt. Sie springt aus dem vierten Stock auf die gegenüber befindliche Landmauer und stürzt dabei ab. Sie bleibt unten schwer verletzt liegen.
Der 13. Zionistenkongreß in Karlsbad im Grandhotel „Schützenhaus“ wird eröffnet. Dort haben sich über 400 Delegierte aus
Von Rudi Baier



allen Teilen der Welt eingefunden.
n 7. Juli 1923: Die ausländischen Zollrevisionsstellen werden in der Oberen Schillerstraße wiedereröffnet.
n 8. Juli 1923: Fassadenkletterer dringen in die im ersten Stock liegenden Räume der Häuser „Rudolfshof“, „Hotel Kaiserbad“ und „Vierjahreszeiten“ durch offenstehende Fenster der Kurgastwohnungen ein und entwenden viel wertvollen Schmuck; bei einer zur Kur weilenden Dame solchen Schmuck im Wert von 250 Millionen deutschösterreichischen Kronen. Die Einschleicher entkommen unerkannt.
Der als Philanthrop (ein Menschenfreund, der anderen Menschen Gutes tut) bekannte sowie wohlbekannte Inhaber eines Reisebüros in Karlsbad, Rudolf Mayer, ist im Alter von 61 Jahren verstorben.
n 19. Juli 1923: Zahnarzt MUDr. Bernhard Wittlin stirbt im Alter von 56 Jahren.
n 20. Juli 1923: Die politische Landesverwaltung weist die von der Stadtgemeinde gegen den Auftrag der Anbringung der Straßenschilder in tschechischer Sprache und gegen die Auflage von tschechischen Speisekarten in den städtischen Gastwirtschaften eingebrachte Beschwerde ab. Die Stadtvertretung beschließt, die Berufung an die dritte Instanz einzubringen.
n 20.–24. Juli 1923: Das Stadttheater-Ensemble gibt Vor-
stellungen im Kurhaus, da im Stadttheater ein fünftägiges Gastspiel der tschechischen Nationaloper aus Olmütz stattfindet.
n 22. Juli 1923: Monster-Konzert der BerufsmusikerVereinigung im Posthof mit 160 Mitwirkenden.
n 23. Juli 1923: Der Unterbau der Zahnradbahn zum Dreikreuzberg und für das Stationsgebäude ist fertiggestellt.
n 24. Juli 1923: Im Kurhaus findet ein Gastspiel von André Mattoni statt.
Der Stadtrat verleiht dem Leiter des Kurorchesters Robert Manzer den Titel eines Generalmusikdirektors.
n 25. Juli 1923: Die Betriebsratswahlen in den Badeanstalten finden statt.
n 26. Juli 1923: Der Freundschaftssaal blickt auf ein hundertjähriges Bestehen zurück.
n 28. Juli 1923: Zwecks Errichtung eines Naturschutzparkes besichtigt eine Kommission das Gelände hinter dem Park Schönbrunn.
n 30. Juli 1923: Seit Jahresbeginn weilten 20 109 Personen zur Kur dort – ein Plus von 1355.
Die Mark sinkt. Umgerechnet heißt das:
1 Krone = 33 000 Mark.
n 31. Juli 1923: Dr. Prof. M.W.H. Welch, amerikanischer Arzt, schreibt im „New York Herald“ einen schmeichelhaften Artikel über Karlsbad.